
Title: Goethes Lebenskunst
Author: Wilhelm Bode
Release date: November 24, 2024 [eBook #74788]
Language: German
Original publication: Berlin: Ernst Siegfried Mittler und Sohn, 1913
Credits: The Online Distributed Proofreading Team at https://www.pgdp.net
Anmerkungen zur Transkription
Der vorliegende Text wurde anhand der Buchausgabe von 1912 so weit wie möglich originalgetreu wiedergegeben. Typographische Fehler wurden stillschweigend korrigiert. Ungewöhnliche und heute nicht mehr verwendete Schreibweisen bleiben gegenüber dem Original unverändert; fremdsprachliche Ausdrücke wurden nicht korrigiert.
Das Original wurde in Frakturschrift gedruckt. Passagen in Antiquaschrift werden in der vorliegenden Ausgabe kursiv hervorgehoben.


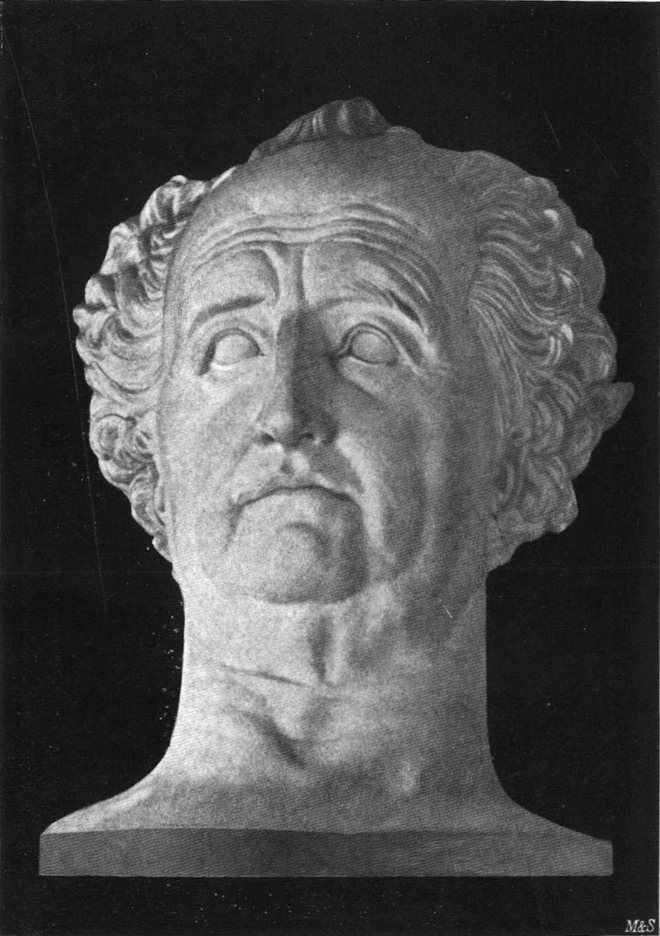
Wilhelm Bode

Siebente, neu bearbeitete Auflage
21. bis 25. Tausend
Mit zahlreichen Abbildungen
Verlegt bei Ernst Siegfried Mittler und Sohn
Berlin 1919
Alle Rechte aus dem Gesetze vom 19.
Juni 1901
sowie das Übersetzungsrecht sind vorbehalten.
Amerikanisches Copyright 1913 by E. S. Mittler & Sohn, Berlin.
[S. V]
Vielleicht hätte ich ein Buch, das bereits in 14000 Abzügen verbreitet und überall freundlich aufgenommen wurde, nicht so stark umgestalten sollen, wie bei dieser neuen Ausgabe geschehen. Aber da ich mich beständig mit Goethes Leben, Werken und Umwelt beschäftige, so kann es nicht ausbleiben, daß meine Kenntnisse zunehmen, meine Auffassungen sich ändern, manche neue Erklärungen sich ergeben und manche Zusammenhänge deutlich werden, die ich früher nicht sah.
Als ich vor vierzehn und dreizehn Jahren dies Buch schrieb, hieß die Aufgabe, die ich mir gewählt hatte: ‚Goethe als Mensch‘. Mit diesem Titel sandte ich die Handschrift an „E. S. Mittler & Sohn“, d. h. an Dr. Theodor Toeche-Mittler, der jetzt nach einer sehr fruchtbaren Tätigkeit dem im gleichen Sinne wirkenden Sohne zusieht. Dieser ältere Freund nahm als ein aufrichtigster Verehrer unseres Dichters an meinen ersten Arbeiten auf diesem Gebiete einen herzlichen Anteil und fügte deshalb seinem bereits sehr ausgebreiteten Verlagshause noch ein Angebäude für Goethe-Bücher hinzu. Das neue Buch, meinte er damals, müsse in ‚Goethes Lebenskunst‘ umgetauft werden. Ich fügte mich, und der Erfolg hat ihm recht gegeben, denn Niemand hat den Titel beanstandet, und einige Beurteiler haben ihn ausdrücklich[S. VI] als zutreffend gelobt. (Nur Signild Wejdling, die eine schwedische Übersetzung herausgab, hat, ohne von mir zu wissen, die ursprüngliche Überschrift vorgezogen: ‚Goethe såsom Människa‘.) So hat also der Verfasser des Buches dem Namengeber zu danken; aber der Leser soll doch wissen, wie die Aufgabe eigentlich gestellt war und daß nicht etwa die Absicht einer Goethe-Verherrlichung zu Grunde lag oder liegt. Es soll durchaus nicht Alles, was hier mitgeteilt wird, als klug und weise gelten; sehr oft tritt eben nur „Goethe als Mensch“ vor uns.
„Wie lange wird es dauern“, sagte er 1809 zu Falk, „so werden sie auch an mich glauben und mir Dies und Jenes nachsprechen. Ich wollte aber, sie behaupteten ihr Recht und öffneten ihre Augen selbst.“
Weimar, Neujahr 1913.
Ein Münchener Nervenarzt schrieb mir einmal, er verordne dies Buch seinen Patienten. Ich weiß nicht, welche Erfolge er damit hat, und wünsche mir mehr gesunde Leser als krankhaft erregte. Aber wahr ist es, daß dies Buch ein ruhiges und beruhigendes ist. Das fällt mir selbst auf, weil ich die neue Auflage in den unruhigsten Zeitläuften, die wir je erlebt haben, abschließe.
Weimar, Neujahr 1919.
Dr. Wilhelm Bode.
[S. VII]
|
Seite
|
||
|
I.
|
Beruf und Erwerb
|
|
|
II.
|
Wohnung
|
|
|
III.
|
Äußere Erscheinung
|
|
|
IV.
|
Verhalten gegen Fremde
|
|
|
V.
|
Fürsten und Vornehme
|
|
|
VI.
|
Untergebene
|
|
|
VII.
|
Geselligkeit
|
|
|
VIII.
|
Freundschaft
|
|
|
IX.
|
Feinde
|
|
|
X.
|
Familienleben
|
|
|
XI.
|
Gesundheitspflege
|
|
|
XII.
|
Die Mahlzeiten und der Wein
|
|
|
XIII.
|
Das Schaffen
|
|
|
XIV.
|
Das Lernen
|
|
|
XV.
|
Kampf und Glück
|
|
|
Bildnisse Goethes:
|
|||
|
Um 1774 Von Heinrich Lips nach einem Schüler Nahls
|
|||
|
1774
|
Von Joh. Peter Melchior
|
n.
|
|
|
1779
|
Von Georg Oswald May
|
n.
|
|
|
1789
|
Büste von Martin Klauer
|
||
|
1791
|
Von Heinrich Lips
|
n.
|
|
|
1818
|
Von Ferdinand Jagemann
|
n.
|
|
|
[S. VIII]
1828
|
Von Josef Stieler
|
n.
|
|
|
1789
|
Büste von Pierre Jean David
|
||
|
1832
|
Von C. A. Schwerdgeburth
|
n.
|
|
|
|
|||
|
Goethe und Karl August. Von C. A. Schwerdgeburth
|
n.
|
||
|
|
|||
|
Erhaltene Kleider
|
n.
|
||
|
Wohnungen:
|
|||
|
Gartenhaus, Grundriß
|
|||
|
Blick auf Haus und Garten 1826. Von C. A.
Schwerdgeburth
|
|||
|
Hausflur. Aufnahme von Otto Rasch
|
n.
|
||
|
Stadthaus, Grundriß.
Obergeschoß
|
|||
|
Ansicht vom Frauenplan. Von H. Tessenow
|
|||
|
Ansicht vom Garten. Aufnahme von L. Held
|
n.
|
||
|
Treppe. Aufgang zum Obergeschoß. Aufnahme
von Otto Rasch
|
n.
|
||
|
Empfangszimmer. Von H. Tessenow
|
|||
|
Vorzimmer zum Arbeitszimmer. Von Otto Rasch
|
n.
|
||
|
Arbeitszimmer. Von H. Tessenow
|
|||
|
Schlafzimmer. Aufnahme von L. Held
|
n.
|
||
[S. 1]
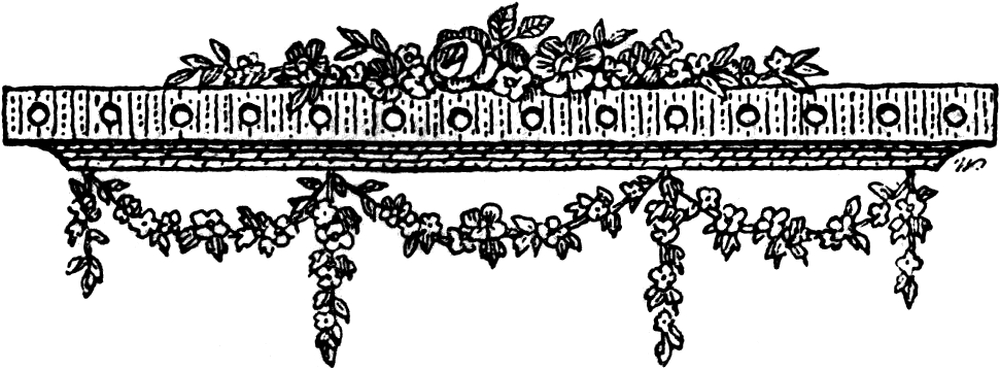
Die ersten poetischen Werke, die Goethe in die Welt sandte, sein ‚Götz von Berlichingen‘ und erst recht seine ‚Leiden des jungen Werthers‘, erregten großes Aufsehen: sie ergriffen, packten, erschütterten viele Tausende; der Name ihres Verfassers ward bei allen „schönen Geistern“ und „fühlbaren Herzen“ schnell berühmt: nun erwarteten sie neue große Gaben von ihm.
Heute wird ein erfolgreicher junger Dichter, wenn ihm sein Brotberuf so wenig zusagt wie dem Doktor Goethe die Advokatengeschäfte, kurzweg Schriftsteller; er erhält dann vom Publikum durch die Verleger und die Bühnenleiter das Nötige zum Leben, wenn er es sonst versteht, die erlangte Gunst festzuhalten. Zu jener Zeit, um 1774, gab es zwar auch schon einige Literaten, die durch Anfertigung der von den Buchhändlern verlangten Bücher und namentlich durch Übersetzungen aus dem Französischen und Englischen ein kärgliches Auskommen fanden; aber ein Dichter, ein Originalschriftsteller, konnte die Honorare nur als glückliche Nebengewinne betrachten: sie reichten für einige festliche[S. 2] Tage, aber nicht für die bürgerliche Nahrung eines ganzen Jahres. Die Zahl der deutschen Bühnen war noch gering; die paar seßhaften wie die reisenden Theatergesellschaften kämpften immer um ihren eigenen nötigsten Bedarf; die Buchverleger aber konnten selbst dann, wenn ein Buch viel Beifall fand, keinen großen Gewinn mit dem Verfasser teilen, weil sich gar rasch in irgend einem deutschen Nachbarstaate ein Drucker fand, der dies Buch nachdruckte, und weil die Obrigkeiten dann keineswegs bereit waren, solchen erwerbseifrigen Untertanen um „ausländischer“ Verleger oder Verfasser willen dies Geschäft zu untersagen. „Ich bedauere einen jeden Autor, der Nutzen von seinen Werken ziehen will“ urteilte 1775 Friedrich Nicolai in Berlin, der Schriftsteller und Buchhändler zugleich war, und ein andrer Berliner Buchhändler, Mylius, beschwerte sich im selben Jahre, als Goethe für seine ‚Stella‘ zwanzig Taler Honorar begehrte; er meinte, dann werde er ja wohl für Goethes nächstes Stück 50 Taler und für seinen ‚Doktor Faust‘ gar 100 Louisdor (1820 M.) zahlen sollen: „Das ist aber wider die Natur der Sache und nicht auszuhalten.“ Es war wirklich wider die Natur der Sache, und deshalb war das Dichten für Goethe zunächst noch eine kostspielige Beschäftigung, zumal wenn er es nicht bloß als Spiel der Phantasie in Mußestunden betrieb, sondern Leben und Dichten, Erleben und Schaffen verflocht und verquickte. Noch 1789 fragte und antwortete er mit Recht:
[S. 3]
Aber die Künste gediehen auch zu jener Zeit. In der Wirtschaftsordnung des Feudalstaates gehörte es zu den Pflichten der Landesfürsten, die Gelehrten, Dichter, Musiker, Maler, Bildhauer und Baumeister zu ernähren und ihnen die Aufgaben zu stellen. Zur höfischen Repräsentation, zur Entfaltung von Prunk und Pracht, um des Ansehens und Ruhmes willen bedurfte man solcher Leute, die wegen ihrer Geschicklichkeit in Wissenschaften und Künsten weithin bekannt waren; viele Landesväter aber hatten auch ein eigenes herzliches Verhältnis zu einigen oder vielen Künsten und Wissenschaften und ihren Angehörigen. Im ‚Tasso‘ hat uns Goethe die zarte Fürsorge eines edlen Fürsten für einen empfindlichen Poeten auf das schönste vor Augen gestellt; sein lebendiges Vorbild für Tassos Gönner, den Herzog Alfons von Ferrara, aber war der junge Herzog Karl August von Weimar, den er selber seit 1775 als seinen Ernährer und Freund rühmen mußte:
Als Gast des achtzehnjährigen Herzogs kam Goethe 1775 nach Weimar; der Gast wurde ein naher Freund, und der Freund mußte ein Arbeitsgenosse des Fürsten werden, teils weil Dieser in der Verwaltung seines[S. 4] Landes eines solchen Engverbündeten bedurfte, teils weil er nicht die Mittel hatte, Künstlern oder Gelehrten zu einem bloßen freien Dichten, Malen oder Forschen einen Ehrensold zu geben. Goethe war nun gleichzeitig Dichter und Geschäftsmann, wie damals der Beamte genannt wurde; für Beides empfing er seinen Unterhalt, denn beiderlei Tätigkeit begehrte der Landesherr. Ob er die ‚Iphigenie‘ dichtete, oder junge Bursche zum Militär aushob, oder im herzoglichen Liebhabertheater eine Rolle einstudierte, oder eine Feuerlöschordnung ausarbeitete, oder an benachbarten Höfen aufwartete, oder seinen Herzog zu Manöver, Krieg und Belagerung begleitete: immer war es Fürstendienst; Karl August besoldete und beschenkte ihn für das Eine wie das Andere. Alle die sechs Schöpfer unserer neuen deutschen Sprache und Literatur: Klopstock und Herder, Lessing und Wieland, Goethe und Schiller, betrachteten ihr Dichten und Schreiben als Arbeit an der Erleuchtung und Erhöhung des Menschengeschlechts in den deutschen Volksstämmen; edle Fürsten dienten gleichen Aufgaben; deshalb entstanden damals so manche Verbindungen zwischen Fürsten und Dichtern. Die schönste und mannigfaltigste war die durch zweiundfünfzig Jahre dauernde Freundschaft und Arbeitsgemeinschaft zwischen Goethe und Karl August.
Mit heutigen Amtsbezeichnungen läßt sich Goethes Tätigkeit in Weimar nicht deutlich machen; er besorgte die verschiedenartigsten Aufgaben, wenn unter den übrigen Beamten keiner war, der besser dazu taugte; fand sich ein Brauchbarer, so zog er sich rasch zu seinen[S. 5] poetischen und wissenschaftlichen Arbeiten zurück. Zumeist bezogen sich seine Aufträge auf die Anstalten für Wissenschaft und Kunst: das Hoftheater leitete er von 1791 bis 1817; außerdem hatte er viele Jahrzehnte die Oberaufsicht über die Bibliotheken zu Weimar und Jena, über die wissenschaftlichen Anstalten der Akademie zu Jena, über die Zeichenschulen zu Weimar und Eisenach, über die Kunstsammlungen und Kunstausstellungen zu Weimar; auch die Veranstaltung und poetische Ausschmückung von Hof- und Volksfesten war lange Zeit hindurch eine häufig wiederkehrende Pflicht, die bald als Lust, bald als Last empfunden wurde. In jüngeren Jahren, als es seinem Fürsten an guten Dienern noch sehr fehlte, bekümmerte sich Goethe aber auch um Landwirtschaft und Industrie, um den Ilmenauer Bergbau, um Wege und Flußläufe, um Verbesserung des Kassenwesens und Mehrung des Landesvermögens.
Diese Kraftzersplitterung wurde oft getadelt. Seine Amtskollegen wünschten, daß er ihnen mehr Arbeit abnehme. Andere erklärten es geradezu für eine Verschwendung, daß der Fürst eines so armen Landes einen Geheimen Rat oder Minister hielt, der sich einen großen Teil des Jahres den Staatsgeschäften entzog, um in Jena oder Karlsbad, einmal sogar fast zwei Jahre in Italien, seiner eigenen Ausbildung oder seinen Dichtungen und Forschungen zu leben. Auf der anderen Seite zürnten alte Freunde Goethes, daß er sein Genie zu höfischen Unterhaltungen und kleinlichen Verwaltungsgeschäften verbrauche, statt jährlich solche Gaben wie ‚Götz‘ und ‚Werther‘ der deutschen Nation auf den Tisch zu legen.
[S. 6]
Goethe kannte solche Urteile und durfte sie nicht verachten. Der einen Partei erwiderte er in seinem Innern, daß er nur dem Herzoge für den Gebrauch seiner Zeit und Kraft verantwortlich sei. Dessen Sache war es, ob er einen Beamten von Goethes Art ernähren konnte; wollte der Fürst dies Opfer für die allgemeine Kultur des deutschen Volkes bringen, so konnte Goethe nur herzlich-dankbar zustimmen. In die konstitutionelle Zeit, die er im Alter auch noch erlebte, paßte solche Auffassung, paßte Goethe als Beamter freilich nur schlecht hinein. Seinen alten Freunden dagegen antwortete er, daß er lieber von seinem Herzoge als von der stets unberechenbaren und oft sehr törichten Leserwelt abhängen wolle und aus dem Dichten keinen Broterwerb machen könne. Sodann: daß ein Dichter, der nur Dichter sei, sich bald ausschöpfen und seine Gedanken und Empfindungen allzu oft wiederholen würde und daß ein fleißiger Mensch auch in solchen Tagen und Stunden schaffen wolle, wenn die Musen nicht geneigt sind, ihn zu umschweben. Erst durch Berufsgeschäfte, durch Arbeiten, die uns schwer fallen und zu denen wir keine Neigung haben, erwerben wir ein wertvolles Stück Bildung: und eigener reicher Bildung bedarf doch der Schriftsteller zumeist, der auf seine Volksgenossen Einfluß ausüben zu wollen die Kühnheit hat.
Und zuweilen dachte Goethe: es kommt nicht so sehr darauf an, was wir machen, sondern darauf, daß wir unsere jeweilige Aufgabe so vorzüglich lösen, wie irgend in unseren Kräften steht. Wer als Jurist und Sohn eines Juristen Genauigkeit und Vorsicht im Denken gelernt[S. 7] hat, meinte er einmal, könne davon auch bei der Farbenlehre Gebrauch machen. „Freilich!“ gestand er ein andermal, als von der vielen Zeit die Rede war, die er mit der Theaterleitung verloren hatte, „ich hätte indes manches gute Stück schreiben können! Doch, wenn ich es recht bedenke, gereut es mich nicht. Ich habe all mein Wirken und Leisten immer nur symbolisch angesehen, und es ist mir im Grunde ziemlich gleichgültig gewesen, ob ich Töpfe machte oder Schüsseln.“
Bleibt freilich die Frage, ob solche nach manchen Richtungen verfließende Arbeit höchste Leistungen ergibt. Ein Mittel, die Gefahr des Verrinnens und Versandens aufzuheben, hatte Goethe in seinem gern gepriesenen Grundsatz der „Folge“, d. h. des Immer-wieder-Anknüpfens an alte Fäden. Er schuf zwar immer nur Bruchstücke einer Faust-Dichtung und ward dieser Arbeit immer wieder untreu, aber er kehrte auch immer wieder zu ihr zurück, so daß am Ende seines Lebens das große Werk doch vollendet ward. Wer sich beschränkt und zusammenfaßt, leistet auf seinem engen Gebiete schneller und sicherer etwas von Wert; dagegen gewinnt der Kenner vieler Gedanken, der Sammler vieler Erfahrungen in jedem Gebiete, das er betritt, rasch neue Erkenntnisse, die dem Kleinfachmann verborgen blieben. Bildung von allen Seiten her, Entfaltung nach allen Seiten hin, Erlangung eines vollständigen All-Menschentums ist schließlich doch eine höhere Aufgabe für unsere Kräfte und in einigen Fällen das bessere Mittel, vom eigenen Erwerb Anderen Wertvolles mitzuteilen.
**
*
[S. 8]
Die Fürsten zahlten zu Goethes Zeiten ihren Dienern – so hießen auch die höchsten Beamten – nur niedrige Gehälter. Goethe bekam anfangs 1200 Taler, von 1781 an 1400, von 1785 an 1600, später 1800 Taler; als 1815 Weimar zu einem Großherzogtum erhoben wurde, erhielt er als ältester Staatsminister 3000 Taler. Aber zum Gehalte kamen manche andere Lieferungen, Geschenke und Vorteile. Die Besoldungen waren damals nicht so genau festgelegt wie heute; die Fürsten übernahmen für ihre Beamten im Grunde die gesamte Fürsorge, auch für ihre Witwen und für die Erziehung ihrer Kinder, die in der Regel recht jung in fürstliche Brotstellen gelangten, so daß die Väter großer Familien mehr empfingen als die kinderlosen und ledigen Männer. Auch Goethe erhielt manche besonderen Zuwendungen: den schönen Garten an der Ilm, das stattliche Haus am Frauenplan, Wagen und Pferde, frühzeitige Anstellung seines einzigen Sohnes und manches Andere.
Ausreichend waren allerdings alle Gaben Karl Augusts nicht für „die etwas breite Existenz“ Goethes. Er verbrauchte schon 1776 1411 Taler; in den nächsten Jahren waren es rund 1600, 1780: 2249, 1782: 2605 Taler, also stets erheblich mehr, als sein Gehalt einbrachte. Das konnte er zunächst als Sohn eines wohlhabenden Vaters so halten; aber auch sein Wort, daß ihm Europa für seine Gedichte nur Lob und sonst nichts gebe, blieb nicht zutreffend. Seine ersten Werke hatte er vertändelt; zu der Zeit, wo alle Welt seinen ‚Götz‘ bewunderte, mußte er sorgen, woher er das Geld[S. 9] nehme, um das Papier dafür zu bezahlen. Aber bald lernte er recht gut, von den Verlegern die größten Honorare, die sie wagen durften, zu erlangen. Für die erste Sammlung seiner Werke, die 1786 begann, zahlte ihm Göschen 2000 Taler. Für die zweite Sammlung, die bei Unger in Berlin erschien, bekam er 500 Taler den Band und für die zwei Bände ‚Wilhelm Meisters Lehrjahre‘ 1500 Taler. Für ‚Hermann und Dorothea‘ forderte und erhielt er von Vieweg 1000 Taler in Gold, eine Summe, die selbst die Freunde Schiller und Wilhelm v. Humboldt „ungeheuer“ fanden, denn es machte zwölf Groschen für jeden Vers. Als Cotta 1802 neue Werke von ihm wünschte, obwohl er an den ‚Propyläen‘ schon erheblich zugesetzt hatte, warnte Schiller seinen Landsmann beinahe vor seinem Freunde:
Es ist, um es gerade heraus zu sagen, kein guter Handel mit G. zu treffen, weil er seinen Wert ganz kennt und sich selbst hoch taxiert und auf das Glück des Buchhandels, davon er überhaupt nur eine vage Idee hat, keine Rücksicht nimmt. Es ist noch kein Buchhändler mit ihm in Verbindung geblieben; er war noch mit keinem zufrieden, und mancher mochte mit ihm nicht zufrieden sein. Liberalität gegen seine Verleger ist seine Sache nicht.
Cotta war und blieb dennoch Goethes Verleger; freilich bedurfte es geschickter Vermittler, um sie zusammenzuhalten. Das Mißtrauen der Verfasser gegen die Ehrlichkeit der Verleger war zu jener Zeit ein allgemeines; Goethe aber ärgerte sich nicht selten über die politischen und anderen Schriften, die Cotta gleichfalls verlegte. Über seine Honorare durfte er sich jedoch nicht beklagen. Für die ‚Wahlverwandtschaften‘ bekam[S. 10] er 2500 Taler, für ‚Wahrheit und Dichtung‘ 12000, für die erste zwölfbändige Cottasche Ausgabe der Werke (1805-1808) volle 10000 Taler für das Verlagsrecht auf acht Jahre, für die neue Ausgabe in zwanzig Bänden 1816 auf weitere acht Jahre 16000 Taler, 1824 gab August v. Goethe der Steuerschätzungs-Kommission als das jährliche literarische Einkommen seines Vaters „in maximo 1400 Taler“ an. Das war Steuer-Pessimismus, obwohl das Einkommen im letztvergangenen Jahre nur 500 betragen hatte; denn im Durchschnitt der letzten zehn Jahre hätte man rund 3500 Taler errechnen können. 1826 forderte und erhielt Goethe von Cotta für eine neue, in 20000 Exemplaren zu druckende Ausgabe seiner Werke in vierzig Bänden sogar 60000 Taler. Im ganzen wurden in den Jahren 1795-1832 von Cotta an Goethe 401090 Mark in heutigem Gelde gezahlt und von 1832-1865 an die Erben noch 464474 Mark. Dagegen blieben die Einnahmen des Dichters von den Bühnen gering; von der Berliner Hofbühne erhielt Goethe in zwanzig Jahren nur 319 Taler, während Kotzebue es dort in der gleichen Zeit auf 4579 Taler brachte.
**
*
Goethe war nie ein Verschwender, aber ängstliche Sparsamkeit war auch nicht seine Sache; wie er sein Leben lang in Lotterien spielte, so wendete er manchmal sein Geld an Hoffnungen und Liebhabereien. Als Privatmann hätte er sich in einfachsten Verhältnissen wohlgefühlt; als erster weimarischer Beamter und als Repräsentant der deutschen Künste und Wissenschaften zog er die „etwas breite Existenz“ vor. „Einen Parvenü[S. 11] wie mich konnte nur die entschiedenste Uneigennützigkeit aufrechterhalten“ sagte er im Alter zu Riemer und Friedrich v. Müller, und zu Eckermann: „Eine halbe Million meines Privatvermögens ist durch meine Hände gegangen, nicht allein das ganze Vermögen meines Vaters, sondern auch mein Gehalt und mein bedeutendes literarisches Einkommen.“ Schon im kleinen Gartenhause an der Ilm hatte er verschiedene Diener: Philipp Seidel, Christoph Sutor, Paul Götze, die Köchin Dorothee. Große Opfer brachte er der Gastfreundlichkeit; große Summen kosteten auch seine Sammlungen, deren Wert damals nur von Wenigen erkannt wurde.
In Geldknappheit befand sich Goethe auch nach den Jugendjahren. 1792 lieh er sich von dem Juristen Hufeland in Jena 1000 Taler, die er viele Jahre verzinste. 1796 wollte er seinen Garten an der Ilm an den Herzog verkaufen, weil er Geld brauchte; aber seine Christiane vermutete, daß dies Geld doch nur wieder für Kunstgegenstände und Mineralien daraufgehen werde, und verlangte einen Umtausch gegen Krautländereien oder andere Grundstücke.
Während der napoleonischen Kriege mit ihren beständigen Einquartierungen war Goethe erst recht oft in Geldnot. Als sein Sohn in Heidelberg studierte und mit seinem Wechsel nicht ausgekommen war, so daß er 50 Taler Schulden hatte, mußte Christiane den Jüngling und seine Gläubiger hinhalten. „Wegen des Geldes können wir Dir aber jetzt nicht gleich welches schicken“ schrieb sie im Januar 1809, „da wir diese Weihnachten sehr viele Ausgaben gehabt und viel Abzug[S. 12] wegen der Kontribution haben .... Die Ausgaben hier übersteigen meine Einnahmen, so daß mir auch Alles ganz knapp zugeschnitten wird.“ Noch viel übler sah es im Jahre 1812 aus. Nicht ohne Grund schrieb Goethe damals, er müsse auf seinen Vorteil aus dem Buchhandel sehen, „wenn ich nicht nach einem mühsamen und mäßigen Leben verschuldet von der Bühne abtreten will.“ Im Jahre 1815 war man auch noch recht arm. Damals mußte Christiane an die Weinhändler Gebrüder Ramann in Erfurt schreiben: „Wegen der Zahlung tragen Sie keine Sorge, mein Mann ist zwar angekommen, aber wegen Gelde, sagte er mir, müßten Sie noch etwas in Geduld stehen.“
In den nachfolgenden Friedenszeiten verbesserte sich seine Lage allmählich und erheblich. Es ging aber noch lange die Sage, daß der alte Dichter zu viel arbeiten oder auch zu viel Unfertiges und Minderwertiges in die Druckerei geben müsse, weil die Ausgaben des Hauses rasche und große Einnahmen verlangten. Erst von seinem 76. Jahre an konnte sich Goethe in gesicherten Verhältnissen als wohlhabender Mann fühlen.
**
*
Wie in allen andern Dingen war Goethe auch in Geldsachen für strenge Ordnung. Er führte über seine Einnahmen und Ausgaben sorgfältig Buch; wir können heute noch nachlesen, wieviel er als Junggeselle für Göttinger Wurst ausgegeben hat und daß er z. B. 1778 34 Tischtücher, 267 Servietten, 108 Handtücher, 194 Hemden mit und 82 ohne Manschetten besaß. Von seinem Besuche in Heidelberg im Jahre 1814 erzählt[S. 13] uns Sulpiz Boisserée: Jeden Abend ließ Goethe seinen Bedienten zu sich auf die Stube kommen, um Rechnung mit ihm abzuhalten über alle Ausgaben des Tages, die größten wie die kleinsten, und für den folgenden Tag den vorläufigen Etat im Ausgabebuch festzustellen. Als Boisserées Freund Bertram über diese haushälterische, dem Materiellen zugewendete Sorgfalt des Dichters seine Verwunderung äußerte, sagte Goethe: „Wenn die Prosa abgetan ist, kann die Poesie um so lustiger gedeihen. Man muß sich das Unangenehme vom Halse schaffen, um angenehm leben zu können, und der Schlaf bekommt uns um so besser.“
Aus ähnlicher Gesinnung entsprang der nachfolgende ernste Brief, den Goethe am 19. September 1816 an seinen Sohn August über Borgen und Bürgen schrieb:
Ohne in den besonderen Fall einer zu übernehmenden Bürgschaft, den Du mir, mein lieber Sohn, vorlegtest, einzugehen, muß ich Dir Nachstehendes zu Herzen geben.
Als mich mein seliger Vater einigermaßen ausstattete, war unter andern guten Lehren, die er mir zugleich erteilte, eine, die einem Befehl glich, daß ich bei seinem Leben keine Bürgschaft eingehen und auch nach seinem Tode diese Warnung immer bedenken solle.
Denn, sagte er, wenn du bares Geld hast, so magst du es einem Freunde auch ohne große Sicherheit leihen. Willst du es verschenken, so ist auch nichts dagegen zu sagen. Borgst du, so wirst du dich einrichten, Interessen zu bezahlen und das Kapital abzutragen. Verbürgst du dich aber, so versetzest du dich in einen unruhigen Zustand, der desto peinlicher ist, als du dich untätig, ja leidend verhalten mußt. Niemand verbürgt sich leicht, außer wenn er glaubt, er laufe keine Gefahr; ist aber die Verbürgung geschehen, so fühlt er sich gar bald, besonders in sorglichen[S. 14] Augenblicken, von einem in der Ferne sich zeigenden Übel bedroht, welches um so fürchterlicher erscheint, als er fühlt, daß er ihm nicht gewachsen sei, wenn es näher treten sollte.
Das Leben für einen Freund zu wagen wie für dich selbst ist löblich, denn der Augenblick entscheidet; aber dir auf unbestimmte Zeit oder wohl gar auf’s ganze Leben Sorge zu bereiten und deinen sichern Besitz wenigstens in der Einbildungskraft zu untergraben, ist keineswegs rätlich: denn unsere körperlichen Zustände und der Lauf der Dinge bereiten uns manche hypochondrische Stunde, und die Sorge ruft alsdann alle Gespenster hervor, die ein heiterer Tag verscheucht. – – –
So war die Gesinnung meines Vaters und so ist auch die meinige geblieben. Ich habe in meinem Leben viel, vielleicht mehr als billig, für Andere getan und mich und die Meinigen dabei vergessen. Dies kann ich Dir ohne Ruhmredigkeit sagen, da Du Manches weißt. Aber ich habe mich nie verbürgt,[1] und unter meinem Nachlaß findest Du keinen solchen Akt. Habe daher das alte Sprichwort vor Augen und gedenke mein!
**
*
Wir können nicht lange von Goethe reden, ohne ihm entgegengesetzte Eigenschaften zuzuschreiben; hier müssen wir zusammenfassen: Goethe war sparsam und verschwenderisch.
Sehr sparsam erscheint er z. B. im Gegensatz zu Herder während des Aufenthaltes in Italien; Herder und Schiller lebten stets über ihre Mittel hinaus,[S. 15] wurden die Schulden nicht los und brauchten für die Erziehung ihrer Kinder fremde Hilfe. In Goethes Hause standen die Ausgaben zu seinem Vermögen und seiner Einnahme doch im rechten Verhältnis. In mancher Hinsicht war er recht sparsam. Wir lesen z. B., daß auch in seinen alten Tagen die Besuchsstuben ganze Wintermonate hindurch nicht geheizt wurden, und noch in seinen letzten Jahren wunderten sich Kinder, die seine Enkel besuchten, daß in einem so vornehmen Hause gewöhnliche Talgkerzen gebrannt wurden. „Er hat den Schlüssel des Holzstalles unter seinem Kopfkissen und läßt das Brot abwiegen“ liest man in einem Briefe von 1831 über den Greis: da war er arger Lotterei im Hause auf die Spur gekommen. Zu andern Zeiten war er sehr freigebig und spielte mit dem Gelde. Einmal wagte er etwas ganz Verwegenes: er kaufte für 14000 Taler ein Landgut, ohne es auch nur anzusehen! Und zwar, obwohl er lange darum handelte und obwohl er in zwei Stunden am Platze sein konnte! Im ganzen erscheint er als ein Herr des Geldes, es nie ängstlich festhaltend, es stets gern gegen unmittelbare Güter eintauschend, auch wenn seine Nächsten den Wert dieser Güter nicht erkennen konnten, wie Das bei seinen Sammlungen der Fall war.
Bei seinem Tode hinterließ er 30000 Taler in bar, außer seinen beiden Grundstücken, seinen Sammlungen und seinem literarischen Eigentum. Geerbt hatte er beim Tode seiner Mutter 22252 Gulden.
[1] Zwei kleine Bürgschaften Goethes sind uns jedoch bekannt. Zunächst für Philipp Seidel, als Dieser in den Staatsdienst und zwar in das Steuerfach eintrat. Sodann für seinen anderen ehemaligen Diener Sutor, der ein Kartenfabrikant wurde; hier handelte es sich um ein Darlehen von 300 Talern.

[S. 17]
Wer nach Weimar kommt, sucht bald auch den Park auf, der die liebliche Ilm umsäumt, und wenn er einige Minuten unter den Bäumen dahingeschritten ist, denen Karl August, Goethe und Bertuch einst ihre Stelle anwiesen, so sieht er hinter einer großen grünen Wiese ein weißgetünchtes Häuschen mit hohem, grauem Dache in und vor einem Garten, der sich den Hügel hinaufzieht. In diesem Garten und diesem Hause hat Goethe viele glückliche und viele schmerzlich-erregte Stunden verbracht. Hier überfiel ihn bald sein Herzog, um Staats- oder auch Liebessachen mit ihm zu besprechen; dann kam wohl auch die „schöne Krone“, die Sängerin Korona Schröter, und brachte ein Sträußchen Waldblumen mit, oder es kam die teuerste von Allen, Frau v. Stein, und ihr junger Verehrer schenkte ihr selber den Kaffee ein, über dessen schädliche Wirkung er sonst mit Überzeugung zu schelten liebte. Hier machte er an Sommerabenden zuweilen für die ganze Hofgesellschaft „den Wirt der herzoglichen Promenade“ und suchte „bald durch Tee, bald durch saure Milch die Gemüter der Frauen zu gewinnen,“ während die Männer am Spieltische saßen oder in seiner Kegelbahn ihre Kunstfertigkeit maßen.
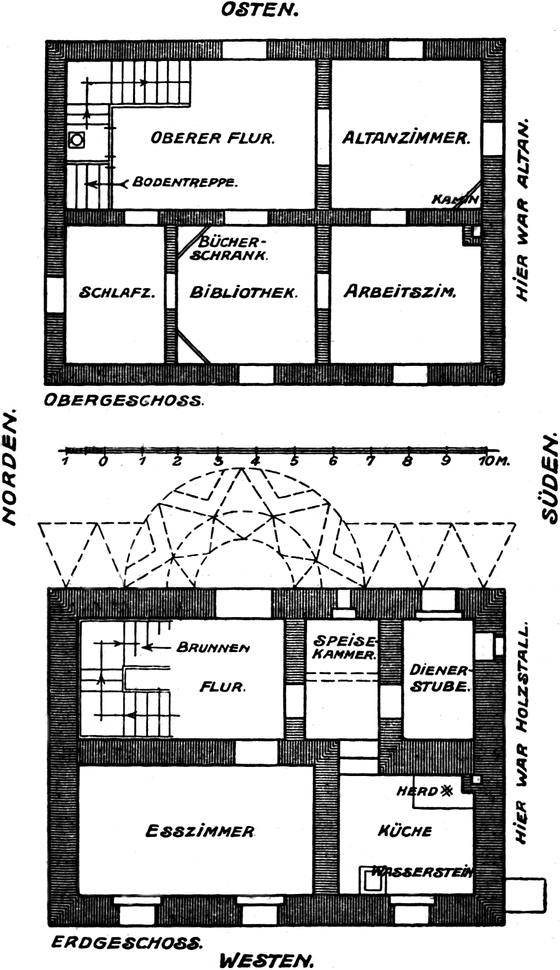

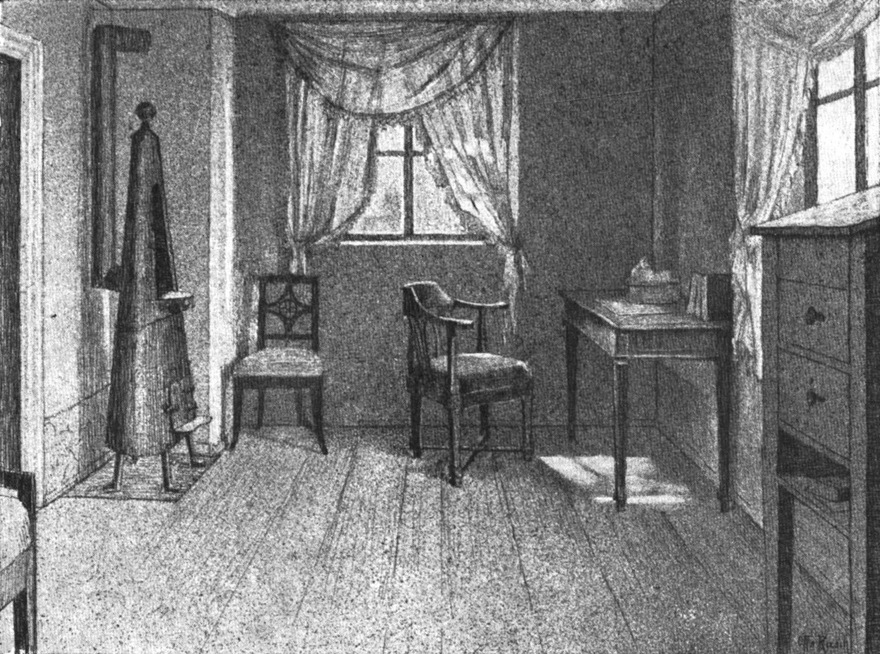
Wir sind nicht wenig erstaunt, wenn wir das Häuschen betreten, das sieben Jahre hindurch dem[S. 19] Busenfreunde des Landesherrn, dem weithin berühmten Dichter, dem Herrn Geheimden Rat als Wohnung diente. So bescheiden hätten wir es uns doch nicht vorgestellt! Unten ist gar kein bewohnbares Zimmer; höchstens kann man einen Raum, an dessen Wänden Pläne von Rom hängen, im Sommer wegen seiner Kühle schätzen. Oben sind drei Stuben und ein Kabinettchen, alle klein und niedrig, mit bescheidenen Fensterchen und schlichten Möbeln; zuerst ein Empfangszimmer mit harten, steifen Stühlen, dann das Arbeitszimmer mit kleinem Schreibtisch, daranschließend ein Bücherzimmer, und zuletzt das Schlafstübchen, in dem noch die Bettstelle aus Holz, Drell und Bindfaden steht, die in drei Teile zusammengeklappt und so als – Koffer auf die Reise mitgenommen werden konnte. Draußen im Garten kann es uns viel besser gefallen als im engen Häuschen; da sieht man, wie in den Rosen, die seine Fenster umranken, Hänflinge und Grasmücken nisten; da blühen die Malven, Lilien und Kaiserkronen; hohe Bäume stehen in flüsternden Gruppen zusammen, und in ihrem Schatten genießen wir den Blick auf das anmutige Flußtal.
Es ist eine herrliche Empfindung, da haußen im Feld allein zu sitzen. Morgens früh, wie schön! Alles ist so still. Ich höre nur meine Uhr tacken und den Wald und das Wehr von ferne.[2]
Das Schloß und die Stadt waren nahe, aber die Bäume des Parks verdeckten sie. Es war, „als sei[S. 20] man in der Nähe eines Waldes, der sich stundenweit ausdehnt. Man denkt, es müsse jeden Augenblick ein Hirsch, ein Reh auf der Wiesenfläche hervorkommen. Man fühlt sich in den Frieden tiefer Natureinsamkeit versetzt, denn die große Stille ist oft durch nichts unterbrochen als durch die einsamen Töne der Amsel oder durch den pausenweise abwechselnden Gesang einer Walddrossel.“[3] Hier (auf dem Altan, der später abgerissen wurde) liebte der junge Goethe, in seinen Mantel gehüllt, die Sommernacht zu verschlafen oder, wenn der Schlaf ihn floh, zu den Sternen hinaufzuschauen:
Oder er sprach zu den Zweigen, die ihm entgegenblühten, von seinem Hoffen und Sehnen:
Und hier im Grünen vergaß er rasch allen Ärger, den ihm die „Ekelverhältnisse“ mit seinen Neidern in der Stadt bereiteten; in der stillen Natur erfrischte er seine Seele immer wieder, wie den Leib in der Ilm oder im Floßgraben, der seinem Häuschen noch näher war:
[S. 21]
„Jeden Morgen empfängt mich eine neue Blume und Knospe“ schreibt er im Frühling 1781 an Lavater; „die stille, reine, immer wiederkehrende Vegetation tröstet mich oft über der Menschen Not, ihre moralischen, noch mehr physischen Übel.“
Hier im grünen Flußtale konnte der junge Mann seinen Naturkultus nach Herzenslust betreiben. Als er zum ersten Male in seinem Garten geschlafen, nannte er sich „Erdkulin“, Erdkühlein nach einem Märchentier, das einsam im Walde haust. Er spricht von seinem „Erdgeruch“ und „Erdgefühl“; ihm war wohl in Klüften, Höhlen und Wäldern. Und seine ganze Umgebung steckte er an. „Sauge den Erdsaft, saug’ Leben dir ein“ riet Karl August in einer poetischen Epistel der Frau v. Stein, und er, der Landesfürst, hauste selber tage- und wochenlang in einer Holzhütte des Parkes, dem Borkenhäuschen, das jetzt nur noch zur Aufbewahrung von Geräten gut genug erscheint. Auch Wieland kaufte einen großen Obstgarten und schrieb: „Mir ist nirgends so wohl, bis ich meinen Stab in der Hand habe, um unter meinen Bäumen zu leben und den unendlichen Erdgeist einzuziehen.“ „Der Statthalter von Erfurt war einige Tage bei uns und ist auch nicht ohne Erdgeruch entlassen worden“ meldet Goethe vergnüglich dem Freiherrn v. Fritsch. Herzogin Amalie lebte wie eine Gutsbesitzerin im Dörfchen Tiefurt. Schiller, der ein Stubenhocker[S. 22] war, sah auch an Knebel Goethes Wirkung: die Verachtung der „Spekulation“ und „das bis zur Affektation getriebene Attachement an die Natur.“
Auch für Goethe kam die Zeit, wo ihm der Garten fremder wurde; er mußte zugeben, daß er eines großen Stadthauses bedurfte. Zeitweilig überließ er das Häuschen seinem Freunde Knebel; zwei Sommer vermietete er den Garten an den Herzog, der ihn als Tummelplatz seiner Kinder brauchte; auch Frau v. Heygendorff hatte ihn zwei Sommer. Aber einige Male wohnte Goethe doch auch als alter Herr wieder auf Wochen draußen. Und zuweilen hatte er Lust, im Gartenhäuschen, wo er „so tüchtige Jahre verlebt“ auch zu sterben.[4]
**
*
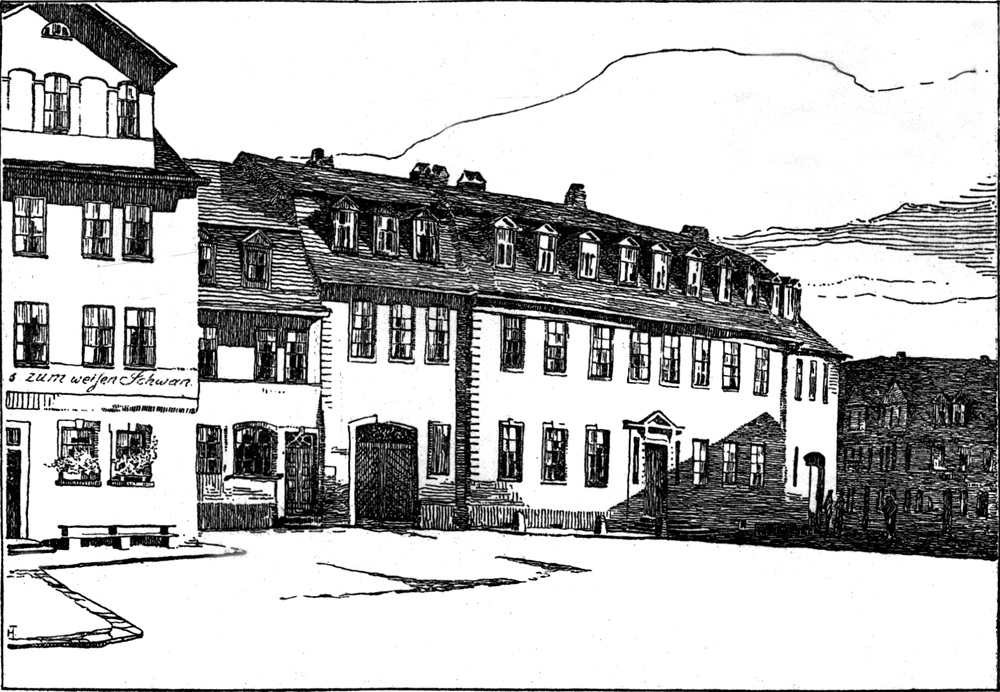

Einen ganz andern Eindruck gewannen die Gäste in Goethes Stadthause am Frauenplan. Nachdem er früher schon zur Miete darin gewohnt hatte, konnte er es sich in den Jahren 1792 und 1793 als eine Art Eigentum einrichten. (Buchmäßig gehörte es zunächst dem Herzoge, der es ihm aber als Geschenk zugedacht hatte.) Goethe suchte bei diesem Umbau Manches, was ihm in Italien gefallen hatte, hier zu wiederholen; es traf sich auch, daß ein Künstler, den er in Rom kennen gelernt und der seinen Geschmack in Italien ausgebildet[S. 25] hatte, jetzt und hier sein Hausgenosse war und sehr oft auch sein Stellvertreter, da Goethe gerade während des Umbaues und der Einrichtung viel abwesend sein mußte. Dieser Künstler, der Schweizer Heinrich Meyer, besaß sein volles Vertrauen, und so ereignete es sich, was bisher noch in keinem deutschen Bürgerhause der Fall gewesen, daß ein Maler den Umbau und die ganze Ausstattung anordnete. So kam es denn auch, daß diese Wohnung des Geheimen Rats Goethe einen ganz andern Eindruck machte, als man sonst gewohnt war; besonders das sehr groß geratene Treppenhaus, die sanft ansteigende breite Treppe und der antike Schmuck ringsum stimmte den Eintretenden feierlich. Man ward dann noch durch ein Gemälde-Zimmer geleitet, ehe sich die Tür öffnete zu dem Raum, in welchem der Fürst des Hauses dem sich verneigenden Besucher entgegentrat. Wer Zeit hatte, sich umzusehen, bemerkte noch ein Zweites, was ihn der gewöhnlichen Welt entrückte: die Zimmer dienten zugleich als eine Galerie für Kunstwerke, Altertümer und Naturschätze. Schon 1794 berichtet ein junger Landsmann Heinrich Meyers, der dem Dichter seine Aufwartung machen durfte, daß er nach der kurzen Audienz noch „sein fürstliches Kabinett von Handzeichnungen berühmter Meister und sein mit dem feinsten epikuräischen Geschmack eingerichtetes Haus“ besehen habe. Wer bei Herder oder Wieland oder sonst einem Gelehrten der Stadt seinen Besuch machte, hatte keine Ursache, über ihre Wohnungen zu reden; bei Goethe aber war schon seine Umgebung ein unvergeßliches Erlebnis.
[S. 26]
Gleich beim Eintritt in das mäßig große, in einfach antikem Stil gebaute Haus deuteten die breiten, sehr allmählich sich hebenden Treppen sowie die Verzierung der Treppenruhe mit dem Hunde der Diana und dem jungen Faun von Belvedere die Neigungen des Besitzers an. Weiter oben fiel die Gruppe der Dioskuren angenehm in die Augen, und am Fußboden empfing den in den Vorsaal Eintretenden blau ausgelegt ein einladendes SALVE. Der Vorsaal selbst war mit Büsten und Kupferstichen auf das reichste verziert und öffnete sich gegen die Rückseite des Hauses durch eine zweite Büstenhalle auf den lustig umrankten Altan und auf die zum Garten hinabführende Treppe. In ein anderes Zimmer geführt, sah der Gast sich auf’s neue von Kunstwerken und Altertümern umgeben: schön geschliffene Schalen von Chalcedon standen auf Marmortischen umher; über dem Sofa verdeckten halb und halb grüne Vorhänge eine große Nachbildung des unter dem Namen der Aldobrandinischen Hochzeit bekannten alten Wandgemäldes, und außerdem forderte die Wahl der unter Glas und Rahmen bewahrten Kunstwerke, meistens Gegenstände alter Geschichte nachbildend, zu aufmerksamer Betrachtung auf.
So schildert einer der vielen Gäste, der gelehrte Leibarzt des sächsischen Königs, Gustav Carus, was er sah, ehe der Ersehnte und zugleich Gefürchtete erschien.

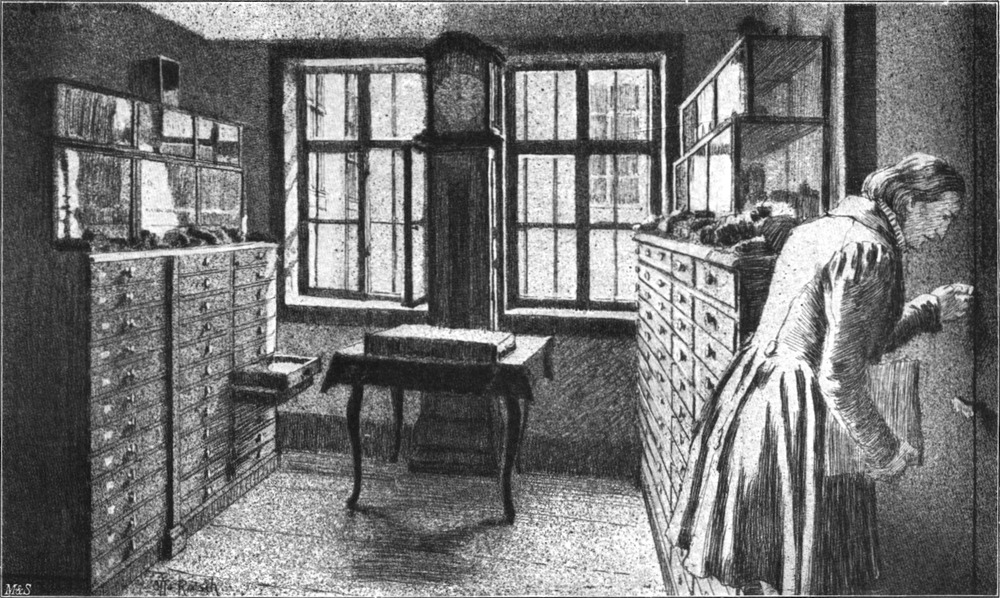
Das Museumsartige des Hauses nahm mit jedem Jahre zu. Dafür sorgte Goethes Liebe zur Kunst und zur Natur, seine Lust am Sammeln, sein Bedürfnis, das Schöne, Merkwürdige oder Lehrreiche zu besitzen und es stets zur Hand und oft vor Augen zu haben. Die Altertümer, die Büsten, Statuetten, Denkmünzen, Plaketten, Kameen, Majoliken, Ölgemälde, Kupferstiche, Handzeichnungen, die Steine, Knochen usw. wuchsen allmählich zu Hunderten und Tausenden an. In ihre[S. 27] Betrachtung vertiefte er sich immer wieder, um feinsten Genuß und neue Belehrung davonzutragen; in ihrer Mitte hielt er oft seine Gesellschaften ab, schon dadurch jede Langeweile ausschließend. Hier erlebte mancher Fachkenner, daß für sein Gebiet die gesamten Lehrmittel sofort herbeigeholt werden konnten; hier waren denn auch die gelehrten Freunde und Mitarbeiter aus der Stadt: Meyer, Riemer und Eckermann, oder die noch gelehrteren Gäste von auswärts, Wilhelm und Alexander v. Humboldt, Friedrich August Wolf und Sulpiz Boisserée, an ihrem Platze.
**
*
Wenn wir aber in diesem Stadthause die Räume aufsuchen, die er am meisten benutzte, so haben wir wieder den Eindruck des Gartenhauses. Goethe wohnte gar nicht in seinem vornehmen Vorderhause am Frauenplan, sondern in einem bescheidenen Hinterhause zwischen Hof und Garten. Das Arbeitszimmer und das daneben liegende Schlafzimmer sind sehr einfache, niedrige Räume. Nichts deutet auf einen vornehmen, reichen Besitzer. Die Studierstube würde heute nur Wenigen genügen, die sich zum Mittelstande rechnen; für „standesgemäß“ würde sie Niemand halten. Alles darin ist zur Arbeit bestimmt, zum Lesen, Schreiben oder Experimentieren: kein Sofa, kein bequemer Stuhl, keine Gardinen, sondern nur Rollvorhänge aus dunklem Rasch. Ein Sofa war lange darin, aber noch in hohem Alter ließ Goethe es hinaustragen, um Platz für seine geliebten Sammlungen zu gewinnen. Auch an den[S. 28] Büchern ist keine Pracht; seine gesammelten Werke sind auf das schlichteste eingebunden: er nahm ja auch seine berühmtesten Dramen oder Gedichte jahrzehntelang nicht wieder in die Hand. Nur ein Möbel hatte Goethe in dieser Stube, das wir nicht kennen: ein kleines Korbgestell, das sein Taschentuch aufnahm. Und auf dem Tische liegt ein Lederkissen, auf das er die Arme legte, wenn er dem gegenüber sitzenden Schreiber diktierte.
Er war über achtzig Jahre alt, als er zum getreuen Eckermann sagen konnte:
Sie sehen in meinem Zimmer kein Sofa; ich sitze immer in meinem alten hölzernen Stuhl und habe erst seit einigen Wochen eine Art von Lehne für den Kopf anbringen lassen. Eine Umgebung von bequemen, geschmackvollen Möbeln hebt mein Denken auf und versetzt mich in einen passiven Zustand.
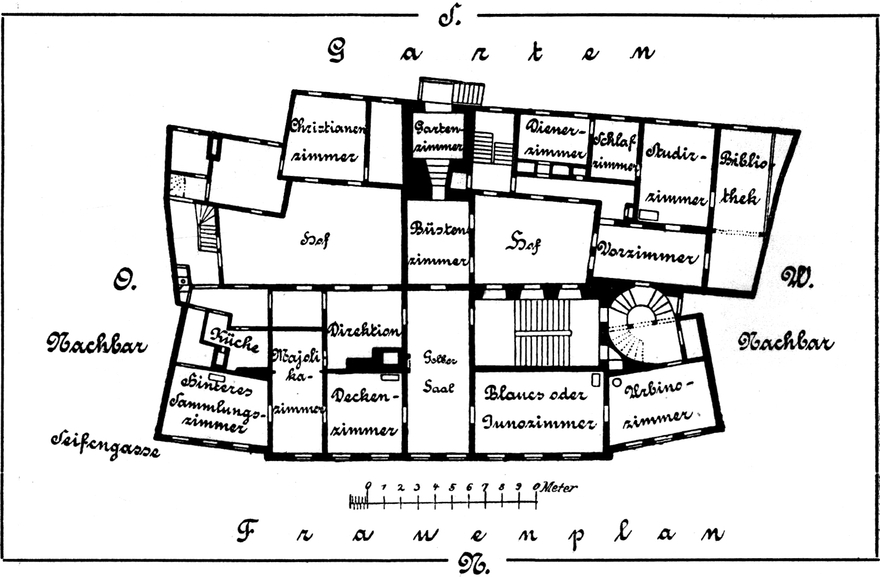


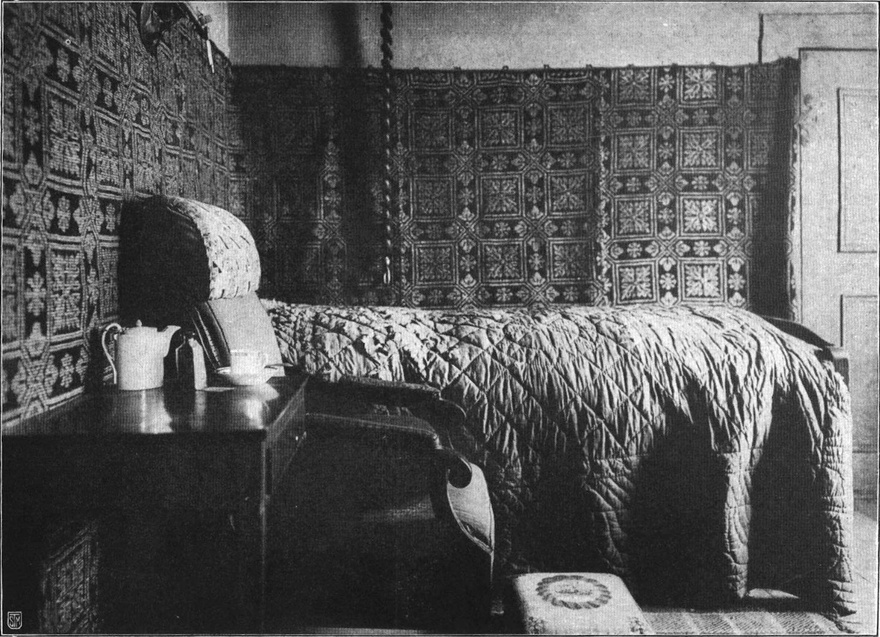
Die einzige Schönheit dieser „Klosterzelle“, die der alte Herr oft wochenlang nicht verließ, war, daß sie ebenso ruhig und friedlich war, wie wenn sie wirklich zu einem Kloster gehöre; kein Lärm von der Straße drang hierher, und die Fenster gingen in den schlafenden „Klostergarten.“ Hier stand er an frühen Winterabenden und blickte auf die Schneelast der Bäume, während sein geliebter großer Ofen die Eisblumen vom Fenster abwehrte. Am Tage freute er sich dann, wie die im Winter willkommene Mittagssonne sein ganzes Zimmer durchleuchtete. Wenn nun die Tage länger wurden, erschienen „Schneeglöckchen, Krokus und andere niedliche Frühblumen in Büschel und Reihen“ vor seinem Fenster, und bald sah man ihn dann mit dem[S. 31] Gärtner die buchsbaumumsäumten Gartenwege eifrig hin und wieder schreiten, das Säen und Pflanzen anordnend, bei dem er früher so gern selber Hand angelegt.
Noch schlichter als die Studierstube ist sein Schlafzimmer. In dem kleinen Gemache ist außer seinem Bette fast nichts vorhanden als der Lehnstuhl, in dem er starb, und daneben ein kleines Tischchen, auf dem noch heute die letzte Medizin steht. Eine Art Waschtisch sehen wir noch, ein sehr kleines Ding mit einem sehr kleinen Waschbecken, wie wir es jetzt kaum noch in Dorfwirtshäusern vorfinden.
**
*
Eine Eigentümlichkeit Goethes war sein Bedürfnis, mehrere Wohnungen gleichzeitig zu haben und mit ihnen zu wechseln. Diese „etwas breite Existenz“, die er im eigentlichen, räumlichen Sinne führte, erklärt sich nicht völlig aus den verschiedenen Darbietungen und Forderungen der Jahreszeit oder aus seinen verschiedenen Beschäftigungen. Eine Unrast, die ihn sein ganzes Leben zuweilen ergriff, und andere, innerliche Gründe veranlaßten ihn oft, der gewöhnlichen Umgebung zu entfliehen. Schon in seinen ersten weimarischen Jahren hatte er zugleich Stadtwohnungen[5] und sein Häuschen an der Ilm, und dies mehrfache Wohnen behielt er sein Leben lang bei. Im Januar 1794 plante Goethe, obwohl er doch schon zwei Besitzungen hatte, den Ankauf eines großen Landgutes, das 45000 Taler kosten[S. 32] sollte. Einige Jahre (1798-1803) besaß er, wie schon erwähnt, das Freigut in Oberroßla; 1808 hatte er große Lust, sich in Frankfurt eine Wohnung zu längeren Besuchen zu mieten.[6]
Vom Sommer 1794 an wohnte Goethe auf viele Jahre in zwei Städten abwechselnd. Denn er hielt sich nun Monate lang auch in Jena auf, teils aus eigenem Triebe, weil er dort ungestörter arbeiten konnte, teils weil der Herzog und sein Ministerkollege Voigt seinen Einfluß auf die Professoren für zuträglich hielten.
In der ersten Zeit hatte er sein dortiges Quartier im Schlosse. Es scheint aber, daß er in diesem Schlosse nur ein einziges kleines Zimmer zum Wohnen und Schlafen benutzte. Im Mai 1809 richtete er sich im Botanischen Garten „eine Art zweiter Wohnung“ ein. Im Frühjahr und Sommer 1818 schlief er bei Inspektor Bischoff, verbrachte die Tage aber in einer Mansarde des Gasthofs zur Tanne in Kamsdorf, also an der Brücke auf der andern Seite der Saale: es war ihm um den Blick auf den Fluß und die weite Aussicht zu tun. Frau Frommann schilderte dies Mansardenzimmer ihrem Sohne:
In der Mitte ein großer Tisch mit Landkarten, auch solche vom Harz und Thüringer Waldgebirge, wo es unruhig[S. 33] wird und braut, denn er beobachtet mit Gläsern und bloßen Augen die Wolken, führt darüber ein Tagebuch. Auch Bücher liegen auf dem Tisch und eine Vase Blumen mit angesteckten Zetteln. Die ganzen Wände sind bedeckt mit guten Zeichnungen, Kupferstichen, zierlich in den Ecken angeheftet. An der einen Seite ein großes, wohl vier Ellen langes Panorama von Rom, an der entgegengesetzten eine etwas kleinere Ansicht von Dünkirchen – die Peterskirche mit den spitzen Türmen – den Einzug Ludwig XIV., Allongenperücken, mit Roß und Mann; gleich darüber eine gute Sepiazeichnung von einer Greueltat aus der biblischen Geschichte. Das Sofa voll Bücher, Hefte in Menge ... Vor dem Fenster liegt immer der artige schwarze Spiegel, um die schönsten Miniaturlandschäftchen zu geben. Die Brücke, das rauschende Strömen der Saale geben herrliche Unterhaltung ... Keine Bequemlichkeit im ganzen Raum als das Bett, worauf er sich abwechselnd legt.
Nicht viel anders sah es in seiner Wohnung im Botanischen Garten aus, die er doch auch viele Jahre beibehielt. Er sprach selber im Herbst 1821 von einer „unscheinbarsten Hütte“ oder der „morschen Schindelhütte“, in der er dort lebe. Ein junger Balte, v. Weltzien, fand diese Wohnung von außen „sehr schofelig“ und drinnen nicht viel besser.
Goethe hält sich gewöhnlich in einem Zimmer eine Treppe hoch auf, welches blau angestrichen und mit vielen Kupferstichen behängt ist. Im Zimmer selbst sieht es ziemlich liederlich aus; alle Tische und Fenster liegen voll Kalender, Bücher usw. Nebenan stößt eine Schlafkammer.
Man kann sich Goethe recht gut in den herrlichsten Räumen denken, und er hat sich oft darin bewegt. Aber seine eigentliche Heimat hatte er doch in bescheidensten[S. 34] Stübchen. So sprach sich der Achtzigjährige zu Eckermann aus:
Prächtige Gebäude und Zimmer sind für Fürsten und Reiche. Wenn man darin lebt, fühlt man sich beruhigt; man ist zufrieden und will nichts weiter. Meiner Natur ist es ganz zuwider. Ich bin in einer prächtigen Wohnung, wie ich sie in Karlsbad gehabt, sogleich faul und untätig. Geringe Wohnung dagegen, wie dieses schlechte Zimmer, worin wir sind, ein wenig unordentlich-ordentlich, ein wenig zigeunerhaft, ist für mich das Rechte; es läßt meiner Natur volle Freiheit, tätig zu sein und aus mir selber zu schaffen.
[2] Goethes Tagebuch, 18. Mai 1776.
[3] Eckermann unter dem 22. März 1824.
[4] Außer diesem Garten besaß Goethe seit 1796 durch Christianes Betreiben ein Krautland hinter der Lotte (jetzt Lassenstraße 27); bei seinem Tode vermachte er es seinem letzten Diener Friedrich Krause.
[5] Burgplatz 1, Fürstenhaus und Seifengasse 16.
[6] Übrigens besaß Goethe 1818 am Alten Markte in Frankfurt ein kleines Haus, das er vielleicht nie betreten oder auch nur angesehen hat. Er hatte von der Mutter her einen Insatz darauf, den er ausklagen mußte, weil der Mieter die Zinsen nicht bezahlte; in der Versteigerung mußte er das Haus kaufen.
[S. 35]
Wir haben von Goethe viele Bilder: sehr verschieden wirken sie auf uns. Und ebenso verschieden sind die Schilderungen Derer, die ihm in seinem Stadthause aufwarteten. Die Einen fanden ihn sehr groß, die Andern „keineswegs von hervorragender Größe.“ Die Einen erblickten ein Ideal männlicher Schönheit, die Andern wissen nichts davon zu berichten. Manche fanden ihn, wie sie ihn sich gedacht hatten; Andere sagten, er sehe aus wie ein Forstmeister, ein Gutsbesitzer oder ein Großkaufmann. Den Einen erschien er überaus sympathisch, mit einem einzigen Blicke Liebe und Verehrung erweckend; Andern war er „ein langer, alter, eiskalter Reichsstadtsyndikus,“ und sie atmeten auf, wenn sie seine Eisluft hinter sich hatten.
So verschieden sehen die Menschen durch ihre Gefühle hindurch! Aber Goethe war auch nicht immer der Gleiche. Groß erschien er, wenn er sich recht steif und gerade hielt und würdig auftrat, und Das pflegte er Fremden gegenüber zu tun; in Wirklichkeit war er nicht so groß, wie wir ihn uns gern denken. Nach einer Marke im Gartenhause, die für sein Maß gilt, würden wir ihm für seine jungen Jahre 1,77 m zuschreiben.[7][S. 36] Und seine Schönheit hing sehr von den Stimmungen ab; in erhöhten Stunden sahen seine Bewunderer in ihm einen Apollo oder Jupiter; kritische Betrachter dagegen bemerkten einige Pockennarben im Gesicht, sahen, daß sein linkes Auge größer war oder höher saß als das rechte, daß die Nase schief gegen die Stirne stand, daß der zahnlose Mund eingefallen und beim Reden unschön war, daß er gelbe Zähne hatte. Sie fanden, daß seine Beine zu kurz seien; in seinen fünfziger Jahren war er auch übermäßig dick. Sicherlich war der Jüngling und der Greis erheblich schöner als der Mann im mittleren Alter.
Ein Bild des jungen Mannes entwarf ein langjähriger Diener: „Als ich bei ihm kam, mochte er etwa siebenundzwanzig Jahre alt sein; er war sehr mager, behende und zierlich, ich hätte ihn leicht tragen mögen.“ Gleim bemerkte um die gleiche Zeit „außer einem Paar schwarzglänzender italienischer Augen, die er im Kopfe hatte,“ nichts Auffallendes.


Oberthür aus Würzburg glaubte schon im 28jährigen Goethe „einen tief denkenden, ernsthaften, kalten Engländer dem Kleide und der Miene nach“ zu sehen; den „lustigen, launigten, auch ein wenig mutwillig-lustigen Gesellschafter,“ von den man redete, hätte er in diesem Manne nie erraten. „Nach und nach merkte ich, daß[S. 37] der Dichter sich noch mehr in sich selbst zurückzog, stille wurde, ernsthaft und kalt wie in einem englischen Spleen dastunde.“ Immer wieder werden seine Augen hervorgehoben. „Das weiß ich, daß in seinen großen, hellen Augen der ganze Goethe strahlte“ schreibt die Tochter der Karschin, und der junge Schauspieler Iffland: „Goethe hat einen Adlerblick, der nicht zu ertragen ist.“
Schiller urteilte 1788:
Er trägt sich steif, geht auch so, sein Gesicht ist verschlossen, aber sein Auge sehr ausdrucksvoll, und man hängt mit Vergnügen an seinem Blicke. Bei vielem Ernst hat seine Miene doch viel Wohlwollendes und Gutes. Er ist brünett und schien mir viel älter auszusehen, als er es sein kann. Seine Stimme ist überaus angenehm.
Die Dichterin Friederike Brun schilderte ihn, wie er 1795 in Karlsbad zu ihr kam.
Anspruchsloser, wie er es ist, in seinem Reden und Schweigen, in seinem Gehen und Stehen, ist es unmöglich zu sein. Sein Gesicht ist edel gebildet, ohne gleich einen inneren Adel entgegen zu strahlen; eine bittere Apathie ruht wie eine Wolke auf seiner Stirn. Bei einem schönen männlichen Wuchse fehlt es ihm an Eleganz, und seinem ganzen Wesen an Gewandtheit.
Sie versuchte, wie viele andere Frauen und auch wohl Männer, die Gestalten seiner Dichtungen oder den Verfasser dieser Dichtungen in ihm zu erkennen. Zunächst sah er nur wie der Urheber des ‚Wilhelm Meister‘ aus; bei weiterem Umgang sah sie aber auch den Faust, den Werther und Egmont hervorleuchten; nur bis zu Tasso und Iphigenie stieg er nicht empor. Einmal sah er leibhaftig aus wie Faust. „Bald glaubte[S. 38] ich ihn auf dem Faß zu sehen, und dann glaubte ich wieder, der Gottseibeiuns würde ihn auf der Stelle holen.“
Dies waren schon die Jahre, wo seine Dickigkeit das Bild verdarb und auch häufige Kränklichkeit und viel Hypochondrie sich abzeichneten. Später aber entstand eine neue Schönheit. Den älteren Mann scheint der schon genannte Mediziner v. Weltzien 1820 sehr unparteiisch zu zeichnen:
Sein Gesicht hat ungeachtet der tiefen Furchen und Runzeln, die zweiundsiebzig Lebensjahre hineingegraben haben, einen außerordentlichen Ausdruck, den ich aber ganz anders fand, als ich erwartete: nichts von Arroganz, nichts von Menschenverachtung, sondern etwas ganz Unnennbares, wie es Männern eigen zu sein pflegt, die durch vielfältige Erfahrungen und Schicksale und gleichsam im Kampf durch das Leben gegangen sind und nun im Gefühl ihrer wohlerhaltenen Integrität mit beneidenswerter Gemütsruhe der Zukunft entgegensehen. In diesem Ausdrucke mischt sich bei Goethe ein unverkennbarer Zug von Herzensgüte und zugleich ein andrer von besiegter ehemaliger Leidenschaftlichkeit, welche noch in dem unsteten Wesen seines Blicks sich offenbart. Diesem Ganzen verleiht das graue Haar einen noch größeren Zauber.
Ganz ähnlich scheint Goethe selber über sein Aussehen gedacht zu haben, denn 1818 schreibt er in dem Aufsatze ‚Antik und modern‘:
Ein geübter Diplomat, der meine Bekanntschaft wünschte, sagte, nachdem er mich bei dem ersten Zusammentreffen nur überhin angesehen und gesprochen, zu seinen Freunden: Voilà un homme qui a eu de grands chagrins! Diese Worte gaben mir zu denken. Der gewandte Gesichtsforscher hatte recht gesehen, aber das Phänomen bloß durch den Begriff[S. 39] von Duldung ausgedrückt, was er auch der Gegenwirkung hätte zuschreiben sollen. Ein aufmerksamer, guter Deutscher hätte vielleicht gesagt: Das ist auch Einer, der sich’s hat sauer werden lassen!
In den Tagebüchern des Grafen Platen finden wir eine Schilderung von 1821:
Er ist sehr groß, von starkem, aber nicht in’s Plumpe fallendem Körperbau. Bei seiner Verbeugung konnte man ein leichtes Zittern bemerken. Auch auf seinem Angesichte sind die Spuren des Alters eingeprägt. Die Haare grau und dünn, die Stirn ganz außerordentlich hoch und schön, die Nase groß, die Formen des Gesichts länglich, die Augen schwarz, etwas nahe beisammen, und wenn er freundlich sein will, blitzend von Liebe und Gutmütigkeit. Güte ist überhaupt in seiner Physiognomie vorherrschend.
Platen fährt fort: „Bei der Feierlichkeit, die er verbreitet, konnte das Gespräch nicht erheblich werden,“ und der Theologe Stickel berichtet von seinem Besuche 1827: „Unwillkürlich verneigte ich mich so tief wie sonst noch vor keinem Sterblichen; eine innere Gewalt beugte mich nieder.“
**
*
Ebenso wie in Haltung und Auftreten, so war Goethe auch in der Kleidung das volle Gegenteil Friedrichs des Großen, von dessen verschabtem blauen Rock und buckliger Gestalt er einmal spricht. Zwar in jungen Jahren legte auch er wenig Wert auf seine Kleidung, und namentlich fragte er nicht nach Mode oder Sitte und erregte dadurch in Frankfurt oft Anstoß. Wo alle andern in feierlichen Kleidern erschienen, war er nachlässig gekleidet; „er ist ganz sein, richtet sich nach[S. 40] keiner Menschen Gebräuchen“ schreibt der Maler Kraus 1775 von ihm. Daß er im Hause der vermeintlichen Schwiegermutter Schönemann elegant und modisch auftreten sollte, um zu ihrem Vermögen, ihrer Geselligkeit und ihren Möbeln zu passen, behagte ihm gar nicht; lieber ließ er sich von den Freunden Bär oder Hurone oder Westindier schelten. Am liebsten ging er in grauem Biberfrack mit lose geschlungenem braunseidenem Halstuch.
Als er dann im Frühjahr 1775 seiner Braut und ihrer Mutter mit den Grafen Stolberg entfloh, trugen sie alle „Werther-Uniform“, d. h. blauen Frack mit Messingknöpfen, gelbe Weste, Lederhose und Stulpenstiefel; namentlich die Stiefel waren ganz gegen die damalige Kleiderordnung, die in besserer Gesellschaft seidene Strümpfe und Schuhe vorschrieb. Auch nach Weimar kam er in dieser Kleidung. Das Naturburschentum war damals Mode, und Goethe war ein Führer dieser Mode. Er entsetzte die Damen durch sein Fluchen bei Tische, brauchte gern unanständige Ausdrücke und machte sich nichts daraus, wenn sein Lieblingswort „Kerl“ Anderen nicht gefiel. Aber bald übernahm er Ämter und Pflichten, und zu gleicher Zeit kam er in die Erziehung der geliebten Charlotte v. Stein; er ward an sich haltender, auf seine äußere Erscheinung bedachtsamer. Auf einem Schattenbilde von 1778 sehen wir ihn mit Haarbeutel, Spitzenkrause, eng anliegendem Rock, der bis über die Knie reicht, seidenen Strümpfen und Schnallenschuhen. Matthisson schildert ihn 1783 als „stattlichen Mann in goldverbrämtem blauem Reitkleid.“[S. 41] Johanna Schopenhauer verliebte sich ein wenig in den berühmten Dichter, als er ihr im Herbst 1806 bei ihrem Eintritt in Weimar die Ehre erwies, sie häufig zu besuchen. Trotzdem sind ihre Schilderungen seiner Person zuverlässig genug.
Er ist das vollkommenste Wesen, das ich kenne, auch im Äußeren. Eine hohe, schöne Gestalt, die sich sehr gerade hält, sehr sorgfältig gekleidet, immer schwarz oder ganz dunkelblau; die Haare recht geschmackvoll frisiert und gepudert, wie es seinem Alter ziemt, und ein gar prächtiges Gesicht mit zwei klaren braunen Augen, die mild und durchdringend zugleich sind. Wenn er spricht, verschönert er sich unglaublich.
Ein ausdrucksvolleres, mobileres Gesicht habe ich nie gesehen. Wenn er erzählt, ist er immer die Person, von der er spricht. Der Ton seiner Stimme ist Musik. Jetzt ist er alt, aber er muß schön wie ein Apoll gewesen sein.
Goethe wechselte offenbar gern zwischen sehr schlichten und sehr feinen Anzügen. Die Freunde sahen ihn im Alter öfters in Hemdsärmeln sitzen, wenn der Tag heiß war, oder im Winter im dicken wollenen Wams behaglich an seinem geliebten breiten Ofen stehen. Selbst am Mittagstisch saß er im Sommer zuweilen in Hemdsärmeln. Er empfing auch wohl Freunde im weißen flanellenen Schlafrock, und wenn ihn in diesem Kostüm gerade ein Bruder Napoleons überraschte, brachte ihn Das auch nicht in Verlegenheit. Aber wo er sich vorbereiten konnte, ließ er sich doch standesgemäß ankleiden. Weltzien notiert 1820: „Ganz in Gala, schwarzer, feiner Frack, worauf der große Stern des Falkenordens prangte, schwarze Pantalons nebst Stiefeln, eine weiße Weste und sehr feine Manschetten, so daß[S. 42] ich nicht begreifen konnte, wie ein Mann in solchem Alter sich zu Hause solchen Zwang antut.“ Da hatte ihm Goethe eben nicht gesagt, daß er den Großherzog erwarte. Gustav Carus erwähnt 1821: „blauen Zeugüberrock, kurzes, etwas gepudertes Haar.“ Der Pole Odyniec sah 1829 „einen dunkelbraunen, von oben herab zugeknöpften Überrock, auf dem Halse ein weißes Tuch, das durch eine goldene Nadel kreuzweis zusammengehalten wurde, keinen Kragen.“ In zwei verschiedenen Gestalten erschien er 1826 dem Dichter Grillparzer. Zuerst in einer großen Gesellschaft: „schwarz gekleidet, den Ordensstern auf der Brust, gerader, beinahe steifer Haltung trat er unter uns, wie ein Audienz gebender Monarch.“ Ein paar Tage später gingen sie im Hausgarten auf und ab, und Goethe war viel gemütlicher und herzlicher:
Sein Anblick in dieser natürlichen Stellung, mit einem langen Hausrock bekleidet, ein kleines Schirmkäppchen auf den weißen Haaren, hatte etwas unendlich Rührendes. Er sah halb wie ein König aus und halb wie ein Vater.
**
*
„Und schreien kann er wie 10000 Streiter“ schreibt Felix Mendelssohn in der Übertreibung, die die Jugend liebt; „einen ungeheuren Klang der Stimme hat er.“ Schwerhörige dagegen klagten, daß Goethe zu leise spräche und, wenn er ihnen zu liebe die Stimme erhöbe, sie doch sogleich wieder sinken ließe. Alle Berichte sagen, daß Goethes Stimme ein sehr wohlklingender Baß gewesen sei und daß er rezitierend oder[S. 43] deklamierend großen Eindruck machte. Uns Heutige würde es vielleicht stören, daß der berühmte Dichter, ebenso wie Schiller und fast alle Zeitgenossen, seine heimatliche Mundart nie ganz aufgab. Eine Schulsprache gab es damals noch nicht, und ebensowenig hatte das Theater die Deutschen in dieser Hinsicht schon einiger machen können. So sprach Goethe, wenn er sich gehen ließ, „frankfortsch“, und dem Berliner, der sich über das Berlinische seiner Landsleute nicht wunderte, fiel das natürlich auf. So dem Dr. Parthey, der am 28. August 1827 mit August Goethe nahe der Tür eines Zimmers stand, in dem der Dichter die Fürstlichkeiten, die ihm zum Geburtstag gratulierten, empfing. Goethe trat plötzlich heraus und sagte eilig zu seinem Sohne im echtesten Frankfurter Dialekte: „August, der König von Bayern will ä Glas Wasser habbe!“ –
„Man soll sich sein Recht nicht nehmen lassen“ meinte Goethe zu Jakob Grimm; „der Bär brummt nach der Höhle, in der er geboren ist“.
[7] 1,74 m gibt Kuhn in seinem Buche ‚Aus dem alten Weimar‘ (Wiesbaden, 1905) an; er stützt sich auf die Berechnungen eines Anatomen und eines Schneidermeisters aus Goethes erhaltenen Kleidern, gibt also die Zahlen für das Alter. Danach maß Goethe ferner von der Mitte bis zur Fußsohle 97 cm; die vordere Armlänge war 57 cm, der Brust- und Rückenumfang 113 cm, der Umfang der Mitte 126 cm, die Schulterbreite 12 cm, der Kopfumfang 60 cm.
[S. 44]
Wir haben schon bemerkt, daß Goethe im Umgang mit den Menschen sehr verschieden sein konnte; sein junger Freund Felix Mendelssohn war von dieser wandelbaren und reichen Natur so betroffen, daß er meinte, man werde in Zukunft gar nicht an einen Goethe, sondern an eine Schar Goethiden glauben. Über seine Verkehrsformen gingen schon bei seinen Lebzeiten und selbst in Weimar die verschiedensten Gerüchte. Die Einen erklärten ihn für stolz und patzig, steif und arrogant und warnten die Neugierigen vor seinen „stummen Audienzen“ oder erzählten: „jedes Wort sei Eis“; die Andern wußten seine Liebenswürdigkeit nicht genug zu rühmen.
Wir dürfen nicht erwarten, daß ein berühmter Mann, wenn wir ihn bei einer geliebten Arbeit stören, und wenn uns vielleicht schon hundert lästige Menschen als Räuber seiner Zeit zuvorgekommen sind, uns noch mit natürlicher Herzensgüte empfängt und aufrichtige Freude über unsern Besuch widerstrahlt. Goethe aber hat das nicht leichte Schicksal gehabt, sechzig Jahre einer der berühmtesten Europäer zu sein, den Viele sehen und sprechen wollten, den Tausende aus Neugier oder Bewunderung oder zur späteren Prahlerei belästigten. Er mußte wohl lernen, sich zu versteinern und einen Graben der Furcht um sich zu ziehen.
[S. 45]
Etwas Anderes kam hinzu. Die genialen Menschen sind nicht so sehr Herren ihrer selbst als die talentvollen; sie sind nicht so anpassungsfähig, so beständig sattelgerecht. Goethe fühlte sich in Gesellschaft oft unfrei und unbeholfen. Und er wußte, daß sein Geist in anderer Richtung sich bewegte als der Zeitgeist, daß er darum auch eine besondere Sprache sprach und überall wenig Aussicht hatte, recht verstanden zu werden. Gut beurteilt hat ihn der Oberbergrichter (spätere Minister) v. Schuckmann, der 1790 in Breslau mit Goethe freundschaftlich verkehrte:
Daß es schwer ist, ihm näher zu kommen, liegt nicht in seinem Willen, sondern in seiner Eigentümlichkeit, in der Sprachschwierigkeit, seine Gefühle und Ideen so, wie sie in ihm liegen, auszudrücken ... Bis er weiß, daß man ihn errät, fühlt, ihm durch jede Öffnung, die er gibt, hineinsieht, kann er nicht reden.
Und in einem späteren Briefe:
Was ich Dir über seine Schwierigkeit im Ausdruck schrieb, war ganz weg, sobald er herzlich ward und außer der Konvention mit mir lebte. Kalt kann er eigentlich nicht reden, und dazu will er sich mit Fremden zwingen, und Das wohl aus guten Gründen. Vertraut, folgt er seiner Natur und wirft aus dem reichen Schatze die Ideen in ganzen Massen hervor ... Freilich, alle übrigen Menschen hier, von Garve bis Seydlitz, finden, daß er sich sonderbar ausdrücke, daß er nicht zu verstehen sei und lästige Prätentionen mache. Und doch hat er sich von meiner guten Mutter recht vertraulich die Wundertaten des Enkels und ihre Wirtschaft erzählen lassen, die ihn auch recht lieb darum hat!
In Gesellschaften, wo Goethe nicht Jedermann für Gutfreund nehmen konnte, hatte er ein besonderes[S. 46] Mittel, etwaige Auflauernde und Zwischenträger lahm zu legen: er sagte nichts von Bedeutung. Schon der Fünfundzwanzigjährige tat gegen seinen unvorsichtigen Freund Lavater den Ausspruch: „Sobald man in Gesellschaft ist, nimmt man vom Herzen den Schlüssel ab und steckt ihn in die Tasche; Die, welche ihn stecken lassen, sind Dummköpfe.“ Aber auch vom Geiste nahm er den Schlüssel ab. Karoline v. Dacheröden, später Wilhelm v. Humboldts Frau, war 1790 einen Abend mit ihm zusammen. „Er ging mir fast nicht von der Seite, sprach offen, so geistvoll und herzlich; aber wenn ein Dritter dazu kam, sprach er das fadeste Zeug, das man denken mag.“ Ebenso erzählt ein Baron Merian aus Basel, der in Dresden 1810 in Goethes Gesellschaft kam: „Er sprach von ganz gewöhnlichen Dingen auf eine ganz gewöhnliche Weise: Das tut er mit Fleiß.“ Sehr groß war die Enttäuschung der Klara Kestner aus Hannover, als sie ihre Mutter im September 1816 zu Goethe geleiten durfte: diese Mutter war die berühmte Lotte Buff aus Wetzlar! Goethe hatte sie vor Jahren fast allzu sehr geliebt und seitdem nicht mehr gesehen; nur in der Weltliteratur lebten ihre Namen zusammen. War nun ein zärtliches oder ein feierliches Wiedersehen zu erwarten? Ach, Goethe empfing sie, wie wenn irgend eine Dame aus Weimar, die er erst vorige Woche gesprochen, zu ihm komme. Und auch als sie bei Tische saßen, gab es keine Blitze und Feuerfunken.
Leider waren alle Gespräche, die er führte, so gewöhnlich, so oberflächlich, daß es eine Anmaßung für mich sein würde,[S. 47] zu sagen: ich hörte ihn sprechen oder ich sprach ihn. Denn aus seinem Innern oder auch nur aus seinem Geiste kam Nichts von Dem, was er sagte. Beständig höflich war sein Betragen gegen Mutter und gegen uns alle: wie Das eines Kammerherrn.
Die Berichterstatterin fügt hinzu, ihr Onkel Riedel, der in Weimar lebte und mit in der Gesellschaft war, habe Goethes Betragen mit seiner bekannten Steifigkeit, ja Blödigkeit entschuldigt; diesmal kam aber auch der Vorsatz hinzu, sich nicht vor Zuschauern zu einem Gefühls-Ausbruche zwingen zu lassen, dessen Schilderung dann in Briefen oder gar Zeitungsartikeln die Neugierde der Leser befriedigte.
**
*
Gern entfloh Goethe seiner eigenen hochgebauten Festung und lebte in den Tälern als Mensch unter Menschen. Als er zehn Jahre in Weimar verbracht hatte, klagte er: „was wir in den kleinen souveränen Staaten für elende einsame Menschen sein müssen, weil man, und besonders in meiner Lage, fast mit Niemand reden darf, der nicht was wollte oder möchte.“ Auch deshalb verbrachte er gern ganze Monate im nahen Jena, wo er ungestört arbeiten konnte, oder in Bädern. Deshalb reiste er auch gern unter fremdem Namen. Er hatte schon als Jüngling viel Lust zu Mummereien und hat oft in Verkleidungen seinen Scherz getrieben; später war die Verkleidung eine Notwehr gegen seinen berühmten Namen und eine gelegentliche Absonderung von sich selbst, wie er sie in seinem Streben nach Objektivität liebte. Am wohlsten fühlte er sich, wenn[S. 48] er unerkannt reisen und behaglich unter dem Volke sich bewegen konnte. Nach Italien fuhr er 1786 als der Kaufmann Philipp Möller aus Leipzig; aus einem Dachsranzen und einem Köfferchen bestand sein ganzes Gepäck, und schon aus Bayern schreibt er ganz vergnügt über seinen neuen Zustand an Frau v. Stein: „Da ich ohne Diener bin, bin ich mit der ganzen Welt Freund. Jeder Bettler weist mich zurechte, und ich rede mit den Leuten, die mir begegnen, als wenn wir uns lange kennten. Es ist mir eine rechte Lust.“ Dann machte es ihm Spaß, daß er einem alten Weibe für einen Kreuzer Birnen abkaufen und sie publice „wie ein anderer Schüler“ verzehren konnte. „Herder hat wohl recht, daß ich ein großes Kind bin und bleibe, und jetzt ist mir so wohl, daß ich ungestraft meinem kindischen Wesen folgen kann.“ In Italien hielt er es ebenso. Er machte sich zum Italiener, trug die Kleidung der mittleren Bürger, gewöhnte sich ihre Gebärden und Bewegungen an und lernte ihre Sprache so gut, daß er auf Märkten und Gassen unauffällig sich unter das Volk mischen, seine harmlose Fröhlichkeit, sein Leben und Lebenlassen teilen konnte.
Oft hat er nachher diese zwei Jahre in Rom und Italien als die glücklichste Zeit seines Lebens bezeichnet. Es mag ein stillvergnügtes Treiben gewesen sein, als Filippo Miller, Georgio Zicci, Frederico Bir und Tisben, d. h. Goethe, Schütz, Bury und Tischbein bei dem Kutscher Collina und seiner Piera Giovanna wohnten, dem „redlichen alten Paar, die Alles selbst machen und für uns wie die Kinder sorgen.“ Gleich nach[S. 49] Goethes Rückkehr reiste Herder nach Italien: Goethe verwies ihn an seine dortigen Freunde und gab ihm die besten Ratschläge. In Rom wurde ihm sogleich Goethes vormalige Wohnung angeboten, aber sie war dem anspruchsvollen Herder nicht vornehm genug; und er mietete sich eine, die in unserem Gelde 53 Mark monatlich kostete. „Goethe hat gut reden“ schrieb er seiner Gattin heim, „alle seine Ratschläge in Ansehung Roms taugen nichts; er hat wie ein Künstlerbursche gelebt ... Auch von Goethes Gesellen habe ich eigentlich wenig: es sind junge Maler, mit denen am Ende doch nicht viel zu tun ist.“ Herder zog vor, sich im fremden Lande als den höchsten Geistlichen des weimarischen Staates kundzutun, und versäumte in Kleidung und Auftreten nichts, was dem „Bischof von Thüringen“ zukam. Als seine Herzogin Amalie, die zu gleicher Zeit in Rom war, nicht schnell genug daran dachte, ihn bei den Kardinälen und Prinzen einzuführen, sagte er ihr geradezu, es schicke sich nicht, daß sie ihn verleugne; nun tat sie ihm den Gefallen, brachte ihn in die feinsten Gesellschaften, wo er sich und sein Amt auch vortrefflich repräsentierte. Aber das Ergebnis war, daß Herder immer unzufriedener wurde.
Man kommt in Rom zu nichts, und man wird seiner Zeit nicht froh ... Man wird mit Zeremonien überladen, und die Besuche aus Höflichkeit werden unendlich, sobald man sich einläßt ... Die große Welt, die Kardinäle, Monsignori, Principi und Principesse fangen an mich zu ennuyieren. Ein Train von seelenloser Konversation und Observanzen, die zuviel Zeit und Geld kosten, als daß sie der Mühe wert wären.
[S. 50]
Goethe hatte also doch recht gehabt!
Wenn es ging, mischte er sich auch in Deutschland unter die kleinen Leute und lebte mit ihnen. Seine Winterreisen in den Harz waren auch Entfernungen aus der vornehmen Welt; die Briefe, die er im Dezember 1777 aus Goslar an die geliebte Frau v. Stein schrieb, verraten seine Liebe zum schlichten Menschentum und gemütlichen Verkehr:
Mir ist’s eine sonderbare Empfindung, unbekannt in der Welt herumzuziehen; es ist mir, als wenn ich mein Verhältnis zu den Menschen und den Sachen weit wahrer fühlte. Ich heiße Weber, bin ein Maler, habe Jura studiert, oder ein Reisender überhaupt, betrage mich sehr höflich gegen Jedermann und bin überall wohl aufgenommen. Eine reine Ruh und Sicherheit umgibt mich. –
Hier bin ich nun wieder in Mauern und Dächern des Altertums versenkt. Bei einem Wirte, der gar viel Väterliches hat. Es ist eine schöne Philisterei im Hause; es wird einem ganz wohl. – –
Wie sehr ich wieder auf diesem dunkeln Zug Liebe zu der Klasse von Menschen gekriegt habe, die man die niedere nennt, die aber gewiß vor Gott die höchste ist! ... Ich trockne nun jetzt an meinen Sachen! Sie hängen um den Ofen. Wie wenig der Mensch bedarf und wie lieb es ihm wird, wenn er fühlt, wie sehr er das Wenige bedarf!
**
*
Diesen schlichten, gemütlichen Menschen, dem Frau v. Stein für die Reise Zwieback in Papier wickelte, der sie um dicke, warme Strümpfe bat, der in Italien oder im Harze mit armen Leuten fröhlich plauderte und lachte, ihn bekamen freilich die Fremden in Weimar[S. 51] nicht zu sehen. Für sie war er oft genug unzugänglich, selbst wenn sie die erste Mauer durchdrungen hatten und mit ihm auf seinem Sofa saßen. Er konnte ganz gründlich schweigsam sein und sich auf hm, hm, so! so! und dergleichen Töne beschränken, die nicht gut als goldene Offenbarungen des unvergleichlichen Genies weiterzuerzählen waren. Oder er wies die Besucher einfach ab. „Man muß den Leuten abgewöhnen, einen unangemeldet zu überfallen“ sagte er 1824 zum Kanzler v. Müller; „man bekommt doch immer andre, fremde Gedanken durch solche Besuche, muß sich in ihre Zustände hineindenken. Ich will keine fremden Gedanken, ich habe an meinen eigenen genug, kann mit Diesen nicht fertig werden.“
Menschen von feinem Gefühl sagten sich Das selber, daß Goethe an seiner eigenen geistigen Arbeit genug habe, und gerade durch ihre Zurückhaltung fanden sie dann vielleicht Zugang. Im Herbst 1815 traf Goethe in Heidelberg in der Bildersammlung des gemeinsamen Freundes Boisserée zwei von den drei berühmten Brüdern Grimm: Wilhelm und Ludwig. „Hat denn Goethe nicht von den ‚Märchen‘ gewußt?“ fragte nach Wilhelms erstem Berichte Jakob, „hast Du ihm nicht den ‚Armen Heinrich‘ gegeben?“ Und Wilhelm erwiderte:
Goethe habe ich weder den ‚Armen Heinrich‘ gegeben, noch von den ‚Märchen‘ etwas Näheres gesagt. Da er sich wohl bewußt sein mag, wie leicht er an Etwas teilnimmt, so hat er eine eigene wunderliche Scheu – man kann sagen: Ängstlichkeit – daß ihm ja Nichts zu nahe rückt, und er[S. 52] weicht gewiß aus und setzt sich eiskalt hin, wenn man von Etwas mit Lebhaftigkeit und Eifer spricht, das er noch nicht kennt ... Ich habe ihm daher kein Wort von der altdeutschen Poesie gesagt, bis er in Heidelberg von selbst zu mir kam und mich fragte, mit welcher literarischen Arbeit wir uns jetzt beschäftigen ..... Der Louis hat es aus natürlichem Gefühl ebenso gemacht, und zu Dem ist er auch gekommen, hat ihn über die Rheinreise gefragt u. dgl., recht liebreich.
Auch noch in hohem Alter verriet Goethe die Verlegenheit und Unbeholfenheit, wenn er mit Fremden – ehrlichen Bewunderern, Schmeichlern, Ausforschern oder was sie sonst sein mochten – zu tun hatte. Der junge Holtei, der als Rezitator herumreiste, sah es ihm an, als der Greis zur erbetenen Audienz in das Zimmer trat. „Ja, bei Gott, Goethe zeigte sich verlegen vor mir! War er’s doch vor jedem Unbekannten, der sich ihm aufdrang! Hab’ ich’s doch später aus seinem eigenen Munde vernommen, wie peinlich solche unvermeidliche, vom Weltruhm unzertrennliche Scenen ihm gewesen sind!“
Bewundernswert ist aber doch, daß er so viele, so unbedeutende Menschen annahm, und oft erscheint er uns merkwürdig gutmütig. Einmal auf der Dornburg meldete ihm, dem Achtzigjährigen, der Gärtner: drei Studenten seien draußen. Aber Goethe mochte nicht gestört sein: „Ich weiß nicht, was die jungen Leute immer von mir wollen.“ Der Gärtner verriet durch seine traurige Miene, daß er den Studenten Hoffnung auf gute Aufnahme gemacht hatte. „Nun, wenn es Ihnen lieb ist, lassen Sie sie immer herein!“ Und er entzückte[S. 53] die Jünglinge so, daß sie nachher auf sein Wohl einige Flaschen Wein begeistert leerten.
**
*
Gegen Plagegeister, die ihm seine Pläne durchkreuzten und die Zeit verdarben, konnte er recht deutlich sein, selbst wenn es Damen waren. Freilich wurde er gerade von weiblicher Bewunderungssucht arg belästigt.
Der Maler Wilhelm v. Kügelgen hat in seinen ‚Erinnerungen eines alten Mannes‘ eine drollige Geschichte erzählt. Es war in Dresden am 24. April 1813. Goethe trat bei seiner Mutter ein und bat sie, von ihrem Fenster aus den Einzug des russischen Kaisers und des preußischen Königs, ohne sie zu stören, ansehn zu dürfen. Frau v. Kügelgen verstand, daß er ungestört sein wolle, und so vermied sie es, ein Gespräch mit ihm anzuknüpfen, während er mit Behagen am Fenster stand, nach seiner Art die Hände auf dem Rücken. Sie wußte, wie sehr ihn die schöngeistigen Damen sonst bedrängten, und schwieg deshalb. Da fing Goethe mit ihr und ihrem kleinen Knaben von selber freundlich zu plaudern an. Lassen wir diesen Knaben als alten Mann weitererzählen:
Indem ward heftig an der Klingel gerissen. Ich sprang fort, um die Tür zu öffnen, und herein drang eine unbekannte Dame, groß und stattlich wie ein Kachelofen und nicht weniger erhitzt. Mit Hast rief sie mich an: „Ist Goethe hier?“ – „Goethe!“ Das war kurz und gut! Die Fremde gab ihm gegen mich, den fremden Knaben, weiter kein Epitheton; und kaum hatte ich Zeit, mein einfaches Ja herauszubringen, als sie auch schon, mich fast übersegelnd,[S. 54] unangemeldet und ohne üblichen Salutschuß wie ein majestätischer Dreidecker in dem Zimmer meiner Mutter einlief. Mit offenen Armen auf ihren Götzen zuschreitend, rief sie: „Goethe! ach Goethe! wie habe ich Sie gesucht! Und war denn Das recht, mich so in Angst zu setzen!“ Sie überschüttete ihn nun mit Freudenbezeugungen und Vorwürfen.
Unterdessen hatte sich der Dichter langsam umgewendet. Alles Wohlwollen war aus seinem Gesichte verschwunden, und er sah düster und verstimmt aus wie eine Rolandssäule. Auf meine Mutter zeigend, sagte er in sehr prägnanter Weise: „Da ist auch Frau v. Kügelgen!“ Die Dame machte eine leichte Verbeugung, wandte dann aber ihrem Freunde, dessen üble Laune sie nicht bemerkte, ihre Breitseiten wieder zu und gab ihm eine volle Ladung nach der andern von Freudenbezeugungen, daß sie ihn glücklich geentert, beteuernd, sie werde sich diesen Morgen nicht wieder von ihm lösen. Jener war in sichtliches Mißbehagen versetzt. – – Er knöpfte seinen Oberrock bis an’s Kinn zu, und da mein Vater eintrat und die Aufmerksamkeit der Dame, die ihn kannte, für einen Augenblick in Anspruch nahm, war Goethe fort.
Noch komischer ist, was die Frau Dutitre, eine Berliner Berühmtheit, manches Mal mit Stolz erzählte.
Ick hatte mir vorjenommen, den jroßen Joethe doch ooch mal zu besuchen, und wie ick mal durch Weimar fuhr, jing ick nach seinem Jarten und jab dem Järtner einen harten Taler, daß er mir in eine Laube verstechen und einen Wink geben sollte, wenn Joethe käme. Und wie er nun die Allee runter kam und der Järtner mir gewunken hatte, da trat ick raus und sagte: „Anjebeteter Mann!“
Da stand er stille, legte die Hände auf den Rücken, sah mir jroß an und fragte: „Kennen Sie mir?“
[S. 55]
Ick sagte: „Jroßer Mann, wer sollte Ihnen nicht kennen!“ und fing an zu deklamieren:
Darauf machte er mir einen Bückling, drehte sich um und jing weiter. So hatte ick denn meinen Willen jehabt und den jroßen Joethe jesehn.
Kaum besser ward zu Heidelberg im Sommer 1814 der Geheime Kirchenrat Schwarz bedient, der als Verfasser eines bekannten pädagogischen Werkes, als Schwiegersohn Jung-Stillings und als Würdenträger sich für berechtigt hielt, Goethes Gesetze zu durchbrechen. Goethe ging morgens ganz früh auf privaten Wegen zur Schloßruine, um den schönen Blick allein und ungestört zu genießen; als er eines Tages zu seinem geliebten Platze kam, saß dort Schwarz, und Dieser redete ihn auch sogleich an: er preise sich glücklich, ihn zu sehen und ihn fragen zu können, was er denn eigentlich mit dem ‚Wilhelm Meister‘ beabsichtigt habe; er habe ihn gewiß für ein Erziehungsinstitut geschrieben. Goethe sah ihn mit seinen großen Augen an: „Ja, Das habe ich bisher selbst nicht gewußt, doch nun leuchtet es mir vollkommen ein. Ja, ja, ich habe den ‚Wilhelm Meister‘ für ein Erziehungsinstitut geschrieben und bitte Sie, Dies ja überall in der Welt bekannt zu machen.“
Für Leute, die seine Unterhaltung suchten, um darüber in Zeitschriften und Büchern berichten und ihre Glossen machen zu können, war er nicht zu Hause. Ein politischer Abenteurer, Witt v. Döring, hielt sich 1828 in Weimar auf, ein Demagoge und Intrigant,[S. 56] der trotz seiner Jugend schon viel erlebt und auch alle seine Erlebnisse bereits in Memoiren bekanntgemacht hatte. Goethe nahm seinen Besuch an, um den Menschen kennen zu lernen; als Witt aber beim Weggehen um die Erlaubnis bat, wiederkommen zu dürfen, erwiderte ihm Goethe mit Nachdruck: „Nein, mein Herr! Das ist das erste und letzte Mal! Sie sagen selber in Ihrem Buche, daß Sie ein gefährlicher Mensch sind, und beweisen es durch Ihre indiskreten Mitteilungen über die Personen, die Sie kennen gelernt haben. Erlauben Sie mir, daß ich mich einer solchen Behandlung nicht aussetze.“
Aufgeschwollene, affektierte, unwahre Menschen und solche, die nur aus Eigennutz zu ihm kamen, behandelte Goethe kurz und grob; auf gedrechselte Reden, Komplimente, nichtssagende Phrasen antwortete er nicht. (Manche verstanden es freilich falsch, daß er die stärksten Schmeichelreden schweigend entgegennahm; sie trugen dann vielleicht noch dicker auf und hielten sich nachher darüber auf, daß Goethe so gar viel Weihrauch verlange.) Sobald er aber etwas Echtes und Gutes in seinem Gegenüber spürte, sobald er fühlte: der Mann möchte dir etwas geben und hat etwas zu geben, zeigte er sogleich seine natürliche Güte. Dann nahm sein Hm hm! nun nun! ja ja! einen eigentümlich gutmütigen Klang an, dann wurde der Stumme zum lebhaften Redner, dann endete er: „Pflege um Zwei zu essen, würde mich freuen, wenn Sie unser Gast sein wollten.“ Holtei hat erzählt, wie er anfangs abblitzte: „Je geistreicher ich zu sein mir Mühe gab, desto abgeschmackter[S. 57] mag ich ihm wohl geschienen haben.“ Und nachher: „Je mehr ich mich gehen ließ, meinem natürlichen Wesen getreu, ohne weitere Ansprüche auf zarten Ausdruck, desto lebendiger wurde der alte Herr.“
**
*
Im allgemeinen teilte Goethe die Fremden in solche ein, die etwas von ihm begehrten, und solche, die vielmehr ihm eine Freude machen wollten. Das war teils Notwehr, teils der gesunde Ichsinn, den er auch lehrte. Zum Kanzler v. Müller sprach er 1830 diese Maxime aus, als es sich um das Beantworten von Briefen handelte: „Wenn ich sehe, daß die Leute bloß ihretwegen an mich schreiben, etwas für ihr Individuum damit bezwecken, so geht mich Das nicht an; schreiben sie aber meinetwegen, senden sie etwas mich Förderndes, Angehendes, dann muß ich antworten ... Ihr jungen Leute wißt freilich nicht, wie kostbar die Zeit ist.“
Ehe man diesen Standpunkt allzu selbstsüchtig finde, bedenke man die Frage, die der eben genannte Friedrich v. Müller in seiner Gedächtnisrede 1832 aufwarf:
Wie hätte er aber auch, ohne sich selbst zu vernichten, all den unsäglichen, oft unsinnigen Anforderungen und Zumutungen genügen können, die so oft gleich einem Wogenschwall auf ihn eindrangen? Daß fast jeder deutsche Jüngling, der einige glückliche Verse oder vollends ein Trauerspiel geschaffen zu haben vermeinte, Rat oder Urteil von ihm begehrte, möchte noch für ganz natürlich gelten; daß aber auch seinem geistigen Kontakt wildfremde Personen sich oft[S. 58] in den wunderlichsten Fällen, z. B. um eine Heirat, die Wahl eines Lebensberufs, eine Kollekte, einen Hausbau zustande zu bringen, zuversichtlich an ihn wendeten, könnte in der Tat höchst komisch erscheinen, wenn es nicht zugleich bewiese, wie unbeschränktes Vertrauen man weit umher ihm zollte, ja für einen Universalhelfer in geistigen und leiblichen Nöten ihn zu halten geneigt war.
Besonders mußte sich Goethe gegen Bittsteller verhärten, die für sich oder Andere etwas erbaten. Schon 1797 schrieb er an Kirms, der in der Leitung des Theaters seine rechte Hand war:
In meinem Leben habe ich so oft bemerkt, daß Menschen, die sonst zuverlässig sind, gegen Jemand, der eine Stelle zu vergeben hat, gar kein Gewissen haben. Man will die Leute anbringen, und wir mögen nachher sehn, wie wir sie los werden.
Und aus seinen letzten Lebensjahren erzählt sein Arzt Vogel:
Die Schwäche, welche nichts abzuschlagen vermag, kannte er nicht. „Ich halte es doch länger aus,“ meinte er, „die Leute anzuhören, als sie, mich zu drängen, Merken sie nur erst, daß sie einem auf solche Weise etwas abzwingen können, so ist man ewig belagert.“
Wem aber Goethe trotz alledem zu hart und kalt erscheint, Der möge lesen, was er 1809 zu Riemer äußerte: „Nur der am empfindlichsten gewesen ist, kann der Kälteste und Härteste werden; denn er muß sich mit einem harten Panzer umgeben, um sich vor den unsanften Berührungen zu sichern. Und oft wird ihm selber dieser Panzer zur Last!“ Goethe glich hierin seinem Vater, „der, weil er innerlich ein sehr zartes[S. 59] Gemüt hegte, äußerlich mit unglaublicher Konsequenz eine eherne Strenge vorbildete.“ Und der Sohn hätte wegen dieser Weichheit manchmal gern dem Vater nachgeahmt, den er „nach so viel Studien, Bemühungen, Reisen und mannigfaltiger Bildung endlich zwischen seinen Brandmauern ein einsames Leben führen“ sah. Aber am Vater hatte er auch die Unzuträglichkeit solcher Absonderung beobachtet, denn der Vater war ein grämlicher, grilliger, geiziger alter Mann geworden, der sich selber, seiner so gern fröhlichen Frau und allen Übrigen zur Last wurde. Der Sohn entschloß sich besser zu einer weisen Abwechslung von Einsamkeit und Geselligkeit. Ganz wolle er der fremden Welt nicht entraten, schrieb er an Zelter, „denn wenn ich gleich meine Zugbrücken aufziehe und meine Fortifikationen immer weiter hinausschiebe, so muß man doch zuweilen auch wieder Kundschaft einziehen.“
[S. 60]
Die Tadler Goethes berichten, daß er gegen Fürstlichkeiten zu devot, daß er ein Fürstenknecht gewesen sei. Es war Vielen nicht recht, daß der Dichter des „revolutionären“ Götz über fünfzig Jahre einem Fürsten diente und als Hofmann das höfische Zeremoniell getreulich mitmachte. Als im Beginn der französischen Revolution auch in Deutschland Viele, und nicht die Schlechtesten, eine gründliche Zerstörung des Alten und einen herrlichen neuen Aufbau erhofften, da war es ihnen verdrießlich, daß Goethe nicht mit ihnen ging daß er vielmehr seinen Herzog in den Krieg gegen die Franzosen wie zu einem Vergnügen begleitete und auch nachher die Freiheitsapostel verspottete. Und als nach der endlichen Niederwerfung Napoleons die Frei- und Deutschgesinnten einen sehr schwierigen und gefährlichen Kampf gegen die Zwingherren-Gelüste der Fürsten und Minister führten, da schmerzte es dies jüngere Geschlecht, daß der geistige König Deutschlands kühl abseits stand. Aber Goethe war nun einmal nicht umstürzlerisch oder auch nur demokratisch gesinnt; er glaubte nicht an Verfassungen, Preßfreiheit und Mehrheitsweisheit; er war durchaus Aristokrat und Monarchist. Und was seine Ministertätigkeit angeht, so konnte er mit Recht fragen: „Diene ich denn etwa einem Tyrannen? einem Despoten? Diene ich etwa einem Solchen, der[S. 61] auf Kosten des Volkes seinen eigenen Lüsten lebt? Solche Fürsten und solche Zeiten liegen gottlob längst hinter uns!“
Ob der heutige Betrachter Goethes politische Ansichten teilt oder nicht: Jeder muß anerkennen, daß er sich um die Gunst der Fürsten nicht eben viel bemüht hat. Er wurde durch sein nahes Verhältnis zu Karl August mit vielen fürstlichen Personen bekannt; er pflegte solche Bekanntschaften aber sehr wenig und erwarb sich denn auch an den Höfen nicht den zehnten Teil der Gunst, die etwa sein Gegner Kotzebue gewann. Karl August war mit der königlichen Familie von Preußen und mit dem Herzoge von Braunschweig nahe verwandt; auf Goethe senkte sich kein Gnadenzeichen aus jenen Fürstenhäusern; man ließ ihn eher Abneigung spüren. Mit einigen benachbarten Fürsten hatte er in jüngeren Jahren eine gewisse Freundschaft; aber auch Das schlief ein. Seine politische Gesinnung hatte er nicht den Mächtigen zu Gefallen. Mehreren Monarchen war er zu aristokratisch, zu konservativ gesinnt, z. B. dem edlen Herzog Ernst von Gotha-Altenburg und seinem Bruder August. Auch der andere vortrefflichste Landesvater im damaligen Deutschland, Franz von Dessau, erklärte, als man ihn fragte, warum er nicht öfter mit Goethe verkehrt habe: Dieser sei ihm zu vornehm, zu höfisch gemessen gewesen, manchmal unangenehm schweigsam. „Auch spürte ich im Allgemeinen etwas von Inhumanität an ihm.“
Goethe hat den Kaiser Napoleon ehrlich bewundert; er hat die kranke junge Kaiserin Maria Ludowika von[S. 62] Österreich wie ein zärtlicher Vater geliebt; im Alter hat er dem kunstbegeisterten König Ludwig von Bayern mit Freude und Hoffnung zugesehen; im übrigen spielten die Kaiser, Könige, Herzöge und Fürsten in seinem Innern keine große Rolle – immer abgesehen von der weimarischen Fürstenfamilie, mit der sein Leben verbunden war. Vielleicht hatte er im Alter eine Schwäche für Orden; aber er war doch schon 59 Jahre alt und bereits seit 32 Jahren ein hoher Staatsdiener, als er die erste Auszeichnung dieser Art bekam, und Diese schätzte er zumeist deshalb, weil Napoleon ihn damit zu ehren wünschte.
Im Jahre 1818 war die Witwe des russischen Kaisers Paul, die Mutter des regierenden Kaisers Alexander und der weimarischen Erbgroßherzogin, in Weimar. Ihr zu Ehren wurde bei Hofe ein Fest gegeben, zu dem Goethe seinen letzten „Maskenzug“ dichtete. Zu dieser Arbeit hielt er sich zumeist in Berka auf, so daß ihn die Kaiserin erst bei der Aufführung zu sehen bekam. Am letzten Tage ihrer Anwesenheit ließ sich Goethe bei ihr melden, um Abschied zu nehmen; er kam dann aber nicht, sondern ließ sich entschuldigen. Als Dies der Kaiserin gemeldet wurde, wandte sie sich zum Großherzog und sagte: „Nun, es freut mich doch, daß ich Goethe wenigstens einmal gesprochen habe und daß er sich gegen mich so freundlich und huldreich bezeigt hat.“ Karl August lächelte bei diesen Worten; sie sah es und fuhr fort: „Ich sage Das nicht ohne Absicht, denn gewiß muß Jeder es für eine Huld erkennen, wenn Goethe gegen ihn freundlich ist.“
[S. 63]
Als Eckermann im September 1827 seinen Meister auf die Höhe des Ettersberges begleitet hatte, blickte Goethe nach Westen, wo man über Erfurt hinaus das hochliegende Schloß Gotha entdecken konnte. „Ich bin dort nicht zum besten angeschrieben“ meinte der alte Dichter. „Als die Mutter des jetzt regierenden Herrn noch in hübscher Jugend war, befand ich mich dort sehr oft. Ich saß eines Abends bei ihr allein am Teetisch, als die beiden zehn- bis zwölfjährigen Prinzen, zwei hübsche blondlockige Knaben, hereinsprangen und zu uns an den Tisch kamen. Übermütig, wie ich sein konnte, fuhr ich den beiden Prinzen mit meinen Händen in die Haare mit den Worten: „Nun, ihr Semmelköpfe, was macht ihr?“ Die Buben sahen mich mit großen Augen an, im höchsten Erstaunen über meine Kühnheit – und haben mir es später nie vergessen.“
Und der Alte fuhr fort: „Ich hatte vor der bloßen Fürstlichkeit als solcher, wenn nicht zugleich eine tüchtige Menschennatur dahinter steckte, nie viel Respekt. Ja, es war mir so wohl in meiner Haut, und ich fühlte mich selber so vornehm, daß, wenn man mich zum Fürsten gemacht hätte, ich es nicht eben sonderlich merkwürdig gefunden haben würde. Als man mir das Adelsdiplom gab, glaubten Viele, wie ich mich dadurch möchte erhoben fühlen. Allein, unter uns, es war mir nichts, gar nichts! Wir Frankfurter Patrizier hielten uns immer dem Adel gleich!“
In diesem Bericht ist Einiges nicht glaubhaft. Daß Goethe nicht mehr nach Gotha kam, erklärt sich aus[S. 64] seinem hohen Alter und daraus, daß der dortige Herzog Friedrich ein schwerkranker Mann war; in gesunden Tagen war er gut Freund mit Goethe gewesen. Auch seinem vor ihm regierenden Bruder August, einem ebenso geistreichen wie wunderlichen Herrn, ist kein Schmollen wegen der „Semmelköpfe“ zuzutrauen; er machte vielmehr seine Witze auch über den „weimarischen Papst“, und so ging ihm Goethe lieber aus dem Wege. Noch weniger aber kann sich Goethe zu den Frankfurter Patriziern gerechnet haben, denn sein Großvater väterlicherseits war ein zugewanderter Schneider, der später Gastwirt wurde; die Vorfahren von der Mutter her waren Gelehrte und Beamte, aber auch keine Patrizier. Das stolze Selbstbewußtsein, mit dem sich Goethe nach Eckermanns Worten den Fürsten gleichsetzte, hatte er jedoch nicht selten. Oft fiel freilich auch das Gegenteil auf. Karl August soll den alten Freund wegen seiner untertänigen Förmlichkeit verspottet haben. Richtig ist, daß Goethe sich durch die Vergünstigungen, die ihm seine Freundschaft mit Karl August, sein weltberühmter Name, sein allgemein bewundertes Genie boten, nicht dazu verführen ließ, sich über die herkömmlichen Formen hinwegzusetzen, und daß er die untertänigen Wendungen der Hofsprache gebrauchte, auch gegen Karl August. Goethe hielt sich auch sonst streng an den Kurialstil. „Hochwürdige, Hoch-, Hochwohl- und Wohlgeborene und Hochedle“ redete er im Juli 1800 die Landschafts-Deputation des Fürstentums Weimar an, und er fährt fort: „Höchst- und Hochzuverehrende, auch Hochgeehrteste Herren! Nachdem ich, Endesunterzeichneter,[S. 65] das freie Lehngut zu Oberroßla, welches durch Serenissimi besondere Gnade neuerlich in ein rechtes Erblehn verwandelt worden, sub hasta erstanden und damit beliehen worden ...“ In solchen Dingen merkte man, daß Goethe eben noch vor der Mitte des achtzehnten Jahrhunderts geboren war. Wer aber die devoten Formen jener alten Zeit beurteilen will, bedenke, wie genau Rechte und Pflichten zusammenhängen: der Eine hielt des Andern überlieferte Rechte heilig, damit auch seine eigenen unverletzlich blieben. Und weiter: Höflichkeit und Förmlichkeit sind Mauern, mit denen wir uns gegen lästige Vertraulichkeit und unerwünschte Zumutungen schützen. Karl August wußte „seine Leute zu plagen“: also war selbst gegen ihn einige Umständlichkeit am Platze.
**
*
Ernst Moritz Arndt wollte Goethes Verhalten gegen Vornehme aus einem Körperfehler erklären.
In der herrlichen Goetheschen Mannesgestalt war doch eine Unangemessenheit; seine Beine waren um 6 bis 7 Zoll zu kurz. Daher hatte er etwas von Dem, was Albrecht Dürer in seiner Beschreibung der vollkommenen Menschengestalt einen gebundenen Leib nennt; es fehlte ihm körperliche Gewandtheit und Leichtigkeit ... Diese seine Beinverkürzung gab ihm wirklich eine etwas unbewegliche Steifigkeit, welche ein Unkundiger und Unwissender leicht als absichtliche Förmlichkeit und angenommene Vornehmigkeit hat deuten können. Ich möchte ferner behaupten, daß Goethe ... dieses Naturmangels seiner Schenkel frühe inne geworden ist, daß daher auch Das entsprungen ist, was in seinen Schriften öfters nicht angenehm auffällt; daß er in der[S. 66] Leichtigkeit und Beweglichkeit der körperlichen Haltung, wie sie jeder Jagdjunker und Kammerjunker unter Lakaien, Rossen und Jägern von Jugend auf gewinnt, oft etwas zu Männliches und Idealisches gesehen und es als Solches dargestellt zu haben scheint. In dem wirklichen Leben unter gewandten Weltleuten (Offizieren, Hofleuten) stand der große Mann daher ohne jenen Stolz, der ihm da wohl doppelt erlaubt gewesen wäre, fast mehr einem Untergeordneten gleich. Ich habe ihn selbst mit Erstaunen vor jungen Leutnanten aus freiherrlichen und gräflichen Geschlechtern mit einer gewissen steifen Verlegenheit stehen gesehen. Er fühlte sich vor solcher Ungebundenheit und Leichtigkeit offenbar mit seinem Körper verlegen und gebunden.
Arndt überschätzte gewiß die Wirkung des Wuchsfehlers, der übrigens auch bei Alexander dem Großen, Friedrich dem Großen, Napoleon, Mozart, Beethoven, Napoleon dem Dritten, Richard Wagner und anderen berühmten Leuten, den sog. Sitzriesen, festgestellt ist und den Homer auch seinem Odysseus zuschreibt. Aber es ist in der Tat aus jedem Lebensalter Goethes diese körperliche „Steifigkeit“ bezeugt; schon der kleine Knabe hielt sich überaus gerade und schritt „gravitätisch“ einher, und über den Sechsundzwanzigjährigen, in Weimar Eintretenden lesen wir: „seine steife Haltung, die enge Bewegung seiner Arme und sein Perpendikulargang fielen allgemein auf.“[8] Als Knabe und Jüngling hörte Goethe manchen Spott darüber. Aber wichtiger für sein Verhalten gegen Gewandtere ist doch der andere Umstand, daß er in Gesellschaft, unter Fremden sich innerlich unbeholfen fühlte. Insofern war ihm fast[S. 67] jeder Sprößling eines guten adligen Hauses im gesellschaftlichen Leben überlegen; also mußte Goethe an vielen vornehmen Leuten, die vielleicht wenig Gehalt hatten, eine höchst wünschenswerte Meisterschaft verehren.
**
*
Hatte er „vor der bloßen Fürstlichkeit als solcher nie viel Respekt“, so mochte er doch das Feine und Gute am aristokratischen Wesen gern genießen. Noch in seinem Todesjahre sprach er zu Eckermann einmal davon, wie sympathisch ihm ein echter Aristokrat sei, ein Mann wie Karl v. Spiegel, von dem gerade die Rede war. „Seine Abkunft kann er ebensowenig verleugnen als Jemand einen höheren Geist verleugnen könnte. Denn Beides, Geburt und Geist, geben Dem, der sie einmal besitzt, ein Gepräge, das sich durch kein Inkognito verbergen läßt. Es sind Gewalten wie die Schönheit, denen man nicht nahe kommen kann, ohne zu empfinden, daß sie höherer Art sind.“
**
*
Aus diesem Gepräge, das die Menschen durch ihre Abstammung haben, aus dieser angeborenen Gewalt des Aristokraten, die durch die Erziehung und den freien Weltüberblick des Wohlhabenden und Gesicherten noch gestärkt wird, erklärt sich zum Teil auch, warum Goethe, nachdem ihm Karl Augusts Fehler gar oft ärgerlich gewesen waren, sich und sein Schicksal diesem selben Karl August schließlich doch völlig anvertraute. „Ich[S. 68] leugne nicht: er hat mir anfänglich viel Not und Sorge gemacht“ erzählte er 1828. „Doch seine tüchtige Natur reinigte sich bald zum besten, so daß es eine Freude wurde, mit ihm zu leben und zu wirken.“ Karl August erwies sich nach dem Ausgären eben gerade als geborener Fürst.
Er hatte die Gabe, Geister und Charaktere zu unterscheiden und Jeden an seinen Platz zu stellen .... Er war beseelt von dem edelsten Wohlwollen, von der reinsten Menschenliebe und wollte mit ganzer Seele nur das Beste. Er dachte immer zuerst an das Glück des Landes und ganz zuletzt erst ein wenig an sich selber. Edlen Menschen entgegenzukommen, gute Zwecke befördern zu helfen, war seine Hand immer bereit und offen. Es war in ihm viel Göttliches ... Und drittens: er war größer als seine Umgebung. Neben zehn Stimmen, die ihm über einen gewissen Fall zu Ohren kamen, vernahm er die elfte, bessere, in sich selber. Fremde Zuflüsterungen glitten an ihm ab ... Er sah überall selber, urteilte selber und hatte in allen Fällen in sich selber die sicherste Basis.[9]
Goethe fühlte, daß auch ihm, dem scheinbar so Selbständigen, die Anlehnung an diesen echten Fürsten zum Segen gereichte. Nach langer Besinnung über seine Vergangenheit und Zukunft und in großer räumlicher[S. 69] Entfernung, in Neapel, schrieb er 1787 an den Herzog:
Ich bin zu Allem und Jedem bereit, wo und wie Sie mich brauchen wollen ... Wie Sie mich bisher getragen haben, sorgen Sie ferner für mich! Und tun Sie mir mehr wohl, als ich selbst kann, als ich wünschen und verlangen darf! Geben Sie mich mir selbst, meinem Vaterlande, geben Sie mich sich selbst wieder, daß ich ein neues Leben und ein Leben mit Ihnen anfange. Ich lege mein ganzes Schicksal zutraulich in Ihre Hände!
Und zehn Monate später wiederholt er:
Ich kann nur sagen: Herr, hie bin ich; mache aus deinem Knecht, was du willst. Jeder Platz, jedes Plätzchen, die Sie mir aufheben, sollen mir lieb sein. Ich will gerne gehen und kommen, niedersitzen und aufstehen.
Goethe erinnerte sich noch recht gut aller der Sprüchlein, die seine Landsleute in der freien Stadt Frankfurt über die Übel des Hoflebens und Fürstendienstes im Scherz und Ernst sagten, und er hatte manche dieser Übel am eigenen Leibe erfahren: dennoch schloß er diesen Bund auf Lebenszeit mit einem thüringischen Herzog. Und Beide hatten großen Vorteil davon. Karl August, den seine Lust am Reisen und am Soldatenleben viel außer Landes führte, wußte daheim stets einen treuesten Freund, vor dem er kein Geheimnis hatte, auf dessen Wahrhaftigkeit und guten Willen er stets rechnen konnte. Und Goethe behielt durch diese Freundschaft den Anschluß an das wirkliche und tätige Leben, bekam Einblick in vielfältige und große Verhältnisse, während er, wenn er nur seiner eigenen Natur gefolgt wäre, sich an ein abseitiges, abgesondertes[S. 70] Gelehrten-Dasein gewöhnt hätte, das vielleicht dem Leben seines Vaters gar zu ähnlich geworden wäre. Und Goethe freute sich geradezu, daß ihn der Herzog beeinflußte und lenkte. Er lasse sich leicht bestimmen, gestand er 1815 dem Altersfreunde Boisserée, und vom Herzog gern, denn Der bestimme ihn immer zu etwas Gutem und Glücklichem. Demselben Freunde sagte er: was die Verhältnisse mit Fürsten teuer und wert mache, sei das Beständige und Beharrliche darin, wenn einmal ein Vertrauen entstanden.


Ihre höchste Feier erlebte diese Freundschaft, als Herzog Karl August fünfzig Jahre seiner Regierung und Goethe fünfzig Jahre seines Aufenthaltes in Weimar beendete. Mit dankbarer Lust rühmten da Beide einander. „Ich bin dem Großherzog seit einem halben Jahrhundert auf das innigste verbunden“ sagte Goethe im Frühjahr 1825 zu Eckermann, „und habe ein halbes Jahrhundert mit ihm gestrebt und gearbeitet; aber lügen müßte ich, wenn ich sagen wollte, ich wüßte einen einzigen Tag, wo der Großherzog nicht daran gedacht hätte, etwas zu tun und auszuführen, das dem Lande zum Wohle gereichte und das geeignet wäre, den Zustand des Einzelnen zu verbessern. Für sich persönlich: was hat er denn von seinem Fürstenstande, als Last und Mühe! Ist seine Wohnung, seine Kleidung und seine Tafel etwa besser gestellt als Die eines wohlhabenden Privatmanns? ... Dieses sein Herrschen, was war es weiter als ein beständiges Dienen?“
[S. 71]
Als dann der 3. September 1825 anbrach, Karl Augusts Jubeltag, trat ihm Goethe morgens um sechs Uhr vor dem ‚Römischen Hause‘ im Park entgegen: ein Chor sang eine von Riemer gedichtete Kantate, Goethe wollte dem Fürsten die auf den Tag geprägte Denkmünze überreichen, aber die Rührung gestattete ihm keine Worte. Der Fürst ergriff des alten Freundes Hände. „Bis zum letzten Hauch beisammen“ sagte er, und dann sprach er von Jugendtagen, von Ilmenau und Tiefurt, und wiederholte das Sprüchlein: „Nur Freundeslieb’ und Luft und Licht, Verzage nicht, wenn Das nur blieb!“ Und Goethe antwortete: „Dies Dreifache gab mir, was ich gegeben.“
Als dann am 7. November Goethes Ehrentag kam, schrieb Karl August einen herzlichen fürstlichen Brief an Goethe, in dem er „die Treue, Neigung und Beständigkeit“ des Jugendfreundes pries und deutlich bekannte: „Seinem umsichtigen Rat, seiner lebendigen Teilnahme und stets wohlgefälligen Dienstleistungen verdanke ich den glücklichen Erfolg der wichtigsten Unternehmungen, und ihn für immer gewonnen zu haben, achte ich als eine der höchsten Zierden meiner Regierung.“
Goethe sah, nachdem er den Brief empfangen, die Leute vor einer Mauer stehen, wo öffentliche Bekanntmachungen angebracht wurden. Er schickte seinen Großneffen Nicolovius hinunter, nachzusehen, was es sei. Als Dieser wiederkam und meldete, der Dank des Großherzogs an Goethe sei gedruckt und angeschlagen, rief der alte Dichter mit Freudentränen: „Das ist Er!“
**
*
[S. 72]
Tüchtige Menschen behalten, auch wenn sie ihrem Fürsten von Herzen ergeben sind, ihre eigene Ansicht der Dinge. Auch Goethe hat seinem Fürsten und Freunde unter vier Augen und in vertraulichen Briefen sehr oft deutlich widersprochen. „Mit dem Herzog gegessen“ heißt es am 19. Januar 1782 in seinem Tagebuche; „sehr ernstlich und stark über Ökonomie geredet und wider eine Anzahl falscher Ideen, die ihm nicht aus dem Kopfe wollen.“ Und ein andermal: „Conseil. Der Herzog zu viel gesprochen. Mit dem Herzog gegessen. Nach Tische einige Erklärungen über Zu-viel-reden fallen lassen, Sich-vergeben, Sachen in der Hitze zur Sprache bringen, die nicht geredet werden sollten. Auch über die militärischen Makkaronis [d. h. Liebe zu überflüssigem Militär].“ Oft kämpfte Goethe gegen des Herzogs Lust an Krieg und Soldaten, die so sehr ein Hemmnis für die Besserung der Staatsfinanzen war und den Fürsten seinem Lande zu entfremden drohte.
Die Kriegslust, die wie eine Art Krätze unsern Prinzen unter der Haut sitzt, fatigiert mich wie ein böser Traum, in dem man fort will und soll und einem die Füße versagen. Sie kommen mir wie solche Träumende vor, und mir ist es, als wenn ich mit ihnen träumte. Ich habe auf dieses Kapitel weder Barmherzigkeit, Anteil, noch Hoffnung und Schonung mehr.[10]
Goethes Briefe sind oft Meisterstücke feinster Diplomatie; seine Schreiben an Karl August zeigen, in welcher klugen Form er seinen Fürsten warnte, tadelte, ermahnte. Im Dezember 1784 war Karl August wieder[S. 73] einmal draußen im Reich; manche Leute daheim schalten laut über diese Reiselust, Goethe aber schreibt ihm, von sich selber redend, jedoch in Gedanken an des Fürsten Unruhe und Streben nach Neuem:
Mich heißt das Herz das Ende des Jahres in Sammlung zubringen. Ich vollende mancherlei im Tun und Lernen und bereite mir die Folge einer stillen Tätigkeit auf’s nächste Jahr vor und fürchte mich vor neuen Ideen, die außer dem Kreise meiner Bestimmung liegen. Ich habe deren so genug und zu viel; der Haushalt ist eng, und die Seele ist unersättlich.
Ich habe so oft bemerkt, daß, wenn man wieder nach Hause kommt, die Seele, statt sich nach dem Zustand, den man findet, einzuengen, lieber den Zustand zu der Weite, aus der man kömmt, ausdehnen möchte; und wenn Das nicht geht, so sucht man doch, soviel als möglich von neuen Ideen hereinzubringen und zu pfropfen, ohne gleich zu bemerken, ob sie auch hineingehen und passen oder nicht. Selbst in den letzten Zeiten, da ich doch jetzt selbst in der Fremde nur zu Hause bin, hab ich mich vor diesem Übel, oder wenn Sie wollen: vor dieser natürlichen Folge nicht ganz sichern können.
Es kostet mich mehr, mich zusammenzuhalten, als es scheint, und nur die Überzeugung der Notwendigkeit und des unfehlbaren Nutzens hat mich zu der passiven Diät bringen können, an der ich jetzo so fest hange.
Und als die Empörung der Untertanen über die vom Herzog am Ettersberge angesiedelten Wildschweine vorgetragen werden mußte, schrieb Goethe scharf und mild zugleich:
Auch die Jagdlust gönn’ ich Ihnen von Herzen und nähre die Hoffnung, daß Sie dagegen nach Ihrer Rückkunft die Ihrigen von der Sorge eines drohenden Übels befreien werden. Ich meine die wühlenden Bewohner des Ettersbergs. Ungern erwähn’ ich dieser Tiere, weil ich gleich anfangs[S. 74] gegen deren Einquartierung protestiert und es einer Rechthaberei ähnlich sehn könnte, daß ich nun wieder gegen sie zu Felde ziehe. Nur die allgemeine Aufforderung kann mich bewegen, ein fast gelobtes Stillschweigen zu brechen, und ich schreibe lieber, denn es wird eine der ersten Sachen sein, die Ihnen bei Ihrer Rückkunft vorgebracht werden. Von dem Schaden selbst und dem Verhältnis einer solchen Herde zu unsrer Gegend sag’ ich nichts; ich rede nur von dem Eindrucke, den es auf die Menschen macht. Noch habe ich nichts so allgemein mißbilligen sehn; es ist darüber nur eine Stimme. Gutsbesitzer, Pächter, Untertanen, Dienerschaft, die Jägerei selbst: Alles vereinigt sich in dem Wunsche, diese Gäste vertilgt zu sehn. Von der Regierung zu Erfurt ist ein Kommunikat deswegen an die unsrige ergangen.
Was mir dabei aufgefallen ist und was ich Ihnen gern sage, sind die Gesinnungen der Menschen gegen Sie, die sich dabei offenbaren. Die Meisten sind nur wie erstaunt, als wenn die Tiere wie Hagel vom Himmel fielen; die Menge schreibt Ihnen nicht das Übel zu; Andre gleichsam nur ungern, und Alle vereinigen sich darinne, daß die Schuld an Denen liege, die, statt Vorstellungen dagegen zu machen, Sie durch gefälliges Vorspiegeln verhinderten, das Unheil, das dadurch angerichtet werde, einzusehn. Niemand kann sich denken, daß Sie durch eine Leidenschaft in einen solchen Irrtum geführt werden könnten, um etwas zu beschließen und vorzunehmen, was Ihrer übrigen Denkens- und Handelnsart, Ihren bekannten Absichten und Wünschen geradezu widerspricht.
Der Landkommissär hat mir gerade in’s Gesicht gesagt, daß es unmöglich sei, und ich glaube, er hätte mir die Existenz dieser Kreaturen völlig geleugnet, wenn sie ihm nicht bei Lützendorf eine Reihe frisch gesetzter Bäume gleich die Nacht drauf zusamt den Pfählen ausgehoben und umgelegt hätten.
Könnten meine Wünsche erfüllt werden, so würden diese Erbfeinde der Kultur ohne Jagdgeräusch, in der Stille,[S. 75] nach und nach der Tafel aufgeopfert, daß mit der zurückkehrenden Frühlingssonne die Umwohner des Ettersbergs wieder mit frohem Gemüt ihre Felder ansehen könnten.
Man beschreibt den Zustand des Landmanns kläglich, und er ist’s gewiß: mit welchen Übeln hat er zu kämpfen! Ich mag nichts hinzusetzen, was Sie selbst wissen. Ich habe Sie so Manchem entsagen sehn und hoffe, Sie werden mit dieser Leidenschaft den Ihrigen ein Neujahrsgeschenk machen, und halte mir für die Beunruhigung des Gemüts, die mir die Kolonie seit ihrer Entstehung verursacht, nur den Schädel der gemeinsamen Mutter des verhaßten Geschlechtes aus, um ihn in meinem Kabinette mit doppelter Freude aufzustellen.
Möge das Blatt, was ich eben endige, Ihnen zur guten Stunde in die Hand kommen![11]
**
*
In seinem Amtsbereiche war Goethe immer sehr unabhängig, ja zuweilen selbstherrlich. Als er in Jena ein Stück der alten Stadtmauer fortreißen ließ, um gegen die Feuchtigkeit der Bibliothek das Nötige zu tun, schickte die Stadtverwaltung an den Herzog eine Deputation mit der untertänigen Bitte, daß es doch Seiner Hoheit gefallen möge, durch ein Machtwort diesem Beginnen ein Ende zu setzen. „Ich mische mich nicht in Goethes Angelegenheiten“ erwiderte der Herzog. „Er weiß schon, was er zu tun hat, und muß sehen, wie er zurechtkommt. – Geht doch hin und sagt es ihm selbst, wenn ihr Courage habt!“ Und wenn es sich um Theatersachen handelte, ärgerte sich der Herzog selber oft genug über seines Untergebenen „Tyrannei“ und „Herrschsucht“. In Weimar war man[S. 76] der Ansicht, daß Goethes Wille von Niemand zu lenken sei; man erzählte sich zum Beispiel von einem Gespräche über die Berufung eines Professors nach Jena, wo der Fürst seine Wahl gegen Goethe verteidigte oder durchzusetzen suchte. „Du bist ein närrischer Kerl“ rief Karl August schließlich; „Du kannst keinen Widerspruch vertragen.“ – „O ja“, versetzte Goethe, „aber er muß verständig sein.“
[8] Karl v. Lyncker, Am weimarischen Hofe.
[9] Eckermann, der diese Worte berichtet, war auf die Gnade des weimarischen Hofes angewiesen; er übertrieb wohl zuweilen Goethes Lob der fürstlichen Familie. Man kann von Karl August sehr viel Rühmliches sagen, aber nicht wohl behaupten, daß er immer zuerst an das Glück des Landes und ganz zuletzt erst ein wenig an sich selber gedacht habe.
[10] An Knebel, 2. April 1785.
[11] 26. Dezember 1784.
[S. 77]
Goethe war sich stets bewußt, daß die Diener an ihrem Platze ebenso vollkommen sein können, wie er an dem seinen. „So göttlich ist die Welt eingerichtet, daß Jeder an seiner Stelle, an seinem Orte, zu seiner Zeit alles Übrige gleichwägt.“ So sagte er 1810 zu Riemer, und „wenn der Größte ins Wasser fällt und nicht schwimmen kann, zieht ihn der ärmste Hallore heraus.“ Gern bedachte er auch die Gleichheit des Menschenloses in den wichtigsten Erlebnissen: „Es ist ganz einerlei, vornehm oder gering sein: das Menschliche muß man immer ausbaden.“
Manchmal stellte er die „kleinen Leute“ geradezu über die Großen: wenn er erwog, daß sie die allgemeinen[S. 78] Ernährer sind, oder wenn er ihre Hülfsbereitschaft sah. Als es im Juni 1774 in der Frankfurter Judengasse brannte und auch Goethe „seinen Tropfen Wasser geschleppt“ hatte, bekannte er im nächsten Briefe an Schönborn: „Ich habe bei dieser Gelegenheit das gemeine Volk wieder näher kennen gelernt und bin aber- und abermal vergewissert worden, daß Das doch die besten Menschen sind.“
Auch als Weisheitslehrer nahm er Leute „aus dem Volke“ oft an, und dabei meinte er nicht nur den Spruchschatz, den sie von den Vätern her in ihren Reden zum Vorschein bringen, sondern ihre eigenen, erworbenen und bewußten Erfahrungen. 1785 schrieb er seiner Freundin Charlotte v. Stein über einen Buchbinder, der ihm seine Handschrift von ‚Wilhelm Meisters theatralischer Sendung‘ vor seinen Augen zusammenheften mußte: „Unter der Arbeit erzählte er mir seine Geschichte und sprach über sein Leben; jedes Wort, das er sagte, war so schwer wie Gold, und ich verweise Dich auf ein Dutzend Lavaterischer Pleonasmen, um Dir die Ehrfurcht auszudrücken, die ich für den Menschen empfand.“ In späteren Jahren nannte er in einem Aufsatze neben dem hochberühmten Geschichtsschreiber und Philosophen Plutarch den gothaischen Schuhmacher Steube als einen Zeugen für die göttliche Leitung des Menschenlebens. Und von drei andern Kleinen gab er die von ihnen niedergeschriebenen Erinnerungen heraus und leitete sie mit eigenen Betrachtungen ein: von dem Bibliotheksdiener Sachse, dem Gastwirt, früheren Diener, Soldaten und Barbierlehrling[S. 79] Mämpel und einem ungenannten Elsässer, der als Landmann zu Napoleons Truppen gepreßt wurde und in Spanien Mämpels Kriegskamerad war.
Wegen seiner Sammlungen hatte Goethe oft mit schlichten Handwerkern zu tun, die sich durch ihre Kenntnisse auszeichneten. Sehr auffällig war sein Besuch bei Karl Huß in Eger und daß er sogar an dieses Mannes Tische aß, denn Huß war von Beruf Scharfrichter und also nach der Auffassung jener Zeit „unehrlich.“
**
*
Den ihm unterstellten Beamten gönnte Goethe ziemlichen Ellbogenraum. „Ich suche jeden Untergebenen frei im gemessenen Kreise sich bewegen zu lassen, damit er auch fühle, daß er ein Mensch sei. Es kommt alles auf den Geist an, den man einem öffentlichen Wesen einhaucht.“ Er wünschte, daß auch jeder Diener seine Besorgung für recht wichtig ansehe. Und wie er selber Tagebuch führte, mußten auch die bei den Bibliotheken in Weimar und Jena Angestellten sauber geschriebene Tagebücher halten, worin Witterung, Besuche, Eingänge und Vorgänge jeder Art sowie das an jedem Tage Geleistete aufgezeichnet wurden. „So wird den Leuten erst lieb, was sie treiben, wenn sie es stets mit einer gewissen Wichtigkeit anzusehen gewohnt werden, stets in gespannter Aufmerksamkeit auch auf das Kleinste bleiben.“ Goethe ließ sich diese Tagebücher aus Jena regelmäßig senden und freute sich herzlich, wenn sie ihm die Überzeugung gaben, „daß die sämtlichen Verfasser bei Fortsetzung derselben sich zu eigener Satisfaktion, zu pflichtmäßiger Beruhigung und Legitimation arbeiten.“
[S. 80]
„Das ist ein prächtiger Herr“ urteilte der jenaische Hofgärtner, als man ihn im Frühjahr 1820 nach Goethe fragte. „Den schätz’ ich am höchsten – Das heißt, nächst dem lieben Gott – und wer ihn kennt und ihn nicht schätzt, Das ist kein christlicher Mensch, und Das will ich Jedem in’s Gesicht sagen. Und sehen Sie, er ist so ein christlicher Herr; er läßt mit sich reden, denn er denkt: leben und leben lassen!“
**
*
Zu den ihm Unterstellten gehörten auch die Schauspieler, und dieses Völkchen war zu allen Zeiten schwer zu regieren. „Ich will mit dem Schauspielervolk nichts mehr zu schaffen haben“ schrieb ihm Schiller einmal, „denn durch Vernunft und Gefälligkeit ist nichts auszurichten; es gibt nur ein einziges Verhältnis zu ihnen, den kurzen Imperativ, den ich nicht auszuüben habe.“
Goethes Grundsatz im Theater war: stets die Paragraphen der Hausgesetze entscheiden lassen. „Bei Schauspielern muß man in der Ordnung streng am Buchstaben halten, sie sind Meister in Ausflüchten“ schrieb er 1798 an Kirms. Aber als Jemand einmal bemerkte, es möge wohl schwer sein, ein Theater in gehöriger Ordnung zu halten, sprach er die Worte, die sich jeder Regierende in’s Album schreiben sollte: „Sehr viel ist zu erreichen durch Strenge, mehr durch Liebe, das meiste aber durch Einsicht und eine unparteiische Gerechtigkeit, bei der kein Ansehn der Person gilt.“
Die Liebe, die er zu seinem Schauspieler- und Theatergehülfen-Völkchen hatte, sprach Goethe auch[S. 81] öffentlich mit herzlichen Worten aus. Jeder aus dem noch so vielfach verachteten Stande der „vor Hunger kaum, vor Schande nie bewahrten“ Komödianten mußte mit Lust die Gedichte ‚Auf Miedings Tod‘ und ‚Euphrosyne‘ lesen. Mieding war ein schlichter Tischler, aber kunstfertig, eifrig, anspruchslos und für das fürstliche Liebhabertheater ebenso unentbehrlich wie dessen beste Darstellerin Korona Schröter. Beide verherrlichte Goethe öffentlich, als Mieding an der Schwindsucht gestorben war; aus Koronas Händen läßt er den ehrenden Kranz in Miedings Grab fallen.
Noch tiefer ergriffen war Goethe, als Christiane Neumann, die er selber zur Schauspielerin herangebildet hatte, die er gern Euphrosyne, die Frohsinnige, nannte – sie führte diesen Namen in einer ihrer Rollen –, als ganz junge Frau starb. In den schweizerischen Bergen erhielt er die Nachricht; ihm war es, als ob die Seele der Gestorbenen ihm nachgeeilt sei, um auch von ihm noch Abschied zu nehmen. Und er hörte ihre Bitte:
Solche Liebe zu den Untergebenen wächst, wenn es angenehme Menschen sind, gar leicht in allzu große Gunst hinein, und nirgends ist die Versuchung zur Günstlingswirtschaft größer als bei der Leitung eines Theaters. Goethe aber wußte und lehrte: „Man muß stets die Gunst verteilen, sonst windet man das Ruder sich selbst aus der Hand.“ Zu Eckermann sagte er, als von den Schwierigkeiten der Theaterleitung die Rede war:
Ich hatte mich vor zwei Feinden zu hüten. Das Eine war meine leidenschaftliche Liebe des Talents, die leicht in[S. 83] den Fall kommen konnte, mich parteiisch zu machen. Das Andere will ich nicht aussprechen, aber Sie werden es erraten. Es fehlte bei unserm Theater nicht an Frauenzimmern, die schön und jung und dabei von großer Anmut der Seele waren. Ich fühlte mich zu Mancher leidenschaftlich hingezogen; auch fehlte es nicht, daß man mir auf halbem Wege entgegenkam. Allein ich faßte mich und sagte: Nicht weiter! Ich kannte meine Stellung und wußte, was ich ihr schuldig war. Ich stand hier nicht als Privatmann, sondern als Chef einer Anstalt, deren Gedeihen mir mehr galt als mein augenblickliches Glück. Hätte ich mich in irgend einen Liebeshandel eingelassen, so würde ich geworden sein wie ein Kompaß, der unmöglich recht zeigen kann, wenn er einen einwirkenden Magnet an seiner Seite hat. Dadurch aber, daß ich mich durchaus rein erhielt und immer Herr meiner selbst blieb, blieb ich auch Herr des Theaters, und es fehlte mir nie die nötige Achtung, ohne welche jede Autorität bald dahin ist.
Gegen ältere Schauspieler gab Goethe seiner Unzufriedenheit nie strenge Worte; sein Tadel war nie verletzend. Z. B.: „Nun, Das ist ja gar nicht übel, obgleich ich mir den Moment so gedacht habe; überlegen wir uns Das bis zur nächsten Probe, vielleicht stimmen dann unsere Ansichten überein.“ Widerspruch nahm er auch hier gut auf, wo er berechtigt war. Bei einer Theaterprobe las der sonst fleißige Schauspieler Unzelmann seine Worte aus der Rolle ab. Sogleich ertönte Goethes mächtige Baßstimme aus seiner Loge hinter dem Parterre: „Ich bin es nicht gewohnt, daß man seine Aufgaben abliest.“ Unzelmann entschuldigte sich, seine Frau liege seit mehreren Tagen krank darnieder, deshalb hätte er nicht zum Lernen kommen können. „Ei was!“ rief Goethe, „der Tag hat vierundzwanzig[S. 84] Stunden, die Nacht mit eingerechnet.“ Unzelmann trat bis in’s Proszenium vor und sagte: „Euere Exzellenz haben vollkommen recht, der Tag hat vierundzwanzig Stunden, die Nacht mit eingerechnet. Aber ebensogut wie der Staatsmann und der Dichter der Nachtruhe bedarf, ebensogut bedarf ihrer der arme Schauspieler, der öfter Possen reißen muß, wenn ihm das Herz blutet. Euere Exzellenz wissen, daß ich stets meiner Pflicht nachkomme, aber in solchem Falle bin ich wohl zu entschuldigen.“
Diese kühne Rede erregte allgemeines Erstaunen, und Jeder stand erwartungsvoll, was nun kommen würde. Nach einer Pause rief Goethe mit kräftiger Stimme: „Die Antwort paßt! Weiter!“
Als der Kanzler v. Müller ein halbes Jahr nach Goethes Tod vor der Erfurter Akademie gemeinnütziger Wissenschaften eine Vorlesung über seinen großen Freund hielt, betonte er auch Goethes gutes Verhältnis zu seinen Schauspielern:
Nirgends vermochte Goethe den Zauber seiner imposanten Persönlichkeit freier zu üben und geltend zu machen als unter seinen dramatischen Jüngern. Streng und ernst in seinen Forderungen, unabwendlich in seinen Beschlüssen, rasch und freudig jedes Gelingen anerkennend, das Kleinste wie das Größte beachtend und eines Jeden verborgenste Kraft hervorrufend, wirkte er im gemessenen Kreise, ja, meist bei geringen Mitteln, oft das Unglaubliche. Schon sein ermunternder Blick war reiche Belohnung, sein wohlwollendes Wort unschätzbare Gabe. Jeder fühlte sich größer und kräftiger an der Stelle, wo er ihn hingestellt, und der Stempel seines Beifalls schien dem ganzen Leben höhere Weihe zu gewähren. Man muß es selbst gesehen und gehört haben, wie die[S. 85] Veteranen aus jener Zeit des heitersten Zusammenwirkens von Goethe und Schiller noch jetzt mit heiliger Treue jede Erinnerung an diese ihre Heroen bewahren, mit Entzücken einzelne Züge ihres Waltens wiedergeben und schon bei Nennung ihrer Namen sich leuchtenden Blickes gleichsam verjüngen, wenn man ein vollständiges Bild der liebevollen Anhänglichkeit und des Enthusiasmus gewinnen will, die jene großartigen Naturen einzuflößen vermochten.
**
*
„Wenn Sie es nicht machen wollen, so mache ich es selber“ war ein Trumpf, den Goethe gegen Untergebene ausspielen konnte. „Und sie wußten, daß ich verrückt genug war, mein Wort zu halten und das Tollste zu tun“ fügte er hinzu, als er von dem Schauspieler Becker erzählte, dem eine Rolle zu unbedeutend für seine hohe Persönlichkeit erschienen war. Als sein Diener Stadelmann immer noch keine Wischtücher zum Abstauben der Kunstmappen besorgt hatte, da schalt er: „Ich erinnere dich heute zum letzten Male! Gehst du nicht noch heute, die oft verlangten Tücher zu kaufen, so gehe ich morgen selbst, und du sollst sehn, daß ich Wort halte.“ Auch aus solchem Schelten hörte man heraus, daß Goethe es gut meinte. Er machte sich viele Gedanken um das gute Fortkommen seiner Diener und Untergebenen. Für den Bibliotheksdiener erbat er 1805 vom Herzog sogar die Erlaubnis, sich von den Personen, die die Bibliothek benützten, ein Neujahrs-Trinkgeld erbitten zu dürfen, denn „zur allgemeinen Bettelei dürfte wohl auch Diese billig hinzukommen;“ die Finanzen des Ländchens mögen in jenen Kriegszeiten ihre Verwalter nicht zu Stolz und Freigebigkeit gestimmt haben. Bei seinen[S. 86] eigenen Dienern wünschte er, daß sie das Rasieren, die Gartenarbeit oder dergleichen Leistungen lernten, die ihnen später von Nutzen sein und sie jetzt schon vor Müßiggang bewahren konnten. Als er nach Karl Augusts Tode auf der Dornburg an sein eigenes Ende viel dachte, da fragte er sich auch, was aus seinen Bedienten dann werde, und er sprach darüber mit dem Gärtner und dem Barbier, den er reichlich belohnte.
Ebenda war es, daß sein Sekretär John und sein Diener Friedrich Krause mit dem Gärtner Sckell sich einen fröhlichen Nachmittag machten, wobei ihnen der Dornburger Wein so sehr zu Kopfe stieg, daß sie nach der Heimkehr sogleich in schweren Schlummer sanken. Goethe rief vergebens nach ihnen, als sie zu ihren gewohnten Diensten nicht kamen. Am andern Morgen erschraken sie sehr, als sie ihre Pflichtvergessenheit bemerkten. Ganz besonders war Friedrich erschrocken; er wollte sich gar nicht beruhigen lassen. Als ihn bald darauf Goethe rief und den Kaffee zu bringen befahl, wurde er totenbleich und wankte mit schlotternden Gliedern die Treppe hinauf. „Neugierig, was Goethe wohl sagen werde, schlich ich mich hinter dem Bedienten her“ – so erzählt Sckell – „und blieb horchend an der Tür stehen. Als der Bediente eingetreten war, sagte Goethe: „Na, na, Friedrich! du zitterst ja wie ein armer Sünder. Setze nur das Kaffeebrett ab, sonst lässest du es noch fallen! Nicht wahr, du glaubst, ich werde dich recht auszanken? Das tue ich nicht; du hast ja deine Strafe wohl so schon bekommen? Wie sieht es denn heute hier aus?“ fuhr er fort, sich mit[S. 87] dem Zeigefinger über die Stirn streichend. „Setz nur ab und gehe! Es ist abgemacht!“ – Hocherfreut, mit diesem kleinen Verweise davongekommen zu sein, verließ der Bediente das Zimmer.
An Schärfe fehlte es Goethen gegen seine Diener freilich auch nicht, wenn er mit der Geduld schließlich nicht zum Ziele kam. Und wenn er Jemand entließ, so nahm er es ernst mit der Polizei-Verordnung, die es den Herrschaften zur Pflicht macht, die Dienstboten „nicht bloß mit allgemeinen und unbedeutenden Attesten zu entlassen, sondern darin gewissenhaft ihr Gutes und ihre Mängel auseinanderzusetzen.“ Als er im März 1811 eine Köchin wegschickte, die er als „eine der boshaftesten und inkorrigibelsten Personen“ befunden hatte, schrieb er ihr folgendes aufrichtiges Zeugnis:
Charlotte Hoyer hat zwei Jahre in meinem Hause gedient. Für eine Köchin kann sie gelten, und ist zuzeiten folgsam, höflich, sogar einschmeichelnd. Allein durch die Ungleichheit ihres Betragens hat sie sich zuletzt ganz unerträglich gemacht. Gewöhnlich beliebt es ihr nur nach eigenem Willen zu handeln und zu kochen; sie zeigt sich widerspenstig, zudringlich, grob, und sucht Diejenigen, die ihr zu befehlen haben, auf alle Weise zu ermüden. Unruhig und tückisch, verhetzt sie ihre Mitdienenden und macht ihnen, wenn sie nicht mit ihr halten, das Leben sauer. Außer andern verwandten Untugenden hat sie noch Die, daß sie an den Türen horcht.
Charlotte Hoyer hatte keine Ahnung, welchen Preis ihr von Goethe gezeichnetes Charakterbild bei Liebhabern später haben würde, und riß es auf der Treppe in hundert Stücke. Goethe schickte die Beweise dieser neuen Frechheit der Polizei zu, deren „einsichtsvollem[S. 88] Ermessen“ er „die Ahndung einer solchen Verwegenheit“ anheimgab.
Aber auch von einer wackeren Köchin wissen wir, wie sie zu Goethe als ihrem zeitweiligen Herrn stand. Henriette Hunger war seit 1817 bei dem Verleger Frommann in Jena in Stellung; ihre Erinnerungen erzählt sie am besten in eigener Sprech- und Schreibweise:
Göhte war ein treuer Freund zu Frommanns. Alle Morgen 11 Uhr fuhr Göhte vor Und machten Seinen Morgenbesuch. Wobei ich auch das Unglück hatte, Göhte mit Eine Butte Wasser zu überschitten. Göhte wollte mich die Tür halten aus Bescheidenheit und ich ebenfalls, ich versah das Tembo und war in fallen und Göhte wollte mich halten und bekam die Wasserbutte auf den Halz, ich zum Tode Erschrocken. Madam und Fräulein Frommann Kamen mit Tüchern und beseitigten das nasse Element. Göhte fuhr nach Haus um sich umzukleiden. Deßhalb gab es keine Feindschaft. Den andern Morgen war Göhte wieder da und lachte. Göhte war nachdem in den botanischen Garten gezogen wolte aber nicht lange mehr in Jena bleiben, weil Ihn das Essen aus den Speisehäusern nicht Schmeckte. Frommanns wolten Göhte gerne für sich und Jena Erhalten, der Grund war das Essen wie anfangen, die Madam Fromman Eine sehr kluge Dame sann hin und hehr. Endlich kam sie auf Ihre Köchin, das war ich. Sie ließ mich in Ihr Zimmer kommen und sagte, ich habe ein großes anliegen an Dich was G. betrift und Du die Hauptperson bist (Du die Hauptperson? dachte ich) willst Du für G. Kochen den Mittagstisch übernehmen Meine Speisekammer Steht Dir Ofen, thue es, ich werde Dirs niemals vergessen, nach langes Zureden gab ich mein Wort. An Göhte geschriben das Ihre Köchin für Ihn den Mittags Tisch übernehmen wolte, mit Freuden Nehme ich dis An – war die Rückantwort. So kochte ich ein halbes Jahr für den Großen Mann zu danke.[S. 89] Göhte nahm sich gegen mich nicht als wäre ich Köchin sondern als wäre ich mehr, wenn ich mit meinen Zettel kam, lag Schon was Schönes da, anzusehen für mich, Kurz ich kam mich vor als gehörte ich der gelehrten Welt mit an. – –
Seine männlichen Diener gehörten erst recht „der gelehrten Welt mit an.“
Als Goethe 1775 nach Weimar reiste, brachte er einen um sechs Jahre jüngeren Landsmann aus der Kleinen Eschenheimergasse, Philipp Seidel, als sein Faktotum nach Weimar mit. Philipp war auch Schreiber für seinen Herrn und wurde, als die eigene Wirtschaft eingerichtet wurde, eine Art Haushofmeister und Kassenverwalter. Christoph Sutor und die Köchin Dorothee waren seine ersten Untergebenen; vorher hatte er selber die Eierkuchen für seinen Herrn und sich gebacken. Wir wissen, daß Goethe allein mit diesem Diener in seinem Gartenhause den Abend verbrachte und mit ihm in der gleichen engen Kammer schlief. „Mit meinem Philipp von seiner und meiner Welt geschwätzt“ heißt es in einem Briefe Goethes; Philipp aber berichtete an einen Frankfurter Freund, wie weit diese Gespräche gingen.
Stell’ Dir die erschreckliche Wendung vor: von Liebesgeschichten auf die Insel Korsika, und auf Dieser blieben wir in dem größsten und hitzigsten Handgemenge bis morgens gegen Viere. Die Frage, über die mit so viel Heftigkeit als Gelehrsamkeit gestritten wurde, war Diese: ob ein Volk nicht glücklicher sei, wenn’s frei ist, als wenn’s unter dem Befehl eines souveränen Herrn steht. Denn ich sagte: die Korsen sind wirklich unglücklich. Er sagte: nein, es ist ein Glück für sie und ihre Nachkommen; sie werden nur verfeinert, entwildert, lernen Künste und Wissenschaften, statt sie zuvor roh[S. 90] und wild waren. Herr! – sagte ich – ich hätt’ den Teufel von seinen Verfeinerungen und Veredelungen auf Kosten meiner Freiheit, die eigentlich unser Glück macht.
Philipp war ein recht praktisch angelegter Mensch; schon mit dreiundzwanzig Jahren begann er als Nebenverdienst eine Flachsspinnerei und einen Strumpfverlag. Goethe benutzte ihn wegen dieser Talente auch für seine gemeinnützigen Zwecke; als er den Vorsitz der Kriegskommission übernahm und die Garnisonschule nach dem Muster der Frankfurter Stadtschule verbesserte, da gründeten Herr und Diener gemeinsam auch eine Strick-, Näh- und Spinnschule für die Soldatenkinder, und sie verfaßten gemeinsam eine ‚Anweisung zum Spinnen‘.
Am wertvollsten wurde der Diener seinem Herrn, als dieser nach Italien ging und daheim eines sehr zuverlässigen Verwalters und Stellvertreters bedurfte. Philipp besorgte nun alle Haus- und Kassengeschäfte, berichtete die kleinen und großen weimarischen Ereignisse, überbrachte Andern die Sendungen und Bestellungen seines Herrn; ja, er öffnete im Anfang die an Diesen gelangenden Briefe und grüßte Hoch und Niedrig von dem Abwesenden, je nachdem er, Philipp, es für angebracht hielt. Das war dem Dichter recht. Aus Rom schreibt er:
Du gehst zu den Herren Geheimräten und machst von hier aus meine besten Empfehlungen und empfiehlst mich ihrem Andenken. Ein Gleiches kannst Du bei Herrn und Frau v. Wedel und bei den Hofdamen tun. Fällt Dir sonst noch Jemand ein, so tue das Gleiche; ich gebe Dir Vollmacht; wo Du es schicklich und artig hältst, gebe ich Dir Vollmacht. Schreibe mir nur nachher, wen Du gegrüßt hast.
[S. 91]
Aus Neapel heißt es dann:
Bleibe ja dabei, und ich fordere Dich dazu auf, mir über Alles, was mich sonst angeht und was Du sonst gut finden magst, Deine Meinung unverhohlen, ja ohne Einleitung und Entschuldigung, zu sagen. Ich habe Dich immer als einen meiner Schutzgeister angesehen; werde nicht müde, dieses Ämtchen auch künftig beiher zu verwalten.
Und Philipp war aufrichtig. Er schrieb z. B., daß ihm die neue, italienische Fassung der ‚Iphigenie‘ nicht so gut gefalle wie die frühere in Prosa. Und Goethe antwortete:
Was Du von meiner ‚Iphigenie‘ sagst, ist im gewissen Sinne leider wahr. Als ich mich um der Kunst und des Handwerkes willen entschließen mußte, das Stück umzuschreiben, sah ich voraus, daß die besten Stellen verlieren mußten, wenn die schlechten und mittlern gewannen. Du hast zwei Szenen genannt, die offenbar verloren haben. Aber wenn es gedruckt ist, dann lies es noch einmal ganz gelassen, und Du wirst fühlen, was es als Ganzes gewonnen hat.
Seidel blieb dabei, daß die alte, prosaische Form die bessere gewesen sei, wie auch die ‚Claudine von Villabella‘ durch die Jamben nicht gewonnen habe. Goethe antwortete wieder geduldig:
Du sollst auch eine ‚Iphigenie‘ in Prosa haben, wenn sie Dir Freude macht. Der Künstler kann nur arbeiten. Beifall läßt sich, wie Gegenliebe, nur wünschen, nicht erzwingen.
Ebenso wie Philipp ihn, so beriet er seinen Diener bei Dessen literarischen Arbeiten. Philipp dichtete, schrieb eine Abhandlung über das Münzwesen (Goethe gab ihm Aufschluß über die Währung in Neapel),[S. 92] schrieb eine Abhandlung über das weibliche Geschlecht, Alles neben seinem Dienst, seinen eigenen Unternehmungen und seinen naturwissenschaftlichen Studien; er war eben Goethes „vidimierte Kopie“, wie man in Weimar sagte. Sein Herr urteilte immer wohlwollend.
Was Deine kleine Schrift über das weibliche Geschlecht betrifft, so möchte ich Dir fast raten, sie geradezu drucken zu lassen, besonders wenn Du unbekannt bleiben könntest. Jene Ausarbeitung über’s Geld kann nicht reif genug werden; moralische Sachen aber lernt ein Unbefangener aus dem Effekt auf’s Publikum erst recht kennen.
Auch die Meinung seines Dieners über Staatsangelegenheiten war ihm wichtig. So bat er im Sommer 1787:
Mache Dir einmal wieder ein Geschäft, mir einen langen Brief zu schreiben und mir mit Deiner gewöhnlichen Freimütigkeit über die gegenwärtige Lage unseres kleinen Staats, insofern Du sie übersiehst, und was das Publikum denkt und sagt, über das neue Kammersystem usw. Deine Gedanken zu eröffnen.
Philipp wird nicht wenig kritisiert haben, und Goethe antwortete: „Alle Briefe, die an mich kommen, sind voll Klagen und Trauer über die Veränderungen, die sich bei uns zugetragen haben.“ Das heißt, in’s Offene übersetzt: Es ist ein großer Jammer, daß unser guter Herzog sich hat einfallen lassen, preußischer Soldat zu werden; er wird damit sich selber und seinem Lande schaden.
Philipp war mit seinem Herrn Naturforscher geworden und setzte nun das Mikroskopieren auf eigene[S. 93] Hand fort; er teilte seine Entdeckungen freudig mit. Goethe antwortete:
Du tust sehr wohl, mein Lieber, Dich mit Betrachtung der Natur zu beschäftigen. Wie der natürliche Genuß der beste ist, so ist auch die natürliche Betrachtung die beste. Deine Beobachtungen sind recht gut ... Schreibe mir Alles, was Du auf diesem Wege triffst. Mich interessiert’s sehr, und ich lerne immer.
Oft schreibt Goethe seinem Diener Lob und Zustimmung; muß er aber einmal tadeln, so findet er die feinste Form:
Noch ein Wort! Ich kann nicht billigen, daß Du der Frau v. Stein nicht nähere Auskunft wegen des Kastens gabst. Ich bin dadurch auf einige Zeit in Sorge geraten. Wo man aufklären, auch in Kleinigkeiten, kann, soll man es ja und bald tun. Ich gebe diese Lehre und Ermahnung Dir und mir, indem ich Dies schreibe.
Auch für das Fortkommen Philipps sorgt Goethe auf’s beste. Er ließ ihn zuerst Kammerkalkulator, dann Rentkommissär werden; 1789 rückte Seidel zum Rentamtmann auf, und Goethe stellte die dabei nötige Kaution von 1000 Talern. Seidel war bis zu seinem 1820 erfolgten Tode ein tüchtiger Beamter. – –
Unter Philipps Nachfolger war Karl Stadelmann aus Jena einer der wichtigsten; er trat am 1. Februar 1817 seine Stelle als Kammerdiener an, und schon im April läßt er von Jena aus an den jüngeren Herrn v. Goethe bestellen, daß er bei seinen mineralogischen Wanderungen in der Gegend glücklich sei und auch schon den Befehl erhalten habe, den Ettersberg auf seine Art zu untersuchen. Und schon vorher, am 30. März, steht[S. 94] in Goethes Tagebuche: „Wunderbarer Fund von Versteinerungen an der alten Löbstädter Straße durch Stadelmann und Barth“ – Barth war der Kutscher. Nicht lange danach berichtete Stadelmann an den Bibliotheks-Sekretär Kräuter, daß er wegen all des gelehrten Betriebes nicht zum Briefschreiben gekommen sei. „Sehen Sie, hier in Jena, da laufen Unsereinem die Professoren immer vor den Füßen herum: da kommt ein Bergrat, dort ein Chemiker, da wieder ein Künstler, ein Technolog und weiß Gott was alles; ich muß mich den ganzen Tag mit den Leuten so herumbalgen, und da hab’ ich denn Jedem so etwas abgemerkt.“
Sieben Jahre bewährte sich Stadelmann als gelehrter Kammerdiener. Er suchte in Thüringen und Böhmen die Berge ab nach seltenen Steinen für die Sammlungen seines Herrn und eignete sich auch auf anderen Gebieten viele Kenntnisse an. Soret erzählt, wie Karl einmal mit triumphierender Miene das Gespräch unterbrochen und um die Erlaubnis gebeten habe, Goethen eine neue Entdeckung vorzutragen. Es handelte sich um die geliebte Farbenlehre.
„Ich habe ein Weinglas auf ein weißes Blatt Papier gestellt – so – ferner eine Kerze“ begann Karl. „Man sieht, daß das durch die Flüssigkeit dringende Licht auf dem Papier drei Sonnen mit einem Regenbogen hervorbringt, wie wir ihn neulich am Himmel beobachteten. Dreht man es so, so sieht man eine Sonne; so werden es zwei und so drei. Und hier ist der Regenbogen, hier der helle Kreis und hier der dunkle Kreis.“
[S. 95]
Goethe hörte andächtig zu, obwohl er sogleich sah, daß hier wieder einmal der Laie aus richtiger Beobachtung voreilige Schlüsse zog. Und Stadelmann war glücklich. „Jawohl!“ rief er aus, „es ist doch sonderbar, es ist merkwürdig! Ich habe nur eine halbe Stunde zu diesem Experimente gebraucht und würde wohl noch Anderes entdecken, wenn ich nur Zeit hätte!“
Noch in der Nacht vor seinem eigenen Tode zeigte sich Goethes gutes Herz gegen seine Diener. Er sah, daß Friedrich vom vielen Nachtwachen der letzten Wochen sehr müde war; und er mußte ihn doch in seiner Nähe haben. Da ließ er ihn auf seinem eigenen Bett schlafen, während er im Lehnstuhl, wo er leichter Atem bekommen konnte, daneben saß; der Kopist mußte in dieser letzten Nacht aufpassen, daß der Kranke nicht beim Einschlafen vornüber fiel.
[12] So heißt es in einer Variante zur dritten Bearbeitung des ‚Götz‘.
[13] Prolog zum moral.-pol. Puppenspiel 1774.
[S. 96]
Auch wenn wir von Goethes Geselligkeit reden, müssen wir ihm Eigenschaften zuschreiben, die einander widersprechen: er war gewandt und steif, biegsam-schmiegsam und unbeholfen, Zauberer und Pedant, hingebend und unfühlend.
Wir haben also sehr verschiedenartige Urteile über seinen Umgang mit Menschen. Sobald er als Dichter aufgetreten war, bewunderten seine neuen Bekannten auch den Menschen in ihm und rühmten seine Unterhaltung in höchsten Tönen. Wirklich in höchsten, denn ein Schriftsteller und Hofmeister Clemens Werthes verglich ihn geradezu mit Christus und fragte: „Brannte nicht unser Herz in uns, da er mit uns redete?“ Er war damals aber auch ein recht gutmütiger Gesellschafter, wenigstens wenn er in neue Kreise trat, wie zum Beispiel als Begleiter Lavaters im Sommer 1774. Dieser bezeugte denn auch: „Ich habe ihn neben Basedow und Hasenkamp,[14] bei Herrnhutern und Mystikern, bei Weibchens und Männinnen: allenthalben denselben edeln, Alles durchschauenden, duldenden Mann gesehen.“
Acht Wochen nach Goethes Erscheinen in Weimar dichtete Wieland die Verse:
[S. 97]
Später hätte Wieland dies Gedicht als eine allzu enthusiastische Übertreibung gern aus der Welt geschafft; 1797 meinte er einmal, Goethes Kunst habe von jeher darin bestanden, die Konvenienz mit Füßen zu treten und doch dabei immer klug um sich zu sehen, wie weit er’s gerade wagen durfte. Jenes Gedicht bezog sich auf einen Besuch Goethes und Wielands bei der Familie v. Keller in Stetten; hier in Stetten, erzählte nun Wieland, sei Goethe gegen die alte Dame weit respektvoller gewesen als daheim in Weimar gegen die Herzogin-Mutter, in deren Gegenwart er sich oft auf dem Boden im Zimmer herumgewälzt und durch Verdrehung der Hände und Füße Lachen erregt habe.
In jener ersten weimarischen Zeit besuchte einmal der alte Gleim aus Halberstadt seine Freunde Wieland und Bertuch, und ehe er Goethe kannte, nahm er an einer höfischen Gesellschaft teil. Da erbot sich ein feiner Jäger, ihn im Vorlesen aus dem neuesten Musenalmanach abzulösen, und bald las dieser Jäger das tollste, geistvollste, witzigste Zeug, das gar nicht auf den Blättern stand; sogar eine Fabel auf Gleim improvisierte er in Knittelversen. „Das ist entweder Goethe oder der Teufel!“ flüsterte der Halberstädter Gast Wieland zu. „Beides!“ gab Jener zur Antwort.
Dieser Hexenmeister für fröhliche Gesellschaften, dieser liebenswürdigste Kamerad blieb Goethe nicht[S. 99] lange, oder vielmehr: was anfangs die Regel gewesen war, wurde bald zur seltenen Ausnahme. Es erheben sich auch unter den weimarischen Freunden bald Klagen über sein zugeknöpftes, allzu ernstes Wesen. Und als er von der italienischen Reise wiederkam, erschien er vollends als ein Fremder.
Es ist vielen der nähern Freunde und Lebensgenossen Goethes begegnet, daß er ihnen nach seiner italienischen Reise ganz umgewandelt vorkam, ja, daß sie fast irre an ihm wurden, wenn sie jenen freien harmlosen Lebenssinn, jene unbefangene, zutrauliche, hinreißende Lebhaftigkeit, mit der sie ihn früher die verschiedenen Gegenstände ergreifen zu sehen gewohnt waren, nicht mehr an ihm zu gewahren glaubten. So kam er dem Einen erkaltet, dem Andern verschlossen oder selbstsüchtig, rätselhaft den Meisten vor, und noch späterhin haben ähnliche Klagen nachgeklungen.[15]
Goethe versuchte zuweilen, die Tage unbefangener Jugendlust mit Gewalt zurückzurufen; man sah z. B. bald nach seiner Heimkehr aus Italien, wie er auf einem Hofballe nur mit solchen Mädchen und Frauen tanzte und schwätzte, die außer der Jugend und einem hübschen Gesicht nichts zu bieten hatten, während er die Älteren und Verständigeren mied; und später umgab er sich gern mit jungem Schauspielervolk, das denn doch besser zu seiner Christiane als zu ihm paßte. Im Herbst 1801 erschien er plötzlich einmal in einer Damengesellschaft bei dem klugen alten Hoffräulein v. Göchhausen und begann vor den überraschten Damen alsbald eine Strafpredigt über die verderbte Geselligkeit, die jetzt herrsche.[S. 100] Mit den grellsten Farben schilderte er die dermalige Geistesleere und Gemütlosigkeit: wieviel gemütlicher sei es doch früher gewesen! Seinen ganzen Zorn ergoß er über den Teufel der Hoffart, der die Genügsamkeit und den Frohsinn aus der Welt verbannt, dagegen aber die unerträglichste Langeweile eingeschmuggelt habe. Dann schlug er einen Reformverein vor und zwar eine – cour d’amour. Sein Vorschlag wurde angenommen; die phantastische Gesellschaft bildete sich aus sieben Damen und sieben Herren. Man kam jeden Mittwoch Abend nach dem Theater in Goethes Haus zusammen; die Damen sorgten für das Essen, die Herren für den Wein. Aber der Liebeshof wurde nicht so unterhaltend, wie man gehofft hatte, und man klagte über Goethes Steifheit, Pedanterie und Tyrannei. Schon nach einem halben Jahre bewirkte die erste Meinungsverschiedenheit, daß die Zusammenkünfte aufhörten.
**
*
Auch Goethe selber hat uns bezeugt, daß er in der Geselligkeit bald frei-spielend, bald unfrei und unbeholfen gewesen sei. „Doch ach! ein Gott versagte mir die Kunst, Die arme Kunst, mich künstlich zu betragen“ so klagt er schon 1783, und: „Mir ist’s nicht gegeben, gegen die Menge und mit der Menge herzlich zu sein“ schreibt er 1785 an Knebel, als er gegen die berühmte Frau v. der Recke so stumm und kalt geblieben war, daß ihre Begleiterin Sophie Becker von ihm niederschrieb: „Er hat etwas entsetzlich Steifes in seinem Betragen und spricht gar wenig; es war mir immer, als ob ihn[S. 101] seine Größe verlegen mache.“ In den ‚Annalen‘ von 1804 fügt Goethe hinzu: auch wenn er sich nicht verstelle, sondern sich gehen lasse, werde er doch immer von den Leuten nicht recht gefaßt. Um so mehr mußte er mit Staunen später bemerken, wie sehr der Stubengelehrte Schiller in jeder Gesellschaft Herr seiner selbst war.
Schiller war ein ganz anderer Geselle als ich und wußte in der Gesellschaft immer bedeutend und anziehend zu sprechen .... Er ist so groß am Teetisch, wie er es im Staatsrat gewesen sein würde. Nichts geniert ihn, Nichts engt ihn ein, Nichts zieht den Flug seiner Gedanken herab. Was in ihm von großen Ansichten lebt, geht immer frei heraus ohne Rücksicht und ohne Bedenken. Das war ein rechter Mensch, und so sollte man auch sein! Wir Andern dagegen fühlen uns immer bedingt; die Personen, die Gegenstände, die uns umgeben, haben auf uns ihren Einfluß .. wir sind die Sklaven der Gegenstände.
Ganz anders klingt dann wieder, was Goethe in der ‚Kampagne in Frankreich‘ über sich und seinen Aufenthalt in Düsseldorf und Münster erzählt. Er beginnt auch hier damit, daß er in Jacobis Hause seine optischen Entdeckungen nur „didaktisch und dogmatisch“ vortragen konnte, denn, sagt er, „eine eigentlich dialektische und konversierende Gabe war mir nicht verliehen.“ Dann aber spricht er von einer „bösen Gewohnheit.“
Da mir das Gespräch, wie es gewöhnlich geführt wird, höchst langweilig war, indem nichts als beschränkte Vorstellungsarten zur Sprache kamen, so pflegte ich den unter Menschen gewöhnlich entspringenden bornierten Streit durch gewaltsame Paradoxen aufzuregen und an’s Äußerste zu führen. Dadurch war die Gesellschaft meist verletzt und in[S. 102] mehr als einem Sinne verdrießlich. Denn oft, um meinen Zweck zu erreichen, mußte ich das Böse Prinzip spielen, und da die Menschen gut sein und auch mich gut haben wollten, so ließen sie es nicht durchgehen. Als Ernst konnte man es nicht gelten lassen, weil es nicht gründlich, als Scherz nicht, weil es zu herb war; zuletzt nannten sie mich einen umgekehrten Heuchler und versöhnten sich bald wieder mit mir. Doch kann ich nicht leugnen, daß ich durch diese böse Manier mir manche Person entfremdet, Andere zu Feinden gemacht habe.
Er fährt fort:
Wie mit dem Zauberstäbchen jedoch konnte ich sogleich alle bösen Geister vertreiben, wenn ich von Italien zu erzählen anfing ... Ich konnte beschreiben, als wenn ich’s vor mir sähe; von belebender Staffage wimmelte es durch und durch, und so war Jedermann von den lebhaft vorbeigeführten Bilderzügen zufrieden, manchmal entzückt.
„Er ist und bleibt der wahre Zauberer“ schrieb damals Helene Jacobi an Gräfin Sophie Stolberg.
Was die Leute Sonderbares von ihm schwatzen und reden, ist, weil sie immer nur die linke Seite sehen, und Dies ist auch das Verkehrteste an ihm, daß er so gern das Verkehrte aus sich herauswendet.
Wenige Tage danach war Goethe in Münster bei der Fürstin Gallitzin in einem Kreise frommer katholischer Laien und Priester. Er fügte sich vollkommen in diesen Kreis.
Hier wählte ich unaufgefordert die römischen Kirchenfeste, Karwoche und Ostern, Fronleichnam und Peter Paul, sodann zur Erheiterung die Pferdeweihe, woran auch andere Haus- und Hoftiere teilnehmen. Diese Feste waren mir damals nach allen charakteristischen Einzelheiten vollkommen gegenwärtig, denn ich ging darauf aus, ein ‚Römisches Jahr‘[S. 103] zu schreiben, den Verlauf geistlicher und weltlicher Öffentlichkeiten; daher ich denn auch meinen katholischen frommen Zirkel mit meinen vorgeführten Bildern ebenso zufrieden sah, als die Weltkinder mit dem Karneval. Ja, Einer von den Gegenwärtigen, mit den Gesamtverhältnissen nicht genau bekannt, hatte im stillen gefragt, ob ich denn wirklich katholisch sei. Als die Fürstin mir Dieses erzählte, eröffnete sie mir noch ein Anderes; man hatte ihr nämlich vor meiner Ankunft geschrieben, sie solle sich vor mir in acht nehmen; ich wisse mich so fromm zu stellen, daß man mich für religiös, ja für katholisch halten könne. – „Geben Sie mir zu, verehrte Freundin“ rief ich aus, „ich stelle mich nicht fromm: ich bin es am rechten Orte! Mir fällt nicht schwer, mit einem klaren, unschuldigen Blick alle Zustände zu beachten und sie wieder auch ebenso rein darzustellen. Jede Art fratzenhafter Verzerrung, wodurch sich dünkelhafte Menschen nach eigener Sinnesweise an dem Gegenstand versündigen, war mir von jeher zuwider. Was mir widersteht, davon wende ich den Blick weg; aber Manches, was ich nicht gerade billige, mag ich gern in seiner Eigentümlichkeit erkennen. Da zeigt sich dann meist, daß die Andern ebenso recht haben, nach ihrer eigentümlichen Art und Weise zu existieren, als ich nach der meinigen.“
Ein junger Schweizer, Horner aus Zürich, durfte im Oktober 1794 als Begleiter seines Landsmanns Heinrich Meyer an einer Gesellschaft bei Herder teilnehmen. Er wunderte sich, wie ungeniert die großen Geister miteinander verkehrten. „Jeder sprach und stand oder setzte sich, zu wem er wollte.“ Herder zeigte sich als der Unterhaltsamste und Überlegenste; Goethe blieb stumm. Da brachte ein gewisser Professor Meyer aus Berlin „auf eine infam-witzige Manier die Heirats- und Sterbensgeschichte“ des armen Karl Philipp Moritz vor.
[S. 104]
Dies weckte Goethen so nach und nach aus seiner Kälte auf. Er saß neben mir, und wir schenkten uns wechselseitig um die Wette ein. Nun fing auch er an, von Moritz zu erzählen: was er in Rom für dumme Streiche gemacht hatte, und schlug mit seinem Witz, der viel feiner war, den Professor und bisweilen auch Herdern zu Boden.
Stephan Schütze, der ihn namentlich im geselligen Kreise der Bankierswitwe Johanna Schopenhauer, der Mutter von Adele und Arthur Schopenhauer, beobachtete, schildert ihn uns, wie er in den Notjahren nach dem Oktober 1806 dort erschien.
Das Merkwürdigste war, ihn fast jedesmal in einer anderen Stimmung zu sehen, so daß, wer ihn mit einem Male zu fassen glaubte, sich das nächste Mal gewiß gestehen mußte, daß er ihm wieder entschlüpft sei. Man hatte bald einen sanft-ruhigen, bald einen verdrießlich-abschreckenden – auch Kummer drückte sich bei ihm gewöhnlich durch Verdrießlichkeit aus – bald einen sich absondernden, schweigsamen, bald einen beredten, ja redseligen, bald einen episch-ruhigen, bald, wiewohl seltener, einen feurig-aufgeregten, begeisterten, bald einen ironisch-scherzenden, schalkhaft neckenden, bald einen zornig scheltenden, bald sogar einen übermütigen Goethe vor sich .... Goethe übte gewiß eine Herrschaft über sich, wie leicht Niemand; dennoch drang ein Nachhall der letzten Stunde oder die Laune des Augenblicks oftmals durch die feste Haltung hindurch, und als Gast ohne besondere Verpflichtung ließ er sich hier weit freier gehen als zu Hause, wenn er selbst Gäste empfing.
Schütze erzählt weiter:
Gewöhnlicherweise warf er weder mit Witz noch mit Ideen um sich; ja, er vermied diese sogar, sondern er gefiel sich meist im Ton einer heitern Ironie, die etwas zu loben schien, dessen Unhaltbarkeit sich so von selbst ergeben mußte.[S. 105] ... Schnelle Kreuz- und Querzüge konnte er in der Unterhaltung nicht leiden ... Noch mehr liebte er, etwas ruhig durchzusprechen, wobei Andere oft nur beipflichtend und fragend beförderlich waren, während er eigentlich nur das Gespräch führte und fortsetzte.
Höher noch stieg seine Liebenswürdigkeit, wenn er ganz und gar einer epischen Stimmung sich hingab, wenn er z. B. einen römischen Karneval beschrieb oder sonst etwas von Italien erzählte. Hier konnte man stundenlang ihm zuhören und die ganze übrige Gesellschaft darüber vergessen. Die Ruhe, die Klarheit, die Lebendigkeit, der an’s Komische hinstreifende, halb feierliche Ton, womit er schilderte und Alles deutlich vor Augen stellte, flößten mit dem Reize der Unterhaltung zugleich ein großes Behagen, ein großes Wohlgefallen am Leben ein.
So angenehm fesselnd indes auch seine Schilderungen waren, die höchste Glorie umleuchtete ihn erst in Augenblicken der Begeisterung, wenn ein lebhaftes Rot die Wangen überflog, deutlicher der Gedanke auf der erhabenen Stirn hervortrat, himmlischer noch die Strahlen seines Auges glänzten, und sein ganzes Antlitz sich zum Ausdruck einer göttlichen Anschauung verklärte. Es war Dies namentlich der Fall, als er eines Abends [1807] Calderons ‚standhaften Prinzen‘ vorlas. Bei der Szene, wo der Prinz als Geist mit der Fackel in der Nacht dem kommenden Heere voranleuchtet, wurde er so von der Schönheit der Dichtung hingerissen, daß er mit Heftigkeit das Buch auf den Tisch warf.
**
*
Ein abwechselndes Vorlesen und ein Lesen mit verteilten Rollen ward auch in Goethes Hause gepflegt, wenigstens eine Zeit lang. Der junge Heinrich Voß, der Sohn des Homer-Übersetzers, erzählt davon im Januar 1801:
Da sitzt die ganze Gesellschaft um einen langen Tisch, Goethe in der Mitte, und liest abwechselnd. Es traf sich,[S. 106] daß beidemal, als ich zugegen war, aus der ‚Luise‘ gelesen wurde. An Goethe kam die Stelle von der Trauung, die er mit dem tiefsten Gefühle las. Aber seine Stimme ward kleinlaut: er weinte und gab das Buch seinem Nachbar. „Eine heilige Stelle!“ rief er aus mit einer Innigkeit, die uns alle erschütterte.
Nachher traf ihn die Stelle: „den Gesang, den unser Voß in Eutin uns dichtete.“ Aus dem Pathos, mit welchem er diese Worte vortrug, hätte ich schon seine Liebe zu meinem Vater abnehmen können.
Vier Jahre später schilderte Frau Schopenhauer ihrem Sohne einen Abend bei Goethe, „wo es allerliebst war.“
Er hatte einige junge Schauspieler, die er oft bei sich deklamieren läßt, um sie für ihre Kunst zu bilden, eingeladen und las mir mit ihnen einige seiner frühesten Arbeiten, ein Stück von Laune und Humor: ‚Die Mitschuldigen‘, vor. Er hatte selbst die Rolle eines alten Gastwirts darin übernommen ... Ich habe nie was Ähnliches gehört; er ist ganz Feuer und Leben, wenn er deklamiert; Keiner hat das Echtkomische mehr in seiner Gewalt als er.
Zwischendurch meisterte er die jungen Leute. Ein paar waren ihm zu kalt. „Seid ihr denn gar nicht verliebt?“ rief er komisch erzürnt, und doch war es ihm halb ein Ernst. „Seid ihr denn gar nicht verliebt, verdammtes junges Volk! Ich bin sechzig Jahre alt und kann’s besser.“
Wir blieben bis halb Zwölf zusammen, Ich saß bei ihm, und die Bardua auf der andern Seite.
**
*
„Wohl perlet im Glase der purpurne Wein“ beginnt Schiller ein Gedicht, „Wohl glänzen die Augen der Gäste: Es zeigt sich der Sänger, er tritt herein. Zu dem Guten bringt er das Beste.“ Und ebenso zeichnet[S. 107] uns Goethe den singenden Dichter, den der König herbeirufen läßt, seine Gäste zu erfreuen.
Diese Erfahrung, daß Dichtung und Musik zum Guten das Beste hinzufügen, hatten beide Dichter oft mit erlebt: bei Hofe, in geselligen Vereinen und im eigenen Hause. Als Fürst Radziwill einmal nach Weimar kam, sein Cello mitbrachte und zum Cello sang, glaubte Goethe einen Troubadour aus alten Zeiten zu sehen. In jüngeren Jahren war Korona Schröter so eine Bringerin der schönsten Freude in Goethes Häuschen an der Ilm; in späteren Zeiten kamen Liedermeister wie Reichardt, Zelter und Methfessel zu ihm und sangen zur Gitarre, zum Klavier oder ohne jedes Instrument. Oder es kamen Sänger und Sängerinnen vom Theater: Ehlers, Strohmeier, Moltke, Ernestine Engels, Henriette Eberwein und von auswärts Henriette Sontag, Wilhelmine Schröder-Devrient. Auch tüchtige Klavierspieler und Geiger erfreuten ihn und seine Gäste nicht selten: Hummel, Organist Schütz aus Berka, Karl Eberwein, Ferdinand Hiller, Felix Mendelssohn, Maria Szymanowska, Klara Wieck, die nachmalige Gattin von Robert Schumann, und Andere mehr.
Eine eigene Hauskapelle hatte er sich schon lange gewünscht; im Herbst 1807 glückte es ihm, sie einzurichten; ein paar Sänger und Sängerinnen vom Theater übten sich bei ihm zweimal die Woche; der Geiger[S. 108] Karl Eberwein warf sich zum Dirigenten auf; im Januar 1808 konnte Goethe schon das erste Konzert seines eigenen Singechors vor geladenen Gästen veranstalten. In den nächsten Wintern waren dann seine Hauskonzerte seine liebste Geselligkeit. Sie fanden an den Sonntagmittagen statt; alle Freunde waren geladen, und einige Male zählte man an die fünfzig Zuhörer. Diese Tonfreuden begannen gewöhnlich mit Werken der musica sacra; dann folgten weltlich-ernste Stücke, und schließlich fehlte auch das Lustige nicht.
Um 1812 und 1813 schlief diese kleine Anstalt ein, besonders infolge von Mißhelligkeiten im Theater. Aber das Ehepaar Eberwein blieb dem alten Dichter treu anhänglich, und wenn nun Goethe in seinem Saale ein Konzert wünschte, so bedurfte es nur einer kurzen Mitteilung: Eberwein brachte die Vortragenden rasch zusammen. Eckermann hat uns solche Abende geschildert, wo Goethe sich mit den Seinen Händels ‚Messias‘ zurückrief oder sich an dem Vortrag seiner eigenen Lieder erfreute, die Henriette Eberwein gar lebendig vortrug, und zwar in Melodien, die teils ihr Mann, teils ihr Schwager, der Rudolstädter Eberwein, gesetzt hatten.
**
*
Auch das Zeichnen und Malen wurde im klassischen Weimar zuweilen zum gesellschaftlichen Vergnügen. Wir besitzen ein Bild von Georg Melchior Kraus, wo er im Kreise um die Herzogin Amalie neun Damen und Herren an einem Zeichentische abgebildet hat: Goethe, Einsiedel, Herder usw.; zwei der Damen sticken, Herder macht den Zuschauer, die Übrigen haben alle den[S. 109] Stift oder den Pinsel zur Hand. Als im Oktober 1806 die Frau Schopenhauer trotz ihrer Neuheit in Weimar zweimal in der Woche Tee-Abende geben und dazu namentlich den Geheimen Rat Goethe als regelmäßigen Gast gewinnen wollte, gab ihr sein Freund Heinrich Meyer einen guten Rat. „Goethe fühlt sich recht wohl bei mir“ konnte sie dann sehr bald an ihren Arthur schreiben;
ich habe einen eigenen Tisch mit Zeichenmaterialien für ihn in eine Ecke gestellt. Wenn er dann Lust hat, so setzt er sich hin und tuscht aus dem Kopfe kleine Landschaften: leicht hingeworfen, nur skizziert, aber lebend und wahr, wie er selbst und Alles, was er macht.
Einmal brachte er der Gastgeberin einen schön aus Papier ausgeschnittenen Blumenstrauß von dem Hamburger Maler Philipp Otto Runge mit; da zeigte ihm Frau Schopenhauer, daß sie diese Kunst auch verstand, und legte ihm einen ebensolchen Kastanienzweig vor.
Er freute sich darüber wie ein Kind zum Weihnachten ... Die Übrigen gingen an’s Klavier im Nebenzimmer; ich blieb allein bei Goethe an seinem Zeichentische ... Nun erzählte er mir von einem Ofenschirme, den ich so machen müßte, machte mir mit ein paar Strichen eine Zeichnung dazu und will mir auch beim Aufkleben helfen.
Beide gingen sogleich mit großem Eifer an diese Aufgabe. Die junge Witwe schnitt ihre Blumen, und der berühmte Dichter war „gewaltig beschäftigt“, sie zur Verzierung des Ofenschirmes zu ordnen. Ende Januar 1807 berichtet Johanna wieder darüber.
Es ist eine herrliche Sache um solche gemeinschaftliche Arbeiten, die man mit Lust und Liebe anfängt; es gibt kein[S. 110] schöneres, festeres Band für’s gesellige Leben. Ich habe immer mit meinen Freunden Etwas vor, und Das gibt ein Zusammenkommen, ein Beraten, ein Überlegen, als hinge das Wohl der Welt daran; am Ende wird es ein Ofenschirm ... Klugen, vernünftigen Leuten muß unser Beginnen fast töricht erscheinen. Wenn so ein Senator oder Bürgermeister sähe, wie ich mit Meyer Papierschnitzel zusammenleime, wie Goethe und die Andern dabei stehen und eifrig Rat geben, er würde ein recht christliches Mitleid mit uns armen kindischen Seelen haben ...
Der Ofenschirm ist fertig und die Bewunderung aller Welt; er ist wirklich über Erwarten hübsch! Goethe hat letzt mit dem Lichte in der Hand wohl eine halbe Stunde davor gesessen und ihn besehen, und wer ihm näher kam, Der mußte mit bewundern und besehen.
**
*
Zu den väterlichen Warnungen, die Goethe auf die Universität mitnahm, gehörte diejenige vor allem Kartenspiel. In Leipzig aber überzeugte ihn eine mütterliche Freundin, die Hofrätin Böhme, daß nur der Mißbrauch gefährlich und schädlich sei, und sie unterwies ihn in Pikett, L’hombre und anderen in Gesellschaft üblichen Spielen. Ein guter Kartenspieler wurde ihr Zögling jedoch nicht. „Ich hatte wohl den Spielsinn, aber nicht den Spielgeist“ so schilderte sich Goethe später:
Ich lernte alle Spiele leicht und geschwind, aber niemals konnte ich die gehörige Aufmerksamkeit einen ganzen Abend zusammenhalten. Wenn ich also recht gut anfing, so verfehlte ich’s doch immer am Ende und machte mich und Andere verlieren, wodurch ich denn jederzeit verdrießlich entweder zur Abendtafel oder aus der Gesellschaft ging. Kaum war Madame Böhme verschieden, die mich ohnedem während ihrer langwierigen Krankheit nicht mehr zum Spiel angehalten[S. 111] hatte, so gewann die Lehre meines Vaters Kraft; ich entschuldigte mich erst von den Partien, und weil man nun nichts mehr mit mir anzufangen wußte, so ward ich mir noch mehr als Andern lästig, schlug die Einladungen aus, die denn sparsamer erfolgten und zuletzt ganz aufhörten.
Diese Erfahrung machte ihn in Straßburg willfährig, als dort ein älterer Freund, Salzmann, die gleiche Forderung an ihn stellte wie einst die Professorin Böhme. Goethe sah ein, daß man sich durch diese kleine Aufopferung – wenn sie ja als solche gelten dürfe – manches Vergnügen und „sogar eine größere Freiheit in der Sozietät verschaffen könne, als man sonst genießen würde“; handelte es sich doch damals, wenn vom Kartenspiel die Rede war, in der Regel nicht um einen Wirtshaus-Zeitvertreib unter Männern, sondern um eine häusliche Unterhaltung zwischen Damen und Herren. Die Gefahr, daß Einzelne von der Spielleidenschaft ergriffen wurden, blieb freilich; nicht Wenige brachten sich bei Kunst- und Glückspielen um Wohlstand, Häuslichkeit und Ehre. Aber Goethe fühlte nie eine übermäßige Anziehung vom Spieltisch aus, und wenn er die Karten in der Hand hielt, blieb ihm das Beisammensein mit den Menschen die Hauptsache.
Das alte eingeschlafene Pikett wurde daher hervorgesucht; ich lernte Whist, richtete mir nach Anleitung meines Mentors einen Spielbeutel ein, welcher unter allen Umständen unantastbar sein sollte, und nun fand ich Gelegenheit, mit meinem Freunde die meisten Abende in den besten Zirkeln zuzubringen.
Er war selber noch ein junger Student, als ein noch jüngerer, Augustin Trapp in Worms, ihn um einen Gewissensrat[S. 112] über das Kartenspielen bat; Goethe neigte damals zur herrnhutischen Frömmigkeit und hatte Verständnis für solche Nöte; seine Antwort war vermittelnd:
Wenn Sie es für eine Sünde halten, so spielen Sie nicht! Warum wollen Sie törig sein und Ihr Gewissen, anderen Leuten zu gefallen, beschweren? Aber ich wünschte nicht, daß Sie eine Religionssache daraus machten und sagten: Ich tu es nicht, weil ich’s für Sünde halte.
Und noch weniger wünschte ich, daß Sie Jemanden, der gerne spielt, abhalten und denen Leuten beweisen wollten, es sei Sünde. Wer spielen will, Den lassen Sie spielen! Aber Sie, lassen Sie’s sein! Wenn man Sie nötigt, so sagen Sie: „Ich spiele nicht.“ Wenn man fragt: „warum?“ so sagen Sie: „Weil ich keinen Gefallen dran habe.“ Sagen die Leute: „Das ist Grille,“ so antworten Sie mit einem großen Philosophen: „Gut, es sei Grille: habt Ihr etwan keine?“ Und wenn man Sie fragt: „Was halten Sie von dem Spiel?“, so können Sie sagen: „Ich spiele nicht; was ich davon halte, kann sehr einerlei sein; meine Meinung wird zur Entscheidung des Streits nichts beitragen.“
Und so helfen Sie sich durch, wenn Sie können! Denn es ist aus tausend Ursachen gut, gewisse Kleinigkeiten nicht nach den Grundsätzen der Religion, besonders öffentlich, zu beurteilen. –
Als Goethe nach Weimar kam, fand er, daß an diesem Hofe, wie an allen deutschen Höfen, das Kartenspiel die tägliche Unterhaltung war, ebenso bei allen adligen und bürgerlichen Gesellschaften. Bei den Redouten fehlte auch die Pharaobank nie. Wir wissen nur wenig von großen Geldverlusten; der Zeitverlust aber war ein ungeheurer. Die Wenigen, die sich ausschlossen oder gar gestanden, sie hätten die Spiele nicht gelernt (L’hombre, Tarock, Whist usw.) wurden von den damaligen[S. 113] Regelrechten wie Meerwunder angestaunt. Goethe und Frau v. Stein gehörten zu diesen Ausnahmemenschen: schon diese Besonderheit führte sie in Gesellschaft zueinander.
Goethe hat von diesem Zeitverderb sein ganzes Leben lang keine gute Meinung gehabt, und in Bausch und Bogen könnte man sagen, er habe keine Karten gespielt. Einige Ausnahmen finden sich jedoch; z. B. spielte er in den Jahren 1811, 12 und 13 ziemlich oft nach Tische oder auch abends mit Christiane, August und den Schauspielerinnen Engels und Lortzing eine Partie Whist. Im Januar 1814 schildert er einem alten Freunde, wie er jetzt den Frauen schön tue: „Mit den bejahrten spiele ich Karte und die jüngeren lehre ich Irgendetwas.“
Danach oder mit Christianens Ausscheiden scheint das Kartenspielen für ihn aufgehört zu haben. Aus seinen letzten Jahren bezeugt einer seiner Freunde, Soret, daß Goethe diese Art, sich in größeren Gesellschaften zu unterhalten, abscheulich fand; er spottete darüber, daß die Schönen in all ihrer Huld und Frische mit jungen, fast unbärtigen Männern die gelehrten Regeln des Whist und Boston ernsthaft besprachen. „Doch laßt’s nur gut sein“ meinte er dann wohl, „in unserer Zeit, wo die Throne gestürzt werden, zeigt man seine natürliche Liebe zur Ordnung und Unterordnung wenigstens durch Anerkennung des Karo-Königs.“
**
*
Das Tanzen war in Goethes Zeit und in den Kreisen, wo er sich bewegte, ein sehr häufiges Vergnügen; die Tanzkunst war bei den Vornehmen geradezu[S. 114] eins der ersten und wichtigsten Unterrichtsfächer; es ward noch mehr Zeit darauf verwandt als auf den Katechismus. Unter Goethes Freunden waren denn auch nicht wenige Künstler in diesem Fache; er selber tanzte sehr gern und blieb zeitlebens ein Lobredner dieser Unterhaltung. Auf die Ausschmückung der Redouten hat er sehr viel Zeit verwandt. Zum letzten Male „tanzte“ er am Abend vor seinem 74. Geburtstag; es war in Karlsbad bei einem Tanztee, den Graf Zenigeo gab: „Zu der Schlußpolonaise forderte mich eine polnische Dame zum Tanze auf, den ich mit ihr herumschlich und mir nach und nach beim Damenwechsel die meisten hübschen Kinder in die Hand kamen.“
**
*
Ebenso begünstigte er das gesellschaftliche Theaterspiel zeitlebens, sowohl bei Erwachsenen wie bei Kindern. Als vierjähriger Knabe erlebte Goethe die erste häusliche Schauspiel-Vorstellung durch ein Puppentheater, das er zu Weihnachten bekam; das letzte Theaterstück sah er als zweiundachtzigjähriger Greis, wiederum zu Hause; seine Enkel und ihre jungen Freunde spielten ihm am 6. November 1831 seine eigene ‚Fischerin‘ vor.
**
*
Die allergewöhnlichste Unterhaltung, der Klatsch, beschäftigte auch im klassischen Weimar viele Zungen. Goethe stand von jeher abgesondert und hatte den Kopf voll von höheren Dingen; er erfuhr nur selten, was über ihn und die Seinen gesprochen wurde, und nahm auch an dem allgemeinen Hin und Her der höfischen und städtischen Tagesgeschichte nur selten teil. Zuweilen[S. 115] merkte er dann, daß seine „fortdauernde reine Entfremdung von den Menschen“ für einen Staatsdiener doch nicht ganz ratsam war. „Ich bin nicht zu dieser Welt gemacht“ schrieb er dann in sein Tagebuch; „wie man aus seinem Haus tritt, geht man auf lauter Kot, und weil ich mich nicht um Lumperei kümmere, nicht klatsche und solche Rapporteurs nicht halte, handle ich oft dumm.“
Nun sind hübsche Geschichten nur um so anschaulicher, wenn sie in unserer Nähe spielen und unsere Bekannten betreffen. Solche Geschichten hat auch Goethe gern angehört und selber erzählt. In seinem Alter ließ er sich von dem trocken-witzigen Heinrich Meyer gern Dergleichen mitteilen; namentlich hörte er von seiner Schwiegertochter Ottilie und ihrer Schwester Ulrike gern „neuerliche frauenzimmerliche Vorkommnisse“ oder Nachrichten von den fürstlichen Personen. „Ottilie, von Belvedere kommend, den Hofzustand schildernd, mit Neigung, wie ich’s liebe“; so lesen wir einmal im Tagebuch von 1831, und ein andermal: „Mittag Ottilie, allen Stadtklatsch durchgearbeitet, wobei denn gar hübsche novellenartige Verhältnisse zum Vorschein kamen.“
Ganz anders aber stellte er sich, wenn die Erzähler nicht so gutartig waren, wenn sie ihre Neigung zu Witz und Spott oder gar ihren Haß an den gemeinsamen Bekannten ausließen. Als der Kanzler ihm einmal einen bösen Witz Riemers erzählte, fuhr er auf: „Durch solche böswilligen und indiskreten Dichteleien macht man sich nur Feinde und verbittert Laune und Existenz sich selbst! Ich wollte mich doch lieber aufhängen, als[S. 116] ewig negieren, ewig in der Opposition sein, ewig schußfertig auf die Mängel und Gebrechen meiner Mitlebenden, Nächstlebenden lauern. Ihr seid noch gewaltig jung und leichtsinnig, wenn Ihr so etwas billigen könnt!“ Noch deutlicher wurde er einmal, als Jenny v. Pappenheim bei ihm zu Tische war und eine Klatscherei zum Vorschein kam. „Euren Schmutz kehrt bei Euch zusammen, aber bringt ihn nicht mir in’s Haus!“ rief er mit dröhnender Stimme. In größerer Gesellschaft sprach er lieber über Menschen früherer Jahrhunderte und ferner Länder als über die Nachbarn und Freunde.
Wir wissen schon, daß sich Goethe nicht ausforschen ließ. Der Alte hat mit Eckermann absichtlich Ausfrage-Gespräche geführt, aber da war er der Herr und Lenker, und der bescheidene Eckermann stellte nur willkommene Fragen. Kam aber Jemand, der ihn überlisten wollte, so fand er in Goethe seinen Meister. Heinrich Luden wollte, als der ‚Faust‘ erst halb fertig vorlag, über den Fortgang und die Grundgedanken des Werkes gern Offenbarungen haben; Goethe sprach auch recht lange und eingehend mit ihm; das Gespräch füllt vierunddreißig Druckseiten, aber wohl offenbart Luden darin Alles, was er über den ‚Faust‘ weiß und denkt, Goethe jedoch sagt so gut wie nichts. Jean Paul wollte einmal hören, was Goethe über ihn selber denke, wie hoch er seine humoristischen Werke bewerte. Er fragte nicht geradezu, sondern redete über seine Berufsverwandten Sterne, Hippel usw., in der Hoffnung, daß Goethe nun sagen sollte, er, Jean Paul, übertreffe sie doch alle. Aber das Gespräch ward ein Schachspiel, in dem Goethe[S. 117] immer Züge tat, die sein Gegner nicht erwartete, bis sich Jean Paul endlich schachmatt nach Hause begeben mußte. „Einen durchtriebeneren Schalk gibt es auf Erden nicht wie den Goethe“ schreibt Karoline Schlegel über dies Gespräch an Wilhelm Schlegel.
Für ungut aber nahm es Goethe, wenn ihn Jemand durch das Gespräch in eine gemütliche, offenherzige Stimmung bringen wollte, wie Mancher wohl fleißig Wein einschenkt, damit der Andere sein Herz offenbare. „Todfeindschaft kann daraus entstehen“ sagte Goethe einmal bei Tische, „wenn man es tut und sich gegen mich berühmt, daß man mich auf meine Schnurre gebracht habe, sobald ich mit Gutmütigkeit mich geäußert und gehen gelassen habe. Weil es eine falsche Superiorität des Andern und eine Gemütlosigkeit verrät!“
**
*
Auch insofern verkaufte sich Goethe nicht der Geselligkeit, als er sich seine Arbeitszeit nicht verkürzen ließ. Wohl wissen wir von vergnügten Abenden, die bis in die Nacht reichten; aber es sind für Goethes viele Lebenstage doch nur wenige. Die Regel: „früh zu Bett und früh heraus“ hat er nur selten durchbrochen. Die ihm zusagende Geselligkeit war: nach einem langen, arbeitsreichen Vormittage ein fröhliches Mittagessen mit Gästen, danach Plauderstunden mit Solchen, die sein geistiges Leben teilten oder bereicherten. Der jüngere Voß hat uns die lebendigsten Schilderungen aus jener Zeit um die Jahrhundertwende gegeben, wo die Schauspieler und Schauspielerinnen durch Christiane mehr in’s Haus kamen als früher und später.
[S. 118]
Es wurde bei Tisch gescherzt, gelacht, am Ende sogar die bunte Reihe hindurch geküßt, und Goethe war am lustigsten. Ich bat gegen das Ende der Mahlzeit den Hofmeister von Goethes August, mir einen Schlag zu geben mit den Worten: „Schick’s weiter!“ Ich gab ihn meiner Nachbarin Silie, und Diese ihrem Nachbar, und so ging’s weiter bis zur Maaß, die neben Goethe saß. Die Maaß stutzte ein wenig, doch entschloß sie sich endlich, Goethe einen tüchtigen Klaps zu geben. Goethe drehte sich zu ihr und küßte sie und darauf seine andere Nachbarin mit den Worten: „schick’s weiter!“ Die will durchaus nicht, wahrscheinlich, weil ihr der Nachbar nicht anstand. „Nun,“ sagte Goethe, „wenn’s nicht so herum will, muß es retour gehen“, läßt sich wieder küssen, küßt wieder die Maaß und so geht’s fort bis auf die kleine Silie, die mir den letzten Kuß gab. Nun denk Dir den armen Riemer, der neben mir saß und leer ausgehen mußte, weil bei mir die bunte Reihe aufhörte.
Auch Goethes Abende zeichnet uns Heinrich Voß:
Wenn es Sechs schlägt, so versammelt sich ein kleines Häufchen um ihn, außer mir noch Professor Meyer, Fernow und Riemer, und da bleiben wir dann bis Acht, Neun oder auch wohl bis Zehn ...
Weil er nie ernstlich des Abends arbeitet und seine Augen das Lesen bei Licht nicht vertragen, so hat er gerne Jemand bei sich, mit dem er sprechen kann. Nie ist der Mann liebenswürdiger als in solchen Abendstunden. Dann sitzt er im tiefsten Negligee, in einem wollenen Jäckchen, ohne Halstuch, mit bloßer Brust, die Strümpfe über die Hosen gezogen, auf seinem Sofa und unterhält sich oder läßt sich vorlesen. Und diese Bequemlichkeit, die Abendstille und die Ruhe nach schwerem Tagesgeschäft machen ihn so überaus heiter und gesprächig ... Wenn er dann recht lebendig ist, so kann er auf dem Sofa nicht aushalten; dann springt er auf und geht hastig im Zimmer auf und nieder, und jede Gestikulation, ihm selbst unbewußt, wird zur lebendigsten Sprache. Ja,[S. 119] dieser Mann spricht nicht bloß mit dem Organ der Zunge, sondern zugleich mit hundert andern, die bei gewöhnlichen Menschen stumm sind; und aus seinen Augen strahlt das seelenvollste Feuer. Dann hat sein manchmal furchterregender Blick auch alles Schreckhafte verloren. Besonders gern erzählt er dann von seinem Leben, nie aber etwas Anderes als heitere Dinge. So hat er, obgleich ich ihn mehrmals darauf lenkte, nie umständlich von seiner Krankheit vor drei Jahren gesprochen, und was er davon erzählte, waren auch nur die heitern Zeiten der Krankheit.
Ähnlich erzählt die Malerin Luise Seidler von 1810, wo Frau Christiane und ihre Gesellschafterin, Fräulein Ulrich, noch fröhlich das Leben genossen.
Beim Mittagsessen war Goethe mit Riemer, Meyer und anderen Gästen, deren Zahl jedoch niemals acht überstieg, sehr heiter. Man speiste in einem kleinen Zimmer, dessen Wände mit Handzeichnungen berühmter alter Meister geschmückt waren; das Mahl war stets von gediegener Einfachheit, das Getränk trefflicher Burgunder. Beim Dessert entfernten sich die Damen, „die lustigen Weiber von Weimar“, wie Goethe sie scherzend nannte, um spazieren zu fahren ... Die Herren – denn nur sehr selten wurden Damen zu Tisch geladen – blieben sitzen; auch ich hatte ein für allemal die Erlaubnis zum Dableiben. Sobald wir allein waren, nahm Goethe jederzeit irgend einen bestimmten Gegenstand, an welchen er seine scharfsinnigen Bemerkungen reihte, z. B. einen bronzenen Moses von Michel Angelo ... Unter diesen interessanten Gesprächen kam unmerklich der Abend herbei, der neue Genüsse brachte, da man gewöhnlich in das Theater fuhr. Der Dichter hatte damals eine geschlossene Parterreloge unterhalb der herrschaftlichen. In den Zwischenakten wurde kalte Küche präsentiert; auch der Burgunder fehlte nicht.
Alle Besucher, die an Goethes Mahlzeiten teilnehmen durften, rühmten noch lange über die guten[S. 120] Speisen die sehr angenehme Unterhaltung; sie empfanden es als ehrende Liebenswürdigkeit, wie Goethe auch um ihr geistiges Genießen bei der Tafel und nach der Tafel besorgt war. „Die Unterhaltung war eine allgemeine, lebendige und nie stockende, Goethe leitete sie meisterhaft“ ist das Zeugnis Zahns (1827), und Ernst Förster berichtet von 1825: „Es schien bei ihm Bedürfnis, dem Besuchenden entweder eine Freude zu machen, oder einen womöglich sichtbaren Stoff der Unterhaltung zu bieten“; in seinem Falle hatte Goethe eine Anzahl sehr kunstreicher Papier-Schattenbilder von der Hand der Adele Schopenhauer bereit gelegt und ging sie einzeln unter Beachtung jeder Kleinigkeit mit ihn durch.
Förster erwähnt auch eine anmutige Tafelsitte, die man an festlichen Tagen der Mitwirkung Eberweins verdankte:
Das Gespräch wurde auf eine überraschende Weise unterbrochen. An dem einen Ende der Tafel wurde es unruhig; man räusperte sich, gab ein leichtes Zeichen am Glas, und ein vierstimmiger Gesang wurde angestimmt. Es gehörte die schöne Sitte, das Mahl mit Gesängen zu würzen, zu Goethes besonderen Tafelfreuden bei festlichen Gelegenheiten, und so folgte auch heute nach jedem Gange ein Gesang ... Nach dem Dessert setzte sich Hummel an’s Instrument und gab dem kleinen Feste mit einer heitern und reichen Phantasie einen glänzenden Schluß.
[14] Basedow war ein Aufklärer, Hasenkamp ein Pietist.
[15] Fr. v. Müller in der Erfurter Gedächtnisrede 1832.
[S. 121]
Schon das Wohlgefallen an der äußeren Erscheinung eines neuen Bekannten, an seiner Stimme und Sprache, seinen Gebärden, Bewegungen und Sitten, erweckt in uns eine Zuneigung, die der Liebe zwischen Mann und Weib verwandt ist. Solche Anziehung übten auf den jüngeren Goethe z. B. Fritz Jacobi, Lavater und Herder aus, schöne Männer, die höchst liebenswürdig sein konnten. Und in älteren Jahren wirkte mancher Aristokrat ähnlich, mit dem ihn die Geselligkeit am weimarischen Hofe oder in böhmischen Bädern zusammenführte.
Häufiger vermitteln gleiche Beschäftigung, Neigung zu den gleichen Wissenschaften oder Künsten oder auch nur gleicher Zeitvertreib eine Befreundung; da Goethe nicht wenige Steckenpferde hatte, so gewann er gar viele Freunde und Halbfreunde dieser Art.
Ähnliche Gesinnung in den Hauptpunkten ist stets Voraussetzung eines engeren Verhältnisses, namentlich wenn man am selben Orte wohnt oder sonst häufig zusammenkommt. Ein solcher Hauptpunkt ist immer die Religion; seit Beginn der französischen Umwälzung wurde aber auch in Deutschland die politische Parteinahme eine Ursache vieler Vereinigungen und Trennungen. Goethe zog sich damals von den „Neufranken“ und für alle Zukunft von den Demokratisch-gesinnten[S. 122] zurück oder hielt sie sich doch so fern wie möglich, nicht etwa aus Rücksicht auf seine Stellung zum Hofe oder Staate, denn sein Landesfürst verlangte dergleichen Vorsicht keineswegs und übte sie selber nicht, sondern weil ihm selber die auf Umsturz und Massenherrschaft gerichteten Bestrebungen peinlich waren, so daß er nicht ohne Not daran erinnert werden mochte.
Leicht und gleichsam ohne Worte verstehen wir uns mit Denen, die ungefähr denselben Lebensweg wie wir gemacht und daher ähnliche Erfahrungen gesammelt haben. Also mit Landsleuten, Altersgenossen, Berufsgenossen, namentlich aber mit Schicksalsgenossen. Goethe war von seinem 26. Jahre an in den Kreisen, in denen er lebte, ein parvenu – er nannte sich selber so – und vielleicht finden wir deshalb auch unter seinen Bekannten und Freunden recht viele Emporkömmlinge. Freilich war ja auch bei ihnen das Aufsteigen ein Beweis ihrer Gaben und Kräfte. Schiller, der Kanzler v. Müller und der französische Diplomat v. Reinhardt waren, wie Goethe, auf Grund ihrer Tüchtigkeit und vornehmen Haltung in den Adelsstand erhoben worden; der ehemalige schwäbische Theologe Reinhardt ward später sogar Graf und Pair von Frankreich. Andere, die nicht ganz so hoch stiegen, hatten ihre Laufbahn auch noch tiefer begonnen. Oeser war der uneheliche Sohn eines Handschuhmachers in Preßburg. Jung-Stilling war Schneider gewesen, Moritz Hutmacherlehrling. Wilhelm Tischbein kam aus dem Hause eines hessischen Dorfdrechslers. Fernow nannte einen uckermärkischen Gutsknecht seinen Vater. Christoph Bode[S. 123] weidete als Sohn eines braunschweigischen Ziegelarbeiters das Vieh für die Bauern, bis er zu einem Stadtmusikus in die Lehre kam. Zelter mußte als Sohn eines Berliner Maurermeisters das väterliche Handwerk erlernen und ausüben. Und der Hausiererssohn Eckermann aus Winsen an der Luhe half wie andere ärmste Landjungen am Erwerb des Nötigsten mit: durch Schilfschneiden, Ährenlesen, Reisigsammeln und Hüten der Kühe für reichere Leute, denn seine Eltern besaßen nur eine Kuh. Diese Emporgestiegenen verrieten zuweilen ihre gröbere Erziehung; z. B. Zelter war „ein Kerl, der in die Stube spuckt“; Goethe sah darüber hinweg und freute sich der Kernhaftigkeit solcher selbstgemachten Männer. Er bewunderte ja auch Napoleon unter allen Herrschern am meisten und freute sich, daß gerade Dieser ihn bemerkte und ehrte, als die Kaiser und Könige „von Gottes Gnaden“ sein Dasein noch nicht beachtet hatten.
Die eigentliche Grundlage aller dauerhaften Freundschaft ist aber nicht das Gefallen, Anerkennen, Verstehen, sondern das gegenseitige Nützen und Unterstützen. Der Freund muß uns irgendwie ergänzen und daher uns durch seinen Anschluß bereichern; er muß für sein Geben aber auch von uns empfangen können; das Bündnis muß Beiden förderlich sein. Bei Goethes wichtigsten Freundschaften: mit Karl August, Knebel, Schiller, Zelter und Heinrich Meyer, erkennen wir diesen gegenseitigen Nutzen. Daraus folgt keineswegs, daß solche Bündnisse aus Eigennutz geschlossen wurden; die Liebe Goethes zu Karl August war zuerst eine[S. 124] Fürsorge des Älteren für den jüngeren Schutzbedürftigen; ebenso behielt Knebel durch seine seelischen Nöte Macht über den Dichter von ‚Werthers Leiden‘; ebenso Moritz in Rom und mancher Andere. Auch Schiller, Zelter, Heinrich Meyer bedurften seiner Hilfe, als er sie kennen lernte.
**
*
Es ist nicht leicht, Goethes große Liebe für einige dieser Männer zu verstehen;[16] am merkwürdigsten war jedoch sein Verhältnis mit Schiller, ganz abgesehen davon, daß man Nebenbuhler-Gefühle vermuten könnte zwischen zwei Dichtern, von denen bald der Eine, bald der Andere erfolgreicher erschien. Als Schiller nach Weimar kam, hielt sich Goethe noch in Italien auf, und als sich die beiden Männer endlich begegneten, war Goethe zu einem näheren Verhältnis, wie es Schiller wünschte, nicht bereit. Der Dichter des ‚Tasso‘ und der ‚Iphigenie‘ lebte innerlich zu weit entfernt von dem neuen Stürmer und Dränger, der mit den ‚Räubern‘, ‚Fiesco‘ und der ‚Millerin‘ das Publikum erregt hatte. Sechs Jahre wohnten sie nahe beieinander, hatten gemeinsame Freunde und blieben gegeneinander kalt und fremd. Es trennte sie Vieles: Denkart, Dichtart, Lebensweise. Jeder war für den Anderen ein wunderbares Phänomen, ja fast eine Naturwidrigkeit. „Ein solches Wesen sollten die[S. 125] Menschen um sich herum nicht aufkommen lassen“ schrieb Schiller sogar.
Allmählich näherten sie sich dann doch, zumeist durch eine Wandlung oder ein Fortschreiten Schillers. Im August 1794 bat der Jüngere den Älteren um Mitarbeit an einer neuen Zeitschrift und erwies in dem Briefe, wie gut er Goethes Wesen verstand. Dieser erwiderte herzlich vertrauend:
Zu meinem Geburtstag hätte mir kein angenehmer Geschenk werden können als Ihr Brief, in welchem Sie mit freundschaftlicher Hand die Summe meiner Existenz ziehen und mich durch Ihre Teilnahme zu einem emsigern und lebhaftern Gebrauch meiner Kräfte aufmuntern.
Und weiter:
Wie groß der Vorteil Ihrer Teilnehmung für mich sein wird, werden Sie bald selbst sehen, wenn Sie bei näherer Bekanntschaft eine Art Dunkelheit und Zaudern bei mir entdecken werden, über die ich nicht Herr werden kann, wenn ich mich ihrer gleich sehr deutlich bewußt bin.
Und gleichzeitig:
Reiner Genuß und wahrer Nutzen kann nur wechselseitig sein,
und
Alles, was an mir ist, werde ich mit Freuden mitteilen.
Dieser Freundschaftsbund, dem Beide, und mit ihnen ihr Volk, Großes verdanken, wurde also wie eine Verstandesehe geschlossen; mit gutem Grunde sprach Goethe später von dem „großen Kunststück“, „bei völlig auseinanderstrebenden Richtungen“ mit Schiller „eine gemeinsame Bildung fortzusetzen.“
[S. 126]
Bei so geringer natürlicher Anziehung können nur zwei sehr kluge Menschen Freundschaft miteinander halten; aber das Verhältnis zwischen Schiller und Goethe wurde mit jedem Jahre herzlicher und brüderlicher: weil gegenseitige Hilfe und Treue auch Liebe erweckt, bewähren sich doch die Verstandesehen nicht schlechter als die Liebesheiraten! Der Gedankenaustausch, die gegenseitige Prüfung und Steigerung durch Briefe und Gespräche über die nächsten Arbeiten, die gemeinschaftliche Einwirkung auf das Publikum durch Zeitschriften, die gemeinschaftliche Verbesserung des weimarischen Theaters, die Abwehr der Gegner: Das blieb die Hauptsache. Aber dabei wurde Schiller in Goethes und Goethe in Schillers Hause heimisch, und die Freunde erlebten alle menschlichen und häuslichen Freuden und Sorgen miteinander. Wie lieb Goethe den spätgefundenen Freund schließlich hatte, lesen wir am schönsten aus den Berichten des jungen Voß vom Mai 1805.
In der letzten Krankheit Schillers war Goethe ungemein niedergeschlagen. Ich habe ihn einmal in seinem Garten weinend gefunden; aber es waren nur einzelne Tränen, die ihm in den Augen blinkten: sein Geist weinte, nicht seine Augen, und in seinen Blicken las ich, daß er etwas Großes, Überirdisches, Unendliches fühlte. Ich erzählte ihm Vieles von Schiller, das er mit unnennbarer Fassung anhörte. „Das Schicksal ist unerbittlich, und der Mensch wenig!“ Das war Alles, was er sagte, und wenige Augenblicke nachher sprach er von heiteren Dingen.
Aber als Schiller gestorben war, war eine große Besorgnis, wie man es Goethen beibringen wollte. Niemand hatte den Mut, es ihm zu melden. Meyer war bei Goethen,[S. 127] als draußen die Nachricht eintraf, Schiller sei tot. Meyer wurde hinausgerufen, hatte nicht den Mut, zu Goethen zurückzukehren, sondern ging weg, ohne Abschied zu nehmen. Die Einsamkeit, in der sich Goethe befindet, die Verwirrung, die er überall wahrnimmt, das Bestreben, ihm auszuweichen, das ihm nicht entgehen kann – alles Dieses läßt ihn wenig Tröstliches erwarten. Ich merke es, sagte er endlich, Schiller muß sehr krank sein, und ist die übrige Zeit des Abends in sich gekehrt. Er ahnte, was geschehen war; man hörte ihn in der Nacht weinen. Am Morgen sagte er zu einer Freundin: „Nicht wahr, Schiller war gestern sehr krank?“ Der Nachdruck, den er auf das sehr legt, wirkt so heftig auf Jene, daß sie sich nicht länger halten kann. Statt ihm zu antworten, fängt sie laut an zu schluchzen.
„Er ist tot?“ fragt Goethe mit Festigkeit. – „Sie haben es selbst ausgesprochen,“ antwortete sie. „Er ist tot!“ wiederholte Goethe noch einmal und bedeckte sich die Augen mit den Händen. –
Um 10 Uhr sehe ich Goethe im Park gehen; ich hatte aber nicht den Mut, ihm zu begegnen. Drei Tage lang bin ich ihm ausgewichen. – – –
Jetzt spricht Goethe sehr selten von Schiller, und wenn er es tut, so sucht er die heiteren Seiten ihres schönen Zusammenlebens auf.
**
*
Goethe war sich bewußt, daß lang andauernde Freundschaften zeitweilig ruhen müssen. Wir dürfen es nicht verübeln, sondern müssen geradezu erwarten, daß der Andre sich zeitweilig von uns entfernt und neue Menschen genießt. Wer eine beständig gleichmäßige Freundschaft fordert, zerstört eben dadurch die Fortdauer des guten Verhältnisses. Wieland und Goethe standen miteinander zeitlebens gut, seitdem sie sich von Angesicht kannten, d. h. von 1775 bis 1813, aber der[S. 128] anfängliche tägliche und brüderliche Verkehr ward bald viel seltener; Goethe mußte sich gefallen lassen, daß sich Wieland mehr an Herder anschloß, und ebenso Wieland, daß sich Goethe und Schiller beinahe gegen alle Welt verbündeten. Dies Abnehmen und Zunehmen der Freundschaft soll man erwarten. „Wer sich nähert, Den stoßt nicht zurück“ riet Goethe seiner Frau und seinem Sohne, „und wer sich entfernt, Den haltet nicht auf, und wer wiederkommt, Den nehmt auf, als wenn er nicht weg gewesen wäre.“
Auch als Goethe und Schiller Freunde waren, gab es Wochen, wo sie einander mieden, weil sie sich nicht einig fühlten. Und ebenso gab es Zeiten, wo Goethe und Karl August miteinander diplomatisch „wie zwei Großmächte“ verkehrten. Sein gutes Verhältnis mit Fritz Jacobi, der in der Weltanschauung zu ganz andern Sätzen kam, konnte Goethe bis zu Jacobis Tode nur dadurch erhalten, daß sie jahrelang die Aussprache unterließen und geduldig die Gelegenheiten abwarteten, wo sie einander wieder Liebes erweisen konnten. Aus solchen Erfahrungen schrieb Goethe 1827 nach einer Meinungsverschiedenheit an seinen Verleger Cotta:
Ich habe, wenn zwischen Freunden, notwendig Verwandten und Verbundenen sich einige Differenz hervortat, immer lieber geschwiegen als erwidert; denn in solchen Fällen bleibt ein Jeder doch einigermaßen auf seinem Sinn, und so entstehen aus gewechselten Äußerungen neue Differenzen, und die Mißverständnisse verwickeln sich, anstatt sich aufzuklären. Dagegen habe ich gefunden: die Zeit sei die eigentlichste Vermittlerin; in derselben entwickeln sich Handlungen, die einzige Sprache, die zwischen Freunden giltig ist, um das wahre Verhältnis auszudrücken.
[S. 129]
Die frühen Jugendfreundschaften kann man wie eine erste Liebe in ihrer Schönheit nur erhalten, wenn man sie gänzlich im Erinnerungsleben beläßt. 1824 war von Goethes Landsmann Klinger die Rede, der in Rußland zu hohem Ansehen gestiegen war; er hatte sich kürzlich als ein guter Freund Goethes bewiesen; trotzdem sagte Dieser:
Alte Freunde muß man nicht wiedersehen. Man versteht sich nicht mehr mit ihnen; Jeder hat eine andere Sprache bekommen. Wem es ernst um seine innere Kultur ist, hüte sich davor! Denn der alsdann hervortretende Mißklang kann nur störend auf uns einwirken, und man trübt sich das reine Bild des früheren Verhältnisses.
Von drei Jugendfreunden, die er sehr geliebt hatte, wandte sich Goethe mit stillem Kummer und Zorn allmählich ab: von Merck, Lavater und Herder. Mit Lavater hatte er sich verbrüdert, als er selber zum Pietismus neigte; was bei Goethe nur ein anfänglicher Entwicklungszustand war, blieb Lavaters Natur bis ans Ende. Deswegen hätten sie nun wohl Freunde bleiben können, zumal bei der großen Entfernung zwischen Zürich und Weimar, vertrug und verstand sich doch Goethe auch mit manchem gläubigen Katholiken! Aber Lavater, der sonst von Herzen Gütige, verkündigte seinen Glauben mit solcher Inbrunst, daß er gegen Andersdenkende ungerecht und beleidigend wurde; Goethe warnte ihn schon 1779, als man eine Zusammenkunft plante, in seiner feinen Weise vor dieser Untugend, indem er bat, „daß wir einander unsere Partikular-Religionen ungehudelt lassen; Du bist gut darinne, aber[S. 130] ich bin manchmal hart und unhold.“ Lavater hielt jedoch nicht Ruhe und wurde überlästig wie jeder Freund, der einen allein-seligmachenden Glauben zu haben meint und uns nun mit Gewalt in seinen Himmel führen möchte. Schlimm war auch, daß Lavaters Glaubenslust an den Mysterien des Neuen Testaments noch nicht satt wurde, sondern auch alle Wundertaten Gaßners, Kaufmanns, Cagliostros und anderer Schwindler oder Halbschwindler gläubig aufnahm und weiter verkündete. Dadurch kam er schließlich in Verdacht, es selber mit der Wahrheit nicht genau zu nehmen. Jedenfalls mochte Goethe, dem die Wahrhaftigkeit das erste und vornehmste Gebot war, nicht mit Phantasten und Betrügern freundschaftlich verbunden sein.
Merck war ein ganz anderer Geist; ihn betrog Niemand; er sah und sagte die verdrießlichen Wahrheiten und öffnete seinem jungen Freunde Goethe mehr als einmal die Augen. Da es ihm selber nicht gut ging, tröstete und erfreute er sich an der Beobachtung der Schwächen seiner Mitmenschen, am Aufdecken ihrer Blößen. Er ward mit der Zeit ein halber Mephistopheles: Gemüt und Gewissen schrumpften ein, weil Verstand, Witz, scharfer Blick, kluge Kenntnis der Welt die Übermacht gewannen. So schrieb er nach Weimar an den Herzog und seine Mutter sehr unterhaltende Briefe, in denen er über alles Närrische, Kranke, Schlimme im Darmstädtischen und in der Nachbarschaft am Rhein und Main berichtete und spottete; die Empfänger lasen Dergleichen mit Vergnügen und sogar mit Belehrung, aber Goethe erinnerte sich, daß der Briefschreiber[S. 131] im Dienst des Landgrafen von Darmstadt stand, daß er also treulos und verräterisch gegen seine Ernährer und Ortsfreunde handelte. Und Goethe war sich bewußt, daß alle menschliche Gesellschaft und Behaglichkeit auf gegenseitiges Wohlwollen, Dulden und Tragen angewiesen ist; der rücksichtslose Fehlerfinder ist ein Feind der Gesellschaft: wer mag ihm nahe bleiben?
Seltsamer Weise trug auch der erste christliche Geistliche in Weimar, Herder, neben dem faustischen einen Mephistopheles-Geist in sich. Er war ein Unzufriedener wie Merck und ergrimmte oft über Diejenigen, die ihm oder seinem Amte nicht so viel Gehör, Macht und Einfluß gewährten, wie er fordern zu dürfen glaubte. Goethe war viele Jahre sein Freund und Bewunderer, wie denn Herder immer Männer und Frauen um sich hatte, die ihn verehrten; Goethe ertrug viele Jahre Herders Fehler und hätte gern die alte Freundschaft dadurch aufrecht erhalten, daß er den Verkehr und die Berührungspunkte verminderte. In diesem Sinne schrieb er einmal an Herders ältesten Sohn, damit es die Eltern bedächten:
Wenn wir immer vorsichtig genug wären und uns mit Freunden nur von einer Seite verbänden, von der sie wirklich mit uns harmonieren, und ihr übriges Wesen weiter nicht in Anspruch nähmen, so würden die Freundschaften weit dauerhafter und ununterbrochener sein. Gewöhnlich aber ist es ein Jugendfehler, den wir selbst im Alter nicht ablegen, daß wir verlangen, der Freund solle gleichsam ein anderes Ich sein, solle mit uns nur ein Ganzes ausmachen, worüber wir uns dann eine Zeitlang täuschen, das aber nicht lange dauern kann.
[S. 132]
Leider wurde oder blieb der „Töpferberg“, wo Herder hinter der Stadtkirche seine Amtswohnung hatte, eine Stätte des Grolls, von wo bald gegen Goethe und Schiller, bald gegen den Herzog und seine Minister, bald gegen den ehemaligen Lehrer Immanuel Kant Blitze geschleudert wurden, die nicht töteten, nicht lähmten, aber doch ärgerten. Goethe und Herder begegneten sich selten; wenn es geschah, fühlten sie sich zuweilen einig wie sonst, bis irgend eine Bemerkung offenbarte, wie fern und feindlich sie jetzt standen. In seinen ‚Annalen‘ von 1803 zeigt Goethe das Gift, das diese Freundschaft mit Herder zerstörte:
Schon drei Jahre vor seinem Tode hatte ich mich von ihm zurückgezogen, denn mit seiner Krankheit vermehrte sich sein mißwollender Widerspruchsgeist und überdüsterte seine unschätzbare einzige Liebensfähigkeit und Liebenswürdigkeit. Man kam nicht zu ihm, ohne sich seiner Milde zu erfreuen; man ging nicht von ihm, ohne verletzt zu sein. Wie leicht ist es, Irgendjemand zu kränken oder zu betrüben, wenn man ihn in heitern, offenen Augenblicken an eigne Mängel, an die Mängel seiner Gattin, seiner Kinder, seiner Zustände, seiner Wohnung mit einem scharfen, treffenden, geistreichen Wort erinnert!
**
*
Goethe war zart und behutsam gegen seine Freunde, schonte ihre empfindlichen Stellen, wie er die seinen geschützt zu sehen wünschte, behinderte ihre Freiheit nicht, weil er selber frei sein wollte. Und er erwartete nicht zu viel von der Freundschaft: sie ist ein köstliches Glas, das uns erhalten bleibt, wenn wir es schonen und behüten. Goethes vorsichtiges Schonen der Freundschaft[S. 133] zeigt uns Riemers Mitteilung, daß Goethe über die Personen, die er liebte, nicht urteilen wollte. „Ich denke nicht über sie“ sagte er, wenn man ihm von ihren Eigenheiten und Fehlern etwas vorreden wollte.
Namentlich aber wußte er, daß wir die Freundschaften erhalten können, wenn wir, statt auf Gleichheit der Meinungen zu drängen, uns gegenseitig in der Arbeit und in der Ausbildung unseres Wesens nützen.
Das sicherste Mittel, ein freundliches Verhältnis zu hegen und zu pflegen, finde ich darin, daß man sich wechselweise mitteile, was man tut; denn die Menschen treffen viel mehr zusammen in Dem, was sie tun, als in Dem, was sie denken.[17]
Daß sich Freunde zu ein und derselben Arbeit vereinigen können, ist selten; wohl aber können sie einander bei ihren besonderen Arbeiten anregen, anfeuern, belehren, aufklären, aushelfen. Goethe, der über sein Genie wenig Herr war und die Poesie keineswegs „kommandieren“ konnte, bedurfte solcher Freundesdienste in hohem Maße und schätzte sie darum auf das dankbarste. Erst die Freunde klärten ihn über sich selber auf; er bekannte gern, daß er von Personen, denen es gefiel, freundlich über ihn zu reflektieren, Manches gelernt und sie deshalb verehrt habe.[18]
Widersacher kommen nicht in Betracht, denn mein Dasein ist ihnen verhaßt; sie verwerfen die Zwecke, nach[S. 134] welchen mein Tun gerichtet ist, und die Mittel dazu achten sie für ebenso vieles falsches Bestreben. Ich weise sie daher ab und ignoriere sie, denn sie können mich nicht fördern, und Das ist’s, worauf im Leben Alles ankommt! Von Freunden aber laß’ ich mich ebenso gern bedingen als in’s Unendliche hinweisen; stets merke ich auf sie mit reinem Zutrauen zu wahrhaftiger Erbauung.
Goethe erwiderte seinen Freunden und Denen, die es gern sein wollten, oft nicht nach Wunsch; sie bedachten nicht, wie viele Menschen Großes und Kleines von ihm begehrten und daß er doch auch für sich selbst, seine Ämter, seine Studien, seine Dichterarbeit leben wollte. Er vermied die Gefühlsergüsse und versäumte die herkömmlichen Freundschaftshandlungen fast regelmäßig, also namentlich die schriftlichen oder mündlichen Teilnahme-Versicherungen bei Familien-Ereignissen. Dagegen verstand er sich auf große und kleine Liebesdienste außer der Regel. So ärgerte sich die alte Frau v. Stein, daß der ehemalige Pflegevater sich zu den Schicksalen ihres Lieblingssohnes Fritz kaum äußerte; aber wenn sie den Schmerz hatte, daß ihr sehr geliebter Kanarienvogel umkam, so erwachte sie am andern Morgen an dem Gesang eines neuen Hänschens, den ihr Goethe heimlich hatte in das Bauer setzen lassen.
Solche kleinen, aber wirklich ihren Namen verdienenden Aufmerksamkeiten nahm er, wenn sie ihm erwiesen wurden, recht dankbar auf. Eine Frau v. Eybenberg, mit der er von den böhmischen Bädern her befreundet war, rühmte er deswegen:
[S. 135]
Sie haben unter so vielen liebenswürdigen Eigenschaften die besondere, daß Sie die kleinen grillenhaften Wünsche Ihrer Freunde für Etwas halten und, um sie zu befriedigen, sich eine gefällige Mühe geben mögen. Sie wissen vielleicht selbst nicht, daß diese Eigenschaft so selten ist. Man liebt seine Freunde, man schätzt sie, man mag ihnen gern einmal einen derben Dienst, auch mit einiger Aufopferung, erzeigen; aber einem flüchtigen Geschmacke, einem launigen Einfalle, irgend einer Grille genugzutun, sind wir, ich weiß nicht: zu bequem, zu nachlässig, zu trocken, zu falsch-vornehm, und bedenken nicht, daß eben diese wunderlich scheinenden Gelüste, befriedigt, den angenehmsten Genuß geben.
[16] Diejenige mit Zelter glaube ich in meinem Werke ‚Die Tonkunst in Goethes Leben‘ hinreichend begründet zu haben.
[17] 1798 an August Herder.
[18] An Schubarth, 2. April 1818.
[S. 136]
Einst trug der dänische und deutsche Dichter Öhlenschläger ein paar scharfe Spottgedichte vor, die gegen bekannte Schriftsteller gerichtet waren. „So etwas sollt Ihr nicht machen!“ rief ihm Goethe zu; „wer Wein machen kann, soll keinen Essig machen!“ – „Haben Sie denn keinen Essig gemacht?“ fragte der kluge Däne, aber „Teufel noch einmal!“ erwiderte Goethe: „Weil ich es gemacht habe, ist es darum recht?“
Als Goethe in die deutsche Schriftstellerwelt eintrat, mit 22 bis 25 Jahren, zog er sich aus Mutwillen nicht wenige Feinde und Tadler zu. Trotz aller angeborenen Ernsthaftigkeit und Gutmütigkeit liebte er das Raufen: den kecken Angriff, das Necken und Daraufhauen, wohlverstanden: nur mit der Feder, also das Pasquilieren, wie man damals sagte. Er und seine Freunde hänselten sich gegenseitig; Das war nicht nur eine lustige Unterhaltung, sondern es übte auch die Selbstbeherrschung und Geistesgegenwart; man konnte es mit dem Degenfechten vergleichen oder gar an jene Flibustier erinnern, „welche sich in jedem Augenblicke der Ruhe zu verweichlichen fürchteten, weshalb der Anführer, wenn es keine Feinde und nichts zu rauben gab, unter dem Gelagtisch eine Pistole losschoß, damit es auch im Frieden nicht an Wunden und Schmerzen fehlen möge.“ Aber Goethe richtete seine Waffen auch gegen Schriftsteller,[S. 137] nach deren Bereitwilligkeit zu solchem Spiel er nicht vorher fragte.
Unangenehme Gegenwirkungen konnten nicht ausbleiben. Namentlich aber erfuhr Goethe, daß einige der Verletzten recht vortreffliche Menschen waren, die er achten und lieben mußte, sobald er sie in der Nähe sah. Besonders beschämte ihn auch die vornehme und sehr kluge Art, mit der Wieland seine Pfeile abschüttelte. „Ich bin eben prostituiert!“ rief er aus, als er sah, daß Wieland keineswegs auf Rache sann, sondern des jungen Angreifers Talent lobte und seine Fehler als Eigenschaften brausender Jugend rechtfertigte. Bald danach lernte er weimarische Freunde Wielands kennen, und namentlich mit Knebel sprach er sich über seine Streitschriften aus. „Es ist ein Bedürfnis seines Geistes, sich Feinde zu machen“ schrieb damals Knebel heim; „der Bube ist kampflustig, er hat den Geist eines Athleten.“ Und weiter: „Wie er der allereigenste Mensch ist, der vielleicht nur gewesen sein mag, so fing er mir einmal abends in Mainz ganz traurig an: „Nun bin ich mit all den Leuten wieder gut Freund, den Jacobis, Wieland ... Das ist mir gar nicht recht! Es ist der Zustand meiner Seele, daß, sowie ich Etwas haben muß, auf das ich eine Zeitlang das Ideal des Vortrefflichen lege, so auch wieder Etwas für das Ideal meines Zorns. Ich weiß, Das sind lauter vortreffliche Leute, aber just deshalb: was kann ich ihnen schaden? Was nicht Stroh ist, bleibt doch!““
Auch in der ersten weimarischen Zeit juckte das unruhige Blut noch in ihm, und der neue Freundeskreis[S. 138] betrieb das Pasquilieren so gern wie die früheren „oberrheinischen Gesellen.“ Doch war Goethe jetzt schon vorsichtiger, und als er dann in den Staatsdienst trat und die Arbeit für das Gemeinwohl als Pflicht ergriff, da blieb in seiner Seele nur wenig Raum für Negation und Opposition. Nur einmal noch fiel er in den Jugendfehler zurück; 1796, als Schiller und er vom Gefühl ihrer Doppelkraft berauscht waren, ließen sie sich hinreißen, gegen die Zeitgenossen, die ihnen nicht anstanden, „Xenien“ zu schmieden und sie im Druck auszusenden. Freude konnte Goethe an diesen Erzeugnissen übermütiger Laune nicht erleben; Nutzen konnten sie nicht stiften. Andere hatten Ärger und Kummer davon; er selber erfuhr nicht selten Beschämung und Verlegenheiten daraus. Er mußte wohl erkennen, daß er vielen ehrenwerten Menschen wehgetan hatte und daß er ihre Fehler durch seine Spötterei nicht beseitigte: kein Herkules kann den Parnaß von den Schwächlingen rein kehren, die immer wieder bergauf zu krabbeln suchen.
Gern ergriff darum Goethe die Gelegenheit, wenn er mit einem literarischen Gegner sich wieder versöhnen konnte. So war er mit dem Kapellmeister Reichardt befreundet gewesen, der manches seiner Lieder in Musik gesetzt hatte; später hatte Reichardt, besonders auch als Politiker, Goethes Zorn erregt, und da auch Schiller ihm nicht gewogen war, wurde er in den ‚Xenien‘ hart mitgenommen. Reichardt blieb die Antwort nicht schuldig. War er ein böses Insekt gescholten, so nannte Reichardt Goethes und Schillers Stachelverse einen „Pasquillanten-Unfug aus empörter Eitelkeit“, drückte[S. 139] seine „herzliche Verachtung“ aus gegen Schillers „nichtswürdiges und niedriges Betragen“ und sprach davon, daß Goethe sich durch Unsittlichkeit beflecke. Kurz: hier hatte Goethe sich einen begabten Freund zum Feinde gemacht. Als aber Goethe zu Beginn des Jahres 1801 so schwer erkrankte, daß allgemein sein Ableben erwartet wurde, gedachte Reichardt der früheren Freundschaft mehr als des späteren Zwistes und schrieb ihm freundlich, und der Dichter antwortete nach der Genesung mit einem Gedanken, der echt goethisch war:
Freunde und Bekannte nicht allein, sondern auch Fremde und Entfremdete bezeigten mir ihr Wohlwollen, und, wie Kinder ohne Haß geboren werden, wie das Glück der ersten Jahre darin besteht, daß in ihnen mehr die Neigung als die Abneigung herrscht, so sollte ich auch bei meinem Wiedereintritt in’s Leben dieses Glücks teilhaft werden, mit aufgehobenem Widerwillen eine neue Bahn anzutreten ... Ein altes, gegründetes Verhältnis wie das unsrige konnte nur, wie Blutsfreundschaft, durch unnatürliche Ereignisse gestört werden. Um so erfreulicher ist es, wenn Natur und Überzeugung es wieder herstellt ... Senden Sie mir doch ja Ihre neuesten Kompositionen! Ich will mir und einigen Freunden damit einen Festabend machen ... Nehmen Sie wiederholten Dank für Ihre Annäherung in diesem Zeitpunkt!
Nach dem Xenien-Abenteuer hat Goethe niemals wieder die Verse veröffentlicht, zu denen ihn seine Widersacher reizten. Wenn er sie später benutzte, so löste er sie vom einzelnen Falle so sehr ab, „daß es zwar dem Leser nicht an Beziehungen fehlen, aber Niemand wissen wird, worauf es eigentlich gemeint ist.“[19][S. 140] Soret fragte ihn einst, warum er gewisse Epigramme gegen Kotzebue nicht drucken ließe – Kotzebue war damals schon längst tot – und Goethe antwortete, er wolle das Publikum mit seinen Privatstreitigkeiten nicht belästigen oder gar Lebende damit quälen.
Zu gelegener Zeit kann man, ohne unziemlich zu werden, von Dem, was in der Richtung gut ist, Gebrauch machen. Meinerseits habe ich darin immer nur ein Mittel gesehen, meinen Unmut an den Tag zu bringen, ohne andere Personen in’s Vertrauen zu ziehen, höchstens einmal eine mir ganz nahestehende.
Ebenso zeigte er ein Gedicht ‚Das Gastmahl der Weisen‘ von 1815 nur wenigen Freunden: „Wenn es bekannt würde, so müßte es gewisse Individuen sehr tief verletzen, und die Welt ist denn doch nicht wert, daß man sich, um ihr Spaß zu machen, mit der Welt überwerfe.“ Das Gedicht ist denn auch nur nach Wegnahme der Stacheln im Druck erschienen; ‚Die Weisen und die Leute‘ heißt es in seiner neuen Gestalt.
Zeitlebens behielt er das Bedürfnis, auch auf seine Gegner und alles ihm Verdrießliche Verse zu machen; er erwiderte jeden starken Eindruck durch einen poetischen Ausdruck. Aber die Erfüllung dieses Bedürfnisses war, wenn es sich um einen Feind handelte, weniger ein Akt der Feindseligkeit als ein Friedensschluß, denn dadurch wurde der Dichter die unfreundliche Stimmung vom Herzen los. Erst das Veröffentlichen solcher Zornesergüsse oder witziger Angriffe kann Feindschaft erregen oder verschlimmern.
**
*
[S. 141]
Der gereifte Goethe hütete sich, Feindschaft zu erregen oder die vorhandene zu vergrößern, oder gar in der eigenen Brust der Feindschaft Raum zu geben. Dem Gehaßten schadet die Feindschaft zuweilen, dem Hassenden immer.
Als Heinrich Voß mit einem andern jungen Gelehrten einen Streit bekam, der sich an die Dramen von Sophokles anknüpfte, hinderte Goethe das Anwachsen dieses Streites schon deshalb, weil seinem jungen Freunde dadurch schließlich sogar der Sophokles verleidet werden könnte. Erst recht war Goethe unglücklich, als er bemerkte, daß ein so hoch begabter Dichter wie Graf Platen in der herrlichen Umgebung von Rom und Neapel an seine deutschen literarischen Gegner dachte und seine Zeit und Kraft der Polemik mit ihnen gönnte. „Solche Händel okkupieren das Gemüt!“ rief Goethe aus,
Die Bilder unserer Feinde werden zu Gespenstern, die zwischen aller freien Produktion ihren Spuk treiben und in einer ohnehin zarten Natur große Unordnung anrichten! Lord Byron ist an seiner polemischen Richtung zugrunde gegangen, und Platen hat Ursache, zur Ehre der deutschen Literatur von einer so unerfreulichen Bahn für immer abzulenken!
In Jena lehrte seit 1810 ein Philosoph Bachmann, der sich besonders mit den Ergebnissen der Naturwissenschaften beschäftigte; einst schickte er an Goethe[S. 142] eine Abhandlung, in der ein Stück, ein Loblied nämlich auf Newton und die Mathematiker, dem Verfasser der gegen Newton ankämpfenden ‚Farbenlehre‘ peinlich sein mußte. Goethe las die Schrift nur bis zu diesem Teil:
Hier mach’ ich Halt nach längst geprüfter Lebensregel: was mit mir übereinstimmt, bringt eine heitere Stunde; Dem aber ein Ohr zu leihen, was mir widerstrebt, warte ich auf einen Augenblick, wo ich mir selbst gewissermaßen gleichgültig bin und auch wohl das Gegenteil meiner Überzeugungen geschichtlich anhören mag. Der Menschenkenner sollte sich überzeugen, daß Niemand durch seines Gegners Gründe überzeugt wird. Alle Argumente sind nur Variationen eines ersten festgefaßten Meinungs-Thema, deswegen unsere Vorfahren so weislich gesagt haben: mit Einem, der deine Prinzipien leugnet, streite nicht!
So hütete er sich vor allem literarischen Streit. Als Wolfgang Menzel an ihm zum Helden zu werden begehrte, las Goethe seine Angriffe gar nicht, sondern meinte: „Ich habe Breite genug, mich in der Welt zu bewegen, und es darf mich nicht kümmern, ob sich Irgendeiner da oder dort in den Weg stellt, den ich einmal gegangen bin.“ Er gestand den Andersgesinnten gern das Recht zu, sich ihren Widerspruch oder ihren Ärger von der Brust wegzureden. „In der großen deutschen Nationalversammlung tut man wohl, wenn man seine Meinung gesagt hat, Andern auch den Ausdruck der ihrigen zu gönnen.“ So an Kosegarten 1822, und an Eichstädt, den ihm unterstellten Redakteur der Jenaischen Literaturzeitung 1804: „Adelungen würde meo voto nicht geantwortet. Wenn man Jemand so tüchtig durchdrischt, so ist es billig, daß man ihn Gesichter[S. 143] schneiden lasse, soviel er will. Durch Dupliken wird nichts ausgerichtet vor dem Publikum; es ist schon eine Art defensiver Stellung, die niemals vorteilhaft ist.“
Man hat die Polemik zwischen Gelehrten, Schriftstellern und Rednern wohl öfters mit den Turnieren des Mittelalters verglichen; Goethe aber betonte, daß es diesen geistigen Kämpfen an ritterlichem Schrankenraum, an Kreiswärteln und Kampfrichtern fehle, „und in jedem Schaukreise wirft sich, wie vor alters im Zirkus, die ungestüme Menge parteiisch auf die Seite der Grünen oder Blauen; die größte Masse beherrscht den Augenblick.“
Ist es schon töricht, das Publikum in einem wissenschaftlichen Streite zum Richter zu machen, so ist jeder öffentliche Hader in politischen Dingen noch viel bedenklicher. Diejenigen, die zu gemeinsamer Arbeit für das Wohl der Stadt oder des Landes berufen sind, können freilich nicht immer einig bleiben, und zwischen heftigen Naturen wird heftiger Streit entstehen. Aber kluge Freunde werden dann sorgen, daß dies Feuer auf seinen Herd beschränkt werde, daß nicht die Funken und brennenden Scheite nach allen Seiten fliegen. Ein junger Anverwandter Goethes, J. F. H. Schlosser in Frankfurt, hatte 1816 einen Amtsgenossen öffentlich angegriffen; Goethe schrieb ihm, er würde in solcher Lage verzweifeln.
Beurteilen kann ich nicht, ob es unvermeidliche Notwendigkeit war, Herrn v. Guaita auf eine unwiderrufliche Weise anzugreifen. In ähnlichen Verhältnissen habe ich mich auch gewehrt, aber innerhalb der Verhältnisse selbst, und[S. 144] es wäre mir unmöglich gewesen, das Publikum, das nie rechten kann noch wird, dergestalt als Instanz zu ehren ... Wenn ich mir denke, daß Sie mit diesem angesehenen, bedeutenden Manne zeitlebens in einer Stadt wohnen, öfters in einem Kollegium, vielleicht gar als Ratsherr in einer Reihe mit ihm sitzen sollen, nachdem Sie ihm seine Herkunft vorgeworfen, seine Tüchtigkeit zu einem Geschäfte, zu dem er sich erboten, öffentlich bezweifelt und nicht allein ihn, sondern auch seine Freunde, Verwandte, Verbündete sich zu Todfeinden gemacht haben, ohne vielleicht von dem gleichgültigen und schwankenden Publikum gebilligt zu werden, so stelle ich mir Ihre und Ihres würdigen Bruders Lage so schrecklich vor, daß ich mich darüber kaum beruhigen kann.
In solcher Gesinnung kam Goethe auch zu der weiteren Meinung, daß man über Ortsgenossen sich überhaupt nie öffentlich äußern solle.
Über den Ort, wo man gewöhnlich sich aufhält, wird Niemand wagen, etwas zu schreiben, es müßte denn von bloßer Aufzählung der vorhandenen Gegenstände die Rede sein. Ebenso geht es mit Allem, was uns noch einigermaßen nah ist. Man fühlt erst, daß es eine Impietät wäre, wenn man auch sein gerechtestes, mäßigstes Urteil über die Dinge öffentlich aussprechen wollte.
Es dachten freilich auch damals (1799) schon Viele anders! Die Zeitungen fingen an, auch örtliche Nachrichten zu bringen und die persönlichen Angelegenheiten zu berühren; nach der Schlacht bei Jena erzählten sie z. B. auch, daß Goethe seine Haushälterin geheiratet habe und wie es bei der Plünderung dem Romanfabrikanten Vulpius und seiner Gattin gegangen sei. Aber solche schamlose Neuigkeitskrämerei, solches öffentliche Zeigen von Abneigung und Haß empfand Goethe[S. 145] fast ebenso schmerzlich wie die Gewalttaten der Franzosen. Denn dies war eine Herabwürdigung, die von innen kam!
**
*
Manche Feindschaft entsteht aus einer plumpen Auffassung der Wahrhaftigkeit. Alle menschliche Gesellschaft ist aber auf Höflichkeit, Gefälligkeit und Duldung angewiesen; wer dazwischen fährt und Anderen „seine Meinung“ oder „die Wahrheit“ sagen will, stiftet Ärger und Haß. Eines Abends 1819 erzählten bei Goethe die jungen Gräfinnen Egloffstein von dem damaligen Posthalter zu Langensalza, der wegen seiner lächerlichen Eitelkeit weithin bekannt war, und die Damen gestanden, daß sie dem Manne noch gröblich geschmeichelt hätten, wobei sie ihm sehr wohl getan und sich heimlich vergnügt hätten. Goethe erfreute sich an dem Berichte und meinte: darin, im Eingehen auf die Schwäche eines Andern, bestehe die eigentliche Lebensklugheit und er rate Jedermann ein solches Benehmen an.
Auf Juliens Frage, warum man nur gegen Karikaturen sich diese augenblickliche Verleugnung seiner Ansichten gestatte, erwiderte er mit sichtbarer Freude über die Bemerkung, daß diese Gattung von Menschen, indem sie aus ihrer Natur heraustrete, auch alle Verpflichtungen, so wir gegen uns und Andere üben, auflösten und man daher diese Personen als halb Wahnwitzige dulde und, statt sie zu widerlegen, in ihre Ideen eingehe.
Julie zitierte eine Person aus ihrer Bekanntschaft, wo man täglich diese Regel übe. Jedes glaubte sie erraten zu haben, als der alte Herr mit Feinheit einfiel, daß man nur im Staatskalender suchen dürfe, um so einen Gegenstand zu finden. „Erhaltet eure Aufrichtigkeit und Wahrheitsliebe[S. 146] soviel wie möglich“ fuhr er fort, „aber verfallt nicht in den Fehler der jetzigen Zeit: nämlich durch allzu große Aufrichtigkeit grob zu werden!“
Hierauf erzählte er uns eine niedliche Anekdote von einer alten würdigen Kastellanin zu Nürnberg, welche in einer Gesellschaft von jungen Leuten, die sich mit ungeziemender Heftigkeit und Unart über die Schmeichler und Heuchler äußerten, plötzlich hinter ihrem Kaffeetisch mit zusammengeschlagenen Händen in vollem Unmut ausrief: „Ach, wie lieb’ ich die Schmeichler und Heuchler!“
**
*
Je älter er wurde, um so tiefer ward seine Friedfertigkeit. Schon 1816 scherzte Goethe, er habe auf seinen letzten Reisen am Rhein und Main das Evangelium Johannis gepredigt: „Kindlein, liebt euch, und wenn Das nicht gehen will, laßt wenigstens einander gelten!“ Später drückte er philosophisch-naturwissenschaftlich aus, daß wir dem Andersgesinnten, Andersgearteten nie gram sein dürfen. So meinte er 1829 gegen seinen jungen Anhänger Schubarth, er wolle zwar die Jugend nicht tadeln, wenn sie sich in den Kampf stürze, müsse aber bekennen, daß bei ihm, dem Alten, die polemischen Richtungen immer schwächer würden „und sich nach der inneren Einheit zusammenziehen: denn die Gegenstellungen sind überall dergestalt unvermeidlich, daß, wenn man den Menschen selbst ganz genau in zwei Hälften spaltete, die rechte Seite sogleich mit der linken in einen unversöhnlichen Streit geraten würde.“ Ähnlich sprach er zu Eckermann:
Man sagt von den Blättern eines Baumes, daß deren kaum zwei vollkommen gleich befunden werden: und so möchten[S. 147] sich auch unter tausend Menschen kaum zwei finden, die in ihrer Gesinnungs- und Denkungsweise vollkommen harmonieren. Setze ich Dieses voraus, so sollte ich mich billig weniger darüber wundern, daß die Zahl meiner Widersacher so groß ist, als vielmehr darüber, daß ich noch so viele Freunde und Anhänger habe. Meine ganze Zeit wich von mir ab, denn sie war ganz in subjektiver Richtung begriffen, während ich in meinem objektiven Bestreben im Nachteile und völlig allein stand.
Das bezieht sich auf die Gegner aus abweichender Denkungsweise. Aber er hatte noch viele andere.
Zuerst nenne ich meine Gegner aus Dummheit; es sind Solche, die mich nicht verstanden und die mich tadelten, ohne mich zu kennen. Diese ansehnliche Masse hat mir in meinem Leben viele Langeweile gemacht; doch es soll ihnen verziehen sein, denn sie wußten nicht, was sie taten.
Eine zweite große Menge bilden sodann meine Neider. Diese Leute gönnen mir das Glück und die ehrenvolle Stellung nicht, die ich durch mein Talent mir erworben. Sie zerren an meinem Ruhm und hätten mich gern vernichtet. Wäre ich unglücklich und elend, so würden sie aufhören.
Ferner kommt eine große Anzahl Derer, die aus Mangel an eigenem Sukzeß meine Gegner geworden. Es sind begabte Talente darunter, allein sie können mir nicht verzeihen, daß ich sie verdunkele.
Viertens nenne ich meine Gegner aus Gründen. Denn da ich ein Mensch bin und als solcher menschliche Fehler und Schwächen habe, so können auch meine Schriften davon nicht frei sein. Da es mir aber mit meiner Bildung Ernst war und ich an meiner Veredelung unablässig arbeitete, so war ich im beständigen Fortstreben begriffen, und es ereignete sich oft, daß sie mich wegen eines Fehlers tadelten, den ich längst abgelegt hatte. Diese Guten haben mich am wenigsten verletzt; sie schossen nach mir, wenn ich schon meilenweit von ihnen entfernt war.
[S. 148]
Übrigens muß schon ein denkender Leser der Novellen, Romane und Dramen zu solcher Duldung gelangen, also erst recht Derjenige, der solche Werke schafft! Als geborener Dichter konnte sich Goethe in die verschiedenartigsten Charaktere hineindenken und hineinfühlen; er wußte also, daß sie in ihrer Art Recht hatten, daß ihr Wesen und Handeln ausreichend begründet war. „So mußt du sein, dir kannst du nicht entfliehen“: dies eingeborene Gesetz gilt für unsere Gegner so gut wie für uns. Da Goethe nun sein Leben lang die Menschen auch noch fleißig beobachtete und studierte, so wurde sein Verhältnis zu ihnen immer sachlicher: der Gegner erschien ihm immer mehr das natürlichste Ding von der Welt.
**
*
Aber ist diese philosophische Betrachtung der Feinde durchzuführen? Die Feinde schaden uns doch, wenn sie es irgend können, oder sie schaden unsern Freunden und der guten Sache. Dürfen wir die Schlechten, die Verblendeten, die Unwissenden ruhig gewähren oder gar herrschen lassen?
Goethes Antwort ist, daß die Feinde, solange wir selber richtig handeln, uns nur selten schaden können und daß der Krieg nicht das Mittel ist, ihnen Abbruch zu tun. Lassen wir uns auf den Ringkampf ein, so verbrauchen wir unsere Zeit und Kraft dazu, ihre Stöße[S. 149] abzuwehren, ihre Blöße zu erspähen, und wir ermüden sogar durch die Schläge, die wir selber austeilen. Mit demselben Aufwand können wir ohne Kampf unserer Sache erfolgreicher dienen. In einer der letzten hundert Nächte seines Lebens lag Goethe lange schlaflos; er hatte Vorträge von Carus in Dresden über Psychologie gelesen; sie reizten ihn zu Gegengedanken, und er arbeitete im Kopfe aus, was er über den gleichen Gegenstand sagen würde. Und diktierte am andern Morgen ins Tagebuch: „Streiten soll man nicht, aber das Entgegengesetzte faßlich zu machen, ist Schuldigkeit.“
Verwandte Maximen hatte er schon früher aufgeschrieben: „Der Irrtum wiederholt sich immerfort in der Tat; deswegen muß man das Wahre unermüdlich in Worten wiederholen.“ Oder:
Schon als Sechsundzwanzigjähriger, im ersten weimarischen Dienstjahre, hielt Goethe es so und lebte, während er nach Wielands Ausdruck die ganze Hennebergische Natur abzeichnete, in Ilmenau völlig unbekümmert, „daß die Welt, die er vergessen hat, soviel von ihm und gegen ihn spricht.“ Er sah damals wohl ein, daß er von den gegen ihn, den Günstling eines unreifen Fürsten, erhobenen Anklagen sich rein waschen müsse; aber nicht Reden waren die beste Verteidigung, sondern ein andauerndes uneigennütziges Handeln. Als Schriftsteller hatte er die gleiche Politik. „Lassen Sie uns[S. 150] nur unsern Gang unverrückt fortgehen!“ schrieb er 1795 an Schiller; „ich kenne das Possenspiel des deutschen Autorwesens schon zwanzig Jahre in- und auswendig. Es muß nur fortgespielt werden: weiter ist dabei nichts zu sagen.“ Und das Gleiche lehrte er für häusliche und bürgerliche Dinge. Als seine Christiane nach der kirchlichen Trauung mit ihm noch mehr als früher angegriffen und verleumdet wurde, antwortete er ihr:
Wenn Dir die Leute Deinen guten Zustand nicht gönnen und Dir ihn zu verkümmern suchen, so denke nur, daß Das die Art der Welt ist, der wir nicht entgehen. Bekümmere Dich nur nichts drum, so heißt’s auch nichts! Wie mancher Schuft macht sich jetzt ein Geschäft daraus, meine Werke zu verkleinern! Ich achte nicht darauf und arbeite fort.
Wo aber die Feindseligkeiten in der Tat nicht wirkungslos bleiben, fragt es sich noch, ob sie schaden oder nützen. Gegen den französischen Diplomaten Reinhardt meinte Goethe 1807:
Der böse Wille, der den Ruf eines bedeutenden Mannes gern vernichten möchte, bringt sehr oft das Entgegengesetzte hervor: er macht die Welt aufmerksam auf eine Persönlichkeit, und da die Welt, wo nicht gerecht, doch gleichgültig ist, so läßt sie sich’s gefallen, nach und nach die guten Eigenschaften Desjenigen gewahr zu werden, den man ihr auf das schlimmste zu zeigen Lust hatte. Ja, es ist sogar im Publikum ein Geist des Widerspruchs, der sich dem Tadel wie dem Lobe entgegensetzt.
Und an Schiller schrieb Goethe sogar, die gegen sie beide gerichteten Schmähschriften seien ganz nach seinem Wunsche, denn
[S. 151]
es ist eine nicht genug gekannte und geübte Politik, daß Jeder, der auf einigen Nachruhm Anspruch macht, seine Zeitgenossen zwingen soll, Alles, was sie gegen ihn in petto haben, von sich zu geben. Den Eindruck tilgt er durch Gegenwart, Leben und Wirken jederzeit wieder. Was half’s manchem bescheidenen, verdienstvollen und klugen Mann, daß er durch unglaubliche Nachgiebigkeit, Untätigkeit, Schmeichelei und Rücken und Zurechtlegen einen leidlichen Ruf zeitlebens erhielt? Gleich nach dem Tode sitzt der Advokat des Teufels neben dem Leichnam, und der Engel, der ihm Widerpart halten soll, macht gewöhnlich eine klägliche Gebärde.
**
*
Eine andere zwar nicht unbekannte, aber doch „nicht genug gekannte und geübte Politik“, die Angreifer loszuwerden, üben wir, indem wir uns unempfindlich stellen. Wehe dem Knaben, der andere Buben merken läßt, daß er sehr kitzlich ist, und wehe dem im öffentlichen Leben stehenden Manne, der dem Gegner verrät, daß seine Pfeile schmerzen! Wer die Zähne zusammenbeißt und eine gute, oder doch gleichgültige Miene zum bösen Spiel macht, setzt die Angreifer matt und stärkt sich nebenbei im Stoizismus, der ihn den nächsten Angriff schon viel leichter ertragen läßt. Goethe hat (Dichtung und Wahrheit I, 2) in seiner Knabenzeit unter roheren Gespielen auch diese Schule durchgemacht und im Unterdrücken des Schmerzes Tüchtiges geleistet. „Dadurch setzt man sich in einen großen Vorteil, der uns von Andern so geschwind nicht abgewonnen wird.“
**
*
[S. 152]
Ein sehr derbes, aber auch sehr richtiges Bild hat Goethe einmal vom Hassen gegeben: „Der Haß gleicht einer Krankheit, dem Miserere, wo man vorn herausgibt, was eigentlich hinten weggehen sollte.“ Wie Goethe seine Feinde verdaute und zur eigenen Ernährung ausnutzte, Das sieht man am besten an seinem Verhalten zu Kotzebue. Dieser machte es sich, als er aus Goethes Kreise zurückgewiesen war, zum Geschäft, auf jede Art und Weise seinem Talent, seiner Tätigkeit, seinem Glück entgegenzutreten.[20] Goethes Hausmittel dagegen war: „die Existenz Desjenigen, der mit Abneigung und Haß verfolgt, als ein notwendiges, und zwar günstiges Ingrediens zu der seinigen zu betrachten.“ So hielt er es auch mit diesem Angreifer:
Ich denke ihn mir gern als Weimaraner und freue mich, daß er der mir so werten Stadt das Verdienst nicht rauben kann, sein Geburtsort gewesen zu sein. Ich denke mir ihn gern als schönen, muntern Knaben, der in meinem Garten Sprengel stellte und mich durch seine freie Tätigkeit sehr oft ergötzte. Ich gedenke seiner gern als Bruder eines liebenswürdigen Frauenzimmers [Malchen K.], die sich als Gattin [des Dr. Gildemeister in Bremen] und Mutter immer verehrenswert gezeigt hat. Gehe ich nun seine schriftstellerischen Wirkungen durch, so vergegenwärtige ich mir mit Vergnügen heitere Eindrücke einzelner Stellen, obschon nicht leicht ein Ganzes, weder als Kunst- noch Gemütsprodukt, weder als Das, was es aussprach, noch was es andeutete, mich jemals anmuten und sich mit meiner Natur vereinbaren konnte. Sehr großen Vorteil dagegen hat mir seine literarische Laufbahn in Absicht auf Übung des Urteils gebracht, welches wir am eigentlichsten durch die Produktionen der Gegenwart[S. 153] zu schärfen vermögend sind. Er hat mir Gelegenheit gegeben, manche Andere, ja das ganze Publikum, kennen zu lernen. Ja, ich finde noch öfters Anlaß, seine Leistungen, denen man Verdienst und Talent nicht absprechen kann, gegen überhinfahrendes Tadeln und Verwerfen in Schutz zu nehmen. Betrachte ich mich nun gar als Vorsteher eines Theaters und bedenke, wie viele Mittel er uns in die Hand gegeben hat, die Zuschauer zu unterhalten und der Kasse zu nutzen, so wüßte ich nicht, wie ich es anfangen sollte, um den Einfluß, den er auf mein Wesen und Vornehmen ausgeübt, zu verachten, zu schelten oder gar zu leugnen; vielmehr glaube ich alle Ursache zu haben, mich seiner Wirkung zu freuen und zu wünschen, daß er sie noch lange fortsetzen möge.
Goethe ließ in der Tat von 1791-1817 nicht weniger als 84 Stücke seines Feindes Kotzebue aufführen; weit über 600 Abende besetzte er damit; weder Schiller, noch Goethe, noch sonst ein Dichter wurden auf der weimarischen Bühne auch nur annähernd so viel gespielt. Einmal verschob Goethe seine Badereise, um Kotzebues Posse ‚Der Rehbock‘ völlig einzustudieren; ja, im Jahre 1817 wandte er vier Wochen fleißiger Arbeit daran, um den ‚Schutzgeist‘ zu kürzen und umzuarbeiten, weil sonst das Stück auf der Bühne nicht zu halten gewesen wäre. Und gleich danach widmete er ebensoviel Sorgfalt dem Lustspiel ‚Die Bestohlenen‘.
Goethes Hausmittel gegen diesen Feind sieht beinahe christlich aus; er will es aber weder als christlich noch als sonst hochmoralisch empfehlen: es sei einfach einem verklärten Egoismus entsprungen und bewähre sich als praktisch, um die unangenehmsten von allen Empfindungen aus dem Gemüt zu verbannen: kraftloses Widerstreben und ohnmächtigen Haß. In der Lehre,[S. 154] man solle seine Feinde lieben, scheint ihm das Wort „lieben“ gemißbraucht oder doch in einem andern Sinne gebraucht zu sein, als es sonst hat; er will deshalb lieber jenen weisen Spruch mit Überzeugung wiederholen, daß man einen guten Haushalter hauptsächlich dann erkenne, wenn er sich auch des Widerwärtigen vorteilhaft zu bedienen wisse.
Goethe hatte auf Kotzebue das Verschen gemacht:
Wollte er diesen Feind völlig überwinden und von ihm Gewinn statt Schaden haben, so mußte er dessen Fehler mit der entgegengesetzten Tugend vernichten:
[19] Zu Eckermann 21. März 1830 über die ‚Piken‘ in der ‚Walpurgisnacht‘.
[20] Biographische Einzelheiten. Kotzebue.
[S. 155]
„Glückselig Der, dessen Welt innerhalb des Hauses ist!“ schrieb Goethe an Kestner, der mit Lotte Buff aus Wetzlar sich einer aufblühenden Familie erfreute. Und als er im Mai 1790 freie Ferientage in Venedig verbrachte, dachte er sehnsüchtig an das eigene Heim im Jägerhause zu Weimar, wo seine Christiane seiner harrte:
Zeitlebens war Goethe sehr häuslich gesinnt, und wenn er auch keineswegs zu den Damenfreunden gehörte, die die weibliche Gesellschaft der männlichen vorziehen, und wenn er noch weniger zu den Schmetterlingen und Don Juans gehörte, denen es um wechselreiches Naschen zu tun ist, so fühlte er sich doch aus seiner Arbeit und aus seinem männlichen Freundeskreise auch immer wieder zur weiblichen Natur hingezogen und war glücklich im gegenseitigen Geben und Empfangen mit geliebten Frauen.
Trotzdem gelangte er erst spät und dann auch nur halbwegs zur Ehe.
[S. 156]
Es fiel ihm in allen Dingen sehr schwer, entscheidende Entschlüsse zu fassen. „Eine Verlobung oder Heirat aus dem Stegreife war mir von jeher ein wahrer Greuel“ sagte er 1825 zum Kanzler v. Müller.
Eine Liebe wohl kann im Nu entstehen, und jede echte Neigung muß irgend einmal gleich dem Blitze plötzlich aufgeflammt sein, aber wer wird sich denn gleich heiraten, wenn man liebt? Liebe ist etwas Ideelles, Heiraten etwas Reelles, und nie verwechselt man ungestraft das Ideelle mit dem Reellen. Solch ein wichtiger Lebensschritt will allseitig überlegt sein und längere Zeit hindurch, ob auch alle individuellen Beziehungen, wenigstens die meisten, zusammenpassen.
So dachte er immer: „Lieben heißt leiden, man muß es nur, man will es nicht“, oder: „Als ob die Liebe etwas mit dem Verstande zu tun hätte!“ Die Ehe aber galt zu Goethes Zeit viel allgemeiner als heute für eine Verstandessache; sie war also viel seltener eine Folge des Verliebens, hatte auch die Liebe nicht zur Voraussetzung. Vielmehr ward sie als eine praktische, gemeinnützige Einrichtung aufgefaßt, die den wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Zustand beider Gatten verbessern, ihr leibliches und seelisches Wohlbefinden erhöhen und zum Aufziehen eines neuen Geschlechtes die geschützte Stätte liefern sollte. Man nahm an, daß ein wünschenswertes Maß von Liebe sich in der Ehe von selbst einstelle, da die Gatten manche Annehmlichkeiten von einander haben und wirtschaftlich der Welt gegenüber verbündet sind. Die Brautleute waren in der Regel noch jung genug, um sich einander anzupassen; namentlich gab man die[S. 157] Mädchen fast noch im kindlichen Alter, wo sie noch biegsam und bildsam sind, an ihre Eheherren. Goethe hat einmal die Erfahrung ausgesprochen: die Liebe der Frauen sei meistens eine pflichteifrige, die der Männer eine enthusiastische. Aus dieser Erfahrung heraus sah man auch den verheirateten Männern neue Verliebtheiten nach, erklärte jedoch die Liebe zu einer Pflicht der Ehe, namentlich für die Ehefrauen. Und viele Frauen liebten in der Tat deshalb ihre Männer, weil sie an diese Pflicht glaubten, und waren ihnen treu und untertan, wie es der Pfarrer bei der Trauung als Gottes Gebot gelehrt hatte.
**
*
Aber wenn Goethe in jungen Jahren um sich schaute, so sah er unter den Ehen, in die er die besten Einblicke hatte, kaum eine, wie er sie für sich wünschen konnte. Seine Mutter und seine Schwester waren an brave Männer und dennoch übel verheiratet. Herzog Karl August und Herzogin Luise waren vortreffliche junge Menschen, aber ihre Ehe war Verdruß und Not. Seine beste Freundin, Charlotte v. Stein, hatte einen achtungswerten Gatten, aber in ihrem inneren Leben ging er nur so nebenher. Dazu kamen dann die Ehepaare, deren Zank und Streit öffentlich bekannt war oder wo der Eine dem Andern davonlief. Es traten nicht wenige Frauen auf, die zu pflichtmäßiger Liebe nicht mehr fähig oder willig waren; es waren Frauen, die sich durch Stärke des Geistes und Gefühls auszeichneten. Charlotte v. Kalb und Karoline v. Beulwitz hatten gegen ihre Männer keine erheblichen Anklagen,[S. 158] aber sie drangen auf Scheidung, weil sie ein hohes Ideal vom Manne in ihren Herzen trugen; beide hängten eine Zeitlang ihre Herzen an Schiller. Eine noch schlimmere Plage ihres rechtschaffenen Gatten war Emilie v. Berlepsch, die den Jean Paul für sich verlangte und vorher sehr gern Frau v. Goethe geworden wäre. Die hübsche Frau v. Werthern entlief ihrem Gatten, weil sie in August v. Einsiedel einen romanhaft vollkommenen Mann gefunden zu haben glaubte. Immer wieder ward Goethe daran erinnert, daß die Ehe gerade für Menschen von verfeinerten Ansprüchen, für Menschen, die von Höhe zu Höhe schreiten, leicht zur qualvollsten Lebenslast wird.
Zwei von seinen Freunden sah Goethe glücklich verheiratet. Herders Gattin war hochgebildet und hochbegabt; sie liebte ihren Mann von ganzem Herzen und lebte sein äußeres und inneres Leben vollkommen mit, war auch die gleichwertige Freundin seiner Freunde. Aber gerade diese innige Verbundenheit des Herderschen Paares erschien auch als etwas Schädliches und Verderbliches; Herder wurde durch seine Gattin in seinen Fehlern bestärkt; sein persönlicher Egoismus wurde durch die Erweiterung zum Familienegoismus nicht angenehmer; Herders machten ihr Pfarrhaus gar zu sehr zu einer eigenen Festung gegen die Mitlebenden und wurden immer ungerechter und verbitterter gegen die ehemaligen Freunde, die ihnen oder ihren Kindern nie genug tun konnten. Viel anspruchsloser und glücklicher war Wieland in seinem gleichfalls kinderreichen Heime. Er hatte in jungen Jahren die geistreichsten Freundinnen[S. 159] gehabt; als er aber heiratete, tat er es ganz nach der alten Sitte. Er wählte die Braut, ehe er sie gesehen hatte; er heiratete sie nach einmaliger Zusammenkunft, obwohl er, der vielbewunderte Autor, wußte, daß sie außer der Bibel und dem Kalender nichts las. Auch durch Schönheit zeichnete sich Dorothea Hillenbrand nicht aus; sie war nur ein gutes Kind und hatte soviel Vermögen, daß sie im Witwenstande davon hätte leben können. Sie blieb auch als Wielands Gattin in einem kindlichen Verhältnis zu ihm, wagte nie, ihn mit „Du“ anzureden, ging nie mit ihm in Gesellschaften, und wenn Beide spazieren gingen, vermieden sie die allgemeine Promenade. Dabei gab es kein glücklicheres Paar und keine glücklichere Familie in Weimar!
Aber weder die wielandische noch die herdersche Ehe waren für Goethe verführerisch.
Und namentlich: es trat ihm, seit er in Weimar Amt und Heimat hatte, kein Mädchen entgegen, das ihn alle Bedenken vergessen ließ. Es konnte ihn kein Mädchen berauschen, weil er in eine zärtliche Freundschaft mit Charlotte v. Stein geraten war und dadurch einen „Maßstab für alle Frauen“ hatte. Diese Freundschaft konnte ihn nicht völlig befriedigen, aber sie verminderte Hunger und Durst nach der rechten Liebe. Und so paßte lange Jahre auf ihn sein eigenes Wort:
**
*
[S. 160]
Als Goethe aus Italien heimkehrte, fühlte er sich in Weimar einsamer als je vorher; und namentlich fand auch Charlotte v. Stein ihn umgewandelt, ihr entfremdet. In dieser Lage lernte er die vierundzwanzigjährige Christiane Vulpius kennen, eine Waise aus einer verarmten Beamtenfamilie; eines Tages stand sie mit einer Bittschrift ihres Bruders im Garten vor ihm als ein hübsches Kind „von naivem, freundlichem Wesen, mit vollem, rundem Gesicht, langen Locken, kleinem Näschen, schwellenden Lippen, zierlichem Körperbau und niedlichen, tanzlustigen Füßchen.“ So war das Mädchen wie eine Blume unter den anderen Blumen. Und der Dichter erzählt weiter:
Er nahm Christiane mit ihrer Tante und Schwester in sein Haus und behielt das Verhältnis Jahr für Jahr bei. Auf die Entrüstung alter Freunde und Feinde antwortete er im stillen mit dem Tasso-Worte: „Viel lieber, was ihr euch unsittlich nennt, als was ich mir unedel nennen müßte!“ Schiller verstand ihn; „diese seine[S. 161] einzige Blöße, die Niemand verletzt als ihn selbst, hängt mit einem sehr edeln Teil seines Charakters zusammen“ schrieb er an die Gräfin Schimmelmann. Goethe brachte für dies häusliche Verhältnis manches Opfer; er ward oft in peinlicher Weise daran erinnert, daß seine Nächste, die Mutter seiner Kinder, von seiner übrigen Gesellschaft nicht als Seines- und Ihresgleichen angenommen werden konnte; trotzdem, meinte er, Christiane passe besser als tausend vornehme, anspruchsvolle Damen zu ihm.
Und Christiane dankte ihm alle seine Liebe. Sie war eine brave Hausfrau, die außer ihrem „Geheimen Rat“ und dem einzigen Sohne, der von fünf Kindern am Leben blieb, noch die vielen Gäste in sorgenden Gedanken trug. Unter der schwersten eigenen Last zeigte sie Jedermann ein munteres Wesen. Manchmal sprach sie ihre Not brieflich gegen einen fernen Freund aus, den Arzt Nikolaus Meyer in Bremen, mit dem sie fröhliche Stunden auf Bällen und Redouten vertanzt hatte. „Ich lebe ganz still und sehe fast keinen Menschen“ schrieb sie im April 1803, „das Theater nur ist meine Freude, denn wegen dem Geh. Rat lebe ich sehr in Sorge; er ist manchmal ganz hypochonder, und ich stehe oft viel aus; doch trage ich Alles gerne, da es ja nur krankhaft ist, habe aber so gar Niemanden, dem ich mich vertrauen kann. Schreiben Sie mir aber[S. 162] hierauf nichts, denn man muß ihm ja nicht sagen, daß er krank ist; ich glaube aber, er wird wieder einmal recht krank.“ Goethe ahnte nicht, welche Angst Christiane um ihn trug; er sah sie fast immer mit fröhlichem Gesicht. „Eine stille, ernsthafte Frau ist übel daran mit einem lustigen Manne, ein ernsthafter Mann nicht so mit einer lustigen Frau“ meinte er später einmal zu Riemer, und Der dachte sich dabei: „So dankt er Gott, daß er nicht nötig hat, lustig zu sein!“ Sie war namentlich eine treffliche Vermittlerin zu den Schauspielern und eine erwünschte Berichterstatterin über die Aufführungen. Aber auch sonst nahm sie an seinem geistigen Schaffen einen bescheidenen Anteil. Er betrachtete sie als seine Gattin, obwohl kein Priester ihren Bund gesegnet hatte. Und allmählich entstand in ihm der Entschluß, zu ihrem und seines Sohnes Vorteil die Ehe auch gesetzlich gültig zu machen. Dieser Entschluß verstärkte sich im Frühjahr 1806, weil damals Christianes Tante und Schwester starben, so daß sie nun keinen Frauen-Anhalt mehr im Hause hatte, gleichsam zu Niemand mehr gehörte. Als dann nach der Schlacht bei Jena die als „Wirtschafterin“ behandelte Person den französischen Soldaten, die auf Goethe sogar mit den Waffen eindrangen, mutig entgegengetreten war, als sie ihm vielleicht das Leben gerettet hatte, da war die rechte Stunde gekommen.
**
*
Es war und blieb nur eine halbe Ehe, aber beide Teile verlangten nichts Unmögliches voneinander und fühlten sich auch in der halben Ehe ziemlich wohl.[S. 163] Christiane redete ihren Geheimrat nach wie vor mit Sie an und lebte gewissermaßen ein Stockwerk tiefer als ihr Gatte. Dem Fremden klang es wunderlich, wenn bei einem Mittagessen im Goethe-Hause die Frau v. Goethe, die vielleicht eine Ausfahrt mit ihrer Gesellschafterin vorhatte, ihren Gatten fragte: „Erlauben Sie, daß wir uns zurückziehen?“ Wohl hatten sie einen gemeinsamen Freundeskreis, aber Jeder hatte daneben seine besondere Welt von Bekanntschaften und Neigungen. Goethes Genossin erfreute sich Dessen, daß er die Frauen gut kannte und ihnen das Recht, ihrer Natur nachzuleben, willigst einräumte und daß er die Eigenart jeder Persönlichkeit zu achten gewohnt war. Die Freiheit, deren er selber bedurfte, gönnte er auch der Gattin. Er konnte und wollte es sich nicht versagen, andere Mädchen und Frauen schön und liebenswert zu finden und ihr freundliches Lächeln zu genießen: so gestattete er auch Christianen das „Äugeln“ und scherzte mit ihr darüber. Da sie überaus gern tanzte, ließ er sie allein auf Bälle gehen, und die Leute mochten reden, was sie wollten. „Meine Frau besucht in Lauchstädt Theater und Tanzsaal“ berichtet er an Bettina v. Arnim, während er selber in Karlsbad an Silvie v. Ziegesar seine Freude hat. Und dann heißt es an Christiane: „Fräulein Silvie ist gar lieb und gut, wir haben viel zusammen spaziert; was sich in diesem Kapitel bei Dir ereignen wird, erfahre ich doch wohl auch.“ Ein anderes Jahr schreibt er wieder aus Karlsbad nach Lauchstädt: „Ich zweifle nicht, daß alter und neuer Äugelchen vollauf sein wird; dazu wünsche auch Glück; macht euch in[S. 164] jener Gegend so viel Freude wie möglich!“ Und wie milde klingt auch seine Warnung aus etwas jüngeren Jahren: „Mit den Äugelchen geht es, merke ich, ein wenig stark; nimm Dich nur in acht, daß keine Augen daraus werden!“ Die große Wahrhaftigkeit zwischen Beiden lesen wir auch aus einem Briefe heraus, in dem er erwähnt, daß er bei Frommanns in Jena Minchen Herzlieb wiedergesehen habe. „Sie ist nun eben ein paar Jahre älter“ schreibt er seiner Frau, „an Gestalt und Betragen aber immer noch so hübsch und so artig, daß ich mir gar nicht übelnehme, sie einmal mehr als billig geliebt zu haben.“ Aber wenn er denkt, daß Christiane wohl auf seine feinen und gelehrten Freundinnen eifersüchtig sein könnte, beeilt er sich stets, ihr zu sagen, wie viel lieber sie ihm sei. Sie mag zuweilen nicht ohne Sorge an das andere Ende der Ackerwand gedacht haben, wo Frau v. Stein wohnte, die nach bitterem Gegensatz langsam wieder seine Freundin wurde; da weiß er ihr gar zart zu sagen, daß er doch nur mit ihr ganz einig, ganz heimisch sei. Als er mit einer andern hochgebildeten Dame, Marianne v. Eybenberg, in Karlsbad in einem Hause wohnte, beruhigte er sie: „Mit der lieben Hausfreundin bleibt’s, wie ich Dir schon gesagt habe; so angenehm und liebreich sie ist, so gehn wir doch nicht auseinander, daß sie nicht etwas gesagt hätte, was mich verdrießt. Es ist wie in der Ackerwand.“
Und in jedem Briefe bemühte er sich, eine Freude für sie anzubringen, ein neues Geschenk anzumelden. „Ich lege abermals ein Endchen Spitze bei, daß ja[S. 165] keine Sendung ohne eine kleine Gabe komme. Lebe recht wohl, liebe mich!“ – „Auch bringe ich Dir eine silberne Tee- und Milchkanne mit, zu der ich zufälligerweise ohne sonderliche Kosten gekommen bin.“ – „Ein recht zierliches Unterröckchen und einen großen Shawl nach der neuesten Mode bring ich Dir mit. In Kassel kannst Du Dir ein Hütchen kaufen und ein Kleid; sie haben die neuesten Waren so gut als irgendwo.“ Immer wieder denkt er daran, sie zu schmücken, und lebt ihre kleinen Freuden mit. „Schreibe mir ja, wie das schwarzseidene Kleid geraten ist und wann Du es zum ersten Male angehabt hast“ bittet er 1797 aus Frankfurt, und eine Woche später heißt es: „Ich bin recht wohl zufrieden, daß Du Dir die goldenen Schnuren anschaffst und Dich recht hübsch herausputzest.“
Und immer wieder versüßt er ihre Tage mit Liebesworten und spricht aus der Ferne von seinem Verlangen nach ihr und ihrem Kinde. „Mit Freuden werde ich Koppenfelsens Scheungiebel [seinem Hausgarten gegenüber] wiedersehen und Dich wieder an mein Herz drücken und Dir sagen, daß ich Dich immerfort und immer mehr liebe.“ „Lebe recht wohl und behalte mich so von Grunde des Herzens lieb wie ich Dich“ ist ein Briefschluß wie viele andere. Klagte sie ihm aber in ihrer ungelenken, naiven Ausdrucksweise, in ihrer sehr volkstümlichen Wortschreibung, daß die Leute wieder so schlecht über sie gesprochen hätten, daß etwa Frau v. Staël boshaft über sie hergezogen sei, da tröstet er sie mit schönen Worten und schließt: „Wir wollen in unserer Liebe verharren und uns[S. 166] immer knapper und besser einrichten, damit wir nach unsrer Sinnesweise leben können, ohne uns um Andere zu bekümmern.“
**
*
Am Sohne,[21] an der Schwiegertochter, an den drei Enkelkindern bewährte Goethe dieselbe Duldsamkeit, dieselbe Anerkennung der Persönlichkeit und ihres jeweiligen Zustandes, dieselbe immer neue Güte.
Gerade dem häuslichen Goethe war wenig häusliches Glück beschieden: die Gattin blieb ihm eine Halbfremde, der Sohn wurde kein glücklicher Mann, und die Schwiegertochter erfüllte seine Hoffnungen nur zum kleinsten Teile. Es kamen Zeiten, wo der alte Dichter den Sohn oder die Tochter wochenlang nicht sehen mochte und einem vertrautesten Freunde gegenüber heftig auf sie schalt. Immer wieder entschloß er sich jedoch zu freundlichster Duldsamkeit als zu dem einzigen Mittel, solche unabänderlichen Übel zu mildern. Er lobte den Sohn und die Schwiegertochter, soviel er nur konnte, stellte ihre Vorzüge in das hellste Licht und bestärkte sich immer wieder in seiner alten Gesinnung, daß man von Kindern und jüngeren Menschen nicht die Eigenschaften verlangen darf, die wir als Tugenden der älteren Jahre schätzen, und daß der Mann sich hüten muß, männliche Art von Frauen zu erwarten.
[S. 167]
Schon ehe er selber Kinder hatte, war er ein eifriger Beschützer der Kinder gegen die Erwachsenen. „Ein Blatt, das groß werden soll, ist voller Runzeln und Knittern, eh’ es sich entwickelt; wenn man nicht genug Geduld hat und es gleich so glatt haben will wie ein Weidenblatt, dann ist’s übel.“ So schrieb er an seinen Freund Jacobi in Düsseldorf, dessen Sohn schwer zu erziehen war. Der Vater – die treffliche Mutter war schon tot – hatte ihn zu Matthias Claudius nach Wandsbek zur Erziehung geschickt, danach zu der edeln Fürstin Gallitzin nach Münster; doch der Knabe tat nicht gut. Goethe redete immer zu Geduld: „Ich mische mich nicht gern in dergleichen Sachen ... aber das Kind dauert mich: es ist doch Dein und Bettys Kind und gewiß nicht zum Bösewicht, zum Nichtswürdigen geboren.“ Der Knabe wurde in der Tat kein Bösewicht, sondern ein preußischer Geheimer Regierungsrat.
Diese Duldsamkeit zeigte Goethe auch im eigenen Hause immer wieder. Der Sohn ist schon in seiner Kindheit von Charlotte v. Stein richtig gezeichnet: „Ich kann manchmal in ihm die vornehme Natur des Vaters und die gemeinere der Mutter unterscheiden. Einmal gab ich ihm ein neues Stück Geld; er drückte es an seinen Mund vor Freuden und küßte es, welches ich sonst am Vater auch gesehen habe. Ich gab ihm noch[S. 168] ein zweites dazu, und da ruft er aus: Alle Wetter!“ August v. Goethe war ein schöner, stattlicher Mann, als Gehülfe seines Vaters und als Beamter wohl brauchbar, schließlich aber aus dem Geleise geratend, dem Weingeist verfallend, als untreuer Gatte einer untreuen Gattin zu Hause nicht glücklich, als mittelmäßig Begabter von der Größe seines Vaters bedrückt. Holtei schildert ihn, wie er ihn 1829 sah: „Seine Heiterkeit war wild und erzwungen, sein Ernst düster und schwer, seine Wehmut herzzerreißend; dabei suchte er aber immer eine gewisse Feierlichkeit der Formen zu bewahren, die oft wie eine unbewußte Nachahmung des Vaters erschien und sich deshalb im Gegensatz zum sonstigen Tun und Treiben gespenstig ausnahm.“ Und August selber läßt uns in sein Unglück hineinsehen durch Zeilen, die er Schillers Sohn Ernst in’s Stammbuch schrieb, als Dieser nach einem Besuche Weimars wieder abreiste:
Auf einer Reise nach Italien sollte und wollte er sich von Übeln und Fehlern befreien: in Rom erlöste der Tod den Vierzigjährigen von allen Übeln und Fehlern. Der Vater verbarg auch jetzt seinen Kummer, so gut es ging, und wenn er von dem Verstorbenen sprach, suchte er die lichten Seiten auf. Aber als er[S. 169] mit Riemer einmal auf häusliche Dinge und besonders auf elterliche Gefühle zu sprechen kam, traten ihm Tränen in’s Auge, und er wiederholte das Wort eines Franzosen: das Zarteste, was die Natur erschaffen habe, sei ein Vaterherz.
**
*
„August kommt nicht wieder; desto fester müssen wir zusammenhalten“ sagte er zur Schwiegertochter, als die böse Nachricht aus Rom gekommen war. Diese Schwiegertochter, Ottilie v. Pogwisch, machte ihm viel Kummer. Das Treiben Ottiliens sei hohl, leer, es sei weder Leidenschaft, Neigung, noch wahres Interesse, es sei nur eine Wut, aufgeregt zu sein, ein abenteuerliches Treiben: so sagte er zum Kanzler einmal im Zorn über die beständigen Liebschaften Ottiliens mit den Engländern, die in Weimar lebten. Aber in der Regel lobte er, was gelobt werden konnte, und war gegen sie von größter Güte. Das Kränkende ward entschuldigt und vergessen; Ottilie blieb sein Töchterchen bis zu seiner letzten Stunde.
So sahen denn die Gäste trotz aller häuslichen Nöte im Goethehause manches schöne Familienbild. Als der böhmische Freund Grüner 1825 kam, führte ihm Goethe seine Enkel Wolfgang und Walter zu. „Sehen Sie meinem Wolf in die Augen“ sagte er; „es spricht so etwas heraus, daß ich meinen sollte, er werde ein Dichter. Mein Sohn hat keine Anlage dazu, wohl aber ist er auf seinem Platz als Kammerrat. Er versieht auch meine ganze Wirtschaft, um die ich mich nicht zu kümmern brauche. Meine Enkel machen mir viele[S. 170] Freude; sie werden gut erzogen. Meine Schwiegertochter ist eine einsichtsvolle, in Sprachen geübte, im Umgange in höhern Zirkeln gewandte, unterrichtete Hausfrau. Sie dürften sich selbst bei der Soirée überzeugt haben, wie sie jeden Gast empfangen und sich bemüht hat, Jeden nach Höflichkeit zu unterhalten.“ – „Ich bewunderte“ antwortete Grüner „ihren edeln Anstand, ihr einnehmendes Wesen und ihre Sprachkenntnisse.“ – „Nun müssen Sie auch“ fuhr Goethe fort „die Sammlung meines Sohnes im Gartenhause ansehen, welches er sich für seine Passion für Petrefakte ganz eingeräumt hat.“
Alle, die Goethe im Umgang mit Kindern sahen, rühmten sein großes Geschick, mit ihnen umzugehen. Der Jüngling war in der Liebe zu den kleinen Menschen seinem Werther gleich; noch der Großvater bewährte diese Liebe am schönsten. „Er hat die Natursprache in seinem Besitz“ schreibt ein Freiherr v. Stackelberg über den Achtzigjährigen. „Es war eine Lust, ihn mit Kindern, die immer ab und zu bei ihm vorkamen, sprechen zu hören, denn er hat eine rührende Art, sich mit ihnen zu unterhalten, spricht ganz in ihrem Sinne, darum sie auch an ihm hängen und ganz mit ihm vertraut sind.“ Es ist nicht ganz Zufall, daß die letzten Menschen, die sich rühmen konnten, Goethe noch gekannt zu haben, nämlich drei sehr alt gewordene Damen: die Witwe des Staatsmanns v. der Gabelentz, die Witwe des Bleistiftfabrikanten Hardtmuth und die Witwe des Malers Karl Hummel, alle drei erzählen konnten, daß sie als Kinder von Goethe auf den Schoß genommen und gehätschelt seien.
[S. 171]
Eine jüngere Schwester der Schwiegertochter, Ulrike v. Pogwisch, wuchs mit im Hause auf. Sie erzählte später:
Wir nannten ihn immer den ‚Vatter‘; Das mochte er gern. O, Das war eine Ehrfurcht, wenn der Vatter kam, und wenn er uns anredete, dann waren wir schon glücklich. Nun mochte er es gern, daß eine von uns jungen Mädchen in seinem Zimmer verweilte, wenn er arbeitete; doch durfte Diese keine Handarbeit vornehmen. Auch wurde nur selten gesprochen, er mochte uns nur gern um sich haben. Das war mir aber zu langweilig, und so nahm ich meine Handarbeit mit. Nun gab’s ein Gezwitscher: „Die Ulrike ist zum Vatter gegangen mit Handarbeit.“ Ich kehrte mich nicht daran, und als es dem Vatter gesagt wurde, wie ungehorsam ich sei, lächelte er so ein ganz wenig – er konnte oft so ein ganz wenig lächeln, und es war dann in seinem Gesicht wie heller, warmer Sonnenschein – und sagte: „Beunruhigt nur die Kleine nicht, sie darf es.“
Ebenso durfte der Enkel Wolf im heiligsten Raume des Hauses, in des Dichters Arbeitsstube, eine Schublade des großen Tisches mit seinen Spielsachen vollpacken und sie täglich neu ordnen; Walter durfte mit seinen Bilderbüchern kommen und Erläuterungen verlangen, und Alma, die einzige Enkelin, trug ihre Puppen herbei. In dem Hausrock Goethes, der uns erhalten ist, steckt noch jetzt ein Puppenkopf. Der Großvater fütterte die Enkelkinder heimlich, wenn die Schwiegertochter sie nach der neuesten Lehre der Ärzte karg hielt. Und wenn die in der Mansarde wohnenden Kinder zu lärmend spielten, schickte er Frankfurter Gebäck hinauf; sie sollten um die einzelnen Stücke Lotto spielen: dabei mußten sie stillsitzen! Goethe war einundachtzig Jahre[S. 172] alt, als Eckermann und Gräfin Karoline Egloffstein einmal zusahen, wie der kleine Wolf seinem Großvater recht viel zu schaffen machte. Er kletterte auf ihm herum und saß bald auf der einen Schulter und bald auf der andern. Goethe erduldete Alles mit der größten Zärtlichkeit, so unbequem das Gewicht des zehnjährigen Knaben seinem Alter auch sein mochte. „Aber, lieber Wolf“, sagte die Gräfin, „plage doch deinen guten Großvater nicht so entsetzlich! er muß ja von deiner Last ganz ermüdet werden.“ – „Das hat gar nichts zu sagen“ erwiderte Wolf; „wir gehen bald zu Bette, und da wird der Großvater Zeit haben, sich von dieser Fatigue ganz vollkommen wieder auszuruhen.“ – „Sie sehen“, nahm Goethe das Wort, „daß die Liebe immer ein wenig impertinenter Natur ist.“
[21] Der Gegenstand der letzten Seiten ist gründlicher behandelt in meinem Buche ‚Weib und Sittlichkeit in Goethes Leben und Denken‘. Sein Verhältnis zum Sohne und zur Schwiegertochter in dem Buche ‚Goethes Sohn‘.
[S. 173]
Mehr als heute galten zu Goethes Zeit die Angehörigen der gelehrten Stände für unfrohe, mißlaunige Menschen; man sprach gar viel von Hypochondern und Hypochondrie und meinte damit ein körperliches und geistiges Leiden, bald mehr körperlich, bald mehr geistig, das eben bei Männern, die in Studierstuben arbeiteten, sehr häufig war, etwa so wie die Hysterie beim andern Geschlechte. Die körperliche Krankheit hatte ihre Stätte, wie der Name sagt, unter dem Brustknorpel, und wurde als Milzsucht bezeichnet oder anderen Teilen des Unterleibs zugeschrieben; der Hämorrhoidarier war mit dem Hypochonder oft eine Person. Im geistigen Leben war die Hypochondrie eine in’s Krankhafte gesteigerte Empfindung der Übel und Nöte, entweder des allgemeinen Weltelends (Wertherstimmung, Weltschmerz) oder der besondern Verdrießlichkeiten, die Keinem erspart bleiben, oder der eigenen sittlichen Beschaffenheit (moralische Selbstbeobachtung, Tagebuchführen, Selbstquälerei, Gewissensbisse, Reue, Buße) oder der eigenen Gesundheitszustände, wobei immer neue bedenkliche Zustände des Körpers entdeckt und immer neue Kuren versucht werden.
Goethe sprach 1815 einmal von der „deutschen Hypochondrie.“ Die Deutschen und alle nördlichen Völker neigten im Gegensatz zu den fröhlichen Romanen[S. 174] besonders zur Milzsucht oder zum spleen; in Deutschland aber ward ihr nicht, wie in England, durch eine frische und lockere Jugenderziehung und viel Bewegung im freien Felde entgegen gearbeitet. „Der dritte Teil der an den Schreibtisch gefesselten Gelehrten und Staatsdiener ist körperlich anbrüchig und dem Dämon der Hypochondrie verfallen“ klagte Goethe 1828.
Er selber war nicht frei von diesem allgemeinen Leiden. „Ich habe viel Humor, bin aber dabei immer Hypochonder“ schreibt er 1780 an Knebel. „Wie stehen Sie mit Ihrem hypochondrischen Freunde?“ fragte er Frau v. Stein im nächsten Jahre. 1792 versichert er seiner Christiane, es fehle ihm nicht das mindeste „und an Hypochondrie ist garnicht zu denken.“ Aber 1803 klagt Christiane einem ärztlichen Freunde insgeheim:
Ich lebe wegen des Geheimrats sehr in Sorge; er ist manchmal ganz Hypochonder, und ich stehe viel aus; weil es aber Krankheit, so tue ich Alles gern.
Knebel bezeugt 1807, daß Goethe seinen Zustand „eine halbe Hypochondrie“ nannte, und im gleichen Jahre schreibt Frau Schopenhauer ihrem Arthur:
Goethe ist seit einiger Zeit nicht recht wohl; er ist nicht krank, aber er fürchtet, krank zu werden, und schont sich ängstlich ... Er kommt mir zuweilen etwas hypochondrisch vor, denn seine Krankheit verschwindet, wenn er nur ein wenig warm in Gesellschaft wird, und Das geschieht so leicht.
„Ich finde höchst nötig“ schreibt Goethe selber wieder 1810, „mich von gewissen hypochondrischen Einflüssen zu befreien.“
Wir brauchen jedoch nur an seine Lebensarbeit zu[S. 175] denken, so wissen wir, daß er durch solche vorübergehenden Anfälle zwar der allgemeinen Gelehrten- und Zeitkrankheit seinen Tribut zahlte, daß er aber seiner Grundgesinnung nach das Gegenteil vom grämlichen, grilligen, selbstquälerischen Hypochondristen war. „Hypochondrisch sein heißt nichts Andres als: in’s Subjekt versinken“ sagte er selber 1814 zu Riemer; sein ganzes Streben aber ging auf Objektivität.
Er hatte so viel mit den Dingen außer sich zu tun, daß er wenig Zeit fand, sich selber zu beobachten, und er wußte, was bei fleißiger Selbstbeobachtung herauskommt: daß man sich nämlich krank und bedroht findet. Man darf den Dichter mit keinem seiner dramatischen Helden ganz gleich stellen, aber recht nahe kommen seiner Gesinnung Egmonts Worte, „daß Der schon tot ist, der um seiner Sicherheit willen lebt“, und ebenso Egmonts Fragen: „Leb ich nur, um auf’s Leben zu denken? soll ich den gegenwärtigen Augenblick nicht genießen, damit ich des folgenden gewiß sei? und Diesen wieder mit Sorgen und Grillen verzehren?“
**
*
Nun glauben noch Viele, daß Goethe sehr gesund und kräftig gewesen sei und schon darum sich um Gesundheit nicht viel zu kümmern brauchte. Aber er war durchaus keine robuste, sondern eine weichliche Natur; Leib und Geist waren für schädliche Einflüsse sehr empfindlich, und so ist er denn auch oft krank und kränklich gewesen. Er hat auch im größten Teile seines Lebens älter ausgesehen, als er war.
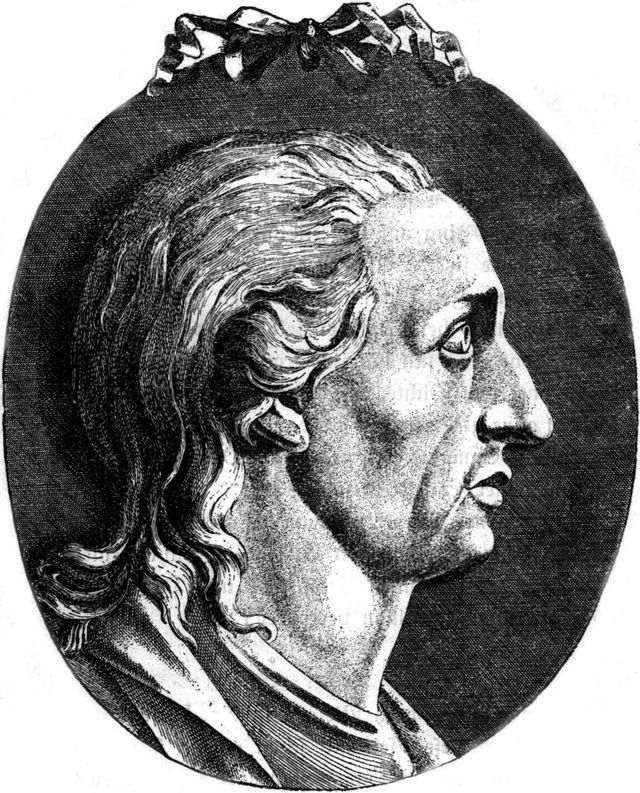


[S. 177]
Als Kind hatte er nicht bloß die gewöhnlichen Kinderkrankheiten, sondern auch die schwarzen Pocken, die Spuren hinterließen. Als achtzehnjähriger Student bekam er im Herbst 1767 einen Blutsturz und schwebte tagelang zwischen Leben und Tod. Als er sich dann ein wenig erholt hatte und in die Heimat zurückgekehrt war, stand er vor seinem Vater als ein Kränkling, der noch mehr an der Seele als am Körper zu leiden schien. Bald erkrankte er wieder so schwer, daß man im Dezember 1768 zwei Tage lang für sein Leben fürchtete. Die Frankfurter Ärzte meinten, seine Krankheit stecke nicht sowohl in der Lunge als in den dazu führenden Teilen, und unser Neunzehnjähriger befand sich im Elternhause nur so gut, „als ein Mensch, der im Zweifel steht, ob er die Lungensucht hat oder nicht, sich befinden kann.“ Mehr als ein Jahr verging, ehe er melden konnte: „Mein Körper ist wieder hergestellt“, und da fügte er hinzu: „aber meine Seele ist noch nicht geheilt.“ Bei der Heimkehr von Straßburg war er körperlich gesünder; „aber in seinem ganzen Wesen zeigte sich doch etwas Überspanntes, welches nicht völlig auf geistige Gesundheit deutete.“ Wenn wir seine Briefe aus jener Zeit lesen, auch noch die 1775 und 1776 an Gräfin Auguste Stolberg gerichteten, haben wir diesen Zustand schwarz auf weiß vor uns.
Auch in Weimar war er oft krank; er wollte Das auf das „infame Klima“ Thüringens schieben, aber wir kennen dieses Klima als sehr gesund, wenn es auch etwas rauh ist. „Es stickt etwas in mir“ hat er manchmal zu Charlotte v. Stein geklagt. Kräftig erscheint[S. 178] er auch nicht, wenn er 1781 der besorgten Mutter schreibt: „Meine Gesundheit ist weit besser, als ich sie in vorigen Zeiten vermuten und hoffen konnte, und da sie hinreicht, um Dasjenige, was mir aufliegt, wenigstens großenteils zu tun, so habe ich Ursache, damit zufrieden zu sein.“ Häufig waren jetzt sowohl die Verdauungsstörungen wie die Erkältungen. Sein Häuschen an der Ilm bot gar zu wenig Schutz gegen das Wetter; übrigens hatte er sein ganzes Leben darunter zu leiden, daß die Wohnhäuser und Gasthäuser und auch die Fürstenschlösser im Winter nicht durchweg warm gehalten wurden, so daß man oft in überheizten, oft in sehr durchkälteten Räumen sich aufzuhalten gezwungen war.
1785 sah er ganz faltig und abgearbeitet aus; Karl August verglich ihn mit einem ausländischen Gewächs, das, in ein rauheres Klima verpflanzt, unter jedem bösen Wetter leide und viel Zeit brauche, sich wieder herzustellen. 1786 suchte er wegen seiner gichtischen Zustände, die ihm große Schmerzen in den Beinen machten, zum ersten Male das Karlsbad auf. Von da ging er heimlich nach Italien. „Die Hauptabsicht meiner Reise war, mich von den physisch-moralischen Übeln zu heilen, die mich in Deutschland quälten und mich zuletzt unbrauchbar machten.“ Auch nach der Heimkehr besuchte er regelmäßig im Sommer Bäder zu seiner Erholung; zwölfmal war er in Karlsbad, dreimal in Marienbad, und ebenso suchte er in Teplitz, Eger, Wiesbaden, Pyrmont, Tennstädt, Lauchstädt und Berka Besserung. Daheim trank er ziemlich regelmäßig die heilsamen[S. 179] Wasser, die von diesen Quellen versandt wurden: Pyrmonter, Egerer, Kreuzbrunnen usw. Die Ärzte waren oft mit ihm beschäftigt. Nur diesen Kuren, Reisen und Badezeiten schrieb er es zu, daß er arbeitsfähig blieb.
Auch in älteren Tagen ist er noch einige Male so schwer krank gewesen, daß man alle Hoffnung aufgab oder ihn bereits tot sagte, so im Januar 1801, im März und April 1805 und im Februar 1823. Er ist viele Wochen nicht aus dem Zimmer gekommen. Selbst wenn er nicht darniederlag, traute man ihm gewöhnlich keine lange Lebensdauer mehr zu. Die beste Kennerin seiner Zustände, Christiane, dachte um 1800, man müsse ihn seine letzten Jahre noch recht pflegen und schonen. „Goethe ist schon wieder krank gewesen“ meldete im März 1806 ihr Bruder Vulpius einem Hausfreunde; „monatlich kommt sein Übel zurück und macht ihn sehr mürbe; es sind böse Hämorrhoidalzufälle.“ Und der mißgünstige Friedrich Schlegel sagte 1803 „kalt-grinsend“ zu Öhlenschläger: „Der alte Kerl hat faule Nieren und wird’s nicht lange mehr machen.“
Zu diesen Krankheiten kam bei ihm eine beständige geistige und leibliche überfeine Empfindlichkeit. Das Wort „sinnlich“ hat er viel gebraucht, weil er selber in der eigentlichen Bedeutung des Wortes sehr sinnlich war; d. h. seine Sinne waren alle feinfühlend, kräftig auf Reize wiederwirkend. Das ist ein physischer Grund seiner genialen poetischen Leistungen; es war ihm aber im Leben oft recht unbequem. Eckermann drückte am 20. Dezember 1829 seine Verwunderung aus, daß man[S. 180] bei ausgezeichneten Talenten, besonders bei Poeten, so häufig eine schwächliche Konstitution finde; Goethe erwiderte:
Das Außerordentliche, was solche Menschen leisten, setzt eine sehr zarte Organisation voraus, damit sie seltener Empfindungen fähig sein und die Stimme der Himmlischen vernehmen mögen. Nun ist eine solche Organisation im Konflikt mit der Welt und den Elementen leicht gestört und verletzt, und wer nicht, wie Voltaire, mit großer Sensibilität eine außerordentliche Zähigkeit verbindet, ist leicht einer fortgesetzten Kränklichkeit unterworfen.
Vor allem brauchte er Licht und Wärme; den Winter haßte er. Den Dezember und Januar nannte der junge Voß 1804 „Goethes Faullenzermonate“: „Er kränkelt da fast jedes Jahr, ohne eben krank zu sein.“ Und 1813, Ende Oktober, just nach der Schlacht bei Leipzig, schrieb die Gräfin O’Donell aus Wien an ihren weimarischen Freund, er solle nun schon anfangen, sich in Baumwolle einzuwickeln. Goethe selber fand die stärksten Ausdrücke für seinen Abscheu gegen die kurzen, dunkeln Tage, die niederhängenden Wolken und das Schlackerwetter. Im Dezember 1803, nach Herders Tode, erklärte er, er begreife recht gut, daß Heinrich III. von Frankreich den Herzog von Guise erschießen ließ, bloß weil es fatales Wetter war, und er beneide Herdern, weil er jetzt begraben werde. Der 21. Dezember war ihm ein Festtag, an dem er ausrief: „Heute feiern wir die Wiedergeburt der Sonne!“ Italien liebte er wegen seiner Fülle des Lichts und seiner warmen Luft; es war ihm, als ob er hier geboren und aufgewachsen wäre „und[S. 181] nun von einer Grönlandsfahrt, von einem Walfischfange zurückkäme.“ Nur mit Schaudern dachte er an die norddeutsche Heimat mit ihren grauen, tiefen Wolken und naßkalten Winden, die uns immer wieder in die Stube zwingen.
In seinen letzten Lebensjahren konnte er zwar recht lange in geschlossener und überheizter Zimmerluft aushalten, aber sonst gehörte reine Luft zu den Bedingungen seines Wohlbefindens. Schiller mußte faule Äpfel in der Schublade seines Arbeitstisches haben; Goethe bekam sogleich eine Übelkeit, als er an diesem Tische saß, ohne dessen eigentümlichen Inhalt zu ahnen. „Eine Luft, die Schillern wohltätig war, wirkte auf mich wie Gift.“ Schiller, Karl August, Knebel und fast alle andern Freunde rauchten; Goethe litt sogleich, wenn er in einem Zimmer sein mußte, wo Tabak und Pfeifen dünsteten. Seine Christiane stellte einmal als sparsame Hausmutter Schweine in einen Stall: sie mußten abgeschafft werden, sobald Goethe den Geruch merkte. Sein Geschmackssinn war ebenso fein, wie sein Geruch. Vom Tee sagte er, daß er wie Gift auf ihn wirke, und ebenso nahm er sich vor dem Kaffee in acht und warnte Andere davor. Knoblauch übte nach seinem eigenen Ausdruck „selbst in der geringsten Dosis höchst gewaltsame Wirkungen“ auf ihn aus. Auch viele Sorten Wein konnte er nicht vertragen oder er lehnte sie von vornherein als Gift ab. Ähnlich ging es ihm mit dem Biere. Dr. Vogel, sein letzter Arzt, hat uns berichtet, daß er ebenso gegen Medizin ungewöhnlich empfänglich und empfindlich war, so daß ihm schwächere[S. 182] Dosen verschrieben werden mußten, als sonst üblich waren.
Namentlich aber richtete sich sein Befinden auch nach dem Barometer; bei hohem Barometerstande fühlte er sich am wohlsten; stand es niedrig, so war ihm sehr schwer, anders als mißmutig und untätig zu sein. Körperliche Schmerzen griffen ihn sehr an; er fürchtete sie, während er den Tod gar nicht fürchtete. Gar nicht leiden konnte er es, wenn die Leute nach seinem Befinden fragten oder etwa sagten, er sähe wohler aus als das letztemal; er mochte über seine Gesundheitszustände nicht sprechen, außer zum Arzt.
**
*
Trotz alledem waren sowohl die leiblichen wie die geistigen Leistungen Goethes bis in’s höchste Alter hinein bewunderungswürdige. Seinen Schwächen müssen also größere Kräfte gegenübergestanden haben; seine Lebensweise muß im Ganzen gut gewesen sein, zumal da er mit den Jahren eher gesünder als kränklicher wurde.
Von Haus aus besaß er zwei große Hülfen zur Gesundheit und Arbeit: einen vortrefflichen Appetit und einen guten Schlaf. Was den Schlaf angeht, so machte es ihm nicht viel aus, ob er dabei lag oder saß, angekleidet oder ausgezogen, im eigenen Bett oder anderwärts war. Auch eine Fülle von Blutleben trug zu seiner Gesundheit viel bei; noch im Alter schienen dem Arzte Aderlässe notwendig; Hufeland, der zehn Jahre lang sein Arzt war, bezeichnete die Produktivität als den Grundcharakter auch seines körperlichen Lebens.
**
*
[S. 183]
Aber auch seine gesundheitlichen Ansichten und Gewohnheiten waren trotz aller Sorglosigkeit besser, als man für jene Zeit voraussetzen darf. Zuerst wertete er die Gesundheit und Strapazentüchtigkeit höher als andere Geistesarbeiter um ihn herum. Schon als Student wußte er, daß man den Körper um der Seele willen pflegen muß. Als ein junger Freund ihm seine Not klagte und über Heiraten und andere Dinge beraten sein wollte, antwortete Goethe mit der Frage: „Wie steht’s mit Ihrer Gesundheit?“ und fuhr fort: „Ich bitte Sie: sorgen Sie doch für diesen Leib mit anhaltender Treue! Die Seele muß nun einmal durch diese Augen sehen, und wenn sie trüb sind, so ist’s in der ganzen Welt Regenwetter.“ Der Einundzwanzigjährige sprach das schon aus eigener Erfahrung: „Es war eine Zeit, da mir die Welt so voll Dornen schien, als Ihnen jetzo. Der Himmelsarzt hat das Feuer des Lebens wieder in mir gestärkt, und Mut und Freude sind wieder da.“[22] Wieland entschuldigte seine dürren Beine mit dem Scherze, er sei noch aus der Zeit, wo die Genies ihre Kraft im Kopfe hatten; Goethe verlangte auch von Gelehrten und Beamten brauchbare Gliedmaßen und einen gesunden Körper. Daß Schiller so oft aussah, als würde er keine vierzehn Tage mehr leben, und daß er nicht das Rechte gegen seine Kränklichkeit tat, bedrückte ihn oft. Da lobte er sich Napoleon, der „vom brennenden Sande der syrischen Wüste bis zu den Schneefeldern von Moskau eine Unsumme von[S. 184] Märschen, Schlachten und Biwaks ertrug, der bei wenig Schlaf und wenig Nahrung sich der höchsten geistigen Tätigkeit hingab: wenn man bedenkt, was Der alles durchgemacht und ausgestanden!“ „Es gab zwar eine Zeit, wo man in Deutschland sich ein Genie als klein, schwach, wohl gar bucklig[23] dachte, allein ich lobe mir ein Genie, das den gehörigen Körper hat.“
Goethe hatte namentlich einen kräftigen Willen zur Gesundheit, und er selber schrieb diesem Willen große Wirkungen zu. „Es ist unglaublich,“ sagte er einmal, „wieviel der Geist zur Erhaltung des Körpers vermag.“
Ich leide oft an Beschwerden des Unterleibes, allein der geistige Wille und die Kräfte des oberen Teiles halten mich im Gange. Der Geist muß nur dem Körper nicht nachgeben! So arbeite ich bei hohem Barometerstande leichter als bei tiefem; da ich nun Dieses weiß, so suche ich bei tiefem Barometer durch größere Anstrengungen die nachteiligen Wirkungen aufzuheben, und es gelingt mir.
Ein andermal rühmte er an seinem Helden Napoleon, daß er die Pestkranken besucht habe, um ein Beispiel zu geben, daß man die Pest überwinden könne.
Und er hat recht! Ich kann aus meinem eigenen Leben ein Faktum erzählen, wie ich bei einem Faulfieber der Ansteckung unvermeidlich ausgesetzt war und wo ich bloß durch einen entschiedenen Willen die Krankheit von mir abwehrte.[S. 185] Es ist unglaublich, was in solchen Fällen der moralische Wille vermag. Er durchdringt gleichsam den Körper und setzt ihn in einen aktiven Zustand, der alle schädlichen Einflüsse zurückschlägt. Die Furcht dagegen ist ein Zustand träger Schwäche und Empfänglichkeit, wo es jedem Feinde leicht wird, von uns Besitz zu nehmen.
Als Sachsen-Weimar zum Großherzogtum erhoben war und die Huldigung des nunmehrigen Großherzogs bevorstand, war Goethe bettlägerig. Es schien unmöglich, daß er an jenem Palmsonntag 1816 an seinem Platze sein könne, aber Napoleons Ausspruch kam ihm in’s Gedächtnis: „L’empereur ne connaît autre maladie que la mort“, und er ließ an Hof sagen, wenn er nicht tot wäre, könne man auf ihn rechnen. Die Natur schien sich diesen tyrannischen Spruch zu Gemüte zu ziehen: er stand zur rechten Zeit an seinem Platze, rechts zunächst am Throne; er konnte auch noch bei Tafel allen Schuldigkeiten genug tun; dann zog er sich zurück, legte sich wieder in’s Bett und wartete auf einen neuen kategorischen Imperativ, der krank zu sein nicht gestattete.
Ein andermal schrieb Goethe einem starken Geiste sogar die Kraft zu, den Körper zu einer zweiten Jugend zu zwingen. Er sprach am 11. März 1828 mit Eckermann über einige bekannte alte Herren, denen im hohen Alter die nötige Willenskraft und jugendliche Beweglichkeit im Betriebe der bedeutendsten und mannigfaltigsten Geschäfte nicht zu fehlen schienen.
Solche Männer sind geniale Naturen, mit denen es eine eigene Bewandtnis hat; sie erleben eine wiederholte Pubertät, während andere Leute nur einmal jung sind.[S. 186] Jede Entelechie[24] nämlich ist ein Stück Ewigkeit, und die paar Jahre, die sie mit dem irdischen Körper verbunden ist, machen sie nicht alt. Ist diese Entelechie geringer Art, so wird sie während ihrer körperlichen Verdüsterung wenig Herrschaft ausüben; vielmehr wird der Körper vorherrschen, und wie er altert, wird sie ihn nicht halten und hindern. Ist aber die Entelechie mächtiger Art, wie es bei allen genialen Naturen der Fall ist, so wird sie bei ihrer belebenden Durchdringung des Körpers nicht allein auf dessen Organisation kräftigend und veredelnd einwirken, sondern sie wird auch bei ihrer geistigen Übermacht ihr Vorrecht einer ewigen Jugend fortwährend geltend zu machen suchen. Daher kommt es denn, daß wir bei vorzüglich begabten Menschen auch während ihres Alters immer noch frische Epochen besonderer Produktivität wahrnehmen; es scheint bei ihnen immer einmal wieder eine temporäre Verjüngung einzutreten.
Eine andere Art, wie der Geist auf den Körper einwirkt, berühren wir mit den Worten Leidenschaft und Ruhe, Lebenslust und Verbitterung. Goethe kannte Weltschmerz und Leidenschaftlichkeit an sich selber nur zu gut, aber gegen beide kämpfte er beständig an. Als 1830 Karl Augusts Witwe gestorben war, deren stets sich gleich bleibendes Wesen er oft lobte, kam er gegen Eckermann und Soret auf die berühmte Ninon de l’Enclos zu sprechen und pries ihren Gleichmut und ihre Lebenslust ohne verzehrende Leidenschaftlichkeit;[S. 187] bekanntlich blieb jene Ninon bis in ihr achtzigstes Jahr so jugendlich schön, daß sie Liebhaber anzog und beglückte.
**
*
Goethes Dienst an seiner Gesundheit ging also namentlich aus der von ihm gewollten Herrschaft des Geistes über den Körper hervor; zu diesem Dienst gehörten namentlich: Frühaufstehen, Bewegung und Abhärtung.
Im Hause des Kaiserlichen Rats Goethe wurden die Kinder verweichlicht; ihr Vater dachte fast nur an die geistige und gelehrte Erziehung. Kornelia Goethe verpimpelte, so daß sie als junge Frau vor jedem Winde oder Regen sich ängstlich im Hause hielt und auch bei der Arbeit nie kräftig zuzugreifen wagte. Auch ihr Bruder Wolfgang wurde vor dem abhärtenden Leben der Knaben, das sich auf den Straßen abspielt, behütet und war nie Das, was man unter einem richtigen Jungen versteht. Er wandelte also mit sechzehn Jahren als ein zarter Gelehrter herum. Dann als Student begann er mit der Abhärtung, und zwar unter dem Einfluß Rousseaus und mit arger Übertreibung. Daher rührte zum Teil seine Leipziger Krankheit; kalt Baden, hartes, schlecht bedecktes Lager nennt er selber unter den unvernünftig angewendeten Mitteln, der Natur nahe zu kommen.
In Straßburg fühlte er sich nach den langen Krankheitswochen, die er im Vaterhause eben ertragen hatte, als ein Genesender; aber eine zurückgebliebene übermäßige seelische Reizbarkeit brachte ihn oft aus dem Gleichgewicht.
[S. 188]
Ein starker Schall war mir zuwider; krankhafte Gegenstände erregten mir Ekel und Abscheu; besonders aber ängstigte mich ein Schwindel, der mich jedesmal befiel, wenn ich von einer Höhe herunterblickte. Allen diesen Mängeln suchte ich abzuhelfen, und zwar, weil ich keine Zeit verlieren wollte, auf eine etwas heftige Weise. Abends beim Zapfenstreich ging ich neben der Menge Trommeln her, deren gewaltsame Wirbel und Schläge das Herz im Busen hätte zersprengen mögen. Ich erstieg ganz allein den höchsten Gipfel des Münsterturms und saß in dem sogenannten Hals, unter dem Knopf oder der Krone, wie man’s nennt, wohl eine Viertelstunde lang, bis ich es wagte, wieder heraus in die freie Luft zu treten, wo man auf einer Platte, die kaum eine Elle ins Gevierte haben wird, ohne sich sonderlich anhalten zu können, stehend das unendliche Land vor sich sieht, indessen die nächsten Umgebungen und Zieraten die Kirche und Alles, worauf und worüber man steht, verbergen. Es ist völlig, als wenn man sich auf einer Montgolfière in die Luft erhoben sähe. Dergleichen Angst und Qual wiederholte ich so oft, bis der Eindruck mir ganz gleichgültig ward, und ich habe nachher bei Bergreisen und geologischen Studien, bei großen Bauten, wo ich mit den Zimmerleuten um die Wette über die freiliegenden Balken und über die Gesimse des Gebäudes herlief, ja in Rom, wo man eben dergleichen Wagstücke ausüben muß, um bedeutende Kunstwerke näher zu sehen, von jenen Vorübungen großen Vorteil gezogen. Die Anatomie war mir auch deshalb doppelt wert, weil sie mich den widerwärtigsten Anblick ertragen lehrte, indem sie meine Wißbegierde befriedigte. Und so besuchte ich auch das Klinikum des ältern Dr. Ehrmann, sowie die Lektionen der Entbindungskunst seines Sohnes in der doppelten Absicht, alle Zustände kennen zu lernen und mich von aller Apprehension gegen widerwärtige Dinge zu befreien. Ich habe es auch wirklich darin so weit gebracht, daß Nichts dergleichen mich jemals aus der Fassung setzen konnte. Aber nicht allein gegen diese sinnlichen Eindrücke, sondern auch gegen die Anfechtungen[S. 189] der Einbildungskraft suchte ich mich zu stählen. Die ahnungs- und schauervollen Eindrücke der Finsternis, der Kirchhöfe, einsamer Örter, nächtlicher Kirchen und Kapellen, und was hiermit verwandt sein mag, wußte ich mir ebenfalls gleichgültig zu machen; und auch darin brachte ich es so weit, daß mir Tag und Nacht und jedes Lokal völlig gleich war.
In körperlichen Übungen war Goethe mit zwanzig Jahren noch sehr zurückgeblieben, schon weil er das Landleben nicht kennen gelernt hatte. Er konnte nicht schwimmen oder rudern oder ein Boot lenken, auch nicht Schlittschuh laufen. Wir wissen von keiner erheblichen Fußwanderung in seinen drei Leipziger Jahren und nur von einer einzigen kleinen Reise. Ehe er zur Universität gesandt wurde, hat er ein wenig Fechten und ein wenig Reiten gelernt. In Leipzig machte er ein paar Male den Sonntagsreiter. In Straßburg dagegen fing er an, größere Reisen zu Pferde zu machen. Und jetzt schaute er sich auch wirklich in dem Lande um, wohin ihn das Schicksal gesetzt hatte. „Die Straßburger sind leidenschaftliche Spaziergänger“ erzählt Goethe in seinen Erinnerungen; jedenfalls betrieb er selber jetzt das Spazieren, Herumstreifen und weite Wandern in viel höherem Maße als zuvor. Und Das setzte er fort, als er nach Abschluß seiner Studien wieder in der Vaterstadt lebte, jetzt als Rechtsanwalt und Dichter. Die Freunde in Darmstadt und im Rheingau nannten ihn geradezu den Wanderer, weil er in großen Fußmärschen die weitere Umgebung der Vaterstadt durchforschte und seine Geistesverwandten aufsuchte. Nach dem Wetter fragte er wenig; für den Straßenkot fand er die gelehrte Formel[S. 190] „Deukalions Flutschlamm“, und noch freundlicher klingt die andre Umschreibung:
Dies ganze Gedicht ‚Wanderers Sturmlied‘ ist ein Gesang der Abhärtung:
Jetzt lernte er auch, ein Schifflein auf dem Flusse zu lenken, und namentlich wurde er ein sehr eifriger Schlittschuhläufer. Dabei spielte Klopstocks Begeisterung für dies gesundeste Vergnügen mit. Dieser angesehenste Dichter der damaligen Zeit ermahnte alle seine Freunde unter den deutschen Gelehrten und Schriftstellern zu einem frischeren Leben in freier Natur und pries ihnen unermüdlich das Baden und Schwimmen, Reiten und Eislaufen an: Dinge, die damals eigentlich gegen die Würde eines gelehrten Mannes gingen.
In Weimar traf Goethe auf einen achtzehnjährigen Fürsten, dessen Leidenschaft das Leben im Freien, das Reisen, Jagen und Hetzen war, der sich in weiten Bergwäldern hundertmal wohler fühlte als in prächtigen[S. 191] Zimmern und der als ein von Geburt Schwächlicher und Kränklicher nur durch Abhärtung und Wagemut ein lebenswertes Leben gewinnen konnte. Goethe war bereits ruhiger und reifer, aber die gleiche Gesinnung, das gleiche Verlangen trug auch er in der Brust – die Egmont-Gesinnung – und so stärkten sich der Fürst und sein neuer Freund aneinander. Man kannte in Weimar das Schlittschuhlaufen noch nicht; Goethe und der Husaren-Rittmeister Friedrich v. Lichtenberg führten es jetzt ein, unterrichteten darin, und nun verbrachte Goethe viele Winterstunden unter den Eisläufern und Schlittenfahrern. Viel wichtiger aber war, daß ihn draußen im Ilmtal ein zum Verkauf ausgebotener Berggarten, in dem auch ein altes Häuschen stand, anlockte; er kaufte dies verwahrloste Besitztum, richtete es als seine Wohnung ein und hatte noch lange Zeit daran zu verbessern; z. B. baute er an der Südseite einen Altan vor seine Wohnzimmer. So ward er immer wieder veranlaßt, auch wenn ihn der eigene Wunsch nicht antrieb, sich im Freien zu bewegen.
Er vertraute sich aber auch sonst wie ein Sohn der Mutter Natur an, lebte so viel, als irgend möglich, im Freien und betrieb so viele körperliche Übungen, wie irgend die Zeit erlaubte. In seinem achtundzwanzigsten Jahre erstieg er die Höhe seiner leiblichen Kraft und Gewandtheit. Sein Körper war sehr mager und sehr sehnig; die beständige Übung machte ihn immer geschmeidiger und ausdauernder. Am 23. April 1777 schrieb er als einzige Eintragung in sein Tagebuch: „Körperliche Übungen allerlei Art“, aber das ganze[S. 192] Jahr betrieb er solche körperlichen Übungen fleißig. Das Tanzen, Reiten, Wandern, Fischen, Jagen, Scheibenschießen, Baden, Eislaufen, Schlittenfahren, Fechten, Kegeln, sie wechselten nach der Jahreszeit miteinander ab. Beim Kegeln ist an das Wurfspiel nach der Trou-Madame zu denken, die im ‚Stern‘ stand. Das Wandern war zumeist ein vergnügtes Herumstreifen mit Anderen, zuweilen ein einsames, scharfes Marschieren zu bestimmtem Ziele; z. B. ging er an einem Juli-Abend von halb Sechs bis halb Zehn nach Kochberg. Im Reiten brachte er es zu viel besseren Leistungen als früher: von Leipzig bis Weimar ritt er von früh halb Sieben bis mittags um Drei; von Eisenach bis Weimar von früh Fünf bis halb Zwölf, obwohl er eine starke Stunde in Erfurt beim Statthalter saß; von Kochberg bis Weimar in zwei Stunden fünf Minuten. Das machten ihm bei dem damaligen Zustande der Straßen nicht Viele nach! Auch junge Pferde zuzureiten, betrieb er als Vergnügen. Am 15. Mai begann er das Schwimmen zu erlernen, zunächst mit einem Schwimmwams und nur im Floßgraben.
Im Winter war der Eislauf schon ein allgemeines Vergnügen der Hofgesellschaft geworden. Auch die Herzogin zeigte sich als eine geschickte Schlittschuhläuferin; sonst ließen sich die Damen meist in Stuhlschlitten von den Kavalieren herumfahren. Der Herzog liebte es, auf dem Eise mit einigen Freunden fröhliche Tafel zu halten, und zuweilen wurde die Lust abends bei Fackeln, Laternen und Feuerwerk fortgesetzt, und die Musikanten spielten auf zum Fackeltanz. Unfälle erhöhten[S. 193] manchmal die Aufregung; Goethe selber brach am 17. Januar ein, kümmerte sich aber nicht um Schreck und nasse Kleider, ging abends auf die Redoute, am andern Morgen wieder auf’s Eis, aß dort mit dem Hofe, tollte weiter herum, bis er abends an der Tafel der Herzogin-Mutter plötzlich ohnmächtig hinsank. Die nächsten Tage aber war er wieder auf dem Eise. Wieland, der an den schönsten Sommerabenden den Mantel nicht zu Hause ließ, schalt auf solche gewaltsamen Abhärtungsversuche:
Goethe leidet zeither immer an Zahnschmerz comme un damné,
schrieb er im Oktober an Merck:
aber er macht’s auch danach mordiable. „Man muß die bestialische Natur brutalisieren“ pflegte der alte Mordiable v. Bassenheim zu Mainz zu sagen; Goethe und der Herzog sind auch von diesem Glauben, aber sie befinden sich meist so übel dabei, daß ich keine Versuchung kriege, ihr Proselyt zu werden.
Ein neues Mittel der Abhärtung und der gewollten Verbindung mit der Natur war für Goethe der neue Altan: hier konnte er im Freien schlafen. Am 2. Mai war abends ein herrliches Gewitter, das den ganzen südlichen Himmel überleuchtete. Goethe sah vom Altan aus zu, obwohl die Frösche von der Ilm aus gar schrill den kommenden Regen ihm in die Ohren verkündeten. Schließlich wurde er müde, wickelte sich in seinen blauen Mantel, suchte sich ein Fleckchen, das der Regen nicht erreichen konnte, und schlummerte bei[S. 194] Blitz, Donner und Regen ein. Als er später das noch nicht abgekühlte Schlafzimmer aufsuchte, war’s ihm fatal in der Schwüle, und von nun an schlief er öfters entweder im Altanstübchen bei geöffneter Türe oder auf dem Altan selbst; einen Strohsack hatte er unter, seinen Mantel über sich. Und es war ihm die größte Augenlust, wenn er in der Nacht aufwachte und ein neues Stück Sternhimmel über ihm strahlte, oder wenn sich die erste Morgenhelle mit dem Mondschein zu einem seltsamen fahlen Lichte vermischte.[25]
Manche Bemerkungen in Goethes Tagebüchern und Briefen zeigen uns, wie bewußt er solche körperlichen Übungen trieb. Kein Wunder also, daß er im Marschieren und Reiten bald Erstaunliches leistete! Einmal ritt er mit Karl August in acht Stunden von Leipzig nach Weimar, was bei dem damaligen Zustande[S. 195] der Straßen eine große Leistung war. Als es am 3. Mai 1776 in Ilmenau brannte, ritt Goethe hinauf, und am nächsten Tage schrieb er seinem Fürsten: „Ich bin keine sechs Stunden geritten, also wie sich’s gehört. Des Husars Pferd wollte nicht mehr fort gegen das Ende, und hinter Büchenloh auch meins nicht mehr.“ In der ersten weimarischen Zeit wurden alle Reisen zu Pferde gemacht; zumeist war der Herzog sein Gefährte, und Dieser liebte die allerschärfste Gangart. Am deutlichsten bewies Goethe Abhärtung und Wagemut durch seine Winterreisen in die Gebirge, die zu besuchen damals auch im Sommer gar nicht üblich war. Ende November 1777 ritt er von Weimar über den Ettersberg dem Harze zu, den er noch nicht kannte. Mitten im Schloßenwetter überkommt ihn reine Ruhe der Seele. Kein Unwetter, kein böser Weg, kein[S. 196] schlechtes Quartier schreckt ihn zurück. Am 10. Dezember bestieg er den Brocken, damals ein Heldenstück, das Jedermann, selbst der Förster im Torfhause, namentlich des dichten Nebels wegen, für unmöglich erklärte. Noch mehr wagte er 1779 in der Schweiz, als er im November mit Karl August in das Gebiet des Montblanc, der Furca und des Gotthard eindrang. Die Genfer Sofamenschen waren arg entrüstet, als sie von solchem Gott versuchenden Vorhaben hörten. Im Spätjahr 1792, bei der törichten Kampagne der deutschen Fürsten gegen die französischen Revolutionäre, bewies Goethe seine Strapazentüchtigkeit noch einmal mit bestem Humor. „Das Wetter war furchtbarer als je“ erzählt er selber,
die Unbequemlichkeit, ja das Unheil stiegen auf’s höchste; die Zelte durchnäßt, sonst kein Schirm, kein Obdach ... Konnte man sich auch unter einem Zelte bergen, so war doch an keine Ruhestelle zu denken. Wie sehnte man sich nicht nach Stroh, ja nach irgend einem Brettstück, und zuletzt blieb doch nichts übrig, als sich auf den kalten, feuchten Boden niederzulegen! Nun hatte ich aber schon in vorigen gleichen Fällen mir ein praktisches Hülfsmittel ersonnen, wie solche Not zu überdauern sei: ich stand nämlich so lange auf den Füßen, bis die Knie zusammenbrachen; dann setzte ich mich auf einen Feldstuhl, wo ich hartnäckig verweilte, bis ich niederzusinken glaubte, da denn jede Stelle, wo man sich horizontal ausstrecken konnte, höchst willkommen war. Wie also Hunger das beste Gewürz bleibt, so wird Müdigkeit der herrlichste Schlaftrunk sein.
Wie die Herberge, so war damals auch die Nahrung oft die mangelhafteste.
Mitten im Regen ermangelten wir sogar des Wassers, und einige Teiche waren schon durch eingesunkene Pferde[S. 197] verunreinigt ... Ich wußte nicht, was es heißen sollte, als ich meinen treuen Zögling, Diener und Gefährten von dem Leder des Reisewagens das zusammengeflossene Regenwasser sehr emsig schöpfen sah; er bekannte, daß es zur Schokolade bestimmt sei, davon er glücklicherweise einen Vorrat mitgebracht hatte. Ja, was mehr ist, ich habe aus den Fußtapfen der Pferde schöpfen sehen, um einen unerträglichen Durst zu stillen.
Als es noch schlimmer kam, als er nur auf einem Krankenwagen vorwärts kommen konnte, half wieder die Macht des Gemütes.
Zwischen ansteckende Kranke gepackt, wußte ich von keiner Apprehension. Der Mensch, wenn er sich getreu bleibt, findet zu jedem Zustande eine heilsame Maxime. Mir stellte sich, sobald die Gefahr groß ward, der blindeste Fatalismus zur Hand, und ich habe bemerkt, daß Menschen, die ein durchaus gefährliches Metier treiben, sich durch denselben Glauben gestählt und gestärkt fühlen.
Es kamen dann Jahre, wo er es sich bequemer machte; er brauchte dann Anlässe und Verführungen, ehe er seine Zimmer verließ. So bewegte er sich in alten Tagen wenig um der Bewegung willen, aber da das Aufsuchen von seltenen Gesteinen, die Vermehrung seines geologischen und mineralogischen Wissens ihm die größte Freude war, so kam er auch als Greis noch oft zu Fußwanderungen, zum Bergsteigen, zum Klettern, zum Beklopfen und Abschlagen der Steine in künstlichen Stellungen. Was manchem Andern die Jagd ist, eine Gelegenheit zur Erheiterung, Erfrischung, Anstrengung und Abhärtung, war ihm das Steinsuchen.
Bis in’s hohe Alter hinein zeigte er sich gelegentlich wetterhart und bewegungslustig. Noch mit[S. 198] vierundsechzig Jahren erwähnt er in einem Briefe an Christiane, daß er am Tage vorher sechs Stunden zu Pferde gewesen und daß es ihm gut bekommen sei. Noch als Achtundsiebzigjähriger setzte er sich Ende September an der Straße nach Berka zum Frühstück auf die Ecke eines Steinhaufens, der vom Frühtau noch feucht war. Das mache ihm nichts, antwortete er ruhig dem besorgten Eckermann. Und immer wieder nahm er sich auch in seinen letzten Jahren vor, recht viel im Freien zu sein. Sie wollten jede Woche einen Tag zu einem großen Ausfluge anwenden, meinte er zu dem eben genannten Begleiter, und als er einige Tage später mit ihm an der Hottelstedter Ecke des Ettersberges stand, die wegen ihrer weiten Aussicht von Weimar und Erfurt aus gern aufgesucht wird, meinte er:
Wir wollen künftig öfter hierher kommen. Man verschrumpft in dem engen Hauswesen. Hier fühlt man sich groß und frei wie die Natur, die man vor Augen hat, und wie man eigentlich immer sein sollte.
Im Greisenalter fuhr er gewöhnlich spazieren, aber so lange es ging, schritt er weite Wege zu Fuß, immer ohne Stock. Beim Gehen durch die Felder schlenderte er die beiden Hände fast überzwerch und berief sich dafür auf die Tiere, die ja auch die Vorderfüße überzwerch setzten.
An seinem Geburtstage 1831, als er zweiundachtzig Jahre vollendete, sehen wir ihn zum letzten Male als den „Wanderer.“ Es hatte ihn noch einmal nach Ilmenau gezogen. Am frühen Morgen fuhr er mit dem Berginspektor Mahr über Gabelbach auf den[S. 199] Gickelhahn. Auf dem Rondell erquickte er sich an der weiten Aussicht und gedachte der Gefährten, die einst mit ihm hier gestanden. „Dann“, so erzählte nachher sein Begleiter, „schritt er rüstig durch die auf der Kuppe des Berges ziemlich hochstehenden Heidelbeersträucher hindurch bis zu dem wohlbekannten zweistöckigen Jagdhause, welches aus Zimmerholz und Bretterbeschlag besteht. Eine steile Treppe führt in den oberen Teil; ich erbot mich, ihn zu führen, er aber lehnte es mit jugendlicher Munterkeit ab.“
Was er suchte, war das am 6. September 1780 von ihm auf die südliche Innenwand des Jagdhäuschens geschriebene Gedicht: Über allen Wipfeln ist Ruh. „Er überlas die wenigen Verse, und Tränen flossen über seine Wangen. Ganz langsam zog er sein schneeweißes Taschentuch aus seinem dunkelbraunen Tuchrock, trocknete sich die Tränen und sprach in sanftem, wehmütigem Ton: »Ja, warte nur, balde ruhest du auch!«“
**
*
Er war zeitlebens ein Freund des frühen Morgens, in großem Gegensatz zu Schiller; bei der Lampe hat er selten gearbeitet; in der Regel ward seine Arbeit an dem recht langen Vormittage getan. Mit gutem Grunde lauten die ersten Verse in seinen gesammelten Gedichten:
[S. 200]
Im Alter begann er den frühen Tag allerdings im Arbeitszimmer, aber in jungen Jahren holte er sich manches Mal zuerst einen Trunk Morgenluft aus der freien Natur:
Daß er sich sehr gerade hielt, ist schon gesagt; die Schultern zog er straff zurück; oft empfahl er seine frühzeitig angenommene Gewohnheit, die Hände hinter dem Rücken zu vereinigen. Riemer berichtet, August Goethe habe nach Lehre und Vorbild des Vaters eine solche Haltung und Ausbildung des Körpers und besonders eine solche Breite und Ausbildung der Brust gewonnen, daß er den antiken Musterbildern eines Antonius oder Meleager gleich erschien und daß seine sonore Stimme den größten gefüllten Raum leicht durchdringen konnte.
Es hat kaum einen Geistesarbeiter gegeben, der so wenig gesessen hat wie Goethe. Selbst im Zimmer saß er sehr wenig. Auch wenn er Gäste hatte, wußte er es einzurichten, daß sie bald in’s Stehen und Gehen kamen; er ging mit ihnen im Garten auf und ab oder stand mit ihnen in einer Fensternische oder im Zimmer vor seinen Kunstschätzen. Und ebenso brachte er seine poetischen und wissenschaftlichen Arbeiten, seinen Briefwechsel[S. 201] usw. im Stehen und Gehen fertig, da ihm das Diktieren so sehr zur Natur geworden war wie uns Andern das Schreiben. Schon 1780 bemerkte er: „Was ich Guts finde an Überlegungen, Gedanken, ja sogar Ausdruck, kommt mir meist im Gehn; sitzend bin ich zu nichts aufgelegt“ und beschloß, „darum das Diktieren weiter zu treiben.“ Auch die Hände konnte er schwer ruhig halten, darin im Alter noch den Knaben gleich. Er zog entweder das zusammengedrehte Taschentuch durch die Hand, oder drehte ein Papierstreifchen, oder knüpfte an Bindfäden, oder hantierte mit der Lichtputzschere. War er bei Frau Schopenhauer oder in Jena bei Frommanns oder Knebels in Gesellschaft geladen, so stellte man ihm einen Tisch mit Zeichengelegenheit hin, und oft begleitete er die Erzählung oder Vorlesung eines Andern mit raschen zugehörigen Bildern.
**
*
Soviel Goethe auch den menschlichen Körper studierte, so hütete er sich doch, in die Aufgaben des Arztes einzugreifen. Zwar schrieb er einmal an Meyer: „Man ist übel daran, daß man den Ärzten nicht recht vertraut und doch ohne sie sich gar nicht zu helfen weiß.“ Aber er lobte doch seine Ärzte gern. Der Satz, daß die Ärzte unseres Lebens Dauer um keinen Tag verlängern können, gehörte zu seinem religiösen Glauben; „wir leben, so lange es Gott bestimmt hat, aber es ist ein großer Unterschied, ob wir jämmerlich wie arme Hunde leben, oder wohl und frisch, und darauf vermag ein kluger Arzt viel.“ So sprach er 1827, und drei[S. 202] Jahre später, als er sich beständig wohl befand: „Daß ich mich jetzt so gut halte, verdanke ich Vogel; Vogel ist zum Arzt wie geboren und überhaupt einer der genialsten Menschen.“ Dr. Vogel aber erzählte von ihm:
Die echten Jünger der Heilkunst achtete Goethe ungemein hoch; er war ein dankbarer und folgsamer Kranker. Konsultationen mehrerer Ärzte betrachtete er mit Mißtrauen. Er sprach gern mit dem Arzt über die Krankheit und verstand sehr viel davon.
Ein wenig neigte er zu Dem, was wir jetzt als Naturheilmethode kennen; in einem Briefe aus Lauchstädt (1805) rühmt er zuerst „das auf Starkens Anraten“ gebrauchte „Tusch-Bad“ und das auf Reils Empfehlung genommene Eger-Wasser. Er fährt dann fort:
An Reil habe ich einen sehr bedeutenden Mann kennen lernen; er beobachtete meine Übel vierzehn Tage, ohne ein Rezept zu verschreiben, als etwa eins, das er selbst für palliativ erklärte. Tröstlich kann es für mich sein, daß er gar keine Achtung vor meinen Gebrechen haben will und versichert, Das werde sich alles ohne großen medizinischen Aufwand wiederherstellen.
Schon vorher war ihm als Hauptkur das Reiten empfohlen, und er hatte selber bestätigt, daß es ihm gut gehe, solange er täglich reite. Ebenso wußte Goethe, daß in den Bädern, die er regelmäßig im Sommer besuchte, nicht nur von ihren Quellen heilende Kraft ausging, sondern mehr noch von dem erfrischenden, geselligen Leben in der Natur, von der größeren Vertraulichkeit und Unvorsichtigkeit im Umgange mit ihr. „Übrigens mutet man sich hier viel mehr zu als zu Hause“ heißt es in einem Karlsbader Briefe an Christiane.
[S. 203]
Man steht um fünf Uhr auf, geht bei jedem Wetter an den Brunnen, spaziert, steigt Berge, zieht sich an, macht Aufwartung, geht zu Gaste und sonst in Gesellschaft. Man hütet sich weder vor Nässe, noch Wind, noch Zug und befindet sich ganz wohl dabei.
Es ist kaum nötig zu sagen, daß er als alter Herr die jungen Leute zu frischer Betätigung ermunterte und ihre neuen Übungen mit Vergnügen sah. Der badische Forstmeister v. Drais erfand 1817 eine Laufmaschine, die aus zwei hintereinander angebrachten Rädern und einem darüber befestigten Sitzbalken bestand; man konnte darauf fahren, wenn man sie durch Laufen in Bewegung gesetzt hatte oder wenn es bergab ging; Goethe sah im Januar 1818 Jenaischen Studenten zu, die sich im „Paradiese“ an der Saale auf solchen Laufrädern versuchten. Wichtiger war das Turnen, das gleich nach den Befreiungskriegen aufkam. Goethe sprach 1817 einmal den jungen Krummacher an, des Parabeldichters Sohn, als Dieser mit der schwarz-rot-goldenen Mütze vom Turnplatze kam, und er sagte:
Die Turnerei halte ich wert, denn sie stärkt und erfreut nicht nur den jugendlichen Körper, sondern ermutigt und kräftigt auch Seele und Geist gegen jede Verweichlichung.
Es war ihm dann sehr schmerzlich, daß Turnen und Politik miteinander verquickt, daß deswegen die Turnanstalten von den Regierungen sehr eingeschränkt oder verboten wurden.
Ich hoffe, daß man die Turnanstalten wiederherstelle, denn unsere deutsche Jugend bedarf es, besonders die studierende, der bei dem vielen geistigen und gelehrten Treiben alles körperliche Gegengewicht fehlt und somit jede nötige Tatkraft.
[S. 204]
Die gleiche Gesinnung hat Goethe in seinen alten Tagen oft ausgesprochen. Er schalt auf die Engbrüstigen und die Brillenträger. Die frischen jungen Engländer gefielen ihm viel besser als die jungen Deutschen. Er billigte es keineswegs, daß von den künftigen Beamten so viele theoretische Kenntnisse verlangt wurden, bei deren Aneignung die jungen Leute vor der Zeit körperlich und geistig geschwächt wurden. „Es fehlt ihnen die nötige geistige, wie körperliche Energie, die bei einem tüchtigen Auftreten im praktischen Verkehr ganz unerläßlich ist.“
„Es geht uns alten Europäern übrigens mehr oder weniger allen herzlich schlecht“ meinte er ein andermal, „unsere Zustände sind viel zu künstlich und kompliziert ... Man sollte oft wünschen, auf einer der Südsee-Inseln als sogenannter Wilder geboren zu sein, um nur einmal das menschliche Dasein ohne falschen Beigeschmack durchaus rein zu genießen.“
[22] An Trapp, 28. Juli 1770.
[23] Lichtenberg und Moses Mendelssohn waren bucklig, Schleiermacher leicht verwachsen.
[24] Eine Entelechie, ein Am-Ziele-sein, ist nach Aristoteles die Seele als dasjenige Hinzutretende, wodurch der Körper, der an sich nur die Fähigkeit, zu leben und zu empfinden, besitzt, wirklich lebt und empfindet, solange es mit ihm verbunden ist. Als Beispiel denke man sich eine Wasserleitung, die erst durch das hineinfließende Wasser Sinn und Vollständigkeit erlangt.
[25] Ich habe die letzten Seiten aus einem besonderen Grunde meinem Buche ‚Goethes Leben im Garten am Stern‘ entnommen. Über Goethes Leipziger und Frankfurter Krankheit ist von Medizinern und Philologen Verschiedenes gemutmaßt, da die vorliegenden Mitteilungen nicht eben sicher auf ein bestimmtes Leiden schließen lassen. B. Fränkel in Berlin hat in der ‚Zeitschrift für Tuberkulose‘ (1910) als „des jungen Goethe schwere Krankheit“: „Tuberkulose, keine Syphilis“ aufgestellt. Um nun zu zeigen, wodurch Goethe sein schweres Lungenleiden überwunden habe, druckte Fränkel die eben mitgeteilten Seiten aus meinem Buche, die ich ohne jeden Gedanken an solche Krankheit und Kur geschrieben, wörtlich ab und fügte hinzu: „Der aufmerksame Leser wird nicht verkennen, daß in dieser Abhärtungsmethode Goethes Grundzüge der modernen Phtisiotherapie enthalten sind, z. B. das Wohnen im Gartenhaus, das Arbeiten und Schlafen im Freien usw. Vielleicht haben wir es ihnen zu verdanken, daß uns die Tuberkulose nicht, wie Dies von Schiller bekannt ist, auch das kostbare Leben Goethes verkürzte. Jedenfalls erkannte und betätigte das gleichzeitig beobachtende und intuitive Ingenium Goethes die Prinzipien, mit denen jetzt die Empirie der Ärzte die Tuberkulose zu heilen sucht.“ – –
Wir können diese Gesundung Goethes noch heute mit Augen sehen, wenn wir seine Bildnisse nacheinander betrachten. Ich meine diese Reihenfolge: Relief von Melchior 1774 – Zeichnung von Lips nach dem verlorenen Relief eines Schülers von Nahl 1774 – Schattenrisse in Ayrers Sammlung – Vorder- und Seitenansicht von May 1779 – Juel 1779 – Büsten von Klauer – Angelika Kauffmann 1787/88 – Lips 1791 – Bury 1800 – Jagemann 1817. Hier in diesem Buche kann ich nur einige davon zeigen.
[26] Venetianische Epigramme 1799.
[S. 205]
Goethe wuchs in einer Stadt auf, wo ein reichliches Essen an der Tagesordnung war: Frankfurt liegt in einem gesegneten Lande, und als ein Handels-Mittelpunkt hatte es die Mittel, seine Bürger auch mit den Erzeugnissen fremder Gegenden zu ernähren. Ob Wolfgang Goethe schon in seinen jungen Jahren im Essen und Trinken ein rechter Frankfurter war, wissen wir nicht. Als er im Sommer 1774 mit seinem Freunde Lavater reiste, fragte Dieser in den Wirtshäusern, wo man hielt, nach Himbeer-Essig, während Goethe überall sein Glas Wein trank, und als sie eines Morgens um Sieben zwischen Neuwied und Andernach in einem Kahne fuhren, vermerkte Lavater in seinem Tagebuche, Goethe verzehre jetzt schon sein Butterbrot „wie ein Wolf“ und sehe sich nach dem übrigen eingepackten Essen um. Im Übrigen ist uns ein starkes Essen oder Trinken Goethes, ein Wertlegen auf die Mahlzeiten erst nach seiner Heimkehr aus Italien, nach seiner Verbindung mit Christiane Vulpius bezeugt.
Danach allerdings war es das allgemeine Zeugnis seiner Gäste, daß er eine recht gute Tafel führe. Einige erzählen, daß sie bei ihm neue Speisen vorgesetzt bekamen, mit denen sie noch nicht umzugehen wußten, z. B. Kaviar oder Artischocken; Andere bewunderten seine Geschicklichkeit im Zerlegen des Bratens oder Geflügels oder seine[S. 206] allgemeine Kochverständigkeit oder seinen vortrefflichen Appetit. „Auch frisset er entsetzlich“ schrieb der karikierende Jean Paul einem Freunde. „Auf den Küchenzettel, den er gewöhnlich selbst angab, hatte die Anwesenheit von Gästen besonderen Einfluß“ berichtet der Maler Ernst Förster 1821.
Es gab außer der Suppe gewöhnlich drei, höchstens vier Schüsseln: Fleisch mit Gemüse (er aß sehr gern ein nach italienischer Kochkunst bereitetes Stuffato), dann gab es Fisch (Forellen liebte er zumeist), Braten (zumeist Geflügel oder Wild) und, wie er erklärte: wegen der Damen, eine Mehlspeise (Karlsbader Strudl). Er selbst zog der süßen Speise ein Stück englischen oder Schweizer Käse vor.
„Es war ungemein splendid: Gänseleberpastete, Hasen und dergleichen Gerichte“ bezeugt schon 1809 der Sprachforscher Wilhelm Grimm, und ebenso wunderte sich 1828 dessen hessischer Landsmann, der Baumeister Johann Heinrich Wolff, über die vielen guten Gerichte und über Goethes Leistungsfähigkeit im Essen und Trinken. „Unter anderem verzehrte er eine ungeheure Portion Gänsebraten und trank eine ganze Flasche Rotwein dazu.“ Im selben Jahr imponierte er auf der Dornburg einigen Studenten, als er ihnen den Salat eigenhändig zubereitete und dabei versicherte, er habe selber einen neuen Salat aus eingemachten Gurken erfunden.
„Man aß nach damaliger Zeit gut, nach jetziger einfach“ erzählte Jenny v. Gustedt 1885, als sie sich an die Mahlzeiten in Goethes Hause erinnerte.
Erst in den letzten Jahren hatte er einen Koch, vorher Haushälterinnen, mit denen er die Wirtschaft führte ohne[S. 207] Ottiliens [seiner Schwiegertochter] Hilfe. Er hatte kein Vertrauen in ihre wirtschaftlichen Talente und sagte wohl scherzend: Ich hatte mir so eine kochverständige Tochter gewünscht, und nun schickt mir der liebe Gott eine Thekla und Jungfrau von Orleans in’s Haus!
Dieser Übergang von einer untauglichen Köchin zu einem Koch, dem jungen Straube, steht in Goethes Tagebuch unter dem 10. Februar 1831 mit einem merkwürdigen Zusatze.
Vulpius[27] entließ die Köchin mit billiger Entschädigung. Von dieser Last befreit, konnt’ ich an bedeutende Arbeiten gehen; ich kann hoffen, die Epoche werde fruchtbringend sein.
So stark drückte der Vollender des ‚Faust‘ es aus, daß seine Leistung von einer guten Zubereitung der Speisen und von der hausväterlichen Zufriedenheit mit der Bewirtung der Gäste und Hausgenossen abhänge.
Aber wir dürfen die Rolle der Tafelfreuden in Goethes Leben nicht überschätzen: er entbehrte sie ebenso leicht, wie er sie gern genoß. Zu Mittag aß er auch deshalb stark, weil es fast die letzte Mahlzeit des langen Tages war. Denn Kaffee, auf den er von jungen Jahren an viel gescholten, bot er wohl den Gästen an, trank ihn aber nicht mit. Nur als Greis trank er frühmorgens Milchkaffee; in früheren Zeiten hatte er Wassersuppe oder Schokolade vorgezogen. Abends hatte er eine dem englischen Fünf-Uhr-Tee entsprechende leichte Mahlzeit; er nahm dann Wein und ein Franzbrot[S. 208] zu sich. Da der Tee zu stark auf ihn wirkte, trank er auch bei Schiller statt dessen Punsch, den er sich aus Arrak und einer Zitrone selber bereitete. Das war sein Abschluß; in späterer Stunde ließ er wohl für Riemer, Eckermann, oder wer sonst da war, decken; „er saß dabei, schenkte ein, putzte die Lichter und plauderte, rührte aber keinen Bissen an.“ Felix Mendelssohn hebt es 1821 als eine Merkwürdigkeit hervor, daß Goethe mit ihm zu Abend aß. Selbst wenn er eine Einladung für den Abend annahm, fügte er wohl hinzu: „Erlauben Sie zugleich mit gastlicher Freimütigkeit zu eröffnen, daß ich niemals gewohnt war, zur Nacht zu speisen.“ (So 1814 in Frankfurt an Simon Moritz v. Bethmann.)
Wenn Goethe allein war, da war von vielen Gängen keine Rede. Im Gartenhause aß er, was Frau v. Stein gerade geschickt hatte, oder ließ sich von seinem Diener einen Eierkuchen backen; manchmal, wenn nichts da war, ging er auch hungrig zu Bett. Später hat er namentlich in seiner jenaischen Zuflucht erbärmliche Kost oft wochenlang ausgehalten. „Ich übertreibe nicht, wenn ich sage, daß ich vier, fünf Tage bloß von Zervelatwurst und rotem Wein gelebt;“ solche Klagen bekam Christiane von Jena aus oft zu hören.
Ich bitte Dich also auf’s allerinständigste, mir mit jedem Botentage etwas gutes Gebratenes, einen Schöpsenbraten, Kapaun, ja einen Truthahn zu schicken, es mag kosten, was es wolle, damit wir nur zum Frühstück, zum Abendessen, und wenn es zu Mittag gar zu schlecht ist, irgend etwas haben, was sich nicht vom Schweine herschreibt.
Einmal schreibt er befriedigter:
[S. 209]
Die Götzen kocht nicht übel; nur, weil sie im Ofen kocht, sind die Sachen wohl einmal rauchrigt.
Eine andere Aufwärterin, die Schloßkastellanin Trabitius, konnte wohl einen Eierkuchen gut bereiten, aber bei dem Salat dazu fehlte schon ein brauchbares Öl; Das war in ganz Jena nicht zu haben. Es mutet uns seltsam an, wie knapp damals manche gute Speise war oder daß kleine Geschenke an Fleisch, Fisch, Gemüse und Obst zwischen Jena und Weimar, zwischen Goethes, Schillers, Knebels und Anderen ausgetauscht wurden; daß sich in früherer Zeit Goethe und Charlotte v. Stein mit Küchengütern beschenkten, daß Goethe sogar die Herzogin Luise aus Italien mit Kaffeebohnen bedachte. Auch aus seinem eigenen Hause in Weimar klagte Goethe 1794, dem Laster gulositas könne er sich nicht ergeben, „indem wir uns höchstens an einem guten Schöpsenbraten und einer leidlichen Knackwurst versündigen können“; er sei aber unglaublich lüstern nach den Leckerbissen, die es in Hamburg gebe: geräuchertes Rindfleisch, Rinds- und Schweinszungen, geräucherte „Aele“ und andere wunderbare Fische, fremden Käse usw. Als nachher die große Gastfreundschaft sich in Goethes Hause entfaltete, da mußte mancher Brief nach Hamburg, Bremen und Frankfurt gesandt werden, damit es an guten Gerichten nicht fehle. Von Bremen kam der französische, spanische und portugiesische Wein und von Speisen: Heringe, Neunaugen, Dorsche, Butter in halben Zentnern, während der Freund, der diese Dinge besorgte, aus Thüringen nur Pflaumenmus, getrocknetes Obst und Schwämme erhielt. Von Frankfurt[S. 210] wurde der deutsche Wein und feines Gebäck bezogen, auch Weintrauben, Artischocken und dergl.; von Hamburg Schinken und Fische, und Freund Zelter schickte jedes Jahr aus Berlin Teltower Rübchen. Was Goethe am liebsten aß, ist zum Teil schon gesagt: Wildpret, Geflügel, z. B. kaltes Rebhuhn zum Zehn-Uhr-Frühstück, von Fischen die Ilmforelle, von Gemüsen Blumenkohl und Spargel. Wie wir Anderen, behielt er manche Speisen der Kindheit in freundlichem Gedächtnis. 1830 gab es bei ihm einmal Kohlsalat mit warmer Brühe. „Das ist ein echt Frankfurter Essen“ sagte Goethe, „wie es meine Mutter mir so häufig gemacht hat.“ In seinen Bittschreiben an Christiane verriet er auch Appetit auf recht gute französische Bouillon, auf Kalbsfüße in Gelee, die nicht gar zu sauer wäre, auf Froschkeulen, auf Schokolade, bei der er aber zu andern Zeiten befürchtet, daß die Fabrikanten allerlei Dunkles zusammenmischen. Aus Torten und süßem Gebäck machte er sich nichts; dagegen war er ein großer Freund von Obst. Als sein August 1808 in Heidelberg studierte, beglückwünschte er ihn zu den Genüssen der Obst- und Traubenhügel, und als er selber in Italien war, freute er sich nicht wenig über das reichlichere Obst. „Mein eigentliches Wohlleben ist in Früchten“ schreibt er aus Oberitalien an Charlotte v. Stein, „Feigen esse ich den ganzen Tag; Du kannst denken, daß die Birnen hier gut sein müssen, wo schon Zitronen wachsen.“ Und in Rom war sein Abendbrot oft ein Pfund Trauben, das er auf der Straße aß.
**
*
[S. 211]
Als Goethe Student war, vertrödelte er manchen Tag mit Allotriis; er trank auch täglich Bier oder Wein, aber wenn ihm in Leipzig ein Merseburger Bier oder in Straßburg ein roter Wein schlecht bekam, so bemerkte er es auch und gab sie auf, und niemals trieb er mit dem Getränk und dem Zechen einen Kultus. Er gehörte keiner Gesellschaft an, die ihn zum Wirtshaustreiben nötigte. In Leipzig und Straßburg, wo er studierte, gab es kein Studentenleben. Ja, es ist uns aus seiner Jugend überhaupt kein Fall bekannt, wo er an einem Kommers nach studentischer Art teilgenommen hätte, und aus seinen späteren Jahren kennen wir einen einzigen solchen Abend, 1780, unter den Theaterfreunden, die oben auf Ettersburg spielten; der Präside war Franz v. Seckendorff.
Die Kneipszene im ‚Faust‘, die in der ersten Fassung noch derber lautete, zeigt uns, wie er schon als junger Mann das Völkchen beurteilte, von denen Mephisto sagt: „Merks! den Teufel vermuten die Kerls nie, so nah er ihnen immer ist.“ „Du Mastschwein!“ läßt er Faust zu Siebel in jener ersten Fassung sagen. Als Dreiundzwanziger wußte er bereits, daß wir die reinste Heiterkeit nur genießen, wenn wir frei vom Weine sind: „Die heiligen Götter gaben mir einen frohen Abend; ich hatte keinen Wein getrunken, mein Auge war ganz unbefangen über die Natur, ein schöner Abend!“ Als ihn in Frankfurt 1775 die jungen Grafen Stolberg besuchten und bei Tische in den poetischen Tyrannenhaß ausbrachen, in den sie mit ihren Freunden im Göttinger „Hain“ sich hineingedacht hatten, holte ‚Frau Aja‘ ihre[S. 212] besten Weine aus dem Keller: „Hier ist das wahre Tyrannenblut! Daran ergötzt euch, aber alle Mordgedanken laßt mir aus dem Hause!“ Begeistert griff Goethe das Wort seiner Mutter auf. „Jawohl, Tyrannenblut!“ rief er aus, „keinen größeren Tyrannen gibt es als Den, dessen Herzblut man euch vorsetzt. Labt euch daran, aber mäßig! Denn ihr müßt befürchten, daß er euch durch Wohlgeschmack und Geist unterjoche. Der Weinstock ist der Universaltyrann, der ausgerottet werden sollte; zum Patron sollten wir deshalb den heiligen Lykurgus, den Thrakier, wählen und verehren ... Dieser Weinstock ist der allerschlimmste Tyrann, zugleich Heuchler, Schmeichler und Gewaltsamer. Die ersten Züge seines Blutes munden euch, aber ein Tropfen lockt den andern unaufhaltsam nach.“
Als Goethe nach Weimar kam, sagten die Leute allerdings bald: der Herzog werde sich totzechen, und sein Abgott, der junge Frankfurter Doktor, habe ihn dann auf dem Gewissen. Auch vom achtundzwanzigjährigen Goethe redete man in Berlin, von ihm sei nichts mehr zu erwarten, da er in kurzer Zeit vom Branntwein ruiniert sein werde. Daß der Fürst wie der Dichter mit höchsten Ehren ihr Fünfzigjahre-Jubiläum feiern würden, ahnte auch der würdige Klopstock nicht, als er einen wohlgemeinten Ermahnungsbrief an den Verführer Karl Augusts richtete. Auch Klopstock warnte: „Der Herzog wird, wenn er sich ferner bis zum Krankwerden betrinkt, anstatt, wie er sagt, seinen Körper dadurch zu stärken, erliegen und nicht lange leben.“
[S. 213]
Aber sehr bald nach dieser tollen Einleitung sehen wir, wie der junge Goethe als fleißiger Staatsbeamter die verdrießlichsten Arbeiten übernimmt, und abends schreibt er vielleicht in sein Tagebuch: „Daß ich nur die Hälfte Wein trinke, ist mir sehr nützlich; seit ich den Kaffee gelassen, die heilsamste Diät.“ So im Januar 1779; am 7. August klingt es fast wie ein Gebet:
Gott helfe weiter und gebe Lichter, daß wir uns nicht selbst viel im Wege stehn! Lasse uns von Morgen bis Abend das Gehörige tun und gebe uns klare Begriffe von den Folgen der Dinge! Daß man nicht sei wie Menschen, die den ganzen Tag über Kopfweh klagen und gegen Kopfweh brauchen und alle Abend zuviel Wein zu sich nehmen. Möge die Idee des Reinen, die sich bis auf den Bissen erstreckt, den ich in den Mund nehme, immer lichter in mir werden!
In dieser Vorsicht gegen den Wein verharrte er diese ganzen arbeitsreichen Jahre. „Seit drei Tagen keinen Wein“ schreibt er am 1. April 1780. „Sich nun vor dem englischen Bier in acht nehmen. Wenn ich den Wein abschaffen könnte, wäre ich glücklich.“ Im gleichen Monat schreibt er eines Abends sehr befriedigt: „War sehr ruhig und bestimmt .... Ich trinke fast keinen Wein. Und gewinne täglich mehr in Blick und Geschick zum tätigen Leben.“ Im Sommer 1780 kommt er im Tagebuch nochmals auf den Wein zurück: „Man könnte noch mehr, ja das Unglaubliche tun, wenn man mäßiger wäre;“ freilich kann hier auch andere Mäßigkeit gemeint sein. Und ähnlich klingt es noch 1786 aus Italien an die geliebte Freundin: „Ich lebe sehr mäßig; den roten Wein der hiesigen Gegend [Vicenza], schon von Tirol her, kann ich nicht vertragen; ich trinke ihn mit viel[S. 214] Wasser wie der heilige Ludwig.“ Das Jahr vorher hatte er seinem Freunde Jacobi im Scherz vorgeschlagen, er wolle ihm den Fritz v. Stein als Mann für sein Töchterchen erziehen: „Aber gib ihr nicht Punsch zu trinken und das andere Quarks! Halte sie unverdorben, wie ich den Buben, der an die reinste Diät gewöhnt ist.“
Da Goethes Dichten stets ein Widerschein seines Lebens war, so finden wir in seinen Versen aus der ersten Hälfte seines Lebens kaum ein Lob des Trinkens. Dagegen tadelt er durch Antonios Mund seinen Tasso, der die erste Pflicht des Menschen, „Speis’ und Trank zu wählen“, töricht erfüllt.
Natürlich kann dem Tasso kein Arzt helfen, so lange er bei dieser schlechten Lebensweise bleibt. Schließlich rät der Arzt, was er gleich hätte raten sollen:
[S. 215]
Das alles beweist einen tiefen Einblick des jungen Dichters in die Wirksamkeit der Rauschgetränke.
**
*
Aber als Goethe aus Italien wiederkehrte, beklagte Frau v. Stein, daß er sinnlicher geworden sei, in heutiger Sprache: materieller. Er gab sich den natürlichen Neigungen völliger hin, zügelte seinen Ehrgeiz schärfer, stellte sich die Aufgaben kleiner, und wenn er auch außerordentlich fleißig blieb, so hatte sein langer Tag doch auch einige Stunden für die Tafelfreuden frei. Seine Hausgenossin Christiane trank den Wein mit Lob und Lust; sie war darin seine Schülerin, aber auch seine Antreiberin. „Den Doktor Stark bitte ich mir auch zum Doktor aus“ schreibt sie im Herbst 1800; „Dem seiner Meinung bin ich gewiß auch, daß Du nicht so wenig Wein trinken sollst und Champagner besonders.“ Zwei Jahre darauf redet Goethe im selben Tone gegen Schiller über den kränkelnden Freund Heinrich Meyer: „Hätte er sich, statt Pyrmonter Wasser hier teuer in der Apotheke zu bezahlen, ein Kistchen Portwein zur rechten Zeit von Bremen verschrieben, sollte es wohl anders mit ihm aussehen.“ Und als dann im nächsten Jahre, 1803, Christiane einen Monat im Bade Lauchstädt verbrachte, sagte man von ihr und zu ihr: sie mache wohl eine Weinkur. Etwa von 1802 an dichtete Goethe auch einige Trinklieder, weil in befreundeten Kreisen Begehr nach solchen Gesängen war. An diesen Trinkliedern ist jedoch bemerkenswert, was nicht darin steht. Er verherrlicht den Wein nur als[S. 216] Sorgenbrecher und Stimmungsverbesserer, der uns zeitweilig erheitert und verjüngt. Als er zu seinen geselligen Abenden das alte Zecherlied: „Mihi est propositum in taberna mori“ bearbeitete, gab er es nicht so echt wieder wie Bürger: „Ich will einst bei Ja und Nein vor dem Zapfen sterben,“ sondern er mischte recht viel Wasser in den alten Wein und schrieb: „Mich ergreift, ich weiß nicht wie, himmlisches Behagen.“ Und man merkt öfter, wie ihm jeder Hang zur Unmäßigkeit auch in diesen weinfreudigen Jahren schmerzlich ist. Er bemerkte ihn schon bei seinem eigenen Sohne, dem Heidelberger Studenten, und deshalb schrieb er die vorsichtig eingekleidete Warnung:
Wir leben nach unsrer alten Weise still und fleißig besonders auch, was den Wein betrifft, wobei mir denn lieb ist, aus Deinem Briefe zu sehen, daß Du Dich auch vor diesem so sehr zur Gewohnheit gewordenen Getränk in acht nimmst, das mehr, als man glaubt, einem besonnenen, heiteren und tätigen Leben entgegenwirkt.
Im selben Jahre (1808) läßt er ein Lieblingskind seiner Muse, die schöne Ottilie, in den ‚Wahlverwandtschaften‘ „über die Unmäßigkeit der Männer, besonders was den Wein betrifft“ klagen:
Wie oft hat es mich betrübt und geängstigt, wenn ich bemerken mußte, daß reiner Verstand, Klugheit, Schonung Anderer, Anmut und Liebenswürdigkeit selbst für mehrere Stunden verloren gingen, und oft statt alles Guten, was ein trefflicher Mann hervorzubringen und zu gewähren vermag, Unheil und Verwirrung hereinzubrechen drohte! Wie oft mögen dadurch gewaltsame Entschließungen veranlaßt werden!
[S. 217]
Sie dachte bei diesen Zeilen an den heimlich geliebten Eduard,
der zwar nicht gewöhnlich, aber doch öfter, als es wünschenswert war, sein Vergnügen, seine Gesprächigkeit, seine Tätigkeit durch einen gelegentlichen Weingenuß zu steigern pflegte.
Ganz ebenso hatte Goethe, der Enkel eines Gastwirts, schon in ‚Hermann und Dorothea‘ das häufige leichte Räuschchen des Wirtes als Ursache von häuslichen Störungen und Trübungen geschildert, und es ist bezeichnend, daß der Held der Dichtung, Hermann, größere Liebe zum Ackerbau als zum einträglichen Wirtsgewerbe zeigt.
Doch reden auch aus den Altersjahren manche Berichte von Goethes Weinfreudigkeit. „Er trank fleißig, besser noch die Frau“ schreibt Wilhelm Grimm 1809. „Der Alte sprach viel und trank nicht wenig“ bekundet Holtei 1827. „Goethe ist sehr munter“ erzählt Eckermann 1824 seiner Braut,
Vorgestern Mittag bei Tisch aß er in Hemdsärmeln und war sehr jugendlich heiter. Bei Tische teilte er Manches mit mir und gibt mir von seinem Teller. Wenn ich abends komme, läßt er gleich eine Bouteille Wein bringen. Der alte Hofrat Meyer trinkt keinen, Kanzler v. Müller Zuckerwasser. Goethe und ich trinken dann allein.
Vom Pfingstnachmittag desselben Jahres berichtet auch der Kanzler v. Müller solche Hemdärmelszene:
Er aß im Hemdärmel und trank mit Riemer. Ersteres war Ursache, daß er Gräfin Line Egloffstein nicht annahm. Sie möge doch, sagte er zu Ottilien, des Abends zu mir[S. 218] kommen, nicht wenn Freunde da sind, mit denen ich tiefsinnig oder erhaben bin.
Auch Liköre waren im Keller des Goethe-Hauses. 1792 schickte Goethe welchen aus dem eroberten Verdun. Später wird Rack oder Arrac öfters erwähnt, der vielleicht nur zur Bereitung des Abend-Punsches diente. Vom Persiko berichtet Heinrich Voß 1804; Das ist ein auf Pfirsich und bittere Mandeln abgesetzter Branntwein.
Gestern vor acht Tagen wurde er, Goethe, so gut aufgeräumt, daß er die Vulpius bat, die Persikoflasche zu holen. Bei dieser Gelegenheit fiel ihm eine Begebenheit ein, wo er vor zwanzig Jahren auch die Persikoflasche nicht geschont habe, und fing an zu erzählen, und währenddessen wurde das Gläschen oft gefüllt und ging die Runde. Die Vulpius leerte es dreimal und ward in den dritten Himmel gesetzt, und als Goethe einmal hinausging, strömte ihr Herz über zu des lieben Geheimrats Lobe.
Betrunken oder stark angeheitert hat jedoch „den lieben Geheimrat“ Niemand gesehen. Zwar als ihn sein Arzt am 27. August 1818 morgens bei einer Flasche fand und ihm bemerkte, es sei ja erst morgen sein Geburtstag, rief Goethe aus: „Da habe ich mich heute umsonst besoffen!“ aber Goethe liebte solche derben Worte. Ein leichtes Angeheitertsein erwähnen ein paar unverdächtige Zeugen; z. B. trat er 1795 nach der Hoftafel mit dem Ausdruck süßen Weines zu der Engländerin Emilie Gore und redete sie zu ihrer größten Verwunderung an: „ma chère, seule, unique amie!“ Einmal urteilt Goethe selber, daß er zuviel getrunken habe. Es war in Tennstädt und in der Nacht vor seinem Geburtstage 1816. Er saß mit Meyer und dem[S. 219] großen Philologen Wolf zusammen, und Wolf ließ wieder seinen ungezügelten Widerspruchsgeist die tollsten Sprünge machen. Da wurde Goethe „bestialisch.“
Glücklicher- oder unglücklicherweise hatte ich so viele Gläser Burgunder mehr als billig getrunken und da hielt ich auch keine Maße. Meyer saß dabei, der immer gefaßt ist, und ihm war nicht wohl bei der Sache.
**
*
In seinen allerletzten Lebensjahren wurde Goethe wieder viel vorsichtiger gegen den Wein; „ja man könnte behaupten, zu furchtsam“ meinte sein Arzt. Zwar blieb er bei dem Glas Madeira zum Frühstück und der Flasche leichtem Würzburger zu Mittag, nahm auch wohl zum Nachtisch ein ganz kleines Gläschen Tinto di Rota, aber wie sehr er auch Verlangen trug nach dem Punsch, den er von früher her abends um sechs Uhr gewöhnt war, oder gelegentlich nach Champagner, den er sehr liebte, so siegte doch stets, selbst gegen die Meinung des Arztes, seine Besorgnis, daß sie ihm schaden könnten.
Namentlich aber war Goethe sein ganzes Leben lang der Ansicht, daß uns der Wein zum geistigen Schaffen nichts nütze. Wir kommen noch darauf zurück. Und Das ist noch zu beachten, daß der Wein das einzige Gift und Reizmittel war, das Goethe gebrauchte, und daß er daran schon in seiner Jugend und von Vorfahren her gewöhnt war. An gebrannten Getränken und an Bier, auf das er oft schalt, hat er in seinem langen Leben nur ganz wenig zu sich genommen. Ebenso lehnte er Kaffee und Tee ab und haßte den Tabak,[S. 220] während fast alle seine Freunde entweder rauchten oder schnupften. Er roch nur an kölnischem Wasser, wenn er eine kleine Anreizung begehrte.
Alles in allem: Goethe hat den Wein zur Steigerung des Lebensgenusses und zur Würze der Mahlzeiten gebraucht, hat aber niemals seine Freiheit an ihn verloren. Dagegen hat er die Gefahr verkannt, die die Weingeistgetränke für seine Frau und namentlich für seinen heranwachsenden Sohn in sich trugen. Diesen Leichtsinn oder Mangel an Wissen und Vorsicht hat er schwer büßen müssen: Daran ist kein Zweifel möglich, wenn er auch seinen Kummer über das schlimme Ende seiner beiden Nächsten stillverschlossen im eigenen Innern verarbeitete.
[27] Der Neffe Rinaldo, der nach Augusts Tode wegen Ottiliens Unbrauchbarkeit viel für die geordnete Fortführung des Haushalts tat.
[S. 221]
Der Fleiß ist ein Bedürfnis und eine natürliche Tugend kräftiger Persönlichkeiten: sie haben so viel zu erfassen, umzubilden, auszudrücken, daß ihnen jede Stunde kostbar und das längste Leben zu kurz erscheint. „Ars longa, vita brevis“ ist ihre Klage von altersher. Wer seine Persönlichkeit schätzt, hält seine Zeit wert und heilig.
Goethe war also zeitgeizig. Er verglich gern die Zeit mit Geld und Gut; hinterließ ihm der irdische Vater 10000 Gulden, so gab ihm der Schöpfer aller Dinge eine viel reichere Fülle von verwertbaren Lebensstunden:
„Er wußte sie wie Keiner zu nutzen, wahrhaft auszubeuten“ urteilte der Kanzler v. Müller, der uns auch den kleinen Zug erzählt, daß Goethe sich aus einem Gespräch mit dem König von Bayern einen Augenblick fortstahl, weil ihm ein Gedanke für die Fortsetzung der Faustdichtung gekommen war, der aufgeschrieben werden mußte. Tage völliger Muße kannte Goethe nicht; Sonn- und Feiertage waren von Werktagen nur wenig verschieden. Von seinem Neffen Rinaldo Vulpius, der ihm einen Brief von Jena nach Weimar mitnahm, schreibt er im Mai 1818:
[S. 222]
Warum er schon wieder nach Weimar läuft, ist mir nicht deutlich. Wie die Menschen das Wort Feiertag hören, so sind sie alle verrückt, und Niemand denkt, daß er die größte Zeit seines Lebens müßig herumläuft oder gestreckt daliegt.
Selbst wenn er noch im Bette liegen wollte, begann er schon mit dem geistigen Schaffen. Da es ihn schmerzte, daß Schiller durch eine ungeschickte, ungesunde Lebensweise manche gute Stunde verlor, so gibt er ihm im Dezember 1796 einen Wink:
Ich muß Anstalt machen, meine Schlafstelle zu verändern, damit ich morgens vor Tage einige Stunden im Bett diktieren kann. Möchten Sie doch auch eine Art und Weise finden, die Zeit, die nur eigentlich höher organisierten Naturen kostbar ist, besser zu nutzen!
An denselben Freund schreibt er:
Es würde nicht schwer werden, sich so einzurichten, daß man auf der Reise selbst mit Sammlung und Zufriedenheit arbeiten könnte. Denn wenn sie zu gewissen Zeiten zerstreut, so führt sie uns zu andern desto schneller auf uns selbst zurück; der Mangel an äußern Verhältnissen, ja die Langeweile ist Demjenigen günstig, der Manches zu verarbeiten hat.
Goethe hat in der Tat recht viele Verse beim Halten der Postkutsche oder des eigenen Reisewagens oder an Gasthoftischen niedergeschrieben. Auch in Bade- und Kurorten verging kein Tag ohne Studium oder Hervorbringung; in Wiesbaden arbeitete er im Juni 1815 sogar 16 bis 17 Stunden täglich an der ‚Italienischen Reise‘ und diktierte auch in der Badewanne.
**
*
[S. 223]
Wer seine Zeit schätzt und seine noch ungetane Arbeit bedenkt, hütet sich vor aller Teilnahme an Bestrebungen und Arbeiten, auf deren glückliches Gelingen er nur geringen oder gar keinen Einfluß hat. Schon aus diesem Grunde war Goethe kein Politiker. Das kollegiale und erst recht das parlamentarische Arbeiten für den Staat erkannte er als eine ungeheuere Zeit- und Kraftvergeudung. Es werde immer das Minimum von Effekt hervorgebracht, wenn man mit Andern und durch Andere zu wirken hat, sagte er zu Riemer, und zum Kanzler: „Ich konnte nie zu Zwei etwas leisten; Diktatur oder Konsulat mit geteilter Gewalt!“ Und schon 1797 schrieb er an Heinrich Meyer:
In der Lage, in der ich mich befinde, habe ich mir zugeschworen, an Nichts recht teilzunehmen als an Dem, was ich so in meiner Gewalt habe wie ein Gedicht, wo man weiß, daß man zuletzt nur sich zu tadeln oder zu loben hat, an einem Werke, an dem man, wenn der Plan einmal gut ist, nicht das Schicksal des penelopeischen Schleiers erlebt. Denn leider in allen übrigen irdischen Dingen lösen einem die Menschen gewöhnlich wieder auf, was man mit großer Sorgfalt gewoben hat, und das Leben gleicht jener beschwerlichen Art zu wallfahrten, wo man drei Schritte vor und zwei zurück tun muß ... Zwar ist, ich gestehe es, ein solcher Entschluß sehr illiberal, und nur Verzweiflung kann einen dazu bringen; es ist aber doch besser, ein für allemal zu entsagen, als immer einmal über den andern Tag rasend zu werden.
Goethe bekam zwar immer einige Zeitungen in’s Haus, aber oft las er sie Monate hindurch nicht. Nicht selten war er in die politischen Vorgänge durch seine Stellung oder seine Freunde besser eingeweiht als die Berichterstatter dieser Blätter, und dann entrüstete er[S. 224] sich über ihr leichtfertiges Umspringen mit der Wahrheit und mit den Gefühlen der an die Öffentlichkeit gezerrten Personen. Immer aber fürchtete er Zeit- und Stimmungsräuber in ihnen. An Zelter schreibt er einmal:
Es fällt einem doch mitunter auf, daß man durch die Kenntnis Dessen, was der Tag bringt, nicht klüger und nicht besser wird. Dieses ist von größter Wichtigkeit. Denn genau besehen ist es von Privatleuten doch nur eine Philisterei, wenn wir Demjenigen zuviel Anteil schenken, worin wir nicht wirken können ... Also wollen wir uns nicht mit Allotrien beschäftigen.
Im Jahre 1831 machte er sich den Spaß, eine Zeitung von 1826 gebunden zu lesen. Bei solcher Wiederholung wird „für den Menschen, der sich in den Kreis seiner Tätigkeit zurückzieht,“ erst recht klar, „daß man durch diese Tagesblätter zum Narren gehalten wurde, und daß weder für uns, noch für die Unsrigen, besonders im Sinn einer höheren Bildung, daher auch nicht das Mindeste abzuleiten war.“
**
*
Die ‚Gesellschaft‘ und die ‚Geselligkeit‘ sind zwei Namen für ärgste Zeiträuber und Persönlichkeitsvernichter. Goethe wußte ihnen von Jugend auf zu begegnen. Nahm er an einer Gesellschaft teil, so behauptete er sich ihr gegenüber; er spielte nicht Karten und verwickelte sich nicht in Klatsch, sondern setzte auch hier sein Studium fort und befestigte sich lehrend im Gelernten. Zeichnen, Musikhören, Betrachten von Mineralien oder Medaillen oder Kupferstichen, Vorlesen, Lesen mit verteilten Rollen, Schilderungen von[S. 225] fremden Ländern: Das waren seine Unterhaltungen in geselligen Stunden. Auch Lustigsein, Trinken, Tanzen und allerlei Possenspiel ließ er als gute Zeitbenutzung gelten.
Aber er war für sich allein zu reich, um häufiger Gesellschaft zu bedürfen oder sie ertragen zu können. „Die Menschen sind wie das Rote Meer“ sagte er einmal, „der Stab hat sie kaum auseinander gehalten, gleich hinterher fließen sie wieder zusammen.“ Zu diesen Menschen gehörte Goethe nicht. „Ich weiß wohl“ sagte er schon 1784, „daß man, um die Dehors zu salvieren, das Dedans zugrunde richten soll; aber ich kann mich denn doch nicht wohl dazu verstehen.“ Als er drei Jahre später nach Rom kam, vermied er sorgfältig alle vornehmen Bekanntschaften und hielt sich zu guten Kameraden, die ihn nicht mit gesellschaftlichen Pflichten behängten. Als seine Anwesenheit dennoch bekannt wurde und er Einladungen und Besuche bekam, hatte er sich schon im Kreise der „Künstlerburschen“ befestigt. „Jedem war es nicht um mich zu tun“ schreibt er über die vornehmen Einladenden an Herder, „sondern nur: seine Partei zu verstärken. Als Instrument wollten sie mich brauchen, und wenn ich hätte hervorgehn, mich deklarieren wollen, hätte ich auch als Phantom eine Rolle gespielt. Nun, da sie sehen, daß nichts mit mir anzufangen ist, lassen sie mich gehen, und ich mache meinen sicheren Weg fort.“
So lernte er freilich die römischen Kardinäle und Prinzessinnen nicht kennen, aber er hatte Zeit und Raum, die ‚Iphigenie‘ umzuschreiben, den ‚Egmont‘ und ‚Tasso‘[S. 226] zu fördern, in die Geheimnisse der bildenden Kunst einzudringen und nebenbei mit fröhlichen Gesellen vergnügt zu leben.
**
*
Man kann sich keinen größeren Gegensatz denken als Goethe und die Frau v. Staël, die doch auch Dichterin und Denkerin sein wollte. Ihr war nur in Gesellschaft wohl; sie mußte stets der Mittelpunkt lauten Lebens sein; ihr herrliches Landgut bei Genf empfand sie als einen düstern Ort der Verbannung, weil Napoleon ihr den Aufenthalt in Paris verboten hatte. Als sie 1804 nach Weimar kam, empfanden Goethe und Schiller ihre gesellschaftlichen Ansprüche recht unbequem, obwohl die geistreiche Französin auch sie nicht kalt ließ. Goethe erzählt in seinen Annalen, wie ihre Salongeschäftigkeit mit dem ernsten Schaffen der deutschen Dichter und Gelehrten im Gegensatz war.
Sie wollte zu einer gewissen Tätigkeit aufregen, deren Mangel sie uns vorwarf. Da sie keinen Begriff hatte von Dem, was Pflicht heißt, und zu welcher stillen, gefaßten Lage sich Derjenige, der sie übernimmt, entschließen muß, so sollte immerfort eingegriffen, augenblicklich gewirkt sowie in der Gesellschaft gesprochen und verhandelt werden.
Auch zeigte gerade die Staël manche Oberflächlichkeit, wie sie die Geselligkeit anerzieht. Goethe erzählt weiter:
Frau v. Staël trat einen Abend vor der Hofzeit bei mir ein und sagte gleich zum Willkommen mit heftiger Lebhaftigkeit: „Ich habe Euch eine wichtige Nachricht anzukündigen! Moreau ist arretiert mit einigen Anderen und des Verrats gegen den Tyrannen angeklagt!“ Ich hatte seit langer Zeit,[S. 227] wie Jedermann, an der Persönlichkeit des Edeln teilgenommen und war seinem Tun und Handeln gefolgt; ich rief im stillen mir das Vergangene zurück, um nach meiner Art daran das Gegenwärtige zu prüfen und das Künftige daraus zu schließen oder doch wenigstens zu ahnen. Die Dame veränderte das Gespräch, dasselbe, wie gewöhnlich, auf mannigfache gleichgültige Dinge führend, und als ich, in meinem Grübeln verharrend, ihr nicht sogleich gesprächig zu erwidern wußte, erneuerte sie die schon oft vernommenen Vorwürfe: ich sei diesen Abend wieder einmal gewohnterweise maussade und keine heitere Unterhaltung bei mir zu finden. Ich ward wirklich im Ernst böse, versicherte, sie sei keines wahren Anteils fähig; sie falle mit der Tür in’s Haus, betäube mich mit derbem Schlag und verlange sodann, man solle alsobald sein Liedchen pfeifen und von einem Gegenstand zum andern hüpfen.
So hütete sich Goethe immer vor Angriffen auf sein Gemütsleben; zur Unterhaltung bedurfte er der Erschütterungen nicht, und seiner Arbeit waren sie schädlich. Da er nun einmal weich und empfindlich war, so schonte er sich demgemäß. In Tollhäuser, die jammervollen Vorläufer unserer heutigen Anstalten für Geisteskranke, konnte ihn auch sein Herzog nicht einzutreten bewegen. Ebenso ging er den Leichen aus dem Wege. „Warum“ sagte er bei Wielands Tode zu Falk, „warum soll ich mir die lieblichen Eindrücke von den Gesichtszügen meiner Freunde und Freundinnen durch die Entstellungen einer Maske zerstören lassen? Es wird ja dadurch etwas Fremdartiges, ja völlig Unwahres meiner Einbildungskraft aufgedrungen. Ich habe mich wohl in acht genommen, weder Herder, Schiller, noch die verwitwete Frau Herzogin Amalia im Sarge zu sehen.[S. 228] Der Tod ist ein sehr mittelmäßiger Porträtmaler. Ich will ein seelenvolleres Bild als seine Masken von meinen Freunden im Gedächtnis aufbewahren.“ Auch auf Bildern ließ er sich nichts Widerliches bieten. Sie sollten ihm Angenehmes sagen und ihn nicht an die Anatomie oder den Schindanger erinnern. Vor frommen Bildern hatte er auch deshalb Scheu, weil sie so oft Menschenquälerei darstellen. Ebenso schonte er seine Phantasie gegen die verwirrenden Eindrücke der Karikaturen. So wollte er im Alter keine Spottbilder auf Napoleon sehen. „Ich darf mir dergleichen widrige Eindrücke nicht erlauben, denn in meinem Alter stellt sich das Gemüt, wenn es angegriffen wird, nicht so schnell wieder her wie bei Euch Jüngeren.“ Als seine Schwiegertochter bei einem Sturze sich das Gesicht zerschunden hatte, sah er sie nicht, bis sie wiederhergestellt war.
Genau so wandte er die Augen ab von politischen Vorgängen, die ihn sehr ergriffen und innerlich beschäftigt hätten, ohne daß er doch Etwas dazu tun konnte, also besonders von Kriegsereignissen und Revolutionen. Seine anscheinende Gleichgültigkeit erregte dann oft Erstaunen und Mißfallen; aber er wußte, weshalb er so handelte. Gleich nach den Befreiungskriegen entstanden in den meisten deutschen Ländern sehr unerquickliche Zustände; zwischen den Volksgenossen zeigte sich ein politischer Haß, der zu schlimmen Taten führte. „Ungerechtigkeit und Unbilligkeit sind an der Tagesordnung“ schrieb Goethe damals (am 16. Januar 1818 an Antonie Brentano) und fuhr fort:
[S. 229]
An meiner Tagesordnung ist die Maxime: man muß sich selbst schonen, wo Nichts geschont wird, und wie Diogenes sein Faß in der allgemeinen Verzweiflung hin und her wälzen.
**
*
Oft mußte Goethe alle Gesellschaft meiden und sich selbst von Frau und Kind abschließen, wenn er Etwas fertig bringen wollte.
Dem Gegenstande, der ihn beschäftigte, gehörte er jedesmal ganz an, identifizierte sich mit ihm nach allen Seiten und wußte, während er irgend eine wichtige Aufgabe sich gesetzt, alles seinem Ideengang Fremdartige standhaft abzulehnen ... Nicht immer jedoch gelang ihm jene augenblickliche Konzentration, und seiner übermächtigen Empfänglichkeit und Reizbarkeit wohl bewußt, griff er dann oft zu den extremsten Mitteln und schnitt plötzlich, wie im Belagerungszustande, alle Kommunikation nach außen gewaltsam ab. Kaum aber hat die Einsamkeit ihn von der Fülle anströmender Ideen entbunden, so erklärt er sich wieder befreit, neuen Interessen zugänglich, knüpft die früheren Fäden sorgsam an, und schwimmt und badet in frischen Elementen weit ausgebreiteten Daseins und Wissens, bis eine neue unbezwingliche Metamorphose ihn abermals zum Einsiedler umschafft.[28]
Gewöhnlich entwich Goethe auf Wochen oder Monate nach dem damals noch recht kleinen Jena; seltener zog er in’s Gartenhaus, wo ihn dann die Seinigen nicht stören durften. „Denn dabei bleibt es nun einmal: daß ich ohne absolute Einsamkeit nicht das Mindeste hervorbringen kann. Die Stille des Gartens ist mir auch daher vorzüglich schätzbar.“ So schreibt er im August 1799 an Schiller, und drei Tage später[S. 230] heißt es schon wieder: „Denn in einer so absoluten Einsamkeit, wo man durch gar nichts zerstreut und auf sich selbst gestellt ist, fühlt man erst recht und lernt begreifen, wie lang ein Tag sei.“ Wohl hatte Christiane oft große Sehnsucht nach ihm, und die kurzen Besuche, die ihr gestattet waren, erschienen ihr als allzu seltene Festtage. Dann schrieb sie ihm wohl:
Es wird fieleicht mit den arbeyden Hier beser gehn als sond du kanns hier wie in Jena in bete dickdiren und ich will des Morchens nicht ehr zu dir komm biß du mich verlangst auch der Gustell soll Frühe nicht zu dir komm. Komm nur balt.
Aber sie fügte sich auch willig, wenn er in seiner freundlichen Weise ihr meldete, daß die gesetzte Aufgabe noch nicht bewältigt sei, und unverdrossen sorgte sie dann, was sie an guten Speisen und Getränken für ihn den Botenweibern mitgeben könne.
**
*
Die Geselligkeit der Entfernten ist der Briefwechsel. Auch die Antwort fordernden Briefschreiber gehören zu den ärgsten Zeiträubern, und wenn Goethe einmal sagt: „Wer für die Welt etwas tun will, muß sich nicht mit ihr einlassen“, so dachte er dabei nicht zuletzt an die Übel der schriftlichen Unterhaltung. „Mit Briefantworten muß man nolens volens Bankerott machen“ sagte er 1830 zum Kanzler und drei Jahre früher zu Eckermann: „Sie sehen ja selbst, wie Das bei mir geht und welche Zusendungen von allen Ecken und Enden täglich bei mir einlaufen, und müssen gestehen, daß dazu mehr als ein Menschenleben gehören würde, wenn man Alles[S. 231] nur flüchtig erwidern wollte.“ Schon in jungen Jahren kam er zu dem Vorsatz, eine große Zahl von Briefen nicht zu beantworten. Der ihm befreundete Statthalter Karl v. Dalberg in Erfurt, der nachmalige Großherzog von Frankfurt, bekam eine Unmenge literarischer Zusendungen, weil er als ein sehr wohlwollender Liebhaber vieler Wissenschaften und Künste bekannt war. In einem Briefe an Zelter erzählt Goethe von diesem alten Freunde:
Nun besaß er zwar ausgebreitete Kenntnisse, um solchen Fällen genug zu tun, aber wo hätte er Zeit und Besinnung hergenommen, um einem Jeden vollkommene Gerechtigkeit widerfahren zu lassen? Er hatte sich daher einen gewissen Stil angewöhnt, wodurch er die Leerheit seiner Antworten verschleierte und Jedem etwas Bedeutendes zu sagen schien, indem er etwas Freundliches sagte. Es müssen dergleichen Briefe noch zu Hunderten herumliegen. Ich war von solchen Erwiderungen öfters Zeuge; wir scherzten darüber, und da ich eine unbedingte Wahrheitsliebe gegen mich und Andere zu behaupten trachtete, so schwur ich mir hoch und teuer, in gleichem Falle, mit dem mich meine damalige Zelebrität schon bedrohte, mich niemals hinzugeben, indem sich dadurch denn doch zuletzt alles reine, wahrhafte Verhältnis zu den Mitlebenden auflösen und zerstieben muß. Daher folgt denn, daß ich von jeher seltener antwortete, und dabei bleibt’s denn auch jetzt in höheren Jahren, aus einer doppelten Ursache: keine leeren Briefe mag ich schreiben, und bedeutende führen mich ab von meinen nächsten Pflichten und nehmen mir zuviel Zeit weg.
**
*
Die Absonderung von den Menschen um des Werkes willen zeigte sich bei Goethe auch oft als Verschwiegenheit und Heimlichtun. Der Kanzler erzählt:
[S. 232]
Das Geheimnis hatte überhaupt stets für Goethe einen ganz besonderen Reiz, vorzüglich darum, weil es vor Entweihung würdiger Vorsätze und Bestrebungen sichert, ihr Gelingen erleichtert und die Willenskräfte der Verbündeten steigert. So hat er denn auch im Leben, ja, selbst in alltäglichen Vorkommnissen diese Liebe zum Geheimnis betätigt und nur selten und ungern über die nächsten Anordnungen und Beschlüsse sich im voraus mitgeteilt. Noch unangenehmer war es ihm, wenn man sein Vorhaben erriet oder Irgendetwas, was er erst später vorzeigen oder eröffnen wollte, vorzeitig entdeckte oder zur Sprache brachte. Seine Naturbetrachtungen hatten ihn gelehrt, wie alles Große und Bedeutende nur im stillen sich vorbereite, wachse und entwickle; seine Welterfahrung ihm bewiesen, daß die edelsten Unternehmungen, voreilig enthüllt, meist den feindseligsten Gegenwirkungen ausgesetzt sind.
Goethe spricht diese Sinnesart öfters in seinen Gedichten aus. Sein Märchen vom getreuen Eckhart schließt: „Verplaudern ist schädlich, verschweigen ist gut: dann füllt sich das Bier in den Krügen.“ In den ‚Römischen Elegien‘ erhebt er die Verschwiegenheit gar in den Rang der Götter:
Und in der ‚Natürlichen Tochter‘ wiederholt er:
[S. 233]
Gern erzählte Goethe, wie er in Jena die Universitätsbibliothek in Ordnung gebracht habe.[29] Sie befand sich in einem entsetzlichen, feuchten und beschränkten Raume. Goethe, mit Vollmacht von den Erhalter-Fürsten ausgestattet, machte den Professoren den Vorschlag, ihm den an die Bibliothek anstoßenden Konferenzsaal der medizinischen Fakultät zu überlassen, damit er die bisherige Bibliothek besser unterbringen und auch die vom Großherzog geschenkten 13000 Bände hinzufügen könnte. Man lehnt ab, verlangt als Ersatz einen neuen Saal, der zwar versprochen, aber nicht sofort erbaut werden kann. Das bloße Versprechen will dem akademischen Kollegium nicht genügen; der verlangte Saal wird verschlossen, und der Schlüssel „läßt sich nicht finden.“ Nun läßt Goethe einen Maurer in die alte Bibliothek kommen und sagt ihm: „Die Scheidemauer da muß stark sein, denn sie trennt zwei Quartiere voneinander. Machen Sie sich einmal daran, mein Freund, Dies zu untersuchen.“ Der Maurer legt Hand an; bald ist der Putz weggestoßen; eine leichte Ziegelwand wird sichtbar. Dann entsteht ein Loch, wodurch man die alten Gemälde des Konferenzsaales: Gelehrte in großen Perücken, schon erblicken kann. „Nur weiter, mein Freund!“ sagt Goethe, „ich sehe noch nicht deutlich genug.“ Das Loch wird größer. „Immer noch ein wenig! Genieren Sie sich ja nicht! Tun Sie, als ob Sie zu Hause wären.“ Der Maurer schlägt weiter ein, und bald ist die Öffnung so, daß sie[S. 234] als Tür gelten kann. Nun dringen die Bibliothekare hindurch und werfen Bücher auf den Fußboden des eroberten Saales, als Zeichen der Besitzergreifung. Im Handumdrehen sind Bänke, Pulte, Stühle, Gemälde weggeräumt; nach ein paar Tagen stehen ein paar tausend Bücher in ihren Regalen. Ganz verblüfft erscheinen die Professoren an der Tür des neuen Bibliotheksaales, als sie endlich erfahren, was hier vorgegangen ist. Sie schelten und zürnen und – fügen sich in’s Geschehene.
Poetisches und wissenschaftliches Schaffen ist von solchem politischen Handeln grundverschieden, aber auch als Dichter war Goethe für größte Heimlichkeit. Er wunderte sich, daß Schiller seine entstehenden Werke mit ihm so gern durchsprach, oft Szene für Szene eines Dramas. Solches Offenbaren unfertiger Dichtung sei ganz gegen seine Natur gewesen, sagte Goethe zu Eckermann: „Ich trug Alles still mit mir herum, und Niemand erfuhr in der Regel Etwas, als bis es vollendet war.“ Aber Goethe sagte doch auch über seine poetischen Werke: „Es ist nicht gut, daß der Mensch allein sei, und besonders nicht, daß er allein arbeite; vielmehr bedarf er der Teilnahme und Anregung, wenn Etwas gelingen soll.“ Er bedurfte der Anregung von außen, um seine Träume niederzuschreiben; er empfand es auch als große Förderung, wenn Kenner wie Herder, Wieland und Schiller seine fertigen Werke durchgingen und lobten und tadelten; aber im eigentlichen Dichten, im ersten Schaffen, hätte der beste Helfer und Ratgeber ihn nur gestört und verwirrt.[S. 235] Sein Schaffen war ein unbewußtes, nachtwandlerisches; er trug seine Gestalten und Geschichten oft jahrelang im Geiste herum, „als anmutige Bilder, als schöne Träume, die kamen und gingen, und womit die Phantasie mich spielend beglückte.“ Wenn sie ganz durchlebt waren, standen sie dann auch rasch auf dem Papiere. „Während wir Andern“, schrieb Schiller an Heinrich Meyer, „mühselig sammeln und prüfen müssen, um etwas Leidliches langsam hervorzubringen, darf er nur leis an dem Baum schütteln, um sich die schönsten Früchte, reif und schwer, zufallen zu lassen.“
Bei wissenschaftlichen Arbeiten ist dagegen viel mehr Geselligkeit nötig und gegenseitige Unterstützung unentbehrlich, zumal wenn man, wie der alte Goethe, große Stücke der Welt übersehen und recht viel Wissensstoff verarbeiten möchte. Um der Wissenschaft willen trat er mit vielen Menschen verschiedenster Berufsart und Landsmannschaft in Verkehr.
Sobald Menschen von scharfen, frischen Sinnen auf Gegenstände aufmerksam gemacht werden, findet man sie zu Beobachtungen so geneigt als geschickt. Ich habe Dieses oft bemerken können, seitdem ich die Lehre des Lichts und der Farben mit Eifer behandle und, wie es zu geschehen pflegt, mich auch mit Personen, denen solche Betrachtungen sonst fremd sind, von Dem, was mich soeben interessiert, unterhalte. Sobald ihre Aufmerksamkeit nur rege war, bemerkten sie Phänomene, die ich teils nicht gekannt, teils übersehen hatte, und berichtigten dadurch gar oft eine zu voreilig gefaßte Idee, ja gaben mir Anlaß, schnellere Schritte zu tun ... Es gilt also auch hier, was bei so vielen andern menschlichen Unternehmungen gilt, daß nur das Interesse[S. 236] Mehrerer, auf einen Punkt gerichtet, etwas Vorzügliches hervorzubringen imstande sei. Hier wird es offenbar, daß der Neid, welcher Andere so gern von der Ehre einer Entdeckung ausschließen möchte, daß die unmäßige Begierde, etwas Entdecktes nur nach seiner Art zu behandeln und auszuarbeiten, dem Forschen selbst das größte Hindernis sei. Ich habe mich bisher bei der Methode, mit Mehreren zu arbeiten, zu wohl befunden, als daß ich nicht solche fortsetzen sollte.[30]
Goethes Briefwechsel im Alter ist denn auch vorwiegend ein wissenschaftlicher, und seine Altersfreunde bildeten um ihn herum eine Haus-Akademie der Wissenschaften.
**
*
Um noch einmal zur Poesie zurückzukehren, so war Goethe geradezu der Meinung, daß Schiller sich durch seine Arbeitsart getötet habe. Zu Conta sagte er 1820: „Ich behauptete immer, der Dichter dürfe nicht eher an’s Werk gehen, als bis er einen unwiderstehlichen Drang zum Dichten fühle ... Schiller dagegen wollte Das nicht gelten lassen. Er behauptete, der Mensch müsse können, was er wolle, und nach dieser Manier verfuhr er auch.“ Manchmal warnte Goethe in seiner vorsichtigen Weise den Freund: „Ich fürchtete, die Musen niemals wiederzusehen“ schreibt er 1798 an Schiller, „wenn man nicht aus Erfahrung wüßte, daß diese gutherzigen Mädchen selbst das Stündchen abpassen, um ihren Freunden mit immer gleicher Liebe zu begegnen.“
[S. 237]
Der Gedanke, daß man ohne Stimmung und Neigung nichts Tüchtiges hervorbringen kann, läßt sich auch dahin erweitern, daß wir uns bemühen sollen, die vorgesetzte Arbeit zu lieben; zuweilen kann man Das ja erreichen. In einem Briefe an Zelter spricht Goethe von einer neuen Bühnenbearbeitung des ‚Götz‘:
Ich begriff nicht, warum ich seit einem Jahre in dieser Arbeit penelopeisch verfuhr, und, was ich gewoben hatte, immer wieder aufdröselte. Da las ich in Ihrem Aufsatz: was man nicht liebt, kann man nicht machen. Da ging mir ein Licht auf, und ich sah recht gut ein, daß ich die Arbeit bisher als ein Geschäft behandelt hatte, das eben auch so mit andern weggetan sein sollte, und deswegen war es auch geschehen, wie’s getan war, und hatte keine Dauer. Nun wendete ich mehr Aufmerksamkeit und Neigung mit mehr Sammlung auf diesen Gegenstand, und so wird das Werk, ich will nicht sagen gut, aber doch fertig.
**
*
Manche Dichter brauchen starken Kaffee oder Wein, um die Stimmung zu erzwingen. Goethe spottete gegen Schiller über Jean Paul, der nur Kaffee zu trinken brauche, „um so gerade von heiler Haut Sachen zu schreiben, worüber die Christenheit sich entzückte.“ Und wenn er um dieselbe Zeit von sich selber sagte, er könne sechs Monate seine Arbeit voraussagen, weil er sich durch eine gescheidte leibliche Diät vorbereite, so war Das kein Selbstlob, sondern eine verhüllte Mahnung an den Zuhörer, nämlich eben an Jean Paul: er möge doch seine Lebensweise im Essen und Trinken einer nötigen Prüfung unterziehen.
[S. 238]
Ausführlich behandelte Goethe dieses wichtige Thema der Reizmittel zu geistiger Arbeit im März 1828 in einem Gespräche mit Eckermann. Dieser fragte: „Gibt es denn kein Mittel, um eine produktive Stimmung hervorzubringen oder zu steigern?“ Und Goethe erwiderte:
Jede Produktivität höchster Art, jeder große Gedanke, der Früchte bringt und Folgen hat, steht in Niemandes Gewalt und ist über aller irdischen Macht erhaben. Dergleichen hat der Mensch als unverhoffte Geschenke von oben, als reine Kinder Gottes zu betrachten, die er mit freudigem Danke zu empfangen und zu verehren hat. Es ist dem Dämonischen verwandt, das übermächtig mit ihm tut, wie es beliebt, und dem er sich bewußtlos hingibt, während er glaubt, er handle aus eigenem Antriebe. In solchen Fällen ist der Mensch oftmals als ein Werkzeug einer höheren Weltregierung zu betrachten, als ein würdig befundenes Gefäß zur Aufnahme eines göttlichen Einflusses. – –
Sodann aber gibt es eine Produktivität anderer Art, die schon eher irdischen Einflüssen unterworfen ist und die der Mensch schon mehr in seiner Gewalt hat, obgleich er auch hier noch sich vor etwas Göttlichem zu beugen Ursache findet. In diese Region zähle ich alles zur Ausführung eines Plans Gehörige, alle Mittelglieder einer Gedankenkette, deren Endpunkte bereits leuchtend dastehen; ich zähle dahin alles Dasjenige, was den sichtbaren Leib und Körper eines Kunstwerks ausmacht.
Goethe zeigte nun diesen Unterschied der mehr göttlichen und der mehr menschlichen Produktivität am ‚Hamlet‘; gerade dessen Dichter machte ihm so recht den Eindruck eines gesunden, vollkräftigen Menschen, der jederzeit eine frühere geniale Eingebung im einzelnen und kleinen verwerten konnte. Dann schienen seine Gedanken von Shakespeare auf Schiller überzufließen.
[S. 239]
Gesetzt aber, eines dramatischen Dichters körperliche Konstitution wäre nicht so fest und vortrefflich und er wäre vielmehr häufigen Kränklichkeiten und Schwächlichkeiten unterworfen, so würde die zur täglichen Ausführung seiner Szenen nötige Produktivität sicher sehr häufig stocken und oft wohl tagelang gänzlich mangeln. Wollte er nun etwa durch geistige Getränke die mangelnde Produktivität herbeinötigen und die unzulängliche dadurch steigern, so würde Das allenfalls auch wohl angehn, allein man würde es allen Szenen, die er auf solche Weise gewissermaßen forciert hätte, zu ihrem großen Nachteil anmerken. Mein Rat ist daher, nichts zu forcieren und alle unproduktiven Tage und Stunden lieber zu vertändeln und zu verschlafen, als in solchen Tagen Etwas machen zu wollen, woran man später keine Freude hat.
Eckermann warf ein, daß er vom Weine doch eine bessere Meinung habe; mindestens führe sein Genuß zu Entschlüssen, und Das sei doch auch eine Art Produktivität. Da mußte Goethe an seine Verse im ‚Divan‘ denken: „Wenn man getrunken hat, weiß man das Rechte,“ aber sogleich kam er doch auf die wahren, großen Ernährer des Geistes zu sprechen:
Es liegen im Wein allerdings produktivmachende Kräfte sehr bedeutender Art; aber es kommt dabei Alles auf Zustände und Stunde an, und was dem Einen nützt, schadet dem Andern. Es liegen ferner produktivmachende Kräfte in der Ruhe und im Schlaf; sie liegen aber auch in der Bewegung. Es liegen solche Kräfte im Wasser und ganz besonders in der Atmosphäre. Die frische Luft des freien Feldes ist der eigentliche Ort, wo wir hingehören! Es ist, als ob der Geist Gottes dort den Menschen unmittelbar anwehte und eine göttliche Kraft ihren Einfluß ausübte. Lord Byron, der täglich mehrere Stunden im Freien lebte, bald zu Pferde am Strande des Meeres reitend, bald im Boote segelnd oder rudernd, dann sich im[S. 240] Meere badend und seine Körperkraft im Schwimmen übend, war einer der produktivsten Menschen, die je gelebt haben.
Ein andermal tadelte Goethe seines großen Freundes Arbeitsart noch schärfer:
Schiller hat nie viel getrunken, er war sehr mäßig; aber in solchen Augenblicken körperlicher Schwäche suchte er seine Kräfte durch etwas Likör oder ähnliches Spirituoses zu steigern. Dies aber zehrte an seiner Gesundheit und war auch den Produktionen selbst schädlich. Denn was gescheite Köpfe an seinen Sachen aussetzen, leite ich aus dieser Quelle her. Alle solche Stellen, von denen sie sagen, daß sie nicht just sind, möchte ich pathologische Stellen nennen, indem er sie nämlich an solchen Tagen geschrieben hat, wo es ihm an Kräften fehlte, um die rechten und wahren Motive zu finden.
**
*
Als Dichter mußte Goethe oft untätig sein; er konnte und wollte nicht der Aufforderung seines Theaterdirektors folgen: „Gebt ihr euch einmal für Poeten, So kommandiert die Poesie!“ Aber deshalb brauchte er keine einzige Stunde zu verlieren: er war ja auch Gelehrter, Verwaltungsmann und Freund seiner Freunde.
Wechsel der Tätigkeit war ihm die einzige Erholung, und wenn man aus seinen Tagebüchern, die er regelmäßig in zweien Abschnitten des Tages diktierte, ersieht, wie noch im höchsten Lebensalter er von frühster Morgenstunde an in ruhig abgemessener Folge sich einer Unzahl von literarischen Arbeiten, brieflichen Mitteilungen, geschäftlichen Expeditionen, Prüfung und Beschauung von eingesendeten Produktionen und Kunstwerken, ernster und heiterer Lektüre der mannigfachsten Art gewidmet, so muß man es ihm hoch anrechnen, ja bewundern, daß er gleichwohl sich geneigt finden ließ, fast täglich[S. 241] einige Stunden besuchenden Fremden oder Einheimischen hinzugeben.[31]
Die große Ordnung, auf die er streng hielt, das Planvolle in seinen Arbeiten war ein ferneres wichtiges Mittel, wodurch er sich vor Zeitverlust schützte. Jahre oder Jahrzehnte hindurch sammelte er Material für zukünftige Schriften. Als Knebel über Lukrez schrieb, beklagte es Goethe, daß der alte Freund keine Kollektionen, keine Akten darüber habe; darum sei es ihm schwer, produktiv und positiv zu sein. „Da habe ich ganz anders gesammelt, Stöße von Exzerpten und Notizen über jeden Lieblingsgegenstand!“
Für jede Arbeit entwarf er ferner eine sorgfältige Disposition, überdachte die Hauptteile und Unterabteilungen, sammelte dann für die einzelnen Kapitel Tatsachen und Gedanken; so konnte er bald an diesem, bald an jenem Teile des Werkes schreiben, je nachdem er aufgelegt war, und so kamen ihm seine Vorarbeiten oft nach Jahrzehnten noch zugute.
Bei dem vielen Zeug, das ich vorhabe, würde ich verzweifeln, wenn nicht die große Ordnung, in der ich meine Papiere halte, mich in den Stand setzte, zu jeder Stunde überall einzugreifen, jede Stunde in ihrer Art zu nutzen und Eins nach dem Andern vorwärts zu schieben.
So schreibt er selber an Schiller im Mai 1798, und der Kanzler urteilte nach seinem Tode, seine Ordnungsliebe sei fast bis in’s Unglaubliche gegangen.
Nicht nur, daß alle eingegangenen Briefe und ebenso die Konzepte oder Kopien aller abgesendeten monatlich in[S. 242] gesonderte Bände geheftet und über einzelne Unternehmungen, z. B. selbst über jeden Maskenzug, den er anordnete, wieder eigene Aktenstücke gebildet wurden – er entwarf auch periodische Tabellen über die Ergebnisse seiner vielseitigen Tätigkeit, Studien und Fortschritte persönlicher oder innerer Verhältnisse, aus denen dann am Jahresschlusse wieder gedrängte Hauptübersichten zusammengestellt wurden.
Selbst die Zeitungen, die er las, wurden aktenmäßig geheftet.
Wichtiger als dieses Sammeln und Einordnen ist die Ordnung und Beherrschung der Arbeitsstoffe durch fleißiges Bedenken. In Goethes Tagebüchern lesen wir neben andern Tätigkeiten oft: „Das Vorliegende durchdacht“ oder „das Jüngstvergangene überdacht“ oder „Überlegung des Gegenwärtigen“ oder nach einem wichtigeren Ereignis; „Betrachtungen darüber.“ So handelte er nach seiner Lebensregel: „Tun und Denken, Denken und Tun“ und ging nicht unter in den Massen, die auf ihn eindrangen.
**
*
Schnellen Erfolgen jagte Goethe nicht nach, auf Anerkennung konnte er warten, und der Menge zu gefallen, war nie sein Bestreben. So hielt er es z. B. bei den ihm unterstellten Sammlungen und Schulen in Weimar, Jena und Eisenach.
Es war keine geringe Aufgabe, mit den doch immerhin sehr beschränkten Mitteln den Anforderungen fortschreitender Ausbildung auch nur einigermaßen Genüge zu tun. Es galt ein sorgsames Abwägen des Notwendigen, wahrhaft Gedeihlichen, ein standhaftes Ablehnen des nur scheinbar Nützlichen, bloß der augenblicklichen Neigung Zusagenden. Goethe ging,[S. 243] wie bei seinen eigenen Kunstsammlungen, von der Maxime aus, lieber aus kleinen Anfängen jedes Institut sich folgerecht entwickeln, allmählich heranwachsen und ausbilden zu lassen, als mit unverhältnismäßiger Anstrengung von vornherein nach dem Imposanten streben, ein Ausgezeichnetes gleichsam improvisieren zu wollen. Nicht um den äußern Schein und Prunk, sondern darum war es ihm zu tun, daß es in jedem Fache nicht an Gelegenheit und zweckmäßiger Anleitung zu stufenweiser Fortbildung fehle, daß in jungen aufstrebenden Männern Sinn und Geschick erweckt und befestigt werde, auf individuell zusagender Bahn frisch und kräftig vorzuschreiten.[32]
Oft hat er die ‚Folge‘, d. h. die Beständigkeit und Konsequenz im Arbeiten, gerühmt: sie könne auch vom Kleinsten angewendet werden, sie verfehle ihr Ziel selten, da ihre stille Macht im Laufe der Zeit unaufhaltsam wachse; wo man nicht mit Folge wirken könne, sei es geratener, gar nicht anzufangen. Er legte darum großen Wert darauf, daß man ihn als treuen Arbeiter schätze und nicht etwa seiner Genialität zuschreibe, was er durch Fleiß erworben. In seinen alten Tagen wurde er gewahr, daß namentlich im Auslande die Ansicht verbreitet war: er, der Poet, habe sich einen Augenblick von seinem Wege ab- und der Botanik zugewendet und sogleich hochbedeutende Entdeckungen über die Gesetze der Pflanzenbildung gemacht. Um dieser Meinung entgegenzutreten, verfaßte er alsbald einen Aufsatz, in dem er ausführte, wie viele Jahre er Botanik studiert habe, und er betonte, daß es dem wissenschaftlichen Bestreben schädlich sei, wenn man einen falschen Glauben an Geistesblitze von[S. 244] Dilettanten verbreite. „Nicht also durch eine außerordentliche Gabe des Geistes, nicht durch eine momentane Inspiration, noch unvermutet und auf einmal, sondern durch folgerechtes Bemühen bin ich endlich zu einem so erfreulichen Resultate gelangt.“
**
*
Auch in kleinen und äußerlichen Dingen zwang Goethe sich und Andere zum langsamen, sorgfältigen Arbeiten.
Jeder schriftliche Erlaß, das kleinste Einladungsbillett mußte auf das reinlichste und zierlichste geschrieben, gefaltet, besiegelt werden. Alles Unsymmetrische, der geringste Fleck oder falsche Strich war ihm unausstehlich.[33]
Damit die Korrekturen in seinen Manuskripten in der reinlichsten und deutlichsten Weise geschehen konnten, hatte er einen Topf mit Kleister und Pinsel in der Nähe, um an solchen Stellen, wo ihm der Ausdruck nicht mehr gefiel, die Handschrift mit Stückchen neuen Papiers zu überkleben. So berichtet Eckermann, und Carus in Dresden erzählt:
Wirklich erinnere ich mich keiner Sendung von Goethe, so Bücher, kleiner Geldsendungen für Kupferstecher u. dgl., die nicht auf’s zierlichste verpackt gewesen wäre ... Nicht minder hatte ich ja gesehen, wie in seinen Zimmern und Portefeuillen eine strenge, musterhafte, an Pedanterie grenzende Ordnung und Reinlichkeit herrschend war, und fern von aller ostensibler liederlicher sogenannter Genialität, konnte die Ordnung und Zierlichkeit seiner äußern Umgebung ein wohltuendes symbolisches Bild geben von der[S. 245] feinen Ordnung und lichten Schönheit seines inneren geistigen Lebens.[34]
**
*
Die Solidität und Gewissenhaftigkeit, die wir an Goethes Arbeit immer wieder wahrnehmen, bedeutet sehr oft auch Begrenzung der schönsten Vorsätze, Verkleinerung der Ideale, Verzicht auf manchen genialen Traum.
Wir staunen, wieviel Goethe als Dichter, Gelehrter, Staatsdiener ausgeführt hat; aber es ließe sich leicht beweisen, daß er noch viel mehr Pläne nur ausgedacht und begonnen hat, daß er viele seiner besten Einfälle absterben ließ, um die übernommenen Pflichten getreulich zu erfüllen. Als Dichter hat er uns von groß angelegten Werken mehr Anfänge hinterlassen als fertige Stücke. Als Staatsmann dachte auch er sich große soziale oder wirtschaftliche oder pädagogische Verbesserungen aus; in praxi aber widmete er dann seine Stunden einem Wegebau, einer Uferbefestigung, einer[S. 246] militärischen Aushebung, einer Verbesserung der Universitätsbibliothek oder was sonst zunächst getan werden mußte. So trug er die Last des Tages, statt den großen Reformator zu spielen.
In der ‚Achillëis‘ und im ‚Faust‘ hat er uns gestanden, was ihm als das lockendste oder befriedigendste Menschenwerk erschien: wie der große Quäker William Penn als Kolonisator auf jungfräulichem Boden ein neues Gemeinwesen schaffen, „auf freiem Grund mit freiem Volke stehn!“ Das ist herrlicher, als was der junge Held Achilles vollbrachte, der hingerissen wurde, ehe er zum ruhigen, schaffenden Manne reifte. Denn:
„Wären wir zwanzig Jahre jünger!“ sprach Goethe wohl zu Meyer, wenn ihn solche Tagesträume beschlichen, und wandte sich wieder der Arbeit zu, die das größte Recht auf ihn hatte.
[28] Kanzler F. v. Müller in der Erfurter Gedächtnisrede.
[29] Das Folgende nach Sorets Bericht.
[30] Der Versuch als Vermittler von Objekt und Subjekt 1793.
[31] F. v. Müller in der Erfurter Rede.
[32] F. v. Müller in der Erfurter Rede.
[33] F. v. Müller in der Erfurter Rede.
[34] Daß mit dieser weitgehenden Ordnung auch einige Unordnung verbunden war, ist schon S. 33 angedeutet. Gerade in der Studierstube, in der er zumeist lebte, findet man heute, wie bei seinem Scheiden, das Mannigfaltigste unter- und nebeneinander; die Bücher sind wie vom Zufall hier und dort aufgestellt und auch wie vom Zufall ausgesucht. W. v. Oettingen schildert es genauer; vgl. Stunden mit Goethe 8. S. 217.
[S. 247]
Als Goethe im Alter die Lebensgeschichte des englischen Dichters Sterne las, fiel ihm darin der Ausdruck the ruling passion auf. Unter unsern Trieben reißt einer die Führung an sich und bestimmt dann vor den andern unser Handeln und Erleben. Menschen, die eigentlich die gleichen Anlagen haben, entwickeln sich sehr verschieden, je nach der Eigenschaft, die zur Herrschaft gelangt: im Ersten waltet der Ehrgeiz vor, im Zweiten die Vorsicht, im Dritten das Verlangen nach Genüssen, im Vierten der Drang zur Tätigkeit usw. Wenn wir die Summe von Goethes langem Leben ziehen, so müssen wir als sein größtes geistiges Bedürfnis: das Lernen nennen.
Zuerst zeigte sich dieser Trieb, wie bei uns allen, als kindliche Wißbegier und sehr bald auch als Stolz auf die zu Tage tretende große Begabung und seine ungewöhnlichen Kenntnisse. Zeitweilig erscheint der Jüngling als ein eingebildeter junger Gelehrter: man sieht ihn auf dem Wege zum hochberühmten Professor. Aber das vom Vater ihm auferlegte Fach sagte ihm wenig zu, und von sich aus erwählt er auch keine andere Wissenschaft mit Entschiedenheit. Sein Wissen und Können ist ein zerstreutes; er ist ein Liebhaber in allerlei Gebieten; den Doktorgrad, genauer den Lizentiatengrad, erwirbt er nur auf die bequemste Weise und ohne Ehre.[S. 248] Die gelehrten Pedanten haßt Jeder, der vor ihnen nicht bestehen kann; aber freilich hatte Goethe ein angeborenes Recht, sich für einen Besseren zu halten. Er ward sich des „Genies“ bewußt, eines höheren, wo nicht göttlichen Geistes, der kürzere oder längere Zeit bei oder in uns wohnt, uns ungewöhnliche, unbegreifliche Kräfte gibt und uns höhere Erkenntnisse vermittelt. Dies Genie braucht der damit Beglückte nur walten zu lassen; er braucht nur die Vorbedingungen zu schaffen, daß dieser Anhauch Gottes ungestört, ungehemmt stattfinden kann. Er wird also seine Kraft nicht verzehren, seinen Geist nicht verdummen mit beständigem Lesen und Schreiben.
Es ist kein Zufall, daß gerade Goethe von allen Dichtern uns am eindringlichsten den Drang nach Erkenntnis vor die Sinne und Seele gebracht hat: Faust in den ersten Szenen des großen Dramas ist durch ihn die persönliche Gestaltung des stärksten und höchsten Lernenwollens geworden. Diesen faustischen Drang fühlte Goethe selber:
In seinen jüngeren Jahren nannten ihn die Leute oft ehrgeizig; aber was sie für Ehrgeiz hielten, war sein Bedürfnis, ein großes Stück Welt erkennend in sich aufzunehmen,[S. 249] es zu verarbeiten, es zu durchleuchten, sich mit der Welt zu vereinigen.
Sein Leben wurde freilich durchaus kein faustisches.
„Ich bin nur durch die Welt gerannt“ sagt Faust, auf Jahrzehnte zurückschauend;
Goethe resignierte schon in jungen Jahren. Er hatte zwar stets Ursache, das Genie zu verehren und die goldnen Gaben dankbar hinzunehmen, die den Sonntagskindern von oben zufallen; aber er ehrte auch den Fleiß und sammelte die Groschen und Pfennige, die die Tagesarbeit uns einbringt. Er hätte gern die höchsten Erkenntnisse vom Himmel heruntergeholt und mit Gott selber über die Geheimnisse der Schöpfung geredet; aber er begnügte sich und freute sich, wenn er die „Urphänomene“ fand, die Haupt- und Grunderscheinungen in allem Weltgeschehen, das Letzte, was vor Gott steht.
Durch sein ganzes Leben betrieb Goethe dies bewußte Lernen. „Die Sachen anzusehen, so gut wir können“ riet er schon bei Vollendung seines einundzwanzigsten Jahres einem noch jüngeren Bekannten, „sie in unser Gedächtnis schreiben, aufmerksam zu sein und keinen Tag, ohne etwas zu sammeln, vorbeigehen zu lassen. ... Dabei müssen wir nichts sein, sondern alles werden wollen.“
[S. 250]
Und die gleiche Lernlust zeigt noch der Vierundsiebzigjährige, wenn er dem jungen Bonner Mineralogen Nöggerath bestellen läßt: „Wie gern durchzög’ ich die Eifel mit ihm zu klarem Schauen Dessen, was immer noch als Problem vor mir steht! Warum bin ich nicht mehr so leicht auf den Füßen als zur Zeit, wo ich die unnützen Reisen in die Schweiz tat, da man glaubte, es sei was Großes getan, wenn man Berge erklettert und angestaunt hätte!“
Goethe forschte und lernte bis zum letzten gesunden Tage; in seiner Arbeitsstube zeigt man heute noch ein Häufchen Gartenerde, das der Alte sich heraufholen ließ, um daran etwas Neues zu beobachten.
**
*
Diese Lernlust zeigte sich namentlich als Aufmerksamkeit auf alles Belehrende. Die Aufmerksamkeit nannte Goethe „das Höchste aller Fertigkeiten und Tugenden“ und er meinte, Nichts sei so leicht zu erreichen und so wohlfeil zu erhandeln als Kenntnis und Wissen: „Die ganze Arbeit ist ruhig sein, und die Ausgabe Zeit, die wir nicht retten, ohne sie auszugeben.“ Goethe ermahnte sich und Andere zwar immer wieder, nur an Dem Interesse zu nehmen, worin man praktisch etwas leisten könne, aber es lag doch in seiner innersten Natur, daß er an unzähligen Dingen der Welt teilnahm.
Da Goethe sich den Besuch so vieler Menschen gefallen lassen mußte, unter denen auch viele Unbeholfene waren, die von sich aus nichts Anregendes vorbrachten, so machte er es sich selber zur Regel, derartige Gäste[S. 251] als Lehrer oder Lehrmittel zu benutzen. Es kam etwa ein bayrischer Verwaltungsbeamter, um ihn anzuglotzen und nachher seine Bemerkungen über den berühmten Mann zu machen; Goethe zwang ihn, alle Einzelheiten des Feuerlöschwesens in seiner Heimat vorzutragen. Ein ander Mal erschien ein vornehmer Engländer, der früher Gouverneur von Jamaika gewesen war, Sir Michael Clare. Am Abend stand dann in seinem Tagebuche: „Sehr erfreut der Bekanntschaft mit Lord und Lady N. N.; sie gab mir erwünschte Gelegenheit, meine Kenntnisse der Zustände von Jamaika ziemlich vollständig zu rekapitulieren.“
Allerdings glückte dies Verfahren nicht immer. So wurde eines Tages Goethe von seinem Sohne gebeten, einen Jenaer Studenten namens Rumpf, den August vom Burgkeller her kannte, anzunehmen und auch zum Essen dazubehalten. Der junge Mann wurde freundlich empfangen. Er möge weiter erzählen:
Bald saß ich ihm in seinem einfachen Studierstübchen gegenüber, während er beschäftigt war, still ein mäßiges Blatt Papier zurechtzuschneiden, und betrachtete voll Aufmerksamkeit ihn selber, sowie seine Umgebung, seine Bücher und umherliegende Steine. August hatte mich sogleich verlassen und war zu den Hausgenossen gegangen.
So war ich mit Goethe ganz allein. Wie pries ich mich glücklich! Jetzt war er mit seinem Papierschneiden fertig und wandte sich zu mir: „Mein August schreibt mir, daß Sie ein Oldenburger wären?“
„Ein Oldenburger, Exzellenz.“
„Gut. Was brennen Sie da?“
„Fast nur Torf.“
„Wie in Ostfriesland, nicht wahr?“
[S. 252]
„Ich glaube, Exzellenz“ war meine Antwort.
„Wie wird der Torf dort gewonnen?“
„Er wird – er wird aus der Erde gegraben.“
„Das wußt’ ich schon, daß er nicht von den Bäumen gepflückt wird! Ich will zunächst genau wissen, mit welcher Art von Instrumenten er aus dem Boden gehoben wird? Wann gräbt man ihn? Wie lange läßt man ihn trocknen? Wie lange Zeit bedarf er dazu? Und wie ich schon eben sagte, wie ist solch ein Werkzeug gestaltet, womit man den Torf bei Ihnen gräbt? Nun sagen Sie mir und zeichnen Sie mir doch einmal die Form genau hier auf das Papier. Hier haben Sie einen Bleistift dazu.“
„Nun, können Sie Das nicht zeichnen?“ fuhr er dann fort, da ich noch verblüfft schwieg. „So beschreiben Sie es mir wenigstens, Sie sehen ja, daß ich mich dafür interessiere.“
Ich beharrte in festem Schweigen. So einen Torfsoden hatte ich zwar oft genug gesehen und sogar in der Hand gehabt, beim Ofenheizen. Aber da ich aus der reinen, echten Marsch stammte, so war mir doch die eigentliche Gewinnung des Torfes völlig fremd.
„Sie brennen also den Torf täglich und wissen dennoch nichts davon, wie er gewonnen wird? Junger Mann, Das mögen Sie offen gestehen?“
Mit durchdringendem Blicke sah Goethe mich an, und ich fühlte, wie mir das Blut zu Kopfe stieg. – Ein eisiges Schweigen folgte! Mir ward es immer ungemütlicher. Goethe nahm ein Buch zur Hand und blätterte darin, bis der Diener kam und meldete, daß das Essen bereit sei. Bei Tische waren noch Frau Christiane v. Goethe und August zugegen. Den zog der Vater ins Gespräch und unterhielt sich sehr lebhaft mit ihm. Mich ignorierte er völlig.
Goethe hatte durch dieses Ausfragen viele Freuden; zum Beispiel machte er auf solche bequeme Weise große Reisen. Als der Berliner Parthey bei ihm zu Tische war und von seinem Aufenthalte im Morgenlande[S. 253] sprach, da wollten die Andern nur hübsche Leckerbissen von ihm haben, abenteuerliche und rührende Anekdoten hören; aber der alte Meister wehrte sie ab, und Parthey mußte ihm drei Tage hindurch seine ganze Reise Schritt für Schritt schildern.
Der Architekt Wilhelm Zahn kam 1827 nach Weimar mit den schreckhaftesten Vorstellungen über des Dichters Unzugänglichkeit; trotzdem wagte er sich in das Haus.
Auf dem Flure trat mir ein Diener entgegen, dem ich meinen Namen nannte: „Zahn, Maler und Architekt.“
„Maler und Architekt!“ wiederholte mechanisch der Diener, indem er mich zweifelhaft musterte.
„Sagen Sie Sr. Exzellenz: Aus Italien kommend.“
„Aus Italien kommend“ wiederholte Jener und entfernte sich, worauf er alsbald zurückkehrte und mich bat, ihm zu folgen.
Bald saß Zahn dem Gefürchteten gegenüber.
„Waren also in Italien?“
„Drei Jahre, Exzellenz.“
„Haben vielleicht auch die unterirdischen Stätten bei Neapel besucht?“
„Das war der eigentliche Zweck meiner Reise. Ich hatte mich in einem antiken Hause zu Pompeji behaglich eingerichtet, und während zweier Sommer geschahen alle Ausgrabungen unter meinen Augen.“
„Freut mich! Höre Das gern“ sagte Goethe, der eine gedrungene Redeweise liebte und gern die Pronomina wegließ. Er rückte mit seinem Stuhle mir näher und fuhr dann lebhaft fort: „Habe den Akademien zu Wien und Berlin mehrere Male geraten, junge Künstler zum Studium der antiken Malereien nach jenen unterirdischen Herrlichkeiten zu schicken; um so schöner, wenn Sie Das auf eigene Hand getan.[S. 254] Ja, ja! das Antike muß jedem Künstler das Vorbild bleiben. Doch vergessen wir das Beste nicht! Haben wohl einige Zeichnungen in Ihrem Reisekoffer?“
„Ich habe die schönsten der antiken Wandgemälde meist gleich nach der Entdeckung durchgezeichnet und farbig nachzubilden gesucht. Wünschen Exzellenz vielleicht einige davon zu sehen?“
„O gewiß, gewiß!“ fiel Goethe ein, „mit freudigem Danke. Kommen Sie nur zum Essen wieder. Speisen gegen zwei Uhr. Werden noch einige Kunstfreunde finden. Sehne mich ordentlich nach Ihren Bildern. Auf Wiedersehen, mein junger Freund!“ – –
So ergriff er auch jede Gelegenheit, sich zum Erfassen der besten Musik zu bilden. Er richtete sich während der napoleonischen Zeit einen eigenen bescheidenen Singechor ein; von ihm hörte er mit seinen Hausgenossen jeden Sonntagmorgen geistliche und weltliche Gesänge. Als Goethe im Winter 1818 auf 19 drei Wochen in Berka zubrachte, mußte ihm der Organist Schütz dort täglich drei bis vier Stunden vorspielen, und zwar in historischer Reihenfolge Sebastian Bach bis zu Beethoven durch Philipp Emanuel Bach, Händel, Haydn, Mozart, auch Dussek und dergleichen mehr. Zugleich studierte er musiktheoretische Schriften. Und noch, als den Achtzigjährigen das Spiel des jungen Felix Mendelssohn entzückte, mußte ihm der Knabe die ganze Entwicklung der Musik vordozieren und vorspielen.
Und da sitzt er in einer dunkeln Ecke wie ein Jupiter tonans und blitzt mit den alten Augen. – –
So hielt er es in Allem. Fuhr er mit Eckermann spazieren, so mußte Dieser ihm lange Vorträge über[S. 255] die Lebensweise seiner geliebten Vögel halten, und im Garten nahmen sie einmal die ganze Lehre vom Bogenbau und Bogenschießen sehr gründlich durch, weil Das auch ein Steckenpferd Eckermanns war. Und der Sechsundsiebzigjährige suchte auch dieser Übung noch Herr zu werden:
Goethe schob die Kerbe des Pfeils in die Senne, auch faßte er den Bogen richtig, doch dauerte es ein Weilchen, bis er damit zurecht kam. Nun zielte er nach oben und zog die Senne. Er stand da wie ein Apoll, mit unverwüstlicher innerer Jugend, doch alt an Körper.
Schon als Student schaute er auf seinen Wanderungen nicht bloß nach schönen Mädchen und guten Weinen aus, sondern kümmerte sich recht sorgsam z. B. um den Gewerbefleiß an der Saar oder die Altertümer bei Niederbronn. Im Alter schreibt er einmal an seinen August, er treibe in Böhmen seinen alten Spaß noch immer fort: in jeder Mühle nachzufragen, wo sie ihre Mühlsteine hernehmen. In Wiesbaden richtete er seine Spaziergänge gern zu Steinbrüchen und auf Bauplätze; so bekam er nämlich eine schnellere Übersicht über den Grundbau der Gegend, als der Laie vermutet. Und an jedem Orte fragte er nach kundigen Leuten, die ihn belehren konnten. Jena liebte er auch darum, weil er dort so viele kenntnisreiche Männer fand. An die dortigen Professoren dachte er besonders, als er 1818 zum Kanzler v. Müller und zur Julie v. Egloffstein sagte: „Seht, liebe Kinder, was wäre ich denn, wenn ich nicht immer mit klugen Leuten umgegangen wäre und von ihnen gelernt hätte? Nicht aus Büchern, sondern[S. 256] durch lebendigen Ideenaustausch, durch heitere Geselligkeit müßt ihr lernen.“
Er selber lernte freilich auch aus Büchern und will hier im Ernste nichts gegen Bücher sagen; nur zog er eigene Anschauung und mündliches Ausfragen vor. Und da nahm er als Lehrer nicht nur Männer an wie die Humboldts, Schiller, Friedrich August Wolf, Voß, Fichte, Schelling, sondern der schlichteste Bergmann oder Seidenweber oder Hafenarbeiter oder Gärtner war ihm ebenso recht. Und wenn so ein Mann aus dem Volke bescheiden meinte, daß er mit seinen einfältigen Worten den berühmten Herrn nicht aufhalten dürfe, antwortete er: „Erzählen Sie! es gibt nichts Unbedeutendes in der Welt. Es kommt nur auf die Anschauungsweise an.“
Einmal machte er ein halbes Kind zu seinem Lehrer. In Ziegenhain bei Jena zeichnete sich nämlich eine Familie Dietrich durch botanische Kenntnisse aus; sie sammelte Arzneikräuter und besorgte für die botanischen Vorträge in Jena die nötigen Pflanzen. Den jüngsten dieser bäurischen Fachgelehrten nahm Goethe 1785 nach Karlsbad mit; schon unterwegs brachte der Jüngling mit eifrigem Spürsinn alles Blühende zusammen und reichte es Goethen in den Wagen, „dabei nach Art eines Herolds die Linnéischen Bezeichnungen, Geschlecht und Art, mit froher Überzeugung, manchmal wohl mit falscher Betonung“ ausrufend. In Karlsbad war der Knabe schon mit Sonnenaufgang im Gebirge und, ehe Goethe noch seine Becherzahl geleert hatte, war er mit seinem Bündel am Brunnen, und manche[S. 257] Kurgäste nahmen neben dem Dichter an dem seltsamen Unterrichte teil. „Sie sahen ihre Kenntnisse auf das anmutigste angeregt, wenn ein schmucker Landknabe im kurzen Westchen daherlief, große Bündel von Kräutern und Blumen vorweisend, sie alle mit Namen, griechischen, lateinischen, barbarischen Ursprungs, bezeichnend.“ Der junge Mensch studierte später und stand in Goethes alten Tagen den großherzoglichen Gärten in Eisenach mit Ehre vor.
So aufmerksam und lernbegierig war Goethe jeden Tag. Die Wolke am Himmel, das Tier am Wege, die Form des Berges, der Lichtschein durch ein Glas: nichts entging ihm. Er konnte mit einem Freunde über Land fahren und plötzlich halten lassen. „Ei, wo kommst denn du hieher?“ redete er dann wohl einen Stein an, und der nächste Bauer mußte ihm sagen, wo mehr solche Steine zu finden seien. Von einem seiner Kutscher, Barth aus Troistedt, wird berichtet, daß er, angesteckt von der Liebhaberei seines Herrn, von seinem hohen Sitze aus gleichfalls scharf ausblickte und zuweilen, die Pferde anhaltend, in den Wagen rief: „Herr Geheemrat, ich globe, da is was für uns!“
**
*
Manchmal gab es wirklich hübsche Entdeckungen. Als Goethe 1785 nach Karlsbad fuhr, achtete er, wie eben erzählt ist, besonders auf Pflanzen, und da entging ihm im Fichtelgebirge der Sonnentau (Drosera rotundifolia) nicht, und er beobachtete, wie die Blätter ihre Purpurhaare, wenn ein Insekt darauf[S. 258] kommt, zusammenlegen und das Insekt töten. Diese Tatsache war damals zwar bereits beschrieben, 1779 durch Dr. Roth in Bremen, aber doch erst Wenigen bekannt. Erst Darwin hat weitere Kreise darauf aufmerksam gemacht.
Als er 1790 auf den Dünen des Lido, welche die venetianischen Lagunen vom Adriatischen Meere trennen, spazieren ging, hob sein Diener einen geborstenen Schafschädel auf und scherzte, es sei ein Judenschädel, denn an jener Stätte wurden früher die Juden beerdigt. Goethe aber sah sofort etwas Neues, eine Förderung der Wissenschaft. Daß der Schädel der Säugetiere aus Wirbelknochen früherer Tierstufen entstanden sei, wußte er schon; hier an diesem zerschlagenen Schöpsenkopf gewahrte er augenblicklich, daß die Gesichtsknochen gleichfalls aus Wirbeln abzuleiten seien, indem er den Übergang vom ersten Flügelbeine zum Siebbeine und den Muscheln ganz deutlich vor Augen hatte.[35]
Im Sommer 1802 fiel ihm auf, daß in jenem Jahre die Wolfsmilchraupe besonders häufig und kräftig ausgebildet war, und sofort studierte er an vielen Exemplaren ihr Wachstum sowie den Übergang zur Puppe. „Auch hier ward ich mancher trivialen Vorstellungen und Begriffe los“ bemerkt er in seinen Annalen.
Goethe selber hat uns anmutig erzählt, wie er zu seinen botanischen Studien kam: mit Abendgesprächen nach den Jagden im Thüringer Walde fing es an; der Verkehr mit dem weimarischen Apotheker Dr. Buchholz[S. 259] und die Garten- und Parkanlagen des Herzogs reizten zur Fortsetzung; das Lesen von Linnés und Rousseaus Schriften erregte Widerspruch oder Zustimmung; und so ging es weiter, bis der Dichter eigene große Wahrheiten den gelehrten Botanikern, die ihn mißtrauisch in ihr Fach eindringen sahen, verkünden konnte, und bis keiner von ihnen an seiner ‚Metamorphose der Pflanzen‘ mehr vorübergehen durfte.
**
*
Er erwähnt in der Geschichte seines botanischen Studiums ein vorzügliches Mittel, die uns so sehr belehrende Aufmerksamkeit zu steigern: das Reisen. Unsere gewöhnliche Umgebung sehen wir fast gar nicht mehr; sie reizt uns wenig zum Nachdenken; die wunderbarsten Dinge erscheinen uns gemein und leer, wenn wir sie täglich haben:
Dagegen finden wir, daß neue Gegenstände in auffallender Mannigfaltigkeit, indem sie den Geist erregen, uns erfahren lassen, daß wir eines reinen Enthusiasmus fähig sind; sie deuten auf ein Höheres, welches zu erlangen uns wohl gegönnt sein dürfte. Dies ist der eigentliche Gewinn der Reisen, und Jeder hat nach seiner Art und Weise genugsamen Vorteil davon. Das Bekannte wird neu durch unerwartete Bezüge und erregt, mit neuen Gegenständen verknüpft, Aufmerksamkeit, Nachdenken und Urteil.
So erging es Goethen in Italien. Schon in den Alpen fiel ihm die Pflanzenwelt mehr auf als daheim, und im botanischen Garten zu Padua sprach eine Fächerpalme deutlicher zu ihm, als die heimische Birke etwa vermocht hätte. Und nun ließ ihn im Süden die[S. 260] Pflanzenwelt nicht wieder los, obwohl er doch nicht ihretwegen gekommen war.
Das Beobachten unterwegs hat Goethe zu einer wahren Kunst ausgebildet. Er schalt wohl zuweilen auf das Reisen, weil es so sehr zerstreue und verwirre, neue Bedürfnisse errege und andere Fragen beantworte, als man stelle; aber er verstand es doch, vielerlei mit nach Haus zu bringen. Er legte sich stets Aktenfaszikel an, in denen er außer seinen eigenen Notizen Zeitungen, Theaterzettel, Preislisten der Märkte, Rechnungen der Gasthöfe und dergleichen zusammentrug. Sein Auge war auf das Sehen des Eigenartigen außerordentlich eingeübt, weil er sich sein ganzes Leben des Zeichnens befleißigte. Er mochte sein Landschaften-Zeichnen, da er es zu hohen Leistungen nicht brachte, wohl als einen bloßen Zeitvertreib entschuldigen, das für ihn Dasselbe sei wie für Andere das Tabakrauchen, aber zu anderen Zeiten rühmte er es als vortreffliches Bildungsmittel. „Es entwickelt und nötigt zur Aufmerksamkeit“, und: „Meine eigenen Versuche im Zeichnen haben mir doch den großen Vorteil gebracht, die Naturgegenstände schärfer aufzufassen; ich kann mir ihre verschiedensten Formen jeden Augenblick mit Bestimmtheit zurückrufen.“ Das half ihm dann auch wieder, die Malereien Anderer richtig zu werten. Er sah es sofort, wenn ein Maler die Natur nicht kannte, wenn er z. B. einen Baum in eine Umgebung brachte, die in der Wirklichkeit zu einem Baume dieser Art und dieses Wachstums nicht vorkommt.
**
*
[S. 261]
Diese Sachlichkeit war Goethes beständiger Vorsatz, und seine Größe als Mensch rührt namentlich von seinem täglichen Bestreben her: alle Dinge und alle Personen ohne Leidenschaft und Vorurteil zu betrachten, sich selbst zu vergessen, alles Neue ruhig auf sich einwirken zu lassen. Das hielt er auch als Reisender so. Seit Sterne seine berühmte ‚Empfindsame Reise‘ herausgegeben hatte, waren alle Reisebeschreibungen in der Hauptsache den Gefühlen, Ansichten und kleinen Erlebnissen der Reisenden gewidmet. Zuweilen artete Das zu recht eitlem Prangen mit dem lieben Ich aus, z. B. bei Kotzebue. Über dessen Berichte aus seinem Leben spottete Goethe einmal scharf:
Ich bin gewiß, wenn einer von uns im Frühling über die Wiesen von Oberweimar herauf nach Belvedere geht daß ihm tausendmal Merkwürdigeres in der Natur zum Wiedererzählen oder zum Aufzeichnen in sein Tagebuch begegnet, als dem Kotzebue auf seiner ganzen Reise bis an’s Ende der Welt zugestoßen ist. Kommt er wohin, so läßt ihn Himmel und Erde, Luft und Wasser, Tier- und Pflanzenreich völlig unbekümmert; überall findet er nur sich selbst, sein Wirken und sein Treiben wieder; und wenn er in Tobolsk wäre, so ist man gewiß damit beschäftigt, entweder seine Stücke zu übersetzen, einzustudieren, zu spielen.
Goethe dagegen hatte längst die Maxime ergriffen, sich bei Reisen und ihren Beschreibungen „so viel als möglich zu verleugnen und das Objekt so rein, als nur zu tun wäre, in sich aufzunehmen.“ Diesen Grundsatz befolgte er z. B., als er dem römischen Karneval beiwohnte. Durch die mündliche Schilderung dieses Karnevals und durch seine im Druck erschienene Beschreibung[S. 262] hat er vielen Lesern und Zuhörern Freude gemacht. Und dabei gestand er dem Engländer Robinson: „Nichts kann langweiliger sein als dieser Karneval! Ich habe meine Beschreibung wirklich nur gemacht, um davon loszukommen. Meine Wohnung lag am Korso; ich stand auf dem Balkon und schrieb Alles auf, was ich sah. Nicht die kleinste Kleinigkeit habe ich hinzugedichtet.“
Ein einfaches Mittel, aus den persönlichen Schranken zur Sachlichkeit zu gelangen, ist: die Wahrnehmungen und Auffassungen Anderer zu benutzen. Gern nahm Goethe auf einem Ausfluge einen Knaben mit, teils um dessen Freude mitzugenießen, teils um die Dinge gewissermaßen von zwei Seiten zugleich zu sehen. Als er 1796 eine neue Reise nach Italien vorhatte, hätte er gern seinen früheren Zögling Fritz v. Stein zum Begleiter gehabt; Dieser mußte jedoch seine Verhinderung anzeigen, und nun erwiderte Goethe:
Ich verliere dabei sehr viel, denn da ich schon in früherer Zeit so gern und mit so vielem Nutzen durch Dein Organ sah, so würde es mir jetzt auf alle Weise wünschenswert sein, da Du gebildet und in Vergleichung der Dinge durch viele Kenntnisse geübt bist, ich hingegen älter und einseitiger werde.
Einen jungen Musiker Christian Lobe, der von Weimar nach Berlin ging, forderte er auf, ihm über das dortige Theater zu berichten, aber, damit der Bericht sachlich werde, nach einem Schema: Stück – Dichter – Schauspieler – Aufnahme im Publikum – Wirkung[S. 263] auf mich – Wirkung auf die Nachbarn und Bekannten: A., B., C. usw.
Diese Sachlichkeit verlangte er immer. Sobald er merkte, daß Jemand ihn beeinflussen, von vornherein die Dinge in der erwünschten Beleuchtung erscheinen lassen wollte, konnte er ihn wohl andonnern: „Die Sache! die Sache; wie ist Die?“ – So wollte er es haben, wie Sulpiz Boisserée es machte, als er den alten Meister wieder zur Gotik zurückbekehren wollte: statt irgendwie dafür zu schwärmen oder nach Art eines Anwalts Beweise beizubringen, legte Boisserée ruhig eine sprechende Zeichnung nach der andern vor, bis sich Goethe gefangen erklärte.
**
*
Goethe war sich Dessen bewußt, wieviel er diesem fleißigen und sachlichen Betrachten verdankte. Als er nach Italien reiste, schreibt er an die Freundin Charlotte v. Stein:
Wie glücklich mich meine Art, die Welt anzusehen, macht, ist unsäglich, und was ich täglich lerne! Und wie mir doch fast keine Existenz ein Rätsel ist! Es spricht eben Alles zu mir und zeigt sich mir an.
So aus Regensburg am 4. September 1786. Und einige Wochen danach wiederholt er in Vicenza seine Freude, daß er falsche Ansprüche der Reisenden überwunden habe.
Jeder denkt doch eigentlich für sein Geld auf der Reise zu genießen. Er erwartet aber die Gegenstände, von denen er so Vieles hat reden hören, nicht zu finden, wie der Himmel und die Umstände wollen, sondern so rein, wie[S. 264] sie in seiner Imagination stehen: und fast Nichts findet er so, fast Nichts kann er so genießen! Hier ist was zerstört – hier was angekleckt – hier stinkt’s – hier raucht’s – hier ist Schmutz usw. So in den Wirtshäusern, mit den Menschen usw.
Der Genuß auf einer Reise ist, wenn man ihn rein haben will, ein abstrakter Genuß. Ich muß die Unbequemlichkeiten, Widerwärtigkeiten, Das, was mit mir nicht stimmt, was ich nicht erwarte: Alles muß ich bei Seite bringen, in dem Kunstwerk nur den Gedanken des Künstlers, die erste Ausführung, das Leben der ersten Zeit, da das Werk entstand, heraussuchen und es wieder rein in meine Seele bringen, abgeschieden von Allem, was die Zeit, der Alles unterworfen ist, und der Wechsel der Dinge darauf gewirkt haben. Dann hab’ ich einen reinen, bleibenden Genuß, und um dessentwillen bin ich gereist, nicht um des augenblicklichen Wohlseins oder Spaßes willen. Mit der Betrachtung und dem Genuß der Natur ist’s eben Das. Trifft’s dann aber auch einmal zusammen, daß Alles paßt, dann ist’s ein großes Geschenk! Ich habe solche Augenblicke gehabt.
Wenn man in alten Tagen Goethes Genialität rühmte, führte er sie wohl auf seine erworbene Sachlichkeit zurück:
Ich lasse die Gegenstände ruhig auf mich einwirken, beobachte dann diese Wirkung und bemühe mich, sie treu und unverfälscht wiederzugeben. Dies ist das ganze Geheimnis was man Genialität zu nennen beliebt.
So sagte er zum Kanzler v. Müller, und ähnlich zum Prinzenerzieher Soret:
Ich verdanke meine Werke keineswegs meiner eigenen Weisheit allein, sondern Tausenden von Dingen und Personen außer mir, die mir dazu das Material boten. Es kamen Narren und Weise, helle Köpfe und bornierte, Kindheit[S. 265] und Jugend wie das reife Alter: alle sagten mir, wie es ihnen zu Sinne sei, wie sie lebten und wirkten und welche Erfahrungen sie sich gesammelt, und ich hatte weiter nichts zu tun als zuzugreifen und Das zu ernten, was Andere für mich gesäet hatten.
**
*
Da wir in Goethe zuerst und vornehmlich den Dichter sehen, so will es uns schwer in den Sinn, daß das poetische Schaffen und alles Betätigen überhaupt Goethes stärkster Trieb nicht war, daß seine „Werke“ mehr nur als eine Folge seiner eigentlichen Leidenschaft, des eindringenden Beschauens, angesehen werden müssen. Er las einmal folgende Zeilen über sich: „Zeigt nicht jedes Blatt, daß er ein weit höheres Bedürfnis fühlt, in das innerste Wesen des Menschen und der Dinge einzudringen, als seine Gedanken poetisch auszusprechen?“ Dies ungewöhnliche Urteil setzte ihn in Verwunderung; es erschien ihm aber richtig, und er wollte nur hinzugesetzt haben: „als sprechend, überliefernd, lehrend oder handelnd sich zu äußern.“
Wenn der Ofen geheizt wird, erwärmt er das Zimmer; was der Schriftsteller lernt, wird alsbald weitergegeben.
Ich habe immer nur dahin getrachtet, mich selbst einsichtiger und besser zu machen, den Gehalt meiner eigenen Persönlichkeit zu steigern und dann immer nur auszusprechen, was ich als gut und wahr erkannt hatte.
So sprach er zu Eckermann, und er konnte hinzufügen:
[S. 266]
Dieses hat freilich, wie ich nicht leugnen will, in einem großen Kreise gewirkt und genützt; aber es war nicht Zweck, sondern ganz notwendige Folge.
**
*
Wie sehr Goethe durch bloßes Sehen und Hören, namentlich durch bloßes Sehen, lernte, können wir Heutigen, die wir unser Wissen meist vom Papier her erlangen oder vom Auswendiglernen für die Schule zurückbehielten, uns nur schwer vorstellen. Eine Folge dieser Art des Lernens ist die besondere goethische Sprache. „Ich habe die Gegenstände ruhig auf mich einwirken lassen“ antwortete er selber, als man ihn nach der Ursache seines schönen Stils fragte.
Um die ihn belehrenden Gegenstände nach Wunsch sehen zu können, wurde er ein großer Sammler; von allen Reisen brachte er Schönes und Merkwürdiges heim; mit andern Sammlern tauschte er Entbehrliches aus; die Freunde regte er zur Beihilfe an, und auch Fremde wußten, daß ein Geschenk dieser Art das sicherste Mittel war, ihm Freude zu bereiten und ein freundliches Wort von ihm zu erhalten. Öffentliche Museen gab es noch sehr wenige; es lag selbst dem Landmanne, der beim Pflügen etwas Seltsames fand, der Gedanke nahe, es Goethen zu schicken. Der Dichter selber aber fahndete beständig auf wertvolle Büsten, Gemmen, Münzen, Medaillen, Kupferstiche u. dgl.
Allein seine Mineraliensammlung umfaßte mehr als 18000 Stücke!
Selbst die Staaten- und Fürstengeschichte sah er in seinen Stuben mit Augen: wenn er nämlich seine Medaillen und Münzen nach Ländern und Zeiten ordnete und betrachtete; z. B. konnte er jeden Papst seit dem fünfzehnten Jahrhundert vorweisen und wußte unzählige Einzelheiten über die Veranlassung der einzelnen Denkmünzen. Und oft konnten Kupferstiche herbeigeholt werden, die noch genauer die Länder und Zeiten anschaulich machten. Immer strebte Goethe zuerst nach dieser Erkenntnis durch die Augen; nachher erst rief er das belehrende Buch zur Hülfe. So nahm er einmal 1400 Schwefelpasten antiker Münzen vor. „Ich habe sie so lange angesehen“ schrieb er an Wilhelm v. Humboldt, „und von allen Seiten betrachtet, bis ich fremder Hülfe bedurfte: dann nahm ich Eckhels fürtreffliches Werk vor.“
**
*
[S. 268]
Da der Tag „grenzenlos lang ist“, so fand Goethe aber auch unzählige Stunden zum Lesen. Er hat einmal darüber gescherzt, wieviel Zeit und Mühe ihm das Lesenlernen gekostet habe und daß er kaum mit achtzig Jahren es richtig könne. Wir wissen, wie er im Februar 1828 die Biographie Napoleons von Walter Scott durcharbeitete. Nach jedem Kapitel fragte er sich, was er Neues empfangen, was ihm in die Erinnerung zurückgerufen ward; dann fügte er Selbsterlebtes zu Walter Scotts Berichten hinzu, so daß er bald selber nicht mehr wußte, was er im Buche gefunden und was er hineingetragen habe.
Genug, mir ist der lange, immer bedeutende und mitunter beschwerliche Zeitraum von 1789 an, wo nach meiner Rückkunft aus Italien der revolutionäre Alp mich zu drücken anfing, bis jetzt ganz klar, deutlich und zusammenhängend geworden; ich mag auch die Einzelheiten dieser Epoche jetzt wieder leiden, weil ich sie in einer gewissen Folge sehe. Hier hast Du also wieder ein Beispiel meiner egoistischen Leseweise; was ein Buch sei, bekümmert mich immer weniger; was es mir bringt, was es mir aufregt. Das ist die Hauptsache.
Das ist ganz im Einklang mit seiner Lehre: „Jedes gute Buch versteht und genießt Niemand, als der supplieren kann. Wer etwas weiß, findet unendlich mehr, als der erst lernen will.“ Man muß freilich auch supplieren und dem Verfasser gelehrter Werke ebenso wie dem Künstler nachhelfen wollen! Goethes langjähriger Mitarbeiter Riemer urteilte von seinem Meister, er sei einer von den gutwilligen Lesern gewesen, die das Brot des Autors mit der Butter guten Willens überstreichen und so die Lücken zukleben, wenn sie nicht gar zu groß[S. 269] sind; dagegen habe Goethe von seinem Freunde Reinhard gesagt; „Der ißt das Brot trocken; da kann er freilich sonderbare Dinge erzählen von Dem, wie es ihm geschmeckt!“
Ein gewöhnlicher Fehler der Lesenden ist, daß sie bei Eintritt in ein neues geistiges Gebiet in falschem Stolze die Schülerbücher meiden und sogleich die höchsten Probleme erfassen möchten. „Ist Das nicht ein starker Beweis von Unwissenheit?“ fragte Soret, und Goethe antwortete; „Jawohl, mein Freund; ich bin auch der Ansicht; daran erkennt man die Esel. Das sind die Spitzen ihrer Ohren!“
Die üblichste Verirrung der Lesenden ist jedoch ihr Bestreben oder Versuch, Alles zu lesen, was von altersher berühmt ist und wovon jetzt gerade die Leute reden oder was der Zufall vor die Augen schiebt.
Man bildet sich vergebens ein, daß man allen literarischen Erscheinungen face machen [ihnen gegenüber Stellung nehmen] könnte. Es geht einmal nicht; man tappt in allen Jahrhunderten, in allen Weltteilen herum und ist doch nicht überall zu Hause, stumpft sich Sinn und Urteil ab, verliert Zeit und Kraft. Man liest Folianten und Quartanten durch und wird um nichts klüger, als wenn man alle Tage in der Bibel läse ....
Man liest viel zu viel geringe Sachen, womit man die Zeit verdirbt und wovon man weiter nichts hat. ...
Seit ich keine Zeitungen mehr lese, bin ich ordentlich wohler und geistesfreier. Man kümmert sich doch nur um Das, was Andere tun und treiben, und versäumt, was einem zunächst obliegt.
Nicht das Neuigkeits-Verschlingen, sondern das fleißige, treuliche Umgehen mit dem uns gemäßen[S. 270] Großen bildet uns in die Höhe. Wenn Goethe die Kupfer nach den berühmtesten italienischen Malern betrachtete, so bekannte sogar er:
Wir kleinen Menschen sind nicht fähig, die Größe solcher Dinge in uns zu bewahren, und wir müssen daher von Zeit zu Zeit immer dahin zurückkehren, um solche Eindrücke in uns aufzufrischen.
Immer wieder Raffael zu betrachten, mahnte er auch Eckermann, damit er im Verkehr mit dem Besten bleibe und sich immerfort übe, die Gedanken eines hohen Menschen nachzudenken.
Den Geschmack kann man nicht am Mittelgut bilden, sondern nur am Allervorzüglichsten. Ich zeige Ihnen daher nur das Allerbeste, und wenn Sie sich darin befestigen, haben Sie einen Maßstab für das Übrige.
So hielt er es auch mit den Dichtern. Bei Homer und den griechischen Dramatikern ging er immer wieder in die Schule; ja sogar von dem Romane ‚Daphnis und Chloe‘ des Longos urteilte er: „Man tut wohl, dies Gedicht alle Jahre einmal zu lesen und immer wieder daran zu lernen und den Eindruck seiner großen Schönheit auf’s neue zu empfinden.“ Ebenso konnte er über Shakespeare oder Byron urteilen, und wenn man wegen des Letzteren Einwendungen machte, so erwiderte er: „Alles Große bildet, nicht etwa bloß das entschieden Reine und Sittliche; an Byron ist auch seine Kühnheit, Keckheit, Grandiosität bildend.“ Von Molière bekannte er 1827: „Ich kenne und liebe ihn seit meiner Jugend und habe während meines ganzen Lebens von ihm gelernt. Ich unterlasse nicht, jährlich von ihm[S. 271] einige Stücke zu lesen, um mich im Verkehr des Vortrefflichen zu erhalten.“ Einmal meinte er: „Man sollte eigentlich immer nur Das lesen, was man bewundert,“ und an einem andern Tage: „Es kommt immer darauf an, daß Derjenige, von dem wir lernen wollen, unserer Natur gemäß sei. – – Überall lernt man nur von Dem, den man liebt.“
Ein sehr wertvoller Rat Goethes war schließlich:
Der Mensch mache sich nur irgend eine würdige Gewohnheit zu eigen, an der er sich die Lust in heiteren Tagen erhöhen und in trüben Tagen aufrichten kann. Er gewöhne sich z. B., täglich in der Bibel oder im Homer zu lesen oder Medaillen oder schöne Bilder zu schauen oder gute Musik zu hören. Aber es muß etwas Treffliches, Würdiges sein, woran er sich gewöhnt, damit ihm stets und in jeder Lage der Respekt dafür bleibe.
**
*
Das Lernen und Unterrichten war zu Goethes Zeit viel freier, freiwilliger und ungeregelter als heute; Goethe nutzte diese schöne Freiheit auch dadurch aus, daß er zeitlebens ebenso Lehrer war wie Schüler. Schon als Kind verriet er seine lehrhafte Natur: als ihm 1759 ein sechsjähriges Brüderchen starb und er darüber nicht weinte, fragte ihn seine Mutter, ob er denn den kleinen Hermann Jakob nicht lieb gehabt habe; da eilte Wolfgang in seine Kammer, zerrte unter dem Bette eine Menge Papiere hervor, die er mit Lektionen und Geschichten vollgeschrieben hatte. „Dies alles hab ich gemacht, um es den Bruder zu lehren!“
Später belehrte er die Schwester und bald auch alle Freunde und Freundinnen, die sich ihm lernlustig[S. 272] nahten. Zuweilen auch Heranwachsende: die Schüler der Zeichenschule, seinen Pflegesohn Fritz v. Stein, seinen Sohn August, jugendliche Schauspieler und Schauspielerinnen, aus denen er eine Theaterschule bildete. Die verschiedensten Fächer lehrte er: Zeichnen, Malen, Englisch, Botanik, Farbenlehre, Anatomie, Deklamation, deutsche Literatur. Manches Jahr waren den Winter über die weimarischen Fürstinnen, ihre Hofdamen und nächsten Freundinnen, wie Charlotte v. Stein und Charlotte v. Schiller, seine Schülerinnen; sie kamen einmal die Woche, z. B. im Winter 1805/06 Mittwochs vormittags von elf bis ein Uhr, und Goethe hatte dann immer etwas für sie zum Vorzeigen zurechtgelegt und zum Vortragen überdacht. Er sprach frei nach Stichworten, manchmal mit der Hand über die Stirn fahrend, während er denkend redete. Fräulein v. Knebel berichtet einmal an ihren Bruder: „Er sprach so reich, reif und mild, daß ich wirklich noch nie so habe sprechen hören. Ich wünschte, er hätte die Rede aufgeschrieben; mich dünkt, sie allein müßte ihm den Ruhm eines seltenen Menschen machen.“ Mit gutem Grunde widmete Goethe seine ‚Farbenlehre‘ der Herzogin Luise und sein ‚Leben Hackerts‘ der Herzogin Amalie. Zu seinen fürstlichen Schülerinnen gehörte auch die junge kranke Kaiserin von Österreich, Maria Ludowika.
Goethe betont auch hier sein Streben nach eigenem Vorteil. „Ich hielt niemals einen Vortrag, ohne daß ich dabei gewonnen hätte“ erzählte er in der ‚Kampagne in Frankreich‘; „gewöhnlich gingen mir unter’m Sprechen neue Lichter auf.“ Und an Zelter schrieb er[S. 273] 1805 über die erwähnten Mittwochsvorträge: „Ich werde bei dieser Gelegenheit erst gewahr, was ich besitze und nicht besitze.“ Als die ‚Farbenlehre‘ nicht recht rücken wollte, meinte er zu Knebel: „Wenn ich genötigt wäre, diese Lehre nur zwei halbe Jahre öffentlich zu lesen, so wäre Alles getan. Aber die Gelehrsamkeit auf dem Papiere und zum Papiere hat gar zu wenig Reiz für mich.“
**
*
Das beständige Lernen führt Manchen, selbst wenn er durch das Verwenden zum eigenen Vortrag Richtung behält, nur zur Vielwisserei, zum Ansammeln von Einzelheiten und Kleinigkeiten. „Dann hat er die Teile in seiner Hand, Fehlt leider! nur das geistige Band!“ Goethe war zur Vielgelehrsamkeit nach Böttigers Art zu sehr Dichter, zu wenig Kleinigkeitsphilister. Er suchte stets im Einzelnen das Allgemeine, in der „zufälligen“ Erscheinung das Gesetz, im Wechselnden das Bleibende. „Wir befinden uns in einem Chaos von Kenntnissen, und Keiner ordnet es; die Masse liegt da, und man schüttet zu; aber ich möchte es machen, daß man wie mit einem Griff hineingriffe und Alles klar würde.“ Die Natur läßt sich zwar ihre letzten Geheimnisse nicht abzwingen, aber dann und wann gelingt es uns, den Schöpfergedanken näher zu kommen. Und eben Das war sein Streben bei aller gelehrten Arbeit.
Andere wieder verlieren sich, um zu großen Wahrheiten zu gelangen, in metaphysischen Phantasien, im Aufbauen philosophischer Systeme oder in okkultistischen[S. 274] Träumereien. Dazu war Goethe wieder zu sehr Naturforscher: Erfahrung, Beobachtung, Versuch sollten ihm zur Erkenntnis verhelfen. Vor dem Okkultismus hütete er sich, obwohl er manche seiner Lehren durchaus nicht leugnete.
Wir wandeln alle in Geheimnissen. Wir sind von einer Atmosphäre umgeben, von der wir noch gar nicht wissen, was sich alles in ihr regt und wie es mit unserem Geiste in Verbindung steht. So viel ist wohl gewiß, daß in besonderen Zuständen die Fühlfäden unserer Seele über ihre körperlichen Grenzen hinausreichen können und ihr ein Vorgefühl, ja auch ein wirklicher Blick in die Zukunft gestattet ist.
Aber er mochte doch nie eine Somnambule sehen, auch dann nicht, als der Ruhm der Seherin von Prevorst seine Umgebung sehr beschäftigte. Er kannte die Gefahr solcher Studien. „Man wird selbst zum Traum, zur Niete, wenn man sich mit diesen Phantomen beschäftigt“ schrieb er schon 1788 an Herder, der, wie seine Gattin, recht abergläubisch war. Und 1830 meinte er auch zum Kanzler:
Ich habe mich immer von Jugend auf vor diesen Dingen gehütet, sie nur parallel an mir vorüberlaufen lassen. Zwar zweifle ich nicht, daß diese wundersamen Kräfte in der Natur des Menschen liegen; aber man ruft sie auf falsche, oft frevelhafte Weise hervor. Wo ich nicht klar sehen, nicht mit Bestimmtheit wirken kann, da ist ein Kreis, für den ich nicht berufen bin.
Gegen die Philosophen und ihre „Ideen“ war er gleichfalls sehr mißtrauisch. Schiller hatte ihn zuerst durch sein wüstes Jugenddrama abgestoßen; als dann der Dichter der ‚Räuber‘ auch noch Kantianer wurde,[S. 275] empfand ihn Goethe erst recht als Geistes-Gegenfüßler, mit dem ein Verkehr unmöglich sei. Aber ihr beiderseitiges Suchen nach großen Anschauungen mußte sie dennoch zusammenführen. Sie hörten in Jena einmal einen naturwissenschaftlichen Vortrag; beim Hinausgehen kamen sie in ein Gespräch, wobei Schiller bemerkte, daß eine so zerstückelte Art, die Natur zu behandeln, den Laien nicht anmuten könne. Goethe horchte auf. Auch dem Eingeweihten bleibe diese zerstückelte Art vielleicht unheimlich, war seine Antwort, und vielleicht könne man es auch anders machen. Man brauche nicht die Natur gesondert und vereinzelt vorzunehmen, sondern könne sie wirkend und lebendig, aus dem Ganzen in die Teile strebend, darstellen. Schiller sah ihn ungläubig an, denn Dergleichen glaubte er den Philosophen vorbehalten, zu denen doch Goethe nicht gehören wollte. So schritten sie weiter, bis an Schillers Haus, bis in sein Zimmer, und dort trug dann Goethe die Metamorphose der Pflanzen lebhaft vor, indem er mit manchen charakteristischen Federstrichen eine symbolische Pflanze vor Schillers Augen entstehen ließ. Dieser hörte mit lebhafter Teilnahme zu; aber als Goethe geendet, schüttelte er den Kopf und sagte: „Das ist keine Erfahrung, Das ist eine Idee!“ Nun stutzte Goethe, einigermaßen verdrießlich. Sein alter Groll gegen die Philosophierei wollte sich wieder regen, aber er nahm sich zusammen und antwortete: „Das kann mir sehr lieb sein, daß ich Ideen habe, ohne es zu wissen, und sie sogar mit Augen sehe.“ Und die nächsten Tage trug er sich mit der Frage: Wenn er Das für eine Idee hält, was ich als[S. 276] Erfahrung anspreche, so muß doch zwischen beiden eine Vermittelung sein? –
So begann ein zehnjähriger Umgang: Beide waren Lehrer und Schüler; Goethe entwickelte die philosophischen Anlagen, die seine Natur enthielt, und eignete sich noch recht ansehnliche Kenntnisse auf diesem Gebiete an.
Aber 1829 konnte er jedoch ohne viel Übertreibung zu Eckermann sagen: „Von der Philosophie habe ich mich selbst immer frei gehalten; der Standpunkt des gesunden Menschenverstandes war auch der meinige.“
**
*
Das fruchtbarste Lernen ist die Überwindung des eigenen Irrtums. Wer keinen Irrtum eingestehen will, kann ein großer Gelehrter sein, aber er ist kein großer Lerner. Wer sich des Irrtums schämt, Der sträubt sich, ihn zu erkennen und zuzugeben; d. h. er sträubt sich vor einem besten innerlichen Gewinn. Da Jedermann irrt, da die Weisesten geirrt haben, so haben wir keinen Grund, unsern Irrtum als etwas Schändliches zu empfinden.
Wenn wir Dasjenige aussprechen, was wir im Augenblick für wahr halten, so bezeichnen wir eine Stufe der allgemeinen Kultur und unserer besonderen. Ob ich mich selbst [berichtige] oder durch Andere zurechtweisen lasse, ist für die Sache selbst gleichviel; je geschwinder es geschieht, desto besser.
„Irrend lernt man!“ rief Goethe seinem Sohne August zu, als Dieser Einkäufe bei Frankfurter Antiquaren[S. 277] machen sollte und sich vor dem Betrogenwerden fürchtete. Und als Frau Grüner in Eger klagte, ihr Mann, den Goethe mit mineralogischen Neigungen angesteckt hatte, bringe so viele gemeine Steine mit nach Hause, neben den wenigen schönen, und verkratze die Tischplatten damit, da erwiderte Goethe: „Machen Sie sich nichts daraus! Ich habe auch manche Fuhre zur Verbesserung der Wege wieder hinausgeschafft. Die Sache läutert sich und macht uns Vergnügen, wenn wir eines Besseren belehrt werden.“
Schon 1804 sprach Goethe in einem Briefe an Eichstädt den kühnen Gedanken aus, daß man sogar am offenbaren Irrtum Wohlgefallen haben dürfe:
Bei strenger Prüfung meines eigenen und fremden Ganges in Leben und Kunst fand ich oft, daß Das, was man mit Recht ein falsches Streben nennen kann, für das Individuum ein ganz unentbehrlicher Umweg zum Ziele sei. Jede Rückkehr vom Irrtum bildet mächtig den Menschen im Einzelnen und Ganzen aus, so daß man wohl begreifen kann, wie dem Herzensforscher ein reuiger Sünder lieber sein kann als neunundneunzig Gerechte. Ja, man strebt oft mit Bewußtsein zu einem scheinbar falschen Ziel, wie der Fährmann gegen den Fluß arbeitet, da ihm doch nur darum zu tun ist, gerade auf dem entgegengesetzten Ufer anzulanden.
Das Erkennen eines eigenen Irrtums oder einer eigenen Schwäche macht uns namentlich auch duldsam und freundlich gegen andere Irrende. „Eigener Fehler erhält Demut und billigen Sinn“ steht von Goethes Hand im Stammbuche seines Schülers Fritz v. Stein.
[S. 278]
Trotzdem gibt Goethe zu, daß es nicht so ganz leicht sei, sich von einem Irrtum zu trennen; „Man zaudert und zweifelt und kann sich nicht entschließen, so wie es schwer hält, sich von einem geliebten Mädchen loszumachen, von deren Untreue man längst wiederholte Beweise hat.“
Aber es bleibt doch dabei: der Fehler nützt uns erst, wenn wir ihn erkennen.
[35] Bedeutende Fördernis d. e. g. W. 1823.
[36] Paul Heyse. – Mehrere Freunde klagten sogar, daß Goethe sich naturwissenschaftliche oder künstlerische Merkwürdigkeiten von ihnen angeeignet habe, die sie nicht als Geschenk gemeint hatten. Sich selbst bereichern wollte er nicht, denn der Geldwert seines Museums kam ihm selten in den Sinn: erst 1831 dachte er einmal daran, es an die Großherzogin Marie zu verkaufen; vielmehr waren diese Sammlungen, die jedem Liebhaber zugänglich waren, ein Opfer von ihm für die Gemeinschaft. In seinem Testamente von 1831 erklärte er, daß er seit 60 Jahren wenigstens 100 Dukaten jährlich (960 M.) für den Ankauf von Kunstwerken und Seltenheiten verwandt habe.
[S. 279]
„Von mir sagen die Leute, der Fluch Kains läge auf mir,“ schreibt der vierundzwanzigjährige Goethe an seinen Freund Kestner, und ein andermal drückt er Dasselbe in althellenischem Bilde aus, indem er sich zu des Tantalus Geschlecht rechnet. „Goethe ist nicht glücklich und kann schwerlich glücklich werden“ schrieb 1779 seine Freundin Johanna Fahlmer an Fritz Jacobi. „Er ist ein sehr unglücklicher Mensch“ urteilte 1791 der deutsch-dänische Bischof Münter über den zweiundvierzigjährigen Goethe, „muß beständig mit sich selbst in Unfrieden leben.“
Später sagten scharfe Beobachter: Goethe sehe aus wie Einer, der großen Kummer in sich verarbeitet habe. Aber allmählich entstand der Glaube, daß Goethe ein Schoßkind des Glückes gewesen sei: ihm habe das Leben so heiter gelacht wie nur irgend einem Sterblichen.
Den gewöhnlichen Kampf um’s Dasein, der die Meisten von uns zeitlebens beschäftigt, hat Goethe allerdings nicht kämpfen müssen; ernste Sorgen um Einkommen und Auskommen hat er sich nie zu machen brauchen; zu hohem Ansehen und Rang kam er schon in recht jungen Jahren; Freunde und Freundinnen erwarb sich der schöne und begabte Mann ohne viel Mühe. Aber tausend Quellen von Leid und Not fließen[S. 280] auch noch auf solchen Bevorzugten zu, und es muß ein tapferer Schwimmer sein, der ihre Fluten teilen und das Ufer erreichen will, zu dem er strebt.
Auch Goethe hatte tausendfach zu ringen: um körperliche und geistige Gesundheit, um häusliches Wohlbefinden, um ein gutes Verhältnis zu den Menschen, die ihn nah und fern umgaben. Bei seiner großen Weichheit und Empfindlichkeit trafen ihn die Krankheits- und Todesfälle und sonstige Nöte in seiner Freundschaft außerordentlich schwer. Sein ehemaliger Hausgenosse Heinrich Meyer wußte von den sehr starken Ausbrüchen des Schmerzes zu erzählen, denen sich Goethe beim Tode seiner Kinder hingab: daß er sich laut weinend auf der Erde gewälzt habe. Wir wissen, daß Niemand wagte, ihm Schillers Tod zu sagen; ebenso war es, als Ernestine Vulpius, eine Schwester seiner Frau, der Schwindsucht erlegen war. Als ihm dann der einzige übrig gebliebene Sohn auch noch in’s dunkle Land vorausging, seufzte der Greis: „Es scheint, als wenn das Schicksal die Überzeugung habe, man sei nicht aus Nerven, Venen, Arterien und anderen daher abgeleiteten Organen, sondern aus Draht zusammengeflochten.“ So empfand er also das allgemeine menschliche Schicksal tief. Welche besonderen Leiden aber der geniale, nach höchsten Erkenntnissen strebende Forscher trägt, hat uns Goethe im ‚Faust‘ offenbart; an eben solche Leiden dachte der genannte Bischof Münter, als er von Goethes Unglück sprach: „Alles arbeitet in seinem Kopf und drängt ihn zur Tätigkeit, und doch will er sein Amt nicht abwarten ... Hat Botanik, Anatomie, Kunst studiert,[S. 281] Alles wieder liegen lassen und arbeitet nun über die Theorie der Farben.“ Und Schopenhauer belehrt uns:
Die bloßen Talentmänner kommen stets zur rechten Zeit; denn, wie sie vom Geiste ihrer Zeit angeregt und von dem Bedürfnis derselben hervorgerufen werden, so sind sie auch gerade nur fähig, Diesem zu genügen. Sie greifen daher ein in den fortschreitenden Bildungsgang ihrer Zeitgenossen oder in die schrittweise Förderung einer speziellen Wissenschaft; dafür wird ihnen Lohn und Beifall.
Das Genie hingegen trifft in seine Zeit wie ein Komet in die Planetenbahnen, deren wohlgeregelter und übersehbarer Ordnung sein völlig exzentrischer Lauf fremd ist. Demnach kann es nicht eingreifen in den vorgefundenen regelmäßigen Bildungsgang der Zeit, sondern wirft seine Werke weit hinaus in die vorliegende Bahn, auf welcher die Zeit solche erst einzuholen hat. Daher steht das Genie in seinem Treiben und Leisten meistens mit seiner Zeit im Widerspruch und Kampf.
Aus innerster Seele hat Goethe diesen Kampf und diese Einsamkeit des genialen oder auch nur des eigenartigen Menschen in seinen Dichtungen manches Mal dargestellt. Was hat nicht Tasso zu tragen, weil sich die Welt in ihm anders spiegelt als in regelrechten Hofleuten und fürstlichen Personen! Die Kühnsten der goethischen Helden ballen in ihrer Verzweiflung sogar gegen den Himmel die Faust. „Ich dich ehren? Wofür? Hast du die Schmerzen gelindert je des Beladenen? Hast du die Tränen gestillet je des Geängsteten?“ So ruft Prometheus, und nicht weniger bitter ist das Mitleid, mit dem Mephistopheles die Jubelhymnen der Erzengel in seiner Weise abschließt: „Von Stern und Welten weiß ich nichts zu sagen; ich sehe nur, wie sich[S. 282] die Menschen plagen ... Die Menschen dauern mich in ihren Jammertagen!“ Werther erschießt sich, Faust führt die Giftschale an den Mund, und ihr Dichter bekennt:
Daß die Symptome dieser wunderlichen, so natürlichen als unnatürlichen Krankheit [des Lebensekels] auch einmal mein Innerstes durchrast haben, daran läßt ‚Werther‘ wohl Niemand zweifeln. Ich weiß recht gut, was es mich für Entschlüsse und Anstrengungen kostete, damals den Wellen des Todes zu entkommen, sowie ich mich aus manchem spätern Schiffbruch auch mühsam rettete und mühselig erholte.
So schrieb er 1812, als sich Zelters Stiefsohn das Leben genommen hatte, und vier Jahre später, als er den ‚Werther‘ selber wieder gelesen:
Da begreift man denn nun nicht, wie es ein Mensch noch vierzig Jahre in einer Welt hat aushalten können, die ihm in früher Jugend schon so absurd vorkam.
**
*
So wenig wertvoll also erschien auch diesem Bevorzugten das Leben. Das Verbleiben darin konnte er nur durch einen geheimnisvollen Lebensdrang erklären, der unser Sonderwesen erst völlig ausgebildet und danach völlig verbraucht sehen will, ehe er die Auflösung des Leibes, seines Werkzeuges, zuläßt.
Ein Teil des Rätsels löst sich dadurch, daß Jeder etwas Eigenes in sich hat, das er auszubilden gedenkt, indem er es immerfort wirken läßt. Dieses wunderliche Wesen hat uns nun tagtäglich zum besten, und so wird man alt, ohne daß man weiß: wie und warum. Beseh’ ich es recht genau, so ist es ganz allein das Talent, das in mir steckt, was mir[S. 283] durch alle die Zustände durchhilft, die mir nicht gemäß sind und in die ich mich durch falsche Richtung, Zufall und Verschränkung verwickelt sehe.
Daß Goethe stets bemüht war, sein Inneres vor fremden Anforderungen nach Möglichkeit zu beschützen oder davon wieder freizumachen, und wie ernst und treu er sich um die höchste Ausbildung seiner Persönlichkeit bemühte, haben wir in manchen Einzelheiten gesehen; einen deutlichsten Ausdruck fand dies Bestreben um die Mitte seines Lebens durch die Flucht nach Italien. Alles Befreien unserer Persönlichkeit, alle Entfaltung unserer besonderen Kräfte, alles Offenbaren unserer Begabung durch Taten oder Werke, alles Herausstellen von Leistungen, die unser Gepräge haben, stimmt uns nun aber glücklich.
So hatte Goethe bei allen Leiden, die ihn als eine eigenartige und zugleich sehr zarte Persönlichkeit trafen, in seiner ziemlich freien Stellung und in der dadurch gegebenen Möglichkeit freier, persönlicher Arbeit eine unversiegliche Quelle des Glücks. Besonders mußte ihn auch sein beständiges Lernen erheitern, denn das Lernen ist, was im Zeitalter der Zwangsschulen nicht Jedermann weiß, eine Ursache des Wohlbefindens und muß es sein, da es eine Ausdehnung und Bereicherung unserer Persönlichkeit, ein inneres Besitzergreifen der Welt bedeutet. „Das einzige reine Glück“, lehrt Schopenhauer,
[S. 284]
welchem weder Leiden, noch Bedürfnis vorhergeht, noch auch Reue, Leiden, Leere, Überdruß notwendig folgt, ist das reine willensfreie Erkennen (die ästhetische Kontemplation) ...
In der Kindheit verhalten wir uns viel mehr erkennend als wollend. Gerade hierauf beruht jene Glückseligkeit des ersten Viertels unseres Lebens, infolge welcher es nachher wie ein verlorenes Paradies hinter uns liegt. Wir haben in der Kindheit nur wenige Beziehungen und geringe Bedürfnisse, also wenig Anregung des Willens; der größere Teil unseres Wesens geht demnach im Erkennen auf, und zwar in dem Erkennen, das im stillen an den individuellen Dingen und Vorgängen die Grundtypen, die Ideen, das Wesen des Lebens selbst aufzufassen beschäftigt ist. Hieraus entspringt die Poesie und Seligkeit der Kinderjahre.
Der geniale Mensch ist dem Kinde verwandt – Goethe ist bei Lebzeiten oft ein großes Kind genannt worden – und bedarf nicht erst der Mahnung: „So ihr nicht werdet wie die Kinder ...“ „Der gewöhnliche Mensch“ sagt wiederum Schopenhauer,
diese Fabrikware der Natur ist einer völlig uninteressierten Betrachtung der Dinge, welches die eigentliche Beschaulichkeit ist, nicht – wenigstens nicht anhaltend – fähig. Er richtet seine Aufmerksamkeit auf die Dinge nur insofern, als sie irgend eine, wenn auch nur sehr mittelbare Beziehung auf seinen Willen haben. Der Geniale dagegen verweilt bei der Betrachtung des Lebens selbst, strebt, die Idee jedes Dinges zu erfassen, nicht dessen Relationen zu andern Dingen und zum Willen. Während dem gewöhnlichen Menschen sein Erkenntnisvermögen die Laterne ist, die seinen Weg beleuchtet, ist es dem Genialen die Sonne, welche die Welt offenbar macht ...
Der Normalmensch ist gänzlich auf das Sein verwiesen, das Genie hingegen lebt und webt im Erkennen. Daraus[S. 285] folgt, da alle Dinge herrlich zu sehen, aber schrecklich zu sein, daß auf dem Leben der gewöhnlichen Leute ein dumpfer, trüber, einförmiger Ernst liegt, während auf der Stirn des Genies eine Heiterkeit eigener Art glänzt.
Schopenhauer hatte bei diesen Ausführungen Goethe, den er persönlich kannte, im Auge. Und der Kanzler v. Müller, der die Erlebnisse des alten Goethe am nächsten sah, sagt geradezu, daß er jedes Unglück durch das Erkennen zu überwinden trachtete.
Denn ihm war es Bedürfnis, von jedem noch so heterogenen Zustande einen deutlichen Begriff zu gewinnen, und die unglaubliche Fertigkeit, mit der er jedes Ereignis, jeden persönlichen Zustand in einen Begriff zu verwandeln wußte, ist wohl als das Hauptfundament seiner praktischen Lebensweisheit anzusehen, hat sicher am meisten beigetragen, ihn, den von Natur so Leidenschaftlichen, so leicht und tief Erregbaren, unter allen Katastrophen des Geschicks im ruhigen Gleichgewicht zu erhalten. Indem er stets das geschehene Einzelne sofort an einen höheren allgemeinen Gesichtspunkt knüpfte, in irgend eine erschöpfende Formel aufzulösen suchte, streifte er ihm das Befremdliche oder persönlich Verletzende ab und vermochte nun, es in der Form naturmäßiger Gesetzlichkeit ruhig zu betrachten, ja als ein Geschichtliches, gleichsam nur zur Erweiterung seiner Begriffe Erscheinendes, zu neutralisieren. Wie oft hörte ich ihn äußern: „Das mag nun werden, wie es will, den Begriff davon habe ich weg; es ist ein wunderlicher komplizierter Zustand, aber er ist mir doch völlig klar.“ So gewöhnte er sich denn immer mehr, Alles, was im nähern und weitern Kreise um ihn vorging, als Symbol, ja sich selbst nur als geschichtliche Person zu betrachten, ohne darum an liebevoll persönlicher Teilnahme für Freunde und Gleichgesinnte abzunehmen.
**
*
[S. 286]
Im Jahre 1817 rühmte Knebel seinen alten Freund gegen Frau v. Schiller mit diesen Worten:
Er hat sich ein Reich der Kenntnisse und Wissenschaften erschaffen, worin er sich immer zu beschäftigen weiß, und seine fast unerschöpfliche Produktivität sichert seinen Geist vor äußern Anfällen des Schicksals.
Damals war Goethe durch den Tod seiner Frau einsamer geworden und hatte auch noch die etwas gewaltsame Trennung vom Theater zu verwinden. Nach dem allerletzten Schlage, der ihn traf, nach Augusts Tode oder Untergange, schrieb Goethe selber:
In solchen Epochen fühl’ ich erst recht den Wert eines allgemeinen Wissens, verbunden mit einer besonderen Teilnahme an dem Guten und Schönen, das die unendlich mannigfaltige Welterscheinung uns darbietet.
Damit meinte er kein untätiges Betrachten. Vielmehr war angestrengtes Arbeiten ein Hausmittel Goethes, um über schmerzliche Erlebnisse hinwegzukommen. Besonders nach dem Tode eines Nahestehenden fragte er, „was uns zu erhalten und zu leisten übrig bleibt.“ „Das Außenbleiben meines Sohnes“ schreibt er an Zelter, als August an der Pyramide des Cestius begraben war,
das Außenbleiben meines Sohnes drückte mich, auf mehr als eine Weise, sehr heftig und widerwärtig; ich griff daher zu einer Arbeit, die mich ganz absorbieren sollte. Der vierte Band meines ‚Lebens‘ lag, über zehn Jahre, in Schematen und teilweiser Ausführung, ruhig aufbewahrt, ohne daß ich gewagt hätte, die Arbeit wieder vorzunehmen. Nun griff ich sie mit Gewalt an, und es gelang so weit, daß der Band gedruckt werden könnte ... Plötzlich riß ein Gefäß[S. 287] in der Lunge, und der Blutauswurf war so stark, daß, wäre nicht gleich und kunstgemäße Hilfe zu erhalten gewesen, hier wohl die ultima linea rerum sich würde hingezogen haben.
Aber auch in gewöhnlichen Zeiten nutzte Goethe das Arbeiten und Lernen als Mittel zum Wohlbefinden aus. „Vielleicht waren die Marienbader Zeiten [die Sommer 1820-22] die glücklichsten des goethischen Alters“ urteilt ein guter Kenner[37], und bezeichnend ist, daß dieser Kenner in der begründenden Fortsetzung lauter Lerngelegenheiten aufführt.
Auf der Hin- und Rückreise hielt er sich immer länger im alten historischen Eger auf. Auf seinen mineralogischen Fahrten durchquerte er neue Strecken des Landes. Einzelne Ausflüge führten u. a. nach Franzensbad, Liebenstein, Dölitz, Hartenberg, Falkenau, Seeberg, Schönberg, Waldsassen, Redwitz, Elbogen. Seine meteorologischen Studien fanden Förderung im Stifte Tepl. Alle sozialen und nationalökonomischen Einrichtungen studiert er; er läßt sich im Erzgebirge das neu eingeführte Spitzenklöppeln zeigen, beobachtet die Glasfabrikation, interessiert sich für Schleifsteine, für Maschinen zum Zügeln der Ochsen, für böhmische Pflüge; er wohnt dem Unterricht und der Prämienverteilung im Gymnasium zu Eger bei, sieht Schulbücher und Chrestomathien durch, läßt sich über den Geist wie über Einzelheiten der Verwaltung und Regierung aufklären; alles Altertümliche und Eigenständige fällt ihm auf, z. B. die Organisation der künischen Freibauern im Südwesten von Pilsen, die eine Art von Selbstregiment führen.
Man sieht Goethe in seinen Eigentümlichkeiten nie deutlicher, als wenn man seinen Bericht über die[S. 288] Kampagne in Frankreich liest. Der König von Preußen, der Herzog von Braunschweig, sein eigener Herzog, alle die Offiziere und Soldaten um ihn herum kämpfen mit den Franzosen und mit den noch gefährlicheren Unbilden eines unaufhörlichen Regenwetters. Goethe befindet sich mitten in diesem Kampf und Erleiden, aber sein Geist richtet sich auf naturwissenschaftliche Erkenntnis. Eine weiße Topfscherbe, die in eine Quelle geworfen war und nun aus der Tiefe herauf die schönsten Farben zeigt, beschäftigt ihn tagelang, wochenlang. Als Verdun bombardiert wird, geht er abends mit einem Fürsten von Reuß hinter den Weinbergsmauern, die sie vor den Kugeln der Belagerten schützen, auf und ab; der Fürst fragt nach des Dichters letzten Arbeiten, und Goethe spricht stundenlang von der weißen Scherbe und von seinen sonstigen optischen Studien. Sie reden die Nacht hindurch, denn der Fürst wird von Goethes Ausführungen ergriffen; sie wärmen sich bei einbrechendem Morgen an einem Biwakfeuer der Österreicher und reden weiter über die Wunder der Natur. Und als Goethe vierzehn Tage später immer noch mit den Kriegsgenossen dem ärgsten Regen und tausend Unbequemlichkeiten ausgesetzt war, dachte er auch immer noch an seine Quelle und die Blau- und Violettfarben der Scherbe.
Es regnete unaufhörlich, nicht ohne Windstoß; die Zeltdecke gewährte wenig Schutz. Glückselig aber Der, dem eine höhere Leidenschaft den Busen füllte! Die Farbenerscheinung der Quelle hatte mich diese Tage her nicht einen Augenblick verlassen; ich überdachte sie hin und wieder, um sie zu bequemen[S. 289] Versuchen zu erheben. Da diktierte ich an Vogel (des Herzogs Schreiber) in’s gebrochene Konzept und zeichnete nachher die Figuren daneben. Diese Papiere besitze ich noch mit allen Merkmalen des Regenwetters.
**
*
Alle Übel haben ein anderes Gesicht, je nachdem wir uns zu Zeit und Ewigkeit, zu Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft verhalten. Goethe rät uns Zweierlei, was sich nicht sogleich zusammenreimen will: Lebe im Augenblick! Lebe in der Ewigkeit! Eine Brücke zwischen beiden Begriffen schlägt er, wenn er Eckermann zuruft: „Halten Sie immer an der Gegenwart fest! Jeder Zustand, ja jeder Augenblick ist von unendlichem Wert, denn er ist der Repräsentant einer ganzen Ewigkeit.“ Räumlich drückte er denselben Gedanken gern durch lateinische Sprichwörter aus: „Hic est aut nusquam quod quaerimus“, „Hic Rhodus, hic salta!“ Verdeutscht und verzeitlicht im ‚Wilhelm Meister‘: „Hier oder nirgends ist Amerika!“
Er warnt also vor jeder Beschädigung und Geringschätzung der Gegenwart durch die Vergangenheit oder durch die Zukunft und will Ähnliches sagen wie Christi Mahnungen: „Laßt die Toten ihre Toten begraben! Sorget nicht für den anderen Morgen!“ Weil die Menschen die Gegenwart nicht zu würdigen, zu beleben wüßten, schmachteten sie so nach einer besseren Zukunft, kokettierten sie so mit der Vergangenheit, sagte er zum Kanzler, als von romantischen und sentimentalen Gedichten, von Proben der ihm verhaßten „Lazarettpoesie“ die Rede[S. 290] war. Demselben Freunde riet er, sich nicht durch Reue und schmerzliche Rückblicke die Stunde zu verderben:
Keine Rekriminationen, keine Vorwürfe über Vergangenes, nun doch nicht zu Änderndes! Jeder Tag bestehe für sich! Wie kann man leben, wenn man nicht jeden Abend sich und Andern ein Absolutorium erteilt!
Ein Mann nach Goethes Sinn mußte nach jedem Unfall sofort wieder auf den Beinen stehen. Karl August war nach seinem Sinn:
Wenn Etwas mißlang, so war davon weiter nicht die Rede. Ich dachte oft, wie ich dies oder jenes Verfehlte bei ihm entschuldigen wollte, allein er ignorierte jedes Mißlingen auf die heiterste Weise und ging immer sogleich wieder auf etwas Neues los.
Mit Vergnügen erzählte er auch vom Salinendirektor Glenck in Stotternheim, dem in seinem Schacht ein sehr kostspieliges Mißgeschick passiert war, der jedoch in seinem Bericht keinen andern Gedanken hinzufügte, als: „Ich habe eine Erfahrung gemacht, die mir nicht verloren sein soll.“ „Das nenne ich doch noch einen Menschen, an dem man Freude hat!“ rief Goethe aus.
Sich selber schildert Goethe als einen Gegenwartsmenschen etwas anderer Art. Er mochte sich seine eigene Vergangenheit nicht wieder lebendig machen (außer wo sie schon so weit von ihm entfernt lag, daß er sie kühl-geschichtlich, als Etwas, was ihn wenig anging, betrachten konnte). Er mochte seine Dichtungen nicht gern wieder lesen; selbst seine ‚Iphigenie‘ von 1786 war ihm 1793 lästig, als die Freunde in Düsseldorf[S. 291] sie hören wollten. Er wünschte nur Das vorzutragen, was ihm jetzt gerade gemäß war: Naturwissenschaftliches am liebsten. Er erzählt, daß er durch diese Eigenheit in Jacobis Hause, wo man in ihm den früheren Freund wieder genießen wollte, in ein Mißverhältnis kam; denn er konnte und wollte nicht „ganz der Alte“ sein und machte sich um seine günstige Erscheinung und Wirkung keine Gedanken.
Wie ich überhaupt ziemlich unbewußt lebte und mich von Tag zum Tage führen ließ, wobei ich mich, besonders die letzten Jahre, nicht übel befand, so hatte ich die Eigenheit, niemals weder eine nächst zu erwartende Person, noch eine irgend zu betretende Stelle vorauszudenken, sondern diesen Zustand unvorbereitet auf mich einwirken zu lassen. Der Vorteil, der daraus entsteht, ist groß: man braucht von einer vorgefaßten Idee nicht wieder zurückzukommen, nicht ein selbstbeliebig gezeichnetes Bild wieder auszulöschen und mit Unbehagen die Wirklichkeit an dessen Stelle aufzunehmen. Der Nachteil mag dagegen wohl hervortreten, daß wir mit Unbewußtsein in wichtigen Augenblicken nur herumtasten und uns nicht gerade in jeden ganz unvorhergesehenen Zustand aus dem Stegreife zu finden wissen. In eben dem Sinne war ich auch nie aufmerksam, was meine persönliche Gegenwart und Geistesstimmung auf die Menschen wirke.
Hier erscheint uns sein Im-Augenblick-Leben als etwas Unfreiwilliges; aber auch der Ausruf: „Ich will nicht hoffen und fürchten wie ein gemeiner Philister“ kennzeichnet ihn. In den schwersten Zeiten machte er es sich zur Regel, nicht vor und zurück, sondern auf den Tag zu schauen, nur dem gegenwärtigen Tage zu[S. 292] leben. Und auf die Frage: „Was ist deine Pflicht?“ antwortet er: „Die Forderung des Tages.“
**
*
Aber wir wissen schon, daß er nicht mit kleinen Tagesdingen den Tag ausfüllte, nicht mit Tageblattlesen, mit Tagesklatsch-Anhören, mit Teilnahme an politischem Tagesstreit. Als im Juli 1830 in Paris die Revolution ausgebrochen war, sagte Goethe zu Soret: „Nun, was denken Sie von dieser großen Geschichte? Alles steht in Brand! Es verläuft nicht mehr bei geschlossenen Türen! Der Vulkan kommt zum Ausbruch!“ Soret stimmte ein: „Die Lage ist entsetzlich! Eine so erbärmliche Familie, die sich auf ein ebenso erbärmliches Ministerium stützt, gibt wenig Hoffnung. Man wird sie schließlich fortjagen.“ Da guckt Goethe den Gast ganz verwundert an und ruft aus: „Aber ich rede ja nicht von dieser Gesellschaft! Was liegt mir denn daran! Es handelt sich um den großen Streit zwischen Cuvier und Geoffroi.“ Darauf also hatte Goethe während der Juli-Revolution geachtet, und er hatte recht: denn in diesem Streit handelte es sich wirklich um etwas Großes: um die Entwicklungslehre, und Das war Etwas, woran Goethe viele Jahre mitgearbeitet hatte, was ihn wirklich mehr anging als das jeweilige Bild auf dem politischen Theater der Pariser.
Wissenschaft und Kunst reichten ihm dauernde Güter; lesend und beschauend konnte er sich mit den besten Vorfahren, schreibend mit den besten Künftigen unterhalten.
[S. 293]
Wie es die Welt jetzt treibt, muß man sich immerfort sagen und wiederholen: daß es tüchtige Menschen gegeben hat und geben wird, und Solchen muß man ein schriftliches gutes Wort gönnen und auf dem Papier hinterlassen ...
Ich möchte mich nur mit Dem beschäftigen, was bleibende Verhältnisse sind und so nach der Lehre des Spinoza meinem Geiste die Ewigkeit verschaffen.
So schrieb der Vierzigjährige, und dieser Wunsch lebte immer in ihm. Es war nicht Absicht und ist doch kein Zufall, daß die Dichtung, die ihn durch sein ganzes Leben hindurch beschäftigte, der ‚Faust‘, die Geschichte von drei Jahrtausenden umfaßt: von der Eroberung Trojas bis zu Byrons Teilnahme am Befreiungskriege der Neugriechen. Auch wenn er sich, wie so oft und gern, in den Sammlungen seines Hausmuseums bewegte, ließ er sich von ältesten und neuesten Zeiten erfreuen, belehren, unterhalten. Wir wissen, wie viel Liebe er den Dichtern der Vergangenheit: Molière, Shakespeare, Calderon und besonders den Griechen zuwandte. Bald machte er sich im alten germanischen Norden heimisch, bald in Arabien, dann unter Neugriechen oder Serben, dann unter Chinesen. Wenn ihn vielleicht einer der Neuesten zu entthronen meinte, achtete er gar nicht darauf und steckte vielleicht tief in den persischen Dichtern. „Die Perser“, so sprach er dann zu einem Hausfreunde, „hatten in fünf Jahrhunderten nur sieben Dichter, die sie gelten ließen, und unter den verworfenen waren mehrere Kanaillen, die besser als ich waren.“
Seinen geologischen Studien dankte er es, daß er noch mehr über die Jahrtausende zu blicken sich gewöhnte.[S. 294] Es scheint, daß namentlich auf Bergeshöhen auch sein geistiges Auge den weiten Ausschau liebte. So stand er einmal mit Eckermann am Abhange des Ettersberges und blickte auf die Siedelungen und Hügel in der Nähe und auf die blauen Berge in der Ferne. Der Gefährte brachte ihm Muscheln und zerbrochene Ammonshörner vom Straßenrande. „Immer die alte Geschichte!“ sagte Goethe, „immer der alte Meeresboden! Wenn man von dieser Höhe auf Weimar hinabblickt und auf die mancherlei Dörfer umher, so kommt es einem vor wie ein Wunder, wenn man sich sagt, daß es eine Zeit gegeben, wo in dem weiten Tale dort unten die Walfische ihr Spiel getrieben. Und doch ist es so, wenigstens höchstwahrscheinlich. Die Möwe aber, die damals über dem Meere flog, das diesen Berg bedeckte, hat sicher nicht daran gedacht, daß wir beide heute hier fahren würden. Und wer weiß, ob nach vielen Jahrtausenden die Möwe nicht abermals über diesen Berg fliegt!“
Auch als er an seinem letzten Geburtstage auf dem Kickelhahn war, glitten seine Gedanken von seiner Lebenszeit aus bald über zu den großen Zeitspannen der Erdgeschichte. Zuerst dachte er an die in jugendlichem Wagemut im nahen Ilmenau begonnenen Bergwerksbauten, die später aufgegeben werden mußten.
Nach so vielen Jahren war denn zu übersehen: das Dauernde, das Verschwundene. Das Gelungene trat vor und erheiterte, das Mißlungene war vergessen und verschmerzt. Die Menschen lebten alle nach wie vor, ihrer Art gemäß, vom Köhler bis zum Porzellanfabrikanten. Eisen[S. 295] ward geschmolzen, Braunstein aus den Klüften gefördert, wenn auch in dem Augenblick nicht so gesucht wie sonst. Pech ward gesotten, der Ruß aufgefangen, die Rußbüttchen künstlichst und kümmerlichst verfertigt, Steinkohlen mit unglaublicher Mühe zutage gebracht, kolossale Urstämme in der Grube unter dem Arbeiten entdeckt; und so ging’s denn weiter, vom alten Granit, durch die angrenzenden Epochen, wobei immer neue Probleme sich entwickeln.
**
*
Wer so in größten Zeitverhältnissen lebt, gleicht dem sehr reichen Manne, der noch nicht zu jammern braucht, wenn ihm ein Haus abbrennt oder ein Schiff untergeht. Aber Goethe schalt überall auf das Jammern und Klagen, weil es das Unglück verschlimmert. Jedes Übel ist größer oder kleiner, je nachdem wir uns ihm zuwenden oder abwenden und von unserm Innern aus Trübes oder Heiteres dazu tun. Goethe war für Schweigen, so lange es irgend anging.
so spricht der Graf in der ‚Natürlichen Tochter‘, und der König antwortet ihm:
Als nach der Schlacht bei Jena und der Plünderung von Weimar tausend Leute auch ihm ihre persönlichen Nöte und Verluste gern in höchsten Tönen schildern[S. 296] wollten, fanden sie bei Goethe nicht immer das gewünschte Echo. „Daß jeder Narr jetzt seine eigene Geschichte hat, Das eben ist keine der geringsten Plagen der jetzigen bösen Zeit.“ Aber viel ärgerlicher war er, wenn Andere das wirkliche Übel noch durch Hinzudichten eingebildeter Übel vermehrten und von einem Zusammenbruch alter deutscher Herrlichkeit sprachen, die gar nicht vorhanden gewesen war.
Goethes einsichtigste Freunde verstanden sein Schweigen nach großen Verlusten, z. B. nach dem Tode Schillers. Der Dresdner Kunstkenner Johann Gottlob v. Quandt, der das Unglück hatte, beide Beine zu brechen, rühmt geradezu, daß Goethe in seinen Briefen an ihn in „richtigem Takt“ dieses Unglücks nicht erwähnte:
Ich litt an der unzweckmäßigen chirurgischen Behandlung drei Jahre unaussprechlich. Jedesmal hatte ich einen Kampf zu bestehen, wenn mich Jemand bedauerte, denn das vergebliche Mitleid weckt nur besiegte Schmerzen. Selbst das Mitleid, welches ein Freund fühlt, kann den Unglücklichen nicht freuen, denn es ist das Leiden des Andern, was uns doch kein Vergnügen machen kann. Das wußte Goethe sehr wohl. Einer Weimaranerin, die mich in Dresden besucht hatte und ihm meinen Zustand ausführlich beschreiben wollte, fiel er in’s Wort: „Verderben Sie meine Phantasie nicht! Quandt steht in seiner vollen Kraft und Tätigkeit vor mir.“ Unsere Freundin teilte mir diese Äußerung schriftlich mit, die mich erfreute, denn ich erkannte daraus, daß in Goethe ein Bild von mir stand, das ihm lieb war.
Wo des Unglücks oder des Verdrießlichen durchaus gedacht werden mußte, suchte Goethe nach den mildesten Ausdrücken, dämpfte alles Schmerzhafte, hob[S. 297] das Erfreuliche hervor. Wir haben allemal, wenn wir von Not und Tod sprechen, einen großen Vorrat von Haupt- und Eigenschaftswörtern zur Auswahl, und an denen, die wir wählen, zeigen wir, wie es mit unserer Philosophie und unserem Herzen bestellt ist. Goethe war fast ein Schönfärber, wenn er über vergangene, unabänderliche Dinge berichten mußte[38]; Niemand sonst wird dem Herzog Karl August die Zerstörungen in Weimar nach der Schlacht bei Jena so gering dargestellt haben wie er; Niemand auch wird dem Fürsten den Glauben, daß sich alles Beschädigte bald besser wiederherstellen lasse, so sehr gestärkt haben. –
**
*
Dieses Streben, in großen Zeiträumen zu leben und gegenwärtiges oder jüngstvergangenes Übel zu vergessen oder doch eher zu verkleinern als zu vergrößern, hat eine gewisse Beharrlichkeit und Tapferkeit zur Folge. Unruhig-ängstliche Zeiten können nur vergehen, wenn möglichst viele Menschen ihre gewöhnlichen Geschäfte so besorgen, wie wenn nichts passiert wäre,
[S. 298]
„Ruhe und nachgiebige Beharrlichkeit“ pries Goethe seiner Gattin als das Einzige an, was leidlich durch’s Leben helfe. Und seinem unglücklichen Sohne schrieb der Achtzigjährige nach Italien: „Wer sich in die Welt fügt, wird finden, daß sie sich gern in ihn finden mag; wer Dieses nicht empfindet oder lernt, wird nie zu irgend einer Zufriedenheit gelangen.“
Ausdauer an dem Orte, wo sie einmal seien, rät er auch den Freunden an. „Ihr werdet vordringen durch’s Bleiben“ ruft er Kestnern zu. „Wer seinen Zustand verändert, verliert immer die Reise- und Einrichtekosten, moralisch und ökonomisch, und setzt sich zurück.“ Und ebenso an Herder:
Die zehn weimarischen Jahre sind Dir nicht verloren, wenn Du bleibst; wohl wenn Du änderst. Denn Du mußt am neuen Ort doch wieder von vorne anfangen und wieder wirken und leiden, bis Du Dir einen Wirkungskreis bildest. Ich weiß, daß bei uns Viel, wie überhaupt, auch Dir unangenehm ist; indessen hast Du doch einen gewissen Fuß- und Standort ... Es kommt doch am Ende darauf an, daß man aushält und die Andern überdauert.
**
*
Schließlich fand Goethe im Glauben eine starke Hülfe zum Leben, zum Ertragen der tausendfältigen Not und Pein. Er war kein Rechtgläubiger im Sinne der einen oder andern Kirche, aber er glaubte an die[S. 299] Fortdauer der Persönlichkeiten nach der Auflösung ihrer irdischen Leiber, besonders an ein weiteres Wachsen und Wirken der hier schon als stark bewährten Geister, und er glaubte an Gott.
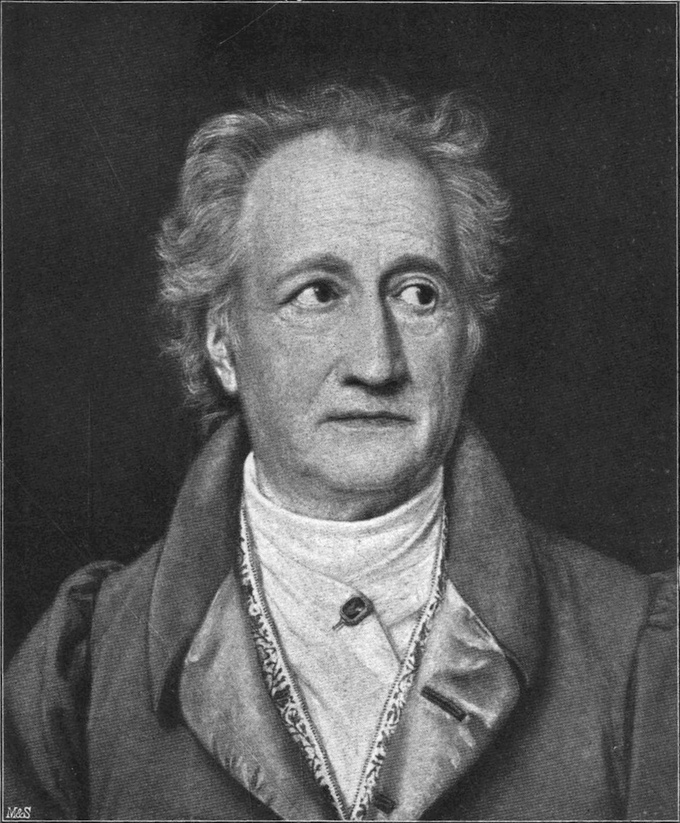

Gott glauben heißt, in’s Tätige übersetzt, sich in Gottes Willen ergeben, das Weltregiment ihm anvertrauen, sich selber in seine Hände legen. In jüngeren Jahren nannte Goethe die höchste Macht wohl auch „Schicksal“ oder „Natur.“ „Du hast uns lieb“ redete er das Schicksal an: „Du hast für uns das rechte Maß getroffen.“ So glaubt er mit siebenundzwanzig Jahren, und mit dreiunddreißig rühmt er ebenso die „Natur.“ „Wir sind von ihr umgeben und umschlungen, unvermögend, aus ihr herauszutreten ... Sie hat mich hereingestellt, sie wird mich auch herausführen. Ich vertraue mich ihr. Sie mag mit mir schalten. Sie wird ihr Werk nicht hassen.“[39]
Und oft gesteht er später in Prosa und Versen das gleiche Gottvertrauen. Sogar im fröhlichen Liede, das er in den Kriegsstürmen von 1813 an einer Wirtstafel zu Oschatz niederschreibt:
Und lebt nicht dieser Glaube auch in seinen größten Werken, in der ‚Iphigenie‘, im ‚Wilhelm Meister‘, im ‚Faust‘?
[37] August Sauer, Goethe und Österreich II.
[38] Gestehen wir zu: er war es völlig. Man vergleiche zum Beispiel, wie er 1821 in den Annalen über 1811 den bösen Streit mit dem Ehepaar v. Arnim darstellt, die er doch im folgenden Jahre als „Tollhäusler“ bezeichnet hat, die er froh sei, losgeworden zu sein. Es lohnt sich auch, die ‚Kampagne in Frankreich‘ mit dem Bericht zu vergleichen, den der gemeine Soldat Laukhardt über dieselben Dinge gegeben hat (C. F. Laukhardts Leben und Schicksale, Dritter Teil, Leipzig 1796).
[39] Das Fragment über die Natur, das in Goethes Werke immer wieder aufgenommen wird, ist nicht von Goethe, sondern von Georg Christoph Tobler aus Zürich verfaßt, der 1781 viel mit Goethe umging. Vielleicht hat Goethe ein wenig daran gearbeitet, ehe er es in’s ‚Tiefurter Journal‘ gab. Hier dürfen wir es als etwas Goethisches erwähnen, da es, wie er selber später bestätigte, seine damalige Denkart ausdrückt.
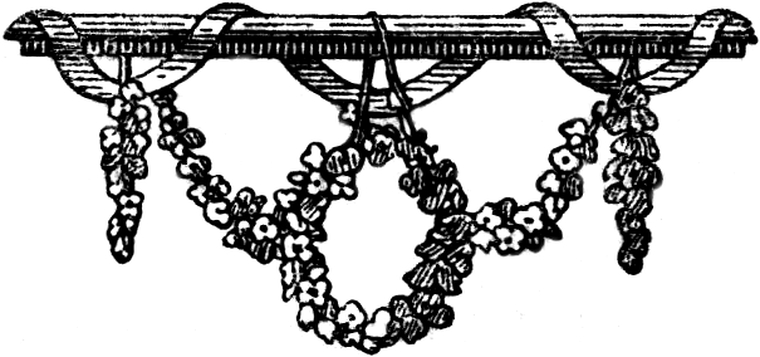
Gedruckt bei E. S. Mittler & Sohn, Berlin SW68, Kochstraße 68-71.
Dr. Wilhelm Bodes Goethe-Bücher
Verlag von E. S. Mittler & Sohn, Berlin SW68
Goethe
in vertraulichen Briefen seiner Zeitgenossen
Auch eine Lebensgeschichte
4. und 5. Tausend Umfang 836 Seiten Geheftet M 12,95,
‖‖‖ in Pappband M 16,55, in Ganzleinenband M 18,— ‖‖‖
Es sprechen in diesem Buche Menschen über einen hervorragenden Mann aus ihrem Kreis. Das ergibt eine merkwürdige, in allen Einzelzügen interessante Schilderung. Vor uns entrollt sich ein Gemälde jener Zeit, das nicht nur Einblicke in die besondere Kulturlage jener Tage gewährt, sondern auch alle Persönlichkeiten im Kreis um Goethe vorführt. Die eifrige, sorgsame und liebevolle Arbeit Bodes verdient volle Anerkennung.
Die Post.
Goethes Leben
im Garten am Stern
|
‖‖‖‖‖‖‖‖ 27. und 28. Tausend ‖‖‖‖‖‖‖‖
|
||
|
382 Seiten mit vielen Abbildungen
|
||
|
Geheftet
|
M
|
8,—
|
|
In hübschem Pappband
|
M
|
11,—
|
|
In reichem Ganzleinenband
|
M
|
14,—
|
Dies Buch, schon nach seinem Äußern eine geschmackvolle, feinsinnige und liebenswürdige Erscheinung, enthält weit mehr als sein Titel besagt, nämlich den ganzen inneren Werdegang des Dichters und des Menschen in der ersten Weimarischen Zeit, als der Garten und sein Haus, heute darum mit Recht eines der verehrtesten Heiligtümer und Pilgerziele der thüringischen Hauptstadt, Goethes täglicher dauernder Aufenthalt war, und in den letzten beiden Abschnitten Ausblicke in Goethes Mannes- und Greisenalter.
Zeitschrift des Allgemeinen Deutschen Sprachvereins.
Der weimarische
Musenhof
Siebente Auflage 13. bis 15. Tausend
487 Seiten mit zahlreichen Abbildungen
|
Geheftet
|
M
|
8,—
|
|
In farbigem Pappband
|
M
|
11,—
|
|
In Ganzleinenband
|
M
|
13,—
|
Die Männer und Frauen des Hofes und der Gesellschaft zu Weimar, welche die Umwelt der Klassiker bildeten, erwachen in diesem Buche zu neuem Leben. Fesselnd schildert der bekannte Goetheforscher die vor Goethes Erscheinen in Weimar liegende Regierungstätigkeit und die künstlerischen Neigungen der früh verwitweten Fürstin. Aber auch die Dichter und Künstler selbst treten uns in greifbarer Gestalt und sprechend gegenüber. So gewinnt man aus dem Buche nicht nur angenehme Unterhaltung, sondern zugleich auch eindrucksvolle Belehrung. Diese Wirkung wird verstärkt durch einen sehr reichen Bilderschmuck.
Karl August
von Weimar
Zweite Auflage
Jugendjahre
382 Seiten mit zahlreichen Abbildungen
In schönem Pappband M 7,20
In anschaulicher Darstellung und dabei streng sachlich schildert der Verfasser die Jugendentwicklung und Erziehung des fürstlichen Kindes, das Heranreifen zum Herrscher, den Charakter des jungen Herzogs, der das kleine unwichtige Weimar zu einer Pflegestätte geistigen Lebens, zur Hauptstadt der deutschen Gelehrten und Künstler umwandelt. Unter der Charakteristik der Persönlichkeiten des Weimarer Hofes tritt besonders die quellenmäßige, fein abgewogene Darstellung des Freundschaftsverhältnisses zwischen Karl August und Goethe hervor.
Literarisches Zentralblatt.
Goethes Sohn
|
‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖ 3. und 4. Tausend ‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖
|
||
|
420 Seiten mit 16 Bildnissen
|
M
|
7,50
|
|
In farb. Pappband
|
M
|
10,—
|
|
In Ganzleinen-Geschenkband
|
M
|
12,—
|
Dieses neue unterhaltende Buch behandelt ein besonders wichtiges Stück von Goethes Leben. Wir sehen den Dichterfürsten als Vater und Erzieher, aber auch seine ganze häusliche Umgebung sowie deren Tun und Treiben. Und zwar auf vierzig Jahre, denn August entwuchs dem Vaterhause niemals. Jedes Blatt der anziehenden Lebensbeschreibung bestätigt zudem, daß es nicht leicht war, Goethes und Christianens Sohn und Ottilies Gatte zu sein.
Charlotte
von Stein
|
‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖ 18. und 23. Tausend ‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖
|
||
|
725 Seiten mit vielen Abbildungen
|
M
|
10,—
|
|
In Ganzleinen-Geschenkband
|
M
|
15,—
|
Feierstunden sind es, die man dem feinsinnigen Verfasser des Buches verdankt, wenn man ihm folgt in den Duft und die Poesie Weimarer Zeiten. Wie Bode das Wesen der Frau von Stein und das Wesen ihrer Liebe schildert, das ist ein Genuß, den sich niemand von uns entgehen lassen sollte. Durchflutet von Liebe zu dem behandelten Stoff, geistreich und klar in Sprache und Form, kann das interessante und mit guten Illustrationen geschmückte Buch nicht genug empfohlen werden, auch als Geschenkwerk für unsere heranwachsenden Töchter.
Die Deutsche Frau.
Goethes
Liebesleben
Siebentes und achtes Tausend
|
472 Seiten mit zahlreichen Bildertafeln
|
||
|
== Kopfleisten und Textabbildungen ==
|
||
|
Geheftet
|
M
|
8,—
|
|
in farbigem Pappband
|
M
|
11,—
|
|
in geschmackvollem Leinenband
|
M
|
13,—
|
Ein Buch, das zum ersten Male die Mädchen- und Frauengestalten in das Licht der historischen Wahrheit rückt. Sie treten uns hier als Menschen von Fleisch und Blut entgegen, und durch ihr Wirken und Handeln, ihr Lieben und Leiden wird uns wiederum auch Goethe lebendiger, menschlich näher gerückt. Es ist ein wundervoll feinsinnig geschriebenes Buch, voll blühender Darstellungskraft.
Schlesische Zeitung.
Die Tonkunst
in Goethes Leben
== Zwei Bände / Zweites bis viertes Tausend ==
700 Seiten mit 24 Bildertafeln und zahlreichen Musikstücken
|
M 11,50, in hübschen Pappbänden
|
M
|
12,95
|
|
in stilvollen Halbpergamentbänden
|
M
|
14,40
|
Der Laie wie der Musikfachmann wird die köstlichen Früchte aus dieser lebendig anschaulichen Darstellung ernten. Es ist bewundernswert, wie Bode bis ins kleinste Goethes musikalischen Neigungen nachgegangen ist, dessen Beziehungen zu den Komponisten seiner Gedichte und zu andern zeitgenössischen Meistern der Tonkunst.
Neue Musik-Zeitung.