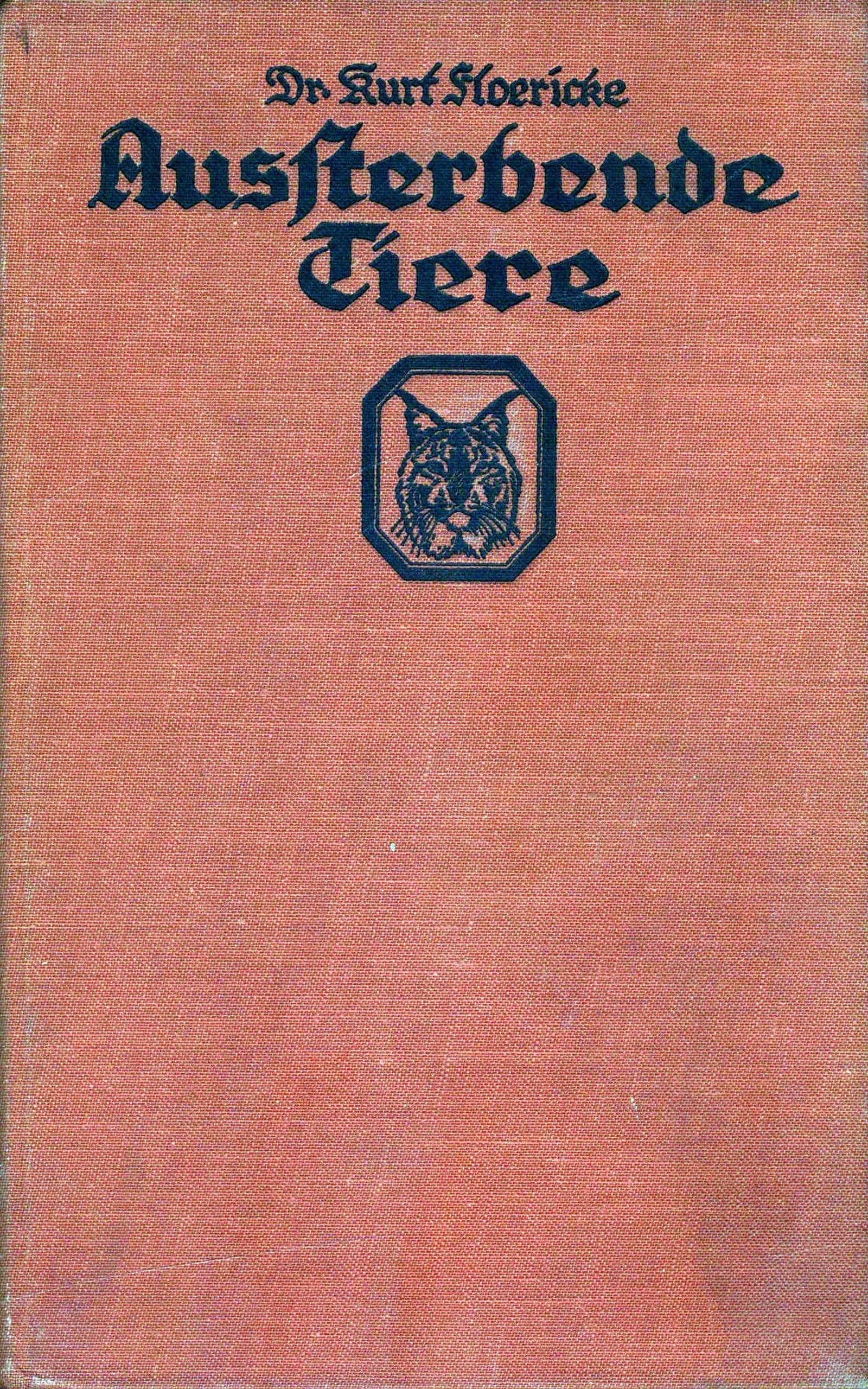
Title: Aussterbende Tiere
Biber, Nerz, Luchs, Uhu
Author: Kurt Floericke
Release date: January 26, 2026 [eBook #77785]
Language: German
Original publication: Stuttgart: Franckh'sche Verlagshandlung, 1927
Credits: The Online Distributed Proofreading Team at https://www.pgdp.net
Anmerkungen zur Transkription.
Das Original ist in Fraktur gesetzt. Schreibweise und Interpunktion des Originaltextes wurden übernommen; lediglich offensichtliche Druckfehler sind stillschweigend korrigiert worden.
Worte in Antiqua sind "kursiv" dargestellt.
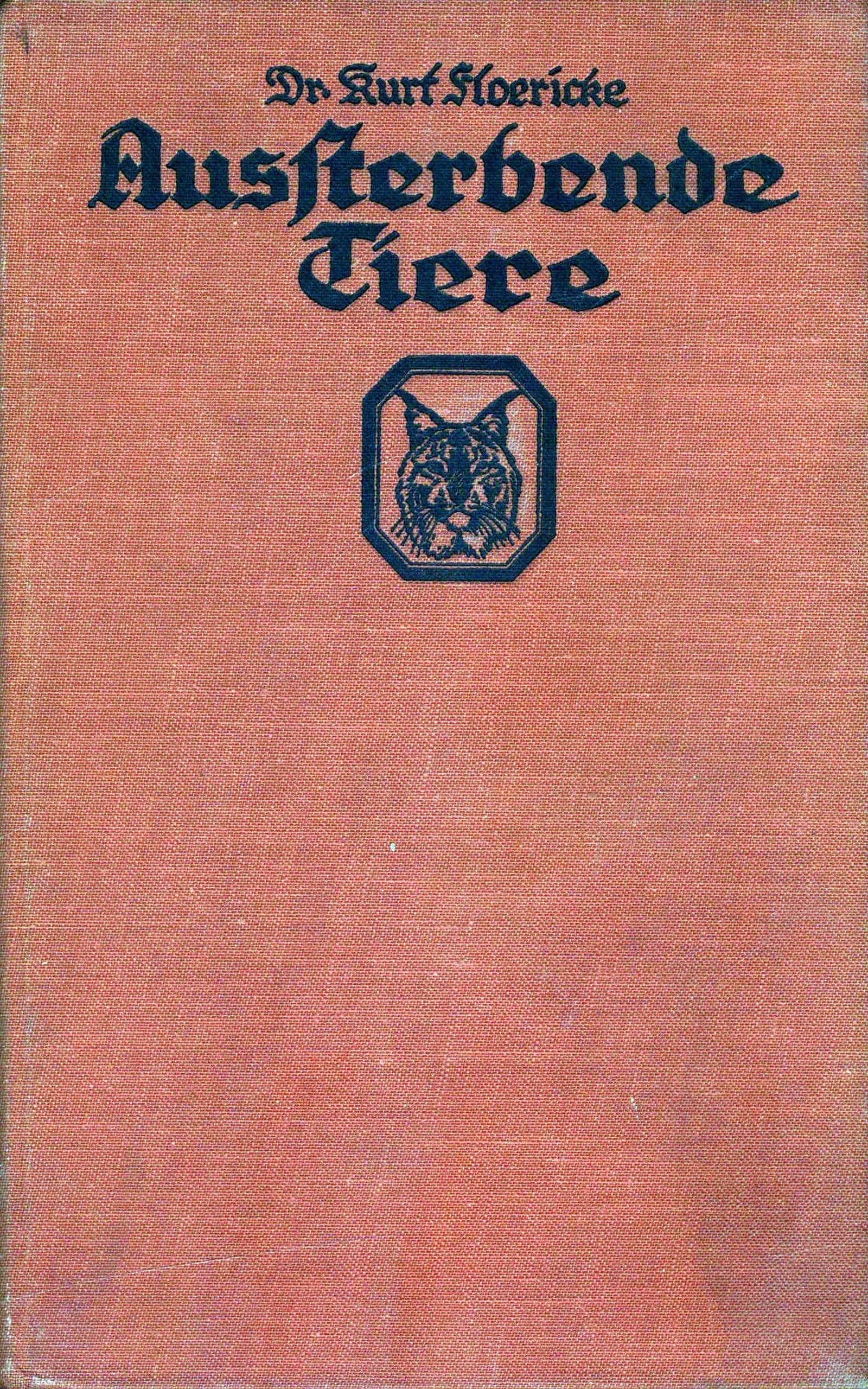

KOSMOS-BÄNDCHEN
AUSSTERBENDE TIERE
KOSMOS
Gesellschaft der Naturfreunde in Stuttgart
Die Gesellschaft Kosmos bezweckt, die Kenntnis der Naturwissenschaften und damit die Freude an der Natur und das Verständnis ihrer Erscheinungen in den weitesten Kreisen unseres Volkes zu verbreiten. — Dieses Ziel sucht die Gesellschaft durch Verbreitung guter naturwissenschaftlicher Literatur zu erreichen im
KOSMOS
Handweiser für Naturfreunde
Jährlich 12 Hefte mit 4 Buchbeilagen
Diese Buchbeilagen sind, von ersten Verfassern geschrieben, im guten Sinne gemeinverständliche Werke naturwissenschaftlichen Inhalts. Vorläufig sind für das Vereinsjahr 1927 festgelegt (Reihenfolge und Änderungen auch im Text vorbehalten):
Dr. Kurt Floericke, Aussterbende Tiere,
Wilh. Bölsche, Im Bernsteinwald,
H. Günther, Was ist Magnetismus?,
W. Flaig u. Dr. L. Lang, Der Gletscher
Jedes Bändchen reich illustriert
Diese Veröffentlichungen sind durch alle Buchhandlungen zu beziehen; daselbst werden Beitrittserklärungen entgegengenommen. Auch die früher erschienenen Jahrgänge sind noch erhältlich.
Geschäftsstelle des Kosmos: Franckh'sche Verlagshandlung, Stuttgart
Von
Dr. Kurt Floericke

Stuttgart
Kosmos, Gesellschaft der Naturfreunde
Geschäftsstelle: Franckh'sche Verlagshandlung
1927
Mit 17 Abbildungen und einem farbigen
Umschlagbild
Alle Rechte, besonders das Übersetzungsrecht, vorbehalten
Nachdruck verboten
Copyright 1927
by Franckh'sche Verlagshandlung, Stuttgart
Printed in Germany
Druck von Holzinger & Co. Stuttgart
[S. 5]
Wer gleich dem Verfasser die freilebende Tierwelt unseres Vaterlandes vier Jahrzehnte lang fleißig und liebevoll beobachtet hat, der wird tief erschrocken sein darüber, wie furchtbar sie innerhalb dieser Zeitspanne, die doch vom naturgeschichtlichen Standpunkte aus nur als winzig bezeichnet werden kann, verarmt und verödet ist. Wir wissen alle, daß die sogenannte menschliche Kultur mit ihren mancherlei unangenehmen Begleiterscheinungen und Auswüchsen die Hauptschuld an dieser unaufhaltsam sich vollziehenden Veränderung trägt, und zur Abwendung des Schlimmsten ist ja als notwendiges Gegengewicht gegen den Siegeszug von Industrie und Technik die Naturschutzbewegung ins Leben getreten, die erfreulicherweise bereits weite Kreise unseres Volkes erfaßt hat. Es ist dringend zu wünschen und zu hoffen, daß es ihr gelingen möge, wenigstens kärgliche Reste einstiger Herrlichkeit in großen Naturschutzparken oder durch strenge und vernünftige Gesetzesvorschriften, die aber nicht nur auf dem Papier stehen dürfen, in letzter Stunde zu retten und den kommenden Geschlechtern zu erhalten. Nun wird von mancher Seite den Naturschützern entgegengehalten, daß zwar die rastlos fortschreitende Kultur manche Tiere, die sog. Kulturflüchter nämlich, ausgerottet oder in ihre entlegensten Schlupfwinkel verdrängt, daß sie aber dafür andere Arten, denen gerade die Beschaffenheit der neuzeitlichen Kultursteppe zusagt, zur Einwanderung veranlaßt oder ihre Vermehrung und Ausbreitung weitgehend begünstigt habe. Das ist auch gar nicht zu leugnen und wenigstens bis zu einem gewissen Grade richtig. Aber der Tausch, den der Naturfreund dabei gemacht hat, ist doch ein herzlich schlechter. Verschwunden sind die urwüchsigen und reckenhaften Gestalten des altgermanischen Waldgebiets, eingezogen sind kleine und unansehnliche Formen, die unserem Gemüt wenig zu sagen haben, zumal sie teilweise gar nicht alteingesessene Arten sind, sondern ursprüngliche Bewohner der Mittelmeerländer. Das ist ein gewaltiger Unterschied, der uns erst recht klar wird, wenn wir die betreffenden Tiere einmal näher betrachten. Ich möchte deshalb zunächst in diesem Kosmosbändchen einige wenige Vertreter dieser Tiere unseren Lesern eingehender vorführen, um ihnen zu zeigen, welch unersetzliche Naturschätze wir schon verloren haben oder zu verlieren im Begriff stehen.[S. 6] Ich möchte weiter dartun, in welcher Schnelligkeit und in welcher Weise die Ausrottung vor sich ging und welche Hoffnungen noch bestehen auf Erhaltung der Überbleibsel. Wenn dadurch die Teilnahme weiterer Kreise für solche schwer bedrohten »Naturdenkmäler« wachgehalten und das Interesse für die Schaffung großer Naturschutzparke (vgl. S. 78) zu ihrer Erhaltung gesteigert würde, so wäre der vornehmste Zweck dieses Büchleins erreicht.
Ein einziges deutsches Säugetier kannte ich bisher noch nicht aus freier Natur: unseren größten und gescheitesten Nager, den sagenumwobenen Biber. Im Sommer 1924 war es mir endlich zu meiner großen Freude vergönnt, diese Lücke bei einem zweitägigen Aufenthalt in Aaken a. d. Elbe auszufüllen. Wenn ich trotz der bedauerlichen Kürze der Beobachtungszeit hier einiges Neue und Wissenswerte über den Biber und seinen gegenwärtigen Bestand mitzuteilen vermag, so verdanke ich dies in erster Reihe der großen Liebenswürdigkeit einiger ortsansässiger Biberfreunde, die mir nicht nur in geradezu mustergültiger Weise als sachkundige Führer dienten, sondern mir auch aus dem reichen Schatze ihrer langjährigen Erfahrungen viele hochinteressante Eigenbeobachtungen zur Verfügung stellten. Besonders gebührt dieser Dank, dem ich hierdurch auch öffentlich Ausdruck geben möchte, Herrn Karl Krietzsch in Dessau, Herrn Oberpostsekretär Winkelmann in Aaken und Herrn Amtmann Behr in Steckby. So schrieb mir z. B. Herr Krietzsch kurz vorher nach Magdeburg: »Punkt 4 Uhr früh schwimmt der Biber bei Aaken über die Elbe, bezieht seinen Bau im Hornhafen und wird dabei photographiert.« Und genau nach diesem Programm verlief die Sache, nur daß sich die Beleuchtung in der frühen Morgenstunde noch als zu schwach für gute photographische Aufnahmen erwies. Es ist eine Lust, unter so ausgezeichneter Führung Naturstudien und Beobachtungen zu machen; der Ortsunkundige wird wohl manchen vergeblichen Gang tun müssen, bis es ihm glückt, eines Bibers ansichtig zu werden, obwohl die vielen Schleif- und Hauspuren des Tieres einem aufmerksamen Auge kaum entgehen können. Für mich war es ein geradezu weihevoller Augenblick, und das Herz schlug mir rascher, als nach einer Viertelstunde bangen Wartens der große Rattenkopf des schwimmenden Bibers in den Elbefluten auftauchte[S. 7] und wir nun rasch einen Kahn bestiegen und auf bequemste Beobachtungsentfernung dem seltenen Wilde bis zu seinem Baue folgten.
Früher war der europäische Biber, Castor fiber L. (der nordamerikanische ist von neueren Forschern unter dem Namen canadensis als besondere Form abgetrennt worden) weit verbreitet und insbesondere in Deutschland durchaus keine Seltenheit, worauf schon Ortsnamen wie Biberach und Bebra hinweisen. Die Stadt Biebrich am Rhein führt einen Biber im Wappen, der aber fälschlich einen Fisch im Maule hält, während in Wirklichkeit der Biber niemals an Fischen oder anderem Getier sich vergreift, sondern ausschließlich Pflanzenfresser ist. Doch wird schon im Mittelalter über rasche Abnahme der Biber an Rhein und Donau geklagt, weil das Tier sich nicht mit dem regen Schiffsverkehr auf diesen Strömen vertrage. Das ganze Mittelalter hindurch spielte der Biber als geschätzter Fastenbraten eine große Rolle, und als besonderer Leckerbissen galt der Biberschwanz, für den man gern den in damaliger Zeit erstaunlichen Preis von 6 Gulden zahlte, und nach dessen absonderlicher Gestalt ja heute noch eine bestimmte Dachziegelart ihren Namen führt. Von Quacksalbern aller Art sehr begehrt war das sog. Bibergeil (man zahlte beim Seltenerwerden des Tieres zeitweise bis zu 180 Gulden für die Geilsäcke eines alten Männchens!), das gegen alle erdenklichen Übel helfen sollte, hauptsächlich aber als Beruhigungsmittel bei Krampfzuständen galt. Großer Wertschätzung erfreute sich auch der feine und leichte Biberpelz, nach welchem ja Gerhart Hauptmann seine prächtige Diebskomödie mit den vielen politischen Spitzen benannt hat. Der mollige Biberpelz, dem die langen Grannenhaare abgeschoren wurden, schützt vortrefflich gegen rauhe Winde und scharfen Frost, während die minderwertigen Felle zu teuren Filzhüten verarbeitet wurden. Da also der erlegte Biber einen erheblichen Geldwert darstellte, kann es nicht wundernehmen, daß die Zahl der Tiere infolge unablässiger und schonungsloser Verfolgung rasch und dauernd zurückging. Zuerst wurde der Biber, wie so viele Tiere, in dem schießwütigen England ausgerottet.
Gegenwärtig ist der europäische Biber nur in Sibirien noch in größerer Menge zu finden, während er in Europa selbst fast völlig ausgerottet und auch an seinen letzten Zufluchtstätten mit dem Untergange bedroht ist. Heute kommt er in Europa nur noch an vier Stellen vor, nämlich 1. im weiten Urstromtale der Elbe zwischen Wittenberg und Magdeburg, 2. im südfranzösischen Rhonedelta, 3. im südlichen Norwegen gegenüber dem Skagerrak, 4. im russischen[S. 8] Sumpfgebiet Polesje, das vom Prijpet durchflossen wird. Allerdings sind schon Stimmen laut geworden, daß der Biber durch die Kriegs- und Revolutionszustände dort ausgerottet worden sei; wer aber die Unzugänglichkeit dieser Gegend sowie die große Menschenscheu der dortigen Biber kennt, wird gleich mir nicht recht daran glauben. Ferner findet sich in »Brehms Tierleben« und anderen Werken die Angabe, daß der Biber auch auf der Balkanhalbinsel noch vorkomme und in Bosnien »besonders häufig« sei. Da ich aber dort nie die geringste Spur des großen Nagers gefunden habe, wandte ich mich um nähere Auskunft an meinen alten Freund, den bekannten Balkanforscher Othmar Reiser, der so freundlich war, mir folgendes zu antworten: »Ich habe schon vor Jahren festgestellt, daß es sich bei diesen Angaben um Verwechslungen mit dem Fischotter oder sogar mit dahintreibenden Baumstämmen handelte. Lange kann es freilich noch nicht her sein, daß der Biber von dort verschwunden ist, denn Knochenreste sind vielfach gefunden worden, und ich selbst war einmal zufällig Zeuge, wie bei einer prähistorischen Grabung am Trebewitsch bei Sarajevo ein gut erhaltenes Kieferstück des Bibers zutage gefördert wurde. Außerdem hat sich der slawische Name des Tieres ›Dabar‹ im Dabar-Polje in der Herzegowina, an das Du Dich wohl noch erinnern wirst, und im Namen des Dorfes Dabar im Bezirke Sanskimost erhalten. Als einzigen greifbaren Beweis aus diesen Gegenden kenne ich aber nur die traurigen Überreste eines ausgestopften Bibers in der unbedeutenden zoologischen Sammlung in Belgrad, der in den 60er Jahren in der Drina gefangen worden sein soll.«
Fast alles, was wir über die Naturgeschichte des europäischen Bibers wissen, ist an den Elbebibern beobachtet worden, über die erst neuerdings (1922) wieder Mertens eine sorgfältige und ausführliche Arbeit veröffentlicht hat. Das Wohngebiet des Bibers an der Elbe und ihren Nebenflüssen ist landschaftlich von hohem Reiz und auch sonst für den Tier- und namentlich für den Vogelforscher von hervorragender Anziehungskraft. Dichte Auwaldungen mit üppigem Unterwuchs und eingebetteten Wiesen und kleinen, schilf- und rohrbewachsenen Seen geben der überaus wechselvollen Landschaft das Gepräge. Selten sah ich irgendwo in Deutschland so viel Tagschmetterlinge wie hier, und in hoher Luft entzückte mich das herrliche Flugbild des edlen Wanderfalken. Der Biber liebt besonders die Altwässer der Elbe mit ihren vielen Lachen und Tümpeln, Seerosen, Igelkolben, Schwertlilien und Schachtelhalmen (auch die[S. 9] Wassernuß kommt hier noch vor), mit ihrem stattlichen Wuchs von Weichhölzern und den zahlreichen Weidenhegern am Rande und mit ihren undurchdringlichen, von Brennesseln und wildem Hopfen durchwucherten Dorndickichten. Daß sich der Biber gerade hier in der Nähe großer Industrien und an der durch eine starke Schiffahrt beständig beunruhigten Elbe erhalten konnte, dürfte auf verschiedene Umstände zurückzuführen sein. Vor allem sind diese sumpfigen Geländestreifen verhältnismäßig spät vom Menschen besiedelt worden, denn man scheute die Mühe ihrer Urbarmachung und den Kampf mit dem Hochwasser, der die Errichtung kostspieliger Dämme und Deiche erforderte. Erst in neuerer Zeit ist diese Besiedlung in stärkerem Maße erfolgt, und damit begann auch das allmähliche Erlöschen des Biberbestandes, der bis dahin ein ziemlich ungestörtes Dasein hatte führen können. Ein weiterer glücklicher Zufall war es, daß dieses Gebiet in fast ununterbrochenem Zusammenhange Domänen- oder Regierungsbesitz darstellte, und daß die Fürsten und Herzöge von Anhalt von jeher weidgerechte Jäger und große Naturfreunde waren, ebenso ihre Forstbeamten. Die Biberjagd an sich hatte ja überhaupt für die Fürsten und großen Herren wenig Reiz, denn sie brachte keine stolzen Trophäen, keine Gehörne und Geweihe; sie reizte auch nicht durch die Gefahr, die in der Bekämpfung des Bären oder des grimmen Bassen lag, gab auch keine Gelegenheit zur Entfaltung höfischen Prunkes wie etwa die Reiherbeize. War also auch Aasjägerei ausgeschlossen, so konnte doch die Wilddieberei auf den wertvollen Biber niemals ganz unterdrückt werden, und in der Zeit des Umsturzes ist sie natürlich wieder besonders üppig ins Kraut geschossen. Auch die hohen Steilufer waren dem Biber günstig, denn sie ermöglichten es ihm, seine Baue so anzulegen, daß er jederzeit unter Wasser ausfahren konnte, während der üppige Pflanzenwuchs stets genügende Äsung bot. Alle diese Umstände haben zusammengewirkt, um den Bestand der Elbebiber bis auf die heutige Zeit zu erhalten. Wie lange noch?
Die heutige Anzahl der Biber einigermaßen zuverlässig festzustellen, ist sehr schwer und erfordert unermüdliche Ausdauer neben großer Begeisterung für die Sache. Herr Amtmann Behr brauchte dazu im Jahre 1913 vom September bis Dezember volle 43 Tage. Er führt insgesamt 188 Biber auf. Davon kamen auf preußisches Gebiet 82 Baue mit 114 und auf anhaltinisches 59 Baue mit 74 Bibern. Das bedeutete schon eine wesentliche Abnahme, denn um die Jahrhundertwende herum hatte der verstorbene Forstmeister Freiherr[S. 10] von Nordenflycht in Lödderitz, der sich auch als Jagdschriftsteller einen Namen gemacht hat, den Gesamtbestand der Elbebiber auf 250 Stück angegeben. Leider ist auch seit der Behrschen Zählung eine unverkennbare weitere Verringerung des Biberbestandes eingetreten, und Professor Mertens urteilt sicherlich viel zu optimistisch, wenn er die heutige Kopfzahl auf rund 200 schätzt. Im September 1924 gab mir Herr Krietzsch eine genaue Aufstellung der nach seinen Beobachtungen noch vorhandenen Biber. Darnach wohnten an der Elbe von Wittenberg bis zum Wellmitzhafen bei Dessau vor dem Kriege 92 Biber, heute dagegen nur noch 14 Alte und 4 Junge; an der Mulde von Dessau bis Raguhn früher 81 Biber, heute noch 6 Alte; an der Elbe von Wallmitzhafen bis Magdeburg früher 48 Stück, heute noch 13. Die Gesamtzahl betrug also 1913 immerhin 222 Biber, heute nur noch 37, darunter 6 Junge. Das wäre allerdings ein ganz erschreckendes Zusammenschmelzen innerhalb 12 Jahren, das für die Zukunft des Biberbestandes das Schlimmste befürchten ließe. Es mag sein, daß diese Schätzung etwas zu niedrig gegriffen ist, zumal neuerdings von zuverlässiger Seite eine Zunahme der Biber in der Kreuzhorst bei Magdeburg gemeldet wird, aber immerhin dürfte sie gegenwärtig der Wahrheit näher kommen als die Mertenssche Angabe. Von diesen 37 einwandfrei festgestellten Bibern leben 15 auf preußischem und 22 auf anhaltinischem Gebiet. Amtmann Behr nimmt den heutigen Bestand doch als wesentlich höher an. Wie weit das Hochwasser 1926 geschadet hat, entzieht sich noch meiner Kenntnis.
Im allgemeinen läßt sich in neuerer Zeit eine Verschiebung des Verbreitungsbezirkes nach Norden feststellen; namentlich in der teilweise abgesperrten Kreuzhorst bei Magdeburg scheint infolge Neueinwanderung eine Zunahme des Bestandes stattzufinden.
Außerdem lebte von 1917 bis 1924 noch ein Biber als Einsiedler im Mühlteich bei Mosigkau. Wie der dorthin gekommen sein mag? Er errichtete nicht nur einen Bau, sondern auch eine Burg und ging zur Ranzzeit oft aus dem Wasser heraus aufs Feld. Seit April 1924 ist das Tier spurlos verschwunden, aber anscheinend nicht gewilddiebt worden, sondern liegt wahrscheinlich infolge Äsung von Eichenrinde verendet in seinem Bau. Wo die Biber nämlich an ihren Bauen gestört werden und der eine Teil zugrunde geht, bekommt der andere in der Ranzzeit Sehnsucht nach seinesgleichen, sucht nach einem neuen Gatten, findet ihn nicht und treibt sich deshalb ruhelos in der Gegend umher, wobei er in die Nebenlöcher der Elbe und[S. 11] Mulde gerät, vereinzelt sogar schon weit in die Havel hinaufgeschwommen ist. Weiden gibt es an solchen Plätzen gewöhnlich nicht; die Tiere äsen deshalb aus Not Eichenrinde, deren Gerbsäuregehalt schwere Verdauungsstörungen bei ihnen hervorzurufen scheint. Ein alterfahrener Waldläufer versicherte meinem Gewährsmann, daß viele Biber auf diese Weise umkämen und daß man sein blaues Wunder erleben würde, wenn man einmal alle Baue öffnen wollte. Eine gewisse Bestätigung erfährt diese auch von Krietzsch geteilte Ansicht durch die Sektion eines Bibers, der in den ersten Tagen des Februar 1925 in stark abgemagertem, aber sonst unverletztem und gut erhaltenem Zustande verendet in der Elbe bei Trochheim gefunden und dem Zerbster Museum eingeliefert wurde. Die ganzen Därme waren voll großer Klunkern und die Leber tuberkulös. Auch ein im November 1924 in einem Graben bei Groß-Rosenburg tot aufgefundener Biber wies keine Schußverletzung oder sonstige Spuren von Gewaltsamkeit auf. Das schon recht alte Tier war bereits einige Wochen vorher in offenbar krankem Zustande an der Modderschleuse beobachtet worden.
Durch allerlei dumme Zufälle gehen alljährlich mehrere Biber zugrunde. So ergab die Untersuchung eines wahren Prachtstückes, das am 3. März 1925 im Luch am Elbeufer verendet angetrieben wurde, daß das Tier nicht von Menschenhand getötet, sondern wahrscheinlich von einem Dampfer gerammt worden war. Einige Wochen vorher wurde bei Vogerode ein toter Biber angeschwemmt, der mit dem linken Vorderfuß in einer neuen Bügelfalle hing. Durch das Auslegen von Ottereisen, das im Biberbezirk ganz verboten werden müßte, werden die Biber überhaupt sehr gefährdet, wenn auch meist unabsichtlich. Dazu kommt die immer noch nicht völlig unterdrückte Wilddieberei. So ging im Frühjahr 1924 durch die Zeitungen die Nachricht, der »letzte« Biberbau an der Saale sei von Wilddieben zerstört und seine Bewohner erschlagen worden. Laut brieflicher Mitteilung des Herrn Winkelmann verhielt sich die Sache aber doch etwas anders. Ein berüchtigter Wilddieb hatte während des Frostes den kleineren Biberbau am Goldberger See im Lödderitzforst mit dem Spaten angegraben und dann in die Öffnung hineingeschossen, wobei er von einem Bauern aus der Umgegend beobachtet wurde. Der eine Biber war daraufhin unter das Eis geflüchtet, ist hier elend umgekommen, wurde im Frühjahr beim Fischen gefunden und der Oberförsterei übergeben, die das Skelett aufgestellt hat. Harte Winter sind überhaupt für den Biber insofern schlimm, als[S. 12] dann die Strolche auf dem Eise an jeden Bau herankommen, die Biber selbst aber wegen des Eises schwer flüchten können. So kommen viele um und werden erschossen oder erschlagen. Wie mir Herr Maler Zehle mitteilt, wurde noch im letzten Winter versucht, die Biberburg im Krügersee niederzubrennen und so die Tiere herauszutreiben. Zum Glück brannte aber das Schilf nur auf der einen Seite an, ohne den Bau wesentlich zu beschädigen.
Ferner gehen leider auch ohne besonderes Zutun des Menschen viele Biber dadurch verloren, daß sie in die Reusen und Netze der Fischer geraten und ertrinken, wenn sie sich nicht durch Zerreißen der Netze befreien können. Da das zuweilen geschieht, freuen sich die dadurch geschädigten Fischer über jeden umgekommenen Biber, dreifach aber, wenn sie sich durch heimliche Aneignung des Tieres mit dem wertvollen Pelze, dem teuren Bibergeil und dem schmackhaften Fleisch bereichern können. Besonders gefährlich sind auch die Nachstellungen, die durch die Mordlust der Schiffer drohen, die mit ihren Kähnen zeitweise innerhalb der Biberreviere ankern. Während der Schutzbeamte auf dem Lande sich bewegen muß, kann der Schiffer vom Wasser aus im kleinen Kahne den Biberbauen ungesehen sich nähern, und so wird manches Stück heimlich umgebracht oder angeschossen und später verludert im Bau gefunden. Manchmal werden die Tiere auch bei der Fischerei mit dem Netz ans Land gezogen, denn sie sind zu dumm oder zu träge, um über das Netz hinwegzuspringen. Ein auf diese Weise gefangener Biber benahm sich so zutraulich und täppisch, daß er mit der Rute wieder ins Wasser zurückgejagt werden mußte. Der schlimmste Feind des aussterbenden Tieres ist aber doch plötzlich einsetzendes Hochwasser, namentlich wenn es noch Eisschollen mit sich führt. Die Biber flüchten dann aus ihren Bauen auf die Deichkronen oder andere erhöhte und trockene Plätze und sind hier natürlich allen Zufälligkeiten und Nachstellungen preisgegeben. Bei solchen Gelegenheiten weit sich verirrende Biber werden oft aus bloßer Unkenntnis umgebracht, weil man sie irrtümlich für Fischottern hält. Aber auch für den friedlichen Beobachter ergibt das schöne Gelegenheiten.
So schreibt mir Herr Winkelmann: »Vor zwei Jahren saßen zwei Biber beim Frühlingshochwasser, als der Damm nur 1-½ Meter aus der Flut hervorragte, unterhalb des Wachthauses auf dem Damme und versuchten wiederholt, sich in die Deichkrone einzugraben. Dies mußte jedesmal von der Deichwachmannschaft, die dort während des Hochwassers Tag und Nacht in Bereitschaft lag, verhindert[S. 13] werden. Schließlich nahmen die Tiere davon Abstand, hielten sich aber noch tagelang auf der Deichkrone auf. Beim Herannahen von Menschen plumpsten sie jedesmal ins Wasser, schwammen zwischen den Bäumen herum und kehrten nach Vorübergang der Störenfriede auf ihre alten Plätze zurück. Als später das Wasser fiel, suchten sie ihre Baue wieder auf.« Es sei aber ausdrücklich betont, daß auch in solchen Fällen ernsthafte Dammbeschädigungen durch den Biber höchstens bei ganz mangelhafter Aufsicht verursacht werden könnten. Die Tiere kommen auf die Dämme ja überhaupt nur, wenn diese unmittelbar ans Wasser stoßen und kein anderes erhöhtes Ufer zur Verfügung steht. Deshalb erscheint schon aus rein praktischen Gründen der Vorschlag von Mertens sehr beachtenswert, für solche Fälle besondere Biberschutzhügel anzulegen. Auf der Straße von Aaken nach Steutz liegt ein Wirtshaus, das jenseits der Straße noch eine Veranda für die Gäste hat. Bei Hochwasser fährt das Motorboot des Fährmanns bis an die Treppenstufen des Gasthauses. Als Herr Winkelmann einmal das Fährboot benutzte, saßen die beiden am Hornhafen heimischen Biber auf einem Bündel selbst zusammengeschleppten Reisigs unmittelbar hinter der Veranda. Beim Heranfahren des Bootes plumpste der eine ins Wasser, der andere aber blieb ruhig sitzen und äugte die Menschen nur neugierig an. Daraufhin kam auch der andere Biber sofort wieder auf die Sasse zurück, und beide ließen sich nun in aller Ruhe und Bequemlichkeit beliebig lange beobachten.
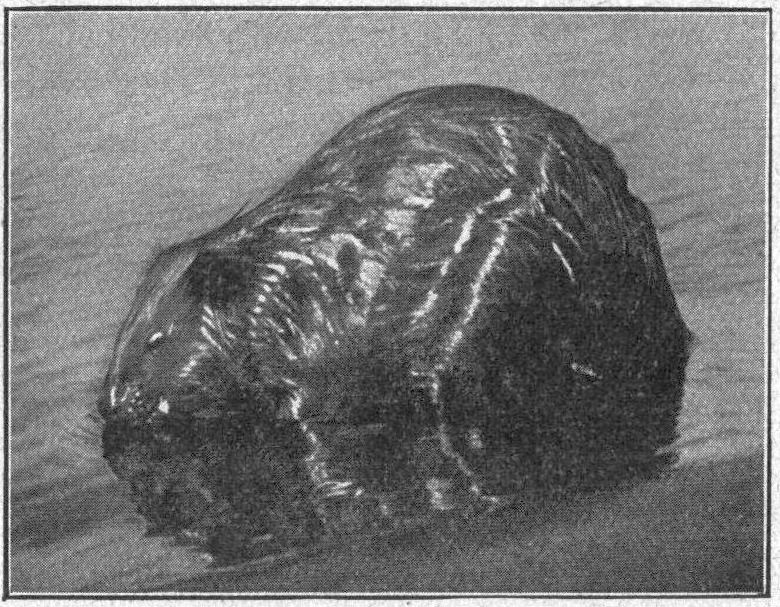
Der am Ufer ruhende Biber macht einen gedrungenen Eindruck und erinnert stark an eine riesenhafte Ratte, nur daß die Hinterfront abgestutzt erscheint, weil die Kelle im Ruhezustande unter den Leib geschlagen wird, also überhaupt nicht sichtbar ist (Abb. 1). Von weitem sieht ein solcher ruhender Biber wie ein am Ufer liegender[S. 14] Stein aus und wird deshalb trotz seiner Größe in seiner Unbeweglichkeit vom Unkundigen leicht übersehen. Selbst bei der Anlage ihrer Baue kümmern sich die Biber bisweilen herzlich wenig um die unmittelbare Nachbarschaft des Menschen. So ist im Aakener Hornhafen von jeher ein Biberbau gewesen, und die Tiere haben sich durch das beständige Hämmern und Klopfen der Schiffsbauer eigentlich nie stören lassen. Brieflicher Mitteilung des Herrn Behr zufolge lag früher am hochbewaldeten Ufer der Elbe bei Steckby hinter einem Buhnenwinkel ein weitverzweigter Biberbau, der zuweilen auch von Dächsen und Füchsen befahren wurde. Hochwässer hatten hier einen tiefen Kolk gerissen, der durch eine schmale Rinne mit der Elbe in Verbindung stand, aber bei niedrigem Wasserstande trocken lag, so daß der Biber, um zu seinem Bau zu gelangen, über Land wechseln mußte. Die Zugangsröhren lagen bis auf einige vom Dachs angelegte unter Wasser, wie dies bei Biberbauen stets der Fall zu sein pflegt. Da die Strömung weitere Landmassen wegriß, wurde von der Strombauverwaltung ein Deckwerk aus Faschinen und Steinpflaster angelegt, wobei die tief liegenden Eingänge verschüttet wurden. Diese geräuschvollen Arbeiten konnten aber das hier hausende Biberpaar nicht zum Verlassen seines Heims bewegen, sondern die Tiere benutzten nun eine hochliegende Dachsröhre als Einschlupf, wobei sie eine Strecke von 12 Metern den Hang hinauf zurückzulegen hatten und sich dabei oft prächtig beobachten ließen.
Werden die Biber an solchen Plätzen vom Menschen überrascht, so zeigen sie sich recht blöde und unbeholfen, aber nicht eben furchtsam. Das Tollste in dieser Beziehung hat Herr Amtmann Behr erlebt. Er teilte mir darüber brieflich folgendes mit: »Im Sommer 1922 war der Wasserstand der Elbe überaus niedrig, so daß die Sandbänke, die die Tiere passieren mußten, bis weit ins Flußbett hineinliefen. Des Abends erfolgte der Auswechsel, wenn das Büchsenlicht längst geschwunden war, während sich des Morgens die Heimkehr oft stark verspätete, namentlich wenn Fischer oder Schiffer hier tätig waren. So lag ich einmal im Juli vor Tagesgrauen in meinem Versteck und harrte der Heimkehr meiner Freunde. Auf der Sandbank hatte Herr Hermann Hähnle aus Stuttgart einen Kino-Apparat aufgestellt, um die Tiere zu filmen, was auch tadellos gelang. Da die ständig vorüberfahrenden Kähne ein zeitiges Einwechseln verhinderten, erfolgte dieses erst um 8 Uhr morgens, als die Sandbank schon stark von der Sonne beschienen wurde. Langsam,[S. 15] Schritt für Schritt, stieg der erste Biber schwerfällig über die dünenartige Fläche, wobei er die Kelle nachschleifen ließ (Abb. 2). Am Kolk angelangt, schob er sich ebenso schwerfällig ins Wasser und schwamm, nur den Kopf zeigend, zur anderen Seite hinüber, um hier ebenso täppisch auszusteigen. Als er so ziemlich an das Rohr angelangt war, sprang ich ihm entgegen und stellte mich auf den Wechsel, um ihn wieder in den Tümpel zurückzutreiben. Doch diesen Scherz faßte er falsch auf, ging zum Angriff über und biß mit seinen langen Nagezähnen durch den Schaft meines Wasserstiefels, auch noch durch Beinkleid, Unterbeinkleid und Strümpfe, und erst als ich ihm einen leichten Schlag auf den Kopf versetzte, ließ er los, kehrte um und machte denselben Weg zurück.«

Noch ein anderes hübsches Biberstückchen vom Januar 1913 aus Dessau! Damals kam ein Biber in die sog. Wasservorstadt, nachdem er sich schon im Herbst öfters dort hatte blicken lassen. Er entwickelte eine ganz verblüffende Dreistigkeit und unternahm öfters am hellen Tage Spaziergänge über den Wasserwall hinweg in die eingefriedigten Gärten, um dort mit großem Behagen die Kohlköpfe zu verspeisen. Auch zugeworfene Apfelstückchen nahm er gerne an und ließ sich bei seinen Schmausereien durch Zuschauer nicht im geringsten stören, obgleich einmal ein ganzes Mädchenpensionat um ihn versammelt war. Den Schaden an den Kohlstrünken hätte man ihm gern verziehen, aber leider benagte er auch die Obstbäume, und es wurde deshalb beschlossen, ihn einzufangen und an die Forstverwaltung[S. 16] abzuliefern. Bald war zur Ausführung dieser schwarzen Tat ein Mann mit einem großen Sack zur Stelle. Der Biber aber setzte sich ruhig hin und harrte der Dinge, die da kommen sollten. Es sah aus, als wäre es eine Kleinigkeit, ihm den Sack überzustülpen, aber sobald ihm der Mann den Sack vorhielt, sprang der Biber mit Fauchen und Knurren nicht etwa in den Sack, sondern auf den Mann. Sack und Mann verschwanden jedesmal nach der glänzenden Attacke des Bibers, und schallendes Gelächter der Zuschauer belohnte den Sieger. Dieses Schauspiel wiederholte sich einigemal, aber der Biber ließ sich das wenig verdrießen, denn nachdem er seinen Gegner schneidig abgewiesen hatte, ging er in aller Seelenruhe wieder an seinen Kohl und labte sich. Schließlich sah man ein, daß dem Biber bei seiner Tapferkeit und überlegenen Ruhe nicht beizukommen sei und ließ ihn ungestört seines Weges ins nahe Wasser ziehen.
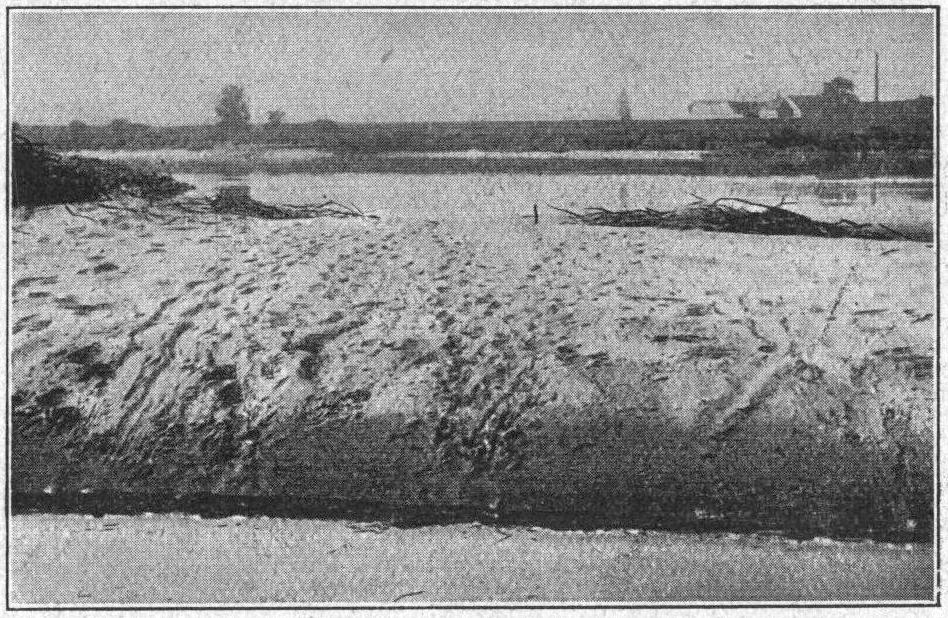
Sportsegler, die im Sommer die Wasserreise von Dresden nach Potsdam zu machen pflegen, haben mir oft versichert, daß sie auch bei Tag auf Reisighaufen oder Weidenköpfen ruhende Biber antrafen, die sich um die lautlos vorbeisegelnden Boote kaum kümmerten, sondern ruhig weiter dösten, um erst im Wasser zu verschwinden, wenn man Lärm machte oder ihnen gar zu nahe auf den Leib rückte. Besonders menschenscheu kann man nach alledem den Elbebiber also unmöglich nennen, wenn er auch unter gewöhnlichen Umständen immer genügend auf seine Sicherheit bedacht bleibt. Erschwert wird[S. 17] seine Beobachtung aber durch seine nächtliche Lebensweise und durch die sumpfige Beschaffenheit des Geländes, in dem man es an Sommerabenden vor Stechmücken kaum aushalten kann. Die unverkennbaren Spuren seiner Anwesenheit müssen schon jedem halbwegs aufmerksamen Spaziergänger auffallen, am meisten natürlich die Burgen und abgeschnittenen Hölzer mit der sanduhrartig gestalteten Schnittfläche und die herumliegenden Späne, auf denen sich der Eindruck der großen Nagezähne deutlich erkennen läßt. Aber auch die regelmäßig begangenen Wechsel stechen sehr ins Auge, sei es als deutliche Straßen im hohen Wiesengrase, sei es als glatte Rutschbahnen am abschüssigen Ufer, sei es als scharf ausgeprägte Fährte auf einer Sandbank. An solchen Stellen kann man sowohl die Schwimmhäute der Hinterbeine wie die Zehen der Vorderfüße deutlich erkennen, wenn auch alles durch den nachschleifenden Schwanz etwas verwischt erscheint (Abb. 3). Stellt man sich an einem solchen Wechsel etwas gedeckt an und verhält man sich nur bewegungslos, so wird man namentlich an schönen, stillen Sommerabenden oft die Freude haben, den Biber im nahen Wasser unter der Oberfläche entlang schwimmen zu sehen, wobei er nur die Nasenspitze herausstreckt, während sich zwei feine Striche im Wasserspiegel abzeichnen. Wo das Tier sich ganz sicher fühlt, taucht es auch weiter aus dem Wasser hervor, so daß der halbe Kopf und der Rücken hervorragen (Abb. 4). Schließlich steigt der Biber an Land, schiebt sich schwerfällig die Böschung hinauf, schüttelt sich das Wasser aus dem Pelz und trottet langsam[S. 18] am Ufer entlang, bis er nach einiger Zeit mit weithin hörbarem Plumps wieder ins Wasser zurückfällt. War er irgendwie erschreckt worden, so stößt er mit seinen breitruderigen Hinterfüßen kräftig nach oben aus, schlägt gleichzeitig mit dem Schwanze laut klatschend auf die Wasseroberfläche, was wohl ein Warnungszeichen für seine Kameraden sein soll, und sinkt dann fast senkrecht in die Tiefe. Oft aber gleitet er auch völlig lautlos ins feuchte Element, wenn nämlich ringsum alles ruhig blieb. Beim Tauchen werden die auch auf der Innenseite dicht behaarten Ohrmuscheln zusammengefaltet und so der Gehörgang verschlossen, die durchsichtige Nickhaut über die kleinen Rundaugen gezogen und die Nasenflügel mit Hilfe besonderer Muskeln fest zusammengepreßt. Die Lehrbücher geben übereinstimmend an, daß der Biber etwa zwei Minuten unter Wasser bleiben könne, dann aber zum Atemholen wieder an die Oberfläche kommen müsse. Indessen ist diese Zeitangabe sicherlich viel zu niedrig gegriffen. Ich selbst konnte mit der Uhr in der Hand an einem in Gefangenschaft gehaltenen Biber feststellen, daß er volle 10 Minuten unter Wasser blieb, und Behr sah in einem kleinen, klaren Tümpel bei Steckby einen Biber sogar 14 Minuten lang ruhig auf dem Grunde liegen, ehe er von neuem Atem schöpfte. Ein Förster und ein Bühnenarbeiter wollen dasselbe 15 bis 20 Minuten lang beobachtet haben. Die außergewöhnlich großen Lungen des Tieres vermögen ja auch eine ganz bedeutende Luftmenge zu fassen. Das Geruchsvermögen des Bibers ist gut entwickelt, während die etwas blöde dreinblickenden Augen stark kurzsichtig sind. Die selten zu hörende Stimme ist leise knurrend, bei Ärger zornig fauchend. Die noch im Bau liegenden Jungen wimmern nach Mertens wie kleine Kinder.
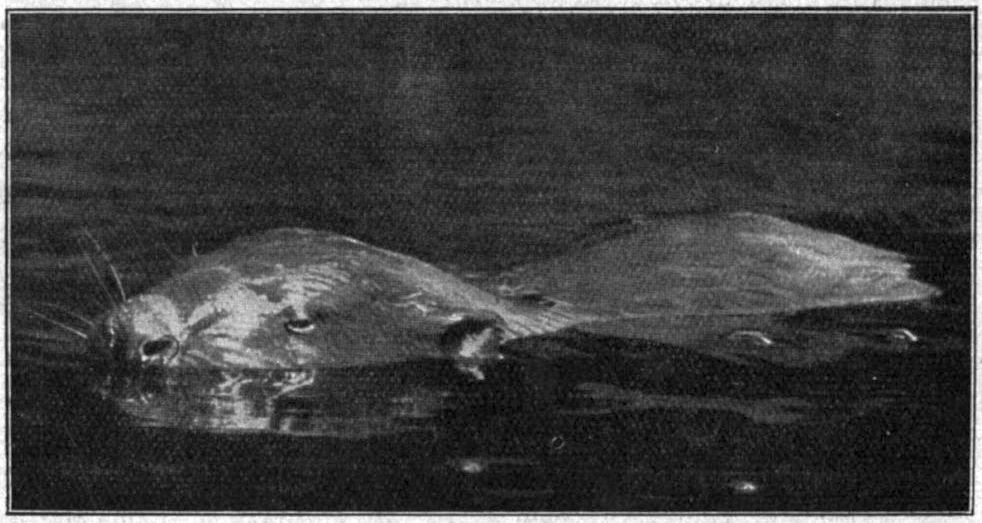

(Naturaufnahme von Amtmann Behr)
Wenn man unsere Abb. 5 betrachtet, wird man sehr geneigt sein, den Biber für einen argen Waldverwüster zu halten, denn er hat hier in der Tat ganz greulich gewirtschaftet. Unser Erstaunen wird noch wachsen, wenn wir hören, daß hier die Arbeit eines einzigen Bibers vorliegt, der sich im Frühjahr 1913 als Einzelgänger bei Törten a. d. Mulde aufhielt. Er war zugewandert, als an seinem alten Wohnorte die Weidenanpflanzungen immer seltener wurden und hatte nun seinen Stand in hohes Laubholz verlegt, wo er Espen fällte, darunter Stämme bis zu 40 cm Durchmesser. Der Schlag erreichte schließlich eine Größe von 3/4 Morgen. Der Übeltäter war ein ungewöhnlich starkes Tier und wurde von Förster Radtke, der ihn öfters beobachtete, auf 80, von anderen sogar auf 90 Pfund[S. 19] geschätzt (Brehm gibt das Gewicht des Bibers mit 20 bis 30 kg sicher zu niedrig an), ein Zeichen dafür, daß trotz unvermeidlicher Inzucht noch keine Entartung des deutschen Biberbestandes eingetreten ist. Trotz unserer lehrreichen Bilder ist der forstliche Schaden des Bibers nicht so groß, wie vielfach angenommen wird, und wird eigentlich nur dann wirklich empfindlich, wenn man den Tieren ihre natürliche Hauptnahrung, nämlich Weiden- und Wurzelwerk von Wasserpflanzen, schmälert. Es sind ja immer nur einzelne Stücke, die dazu neigen, übermäßig zu schneiden und auch stärkere Bäume anzugehen. Man sollte also die Schädlichkeit des Bibers nicht noch aufbauschen, wie es leider vielfach geschieht, um Freund Bockert »interessanter« zu machen; es fehlt ohnehin nicht an Stimmen, die den Abschuß der letzten Elbebiber immer und immer wieder verlangen. Seine Arbeiten verrichtet der Biber nur des Nachts bei völlig hereingebrochener Dunkelheit und läßt sich dabei nicht gerne belauschen. Dies war sogar im Hamburger Tiergarten der Fall, wo das Bibergehege einen besonderen Anziehungspunkt bildet. Selbst in mondhellen Nächten konnten die Tiere nicht beim Fällen der für sie eingepflanzten Pappelstümpfe beobachtet werden. Sie brauchten 29 Tage[S. 20] zum Fällen eines 36 cm starken Baumes, weil sie offenbar nur mit großen Unterbrechungen daran arbeiteten, da sie ja anderweitige Nahrung im Überfluß hatten. Die von Brehm gepflegten Biber zeigten sich etwas umgänglicher und schnitten schließlich auch in den späteren Nachmittagsstunden. Zum Umlegen einer 8 cm dicken Weide brauchten sie nur fünf Minuten. In Steckby vom Biber abgeschnittene Stämme hatten gewöhnlich eine Dicke von 15 bis 30, manchmal aber auch 40 und selbst 60 cm, und zwar handelte es sich in diesem Falle stets um Schwarz- oder Silberpappeln. Nach einem Berichte Friedrichs wurde am Kühnauer See bei Dessau eine Pappel von 192 cm Umfang in mehrjähriger, von großen Pausen unterbrochener Arbeit umgelegt. Für mich unterliegt es gar keinem Zweifel, daß solche starke Bäume nicht zu Nahrungszwecken, sondern lediglich zum Schärfen der Schneidezähne angenommen werden, oft wohl auch nur aus Langeweile und Spielerei. So sah ich im Gasthause in Aaken die Photographie einer riesenhaften Pappel, die aus vier Stämmen zusammengewachsen war. An diesem gewaltigen Baum hatten fünf Biber jahrelang genagt, natürlich nur ab und zu. Dieses Biberfraßstück sollte auf eine Ausstellung nach Leipzig geschickt werden, aber sein Umfang erwies sich als so groß, daß der Transport unterbleiben mußte. Ein halbes Jahr später riß ein Sturm den mächtigen Baum um, und zwar an der angefressenen Stelle. Schneereiche Winter bereiten dem Schneiden mancherlei Schwierigkeiten. So sah ich einen Stamm, der vom Biber zunächst in der gewöhnlichen Weise unten angeschnitten war. Tiefer Schnee hatte ihn dann genötigt, die Arbeit an einer höheren Stelle von neuem zu beginnen. Hier wiederum durch stärkeren Schneefall vertrieben, hat er endlich in großer Höhe nochmals angefangen und nun den Baum wirklich gefällt, der also unterhalb der Bruchstelle noch zwei weitere tiefe Einschnitte zeigt. Pappeln und Weiden sind die Lieblingsbäume des Bibers, er geht aber auch alle anderen Weichhölzer des Auenwaldes an, mit Vorliebe Ahorn, Wildbirne, Holzapfel und Haselstrauch, seltener die bitteren Schwarzerlen und Eichen, nur ausnahmsweise die Birke und die Kiefer, die er aber nicht entrindet, weil ihm wahrscheinlich ihr Harzgehalt zuwider ist. Sehr gern werden neu auftauchende Baumarten heimgesucht, wie dies ja auch von den Spechten bekannt ist. So erzählt Mertens, daß auf dem Klostergut Prester eine ganze Reihe frisch gesetzter Apfelstämmchen in wenigen Nächten abgeschnitten und ins Wasser geschleppt wurde.
[S. 21]

(Blitzlichtaufnahme von Amtmann Behr)
Seinem Schneideplatze nähert sich der Biber erst nach völlig hereingebrochener Dunkelheit und mit erhöhter Vorsicht, wie sich dies sehr hübsch auf unserer nach einer Blitzlichtaufnahme hergestellten Abb. 6 sehen läßt, wo das Tier gerade in den zum Schneiden bestimmten Weidenstrauch kriecht. Beim Schneiden nimmt es eine eichhörnchenartig hockende Stellung an, und in den Erholungspausen setzt es sich fast aufrecht, wobei es sich fest auf die Kelle stützt. Durch das schnelle Schneiden entsteht ein schnarrendes Geräusch, und dünne Stangen fallen schon nach Verlauf weniger Minuten. Während dünne Weidenzweige glatt durchgenagt werden, erhält die Schnittfläche bei stärkeren Stämmen schließlich das sanduhrartige Aussehen, das wir auf den Abb. 5 und 7 gut bemerken können. Auf Abb. 7 sehen wir zugleich, daß Meister Bockert manchmal auch vergeblich arbeitet, indem der Baum zwar fällt, aber mit seinem Wipfel in den Nachbarbäumen hängen bleibt. Kommt der Stamm dabei recht schräg zu liegen, so besteigt der Biber ihn wenigstens, um die Rinde zu äsen. Am Schneideplatz liegen massenhaft Späne bis zu 10 cm Länge herum, denen die Spur der Nagezähne so deutlich aufgeprägt ist, daß man nach ihrer größeren oder geringeren Breite leicht das ungefähre Alter des Bibers bestimmen kann. Nähert sich die Arbeit ihrem Ende, so rückt der Biber von Zeit zu Zeit von dem Stamm ab und blickt spähend zum Wipfel empor, als ob er sich vergewissern wolle, nach welcher Richtung hin der Baum wohl fallen wird. Er muß in dieser Beziehung ein sehr gutes Urteilsvermögen besitzen,[S. 22] denn nur äußerst selten kommt es vor, daß ein Biber von dem fallenden Baum erschlagen wird. Mir ist diesbezüglich nur ein gut beglaubigter Fall zu Ohren gekommen. Mertens geht also immerhin zu weit, wenn er angibt, daß es überhaupt niemals vorkäme. Ich vermute, daß auch die eigentümliche sanduhrartige Form des Schnitte die Fallrichtung in bestimmter Weise beeinflußt, aber über diesen Punkt wären noch weitere und gründlichere Untersuchungen notwendig. Die beim Schneiden gewonnene Rinde wird gleich an Ort und Stelle behaglich zerschrotet. Die gefällten Bäume werden dann nach und nach in »handliche« Stücke zerschnitten, aber nicht entrindet, und allmählich ins Wasser geschleppt, besonders die Weiden. Muß das Tier dabei über Sandbänke hinweg, so entstehen auf diesen förmliche Schleifbahnen (Abb. 8). Das Hinabschaffen der Zweige an den mit Gestrüpp bewachsenen Steilufern wäre nicht leicht, wenn jedesmal eine andere Stelle benützt werden sollte, und deshalb schafft sich Meister Bockert durch beständige Benutzung der gleichen Stelle eine Schlittenbahn, auf der er mit seinen Vorräten leicht und vergnüglich hinabrutscht. Die eingesammelten Hölzer bilden schließlich ein Floß vor dem Eingang zum Biberbau, und im Wasser erhält sich die Rinde namentlich der Weidenzweige frisch und schmackhaft und kann dann an ungemütlichen Wintertagen als Nahrungsvorrat dienen. Der Biber futtert ja am liebsten naß. Aus dem Gesagten erhellt schon, daß die Anlage von Weidenpflanzungen die erste Vorbedingung für das Gedeihen dieser Tiere ist. Exinger beobachtete an seinen gefangenen Bibern, die er auf einem ziemlich großen Teiche hielt, daß sie ein feines Vorgefühl für die kommende Witterung haben und sich nach ihr zu richten wissen. Eines Abends[S. 23] machten sie sich bei schönem Wetter plötzlich mit großer Hast an die Arbeit, Stämme in ihren Teich zu schleppen. Binnen einer einzigen Nacht hatten sie 186 Stämme von 2 bis 3 m Länge und 8 bis 11 cm Dicke ins Wasser geschafft, und wirklich trat ein Witterungsumschlag ein, und 24 Stunden später war der ganze Teich fest zugefroren und mit einer 7 cm dicken Eiskruste bedeckt.


Neben Weidenzweigen bilden die Wurzeln von allerlei Sumpf- und Wasserpflanzen die Hauptnahrung des Bibers, wodurch sich auch seine Vorliebe für die alten und toten Elbearme und die kleinen Seen im Urstrombette erklärt. Bevorzugt werden die süßen Wurzelknollen vom Rohr, Schilf und namentlich der beiden Wasserrosen. Der Biber beißt sie unter Wasser ab, so daß sie zur Oberfläche emporsteigen, oft viele an einer Stelle. Wo Zuckerrübenfelder in der Nähe des Wassers sich befinden, werden sie auch nächtlicherweile vom Biber gern heimgesucht. Während der schönen Jahreszeit werden als Zukost auch die zartesten Blätter und Blüten der Wasserpflanzen verspeist, junges Gras auch nicht verschmäht und sogar Seerosenfrüchte aufgenommen, deren harte Samenschalen unverdaut wieder abgehen. Mertens hatte einmal einen merkwürdigen Anblick, indem auf der von leichtem Nebel verschleierten Wasserfläche eine weiße Welle sich zu nähern schien. In Wirklichkeit war es ein Biber, der Seerosenblüten in großer Zahl gepflückt und in den Fang genommen hatte, so daß sie rechts und links wie ein Strauß heraushingen.
Die gewöhnlichen Wohnbaue der Biber werden ganz nach Art des Fischotters im Steilufer des Flusses angelegt, womöglich der größeren Festigkeit halber im Wurzelgeflecht einer alten Eiche, Rüster oder Weide, immer so, daß das Tier auch bei niedrigem Wasserstande[S. 24] unter Wasser in seine Behausung gelangen kann. Bisweilen wird dabei der schützende Baum derartig unterwühlt, daß er schließlich zum Umstürzen gebracht wird, wie dies im Aakener Hornhafen vorgekommen ist. Auch am Nordufer des Steinsees haben die Biber eine 80 cm starke Eiche durch Unterwühlen des Erdreichs zu Fall gebracht. Alte Baue können im Laufe der Zeit einen recht beträchtlichen Umfang annehmen, und manche Röhren führen dann so niedrig unter der Erdoberfläche entlang, daß das Begehen oder Befahren solcher Uferstrecken geradezu gefährlich wird und namentlich bei der Heuernte gar nicht selten Menschen oder Pferde durchbrechen. Der Biber fährt dann erschrocken aus seinem Bau und flüchtet ins Wasser. Noch schlimmer wird die Sache, wenn die Biber in den Deichen wühlen, was glücklicherweise selten vorkommt. Doch muß die Strombauverwaltung in dieser Beziehung immer ein scharfes Auge auf sie haben. Auch in solchen Fällen ist es nicht nötig, die Tiere abzuschießen, weil sie sich auch durch andere Mittel leicht vergrämen lassen. Mertens gibt an, daß der Damm bei Ranies in den Jahren 1920 und 1921 stark unterwühlt war und deshalb mit großen Kosten wieder ausgebessert werden mußte; die Gesamtlänge der damals aufgegrabenen Röhren soll nicht weniger als 86 m betragen haben. In den Wohnkessel des Baus werden einige derbe Holzprügel eingetragen und zu ganz feinen Spänchen zernagt, wodurch eine weiche Unterlage geschaffen wird.
Wo Ruhe im Revier herrscht und der Biber sich unbehelligt weiß, errichtet er außer diesen Bauen, die dann nur als Notwohnungen dienen, auch noch sog. Burgen, wie ich selbst eine am Schmiedersee besichtigen konnte. Sie sind oberirdisch sichtbar und haben backofenförmige Gestalt (Abb. 9). Diese Burg fiel schon von weitem durch die teilweise entrindeten und deshalb weißen Weidenzweige auf, die zu ihrer Herstellung verwendet waren. Obenauf lagen lange, trockene Rohr- und Schilfhalme. Die Baustoffe werden nicht etwa sorgfältig angeordnet, sondern liegen wirr, kreuz und quer durcheinander, so daß der ganze Bau ein sehr sparriges Aussehen erhält. Früher befand sich dort mitten im Wiesengelände eine zweite Biberburg dicht beim sog. Försterfriedhof auf einer kleinen Erhebung, die den winzigen Rest der sog. Schmiedburg, eines alten Bollwerks der Sachsen gegen die Wenden, darstellt. Im Goldberger See bei Lödderitz befindet sich gleichfalls im Schilf und Rohr versteckt eine regelrechte Biberburg, die ziemlich hoch und etwa 3 m breit ist. Zu den Burgen führen im tieferen Wasser mündende Geschleife.[S. 25] Ändern sich die Örtlichkeitsverhältnisse in unerwünschter Weise, so verlegen die Biber ihren Wohnsitz. So lebte vor einigen Jahren ein Paar im sog. Kuhlenhagen. Da aber dieser Teil der alten Elbe Fischreichtum aufwies und infolgedessen immer stärker befischt wurde, haben sich die ruheliebenden Tiere nach dem nördlichen Teile der Kreuzhorst verzogen, wo sie unter Naturschutz stehen und deshalb weniger gestört werden. Fortwährend haben die Tiere an ihren Burgen herumzubasteln, zu ändern, zu vergrößern und zu verbessern. Alle erforderlichen Dichtungsstoffe, wie Gras, Erde, Sand, Lehm und Schlamm, werden (wie auch bei den Dammbauten) nur mit dem Maule und mit den Händen bewegt und ausschließlich mit letzteren verarbeitet, also nicht mit der Kelle, welches unausrottbare Märchen sich immer wieder in den Büchern fortpflanzt. An schönen, ruhigen Tagen sonnt sich der Biber gerne auf dem Dache seiner Burg oder auf in der Nähe befindlichen Kopfweiden, oder er richtet sich als lauschige Ruheplätzchen besondere Sassen her. Die Sasse, von der ich selbst einen Biber aufscheuchte, war in den lehmigen Morast eingetieft und mit trockenem Gras und Laub gepolstert, übrigens so angelegt, daß bei nahender Gefahr ein einziger Satz das Entkommen ins Wasser ermöglichte.

(Naturaufnahme von Oberpostsekretär Winkelmann)
In Amerika, wo es noch viele Biber gibt, vermögen die in großen Siedlungen hausenden Tiere durch ihre Arbeiten geradezu landschaftgestaltend zu wirken, indem sie durch Aufführung von oft 100 m langen und 2 bis 3 m hohen Dämmen weite Strecken[S. 26] der Flußläufe in eine Seenkette verwandeln und durch ihre Holzschläge in den benachbarten Waldungen ausgedehnte Lichtungen, die sog. Biberwiesen, schaffen. Damit ist es für Deutschland natürlich längst vorbei. Immerhin legen auch die wenigen Elbebiber bei niedrigem Wasserstand hier und da einmal Stauwerke an, die wegen der planvollen Umsicht der vierbeinigen Ingenieure immer wieder unsere Bewunderung herausfordern. Ist ja doch der Biber in dieser Beziehung geradezu der Lehrmeister des Menschen gewesen! So hatten vor einigen Jahren die Biber unterhalb Breitenhagen ein Wasserloch vollständig abgedämmt. Als im Forstamt Witlingkau ein Teich abgelassen und auch der dazu gehörige Bach trocken gelegt wurde, fanden die Biber bald die Ursache des Wassermangels heraus und verbauten daher das Zapfenhaus mit Schilf und Schlamm derart, daß kein Tropfen mehr durchkam. Auf diese Weise wollten sie sich das Wasser erhalten, und es kostete nicht geringe Mühe, die Verdämmung zu beseitigen. Einen regelrechten Biberdamm, der quer über einen Arm der Altelbe bei Wartenburg gezogen war, sehen wir auf Abb. 10. Einen anderen Damm hatten die Biber nach Friedrich 1891 im Bruchgraben beim Kühnauer See aufgeführt. Er war geradlinig, 1-1/2 m hoch und 3 m breit. Zur Verwendung gelangten meterlange Knüppel von 10 bis 15 cm Dicke, die Zwischenräume waren mit Haselreisig ausgefüllt und schließlich das Ganze mit schlammigen Rasenstücken so gut abgedichtet, daß es für Wasser vollkommen undurchlässig und fest genug war, um einem erwachsenen Menschen das Begehen des Dammes zu ermöglichen. Mertens erwähnt zwei weitere Dammbauten, die aber des hier besonders reißenden Wassers wegen nicht gerade verliefen, sondern halbmondförmig ausgebuchtet waren. Die durch sie bewirkte Hebung des Wasserspiegels betrug etwa 30 cm. Beschädigungen durch Menschenhand an den Biberdämmen werden von den Tieren sehr rasch wieder ausgebessert. Bei dem abgebildeten Damm z. B. hatten Fischer ein großes Loch hineingerissen, um mit ihrem Kahn hindurchfahren zu können, aber schon am nächsten Morgen war die Lücke aufs gründlichste wieder verschlossen. Endlich schafft sich der Biber, der ja viel lieber und sicherer schwimmt als geht, auch noch besondere Schwimmkanäle, wenn das Gelände zu sehr versumpft, indem er die Rinnen durch fortgesetzte Benützung vertieft, auch wohl durch Herausheben von Schlammerde mit den Pfoten nachhilft.
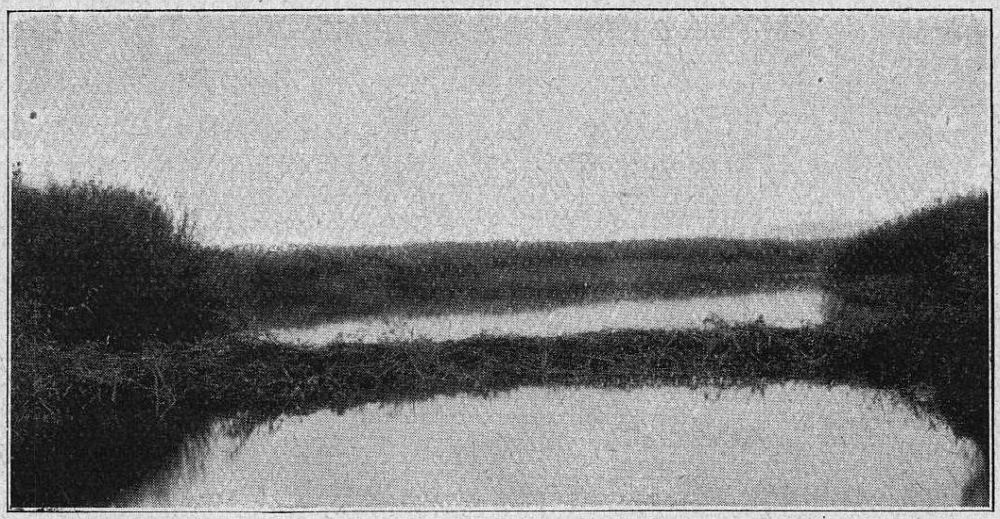
(Naturaufnahme von Amtmann Beyr)
Die gewöhnliche Zahl der Jungen beträgt vier, entsprechend den vier Zitzen des Muttertieres; drei oder gar nur zwei Junge[S. 27] kommen öfters vor, während mir ein Wurf von fünf Jungen nur in einem einzigen Fall bekannt geworden ist. Amtmann Behr hatte einmal das große Glück, Jungbiber im Bau zu beobachten. Er schreibt mir darüber: »Im Juni 1908 war Hochwasser eingetreten und hatte die Biber aus der Saale ins Binnenland getrieben. Da bekam ich von Patretz Drahtnachricht, es sei ein Biberbau mit Jungen gefunden. Schnell wurde der Photoapparat und ein halbes Schock Kassetten gepackt, und fort ging's, dem Ziele zu. Es herrschte glühende Hitze, und die Tierwelt schien wie ausgestorben. Nur Tausende und aber Tausende von Mücken und Stechfliegen erhoben sich aus den üppigen Wiesen, Weidenbüschen und Sumpflachen. Endlich zeigte mein Führer lautlos nach einer Kopfweide, die an einem mit hohen Ufern versehenen Bächlein stand. Ich kroch lautlos durch ein Weizenstück, das teilweise unter Wasser stand. Vorsichtig hob ich dann den ausgestreckten Kopf, auf dem bereits unzählige Mücken und Stechfliegen Platz genommen hatten. Da bot sich mir ein unvergeßlicher Anblick: eine starke Bibermutter mit vier Jungen lag am jenseitigen Grabenufer in einer Erdhöhle unter Weidengestrüpp, Rohr und schilfartigem Gras! Offenbar handelte es sich hier um einen Notbau, denn es war lediglich eine kesselförmige Vertiefung unter dem dichten Weidenstrauch. Die Jungen erkletterten den Rücken der Alten, purzelten wieder herunter und ließen ein lautes Fauchen hören. Auch die Alte wälzte sich öfters herum, geplagt durch unzählige Fliegen, und hatte offenbar keine Ahnung von meiner Gegenwart. Leider war die Beleuchtung in der Höhle so schlecht und die Unruhe in der[S. 28] Familie so groß, daß nur Momentaufnahmen gemacht werden konnten, die zur Reproduktion nicht scharf genug sind, aber immerhin wertvolle Natururkunden bilden. Als mein Begleiter näher kam, erhob sich langsam die Mutter, um gleich darauf blitzschnell im Wasser zu verschwinden. Ein undeutlicher Strich zeigt auf der Aufnahme den Weg an, den sie genommen, und einige Luftbläschen stiegen aus dem ruhig dahinfließenden Wasser empor. Schließlich stieg ich zu den Jungen hinüber und gewahrte nun erst, daß zwei davon verendet und mit Schmeißfliegen bedeckt am Rande der backofenförmigen Vertiefung lagen, während die beiden Überlebenden den Eindringling mit ihren kleinen blauen Augen erstaunt ansahen und fauchende Töne ausstießen. Schnell wurden einige Aufnahmen mit der Handkamera gemacht, und zurück ging's auf den alten Platz. Immer noch ließ sich die Alte nicht sehen. Da kam der eine Jungbiber auf den Ausstieg der Mutter und fuhr gleichfalls zu Wasser, wohin ihm der andere sofort folgte. Nun konnte auch ich nach 3-½stündiger Arbeit, die eine große Reihe von Aufnahmen geliefert hatte, den Heimweg wieder antreten, voller Holzläuse und anderem Ungeziefer, gründlich von den Mücken zerstochen, zu Tode erschöpft, aber von dem Gedanken beseligt, der Wissenschaft einen Dienst erwiesen zu haben.«
Wie unheimlich rasch die Abnahme der Biber an manchen Örtlichkeiten vor sich geht, erhellt aus einer Zuschrift des Herrn Winkelmann, der beispielsweise an einer langgestreckten Wasserlache, die zwischen Fährbuhne und Badeanstalt bei Aaken sich hinzieht und nach dem Walde zu Steilufer hat, im Jahre 1915 noch zwölf Baue zählte. »Jetzt sind diese Baue sämtlich verlassen, die Biber teils von Wilddieben gefangen, teils ausgewandert. Wenn man in Aaken Sonntags die Kirchgänger mustert, kann man oft Leute in Biberpelzen sehen, womit man die einfachste Erklärung für das Verschwinden der Biber vor sich hat. Jetzt haben die Kürschner in Köthen und Dessau strenge Anweisung, Überbringer von frischen Biberpelzen festzustellen und zur Anzeige zu bringen.« Diese Bestimmung ist sehr wichtig und erfreulich, sie müßte aber vor allem noch durch eine scharfe Beaufsichtigung der wandernden Fellhändler ergänzt werden. Auch die Kürschner, die frische Biberfelle aufkaufen, müßten als Hehler bestraft werden, denn sie wissen ganz genau, daß solche Felle nicht rechtmäßig erworben sein können. Noch ist es nicht zu spät, einschneidende Maßregeln für die dauernde Erhaltung unseres letzten, hartbedrängten Biberstandes zu treffen, aber es ist höchste, ja allerhöchste[S. 29] Zeit! Neuerdings hat sich namentlich Herr Zehle, der sich als Maler und Bildhauer die künstlerische Darstellung des Bibers zur besonderen Aufgabe gemacht hat, in Wort und Schrift des Bibers warmherzig und nachdrücklich angenommen, und es wäre nur dringend zu wünschen, daß seine hauptsächlich in den Jagdzeitungen erscheinenden Aufrufe nicht ungehört verhallen. Er fordert vor allem eine entsprechende Vermehrung der Aufsichtsbeamten, und da die wenigen, überdies sonst stark in Anspruch genommenen Forstleute für den Biberschutz nicht ausreichen, solle man dazu in passender Weise auch die Fährmeister heranziehen, vielleicht auch geeignete Privatpersonen. Für die Abfassung oder Ermittlung von Lumpen, die den Bibern nachstellen oder ihre Baue und Burgen zerstören, müßten Geldbelohnungen öffentlich ausgeschrieben werden. Die Strafen wären so scharf als möglich zu fassen. Mit Unkenntnis kann sich niemand entschuldigen, denn im Bibergebiet weiß jeder Mensch, wie der Biber aussieht und daß er gesetzlich geschützt ist. Weiter müßten die Weiden erhalten oder neu angepflanzt werden. In dieser Beziehung wird noch viel gesündigt. Man nimmt dem Biber seine natürliche Äsung und schreit dann Zeter und Mordio, wenn er aus Not und Hunger bei den angepflanzten Nutzhölzern Ersatz sucht. Bei Bemessung der Pachtpreise für die Weidengehege sollte eben von vornherein auf den unvermeidlichen Biberschaden Rücksicht genommen werden. Die Weidenpächter wären streng zu verpflichten, die Biber in Ruhe zu lassen und insbesondere keine Biberburgen abzubrennen, wie sie dies gerne tun. Ähnliches gilt für die Fischereipächter. Am besten würde man die Fischwässer im Bibergebiet überhaupt nur an Forstbeamte verpachten, die dann keine Stellnetze und Flügelreusen verwenden und in unmittelbarer Nähe der Biberbaue gar nicht fischen dürften. Wichtig wäre es auch, den Jägern das Auslegen von Tellereisen für Fischottern zu verbieten und bei Hochwasser Zufluchtstätten für die Biber zu errichten.
Herr Zehle ruft zur Gründung eines Biberschutz-Vereins nach Art des Wisentschutz-Vereins auf, und wir wollen nur hoffen und wünschen, daß er damit Erfolg hat. Er ist der Meinung, daß bei nachdrücklicher Durchführung der Schutz- und Hegemaßnahmen der Elbebiber seinen jetzigen Bestand nicht nur wahren, sondern auch mehren und sein Verbreitungsgebiet weiter ausdehnen würde, so daß er im Laufe der Zeit wieder als wertvolles Jagdwild in Betracht kommen könnte, zumal er sich von der Elbe aus auch leicht wieder in der Romintener Heide, im Zehlau-Bruch und an anderen geeigneten[S. 30] Orten einbürgern ließe. Ich selbst denke allerdings nicht so optimistisch, sondern glaube, daß alle Ausdehnungsversuche an der leidigen Habsucht der heutigen Menschheit scheitern werden. Immerhin wird sich der Biber bei genügendem Schutz an der Elbe wohl noch einige Jahrzehnte halten, aber es wäre angezeigt, auch für die Zukunft und damit für eine dauernde Erhaltung vorzusorgen. Mit vollem Recht ist deshalb schon der Vorschlag gemacht worden, einige Biber einzufangen und auf den Besitzungen des »Vereins Naturschutzpark« in der Lüneburger Heide anzusiedeln.
Ob man den Nerz, dieses merkwürdige Zwischenglied zwischen Fischotter und Marder, heute wohl überhaupt noch in einem Verzeichnis deutscher Säugetiere mit aufführen darf? Es gibt viele Tierkundige, die diese Frage verneinen. Unser Jagdgesetz ist anderer Ansicht, denn es nennt den Nerz immer noch in der Liste der jagdbaren Tiere. Ich selbst kann mir auch nicht gut denken, daß der Schwimmarder, wie man ihn treffend nennen könnte, bei uns schon gänzlich ausgestorben sein soll, denn trotz aller öden Gleichmacherei der Natur durch die sog. Kultur gibt es doch im ostpreußischen Memeldelta und an den Masurischen Seen, an den verschilften Teichen der schlesischen Bartschniederung, an den brandenburgischen Luchen und beim mecklenburgischen Großgrundbesitz noch verschwiegene Winkel genug, die allen Anforderungen dieses Seltlings durchaus entsprechen und wo immer noch das eine oder andere Pärchen unbeachtet oder unerkannt sein Dasein fristen mag. Allerdings war der Nerz (Abbildung 11) von jeher ein nordöstliches Tier und als solches in Süddeutschland wohl überhaupt nie heimisch, wenigstens nicht in geschichtlicher Zeit, auch in Norddeutschland nie eigentlich häufig, sondern immer nur in einzelnen Gegenden, gewissermaßen in versprengten Stämmen vorhanden. Schon Wildungen klagt 1799, daß der Nerz so selten und manchem wackeren Weidmann überhaupt unbekannt sei. Vor allem muß betont werden, daß der Nerz wegen seiner ausgesprochenen Menschenscheu und seiner streng nächtlichen Lebensweise an seinen versteckten und schwer zugänglichen Aufenthaltsorten überaus schwer zu beobachten ist und von Unkundigen gewöhnlich mit dem Iltis oder mit einem jungen Fischotter verwechselt wird. Sein[S. 31] sumpfiges Wohngebiet ist oft so unzugänglich, daß es überhaupt nur im Winter bei Frost betreten werden kann.
Dann eine Frage: Wie viele Jäger oder Naturforscher gibt es denn in ganz Deutschland, die imstande sind, bei fahlem Mondschein das undeutliche Etwas auf der Wasserfläche richtig als das Köpfchen eines schwimmenden Nerzes anzusprechen? Nur höchst selten fügt es einmal der Zufall, daß ein Nerz von scharfen Teckeln oder Foxterriers aus dem Wurzelgeflecht am Steilhang eines Baches oder Teiches aufgestöbert wird, aber der Herr des Hundes hält dann, selbst wenn er den grünen Rock trägt, also eigentlich in der heimischen Tierwelt gründlich Bescheid wissen sollte, das herausgejagte flinke Tierchen in der Regel für einen Iltis und wundert sich höchstens darüber, daß dieser »Iltis« so gut schwimmen und auch ebenso gut tauchen kann.
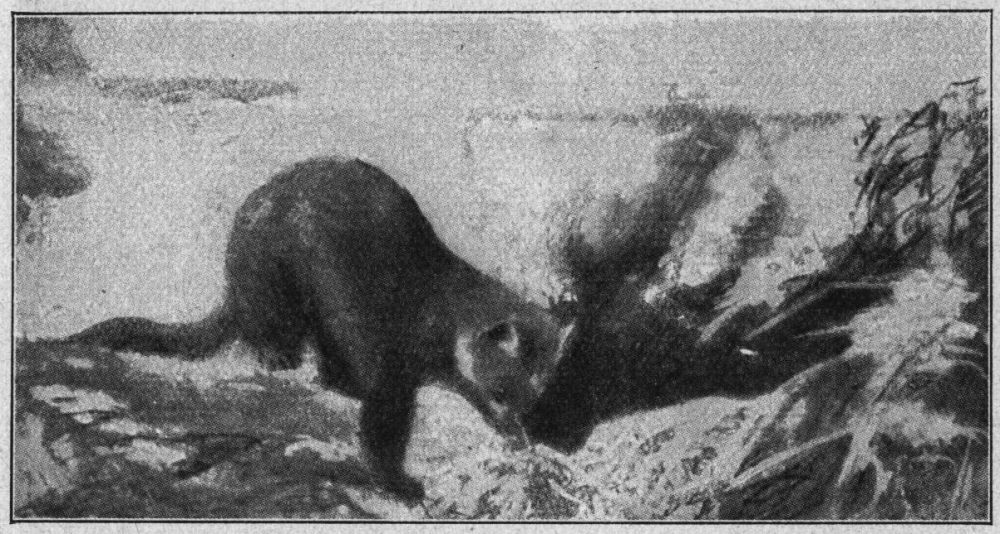
(Nach einer von der Deutschen Versuchszüchterei edler Pelztiere G. m. b. H. & Co., Leipzig zur Verfügung gestellten photographischen Aufnahme)
Selbst die sorgfältigste Untersuchung der Fährte gibt keine volle Sicherheit, da die kurze, charakteristische Schwimmhaut zwischen den Zehen des Nerz bei gewöhnlicher Gangart selbst in weichem Boden sich nicht mit abdrückt. Und doch sind beide Tiere für den aufmerksamen Beobachter kaum zu verwechseln. Flüchtet das aufgescheuchte Geschöpf sofort ins Wasser und taucht es hier gar anhaltend,[S. 32] so handelt es sich sicher um den Nerz, denn der Iltis ist durchaus kein Freund der Nässe, sondern entfleucht stets aufs feste Land und sucht hier womöglich einen erhöhten Standpunkt zu gewinnen. Ich trete der Auffassung Schlotfelds bei, wenn er z. B. sagt: »Unsere hannoverschen Bültenmoore, der Schrecken und andrerseits wieder die Freude der Jäger, sind nur unter den größten Anstrengungen zu bejagen und oft lange Zeit hindurch ganz unzugänglich. Hier herrscht absolute Ruhe, und mancher Nerz mag hier noch in aller Beschaulichkeit hausen, von dessen Vorhandensein kein Mensch eine Ahnung hat.« Auch Ziegler schrieb schon 1848, daß der Nerz sicherlich viel häufiger sei, als man allgemein glaube.
Die Gegend von Bremen war oder ist der westlichste Verbreitungspunkt des Nerz, und von hier aus erstreckt sich sein Gebiet durch die baltischen Länder nach dem nördlichen und mittleren Rußland, während er z. B. in der Krim fehlt, ebenso wie seine Lieblingsnahrung, die Krebse. Noch häufiger wird der Nerz in Sibirien, China und Japan, in welchen Ländern eigene geographische Rassen sich herausgebildet haben, wogegen der nordamerikanische Nerz, der sog. Mink, eine besondere Art vorzustellen scheint. Um die Jahrhundertwende herum kamen jährlich etwa 370000 Minkfelle gegenüber 55000 meist sibirischen Nerzfellen in den Handel. Da also der Mink noch viel häufiger ist, sind wir auch über seine Lebensweise ungleich besser unterrichtet als über die des echten Nerz, von der wir eigentlich verblüffend wenig wissen. Die Kenntnis seiner Fortpflanzungsgeschichte z. B. beschränkt sich fast nur auf Vermutungen, und es wäre dringend zu wünschen, diese beschämende Lücke auszufüllen, ehe es dazu durch völliges Aussterben des Tieres zu spät wird. Hoffentlich bewahrheitet sich aber auch beim Nerz das alte Sprichwort, daß die Totgesagten noch recht lange leben. Ihm vor allen sollte auch in den großen Naturschutzparken eine letzte Zufluchtstätte gewährt werden. Schon in Livland kommt er noch regelmäßig vor, wenn auch sehr selten; immerhin wird alljährlich hier und da einer geschossen, namentlich in den östlichen und nördlichen Landesteilen, wo nach Mitteilung des Barons von Loewis Händler immer noch eine Anzahl Felle von den unwissenden Bauern als Iltisfelle aufkaufen. Ende März 1905 ging ein dortiger Oberförster aus dem Walde heimwärts, als seine Teckel bei einem Bruch und einer Holzbrücke unruhig wurden und hitzig verbellten. Herausgestöbert wurde ein starker männlicher Nerz und glücklich erlegt. Trotzdem arbeiteten die Hunde weiter fort, und bald darauf kam schwimmend im Wasser[S. 33] ein zweiter Nerz zum Vorschein, der leider angeschossen verloren ging. In Siebenbürgen soll der Nerz heute auf einen winzigen Platz im sumpfigen Maroschtale beschränkt sein; Skelettfunde beweisen aber, daß er früher in diesem Lande viel weiter verbreitet war. Für Schlesien wird der Nerz noch von Gloger angeführt, der aber bereits darüber klagt, daß das Tier überall da rasch verschwinde, wo Entwässerungsarbeiten vorgenommen werden. Auch Brehm kannte schlesische Nerze aus eigener Anschauung, und nach Schlotfeld erhielten die Schweidnitzer Kürschner noch in den 80er Jahren öfters Nerzfelle durch die Bauern, die sie für besonders dunkle Iltisse hielten. In der Provinz Posen wurde 1892 ein Nerz erlegt. Am hoffnungsvollsten lauten wieder einmal die Nachrichten aus dem tierreichen Ostpreußen. Hier führt Rathke 1846 den Nerz noch als sicheres Standwild auf, ohne allerdings selbst einen gesehen zu haben. Zwar entpuppte sich ein später in der Oberförsterei Johannisburg erlegter angeblicher Nerz bei näherer Untersuchung durch von Hippel als Iltis, aber doch liegen auch aus neuerer Zeit sichere Beweise seines Vorkommens vor. So erlegte Förster Gerhardt in Skirwieth (Kreis Heidekrug) am 6. August 1902 ein Stück, dessen Schädel dem Ostpreußischen Fischereiverein übergeben wurde und durch diesen in das Königsberger Museum gelangte. Endlich wurde am 3. April 1908 im Kreise Ortelsburg ein Nerz geschossen und an das Berliner Museum eingeliefert. Es ist dies meines Wissens der vorläufig letzte sichere Nerz, der auf deutschem Boden erbeutet wurde. Wenn seitdem auch aus Ostpreußen nichts mehr über Nerze verlautete, so ist dies bei der Unbekanntheit des Tieres und der großen Schwierigkeit seiner Beobachtung noch lange kein Beweis für sein völliges Ausgestorbensein.[A] In Pommern scheint es dagegen schon seit längerer Zeit tatsächlich keine Nerze mehr zu geben. Länger hat sich der Nerz im seenreichen Mecklenburg und im Lauenburgischen gehalten, wo er namentlich von Ludwigslust, Wismar und vom Müritzsee sowie aus der Umgebung von Lübeck öfters erwähnt wird. Diese Angaben reichen bis zum Jahre 1896, und es ist durchaus nicht ausgeschlossen,[S. 34] daß das Tier in einsamen Brüchen auch heute noch dort vorkommt, wenn auch nur als große Seltenheit. Besondere Verdienste um die Beobachtung der dortigen Nerze hat sich Förster Claudius erworben, der darüber eingehend an Brehm berichtete. Danach umfaßte das Verbreitungsgebiet bei Lübeck zwar nur wenige Quadratmeilen, aber in diesem war das Tier keineswegs besonders selten und jedem Jäger unter dem Namen Ottermenk bekannt. Sonst heißt er im Volksmunde auch noch Krebsotter, Steinhund, Schwimmarder, Wasserwiesel, Wassermenk und Sumpfotter — alles recht bezeichnende Namen —, während ihn baltische Jäger unter dem Namen Norke kennen. Claudius, der 1868 selbst ein lebendes Nerzweibchen fing und an Brehm schickte, während 1878 ein Jungnerz von einem scharfen Hühnerhund erwürgt wurde, traf das Tier namentlich an der Wagenitz, dem zwei Meilen langen Abfluß des Ratzeburger Sees in die Trave bei Lübeck. Hornung hält allerdings alle diese Angaben für veraltet und ist der Ansicht, daß der Nerz bald darauf dort völlig ausgestorben sei, aber dem steht entgegen, daß auch Schlotfeld im Hochsommer 1906 den Nerz im Wietzebruch antraf, einem früher durch die weit ausgelegten Geweihe seiner Rothirsche jagdlich berühmten Revier. Eine Verwechslung mit Iltis oder Fischotter hält er für ausgeschlossen, obwohl er nicht schießen konnte, da der aufgestöberte kleine Räuber sich mutig in die Lefzen seines Hundes verbissen hatte. Bei Plön wurden 1864 zwei Nerze gefangen, und es hat den Anschein, als ob sie damals im östlichen Holstein noch ziemlich verbreitet waren. Im Blockland von Bremen wurde in den 80er Jahren ein Nerz geschossen und gelangte in das Städtische Museum. Dies ist also der bisher westlichste Verbreitungspunkt, da angebliche Beobachtungen aus der Gegend von Emden nicht durch ein Belegstück erhärtet werden konnten. Nach Bechstein kam der Nerz Ende des 18. Jahrhunderts noch vereinzelt an der Leine bei Göttingen vor, Anfang des 19. Jahrhunderts wurde ein Stück an der Werra erlegt, 1852 nach Blasius eines im Harz in der Grafschaft Stolberg und 1858 eines an den Riddagshausener Teichen, also unmittelbar vor den Toren Braunschweigs. Vielleicht ist dieses Stück identisch mit dem Nerz, den Forstrat Hattich als 1859 im Forstgarten bei Braunschweig erlegt meldet. Gewisse Stellen der Lüneburger Heide scheinen noch bis in die neueste Zeit hinein Nerze beherbergt zu haben. Wenigstens meldet Merk-Buchberg aus anscheinend zuverlässiger Quelle, daß bei Wilsede kurz vor Erwerbung der dortigen Ländereien durch den »Verein Naturschutzpark«[S. 35] noch zwei Nerze geschossen worden seien. Diese auch mir mündlich von dortigen Anwohnern gemachte Mitteilung erscheint mir um so glaubwürdiger, als ich selbst bei meinem ersten Besuche dieser Gegend das seltene Glück hatte, einen vom Hunde aufgestöberten Nerz ins Wasser plumpsen und wegtauchen zu sehen. Es wäre herrlich, wenn gerade hier unter dem tatkräftigen Schutze des Vereins der Nerz auch heute noch lebte, was nicht unmöglich ist, obschon Nachrichten aus neuester Zeit fehlen. Außerdem bin ich in meinem ganzen Leben nur noch einmal flüchtig mit dem Seltling zusammengetroffen: es war anfangs der 90er Jahre auf dem ornithologisch berühmten Möwenbruch bei Rossitten auf der Kurischen Nehrung.
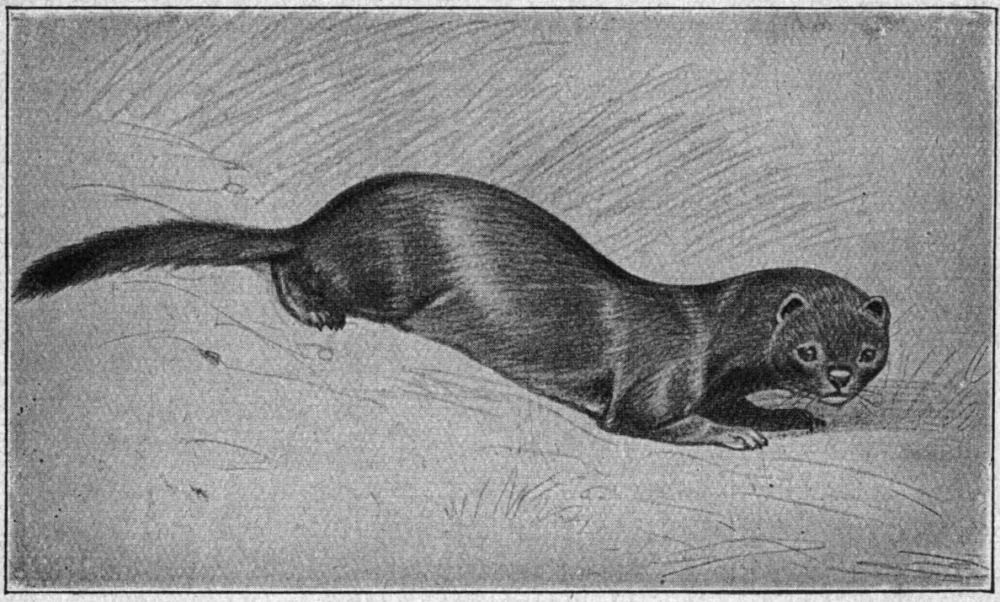
Bruchartige, verschilfte Teiche und Seen oder ganz langsam schleichende Flüsse und Kanäle mit von Baumwurzeln durchsetzten Ufern bilden den Lieblingsaufenthalt unseres Schwimmarders, der also kein Freund starker und reißender Strömungen ist. Je stiller, einsamer und unzugänglicher eine Gegend ist, desto angenehmer ist sie diesem menschenscheuen Sonderling. Hier ruht er tagsüber faul und verschlafen im Wurzelgeflecht der Uferbäume oder in einer Baumhöhlung oder auf einem geköpften Weidenstumpf oder auch nur im hohen Riedgras und zieht erst nach Sonnenuntergang still und verschwiegen auf Beute aus, und es ist dann natürlich ungeheuer schwer, im Dunkel der Nacht und im unzugänglichen Sumpfe[S. 36] das lautlos herumhuschende, schlanke Tierchen zu erkennen. Nach den sorgsamen Beobachtungen von Claudius schleicht es mehr als es läuft (Abb. 12), gleitet rasch und behende über alle Unebenheiten hinweg, hält sich aber stets auf dem Boden und strebt nicht nach der Höhe. Das sehr klug aussehende Köpfchen hält dabei nicht einen Augenblick still, die scharfen Seher durchmustern ohne Unterlaß die Umgebung, und die kleinen Lauscher spitzen sich so weit als möglich, damit ihnen nur ja kein Geräusch entgehe. Meist wird beim Laufen der Rücken mehr oder minder gekrümmt, und kein noch so verborgenes Winkelchen bleibt undurchschnüffelt. Das Klettervermögen ist nur mäßig, aber dafür zeigt sich der Nerz als ein tüchtiger Schwimmer und versteht es, sehr gewandt und anhaltend zu tauchen. Er besitzt alle Gewandtheit der Marder, aber nicht ihre Kletterfähigkeit und Rastlosigkeit. Beim Schwimmen rudert er nicht abwechselnd mit den Beinen, sondern schnellt sich stoßweise fort, und zwar mit überraschender Geschwindigkeit. Im Winter sah ihn Claudius bisweilen an den Aussteigstellen auf dem Eise sitzen, fast unkenntlich vor Schlamm. Im übrigen stellt das ganze Wesen des Nerz ein sonderbares Gemisch von Marder und Fischotter vor. Mit beiden hat er Schlauheit, Raubgier und Blutdurst gemeinsam. Unter den Sinnen dürften Geruch und Gesicht obenan stehen. Der häßliche Gestank, den die Marder- und Iltisarten ausströmen, fehlt dem Nerz völlig, denn er ist fast geruchlos.
Krebse bilden seine Lieblingsspeise. Außerdem jagt er noch Fische, Frösche, Molche und größere Wasserinsekten, raubt die Nester der Wasservögel aus und würgt auch wohl junge Enten und Gänse ab. Mäuse und Kleinvögel werden gleichfalls gern genommen. Bisweilen bricht er auch in die Geflügelställe ein, aber doch nur auf einsamen Fischergehöften oder Förstereien, nicht aber in geschlossenen Siedlungen. Die Fischer an der Wagenitz haben nach Claudius die Gewohnheit, ihren täglichen Fang nicht in Behältern, sondern in offenen Weidekörben an Inselchen in der Nähe ihrer Hütten aufzubewahren, und solchen Stellen stattet der Nerz gern unerwünschte Besuche ab, wobei er sich namentlich dadurch unbeliebt macht, daß er lieber die oft daumendicken Weidenruten durchbeißt, als daß er über den Rand des offenen Korbes klettert. Brehms gekäfigter Nerz verschmähte auffallenderweise hartnäckig die ihm vorgelegten Hühnereier, aber ich glaube trotzdem nicht, daß er in freier Natur den Gelegen der Wasservögel gegenüber gleichgültig bleibt. Die Krebse haben jedenfalls mit dem Aussterben des Nerz einen Hauptfeind[S. 37] verloren. Aber ob ihnen dadurch nicht auch der naturgemäße Bestandsregler genommen und den verheerenden Krebsseuchen Tür und Tor geöffnet wurde? Umgekehrt könnte man auch daran denken, daß die reißende Abnahme der bei uns ihrer unzugänglichen Wohnorte halber eigentlich doch nur wenig verfolgten Nerze mit dem Verschwinden ihrer Lieblingsnahrung zusammenhängt? Was bisher über die Fortpflanzungsgeschichte des Nerz veröffentlicht wurde, beruht größtenteils eigentlich nur auf Vermutungen, denn nur ganz ausnahmsweise hat man einmal Junge unter Baumwurzeln oder auf einer trockenen Kaupe im Sumpfe gefunden. Sie sollen im April oder Mai blind geboren werden, während die Rollzeit in den Februar oder März fällt. Die Jagd auf den Nerz, dessen schönes Pelzwerk mit Recht großer Beliebtheit sich erfreut, ist für Mitteleuropa reine Zufallssache. Nur höchst selten kommt oder kam einmal einer bei der Birkhahnbalz oder auf der Entenjagd zu Schuß. Leichter läßt sich der mißtrauische Seltling durch Fallen berücken, selbst durch solche einfachster Art. In der Gefangenschaft zeigt sich der Nerz nicht gerade von seiner liebenswürdigsten Seite, zumal er tagsüber entsetzlich verschlafen ist und selbst durch das Vorhalten der schönsten Leckerbissen sich nicht zum Aufstehen bewegen läßt. Ohne sich boshaft oder bissig zu zeigen, lehnt er doch jedes nähere Verhältnis zum Menschen hartnäckig ab und wird niemals wirklich zahm. — Das ist so ziemlich alles, was wir über die Naturgeschichte dieses in mehrfacher Beziehung hochinteressanten Tieres wissen, und es ist eigentlich geradezu beschämend wenig. Hier sind noch große Lücken auszufüllen!
[A] Eben erfahre ich — beim Lesen der Korrektur —, daß Kürschnermeister Götz in Elbing Anfang April 1926 ein ganz frisch abgezogenes Nerzfell erhielt und ausstopfte. Das Tier war in der nächsten Umgebung von Elbing im Eisen gefangen worden und soll an den vorhergehenden Tagen mehrere Hühner geraubt haben. Vor zwei Jahren soll ein Landwirt in der gleichen Gegend ebenfalls einen Nerz in der Falle gefangen haben, und die Richtigkeit der Bestimmung wurde von wissenschaftlicher Seite bestätigt. Es gibt also noch deutsche Nerze!
Es kann einigermaßen fraglich erscheinen, ob man den Luchs in einem Verzeichnis deutscher Tiere überhaupt noch mit aufführen darf. Standwild ist diese menschenscheue und listige Großkatze bei uns ja schon seit Menschengedenken nicht mehr, aber immerhin wechselt doch noch ab und zu ein Stück über die Grenzen und wird dann auf deutschem Boden erlegt, namentlich in Ostpreußen, so daß wir den Luchs auch für Deutschland noch nicht gänzlich und endgültig aus dem Buche der Lebenden zu streichen brauchen. Vor dem Dreißigjährigen Kriege war das prachtvolle Tier in unserem Vaterlande durchaus keine seltene Erscheinung, wie schon daraus hervorgeht,[S. 38] daß allein im Albertinischen Sachsen von 1611 bis 1665 305 Luchse erlegt werden konnten. In der Götterlehre der alten Germanen spielte der Luchs eine beträchtliche Rolle, und wahrscheinlich ist er es und nicht die Katze, der als Tier der Freia aufgefaßt werden muß und ihren Wagen zieht. Bei den großartigen Zirkusspielen der Römer wurden allerdings Luchse ungleich seltener vorgeführt als Löwen oder Leoparden, aber dies ist wohl dadurch zu erklären, daß der Luchs nicht leicht zu fangen ist und sich in der Gefangenschaft schlecht hält. Die Verdrängung des Tieres aus Mitteleuropa muß hauptsächlich in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts erfolgt sein und ist in der Hauptsache wohl auf die gleichzeitige große Vervollkommnung der Schußwaffen zurückzuführen. Das Vernichtungswerk ging deshalb mit überraschender Schnelligkeit vor sich, und schon etwa 1710 war das Verbreitungsgebiet des Luchses derart durchlöchert, daß überall nur noch von vereinzeltem Vorkommen die Rede sein kann. In den flachen Teilen Mitteldeutschlands fehlt der Luchs bereits von 1820 an völlig. Am 17. März 1818 wurde noch einer bei Seesen erlegt, der jetzt ausgestopft im Braunschweiger Museum steht. Spätere Nachrichten sind irrtümlich, so über ein angebliches Vorkommen im März 1898 in Anhalt, wo es sich in Wirklichkeit um verwilderte Hunde handelte. In Pommern wurde der Luchs schon 1738 ausgerottet, und im allgemeinen war er wohl schon beim Tode Friedrichs des Großen nicht mehr Standwild in den preußischen Staaten, während für diese in den Jahren 1723 bis 1737 immerhin noch 229 erlegte Luchse verzeichnet wurden. König Friedrich Wilhelm I. legte großen Wert auf die pünktliche Einlieferung aller Luchs- und Biberfelle. »Die Lux Heutte will vor mir haben,« verordnete er. Nur einmal (1720) wollte ein Hauptmann von Driessen einen von ihm geschossenen Luchs durchaus nicht herausrücken und erhielt ihn schließlich auch wirklich zum Geschenk, denn für seine »blauen Kinder« hatte der »Soldatenkönig« ja immer etwas übrig. Bei Potsdam war der Luchs 1680 noch häufig, 1696 gab es noch welche bei Ruppin, 1702 bei Luckenwalde, 1734 bei Liebenwalde, und zwischen 1750 und 1760 wurden noch einige bei Gardelegen zur Strecke gebracht. Sehr auffällig ist es, daß sogar 1875 ein Luchs auf der Insel Wollin erschossen wurde, der aber vielleicht einer Menagerie entsprungen war. In Westfalen fiel der letzte Luchs 1745.
Ganz ähnlich liegen die Verhältnisse in Sachsen, wo in den Schußlisten des prunkliebenden Kurfürsten Johann Georg II. (1656[S. 39] bis 1680) auch noch 191 Luchse aufgeführt werden. Damals hatte ja das Raubzeug noch gute Tage, denn der gewaltige Wildstand deckte ihm reichlich den Tisch, und auch Haustiere waren leicht zu ergattern, da sich das Vieh den größten Teil des Jahres über auf freier Weide erging und die Stallfütterung noch wenig üblich war. Zwar reizte gerade der Luchs die Jagdlust des Menschen von jeher in besonderem Maße, teils seiner großen Schädlichkeit, teils seines hochgeschätzten Pelzes halber, aber seine Schlauheit und Gewandtheit sowie die Unvollkommenheit der damaligen Jagdwaffen brachten es doch mit sich, daß er sich der Vernichtung lange zu entziehen vermochte und noch um 1700 herum in allen Teilen des Landes regelmäßig anzutreffen war. Erst als im 18. Jahrhundert die steigende Volksvermehrung eine stärkere Ausnutzung von Grund und Boden bedingte, als Axt und Säge auch in die tiefsten Wälder und in die verstecktesten Schluchten eindrangen und zugleich die verbesserten Feuerwaffen zur vollen Auswirkung gelangten, schlug auch dem Luchs gleich Wolf und Bär die Todesstunde. Zwar wird der Luchs noch 1717 unter den jagdbaren Tieren Sachsens angeführt, aber er muß damals doch schon recht selten gewesen sein, da man es nach Robert Berger der Mühe für wert hielt, einen bei Zittau geschossenen Luchs abmalen zu lassen und das Bild der dortigen Ratsbücherei einzuverleiben. Im Elbsandsteingebirge erlegte Förster Puttrich unweit der böhmischen Grenze 1743 einen Luchs, und man verewigte dieses Ereignis dadurch, daß an der betreffenden Stelle ein Luchsbild nebst erklärender Unterschrift in die Felswand eingehauen wurde. Einzelne Überläufer mögen auch noch später die sächsische Grenze überschritten haben, da der Luchs im benachbarten Böhmen sowie im Thüringer Wald und im Harz erst im 19. Jahrhundert ausgerottet wurde. Im Fichtelgebirge wird der letzte Luchs dagegen schon 1774 verzeichnet, im Frankenwald 1730. Im Thüringer Wald und im Harz erfolgte die Ausrottung dieser dem Wildstand so gefährlichen Katzenart fast gleichzeitig. Für den Harz werden 1814, 1816, 1817 und 1818 als letzte Erlegungsdaten angegeben, für den Thüringer Wald 1819 und 1820; dann folgt aber nach langer Pause noch ein Nachzügler, der 1842 im Gothaischen zur Strecke gelangte. Der letzte Harzluchs, den man schon seit 1814 gespürt, aber irrtümlicherweise für einen Wolf gehalten hatte, befindet sich heute ausgestopft in der gräflich Stolbergschen Bücherei in Wernigerode. Allerdings soll nach Forstmeister von Seelen noch 1911 und nach anderen Quellen sogar noch 1917 ein Luchs im Harz geschossen[S. 40] bezüglich gesehen worden sein, indessen vermochte ich diese sehr unwahrscheinlich klingenden Angaben nicht näher nachzuprüfen.
In der Oberpfalz wurde noch 1814 ein Luchs von 65 Pfund geschossen, während im Elsaß der letzte schon im Dezember 1640 erlegt worden sein soll. In Baden kam der letzte Luchs 1834 bei Wertheim auf der Halde eines alten Steinbruchs durch einen Förster zur Strecke. Noch länger hielt sich der Luchs in Württemberg, denn nach einem ausführlichen Bericht des Herrn Dr. Metzger traf der Förster Martz am 15. Februar 1846 von der Ruine Reußenstein bei Wiesensteig unweit Geislingen aus mit sicherer Kugel ein schwaches Männchen. Das Raubtier hatte schon seit längerer Zeit den Schafherden und dem Rehbestand der dortigen Gegend übel mitgespielt, war aber auf allen Treibjagden immer glücklich durchgekommen. Ein die Erlegung darstellendes Ölbild befindet sich noch im Besitz der Familie Metzger in Stuttgart, und eine Kopie davon wurde neuerdings auch im Rathause zu Wiesensteig aufgehängt. Der tote Luchs wurde auf einem Wagen nach Stuttgart gefahren und unterwegs überall von der Schuljugend bestaunt; er steht jetzt ausgestopft in der Stuttgarter Naturaliensammlung als der Letzte seines Geschlechts. Allerdings meldeten im Dezember 1922 die Stuttgarter Tageszeitungen, daß auf einer Treibjagd im Schwarzwald (Oberamt Villingen) wieder ein Luchs von 1,3 m Länge geschossen worden sei. Meine sofortige briefliche Anfrage beim Jagdpächter blieb aber bezeichnenderweise unbeantwortet; auch über den Verbleib des wertvollen Stückes habe ich niemals das Geringste gehört, und so wird dieser allerletzte Schwarzwald-Luchs wohl eine Ente gewesen sein. Was Bayern anbelangt, so konnten nach Brehm zwei Jäger, Vater und Sohn, in den Jahren 1790 bis 1838 immerhin noch 30 Stück der gehaßten Raubtiere im Eisen fangen. Dann aber ging es schnell bergab mit dem Luchsbestand. 1832 wurden im Revier Immenstadt noch drei Luchse geschossen, aber schon anderthalb Jahre später der letzte dort gefangen. Ähnlich war es im Revier Marquartstein, wo 1830 noch vier Luchse zur Strecke kamen, darunter ein sehr altes Männchen von 67 Pfund, das keinen ganzen Zahn mehr besaß. Bei Berchtesgaden war der Luchs im Beginn des 19. Jahrhunderts noch Standwild, und 1826 werden sieben erlegte Stücke gemeldet, seitdem aber keiner mehr. Etwas länger hielt sich der Luchs im Retterschwanger Tal, wo 1838 der letzte gestreckt wurde. Langkovel erzählt, daß über der niedrigen Tür des Forsthauses im Hindelanger Tal zwölf Luchsköpfe hingen als Jagdtrophäen der dort seit langem[S. 41] ansässigen Försterfamilie. Einer dieser Luchse war 1830 auf der Zipfelalp geschossen worden, zwei andere 1850 und der letzte am 25. Mai 1872 bei Partenkirchen. Auch im bayrischen Allgäu sollen noch 1850 Luchse gespürt worden sein, kamen aber nicht zum Schuß. Als der letzte bayrische Luchs darf wohl der 1888 bei Rot am See erlegte gelten, der wahrscheinlich aus dem Österreichischen eingewechselt war. Im Bregenzer Wald ging es mit dem Luchs 1855 zu Ende, in Tirol 1872, wo am 3. Mai ein Stück bei Stauders angeschossen, aber erst eine Woche später verludert aufgefunden und für die Gymnasialsammlung in Chur ausgestopft wurde; trotz seiner tödlichen Verwundung hatte dieser Luchs noch einen Hasen gerissen. Im gleichen Jahre wurde auf dem Friedhof in Schlanders ein angeblicher Wolf erschlagen, dessen zur Einlösung des Schußgeldes eingeschickte Vorderpfoten sich aber als solche vom Luchs erwiesen. Früher war gerade in Tirol und Vorarlberg der Luchs das verhältnismäßig häufigste Raubtier, und die Bauern im Bregenzer Wald erzählen sich noch heute mit Schaudern davon, daß durch ihn einmal eine ganze Schafherde von 600 Stück in einen Abgrund gejagt wurde, wodurch der Besitzer völlig verarmte. Im Stubachtal, wo heute der Naturschutzpark sich befindet, taten die Luchse noch um die Mitte des vorigen Jahrhunderts großen Schaden am Wild. In Steiermark war der Luchs von jeher häufiger als Bär oder Wolf, und die Nachrichten über ihn reichen bis zum Ausgang des 19. Jahrhunderts. In Sulzbach wurden in einem Jahre 90 Schafe von ihm zerrissen, in Weißwasser an einem Tage 9. Bei Völkermarkt und bei Windischgrätz wurden 1887 noch Luchse gespürt und 1892 sogar einer geschossen. In Krain tritt der Luchs heute noch regelmäßig, wenn auch selten, auf, und in Kärnten wenigstens ab und zu, soweit dort noch schwer zugängliche, aber wildreiche Waldungen mit ausgedehnten Dichtungen vorhanden sind. In der Schweiz waren noch um 1838 herum Luchse keine besondere Seltenheit, so daß allein in Graubünden jährlich 7-8 zur Ablieferung gelangten, aber schon 1850 beschränkte sich die Gesamtstrecke der ganzen Schweiz auf die gleiche Zahl. Möglich, daß auch heute noch dieser oder jener Luchs versteckt in den Einöden des Berner Oberlandes oder im Gebiete der alten Rätier lebt, aber erlegt worden ist seit 1878 keiner mehr. Zwar werden diesbezügliche Fälle noch 1887 aus Wallis und Graubünden gemeldet, aber sie erscheinen nicht genügend beglaubigt und sonderbarerweise ist das hohe Schußgeld von 100 Franken nicht für sie in Anspruch genommen worden. Glaubwürdigere Nachrichten liegen[S. 42] aus Oberösterreich vor, wo im November 1902 eine vierköpfige Luchsfamilie sich in den schluchtenreichen, düstern und wenig betretenen Waldungen an der Ybbs zeigte und in erschreckender Weise unter dem Wildstand wütete. Die Jägerei fand über 30 zerrissene Rehe, denen ausnahmslos in der für den Luchs so bezeichnenden Weise der Kopf vom Rumpfe getrennt war. Trotz eifriger Nachstellungen konnte man der Räuber nicht habhaft werden, die nach einiger Zeit spurlos wieder verschwanden, also offenbar nur eine Gastrolle gegeben haben.
Aus Italien habe ich sichere Daten über das Vorkommen des Luchses überhaupt nicht erhalten können. In Frankreich kam er früher namentlich am nördlichen Hange des Zentralplateaus vor, wo noch 1865 ein stattliches Exemplar im Departement Puy de Dôme erlegt wurde. Merkwürdig ist das rasche Verschwinden des Luchses aus Bosnien. Daß er früher dort keine Seltenheit war, beweisen eine Reihe von Ortsnamen, aber seine Ausrottung liegt doch schon lange zurück. Wie mir Othmar Reiser freundlichst mitteilte, wechselte anfangs der 90er Jahre ein Luchs aus Montenegro in den Bezirk Gacko ein, hielt sich dort aber nur kurze Zeit auf. Andere Stücke wurden in Montenegro selbst 1890 und 1894 bei Jagden des Fürsten Nikita erlegt. In Mazedonien und Arkadien gibt's noch jetzt Luchse. Dasselbe gilt für die Karpathen, wo unserem Räuber namentlich die Vermehrung des Rehstandes zustatten gekommen ist. In den oberungarischen Revieren des Zaren Ferdinand von Bulgarien bei Lentschau und Igelo wurden 1905 innerhalb eines Vierteljahres fünf Luchse abgeschossen, da sie großen Schaden am Edelwild taten. Aus ganz Ungarn wurden 1873 bis 1887 über 100 erlegte Luchse gemeldet, doch waren es in Wirklichkeit wohl erheblich mehr, da viele Fälle den Behörden überhaupt nicht angezeigt werden. Wurden doch nach sorgfältigerer Buchführung nur in den ungarischen Kronforsten von 1884 bis 1893 333 Luchse geschossen oder gefangen. Die meisten Vorkommnisse beziehen sich auf die nördlichen und nordöstlichen Teile des alten Ungarn. In den Beskiden ist unsere räuberische Großkatze auch heute noch ein regelmäßiges Standwild, ebenso in den wildesten Teilen der siebenbürgischen Randgebirge. Hier gelangen jährlich noch 6-8 Stück zum Abschuß, der aber gänzlich dem Zufall anheimgegeben ist. Selbst in der Umgebung von Hermannstadt und Kronstadt wurden in den 90er Jahren noch prachtvolle Luchse erlegt. Während des Krieges wurde ein Luchs im Rotenturmpaß von Pionieren aufgestöbert[S. 43] und erbeutet. Die Bukowina verzeichnet 1892 vier erlegte Luchse; also auch hier ist das Tier noch seltenes Standwild. Oberjäger Moser hat in seinem früheren Revier im Bezirk Watra und in seinem jetzigen im Bezirk Gurahumora im Laufe der Jahre je fünf Luchse im Eisen gefangen. Das ebene Ostgalizien hatte auffallenderweise im März 1895 fünf erlegte Luchse zu verzeichnen, und sogar auf der westgalizischen Herrschaft Saybusch wurde im Oktober des gleichen Jahres ein Exemplar mit wundervoller Zeichnung geschossen. Alle diese Luchse waren Männchen, und man darf sie wohl für Flüchtlinge aus den Mittelkarpathen halten, aus denen sie durch ungewöhnlich starke Abholzungen vertrieben worden waren. Nach einer Mitteilung von Rittmeister Schlickriede wurde während des Krieges auf einer kleinen Treibjagd in Wolhynien am 2. März 1916 ein Luchs von 1,4 m Länge auf 27 Schritt durch einen Schrotschuß zur Strecke gebracht. In Österr.-Schlesien hatte man schon lange nichts mehr von Luchsen gehört, bis sie sich in den 80er Jahren wieder spürten und dann auch 1889, 1891, 1893 und 1894 einzelne, aus dem Trentschiner Komitat eingewechselte Stücke in der Nähe der ungarischen Grenze unschädlich gemacht wurden, das letzte, ein Weibchen, 1914 bei Althammer. Auch in Böhmen und Mähren hielt sich der Luchs verhältnismäßig lange, denn noch 1890 wurde er im Böhmer Wald erlegt und im November 1894 ein Weibchen in Mähren, während das zugehörige Männchen entkam. In der Dukla-Senke wurden am 25. November 1893 zwei Luchse geschossen, während vier weitere entwischten, und einen Monat später fiel in derselben Gegend noch einer. In Slawonien soll es noch überall Luchse geben, aber nirgends häufig.
Innerhalb Deutschlands läßt sich der Luchs heutzutage am ehesten noch einmal in Ostpreußen blicken, freilich auch nur auf recht seltenen Gastspielreisen. Nachstehend das Verzeichnis der im letzten Jahrhundert in Ostpreußen geschossenen Luchse, so weit es sich heute noch mit Sicherheit feststellen läßt:
1. 1820 bei Gumbinnen.
2. 1832 in der Romintener Heide.
3. 1846 bei Gilgindischken (Museum Eberswalde).
4. 10. Februar 1861 ein Weibchen im Nassowener Forst, Kreis Goldap (Museum Eberswalde).
5. 1868 in der Puppener Forst (Museum Minden).
6. 1. September 1870 im Forst Heidwalde, Kreis Angerburg.
7. 20. Januar 1872 im Laukenwald, Kreis Mohrungen.
[S. 44]
8. 1873 bei Rastenburg. Nicht ganz sicher verbürgter Fall.
9. 25. Januar 1879 in der Puppener Forst.
10. März 1898 bei Seetz (?).
11. 25. November 1901 bei Schorellen (Museum Berlin).
12. 21. September 1915 ein Männchen bei Ortelsburg (Museum Oldenburg).
13.10. März 1924 im gräflich Eulenburgschen Forst Bettnarken ein schwaches Stück von 1,19 m Länge und 43 Pfund Gewicht. Hilfsförster Kaluza war der glückliche Schütze. Es dürfte dies der bisher letzte sichere Luchs sein, der auf deutschem Boden geschossen wurde.
In Westpreußen wurden die letzten beiden Luchse 1870 erlegt. In Kurland war der Luchs um 1830 herum derart verbreitet, daß er stellenweise den ganzen Rehstand vernichtete. Wie rasch dann aber seine Ausrottung vor sich ging, zeigen die Abschußlisten der großen Herrschaft Dodangen: im Winter 1844/45 17 Stück, 1845/46 12, 1846/47 7, 1847/48 5, 1848/49 4, 1849/50 2 und 1850/51 nur noch ein einziger. Nach Grevé wurde noch im Januar 1907 ein Luchs im Revier Schlüterhof geschossen und ein anderer in Poppen, nachdem beide schon den ganzen Sommer über gespürt worden waren. Auf der Insel Ösel soll der letzte Luchs 1877 erbeutet worden sein. Auch in Livland ist nach den Berichten des Herrn von Middendorf der Luchs jetzt schon sehr selten geworden. Im Kreise Dorpat wurde der letzte 1867 erlegt, und im September 1904 wurde wieder einer beobachtet. Im Rigaer Kreis zeigte sich der letzte 1900, und im Kreis Wenden wurde noch im Jahre 1911 einer erlegt. Eine selten erfolgreiche Luchsjagd fand Anfang November 1910 im Walkschen Kreise statt, wo an zwei Jagdtagen neun Luchse zur Strecke kamen. In Estland wurden noch im Winter 1908/09 mehrere Luchse erbeutet und andere gespürt. Einer sprang in der Nähe von Mecks über einen hohen Drahtzaun in den Damhirschpark und richtete dort greuliche Verwüstungen an, ohne daß er erwischt werden konnte. Zusammenfassend kann man über das Vorkommen des Luchses im Baltikum sagen, daß er für Kurland noch an den äußersten Punkten im Westen und Osten zu verzeichnen ist, in Livland in den Kreisen Walk, Wera und Dorpat, in den großen Forsten von Pernau und in den Strandwäldern des Rigaischen Meerbusens und endlich für die ganze östliche Hälfte Estlands. Nach dem Innern Rußlands zu wird er dann zahlreicher, und in Sibirien, von wo alljährlich etwa 9000 Luchsfelle [S. 45] in den Pelzhandel kommen, ist er noch häufig.
In Norwegen ist der Luchs noch spärliches Standwild, wird aber seltener geschossen als der Bär, und die Abschußziffern halten sich seit 1889 auf etwa gleicher Höhe, nämlich 50-70 Stück jährlich. In Schweden war der pinselohrige Geselle früher eines der bekanntesten, aber seiner unersättlichen Raubgier halber auch verhaßtesten Raubtiere, dessen Verbreitungsbezirk bis nach Wermeland und Dalekarnien herunterreichte. Bei seinem rastlosen Herumschweifen in den ungeheuren Wäldern fiel er nur dem erfahrenen Berufsjäger zum Opfer, während er dem gewöhnlichen Bauernjäger höchstens zufallsweise zum Schuß kam. Es soll aber einzelne Jäger gegeben haben, die in ihrem Leben 137, ja sogar 183 Luchse erlegt hatten, und daß ein einzelner Schütze jeden Winter zehn bis zwölf streckte, kam noch in der Mitte des vorigen Jahrhunderts vor. Von 1835 bis 1839 wurden in ganz Schweden 1324 erlegte Luchse angemeldet, also rund 265 Stück jährlich. Dagegen betrug die Gesamtstrecke des Jahres 1894 nur 35, 1905 nur noch zwei Stück. Das seitherige Schußgeld von 25 Kronen für jeden erlegten Luchs wurde daher 1913 aufgehoben, wogegen aber zwei Jahre später die lappländische Nomadenbevölkerung Verwahrung einlegte, weil innerhalb zwei Monaten 15 Renntiere von Luchsen zerrissen worden waren. Besser vermochte sich der Luchs im benachbarten Finnland zu halten, wo aber sein Verbreitungsgebiet nach Norden kaum bis zum Polarkreis reichte. Südlich davon war er noch in den 70er und 80er Jahren so häufig, daß man fast in jedem Kirchspiel Luchse erlegte, in manchen sogar in beträchtlicher Anzahl. Um die Jahrhundertwende herum schmolz dann der Bestand stark zusammen, und heute kommen im westlichen Finnland südlich Uleaburg Luchse nur noch ausnahmsweise vor, während sie in den östlichen Landesteilen häufiger sind. Die meisten Luchse, die wir in den Tiergärten zu sehen bekommen, stammen aus Finnland. Es heißt dort, daß Wolf und Luchs Todfeinde sind und sich in ihrer Verbreitung gegenseitig fast ausschließen. In der Tat trifft man da kaum Luchse an, wo es viele Wölfe gibt, und umgekehrt.
Der gedrungene Körperbau, die hohen Läufe, der kurze, wie abgehackt aussehende Schwanz, die abenteuerlichen Pinselohren und die gemessenen, fast ein wenig plump und eckig anmutenden Bewegungen machen den Luchs zu einer höchst eigentümlichen Erscheinung, aber er ist trotzdem in jeder Beziehung vom Scheitel bis zur[S. 46] Sohle eine echte Katze. Er steht höher auf den Beinen als ein Panther, ist aber trotzdem viel kürzer gebaut, zumal ihm ja der lange Schwanz anderer Großkatzen abgeht. Die kraftstrotzende Muskulatur, das scharfe Gebiß und die gewaltigen Pranken machen ihn zu einem in seiner Art furchtbaren Räuber, obschon er an Größe einen starken Hühnerhund kaum übertrifft. Das Gewicht eines ausgewachsenen Männchens beträgt 30-35 kg. Döbner erhielt aus Norwegen einen Luchskopf von einem offenbar sehr alten Tier, da der erste Backenzahn im Oberkiefer jederseits bereits ausgefallen war. Bei Herrichtung des Schädels ergab sich die auffallende Tatsache, daß auch auf jeder Seite des Unterkiefers hinter dem Reißzahn ein kleiner Höckerzahn sich befand und daher sowohl unten wie oben jederseits vier Backenzähne vorhanden waren, während sonst die katzenartigen Tiere im Unterkiefer jederseits nur drei haben. Größe und Färbung schwanken beim Luchs sehr, und man hat deshalb eine ganze Reihe von Abarten aufgestellt, die sich aber nicht aufrecht erhalten lassen, da die angeblichen Unterschiede sich im allgemeinen als solche lediglich individueller Art erwiesen haben. Höchstens kann man zugeben, daß die nordischen Luchse durchschnittlich etwas stärker sind als die aus dem Alpengebiet oder dem südöstlichen Europa. Nach Färbung und Zeichnung unterscheiden die Jäger Hirsch-, Wolf-, Kalb-, Pardel- und Katzenluchse, und auch der schwedische Tierforscher Nilsson hat früher ähnliche Ansichten vertreten, mußte sich dann aber selbst berichtigen, als er aus dem gleichen Gewölf ganz verschieden gezeichnete Tiere erhielt. Die Fährte des Luchses, den die Russen Rys, die Letten Luhsis oder Luhsa und die Esten Ilvis nennen, ist reichlich doppelt so groß wie die einer starken Katze, ja noch etwas größer als die des Wolfes, unterscheidet sich aber von dieser sofort dadurch, daß sie keine Kralleneindrücke hinterläßt. Da der Luchs beim ruhigen Gehen schnürt, gleicht die ganze Fährte einer aufgereihten Perlenkette. Die Losung wird stets an ganz bestimmten Steinen oder Baumstümpfen hinterlassen, und wenn der Luchs wieder des Weges kommt, versäumt er es nie, seine Visitenkarte behaglich zu beschnüffeln, ein Umstand, den erfahrene Fallensteller sehr wohl auszunützen wissen.
Ich selbst habe nur einmal im Leben einen Luchs in freier Natur zu sehen bekommen. Es war in einem entlegenen Balkanwinkel, als ich abends auf den Rehbock ansaß. Plötzlich rührte sich auf dem mir gegenüberliegenden Hange in etwa 160-170 m Luftlinie etwas Rotgelbes, das ich zunächst für einen guten Bock ansprach. Aber[S. 47] genaueres Hinsehen durch das Jagdglas zeigte mir einen starken Luchs, der in vorsichtig geduckter Haltung ganz langsam bergauf schlich, den Kopf immer nach einer ganz bestimmten Stelle gerichtet. Dort bemerkte ich denn schließlich auch ein Schmalreh, das etwa 70-80 m über dem Luchs stand — ein unvergeßlich schöner Anblick. Bald verschwand der Luchs ganz hinter Felsblöcken, bald zeigte er sich mir, der ich leider nur die Schrotflinte führte, völlig frei. Für diesmal erreichte der Räuber seinen Zweck jedoch nicht, denn das Reh bekam offenbar Witterung von ihm und ging schon auf große Entfernung flüchtig ab. Die Großkatze verfolgte nicht, sondern drückte sich im Gefels und wurde bald unsichtbar. — Der sehr ungesellig lebende Luchs ist ein ausgesprochenes Waldtier, fühlt sich aber nur in sehr ausgedehnten, urigen, dicht verwachsenen und schluchtenreichen Waldungen auf die Dauer wohl, die er nachts unermüdlich durchstreift und dabei oft weite Entfernungen zurücklegt, gern die Holzabfuhrwege benutzend. Doch weiß er sich immer überaus heimlich zu halten, und nur zur Ranzzeit verrät ihn sein durchdringendes Geschrei dem nächtlichen Wanderer. Selbst in noch dicht von Luchsen besiedelten Gegenden beansprucht jeder einzelne ein Jagdgebiet von mindestens 6-8 km2. Bei ausgedehnten Waldbränden flüchten die entsetzten Luchse unter Umständen bis in die Obstgärten der Dörfer, wie dies z. B. 1868 im Petersburger Gouvernement der Fall war. Auch starker Hunger treibt ihn im Winter bisweilen in die unmittelbare Nähe der menschlichen Gehöfte. In mehrfacher Beziehung interessant ist diesbezüglich der folgende Fall, den Hochgreve erzählt: »Ich fand frische Spuren unmittelbar am Gutshof, wohin die Luchse wohl durch den Geruch einer Schafherde angelockt wurden, die tagsüber in einem Gatter untergebracht war und abends in eine geräumige Scheune getrieben wurde .... In der nächsten Nacht beobachtete ich den Luchs, wie er das Gehöft umkreiste, um einen Eingang zu suchen. Als er einen solchen gefunden hatte, sprang er plötzlich mit mächtigem Satz auf das Dach der Scheune, rollte aber mit einer sich loslösenden Schneelawine wieder herab. Er sprang wütend zum zweiten Male hinauf, krallte sich an den Holzschindeln fest und begann das Dach grimmig zu bearbeiten, während die Schafe sowie die Hühner im Stall durch Blöken und Gackern die Nähe der Gefahr verrieten .... Auf dem Dach bot der Luchs ein besseres Ziel, aber im trügerischen Mondschein fuhr die Kugel an seinem starken Kopf vorbei, und ehe ich imstande war, neu zu laden, hatte sich der Luchs mit einem gewaltigen Sprung in Sicherheit[S. 48] gebracht. Am nächsten Morgen entdeckte ich zu meiner Überraschung noch die Fährte eines zweiten Luchses, wahrscheinlich des Weibchens, das sich scheu im tiefen Schatten gehalten haben mußte. Im nahen Walde fand ich die Federn einer Birkhenne als Beweis, daß das Raubtier doch etwas zur Stillung seines Heißhungers gefunden hatte. ... Einige Tage später erhielten wir die Nachricht, daß der Hühnerstall eines in der Nähe wohnenden Arbeiters vollständig ausgeräubert worden sei und daß die Fährten auf Luchse als auf die Übeltäter hinwiesen. ... Ich legte ein Eisen, und in diesem fing sich auch in der nächsten Nacht ein männlicher Luchs mit der Vorderpranke. Zu meinem Erstaunen war er tot und der Balg wies starke Bißwunden auf, während im Schnee deutlich die Spuren eines heftigen Kampfes zu sehen waren. Da keine anderen Fährten festzustellen waren als diejenige eines zweiten Luchses, hatte offenbar dieser in seinem Heißhunger dem Gefangenen die tödlichen Verletzungen beigebracht.«
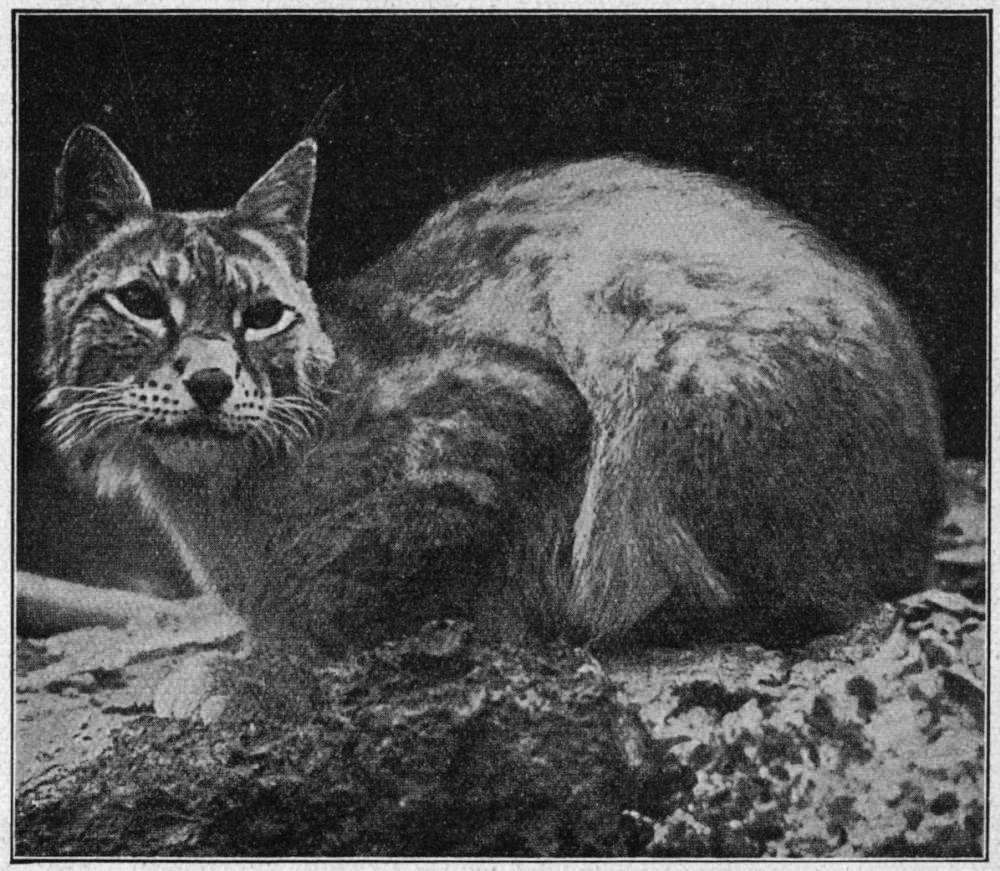
(Nach einer photographischen Aufnahme aus dem
Zoologischen Garten in London)
[S. 49]

(Nach einer photographischen Aufnahme aus dem Zoologischen Garten in London)
Seine Wechsel hält der Luchs genau ein, ja er tritt sogar beim Rückweg wieder in die eigenen Spuren, und wenn die Familie gemeinsam jagt, setzt jeder die Läufe in die Fährte seines Vordermannes, wie die Indianer auf dem Kriegspfade. Läßt er sich mit schlaffen Gliedmaßen an einem Baum mit grobem, flechtenbehangenem Gezweig nieder, so verschwimmt er für das menschliche Auge so vollkommen mit seinem Hintergrunde, daß selbst im beschränkten Raum des Tiergartenkäfigs es dem ungeschulten Beschauer schwer fällt, das große Tier sofort zu entdecken. Die Klause des blutdürstigen Einsiedlers ist in den Urwäldern sehr oft eine alte, hohle Weißtanne, die nur durch ein Astloch zugänglich ist. Das sind natürlich Riesenbäume von mindestens 1-½ m Durchmesser, durch deren ausgefaulte Astlöcher auch ein Mensch sich würde hindurchzwängen können, falls er nicht mit einem Schmerbauch gesegnet ist. Für den pinselohrigen Raubritter aber ist ein solcher Einschlupf mehr als bequem. Derartige[S. 50] Schlupfwinkel bevorzugt er bei nassem und unfreundlichem Wetter, bei warmem und freundlichem aber liegt er lieber zwischen Felsklippen oder in jungen Dickichten, um sich die liebe Sonne auf den Balg scheinen zu lassen (Abb. 13), denn das liebt er sehr, wie ja alle Katzenarten. Obschon durchaus Nachttier, streift er doch gelegentlich auch am Tage herum, wenn es hübsch ruhig und still im Revier ist. Seine Bewegungen vereinigen Geschmeidigkeit mit Kraft, Anmut mit Wildheit, unheimliche Schnelligkeit mit eiserner Ruhe, würdevollen Ernst mit rastloser Gier. Faul liegt die große Katze halbe Tage lang wie ein aus Erz gegossenes Standbild ohne Bewegung auf dem gleichen Ast oder auf demselben Felsblock. Nur leises Zucken der langen Lauscher, Blinzeln der grünlichen Lichter, Rümpfen der schnurrbärtigen Lefzen und gelegentliches Stelzen oder Wedeln der kurzen Lunte verraten, daß, Leben in ihm ist. Der Schlaf ist außerordentlich leise; beim geringsten Geräusch spitzen sich die gepinselten Ohren, und die funkelnden Raubtieraugen richten sich aufmerksam nach der verdächtigen Gegend (Abb. 14). Erst wenn das letzte Vogelgezwitscher verstummte und die Schatten der Nacht tiefer herabsanken auf den schweigenden Wald, erhebt sich der Luchs und begibt sich mit weit ausgreifenden, federnden Schritten geräuschlos auf seinen Jagdzug. Im Vergleich zu ihm sind Bär und Wolf Stümper im Pirschen und Schafe an Mordlust. In allen älteren Naturgeschichtsbüchern wird übereinstimmend die hervorragende Kletterkunst des Luchses gerühmt. Seine für eine Katzenart sehr hohen Läufe lassen aber eigentlich nicht auf einen vorzüglichen Kletterer schließen. In neueren Lehrbüchern heißt es auch nur, daß der Luchs ziemlich gut klettere, wenn auch andrerseits Schäff sicherlich zu weit geht mit der Behauptung, daß der Luchs freiwillig überhaupt nicht klettere und seine Beute niemals von Baumästen aus anspringe. Erwähnt doch von Hippel bei einem in Ostpreußen geschossenen Luchs ausdrücklich, daß er gerade in dem Augenblick getroffen wurde, als er vom Baume aus auf ein Reh herabsprang. Immerhin ist dies nicht seine gewöhnliche Jagdmethode. Wird der Luchs von scharfen Hunden gehetzt, so baumt er fast regelmäßig auf. Zweifellos ist dagegen der Luchs ein Meister im Springen, der mit einem einzigen Satz eine 15 Fuß breite Schneise überfällt oder einen 10 Fuß hohen Felsblock besteigt. Da hilft dem armen Lampe kein noch so fixes Hakenschlagen, der ungeheure Sprung des furchtbaren Räubers trifft ihn mit tödlicher Sicherheit. Gewässer werden ohne Bedenken kräftig und geschickt durchschwommen. Während der Luchs wie alle Katzenarten[S. 51] schlecht wittert und deshalb niemals der Fährte eines Beutetieres mit der Nase folgt, ist sein Auge scharf und sein Tastsinn hoch entwickelt. Alles, mit dem er sich näher befassen will, wird erst mit den Schnurrhaaren betastet. Sein schärfster Sinn ist aber zweifellos das Gehör, und die langen Pinselohren sind nicht etwa nur eine bloße Zierde des ausdrucksvollen Kopfes. Der Luchs hört das leise Nagen des Hasen an der Espenrinde und geht dann diesem Geräusch vorsichtig nach, bis er seiner Beute ansichtig wird. Obwohl Oberförster Dohrandt auf Grund seiner in Rußland gemachten Erfahrungen den Luchs als dumm bezeichnet, möchte ich es doch mit Brehm halten, der in ihm ein geistig hochstehendes Geschöpf und jedenfalls eines der klügsten Raubtiere erblickt. Schon die Naturforscher des Mittelalters nennen den Luchs mit Recht ein überlegendes und listiges Tier.
Schon aus dem Gesagten geht zur Genüge hervor, daß der Luchs seiner Beutetiere in der Regel durch katzenartiges Beschleichen Herr wird. Grevé sagt sogar: »Daß er vom Baume herab auf seine Beute springt oder in dieser Art gar Elche überfällt, ist eine noch immer gern geglaubte Fabel, die durch Bilder von Jagdmalern, die nie einen Luchs in freier Wildbahn beobachtet haben und sich auf das Latein lustiger Hubertusjünger verlassen, unterstützt wird, ebenso wie der stereotype, den Schützen auf den Hinterpranken annehmende Bär nicht von der Bildfläche verschwinden will, trotz des beständigen Protestes erfahrener Bärenjäger.« Völlig kann ich nun zwar Grevé weder hinsichtlich des Luchses noch des Bären beipflichten, aber für die große Mehrzahl der Fälle hat er sicherlich recht. Auf flacher Erde erreicht der Luchs das geduldig beschlichene Opfer mit zwei bis drei Riesensprüngen von je 4 m Weite und wirft es nieder, um ihm die Pulsader aufzureißen oder das Genick zu durchbeißen und es so augenblicklich zu töten. Durch Spuren im frisch gefallenen Schnee konnte nach Brehm festgestellt werden, wie ein Luchs einen Hasen durch neun ungeheure Sprünge von durchschnittlich 13 Fuß Weite ereilt hatte. Geht der entscheidende Sprung fehl, so wendet sich der Luchs in der Regel mürrisch ab und sucht verdrießlich nach einem neuen Wild. Ist er aber sehr hungrig, so verfolgt er seine Beute auch wohl kilometerweit laufend wie ein Wolf, und man hat dies sogar schon am hellen Tage beobachtet. Hasen bzw. Schneehasen und Rehe bilden wohl sein Hauptwild, aber vom Hirsch bis zur Maus, vom Auerhahn bis zum Zaunkönig ist überhaupt nichts vor ihm sicher. Solange er Wild haben kann, zieht er dieses den Haustieren[S. 52] entschieden vor, und da er äußerst lecker ist und nur die besten Stücke verzehrt, kann er als furchtbarer Jagdschädling in gepflegter Wildbahn unmöglich geduldet werden. Hat er Überfluß, so schwelgt er im Blutrausch und wird zum Massenmörder. So erzählt Vater Bechstein, daß ein Luchs, der sich 1772 im Thüringer Wald aufhielt, in einer einzigen Nacht über 30 Schafe erwürgte. Trotzdem frißt der Luchs mäßig und gelassen und kehrt nach Stillung seines Hungers den Überbleibseln verächtlich den Rücken. Größere Tiere bedeckt er allerdings mit Laub oder Erde und kommt dann in der nächsten Nacht nochmals zu dem Braten zurück, während er nicht von ihm selbst gerissenes Aas niemals berührt. Tiere von Hasengröße an aufwärts sind ihm immer lieber, und mit Eichhörnchen oder gar Mäusen befaßt er sich nur im Notfall, wenn Schmalhans für längere Zeit Küchenmeister geworden ist. Doch erregt jedes vorüberhuschende Mäuschen schon seine Mordlust, und den vorüberflatternden Singvogel schlägt er mit sicherem Prankenhiebe aus der Luft herunter. Die brütende Auerhenne oder die dösende Lagerschnepfe sind für ihn in des Wortes wahrster Bedeutung ein gefundenes Fressen. Die häßliche Katzengewohnheit, mit gefangenen Kleintieren noch zu spielen und sie angesichts des Todes zu quälen und zu ängstigen, besitzt auch er, bleibt aber dabei immer ruhig und gelassen. Was er einmal gepackt hat, läßt er nicht so leicht wieder los und zerreißt den Beutetieren die Decke mit seinen nadelscharfen Krallen ganz erbärmlich. In Norwegen wurde ein junger Luchs, dessen Raubgier stärker gewesen war als seine Klugheit, von einer angesprungenen Ziege bis in den Hof des Besitzers geschleppt und dort erschlagen. Einem alten Luchs wäre das sicherlich nicht passiert. Tschudi erzählt, daß der Luchs in der Schweiz sich bisweilen unter der Erde nach den Schaf- und Ziegenställen durchzugraben versuche, wobei einmal ein mutiger Ziegenbock den unterirdischen Feind bemerkte, als er eben den Kopf aus der Erde hob, und ihn mit seinen Hörnern so derb bearbeitete, daß der Räuber tot in seinem Tunnel liegen blieb. Mit Vorliebe stellt der Luchs den Gemsen nach, die ihm aber infolge ihres scharfen Witterungsvermögens oft entgehen; häufiger fallen ihm Murmeltiere zum Opfer. An Hirsche, Sauen oder gar Elche dürften sich nur ausnahmsweise ganz starke Luchse wagen. Die stärkste Kraft dieser Großkatze, die sich ihre Jagden gern möglichst bequem gestaltet, liegt in den Füßen, in der Kinnlade und im Nacken. Der Luchs ist nicht so schlau wie der Fuchs, aber geduldiger, nicht so frech wie der Wolf, aber ausdauernder, nicht so stark wie der Bär,[S. 53] aber scharfsinniger. Erbeuteten Rehen oder ähnlichen Tieren wird regelmäßig der Kopf vom Rumpfe getrennt, und wo man öfters im finsteren Gebirgstann derartig geköpfte Rehe findet, kann man mit einiger Sicherheit darauf schließen, daß hier der »Blutschreck«, wie der Luchs früher bei den Tiroler Bauern hieß, sein unheimliches Wesen treibt. Im übrigen tafelt der Luchs wie ein richtiger Feinschmecker, saugt sein Opfer fast blutleer und wählt nur die zartesten Stücke zum Fraße, während alles übrige neidlos dem Waldpöbel überlassen wird. Gerade durch diese wenig haushälterischen Eigenschaften wird er ja zu einem so argen Wildverwüster.
Die Ranzzeit europäischer Luchse fällt in den Januar und Februar, und die Kater kämpfen dann nachts um der Minne Lohn mit so greulichem Geschrei, daß dem unerfahrenen Wanderer die Haare zu Berge stehen. Keine Zigeunergeige und kein Zimbal kann so herzzerbrechend schluchzen wie diese Teufelsbiester. »Erst klingt es,« schreibt Fritz Bley, »wie süße Sehnsucht von Verliebten, dann wie das Angstgeschrei eines Gefolterten und schließlich wie das letzte Röcheln eines Gehenkten. Dann wieder plärrt und keift eine scheußliche Hexe dazwischen oder ein alter Urteufel grunzt vor Lüsternheit im tiefsten Basse.« Werden die Kämpfer handgreiflich, so knurren und fauchen sie ingrimmig und lassen dann ein plärrendes Gebrüll hören, hoch und fein anfangend und mit tiefen, dumpfen Tönen endigend. Die Luchsin miaut dazu wie eine Hauskatze, aber mit tiefer Baßstimme. In merkwürdigem Gegensatz zu alledem heißt es bei Brehm, daß die Begattung ohne das übliche abscheuliche Katzengeschrei erfolge. Außerhalb der Ranzzeit sind die Luchse allerdings sehr schweigsam und schreien nur bei Hunger oder Langeweile in dumpf plärrenden oder bärenartig brüllenden Tönen. Im Laufe des März trennt das Weibchen sich dann wieder vom Männchen und bezieht an einer recht einsamen und schwer zugänglichen Stelle, etwa in einer durch Windbrüche und Baumwurzeln gebildeten Höhlung oder auch in einem alten Dachsbau ihr Wochenbett, wo sie nach zehnwöchiger Tragzeit, also etwa Anfang Mai, zwei bis drei, selten vier Junge wirft, die anfangs von ganz heller Farbe sind, neun Tage lang blind bleiben, und die sie als fürsorgliche Mutter mit zartestem Geflügel füttert. Glückselig schnurrend ruht sie dann auf weichem Pfühle und bietet den leise maunzenden Sprößlingen geduldig die Zitzen, nimmt es auch mit stillem Behagen hin, daß die kleinen Rüpel das Gesäuge mit ihren derben Pfoten recht unsanft kneten. Im Juni nimmt sie ihre Kinder schon auf kürzere Streifzüge mit und[S. 54] bummelt nun bis zum Eintritt der nächsten Ranzzeit mit ihnen gemeinsam herum. Merkt sie Gefahr für die Jungen, so stößt sie in oftmaliger Wiederholung einen groben Nasenlaut aus, der wohl ein Warnungssignal sein soll. Im übrigen wissen wir über das Familienleben dieser einsiedlerischen und menschenscheuen Tiere herzlich wenig, doch behaupten manche Beobachter, daß die geile Luchsin sich nicht mit einem Gatten begnüge, sondern alljährlich ihre Gunst an mehrere Liebhaber verschenke.
Es gibt in europäischen Jagdgründen kein Wild, das so schwierig zu bejagen und zu erlegen ist wie der Luchs. Seine argwöhnische Schlauheit vereitelt die besten Anschläge, und gewöhnlich ist es nur ein seltener Zufall, der ihn einmal vors Rohr bringt. Auf Treibjagden bleibt er seelenruhig in seiner Baum- oder Felsenhöhle liegen und läßt Treiber und Hunde vorbeiziehen, oder er baumt beim ersten Lärm auf, rührt sich nicht mehr und wird dann gewöhnlich übersehen. Nur wenn er im niedrigen Dickicht ruhte, vermögen ihn sehr schnelle und scharfe Hunde herauszutreiben, zum Aufbaumen zu zwingen und zu verbellen, wo ihn dann die herbeieilenden Jäger leicht herunterschießen können. So sehr der Luchs den Menschen fürchtet und meidet, so wenig macht er sich doch aus bloßem Lärm und liegt deshalb gar nicht selten in unmittelbarer Nähe viel benutzter Waldwege. In Rußland bildet man bei Luchsjagden mit wenigen, aber sicheren Schützen und ortskundigen Treibern einen möglichst engen Kreis und läßt dann die Bracken in den Trieb, die das Raubtier rasch aufstöbern und im Falle eines Durchbruchs unter Lautgeben verfolgen. Der Luchs zeigt auch vor großen Hunden keine sonderliche Furcht, denn er ist sich seiner Überlegenheit über sie wohl bewußt. Im Nahkampf wirft er sich gern auf den Rücken und gebraucht seine furchtbaren Tatzen in der nachdrücklichsten Weise. Dann muß der Hund unterliegen, und der Jäger tut deshalb gut daran, schleunigst herbeizueilen, wenn er nicht seinen vierbeinigen Jagdgehilfen verlieren will. Die Hunde zeigen deshalb auch wenig Neigung, mit einem so gefährlichen Gegner ernstlich anzubinden. Recht wenig aussichtsreich ist das Ausgehen der Fährte bei Neuschnee, da der Luchs in einer Nacht ganz gewaltige Wegstrecken zurückzulegen pflegt. Stößt er dabei auf eine frische Menschenspur, so trollt er sich sofort mißtrauisch in eine andere Gegend. Die Luchsjagd ist aber nicht nur unergiebig und beschwerlich, sondern sie kann unter Umständen sogar gelegentlich einmal gefährlich werden. Dies gilt besonders für den Fall, daß der aufgebaumte und vom Hunde[S. 55] verbellte Luchs zunächst nur angeschossen wird. Dann kann es vorkommen, daß das schwer gereizte und vor Schmerz halb wahnsinnige Tier mit einem gewaltigen Satze auf seinen Peiniger herunterstürzt und ihm die scharfen Krallen tief in die Brust schlägt. Allerdings springt er gewöhnlich zuerst den Hund an, so daß der Jäger Zeit gewinnt, neu zu laden und den Kampf durch eine besser gezielte Kugel aus nächster Nähe zu entscheiden. Gut beglaubigt ist der Fall eines schwedischen Jägers, der mitsamt seinem Hunde von einem angeschossenen Luchs derart zugerichtet wurde, daß beiden die Lust zur Luchsjagd für immer verging. Überhaupt erzählt man sich in Skandinavien manche Geschichten von Luchsjagden, bei denen der, der auf der Strecke blieb, nicht immer Meister Pinselohr war. Es braucht das meines Erachtens nicht immer Jägerlatein zu sein, obschon zahlreiche und grobe Übertreibungen dabei mit unterlaufen sein mögen. Die baltischen Herrenjäger bekunden übereinstimmend, daß ihnen niemals etwas von Angriffen des Luchses auf den Menschen bekannt geworden sei, daß vielmehr jener seiner völligen Ohnmacht gegenüber dem Herrn der Schöpfung sich stets bewußt bleibe. Gewöhnlich bleibt der aufgebaumte Luchs ruhig auf seinem Aste liegen und starrt den sich nahenden Menschen unverwandt an, ja es gibt sogar erfahrene Jäger, die behaupten, daß man die Aufmerksamkeit des Räubers durch aufgepflanzte Kleidungsstücke stundenlang fesseln und derweil seine Flinte holen könne, falls man ihm zufällig und waffenlos begegnet sei. Daß dem Luchs bei aller Menschenscheu doch auch ein gut Teil Frechheit innewohnt, geht daraus hervor, daß einmal ein Luchs während einer Treibjagd sich einen der aufgescheuchten Hasen fing, welche Keckheit er allerdings mit dem Leben bezahlen mußte.
Aussichtsvoller als die Jagd auf den Luchs ist der Fang mit dem Tellereisen, allerdings immer noch viel schwieriger, umständlicher und mühseliger als etwa beim Fuchs. Um Fangbrocken und Luder, selbst um frische Pferdekadaver kümmert sich der Luchs nicht; ihm schmeckt nur selbst erlegte Beute, und auch die nur, solange sie frisch ist. Man kann also nur dann auf Erfolg rechnen, wenn man Gelegenheit hatte, das Eisen bei einem vom Luchs selbst gerissenen Reh oder dergleichen auszulegen. Der in Eisen sitzende Luchs gebärdet sich namentlich beim Erscheinen des Jägers wie rasend. Seine Wut kennt keine Grenzen, und er macht mit bewundernswerter Kraft die verzweifeltsten Anstrengungen, um freizukommen, wobei er sich nicht selten die Krallen ausreißt oder die Fangzähne abbricht. Ein gefangener[S. 56] Luchs war mit dem schweren Eisen an einer Tatze auf einen hohen Baum geklettert und blinzelte von da tückisch auf seinen Verfolger herab. Es erschien rätselhaft, wie er mit dem stark verletzten Fuß und dem gewichtigen Eisen an dem steilen und glatten Stamm hatte hochkommen können. Nur einer fabelhaften Gewandtheit in Verbindung mit unglaublicher Muskelkraft und Willensstärke konnte ein solches Unternehmen gelingen. Ein anderer Luchs hatte das Eisen eine tiefe Schlucht hinunter und auf der anderen Seite wieder in die Höhe geschleppt. An den Spuren im Schnee ließ sich feststellen, daß das Raubtier die ganze Zeit über, während das Eisen an einer gerissenen Ricke gestellt worden war, kaum 30 Schritte davon auf einer dicht beasteten Fichte gelegen und ruhig zugesehen hatte. Ratz hatte einmal einen hohen Felsen erklettert und wollte sich gerade zum Ausruhen niedersetzen, als plötzlich zehn Schritte vor ihm ein Luchs absprang. Er beschoß ihn auf sechzig Schritte mit Hasenschrot, fand auch Schweißspuren und ein gerissenes Reh, aber der Luchs selbst blieb verschwunden. Am nächsten Morgen fing er sich in dem bei seinem Opfer gestellten Eisen, mit dem er sich dann zwischen zwei dicht beieinanderstehenden Baumstämmen derartig einklemmte, daß er leicht den Gnadenschuß erhalten konnte. Vorher war er noch mitsamt dem Eisen einen hohen Felsen herabgesprungen, und es war nur zu verwundern, daß er sich dabei nicht den Schädel zerschmettert hatte. — Der Balg des Luchses gibt ein geschätztes Pelzwerk ab, das namentlich in China sehr beliebt ist, weshalb die große Mehrzahl der sibirischen Luchsfelle nach dort ausgeführt wird. In Europa gelten die nordischen Luchsfelle für besser als solche aus südlichen Ländern. Luchsbraten galt früher als ein Leckerbissen oder doch wenigstens als ein begehrtes Schaugericht für die Tafel der Vornehmsten. Noch auf dem Wiener Kongreß soll mehrfach Luchsbraten aufgetischt worden sein. Je seltener dieses Gericht wurde, um so mehr kam es in den Geruch der Heilkräftigkeit und Wundertätigkeit. 1819 erhielt die bayrische Jägerei den Auftrag, unter allen Umständen einen Luchs zur Strecke zu bringen, da dessen Wildbret dem bayrischen König als Mittel gegen Schwindelanfälle dienen sollte. Neuerdings hat Baron von Loewis einer Gesellschaft baltischer Feinschmecker Luchsbraten vorgesetzt, der allgemein für Truthahn gehalten und mit Vergnügen verspeist wurde. Dagegen fand Baron von Krüdener, daß geräuchertes Luchsfleisch unangenehm süßlich schmecke. In Estland wird heute noch Luchsfleisch von hoch und niedrig gern gegessen; es sei zart und hellfarbig, ohne jeden unangenehmen Wildgeschmack[S. 57] und dem besten Kalbfleische gleich. Die Krallen des erlegten Luchses, die sog. »Luchskräneln«, läßt sich der glückliche Schütze in der Regel in Silber fassen und trägt sie mit berechtigtem Stolze an der Uhrkette.
Gefangene Luchse, die in den Tiergärten nicht eben häufig zu sehen sind, verlangen sorgfältigste Pflege. Wenn sie sich auch aus Witterungsunbilden nicht viel machen, so beanspruchen sie doch große Abwechslung in der Nahrung und nur frisches Fleisch bester Sorte. Alte Luchse bleiben immer mürrisch und eigensinnig und lehnen jeden näheren Anschluß an den Menschen fauchend und übellaunig ab. Dagegen werden Junge, die aber schwer aufzutreiben sind, überraschend zahm und zeigen sich dem Pfleger gegenüber von ihrer liebenswürdigsten Seite. Grill war so glücklich, einen etwa zweitägigen Jungluchs zu erwerben. Seine Hauskatze mußte das kleine Waisenkind großsäugen und tat dies mit all der unerschöpflichen Zärtlichkeit, die Katzenmütter hilflosen Jungtieren gegenüber an den Tag legen. Dieser Jungluchs bekam auch später nur Milch, Brei, Kartoffeln u. dgl. und blieb wohl deshalb so zahm wie eine Hauskatze. Auch in einem andern Falle diente eine Katze als Amme. Der Pflegling gedieh dabei prächtig und wurde bald zum Liebling der ganzen Familie, obgleich er gelegentlich durch seine übergroße Neugier lästig fiel. Als er schon doppelt so groß war wie seine Pflegemutter, leckte diese den Rüpel immer noch zärtlich. Wenn er aber dann in seiner groben Art mit ihr spielen wollte, wurde Mieze ungemütlich, sprang ihm auf den Rücken und backpfeifte ihn, daß es nur so rauchte. Zu einer gewissen Berühmtheit hat es der zahme Luchs des Barons von Loewis gebracht. Dieses Tier war so gehorsam, daß ein drohender Zuruf genügte, um es augenblicklich von Hasen, Hühnern oder Schafen abzuhalten. Es hörte genau auf seinen Namen und durfte deshalb sogar seinen Herrn zu den Treibjagden begleiten, auf denen es sich damit vergnügte, Hasen abzufangen. Nachdem Sprünge auf am Boden sitzende Tauben mehrmals mißglückt waren, lernte »Luzy« sehr geschickt, sie mit einem Prankenhiebe beim Auffliegen aus der Luft herunterzuschlagen. Fuhren Herr von Loewis und sein Bruder auf einen Tag in die Nachbarschaft, so konnte niemand »Luzy« bändigen, und dann wehe jedem unbedachten Huhn, jeder sorglosen Ente oder Gans! Rollte dann spät in der Nacht der Wagen wieder vor das Wohnhaus, so war Luzy im Nu vom Dach, wo sie sich neben dem Schornstein zur Ruhe niedergetan hatte, herunter und flog mit weiten Sätzen ihrem Herrn[S. 58] an die Brust, seinen Hals mit ihren starken Vorderpranken umschlingend, laut schnurrend und mit dem Kopf nach Katzenart stoßend und reibend. So folgte sie in die Stube, um auf dem Sofa oder neben dem Ofen ihr Nachtlager aufzuschlagen. Einige Male durfte sie auch das Bett mit ihrem Herrn teilen, legte sich dann aber gern quer über dessen Hals und verursachte dadurch Alpdrücken und beunruhigende Träume. Als einmal die Gebrüder Loewis für eine ganze Woche verreisten, geriet der Luchs in große Unruhe, suchte schreiend nach seinem Herrn, verweigerte die Annahme von Nahrung und übersiedelte schon am zweiten Tage in ein nahes Birkenwäldchen, von wo er nur zum Übernachten auf sein gewohntes Plätzchen neben dem Schornstein zurückkehrte. Seine Freude bei der endlichen Wiederkehr der beiden Barone kannte keine Grenzen. Scham- und Ehrgefühl waren stark entwickelt, wie es sich z. B. zeigte, als die Luchsin einmal beim Beschleichen von Gänsen ins Wasser geplumpst war. Durchaus Feinschmecker, nahm auch dieser Luchs nur ganz frisches Fleisch, am liebsten Wild und Geflügel. Eigentümlich war sein glühender Haß gegen Hauskatzen, die er mit gräßlicher Wut zerfleischte. In kurzer Zeit hatte er sämtliche Katzen auf dem Gute ausgerottet, obwohl man sie sorgsam vor ihm verborgen hielt. Nur einmal wagte es Herr von Loewis, Luzy zu einem Besuch auf ein Nachbargut mitzunehmen. Kaum aber war man eine Stunde dort, so meldete auch schon der Diener, daß die Lieblingskatze der Hausfrau von dem Luchs zerrissen worden sei.
Zuchterfolge mit gefangenen Luchsen sind namentlich im Stockholmer Tiergarten erzielt worden. Anfang März 1905 bemerkte der Direktor Alarik Behm, daß ein Pärchen Luchse sich für einander interessierte. Oft saßen die Tiere dicht aneinandergeschmiegt auf den großen Felsblöcken ihres Käfigs, und der Kater leckte nicht selten Wangen, Ohren und Schnauze der Luchskatze. Am 22. Mai wurden zwei Junge geboren, starben aber nach fünf Monaten an Rachitis, und auch der Vater ging bald darauf an Spulwürmern zugrunde. Dem Weibchen wurde nun ein anderes Männchen beigesellt und auch am 14. März 1906 eine Paarung beobachtet, die aber keine Folgen hatte. Im nächsten Jahre erfolgte die Paarung am 9. März, und am 17. Mai wurden drei Junge geboren. Leider blieben auch diese nicht lange am Leben; zwei gingen im Oktober ein, und das dritte im Dezember, alle mit Spulwürmern behaftet. Der 15. Mai 1908 brachte wieder zwei Junge, die erst am 16. Lebenstage die Augen öffneten, den Winter gut überstanden und gesund[S. 59] und munter blieben. Während ihrer ersten Lebensmonate ließen die jungen Luchse oft ein leises Piepen hören. Im gleichen Wurf fanden sich verschiedene Spielarten, und sowohl Wolf- wie Fuchs- wie Katzenluchse sind von dem gleichen Elternpaar gezogen worden. Das Wachstum der Jungen vollzieht sich sehr langsam; im Dezember waren sie erst halbwüchsig. Die Luchsmutter pflegt ihre Kleinen mit unübertrefflicher Zärtlichkeit und trägt sie bei der geringsten Beunruhigung in die Höhle zurück; später verwendete sie viel Zeit auf das Spielen mit ihren niedlichen Kindern. Der Luchskater war während der Geburt 1905 auch im Käfig anwesend und schlief in der ersten Zeit mit seiner Familie zusammen. Als die Jungen größer wurden, beschäftigte er sich fast ebensoviel mit ihnen wie die Luchsmutter und ließ die übermütigen Kleinen geduldig über sich hinweg klettern und tollen oder sich von ihnen am Schwanz und an den Ohren reißen. Bei den späteren Würfen wurde der Kater aber doch vorher entfernt, weil er nach Aussage der Wärter dem Weibchen und den Jungen zu viel von dem guten Wochenstubenfutter (Kaninchen, Tauben, Sperber) wegfraß.
Finsterling Uhu, der stärkste Vertreter des Eulengeschlechts, teilt mit dem Steinadler den gefährlichen Ruhm, der gewaltigste Räuber unserer heimischen Vogelwelt zu sein. Gibt doch das Uhuweibchen dem Steinadler an Größe tatsächlich nur wenig nach, ja, wenn es im Zorne alle seine Federn sträubt, die übrigens bei manchen Völkerschaften Mittelasiens als geschätzte Schmuckfedern gelten, dann erscheint es fast noch größer. Die Flügellänge europäischer Uhuweibchen, die auch an dem stärkeren Schnabel und den längeren Zehen von den kleineren und schwächeren Männchen zu unterscheiden sind, beträgt 465-490 mm, die der Männchen 430-465 mm. Das durchschnittliche Gewicht der Weibchen beträgt 3-½, das der Männchen nur etwa 3 kg. Anscheinend kann der Vogel ein ziemliches Alter erreichen; wenigstens lebte ein ungarischer Hüttenuhu volle 32 Jahre in seinem Verschlag, und in freier Natur dürfte diese Zahl wohl noch wesentlich überschritten werden, wenn nicht Pfahleisen oder Blei ein verfrühtes Ende herbeiführen. Je nach Grundfärbung, Fleckung und Schwingenverhältnissen unterscheiden die Vogelforscher beim Uhu eine ganze Reihe geographischer Rassen, jedoch ist Hartert[S. 60] der Ansicht, daß ganz Europa von Skandinavien und Nordrußland bis zu den Pyrenäen, Italien und Griechenland von einer einheitlichen Form bewohnt wird, während Reichenow auch diese noch in mehrere Rassen aufsplittern möchte. Ich selbst kann allerdings skandinavische Uhus von deutschen unterscheiden, nicht aber diese von ungarischen. Gut kenntliche Rassen sind jedenfalls der turkmenische und der nordafrikanische Uhu.
Macht der Uhu auf den ersten Blick auch einen etwas abenteuerlichen Eindruck, so muß man ihn bei näherer Betrachtung doch entschieden als schön erklären. Man schaue ihm nur einmal in die prachtvollen, goldgelben, feuersprühenden Glotzaugen mit ihrem magischen Phosphorglanz, denen weder bei Tag noch im Dunkel der Winternacht die kleinste Beute entgeht; man bedenke, daß die absonderlichen Ohrbüschel auf unglaubliche Entfernung hin das leiseste Geräusch auffangen, man betrachte das weiche, üppige Gefieder mit seiner feingemusterten Zeichnung und großartigen Schutzfarbe, die gewaltigen, breiten Fittiche, die furchtbaren Waffen, die unheimliche Kraft und Sicherheit, mit der sie geschwungen werden, — und dann wird man zugeben müssen, daß die Natur im Uhu nicht einen häßlichen Kobold, sondern ein Meisterwerk von höchster Vollendung und eigenartiger Schönheit schuf. Frau Sage hat ein düsteres Märchengewebe um den geheimnisvollen Sonderling gewoben. Jedes Kind kennt ja den Uhu, aber nur die allerwenigsten Menschen haben ihn in freier Natur wirklich gesehen. Aber sein abenteuerliches Aussehen, seine nächtlichen Raubritterstreiche, sein waghalsiger Mut und seine unheimliche Stimme haben ihm im Verein mit allerlei gespenstischen Sagen zu einer gewissen Berühmtheit verholfen, die durch alle Schichten des Volkes reicht. Es kann keinem Zweifel unterliegen, daß der Uhu mit am meisten zur Entstehung der weitverbreiteten Sage vom wilden Jäger beigetragen hat. Man begreift das, wenn man einmal in einer stürmischen Frühlingsnacht zwei eifersüchtige Uhumännchen sich balgen sah. Heftige Schwingenschläge, wütendes Fauchen, Zischen und Schnabelknappen, freches Kichern und heiseres Kreischen! Die dumpfen Rufe durchlaufen dabei alle Stufen von Zorn und Wut, Ingrimm und Ärger, Bosheit und Tücke und endigen schließlich in einem entsetzlichen Siegesgeheul. Wenn der erregte Vogel sein üppig volles Gefieder zu einem unförmlichen Federball aufbläst, wenn gleichzeitig seine riesigen Augen wie zwei Feuerräder grünlich geisterhaften Phosphorglanz sprühen, wenn sein schauerliches Rufen im Verein mit[S. 61] Schlangengezisch und Gefauche die Abendstille durch eine gräßliche Musik unterbricht, dann denken ängstliche und abergläubische Gemüter wohl leicht an das Konzert rasselnder Totengerippe zur Mitternachtsstunde auf dem alten Friedhof, wie es in der dörflichen Spinnstube so oft und so anschaulich geschildert worden ist. Dann gruselt's solche Menschen!
Die Forscher aus der klassischen Zeit der deutschen Vogelkunde, auch noch Eugen von Homeyer und Altum, kennen den Uhu alle noch als einen ganz regelmäßigen Brutvogel in den weitaus meisten Gegenden unseres Vaterlandes, obgleich sich schon ein Rückgang bemerklich machte. So schreibt Gloger in seiner 1834 erschienenen »Naturgeschichte der Vögel«: »In Deutschland, etwa das Saaletal ausgenommen, fängt der Uhu, wie in allen kultivierten Staaten, bereits an, etwas selten zu werden.« Noch in den 80er Jahren des vorigen Jahrhunderts war der Uhu in vielen Gegenden eine durchaus nicht besonders seltene Erscheinung. Das ist leider ganz anders geworden, und namentlich seit der Jahrhundertwende hat nahezu überall eine geradezu erschreckend rasche Abnahme des »Königs der Nacht« eingesetzt, die sein völliges Aussterben in sehr absehbarer Zeit befürchten läßt. Schonungslose Verfolgung hat die majestätische Eule schon heute in den meisten Gegenden Mitteleuropas völlig vernichtet und die spärlichen Reste in die finstersten Waldungen der Ebene oder in die abgelegensten Felsengebiete der Gebirge zurückgedrängt, wo der Vogel vollends zum menschenscheuen Einsiedler geworden ist. Das Herz krampft sich einem förmlich zusammen und die Schamröte steigt einem ins Gesicht, wenn man dieses widerwärtige Trauerspiel in seinen Einzelheiten näher verfolgt, wenn man etwa in den letzten 25 Jahrgängen der Jagdzeitschriften all diese selbstgefälligen, schieß- und fangwütigen Ausrottungsberichte zusammenstellt. Es ist immer und überall dieselbe lausige Geschichte: Irgendwo haust noch in stiller Abgeschiedenheit ein einsames Uhupaar. Es wird ausfindig gemacht, und alljährlich werden ihm nun schonungslos sämtliche Eier oder Junge weggenommen, bis schließlich auch die alten Brutvögel kaltblütig abgeknallt werden. Schluß! Wieder ein deutscher Uhubrutplatz weniger! Wen kümmert's groß? Das ist selbst in neuester Zeit kaum anders geworden, obwohl der aussterbende »König der Nacht« heute als Naturdenkmal gesetzlich geschützt ist. Aber solche Gesetze stehen ja bekanntlich nur auf dem Papier, und die große Mehrzahl der Auchjäger schert sich den Teufel darum.
[S. 62]
Vergegenwärtigen wir uns nun einmal an der Hand der Jagd- und Fachpresse, wie sich die Ausrottung des Vogels in den früher uhureichsten Gegenden vollzogen hat, und suchen wir zugleich festzuzustellen, wo heute in Mitteleuropa Uhus überhaupt noch brüten. In Mecklenburg war der Uhu früher namentlich in den südlichen und südöstlichen Teilen des Landes verbreitet, zählt aber heute gleich dem Steinadler zu den ausgestorbenen Vogelarten. Selbst aus den großen Waldungen der Rostocker Heide ist er heute völlig verschwunden. Die letzten Brutpaare horsteten zu Beginn dieses Jahrhunderts bei Speek in der Nähe von Röbel, bei Testorf und bei Ankershagen. An letztgenanntem Platze wurde noch Anfang 1916 ein Uhu erlegt, der aber wohl nur ein gattenlos herumstreichender Durchzügler war. In Pommern war der Uhu nach E. F. v. Homeyer in der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts »nicht selten« und kam namentlich in den großen Kiefernwäldern der östlichen Landesteile noch »oft genug« vor. Heute hört man so gut wie nichts mehr von pommerschen Uhus. Auch in Ostpreußen war der Uhu noch zu Ende des vorigen Jahrhunderts durchaus keine Seltenheit. Bekannte Horstplätze waren z. B. die Oberförsterei Fritzen im Samland, ferner die Gegenden von Memel, Heydekrug, Sorquitten, Ibenhorst, Trygallen, Norkitten, Wehlau u. a. Auf den Treibjagden wurden häufig nebenbei auch Uhus erlegt, und der bekannte Königsberger Präparator Künow hatte oft ein halbes Dutzend und mehr gleichzeitig zum Abbalgen daliegen. Ich selbst kannte einen Horst, der auf einem gar nicht besonders hohen Baume stand. Damals wurden immer nur zufällig Uhus geschossen oder gefangen, die alteingesessenen Brutpaare dagegen sorgfältig geschont, schon der wertvollen Jungen wegen. Oberst Biclitz schreibt, daß dies auch heute noch so sei und daß infolgedessen ein wesentlicher Rückgang der ostpreußischen Uhubestände nicht eingetreten sei, zumal in den endlosen, einsamen Waldungen so mancher Horst überhaupt nicht aufgefunden werde. Neuerdings gibt der bekannte Oologe Szielasko an, daß der Uhu in Masuren und Litauen noch regelmäßiger Brutvogel sei, besonders aber in der »Niederung«, wo er geradezu als häufig gelten könne. Tischler schätzt den gegenwärtigen Uhubestand Ostpreußens auf 19 bis 20 Horstpaare. Nach alledem scheint es also, als ob wir in Ostpreußen die uhureichste Provinz Deutschlands vor uns haben, wenn auch in neuester Zeit ein bedenklicher Rückgang, namentlich in Masuren, leider nicht zu verkennen ist.
[S. 63]
Als eine besonders uhureiche Gegend galt früher auch der Harz, dessen natürliche Beschaffenheit sich ja hervorragend für diesen Vogel eignet. Aber es ist zu unruhig in dem schönen Gebirge geworden, und so wird auch hier dem Finsterling bald die Todesstunde geschlagen haben, wie ja allen großen und eigenartigen Vögeln von der sogenannten Kultur bald der Garaus gemacht wird. Im Oberharz ist der Uhu heute bereits ausgerottet und im Unterharz horstet noch ein einziges Paar, dessen Standort sich nach Smalian in schwer zugänglichen Felsen bei Schloß Falkenstein befindet. Von einem der letzten Horste berichtet Oberförster Robitzsch aus Ballenstedt. Der Horst stand in einer tiefen Felsspalte eines seit Jahren unbenutzten Steinbruchs etwa 15 m über der Steinbruchsohle. 1912 wurde der Steinbruch vorübergehend wieder in Betrieb genommen, aber erst als die Arbeit schon mehrere Wochen gedauert hatte, verriet einer der alten Uhus den Horst dadurch, daß er einmal bei verfrühtem Eintreffen der Leute aus der Felsplatte heraus abstrich. Das Gefieder der Uhus stimmte nämlich in seiner rostbraunen Farbe so vorzüglich mit dem Grauwackengestein überein, daß man von der Steinbruchsohle aus selbst mit dem Jagdglase die Vögel nicht von ihrer Umgebung unterscheiden konnte. Die jungen Uhus saßen etwa 1-½ m tief in der Spalte und mußten erst mit Hilfe eines Spatens aus ihrem Versteck hervorgeholt werden. Oberförster Robitzsch schenkte ihnen erfreulicherweise die Freiheit. Auch Wichfeld erzählt noch 1916 von einem Harzer Uhuhorst, der gleichfalls in einem alten Steinbruch unter einem überhängenden mächtigen Felsblock sich befand und nur mit Hilfe des Seiles zu erreichen war. Er enthielt drei Junge, die den Kletterer mit wütendem Schnabelknappen begrüßten, übrigens ohne jede Nestunterlage in einer flachen Geröllmulde saßen und einen Hamster, eine Fasanenhenne sowie mehrere Karnickel und Igel zur gefälligen Auswahl vor sich liegen hatten. Der alte Uhu hakte gewöhnlich in einer hohen alten Fichte auf, die dem Steinbruch gegenüberstand, und ließ von hier aus seinen dumpfen Ruf erschallen. Auch im nächsten Jahre enthielt der Horst wieder zwei Eier, aber seitdem scheint er verlassen zu sein, und man hat über das Schicksal dieses Paares nichts mehr gehört.
Ähnlich günstige Verhältnisse wie im Harz boten sich dem Uhu in der Sächsischen Schweiz mit ihren steilen und stark zerklüfteten Sandsteinfelsen. Bei der schweren Zugänglichkeit dieser Felswände hat sich der Uhu hier etwas besser gehalten, und es brüten auch heute noch alljährlich mehrere Paare zwischen Schandau und Pirna. In[S. 64] den Schrammsteinen wurde 1889 ein junger Uhu aufgefunden, der aus dem Horste herausgefallen war. Loos sah 1904 drei Jungvögel, die im Schulzengrunde ausgehoben worden waren. Im übrigen Sachsen aber ist der Uhu als Brutvogel heute ausgestorben, auch im Erzgebirge sowie bei Zittau, wo früher (bis 1889) in den Wänden des Oybin immer zwei bis drei Paare horsteten. Nur als Strichvogel wird hier und da noch einmal ein Stück erlegt. — Im Fichtelgebirge sollen noch 1914 zwei Jungvögel einem Horste entnommen worden sein. Im Spessart kam der Uhu nach Behlen schon 1843 nur noch in vereinzelten Paaren vor, während er früher in den einsamen Waldungen dieses Gebirgszuges geradezu häufig genannt werden konnte. Die zunehmende Beunruhigung der Forsten und die rücksichtslose Waldverwüstung haben ihn ebenso vertrieben wie den Schwarzstorch, und die Naturschutzbewegung kam im Spessart zu spät. In den 70er Jahren war der Uhu noch Standwild in den Kalkfelsen bei Mühlbach, wo jetzt Zementfabriken ihre Steinbrüche haben. 1875 brütete der Uhu noch auf der Benediktenhöhe und in den 80er Jahren zwischen Mittelstadt und Karlstadt, bei Wertheim und sogar auf der Marienfeste in Würzburg. Alle diese Paare wurden durch Abschuß des einen Gatten vertrieben, und heute ist der Uhu aus der Liste der Spessart-Brutvögel zu streichen. Hoffmann sah den letzten 1918 bei Eusenheim im Werratal.
Ein weiterer bevorzugter Wohnplatz des Uhus war von jeher das obere Saaletal, und der herrliche Vogel kommt dort auch heute noch horstend vor. So nistet ein Paar regelmäßig auf dem Weißenfelsen am rechten Saaleufer unweit Rudolstadt und wird dort erfreulicherweise geschont. Ein anderer Horst steht unter hängendem Gestein in den Klippen des Thälendorfer Reviers und enthielt am 19. Juni 1915 drei kräftige Dunenjunge. Ebenso werden Dornburg und bis 1893 auch der Kobersfelsen bei Burgk a. d. Saale als Brutplätze genannt. Auch der »Uhustein« an der Saale trägt seinen Namen nicht umsonst. Ja selbst in der unmittelbaren Nähe von Jena befand sich bis in die neueste Zeit hinein ein besetzter Uhuhorst, aber leider wurde das Brutpärchen von den Jagdpächtern hart verfolgt, obwohl es ausschließlich auf der Hochebene jagte und hier fast nur Kaninchen und Hamster schlug, die dort eine wahre Landplage bilden. — Auch am Rhein haben sich noch spärliche Restbestände des Uhus erhalten, da, wo der Strom die ihm den Weg versperrenden Gebirge durchbricht und infolgedessen Steilabstürze vorhanden sind. Altbekannt ist z. B. ein Uhuhorst bei St. Goarshausen,[S. 65] der schon seit vielen Jahren von der Forstverwaltung als Naturdenkmal beschützt wird. Auch am Loreleifelsen kann man noch ab und zu Uhus sehen, die vielleicht dort horsten. Ein anderer Felsvorsprung am Rhein heißt im Volksmunde geradezu »Uhusnack«. Auch auf steilen Felswänden bei Bacharach hat sich der Uhu lange gehalten, bis 1916 das Weibchen des Horstpaares abgeschossen wurde. Genau ebenso ging es um die gleiche Zeit dem seit vielen Jahren bei Münstermaifeld brütenden Uhupaar. Auf einem fast unzugänglichen Hang bei Mayschoß im Ahrtal stand ein Uhuhorst, dem 1910 und 1913 ein Farnkrautsammler je zwei fast flügge Junge entnahm, um sie an Elberfelder Hüttenjäger zu verkaufen. Ein seit mehreren Jahren verlassener Uhuhorst bei Altenahr wurde 1912 wieder bezogen, mußte aber gleichfalls seine beiden Jungvögel hergeben. Er steht auf einem hohen Basaltfelsen im Denntale, einem Nebental des Ahrtales. Der bekannte Ornithologe König in Bonn erhielt Uhueier aus dem Ahrtale und vermutet dort noch mehrere Brutpaare. Im Sauerlande und auch im Roertale, wo er sich bis 1890 hielt, ist der Uhu heute als Brutvogel ausgestorben, wenn auch ab und zu noch herumstreichende Stücke erlegt werden. Dagegen finden sich auf den Hängen der Eifel nach dem Moseltale zu noch besetzte Uhuhorste. Le Roi nennt solche von Burg Eltz, Karden, Kochem und Trarbach.
Im Thüringer Wald ist der Uhu wenigstens noch nicht gänzlich ausgestorben. Annenhöfer schreibt 1913: »Schon seit Jahren war einem Teil der hiesigen Jägerei das Vorhandensein eines Uhupaares sowie dessen Horst im ›Zeiher‹, einem schroffen Talkessel mit 50 bis 100 m hohen Hängen an den Nordfuß der Reinsberge grenzend, bekannt. Die beiden Jungen wurden voriges Jahr geraubt und sind dieses Jahr für gutes Geld als fertige lebende Jagduhus in die Welt gewandert. Leider fiel letztes Jahr das Weibchen den Schroten eines Jägers in Dosdorf zum Opfer. Trotzdem scheint es dem Männchen gelungen zu sein, wieder eine Gefährtin zu finden, denn vorige Woche haben Bekannte von mir zwei Arbeiter getroffen, die wieder zwei Uhus ausgenommen hatten.« Neueren Nachrichten zufolge war dieser Arnstadter Horst auch in den letzten Jahren noch besetzt. An der Heilsberger Felswand bei Stadt Remda horstete nach elf Jahren 1910 zum ersten Male wieder ein Uhupaar, das leider ungastlichen Empfang fand, da man ihm die Jungen aus dem Neste raubte. Die altbekannten Horstplätze am Iltenberg bei Themar und im Melkerser Felsen bei Meiningen sind längst verödet. In ganz[S. 66] Hessen und dem angrenzenden Waldeck gibt es nur noch ein bis zwei Brutpaare, die aber baldigem Untergang geweiht sind. Aus der Provinz Hannover war der Uhu nach Löns schon vor dem Weltkriege völlig verschwunden. Dagegen hat die wild- und waldreiche Mark Brandenburg immer noch eine Reihe Uhuhorste aufzuweisen, namentlich in der stillen Neumark. Förster Rüdiger schickte mir von dort eine Anzahl Gewölle, die von einem Horste stammten, der merkwürdigerweise inmitten einer bewohnten Reihersiedlung errichtet war. In Schlesien gab es früher Uhus genug im Riesengebirge, Altvater, Heuscheuer, Oberschlesien usw., aber die Bestände haben sich seit Mitte des vorigen Jahrhunderts mit so rasender Schnelligkeit vermindert, daß heute in der ganzen, sonst so vogelreichen Provinz kein einziger sicherer Uhuhorst sich mehr nachweisen läßt. Allerdings werden noch ab und zu einzelne herumstrolchende Uhus erlegt, aber es handelt sich dabei wohl allermeist um Zuzügler aus den Karpathen.
Dagegen ist der Uhu nach Gengler trotz aller Verfolgungen immer noch vereinzelter Brutvogel in Mittelfranken. Es kommt ihm zustatten, daß die Krähenhütte dort wenig betrieben und gewöhnlich ein ausgestopfter, mechanisch bewegter Uhu dabei verwendet wird. Ich selbst erhielt bis in die neueste Zeit öfters Uhugewölle aus der Fränkischen Schweiz zur Untersuchung. Gengler führt die Gegenden von Altdorf, Hersbruck und Hartenstein als noch heute besetzte Brutplätze an. Früher war der Uhu in dem bergigen und felsigen Altmühltal verhältnismäßig häufig anzutreffen und horstete ständig bei Arnsberg und bei Kipfenberg, ist aber jetzt dort ausgestorben. Der letzte wurde nach Graf Geldern 1890 dort geschossen. Ein schönes, altbekanntes Pärchen starb 1910 durch Berührung mit dem Leitungsdraht eines Kraftwerkes, den es sich zum Hochzeitsbette auserkoren hatte. In der Oberpfalz soll bei Breitenbrunn noch ein vereinzeltes Uhupaar horsten. Aus den südbayrischen Mösern ist der schöne Vogel leider schon völlig verschwunden; nur selten noch verstreicht sich einer vom Gebirge her in die Randmöser. Im bayrischen Hochgebirge ist der Uhu zwar noch regelmäßiger Brutvogel, aber doch schon überall eine bemerkenswerte Seltenheit. Glücklicherweise wird er in manchen Gegenden jetzt wirklich geschont. Über das Vorkommen des Uhus in Württemberg sind wir neuerdings durch eine sorgfältige Arbeit Pfeiffers vorzüglich unterrichtet worden. In dem durch seine großen Waldungen und schönen Felsentäler für ihn sehr geeigneten Schwabenländle bewohnte die große Eule noch beim Ausgang[S. 67] des vorigen Jahrhunderts die gesamte Alb sowie beträchtliche Teile des Schwarzwaldes. In diesem kommt sie heute als Brutvogel nicht mehr vor. Über das Schicksal der letzten Paare hören wir: Auf der Schloßruine von Nagold hausten bis 1896 zwei Paare, bei Teinach in der Ruine Waldeck bis 1900 ein Paar, von dem dann der eine Gatte durch einen Bauern abgeknallt wurde. Ein dritter Schwarzwaldbrutplatz befand sich bis 1894 auf einem Felsen im Enztale bei Sprollenhausen, wo die Brutvögel von Bauern getötet und die Brut selbst vernichtet wurde. Im Alpirsbacher Stadtwald hielt sich der Finsterling am Beilstein bis 1885 und verschwand dann nach erfolgter Plünderung des Horstes auf Nimmerwiedersehen. Der Rottweiler Stadtwald hat sogar bis 1910 den Uhu beherbergt, obwohl ihm alljährlich die Jungen weggenommen wurden. Leider wurde dann der eine Vogel zufällig auf einer Treibjagd abgeschossen, und so wurde auch dieser letzte Brutplatz im württembergischen Schwarzwald verlassen. Häufiger war der Uhu von jeher auf der Schwäbischen Alb, ganz besonders aber im oberen Donautal mit seinen großartigen Felswänden. Freilich ist es auch hier mit dem Bestande rasend schnell bergab gegangen, und die mittlere sowie die östliche Alb, wo früher der Vogel geradezu häufig war, sind heute uhufrei. Aber wenigstens in der westlichen Alb ist er heute noch Brutvogel, und zwar nicht mit einem einzigen Paare, wie man in den Kreisen der Vogelfreunde allgemein annahm, sondern die genauen Nachforschungen Pfeiffers haben die erfreuliche Tatsache ergeben, daß immerhin noch fünf Horstpaare vorhanden sind (Zwiefalten, Balingen, Sulz, Ebingen, Donauschleife zwischen Fridingen und Mühlheim). 1890 freilich waren es mindestens 55, 1907 immerhin noch 20. Der Bestand ist also innerhalb 35 Jahren auf den elften Teil zusammengeschmolzen! Verwundern kann das freilich nicht, wenn man hört, daß noch 1903 im Lenninger Tal nicht weniger als sechs Uhus im Pfahleisen gefangen wurden. Allein das herrlich gelegene Urach hatte um die Jahrhundertwende noch drei bis vier Brutpaare aufzuweisen. Einer der alten Horste stand bei Bierlingen ganz bequem zugänglich auf einer Geröllhalde und wurde natürlich alljährlich ausgeplündert, bis die Vögel die Sache doch schließlich satt bekamen. Als besonders empfindlich erwies sich das Brutpaar am Lichtenstein, denn es verschwand 1908, als man einen Gehweg am Fuße des Horstfelsens angelegt hatte.
Ebenso genau wie über die Uhus Württembergs sind wir über diejenigen Böhmens unterrichtet durch eine eingehende Arbeit des[S. 68] Forstmeisters Kurt Loos. Während vor wenigen Jahrzehnten noch mindestens 50 Uhupärchen in Böhmen horsteten, konnte er 1907 nur noch 18 aufführen mit der Bemerkung, daß auch dieser geringe Bestand sich beständig vermindere, da alljährlich etwa zehn alte Vögel abgeschossen oder im Pfahleisen gefangen und etwa 35 Jungvögel für die Krähenhütte ausgehoben würden. Am zahlreichsten fand Loos den Uhu noch in der Gegend von Aussig. Wiederansiedelungsversuche bei Horowitz hatten leider nur vorübergehenden Erfolg, da die Schießlust der »Jäger« nicht zu bändigen war. Neuere Nachrichten führen gar nur noch zwei böhmische Uhuhorste auf am Stellnitzer Berg und am Schlagniger Berg bei Bilin. — In den Gebirgsgegenden Deutsch-Österreichs liegen die Verhältnisse ähnlich wie in Oberbayern, d. h. der Uhu kommt zwar noch horstend vor, ist aber überall eine Seltenheit und in weiterer Abnahme begriffen. Bekannte Horstplätze befinden sich z. B. im Thayatal, im Zillertal, im Kremstal, bei Gastein usw. Auf den Besitzungen des »Vereins Naturschutzpark« im Stubachtal hat der König der Nacht nunmehr eine geschützte Zufluchtstätte gefunden, aber leider wird so mancher jenseits der Grenzen in den widerwärtigen Pfahleisen weggefangen, die unbedingt gesetzlich verboten werden sollten. In der Statistik des österreichischen Ackerbauministeriums für 1896 werden allerdings noch 1902 in den cisleithanischen Provinzen erlegte Uhus aufgezählt, aber es steht zu vermuten, daß ein großer Teil dieser angeblichen Uhus ganz gewöhnliche Waldohreulen gewesen sind. Zahlreicher wird der Vogel dann in den heute zu Jugoslawien gehörigen Teilen von Kärnten und Krain sowie in Dalmatien, wo er sich auch auf manchen Inseln ansiedelt, selbst auf unmittelbar zum Meer abstürzenden Felsen. Im Balkan, z. B. in Montenegro, ist er noch eine häufige Erscheinung, wovon ich mich erst im Frühjahr 1926 wieder selbst überzeugen konnte. Es kümmert sich dort eben niemand groß um den Finsterling, und das ist die Hauptsache für sein Gedeihen. Ludwig von Führer konnte in Montenegro innerhalb eines Jahres 16 Uhus erlegen. Auch in den Karpathen gibt es noch Uhus genug, obschon dort bereits die Verfolgung eingesetzt hat, ebenso in Galizien und Ungarn, wo sie mit Vorliebe auf den vogelreichen Donauinseln brüten. Daß es den endlosen Waldungen des inneren Rußlands nicht an Uhus fehlt, bedarf wohl kaum besonderer Erwähnung. In England ist unser Vogel längst ausgerottet, das felsenlose und baumarme Holland bietet ihm keine geeignete Stätte und in Frankreich ist er eine große Seltenheit. In der[S. 69] Schweiz ist er aus den Ebenen und dem Vorgebirge, wo die Niederjagd eine Rolle spielt, in die höheren Lagen zurückgedrängt worden. Verhältnismäßig zahlreich soll er in den südlichen Kantonen vorkommen, während er im Solothurner Jura nach von Burg heute ausgestorben ist. Im Kanton Graubünden sollen von 1900 bis 1904 zwölf Uhus geschossen worden sein.
Fragen wir nach den Gründen des fast allenthalben sich bemerkbar machenden Rückgangs, so ist neben der fortschreitenden Kultur, der Beunruhigung der Berge und der Lichtung der Wälder vor allem die unersättliche Habgier des Menschen anzuführen. Es ist weniger der gelegentliche Abschuß, insofern er nicht zur Brutzeit geschieht, der den Uhubestand so schädigt, sondern vielmehr der, wenn auch unbeabsichtigte, Fang in den dreimal verfluchten Pfahleisen, am allermeisten aber das unausgesetzte Wegnehmen der ein gut Stück Geld einbringenden Jungvögel für die Krähenhütte, soweit sie nur irgend erreichbar sind. Auch fanatische Eiersammler haben manchen deutschen Uhuhorst auf dem Gewissen, ohne ihr frevelhaftes Tun durch »wissenschaftliche« Gründe rechtfertigen zu können. Wenn man doch in solchen Fällen dem Uhu wenigstens ein Junges zur Aufzucht überlassen wollte! Aber freilich, drei junge Uhus bringen mehr Geld als zwei, und Götze Mammon ist heute unbeschränkter Beherrscher des Erdenballs. Da fällt mir ein kleines Erlebnis aus dem Balkan ein, wo bekanntlich Adler noch recht häufig vorkommen. Ich hatte einen Adlerhorst mit zwei Jungen entdeckt und schickte einen Eingeborenen als Kletterer hinauf, um die beiden jungen Adler herunterzuholen. Er brachte aber nur einen, und auf meine erstaunte Frage, wo denn der andere bliebe, meinte er mit vorwurfsvoller Verlegenheit: »Aber der arme Adler muß doch wenigstens ein Kind behalten.« Das sagte dieser einfache Hirte, der nie etwas von Naturschutzpredigten gehört hatte, lediglich aus seinem unverdorbenen Gefühl heraus, obwohl ihm der Adler sicherlich manches Lämmlein oder Zicklein aus der Herde geraubt hatte. Ich habe mich in diesem Augenblick recht geschämt, trotzdem ich ja im Interesse der Wissenschaft handelte. Können denn wir Europäer, die wir so furchtbar stolz sind auf unsere Scheinkultur, uns wirklich nicht mehr zu ähnlichen Anschauungen aufschwingen? Aber nein, da muß alles restlos vernichtet und mit Stumpf und Stiel ausgerottet werden! Einen besonderen Ansporn empfing dieser traurige Vernichtungskrieg durch die leidigen Schuß- und Fanggelder, die ja jetzt glücklicherweise aufgehoben sind. Um das drohende Aussterben[S. 70] des Uhus zu verhindern, ist er neuerdings sogar zum »Naturdenkmal« (ein unglückseliger Ausdruck!) erklärt und unter gesetzlichen Schutz gestellt worden. Wirksamer noch dürften Schonprämien an das Forstpersonal sein für jede glücklich ausgekommene Uhubrut. Leider gibt es kaum eine Vogelart, die sich so schwer schützen läßt wie der Uhu, da er seine nächtlichen Beutezüge auf 30 km und mehr im Umkreise ausdehnt und deshalb nur zu leicht den Pfahleisen der Nachbarreviere zum Opfer fällt. Daran sind bisher auch alle noch so sorgfältig vorbereiteten Wiedereinbürgerungsversuche gescheitert, auch wenn sie anfänglich vollen Erfolg hatten. Nur ein völliges Verbot der Pfahleisen, in denen auch unzählige andere Eulen und harmlose Bussarde sich zu Tode schinden, könnte da helfen. Hoffen wir, daß den opfer- und mühevollen Einbürgerungsversuchen Dr. Pfeiffers in der Schwäbischen Alb ein besserer Erfolg beschieden sein möge (Abb. 15)! Meiner Ansicht nach läßt sich ein wirklich wirksamer Schutz des Uhus nur in großen Naturschutzparken durchführen, nicht aber in kleinen Banngebieten. Auch die Starkstromleitungen fordern manches Opfer. So wurde im Oktober 1912 bei Meran ein in der Starkstromleitung hängender Uhu verendet aufgefunden. Ein Fang war völlig verbrannt, während der andere, der gleichfalls starke Brandwunden aufwies, noch den Leitungsdraht umklammert hielt. Ein ganz ähnlicher Fall ereignete sich kurz darauf bei Schlanders.
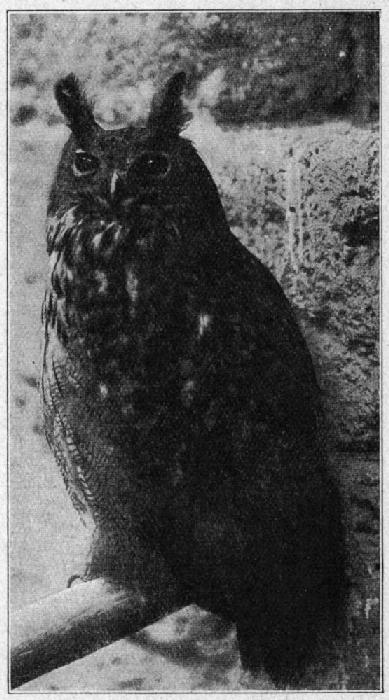
Abb. 15. Einer der von Dr. Pfeiffer in der
Schwäbischen Alb ausgesetzten Uhus
Gewöhnlich sucht man die rücksichtslose Verfolgung des Uhus mit seiner angeblich sehr großen Schädlichkeit zu rechtfertigen. In Wirklichkeit ist diese aber gar nicht so arg, wenn auch nicht geleugnet werden kann, daß der Uhu ein gewaltiger Räuber ist und namentlich zur Brutzeit die Niederjagd gehörig zehntet. Hierbei ist aber zu berücksichtigen, daß der angerichtete Schaden bei dem Einsiedlerleben des Finsterlings und bei der großen Ausdehnung seiner Streifzüge, auf denen er immer wieder andere Gegenden aufsucht, auf weite Strecken sich verteilt und deshalb für die einzelnen kleinen Niederjagdreviere nicht eben viel bedeutet. Greschik untersuchte zwölf ungarische Uhumägen und fand darin zwei Igel, zwei Wanderratten, 2 Wiesel, elf Mäuse, zweimal Federn, einmal Fuchsknochen: also ein ziemlich harmloses Ergebnis. Ich selbst habe im Laufe der Jahre eine ganze Reihe von Uhugewöllen untersucht, im allgemeinen mit ähnlichem Erfolg. Aus den letzten acht, die ich durch Förster Rüdiger aus der Neumark erhielt, konnte ich herausschälen: 1. drei Wühlmäuse und die Reste eines Igels, darunter auch einige Stacheln,[S. 71] 2. das dicht zusammengefilzte Haar einer schwarzen Katze, die offenbar auf einem verbotenen Abendbummel zu ihrem Unglück dem König der Nacht begegnet war, 3. einen Schädel sowie viele zertrümmerte Knochen und verfilzte Haare von Wasserratten, 4. eine Wasserratte und die Reste einer Drossel, 5. nur Reste von Feldmäusen, 6. nur verfilzte Haare der Waldwühlmaus, 7. ebenso, 8. Schnabel und Federn eines Stars sowie zwei Wühlmäuse. Nach Größe und Form sind solche Gewölle sehr verschieden. Ich ermittelte ihr Gewicht mit 30-55 g. Sie sehen meist schokolade- bis eisenfarbig aus, und öfters ragen größere Knochensplitter aus der Masse heraus. Der Uhu muß ein stärkeres Verdauungsvermögen haben als andere Eulen, denn in der Regel sind die vorhandenen Tierreste recht undeutlich und die Schädel arg zertrümmert. Im übrigen ist er hinsichtlich seiner Ernährung weder wählerisch noch verschwenderisch, und auch dieser Umstand vermindert seine Schädlichkeit erheblich. Ein größeres Beutetier, das er nicht in der gleichen Nacht bewältigen kann, wird sorgsam in seine Decke eingeschlagen und dann am nächsten Abend wieder aufgesucht. Im äußersten Notfall wird sogar Aas angenommen. Ferner behaupten viele Jäger, daß der Uhu in unmittelbarer Nähe seines Horstes überhaupt nicht raube, und es mag wohl etwas Wahres daran sein. Igel gelten ihm wie[S. 72] den Zigeunern offenbar als ein ganz besonderer Leckerbissen. Die meisten Beobachter geben zwar an, daß er das Fleisch aus der stacheligen Rückenhaut herausfresse und diese selbst liegen lasse, aber ich habe oft genug auch Igelstacheln in den Gewöllen gefunden, bei solchen aus der Fränkischen Schweiz fast regelmäßig. Schade, daß noch niemand näher beobachtet hat, wie der Uhu den Stachelhelden eigentlich überwältigt. Vermutlich greift er mit seinen langen Fängen und gewaltigen Klauen einfach durch den Stachelpanzer hindurch. Schlafende Vögel bringt er wahrscheinlich erst durch Rufen, Schnabelknacken und Schwingenklatschen zum Auffliegen, um sie dann in der Luft mit unfehlbarer Sicherheit zu ergreifen. Das brütende Weibchen sowie die Jungen werden fast überreichlich mit Nahrung versorgt, so daß der Horstrand eine wahre Schlachtbank darstellt und allerdings oft ein wesentlich anderes und ungünstigeres Bild darbietet als die Magen- und Gewöllinhalte aus anderen Jahreszeiten. An dem erwähnten Horste bei Rudolstadt fand Schrader zahlreiche Kaninchenreste, auch einige von Hasen sowie eine Unmenge Krähenfedern. In einem anderen Horste wurden dem brütenden Weibchen von dem aufmerksamen Gatten die auserlesensten Leckerbissen überbracht, also hauptsächlich zarte Junghasen und köstliche Igel, und ein zärtlicher Blick aus den großen Kulleraugen war dann jedesmal sein Lohn. Ein Uhufelsen war ganz mit Dohlenfedern bedeckt, da das Brutpaar hauptsächlich von einer in der Nähe befindlichen Dohlenkolonie lebte. In einem Horste bei Nakel war an geschlagenem Raub vorhanden: Kaninchen, Hasen, Enten, Taucher, zwei Birkhühner und nicht weniger als 30 Köpfe von Wasserhühnern. Graf Wodcicki entdeckte in einem galizischen Horste zwei halbwüchsige Hasen, zwei Ratten, einen Kiebitz und eine Bekassine. Loos sah einen Horst mit fünf ausgefressenen Igelbälgen und einen anderen mit frischen Resten von elf Rebhühnern, sieben Junghasen, drei Kaninchen, sieben Fasanen, einer Wildtaube, drei Krähen, einem Eichhörnchen. Pfiffige Bauern haben sich die haushälterischen Anlagen des Uhus von jeher zunutze zu machen gewußt. So lebte eine Fischerfamilie in den Sümpfen Galiziens geraume Zeit von einem Uhuhorste. Die Ratten, Igel, Ziesel und Mäuse überließ der Fischer seinem gefiederten Freund; Enten, Waldhühner und Hasen dagegen nahm er mit nach Hause und stand sich gut dabei. Auch aus einem Horste bei St. Goar konnte sich nach Altum ein schlauer Bauer fast jeden Morgen einen Hasen holen. Auch die gefangene Gattin oder die ausgehobenen Jungen werden vom Uhu[S. 73] weiter gefüttert, falls man ihm Gelegenheit dazu gibt. Große Tiere werden an Ort und Stelle verzehrt und förmlich aus dem Felle herausgeschält, kleine aber zu bestimmten Fraßplätzen getragen und hier ganz verschluckt, nachdem ihnen vorher mit dem Schnabel der Kopf eingedrückt wurde. Das feine Gehör und das scharfe Gesicht leiten den Uhu auf seinen Beutezügen, wobei er seine Opfer meist im Schlaf überfällt. Fitzinger erzählt, daß der Uhu bisweilen in der Dämmerung anderen Raubvögeln ihre Beute abjagt, indem er von oben her auf sie stößt. So viel ist sicher, daß der kraftvolle Uhu selbst eine gelegentliche Rauferei mit dem kühnen Stein- oder dem mächtigen Seeadler nicht scheut und überhaupt kaum einen natürlichen Feind zu fürchten hat. Mit dem Fuchs wird er mühelos fertig. Was er einmal mit seinen nadelscharfen Krallen gepackt hat, läßt er so leicht nicht wieder los. Auch Rehkitze sind nicht vor ihm sicher, obgleich man seine Schädlichkeit in dieser Beziehung stark übertrieben hat. Planke beobachtete beim abendlichen Enteneinfall einen Uhu, der wie ein Habicht nach einer Stockente stieß; da er sie aber nicht erwischte, begnügte er sich mit einer Wasserratte. Stecher sah, wie ein Uhu einen balzenden Auerhahn schlagen wollte und nur durch das Dazwischentreten des Jägers daran verhindert wurde. Eine Abnahme des Auer- und Birkwildes im Revier war aber nicht festzustellen. Zur Abwechslung hat der Uhu gern auch mal ein Fischgericht, versieht es aber bisweilen bei seiner Fischerei; mir sind im Laufe der Jahre zwei Fälle von dabei ertrunkenen Uhus bekannt geworden. Zur Not begnügt er sich aber auch mit Fröschen. Während des Krieges sah ich in der Dobrudscha mehrfach von unseren Soldaten gehaltene Uhus, die hauptsächlich mit den dort massenhaft vorhandenen Fröschen ernährt wurden und sich ganz wohl befanden. Forellen sind ihm freilich lieber. Auch kannibalische Gelüste sind dem Uhu nicht fremd. Seine kleineren Verwandten murkst er ohne weiteres ab, und Grevé erlebte es sogar, daß sein zahmes Uhuweibchen das schwächere Männchen ermordete und teilweise auffraß. Von der Stärke des Vogels kann man sich einen Begriff machen, wenn man erfährt, daß ein im Pfahleisen gefangener Uhu das schwere Eisen samt einem langen Stück starken Drahtes über 5 km weit forttrug und erst 14 Tage später gelegentlich einer Treibjagd erlegt werden konnte. Gefangene Uhus verlieren in der engen Haft meist ihre angeborene Geschicklichkeit und Schneidigkeit und werden dadurch unbeholfen und feige. Kehrberg setzte zu seinen nahezu erwachsenen Uhus einen Steinkauz. Einer der Uhus wollte ihn[S. 74] greifen, stellte sich aber dabei so tolpatschig an, daß der Kauz Gelegenheit zu einem ungestümen Angriff auf den Kopf des Gegners bekam und dieser vor Schreck darüber auf den Rücken fiel. Sowie er sich wieder aufrichten wollte, ging der Kauz erneut zum Angriff über, und in einem wahren Siegesrausch jagte der kleine tolle Kerl die drei entsetzt fliehenden Uhubrüder im Käfig herum, daß die Federn nur so stoben. Solche jung aufgezogenen Uhus haben eben nicht gelernt, ihre natürlichen Waffen zu gebrauchen. Ein anderer Uhu bekam eine geflügelte Elster als Futter, wurde aber von dieser durch einen tiefen Schnabelhieb ins Herz derartig verletzt, daß er am nächsten Morgen tot war. Förster Gerlach verabreichte seinem Uhu eine leicht geflügelte Krähe. Zu seiner Verwunderung war sie am nächsten Morgen noch am Leben, und der »Auf«, ein 20jähriges Weibchen, ließ sie ruhig an seinem Fraße teilnehmen. Bald saßen sie einträchtiglich dicht nebeneinander auf der Stange. Dies blieb auch in Zukunft so, ja der Uhu ließ sich gutmütig von dem frechen Rabenvieh die besten Bissen wegstehlen. Ziehen wir nun aus alledem die Schlußfolgerung, so ergibt sich, daß der Uhu zwar mancherlei Schaden verursacht, namentlich der Niederjagd gegenüber, daß er ihn aber durch fleißiges Vertilgen von Krähen, Elstern, Hähern, Eichhörnchen, Hamstern, Ratten und Mäusen zum großen Teile wieder ausgleicht. Sehr treffend urteilt Forstmeister Moosmaier: »Merklicher Schaden entstand nicht durch den Uhu. Als wir Uhus und viel Füchse hatten, gab es auch viel Hasen und Rehe. Unser Wildstand wurde vom großen Räuber, dem sog. Jäger, vernichtet und nicht vom Uhu.«
Viel Vergnügen gewährt es, die verschiedenen, überaus eindrucksvollen Stellungen des Uhus zu beobachten. In der Ruhestellung (Abb. 16) hat er bei niedergelegten Ohren, halb geschlossenen Augen und locker gehaltenem Gefieder ein eigentümlich gedunsenes Aussehen. Erregt aber irgend etwas Ungewöhnliches die Aufmerksamkeit des feinhörigen Vogels, so geht er sofort in die Hab-Acht-Stellung (Abb. 17) über, wobei die Federn knapp angelegt, der Kopf aufgerichtet und die großen gelben Kulleraugen weit aufgerissen werden, während gleichzeitig auch die Federohren in steigendem Maße sich heben. Rückt ihm aber eine Gefahr wirklich auf den Leib, dann nimmt er seine Droh- und Schreckstellung ein, wo er infolge des zornig gesträubten Gefieders fast doppelt so groß aussieht wie sonst, mit dem Schnabel knackt, den Schwanz fächert, die Flügel hebt oder zu Boden senkt und erregt von einem Fuß auf[S. 75] den anderen tritt. Dann macht er in der Tat einen ganz furchterweckenden Eindruck.

Am liebsten brütet der Uhu auf steilen, unzugänglichen Felswänden inmitten großer Gebirgswaldungen, wo ihn dann ausgedehnte Abholzungen leicht zum Verlassen der Gegend bewegen. In Ausnahmefällen ist der Horst aber auch so leicht zugänglich, daß sein Inhalt bald dem Dachse oder der Schuljugend zum Opfer fällt. In den Wäldern der Ebene muß der Uhu natürlich auf oder in Bäumen brüten, und gern benutzt er dann einen alten Bussardhorst. In großen, vogelreichen Sümpfen fand ich das Uhuheim sogar schon bodenständig auf einem trockenen Inselchen. Altes Gemäuer zerfallender Burgen ist ihm auch sehr erwünscht, ja im Orient, wo ihm niemand etwas zuleide tut, errichtet er sein Heim sogar inmitten volkreicher Städte. So konnte man ihn wenigstens früher in Sarajevo und Mostar öfters vom Fenster aus beobachten. Für Konstantinopel gehört der Uhu noch heute geradezu zu den Kennvögeln. Brehm fand ihn in den Ringmauern der spanischen Stadt Jativa brütend, und Lenz erhielt junge Uhus vom Dachboden einer tief im Thüringer Wald versteckten Fabrik. Der Horst ist mit etwa 1 m Durchmesser zwar ziemlich umfangreich, aber mit sehr wenig Kunst erbaut, ja häufig legt der Vogel seine Eier ohne jede Unterlage einfach auf den nackten Fels. Während der Paarungszeit macht er sich durch vieles Rufen und die grimmigen Katzbalgereien der eifersüchtig ihre Reviergrenzen wahrenden Männchen recht bemerkbar,[S. 76] aber während der eigentlichen Brutzeit, die 30-35 Tage dauert, verhält er sich ziemlich still. Die Eier sind von rundlicher Form und rein weißer Farbe, an Zahl gewöhnlich zwei bis drei, aber auch nur eines oder vier bis fünf. Dombrowski möchte dieses starke Schwanken der Eierzahl auf das verschiedene Alter der Brutvögel zurückführen. Die Jungen verraten sich leider leicht durch beständiges Zischen und Pfeifen. Die halbflügge Brut klettert schon auf den Horstrand, um gierend und klagend die futterbringenden Alten zu erwarten. Diese hängen mit großer Liebe an ihrer Nachkommenschaft und führen auch miteinander ein musterhaftes, sehr zärtliches Eheleben. Bei ihren Kindern läßt Frau Uhu ein sanftes »Tuck tuck« hören und füttert die Kleinen anfangs aus dem Kropf, bis sie imstande sind, selbst kleine Fleischstücke aus den überbrachten Beutetieren herauszureißen. Man kennt Beispiele, wo die Alten ihre Jungen in einen andern Horst schleppten, wenn der erste zu stark beunruhigt wurde.
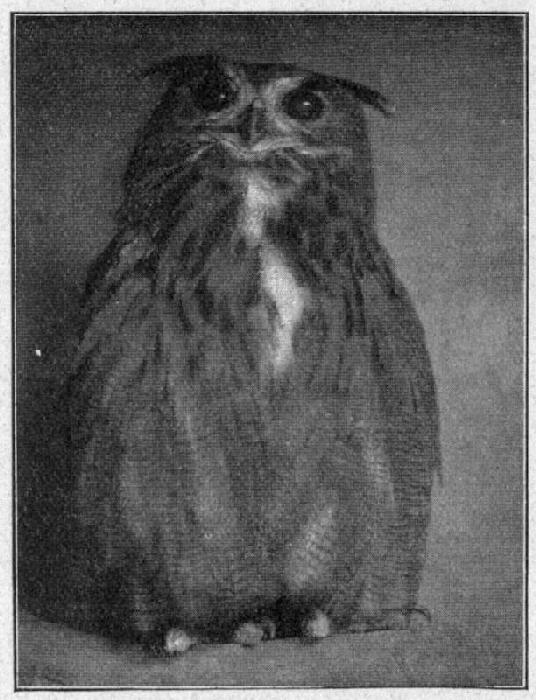
Mohr besaß ein Uhuweibchen, das ein Ei legte, worauf er ihm zwei Hühnereier zum Bebrüten unterschob. Der Uhu brütete diese auch wirklich aus und nahm sich mit mütterlicher Sorgfalt der geschlüpften Kücken an. Noch als sie schon drei Wochen alt waren, betreute er sie mit größter Zärtlichkeit, gluckste wie eine Henne und ließ nur ausnahmsweise sein »Uhu« hören. Das ihm vorgesetzte Fleisch zerbröckelte er in ganz kleine Stückchen und legte diese dann den Küchlein vor. Gegen jeden, der sich den Kücken nähern wollte, nahm er sofort Kampfstellung ein. In einem ähnlichen Falle brütete der Uhu zwar Enteneier aus, kröpfte aber dann ganz behaglich die jungen Entchen. Gefangene Uhus sind im Käfig schon häufig zur Fortpflanzung gebracht worden, selbst unter ganz primitiven Verhältnissen. Berühmt geworden ist namentlich die ergiebige, lange Jahre hindurch fortgesetzte Uhuzucht des Stockholmer Tiergartens. Ich entnehme darüber dem Berichte Dr. Alarik Behms folgendes: Die erste Paarung wurde am 1. April beobachtet und dann bis zum 11. an jedem Abend. Das Männchen sträubte vorher das Gefieder, breitete den Schwanz fächerförmig aus und erinnerte in seinen Bewegungen an einen balzenden Birkhahn. Sein Ruf war tief und grob, der des Weibchens dagegen eine halbe Oktave höher und heller. Die Paarung wurde unter mächtigem Flügelschlagen und lautem Geschrei vollzogen; namentlich das Weibchen pfiff dabei stark. Auch beim Eintragen der Baustoffe, das schon am 2. April begann[S. 77] und bei dem auch das Männchen mithalf, stieß es pfeifende Laute aus, die wie das Geräusch einer ungeschmierten Schiebkarre klangen. Eingetragen wurden: Sägespäne, Rindenstücke und Kies. Am 14. lag das erste, am 20. das zweite und am 28. das dritte Ei im Horste. Das Weibchen begann aber mit dem Brutgeschäft gleich beim ersten Ei. Das Männchen zeigte sich als idealer Ehemann und fütterte seine Gemahlin fleißig mit Katzenfleisch, Hühnerköpfen und anderen Leckerbissen. Auf einem Ast gegenüber der Bruthöhle verkürzte es durch fleißiges »Singen« dem Weibchen die langen Tage des Wartens. Menschen gegenüber zeigte es sich um diese Zeit sehr bösartig und zerriß einmal dem Wärter die Mütze, so daß dieser nicht mehr zum Betreten des Käfigs zu bewegen war und infolgedessen in diesem bald eine fürchterliche Schweinerei herrschte. Das erste Junge schlüpfte am 20., das zweite am 22. Mai aus, während das dritte Ei sich als unbefruchtet erwies. Die Jungen waren beim Ausschlüpfen nicht größer als Küchlein, wuchsen aber erstaunlich schnell. Schon nach acht Tagen krochen sie unter den Federn der Mutter hervor, um wenigstens mit den Köpfen draußen zu liegen. Der Vater trug die Atzung in die Bruthöhle, aber das wirkliche Füttern besorgte nur die Mutter.
[S. 78]
| Einleitung | 5 |
| Die letzten deutschen Biber | 6 |
| Der Nerz | 30 |
| Der Luchs | 37 |
| Der Uhu | 59 |
Der Verein Naturschutzpark
hat die Absicht, in der Lüneburger Heide und in den Salzburger Hohen Tauern zwei Gebiete zu schaffen, in denen Pflanze und Tier vollständigen Schutz vor dem menschlichen Zugriff haben sollen und in dem die volle Harmonie der Kräfte in der Natur wiederhergestellt werden soll, die der Mensch durch seinen Erwerb fast überall zu stören gezwungen ist. Die Gebiete sind so groß, daß die ursprüngliche Tier- und Pflanzenwelt erhalten wird. Durch den Verein soll zunächst an zwei Stellen ein Stück deutscher Erde in vollkommener Unberührtheit und Schönheit künftigen Zeiten erhalten werden.
Der Verein bittet alle, die mit seinen Zielen übereinstimmen, um ihre Mitgliedschaft, die jährlich RM 3.— (Mindestbeitrag) kostet. Für körperschaftliche Mitgliedschaft von Vereinen sind RM 20.— angesetzt. Die Mitglieder erhalten die Mitteilungshefte des Vereins unberechnet.
Der Verein besitzt folgende Lichtbilder-Vorträge:
A. Die Naturschutzbewegung
B. Der Naturschutzpark in der Lüneburger Heide
C. Der Naturschutzpark in den Salzburger Alpen
D. Naturschutzgebiete außerdeutscher Länder
E. Aussterbende und ausgestorbene Tiere
Die Vorträge können jederzeit nur gegen Erstattung der Versand- und Verpackungskosten vom Verein leihweise bezogen werden. Mitteilungshefte, in zwangloser Folge, unterrichten unsere Mitglieder über das Neueste der Naturschutzparkbewegung. Ansichtspostkarten unserer Parke, Vereinsnadeln, Plakate, Werbemarken und Prospekte stehen zu geringsten Preisen zur Verfügung
Verein Naturschutzpark E. V.
Geschäftsstelle Stuttgart, Pfizerstraße 2 D
[S. 79]
Freude am Leben
und sichere Grundlagen für eine moderne
Weltanschauung
findet jeder in der
Natur
Zum Beitritt in den
KOSMOS
Gesellschaft der Naturfreunde
laden wir
alle Naturfreunde
jedes Standes, sowie alle Schulen, Volksbüchereien, Vereine usw. ein
Die Mitglieder erhalten laut § 5 der Satzung als Gegenleistung
für ihren Jahresbeitrag im Jahre 1927 kostenlos:
I. Die Monatsschrift Kosmos, Handweiser für Naturfreunde. Reich bebildert. 12 Hefte im Jahr
II. Die ordentlichen Veröffentlichungen. 4 Buchbeilagen. 1927 sind vorgesehen:
Dr. Kurt Floericke, Aussterbende Tiere :: Wilh. Bölsche,
Im Bernsteinwald
H. Günther, Was ist Magnetismus? :: W. Flaig und Dr. Lang, Der Gletscher
III. Vergünstigungen beim Bezuge von hervorragenden naturwissenschaftlichen Werken
Jedermann kann jederzeit Mitglied werden.
Bereits Erschienenes wird nachgeliefert
Anmeldungen bei jeder Buchhandlung oder
durch die Geschäftsstelle des
Kosmos. Stuttgart, Pfizerstraße 5
Folgende seit Bestehen des Kosmos erschienene Buchbeilagen
erhalten Mitglieder, solange vorrätig, zu Ausnahmepreisen:
Bölsche, W., Abstammung des Menschen. — Meyer, Dr. M. W., Weltuntergang. — Zell, Ist das Tier unvernünftig? (Dopp.-Bd.). — Meyer, Dr. M. W., Weltschöpfung.
Bölsche, Stammbaum d. Tiere. — Francé, Sinnesleben d. Pflanzen. — Zell, Tierfabeln. — Teichmann, Dr. E., Leben u. Tod. — Meyer, Dr. M. W., Sonne u. Sterne.
Francé, Liebesleben d. Pflanzen. — Meyer, Rätsel d. Erdpole. — Zell, Streifzüge d. d. Tierwelt. — Bölsche, Im Steinkohlenwald. — Ament, Seele d. Kindes.
Francé, Streifzüge im Wassertropfen. — Zell, Dr. Th., Straußenpolitik. — Meyer, Dr. M. W., Kometen und Meteore. — Teichmann, Fortpflanzung und Zeugung. — Floericke, Dr. K., Die Vögel des deutschen Waldes.
Meyer, Dr. M. W., Erdbeben und Vulkane. — Teichmann, Dr. E., Die Vererbung. — Sajó, Krieg und Frieden im Ameisenstaat. — Dekker, Naturgeschichte des Kindes. — Floericke, Dr. K., Säugetiere des deutschen Waldes.
Francé, Bilder aus dem Leben des Waldes. — Meyer, Dr. M. W., Der Mond. — Sajó, Prof. K., Die Honigbiene. — Floericke, Kriechtiere und Lurche Deutschlands. — Bölsche, W., Der Mensch in der Tertiärzeit.
Koelsch, Pflanzen zw. Dorf u. Trift. — Dekker, Fühlen u. Hören. — Meyer, Welt d. Planeten. — Floericke, Säugetiere fremd. Länder. — Weule, Kultur d. Kulturlosen.
Koelsch, Durch Heide und Moor. — Dekker, Sehen, Riechen und Schmecken. — Bölsche, Der Mensch der Pfahlbauzeit. — Floericke, Vögel fremder Länder. — Weule, Kulturelemente der Menschheit.
Gibson-Günther, Was ist Elektrizität? — Dannemann, Wie unser Weltbild entstand. — Floericke, Fremde Kriechtiere und Lurche. — Weule, Die Urgesellschaft und ihre Lebensfürsorge. — Koelsch, Würger im Pflanzenreich.
Bölsche, Festländer u. Meere. — Floericke, Einheimische Fische. — Koelsch, Der blühende See. — Zart, Bausteine des Weltalls. — Dekker, Vom siegh. Zellenstaat.
Bölsche, W., Tierwanderungen in der Urwelt. — Floericke, Dr. Kurt, Meeresfische. — Lipschütz, Dr. A., Warum wir sterben. — Kahn, Dr. Fritz, Die Milchstraße. — Nagel, Dr. Osk., Romantik der Chemie.
Bölsche, W., Der Mensch der Zukunft. — Floericke, Dr. K., Gepanzerte Ritter. — Weule, Prof. Dr. K., Vom Kerbstock zum Alphabet. — Müller, A. L., Gedächtnis und seine Pflege. — Besser, H., Raubwild und Dickhäuter.
Bölsche, Stammbaum der Insekten. — Sieberg, Wetterbüchlein. — Zell, Pferd als Steppentier. — Weule, Krieg in den Tiefen der Menschheit (Dopp.-Bd.).
Besser, Natur- u. Jagdstud. i. Deutsch-Ostafrika. — Floericke, Dr., Plagegeister. — Hasterlik, Dr., Speise u. Trank. — Bölsche, Schutz- u. Trutzbündnisse i. d. Natur.
Bölsche, Sieg des Lebens. — Fischer-Defoy, Schlafen und Träumen. — Kurth, Zwischen Keller u. Dach. — Hasterlik, Dr., Von Reiz- u. Rauschmitteln.
Bölsche, Eiszeit und Klimawechsel. — Floericke, Spinnen und Spinnenleben. — Zell, Neue Tierbeobachtungen. — Kahn, Die Zelle.
Fischer-Defoy, Lebensgefahr in Haus u. Hof. — Francé, Die pflanze als Erfinder. — Floericke, Schnecken und Muscheln. — Lämmel, Wege zur Relativitätstheorie.
Weule, Naturbeherrschung I. — Floericke, Gewürm. — Günther, Radiotechnik. — Sanders, Hypnose und Suggestion.
Weule, Naturbeherrschung II. — Francé, Leben im Ackerboden. — Floericke, Heuschrecken und Libellen. — Lotze, Jahreszahlen der Erdgeschichte.
Flaig, Kampf um Tschomo-lungma. — Floericke, Falterleben. — Francé, Entdeckung der Heimat. — Behm, Kleidung und Gewebe.
Floericke, Käfervolk. — Henseling, Astrologie. — Bölsche, Tierseele und Menschenseele. — Behm, Von der Faser zum Gewand.
Lämmel, Sozialphysik. — Floericke, Wundertiere des Meeres. — Henseling, Mars. — Behm, Kolloidchemie.
Francé, Die Harmonie in der Natur. — Floericke, Zwischen Pol und Äquator. — Bölsche, Abstammung d. Kunst. — Dekker, Planeten und Menschen.
Preise: Einzeln bezogen kostet jeder Band brosch. RM 1.20, geb. RM 1.80
Für Nichtmitglieder des Kosmos je RM 1.50 bzw. RM 2.40
Besonders niedrige Preise bei Gruppenbezug nach Wahl des Bestellers
10 Bände geb. für nur RM 14.50
10 Bände brosch. für nur RM 10.—
20 Bände geb. für nur RM 27.—
20 Bände brosch. für nur RM 18.50
50 Bände geb. für nur RM 62.—
50 Bände brosch. für nur RM 42.—
Auf Wunsch können größere Beträge nach vorhergehender Vereinbarung auch in Teilzahlungen entrichtet werden.