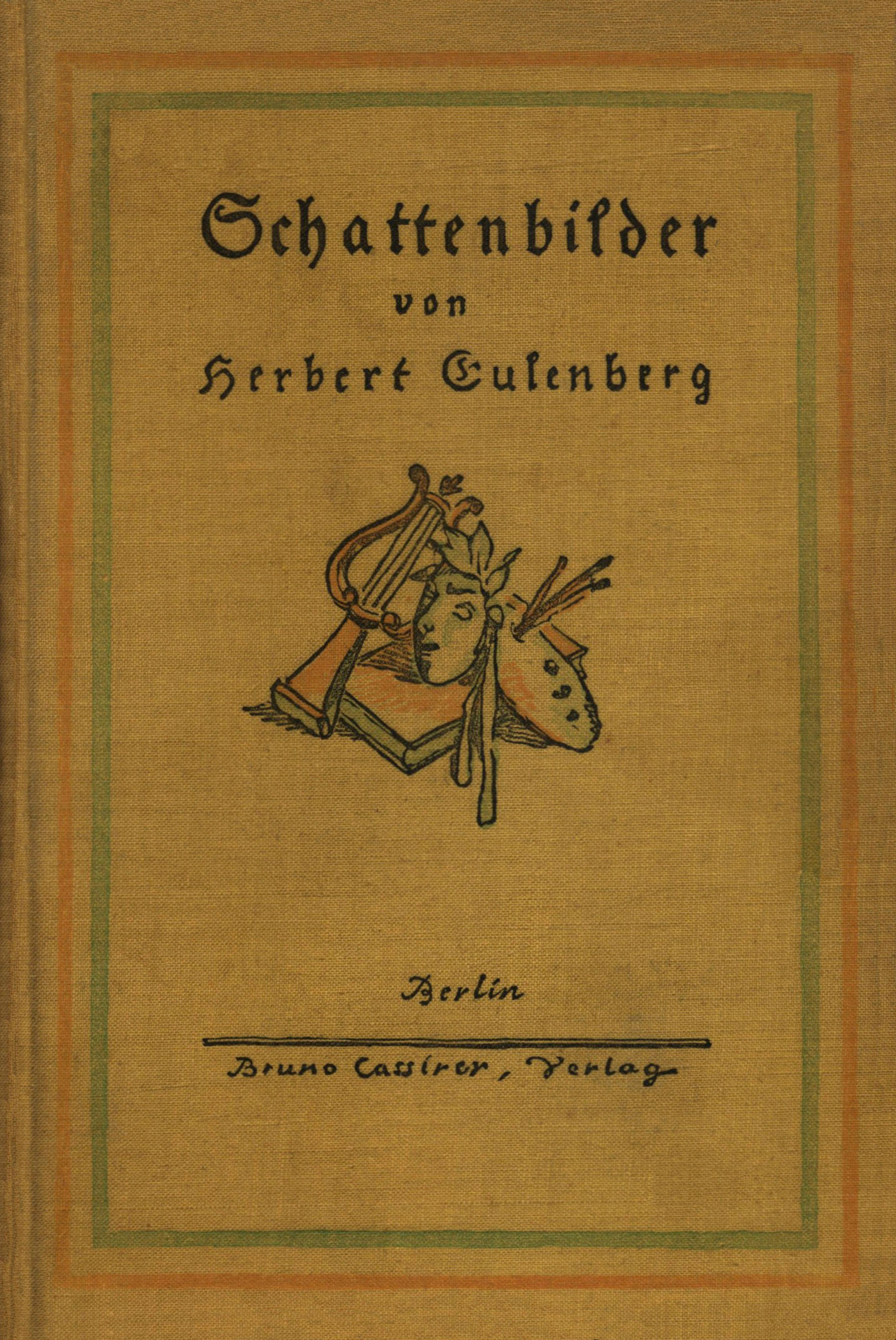
Title: Schattenbilder
Eine Fibel für Kulturbedürftige in Deutschland
Author: Herbert Eulenberg
Release date: February 18, 2026 [eBook #77975]
Language: German
Original publication: Berlin: Verlag von Bruno Cassirer, 1927
Other information and formats: www.gutenberg.org/ebooks/77975
Credits: The Online Distributed Proofreading Team at https://www.pgdp.net
Anmerkungen zur Transkription
Der vorliegende Text wurde anhand der Buchausgabe von 1927 so weit wie möglich originalgetreu wiedergegeben. Offensichtliche Fehler wurden stillschweigend korrigiert. Ungewöhnliche und heute nicht mehr verwendete Schreibweisen bleiben gegenüber dem Original unverändert. Auch inkorrekt geschriebene Personennamen wurden nicht korrigiert, sofern die Identität der betreffenden Personen erkennbar ist.
Die Fußnote wurde an das Ende des betreffenden Abschnitts versetzt.
Das Original wurde in Frakturschrift gesetzt. Passagen in Antiquaschrift werden kursiv dargestellt. Abhängig von der im jeweiligen Lesegerät installierten Schriftart können die im Original gesperrt gedruckten Passagen gesperrt, in serifenloser Schrift, oder aber sowohl serifenlos als auch gesperrt erscheinen.
In der Buchversion wurden neue Absätze weder mit einem Einzug noch mit einem größeren Zeilenabstand kenntlich gemacht. Insbesondere an den Seitenübergängen war es daher anhand des Buchlayouts nicht immer möglich, zweifelsfrei zu ermitteln, ob ein neuer Absatz vorliegt. Am Beginn der Seiten 110 (‚Die traurige absonderliche Aventüre‘ ...) und 233 (‚Er entsann sich noch der Nächte,‘ ...) wurde vom Bearbeiter sinngemäß ein Absatzwechsel festgelegt.
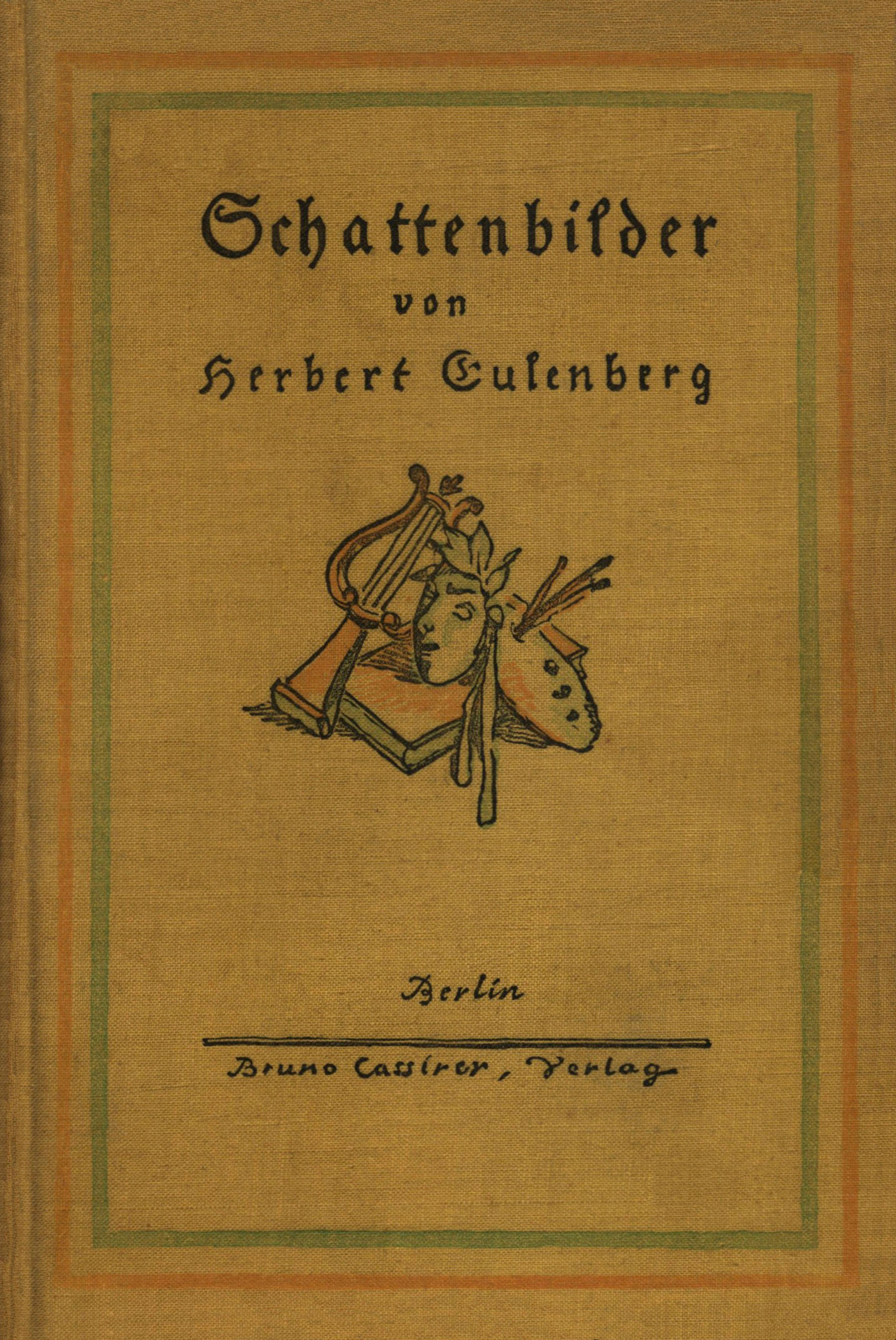
Schattenbilder
Eine Fibel für
Kulturbedürftige in Deutschland
Von
Herbert Eulenberg
83. bis 85. Tausend
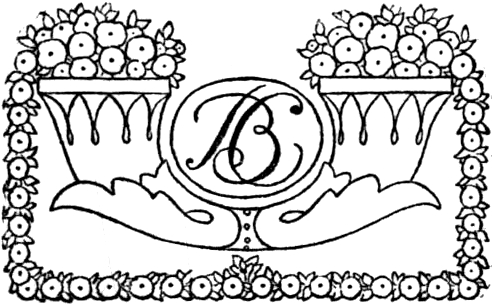
Verlag von Bruno Cassirer
Berlin 1927

Druck
der Spamerschen
Buchdruckerei in Leipzig
[S. V]
|
Vorrede
|
|
|
Vorwort zur zweiten Auflage
|
|
|
Hans Sachs
|
|
|
Eine Rede von Hans Sachs
|
|
|
Andreas Gryphius
|
|
|
Lessing
|
|
|
Der junge Goethe
|
|
|
Goethe und Italien
|
|
|
Nachfolge Goethes
|
|
|
Schiller
|
|
|
Jean Paul
|
|
|
Heinrich von Kleist
|
|
|
Franz Grillparzer
|
|
|
Friedrich Hebbel
|
|
|
Adelbert v. Chamisso
|
|
|
Heinrich Heine
|
|
|
Brentano der Dichter
|
|
|
Eduard Mörike
|
|
|
Der Graf Platen
|
|
|
Ludwig Tieck
|
|
|
E. T. A. Hoffmann
|
|
|
Schweizer Dichter
|
|
|
Theodor Fontane
|
|
|
Rückert
|
|
|
Geibel
|
|
|
Wilhelm Busch
|
|
|
Homer
|
|
|
Cervantes
|
|
|
William Shakespeare
|
|
|
Martin Luther
|
|
|
Franziskus von Assisi
|
|
|
[S. VI]
Dante
|
|
|
Raffael
|
|
|
Michelangelo in seinen Gedichten
|
|
|
Boccaccio
|
|
|
Giordano Bruno
|
|
|
Zur Würdigung Molières
|
|
|
Emile Zola
|
|
|
Graf Gobineau
|
|
|
Maupassant
|
|
|
Lord Byron
|
|
|
Oskar Wilde
|
|
|
Dostojewski
|
|
|
Ibsen
|
|
|
Bismarck
|
|
|
Etwas über Friedrich den Großen
|
|
|
Napoleon
|
|
|
Gedanken über Albrecht Dürer
|
|
|
Rembrandt
|
|
|
Arthur Schopenhauer
|
|
|
Friedrich Nietzsche
|
[S. VII]
(Zur ersten Auflage.)
Kaiserswerth am Rhein.
Im Herbst 1909.
Herbert Eulenberg.
[S. XVII]
Nun muß ich doch aus dem Poetischen ins Prosaische lavieren und aus dem Scherz Ernst machen, angesichts dieser neuen Auflage, die mir und meinem Buche widerfahren ist. Ich muß es, einmal, um auf die vielen freundlichen Zuschriften, die mir aus dem großen Leserkreis, den zu meinem Erstaunen literatur- und kulturhistorische Aufsätze im heutigen Deutschland finden, zugegangen sind, hier mit schlichten deutschen Worten mein: „Ich danke Euch allen!“ hinzusetzen.
Dann aber bin ich auch gezwungen, den mancherlei böswilligen Äußerungen, Angriffen und Vorwürfen die Spitze zu bieten, mit der mir von der Seite meiner Gegner zu Leibe gerückt worden ist. Ich halte dafür, daß man alle Ausfälle seiner Feinde möglichst schnell erwidern und abwehren muß. Sonst setzt sich leicht beim zuschauenden und zuhörenden Publikum die Meinung fest, daß unsere Widersacher über uns triumphiert hätten, daß wir die Unterlegenen wären, und daß es mit unseren Ansichten schwach, wenn nicht faul stände. Solche irrigen Annahmen soll man aber niemals beim Publikum, wie man vom Rheumatismus sagt, „einreißen“ lassen. Und darum nütze ich gleich die gute Gelegenheit, die mir dieses Vorwort zur zweiten Auflage bietet, mich vor den Schranken meiner Leser mit meinen Gegnern auseinanderzusetzen.
Viele Kritiker haben nämlich gefunden, daß diese kurzen Aufsätze dem Vorwurf selten ganz gerecht würden, daß [S. XVIII]sie kleine Federzeichnungen, keine lebensgroßen Bilder und Darstellungen der Männer, denen sie gewidmet wären, wiedergäben. Diese mir offenbar nicht wohlwollenden Leute muß ich darum bitten, nochmals auf den Titel dieser Sammlung von Miszellen zu achten, der besagen will, daß es sich hier nur um hoffentlich gut gezeichnete Umrisse von großen Menschen, um eine skizzenhafte Darstellung ihres Wesens und Wirkens in meiner Manier handelt. Man werfe diesen Radierungen darum nicht das vor, was sie ausmacht: Kürze, Wesentlichkeit, Knappheit.
Man wird vielleicht, auch auf der Seite meiner Feinde, gerechter und milder gegen mich sein, wenn ich den Ursprung der meisten dieser kurzen, zwanglosen literarischen Skizzen offenbare. Es sind nämlich in der Mehrheit Reden, Theaterreden, die ich während eines Zeitraums von vier Jahren allsonntäglich in den von Louise Dumont angeregten Matineen des Düsseldorfer Schauspielhauses gehalten habe. Das waren wiederum künstlerische Veranstaltungen, zu deren Erklärung für den, der sie nicht gekannt hat, ich hier drei Programme abdrucken will, aus denen man, wenn man sie durchliest, sich schnell und gut ein Bild von ihnen machen kann.
[1] Es wurde gleichzeitig mit dem Vorwort zur ersten Auflage gedruckt, in der festen Annahme, daß die erste die letzte bleiben würde.
Hans Sachs (1494–1576) und Andreas Gryphius (1616–1664)
1. Einführende Worte. (Herbert Eulenberg.)
2. Etzliche ergötzliche Schwänke und Narrenspossen in lustige Reimpaare gebracht von Hans Sachs, der [S. XIX]weyland ehrsamer Schuhmachermeister in Nürnberg gewesen ist und ein tüchtiger Poet dazu.
Vorgetragen von einem wackern Schauspieler.
3. Meisterlieder der Meistersinger in den alten Weisen der Singschulen, wie sie in Nürnberg, Mainz, Straßburg, Kolmar und an andern Orten Gott und der Welt gefällig, üblich waren.
Gesungen von einem höchst fürtrefflichen Sänger.
4. „Das Kälberbrüten“, ein Fastnachtspiel von Hans Sachs vom 7. Oktober 1551. Mit drei Personen folgendermaßen darzustellen:
5. Einige ernste geistliche Lieder von dem Syndikus zu Glogau, Andreae Gryphio sich selbst und andern zum Trost nach jenem entsetzlichen, dreißig Jahre lang währenden Kriege aufgeschrieben.
Schön vorgetragen von einem würdigen Mimen.
6. „Horribilicribrifax“ ein gar lustiges „Schertzspiel“ in mehreren Akten vom besagten schlesischen Poeten Gryphius verfaßt und in eine kurzweilige Szene kontrahieret von einem heutigen Dichtersmann. In diesem Schertzspiel von dem berühmten Kapitäne Horribilicribrifax von Donnerkeil auf Wüsthausen werden eingeführt als Redende:
[S. XX]
Zum Beginn und Abschluß des Stückes findet ein feierlicher Umzug der Akteurs über die Szene statt.
Gedächtnisfeier zur Erinnerung an den großen Certaldesen,
Giovanni Boccaccio
den Verfasser des „Dekameron“, den ersten Meister in der Kunst des Erzählens im Abendlande. (Er ward geboren vor fast 600 Jahren zu Certaldo im Florentinischen und starb daselbst am Tage der Lichtwende im Dezember anno 1375.) Dieses ist die Inschrift, die er auf sein Grab in der Stiftskirche St. Jacopo ebendort setzen ließ:
1. Worte zur Einführung,
gesprochen von Herbert Eulenberg.
[S. XXI]
2. Die berühmte Beschreibung der Pest zum Eingang des „Dekameron“.
Vorgetragen von einem guten Sprecher.
3. Etzliche Liebesfragen und ihre Entscheidungen, ein ergötzliches Gesellschaftsspiel, so in vornehmen Kreisen von Neapel und Florenz in jenen vergangenen Zeiten oft angestellt wurde. (Aus Boccaccios „Filocopo“, seinem Erstlingswerk.) — Liebesliedchen der Fiammetta.
Vorgetragen von einer jungen anmutvollen Schauspielerin.
4. Erzählung von dem Studenten, dessen Liebe von einer schönen Witwe böslich verschmäht wurde, welcher aber alsbald fürchterliche Rache an ihr nahm — eine bittere Warnung für alle spröden und tückischen Frauenspersonen. (Die 7. Novelle aus dem 8. Tage des „Dekameron“.)
Wiedererzählt von einem gleich
dem Studenten tollen Kerl.
„Ach, wer bringt die schönen Stunden
Jener Zeiten uns zurück?“
1. Introduktion.
Gesprochen von Herbert Eulenberg.
2. Suite für Violine und Spinett von Arcangelo Corelli: Praeludio. — Sarabande I. — Sarabande II. — Gavotte. — Adagio.
Ausgeführt von einer Violine und einem Spinett.
3. Lieder „An Chloë“. — „Warnung“. (Beide von dem [S. XXII] berühmten Wiener Meister W. A. Mozart.) — „Schäferlied“ von Jos. Haydn. — „Wiegenlied“. (Text von Weiße.) Musik vermutlich von Mozart.
Lieblich vorzutragen von einer Demoiselle.
4. Gedichte Hagedorn: Die Küsse. — Gleim: Triolet. — Der junge Goethe: Wirkung in die Ferne. — Wer kauft Liebesgötter? — Hölty: Die Lebenspflichten. — Das Kanapee. — Gellert: Die Widersprecherin. — Der betrübte Witwer.
Zu sprechen von einer spitzen Aktrice.
5. Flötenkonzert von Joh. Joach. Quant, Friedrich dem Großen zugeeignet.
Ausgeführt von einer Flöte,
einer Geige und dem Spinett.
Alt-Arie von Ritter Christoph Willibald Gluck.
Melodisch zu singen von einer Demoiselle.
7. Tänze aus der Zeit des Rokoko:
Am besten von zwei jungen Jungfern
in der Tracht jener Tage vorzuführen.
Diese Matineen, ich muß noch ein wenig von ihnen erzählen, wollten nicht mehr und nicht weniger als dem Volke an seinen Sonntagen den Gottesdienst ersetzen, der in seinen alten Formen den höheren Menschen heute nicht mehr Befriedigung geben kann. Sie vereinigten an jedem Sonntag ein zahlreiches Publikum unter dem Sockel eines großen Mannes zu einer schönen stillen Feier zu seinen Ehren, in [S. XXIII]seinen Manen die Gottheit achtend, die ihn uns schenkte. Denn uns Heutigen sind wirklich die gewaltigen oder zarten Künstler vor uns in der Musik, der Malerei, der Philosophie, der Staats-, der Bau- und der Dichtkunst zu unsern Heiligen und Schutzpatronen geworden, an denen wir uns im Glück erfreuen, im Leiden trösten können. „Du sollst keine anderen Götter haben neben ihnen!“
Dem Redner, der die Menge durch ein paar kurze einleitende Sätze zu dem Großen, dem die Feier galt, hinführen mußte, war mit Absicht von vornherein nur geringe Zeit von der einen Stunde gegeben, die im großen und ganzen allsonntäglich festgesetzt war. Am meisten galt es stets, den Heiligen des Tages selber zu Worte kommen zu lassen. Denn schließlich sind und sollen jedem die zehn schönsten Gedichte eines Mörike etwa lieber sein als die beste Rede oder Schreibe über ihn, und auch diese ganzen Aufsätze „über“ Künstler sollen eigentlich nur zur Beschäftigung mit ihnen selbst anregen. Durch diese kurze Frist für den Vortragenden war von Anfang an das Bildungsphilisterhafte, das sich solchen Feiern gern einmischt, möglichst ausgeschlossen. Es galt, sich kurz zu fassen, klar zu sein, Phrasen zu vermeiden und jedem, auch dem Laien in literarischen Dingen, verständlich zu bleiben.
So sind die meisten dieser Arbeiten entstanden. Es war mein Ehrgeiz, auch der breiten Menge, die während der Woche schwer arbeiten muß, Interesse für die Kunst abzugewinnen, ihnen eine Stunde lang Dichtungen als edle Arznei in ihrem harten Leben einzugeben, und Menschen, die nichts [S. XXIV]als Prosa treiben können, für die Künstler unseres Volkes und aller Zeiten begeistert zu machen und somit mein Teil an der Erziehung des Menschengeschlechtes mitzuarbeiten. Was dem Fachmann und Literaten darum an diesen Aufsätzen tadelnswert scheint, daß sie volkstümlich gehalten sind, daß jeder sie lesen kann, das — ich kann euch nicht helfen, ihr lieben Feinde! — das sollte ja gerade wiederum ihre Tugend und ihr Vorzug sein. Auch kam es nicht darauf an, wissenschaftlich genau und haarscharf dem Vorbild getreu meine Schattenrisse aufzuzeichnen, nein, diese peinliche und mühselige äußere Ähnlichkeitspinselei des Anstreichers mußte vermieden werden, wenn nur ein gutes, das Wesen des Modells wiedergebendes künstlerisch wertvolles Bild entstand. Je mehr der Maler von sich, von seiner Persönlichkeit oder — altmodisch gesprochen! — von seiner Seele in das Bildnis, das er in seinem Vorwurf vor Augen hat, hineinmalt, um so wertvoller, um so interessanter und um so ähnlicher wird zum Schluß das Bild geworden sein. Womit ich den Kleinigkeitskrämern das Aufstöbern von Ungenauigkeiten und Unrichtigkeiten in diesen Zeichnungen von vornherein versalzen möchte.
„Nun wohl,“ haben schließlich einige Kritiker gesagt, „wir wollen uns an den populären, simplen, leicht faßlichen Ton dieses Volkspredigers mit überlegenem Lächeln gewöhnt haben. Aber, um diese harmlosen Plaudereien, diese biblia pauperum in einem Buche öffentlich herauszugeben, dazu war wirklich kein Grund, dafür war wirklich kein Bedürfnis vorhanden. Vor allen Dingen fehlt bei dieser losen [S. XXV]Zusammenreihung von zufälligen Arbeiten das geistige Band, das sie zusammenhält. Sie stehen ungeordnet wie ein Stück Natur zusammen, Korn, Blumen und Unkraut, und sind nicht unter einen Hauptgedanken rubriziert und klassifiziert.“
Nun sind dies zwar Essaysammlungen niemals, denn das — verzeiht, verzeiht mir zum drittenmal, meine Widersacher! — ist eben ihr Wesen, daß sie, wenn sie in ein Buch zusammengefügt werden, unter einem Titel nebeneinander gedruckt werden. Ich wüßte wahrhaftig nichts anderes darauf zu entgegnen, außer etwa, daß meine Persönlichkeit das geistige Band ist, das diese Aufsätze zu einem einzigen macht. Für diese meine Persönlichkeit muß man sich daher freilich in etwa interessieren.
Aber ich merke zu meinem Schrecken, daß ich im Begriff bin, auch dieses zweite Vorwort dazu auszunutzen, mich und meine Person in den Vordergrund zu rücken, weil ich in dem Buche selbst gar keine Gelegenheit mehr dazu habe. Man verzeihe es mir darum in Gnaden, und wer, nach der Art vieler Leser, nur auf diesen letzten Satz in meinem Vorwort stiert, der muß es zur Strafe nun wirklich von vorne an lesen.
Kaiserswerth am Rhein.
Vor dem Winter 1909.
Herbert Eulenberg.
[S. XXVI]
Im Herbst 1910.
Dein Urheber.
[S. XXVIII]
Zwei Jahre später.
Im Herbst 1912.
H. E.
[S. 1]
Wer so ums Jahr 1520 herum abends zum Dämmerschoppen in der Stadt Nürnberg in das noch heute bescheiden an der Moritzkapelle klebende kleine Wirtshaus zum Bratwurstglöcklein einkehrte, der konnte dort vielfach drei heute weltbekannte Meister, pokulierend und sinnierend beisammen sitzen sehen: Peter Vischer, den Rotschmied und den Steinmeißler, Albrecht Dürer, den Maler, Holzschneider und Kupferstecher, und Hans Sachs, den Schuhmacher, Meistersinger und Poeten.
Diese drei Meister, die nach der Arbeit beim Schoppen Frankenwein oder beim Zinnkrug voll braunen Tucherbieres mitsammen saßen, der eine, Vischer, mit Kappe, Schurzfell und Werkzeug, so wie er aus seinen Gießhütten kam, der andere, Dürer, mit dem Christuskopf, das bleiche, etwas kränkliche Gesicht von dem langen gekräuselten Haar umrahmt, und neben ihm Hans Sachs, in der pelzbesetzten Schaube — „denn außer der Werkstatt muß man fein manierlich gehen!“ — diese drei Meister stellen die Renaissance in Deutschland dar. Und wenn uns ein Fremder fragt, wo in aller Welt habt ihr Deutschen denn euer Athen und euer Florenz, kurz eine Stadt, der man noch heute ansieht, daß hier eine Zeitlang einmal Kunst und Leben, Bürger und Künstler eines waren, so können wir ihn stolz auf Nürnberg als denkwürdigste Stätte einstiger deutscher Kultur hinweisen.
Wer sich mit dem dritten der drei Meister, mit Hans Sachs, [S. 2] beschäftigen will und durch die Wissenschaften an ihn heranzukommen sucht, der muß sich wie der, welcher in das von ihm zuerst beschriebene Schlaraffenland will, erst durch einen ganzen Staubberg von Gelehrsamkeit durchfressen, eh’ er das verschmitzt lächelnde Bild unseres Meisters vor sich sieht. Die Philologen, die bei uns bekanntlich bestimmen, was und wie uns etwas zu gefallen oder nicht zu gefallen hat, haben den Weg zu ihm und zu den Meistersingern, zu denen er zählt, durch einen Haufen von klugen Worten aus jener Zeit versperrt, als da sind: „Tabulatur, Gemerke, Hageblütweise, Schwarz-Tintenweise, Stollen, Vielfraßweise usw.“ Erst Goethe, unser größter Befreier aus Philisternetzen, bahnte sich über alle Wissenschaft wie der Märchenprinz zu Dornröschen mit einem bloßen Kuß einen einfachen Weg zu Hans Sachs, indem er als erster ihn wieder aufführte und dem Deutschen Theater, das damals kaum noch über Lessing hinausging, damit wieder eine Vergangenheit schuf.
Zu allgemeinem Jubel brachte er auf dem Theater zu Weimar Anno 1810 zum erstenmal wieder ein Fastnachtspiel Hans Sachsens, „das Narrenschneiden“, auf die deutsche Bühne.
Es darf hier wohl kurz daran erinnert werden, was oft vergessen wird, wie viel Goethe von Hans Sachs gelernt und angenommen hat. Nicht nur sprachlich hat er die Form des Nürnberger Meisters, den Knittelvers im „Faust“ übernommen. Auch in der Gestaltung seiner Figuren lehnt er sich an die Holzschnittmanier des Alten an, so daß man [S. 3]z. B. bei dem Fastnachtspiel „Der fahrende Schüler im Paradeis“ unwillkürlich an die Szenen zwischen Frau Marthe Schwerdtlein und Mephisto denken muß.
Richard Wagner ahnte vielleicht mehr, als er damals schon wissen konnte, welch ein großer Kerl Hans Sachs gewesen war, und setzte ihm in den „Meistersingern“ ein tönendes Monument. Denn ein bloßer „Vereins-Meistersinger“ — übrigens eine viel edlere Zunft als unsere heutigen Skat- oder Kegelbrüder — war Hans Sachs ebensowenig und soviel als Goethe Staatsminister war. Er hat, was sehr charakteristisch ist, seine Meisterlieder niemals drucken lassen, weil er etwas ganz anders und mehr als ein Meistersinger, weil er ein Dichter war, und wußte, daß das, was er nicht aus freien Stücken, sich selber zu Nutz und Frommen geschrieben hatte, nur Vereinstätigkeit war und die Nachwelt nichts anging. Übrigens wär’ es endlich einmal an der Zeit, die Meistersinger etwas von dem Fluch der Lächerlichkeit zu erlösen, der ihnen anhaftet. Es ist sehr schade, daß sich heute kein Musiker und vor allem kein Sänger findet, der geneigt ist, diese im gemeinen Sinn undankbaren Lieder und Weisen der Meistersinger vor dem gefährlichen Publiko vorzutragen. Man würde dann neben manchem Lächerlichen den rührenden Ernst anerkennen müssen, mit dem diese Enthusiasten um die Kunst beflissen waren, und gelegentlich auch die überlegene Schalkhaftigkeit. Denn diese Leute waren gar nicht so strohdumm, wie Richard Wagner des komischen Zweckes halber es uns weismacht.
[S. 4]
Zu diesen Dichtern von Beruf, die an Wintersonntagnachmittagen in den Kirchen Nürnbergs zusammenkamen, um dort nach gewissen Regeln, nach der sogenannten „Tabulatur“, dem poetischen Kontrapunkt, in deutscher Sprache zu dichten und zu singen, gehörte Hans Sachs nur als angesehener Bürgersmann seiner Vaterstadt. Als Dichter gehörte er vielmehr zu den fahrenden Leuten, die damals mit ihren Zeltbuden und Schwänken durchs Land zogen, für ein paar Wochen irgendwo dann Halt machten und allabendlich die ganze Stadt unterhielten. Für diese Schauspielerbanden, die damals das deutsche Theater zu Lehen hatten, schrieb Hans Sachs seine 85 Fastnachtspiele. Später schulte er sich eine eigene Truppe, durch die er seine Komödien darstellen ließ, und war Direktor, Regisseur und Schauspieler zu gleicher Zeit. Und alles das, ohne daß ihm die Kundschaft, die sich bei ihm Schuhe machen und reparieren ließ, davonlief. Er hatte nicht weniger Erfolg mit seinen Stücken als heute Kadelburg. Der Rat der Stadt sah ein, wie viel besser seine Komödien waren als die üblichen, ordinären Faschingsspäße, und traute ihm so viel Geschmack zu, daß er ihn mit der Zensur verschonte, und selbst die Kirche machte gute Miene zu seinen guten Spielen und überließ ihm — man muß sich das heute einmal vorstellen! — Kirchen und Klöster, mit seiner Truppe dort zu spielen.
Man darf nun von einem solchen Fastnachtspiel kein dramatisches Leben in unserem Sinne, keine Hatzjagd nach Überraschungen, keine fieberhafte Spannung erwarten. [S. 5]Man muß ein Hans Sachssches Fastnachtspiel geduldig und genau ansehen wie einen alten Kupferstich, um dann auf einmal zu entdecken, welch eine köstliche, feine Arbeit das ist, und wie sie auch im Kleinsten noch voll Leben steckt. Mit meisterhafter Sicherheit holt er mit seinem Grabstichel seine Figuren auf die Kupferplatte seines Theaters: die Bauern wie die bösen Weiber, Scholaren, Spitzbuben und Pfaffen, samt anderm menschlichen und mythologischen Gesinde.
Und je mehr Zeit wir ihm schenken, desto lieber und größer wird uns dieser prächtige alte Meister, der an der Spitze unseres ganzen deutschen Theaters steht, aufgehen.
Und wir werden ihn heute noch so laut und aufrichtig feiern können, wie Goethe ihn zu seiner Zeit verherrlicht hat!
[S. 6]
Vor der Uraufführung des „Kälberbrütens“ und des „Roßdiebs zu Fünsing“ gesprochen.
Diese beiden Spiele von Hans Sachs, das eine von dem Bauern, der aus Käse Kälber brüten wollte und das andere von dem Roßdieb zu Fünsing, einem Vorläufer unseres Hauptmanns von Köpenick, sind zuerst im Mai 1554 in der schönen Stadt Nürnberg in einem Zelt auf der Festwiese vor der Burg aufgeführt worden. Es war ein blau und weißer Frühlingsmittag, und die Sonne schien so lieblich, daß die Toten gern aus ihren Gräbern gestiegen wären, um eine Weile wieder lachend den Schwänken Hans Sachsens zuzuhören. Halb Nürnberg war an jenem Tage auf den Beinen: Würdige Ratsherren in prächtigen schwarzsamtnen Schauben, die wackeren Gildenmeister mit runden Bäuchen unter ihnen, Kaufleute, Handwerker, Bettler und viel junges Volk. Wie bei Faustens Osterspaziergang. Ganz alte, fast taube Leute hatten sich heute noch aufgemacht und fragten in den Pausen, die Hand ans Ohr gelegt, nach dem, was ihnen entgangen war. Auf der linken Seite vor der sogenannten Bühne saßen von den Männern getrennt die Frauen und lächelten, und hinter ihnen die Mädchen und kicherten. Hans Sachs trat aber zu Beginn des Spieles hervor und hub folgendermaßen an zu sprechen:
„Liebwerte Bürger und Stadtgenossen! Wollet auch heute wiederum gute Miene zu unserm Spiele machen. Insofern der heutige Frühlingstag viel zu schön ist, zum Schimpfen oder schief Maul ziehen, oder mit armem, fahrendem Volke zu hadern. Wir wollen auch diesmal — des dürft ihr gewiß [S. 7]sein! — unser Bestes geben, und der ist ein Lumpenhund, wie ihr wisset, der mehr gibt, als er hat. Wollet also nit zu viel verlangen, sondern bedenket, daß nicht Halbgötter, wie weiland zu Homeri und der alten Griechen Zeiten, auf der Bühne stehen, sondern schlichte Menschen mit Fehlern und Schwächen wie Hannes Holzschuher, Martin Behaim oder ich selber. Guckt also einem solchen Gesellen nicht allzu scharf aufs Maul und verarget es ihm nicht, wenn er sich einmal versprechen sollte — auch der Herr Bürgermeister kann einmal stolpern — oder ein Verslein falsch spricht — auch die Frau Bürgermeisterin kann einmal beim Strumpfstricken eine Masche fallen lassen.
„Wenn einer sein Handwerk ernst nimmt und nimmer denkt, daß er nicht noch besser in ihm werden könnte, soll man ihn nicht schelten. Und so ist es bei dem Maulwerk, so wir betreiben, auch bestellt. Wer aber zufrieden mit sich ist und sich für einen ausgemachten Meister hält, dem soll man einen Mühlstein und ein sattes Schwein an den Hals hängen und ihn in die Pegnitz werfen, dort, wo sie mehr denn zween Meter tief ist. Ich selbst, wiewohl ich schon über tausend Paar Stiefel geflickt und mehr denn 500 neu aus dem Leder geschnitten habe, halte mich noch nit für vollendet in dieser Kunst des heiligen Crispinus, vielmehr gucke gern noch manchem jungen Gesellen, der in Böhmen oder gar in Welschland gewesen ist, seine Sächelchen ab, wenn sie fein sauber sind. Vollends nun gar in der Reimerei oder der Pegasusreiterei, wie die alten Heiden sagten, bin ich aufs Lernen versessen wie ein junges [S. 8]Mädchen unter Zwanzig, so noch keinen Mann gefangen hat, aufs Tanzen. Lasse mir auch gern von jedem Mann und jeder Frau die Wahrheit sagen, selbst wenn es nur ein einfacher Bader ist, der mir den Bart rundschneidet oder ein altes Weiblein, das mir die gelb gewordenen Kragen wieder weiß wäscht. Nur muß es auch die Wahrheit sein, und nit bloß grobes, unmanierliches Zeug. Einem solchen Stoffel und Schimpfpeter, der seine Tage damit zubringt, unserm Herrgott die Fehler vorzuhalten, die er bei der Schöpfung gemacht hat, möchte ich am liebsten zeitlebens das Maul mit Senfpflaster zukleben oder ihm einen Papageien kaufen, der ihm bei Tag und Nacht in die Ohren schrie: ‚Schimpfen ist leichter als loben‘.
„So, liebe Stadtgenossen, wollt’ ich itzo, daß ihr die beiden Stücklein entgegennehmen möchtet, die Apollo, der Gott der Schalkheit, mir letzte Weihnachten, da ich zwei Tage lang meine Schusterwerkstatt schließen und auf den Dichterberg Parnassus klettern konnte, beschert hat: Nicht als das Gewaltigste, was je in Reime gebracht worden ist, noch aber auch als etwas allzu Geringes, wie etwa einen Bierschwank oder eine Sauposse, die ins rechte Ohr hineinschlüpft, um gleich aus dem linken wieder hinauszuspringen, und bei der man zuerst zwar lacht, aber gleich hinterdrein zu sich denken muß: ‚Alter Schafskopf, warum lachst du über solche Narrenspossen!‘ Sondern ihr sollt die Stücklein hinnehmen als zween Leckerbissen und in euer Gedächtnis einschließen wie zwo Goldstücke, die man später in Stunden der Not und der schlechten Laune noch hervorholen [S. 9]kann, um sich zu erheitern und wieder ein paar lustige Augenblicke zu machen.
„Seid auch heute nicht ungehalten, wenn wir ein Frauensmensch mit auf die Bretter bringen. Sintemal ich es für ein Mädchen nit für lästerlich halte, falls sie Witz dafür hat, zum fahrenden Volk zu gehen und mit den Mannsleuten um die Wette zu agieren. Solch eine dient Gott ebenso, wie eine, die gut spinnen kann, ihm am Rocken dient, und wenn auch die meiste Welt anderer Ansicht ist, kann ich doch von dem Glauben nit lassen und will ihn gegen den besten Vater und die fleißigste Mutter vertreten. Freilich, wer die Kunst, andere nachzuahmen und Menschenaffe zu sein, nicht versteht, der soll ruhig hinter dem Ofen oder dem Schraubstock bleiben. Denn der Dienst bei den neun Musen ist schwerer als bei einer zänkischen Herrin, und ich habe — das könnte ich mit den härtesten Eiden beschwören! — beim Reimschmieden viel mehr geschwitzt denn beim Schuhmachen.
„Aber des wollen wir heute nicht gedenken, vielmehr ein jeder sein Arbeit vergessen und lustig sein, wie es sich für einen Sonn- und Feiertag geziemt. Denn niemand weiß, wie es mit unsereinem nach dem Tode wird. Drum wollen wir, solange wir leben, bedenken, daß der Mund den Menschen um dreierlei Dinge gegeben wurde, um zu essen, um zu küssen und um zu lachen. Man kann nur drüber streiten, was das köstlichste von den dreien ist.
[S. 10]
Im Herbste 1667, vor mehr als 250 Jahren also, da am Pegel zu Köln, wenn es hoch kam, sechs Schiffe lagen und das Pfund Fleisch auf dem Markte noch ½ Silbergroschen kostete, setzte sich ein Trupp von schauspielernden Studenten zu Frankfurt an der Oder auf ein Treidelschiff, um sich den Fluß hinauf gen Glogau in Schlesien ziehen zu lassen. Sie waren von einem hochwohllöblichen Magistrat zu Glogau für insgesamt einen Taler, vier Neugroschen gemietet worden, um den 45. Geburtstag des hochgeachteten Bürgers und Syndikus der Stadt, Andreas Gryphius, durch Aufführung und Wiedergabe eines seiner Schaustücke zu honorieren, zu illuminieren und zu personifizieren. Als sich das Schiff in Bewegung setzen wollte, kam noch der Komödiantenmeister mit einem großen Sack auf dem Rücken angekeucht, enthaltend niederländische Koller und ein paar verrostete Stoßdegen, so er alles bei einem Althändler zusammengeramscht hatte. Man zog ihn und die Theatergarderobe auf das Schiff, und sobald man die Schnupftücher der Nachwinkenden aus den Augen verloren hatte, begann man die Getreidesäcke, die als stummes Gut mit nach Glogau verfrachtet waren, beiseite zu schieben und auf dem Verdeck des Schiffes unter freiem Himmel Probe abzuhalten. Der Mensch, zumal wenn er Student und Schauspieler ist, hat im allgemeinen die Eigenschaft, erst kurz vor dem Examen oder der Aufführung zu lernen anzufangen. Von diesem Brauch wich [S. 11]auch unsere Frankfurter Studententruppe um keines Haares Breite ab, und es stellte sich bald heraus, daß keiner von ihnen, um nicht die andern etwa zu beschämen, mehr als gar nichts gelernt hatte. So begann man denn mit Feuereifer von früh bis spät an dem Stück „Horribilicribrifax“, einem Scherzspiel in fünf Begebenheiten, das der Glogauer Magistrat aus den Stücken des Meisters zur Aufführung auserkoren hatte, zu probieren: Die Wolken am Himmel und die Weiden an den Flußufern sahen ihrem tollen Treiben lachend zu, die Getreidesäcke als stumme Passagiere gähnten und dachten bei sich: „Mit welch dummem Zeug die Menschen doch ihr Leben hinbringen!“, und die Matrosen, die anfangs vermeinten, einen Haufen Affen an Bord zu haben, verstanden nach und nach, um was es sich handelte, stahlen sich nach Möglichkeit von ihrer Arbeit fort und hielten sich den Bauch vor Lachen beim Zusehen. Die Treidelpferde aber zogen mit gesenkten Ohren auf dem Leinpfad das Schiff stromaufwärts und bedauerten sehr, daß sie nicht Menschen geworden waren.
Drei Tage und vier Nächte dauerte die Fahrt, zu der man heute drei Stunden braucht. Um die Abenddämmerung kam man endlich vor der alten, mit verwitterten Türmen umstandenen Stadt Glogau an. Die schwarzen Festungsmauern, die wie alte bärbeißige Polizisten rund um die Stadt herumliefen, guckten verschlafen aus dem Herbstnebel heraus. Eine einzige bunte, den Schweden abgenommene Fahne hing aus einer Schießscharte und sagte den Komödianten: „Guten Abend!“ Die kehrten in die [S. 12]Herberge zum „König von Polen“ gleich am Hafen ein, die ihnen von den Schiffern als wohlfeil empfohlen war, und in der je drei in einer Bettstelle schlafen mußten. Aber da die Wanzen schon ihre Winterquartiere bezogen hatten, gab es für sie alle eine friedliche Nacht.
Am andern Morgen in der Frühe besichtigten unsere Spieler zunächst das Zelt und die Bühne, auf der sie vor dem Magistrat und Volk zu Glogau ein Zeugnis ihrer Kunst ablegen sollten. Sie machten flugs einen alten Leiterwagen zur Garderobe zurecht, schnitten denen unter ihnen, die Frauen darstellen mußten, die Bärte, die während der Schiffahrt lang gewachsen waren, aus dem Gesicht und borgten sich aus der Festung eine dicke Trommel, um hinter der Szene donnern zu können.
Dann machte sich der Prinzipal der Truppe in seinem besten französischen Rocke auf, um zunächst den Magistrat und hernach den hochachtbaren Syndikus Andreas Gryphius selber aufzusuchen. Sein Weg führte ihn mitten durch die Stadt, wo es gar elend und erbärmlich aussah. Die Kriegsfurie, die dreißig Jahre lang in Deutschland geschaltet hatte, war auch mit Glogau nicht anders denn wie ein roher Viehtreiber umgegangen. Die meisten Häuser standen noch heute, neunzehn Jahre nach dem Friedensschluß, leer, und man hörte am hellen Mittag die Ratten drin rumoren. Schutt lag auf den Straßen, die Kirchen waren kahl und ausgeraubt, und der Pfarrer hätte alle Sonntage über den Text: „Und die Erde war wüst und leer, und es war finster auf der Tiefe!“ predigen können. Die [S. 13]paar Menschen aber gingen zwischen den verfallenen Häusern stumm und ernst herum wie Statisten, die Trauer, Armut und Verzweiflung darstellen sollen.
Mitten in dieser Illustration zu einer Prophezeiung des Jeremias sah das alte schiefe Patrizierhaus des Syndikus Gryphius fast fürstlich aus. Unser Komödiantenmeister klopfte denn auch unter einem feierlichen Gefühl mit dem Türringe an und ließ sich stumm wie eine Seele über den Acheron durch den finstern Flur zum Studierzimmer des gelehrten Poeten geleiten. „Introite!“ rief eine feine Stimme. Aber es dauerte lange Zeit, ehe der Komödiant den Kopf, der zu dieser Stimme gehörte, erblicken konnte. Hinter einem hohen Haufen von Folianten und Pergamenten und Quadranten unter einer schweren, riesigen weißlockigen Perücke saß der hochgelehrte Andreas Gryphius, eine Hornbrille auf der Nase und eine Gänsefeder in der Hand, und sann über einen Reim auf „Menschen“ nach. Sein Gesicht war ganz gelb, denn die Leber drückte ihn heute noch mehr als sonst. Seine schneeweißen Hände zitterten vor Frost trotz der Pelzstauchen, die er über den Pulsen trug. Aber seine Augen blickten den Hereinkommenden fest und tief an, wie die Augen eines Mannes, der viele Länder und viele Leiden gesehen hat, und der weiß, daß er nicht mehr lange Zeit zu leben hat.
Es war dem Syndikus gar nicht recht, daß der Magistrat gerade dies lustige Stück von ihm zur Repräsentation gewählt hatte. Viel lieber wäre es ihm gewesen, man hätte eines seiner Trauerspiele inszeniert, in denen die Menschen [S. 14]in Alexandrinern sprachen und es zum Schluß auf ein paar Leichen mehr oder weniger nicht ankam, wenn nur die Moral siegreich blieb, Trauerspiele, in denen das Blut dick über die Bühne floß, in denen die Helden noch im Sterben reimen konnten, und in denen „die Parzen“ — so nannte er die Chöre — in edler und erhabener Sprache Verse über die Vergänglichkeit wie diesen deklamierten:
Aber der schlaue Magistrat von Glogau hatte folgendermaßen kalkuliert: „Ein Hanswurst oder Pickelhering kommt in keinem Stück von Andreas Gryphius vor. Ergo fällt die Hauptattraktion für das Publiko von vorneherein fort. Lassen wir nun gar ein trauriges Stück unsers Syndikus agieren, so kommt uns nicht einmal ein Jude herein, und wir müssen unser Stadtsäckel öffnen, in dem nicht mehr denn etliche lumpige Dukaten miteinander Verstecken spielen. So wir aber ein Scherzspiel des Poeten, etwa den ‚Horribilicribrifax‘ figurieren lassen, werden mehr als hundert zahlende Leute kommen, und wir können von etwaigem Überschuß sogar unser Ratszimmer neu kälken lassen.“
So ward denn der „Horribilicribrifax“ zum Jubel der halben Stadt — denn die Frauen durften damals nicht mehr zu solchen Spielen gehen — angesetzt, und Gryphius [S. 15]selber sagte schließlich dem Komödiantenmeister, nachdem dieser ihm feierlich versprochen hatte, ein paar ernste Lieder des Dichters vor dem Theaterspiel sprechen zu lassen, sein Erscheinen zu. Und er kam pünktlich um die Stunde, da es beginnen sollte, und ward mit vielen Zeremonien, während das Volk „Vivat“ schrie, oben auf die Bühne geleitet. Dort saß schon der ganze Magistrat versammelt. Der Bürgermeister hielt eine lateinische Rede auf den „divus Andreas“, in der Gryphius trotz seiner Rührung leise 14 Fehler konstatierte, und das Spiel begann. Und wie nun der gelahrte Dichtersmann seine bunten Geschöpfe auf den Brettern herumspringen und -stelzen sah, da vergaß er auf einmal seine Leberschmerzen und seine Feierlichkeit und lachte mit den andern um die Wette, daß ihm die runden Tränen aus seinen meist ins Papier vergrabenen Augen schossen.
Und wenn wir ihm heute wie damals seine Mitbürger am Schlusse der Feier einen Lorbeerkranz auf die Perücke setzen, so wird er uns wie seinen Glogauern nicht verargen, wenn wir nicht mehr mit ihm weinen, sondern nur noch mit ihm lachen können. Das aber soll ihm nie vergessen werden, daß dieser Schlesier überhaupt der einzige gebildete Mensch und Dichter von bleibender Bedeutung gewesen ist, der sich zwischen Hans Sachs und Lessing mit dem deutschen Theater und damit mit unserer Kultur befaßt hat.
[S. 16]
Man kann an das Leben Lessings wie an das Mozarts nicht denken, ohne dabei vor Scham sich zu wünschen, lieber Botokude als ein Deutscher zu sein. Auf seinem Denkmal zu Braunschweig steht mit großen Buchstaben: „Dem großen Denker und Dichter das deutsche Vaterland“. Auf seinem Antlitz stand, da er noch lebte, mit kleinen Falten geschrieben: Undank, Verbitterung, Ekel, Ingrimm, Wehmut und Verachtung. Und wenn er gleich Mozart, dem er mit seinem Humor in den Augen ähnlich sah, über die Menschen, wie der Mond über die Hunde, lachen konnte, wenn er auch in seltenen lichten Momenten vor seinem inneren Auge das bewußte Denkmal in Braunschweig mit der pompösen Inschrift erschaut hat: Dies Lachen Lessings und Mozarts tut mir weher, als wenn ich von dem Elend Deutschlands nach dem Dreißigjährigen Krieg oder unserer Niederlage bei Jena lese.
Lessing hatte von vornherein ein schwarzes Los gezogen, da er sein Leben in der Hauptsache dem deutschen Theater widmete. Schon als Student von achtzehn Jahren studierte er zu Leipzig für Theologie lieber Theatrologie und verkehrte statt mit dem heiligen Paulus mit Madame Neuberin, die dort zum erstenmal den deutschen Thespiskarren festgebunden hatte, und mit den verwegensten und besten Mitgliedern ihrer Truppe. Damals waren die Schauspieler noch nicht wie heute gute, solide Bürgersleute mit reinen Stehkragen, biederen Manieren, kleineren Orden, bezahlten [S. 17]Rechnungen, großen Gagen, die gleich nach dem Theater zu Bett gehen, in Gesellschaften nach dem Pudding ein paar Gedichtchen vortragen, und die man, wenn sie sich die Bärte wachsen ließen, ruhig mit Gerichtsassessoren verwechseln könnte. Nein, zu jener Zeit waren meist Kerle dabei, mit denen man nicht gern allein bei Nacht eine Stunde Wegs gegangen wäre, Kerle, die, wenn sie sich gezankt hatten, nicht zum Richter liefen, sondern sich ein paar um die Ohren schlugen und dann gerührt einander in die Arme fielen, die den Karl Moor aus innerer Erfahrung spielten und einen Umweg um jeden Polizisten machten, die es für ein Verbrechen hielten, Schulden zu zahlen, und darum gar kein Geld nötig hatten, die eine heisere Kehle mit Branntwein und nicht mit chlorsaurem Kali heilten, und deren Leben schnell und prasselnd wie eine Pechfackel, nicht ruhig und musterhaft wie eine Kirchenkerze, zu Ende brannte.
Man kann sich vorstellen, was aus dem würdigen Gesicht des Vaters Lessing, des ehrwürdigen Pastor Primarius und Diakonus zu Kamentz wurde, als er von diesem ruchlosen Umgang seines Sohnes erfuhr. Er sah aus wie der fünfte Akt eines Trauerspiels, wenn die Katastrophe heranbricht. Er hielt seinen Sohn schon für so radikal böse, daß er glaubte, er würde kaum mehr aus des Satans Klauen zu reißen sein. Gleichwohl wollte der fromme Vater alles noch mögliche versuchen und ersann eine — wie man in solchem Falle zu seinem Gewissen sagt! — Notlüge. Er schrieb dem Sohne, die Mutter sei schwer erkrankt, und [S. 18]wenn er ihr noch einmal, bevor sie ins Himmelreich käme, und so weiter. Drei Tage darauf, mitten im eiskalten Januar 1748, erschien der gehorsame Sohn, Stipendiat und Student der Gottesgelahrtheit vor seinem Vater.
Der war ganz erstaunt, daß dem Jungen bei seinem Verkehr mit der Theaterwelt noch kein Pferdefuß und keine Hörner angewachsen waren, und lachte dann den vor Schrecken und Frost Halbtoten tüchtig aus. Zum Abschied aber gab er dem jungen Theaterdichter folgende gute Lehre mit nach Leipzig: „Häng er sein Herz nicht an die Bühne, mein Sohn! Es wird ihm nimmerdar zum Segen gereichen. Wenn es ihn nach einem Spiegel gelüstet, darinnen er sich beschauen möchte, so blick er in die Bibel hinein, oder schließe sich in sein Kämmerlein und halte dort eine stille Parade ab über sein Herz. Finito, und zur Hauptsache: Geh er nicht mit Komödianten um, mein Sohn! Man wird es ihm niemals Dank wissen, und er wird dessen nimmer froh werden! Der kleinste Schauspieler dünkt sich mehr, als er, Gotthold Ephraim Lessing, in seinen besten Stunden. Wenn er durchaus reimen und auf dem Pegasus traben muß, so verfertige er Lieder wie dieser Gleim, oder Hexameter, wie der fromme Klopstock, oder hübsche Fabeln, wie jener Gellert zu Leipzig sie machen soll, oder meinethalber auch ein paar gute Sinnsprüche nach der Weise des seligen Logau. Aber um seiner Seele willen fang er keinen Handel mit Schauspielern an! Ich möchte ihn lieber — Gott verzeih’ mir! — nicht auf die Erde gesetzet haben, wenn ich dies wüßte. Oder ich möchte lieber — Gott, verzeih’ [S. 19]mir noch mehr! — itzt einen Knüppel nehmen und ihn damit so lange vor den Kopf schlagen, bis er tot wäre, um ihm den Ärger zu ersparen, der ihn sonst vor der Zeit gelb färben wird. Eher möchte ich unsern Schweinen Lateinisch beibringen, als meine Verse den Schauspielern, und es dünkt mich ehrenvoller, Türklinke an einem schlechten Hause als deutscher Theaterdichter zu sein!“
Aber der junge Lessing war schon so von dem Theaterfieber besessen, daß die Warnungen seines Vaters von einem Ohr zum anderen spazierten, ohne daß ein Wort in seinem Kopfe kleben blieb. Er fuhr nach Leipzig zurück und opferte sein Blut und sein ganzes Genie, das er hatte, dem deutschen Theater. Er schrieb „Minna von Barnhelm“, „Emilia Galotti“ und „Nathan den Weisen“. Er wurde der erste deutsche Dramaturg und widmete ein ganzes Jahr seines kurzen Lebens dem Hamburger Theater. Er wollte ein Gleiches für Mannheim tun, wenn er dort nicht schlechter als der Portier bezahlt werden sollte. Er vertrieb die Franzosen von der deutschen Schaubühne mit derselben Tapferkeit und Unerschrockenheit, wie sie Blücher fünfzig Jahre später an der Katzbach bewies, und Corneille war kein schwächerer Gegner als Napoleon. Er öffnete das deutsche Theater für Shakespeare und war damit Anlaß, daß über hundert Jahre lang bis heute dieser größte Dichter bei uns häufiger als in England aufgeführt wurde. Er bewies schließlich mit seinen eigenen Stücken, daß man nicht durchaus ein Ausländer sein muß, um in Deutschland aufgeführt werden zu können, und kam nach allem [S. 20]Schaffen und Ärger, wie der Alte prophezeit hatte, zu der sauren Erkenntnis, daß das deutsche Theater ihm immer fatal gewesen, und daß er sich nie, es sei auch noch so wenig, habe damit bemengen können, ohne Verdruß und Unkosten davon zu haben.
So mußte er, der Freiesten einer, die je gelebt haben, einer, der eher seine Zunge aufgegessen als eine Schmeichelei gesagt hätte, Fürstendiener werden, und ward für 600 Taler im Jahr als Bibliothekar des Erbprinzen von Braunschweig angestellt, während die Mätresse des alten Herzogs 60000 Taler pro Anno verschlang. „Arm wie Lessing“ heißt es noch heute in Wolfenbüttel von einem, der drei Fastentage in der Woche feiert, und dessen Hosenböden glänzen. Dazu kam, daß Lessing nicht weniger Unglück in seinem Leben wie im Spiel hatte und mehr als Hiob und Lazarus zusammen. Er hatte einen Freund, Ewald von Kleist: der ward ihm in der Schlacht von Kunersdorf erschossen. Er hatte einen Monarchen, den er verehren mußte, Friedrich den Großen: er ward von ihm völlig ignoriert und jedem hergelaufenen Franzosen nachgesetzt. Er hatte eine Frau, die er liebte wie Tellheim seine Minna: er besaß sie nur ein Jahr. Er hatte einen Sohn, auf den er sich unbändig gefreut hatte: der lebte nur ein paar Stunden und riß die Mutter mit ins Grab. Schließlich war er in die Wahrheit vernarrt und verdarb es dadurch mit den meisten Menschen, denen mehr an einem guten Frühstück als an der Wahrheit gelegen ist. Die Professoren konnten ihm nicht verzeihen, daß er die alten Sprachen besser als sie verstand, und die Pastores grollten [S. 21]ihm, weil er Christen, Juden und Mohammedaner gleich selig pries und vor nunmehr hundertunddreißig Jahren erklärte, daß Gott alle Konfessionen gleich liebhabe. Man war daher allgemein froh als Lessing starb und nicht älter als einundfünfzig Jahre wurde, denn er hätte schließlich alles gutgemacht, was Fanatiker bis damals Übles angerichtet hatten. In den Armen eines dankbaren Juden, für den er, als man ihn wie üblich malträtieren wollte, sich beim Herzog verwandt hatte, und der ihn hielt, als der Todeskrampf ihn schüttelte, ist Lessing gestorben. Er war der erste, der ausging, den Deutschen ein Nationaltheater zu schaffen, und nur Juden an seinem Wege fand.
Er starb so arm, daß der Herzog von Braunschweig ihn auf Staatskosten bestatten lassen mußte. Die Pferde, die bis dato nur dumme Prinzen zu Grabe gefahren hatten, waren ganz stolz über die Ehre, die ihnen widerfuhr. Die Erben Lessings bekamen zehn Tage später ein Reskript von der herzoglichen Kasse, daß Lessing, der im Vorschuß gewesen sei, durch seinen Tod einschließlich der Beerdigungskosten dem Herzog einen Verlust von 361 Talern verursacht habe, die allergnädigst nachgelassen würden.
Auf allen deutschen Bühnen wurden Trauerfestlichkeiten um ihn abgehalten, und der große Schröder in Hamburg sagte schluchzend zu seinen Schauspielern: „Lessing ist tot. Laßt euch begraben, Kinder!“ Goethe und Schiller aber, deren besonderer Gläubiger er war, schrieben ihm auf den Leichenstein:
[S. 22]
An einem schönen Maiabend des Jahres 1772, als die Sterne schienen, die Frösche quakten, die Hunde an der Kette sich mit dem Mond zankten und die Bürger zum erstenmal probierten, wie das Bier auf offener Straße schmeckte, brachte die Post, die alle Tage von Gießen nach Wetzlar humpelte, einen für einen Gerichtspraktikanten, wie man ehemals die Referendare nannte, höchst seltsam aussehenden jungen Menschen in das friedliche Städtchen, in dem zu jener Zeit das Reichskammergericht in den letzten Zügen lag. Er trug einen damals modischen blauen Frack nebst gelber Weste, dazu eine buntseidene Hose und hohe braune Stulpstiefel. Den Hut hatte er unterwegs verloren oder zu den Sternen in die Luft geworfen, und so sah man, daß er schöne braune Locken auf dem Haupte hatte, unter denen zwei schwarze Augen leuchteten, die so groß waren wie die Räder der Postkutsche, die ihn durch die steilen Gassen von Wetzlar fuhr. Vor dem Gasthof zum Kronprinzen, dicht an dem riesigen, grauen Dom, in dem noch heute wie damals links die Katholiken und rechts die Protestanten in seltener Eintracht zum lieben Herrgott beten, hielt der zitronengelbe Postwagen an, nachdem er zuvor noch einmal über einen dicken Prellstein gehopst war, daß dem armen Rechtspraktikanten schier die Eingeweide aus dem Munde gesprungen wären.
Gleich trat der Wirt wie aus „Minna von Barnhelm“ eilfertig aus dem Hausflur heran, schwatzte über das [S. 23]schöne Wetter und das beschwerliche Reisen, wobei er im stillen abschätzte, in welches Stockwerk er den Fremden unterbringen sollte. Dann nahm er ein Windlicht zur Hand, trieb den Hausknecht mit „Allez! Allez!“ zum Gepäck, um zu zeigen, daß er auch französisch schimpfen konnte, und geleitete den Rechtspraktikanten aus Frankfurt — das hatte er schon in der ersten Minute herausgefragt — in ein niedriges, blau gestrichenes Zimmer, in dem ein Riesenbett, ein Schrank und eine Waschkommode sich im Mondschein kichernd über Wetzlars Vergangenheit und die Eigenheiten der Durchreisenden unterhielten. Der Rechtspraktikant ohne Hut und mit den großen Augen schaute sich das alles mit einem kurzen Blick an, als hätte er es schon tausendmal gesehen, streute ein paar Veilchen, die er unterwegs gepflückt hatte, auf das Bett, um sich nicht zu einsam vorzukommen, lehnte den Kopf zum Fenster hinaus, blickte zum Dom und zu den Sternen und wartete träumend, bis man ihm sein Abendbrot heraufbringen würde. Dazwischen schritt er ein paarmal im Zimmer auf und ab, redete mir nichts dir nichts den Schrank an, der ob dieser schnellen Vertraulichkeit gravitätisch sich in seinen Fournieren zusammenzog, oder sprach wie ein Verliebter ein paar sinnlose Verse vor sich her, so daß die Stubenmagd, die draußen am Schlüsselloch stand, ganz entsetzt in die Küche lief und schrie: „Gott sei bei uns! Es ist ein Schauspieler!“
Zu allgemeinem Erstaunen ließ er sich dann, als er sein Essen und zwei Flaschen Rotwein heruntergestürzt hatte, noch den Torschlüssel geben, obschon die Domuhr grade [S. 24]zehnmal „Nein!“ schlug, und rannte dann ohne Hut durch das schnarchende Städtchen, um wie weiland Diogenes eine Menschenseele in Wetzlar zu finden. Der Nachtwächter der freien Reichskleinstadt aber sah ihn in jener Nacht an drei Orten: Zum ersten Male wie er unten an der Mühle in der Lahn badete und sich dabei, ohne sich zu schämen, vom Mond bescheinen ließ, zum anderen, wie er am Brunnen vor dem Tore sich mit einem alten Salamander, der dort seit 1500 hauste, über Shakespeare unterhielt, und zum dritten Male, wie er beim Zurückklettern über die Stadtmauer zwei andere Rechtspraktikanten traf, die vom Liebchen heimkamen und ihn mit in eine Weinstube zogen, um auf die Gesundheit des schwindsüchtigen Heiligen Römischen Reiches einen Kanon zu singen. Um drei Uhr in der Frühe, als die Hähne schon anfingen, ihr Organ zu üben, kam der junge Fremdling vor die Türe seines Gasthauses. Aber da er den Torschlüssel längst verloren hatte, mußten sie zu dreien erst eine Katzenmusik anstimmen, bis der Wirt mit der Nachtzipfelmütze ihm öffnete und ihn in sein Gemach geleitete, das ihm ein höchst vorwurfsvolles Gesicht schnitt. Aber der junge Herr lachte es aus, warf seine Stiefel dem entrüsteten Schrank vor den Kopf, sprang ins Bett und weinte sich über einen Band Klopstockscher „Oden“, der stets auf seinem Nachttisch lag, langsam in seligen Schlaf.
Von da an sah man ihn alle Mittage im „Kronprinzen“ zu Wetzlar in der Tafelrunde, die sich dort um den Herrn von Goué, einen gutmütigen alten Sonderling, als König [S. 25]Artus versammelte und Allotria trieb. Es waren lauter „Originalgenies“, wie man sie damals nannte, die da herumrumorten und über dem guten alten Städtchen krächzend wie die frechen Krähen einherflogen: Junge Burschen, die, wenn man sie fragte, was sie werden wollten, einen Lachkrampf bekamen, oder denen es einfiel, plötzlich auf der Straße auf einem Bein zu stehen oder mit den Zähnen zu fletschen oder einem alten Weib die Zunge herauszustrecken. Und ältere Knaben waren darunter, die erklärten, solange Friedrich der Große lebe, brauche kein anderer Mensch in Deutschland etwas zu tun, und die Frauen seien nur dazu da, um Hosenknöpfe anzunähen und Heringe einzumachen, und der Wein sei die bequemste Weise, um ins Paradies zu kommen. Zwischen beiden, dem Gemüt und der Gesinnung nach gleichen Parteien, bewegte sich der neuhinzukommende Rechtspraktikant aus Frankfurt so vergnügt, als sei er unter solchem trinkfesten, aber charakterschwachen Gesindel zur Welt gekommen. Seine Tante — denn wie jeder gute Bürgerssohn hatte auch er in allen größeren Städten 50 Meilen um seine Vaterstadt eine Tante wohnen! — war ganz empört, als sie ihren Jungen, noch dazu mit augenscheinlichem Behagen unter jenen Räubern entdeckte. Mit Ingrimm sah sie ihn jedesmal, wenn man an dem düsteren Gebäude des Reichsjammergerichts vorüberkam, ein Kreuz schlagen, als säße der Teufel darinnen, und hörte mit Seufzen beim Morgenkaffee die Moritaten ihres Herrn neveu aus der vergangenen Nacht erzählen.
Plötzlich nach ein paar Wochen ward es mit einem Male [S. 26]ganz ruhig um den jungen schönen Mann aus Frankfurt. Er saß wohl noch bei der Tafelrunde alle Mittage im „Kronprinzen“, aber es war, als habe er nur seine Hände, seinen blauen Frack und seine gelbe Weste dahingesandt und lachte nur in effigie mit, wenn der alte Herr von Goué Unsinn erzählte. In Wirklichkeit lief der Jüngling immer, ob er nun saß, trank oder schlief, um ein kleines Haus in der Stadt herum, das „Deutsche Haus“, in dem die Tochter des Amtmanns Buff als Braut des würdigen Herrn Johann Christian Kestner lebte. Sobald er allein war, konnte er nur „Lotte“, nichts als „Lotte!“ flüstern, ihr Schattenbild trug er immerfort in der linken Brusttasche über seinem Herzen, und nachts hing er es an die Wand über sein Bett, damit er es beim ersten Augenaufschlagen sehen könnte. Kestner, der Bräutigam, dem er sich anvertraute, konnte es gar nicht fassen, daß man so lieben konnte. Er verstand darunter nur, ein bis zwei Jahre verlobt zu sein, bei Tisch nebeneinander zu sitzen, sich angesichts des Vaters täglich einen Kuß zu versetzen, zu heiraten und Kinder zu bekommen.
Wollte dieser junge Mensch denn eine neue Art sich zu lieben in Deutschland entdecken? Lotte selber ahnte nicht, was das war, sie glaubte, das Fieber zu bekommen in seiner Nähe, sie konnte ihm nicht gehören und mußte doch immer weinen, wenn sie seiner gedachte, und sie wußte nicht ganz genau, ob sie ihn das einemal, da er sie geküßt, nicht vorher leise wiedergeküßt hatte, ehe sie ihn von sich stieß. Jede Nacht in Wetzlar aber sah den [S. 27]Jüngling nicht mehr wie noch vor wenigen Wochen lachend und jauchzend durch das Städtchen rennen, sondern schaute ihn, mit der Pistole in der Hand zwischen Leben und Tod schwankend von Schatten zu Schatten flüchten, und noch heute glitzern am Abend alle Bäume in Wetzlar von dem Tränentau jenes Unglücklichen, und es ist dann, als ob sein Schmerz noch die ganze Stadt überschatte. Diese gräßliche Unentschiedenheit währte bis zu dem Morgen, da der junge Rechtspraktikant ohne Abschied zu nehmen — Kestner und die Tante waren ganz verwundert darob! — Wetzlar verließ, die Pistole in die Lahn schleuderte und ins Leben weiter seine Straße zog und aus seinen dortigen Abenteuern den Roman „Werthers Leiden“ wob, mit den erschütternden Schlußsätzen, die wie Hammerschläge klingen, mit denen man einen Sarg zunagelt.
Aus diesem jungen Rechtspraktikanten wurde später der Geheime Legationsrat Goethe zu Weimar, der noch viele Lieben und Krankheiten überstehen und alles, was ihm je teuer war, überleben mußte, bis er als Greis als größter Dichter Deutschlands nach Walhalla zu den germanischen Göttern entrückt ward.
[S. 28]
Jeder Deutsche von Bildung, der einen Sohn hat, sollte vom Augenblick seiner Geburt an jeden Tag einen Groschen für ihn zurücklegen, auf daß er ihn, wenn er zwanzig Jahre alt geworden, eine Reise durch Italien machen lassen könnte. Denn Italien ist noch heute das komplementäre Land für einen jeden von uns, und was uns unsere Schulen und Universitäten schuldig bleiben, das wird uns Florenz und Rom in müheloser Schönheit lehren. Goethe, dessen halbes Wesen italienisch ist, war 37 Jahre alt, als er zum erstenmal über den Brenner fuhr. Es war ihm zumute, als sei er in Italien geboren und erzogen worden und käme nur von einer Grönlandfahrt zurück. Die zwei Jahre, die er in Italien und in Rom zubrachte, hat er die glücklichsten Jahre seines Lebens genannt, und die vierzig grauen deutschen Jahre, die dieser Reise folgten, hätte er nicht so ertragen, wenn er nicht diese Bilder in der Erinnerung gehabt hätte. Ein junger Maler vom Rhein, der damals Studien halber in Rom lebte, hat Goethe dort kennengelernt und hat ihn in einem bisher unbekannt gebliebenen Briefe an seine Eltern folgendermaßen beschrieben:
„Ihr könnt Euch nicht denken, wie enttäuscht ich zu Anfang war, als mir der berühmte Verfasser des ‚Werther‘ präsentiert wurde. Es war in Trastevere, auf dem rechten Tiberufer, nahe bei der herrlichen Kirche Santa Maria. Man hatte dort beim Arbeiten an dem Brunnen auf [S. 29]dem Platz vor der Kirche eine antike Statue gefunden, und eine kleine Künstlergesellschaft hatte sich von der Stadt aus frühmorgens aufgemacht, um den Fund an Ort und Stelle zu betrachten, ehe er versteigert wurde. Tischbein hatte Goethe mitgebracht, und so konnte ich, der ich mit Angelika Kauffmann hinausgepilgert war, den berühmten Mann nach Herzenslust betrachten. Außer seinen ungewöhnlich großen Augen fiel mir erst nichts Sonderliches an ihm auf, es sei denn, daß er äußerst schweigsam war und sich das Werk nur stumm betrachtete, während alle anderen, voran zwei junge Bildhauer aus Berlin, laut schreiend Vermutungen über Gegenstand und Alter der Bildsäule anstellten. Es schien ihn zu genieren, daß wir jüngern ihm gelegentlich neugierig auf den Mund starrten, wie die Priester zu Delphi auf die Pythia, voll Erwartung, welche Worte der Weisheit herauskommen würden. Er tat uns aber den Gefallen nicht, sondern hörte nur ganz gespannt auf das, was die anderen, insonderheit Tischbein, von sich gaben. Wie mir denn überhaupt dieses an Goethe auffiel, daß er gleichsam vier Augen und vier Ohren am Kopfe hat, mit denen er alles, was um ihn ist und vorgeht, in sich hineinfrißt.
Erst als wir ihn und seine ganze Berühmtheit beinahe vergessen hatten, wurde er mitteilsamer. Es war beim Imbiß, den wir in der bescheidenen Trattoria neben der Kirche unter freiem blauem Himmel einnahmen. Ich kam zufällig neben ihn zu sitzen, und da ich unversehens mit dem Wein einen roten Flecken auf das weiße Tischtuch machte, [S. 30]zog er mich väterlich bei dem Ohre, und zwar so schelmisch, daß ich ihm nicht böse sein konnte. Es schien mir, als ob ein großes Kind in diesem Manne stecke, das nur, um nicht mehr aufzufallen und ausgelacht zu werden, sich ein steifes, würdiges Wesen zurechtgelegt hatte.
Nachher geriet, ich weiß nicht wie, die Unterhaltung auf den erhabenen Michelangelo, und da wurde auf einmal mein Nachbar so lebendig, wie unsereins nicht nach zwei Flaschen Frascati. Er meinte, angesichts eines solchen Künstlers müsse man eigentlich Pinsel und Feder vergraben. Man könne nichts Besseres schaffen als dieser, und man müsse ihn ganz vergessen wie das Gefühl der Vergänglichkeit, ehe man zu arbeiten begönne.
‚Aber deine ‚Iphigenie‘, mein Freund!‘ rief ihm Tischbein lächelnd über die Tafel herüber.
Da sprang Goethe auf, schnitt ihm eine Grimasse und lief recht wie ein ungezogener Junge von dannen. Wir suchten ihn allesamt und fanden ihn endlich hinter dem Hause, wie er mit einem kleinen, gelben, wohl vierzehnjährigen Mädchen, das er ‚Mignon‘ nannte, das Händespiel Mora spielte, wobei er lachend einen Soldo nach dem anderen verlor. Ich habe niemals einen erwachsenen Menschen so kindlich und natürlich spielen sehen. Wie er denn überhaupt eine große Liebe zu Kindern und zu dem naiven Volke an den Tag legte!
Auf der Heimfahrt, da wir mit der Kauffmann selbdritt in einem Wagen saßen, unterhielt er sich in einemfort mit dem Vetturino über die Mücken und die Pferde und die Straßen [S. 31]von Rom, bis die Kauffmann, die sich vernachlässigt fühlte, ihn ganz verstimmt am Rockärmel zupfte.
‚Verzeih’, liebste Angelika,‘ sagte er, ‚aber dieser Mann ist so klug wie die sieben Weisen zusammen. Du glaubst nicht, was selbst ein Kutscher alles über Rom zu sagen hat.‘
Als wir den Tiber hinunterkamen, und die eirunde unvergeßliche Kuppel von Sankt Peter über der Stadt an dem roten Abendhimmel stand, meinte Goethe, daß er immer eine Art Furcht vor Michelangelo habe, der wie ein Zauberer noch heute über Rom herrsche, und daß er darum von ihm nur mit Bewunderung und Beben, wie die Juden von ihrem Gott, sprechen könnte. Wenn er wie Odysseus die Toten auf eine kurze Zeit wieder zum Leben erwecken könnte, würde er zunächst vor allen anderen dies mit Michelangelo tun, um ihm einmal zu sagen, welch ein großer Mensch er gewesen sei, und wie er ihn bewundere.
Hinterdrein vor dem Abschiednehmen gingen wir in der warmen Nacht noch in eine Osteria und tranken schäumenden Wein, Goethe mehr als wir alle. Ihr könnt Euch nicht denken, wie artig er um die Kauffmann bemüht war, die ganz verliebt in ihn schien, und wie er sein Frankfurter Deutsch setzte, daß es so flink wie Französisch und so anmutig wie Toskanisch klang. Und mit uns Künstlern trieb er Schabernack, daß ich mich verwunderte, wie ein solch heiterer Mensch über zehn Jahre in Weimar, wie man sagt, damit zubringen konnte, Akten und Rechnungen zu revidieren, Rekruten auszumustern, Bergwerke zu befahren, [S. 32]Felder zu visitieren und Verordnungen über das Ochsentreiben oder den Kümmelausschank zu diktieren. Freilich fiel mir auf, daß er immer, wenn auf Deutschland die Rede kam, ein ganz ernstes Gesicht machte, wie etwa ein Arzt, wenn man von Krankheiten spricht, und er einmal erklärte, erst wenn um Berlin Wein wüchse und es über Preußen Gold geregnet hätte, könnte man das Leben dort gut aushalten.
Bei all der Ausgelassenheit, wie er sie da in der Schenke zu Nacht brachte, hatte Goethe doch etwas Stilles an sich, dergestalt, daß nur der, der ihn hören wollte, ihn hören konnte, ganz anders wie die meisten deutschen Reisenden, die man in Italien schon um drei Straßenecken herum schreien hört und die die Kunstschätze vernehmlich wie die Wiederkäuer abgrasen.
Wir trennten uns alle nach Mitternacht, als die Glocken von den Kirchen auf Kommando der Zeit ‚Drei‘ schlugen und außer ein paar verliebten Katzen nichts mehr auf den Straßen lebendig war, wobei Goethe lächelnd sagte: ‚Nun gehe ich zu meiner Juno.‘ Hiermit meinte er die Büste des großen Kopfes aus der Villa Ludovisi, die bei Tag und Nacht neben seinem Lager stehen, und in die er, wie einst Pygmalion in Galathea, verliebt sein soll.
So seltsam es klingt, erst als er weggegangen war, wurde mir klar, welch ein seltener Mensch mit ihm unter uns Deutschen wandelt, wie man denn das Licht eines Leuchtturmes erst weit draußen auf dem Meere recht zu würdigen weiß und den Geist eines Großen erst, wenn er uns [S. 33]in unser Leben hineinleuchtet und ihm seine Farbe verleiht. —“
Dies ist ein kleines Abbild von dem römischen Goethe, eh’ er nach Deutschland in den Wald von Kaminen zurückkehrte und in Weimar heimisch wurde und ein Weib nahm und Kinder bekam, die ihm alle dahinstarben bis auf den einzigen Sohn, der gedrückt und verunglückt war und nicht alt werden konnte und in Rom begraben liegt an der Stätte, wo der Vater in schönster Blüte gestanden hat. Wenige Jahre später aber wandelte der Enkel Goethes einsam wie ein Sonderling auf dem Palatin und schrieb die in ihrer Unbeholfenheit wehmütigen Verse in sein Tagebuch:
Solche Sperlinge waren aus den Kindern dieses größten Deutschen geworden, dessen ganzes Manneskunstwerk auf der Kenntnis und der Liebe zu Italien steht, und der darin unsern Schwalben und Singvögeln gleicht, die bei uns brüten und Lieder singen aus Sehnsucht nach dem Süden.
[S. 34]
Eine Laienpredigt.
Goethe der Große steht auf der Wende vom achtzehnten zum neunzehnten Jahrhundert, zwischen dem Rokoko und der Moderne, am Ende einer Gesellschaft, bei der die Geburt alles galt, und zu Anfang einer neuen, bei der einzig das Geld den Ausschlag gibt. Denn, werden wir uns darüber klar, in unserer heutigen Gesellschaft hängt die Stellung des einzelnen und die Achtung, die er genießt, vor allem von der Summe des Geldes ab, die er besitzt. Adel und Orden sind auch heute noch schön, aber sie haben nicht mehr die Kreditfähigkeit wie früher, da man auf sein Adelsprädikat hin, so viel man zum Leben brauchte, geborgt bekam. Heute leiht auch der dümmste Krämer keinem etwas bloß auf diese Garantien, und das Wörtchen „von“ hat keinen Kurswert, ja kaum einen Achtungswert mehr in der Bürgerwelt. Man erinnere sich nur des Stolzes, mit dem der alte Krupp diese Ehre, die keine mehr ist, die er nicht mehr so empfand, abgelehnt hat, was hundert Jahre früher undenkbar gewesen wäre. Titel und Uniformen sind immer noch in Deutschland etwas gern Gehörtes und Gesehenes und flößen manchem Mann und mancher Frau eine gewisse Ehrfurcht ein. Aber im kleinsten Krähwinkel gilt heute der Reichtum ebensoviel und der Millionär nicht weniger als der Landrat und der Major. Vollends im Ausland, und wir müssen heutzutage, ob wir wollen oder nicht, kosmopolitisch denken, fallen alle Titel wie Lumpen von uns [S. 35]ab, und der Geheimrat, der sich seine Briefe nach Capri oder Spanien unter seinem Titel senden läßt, wird wie jeder andere dort nicht nach ihm, sondern nur nach der Höhe seiner Trinkgelder behandelt, und das höchste, was er mit seinem Titel erreichen kann, ist, daß man ihm die Hotelrechnung verteuert.
Unsere heutige verbürgerte und amerikanisierte Gesellschaft reguliert sich in Deutschland, wie in allen Staaten, das kann man selbst in Hinterpommern und auf der Schneeeifel nicht mehr leugnen, vorwiegend nach dem Geld und dem Geldwert des einzelnen und ist mehr als je zuvor auf dem Weg zu einer reinen Plutokratie, die in Amerika ja tatsächlich schon eingetreten ist. Richtete sich einstmals der Ehrgeiz in Deutschland vor allem auf einen möglichst langen Titel oder eine möglichst schöne Uniform, so geht er heute im allgemeinen darauf aus, ein Automobil zu besitzen, beim besten Schneider arbeiten zu lassen, in den feinsten Hotels zu sitzen, weite Reisen zu machen, ein vornehmes Haus oder besser noch, zwei vornehme Häuser zu führen usw. Seien wir ehrlich, die wenigen Menschen, die dieses alles und mehr zur Verfügung haben, die regieren jetzt in Deutschland, die genießen das schönste Leben und die höchste Achtung, für die ist unser Militär, unsere Polizei, unsere Justiz und sind unsere Gefängnisse da.
Die Leute, die dieses mehr oder minder klar bei uns eingesehen haben, pflegen sich je nach ihrem Temperament zu bescheiden oder zu opponieren. An die ersten wendet sich bei uns die Kirche, an die letzten, die Revoluzer, die [S. 36]Sozialdemokratie. Und merkwürdigerweise haben beide im Grunde den gleichen Trost für ihre Patienten, nämlich den auf ein besseres Leben im Jenseits oder im Diesseits, im Himmel oder im Zukunftstaat. Von diesen beiden Hoffnungen leben heute Millionen Menschen in Deutschland, trotzdem keiner ganz genau weiß, ob und wie sie sich wirklich jemals erfüllen werden.
Um dieser Hoffnung willen ertragen sie „des Mächt’gen Druck, des Stolzen Mißhandlungen“, und vermögen sich in all ihren Leiden und Entbehrungen zu freuen, weil sie selig in ihrem Glauben sind, in dem sie von den Herrschenden nach Kräften noch unterstützt werden, einmal indem man die Religion von obenher fördert und zum andern, indem man die Unzufriedenen auf dem Wege zu ihrem Zukunftstaat durch allerhand Mittelchen und Klebpflästerchen zu vertrösten sucht.
Zwischen diesen beiden auch der Anzahl nach stärksten Parteien in Deutschland wachsen nun eine Anzahl Männer und Frauen wie Blumen im Korn herauf, die auf eine bessere Zukunft zugunsten einer guten Gegenwart Verzicht leisten, die sich sagen: „Wir wollen etwas von unserm Dasein haben, indem wir mit den Menschen und mit dem Leben fertig werden wollen, wie sie uns jetzt umgeben, wie es uns heute und nur heute einmal verliehen ist.“ Diese merkwürdigen unzusammenhängenden Menschen haben sich nach einer stummen aber deutlichen Übereinkunft als Schutzpatron nicht etwa Nietzsche, der sonst für alles Moderne als der Taufpate gilt, sondern Goethe ausersehen. [S. 37]Und zwar nicht einmal so sehr Goethe den Dichter als wie Goethe den Menschen, den Freien, den Parteilosen, den Einzelnen, die Persönlichkeit. Das Ideal „Goethe“ ist errichtet worden. Um diesen Freiheitsbaum tanzen heute die Freien im Geiste in Deutschland wie einst die Jakobiner beim Ausbruch der Revolution in Frankreich um die junge Pappel. Auf das große Bild seines Lebens weisen sie hin mit Stolz und erhobenem Finger wie auf eine Riesengottheit und sagen und singen: „So leben wir, so leben wir alle Tage.“
Er ist kein Christ gewesen dieser Goethe, jedenfalls nicht im kirchlichen Sinne, mag man immerhin ein paar Ausdrücke, die darauf schließen lassen könnten, aus seinen zahlreichen Werken herausfischen und zusammenreihen. Im Grunde war er schon als echter Sohn des achtzehnten, des heidnischsten Jahrhunderts so wenig ein Christ wie Friedrich der Große. Daß ihm die Person Christi selber als einer der verehrungswürdigsten Typen der Menschheit erschien, ist bei einem edel denkenden Menschen selbstverständlich. Aber die Institution der christlichen Kirche und ihre Moral hat er rein tatsächlich nicht gebilligt: Er hat jahrzehntelang mit einer Frau ohne kirchlichen Segen zusammengewohnt, er hat seine Kinder nicht oder erst spät taufen lassen, ist ohne Priester und Bibel gestorben und hat sich, anders wie Ibsen, so unkirchlich wie möglich beerdigen lassen. Man mag darüber denken wie man will, man soll es nur nicht verschweigen oder beschönigen. Seine Lebensführung war somit von Anfang bis zu Ende eine dem [S. 38]kirchlich-christlichen Geist entgegengesetzte, sein Sittengesetz ein freies und jenem begrenzenden Geist geradezu feindliches, indem er die möglichste Entfaltung der Persönlichkeit statt ihre Beschränkung zur Norm für jeden erhob. Er machte den Egoismus, der sich bis dahin wie eine Spinne in allen Ecken herumgedrückt hatte, zum Herrn im Hause und nahm ihm die falsche Scham, die er hatte erheucheln müssen. Er lehrte sich und andern den Himmel auf Erden und nicht über den Wolken oder in der Zukunft zu suchen und zu finden:
Er ging in keine Kirche hinein, und wenn der Sonntag oder ein Feiertag kam, so ließ er sich von seinem Diener Kupferstiche bringen und besah sich die Bilder von Raphael oder ließ sich vormusizieren oder schrieb ein Gedicht an eine Wand im Freien und lief durch den Wald und war mit alledem Christo ebenso nahe wie der Kirche ferne. Und dabei hat man niemals eine Gotteslästerung wie noch bei Voltaire und Diderot oder die Verhöhnung eines Ritus bei ihm erlebt. Nein, er hat beispielsweise den Katholizismus, soweit er deutsche Religion ist, verstanden und tief mitempfunden, ohne dabei freilich in die frömmelnde Richtung eines Friedrich Schlegel oder Zacharias Werner zu geraten, welch letzterem er ob seines Übertritts zur römischen Kirche geradezu sein Haus verboten hat. Er hat das überirdische Bild Christi, wie es uns in den schlichten Farben der Evangelien überliefert ist, stets verehrt und niemals, wie etwa [S. 39]später Heine, geschmäht und besudelt. Aber er war darum doch kein Christ, wie ihn die Kirche, katholische oder protestantische, bei uns verlangt, und hat dies bei jeder Gelegenheit so laut, wie es ihm möglich war, betont. Das soll man nie vergessen, wenn man ihn, den „dezidierten Nichtchristen“, wie dies heute sogar von orthodoxer Seite gern geschieht, zum advocatus dei machen will.
Ebensowenig war er aber auch ein Gesellschaftsmensch, ein Mann der Menge, ein Kompromißler, als welcher er jetzt in der Vorstellung vieler Menschen gravitätisch herumspaziert als hehres Beispiel, wie man sich in die Welt eingliedern soll. Freilich hat er das examen rigorosissimum des Lebens glänzend bestanden, ist als ein alter reicher Mann in allen Ehren gestorben, nachdem er seine Schriften, sein Leben und seinen Ruhm wohl geordnet hatte. Seine Mitmenschen achteten ihn, weil sein Herzog ihn geliebt und geehrt hatte, und wenn man auch bei seinen Lebzeiten seine Stücke nicht anhören mochte, so nahm man ihn doch als Staatsminister und damit höheres Wesen ehrfurchtsvoll und kostenlos hin. Aber sein Leben darum als Musterbeispiel eines guten Bürgers, eines wackeren Staatsangehörigen hinzustellen, das geht wirklich nicht an. Denjenigen, die ihn wegen seiner Kompromisse bei festlichen Gelegenheiten gerne als archicivis feiern und zitieren, muß man zurufen: „Laßt unsern Goethe aus dem Spiel!“ Denn einmal ganz abgesehen von der Moral seiner Schriften wie seines Lebens, welche die breite herrschende oder doch erheuchelte Gesellschaftsmoral fortwährend heute noch vor [S. 40]den Kopf stößt und erst recht gestoßen hat, kann man nicht behaupten, daß Goethe sich sehr in seine Zeit und seine Mitwelt gefügt hat. Erinnert sei nur, um nicht in Kleinigkeiten zu geraten, daran, wie er die „gute Gesellschaft“ in Weimar brüskierte, wie er sich Anno 1813 verhielt, als er seinen Sohn verhinderte, bei Lützows Jägern einzutreten, weil ihm sein einziges Kind noch lieber war als Deutschlands Freiheit, und wie er nicht mit in die Begeisterung gegen Napoleon einstimmte, weil er seine Größe fühlte und nicht behaglich im Zimmer sitzen und Kriegslieder schreiben konnte. Oder man denke daran, wie er sich in jenen häßlichen literarischen Froschmäusekrieg, den „Xenienstreit“, hineinbringen ließ, so daß einer seiner Feinde mit Recht sagen konnte:
Nein, ein bequemer Bürger, ein treuer Diener seiner Zeit und ein gutes Mitglied der Gesellschaft ist dieser Mann nicht gewesen, dessen größtes Glück war, einen Karl August zu finden, der ihn vor dem Verhungern und vor der Verbannung gerettet hat.
Was war nun aber das große Geheimnis Goethes, das trotzdem bewirkt hat, daß man sein Leben und gerade dieses heute noch als ein Vorbild für jeden Menschen hinstellen kann und die Nachfolge Goethes fast als modernes Evangelium predigt? Es war einfach dies, sein [S. 41]Leben seiner Veranlagung und seinen eigenen Gesetzen nach aufrichtig zu führen, unbekümmert um die Vorschriften der Außenwelt, die nicht mit seinen sittlichen Anschauungen zusammenfielen, und ohne bei jeder Tat, jedem Wort zu fragen, was nützt mir das oder was schadet mir das? Das ist seine Lebensführung gewesen, die ihm ein jeder von uns an der Stelle, wo er steht, und mit den Gaben, die ihm verliehen sind, nachmachen kann. Daß man ein guter Kaufmann, Vater, Gatte, Gelehrter und Beamter trotz einer Persönlichkeit sein kann, hat er am Anfang unserer Zeit für diese bewiesen. Ein Japaner, der nach längerem Aufenthalt im jetzigen Europa gefragt wurde, was er für die vorwiegendste Eigenschaft in unserer heutigen europäischen Gesellschaft halte, entgegnete mit vollem Recht: „Die Feigheit“. Es ist erklärlich, daß eine Gesellschaft wie die unsrige, die vor allem auf Geld und seiner Wertschätzung steht, so furchtsam ist. Denn diese Grundlage ist nicht so sicher, wie der Grundbesitz und die Fideikommisse der adligen Gesellschaft: Geld rollt, Banken können verkrachen, Fabriken können verbrennen und verfallen, und der Mieter wohnt nie fest. Aber die Angstmeierei unserer Gesellschaft, das Zittern vor dem, was die Leute denken, und das ewige Rücksichtnehmen, bis man sich Hals und Grat verdreht hat, ist der Schrecken vor einem Phantom, das nicht da ist, einem Schatten, der nicht fällt. Mit den ewigen Scherwenzeleien und Schiebungen kommen doch — so stark sind die demokratischen Wurzeln unserer Gesellschaft — immer nur [S. 42]wenige weiter und vermögen sich nur unter ständiger Gefahr für ihre Stellung zu halten. Wenn man den einzelnen aus der Gesellschaft herausholen und ihn ausfragen würde: „Wovor zitterst du eigentlich beständig?“ so könnte man ihm leicht Grund nach Grund für seine Furchtsamkeit wie Zwiebelschalen fortnehmen. Denn weil einer nie seine Meinung sagt oder alle Festessen mitißt oder sich stets und überall beliebt machen will, darum kauft keiner ihm einen Knopf mehr ab, wenn die Knöpfe nichts taugen, oder behandelt ihn schlecht, wenn er Vorteile von ihm haben kann, oder läßt ihn avancieren, wenn er ein Rindvieh ist. Die wenigen Ausnahmen davon sind zu erbärmlich, daß man sie weiter erwähnen müßte. Die aber, die erkannt haben, wie Glück und Achtung nicht erschlichen werden können und wie die Gesellschaft im Grunde und mit Recht den einzelnen nur nach dem Nutzen wertet, den sie von ihm hat, und wie „das höchste Glück der Erdenkinder nur die Persönlichkeit“ ist, die man einzusetzen hat, alle die werden sich mit Stolz und Recht heute Goethes Jünger nennen.
[S. 43]
Noch heute ist Schiller der volkstümlichste, der beliebteste Dichter in Deutschland, ist in unseren Tagen noch so volkstümlich wie ein Kinematographentheater und wie Zeppelin und Hindenburg. Und er hat dies verhältnismäßig ohne große Konzessionen erreicht.
Wohl hat er manchmal klein beigegeben, hat dem Theater gegeben, was es damals wie heute forderte: Schaustellungen, herrliche Aktschlüsse mit bengalischer Beleuchtung, Katafalk, Fahnen und Orchester, große spannende Auftritte und leider auch, wenn nicht immer Belohnung der Tugendhaften — dafür schrieb er Tragödien! — so doch meistens Bestrafung der schlechten Menschen auf der Bühne, des bösen Geßler, der heuchlerischen Königin Elisabeth. Schon als Jüngling von 23 Jahren mit den „Räubern“ auf das Theater gebracht, lernte er diesem gefährlichen Untier zu schmeicheln und sich den Beifall des Publikums sichern. Es ist erstaunlich, mit welcher Kälte er schon damals, als feuertrunkener Schwärmer, über seine Helden und Heldinnen nicht anders, als seien es Kaninchen, verfügte. „Daß Euro Excellenz“, schrieb er an den Mannheimer Intendanten Heribert von Dalberg, „die Amalia lieber erschießen als erstechen lassen wollen, gefällt mir ungemein, und ich willige mit Vergnügen in diese Veränderung. Der Effekt muß erstaunlich seyn, und kömmt mir auch räubermäßiger vor.“
Auch späterhin in seinen Briefen an Goethe oder Iffland, die beiden Theaterdirektoren, spielt das Wort „Effekt“ eine [S. 44]Hauptrolle bei den Mitteilungen über seine neuen Stücke, und auch als längst anerkannter Dichter war er stets zu solchen Änderungen in seinen Stücken, die das Theater verlangte, sofort bereit. Man sieht, dieser große Idealist, wie er einem in der Schule als überirdisches Wesen vorgestellt wird, war ein ebenso großer Realpolitiker, wenn es galt, die Anforderungen der großen Menge und ihrer Anwälte, der Theaterdirektoren, zu befriedigen. Das nahmen ihm die Romantiker übel, die den verworrenen Gang des Lebens kaleidoskopisch verworren gestaltet wissen wollten, daß er Menschen und Schicksale in Transparent und in Theater setzte und mehr als nötig war „idealisierte“. Darum stießen sich Künstler wie Otto Ludwig, stößt sich heute schon ein ganzer ästhetisch fein empfindender Kreis in Deutschland an solchen Stellen in seinen Stücken, Momenten oder Passagen, den Geschmack wund, in denen er mit kalter Berechnung dem Moloch Theaterpublikum rohe Opfer gebracht hat. Während seine Gedichte, die er nicht für das Lesebuch und für kein anderes Publikum als für reife Menschen schrieb, vor allem seine Gedankenlyrik von keinem bemängelt, von keinem übertroffen werden können.
Er wollte als Dramendichter ebenso ungestüm wie ein Theaterdirektor, daß das Haus voll besetzt war, wenn seine Stücke gespielt wurden und hätte, wie Goethe es getan hat, aufgehört, Dramen zu dichten, wenn bei ihnen, wie etwa bei der „Iphigenie“, das Parkett so leer wie heute die Kirchen in Paris ausgesehen hätte. Darum war „Wirkung, Effekt“ die Parole, unter der er seine Schlachten [S. 45]auf der Schaubühne schlug, und je älter er wurde, je seltener wagte er einen Ausfall gegen die herrschende Moral, den herrschenden Geschmack seiner Zeit. Nein, er befestigte durch viele Sentenzen in seinen Stücken wie durch deren ganze sittliche Haltung gradezu die moralische gut bürgerliche Ordnung, wie sie nach der großen Revolution, für die er, wie Goethe, übrigens kein tieferes Verständnis gehabt hat, über die Welt gekommen war. Das konnte ihm Nietzsche, der nach Otto Ludwig zweite große Schillerhasser in Deutschland, nicht vergeben, daß er die großen, nichtssagenden Worte, das Edle, das Schöne, das Wahre, die Phrasen, bei uns in Umlauf und Wert gesetzt hat. Er machte ihn vor allen für diese billige, bildungsphilisterhafte kleine Gesinnung im neuen Deutschland, die sich mit großen Redensarten loskauft, die mit Worten, nicht mit Taten zahlt, verantwortlich, für jene falsche Pathetik, die fortwährend „die Ideale“ im Munde herumdreht, die Hebbeltheater gründet, um Possen darin aufzuführen, die sich patriotisch gebärdet, um Kommerzienrat zu werden, die im Frieden mit dem Degen rasselt, die mit der rechten Hand Geld abnimmt, indessen die linke betet.
Es ist wahr, Schiller hat, Kants praktische Vernunft in die Poesie umsetzend, alle jene allgemeinen edlen Begriffe Wahrheit, Schönheit, Tugend und Gott als Worte des Glaubens auf den Thron erhoben und als Götzen über uns gesetzt und uns mit dem Schreckgespenst der Schuld bedroht. „Der Übel größtes aber ist die Schuld.“ Konservativ wie die meisten Dichter, hat er mit schönen Sätzen [S. 46]und herrlichen Versen einen Schutzwall um die Guten gebaut und das zum Sieg gekommene Bürgertum, dem er angehörte, im ruhigen Besitz seiner gewonnenen Güter befestigt. Aber er selbst hat diesen Sieg erst in seiner Jugend mit erringen helfen, da er seine vier gewaltigen Jünglingswerke „in tyranos“ geschrieben hat. Die französischen Schreckensmänner, die ihn zum Dank für „die Räuber“ zum Ehrenbürger der französischen Republik ernannten, verstanden seine Bedeutung für seine, für unsere Zeit viel besser als er selbst. Sie merkten, daß er, wenn auch nicht wie Franklin „dem Himmel den Blitz“, so doch „den Tyrannen das Zepter entrissen“ hatte. „Die Räuber kosteten mich Vaterland, Ehre und Familie,“ durfte Schiller sagen, der um dieses sein Werk alles auf einen Wurf gesetzt hatte.
Dieses blieb das größte Erlebnis in seinem Dasein, die Flucht von der Karlsschule, das Zerbrechen der Fesseln, die Selbstbefreiung des Individuums. Die sollte man nicht vergessen, wenn man mit den Sentenzen des abgeklärten, des friedlichen Schillers herumwirtschaftet. Die Leute, die wie manche moderne Dichter nichts anderes erleben, als daß sie sich einmal einen Zahn plombieren lassen oder höchstens einmal Schöffe oder Geschworener werden, sollten daran denken, daß Schiller um seine Ruhe gekämpft und gelitten hat wie ein Held.
Dazu kommt, daß Schiller niemals platt im niedern Sinne wird. Eine weite Fläche voll von Gemeinplätzen trennt [S. 47]ihn von Wildenbruch und seinen andern Epigonen. Selbst in seinen schwächsten Stücken, in der „Jungfrau von Orleans“, in „Maria Stuart“, trägt ihn sein Fittich noch hoch über die Niederungen, in denen die von ihm in den „Xenien“ verhöhnten literarischen Frösche quaken. Aller Hurrapatriotismus, alle Festbegeisterung wären ihm zuwider gewesen. Als Kotzebue ihn feiern wollte, sagte er wegen Übelkeit im Magen ab.
Diese innere Wahrhaftigkeit mit jenem prachtvollen Schwung vereinigt, mit dem er gleich dem Orchester, das er nach der Rütliszene vorschrieb, in seine Verse wie der Sänger in die Harfe fällt, machen ihn, den dithyrambischen Dichter, aus und ergreifen uns noch heute. Darum faßt auch den, dem die Kunst sonst nichts bedeutet oder der ihr den Rücken zugekehrt hat, beim Tönen seiner Verse eine ungeahnte Sehnsucht nach einem höheren Reich wie den Älpler in der Ebene beim Klange des Alphorns Heimweh nach den Alpen überkommt.
So ist sein Name bedeutungsvoll für sein Dichten geworden, das noch jetzt wie immer im ersten Glanz, den er ihm verliehen hat, zu uns „schillert“.
Das Leben, das er uns hinterließ, hat etwas Fragmentarisches, mehr noch als ein jedes Menschenleben ein Fragment [S. 48]bedeutet. Es beginnt mit jener Rhapsodie seiner Flucht aus Schwaben und mit der leidenschaftlichen Neigung zur titanischen Charlotte von Kalb und endet mit dem Adagio seines stillen Lebens in Weimar zwischen der Liebe zu seinem sanften Lottchen und der Freundschaft zu Goethe. Sinnlos riß der Tod ihn fort von einem Werke, dessen Torso noch erschütternd groß wirkt. Napoleons Gipfel und Absturz, die gewaltigste Tragödie seiner Zeit, hat er nicht mehr erlebt. Der hätte ihn sicherlich gleich Goethe und Wieland zu sich nach Erfurt beschieden und ihn als Mitbürger einer neuen Zeit begrüßt, die mit der Nacht begonnen hat, die bedeutungsvoller als die Nacht von Bethlehem war, mit der Nacht, da in Paris die Menschenrechte erklärt wurden, und Posas Ideal „Gedankenfreiheit“ endlich erfüllt werden sollte. Ja, Schiller war einer der Taufpaten dieser herrlichen heutigen Zeit, in der der einzelne frei in seinem Staate lebt, und auch in Deutschland und Preußen ein jeder verfassungsmäßig das Recht hat, in Wort und Schrift seine Meinung frei zu äußern, wenn auch leider nur wenige bisher von diesem Rechte Gebrauch zu machen pflegen.
Den Revolutionär Schiller, den Robespierre des Dramas, der die Tyrannen in seinen Stücken guillotinierte, soll man darum nicht vergessen, wenn man des Dichters der Glocke, des Hüters der heiligen Ordnung, der züchtigen Sitte, gedenkt. Diesen soll man wiederum nicht in den Himmel erheben, wie es in der Aula wohl geschieht, wo Sankt Schiller mit seinen Bürgersprüchen bis ins Maßlose gefeiert wird. Er war ein Mensch wie wir, dem [S. 49]Wetter, der Zeit und den Launen unterworfen und aus vielem zusammengesetzt. Denn ein absolut edles Wesen ist ein Monstrum, das nur in der Weltflucht gedeiht, oder ein Mythus, der nie unter Menschen gewandelt ist. Aber Schillers Hand hielt doch die langen bangen Jahre einer schrecklichen Krankheit hindurch bis zu seinem Tode des Lichtes Himmelsfackel in der Hand, der Würde der Menschheit zu leuchten. Und sein Genius, der sich an der Morgenröte einer neuen Zeit entzündet hatte, stand wie eine Sonne bis zum Tode über seinem Volke, das er, ein einzelner, Jahrzehnte vor Bismarck schon geeinigt hatte. So starb er, so ging er durch die porta nigra des Todes, „unendlich Licht mit seinem Licht verbindend“. Auf seinem Grabstein steht nur sein Name, den er unsterblich in des Wortes menschlicher Bedeutung gemacht hat. Wollte man dem etwas hinzufügen, man könnte keine schöneren Worte finden als die, die Shakespeare dem gefallenen Freiheitskämpfer Brutus nachruft:
[S. 50]
O du seliger, ewig jugendlicher Jean Paul, der du jetzt auf den Asphodeloswiesen im Elysio unter den Schatten einherwandelst und am Abend die grauen Flockenblumen abzupfst und in die Luft fortpustest, ihnen nachschauend wie Kinder den Seifenblasen im Sonnenschein, siehst du dich noch in jenem Zimmer der derben kreuzbraven Wirtin Rollwenzel vor dem Städtchen Bayreuth sitzen, an dem Federhalter kauen, hin und wieder einen Gedanken oder ein Bild aus deinen Nackenhaaren hinter deinem kahlen Scheitel herausziehen und das große weiße Papier, das vor dir liegt, langsam mit deinen schönen Buchstaben zumalen? Siehst du dich noch schmunzeln vor Behagen, wenn dir ein besonders eigenartiger Einfall übers Papier lief, und du ihm zwei Seiten lang nacheiltest und dabei vom Hundertsten ins Tausendste und Hunderttausendste kamst, oder wenn die Wirtin mit einem Krug voll Kulmbacher Bier zu dir trat und du dich zurückbeugtest und die dicke braune deutsche Ambrosia hinunterspültest und dabei drüberhin dankbar in den Himmel sahst wie ein trinkendes Huhn? Wenn du dann noch eine Prise Borkauer Schnupftabaks in die breiten Nasenlöcher geschoben hattest, wie konntest du dann auf dem Papier mit den Flügeln schlagen und über die Hecken und Zäune der Menschen fortfliegen und vor Vergnügen krähen! Über dreißig deutsche Kleinstaaten flogst du an einem solchen Vormittag, vor Bayreuth schreibend, hinüber und picktest alles, was [S. 51]dir lächerlich schien, von den Wegen auf und brachtest es zu Papier, allerlei schnurriges und monströses Zeug, das sonderbar aussah wie Spinnen oder Meertiere im Spiritus. Vor dir, wenn du vom Schreiben aufschautest, lagen die Höhen des Fichtelgebirges oder Frankenwaldes; und du ließt deine großen, sanften, blauen Augen an ihren stillen Linien so zufrieden vorbeirollen, wie der Herr von Goethe in Weimar hinter den Bergen die Rückenformen schöner Menschen in Stein oder Fleisch betrachtete. Nie fiel es dir ein, das Land Italia, von dem die von der Griechheit befallenen damaligen Deutschen wie junge Mädchen von ihren Erziehern schwärmten, zu betreten. Höchstens deine Helden führtest du an ihrem Schopf auf den Palatin oder den Posilipp oder ließest sie ihre Schwermut in dem Lago Maggiore widerspiegeln. Dir selbst wäre es nicht wohl gewesen in Ländern, wo man kein Bier trinkt, wo keine Wälder duften, keine Serenissimi reden und regieren, damit ihre Untertanen etwas zu lachen und zu erzählen haben, und wo keine deutsche Musik geblasen, gegeigt, gespielt, getrommelt oder gesungen wird. Du mußtest im Frühling Aurikeln und Veilchen, im Sommer Rosen und Gelbveiglein und im Herbst Astern und Stiefmütterchen um dich haben und mußtest im Winter dicke Eisblumen an den Fenstern sehen: sonst wärst du gestorben vor Heimweh. Wenn die anderen von Welschland sprachen, hieltest du dir die Ohren zu und pfiffst Beethoven vor dich hin; und nachts, wenn die Sterne am Himmel aufzogen, sagtest du: „Nun ist alles auf Erden gleich.“
[S. 52]
Drum saßest du alle Morgen allein im offnen Zimmer neben der Gaststube der kreuzbraven Wirtin Rollwenzel vor dem Städtchen Bayreuth, die Perlmutterdose voll Tabak und den Steinkrug voll Bier neben dir und Oberfranken im Fenster eingerahmt vor dir, und schriebst ganz gemächlich deine zehn bis fünfzehn Seiten deutsche Prosa tagtäglich in deine Kladde. Und warst dabei nicht minder des Gottes voll als Dante, da er in der Pineta dichtend umherging, oder als der blinde Milton, als er seiner Tochter die Beschreibung des Satanas und der weinenden Eva in die Feder diktierte. Und warst dabei nicht weniger behutsam und dachtest ebensoviel über deine Kunst nach wie Lessing, Herder und Schiller, die sich beim Dichten oft den Puls zählten wie ein Kranker im Fieber. Du stütztest die Stirn in die Hand vor jedem neuen Kapitel (oder Summula oder Jobelperiode oder Station oder Hundsposttag oder Nummer oder Zettelkasten, oder wie du sonst noch deine Abschnitte nanntest) und sannst dann lang und breit über das Romantische, über den Humor, über den Stil, über die deutsche Sprache nach, bis du auf einmal den Faden deiner Erzählung ganz verloren hattest. Dann galt es, schnell übers Garn zu schlagen und mit ein paar Rückzügen, die nicht ungeschickter, wenn auch unberühmter waren als die Friedrichs des Großen nach der Schlacht bei Hochkirch oder die Napoleons von Leipzig nach Paris, zu deinem Thema zurückzugelangen. Freilich verlorst du oft eine Schar Leser bei solchen Exkursionen; Leute, die sagten: „Wir kommen auf der Straße nicht mehr mit. Der Kerl gerät uns zu sehr auf Abwege [S. 53]und Seitensprünge.“ Aber dir lag nichts an solchen Lesern, die gegängelt werden wollen und mit Extrapost und stets frisch gewechselten Pferden, wie ein persischer Satrap durch seinen Bezirk, durch die Ereignisse hindurchreiten wollen bis zur Verlobung oder zum Begräbnis. Sacht wie ein Landomnibus zwischen zwei Marktflecken fährst du deine Insassen weiter; was tut’s, wenn der Pegasus unterwegs stehen bleibt, wo immer ein Vergißmeinnicht sich zeigt, um es mitzunehmen? „Nur Geduld!“ rufst du vom Bock hinunter, „wir kommen schon an;“ und verkaufst für die Tränen einer Liane oder das Grinsen eines Ironikers über eine schöne oder kluge Stelle tausend Seelen an Kotzebue. Davon rührt es, daß heute mancher so schwer dich liest wie einen Palimpsest, auf dem drei Texte übereinander geschrieben sind, und du in Bibliotheken oft hoch oben stehst, wo selbst keine langen Spinnfängerbesen mehr hinaufreichen, und das Subjekt, das alle Jahre einmal zum Staubwischen dort hinaufklettern muß, kopfschüttelnd deine seltsamen Titel liest, wie etwa diese: „Die Kunst, einzuschlafen“, „Dr. Fenks Leichenrede auf den Höchstseligen Magen des Fürsten von Scheerau“, „Über das Leben nach dem Tode oder der Geburtstag“, „Das Glück, auf dem linken Ohr taub zu sein“, „Verschiedene prophetische Gedanken, welche teils ich, teils hundert andere wahrscheinlich 1807 am einunddreißigsten Dezember haben werden“, „Ruhige Darlegung der Gründe, warum die jungen Leute jetzo mit Recht von dem Alter die Ehrfurcht erwarten, welche sonst selber dieses von ihnen fordert“, „Bitte, mich nicht durch [S. 54]Geschenke arm zu machen“, „Vollständige Mitteilung der schlechten, aberwitzigen unwahren und gottlosen überflüssigen Stellen, die ich in meinen noch ungedruckten Satiren aus Achtung für den Geschmack und das Publikum ausgestrichen habe“, „Einige gutgemeinte Erinnerungen gegen die noch immer fortdauernde Unart, nur dann zu Bette zu gehen, wenn es Nacht geworden.“
Wenn du täglich deine Hefte vollgeschrieben hattest, ewig wie das Fichtelgebirge lebender Jean Paul, schrittest du zufrieden wie ein Buchführer, dessen Saldos stimmen, nach Hause. Auf dem Marktplatz von Bayreuth verwickelte sich dein Fuß dann wohl in den geschnörkelten Schatten des vom Markgrafen Friedrich errichteten alten Barockschlosses, du stolpertest und ließest das Dreierlicht im Marienglas, das dir heimleuchtete, fallen und standest dann allein unter den Sternen in der Abendluft, die nach Wäldern roch. Dann fuhren wohl ein paar titanische Gedanken durch deine mächtige Stirn, daß sie mit dem Jupiter und dem Hesperus über dir um die Wette leuchtete und du sagen durftest: „Gefühlt habe ich es auch, Goethe!“
Aber dann kamen schon die Nachbarkinder und zupften und zogen dich hinein, mit ihnen um die Lampe „Schwarzer Peter“ zu spielen, und du folgtest ihnen willig, eingedenk deiner Worte: „Um wieviel leichter erkauft man den unmündigen Kindern arkadische Schäferwelten als den Erwachsenen nur ein Schaf daraus!“ Und du hieltest ganz still und ließest dir ruhig mit dem Korkstopfen einen dicken schwarzen Bart über dein breites, feistes Gesicht malen, [S. 55]daß du aussahst wie die Maske der Komödie bei den Griechen, und die Nachtwächter vor dir erschraken. Und wenn du deine Nachtsuppe mit Pflaumen heruntergelöffelt hattest (denn das viele Beißen verlernten deine Zähne sehr früh), dann gingst du noch einmal zu einem Schlaftrunk schon im Schlafrock in die Kneipe nebenan und schmunzeltest bis zu den Ohren hinauf, wenn der Apotheker, der Pfarrer und der Bürgermeister, drei abgefeimte Hasenfüße, sich zusammentaten, über Napoleon zu schimpfen, den sie durch ein Nadelöhr gejagt haben würden. Nachts aber, in deiner hölzernen Bettstelle, in der gewürfelten Flanelljacke, die dir den rundlichen Leib warmhielt, träumtest du von einer Reihe sonderbarer Geschöpfe, die dich umflogen: E. T. A. Hoffmann war darunter mit seinem Eulengesicht und Ludwig Börne mit seinen traurigen Augen, der Professor Fechner mit seiner Brille, Robert Schumann mit seinem edelsten Lächeln, Carlyle aus Schottland, Friedrich Vischer aus Schwaben, Wilhelm Raabe, die Feder in der Hand, und Gottfried Keller mit seinem Züricher Dialekt und viele, viele andere. Alle aber nannten dich „Vater“, als hätten sie dich über den Verlust deines einzigen Sohnes forttrösten wollen. Und einer unter ihnen (es war Ludwig Börne, wie sich zwanzig Jahre später herausstellte) trat hervor und redete dich an: „Eine Zeit wird kommen, da wirst du allen geboren. Du stehst geduldig an der Pforte des zwanzigsten Jahrhunderts und wartest lächelnd, bis dein schleichend Volk dir nachkomme.“
[S. 56]
An einem Spätabend Ende November 1811 kam die Nachricht vom Tode des vierunddreißigjährigen Heinrich von Kleist nach Weimar. Der alte Wieland, bei dem der junge Dichter vor wenigen Jahren mehrere Wochen zu Besuch geweilt hatte, erfuhr es zuerst. Er saß in seinem gepolsterten Lehnstuhl nach dem Nachmittagskaffee, hatte sich eine lange Pfeife angezündet und wollte gerade in geistiger Gemächlichkeit in den Leipziger Blättern, die am Tisch vor ihm lagen, einen Rebus raten, wie er dies gerne tat, als er unvermutet auf diese Anzeige als ein noch größeres Rätsel stieß. Die Anzeige lautete aber:
„Am Nachmittag des 21. November zwischen 4 und 5 Uhr erschoß sich in der Nähe des am Wannsee bei Berlin gelegenen Wirtshauses ‚Zum Stimming‘ der junge Schriftsteller Heinrich v. Kleist. Er war am Vorabend mit einer gewissen Frau Henriette Vogel aus Berlin, die verheiratet gewesen sein soll und Kinder hat, dort abgestiegen. Die Frau, die an einem unheilbaren Herzleiden litt, soll von ihm ihren eigenen Tod als einen Freundschaftsdienst gefordert haben, und er hat, um seinen Mut und seinen Zynismus zu beweisen, ihr willfahren. Er hat erst seine sogenannte Freundin getötet und hierauf seinem eigenen Leben durch einen Schuß in den Mund ein Ende gemacht. Fuhrleute, die mit Weißbier nach Potsdam zufuhren, fanden die beiden Leichen nebeneinander liegen in einer Sandgrube am See. Kleist galt in literarischen Kreisen als talentvoll, aber, wie dies [S. 57]eben seine Tat beweist, auch als völlig undiszipliniert und haltlos. So erzählen die Wirtsleute, daß er am Abend vor der Tat mit jener überspannten Frau reichlich Rum getrunken habe und daß beide mit einer unaussprechlichen Heiterkeit und Frivolität am Mittag zum Tode wie zu einer Ruderpartie aufgebrochen seien. Man hat die Leichen der augenscheinlich geistig gestörten Unglücklichen an dem Fundort auf der Uferhöhe des Sees bestattet. Gott bewahre unsere Jugend in diesen aufgeregten Zeitläuften vor einer solchen Lebensauffassung, die sich den schweren Aufgaben unserer Tage feige entzieht!“
Der alte Wieland zitterte an allen Gliedern, als er dies langsam in sich hineinbuchstabiert hatte. Und da sein Sohn, Kleists Jugendfreund, nicht da war und auch sonst keiner, bei dem er sein altes Herz über diese unbegreifliche Kunde ausschütten konnte, beschloß er, um nur mit jemandem darüber reden zu können, auszugehen und irgendwen zu besuchen. Als er sich seinen braunen Otterpelz anzog, fiel ihm ein, daß er es zu Goethe am nächsten hatte, und so trippelte er denn, eine Stocklaterne in der Hand, durch die Gassen Weimars im Abendnebel nach dem Frauenplan. Erst als er vor dem Hause stand, aus dem heller Kerzenglanz wie aus einem Schloß herauskam, fiel dem Alten ein, daß Goethe, wie man sich sagte, dem lebenden Kleist gar nicht so sehr gewogen gewesen sei. Aber da er nun schon dort war, mochte er nicht mehr umkehren, pochte mit dem Türklopfer an und trat in den feierlichen Hausflur mit der majestätisch breiten Treppe ein.
[S. 58]
Goethe saß oben in dem erleuchteten, warmen Empfangszimmer schon im Staatsrock, den Stern auf der Brust, bereit, ein paar Gäste zum Abendtisch zu bewillkommnen. Eine Flasche Rotwein, die ihm noch seine reiche Mutter geschickt hatte, stand neben ihm auf dem Tisch, auf dem ein paar Kupferstiche Albrecht Dürers lagen, die der Geheimrat sich langsam und ganz genau mit der Lupe besah. Als ihm der alte Wieland gemeldet wurde, ging ihm Goethe steifen Schrittes mit beiden ausgestreckten Händen entgegen.
„Es ist prächtig, daß Sie kommen! Sie treffen es gut. Ich erwarte ein paar Abendgäste. Kanzler Müller wird kommen und Madame Schopenhauer will mit ihrem Sohne erscheinen. Zudem versprach mir eine polnische Pianistin, die auf der Durchreise nach Paris ist, uns ein paar slawische Volkslieder vorzutragen. Aber was ist Ihnen?“
Wieland erzählte mit ein paar fliegenden Sätzen die entsetzliche Nachricht vom Tode Kleists, ohne dabei zu gewahren, wie die Augen Goethes ganz groß wurden und seine Stirne leise eine Falte mehr bekam.
„Das ist in der Tat erschütternd“, erwiderte der Dichter des Werther und hielt sich zitternd am Stuhle fest. „Ich kann nie von dem Selbstmord eines jungen Menschen hören, ohne dabei bis in das Innerste meines Wesens zu erbeben. Denn es hat auch in meinem Leben Zeiten gegeben, wo ich ganze Nächte lang mit der Pistole in der Hand durch das Dunkel gelaufen bin, und wo es nur eines letzten Anstoßes zur Tat bedurfte. Der braucht dann freilich nur ganz klein zu sein, wie etwa im Falle Kleistens die Trostlosigkeit [S. 59]eines Tages im November, diesem ‚Hängemonat‘, wie ihn die Engländer nennen.“
„Aber diese Seelenruhe, dieser frivole Frohsinn, diese εἰρήνη, mit der der Jüngling Kleist wie weiland Sokrates in den Tod gegangen ist, dünket mich unerklärlich“, warf Wieland ein.
„Mitnichten,“ fuhr Goethe fort, „wenn einmal das letzte Bedenken überwunden und gleichsam die letzte Aufenthaltsstation des Lebens überschritten ist, wird man den Tod selbst schon als einen Vorgeschmack der süßen Ruhe, die uns mit ihm erwartet, genießen, und wenn erst der Fahrwind aus dem Elysium über eine Seele weht, wird sie sich mit Frohlocken von diesem unserem höchst problematischen Leben lösen. Darum soll keiner die Tat des Kleist eine frivole nennen. Selbst wir zwei Alten, die wir uns hier im Warmen gegenübersitzen und mit Recht stolz auf unsere sechzig oder wie Sie, mein Lieber, fast achtzig überlebten Jahre sein können, wollen dies nicht tun. Denken wir uns nur in die Seele dieses Unglücklichen, von dessen zahlreichen Dramen eines ‚Der zerbrochene Krug‘ hier in Weimar unter meiner Leitung aufgeführt und vom Pöbel verlacht wurde und ein anderes, das große Ritterschauspiel ‚Käthchen von Heilbronn‘, dreimal in Wien gegeben und abgelehnt wurde. Mehr weiß unser deutsches Theater noch nicht von Kleist. Summieren Sie zu dieser Nichtachtung, die einen ehrgeizigen Menschen, wie er war, dreifach traf und vergiftete, noch das Elend seines preußischen Vaterlandes seit Jena und die qualvolle Lage eines, der heute von der Feder leben muß und hündischen Demütigungen [S. 60]ausgesetzt ist, so werden Sie sich über seinen gewaltsamen Tod als einzigen Ausweg aus dieser See von Plagen kaum mehr verwundern können.“
„Er soll eine solch verbitterte Wut gegen Napoleon gehabt haben,“ bemerkte Wieland, „daß er, wie mir mein Sohn erzählt hat, sich monatelang mit dem Plane trug, den Kaiser selbst zu ermorden.“
„Das steht ihm nicht übel,“ war Goethes Antwort, „wie er denn auch auf die Nachricht von dem Durchfall des ‚Zerbrochenen Kruges‘ in Weimar meinen Namen unter Fäusteballen genannt und dazu gesagt haben soll: ‚Ich werde ihm den Lorbeer schon von der Stirne reißen‘, als ob ich allein die Schuld an seinem Mißgeschick gewesen wäre. So hat er auch späterhin mich mit manchen Spottversen und Pasquinaden geärgert und mir damit jede Möglichkeit genommen, mich weiter für ihn einzusetzen und noch etwas für ihn zu tun.“
„Ja,“ rief der alte Wieland dazwischen, „aber man spricht doch davon, daß Sie ihn durchaus nicht anerkannt und gewürdigt hätten.“
„Ich weiß es, mein Freund, und diese literarische Lüge wird vielleicht noch lange weiterleben, denn solch ein falsches Urteil läuft von einem zum anderen gedankenlos über. Wie man auch Sie, mein lieber Wieland, noch vielfach einen sittenlosen Mann nennt, trotzdem Sie in zwanzigjähriger treuer Ehe vierzehn lebende gesunde Kinder zuwege gebracht haben. Es hat wenige gegeben, die diesen Kleist, da er lebte, mehr geachtet haben als ich, wenngleich [S. 61]mir sein Wesen und Dichten von Grund aus ferne stand. Das Zertrümmerte, Chaotische bei ihm, dieser Zustand, in dem ich lebte, ehe ich dichtete, machte mich bis in alle meine Moleküle unruhig. Dieses Aufspüren und Aufjagen von Urtrieben in uns bei Kleist, die wir mit Mühe seit ein paar tausend Jahren gezähmt haben, flößte mir Grauen und Unbehagen ein und verwirrte mein sicheres Gefühl vom mechanischen wie moralischen Gleichgewicht dieser Welt. Aber darum verkannte ich nicht die titanische Größe in seiner ‚Penthesilea‘, deren Verse mir den Atem versetzten und mich vierzig Jahre zurückwarfen, noch entging mir der feine Reiz im ‚Zerbrochenen Krug‘, einem Stimmungsbild, das ein Teniers nun eben nicht besser hätte malen können.“
„Sie kennen seinen Robert Guiskard nicht“, rief nun Wieland dazwischen. „Wenn er dies Werk, aus dem er mir als mein Gast einst ein paar Szenen vortrug, vollendet hätte, statt es zu vernichten, so müßten Äschylus, Sophokles und Shakespeare vor ihm als Anfänger ausreißen. Das Feuer, das dieser unaussprechliche Mensch in sich trug, vermochte mich alten Vater, der ich dem lieben Gott fast schon die Hand reichen kann, noch zu Tränen über das Weh dieser Welt zu schmelzen. Er hat mir eingestanden, daß er sich beim Schreiben von Akt zu Akt immer mehr in seine Helden bis zur Narrheit verliebe, so daß es ihm das Herz abpresse, wenn er wie an jene Penthesilea schließlich Hand an sie legen müsse. Und er weinte dabei ganz wahrhaftig, wie einst meine Frau, als ich sie zwang, unseren lieben alten Gockelhahn abzuschlachten, und sie das [S. 62]Messer in der Hand vor ihm stand und ihn mit den Worten: ‚Mein Herzchen, mein Liebes, mein Lebenslicht, mein alles, mein Hab und Gut, meine Schlösser, Äcker, Wiesen und Weinberge, mein Innerstes, mein Herzblut und mein Augenstern‘, langsam ins andere Leben hinüberschnitt. Von den Frauen insgemein verstand der Jüngling Kleist — denken Sie nur an sein ‚Käthchen‘ oder ‚Evchen‘! — mehr als unser seliger Schiller mit all seinen Theaterjungfrauen, denen ich für mein Leben gern einmal in der Nachthaube begegnen möchte, um zu wissen, ob sie von Fleisch und Blut seien. Summa summarum: Ich behaupte dreist, daß wir Deutschen in diesem Kleist unseren Shakespeare verloren haben.“
Zum Glück für den alten Wieland kam in diesem Augenblick der Diener und meldete die Ankunft der Gäste. Goethe aber machte wie allem so auch diesem Gespräch ein Ende, indem er sich erhob und kurz sagte:
„Dieses zu entscheiden, Herr Wieland, müssen wir dem Jahrhundert nach uns überlassen.“
So sprach Goethe. Der Festredner aber, der zum hundertjährigen Todestage am Grabe Heinrich von Kleists sprechen durfte, hätte sagen müssen, daß es einen Shakespeare leider nur einmal gegeben hat, und daß irreale Bedingungssätze an einer Gruft und angesichts eines Toten im Grunde überflüssig seien, aber daß der frühe Tod Kleists, der nicht minder als Theodor Körner für sein Vaterland gefallen ist, für unser deutsches Theater der schwerste Verlust gewesen ist, den es jemals erfahren hat.
[S. 63]
Was der Bürger heute bei uns zulande unter „Künstlern“ versteht, das sind meist friedfertige, tugendhafte und tadellose Männer, deren Gewissen so hell glänzt wie das Hemd, das sie tragen, die pünktlich ihre Steuern zahlen, Weib und Kinder haben und am Sonntag doppelt so fromm sind wie an Werktagen. Es sind gute Staatsbürger, die tagsüber schreiben oder malen, mittags um zwölf Uhr essen und abends kegeln oder Karten spielen, ehrsame Geschöpfe, die von den Schutzleuten gegrüßt werden, mindestens zwei Vereinen angehören, ein Haus besitzen, den Oberbürgermeister duzen, und wenn sie gestorben sind, mit Musik und vielen Kränzen begraben werden. Öffnet man dann ihr Testament, so entdeckt man zur allgemeinen Freude, daß der Dahingegangene zudem noch ein hübsches kleines Vermögen hinterlassen hat, und Kinder und Enkel feiern noch nach Jahren den einstigen Künstler in der Familie nach. Gutmütig scheinen die Augen eines solchen Mannes, und sein Mund spricht Worte der Milde und Liebe, und man schläft nicht unruhig, wenn man einen Abend mit ihm verbracht und verlacht hat.
Leider stimmt das Bild, das die Geschichte uns von dem Leben der ganz großen Künstler gibt, nicht mit diesem friedlichen Idyll überein, das der gute Bürger, der abends im Klub, im Kasino oder in der „Erholung“ sitzt, sich nach dem Beispiel seiner heimischen städtischen Künstler zurecht macht. Wir wollen einmal ganz absehen von der Kategorie [S. 64]der ungeordneten wilden Individuen, die der Gesellschaft den Krieg erklären, mit jedermann in Unfrieden leben, ihre Pflichten verträumen, ewig gereizt sind und stets über 36 Grad Blutwärme haben, die früh sterben, im Duell oder am Wein, oder abseits von allen verbittert den Tod suchen und finden. Aber es gibt doch noch eine zweite Spielart von großen Künstlern, die anscheinend ein schlichtes bürgerliches Leben führen, ohne Lärm und ohne Widerspruch und scheinbar restlos im Staate aufgehen, so daß man vermeinen könnte, sie hätten die Harmonie zur Welt gefunden, die Goethe der Größte sich errungen hat. Blickt man jedoch hinter diesen Deckel ihres äußeren Daseins in das Uhrwerk ihres geheimen Lebens, zu dem nur sie selber den Schlüssel haben, so erschrickt man wie vor dem Haupte der Medusa, das jeden, der es sah, versteinerte. Zu diesen Tasso-Menschen, die von sich selbst gehetzt, Jagdhund und Hase zugleich, die kurze Summe ihrer Tage unter Schmerzen von der großen Qual der Welt subtrahieren, gehörte der bedeutendste Dichter, den Wien uns Deutschen geschenkt hat: Franz Grillparzer.
Das Gemütsleben dieses Dichters, den jede Töchterschülerin lesen darf, ist eine Hölle von Bitternissen und Sorgen und Ängsten gewesen mit tiefen Schlünden, in die sich die Gewitter, die sich niemals offen bei ihm entladen konnten, scheu hineinverkrochen. In seinen Tagebüchern, in denen er sich vor uns aufgeschlossen hat, hat er seine Leiden hinausgeschrien wie Philoktet auf seiner einsamen Insel, daß dem, der vorüberfährt, vor Mitleid das Eingeweide brennt.
[S. 65]
Schon der Beruf, in dem er saß, und den er doch nicht fortwerfen konnte, so wenig wie ein Lahmer seine Krücke, machte ihm die Tage grau. Jahrelang hockte er als Unterbeamter im Wiener Finanzministerium sich den Rücken und die Seele krumm, zwischen Bureaukraten, die vom Wetter, vom Gehalt und von den Vorgesetzten sprachen, unter „Theater“ Verkehr mit Schauspielerinnen verstanden und sich für des Dichters Stücke höchstens nur wegen der Honorare, die sie einbringen könnten, interessierten. Wenn Grillparzer über die Kindermörderin Medea grübelte, klopfte plötzlich etwas an die Tür, und eine quäkende Stimme fragte: „Haben der Herr Konzeptspraktikant schon die Zollabrechnung der niederösterreichischen Bezirke revidiert?“
Immerfort bewarb er sich um einen Posten, der seiner geistigen Beschaffenheit mehr zugesagt hätte, etwa bei der Hofbibliothek, und schrieb unzählige Briefe, die anfingen: „Der gehorsamst Unterzeichnete bittet devotest und in untertänigster Ehrfurcht ersterbend usw.“, und die dann alle Verdienste des in tiefster Verehrung Erblassenden aufzählen mußten, eine Beschäftigung, die jedem feiner organisierten Menschen ein Gefühl ähnlich dem der Seekrankheit verursacht. Aber alles dies half nicht einmal. Der sprichwörtlich gewordene Undank des Hauses Habsburg bewährte sich auch bei diesem seinem größten Verherrlicher auf das sichtbarste. Dreiundvierzig Jahre lang mußte der Dichter subalterne Bücklinge machen und das Faß der Danaiden füllen helfen, bis ihm endlich, als er nicht mehr singen, sondern nur noch [S. 66]knurren konnte, das Gnadenbrot mit einem Titel und Orden daran überwiesen wurde.
Auch sein wirklicher Beruf, die dramatische Dichtkunst, belohnte ihn nicht nach Verdienst. Nahm man seine Jugendwerke teilweise mit überschwenglichem Jubel auf, so hatte man um so mehr an seinen späteren Stücken zu nörgeln. Schließlich pfiffen ihn die bösartigen Wiener so laut aus, daß er ganz theaterscheu wurde und zu zittern anfing, wenn man ihn nach einem neuen Stück fragte. So starb seine Liebe zum Theater mit fünfzig Jahren plötzlich ab, in einem Alter, da beispielsweise Ibsen später erst sein eigentliches Lebenswerk begann. Er verschloß das wenige, was er noch bis zu seinem einundachtzigsten Geburtstag schrieb, ängstlich in seinem Schreibtisch, wo es lieber vergilben als je wieder ausgezischt werden sollte. Erst nach seinem Tode kam es ans Licht. Mitsamt den ungezählten boshaften Sprüchlein, die der alte harmlose Herr Hofrat Grillparzer, der immer den Hauszins pünktlich einzahlte, und den die Kinder in Wien auf der Straße grüßten, jedesmal, wenn er sich „gegiftet“, hergereimt hatte. Da sah man auf einmal, daß diese Stütze des Staates, dieser korrekte Bürgersmann Grillparzer mit einer Schar bissiger Ratten und giftiger Schlangen zusammengehaust hatte, die ihm immerwährend vom Keller zum Giebel, vom Herzen zum Kopf gelaufen und gekrochen waren.
Denn die unwürdige Behandlung, die er zeitlebens vom Kaiser bis zum letzten Kritiker erdulden mußte, war Milch und Honig gegen die Teufel, die in seiner Brust herumbrodelten. Außer Rousseau hat sich wohl kein Geist so [S. 67]sehr selber gequält wie Grillparzer. Eine seltsame Lust am Schmerz verlockte ihn immer wieder, sein Inneres im Spiegel zu sehen, um schaudernd vor seinem Bilde zurückzufliehen: Neid, Eitelkeit, Spottlust, Hang zur Lüge, zum Diebstahl und zur Wollust und ein grenzenloser Egoismus, das alles stak in einen garstigen Knäuel verschlungen in ihm und schnitt dem entsetzten Hofrat, der doch keinen Flecken an seiner Hose duldete, gräßliche Fratzen. Er hatte nicht die Einsicht noch den Humor, zu sich selber zu sagen: „Ecce homo!“ „So ist der Mensch!“, sondern trug sich wie eine ekle Last, eine lebende Leiche, ächzend zu Grabe.
Das Durcheinander in seiner Natur hat ihn, der als Beamter an genaue Registrierung gewöhnt war, wohl am meisten gewurmt: Heute zerfleischte und verkleinerte er sich selbst und kam sich erbärmlicher als Kotzebue vor, morgen wieder blähte er sich in gereiztem Selbstgefühl vor allen Dichtern wie ein kalkuttischer Hahn, schimpfte über Schiller und nahm dreist neben Goethe Platz. Er wurde von seinen Launen wie von bösen Winden hin und her getrieben, wie er sich auch mit seinen schwachen Kräften dagegen stemmen mochte. Er gehörte zu den Leuten, die immer aus Furcht vor Regen einen Schirm bei sich tragen, aber wenn es wirklich regnet, zufällig einen Stock mitgenommen haben, oder zu denen, die im Theater stets hinter einem Pfeiler zu sitzen kommen, denen die Bahn stets vor der Nase abfährt, und die bei der Table d’hote immer die kalten Platten erhalten und dann eine Tücke in das Objekt hineinlegen, die doch nur aus ihnen selber kommt. Dazu war er ein [S. 68]Hypochonder, der ewig kränkelte, sich immerzu den Puls befühlte oder die Zunge im Taschenspiegel besah, und dabei zweiundachtzig Jahre alt wurde, ohne jemals dem Tode nahe gewesen zu sein.
Am allerunglücklichsten aber war er in der Liebe, diesem schönen Fieber, das in allen seinen Stücken doch End- und Angelpunkt ist. In seinem Leben war es nur eine Qual mehr, der Pfeil, der ihm am tiefsten im Fleische saß. Jedesmal, wenn er sich verliebt hatte, merkte er auf einmal beim dritten Kuß, daß er gar nicht lieben konnte. Er zerpflückte seine Gefühle wie ein Kind die Blumen, und war dann entsetzt und betrübt, wenn sie nicht mehr dufteten. So empfand er schon vor der Liebe, was die Männer gemeiniglich erst nach der Liebe verspüren, und blieb darum einsam, scheu und verkehrt vor der goldenen Pforte zum Paradiese stehen. Und er fand, er schuf sich eine Gefährtin dabei, die er festhielt, Kathi Fröhlich, ein Wiener Mädchen, so beschaffen wie ihr Name, ein liebes Ding, dessen Briefe klingen wie Vogelstimmen vor Sonnenaufgang. Sie opferte ihm ihr Leben und ihre Seele, denn er machte sie zu seiner „ewigen Braut“, der nie die Hochzeitsfackel brannte. Sie glühten, — aber ach, sie schmolzen nicht. Er hat sie nicht aus Geldmangel nicht geheiratet, wie man auf der Schule lernt, sondern aus der Unfähigkeit, sich hinzugeben und sie hinzunehmen. Sie muß Unsagbares gelitten haben, bis er sie dazu brachte, aus dem „du“ wieder in das „Sie“ zu kommen, wenn sie mit ihm sprach, und aus der wärmsten Liebe wieder in eine kühle Freundschaft hinein. [S. 69]Und man möchte lieber der Karrenhund eines armen Kesselflickers als Grillparzers „ewige Braut“ gewesen sein.
Ganz spät erst, als sie beide keine Zähne mehr hatten und einander völlig ungefährlich geworden waren, zog er mit ihr und ihren Schwestern zusammen unter ein Dach. Und abends spielten die beiden wohl Klavier oder Tarock, je nach seiner Laune, und lächelten sich beim Abschied Punkt zehn Uhr wehmütig aus runzligen Gesichtern an. So lebten sie noch zwanzig Greisenjahre durch eine Wand getrennt nebeneinander, bis der Tod sie holte, und man ihre Leichen nur durch eine Spanne Erde getrennt nebeneinander in den Friedhof bettete. Ein paar Träumer aber wollen ihre Seelen drunten im Inferno beide in trauriger Gemeinschaft unter der dunklen Schar derer um Paolo und Francesca fliegen gesehen haben.
So war Franz Grillparzer, Dichter, Hofrat und Mensch, wohnhaft zu Wien, Spiegelgasse Nr. 21, von dem man noch sprechen wird, wenn das letzte schöne Haus aus den Tagen Alt-Wiens abgebrochen und fortgeschleift ist, um irgendeinem hohen modernen Mietkasten Platz zu machen. Mit einem tiefen Seufzer, wie ihn einst unser Dichter, dessen schweren Namen sich die Literaturgeschichte nach Lord Byrons Prophezeiung gemerkt hat, ihn ausstieß, als er schrieb: „Ich möchte, wär’s möglich, stehen bleiben, wo Schiller und Goethe stand.“
[S. 70]
Die meisten Menschen gleichen leider im Leben den Gefährten des Odysseus auf der Fahrt an der Insel der Sirenen vorüber: Wachs in den Ohren rudern und arbeiten sie sich ab und hören nicht den lockenden Sirenensang der Musen, die aus den Rätseln des Daseins Musik machen, und starren verwundert und ohne Begreifen auf das Genie, das gleich Odysseus in der Mitte ihres Fahrzeuges fest gebunden, beim Klang der Zaubermusik vor Wonnen und vor Qualen sich windet. Als ein solcher Abgetrennter stand auch Friedrich Hebbel in seiner Zeit, fest gebunden an den Mast seiner Natur, unverstanden von den meisten, ein sich selbst Quälender. So fuhr er unter laokoontischen Leiden den Weg zum Tode hinab. Es gibt heute noch zahlreiche, meist sehr satte Leute, die behaupten, daß viele Leiden erst den wahren Künstler machen, und daß insbesondere ein rechter Dichter tüchtig hungern müsse wie ein Bär, um nachher besser tanzen und springen zu können. Das Beispiel Hebbels allein sollte diesen Spöttern ein für allemal den Mund stopfen: Zeit seines Lebens hat er unter der gräßlichen Not seiner Jugend gelitten, die er, der Sohn eines armen Maurers, in einem freudlosen Marktflecken oben in Holstein unter Hunger und Entwürdigungen aller Art verleben mußte. Er war nicht so leicht und glücklich geartet wie ein anderer Parvenü, der freilich ein Bürgerssohn und somit viel weniger zu leiden hatte, ich meine Napoleon, der gerne in Gegenwart des Königs von Preußen und des Kaisers von [S. 71]Rußland — man kann sich die Gesichter der hohen Potentaten dabei denken! — von der Zeit erzählte, da er noch Unterleutnant bei der Artillerie gewesen war. Hebbel konnte später, da es ihm gut ging und er sich satt essen und anständig kleiden konnte, nicht einmal stolz sein auf diesen Wechsel, ohne zugleich bitter werden zu müssen. Das Gefühl, ein Proletarier gewesen zu sein, das nur der zu gleichem Los Verdammte verstehen kann, hat ihn, mehr als er es noch sagen und klagen wollte, gequält. Man muß ihn sich nur vorstellen, wie er herumstand mit seiner großen gekrümmten Gestalt, seinen Bauernknochen und seinen roten, einst oft verfrorenen Händen in den Salons der reichen blasierten Wiener Aristokraten, die ihn fortwährend mit dem alemannischen Dichter Hebel verwechselten, die den Hunger nicht kannten und ihren Magen nur, wenn sie zu viel gegessen hatten, verspürten. Gerade das Leben in Wien, dieser weichen, genußsüchtigen Stadt, muß ihn immer wieder an die harte Not der Kindheit gemahnt haben, da man die paar Winterkartoffeln im Keller verkaufen mußte, um den Sarg für den Vater, der ihn und seine Geschwister stets voll Wut seine „gefräßigen Wölfe“ genannt hatte, bezahlen zu können, da seine Mutter bei fremden Leuten waschen mußte, um seine kleinen Geschwister vor dem Hungertode zu bewahren, und da er selbst, ein bleicher Schreiberlehrling, nachts neben den Stallknechten und Kuhmägden schlief. Der Schatten dieser düstern Jugendzeit hat über seinem ganzen Leben gelegen. Niemals hat er aus vollem Herzen lachen können, und [S. 72]mit einem bittern Abschiedswort im Mund ist er aus seinem Menschendasein fortgeschlichen.
Nicht, daß er kleinmütig gewesen wäre, ein anderer hätte die Riesenlast und die Qual einer solchen Vergangenheit überhaupt nicht ertragen können. Nur einsam und menschenscheu war er geworden und klammerte sich lieber noch an die Tiere, Hunde oder Eichkätzchen, an, als an die lieben Nachbarn, die — seine Jugend hatte es ihn gelehrt! — den Schwächeren so unmenschlich quälen konnten. Nur den Frauen, die ihn mehrmals in seinem Leben durch ihre Arbeit ernährt hatten, bewahrte seine Seele eine glühende Dankbarkeit. Und in ritterlicher Weise hat er, ein moderner Frauenlob, seine Schuld gegen das weibliche Geschlecht in allen seinen Dramen abgetragen. Sonst lebte er wie eine Spinne in seinem Netz und zog aus sich selbst seine Gedankenfäden und schrieb jahraus, jahrein seine Tagebücher, in denen er sich über sich selber Rechenschaft ablegte und das Plus und Minus seiner Seele miteinander verglich. So kam er von selbst dazu, mehr die Menschen und die Dinge zu begrübeln und ins Abstrakte, ins Reich der Ideen hinüberzuspielen, als sie zu erleben. Der Geist des großen Philosophen Hegel, den er als Werdender in sich aufgenommen hatte, begleitete ihn auch als reifen Künstler. Darum war ihm das Wichtigste an einem Werke, daß es „seine Idee“ klar zum Ausdruck brachte. Unter dieser Voraussetzung schuf er denn auch, der direkte Vorläufer Ibsens, seine großen Dramen.
Das einzige, was ihn nämlich immer wieder mit der Öffentlichkeit zusammenbrachte, war das Theater. Er liebte es [S. 73]mit der ganzen heimlichen Liebe, die in ihm war. Schon äußerlich war er mit ihm dadurch verbunden, daß seine Frau, der er sein ganzes spätes Glück verdankte, als erste Darstellerin an der damals, beileibe nicht heute, ersten deutschen Bühne, dem Wiener Hofburgtheater, tätig war. Freilich fügte es sich — wie manche Menschen eben Unglück haben müssen, bis ihnen kein Zahn und nichts mehr weh tut —, daß der damalige Leiter des Burgtheaters ein anderer Maurerssohn, nämlich Heinrich Laube, war. Mit diesem lebte Hebbel in beständiger literarischer Feindschaft, und Laube, der keineswegs zu den vornehmen Charakteren gehörte, rächte sich in seiner Weise dafür, indem er auf seiner Bühne nur Frau Hebbel und höchstens notgedrungen Herrn Hebbel zu Worte kommen ließ. Auch dieses Mißgeschick konnte Hebbel nicht mit Humor ertragen. Er verzehrte sich in stummer Wut über den hoffähig gewordenen früheren Revolutionär, der ihm da vor der Nase französische Plauderstücke und verlogene deutsche Jambendramen aufführen ließ. Dazu kam, daß die Tagespresse sich das unfeierliche Gelübde abgelegt hatte, Hebbel totzuschweigen, und nur ein paar Juden, Emil Kuh, Felix Bamberg u. a., halfen dem deutschen Barden über den kleinen Kummer und die große Verzweiflung hinweg.
Aber schließlich konnte ihm dies alles nicht den Mut und die Lust am Theater nehmen. Wie Goethe hoffte er stets von neuem auf einen Frühling der deutschen Bühne, wollte und konnte er nicht glauben, daß die meisten Deutschen lieber in alberne Schwänke als in ernste Stücke hineinliefen, [S. 74]daß der normale Mann in Deutschland wöchentlich mehr für Zigarren, als jährlich fürs Theater ausgibt. Wer ihm das bewiesen hätte, dem hätte er ein: „Das wird und muß anders werden!“ entgegengehalten. Ja, er war der Ansicht, daß wie die Germanen einst einen Bonifazius hatten, der sie zum Christentum überredete, so hätten sie heute einen ebenso starken Glaubenshelden nötig, der sie zum Theater als zu einer Kult- und Kulturstätte bekehren könnte. In dieser Hoffnung schrieb er seine Stücke, allen voran die ragende Nibelungentrilogie, eine Saat für die Zukunft, am Tage der Garben zu reifen.
Es war ihm nicht vergönnt, gleich Richard Wagner, der ein Gleiches wie er für die Deutschen in der Oper, dieser Mißgeburt aus Wort und Musik, erstrebte, den Tag der Ernte zu erleben. Hebbels Bayreuth ist jetzt noch überall und nirgends in Deutschland. Seine Recken- und Heldenwelt liegt heute noch meist wie die Tierfelle, die sie nach alter falscher Überlieferung tragen müssen, in deutschen Theatergarderoben eingekampfert. Hin und wieder klopft und stellt irgendein Festtag sie noch aus. Ibsens schlechteste Jugenddramen, Shaws albernste Possen, Strindbergs ödeste Lamentationen muß das deutsche Publikum heute geduldig über sich ergehen lassen, Hebbels reifste Werke bleiben ihm noch immer so viel als möglich versagt. Aber wenn einstmals die Japaner und Mongolen Europa einnehmen, oder die Amerikaner es aufkaufen und sich eine Vorstellung von dem einstigen deutschen Geist und Wesen machen wollen, so werden sie sich Hebbels „Nibelungen“ aufführen lassen.
[S. 75]
Drei Tage aus dem Leben Chamissos geben ein anschauliches klares Bild von dem Schicksal und dem Wesen dieses deutschen Dichters, der zeitlebens besser und schneller französisch als deutsch geredet und verstanden hat, und der in der Nacht vor seinem Tode unaufhörlich in der Sprache Frankreichs von seiner Kindheit phantasierte.
Der erste Tag war ein strenger Wintertag im Jahre 1790. Der Schnee lag schon fußhoch in den meilenweiten stillen Wäldern, die sich um Boncourt, das Stammschloß der Chamissos in der Champagne, ausdehnten. Der neunjährige Adelbert hatte den Nachmittag mit seinen Schlittschuhen auf dem Weiher vor dem Schlosse zugebracht und war wohl fünfzigmal in stummen Träumereien unter der steinernen, schneebedeckten Brücke hin und her gelaufen, abseits von den Geschwistern, die, in vornehme Pelze und Schals gehüllt, Bonbons lutschten und dabei von Paris, der Königin Marie Antoinette und dem nächsten Hofball plauderten. Eine strenge mürrische Erzieherin — denn die Eltern verkehrten damals nur par distance mit ihren Kindern — brachte den Kleinen ins Bett, und dort, in einem großen, weißen und goldenen Rokokosaal, den ein Kaminfeuer voll Scheitholz und Tannenzapfen durchwärmte, träumte das Kind unter Spitzenvorhängen mit geschlossenen Augen weiter, wie es vorhin auf dem weißen Eise mit offenen Augen von einer märchenhaften Zukunft geträumt hatte. Mitten in der Nacht wurde der kleine Adelbert [S. 76]von einem wahren Höllenlärm aufgeweckt. Drunten in der dunklen Stille hörte man wilde Männerstimmen die Carmagnole johlen, die Hunde bellten und erdrosselten sich vor Wut beinahe selber an ihren Ketten. Nun pfiffen Flintenschüsse durch die Nacht. Scheiben klirrten. In dem Vogelhaus hinter dem Brunnen mit der Sphinx hörte man die Hühner vor Angst gackern, und es war, als ob der Lärm der Männer von Minute zu Minute näher käme. Der Knabe sah beim Kerzenschein seine Eltern voll Angst im Saale hin und her laufen, die Geschwister fingen an zu weinen. Dann wurde er von einem alten Diener ergriffen, in das Kissen seines Bettes gepackt und in einen großen Schlitten getragen, der hinter dem Schlosse wartete. Die Eltern und Geschwister kamen zitternd und wimmernd gleich hinterher. Die Revolutionsmänner hatten indes schon die Scheune und die Dienerschaftsräume angesteckt. Es war so hell geworden, daß man die Tauben erschreckt um den Turm mit der Sonnenuhr flattern sah, auf der man deutlich die grün-goldenen Ziffern erkannte. Die Luft war von dem Feuer ganz warm geworden, und der kleine Adelbert, dem ganz sonderbar bei diesem schönen und schrecklichen Traumgesicht zumute wurde, sah nur noch, wie ein Mann im Bauernkittel wütend das Wappenschild der Chamissos, einen stehenden und einen ruhenden Löwen, von dem Tor im Burghof herunterriß. Dann zogen die Pferde an, und der Schlitten mit den lebenden Überresten von Schloß Boncourt fuhr eilig der Grenze zu. Am andern Morgen, als der Knabe erwachte und zu seinem [S. 77]Feigenbaum heruntergehen wollte, erzählte ihm die Mutter mit Tränen, daß alles eingeäschert sei, und nach wenigen Wochen sah er sich mit den Seinen in einer elenden Mietwohnung zu Düsseldorf am Rhein, wo die völlig mittellosen Eltern mit sich zu Rate gingen, ob ihr vierter Sohn Adelbert oder vielmehr Louis Charles Adelaide Comte de Chamisso, Vicomte d’Ormond et Seigneur de Boncourt, nicht am besten zu einem Tischler in die Lehre treten sollte.
Der zweite bedeutungsvolle Tag im Leben unseres Dichters war im Herbst des Jahres 1805. Er war mittlerweile, da seine Hände doch zu viele vornehme nichtstuende Ahnen gehabt hatten, um das Schreinern erlernen zu können, Page am preußischen Hofe und dann Leutnant im preußischen Linien-Infanterie-Regiment „von Goetze“ geworden. Allerdings brachte er auch für dieses Handwerk nicht das rechte Talent mit. Der Sinn für die Wichtigkeit der Gewehrgriffe oder des Lederzeugs und die Bedeutung der Feldsignale ging ihm völlig ab, so daß er vor seinem Oberst durchaus nicht die rühmliche Rolle wie später vor Apollo gespielt hat. „O dieser Oberst!“ schrieb er nach Jahren auf seiner Weltreise in dem Hafen von Hawaii in sein „Tagebuch“, als er wieder einmal wie unsereins von der Schule von ihm geträumt hatte, „er hat mich, ein schrecklicher Popanz, durch die Meere aller fünf Weltteile, wann ich meine Kompagnie nicht finden konnte, wann ich ohne Degen auf die Parade kam, wann — was weiß ich, unablässig verfolgt, und immer sein fürchterlicher Ruf: „Aber Herr Leutnant! Aber Herr Leutnant!“
[S. 78]
An jenem Herbstabend Anno 1805 kam unser Chamisso spät vom Dienst aus seiner Kaserne zu Potsdam. Man hatte ihm soeben mitgeteilt, daß der Krieg mit Napoleon und Frankreich nun bald bevorstehe, und daß man Marschordre bekommen und ins Feld rücken werde. Chamisso warf noch einen Blick auf das kahle zweistöckige Soldatenhaus, lauschte den Hörnern, die an allen vier Ecken des Kastens zu Bett bliesen, und wandte sich seufzend zum Gehen, wobei er über seinen Degen stolperte. „Sie alle haben ihre Heimat und ihr Vaterland,“ grübelte er vor sich hin, „auf das sie stolz sind, und dem sie dienen können!“ Seine Eltern und seine Geschwister waren längst wieder über den Rhein heimgekehrt, und suchten unter Napoleon das wiederzufinden, was sie unter Ludwig verloren hatten. Er allein besaß kein Vaterland mehr unter und hinter sich, und gegen das, was er gehabt hatte, sollte er nun das Schwert führen, das ihm an der Seite baumelte. Eine bittere Melancholie überkam ihn, und seine Seele ward tieftraurig in dieser erbärmlichen, erbärmlichen Welt. Die Wut seiner Kameraden gegen Napoleon, die diesen Dämon immer „einen Teufel und ein Scheusal“ schimpften, konnte er nicht mitfühlen. Und wie vermochte er erst die Franzosen zu hassen, in deren Sprache er mehr als die Hälfte seiner Gedanken dachte! Er zog heimlich auf der dunklen Straße seinen Degen aus der Scheide und betrachtete ihn wehmütig, wie ein Schmetterling sich ein Stück Bindfaden besieht, und er kam sich plötzlich wie ein Chevalier ohne Land, ein Reiter ohne Pferd oder wie ein armer Jude und Schlemihl vor, und es [S. 79]schien ihm im trüben Schein der Potsdamer Öllaterne, als habe er sogar seinen Schatten verloren. Er weinte im Finstern ein paar stille Tränen zum Erstaunen der geraden Stadt Potsdam, in der nachts die Häuser exerzieren, und die so etwas höchst selten sah, und kam traurig wie eine Nachtmütze vor seine Mietswohnung. Oben an seinem Schreibtisch erst, bei seiner Studierlampe und vor seinen Büchern fand er, Shakespeare, Schiller und Goethe um sich, seinen Frieden wieder, und er übersetzte Rousseaus Ode:
ins Deutsche, während drunten auf der Gasse ein betrunkener preußischer Patriot „Nieder mit Napolium!“ vor sich hingröhlte.
Der dritte Tag im Leben Chamissos, der uns sein Bild vervollständigt, war im Sommer des Jahres 1828. Vor dem Geschick, gegen Frankreich das Schwert zu führen, hatte ihn vor sechzehn Jahren die schmähliche Kapitulation der Festung Hameln, in der er mit seinem Regiment gelegen hatte, bewahrt. Er war nach Frankreich heimgekehrt und hatte versucht, wieder Franzose zu werden. Aber vergebens! Ein kurzes Gespräch mit Uhland, der zu gleicher Zeit mit ihm in Paris weilte, dünkte ihm schöner als eine Woche am Hofe Napoleons. Selbst die Verführungskunst der Frau von Staël, die gleich ihm eine Verbannte war, und die ihm um ein süßes Gramm mehr als eine Freundin zugetan war, machte ihn nicht wieder zum Franzosen. Es schien ihm, als könnte er nie mehr Ruhe finden. Es ging [S. 80]ihm mit dieser schönen Frau wie mit seinem Vaterlande, sie zog ihn an, und er floh innerlich vor ihr. So zwischen Frankreich und Deutschland hin und her gewürfelt hatte er seltsamerweise seine Ruhe erst auf einer großen dreijährigen Weltreise gewonnen, die er auf einem russischen Schiffe unternahm. Wie Peter Schlemihl den Verlust seines Schattens endlich vergessen konnte, als er die Siebenmeilenstiefel gefunden hatte, so erging es Chamisso, als er an den weltentlegenen glücklichen Inseln des Stillen Ozeans landete und angesichts fröhlicher anspruchsloser sogenannter „Wilder“ einsah, daß für den weisen Menschen überall das Vaterland ist.
Nun war er schon seit zehn Jahren in Berlin, hatte den Leutnantsrock längst vergessen und sich statt dessen mit Steinen und Pflanzen angefreundet, die nach seinem Bekenntnis „viel mehr Verstand als alle Rekruten hatten“. An einem Sommertage nun hatte ihn sein Freund Hitzig, auch ein früherer Schattenloser, der sich darum ein „H“ vor den Namen „Itzig“ gestohlen hatte, von der Stettiner Post abgeholt. Chamisso, oder, — er hatte sogar jetzt einen Titel hinter sich, — „der Kustos des botanischen Gartens zu Berlin“, war mit einer riesigen Botanisiertrommel und einem Barometerkasten auf dem Buckel draußen in der Mark gewesen, um „Heu“ für seine Herbarien einzusammeln. Nun wanderte er rüstig mit seinen guten Spazierhölzern neben seinem Freunde die lange Friedrichstraße hinauf nach Hause. Und als er die Leute hinter sich, die dem wunderlichen Mann mit den langen Haaren und der Botanisiertrommel nachsahen, respektvoll flüstern hörte: „Der Dichter [S. 81]Chamisso!“ und als er bedachte, daß nach ein paar Schritten ein Haus kam, in dem sein Weib auf ihn wartete und seine fünf Jungen ihn mit dem Kriegsgesang „Arocha“ von den Sandwichinseln begrüßen würden, den er ihnen beigebracht hatte, da wurde ihm so ausgelassen zumute, daß er zum Erstaunen Hitzigs und der Friedrichstraße auf einem Bein zu tanzen anfing. Ja, es war wahr geworden, was er kaum gehofft hatte: Mit fünfzig Jahren war er zum deutschen Dichter geworden, und war das heute, was Uhland der Deutsche mit dreißig Jahren gewesen war, und aus dem „passivsten Tier der Welt“, wie er sich selbst in den Jahren des Hin- und Herschwankens getauft hatte, war einer der fleißigsten Menschen geworden. Er dachte daran und es wurde ihm warm dabei, daß er mit dem „Heu“ von draußen ein paar frische Gedichte für seine Frau mitgebracht, der er von der Reise geschrieben hatte: „Vergiß nicht die Rosen, vergiß nicht, die Blumen in meinem Garten zu begießen, vergiß nicht, den Sperlingen unter meinem Fenster Futter zu streuen, und vergiß nicht, den Jungen die Buchstaben beizubringen. Ich bringe mich dir wieder ganz, wie ich dich verlassen habe.“
Und auf einmal fiel er dem sprachlosen Hitzig vor lauter Jubel auf der Straße um den Hals: „Weißt du, welches Motto ich meinen gesammelten Gedichten voranstellen will? Die Verse, die Goethe dem Tasso in den Mund legt, wie er seine Dichtung seinem Fürsten bringt:
[S. 82]
Die Rheinländer haben unserm Volke und unserer Geschichte nicht viele große Männer geschenkt. In der kurzen Spanne Zeit, der Handvoll von Jahrhunderten, die uns moderne Deutsche von den mit Tierfellen bedeckten, Jagd und Fischerei treibenden, unhistorischen Germanen, unseren Vorfahren, trennen, haben die Rheinländer nur wenige bedeutende Männer hervorgebracht, die einen gewaltigen, bleibenden Anteil an der Kulturarbeit in unserem Volke gehabt, die ihren Namen über die Jahrhunderte glänzend und für die Geschichte Deutschlands unvergeßlich gemacht haben.
Sachsen, Schwaben und Schlesien haben vor allem unserm Vaterland in der Literatur, der Philosophie, in der Kunst und den Wissenschaften die führenden Geister gegeben, die das Gedanken- und Empfindungsleben unseres Volkes geschaffen und zum Ausdruck gebracht haben. In wirtschaftlicher Hinsicht allen anderen Stämmen unseres Vaterlandes überlegen, haben die Rheinlande für die Kunst nur ein verhältnismäßig kleines Kontingent von großen Meistern gestellt. Beethoven, den sie in der Musik haben, ist eigentlich nur ein Zufallsrheinländer. Dreiviertel seines Lebens hat er in Wien zugebracht, und der Grundcharakter seines Wesens und seiner unendlichen Musik ist nicht rheinisch gewesen. Goethe ist von Geburt ein Mittelfranke, kein eigentlicher Rheinländer. Und der einzige auch als Persönlichkeit bedeutungsvolle Dichter, den sie bisher [S. 83]in der Literaturgeschichte aufzuweisen haben, der am Rheine geboren und groß geworden ist, dessen Name, nennt man die besten Namen, immer genannt werden wird, ist ein Jude gewesen: Heinrich Heine.
Die meisten Literaturhistoriker haben das Phänomen Heinrich Heine unter den Deutschen — denn ein solches ist er unter unseren Dichtern gewesen und geblieben! — lediglich aus seinem Judentum zu erklären versucht. Die Selbstironie in seinem Wesen wie in seinem Dichten, der Sarkasmus, mit dem sich fast ein jedes seiner Gedichte zum Schluß selbst in den Schwanz beißt, die Spottsucht, die hinter jedem Ernst nach seinem Witz sucht, das alles hat man als ein Charakteristikum seines Volkes, seiner Rasse bezeichnet und gegeißelt. Man muß zugeben, daß sich diese skeptische, ironisierende Neigung, die mit sich selbst gern Schindluder treibt, vielfach bei den Juden, die jahrhundertelang wie die Kellertiere von der Sonnenseite des Lebens und Wirkens ferngehalten worden sind, ausgebildet hat. Aber diese Selbstironie, diese Spottlust bei den Juden, die sich meist in Kalauern und Börsenwitzen ein Genüge tut, ist doch mehr Kopfarbeit und mehr Galgenhumor, als eigene eingeborene Empfindung, mehr eine Notwehr des Verstandes, denn ein Erbteil des Herzens. So sehen wir ja auch unsere heutigen frei gewordenen Juden immer weniger Gebrauch von einer bitteren Selbstbespottung machen, mit der sie einstmals vor Verzweiflung Rache am eigenen Schicksal nahmen. Nicht eigentlich jüdisch ist also diese Selbstironie, diese Zwiespaltigkeit [S. 84]des Innern, die sich immer als Doppelgänger sieht, diese unüberwindliche Scheu vor allem Pathetischen, diese quälerische Lust, allem Ernsten eine Fratze zu ziehen. Nein, alle, die Rheinländer sind, fühlen, daß dies ihre eigene tragikomische Domäne der Empfindungen ist, daß Heine nur das Echo ihres Herzens war, und daß sein Blut wie das ihre geklungen hat, mag er immerhin außerdem ein Jude gewesen sein.
Dieser Kern des Heineschen Wesens und Dichtens, diese Angst vor der Phrase, diese Furcht vor der Lächerlichkeit, diese Scheu vor den eigenen Tränen, die sich ihr Gemüt zu zeigen schämt, die ist typisch rheinisch, die stammt aus Düsseldorf und nicht aus Palästina. Wenn ihn jedes Große, dem er im Leben begegnet, zwingt, ihm den Witz abzugucken, wenn er alle Dinge, alles Erleben komisch zu nehmen sucht, wenn er sich selbst in der Matratzengruft in Paris, wo er die letzten acht Jahre seines Lebens fast gelähmt zubrachte, zu einem schlechten Spaß machte, so ist das echt rheinisch empfunden.
Aus dem Judentum Heines heraus hat man auch immer den zweiten Hauptvorwurf begründet, mit dem man ihn vor und nach seinem Tode wie einen herrenlosen Hund beschimpft hat: Er sei kein Deutscher, kein Patriot, sondern ein Verräter und Franzosenfreund gewesen. Nun sind die Rheinländer ihrem Naturell und ihren Neigungen nach schon mit dem benachbarten, weintrinkenden Volk der Gallier verwandt. Ja, sie fühlten sich durch häufige Berührung und geistigen Austausch jahrhundertelang, eh’ die Erbfeindschaft [S. 85]entstand, als Halbfranzosen. Ein Vorwurf der erwähnten Art trifft Heine also nicht so furchtbar schwer, wie die Franzosenfresser glauben. Wir denken ja alle seit 1870 Gott sei Dank ein wenig anders und milder und menschlicher über diese Dinge. Wir geraten nicht gleich mehr in furor teutonicus, wenn wir an Frankreich und Paris denken. Der Gedanke: „Der Rhein, Deutschlands Strom, nicht Deutschlands Grenze“, berauscht uns nicht mehr so wie unsere Voreltern, weil er uns selbstverständlich geworden ist. Der Erz- und Erbfeind, in dessen Hauptstadt wir in acht Stunden gelangen können, ist uns naturgemäß nicht mehr so fremd und fürchterlich als wie vor fünfzig Jahren noch. Und es ist ein erfreuliches Zeichen unserer Kultur, daß man begonnen hat, auch in den Schulen unserer Jugend nicht mehr die Tollwut gegen alles, was französisch heißt, einzuimpfen.
Denken wir nur kurz an die Zeit zurück, in der Heinrich Heine vom Jüngling zum Manne reifte, also in dem Alter war, in dem sich die politische Gesinnung im Menschen bildet. Es war die Zeit für Deutschland, wo Metternich Politik machte, wo die finstere Reaktion gegen jeden Fortschritt vom Rhein bis zur Memel die Gemüter niederdrückte. War es da einem Manne zu verdenken, wenn er nach Frankreich hinüberschaute und sich hinübersehnte, wo der durch die Revolution einmal entfesselte Wille zur Freiheit sich nicht niederducken lassen wollte, sondern sich hintereinander 1830 und 1848 aufbäumte und die Geschichte aus ihrem Schlafe riß? Was hätte Heine tun [S. 86]sollen? Hätte er Rhein- und Weinlieder dichten, oder Friedrich Wilhelm III., seinen wortbrüchigen, oder Friedrich Wilhelm IV., seinen unglücklichen Landesherrn, besingen sollen? Konnte er das nicht ruhig den preußischen Hofpoeten überlassen, die damals unser Volk tagtäglich mit patriotischen Gesängen überschwemmten? Mußte es nicht einen Mann, der den Wert der alten französischen Kultur kannte und genoß, zum Spotte reizen, wenn Leute wie Maßmann, der Dichter unseres „Heil Dir im Siegerkranz“, die Franzosen als „Barbaren“ beschimpfte?
Es ist wahr, Heine hat für Napoleon den Ersten geschwärmt. Aber tat das nicht Goethe fast noch mehr, der erklärt hatte, „dieser Mann ist viel größer als seine Feinde“, der immer von Napoleon wie von einem göttlichen Wesen gesprochen hat! Sahen nicht die beiden Dichter mit ihrem Blick für Menschengröße täglich in ihrem Leben die gewaltigen Segnungen aufwachsen, die Napoleon als Vollstrecker der Errungenschaften der Revolution über unsere alte Erde gebracht hatte? Schändet Heroenverehrung einen Menschen? Ist sie nicht vielmehr das, was ihn von einem Kammerdiener unterscheidet? Man entsinnt sich der Stelle in Heines Buch: „Le Grand“, wo er erzählt, wie er zuerst Napoleon gesehen habe: Es war in Düsseldorf. Heine war noch ein Knabe, als Napoleon seinen Einzug hielt. Es war in der Hauptallee des Hofgartens, und der Knabe dachte gleich mit Schrecken an die hochwohllöbliche Polizeiverordnung, daß man bei fünf Talern Strafe nicht mitten durch die Allee reiten dürfe. Aber — man denke! — der Kaiser ritt auf seinem [S. 87]Schimmel im Sonnenschein mit seinem Gefolge mitten durch die Allee! In diesem Geschichtchen hat man den ganzen Napoleon, den Mann, der durch Polizeiverordnungen, Gebräuche, Gewohnheiten und Gesetzesparagraphen mitten hindurchritt. Und die Begeisterung für einen solchen Menschen hat man Heinrich Heine in der damaligen heldenlosen Zeit verdacht!
Es stimmt fernerhin, Heine hat von der französischen Regierung ein Jahreseinkommen erhalten und angenommen. Aber was blieb ihm anders übrig in jener kläglichen Zeit, da seine Schriften vom Bundestag in Deutschland verboten waren und nur heimlich gedruckt und verkauft wurden, ohne daß er im fernen Paris viel von den Einkünften zu sehen bekam. Hat nicht auch der urdeutsche Hebbel damals Gelder von dem deutschfeindlichen Dänenkönig in Empfang genommen, um sein Dasein fristen und seiner Kunst leben zu können? Müßten wir uns nicht, statt Heine daraus ein Verbrechen zu machen, unseres Volkes in Grund und Boden schämen, das seine führenden Geister hungern und betteln läßt, das so wenig Gefühl für seine Würde und so wenig Liebe und Verständnis für die Kunst hat, daß es den Beruf des Künstlers noch heutzutage nicht genug achtet und stützt?
Nein, Heinrich Heine ist ein Deutscher gewesen, wenn er auch die letzten fünfundzwanzig Jahre, fast die Hälfte seines Lebens, in Paris gelebt hat. Das Heimweh nach dem Land über dem Rhein, diese echt deutsche Gemütskrankheit, hat ihn bis zu seinem Tode geplagt. Seine [S. 88]Muttersprache hat er, wie Richard Dehmel in seinem prächtigen Gedicht zu Heines Ehren gesagt hat, mächtiger gesprochen, als alle deutschen Müllers oder Schultzes. Seine ganze schriftstellerische Arbeit in Frankreich war im Grunde nichts anderes als das Kulturwerk, zwischen deutschem und französischem Wesen zu vermitteln, den beiden Völkern Verständnis und Achtung füreinander beizubringen. Und dies ist ihm bei den damaligen Franzosen so weit gelungen, daß ihre Dichter eine Zeitlang Deutschland gerne „le pays de Henri Heine“, das Land Heinrich Heines, genannt haben.
Der einzige Vorwurf gegen Heine, der lauter als die beiden genannten heute noch den Markt der Meinungen beherrscht, ist der, daß er unsere deutsche Kunst verdorben, unsere Lyrik vergiftet habe. Er selbst hat sich zuweilen den letzten Romantiker genannt, hat seinen „Atta Troll“ für „das letzte freie Waldlied der Romantik“ erklärt. In Wahrheit stand er zwischen der Romantik und dem Realismus, der unsere moderne Zeit beherrscht. Seine Jugend fiel in die träumerische Zeit, da die deutschen Dichter in den Wald der Poesie hinausritten, wie Heinrich von Ofterdingen, die blaue Blume zu suchen, sein Ende in den Anfang der nervösen Zeit, wo Eisenbahnen und Telegraphen und Maschinen unser Blut unruhig aber nüchtern gemacht und die Menschen so umgerüttelt haben, daß selbst die Dichter nicht mehr träumen können oder wollen. Zwischen diesen zwei Zeiten hat Heinrich Heine gestanden, und es heißt nur die Zeit schelten, wenn man den Zwiespalt, der notwendigerweise [S. 89]dadurch in sein Dichten gekommen ist, tadeln will. Hätte er mit der alten Zeit versteinern sollen, hätte er den feigen Tod der Romantiker im Schoße der Kirche sterben sollen? Nein, er wußte und fühlte, daß es nichts Unwürdigeres und nichts Dummeres gibt, als die Ideale von gestern anzubeten, daß der, dessen Pulsschlag nicht mit dem seiner Zeit geht, schon tot ist, ob er gleich noch weiter lebt. Und so gab er sich seiner Zeit, wagte er es, modern zu sein, und eröffnete damit als erster unter uns Deutschen die Zeit der Kritik, in der die Dichter den Menschen und dann die Gesellschaft besahen, beurteilten und schließlich verurteilten.
Und darum hat er, dessen Ehre es ist, in unserer denkmalwütigen Zeit kein öffentliches Monument in Deutschland zu haben, sich einen Denkstein in uns verdient.
[S. 90]
Man schrieb achtzehnhundertdreiundzwanzig, da wohnte zu Dülmen, im finsteren Münsterlande, seit vier Jahren ein junger Mann, der mit seinen geringelten schwarzen Locken, die ihm um die hohe Stirn hingen, seinen dunklen italienischen Augen, seinem schönen ausdrucksvollen sinnlichen Munde in diese flache Gegend, wo Gehöft und kahle Heide einförmig umeinander standen und unter diesen derben flachsblonden dickköpfigen deftigen Menschenschlag so schlecht wie etwa die Schwalbe in unsern Winter hineinpaßte. Er hatte sich in einer breiten, niedrigen westfälischen Bauernstube eingenistet, in der er keinen andern Schmuck duldete als ein großes, buntes, hölzernes Kruzifix, das er von einem Küster im benachbarten Coesfeld gekauft hatte, und das mit rotgemalten Blutstropfen überronnen zu Häupten seines Bettes hing. In den ersten Wochen, als er dort wohnte, hatte auf der schwarzen altmodischen Bauernkommode noch ein schönes Frauenbildnis gestanden, unter dem „Sophie Mereau“ zu lesen war. Und hinter diesem Namen war ein schwarzes Kreuz von einer zitternden Hand mit Tinte aufgemalt. Aber jetzt war dies schöne Bild, das wie ein Sonnenstrahl in dem düsteren Zimmer gewirkt hatte, verschwunden, weil der Fremde es verschlossen hatte und in einer Schieblade zwischen welken Efeublättern von ihrem Grabe verwahrte. Es war, als habe er das heitere Bild der Toten aus ihrer Jugendzeit nicht mehr ertragen: Dies Bild, das in seinen stillen Zügen noch nichts von dem [S. 91]eigenen späteren Geschick wußte, noch nichts von jener entsetzlichen Nacht, da sie unter schreienden Schmerzen ein totes Kind in die Welt stoßen würde, noch nichts von dem grauen anderen Morgen, da sie voll Verzweiflung sich von dem toten Kinde nachziehen lassen würde in Frieden und Schweigen. Wie zum Hohne hatte ihn, den Überlebenden, dies glückselige Bildnis seiner einstigen Frau angelächelt, aus holden kindlichen Augen, die zu sagen schienen, so etwas Schreckliches kann es nicht geben. Nun lag es im Schrank, den Blick nach unten gekehrt, wie im hölzernen Sarge zwischen den welken Blättern von ihrem Grabe neben der Zither mit blauem Band, auf welcher der Fremde zuerst wohl abends, wenn die Schatten kamen, gespielt hatte. Bis die Nähe des blutenden Heilands am Kruzifix ihn davon zurückgeschreckt und er sie verschlossen hatte. Mit schlaff gewordenen Saiten lag nun die Zither gleich dem Bilde nach unten gekehrt im Schrank, vergessen und tot wie seine Jugendzeit, und das Kreuz des Herrn hing triumphierend, einem großen Vogel gleich, mit ausgespannten Flügeln als einziger Schmuck in der finsteren Kammer. Allabendlich aber ging der Fremde auf die Gasse hinaus. Den Kopf zur Erde geneigt gleich einem Geistlichen, schritt er an den Bauernhäusern entlang, um deren Giebel am Sommerabend die Vögel schwirrten.
[S. 92]
zog es wie ein Traum durch seinen Kopf. Dann neigte er die schöne Stirne noch tiefer, stierte auf den schwarzen Erdboden und murmelte fünfmal ein Paternoster und fünfmal zehn Ave-Maria, wobei er die braunen Kügelchen des Rosenkranzes, den er stets um den Hals geschlungen trug, gedankenlos mit den Fingern abrollte. Vor einem niedrigen einstöckigen Bauernhaus, in dem vorn eine Schenke war, am Ende der Gassen, blieb er stehen. Eine Weile lauschte er, mit den einst so glänzenden, jetzt lichtscheuen Augen in das Abendrot blinzelnd, auf das Lied, das die Kinder hinter ihm sangen, die sich paarweise aufgestellt hatten und das letzte Paar immer wieder durchs Tor kriechen ließen:
„O du verlorenes Wunderhorn“, seufzte er laut und wandte sich ab, seine Tränen in die Schatten des Hauses zu verbergen. Die Türe stand offen wie eine Kirchtüre. Durch einen langen schwarzen Flur ging es ins Hinterhaus. Über die knarrende Wendeltreppe stieg er dort langsam hinauf zum ersten Stock. Aus der Kammer hörte er seltsame Laute und Sätze kommen, wie: „O du liebes [S. 93]Jesulein, du mein himmlischer Bräutigam, sie ist so schwer, deine Last, und so süß! Laß mich den Stein noch ein wenig tragen, gib ihn mir, du kannst nicht mehr, gib ihn mir! Oder soll ich dir die Nesseln im Weinberge ausraufen? O das viele Unkraut! O die Nachlässigen im Gebete! Wie mir meine Hände von den Nesseln brennen! Mehr, mehr noch! Alle will ich vertilgen und ausreißen, meine Fingerknöchel tun mir weh! O wie süß!“ Leise, ganz leise stieß Brentano die Türe auf, die zu dieser Stimme führte. Da lag im breiten eichenen Bauernbett eine wächserne weibliche Gestalt, Kopf und Brust emporgerichtet und die Arme wie zwei dürre Stöcke von sich gestoßen. Ein weißes Tuch, um ihre Haare gewunden, hob die scharfen bleichen Züge mit den schwarzen Gruben unter den Augen unheimlich ins Geisterhafte. Es war Anna Katharina Emmerich, die Tochter armer westfälischer Bauersleute, das fromme Nönnchen von Dülmen, die die Wunden unseres Heilandes an ihrem Körper trug, der zuliebe Brentano, ein Mensch, der aus Goethes Geschlecht stammte, seit vier Jahren hier hinter dem Leben der Welt sein Dasein verbrachte, ihre Gesichte und Offenbarungen zu betrachten, zu belauschen, zu beschreiben.
Als sie mit ihren weit aufgerissenen, ekstatisch verdrehten Augen den Freund, den „Pilger“, wie sie ihn hieß, in dem Türrahmen stehen sah, sank sie, als hätte sie auf seinen Anblick gewartet, erschöpft aufstöhnend in die von ihrem Schweiß feuchten Kissen zurück. Noch in ihrem Sinken ergriff er zärtlich mit seinen beiden [S. 94]Händen behutsam die mit der ehrwürdigen Signatur des höchsten Mitleidens bezeichnete Hand, dieses bei ihr nur geistige Sinneswerkzeug. „Wie steht es heute, Schwester Anna Katharina?“ fragte er gedämpft, wie man in einer Krankenstube spricht. „Unaussprechlich schön!“ kam es wie von weit her aus ihrem Munde. „Ich bin jetzt so ruhig und habe ein solches Vertrauen, als hätte ich nie eine Sünde begangen. Dies sind so gesunde Schmerzen. Ich weiß nichts mehr von der trüben, schmutzigen Welt. Unser lieber Heiland war bei mir, er hat mich mitgenommen, ich wollte bei ihm bleiben! ...“ Aber plötzlich besann sie sich erschrocken und deutete mit dem Finger geheimnisvoll auf den Mund. „Aber ich darf um alles nicht davon reden“, und schwieg und lehnte sich zurück. In dem Augenblicke flog die zahme Lerche, die in ihrem Zimmer oben über dem Fensterbalken nistete, auf ihr Kopfkissen, als sei sie allein dieser Geheimnisse wert. Die schwarze Krankenschwester aber, die bis dahin, ohne sich zu rühren, neben dem Bette gesessen und wie verzückt der Stimme der seligen Ekstatikerin gelauscht hatte, erhob sich und wischte der starr Daliegenden mit einem Schweißtuch die Angsttropfen von der Stirn. „Gelobt sei Jesus Christus, Schwester Luise“, flüsterte Brentano und setzte sich der Schwester gegenüber auf den hölzernen Bauernstuhl auf der andern Seite des Bettes. Dann schwiegen die beiden, neben der leise röchelnden Kranken sitzend, eine lange bedeutungsvolle Weile miteinander. Sie wußten, daß sie Braut und Bräutigam waren vor Gott, er, Klemens Brentano, [S. 95]und sie, Luise Hensel, in der unsichtbaren Kirche Christi einander angetraut, aber auf Erden durch ihre Leiblichkeit eines von dem andern getrennt. „Erzähl etwas, Klemens“, brach sie, durch das Schweigen verwirrt, das ihr wie eine Sünde vorkam, die Stille. „Du weißt, sie hört es gerne“, fügte sie mit einem liebevollen Blick auf die im Halbschlummer bei den toten Heiligen weilende Kranke hinzu.
Und Klemens begann ihr aus der Chronika eines fahrenden Schülers leise weiterzuerzählen. „Ich bin noch vielfach herumgeirrt durch die Lande, ehe ich meinen Herrn und Meister Jesum Christum gefunden habe und von ihm wert befunden ward, seine Wunder und seine Wunden zu verehren. Denn ich war hoffärtig von Kindheit an, weil ich aus einem vornehmen Hause stamme, darinnen Klugheit, Witz und Weltlichkeit umgingen seit Väter Zeiten. Und ich ward mit viel Fürwitz empfangen und bei Reichtum und Dünkel in die Schule geschickt. Und späterhin ging ich mit lauter klugen Gesellen um, an allerhand Orten, in Jena und Berlin, die vermeinten, das Reich Gottes mit ihrer flachen Hirnschale erobern zu können. Durch sie verlockt wie einst du durch den Bann der falschen Lehren Luthers lief ich gleich Parzival jahrelang in der Irre. Aber immer brannten die himmlischen Tropfen, mit denen ich unter der Patenschaft des letzten Kurfürsten von Trier, des Erzbischofs Klemens Wenzeslaus, dereinst zum katholischen Christen getauft worden bin, wie Feuer auf meinen Scheitel, so daß ich nur mit ewiger Reue ein solch weltliches [S. 96]Leben geführt habe. Und ob ich mich auch an ein Weib verloren habe, der Gott die ewige Seligkeit schenken möge, ich bin dessen wie aller Irrwege zum Heil niemals aus Herzensgrunde froh geworden. Und erst als ich dich fand, du gleich mir Bekehrte, du sanfte, barmherzige Zuhörerin meiner Leiden, du Trösterin, du mein liebes, neues Leben, du Heiligtum, in deren Nähe alle Furien weichen, als du mir deinen Mund entzogst und mit deiner Rechten auf das Kreuz mich wiesest, das immerdar durch alle Nebel um mich golden zu mir gestrahlt, da ward es Ruhe und Meeresstille in mir. Da wurde ich inne, daß alle meine Träume, deren Wollust ich seit meiner Kindheit am Rheine genoß, da ich am liebsten die Welt in einem Spiegelglas umgekehrt verzaubert betrachtete, nur Wolken waren, in deren Anblick ich mich beim Aufstieg des Kreuzwegs nach Golgatha verloren hatte. Dort, wo deine Hand hinwies, hing mein Herr und Heiland mit nach uns ausgespannten Armen am Stamm, die köstlichste Frucht, die der Baum der Menschheit getragen hat. Dort unter dem ewigen Licht, wo der Bronnen seines Blutes rinnt, haben unsere Geister im Gebet sich gefunden und vereinigt.“
Er reichte der barmherzigen Schwester, seiner unkörperlichen Geliebten, von Rührung ergriffen, über das Bett der seraphischen Kranken seine zitternde Hand. „Stille! Stille nur“, kam es von den Lippen seiner Vermählten in Christo, und mit ihrem weißen Finger wies sie auf die bleiche Nonne, die sich langsam wie ein Gespenst aus ihren Kissen wieder emporhob. „Es kommt über sie,“ fuhr sie [S. 97]fort, „morgen ist Freitag, der rote Todestag unseres Herrn, an dem ihre Wunden bluten müssen.“ Das verzückte Lallen der stigmatisierten westfälischen Nonne erhob sich von neuem mit seinen halb kindlich, halb priesterlich monotonen Lauten. Es hallte, wie das Echo einer Abend-Litanei von den Steinwänden eines Kirchengewölbes hallt. „Herr, hilf doch! Komme doch, Jesu! O Herr, o Herr, komm! Meine Kräfte reichen nicht mehr. Sie sind zu schwer für mich, alle diese Leiden, die ich für andere tragen muß. Da ist eine arme Frau, ganz deutlich sehe ich sie, die an Brustwassersucht leidet, mit der muß ich leiden, für die muß ich leiden. Wir sind alle ein Leib in Jesu Christo! O hilf mir, mein himmlischer Bräutigam, ich liege auf dem Kreuz, es ist ja bald aus. O Herr, hilf doch!“ Immer stoßweiser ging ihr Atem, immer heftiger arbeitete ihre arme Brust. Da beugten sich die beiden Menschen zu seiten des Bettes, die miteinander lauschend diese sublimierte Wollust genossen, voll Sorge über die ekstatische Kranke. Und sie sahen mit Schaudern, wie sich die Male und Zeichen der Nonne zu röten begannen, und wie ihre Stirne, ihre Brust und ihre Seite aus aufbrechenden Wunden bluteten.
„O holt mir meine Seelenspeise“, wimmerte das Nönnlein mit schwacher Stimme. „Gebt mir von dem heiligen Öle! Es durchdringt jedesmal wie ein stärkender Tau alle meine Gebeine. Ich hungere nach meinem himmlischen Gott und Herrn!“ —
Luise Hensel gab dem Freunde ein stummes Zeichen. „Es steht schlimm um sie. Gehen Sie, ihr den Priester zu holen!“
[S. 98]
Und hinaus in die Schatten schritt beim Klang des Angelus für die stigmatisierte Nonne Emmerich, dies Häuflein wundes Fleisch, in der nahen Pfarrkirche das letzte Sakrament zu bestellen, Klemens Brentano, der größte Volksliederdichter der Deutschen, der Bruder der freien Bettina, das Pflegekind der sonnigen Mutter Goethes, der später geisteskrank wurde, den die katholische Nacht verschlang.
[S. 99]
Kleversulzbach, ein Flecken von 600 Einwohnern mit schwäbischem Dialekt, zwischen den drei Oberamtsstädten Heilbronn, Weinsberg und Neckarsulm gelegen, war in großer Erregung. Denn die entsetzliche wochenlange pfarrerlose Zeit, da sich die Gemeinde bei Kindtaufen, Hochzeiten und Begräbnissen mit jungen unwürdigen Vikaren behelfen mußte, denen nichts im Gesicht stand als das Tübinger Stift, Homiletik und gute Vorsätze, war vorüber. Heute sollte der neue Pfarrherr in das mit Ackerblumenkränzen und einem vom Anstreicher des Dorfes mit roten und grünen Buchstaben neu bemalten Willkommenschild geschmückte Pfarrhaus einziehen. „Eduard Mörike hieß er und stammte aus Ludwigsburg, war also Gott sei Dank ein Schwabe von Geburt“, mehr wußte der Dorfschulze nicht von ihm zu berichten. Denn daß er das theologische Studium nur mit mittelmäßigem Erfolge absolviert hatte, und daß auch in seiner sittlichen Führung hin und wieder etwas auszusetzen gewesen war, wie dies alles in den Papieren und dem keineswegs glänzenden Schulzeugnis des jetzigen Herrn Hochwürden zu lesen stand, das verschwieg der Schulze vorsichtigerweise der höchst sittlichen Gemeinde von Kleversulzbach. Desgleichen auch die Stelle aus dem Briefe des Pfarrers, bei dem der junge Mörike zuletzt Vikariatsdienst versehen hatte, und die da lautete: „Vikarius Mörike zeigte bei mir eine fast sündhafte Neigung zur Musik, und zwar leider zu der ungeistlichen. So hat er in der ganzen [S. 100]Zeit von acht Wochen, die er bei mir war, keinen Tag vorübergehen lassen, ohne sich nicht etwas aus dem ‚Don Juan‘ des Mozart vorzuklimpern. Sonst ist mir noch unangenehm an ihm aufgefallen, daß er in gelegentlichen Disputen über den Wert der verschiedenen Religionen, falls es einem überhaupt gelang, ihn da hinein zu verwickeln, bisweilen eine sonderbare schwärmerische mystische Vorliebe für den Katholizismus äußerte.“
So viel oder so wenig Ungünstiges wußte der Ortsvorstand von Kleversulzbach über den neuen Pfarrer Mörike. Die Klatschbasen aber, die auch hier wie das Unkraut überall gediehen, wußten außerdem noch ein paar kleine hübsche Sächelchen von ihm. So zur Hauptsache, daß er noch unvermählt sei und zusammen mit seiner Mutter hause und einer Schwester, die er zärtlich liebe, und die ihn recht im Essen und in der Bequemlichkeit verwöhnt habe, so daß er zimperlich wie ein Apotheker sei. Sodann — und dies war ja noch viel interessanter —, daß er bereits einmal zu heiraten probiert habe, indem er schon vier Jahre lang verlobt gewesen sei, natürlich mit einer Pfarrerstochter, und zwar aus Plattenhardt. Aber zur Hochzeit sei es nicht gekommen, weil er der Jungfer aus Plattenhardt nicht fromm genug gewesen war.
Das Interessanteste jedoch, was es von ihm zu klatschen gab, war, daß er einmal als Student der Theologie in Tübingen eine Zeitlang gemütsleidend gewesen war, und zwar aus Liebe zu einem überspannten jungen Geschöpf aus der Schweiz, die unstet herumreiste und [S. 101]für die das schwäbische Wort „rappelköppig“ recht wie erfunden zu sein schien. Sie hatte den jungen dermaligen Kandidatus Mörike aber mit ihrem Irrsinn so angesteckt, daß er sogar Verse auf sie gemacht und sie unter dem Namen „Peregrina“ besungen haben sollte. Bis sie dann wie ein Irrlicht plötzlich wieder verschwunden sei und dem Herrn Kandidaten statt der „rot Fastnachtskleider“, in denen er eine Weile zu stecken glaubte, wieder die ehrsamen schwarzen langen Theologenrockschöße hinten angewachsen waren.
Während so Kleversulzbach, mit der nötigen Zurückhaltung natürlich, da es sich um einen Pfarrer handelte, über Mörike sich unterrichtete, wobei die guten alten Sprichworte: „Ein toller Most gibt einen reinen Wein“, oder „Gut Ding will Weile haben“ zum Niederschlagen etwaiger Unruhen angewandt wurden, zog unser Dichter und Pfarrer selber in aller Seelenruhe in sein Dörfchen ein.
Es war ein nicht gar großes, nicht gar flinkes bedächtiges Männlein im dunklen Überrock, nicht zu fett, aber auch beileibe nicht zu dürr, mit lockigem, blondgrauem Haar, einem rundlichen, würdigen Gesicht und einem kleinen feinen Stöckchen in der Hand. Seine schelmischen stillen Augen standen sehr nahe unter der Stirn zusammen. Durch eine altmodische goldene Brille sah er sich alles geruhsam an, die Pfarre, die Diele, in der es spuken sollte und in der nachts die sündige Seele eines früheren, in den Wein verliebten Pfarrers herumpolterte, die braune Treppe und [S. 102]sein Predigtstüblein mit dem alten mit Fabeln und Legenden bemalten Kachelofen. Dann trat er aus der Flurtüre unten in den Garten hinaus, freute sich auf die Gockelhühner, die in dem Stall bald herumstolzieren würden, beschaute sich den kahlen Gartensaal mit den verschimmelten Fresken, die nur darum so schön waren, weil man nichts mehr von ihnen sehen konnte. Die Äolsharfe, die draußen zwischen Efeu im Fenster stand, ließ zu Ehren des neuen Pfarrers ein paar traurige langgezogene Töne erklingen, die Mörike wie die Stimmen seiner verstorbenen Vorgänger in die Ohren drangen. Dann wandelte er durch den Obstgarten weiter, in dem unter der Junisonne die Äpfel süß und die Pastorenbirnen saftig wurden, und kam an das Hinterpförtchen, das ins freie Feld abseits vom Dorf hinausführte. Und als er die Türe, die sich schwer auf rostigen Angeln drehte, nach außen aufstieß, sang sie ihm zum Willkommen die Arie aus Mozarts „Titus“ vor: „Ach! Nur einmal noch im Leben!“
Indessen war draußen auf der Straße vor dem Pfarrhaus auf einem Leiterwagen das Hausgerät Seiner Hochwürden angelangt. Und ganz Kleversulzbach half mehr noch aus Neugierde als aus Menschenliebe der Mutter und der Schwester des neuen Pfarrers beim Auspacken und Einräumen. Man schob das Spinett in die Diele, Kinder trugen die vielen dicken Bücher in die Stube zum Pastor hinauf. Geranientöpfe wurden vor jedes Fenster gestellt, und den Junokopf, der jeden an dieser Stätte in der Hand genierte, setzte schließlich Mörike zum Entsetzen aller mitten [S. 103]auf sein Pult und schob, damit er nicht wackeln konnte, einfach die Bibel darunter.
Dann wurde die Hausmenagerie untergebracht, die Goldfische, die Distelfinken, der Hund und die Katze, wobei der Hausherr folgendes Vierklassensystem für die Tiere entwarf: „1. stinkende und zugleich singende, 2. rein singende, 3. rein stinkende und 4. solche, die weder stinken noch singen.“ Zum Schluß kamen dann die Raritäten in ihre Schubfächer oder auf ihre Schränke und Wandgestelle: Die Münzen, Autographen, Altertümer, Kruzifixe, Versteinerungen und vor allem die Hausapotheke. Und man war mit alle diesem kaum zur Hälfte fertig, als schon die Sterne in goldenen Haufen über Kleversulzbach heraufzogen und den Gerechten nicht schöner als den Ungerechten leuchteten. Und bald war es draußen auf den Dorfstraßen ganz still und friedlich wie am Versöhnungsfest.
In dieser Idylle verlebte Mörike das wichtigste Jahrzehnt seines Daseins. Hier konnte er die ersten fünf Tage in der Woche — denn vor Freitagabend dachte er nicht ans Predigen — dichten, sammeln, zeichnen, schnitzen, gravieren, mit seinen ungewöhnlich geschickten Händen an allerhand Dingen herumbasteln, mit seinem beweglichen Gesichte Fratzen schneiden und an sich als großer Hypochonder, der er war, nach Herzensqual herumquacksalbern. Hier konnte er vor allem, was nach dem Dichten das Schönste für ihn war, herumfaulenzen wie ein Neapolitaner. Wie schön waren die Tage, wenn man nichts zu tun hatte, wie den fleißigen Bienen zuzusehen oder auf dem Rücken [S. 104]im hohen Grase zu liegen, bis irgendeine Stimme rief: „Herr Pfarr! Das Essen ischt fertick!“ und man sich am Abend wie ein Held vorkam, wenn man einen Brief geschrieben hatte. Freilich auch in der Korrespondenz darf man sich nicht zu sehr übersputen, und der biedere Theodor Storm, der seinem schwäbischen Bruder in Apoll seine „Sommergeschichten und Lieder“ mit einer prächtigen Widmung zugesandt hatte, mußte zweieinhalb Jahre auf eine Antwort warten. Um sich das Vergnügen des Faulenzens und Spintisierens noch mehr zu Gemüte führen zu können, hielt sich Mörike meist in Kleversulzbach noch einen Vikar für seine Gemeinde, der Taufreden und Grabpredigten da capo halten mußte. Doch wenn er in jenen zehn Jahren in Kleversulzbach auch nicht mehr getan hätte, als das Gedicht vom „verlassenen Mägdlein“ oder von dem „alten Turmhahn“ zu machen, so könnte er von uns aus noch weitere zehn Jahre zum Faulenzen bekommen.
Den Rest seines Lebens verbrachte der Dichter, der zum Pfarrer im Grunde so wenig wie Schiller zum Medikus paßte, in Stuttgart als Lehrer kleiner Mädchen am Katharinenstift, der einzige große Schwabe nach Schiller, der dieser ihrer schönen Hauptstadt durch seine Gegenwart etwas Athenisches verliehen hat. Er probierte noch einmal zu heiraten. Aber dieses zweite Experiment mißlang dem scheuen, lässigen, in sich gekehrten, wetterwendischen Herrn noch mehr und endete nach mancher perturbatio domestica mit Tränen und Türenschlagen und einer schließlichen Trennung „auf unbestimmte Zeit“. Daraufhin [S. 105]zog der alte Junggeselle mit einem Töchterchen wieder zur Schwester hin und wartete zwischen Goldfischen, Versteinerungen, Noten und Gedichten geduldig auf den Tod, der dem Siebenzigjährigen das Licht aus der Hand blies. Seinen vornehmen, auserlesenen Geschmack, diese seine beste Qualität, bewies er noch, indem er sich Anno 1870 nicht flugs über Nacht als patriotischer Dichter begeistern konnte und drum nicht gleich mit in die laute ungestimmte Fanfare hineingestoßen hat.
Sein Ruhm, der zeit seines Lebens nur ganz bescheidentlich wie „auch einer“ geleuchtet hatte, weit überstrahlt von den hohen Namen eines Uhland, Kerner und Schwab, erwies sich auf einmal als dauernder denn das ganze Urteil seiner Zeit. Und heute gilt uns Mörike neben Schiller und Hölderlin als einer der drei großen Griechen aus Württemberg, dessen Verse nicht minder lange blühen werden als die des von ihm gefeierten Anakreon. Denn ein rosiger Hauch haftet an jeglichem seiner Lieder.
[S. 106]
Was waren das für glückliche harmlose Zeitläufte bei uns, da man in Deutschland noch nicht, wie die Franzosen scherzend sagten, „die Homosexualität entdeckt hatte“! Da konnten die Literarhistoriker noch des Dichters Platen gedenken, ohne dieses Problem seines Daseins und Dichtens überhaupt erwähnen zu müssen. Da gab es für den deutschen Gelehrten derlei nur bei Sueton im neronischen Rom oder in Griechenland, beileibe nicht in unserem frommen, friedfertigen, moralischen Vaterland, in dem man sich darum über solche Sachen nicht einmal empören mußte, weil sie eben totgeschwiegen wurden. Heute in unserer verfluchten, ehrlichen, die Menschen allesamt öffentlich abstempelnden Zeit ist man, will man kein Falschmünzer oder Duckmäuser heißen, geradezu genötigt, das Rätsel, das Platen wie jeder bedeutende Mensch seinem Volke aufgab, von dieser Seite aus zunächst zu lösen. Seine Tagebücher lassen keinen Zweifel, daß der Dichter ein völlig konträr sexual empfindender Mensch gewesen ist, daß er sich fortwährend, und zwar auf das heftigste, Frauen gleich in Männer verliebt hat. Schon auf der Kadettenschule in München, auf die ihn seine adligen Eltern, die nach Väterweise einen Offizier aus ihm machen wollten, mit zehn Jahren von Ansbach gebracht hatten, fing es an. Eine vielleicht angeborene Neigung wurde so durch den ausschließlichen Verkehr mit Männern, meist jüngeren Alters, auf das unseligste gereizt und verstärkt. Nichts ist bekanntlich gefährlicher [S. 107]für die Gesundheit der Liebes- und Geschlechtsempfindungen — alle in Internaten aufgewachsenen Menschen bestätigen es! — als der einseitige fortwährende Verkehr mit Gleichgeschlechtlichen und die intime Vertraulichkeit, die durch das stete zwangsgemeinsame Leben erweckt und genährt wird. Es ist erschütternd in diesen Tagebüchern zu lesen, wie zart erst auf den Zwischenstufen zwischen Knabe und Jüngling die Liebe diesen noch schlummernden wie eine Pflanze lebenden Poeten ergriff. Die Liebe zu einem Mann natürlich, denn Frauen oder „Weiber“, wie er bezeichnenderweise sagt, hatte er kaum gesehen. Und zwar zu einem jungen blonden französischen Grafen, von dem er, vom Kadetten zum Hofpagen aufgerückt, wie ein junges Mädchen von seinem Ideale schwärmt, ohne daß er jemals ein Wort mit ihm zu sprechen wagte. Noch hätte eine entschlossene Erziehungsweise, ein erfahrener, vornehmer, älterer Mann vielleicht diesen weichen Knaben umbiegen und sein Herz und seine Physis auf das andere Geschlecht hinlenken können. Aber der fehlte eben dem Jüngling wie dem Kinde. Denn sein Vater in Ansbach hatte Wichtigeres zu tun, hatte Forsten zu besichtigen und junge Bäume zu behüten und über die harten napoleonischen Zeiten zu seufzen, und konnte sich nicht um die Seele seines in zweiter Ehe spätgebornen Knaben bekümmern.
So sehen wir den jungen Pagen Platen immer mehr in die Liebe zum eigenen Geschlecht verstrickt. Dem Idealbild des jungen blonden Franzosen folgt ein bayerischer Prinz als Gegenstand seiner Neigung, und bald muß er sich gestehen, [S. 108]daß er sich am meisten in ungemischter Männergesellschaft schüchtern fühle, weil die Zartheit der Weiber seinem Wesen innewohne. Immer bedenklicher, gefährlicher wird diese unglückliche Veranlagung. Als er faute de mieux sich entschloß, Leutnant zu werden, wurde ihm der Abschied vom Pagengalakleid schwer, das ihm so teuer war, wie weiland Werthern sein blauer Frack, in dem er Lotten zum erstenmal gesehen, weil — armer verirrter Knabe! — einen Augenblick lang des Franzosen schöne Hand darauf geruht hatte.
Bald wird er dann immer widerstandsloser das Opfer seiner Perversion, die ihn wechselnd, gleich einem Schmetterling im Sturm, von einer Neigung zur anderen treibt. Meist ohne Erwiderung seiner Leidenschaften zu finden. Aus einem jungen Offizier, Friedrich von Brandenstein, den er im Alter von achtzehn Jahren wie ein Backfisch bei einem Konzert und Deklamatorium in der Münchener Harmonie kennen lernte, und den er in seinem Tagebuch wieder wie ein Backfisch als „Federigo“ anschwärmt, bekommt er nur die Worte „Gut“ und „doch“ als Entgegnung auf seine Fragen heraus. „Er ist blond wie der französische Graf“ — immer wieder kommt er auf diesen ersten Geliebten zurück —, „aber er scheint sehr monoton zu sein“ muß er sich sagen. Er freut sich darauf, seinem Federigo, der mit seinem Regiment gegen den von Elba entsprungenen Napoleon ins Feld ziehen mußte, nach Frankreich folgen zu können, wo die groben und abscheulichen unsittlichen Schriften, die er in den Bibliotheken [S. 109]mancher Quartiere aufstöbert, sein Zartgefühl verwundeten.
Sonst unblessiert heimgekehrt, wechseln flüchtige Passionen zu Freunden und Fremden in seinem Busen wieder mit ernsten Leidenschaften, so zu einem Hauptmann, den er „mein Wilhelm“ nennt, bis er auf einmal, mit ihm auf die Wache ziehend, zu seinem Entsetzen entdeckt, daß er gefühllos „wie ein Stein“ ist und keinen Begriff von Liebe und Freundschaft hat.
Mehr und mehr von dem kalten soldatischen Gamaschendienst in den kriegsmüden Zeiten nach Napoleon angewidert, wirft er sich auf Sprachstudien, für die er ungewöhnlich begabt ist, und erlernt schnell Lateinisch, Griechisch, Persisch, Arabisch, Italienisch, Französisch, Spanisch mit besonderer Vorliebe, Schwedisch, Englisch und gar Holländisch. Bald erlangt er durch die ihm von seinem König gewährte Entlassung aus dem Militärdienst volle Studierfreiheit, der er sich in Würzburg unter Döllinger und in Erlangen unter Schellings Einfluß mit der ganzen Wißbegierde seiner zweiundzwanzig Jahre hingibt. Neue Lieben, neue Freuden, neue Schmerzen erwarten den vom soldatischen Zwang befreiten Jüngling auf der Universität. Diesmal heißt das ahnungslose Opfer seiner Leidenschaft Eduard Schmidtlein, ein simpler Junge allem Anschein nach, den er zuerst wieder „Adrast“ nennt, und von dem er in sein jungfräuliches Tagebuch — er versteckt sein Herz jetzt gern hinter die französische Sprache — schreibt: „Il est beau comme Apollon et vigoureux comme Hercule.“
[S. 110]
Die traurige absonderliche Aventüre mit diesem guten Jüngling, den der Dichter auf der Straße mit Maiglöckchen beschenkte, den er belehrte und zu edler Lektüre anregte, und der seine warme Neigung kühl erwiderte, ist ergreifend in den Tagebüchern zu lesen. Bis zu jenen Worten, bei denen man sich nach der Existenzberechtigung des § 175 in unserm Strafgesetzbuch fragen muß, die lauten:
„O mein Eduard, morgen sind es vier Monate her, seit wir zärtlich voneinander Abschied nahmen. Wir sollten uns niemals wiedersehen, wir haben es nicht vermutet. Ich habe noch zwei Rosen von Dir, die ich heute fand, eine rote und eine weiße; sie sind vertrocknet, aber sie duften noch. Und meine Tränen fließen noch. Wir haben es nicht vermutet.“
Dabei hat Platen — man fühlt es aus all diesem Zarten heraus, nicht wahr? — nie an eine physische Hingabe und Vereinigung mit seinen von ihm geliebten Freunden gedacht. Er ist später in Italien, in Neapel, ganz erstaunt, als er hört, daß so etwas möglich ist. Seine feine Seele zittert vor solchen Akten, und die Liebe zum eigenen Geschlecht hat ihn — diesen Fluch der Natur hat sie mitbekommen! — niemals befriedigt. Sein Wesen war gegensätzlich zu Oskar Wilde gar nicht auf faktische Ausschweifung gerichtet. Er litt christlich gräßlich unter seinem „Anderssein“, das ihn in die größte Melancholie und Menschenscheu geworfen hat. Sein ganzes Gesicht, die schöne, aber scheue Stirne und der verkniffene eingezogene Mund mit seinem unmännlichen, süßlich-schüchternen Ausdruck, alles dies sieht [S. 111]aus wie das fleischgewordene schlechte Gewissen. Die letzten acht Jahre verbrachte er, von seinem Bayern-König Ludwig unterstützt, ewig wandernd unstet in Italien. Kreuz und quer hat er dies Land durchzogen von Stadt zu Stadt und jeden Punkt, der ihm dort gefiel, als ein poetischer Baedeker mit einem Epigramm oder einem Sonett oder einer Ode gefeiert. Bescheiden wie ein Franziskaner vermochte er mit geringem Geld dieses rastlose Wanderleben in der Fremde zu führen. Nicht nur seine krankhafte Geschlechtlichkeit trieb ihn scheu aus seinem Volke in die Wildnis. Auch die geringe Anerkennung, die man daheim seinem Schaffen entgegenbrachte, die Lobhudelung falscher Dichterpropheten neben ihm durch das Publikum, machte ihn vor Schopenhauer und Nietzsche deutschlandkrank. Seine Gereiztheit reagierte in den nach Grabbes Literaturspaß beiden besten, wenn nicht einzigen literarischen Komödien, die wir haben, in der „verhängnisvollen Gabel“ gegen Müllner und die Schicksalstragödianten und im „romantischen Ödipus“ wider Immermann und Heine, seine beiden persönlichen Feinde. Denn „Feind“ war ihm jeder, der seine Verse nicht vollendet fand, die er stets gerne seinen Freunden vorlas, vielmehr „vorsang“, wie ein Ohrenzeuge berichtet, oder auch sich allein „im Pinienhain, an den Buchten des Meers, wo die Well abfließt voll triefenden Schaums“, vorsprach, wo er einsam wandelnd sich an der Fülle des eigenen Wohllauts berauschte.
Man nimmt heute, sofern man sich in Deutschland noch für solche Fragen, statt für Propeller interessiert, vielfach [S. 112]an, daß Heine in der Kontroverse mit Platen zu weit gegangen sei. Mag sein. Aber wenn Schriftsteller miteinander zanken, geht es bei uns selten manierlich zu. Und daß Heine den Homosexualisten aus den Gedichten des Gegners hervorholte und an die Wand malte, war schließlich nicht schlimmer, als daß Platen ihn „den Petrarka des Laubhüttenfests“ geschimpft hatte, „dessen Küsse Knoblauchgeruch absondern“ — und dies alles nur, weil Heine ein höchst harmloses Xenion Immermanns gegen den Gaselendichter publiziert hatte. Die Verbissenheit, die aus Platens aristophanischen Literaturkomödien gegen das Romantische, als die derzeitige Mode in der Lesewelt und auf der Bühne, mit der Wut eines Abseitsstehenden und Nichtanerkannten knirscht, ist in ihnen oft stärker, als der Humor, den der Dichter wider seine Gegner auftreiben kann. Der ist mehr teutsch plump als attisch fein gesalzen, mehr kleinlich zänkisch als überlegen spielerisch wie bei dem Unikum Aristophanes, wenngleich Platen in seiner sich selbst gedichteten prahlerischen Grabschrift davon meint:
Es ist kennzeichnend für Platen, daß er soviel Blut und Zeit an die Literatur vergeudete, weil seine Veranlagung ihn ebenso von dem aufreibenden Kampf der Geschlechter wie von einem lebendigen Wirken in seinem Volke und Staate scheu zurückhielt. Der Außenstehende flüchtete sich in Klagen, Elegien, Gaselen und Festgesängen, stellte sich [S. 113]und seiner formalen Begabung gern schwere metrische Aufgaben, die er in metrischen Verszeichen als ein Rechenexempel vor seine Oden setzte, und ist stolz, wenn er sie gelöst hat:
Viel Kunstvolles ist ihm gelungen, dessen Lieblingsblume die künstlich gemacht aussehende Zierpflanze, die regelmäßige Tulpe war. Neben manchem Gequälten. Er, der sich stets soviel auf seine Sprache zugute tat, hat die fürchterlichsten Verse gedichtet, wie etwa die — und es lassen sich noch viel schlimmere leicht herausfinden — mit denen er „Hermann und Dorothea“ zu kritisieren wagte:
Weil ihm der Vers so leicht vom Munde floß, denn er vermochte selbst nach der Erstaufführung — man denke an unsere heutigen premièrebangen Poeten! — eines seiner Stücke in Erlangen zum Schluß von der Bühne herab in improvisierten Reimen zu danken, darum vermeinte er, alles sei herrlich geraten, was er in seinen Gedichten auf Stelzen laufen ließ. An Goethe, den er, wie ein Templer seinen Großmeister, abgöttisch verehrte schätzte er vor allem das Nachgedichtete, den Westöstlichen [S. 114]Divan, das Gebaute, Gebildete, Gemachte oder antiker Form sich Nähernde, während er das Volksmäßige bei ihm, „den Faust“ etwa, so wenig wie Schillers Stücke und Verse beachtete. So sind auch Platens Schönstes die Sonette und die „Gaselen“ geblieben, die der Fünfundzwanzigjährige „dem Stern des Dichterpoles“ Goethen widmete. In diesen unter seiner Sprache leicht gefügten, sonst so oft gekünstelt wirkenden Lobgedichten gibt sich seine zarte Seele in edler Weise preis. Sie haben in ihrer ganz beherrschten Form bis auf unsere Zeit, so noch auf Stephan George und die Seinen, Einfluß gehabt. Gedichte wie:
Noch ohne Bitternis, noch ohne Eigenlob singt hier der junge Poet seine Schmerzen, seine Lust und seine Sehnsucht uns zu, ein feiner, halb geratener Mann, eine „links angehängte Null“, wie er selbst sich einmal genannt hat, ein Paradiesvogel, der später zur Spottdrossel wurde. Scheu und schüchtern verbarg er das Rätsel seines Leibes, seiner Seele vor der Welt. In der Erde der Fremde, bei Syrakus, in dem Staube, den ein Äschylos, ein Pindar und Bacchylides durch ihre Schritte geweiht haben, liegt er begraben. Dorthin war er matt und krank von Neapel [S. 115]geflüchtet, „weil der protestantische Kirchhof in Neapel unweit der Bordelle liege, und es darum nicht poetisch sei, dort bestattet zu sein“. Von Männern umringt, gab er an einem kalten Winternachmittag sein verkehrtes Wesen zur Heilung an die Natur zurück. Immergrüner Lorbeer wächst um seine Gruft.
[S. 116]
„Süße Liebe denkt in Tönen,
denn Gedanken stehn zu fern.“
Eines Nachts träumte Tieck, wovon er häufig träumte, daß er eine seiner berühmten Vorlesungen abhalte. Es war noch in Dresden, wo er in einem Eckhaus am Altmarkt wöchentlich zweimal die Zuhörer um sein Lesepult versammelte. Jeder Bekannte wie jeder gebildete Fremde hatte freien Zutritt zu diesen Abenden. Und kein Mensch von Namen und Ruf, der durch Dresden reiste, versäumte einer solchen Vorlesung beizuwohnen, so daß Tieck mit diesen Veranstaltungen geradezu seinem Hoftheater, als dessen Dramaturg er für 700 Taler im Jahr angestellt war, selber Abbruch tat.
Schon schienen ihm in seinem Traum einige Menschen anwesend zu sein. Es war kurz vor Beginn seiner Vorlesung, die mit dem Glockenschlag sieben abends anzuheben pflegte. In dem Raum, den rings an den Wänden seine sechzehntausend Bücher umglänzten, herrschte wie vor dem Anfang eines Stücks im Theater jene gespannte Stimmung, die ihm beinahe noch lieber war als das nachfolgende eigentliche Spiel. Eine Stimmung, wie er sie im Prolog zu seinem „Gestiefelten Kater“ gemalt hat: Man schwatzte durcheinander. Man rückte auf den Stühlen zurecht. Seine weißhaarige Dienerin Friederike schob für zwei hinzukommende österreichische Herren, die mit Orden geschmückt waren, noch zwei Prunksessel ein. Seine Frauen erschienen: Seine etwas hausbackene Gattin Amalie, die ihm früh vermählte, in der Jugend heißgeliebte Pastorentochter, [S. 117]die, bevor sie sich setzte, noch das Deckchen an ihrem Ohrenstuhl zurechtzupfte. Und seine Freundin, die Gräfin Finkenstein, über ihren entzündeten schwachen Augen einen grünen Schutzschirm tragend, die im Vorbeigehen zwei Fräulein, die mit Handarbeiten beschäftigt waren, streng anherrschte: „Nicht stricken, meine Damen! Das verträgt der Dichter nicht.“ Und zwischen den beiden seine kluge Tochter Dorothea, die Übersetzerin, sein „bestes Werk“, wie seine Feinde sie bezeichneten, mit ihrer hohen, vom Vater ererbten schwermütigen Stirn, ein wenig näher zur Mutter als zur Gräfin geneigt.
Noch eine kurze Pause, während der die alte Friederike aus dem Nebenzimmer das Lesetischchen mit den zwei Wachskerzen holte. Und nun trat er selbst herein: die kleine von der Gicht völlig verkrümmte Gestalt im feierlich altmodischen Frack und mit einem dicken Knoten im weißen Halstuch. Die beiden Kinderaugen in seinem glatten Gesicht, das in Paris jeden an den großen Napoleon erinnert hatte, glänzten heller als die zwei Kerzen, zwischen die er sich jetzt niedersetzte. Der Augenblick der höchsten Spannung war da, der, wo er den aufhorchenden Gästen verkündete, was er heute vorlesen würde. Seine herrliche, volltönende Stimme klang laut und priesterlich in die lauschende Stube:
„Leben und Tod der heiligen Genoveva, ein Trauerspiel von Ludwig Tieck.“
Ergebungsvoll sanken einige der anwesenden Damen, die das Stück vielleicht schon kannten, in ihre Stühle zurück. Die Gräfin Finkenstein funkelte sie mit zornigen Falkenblicken an: „Jawohl, meine Damen!“ hörte der Dichter sie [S. 118]zu seinem Erstaunen mit spöttischer Stimme sprechen: „Es dauert volle drei Stunden.“
Da begann er schon vorzulesen und seinen heiligen Bonifacius mit Schwert und Palmenzweigen einzuführen:
Aber schon wieder war er unterbrochen. Irgendeiner fing an zu gähnen. Und weil dies ein leicht ansteckender Gesichtsausdruck ist, tat bald der eine, bald die andere dem Gähnenden nach, daß der vorlesende Dichter sich bald einem ganzen Auditorium von weit geöffneten Mäulern gegenübersah.
„Ehe diese Leute mich zum besten haben, will ich ihnen selber einen Schabernack spielen!“ dachte der Dichter im Traum. Er blätterte unbemerkt in dem Band seiner „Gesammelten Schriften“ zurück und las:
Fischer: Ich möchte fast nach Hause gehn, denn ich fürchte toll zu werden.
Bötticher: Es ist beinahe, als wenn es der Dichter drauf angelegt hätte.
Müller: Ein exzellenter Kunstgenuß, toll zu sein, das muß ich gestehn.
Die Worte, die der Dichter gesprochen hatte, stammten aus seinem Kindermärchen vom „gestiefelten Kater“. Das Publikum spricht sie dort in das Stück hinein. Sein eigenes Publikum fuhr fort zu gähnen; allerdings schon etwas gelinder. Da las er ihm, weiter ins Buch greifend, den Schluß vor:
[S. 119]
Souffleur: Versuchen Sie ein paar Verse zu machen, Herr Dichter, vielleicht bekommen sie dann mehr Respekt vor Ihnen.
Dichter (gegen das Parterre):
Im Traum sah Ludwig Tieck hierbei von seinem Buch auf. Die Zuhörer vor ihm schienen nichts davon zu merken, daß er sich über sie lustig machte mit seinem Vorlesen. Der Rat des Souffleurs leuchtete ihm ein. Er deklamierte leise die Verse:
Das war wieder aus seiner „Genoveva“. Das Lied eines Schäfers. Kecker geworden setzte der Dichter mit einem schelmischen Blick in sein Auditorium hinzu:
Dies rührte aus seiner wundersamen Liebesgeschichte von der schönen Magelone her.
Nun wurde der träumende Dichter ganz verwegen und reihte noch den Vogelgesang aus seiner Novelle vom „blonden Eckbert“ unvermittelt an:
[S. 120]
Schon als er das erste Wort dieses Gedichtes sprach, ward ihm etwas unheimlich zumut, als ob er gefühlt hätte, daß er zu weit gegangen wäre. Und in der Tat! Es erhob sich in diesem Augenblick aus der schweigenden Schar seiner Zuhörer ein Mann, der im Schein der Kerzen einen schwarzen Schatten über ihn warf und den Dichter folgendermaßen andonnerte: „Mein Herr! Was unterstehen Sie sich aus Ihrem Publikum einen solchen Narren zu machen, wie Sie selber einer sind!“
Ludwig Tieck (im Traum): „Ahnte mir doch ein Unheil! Bei meinem melancholischen Gemüt! Sie sind ein Kunstrichter, nicht wahr?“
Der Kunstrichter: „So ist es. Ich habe mich erhoben als Sachwalter der überreichen Begabung, mit der ein Genius Sie bei Ihrer Geburt ausgestattet hat. Wissen Sie, daß Sie der leichtfertigste Poet sind, der jemals von den Musen gehätschelt worden ist? Was können Sie nicht: Gedichte, Novellen, Romane und Stücke purzeln Ihnen nur so aus Ihrem Kopf wie Spielwaren aus Ihrem geliebten Nürnberg. Aber alles ist oberflächlich gemacht. Hingehuschelt, wie Frau Aja sagte. Sie arbeiten zu viel und vor allem zu schnell. Muß denn ein Stück wie ‚Ritter Blaubart‘ beinahe an einem Abend hingerast werden und ein sechsaktiges Spiel wie ‚Prinz Zerbino‘ in drei Tagen? Sehen Sie sich Goethe und Shakespeare, Ihre Muster, an, zwischen denen Sie lichtempfangend wie dort oben zwischen den zwei Kerzen sitzen, und — — —“
Ludwig Tieck unterbrach an dieser Stelle, wie er sich am Morgen nach dem Erwachen genau erinnerte, die lange Strafpredigt seines Kritikus dadurch, daß er ironisch lächelnd mit [S. 121]seinen bloßen Fingern die Kerzen zu seinen beiden Seiten schneuzte. Ganz deutlich hatte er dabei den brennenden Schmerz in seinen Fingerspitzen gefühlt. Vermutlich ein Zucken der Handgicht, die ihn zuweilen zwickte.
Dann war er wieder eingeschlafen. Und sein Traum hatte sich fortgesetzt. Aber diesmal befand er sich unter den Zuhörern. Am Lesepult saß zu seinem komischen Schrecken ein anderer als er. Nämlich sein alter Freund und späterer großer Gegner, der Berliner Aufklärer Friedrich Nicolai. Er hielt in seiner Hand ein Glas, in dem algengleich ein molluskenartiges Geschöpf herumschwamm, dem eine gewisse äußere Ähnlichkeit mit Tieck selber nicht abzusprechen war: „Sie sehen hier“, so begann Nicolai mit seiner kratzbürstigen preußischen Stimme zu dozieren, „in dieser Retorte eingefangen den Affen Goethes, genannt Ludwig Tieck. Ursprünglich mit reiner Vernunft begabt, verkrümmte sich dieser Berliner Junge unter dem Einfluß der Lektüre der Bänkelsängereien des sechzehnten Säkuli zu einem qualligen, romantischen Seeuntier. Lachen Sie nicht! Es ist zum Weinen und zum katholisch werden! Was ihm, wie ich vernehme, seine Frau und seine Tochter bereits vorgemacht haben sollen. Nur der Rest von gesundem Menschenverstand, der ihm von seinem biederen Vater, einem Seilermeister aus der alten Roßstraße vermacht worden ist, hat dies letzte verhindert. Heiliger Lessing! Und so etwas muß ausgerechnet in unserm Berlin jeboren werden. Warten Sie, meine Besten! Ich will Ihnen nunmehr ein Kunststück vormachen. Ich werde mit dem Verstand an diese poetische Mißgeburt herangehen.“
[S. 122]
Der alte Nicolai stülpte das Glas um, blies dreimal kalt darauf: „Was sehen Sie, meine Teuersten? Es ist leer. Leer wie seine ganze Dichterei.“
Jetzt erhob sich in den Ohren des träumenden Dichters plötzlich eine andere Stimme, eine viel weichere weltmännische. Sie ging von einem jungen Manne aus, der sich unversehens aus den Zuhörerreihen als Opponent erhoben hatte. Und wie Tieck weiter lauschte, war es der geistige Genosse seiner Jugend, Friedrich Schlegel, der dem alten Nicolai in die Parade fuhr: „Wir haben Sie nicht nötig und Ihre Rezensionen, die neueste Literatur betreffend. Schweigen Sie! Sie blamieren sich hier nur. Wir machen unsere Kritik selber, wir Romantiker. Merken Sie denn nicht endlich, daß Sie bei der Beurteilung seiner Werke von ganz verkehrten Voraussetzungen und Forderungen ausgehen, Sie Nachtwächter? Blasen Sie Ihre Laterne aus. Was schleifen Sie mit ihr noch durch den Morgentau herum? Hören Sie nicht diese Melodie, Sie Stocktauber?“
Und wahrhaftig, man hörte jetzt eine merkwürdige Weise. Wie ein altes Lied schien sie aus einer versunkenen Grotte im Runenberg zu sumsen. Und sie tönte ähnlich wie jene Schauerromanze Tiecks, „Die Zeichen im Walde“ genannt, die aus einhundertvierzehn auf „u“ anklingenden Strophen bestand. Zwischendurch schien eine Fiedel ganz hell zu singen, so wie Wackenroders und Novalis’ früh verhallte Stimmen gesprochen hatten: „Laßt ihn doch! Er ist ein Dichter.“ „Dank Euch, meine beiden Lieblinge,“ lispelte Tieck im Traum. Und ein Lächeln sprang über sein Gesicht. [S. 123]Immer lauter überdröhnte nun alles die dumpfe Melodie, die aus der Welt hervorwuchs: „Bim-baum! Bim-baum!“
Da erwachte der Dichter Tieck in seinem Berliner Zimmer in der Friedrichstraße von den Morgenglocken, die von der französischen Kirche tönten. An seinem Bett stand sein Diener mit einem schwarzen Samtrock, um dem Achtzigjährigen beim Ankleiden zu helfen. Tieck strich sich über seine Brauen: „Was hab’ ich mir da wieder zusammengeträumt! Welch ein Tag ist heute?“ frug er den Diener. „Sonntag, Herr Hofrat! Hören Sie es nicht an dem Läuten.“ „Ach ja!“ lächelte der fromme Tieck. „Für einen Dichter ist immer Sonntag. Den andern Menschen muß man es ansagen.“
Jetzt erschien auch der junge Köpke, sein getreuer Eckermann. Er brachte dem Meister einen Gipsabguß von der Büste seines Königs Friedrich Wilhelms des Vierten. Tiecks Bruder, der Bildhauer, hatte das Original gemacht. „Welch eine schöne Morgengabe!“ dankte der königstreue Sänger dem Jünger. „Was haben Sie noch in der Hand?“ fragte er. „Den Wochenspielplan der Berliner Theater.“ „Ach! Legen Sie ihn hinten zu den ungelesenen Zeitungen in die Ecke! In das Zimmer, in dem einst meine sechzehntausend Bücher standen, die ich in der letzten Woche alle verkauft habe! Weg mit dem Ballast vor der letzten Fahrt! Die Gescheitheit ist uns nur im Wege auf der Reise zu Gott. Wochenspielplan! Was kümmern mich die Herren Gutzkow und Laube! Mich führt doch keine Bühne auf. Man hat mich vergessen. Aber was tut’s? Darum bleibt doch für einen Dichter alle Tage Sonntag.“
[S. 124]
Im Winter des Jahres 1821 bekamen eine Reihe geistvoller und künstlerischer Männer zu Berlin durch die Post eine in zierlichen Antiquabuchstaben geschriebene Todesanzeige zugeschickt, die folgendermaßen lautete:
„In der Nacht vom 29. bis zum 30. November dieses Jahres entschlief, um zu einem besseren Dasein zu erwachen, mein theurer geliebter Zögling, der Kater Murr, im vierten Jahre seines hoffnungsvollen Lebens. Wer den Verewigten Jüngling kannte, wer ihn wandeln sah auf der Bahn der Tugend und des Rechts, mißt meinen Schmerz und ehrt ihn durch Schweigen.“ Der Mann, dem dieser Kater, als er noch springen konnte, gehört hatte, der ihn immer, wenn er schrieb, auf seinem Pulte liegen gehabt und ihm zwischendurch beim Dichten die Funken aus dem Fell gestreichelt hatte, war der Königl. Preußische Kammergerichtsrat Hoffmann, der seit dem Jahre 1816 für tausend Taler im Jahre zu Berlin judizierte und Verfügungen verfaßte.
Dieser höchst sonderbare Mann war unter der Regierung Friedrichs des Großen zu Königsberg in Preußen von zwei merkwürdigen Menschen in die Welt gesetzt worden. Von einem Vater, der es vorzog, seine Familie allein leben zu lassen, und der, nachdem er zwei Söhne hervorgelockt hatte, sich nach Insterburg versetzen ließ, um seine ganze Ehegeschichte wie einen schlechten Roman, den man gelesen hat, gänzlich aus dem Gedächtnis zu verlieren. Zwanzig Jahre lebte der Alte droben an der Inster allein als Kriminalrat [S. 125]mit seinen Akten, seinem Tabak, polnischem Branntwein und saufenden Gutsbesitzern, bis er Anno 1797 starb, und der Sohn nichts anderes über ihn zu sagen wußte, als: „Mancher ist in diesem Jahre gestorben, z. B. mein sogenannter Vater.“
Die Frau zu diesem Manne, die Mutter Hoffmanns, besaß zwei ebenso hartnäckige wie unangenehme Eigenschaften, sie war hysterisch und ordnungliebend. Diese letztere Tugend hatte ihren Mann von ihr nach Insterburg getrieben. Die Hysterie, die sich in stets verweinten Augen und einer roten Nasenspitze bei ihr abmalte, vertrieb ihr den Sohn, dem die stete stumme Predigt ihrer traurigen Augen über das Thema: „Warum hat mich dein Vater verlassen?“ allgemach fatal wurde. So kletterte der kleine possierliche Junge lieber auf den Schoß seiner Tante Sophie, der jüngeren Schwester seiner duldenden Mutter, die eine schöne Stimme hatte und zur Laute die herrlichsten Lieder singen konnte. Oder das Kind machte sich an den Bruder seiner Mutter, in dessen Hause sie wohnten, seinen Vormund und Onkel Ottfried, einen hoch musikalischen, aber völlig vertrottelten alten Sonderling, der trotz seiner Glatze von der wehmütigen Schwester noch stets „Ottchen“ genannt wurde, und der allabendlich, wenn die Kerzen brannten, allein oder mit Freunden Konzerte veranstaltete, wobei er in einem pflaumfarbenen oder zeisiggrünen Rock im Zimmer herumsprang wie die Tasten auf der Klaviatur. Dies waren die ersten lebendigen Eindrücke des Kindes, das später, als es Mann geworden, einmal die bittern Worte schrieb: [S. 126]„Ein schlechter Vater ist noch immer viel besser als ein guter Erzieher.“
So wurde die Musik allein die beste Freundin und Trösterin des einsamen Kindes. Und es ist fast symbolisch für ihn und für sein Leben, daß sein Vater, der mysteriöse Mann zu Insterburg, in der Stunde seiner Geburt, um der Mutter die Schmerzen zu erleichtern, und um dem Kinde bei seinem Eintritt das Menschenleben möglichst pläsierlich vorzutäuschen, einen Lautenisten herbeigeholt hatte, der der Wehmutter und dem Säugling einen „Murki“, ein Murmelstück im Baß vorspielen mußte. Von Oheim und Tante verwöhnt, aber mit Musik erfüllt, bezog der Jüngling die damals weltberühmte Universität Königsberg, wo er, wie sein weiland Vater, die Rechte studieren sollte. Es ist ergötzlich, wenn man sich den jungen Hoffmann zu den Füßen Kants vorstellt, dessen Vorlesungen er eifrig besuchte, ohne sie jemals verstehen zu können, und den Humor Gottes sich klarmacht, der diese beiden extremen Geschöpfe erschafft und in diese komische Situation zusammenbringt.
Wie der von uns Erwachsenen sogenannte „Ernst des Lebens“, d. i. die Zeit, wo man sich selbst sein Geld verdienen muß, für Hoffmann begann, zeigte sich, daß in den damaligen unruhigen Zeitläuften, wo gerade Napoleon mit Deutschland Katze und Maus spielte, die Musik ihren Mann fast noch eher ernähren konnte, als die Juristerei. Zumal da Hoffmann, der außerdem, daß er erzählen und mit der Feder wie auf dem Klavier phantasieren konnte, noch die [S. 127]dritte Gabe, zeichnen zu können, besaß. Dieses Talent machte sich bei ihm, dem anfänglichen Assessor zu Posen, in farbigen Karikaturen Luft, die er von seinen Vorgesetzten, um die Akten etwas zu beleben, zuweilen an deren Rand zeichnete. Nun können preußische Beamte einen Spaß oder Stoß von Untergebenen sehr schlecht vertragen, und der Assessor Hoffmann ward, um seine Phantasie etwas trocken zu legen, in ein kleines Nest an der Weichsel versetzt, auf daß er in sich gehe und einsehe, wie man sich als Beamter besser steht, wenn man keine Karikaturen zeichnet.
Um sich in der Polackei nicht tot zu langweilen, heiratete Hoffmann dort eine Polin, ein gutes, treues Weib, die den Humor hatte, zu allem, was der kleine hagere koboldartige Mann trieb, „Ja und Amen“ zu sagen, und die alle Stunden bis zu seiner letzten bei ihm ausgehalten hat. Sie weinte denn auch keine Träne, als ihr Mann den sichern Staatsdienst verließ und sein Glück den Musen anvertraute. Sie folgte ihm, als er als Musikdirektor ans Theater nach Bamberg ging, dorthin, und stopfte ihm die Strümpfe und die üble Laune, wenn er weinend aus einem Stück von Kotzebue heimkam.
Als er das Theater leid bekommen hatte, ging er wieder auf die Wanderschaft und nährte sich zu Dresden — es war gerade Anno 1813 — von Karikaturen auf Napoleon, die einen reißenden Absatz fanden. Zum Glück für ihn war justament sein Oheim Ottfried gestorben, der ihm ein paar verstimmte Geigen, etzlich bunte Kleider und einige blanke Taler hinterließ, und Hoffmann konnte, ohne zu [S. 128]verhungern, abwarten, bis Napoleon nach Elba expediert war.
Um die Zeit besann man sich in Berlin wieder auf den früheren Beamten Hoffmann aus Königsberg, der sein Assessorexamen dereinst mit „vorzüglich“ bestanden hatte, und dem, außer daß er zeichnen und musizieren konnte und eine Zeitlang beim Theater gewesen war, nichts Übles nachzusagen war. Man machte drum durch dieses wie durch alles, was unter Napoleon geschehen war, einen dicken Strich, vielmehr man setzte es in Klammern, und ernannte Hoffmann zum Kammergerichtsrat. Zumal ein so ehrenwerter Mann wie sein Freund Hippel sich für ihn verwandte, derselbe, der für den König Friedrich Wilhelm III. den „Aufruf an mein Volk“ verfaßt hatte, der also ein Meister darin war, Gegensätze zu vermitteln.
Hoffmann war nun als Kammergerichtsrat wieder ein nützliches Mitglied der preußischen Gesellschaft geworden und versah zum größten Erstaunen seiner nicht dichtenden und phantasielosen Kollegen sein Amt auf das gewissenhafteste. Der Zufall wollte es — und dies ist der beste Witz in seinem Leben —, daß er, der Dichter der Nachtstücke und Karikaturist, zum Mitkommissarius bei der Untersuchung der sogenannten demagogischen Umtriebe eingesetzt wurde und eine alte ehrliche Haut wie den Turnvater Jahn aburteilen mußte, der sicherlich nachts nur von der Kniewelle, vom Stangenklettern oder dem Riesenaufschwung träumte, während sein Judex, der Kammergerichtsrat, nachts in den Schatten Teufel, Zwerge und Grimassen machende [S. 129]Marionetten sah, von denen er eine ganze Menge mit scheußlichen Höllenfratzen in seinen Schränken gesammelt hatte.
Solche Allotria, wozu auch ein ewiges Gesichterschneiden, seine Lieblingsbeschäftigung, gehörte, trieb der Kammergerichtsrat Hoffmann aber nur, um vor sich und dem Erzschelm, der ihm im Nacken saß, seine Würde ertragen zu können. Daß er eine sogenannte Säule des Staates geworden war, erschien ihm so tragikomisch, daß er jede Nacht in der Weinstube bei Lutter und Wegener darauf trinken mußte, bis er in jene Region kam, wo man vergißt, daß man Justizrat genannt wird und eine Respektsperson ist. So waren ihm die liebsten Abende die „Serapionsbrüderabende“, herrliche Kneipstunden, da sich die Dichter Berlins bei ihm versammelten, und er mit einer weißen Schürze dazwischen stand und unaufhörlich Kardinal, das war ein von ihm erfundenes Gemisch von Rheinwein und Champagner, bereitete. Hatte er sich so in die Hinterwelt der Träume hineingetrunken, so plauderte er stundenlang mit seinem Kater Murr, wie er früher in Bamberg am meisten mit einem Wirtshaushunde, den er „Berganza“ nannte, verkehrt hatte. Oder er schrieb ein Nachtstück oder Phantasiestück nach Mitternacht auf preußisches Aktenpapier und sah seine Gestalten schließlich so lebendig werden, daß seine Frau sich mit dem Strickstrumpf zu ihm setzen mußte, damit ihm nicht der Verstand vor Schrecken scheu wurde und fortflog. Kein Wunder war es, daß er bei einer solchen ungewöhnlichen [S. 130]Lebensweise kein Jubelgreis wurde, sondern, sechsundvierzig Jahre alt, an der Rückenmarksdarre starb und den gleichen scheußlichen Weg wie später Heine zum Tode ging.
Viele Literarhistoriker, die mit moralischen Messern sein Leben sezierten, haben immer wieder geklagt: Was hätte Hoffmann nicht alles erreichen können, wenn er einen besseren Wandel geführt hätte! Wir aber, die wir mit Goethe glauben, daß jedes Menschen Bahn von Anbeginn beschlossen ist, wollen nicht maulen, daß dieser Meteor kein Fixstern war, und daß seine Werke keine lodernden Feuer sind, sondern mehr den elektrischen, phosphorfarbenen Funken ähneln, die er aus dem Fell seines Katers strich, und ihm stets voll Dank wieder Stunden aus unserm Leben schenken.
[S. 131]
(Gottfried Keller und C. F. Meyer)
Wir Deutschen haben mit dem kleinen Verbindungswörtchen „und“ schon oftmals in der Kunstgeschichte einen groben Unfug verübt: Goethe und Schiller, zwei sternweit verschiedene Persönlichkeiten und Dichter, sind durch dieses „und“ für Zeit und Ewigkeit wie auf ihrem Denkmal in Weimar an ein und denselben Lorbeerkranz gebannt. Neuerdings hat man denn auch wohl Nietzsche und Schopenhauer zusammengespannt, was ungefähr so klingt, als wenn man Himmel und Hölle sagt, oder man nennt Ibsen und Björnson, ein Genie und einen talentierten Tagesschriftsteller, kaum ohne eine Unterscheidung zu machen, zusammen. Nicht anders ist es mit Gottfried Keller und Conrad Ferdinand Meyer gegangen, die man seit den neunziger Jahren immer wie eine Schweizerfirma zusammen im Munde führt. Wiewohl Keller, der Bedeutendere, manchesmal in seiner geraden, groben Art gegen diese Zusammenstellung, die ihn, wie er sagte, zum „ewigen siamesischen Zwillinge machte“, kräftig gewettert hat. Denn außer, daß sie beide Züricher und Schweizer sind, gibt es nicht viel, was sie miteinander gemeinsam haben.
Der eine, Keller, gibt die Menschen seiner Umgebung oder früherer Zeiten, wie er sie sah und empfand, gleichsam auf Goldgrund wieder. Wie ein alter Meister der Holzschneidekunst setzt er sich hin und zeichnet umständlich [S. 132]und säuberlich seine Menschlein auf. Er schwindelt nicht, ebensowenig wie Flaubert oder Fontane oder Tolstoi, um die größten Romanciers seiner Zeit zu nennen. Aber er stellt seine Figuren nicht so hart in die Luft wie jene, er malt sie nicht en plein air, roh hin, garstig oder hübsch, bescheiden oder frech. Er geht mit ihrem Bilde, wie er es der Natur haarscharf abgesehen hat, in sein Kämmerlein und zeichnet sie langsam ab wie Dürer oder ein Meister des Mittelalters seine Gestalten, am liebsten noch mit ein paar Schwänzen oder Schnörkeln und möglichst vielen Zutaten. Und da stehen sie, „die drei gerechten Kammacher“ oder „Pankraz der Schmoller“. Stets nimmt er sich Zeit, das macht ihn in unserer nervösen Zeit für viele ungenießbar; oft werden ihm aus einer Geschichte zwei, wie beim „Tanzlegendchen“, oder ein Dutzend und noch mehr, wie im „Grünen Heinrich“, und sein sauberer Chronistenstil trabt, nie gehetzt, aber auch nie gehemmt, an schönen und schaurigen Geschehnissen in gleicher Ruhe vorbei. Und doch ist er nie oberflächlich, sondern sucht allem Lachen und allem Weinen auf den dunklen Grund zu gehen, und wo er am einfachsten ist, wie bei seinen Frauenfiguren, wo er nichts hinzuphantasieren und verzieren konnte und mochte, da ist er am schönsten.
Die Welt von Conrad Ferdinand Meyer ist eine ganz andere wie dieses kleine, schlichte, winklige Beisammen der alltäglichen Menschen Kellers: Feldherren und Kardinäle, Courtisanen und Regenten, Verbrecher und Helden leben und welken und sterben in seinen Gedichten und Geschichten, [S. 133]in denen die Zeit der Hohenstaufen und der Reformation oder die Tage Dantes sich widerspiegeln. Die Welt Kellers, in der es über dem Durchschnitt nur noch Originale, keine Heroen gab, wäre seinem von allen Literaturen überfütterten Geist bald zu klein und zu eng geworden. Er, der seinen nicht gerade bedeutenden Namen Meyer mit den kühnen Vornamen „Conrad Ferdinand“ herausschmücken mußte, sehnte sich nach Größe und Heldentum, das er nicht in der Gegenwart, sondern nur in der Vergangenheit entdecken konnte.
Und so verschieden wie ihr Dichten ist auch das Leben und Trachten der beiden Schweizer gewesen: Der Jüngere, C. F. Meyer, war der Sproß einer alten Zürcher Patrizierfamilie, Sohn eines frommen und gelahrten Mannes und einer klugen, hochgebildeten, schwermütigen Frau, die ihrer späteren Gemütskrankheit durch einen freiwilligen Tod im Gebirgswasser ein tapferes Ende machte. Sie hatte den Ruhm ihres einzigen Sohnes, den sie drei Viertel deutsch und ein Viertel französisch erziehen ließ, nicht mehr erlebt. Denn der war ein spät fertiger Mann und wurde neununddreißig Jahre alt, bevor er die ersten Früchte trug: Zwanzig Balladen aus der Historie aller Zeiten und Völker. Als Jüngling und heranwachsender Mann hatte der Sohn, der mit Unliebe wie Goethe und mit noch größerer Unfähigkeit als Heine die Rechte zu studieren versuchte, so jämmerlich wenig versprochen, daß die in ihrem Mutterstolz betrübte Frau, die den Vaterlosen auf ihre Weise erzog, an ihren besten Freund über [S. 134]ihn dieses schrieb: „Er hat kein Ziel und keine Karriere und kann keinen Entschluß fassen. Und ich muß sagen, daß ich von ihm nichts mehr in dieser Welt erwarte.“
Bis zur Gemütskrankheit und zur Irrenanstalt brachte diese jahrelange Entschlußunfähigkeit und Willenlosigkeit den reichen und weichen Jüngling, der mutlos und kraftlos, ein Kolumbus ohne Amerika, ein Bonaparte ohne Kriege, seine Tage nicht anders wie seine Nächte in unfruchtbarem, untätigem Dämmerzustand verbrachte. Da hat ihn die einzige Schwester Betsy, die sich viel besser als die Mutter auf seine Entwickelung verstand, nach deren Tod von neuem zum Leben erweckt. Sie war eigentlich versehentlich durch einen Irrtum vor ihrer Geburt von den beiden Geschwistern die Schwester geworden. Sie hatte das männliche, entschlossene, zupackende Wesen mitbekommen, das dem Bruder fehlte, während er mit seiner zarten, in sich gekehrten Art und seiner nach innen geschlagenen heißen Leidenschaftlichkeit und Sinnlichkeit auf manchen wie ein halbes Weib wirkte. Drum gebührt der Schwester Betsy, die den Dichter in ihm aus seiner traurigen Verpuppung durch ihre Liebe entfaltete, der Kranz, den Minerva den Frauen verliehen hat, die einen Künstler und das delphische Feuer in ihm entzünden und hüten können. Er gebührt ihr mehr noch als der eigenen späten Frau ihres über alles geliebten Conrad, von der Betsy ihm abriet, solang es gehen wollte, und die er, wie er alles eben spät anfing, erst als ein voller Fünfziger heimführte.
[S. 135]
Nun sieht die Schwester ihn zum erstenmal mit einem Weib, das auch nachts, nicht bloß tags wie sie, die Stube mit ihm teilen darf, in den besungenen und unbesungenen Süden reisen. In die Provence, die ihm die Dekorationen zu mancher in ihm jetzt keimenden Geschichte gibt, und nach Korsika, des alten Seneca wildem Patmos, das er beim Abschiednehmen zum Dank mit deutschen Weisen feiert. Heimgekehrt in das Land des Firnelichts, des großen stillen Leuchtens, siedelt er sich in Kilchberg, einem Landgut bei Zürich über dem See an. Und dort lebt er das letzte Drittel seines Daseins in behaglicher, sorgenloser Abgeschiedenheit wie ein reicher, schöngeistiger Gelehrter. Freilich lag sein Winkel nicht allzu fern von der Schweizer Hauptstadt, von der er sich allwinterlich wider Willen in ihr kantonales und internationales gesellschaftliches Leben ziehen ließ. Mehr als vierzig Antrittsbesuche hat er an nur einem einzigen Tage gemacht. Und wie viele schönen Stunden wurden damit zugebracht, Karten dieses Inhalts auszufüllen oder zu beantworten: „C. F. Meyer und Frau erlauben sich Herrn Carl Stauffer zum einfachen Abendessen einzuladen.“ Oder: „C. F. Meyer und Frau danken Herrn Eduard Stößli für die liebenswürdige Einladung, der sie gerne Folge leisten werden.“ So mit Menschen lebend und ohne sie schaffend wirkte er wie ein Ausgraber und ein Neubeleber toter Zeiten, ein Schliemann des Mittelalters und der Renaissance, deren Evangelium soeben Jakob Burkhardt zu Basel in klarer, guter deutscher Sprache gepredigt hatte. Kurz vor seinem Tode [S. 136]trübte sich noch einmal das Licht in seinem Kopf, bei dessen Schein er wie bei einer gemütlich brennenden Studierlampe seine Helden und Heiligen aufgemalt hatte, und er ward mit seiner Einwilligung noch einmal auf ein Jahr in eine Nervenheilanstalt geborgen. Aber als dann die schwarze Majestät Mors wirklich fünf Jahre später vor ihn hintrat, da stand er wieder fest und aufrecht auf seinem Kilchberg als anerkannter und gekaufter Autor, als Gutsherr und Familienvater, als Ehrendoktor der Philosophie der Universität Zürich, als Inhaber des königlich bayrischen Maximilianordens und als Ehrenmitglied zahlloser Vereine.
Ganz anders Keller, dessen Leben außer dem, daß auch er wie ein guter Wein erst spät klar und schmackhaft wurde, dem seines Landsmann und Nachbarn so unähnlich ist wie ihre beiden Gesichter. Seine Jugend möchte ich nicht und sollte keiner erzählen aus Respekt vor dem „Grünen Heinrich“, in dem er in Wahrheit und Dichtung sich und das Ringen seiner jungen Jahre abkonterfeit hat. Dieses sein größtes Werk war die Frucht seiner Jünglingstränen und hat ihn belohnt für all sein Hungern und Hoffen und Verzweifeln um „die heilige Kunst“, die ihn schließlich doch aus dem Labyrinthe des Lebens zum Licht geführt hat. Als er nach langen Irrfahrten endlich, siebenunddreißig Jahre alt, nach Zürich zurückkehrte, wo seine treue Mutter den verlorenen Sohn, vor Freude weinend, empfing, war er gerade so weit gekommen, daß er wußte, daß er nicht zum Maler taugte. Fünf Jahre [S. 137]lebte dann der Taugenichts in Zürich herum, ohne etwas Rechtes zu tun, bis auf die andauernde unermüdliche Tätigkeit, die er alle Abende in den Kneipen der Stadt bis zum frühen Morgen entfaltete. Er wäre vielleicht verkommen, wie die „kompakte Majorität“ so hübsch zu sagen pflegt, und an sich selbst zugrunde gegangen, wenn da nicht der Züricher Regierungsrat, als hätte es so kommen müssen, ihn zum ersten Staatsschreiber, einem recht angesehenen Posten des Kantons, ernannt hätte. Man kann sich denken, wie damals in der ganzen Stadt über diesen „Geniestreich“ der Regierung gelacht und geschimpft wurde. „Ein ausgemachter Lüdrian, ein unpraktischer Poet an der Spitze der Verwaltung!“ Keller bewies in fünfzehn Jahren strenger, zuverlässigster Pflichterfüllung, daß man nicht geradezu ein Idiot und ein untaugliches, träumerisches Subjekt im öffentlichen Leben sein muß, wenn man außerdem noch Verse und Novellen schreibt. „Er sei der beste Staatsschreiber der Schweiz gewesen“, haben sogar — seine Vorgesetzten von ihm gesagt. So wirkte er pünktlich und treu bis zu dem Tage, wo er seinen Abschied nahm, sich einen staatsmäßigen Schlafrock kaufte und dann in stiller Ruhe seine letzten Werke schuf. Der Berüchtigte war mit den Jahren berühmt geworden: Sein sechzigster Geburtstag war ein Festtag für die ganze Schweiz. Viele Reden wurden auf ihn gehalten. Fünfzig Männergesangvereine sangen ihm hintereinander sein Lied „O mein Heimatland“, das zur schweizerischen Nationalhymne geworden war, vor, bis er [S. 138]schließlich unter ein paar kräftigen Flüchen den Saal verließ. — Zu allem hatte er sich Zeit genommen, und auch zum Sterben nahm er sich gute Weile. Ein Jahr lang siechte er dahin, ganz allein, „eine korrupte Bestie“, wie er sich grimmig schalt. Er war, nachdem er ein paar Körbe bekommen hatte, grimmig lachend und resignierend Junggeselle geblieben, und die brummige Schwester Regula war zu ihm ins Haus gezogen. Nun ließ sie, kurz vor ihm ins Grab gehend, unzuverlässig wie alle Frauenzimmer, ihn für seine letzten Tage noch im Stich und allein. Arnold Böcklin, der späte Freund, den er gefunden hatte, hielt seine Hand, als er starb.
Es sind keine Riesen, diese beiden Schweizer Poeten, keine Schöpfer, bei deren Werken einem der Atem vor Bewunderung stockt oder die Seele überquillt. In der Schweiz wächst, die Tüchtigkeit dieses braven, tatfröhlichen Volkes in allen Ehren, außer den Bergen nicht viel Großes. Man hat mir diese letztere Glosse im Lande Tells bös verargt, wie mir zahlreiche Zuschriften schmerzlich bekundeten. Es tut mir wegen des allzu groben Tons mancher dieser Beschwerdeführer fast leid, daß ich nicht verantwortlich für diese Bemerkung zeichnen kann. Sie stammt von Böcklin, und ist von ihm in Basel, in der Stadt, wo es nach seiner Ansicht „über vierhundert Vereine und keine vier Menschen gab“, oftmals im Wein und im Ärger herausgesprudelt worden. Und wer es nicht glauben will, der mag die alten Maler fragen, die noch mit ihm dort und in Florenz zechen durften, oder die steinernen Fratzen in Basel. Sie werden [S. 139]es grinsend bestätigen. Aber die beiden Dichter der schönen, der freien Schweiz haben in schlichter Weise als treue Landsknechte der Kunst ehrlich gedient und sind echte deutsche Meister gewesen, denen wir im Reich in jenen Jahren außer dem alten Fontane nichts an die Seite zu stellen haben.
[S. 140]
Eine einzige Eigenschaft hat den alten Fontane groß gemacht, eine Eigenschaft, die man, ich weiß nicht, ob auf das Konto seiner Klugheit oder seines Herzens setzen muß, nämlich die, daß er nicht alt wurde mit den Alten, sondern jung mit der Jugend geblieben ist. Und während die, welche mit ihm grau geworden waren, auf ihr Alter und ihre Erfahrung pochend, die Jungen ausschalten und höhnten, die sie von ihrem Platz verdrängen wollten, da hat er fröhlich der Jugend seine alten Hände gereicht und sie gebeten, bei ihnen stehen und mit ihnen leben zu dürfen. Das war sein Eigentümliches, daß er nicht alt und nicht feierlich werden konnte. Er fühlte das schon als Dreißigjähriger, wo er einmal sein kleines zweijähriges Söhnchen, das, wie er voraussah, bald viel älter und würdiger sein würde als sein Herr Papa, andichtete:
Und als er plötzlich später Großvater geworden war, fing er gleich wieder an, mit seiner Enkelwelt jung zu sein und mit ihnen Sorgen und Freuden zu teilen, wie mit dem Enkelkind von ihm, das „vorschulpflichtig“ geworden ist:
[S. 141]
Sie ist sehr selten gewesen, die sokratische Tugend des alten Fontane, jung zu bleiben mit der Jugend, in der Generation in Deutschland, in der er gelebt hat, der wir 1870 und alles, was wir heute bedeuten, zu verdanken haben. Gerade dies Gefühl des eigenen Verdienstes, das diese Generation haben durfte, mußte sie den Jungen gegenüber, die nach ihr kamen, so überlegen und zäh im Bewahren ihrer Macht und ihrer Stellung machen. Denken wir nur an den Gewaltigsten aus der Zeit, an Bismarck zurück, wie er Wutanfälle und Weinkrämpfe bekam und die Stühle und die Materie um sich zertrümmerte, als er den Abschied nehmen und der Jugend das Feld räumen mußte. Und wie er bis zu seinem Tode noch darunter stöhnte und seine Seele zerquälte, daß er andere an seinem Werke schaffen sah: Die ergreifendste Tragödie, die das Theater der Welt unsern Augen zu schauen gegeben hat. — Oder, wer entsinnt sich nicht, um die komische Seite dieser alterstolzen Zeit zu nehmen, wie die Dichter von damals und auch die besten unter ihnen, wie Heyse, Geibel und Freytag, immerfort über „den Kot“ zeterten, der durch die modernen Schriftsteller in die Kunst gebracht würde, und dabei stets ihre ästhetischen Forderungen, vor allem die Definition des „Schönen“, herumpräsentierten, ohne daß sich die Menge und Mode drum kümmern wollte. Dagegen war es wieder Fontane unter den Alten, der einsah, daß sich die neue Zeit und die neue Kunst nicht wegräsonieren ließen, der Zola las, den er „scheußlich“ fand, „aber mit verflucht viel Talent“, und der noch in Gerhart [S. 142]Hauptmann den Naturalismus auf unserer deutschen Bühne begrüßte. So ist es gekommen, daß er als Sechzig- oder besser noch als Siebenzigjähriger, denn so alt war er, als er seine bedeutendsten Romane schrieb, während alle seine Jugendgenossen in Apoll längst vertrocknet waren, auf einmal wie ein alter Birnbaum in schöner, rührender Blüte stand.
Wie Ibsen, der gleich ihm sein Eigentliches und Größtes erst in hohem Alter zu sagen hatte, war er in seiner Jugend zunächst auf den Wunsch seiner Eltern Apotheker geworden. Aber er bekam die „Giftbude“ bald satt und faßte nun die „unglaubliche Idee“, wie er sagte, die damals noch sehr selten war, ein Schriftsteller zu werden. Und da die paar Gedichte und Balladen, die er schrieb, ihn und seine Familie nicht nähren konnten, war er gezwungen, Zeitungskorrespondent und Kritiker zu werden, und hat als solcher sein Leben lang vom dreißigsten bis zum siebzigsten Jahre sich abgeplagt und gemüht und auf das Glück gewartet. Er fühlte, er hatte kein Recht, sein Leben ganz an die Sache zu setzen: „Ich bin keine große und keine reiche Dichternatur,“ gestand er, bescheiden wie Lessing, sich selbst, „es drippelt nur so.“ Und darum hielt er den schweren Beruf des Journalisten aus, solange er konnte, und resignierte schließlich an seinem Lebensabend, nachdem er dreihundertmal vergeblich gehofft und gewartet hatte, wie er es mit hübschem Humor in Verse gefaßt hat:
Das war schließlich das, was bei seinem langen Leben herausgekommen war, eine stille lächelnde Ergebung in sein Schicksal: Nur nicht sich den Hals abjagen nach dem Glück: „Es muß sich dir von selber geben — Man hat es oder hat es nicht.“ Nur nicht denken, man hätte das Leben besser führen können, wenn man sieht, daß man die Partie verloren hat. Die, die darüber klagten oder stöhnten, pflegte er wie sein alter Briest zu trösten: „Laßt, laßt ... das ist ein zu weites Feld!“ Darum konnte er wie kein anderer mit denen, die ihr Leben für verpfuscht hielten, — und wie die Welt steht und geht, müssen dies drei Viertel aller Menschen glauben — leise mitweinen. Und man sieht, namentlich bei seinen schönsten Romanen „Effie Briest“ und „Irrungen, Wirrungen“, den alten Mann vor sich, wie er von seinem Berliner Pult still ans Fenster tritt und hinausblinzelt und tapfer die Tränen verschluckt, die ihm in die blauen Augen getreten sind, die nach Hardens Ausspruch über seinem soliden Gesicht „wie ein Band Goethe in einer Feldwebelstube“ standen.
Seine Natur weist manche Ähnlichkeiten mit Bismarck auf. Er war doch mehr Märker als Gascogner, wenn er sich auch das Gegenteil weismachen wollte. Namentlich in seinen [S. 144]prächtigen Briefen an seine Frau, mit der er fast fünfzig Jahre lang Krieg und Frieden hatte, kann man ihn oft mit Bismarck verwechseln: Familiensinn, Heimatliebe, Nüchternheit im Beobachten und Handeln, unbedingte Zuverlässigkeit gegen Freund und Feind, das sind ein paar märkische Eigenschaften, die beiden gemeinsam waren. Es ist ein Typ, der langsam ausstirbt. Der alte Märker ist tot, und wir haben den modernen Berliner dafür bekommen, was ein recht schlechter Tausch gewesen ist. Der alte Fontane hat diese Wandlung noch miterlebt und hat sie wiederum gefaßt ertragen und gelitten, wie alles, was ihm sein langes Leben gebracht hatte. Zu seinem siebenzigsten Geburtstag war’s, als er auf ein Bankett ging, das man ihm zu Ehren gab. Wen hoffte er da nicht alles zu finden, die von Zitzewitz und von Platen und von Stechlin und von Rammin und wie die märkischen Adelsfamilien sonst noch heißen, die er in seinen Romanen gekonterfeit und gefeiert hatte. Aber nichts von alledem war dort zu sehen; lauter fremde, nichtarische Gesichter umdrängen ihn schreiend und jubelnd, als er eintritt. Da nimmt der Alte resigniert den Arm eines von ihnen, den er kennt und der ihm zunächst steht, und mit den Worten: „Kommen Sie, Cohn!“ läßt er sich von ihm an seinen Ehrenplatz geleiten.
Seine Balladen und noch mehr als diese, seine Romane werden den alten Fontane der Nachwelt bewahren. Wie sein Freund und Nachbar Menzel alles, die ganze Arche Noä, malen konnte, so konnte er, Fontane, alles bedichten: den sterbenden Cromwell, den jungen Bismarck, die schöne [S. 145]Rosamunde, aber auch die Flamingos im Zoologischen Garten, die Müggelberge und die Gegend um Potsdam, so gut wie Chinesen, schottische Könige, Spreewälder Ammen und den Backfisch mit dem Mozartzopf. Die beiden, der Maler und der Dichter, werden bleiben von dem, was Berlin uns zwischen 1870 und 1900 an Kunst beschert hat. Und die Werke des alten Fontane werden über seinem Grabe stehen wie der Birnbaum über dem Sarge des alten Herrn von Ribbeck im Havelland, den er besungen hat, und noch viele Jahre jeden, der davon pflückt, erfreuen und erfrischen.
[S. 146]
„Nein! Der richtige Ausdruck ist noch nicht da. Verflixt!“ seufzte der Kunstmaler, den der Magistrat der Bezirksstadt Schweinfurt in Unterfranken zur Verfertigung eines Bildes von dem größten Sohn der Stadt, ihrem Ehrenbürger Friedrich Rückert, nach seinem Gut Neuseß bei Koburg entsandt hatte. Zum Gedächtnis des demnächstigen fünfundsiebenzigsten Dichter-Geburtstages sollte dies Bild im Rathaussaal zu Schweinfurt aufgehängt werden. Fast wütend sah der Maler auf die Staffelei, auf der die Leinwand stand. Schon sechs Sitzungen waren ihm von dem greisen Dichter bewilligt worden. Aber der richtige Ausdruck und das Geheimnis der Ähnlichkeit fehlte noch dem aus bunten Ölfarben gemischten begonnenen Entwurf.
Es war ein goldener trächtiger Herbsttag. Ein paar weiße Wolken zogen am blauen Pantheon des Himmels über das Dach des Dichterhauses, wie die großen Gedanken der Menschheit: Gott, Liebe, Leben und Vergehen über die Stirn des Poeten darin gezogen waren. Er selbst hielt gerade seinen gewohnten einstündigen Nachmittagschlaf. Nach ihm erwartete er den Maler zum Kaffee in der Gartenlaube, um ihm vor dem Abend noch einmal zu sitzen. Der Künstler hatte sich inzwischen vor das angefangene Bild gestohlen. Es stand in der Glasveranda des Hauses, weil hier das beste Licht zum Malen war. Mißvergnügt über sein Werk, das ihn noch nicht mit dem warmen Blick des Lebens anschaute, pinselte und strichelte er ein wenig daran herum.
[S. 147]
„Könnte man doch dem alten Dichter leibhaftig den Kopf abnehmen an seinen langen schlichten eisgrauen Haaren, die ihm bis auf die Schultern reichen, und ihn dort in den Rahmen für Schweinfurt hineinsetzen!“ grübelte der Maler in seinen unglücklichen Geburtswehen. „Er trägt ohnedies schwer an seinem gewaltigen Schädel, seitdem ihn seine angebetete Frau Luise verlassen hat. Und wenn er keine so starken Knochen hätte, wär’ er wohl schon unter dem Schmerz der Witwerschaft zusammengebrochen, der seinen greisen Pastorenkopf zerknittert hat, wie ein Gewitter ein reifes Ährenfeld. Ein komisches knorriges Gesicht! Zu den ewig gerunzelten Augenbrauen, die ständig auf schlecht Wetter stehen und keins der genossenen Lebensjahre zurückwünschen, will der liebenswürdige ausdrucksvolle Mund nicht passen, der von Weisheiten und Versen überläuft wie ein Brunnen, den das schmelzende Eis des Parnasses nährt. Könnt’ ich nur den richtigen Ausdruck erwischen“, ächzte der Maler, an seinem Handwerk verzweifelnd. Er wandte sich, die neue Sitzung herbeisehnend ins Haus. Das breite sogenannte „Gute Zimmer“ neben der Veranda war von der verstorbenen Frau ganz den Bildern und Andenken ihres Friedrichs vorbehalten. Und der Dichter achtete scharf wie ein kleinstaatlicher Zollvisitator darauf, daß nicht das geringste hier verschoben oder anders eingerichtet würde, wie es seine selige Luise angeordnet hatte. Da hing an der Wand des von den Linden draußen verdunkelten Zimmers des Dichters Silhouette als Würzburger Student der Philologie. Und dort auf dem Nähkästchen [S. 148]seiner Frau über der von ihr fein gehäkelten Decke lagen seine ersten Verse. Seine „Deutschen Gedichte“, die er noch unter dem bescheidenen Namen „Freimund Reimer“ veröffentlicht hatte. Darunter waren seine 46 geharnischten Sonette, in denen er mit papierenem Schwerte Napoleon bekämpft und ihm zweimal die 23 Stiche, mit denen einst die Verschwörer den Cäsar trafen, versetzt hatte, der sonst so friedfertige Jüngling, der zu zart war, um mit in die wirklichen Schlachten hinauszuziehen. Das Hauptzierstück des Zimmers aber war ein großer Kupferstich nach dem Stielerschen Gemälde von Goethe. Mit seinen sonnenhaften Augen schwebte der olympische Vater des ganzen neuen deutschen Dichterhimmels über diesem Raum wie sein Genius über der Poesie Rückerts. Bescheiden wie der Mond, der sein mattes Licht einer stärkeren Leuchtkraft entlehnt, hing darunter die bekannte Zeichnung, die Carl Barth, der Kupferstecher, von seinem geliebten „Rückerto“ gemacht hatte. Sie stammte aus Rückerts römischer Zeit Anno 1817 nach den großen Kriegen, da dort unter dem Vorsitz des für Teutschland erglühenden bayrischen Kronprinzen Ludwig ein geistiges Coenaculum bestand, dem die Nazarener ihr Öl und die Historiker Niebuhr und Bunsen ihr Salz beimischten. Ein Gedicht in Faksimile hing eingerahmt darunter. Das begann:
Der Dichter selbst aber sah finster aus seiner Zeichnung herab. Mit dunklen stechenden Augen in schwarzer altdeutscher [S. 149]Burschentracht und mit offenem Kragen, das kriegerische Schnurrbärtchen der Befreiungskämpfer und Sänger um die Lippen. Düster wie Simon Magus war er einst so durch Rom gewandelt, dem er innerlich fremd geblieben war. Ihn hatte es viel mehr nach dem Orient gezogen. Und in Wien, wo dieser beginnt, war ihm weit heimischer zumute gewesen, als an der Tiber, die Goethen beseligte. „Zur Erinnerung an den Winter in Wien“ stand unter der Zeichnung, die an der Wand gegenüber hing. Es war Joseph von Hammer-Purgstall, der erste und größte Orientalist, der den einstigen Freund aus seinem Rahmen anschaute, mit dem Einverständnis aus der gleichen Liebe zum Osten, die sie verbunden hatte, bis sie über die Aussprache einiger persischer Wörter sich nach Professorenweise miteinander verkrachten.
Der Maler, der sich die Vergangenheit seines Dichters an den Wänden seiner guten Stube betrachtet hatte, stöhnte: „Das gibt mir alles nicht mehr den richtigen Ausdruck für ihn“ und begab sich zu der Laube, wo er sein lebendes Modell erwarten sollte. Leise schritt er durch den Garten unter den Bäumen, die der Dichter, der sich nach seinem eigenen Geständnis weit besser darauf verstand, Bäume zu züchten und zu veredeln als Studenten der Philologie und zünftige Orientalisten heranzubilden, meist selbst gepflanzt hatte. Da, wie der Maler in den Seitenpfad zur Laube biegen wollte, sah er den greisen Poeten schon dort liegen. In edler Verdrossenheit und Ungeselligkeit, zwischen den türkischen Bohnenblüten, mit denen die Laube eingefaßt war. [S. 150]Sie nickten ihm freundlich zu, wie die mit weißem Turban oder rotem Fes geschmückten Häupter der morgenländischen Dichter, die er übersetzt hatte, ein Dschami, ein Saadi, ein Dschelaledin Rumi, ein Hariri und Firdusi im Geist ihn grüßen mochten.
Lang ausgestreckt auf seinem Rücken lag er da, des Dorfamtmanns Sohn aus Frankenland, seiner liebsten Gewohnheit gemäß ins Anschauen Gottes versunken, und lauschte auf das Klirren des Bächleins, das an seinem Haus vorübersprang. Die lange Pfeife lehnte neben ihm und mischte ihren Duft mit dem Kaffee, den man ihm gebracht hatte, dem würzigen Getränk Arabiens, wie er sein reines Deutsch mit dem Indischen, Hebräischen, Persischen und Chinesischen vermählt hatte. Auf seinem Schoß lag ein Notizbuch. Darein schrieb der Alte ab und zu mit seiner klaren zierlichen Handschrift, mit der er die gesamte Literatur des Ostens exzerpiert hatte, einen Vers, den er sich leise vorsprach, indes die Hummeln seinen glatten Mund umsummten. Wieviel hunderttausend Reime waren ihm nicht entflogen seit seinem ersten Kindergedicht! Es gab nichts in der Welt für ihn, das sich nicht bedichten ließ: Der Tod eines Kindes so gut wie die Ablehnung einer Einladung oder das Ausfliegen eines Kanarienvogels oder das Heldenmädchen Prohaska oder der Abschied eines Dienstboten oder die Württemberger Verfassung oder ein verstauchter Fuß oder das Frankfurter Rumpfparlament. Auf alles fand er einen Reim. Hatte er doch zum Spaß ihrer sechsundzwanzig allein auf das Wort: „Märchen“ aufgestöbert.
[S. 151]
Am liebsten freilich waren ihm die Reime „Mein“ und „Dein“, so wie er als Mann auch stets den Gleichklang auf sein Ich und die Hälfte, die ihm zum Ganzen fehlte, gesucht hatte. Von Agnes Müller, der frühverstorbenen, angefangen über Marielies, die Thüringer Wirtstochter, die er unter dem Blumennamen „Amaryllis“ besang, trotzdem sie ihn verschmähte und seine Gedichte — o Tod jeder Dichterliebe! — zerriß, bis zu Luise, der Braut und Gattin, der er seinen vollen Liebesfrühling in den Schoß geschüttet hatte.
Selbst die weißgestrichenen Pfosten der Laube waren mit Reimen gefüllt, mit versus memoriales, die der Dichter, der außer seinen Briefen keine Prosa schrieb, und der seinem eigenen Geständnis nach nur in Versen denken und fassen konnte, dort hingekritzelt hatte. Neben der Kaffeekanne auf dem Tischchen lagen drei Bände seiner Dramen, die kein Mensch las, außer ihm selber. Im Banne Calderons, der ihm wie der Dämon dem heiligen Cyprian mit magischer Gewalt im Nacken saß, hatte er in ihnen den König Arsak von Armenien, Saul und David, Herodes den Großen, Kaiser Heinrich den IV. und Cristoforo Colombo bedichtet und sich fast krank geärgert, als keine Bühne gierig danach griff. Doch, um den alten Poeten über diese nie vernarbte Wunde zu trösten, stand dicht neben diesen totgeborenen [S. 152]Werken eine Vase voll hundertblättriger Rosen die seine sorgliche Tochter dorthin gerückt hatte und duftete ihm wie die sechs Liedersträuße zu, die er einst im Liebeslenz gewunden hatte.
So lag er dort auf seiner Gartenbank zwischen seinen Blumen, seinen Versen und seinen dramatischen Schmerzenskindern, der ungesellige greise Dichter. Wie ein morgenländischer Zauberer sah er im Schmuck seiner langen Haare aus, indes seine knochigen Wangen noch von dem Wein, den er beim Mittagsmahl genossen hatte, wie die des Hafis gerötet waren. „Könnt’ ich ihn so aus der Natur wegstehlen“, dachte der Maler, der ihn lange von ferne betrachtete, den weisen Brahmanen, der Verse fangend in den Himmel schaute. Um das ländliche Bild des Stillebens eines deutschen Dichters zu vollenden, spielte sein Enkeltöchterchen, ein kleiner Blondkopf, um ihn herum. Sie wartete darauf, daß er ihr ein Märlein von dem Bäumchen, das andere Blätter gewollt, oder vom Büblein, das überall hat mitgenommen sein wollen, erzählte. Jetzt reizte das goldene Medaillon an der Uhrkette des Großvaters besonders ihre Neugier. Listig und leise machte sie sich an ihn heran, der mit den poetischen Geistern der Luft zu sprechen schien. Vorsichtig öffnete sie das Schlößchen, das die beiden Goldkapseln zusammenhielt. „Wer ist das, Großväterchen?“ rief sie, erstaunt auf die beiden Bildchen blickend, die darin waren. Sanft erschrocken, schaute der greise Dichter zur Seite. Er sah seine über alles geliebte Luise als Braut und als Silberbraut in den Händchen [S. 153]der Kleinen und einen Schimmer der Ähnlichkeit mit seiner Frau auf dem Gesichtchen der Enkelin leuchten. Die Tränen traten ihm in die Augen. Und jetzt — das war der richtige Ausdruck für den greisen Dichterkopf, wie der Maler ihn suchte — jetzt legte der Gottesfürchtige seine morsche Hand zum Segen auf den blonden Scheitel der Kleinen und flüsterte mit seiner immer leisen Stimme:
[S. 154]
„Das soll mir einmal einer nachmachen von diesen Jungen, die sich heute auf der deutschen Schaubühne herumlümmeln und der anständigen Kunst die Luft wegnehmen, die wenige, die ihr die seichte, zuchtlose, französische Schwankliteratur übrig läßt, Gott sei’s geklagt!“ Der Mann, der das sagte, war ein bleicher Sechziger. „Unser Geibel“ nannten ihn seine Lübecker. Er trug eine violette Samtjacke und ein schwarzes Samtkäppchen, unter dem sich zu beiden Seiten und nach hinten schöne Reste kühn geschwungener weißer Locken hervortaten. Er saß auf einem roten Plüschstuhl. In der einen Hand hielt er ein Manuskript, dessen Goldschnitteinband in dem Licht der roten Ampel glänzte, die auf dem Sekretär neben ihm brannte. Mit der andern Hand schlug er zuweilen zur rhythmischen Begleitung der Verse, die er vortrug, oder auch zur Bekräftigung seiner Ansichten auf die mit zwei Löwenköpfen aus Messing geschmückte Armlehne seines Plüschstuhles. Jetzt fuhr er fort, aus dem sauber und deutlich wie ein hanseatisches Konossement geschriebenen Manuskript in seiner Linken vorzulesen, in das er freilich kaum hineinzublicken brauchte, so geläufig waren ihm die Verse.
Brunhild: Nieder in den Staub, du Schlange, die mit gift’ger Zunge sticht!
Lügnerin!Kriemhild: Die Wahrheit sprach ich und dein Grimm verlöscht sie nicht!
[S. 155]
Brunhild: Schweig! Wie Flaumen in die Lüfte blas’ ich deiner Märchen Bau.
Kriemhild: Glauben willst du nicht dem Worte, rasend Weib, wohlan, so schau!
Kennst du diese Doppelspange: Dir vom Gürtel kam sie nie!
Bis der Held dich unterjochte — — —Die Jungfrauen: Wehe! Wehe!
Kriemhild: Kennst du sie?
Brunhild: Gaukelspiel der finstern Mächte!
Kriemhild: Antwort gib!
Brunhild: Wie Rabenflug
Schwirrt es düster mir vor Augen. Aber nein! Es ist ein Trug
Du entwandest sie!Kriemhild: Du wagst es?
Brunhild: Räuberin!
Sigrun: Laßt ab vom Streit!
Dort vom Schlosse naht der König.Kriemhild: Wohl! Er kommt zur rechten Zeit.
„Das soll mir einmal einer nachmachen von diesen Dichterlingen und modernen Schmierfinken, die unser Theater schänden!“ unterbrach der Dichter seine Vorlesung. „Das ist echt dramatisch. Nicht zum Einschlafen langweilig wie das Stabgereime eines Richard Wagners, bei dem einem übel werden kann wie Gunthers Weibe in seiner verblasenen Götterdämmerung! Vermutlich weil sie das endlose Vorspiel der drei Nornen auf dem Walkürenfelsen mitanhören mußte. Die ganze hehre Edda ist uns durch diesen unsittlichen Sudelmusikanten verzerrt und in den Kot gezogen worden.
[S. 156]
Auch meine Szene ist gewagt, ich geb’ es zu. Aber der gewaltige Dichter des Nibelungenliedes hat sie nun einmal überliefert. Und ich glaube, daß ich nicht gestrauchelt noch ausgeglitten bin, wie es leider einem Hebbel an solchen schlüpfrigen Stellen zuweilen widerfahren ist. Selbst den Gürtel, den er, dem Liede folgend, die rasende Kriemhild der Nebenbuhlerin vor dem Münster zeigen läßt, hab’ ich als anstößig vermieden und geb’ ihr nur seine Doppelspange. Was auch nur im kleinsten über die Grenzen des Sittlichen hinausschweift, ist nicht mehr ‚schön‘ nach den ewigen Grundbegriffen der Ästhetik. Irret euch nicht, ihr herumvagierenden Ritter der Moderne! Gott läßt seiner nicht spotten. Hab’ ich nicht recht, meine Lieben?“
Sein kleines Auditorium, das wie gewöhnlich aus seiner einzigen Tochter Marie, ihrem Manne, dem soliden Rechtsanwalt Doktor Fehling, und seiner rührend um ihn besorgten Nichte Bertha bestand, beteuerten mit Kopfnicken, Brummen und Zärtlichkeiten die Richtigkeit seiner Behauptungen und Befürchtungen. „Item, ich fahre fort“, kündigte der Alte jetzt als sein eigener Heroldsruf mit erhobener Stimme an: „Gunther tritt auf im königlichen Schmucke.
Gunther: Welch ein Zwist! Wer ist’s, der frevelnd unsrer Hofburg Frieden brach?
Brunhild: Schütze, räche mich mein Gatte, räche deines Weibes Schmach!
Gunther: Was geschah?
[S. 157]
Brunhild (weist auf Kriemhild): Es spricht die Stolze — meine Lippe bebt vor Scham,
Daß nicht deine Kraft, daß Siegfried mir zur Nacht den Gürtel nahm.Gunther: Wort des Unheils! Wehe!
Sigrun: Wehe, daß du diesen Zwist begannst!
Brunhild: Brich die Lästrung! Richte! Räche!
Kriemhild: Straf’ mich Lügen, so du kannst!
Brunhild: Ha! Du schweigst? Du zögerst? Rede! Bei der Hölle Pforten, sprich!
War es Siegfried?(Gunther schweigt)
Die Jungfrauen: Wehe! Wehe!
Kriemhild: Sein Verstummen richtet dich.“
Der Dichter hatte seine Stimme, so sehr er konnte, entfaltet. Wie Theater-Donnerrollen dröhnte es durch die niedrige Lübecker Wohnstube. Aber plötzlich brach er ab und heftete seine funkelnden blauen Augen angstvoll ins Leere. Die Krankheit, die ihn allnächtlich um die elfte Stunde wie ein stygischer Schatten heimzusuchen pflegte, trat heischend hinter ihn und nahm ihm die Kraft, weiter zu deklamieren. Nur ein paar Bekräftigungen seiner selbst ließ er, den das Glück überall, nur nicht auf dem Theater angelächelt hatte, noch gegen die Dämonen der Zweifelsucht los: „Was! das ist dialektisch gebaut! Ein Äschylus würde sein Ergötzen daran haben. Traun! In der Form steh’ ich hinter keinem zurück. Wie knapp Rede und Gegenrede aufeinander folgen! Meist nur in einem Vers! ‚Stichomythie‘ nannten das die Griechen. Schade, daß ich nicht mein [S. 158]eigener Kommentator sein kann! Ich könnte mehr aus meinen Werken herauslesen als Bulthaupt von Bremen und dieser naseweise Freytag. Ja, ja! man muß scharf zusehen bei mir, meine Herren Kritiker! Die Stelle, die ich euch vorlas, bedeutet die Peripetie des Dramas, den vorgeschriebenen Wendepunkt im Schicksal der Heldin, das von nun an der Katastrophe zueilt. Ihr könnt euch den Aufbau meiner Stücke an einer Pyramide klarmachen.“ Er zeichnete mit zitternder Hand eine solche Figur in die Luft. „Seht ihr! Das war die Spitze, zu der ich meine Brunhild führte. Jetzt geht’s bergab mit ihr. ‚Αὖτις ἔπειτα πέδονδε κνλίνδετο λᾶας ἀναιδής‘, wie Allvater Homer singt, was unser plumper alter Voß, vergröbernd wie immer mit: ‚Hurtig wie Donnergepolter entrollte der tückische Marmor‘ übersetzt hat. Ich hätte ihm gerne die Hand führen mögen bei manchen Versen des Joniers, meinem Nachbarn, dem etwas grobschichtigen Alten von Eutin.
Hab ich’s euch recht gemacht mit meinem Vorlesen? Ich sag’ euch, die Ziegler selbst ist zu matt an dieser Stelle, die freilich die Kraft einer Göttin verlangt. Wahrlich! stellt das nicht alles in den Schatten, womit sich dieser wabernde, wollustwühlende, wahnwitzige Wagner an den Nibelungen versündigt hat?“
Die Nichte gab heimlich über seinem Kopf den beiden andern das Zeichen zum Aufbruch. Allzu große Aufregung verschlimmerte die nächtlichen Leiden des Onkels. Das wußte sie aus peinlicher Erfahrung. Tochter und Schwiegersohn verabschiedeten sich denn auch unter den üblichen [S. 159]Beifallsbestätigungen. „Nun? Bin ich wieder einmal zu heftig gewesen, mein Nichtchen?“ meinte der greise Dichter, als sie beide allein waren, schelmisch lächelnd. „Hab’ ich diesen Wagner wieder ad posteriora vorgenommen? Schon recht, Mimosa pudica! Reich’ mir nur die Büchse her. Ich verurteile mich selbst zu dem üblichen Strafschilling.“
Er ließ, noch immer neckisch, eine Mark in die von der Nichte ihm vorgehaltene Sparbüchse fallen. Es war dies das Strafgeld, das er für jede in Gegenwart von Damen gemachte gewagte Äußerung in seinem Hause eingeführt hatte. „Da ist mein Obolus“, fügte er hinzu, und sein Gesicht bekam plötzlich einen sinnenden Ausdruck, als wäre ihm bei dem harten Fall des Geldstückes zu Bewußtsein gekommen, wie bald er so dem Charon das letzte Fährgeld über den Totenstrom zahlen müßte.
wie sein geliebter Horaz, dessen fünfzig schönste Oden er übersetzt hatte, seinem Postumus klagt.
Die Nichte hatte behutsam die gestrickte Decke von den Knien des Onkels fortgezogen, der sich nun, von ihr gestützt, ächzend aus dem weichen Plüschstuhl erhob. „Eheu fugaces, Postume, Postume labuntur anni!“ sprach er, nachdenklich die langsam verblühenden Wangen der Nichte [S. 160]tätschelnd. Sie wandte sich etwas frierend von seiner kalten Hand zum Mahagoni-Büfett, einen silbernen Teelöffel aus dem Dutzendkästchen für den Grog des Onkels zu holen, der ihm vor der Nachtruhe an sein Bett gebracht werden mußte.
Langsam ging der greise Poet seinem Schlafzimmer zu. Vor dem lebensgroßen Ölbild seiner verstorbenen Frau Ada Geibel, geborenen Trummer, blieb er wie jeden Abend zu einer kurzen Andacht stehen. Im Reifrock der Mode von 1850 aus blauem Taft mit breiten Volants hing sie dort, wie ein Engel schon über ihm schwebend im Reichtum ihrer Locken, die, wenn sie losgeschürzt waren, wie ein schwarzer Wasserfall ihr bis an die Knie gereicht hatten. Sie schaute mit ihren braunen Rätselaugen an ihm vorüber in das Himmelreich, in das sie ihm vorangegangen war. Nur drei Jahre war sie sein gewesen. Aber er war ihr treu geblieben, er, der Pastorensohn. Über die Jahrzehnte hinaus, die sie jetzt von ihm trennten. „Anders wie jener französierte Heine, der aus seinem Herzen einen Rangierbahnhof gemacht hat!“ knurrte er in seinen geschweiften Knebelbart. Sein Fuß stieß an die Laute, die an die Palmen und Blattpflanzen vor ihrem Bilde gelehnt war. Sie klang wie das gebrochene Herz der Sappho auf Mytilene auf Lesbos. Seine müden Augen, die einst in seiner Jugend, da er noch Hauslehrer in Athen gewesen war, Marathons Ebene und das Felsengestade von Salamis und das goldrostige Marmorgebälk der Akropolis geschaut hatten, blieben an dem Ölgemälde Oswald [S. 161]Achenbachs: „Ein Abend in Sorrent“ haften, das neben der Tür zu seinem Schlafgemach hing. „Sonderbar! Daß ich niemals in Rom war!“ sagte er, halb zur Nichte gewandt. Und eine Feuerbachsche Sehnsucht nach dem Land voll Sonnenschein glomm in ihm auf. Aber er korrigierte sich alsbald: „Freilich fürwahr, wer die Antike aus erster Hand genossen hat, mag sie nicht mehr als Kopie aufgetischt bekommen.“ Die gemütvollen Straßenlampen der Marzipanstadt blinzelten ihrem Hofpoeten bestätigend durch das Fenster zu. Er schickte sich an, sich zur Ruhe zu begeben, soweit das schmerzvolle Darmleiden, das er seit seinem Aufenthalt in Griechenland hatte und das ihn regelmäßig außer den Mittags- und Abendstunden wie der Geier den Prometheus heimsuchte, sie ihm vergönnte. „Gute Nacht, Nichtchen!“
Aber sie hatte noch ein Anliegen: „Fräulein Froböse möchte wissen, wie dir der erste Aufzug ihres Trauerspiels gefallen hätte, und ob sie es weiterdichten sollte.“
„Richtig“, sagte er, schon in der Türe zu seinem Schlafzimmer stehend, und begann lächelnd, wie er es oft in jüngeren Jahren im Lübecker Ratskeller getan hatte, aus dem Stegreif in Versen zu sprechen:
Doch er war zu müde noch einen Reim zu suchen. Er dachte zitternd, daß bald der Tod ihn mit dem Wort „Zypressen“ finden und Dichter wie Gedicht damit zudecken [S. 162]würde. „Gott wird’s füglich fertig machen!“ sprach er unter einem halben Gähnen. „Gott wird alles fertig machen, sag’ ihr das, was von uns hier nicht vollendet und nicht gut gemacht worden ist. Alles, bis auf Bismarcks Werk!“ Er lüftete leise sein Samtkäppchen ihm zu Ehren, er, der Herold des neuen deutschen Kaiserreiches. „Denn das ist vortrefflich geraten und bedarf keiner Verbesserung! Ehre sei Gott in der Höhe! Gute Nacht!
Du magst mir noch etwas auf der Laute vorspielen, wie der Knabe dem Scipio vor seinem Zelt in meiner herrlichen ‚Sophonisbe‘. Ich werde dabei, soweit mein Darm es zuläßt, von Griechenland träumen.“
[S. 163]
Eine Silhouette von ihm, zu seinen Lebzeiten geschnitten.
Wiedensahl, das Dörfchen, in dem Wilhelm Busch geboren und gestorben ist, ist ein Flecken in der Provinz Hannover mit einer Handvoll Häusern, die friedlich dastehen, rote Ziegeldächer als Hüte über den Kopf gestülpt oder dicke, moosbedeckte Strohkappen schief aufgesetzt. Ein Bächlein fließt um das Dorf herum, auf dem im Sommer und im Winter, wenn es nicht, um sich nicht zu erkälten, eine Eisdecke übergezogen hat, die Enten und Gänse fröhlich ohne Unterschied des Geschlechtes zusammen baden. Fette Wiesen und herrliche dunkle Tannenwälder umrahmen das Bild. Den Dampf und die Elektrizität kennt diese jenseits der Eisenbahn gelegene Idylle noch nicht. Und als es geschah, daß zum erstenmal ein Automobil wild die Gegend durchfauchte, schrien die Bauern: „Der Düvel ist gekommen und will den Wilhelm Busch holen.“ Man wäscht sich dort an der Pumpe, man liest die Zeitungen von vorgestern, und Musik nennt man dort, wenn der Viehknecht abends ins Horn trötet, daß die Kühe von der Weide heimkehren sollen. Gleichwohl läßt es sich im Sommer, wenn die Wiesen dick voller Blumen stehen und in der Sonne strahlen wie ein Pfauenschwanz, und wenn die Vögel alle zusammen musizieren, ohne je aus dem Takt zu kommen, dort ebensogut leben wie in Berlin. Und selbst im Winter, wenn an den Fenstern die weißen Eisblumen blühen und es draußen friert, daß die Steine [S. 164]heulen, und man drinnen bei Rheinwein oder wenn’s zu kalt wird, bei altem Nordhäuser sich tröstet, kann man das Dasein dort ebensogut ertragen wie in Rom oder in Florenz. So dachte auch Wilhelm Busch, als er am 15. April 1832 in Wiedensahl zur Welt kam:
Sein Vater war der Krämer des Dorfes, der schwarze Seife, Talglichter, Salz, Karamellen, Streichhölzchen und Bindfaden verkaufte. Und sein Weib half ihm tapfer dabei. Die Großmutter nahm sich des Kleinen an, da die Eltern, wie gesagt, Besseres und mehr zu tun hatten, als Kinder zu weiden und groß zu ziehen. Die Alte, die, wie die Leute über siebenzig Jahre gewöhnlich, nicht mehr viel schlafen konnte, stand mit Herrn Busch jun. in der Frühe auf, schob ihm ein Stück Pumpernickel in den Mund, damit seine Zähne sich amüsieren konnten, und steckte das Herdfeuer an. „Besonders im Winter“, erzählt Busch einmal, „kam es mir wonnig geheimnisvoll vor, so früh am Tage schon selbstbewußt in dieser Welt zu sein, wenn ringsumher noch alles still und tot und dunkel war. Dann saßen wir zwei, bis das Wasser kochte, im engen Lichtbezirk der pompejanisch geformten zinnernen Lampe, sie spinnend, ich spielend oder später aus dem Gesangbuch schöne Morgenlieder lesend.“ Als der Junge größer geworden war und etwas werden mußte, schickte man ihn, während die Großalte sich indessen zu ihren Müttern versammelte, [S. 165]auf die Hochschule nach Hannover. Aber es erging Busch wie allen wählerischen Leuten, er konnte und konnte den Beruf nicht finden, der auf dieser Welt für ihn paßte. Und schon war er nahe daran, sich mangels Beschäftigung aufzuhängen, als ihn ein Freund mit den Worten: „Maler kannst du immer noch werden!“ an die Akademie nach Düsseldorf wies. Hier saß er ein Jahr im Antikensaal ab und wollte gerade vor Langeweile sterben, als ihm einfiel, daß man, wenn man den Rhein hinunterfuhr, nach den Niederlanden kommen müßte. Er machte sich daher auf. Und hier von den Bildern von Brouwer, Teniers, Frans Hals und anderen bekam er wohl die erste Anregung zu seinem späteren Schaffen. „Ihre göttliche Leichtigkeit der Darstellung malerischer Einfälle, ihre Unbefangenheit eines guten Gewissens, welches nichts zu vertuschen braucht, haben für immer meine Liebe und Bewunderung gewonnen“, gesteht er selbst.
Als letzten Studienort hat er sich dann München erwählt, wo er allerdings mehr im Künstlerverein als in der Akademie saß, und wo die „Fliegenden Blätter“ das erste Bild und die ersten Verse von ihm brachten. Dann ging’s wieder für immer der Heimat zu. Über Düsseldorf. Dort führte man ihn, der damals ob seines trockenen Humors in Malerkreisen schon allgemein gefeiert wurde, jubelnd in den Malerverein „Malkasten“, in der Hoffnung, daß dieser Märchenprinz aus Genieland dieses verschlafene Dornröschen wachküssen würde. Aber man war bitter enttäuscht von ihm; kein Spaß entschlüpfte inmitten der porzellanenen Honoratioren [S. 166]seinem Munde. Endlich stand er auf und klopfte ans Glas: Alles fuhr auf. „Wilhelm Busch wird reden“, und hundert neugierige Augen sahen ihm auf den Mund, in Erwartung, was da herauskommen würde: „Kellner! Noch einen Schoppen Mosel!“ sagte er und schwieg damit definitiv.
Am andern Morgen fuhr er in die Einsamkeit nach Wiedensahl und schrieb und malte dort ganz allein, „ohne wem was zu sagen“, wie er sich ausdrückte, alle seine schönen Bildergeschichten auf. Und als es ihm genug schien, schwieg er so beharrlich, wie damals im Düsseldorfer „Malkasten“, und lebte friedlich in Wiedensahl bis auf den heutigen Tag, auf keine andere Unterhaltung angewiesen als auf Bücher, Bauern und das Jägerlatein des Försters am Abend in der Waldschenke. Er hat sich niemals feiern lassen, und während andere berühmte Jubelgreise sich zu ihrem siebenzigsten Geburtstag unter Tränen anreden lassen oder im Kreise der lieben Ihren sitzen, tiefgerührt den Enkel auf dem Schoß, bis dieser, ohne Respekt vor jenem Tag, sich unmanierlich benimmt, floh Wilhelm Busch damals allein in die einsamen Tannenwälder, die Gott sei Dank noch nicht das Reden gelernt haben. Früher las er viel im Darwin und Schopenhauer, und abends, wenn die Leute in den Großstädten Offenbach oder Blumenthal anhören, oder sich darüber freuen, daß einer seiltanzen kann, ohne sich die Beine zu zerbrechen, dann holte er sich Shakespeare und las sich bei der Lampe darin so glücklich, als wenn er im Frack in der ersten Loge der Oper gesessen hätte.
[S. 167]
Heutzutage, wo die Augen schon matter geworden sind, spielt er lieber mit den Kindern herum oder sieht im Sommer den Bienen zu, die ihm noch interessanter sind als eine Reichstagswahl, und raucht dabei Tabak, soviel er paffen kann, und hüllt sich wie Zeus in blaue Wolken ein. Und über kurz oder lang wird er eines nicht schönen Tages sterben, wenn es einmal acht Tage hintereinander in grauen Streifen geregnet hat, oder das Bier im Faß erfriert, und man rechte Lust auf das Grab bekommt, wo man nicht mehr naß und kalt wird, und länger als acht Stunden hintereinander schlafen kann, ohne von irgendeiner verfluchten Pflicht geweckt zu werden. Und seiner Schwester Sohn, der Pfarrer in Wiedensahl ist, wird ihn zur Ruhe bringen und über seiner Gruft folgende Predigt halten: „Hier ruht in Gott und in Erde Wilhelm Busch, ein lachender Philosoph, der letzte große Humorist, den wir Deutsche hatten. Denn die bis dato nach ihm kamen, verdienen leider nicht den Namen. Amen!“
[S. 168]
Der preußische Oberlehrer Traugott Semmelbart war gerade im Begriffe, den Schülern seiner Oberprima die Schönheiten und Schwierigkeiten der ionischen Sprachformen am siebzehnten Gesang der Ilias, der vom Streit um die Leiche des Patroklus handelt, zu beweisen und zu erläutern. Sie waren eben an der Stelle, wo es den griechischen Helden gelingt, den nackten Leichnam, dem Hektor die herrliche goldene Rüstung Achills von den Schultern gerissen hatte, fortzuschleifen, und wo ihr Dichter sie den Trauermarsch zum Zelte des Achills antreten läßt. „Der Vers 722 war falsch skandiert! — Außerdem haben Sie später den Konjunktivus Aoristi mit dem Imperativ verwechselt und in Vers 730 den Genitiv Singularis mit dem Dativ Pluralis. Noch einmal die ganze Stelle von vorne!“
Also war des Oberlehrers Zensur ausgefallen, und der Oberprimaner begann von neuem an den ionischen Versen Homers herumzubohren, zu sägen und zu hobeln. Die Sonne Homers aber, die draußen schien, schaute diesem fast noch mühevolleren Streite um die versifizierte Leiche des Patroklus lächelnd durch die Fenstergitter zu und leuchtete gerade auf die Stirne des an der Spitze der Klasse kämpfenden Oberlehrers. Und siehe, unter ihrem Strahl geschah etwas Wunderbares, etwas, was sich die alten Griechen nur unter der Einwirkung oder durch das Dazwischenkommen irgendeines Gottes hätten erklären können. Traugott [S. 169]Semmelbart unterbrach plötzlich seinen Schüler, klappte das Buch zu, stieg auf sein Katheder und hielt hinter seiner Brille unvermutet eine Ansprache:
„Liebe Schüler! Wir plagen uns nun seit zwei Uhr über dem Optativ, den Synkopen, den Akzenten, den Endungen und dem ganzen Formenreichtum der griechischen Sprache nicht anders, wie Menelaus und die beiden Ajas gegen die Trojaner in Schweiß geraten sind. Es ist meine Pflicht, Ihnen an der Hand des Homer die griechische Sprache zu verlebendigen. Aber, nehmt’s mir nicht übel, ich habe manchmal das schlechte Gewissen, als ginge der alte Homer dabei zu Tode. Vor lauter Nachdenken über alle die schwierigen Worte sehen Sie schließlich die Bilder nicht mehr, die dahinter stehen, und um derentwillen kennen wir Heutigen doch nur unsern Homer, dessen Sprache tot ist gleich der Akropolis. So lassen Sie mich Ihnen denn in dieser Stunde einen einzigen Rat für Ihr ganzes Leben erteilen. Der lautet: Vergessen Sie den Homer nach der Schule nicht! Dies griechische Buch, was Sie da in Händen halten, das mögen Sie meinetwegen als Studenten schon verkaufen, um Bier oder Tabak daraus zu machen. Das bißchen Jonische, das ich Ihnen eindrillen kann, verlieren Sie ohnedies nach dem dritten Semester. Denn ich möchte den sehen, der, wenn er nicht wie ich Altphilologe geworden ist, mir nach zehn Jahren noch einen einzigen Vers aus der Ilias oder der Odyssee ohne Wörterlexikon übersetzen könnte!
Nein, nicht um des Griechischen willen sollen Sie unsern [S. 170]Homer mir nicht vergessen. Dieser Honig ist nur für die letzten Feinschmecker bereitet. Sondern um seiner Kunst willen sollten Sie später, wenn Sie nicht mehr an der Schulbank kleben, den Homer in dem körnigen Deutsch des klugen Vater Voß immer von neuem genießen. Denn sein ist die Kraft und der Reichtum und die Herrlichkeit in Ewigkeit, und solange es Menschen gibt, die dichten müssen, wird Homer der erste praeceptor poetarum bleiben. Goethe nahm seine ‚Odyssee‘ noch als Fremdenführer mit nach Italien und las, als er um Siziliens felsige Küste herumfuhr, die Abenteuer des klugen Dulders mit dem Zyklopen Polyphem. Er wußte, daß der alte Homer, der Schöpfer der ganzen griechischen Kultur, die Fibel ist, vor die man die Dichter setzen soll, ehe sie eine Nähnadel zu beschreiben anfangen.
Denn — und dieses können Menschen unter dreißig Jahren noch nicht würdigen — seine Kunst, Menschen und Gegenstände zu schildern, ist bis zum Ende der Welt meisterhaft. Unter blauem Himmel hat er alles gemalt, was es gibt, Segelschiffe, Pferdegespanne, Schilde, Waffen, Meierhöfe, Mauern, Kleider, Webstühle, Flüsse, Meere und Berge. Man muß nur daran denken, wie er die Dinge, die er beschreibt, zusammensetzt: Einen Helden im Kriegskleid läßt er sich vor uns gürten und Stück für Stück ankleiden, da steht er. Ein Schiff im Wind auf dem Meer läßt er vor uns im Hafen langsam aufbauen, da fährt es. Einen Hund, der uns interessieren soll, läßt er vor uns aufleben von seinem ersten Tage an bis zu seinem letzten, daß wir [S. 171]wie auf ‚du und du‘ mit ihm stehen und traurig werden wie beim Tode des alten Attinghausen, wenn er verlassen und vergessen auf dem Miste liegt und beim Anblick seines nach zwanzig Jahren heimkehrenden Herrn, des Odysseus, den kein Mensch erkennt, schwach mit dem Schwanz wedelt und dann vor Erschütterung stirbt.
Niemals aber kommt es vor, daß sich Homer an seinen Gegenstand verliert, weil er der naivste und darum der größte Dichter ist, den die fünf Erdteile besitzen. Nicht kalt steht er bei seinen Geschöpfen. Mit allumfassender Liebe sieht er alles an, den strahlenden göttlichen Helden Achill, wie die kriechende, sterbliche Schildkröte auf dem Sande davor. Und so wird alles warm für uns unter seiner Hand, das Größte wie das Kleinste. Darum vielleicht dachten sich ihn die Griechen blind, weil er nichts und niemanden bevorzugt und keinem andere Farben mitgibt, als er im Spiegel hat.
Wie aber sind die Menschen, die er geschaffen hat? Es wäre leicht, nur das Schlechte an ihnen aufzuzählen: So wäre sein Agamemnon geizig und feig, der Achill jähzornig und neidisch, Ajas dumm und furchtsam und die Helena schwach und sinnlich zu nennen. Ja selbst sein Himmel wimmelt von menschlichen Leidenschaften völlig unterworfenen Göttern, und sein Zeus ist ein schlimmerer Sünder, als sich das Mittelalter den Teufel vorstellte. Und wenn man seinen Olymp mit Luzians und Offenbachs Augen anschaut, wird im Nu eine Parodie daraus. Und doch sieht man seine Geschöpfe darum, weil er sie nicht verschönt und [S. 172]weiß oder schwarz angestrichen hat, heute noch atmen und mit den Augen rollen, seine Heroen und Götter und Frauen, wie man von den Bildwerken der Antike sagt, daß sie nachts in den Museen aufwachen und miteinander griechisch reden. Homers Himmel kennt keine Heiligen und seine Erde keine Idealgestalten als Menschen, die leben, wie sie sind, ohne Scham und ohne Reue, einzig nur das griechische Gewissen kennend: ‚Erkenne dich selbst und halte dein Maß!‘
Alles dieses aber zu fassen, zu verstehen und zu würdigen, reicht das Gehirn von Achtzehnjährigen noch nicht völlig aus. Und darum, liebe Schüler, ich beschwöre euch“ — und hierbei klang des Oberlehrers Stimme so einschmeichelnd und verführerisch, wie die Harfe im Palast des Odysseus zum Schlemmermahl der Freier oder die Laute der Sirenen, die den heimsegelnden Helden süßer als Vogellieder verlocken wollen —: „Vergeßt den Homer nicht im Leben und lest bisweilen in ihm, ihr mögt als Supernumerare, Schriftsteller, Pastöre, Ingenieure oder Offiziere endigen! Laßt euch von ihm begleiten bis ins vierte und ins achte Jahrzehnt eures Lebens! Und wenn ihr an eurem Todestage sagen könnt: ‚Er ist mein bester Freund gewesen‘, werdet ihr reich ins Grab hinuntergehen.“
Der Oberlehrer Traugott Semmelbart hielt auf einmal erschrocken im Reden still. Seine Bäckchen waren vor Begeisterung ganz rot geworden, wie die Schatten der Unterwelt, als sie wieder Blut getrunken. Er sah auf einmal die Augen seines Primus höhnisch überlegen auf [S. 173]sich ruhen und fühlte dunkel, daß die Bande der Ordnung in seiner Oberprima in Verwirrung geraten würden, wenn er nicht schnell wieder die gewohnten Zügel in die Hand nähme. Mit einem lauten Seufzer, ähnlich dem eines Halbgottes, der zurück zur Erde kehren muß, wandte er sich von seinem erhabenen Olymp zur griechischen Grammatik, stieg vom Katheder hinab und sagte traurig: „Also, noch einmal, Brösicke! Von Vers 722:
ὣς ἔφαθ᾽, οἳ δ᾽ ἄρα νεκρὸν ἀπὸ χθονὸς ἀγκάζοντο.“
[S. 174]
Wem heute ein Zahn weh tut oder der Magen schmerzt, der läßt sich Metall in den Mund oder Pillen in den Magen legen. Oder wer in der Nacht aufwacht und Herzklopfen verspürt, der rennt am andern Tag in der Frühe zum Doktor, zieht sich aus, läßt sich beklopfen und behorchen, und später massieren, elektrisieren oder gar hypnotisieren. So von zehn Spezialärzten begleitet, lebt der moderne Mensch sein Leben dahin. Wird er kränker, so legt er seinen Leib in warme Bäder hinein, und wird er sehr krank, so stiftet er sich einem Sanatorium und läßt ein paar Wochen lang geduldig allen heilsamen Hokuspokus mit sich geschehen. So war es vor dreihundert Jahren, da Shakespeare und Cervantes lebten, noch nicht. Man fragte nach dem Leben des einzelnen nicht viel und noch weniger nach seiner Gesundheit. Wer sterben sollte und der Roßkur des Daseins nicht mehr gewachsen war, den ließ man ohne viel Arzneien und ohne lateinische Worte sterben.
Hier ist ein Brief von dem Dichter des Don Quixote aus dem Jahre 1578, der beweist, wie wenig man sich um das Wohlergehen, ja das Vorhandensein eines einzelnen Menschen bekümmerte, der noch dazu der größte Genius werden sollte, den Spanien der Welt zu vergeben hat. Der Brief des Cervantes ist aus Algier datiert, wo der Dichter damals als Gefangener des Deys Hassan Aga lebte, sofern man das Dasein eines Wurmes „Leben“ [S. 175]nennt, und ist an seinen Bruder Rodrigo gerichtet. Dieser Rodrigo war mitsamt seinen Bruder auf der Fahrt von Sizilien nach Spanien von algerischen Piraten gefangengenommen worden, war aber durch ein Lösegeld, das die gute Mutter Cervantes’ zusammengebettelt hatte, aus der Sklaverei losgekauft und befand sich nun, Zigaretten rauchend und nichtstuend, wieder am Manzanares. Der Brief des Cervantes an diesen glücklichen Bruder lautet nun folgendermaßen:
„Ach, mein teurer Rodrigo, mir ist es eselsschlecht ergangen, seitdem Du dieses Gestade verlassen hast. Mit einem ‚Ach!‘ beginne ich wie diesen Brief so alle meine Tage. Denke Dir, ich habe einen noch greulicheren Herrn gefunden, als der erste war. ‚Der lügt wieder einmal!‘ wirst Du Dir denken, ‚denn das ist schlechterdings nicht möglich.‘ Aber ich schwöre Dir bei meiner linken Hand, die ich, wie Du und die Welt weiß, in der glorreichen Schlacht bei Lepanto wider die Türken verlor, und die nun im Himmel droben auf mich wartet, daß dem wahrlich so ist. War schon mein erster Tyrann grausamer als Pontius Pilatus, so war er ein kupierter Hammel gegen den jetzigen. Dieser, der kein anderer als der Dey von Algier selber ist, ist so tückisch, daß der Teufel selbst nicht mit ihm zu Mittag speisen würde. Sein Haus ist mit Ohren und Nasen tapeziert, die er den Gefangenen bei den geringfügigsten Anlässen abschneiden läßt, und man sagt, er könne abends nicht einschlafen, ehe er nicht mindestens zwei Christen sich zu Tode heulen gehört hätte.
[S. 176]
Jüngst hatte er mich zu zweitausend Stockschlägen verurteilt. Aber beim zweiten Schlag mußten sie aufhören, denn beim dritten wäre ich gestorben vor Wut, daß sie einen Hidalgo zu schlagen wagen. Sie schonen mich aber, weil sie hoffen, noch mehr Lösegeld als Ohrenschmaus aus mir herauszuschlagen.
Du kannst Dir ausmalen, was ich unter einer solchen Bestie durchzumachen habe. Tagsüber mag es noch hingehen, denn man muß arbeiten, bis man nichts mehr denkt und fühlt, es sei selbst, daß einem eine Kanone über die Hühneraugen führe. Auch denke ich, wenn ich neben den anderen Sklaven auf der Galeere mit Ketten angeschmiedet dasitze, wohl an Kolumbus, der auch Ketten tragen mußte, und es vielleicht noch schlimmer hatte als ich, und der nun doch in der Seligkeit sitzt und lacht. Aber des Nachts weiß ich mir oft nicht zu raten und zu helfen vor Qualen und Schmerzen. In ein graues Wollentuch gewickelt, werde ich nicht anders denn wie in mein Grab nebst zween anderen in eine leere Zisterne hineingelassen. Die Heiden decken ein Brett und ein paar Steine darüber, daß wir nicht entwischen, und nun hocken wir drei uns schlafen, nachdem wir vorher zur Madonna gebetet haben. Die Finsternis und der üble Geruch möchten noch angehen, wiewohl die Hölle, wo sie am tiefsten ist, nicht schlimmer duften kann, als der Rauchfang, in dem man uns verfaulen läßt. Das Greulichste aber von allem ist das Ungeziefer, das wir armen Schächer mit unserm letzten bißchen Blut ernähren müssen. Du erinnerst Dich dieser Menschenfresser sicherlich [S. 177]noch aus Deinen türkischen Tagen, Bruderherz. Aber sie treiben es itzo toller als jemals. Morgens, wenn ich mich aus meinem grauen Leichentuch herausschäle, glaube ich stets wieder die Schlacht von Lepanto, in der ich wie Du und die Welt weiß, die linke Hand verlor, mitgemacht zu haben, so voll Blut ist alles.
Kurzum, ich glaube, daß ich, dies alles zusammengerechnet, nicht mehr lange zu leben haben werde. Halb sterbe ich vor Elend und halb vor Mitleid, denn der Jammer um mich herum sticht mich oft mehr als alle Flöhe zusammen. Vollends seit dem letzten Fluchtversuch, der uns durch den Verrat eines Judas mißlang — der Teufel möge ihm darum dermaleinst jeden Tag den Leib aufsägen und heißes Blei hineintröpfeln! — sind alle Christen hier verzweifelt, und jeden Abend muß ich wie ein Proviantmeister meinen Mut unter uns austeilen, bis ich schließlich selbst keinen mehr habe.
Darum bei den Schutzheiligen unserer Familie beschwöre ich Euch, Rodrigo, ruhet nicht eher, Ihr hättet mich denn aus dieser Mausefalle befreit, darin man nur die Schalen vor allem zu essen bekommt, dieweil der Satan seine Heiden uns vor Augen die Früchte selbst schnabulieren läßt. Ich habe kaum fünf Zähne mehr im Munde, und diese fünf stehen alle so verzwickt voneinander, daß ich meine ganze Mathematik zusammennehmen muß, um eine Rinde altes Brot kleinzukriegen.
Male also der Mutter mein Los in rabenschwarzen Farben und sage ihr, wenn sie keine Rabenmutter sein wolle, [S. 178]so möge sie das Lösegeld für mich zusammenbringen, ganz einerlei wie. Sie soll irgendeinem Adligen bei Hofe weismachen, daß seine Mutter eine Nichte des Onkels vom Schwager meines Vaters war, oder daß, wie dies wahr ist, das Blut des Geschlechts der Habsburger, aus dem der König — Gott segne ihn! — selbst entstammt, in uns fließt, und daß es unrecht sei, daß ein Nachfahre solchen erlauchten Hauses mit diesem Blute die algerischen Flöhe füttern müsse.
Wahrlich, ich sage Dir, mir ist oft zumute, als sei ich zu Besserem geboren, als hier mich verschimmeln zu sehen, und ich verspüre bisweilen einen unendlichen Hunger danach, meinen Namen durch die Gassen von Madrid schreien zu hören. Wenn ich wieder frei bin — ich weine, da ich dieses schreibe —, und erst die Vögel spanisch singen höre, will ich lachen, wie noch niemals einer gelacht hat, denn ich weiß, daß es kein Mensch und kein Tier auf der ganzen Welt schlechter haben kann, als ich es gehabt habe.“
Als der Mann, der diesen verzweifelten Brief geschrieben haben würde, wenn er Schreibpapier gehabt hätte, heimgekehrt und fünfundfünfzig Jahre alt geworden war, schrieb er mit seiner einen Hand und seinem ganzen Herzen das Leben und die Taten des edlen Don Quixote auf und wurde damit berühmter als alle Spanier, die vor ihm und nach ihm gelebt haben. Dieser Don Quixote, der nirgends als in dem Kopf des Cervantes gehaust hat, ist der große Witz, den eine neue Zeit auf das Mittelalter gemacht hat.
[S. 179]
In diesem Roman wird die ganze alte Empfindungswelt mit ihren Troubadourliedern, Schäferromanen und ihrem Rüstungsgeklapper von der Natürlichkeit zu Tode gekitzelt. Darum sollte man im Geiste stets Cervantes’ Bild neben das des Kolumbus hängen, weil er, wie jener, die alte Welt verlassend, eine neue Welt entdeckte. Denn er war der erste Dichter, der sich über das Heldentum und die Liebe, dieses Grundeigentum aller Poeten, lustig machte und sitzt als Primus auf der Bank der Spötter, auf der wir heute Shaw und Wedekind gefeiert sehen. Er hatte in seiner göttlichen Naivität keine Ahnung von seiner übermenschlichen Bedeutung, und sah, als er sein Werk vollendet hatte, zu seinem Erstaunen, wieviel sich hineindenken ließ, und wie über seinen Helden nicht nur gelacht, sondern mehr noch geweint werden konnte. Wir aber wollen seine Bilder nicht durch Begriffe verwischen, sondern sie ansehen und anhören, wie große Visionen eines, der mit einem heiteren und einem nassen Auge eine tote Zeit zu Grabe trägt.
Bei dem Don Quixote des Cervantes kam noch hinzu, was der Dichter freilich nicht ahnen konnte, daß er damit ein Selbstbildnis der spanischen Nation aufzeichnete, wie es kein Volk der Erde sonst besitzt. Denn der Anfang eines neuen Spaniens, den man mit der Entdeckung Amerikas gemacht wähnte, war nur der Beginn eines traurigen Abc, das heute schon bis W hinunterbuchstabiert ist. So teilte sich die Abendröte eines sterbenden Landes auch diesem Romane seines komischen Helden mit, und [S. 180]als wir weiland Spanien mit großen Worten und lecken Schiffen in den unglücklichen Kampf um Kuba aussegeln sahen, glaubten wir nicht anders, als daß wir noch einmal den Auszug des unseligen Don Quixote erlebt hätten.
[S. 181]
Es kann an einem schönen Sommertag des Jahres 1612 gewesen sein, als der Komet Shakespeare, ein Mann von siebenundvierzig Jahren, in seine Heimatstadt, nach Stratford zurückkehrte. Er war fast fünfundzwanzig Jahre lang in der Fremde gewesen, in London, wo er als Schauspieler und späterer Theaterleiter ein Vermögen erworben und seinen guten Ruf verloren hatte. Wie der Abdruck seines Gewerbes an der Hand des Färbers, so klebte die Schmach seines verachteten Gewerbes an ihm. Während die fünfundzwanzig Jahre mit Sonnenschein und Regen, mit Donner und Blitz und Ungewitter über seine Seele gezogen waren und in diesem Spiegel Gestalten wie Cäsar, Hamlet und König Lear hineingeschaut hatten, war es in Stratford ganz wie früher geblieben.
Dort floß noch das Flüßchen, in dem er als Knabe gebadet hatte, wie ein silberner Fisch im Morgenlicht dem Meere zu. Da grünten die Wiesen, und Kühe rupften das Gras. Und am Abend, wenn die Nebel steigen, würden wieder die Elfen kommen und tanzen und Oberon und Titania Hochzeit feiern, wie er es einstmals aus jungen träumenden Augen belauscht hatte. Dort war der Abhang, auf dem er immer gelegen hatte, die Chronik in der Hand, aus der ihm Richard III. und Falstaff und Heinrich IV. erschienen waren. Dort blühte die Hecke wieder, hinter der er zuerst geweint hatte, und hinten rauschte der dunkelgrüne Busch, in dem er gewildert und das Gruseln gelernt hatte.
[S. 182]
Ging man ein wenig höher, so kam man auf eine öde Halde, wo ihm einstmals am Abend die Hexen begegnet waren — er sah sie noch ganz deutlich vor sich —, wie sie kichernd und heulend giftige Kräuter sammelten. Dort stand noch das Rathaus, düster und verwittert und stolz auf sein Alter, in dem er zum erstenmal Menschen in bunten Trachten Verse sprechen hörte und bei sich dachte, wieviel herrlicher dies sei, als toten Kälbern das Fell über die Ohren zu ziehen und Handschuhe daraus zu machen, ein Gewerbe, das er damals betreiben mußte.
Drüben lag seines Vaters Haus, das jetzt — man könnte stolz darüber werden! — sein eigenes geworden war. Das Dach war schon oft ausgebessert und geflickt wie ein alter Schuh, und die hintere Seite zeigte Sprünge und Runzeln und Risse. Aber die vordere Seite hatte der alte Shakespeare von dem Gelde seines Sohnes neu herrichten lassen und in kindischer Freude über den Wohlstand des Sohnes mit dem nämlichen Holz, das der Stadtschultheiß an seinem Hause hatte, bekleiden lassen. Das war die letzte Freude des Vaters gewesen, der über die Gelder, die der Sohn ihm von London schickte, fast sein letztes bißchen Verstand verloren hatte. —
Dort stand die Kirche noch, in der man ihn getauft und getraut hatte, oft hatte er beides in den ersten wilden Londoner Jahren vergessen. Die Glocken klangen noch wie früher, nur etwas häufiger und etwas frommer. Denn Stratford war puritanisch und orthodox geworden, und man predigte von den Kanzeln gegen die, die am Sonntag [S. 183]die Leute von den „Versammlungen zu den Heiligen“ zu den „Teufelsversammlungen“ ins Theater lockten. Und wenn jetzt die Schauspieler in den Ferien vor die Tore von Stratford kamen, zogen die puritanischen Ratsherren mit den steifen Mühlsteinhalskrausen hinaus und boten ihnen Geld, daß sie wieder abzögen und ihre Lämmer verschonten.
Wie würden Marlowe und Greene und alle die tollen Gesellen seiner Jugend, die Stürmer und Dränger Altenglands gebrüllt haben, wenn sie dies noch vernommen hätten! Er hörte fast in seinem Ohr die Witze, die sie darüber reißen würden: „Kommt! Laßt uns Stratford belagern! Heutzutage verdient man mehr, wenn man nicht spielt, als früher, wenn man sich heiser schrie.“
Er blickte zum Kirchhof hinüber, wo die Kreuze und weißen Steine stumm über den Toten Wache standen, und mußte ihrer aller, die er gekannt hatte, gedenken. Dort lag auch sein einziger Sohn Hamlet begraben, der als Knabe, elf Jahre alt, gestorben war. Die Zypresse auf seinem Grabe — so groß würde er jetzt sein! — schaute eben über die niedrige Kirchhofsmauer herüber ihn traurig an.
[S. 184]
Auf den Straßen aber spielten die Kinder seiner Schulfreunde mit dem Ball, und keiner kannte ihn, und keinen kannte er. Und er wußte nur, wenn er jetzt die Straße entlang weiterginge bis zu seinem kleinen Hause und den Riegel aufdrückte und gebückt in die niedrige Stube hineinträte, daß dort eine alte Frau, seine eigene Frau, strickend oder spinnend am Herde säße. Sie würde ihn sonder viel Freude begrüßen, als sei er fünf Stunden und nicht fünfundzwanzig Jahre fort gewesen, und dann würde sie darüber keifen und schelten, daß des Nachbars Katze an der Milch gewesen und — alles in einem Atem! — daß ihrer beider Tochter Judith nun fast dreißig Jahre alt sei und noch immer keinen Mann erwischt hätte.
Er mußte lächeln, wenn er daran dachte und auch daran, daß man ihm heute abend eine Bibel an das Bett legen würde, und daß ihm am andern Morgen früh nicht wie sonst irgendein Kamerad an die Tür trommeln könnte mit den Worten: „He, William, fauler Hund! Sollen wir heute ohne dich probieren?“, sondern daß vermutlich ein alter dicker Bürger zu ihm kommen würde, um mit ihm zu beraten, ob nicht sein Sohn Thomas und Shakespeares besagte Tochter Judith ein ehrbares Paar ausmachen könnten, wenn er dem Mädchen eine schöne Aussteuer geben wollte.
Er hatte nicht mehr viel Zeit zum Leben übrig, das wußte er. Nur so viel, um sein Vermögen zu ordnen, sich ein Grab zu kaufen und eine Inschrift dafür zu dichten. Er war sterbensmüde und hatte mit den Menschen, unter [S. 185]denen er herumging, nur den Klang der Sprache noch gemeinsam. Wie ein Riese unter dem Zwergenvolk, oder ein alter Adler, der nicht mehr fliegen will, unter Sperlingen, würde er nun abends in der Schenke unter Stratfords Bürgern sitzen und zuhören, wie teuer in diesem Jahr das Korn sein würde, und wieviel Eier die Hühner am Tage gelegt hätten.
Hinter ihm lag eine Welt voll Bildern, wie sie niemand vor ihm noch nach ihm gesehen hat. Eine Fülle von gesteigerten Gestalten hatte von ihm den Prometheusfunken des Lebens empfangen, und wenn er die Augen schloß, schwirrte und toste die Luft um ihn her von Wesen, die von ihm Blut getrunken hatten. Es schwindelte ihn, und er mußte sich an das Geländer der Brücke lehnen, die über den lieblichen, vielgewundenen Avon führte.
Und es war ihm, als rauschte unter ihm sein ganzes buntes Leben, das arme Leben eines Schauspielers und das reiche eines Dichters, mit seinen vielen Schmerzen und seinen wenigen Freuden vorüber. Und dann war ihm, als zöge er selber nun das goldene Tor der Träume und Märchen hinter sich zu und schritt langsam durch die Welt der Kleinheit dem Grabe zu, in jenes unentdeckte Land, von des Bezirk kein Wanderer wiederkehrt. Und er sprach noch einmal die Abschiedsworte Prosperos aus dem „Sturm“, sein eigenes Lebewohl an die Bühne und an die Kunst, vor sich hin:
[S. 187]
Seit fast vier Jahrhunderten spaltet der Name Martin Luther wie ein Axtschlag Deutschland und seine Bewohner in zwei Parteien. Noch heute wird jener Mann in unseren Schulen links den evangelisch getauften Kindern als der Befreier und wackere Gottsucher und Finder gepriesen, und rechts den katholisch getauften als Deutschlands größter Schaden und als Erzketzer und Sendbote des Satans geschildert. Wahr ist und bleibt, daß Luthers Werk unser Land in die grimmigste Not und dem völligen Zusammenbruch nahegebracht und unser Volk vielleicht für immer, wenn wir nicht die Kraft finden, uns aus diesem Zwiespalt emporzureißen, seiner Kultureinheit beraubt hat. Das alte Lied, das man wider Luther seinerzeit auf den Gassen sang, hat sich bis auf unsere Tage wahr erwiesen:
Seine Tat, sein Protestantismus, hat einmal bewirkt, daß der deutsche Katholizismus sich seinerseits zur Wehr [S. 188]setzen mußte und darum bis in unser Jahrhundert hinein einen Fanatismus gezeitigt hat, wie er in keinem anderen Lande der Welt mehr zu finden ist. Der Deutsche, der zum erstenmal heute über und durch den Gotthard reist, ist ganz erstaunt, drüben in Italien kaum eine Zentrumspartei zu finden, und hört voll Erstaunen die Leute dort viel mehr von ihrem König als vom Papste reden. Die unselige Vermischung von Religion und Politik, die unserm Volk im Marke sitzt, kennt der Italiener, der doch unter den Augen des Papstes lebt, nicht mehr. Bei uns spielt die Frage: „Ist er katholisch oder evangelisch?“ leider noch in fast allen Beziehungen eine Hauptrolle, und man hat vergessen, daß der vornehme geistige Deutsche erst da anfängt, wo diese Fragen aufhören. Ich entsinne mich aus der Schule, daß uns Evangelischen in der Religionsstunde oft mit einer überlegenen Ironie gegen die andere Seite gezeigt wurde, daß Deutschlands große Männer und Künstler, wie Goethe, Schiller, Kant, selbst Friedrich der Große, lauter Protestanten gewesen waren, so daß man sich schon ganz stolz im Besitz dieser übrigens in bezug auf ihre evangelische Religion höchst imaginären Größen vorkam. Bis man erst jahrelang nach dem Religionsunterricht erstaunt entdeckte, daß Mozart, Beethoven und Eichendorff es ihrerseits nicht minder zustande gebracht hatten, große Künstler und Katholiken gewesen zu sein. Der Streit zwischen Protestanten und Katholiken über den Wert ihres Glaubens, der in solche Lächerlichkeiten hineingerät, ist bei uns Deutschen zu unserm eigenen größten Schaden durch Luther [S. 189]entfacht worden. Das ist wahr und muß, wenn von ihm die Rede ist, gesagt werden.
Aber es darf nicht vergessen werden, daß Martin Luther selber dies nicht vorhergesehen hat und nicht vorhersehen konnte. Er handelte aus einem göttlichen Impuls heraus zunächst für sich selber, als er die fünfundneunzig Thesen anschlug und gegen den auch von den heutigen Katholiken verurteilten Ablaßhandel in Deutschland Einspruch erhob. Das souveräne Individuum, der freie Christenmensch in ihm, empörte sich und stand auf: Pereat mundus fiat iustitia! „Und wenn die Welt voll Teufel wär’, es soll uns doch gelingen.“ Ich glaube, daß, wenn man ihm an jenem Abend vor Allerheiligen, da er an der Schloßkirche zu Wittenberg seine Thesen annagelte, mit jedem Schlage Roms Herrschaft durchbohrend, die ganzen Greuel des Dreißigjährigen Krieges vor die Seele gebracht hätte, er hätte nicht anders handeln können. Der Dämon eines Genies läßt sich durch keinerlei praktische Erwägungen lahmlegen, und wer alle Folgen bedenkt, der wird nie zu Taten kommen.
Darum dürfen wir Luther heute nicht mehr angreifen und beschimpfen, weil sein Werk unermeßlichen Schaden über Deutschland gebracht hat. Ebensowenig, wie man ihm vorwerfen kann, daß das Ablaßgeld, gegen das er, der Bauernsohn, tobte, in Rom von den Päpsten hauptsächlich für die Kunst verausgabt wurde und damit dem Edelsten, was es auf der Welt gibt, zugute kam. Dieses für Michelangelo und gegen Luther Partei nehmen, wie es [S. 190]Nietzsche getan hat, ist töricht. Denn man konnte vom Doktor Martinus trotz aller seiner Gelehrsamkeit nicht verlangen, daß er die Dinge und das Welttheater schon unter dem Gesichtswinkel von 1900 ansehen sollte. Für ihn war seine Sache die wichtigste und heiligste von der Welt, und sie an ihren teilweise schlimmen Folgen herabsetzen, heißt jedem Genius die Flügel binden.
Übrigens hat Luther später, als er schrittweise angreifend und erobernd gegen Rom vorging, wohl keinen Augenblick daran gezweifelt, daß er binnen kurzem das ganze Deutschland zu seiner evangelischen Freiheit bekehren würde. Das halbe Deutschland war zwanzig Jahre nach den Thesen auf seiner Seite, mußte er drum nicht meinen, daß nach vierzig Jahren auch die andere Hälfte seiner Lehre zugefallen wäre? Darum verdreifacht er oft sein sattsam bekanntes Schreien im Streit, dessen Molltöne uns heute schon Ohrensausen machen, weil er bei sich dachte: „Voran, Doktor Martin! Noch ein weniges, und alle Teutschen, Mannen und Frauen, sind dein!“
Das war seine stärkste Eigenheit, die ihm die Herzen zutrug, der freudige Mut, mit dem er in jeden Kampf auszog, jene dem Tod und Teufel trotzende Tugend des germanischen Blutes, der zuliebe selbst der alte kleine Windhorst später „Bravo!“ gerufen hat, als Bismarck jene Worte sprach: „Wir Deutschen fürchten Gott und sonst nichts auf der Welt.“ Was Kaiser und Könige zittern gemacht hatte und sie bettelnd nach Kanossa trieb, die Bannbulle des Papstes, Luther verbrannte sie mit eigener Hand, wobei [S. 191]er die Worte sprach: „Weil du den Heiligen des Herrn betrübt hast, verzehre dich das ewige Feuer“, und damit sich als ein Mensch dem Menschen Papst als ebenbürtig zur Seite stellte.
Diese innere Tapferkeit verließ ihn ebensowenig, als er, hierüber zur Rechenschaft gerufen, den Weg Hussens nach Worms zog und, von allen seinen wenigen Freunden gewarnt, im starken Gefühl seines Rechts erklärte: „Ich will nach Worms gehen, und wenn auch so viele Teufel dort wären als Ziegel auf den Dächern.“ Und mehr noch als seine weltberühmten Worte vor Karl V., dem mächtigsten deutschen Kaiser, der je da war, beweist der schlichte Vorgang nach dem Konzil seinen Mut, daß er nämlich, wie Augenzeugen erzählen, beim Heraustreten aus der letzten Sitzung die Hände mit gespreizten Fingern hoch emporstreckte, wie die Deutschen beim Lanzenbrechen zum Zeichen des Sieges zu tun pflegten, und dabei fröhlich ausrief: „Ich bin hindurch, ich bin hindurch.“
Um so mehr ist dieser moralische Mut an ihm zu bewundern, weil Luther, den man sich immer nach seinen späteren Jahren mit einem Schmerbauch und gesunden Knochen vorstellt, einen höchst anfälligen Körper hatte und vielleicht der nervöseste unter allen genialen Männern gewesen ist. Dank einer verprügelten steinharten Jugendzeit war er, der die Bannflüche von vier Päpsten aufrecht ertrug, zeitlebens so schreckhaft, daß ihn ein rauschendes Blatt zum Zittern brachte, und so erregbar, daß er taumelte, als er zum erstenmal als Mönchspriester am Altar den [S. 192]Kelch erhob. Hierzu kam bei ihm, eine Folge seiner Nervenschwäche und eines Steinleidens, eine häufige Schwermut und Bitterkeit, mit der vor allen seine wackere Frau manchen harten Strauß zu kämpfen hatte. Diese seine Schwarzseherei, die sich überall den Teufel an die Wand malte, war letzthin so stark, daß er einen Haufen lieber Menschen um sich oder doch die Laute in der Hand haben mußte, um nicht trübsinnig zu werden. Sein Haus, das alte schwarze Kloster in Wittenberg, in dem er einst als Mönch gebetet und gezweifelt, und das ihm nun sein Kurfürst zum ersten evangelischen Pfarrhaus geschenkt hatte, war stets voll von alten Tanten, Hauslehrern, Studenten, Kostgängern, Bittstellern, Bettlern und geistigen Patienten. Und der Doktor konnte am besten schreiben, wenn draußen unter seinem Fenster seine ältesten mit Melanchthons Kindern um den Birnbaum spielten, oder das jüngste seiner sechs im Laufkorb um seine Beine kroch oder an den Akten, Briefen, Bittschriften und Beschwerden herumzupfte, mit denen in seiner Stube alle Tische, Bänke, Stühle, Schemel und Fensternischen bedeckt waren. Und das Schönste, was er je gesagt hat, ist dies: „Es kann mir nichts Schlimmeres in der Welt geschehen, als wenn mein Sohn Hensichen böse auf mich ist.“
Späterhin erst bei dem alternden Luther trat an die Stelle jenes tapferen Drauflosgehens die berüchtigte, von seinen Gegnern ihm immer wieder vorgeworfene Diplomatie oder auf plump Deutsch „Bauernschlauheit“. Aber was ist begreiflicher und gerechtfertigter, als daß ein Mann, den die [S. 193]Hitze der Jugend verlassen hat, und der immer mehr einsehen mußte, daß das Volk eine Herde ist, die dem Leithammel folgt, und daß die Deutschen besonders gerne nachmachen, was die Fürsten ihnen vormachen, sein Werk unter den Schutz der Mächtigen zu stellen sucht! Sein Sach’ war ihm zu heilig und zu ernst, als daß er sie auf die Spitze des Schwertes stellen wollte und ein kläglich Ende, wie Sickingen, oder ein blutiges, wie Johann von Leyden, finden mochte. Freilich, das Liebedienern um die Fürsten, wie es nach ihm oft die evangelische Hofgeistlichkeit trieb, war nicht in Martin Luthers Sinn. Der nannte einen Fehler seines Herrn des Kurfürsten dreist ihm ins Gesicht eine Dummheit. Und man muß seinen Handel mit dem freimütigen Landgrafen Philipp von Hessen, dem er, weil seine erste Frau schwer krank war, eine zweite Ehe gestattete, erst einmal genau durchlesen, ehe man ihn darum doppelzüngig und fuchsschlau nennt. Jeder, der friedlich in seinem Bette stirbt, ist in gewissem Sinn ein Kompromißmacher, aber er liegt drum oft nicht weniger heldenhaft auf seinem Rücken als der, der den Märtyrertod gestorben oder in der Schlacht gefallen ist. So ist Luther, der uns, wenn auch nicht unter eine Religion, so doch unter eine Sprache gebracht hat, so ist Goethe, so Bismarck für Deutschlands Befreiung gestorben.
Ein Heiliger war der Doktor Martin nicht und wollte es nicht sein; einzig auf den Titel „Reformator“ machte er Anspruch und darf er Anspruch machen. Solange man aber in Deutschland seinen Namen nicht, ohne ihn zu verkleinern [S. 194]und zu verfluchen, oder ohne ihn andererseits mit besonderer Feierlichkeit zu betonen, schlicht und einfach wie den eines jeden großen Mannes nennt, solange wird es keine Kultur bei uns geben. Solange wird es keine Lust sein, unter Deutschen zu leben.
[S. 195]
Aus dem Sonnengesang des Heiligen.
[S. 196]
Zwei Laienpriester aus der guten Stadt Prag in Boheim hatten sich Anno 1213 selbander auf die Beine gemacht, um nach Rom zu pilgern und alldort Seiner Heiligkeit, dem gewaltigen Papst Innocenz dem III., die Füße zu küssen und seinen Ablaß und apostolischen Segen zu empfahen. Sie hatten schon viele Wegemeilen hinter sich und dreimal ihre Sohlen schon völlig abgelaufen, als sie an einem lauen Maienabend in der Stadt Terni, noch fünf Tagereisen vor der ewigen Stadt, ankamen. Sie wandten sich an den Podesta des Ortes, wie man in Welschland den „Schulzen“ heißt, und bekamen von ihm eine bescheidene Herberge hinter dem Dome angewiesen. Sie wuschen sich die staubige Landstraße von Spoleto nach Terni von ihren Gesichtern ab, verfluchten ganz heimlich, daß nur der Teufel es hörte, die ewigen Makkaroni, die man ihnen auftischte, tranken „aqua“, bis sie einen Frosch im Magen zu haben glaubten und wandelten dann gemeinsam einträglich nebeneinander auf den Domplatz hinaus, um Gott zu dienen. Vor einem großen schwarzen Kruzifix aus Byzanz in einer finstern Nische am Dom warfen sie sich nieder und beteten wohl über eine Stunde lang zu dem Gott, der sie von dem goldentorigen Prag durch fremde Menschen und Städte hindurch glücklich bis auf dieses Pflaster geleitet hatte, und der ihnen nun bald seinen leibhaftigen Stellvertreter von Angesicht zu Angesicht zeigen würde. Als sie nun schon sehr lange auf den Knien gelegen hatten, begann der ältere von ihnen, der schon mit Friedrich Barbarossa im Heiligen Lande gewesen war, Kreuzschmerzen [S. 197]zu verspüren. Er stund also auf und fing an, ein wenig im Schatten des Domes herumzugehen und den Tauben auf dem Platz zuzusehen, als er auf einmal das größte Wunder erblickte, was er von Prag bis Jerusalem jemals erschauet hatte.
Es war nämlich ein Mann auf einem Eselein angeritten gekommen, der eine braune Kutte gleich den Bettlern trug, die unser Böhme wohl auf den Landstraßen von Perugia gesehen hatte. Sein Gesicht war ganz bleich und abgezehrt, und ein blonder Bart hing wirr daran, ohne nach einem Bader zu fragen. Das Sonderbarste an ihm war aber für den frommen Laienpriester aus Prag, daß er ganz wie er eine Tonsur ins Haupthaar geschnitten hatte, also geistlich war gleich ihm. Ehe er sich noch darüber ausgewundert hatte, fing — o himmlisches Entsetzen! — der braune Mann auf dem Eselein laut und herrlich an zu singen, und nicht etwa das „Kyrie Eleis“, sondern ein weltlich Lied, das die Sonne am Himmel und die Freude auf Erden pries, und dessen Echo der Dom wie ein aufgewachter Riese vielfach weitergab.
Der Böhme wollte sich voll sittlicher Empörung auf den singenden Reiter Gottes stürzen: „Bruder! Was treibest du da?“ als plötzlich wie auf einen Befehl vom Himmel alle Tauben vom Platz und vom Dach des Domes auf den Mann in der Kutte herniederflatterten, ihn liebkosend umflogen oder sich ihm, der sich ihrer nicht wehrte, auf Haupt, Schultern und Arme setzten. Und auf einmal, als hätte man erst diese Huldigung abwarten wollen, [S. 198]fiel alles Volk, das auf dem Platze beisammen war, auf die Knie und rief: „Santo Francesco!“ und drängte sich an den Heiligen heran, um seine Hände oder wenigstens seine Kutte küssen zu können. Der aber ließ sich weder durch die Tauben noch durch die Menschen beirren, die ihn umflogen und umknieten, sondern fuhr fort, laut über den Platz hin mit zitternder Stimme zu singen und zu jubeln, bis ihm die hellen Tränen über die bleichen Wangen liefen.
Unser Böhme, der dieses ungewöhnliche Bild nicht allein kapieren konnte, lief zu seinem Gefährten zurück, der sich noch immer in seiner finsteren Ecke um Gott plagte und zerbetete, und griff ihn an die Schulter: „Steh auf! Komm mit, itzt sollst du den Antichristen sehen!“ und wies ihm das seltsame Schauspiel. Der heilige Franz auf seinem Eselein hatte indessen zu singen aufgehört und sich daran gemacht, die Vögel mit ein paar Krusten Brot zu füttern, die er aus der Kutte zog, und die ihm selbst viel nötiger gewesen wären als den Tauben. Aber nichts auf der Welt kam der Wonne gleich, die ihm aufs Gesicht trat, wenn er schenken durfte oder trösten konnte. Ein paar Krüppel humpelten nun heran und flehten den Heiligen wimmernd an, mit ihnen ins Siechenhaus zu gehen, wo die Aussätzigen und Bresthaften seiner warteten.
„Lebet wohl, meine Brüder und Schwestern“, sprach nun Franziskus zu dem Volk, das ihn auf dem Markte umdrängte. „Gegen Abend will ich wiederkehren und euch vom lieben Gott und von unserm Herrn Jesus predigen.“ [S. 199]Dies sagte er aber nicht anders, wie eine Mutter ihren Kindern verspricht, vor dem Einschlafen ein paar Märchen zu erzählen. „Als ich auszog, Gott zu finden,“ fuhr er fort, „da wollte es mir zuerst nicht gelingen, meine Augen ohne Ekel auf einem Aussätzigen ruhen zu lassen. Nun kann ich sie mit der Hand streicheln, ohne daß es mich graut, und vor allen meinen Brüdern sind sie mir die nächsten geworden, denn sie bedürfen meiner am meisten. Gott hat sie geschaffen gleich uns, darum müssen sie wohl sein.“ Sprach’s und ritt auf dem Eselein, dessen Zügel zu führen Männer und Frauen sich stritten, den Krüppeln nach zum Siechenhaus. Alles Volk aber wälzte sich schweigend hinterher.
Zu den beiden Böhmen, die staunend und sprachlos dem Zug wie einem Wundertier nachschauten, hatte sich unversehens ihr Gastwirt gesellt. „Was! Den kennt ihr nicht,“ hub er an, „den heiligen Franziskum aus der Bergstadt Assisi? Denkt euch, er heißt eigentlich Bernardone, und sein Vater lebt noch dort und ist ein reicher Tuchhändler. Und dieser Franziskus hat einstmals in Saus und Braus gelebt, und wo ein Fest war in Assisi, war Franzesko dabei und saß, ein Narrenzepter in der Hand, obenan. Aber eines Tages hat er dieses verlassen, die Feste, die Frauen und die Freuden, und hat alles, was er nicht schon verschenkt hatte, feierlich seinem Vater zurückgegeben, selbst das Hemd vom Leibe, also daß er nackend war vor allem Volke, und der Bischof ihn in seinen Mantel hüllen mußte. Fünfhunderttausend Lire [S. 200]könnte er jederzeit wiederhaben, wenn er zum Vater heimkehrte, hat mir der Bruder erzählt, der jüngst noch mit Tuchballen nach Rom reiste. Aber er hungert und bettelt lieber und schläft auf den Kirchentreppen. Fünfhunderttausend Lire im Stiche zu lassen, denkt nur! Darum nenne ich ihn stets heimlich einen „pazzo“, einen Narren, wie die andern ihn laut einen Heiligen heißen. Aber im Grunde mögen pazzo und santo gar nicht so verschieden voneinander sein!“
Unsere beiden Böhmen schienen wohl ein Gleiches zu denken, sie betrachteten ihre stillen Bäuche, dachten an ihre kleine, aber hübsche Pfründe daheim an der Moldau und schüttelten verwundert die frommen Köpfe. Das also war der Spielmann Gottes, von dem man schon in deutschen Landen sprach, der die Armut über alle Dinge heilig pries, der einem Bischof, der Stellen in seinem Sprengel verkaufte, den Stab zerbrochen hatte, und der nicht mehr und nicht weniger als der niederste von allen Brüdern sein wollte, die er um sich versammelt hatte, und die gleich ihm ihr Hab und Gut zuvor den Armen geben mußten! Wollte er mit Jubilieren den Himmel auf Erden verdienen, statt mit Fasten und Beten?
Ganz in Verwirrung gebracht, folgten die beiden biedern Böhmen ihrem Gastwirt, der sie am Ärmel zupfte, in die Herberge, wo ein neuangekommener Kanonikus aus Padua emsig vertieft über einer fetten Ente nebst Bratäpfeln und Kastanien saß. „Störet euch an jenen Bettelbruder nicht, meine böhmischen Brüder!“ hub er an, sie zu beruhigen, [S. 201]indem er vier geröstete Maronen mit einem Zug Chianti hinunterspülte. „Essen und Trinken hält Leib und Seele zusammen, und unser Herr Christus am Kreuze sprach noch: ‚Mich dürstet!‘ Fasten ist gut, aber essen ist besser. Kommt! Trinket mit mir auf alle Länder, darinnen Wein wächset!“
Den beiden frommen Priestern aus Prag wurde jedoch nicht behaglich bei diesem Schlemmermahl. Wie ganz anders hatten die Augen des Heiligen vom Weine Gottes geleuchtet, als die roten Äuglein dieses vom irdischen Moste zwinkerten! So machten sie sich denn beide, nachdem sie zum Schein ein paar Gläser mitgetrunken hatten, vom Schenktisch fort und traten auf die Straße zurück. Der Mond war inzwischen aufgegangen und warf Licht und Schatten um den Dom. Als sie nun in ihre kleine Nische gehen wollten, um vor dem Schlafen noch drei kurze Vaterunser zu beten, sahen sie auf einmal des heiligen Franziskus’ Eselein unter dem Kruzifix stehen und ein Bündlein Heu, das vor ihm auf der Straße lag, verspeisen. Erschrocken blieben sie stehen, denn gleich daneben gewahrten sie den Heiligen selbst im Schatten, wie er ein paar Blumen in der Hand hielt, an denen er roch.
Es war aber eine schöne Jungfrau in Terni, die später die Lieblingstochter der heiligen Klara, der Freundin des Franziskus, wurde. Die dauerte es, daß der Heilige auf bloßen Steinen schlafen sollte. Drum hatte sie in den Winkel am Dom, wo jener zu ruhen pflegte, schöne rote Rosen hingestreut, damit er auf ihnen sich bette. Als aber [S. 202]Sankt Franziskus dieses bemerkte, sprach er: „Mit nichten! Das wäre nicht recht getan, ihr Schwestern Rosen, wenn ich auf euch schlummerte und euch zerdrückte. Ruhet drum hier neben mir und welkt, bis der Tau des neuen Morgens euch erweckt!“ Also sprach der Heilige und bettete sich auf die Erde neben das Eselein und neben die Rosen, deren Duft ihn im Traum auf Seraphschwingen in den christlichen Olymp hinauftrug. Und ein paar verflogene Tauben nisteten über Nacht bei ihm in seiner Kutte und wärmten ihn. Die beiden Böhmen aber, die diesem zuhörten und zusahen, schlichen sich leise fort in ihre Herberge, und wie sie sich endlich anschauten, merkten sie, daß sie beide geweint hatten.
So lebte Franziskus, da er auf Erden wandelte, der sich allem und jedem hier verbrüdert und verschwistert fühlte, der alle Menschen lieben konnte, nur die Verleumder und Angeber nicht, der, seinen Sonnengesang anstimmend, den Tod in seiner Zelle erwartete und den die Kirche für heilig erklärt hat, ohne das Ideal, dem er lebte, verwirklichen zu können. Er steht vor allen Heiligen uns Deutschen am nächsten, und darum haben Franz Liszt und spätere Wagnerianer als bewußte Germanen laut auf ihn hingewiesen: „Kniet nieder! Denn hier ist Geist von unserm Geiste!“, weil seine Lehre der Religion unserer Vorfahren vielfach verwandt ist, vor allem in seiner Verehrung für die Frauen und in der unbegrenzten Liebe zur Natur. Sein Leben hat sich um zwei Augenblicke bewegt, den einen, da er seine Habe fortgab, um arm wie Christus [S. 203]zu werden, und den anderen, da er einsah, daß nicht alle Menschen waren wie er, und daß Egoismus die Welt regiert, und er darum in größter Verzweiflung seinen Vorsitz im Orden aufgab, um ein Einsamer zu werden. Vor dieser konsequenten Treue gegen sein Ideal, das Urchristentum, wirkt der Franziskus unserer Zeit, Leo Tolstoi, recht wie ein Quacksalber gegen einen Arzt. Die Heilmittel, die Franz von Assisi den Menschen, die ihn aufnahmen, brachte, waren aber: Armut und Freude, indem er lehrte und nicht anders lebte, in dem Glauben und der Glückseligkeit, für die Lessing die Worte fand: „Der wahre Bettler ist doch einzig und allein der wahre König.“
[S. 204]
„Vor einigen Wochen“, so lautet der Bericht eines ghibellinischen Ritters aus Ravenna zu Dantes Zeit an seinen Bruder in Verona, „ist hier ein höchst seltsamer Mensch angekommen. Sein Name ist Dante Alighieri, und er stammt aus einer vornehmen bürgerlichen Familie zu Florenz. Er soll alldort am Arno hohe Staatsämter innegehabt haben, bis er, der ein Demokrat war, von der Gegenpartei der Guelfen und Schwarzen, ohne irgendeinen anderen Grund als den, daß er nicht zu ihnen gehörte, aus Florenz verbannt wurde. Seit dem Tage irrt er heimatlos und schutzlos in Oberitalien von Stadt zu Stadt wie ein Vogel, dem man sein Nest zerstört hat. Eine Zeitlang hoffte er, daß der Römerzug des weiland deutschen Kaisers Heinrich VII. Anno Domini 1310 ihn in die Heimat zurückführen würde. Aber der plötzliche jähe Tod dieses Fürsten, dem man — ach, in welchen Zeiten leben wir! — in der Hostie Gift gegeben haben soll, hat Dante jede Hoffnung auf die Heimkehr geraubt. Und seitdem siecht er dahin an der bittersten menschlichen Krankheit, an dem Heimweh, dergestalt, daß man ihn oft im Grase liegen findet, seine Augen immer nach der Richtung hingewendet, wo Florenz, die herrliche Stadt, am Horizonte liegt. Und ich glaube, daß er an dieser Wunde verbluten muß. Ich habe mich, wie du siehst, an ihn gemacht; denn er ist ein großer Gelehrter und kennt alle Sterne bei ihrem Namen. Er unterrichtet hier zu Ravenna die Jünglinge, und davon [S. 205]lebt er. Er muß früher ein großes Leben geführt haben, denn man sagt ihm nach, daß er 33000 Mark Schulden in Florenz hinterlassen habe. Er war dort verheiratet und hat mehrere Kinder gehabt. Aber seine Seele hat er schon in seinem neunten Lebensjahre an ein achtjähriges Kind in blutrotem Kleid zu Florenz verschenkt, die er Beatrice, die Beseligende, nannte, und die, kaum erblüht, schon dahinstarb, als sei sie zu schade für diese Zeit. Ihr galten seine ersten Reime und jenes sonderbare Sonett von Amor, der ihm im Traum erschien:
Es ist wirklich so, als ob diese Maid, bei deren Anblick sein neues, inneres Leben begann, sein Herz verzehrt habe. Denn er spricht noch heutigentags immer, sobald er allein ist — und ich beschleiche ihn gern in solchen Augenblicken — mit dieser seiner Beatrice, als sei sie noch am Lichte, und neulich hörte ich, daß er eine ganze Nacht lang am Meere ihren Namen ins Leere gerufen habe. Und wenn man angesichts solcher Begebenheiten daran denkt, wie mehrere florentinische Jünglinge sein erstes Sonett von dem verzehrten Herzen nach dortiger Sitte mit Versen beantworteten und ihm den guten Rat gaben, er solle sich reichlich Hals und Gesicht waschen, so würde er schon wieder gesunden, [S. 206]dann wird es einem klar, daß es auf Erden zweierlei Sorten von Menschen gibt: die einen, die von Brot und Wein, und die anderen, die von Liebe leben. Und unter dieser letzteren Schar steht Dante vor allen andern.
Wie dieser Mann aussieht, fragst du mich? Er ist ganz braun im Gesicht, hat eine Adlernase, glänzende Augen und ein starkes Kinn, wie aus Erz gegossen. Aber er ist sehr klein und geht gebückt, so daß manche von seiner Erscheinung enttäuscht sind, was ihn bitter kränken muß. Sein Blick ist immer traurig, und nur einmal sah ich ihn wehmütig lächeln, als ein paar Frauen ihm nachriefen: ‚Sehet, das ist der Mann, der hinuntergefahren ist in die Hölle.‘ Seine große Traurigkeit rührt aber davon, daß er fast fünfzehn Jahre schon im Exile lebt und als freier Republikaner, der er war, an die Tür der Tyrannen wie ein Bettler pochen muß, und er, der vielleicht der größte Mann Italiens ist, unter einer Schar Banditen und heimatloser Geächteter leben muß. Ich habe mir ein paar Verse von ihm aufgeschrieben, die ich nie lesen kann, ohne daß mir die Lust zu weinen kommt. Er läßt darinnen seinen Ahnherrn ihm die Verbannung folgendermaßen prophezeien:
Und noch eines von diesem eigenartigen Manne bleibt mir zu erwähnen übrig: das ist jenes, daß er überaus empfindlich ist gegen Schmerz und Freude, und die Farbe auf seinem Antlitz, das Rot und Bleich, so schnell wechselt wie der Himmel im April. Als er seine Beatrice das erstemal sah, wurde er ohnmächtig und ward wie tot von dannen getragen. Vor Begeisterung kann er glühen wie ein Schmelzofen, daß man nicht anders denkt, seine Augen brennten ab, und von Wut und Schmerz kann er zittern wie im Fieber. Und dabei ist er doch stärker, als mancher, der alle Tage im Sattel sitzt. Denn der Harnisch, in dem Dante steckt, ist nicht von dieser Welt. Er hat ein großes Gedicht geschrieben in unserer eigenen italienischen Sprache, in dem er, von dem frommen heidnischen Dichter Vergil und dann von Beatrice geleitet, von der Hölle durchs Fegefeuer zum Himmel schreitet, und der Saum seines Kleides umglänzt ihn dabei wie ein Heiligenschein. Von der Schönheit der himmlischen Engelsmusik, die er vernommen hat, kann man nicht mit Menschenzungen reden. Wie von silbernen Zinken und goldenen Pauken und elfenbeinernen Harfen klingt sie aus seinen Versen an unser Ohr. Eher noch kann ich dir von seiner Höllenfahrt erzählen, bei der einem Hören und Sehen vergeht, und man sich angstvoll an sein Stückchen Leben klammert. Lieber will ich nachts auf einer kahlen Planke über einen wilden [S. 208]Wassersturz treiben, als sein ‚Inferno‘ ein zweites Mal wiederlesen! Er hat in diesem Buche seines Liedes gleichsam eine Fackel genommen und unsere ganze morsche Zeit in Brand gesteckt, daß nichts von ihr übrigbleibt als Feuer und schwarzer Dampf und Rauch und Wehgeschrei.
Wahrlich, was für ein Mann muß das sein, der ein solches Jüngstes Gericht über seine Mitwelt zu halten wagt!“
Dies ist ein Abbild Dantes, des größten Dichters des Mittelalters, der ein Gipfel des Katholizismus war, wie er niemals wieder erreicht worden ist, und dem sein Nachkomme in der Kunst, der zweite große Florentiner, Michelangelo, folgende Verse aufs Grab geschrieben hat:
[S. 209]
Der alte schöne Streit, wer größer gewesen sei, Raffael oder Michelangelo, ist unter uns heute von der intellektuellen Mehrheit zugunsten Michelangelos entschieden worden. Wir als pluralis maioritatis genommen, schätzen heute die Eigenart, das Absonderliche und Gewaltige, das Persönliche in der bildenden Kunst höher als die Harmonie, das Maßvolle und Gefügte, das Unpersönliche. Darum liegt uns Raffael der imitateur weniger als Michelangelo der créateur. Einer kultivierteren, geläuterten und geschmackvolleren Zeit wird Raffael, die Summe seines Jahrhunderts, wieder das Ideal sein, was er den ruhe- und bildungsbedürftigen Geistern aller Zeiten immer gewesen ist. Seine Kunst, die sich aus den Werken aller seiner Zeitgenossen und dem Wissen der ganzen Geschichte vor ihm vollgetrunken hat, wird dann wieder als ein Gipfel des guten Geschmacks gewürdigt werden.
Lange galt er der Welt lediglich als Madonnenmaler und sein Leben als das eines Heiligen. Noch die Nazarener in Deutschland verehrten ihn wie einen Seliggesprochenen und bemühten sich, die chronique scandaleuse seines Landsmannes und Biographen, des Vasari, zu widerlegen, daß Raffael infolge wilder Ausschweifungen schon mit siebenunddreißig Jahren gestorben sei. Man braucht sich nicht gleich für eins dieser Extreme, für den Heiligen oder den Wüstling, bei Raffael zu entscheiden und muß doch dem Märchen von dem holden frommen Jüngling, das bei [S. 210]seinem Namen in den meisten Menschen aufsteigt, widersprechen. Zunächst war Raffael, der größte Madonnenmaler, so wenig fromm im strengen christlichen Sinne, wie es Mozart, der größte katholische Kirchenkomponist, gewesen ist. Der Geist der Renaissance, der Jupiter und Gottvater eines war, die Plato mit der gleichen Verehrung wie das Evangelium las, war in Raffael, der sich in einem heidnischen Tempel bestatten ließ, mächtiger als in den meisten seiner Zeitgenossen. Michelangelo betete und quälte sich und rang mit seinen Engeln und seinen Teufeln, und seine Sonette sind voll von Selbstanklagen, Vorwürfen und Gewissensbissen. Raffael tat seine Sünden wie seine Freuden lächelnd und mit Schönheit und trug ihre Folgen ebenso. Den edlen Gedanken, der in der Absolution, der Gnade auf Erden, liegt, faßte seine kindliche Seele ganz. Wenn ihm Leo X. die Hand mit dem Fischerring des Petrus auf den Scheitel gelegt hatte, fühlte er sich gerechtfertigt und frei. Die beruhigende Macht, die in dem „absolvo te“ liegt, eine harmonische Natur wie Raffael wußte sie zu nehmen wie zu geben. Darum hinterließ er keinen einzigen Feind, vermochte er keinem böse zu sein oder zu grollen, selbst seinem einzigen Nebenbuhler Michelangelo nicht, der ihn, wo er nur konnte, angegriffen hat. Darum lautete seine Antwort auf dessen Äußerung, alles, was Raffael in der Kunst leiste, das habe er von ihm gelernt, vornehm und abweisend: er schätze sich glücklich, zu einer Zeit, in der ein Michelangelo lebe, geboren zu sein. Dies ist wie wenn einer mit der bloßen Hand einem [S. 211]andern ins gezückte Schwert greift und ihn so entwaffnet. Aber dies tat er nicht aus dem Geist des Christentums heraus: „Liebe deine Feinde!“. Eine solche Gemütskraft besitzt der Romane durchweg überhaupt nicht, sondern aus der Vornehmheit des Aristokraten, des Adelsmenschen in der Renaissance, des vollendeten Edelmannes, des „Cortegiano“, der Pöbeleien aus dem Wege geht und sie mit Geringschätzung bestraft oder mit einer Höflichkeit forträumt. Vornehmheit ist überhaupt der Grundzug im Wesen wie im Leben Raffaels gewesen.
Während Michelangelo, auch darin plebejisch, von einem schiefen schielenden Diener sich aufwarten ließ und wie ein Einsiedler nichts nach Küche und Keller fragte, umgab den Raffael ein wahrer Hofstaat, hinterließ er einen Palast gleich einem Fürsten. Beider Beispiel zeigt, wie wenig man einem Künstler sein Leben vorschreiben kann und darf. Eine Schar von Schülern weinte an Raffaels Sarg; als Michelangelo starb, war man fast froh, daß der alte Riese endlich von der Erde mußte.
Auch darin war Raffael ganz der vollkommen vornehme Mann der Renaissance, daß er soviel als möglich zu wissen suchte und, so oft er konnte, mit Gelehrten umging. Nach Lionardo war er sicherlich der universalste Geist unter den Künstlern seiner Zeit. Darin widerlegt er völlig die heute wieder oft gepredigte Lehre, daß ein Maler ungebildet sein müsse, daß das Wissen die Naivität vernichte. Dieser Blödsinn, der aus Haß gegen die Akademien und das Akademische entstanden ist, wird durch einen Blick auf [S. 212]Raffael lächerlich gemacht. Naivität ist als ein Stück göttlicher Jugendkraft eine Veranlagung, die einem Künstler mitgegeben ist oder nicht, und die durch nichts, auch nicht durch alle Gelehrsamkeit der Welt in ihm verändert werden kann, eine Macht, die in einem Künstler, der sie hat, von seiner Knabenzeit bis zu seinem höchsten Greisenalter wirksam ist. Darum hätte der Raffael mit achtzig Jahren im Grunde nichts anderes gemalt wie zur Zeit seines ersten großen Bildes, des „Sposalizio“, und der Vorwurf der Kritiker, den sie gegen einen Künstler erheben: „er bleibt sich selbst immer gleich“, ist stets einer der größten Beweise für ihre Dummheit und das Können des Künstlers gewesen. Die Wissenschaft hat somit das naive Genie eines Raffael nicht verderben können, der in der griechischen Philosophie wie einst als Kind in der „dem Himmel nahen“ Bergstadt Urbino zu Hause war und die Wissenschaft der göttlichen Dinge mit gleichem Ernst und Fleiß wie die Erkenntnis der Ursachen sich zu erringen suchte. Daß er neben dieser Gelehrsamkeit, die ihn zum Architekten an der Peterskirche und zum Archäologen bei der Ausgrabung des antiken Roms befähigte, einen Takt und eine Herzensbildung besaß, die gleichen Schritt mit seinem besten Geschmack hielt, beweist das Zeugnis aller seiner Zeitgenossen. Freilich muß man sich daran gewöhnen, so wie man ihn nicht „fromm“ im kirchlichen Sinne nennen darf, ihm die Eigenschaft der „holden Kindlichkeit“, mit der man früh verstorbene Künstler gerne schmückt, nicht zu verleihen. Er war, wenn auch kein Wüstling, doch einer der sinnlichsten Männer [S. 213]der heißblütigen Renaissance. Als er die Villa Farnesina mit jenen herrlichen göttlichen nackten Gestalten ausmalte, die in einem Deckenfries die Geschichte von Amor und Psyche in heidnischer Heiterkeit vor uns vorüberführen, mußten seine Freunde eine Frau, von der er nicht getrennt sein wollte, zu ihm auf die Gerüste bringen, so daß er durch sie selbst nun bei der Arbeit festgehalten wurde. Es ist einer der für uns Menschen erhabensten Gedanken, daß das Antlitz der Madonna und Himmelsmutter, wie sie Raffael gemalt hat und wie sie von Millionen Menschen im Bilde verehrt wird, die Züge — seiner Geliebten wiedergibt. Nicht so, wie sie „wirklich“ war, beim Herde oder beim Schmause, zufällig, einen Augenblick lang, sondern wie er sie sah, auch wenn sie nicht da war oder wenn er mit geschlossenen Augen von ihr träumte. Dies Bild eines Bildes malte er dann, oder wie er sich selbst in einem Brief an einen Freund ausdrückt: „Ich bediene mich beim Arbeiten einer gewissen Idee, die mir vorschwebt.“ Damit ist er der Hort aller idealistischen, gegen die Kunst als täuschende Nachahmung äußerer Erscheinung gestimmten Meister geworden und muß folgemäßig einer dem Naturalismus zugeneigteren Kunstperiode fremder erscheinen. Aber in den Zeiten idealistisch gesinnter Künstler ist Raffael das herrlichste Exempel für ihre Kunsttheorien. So war er es in den Tagen Winckelmanns und Goethes wie zur Zeit der religiös-romanischen Maler, der Nazarener und neuerdings wieder unter dem Einfluß von Burckhardt und Hermann Grimm. Namentlich die Nazarener, diese leidenschaftliche [S. 214]Sekte der deutschen christlichen Kunst, waren glühende Raffaelverehrer. „Wie könnte jemals“, sprach Friedrich Overbeck, ihr Anführer in Rom, „eine Zeit kommen, wo dieser Meister der Farben und der Komposition nicht mit göttlichen Ehren bedacht würde? Wo nicht das Herz eines jeden Malers erzittert vor der himmlischen Harmonie und Würde und Ruhe dieses Meisters, dessen Bilder, wenn man sie lange betrachtet, in Wahrheit zu singen scheinen, als seien den Farben bei ihm Stimmen gegeben. Stets, solange Menschen malen, wird man ihn als den größten aller Künstler und den Lehrmeister eines jeden feiern, der nach ihm noch den Pinsel in die Hand zu nehmen wagt.“
Als Overbeck diese Worte, seiner Ideale voll, in Rom hervorstieß, wußte er nicht, daß bereits in Paris die moderne Malerei begonnen hatte, daß dort schon neue Menschen lebten, die, wie Manet, vor einem Bilde von Raffael buchstäblich seekrank wurden. Er machte sich nicht klar, daß die Wertschätzung auch dieses seines Abgottes wie die eines jeden großen Künstlers von Zeitströmungen abhängig ist, die man so wenig wie das Wetter machen kann. Er konnte nicht glauben, daß alles, auch das größte Geistige einmal vergehen muß, und hatte doch ein Ereignis miterlebt, das ihn wie nichts andres dazu hätte bewegen müssen. Es war die Öffnung des Sarges von Raffael im Jahre 1833, die er in einem Briefe an seinen Freund Veit wie die Aufdeckung eines heiligen Grabes beschreibt. Es war am Kreuzerhöhungstage genau um Mittag, als man den Sarg öffnete. [S. 215]„Welch ein Schauer uns anwandelte,“ schreibt Overbeck, „als zuerst die Überreste des teuern Meisters aufgedeckt dalagen, das wirst du aus dem, was unfehlbar in dir selber vorgeht, wenn du dies hörst, besser abnehmen können, als ich es dir zu sagen vermöchte!“ Das Skelett und vor allem der Schädel waren noch gut erhalten. Die rechte Hand Raffaels, die jene edlen Werke geschaffen hatte, wurde zur Erinnerung in Gips abgeformt. Aber siehe da, nach dem Abguß zerfiel sie vor den Augen der entsetzten Zuschauer wie Staub, ein erschütternder Beweis für die Vergänglichkeit alles Irdischen, das nie wieder kommt.
[S. 216]
Nicht des Künstlers Michelangelo soll hier gedacht werden, des Malers, der die Decke der Sixtinischen Kapelle mit seinen Gedanken erfüllte, die so groß sind, daß wir Menschen von heute uns darunter fürchten und frieren, des Bildhauers, der aus einem riesigen Marmorblock, den seine Zeitgenossen zerteilen wollten, in wenigen Wochen die Kolossalstatue des David herausschlug, der den zürnenden Moses schuf und die trauernde Mutter Gottes, die stumm vor Schmerz den toten Sohn in ihrem Schoße hält, und der die Bilder der Nacht und der Morgenröte aus ihrem steinernen Schlummer erweckte, auch nicht des Baumeisters, der die letzten welken Jahre seines neunzigjährigen Lebens der Baukunst und der Gelehrsamkeit weihte und die Kuppel zur Peterskirche in Rom wölbte, die der Wanderer stundenweit über die ganze Campagna leuchten sieht. Nein, wir wollen uns hier den unglücklichen einsamen Menschen vergegenwärtigen, der hinter diesen Werken gestanden, gelebt und gelitten hat, den Sterblichen, der den Strom des Göttlichen durch sich rauschen hörte und mit seinen Händen den rohen Stoff, Marmor oder Farbe, zu etwas Geistigem machte, der über sich selber hinausschuf und so zugrunde ging. Und diesen, den Menschen Michelangelo, muß man in seinen Gedichten suchen. Denn in ihnen hat er sich gegeben und verraten, wie er war, er, der seine eigene Seele sonst nur im Stein sich ausweinen oder im Bilde aufschreien lassen konnte. Einsam wie Beethoven, ungesellig wie Timon [S. 217]von Athen, flüchtete er sich, wenn ihn die Wüste des Alleinseins verschlingen wollte, in Verse hinein, sprach und reimte er sich wie Friedrich der Große etwas vor, um nicht an der Überfülle des eigenen Herzens ersticken zu müssen. Während Lionardo da Vinci wie ein Grandseigneur von Hof zu Hof zog, Raffael alle Welt durch seine Liebenswürdigkeit entzückte und Tizian mit Kaisern zu Tische saß und von Venedigs Frauen bis an sein Ende umschwärmt wurde, hauste Michelangelo wie ein Zyklop, wie Polyphem in seiner Höhle, tagelang nur von einem alten Weib oder einem Tölpel von Bedienten, der ihm das Bett machte, aufwusch und kochte, umgeben. Wie Beethoven seine Taubheit, so machte ihn seine Häßlichkeit menschenscheu: Als Jüngling hatte ihm, als er im Atelier von Ghirlandajo in Florenz studierte, ein Mitschüler, den er durch irgendein hartes Urteil verletzt hatte, mit einem Stück Marmor die Nase zerschmettert. Das brachte einen Zug sklavenhafter, „malaiischer“ Häßlichkeit in sein Gesicht und trieb ihn immer wie einen Geächteten aus dem Kreise der Menschen, die einen geselligen Tauschhandel trieben, fort.
Ob es ihn frauenfeindlich gemacht hat, wie man oft behaupten hört, man glaubt es nicht, wenn man in seinen Sonetten liest. Ein Mensch, der die Nacht in ihrer herrlichen Nacktheit geformt hat, kann nicht blind für Frauen gewesen sein. Eins seiner Sonette, das die Gewandung einer Frau beschreibt, beginnt:
und schließt mit den männlichen Versen:
Eine Frau hat jedenfalls seinem Leben, als es schon zur Neige ging, noch einen eigentümlichen Glanz verliehen, das war die Gräfin Vittoria Colonna, eine Frau aus einem der adeligsten Geschlechter Roms. Das Freundschaftsverhältnis, das ihn mit dieser klugen Frau verband, die selbst Dichterin war, und deren Naturell aufs engste mit Kunst verwandt gewesen sein muß, war für die damalige Zeit etwas äußerst Seltenes. Wie in allem war auch hier Michelangelo wieder ganz anders als seine leichtlebigen Zeitgenossen. Seine meisten und seine schönsten Sonette hat er ihr gewidmet, wie jenes wundervolle Liebeslied, das er ihr mit einem weißen Blatt übersandte:
Mit welch schöner überirdischen Liebe muß er an dieser seltenen Frau gehangen haben, daß er die Beantwortung dieser Frage von ihr erbat. Sie war die einzige, mit der er sprechen und, was noch viel mehr bedeutet, mit der er schweigen konnte. Er, der sonst nie begriff, wie ein Künstler, der mitten in seinen Arbeiten stecke, Zeit und Gedanken hernehmen könne, um den Leuten die Langeweile zu vertreiben, wurde Auge in Auge mit ihr zum Plauderer, der über seine Kunst und seine Natur sprechen konnte. Ordentlich galant, maßlos galant wie ein Bär oder ein Riese wurde er vor ihr. Er hatte ihr einmal einige Bilder geschenkt, für die sie ihm mit ein paar Gedichten dankte, worauf er ihr gleich ein Sonett zurücksandte, das mit den Worten schließt:
„Turpissime pitture“, „ganz jämmerliche Malereien“, heißt es im Original. Denn auch dies war eine Charaktereigenschaft [S. 220]bei ihm, daß er niemals mit dem, was er geschaffen hatte, zufrieden war, daß er sich nie genug tat und immer hinter dem, was er wollte, mit seinem Vollenden zurückblieb. Und doch muß — er hätte sonst das Leben nicht ertragen können! — muß er, wie Shakespeare, der Schöpfer des „Lear“, goldene Momente in seinem Leben gehabt haben, wo er fühlte, daß etwas Übermenschliches ihn durchrieselte, wo er das Rauschen von Flügeln, wie Heine es beschreibt, über seinem Haupt gehört hat und wußte, daß sein Name noch nach Jahrhunderten über Italien erklingen würde.
In seinen Gedichten freilich findet sich keine Zeile, die von diesem Glücks- und Größegefühl spricht. Außer Gelegenheitsgedichten, Sonetten oder Madrigalen, die er zum Dank für geschenkte Früchte, für Käse oder Wein seinen Freunden verehrte, ist es immer nur das dunkle Echo seiner Leiden und seiner Sünden, das er in seinen Liedern wachruft. Stets quälte er sich selbst oder litt als echter frommer Katholik an schlechtem und schwachem Gewissen.
sang er von sich oder:
„Seinen eigenen Feind“ hat er sich einmal in einer Strophe genannt.
[S. 221]
Auch an der Zeit, in die sein Leben gestellt war, hat er schwer getragen. Im Mannesalter war es vor allem der Verlust der republikanischen Freiheit für seine Vaterstadt Florenz, an der er zärtlich wie an seiner Familie hing, der ihm ins Herz schnitt und ihn vom Arno fort nach Rom ins Exil trieb, bis er als Leiche im verhüllten Sarg in einer Frühlingsnacht wieder heimkehrte. Er hatte selbst die Befestigungsarbeiten geleitet, als Florenz belagert wurde, war aber dann im Augenblick der Entscheidung, von einer plötzlichen Furcht und Ahnung befallen, geflohen — wieder ein Zeichen für den Widerstreit des Willens, der diesen gequälten Geist hin und her trieb. Später erst, als er die „Nacht“ in Florenz in der Gruftkirche der Mediceer schuf, senkte er seinen ganzen Schmerz über die verlorene Freiheit in diesen Marmor hinein, den er selbst dies Klaglied singen läßt:
Es ist keinem, auch Hermann Grimm nicht, seinem besten Biographen unter uns, gelungen, die Wucht und Trauer dieser Verse in deutsche Reime zu fassen. Später, als er alt geworden, litt er vor allem unter der kunstfeindlichen Strömung am päpstlichen Hofe in Rom. Eingeschüchtert durch die Fortschritte der Reformation in Deutschland, begann man die Kirche immer mehr zu entweltlichen, und Michelangelo mußte es erleben, daß Papst Paul IV. die [S. 222]nackten Figuren, die er im Jüngsten Gericht an die Wand der Sixtina hingemalt hatte, von Stümperhänden mit Kleidern bemalen ließ.
Neunzig Jahre war Michelangelo alt, als er starb. Ein Freund aus Florenz fand den alten Mann, den „Greisen, der fast am andern Ufer angekommen“, kurz vor seinem Tode im strömenden Regen allein auf der Straße. Wie ein Gespenst lief er, der nicht mehr arbeiten konnte, unter den Menschen umher. „Nun muß ich sterben,“ sagte er herzergreifend, „da ich eben anfange, die ersten Laute in meiner Kunst stammeln zu können!“ Drei Tage darauf fand er die Ruhe, nach der er sich so lange gesehnt hatte. In der Kirche Santa Croce in Florenz wurde er bestattet, unweit des Friedhofes, dessen Tote er einstmals in dem herrlichen „Lied von der Vergänglichkeit“, das in Hugo Wolfs Seele zu Musik geworden ist, so besungen hat:
[S. 224]
Dieses ist der Bericht, den der Augustinermönch und Professor der Theologie Martino da Signa zu Florenz über das Leben und Schreiben des hochberühmten Giovanni Boccaccio seinem Bruder in Christo dem Kartäusermönch Ciani zu Siena übersandt hat:
„Du verlangst von mir, mein viellieber Bruder im Herrn, daß ich dir und der Nachwelt eine Beschreibung von dem weltlichen Dasein unsers für und für verehrten Meisters Boccaccio geben soll, ähnlich derjenigen, die er selber von dem größten Sohne unserer Stadt Fiorenza, dem göttlichen Dante, aufgezeichnet hat, an der sich die kommenden saecula nicht minder als wir erfreuen werden. Denn, so schreibst du mit Recht, die Züge eines großen Mannes im Bilde zu erhalten, ist selber etwas Großes, und solche Beschäftigung ist ein adliges Tun. Aber wie vermöchte ich die Feder so leicht und gewandt zu führen, das Wesen dieses Dichters zu schildern, der zart wie eine Mücke über unsere Zeit hinflog und ihr das Blut aussaugte, um es kommenden Geschlechtern zuzubringen. Niemals würde es mir gelingen, ein würdiges Abbild seines Lebens, wie es heute vor uns liegt, aufzuzeichnen, wie solches jenen Heiden vor Christo, einem Plutarch oder Polybius wohl geglückt ist, die weniger fromm, aber auch weniger einfältig als wir gewesen sind, und die unser Meister Boccaccio darum so über alles geschätzt hat. Versuche darum nicht, mich zu einem Werk, das ich nicht leisten könnte, anzustacheln, auf daß ich nicht vor [S. 225]den späteren Zeiten dastehe wie Petrus, da er über den See von Genezareth gehen wollte, darinnen er beinahe versoffen wäre. Sondern vernimm aus diesem Schreiben nur das Wenige und Einfältigliche, das ich für deine Ohren allein von dem irdischen Dasein des Messer Boccaccio zu sagen weiß, vielleicht, daß du selber aus diesem Hanf, den ich dir reiche, Seide spinnen und eine wirkliche wahre Lebensbeschreibung des großen Mannes entwerfen könntest.
Geboren ward unser Meister im Jahre des Heils 1313, zu einer Zeit also, da der König der Deutschen, Heinrich der VII., zum letztenmal versuchte, unser von den schwäbischen Kaisern, den Hohenstaufen, verwüstetes schönes Land unter Germanien zu bringen, und da der Herr der Christenheit, der selige Papst Clemens V., die Residenz St. Peters nach Avignon verlegte und damit die babylonische Gefangenschaft der Kirche begann. Wie sich um die Ehre, einen Homer der Welt geschenkt zu haben, sieben Städte in Griechenland wie Kinder um eine Brezel gezankt haben sollen, wissen bei Boccaccio die drei Städte Paris, Florenz und Certaldo im Gebiet von Siena nicht genau, in welcher von ihnen der Meister zuerst seine Augen aufgeschlagen hat. Ich weiß es auch nicht und hinterlasse die Entscheidung darüber als ein rechtes Fressen den gelehrten Männern, die nach mir kommen und die die Kirchenbücher und Archive danach durchstöbern mögen, bis sie geschliffene Gläser vor den Augen tragen müssen. Tatsache ist, daß er einmal irgendwo geboren worden ist, und daß er darum eine Mutter gehabt haben muß, wenngleich keiner sie kennt und er [S. 226]selbst sie nicht mehr kannte. Ob sie, mag sie nun eine hübsche Pariserin oder eine kluge Florentinerin gewesen sein, von Lorbeeren geträumt hat, da sie mit ihm schwanger ging, gleich der Mutter Dantes, das vermöchte nur ihr Beichtvater zu sagen. Und der ist lange tot wie sie. Einige Feinde unseres Meisters, sonderlich die, die sich ihr Gewissen an den anzüglichen Stellen in seinen Schriften wund und blau stoßen, meinen zwar, seine Mutter habe geträumt, sie läge unter einem Eichenbaum auf einer grünen Wiese neben einer klaren Quelle und habe dort einen Sohn geboren. Der habe sich eine Weile von den Eicheln genährt, die vom Baume herniederfielen, und sich plötzlich, so schien es ihr, in ein Schwein verwandelt. Das Tier sei dann grunzend in den Quell gestiegen und habe mit seinem Rüssel die Erde aufgewühlt, also daß ein Morast aus der Quelle geworden sei, der die ganze Wiese überschwemmt hätte. Alles dies deuten sie sinngemäß auf Boccaccio, einzig aus Wut darüber, daß er einen sittenlosen Mönch einen Schelmen heißt und eine nichtsnutzige Frauensperson ein Nickel. Wie es aber in Wahrheit um seine Frömmigkeit bestellt war, das weißt du, Bruder, der du ihm oft die Beichte abgenommen hast, besser als alle die, die Dreck am Stecken haben und damit nach ihm schlagen, nun er sich nicht mehr wehren und ihnen eine Nase drehen kann, über die noch in sechshundert Jahren die Menschen lachen würden.
Mit seinem Vater muß unser junger Boccaccio nicht gut gestanden haben, denn wo er seiner erwähnt, da geschieht [S. 227]es mit den Worten wie ‚ein fühlloser trübsinniger Greis‘ oder ‚ein roher, stets nur auf Gewinn bedachter Geizhals‘. Ausdrücke, über die man als unehrwürdige und unkindliche wahrlich mit ihm gram sein müsse, wenn anders man nicht bedächte, wie ein junger lebensfrischer Mensch, der Horaz und Ovid seine Kameraden nennen durfte, einen alten mürrischen Filz lieben sollte, der ihn über sechs Jahre lang zwang, kaufmännische Rechenkunst zu treiben, einzig aus dem Grunde, weil er sein Vater war. Und obgleich ein jeder Mensch dem jungen Boccaccio an den Augen ansah, daß er hinter dem Zahltisch Verse machte und abends im Bett Dante las, statt Zinseszinsen auszurechnen, so ruhte doch dieser sein nur auf das Geld erpichter Vater nicht damit, aus dem Sohn ein goldenes Kalb machen zu wollen. ‚Wenn du mehr zum Gelehrten taugst als zum Kommercemachen,‘ sagte er zum Sohn, als der von seinem Lehrmeister ihm als zu dumm zum Kaufmann wieder zugeschickt worden war, ‚so sollst du mir das Rechtsstudium ergreifen und die päpstlichen Gesetzsammlungen, das heilige kanonische Recht, statt deines gottvermaledeiten Dante auswendig lernen. Denn der Mensch ist auf der Welt da, um Gold zu machen, wie die Henne, um Eier auszubrüten. Und wer nicht das Vermögen seines Vaters zum mindesten verdoppelt, der ist ein Lumpenhund, ein Tagedieb, ein Schmarotzer, ein Taugegarnichts gewesen.‘
Mit diesen Zärtlichkeiten jagte der Alte unsern göttlichen Dichter in sechs weitere Sklavenjahre hinein, in denen Boccaccio sich vergeblich bemühte, die dicta Gratiani und [S. 228]die Dekretalen Gregors IX. in sein Gehirn unterzustopfen, das die Poesien aller Zeiten und Völker bereits in sich hereingeschmuggelt hatte. So daß er seit jenen Jahren einen wahren Haß gegen alles Juristische in sich verspürte, und wenn er eines Advokaten oder Notars ansichtig wurde, zu zittern begann, gleichwie ein Pferd, das von ferne ein Kamel herankommen sieht.
Kein Wunder war es demnach fast, daß unser Dichter, der von seinem Vater, wenn es eben anging, so weit weg lebte, wie Neapel von Florenz liegt, nicht mehr als fünf Tränen herausdrücken konnte, als ihm ein Bote die Nachricht brachte, daß dieser Vater an der Pest dahingegangen sei. Denn nun konnte er die Rechtsgelahrtheit mit gutem Gewissen denen überlassen, die besser damit fertig wurden als er. Er fuhr — es verdreußt mich, dieses von ihm zu vermelden — mit einer gewissen stillen Heiterkeit nach Florenz zurück und summte bisweilen Liedchen vor sich hin, die zu seiner schwarzen Trauerkleidung paßten wie eine Gitarre in eine Kirche. Und doch, wer von uns sündhaften Menschen hätte ihm darob lange böse sein können! Denn siehe, das Leben lag nun vor ihm so lustig und frei wie der dritte Tag des Dekameron: Er konnte jetzt dichten und singen von früh bis spät und selbst in der Nacht aufstehen und aus einem falschen Reim einen guten machen, denn am nächsten Tage hatte er ja nichts anderes, schlechteres zu tun. Er konnte ein Haus führen und einen Schmerbauch tragen — er nannte sich selber damals vor dem Spiegel ‚ein kleines Faß‘. Er konnte im Sommer in [S. 229]Certaldo Blumen zum Kranze und Worte zu Gedichten winden. Er konnte seinen Freund und Meister Petrarka zu sich laden, so oft er wollte und jener es ihm gewährte, und konnte mit ihm wochenlang über die großen Sänger und Männer des Altertums disputieren, eine Beschäftigung, die sie etwas vermessentlich ‚Humanismus‘ tauften, nicht anders als ob die Christenmenschen seither bis auf sie im Zustand der wilden Säue gelebt hätten!
Sein Glück vollkommen zu machen, war unser Boccaccio nicht verheiratet, denn die Liebe seiner Fiammetta war nur ein Flämmchen und kein Kochofen geworden. Und wie sein Freund und Meister Petrarka die herrliche Laura nur wenige Male gesehen hatte, um sie dann unaufhörlich besingen zu können, so erging es auch unserm Dichter mit seiner Fiammetta, welche bekanntlich als Tochter König Roberts von Neapel ein Kind der Liebe war, was einige ja auch von unserm Boccaccio selber behaupten. Feststeht, daß Fiammetta schon verheiratet und Mutter war, als der Dichter am Ostersonnabend des Jahres 1338 in der San Lorenzokirche bei der Frühmesse zum ersten Male die schöne Neapolitanerin in grünem Kleide erblickte.
So sehr aber trug unser Poet ihr Bild in seinem Herzen, daß er erst, als viele Jahre hinter diesem Blick lagen, noch einmal sein Herz an ein Weibsbild, eine schöne und reiche Witwe zu Florenz, verlor. Diese aber, die drei andere Männer im Sinne hatte, sah nicht das Feuer des Prometheus in seinen Augen, sondern nur den Gran-Sasso seines Bauches, und wies seine Werbung mit spitzen und [S. 230]garstigen Reden ab. Ein Ofen, der keinen Abzug hat, der qualmt und raucht, bis allen die Augen laufen, und so unser Meister auch nach dieser Niederlage: Er schrieb jene Schmähschrift gegen die Weiber, genannt „Corbaccio“, in der er selber wie ein wütender, alles zerhackender Rabe auf das Geschlecht der Frauen, dem doch auch seine gepriesene Fiammetta angehörte, losfuhr und sie allesamt beschimpft hat, daß man es, wenn man dies Buch gelesen, leicht mit tausend Xantippen aufnehmen könnte, so viele häßliche Worte und Gründe hat er einem damit gegen sie in den Mund gegeben. Recht wie ein Herodes unter die Kinder fällt unser Boccaccio hier zwischen die Frauen, und er hat sich für diese eine, die ihn nicht nahm, an ihnen allen gerächt als ein persischer Wüterich, der das Meer mit Ruten schlagen ließ. Und die Frauen müssen doch wohl da sein, wenngleich — darin hat er recht! — ohne sie viel weniger Sünden auf der Welt wären.
Von dem Alter des Meister Boccaccio kann ich dir, Bruder Ciani, weniger berichten. Und weißt du selbst ja auch mehr davon als ich. Denn du warst doch der wackere Soldat unserer Kirche, der du auf Geheiß deines Ordensmeisters Pietro de Petroni von Siena dich aufmachtest, um nach der Weisung dieses deines verstorbenen Oberen den fast fünfzigjährigen Boccaccio zur Buße und zur Umkehr von seinem sittenlosen Lebenswandel zu ermahnen. Du selbst hast es mir oft erzählt, wie er da unter der Wucht deiner Predigten zusammenschmolz wie eine Kerze, wenn der Wind über sie fährt, wie er weinte wie ein [S. 231]Kind, wenn er seiner lockeren Schriften und dann der Hölle gedachte, wie er in sich ging und es als Gottes Strafgericht hinnahm, daß seine drei Kinder, die er außer christlicher Ehe in die Welt gesetzt hatte, alle längst vor ihm dahingegangen waren. ‚Mein Töchterchen Violante ist gestorben,‘ schrieb er mir damals, ‚sie war fünfeinhalb Jahr alt. Von Kindern, die in diesem Alter sterben, glauben wir, daß sie Engel werden.‘ Du weißt es, mein Bruder, besser noch als ich, daß er seinen Frieden mit der Erde und dem Himmel gemacht hatte, als er selbst zweiundsechzigjährig zu Certaldo von Gott abberufen wurde. Du weißt, daß er mit jenen losen Geschichtchen von uns Mönchen oder Äbten oder Priestern nur diejenigen unserer Klerisei am Hemd gezupft hat, die es nicht besser verdient haben. Denn in unserer Zeit liegt die Geistlichkeit oft im argen, und manch einer von uns scheint mehr die Zotologie als die Theologie studiert zu haben, so daß es hohe Zeit ist, daß einer einmal kommt, diesen Augiasstall auszufegen und unsere Kirche an Haupt und Gliedern zu reformieren. Derowegen wollen wir unserm Boccaccio nicht über das Grab hinaus zürnen, der in seinen zehn Tagen des ‚Dekameron‘ eine Welt aufgebaut hat, die nicht anders ist als die, die unser Herrgott in sechs Tagen geschaffen hat, das ist voller Farben und Schatten, voller Freuden und Schmerzen und voller Tugenden und Schlechtigkeiten, alles durcheinander vermenget bis zum jüngsten Tage.
So: Mehr weiß ich dir nicht weder zum Ruhme noch zum Tadel des Meister Boccaccio zu berichten. Wer es besser kann, der mache es besser!“
[S. 232]
Dem einstigen Dominikanermönch, jetzigem Gefangenen des ehrwürdigen päpstlichen Inquisitionsgerichtes Giordano Bruno war soeben das Todesurteil verkündet worden. Am andern Morgen in der Frühe sollte er auf dem Blumenmarkt zu Rom als Ketzer lebendig verbrannt werden. „Gelobt sei Gott!“, das war das einzige, was der Bote des Gerichts aus dem Munde des Gefangenen auf seine düstere Botschaft hin gehört hatte. Nun lag Bruno wieder allein in seinem Kerker auf einem Bündel stinkenden Strohes, die Hand, an der die Kette war, unter seinen Rücken gebogen, die andere vor Frost in den langen Bart gekrampft, und hielt seine weiße Stirne in das Mondlicht, das durch das Gitterfenster kam, hinein, als hätte es ihn wärmen können. Nichts hörte man als das Klirren oder Schleifen der Kette, wenn er sich bewegte; einmal kam eine Ratte aus einem Loch in der Wand spaziert, lief ruhig an den Gefesselten heran, schaute ihm traurig zu, nahm einen Strohhalm mit und lief wieder zu ihren Kindern zurück, um ihnen ein grausiges Märchen von den Menschen zu erzählen. Stundenlang lag Bruno so da, schaute offenen Auges in den Mond und sprach mit sich selber. Und sein Leben wurde ihm in dieser letzten Nacht zu Bildern, die ihm die Abenteuer eines fremden Menschen zu sein deuchten: Er sah sich als Kind auf dem einsamen Gehöft seines armen Vaters bei Nola mit Steinen spielen, da kein Geld da war, ihm Spielzeug kaufen zu können.
[S. 233]
Er entsann sich noch der Nächte, wenn fern aus dem Dunkel ein roter Schein bis in seine Kammer geleuchtet und der Vater ihm erklärt hatte, daß zwischen Nola und Neapel, wo der Oheim wohnte, ein Berg wachse, der Feuer speie und bei Tag qualme wie ein Kamin, und daß der Teufel darin wohne.
Und dann sah er sich zu Neapel selbst als sechzehnjährigen Novizen, wie ihn das Kloster des heiligen Dominikus aufnahm, und er zuerst „Bruder Giordano“ genannt wurde. Dreizehn Jahre hatte er dort gelebt, erst immer in der Sakristei, drei Viertel des Tages verkniend und verbetend, und dann die letzte Zeit immer in der Bibliothek über Folianten und Büchern aus allen Ländern gebeugt. Die graue Zelle kam ihm wieder vor die Augen, drin er gefastet und gebetet und allen Kasteiungen zum Trotz böse Träume gehabt hatte; ein gelbes geschnitztes Kruzifix hatte als einziger Schmuck an der Wand gehangen, da er alle Heiligenbilder und selbst das der Madonna verschenkt hatte, um ganz allein mit seinem Gotte zu sein.
Er fühlte noch auf seinem Haupte die Kälte der Schere, mit der man ihm die nun längst überwachsene Tonsur in die braunen Haare geschnitten hatte, und fror noch beim Erinnern daran. Er hörte sich wieder als Priester die Messe lesen und die Beichte abnehmen bis zu dem Tage, da er wie ein Tier aus einer Falle im Dunkeln aus Neapel geflohen war und ziellos in der Welt umherziehen mußte.
Was hatte er denn Böses getan? Er hatte im Erasmus [S. 234]von Rotterdam und andern deutschen Büchern gelesen, sich von einem Bruder, der am Hof Karls V. gelebt, von Luther erzählen lassen und hatte ein paar Gedanken als Gedichte aufgeschrieben. „Wenn Ihr das verwünschte Schreiben sein lassen wolltet!“ hatte ihm der gute Prior immer in der Beichte vorgehalten. „In der Tinte steckt der Teufel wie Gott im Weine. Ihr braucht nur an beiden zu lecken, so merkt Ihr es. Ein Mönch muß ein Huhn sein, das seine eigenen Eier selbst aufißt.“
„So wenig Ihr dem Strom gebieten könnt: ‚Fließe nicht mehr!‘ und wie Ihr die Vögel nicht am Singen, noch die Blumen am Blühen hindern könnt, es sei denn, Ihr macht ihrer Daseinsform ein Ende, so wenig könnt Ihr und kann ich dem Weltgeist, der aus mir klinget, den Mund verstopfen, ehrwürdiger Vater!“ war Brunos Antwort gewesen.
Und dann waren die Jahre in der kalten Fremde gekommen, wo kein Lorbeer wuchs und keine Pinien sich breiteten, wo die Menschen im Winter Felle wie die Tiere tragen mußten, und wo man selbst die Marmorsteinbilder umhüllen mußte, daß sie nicht vor Frost zersprangen. Wieviel Kälte hatte er, der Neapolitaner, in den finstern Nebelländern ausstehen müssen! Er sah sich wieder in Paris am Hofe des Königs und an der Universität dort Vorlesungen über die Unendlichkeit der Welt halten, wie ein Storch auf einem Beine stehend, während die ihm feindlichen Professoren die Zuhörer zum Grunzen, Brummen, Heulen, Brüllen und Winseln aufreizten, bis Bruno [S. 235]ironisch sagte: „Fühlt ihr nun, welch ein tragischer Gedanke das ist, zu wissen, daß auf andern Sternen ähnliche Bestien leben?“
Und nach London träumte er sich wieder hin, wo er die glücklichste Zeit seines Daseins im Hause des französischen Gesandten verbrachte, der ihm in einem Dachstübchen Quarantäne gewährt hatte. Dort den geliebten Gestirnen zehn Meter näher, hatte Bruno seine höchsten Gedanken zu Papier gebracht, und die Stadt, in der damals Shakespeare lebte, war ihm trotz ihrer schwarzen Straßen, ihrem Kaufmannsgesicht und ihrem Biergeruch fest ans Herz gewachsen, weil er hier wie ein Vogel im Norden erst das Singen gelernt und seine schönsten Sonette gedichtet hatte.
Aber die Entrüstung der gelehrten Ochsen zu Oxford verscheuchte ihn auch von dort. Die Steine, die ihm die englischen Philosophen nachwarfen, fielen alle ins Meer, das sie wütend ob der Dummheit der Menschen verschlang. Der Schatten Luthers lockte Bruno nach Wittenberg, wo er zwei Jahre lang an der Universität den schweren deutschen Köpfen vergeblich das Fliegen beizubringen suchte. Nur Hamlet, den Dänenprinzen, soll er auf dem Gewissen gehabt haben.
Überall war er nur ein Fremdling, ein Vorübergehender, mehr in der Luft als auf der Erde zu Hause. Einige reckten wohl die Köpfe nach ihm in die Höhe, aber die meisten kümmerten sich so blutwenig um ihn, wie die Bauern, die den Acker pflügen, um die Kraniche zu ihren [S. 236]Häupten. Er hatte sein Vaterland und sein Volk verloren, und keiner um ihn war da, der seine Sprache verstand. Ahasver, der ewige Jude, findet überall doch die Seinigen, die er erkennt und die ihm von Abraham her verwandt sind, aber Bruno fand in der Fremde und in seiner Zeit keinen einzigen, der ihm ähnlich war. Wollte er sich unterhalten, so mußte er nur große Tote, wie Luther und Kopernikus, aus ihren Gräbern emporziehen und mit ihnen Dialoge führen.
Man will ihn oft in warmen Sommernächten auf den Stufen der Schloßkirche zu Wittenberg, an die Luther seine Thesen anschlug, weinend sitzen gesehen haben wie einstmals Alexander den Großen auf dem Grabhügel des Achilles. Und wie jener diesen Heros um seinen Sänger beneidet hatte, so beklagte sich Bruno bei der Nacht, daß ihm ein Volk fehle, das seinen Ruhm wie den Luthers der Welt verkünde. Zur evangelischen Landeskirche, zu der Luthers Religion geworden war, überzutreten, daran hat er nicht eine Sekunde gedacht. Er hat das bis heute vergessene Wort von der „Deformation“ gebildet und, wie nach ihm Schiller, geglaubt, daß man, um religiös zu sein, nicht eine Religion bekennen müsse.
Das Gefühl der Verlassenheit und dieses heimatlose Leben ins Leere hinaus, das sein Kopf und sein Herz, die in ihm gleich stark waren, führen mußten, hatten ihn schließlich nach Italien zurückgetrieben. Die Sehnsucht nach dem Volk, das die Sprache redete, die er schrieb, lockte ihn mit zauberhafter Macht über die Alpen. Wie das irrende [S. 237]Schiff, das am Magnetberg zerschellt, zog es ihn, der im unendlichen Kosmos herumtrieb, in die gefährliche Heimat zurück. „Wie dumm!“ pflegen die klugen Leute hierbei zu sagen, aber die noch klügeren fügen hinzu: „Wie traurig und wie notwendig!“
In der Heimat geriet er in das Netz der Inquisition. Er ward festgenommen und lag nun sieben Jahre lang in Rom im Kerker, um seine Lehren zu widerrufen. Aber wie konnte er widerrufen, was er doch wußte, daß die Erde nicht die Welt sei und daß unendlich viele Sterne über uns brennen, und der Boden, aus dem wir wachsen, nur ein winziges Teilchen des Alls ist, und daß unsere Erde schon Milliarden Jahre vor Christi Geburt gelebt hat! Seine einzige Sünde war die, daß seine beiden Augen schon so weit sahen wie die Fernrohre Anno 1910 und so hielt er denn in jener letzten Nacht vor seinem Tode, ohne ein Quentlein Reue zu verspüren, noch einmal Zwiesprache mit den Sternen, die durch sein Kerkerfenster schauten, und die er alle bei ihren Namen kannte wie die Menschen ihre Kinder.
Als der letzte erloschen war, kam der Kerkermeister, löste ihn wie ein Tier von seiner Kette, und Bruno wurde zum Scheiterhaufen geschleppt und fand den Tod des Phönix, nach dem er sich in seinen schönen Liedern gesehnt hatte. Seine Asche aber zerstäubte als eine Saat, die in kommenden Jahrhunderten emporwuchs.
Denn genau dreihundert Jahre nach jenem Tage, da Bruno ohne ein Wort des Widerrufs, ohne einen Laut des [S. 238]Schmerzes seinen Leib der Flamme preisgab, stand auf dem nämlichen Platze in Rom eine gewaltige Menschenmenge, das junge Italien, und jubelte dem eben auf der Stätte seines Scheiterhaufens enthüllten Denkmal Brunos zu. Der Unterrichtsminister, ein dicker Herr im Frack, hielt eine glänzende Lobesrede auf diesen einzigen Philosophen Italiens. Die Sonne aber wurde bei all dem Lärm neugierig, blickte durch die Februarwolken hindurch und las die Inschrift auf dem Monument: „Dem Giordano Bruno das von ihm vorausgeschaute Jahrhundert hier, wo der Scheiterhaufen gebrannt hat“, sah sich die Menschen an, und verbarg sich weinend wieder hinter dem Gewölk.
[S. 239]
Goethe hat sich zwei gleichgroße kritische Verdienste erworben: Er hat die Augen seiner Mitwelt auf den damals wenig beachteten Rembrandt gelenkt, und er hat die überragende Bedeutung Molières, dieses größten Galliers, erkannt. „Ich kenne und liebe Molière seit meiner Jugend“, hat er einmal zu Eckermann gesagt, „und habe während meines ganzen Lebens von ihm gelernt. Es ist nicht bloß das vollendete künstlerische Verfahren, was mich an ihm entzückt, sondern vorzüglich auch das liebenswürdige Naturell, das hochgebildete Innere des Dichters. Ich lese von Molière alle Jahre einige Stücke, so wie ich auch von Zeit zu Zeit die Kupfer nach den großen italienischen Meistern betrachte. Denn wir kleinen Menschen sind nicht fähig, die Größe solcher Dinge in uns zu bewahren, und wir müssen daher von Zeit zu Zeit immer dahin zurückkehren, um solche Eindrücke in uns aufzufrischen“.
Man achte wohl auf dieses „wir kleinen Menschen“, mit welchem Gefühl ein Goethe vor dem Werke Molières stand, um die ganze Größe jenes Künstlers zu erfassen. Diese ungeheure Anerkenntnis Goethes sollte für immer alle Gegner und Kritiker Molières zum Schweigen bringen. Freilich läßt sich gegen ihn wie gegen alles Menschliche mancherlei sagen und einwenden, und von diesem billigen [S. 240]Vorteil hat man gerade gegen Molière gerne Gebrauch gemacht, ja tut es, weil man ihn zumeist schlecht dargestellt sieht, noch heute vielfach. So könnte man, wenn man einseitig genug wäre, dies zu wollen, gegen ihn sagen, daß er seine Fabel nicht zu erfinden und nicht auszuführen weiß, das, was Aristoteles doch als das erste Erfordernis für den dramatischen Dichter bezeichnet. Oder man könnte, wenn man einfältig genug wäre, dies zu können, von ihm behaupten, daß seine Stoffe zu alltäglich, zu platt und hausbacken wären, daß er sich nicht wie Shakespeare in seinen Komödien über die tatsächliche Wirklichkeit erheben konnte, und daß er nie aus seiner bürgerlichen Welt von Wucherern, Quacksalbern, Kupplerinnen, Tölpeln und anderem Gelichter herausgekommen sei. Es ist wahr, Shakespeare hat die Menschen viel überlegener angeschaut und erreicht dadurch, daß er fast einem jeden seiner komischen Charaktere seinen tragischen Schatten mitgegeben hat, bei denen, die Verständnis dafür haben, viel tiefere Wirkungen. Der Hintergrund, auf den Molière seine Figuren stellt, ist lediglich der der menschlichen Torheit oder der menschlichen Schwäche. Er macht sich über seine Geschöpfe nur lustig und hat wohl, als er sie schuf, oft Tränen über sie gelacht, aber nur selten Tränen um sie geweint. Man erinnere sich nur, wie verschieden die beiden Dichter den Dünkel behandelt haben, der eine an der Figur des Malvolio, der andere an der des Herrn Jourdain, des adeligen Bürgermannes, um sich die Malweise der beiden klarzumachen. Nicht aber, als ob [S. 241]Molière seine Menschen nur einseitig, nur typisch behandelt hätte, wie superkluge Leute oft heutzutage behaupten, als ob er seine Menschen auf einen Leisten gezwängt hätte, dergestalt, daß der eine bei ihm nur geizig, der andere nur eingebildet und ein dritter nur hypochondrisch gewesen sei. Nichts ist verkehrter als dieses. Weil er seine Charaktere auf einen Hauptgrundzug brachte, wußte er doch ebensogut schon wie wir, wie vielgestaltig eines jeden Seele und Sinnesart ist. Wenn er einen Geizhals, wie dies sich eben verhält, fortwährend nur von seinem Gelde, d. h. eigentlich von seiner Armut reden läßt, so vergißt er doch nicht, ihm eine Reihe ganz anderer Eigenschaften mit auf seinen traurigen Weg zu geben, als da sind: Eitelkeit, Sinnlichkeit u. a. m. Daß ein Hypochonder drei Viertel des Tages damit verbringt, sich den Puls zu fühlen, zu den Ärzten zu laufen und über seine Verdauung zu reden, ist eben eine Einseitigkeit dieses Menschen, nicht eine des Künstlers, der aus ihm eine Komödie macht. Von diesem landläufigen Vorwurf gegen Molière, daß er nur Typen, keine Menschen geschaffen habe, sollte man diesen Dichter endlich einmal freisprechen und den Mikrokosmus seiner Gestalten nicht immer durch sinnlose Vergleiche mit Shakespeares Welt trüben. Man achte nur einmal auf die Kunst, mit der Molière die Handlung von innen heraus bloß durch seine Menschen treiben läßt, um zu begreifen, wie lebendig diese sind. Er braucht seine Fabel oft kaum, er pfropft sie manchmal, weil sie nun einmal nach Aristoteles’ und Freund Boileaus Ansicht nicht fehlen [S. 242]darf, dem Schluß seiner Stücke auf, wie z. B. im „Tartüff“ oder im „Geizhals.“ Im übrigen läßt er seine Szenen ohne Zutat ganz einfach von seinen Menschen aufwickeln und spielen, wie jene von Goethe meistgerühmte im „Malade imaginaire“ zwischen dem Kranken und seiner kleinen Tochter Louison, „in der mehr praktische Lehren für den Dramatiker enthalten sind als in sämtlichen Theorien“, oder im „Geizhals“ die Szene zwischen Harpagon und der Kupplerin. In der Weise, wie sich hier seine Figuren enthüllen oder sich verstecken, um sich von neuem zu offenbaren, und wie so das Drama lediglich von den Charakteren, die sich aufdecken und bloßstellen, weitergetrieben wird, in diesem ist Molière ein vollendeter Meister. Er vermag einen menschlichen Charakter im Nu in vielerlei Facetten glänzen zu lassen, hin und her zu wenden und von hundert Seiten zu zeigen. Namentlich für die kleinen Listen und Verschlagenheiten des Menschen, für diese ganze linke Seite unserer Seele, hat er feine Ohren und tiefes Verständnis gehabt. Das alte Schulwort: „Racine schildert die Menschen, wie sie sein sollten, Molière schildert sie, wie sie sind“, hat dies treffend ausgedrückt. Alle läßt er wie in der Natur von ihrem Egoismus in Bewegung setzen, mag der auf Orden und Titel und Ansehen oder auf Wohlbehagen und ein Weibchen oder mag er schließlich auf Einsamkeitsverlangen, wie im „Misanthrope“ gehen. Selbst seine Götter, Jupiter wie Merkurius im „Amphitryo“, treibt nichts Heroisches, nein nur Allzumenschliches auf die Erde. Und dabei — das trägt ihn über alle Zeiten [S. 243]fort — moralisiert Molière niemals, es sei denn, daß er durch einen dritten, den „raisoneur“ des französischen Theaters, seinen „Helden“ einmal die Wahrheit sagen läßt. Sonst hat er die Menschen viel zu lieb, um sie selber ausschelten zu können: selbst den scheinheiligen Tartüff, den er von allen Kreaturen Gottes wohl am meisten gehaßt hat, mag er zum Schluß nicht beschimpfen. „Es muß auch solche Käuze geben“, mit dieser Weisheit, mit der der harmlose Spießbürger seine ungewöhnlichen Mitmenschen erträgt, entläßt er die Geschöpfe, die er geschaffen. Ihn, den Gallier, quälte die Menagerie von Menschen, die er wachgerufen, mit ihren „Tiergesichtern“ noch nicht wie den Germanen Henrik Ibsen. Er lachte nur über die komischen Gesellen, Männlein und Weiblein, die er einfach nach dem Leben abgezeichnet hatte, ohne eine Karikatur aus ihnen zu machen. Darum war und ist es so ungeheuer schwer, Molière darzustellen, weil die meisten Schauspieler sich selten damit genug tun können, „die Bescheidenheit der Natur“, wie Molière sie wiedergibt, vorzuführen, sondern gerne der lieben Wirkung halber etwas hinzufügen. Dann kommen Kotzebuesche Kerle und Benedixsche Frauenzimmer, kurzum Theater, aber keine Menschen von Fleisch und Blut, mit Tugenden und Lastern zum Vorschein. Vor solchen Fratzen muß dann der Gebildete zum Buch flüchten, um Molière wieder verstehen und lieben zu können. Und je mehr man sich mit ihm beschäftigt, um so größer wird er uns. Kein Künstler hat, ohne sich wie unsere Naturalisten in Kleinigkeiten und Nebensächlichkeiten [S. 244]zu verlieren, die Menschheit so trefflich nachgeahmt wie er, mag immer auch der Humor, mit dem er dies tut, nur von dieser Welt sein. Es gibt ganz wenig Szenen bei ihm, wo sein Humor etwas von jener Welt hat, von dem Dämonischen, das, uns unbewußt, uns regiert und unsere Taten tun läßt. Ich denke dabei vor allem an die einzige Szene im „Geizhalse“, eine Szene, die sich neben den stärksten Shakespeares sehen lassen kann: Es ist die, wo der Geizhals nach dem Diebstahl seiner Kassette auf die Bühne stürzt, wie ein Wahnsinniger nach dem Diebe schreiend, bis er schließlich — eines der tiefsten Symbole auf der Bühne! — sich selbst am Ärmel und am Kragen packt, als habe er sich selbst bestohlen. Der Dichter verwischt hier mit Absicht die Grenze zwischen Spiel und Leben, er überspringt die Rampe und läßt den Geizhals auf der sinnlosen Jagd nach seinem Gelde ins Publikum hineinreden. Oder man denke an den Schlußakt des oft zu gering geschätzten „bürgerlichen Edelmanns“ mit seinem grotesken Größenwahnsinn in der türkischen Maskerade!
Moralisiert auch Molière niemals, so spricht doch eine Lieblingstendenz von ihm aus vielen seiner Werke, es ist die Neigung zur Natürlichkeit, die Hochschätzung der Natur wider alles Gekünstelte, Unnatürliche und Verlogene. So führt er in den „Gezierten“ und in den „Gelehrten Frauen“ Kampf gegen das affektierte Wesen der Frauen und läßt die Natürlichkeit, die Naivität triumphieren. So bekriegt er im „Arzt wider Willen“, und erbitterter im [S. 245]„Eingebildeten Kranken“ — man sieht übrigens, wie gerne er ein Thema variiert! — die Kurpfuscherei und preist die Naturheilmethode. So gibt er im „Misanthrope“, einem kleinen Volksliedchen, den Preis über fast alle Sonette und Madrigale, die seine Zeit hervorgebracht hat.
Dieser Abscheu vor aller Unnatur und diese Lobpreisung alles Echten und Ungemachten kam aus dem großen Herzen dieses Menschen, dem „hochgebildeten Innern“, wie Goethe sagte, dieses Künstlers, der gleich unserm Lessing ein reines Herz und eine seltene Vornehmheit besaß. Der angesichts des Todes seiner Frau, die ihn betrogen hatte, weinend verzieh mit den wehmütigen Worten: „Du hast nichts dafür gekonnt“, der als Theaterdirektor todkrank sich nicht schonen wollte, um seine Arbeiter nicht brotlos zu machen, und der auf der Bühne gestorben ist, nachdem er seine Rolle unter dem Jubel des nichtsahnenden Publikums bis zu Ende gespielt hatte.
[S. 246]
Es war im Dezember des Jahres 1861, als ein junger Mensch von einundzwanzig Jahren, bei dessen späterem plötzlichen Tode die ganze gebildete Welt Trauer anlegte, Emile Zola, spät abends im Dunkel die achtzehn Stiegen seiner Behausung im Quartier Latin zu Paris herunterkroch. Er trug über seinem Hemd als einziges Bekleidungsstück einen ehemals schwarzen, jetzt rostig-grünen Überzieher und an den bloßen Füßen ein Paar zwölfmal geflickter, mit Bindfaden zusammengehaltener Filzpantoffeln. Er blinzelte scheu und erschrocken mit den Augen, als die Gaslaternen ihn und seine traurige Gestalt in der schäbigen Schale betrachteten, schlug, zitternd am ganzen Leibe, den Kragen in die Höhe und bog dann schnell in eine der finsteren Seitengassen hinein, die ihn und sein Elend verbarg.
Er rannte mehr, als er ging, um nicht zu sehr zu frieren, die hohen Häuser entlang bis zur Seine herunter, die in Nebel und Nacht gehüllt schläfrig mitten durch Paris floß. Dort am Fluß lag eine Bäckerei in einem feuchten Souterrain, wo es noch drei altbackene Brötchen für einen Sou gab.
Der junge Zola konnte vor Zähneklappern nicht sprechen, er schob nur ängstlich das Geldstück, das ihm in der Hand heiß geworden war, durchs Gitter, nahm sein Brot und rannte spornstreichs an den hohen, düsteren Häusern vorüber zurück. Er hatte seit drei Tagen nichts mehr zu kauen gehabt. Doch, vorgestern war es ihm gelungen, unter einem [S. 247]alten, dicken Schmöker, den er listig in der Dachtraufe als Falle aufgestellt hatte, einen Spatzen zu fangen. Den hatte er an einer Gardinenstange über einem bißchen Holz, das er aus dem Fußboden gebrochen hatte, geröstet. Aber das arme Tier war so klein gewesen, daß er nach drei Stunden wieder hungriger wurde als zuvor. So verschlang er denn das eine Brötchen schon bei dem Aufstieg zu seiner himmelhohen Wohnung.
Oben in der Dachkammer, wo er hauste, lag seine Freundin, die nach Pariser Frauenart Leid und Lust mit ihm teilte, im Bett und lachte ihn an, als er mit seinen Brötchen hereintrat. Hier unter dem Dach war es fast noch kälter als draußen am Fluß. Der Wind heulte ganze Symphonien über Paris.
Außer dem Bett und einem Ofen, der aber kälter war als Grönland, stand einem nichts in der kahlen Kammer im Wege. Nur in einer Ecke lag noch ein alter Seehundskoffer, der auch Tisch sein konnte und mußte, wenn man ihn in die Höhe stellte. Dieser Koffer aber war das Allerheiligste in dem ganzen nackten Raume. Denn in ihm verwahrte der junge Zola seine größten Schätze, mächtige Manuskriptbogen, auf denen lange Verse geschrieben standen, die sich am Schlusse reimen mußten. Mit diesen Reimen, die das Los und das Leben der Menschen besangen, Menschheitsphantasien waren, hatte der Jüngling dermaleinst gehofft, Paris und die Welt zu erobern, als er noch als Gymnasiast in der Provence mit gleichgestimmten Freunden die blauen Tage verschwärmt hatte.
[S. 248]
Nach und nach war die Enttäuschung über ihn gekommen. Der Tod seines Vaters und die völlige Verarmung seiner Mutter trieben ihn aus dem sonnigen Südfrankreich mitten im Winter in das düstere Paris, wo es magere Stipendien und noch magerere Freitische gab. Jäh rüttelte ihn dann das Leben aus dem Traum der Jugend auf: Er fiel zweimal kurz hintereinander durch das Examen. Die paar Bekannten seiner Mutter, die ihm bis dahin geholfen hatten, gaben ihn damit auf. Und nun trieb der junge Zola wie ein Schiffbrüchiger mit seinem Seehundskoffer und den langen, schon etwas vergilbten Versen seiner Jugend in das Zigeunerleben der Großstadt hinein.
Ganz langsam gingen ihm die Kinderaugen auf und fielen die Träume um ihn herunter ab, wie die faul gewordenen Tapeten in seiner Dachkammer.
Und wie er an jenem Abend sich in der kahlen, feuchten Stube wie im Sarge seiner Jugend umblickte, wurde ihm mit einem Male klar, daß die Millionen von Menschen in der Stadt unter ihm, von deren Edelsinn und Nächstenliebe er geträumt hatte, lauter Egoisten waren, und daß die Gesellschaft sich um den einzelnen nicht kümmert, sondern ihn einfach verbraucht, und daß unsere Zeit keine Besonderheiten duldet, und daß die Liebe, dieses überschwengliche Wort, diese höchste Erwartung aller jungen Seelen, schließlich nichts weiter bedeutet als zwei Menschen, die Appetit aufeinander haben und voneinander lassen, wenn sie einander satt bekommen haben.
So wurde aus dem jungen Zola, der im Mondschein Reime [S. 249]schmiedete, unter seinem Kopfkissen Hugos Gedichte hatte, mit seiner Liebsten Veilchen pflückte und mit offenen Augen träumte und durchs Leben nachtwandelte, der Mann Zola, der Verfasser von „Germinal“, der Freund Flauberts, der Hausbesitzer und reiche Schriftsteller, der das Aussehen eines Bankbeamten hatte, der erklärte, daß ein Dichter ein Arbeiter sei wie alle anderen, der nicht mehr betete, weil er zu oft vergeblich gebetet hatte, der statt an Gott nur mehr an Hunger und an Liebe glaubte, der Reklame für sich machte und machen ließ, und Romane in Lieferungen schrieb, der im Winter mitten unter reichgewordenen Spießbürgern wohnte, der alle Phrasen haßte und alle Dinge bei ihrem Namen nannte, der den Maschinen ihre Seele ablauschte, der den Naturalismus für die einzig mögliche Kunstform erklärte, und der an Kohlengas gestorben ist.
So wurde der Künstler Emile Zola, der das große Epos der Bürgerfamilien Rougon-Macquart schrieb und mit Riesenlettern sein „J’accuse“ an den Himmel des alten Frankreich unter Napoleon III. hinschrieb, das Anno 1870 an den Folgen der Ausschweifung und des Leichtsinns zusammenbrach und einen jämmerlichen Tod wie Nana starb. Mit dem sinnlichen Temperament eines Rubens und dem sittlichen Ernst des Tacitus malte er die traurige Geschichte und Zeit jenes schwächlichen Monarchen in überlebensgroßen Bildern ab. Keine verfallende Zeit hat einen größeren Schilderer und Richter gefunden. Wer diesen Dichter aber, wie dies einst geschah und heute noch oft geschieht, einen Mann ohne Scham und Anstand nennt, der begeht damit [S. 250]ein Majestätsverbrechen an der Würde der Menschheit, die in Zolas Hand nicht weniger sicher als in der Schillers gelegen hat. Unerbittlich wie Minos in der Unterwelt hat er alle jene kranken und faulen Seelen, die aus dem Sumpf des zweiten Kaiserreichs heraufgewachsen waren, in den Tartarus zurückgeschleudert. Es gibt selten etwas Größeres und Gräßlicheres in der Kunst, als die Bilder, die Zola von dem Untergange jenes Frankreichs entworfen hat. Seit Michelangelos „Jüngstem Gericht“ war kaum Ähnliches da, und keiner außer Zola hat uns Lebende so über den Totenstrom gefahren, der zwischen uns und unsern Ahnen flutet.
Aber damit nicht müde, so wenig wie Herkules, da er den Stall des Augias gereinigt hatte, begann Zola in seinen letzten Jahren an Stelle des weggefegten Schutts die Fundamente zu einer neuen Zeit zu legen. Schon die große Romanreihe der Geschichte der „Rougon-Macquart“ klingt aus mit einem weichen Akkord, schließt mit jenem wundervollen Bilde von dem kleinen Kinde, dem einzigen, ersten, gesunden Sprossen aus jener Generation von Säufern und Wüstlingen, das mit seinen Händchen nach der Sonne und den Sternen greift. Und der Sechzigjährige begann seine vier Evangelien zu schreiben, die er, der sich in seinen Romanen „Lourdes“ und „Rome“ als der erbittertste Gegner der herrschenden Kirche erklärt hatte, als moderne lebensfrohe Ideale aufstellte. Sie heißen: Fruchtbarkeit, Arbeit, Wahrheit und Gerechtigkeit. In ihnen bricht sein starker Optimismus triumphierend durch. Über alle Hemmnisse preist [S. 251]er den Sieg des Lebens, hofft er auf den friedlichen Fortschritt der Wissenschaft und der Menschheit, die sich schon ihren Planeten unterworfen hat und Raum und Zeit täglich mehr überwindet. Er war der erste, der uns lehrte, daß man beim Dahinsausen eines Zuges durch die Nacht ebenso vor Bewunderung erzittern kann, wie beim Eintritt in einen Tempel, und er fand für das Gefühl: „Nichts ist gewaltiger als der Mensch“, neue herrliche Worte.
Da riß ihn mitten aus der Arbeit an seinem Roman „Arbeit“ der jähe schreckliche Tod hinweg. Man darf wohl sagen, daß der Verlust dieses Mannes für Frankreich kein geringerer war, als der der Schlacht von Sedan. Denn das große Reformationswerk, das Zola begonnen hatte, war noch unvollendet, und es steht dahin, ob ein gleich starker und mutiger Genius es jenseits des Rheines wieder aufnehmen wird. Darum kann Frankreich das Andenken dieses gewaltigen Künstlers und Reformators nicht genug ehren, und wenn es selbst seine Leiche statt in das Pantheon neben die Gebeine Napoleons des Ersten bringen würde.
[S. 252]
Kopfhoch, wie zur Zeit, da er lebte, ragt er noch heute aus dem Bayreuther Menschenkreis um den elbischen Zwergriesen Richard Wagner hervor: Dieser normännische Edelmann, der, wenn man will, ein Dilettant war in allen Künsten, die er trieb, aber als solcher anregender gewirkt hat als manche, die aus ihrem kleinen Glase trinken und ewig die eine gleiche Scholle bearbeiten. Er war einer von den Mittlern, wie sie Goethe liebte, ein Universalgenie aus der Familie der Herodote, der Plinius, der Barthélemy, der Pückler-Muskau. Er war ein Sammler und ein Reisender, wie es wenige gegeben hat, dieser letzte alte französische Aristokrat, der seinen Stammbaum auf einen sagenhaften Yarl Ottar und bis ins neunte Jahrhundert zurückführen konnte, und den das blaue Wikingerblut, das in ihm kreiste, nie lange an einem Fleck rasten und rosten ließ. Die Erinnerungen und Reisefrüchte, die er aus Kephalonia, aus Naxos, aus Neufundland oder anders woher mit nach Hause brachte, brauchten nicht an der Grenze verzollt zu werden, und kein Milliardär konnte sie ihm durch Überbieten streitig machen. Es waren exotische Novellen oder Volkslieder oder alte Keilinschriften oder fremde Heldengedichte oder Sprichwörter, die er eingehandelt hatte, lauter geistige Kostbarkeiten und Seltenheiten, deren ungeheueren Wert nur die Kenner und Liebhaber zu schätzen wußten. Für sich selbst bedürfnislos wie ein Derwisch opferte er alles, was er besaß oder verdiente, für die fremden [S. 253]spirituellen Güter, die er in seinem Kopf mit von dannen trug und die er dann in seinem geliebten Französisch nacherzählt vor den Augen der zivilisierten Welt auspackte. So verband er als einer der ersten in der modernen Zeit wieder den Orient mit dem Okzident durch sein menschliches Gehirn, diesen glühendsten Fokus, der auf dieser Erde brennt.
Er war kein solch großer Dichter und Könner, daß er seine Sache ganz auf die Kunst stellen konnte und wollte. Er mochte als Dilettant, der er in des Wortes bester Bedeutung war, sich gar nicht wie die Poeten rings um ihn auf ein bestimmtes Gebiet verweisen und spezialisieren lassen. Sein liebster Titel, den er gern unter alle seine offiziellen Benennungen auf seine Visitenkarte zu schreiben pflegte, hieß: „Ein Weltweiser“, und das Attribut, das er am meisten scheute, war das, einseitig zu sein. Darum war er mit Lust Diplomat, weil es hier gerade auf Vielseitigkeit ankam, und weil diese Art „Kunst“ keine festbestimmte und von Regeln abhängige war. Es ließ ihn bei einer einzigen Kunst gar nicht ruhen. Gleich dem von ihm höchst verehrten Leonardo malte er, bildhauerte und dichtete er und scharmierte am liebsten mit allen neun Musen zugleich. Bezeichnend für ihn ist, daß er selten an einem einzigen Werke arbeitete, sondern meistens drei oder vier in Angriff hatte. War er orientalisch gestimmt, so übersetzte er ein persisches Heldengedicht, stand er in Renaissancegedanken auf, so fuhr er in der Arbeit an diesem Werke fort, hatte er die Nacht von Marmor geträumt, [S. 254]so machte er sich frühmorgens an seine Statuen und meißelte an einer „Walküre“ oder einem „Buddha“ herum. Oder war er schließlich ganz nüchtern aus dem Bett gestanden und kam ihm beim Waschen und Kämmen keine einzige Impression, so setzte er sich an seine fachwissenschaftlichen Studien und sprang auf sein Steckenpferd, die „Rassentheorie“, in der er behauptete, daß die Kultur Europas von Germanen geschaffen, und daß die ganze Aristokratie aller europäischen Völker aus dieser blonden Rasse entsprossen sei. Dieser, sein Lieblingsgedanke, den er hegte und pflegte und für den er sein Leben lang Beweise sammelte, hat ihn dann auch mit Richard Wagner zusammengebracht, der in ihm freudig einen seiner Bestätiger entdeckte.
Gobineau lebte, als Wagner ihn fand, seiner Kunst, besser gesagt, seinen Künsten in Rom. Er war früher Gesandter der französischen Republik gewesen, bis er auf einmal, vielleicht, weil er sein Vaterland zu aristokratisch vertrat, brüsk von seiner Regierung entlassen wurde. Bis dahin hatte er, ein altadliger französischer Edelmann, der durch die Republik eigentlich heimatlos geworden war, unstet wie Peter Schlemihl von Land zu Land gelebt: Gestern als Attaché in Persien, das Jahr drauf als Bevollmächtigter in Neufundland, dann als Gesandter in Athen, in Rio de Janeiro und wieder ein paar Jahre später in Stockholm. Ein bitteres Gefühl der Entfremdung hielt ihn soviel als möglich von Frankreich fern. Was sollte er dort, wo ein nach Zwiebeln riechender Parvenü wie Gambetta, der Fisch und Kartoffeln mit dem Messer aß, [S. 255]das große Wort und die Regierung führte. „Das Wort Vaterland bedeutet heute nichts mehr als das ausschließliche Bestreben, Geld zu verdienen“, aus diesen seinen Worten spricht ein großer Schmerz und eine noch größere Verachtung. Sein Stammschloß, das seine Ahnen erbaut und jahrhundertelang bewohnt hatten, verkaufte er an irgendeinen reichgewordenen französischen Herrn Meunier oder Jourdain und löste so die letzte, äußerlich gewordene Beziehung, die ihn mit dem Lande seiner Väter verband. Ein treuer, brauner Diener, ein Syrier, Honoré genannt, der Fleisch am Spieß braten und der Kaffee türkisch kochen konnte, sowie ein paar Perserteppiche begleiteten den heimatlosen französischen Grafen auf allen seinen Fahrten von Norden nach Süden. Und so gleichsam zwischen zwei Schnellzügen auf der Reise in Turin, in der nämlichen Stadt, in der Nietzsche ein paar Jahre später seinen großen Geist aufgab, ist Gobineau in einem kalten Hotelbett einsam in der Fremde gestorben.
Von sämtlichen Werken, die er den Gebildeten aller Völker als Vermächtnis hinterlassen hat, ist seine Dichtung über die „Renaissance“ wohl das wertvollste, sicherlich das schönste. Die meisten, die uns durch die gewaltigste neuere Zeit unsers Geschlechtes, die wir kennen, hindurchführen, ziehen uns durch jene Welt wie durch ein Museum an Bildern und toten Steinen vorüber. Gobineau hat, ohne viel Eigenes hinzuzutun, jene Riesen im Guten wie im Bösen selber zu uns sprechen lassen. Gerade das ist das Treffliche an seinen Szenen, daß er nur schildert, nicht richtet, etwa gar [S. 256]noch aus Rücksichten eines im 19. Jahrhundert, nicht im Cinquecento Geborenen. Ohne gelehrten Kommentar läßt er die Menschen und Übermenschen jener Zeit vor uns leben und sterben: Savonarola oder Karl den V. oder Cesare Borgia oder Julius den II., dem jenes tragische Geschick fiel, erst als Greis zum Herrn über Rom und über die Seelen zu werden. Des Tacitus bekanntes Erstgebot für den Geschichtschreiber ist hier erfüllt. Nicht eine Zeile im Text noch im Vorwort verrät uns den eigenen Standpunkt des Schilderers, der die Berichte der Chroniken sowie Briefe und Aufzeichnungen und Anekdoten aus dem cinquecento wie einst die Daten und Urkunden zu seiner Persergeschichte in Iran gesammelt hat, und sie nun in Dialogen lebendig zusammenreiht. Nichts von Abscheu oder moralischer Entrüstung über seinen Vorwurf ist aus diesen Szenen herauszulesen, und es ist kaum einem Historiographen gelungen, die Gestalten der Vergangenheit so getreu und klar in seinen Zauberspiegel einzufangen. Bei keinem seiner anderen Werke hat der Künstler Gobineau so schön dem Gelehrten beistehen und sein Wissen um die Dinge durch die seltene Gabe der Einfühlung in frühere Zeiten erwärmen können.
So schenken die Szenen Gobineaus uns ein Bild im Hochrelief von der „Renaissance“, das so wahr ist, wie es überhaupt ein Bildnis und Gleichnis sein kann, und wer an der Hand dieses Dichters jene Zeit, wie einst Dante an der Hand Vergils die Hölle, durchschritten hat, dem wird jedes andere Bild nur flüchtige Wassermalerei bedeuten gegen diese Erlebnisse.
[S. 257]
So war der Mensch Maupassant: Ein gut gewachsener, breitbrüstiger, muskulöser Kerl mit schönem, starkem braunen Haar, einem gewöhnlichen Schnurrbart und ein Paar großen ernsten Augen. Nichts fiel auf in seinem Gesicht, das dutzendweise vorkam und vorkommt, und hätte sein Name nicht einen so großen literarischen Schatten hinter ihm hergeworfen, kein Mensch hätte sich auf der Straße nach ihm umgeblickt. Seine braunrote Hautfarbe sagte einem, daß dies ein Sportsmann sei, und den kräftigen Armen sah man an, daß er tage- und nächtelang mit seinem Ruderboot auf der Seine verbracht hatte. Das war die schönste Zeit seines Lebens, als er noch im Marineministerium herumfaulenzte, als er noch nicht „schreiben“ konnte und an den Fingern nur Schwielen von der Ruderstange, nicht von der Feder hatte, und mit lustigen Freunden und Freundinnen zwischen sechzehn und dreißig die Umgegend von Paris auf dem Fluß von Charenton bis Argenteuil fröhlich machte. „Wir waren meist zu fünf Strauchdieben“, erzählt er später selbst mit der Wehmut und dem Stolz, die einem im Alter überkommt, wenn man von seiner verflogenen Jugend spricht. „Ich erinnere mich an so seltsame Abenteuer, so unwahrscheinliche Späße, daß sie heute niemand glauben würde. Man lebt heute so nicht mehr, selbst nicht auf der Seine, denn die tolle Phantasie, die uns beständig in Atem hielt, ist in den gegenwärtigen Seelen erloschen. Wir fünf besaßen einen einzigen Kahn, den [S. 258]wir mit großer Mühe erstanden hatten, und in dem wir gelacht haben, gelacht haben, wie wir nie wieder lachen werden.“ Das verlernte er immer mehr, das Lachen, mit jedem Tag, da er älter und reicher wurde. Aus dem jungen Burschen, bei dessen Liebesabenteuern ernste Männer wie Flaubert und Zola vom bloßen Zuhören Seitenstiche vor Lachen bekamen, kroch ein wohlbeleibter, ernster, blasierter Mann heraus, dem die Havannazigarre traurig wie ein Wurm im Munde hing, der „für keinen Groschen Poesie“ hatte, und aus dem das Lachen kurz und vertrocknet klang, wie aus einem, der den Witz schon kennt, dem er zuhören muß. Sein Geld machte ihm nicht die Freude, die er von ihm erhofft hatte. Er war als Schriftsteller ein größerer Geschäftsmann als Beaumarchais. „Ich schreibe keine Zeile unter einem Franc“, war seine Losung, und wenn er von Verlegern sprach, geschah es nie, ohne ein „diese Hunde!“ hinzuzufügen, und sein größter Ehrgeiz war, möglichst viele von ihnen zugrunde zu richten. Als Normanne schätzte er das Geld und konnte besser rechnen als drei Juden. So hatte er es in wenigen Jahren zu einem bedeutenden Vermögen gebracht; konnte sich eine Segeljacht, zwei Häuser, eines in der Normandie und ein anderes in Cannes und vierzehn Frauen in Paris halten. Konnte seiner Mutter Brillanten zu Weihnachten schenken und seinem Vater, der stets mindestens dreißig Meilen von ihr entfernt war, Zigarren schicken, wie sie die Königin von England nicht teurer rauchte, und hätte mit alldem glücklich sein können gleich Fortunatus mit seinem Glückssäckel.
[S. 259]
Aber sein Reichtum machte ihn ebensowenig fröhlich wie Schopenhauer und weiland König Midas: die Ärzte und seine Fettsucht verdarben ihm den Appetit, indem sie ihm, dem Feinschmecker und Vielesser, eine strenge Diät auferlegten. Das Rosenwasser, in dem er, ein Liebhaber von Wohlgerüchen, täglich badete, roch er schließlich gar nicht mehr. Von den Frauen war er übersättigt, sein Ruhm machte ihm auf die Dauer keinen Spaß mehr, und die Arbeit, die Zola jung erhielt, machte Maupassant, der stets sehr schnell und mit zwölf Atmosphären Druck schrieb und schaffte, nur nervös. Dazu kam ein vermutlich schon ererbter Hang zur Melancholie, der von Jahr zu Jahr wuchs und ihn immer mehr überschattete. Aus ihm entstand seine große Verehrung für Schopenhauer, in dessen Pessimismus er die ihm passende Weltanschauung fand, aus ihm seine Liebe zur Einsamkeit und zur Schweigsamkeit, sein Menschenhaß und seine Lieblingsbeschäftigung, den Spießbürger, ohne „Pardon!“ zu sagen, auf die Zehen zu treten. So erschien er in den letzten Jahren seines kranken Lebens als der dekadente Sproß eines französischen Adelsgeschlechtes nach der Revolution, dessen brutale Herreninstinkte sich statt in Hofintrigen oder gefährlichen Liebesabenteuern oder Feldzügen damit befriedigen mußten, Verleger um Geld zu pressen oder dem Herrn Meier und Schulze das schmutzige Hemd aus der Hose zu ziehen oder sich über die schiefgetretenen Absätze des Fräulein Soundso zu mokieren: als der blasierte, sich ewig langweilende, verlebte, reiche junge Herr, für den alles, was über der Materie [S. 260]war, Phrase hieß und abgedroschen war, wie er an Maria Bashkirtseff schrieb, und gegen den Lord Byron wie ein Naturbursche wirkt. So traf ihn sein Geschick, das noch viel grausiger war als das von Oskar Wilde. Am Tisch seiner Mutter in Nizza brach der Irrsinn in ihm aus, und Ibsens „Gespenster“ wurden lebendig. Er hatte noch die geistige Kraft zu einem Selbstmordversuch, aber die Dummheit seiner Diener verhinderte dies. Nach anderthalbjähriger Passionszeit starb er in der Zwangsjacke im Irrenhaus bei Paris. Seine letzten Worte kurz vor dem Tode — und man muß hierbei unwillkürlich an Goethes letzte vernehmlichen Worte: „Mehr Licht!“ denken — waren: „Finster, ach wie finster!“ Kein Geistlicher hat ihn begleitet. Zola, der Mutige, hielt an seinem Grabe die Leichenrede.
So aber war der Dichter Maupassant, der in diesem Menschen hauste: ein Schüler Flauberts, ohne jede Tendenz das Leben erfassend und beschreibend, wie es ist, nackt und nüchtern, nicht beschönigend, nicht verhäßlichend. Das Entsetzen über den Naturalismus hatte sich schon in Frankreich gelegt, als Maupassant zu schreiben anfing, so daß er es nicht mehr nötig hatte, ein Programm aufzustellen und zu verteidigen, was seiner Kunst nur zugute kam. Er war der größte Meister im Erzählen, den die Neuzeit kennt, und seine Lust zu fabulieren ist unerschöpflich gewesen. Vor allem im Beschreiben der Natur, die er mit dem scharfen Auge des Jägers aufs Korn nahm, ist er groß. Wenn er eine Landschaft betrachtete, die er schildern [S. 261]wollte, kniff er gern, ganz wie ein Jäger, ein Auge zu und brachte sie dann in ein paar Strichen, ein schreibender Impressionist, aufs Papier. Ein Stück Natur, an dem Flaubert und Zola noch drei Seiten vollmalten, zeichnete er in drei Zeilen, daß man es sah, roch, hörte und schmeckte. Vor allem die Normandie, seine Heimat, mit ihren Apfelbäumen und ihrer kräftigen salzigen Seeluft, und die Riviera, seine Nervenweide, mit ihren Palmen und ihrem lauen, sinnlichen Duft, traf er wie ein Photograph, und manche seiner Bilder daher wirken, wenn man sie liest, mit der Anschaulichkeit von Ansichtskarten. Unter den Menschen, die aus der Kamera seines Gehirns herauskommen, gelingen ihm die harmlosen Bürger und stumpfsinnigen Bauern am besten, und von den Frauen die mondänen, leichtfüßigen, parfümierten. „Du mußt den Kerl, den du beschreiben willst, an seiner Nase packen und hin und her biegen, bis du ihn in dir hast“, hatte ihn einst Flaubert gelehrt. Maupassant befolgte diese Regel so gut, daß man seine Menschen oft atmen zu hören glaubt. Gern allerdings versetzt er seinen Bürgern, wenn er fertig mit ihnen ist, zum Schluß mit seiner vornehmen Künstlerhand noch ein paar Maulschellen, wie Policinell alle Puppen herunterhaut, ehe sie in den Kasten kommen. Am sichersten ist Maupassant in der Wahl seiner Farben und Beiwörter. Während die Parnassiens zu seiner Zeit oft tage- und nächtelang nach einem passenden Adjektivum wie nach einem verlorenen Kragenknöpfchen herumsuchten, fand er ohne Federlesen schnell das richtige Epitheton. Wie er denn [S. 262]überhaupt ungeheuer rasch im Produzieren war und in zehn Jahren neunundzwanzig Bände zusammengeschrieben hat. Er hatte ebensolange dazu gebraucht, sich unter Flauberts täglichem Einfluß auf seinen Beruf vorzubereiten, und wenn er darum später die andern ganz langsam an ihren Büchern herumbauen und die Worte vorsichtig wie ein Apotheker prüfen und abwiegen sah, dann klimperte er wohl stolz mit seinen Goldstücken, blies den Rauch aus seiner kurzen Pfeife und sagte: „Seht ihr wohl, das kommt davon, daß ich mein Handwerk erst gelernt habe.“
Wenn er bei den Frauen, die er schildert, mehr das Sinnliche an diesen merkwürdigen Wesen betont, wie dies übrigens die Franzosen von jeher getan haben, so geschah dies keineswegs aus Frauenhaß, und Nietzsche hatte unrecht, wenn er ihn darum so klug wie die Kirchenväter nannte, die bekanntlich die Frauen noch als Bestien und nicht als Menschen ansahen. Gerade aus den letzten Werken seines Lebens, aus den Romanen „Fort comme la mort“ und „Notre cœur“ klingt eine so tiefe Verehrung für die Frau als die natürliche Gefährtin des Mannes seit dem Paradiese heraus, eine so edle und zarte Art der Hingabe an das andere Geschlecht, daß man sich verwundern muß, wie man diesen Künstler jemals neben Strindberg als Frauenfeind hat nennen können. Freilich — und hier rundet sich Maupassants nüchterner und darum grausamer Pessimismus — wird auch die Liebe nach seinem Bekenntnis keinen von der Einsamkeit befreien, in der ein jeder von uns lebt, leidet und stirbt. Diese trostlose Einsicht von dem Alleinsein [S. 263]des einzelnen, von dem Gefühl, daß wir alle einsame Feuer sind, kehrt stets als Refrain bei diesem Dichter wieder. Vor diesen großen, grauen Hintergrund sind fast alle seine Kreaturen gestellt, und vor ihm opfert ihr Schöpfer sie dem Leben oder dem Tode mit dem furchtlosen, verzweifelten, traurigen Mitleid des Pessimisten, indem er ihnen als einzigen Trost vor dem Ergrauen das große Wort des Buddhismus zuraunt: „Geh an der Welt vorüber, sie ist nichts!“
[S. 264]
In der Morgenstunde des ersten Dezembers 1900 erschien unter den ersten verdammten Seelen Oskar Wilde vor der Hölle. Er legitimierte sich als Verfasser der „Salome“, worauf man ihn ohne weiteres einließ und ihm eine bestimmte Zelle anwies. Er erkundigte sich sogleich bei dem Teufel, dem er zur besonderen Bedienung und Folterung überwiesen war, wann man in der Hölle Besuche mache oder empfange, und erfuhr zu seiner Freude, daß dies wie oben auf der Erde zwischen zwölf und ein Uhr oder abends um fünf Uhr geschehe und gestattet sei. Der Dichter lächelte dankbar gerührt, gab dem Teufelchen das letzte Frankstück, das er bei sich hatte, und erklärte, daß er zunächst seinen bewunderten Lord Byron besuchen möchte, und fragte, ob es weit zu ihm zu gehen sei. Worauf ihm der Bescheid zuteil wurde: „O nein, Sire, hier eben um die linke Ecke herum. Seine Lordschaft haben sich aus musikalischen Neigungen in der Nähe des deutschen Viertels angesiedelt!“
„Well!“ bemerkte Wilde und machte sich, nachdem er eine Stunde lang die nun einmal notwendigen Folterungen ausgehalten hatte, an die Toilette. Er schnitt sich die etwas zu lang gewachsenen Fingernägel und polierte sie, so gut es mit Stiefelwichse ging, die man ihm als Pomade hingestellt hatte. Zu einem Bade im Styx schien es ihm etwas kalt zu sein, und so verwendete er denn eine Stunde lang dazu, seine Krawatte zu binden, das einzige Bekleidungsstück, [S. 265]das man ihm vergönnt hatte. Denn jeder darf dort unten nur das Stück von seinem ganzen Habit tragen, das ihm am liebsten ist. Als die Höllenuhr zwölf schlug, machte er sich auf den Weg, nahm, um sich anmelden zu können, die schwarze Visitenkarte vorn von der Türe seiner Zelle, auf der mit seinem Blut geschrieben rot sein Name stand, und trat auf die endlos lange, schmale, finstere Gasse hinaus.
Als er so von Tür zu Tür herumtappte, begegnete ihm zu seinem Glücke Charon, der um diese Stunde den von dem ewigen Bellen und Anderketteliegen halb tollen Zerberus spazieren führen mußte. Der geleitete ihn brummend um die Ecke linkerhand, wobei der Zerberus, wie dies bei Hunden üblich, stehenblieb, vor die Behausung seiner Lordschaft, die um ein bedeutendes geräumiger war als die Zellen der Nachbarschaft. Auch hatte sie ein kleines, schwarzes Fenster nach der Straße zu, durch das Wilde vorsichtig hineinguckte, um sich zunächst über die Situation klarzuwerden.
Zu seinem Erstaunen entdeckte er, daß schon ein Besuch bei Byron war, und als er näher hineinguckte, sah er, daß es kein anderer als Shelley war, der dort, bloß mit einem Strohhut angetan, bei dem Lord, der seinerseits, vermutlich um seinen Klumpfuß zu verdecken, nur hohe, braune Stulpstiefel trug, zu Gaste war. Die beiden saßen mit übereinandergeschlagenen, knöchernen Beinen sich an einem Tisch aus Ebenholz gegenüber. Shelley rauchte aus einer Pfeife roten Qualm, und Byron selbst trank aus [S. 266]einer riesigen Flasche Feuerwasser. Sie waren mitten in einem Gespräch, und Wilde, der dies seltsame Bild nicht aufstören wollte, hörte draußen, unter dem Fenster geduckt, wie Lord Byron mit etwas heiser gewordener Stimme seinem Freunde erklärte:
„Du magst sagen, was du willst, Percy, die Engländer sind die knotigsten Kerle, die Gott oben herumlaufen läßt. Sie haben uns beide, weiß der Teufel, so gepiesackt, daß mir der Aufenthalt hier, ohne die blödsinnige Hitze, fast wie ein Sanatorium vorkäme. Und was machen sie mit allem ihrem Gelde, das sie der ganzen Welt abnehmen, sag’ mir doch! Seife, Maschinen und gute Kleider. Das ist ihre ganze Kultur.
Es kommt noch so weit, daß ich mich vor Horaz und Tibull, diesen römischen Griechen und Halbdichtern, schämen muß. Neulich sagte mir schon Ovid im Klub ganz anzüglich: ‚Ihr seid jetzt schon reicher, als wir jemals gewesen sind.‘ Ich dachte an Manchester und konnte nichts erwidern. Wir verkommen, mein Freund, auf unseren Millionen, und schließlich bleibt nur noch Shakespeare von uns übrig, wie Hannibal von Karthago.
Unterbrich mich nicht! Die Kunst gilt ihnen keinen Sixpence mehr. Maler werden zu Anstreichern und Dichter zu Journalisten in London gemacht. Ich hatte mich vor den Aristokraten um meine ganze Lordschaft gebracht, als ich mein erstes Gedicht fertig hatte. ‚Aber dafür sind doch Schullehrer da‘, sagte mir meine Mutter ganz entrüstet, und ich war wie von selbst zu den Whigs [S. 267]geworfen. Jeder Tory sah mich seitdem wie einen Seiltänzer an.
Als ich mein erstes Drama, es war der ‚Manfred‘, herausgab, warnte mich der Herzog von Devonshire: ‚O, armer Mann, denken Sie an Ihre unsterbliche Seele, ehe Sie Souffleur werden!‘ Es war am nämlichen Tage, als mir Goethe aus Deutschland schrieb: ‚Ich rechne es mir zur Ehre an, mit Ihnen in brieflichem Verkehr zu stehen. Ihre dramatischen Versuche werden im Lande Shakespeares sicherlich die große Anerkennung finden, die sie verdienen.‘
Jawohl, Herr Geheimrat, keine Schmiere hat sich drum bekümmert! Sieh dir doch ihr Theater an, Percy, zum Donnerwetter, wiewohl das Fluchen hier unten verboten ist, ehe du mich unterbrichst! Weißt du, was das Neueste auf englischen Bühnen ist? Dreifach verschiedenes Sonnenlicht, bunte Fräcke und echte Schneeflocken, die oben auf dem Schnürboden in einer Gefriermaschine hergestellt werden. Als jüngst Hamlet dort in halbem Mondlicht, umschneit, auf der Terrasse zu Helsingör erschien, rief man zum Schluß den Schnee statt des Hamlets heraus. Und als der Prinz gestorben war, lag er da, den Körper im Schatten, das Antlitz blau und die Hände rot beleuchtet, die Augen zur Decke gerichtet. Das andere war Schweigen. Im Hintergrunde hörte man sich Shakespeare dreimal knarrend im Grabe umdrehen.
Alle ihre neuen Stücke sind um der Kostüme oder der Requisiten willen geschrieben, die darin getragen oder schnell [S. 268]wie faule Wechsel herumgereicht werden. Die Wegweiser nach Griechenland sind abgehauen worden, und wer heute in London fürs Theater schreibt, der muß zuvor zwei Jahre lang zu einem Taschenspieler in die Lehre gehen. Die Poeten in England werden samt und sonders zu Spitzbuben, die sich vom Verblüffen nähren. Auch den irischen, leider etwas byronisierenden Duckmäuser haben sie dazu gemacht, der da draußen hinter dem Fenster steht, und der sich einsperren ließ, statt ihnen davonzulaufen.“
Damit stieß Lord Byron mit seinem Klumpfuß die Türe auf und zog den erschrockenen Wilde an seiner Krawatte in die schwarze Kammer herein.
„Nichts für ungut, mein Bester!“ fuhr seine Lordschaft fort, „ich erkannte Sie schon lange an dem roten Schatten, den Sie drüben auf die Behausung meines Freundes Garrick warfen. Es freut mich, daß Sie endlich zu uns heruntergekommen sind. Hier, Percy, hast du den jungen Athener aus Dublin, dessen ‚Salome‘ ich dir zum vorigen ersten April geschenkt habe. Ein nicht übles Buch, wenngleich es mir ein wenig zu stark parfümiert ist und nach Paris riecht wie eine Sumpfente.
Nehmen Sie Platz! Rauchen Sie oder trinken Sie? Es wird Ihnen sicherlich bei uns gefallen, wiewohl Sie — eine schlechte Wirkung vom Zuchthaus her! — eine gewisse Neigung zum Pietismus in der Nase haben.
Ich werde Sie heute abend zum Klub der Gemütlosen abholen. Sie finden ein paar reizende Menschen dort: Béranger, Heine, Aristophanes, Poë, Goldoni u. a. Die [S. 269]Gesellschaft ist völlig international. Wir erzählen uns Fragmente aus unserm Leben. Mein Freund Schumann macht Musik dazu. Leider ist das Lachen dort, wie überall hier unten in der Hölle, verboten.
Wenn Sie Shakespeare sehen wollen — gewöhnlich die erste Kuriosität für alle neu angekommenen Engländer —, so machen wir den kleinen Umweg über die Asphodeloswiesen, an dem Kessel der schlechten Mütter vorüber, in dem meine Mutter zu sieden den Jammer hat, während mein Vater auf dem Eis für die Jähzornigen ablagert. Shakespeare macht zwischen dem blühenden Schierling allabendlich mit Homer und Li-Tai-Pe seinen Spaziergang, da ihm die Gesellschaft des Sophokles wegen des ewigen Fachsimpelns, in das sie beide wider Willen stets hineingerieten, unerträglich geworden war.
Ich kann Sie leider nicht zum Diner begleiten, bei dem jeder Feinschmecker dazu verurteilt ist, die ihm nicht zusagenden Speisen zu verzehren, da ich Ludwig dem II., dem Bayernkönig — you know him! — versprochen habe, ihm den siebzehnten Gesang meines ‚Don Juan‘ vorzulesen, den ich hier im Inferno geschrieben habe, und in dem ich die neuesten Engländer, made in Germany, Spießruten laufen lasse. Seine höllische Herrlichkeit, der Satan selbst, haben mir zu Ehren in der Maske des ‚Kain‘ gleichfalls sein Erscheinen in Aussicht gestellt. Wenn Sie erst, wie ich heute, 75 Jahre in der Hölle gehaust und ihre Konventionen vergessen haben, werde ich Sie mit zu diesen intimen Zirkeln nehmen.“
[S. 270]
Damit reichte der Lord seinem verlorenen bürgerlichen Bruder die Hand, boxte Shelley freundschaftlich zur Türe hinaus und begann — darin bestand seine harte tägliche Pönitenz —, aus seinen Werken die mißlungenen Verse, die er nun nicht mehr ändern konnte, herauszusuchen und wehmütig zu betrachten.
[S. 271]
Wer im Februar des Jahres 1892 um die Mittagszeit auf dem Embanquement an der Themse in London auf und ab spazierte, der konnte fast täglich beobachten, wie ein höchst elegant gekleideter Herr in einem herrlichen Sealpelzmantel, eine Sonnenblume oder eine Pfauenfeder in der Hand tragend, gegen zwei Uhr vom Lunch aus einem der vornehmen Hotels am Strande dort heraustrat.
Er machte ein paar Schritte auf der Promenade, schaute aus seinen großen, glaskugelartigen Augen zerstreut oder phlegmatisch ein wenig dem Leben auf der Themse zu oder blickte dem Rauch seiner Zigarette nach, drehte seine von grünen und blauen Steinen funkelnden Ringe zurecht, pfiff schließlich einem Cab, drückte dem Bummler, der ihm den Schlag öffnete, einen Schilling in die Hand und rollte von dannen in den Hydepark oder irgendwohin, wo die große Welt sich amüsierte.
Dieser Mann im Sealpelzmantel mit der Sonnenblume und den bunten Ringen und der Zigarette und den großen, glaskugelartigen Augen war Oskar Wilde, der damals im Zenit seines Ruhmes stand und sich den „König des Lebens“ nannte, der 300000 Schilling im Jahre einnahm, die er bis auf den letzten Heller für sich und seine Lebensführung verbrauchte.
Von Hydepark fuhr er dann zum Tee zu irgendeiner Gräfin oder Fürstin, die ihn — er war damals das Orakel des guten Geschmacks für die ganze Aristokratie Londons —über [S. 272]holländisches Porzellan oder altfranzösische Gobelins oder japanische Holzschnitte oder sonstige geldverschlingende Passionen um Rat fragte. Bisweilen traf er dort auch zufällig seine Gattin mit dem einen oder anderen seiner beiden Söhne. Man redete ein paar Worte zusammen: „Sie auch hier, Madame?“ — „Du wirst ja ein hübscher Bengel, my boy!“ und Oskar fuhr, sich mit einer geschickten Wendung einen „guten Abgang“ machend, von dannen. Zu einem Diner bei Lord Douglas oder Comte d’Orsay oder Fürst Metternich oder zu einem der vornehmen Klubs im Pall Mall, wo der Prinz von Wales verkehrte, und wo Wilde seinen Geist und sein Geld, beide unerschöpflich, an die vornehme Welt verspielte.
Oder es gab eine Premiere für ihn an jenem Abend, ach, ja richtig, „Lady Windermeres Fächer!“ wurde heute im St. James-Theater aufgeführt. Und er fuhr hin in dem Gehrock Londons, mokierte sich hinter den Kulissen über die guten, beschränkten Leute, die da vorne vor Lachen tobten und Beifall brüllten, und trat schließlich vor den Vorhang, eine grüne Nelke im Knopfloch, die brennende Zigarette in der Hand und sagte so blasiert als nur möglich: „Ich konstatiere mit Vergnügen, daß das Stück dem Publikum zu gefallen scheint.“
Oder er fuhr mit ein paar Freunden oder noch lieber ganz allein in einem eigens zu diesem Zweck gekauften schlechten Anzug nach Whitechapel oder zu den Docks am Horizont der Riesenstadt hinaus und trieb sich bis zur Erschlaffung in den Opiumhöhlen herum und genoß das Laster mit [S. 273]geschlossenen Augen, wie ein Kind Süßigkeiten herunterlutscht.
Oder er gab ein Fest in seinem Hause, das mit Kunstschätzen vollgepfropft war wie ein Museum, bei dem es neu entdeckte Speisen gab, Premieren von Bowlenmischungen, und bei denen ein Diener ein Vermögen verwüstete, wenn er ein Sauciere fallen ließ.
Oder Wilde reiste, wenn er London und die Lords leid war, auf acht Tage nach Paris, wo er ständig eine große, nur selten benutzte Wohnung auf dem Boulevard des Capucines unterhielt, und wo alte Freunde und neue Freuden seiner warteten.
So lebte damals dieser Mensch, der nach seinem eigenen Ausspruch sein Genie an sein Leben, an seine Werke nur sein Talent ausgegeben hat, und alle Welt war entzückt von ihm oder beneidete ihn.
Wer drei Jahre später als diese Zeit, da sein Glück im Zenit stand, nur gewagt hätte, den Namen „Wilde“ in einem Salon Londons auszusprechen, wäre gesteinigt worden. Der Mann dieses Namens, dem einst der König von England kordial verschmitzt die Hand gedrückt hatte, saß zusammengekauert in einer Art Kaninchenstall, im Zuchthause zu Reading, und mußte mit der kahlen Hand, an der einst die bunten Ringe funkelten, alte Säcke flicken und Taue zerpflücken. Er war vom Schwurgericht zu London als Verderber der Jugend, als sittenloser, unmoralischer Mensch zu zwei Jahren Zuchthaus verurteilt worden. Seine Haltung vor den Geschworenen war glänzend und ein letztes [S. 274]Leuchten der Ritterlichkeit, die im Dandytum steckt. Er widerrief kein Wort von dem, was er geschrieben hatte, und zuckte nur leise nervös mit den Schultern, als der Urteilsspruch ihm in die Ohren klang, während draußen der sittliche Pöbel Londons vor dem Gerichtsgebäude bei der Nachricht kannibalische Freudentänze aufführte. Und er ging aufrecht, ohne daß seine Füße schauderten, in die Nacht der Gefangenschaft, die ihn vernichtete.
Viele schlechte Psychologen haben sich damals gewundert und wundern sich noch heute darüber, daß Wilde nicht die Frist bis zu seiner Verhaftung, die das Gericht — vielleicht absichtlich — in die Länge zog, benutzte, um ins Ausland zu fliehen. Was ihn daran hinderte, war einmal die grausige Neugier, die Leiden zu schmecken, nachdem er alle Freuden durchgekostet hatte, die teuflische Lust, in den Schatten zu gehen und die andere düstere Hälfte des Daseins zu betreten. Und zum andern war es das brünstige Verlangen des, der sich schuldig fühlt, nach Gerechtigkeit, ob sie ihn auch auslöschen mag, der Schrei des einzelnen, der seine Macht und damit sein Recht überschritten hat, nach Sühne, dieser seltsame soziale Trieb im Verbrecher, der einen Raskolnikow zur Anzeige seiner Mordtat, einen Wilde zur Anerkennung und Abbüßung seiner ihm gleichsam von ihm selbst verhängten Strafe treibt. Weil er nicht wie Krupp bei uns den Mut hatte, selber einen Strich durchs Leben zu ziehen, hatte er dafür etwas nicht minder Gutes, nämlich die fixe Idee, nach der Zuchthauszeit ein neues Leben zu beginnen und mit neuen Kunstwerken [S. 275]die Schmach, die auf der schwarzen Tafel seiner Vergangenheit stand, fortzutilgen und sich so wiederum die Welt zu erobern.
Wie unmenschlich er unter dem mittelalterlichen Vollzug seiner Strafe gelitten, das wird jedem aus seiner Ballade vom Zuchthause zu Reading fürchterlich in die Ohren gellen. Nur eine kleine Geschichte sei hier noch erwähnt, die man nicht erzählen und anhören kann, ohne von Wut ergriffen zu werden: Es war in der ersten Hälfte seiner Leidenszeit. Wilde wurde nebst mehreren anderen aus dem Zuchthause zu Wandsworth nach Reading transportiert. Man mußte den Zug wechseln, und der Trupp der Sträflinge stand eine Weile wartend auf dem Bahnsteig einer kleinen Station. Ein paar Kaufleute gingen auf und ab und sprachen wohl über die beste Möglichkeit, der Konkurrenz den Hals zu brechen. Plötzlich bemerkt einer Wilde unter den Kurzgeschorenen. „Das ist ja Oskar Wilde!“ ruft er, geht auf ihn zu und spuckt ihm, der ihn, ohne zu zucken, aus seinen großen, glaskugelartigen Augen ansieht, mitten ins Gesicht hinein. Dieser Mensch, den die Gesellschaft frei laufen ließ, hätte siebenmal den Galgen verdient.
Der Dichter ist nach seiner Entlassung aus dem Kerker nicht wieder in die Höhe gekommen. Er hatte nicht mehr die Kraft, die vita nuova, von der er geträumt hatte, zu beginnen. Das Sträflingsmal war ihm zu tief in die Seele gebrannt, als daß er den Mut zu neuen Werken gefunden hätte. Verkommen, vom Zuchthausbrei aufgetrieben und häßlich geworden, lebte er noch ein paar [S. 276]Jahre in Paris, oft so arm, daß er frühere Freunde um einen Absinth anborgen mußte, bis er im Nebelmonat des Jahres 1900 in einem kleinen Hotel im Quartier Latin verendete. Ein halb Dutzend Genossen aus alter Zeit geleiteten ihn, den einstigen Liebling von ganz London, zum Armenkirchhof; ein einziger Kranz hing an seinem Sarge. Er war von dem Wirte, bei dem er gewohnt hatte. „Meinem Pensionär!“ stand auf der Schleife gedruckt.
So endete dieser Mensch, dessen Leben viel mehr Bedeutung hat als seine Werke, dessen erste Tat nach seiner Entlassung aus dem Zuchthaus — dies beweist seine Güte — ein offener Brief war mit einem eindringlichen Protest gegen die Entlassung eines Gefängniswärters, der einem hungrigen Kinde ein paar Keks gegeben hatte, dessen witzige Stücke — dies beweist seinen überlegenen Verstand — von ihm alle spielend, meist wegen Wetten hingeschrieben wurden, und dessen Lieblingszitat — dies beweist seine Vorurteilslosigkeit — die Worte des greisen Königs Lear im Shakespeare waren: „Kein Mensch ist sündig; keiner, sag’ ich, keiner. Und ich verbürg’ es.“
[S. 277]
In der grauen Frühe eines Wintermorgens im Jahre 1849, in diesem Jahre voll von Ängsten, Qualen und Unterdrückungen für ganz Europa, wurde Fedor Dostojewski, eines reichen Arztes Sohn, gewohnt, fünfmal in der Woche sein Hemd zu wechseln, samt seinen Kameraden aus dem bleiernen Schlaf geweckt, den er auf der Pritsche in den feuchten Gefängniszellen von Schlüsselburg schlief. Aus wilden, garstigen Träumen, die wie zerfetzte Wolken über ihn herflogen, wurde er von Gendarmen wachgeschüttelt. Er wollte sich von dem Unrat der Nacht und der Unsauberkeit des Kerkers reinigen, aber der Mann in Uniform, eine Talgkerze in der Hand, wehrte ihm ab: „Es hat keinen Sinn mehr, Väterchen!“
Im selben Augenblick wußte Dostojewski, daß es zum Tode ging. Dem Gefühl der Erleichterung, das seine wie ein Grab eingefallene Brust für einen Augenblick emporhob, folgte sogleich eine entsetzliche Angst, die ihm den Schweiß auf die Stirn trieb. „Mein Gott! Mein Gott!“ sagte er nur, sich selbst ein Echo. Die Gefangenen wurden wie Schlachtvieh hinausgetrieben. Sie sahen sich beim Licht der Blendlaternen, die wie rote, entzündete Augen aus dem Morgennebel glänzten, aus dem Gefängnis zur Richtstätte wanken, zehn bis fünfzehn schlotternde, halb schon leblose Menschen, eine Schaufel voll für den Satan. Sie waren samt und sonders in die sogenannte Petraschewskische Verschwörung verwickelt gewesen, einen jener zahlreichen [S. 278]Versuche nach 1848, die in Frankreich errungenen Volksfreiheiten auch in östliche Länder zu verpflanzen, Experimente, die Zar Nikolaus I., der absoluteste Monarch Rußlands, nur auf den Tod leiden konnte. Die Gefangenen trotteten stumm, ohne einen Seufzer von sich zu geben, auf das Peloton Soldaten zu, die in einer Ecke des Gefängnishofes bereitstanden, ihre Brüder kaltblütig umzuschießen. Man sah die Gewehre an ihren Beschlägen und Bajonetten in der Ferne hin und wieder aufblitzen. Trotz der Totenstille hatte man das Gefühl, als ob die Luft einen dumpfen Ton von sich gäbe. Die Gefangenen und die Soldaten näherten sich einander. Obgleich das Militär ganz stillstand, schien es den Verurteilten doch, daß sie ebenso langsam auf sie zukämen. In einer Entfernung von zwanzig Schritten vor den Bewaffneten waren drei Pfähle in die Erde gegraben, gegen die sich die Gefangenen anlehnen konnten. Auch war den Soldaten damit das Zielen erleichtert.
Man führte die drei ersten zu den Pfählen hin, zog ihnen die Todeskleider, lange, weiße Hemden, an und schob ihnen als Zeichen des Mitleids weiße Mützen über die Augen. Der Pope trat an jeden mit einem Kreuz heran. In einer geringen Entfernung zur Seite zu — vor erst sechzig Jahren ist dies alles dem größten russischen Genie vor eigenen Augen begegnet! — schaufelten ein paar Arbeiter emsig wie Aaskäfer den Opfern das Massengrab.
Dostojewski war als achter an der Reihe, er sollte also mit der dritten Abteilung zu den Pfählen hingehen. Er [S. 279]wußte, daß er nicht mehr als fünf Minuten zu leben hatte. Er hat später oft erzählt, daß ihm diese fünf Minuten als eine endlose Zeit und ein unermeßlicher Reichtum erschienen wären. Er habe sich diese Zeit sogar eingeteilt und zwei Minuten davon bestimmt, sich von seinen Kameraden zu verabschieden, zwei weitere Minuten dafür, um ein letztes Mal im stillen nachzudenken — wer, wer hat den Mut, wenn er dieses liest, einem Menschen den Tod zu geben? Die übrige Frist, eine ewige Minute, wollte er dazu benutzen, um noch einmal zum letztenmal um sich zu schauen. Die ersten zwei Minuten für den Abschied von den Kameraden seien schnell verstrichen, aber die beiden folgenden, die er für das stille Nachdenken angesetzt hatte, haben ihm endlos lang gedeucht. Es sei ihm unmöglich gewesen, sich auszudenken, daß er jetzt noch lebte, in drei Minuten aber irgend etwas anderes irgendwo anders sein sollte. In der Nähe habe ein Turm gestanden, dessen vergoldetes Dach im ersten Morgensonnenschein geleuchtet habe. Dieses glitzernde Licht schien ihm schon zu jener neuen Natur zu gehören, und er glaubte, er würde in drei Minuten irgendwie mit ihm verschmelzen.
In diese fast schon irren und haltlosen fliegenden Gedanken des Verdammten da unten wurde plötzlich eine weiße Fahne an dem Turm emporgezogen. Auf einen Befehl ihres Offiziers ließen die Soldaten die schon erhobenen Gewehre sinken. Der dem Gefängnis vorstehende Major trat herzu und verkündete den schon zu drei Viertel toten Gefangenen, daß die Güte des Zaren das Todesurteil aufgehoben [S. 280]und sie zu zehnjähriger Zwangsarbeit in Sibirien begnadigt hätte.
Dieses echte Stückchen einer absoluten Zarenlaune, diese grausame Galgenfrist, diese kurze halbe Stunde zwischen Tod und Leben hat Dostojewski, der schon von Geburt an Fallsucht litt, für immer in seinen Nerven behalten. Die Spanne Zeit, in der er Abschied vom Menschendasein genommen hatte und in das stygisch kalte Wasser des Nichtmehrlebens untergetaucht war, hat sich ihm tiefer eingebrannt, als alles Elend, das nachher kam, die fünf Jahre lange Gefangenschaft in Sibirien und der Heeresdienst, den er als Gemeiner in der russischen Armee antreten mußte, bis ihn Alexander II., Rußlands edelster und unglücklichster Monarch, bei seinem Regierungsantritt begnadigte. Sibiriens Glut und Eis, die Öde seines Gefängnisses dort, des „Totenhauses“, zwischen Palisaden und Sträflingen, niemals allein — das war das gräßlichste dabei für diesen zarten Menschen! — die Roheiten beim Militär, alles war leichter zu ertragen und zu vergessen als jene bangen Kirchhofsminuten vor dem Tode, da man ihm die Hoffnung, das letzte Gut des Ärmsten, unter den Füßen fortgeschaufelt hatte und er wie Dantes Verdammte „senza ogni speranza“ im Inferno, in der Luft, im Nichts schwebte.
Es ist leicht auszudenken, wie ein Mensch, der aus dieser Region her zum Leben, zu Menschen heimkehrt, als Schriftsteller schaffen und wirken wird. Eine so gerüttelte Seele muß unrein fließen und strömen, eine heruntergestürzte, soundso oft zersprungene und zerborstene Glocke wird anders klingen [S. 281]als eine, die hoch über allem Volke im Glockenstuhle hängt und nur am Feierabend und an Festtagen ihre Stimme erhebt. Was Dostojewski in die Zvilisation Rußlands nach Petersburg mitbrachte, als er gebleicht von Gefängnisluft, ergraut von Erniedrigungen aller Art, mit vierzig Jahren die Feder nahm, seinen ersten großen Roman zu schreiben, das war die tiefe Kenntnis des russischen Volkes, der russischen Seele. Wie kein Künstler, kein anderer Mensch mit Nerven und Geist in seinem Lande ist er durch ein gemeinsames Schicksal mit seiner Rasse, seinem Volke vermengt und verknetet worden. Tolstois Annäherungsversuche an das russische Bauern- und Volksleben wirken dagegen wie Spielerei, die Laune eines großen Mannes, der auch hinter dem Pflug und im Kittel ein Graf bleibt, und Gorkis Jugendschicksale wie die Wander- und Handwerksburschenjahre eines begabten jungen Menschen, der früh solchen Kreisen entwächst und schnell sein Ziel erreicht. Dostojewski wurde durch ein Geschick, das ihn zu den Paria warf, mit der Hefe seines Volkes vertraut und vermischt. Sechs Jahre seines Manneslebens verbrachte er auf dem Grunde, in der Tiefe zwischen russischen Leuten, durch nichts vor ihnen ausgezeichnet und gesondert, ihnen gleich an Armut, Nahrung, Kleidung und Schicksal.
Nach Petersburg heimgekehrt, fand er die Literatur seines Volkes vor allem durch Turgenjews Einfluß noch mehr europäisiert, als sie es schon durch Puschkin geworden war. Turgenjews erste gefällige Novellen, die nach Pariser Geschmack zugestutzt waren, beherrschten den Büchermarkt.
[S. 282]
Da machte sich Dostojewski mit im Zuchthaus erlerntem geduldigem, zähem Fleiß daran, noch einmal von neuem zu schreiben anzufangen, ganz ohne Vorbild und ohne Rücksicht auf den Geschmack und die Wünsche des gebildeten Publikums, das auf den Boulevards von Petersburg fast das gleiche wie auf denen von Paris verlangt. Es war die Seele seines Volkes, die russische Seele, die er sich in tausend Bildern und Gestalten vom Herzen schrieb, das eigentümliche gemeinsame Wesen dieses Menschenhaufens, der das weite, weite, weite Land von der Weichsel bis zur Wolga und darüber hinaus bis nach Sibirien bewohnt. Keiner hat die russische Seele, dieses unergründliche Mysterium eines Volkes, das uns verwandt und fremd ist, das Werden und Weben seines Wesens so erschöpfend geschildert wie Dostojewski. In tausend Saiten, auf tausend Seiten schlägt er das Melos seines Volkes an. In langen, auch darin seinem Lande ähnlich, weithinschweifenden Romanen — sein größter Roman, die „Brüder Karamasow“, umfaßt mehr als sechzehnhundert Seiten, und dies war erst als Prolog zu einem großen Roman gedacht — schildert er die hervorragendsten Typen seines Vaterlandes. Durch ihre Ausdehnung allein wären diese Romane Dostojewskis Unika der Weltliteratur, wenn sie es nicht auch durch die Ausdehnung ihres Stoffes und der Figuren wären. Wir sehen in ihnen das heilige Rußland vor uns von einem Dichter umgepflügt, Menschen begegnen uns, die Tausende Rubel verschwenden und um eine Kopeke schreien und geifern können. Freunde, die ihre Geheimnisse, ihre Liebsten und [S. 283]die geweihten Kreuze auf ihrer Brust miteinander tauschen und hinterdrein einer dem anderen auflauern, um einander zu ermorden. Frauen, die sich jedem für Geld hingeben, in Palästen und Pelzen sitzen, um auf einmal alles zu verlassen und arm auf die Straße zu rennen. Säufer, die den Wodka literweise trinken und plötzlich in der dunklen Weise der Offenbarung des Johannes reden und in ein Kloster gehen, Bauern, die sich gut vertragen, und von denen unvermutet der eine den anderen um eine silberne Taschenuhr wie einen Hammel mit einem Messer von rückwärts abschlachtet, wobei er sich bekreuzigt und im stillen betet: „Herr, verzeihe mir um Christi willen!“ Männer, die sich jahrelang hassen und fremd aneinander vorübergehen, bis sie sich eines Abends in die Arme sinken: „Wir sind alle lächerlich gute Menschen.“
Die Gegensätze, die die menschliche Brust umspannen kann, kommen bei diesen breit angelegten, einen halben Erdteil umfassenden Menschen herrlich zum Ausdruck.
Wir lassen es uns heute meist bei dem einen Typus, den Dostojewski in Raskolnikow geschaffen hat, dem russischen Intelligenzler, genügen, dem Mörderdilettanten, der seine Tat nicht tragen kann, vor einer Maus erschrickt, mit einem Kanarienvogel fühlt und eine alte Vettel ermordet, der sich in krankhaftem Ehrgeiz ein Napoleon dünkt und über diese einzige Untat, die er nicht zur Guttat in seinem Busen stempeln kann, ins Stolpern kommt. Dostojewskis andere „Helden“ — er darf sie so nennen — Idioten, Sträflinge, Abbilder Christi, die alle [S. 284]lieben und für alle Menschen leiden möchten, Träumer, Phantasten, von Dämonen Besessene, sind bei uns kaum bekannt. Das wundersam weiche Wesen dieser Leute, die zwischen Extremen hin und her fallen, die sich ihren Gefühlen noch rückhaltlos hingeben, die jeden Augenblick wieder ohne Vorurteile und ohne Bedenken sein können wie Tartaren, „aus dem Tartarus“, der Unterwelt Gekommene, kurzum die russische Seele hat Dostojewski in seinen Werken vor allen anderen wiedererschaffen. Darum ist er der größte Dichter Rußlands, und für jeden Fremden, der diesem Volke nahekommen will, geht der Weg auch heute noch durch ihn und seine Werke hindurch.
[S. 285]
Im Frühsommer 1886 saß wie gewöhnlich nachmittags um diese Zeit ein älterer, ziemlich beleibter Herr im schwarzen, sorgfältig abgebürsteten Gehrock, mit langen weißen Haaren und mit ebensolchem Bart an den Backenseiten seines Professorengesichts vor einem Tisch im Café Opera in München. Kaffee und Kognak standen neben ihm, und auf den beiden Stühlen ihm zur Seite lagen hochaufeinander Haufen von Zeitungen und bunten Wochenblättern. Er hatte soeben mit dem letzten Schluck Kognak die letzte Zeitung erledigt und guckte nun aus kleinen verschmitzten Äuglein starr vor sich hin, während hinter seiner hohen wuchtigen Stirne die Gedanken über das Gelesene wie Mäuschen im Speicher hin und her liefen. In diesem Augenblick setzte sich ein etwa zehn Jahre jüngerer Herr, ein gemütlicher, korrekter Fünfziger mit den Worten: „Sie erlauben doch!“ zu ihm an seinen Tisch.
„Bitte sehr, Herr Leutnant oder Herr Hauptmann — ich werde das nie auseinanderhalten können —, ich wollte ohnedies gehen.“
„Ach! Sie sind’s, pardon, Herr Doktor Ibsen!“ sagte der Jüngere, der kein anderer war (wie es in seinen Erzählungen hieß) als der Dichter Martin Greif, der, nachdem er sich als Offizier unter seinem wirklichen Namen [S. 286]„Herman Frey“ hatte pensionieren lassen, nun in München wie Ibsen als vogelfreier Greif und Dichter lebte.
„Also, wie geht’s Ihnen denn, Herr Doktor, was machen Sie, was schreiben Sie jetzt?“ fragte Greif weiter.
„Ich weiß es nicht recht,“ meinte Ibsen, „und Sie?“
„Ja, ich habe soeben meine beiden Hohenstaufendramen ‚Heinrich der Löwe‘ und ‚Die Pfalz im Rhein‘ vollendet und bin nun an den Vorstudien zu meinem ‚Konradin‘. Kommen Sie nur einmal vormittags auf die Bibliothek! Da können Sie mich hinter Büchern und alten Manuskripten schwitzen sehen. Erst muß man die Historie intus haben, ehe man ans eigentliche Dichten herangehen kann. Wissen Sie, einen ‚Konradin‘ muß man schreiben, wenn man überhaupt die Hohenstaufen sich vornimmt. Das ist der Gipfel, die blutige Krone des Ganzen. Und gibt es wohl in der ganzen Welt etwas Tragischeres als diese edle, reine Jünglingsgestalt, die seiner Ideale voll gen Italien ziehet, seine Väter zu rächen und zu erfüllen, und die welsche Hinterlist in Neapel unter dem Beil des Henkers verenden ließ?“
„Ich weiß es nicht,“ warf Ibsen mit seiner hohen spitzen Stimme ein, „mir ist er freilich so gleichgültig wie Ihnen vermutlich Olaf der Heilige, der sein Reich an Knut den Großen verlor und im Meer ertrunken sein soll, was auch keine schöne Todesart ist.“
„Ja, Sie sind eben kein Deutscher, Herr Doktor, verzeihen Sie, aber wenn unsereins schon als Kind von Barbarossa und den anderen großen Hohenstaufen erzählen hört, [S. 287]vibriert es in ihm vor Begeisterung, und wenn er Konradins bejammernswertes tückisches Schicksal nur liest, dann muß er gar mit den Tränen kämpfen.“
„Das mag sein, Herr Greif, aber aus Kindern werden schließlich doch einmal Männer. Und die pflegen bei uns in — Norwegen wenigstens ganz andere Interessen zu haben als die Kreuzzüge, die Hohenstaufen und Olaf den Heiligen. Und am Ende sind die Theater wohl auch bei Ihnen nicht nur für die Kinder aufgebaut!“
„Ich weiß, Sie sind auch einer von den ganz Modernen mit Ihrer ‚Nora‘ und Ihren ‚Gespenstern‘ und wie die Sachen alle heißen mögen, mit denen Sie die Menschheit verbessern wollen. Nicht um ein I-Tüpfelchen werden Sie die Welt anders bekommen durch Ihre Dramen. Alles bleibt schließlich beim alten.“
„Wie zu Zeiten Konradins,“ entwaffnete ihn Ibsen lächelnd.
„Und sie bewegt sich doch, hat schon Galilei, glaube ich, im Kerker gesagt. Sie können doch nicht im Ernst ein Weiterschreiten der Menschheit leugnen.“
„Fällt mir auch gar nicht ein! Ich konstatiere nur, daß es nicht Sache des Theaters ist, Politik zu treiben und Tagesfragen zu erledigen. Dafür sind die Zeitungen da, die da in zwei hohen Bergen um Sie liegen. Dafür ist die Bühne zu schade, sind die Schauspieler zu schade, und ist das Publikum zu schade.“
„So, das ist ja kurz und bündig, wie Sie mich zu den Toten werfen. Und dabei habe ich mir, Sie wissen, ich mag meine Stücke selber nicht sehen, das einzige darauf [S. 288]eingebildet, daß sie kein totes Theater sind, sondern so lebendig wie Sie und ich Gott sei Dank noch sind. Und daß sie darum ihr Publikum, ihr großes Publikum finden werden. Denn sie sind Geist von unserer Zeit, und ich bin, wenn ich mich einmal in meiner früheren Berufssprache so ausdrücken darf, nur der große Destillator gewesen, der die Zeit um mich, wie ich sie sehe, filtriert und den Extrakt daraus in seinen Stücken wiedergegeben hat. So etwas Ähnliches sagt wohl auch, wie ich mich aus meiner Studentenzeit entsinne, ein gewisser Shakespeare im ‚Hamlet‘, glaube ich, wo er die Kunst des Schauspiels als ‚Spiegel und abgekürzte Chronik des Zeitalters‘ bezeichnet. Ich befinde mich also auch für Sie in nicht allzu schlechter Nachbarschaft.“
„Hm!“ knurrte Greif, „vom Standpunkt des Publikums aus können Sie alles entschuldigen: Seiltänzer, Bauchredner, Operetten, Schwänke, Possen, Ballettänzer, Taschenspielereien — — —“
„Und auch meine Stücke, nicht wahr?“ unterbrach ihn Ibsen freundlich. „Ja, aber um des Kuckucks willen, warum schreiben wir denn eigentlich unsere Stücke, wenn nicht des leidigen Publikums wegen? Damit wir sie im Spind liegen haben oder bei Cotta oder Brockhaus oder Reclam oder Hegel in Kopenhagen mit oder ohne Goldschnitt auf dem Lager verstauben lassen? Sie sollen doch gelesen werden von möglichst vielen und aufgeführt werden, wo nur ein Vorhang und Soffitten hängen. Die meisten von uns — Ihre Finanzverhältnisse mögen glücklicher liegen — wollen doch davon leben, wie [S. 289]jeder andere Arbeiter von seiner Arbeit. Von dem Gezeter über die Dummheit oder Faulheit des Publikums wird keiner auf die Dauer satt, geschweige denn fett.“
„So, also Anpassung an den Massengeschmack, Konzession dem Schaupöbel aus Liebe zum täglichen Brot oder Kuchen! Pfui, Herr Doktor, in das Horn der Tantiemenmacher stoßen Sie mit hinein! Die künstlerische Gewissenlosigkeit der französischen Boulevardstückfabrikanten wollen Sie zur Maxime für uns dramatische Dichter erheben! Nein, da mache ich nicht mit, ganz und gar nicht! Lieber wollte ich verhungern, ehe daß ich aus Rücksicht auf Tagesruhm oder Theaterdirektoren oder das Goldene Kalb irgendwie Zugeständnisse machen würde.“
„Sie sollten nicht so verwegen vom Hunger sprechen, Herr Greif! Ich weiß, so gut wie Zola in Paris, was das Wort auf und hinter sich hat, weiß es auch, was es heißt, keine Konzessionen machen, und habe es am eigenen Leibe wohl und wehe durchgemacht und in den meisten meiner Stücke gefeiert wie nichts auf der Welt. Aber klein beigeben müssen wir doch, wenn wir unter und mit Menschen leben wollen. Wir müssen unsere Uhr nach der Zeit einstellen, in der wir stehen. Darum meine ich zunächst, wir sollen auch unsere Stücke so zusammensetzen, daß uns das Publikum von heute dabei aushält und nicht eher wegläuft, bis das letzte Wort gefallen ist und der Vorhang das Stück wie eine Schere oder ein Fallbeil abschneidet. Und darum meine ich zweitens, sollen wir auch unsere Stoffe aus dem Menschenleben um uns herum und nicht [S. 290]aus den Geschichtsbüchern herholen. Schelten Sie mir die Zeitungen nicht, sie stehen stets wie offene Photographenkästen bereit, alles aufzunehmen, und bringen unsere Zeit blitzschnell und haarscharf auf die Platte. Man kann manches davon gebrauchen, wenn man ans Malen oder Dichten selber geht. Was nützen uns die schönsten historischen und poetischen Stücke, wenn das Parkett dabei kalt bleibt und die Galerie lau, und der erste Rang nur immer bei den Aktschlüssen, wenn mechanisch geklatscht wird, aus dem Schlaf erwacht. Die modernen Franzosen sind gar nicht so dumm, wenn sie nur Menschen auf die Bühne bringen, die im Theater selbst überall herumsitzen, also daß die Szene nur ein verlängertes Stück Parkett ist. Glauben Sie mir, ich habe dreißig Jahre lang um Lea gedient und Stücke für sogenannte Gebildete geschrieben und die Geschichte wie ein Eidervogelnest ausgenommen bis in die Wikingerzeit und Kaiser Julian, bis ich endlich merkte, daß es nur Rahel war, die ich liebte und gewinnen wollte, das Volk, die breite Masse, das große Theaterpublikum, die ganze Gesellschaft unserer Zeit. Um die will ich die dreißig letzten Jahre meines Lebens werben mit aller Kraft und Kunst, die mir verliehen ist, werde mich ihren Launen und Nerven mit meinen Stücken äußerlich in der Technik, wie auch innerlich in der Weltanschauung fügen. Ich werde mein Thema — und schließlich ist jedem Künstler nur ein Thema gegeben — nach allen möglichen Seiten variieren und den Leuten immer wieder anders zu kommen versuchen. ‚Anders und doch derselbe!‘ wie ein [S. 291]Sprichwort im Norden heißt. Namentlich die Invaliden des Lebens um mich herum will ich mir aufs Korn nehmen und einen nach dem andern abschießen, und wenn mir selber das Herz dabei weh tut.“
„Sehen Sie nur zu,“ warf Martin Greif dazwischen, „daß Ihnen einer nicht dabei verlorengeht, wenn Sie dem Publikum nachlaufen oder meinetwegen, wie Sie meinen, voranmarschieren: der bessere Teil von Ihnen, der Dichter Ibsen!“
„Den hoffe ich gerade auf meinem neuen Wege immer mehr zu finden. Wissen Sie, früher in meiner ‚ersten Periode‘, wie Ihr Schiller gesagt hätte, kam ich mir stets wie auf einem Maskenball vor, einmal als Wiking oder als Römer, oder als Sören Kierkegard verkleidet. Und das war mir sehr ungemütlich. Und wenn ich mich aus Verlegenheit ganz phantastisch gebärden wollte, dann mußte ich immer an einem Untier vorbei, das vor dem Parnaß lag, wie einstmals die Sphinx vor den Toren von Theben. Dies scheußliche Ungeheuer hieß — Shakespeare und stürzte jeden Dichter, der das Rätsel vom Menschen nicht raten konnte, in den Abgrund hinunter. Und wenn ich die vielen Dichterknochen sah, die da unten bleichten oder wie alte vergessene vermoderte Bücher verfaulten, da wurde mir noch ungemütlicher zumute. Und darum beschloß ich, meinen Ehrgeiz darin zu suchen, möglichst ohne Maske auf dem Theater zu erscheinen und nicht ängstlich darauf zu passen, ob ich auch Dichter genug bliebe und die Schönheit und Poesie nicht dabei in Lumpen und Fetzen und Motten ginge, wie [S. 292]alte aus der Mode gekommene Kostüme. Wenn unsere Zeit, wenn unsere Bühne keinen Dichter verlangt und erzeugt, gut, so gebe ich ihn, wie eine Schlafmütze oder einen Haarbeutel oder einen Vatermörder oder sonst etwas Altes, was wir nicht mehr tragen, hinter den Kulissen ab und komme als Richter, als Arzt, als Pastor, als Lehrer auf die Bühne heraus. Und die Gesinnung, die mich dazu treibt, helfen, raten, klären zu wollen, und meiner Zeit den Spiegel vorzuhalten: ‚Wohl euch oder weh euch! So seid ihr!‘, die wird jedes meiner Worte dann draußen auf der Szene adeln, so gut, als hätt’ ich es mir von Apollo und der tragischen oder komischen Muse selbst soufflieren lassen.“
So sprach der Mann, den wir in die Zukunft mitnehmen wollen, wie eine alte Standarte, mit der und unter der viele Siege gegen die Masse als „kompakte Majorität“ erkämpft worden sind. Und wenn man uns Anno 1950 fragt: „Was tragt ihr da für eine alte zerschossene und verstaubte Scharteke auf dem Rücken?“ so wollen wir antworten: „Es war der, den seine Zeit verlangte und der sie erfüllte, und darum trotz alledem: Ecce poeta!“
[S. 293]
Preußen und damit das neue Deutschland verdankt das, was es in der Welt bedeutet hat, Friedrich dem Großen und Bismarck. Diese beiden Genies, die wie durch ein Wunder ganz kurz hintereinander aus dem dürren märkischen Boden hervorwuchsen, haben das Deutschland unserer Tage geschaffen. Sie haben sehr viel Verschiedenes in sich gehabt, diese beiden Preußen, und es ist ein Glück gewesen, daß sie nicht zu gleicher Zeit in und um Berlin lebten, denn sie hätten sich sicherlich nicht er- und vertragen können. Der Alte Fritz war ein Freidenker und hat im ganzen Siebenjährigen Kriege kein einziges Mal gebetet. Bismarck nahm, hundert Jahre später, die Bibel mit nach Sedan und Paris und wechselte mit seiner puritanischen Braut Briefe über das Wesen der Erbsünde und darüber, ob sein Vater, der ein leichtlebiger Rittmeister gewesen, in den Himmel gekommen sei. Bismarck verstand im Gegensatz zu dem Sieger von Leuthen blutwenig von der Kriegskunst, und es ist eine ganz verkehrte Gewohnheit unserer Maler und Bildhauer, ihn, der seiner Profession nach Jurist war und bei jeder Parade oder Feier die Uniformstücke verwechselte, stets im Soldatenrock darzustellen. Schließlich hatte Bismarck, ganz anders wie jener große Monarch, der die Kunst und Kultur seiner Zeit kannte und genoß und alle Musen zu sich nach Sanssouci lud, kein Verständnis für die Kunst. (Gegen diese Behauptung spricht natürlich nicht, daß er die Klassiker [S. 294]zu zitieren wußte oder gelegentlich Beethoven pries.) Wenn der Alte Fritz noch im späteren Alter Rousseau zu verstehen suchte und ihn allnächtlich nach dem Tagewerk noch studierte, blätterte Bismarck, wenn er abends erschöpft heimkam und nach dem Essen mit Frau und Kindern und Hunden um den Kamin saß, zu müde zu sprechen, in Stindes harmlosen Geschichten von der Berlinerin Buchholz oder bestenfalls im Fritz Reuter herum, oder ließ sich, wenn er sich zu sehr geärgert hatte, ein paar Lieder aus dem „Trompeter von Säckingen“ vorsingen. Richard Wagners Bedeutung sah er nicht, Zola war ihm ein Greuel, und daß zu seiner Zeit eine Persönlichkeit wie Nietzsche gelebt hatte, erfuhr er ohne Erregung und ohne Interesse erst in Friedrichsruh. Das Theater war ihm gleichgültig, wenn nicht verhaßt, und die Malerei seiner Zeit war ihm, wenn nicht „Lenbach“ darunter stand, ebenfalls „Wurscht“, um seinen Ausdruck zu gebrauchen.
So nebensächlich vor dem Riesenlebenswerk des großen Mannes dies auch erscheint, so traurig ist es doch, daß er in keiner einzigen Kunst mitreden konnte, außer in der Staatskunst, wo er alles verstand; daß kein Haus, kein Stein aus seiner Zeit einen heute gewaltig oder lieblich an ihn in Berlin erinnert, wo er doch mehr als dreißig Jahre lang wie ein ungekrönter König gewirkt hat. Er hätte niemals dort hausen und herrschen brauchen, so weniges erinnert noch in Berlin an Bismarck. Nicht einmal den Leichnam des Mannes, der für Preußen das Leben von Millionen Menschen mehr wert war als Napoleon [S. 295]der Erste für Frankreich, hat man dorthin gebracht, und nachts fühlt man heute am Brandenburger Tor eher noch den Geist Friedrichs des Großen, als den Bismarcks herumspuken.
Es ist darum eigentlich sehr seltsam, daß Bismarck so wenig Verständnis und Liebe für die Kunst seiner Zeit, für die Kunst überhaupt gehabt hat, weil er im Grunde selbst aus dem Stoff, aus dem man Künstler bildet, zusammengemischt war und, nach einem Wort Hardens, aus „Goethes Geschlecht“ stammte. Vielleicht war nur die fehlende halbe Flasche Champagner, die — er selbst hat es gesagt! — jedem Märker und Berliner im Blute mangelt, schuld daran, daß er sich, blind und taub gegen die Musen, ganz von seiner gewaltigen Aufgabe verschlingen ließ. Wer ihn draußen in Freiluft sah, dem fiel immer gleich das Künstlerische, Sensible an ihm auf, der merkte, daß dieser Realpolitiker eigentlich die Augen eines Träumers im Kopfe hatte. Die Natur um sich herum sah er mit den Gefühlen eines Malers oder Poeten an, der weiß, daß er diese Schönheit um sich nur auf kurze Zeit in Pacht hat und sie darum dreifach mehr als die anderen Sterblichen genießt. Die graue Herbst- und Winterschönheit seines Nebelheims an der Elbe wußte er prachtvoll wie ein Balladendichter zu schildern.
Das war ja die Tragödie seines Körpers und seines Lebens, daß er, statt unter Blättern und Bäumen zu atmen, zwischen gelbem Papier und Menschen sein Dasein versitzen mußte, unter Ministern die einzig fühlende Brust, daß er, statt [S. 296]den Staren und Hirschen lauschen zu können, mit Windthorst und Richter und Bebel sich herumzanken mußte. Er hätte ja längst abgedankt und dies Amt, das er sich für sich selbst geschaffen hatte, verlassen, wenn er nur einen gesehen hätte, der es besser verstanden als er. Er hätte niemals den schmachvollen Tag seiner Entlassung abgewartet, wenn er nicht bestimmt voraus gewußt hätte, daß ein Caprivi nach ihm Dummheiten machen werde. So hielt ihn die Pflichttreue, diese heilige preußische Tugend, die er mit Kant, mit Friedrich dem Großen gemeinsam hatte, in den Sielen und an der Spitze bis zu jenem Tage, da er, ganz allein, eine gelbe Rose in der Hand vom Schloß in Berlin Unter den Linden ging, um den Möbelwagen vor das Kanzlerpalais zu bestellen. Er gehorchte wie eine Schildwache, nicht ein Tropfen vom Blut eines Wallenstein war in ihm, und wenn er auch daheim in der ersten Wut Spiegel zertrümmerte, wenn er auch gelegentlich in Zeitungsartikeln seinem Ärger, seiner Verbitterung Luft machte, eine Auflehnung gegen den Willen des Monarchen wäre ihm als Preußen ganz unmöglich gewesen. Denn jener unbedingte Gehorsam gegen den Vorgesetzten, das stumme Sichfügen in die Bestimmungen über einen, ist eben das Ideal, das aus Brandenburg Deutschland gemacht hat.
Neben dieser Pflichttreue, die Bismarck veranlaßte, sich für Wilhelm I. täglich müde zu arbeiten, wie sie ihn ebenso dazu zwang, sich von Wilhelm II. wortlos abdanken zu lassen, ist es vor allem der Mut, in dem er dem Alten Fritzen um nichts nachstand. Er sprang selbst auf den [S. 297]Attentäter Kullmann zu, der ihn angeschossen hatte, und hielt ihn am Gelenk über dem Ärmel fest — denn die Haut eines solchen Menschen berührt man nicht —, bis die Polizei kam, den Mörder zu verhaften. Er ritt ganz allein Anno 71 in seinem allbekannten Kürassierrock durch den Triumphbogen nach Paris hinein, wo täglich Tausende Tod und Pest für ihn herunterbeteten, und rauchte ruhig seine Zigarre dabei, während die wütenden Weiber und Damen der Halle seinen Schimmel anspuckten. Er hatte schließlich den höchsten moralischen Mut, daß er stolz darauf war, am meisten gehaßt zu werden in Europa, allen Deutschen damit ein Beispiel gebend, Unbeliebtheit und Hohn zu überwinden.
Durch diese Eigenschaften, die er im Krieg und Frieden, in der Diplomatie wie im Parlament tagtäglich angesichts Deutschlands vormachte und vorlebte, ist er der größte Erzieher unseres Volkes gewesen, den die Geschichte kennt. Ja, man kann sagen, daß er wie ein Prometheus ganz neue Deutsche geschaffen, und daß seit ihm unser Volk überhaupt ein ander Gesicht bekommen hat. Jeder, der Bismarck als Gesandten in den sechziger Jahren im Ausland kennenlernte, war erstaunt darüber, in ihm einen praktischen, klaren, entschlossenen Deutschen kennenzulernen. „Er ist gar nicht sentimental“, schrieb Mérimée ganz enttäuscht in Biarritz über ihn in sein Tagebuch. Namentlich die Franzosen, die seit Hoffmann und Heine die Deutschen immer als Träumer und Sterngucker angesehen hatten, die auch tagsüber noch die Schlafmütze über die Ohren trugen, [S. 298]waren ganz entsetzt, daß auf einmal einer kam, der rechnen konnte wie sie, und nach der fünften Flasche Sekt noch keine Träne vergossen hatte, ja noch genau wußte, was er bei der ersten gewollt hatte. Das unterschied Bismarck völlig von dem Freiherrn vom Stein, seinem geistigen Vorfahren in Preußen, daß er seinen Willen durchsetzen konnte. Früher war es Deutschland lange ergangen wie dem schüchternen Gast, der vor Bescheidenheit immer wartet, bis er auf einmal verdutzt sieht, daß alle Plätze besetzt sind. Bismarck setzte sich auf den ersten besten leeren Stuhl und erklärte dann laut: „Wo ich sitze, ist immer obenan.“ So hob er den deutschen Michel in den Sattel und führte jene gewaltige Metamorphose der Deutschen herbei, der das Ausland seit Jahren mit Staunen und mit Grollen zuschaut.
Daß dieser Mann, der, wie er selbst sagte, „dem teutonischen Teufel verschrieben war“, ein Genie gewesen, das sahen selbst die Windthorst und Richter ein, als sein gewaltiges Bild plötzlich wie ein Spuk verschwand und ihnen angesichts des neuen Reichstages war, als hätten sie diesen Riesen nur geträumt. Sein Staatswerk hat ihn dank der völligen Unfähigkeit seiner Nachfolger nicht lange überlebt. Aber seine Persönlichkeit ist geblieben und wird wachsen ins Sagenhafte.
[S. 299]
Wie Achilles seinen Homer, der Halbgott den heroischen Sänger gefunden hat, so fand Friedrich der Große seinen Verkündiger, seinen Chronisten und Bildner in Adolf Menzel, einem zugleich nüchternen, trocknen, zugleich dämonischen Künstler. Und so war der große König auch, den er in seinen Bildern geschildert und wiedergeboren hat: Einerseits nüchtern, prosaisch, genau, ein Pflichtmensch und der erste Diener seines Staates — „wir Märker haben alle unsere Normaluhr im Kopfe“, sagte Fontane — und kalt und verdrossen und mit den Jahren immer schwerer und immer seltener zu schönen Aufwallungen geneigt —, „uns Märkern fehlt allen eine halbe Flasche Champagner im Blut und Temperament“, sagte Bismarck. Aber zugleich steckte eine unheimliche Dämonie, ein höllisches Feuer, eine überirdische Glut in dem alten wie in dem jungen Fritzen.
Es ist wohl allgemein anerkannt — und nur auf den Schulbänken wurde es aus altmodischer Anständigkeit noch anders gelehrt —, daß Friedrich II. im Grunde keinen rechtmäßigen Anspruch auf die schlesischen Provinzen hatte. Gab es den überhaupt jemals, so hatte Brandenburg, wie selbst die Freunde des Königs zugeben mußten, doch längst durch feierliche Verträge darauf verzichtet. Nicht also Pakten und Pergamente, noch der Besitz des schlesischen Landes, sondern einzig die Ruhmsucht war es, die Friedrich II. in drei blutige Kriege hinaustrieb. Immer wieder sucht er anderen und sich zu beweisen, welch eine edle [S. 300]Eigenschaft dieses sei, und wie alles Große in der Welt nur der Ruhmsucht seine Geburt verdanke. Aber der preußische Selbstregulator in ihm bewahrte ihn zugleich vor dem Schicksal Napoleons und lehrte ihn sich beschränken und sich Grenzen zu setzen. So machte er an der Oder halt: „Bis hierher und nicht weiter!“, während alle seine Bewunderer ihn am liebsten ganz Österreich hätten verschlingen und bis zum Ende der Welt vordringen sehen.
Er wagte Preußen dabei, das ist wahr, aber nicht wie ein tollkühner Spieler, sondern wie ein Mann bei der besten Chance, groß zu werden oder gering zu bleiben. Er trug während des ganzen Siebenjährigen Krieges, da es sich um Sein oder Nichtsein seines Landes handelte, immerwährend Gift bei sich, weil er wußte, daß in diesen Jahren Preußen und er ganz eins waren und er, wenn Preußen fiel, mitsterben mußte. Darum hätte er — und dies ist seine wahre Größe — nicht eine Sekunde lang ein St. Helena, nicht eine halbe Sekunde lang ein Amerongen erduldet. Und dies Bild ist das ergreifendste aus seinem Leben, wie er nach der Schlacht bei Kunersdorf, eine Weile von den Seinigen abgeschnitten, versteckt unter einer Brücke saß, sein Windspiel neben sich, dem er, um nicht verraten zu werden, die Schnauze zudrückte, während er in der anderen Hand ein Fläschchen mit Gift hielt, jeden Augenblick bereit, es zu leeren, falls er vom Feind entdeckt würde.
Die Pflichttreue, mit der er im Kriege allem, der kleinsten Parade wie der größten Schlacht, beiwohnte, ist allbekannt und seit jener Zeit zum preußischen Ideal geworden. [S. 301]Ebenso die Bestimmtheit und Entschlossenheit in Wort und Tat, die spartanisch-brandenburgischen Eigenschaften, die „Feldwebeltugenden“, wie Heine sagte, die der König schon als Kind zeigen konnte, dessen erster, uns erhaltener Brief — er galt seinem freigeistigen Erzieher, und Fritz war damals fünfzehn Jahre alt — so lautete: „Ich verspreche Ihnen, mein lieber Duhan, Ihnen jährlich, wenn ich über mein eigenes Geld verfügen kann, 2400 Taler zu geben und Sie immer noch ein wenig mehr zu lieben, als jetzt, wenn es mir möglich ist. Friedrich, Kronprinz.“
Kriegsmüde und verbittert war der Alte Fritz aus einem Krieg mit der ganzen Welt, die sieben Jahre lang mit allen Waffen des Hasses und der Hinterlist wider ihn gekämpft hatte, nach Berlin heimgekehrt. Man kannte ihn kaum wieder, so verwüstet sah er aus. Mit dem Humor, der noch in ihm hauste wie ein Käuzchen in einer Ruine, hat er sich selbst in einem Brief an eine Freundin beschrieben: „Auf der rechten Seite des Kopfes sind meine Haare grau; meine Zähne zerbrechen und fallen aus; mein Gesicht ist runzlig wie die Falbeln eines Weiberrockes, mein Rücken krumm wie ein Fiedelbogen und mein Geist traurig und niedergeschlagen wie ein Mönch des Trappistenordens.“
Er fuhr nach Potsdam hinaus, ließ sich ganz allein in der Kirche ein Tedeum vorspielen, daß keiner die Tränen sah, die er weinte, und ging dann stumm an seine Geschäfte. Er war ein Freigeist in allen religiösen Dingen; jahrelang hatte er Voltaire, den größten Atheisten jener [S. 302]Zeit, um sich, was ungefähr so wäre, als wenn Wilhelm der Zweite tagtäglich statt mit Hofpredigern und Dauerbetern mit Häckel verkehrt hätte. Alle Religionen sind gleich „gut“, erklärte er, „und wenn selbst Türken und Heiden mein Land peuplieren, will ich sie Moscheen bauen“, und erließ dann den berühmt gewordenen Bescheid an seinen Kultusminister, das schönste Fürstenwort, das es gibt: „In meinen Landen kann jeder nach seiner Fasson selig werden.“
Friedrich der Große ist gestorben an der traurigen Krankheit, an der alle großen Eroberer sterben, an der Menschenverachtung. Freilich die Schmeichler, diese Hofpest, wußte er sich gründlich vom Leibe zu halten. Schon sein ruppiger Vater, würdig ein Genie zum Sohn zu haben, duldete solche Kerle nicht. Als ihn einst ein Bürgermeister nach der auch bis ins zwanzigste Jahrhundert noch herrschenden Unsitte mit einer devoten lobesvollen Rede am Stadttor empfing, unterbrach ihn der König, indem er ihn dabei auf seinen dicken Bürgermeisterbauch im Sonntagsrock klopfte, mit den Worten: „Genug, Alter! Erkälten Sie sich Ihren Chimborasso nicht!“ Der alte Fritz konnte über Schmeichler so wütend werden, daß er seinen Krückstock nach ihnen warf. Anderseits gab es auch keine Majestätsbeleidigungen für ihn; er wußte, daß er zu groß war, als daß ihn die Kanaille hätte beleidigen können. Eine Schmähschrift, die einst an den Mauern Berlins wider ihn angeschlagen war, ließ er bekanntlich „niedriger hängen“, damit sie besser zu lesen sei.
Alle Künstler behandelte er wie seinesgleichen. „Um Gottes [S. 303]willen,“ heißt es in einem Briefe an Voltaire, „schreiben Sie mir nur als Mensch, und verachten Sie mit mir Titel, Namen und allen äußeren Prunk.“ Aber im ganzen war ihm das Menschengeschlecht, „diese verruchte Rasse, der wir angehören“, wie er sich ausdrückte, völlig zuwider geworden. Seine Preußen hatten schließlich den Drill so sehr in den Knochen, daß sie ihm wie Sklaven, nicht mehr wie Menschen vorkamen. Die Handvoll Personen, die er geliebt, starben fast alle vor ihm, und so lebte denn der einsame Philosoph in Sanssouci ohne eine Menschenseele zwischen Bedienten, Hunden, Affen und Papageien. Die Zeit, die er einst der Kunst, vor allem der Musik, geweiht hatte, verschlang nun gänzlich der Staatsdienst. Er starb ganz einsam, ohne Priester, ohne einen Verwandten, in den Armen eines Dieners, während draußen im Vorzimmer zwei Lakaien sich um die Wachskerzen, die sie aus den Leuchtern gestohlen hatten, zankten. Er wollte neben seinem Schlosse zwischen seinen Windspielen bei Nacht bestattet werden. Aber die sogenannte Pietät seiner Nachfolger verhinderte dies.
So starb dieses Genie, der größte Hohenzollernfürst, dessen Lebenswerk über Jena und Sedan hinaus gehalten hat.
[S. 304]
Schon Goethe hatte sich über die Weisheit: „Für einen Kammerdiener gibt es keinen Helden“ tüchtig geärgert und laut erklärt, daß dieses immer nur die Schuld des Kammerdieners wäre, der über dem Allzumenschlichen seines Herrn, das er täglich sieht, größenblind geworden sei. Wer über einem Menschen in Unterhosen den Sieger von Austerlitz vergißt, der hat eine Lakaienseele und ist zu nichts Größerem geboren, als mächtigen Herren die Stiefel auszuziehen und abzuputzen. In einer die Helden hassenden Zeit haben wir Napoleon, den Heine und Byron immer nur den Großen schlechthin nannten, mehr als uns recht war, mit Kammerdieneraugen betrachten sehen: So von Shaw, dem nichts zu groß ist, um es nicht klein zu kriegen, so von Sardou in seinem Kulissenreißer „Madame Sans-Gêne“ und von manchen anderen. Nicht mehr mit der Kinderphantasie unserer deutschen Pastoren vor hundert Jahren haben die Schreiber unserer Zeit Napoleon geschaut, etwa als einen Werwolf, der von Menschenblut lebt oder ein wildes Tier, das aus der Felseneinsamkeit Korsikas ausgebrochen war, um Europa zu dezimieren und die Welt auf den Kopf zu stellen.
Nein, im Gegenteil, man hat in unseren Tagen den gewaltigen Zwergen, der am Anfang unserer ganzen bürgerlichen Zeit steht, für diese jetzige Bürgerwelt zurecht photographiert, ihn vermenschlicht und unter uns andere gebracht, ihm bestens sein Absonderliches, nicht sein Ausschließliches [S. 305]abgeguckt. So bekamen wir einen Napoleon zu sehen, wie er noch heute unter uns herumlaufen könnte, ohne sehr in der Menagerie der Menschen aufzufallen: einen Mann, der gern schnupfte, viel und alles durcheinander aß, Käse nach der Suppe und Äpfel zum Schellfisch, der bei dem Schauspieler Talma Stunden im Repräsentieren nahm, und einen dicken Bauch hatte, der eifersüchtig und abergläubisch wie ein Italiener war, parvenühaft seine Familie auf alle Throne Europas zu kleben suchte, der Französisch sprach wie ein Bauer bei uns Hochdeutsch, der die Schlacht bei Leipzig infolge von Magenschmerzen verlor, und der sich auf der Insel Sankt Helena mit dem gleichen Ungestüm mit einem unbedeutenden Gefängniswärter wie einstmals mit Blücher, mit Metternich oder dem Kaiser von Rußland herumzankte.
Diese verkleinerte Photographie fängt das Rätsel Napoleon noch weniger ein als das Zerrbild, das die deutschen Freiheitskämpfer Anno 1813 sich von ihm machten, die ihn als Vernichter ihres Vaterlandes, als Lügner und falschen Propheten gehaßt haben, wie noch keiner in Deutschland gehaßt worden ist. Was er zunächst als Testamentsvollstrecker der Französischen Revolution allein für Gutes über Europa gebracht hat, das sah man damals im Rausch des Patriotismus noch nicht. „Attila! Attila!“ sollen ihm die Studenten zu Jena nachgerufen haben, dieselben vielleicht, die zehn Jahre darauf unter Metternichs Knutenwirtschaft sich fast nach dem fremden Tyrannen zurücksehnten. Der einzige Mann von Bedeutung in Deutschland, [S. 306]der den allgemeinen Haß gegen Napoleon nicht mithassen konnte, ist bekanntlich Goethe gewesen, der so begeistert von dem persönlichen Reiz des Kaisers war, daß er — die Geschichte hat kein größeres Kompliment für Napoleon! — lange überlegte, ob er nicht sein Vaterland aufgeben und nach Paris ziehen sollte. Aber es war nur das Dämonische, die Urkraft in Napoleon, die Goethe zur Bewunderung hinriß. Das Stück Zukunft in diesem Bürgerkaiser wurde der Aristokrat und weimarische Staatsminister mit allen anderen noch nicht gewahr, das Demokratische, man möchte fast sagen, Amerikanische in Napoleon, das nicht Adel noch Stand, sondern nur das persönliche Verdienst hochschätzte. Dies kam zum Vorschein, wenn er etwa an den Habsburger, den Kaiser von Österreich, der ihn, um sich den bürgerlichen Schwiegersohn zu erleichtern, an den Familienadel der Bonaparte erinnerte, einfach schrieb, „Mein Adel rührt von Montenotte, meiner ersten siegreichen Schlacht über die Österreicher, und von nichts anderem her.“ Oder, wenn er einen beliebigen Prinzen von Preußen in bitterer Ironie zu einer Hasenjagd auf dem Schlachtfeld von Jena einlud und ihn dann obendrein noch warten ließ, während er von seinem Stuhl aufsprang, als Goethe zur Audienz hereinkam.
Aber für dieses Demokratische in seinem Wesen hatte die Zeit, die ihn erlebte, ebensowenig Augen wie für das Romantische in Napoleon. Man war zu sehr überrascht von dieser Erscheinung, um sie schon verstehen zu können. Denn Napoleon war wirklich ein Romantiker auf dem [S. 307]Throne, wie es vor ihm nur Alexander der Große gewesen ist. Das, was deutsche Geschichtschreiber stets als Pose und Phrase bei ihm gescholten haben, das war seine Triebfeder, sein Daseinsgrund: So, wenn er, der keine Dynastie hinter sich hatte, in Briefen oder Reden sich Hannibal zum Ahnherrn machte, als er über die Alpen zog, oder Cäsar, wenn er in Italien und Mohammed, wenn er in Ägypten war, oder den nach Persien flüchtenden verbannten Themistokles, als er nach Belle-Alliance den Schutz des englischen Königs anrief.
Es war ebensowenig geschauspielert wie unwahr, wenn in Potsdam sein erster Besuch dem Sarge Friedrichs des Großen galt, und wenn er den Degen des alten Fritzen für die schönste Beute aus allen seinen Kriegen erklärte, oder wenn er den Papst zu seiner Kaiserkrönung herbeizog, oder wenn er seinen Sohn in der Wiege zum König von Rom erklärte. Große Augenblicke bedürfen großer Worte, und man sollte Napoleon so wenig einen Phrasenmacher nennen wie Bismarck, der, um Rußland einzuschüchtern, schrie „Wir Deutschen fürchten Gott und sonst nichts auf der Welt“. Politik ließ sich damals und läßt sich auch heute oft nicht anders übersetzen als: Die Kunst, schön zu lügen. Und hatte Napoleon nicht das Recht, ein Romantiker zu sein, wenn er seinem Leben, das sich noch heute wie ein Roman erzählt, auf den Rücken sah? Es gibt nichts Reizvolleres in seinem Leben für uns, die wir es heute aus der Vogelschau betrachten, als die kurze Zeit, da er 22 Jahre alt, im Sommer 1791 als Sekondeleutnant in Valence, [S. 308]einem Städtchen in Südfrankreich, bei der Artillerie stand. Er dichtete damals — welcher bessere Sekondeleutnant täte dies nicht! — klagte über den Dienst, war unglücklich verliebt, las fünfmal „Werthers Leiden“ und schrieb Sätze wie diesen in sein Tagebuch: „Die Liebe bringt mehr Unglück als Glück, und es wäre eine Wohltat der schützenden Gottheit, uns damit zu verschonen und die Menschen davon zu befreien.“ Er ahnte damals noch nicht im geringsten, was das Schicksal aus ihm machen würde. „Erst nach meiner dritten siegreichen Schlacht fühlte ich — auf der Brücke von Arcole war es! — daß ich ein großer Mann werden würde, und diese fixe Idee verließ mich seitdem nicht mehr“, hat er auf Sankt Helena gesagt.
Wenn man das Genie als eine Art Krankheit bezeichnen will, deren Wesen Ruhmsucht ist, so war Napoleon später völlig von dieser Krankheit besessen. Ruhelos trieb sie ihn, wie den Orest die Furien, durch ganz Europa umher, bis er auf der kleinen Felseninsel im Atlantischen Ozean, wo dreitausend arme, verkommene Menschen, ein paar Schafe und Ziegen und Milliarden Mücken lebten, eine qualvolle Erlösung fand. So war er ein Abbild dessen, der vom Geist der Ordnung überritten wird, und der in der Offenbarung Johannis also beschrieben wird: „Und es ging heraus ein anderes Pferd, das war rot; und dem, der darauf saß, ward gegeben, den Frieden zu nehmen von der Erde und daß sie untereinander erwürgeten; und ihm ward ein großes Schwert gegeben.“
Neben dieser übermenschlichen dämonischen Triebkraft seines [S. 309]Daseins seien schließlich noch ein paar freundliche Züge in dem Wesen dieses „Tigers in Menschengestalt“, wie Theodor Körner ihn nannte, erwähnt. Einmal die Art seiner Kriegführung in Ägypten, wo er zivilisierter, als wir in China es waren, die alten Heiligtümer des Landes den Gelehrten, nicht den Soldaten überließ, oder in Italien, wo er den mit dem Tode bedrohte, der ein Kunstwerk zerstören würde und Florenz um Michelangelos und Arezzo um Petrarkas willen nicht beschießen ließ. Vergessen sei auch nicht, wie gütig er gegen seine Soldaten gewesen ist, die wirklich nicht für einen Tyrannen und Menschenfresser so oft in den Tod gegangen wären, wie er die Pestkranken, um sie von ihren unheilvollen Qualen zu befreien, vergiften lassen wollte, und wie er manche Nachmittage vor den Soldatenspitälern zu Paris Musik machen ließ, um die Genesenden heiter zu stimmen.
Für die Franzosen ist dieser Napoleon eigentlich nur ein schöner Luxus gewesen, wie sein Neffe, Napoléon le petit zum Kaufmann geboren, zum Kaiser bestellt, ein unschöner Luxus für sie geworden ist. Jedenfalls hat das französische Volk von der ganzen Kaiserei Bonapartes heute nichts mehr in Händen als große Erinnerungen und verschollenen Ruhm und eine noch jetzt mit infolge seiner vielen Kriegszüge dezimierte Menschenschar. Die sozialen Eroberungen der großen Revolution, von denen die dritte Republik heute zehrt und lebt, hat Napoleon gehemmt und dem Volke, das ihn als Götzen anbetete, in seiner Entwicklung nur geschadet. Was er, diese Laune des Seins, als unbewußter [S. 310]Testamentsvollstrecker Voltaires, Rousseaus, Mirabeaus, Dantons den übrigen Völkern übermittelt hat, die großen bleibenden demokratischen Ideen aus dem Jahre 1789, hat alle Nationen weniger gekostet als die französische. Namentlich um Deutschland hat sich dieser Sendbote der Revolution verdienter gemacht als Bonifazius: Er hat die geistliche Weltmacht in Deutschland vernichtet, die Reichsstädte größtenteils aufgehoben, die Reichsritterschaft lächerlich gemacht und mit diesem allen wider Wissen und Willen der Einigung des Reiches und Bismarck vorgearbeitet. Er hat den Gedanken der Volksfreiheit und der Verfassung über die Elbe fast bis nach Mecklenburg getragen, und wenn wir in unsern Tagen auch in Preußen von Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit zu sprechen beginnen, so verdanken wir dies dem Dämon, der ausgesandt ward, in alle Welt zu gehen und alle Völker zu lehren und auf den heiligen Geist der neuen Zeit zu taufen. Und darum können wir hundert Jahre nach dem Erscheinen dieses Kometen Napoleon mit Fug und Recht ihn im Elysium zum deutschen Ehrenbürger ernennen.
[S. 311]
Es ist ein Prüfstein für jeden heutigen Menschen, wie er sich zu Napoleon stellt. Nicht als ob noch ein Streit über seine persönliche Bedeutung notwendig wäre. Die Zeit, die unmittelbar auf seine Schreckensherrschaft folgte, hielt es in ihrer Verachtung gegen ihn für angebracht, ihm fast jede überlegene außergewöhnliche Begabung abzusprechen. Chateaubriand, der ihn nach Madame de Staël wohl am heftigsten in Frankreich gehaßt hat, ging sogar so weit, ihm als gepriesenem Feldherrn ein Mißtrauensvotum zu erteilen. „Man hat gemeint,“ so schrieb er, „Napoleon hätte die Kriegskunst entwickelt und vervollkommnet. In Wirklichkeit hat er sie zu ihrer Kindheit zurückgeführt.“ Dieser Ausspruch ist freilich nicht so töricht, wie Flaubert geglaubt hat, der ihn in seine Sammlung denkwürdiger Dummheiten aufgenommen hat. Denn Napoleons Krieg- und Schlachtenführung hatte wirklich etwas sehr Primitives an sich. Und das ganze große Geheimnis dieser „Kunst“, die wie keine andere vom allmächtigen Zufall abhängig ist, besteht nach seinen eigenen verächtlichen Worten darin, daß man mit einer größeren Heereszahl eine kleinere angreift. Aber lassen wir ihm ruhig seine lang genug erprobte Feldherrengabe, die er am meisterhaftesten noch in seinem Absturz, in dem Feldzug in Frankreich 1814, bewährt haben soll! Mögen sich Generalstäbler und Kriegsschüler daran erbauen.
Seine Fähigkeit, Schlachten anzuordnen und Truppen zu leiten, soll ebensowenig mehr bestritten sein wie seine Kraft, [S. 312]die Mannschaften anzufeuern und Menschen für sich zu gewinnen. Von dem Zauber seiner Persönlichkeit, mit dem er Männer, an deren Freundschaft oder Bewunderung ihm etwas lag, einzufangen wußte, sind uns zahllose Zeugnisse erhalten. In Deutschland ist die magnetische Macht seines Einflusses am bekanntesten durch die Verehrung Goethes geworden, der von ihm seit der Zusammenkunft in Erfurt stets wie von einem überirdischen Wesen sprach und diese Vergötterung des „Einzigen“ noch seinem unglücklichen Sohn August vermachte, dem im Freundeskreis die Tränen in die Augen traten, wenn man die Schlacht bei Leipzig feierte. Diese maßlose Überschätzung des fremden Kriegsgötzen verstieg sich bei Goethe zu dem bekannten Ausspruch gegen Theodor Körner und Lützows Freischaren im Jahre 1813: „Schüttelt immer an Euren Ketten! Der Mann ist Euch zu groß. Ihr werdet sie nicht zerbrechen.“ Wir wollen diese Narrheit des Dichters nicht hinterher zu entschuldigen und verständlich zu machen suchen. Goethe hatte sich einmal in die dämonische Persönlichkeit Napoleons versehen und war als Staatswesen überhaupt auf das Unterordnen eingestellt. Für ihn gab es, nach seinen eigenen Worten, kein schöneres Los, als einem selbsterwählten würdigen Fürsten zu dienen. Napoleon galt ihm mit Recht als der befähigtste, der gebieterischste unter allen ihm bekannten Herrschern seiner Zeit. Und darum brachte er ihm, von dem er sich wie ein Pair behandelt sah, willig seine Huldigung dar. Bis zu seinem eigenen Tode bewahrte er Napoleon diese Treue, übersetzte im hohen Alter noch, wo er kaum [S. 313]mehr etwas übertrug, Manzonis Ode auf den fünften Mai, den Todestag des Kaisers, und sprach gegen seinen Eckermann stets von ihm wie von einem vollkommenen Helden.
Die trübe Zeit der geistigen Reaktion, die auf den Sturz Napoleons folgte, trug viel dazu bei, das Andenken an den Gewaltigen zu verschönern. Die Unterdrückung, die sich auf alle freiheitlichen Regungen legte, gab dem verschollen auf einer kleinen Insel des Weltmeeres in Gefangenschaft lebenden Kaiser in der Vorstellung der daheim Geknechteten einen Glanz und eine Verklärung, die seinem Wesen in Wirklichkeit gar nicht entsprach. So durch einen Nebel von Sagen und verherrlichenden Erinnerungen sahen ihn die unter den poetischen Jüngern, die seine Exhumation, seine Befreiung vom Staube der Verleumdung herbeiführten. Wie beispielsweise Lord Byron in England, wie die polnischen Dichter, die ihn hinterdrein als ihren Messias feierten, wie Heinrich Heine bei uns und der alte Stendhal und der junge Viktor Hugo in Frankreich. Bis zu dem Jahre 1841, da man unter dem Ministerium seines Geschichtschreibers Thiers die Asche des Kaisers von Sankt Helena in den Invalidendom überführte, blühte diese Wiedergeburt Napoleons in der Dichtung. Man umkleidete in der poetischen Vorstellung den gewesenen Tyrannen, den Mörder des Herzogs von Enghien, des armen Buchhändlers Palm und des biederen Andreas Hofer, nun nachträglich mit den freiheitlichen Gedanken der französischen Revolution, die er zeitlebens persönlich verachtet und verlacht hatte. Man wollte sich nicht mehr erinnern, daß Napoleon alle, die später noch von den großen gesellschaftlichen [S. 314]Plänen des Jakobinertums sprachen, dem er selber ehemals seine militärischen Dienste angeboten hatte, als „Ideologen und Faselhänse“ verfolgt hatte. Man vergaß, daß Beethoven die Widmung der „Eroika“ an ihn zerrissen hat. Vergaß, daß Napoleon seinem begabten Bruder Lucian, der sich seine republikanische Gesinnung bewahrt hatte, geradezu nach dem Leben trachten ließ und ihn zum vollkommenen Schweigen verurteilte. Gewiß! Napoleon gab sich gern demokratisch und war es schon als Südländer mehr als etwa sein nordischer Freund und Feind, Kaiser Alexander I. von Rußland, der die heilige Allianz zur Erhaltung der Monarchien begründete. Auch das Wort, dessen frohe Botschaft wir wieder vernahmen: „Freie Bahn dem Tüchtigen!“ findet sich schon mehrfach in der Fassung: „Dem Fähigen!“ bei Napoleon. Aber dies Gebahren war bei ihm, dem Advokatensohn und Profitmacher der großen Revolution, mehr eine verfluchte Notwendigkeit als eine Sache der Überzeugung. Er konnte sich als bürgerlicher Parvenu kaum noch auf den zum größten Teil durch die Guillotine weggefegten französischen Adel stützen. „Der Adel hat mir gedient,“ schrieb er einmal, „aber zwischen uns gab es niemals Gemeinschaft. Mit dem Volk Frankreichs dagegen war es eine andere Sache. Seine Gemütsart stimmte mit der meinigen überein.“
Darum wußte er auch dies Volk so gut zu behandeln, daß es sich bis zur Grenze seiner Möglichkeit für ihn hinschlachten ließ, daß es bis Waterloo nicht müde ward, sein „Vive l’empereur!“ zu schreien. An dem Glück dieses [S. 315]Volkes, das er, wie er in seinem Testament beteuert, so sehr geliebt hat, daß seine Gebeine an den Ufern der Seine inmitten der französischen Nation ruhen sollten, hat er nur, soweit es für ihn paßte, Anteil genommen. Die „soziale Frage“, die bereits mit der ersten französischen Revolution der Welt ihr Rätsel aufgab, hat er kaum beachtet. Ihm war vor allem anderen an seinem Ruhm gelegen. „Der Ehrgeiz ist der Hauptbeweggrund des Menschen“, mit diesem Satz begann und endete seine ganze höchst einfache und wilde Psychologie. „Der Wille zur Macht“, das war für ihn wie für seinen späten Bewunderer Nietzsche, der nicht nur den Anfangsbuchstaben mit ihm gemein hatte, die alleinige Triebkraft aller Menschen. Von sozialen Gefühlen mochte der Korse ebensowenig wie der grausame Sachse wissen. „Ich habe die Grenzen des Ruhms erweitert.“ Auf diese traurige Selbstvergötterung laufen die Bekenntnisse hinaus, die er in Sankt Helena von sich gab. Diese neronische Leidenschaft für den Ruhm, la gloire, die kein Volk mehr als das französische empfinden kann, hat ja diese Nation stets wieder an ihn angezogen. Bis auf die Nationalisten und Annexionisten nach 1870 in Frankreich, die ihn wie ihre Vorfahren den heiligen Ludwig als ihren Abgott verehrten. Man verzieh ihm um seiner kriegerischen Ruhmestaten, der vergessenen Schlachten und der verstaubten Fahnen willen sogar, daß er die Republik samt ihren erhabensten geistigen Errungenschaften vernichtet hatte. Denn den freien Kult der Religionen hat er, der sich selber einen „guten Katholiken“ nannte, anders wie sein leuchtendes [S. 316]Vorbild, Friedrich der Große, möglichst im Sinne Roms eingeschränkt.
Er hat sich später nach seinem Sturz viel darauf zugute getan, daß er die Ordnung in Frankreich wieder hergestellt habe. „Ich habe den Abgrund der Anarchie zugeschüttet. Ich habe ein Chaos gesichtet, die Revolution geläutert, habe die Völker veredelt, die Könige auf ihrem Thron gesichert.“ So und ähnlich rühmt sich Napoleon in der „Selbstrechtfertigung“, die er auf seiner letzten Insel diktiert hat. Wie leicht er es sich mit diesem Ordnungschaffen gemacht und auf wie falscher Grundlage seine Tyrannei gestanden hat, das verschweigt der Regisseur seines eigenen Ruhmes. Um das von ihm wieder völlig entmündigte Volk der Franzosen über seine neue Knechtschaft hinwegzutrösten, hat er es von einem betäubenden Blutbad ins andere gestürzt und mit dem Leben seiner Untertanen in einer Gefühlsroheit und Phantasielosigkeit gewüstet, wie sie nur noch in unsern Zeiten überboten werden sollte. Hinterdrein auf Sankt Helena hat er die eiserne Stirn gehabt — und auch in diesem berühmten Muster hat man ihn heutzutage nachgeahmt — zu behaupten, daß er immer hätte Frieden machen wollen, und daß man ihn, den armen unfreiwilligen Feldherrn, der „die Grenzen des Ruhmes erweitert“ hat, genötigt hätte, stets neue Schlachten zu schlagen. Seine Frechheit in diesem Punkte ging so weit, daß er in der erwähnten „Selbstrechtfertigung“ geradezu behauptete: „Will man mich beschuldigen, den Krieg zu sehr geliebt zu haben, so braucht mein Historiker nur nachzuweisen, [S. 317]daß ich stets der Angegriffene war.“ Nirgends sind Feldherren widerwärtiger, als wenn sie sich hinter ihre Lügen verschanzen. Man „braucht nur“ den unnötigsten aller Feldzüge, den von 1812 und seine Vorgeschichte zu erwähnen, um diese verlogenste Ausrede des Italiäners zu entwaffnen.
Napoleon hat sich sicherlich zuweilen selber gesagt, daß solche Ausflüchte, wie er sie da für seine unersättliche Ruhmsucht machte, von verständigen Menschen kaum geglaubt werden konnten. Er mußte sich, wenn er sein Leben und seine Taten, wie er das fast unaufhörlich tat, mit denen seines kriegerischen Vorbildes, mit Friedrich dem Großen, verglich, selber bekennen, daß er sich und seinen Ehrgeiz nicht gleich jenem Philosophen auf dem Thron zu bändigen gewußt hatte. Darum suchte der schlaue Advokatensohn noch nach einem besonderen Kniff, um die wahnsinnige russische Unternehmung, den Beginn seines Bankerotts, vor der Nachwelt zu retten. Er habe, so behauptet er keck, mit diesem seinem endgültigen „letzten“ Kriegszug Europa unter einen Hut, seinen eigenen Dreispitz natürlich, bringen wollen. „Ich wollte ein großes Weltreich mit einer Münze, einem Maß, einem Gewicht usw. aus ganz Europa mit der Hauptstadt Paris bilden und dieses als Gegenschöpfung gegen die Vereinigten Staaten Amerikas, diese großartige Gründung Washingtons, meinem Sohne hinterlassen.“
Ein auch den Friedensfreund berauschender Gedanke! Seine Ausführung hätte uns mit den Hekatomben von Menschen, die von Napoleon hingeschlachtet worden sind, einigermaßen [S. 318]versöhnen können. Aber der Kaiser der Franzosen vergaß bei dieser großen Rechnung die Hauptsache, nämlich, daß er gar nicht der Mann war, der sich wie Washington das allgemeine Vertrauen verdient hatte. Und er begriff nicht, daß diese Riesenaufgabe sich nicht mit einem Kriege von noch so großer Ausdehnung lösen ließ. Das plumpe Mittel des Kriegshelden Alexander, den gordischen Knoten einfach mit dem Schwert zu durchhauen, hätte bei dem europäischen Problem nichts geholfen. Es wird hier nie zur Einheit führen. Nur auf friedliche Weise, nicht auf dem Weg durch Blut und Eisen sind die Vereinigten Staaten Europas zu schaffen. Amerika hat seit dem Bestehen seiner Republik weniger Kriege geführt als jeder kleinste Staat in Europa und hat trotzdem auf friedliche, geistige Weise die widerstrebendsten, verschiedensten Menschen seines Riesenreiches zusammengeschweißt.
Napoleon wäre durchaus ungeeignet gewesen, dies Werk Washingtons, um dessen Tod er seine Armee in einer seiner wirklich schönen Gesten Trauer anlegen ließ, für Europa nachzumachen. Er, der ein Kulturvolk wie das englische überhaupt vom Kontinent ausschließen wollte, was heutige Narren ihm wieder nachzuäffen suchten. Er, der jede selbständige Regung eines von ihm unterworfenen Volkes in Hamburg wie in Tirol niederknallen oder knütteln ließ. Und er, der die Religion nur darum pflegte, um mit ihr die Menschen zu knechten, weil er wie ein Großkapitalist meinte: „Die Gesellschaft kann ohne Ungleichheit des Vermögens nicht bestehen, und die Ungleichheit des Vermögens kann nicht ohne Religion existieren.“
[S. 319]
Nein! Zum Begründer des modernen, des freien Europas war dieser Unfreie, dieser Lobredner der Artillerie, nicht geboren. Man muß nur bei den Zeitgenossen nachlesen, wie alle Nationen, auch die eigene französische, bei seiner schließlichen sichern Verbannung aufatmeten. Selbst ein Goethe konnte sich in seinem Napoleonkult diesem Freiheitshauch nicht entziehen, als er mit Hunderten von Landsleuten damals 1615 an den endlich nicht mehr umkämpften Rhein reiste. Napoleon hatte stets den Krieg, den er gerade führte, als letzten dargestellt. 1812 galt es nur noch einmal um die Einheit Europas Menschen hinzuopfern. Und 1813 waren es die alten Grenzen Frankreichs, und nach seiner Rückkehr von Elba war es nur noch der sichere Bestand des teuren Vaterlandes, um den andere ihr Blut lassen mußten. Solche Kampfhähne und Helden wie er finden ja immer wieder eine berechtigte Ausrede für ihre Unsinnigkeiten und eine Heiligsprechung ihrer Mordtaten.
Der Geist der Bildung wendet entsetzt und angewidert sein Haupt von diesem entarteten Sprossen und Überwinder der französischen Revolution. Nur als Testamentsvollstrecker dieser geistigen Bewegung hat er Bedeutung für das zwanzigste Jahrhundert. Er selber hat keine Ideen hinterlassen, höchstens einige Phantasien. Die Kriegsgeschichte mag seine 50 bis 60 großen Schlachten behalten. Die Geschichte der Menschheit als eine Würdigung ihrer Höherentwicklung aus dem Tierischen will nichts mehr von solchen „Ruhmestaten“ noch von jenem riesigen Menschenverächter wissen. Sie fühlt nur noch ein Schaudern vor dem Massenmörder, [S. 320]wie es in der gespenstischen Ballade von Zedlitz ausgedrückt ist, wenn nachts um die zwölfte Stunde der Mann im kleinen Hütchen Heerschau über die unzähligen Toten hält, mit denen er wie das deutsche Kaisertum in dem letzten Kriege die Erde Europas um eines Phantoms willen besät hat. „Ein falscher Wille zerstört die Bildnis“, die Wahrheit dieser Worte des gottseligen Schusters Jakob Böhme hat Napoleon der Welt erwiesen. Oder um es in die Sprache des Philosophen zu fassen: „Napoleon als ein gewaltiger Spiegel des Willens zum Leben hat die ganze Bosheit des menschlichen Willens offenbart. Die Leiden seines Zeitalters, als die notwendige andere Seite davon, waren mit solchem bösen Willen unzertrennlich verknüpft. Er hat niemals begriffen, daß die Welt ein Trauerspiel sei, in welchem der Wille zum Leben sich erkennen und — sich wenden soll.“
[S. 321]
Es gibt einen Begriff bei uns in Deutschland, mit dem wir tagtäglich umgehen wie mit dem Metermaß, dem Literkrug und dem Pfundgewicht, ein konstruierter Begriff, für den es im wirklichen Leben kein einziges Beispiel gibt, das ist der Normalmensch. Für ihn sind unsere Gesetze verfertigt, für ihn gelten unsere Sitten, geben wir unsere Gesellschaften, feiern wir unsere Feste, für ihn sind unsere Verfügungen erlassen, und sind Apotheken, Kirchen und Schulen erbaut. Für ihn macht der Schneider seine fertigen Anzüge, schreibt der Arzt seine Rezepte, gibt der Lehrer seine Schulaufgaben und der Richter seine Urteile, und für ihn schaufelt der Totengräber seine Gräber. In Wahrheit hat ihn niemand gesehen noch gehört; wie ein unsichtbarer Geist wandelt der Normalmensch unter uns Deutschen umher, aber für dieses knöcherne Gespenst tun wir alle unsere Pflichten, zahlen wir unsere Steuern, leiden wir unseren Ärger. Was einem etwa im Leben als solcher begegnet oder vorgestellt wird, das sind so widerwärtige Kreaturen, daß man im Interesse des idealen Normalmenschen sich dagegen verwahren muß, daß diese bloß anscheinend korrekten Geschöpfe seinen Namen führen. Wenn man bloß einmal im kleinen Umkreis seiner Familie und seiner Verwandtschaft Umschau hält, ist man baß erstaunt, daß man so einen ganz richtigen Normalmenschen nirgends entdecken kann. Da ist eine sonst unbescholtene Tante, die nachts ohne Licht nicht schlafen mag, da ist ein Onkel, der trinkt, ein Neffe, der das Schießen [S. 322]nicht vertragen kann, eine Cousine, die einen Zirkusreiter geheiratet hat, ein Vetter, der gerne Tiere quält und ein Schwager, der die Platzangst hat oder einer, der ins Hasardspiel versessen ist. Alles ganz harmlose, unbestrafte Individuen, aber samt und sonders keineswegs völlig normal zu nennen. Ja, man findet einen solchen Mustermenschen in ganz Deutschland, von Memel bis Lindau nicht, und selbst Staatsanwälte, die sich im Spiegel besehen, werden finden, daß sie irgend etwas Anormales an sich haben, etwa, daß sie mit der linken Schulter zucken, wenn einer freigesprochen wird, oder nachts das Strafgesetzbuch unter dem Kopfkissen haben müssen.
Das Seltsame dabei ist, daß der Mensch meist diesen kleinen Grillen mit einer gewissen Wehmut obliegt, daß er geärgert oder bekümmert diesen seinen fixen Ideen nachgeht, durch die er lebt und verbrennt. „Denn Leiden ist allen Kreaturen beigemischt“, wie Meister Eckehart sagt, und darum sind seit alters her Rausch und Tränen Nachbarn gewesen. An dieses Anormale und Schmerzliche, das in jedem Menschen wohnt und ihn ausmacht, muß man immer denken, wenn man in die Bildergalerie von Meister Albrecht Dürer eintritt. Bei ihm, der doch nach seinem eigenen Bekenntnis „alles mit Fleiß nach der Natur gemacht hat und nicht das Kleinste von ihr abgewichen ist“, überkommt uns als nächstes Gefühl vor seinen Werken das der Absonderlichkeit und der Anormalität. Alle seine Menschen und Figuren haben etwas Merkwürdiges, Apartes, ihnen schmerzlich Eigentümliches. Dieser nach seinem besten Wissen rein naturalistische Künstler [S. 323]hat, mit seiner Staffelei vor seinen Mitmenschen sitzend, keinen Normalmenschen, ja nicht einmal einen Typus entdecken können. Jeder hat sein eigen Gesicht wie seine Seele, und seine besonderen Eckchen und Fältchen, Hans Tucher so gut wie Kaiser Maximilian und der Apostel Petrus. Und wenn man selbst das harte normale Stadtverordnetengesicht des Jakob Muffel lange betrachtet, wird es einem plötzlich, als sähe man diesen scheinbar ruhigen Mann nachts vom Bett aufspringen und wie Harpagon mit heißen, zitternden Händen an seinen Truhen und Schränken herumstreichen, um sich zu überzeugen, daß alles verschlossen sei. Oder seht euch das Bild des Hieronymus Holzschuher an, das heute in Berlin lebt! Sieht er nicht aus wie ein würdiger Ratsherr und Bürgermeister, von dessen Lippen Worte der Weisheit träufeln, und der mit Martin Behaim, dem Seefahrer, von dem neu entdeckten Westindien und der Insel Java parlieren konnte, wo „die leut Man und Fraven hinden schwanz gleich die hündt haben?“ Aber blickt diesem Herrn Holzschuher nur ein wenig länger in die Augen und auf den Mund, und ihr seht plötzlich das feierliche Bild verwischt und habt einen jähzornigen Mann vor euch, der mit seinem Weib wegen einer angebrannten Suppe wie ein Feldwebel mit seinen Rekruten brüllt, oder der leberkrank wird, wenn sein Söhnchen nicht Primus ist, oder der einen Hund in den Leib tritt, der zu ungelegener Zeit an ihm hochspringt.
Und so ist es mit jeglichem Bilde, das der Meister gemalt hat. Es führt sein eigenes, seltsames, begrenztes Leben, und [S. 324]ist nicht ein Mensch dem andern gleich auf Erden. Für diese Verschiedenheit der Menschen hat kein Maler auf der ganzen Welt wohl schärfere Augen gehabt als Albrecht Dürer, der um 1500 zwischen Himmel und Hölle in deutschen Landen zu Nürnberg auf Erden lebte. Führte ihn seine Kunst zu Gott empor, so zog ihn ein zänkisches Weib, das ihm sein Leben lang beigesellt war, zum Teufel hinab. Der Schmerz der Erkenntnis, die Folge von Adams Apfelbiß, spricht wie aus seinen schönen traurigen Augen und Lippen aus fast allen seinen Werken: Aus dem Blick des Christuskindes, das mit der Nelke oder den Haaren seiner Mutter spielt, ebenso wie aus den Händen des heiligen Hieronymus, oder der Haltung des Frauenkopfes bei dem Bild von der Melancholie, oder vielleicht am gewaltigsten aus jenem Kupferstich vom verlorenen Sohn. Mitten in einem deutschen Gehöft kniet er auf dem Boden, rings um sich die Schweine, die behaglich schmatzende, mit dem Rüssel im Boden wühlende, vergnügliche Kreatur. Da muß er die Hände zusammenfalten und zum Himmel emporblicken und wieder kommen erste Tränen aus seinen Augen und ein erstes Gebet aus seinem Munde. Wer den Menschenschmerz, der aus diesen zusammengepreßten Händen und diesem geöffneten Munde kommt, einmal tief betrachtet hat, der weiß, was Malen heißt, und was für eine zauberhafte Kunst das ist.
Ein solcher Künstler war Dürer, der größte Maler, den Deutschland hervorgebracht hat, der das Leben verdoppeln konnte, weil er alles sah wie es war, und jedem Menschen [S. 325]auf den Grund schauen konnte, wo wir nur Oberfläche und Umrisse erblicken, als ob er dabei gewesen wäre und zugesehen hätte, wie Gott die Welt erschuf. Er löste das Siegel eines jeden Menschen, wenn er ihn malte, und als ein Freund und Schüler ihn einmal leise getadelt hatte, daß das Bild, das er von seiner eigenen alten Mutter gezeichnet hatte, nicht häßlich genug wäre, da holte er diesen, als die Alte später gestorben war, an die Leiche, auf daß er sie betrachte und erkenne, „daß sie in ihrem Tod viel lieblicher sach dann da sie noch das Leben hätt’“. „Und mir war dabei,“ erzählt jener, „als ob Meister Albrecht sie schon im Leben oft so wie heute auf der Totenbahre geschauet hätte.“ Das ist das Wunderbarste und Genialste an Dürer, daß er außer seinen beiden Augen, die jedes Härchen auf den Lidern des anderen sahen und den Mundwinkeln einer Frau anmerkten, ob sie eine wilde oder eine fromme Jugend durchgemacht hatte, noch jenes dritte Auge hatte, vor dem alle Formen in eins zusammenfließen und alles Vergängliche verewigt wird.
Der Normalmensch, der nirgends existiert, würde schließlich noch von Dürer berichten, daß er bei Michael Wohlgemut zu Nürnberg Zauberlehrling war und das Malen erlernte, und daß er in Venedig und in Antwerpen gewesen wäre, und daß er an der Auszehrung gestorben sei, und daß der Schwerpunkt der Dürerschen Kunst in seiner ungewöhnlichen Persönlichkeit liege, der überwältigenden Kraft seines leidenschaftlichen seelischen Empfindens, der rein menschlichen und streng sittlichen Bildung seines Geistes, der Kindlichkeit [S. 326]seines Gemüts und dem Adel seiner Gesinnung, der sich nicht nur überall in seinen Leistungen ausspräche, sondern auch von seinen bedeutendsten Zeitgenossen wie Pirkheimer, Kamerarius und Melanchthon wiederholt bezeugt werde, wie dies alles in Brockhaus’ Konversationslexikon — auch einer Einrichtung für Normalmenschen! — zu lesen ist. Aber er würde vergessen, zu erzählen, daß auf seinem Grabstein auf dem Friedhof der St. Johanneskirche zu Nürnberg die Worte stehen: „Streue ihm Blumen, o Wanderer, Blumen“, — keine Phrasen!
[S. 327]
Rembrandt kam von dem Begräbnis seiner Frau in sein Haus zurück. In der Breestraat lag es, mitten im Amsterdamer Judenviertel. Die reichen Verwandten seiner Frau, die mit draußen auf dem Friedhof gewesen waren, hatten ihn alle verlassen. Sie liebten diese mit jüdischen Trödlern und Bettlern gefüllten Gassen nicht, und einer hatte sogar auf dem Wege zum Grabe ziemlich laut gesagt, seine Base Saskia sei an der schlechten jüdischen Luft so früh zugrunde gegangen. Und dann hatten sich noch einmal alle Augen der reichen Sippschaft auf den Maler Rembrandt gerichtet, der als ein armer Müllerssohn die Frechheit gehabt hatte, ihre reiche Verwandte zu heiraten und nun noch lebendig dastand mit seinem breiten plumpen, gemeinen plebejischen Gesicht, während man den Sarg seiner Frau am Strick in die Erde hinunterließ. An den stumm beredten Ausdruck dieser Augen, mit dem nur reiche Holländer einen armen Schlucker ansehen können, dachte der Maler, als er den Schlüssel in das Schloß seiner Haustüre steckte. Er zog seine schwarzen Handschuhe aus, und er wußte plötzlich nicht, hatte er jene Szene gemalt oder erlebt. Dann hing er den breiten braunen Hut an einen Nagel, der aus dem Dunkel des Flurs aufleuchtete, und ging in seine Werkstatt über den Gang nach hinten. Er setzte sich vor seine Staffelei und sah sich das Machwerk, das daran hing, scharf und lange an. Es war sein Selbstbildnis, das er in den Tagen ihrer Krankheit, da er zu nichts anderm [S. 328]Geduld fand, begonnen hatte. Da stand noch der Spiegel neben der Staffelei und fing seinen Kopf auf, als er sich vornüber beugte. Er sah hinüber und herüber und verglich die beiden Gesichter bis in die Schnurrbartspitzen. Also solch ein Kerl war er! Eine dicke, nicht ganz gerade Nase, nicht schöner als die des Sokrates, das Kinn sinnlich und nicht energisch vorgebaut, die breite Stirne über den scharfen Augen von dem vielen angespannten Sehen mit Falten grade und quer überzogen. Und just diesen scheusäligen Kerl, dessen Bild sich im Spiegel ewig bewegte, während das auf der Staffelei ewig stille stand, hatte diese schöne Frau, die man eben zu Grabe getragen hatte, sich unter vielen ausgewählt und liebgehabt. Wo mochte da das Rätsel stecken? Und Rembrandt hatte, ohne daß er wußte, was er tat, wieder zu malen angefangen und ließ seinen Pinsel kalt und ruhig zwischen den beiden Abbildern wie einen unbestechlichen Richter zwischen zwei Parteien hin und her gehen, um einen möglichst gerechten Vergleich herauszubekommen. Aber es wollte ihm heute nicht recht gelingen, unparteiisch zu sein, das höchste Ziel, das einem Künstler, der zwischen Gott und Natur steht, vorschwebt. Er mußte immer an den Rembrandt denken, den die reichen Verwandten seiner toten Frau auf dem Kirchhof wie einen Räuber und Mörder angesehen hatten. Er stand auf und trat aus dem Zwielicht seiner Werkstatt an das Fenster, durch das aus dem Hof das Licht ganz abgedämpft wie in eine Krankenstube hereinsah. Das Blatt Papier fiel ihm ins Gedächtnis, das ihm irgendein Vetter oder Schwager [S. 329]auf dem Heimwege mit einem vorwurfsvollen und zugleich etwas hämischen Augenaufschlag zugesteckt hatte. Er zog es aus der Tasche verknittert heraus. Vermutlich ein Traktätchen, wie es die Kalvinisten, Remonstranten, Mennoniten oder wie die Sekten in Holland alle hießen, drucken und unters Volk verteilen ließen, in dem mit vielen gelehrten und ungelehrten Sätzen aus einem schönen Bibelspruch etwas Unschönes gemacht worden war. Der Maler holte sein Augenglas hervor, um besser lesen zu können — denn er meinte kindlicherweise, die Wissenschaft stecke in der Brille — und begann ganz langsam, wie er es auf der Küsterschule in Leyden gelernt hatte, zu buchstabieren. „Es ist nicht zu leugnen (Non est negandum), daß der vermeintliche Maler Rembrandt van Rijn keinesweges die Erwartung erfüllet hat, welche daß künstlerische Holland auf Grund seiner in Leyden gemachten Schildereien, insbesondere jenes fürtrefflichen Bildes von der Reue des Judas, auf ihn gesetzt hatte. Die braune Brühe, in die er die Bildwerke seiner zweiten Manier getunkt hat, um ein paar goldene Flecken heller und greller daherauszufischen, ist sowohl unnatürlich als auch unschön. Es ist nicht zu verwundern (non est mirandum), daß der Maler in Amsterdam auf diesen Knüppel- und Irrweg geraten ist. Hört man doch die Kenner von ihm berichten und erzählen, daß er in einer finsteren Baute im finstersten Viertel von Amsterdam hauset, die er mit türkischen Teppichen, Kaftans, indischen Schals und arabischem Rüstzeug vollgepfropft und noch verdunkelt hat, daß man drinnen nicht [S. 330]mehr weiß, ob draußen der Mond oder die Sonne am Himmel hängt. In solch einer Grube mag dann freilich ein Gesicht oder eine ausgestreckte Hand wie Silber oder der Stern von Bethlehem leuchten. Ist das die ganze Herrlichkeit, die bei einem üppigen Wohlleben und Saufen mit den deftigen Herren der Kaisergracht herauskommt?
Aber Afterkunst blendet nur die Pöbelplebs oder rohe Barbarenseelen. Wir aber, seine Leydener Landsleute, die wir es wohlmeinen mit einem jeden Sohne unserer Stadt, fragen diesen an, wie lange will er wohl noch die Maulwurfsmalerei betreiben? Wartet er darauf, bis unsere Geduld oder sein Talent zu Ende ist? Er soll es uns nicht zu weit treiben, denn erstere ist vielleicht noch schwächer als letzteres. Warum malet er nichts Niederländisches, Echtes, als da sind ein Stilleben oder eine Mühle wie früher statt des morgenländischen Plunders, den er uns neuerlich auftischt?“
„Und so weiter!“ dachte Rembrandt und besah sich nur noch die Unterschrift des würdigen Traktamentes, das nach Galle wie ein eingelegter Hering nach Essig schmeckte. „Arent van Büchel aus Leyden“ stand darunter, und der Künstler wußte nun gleich, warum der Esel ihm über den Weg lief. Es war ein höherer Beamter und Ratsmitglied seiner Vaterstadt, der sich darüber gefuchst hatte, daß der Maler aus Leyden fort in die Hauptstadt verzogen war und die Mitgift seiner Frau in Amsterdam versteuerte. „Wenn ich am Meer hauste oder in der Sonne säße, würden sie so klug sein und daraus schließen, daß ich zu helle Farben hätte, [S. 331]und wenn ich arm wäre, hieß es, daß ich reicher sein müßte!“ dachte der Maler und sah sich in seiner exotischen Werkstatt um. „Wo Licht ist, da ist Finsternis, und wo Finsternis, da ist Licht“, mehr kann man in der Malerei, wie in der ganzen Welt nicht lernen, sprach er und zog sich selber an seinen Haaren wieder zu seinem Bild zurück. „Ich weiß nicht, was ich bin und kann nur, was ich war, wie dort meine Nase im Spiegel sehen.“ Das war aber ein Mensch, der heute seine tote Frau begraben hatte und vorgestern die Amme seines Sohnes auf dem Schoß gehabt und ihr die Ehe versprochen hatte, und der in diesen Tagen die „Nachtwache“, eines der ersten Bilder der Welt, vollendet hatte. Ein Mensch, der wußte, daß, wenn er den Holzhammer neben sich an die Stubentüre auf der Seitenwand warf, dann ein junges Dienstmädchen erschien, Hendrikje gerufen, sein Söhnchen Titus auf dem Arm und einen Teller Suppe in der andern Hand, und daß sie selbdritt dann essen würden, als sei dieses Kind ihr eigenes, dasselbe, das Saskia, die er geliebt, als letztes vor dem Sterben mit den Lippen berührt hatte. Aber er wußte nicht, ob er, der Mensch, dem die Tote dieses Knäblein anvertraut hatte, das er so liebte, nicht doch einmal an die Mündelgelder dieses Kindes greifen würde, wenn die Gläubiger, die unter dem Kommando des Konkursverwalters mit dem furchtbaren Namen Torquinius schon in sein Haus eingedrungen waren, ihn auf der Treibjagd in die Enge gepreßt hätten. Und bei dem war er so wenig ein Wüstling, daß er vier Fünftel der Zeit, die er wach war, der Arbeit weihte, und war ein so guter Vater, daß sein [S. 332]Sohn Titus, als er ein Mann geworden war, ihn mehr noch als sein eigenes Weib und seine Kinder lieb hatte.
So seltsam sah der Mensch aus, den er um sein Herz zu tragen hatte, bis er in einer Oktobernacht im Jahre 1669 erlosch. Wo waren die Engel, die er so oft gemalt hatte, als er in den letzten Wochen seines irdischen Daseins, die Binde unter der Mütze über die Stirn geknüpft, um die ewigen Kopfschmerzen zu lindern, die Augen trüb und halb blind vom Fusel abends wie eine Nachteule in den Schnapskneipen des Armenviertels von Amsterdam herumkroch? Warum tat der Himmel, der ihm soviel verdankte, nicht einmal seinen Mund auf, um diesem zitternden, fast erblindeten Greise, den die Gassenkinder verhöhnten, ins Ohr zu flüstern: „Du bist der größte Maler, den die Welt geboren hat.“ Der Totengräber, der am Sterbemorgen in Rembrandts Stube kam, um zu sehen, ob man den Geistlichen bei dem Begräbnis bezahlen könnte, stellte grinsend fest, daß außer dem Malergerät und dem wollenen Kleiderflaus nichts vorhanden war, und daß man von einer Predigt und dem Segen an seinem Grabe absehen müßte. Wo ihr größter Landsmann, der „einzige fliegende Holländer“, begraben liegt, wußte nach drei Jahren keines Menschen Seele mehr in den Niederlanden.
Erst als man das Wort und den Begriff „Helldunkel“ erfunden hatte, wachte auch Rembrandt aus seiner Vergessenheit wieder auf. Goethe war einer der kühnsten Entdecker des unbekannten Wundermannes. Die schönen Worte, die bei Rembrandts Leben und Sterben gefehlt hatten, fanden [S. 333]sich nun in würdigen Massen wie beim Begräbnis eines Akademiedirektors ein. Man nannte ihn den Vertreter des protestantischen Christentums in der Kunst und den tief Religiösen, ohne daran zu denken, daß dieser schlichte große Mann seine Stoffe lediglich aus der Bibel nahm, weil sie das einzige Buch war, das er las und lesen konnte, bis der Konkursverwalter es ihm mit versteigerte. Grade seine Wiedergabe von Christus selbst war lange Zeit und ist auch heute vielen noch nicht nach dem Sinne. Denn er hat weniger den Gott als den Menschen in ihm gesehen, den, der am meisten gelitten hat, den Freund der Bettler, Kinder und Narren, dessen Schicksal dem seinigen verwandt war. Nie hat er ihn „idealisiert“, wie man in der Töchterschule und in der Gipsklasse sagt, oft ihn qualvoll, verzerrt und traurig dargestellt, aber immer mit jener Hoheit, die aus den Augen Goethes oder von der Stirne Napoleons leuchtete. Das stille, nie die Bescheidenheit der Natur überschreitende dramatische Leben seiner Bilder hat erst unsere Zeit ganz gewürdigt. Denkt man dabei an die schreienden, verzuckerten, affektierten übertriebenen Figuren vieler Christusmaler, so ist einem, als wenn man von Shakespeare zu Wildenbruch kommt oder von einem Helden zu einem schlechten Schauspieler.
Über Rembrandts Malweise ist zu sagen, daß er sehr früh, schon in Leyden merkte, daß die Geburtsstunde eines jeden bedeutenden Malers der Augenblick ist, wo er sich innerlich frei macht von der Akademie und ein neues Leben beginnt, indem er seine eigene Technik gefunden hat. Und wenn auch diese den heutigen Malern nichts mehr zu geben [S. 334]hätte, die das Licht und „seine Leiden und Taten“, die Farben, wie Goethe, der Sohn des Lichtes, sie genannt hat, draußen im Freien aufsuchen, die große Persönlichkeit, die hinter den Werken Rembrandts steht, die kann allen Deutschen, wie jener eine Deutsche in einem ganzen Buche bewiesen hat, den Künstlern wie dem Publikum noch heute ein Erzieher sein. Sie lehrt uns vor allem in der Kunst keine Kompromisse zu machen und zu verlangen. Was klein an so großen Künstlern wie Schiller und Richard Wagner ist, das haben sie ihrer Schwäche in diesem Punkte zu verdanken. Rembrandts erhabenes tragisches Beispiel weist dem Künstler den Weg zur Unsterblichkeit. Vor ihn sollte man die jungen Akademiker führen, nicht um ihn zu kopieren, sondern um Persönlichkeiten und eigene Menschen wie er zu werden. Und man sollte sie noch heute anreden wie der alte Cornelius seine Schüler: „Nicht darauf kommt es an, meine Herren, möglichst viele tausend Taler im Jahre zu verdienen und ein Haus in der vornehmsten Straße zu erwerben, sondern einzig darauf, Kunst zu machen.
Was nützt es dem Maler, wenn er sich hohe Orden und Titel und Revenuen wie Rothschild ermalt und erster Klasse mit sechs Pferden und mit Musik begraben wird, wenn er zehn Jahre später der Lächerlichkeit verfällt und seine Bilder immer höher bis auf den Speicher wandern und die Motten selbst sie nicht mehr mögen? Auf Rembrandt schaut, ihn ehrt wie einen Heiligen, den Welteroberer, der auf der Strohmatte gestorben ist und als Bettler erlosch, um als größter Künstler fortzuleben!“
[S. 335]
Wir haben in Deutschland niemals eine richtige, erfolgreiche Revolution gehabt. Das bißchen schöne heiße deutsche Blut anno 1848 wurde durch die mechanisch bei uns wirkende Militärmaschine niedergedrückt und tobte sich in den klingenden endlosen Reden des Frankfurter Parlaments langsam und friedlich in einem nicht wehetuenden Idealismus zu Ende. Und siebenzig Jahre später, 1918, ging es auch noch höchst gedämpft und maßvoll zu. Es ist wohl weniger die Furcht vor Pulver, denn in drei siegreichen Kriegen unter Bismarck und in dem verlorenen unter Hindenburg bewiesen wir den alten furor teutonicus — als vielmehr die eingeborene Scheu vor unseren Fürsten, die uns beim Revolutionieren hinderte, derzufolge wir verfahren, wie Heine gepfiffen hat:
Die fürchterliche Aufgabe, Revolution zu machen, blieb somit in Deutschland immer nur einzelnen überlassen, die wiederum in das Gebiet des Geistigen verschlagen wurden, da Politik bislang fast stets bei uns Sache der oder des Fürsten war. So kam es, daß unser Cromwell Martin [S. 336]Luther hieß, der die Bibel ins Deutsche übersetzte, statt Karl V. den Kopf abzuschlagen, und daß unser unblutiger Camille Desmoulins Immanuel Kant war, der eher fast Gott selber entthront hätte, als daß er eine Zeile gegen seinen Monarchen geschrieben hätte. Und so wird auch vielleicht die Religion der Zukunft als eine geistige Umwälzung von Deutschland aus ihren Ausgang nehmen.
In die Reihe dieser deutschen Empörer und Aufwiegler, die die schwere Aufgabe, die ihnen zugefallen ist, mit einem tragischen Leben besiegeln, gehört auch der große Mensch, Denker und Künstler Arthur Schopenhauer, dessen gewaltigen Schatten wir hier heraufbeschwören wollen. Seine Ausnahmestellung unter den deutschen Gelehrten verdankte er, da er lebte, zunächst einmal seinem Reichtum. Die Philosophen und Künstler waren bis dahin in Deutschland von der Gnade ihres Herrschers oder der Großen abhängig, oder wie noch heute bei uns, an die Gunst des Publikums verkauft. Noch Goethe saß in der Idee fest, daß der Künstler und Denker mit einem Augenaufschlag zu dem Fürsten oder dem Mächtigen emporblicken müsse, der ihm die Mittel zum Leben spendete. Der Fleiß und die Tatkraft eines reichen, früh verstorbenen Vaters, an dem der Sohn sein Leben lang mit hamletischer Liebe hing, brachte Schopenhauer von Jugend auf in eine völlig freie Unabhängigkeit, so daß er von keines andern Laune und Humor, noch von der Anerkennung seiner Mitwelt zu leben brauchte.
Man kann sich das herrliche Gefühl vorstellen, mit dem er im „Hotel zum Schwanen“ oder im „Englischen Hof“ [S. 337]zu Frankfurt am Main, wo er täglich zu Mittag aß, an der Table d’hote zwischen reisenden Engländern, Offizieren, Bankiers und Millionären saß, ohne irgend jemand den Hof machen oder sich überhaupt unterhalten zu müssen. Die Freude, daß das Geld endlich einmal an den Rechten in Deutschland gekommen war, soll bisweilen, wenn er den Schaum vom Champagner blies, aus seinen kleinen Augen gezwinkert haben. Ohne diesen Reichtum, der ihm die Freiheit gab, hätte er vielleicht dies Leben damals in Deutschland gar nicht überstehen können. Denn zumeist saß er verbittert und in sich geduckt wie einer, der nur auf die innere Stimme hört, und angewidert unter den Menschen seiner Zeit. Man erzählte sich, und wenn es auch bloß erfunden ist, so ist es doch gut erfunden, daß er im „Englischen Hof“ zu Frankfurt wochenlang täglich einen Taler vor sich auf den Tisch gelegt und dabei vor sich hingeknurrt hätte: „Den will ich den Armen schenken, wenn die Offiziere gegenüber heute von etwas anderem als von Pferden und von Weibern sprechen!“ Aber nach jeder Mahlzeit hätte er grinsend den Taler wieder zu sich gesteckt. Der Mangel an Ernst bei den meisten Menschen um ihn mußte ihn, der noch oder schon die Schauer der Unterwelt in sich verspürte und hinter allem und jedem die Flügel des Todes rauschen hörte, unsagbar quälen.
Zuweilen geschah es dann, daß dieser an einem Freitag zur Welt gekommene graue Geist beim Essen wohl wütend die „Times“ hervorholte und zu lesen begann, bis ein reicher Lord, der neben ihm saß und für den der Hausknecht sich englische Sprachbrocken [S. 338]einstudierte, ihn erfreut fragte: „Oh, you speak English?“, und der Philosoph mit einem kurzen „Nein!“ die Unterhaltung im Keim erstickte. Dazu kam, daß diesen von Natur schon ungeselligen Polyphem die völlige Teilnahmlosigkeit, welche die Mitwelt seinem Denken und Schreiben entgegenbrachte, noch mehr in Menschenhaß und Einsamkeit hineintrieb.
Das philosophische System Hegels hing damals wie eine Sonne über dem ganzen geistigen und künstlerischen Leben Deutschlands und gab allem, was erdacht und erdichtet wurde, sein Licht mit. Gerade diesen Hegel nun haßte Schopenhauer, wie Tag und Nacht sich hassen, und hat ihn so kräftig beschmäht, wie seit Luther keiner in Deutschland geschimpft hat. Die Folge davon war, daß er nicht einmal von den gelehrten Kreisen und den Besten seiner Zeit beachtet wurde. In Heines Schriften, der doch sehr belesen und stets auf Neues erpicht war, ist der Name „Schopenhauer“ nicht einmal genannt. Hebbel, sonst ein Vorposten der Generation um 1900, erwähnt ihn wenige Male, aber nur, um ohne Blick für seine Größe sich über ihn als einen philosophischen Sonderling lustig zu machen. Hegel selbst hat ihn völlig ignoriert.
Man kann sich denken, wie es in der Brust eines schon von Natur ernst und düster veranlagten Menschen, dessen großer Ehrgeiz durch völlige Nichtbeachtung oder Verhöhnung erstickt wurde, ausgesehen haben muß! Die Hölle, wo sie am tiefsten ist, muß silberweiß sein gegen die Nacht, in der dieser Geist jahrzehntelang gebrannt hat. Immer [S. 339]wieder ruft er sich die Namen aller großen Männer und Märtyrer zu, wie ein Krieger in der Schlacht seine Heiligen, um nicht vor Furcht oder Ekel wahnsinnig zu werden. Aber die Kraft seines Geistes und sein Mut, der es mit Tod und Teufel aufnahm, überstand dieses isolierte Leben über den Menschen seiner Zeit, das seinen besten Jünger Nietzsche später zerbrochen hat. Er wußte ganz genau, daß er den Prozeß, den er um sein Werk mit der Mitwelt führte, vor der Nachwelt gewinnen würde, und darum schrie er so lange: „Ich habe recht!“, bis ganz Deutschland ihn anstarrte. Freilich kam er so zerzaust und verwundet aus dem Streit heraus, daß sein Greisengesicht das entsetzlichste Antlitz ist, das wir Menschen kennen. Bismarck, der doch Mut für sieben hatte, ertrug den Anblick dieses Mannes schwer und saß als Gesandter beim Deutschen Bunde zu Frankfurt ungern im „Englischen Hof“, wenn jener steinerne Gast erschien.
Dreißig Jahre lang lebte Schopenhauer in der Geburtsstadt Goethes, mit dem er als Jüngling befreundet gewesen, und den er nun als einzige deutsche Gottheit neben Kant verehrte. Lebte da zusammen mit seinen Widersprüchen, seinen fixen Ideen, seiner Flöte und seiner genau von ihm abgemessenen Weichselrohrpfeife, seinem Pudel und seinem Weiberhaß, der wieder wie bei Hamlet zunächst daher rührte, daß seine Mutter in den neuen Umarmungen eines Hausfreundes den geliebten Vater vergessen hatte. Wie der finstere Alberich den Nibelungenhort hütete er seine Lehre für die Zukunft. Sein Stolz war, viel zu denken [S. 340]und wenig zu schreiben, und dies Wenige in einer so klaren und schönen Sprache, daß jeder Deutsche, wofern er nur selbst denken will, es verstehen kann. Er rechnete damit, daß, wie von Hellas nur der Name und das Werk seiner Dichter und Denker übriggeblieben wäre, so auch, wenn Deutschland dereinst vergehen könnte, sein Name und seine Lehre wie die Platos die Jahrtausende überdauern sollte. Darum predigte er unserem Volke stets die Ehrfurcht vor seinen geistigen Führern vor, versuchte er vergeblich den Barbaren und Hyperboräern, unter denen wir hausen, Verehrung und Liebe für die Künste einzuposaunen.
Seine Lehre ist aufgeschrieben in dem Werk, dem er den Titel gab: „Die Welt als Wille und Vorstellung.“ Seine Ethik ist darum für uns Heutige von solcher Bedeutung, weil sie in der indischen und der ihr nah verwandten untergegangenen germanischen Religion, der Mystik, wurzelt, wie sie vor 600 Jahren zuletzt der Dominikanermönch Meister Eckehart öffentlich vor dem Dom zu Köln verkündet hat. Darum kann Schopenhauer jedem Deutschen, der sich in ihn versenkt und der ihm opfert, ein Seelsorger, ein Tröster und Berater über dies Leben hin werden. Und wer in der grauen Stunde des Todes die Hand nach ihm ausstreckt, der wird mit allen Heilsmitteln, die die menschliche Vernunft zu vergeben hat, von ihm gestärkt werden und ein schönes leichtes irdisches Ende haben.
[S. 341]
Friedrich Nietzsche, der Künstler, ist plötzlich in das Deutschland nach 1870 wie ein Wolf in eine Hürde eingebrochen. Es läßt sich nicht mehr leugnen, daß er während der letzten Jahrzehnte und noch heute unser ganzes geistiges Leben bestimmt, mehr noch als dies, daß er eine ganz neue Gefühlswelt wachgerufen und heiliggesprochen hat. Darum vornehmlich ist er der Führer und Abgott des heutigen jungen Deutschlands geworden, nicht weil er alte Tafeln zerbrach — das taten mit ihm Ibsen und andere noch viel krachender —, sondern weil er neue Tafeln aufrichtete und frische, blühende Worte und Werte daraufschrieb. In seinem Werk „Jenseits von Gut und Böse“, das leben wird wie die Evangelien, hat er den Punkt außerhalb der alten moralischen Welt der Vorurteile gefunden, von dem aus man diese ganze überkommene Welt der Moralität aus den Angeln heben und umwerten kann. Indem er einen jeden an seinem Kragen packte und ihm an seinem höchst eigenen Charakter Hamlets Weisheit: „An sich ist nichts weder gut noch böse; das Denken macht es erst dazu“ klar machte, nötigte er ihn, zu fühlen, wie widersinnig es ist, die Menschen in schwarze und weiße Schafe zu scheiden. So hat er unsere Strafgesetzgebung ihrer falschen pharisäer- und philisterhaften Moral zu entkleiden, unser Gesellschaftsleben auf ein freieres Fundament [S. 342]zu stellen versucht, und so hat er die Freiheit des Einzelmenschen gepredigt, Deutschlands zweiter größerer Reformator als Luther. Das ist sein Eigenes, daß alle Erkenntnis ihm immer Erlebnis hieß, daß er aus einem Denker ein Dichter wurde und aus einem Philosophen ein Prophet. Er hat in seinem Zarathustra, diesem einzigen Werke, keinen Satz geschrieben, der ihm nicht aus der Tiefe seiner Empfindung wie eine Träne emporstieg. Seine ganze Liebe galt den Menschen der Zukunft, den neuen, den Übermenschen, die den Menschen, das unvollkommene traurige Erden- und Herdentier überwunden haben. Sein ganzer Haß galt der Vergangenheit und ihren falschen Werten, als da waren: Mitleid mit dem Schwachen und Hinfälligen, oder Sehnsucht nach dem Jenseitigen. Wie eine Stimme von einem andern Stern klingen dann seine Worte: „Ich beschwöre euch, meine Brüder, bleibt der Erde treu und glaubt denen nicht, welche euch von überirdischen Hoffnungen reden. Giftmischer sind es, ob sie es wissen oder nicht.“ Keiner vor ihm hat jemals so stark und unbedingt das Menschenleben gefeiert und gepriesen wie er. Und das war ihm die Krone des irdischen Lebens: Lachen und sich freuen und tanzen zu können. „Das Lachen sprach ich heilig; ihr höheren Menschen, lernt mir — lachen.“ Namentlich dieses hat man ihm lange Zeit bei uns in Deutschland sehr verübelt, wo man die Ehe, die Kindererziehung, den Beruf für entsetzlich ernste, trübselige und mit äußerster Schwerfälligkeit zu verrichtende Beschäftigungen hält, und wo man vor lauter Pflichten gegen [S. 343]andere die Pflichten gegen sich selbst vergessen hat. Dafür allein sind wir ihm zur ewigen Dankbarkeit verpflichtet, daß er uns gelehrt hat, alles Vergängliche einmal von oben herab, wie ein Vogel, wie ein Fliegender zu betrachten. Nicht frivol, wie Feindschaft und Unverstand gemeint haben. Der Mann, der sich und uns das Wort gegeben hat: „Was uns das Leben verspricht, das wollen wir — dem Leben halten“, der niemals genießen wollte, ist vor diesem Schimpf, mit dem „man“ die Freien gerne bedenkt, für immer gerettet.
Denn sein Leben ist das eines Märtyrers gewesen: Als Sohn eines Pfarrers und als Sproß einer ganzen Pastorengeneration bestimmte ihn sein Dämonion dazu, der stärkste Gegner des Christentums zu werden, den es seit Voltaire gegeben hat. Zur Geselligkeit geneigt, trieben ihn Krankheit und grausame Schmerzen von allen Menschen fort in die eisige Öde der Gletscherwelt oder an das einsame blaue Meer. Von den Frauen, mit denen seine zarte, edel gezüchtete Seele sich gerne vermischte, scheuchte ihn späterhin vermutlich jene schlimmste Ansteckung zurück, die den schönen Anschluß der Geschlechter zu Gift macht. Auf die Freundschaft angewiesen wie kaum ein germanischer Mann vor ihm, mußte er, der von Jahr zu Jahr sich wandelte, alle Kameraden und Freunde hinter sich lassen und war schließlich unverstanden und ganz allein in der Einsiedelei und Wüste seiner Gedanken und Gefühle, von Teufeln und Tieren umlebt wie der heilige Antonius in der Versuchung. „Aber, was tun Sie hier den lieben langen Tag?“, [S. 344]fragte ihn die Frau eines einstigen Freundes, als sie ihn zwischen Kühen auf einem blumenübersäten Wiesenabhang im Engadin träumend fand. „Ich fange Gedanken“, war seine lächelnde Antwort.
Das war also aus dem vielversprechenden, glänzenden jungen Gelehrten geworden, einer, der dichtet und in den Himmel stiert und dem Herrgott die Zeit stiehlt. Keiner hatte ein volles Verständnis für ihn, nirgends fand er einen Widerhall, und als endlich der heißersehnte Ruhm ihn aus seiner Einöde für die ganze Welt emporriß, war es zu spät geworden. Irgendwo in der Fremde, in einer großen Stadt, in der er auch nicht eine einzige Seele kannte, ergriff ihn der Wahnsinn. Irgend ein gleichgültiger Mensch holte ihn von der Straße fort, als er, sich nach Liebe sehnend, ein Droschkenpferd umarmte. Er hatte nicht mehr die Kraft des Bewußtseins, von dem Gift, das er für den letzten Fall bei sich hatte, zu nehmen, und so fiel er denn in die gütigen Hände seiner barmherzigen Schwester, die ihn, das heißt seinen irren Kadaver, bis zum Ende seines Daseins weiterpäppelte. So mußte er, der den freien Tod gelehrt hatte und das Wort: „Stirb zur rechten Zeit!“ noch zehn elende Jahre auf der Erde fristen. Bei einem Gewitter im Sommer 1900, zu Beginn des Jahrhunderts, von dem er prophezeite, daß in ihm Europa über seine Lehren in Krämpfe fallen werde, unter Donner und Blitz, ist er gestorben und nieder zur Hölle gefahren. „Zur Erde will ich wieder werden, daß ich in der Ruhe habe, die mich gebar“, hatte er einst gesprochen. Und so hat man ihn auf dem [S. 345]Friedhof neben dem Pfarrhause, das ihn wie einen Drachen, der es verschlingen sollte, erzeugt hatte, zur Ruhe bestattet. So sehr hat er das Leben lieb gehabt, daß in ihm am Ende eine längst vergessene heidnische Lehre wieder zur Gewißheit wurde, die Lehre von der ewigen Wiederkunft, nämlich, „daß alle Dinge ewig wiederkehren und wir selber mit, und daß wir schon ewige Male dagewesen sind, und alle Dinge mit uns“. Das war die letzte Erkenntnis, die ihm sein Dasein brachte, die ihn quälte, wenn er sich bewußt wurde, daß auch der kleinste Mensch ewig wiederkommen wird, und die ihn zugleich beseligte, wenn er seines eigenen Heldenlebens gedachte. Mit diesen zwiespältigen Gefühlen, die er in Liedern und Dithyramben sich zusang, ist er vom Leben geschieden, mit irren Schritten schon durch den Vorhof des Todes tappend.
Kein Denkmal verkündet noch in deutschen Landen mit steinernem Munde seinen Ruhm. Aber Könige werden sterben und Reiche dahinsinken, doch sein Name wird noch über ferne Jahrhunderte glänzen.
Von
Herbert Eulenberg
erschienen als weitere Bände der „Schattenbilder“
im Verlage von Bruno Cassirer,
Berlin
Neue Bilder
*
Letzte Bilder
*
Bühnenbilder
*
Sterblich Unsterbliche
*
Jeder Band in Ganzleinen
7 Mark
Bruno Cassirer / Verlag / Berlin