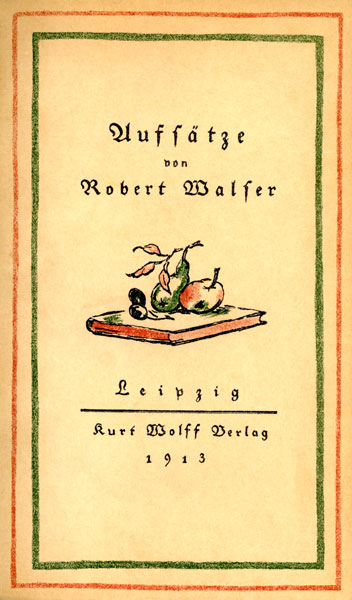
The Project Gutenberg EBook of Aufsätze, by Robert Walser This eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this eBook or online at www.gutenberg.org Title: Aufsätze Author: Robert Walser Illustrator: Karl Walser Release Date: September 30, 2011 [EBook #37579] Language: German Character set encoding: UTF-8 *** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK AUFSÄTZE *** Produced by Jana Srna and the Online Distributed Proofreading Team at https://www.pgdp.net
Anmerkungen zur Transkription:
Schreibweise und Interpunktion des Originaltextes wurden übernommen; lediglich offensichtliche Druckfehler wurden korrigiert. Änderungen sind im Text so gekennzeichnet. Der Originaltext erscheint beim Überfahren mit der Maus. Eine Liste der vorgenommenen Änderungen findet sich am Ende des Textes.
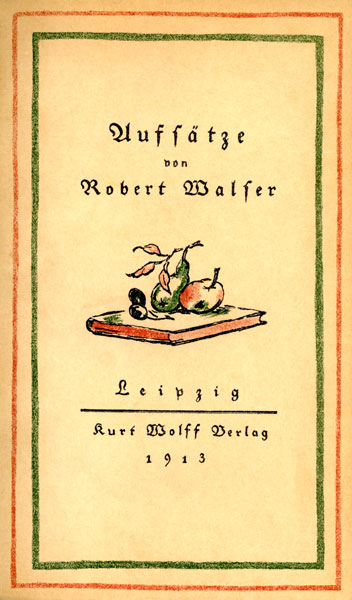

Leipzig
Kurt Wolff Verlag
1913
Einband und Vignetten zeichnete Karl Walser. Gedruckt bei Oscar Brandstetter, Leipzig. 25 Exemplare wurden auf Bütten abgezogen und handschriftlich numeriert
Copyright 1913 by Kurt Wolff Verlag, Leipzig
| Seite | |
|---|---|
| Brief von Simon Tanner | 9 |
| An die Heimat | 16 |
| Brief eines Mannes an einen Mann | 17 |
| Eine Theatervorstellung | 20 |
| In der Provinz | 29 |
| Frau und Schauspieler | 39 |
| Entwurf zu einem Vorspiel | 46 |
| Zwei kleine Märchen | 49 |
| Vier Späße | 52 |
| Tell in Prosa | 57 |
| Berühmter Auftritt | 60 |
| Percy | 63 |
| Gebirgshallen | 67 |
| Auf Knien | 70 |
| »Guten Abend, Jungfer!« | 73 |
| Porträtskizze | 76 |
| Ein Genie | 79 |
| Don Juan | 82 |
| Kino | 87 |
| Wanda | 90 |
| Fanny | 92 |
| Lebendes Bild | 95 |
| Ovation | 100 |
| Guten Tag, Riesin! | 103 |
| Aschinger | 109 |
| Markt | 114 |
| Dinerabend | 118 |
| Friedrichstraße | 123 |
| Berlin W | 128 |
| Ballonfahrt | 132 |
| Tiergarten | 137 |
| Die kleine Berlinerin | 142 |
| Brentano | 157 |
| Aus Stendhal | 165 |
| Kotzebue | 168 |
| Büchners Flucht | 171 |
| Birch-Pfeiffer | 173 |
| Lenz | 176 |
| Germer | 184 |
| Das Büebli | 193 |
| Paganini | 202 |
| Der Schriftsteller | 207 |
| Allerlei | 215 |
| Der Wald | 224 |
| Zwei sonderbare Geschichten vom Sterben | 227 |
| Der fremde Geselle | 230 |
| Die Einsiedelei | 233 |
| Reigen | 236 |
Das alles, was ich jetzt hier schreibe, ist für Sie, liebe Frau. Ich sehe so viel Zeit vor mir, die ich zu nichts anderem als zu einer künstlichen Spielerei verwenden kann, eine solche Menge, einen solchen Haufen von Zeit, daß ich nur von Herzen froh sein kann, diesen Zeitvertreib gefunden zu haben. Man will und kann mich nicht beschäftigen, man braucht mich nicht, ich stehe völlig außerhalb jedes Bedürfnisses, wohlan, so gebrauche ich mich eben selber, wähle mir selber den Zweck und halte mich für gut genug, irgendein Werk, wäre es auch das sonderbarste und nutzloseste, zu vollführen. Ich bin breit und schwer und voll von Empfindungen. So kläglich auch meine jetzige Lage sein mag in dieser Spiegelgasse, so seltsam frei und mutig komme ich mir vor, so leicht und erfinderisch in wohltuenden Gedanken ist mein Herz. Nur ab und zu, um es offen herauszusagen, bin ich traurig und hoffnungslos, denke an meine Zukunft als wie an etwas Verlorenes und Düsteres, aber das sind Augenblicke, weiter nichts.
Ich schreibe an Sie, weil Sie eine schöne und liebe Frau sind, weil ich jemanden im Sinne tragen muß, um lebhaft und aufrichtig schreiben zu können, weil ich auf Erden immer das Nächste liebgehabt habe, und weil Sie mir die Nächste sind, Sie, von der ich nur durch eine dünne, dumme Zimmerwand abgetrennt atme und lebe. Ich finde darin etwas Schönes, es hat für mich etwas Berauschendes und Geheimnisvolles und Weithintragendes. Ich bin zu Ihnen gekommen an einem heißen Tag, Sie wissen es auch, wo die Sonne die Gasse verbrannte, durch Zufall und Einfall, vielleicht auch durch Wunderlichkeit, weil ich dachte, daß in dieser Gasse die Zimmer besonders dunkel, sonnenlos, schattig, eng und auch ... billig sein müßten. Sie standen auf dem Treppenansatz und sahen mich mit Ihren Augen ziemlich durchdringlich an, und ich muß gestehen, ich zitterte ein wenig vor diesem Blick, denn ich kam mir so recht vor wie ein Suchender, Bittender, auch hatte ich nur noch eine Kleinigkeit von Geld in der Tasche und glaubte, Sie müßten mir das ansehen. Bettler betragen sich bekanntlich immer unsicher. Sie zeigten mir das Zimmer, und ich drückte Ihnen, ich weiß nicht mehr aus welchem Gefühl des Stolztuns, meine letzten Geldmünzen in die Hand; Sie nickten befriedigt und der Handel war abgeschlossen. Seitdem habe ich kein Wort mehr mit Ihnen gesprochen, und doch ist beinahe ein Monat seither verflossen, und ich nehme an, Sie halten mich für einen stolzen Menschen. Es macht mir Vergnügen, dies annehmen zu dürfen und zu denken, daß Sie es gar nicht wagen, mich mit einem Wort anzureden, der doch glücklich wäre, wenn Sie es tun würden. Nun, ich bin auch so glücklich. Ich sehe, ich mache einen günstigen Eindruck auf Sie, mein Schweigen erzwingt sich Ihre Achtung, denn gewöhnlich sind Bettler geschwätzig. Sie halten mich für einen armen Menschen, Sie haben schon Mitleid mit mir und fürchten sicher, daß ich nicht werde bezahlen können, wenn der Monat zu Ende geht, und doch wagen Sie nicht die geringste Annäherung, sagen kein Wort, machen immer ein achtungsvoll freundliches Gesicht, wenn Sie mir begegnen, in dessen Zügen ich den Wunsch, zu reden, lebhaft unterdrückt sehe. Während Sie fürchten müssen, von mir hintergangen zu werden, werden Sie immer freundlicher zu mir, erweisen mir kleine Aufmerksamkeiten, die man schätzt, weil sie schweigend geschehen, stellen mir einen Teppich und einen Spiegel ins Zimmer und gestatten mir, Sie nachts, wenn Sie schlafen, aus der Ruhe zu schrecken, um mich ins Haus einzulassen, verzeihen mir das und verzeihen sogar, wenn ich nicht einmal dafür um Entschuldigung bitte. Im ganzen genommen, Sie sehen etwas Besonderes an mir, Sie meinen vielleicht, daß ich ein guter Mensch bin, der etwas in die Klemme geraten ist, Sie sind davon überzeugt, daß meine Eltern hochachtbare Menschen gewesen sind, oder noch sind, Sie schätzen mich und wünschen, mich nicht zu kränken; nun, aus all diesen Gründen, die ich mir zunutze machen will, und die ich deutlich klar sehe, will ich, wenn der Monat zu Ende sein wird, vor Sie hintreten, kurz und rasch, vielleicht mit etwas empfindlicher Röte im Gesicht, mit etwas absichtlicher Wärme in der Stimme, und Ihnen offen bekennen, und Sie dabei anblicken, wie, das weiß ich noch nicht, aber jedenfalls bezwingend, Ihnen einfach frech das Bekenntnis ablegen, daß ich außer der Lage sei, bezahlen zu können. Ich weiß, daß ich siegen werde und daß der Sieg nicht einmal ein unfreundlicher sein wird, Sie liebe Frau! Wie ich Sie liebe, daß ich dieses alles so genau weiß. Sie kennen mich und ich kenne Sie, ich finde das so wunderschön, so erwärmend. Es kann mir, solange ich bei Ihnen bin, unmöglich schlecht gehen. Nein, unmöglich!
Habe ich es nicht zum voraus gesagt? Sie hatten nicht einmal Zeit, mich zu beruhigen und mir die Versicherung zu geben, daß ich mir doch deswegen nicht die mindesten Gedanken zu machen brauche, so rasch schnitt ich ab, indem ich einfach fortlief. Ich habe nur den Kopf und ein Viertel des Leibes zur Türe ins Zimmer hineingestreckt und ziemlich fließend und kalt mein Geständnis vorgebracht und bin verschwunden, ohne nur hören zu wollen, was Sie auch dazu sagen würden. Sie saßen, mit einer Handarbeit beschäftigt, auf dem Sofa und waren verwundert und wiederum gar nicht im mindesten verwundert darüber. Sie haben gelächelt, und Sie scheinen über diesen Punkt sorglos zu sein. Mein Betragen scheint Ihnen, trotz seiner Kaltblütigkeit, oder vielleicht gerade deshalb, gefallen zu haben. Es ist allerdings wahr, ich bin pünktlich erschienen, absichtlich pünktlich, mit meiner Eröffnung: ich bin Ihr Schuldner; ich scheine also in Ihren Augen ein ordnungsliebender Mann zu sein, einer, der genau weiß, wann Termine ablaufen, einer, der den Kalender mit seinen dreißig Tagen genau im Kopfe hat. Es hat also einen guten Eindruck auf Sie gemacht, daß ich so genau wußte, wieviel und von welchem Tage ab ich Ihnen schuldig bin, und ich bin Ihnen ganz gern etwas schuldig und freue mich sehr, eines Tages vor Ihnen zu erscheinen, ebenso rasch und achtlos, wie es diesmal geschah, um meine Schuld abzubezahlen. Sie werden sich alsdann sehr wahrscheinlich fürchterlich, und in ganz überflüssig großer Weise, bedanken, und das wird mich lachen machen. Ich lache sehr gern über solche Sachen, man kommt so am besten darüber hinweg. Jetzt verdiene ich etwas Geld, durch Aufsätze, die ich an eine christliche Zeitung einsende. Außerdem schreibe ich Adressen und rechne Rechnungen durch, so daß ich hoffen darf, Sie bald zu befriedigen. Wenn Sie nur wüßten, wie sehr es mir Vergnügen macht, für Sie zu sparen. Es ist doch ganz gut, daß ich Sie nicht bezahlen konnte, nun kann ich doch Ihretwegen etwas tun, Ihre Gestalt erscheint mir freundlich, wenn ich arbeite, ich arbeite dann sozusagen für Sie, wegen Ihnen, unter Ihrem Eindruck. Nein, ganz sorglos möchte ich nie sein. Sorgen haben müssen, das verfeinert das Leben und gibt dem Tag einen, wenn auch engen und kleinen, so doch innigen Anstrich. Es ist doch ganz gut so.

Die Sonne scheint durch das kleine Loch in das kleine Zimmer, wo ich sitze und träume, die Glocken der Heimat tönen. Es ist Sonntag, und im Sonntag ist es Morgen, und im Morgen weht Wind, und im Wind fliegen alle meine Sorgen wie scheue Vögel davon. Ich fühle zu sehr die wohlklingende Nähe der Heimat, als daß ich mit einer Sorge im Wettstreit grübeln könnte. Ehemals weinte ich. Ich war so weit entfernt von meiner Heimat; es lagen so viele Berge, Seen, Wälder, Flüsse, Felder und Schluchten zwischen mir und ihr, der Geliebten, der Bewunderten, der Angebeteten. Heute morgen umarmt sie mich, und ich vergesse mich in ihrer üppigen Umarmung. Keine Frau hat so weiche, so gebieterische Arme, keine Frau, auch die schönste nicht, so gefühlvolle Lippen, keine Frau, auch die gefühlvollste nicht, küßt mit so unendlicher Inbrunst, wie meine Heimat mich küßt. Tönt Glocken, spiele Wind, braust Wälder, leuchtet Farben, es ist doch alles in dem einzigen, süßen Kuß, welcher in diesem Augenblick meine Sprache gefangen nimmt, in dem süßen, unendlich köstlichen Kuß der Heimat, der Heimat enthalten.
Sie schreiben mir, daß Sie sich ängstigen, weil Sie ohne Stelle sind, und weil Sie fürchten müßten, lange ohne Verdienst zu bleiben. Ich bin etwas älter als Sie und darf Ihnen aus der Erfahrung raten. Fürchten Sie sich doch ja nicht. Denken Sie weiter nichts. Wenn Sie Entbehrungen zu tragen haben, so seien Sie stolz, sie ertragen zu dürfen. Leben Sie so, daß Sie mit einer Suppe, einem Stück Brot und einem Glas Wein leben können. Das kann man. Rauchen Sie nicht, denn das nimmt Ihnen die wenigen körperlichen Stärkungen, die Sie sich leisten können, weg. Sie haben eine ungeheure Freiheit vor sich. Rund um Sie duftet die Erde, Ihnen gehört sie, will Ihnen gehören. Genießen Sie sie. Fürchtlinge genießen nichts. Also weg mit der Furcht. Seien Sie nicht grob, und fluchen Sie keinem Menschen, auch dem Bösesten nicht. Versuchen Sie lieber, zu lieben, wo ein anderer, weniger Besonnener und Starker, hassen würde. Glauben Sie mir dieses Wort: Der Haß zerstört den Geist im Menschen auf eine vernichtende Weise. Lieben Sie nur gleich alles. Es schadet nichts, zu verschwenden. Stehen Sie am Morgen früh auf, sitzen Sie wenig, schlafen Sie korrekt und schnell. Man kann das. Wenn Sie an der Hitze leiden, so achten Sie nicht übermäßig viel darauf, sondern tun Sie so, als ob Sie es nicht bemerkten. Wenn Sie an eine frische Waldquelle kommen, so versäumen Sie nicht, daraus zu trinken. Wenn man Ihnen mit Anstand schenkt, nur genommen, aber, mit Anstand. Prüfen Sie sich jede Stunde, rechnen Sie mit sich, unterhalten Sie sich lieber mit Ihrem eigenen Geist, als mit dem Verstand gelehrter Menschen. Meiden Sie die Gelehrten, denn es sind, mit wenig Ausnahmen, herzlose Menschen. Schaffen Sie sich öfters Gelegenheit, zu lachen, zu tändeln. Die Folge davon: Sie werden ein schöner, ernsthafter Mensch. Seien Sie, wenn es Ihnen auch oft schwer ankommt, in allem schön. Kleiden Sie sich elegant, das verschafft Ihnen Achtung und Liebe. Es braucht kein Geld, nur die Anstrengung der Sinne dazu. Was die Mädchen betrifft, so halten Sie sich die meisten vom Halse. Üben Sie sich im Verschmähen. Gewöhnen Sie sich daran, immer eine Leidenschaft zu haben, das kennzeichnet den schönen Mann. Der Leidenschaftlichste ist der Beste: lernen Sie es. Man lernt alles. Ich werde Ihnen ein anderes Mal schreiben.
Simon war ein zwanzigjähriger Mann. Er war arm, aber er tat nichts, seine Lage zu verbessern.

Der Winternachthimmel war ganz mit Sternen gespickt, ich lief den Schneeberg hinunter, in die Stadt, an die Kasse des Madretscher Stadttheaters, ließ mir eine Fahrkarte verabfolgen und fuhr wie ein geistig nicht mehr Normaler die steinerne, uralte Wendeltreppe hinauf, die ins Stehparterre führte. Das ganze Theater war dickvoll von Menschen, eine schlechte Luft schlug mir unter die Nasenflügel, ich erbebte und versteckte mich hinter einen Technikumsschüler. Ich war ganz atemlos und konnte nun ein wenig verschnaufen, bis der Vorhang in die Höhe ging, das tat er nach etwa zehn Minuten, er erhob sich und ließ in ein Loch voll Feuer blicken. Die Gestalten bewegten sich alsobald, riesige, plastische, übernatürlich scharf gezeichnete Gestalten, und spielten Maria Stuart von Schiller. Königin Maria saß im Kerker, und ihre gute Kammerfrau stand daneben, und dann zeigte sich ein finster aussehender, mit einer Rüstung bedeckter Mann, die Königin brach in Tränen des Zornes und des Schmerzes aus. Wie wundervoll sich das ansah. Meine Augen brannten. Ich hatte vorher stundenlang in den hellen, weißschimmernden Schnee gesehen und dann in das Dunkel der Logen, und jetzt mußten sie in eitel Feuer, Glut, Pracht und Glanz schauen. Wie schön und groß das war. Wie das von den rötlichen Lippen taktmäßig herabtönte, in Uhrmacher-, Techniker- und sonstige Ohren hinein, schöne, edel hin und her und auf und nieder tanzende, schwankende, tönende Verse. Ah, das sind die Verse Schillers, so dachte wohl mancher.
Der junge, schlanke Mortimer, mit einem Busch heller, goldener Locken auf dem Kopf, sprang aus der Szene in die offene Szene hinein und sprach der Königin, die lächelnd zuhörte, verführerische Worte vor. Er hatte ein merkwürdig blaß gefärbtes Gesicht, als sei ihm der ahnungsvolle Schrecken darin gelegen, und schwarzumränderte Augen, als habe er viele vorangegangene Nächte hindurch, von Träumen hin- und hergeschleudert, kein Auge zudrücken können. Er spielte meiner Meinung nach herrlich; nicht so Maria, die ihre Rolle nicht auswendig wußte, die sich eher wie eine Kneipenkellnerin niederster Stufe benahm, als wie eine so vornehme Frau, vornehm im zugespitzt kältesten Sinne: Königin und dazu noch Dulderin, wie man sich Maria Stuart denken mußte. Aber sie rührte unendlich. Das Nichtskönnen rührte in erster Linie und dann jener Mangel an Hoheit. Der Mangel dessen, was sein sollte, erschütterte und blendete und trieb mir das Wasser der Empfindung schamvoll zu den erregten Augen heraus. O du Zauber der theatralischen Bühne. Ich dachte immer: »Wie schlecht sie doch spielt, diese Maria,« und ward im selben Moment von dem unmöglichen Spiel an Leib und Seele hingerissen. Wenn sie etwas Trauervolles sagte, lächelte sie verschmitzt und ganz unpassend dazu, ich korrigierte in Gedanken an ihren Gesichtszügen, Tönen und Bewegungen herum, und indem ich das tat, hatte ich den lebendigeren und ergreifenderen Eindruck von ihrem fehlerhaften Spiel, als ich ihn vor dem tadellosen hätte haben können. Sie war mir so nah auf diese Weise, es war, als würde da oben eine Schwester, Cousine oder Freundin von mir gespielt haben, um deren Äußerungen ich Ursache gehabt hätte, ängstlich zu zittern. Bisweilen stand sie ganz vergnügt und ratlos, also ratlos und doch nicht fassungslos da, sah in den dunkeln Zuschauerraum hinein, zupfte an ihrem Schleier und lächelte ganz keck, ließ das Spiel liegen, während dieses von ihr eine bestimmte Haltung und Empfindung verlangte. Und warum war sie trotzdem wundervoll?
In den Zwischenpausen bog ich meinen Kopf um und blickte in die Logen hinein, in deren einer eine vornehme Dame saß, in ausgeschnittenem Kleid, daß die Brust und die Arme aus der dunkeln Umgebung nur so herausschimmerten. In der behandschuhten Hand hielt sie ein Lorgnon mit langem Stiel, das sie von Zeit zu Zeit an die Augen führte. Sie schien eine alte, doch noch immer berückende Zauberin zu sein, so allein saß sie dort hinten, abgesondert von den übrigen Menschen. Sie wohnte, weiß der Teufel, vielleicht in einem jener graziös erbauten Häuser aus der Zeit Ludwigs von Frankreich, die man in Madretsch häufig hinter den hohen Bäumen alter, verträumter Gärten weiß hervorglänzen sieht. In einer andern Loge hockte der Präsident des Madretscher Gemeinderats und Mitglied des Verwaltungsrats des Stadttheaters, so ein alter Bock, wie man sich zuflüsterte, der es als ein Vergnügen empfand, den Schauspielerinnen unter die Röcke zu greifen. Das ließ sich ja schließlich solch eine herumwandernde Maria Stuart noch ganz gerne gefallen. So sah sie nämlich auch aus auf der Bühne, wie eine Dirne, und nicht einmal wie eine gut-, sondern wie eine minderwertig geartete. Wie kam es, daß sie trotzdem so schön war?
Der Vorhang ging wieder auf. Ein breiter, weißlicher Strom Parfüm floß aus dem offenen Loch in die Zuschauerdunkelkammer und beklemmte und befreite die Nasen. Man war froh, wieder diesen holden Duft einzuziehen; ich hinter meinem Technikumsschüler war es wahrscheinlich ganz besonders. Der Bühnenrachen fing wieder an zu reden, diesmal war die Szene ein Zimmer im königlichen Palast von England. Elisabeth saß auf einem mit blauen Tüchern behangenen Thron, einen Baldachin über sich, vor ihr die Großen des Hofes, Lester und jener andere mit der sanften Denkermiene. Im Hintergrund standen dicke Weibsbilder als Pagen, nicht etwa Knaben, nein, vierzigjährige Weiber in Trikots. Das war schamlos schön. Diese Pagen standen mit der barocken Schwere ihrer gedunsenen Leiber in wahnsinnig kleinen, zierlichen Schuhen auf dem Boden wie unbegreifliche, phantastische Traumfiguren, die ins Publikum hineinlächelten. Es war, als hätten sie sich ein wenig geniert, so auffällig zu sein, aber dann war's wieder nichts mit diesem Genieren. Die Sache verhielt sich so: wer sie ansah, der genierte sich. Ich zum Beispiel genierte mich bis zur Glückseligkeit. Elisabeth stieg dann vom Thron herab, jeder Zoll an ihr lieb und einfach, fast tantlich, mütterlich, sie gab Zeichen von Ungnade, und die Szene verschwand.
Ein wenig später gab es eine Parkszene mit grünem, verschwommenem Waldhintergrund, Jagdhörner tönten in der Ferne in wundervoll fern herklingendem Spiel. Ich glaubte mich augenblicklich in das Dickicht eines Waldes versetzt; die Hände liefen, Pferde stürzten aus dem Laubwerk hervor, schöne, kostbar gekleidete Reiterinnen tragend, und überall sprangen die Knechte und Falkoniere und Pagen, die Jäger in den knappen, grünen Trachten herum. Alles das spiegelte sich ganz natürlich in den paar Fetzen von Dekorationen tönend und leuchtend wieder. Maria, die Königindirne, trat auf und sang, man kennt ja die Worte, nein, sie sang nicht, aber es hörte sich ganz wie ein wehklagendes, sehnsüchtiges Singen an. Die Frau schien eine Riesin geworden zu sein, so sehr vergrößerte sie ihr Seelenausbruch. Sie sprang wie irrsinnig vor Freude und Herzensqual umher, und jammerte, als sie zu jubeln meinte. Außerdem war sie ein bißchen der Rolle wegen, die sie nicht studiert hatte, in Verlegenheit, aber ich glaubte steif und fest, das sei der Wahnsinn des Nicht-mehr-an-sich-halten-Könnens, die Qual der Freiheit, das Versagen der ruhigeren Frauenvernunft. Als sie weinte, da schrie sie, denn weinen wäre ihr zu wenig gewesen. Für nichts, was sie empfand, hatte sie einen entsprechenden Ausdruck mehr. Das Empfinden peitschte seinen Ausdruck. Im Übermaß alles dessen, was sie war und sah und hörte und fühlte, warf sie sich köpflings an die Erde, da trat Elisabeth auf.
Die Peitsche in der Hand, hinter ihr her die Trabanten. Die Frau ganz anschließend, anschmiegend in dunkelgrünen Samt gekleidet, der Rock hinaufgerafft, daß das männerhaft bestiefelte und bespornte Bein grell sichtbar ist. Zorn, Hohn und Furcht im Gesicht. Auf dem Jagdhut eine schwer herunterfallende Feder, deren Spitze bei jeder Bewegung des Hauptes die Schulter berührt. Und dann sprach sie, ah, sie spielte meisterhaft. Überdies war sie mir eine liebe Erscheinung. Nicht lange ging es, so prallten sie aneinander und hauchten einander das Feuer des Wehs in die Gesichter; beider Frauen Leiber zitterten wie vom Sturm gepackte Baumstämme. Maria, die schlechte Schauspielerin, schlug der guten eins ins Gesicht. Darob schmerzhaftes Frohlocken der einen und jähe Flucht der andern. Die liebe Elisabeth muß fliehen, und die dumme Maria muß jetzt in Verlegenheit sein, wie sie es angattern soll, in die Ohnmacht befriedigten Rachegefühls zu sinken. Sie machte es schlecht, aber in der Art und Weise, wie sie es verpfuschte, lag wiederum das Grandiose. Das ganze Frauengeschlecht, das vergangene und gegenwärtige und zukünftige, schien hinten über, den Kopf seitwärts gesenkt, in herrlich-süßer Beugung und Empfindung umfallen zu wollen. So schön machte sie's. Dem Verstand war's hurenhaft, dem Gefühl titanisch. Ich wußte nichts mehr, ich hatte genug, ich packte das Bild mit meinen Augen, wie mit zwei wehrhaften Fäusten, an und trug es über die steinerne Wendeltreppe hinunter, zum Theater hinaus, an die kalte, winterliche Madretscher Luft hinaus, unter den eisig-schauerlichen Sternenhimmel, in eine Kneipe von zweifelhafter Existenzberechtigung, um es zu ersäufen.

Ja, in der Provinz, da kann es der Schauspieler etwa noch schön haben. Dort, in den kleinen Landstädtchen, die noch von alten Ringmauern trotzig umschlossen sind, gibt es keine Premieren und keine fünfhundertste Aufführung ein und desselben Salates. Die Stücke wechseln mit den Tagen oder Wochen wie die blendenden Toiletten einer geborenen Fürstin, die zornig würde, wenn einer ihr zumuten wollte, jahrelang immer dasselbe Kleid zu tragen. Auch keine solche schnauzige Kritik gibt es in der Provinz, wie dergleichen der Schauspieler in den Weltstädten zu ertragen hat, wo es nichts mehr Ungewöhnliches ist, mit anzusehen, wie der Künstler von oben bis unten von grimmigen Witzen wie von wütenden Hunden zerrissen wird. Nein, in der guten, ehrlichen Provinz wohnt erstens der Mann mit der Maske vor dem Gesicht im Hôtel de Paris, allwo es toll und urgemütlich zugeht, und zweitens lädt man ihn etwa noch zu Abendgeselligkeiten ein, in feine, alte Häuser, wo es ein ebenso wohlschmeckendes Essen wie eine delikate Unterhaltung mit den ersten Personen der Kleinstadt gibt. Zum Beispiel meine Tante in Madretsch, die gab es nie und nimmermehr zu, daß von den Komödianten in unziemlichem, wegwerfendem Ton geredet wurde, im Gegenteil, nichts war ihr angenehmer und erschien ihr passender, als zum Abendessen, dessen Zubereitung sie selber beaufsichtigte, jede Woche einmal mindestens, so lange sie in der Stadt spielten, diese umherziehenden Leute recht lustig und fidel bei sich zu sehen. Meine Tante, die jetzt gestorben ist, war eine geradezu schöne Frau, auch noch zu einer Zeit, wo andere Frauen beginnen, ältlich und runzelig zu werden. Mit ihren fünfzig Jahren schien sie noch eine der allerjüngsten zu sein, und während in ihrer Umgebung die Frauen plumpe, mißförmige Figuren zur Schau trugen, zeichnete sie sich durch eine feste, üppig-schlanke Körperform zu ihrem eigenen, sehr großen Vorteil aus, daß sie jedermann, der sie ansah, für schön erklären mußte. Nie vergesse ich ihr helles, zartes Gelächter und nie den Mund, aus dessen reizender Öffnung das Lachen heraustönte. Sie wohnte in einem seltsamen, alten Haus; wenn man die schwere Tür auftat und eintrat, in den stets dunkeln Korridor, lispelte einem das Plätschern eines unaufhörlich fallenden Brunnens entgegen, der kunstreich in die Mauer eingefügt worden war. Die Treppen und deren Geländer strotzten und dufteten förmlich von Sauberkeit, und erst die Zimmer. Ich habe nie nachher wieder solche Zimmer gesehen, solche heitere, polierte, zimmerliche Zimmer. Ich glaube, wenn ich mich nicht irre, man sagt Gemach, wenn man von einem Zimmer redet, das traulich und zugleich äußerst vornehm und etwas altertümlich ausgestattet ist. In einem solchen Hause, bitte ich zu beachten, dürfen also in der Provinz Bühnenkünstler aus- und eingehen, dürfen solche Treppen mit ihren wahrscheinlich manchmal ungeputzten Stiefeln berühren, solche Klinken, messingene und rasend peinlich glänzende, mit ihren Händen anfassen, um in solche Gemächer hineinzutreten, und dann einer solchen Frau, wie meiner Tante, ungezwungen Guten Abend zu sagen. Was tut der Schauspieler in der Großstadt? Er schuftet, läuft wie wahnsinnig in die Proben und reibt sich auf, um es ja der säuerlichen Kritik recht zu machen. So etwas gibt es in der Umgegend von Madretsch nicht, meine Damen und Herren. Von Kranksein und Aufreiben wird da kaum die Rede sein dürfen, vielmehr bummelt so ein Kerl, den Zylinder, den er weiß der Himmel woher hat, auf dem Kopf, die Hände in womöglich hellgelben Handschuhen, den Stock in der Rechten, in einem tragischen Mantel, dessen Schöße im Winde flattern, so gegen elf Uhr vormittags oder halb zwölf, um nicht gelogen zu haben, seelenheiter und von allen Passanten auf der Straße für einen illegitimen Fürstensohn gehalten, angeblinzelt von Mädchenaugen, die schöne Promenade entlang, um vielleicht zum See hinauszugehen und dort eine halbe Stunde lang, bis es Zeit zum Essen ist, in die Ferne zu schauen. Das, meine Herren, verschafft Appetit, ist gesund und wohl etwa noch zu ertragen. Wo gibt es in der Großstadt einen See, einen Felssturz, dessen Gipfel von einem im griechischen Stil erbauten, niedlichen Pavillon gekrönt wird, wo man in der hellen Vormittagssonne mit einer Frau, die man eben hat kennen lernen und die, sagen wir mal, dreißig Jahre alt ist, ein seelenvolles Gespräch führen kann? Wo gibt es ein Schulhaus in Weltstädten, in das der Herr jugendlicher Liebhaber, Herr von Beck, so gegen drei Uhr, weil er gerade Lust zu einem solchen Unternehmen hat, eintreten und den kleinen neun- bis zwölfjährigen Schulmädchen einen Schulbesuch abstatten kann? Es ist gerade Religionsstunde, die Mädchen langweilen sich ein bißchen, da tritt Beck ein und frägt an, ob ihm wohl gestattet wäre, dem ihn im höchsten Grade interessierenden Unterricht beizuwohnen. Der Pfarrer, ein durchaus weltmännisch gebildeter, sympathischer Herr, errötet über die Keckheit und weiß nicht recht, was er sagen soll, im ersten Augenblick nämlich, wo ihm die Heldenmanieren eines von Beck den Verstand rauben. Aber schon hat er sich gefaßt und schiebt den Darsteller des Ferdinand in Kabale und Liebe sanft zur Tür hinaus, wohin er ja schließlich, wenn man die Umstände bedenkt, auch gehört. Aber, Hand aufs Herz, ist das etwa nicht reizend, und gibt's in Millionenstädten etwas Derartiges? Wie hübsch dieser Herr Pfarrer gehandelt hat, Herrn Beck zu verbieten, in der edlen Religionsstunde mit den Schülerinnen Allotria zu treiben. Aber wie entzückend wiederum dieser Beck ist, der den Pfarrer zu dem liebenswürdigen Benehmen veranlaßt hat; denn wenn es keine Becks gäbe, die die Unverschämtheit besitzen, den Schulaufsichtsrat zu spielen, am hellen Tag, wo die Sonne überall scheint und es in ganz Madretsch nach Käsekuchen duftet, so gäbe es auch kein pfarrerlich-schönes Betragen, wie denn Spitzbuben nicht fehlen dürfen, wo man noch hoffen will, Tugenden anzutreffen. Solche Dinge ergeben sich in einer Kleinstadt von selber; das reizende Erlebnis nimmt dort noch gern plastische Gestalt an, und wer eignet sich in der Provinz besser zu Erlebnissen aller Art als die Lumpenkomödianten, denen der Ruf des Gefährlichen, Schönen, Geheimnisvollen und Abenteuerlichen immer vorangeht? Da sieht sie der Bewohner von Bözingen oder Mett oder Madretsch in Gruppen vor dem Rathause stehen, gestikulierend und in fremdartigen, eleganten Akzenten sprechend, die Rollen, die sie abends spielen, in den blassen durchgeistigten Händen, so wildfremd, so sehr scheinbar aus Königsschlössern und Mätressenboudoirs herkommend, mit so schönen, hohen Stirnen und mit wenn immer denkbar goldenen Haarlocken! Kann der hauptstädtische oder gar reichshauptstädtische oder gar noch literarische Schauspieler diese Genugtuung auch genießen, eine wildfremde Figur auf Straßen, Plätzen und Promenaden zu sein? Kann er überhaupt auch nur noch tiefer und inniger interessieren, als was auf fünf Spalten im Lokalanzeiger gedruckt paßt? Und wenn er gar berühmt ist und viel genannt wird, was ist das? Ich muß geradezu lächeln, daran zu denken, wie oberflächlich das Interesse im Laufe der Jahre wird, das man Berühmtheiten zollt. Nein und noch einmal nein. Wer gern mag, daß ihm eine rote, warme, saftvolle, gequetschte, spritzende, sprühende und duftende Empfindung dargebracht wird, der werde so rasch wie möglich Schmierenschauspieler. Das bißchen finanzielle und ökonomische Elend, das mit diesem Berufszweig ja allerdings immer verbunden sein wird, ist zu ertragen. Ich mache gern noch auf ein paar Einzelheiten aufmerksam: Schauspieler Beck wird eines Nachts von einem unkultivierten Burschen einfach mir nichts dir nichts Hundsfott genannt. Das ist allerdings starker Schnupftabak. Beck stürzt vor, und beide, der lümmelhafte Sohn des Uhrenfabrikanten und das zierliche Söhnchen der dramatischen Kunst packen einander am beiderseitigen Stehkragen, an den Haaren, beim Genick, am Schopf, bei den Nasen, an den Lippen und Ohren, unterm Knie, rund um die Leiber, um den Kampf zweier erzürnter Gottheiten aufzuführen. Auch nicht denkbar in Reichsmetropolen, wo die Menschen anfangen, so windig gesittet zu werden und ihren Zorn immer in die Taschen stecken, wenn zu befürchten ist, daß er losbrennen will. Im Hôtel de Paris sind immerhin noch ganz andere Sachen möglich. Dort küßt man beispielsweise den Kellnerinnen die Hände, so fein sind sie, und plaudert englisch mit der Leiterin des Geschäfts am Bufett, so lange, bis einer kommt und einem von hinten her quer eins hinüberhaut, bis man genug hat. Und dann die Natur in Kleinstädten. Das ist nun geradezu die Wunderquelle, in der sich Karl Moor bis zum Strotzen gesund baden kann, denn überall lockt's ihn, in Schluchten zu gehen, in denen Wasserfälle schäumend und zischend und kühlend niederbrausen; über ebene, weite Felder bis an den Rand mächtig-hoher und grüner Eichenwälder; über Waldhügel hinüber, allwo er Blumen suchen und sie in seine Botanisierbüchse stecken kann, um sie zu Hause in ein Glas Wasser zu tun; auf breite, tausend Meter hohe Berge, entweder zu Fuß oder zu Roß, wenn er eins auftreiben kann, oder per Drahtseilbahn, zu der entzückend gelegenen Weide mit ihrer Blumen- und Gräserpracht, bis er am Abend, erschöpft und erfüllt von schönen, müden Empfindungen, unter einer hundertjährigen Tanne in die Matte sinkt, um den herrlichen Sonnenuntergang zu betrachten. In Krächen und Schluchten liegt noch der winterliche Schnee, obgleich es schon toller, üppiger Frühling ist. Oder es lockt ihn, in eine leichte, schwankende Gondel zu steigen, die zu haben ist bei Frau Hügli, Schiffsvermieterin, dicht am Ufer des Sees, und aufs schöne, spiegelglatte Wasser hinauszufahren, zwischen knirschenden Schilfgewächsen hindurch, bis er in der Mitte des Sees angelangt ist und, die Ruder fahren lassend, sieht, wie köstlich die Rebberge und Landhäuser und kleinen Jägerschlösser sich im tiefen Wasser naturgetreu widerspiegeln. Und so noch vieles, und zu allen Jahreszeiten, im Winter, Herbst, Sommer und Frühling. Die Natur ist bekanntlich in allen ihren Verkleidungen erfrischend und bezaubernd und immer des ganz und gar innigen Ansehens und Genusses wert. Geht in die Provinz, in Kleinstädte; dort habt ihr noch Hoffnung, daß man euch an euerm Benefizabend einen Lorbeerkranz vor die Füße und Nase wirft, den ihr dankend aufheben und freudig nach Hause tragen könnt. Den schauspielenden Damen nicht minder als den Herren sind diese Städte zu empfehlen, auch sie werden sehr bald finden, daß ich nicht unrecht gehabt habe, ihnen anzuraten, es einmal wieder mit der Provinz zu versuchen. Zu guter Letzt: Es wird gut gekocht an solchen Orten, und es muß ratsam erscheinen, bald einmal hinzugehen und diese vortreffliche Kost zu probieren. Schmackhaftes Essen ist nicht zu verachten.

Mein Herr, ich bin gestern abend im Stadttheater gewesen und habe Sie als Prinzen Max in der »Hofgunst« gesehen, und ich schreibe Ihnen jetzt. Ich bin, damit Sie es gleich im voraus wissen, eine Frau von dreißig Jahren, etwas darüber, interessiert Sie das? Sie sind jung und hübsch, machen eine gute Figur und sind wohl schon viel von Frauen angeschwärmt worden. Apropos, rechnen Sie mich nicht zu den Frauen, die für Sie schwärmen, und doch, ich muß es Ihnen nur gleich gestehen, Sie gefallen mir, und ich sehe mich genötigt, Ihnen zu sagen, warum. Dieser Brief wird vielleicht etwas zu lang werden, glauben Sie? Als ich Sie gestern spielen sah, ist es mir gleich vom ersten Moment an aufgefallen, wie unschuldig Sie sind; jedenfalls haben Sie viel Kindliches an sich, und Sie haben sich den ganzen Abend auf der Bühne so benommen, daß ich mir sagte, ich würde Ihnen vielleicht einiges schreiben dürfen. Ich tu es ja jetzt; werde ich diesen Brief abschicken? Verzeihen Sie, oder so: Sie sollen stolz sein, daß man wegen Ihnen im Zweifel sein muß. Vielleicht schicke ich diese Worte nicht ab, dann wissen Sie nichts und werden auch keinen Grund haben, in ein unschönes Gelächter auszubrechen. Machen Sie so etwas? Sehen Sie, ich vermute ein schönes, frisches, reines Herz in Ihnen, aber Sie sind vielleicht noch zu jung, um wissen zu können, daß das wichtig ist. Wo verkehren Sie, sagen Sie mir das, wenn Sie mir antworten, oder sagen Sie es mir mündlich, kommen Sie zu mir, morgen nachmittag um fünf, ich erwarte Sie. Die meisten Menschen setzen ihren ganzen Ehrgeiz in die unedle Unmöglichkeit, einer Torheit fähig zu sein, sie lieben den Anstand des Benehmens nicht, obwohl das so scheint. Die Sitte liebt eines nur dann, wenn es sich um ihretwillen einiger Gefahr unterziehen mag. Denn Gefahren erziehen, und ohne die beständige Lust mit sich zu tragen, auf lebendige Art über wichtige Dinge belehrt zu werden, ist man sittenlos. Ängstlichkeit scheint oft die wahre Sitte zu sein – welch eine träge Gedankenlosigkeit! Hören Sie mir noch zu, und tun Sie's auch aufrichtig? Oder sind Sie einer der leider vielen Menschen, die glauben, alles, was ein wenig beschämend und anstrengend ist, langweilig finden zu müssen? Spucken Sie auf dieses Schreiben und zerreißen Sie es, wenn es Sie langweilt, aber nicht wahr, es reizt Sie, es kann Sie anregen, es ist nicht langweilig. Wie hübsch Sie sind, mein Herr, mein Gott, und so jung, sicher kaum zwanzig. Ein bischen steif habe ich Sie gestern abend gefunden und Ihre schöne Stimme ein bischen geschraubt. Entschuldigen Sie es, daß ich so rede? Ich bin zehn Jahre älter als Sie, und es tut mir so wohl, mit einem Menschen reden zu dürfen, der jung genug ist, daß ich mich als zehn Jahre älter ihm gegenüber fühlen darf. Sie haben in Ihrem Benehmen etwas, was Sie noch jünger erscheinen läßt, als man Sie, wenn man mit dem Verstand nachrechnet, schätzen muß; das ist das bischen Geschraubtheit. Gewöhnen Sie es sich, ich bitte Sie, noch nicht so rasch ab, es gefällt mir, es wäre schade um dieses Stück, ich möchte sagen, natürlicher Unnatürlichkeit. Kinder sind so. Beleidige ich Sie? Ich bin so offen, nicht wahr, aber Sie wissen gar nicht, welche Freude für mich in der Einbildung liegt, die mir zuflüstert: er gestattet es, er liebt das. Wie Ihnen die Offiziersuniform gut gestanden hat, die engen Stiefel, der Rock, der Kragen, das Beinkleid, ich bin entzückt gewesen, und was für prinzliche Manieren Sie gehabt haben, was für energische Bewegungen! Und wie Sie gesprochen haben: so ganz überflüssig heldenhaft, daß ich mich beinahe ein bischen vor mir, vor Ihnen, vor alle dem habe genieren müssen. So laut und wichtig haben Sie im Salon Ihres oder Ihres Herrn Vaters Schlosse gesprochen. Wie Ihre großen Augen manchmal hin und her rollten, als wenn Sie jemanden aus dem Zuschauerraum hätten aufessen wollen, und so nah waren Sie. Einmal zuckte es mir im Arm, ich wollte unwillkürlich die Hand ausstrecken, um Sie, wo Sie standen, anzurühren. Ich sehe Sie so groß und laut vor mir. Werden Sie bei mir, wenn Sie morgen zu mir kommen, auch so gewichtig auftreten? In meinem Zimmer, müssen Sie wissen, ist alles so still und so einfach, ich habe noch nie einen Offizier empfangen, und es hat noch nie eine Szene bei mir gegeben. Wie werden Sie sich betragen? Aber das ganze, hochaufgepflanzte, fahnenstangenhafte Wesen an Ihnen gefällt mir, es ist neu, frisch, gut, edel und rein für mich, ich möchte es kennen lernen, weil, wie ich es empfinde, etwas Unschuldiges und Ungebrochenes in ihm steckt. Zeigen Sie es mir, wie es ist, ich achte es im voraus und ich glaube, ich liebe es. Sie kennen keinen Hochmut mit diesem Ihrem ganzen scheinbar so hochmütigen Wesen. Sie sind keines Truges fähig, Sie sind zu jung dazu und ich zu erfahren, um mich in Ihnen täuschen zu können, und jetzt zweifle ich nicht mehr, daß ich diesen Brief an Sie abschicken werde, aber lassen Sie mich Ihnen noch einiges sagen. Sie kommen jetzt also zu mir, es ist abgemacht. Putzen Sie dann zuerst Ihre Stiefel vor der Treppe ab, bevor Sie ins Haus treten, ich werde am Fenster stehen und Ihr Benehmen beobachten. Wie ich mich darauf freue, so dumm zu sein und das zu tun. Sie sehen, wie ich mich freue. Vielleicht sind Sie ein Unflätiger und werden mich dafür strafen, daß ich es unternommen habe, Zutrauen zu mir in Ihnen zu erwecken. Wenn Sie so sind, so kommen Sie, machen Sie sich einen Spaß, strafen Sie mich, ich habe es ja verdient. Aber Sie sind jung, das ist ja das Gegenteil von unflätig, nicht wahr? Wie deutlich ich Ihre Augen vor mir sehe, und ich will Ihnen etwas sagen: für gar so klug halte ich Sie nicht, aber für recht, für gerade, das kann mehr sein als klug. Bin ich da auf einem Holzweg? Gehören Sie zu den Raffinierten? Wenn das ist, muß ich in Zukunft allein und verlassen in der Stube sitzen, denn dann verstehe ich die Menschen nicht mehr. Ich werde am Fenster stehen und Ihnen dann die Tür auftun, Sie brauchen dann vielleicht gar nicht erst noch lange zu klingeln, und dann werden Sie mich sehen, so bald schon. Eigentlich wünschte ich – nein, ich will nicht so viel sagen. Lesen Sie noch? Ich bin ziemlich schön, ich muß Sie auch darauf im voraus aufmerksam machen, damit Sie sich ein wenig Mühe geben und Ihr Bestes und Gebürstetstes anziehen. Was wollen Sie trinken? Sie werden es mir ungeniert sagen, ich habe Wein im Keller, das Mädchen wird heraufholen, aber vielleicht ist es am besten, wir trinken zuerst eine Tasse Tee, nicht? Wir werden allein sein, mein Mann arbeitet zu dieser Zeit im Geschäft, aber fassen Sie das nicht als eine Aufforderung, unehrerbietig zu sein, auf, das muß Sie im Gegenteil schüchtern machen. So will ich Sie sehen, schüchtern und schön, sonst laufe ich dem Briefboten nach, der Ihnen diese Zeilen überbringen will, schreie ihn an, nenne ihn einen Räuber und Mörder, begehe Ungeheuerlichkeiten und komme ins Gefängnis. Wie mich danach verlangt, Sie anzusehen, Sie in der Nähe zu haben; weil ich so mutig auf meiner guten Meinung von Ihnen beharre, spreche ich so, und wenn Sie nach all dem Gesagten kommen, so haben Sie Mut, und dann werden die anderthalb Stunden, die wir miteinander verbringen, schön sein, und dann ist es überflüssig gewesen, zu zittern, wie ich jetzt tue, denn es ist dann keine solche Tollkühnheit gewesen, Sie zu mir eingeladen zu haben. Sie sind so schlank, ich werde Sie schon erkennen, wenn Sie noch unten auf der Straße vor der Gartentüre stehen werden. Was machen Sie jetzt? Was meinen Sie, soll ich jetzt aufhören zu schreiben? Sie werden lachen, wenn ich vor Sie hintrete und Ihnen vormache, wie Sie als Prinz Max dagestanden haben. Ich beschwöre Sie, verneigen Sie sich tief vor mir, wenn Sie mich erblicken, und seien Sie steif und benehmen Sie sich herkömmlich, gestatten Sie sich keine freie Bewegung, ich warne Sie, und ich werde Ihnen dafür danken, daß Sie mir gehorcht haben, wie man Ihnen vielleicht nie in Ihrem Leben wieder danken wird.
Eine Bühne
Der Vorhang geht auf, man sieht in einen offenen Mund hinein, in eine rötlich beleuchtete Kehle hinunter, daraus hervor eine große, breite Zunge leckt. Die Zähne, die den Bühnenmund umrahmen, sind spitz und blendend weiß, das Ganze sieht dem Rachen eines Ungetüms ähnlich, die Lippen sind wie ungeheure menschliche Lippen, die Zunge bewegt sich nach vorn, über die Rampe hinaus und berührt mit ihrer feurigen Spitze beinahe die Köpfe der Zuschauer, dann geht sie wieder zurück, und ein anderes Mal tritt sie wieder vor, ein schlafendes schönangekleidetes Mädchen auf ihrer breiten, weichen Fläche dahertragend. Die golden-hellen Haare des Mädchens fließen wie eine Flüssigkeit von ihrem Kopf um ihr Kleid herum, in der Hand hält sie einen glitzernden Stern, ähnlich einem großen, weichen, sonnigen Schneeflocken. Auf dem Haar eingedrückt sitzt eine zierliche grüne Krone, ihr Mund lächelt im Schlaf, während sie so liegt, auf ihren Ellbogen gestützt, auf der Zunge wie in Bettkissen ruhend. Auf einmal öffnet sie ihre Augen, und das sind Augen, wie man sie manchmal in Träumen sieht, wenn sie sich, von irgendeinem übernatürlichen Licht umflossen, zu den unsern herabneigen. Diese Augen haben einen wunderbar erfrischenden Glanz, und sie schauen jetzt so nach allen Seiten herum, wie es Kinderaugen tun, die fragend und suchend und schuldlos in die Welt blicken. Aus der feurig-schwärzlichen Kehle klettert jetzt ein Mann hervor, angezogen mit fliegenden, scheinbar von einem halbtollen Schneider entworfenen Tüchern, die wie Fetzen seine massiven Glieder umgeben, schreitet auf der unter seinen Tritten zusammenzuckenden Zunge nach vorn, zu dem Mädchen hin, beugt sich über sie und küßt sie. Im selben Augenblick sprühen aus dem Schlund Feuerflammen und Funken hervor, die über die beiden, ohne sie im mindesten ängstlich zu machen, herabregnen. Der schlanke Mann hebt die junge Dame in seinen Arm und trägt sie nach rückwärts, die große Zunge wirft sich, indem sie sich hoch aufbäumt, über das Paar, um es im Rachen krachend und hinabpolternd zu verschlingen. Der weiße Stern des Mädchens blitzt vorn bei den Zähnen, da schießen mit einem Male blaue, grüne, gelbe, hochrote, dunkelbläuliche und schimmernd weiße Sterne in einem feurig-farbigen Sturzregenbogen aus der dunkeln Kehle hervor, Musik spielt dazu, und die Sterne zerspringen immer in der Luft ins Nichts, endlich bewegen sich die Lippen des großen Maules und sprechen das stille, aber deutlich und warm hörbare Wort:
Das Stück beginnt.
Vorhang.

Es schneite in der Straße. Da kamen die Droschken und Autos vorgefahren, setzten ihren Inhalt ab und fuhren wieder von dannen. Die Damen staken alle in Pelzen. An der Garderobe wimmelte es von Leuten. In den Foyers gab es ein Grüßen, Anlächeln und gegenseitiges Händedrücken. Die Kerzen schimmerten, die Roben rauschten, die Stiefelchen flüsterten und knarrten. Der Boden war ganz glatt gewichst und Diener standen da und machten Handbewegungen, bald so, bald anders. Die Herren waren in Fräcke geschnürt, so ein Frack muß sitzen. Man verbeugte sich. Artigkeiten flogen wie Tauben von Mund zu Mund, die Frauen strahlten, manche alte auch noch. Alles stand aufrecht bei den Sitzplätzen, um Bekannte zu sehen, nur wenige saßen. Die Gesichter waren so nahe beisammen, der Atem des einen berührte die Nasenflügel des zunächst Stehenden. Die Kleider der Frauen dufteten, die Scheitel der Herren waren glatt, die Augen blitzten, die Hände sagten: Na, auch wieder, du? Wo denn solange gewesen? In der ersten Reihe saßen die Kritiker wie Gläubige in einer hohen Kirche, so still, so andächtig. Der Vorhang bewegte sich ein bischen, da ertönte das Zeichen zum Anfang, wer sich räuspern zu müssen glaubte, tat es rasch, und da saßen sie alle wie Kinder in der Schulstube, gradausschauend, mäuschenstill, da erhob sich was und spielte sich was.
Der Vorhang ging in die Höhe, alles war gespannt, was es geben würde, da trat ein Knabe auf, und der fing an zu tanzen. In einer Loge im ersten Rang saß die Königin, umringt von den Hofdamen. Der Tanz gefiel ihr so gut, daß sie sich entschloß, auf die Bühne zu gehen, um dem Knaben etwas Liebevolles zu sagen. Bald darauf erschien sie auf der Bühne, der Knabe schaute sie mit seinen jungen, schönen Augen an. Er lächelte. Da durchfuhr es die Königin wie ein Blitz, an dem Lächeln erkannte sie ihren eigenen Sohn, sie stürzte zu Boden. Was hast du, fragte der Knabe. Da erkannte sie ihn immer deutlicher, an der Stimme auch noch. Da war es mit ihrer königlichen Würde vorbei. Sie warf die Hoheit beiseite und schämte sich nicht, den Jungen fest an ihr Herz zu pressen. Ihre Brüste hoben und senkten sich, sie weinte vor Freude, du bist mein Sohn, sagte sie. Das Publikum klatschte Beifall, aber was wollte der Beifall? Das Glück dieser Frau war gewiß über allen Beifall erhaben, es würde auch ein Zischen haben ertragen können, der Kopf des Knaben wurde immer wieder genommen und an den wogenden Busen gedrückt. Sie küßte ihn, dann kamen die Hofdamen und erinnerten ihre Gebieterin an die Unschicklichkeit der Szene. Da lachte das Publikum, aber die Hofdamen streuten Verachtung auf die vielköpfige Plebs herab. Sie zuckten mit dem Mund, da zuckte der Vorhang und fiel herab.

Bei Wertheim, zu oberst, dort, wo man Kaffee trinkt, ist gegenwärtig etwas Köstliches zu sehen, nämlich der dramatische Dichter Seltmann. Er hockt auf einem kleinen Rohrstuhl auf erhöhtem Gestell, allen Blicken eine leichte Zielscheibe, hämmert und nagelt und klopft in einem fort und schustert, wie es denen vorkommt, die ihn betrachten, Blankverse. Das kleine, viereckige Gestell ist mit dunkelgrünen Tannenzweigen geschmackvoll bekränzt. Der Dichter ist anständig angezogen worden, Frack, Lackschuh und weiße Binde, das alles ist da, und keiner wird sich zu genieren haben, dem Mann seine Aufmerksamkeit zu schenken. Das Wunderbare aber ist der rostgelbe, herrliche Haarsturz, der sich von Seltmanns Kopf, über die Schulter weg, mächtig bis an den Fußboden niederwölbt. Er gleicht der Mähne eines Löwen. Wer ist Seltmann? Wird er uns von der Schmach befreien, unser Theater etlichen Salpeterfabriken ausgeliefert zu wissen? Wird er das nationale Schauspiel schreiben? Wird er uns eines Tages als der Kerl erscheinen, nach dem wir uns jetzt alle wieder mal so blutwürstig sehnen? Jedenfalls aber muß man der Leitung des Warenhauses Wertheim für die Ausstellung Seltmanns Dank wissen.
Wie dem Theater allmählich die besten und gediegensten Kräfte dahinschwinden, geht zu unserm großen Leidwesen aus einer Zuschrift hervor, die Frau Gertrud Eysoldt an uns adressiert hat. Sie teilt uns mit, daß sie an der Kantstraße, Ecke Joachimsthaler Straße, nächstens einen Korsettladen eröffnen werde, um sich allda gänzlich als Geschäftsfrau zu etablieren. Welch sonderbarer Entschluß, und wie schade! Auch Schauspieler Kayßler will wegmachen, und zwar, wie wir hören, aus der Empfindung heraus, daß es sich in die Zeitläufe besser schicke, hinter einem Schanktisch zu stehen, als Figurinen auf den Brettern zu spielen. Er soll zum ersten Mai eine kleine Kneipe im Osten übernommen haben, und er freut sich schon darauf, sagen einige, Bier einzuschenken, Gläser zu putzen, Butterbrote zu streichen, Bücklinge zu servieren und nachts die Besoffenen zur Bude herauszustiefelwichsen. Ein Jammer! Wir aber müssen aufs tiefste bedauern, zwei so sehr bewunderte und wertgeschätzte Künstler ihrer Kunst untreu werden zu sehen, und wir wollen hoffen, daß solches nicht Mode werde.
In den Kammerspielen ist noch kurz vor Toresschluß eine kleine Änderung getroffen worden. Die Direktion hat den Dramaturgen kleidsame hellblaue Fräcke übergeworfen, mit großen, silbernen Knöpfen dran. Wir halten das für hübsch, denn wir halten's für richtig. Die Theaterdiener sind abgeschafft worden, und die Dramaturgen nehmen nun an den Spielabenden, also zu einer Zeit, wo sie ja sowieso nichts zu tun haben, den Damen die Mäntel ab und weisen den theaterbesuchenden Herrschaften die Plätze an. Auch öffnen sie Türen und geben allerhand kleine, aber notwendige Auskünfte. An den Beinen tragen sie jetzt lange, dicke, ledergelbe, kniehohe Getern, auch können sie einem schon ganz ausgezeichnet, unter einer eleganten Verbeugung, Programme darreichen und Guckgläser anbieten. In der Provinz würden sie außerdem noch Zettel vertragen; dies ist aber hier in Berlin nicht nötig. Kurz und gut, kein Kritiker wird nunmehr noch fragen dürfen, was ein Dramaturg sei, und was er für Obliegenheiten zu erfüllen habe. Sie tun jetzt ihr Äußerstes, und man wird sie in Zukunft in Ruhe lassen müssen.
Um endlich einmal dem ewigen Gejammer und den beständigen Vorwürfen, er gebe nur Ausstattungen, keine Stücke, energisch auszuweichen, ist Direktor Reinhardt auf die Idee gekommen, zukünftig seine Stücke einfach vor weißer Wäsche spielen zu lassen. Seine Dramaturgen haben natürlich das Geheimnis bereits ausplaudern müssen, und er wird erstaunt, wenn nicht entrüstet sein, uns schon heut mit der Neuigkeit auftrompeten zu sehen. Weiße Wäsche! Muß es denn gerade schneeweiße sein? Kann sie nicht von irgendeiner unbekannten Riesendame aus dem Panoptikum, sagen wir, etwa anderthalb Tage lang getragen worden sein? Alsdann würden die Dekorationsstücke einen sicherlich bezaubernden Schenkelduft ausströmen, was den Herren Kritikern nur gut tun könnte, die dann vergäßen, wo sie säßen, und betäubt würden in ihren schärfern Sinnen. Ohne Spaß. Reinhardts Idee scheint uns entwicklungsfähig, also glänzend. Auf den weißen Tüchern werden sich die Gesichter und Spukgestalten der Akteure und Aktricen außerordentlich farbig abheben. Ob Reinhardt das aber auch am Hoftheater durchsetzen wird?

Hohlweg bei Küßnacht
Tell (tritt zwischen den Büschen hervor): Durch diese hohle Gasse, glaube ich, muß er kommen. Wenn ich es recht überlege, führt kein andrer Weg nach Küßnacht. Hier muß es sein. Es ist vielleicht ein Wahnsinn, zu sagen: Hier muß es sein, aber die Tat, die ich vorhabe, bedarf des Wahnsinns. Diese Armbrust ist bis jetzt nur auf Tiere gerichtet gewesen, ich habe friedlich gelebt, ich habe gearbeitet, und wenn ich müde von der Anstrengung des Tages gewesen bin, habe ich mich schlafen gelegt. Wer hat ihm befohlen, mich zu stören, auf wessen Veranlassung hin hat er mich drücken müssen? Seine böse Stellung im Land hat es ihm eingegeben. (Er setzt sich auf einen Stein.) Tell läßt sich beleidigen, aber nicht am Hals würgen. Er ist Herr, er darf meiner spotten, aber er hat mich an Leib, Liebe und Gut angegriffen, er hat es zu weit getrieben. Heraus aus dem Köcher! (Er nimmt einen Pfeil heraus.) Der Entschluß ist gefaßt, das Schrecklichste ist getan, er ist schon erschossen durch den Gedanken. Wie aber? Warum lege ich mich in den Hinterhalt? Wäre es nicht besser, vor ihn hinzutreten und ihn vor den Augen seiner Knechte vom Pferd herunterzuschlagen? Nein, ich will ihn als das ahnungslose Wild betrachten, mich als den Jäger, das ist sicherer. (Er spannt den Bogen.) Mit der friedlichen Welt ist es nun vorbei, ich habe auf das Haupt meines Kindes zielen müssen, so ziele ich jetzt auf die Brust des Wüterichs. Es ist mir, als hätte ich es bereits getan und könnte nach Hause ziehen; was im Geist schon geschehen ist, tun die Hände hinterher nur noch mechanisch, ich kann den Entschluß verzögern, aber nicht brechen, das müßte Gott tun. Was höre ich. (Er horcht.) Kommt er schon? Hat er es eilig? Ist er so ahnungslos? Das ist das Eigentümliche an diesen Herren, daß sie ruhigen Herzens Jammervolles begehen können. (Er zittert.) Wenn ich jetzt den Schuß verfehle, so muß ich hinabspringen und das verfehlte Ziel zerreißen. Tell, nimm dich zusammen, die kleinste Ungeschicklichkeit macht dich zum wilden Tier. (Hornruf hinter der Szene.) Wie frech er durch die Länder, die er erniedrigt, blasen läßt. Er meint, herrisch zu sein, aber er ist nur ohne Ahnung. Er ist so sorglos wie ein tanzendes Kind. Hundertfacher Räuber und Mörder. Er tötet, wenn er tänzelt. Ein Ungeheuer muß in der Ahnungslosigkeit sterben. (Er macht sich zum Schuß bereit.) Jetzt bin ich ruhig. Ich würde beten, wenn ich weniger ruhig wäre. Ruhige wie ich erledigen Pflichten. (Der Landvogt mit Gefolge auf Pferden. Prachtvoller Auftritt. Tell schießt.) Du kennst den Schützen. Frei ist das Land von dir. (Ab.)

Gräfliches Zimmer. Der alte Moor ist gegangen.
Franz (allein): Du mein Gott, wie plump ich gewesen bin. Ich geniere mich ordentlich. Ich habe ihm die Schurkerei wie ein übelduftendes Fressen aufgetischt, und er hat es bereitwillig eingenommen. Sei's. Wie müde ich mich fühle, mich so schmutzig benommen zu haben. Ich hatte kaum recht die Absicht, zu töten, da gelang's mir schon. Ich habe, glaube ich, nur eine vorläufige Probe anstellen wollen, und da ist das widerwärtige Meisterwerk schon fertig. Meinetwegen. Alter Schafskopf. Was sind das für lieblose Töne? (Er besieht sich im Spiegel.) Wie hübsch ich aussehe. Eine vollkommen ruhige Miene. (Er lächelt.) Und dieses Lächeln. Wie unboshaft. Ich hätte nicht so rohe Mittel brauchen ins Werk zu setzen, Schrecken zu verbreiten. Aber das ist es: das Unfeine überzeugt am raschesten. Ich bin um eine Erfahrung reicher. Wie faul ich bin. (Er streckt sich auf einem Ruhebett aus.) Ich würde indischen Tabak rauchen, wenn ich gerade welchen hätte. Ich bin ein bischen angeödet von all dem Vorgefallenen. Ich habe zu schmierig gelogen, und es ist mir zu brutal geglaubt worden. Das entkräftet. Mag's. Was soll ich jetzt tun? Heda, Hermann! (Hermann tritt auf.) Geh wieder. Es war ein Traum, dich zu rufen. Ich hasse Träume. (Hermann ab.) Ich will der Amalie einen erneuten Liebesantrag machen. Ich glaube, ich habe Lust, beschimpft zu werden. O, die Herrlichkeit der Beleidigung. Mich so zu verkennen, das grenzt an Irrsinn. Ich habe ein zu zart entwickeltes Empfindungsvermögen, und ich langweile mich ein wenig. Mich langweilt das Natürliche. Mich entsetzt der Gedanke, ich könnte Erfolg in der Welt haben. (Amalie tritt auf.) Ich habe soeben gelogen, ich habe deinen Karl verdächtigt. Ich bitte dich, eile, sonst geschieht ein Unglück. Der alte Moor ist daran, ihn zu verdammen. Aber ich lüge. Dieses offene Bekenntnis ist die Kaprize eines Nichtswürdigen. (Amalie geht verächtlich lächelnd ab.) Sie glaubt es. Und so taucht langsam hervor, Ungeheuerlichkeiten. Breite dich aus, Schauder. Furchtbarkeiten, tretet heran, amüsiert mich. (Er springt auf.) Ich habe der geordneten Natur jetzt einen Fußtritt versetzt. Sie wird nie wieder gesunden. Ich zitterte, aber vor Weh. Wenn es nicht möglich ist, zart zu sein, so ist es erlaubt, zum Tier zu werden. (Er gähnt.) Ich glaube unerschütterlich fest an den Segen des Furchtbaren. Ich will die Güte zur Welt hinauspeitschen. (Er sieht ein Band am Boden.) Ich will sie zur Hure machen, dafür, daß ich ihr nicht habe begreiflich machen können, daß ich edlen und großen Herzens bin. Los. Vorwärts. Hermann! (Hermann erscheint.) Mach' mich betrunken. Ich muß schlemmen. Ich muß die Höllenkräfte, die in mir donnern, künstlich ersticken. Ich bilde mir sonst ein, ich sei Gott und vernichte das Weltall. (Geht ab.)

Wenn man sagt, er sei ritterlich vom Scheitel bis zur Fußzehe, so ist das noch lange keine Porträtskizze. Sein Gesicht ist nicht gerade schön. Fast gar keine Nase. Die Nase ist in den Gesichtsball eingedrückt, als wäre sie in irgendeiner Stunde von einem unbarmherzigen Schwerthieb zur Hälfte abrasiert worden. Ich sage absichtlich: wegrasiert. Die Nichtachtung des Schicklichen paßt zu dieser Manneserscheinung. Percy haßt die treffenden Worte, die Grazie, die Parfüms. Die Zeichnung seines Mundes drückt Wehmut und Zorn zugleich aus, aber in seine großen Augen scheint sich das Entzücken von hundert blauen Himmeln ein für allemal verliebt zu haben. Wenn der Mann diese Augen schließt, erwarten die Umstehenden etwas Furchtbares, die Gegend zuckt zusammen, die Welt wird finster. Die Gestalt ist eher klein als groß, eher unscheinbar als imponierend. Die Rüstung ist einfach, aber die Haltung ergibt das unsichtbar-sichtbare Bild des Königlichen. Die Lippen sind unbeweglich, sie lächeln wunderselten, und wenn sie es einmal tun, so schießt Hohn zum Gesicht heraus. Spott bedeutet bei Percy, infolge der Rauheit, die ihn beherrscht, die Spitze der Gutmütigkeit. Wen er verspottet, den liebt er, und er kann lieben. Sein Körper macht nicht die geringste überflüssige Bewegung. Er haßt das Schöne, er bemüht sich, eckig aufzutreten. Was an ihm schön erscheint, ist unbewußt. Wenn er wüßte, wie hübsch er ist, zerrisse er sein eigenes goldenes Wesen, ja, er würde sich selber ins Gesicht spucken. Aber dazu müßte er einen Spiegel haben, und diesen Gebrauchsgegenstand kennt er gar nicht. Was er liebt, verachtet er, was er bevorzugt, findet er langweilig, wovon er träumt, das ist lebensgefährlich. Wo das Leben nicht auf dem Spiel steht, mag er nicht leben. Nie ist ein Ehemann von seiner Gattin so geliebt worden und nie mit mehr Ursache. Percy kennt gar keine Tapferkeit. Man kennt nur, was man studiert. Percys Kühnheit ist Percy angeboren, er kann nichts dafür, daß er ein Held ist. Seine Leibfarbe ist grau, sein Schmuck grün, der Federbusch rot. Einer seiner Diener stülpt ihm den Helm auf den Kopf, gleichviel welchen; Percy ist geschmacklos. Er ist zu voll von Ahnung, als daß er in solchen Dingen eine Wahl treffen könnte. Er ist zu frech zu irgendwelcher Bekleidungsfrage und zu zartfühlend zur Farbenlehre. Seiner Frau ist er Gott, er weiß das, und das plagt ihn, wenn er frühstückt. Die Zärtlichkeit, die er empfindet, sobald er sein Weib nur anschaut, will ihn »jedesmal kaput machen«. Hoffentlich sind das seine eigenen Worte. Er macht dann Witze, sagt Adieu und reitet zum Teufel. Die Manieren des Rittertums sind ihm viel zu fade, er benimmt sich wie ein heutiger einfacher Arbeiter. Die Musik liebt er wie nicht gescheit. Wenn sie ihm, abends, nach der Schlacht, wenn er sich ermüdet an einen Baum anlehnt, ertönt, will ihm das Herz, von Tränen getragen, wegschwimmen. Er, der am Tag eine stattliche Sammlung von abgehauenen Armen, Beinen, Köpfen und Händen auf die blutiggefärbte Wiese zusammengejähzornt hat, versteht es, unmittelbar nach Vollendung des schrecklichen Werkes, aus der Natur schöne und sonderbare Stimmungen zu ziehen und sich denselben, wenn auch nur für kurze Zeit, hinzugeben. Seine Stimme, wenn sie genug geschrien und trompetengeblasen hat, will sich zur Abwechslung auch mal die Wonne des Erzitterns gönnen. Zur Religion steht er sich, na! Lieber nicht aussprechen. Ich glaube, sie ist ihm mehr als gleichgültig. Sie ist ihm eine Krähe oder sonst was, genug, er bedarf ihrer nicht. Er hat Hölle und Himmel auf Erden. Ideale hat er keine, nicht einmal Ehrgefühl; es reißt ihn zum Wagnis hin, zufällig ist das gerade sein Ideal, er tobt und erwirbt Ehre. Er träumt davon, den Prinzen von Wales kampfunfähig zu machen, dann zu lachen und den Überwundenen zu küssen. Bis dahin tötet er, was ihm unter das Schwert läuft, von da an würde er möglicherweise ein gesitteter Mensch werden, aber wahrscheinlich auch dann nicht, sein Trotz würde es ihm kaum gestatten. Er stirbt als Junge, aber man hat, wenn man ihn röcheln und sterben sieht, das Gefühl, ein Riese hauche da seinen Atem aus.

Kennen Sie die Gebirgshallen unter den Linden? Vielleicht probieren Sie einmal einen Gang dorthin. Der Eintritt kostet nur dreißig Pfennige. Wenn Sie die Kassiererin auch Brot oder Wurst essen sehen, so müssen Sie nicht degoutiert umkehren, sondern sogleich bedenken, daß es Abendbrot ist, welches da verzehrt wird. Die Natur fordert überall ihre Rechte. Wo Natur ist, da ist Bedeutung. Und nun werden Sie eintreten, ins Gebirge. Und da wird Ihnen eine große Figur, eine Art Rübezahl, begegnen, es ist der Wirt des Lokals, und Sie werden gut tun, ihm durch Hutlüften zu salutieren. Er sieht das gern, und er wird Ihnen artig für Ihre Höflichkeit danken, dadurch, daß er sich halb vom Stuhl, auf dem er sitzt, hochhebt. In der Seele geschmeichelt, treten Sie näher an den Gletscher heran, es ist dies die Bühne, eine geologische, geographische und architektonische Merkwürdigkeit. Sowie Sie sich gesetzt haben, bekommen Sie Trinkofferten von einer vielleicht leidlich hübschen Kellnerin. Man muß vorlieb nehmen mit dem, was da ist. Es strotzt auch an Kammerspielabenden vielleicht nicht einmal von fraulichen Finessen. Geben Sie acht, daß sich nicht allzu viele geschlagen und geworfen volle Apfelweingläser um Ihre Zahlperson herum gruppieren. Die Mädchen machen sich zu gern an solche Herren ran, die Mitleid mit ihnen haben. Mitleid ist unschicklich bei Kunstgenüssen. Haben Sie jetzt auf diese Tänzerin acht gegeben? Kleist hat auch jahrelang auf Anerkennung lauern müssen. Klatschen Sie nur tapfer in die Hände, auch wenn es Ihnen beinahe mißfallen hat. Wo haben Sie Ihren Bergstock? Zu Hause gelassen? Das nächste Mal müssen Sie wohl oder übel sportmäßig ausgerüstet im Gebirge erscheinen, für alle Fälle. Besser ist besser. Was trippelt da für eine reizende Sennhütten-Prinzessin auf Sie zu? Das ist die Kleine. Die will ein geschmettert Volles für fünfzig Pfennig von Ihnen. Werden Sie diesen Lippen, diesen Augen, dieser süßen, dummen Bitte widerstehen können? Sie wären zu beklagen, wenn Sie das könnten. Nun öffnet sich Ihnen wieder der Bühnen-Gletscherspalt, und eine dänische Liedersängerin wirft Sie mit Tönen und Anmutsschneeflocken an. Sie nehmen gerade einen Schluck von Ihrer kuhwarmen Gebirgsmilch. Der Wirt macht die aufpassende Rausschmeißrunde durch das Lokal. Er sorgt für den Anstand und für das gute Betragen. Gehen Sie doch mal hin, ich kann Ihnen sagen, na! Vielleicht treffen Sie dort auch mich wieder einmal an. Ich aber werde Sie gar nicht kennen, ich pflege dort, von Zaubereien gebannt, stillzusitzen. Ich lösche dort meine Dürste, Melodien wiegen mich ein, ich träume.

Kann es eine reizendere Liebhaberrolle geben als den jungen Römer Ventidius? Sonst können etwa Liebhaber auf die Nerven fallen, anlangweilen, anöden, dieser da in keinem Moment. Der Elegant aus dem alten Rom vermeidet es, überflüssige Worte zu machen, und doch fließt ihm die Rede nur so sturzweise, nicht nur glas-, sondern literflaschenweise zum Mund heraus.
Glänzend versteht er es, Frauen den Hof zu machen. Er ist eher eine liebe, als eine bedeutende Erscheinung, ein reizender Quatschkopf, ein Gelegenheitsarbeiter, der in Schwung kommt, wo's was zu erschnappen gibt. Seine gute Erziehung macht ihn poetisch, er ist durch und durch Großstadtpflanze, er würde mitleidig lächeln, wenn man ihm zumuten wollte, tief zu empfinden.
Seine Sprache atmet Aufrichtigkeit, und das ist er auch, er ist aufrichtig, denn er ist jung, aber er ist zugleich ein Italiener, was heißen will: ein Abkömmling von Leuten, die das Talent hatten, die Welt zu unterjochen. Er ist herrisch und zugleich graziös, was aber ist Anmut anderes als Demut? Unser junger Mann mit der flehenden Bitte auf der Lippe ist ein Lügner, ein Unterdrücker aus Gewohnheit, daher interessiert er so lebhaft.
Wie eitel er ist. Augenblickserfolgsmensch, was er ist, verwundet es ihn tief, sich glauben machen zu sollen, daß man ihn entbehren kann. Daß man ihn verächtlich finden kann, das kann er unter keinen Umständen glauben. Der Glaube an Siege war die Religion der Römer.
Hier wird er zornig. Wenn er jetzt nicht entzückt, ist er lächerlich. Der Schauspieler, der ihn spielt, muß Tränen gutgespielten Schmerzes zur Verfügung haben. Außerdem muß er zu knien gelernt haben. »Leidenschaftlich« wird hier, laut Kleistscher Textanmerkung gekniet. Wie aber benimmt sich der Schauspieler bei Mondschein?
Eine Minute später wird er von Bären zerrissen. Jetzt hat er die Pflicht, eines elenden Todes zu sterben.

Wurm, Haussekretär des Präsidenten. Welch eine merkwürdige Figur. Dieser großartig angelegte Schleicher. In seiner Seele hat einstmals jugendliches Feuer gebrannt. Man muß sich einen Wurm als jung denken. Damals hat er noch weinen, beben, beten und hell auflachen können. Es ist möglich, daß er sogar Gedichte geschrieben hat, und jetzt! Er möchte gern etwas ganz Großes sein, er hat Phantasie, und er ist in den Bezirken des Hohen und Guten wie zu Hause. Aber er hat es zu nichts Hohem und Fertigem gebracht, zu nichts Befehlshaberischem. Da er sich vor unfeinen, ja scheußlichen Gewalten bücken muß, hat er sich auf die betörende Grausamkeit verlegt, das zeigt unanfechtbar deutlich an, daß er die Hoheit des Schönen und Guten schauerlich empfindet. Er wäre ein guter Kerl, wenn ihm ein schöner Mund zulächeln wollte. Da schleicht er nun, wie so ein vollendeter Schleicher, das vollkommene Bild eines lebentötenden und -vergiftenden Schurken, und hat doch eine krankhafte Sehnsucht nach dem Lieblichen. Wie wünscht er, gut und rechtschaffen und wohlwollend zu sein. Schon allein seine Klugheit wünscht das. O, er weiß in allen Herzenssachen so trefflich Bescheid, er kennt die Welt, und er weiß, daß er das beste Weltgeschäft verpaßt hat: Zündende Wärme und Liebe. Und da geht er nun hin, eines Abends, es fängt schon zu dunkeln an, zu Luise, die er anbetet, und will nun um sie werben, obschon er von der Nutzlosigkeit seiner Absichten überzeugt ist. Und nun beginnt diese furchtbare Folterung der liebenden Seelen. Unzweifelhaft ist Wurm ein Schurke, es macht ihm Spaß, zu quälen, aber ebenso gewiß tut er sich weh, er liebt, und das ist sehr wichtig. Denn nun tut sich vor unsern Augen da eine wahre Seelenschmerzenhölle auf, es regnet in dieser herrlichen Abendszene Qualen. Das Luisen-Zimmer ist gleichsam tapeziert mit Bildern der unnennbarsten Pein. Rache und Zärtlichkeit, körperliche Lust und Bosheit, Schurkerei und herrische Standhaftigkeit, wie wimmelt das kraß durcheinander. Wurm ist Weltmann, er besitzt die solide Bildung eines Mannes mit guten Beziehungen, er ist genau informiert über die Charaktereigenschaften des Heldenmädchens. Er bewundert sie ohnegleichen in dem Moment, wo sie sich seinen entsetzlichen Plänen überliefert. Er fühlt die grenzenlose Verachtung, welcher er sich aussetzt, er hält das aus, ja, er übersteigt noch die Grenze, er zwingt sich zuletzt noch zu Widerlichkeiten. Er steht unbedingt groß da, er ist Held. Inwiefern Ferdinand Kavalier ist, kann er stolz sein, durch so kühne Intrigen zu fallen.

Es ist mir, als sähe ich ihn vor mir, den Prinzen von Homburg. Er ist in das Kostüm seiner Zeit gesteckt worden, und nun bildet er sich etwas ein auf die Farben, die er trägt, ein scheinbar so eitler Fritze ist er. Übrigens ist er ein Talent, er kann reden, und das ist wiederum etwas, worauf er sich etwas einbildet. Er hat hohe, glänzend gewichste Stiefel an den gespreizten Beinen und, Donnerwetter, ritterliche Handschuhe an den Händen, das hat nicht jeder, ein einfacher Bourgeois zum Beispiel kann das nicht haben. Auf dem Kopf hat er eine Perücke, sein Schnurrbart ist fabelhaft geringelt, das allein bürgt für den künstlerischen Erfolg. Er braucht jetzt nur noch ärgerlich mit seinem Soldatenbein auf den Boden zu stampfen, um alle übelwollenden Kritiken wegzufegen, er tut's, und von diesem Augenblick an ist dieser Herr Prinz von Homburg ein gottbegnadeter Künstler. Übrigens hat er seine Rolle auswendig gelernt, reiner Überfluß, sich die Stellen gemerkt, wo sein ganzes prinzlich homburgisches Wesen zum Durchbruch kommen soll, absoluter Mangel an Kunstunbewußtheit. Er braucht nichts zu können, ja, es ist sogar gut, wenn er nichts kann, der echte Schauspieler ist nicht fürs Lernen, denn er hat's von der Geburt her. Das ist es ja, was diesen hohen Beruf von den übrigen Erdenberufen rühmlich unterscheidet: Man stiefelt einfach in Stiefeln hervor, rasselt mit dem Degen, macht eine Geste und heimst Beifall ein. Das sind keine so einfachen Menschen, die sagen können:
So etwas kann ein Arzt, ein Techniker, ein Journalist, ein Buchbinder oder ein Bergebesteiger nicht sagen, hat ja auch, Gott soll mich strafen, keine Veranlassung dazu. Prinz von Homburgs Augen rollen schrecklich, er spricht die Verse mehr mit seinem Augenrollen als mit seinen Lippen. Übrigens spricht er die Verse schlecht, das beweist, daß er ein guter Mensch ist, daß er Seele, Frau und Kind hat, Charakter hat, und es beweist auch, ja, jetzt merke ich es endlich, daß er tief, tief über seine Rolle nachgedacht hat. Dieser Prinz von Homburg ist von einer bezaubernden Naturburschenhaftigkeit, wenn es gilt, zu sagen:
Diese Worte brüllt er womöglich. Und jetzt gewärtigt er Beifall, aber über den Bürger, dessen Beifall er will, fühlt er sich adlig erhaben. Nun, er ist von Adel, er besitzt Güter am Rhein:
Du liebe Zeit, er geht eben ganz in der Rolle auf. Talent hat der Schuster gehabt, der ihm die Kanonenstiefel angemessen hat, nicht er, das heißt, ja, Talent schon, aber alles das geht ja den einfach geborenen Bürger nichts an.

Ich bereite mich gegenwärtig darauf vor, Schauspieler zu werden. Mein erstes Auftreten auf den Brettern ist nur noch die übliche Frage der Zeit. Momentan lerne ich Rollen auswendig. Den ganzen Tag, trotz des herrlichsten Wetters, sitze oder stehe ich aufrecht in meiner Bude und deklamiere in allen Tonarten. Ich bin vollständig vom Theaterteufel verschlungen. Meine Nachbarschaft bringe ich durch mein Brüllen zur Verzweiflung. Was soll aus mir werden? Aber das hat so kommen müssen. Ich erblicke in dem Mimenberuf die höchste und reinste Menschenaufgabe, und ich glaube nicht, daß ich mich täusche. Ich werde fürs erste in das Heldenfach eintreten, später wird es sich dann zeigen, ob ich der Mann dazu bin, in Charakterrollen hinüberzuspringen. Ich bin, was meine ganze Naturanlage betrifft, einer der süßlichsten Kerls in Europa, meine Lippen sind Zuckerfabriken, und mein Benehmen ist ein total schokoladenes. Dagegen gibt es in mir und an mir eine Art Männlichkeitston, der reine Fels. Ich kann plötzlich, wenn ich es für gut finde, Stein sein, oder Holz; das wird den Liebhabern, die ich spielen werde, notwendigerweise zu statten kommen. Von meiner Figur, die eine sehr altbackene ist, wird Erschütterung ausgehen, meine Augen werden faszinieren, mein Betragen wird blenden, denn es besteht aus lauter Glühstrümpfen. Ich habe einen etwas krummen Rücken nebst einem kleinern Buckel. Diese Verunstaltung meines Körpers wird hinreißen, denn ich gedenke sie vergessen zu machen durch die plastische Darstellung meiner zahlreichen innern Vollkommenheiten. Man wird etwas Häßliches und zugleich etwas Schönes sehen, und das Schöne wird den Sieg davontragen. Mein Kopf ist mächtig groß, meine Lippen sind dick wie starke Folianten, meine Hände gleichen den Füßen von Elefanten, und dazu besitze ich eine furchtbar modulationsfähige Stimme. Wenn jener melancholische Königssohn sagen konnte, er habe Dolche geredet, so darf ich behaupten, und zwar füglich, ich rede und schwatze Schwerter. Schon als Junge bin ich einmal im dramatischen Verein »Edelweiß« aufgetreten, nämlich als Hausknecht, ich spielte schlecht, denn ich fühlte mich zu Höherem berufen. Nunmehr ist die Sache ja für mich entschieden. Nächste Woche findet mein Debüt statt, das Stück heißt: »Du lachst dich kaput«. Hoffentlich erscheinen nun die billettlösenden Herrschaften recht zahlreich, wenn nicht, dann eben nicht, umbringen wird mich die Gleichgültigkeit eines verständnislosen Publikums niemals.

Das Theater war voll besetzt. Das Zeichen zum Beginn der Vorstellung ertönte. Der Vorhang ging in die Höhe. Nein, vorher tönte schon das Orchester mit seiner Ouvertüre, und jetzt erst ging der Vorhang in die Höhe, und Don Juan, der Verführer der Frauen, trat auf, und gar nicht lange dauerte es, und so zog er seinen Degen und rannte ihn dem schwächlichen Gegner in den Leib. Dies war der arme alte Vater, worauf nun, unter einem überaus melodiösen Geschrei, das einem das Herz zerriß, die Tochter herbeieilte, um am Leichnam des Erschlagenen niederzustürzen. Hierauf sang die verzweifelte Frau ein so schönes, in die höchsten Schmerzen steigendes Klagelied, daß den Hörern die Tränen in die Augen treten mußten. Und so wogte der Inhalt der Oper auf und ab, und Lichter schossen aus der Finsternis blendend hervor, und Geister tauchten, zum Entsetzen derer, die sie sahen, auf, und Augen wurden naß, und frevelhafte Worte wurden ausgesprochen, wobei die Musik bald zu tönen aufhörte und bald wieder mit Gesang und Klang von neuem einsetzte, um jedes Ohr zu bezaubern. Die Ohren, die das alles hörten, wurden von der Musik verwundet, um gleich darauf wieder, nur von einem neuen Strom von Musik, geheilt und erlöst zu werden. So wechselten der Tod mit dem Leben, die Erschöpfung mit der Erquickung, die Verwundung mit der Gesundung ab, und Bilder taten sich vor den Augen der Zuschauer auf, die sie, so sagten sie sich, nie wieder würden vergessen können. Die wunderbare Musik tröstete und beengte alle Seelen, betörte und beglückte alle Herzen. Und der schöne, edle, volltönende Gesang glich dem glücklichen Kind, das getragen und gehoben wird von den Armen der vielleicht noch viel glücklicheren Mutter. Und so strömte und loderte es gleich einer überanmutvollen, schreckenerregenden Feuersbrunst, und gleich einem in sich selber tosenden und in die Schlucht hinabstürzenden und brüllenden wilden Wasserfall. Dann wieder war es ein stilles, kaum hörbares Seufzen. Einige Zeit lang glich es einem süßen, liebevollen Anmutgeriesel oder wohltuendem Schneegestöber. Dann schien es zu sein, als regne es leise auf Dächer herab, worauf wieder ein gereizter gewaltiger Löwe zu brüllen schien, so daß Furcht und Schönheitsempfinden miteinander kämpften. Und immer war es getaucht in silberne, milde Mondesgroßartigkeit, daß man meinte, nicht ein Mensch, sondern ein himmlischer, erdenunabhängiger Engel müsse das alles erfunden und gemacht haben. Man dachte überhaupt, weil das Ganze eine so schöne Schöpfung war, nicht an eine Schöpfung, denn man hatte zu viel mit dem Bewußtsein des Genusses zu tun. Jagdhörner, Waldhörner klangen zwischen den Flöten, Klarinetten und elegischen Geigen, daß ganze rauschende, uralte Eichen-, Buchen- und Tannenwälder sich vor der Seele und vor dem musikdurchschauenden Auge auftaten. Und dann, was war dann? Dann, und so kam ja die herrliche, gnaden- und tonüberströmte Verzeihungsszene, wo die liebliche Zerline ihren Gatten um Verzeihung des Fehltrittes bittet, die gewährt wurde unter einem unsagbar schönen Gesang, wobei sie beide singen, die Verzeihliche sowohl wie der liebe gute Verzeihende. So versöhnten und verziehen sie sich, und man wußte gar nicht mehr, wo man war vor lauter Schwelgen und Träumen in wehmutvoll-empfindungsvollen Rätseln. In den Logen und Parketten schauten sich Gatte und Gattin, Bruder und Schwester, Freund und Freundin, Sohn und Vater, Tochter und Mutter in die Augen und nickten mit den gedankenvollen Köpfen. In einer Loge, wie in einem Lusthaus oder wie in einem Tempel, saß eine schöne Frau mit großen, schwarzen, leidenschaftdurchglühten Augen, die sich nicht verwinden konnte, eine Bewegung zu machen, als wolle und müsse sie an den sterblich schönen und süßen Tönen kranken und sterben, um im Schönheitsgenuß zu endigen. Und so vielleicht noch allerlei andere, weniger bedeutsame Personen. Oskar, der finstere Oskar, der Held der Epoche, in der er lebte, lehnte an einer goldenen Säule, und er mußte schaudern vor den Gewinnsüchtigkeiten und Schlechtigkeiten des Lebens, das er führte, da er so himmlisch Schönes und Wohllautendes hörte. Doch er verzog keine Miene seines harten Gesichtes, und er rührte kein Glied seines schlanken, wie aus schmiegsamem Eisen gebauten Körpers. »Komm auf mein Schloß, mein Leben« – so sang der verwilderte Kerl mit dem rabenschwarzen Bart im Wüstlingsgesicht. Doch wir scheinen vergessen zu haben, zu sagen, wie eine Dame, ganz in schwarz gekleidet, mit nicht endenwollendem Gram- und Schmerzgesang aus dem Hintergrund der Welt an das Licht hervortrat. Zuletzt, als alles nichts half bei dem Verworfenen und Verderblichen, öffnete sich feurig rot der Höllenschlund und verschlang den unverbesserlichen Bösewicht mit Gepolter, Gekrach und Geknatter. Die Musik spielte noch einige nachtragende Töne, und auf einmal war alles mäuschenstill, der Vorhang fiel nieder, und das Publikum ging nach Hause. An diesem Abend machte Oskar die Bekanntschaft der schönen Gräfin von Erlach, die die Männer liebte, um sie zu vernichten. In der Folge wußte er sich aber den schrecklichen Einflüssen dieser Frau zu entziehen, wozu ihm die näher mit den Dingen Vertrauten gratulierten.

Graf und Gräfin sitzen beim Frühstück. In der Tür erscheint der Diener und überreicht seiner gnädigen Herrschaft einen anscheinend gewichtigen Brief, den der Graf erbricht und liest.
Inhalt des Briefes: »Sehr geehrter, oder, wenn Sie lieber wollen, hochwohlgeborener, nicht genug zu rühmender, guter Herr, hören Sie, Ihnen ist eine Erbschaft zugefallen von rund zweimalhunderttausend Mark. Staunen Sie und seien Sie glücklich. Sie können das Geld persönlich, sobald es Ihnen beliebt, in Empfang nehmen.«
Der Graf setzt seine Frau von dem Glück, das ihm in den Schoß gefallen ist, in Kenntnis, und die Gräfin, die einige Ähnlichkeit mit einer Kellnerin hat, umarmt den höchst unwahrscheinlichen Grafen. Die beiden Leute begeben sich weg, lassen aber den Brief auf dem Tisch liegen. Der Kammerdiener kommt und liest, unter einem teuflischen Mienenspiel, den Brief. Er weiß, was er zu tun hat, der Schurke.
»Bier, wurstbelegte Brötchen, Schokolade, Salzstangen, Apfelsinen gefällig, meine Herrschaften!« ruft jetzt in der Zwischenpause der Kellner.
Der Graf und der Kammerdiener, das ungetreue Scheusal, als welches er sich nach und nach entwickelt, haben sich aufs Meerschiff begeben, und jetzt sind sie in der Kajüte. Der Diener zieht seinem Herrn die Stiefel aus, und letzterer legt sich schlafen. Wie unvorsichtig das ist, soll sich alsbald zeigen, denn nun entpuppt sich der Schurke, und ein mörderischer Kammerdiener gießt seinem Gebieter eine sinnberaubende Flüssigkeit in den Mund, den er gewaltsam aufreißt. Im Nu sind dem Herrn Hände und Füße gefesselt, und im nächsten Augenblick hat der Räuber den Geldbrief an sich gerissen, und der arme Herr wird in den Koffer geworfen, worauf der Deckel zugeklappt wird.
»Bier, Brause, Nußstangen, Schokolade, belegte Brötchen gefällig, meine Herrschaften«, ruft wieder das Ungeheuer von Kellner. Einige der anwesenden Vorortherrschaften genehmigen eine kleine Erfrischung.
Nun prunkt der verräterische Diener in den Anzügen des vergewaltigten Grafen, der in dem Amerikakoffer schmachtet. Dämonisch sieht er aus, der unvergleichliche Spitzbube.
Es rollen noch weitere Bilder auf. Zuletzt endet alles gut. Der Diener wird von Detektivfäusten gepackt, und der Graf kehrt mit seinen zweimalhunderttausend Mark glücklich, obgleich unwahrscheinlich, wieder nach Hause.
Nun folgt ein Klavierstück mit erneuertem »Bier gefällig, meine Herrschaften«.

Als ganz junger Mensch schon, zu der Zeit, da ich Volksbanklehrling war, fühlte ich mich auf das entschiedenste als Dramatiker geboren. Was für einen wackern Schaffensdrang und -mut ich entwickelte, mag daraus hervorgehen, daß ich oben in einer staubigen Dachstube an einem Stehpult stand, das meinem ältern Bruder, der Student war und der ebenfalls in großen Linien drauflos dramatisierte, von einer Verehrerin und Gönnerin zum Geschenk gemacht worden war. Mein Bruder wälzte sich an einem historischen Stoff herum, der den Titel trug: »Der Bürgermeister von Zürich«. Ich aber, indem ich mich in das Polentum verliebte, hatte mich in den polnischen Freiheitskampf geworfen, und der Gegenstand meiner leidenschaftlichen dichterischen Bestrebungen hieß: »Wanda, die Polenfürstin«. O Gott, wie schwelgte ich am Genuß dieses hochherzigen Heldenkindes. Andrerseits aber träumten wir beide, mein produktiver Bruder und ich, der ich mir nicht minder produktiv erschien, von rauschendem Applaus, von Lorbeerkränzen und von mehr-, ja, vielleicht hundertfach wiederholten Aufführungen, hervorgerufen durch allseitiges stürmisches Verlangen, unsre bezaubernden Werke immer von neuem wieder zu sehen. Es war im Sommer, und in der Dichterdachkammer herrschte eine versengende, brütende Hitze, und den beiden jungen hoffnungsvollen Theatralikern lief der Schweiß von den erfinderischen und schöngeistigen Stirnen herunter. Meine Polen schienen das Leben, das doch so amüsant sein kann, nicht sonderlich hochzuschätzen, sondern sie warfen es, erfüllt, wie sie waren, von glühender Vaterlandsliebe, weg, als tauge es keinen Pfifferling, oder als tauge es nur angesichts des Todes etwas. Ich erschrecke heute, wo aus mir ein Genüßling und Lüstling geworden ist, der die Teller leckt und den üppigen Frauen bereitwilligst den Hof macht, über den vormaligen dramatischen Heldenmut, womit ich umging, als sei ich nicht meiner lieben Mutter, sondern einer Löwin Sohn, bestimmt für die Schlacht und für den grausigen Kanonendonner. »Wanda« ist indessen nie als Buch erschienen, und ebensowenig habe ich erfahren, daß dieses herrliche Stück je seine Aufführung erlebte.
Meine bescheidene Wenigkeit war im elterlichen Hause, als kleiner Junge, der noch unglaublich grün und noch ziemlich naß hinter den Ohren war, der bevorzugte Inszeneur, Theaterspieler, Dramaturg, Regisseur und Geschichtenmacher meiner jüngern Schwester, der ich eine Zeitlang immer Geschichten, nicht etwa nur erzählen, nein, machen mußte, wessen ich mich heute glücklicherweise noch deutlich erinnere, da ich sonst diesen interessanten Aufsatz ja gar nicht schreiben könnte. Fanny, so, meine ich, hieß die entsetzliche kindliche Tyrannin, die gebieterisch von mir verlangte, ich solle ein dichterisches Genie sein, um sie mit Vorgängen zu erbauen und mit Geschichten zu unterhalten, wobei sie mir stets, und das war das Schreckliche, drohte, zu Mama zu gehen und mich als Bösewicht zu verklagen, wenn ich mich von Zeit zu Zeit eines so ermüdenden und geistig so aufreibenden Geschäftes, wie das edle Dramatisieren ist, ein wenig entziehen wollte. Stundenlang dauerte das Theater; und die Geschichten, die ich machte und in Szene setzte, wollten schon, aber durften nicht enden, da sonst mein gestrenges Publikum, das heißt: meine liebe Schwester, indem sie eine mir nur zu wohlbekannte zürnende Miene aufsetzte, sogleich sagte: »Du scheinst heute keine besondere Lust zu haben, mir eine Geschichte zu machen, an welcher ich mich ergötzen könnte. Ich rate dir, habe nur Lust, sonst geh ich zu Mama und sage ihr, daß du mich immer ärgerst, und dann bekommst du Prügel, das weißt du. Nimm nur deine Phantasie mit aller Kraft zusammen und gib mir stets nur das Beste von deinem Können. Ich weiß, daß du kannst, wenn du willst, und ich will keinerlei Entschuldigungen anhören, wie die, daß dir der Geist erlahme. Umsonst sind alle deine Bemühungen, die du machst, um dich deiner Aufgabe, einer Aufgabe, zu deren Lösung du verpflichtet bist, zu entziehen. Du mußt, du mußt spielen. Sonst werde ich erbärmlich zu weinen anfangen, was Mama haßt, und was das für unausbleibliche peinliche Folgen für dich hat, das kann dir dein Geschichtenmacherkopf erzählen, den schon so mancher Schlag von Mamas Hand getroffen hat.« So oder ähnlich redete eine schauderhafte Unterdrückerin zum erbarmungswürdigen, armseligen Gedrückten, Gepreßten, Verkauften und Unterdrückten. Machte ich meine Sache gut und war Schwesterchen zufrieden mit der Kunst, die ich ausübte, so belohnte ein reizendes, gnädiges, wenngleich etwas höhnisches Lächeln den Angstschweiß, mit dem ich gekämpft hatte. Wenn ich aber der Tyrannin trotzte und mich den schwesterlichen Befehlen nicht fügen wollte, so kam es heran, das Ungeheure, und ich erhielt Hiebe auf meinen phantasielosen Schädel, eine Maßregel, die ich natürlicherweise im höchsten Grade verabscheute. Und da mir Mamas Zorn stets mindestens ebenso weh tat wie die Ohrfeige, die sie mir versetzte, so suchte ich im allgemeinen meines geehrten Publikums Gunst zu erwerben und Mißfallen zu vermeiden, und bald kam ja dann die Zeit, wo die lästige Geschichtenmacherei und dramatische Kunst überhaupt aufhörte.

Ein großstädtischer Hof, vom Mond beleuchtet. Mitten im Hof eine eiserne Kiste. Eine Partie Gesang von innen her in den Zuschauerraum tönend. Ein Löwe an einer Kette angebunden. Ein Schwert neben der Kiste. Eine dunkle, unerkennbare Gestalt etwas weiter davon entfernt. Der Gesang, das heißt, eine junge, schöne Frau, beugt sich oben zu einem lampenerhellten Fenster hinaus, immer weiter singend. Es scheint entweder eine gefangen gehaltene Prinzessin königlichen Ursprungs oder eine Opernsängerin zu sein. Zuerst ist der Gesang wie eine schlichte, ziemlich schülerhafte Gesangsübung gewesen, aber nach und nach erweitert und verbreitert er sich zu was Großem, zu was Menschlichem, er ist hinreißend, er klagt, dann wieder scheint er sich im eigenen Schmerz zu gefallen. Dieser Gesang reißt das Fenster auseinander und gibt der Luft eine schöngebaute Treppe zum Hinuntersteigen. Die Frau kommt hinunter, aber immer noch singend. Aus der eisernen oder stählernen Kiste taucht jetzt ein Mannskopf hervor, furchtbar blaß und von schwarzen, wilden Haaren umrahmt. Die Augen des Mannes reden die stumme Sprache der Verzweiflung, der breite, man darf wohl sagen: volkstümliche Mund lächelt, aber was ist das für ein schreckliches Lächeln? Der Zorn und der Gram scheinen es in jahrelanger Übung still zusammengebaut zu haben. Die Wangen sind eingefallen, aber das ganze Gesicht drückt unaussprechliche Güte aus, nicht solche, der es leicht geht, sondern solche, die das Schwerste erfahren hat. Die Sängerin setzt sich unter einer unnachahmlichen Bewegung auf den Rand der Kiste, die Hand legt sie wie liebkosend auf den Kopf des Eingeschlossenen. Der Löwe rasselt mit der Kette. Ist hier alles, alles gefangen? Laß sehen. Wirklich, auch das Schwert am Boden rührt sich in keiner Weise, aber es lebt, denn es gibt jetzt einen kurzen Ton von sich, es seufzt. Was ist das für ein Zeitalter, das Künstlerinnen zu Löwen wirft, neben eine klirrende Kette, vor ein seufzendes Schwert, an die Seite von Leuten, die die sonderbare Laune haben, in eisernen Kasten zu wohnen? Plötzlich stürzt der Mond von seiner unermeßlichen Höhe in den Hof hinab, der Frau vor die Füße. Diese setzt den Fuß auf die blasse, schimmernde Kugel und bewegt sich solchermaßen rund um die Kiste herum. Da zerteilt und zerlegt sich der Mond in ein weites Gewand, oder in eine Art Teppich, oder in eine Schicht weißlichen Nebel, die Häuser, die den Hof bilden, verschwinden, blendend weiße Alpengipfel steigen aus dem Abgrund der Bühne langsam in die Höhe, der Nebel legt sich den Alpen zu Füßen, ein rötlicher Stern schießt aus der bläulich-schwärzlichen Luft herab in die Haartracht der Sängerin. Dieser Schmuck ist blendend, aber in diesem Moment entsteigt der Kiste eine hohe, dunkelgrüne Tanne, und der Mann steht, mit einer prachtvollen Rüstung bedeckt, unter den Ästen dieser Tanne, aber noch mehr: da, wo ein Löwe an der Kette gerissen hat, steht jetzt ein zierlicher Tempel von altgriechischer Bauart. Das Schwert hat, wie es scheint, Bewegung gefunden, denn es befindet sich wunderbarerweise jetzt in den Händen des Mannes, und dieser Mann! Worte wagen sich nicht an die Beschreibung seiner kräftestrotzenden Erscheinung heran. Er singt, oder irgend etwas um ihn herum scheint zu erbeben unter Klängen. Hinter den Bergen läuten die Glocken. Ein ferner, blauer See spiegelt sich in der Luft über den Häuptern der Darsteller formvollendet, aber verkleinert ab. Dem Bühnenboden entsprießen Gräser, Kräuter und Blumen, wir befinden uns, glauben wir, auf der üppigen Matte eines breiten Vorberges. Da kommt auch noch eine Kuh mit bim bam und bum bum und weidet friedlich. Ein Summen umhüllt alles. Aber wo ist die Sonne. Ei, unter dem Sonnigen vergißt man eben die Gegenwart der Sonne. Aber plötzlich legt sich eine schwarze, ungeheuerlich große Hand breitfingrig über das alles und erdrückt es. Hinab! donnert eine höllische Stimme, und wieder taucht der schwärzliche Hof auf, der Löwe brüllt, die Zeit steht etwas abseits von dem Gebrüll an einen Pfahl angelehnt, unerkennbar und totenstill, der Kopf des Mannes ragt zur Kiste heraus, er murmelt jetzt etwas, und der künstlerische Schmerz singt wieder zum Fenster hinaus. Dazwischen hört man das ferne, ferne Gezwitscher eines Vogels, wobei man an den See denken muß, der in der losen Luft gehangen ist. Das Schwert schlägt dumpf zu Boden. Und nun sinkt der Gesang der Frau zu der anfänglichen Gesangschule herab, der Mann duckt sich eilig und verschwindet vollständig in seiner eisernen oder gußeisernen Umgebung. Die dunkle Gestalt raucht eine Zigarette, als wollte sie sagen: das ist mein Kennzeichen. Sie gibt dadurch tatsächlich dem Bild eine andre Wendung, denn nach einer momentanen Dunkelheit blicken die Zuschauer in ein modern ausgestattetes Kaffeehaus, worin einzelne Leute gierig Zeitungen lesen. Sie tippen mit den Fingern auf Gedrucktes, lächeln fein und farblos dazu und rufen dann: Bitte zahlen, Ober! Der Löwe spaziert manierlich herein, hinter ihm die vermeintliche Prinzessin, auch der Mann kommt, eine »interessante Erscheinung«, dann das hübsch frisierte Schwert, dann der blauäugige See in ganz neuem Anzug, und bestellen alle hintereinander eine Tasse Kaffee und schwatzen miteinander.

Stelle dir, lieber Leser, vor, wie schön, wie zauberhaft das ist, wenn eine Schauspielerin, Sängerin oder Tänzerin durch ihr Können und durch die Wirkung desselben ein ganzes Theaterpublikum zu stürmischem Jubel hinreißt, daß alle Hände in Bewegung gesetzt werden und der schönste Beifall durch das Haus braust. Stelle dir vor, daß du selber mit hingerissen seiest, der Glanzleistung deine Huldigung darzubringen. Von der umdunkelten, dichtbevölkerten Galerie herab hallen, Hagelschauern ähnlich, Beifallskundgebungen herab, und gleich dem rieselnden Regen regnet es Blumen über die Köpfe der Leute auf die Bühne, von denen einige von der Künstlerin aufgehoben und, glücklich lächelnd, an die Lippen gedrückt werden. Die beglückte, vom Beifall wie von einer Wolke in die Höhe gehobene Künstlerin wirft dem Publikum, als wenn es ein kleines, liebes, artiges Kind sei, Kußhand und Dankesgeste zu, und das große und doch kleine Kind freut sich über diese süße Gebärde, wie eben nur immer Kinder wieder sich freuen können. Das Rauschen bricht bald in Toben aus, welches sich wieder ein wenig zur Ruhe legt, um gleich darauf von neuem wieder auszubrechen. Stelle dir die goldene, wenn nicht diamantene Jubelstimmung vor, die wie ein sichtbarer göttlicher Nebelhauch den Raum erfüllt. Kränze werden geworfen, Buketts; und ein schwärmerischer Baron ist vielleicht da, der ganz dicht am Rand der Bühne steht, den Schwärmerkopf bei der Künstlerin kleinen, kostbaren Füßen. Nun, und dieser adlige Begeisterungsfähige legt vielleicht dem umschwärmten und umjubelten Kinde eine Tausendmarknote unter das bestrickende Füßchen. »Du Einfaltspinsel, der du bist, behalte du doch deine Reichtümer.« Mit solchem Wort bückt sich das Mädchen, nimmt die Banknote und wirft sie verächtlich lächelnd dem Geber wieder zurück, den die Scham beinahe erdrückt. Stelle dir das und andres recht lebhaft vor, unter anderm die Klänge des Orchesters, lieber Leser, und du wirst gestehen müssen, daß eine Ovation etwas Herrliches ist. Die Wangen glühen, die Augen leuchten, die Herzen zittern, und die Seelen fliegen in süßer Freiheit, als Duft, im Zuschauerraum umher, und immer wieder muß der Vorhangmann fleißig den Vorhang hinaufziehen und herunterfallen lassen, und immer wieder muß sie hervortreten, die Frau, die es verstanden hat, das ganze Haus im Sturm für sich zu gewinnen. Endlich tritt Stille ein, und das Stück kann zu Ende gespielt werden.

Es ist einem, als schüttle da eine Riesin ihre Locken und strecke ein Bein zum Bett heraus, wenn man am frühen Morgen, noch ehe die Elektrischen fahren, von irgendeiner Pflicht angetrieben, in die Weltstadt hineingeht. Kalt und weiß liegen die Straßen wie ausgestreckte Menschenarme da; man läuft, reibt sich die Hände und sieht, wie zu den Toren und Türen der Häuser Menschen heraustreten, als speie ein ungeduldiges Ungeheuer seinen warmen, flammenden Speichel aus. Augen begegnen dir, wenn du so dahergehst, Mädchen- und Männeraugen, trübe und frohmütige; Beine laufen hinter und vor dir, und du selber beinelst auch, was du nur kannst und schaust mit deinen eigenen Augen, mit denselben Blicken, wie alle blicken. Und die Brüste tragen alle irgendein verschlafenes Geheimnis, und in den Köpfen allen spukt irgendein wehmütiger oder anspornender Gedanke. Herrlich, herrlich. Da ist es also kalter, halb sonniger, halb trüber Morgen, viele, viele Menschen liegen noch in ihren Betten, Schwärmer, die die Nacht und den halben Morgen durchgelebt und -geabenteuert haben, Vornehme, zu deren Lebensgewohnheiten es gehört, spät aufzustehen, faule Hunde, die zwanzigmal erwachen, gähnen und wieder einschnarchen, Greise und Kranke, die sich überhaupt nicht mehr, oder nur mühsam erheben können, Frauen, die geliebt haben, Künstler, die sich sagen: a was, quatsch, früh aufstehen, Kinder von reichen, schönen Eltern, fabelhaft gepflegte und behütete Wesen, die in ihren eigenen Stuben, hinter schneeweißen Fensterumhängen, das Mündchen offen, märchenhaft träumend, bis neun, zehn oder elf Uhr schlafen. Was zu solch früher Morgenstunde aus den wild ineinander verschlungenen Straßen gramselt und ameiselt, das sind, wenn nicht Dekorationsmaler, so doch vielleicht Tapezierer, Adressenschreiber, kleine, lausichte Agenten, Menschen auch, die einen frühen Eisenbahnzug nach Wien, München, Paris oder Hamburg erreichen wollen, kleine Menschen in der Regel, Mädchen von allen möglichen Erwerbszweigen, Erwerbende also. Einer, der dem Rummel zusieht, muß das notwendigerweise einzig finden. Er geht dann so und meint beinahe, auch rennen, atempusten und seine Arme hin und her schwenken zu müssen; das Treiben und Emsigtun ist ja so ansteckend, wie etwa ein schönes Lächeln ansteckend sein kann. Nein, nicht so. Der frühe Morgen ist noch etwas ganz anderes. Er schleudert aus Kneipen etwa noch ein paar schmierig gekleidete Nachtgestalten mit ekelhaft rotbemalten Gesichtern auf die blendend-staubig-weiße Straße hinaus, wo sie eine gute Weile, den Hakenstock an der Schulter tragend, blödsinnig stehen bleiben, um Vorübergehende anzuöden. Wie ihnen die trunkene Nacht zu den schmutzigen Augen hinausblendet! Weiter, weiter. Bei Besoffenen hält sich das blauäugige Wunder, der frühe Morgen, nicht auf. Er hat tausend schimmernde Fäden, womit er dich weiterzieht, er schiebt dich von hinten und lockt und lächelt dich von vorne an, du siehst hinauf, wo ein weißlich verschleierter Himmel ein paar zerrissene Stücke Blau hervorläßt; hinter dich, um einem Menschen, der dich interessiert, nachzuschauen, neben dich, an ein reiches Portal, hinter dem ein fürstliches Palais verdrossen und vornehm emporragt. Statuen winken dir aus Gärten und Parkanlagen entgegen; immer gehst du und hast flüchtige Blicke für alles, für Bewegliches und Feststehendes, für Droschken, die träge fortrumpeln, für die Elektrische, die jetzt zu fahren beginnt, von der herab Menschenaugen dich ansehen, für den stupiden Helm eines Schutzmannes, für einen Menschen mit zerrissenen Schuhen und Hosen, für einen zweifellos ehemals Gutsituierten, der im Pelzmantel und Zylinder die Straße fegt, für alles, wie du selber für alles ein flüchtiges Augenmerk bist. Das ist das Wunder der Stadt, daß eines jeden Haltung und Benehmen untertaucht in all diesen tausend Arten, daß das Betrachten ein flüchtiges, das Urteil ein schnelles und das Vergessen ein selbstverständliches ist. Vorüber. Was ist vorüber? Eine Fassade aus der Empirezeit? Wo? Da hinten? Ob sich da einer wohl entschließen kann, sich nochmals umzudrehen, um der alten Baukunst einen Extrablick zu schenken? I woher. Weiter, weiter. Die Brust dehnt sich, die Riesin Weltstadt hat jetzt in aller üppigen Gemächlichkeit ihr schimmernd-durchsonntes Hemd angezogen. So eine Riesin kleidet sich eben ein bißchen langsam an; dafür aber duftet und dampft und pocht und läutet jede ihrer schönen, großen Bewegungen. Droschken mit Amerikakoffern obenauf poltern und radebrechen vorbei, du gehst jetzt im Park; die stillen Kanäle sind noch mit grauem Eis bedeckt, die Matten frieren dich an, die schlanken, dünnen, kahlen Bäume jagen dich mit ihrem zitternd-frörlichen Aussehen flugs weiter; Karren werden geschoben, zwei herrschaftliche Fuhrwerke aus der Remise irgendeines Menschen von offiziellem Gepräge, jedes zwei Kutscher und einen Lakaien tragend, jagen vorüber; immer ist etwas, und jedesmal ist das Etwas, wenn man es näher betrachten will, verschwunden. Natürlich hast du eine Unmenge Gedanken während deines einstündigen Marsches, du bist Dichter und kannst dazu ruhig deine Hände in den Taschen deines hoffentlich anständigen Überziehers behalten, du bist Maler und hast vielleicht bereits während deines Morgenspazierganges fünf Bilder fix und fertig gemacht. Du bist Aristokrat, Held, Löwenbändiger, Sozialist, Afrikaforscher, Tänzer, Turner oder Kneipenwirt gewesen, hast flüchtig geträumt, eben jetzt dem Kaiser vorgestellt worden zu sein. Er ist vom Thron herniedergestiegen und hat dich in ein halbstündiges, vertrauliches Gespräch, an welchem sich auch die Frau Kaiserin dürfte beteiligt haben, gezogen. Du bist in Gedanken Stadtbahn gefahren, hast Dernburg seinen Lorbeerkranz vom Haupte gerissen, geheiratet und dich in einer Ortschaft in der Schweiz heimisch niedergelassen, ein bühnenfähiges Drama geschaffen – lustig, lustig, weiter, he da, was? Sollte das? Ja, da ist dir dein Kollege Kitsch begegnet, und da seid ihr zusammen nach Hause gegangen und habt Schokolade getrunken.

Ein Helles bitte! Der Biereingießer kennt mich schon seit geraumer Zeit. Ich schaue das gefüllte Glas einen Moment an, nehme es mit zwei Fingern an seinem Henkel und trage es nachlässig zu einem der runden Tische, die mit Gabeln, Messern, Brötchen, Essig und Öl versehen sind. Ich stelle das nässende Glas ordnungsgemäß auf den Filzuntersatz und überlege, ob ich mir etwas zu essen holen soll, oder nicht. Der Eßgedanke treibt mich zu dem blauweiß gestreiften Schnittwaren-Fräulein. Von dieser Dame lasse ich mir eine Auswahl Belegtes auf einem Teller verabreichen, derart bereichert trabe ich ordentlich träge an meinen Platz zurück. Ich gebrauche weder Gabel noch Messer, nur das Senflöffelchen, mit dem ich meine Schnitten braun anstreiche, worauf ich dieselben gemütvoll in den Mund hineinschiebe, daß es die Seelenruhe selber ist, die mir jetzt unter Umständen zuschauen darf. Bitte, noch ein Helles. Bei Aschinger gewöhnt man sich rasch einen Eß- und Trink-Vertraulichkeitston an, man spricht dort nach einiger Zeit fast nur noch wie Waßmann im deutschen Theater. Mit dem zweiten oder dritten Glas Hellem in der Faust treibt's einen dann gewöhnlich an, allerlei Beobachtungen zu machen. Man will gern recht exakt notiert haben, wie die Berliner essen. Sie stehen dabei, aber sie nehmen sich ganz nett Zeit dazu. Es ist ein Märchen, zu glauben, in Berlin haste, zische oder trabe man nur. Man versteht hier geradezu drollig, Zeit dahinfließen zu lassen, man ist eben auch Mensch. Es ist eine innige Freude, zu sehen, wie hier nach Wurstbrötchen und italienischen Salaten geangelt wird. Die Gelder werden meistens aus Westentaschen hervorgezogen, es handelt sich ja doch beinahe regelmäßig nur um einen Groschen. Jetzt habe ich mir eine Zigarette gedreht und nehme am Selbstbrenner, der unter grünem Glas steckt, Feuer. Wie gut ich dieses Glas kenne und die Messingkette zum Anziehen. Immer wimmelt es ein und aus von eßlustigen und satten Menschen. Die Unbefriedigten finden rasch an der Bierquelle und am warmen Wurstturm Befriedigung, und die Satten springen wieder an die Geschäftsluft hinaus, gewöhnlich eine Mappe unter dem Arm, einen Brief in der Tasche, einen Auftrag im Gehirn, einen festen Plan im Schädel, eine Uhr in der offenen Hand, die sagt, daß es jetzt Zeit ist. Im runden Turm in der Mitte des Gemaches thront eine junge Königin, es ist die Beherrscherin der Würste und des Kartoffelsalates, sie langweilt sich ein wenig in ihrer köcherlichen Umgebung. Eine feine Dame tritt ein und spießt ein Kaviarbrötchen an zwei Fingern auf, sofort mache ich mich ihr bemerkbar, aber so, als ob mir das Bemerktwerden Wurst wäre. Ich habe inzwischen Zeit gefunden, mich an einem neuen Hellen festzuhalten. Die feine Frau geniert sich ein bischen, in die Kaviarherrlichkeit hineinzubeißen, ich bilde mir natürlich sogleich ein, das sei ich und kein anderer, wegen dem sie ihrer Zubeißesinne nicht so ganz völlig mächtig wäre. Man täuscht sich so leicht und so gern. Draußen auf dem Platz ist ein Lärm, den man eigentlich gar nicht hört, ein Durcheinander von Wagen, Menschen, Autos, Zeitungsverkäufern, Elektrischen, Handwagen und Fahrrädern, das man eigentlich auch gar nicht mal sieht. Es ist beinahe unpassend, zu denken, man wolle das hören und sehen, man ist doch kein Zugereister. Die elegant-geschweifte Taille, die soeben noch Brot geknuspert hat, verläßt jetzt Aschinger. Wie lange habe eigentlich denn ich im Sinn, dazubleiben? Die Bierburschen haben momentan ein wenig Ruhe, aber nicht lange, denn es wälzt sich wieder von draußen herein und wirft sich durstig an die sprudelnde Quelle. Menschen, die essen, betrachten andere, die ebenfalls mit den Zähnen arbeiten. Wenn einer den Mund gerade voll hat, so sehen zu gleicher Zeit seine Augen einen, der mit Hereinschieben betätigt ist, an. Und die Leute lachen nicht einmal, auch ich nicht. Seit ich in Berlin bin, habe ich mir abgewöhnt, das Menschheitliche lächerlich zu finden. Übrigens lasse ich mir in diesem Augenblick selber ein neues Eßzauberstück geben, es ist dies ein Brotbrett mit einer schlafenden Sardine darauf, sie liegt auf einem Butterlaken, dies gewährt einen so reizenden Anblick, daß ich das ganze Schauspiel beinahe auf einen Ruck in den offenen Drehbühnen-Rachen hinunterwerfe. Ist so etwas lächerlich? Keineswegs. Nun also. Was an mir nicht lächerlich ist, kann es an den andern noch weniger sein, denn man hat die Pflicht, andere unter allen Umständen höher zu achten, als sich selber, eine Weltanschauung, die zu dem Ernst, mit dem ich jetzt an den ruckweisen Untergang meines Sardinennachtlagers denke, prächtig paßt. Einige von den Menschen, die mich umgeben, unterhalten sich essend. Die Gewichtigkeit, mit der sie solches tun, ist ansprechend. Wenn man schon dabei ist, etwas zu unternehmen, unternehme man es würdig und sachlich. Würde und Selbstbewußtsein wirken behaglich, auf mich wenigstens, und deshalb stehe ich so gern in irgendeinem von unsern Aschingerhäusern, wo die Menschen zu gleicher Zeit trinken, essen, reden und denken. Wie viele Geschäfte sind hier schon ersonnen worden. Und das Schönste ist: man kann stundenlang am Fleck stehen, das verletzt niemanden, das findet kein einziger von all denen, die kommen und gehen, auffällig. Wer hier an der Bescheidenheit Geschmack findet, der kann auskommen, er kann leben, es hindert ihn niemand. Wer keine gar so besondere Herzlichkeit beansprucht, der darf ein Herz haben, man erlaubt ihm das.

Ein Wochenmarkt ist etwas Helles, Lebendiges, Reichliches und Lustiges. Durch die breite, sonst so stille Straße ziehen sich zwei lange, von Lücken unterbrochene Reihen Warenstände, belegt und behängt mit allem, was Haushaltungen und Familien tagtäglich nötig haben. Die Sonne, die sonst hier herum herrisch und träge liegen kann, hat heute zu springen und zu blitzen, sozusagen zu fuchteln, denn jedes bewegliche Ding, das hier herumrührt, jeder Gegenstand, jeder Hut, jede Schürze, jeder Topf, jede Wurst, alles will angeblendet sein. Würste in Sonnenschein gebadet sehen prächtig aus. Das Fleisch prahlt und prunkt von den Haken, an denen es hängt, stolz und purpurrot herunter. Das Gemüse grünt und lacht, Apfelsinen scherzen in prachtvoll gelben Mengen, Fische schwimmen in breiten wassergefüllten Kübeln. Man steht so, und dann tut man einen Schritt. Man tut. Es kommt so genau nicht darauf an, ob der geplante, probierte und ausgeführte Schritt wirklich ein wahrhaftiger Schritt ist. Dieses fröhliche, einfache Leben, wie es bescheiden anzieht, wie es einen kleinbürgerlich und häuslich anlacht. Dazu ist der Himmel von einem allererstklassigen Blau. Erstklassig! Man will sich nicht zu dem Wort »süß« versteigen. Wo man Poesie empfindet, bedarf's keinerlei poetischer Anwandlungen. »Drei Abbelsinen for'n Jroschen.« Wie oft, Mann, hast du das eigentlich schon bald mal gesagt? Welche Auswahl prächtiger, dicker Weiber. Unfeine Menschenfiguren mahnen so recht an die Erde, an das Landweben und -leben, den Gott selbst, der sicher auch keinen gar so übertrieben schönen Leib hat. Gott ist das Gegenteil von Rodin. Wie entzückend ist das: an etwas Bäurischem ein wenig, wenn auch nur für einen »Jroschen« Geschmack empfinden zu dürfen. Frische Eier, Landschinken, Land- und Stadtleberwürste! Ich muß es heraussagen: ich stehe und taugenichtse gern in der Nähe von lockenden Eßwaren umher. Wieder erinnert's ans lebhaft Vergängliche, und das Lebendige ist mir lieber als das Unsterbliche. Hier sind Blumen, dort Kachelgeschirre, nebenan Käse, Schweizer, Tilsiter, Holländer, Harzer, und entsprechender Geruch dazu. Wenn man nun in die Ferne schaut, so wimmelt es von Landschaftsmalmotiven, schaut man zur Erde, so entdeckt man Schalen von Äpfeln und Nüssen, Fleischabfälle, Papierreste, halbe und ganze Weltblätter, einen Hosenknopf, ein Strumpfband. Blickt man hoch auf, so ist es ein Himmel, blickt man gerade vor sich, so ist es ein Durchschnittsmenschengesicht, von Durchschnittstagen und -nächten redet man nicht, von einer Durchschnittsnatur auch nicht. Ist denn nicht das Durchschnittliche das Festeste und Beste? Ich bedanke mich für Genietage und -wochen, oder für einen außergewöhnlichen Herrgott. Das Bewegliche ist stets das Gerechteste. – Und wie zierlich können einen Bauernweiber angucken. Mit welch seltsamen leisen Gebärden sich hin und her drehen. Der Markt läßt immer ein Stück Landahnung im Stadtviertel zurück, gleichsam, um es aus seinem monotonen Hochmut aufzurütteln. Wie hübsch ist das, daß alle diese Kaufgegenstände in der freien, frischen Luft liegen. Jungens kaufen sich warme Würste, sie lassen sich dieselben der ganzen saftigen Länge nach an- und abstreichen, damit sie sie gleich kunstgerecht verzehren können. Essen paßt so gut unter den blauen, hohen Himmel. Wie reizend sehen mir da die üppigen Blumenkohlbüschel aus. Ich vergleiche sie (nicht ganz gern) mit weiblichen straffen Brüsten. Der Vergleich ist impertinent, wenn er nicht klappt. Wieviel Frauen da um einen herum sind. Aber der Markt geht, sehe ich, zu Ende. Die Zeit des Abrüstens ist da. Obst wird in Körbe zusammengescharrt. Bücklinge und Sprotten werden eingepackt, Buden abgeschlagen. Das Gewimmel hat sich verzogen. Nach kurzer Zeit wird die Straße wieder ihr vorheriges Aussehen zurückerwischt haben. Adieu Farben. Adieu vielerlei. Adieu Gesprenkel von Lauten, Düften, Bewegungen, Schritten und Lichtern. Übrigens habe ich ein Pfund Wallnüsse eingehandelt. So kann ich nun nach Hause traben, in meine Wi-wi- und Wä-wä-Kindergeschrei-Wohnung. Ich esse so ziemlich alles gern, aber wenn ich Nuß esse, bin ich direkt glücklich.

O, in Gesellschaft zu gehen, das ist gar nicht so ohne. Man zieht sich so hübsch an, wie es einem die Verhältnisse, in denen man vegetiert, gestatten, und begibt sich an Ort und Stelle. Der Diener öffnet die gastliche Pforte. Gastliche Pforte? Ein etwas feuilletonistischer Ausdruck, aber ich liebe es, mich im Stil kleiner Tagesware zu bewegen. Ich gebe mit so viel Manier, als ich kann, Hut und Mantel ab, streiche mein ohnehin glattes Haar vor dem Spiegel noch ein wenig glätter, trete ein, stürze mich dicht vor die Herrin des Hauses, möchte ihr die Hand gleich küssen, gebe indessen diesen Gedanken auf und begnüge mich damit, eine vollendete (?) Verbeugung vor ihr zu machen. Vollendet oder nicht, vom geselligen Zug hingerissen, entfalte ich jetzt eine Menge Schwung und übe mich in den Tönen und Sitten, die zu den Lichtern und Blumen am besten zu passen scheinen. »Zum Essen, Kinder«, ruft die Hausfrau aus. Schon will ich rennen, ich erinnere mich aber rasch, daß man so etwas nicht tun soll, und ich zwinge mich zu einer langsamen, ruhigen, stolzen, bescheidenen, gelassenen, geduldigen, lächelnden, flüsternden und schicklichen Gangart. Es geht vortrefflich. Entzückend sieht mir da wieder einmal die Tafel aus. Man setzt sich, mit und ohne Dame. Ich prüfe das Arrangement und nenne es im stillen ein schönes. Wäre noch schöner, wenn einer wie ich irgend was an der Dekoration auszusetzen hätte. Gottlob, ich bin bescheiden, ich danke, indem ich jetzt zugreife, zugable und messere und löffle und esse. Wunderbar schmecken einem gesunden Menschen solch zartsinnig zubereitete Speisen, und das Besteck, wie es glänzt, die Gläser, wie sie beinahe duften, die Blumen, wie sie freundlich grüßen und lispeln. Und jetzt lispelt auch schon meinerseits eine ziemlich ungenierte Unterhaltung. Nimmt mich bald einmal selber wunder, wo und wie ich's hernehme, dieses Weltbetragen, derart Essen zum Mund führen, und dazwischen parlieren zu können. Wie doch die Gesichter purpurn anlaufen, je mehr Speisen und Weine dahergetragen werden. Schon könnte man satt sein, wenn man wollte, aber man will nicht, und zwar in erster Linie aus Schicklichkeitsgründen. Man hat weiter zu danken und weiter zu essen. Appetitlosigkeit ist eine Sünde an so reichbesetzten Tischen. Ich gieße immer mehr flüssige und leuchtende Laune in die allezeit, wie es scheint, durstige Kehle hinunter. Wie das anhumort. Jetzt schenkt der Diener auch noch aus dicken Flaschen schäumende Begeisterung ein, in Gläser, breitgeformte, in denen das holde Wasser wie in schönen Seebecken ruhen und glänzen kann. Und nun prosten alle, Damen und Herren, einander zu, ich mache es nach, ich geborner Nachahmer. Aber stützt sich denn nicht alles, was in der Gesellschaft taktvoll und lieblich ist, auf die fortlaufende Nachahmung? Nachahmer sind in der Regel glückliche Kerls, so ich. Ich bin in der Tat ganz glücklich, schicklich und unauffällig sein zu dürfen. Und jetzt erhebt sich der leichte Witz, die Zunge wird lose, das lachende Wort will jedesmal an die sorglose, süße Ungezogenheit streifen. Es lebe, es lebe! Wie dumm! Aber das Schöne und Reiche ist immer ein ganz klein wenig dumm. Es gibt Menschen, die plötzlich lachen müssen beim Küssen. Das Glück ist ein Kind, das »heute« wieder gottlob einmal nicht zur Schule zu gehen braucht. Immer wieder wird eingeschenkt, und das wie von unsichtbarer Geisterhand Eingegossene wird hinuntergeschüttet. Ich schütte geradezu unedel hinunter. Aber die silbernen Flügel hübschen Anstandes rauschen um mich und zwicken mich öfters mahnend an die Wangen. Hinwiederum verpflichten die Weine und die Schönheit der Frauen zu leisen, feinen Unverschämtheiten. Die Verzeihung dazu ist der Kirschkuchen, der jetzt galant serviert wird. O, ich freue mich über das alles, ich Proletarier, was ich bin. Mein Gesicht ist ein wahres, hochrotes Eßgesicht, aber essen Aristokraten etwa nicht auch? Es ist dumm, allzufein sein zu wollen. Die Eß- und Trinklust hat vielleicht einen ganz aparten feinen Ton des Umganges. Das Wohlbefinden bewegt sich möglicherweise noch am zartesten. Das sage ich so. Was? Auch noch Käse? Und noch Obst und jetzt noch einmal einen See voll Sekt? Und nun steht man auf, um vorsichtig nach Zigarren angeln zu gehen. Man spaziert durch die Räume. Welche Weltsicherheit. In reizenden kleinen Nischen setzt man sich ungezwungen und eng neben die Damen nieder. Alsdann, um es nicht ganz zu verlernen, schritthüpft man zu den Likörtischen, um sich in Wolken von Genüssen von neuem einzuhüllen. Der Herr des Hauses scheint fröhlich. Das genügt, um sich wie sonnenbeschienen vorzukommen. Lässig und witzig redet man zum weiblichen Geschlecht, wenn man kann. Immer zündet man sich neue Zigarettenstangen an. Das Vergnügen, einen neuen Menschen kennen zu lernen, tippt einen an die Stirne, kurz, es ist ein beständiges, gutes, dummes, behagliches Lachen um einen herum. Nichts kann mehr aufregend sein. Gewöhnt an das Schwelgen, bewegt man sich mit einer behäbigen Sicherheit und mit dem Mindestmaß an Formen im Glanz und im Menschenkranz einher, daß man leise und glücklich staunen muß, es im Leben so weit gebracht zu haben. Spät sagt man gute Nacht, und dem Diener drückt man mit Gewicht sein in mancherlei Beziehung redlich verdientes Trinkgeld in die Hand.

Oben ist ein schmaler Streifen Himmel, unten der glatte, schwärzliche, gleichsam von Schicksalen polierte Boden. Die Häuser zu beiden Seiten ragen kühn, zierlich und phantastisch in die architektonische Höhe. Die Luft bebt und erschrickt von Weltleben. Bis zu den Dächern hinauf und über die Dächer noch hinaus schweben und kleben Reklamen. Große Buchstaben fallen in die Augen. Und immer gehen hier Menschen. Noch nie, seit sie ist, hat in dieser Straße das Leben aufgehört zu leben. Hier ist das Herz, die unaufhörlich atmende Brust des großstädtischen Lebens. Hier atmet es hoch auf und tief nieder, als wenn das Leben selber über seinem Schritt und Tritt unangenehm beengt wäre. Hier ist die Quelle, der Bach, der Fluß, der Strom und das Meer der Bewegungen. Niemals sterben hier die Bewegungen und die Erregungen ganz aus, und wenn das Leben am obern Ende der Straße beinahe aufhören will, so fängt es am untern Ende von neuem an. Arbeit und Vergnügen, Laster und guter Trieb, Streben und Müßiggang, Edelsinn und Niedertracht, Liebe und Haß, feuriges und höhnisches Wesen, Buntheit und Einfachheit, Armut und Reichtum schimmern, glitzern, blöden, träumen, eilen und stolpern hier wild und zugleich ohnmächtig durcheinander. Eine Fessel ohnegleichen bändigt und sänftigt hier die Leidenschaften, und Verlockungen ohne Zahl führen zugleich in die begehrlichen Versuchungen, derart, daß die Entsagung mit dem Rockärmel den Rücken der befriedigten Begierde streifen, daß die Unersättlichkeit mit den lodernden Augen in den weisen Frieden der Augen des Durch-sich-selbst-gesättigten schauen muß. Hier klaffen Abgründe, hier herrschen und gebieten bis zum offenen Unanstand, durch den sich kein vernünftiger Mensch verletzen läßt, Gegensätze, die unbeschreiblich sind. Wagen fahren immer an Menschenleibern, -köpfen und -händen dicht vorüber, und auf den Verdecken und im hohlen Innern der Wagen sitzen, dicht aneinandergepreßt und geknechtet, Menschen, die aus irgendwelchen Gründen hier drinnen sitzen, hier oben sitzen, sich drängen und pressen und fahren lassen. Für jede Dummheit gibt es hier unsagbar rasch rechtfertigende, gute, kluge Gründe. Jede Torheit ist hier durch die offenbare Schwierigkeit des Lebens geadelt und geheiligt. Jede Bewegung hat Sinn, jeder Ton hat hier praktische Ursache, und aus jedem Lächeln, jeder Geste, jedem Wort strahlt eine sonderbar anmutige Gesetztheit und Korrektheit billigend hervor. Hier billigt man alles, weil jeder einzelne, durch den Zwang des zusammengeknebelten Verkehrs genötigt, ohne Zaudern alles, was er hört und sieht, billigen muß. Zu Mißbilligungen scheint niemand Lust, zu Abneinungen niemand Zeit und zu Unlust niemand ein Recht zu haben, denn hier, und das ist das Großartige, fühlen sich alle auf leichte, vorwärtshelfende Manier, gleichsam säuberlich, verpflichtet. Jeder Bettler, Gauner, Unhold usw. ist hier Mitmensch und muß einstweilen, weil alles schiebt, stößt und drängt, als etwas Mithinzugehöriges geduldet werden. Ah, hier ist die Heimat der Nichtswürdigen, der Kleinen, nein, der ganz Kleinen, der irgendwo und wann schon einmal Entehrten, hier, hier herrscht Duldung, und zwar deshalb, weil sich niemand mit Ungeduld und Unfrieden aufhalten und abgeben will. Hier wird im Sonnenschein friedlich spaziert, wie auf einer entlegenen stillen Bergesmatte, und im Laternenschimmer elegant gebummelt wie in einem Feenmärchen voller Zauberkünste und -worte. Wunderbar ist, wie der zweiteilige Menschenstrom auf den Trottoirs unaufhaltbar und unaufhörlich ist, gleich einem dickflüssigen, schimmernden, vielbedeutenden Wasser, und herrlich ist, wie hier die Qualen gemeistert, die Wunden verschwiegen, die Träume gefesselt, die Brünste gebändigt, die Freuden unterdrückt und die Begierden gemäßigt werden, weil alles Rücksicht, Rücksicht und nochmals liebende und achtende Rücksicht nehmen muß. Wo der Mensch so nah am Menschen ist, da erhält der Begriff Nebenmensch eine tatsächlich geübte, begriffene und rasch verstandene Bedeutung, und es darf da niemandem mehr einfallen, überlaut zu lachen, übereifrig sich seinen persönlichen Bedrängnissen hinzugeben oder überhastig Geschäfte machen zu wollen, und doch, welch eine hinreißende betörende Hast ist in all der scheinbaren Gedrängtheit und Besonnenheit. Die Sonne scheint hier in einer Stunde auf unzählige Köpfe, der Regen netzt und näßt hier einen Boden, der gesalbt ist gleichsam von Lustspielen und Tragödien, und abends, ah, wenn es beginnt zu dunkeln und wenn die Lichter angezündet werden, tut sich ein Vorhang langsam auf, um in ein Stück üppig voll immer derselben Gewohnheiten, Lüsternheiten und Begebenheiten schauen zu lassen. Die Sirene Vergnügen fängt dann an in himmlisch lockenden und anmutenden Tönen zu singen, und Seelen werden dann zerrissen von den vibrierenden Wünschen und Nichtbefriedigungen, und ein Geldauswerfen beginnt dann, wie es der bescheidene kluge Begriff nicht kennt, wie es sich kaum eine dichterische Phantasie mühselig vorstellen kann. Ein wollüstig auf und nieder atmender Körpertraum sinkt dann auf die Straße herab, und alles läuft, läuft und läuft diesem vorherrschenden Traum mit ungewissen Schritten nach.

Es scheint hier jedermann zu wissen, was sich schickt, und das erzeugt eine gewisse Kälte, und es scheint ferner, daß hier jedermann sich durch sich selbst behauptet, und dies ruft die Ungestörtheit hervor, die der Neuling hier bewundert. Die Armut scheint hinausgeschoben in die Viertel, die an die offenen Felder streifen oder nach innen ins Düster und Dunkel der Hinterhäuser gedrängt, die von den herrschaftlichen Vorderhäusern verdeckt werden wie von mächtigen Körpern. Es scheint, als habe hier die Menschheit aufgehört zu seufzen und angefangen, ihres Lebens und Daseins endgültig froh zu sein. Doch der Schein trügt, und die Pracht und Eleganz sind nur ein Traum. Aber auch das Elend ist vielleicht nur eine Einbildung. Was die Eleganz des Westens von Berlin betrifft, so scheint sie ausgezeichnet durch Lebhaftigkeit und zugleich ein wenig verdorben durch die Unmöglichkeit, sie ruhig zu entfalten. Es steckt hier übrigens alles in einer fortlaufenden Entfaltung und Veränderung. Die Männer sind ebenso bescheiden wie unritterlich, und man kann sehr glücklich darüber sein, denn die Ritterlichkeit ist stets zu drei Vierteln unpassend. Die Galanterie ist etwas außerordentlich Dummes und Vorlautes. Es gibt hier demnach wenig gefühlvolle Auftritte, und wo sich irgendein feinsinniges Abenteuer entspinnt, merkt man es gar nicht, das ist doch immerhin sehr fein. Die Herrenwelt ist heute eine Geschäftswelt, und wer Geld verdienen muß, hat keine oder wenig Zeit, sich auffallend schön zu benehmen. Daher eine gewisse rauhe abfertigende Tonart. Im allgemeinen gibt es viel Amüsantes im Westen; die Lächerlichkeiten leben so reizend und hübsch, wie man es sich nur träumen kann, weiter. Da ist die Emporkömmlingin, eine Gewaltsdame, naiv wie ein kleines Kind. Ich persönlich schätze sie sehr, weil sie so üppig und zugleich so drollig ist. Da ist die »Kleine vom Kurfürstendamm«. Sie gleicht einer Gemse, und es ist viel Braves und Liebes an ihr. Da ist der Lebegreis. Es spazieren nur noch sehr wenige Exemplare dieses Kalibers in der Welt, die zu leben weiß, herum. Die Sorte ist im Aussterben begriffen, und ich finde, daß das sehr schade ist. Ich sah neulich einen solchen Herrn, er kam mir wie eine Erscheinung aus verschwundenen Zeiten vor. Da haben wir wieder etwas anderes, den reichgewordenen ländlichen Ansiedler. Er hat sich noch nicht abgewöhnt, Augen zu machen, wie wenn er über sich selbst und über das Glück, in dem er sitzt, staune. Er benimmt sich viel zu sittsam, so, als fürchte er, zu offenbaren, woher er stamme. Da haben wir wieder die ganz, ganz gestrenge Gnädige aus der Bismarckzeit. Ich bin ein Bewunderer von strengen Gesichtern und von ins Wesen des Menschen übergegangenen guten Manieren. Mich rührt ja überhaupt das Alte, sowohl an Bauten wie an Menschengestalten; deswegen erquickt mich aber das Frische, Neue und Junge nicht weniger; und jung ist's hier, und gesund scheint mir der Westen zu sein. Sollte eine gewisse Portion Gesundheit eine gewisse Portion Schönheit verdrängen? Mitnichten. Das Lebhafte ist zuletzt das Schönste. Nun ja, vielleicht wedle und scharwenzle und schmeichle ich jetzt ein bißchen; wie z. B. durch folgenden Satz: Die hiesigen Frauen sind schön und anmutig! Die Gärten sind sauber, die Architektur ist vielleicht ein wenig drastisch, was kann das mich kümmern. Es ist heute ja jedermann überzeugt, daß wir Stümper sind im Großen, Stilvollen und Monumentalen und wahrscheinlich deshalb, weil in uns zu sehr der Wunsch lebt, Stil, Größe und Monumentalität zu besitzen oder zu erzeugen. Wünsche sind schlimme Dinge. Unser Zeitalter ist entschieden das Zeitalter der Empfindlichkeit und Rechtlichkeit, und das ist doch sehr hübsch von uns. Wir haben Fürsorgeanstalten, Krankenhäuser, Säuglingsheime, und ich bilde mir gerne ein, das sei doch auch etwas. Wozu alles wollen? Man denke an die Schauder der alten Fritzen-Kriege und an sein – Sanssouci. Wir haben wenig Gegensätze; das beweist, daß wir uns danach sehnen, ein gutes Gewissen zu haben. Aber wie schwenke ich da nur ab. Darf man das? Es gibt einen sogenannten alten Westen, einen neueren Westen (rund um die Gedächtniskirche) und einen ganz neuen Westen. Der mittlere ist vielleicht der netteste. Ganz bestimmt trifft man in der Tauenzienstraße die höchste und meiste Eleganz an; der Kurfürstendamm ist reizend mit seinen Bäumen und seinen Kaleschen. Ich sehe mich mit großem Bedauern schon an den Rahmen meines Aufsatzes anstoßen, in der fatalen Überzeugung, daß ich vieles, was ich unbedingt habe sagen wollen, gar nicht gesagt habe.
Die drei Menschen, der Kapitän, ein Herr und ein junges Mädchen, steigen in den Korb ein, die befestigenden Stricke werden losgeknöpft, und das seltsame Haus fliegt langsam, als ob es sich erst noch auf irgend etwas besänne, in die Höhe; gute Reise!, rufen die versammelten Menschen von unten her, hüte- und taschentuchschwenkend, nach. Es ist zehn Uhr abends im Sommer. Der Kapitän zieht eine Landkarte zu einer Tasche heraus und bittet den Herrn, sich mit Kartenlesen beschäftigen zu wollen. Man kann lesen und vergleichen, alles Sichtbare ist hell. Es hat alles eine beinahe bräunliche Helle. Die schöne Mondnacht scheint den prachtvollen Ballon in unsichtbare Arme zu nehmen, sanft und still fliegt der rundliche Körper zur Höhe, und nun wird er, kaum, daß man es bemerkt, von feinen Winden nördlich getrieben. Der kartenstudierende Herr wirft von Zeit zu Zeit auf Anleitung des Führers eine Hand voll Ballast in die Tiefe hinunter. Es befinden sich fünf Säcke voll Sand an Bord, und es muß sparsam damit umgegangen werden. Wie schön ist die runde, blasse, dunkle Tiefe. Das liebe, bedeutsame Mondlicht macht die Flüsse silbern kenntlich. Man sieht Häuser da unten, so klein, dem unschuldigen Spielzeug ähnlich. Die Wälder scheinen dunkle, uralte Lieder zu singen, aber dieser Gesang mutet eher wie eine edle, stumme Wissenschaft an. Das Bild der Erde sieht den Zügen eines schlafenden, großen Mannes ähnlich, wenigstens träumt so das jugendliche Mädchen, es läßt seine bezaubernde Hand träge über den Rand des Korbes herabhängen. Einer Kaprice zufolge ist der Kopf des Kavaliers mit einem ritterlichen Federhut bedeckt, im übrigen ist er modern gekleidet. Wie still die Erde ist. Man sieht alles deutlich, die einzelnen Menschen in den Dorfgassen, die Kirchspitzen, den Knecht, wie er, vom langen Tagwerk ermüdet, schwerfällig über den Hof schreitet, die geisterhafte, vorbeisausende Eisenbahn, die blendendweiße lange Landstraße. Bekanntes und unbekanntes Menschenleid scheint von unten heraufzumurmeln. Die Einsamkeit verlorner Gegenden hat ihren besondern Ton, und man meint, dieses Besondere, dieses Unverständliche verstehen, ja sogar sehen zu sollen. Wundervoll blendet jetzt die drei Menschen der herrlich gefärbte und beleuchtete Lauf der Elbe an. Der nächtliche Strom entreißt dem Mädchen einen leisen Sehnsuchtsschrei. An was mag sie denken? Sie nimmt von einem Bukett, das sie mitgenommen hat, eine dunkle, prangende Rose und wirft sie ins glitzernde Wasser. Wie ihre Augen traurig dabei blitzen. Es ist, als wenn die junge Frau jetzt qualvollen Lebenskampf hinuntergeworfen hätte, für immer. Es ist ein großer Schmerz, von einer Qual Abschied nehmen zu müssen. Und wie lautlos die ganze Welt ist. In der Ferne glitzern die Lichter eines Hauptortes, der Kapitän nennt sachkundig den Namen der Stadt. Schöne, verlockende Tiefe! Man hat schon unzählige Stücke Wälder und Felder hinter sich, es ist jetzt Mitternacht. Jetzt schleicht auf der festen Erde irgendwo ein beutelauernder Dieb, Einbruch geschieht, und alle diese Menschen in ihren Betten da unten, dieser große Schlaf, geschlafen von Millionen. Eine ganze Erde träumt jetzt, und ein Volk ruht von Mühsalen aus. Das Mädchen lächelt. Und wie es warm ist, es ist, als säße man in einer heimatanmutenden Stube, bei Mutter, Tante, Schwester, Bruder, oder bei dem Geliebten, bei der friedlichen Lampe und läse in einer schönen, aber etwas eintönigen, langen, langen Geschichte. Das Mädchen will einschlafen, sie ist jetzt etwas ermüdet vom Schauen. Die beiden im Korb stehenden Männer blicken schweigend aber fest in die Nacht hinaus. Merkwürdige weiße, gleichsam blank geputzte Ebenen wechseln mit Gärten und kleinen Buschwildnissen ab. Man sieht in Gegenden hinunter, in die einen der Fuß nie, nie hintrüge, weil man in gewissen, ja, in den meisten Gegenden nie etwas Zweckvolles zu suchen hat. Wie groß und wie unbekannt uns die Erde ist!, denkt der federhutbedeckte Herr. Ja, das eigene Vaterland wird hier oben, Blicke hinunterwerfend, endlich zum Teil verständlich. Man empfindet, wie unerforscht und wie kraftvoll es ist. Zwei Provinzen sind durchwandert, als es beginnt zu tagen. Unten in den Siedelungen erwacht schon wieder das menschliche Leben. »Wie heißt dieser Ort?« schreit der Führer hinunter. Eine helle Jungenstimme antwortet. Und immer noch schauen die drei Menschen; auch das Mädchen ist jetzt wieder erwacht. Es zeigen sich jetzt Farben, und die Dinge werden bestimmter. Man sieht Seen in ihren zeichnerischen Umrissen, wundervoll zwischen Wäldern verborgen, man erblickt Ruinen alter Festungen zwischen altem Laubwerk hochaufragen; Hügel erheben sich fast spurlos, Schwäne sieht man weißlich im Gewässer zittern, und Stimmen des menschlichen Lebens werden sympathisch laut, und man fliegt immer weiter, und endlich zeigt sich die herrliche Sonne, und von diesem stolzen Gestirn angezogen schießt der Ballon in zauberische, schwindelerregende Höhe. Das Mädchen stößt einen Schreckensschrei aus. Die Männer lachen.

Vom Zoologischen Garten her tönt Regimentsmusik. Man geht so, ganz gemächlich. Ist es denn nicht Sonntag? Wie warm es ist. Jedermann scheint erstaunt darüber zu sein, daß es jetzt, wie auf Zauberschlag, so leicht, so hell, so warm ist. Wärme allein gibt schon Farbe. Die Umwelt ist wie ein Lächeln, und es wird einem ganz weiblich zumut. Wie gern möchte ich jetzt (beinahe) ein Kind auf dem Arm tragen und treubesorgtes Dienstmädchen spielen. Wie stimmt der beginnende, herzbetörende Frühling zärtlich. Ich könnte, bilde ich mir ein, geradezu Mutter sein. Im Frühling, so scheint es, werden Männer und Mannestaten plötzlich so überflüssig, so dumm. Nur keine Tat jetzt. Horchen, bleiben, am Fleck stehen. Göttlich durch ganz weniges berührt sein. In dieses wonnensüße kindheitartige Grün schauen. Ach, ist doch Berlin und sein Tiergarten jetzt schön. Es wimmelt von Menschen. Die Menschen sind starke, bewegliche Flecke im zarten, verlornen Sonnenschimmer. Oben ist der lichtblaue Himmel, der wie ein Traum das untenliegende Grün berührt. Die Leute gehen leicht und bequem, so, als fürchteten sie, in Marschierschritt und in grobes Gebärden zu verfallen. Es soll Leute geben, die nie daran denken, oder die sich zieren, sich am Sonntag auf eine Tiergartenbank zu setzen. Wie doch solche Leute sich des reizendsten Vergnügens berauben. Ich selbst finde das Sonntagspublikum in seiner offensichtlichen harmlosen Sonntagslust bedeutender als alles Kairo- und Rivierareisen. Da wird das Harte gefällig, das Starre lieblich, und alle Linien und Gewöhnlichkeiten gehen traumhaft ineinander über. Unnennbar zart ist solch ein allgemeines Spazieren. Die Spaziergänger verlieren sich bald einzeln, bald in anmutigen dichten Gruppen oder Haufen zwischen den Bäumen, die hoch oben noch luftig-kahl sind, und zwischen dem niedrigen Gesträuch, das ein Hauch von jungem, süßem Grün ist. Es zittert und bebt in der weichen Luft von Knospen, die zu singen, zu tanzen, zu schweben scheinen. Das ganze Tiergartenbild ist wie ein gemaltes Bild, dann wie ein Traum, dann wie ein weitschweifiger angenehmer Kuß. Überall ist leichte, verständliche Lockung zum lange Hinschauen. Auf einer Bank am Schiffahrtskanal sitzen zwei Ammen im schneeweißen imposanten Kopfputz, weißer Schürze und knallroten Röcken. Indem man geht, ist man befriedigt; indem man sitzt, ist man ganz ruhig und schaut gelassen in die Augen der vorübergehenden Gestalten. Diese sind Kinder, an Leinen geführte Hunde, Soldaten mit dem Mädel im Arm, schöne Frauen, kokette Damen, alleinstehende, -tretende und -gehende Herren, ganze Familien, schüchterne Liebespaare. Schleier wehen, grüne und blaue und gelbliche. Dunkle und helle Kleider wechseln ab. Die Herren tragen meistens die unvermeidlichen trockenen halbhohen steifen Hügelhüte auf den Kegelköpfen. Man möchte lachen und zugleich ernst sein. Es ist alles zugleich lustig und heilig, und man ist sehr ernst dabei, wie alle. Alle zeigen denselben schicklichen leichten Ernst. Ist nicht so auch der Himmel, der auch so ein Gesicht macht, als spreche er: »Wie wunderbar ist mir?« Jetzt huschen, freundlichen Schemen ähnlich, windähnliche Schatten durch die Bäume, über die hellen weißen Wege, wohin? Man weiß es nicht. Kaum sieht man es, so zart ist es. Maler machen auf solche Delikatessen aufmerksam. In einiger sanfter Entfernung rollen roträdrige Droschken durch das milde grüne Gewebe, als gleite ein rotes Band durch ein Stück zartes Frauenhaar. Alles atmet Fraulichkeit, alles ist Helle und Milde, alles ist so weit, so durchsichtig, so rund, nach allen Seiten dreht man den Sonntagskopf, um die Sonntagswelt hübsch zu genießen. Menschen machen das Ganze eigentlich. Ohne die Menschen würde man die Schönheit des Tiergartens nicht sehen, nicht merken, nicht empfinden. Wie das Publikum ist? Na, gemischt, alles durcheinander, Elegantes und Einfaches, Stolzes und Demütiges, Fröhliches und Besorgtes. Ich selbst sorge mit meiner eigenen Person ebenfalls für Buntheit und trage mit zur Gemischtheit bei. Ich bin gemischt genug. Doch wo ist der Traum? Laß uns ihn doch noch rasch einmal betrachten. Auf einer rundgebogenen Brücke stehen viele Leute. Man steht selbst da, lehnt sich leicht und voll guter Manier an das Geländer und schaut hinab in das zärtlich-bläulich glimmende, warme Wasser, wo Boote und Kähne, menschenbesetzt und fähnchengeschmückt, leise, wie von guten Ahnungen gezogen, umherfahren. Die Schiffe und Gondeln schimmern in der Sonne. Da bricht ein Stück dunkles Samtgrün aus der Lichtheit hervor, es ist eine Bluse. Enten mit farbigen Köpfen schaukeln auf dem Gekräusel und Gezitter des Wassers, das manchmal schimmert wie Bronze oder wie Emaille. Herrlich ist es, wie das Feld des Wassers so eng und so klein ist und doch so vollbesetzt mit gleitenden Lustkähnen und Freudenfarben-Hüten. Überall, wohin man blickt, glänzt und bricht der Damenhut mit rot, blau und andern Augengenüssen aus dem Gebüsch hervor. Wie ist alles so einfach. Wohin geht man jetzt? In ein Kaffeehaus? Wirklich? Ist man jetzt so barbarisch? Jawohl, man tut's. Was tut man nicht alles? Wie schön ist es, zu tun, was ein anderer ebenfalls tut. Wie ist er nur schön, der Tiergarten. Welcher Einwohner von Berlin liebte ihn nicht?

Heute hat mir Papa eine Ohrfeige gegeben, natürlich eine echt väterliche, eine zärtliche. Ich gebrauchte die Redensart: »Vater, du hast wohl einen Knall.« Das war allerdings ein wenig unvorsichtig. »Damen sollen sich einer gewählten Sprache bedienen«, sagt unsere Deutschlehrerin. Sie ist entsetzlich. Aber Papa will nicht haben, daß ich diese Person lächerlich finde, und vielleicht hat er recht. Man geht schließlich zur Schule, um einen gewissen Lerneifer und einen gewissen Respekt an den Tag zu legen. Übrigens ist es billig und unedel, an den Mitmenschen Komisches zu entdecken und darüber zu lachen. Junge Damen sollen sich an das Feine und Edle gewöhnen, das sehe ich sehr gut ein. Man verlangt keine Arbeit von mir, man wird nie eine solche von mir fordern, dafür aber wird man vornehmes Wesen bei mir voraussetzen. Werde ich im späteren Leben irgendwelchen Beruf ausüben? Nicht doch. Ich werde eine junge feine Frau sein, ich werde mich verheiraten. Es ist möglich, daß ich meinen Mann quälen werde. Doch das wäre fürchterlich. Man verachtet sich immer selbst, sobald man einen andern glaubt verachten zu sollen. Ich bin zwölf Jahre alt. Ich muß geistig sehr entwickelt sein, sonst würde ich niemals an so etwas denken. Werde ich Kinder haben? Und wie wird das zugehen? Wenn mein zukünftiger Mann kein verachtungswürdiger Mensch sein wird, dann, ja dann, das glaube ich bestimmt, werde ich ein Kind haben. Dann werde ich dieses Kind erziehen. Aber ich bedarf ja selber noch der Erziehung. Wie man nur so dummes Zeug denken kann.
Berlin ist die schönste, die bildungsreichste Stadt der Welt. Ich wäre abscheulich, wenn ich hiervon nicht felsenfest überzeugt wäre. Lebt nicht hier der Kaiser? Würde er hier zu wohnen nötig haben, wenn es ihm hier nicht am besten gefiele? Neulich sah ich Kronprinzens im offenen Wagen. Sie sind entzückend. Der Kronprinz sieht wie ein junger, heiterer Gott aus, und wie schön erschien mir die hohe Frau an seiner Seite. Sie war ganz in duftende Pelze gehüllt. Es schien Blüten aus dem blauen Himmel auf das Paar herabzuregnen. Der Tiergarten ist herrlich. Ich gehe beinahe jeden Tag mit unserem Fräulein, der Erzieherin, darin spazieren. Man kann stundenlang, auf geraden und krummen Wegen, unter dem Grün gehen. Auch Vater, der sich doch eigentlich nicht zu begeistern brauchte, begeistert sich für den Tiergarten. Vater ist ein gebildeter Mensch. Ich glaube, er liebt mich rasend. Schrecklich, wenn er dies läse, aber ich werde das Geschriebene zerreißen. Im Grunde schickt es sich ja gar nicht, zugleich noch so dumm und so unreif zu sein wie ich und schon ein Tagebuch führen zu wollen. Aber manchmal langweilt man sich ein wenig, und dann läßt man sich sehr leicht zu Unpassendem hinreißen. Das Fräulein ist sehr nett. Nun ja, im allgemeinen. Sie ist treu, und sie liebt mich. Außerdem hat sie wirklichen Respekt vor Papa, das ist die Hauptsache. Sie ist dünn von Figur. Unsere frühere Erzieherin war dick wie ein Frosch. Sie schien immer zu platzen. Sie war Engländerin. Sie ist gewiß auch heute noch eine Engländerin, aber sie ging uns von dem Augenblick an, wo sie sich Frechheiten erlaubte, nichts mehr an. Vater hat sie fortgejagt.
Wir beide, Papa und ich, werden bald reisen. Es ist jetzt ja die Zeit, wo honette Leute einfach reisen müssen. Ist der nicht verdächtig, der zu solch einer grünenden und blühenden Zeit nicht reist? Papa zieht an den Meeresstrand, und er wird dort offenbar tagelang im Sand liegen und sich von der Sommersonne dunkelbraun braten lassen. Er sieht im September immer am gesündesten aus. Seinem Gesicht steht die Blässe der Abgespanntheit nicht gut. Übrigens liebe ich persönlich das Sonnverbrannte im Gesicht eines Mannes. Es ist dann, wie wenn er aus dem Krieg käme. Sind das nicht echte Kinderdummheiten? Ja, gewiß bin ich noch ein Kind. Was mich angeht, so reise ich nach dem Süden. Zuerst ein wenig nach München, dann nach Venedig, wo ein Mensch wohnt, der mir unsagbar nah steht, Mama. Meine Eltern leben aus Ursachen, deren Tiefe ich nicht zu verstehen, also nicht zu würdigen imstande bin, getrennt. Ich lebe die meiste Zeit bei Vati. Aber Mama hat natürlich auch das Recht, mich wenigstens für eine Zeitlang zu besitzen. Ich freue mich mächtig auf die bevorstehende Reise. Ich reise gern, und ich glaube, daß fast alle Menschen gern reisen. Man steigt ein, der Zug fährt ab, und nun geht es ins Weite. Man sitzt und wird in ungewisse Ferne getragen. Wie gut ich es doch eigentlich habe. Weiß ich, was Not, was Armut ist? Keine Spur. Ich finde, es ist auch gar nicht notwendig, daß ich so nichtswürdige Erfahrungen mache. Aber die armen Kinder dauern mich. Ich würde zum Fenster hinausspringen in solchen Verhältnissen.
Ich und Papa wohnen im vornehmsten Viertel. Viertel, die still, peinlich sauber und von einer gewissen Älte sind, sind vornehm. Das ganz Neue? Ich möchte nicht in einem ganz neuen Haus wohnen. Am Neuen ist stets irgend etwas nicht ganz in Ordnung. Man sieht fast gar keine armen Leute, z. B. Arbeiter, in unserer Gegend, wo die Häuser ihre Gärten haben. Es wohnen Fabrikbesitzer, Bankiers und reiche Leute, deren Beruf der Reichtum ist, in unserer Nähe. Nun, da muß also Papa zum mindesten sehr wohlhabend sein. Arme und ärmere Leute können hier herum einfach gar nicht wohnen, weil die Räumlichkeiten viel zu teuer sind. Papa sagt, die Klasse, in welcher das Elend herrscht, lebe im Norden der Stadt. Welch eine Stadt. Was ist das: der Norden? Ich kenne Moskau besser als den Norden unserer Stadt. Von Moskau, Petersburg, Wladiwostok und aus Yokohama sind mir zahlreiche Ansichtspostkarten geschickt worden. Ich kenne den belgischen und holländischen Strand, ich kenne das Engadin mit seinen himmelhohen Bergen und grünen Matten, aber die eigene Stadt? Berlin ist vielleicht vielen, vielen Menschen, die es bewohnen, ein Rätsel. Papa unterstützt die Kunst und die Künstler. Es ist Handel, was er treibt. Nun, Fürsten treiben ebenfalls oft Handel, und dann sind die Geschäfte Papas von einer absoluten Vornehmheit. Er kauft und verkauft Gemälde. Es hängen sehr schöne Gemälde in unserer Wohnung. Die Sache mit Vaters Geschäften, glaube ich, ist so: die Künstler verstehen in der Regel nichts von Geschäften, oder sie dürfen aus irgendwelchen Gründen nichts davon verstehen. Oder es ist so: die Welt ist groß und kaltherzig. Die Welt denkt nie an die Existenz von Künstlern. Da tritt nun mein Vater auf, der Weltmanieren besitzt und allerhand bedeutungsreiche Beziehungen hat und macht diese im Grunde vielleicht ganz kunstunbedürftige Welt auf die Kunst und auf die Künstler, die darben, auf schickliche und kluge Art aufmerksam. Papa verachtet oft seine Käufer. Aber er verachtet oft auch die Künstler. Es kommt da ganz darauf an.
Nein, ich möchte nirgends anderswo fest wohnen als in Berlin. Leben die Kinder der Kleinstädte, solcher Städte, die ganz alt und morsch sind, schöner? Gewiß gibt's dort manches, was es bei uns nicht gibt. Romantik? Ich glaube, ich irre mich nicht, wenn ich etwas, was nur noch halb lebt, für romantisch halte. Das Defekte, Zerbröckelte, Kranke, z. B. eine uralte Stadtmauer. Das, was zu nichts nützt, was auf geheimnisvolle Art schön ist, das ist romantisch. Ich träume gern von derartigen Dingen, und wie ich empfinde, genügt es, davon zu träumen. Schließlich ist das Romantischste, was es gibt, das Herz, und jeder fühlende Mensch trägt alte Städte, die von uralten Mauern umschlossen sind, in sich. Unser Berlin platzt bald überhaupt von Neuheit. Vater sagt, alles historisch Denkwürdige werde hier verschwinden, das alte Berlin kenne kein Mensch mehr. Vater weiß alles oder wenigstens fast alles. Nun, davon profitiert natürlich seine Tochter. Ja, kleine, mitten in der Landschaft gelegene Städte mögen schon auch schön sein. Es wird da reizende verborgene Schlupfwinkel zum Spielen geben, Höhlen, in die man hineinkriechen kann, Wiesen, Felder und nur ein paar Schritte weit entfernt der Wald. Solche Ortschaften sind ganz wie von Grün umkränzt, aber Berlin hat einen Eispalast, wo die Menschen mitten im heißesten Sommer Schlittschuh fahren. Berlin ist allen übrigen deutschen Städten eben einmal voran, in allen Dingen. Es ist die sauberste, modernste Stadt der Welt. Wer sagt das? Nun, natürlich Papa. Wie gut er eigentlich ist. Ja, ich kann viel von ihm lernen. Unsere Berliner Straßen haben alles Schmutzige und Holprige überwunden. Sie sind so glatt wie Eisflächen, und sie schimmern wie peinlich polierte Fußböden. Gegenwärtig sieht man einzelne Menschen Rollschuh laufen. Wer weiß, vielleicht werde ich das auch eines Tages tun, wenn es nicht vorher schon wieder außer Mode geraten ist. Es gibt hier Moden, die kaum Zeit haben, recht aufzutreten. Voriges Jahr haben alle Kinder, auch viele Erwachsene, Diabolo gespielt. Nun, dieses Spiel ist aus der Mode, man mag es nicht mehr spielen. So wechselt alles ab. Berlin gibt immer den Ton an. Es ist niemand zur Nachahmung verpflichtet, und doch ist die Frau Nachahmung die große und erhabene Gebieterin dieses Lebens. Jedermann ahmt nach.
Papa kann reizend sein, er ist eigentlich immer nett, aber zuweilen wird er wütend, über was, das kann man nicht wissen, und dann ist er häßlich. Ja, ich merke es an ihm, wie die heimliche Wut, wie der Mißmut den Menschen häßlich macht. Ist Papa nicht gut aufgelegt, so fühle ich mich unwillkürlich als geprügelter Hund; und deshalb sollte Papa vermeiden, seiner Umgebung, auch wenn sie nur aus einer Tochter besteht, seine Unpäßlichkeit und seine innere Unzufriedenheit zu zeigen. Väter begehen da, gerade da, Sünden. Das empfinde ich lebhaft. Aber wer hat keine Schwächen, keine, gar keine Fehler? Wer ist ohne Sünde? Eltern, die es nicht für nötig erachten, ihren Kindern ihre persönlichen Stürme vorzuenthalten, würdigen dieselben im Nu zu Sklaven herab. Böse Stimmungen soll ein Vater im stillen besiegen (aber wie schwer ist das!) oder er soll sie zu fremden Leuten tragen. Eine Tochter ist eine junge Dame, und in jedem gebildeten Erzeuger soll ein Kavalier lebendig sein. Ich sage ausdrücklich: ich befinde mich bei Vater überhaupt wie im Paradies, und wenn ich Mängel an ihm entdecke, so ist es die ohne Zweifel von ihm auf mich übergegangene, also seine, nicht meine Klugheit, die ihn scharf beobachtet. Papa mag nur füglich seinen Zorn an Leuten auslassen, die von ihm in gewisser Beziehung abhängig sind. Es umflattern ihn genug solche Leute.
Ich habe meine eigene Stube, meine Möbel, meinen Luxus, meine Bücher usw. Gott, ich bin eigentlich sehr reich ausgestattet. Bin ich Papa dankbar dafür? Welch eine geschmacklose Frage. Ich bin ihm gehorsam, und dann bin ich doch sein Besitz, und er darf schließlich doch stolz auf mich sein. Ich mache ihm Gedanken, ich bin seine häusliche Sorge, er darf mich anschnauzen, und ich sehe es immer als eine Art von feinsinniger Pflicht an, ihn auszulachen, wenn er mich anschnauzt. Papa schnauzt gern an, er hat Humor und ist zugleich temperamentvoll. Weihnachten überhäuft er mich mit Geschenken. Übrigens sind meine Möbel von einem gewiß nicht unberühmten Künstler entworfen. Papa verkehrt fast nur mit Leuten, die irgendeinen Namen haben. Er verkehrt mit Namen. Steckt in solch einem Namen etwa auch noch ein Mensch, um so besser. Wie gräßlich muß es sein, zu wissen, daß man berühmt ist und zu fühlen, daß man das gar nicht verdient. Ich stelle mir viele solcher Berühmtheiten vor. Ist solch ein Ruhm nicht wie eine unheilbare Krankheit? Wie ich mich nur ausdrücke. Meine Möbel sind weiß lackiert und von einer kunstverständigen Hand mit Blumen und Früchten bemalt. Die sehen reizend aus, und der sie bemalt hat, ist ein ausgezeichneter Mensch, der von Vater sehr geschätzt wird. Wen Vater schätzt, der soll sich aber auch geschmeichelt fühlen. Ich meine, es bedeutet etwas, wenn Papa wohlwollend zu jemandem ist, und diejenigen, die das nicht empfinden und tun, als wenn es ihnen pipe sei, die schaden sich natürlich. Die blicken zu wenig hell in die Welt. Ich halte meinen Vater für einen durchaus seltenen Menschen; daß er in der Welt Einfluß ausübt, liegt klar auf der Hand. – Viele meiner Bücher langweilen mich. Nun, dann sind es eben nicht die rechten, wie z. B. sogenannte Bücher für »das Kind«. Solche Bücher sind eine Unverschämtheit. Wie? Man erkühnt sich, Kindern Bücher zum Lesen zu geben, die nicht über ihren Horizont hinausgehen? Zu Kindern soll man nicht kindlich reden, das ist kindisch. Ich, die ich doch auch ein Kind bin, hasse das Kindische.
Wann werde ich aufhören, mich mit Spielsachen abzugeben? Nein. Spielsachen sind süß, und ich spiele mit der Puppe noch lang, das weiß ich, aber ich spiele bewußt. Ich weiß, daß es dumm ist, aber wie schön ist das Dumme und Nutzlose. So, denke ich mir, empfinden Künstlernaturen. Zu uns, d. h. zu Papa, kommen öfters verschiedene jüngere Künstler essen. Nun, sie werden eingeladen, und dann erscheinen sie. Oft schreibe die Einladungen ich, oft das Fräulein, und es herrscht dann eine große, amüsante Munterkeit an unserm Eßtisch, der natürlich, ohne zu prahlen oder geflissentlich zu prunken, wie der gedeckte Tisch eines feinen Hauses aussieht. Papa umgibt sich scheinbar sehr gern mit jungen Leuten, mit Leuten, die jünger sind als er, und doch ist er eigentlich immer der Lebhafteste und Jüngste. Man hört die meiste Zeit ihn reden; die übrigen horchen, oder sie erlauben sich kleine Bemerkungen, was oft sehr drollig ist. Vater überragt sie alle an Bildung und Schwung der Weltauffassung, und alle diese Leute lernen von ihm, das sehe ich deutlich. Oft muß ich lachen bei Tisch, dann kriege ich eine sanfte oder unsanfte Zurechtweisung. Ja, und nach dem Essen wird bei uns gefaulenzt. Papa legt sich aufs Ledersofa und fängt an zu schnarchen, was eigentlich recht schlechter Ton ist. Aber in Papas Benehmen bin ich verliebt. Mir gefällt auch seine aufrichtige Schnarcherei. Will man, oder kann man denn immer Unterhaltung machen?
Vater gibt sicher viel Geld aus. Er hat Einnahmen und Ausgaben, er lebt, er erzielt Gewinne, und er läßt leben. Er sieht sogar ein wenig nach Vergeudung und Verschwendung aus. Er ist stets in Bewegung. Ganz offenbar gehört er zu den Menschen, für die es ein Genuß, ja eine Notwendigkeit ist, immer irgend etwas zu riskieren. Es ist bei uns viel von Erfolg und Mißerfolg die Rede. Wer bei uns ißt und mit uns verkehrt, der hat irgendwelche kleinere oder größere Erfolge in der Welt erzielt. Was ist Welt? Ein Gerücht, ein Gerede? Mein Vater steht jedenfalls mitten drin, in diesem Gerede. Vielleicht dirigiert er es sogar bis zu gewissen Grenzen. Papas Ziel ist auf alle Fälle, Macht auszuüben. Er sucht sich und diejenigen, für die er sich interessiert, zu entfalten, zu behaupten. Sein Grundsatz ist: für wen ich mich nicht interessiere, der schadet sich. Infolge dieser Auffassung ist Papa immer von seinem gesunden Menschenwert durchdrungen und kann fest und sicher auftreten, und das schickt sich. Wer sich keine Bedeutung zumutet, dem macht es nichts, Schlechtigkeiten zu verüben. Wie rede ich? Habe ich das von Vater?
Genieße ich eine gute Erziehung? Ich verzichte darauf, das zu bezweifeln. Man erzieht mich, wie eine Großstädterin erzogen werden soll, mit Vertraulichkeit und zugleich mit einer gewissen gemessenen Strenge, die mir erlaubt und zugleich gebietet, mich an Takt zu gewöhnen. Der Mann, der mich heiraten wird, muß reich sein oder er muß begründete Aussichten auf einen festen Wohlstand besitzen. Arm? Ich kann nicht arm sein. Mir und Geschöpfen, die mir gleichen, ist es unmöglich, pekuniäre Not zu leiden. Das sind Dummheiten. Im übrigen werde ich ganz bestimmt die Einfachheit der Lebensführung bevorzugen. Ich mag äußern Prunk nicht leiden. Die Schlichtheit muß ein Luxus sein. Schimmern muß es von Propperkeit in jeder Beziehung, und solche bis ins Letzte geforderte Lebensreinlichkeit kostet Geld. Die Annehmlichkeiten sind teuer. Wie energisch ich da rede. Ist das nicht ein bißchen unvorsichtig? Werde ich lieben? Was ist Liebe? Was für Seltsamkeiten und Herrlichkeiten müssen mir noch bevorstehen, da ich mir noch so unwissend vorkomme in Dingen, für deren Kenntnis ich noch zu jung bin. Was werde ich erleben?

Er sah keine Zukunft mehr vor sich, und die Vergangenheit glich, wie sehr er sich auch bemühte, sie erklärlich zu finden, etwas Unverständlichem. Die Rechtfertigungen zerstoben, und das Gefühl der Wollust schien immer mehr zu verschwinden. Reisen und Wanderungen, ehemals seine geheimnisvolle Freude, waren ihm seltsam zuwider geworden; er fürchtete sich, einen Schritt zu tun, und er erbebte wie vor etwas Ungeheuerlichem vor dem Wechsel des Aufenthaltsortes. Er war weder ehrlich heimatlos noch auch redlich und natürlich irgendwo in der Welt zu Hause. Er hätte so gern ein Orgelmann oder ein Bettler oder ein Krüppel sein mögen, damit er Ursache hätte, um das Mitleid und um das Almosen der Menschen zu flehen, aber noch inbrünstiger wünschte er zu sterben. Er war nicht tot und doch tot, nicht bettelarm und doch solch ein Bettler, aber er bettelte nicht, er trug sich auch jetzt noch elegant, machte auch jetzt noch, ähnlich einer langweiligen Maschine, seine Verbeugungen und machte Phrasen und entrüstete und entsetzte sich darüber. Wie qualvoll kam ihm sein eigenes Leben vor, wie lügenhaft seine Seele, wie tot sein elender Körper, wie fremd die Welt, wie leer die Bewegungen, Dinge und Geschehnisse, die ihn umgaben. Er hätte sich in einen Abgrund hinunterstürzen mögen, er hätte einen Glasberg hinanklimmen mögen, er hätte sich auf die Folter spannen lassen mögen, und mit Wollust würde er sich als ein Ketzer haben mögen langsam verbrennen lassen. Die Natur glich einer Gemäldeausstellung, durch deren Räumlichkeiten er mit geschlossenen Augen wanderte, ohne sich gelockt zu fühlen, die Augen zu öffnen, da er doch alles mit den Augen schon längst durchschaut hatte. Es war ihm, als sähe er den Menschen durch die Körper mitten durch die elendiglichen Eingeweide, es war ihm, als höre er sie denken und wissen, als sähe er sie Irrtümer und Albernheiten begehen, als könne er es einatmen, wie unzuverlässig, dumm, feig und treulos sie seien, und es war ihm zu guter Letzt, als sei er selber das Unzuverlässigste, Lüsternste und Treuloseste, was es gebe auf der Erde, und er hätte laut aufschreien, laut um Hilfe rufen, in die Knie sinken und laut weinen, tage-, wochenlang schluchzen mögen. Dessen aber war er nicht fähig, er war leer, hart und frostig, und vor der Härte, die ihn erfüllte, schauderte es ihn. Wo waren die Schmelzungen, die Bezauberungen, die er empfand, wo die Liebe, die ihn beseligte, die Güte, die ihn durchglühte, das endlose meergleiche Vertrauen, an das er glaubte, der Gott, der ihn durchentzückte, das Leben, das er umarmte, die Wonnen und die Verherrlichungen, die ihn umarmten, die Wälder, die er durchwandert, das Grün, das sein Auge erfrischte, der Himmel, in dessen Anblick er sich verloren? Er wußte es nicht, so wenig wie er noch wußte, was er sollte und wohinaus es mit ihm mußte. O, seine Person. Abreißen von seinem Wesen, das noch immer gut war, hätte er sie mögen. Die eine Hälfte des Selbst töten, damit die andere nicht zugrunde gehe, damit der Mensch nicht zugrunde gehe, damit der Gott in ihm nicht völlig sich verlöre. Es war ihm alles noch schön und doch zugleich so furchtbar, noch so lieb und gut und doch so zerrissen, und nächtlich war alles, und wüst und er selber war seine eigene Wüste. Oftmals, beim Anhören eines Tones meinte er zurücksterben zu können in die vorigen heißen, empfindungsvollen Sicherheiten, in die bewegliche reiche warme Stärke von früher. Wie gespießt auf einen Eisberggipfel kam er sich vor, schrecklich, schrecklich. – – –
Beim Gehen schwankte er wie ein Fiebernder oder wie ein Betrunkener, und er hatte das Gefühl, als müßten die Häuser über ihn umstürzen. Die Gärten, so gepflegt sie auch sein mochten, schienen ihm traurig und unordentlich dazuliegen, er glaubte an keinen Stolz, an keine Ehre, an kein Vergnügen, an keinen wahren, echten Jammer und an keine wahre, echte Freude mehr. Wie ein Kartenhaus erschien ihm das bisher feste üppige Weltgebäude: nur ein Hauch, ein Schritt, eine leichte Rührung oder Bewegung, und es bricht in dünne papierne Platten zusammen. Wie dumm, und wie fürchterlich – –
In die Gesellschaft der Menschen wagte er nicht zu gehen, aus panikartiger Furcht, man könnte merken, wie schlimm, wie trostlos es mit ihm stand; zu Freunden zu gehen und sich auszusprechen: dieser bloße Gedanke peinigte ihn aufs ärgste. Kleist war unzugänglich, ein elender grandioser Glücklicher, aus dem kein Wort mehr herauszubringen war. Der glich einem Maulwurf, einem Lebendigbegrabenen. Die andern waren ihm so schrecklich, so greulich zuversichtlich, und die Frauen? Brentano lächelte. Es war ein Gemisch von Kinderlächeln und Teufelslächeln. Und er machte eine abwehrende furchtsame Handbewegung. Und dann seine vielen, vielen Erinnerungen, wie sie ihn töteten, wie sie ihn marterten. Die Abende voller Melodien, die Morgen mit dem Blau und Tau, die heißen, tollen, schwülen, wunderbaren Mittagsstunden, der Winter, den er über alles liebte, der Herbst – – nur nicht denken. Es soll alles auseinandergehen, wie gelbe Blätter. Nichts soll stehen, nichts soll einen Wert haben, nichts, nichts soll bleiben.
Ein Mädchen aus guten Kreisen, das ebenso klar-vernünftig wie schön dachte, sagte ihm eines Tages folgendes: »Brentano, sagen Sie, fürchten Sie sich denn nicht vor sich selber, so ohne einen höheren Wert und so ohne Inhalt Ihr Leben dahinzuleben? Mußte es mit einem Menschen, den man lieben, ehren und bewundern möchte, so weit kommen, daß man ihn beinahe verabscheuen möchte? Kann ein Mensch, der so viel und so schön fühlt, zugleich so gefühlsarm sein, kann es Sie denn wirklich immer, immer wieder hinreißen, sich zu zerstreuen und Ihre Kräfte zu zersplittern? Fangen, fesseln Sie sich doch. Sie sagen, daß Sie mich lieben? Und daß Sie durch mich glücklich und wahr und aufrichtig würden? Ich aber, o des Grauens, Brentano, kann nicht glauben an das, was Sie sagen. Sie sind ein Unmensch, Sie sind ein lieber Mensch, und doch ein Unmensch, Sie sollten sich hassen, und ich weiß, daß Sie das tun, ich weiß, daß Sie sich hassen. Sonst verschwendete ich kein so warmes Wort an Sie. Bitte, verlassen Sie mich.«
Er geht und kommt wieder, er schüttet ihr sein Herz aus, er fühlt etwas Wunderbares in ihrer Nähe in sich aufquellen, er spricht ihr immer wieder von seiner Verlassenheit und von seiner Liebe, sie aber bleibt stark und starr und erklärt ihm, daß sie seine Freundin sei, daß es aber dabei bleibe, und daß sie nie seine Frau werden kann noch will noch darf und ersucht ihn, aufzuhören zu hoffen, daß das je geschehen könne. Er verzweifelt, sie aber glaubt nicht an die Tiefe und an die Wahrhaftigkeit seiner Verzweiflung. Sie bittet ihn eines Abends in einer Gesellschaft von sehr vielen feinen und angesehenen Leuten, er möchte ein paar seiner schönen Gedichte vortragen, er tut es und erntet großen Beifall. Jedermann ist entzückt über den Wohllaut und über die überquellende Lebendigkeit dieser Poesien.
Ein Jahr oder auch zwei Jahre vergehen. Er mag nicht mehr leben, und so entschließt er sich denn, sich selber gleichsam das Leben, das ihm lästig ist, zu nehmen, und er begibt sich dorthin, wo er weiß, daß sich eine tiefe Höhle befindet. Freilich schaudert er davor zurück, hinunterzugehen, aber er besinnt sich mit einer Art von Entzücken, daß er nichts mehr zu hoffen hat, und daß es für ihn keinen Besitz und keine Sehnsucht, etwas zu besitzen, mehr gibt, und er tritt durch das finstere große Tor und steigt Stufe um Stufe hinunter, immer tiefer, ihm ist nach den ersten Schritten, als wandere er schon tagelang, und kommt endlich unten, ganz zu unterst, in der stillen kühlen tiefverborgenen Gruft an. Eine Lampe brennt hier, und Brentano klopft an eine Türe. Hier muß er lange, lange warten, bis endlich, nach so langer, langer Zeit des Harrens und Bangens, ihm der Bescheid und der grausige Befehl erteilt wird, einzutreten, und er tritt mit einer Schüchternheit, die ihn an seine Kindheit erinnert, ein, und da steht er vor einem Mann, und dieser Mann, dessen Gesicht mit einer Maske verhüllt ist, ersucht ihn schroff, ihm zu folgen. »Du willst ein Diener der katholischen Kirche werden? Hier durch geht es.« So spricht die düstere Gestalt. Und von da an weiß man nichts mehr von Brentano.

Stendhal erzählt in seinem schönen Buch von der Liebe eine ebenso einfache wie schauervolle und tragische Geschichte, die von einer Gräfin und von einem jungen Pagen handelt, die sich lieben, weil sie ein süßes Gefallen aneinander finden. Der Graf ist eine finstere, schrecknisversprechende Figur. Die Liebesgeschichte spielt in Südfrankreich. Ich stelle mir Südfrankreich reich an mittelalterlichen Burgen, Kastellen und Schlössern vor, und die Luft träumt und lispelt dort von holder, heimlicher, schwermütiger Liebe. Es ist ziemlich lange her, daß ich die Geschichte gelesen habe, die in einem sonderbaren altmodischen naiven Französisch geschrieben ist, welches rauh und lieblich zugleich klingt. Auch die Sitten müssen damals rauh und dennoch schön gewesen sein. Da sehen sie sich also an, die Frau und der Edelknabe, und so gewöhnen sich ihre Augen aneinander. Sie lächeln, wenn sich ihre Blicke begegnen, und doch kennen beide wohl die grausame barbarische Gefahr, in die sie sich begeben, wenn sie glücklich sind im gegenseitigen Wohlgefallen. Der junge Mann singt so schön, da bittet sie ihn, etwas zu singen, und er tut es, er greift zum Instrument, das er mit Grazie zu handhaben weiß, und singt ein Liebeslied dazu, und sie lauscht ihm, sie lauscht seinen Tönen. Ihr Gatte ist ein Liebhaber der Jagd und der wilden Raufereien. Händel und Krieg interessieren ihn mehr als die Lippen der Frau, die der milden wonnigen Mainacht an Schönheit gleicht. So begegnen sich denn eines Tages, zu gegebener Stunde, die Lippen des jungen Edelknechtes und der schönen Frau, und das Ergebnis dieser reizenden Begegnung ist ein langer, heißer, wilder, süßer, herrlicher Kuß, an dessen Wonne die beiden zu sterben wünschen. Das Gesicht der Gräfin ist mit einer heiligen, entsetzlichen Blässe bedeckt, und in ihren großen dunklen Augen flammt und lodert ein verzehrendes Feuer, das mit dem Himmel und mit der Hölle verwandt ist. Doch sie lächelt ein seliges, überglückliches Lächeln, das einer duftenden, träumerischen Blüte gleicht. Zu bedenken ist, daß diese Frau, indem sie am Kusse hängt, zum Tode entschlossen ist, da der Graf, ihr Gemahl, ein schrecklicher Mann ist, von dem sie weiß, daß er tötet, wenn er in Zorn gerät. Auf wie hohe Art liebt sie, wenn sie liebt, wo sie weiß, daß die Liebe ihr das Leben kostet, wenn es auskommt, was nicht auskommen soll, was aber so leicht auskommen kann. Auch das Leben des Geliebten hängt an einem Haar, wo er sich dem Vergnügen des Kusses hingibt, woraus notwendig folgt, daß es ein Vergnügen hoher Art ist, das er kostet. Der Liebende und die Liebende sind beide gleich kühn, gleich entschlossen zum Äußersten, aber sie genießen dafür auch das Höchste. Sie erleben den Gipfel des Lebens, da sie spielen mit ihrem Leben, und nur so ist es möglich, den Gipfel zu erreichen. Wo das Leben nie in Gefahr ist, gibt es nie eine Beseligung eben dieses Lebens.

Eigentlich kann man nicht sagen, daß Kotzebue Unvergängliches geschaffen hat, obgleich man doch seinen kotzebutzlichen katzlichen Namen auch heute noch hin und wieder nennt. Es ist mit Berühmtheiten, vielmehr Unsterblichkeiten, wie Kotzebue eine ist, ein seltsames Ding. Ich persönlich, das heißt: still für mich, stelle mir vor, daß Kotzebue entsetzlich gewesen ist. Er bestand nicht aus Knochen und anliegendem zähen oder weichlichem Fleisch, nein, er war Asche. So blies man zum Beispiel: und weg war Kotzebue. Kotzebue hat einer stets dankbaren und freundlich-anhänglichen Nachwelt seine massiven, sämtlichen, gepreßten, gedruckten, in Kalbsleder gebundenen, gekotzten und gebutzten Werke hinterlassen, und dennoch, so darf man sich wohl erdreisten, zu sagen, wird er kaum noch je wieder gelesen. Die ihn lesen, müssen erblassen, und die ihn nicht lesen, scheinen nicht viel zu verlieren, indem sie ihn ignorieren. Immerhin ist er ein Biedermann. Sein Gesicht war ganz verkrochen und verborgen in einem ungeheuerlich großen und kühnen Rockkragen. Einen Hals hatte Kotzebue gar nicht. Seine Nase war lang, und was seine Augen betrifft, so glotzten sie. Er hat zahlreiche Lustspiele geschrieben, die mit glänzendem Kassensturzerfolg während der Zeit, da Kleist verzweifelte, aufgeführt worden sind. Im allgemeinen, das muß man ihm lassen, hat er saubere Arbeit geliefert. Wenn man in Kotzebues Nähe trat, so kutzelte und kotzelte es ganz bedenklich, und diejenigen Mitmenschen und Zeitgenossen, die mit ihm zu tun hatten, schämten sich unwillkürlich, daß sie lebten. So und nicht anders war es rund um Kotzebue, der denn auch, wie wir hoffen, zu den Heroen der deutschen Geisteswelt gerechnet werden darf, wie so mancher andere, der ein ebenso seltsamer Kotzebukauz war wie er. Wenn ich nicht ganz vom Irrtum befangen bin, war er in Weimar tätig. Wo er aber erzogen worden ist, und wer ihm sein bischen Bildung eingeimpft hat, das wissen die Götter. Die Götter wissen alles. Die Großherzigen, die Gütigen! Sie wissen sogar über einen Kotzebue Bescheid. Kotzebue hat die Götter in jeder Beziehung beleidigt, und zwar durch nichts andres als einzig und allein schon dadurch, daß er sich einbildete, er habe die Pflicht, sich für was Bedeutendes zu halten. Ein dummer Mensch, der Sand hieß, glaubte in seiner Blindheit, die Welt von Kotzebue befreien zu sollen und schoß ihm eine Kugel durch den Schädel. So endete Kotzebue.

In der und der geheimnisvollen Nacht, durchzuckt von der häßlichen und entsetzlichen Furcht, durch die Häscher der Polizei arretiert zu werden, entwischte Georg Büchner, der hellblitzende jugendliche Stern am Himmel der deutschen Dichtkunst, den Roheiten, Dummheiten und Gewalttätigkeiten des politischen Gaukelspiels. In der nervösen Eile, die ihn beseelte, um schleunigst fortzukommen, steckte er das Manuskript von »Dantons Tod« in die Tasche seines weitschweifigen, kühn geschnittenen Studentenrockes, aus welcher es weißlich hervorblitzte. Sturm und Drang fluteten, einem breiten königlichen Strom ähnlich, durch seine Seele; und eine vorher nie gekannte und geahnte Freude bemächtigte sich seines Wesens, als er, indem er mit raschen und großen Schritten auf der mondbeglänzten Landstraße dahinschritt, das weite Land offen vor sich daliegen sah, das die Mitternacht mit ihren großherzigen, wollüstigen Armen umarmte. Deutschland lag sinnlich und natürlich vor ihm, und es fielen dem edlen Jüngling unwillkürlich einige alte schöne Volkslieder ein, deren Wortlaut und Melodie er laut vor sich hersang, als sei er ein unbefangener, munterer Schneider- oder Schustergeselle, befindlich auf nächtlicher Handwerkswanderung. Von Zeit zu Zeit griff er mit der schlanken feinen Hand nach dem dramatischen, nachmals berühmt gewordenen Kunstwerk in der Tasche, um sich zu überzeugen, daß es noch da sei. Und es war noch da, und ein fröhliches, lustsprudelndes Gewaltiges überkam und überrieselte ihn, daß er sich in der Freiheit befand, eben da er in das Kerkerloch des Tyrannen hatte wandern sollen. Schwarze, große, wildzerrissene Wolken verdeckten oft den Mond, als wollten sie ihn einkerkern, oder als wollten sie ihn erdrosseln, aber stets wieder trat er, gleich einem schönen Kind mit neugierigen Augen, aus der Umfinsterung an die Hoheit und an die Freiheit hervor, Strahlen auf die stille Welt niederwerfend. Büchner hätte sich vor lauter wilder, süßer Flüchtlingslust auf die Knie an die Erde werfen und zu Gott beten mögen, doch er tat das in seinen Gedanken ab, und so schnell er laufen konnte, lief er vorwärts, hinter sich das erlebte Gewaltige und vor sich das unbekannte, noch unerlebte Gewaltige, das ihm zu erleben bevorstand. So lief er, und Wind wehte ihm in das schöne Gesicht.
Wenn jemals jemand, so kalkuliere ich, Talent besessen hat, so war es die berühmte Birch-Pfeiffer. Sie hat in dem idyllisch gelegenen Zürich gewohnt und nannte sich Gräfin. Dick und zugleich gewissermaßen schlank von Figur, war sie eine imponierende, ja, man darf sagen, berückende und bezaubernde Erscheinung. Alles huldigte ihr, alles und jedes kniete vor ihr nieder. Sie hat sowohl als Mensch wie als Dichterin die üppigsten Erfolge errungen. Sie erschwang sich, indem sie ihre breiten Röcke raffte, mit einem prachtvollen Schwung die Bühne, und von da an beherrschte sie sie. Sie war eine Begnadete, und sie selbst teilte in Hülle und Fülle Gnaden, Genüsse und Entzückungen aus. Noch heute, nach so vielen Jahren, werden ihre Bonbons, das heißt: Stücke gegeben. Sie hat so süß und so liebreizend gedichtet, daß alle diejenigen Leute, die ins Theater liefen, um sich ihr Stück anzusehen, vor Rührung und Seelenbeklemmung weinen mußten. Sie hat einer liebelechzenden Welt das Rührstück, das stets auch zugleich Zugstück war, vor die Nase geworfen, und die gerührte und erschütterte Welt dankte ihr, indem sie sie hochhob und im Triumph auf der Achsel herumführte. Eins ihrer am häufigsten gegebenen Stücke heißt: Das Lorle oder Dorf und Stadt, Schauspiel in fünf Ab- und Aufzügen. Während ein Büchner, der zu gleicher Zeit lebte wie die Birch-Pfeiffer, so gut wie verschollen und unbekannt blieb, schrie man nach ihr, und wenn sie vor dem Vorhang, breit und groß, wie sie war, erschien, so wollte der Jubel kein Ende nehmen. Noch einige Merkwürdigkeiten, die die große Frau an sich hatte, wollen wir uns erlauben zum besten zu geben: O, daß wir stürben am Andenken an die Unvergleichliche und Unvergeßliche. Die Süße, sie hatte einen so starken Busen, daß, wer sie zu Gesicht bekam, umfiel, als wäre er von einer Kanonenkugel getroffen worden. Gleich einem beweglichen Hektoliterfaß stürmte sie daher, und ihre Adlernase konnte niemand anschauen, ohne aufs tiefste von dem edlen Anblick betroffen zu sein. Sie trug, so heißt es in den Annalen, mit Vorliebe grellgelbe Strümpfe mit getrocknet-schwarzen Strumpfbändern. Ihre Taille war mächtig, und ihr Rücken stemmte sich hinten hoch zu Berg, als wenn er zersprengen wollte. Ihre gewitterdunklen Augen blickten stets strafend, und ihr Mund war zugebissen. So, das sind einige der markantesten Züge. Es bliebe noch manches zu sagen – aber wir wollen lieber schweigen und ... ehren!

Sesenheim. Stube
Friederike: Warum sind Sie traurig, lieber Herr Lenz? Machen Sie doch eine muntere Miene. Sehen Sie: ich bin so fröhlich. Kann ich denn etwas dafür, daß ich guter Laune bin? Nehmen Sie mir das übel? Nehmen Sie mir übel, daß ich nicht trüb und mißgestimmt sein mag? Wie kommt mir nur heute die Welt so schön vor. Ihnen nicht?
Lenz: Ich kann es nicht mehr aushalten. Ich muß hinaus. Schnell. Sie sind glücklich, Sie sind göttlich. Um so elender bin ich. Wenn ich Sie so schön sehe, muß ich Sie beim Kopf nehmen und küssen, und das wollen Sie nicht, das werden Sie nie wollen, nie wünschen. Wir sind nicht für einander. Ich bin für nichts auf der Welt.
Friederike: Warum nur gleich so den ganzen Mut sinken lassen. Sie können mir recht weh tun. Sie könnten mir eine wahre Lust schenken, wenn Sie sich ein wenig wohlbefinden wollten, aber das wollen Sie nicht.
Lenz: Ich kann nicht.
Friederike: Ja, gehen Sie. Gehen Sie hinaus. Lassen Sie mich. Es ist besser.
Lenz: Wissen Sie, wie ich Sie liebe? Wie ich Sie vergöttere?
Friederike: Das hätten Sie nicht nötig gehabt zu sagen. Hier kommt Goethe. Weiß Gott, es nimmt mich, es reißt mich, wie ich diesen lieben Menschen sehe.
Friederikens Kammer. Dämmerung
Lenz: Leise, leise. Daß nur ja kein Mensch mich sieht. Wie bin ich abscheulich. Aber es ist besser, abscheulich und häßlich sein als so trostlos. Mag denn ein Elender auch seine Freude haben. Warum muß einem Menschen gar nichts, gar nichts und einem andern alles, was es Schönes gibt, gegönnt sein? Lieber verworfen sein als gar nichts sein. O Natur. Wie himmlisch bist du. Selbst denen, die dich entstellen, wirfst du Wonnen und Seligkeiten vor die Seele. Hier sind ihre Strümpfe. (Küßt sie.) Ich bin wahnsinnig. Wie ich zittre. So zittert der Verbrecher. Wie heilig mir diese Gegenstände sind. Wie's mir über den Kopf kommt. Wenn jemand käme. Fort. Ich wäre auf immer zuschanden.
Goethe: Wie herrlich dieser Blick ist. Studium und Genuß sind nie besser verbunden als an einem solchen erhabenen Ort. Indem man Lust hat, immer weiter mit dem Auge zu schweifen, wird die schöne weite Aussicht immer lehrreicher. Dort der Fluß im breiten, wohlwollenden Land, wie er schimmert. Wie eine Sage, wie eine alte, gute Wahrheit schlängelt er sich durch die ausgedehnte Ebene. Dort hinten in der Ferne die Berge. Man kann alles auf einmal sehen und sich doch nicht satt sehen. Unser Auge ist eine seltsame Maschine. Es greift und läßt alles wieder fahren. Da unten in den alten, lieben Gassen: wie sie treten, gehen und tagewerken, die traumhaft befangenen Menschen. Man kann von hier oben herab so recht sehen, wie wohltätig und wie rechtschaffen wir sind ergriffen von der gesunden täglichen Gewohnheit. Ist nicht Ordnung immer wieder das Schöne?
Lenz: In unsere deutsche Literatur muß der Sturm fahren, daß das alte, morsche Haus in seinen Gebalken, Wänden und Gliedern zittert. Wenn die Kerls doch einmal natürlich von der Leber weg reden wollten. Mein »Hofmeister« soll sie in eine gelinde Angst jagen. Jagen, stürmen. Man muß klettern. Man muß wagen. In der Natur ist es wie in Rauschen und Flüstern von Blut. Blut muß sie in ihre aschgrauen, blassen, alten Backen bekommen, die schöne Literatur. Was: schön. Schön ist nur das Wogende, das Frische. Ah, ich wollte Hämmer nehmen und drauflos hämmern. Der Funke, Goethe, der Funke. Die »Soldaten«, bilde ich mir ein, müssen so etwas wie ein Blitz werden, daß es zündet.
Goethe (schaut ihn an, lächelt).
Gasse. Es regnet
Lenz: Es wird mir hier alles barbarisch. Ich verkomme. Kein Fingerzeig. Die Illusionen schwinden. Kein Traum mehr. Und wie tot, wie schwül ist alles. Muß es denn gerade jetzt regnen? Wozu ist überhaupt der Regen? Der Regen ist dazu da, daß es Regenschirme und nasse Straßen in der Welt gibt. Unter meinen Augen ist es mir siedend heiß. Am liebsten möchte ich jetzt kriechen. Dieses ewige Gehen. Was man sich doch für dumme Mühe macht ...
Die Herzogin: Also so sehen Sie aus? Treten Sie ungescheut näher. Wie man Sie willkommen heißt, dürfen Sie auch ein Zutrauen haben. Ihre dramatischen Arbeiten sehen Ihnen ähnlich. Es ist etwas Schüchternes und etwas Wildes an beiden. Legen Sie beides ein wenig ab, so werden Sie mehr Genuß an Ihrem Dichterfeuer und an Ihnen selbst haben. Es freut mich aber wirklich sehr, daß Sie Neigung gefunden haben, zu uns zu kommen, und hoffentlich wird es Ihnen bald auch bei uns einigermaßen behagen. Das Leben will eine gewisse behagliche Wärme und auch eine gewisse schickliche Breite haben. Doch ich tu' ja, als wenn ich Ihnen einen Vortrag halten wollte. Das will ich und soll ich nicht; ich soll mich nur sehr von Herzen freuen, daß Sie hier sind, und das tu' ich, glauben Sie es mir. Haben Sie auch schon eine günstige Wohnung gefunden? Ja? Das ist gut. Unser Weimar kann Ihnen sicher heimisch werden, es bietet mancherlei. Nur müssen Sie es eben, wie es ist, auch zu nehmen und zu genießen wissen. Sieht man Sie so, so glaubt man, Sie ein bischen schulmeistern zu dürfen. Verübeln Sie, daß ich warm mit Ihnen rede? Nicht? Um so besser. Aber ich schwatze, und der Herzog wartet auf mich.
Lenz (errötend; sehr unsicher, will etwas sagen).
Herzogin: Ach, nur keine sonderlichen Danksagungen. Sagen Sie sie mir ein andres Mal. Oder lieber gar nicht. Ihr Gesicht gefällt mir. Das genügt. Es hat alle Artigkeiten und Höflichkeiten schon längst ausgesprochen. Ich werde sorgen, daß wir uns wiedersehen. (Ab.)
Lenz: Schweb' ich? Wo bin ich?
Terrasse. Ausblick in den Park
Lenz: Ich dichte, schaffe nichts. Dieses ewige Knixen und Schöntun. Dieser Frost, diese nichtssagenden Förmlichkeiten. Bin ich noch ein Mensch? Warum bin ich enttäuscht? Warum will ich mich nur gar nirgends in der Welt anschmiegen? Da war's doch in Straßburg anders. War's denn etwa dort besser? Ich weiß nicht. Kann ich nirgends Fuß fassen? Kann ich mich nirgends behaupten? Ich fürchte mich. Ich bin grauenhaft.
Gräfin: Was soll das heißen?
Lenz: Lassen, lassen Sie mich. Vergönnen Sie mir den Genuß, zu Ihren Füßen liegen zu dürfen. Wie schön, wie trostreich für die verdurstende, schrecklich gepeinigte Seele ist dieser Moment. O, klingeln Sie nicht, rufen Sie nicht Ihre Leute. Bin ich denn ein Räuber, ein Einbrecher? Freilich bin ich unangemeldet hergestürzt. Wo man liebt: soll man sich da erst noch lange um die hergebrachte Sitte kümmern müssen? Wie sind Sie schön, und wie bin ich glücklich, und wie feurig, wie innig wünsche ich, nicht Ihr Mißfallen zu erregen. Können Worte, die aus der Brust eines Menschen kommen, der Sie anbetet, Sie beleidigen? Gewiß ist das ja möglich, gewiß, gewiß. Ich Sie beleidigen, ich Sie auch nur mit einem Hauch beunruhigen? Wie wäre das möglich? Schauen, schauen Sie mich nicht so hart an. Ihre Augen, die so schön sind, haben nicht verdient, daß sie so kalt, so unfreundlich, so ungütig blicken müssen. Retten Sie mich. Ich bin dem Verderben preisgegeben, wenn Sie kein Gefühl für mich haben. Haben Sie kein Gefühl? Dürfen Sie keins haben? Bin ich denn jetzt zerschmettert? Bin ich verloren mit allen meinen himmlisch-schönen Träumen? Wissen Sie, wie süß, wie schön ich träumte? Doch ich weiß nicht mehr, was ich sagen soll. Ich soll schweigen, ich soll jetzt wohl einsehen, daß ich die höchste aller Unziemlichkeiten begangen habe, ich soll fühlen, daß alles kalt ist, und daß alles zu Ende ist.
Gräfin: Ich bin sprachlos.
Lenz: Wie schön du bist. Dieser Busen, diese Arme, dieser Körper. Können so viele Herrlichkeiten sich anders als sanft gebärden?
Gräfin: Entfernen Sie sich auf der Stelle. Soll ich Ihnen erst noch sagen, daß Sie bewiesen haben, wie verzweifelt und wie unmöglich Sie sind. Sind Sie um die gesunde Vernunft gekommen? Ich muß es glauben.
Arbeitskabinett des Herzogs
Goethe: Er ist ein Esel.
Herzog: Ein unglückliches Kind. Was er getan hat, wäre sonst unbegreiflich. Man schaffe ihn auf eine sanfte Manier fort. Mein Hof kann dergleichen nicht dulden.
Ein Lebensposten ist gar nicht so ohne. Ganz gewiß nicht. Jedermann sieht gern ein, daß mit einer Weltposition hundert kleine Schönheiten, Bequemlichkeiten und Annehmlichkeiten verbunden sein können, so zum Beispiel die reizende, ruhige Mitgliedschaft zum literarischen Lesezirkel. Wer eine Existenz hat, darf sich gemütliche Bockbierabende erlauben. Das regelmäßige Einkommen sitzt abends im Konzert oder im Theater. Der gute Monatslohn macht mit Schwung und Selbstbewußtsein Maskenbälle mit. Und doch hängt an der Lebenspostenexistenz manches, was nicht fein ist, unter anderem die Unterminierung der körperlichen und geistigen Gesundheit. Hier sei schüchtern an das menschliche Nervensystem erinnert.
Germer, langjähriger Inhaber eines schwierigen Wechselportfeuillepostens, kann den Atem und die leibliche Bildung seiner Herren Kollegen nicht mehr ertragen. Wer gesund und robust ist, der macht gern Witze, die Meier vom Landgut und Stadthaus zum Beispiel. Diese beiden sind Witzbolde ersten Ranges. Germer ist ungeduldig. Wer ungeduldig ist, haßt das gemütliche Bockwurstwitzwesen. Außerdem hat ihn die Langjährigkeit seines Postens krank im Geist gemacht. Er macht zwar noch immer sein Pflichtchen, freilich, aber mit permanenter Zusammenraffung seiner letzten Geniekräfte. Ja, ja, so ein Weltposten.
Fast täglich gibt es in der hochberühmten Bankkomptabilität, so gegen halb zwei Uhr mittags, gratis Volksschauspiele. Zugelassen werden natürlich nur die Herren Angestellten und Maschinenrechner, aber das ist schon ein ganz artiges Theaterpublikum. Vollzählig sind sie da, die Senn, die Glauser, die Tanner, die Helbling, die Schürch, die Meier von da und dort, die Binz und die Wunderli. Sitz- und Stehplätze werden nonchalant, den Zigarrenstumpen im Mund, eingenommen. Duft und Stimmung, Wesen und Privatabsicht, Spezielles und Allgemeingültiges, und draußen scheint die Sonne. »Herr Germer!« sagt einer. Dieser eine geht langsam zu Germer hin und stellt sich dicht neben ihm auf. »Lassen Sie mich! Weg!« sagt Germer, indem er mit der gräßlich flachen Hand wegwischt. Alles schmettert und schnattert vor Lachen. Ja, ja, so eine duftvolle Mittagspause.
Was gesund, rotwangig und robust ist, das muß etwas zum Spielen, Unterhalten und Peinigen haben. Schon die lieben Kinder gehen da mit einem selten guten Beispiel voran. Wie köstlich macht sich das, und solch ein tönendes Lachen, wie ist das göttlich! Das heilige Lachen! Die Götter im Olymp sind auch Angestellte. Auch sie langweilen sich wahrscheinlich zuzeiten ziemlich stark, und auch sie begrüßen daher Gratisvolksschauspiele und -auftritte mit dankbar schallendem Vergnügen. Sicher ist die gepriesene Götterwohnung auch nur eine Art Komptabilität, gerade wie die unsere, und die Götter und Göttinnen schreiben und rechnen und korrespondieren vielleicht auch an solchen schmalen Pultreihen, angeschmiedet, gerade wie wir's hier so furchtbar deutlich schauen, an öden Lebensposten.
Jedes Ding auf dieser Erde hat seine trivialen zwei Seiten, eine schattige düstere und eine fidele helle. Wem das saure tägliche Brot nur so auf den Monatssalärtisch fällt, der muß sich verpflichtet fühlen, nach und nach zur kontraktlich regelmäßigen Maschine zu werden. Im Ernst: dies ist erste und letzte Aufgabe. Germer ist eine schlechte Maschine, er beherrscht seine Empfindungen nicht, er tobt, er brüllt, er pfeift, er wischt ab, er knirscht mit den Zähnen, er macht großzügige Arm- und Handbewegungen, er schreitet einher wie ein König der Bretter, die die Welt bedeuten sollen, er ist krank. Es gibt ja Krankheiten, die zu Lebensstellungen noch ganz gut passen. Germers Krankheit aber ist der scheinbar persönliche und überzeugte Feind seines kräftefordernden Postens. Schickt sich das? Wer einen Posten besetzt, der muß alles Unpostengemäße wegwischen. Unser Mann aber wischt mit der Hand seinen Posten weg. Das ist dumm, weil es unmöglich ist. Niemand kann Existenzen abwischen. Germer sagt immer: »Weg! Lassen Sie mich in Ruhe!« Ja, ja, so eine defekte Maschine.
Ein Herr Kollege soll auch kollegialisch empfinden. Das Prinzip der Kollegialität ist ein herrisches und ein nur zu tief begründetes. Das ist so gewesen und wird sicher so bleiben. Ein hungernder Vagabund hat nicht nötig, Rücksicht zu nehmen, dafür hungert er aber auch. Germer aber hat jeden Tag sein Essen, Trinken, Schlafen, Wohnen, Spazieren und Stumpenrauchen, diese wie vom Himmel auf seine Person heruntergefallenen Tischlein-deck-dich-Sachen kommen von der weltgebietenden Kollegenschaft. Darf er das hintansetzen? Darf er dem Herrn Buchhalter Binz die Zunge ausstrecken, darf er »Affen!« zu den Korrespondenten sagen? Ganz gewiß nicht, und doch tut er's, aber nicht er tut's eigentlich, seine Krankheit begeht diese Sünden, also ist Germers Krankheit ein Feind des mächtigen Kollegengedankens. Meier vom Land, der weiß, wie schön es auf dem Land ist, hat schon mehrmals der Idee Ausdruck verliehen, daß Germer aufs Land gehöre. Diese Idee wird von Kollege Helbling, zur Abwechslung scheinbar, wieder einmal, von Mann zu Mann im ganzen Bureau herumgetragen: »Es wäre bald besser, man täte den Germer aufs Land.« Chef Hasler, der stets Umsichtige, macht der Verbreitung guter Literatur in die breiten Volksschichten ein rasches, stirnrunzelndes Ende: »Es ist mir lieber, Sie arbeiten, Helbling.«
Die Landidee ist aber nicht mehr auszurotten. Binz, der Buchhalter im Profil, gibt ihr weiteren Ausdruck: »Da hätte er's doch verflucht gut. Die Landluft könnte ihn am Ende wieder völlig gesund machen. Hier wird er von Tag zu Tag dümmer. Es ist bald eine Schande, so einen Menschen überhaupt nur anzusehen. Es ekelt einen ja bald einmal. Auf dem Land würde er Sonnenschein und eine leichte Beschäftigung haben. Den halben Tag könnte er unter einem Baume im Gras liegen und ›Weg von mir!‹ sagen. Die Mücken und Fliegen würden es ihm beim Eid nicht übelnehmen. Man geniert sich bald. Und mit dem Helbling müßte man eigentlich auch bald endlich einmal kurzen Prozeß machen. Wenn ich Chef wäre, ich würde hier herum allweg bald besser Ordnung machen.« Wenn ich Chef wäre! Herr Binz im Quadrat möchte gern Chef der gesamten Abteilung sein. Seiner Nase nach steht es schlimm mit der Zucht und Würde in den Buchhaltungsräumlichkeiten. An seine dicken täglichen Folianten gedrückt, träumt er von eisernen Reformen und von sich als von dem gestrengen Vollstrecker derselben. Ja, ja, die Untergebenen.
Es wird auch nicht schlecht über die vermutlichen und vermeintlichen Ursachen von Germers geistiger Verwilderung hin und her gesprochen. Der Posten ist schuld. Der Posten ist zu aufreibend. Längst gehörte Germer vom Posten weg. Jeder andere würde an solch einem Posten ebenfalls verrückt. Und dann wird geflüstert, Rüegg sei schuld, Herr Rüegg, der Unterchef. Dieser habe den Germer mit kalter Berechnung in den Wahnsinn gehetzt. Kein anderer als Rüegg trägt Schuld. Das sei ein Schikaneur von der durchtriebensten Sorte. Neben diesem Satan zu arbeiten, das sei eine Qual. Erstens das teuflische Portefeuille, zweitens Rüegg, der figürliche Teufel. Der Germer sei zu bedauern. Warum sich das Kalb habe abhetzen lassen? Jedenfalls müsse er vom Posten weg. Helbling unternimmt es bereitwilligst, im ganzen Bureau herum die Qualen des Germerschen Postens zu schildern, er malt mit den absichtlich schwärzesten und zeitraubendsten Malmitteln. Er schildert wieder einmal Zeit tot. Aber Chef Hasler, kunstfeindlich wie immer, zerstört das Wandgemälde.
»Herr Germer, Sie müssen exakter arbeiten,« sagt Rüegg, der Chef des Portefeuilles, ein älteres, stilles, bebrilltes, schmächtiges, monotones, graues, bebartetes, bleiches Herrchen mit schmachtender, bohrender Stimme. »Herr Rüegg, lassen Sie mich in Frieden. Verstanden! Weg!« sagt Germer. Nun sind das ja keineswegs Untergebenenworte, noch viel weniger Tägliche-Brots-Worte, und noch weniger Worte eines Menschen, der fürchten muß, vom Posten weggewischt zu werden. Aber was kann man dafür, wenn es in Gottes Namen aus einem heraussprudelt. O wie Rüegg Germer haßt, aber noch schrecklicher ist es, wie Germer Rüegg haßt, und am fürchterlichsten ist es, wie beide einander in den Tod sich hassen. Und doch müssen sie zusammen arbeiten, eng verschlungen wie die geschmeidig sein sollenden Bestandteile einer schnurrenden Maschine. Des einen Tätigkeit ist futsch ohne die bereitwillige Tätigkeit des andern. Macht einer Fehler, so müssen drei drunter leiden, und Germer macht immer Fehler, aber er glaubt steif und fest, er arbeite nur deshalb schlecht, weil Rüeggs Bosheit ihn kaput macht. Rüegg dagegen ist ein feiner, geschmackvoller Mensch, er beteiligt sich nie an den »Volksschauspielen«, er behandelt Germer als einen völlig Normalen, und das gerade reizt den Kranken: »Weg!« Sagt Hebel A zu Hebel B solche Worte? Ja, ja, so ein Bestandteil.
Und jahrelang haben die beiden Hebel A und B zusammen das Rad der Arbeit mühsam geschwungen. Unter: »Sie müssen besser arbeiten!« und: »Gehen Sie mir weg!« Unter heimlich fressendem Ärger. Rüegg hat den Germer immer unter der Brille schräg hinauf angeschaut. Vielleicht haben diese Blicke das Ungestüm in Germers Wesen heraufbeschworen. Wer kann einer Seele sagen, woran sie erkrankt. Überlassen wir die zeitgemäße Beantwortung dieser Frage unsern Herren der Wissenschaft. Die haben's Patent drauf. Wenn so eine fleißige, emsige Stille im Saal herrscht, pfeift einer plötzlich, und wer ist es? Germer. Auch laut lachen kann er plötzlich. Und immer wischt er mit der schrecklich großen und flachen Hand etwas aus der Luft weg. Armer Germer.
Ja, ja, das Leben ist hart, Helbling weiß auch ein Lied davon zu singen. Man sagt, die eintönigen Lieder seien die rührendsten. Germer ist verheiratet, er hat Frau und zwei Kinder, Mädchen, die jetzt anfangen zur Schule zu gehen. Alle sechs bis acht Wochen besucht Frau Germer den Direktor der Bank, um diesen hochachtbaren Mann weinend zu bitten, er möge das Nötige tun und veranlassen, daß man ihren Mann möglichst schone und in Ruhe lasse. Es ist der Kollegenschaft bedeutet worden, die Veranstaltung von Extravorstellungen zu unterlassen. »Besser wäre, man täte ihn aufs Land,« meint Meier vom Land.
Er ist Bankkommis und ein kleiner Kerl, »Säubübli« von seinen Kollegen genannt, eine Benennung, die er mit scheinbarer Gleichgültigkeit erträgt. Etwas Geringfügiges schwebt um seine Gestalt, und eigentlich ist er nur eine Figur, keine Gestalt, nur ein menschliches Etwas, keine Erscheinung. Ein bißchen ländlich beträgt er sich, und er stammt in der Tat auch vom Land, sein Vater verträgt in dem Dorf, wo er her ist, die Briefe. Es soll also wohl oder übel auch etwas Pöstliches an ihm sein, ja, beinahe, aber dies kommt ungefähr so schwach zum Ausdruck, wie die Mienen an den Personen eines schlechtgeschriebenen Romanes, oder wie das Lächeln eines jener geriebenen Menschen, die nicht mit den Lippen, sondern mit den Ohrlappen zu lächeln pflegen. Im übrigen heißt unser Statist Glauser, Fritz mit Vornamen. Er nimmt Fechtstunden, »so ein Dräckbürschli«. Seine Körperhaltung ist infolgedessen eine recht gute, die Haltung schulmeistert beständig das, vermöge dessen sie da ist, den Körper, und der kleine, gute Glauser-Körper läßt sich ruhig und ergeben von der unzufriedenen Geist-Haltung kommandieren. An der Haltung merkt man etwas, und am Körper belächelt man etwas, und an Glauser will man immer etwas auszusetzen haben.
So zum Beispiel sagt man, er sei ein Streber, was ja nun allerdings ein wenig wahr ist, aber sein Strebertum ist ein feines und bewußtes, es korrespondiert mit den »Fechtstunden«. Er strebt danach, seinen Herren Abteilungschefs und Meistern Vorgesetzten zu gefallen. Keine üble Idee, aber in den Augen des Kollegen Senn, des »aufrührischen Vasallen«, ist das gemein. Den säuerlich dampfenden und kochenden Atem seines Meisters Hasler verträgt Glauser, wenn derselbe unvermutet hinter ihm steht, mit Bravour, ja sogar mit Liebe, denn er sagt sich: »Anstandshalber habe ich gegen solcherlei Atemübungen nichts einzuwenden. Ein besserer Duft wäre mir lieber. Aber wenn Chefs so atmen, so nehme ich 's hin.«
Er ist klug, und er hat Charakter, er kennt keine Torheiten. Seinen weiteren Kollegen Helbling verachtet er, aber vorsichtig, und seinen noch weiteren Kollegen Tanner hält er für einen netten Kerl, aber für prinzipienlos. Helbling will nicht arbeiten, Tanner bezweckt nichts mit der Arbeit, aber Glauser arbeitet an seiner persönlichen Weiterentwicklung, er fühlt sich berufen, Großes zu erreichen, er macht im Geist Karriere.
Er spart auch, er ißt für vierzig oder für dreißig Rappen zu Mittag, eine Ausgabe, die ihm imponiert, weil sie zu seinen Plänen paßt. Zu rauchen gestattet er sich nicht, obwohl er es gern täte, dafür aber trägt er Handschuhe und einen gewichtigen Spazierstock mit silbernem Knopf. Es ist dies ein Luxus, aber erstens nur ein einmaliger, und zweitens gibt der Mensch, der etwas erstrebt, gerne zu merken, daß es ihm eine Unmöglichkeit ist, sich zu unterschätzen.
»Ich bin vom Land,« denkt öfters Glauser, »und habe aus diesem Umstand heraus die Verpflichtung, es den Städtern zu zeigen, was ein fester Willen vermag.« Er benützt und besucht die Lesehallen, er ist im höchsten Grade bildungsbedürftig, und er weiß sich die Vorteile, die die Stadt bietet, zu Nutzen zu machen. Er sagt sich: »Diese Städter! Da schwärmen sie für die Landschaft. Ihre Bibliotheken vernachlässigen sie. Gut, dann übernehmen eben die Söhne vom Land ihre Errungenschaften.«
Glauser hat scheinbar ein Verhältnis mit der Kellnerin des »Ochsen«. Dort pflegt er zu Abend zu essen, das ist etwas teurer als im Volkswohltätigkeitshaus, man trinkt Bier zu einer Portion saurer Lebern, aber es gehört sich, infolgedessen tut er's. Die Verbindung mit dem Mädchen kostet nichts, denn sie liebt ihn. Das »Säubübli« ist also irgendwo Hahn im Korb, hat irgendwo einen Stein im Brett, das wirkt wohltuend, das erhebt, das macht, daß man sich seiner Vorteile beständig bewußt bleibt. Da kann man die andern reden lassen.
Sein Gehalt ist ein geringer, aber Glauser verbietet sich auf das strengste, von einem höheren Salär zu träumen. So etwas reibt auf und ist inkorrekt, denn es lenkt von den Obliegenheiten des Tages ab, und das verhindert ein Mensch, der weiß, was Pflicht und Schuldigkeit sind. »Das ist helblingisch,« denkt er und ist stolz und froh, sich derart bemeistern zu können. Absichtlich macht er Fehler, um ab und zu einen Verweis zu hören, aus Diplomatie, damit es nicht in der hintersten Ecke heißt: »Dieser kleine Luscheib von Streber!« – Jeder will gern ein bischen populär sein, am liebsten die zukünftigen Herrscher.
An Gehaltszahltagen freuen sich die meisten Angestellten kindlich. Der Klang des klimpernden Goldes erinnert an schöne Naturmomente, an Genüsse, an das Verhalten-Menschliche. Es spricht eben zu den Herzen und zu den Einbildungskräften. Nicht so Glauser. Der begegnet der fein lächelnden Angestelltin, die gewöhnlich auszahlt, kalt und gebärdet sich, während die liebliche Zahlerin ihres Amtes bei ihm waltet, folgendermaßen: »Dummköpfin! Mach's rasch!« – Es paßt ihm nicht, sich zu freuen, seine Lüste sind tieferer und bewußterer Art.
An gemeinschaftlichen Sonntagsvergnügungen nimmt er indessen teil, aus Politik, aber auch aus Anstandsgefühl, da er nicht ein versteckter Einsamer sein will. So etwas gehört sich, Grund genug, mit dabei zu sein. Das Tanzbein schwingt er trocken, aber er schwingt es wenigstens. Das Tanzen gehört im Vergleich zum »Saufen« noch in den schönen Kreis des Geistigen, demnach hat man sich's in keinerlei Weise zu verbieten. Daneben kann Glauser sich ja noch ruhig über die Sache erhaben fühlen, sowohl als über den armen Helbling, der dem Vergnügen leidenschaftlich ergeben ist, und der sich von der »Sache« hinreißen läßt.
Glauser liest Nietzsche, er liest ihn, aber er läßt sich durch diesen Autor nur zeitweise fesseln, niemals bestürmen, auch nicht irgendwelche Muster vorschreiben. Er hat seine ganz eigenen Gedanken, ihm imponiert so leicht keiner. Die Geschichte Napoleons aber hat es ihm angetan, diesen Mann nimmt er zum Vorbild. Daneben ist es eine englische Grammatik, der er vorzugsweise seine Nebenstunden widmet. Er ist Mitglied des Kaufmännischen Vereines, aber ein laxes, die Verbandsinteressen berühren ihn wenig, übrigens ist er erst zwanzig und ein halbes Jahr alt.
Gesundheitshalber begibt sich das kleine »Glauserli« fast jeden Mittag, während der Bureaupause, zum See hinaus, in die dortigen, hübschen Quaianlagen, um sich auf eine Bank zu setzen. Der Schatten ist ihm ebenso lieb wie die Sonne, aber um kein Haar lieber. Der Wind ist ihm angenehm, aber nicht süß wie »diesem Poeten Tanner«. Die Natur ist nützlich und gut, keineswegs entzückend. Auf der Bank liest er ein Buch. Drum herum ist Natur, aber eben, das ist es, die Natur ist gut zum Drumherumliegen, das Buch ist die Hauptsache. Die Natur wärmt und freundet sich an: von selber: eine Art Dienstbotin, eine stumme, gutmütige Pflegerin. Man nutzt das aus, denn das lohnt sich.
Schritt für Schritt schreitet unser Held vorwärts, und das heißt soviel als, er macht immer seine Sache ordentlich. Nie verspätet er sich. Sein Anzug ist ebenso sauber wie seine Arbeiten, die er abliefert, sein Auftreten aber entspricht seinen Plänen, das heißt, es ist bescheiden, hohe Pläne schreiben das vor. Während er arbeitet, scheint er verschwunden zu sein, er ist gar nicht mehr auf der Welt, er lebt in den unsichtbaren und unsichtbarmachenden Regionen der Pflichterfüllung. »Meine Arbeit ist zu geistlos für mich,« denkt er, aber es genügt ihm, daß er diesen Einfall gehabt hat, er macht kein Drama daraus. Er arbeitet langsam, Zahl für Zahl, Buchstabe für Buchstabe, richtig, gesetzt, leidenschaftslos, wie es sich schickt vor einer Leistung, die keine Anforderungen an die Begabung stellt. Das freut ihn kalt, daß es so ist. Glauser, »das Lusbübli«, ist von einer durchtriebenen Zufriedenheit beseelt, und das ist es, was andern in die Augen sticht, denn »dahinter steckt etwas!« –
»Eines Tages,« denkt ›dä chli Hagel‹, »werde ich ihr Chef sein. Die werden sich wundern.« Er hat sich im stillen längst vorgenommen, nie Stellung zu wechseln, eigenmächtig, sondern sich langsam an immer bessere Posten versetzen zu lassen. Er weiß, daß es jahrelang dauert, ehe er avancieren kann, aber das schreckt ihn nicht, im Gegenteil, er hat eine diabolische Genugtuung, empfinden zu dürfen, daß man ihm reichlich Gelegenheit zum hartnäckig Ausharren geben wird. Er weiß sich im Besitz der hierzu erforderlichen Tugenden, und er lacht auf den Stockzähnen hinten. Er hat Geduld wie eine Bahnübergangsbarriere. Er sieht ja täglich das Muster der natürlichen Ungeduld vor sich, den Helbling, der mit den Uhren kokettiert. Von diesem denkt er: »Der macht's nicht mehr lange.«
Tanner macht's auch nicht mehr lange. Der arbeitet um des Arbeitens willen. Das ist so eine Art zweckloser Künstlernatur! Das still beobachtende »Bübli« ist seiner Sache sehr sicher. Nach kurzer Zeit fliegen die beiden »hinaus«, Helbling auf dem Wege des Schassens und Tanner aus eigenem Drang. Der eine »geht« zwecklos und der andere mit Schand und Spott. Glauser aber stickt und zeichnet an dem fein erdachten Gewebe seines Berufsprogrammes ruhig weiter.
Er hält das Ding aus, und weit mehr: Die Bureausystemseele ist wie seine eigene, das heißt, keine Verdächtigungen! Er meistert eben seine Seele. Er sieht: aha, hier geht es so zu, und da geht es sofort in ihm selber ähnlich zu. Seine Energie läßt kein Unwohlbefinden aufkommen. So eine Seele ist weich, und wozu? Zum Daraufdrücken! Eine Seele ist nach Glausers Prinzipien zum Zermalmen da.
O er bringt es weit, aber noch lange nicht. Es geht langsam, aber dann, nachdem es ein Leben gedauert hat, wird er konstatieren können, daß er es weit gebracht hat. Und wenn er's zu nichts bringt, so hat er doch reich gelebt: er hat gewollt! –

Obwohl dieses Spiel für immer dahin ist, und obwohl meine Ohren es niemals vernommen haben, so kann ich doch träumen davon, dichten und phantasieren und kann mir vorstellen und ausmalen, wie süß es geklungen haben muß, wie herrlich es geklagt, wie wunderbar es gejubelt und wie betörend es geschluchzt haben muß. Wo der Name Paganini ausgesprochen wird, hört man noch heute die Tonwellen auf und nieder rauschen, sieht man heute noch eine gespenstisch dünne und schlanke weiße Hand den Zauberbogen führen, glaubt man heute noch sein himmlisches Konzert zu hören. Dämonisch soll er gespielt haben auf seinem Seeleninstrument, auf der Herzengeige, und ich glaube es. Er gibt Dinge, an die man mit aller Gewalt glaubt, an die man glauben – – will, und so glaube ich denn, daß Paganini zaubervoll spielte und daß er mit seinem Bogen umging, wie Napoleon mit seinen Armeen. Gewiß, eine kühne Vergleichung. Doch lassen wir das. Er spielte so schön, daß die Frauen ihre geheimsten Träume von den Herrlichkeiten der Liebe in Erfüllung gehen sahen, indem sie sich von den liebsten und schönsten Lippen geküßt, und zwar mit einer so großen Gewalt geküßt fühlten, daß sie vergehen zu müssen meinten. Es war nicht, als wenn Hände, nein, es war, als wenn die Liebe selber spielte; es war weniger der Gipfel der Geigenspielerkunst, obgleich es ein völliger Gipfel war, als vielmehr die bloße, große Seele, die ja aller und jeder Kunst erst die Weihe, den Klang und den Inhalt gibt. Dadurch, daß er spielte, als wenn er lachte, redete und weinte, küßte und mordete, eine Schlacht mitkämpfte und in der Schlacht verwundet wurde, ein Pferd bestieg und auf und davon jagte, oder als wenn er in unendlicher, unsagbarer Einsamkeit schwermütigen Gedanken nachhinge, oder als wenn er auf stürmischer See Schiffbruch litte, oder als wenn er zittere im Genuß eines wilden, unverhofften Glückes – war er dämonisch. Weil er einfach war, war er groß. Gütiger Leser, lächle, ich bitte dich, über alle diese, wie du sagen wirst, überreizten Einbildungen, doch höre weiter, wie er spielte, wie Paganini spielte. Mir ist es, als hörte ich ihn in diesem Augenblick toben, wüten, zürnen, schwelgen und spielen. Er spielte sein Spiel so herunter, daß die Hörer glaubten, er zerrisse die Tonwelt mit dem Bogen, um sie wieder zusammensetzen zu können, sich verlierend in Harmonien. Nachtigallen, arabische Feenschlösser, Nächte, von denen die träumerische Liebe träumt, Treue, Güte und engelgleiche Zärtlichkeiten wurden wahr durch seines Spieles mondscheinmilden Zauber, und das Spiel selber, welchem Fürsten mit Vergnügen lauschten, floß dahin, wie zerrinnender, unter dem Kuß der Sonne sich langsam, langsam auflösender Schnee, floß dahin wie ein musikalischer Honigstrom, sich verliebend in die eigene Hoheit, Schönheit und Flüssigkeit. So spielte er. Aber er spielte noch viel schöner, er spielte so, daß der Haß sich in Liebe, die Treulosigkeit sich in Treue, der Übermut sich in Wehmut, der Mißmut sich in Wonne, die Häßlichkeit sich in Schönheit und die Hartnäckigkeit sich in süße, purpurn strahlende Freudigkeit, Freundlichkeit, Versöhnlichkeit und Willigkeit verwandelte. Goethe lauschte seinem märchenhaften Spiel, das ihn entzündete und bis tief in die große Seele entzückte. Je größer der war, der ihm zuhörte, um so höher und größer war auch der Genuß. Es ist dies ja das Geheimnis des Kunstgenusses überhaupt. Paganini wußte im voraus nie genau, wie und was er spielen wollte und würde; er ließ sich von den Tönen zu den Tönen, von den Stufen zu den Stufen, von den Wellen zu den Wellen, von den Unbewußtheiten zu den goldenen Bewußtheiten hinreißen, derart, daß ihm das Geigenspiel wie eine stolze Palme aus dem Boden des Beginnens emporwuchs und größer und größer, schöner und schöner wurde wie ein breites, gedankenvolles, wollüstiges Meer. Ähnlich geht der Mensch durch das Leben, nicht wissend, was aus ihm wird, keimend oder fallend, je nachdem das Schicksal es will. So war sein Spiel ein schicksalhaftes, zwischen Wollen und Sollen schwebendes menschliches Spiel, das darum auch alle Herzen gefangen nahm, alle Ohren bezauberte und alle Seelen überschwemmte mit seiner Bedeutung. Napoleon hörte ihm zu, zwei volle Stunden lang, wiewohl ich mir das vielleicht nur einbilde, wozu ich ein gewisses Recht habe, da doch dieser ganze Aufsatz nur auf der Einbildung und auf der Erhebung beruht. Strenggläubige Leute, Katholiken wie Protestanten, lauschten ihm mit Freuden, denn es strömte Religion, wie liebliche nahrhafte Milch, aus seinem Bogen. Seine Kunst glich einem Regen, einem Segen, einem Sonntag, einer wundervollen hinreißenden Predigt. Der Krieger lauschte ihm, alles, alles lauschte ihm, ganz Aufmerksamkeit, ganz nur Ohr.

Der Schriftsteller besitzt in der Regel zwei Anzüge, einen für die Straße und zum Besuche machen und einen für die Arbeit. Er ist ein ordentlicher Mensch; das Sitzen am engen Schreibtisch hat ihn bescheiden gemacht, er verzichtet auf die heitern Genüsse des Lebens, und wenn er von irgendeinem nützlichen Ausgang nach Hause kommt, so zieht er seinen guten Anzug rasch vom Leib, hängt Hose und Rock, wie es sich gehört, säuberlich in den Kleiderschrank, wirft sich in seine Arbeiterbluse und Hausschuhe, geht in die Küche, macht Tee zurecht und begibt sich zur gewohnten Arbeit. Er trinkt nämlich immer Tee während des Schaffens, das behagt ihm sehr, es erhält ihn gesund, und seiner Meinung nach ersetzt ihm das alle übrigen weltlichen Genüsse. Verheiratet ist er nicht, denn er hat nicht die Kühnheit gehabt, sich zu verlieben, weil er allen ihm zu Gebote stehenden Mut dazu hat anwenden müssen, seiner künstlerischen Pflicht gegenüber, die, wie es vielleicht bekannt ist, eine sehr harte sein kann, treu zu bleiben. Er hauswirtschaftet in der Regel gänzlich allein, es sei denn, eine Freundin helfe ihm beim Ausruhen und ein unsichtbarer Schutzgeist beim Arbeiten. Seiner innersten Überzeugung nach ist sein Leben weder besonders freudig noch gar sehr trübe, weder leicht noch schwer, weder eintönig noch abwechslungsreich, weder eine fortdauernde noch eine oft unterbrochene Lustbarkeit, weder ein Schrei noch ein anhaltendes, munteres Lächeln: er schafft, das ist sein Leben. Er versucht in einem fort, sich in alles und jedes hineinzuleben, darin besteht sein Schaffen, und wenn er von seiner Arbeit einen Augenblick aufsteht, um sich eine neue Zigarette zu drehen, einen Schluck Tee zu trinken, ein Wort zur Katze zu sagen, jemandem die Tür zu öffnen oder rasch aus dem Fenster zu schauen, so sind das nicht wesentliche Unterbrechungen, sondern gewissermaßen nur Kunstpausen oder Atemübungen. Manchmal turnt er ein bischen im Zimmer, oder es fällt ihm ein, ein wenig zu jonglieren; auch Übungen im Gesang oder in der tönenden Deklamation sind ihm willkommen. Diese kleinen Dinge tut er, damit er beim Schreiben nicht ganz und gar, wie er sonst leicht befürchten müßte, zum Narren wird. Er ist ein exakter Mensch; sein Beruf hat ihn dazu gezwungen, denn was sollten Liederlichkeit oder Unordentlichkeit tagelang am Schreibtisch zu suchen haben? Der Wunsch und die Leidenschaft, das Leben in Worten zu zeichnen, entstammen schließlich nur einer gewissen Genauigkeit und schönen Pedanterie der Seele, der es Schmerz bereitet, beobachten zu müssen, wie so viel Schönes, Lebendiges, Eilendes und Flüchtiges in der Welt davonfliegt, ohne daß man es hat ins Notizbuch bannen können. Welche ewige Sorge! Der Mann mit der Feder in der Hand ist quasi ein Held im Halbdunkel, dessen Betragen nur deshalb kein heroisches und edles ist, weil es der Welt nicht zu Gesicht kommen kann. Man spricht nicht umsonst von »Helden der Feder«. Vielleicht ist das nur ein trivialer Ausdruck für eine ebenso triviale Sache, aber ein Feuerwehrsmann ist auch etwas Triviales, obschon nicht ausgeschlossen ist, daß er gesetzten Falls ein Held und ein Lebensretter sein kann. Wenn es bisweilen einem Mutigen gelingt, ein Kind, oder was es sei, mit Lebensgefahr aus dem strömenden Wasser zu retten, so dürfte es vielleicht des öftern der Kunst und dem aufopfernden Bemühen eines Schriftstellers vorbehalten bleiben, dem achtlos und gedankenlos dahinflutenden Strom des Lebens Schönheitswerte, die eben am Ertrinken und Untergehen sind, mit Gefahr seiner Gesundheit zu entreißen, denn gesund ist es nicht, zehn bis dreizehn Stunden hintereinander am Romanen- oder Novellentisch zu sitzen. Er kann also wohl zu den mutigen, kühnen Naturen gerechnet werden. In der Gesellschaft, wo es immer so glänzend und glatt zugeht, benimmt er sich mitunter steif aus Schüchternheit, rauh aus Gutmütigkeit und holperig aus Mangel an Schliff. Aber man unternehme es doch, ihn in ein Gespräch zu ziehen oder ins Netz einer herzlichen Unterhaltung einzufädeln, und man wird ihn alsobald sein linkisches Wesen abwerfen sehen; seine Zunge wird sprechen wie jede beliebige andre Zunge, seine Hände bekommen die allernatürlichsten Bewegungen, und in seinen Augen wird gewiß ebensoviel Feuer schimmern, als in den Augen irgendeines Staats-, Industrie- oder Marinemenschen. Er ist gesellig, wie nur irgendeiner. Er erlebt vielleicht einmal während eines ganzen Jahres nichts Neues, da er sich immer mit Satz- und Tonreihen abgegeben hat und mit der Vollendung seines Werkes, aber, ich bitte, hat er dafür nicht Phantasie? Schätzt man die gar nicht mehr heutzutage? Er ist fähig, mit seinen Einfällen eine Gesellschaft von, sagen wir, zwanzig Menschen sich beinahe kaput lachen zu machen, oder er kann Staunen erwecken, und zwar im Handumdrehen, oder er kann Tränen entlocken, indem er einfach ein Gedicht, das er gemacht hat, vorliest. Und dann, wenn seine Bücher auf dem Markt erscheinen! Alle Welt, bildet er sich in seiner dachstubigten Verlassenheit ein, springt danach und reißt sich um die hübsch eingebundenen oder sogar in braunes Leder gepreßten Exemplare. Auf dem Titelblatt steht sein Name, ein Umstand, der seiner naiven Meinung nach genügt, ihn überall in der runden, weiten Welt bekannt zu machen. Alsdann kommen die Enttäuschungen, die Zurechtweisungen in den Blättern, das Zischen zu Tode, das Verschweigen ins Grab hinein; unser Mann erträgt es eben. Er geht nach Hause, vernichtet alle seine Papiere, versetzt dem Schreibtisch einen furchtbaren Stoß, daß er umfliegt, zerreißt einen angefangenen Roman, zerfetzt die Schreibunterlage, wirft den Vorrat an Schreibfedern zum offenen Fenster hinaus, schreibt seinem Verleger: »Sehr geehrter Herr, ich bitte Sie, aufzuhören, an mich zu glauben,« und segelt auf Wanderschaften. Sein Zorn und seine Scham kommen ihm übrigens nach kurzer Zeit lächerlich vor, und er sagt sich, daß es seine Pflicht und Schuldigkeit sei, von neuem mit seiner Arbeit zu beginnen. So macht's der eine, der andre macht's vielleicht um eine Schattierung anders. Nie verliert ein zum Schriftstellern geborener Schriftsteller den Mut; er hat ein beinahe ununterbrochenes Vertrauen zur Welt und zu den tausend neuen Möglichkeiten, die sie ihm jeden neuen Morgen bietet. Er kennt jede Art Verzweiflung, aber auch jede Art Glücksgefühl. Das Sonderbare ist, daß ihn eher die Erfolge als die Mißerfolge mißtrauisch gegen sich machen; das kommt aber vielleicht nur daher, weil die Maschine seines Denkens fortgesetzt in Bewegung ist. Hin und wieder macht der Schriftsteller Vermögen, aber er geniert sich beinahe, Haufen Geldes erworben zu haben, und er macht sich in solchen Fällen absichtlich klein, um den vergifteten Pfeilen des Neides und der Spottsucht möglichst auszuweichen. Ein ganz natürliches Verhalten! Wie aber, wenn er arm und verachtet dahinlebt, in feuchten, kalten Stuben, an Tischen, über deren Platten ihm das Ungeziefer kriecht, in Betten aus Stroh, in Häusern voll wüsten Gelärms und Geschreis, auf ganz und gar einsamen Wegen, in der Nässe des herabströmenden Regens, auf der Suche nach Lebensunterhalt, den ihm, weil er vielleicht eine dumme Figur macht, kein vernünftiger Mensch gewähren will, unter der Glut der hauptstädtischen Sonne, in Herbergen voll Ungemach, in Gegenden voll Sturm oder in Asylen ohne die Freundlichkeit und Heimatlichkeit, die in dem Namen so schön enthalten ist? Ist ein derartiges Unglück ausgeschlossen? Nun also: auch Gefahren kann der Schriftsteller durchmachen, und von seinem Genie, sich in alle üblen Umstände zu schicken, wird es abhängen, wie er sie durchmacht. Der Schriftsteller liebt die Welt, denn er fühlt, daß er aufhört, ihr Kind zu sein, wenn er sie nicht mehr lieben kann. In diesem Fall ist er ja auch meist nur noch ein mittelmäßiger Schriftsteller, das empfindet er deutlich, und deshalb vermeidet er es, dem Leben ein mißmutiges Gesicht zu zeigen. Infolgedessen kommt es auch oft vor, daß man ihn für einen urteilslosen, beschränkten Schwärmer ansieht, während man doch gar nicht bedenkt, daß er ein Mensch ist, der sich weder den Spott, noch den Haß gestatten darf, weil ihm diese Empfindungen zu leicht die Lust am Schaffen rauben.

Das Sittsame fördert; das Rücksichtvolle scheint es zu etwas zu bringen. Der, der die Zeit niemals mit irgend etwas Ablenkendem verlieren will, trocknet und rostet ein. Es scheint, daß es unklug und bösartig ist, immer energisch zu sein. Mangel an Zuversicht gebärdet sich gern konstant energisch. Nun ist ja das alles so wunderbar. Fallen und seinen Posten verlieren, heißt oft: einen neuen unter die Füße bekommen. Triumphieren ist oft nichts anderes als Versinken in den Wellen der Anmaßung; und doch triumphiert man so gern. Immer und immer gesetzt, gerecht und gefaßt sein, ist hart und streift ans Unmenschliche, während doch menschlich sein unser unabänderliches Los ist. Schön und vortrefflich ist nur das Menschliche. Gewisse Tugenden sind ein Laster oder die Blüte eines solchen. Das Laster scheint eine Höhle voll Unrat und Unverständnis zu sein, aber aus dem Laster hervortreten, mit Reue in der Seele, ist schöner als niemals sündigen. Sind denn nicht vielfach die Fehler der Anlaß zu den Entzückungen und Rührungen? Wie willkommen ist dem alten Vater der verlorene Sohn; wie herrlich, wie herrlich ist es, Gnade und Erbarmen zu finden. Die Tugend beißt sich in die Lippen und kehrt dem liebevollen Schauspiel schamhaft und boshaft den Rücken, schauervoll fühlend, wie häßlich es ist, nie fehlzugehen. Das Sittsame, das Kämpfe duldet und übersteht, ist das Wundervolle. Der wirkliche Weltmann, zum Beispiel, ist sittsam; er ist fromm und duldet.
Die Wortkargheit kann in eine Schwäche ausarten; genau wie das Gegenteil. Das Schweigen beherrscht uns oft, wie uns die Sucht, alles auszuplaudern, beherrschen kann. Man soll nicht schweigen, wo es uns schicklich scheint, den Mund aufzutun; nur müssen wir freilich ungefähr wissen, was schicklich ist: und das weiß der Seelenvolle. Kann man nicht auch durch das Schweigen verleumden? Jedenfalls sehr unangenehm kann man sein. Man soll stets ein wenig lügen, das, was man nicht sagen darf, so sagen können, daß es wie eine einfache Unterhaltung klingt. Das Gehörte dem, den es angeht, genau so wiedersagen, wie es uns gesagt wurde, ist taktlos und muß verletzen. Aus Rücksicht ein wenig die Wahrheit entstellen, heißt sie vertiefen und verfeinern. Die Liebe versteht zu lügen, die Liebe versteht zu reden, die Liebe allein versteht, auf schöne Art zu schweigen. Übrigens sind das alles Schwankungen. Es kommt da auf die Fälle an und auf die Personen. Zu gewissen Menschen steht man so, daß ich und der andere es fühlen, wie unmöglich es ist, daß wir einander verkennen oder mißverstehen können. Beleidigungen, zum Beispiel, liegen nie im Ausdruck, sondern immer in den besonderen Umständen. Plötzlich habe ich irgendwen tief verletzt und ich weiß es gar nicht. Dich liebt jemand: und du drehst dieser Person im Weltleben den Rücken. Du liebst dann wieder dort, wo du mißverstanden und verkannt wirst.
Der große Dienst, den wir einer Frau erweisen, stürzt uns in die Gefahr, von ihr für einen Dummkopf gehalten zu werden. Man muß ihr dann grausam hart begegnen, um sie zu überzeugen, daß sie es mit einem Menschen von Selbstbewußtsein zu tun hatte. Nichts verachten und verschmähen echte weibliche Naturen so sehr wie Güte so ins Blaue hinein. Die Frauen erziehen den anwachsenden Mann zur Schätzung und Wertung seiner selber. Vielleicht geht im Meer dieser Erziehung manche feine, gute und tüchtige Mannesgesinnung für immer unter, denn edel und hochherzig ist man nicht gern zum zweitenmal, wo man das erstemal ausgelacht worden ist. Doch wer könnte edel von Natur sein und nicht für immer?
Das Schweizerland, wie kühn und klein steht es da, umarmt von den Staaten! Was ist es als Land allein für eine zugleich hehre und anmutige Erscheinung! Europas schneeige Pelzboa könnte man es nennen. Wundervoll wie seine Geschichte ist seine Natur. Merkwürdig wie sein Volk ist sein Bestand. Es ist, als ducke es sich. Doch scheint es auch nicht ein Panther, denn es hat keine Grenzenbeute zu machen. Seine Enthaltsamkeit ist seine Festigkeit, seine Bescheidenheit ist seine Schönheit, seine Beschränkung sein unvergleichliches Ideal. Wie ein politischer Felsen steht es da, umbrüllt von den politischen Wogen. So lange es bleibt, was es ist, schadet ihm, scheint es, nichts. Inwiefern es sich klein fühlt, darf es sich stark und eigen und unabhängig fühlen, abhängig nur von der Besonnenheit und Unerschrockenheit. Seine Würde ist seine Grenze; und solange es diese in ihrer Art unübersehbare Grenze zu bewahren weiß, ist es in seiner Art ein bedeutendes und großes Land, groß als Gedanke. Wie reizend und wie gefährlich ist seine Lage. Seine Menschen, wie heimatlich wissen sie, das Altertum bekräftigend, zu leben. Sein Handel geht hoch, seine Wissenschaften blühen. Doch wozu ihm schmeicheln? Daß es sein Eigen ist, schmeichelt ihm am tiefsten. Man will sie grob nennen im Ausland, die Schweizer. Das ist so, als nennte man den Franzosen unzuverlässig, den Deutschen anmaßend, den Türken unsauber, den Russen rückständig. Wie verpesten Redensarten die Erde! Wie vergiften gewisse Gerüchte das Leben!
Reisen, im Eisenbahnwagen sitzen, erster Klasse natürlich. Man ist eingestiegen und immer fährt man ins unbekannte, fremde Weite. Das ist reizend. Man beherrscht so ein bischen alle Sprachen. Kauderwelschen: Das ist so nett. Attachiert ist man als richtiger Reisender. Süß, einfach göttlich. Und nun sitzt man; draußen ist Winternacht, es schneit. Von der Wagendecke lächelt das Lämpchen wie ein unaufgeklärtes tiefes Menschenbrust-Geheimnis dich an. Tränen treten dir plötzlich in die Augen. Wie ist dir, du attachierter perfekter Reisender? Empfindest du Schmerzliches? Ja, ich bin versunken in ein Meer von wehmutvollen Erinnerungen. Ich werde in die fernen Länder davongetragen. Übrigens lese ich ja jetzt die Zeitung. Plötzlich ist mir vollkommenem Weltreisenden, als fahre ich zurück in die freudenüberströmte, liebe Kindheit. Die Eltern tauchen vor mir auf; und da schaue ich namentlich Mama tief in die Augen. Welch eine Wonne, welch ein Glück ist es, klein zu sein! Mir ist, als möchte ich gerade jetzt von Papa verprügelt werden. Doch weiter fährt es, weiter, weiter. Reisender sein: ach ja; und draußen der Mitternachtschnee. Ach ja, Reisender sein, ist hübsch. Aber richtiger attachierter Reisender muß man sein.
»Das alles ist nicht so schlimm«: finde ich hübsch gesagt. Mein lieber Bruder Hans sagte das immer. Er ist ein goldener Mensch, golden durch Treue. Ja, wenn es bei uns zu Haus oft schlimm aussah, sagte Hans: »Das alles ist nicht so schlimm. Es sieht nur so schlimm aus.« Mir scheint, Ehre und Liebe reden so. Tragisch die Dinge nehmen, ist ja plump. Wenn du keinen Erfolg in der Welt hast, so ist das gar nicht so schlimm. Der Humor ist die unübertreffliche Königin des Weltlebens. Hier wäre wieder ein Wörtchen vom Wesen des wahren Weltmannes zu sagen. Doch man muß sich diese Schreibfreude leider versagen; und das ist gar nicht so schlimm. Einen Hieb bekommen, ist gar nicht so schlimm. Verachtung wecken, wo man meinte, es recht getan zu haben, ist auch nicht so schlimm. Was ist schlimm? Mutlos und freudlos sein? Ist das wirklich so schlimm? Ja: das, das ist schlimm. Wenn ich falle und dazu lache, ist das gar nicht so schlimm. Wenn ich mich aber über die Niederlage ärgere, dann ist es schlimm. Doch ich habe noch allerlei anderes zu sagen. Das Leben enthält nicht nur einerlei, sondern gar mancherlei. Also auf ins Allerlei!
Wenn ich eine Weile nicht habe denken dürfen, sondern habe wirken müssen, wie sehne ich mich da wieder nach dem Leben in den Gedanken! Wenn es mir schlecht in der Welt geht, wie wünsche ich da wieder, geachtet, ausgezeichnet, gestreichelt, verwöhnt und geliebt zu werden! Wenn ich lange Zeit mit gewöhnlichen Menschen zu tun gehabt habe, wie schwebt mir da der Umgang mit feinen, ungewöhnlichen Menschen paradiesgartenähnlich wieder vor! Und wenn ich dahingesunken bin in den Abgrund der Verwilderung, ach, wie so gern betrage ich mich nachher wieder gesetzt und gesittet! Muß alles so sein Gegengewicht haben? Soll man immer und immer wieder durch die Schärfe der Gegensätze gerüttelt und geschüttelt werden? So scheint es; und so mache du dich nur stets auf Schwankungen, Unklarheiten und Unordnungen gefaßt. Trage es immer wieder, das Schwere, dulde es immer wieder, das Unangenehme, finde es immer wieder beherzigenswert und liebenswert, das Vielerlei. Pünktliche Ordnung schaffst du nie rund um dich und in dir. Deshalb sei doch ja nicht versessen auf die Ordentlichkeit. Dies stört, macht feig und blendet.
Wir stecken immer noch sehr im Mittelalter, und diejenigen, die über die Neuzeit murren, weil sie seelenarm sei, im Vergleich mit der Vorwelt, irren arg. Abschaffen ist der Lauf der Welt? Wie? Wenn alles so leer, so leicht würde, daß man an gar nichts mehr zu denken brauchte? Anzeichen, daß die Menschen der Kultur und ihrer Peinlichkeiten überdrüssig werden, sind vorhanden. Eine Welt glatt wie Glas, ein Leben sauber wie eine Stube am Sonntag. Keine Kirchen und keine Gedanken mehr. Puh, mich friert. Es sollte doch wohl immer noch allerlei in der Welt geben. Mich würde nichts bewegen, wenn nicht allerlei mich bewegte.

Von allerlei seltsamen Empfindungen durchdrungen, ging ich langsam auf dem felsigen Weg in den Wald hinauf, der mir wie ein dunkelgrünes undurchdringliches Rätsel entgegentrat. Er war still, und doch schien es mir, als bewege er sich und trete mir mit allen seinen Schönheiten entgegen. Es war Abend, und soviel ich mich erinnere, war die Luft von süßer melodischer Kühle erfüllt. Der Himmel warf goldene Gluten in das Dickicht hinein, und die Gräser und Kräuter dufteten so sonderbar. Der Duft der Walderde bezauberte mir die Seele, und ich vermochte, benommen und beklommen wie ich war, nur langsamen, ganz langsamen Schrittes vorwärtszugehen. Da tauchte aus dem niedrigen Eichengebüsch, zwischen Tannenstämmen, eine wilde, große, schöne fremde Frau hervor, angetan mit wenigen Kleidern und den Kopf bedeckt mit einem kleinen Strohhut, von dem ein Band aufs schwarze Haar herabfiel. Es war eine Waldfrau. Sie nickte und winkte mir mit ihrer Hand zu und kam mir langsam entgegen. Der Abend war schon so schön, die Vögel, die unsichtbaren, sangen schon so süß, und nun noch diese schöne Frau, die mir wie der Traum einer Frau, wie die bloße Vorstellung dessen, was sie war, erschien. Wir traten uns näher und begrüßten uns. Sie lächelte, und ich, ich mußte ebenfalls lächeln, bezwungen von ihrem Lächeln und gefangen genommen von der herrlichen, tannengleichen Gestalt, die sie hatte. Ihr Gesicht war blaß. Der Mond trat nun auch zwischen den Ästen hervor und schaute uns beide mit gedankenvollem Ernst an, und da setzten wir uns nebeneinander ins feuchte, weiche, süßduftende Moos und schauten uns zufrieden in die Augen. O, was hatte sie für schöne, große, wehmutsvolle Augen. Eine Welt schien in ihnen zu liegen. Ich faßte sie um den großen weichen Leib und bat sie, mit so viel Schmeichelei in der Stimme, als ich hineinzulegen vermochte (und das war nicht schwer), mir ihre Beine zu zeigen; und sie nahm den Rock von den Beinen weg, und da schimmerte mir durch das Dunkel des Waldes sanft das himmlisch schöne weiße Elfenbein entgegen. Ich neigte mich und küßte beide Beine, und ein freundlicher willkommener Strom strömte mir durch den beseligten Körper, und ich küßte nun ihren Mund, der die schwellende nachgiebige Güte und Liebe selber war, und wir umarmten uns und hielten uns lange, lange, zu unserem gegenseitigen stillen Entzücken, umschlungen. Ach, wie mich der Duft der Waldnacht entzückte, wie mich aber auch der Duft entzückte, der dem Körper der Frau entströmte. Wir lagerten auf dem Moos wie in einem kostbaren, reichgeschmückten Bett, Stille und Finsternis und Frieden um uns her, über uns die tanzenden und blitzenden Sterne und der gute, sorglose, liebe, große, göttliche Mond.

Die Magd. Eine reiche Dame hatte eine Magd, die mußte das Kind hüten. Das Kind war so zart wie Mondstrahlen, so rein wie frisch gefallener Schnee und so lieb wie die Sonne. Die Magd hatte es lieb wie Mond, wie Sonne, fast wie ihren lieben Gott selbst. Aber da ging das Kind einmal verloren, man wußte nicht wie, und da suchte es die Magd, suchte es in der ganzen Welt, in allen Städten und Ländern, sogar in Persien. Dort in Persien kam die Magd eines Nachts vor einen finstern, hohen Turm, der stand an einem breiten, dunklen Strom. Hoch oben aber im Turm brannte ein rotes Licht, und dieses Licht fragte die treue Magd: Kannst du mir nicht sagen, wo mein Kind ist? es ist verloren gegangen, ich suche es nun schon zehn Jahre! – So suche noch weitere zehn Jahre! antwortete das Licht und erlosch. Da suchte die Magd weitere zehn Jahre lang nach dem Kind, in allen Gegenden und Umgegenden der Erde, sogar in Frankreich. In Frankreich ist eine große, prächtige Stadt, die heißt Paris, zu der kam sie. Da stand sie eines Abends vor einem schönen Garten, weinte, daß sie das Kind nicht zu finden vermochte und nahm ihr rotes Schnupftuch hervor, um ihre Augen damit abzuwischen. Da ging der Garten plötzlich auf, und ihr Kind trat heraus. Da sah sie es, und da starb sie vor Freude. Warum starb sie? Hat das denn etwas genützt? Sie war aber schon alt und konnte nicht mehr soviel vertragen. Das Kind ist jetzt eine große, schöne Dame. Wenn du ihr begegnest, so grüße sie doch von mir.
Der Mann mit dem Kürbiskopf. Es war einmal ein Mann, der hatte statt eines Kopfes einen hohlen Kürbis auf den Schultern. Damit konnte er nicht weit kommen. Und doch wollte er der Vorderste sein! So einer! – Als Zunge hatte er ein Eichblatt aus dem Munde hängen, und die Zähne waren nur mit dem Messer ausgeschnitzt. Statt der Augen hatte er bloß zwei runde Löcher. Hinter den Löchern flackten zwei Kerzenstümpchen. Das waren die Augen. Damit konnte er nicht weit sehen. Und doch sagte er, er habe die besten Augen, der Prahler! – Auf dem Kopf hatte er einen hohen Hut; den zog er ab, wenn jemand zu ihm redete, so höflich war er. Da ging der Mann einmal spazieren. Doch der Wind blies so heftig, daß die Augen ausloschen. Da wollte er sie wieder anzünden; aber er hatte keine Zündhölzchen. Er fing an zu weinen mit seinen Kerzenrestchen, weil er den Weg nach Hause nicht mehr finden konnte. Da saß er nun, nahm den Kürbiskopf zwischen seine beiden Hände und wünschte zu sterben. Aber das Sterben ging ihm nicht so leicht. Es kam vorher noch ein Maikäfer und fraß ihm das Eichblatt vom Munde weg. Es kam vorher noch ein Vogel, und pickte ein Loch in seinen Kürbisschädel. Es kam vorher noch ein Kind und nahm ihm beide Kerzenstümpchen weg. Da konnte er sterben. Noch frißt der Käfer am Blatt, noch pickt der Vogel, und das Kind spielt mit den Kerzchen.

Das sind große Unterlassungssünden. Ich bin ein bedeutender Schurke gegen mich selber. An mir sehe ich, wie die Menschen durch Trägheit sündigen. Ich warte immer auf etwas, das mir entgegenzutreten habe. Wie nun, wenn alle Menschen das tun; wenn jeder so wartet auf das, was da kommen soll? Es kommt nie etwas. Es kommt demnach für niemand das betreffende Etwas. Was einer so erwartet und erwartet, kommt nie. Was also alle erwarten, erscheint allen nie. Hier ist die große Sünde. Anstatt daß ich gehe und jemand entgegengehe, warte ich, bis jemand mir gefällig entgegentritt, das ist die rechte Trägheit, der rechte ungerechtfertigte Stolz. Gestern abend schaute ein sonderbarer wildfremder Geselle, der irgend etwas zu suchen schien, zu mir hinauf. Ich stand am offenen Fenster. Ich schaute ihn an, der zu mir hinaufschaute, so, als sei er eines kleinen Zeichens gewärtig. Ich hätte nur zu nicken brauchen mit dem Kopf, und eine seltsame, ungewöhnliche Menschenverbindung wäre vielleicht schon angebahnt gewesen. Vielleicht auch nicht. Wer vermag es zu wissen. Etwas Ungewisses vermag man nicht zu wissen, aber gleichviel. Ich hätte der dunklen, ungewissen, vom zauberischen Abendlicht umflossenen Menschengestalt ein Zeichen geben sollen. Es sah aus, als sei der fremde Mensch einsam, arm und einsam. Doch sah es zur selben Zeit aus, als wisse er viel und vermöge manches, das wert sei, vernommen zu werden, zu erzählen, als sei alles das, was er zu sagen habe, angetan, zu Herzen genommen zu werden. Und warum bin ich ihm nun gar nicht entgegengekommen? Ich begreife mein Benehmen kaum; auf solche Art und Weise kommen sich Menschen in die Nähe und gehen, ohne Spuren zu hinterlassen, wieder voneinander weg. Das ist nicht gut. Das ist eigentlich recht schlecht. Es ist eine rechte Sünde. Nun will ich natürlich eine Ausrede suchen und mir vorsagen, daß an dem Fremdling möglicherweise nichts gelegen sei. Möglicherweise? Da bin ich schon gefangen; denn ich gebe ja zu, daß, auf der andern Seite, d. h. bei anderem Licht besehen, irgend etwas ist an ihm. Ich bin demnach also keineswegs zu entschuldigen. Kalt habe ich den Gesellen, der mir vielleicht ein Freund hätte werden, und dem auch ich ein Freund hätte werden können, abziehen lassen. Seltsam, seltsam. Ich bin erstaunt, nein, ich bin mehr als erstaunt, ich bin ergriffen, und Trauer schleicht sich mir in das Herz.
Ich komme mir ganz unverantwortlich vor, und ich könnte sagen, daß ich unglücklich sei. Doch ich liebe die Worte Glück und Unglück nicht; sie sagen nicht das Rechte. Ich habe bereits dem unbekannten Menschen, der zu mir hinaufgeschaut hat, einen Namen gegeben. Ich nenne ihn, wenn ich an ihn denke, Tobold. Mir ist dieser Name zwischen Schlafen und Wachen eingefallen. Wo ist er jetzt, und an was denkt er? Ob es mir wohl möglich sein wird, seine Gedanken zu denken, zu erraten, was er denkt, und das gleiche, wie er, zu denken? Meine Gedanken sind bei ihm, der mich suchte. Offenbar hat er mich gesucht, und ich habe ihn nicht eingeladen, zu mir zu kommen, und er ist dann wieder gegangen. An der Ecke des Hauses hat er sich nochmals umgedreht, dann verschwand er. Ist er nun für immer verschwunden?
Irgendwo in der Schweiz, in bergiger Gegend, findet sich, zwischen Felsen eingeklemmt und von Tannenwald umgeben, eine Einsiedelei, die so schön ist, daß man, wenn man sie erblickt, nicht an Wirklichkeit glaubt, sondern daß man sie für die zarte und träumerische Phantasie eines Dichters hält. Wie aus einem anmutigen Gedicht gesprungen, sitzt und liegt und steht das kleine, gartenumsäumte, friedliche Häuschen da, mit dem Kreuz Christi davor, und mit all dem holden, lieben Duft der Frömmigkeit umschlungen, der nicht auszusprechen ist in Worten, den man nur empfinden, sinnen, fühlen und singen kann. Hoffentlich steht das liebliche, kleine Bauwerk noch heute. Ich sah es vor ein paar Jahren, und ich müßte weinen bei dem Gedanken, daß es verschwunden sei, was ich nicht für möglich halten mag. Es wohnt ein Einsiedler dort. Schöner, feiner und besser kann man nicht wohnen. Gleicht das Haus, das er bewohnt, einem Bild, so ist auch das Leben, das er lebt, einem Bilde ähnlich. Wortlos und einflußlos lebt er seinen Tag dahin. Tag und Nacht sind in der stillen Einsiedelei wie Bruder und Schwester. Die Woche fließt dahin wie ein stiller, kleiner, tiefer Bach, die Monate kennen und grüßen und lieben einander wie alte, gute Freunde, und das Jahr ist ein langer und ein kurzer Traum. O wie beneidenswert, wie schön, wie reich ist dieses einsamen Mannes Leben, der sein Gebet und seine tägliche, gesunde Arbeit gleich schön und ruhig verrichtet. Wenn er am frühen Morgen erwacht, so schmettert das heilige und fröhliche Konzert, das die Waldvögel unaufgefordert anstimmen, in sein Ohr, und die ersten, süßen Sonnenstrahlen hüpfen in sein Zimmer. Beglückter Mann. Sein bedächtiger Schritt ist sein gutes Recht, und Natur umgibt ihn, wohin er mit den Augen schauen mag. Ein Millionär mit all dem Aufwand, den er treibt, erscheint wie ein Bettler, verglichen mit dem Bewohner dieser Lieblichkeit und Heimlichkeit. Jede Bewegung ist hier ein Gedanke, und jede Verrichtung umkleidet die Hoheit; doch der Einsiedler braucht an nichts zu denken, denn der, zu dem er betet, denkt für ihn. Wie aus weiter Ferne Königssöhne geheimnisvoll und graziös daherkommen, so kommen, um dem lieben Tag einen Kuß zu geben und ihn einzuschläfern, die Abende heran, und ihnen nach folgen, mit Schleier und Sternen und wundersamer Dunkelheit, die Nächte. Wie gerne möchte ich der Einsiedler sein und in der Einsiedelei leben.

Plötzlich, ehe es die andern alle nur wissen, ist einer als groß und bedeutend erklärt. Wer zuerst die Erklärung gegeben hat, das weiß später niemand unter der Schar ganz genau. Das Leben und das Spiel des Lebens scheinen auf einer Fülle von erhitzenden und erregenden Ungenauigkeiten zu beruhen, und es fühlen es alle, daß die Besonnenheit nicht das Hohe erreicht. Es sind aber auch welche da, die mit Mäßigem erstaunlich zufrieden sind, und so erstaunlich ist das wohl gar nicht. Die Wünsche und Begierden harmonieren letzten Endes immer mit den Fähigkeiten, und es vergeht kein Jahr, so empfindet der Mensch, was er ungefähr vermag. Im rundlichen Kreis des Spiels befindet sich eine Einsame, die weint. Nun benehmen sich die übrigen so, als bemerkten sie das nicht, und das ist doch immerhin schicklich. Wen ich bemitleide, zu dem soll ich auch hintreten und ihn umhalsen und ihm das Leben weihen, und davor scheut man denn doch ein wenig zurück. Wie tief und wie sehr müssen sie alle sich selbst schätzen und lieben. So lautet das Naturgesetz. Die Liebe spielt eine eigentümliche Rolle auf dem grünen Rasen des Lebens. Es lieben sich zwei, aber sie vermögen nicht einander auch zu ehren. Hier verachten sich zwei, und können doch sehr gut miteinander für den täglichen Verkehr auskommen. Liebe ist unergründlich und ein Ziel für Irrtümer. Da ist einer, der gern ein Gewaltiger wäre, aber man merkt es ihm schon an, daß er niemals Gelegenheit haben wird, zu herrschen und anzuordnen. Ein andrer möchte Bevormundeter sein und muß bevormunden. Seltsames Spiel des Lebens. Man sieht schneeweiße Schmetterlinge umherflattern: das sind Gedanken, deren Los das Flattern, Ermüden und Stürzen ist. Die Luft ist voll unsagbarer Sehnsucht, heiß von Entsagung. An einem entfernten Ort steht der Vater, und wenn eins der Menschenkinder zu ihm hinspringt, um eine Klage vorzubringen, lächelt er und bittet es, in den spielerischen Kreis zurückzutreten. Wenn ein Kind stirbt, hat es ausgespielt. Die andern aber spielen fort und fort weiter.

Anmerkungen zur Transkription:
Im folgenden werden alle geänderten Textstellen angeführt, wobei jeweils zuerst die Stelle wie im Original, danach die geänderte Stelle steht.
End of the Project Gutenberg EBook of Aufsätze, by Robert Walser
*** END OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK AUFSÄTZE ***
***** This file should be named 37579-h.htm or 37579-h.zip *****
This and all associated files of various formats will be found in:
https://www.gutenberg.org/3/7/5/7/37579/
Produced by Jana Srna and the Online Distributed
Proofreading Team at https://www.pgdp.net
Updated editions will replace the previous one--the old editions
will be renamed.
Creating the works from public domain print editions means that no
one owns a United States copyright in these works, so the Foundation
(and you!) can copy and distribute it in the United States without
permission and without paying copyright royalties. Special rules,
set forth in the General Terms of Use part of this license, apply to
copying and distributing Project Gutenberg-tm electronic works to
protect the PROJECT GUTENBERG-tm concept and trademark. Project
Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you
charge for the eBooks, unless you receive specific permission. If you
do not charge anything for copies of this eBook, complying with the
rules is very easy. You may use this eBook for nearly any purpose
such as creation of derivative works, reports, performances and
research. They may be modified and printed and given away--you may do
practically ANYTHING with public domain eBooks. Redistribution is
subject to the trademark license, especially commercial
redistribution.
*** START: FULL LICENSE ***
THE FULL PROJECT GUTENBERG LICENSE
PLEASE READ THIS BEFORE YOU DISTRIBUTE OR USE THIS WORK
To protect the Project Gutenberg-tm mission of promoting the free
distribution of electronic works, by using or distributing this work
(or any other work associated in any way with the phrase "Project
Gutenberg"), you agree to comply with all the terms of the Full Project
Gutenberg-tm License (available with this file or online at
https://gutenberg.org/license).
Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg-tm
electronic works
1.A. By reading or using any part of this Project Gutenberg-tm
electronic work, you indicate that you have read, understand, agree to
and accept all the terms of this license and intellectual property
(trademark/copyright) agreement. If you do not agree to abide by all
the terms of this agreement, you must cease using and return or destroy
all copies of Project Gutenberg-tm electronic works in your possession.
If you paid a fee for obtaining a copy of or access to a Project
Gutenberg-tm electronic work and you do not agree to be bound by the
terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or
entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph 1.E.8.
1.B. "Project Gutenberg" is a registered trademark. It may only be
used on or associated in any way with an electronic work by people who
agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few
things that you can do with most Project Gutenberg-tm electronic works
even without complying with the full terms of this agreement. See
paragraph 1.C below. There are a lot of things you can do with Project
Gutenberg-tm electronic works if you follow the terms of this agreement
and help preserve free future access to Project Gutenberg-tm electronic
works. See paragraph 1.E below.
1.C. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation ("the Foundation"
or PGLAF), owns a compilation copyright in the collection of Project
Gutenberg-tm electronic works. Nearly all the individual works in the
collection are in the public domain in the United States. If an
individual work is in the public domain in the United States and you are
located in the United States, we do not claim a right to prevent you from
copying, distributing, performing, displaying or creating derivative
works based on the work as long as all references to Project Gutenberg
are removed. Of course, we hope that you will support the Project
Gutenberg-tm mission of promoting free access to electronic works by
freely sharing Project Gutenberg-tm works in compliance with the terms of
this agreement for keeping the Project Gutenberg-tm name associated with
the work. You can easily comply with the terms of this agreement by
keeping this work in the same format with its attached full Project
Gutenberg-tm License when you share it without charge with others.
1.D. The copyright laws of the place where you are located also govern
what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in
a constant state of change. If you are outside the United States, check
the laws of your country in addition to the terms of this agreement
before downloading, copying, displaying, performing, distributing or
creating derivative works based on this work or any other Project
Gutenberg-tm work. The Foundation makes no representations concerning
the copyright status of any work in any country outside the United
States.
1.E. Unless you have removed all references to Project Gutenberg:
1.E.1. The following sentence, with active links to, or other immediate
access to, the full Project Gutenberg-tm License must appear prominently
whenever any copy of a Project Gutenberg-tm work (any work on which the
phrase "Project Gutenberg" appears, or with which the phrase "Project
Gutenberg" is associated) is accessed, displayed, performed, viewed,
copied or distributed:
This eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with
almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or
re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included
with this eBook or online at www.gutenberg.org
1.E.2. If an individual Project Gutenberg-tm electronic work is derived
from the public domain (does not contain a notice indicating that it is
posted with permission of the copyright holder), the work can be copied
and distributed to anyone in the United States without paying any fees
or charges. If you are redistributing or providing access to a work
with the phrase "Project Gutenberg" associated with or appearing on the
work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.E.1
through 1.E.7 or obtain permission for the use of the work and the
Project Gutenberg-tm trademark as set forth in paragraphs 1.E.8 or
1.E.9.
1.E.3. If an individual Project Gutenberg-tm electronic work is posted
with the permission of the copyright holder, your use and distribution
must comply with both paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 and any additional
terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked
to the Project Gutenberg-tm License for all works posted with the
permission of the copyright holder found at the beginning of this work.
1.E.4. Do not unlink or detach or remove the full Project Gutenberg-tm
License terms from this work, or any files containing a part of this
work or any other work associated with Project Gutenberg-tm.
1.E.5. Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this
electronic work, or any part of this electronic work, without
prominently displaying the sentence set forth in paragraph 1.E.1 with
active links or immediate access to the full terms of the Project
Gutenberg-tm License.
1.E.6. You may convert to and distribute this work in any binary,
compressed, marked up, nonproprietary or proprietary form, including any
word processing or hypertext form. However, if you provide access to or
distribute copies of a Project Gutenberg-tm work in a format other than
"Plain Vanilla ASCII" or other format used in the official version
posted on the official Project Gutenberg-tm web site (www.gutenberg.org),
you must, at no additional cost, fee or expense to the user, provide a
copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon
request, of the work in its original "Plain Vanilla ASCII" or other
form. Any alternate format must include the full Project Gutenberg-tm
License as specified in paragraph 1.E.1.
1.E.7. Do not charge a fee for access to, viewing, displaying,
performing, copying or distributing any Project Gutenberg-tm works
unless you comply with paragraph 1.E.8 or 1.E.9.
1.E.8. You may charge a reasonable fee for copies of or providing
access to or distributing Project Gutenberg-tm electronic works provided
that
- You pay a royalty fee of 20% of the gross profits you derive from
the use of Project Gutenberg-tm works calculated using the method
you already use to calculate your applicable taxes. The fee is
owed to the owner of the Project Gutenberg-tm trademark, but he
has agreed to donate royalties under this paragraph to the
Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payments
must be paid within 60 days following each date on which you
prepare (or are legally required to prepare) your periodic tax
returns. Royalty payments should be clearly marked as such and
sent to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation at the
address specified in Section 4, "Information about donations to
the Project Gutenberg Literary Archive Foundation."
- You provide a full refund of any money paid by a user who notifies
you in writing (or by e-mail) within 30 days of receipt that s/he
does not agree to the terms of the full Project Gutenberg-tm
License. You must require such a user to return or
destroy all copies of the works possessed in a physical medium
and discontinue all use of and all access to other copies of
Project Gutenberg-tm works.
- You provide, in accordance with paragraph 1.F.3, a full refund of any
money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the
electronic work is discovered and reported to you within 90 days
of receipt of the work.
- You comply with all other terms of this agreement for free
distribution of Project Gutenberg-tm works.
1.E.9. If you wish to charge a fee or distribute a Project Gutenberg-tm
electronic work or group of works on different terms than are set
forth in this agreement, you must obtain permission in writing from
both the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and Michael
Hart, the owner of the Project Gutenberg-tm trademark. Contact the
Foundation as set forth in Section 3 below.
1.F.
1.F.1. Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable
effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread
public domain works in creating the Project Gutenberg-tm
collection. Despite these efforts, Project Gutenberg-tm electronic
works, and the medium on which they may be stored, may contain
"Defects," such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or
corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual
property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a
computer virus, or computer codes that damage or cannot be read by
your equipment.
1.F.2. LIMITED WARRANTY, DISCLAIMER OF DAMAGES - Except for the "Right
of Replacement or Refund" described in paragraph 1.F.3, the Project
Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project
Gutenberg-tm trademark, and any other party distributing a Project
Gutenberg-tm electronic work under this agreement, disclaim all
liability to you for damages, costs and expenses, including legal
fees. YOU AGREE THAT YOU HAVE NO REMEDIES FOR NEGLIGENCE, STRICT
LIABILITY, BREACH OF WARRANTY OR BREACH OF CONTRACT EXCEPT THOSE
PROVIDED IN PARAGRAPH 1.F.3. YOU AGREE THAT THE FOUNDATION, THE
TRADEMARK OWNER, AND ANY DISTRIBUTOR UNDER THIS AGREEMENT WILL NOT BE
LIABLE TO YOU FOR ACTUAL, DIRECT, INDIRECT, CONSEQUENTIAL, PUNITIVE OR
INCIDENTAL DAMAGES EVEN IF YOU GIVE NOTICE OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
1.F.3. LIMITED RIGHT OF REPLACEMENT OR REFUND - If you discover a
defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can
receive a refund of the money (if any) you paid for it by sending a
written explanation to the person you received the work from. If you
received the work on a physical medium, you must return the medium with
your written explanation. The person or entity that provided you with
the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a
refund. If you received the work electronically, the person or entity
providing it to you may choose to give you a second opportunity to
receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy
is also defective, you may demand a refund in writing without further
opportunities to fix the problem.
1.F.4. Except for the limited right of replacement or refund set forth
in paragraph 1.F.3, this work is provided to you 'AS-IS' WITH NO OTHER
WARRANTIES OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO
WARRANTIES OF MERCHANTIBILITY OR FITNESS FOR ANY PURPOSE.
1.F.5. Some states do not allow disclaimers of certain implied
warranties or the exclusion or limitation of certain types of damages.
If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the
law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be
interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by
the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any
provision of this agreement shall not void the remaining provisions.
1.F.6. INDEMNITY - You agree to indemnify and hold the Foundation, the
trademark owner, any agent or employee of the Foundation, anyone
providing copies of Project Gutenberg-tm electronic works in accordance
with this agreement, and any volunteers associated with the production,
promotion and distribution of Project Gutenberg-tm electronic works,
harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees,
that arise directly or indirectly from any of the following which you do
or cause to occur: (a) distribution of this or any Project Gutenberg-tm
work, (b) alteration, modification, or additions or deletions to any
Project Gutenberg-tm work, and (c) any Defect you cause.
Section 2. Information about the Mission of Project Gutenberg-tm
Project Gutenberg-tm is synonymous with the free distribution of
electronic works in formats readable by the widest variety of computers
including obsolete, old, middle-aged and new computers. It exists
because of the efforts of hundreds of volunteers and donations from
people in all walks of life.
Volunteers and financial support to provide volunteers with the
assistance they need are critical to reaching Project Gutenberg-tm's
goals and ensuring that the Project Gutenberg-tm collection will
remain freely available for generations to come. In 2001, the Project
Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure
and permanent future for Project Gutenberg-tm and future generations.
To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation
and how your efforts and donations can help, see Sections 3 and 4
and the Foundation web page at https://www.pglaf.org.
Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive
Foundation
The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non profit
501(c)(3) educational corporation organized under the laws of the
state of Mississippi and granted tax exempt status by the Internal
Revenue Service. The Foundation's EIN or federal tax identification
number is 64-6221541. Its 501(c)(3) letter is posted at
https://pglaf.org/fundraising. Contributions to the Project Gutenberg
Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent
permitted by U.S. federal laws and your state's laws.
The Foundation's principal office is located at 4557 Melan Dr. S.
Fairbanks, AK, 99712., but its volunteers and employees are scattered
throughout numerous locations. Its business office is located at
809 North 1500 West, Salt Lake City, UT 84116, (801) 596-1887, email
business@pglaf.org. Email contact links and up to date contact
information can be found at the Foundation's web site and official
page at https://pglaf.org
For additional contact information:
Dr. Gregory B. Newby
Chief Executive and Director
gbnewby@pglaf.org
Section 4. Information about Donations to the Project Gutenberg
Literary Archive Foundation
Project Gutenberg-tm depends upon and cannot survive without wide
spread public support and donations to carry out its mission of
increasing the number of public domain and licensed works that can be
freely distributed in machine readable form accessible by the widest
array of equipment including outdated equipment. Many small donations
($1 to $5,000) are particularly important to maintaining tax exempt
status with the IRS.
The Foundation is committed to complying with the laws regulating
charities and charitable donations in all 50 states of the United
States. Compliance requirements are not uniform and it takes a
considerable effort, much paperwork and many fees to meet and keep up
with these requirements. We do not solicit donations in locations
where we have not received written confirmation of compliance. To
SEND DONATIONS or determine the status of compliance for any
particular state visit https://pglaf.org
While we cannot and do not solicit contributions from states where we
have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition
against accepting unsolicited donations from donors in such states who
approach us with offers to donate.
International donations are gratefully accepted, but we cannot make
any statements concerning tax treatment of donations received from
outside the United States. U.S. laws alone swamp our small staff.
Please check the Project Gutenberg Web pages for current donation
methods and addresses. Donations are accepted in a number of other
ways including including checks, online payments and credit card
donations. To donate, please visit: https://pglaf.org/donate
Section 5. General Information About Project Gutenberg-tm electronic
works.
Professor Michael S. Hart was the originator of the Project Gutenberg-tm
concept of a library of electronic works that could be freely shared
with anyone. For thirty years, he produced and distributed Project
Gutenberg-tm eBooks with only a loose network of volunteer support.
Project Gutenberg-tm eBooks are often created from several printed
editions, all of which are confirmed as Public Domain in the U.S.
unless a copyright notice is included. Thus, we do not necessarily
keep eBooks in compliance with any particular paper edition.
Most people start at our Web site which has the main PG search facility:
https://www.gutenberg.org
This Web site includes information about Project Gutenberg-tm,
including how to make donations to the Project Gutenberg Literary
Archive Foundation, how to help produce our new eBooks, and how to
subscribe to our email newsletter to hear about new eBooks.