
Erika S. Freudiges Lachen.

Erika S. Schalkhaftes Lachen.

Erika S. Geschmeicheltes Lächeln.
This eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this eBook or online at www.gutenberg.org
Title: Geschichte der Neueren Deutschen Chirurgie
Author: Ernst Georg Ferdinand Küster
Release Date: April 24, 2012 [eBook #39529]
Language: German
Character set encoding: ISO-8859-1
***START OF THE PROJECT GUTENBERG EBOOK GESCHICHTE DER NEUEREN DEUTSCHEN CHIRURGIE***
Anmerkungen zur Transkription
Die Originalschreibweise und kleinere Inkonsistenzen in der Rechtschreibung und Formatierung wurden beibehalten. Offensichtliche Druckfehler wurden korrigiert. Änderungen sind im Text gekennzeichnet, der Originaltext erscheint beim Überfahren mit der Maus.
VERLAG VON FERDINAND ENKE IN STUTTGART.
NEUE DEUTSCHE CHIRURGIE
Herausgegeben von P. v. Bruns.
Die „Neue Deutsche Chirurgie“ ist als Fortsetzung der „Deutschen Chirurgie“ von dem gegenwärtigen Herausgeber dieses monumentalen, dem Abschlusse entgegengehenden Sammelwerkes, Exzellenz v. Bruns, begründet worden.
Die „Neue Deutsche Chirurgie“ erscheint als eine fortlaufende zwanglose Sammlung von Monographien über ausgewählte Kapitel der modernen Chirurgie. Das beigegebene Verzeichnis der bereits erschienenen sowie in Vorbereitung befindlichen Bände zeigt, daß von den berufensten Autoren die neuzeitlichen Errungenschaften der Chirurgie sowie die neuerdings der chirurgischen Behandlung zugänglich gemachten Gebiete in sorgfältiger Auswahl dargestellt werden. Nach Bedarf werden immer neue Bände hinzugefügt.
Von der Kritik ist das Erscheinen der „Neuen Deutschen Chirurgie“ mit Freude begrüßt und dem großen Werke ein weitgehendes Bedürfnis zuerkannt worden. Die bisher erschienenen Bände werden sämtlich dem Fachmann als willkommen und unentbehrlich manche auch dem praktischen Arzte angelegentlich empfohlen.
Die „Neue Deutsche Chirurgie“ hat in der kurzen Zeit ihres Erscheinens bereits einen außerordentlich großen Kreis von Lesern und besonders von Abonnenten sich erworben, so daß zu hoffen ist, daß die Sammlung sich bald jedem Chirurgen als unentbehrlich erweisen wird.
Im Abonnement auf die „Neue Deutsche Chirurgie“ — es ist für dieses ein etwa 20 Prozent niedrigerer Bandpreis angesetzt — wird den Chirurgen die Gelegenheit geboten, allmählich eine wertvolle Fachbibliothek in sorgfältigster Auswahl und Bearbeitung zu erwerben.
Ferdinand Enke, Verlagsbuchhandlung
Stuttgart.
Bisher erschienene Bände:
1. Band. Die Nagelextension der Knochenbrüche. Von Privatdoz. Dr. F. Steinmann. Mit 136 Textabbildungen. Lex. 8o. 1912. Preis für Abonnenten geh. M. 6.80, in Leinw. geb. M. 8.20. Einzelpreis geh. M. 8.40, in Leinw. geb. M. 9.80.
2. Band. Chirurgie der Samenblasen. Von Prof. Dr. F. Voelcker. Mit 46 Textabbildungen. Lex. 8o. 1912. Preis für Abonnenten geh. M. 7.80, in Leinw. geb. M. 9.20. Einzelpreis geh. M. 9.60, in Leinw. geb. M. 11.—
3. Band. Chirurgie der Thymusdrüse. Von Dr. Heinrich Klose. Mit 99 Textabbildungen, 2 Kurven und 3 farbigen Tafeln. Lex. 8o. 1912. Preis für Abonnenten geh. M. 10.40, in Leinw. geb. M. 11.80. Einzelpreis geh. M. 12.80, in Leinw. geb. M. 14.20.
4. Band. Die Verletzungen der Leber und der Gallenwege. Von Professor Dr. F. Thöle. Lex. 8o. 1912. Preis für Abonnenten geh. M. 6.80, in Leinw. geb. M. 8.20. Einzelpreis geh. M. 8.40, in Leinw. geb. M. 9.80.
5. Band. Die Allgemeinnarkose. Von Professor Dr. M. v. Brunn. Mit 91 Textabbildungen. Lex. 8o. 1913. Preis für Abonnenten geh. M. 15.—, in Leinw. geb. M. 16.40. Einzelpreis geh. M. 18.60, in Leinw. geb. M. 20.—
6. Band. Die Chirurgie der Nierentuberkulose. Von Privatdozent Dr. H. Wildbolz. Mit 22 teils farbigen Textabbildungen. Lex. 8o. 1913. Preis für Abonnenten geh. M. 7.—, in Leinw. geb. M. 8.40. Einzelpreis geh. M. 8.60, in Leinw. geb. M. 10.—
7. Band. Chirurgie der Lebergeschwülste. Von Professor Dr. F. Thöle. Mit 25 Textabbildungen. Lex. 8o. 1913. Preis für Abonnenten geh. M. 12.—, in Leinw. geb. M. 13.40. Einzelpreis geh. M. 14.—, in Leinw. geb. M. 15.40.
8. Band. Chirurgie der Gallenwege. Von Professor Dr. H. Kehr. Mit 137 Textabbildungen, einer farbigen Tafel und einem Bildnis Carl Langenbuchs. Lex. 8o. 1913. Preis für Abonnenten geh. M. 32.—, in Leinw. geb. M. 34.—. Einzelpreis geh. M. 40.—, in Leinw. geb. M. 42.—
9. Band. Chirurgie der Nebenschilddrüsen (Epithelkörper). Von Professor Dr. N. Guleke. Mit 22 teils farbigen Textabbildungen. Lex. 8o. 1913. Preis für Abonnenten geh. M. 7.—, in Leinw. geb. M. 8.40. Einzelpreis geh. M. 8.40, in Leinw. geb. M. 9.80.
10. Band. Die Krankheiten des Knochensystems im Kindesalter. Von Professor Dr. Paul Frangenheim. Mit 95 Textabbildungen. Lex. 8o. 1913. Preis für Abonnenten geh. M. 11.80, in Leinw. geb. M. 13.20. Einzelpreis geh. M. 14.80, in Leinw. geb. M. 16.20.
11. Band. Allgemeine Chirurgie der Gehirnkrankheiten. I. Teil. Bearbeitet von Professor Dr. A. Knoblauch, Professor Dr. K. Brodmann und Priv.-Doz. Dr. A. Hauptmann. Redigiert von Professor Dr. F. Krause. Mit 149 teils farbigen Abbildungen und 12 Kurven. Lex. 8o. 1914. Preis für Abonnenten M. 20.—, in Leinw. geb. M. 21.60. Einzelpreis geh. M. 24.—, in Leinw. geb. M. 25.60.
12. Band. Allgemeine Chirurgie der Gehirnkrankheiten. II. Teil. Bearbeitet von Professor Dr. G. Anton, Professor Dr. L. Bruns, Professor Dr. F. Haasler, Priv.-Doz. Dr. A. Hauptmann, Dr. W. Holzmann, Professor Dr. F. Krause, Professor Dr. F. W. Müller, Professor Dr. M. Nonne und Professor Dr. Artur Schüller. Redigiert von Professor Dr. F. Krause. Mit 106 teils farbigen Abbildungen. Lex. 8o. 1914. Preis für Abonnenten M. 17.20, in Leinw. geb. M. 18.80. Einzelpreis geh. M. 21.—, in Leinw. geb. M. 22.60.
13. Band. Die Sportverletzungen. Von Priv.-Doz. Dr. G. Freiherrn v. Saar. Mit 53 Textabbildungen. Lex. 8o. 1914. Preis für Abonnenten geh. M. 11.—, in Leinw. geb. M. 12.40. Einzelpreis geh. M. 13.40, in Leinw. geb. M. 14.80.
14. Band. Kriegschirurgie in den Balkankriegen 1912/13. Bearbeitet von Alfred Exner, Hans Heyrovsky, Guido Kronenfels und Cornelius Ritter von Massari. Redigiert von Alfred Exner. Mit 51 Textabbildungen. Lex. 8o. 1915. Preis für Abonnenten geh. M. 10.—, in Leinw. geb. M. 11.40. Einzelpreis geh. M. 11.60, in Leinw. geb. M. 13.—
15. Band. Geschichte der neueren deutschen Chirurgie. Von Prof. Dr. Ernst Küster. Lex. 8o. 1915. Preis für Abonnenten geh. M. 4.40, in Leinw. geb. M. 5.60. Einzelpreis geh. M. 5.20, in Leinw. geb. M. 6.40.
In Vorbereitung befindliche Bände:
Preis für Abonnenten geh. M. 4.40, in Leinw. geb. M. 5.60.
Einzelpreis geh. M. 5.20, in Leinw. geb. M. 6.40.
NEUE
DEUTSCHE CHIRURGIE
(HERAUSGEGEBEN VON)
P. von BRUNS in Tübingen.
BEARBEITET VON
Albrecht-Tübingen, Anton-Halle, Apolant-Frankfurt a. M., Arndt-Berlin, Axhausen-Berlin, Baisch-Heidelberg, Bauereisen-Kiel, Becker-Rostock, Bernhard-St. Moritz, Bircher-Aarau, Borchard-Posen, Braun-Berlin, Brodmann-Tübingen, Brünings-Jena, v. Brunn-Bochum, Brunner-Münsterlingen, Bruns-Hannover, Burckhardt-Berlin, Cassirer-Berlin, Chiari-Wien, Clairmont-Wien, Dönitz-Berlin, Dreyer-Breslau, v. Eiselsberg-Wien, Exner-Wien, Fabian-Leipzig, Fehling-Straßburg, Finckh-Stuttgart, Frangenheim-Cöln, Friedrich-Königsberg i. Pr., Fritsch-Breslau, Glässner-Berlin, Goebel-Breslau, Gottstein-Breslau, Graser-Erlangen, Grashey-München, Groedel-Nauheim, Guleke-Straßburg, Haasler-Halle, v. Hacker-Graz, Häcker-Essen, Härtel-Berlin, Hauptmann-Freiburg, Heineke-Leipzig, Helbing-Berlin, Henschen-Zürich, Heymann-Berlin, Hildebrand-Berlin, Hinsberg-Breslau, Hirschel-Heidelberg, Hohmeier-Marburg, Holzmann-Hamburg, Hosemann-Rostock, Iselin-Basel, Kausch-Berlin, Kehr-Berlin, Klose-Frankfurt a. M., Knoblauch-Frankfurt a. M., Kocher-Bern, Konjetzny-Kiel, Krause-Berlin, Krauss-Cöln, Kreuter-Erlangen, Kümmell-Hamburg, Küster-Berlin, Küttner-Breslau, Lampé-München, Lange-München, Leser-Frankfurt a. M., Levy-Breslau, Lexer-Jena, v. Lichtenberg-Straßburg, Linser-Tübingen, Lotheissen-Wien, Lubarsch-Kiel, Machol-Erfurt, Madelung-Straßburg, Mayer-Berlin, Mayrhofer-Innsbruck, Melchior-Breslau, Momburg-Bielefeld, Most-Breslau, Müller-Rostock, Müller-Tübingen, O. Nägeli-Tübingen, Th. Nägeli-Zürich, Nonne-Hamburg, Nordmann-Berlin, Passow-Berlin, Payr-Leipzig, De Quervain-Basel, Ranzi-Wien, Reich-Tübingen, Ritter-Berlin, Ritter-Posen, Rollier-Leysin, Ruge-Frankfurt a. O., v. Saar-Innsbruck, Sauerbruch-Zürich, Schlössmann-Tübingen, Schmieden-Halle a. S., Schüller-Wien, Sonnenburg-Berlin, Spitzy-Graz, Steinmann-Bern, Stich-Göttingen, Stieda-Halle a. S., Stierlin-Basel, Tandler-Wien, Thöle-Hannover, Tschmarke-Magdeburg, Voelcker-Heidelberg, Wendriner-Wien, Werner-Heidelberg, Wildbolz-Bern, Wilms-Heidelberg, Wrede-Jena, Wrobel-Breslau, Zesas-Basel, Zuckerkandl-Wien.
15. Band:
Geschichte der neueren deutschen Chirurgie.
Von
Dr. ERNST KÜSTER,
o. ö. Professor der Chirurgie an der Universität Marburg,
in Charlottenburg.
VERLAG VON FERDINAND ENKE IN STUTTGART.
1915.
VON
DR. ERNST KÜSTER,
o. ö. PROFESSOR DER CHIRURGIE AN DER UNIVERSITÄT MARBURG,
in CHARLOTTENBURG.
VERLAG VON FERDINAND ENKE IN STUTTGART.
1915.
ALLE RECHTE, INSBESONDERE DAS DER ÜBERSETZUNG, VORBEHALTEN.
COPYRIGHT 1915 BY FERDINAND ENKE, PUBLISHER, STUTTGART.
Druck der Union Deutsche Verlagsgesellschaft in Stuttgart.
DER
DEUTSCHEN GESELLSCHAFT FÜR CHIRURGIE
GEWIDMET.
| Seite | |
| Vorwort | XV |
| Erster Abschnitt. | |
| Der Zustand der Chirurgie vor Einführung der antiseptischen Wundbehandlung. | |
| Kapitel I. Zustand der Gesamtmedizin vor der antiseptischen Wundbehandlung | 1 |
| Beschreibende Anatomie | 1 |
| Topographische Anatomie. Entwicklungsgeschichte | 2 |
| Feinere Anatomie und Physiologie | 2 |
| Pathologische Anatomie | 2 |
| Gesundheitslehre | 3 |
| Kapitel II. Die Krankenanstalten vor der antiseptischen Wundbehandlung | 3 |
| Alte Krankenhäuser. Massivbau | 3 |
| Das Pavillonsystem | 4 |
| Baracken | 5 |
| Leinwandzelte | 6 |
| Döckersche Zeltbaracke | 7 |
| Das Krankenzerstreuungssystem | 8 |
| Kapitel III. Die Krankenanstalten vor der antiseptischen Wundbehandlung | 8 |
| Die älteren Wundbehandlungsmethoden | 8 |
| Salben und Pflaster | 9 |
| Offene Wundbehandlung | 9 |
| Charpieverbände | 9 |
| Die Wundkrankheiten | 10 |
| Wundfäulnis, Sepsis | 10 |
| Eiterfieber, Pyämie | 11 |
| Hospitalbrand | 12 |
| Wundstarrkrampf, Tetanus | 13 |
| Wundrose, Erysipelas | 14 |
| Zustände auf älteren chirurgischen Abteilungen | 15 |
| Zweiter Abschnitt. | |
| Joseph Listers antiseptische Wundbehandlung. | |
| Kapitel IV. Die Vorläufer Listers | 18 |
| Vorarbeiten. Klinische Beobachtung | 18 |
| Der Geburtshelfer Semmelweis | 18 |
| Gay-Lussac. Der Sauerstoff als Fäulniserreger | 19 |
| Schwanns Begründung der Keimlehre | 19 |
| Pasteurs Versuche über Zersetzung | 20 |
| Kapitel V. Listers Übertragung der Keimlehre auf die Chirurgie[xii] | 20 |
| Behandlung offener Knochenbrüche | 23 |
| Behandlung der Abszesse | 24 |
| Die Unterbindungsfäden | 24 |
| Antiseptischer Dauerverband | 25 |
| Der Zerstäuber (Spray) | 26 |
| Widerstand gegen das Verfahren in England und Frankreich | 28 |
| Dritter Abschnitt. | |
| Der Einzug der Antisepsis in die deutsche Chirurgie. Die Asepsis. Das Langenbeckhaus. | |
| Kapitel VI. Einführung und Ausbau der antiseptischen Wundbehandlung in Deutschland | 30 |
| Vortrag des Stabsarztes A. W. Schultze über Antisepsis | 30 |
| Gründung der Deutschen Gesellschaft für Chirurgie | 31 |
| Richard Volkmanns Tätigkeit | 32 |
| Die Bakterienkunde als Hilfsmittel der Chirurgie | 33 |
| Robert Koch. Ätiologie der Wundinfektionskrankheiten | 34 |
| Bedeutung der Bakterien für die praktische Chirurgie | 36 |
| Fehleisen, Rosenbach | 37 |
| Nicolaier | 38 |
| Ausbau der antiseptischen Wundbehandlung | 38 |
| Änderungen an dem Listerschen Verfahren | 39 |
| Schedes feuchter Blutschorf | 42 |
| Kapitel VII. Einführung der Asepsis | 43 |
| Veranlassung zur Einführung der Asepsis | 44 |
| Technik der Asepsis nach Schimmelbusch | 45 |
| Wundschutz und Händeschutz | 45 |
| Kapitel VIII. Die Gründung des Langenbeckhauses | 46 |
| Das Langenbeckhaus und die Kaiserin Augusta | 46 |
| Das Langenbeck-Virchow-Haus | 51 |
| Vierter Abschnitt. | |
| Wandlungen und Eroberungen auf dem Gebiete der allgemeinen Chirurgie. | |
| Kapitel IX. Wandlungen der allgemeinen Therapie | 52 |
| Die Methoden zur Herbeiführung der Schmerzlosigkeit | 52 |
| Allgemeine Gefühllosigkeit | 53 |
| Die örtliche Empfindungslosigkeit | 56 |
| Die künstliche Blutleere | 58 |
| Andere Methoden der Blutersparung | 58 |
| Hyperämie als Heilmittel | 59 |
| Die Durchleuchtung nach Röntgen | 59 |
| Radium und Mesothorium | 60 |
| Veränderungen der operativen Technik | 60 |
| Veränderung der Vorstellungen über Wundheilung | 61 |
| Kapitel X. Wandlungen der Kriegschirurgie | 62 |
| Schußwunden und Kriegschirurgie | 62 |
| Verbesserung und Förderung der Krankenpflege | 65 |
| Krankenzerstreuung auf dem Schlachtfelde | 66 |
| Die Aktinographie im Kriege | 68 |
| Kapitel XI. Wandlungen auf dem Gebiete spezifischer Infektionskrankheiten und bösartiger Neubildungen | 69 |
| Wunden in tuberkulösen Geweben | 69 |
| Robert Kochs Tuberkulin | 71 |
| Die Serumtherapie[xiii] | 76 |
| v. Behrings Diphtherieheilserum | 77 |
| Heilserum gegen Wundstarrkrampf | 77 |
| Lepra, Aktinomykose | 78 |
| Syphilis, Gonorrhöe, weicher Schanker | 78 |
| Hülsenwurm | 79 |
| Bösartige Neubildungen | 79 |
| Fünfter Abschnitt. | |
| Eroberungen auf dem Gebiete der speziellen Chirurgie. | |
| Kapitel XII. Ausbau der Eingriffe an schon bisher zugänglichen Organen | 81 |
| Die plastischen Operationen | 81 |
| Eingriffe an großen Gefäßen | 83 |
| Augenheilkunde und Ohrenheilkunde | 84 |
| Nasen-, Rachen- und Kehlkopfkrankheiten | 85 |
| Die Gynäkologie | 86 |
| Die Chirurgie der Harnorgane | 86 |
| Erkrankungen der Knochen und Gelenke | 88 |
| Gelenkresektionen. Orthopädie | 89 |
| Kapitel XIII. Neue Eingriffe an bisher unzugänglichen Organen | 89 |
| Die serösen Körperhöhlen | 89 |
| Bauchchirurgie | 90 |
| Milz, Leber, Gallenblase | 90, 91 |
| Bauchspeicheldrüse | 91 |
| Magendarmkanal | 92 |
| Entzündung des Wurmfortsatzes | 94 |
| Bauchbrüche | 95 |
| Chirurgie der Brusthöhle | 96 |
| Chirurgie des Schädelinneren | 98 |
| Chirurgie des Rückenmarkes | 98 |
| Erkrankungen der Schild- und Thymusdrüse, der Hypophysis cerebri | 99, 100 |
| Sechster Abschnitt. | |
| Entwicklung der chirurgischen Literatur in Deutschland. | |
| Kapitel XIV. | 101 |
| Schlußwort | 106 |
| Namenverzeichnis | 107 |
Als mir im Jahre 1911 seitens meines Freundes Paulv. v. Bruns die Aufforderung zuging, eine Geschichte der neueren deutschen Chirurgie zu schreiben, da hat es erst längerer Überlegung bedurft, ehe ich mich zur Annahme des Anerbietens zu entschließen vermochte. Vor allen Dingen war es mein Alter, welches immer wieder neue Zweifel darüber wachrief, ob zu einem solchen Unternehmen noch die rechte Eignung in mir sei. Und zu diesen persönlichen gesellten sich weiterhin schwerwiegende sachliche Bedenken, die ich kurz berühren muß.
Geschichtschreibung ist nichts als die Wiedergabe des Bildes, unter welchem die Ereignisse früherer Zeiten sich in des Berichterstatters Seele spiegeln. Mit anderen Worten: Keine geschichtliche Darstellung kann rein objektiv bleiben, sondern sie muß immer, mehr oder weniger ausgeprägt, einen persönlichen Stempel tragen, und zwar um so deutlicher, je mehr sie sich der Gegenwart nähert. Handelt es sich aber gar um selbsterlebte Dinge, so wird es schier unmöglich, über der Parteien Haß und Gunst gänzlich hinwegzusehen, Licht und Schatten in gerechter Weise zu verteilen.
Wenn ich dennoch zu dem Entschlusse gekommen bin, die Arbeit zu übernehmen, so geschah es zunächst, weil ich als einer aus der sehr geringen Zahl der noch lebenden Begründer der Deutschen Gesellschaft für Chirurgie, unter denen ich nahezu der älteste bin, eine gewisse Verpflichtung fühlte, die noch sehr lebhaften Erinnerungen einer großen Zeit nicht mit mir zu Grabe tragen zu lassen. Aber es reizte mich auch, eine Geschichte zu schreiben, die ich selber als Geschichte erlebt habe, einem Zeitabschnitte und einer Anzahl von Männern gerecht zu werden, die ich noch heute von dem goldigen Schimmer der Größe und des Ruhmes umstrahlt sehe, ein Bild von dem gewaltigen Strome hingebender Begeisterung zu entwerfen, der vor wenigen Jahrzehnten unser ganzes wissenschaftliches Leben zu durchfluten begann. Wenn es mir gelungen sein sollte, in der Seele des Lesers davon eine Vorstellung zu erwecken, so würde ich meine Aufgabe als erfüllt ansehen.
Das Büchlein, welches sich Häsers im Jahre 1879 als erste Lieferung der „Deutschen Chirurgie“ erschienener, knapp gehaltener Geschichte der Chirurgie unmittelbar anschließt, umfaßt nur eine kurze Zeitspanne von kaum 50 Jahren. Angesichts des mehr als 2000 Jahre alten Bestehens unserer Wissenschaft mag es gewagt und selbst anmaßend erscheinen, eine zeitlich so begrenzte Entwicklungsperiode auch noch räumlich dadurch einzuengen, daß die deutsche Chirurgie in den Vordergrund gestellt und die fremdländische nur soweit berührt wird, als sie auf den Gang des Emporblühens in unserem Vaterlande von maßgebendem Einflusse gewesen ist; denn die geistigen Güter gehören allen Völkern gemeinsam[xvi] und keines gibt es, welches in irgend einer Wissenschaft den ganzen Ruhm des Erfinders und Fortbildners für sich allein in Anspruch nehmen könnte. Trotzdem läßt sich diese doppelte Beschränkung wohl rechtfertigen. Zeitlich gewiß: denn die fragliche Periode ist nicht nur durch einen gewaltigen Wall des Erkennens von früheren Zeitläuften getrennt, sondern sie bringt auch eine so vollkommene Um- und Neuformung sowohl der Chirurgie wie der Gesamtmedizin, daß sich in deren ganzer Geschichte nichts auch nur entfernt Ähnliches vorfindet. Und räumlich gleichfalls, obwohl der Anstoß zu dieser geistigen Bewegung von einer Großartigkeit ohnegleichen nicht aus Deutschland, sondern aus dem Auslande kam; denn durch die schnelle Aufnahme, Weiterentwicklung und Vervollkommnung der Neuerung hat Deutschland sich vor allen anderen Ländern das Recht wenigstens der Patenschaft an der Wundbehandlung erworben, zumal da diese vielfach erst in deutschem Gewande und in deutscher Umformung den übrigen Kulturvölkern vertraut geworden ist. Alle übrigen Erfindungen, durch welche späterhin die Chirurgie bereichert wurde, sind fast ausnahmslos deutschen Ursprunges. So kann es denn unmöglich als Überhebung gedeutet werden, wenn der Deutsche die Geschichte seiner Wissenschaft in deutscher Umrahmung zur Anschauung zu bringen sucht.
Es mag auffallen, daß die in den Vordergrund tretenden Persönlichkeiten nicht überall in gleicher Ausführlichkeit behandelt sind, manche Verdienste sogar unbesprochen geblieben sein mögen. Insbesondere sind die noch lebenden Chirurgen meist nur kurz erwähnt, bei der Besprechung erheblicher Fortschritte ist oft nur ein Name genannt, des Mannes nämlich, der einen neuen Gedanken zuerst faßte, oder ihn zuerst in die Tat umsetzte, während spätere Umformungen und Erweiterungen ohne Nennung ihrer Urheber einfach aufgezählt werden. Man darf mir daraus nicht den Vorwurf machen, ein laudator temporis acti zu sein. Der geschichtliche Sinn verbietet eingehende Betrachtung noch lebender Persönlichkeiten, die als solche nicht historisch sein können, da sie den natürlichen Abschluß noch nicht gefunden haben, wenn auch ihre Taten schon der Geschichte angehören. Besprochen sind deshalb auch für gewöhnlich nicht die vorübergehenden Erscheinungen, selbst wenn sie für einige Zeit Aufsehen erregt haben, sondern nur die bleibenden Errungenschaften. Daß aber die Beurteilung dessen, was erheblich ist, mindestens teilweise dem subjektiven Ermessen des Berichterstatters überlassen bleiben muß, liegt auf der Hand. Wenn daher fehlerhafte Auslassungen auf der einen und Übertreibungen auf der anderen Seite gefunden werden, so hat es wenigstens nicht an meinem guten Willen gelegen, sie zu vermeiden.
Charlottenburg, den 17. Mai 1914.
Ernst Küster.
Das gegenwärtig lebende und wirkende Geschlecht der Chirurgen hat kaum noch eine Vorstellung von den Zuständen, welchen durch den bald nach der Mitte des 19. Jahrhunderts einsetzenden gewaltigen Umschwung ein Ende gemacht wurde. Seine Bedeutung, welche darin besteht, daß er in dem kurzen Zeitraume eines Menschenalters alle Fehler und Irrungen von zwei Jahrtausenden in der Behandlung der Wunden gutzumachen gewußt hat, kann aber erst völlig erfaßt werden, wenn wir zunächst nicht nur auf den Zustand der Chirurgie, sondern auch auf den der gesamten Medizin jener Zeit einen prüfenden Rückblick werfen.
Die beschreibende Anatomie war seit Andreas Vesalius die selbstverständliche Grundlage der Chirurgie geblieben, so sehr, daß ein guter Chirurg ohne genaue anatomische Kenntnisse undenkbar gewesen wäre. Eine natürliche Folge war, daß nicht wenige der älteren Chirurgen rein anatomische Untersuchungen veröffentlichten, oder daß sie gar, wie Konrad Martin Langenbeck, Viktor Bruns und Adolf Bardeleben, erst von der Anatomie zur Chirurgie übergingen. Aber an Lehrbüchern der Anatomie war die deutsche Literatur in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts ziemlich arm; und auch die Lehreinrichtungen für dies Fach, sowie die Art des Unterrichtes ließen in Deutschland sehr viel, zuweilen fast alles zu wünschen übrig. Es waren zwei Männer, welche nahezu gleichzeitig Wandel schufen. Joseph Hyrtl in Prag, später in Wien, wurde mit seinem anziehend geschriebenen, aber in gedrängter Kürze gehaltenen Lehrbuche, welches von 1846 bis 1884 in 17 Auflagen erschienen ist, den meisten deutschen Studenten der Medizin ein zuverlässiger Führer durch die Geheimnisse des menschlichen Körpers. Neben ihm trat Jakob Henle in Zürich, später in Göttingen, im Jahre 1841 mit seiner Allgemeinen Anatomie und von 1855 an mit einem überaus fleißigen dreibändigen Werke auf, welches durch zahlreiche Abbildungen erläutert, für den Chirurgen eine unerschöpfliche Fundgrube anatomischer Anschaulichkeit geworden ist.
Indessen trotz ihrer hohen Bedeutung für die Chirurgie hat die beschreibende[2] Anatomie nur selten neue Anregungen gegeben, zumal seit sie nach der Mitte des Jahrhunderts in der Anthropologie ein neues Feld der Betätigung suchte; denn so sehr letztere und mit ihr die Urgeschichte auch durch sie gefördert wurden, so fiel doch für die Chirurgie ein sichtbarer Nutzen zunächst nicht ab. In erheblichem Maße geschah dies aber durch die topographische Anatomie, deren geschickte und durchweg praktischen Zielen zugewandte Bearbeitung durch Joseph Hyrtl (seit 1847) diesen Zweig der menschlichen Anatomie in Deutschland erst einführte, soweit nicht Chirurgen bereits stückweise Bearbeitungen geliefert hatten. Er hat sich für die Chirurgie als überaus fruchtbar erwiesen. — Auch die Entwicklungsgeschichte wurde seit Robert Remaks Keimblätterlehre durch den Nachweis ihrer Beziehungen zu dem Aufbau einzelner Organe von immer steigender Bedeutung für die praktische Chirurgie.
Nicht das gleiche läßt sich von der feineren Anatomie und der Physiologie sagen. Denn obwohl die gegen Ende der dreißiger Jahre durch Schleiden und Schwann aufgestellte Zellenlehre und die Vervollkommnung der optischen Werkzeuge, zumal des Mikroskopes, eine völlige Umgestaltung der biologischen Anschauungen hervorgerufen hatten, obwohl seitdem alle Körperorgane aufs fleißigste durchforscht wurden, so kamen doch diese Ergebnisse der Chirurgie erst auf dem Umwege über die Physiologie und mehr noch der pathologischen Anatomie zugute. Die Physiologie nämlich, deren Kenntnis zwar von jedem gebildeten Chirurgen vorausgesetzt werden mußte und deren Methoden man in den sechziger Jahren auch für chirurgische Versuche an Tieren bereits zu verwenden begonnen hatte, konnte doch erst darin den vollen, befruchtenden Strom ihres Wissens der Chirurgie zuführen, als sichere Wundbehandlungsmethoden zu Entdeckungsreisen in solche Körpergegenden den Anreiz gaben, die bisher der Hand des Chirurgen verschlossen geblieben waren. Seitdem ging eine Wechselwirkung des Erkennens nicht nur von der Physiologie zur Chirurgie, sondern auch von dieser zu jener.
Viel früher als die Physiologie übte die pathologische Anatomie einen anregenden und belebenden Einfluß auf die Chirurgie aus. Mit Recht sagt Häser (1879), daß die Chirurgie unserer Tage, d. h. im Beginne der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, gleich allen übrigen Zweigen der Heilkunde den größten Teil ihres wissenschaftlichen Zuwachses der pathologischen Anatomie verdanke. Zweier Männer Namen werden mit diesem Aufschwunge für immer verknüpft bleiben. Es sind das Karl Rokitansky in Wien, wo er seit 1841 bis zu seinem Tode den Lehrstuhl der pathologischen Anatomie innehatte, und Rudolf Virchow, der, seit 1849 in Würzburg, seit 1856 als ordentlicher Professor der pathologischen Anatomie nach Berlin zurückberufen, nunmehr endgültig die Führung in dieser Wissenschaft übernahm. War durch die Arbeiten beider, zumal des letzteren, die pathologische Anatomie zu dem Range einer echten Naturwissenschaft erhoben worden, so geschah dies in noch reicherem Maße durch den Ausbau der mikroskopischen Pathologie die, durch Virchow allerlei phantastischen Deutungen entrückt, in seiner im Jahre 1858 erschienenen und bis zum Jahre 1871 in vier Auflagen weiter ausgebauten Zellularpathologie, welche zum ersten Male[3] den Lehrsatz: Omnis cellula e cellula aufstellte, eine feste und unverrückbare Grundlage erhalten hatte. Als eine weitere Frucht seiner Forschungen veröffentlichte der Verfasser vom Jahre 1863 an seine leider unvollendet gebliebenen „Krankhaften Geschwülste“. Eine Welle der Befruchtung ergoß sich von diesen Arbeiten aus auf die gesamte praktische Medizin, die, bisher im wesentlichen auf Erfahrungen am Krankenbette gestützt, nunmehr gleichfalls ihren Teil zu den die Medizin umgestaltenden naturwissenschaftlichen Bestrebungen beitrug. Auch für die Chirurgie gilt dies in vollem Umfange, seitdem der erst 29jährige Theodor Billroth als Assistent der Langenbeckschen Klinik und Privatdozent zu Berlin im Jahre 1858 zuerst den Versuch unternahm, in seinen „Beiträgen zur pathologischen Histologie“ die Forschungsergebnisse auf diesem Gebiete für die chirurgische Tätigkeit zu verwerten. In noch weiterem Umfange wirkte sein grundlegendes Werk: „Die allgemeine chirurgische Pathologie und Therapie in 50 Vorlesungen“ vom Jahre 1863, welches zahlreiche Auflagen erlebte und, in die meisten europäischen, selbst in asiatische Sprachen übersetzt, nicht wenig zu dem schnell sich steigernden Ansehen der deutschen Chirurgie im Auslande beitrug. In diesem Werke benutzte Billroth die durch Virchows Arbeiten gewonnenen Anschauungen in geistvoller Weise zu einer neuen Anordnung und Einteilung, sowie zu einer Zusammenfassung sämtlicher Erfahrungen der praktischen Chirurgie. Die hiermit angebahnten Fortschritte sind nur auf dem Unterbau der pathologischen Anatomie möglich geworden.
Die im Beginne der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts zwar nicht zuerst, aber nunmehr systematisch auftauchenden Bestrebungen auf dem Gebiete der Gesundheitslehre blieben zwar zunächst für die Chirurgie anscheinend ohne große Bedeutung, da sie sich, noch ohne die erst einige Jahrzehnte später erworbene Kenntnis der Krankheitserreger, d. h. ohne die Grundlage einer wissenschaftlichen Bakteriologie auf die Bekämpfung der Seuchen durch Verbesserung der Lebensbedingungen beschränkte. Immerhin wurden aber wertvolle Erfahrungen über Ernährung, Bauweise der Häuser und Wohnungen, öffentliche und private Badeeinrichtungen, Kanalisation und Abfuhr, Benutzung der Abfuhrwässer zur Berieselung öder und unfruchtbarer Landstrecken gesammelt, die freilich erst unter den seit 1878 auftretenden Fortschritten der Bakteriologie ihre volle Bedeutung erkennen ließen. Aber schon früh begannen diese Bestrebungen doch auch auf die Chirurgie nach zwei Richtungen hin einzuwirken, da sie einerseits die so wichtigen Wundinfektionskrankheiten mit in den Kreis ihrer Betrachtungen zogen, anderseits die für die Behandlungserfolge höchst bedeutungsvolle Anlage von Krankenhäusern einer neuen Richtung entgegenführten.
Die alten Krankenhäuser stellten unter dem Zwange der meist nur geringen, von Staat, Gemeinde oder Körperschaft zur Verfügung gestellten Summen je ein einziges steinernes Gebäude dar, welches[4] alle oder fast alle Räume für die Unterkunft und Behandlung kranker Menschen einheitlich oder nahezu einheitlich umschloß. So bequem dies für die in dem gleichen Gebäude untergebrachte Verwaltung war, so große Nachteile ergaben sich daraus für die Krankenbehandlung, indem genügende Zufuhr frischer Luft, sichere und unschädliche Beseitigung der Abfallstoffe und aller Unreinigkeiten, zuverlässige Absonderung ansteckender Krankheiten und manche andere Dinge ganz erheblich in den Hintergrund traten, auch bei der mangelnden Kenntnis von Entstehung und Übertragung solcher Leiden in den Hintergrund treten mußten. Vor allem machten sich diese ungünstigen Verhältnisse bei Verwundeten, insbesondere bei Kriegsverwundeten geltend. So konnte der englische Feldarzt Sir John Pringle schon im Jahre 1753 den Ausspruch tun, daß eine wesentliche Ursache der Krankheiten und Todesfälle bei einer Armee deren Hospitäler seien; und noch schärfer drückte sich das „Dekret des Nationalkonvents aus dem Jahre 1794 für die Hospitäler der französischen Armee“ in dem Satze aus: „Die Spitäler sind ebenso gesundheitswidrig wie die Moräste.“ Aber auch die öffentlichen Krankenanstalten des Friedens wiesen meistens derartige Zustände auf, daß die Menschheit sie als Pesthöhlen ansah und von einer fast wahnsinnigen Furcht vor ihnen erfüllt war. Es begreift sich das, wenn man von der Sterblichkeit höchst angesehener Anstalten hört. Die Langenbecksche Universitätsklinik zu Berlin hatte nach F. Busch im Jahre 1869 eine Sterblichkeit von 17⅓ % und nach Abzug der zahlreichen Fälle von Diphtherie immerhin noch eine solche von 10¾ %. J. Israel berichtet aus dem jüdischen Krankenhause von 1873 bis 1875, daß 62,5 % der operierten und 37,5 % der nichtoperierten Kranken von Pyämie befallen wurden. Im Berliner Diakonissenhause Bethanien starben nach eigenen Aufzeichnungen des Verfassers der Jahre 1868 und 1869 von 6 Amputationen des Oberarmes 5, von 5 Absetzungen des Vorderarmes 4, von 15 des Oberschenkels 11, meistens an Pyämie. — Noch schlimmer lauten ältere Erfahrungen aus dem Auslande. In einem 5jährigen Berichte aus den Pariser Hospitälern zählt Malgaigne 300 Todesfälle auf 560 Operationen und Pirogoff in seinem Jahresberichte von 1852/53 159 Todesfälle auf 400 große Operationen!
Diese unerhörten Zustände wandten sich erst zum Besseren, als die Vertreter der Gesundheitslehre mit immer wachsendem Nachdrucke den Bau neuer und den Fortschritten ihrer Wissenschaft angepaßter Krankenhäuser forderten, die natürlich viel größere Mittel in Anspruch nahmen, als man bisher für nötig gehalten hatte. Auch auf diesem Gebiete haben wir Rudolf Virchow viel zu danken, der in Wort und Schrift bei jeder Gelegenheit für die Forderung eintrat und bei dem großen Einfluß, den er als Abgeordneter und Mitglied des städtischen Verwaltungskörpers besaß, zunächst die Stadt Berlin und demnächst den preußischen Staat zur Herstellung zweckmäßiger Krankenhäuser zu bewegen wußte. So entstand das Pavillonsystem. In dem Bestreben, die Zusammenhäufung kranker Menschen nach Möglichkeit zu vermeiden und beste hygienische Bedingungen zu schaffen, erbaute man zahlreiche kleinere, höchstens zweistöckige Häuser, die, von Gärten umgeben und über eine große Bodenfläche verteilt, unter einer gemeinsamen Verwaltung standen. Es war nunmehr möglich geworden, ansteckende Krankheiten sicher abzusondern und die leichter erkrankten Menschen vor Ansteckung zu[5] schützen; ebenso die Genesenden durch langen Aufenthalt in frischer Luft einer schnelleren Erholung zuzuführen. Aber freilich brachte das Pavillonsystem neben seinen unleugbaren Vorzügen gegenüber dem alten Massivbau auch mancherlei Nachteile, ganz abgesehen davon, daß der Bau zahlreicher Einzelhäuser und deren zweckmäßige Einrichtung an sich erheblich größere Kosten verursachte. Der steigende Bodenwert großer und selbst mittlerer und kleiner Städte zwang Gemeinden und Verbände zu immer größeren und zuletzt fast unerschwinglichen Ausgaben, deren natürliche Folge es war, daß wenigstens die Neuanlagen in mehr oder weniger großer Entfernung vom Mittelpunkte der Stadt ihren Platz fanden. Macht eine solche Anordnung in Städten mit mehreren Krankenhäusern nicht viel aus, so treten bei wenigen oder gar sonst fehlenden Anstalten gleicher Art sofort große Übelstände hervor, da dann gleichzeitig für ausgiebige und leichte Verbindungen gesorgt werden muß; und selbst, wenn diese vorhanden sind, so bleibt die Notwendigkeit einer weiten und vielleicht umständlichen Krankenbeförderung nicht ganz ohne Bedenken. In den großen amerikanischen Städten, zumal in New York, ist man deshalb auf ein anderes Mittel verfallen, um den Massivbau hygienisch angemessener zu gestalten, als dies früher der Fall war: man baut die Krankenhäuser bis zu zwölf und mehr Stockwerken in die Höhe, legt die durch zahlreiche Aufzüge zu befördernden Kranken, nebst den Operationsräumen, in die obersten Stockwerke, um dem Straßenstaube zu entgehen, und benutzt die unteren Stockwerke als Verwaltungsräume. Das einzige schwere Bedenken gegen solche Anordnungen liegt in der nicht zu unterschätzenden Feuersgefahr. Auch in Deutschland ist man seit allgemeiner Einführung zuverlässiger Wundbehandlungsmethoden vielfach von der ganz strengen Durchführung des Pavillonsystems zurückgekommen und zu einem mehr gemischten Systeme übergegangen. Es geschieht dies in der Weise, daß ein großer Massivbau die Verwaltungsräume, die Poliklinik, die besonderen Untersuchungszimmer, zuweilen auch noch besser ausgestattete Einzelzimmer aufnimmt, während die meisten Kranken in steinernen Pavillons oder Baracken ihre Aufnahme finden.
Die Baracken können aber auch für sich allein oder fast allein die Grundlage einer Krankenanstalt bilden und stellen dann die dritte Gruppe der Krankenhausbauten dar. Als Hilfsmittel für die Versorgung Kriegsverwundeter und Kranker sind sie hier und da, auch in Deutschland, schon gegen Ende des 18. Jahrhunderts aufgekommen; so schildert der braunschweig-lüneburgische Feldarzt Michaelis in einer Schrift vom Jahre 1801 bereits ihre Herstellung und Einrichtung. Aber erst der amerikanische Bürgerkrieg von 1861 bis 1865 brachte sie zu allgemeiner Verwendung und zwar infolge einer Notlage, da die Unterbringung der zahllosen Verwundeten aus den überaus mörderischen Schlachten in steinernen Gebäuden eine Unmöglichkeit war. Denn die Landstriche, in denen der Krieg vorwiegend tobte, waren dünn bevölkert und enthielten sowohl auf dem Lande, wie selbst in kleinen und größeren Städten fast nur Holzbauten, deren sehr billiges Baumaterial überall mit Leichtigkeit zu beschaffen war. So entschloß sich denn die Militär-Medizinalverwaltung der nördlichen Bundesstaaten zur Herstellung hölzerner Baracken; und mit der dem Amerikanertum eigenen praktischen Energie wurden auf den Schlachtfeldern und in der Nähe der kämpfenden Heere wahre Lazarettstädte[6] aus Holz erbaut, die schnell zusammengezimmert und deren Einzelbaracken möglichst einfach ausgestattet waren. Sie haben sich als eine so segensreiche Einrichtung bewährt, daß sie in den folgenden europäischen Kriegen, wenigstens von deutscher Seite, sofort Nachahmung fanden, wenn auch entfernt nicht in gleichem Umfange wie jenseits des Ozeans. Aus dieser ursprünglich nur für den Krieg gedachten Bauform ist eine Bereicherung des Lazarettwesens und der Krankenpflege auch für den Frieden hervorgegangen. Nur einmal freilich ist der Versuch gemacht worden, die Holzbaracke als Dauerbaracke zur Herstellung eines ganzen Krankenhauses zu benutzen und zwar in dem im Jahre 1869 von Esse errichteten Berliner Augusta-Hospital. Der Versuch hat sich als verfehlt erwiesen, da die Baracken, wenn sie auch mehr als 40 Jahre benutzt wurden, doch so viele Nachteile aufwiesen, insbesondere in der Notwendigkeit fortgesetzter Ausbesserungen und Umänderungen, welche die Verwaltung erheblich verteuerten, daß sie späterhin sämtlich durch Steingebäude ersetzt worden sind. Aber hiervon abgesehen hat die Holzbaracke sich auch im Frieden als ein sehr wertvolles Hilfsmittel in allen den Fällen erwiesen, in welchen Massenerkrankungen durch Ansteckung, Vergiftungen und Unglücksfälle die Gemeinden und Behörden zur schleunigen Errichtung von Nothospitälern zwangen. Auch Dauerhospitäler machen gelegentlich von dieser Aushilfe Gebrauch, zuweilen selbst für lange Jahre, bis Mittel zusammengebracht sind, um den Holzbau durch steinerne Gebäude zu ersetzen.
Ein wenn auch nicht gleichwertiges, so doch durch die schnelle Beschaffungsmöglichkeit vielfach unentbehrliches Hilfsmittel stellen die Leinwandzelte dar. Ihr Gebrauch ist erheblich älter als der der Baracken, da sie mindestens bereits in den Kriegen des 18. Jahrhunderts vielfach benutzt worden sind. Auch unter den entsetzlichen hygienischen Zuständen, welche sich nach der mörderischen Schlacht bei Leipzig am 16. bis 19. Oktober 1813 entwickelten und über die wir vom 26. Oktober einen wahrhaft schaudererregenden Bericht des Professors J. C. Reil, des edlen Ostfriesen, wie ihn Heinrich v. Treitschke nennt, besitzen haben die Leinwandzelte weiterhin die besten Dienste getan. Im Krimkriege von 1854/55 spielten Zelte und bewegliche Baracken gleichfalls eine erhebliche Rolle; die dabei gewonnenen Erfahrungen wurden insbesondere durch die Bemühungen der um die Kriegslazarettpflege hochverdienten Engländerin Florence Nightingale festgehalten und zu einem Gemeingute der Krankenpflege aller Völker umgestaltet.
Seitdem sind die Leinwandzelte zur Krankenbehandlung unentbehrlich geworden, zumal im Kriege. Preußen hat in seinen großen Kriegen von 1863 bis 1871 dauernd von ihnen Gebrauch gemacht und gegenwärtig sind alle deutschen Heereskörper so reichlich mit ihnen ausgestattet, daß Schwierigkeiten für die erste Unterbringung Verwundeter und Kranker nicht leicht mehr entstehen können, zumal da das auf eine hohe Stufe der Vollendung gebrachte Krankentransportwesen unausgesetzt für eine schnelle Entlastung der Umgebung des Schlachtfeldes und der stehenden Feldlazarette sorgt. Aber auch in Friedenszeiten hat die schnelle Aufstellbarkeit solcher Unterkunftsräume eine erhebliche Bedeutung gewonnen.
Ihr Hauptmangel liegt in dem Umstande, daß sie, als nicht oder doch nur unvollkommen mit Heizvorrichtungen versehbar, ausschließlich[7] im Sommer und bei guter Witterung benutzt werden können. In ungünstigen Jahreszeiten tritt indessen eine andere Erfindung der Neuzeit an ihre Stelle, nämlich die v. Döckersche Zeltbaracke, die einen Übergang von der Baracke zum Leinwandzelte bildet, in vollem Umfange zwischen beiden steht. Der dänische Rittmeister v. Döcker führte seine neue Vorrichtung zur Krankenlagerung zuerst auf der Berliner Ausstellung von 1883 vor und schenkte das Modell späterhin dem Augusta-Hospital, in welchem es seit 1884 ausgiebige Verwendung fand. Ebenso hat die preußische Militär-Medizinalverwaltung sofort eine Prüfung ihrer Brauchbarkeit vorgenommen. In ihrer ersten Form war die Baracke freilich auch nur für die Sommermonate brauchbar. Sie besteht nämlich aus einer Anzahl genau zusammenpassender Holzrahmen, deren Lichtung nur von außen von einem sehr groben, segeltuchartigen Stoffe geschlossen wird, der an dem Holzrahmen durch Nägel befestigt ist. An der äußeren Seite ist der Stoff von einer dicken Schicht Ölfirnis überzogen. Die Rahmen sind mittels Haken und Ösen leicht zusammenfügbar, so daß ein solcher Bau in wenigen Stunden aufgestellt, in noch kürzerer Zeit wieder abgebrochen werden kann. Die leichte Brennbarkeit der benutzten Stoffe machte selbstverständlich irgendwelche Heizvorrichtungen unmöglich; allein durch eine wenig kostspielige Umänderung lernte man, wie es scheint zuerst im Berliner Augusta-Hospital, diesem Übelstande zu begegnen und die Zeltbaracke auch für den Winter bewohnbar zu machen. Die Wandflächen wurden nämlich durch Aufnagelung eines zweiten Stoffstückes an der Innenseite des Rahmens verdoppelt, der Stoff durch Aufstreichen von Wasserglas an beiden Seiten unverbrennbar gemacht, ein kleiner verschließbarer Dachreiter für die Ventilation aufgesetzt und endlich eiserne Öfen in dem nun nahezu feuersicheren Raume angebracht. In dieser Form ist die Döckersche Baracke für Friedens- und Kriegszeiten in allgemeinen Gebrauch gekommen.
Die besprochene Vielgestaltigkeit der Krankenunterkunftsräume, unter denen bis zum heutigen Tage das Pavillonsystem als das beste, zugleich aber auch kostspieligste anerkannt werden muß, hatten auf die Gesundheitsverhältnisse großer Krankenhäuser einen sehr merkbaren Einfluß in günstiger Richtung ausgeübt: die Sterblichkeitsziffer sank erheblich, solange die Krankenräume frisch und neu waren. Allein es war unmöglich sich der Erkenntnis zu entziehen, daß in den gleichen Krankenhäusern die Verhältnisse sich von Jahr zu Jahr wieder verschlechterten, so daß nur ausgedehnte Erneuerungen und jährliche Neuanstriche, welche die Unterhaltungskosten wesentlich in die Höhe trieben, imstande waren, zumal auf chirurgischen Abteilungen, die Wundkrankheiten auf erträglicher Höhe zu erhalten. Das Gespenst des unbekannten Etwas, welches die Erfolge der Chirurgen seit Jahrhunderten beeinträchtigt hatte, begann wieder drohend sein Haupt zu erheben. Da aber in kleinen Krankenanstalten der Krankheitsverlauf sich viel länger günstig gestaltete als in großen, da insbesondere sich zeigte, daß Kranke und Verletzte, die in ihrer eigenen Wohnung behandelt wurden, viel seltener von schweren Wundstörungen heimgesucht wurden als die Insassen großer Hospitäler, so blieben die Chirurgen bei dem uralten System der Operationen in Privathäusern, so viele Unbequemlichkeiten damit auch verknüpft waren; und als das sich immer enger ziehende Eisenbahnnetz es auch dem weniger Bemittelten möglich machte, angesehene Chirurgen in fernen Städten aufzusuchen,[8] ging man zu dem Krankenzerstreuungssystem über, welches zwar schon seit Jahrhunderten hier und da benutzt, doch erst in sehr eigenartiger Weise von Nicolai Pirogoff angewandt und bekannt gemacht worden war.
Unter dem Eindruck sehr schlechter Erfahrungen, welche dieser bedeutendste und mit der Entwicklung der westlichen Medizin genau vertraute russische Chirurg in der chirurgischen Klinik zu Dorpat und in St. Petersburger Krankenhäusern gemacht hatte, begann er auf seinem großen Gute in Podolien um 1860 ein System einzurichten, das ihm schon aus seinen Kriegserfahrungen im Kaukasus geläufig geworden war. Die zahlreichen Kranken, welche hilfesuchend von allen Seiten ihm zuströmten, verteilte er nach vorgenommener Operation in die elenden Hütten seiner leibeigenen Bauern, die gegen Bezahlung seitens der Kranken diese einzeln in den gemeinsamen Wohnraum der Familie aufnahmen und verpflegten. Dort lagen sie in einem Winkel auf Stroh, oft wochenlang in der gleichen, mit Blut und Eiter beschmutzten Wäsche, die Wunde tagelang ohne Verband, oder nur mit eitergetränkten, übelriechenden Lappen bedeckt. Der Verbandwechsel wurde entweder von den Kranken selber oder von einem rohen, unwissenden Feldscher vorgenommen; Pirogoff selber konnte seine Operierten höchstens zweimal in der Woche besuchen. Trotzdem sah er im Laufe von 1½ Jahren niemals Wundrose oder „purulente Diathese“ und verlor unter einigen Hunderten von Leuten, an denen große Operationen vorgenommen waren, nur einen Fall nach einer Lithothrypsie. Diese erstaunlichen und von den Erfahrungen der Behandlung in Hospitälern himmelweit verschiedenen Ergebnisse führt Pirogoff ausschließlich auf die strenge Verteilung der Kranken zurück, so daß Hospitalmiasmen und Kontagien, von denen er wiederholt als von den eigentlichen Ursachen der Krankenhausseuchen spricht, nicht zur Entwicklung kommen konnten. Ob freilich die verblüffend guten Ergebnisse, welche er mit seinem Systeme auf dem Lande erzielt hatte, ihm auch im weiteren Leben treu geblieben sind, ist aus seinen Schriften nicht sicher zu ersehen; doch darf daran um so mehr gezweifelt werden, als späterhin kaum noch davon gesprochen wird. Zumal in großen Städten sicherte auch die Krankenzerstreuung keineswegs ausreichend vor dem Auftreten von Wundkrankheiten, unter denen die Wundrose auch in Privatwohnungen eine besonders unliebsame Rolle spielte. Es bedurfte erst der Entdeckung der letzten Ursachen für Wundeiterung und Wundkrankheiten bevor man in zweckentsprechender Weise ihre Bekämpfung in die Hand nehmen konnte.
Ehe wir uns indessen der Schilderung dieses Entwicklungsganges zuwenden, soll eine Darlegung der Wundbehandlungsmethoden, mit denen unsere Altvordern arbeiteten, sowie eine Würdigung der damit erzielten Ergebnisse Platz greifen, die uns erst über den ungeheuren Abstand zwischen den Verfahren beider Zeiträume aufklären.
Die Salben und Pflaster, welche noch bis zum Beginne des 19. Jahrhunderts[9] den Hauptbestandteil der dem Chirurgen zur Verfügung stehenden Hilfsmittel für die Behandlung von Wunden bildeten, waren durch die Bemühungen Vinzenz v. Kerns in Wien in den Jahren 1805 bis 1828 einer einfacheren und naturgemäßeren Behandlung gewichen, wenn sie auch nicht ganz ausgeschaltet werden konnten. Das Kernsche Verfahren war das gleiche, welches in den fünfziger und sechziger Jahren des 19. Jahrhunderts unter dem Namen der offenen Wundbehandlung noch einmal eine gewisse Rolle gespielt hat. Bartscher und Vezin in Osnabrück 1856, Burow in Königsberg 1859, Volkmann in Halle bis Ende 1872, Rose und sein Assistent Krönlein in Zürich 1872 waren die späten Vertreter dieser Richtung, die erst bei dem allmählichen Aufkommen der antiseptischen Wundbehandlung, wenn auch nicht ohne scharfen Kampf, völlig ihren Boden verlor. Vor Kern wurden die Wunden mit allerlei Deckverbänden behandelt unter der Vorstellung, daß sie die verletzten Gewebe vor unmittelbarer Berührung mit der Luft, insbesondere mit dem als überaus schädlich angesehenen Sauerstoffe, zu schützen, zugleich aber eine Beschmutzung der Leib- und Bettwäsche durch den ausfließenden Eiter zu verhindern hätten mittels der Anwendung eines die Wundflüssigkeiten aufsaugenden Verbandmateriales. Als solches diente seit dem 18. Jahrhundert die aus der französischen Chirurgie übernommene Charpie, Fäden aus alter weicher Leinwand gezupft und zu großen und kleinen Bündeln vereinigt. So stark hydrophile Eigenschaften dieser Stoff auch besitzt, so gefährlich wurde er durch die Art seiner Herstellung und seiner Anwendung. Denn die Herstellung geschah vielfach in den Krankenräumen selber durch die vorher nicht gewaschenen und gereinigten Finger der Kranken; und nirgends fand ein besonderer Abschluß, eine zuverlässige Aufbewahrung des aus den allerverschiedensten Quellen stammenden Verbandmateriales statt. So kam denn eine nicht einmal äußerlich rein aussehende, jedenfalls mit Keimen aller Art überladene Charpie auf die Wunden, und zwar meistens in der Art, daß diese ausgestopft, durch Binden zusammengehalten und zugleich unter einen nicht immer unbedeutenden Druck gestellt wurden. Die Notwendigkeit eines mehrmaligen Verbandwechsels täglich, um die beschmutzten und durchweichten Verbandstücke zu ersetzen, vermehrte nur das Übel, da jeder Neuverband eine starke Beunruhigung und Reizung der Wunde, zuweilen selbst mit erheblichen Blutungen aus den üppig wuchernden Granulationen hervorrufen mußte.
Es begreift sich, daß unter solchen Umständen das Vorgehen Kerns, das verwundete Glied nur zweckmäßig zu lagern, die Wunde nur mit Kaltwasserumschlägen zu behandeln, sie offen zu lassen und nur ausnahmsweise einige wenige Nähte anzulegen, als ein großer Fortschritt angesehen werden mußte. Aber auf die Dauer vermochte sich dies einfache Verfahren nicht durchzusetzen. Die große Mehrzahl der Chirurgen suchte immer noch ihr Heil in den alten, schnell schmutzig werdenden Deckverbänden und nach Kerns Tode ist auf Jahrzehnte hinaus von der offenen Wundbehandlung nicht mehr die Rede. Nur die einfachen Kaltwasserumschläge zur Linderung des brennenden Wundschmerzes blieben als einzige Erinnerung an die Kernsche Behandlungsmethode bei den Ärzten bis zur Einführung der Antisepsis, bei den Laien bis zum heutigen Tage in Gebrauch. Die alte Behandlung kehrte in vollem Umfange[10] zurück. So forderten denn in großen chirurgischen Abteilungen nach wie vor die Wundkrankheiten allwöchentlich ihre Opfer; zumal die Kriegslazarette wurden Brutstätten endemischer Seuchen, die so manchem Krieger einen Soldatentod auf dem Schlachtfelde gegenüber dem Aufenthalte in solchen Pesthöhlen als das erheblich kleinere Übel erscheinen ließen.
Die Wundkrankheiten, welche in fast allen größeren Krankenanstalten in so schreckenerregender Weise auftraten, waren faulige Zersetzung der Wundflüssigkeiten (Septichämie oder kurzweg Sepsis), die metastasierende Pyämie, die Wundrose, der Wundstarrkrampf und endlich der Hospitalbrand. Alle übrigen Störungen, wie Nachblutungen, Phlegmonen, Ekzeme, Wundscharlach usw., dürfen beiseite gelassen werden, da sie entweder das Leben nur selten bedrohten, oder nur als Beigaben genannter schwerer Krankheiten die Gefahr erhöhten.
Die Pathologie dieser Zustände kann hier nur kurz berührt, darf aber doch nicht ganz übergangen werden, da einer derselben, der Hospitalbrand, fast völlig verschwunden, also wirklich geschichtlich geworden ist, während andere, so die metastasierende Pyämie, selbst die schweren Formen der Wundrose, so selten geworden sind, daß das jüngere und jüngste Geschlecht deutscher Chirurgen nur noch ganz ausnahmsweise Gelegenheit findet, sie kennen zu lernen. Man vergleiche nur einen Jahresbericht aus älterer Zeit, z. B. von F. Busch, Billroth, Lister (vor Einführung der antiseptischen Wundbehandlung) und anderen, mit einem solchen des letzten Jahrzehntes, um sich zu überzeugen, welche ungeheure Einschränkung die Besprechung der Wundkrankheiten erfahren hat, da mit ihrer zahlenmäßigen Verminderung auch das Interesse an ihnen heruntergegangen, ja nahezu erloschen ist. Freilich ist hervorzuheben daß die Entstehung aller dieser Krankheiten durch mehr oder weniger spezifische Bakterien und deren Stoffwechselgifte (Toxine) zu jener Zeit noch gänzlich unbekannt war; wir beschränken uns also im wesentlichen auf die Krankheitsbilder, wie sie von unseren Altvordern zuweilen in überraschender Schärfe, zuweilen aber auch mit verschwommenen Grenzen gezeichnet worden sind.
Wundfäulnis, Sepsis, Septichämie, Sephthämie nannte man nach der Mitte des 19. Jahrhunderts einen Zustand, bei welchem die Wundflüssigkeiten ein graugelbes, graues, rotbraunes oder dunkelbraunes, mehr oder weniger blutig gefärbtes Ansehen bekamen und zugleich einen üblen Geruch annahmen, in einzelnen Fällen selbst aashaften Gestank verbreiteten. Diese Erscheinungen entwickelten sich nicht plötzlich, steigerten sich aber doch in wenigen Tagen zur Höhe und gingen nicht nur mit einer Veränderung der Wunde und ihrer Umgebung, sondern auch mit einer wachsenden Beeinträchtigung des Allgemeinbefindens einher. Die Wundränder nahmen eine blasse Rötung an, schwollen etwas an, waren aber nicht auffallend empfindlich; in vorgeschrittenen Fällen war häufig sogar eine erstaunliche Unempfindlichkeit vorhanden, die auf beginnende und schnell zunehmende Benommenheit des Bewußtseins zurückgeführt werden mußte. Der Puls wurde schnell, zuweilen schon zu einer Zeit, in welcher die örtlichen Veränderungen noch nicht in die Augen sprangen, die Arterien zeigten sich wenig gefüllt. Hand in Hand mit dieser Pulsveränderung stellte sich ein remittierendes Fieber[11] ein, meistens mit morgendlichen Abfällen bis zur Norm oder gar weit darunter, und einem abendlichen Anstiege, dessen Spitzen immer höher reichten, bis mit dem Nachlassen der Herzkraft oft plötzlich ein bedeutendes Sinken eintrat. Dies galt bei schneller und kleiner werdendem Pulse als ein sehr ungünstiges Zeichen und ging meistens dem Tode unmittelbar voran.
Daß es sich um eine Giftwirkung der in der Wunde sich ansammelnden fauligen Stoffe handle, war schon um die sechziger Jahre den meisten Beobachtern nicht zweifelhaft. In der Tat gelang es E. Bergmann und Schmiedeberg in Straßburg im Jahre 1868, aus faulender Bierhefe ein Alkaloid, das Sepsin herzustellen, welches, dem Tierkörper in genügender Menge einverleibt, ein der menschlichen Septichämie sehr ähnliches Krankheitsbild hervorrief. Für die Behandlung war damit aber zunächst nichts gewonnen, da einerseits die Ursachen der Wundfäulnis mit dem Nachweise des Sepsins noch längst keine Erklärung gefunden hatten, andererseits die einzelnen Fälle, neben mancher Ähnlichkeit in den Umrissen, doch auch recht erhebliche Verschiedenheiten aufwiesen. Billroth und seine Schule mühten sich jahrelang vergeblich ab, der Natur hinter ihr Geheimnis zu kommen, bis er mit seinem Buche „Über die Cocoobacteria septica“ den ersten Schritt auf dem noch sehr unsicheren und schwankenden Grunde der chirurgischen Bakterienforschung tat. Wir werden darauf an späterer Stelle im Zusammenhange zurückzukommen haben.
Ein in seinen ausgeprägten Formen sehr verschiedenartiges Krankheitsbild stellte das Eiterfieber, die Pyämie oder Pyohämie dar. Voraussetzung für ihr Auftreten war das Vorhandensein einer meist größeren Wunde, am häufigsten an den Bewegungsorganen; doch gehörte es in verseuchten Krankenhäusern keineswegs zu den Seltenheiten, das Leiden selbst bei kleinen und anscheinend wenig bedeutenden Wunden auftreten zu sehen. Während aber die Wundfäulnis in langsamer Steigerung ihre Höhe erreichte, trat die Pyämie meist ohne jede Vorbereitung und ganz plötzlich in die Erscheinung. Ein Mensch mit einer ganz reinen, von guten Granulationen bedeckten und einen geruchlosen Eiter absondernden Wunde erkrankte, zuweilen aus voller Fieberlosigkeit heraus, andere Male nach nur geringfügigem Anstieg der Körperwärme, mit einem heftigen Schüttelfroste, dem ein ergiebiger Schweißausbruch folgte. Nach 2–4 Stunden sank die bis zu 41oC und selbst darüber emporgeschnellte Körperwärme in steilem Sturze wieder zur Norm oder selbst erheblich darunter, der Kranke fühlte sich zwar etwas angegriffen, aber doch so wohl, daß er der Sache keine Bedeutung beizulegen geneigt war, bis die öftere Wiederkehr der Fröste seinen Gleichmut zu zerstören, sein Befinden zu verschlechtern begann.
Nach den ersten Schüttelfrösten nämlich traten auch für den Kranken sehr merkbare Veränderungen der Wunde auf. Die bis dahin roten und üppigen Granulationen wurden blaß und flach, viel seltener, infolge einer Venenthrombose, glasig gequollen, die Wunde sonderte statt des gelben Eiters eine mehr fleischwasserähnliche, gewöhnlich leicht übelriechende Flüssigkeit ab; zugleich wurde sie so empfindlich, daß der Kranke bei jeder Berührung aufschrie, zuweilen schon bei leichter Erschütterung seines Lagers einen Schmerzensschrei ausstieß. Im Gegensatze[12] zu einem Septichämischen mit seinem gleichgültigen, stupiden Gesichtsausdrucke und seinen glanzlosen Augen zeigte der Pyämische auf der Höhe seines Leidens ein ängstliches, aufgeregtes Gesicht mit leicht verzerrten Zügen, sowie die glänzenden Augen des fiebernden Menschen. Für den kundigen Blick war das Krankheitsbild der ausgeprägten Pyämie ohne weiteres erkennbar.
Den eigentlichen Stempel aber erhielt die verderbliche Krankheit durch das Auftreten zahlreicher Eiterherde, meist in inneren, aber auch in äußeren Organen. Gehirn, Lungen, Leber, Milz, Nieren und Herzfleisch wiesen ebenso oft große und kleine Eiterherde auf, wie das Bindegewebe, die Muskeln, die Gelenke und serösen Höhlen. Diese Eiterungen, die zuweilen zu gewaltigen, schnell wachsenden Herden sich umwandelten, traten in der Regel im unmittelbaren Anschluß an Schüttelfröste auf; sie waren, wie Virchow um 1850 als erster nachzuweisen vermochte, die Folge des Eindringens zerfallender Gefäßthromben in die Blutbahn und entwickelten sich an solchen Stellen, an denen ein verschleppter Embolus in feineren Gefäßen stecken blieb. Daß der Zerfall eines in der Wundebene liegenden Gefäßthrombus durch eindringende Bakterien vermittelt wurde und daß die mit Bakterien beladenen Gerinnsel oder gar die im Blutstrome kreisenden und zusammengeballten Bakterien für sich allein am Orte ihres Haftens Eiterung hervorriefen, wurde erst wesentlich später erkannt.
Nicht immer haben die Vorgänge so klar vor Augen gelegen, wie sie hier geschildert worden sind. Die Schwierigkeiten für die Erkenntnis hatten zwei Gründe. Zunächst konnte der Zerfall eines Thrombus auch in einer Wunde sich ereignen, die schon einige Zeit zuvor von Wundfäulnis heimgesucht war; oder aber letztere gesellte sich den pyämischen Erscheinungen hinzu. Dann entstanden Mischformen, die zuerst Karl Hüter mit dem Namen der Septikopyämie belegt hat (1868); und da die Zeichen beider Krankheiten, bald mit Vorwiegen der Fäulnis, bald der Metastasen, sich durcheinanderschoben, so war eine reinliche Scheidung vielfach unmöglich gemacht. Noch mehr aber trug zur Unklarheit und Verwirrung die Kenntnis einer bis dahin unbekannten Krankheit, der metastasierenden Osteomyelitis, bei, die zuerst von Chassaignac im Jahre 1854, bald darauf auch von Klose in Prag unter dem Namen der akuten Osteomyelitis, späterhin wegen der Ähnlichkeit ihres Verlaufes mit der Wundpyämie vielfach als Pyaemia interna oder spontanea beschrieben worden ist. Die Frage hat eine höchst umfangreiche Literatur hervorgerufen, bis Rosenbach in Göttingen im Jahre 1884 die Krankheit auf die gleichen Erreger, welche in der Wundpyämie ihre Lebensäußerung zeigen, zurückzuführen vermochte, nämlich auf den Staphylococcus pyogenes aureus und verwandte Schmarotzer.
Der Hospitalbrand scheint eine fast ausgestorbene Krankheit geworden zu sein, da auch die neuesten, so blutigen und unter den ungünstigsten hygienischen Bedingungen geführten Kriege sie glücklicherweise fast nirgends zu neuem Leben zu erwecken vermocht haben. Nur im Russisch-Japanischen Kriege von 1904 ist sie wieder gesehen worden, ohne daß Zeit und Umstände für genauere Beobachtungen und bakterielle Forschung günstig gewesen wären. Und doch war sie einst die schrecklichste Geißel großer Krankenhäuser des Friedens und umfangreicher Militärlazarette. Ob sie eine besondere, auf einen eigenen Erreger zurückzuführende[13] Form der Wundfäulnis darstellt, kann heute nicht mehr gesagt werden, da sie unter dem Einflusse der antiseptischen Wundbehandlung so schnell verschwunden ist, daß die bis dahin noch höchst unvollkommenen bakteriologischen Untersuchungsmethoden nicht mehr imstande waren, ihr Wesen festzustellen. Um so mehr ist es geboten, ihre Erscheinungsformen festzuhalten, und zwar nicht nur von rein geschichtlichen Gesichtspunkten aus; denn wie andere verheerende Seuchen des menschlichen Geschlechtes, Diphtherie z. B. und Pest, gewissermaßen unter unseren Augen eine Wiedererstehung erlebt haben, so sind Verhältnisse auf Erden denkbar, verheerende Ereignisse irgendwelcher Art, welche auch dem Erreger des Hospitalbrandes aus der bisherigen Versenkung aufzutauchen erlauben.
In großen Krankenhäusern des Friedens, besonders aber in Kriegslazaretten, in denen zahlreiche Verwundete dicht zusammengehäuft waren, trat die Krankheit gelegentlich in ihren gefährlichsten und abschreckendsten Bildern auf. Seit Delpech in Montpellier (1815) unterschied man zwei Formen, den ulzerösen und den pulpösen Brand, die zwar im Beginne nicht unerhebliche Verschiedenheiten zeigten, im späteren Verlaufe aber untrennbar ineinander übergingen. Die erste begann mit dem Auftreten eines oder mehrerer graugelblicher, etwas erhabener und mit bräunlichen Punkten (von thrombotischen Gefäßen herrührend) durchsetzter Flecken, welche sich schnell vergrößerten, dann zerfielen und scharfrandige, rundliche Geschwüre hinterließen, die sich bald vereinigten und in kurzer Zeit die Hautränder der Wunde erreichten. Der pulpöse Brand dagegen begann mit dem Auftreten eines grauen Belages in einem Teile oder von vornherein in der ganzen Wunde, der nur in Fetzen abgerissen werden konnte und eine blutende Fläche hinterließ. Der zunächst etwas flache Grund erhob sich bald unter dem Drucke der in der Tiefe entwickelten Fäulnisgase, zerfiel und wandelte sich in eine schmierige, faulender Gehirnsubstanz ähnliche Masse um. Bald kam es infolge von Gefäßstauungen zu heftigen, oft wiederholten kapillären Blutungen und zugleich schritt die Zerstörung in die Breite und in die Tiefe mehr oder weniger schnell fort. Kein Gewebe widerstand auf die Dauer; doch starb am schnellsten das lockere Bindegewebe ab, während Faszien, Muskeln und große Gefäßstämme länger Widerstand leisteten. Die Knochen wurden ihres Periostes beraubt und verloren in steter Berührung mit der faulenden Flüssigkeit teilweise oder auch im ganzen Umfange ihre Lebensfähigkeit. Die Wunde verbreitete einen widerwärtigen Geruch, der aber dem gewöhnlichen Geruche faulender Gewebe nicht völlig glich. Eine Heilung war selbst in vorgeschrittenen Fällen noch möglich wenn auch meist mit Hinterlassung schwerer Schädigungen; ein erheblicher Prozentsatz der Kranken aber erlag den fortgesetzten Blutungen oder der septischen Vergiftung, oft auch einer ausgesprochenen Pyämie.
Die Krankheit hat unverkennbare Ähnlichkeit mit den schweren Fällen von Diphtherie, welche nach einem Luftröhrenschnitte auf die äußeren Weichteile des Halses übergreift; doch scheint es heute nicht mehr möglich, nachdem auch letztere wohl kaum noch zur Beobachtung kommen, die Gleichheit oder Verwandtschaft beider Krankheiten bakteriologisch festzustellen.
Der Wundstarrkrampf oder Tetanus ist eine weitere Wundkrankheit, die nur selten in größerer Zahl auf einmal, sondern gewöhnlich[14] nur in vereinzelten Fällen nicht allein bei der Zusammenhäufung zahlreicher Verwundeter in einem Raume, sondern auch bei Menschen vorkommt, die in Privathäusern ein Zimmer für sich bewohnen. Ist somit die allgemeine Bedeutung des Leidens für Krankenhäuser und Feldlazarette geringer als die der meisten anderen Wunderkrankungen, so ist doch das einzelne Krankheitsbild so schrecklich, daß es bereits sehr früh die Aufmerksamkeit der Ärzte auf sich zog. Schon Hippokrates hat ihm einen eigenen Abschnitt gewidmet.
Während man früher neben dem traumatischen noch einen rheumatischen oder idiopathischen Tetanus unterschied, ist seit der Entdeckung des Tetanusbazillus durch Nikolaier im Jahre 1884 kein Zweifel mehr geblieben, daß die Ansteckung durch eine Wunde geschieht, die aber zuweilen sehr unbedeutend oder zur Zeit des Krankheitsbeginnes schon verheilt ist. In die Fußsohle oder unter die Nägel eingestoßene Holzsplitter sind von jeher besonders gefürchtet gewesen. Die Krankheit beginnt mit einer Spannung in den Kaumuskeln (Trismus) oder mit Schlingbeschwerden; die krampfhafte Zusammenziehung der Gesichtsmuskeln (Bisus sardonicus), die gerunzelte Stirn, die harte Spannung der Rückenmuskeln (Opisthotonus), sowie der Muskeln der Bauchwand bilden die Fortsetzung. Endlich treten von Zeit zu Zeit tonische Krämpfe in den genannten Muskelgruppen auf, die auch in stoßartiger Form sich geltend machen können. Die Extremitäten bleiben meistens frei; doch gibt es auch einen örtlichen Wundstarrkrampf, der dauernd oder in erster Linie auf eine einzelne Extremität beschränkt bleibt. In den milden Fällen klingen die kurz umrissenen Erscheinungen allmählich ab, in den schwereren erfolgt unter steter Steigerung der Krämpfe der Tod durch krampfhaften Stillstand der Atemmuskeln, Glottisödem oder Apoplexie im Gehirne.
Daß es sich um eine Giftwirkung, insbesondere auf die Nervensubstanz, handle, war längst vermutet worden; die Entdeckung des Tetanusbazillus in der Gartenerde, im Straßenstaube, überhaupt in weitester Verbreitung, hat diese Annahme bestätigt. Das Studium seiner Lebensbedingungen hat als Krankheitserreger ein Toxin erkennen lassen, und die mit dem v. Behringschen Tetanusantitoxin angestellten Behandlungsformen, insbesondere dessen prophylaktische Anwendung, haben nicht nur die Sterblichkeit, sondern schon die Häufigkeit der Erkrankung außerordentlich vermindert. So sah Max Martens, der im Berliner Krankenhause Bethanien die prophylaktische Serumeinspritzung seit 1904 durchgeführt hat, im Laufe von 10 Jahren, abgesehen von eingelieferten Erkrankungen, nur einen einzigen Fall, bei dem die übliche Sicherung durch Zufall unterlassen worden war; so wird auch von der Graserschen Klinik in Erlangen berichtet, daß nach Einführung des gleichen Verfahrens die Krankenräume seit 5 Jahren von Starrkrampf verschont geblieben seien.
Zu den echten Wundkrankheiten gehört auch die Wundrose, das Erysipelas, da das Gift, welches sich in den benachbarten Saftkanälen und Lymphbahnen ausbreitet, stets und unter allen Umständen durch die verletzte Haut eindringt. Allerdings hat diese Erkenntnis sich erst in den letzten drei Jahrzehnten zu allgemeiner Anerkennung durchgerungen; denn der Umstand, daß sehr unbedeutende Verletzungen der Haut oder der Schleimhäute, die, wie leichte Abschürfungen, schon in[15] einem Tage bis zur Unerkennbarkeit geheilt sind, die Eingangspforten des Giftes bilden können, der fernere Umstand, daß die Wundrose nach Fehleisens Untersuchungen eine Inkubationszeit von 15–61 Stunden besitzt, während deren manche Eingangspforte schon unkenntlich geworden ist, haben der richtigen Deutung der Erscheinungen beharrlich im Wege gestanden. Daher die bis in die achtziger Jahre des 19. Jahrhunderts hineinreichende Unterscheidung zwischen einem chirurgischen, von Wunden ausgehenden und einem medizinischen, selbständig im Körper entstehenden Erysipel, als dessen Ursache man eine „gallige Schärfe im Blut“ neben allerlei atmosphärischen und klimatischen Einflüssen anzunehmen pflegte. Wir dürfen diese Anschauungen als gänzlich überwunden betrachten, seitdem die bakterielle Natur des Leidens festgestellt worden ist. Die atmosphärischen Einflüsse sind allerdings insofern nicht gänzlich ausgeschaltet worden, als sie zweifellos von Bedeutung für das Wachstum der Keime und ihre zeitweilig gesteigerte Giftigkeit sind.
Die Wundrose tritt in der unmittelbaren Umgebung der Eingangspforte in Form einer dunkel- oder rosenroten Schwellung auf, die ganz scharf abgegrenzt und über der blassen Haut der Nachbarschaft durch Quellung etwas erhaben ist. Sie erscheint bei zuvor fieberlosen Kranken nach einem mehr oder weniger heftigen Schüttelfroste, dem andauernd hohes, morgens etwas abfallendes Fieber folgt. Zugleich breitet sich die scharfrandige Rötung in breiten Vorschüben nach verschiedenen Richtungen aus, überzieht mehr oder weniger erhebliche Teile der Körperhaut und endet meist in wenigen Tagen, zuweilen aber erst nach wochenlangem Umherwandern, welches selbst schon einmal befallene Körperstellen nicht verschont, mit plötzlichem Temperaturabfalle und meist einer Abblätterung, seltener bloßer Abschilferung der Oberhaut.
Gefährlich wird das Leiden, zumal bei alten Leuten, durch die lange, mit hohem Fieber verbundene Dauer und durch die Neigung mancher Fälle zu metastatischen Eiterungen. Indessen ist das Erysipel unter den neueren Wundbehandlungsmethoden nicht nur an Zahl, sondern auch an Gefahr ganz erheblich zurückgegangen. In den gutgehaltenen chirurgischen Abteilungen großer Krankenhäuser ist die Wundrose als Hospitalkrankheit fast völlig verschwunden; doch werden immer noch eine Anzahl von außerhalb entstandenen Fällen eingeliefert, die indessen meist einen leichten Verlauf nehmen. Ein Todesfall an Wundrose dürfte heute bereits zu den Seltenheiten zählen.
Wir haben hiermit die fünf Hauptkrankheiten erwähnt, welche einst die Tätigkeit des Wundarztes und seine Erfolge, zuweilen in schreckenerregender Fülle, einengten und bedrohten. Versuchen wir nun, ein Bild zu entwerfen von dem Aussehen einer chirurgischen Abteilung vor einem bis zwei Menschenaltern.
Dem in einen großen Krankensaal Eintretenden fiel zunächst der fade, süßliche Eitergeruch, nicht selten sogar ausgesprochener Fäulnisgeruch auf, die nur mühsam durch den Duft chemischer oder pflanzlicher Verbandmittel der Kamille, des Kampfers, später der Karbolsäure und anderer Stoffe gedämpft wurden. Schon die Gesichter der Kranken, an deren Betten man vorüberging, verrieten, daß man sich unter Schwerleidenden befand. Die hektisch geröteten Wangen, die glänzenden Augen[16] und das schweißbedeckte Antlitz der Fiebernden, ihr ängstlicher Gesichtsausdruck, daneben die blassen, gleichgültigen Züge der Septischen, das Stöhnen und Sprechen in abgerissenen, halb unverständlichen Sätzen — das waren die immer wiederkehrenden Bilder, die jedem fühlenden Arzte das Herz zusammenschnürten. Deckte man die Wunde auf, so fand man den Verband von Eiter durchtränkt und übelriechend. Selbst bei mehrfach am Tage vorgenommenem Verbandwechsel durchdrangen die Flüssigkeiten nicht selten den Verband, beschmutzten benachbarte Körperteile, verunreinigten die Bettdecke und das Bettuch, suchten ihren Weg selbst über Gummiunterlagen hinweg und drangen in die Matratze ein. So erforderte jeder Verbandwechsel zugleich einen Wechsel der Bettwäsche, selbst der Matratzen; und alles das war nicht möglich, ohne den Verletzten vom Lager zu erheben, ihn und seine Wunde zu beunruhigen und zuweilen heftige Schmerzen zu erzeugen. Rechnet man hinzu, daß in überfüllten Krankenhäusern und Kriegslazaretten die auf diese Weise geforderte Arbeitslast oft genug die körperliche Leistungsfähigkeit der vorhandenen Ärzte weit überstieg, so begreift es sich, daß vieles den weniger geschulten Händen des Wartepersonals überlassen wurde, was besser dem Arzte vorbehalten geblieben wäre. Und wenn man endlich in Anschlag bringt, daß eine so schwere Fronarbeit unter dem steten Drucke zu leisten war, daß doch das meiste an ärztlicher Arbeit und Quälerei des Kranken ganz vergeblich sei, daß man gegen ein unabwendbares Fatum ankämpfe, daß eine große Anzahl Schwerverletzter mit dem Augenblicke als verloren zu betrachten war, in welchem sich ihnen die Pforten des mehr oder weniger verseuchten Krankenhauses oder Unterkunftsraumes öffneten, so begreift es sich, welch eine Fülle von körperlicher Leistungsfähigkeit und Charakterstärke dazu gehörte, um auch nur den ärztlichen Gehilfendienst pflichtgemäß zu erfüllen. Für den leitenden Arzt aber kam noch das schwere Verantwortlichkeitsgefühl bei jedem operativen Eingriff hinzu, um die der Seele aufgeladene Last manchmal bis zum Unerträglichen zu steigern. Daß unter solchen Umständen so mancher jüngere Arzt unter der Schwere seines Berufes fast zusammenbrach, die Unberechenbarkeit seiner Tätigkeit nicht mehr zu tragen vermochte und deshalb von der Chirurgie, der er sich in glücklicher Unkenntnis zunächst mit Begeisterung zugewandt hatte, Abschied nahm, um sich einem minder verantwortungsvollen Zweige der Medizin zuzuwenden, kann nicht überraschen. Um so bewundernswerter müssen uns aber jene Männer erscheinen, welche unter den niederdrückendsten Erfahrungen aller Art, im steten und vielfach vergeblichen Kampfe gegen dunkle Hemmnisse, durch welche oft genug die an eine wohlgelungene Operation geknüpften Hoffnungen aufs grausamste zerstört wurden, unbeirrt ihren Weg fortsetzten, um der schweigsamen Natur ihre Geheimnisse abzulauschen, ihre Wissenschaft auszubauen und zu retten, soweit es eben möglich war. Konnte sich unter allen Schrecken des Krankenhauses doch gelegentlich ein Hochmut entwickeln, wie er am verblüffendsten in einem Satze des französischen Chirurgen Boyer zutage tritt, der in der Einleitung zu seiner „Chirurgie“ (1814–1826) folgende Worte findet: „Die Chirurgie unserer Tage hat die größten Fortschritte gemacht, so daß sie den höchsten oder nahezu den höchsten Grad der Vollkommenheit, deren sie überhaupt fähig ist, erreicht zu haben scheint.“
Den meisten anderen Chirurgen hat wohl die in diesem Satze ausgeprägte[17] Überhebung ferngelegen; sie übten vielmehr jene Entsagung, der einst bereits Ambroise Paré einen schönen Ausdruck gegeben hat, indem er, nach dem Befinden eines Kranken gefragt, erwiderte: „Je l'ai opéré, Dieu le guérira.“
Diesen unerhörten Zuständen hat Joseph Listers schrittweise entwickelte Wundbehandlung ein für allemal ein Ende gemacht. Er erlöste die ärztliche Welt von dem Albdrucke unbekannter und unberechenbarer Einflüsse auf den Wundverlauf und gab ihr damit eine Freiheit des Handelns, wie sie unsere Wissenschaft und Kunst während ihrer mehr als 2000jährigen Geschichte niemals auch nur entfernt besessen hat. Erst jetzt erhielt auch die chirurgisch-operative Phantasie den nötigen Spielraum, um immer neue Ausflüge in bisher dunkle und unbekannte Gebiete zu unternehmen, sie zu erobern und zu unterwerfen, Nachbargebiete der Chirurgie zu befruchten, den Ausbau der Hilfswissenschaften anzuregen und selbst ganz neue Wissenszweige ins Leben zu rufen.
Wie alles das im einzelnen vor sich gegangen ist, soll in den nachfolgenden Blättern geschildert werden.
Gleich fast allen großen Entdeckungen und Erfindungen ist auch die Listersche Wundbehandlung nicht unvermittelt aus dem Kopfe eines einzigen hervorragenden Mannes hervorgegangen, sondern zahlreiche Arbeiten, Schriften und Entdeckungen bereiteten ihr den Weg. Wir Deutsche dürfen stolz darauf sein, daß schon unter den Vorarbeiten der deutsche Anteil recht erheblich gewesen ist.
Diese Vorarbeiten suchten auf zwei völlig getrennten Wegen der Aufgabe einer Beseitigung oder wenigstens einer Einschränkung der Wundkrankheiten und damit einer verständigen Wundbehandlung näher zu kommen; nämlich einmal auf dem Wege klinischer Beobachtung und Erfahrung, anderseits mit Hilfe der Bakteriologie.
Es war ein Geburtshelfer, der als erster die Wunderkrankungen, hier der durch die Vorgänge des Gebärens in eine Wunde verwandelten Innenfläche der Gebärmutter, also die verschiedenen Formen der verderblichen Wochenbettleiden, zu bekämpfen suchte. Sie waren bisher, d. h. bis in die vierziger Jahre des 19. Jahrhunderts, von den Geburtshelfern ganz allgemein auf sehr unklare miasmatisch-epidemische Einflüsse zurückgeführt worden, die auch in den Anschauungen der Chirurgen die fehlenden tieferen Kenntnisse der eigentlichen Krankheitsursachen ersetzen mußten. Gegen diesen Glauben kämpfte seit dem Jahre 1847 der junge deutsch-ungarische Geburtshelfer Semmelweis auf Grund seiner Erfahrungen und scharfsinnigen Beobachtungen in der ersten Gebärklinik des Allgemeinen Krankenhauses zu Wien, wo er als Assistent tätig war. Er erkannte die völlige Gleichartigkeit einer Gruppe von Puerperalerkrankungen mit solchen Wundkrankheiten, welche die Chirurgen, bis dahin ohne scharfe Abgrenzung, als Pyämie zu bezeichnen pflegten und führte als erster die häufigste Entstehung der Krankheit auf den untersuchenden Finger des Geburtshelfers oder seiner Gehilfen, also auf unmittelbare Übertragung des Krankheitserregers zurück. Neben dieser Einimpfung ließ er aber auch eine Verbreitung der Krankheit auf dem Luftwege zu. Sehr angesehene Vertreter der Medizin, wie Rokitansky, Skoda und Hebra, traten mehr oder weniger entschieden auf seine Seite. Aber an dem starken Widerspruche der Geburtshelfer, der Kiwisch,[19] Scanzoni und Seyfert, scheiterte der ideenreiche und kluge Mann bis zu dem Maße, daß er im Jahre 1850 verstimmt und mißmutig Wien verließ und in seine Vaterstadt Pest zurückkehrte. Hier wurde er 1855 Leiter der geburtshilflichen Universitätsklinik, vermochte sich aber auch als solcher nicht durchzusetzen, obwohl er im Jahre 1861 seine Anschauungen in einem umfangreichen Werke: „Die Ätiologie, der Begriff und die Prophylaxis des Kindbettfiebers“ niedergelegt hatte. Nachdem auch der größere Teil der Chirurgen und unter den pathologischen Anatomen Virchow noch im Jahre 1864 sich gegen Semmelweis' Lehre ausgesprochen hatten, war sein Schicksal entschieden: man verlachte ihn als einen unklaren Schwärmer. Er starb in einer Irrenanstalt in Wien im Jahre 1865 an Pyämie als Folge einer Fingerverletzung. In so trauriger Weise endete das Leben eines Pfadfinders, dessen Anschauungen und Lehren erst einige Jahrzehnte später die unumwundene Anerkennung gefunden haben.
Es war nicht die Geburtshilfe allein, welche die Kosten dieses bedauerlichen Zusammenbruches zu tragen hatte, sondern in gleicher Weise wurde auch die Chirurgie auf dem Gebiete der Wundkrankheiten und der Wundbehandlung zum Stillstande verdammt. Der beherrschende Einfluß eines Virchow machte sich selbst bei Männern wie Billroth und Otto Weber in der Abweisung des Gedankens einer unmittelbaren Übertragung einer äußeren Ansteckung geltend, während Wilhelm Roser die Pyämie durch ein Miasma und Kontagium sich fortpflanzen ließ und den pyämischen Erkrankungen auch das Kindbettfieber wie die Wundrose zurechnete. Ebenso spricht Pirogoff fortgesetzt von miasmatisch-kontagiösen Einflüssen als den Erzeugern der Wundkrankheiten. In solchen Vorstellungen blieben alle Chirurgen der damaligen Zeit befangen; und dem rückschauenden Blicke ist es leicht erkennbar, daß aus ihnen eine gesunde Wundbehandlung nicht hervorzukeimen vermochte.
Zu ihr führte aber der zweite Weg, der längst gebahnt, aber von den Chirurgen bisher noch nicht betreten worden war: die ersten Anfänge und der weitere Ausbau der Keimlehre. Gegen Ende des 18. Jahrhunderts hatte Gay-Lussac in Paris den Sauerstoff der Luft als den Erreger der Fäulnis und Gärung und damit als Zerstörer organischer Substanzen hingestellt. Dieser Anschauung war auch der größte Teil der damals lebenden Chirurgen zugewandt. Sie wurde erst erschüttert, als Theodor Schwann, damals Gehilfe am anatomischen Museum zu Berlin, der hochberühmte Begründer der tierischen Zellenlehre aus den Jahren 1838 und 1839, mit bedeutsamen Arbeiten über den Anteil lebender Organismen an den Gärungs- und Fäulniserscheinungen hervortrat. Sie knüpften an die Entdeckung des Hefepilzes (Torula cerevisiae) an, die ihm im Jahre 1837, ungefähr gleichzeitig mit dem Franzosen Cagniard-Latour, gelungen war. So wurde Schwann auch der Begründer einer Keimlehre, die schnell eine weitere Entwicklung fand. Im Jahre 1840 veröffentlichte der mit Schwann befreundete Jakob Henle eine Abhandlung, die zum erstenmal mit aller Bestimmtheit die kontagiösen Krankheiten auf organische Krankheitserreger, wahrscheinlich pflanzlicher Natur, zurückführte. Die geistvolle Schrift, welche auf deduktivem Wege zu einer Auffassung gelangt, die mit unseren heutigen Anschauungen fast vollkommen übereinstimmt, erwähnt auch bereits den Grund, der die Entdeckung und den Nachweis solcher Organismen bisher verhindert[20] hatte. Sie entzögen sich, so sagt Henle, wahrscheinlich nur deshalb der mikroskopischen Wahrnehmung, weil man sie nicht ohne weiteres von den umgebenden Geweben unterscheiden könne. Wie richtig das alles ist, hat die spätere Entwicklung der Färbemethoden, durch welche auch die kleinsten Organismen dem bewaffneten Auge noch erkennbar geworden sind, vollauf bewiesen. — Auf dem gleichen Gebiet bewegten sich Schriften von Helmholtz, Schultz und anderen Forschern.
Die Schwannschen Versuche über Zersetzung wurden in vollem Umfange aufgenommen und nach allen Richtungen erweitert durch Louis Pasteur in Paris. Der körperlich kleine, frühzeitig etwas untersetzte Franzose, in dessen etwas harten Zügen zwei durchdringende Augen von einer großen Schärfe des Verstandes und rastloser Tatkraft redeten, beschäftigte sich schon seit der Mitte der fünfziger Jahre mit dem Problem der Gärung und Zersetzung. Er wußte es durchzusetzen, daß die Akademie eine Kommission ernannte, um seine Versuche zu prüfen; und diese, aus den ersten Männern der Naturwissenschaften in Frankreich zusammengesetzte Körperschaft zögerte nicht, Pasteurs Vorführungen als beweisend anzusehen. Es lohnt sich, seines grundlegenden Versuches mit einigen Worten zu gedenken. Eine Anzahl gläserner Behälter mit dünnen Hälsen füllte er zum Teil mit einer durchgeseihten, klaren und durchscheinenden Hefenabkochung, die eine Zeitlang siedend erhalten wurde, um alle etwa vorhandenen Keime zu zerstören. Noch während des Kochens wurde der Hals zugeschmolzen, so daß nach der Abkühlung innen ein luftleerer Raum entstehen mußte. Eine Anzahl dieser Gefäße wurde dann z. B. in Hörsälen und ohne besondere Vorsicht geöffnet, aber sofort wieder mittels des Lötrohres geschlossen: regelmäßig trübte und zersetzte sich dann die Flüssigkeit binnen wenigen Tagen. Geschah aber die Eröffnung an keimarmen Orten, z. B. auf einem hohen Berge, im Wehen des Windes von einem Gletscher her, oder brachte man den Hals während des Durchfeilens in eine Spiritusflamme, in der auch die zum Abbrechen bestimmte Zange zuvor geglüht worden war, so entwickelte sich unter 20 Flaschen nur in einer eine Pilzbildung, während 19 ganz klar blieben. — Chevreuil vervollständigte diesen Versuch dahin, daß er den Flaschenhals zu einer feinen Röhre auszog und diese zwar mehrmals winklig knickte, aber vollständig offen ließ. Obwohl nun ein freier Austausch der eingeschlossenen mit der äußeren Luft stattfinden konnte, so blieb doch jede Zersetzung aus, weil nachweisbar die Luftkeime an den Winkeln der Röhre mechanisch zurückgehalten wurden.
Der Wahn von der Schädlichkeit des Sauerstoffs war hiermit endgültig zerstört; die in ihrer Natur und ihrem Wesen bisher noch fast gänzlich unbekannten Keime mußten als die Unheilstifter bei allen Arten der Zersetzung angesehen werden.
Indessen wußte man in der praktischen Chirurgie mit dieser Entdeckung zunächst noch nichts anzufangen, da irgend ein Weg, die Wunden vor dem Eindringen von Keimen zu schützen, bisher noch[21] nicht gefunden war. In diese Lücke trat Joseph Lister ein, nicht mit dem Vorwärtsstürmen eines alle Hindernisse überspringenden Genies, sondern in der langsamen Weise des ruhigen Beobachters und ernsten Naturforschers, der keinen Schritt vorwärts tut, ohne sich vorher die Grundlage zu sichern, auf die er treten will. Lister war mit 42 Jahren auf den Lehrstuhl für Chirurgie in Glasgow als Nachfolger seines Schwiegervaters Syme berufen worden; als er die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen begann, war er Professor der Chirurgie in Edinburgh. Der hochgewachsene, kräftige Mann von echt germanischem Typus, das Haupt mit leicht gewellten, ein wenig lang getragenen Haaren bedeckt in dessen blauen Augen sich neben einem etwas schwärmerischen Ausdrucke eine unendliche Güte und nie versagende Liebenswürdigkeit widerspiegelte, stand dort im achten Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts auf der Höhe seines Schaffens. Dort empfing er die zahlreichen Besucher aus allen Weltteilen sowohl in seiner Klinik, der alten Infirmary, als in seinem Hause immer mit der gleichen Gastlichkeit, aber auch stets mit der gleichen wissenschaftlich ernsten Sachlichkeit. Denn oft geschah es, daß er nach einem Mittagessen in seinem Hause einen oder mehrere seiner Gäste zu einem Vortrage über seine Theorie und zur Besichtigung seiner Bakterienzüchtungen einlud; und nicht selten holte er noch spät abends einen Gast aus dem Gasthause ab, weil eine wichtige Verletzung ihm aus der Klinik gemeldet worden war. So wußte er seine Zuhörer stets in kürzester Zeit in Theorie und Praxis einzuführen. —
Durch Pasteurs Arbeiten angeregt, hatte sich Lister schon jahrelang mit dem Studium der Bakterien und ihrer Beziehungen zu Wunden beschäftigt, aber zunächst rein theoretisch. Den Anstoß zur Umsetzung in die praktische Tätigkeit erhielt er durch einen Bericht vom Jahre 1865 über die Wirkungen, welche man auf den Rieselfeldern der Stadt Carlisle durch Zusatz von Karbolsäure zu den Abwässern gemacht hatte: fast jede Art von Fäulnis wurde auf diese Weise verhindert, tierische und pflanzliche Schmarotzer unschädlich gemacht und zerstört. Von diesem Antiseptikum, der Karbolsäure, gingen also Listers praktische Versuche aus; aber es möge von vornherein betont werden, daß sie einem wesentlich anderen Gesichtspunkte Rechnung trugen, als dies bisher geschehen war. Seine zahlreichen Gegner, die ihm besonders in England erstanden (Simpson, Elliot u. v. a.), suchten zu beweisen, daß seine „antiseptische Behandlung“ nichts weiter sei als die längst bekannte Anwendung der Karbolsäure bei der Wundbehandlung. Demgegenüber hat Lister stets den grundsätzlichen Unterschied zwischen seiner „antiseptischen Wundbehandlung“ und der Anwendung antiseptischer Mittel als Verbandmaterial hervorgehoben.
Um diesen Unterschied klar hervortreten zu lassen, möge zunächst ein kurzer Abriß der Geschichte der bisher üblichen chemischen Wundmittel gegeben werden, die von den Gegnern Listers zusammengetragen worden ist. Sie ist von Thamhayn (Halle) in seinem unter der Anregung Volkmanns geschriebenen Buche: „Der Listersche Verband. 1875“ verwertet worden. Auf die von John Colbatch („A treatise on Alkali and Acid“) im Jahre 1698 verfaßte Schrift brauchen wir nicht weiter einzugehen, da sie nur für Physiologen und innere Mediziner Interesse bietet. Aber sie enthält einen Anhang unter dem Titel: Novum lumen chirurgicum, in welchem ein Wundpulver dringend[22] empfohlen wird, nicht nur als vortreffliches Blutstillungsmittel, sondern zugleich wegen seiner Einwirkung auf frische Wunden. Der entscheidende Satz lautet nach Thamhayns Übersetzung folgendermaßen: „Ungefähr 4 Tage nach der ersten Anwendung des Pulvers wurde die Wunde wegen eines neuen Verbandes freigelegt. Sie war in einem sehr guten Zustande, eiterte nicht im geringsten, und nur eine dünne wäßrige Flüssigkeit von der ich vermute, daß sie aus den Drüsen und Lymphgefäßen ausgeschwitzt sei, kam zum Vorschein. Blieb sie eine Zeitlang auf dem Verbände liegen, so fing sie an zu riechen; aber das, was aus der Wunde frisch herauskam, war wohlriechend wie eine Rose.“ Da der Verfasser die Zusammensetzung des Pulvers nicht verrät, so ist es müßig, sich darüber den Kopf zu zerbrechen; nur so viel sei gesagt, daß die Schilderung des Verhaltens der Wunde der Wirkung eines antiseptischen Mittels entspricht ohne daß man gerade an Karbolsäure zu denken braucht.
Die Karbolsäure, welche in Listers antiseptischer Behandlung eine so hervorragende Rolle gespielt hat, wurde im Anfange der sechziger Jahre des 19. Jahrhunderts von Deutschland und Frankreich aus ungefähr gleichzeitig empfohlen. Der Franzose Lemaire veröffentlichte 1863 eine Abhandlung über das Mittel, die 1865 in erweiterter Ausgabe erschien. Eine im Inhalte ähnliche Arbeit lieferte in dem gleichen Jahre Déclat; doch soll schon im Französisch-Österreichischen Feldzuge von 1859 die Karbolsäure in Form eines Pulvers aus Kreide und Steinkohlenteer zur Anwendung gekommen sein. Noch früher, als es in Frankreich geschah, hat Küchenmeister in Dresden (1860) die Karbolsäure unter dem Namen Spirol äußerlich und innerlich benutzt. Er beschreibt das Spirol als einen farblosen kristallisierten Körper, der bei 34oC schmilzt, bei 187o siedet und den man entweder aus dem Steinkohlenteeröl oder durch Destillation des Salizins mit Kreide herstellt.
So hatte die Karbolsäure in Deutschland und Frankreich sich bereits ein gewisses Feld erobert, als man auch in England mit der Anwendung des Eiterung und Fäulnis hemmenden Mittels begann. Auf diesen Zustand der Dinge stieß Lister, als er dazu überging, seine theoretischen Studien praktisch zu verwerten.
Es war im Jahre 1867, als Lister mit seinen ersten Erfahrungen über die neue Behandlungsmethode bei offenen Knochenbrüchen und Abszessen hervortrat; bald folgte ein Vortrag in der British Medical Association zu Dublin am 9. August desselben Jahres, in welchem er die Art seiner Behandlung aller frischen Wunden darlegte. Und von nun an setzte sich fast durch ein Menschenalter hindurch eine ununterbrochene Reihe von Äußerungen in Wort und Schrift fort, die dazu dienten, der neuen Behandlung den Boden zu bereiten und sie immer weiteren Kreisen zuzuführen.
Lister ging von dem Gesichtspunkte aus, daß alle Wundstörungen ausschließlich als Bakterienwirkungen zu betrachten seien; demgemäß habe die Wundbehandlung nur die Aufgabe, das Eindringen der Schmarotzer in die Wunde zu verhüten oder, falls sie bereits während der Verletzung eingedrungen seien, ihre Unschädlichkeit herbeizuführen. Diesem Gedankengange entsprechend entwarf er seinen Behandlungsplan, den er bei wachsender Erfahrung fortgesetzt zu bessern und zu vervollkommnen sich bemühte.
Die Behandlung offener Knochenbrüche setzte sich[23] zum Ziele, einen aseptischen Schorf auf der Wunde zu erzeugen, der sie vor weiterer Verunreinigung schützen und dadurch eine gleiche Gunst der Verhältnisse herstellen sollte, wie sie die geschlossenen Brüche genießen. Die Wunde wurde mit einem in flüssige Karbolsäure getauchten Lintlappen betupft, später sogar in ihrer Tiefe ausgewischt, zum Schluß mit einem neuen, die Wundränder nur wenig überragenden, in Karbolsäure getauchten Lintstücke bedeckt und dieser so lange angedrückt gehalten, bis er festhaftete. Das Läppchen bildete mit Blut und Serum einen die Wunde verschließenden Schorf, der nun die Möglichkeit einer Heilung wie bei geschlossenen Knochenbrüchen darbot, wenn das verletzte Glied zugleich entsprechend geschient worden war; aber in der Weise, daß die Wunde immer leicht zugängig blieb. Denn wenn auch Lister von vornherein dem Grundsatze huldigte, daß die Wunde nach Möglichkeit in Ruhe gelassen werden müsse, so trat dieser Gesichtspunkt doch zurück gegenüber der drohenden Gefahr einer Bakterieneinwanderung, wenn bei schneller Verdunstung der Karbolsäure und Eintrocknen des Schorfes sich in letzterem Risse bildeten, oder wenn der Lintrand sich lockerte. Um dem entgegenzutreten, wurde der Schorf entweder täglich von neuem antiseptisch angefeuchtet, oder Umschläge mit verdünnter Karbolsäure gemacht, auch wohl, um die Verdunstung zu verlangsamen, das ursprüngliche Lintstück mit angefeuchtetem Wachstaft (Protective silk), oder Ölpapier, oder endlich mit einem dünnen, biegsamen Stücke Zinnblech oder Stanniol überdeckt. Diese Behandlung wurde fortgesetzt, selbst wenn etwas Eiterung sich einstellte, meistens mit dem Erfolge, daß die Absonderung bald aufhörte und die weitere Heilung ungestört verlief.
Die Eiterbildung war häufig nur die Folge der Reizung, welche die starke Karbolsäurelösung (20–40 %) auf der Haut hervorrief. Auch zeigte sich bald, daß die bisherige Behandlung nur für kleinere Wunden brauchbar war, für größere aber ihre Bedenken hatte, weil die weit überdeckte Haut unter der ätzenden Wirkung des Heilmittels zu leicht abstarb. Um das zu vermeiden, stellte Lister eine dem Glaserkitt gleichende Paste aus Schlämmkreide und gekochtem Leinöl her, der im Verhältnis von 1:4 Karbolsäure zugesetzt wurde; sie war übrigens von ihm schon früher bei Abszeßeröffnungen benutzt worden. Diese Paste wurde, auf Zinnblech oder Stanniol gestrichen, auf die Wunde gelegt und durch Heftpflaster festgehalten; die Kappe sollte so geformt sein, daß der Abfluß der Wundfeuchtigkeiten möglich blieb. Sehr bezeichnend ist aber des Meisters Furcht vor einer Ansteckung der Wunde durch Luftkeime, die in seinen Anschauungen stets eine erhebliche Rolle gespielt hat. Unter die Zinn- oder Stanniolkappe, deren Unterseite mit dem Gemisch von Glaserkitt und Karbolsäure bestrichen ist, legt er nämlich noch ein mit Karbolsäure getränktes Lintstück unmittelbar auf die Wunde; aber nicht, wie man denken sollte, um ein seitliches Einwandern von Keimen zu hindern, sondern seine Sorge richtet sich vor allen Dingen darauf, daß beim täglichen Abheben der Deckplatte jenes Lintstück nicht abgerissen oder auch nur gelüftet werde, weil ein auch nur vorübergehend freier Zutritt der Luft den verderblichen Luftkeimen den Eingang zur Wunde eröffnen könne. Diese Sorge ist auch für die weitere Entwicklung seiner Behandlungsmethode maßgebend gewesen.[24] Im übrigen unterscheidet er bereits in dieser frühen Periode die durch Bakterienwirkung erzeugte von der durch chemische Mittel hervorgerufenen Eiterung.
Die zweite Gruppe von Erkrankungen, auf welche die neue Behandlung Anwendung fand, waren die Abszesse. Die darüber von Lister angestellten Betrachtungen sind weniger grundlegend geworden, als die Behandlung offener Knochenbrüche und anderer Wunden; denn da der Tuberkelbazillus damals noch nicht entdeckt und die infektiöse Grundlage der kalten Abszesse demnach noch unbekannt war, so findet nirgends eine Scheidung zwischen heißen und kalten Abszessen statt. Die Besprechung seiner Behandlung bezieht sich aber fast ausschließlich auf letztere, was aus seiner Bemerkung entnommen werden kann, daß im ungeöffneten Abszesse der allgemeinen Regel nach keine septischen Lebensformen vorhanden seien. Die großen Hoffnungen, welche er an die Anwendung seiner Methode auch bei dieser Erkrankung knüpfte, haben sich freilich bei ausgedehnterer Erfahrung nicht in dem ursprünglichen Sinne aufrecht erhalten lassen, da zwar die Eiterabsonderung mehr oder weniger aufhörte, aber an ihre Stelle eine Fistel mit wäßriger Absonderung ohne Heilungsneigung zu treten pflegte. Immerhin hat die Methode erst die Möglichkeit eröffnet, den Verlauf einer tuberkulösen Eiterung, frei von jeder Gefahr einer Ansteckung durch Bakterien anderer Art und Wirkung, zu studieren und die Lebensäußerungen dieser gefährlichen Schmarotzer in breiterem Rahmen festzustellen.
Die Eröffnung der Abszesse geschah nach den gleichen Grundsätzen der Antisepsis, die oben schon dargelegt wurden. Ein Stück Zeug, in eine Lösung von 1 Karbolsäure zu 4 gekochten Leinöls getaucht, wird über den Hautbezirk gedeckt, in welchem die Eiteransammlung eröffnet werden soll, das obere Ende von einem Gehilfen festgehalten, das untere ein wenig gelüftet, hier das zuvor in die Lösung getauchte Messer eingeführt, durch die Haut gestoßen und sofort zurückgezogen, während die antiseptische Decke sogleich wieder angedrückt wird. Der Eiter wird durch die Finger unter dem Decklappen herausgepreßt und kann sich durch die Schnittöffnung hindurch frei entleeren. Nur bei stärkerer Blutung oder sehr dicker Abszeßwand soll man ein Stück getränkten Lints in die Öffnung legen. Über diesen tiefsten Schutzverband kommt dann die oben beschriebene Kappe des mit antiseptischer Paste bestrichenen Zinnblechs oder eines Stückes Stanniol.
Wir sehen also, daß der ursprüngliche antiseptische Verband so eingerichtet ist, daß die obere Schicht täglich abgenommen und durch Aufträufeln von Karbolsäure auf die tieferen Schichten in seiner Wirksamkeit immer von neuem verstärkt werden kann. Die Wundfläche als solche bleibt dabei völlig unberührt, die Wunde heilt unter einem antiseptischen Schorfe.
Ein weiterer, besonders bedeutungsvoller Schritt wurde durch Abänderung und Vervollkommnung der Unterbindungsfäden getan. Die bisher benutzten seidenen Fäden, die in ihrem lockeren Gewebe stets eine Menge von Keimen enthielten, riefen demgemäß gewöhnlich Eiterung der Umgebung hervor, die durch ihren Einfluß auf die Unterbindungsstelle des Gefäßes und seines aus einem oder — bei Kontinuitätsunterbindungen — aus zwei Blutpfröpfen bestehenden Inhaltes bei Arterien zu gefährlichen und oft wiederholten Nachblutungen, bei größeren Venen[25] zu pyämischen Erscheinungen infolge der Fortschwemmung keimbeladener Thrombenbröckel zu führen vermochte. Lister sprach sich zuerst im Jahre 1867 bei noch geringer Erfahrung über die Möglichkeit aus, antiseptisch gemachte Unterbindungsfäden kurz abzuschneiden und sie in der Wunde zu versenken, wo sie durch Aufsaugung oder sonstwie verschwinden möchten. Versuche an der umfangreichen äußeren Halsschlagader des Pferdes, die mit gewöhnlichen, aber zuvor mit Karbolsäure durchtränkten Seidenfäden unterbunden worden war, bestätigten seine Vorstellungen; und seitdem wurden alle seidenen Unterbindungsfäden abgeschnitten und versenkt. Zugleich machte er dabei die Erfahrung daß die durch Zusammenschnürung des Fadens absterbenden Gewebsteile keinerlei Schaden anrichten, vorausgesetzt, daß sie keimfrei bleiben. Immerhin war die durch dies Verfahren erzielte Sicherheit noch keineswegs vollkommen und wir finden daher den fleißigen Forscher jahrelang mit der Verbesserung des Unterbindungsmaterials beschäftigt. In der Darmsaite (Catgut), nachdem sie eine vorgeschriebene Zeit in Karbolöl gelegen hatte, glaubte er im Jahre 1870 einen allen Anforderungen genügenden Stoff gefunden zu haben, zumal auch in der Richtung, daß die kurz abgeschnittenen Fäden in der geschlossenen Wunde der Aufsaugung verfielen und deshalb außerstande wären, später Störungen hervorzurufen. In der Tat hat die Karboldarmsaite lange Jahre als ein notwendiger Bestandteil des antiseptischen Verbandes gegolten, bis auch hier die immer schärfer einsetzende Kritik auf Grund der wachsenden Fortschritte in der Bakterienlehre das Karbolcatgut zu Fall brachte, die Karbolsäure durch andere Stoffe ersetzte und das Verfahren vielfach änderte; bis man in dem ewigen Kreislaufe der Dinge endlich zum seidenen Unterbindungsfaden fast allgemein zurückgekehrt ist. Wir werden darauf weiter unten zurückzukommen haben.
Inzwischen nehmen wir den Faden der weiteren Entwicklung des eigentlichen antiseptischen Verbandes wieder auf, dessen verschiedene Abänderungen wir nur kurz zu berühren brauchen, da sie eine dauernde Bedeutung nicht gewonnen haben. Die beiden Ziele, welche Lister verfolgte, waren einerseits die Verhinderung einer fortgesetzten Berührung der Karbolsäure mit der Wunde, durch welche erfahrungsgemäß eine übermäßige Heizung und Absonderung hervorgerufen wurde, anderseits der sichere Abschluß der Wunde gegen Luftkeime. Dazu kam allmählich das Bestreben, den täglichen Wechsel der oberen Verbandschichten behufs ihrer neuen Durchtränkung mit Karbolsäure zu vermeiden, also einen Dauerverband herzustellen, unter dem wenigstens mehrere Tage lang die Wunde vor einer Infektion gesichert sein konnte. Das erstgenannte Ziel suchte er nun zeitweilig auch auf dem Wege zu erreichen, daß er die Karbolsäure durch ein anderes Mittel, das Chlorzink, zu ersetzen anstrebte; allein so wertvoll sich dieses bei Wunden erwies, die nicht sicher aseptisch zu halten waren, wie solche der Zunge und des Oberkiefers, so blieben doch für alle anderen die Eigenschaften der Karbolsäure unerreicht Die Schlämmkreide als Trägerin des antiseptischen Mittels ersetzte er eine Zeitlang durch Bleipflaster, dem die Karbolsäure und etwas Wachs beigemischt waren. Darüber legte er ein mit wäßriger Karbolsäurelösung getränktes Stück Kaliko, welches wiederum von einem breiten Bleipflasterstreifen festgehalten wurde. Allein als sich zeigte, daß durch die wäßrige Lösung die Pflastermasse erweicht und allmählich die Sicherheit[26] der Wunde gefährdet wurde, vertauschte er das Bleipflaster mit einem Schellackpflaster, welches später noch von einer schwachen Lösung von Guttapercha in Schwefelalkohol überpinselt wurde, um das unangenehme Ankleben des Schellacks an die Haut zu vermeiden. Ein solcher Verband wurde dann bei einer frischen Wunde (offener Knochenbruch) in folgender Schichtenfolge angelegt: Einspritzung einer reichlichen Menge wäßriger 20 %iger Karbolsäurelösung in die Wunde, Verbreitung derselben durch Druck und Wiederentfernung eines Teils durch Streichen und Drücken; Auflegen eines antiseptisch befeuchteten Stückes Zinnblech dessen Bedeckung mit einem weit überragenden Stücke Schellackpflaster darüber ein zusammengefaltetes Verbandstück, von öliger Karbolsäurelösung 1:4 durchtränkt, endlich Pappschienen, die den Knochenbruch sicherten. Die geölte Überlage wurde alle 24 Stunden erneuert, blieb aber vom 3. Tage an liegen und wurde nur noch mit Karbolöl überstrichen.
Hatte sich das geschilderte Verfahren auch auf das beste für einfachere Verwundungen bewährt, so nötigte doch die Vielgestaltigkeit der Verletzungen zu immer neuen Maßnahmen. Insbesondere waren es die durch Operation erzeugten Wunden, die zu besonderen Vorsichtsmaßregeln zwangen, um von dem Kranken jede schädliche Einwirkung fernzuhalten. So entstanden neue Vervollkommnungen, die der Unermüdliche in seinem Vortrage gelegentlich der 39. Jahressitzung der British Medical Association zu Plymouth im August 1871 besprach. Als die unverrückbare Grundlage seiner Methode sieht er nach wie vor Pasteurs Versuche an, die er selbsttätig fortsetzte und ergänzte. So erweiterte er den auf S. 20 geschilderten Versuch Pasteur-Chevreuils in folgender Weise: An vier, zum Teil mit frischem Harn gefüllten Flaschen zog er bei dreien den Hals lang aus mit mehrmaligen winkligen Knickungen, während er den der vierten Flasche noch enger machte, aber kurz und senkrecht stehen ließ. Dann wurde der Inhalt aller vier Gefäße 5 Minuten lang gekocht und unverschlossen weggestellt. In dem Behälter mit geradem Halse entwickelten sich schon nach wenigen Tagen ein Pilzrasen und Zersetzung, während der Urin der drei anderen Flaschen noch nach 4 Jahren unverändert war. Mit Recht deutet Lister den Versuch dahin, daß die in alle vier Gefäße gleichmäßig ein- und ausströmende Luft ihre Keime an den Winkeln absetze, während diese durch den zwar engen, aber geraden Hals ohne Hindernis zur Flüssigkeit gelangen. Auch physikalisch konnte diese Annahme bestätigt werden, indem sich zeigte, daß die in den Flaschen enthaltene Luft optisch leer, d. h. ohne alle Staubteilchen war.
Auf dieser Grundlage baute er an der Vervollkommnung seiner Behandlungsmethode unentwegt weiter. Bei seinen Versuchen hatte er die Entdeckung gemacht, daß die durch Watte hindurchströmende Luft ihres Gehaltes an Staub und Keimen entkleidet wurde; demgemäß spielte auch die „antiseptische Watte“ in seinen späteren Verbänden eine hervorragende Rolle. Im übrigen gibt er über den dermaligen Stand seiner Maßnahmen einen Bericht, dem noch die weiteren Verbesserungen bis zum Jahre 1874 eingefügt werden sollen.
Als neu ist der Zerstäuber (Spray) eingeführt, ein mit verdünnter Karbolsäure gefülltes Glas, dessen Inhalt durch ein Gebläse mit doppeltem Gummiballon in Form eines Dunstkegels ausgeworfen wurde und den[27] Zweck hatte, die während einer Operation anzulegende Wunde vor dem Eindringen von Luftkeimen zu schützen. Zuvor wurde die Oberhaut antiseptisch befeuchtet und die zum Gebrauche bestimmten Geräte, sowie alle Schwämme zum Reinigen der Wunden in eine Karbolsäurelösung getaucht, deren Stärke eine Zeitlang bis auf 1:100 heruntergegangen war, späterhin aber wieder auf 1:40 = 2½ % oder selbst auf 5:100 erhöht wurde. Wunden, die erst längere Zeit nach der Verletzung zur Behandlung kamen, wurden mit einer noch stärkeren Lösung, nämlich 1:5 Weingeist, gewaschen.
Schon seit 1870 stellte sich das Bedürfnis heraus, bei genähten und unregelmäßigen Wunden für den Abfluß der Wundabsonderungen zu sorgen. Das geschah zunächst durch Einführung eines in Karbolöl getauchten Lintstreifens, der später durch Gummiröhrchen, endlich durch aufsaugbare Drains ersetzt wurde.
So hatte sich denn der eigentliche Wundverband seit jenem Jahre zum antiseptischen Dauerverbande entwickelt. Er bestand aus einem grobmaschigen Baumwollengewebe, dem antiseptischen Mull, der in eine Mischung von Karbolsäure 1, Harz 5 und Paraffin 7 eingetaucht, dann zwischen zwei Rollen ausgepreßt und getrocknet wurde. Auf diese Weise erreichte man die völlige Durchtränkung der Fäden, die Maschen des Gewebes aber blieben offen. Das Harz sollte die antiseptische Flüssigkeit längere Zeit festhalten, der Paraffinzusatz das nachteilige Ankleben verhindern. Der Verband wurde in folgender Weise angelegt: Unter fortgesetzter Karbolzerstäubung legte man auf die offene oder genähte Wunde ein Stück Schutzhülle (Protective silk), d. h. ein Stück undurchlässigen Stoffes von dem Umfange der Wunde, um diese vor der fortdauernden Reizung durch die Karbolsäure des Verbandes zu schützen. Darüber kam eine achtfache Lage des antiseptischen Mulls, die Wundränder weit überragend, zwischen dessen zwei obersten Lagen wiederum ein Blatt guten, wasserdichten Stoffes (Mackintosh-Zeug) eingefügt war. Das Ganze wurde später, wenigstens in Deutschland, gewöhnlich noch mit einer Schicht antiseptisch gemachter, trockener Watte überdeckt, die Verbandstücke durch eine darübergelegte Binde, entweder aus dem gleichen antiseptischen Mullstoffe, oder mit steif werdenden Gazebinden befestigt. Auf letztere hat später Volkmann einen besonderen Wert gelegt, da sie eine Art von Schienung darstellten, welche die Bewegungen des verletzten Körperteiles einschränkte. — Die beschriebene Anordnung hatte den Zweck, einesteils die Wunde vor jeder Reizung zu schützen, andernteils die Wundflüssigkeiten zu einem weiten Wege durch die Verbandstoffe zu zwingen, ehe sie an der Oberfläche erschienen. Geschah dies, so mußte der Verband sofort gewechselt werden, entweder ganz oder wenigstens in den oberen Schichten; dagegen konnte er bei nur geringer Absonderung zuweilen 8 und selbst 14 Tage liegen bleiben, so daß die Heilung nicht selten unter einem einzigen Verbande ganz oder doch zum größten Teile erfolgte.
Die Karbolsäure wurde damals fast ausschließlich in wäßriger Lösung benutzt; nur selten kamen noch ölige Lösungen oder Chlorzink zur Anwendung.
Der hier beschriebene Verband ist lange Jahre unter dem Namen des „Listerschen Verbandes“ gegangen. Die deutsche Sprache wurde sogar um ein Zeitwort bereichert, indem man die Anwendung der Methode mit dem Worte „listern“ bezeichnete. Ihre Beschreibung dürfte[28] den Beweis geliefert haben, daß Lister völlig im Rechte war, als er gegen die Gleichstellung seines Verfahrens mit der alten Anwendung antiseptischer Mittel auf Wunden Verwahrung einlegte. Es gewährt einen nicht geringen ästhetischen Genuß, die in allen Einzelheiten fein ausgeklügelte Methode in ihren Entwicklungsstufen zu verfolgen; nicht minder aber, zu sehen, mit welcher wachsenden Zuversicht der edle, ganz seinen Zielen sich hingebende Mann das Wesen und die Wirksamkeit seiner Behandlung darlegt und mit welcher nachdrücklichen, aber trotzdem bescheidenen Weise er von deren Erfolgen spricht.
Man hätte denken sollen, daß ein wissenschaftlich so sorgfältig vorbereitetes, bis ins kleinste durchdachtes Behandlungssystem mit seinen schon damals glänzenden Ergebnissen, wie sie von Lister bruchstückweise mitgeteilt wurden, sich die Welt im Fluge hätte erobern müssen. Davon war indessen auf lange hinaus nichts zu verspüren. Der völlige Bruch mit den hergebrachten Anschauungen und Überlieferungen, die menschliche Trägheit, welche es verschmäht, sich in Gedankengänge hineinzuarbeiten, denen gegenüber von vornherein ein gewisses Mißtrauen erwacht, der bequeme Schlendrian des bisherigen Verfahrens, die teilweisen Mißerfolge der ersten halben Versuche und die Furcht, zu schaden, die häufigen Abänderungen der Methode, endlich hier und da Neid und Mißgunst: alles das kam zusammen, um den Siegeslauf der neuen Gedanken in einer Weise zu mäßigen, daß man bei der Rückschau in jene Zeit fast vor einem Rätsel steht. In England, zumal in Schottland, und sogar in der nächsten Umgebung Listers verhielt man sich ablehnend, bestenfalls abwartend. Von seinen chirurgischen Kollegen (Namen wie Watson, Spence, Annandale) in der alten Infirmary zu Edinburgh, wo jener seine klinische Abteilung hatte, war noch im Jahre 1876 kein einziger über die ersten schüchternen Versuche hinausgelangt; meistens verhielten sie sich gleichgültig oder gar feindlich. Und noch lange darüber hinaus bewährte sich das Wort, daß der Prophet in seinem Vaterlande nichts gilt; denn die größere Menge der englischen Chirurgen folgte erst nach, als der Ruhm des Landsmannes im Auslande bereits fest begründet war.
Noch viel länger freilich als in England dauerte der Widerstand in Frankreich. Nicht zum wenigsten trug hierzu der nationale Widerwille gegen eine Neuerung bei, die alle Errungenschaften der bis dahin führenden französischen Chirurgie umzuwerfen oder auf den Kopf zu stellen drohte. Im Laufe des 18. und 19. Jahrhunderts war Frankreich fast unbestritten das Land des chirurgischen Fortschritts gewesen, obwohl hervorragende Geister in England wie in Deutschland wiederholt den Versuch gemacht hatten, ihre Wissenschaft von der geistlosen und unselbständigen Bewunderung des Fremden zu befreien und ihr ein mehr völkisches, auf gesunder Kritik beruhendes Gepräge zu geben. Solche Wege waren, freilich ohne allzu große Erfolge, schon von August Gottlieb Richter und Vinzenz v. Kern, späterhin mit größerem Nachdrucke von Karl Ferdinand v. Gräfe, C. F. Dieffenbach und Bernhard v. Langenbeck eingeschlagen worden; aber die hohe Stellung der französischen Chirurgie, der Einfluß insbesondere der Schule von Paris auf das Urteil der deutschen Ärzte blieb dennoch[29] fast unerschüttert. So begreift sich seelisch die Abneigung der Franzosen gegen die Neuerungen aus einem Lande, welches man damals noch als Sitz des Erbfeindes zu betrachten niemals aufgehört hatte. Freilich hat die französische Chirurgie ihr sehr langes Zögern mit der zeitweilig starken Verminderung ihres Ansehens bezahlen müssen, obwohl sie späterhin in glänzendem Aufschwunge ihre Fehler gutzumachen, das Versäumte einzuholen verstand.
Indessen soll es nicht unsere Aufgabe sein, diese Entwicklung in England und Frankreich, bald auch in allen anderen europäischen Ländern und in Amerika zu verfolgen; vielmehr müssen wir uns damit begnügen, den Umschwung zu schildern, wie er sich in Deutschland vollzog. Denn Deutschland ist das Land, dem Lister seine ersten großen Erfolge in allgemeiner Anerkennung verdankt, wie er selber es wiederholt ausgesprochen hat. Die Hoffnung, der er in einer Julinacht des Jahres 1874 in Edinburgh dem jungen Dozenten Otto Madelung gegenüber bewegten Herzens Worte lieh, daß seine jungen ausländischen Schüler, insbesondere die deutschen, ihm helfen würden, alle die Widerstände zu überwinden, die ihm in seiner nächsten Umgebung, wie in ganz England, auf Schritt und Tritt begegneten, ist denn auch nicht getäuscht worden.
Schon die erste Arbeit Listers: „Über ein neues Verfahren, offene Knochenbrüche und Abszesse zu behandeln, mit Beobachtungen über Eiterung“, vom Jahre 1867 war in Deutschland nicht unbeachtet geblieben; allein der einzige Gewinn, den man daraus zog, beruhte in der Annahme, daß die Karbolsäure in öliger, später auch in wäßriger Lösung ein vortreffliches Verbandmittel sei. Nur wenige deutsche Chirurgen wagten sich einen Schritt weiter, indem sie an die Stelle der Charpie Listers Karbolpflaster zur Bedeckung der kleinen Wunden bei Durchstechungsfrakturen setzten. Im Deutsch-Französischen Kriege von 1870/71 spielten die Karbollösungen in Öl oder Wasser eine große Rolle; da man sie aber nur zur Anfeuchtung von Charpie überaus zweifelhafter Herkunft benutzte, so rochen zwar die Dauerlazarette innen und außen stark nach dem Verbandmittel, aber für die Heilung und das Wohlergehen der Kranken war damit nichts gewonnen. Die Wundkrankheiten forderten demnach in den überfüllten Kriegslazaretten ebenso regelmäßig ihre Opfer, wie dies in alten, verseuchten Krankenhäusern des Friedens bisher der Fall gewesen war. Auf das eigentliche Wesen der antiseptischen Wundbehandlung war bisher niemand eingegangen.
Ein Umschwung trat erst ein, als der Stabsarzt A. W. Schultze, ein Schüler der Bardelebenschen Klinik in der Berliner Charité, in der Sitzung der Militärärztlichen Gesellschaft vom April 1872 einen Vortrag über Listers antiseptische Wundbehandlung hielt, als Frucht einer Studienreise, die er im Oktober 1871 durch Deutschland, Belgien, Holland und England bis Edinburgh unternommen hatte. Dieser Vortrag erschien im Februar 1873 in Volkmanns Sammlung klinischer Vorträge. In klarer und umfassender Weise ging Schultze auf die Idee ein, welche dem ganzen Verfahren zugrunde lag und schilderte letzteres in allen Einzelheiten so genau, daß fortan die Verbreitung einer gründlichen Kenntnis bei allen deutschen Chirurgen mindestens angebahnt wurde. Der schnelle Aufschwung indessen, welchen die Listerschen[31] Lehren von nun an in Deutschland erfuhren, würde gar nicht zu verstehen sein ohne die Berücksichtigung jenes großen, nunmehr zu besprechenden Ereignisses, durch welches die deutsche Chirurgie in den Stand gesetzt wurde, binnen wenigen Jahren die führende Stelle in den Wettbestrebungen zur Verbesserung des Loses verwundeter und erkrankter Menschen zu übernehmen.
Auf eine von Gustav Simon schon im Herbste des Jahres 1871 erfolgte Anregung erließen nämlich im März 1872 Bernhard v. Langenbeck (Berlin), Gustav Simon (Heidelberg) und Richard Volkmann (Halle) ein Rundschreiben, welches die Aufforderung zur Gründung einer Deutschen Gesellschaft für Chirurgie und zur Abhaltung eines Kongresses in Berlin in den Tagen vom 10. bis 14. April enthielt. Man hatte sich zuvor der Zustimmung einer größeren Anzahl deutscher Chirurgen versichert, zunächst aber noch keine Satzungen entworfen, vielmehr nur in allgemeinen Umrissen die Ziele bezeichnet, denen man zustrebte. Die Ausarbeitung der Satzungen blieb einem Ausschusse vorbehalten, der in der ersten Sitzung des Kongresses gewählt werden sollte. Der Kongreß wurde am 10. April 1872 im Hôtel de Rome zu Berlin unter dem Vorsitze v. Langenbecks eröffnet, der bei der Wahl des Vorstandes Vorsitzender blieb. Eine glücklichere Wahl hätte nicht getroffen werden können, um das neue Unternehmen über die ersten Schwierigkeiten hinweg in geordnete Bahnen überzuführen. Der gleich vielen großen Deutschen einem evangelischen Pfarrhause entsprossene, im hannöverschen Horneburg geborene Wundarzt stand damals mit seinen 61 Jahren auf der Höhe seines Ruhmes. Aber es waren nicht allein seine Stellung als Leiter der angesehensten Universitätsklinik Deutschlands, nicht nur seine hohe wissenschaftliche Bedeutung, welche die Wahl auf ihn lenkten, sondern mindestens in gleichem Maße die Eigenschaften seines Körpers und Charakters. Der kaum mittelgroße zierliche Mann mit vollem, grauem, leicht gewelltem Haupthaar hatte in Haltung, Bewegung und Rede etwas so ungesucht Vornehmes, daß er auch unter vielen sofort die bewundernden Blicke auf sich zog. Dazu kam sein stets verbindliches und maßvolles Wesen, welches auch kleinen Geistern gegenüber niemals sein Übergewicht hervorkehrte. Mit Recht nennt ihn der im Zentralblatte für Chirurgie nach seinem Tode erschienene Nachruf den ersten und edelsten Chirurgen seiner Zeit. Ein Mann mit solchen Eigenschaften war der geborene Vorsitzende der von ihm gegründeten Gesellschaft und seine alljährliche Wiederwahl erschien trotz seinem Widerstreben als eine Selbstverständlichkeit, auch als er im Jahre 1881 auf sein Amt als Leiter der Klinik verzichtete und seinen Wohnsitz nach Wiesbaden verlegte. Erst mit dem Kongreß von 1885 trat er endgültig zurück, nachdem die Gesellschaft ihn zum Ehrenmitgliede ernannt hatte. Im folgenden Jahre war die Leitung zum erstenmal in anderen Händen, da R. v. Volkmann zum ersten Vorsitzenden gewählt worden war; aber keiner der Nachfolger Langenbecks auf dem Stuhle des Vorsitzenden hat es zu ähnlicher stillschweigender Anerkennung seines Wesens gebracht, wie sie jenem entgegengetragen wurde.
Schon die dritte Sitzung des ersten Kongresses wurde nicht mehr im Römischen Hofe, sondern in der chirurgischen Universitätsklinik abgehalten; von da an bis zum Jahre 1891 stand der Gesellschaft die alte[32] Aula im Universitätsgebäude zur Verfügung. Die Übersiedlung in ein eigenes Heim soll später erzählt werden.
Die Gesellschaft zählte im Eröffnungsjahre 130 Mitglieder, von denen 81 sich am Kongresse beteiligten. Dem Ausschusse gehörten außer dem Vorsitzenden an: Viktor v. Bruns als stellvertretender Vorsitzender, Volkmann und Gurlt als Schriftführer, Trendelenburg als Kassenführer. Die Vermehrung der Mitglieder erfolgte in den ersten 10 Jahren des Bestehens in einem keineswegs überstürzten Zeitmaße; vielmehr war auf dem X. Kongreß von 1881 erst die Zahl 287 erreicht. Seitdem aber begann ein so schnelles Ansteigen, daß im Jahre 1900 das erste, 10 Jahre später bereits das zweite Tausend überstiegen war. Von den Schwierigkeiten, welche dadurch für die Unterbringung der Teilnehmer an den Kongressen, für die Geschäftsführung und die Verständigung der Mitglieder untereinander erwuchsen, soll später gesprochen werden; doch wird man ohne Übertreibung sagen können, daß die ersten 15 Jahre die glücklichsten der Gesellschaft gewesen sind, da die kleine Zahl allen Mitgliedern Gelegenheit zu persönlicher und freundschaftlicher Annäherung bot, durch welche manche Schärfe in den Verhandlungen vermieden wurde. Und doch gab gerade jene Periode, in der um die Einführung der Antisepsis zuweilen erbitterte Kämpfe ausgefochten wurden, Gelegenheit genug zu Reibungen aller Art. Niemals wieder hat späterhin eine gleich bewegte, fast begeisterte Teilnahme an den Verhandlungen stattgefunden, wie damals, als ein großes Ziel des Strebens erst in den Umrissen gezeigt, aber noch nicht erreicht war.
Wenden wir uns nun wiederum der Art und Weise zu, in welcher die neuen Lehren Boden suchten und fanden, so müssen wir vor allen Dingen eines Mannes gedenken, der mit fast jugendlicher Begeisterung — er war damals 42 Jahre alt — sie ergriff und in stetem, oft überaus lebhaft geführtem Kampfe, in welchem sein Geist, seine dichterische Begabung, sowie seine Meisterschaft in der Beherrschung der Sprache ihm die schärfsten Waffen liehen, die widerstrebende Masse der Ärzte und Chirurgen allmählich zu überzeugen und fortzureißen wußte. Richard Volkmann, dem mittelgroßen, zierlich gebauten, beweglichen Manne mit den stahlblauen Augen, dem rötlichen Haupthaare und dem das Kinn freilassenden roten Backenbarte, verdankt die deutsche Chirurgie die frühzeitige Erkenntnis des Wertes der neuen Behandlung, für die er seine ganze Persönlichkeit einlegte. Der Leipziger Professorensohn war in der Tat der rechte Mann zur Durchführung einer solchen Aufgabe, für welche ihm neben seiner überragenden Klugheit ein schneidender Sarkasmus, der selbst in unverhüllte Derbheit übergehen konnte, zu Gebote standen. So geschah es denn, daß er bis zu seinem im Jahre 1889 erfolgten Tode nahezu unbestritten der Führer der deutschen Chirurgen auf dem Gebiete der Wundbehandlung gewesen ist, die alle, einige sehr früh, die meisten erst spät, seinen Spuren gefolgt sind.
Volkmann hatte in seiner Klinik zu Halle, die außerordentlich ungünstige hygienische Verhältnisse darbot, bisher die offene Wundbehandlung geübt, in Verbindung mit einer regelmäßigen Waschung der Wunden durch Lösungen von übermangansaurem Kali, Chlorkalk, später Karbolsäure. Bei der übergroßen Zahl schwerer Verletzungen, die in dem kleinen, überfüllten Krankenhause mit 50 Betten zuweilen bis zu[33] 45 v. H. aller Aufnahmen betrugen, verschlechterten sich aber die Verhältnisse in einem Maße, forderten die Wundkrankheiten so hohe Opfer, daß er im Sommer 1871 nahe daran war, die vorübergehende Schließung der Anstalt zu beantragen. Nur aus dem Gesichtspunkte einer lästigen, aber unabweislichen Pflichterfüllung begann er Ende November 1872 die Prüfung der Listerschen Methode, in der bestimmten Überzeugung, daß es sich nur um einen wenige Wochen dauernden, vergeblichen Versuch handeln würde. Die Ergebnisse aber, welche er unter genauer Befolgung aller Vorschriften erzielte, waren so verblüffend, daß er nicht wieder davon abkam. Am 10. April 1874, den wir mit Madelung als einen denkwürdigen Tag in der Geschichte der deutschen Chirurgie ansehen müssen, hielt er auf dem III. Kongreß einen Vortrag: „Über den antiseptischen Okklusionsverband und seinen Einfluß auf den Heilungsprozeß der Wunden“, in welchem er seine seit 15 Monaten gesammelten Erfahrungen besprach. Der Vortrag ist in seinen im Jahre 1875 erschienenen Beiträgen zur Chirurgie ausführlich wiedergegeben. Eigentümlich berührt in ihm die große Vorsicht, mit der der Redner sich gegen den Gedanken einer unbedingten Annahme der wissenschaftlichen Grundlage der Antisepsis, nämlich der bakteriellen Entstehung von Eiterung und Wundkrankheiten, verwahren zu müssen glaubt. Es braucht keineswegs angenommen zu werden, daß auch in diesem klaren Kopfe die Idee der Urzeugung der Keime, welche bei englischen Ärzten damals noch eine erhebliche Rolle spielte, mitgewirkt habe; immerhin hielt er es für geboten, die einfache Tatsache einer stark veränderten, besseren Wundheilung hinzunehmen, ohne sich durch eine bisher noch umstrittene Theorie die Hände binden zu lassen. Dagegen sprach er es unumwunden aus, daß mit den neuesten Listerschen Abänderungen seines Verbandes noch nicht das letzte Wort gesprochen sein könne. Insbesondere hoffe er, daß die Benutzung der Karbolsäure, „eines fatalen und nicht einmal ungefährlichen Mittels“, möglichst bald wieder aus der Chirurgie verschwinden werde. Darin hat er sich nicht getäuscht.
Seit jenem Tage ist die Frage der allgemeinen Wundbehandlung mehr als 25 Jahre lang in den Tagesordnungen der Chirurgenkongresse zu finden gewesen; denn die Deutsche Gesellschaft für Chirurgie war das Manometer, welches die Hebungen und Senkungen der Anschauungen stets getreulich aufzeichnete.
Mit gleichem Eifer wie die Entwicklung der Verbandtechnik behandelte sie aber auch dessen wissenschaftliche Grundlage, so sehr ablehnend sich Volkmann zunächst auch dagegen verhielt. Wir sind daher genötigt, auf das Aufkommen und den Ausbau der Bakterienkunde, soweit sie einen unmittelbaren Einfluß auf die Chirurgie ausgeübt hat, einen zusammenfassenden Rückblick zu werfen.
Auf S. 19 ist bereits erzählt worden, wie Schwann als erster alle Zersetzungsvorgänge auf Luftkeime zurückführte und wie zahlreiche Nachfolger er für seine Anschauungen fand. Aber trotz allem Geist und Scharfsinn, mit denen diese Theorie vorgetragen, verfochten und durch äußerst sinnreiche Versuche bestätigt wurde, blieb sie für die Lehre von der Entstehung der Wundkrankheiten dennoch zunächst unfruchtbar. Der Grund dafür lag in der schon 1840 von Henle beklagten Unfähigkeit,[34] die Erreger der Zersetzung, in denen er kleinste Pflanzen vermutete, auch dem bewaffneten Auge sichtbar zu machen. Zwar hatte Lister die Pilzrasen auf einem entsprechenden Nährboden zu züchten und die Art ihres Wachstumes zu beobachten gelernt; aber auch damit war man über den allgemeinen Begriff der „Keime“ nicht hinausgekommen.
An diesem toten Punkte erschien die Hilfe in Gestalt der seit dem Jahre 1855 durch J. v. Gerlach eingeführten Färbemethoden, durch welche es möglich wurde, einzelne Gewebe und Gewebsteile derart mit einem Farbstoffe zu tränken, daß sie im mikroskopischen Bilde mit Leichtigkeit von den Nachbargeweben unterschieden werden konnten. Allerdings dauerte es noch mehr als zwei Jahrzehnte, ehe man auch die pflanzlichen Schmarotzer zu färben und dem Auge sichtbar zu machen lernte; aber schon die in die gleiche Zeit fallende Verbesserung und Vervollkommnung der Mikroskope hatte die Forscher zu allerlei beachtenswerten Entdeckungen geführt. So hatte Rindfleisch schon im Jahre 1866 das Vorkommen von Bakterien in den Organen der an Wundinfektionskrankheiten Gestorbenen nachgewiesen, was durch Waldeyer und v. Recklinghausen 1871 bestätigt wurde. Im gleichen Jahre beschrieb Klebs das Microsporon septicum als den Erreger der Eiterung und Gewebsfäulnis, indem er unter jenem Namen die Stäbchen- und Kugelbakterien zusammenfaßte, wie es vor ihm schon Karl Hüter mit seinen „Monaden“ getan hatte. Dagegen stellte sich Billroth in seiner sehr umfangreichen und fleißigen, der Deutschen Gesellschaft für Chirurgie gewidmeten Arbeit „über die Vegetationsformen der Coccobacteria septica“ (1874) auf einen wesentlich verschiedenen Standpunkt. Auch er fand solche, zuweilen ungemein voneinander abweichende Vegetationsformen, die er einheitlich unter jenem Namen zusammenfaßte, zwar in allen gärenden und faulenden Flüssigkeiten und eiternden Geweben, sah sie aber nicht als die Ursache der Zersetzung an, sondern ließ diese aus der akuten Entzündung der Gewebe hervorgehen. Erst eine solche führe zur Bildung eines „phlogistischen Zymoids“, welches einen sehr günstigen Nährboden für die Entwicklung von Kokkobakterien darstelle. — Eine so geschraubte Deutung wird nur erklärlich, wenn man berücksichtigt, daß Billroths an sich vortreffliche Bakterienbilder doch sämtlich ohne Färbemittel gewonnen sind und daß, mit dem Fehlen der Unterscheidung bestimmter Arten, auch eine experimentelle Prüfung der Lebensvorgänge noch nicht hatte angebahnt werden können.
Wenn auch die übrigen Forscher sich mehr und mehr der von Rindfleisch, Klebs und Karl Hüter vertretenen Auffassung zuneigten, daß die in den Wundflüssigkeiten vorhandenen pflanzlichen Schmarotzer als Erreger der Wundkrankheiten anzusehen seien, so konnte man doch so lange nicht weiterkommen, als alle diese Lebewesen einheitlich betrachtet wurden; denn bis dahin war es weder möglich, die verschiedenen Formen systematisch zu ordnen, noch ihre Lebensäußerungen in nutzbringender Weise zu verfolgen. Für die Notwendigkeit einer Scheidung sprachen sich zwar einzelne Botaniker wie Pathologen aus; aber nachhaltig gelang dies erst durch die bahnbrechende Arbeit Robert Kochs über die Ätiologie der Wundinfektionskrankheiten (1878). Koch, der als erster in umfangreicher Weise mit Färbemitteln und Tierversuchen arbeitete und der die in den verschiedenen Wundkrankheiten vorkommenden Bakterien einer genauen, durch Reinkulturen unterstützten Untersuchung[35] unterwarf, kommt zu dem Schluß, daß die verschiedenen Formen der krankheitserzeugenden Keime als verschiedene, unabänderliche Arten anzusehen seien. Hiermit trat er dem größten Teile der Botaniker, die, wie vor allen anderen Nägeli in München, auf dem Standpunkt standen, daß keinerlei Nötigung vorliege, um auch nur zwei spezifische Arten voneinander zu unterscheiden, mit voller Schärfe entgegen. Neben den Studien über Septichämie, Pyämie, Erysipelas, Gewebsnekrose und fortschreitende Abszeßbildung bei Tieren gab Koch auch eine solche über den Milzbrand und dessen Erreger, die seitdem in allen ihren Teilen bestätigt worden ist.
Die Kochschen Untersuchungen und Methoden sind die Grundlagen der neueren Bakteriologie geworden und haben eine ganze Reihe der wichtigsten und weittragendsten Entdeckungen herbeigeführt. —
Wie bereits erwähnt, beschäftigte sich die Deutsche Gesellschaft für Chirurgie von Anfang an auch mit der Bedeutung der Bakterien für die praktische Chirurgie. Schon auf dem ersten Kongreß wurde ein Schreiben Wilhelm Rosers (Marburg) verlesen, in welchem er sich über den „Pyämiepilz“, über das Sepsin und das Microsporon septicum ausspricht und für die Forschung und Fragestellung auf diesem Gebiete einige Winke gibt. Auf dem zweiten Kongreß von 1873 trat Ernst Bergmann (Dorpat), der später für die deutsche Chirurgie eine erhebliche Bedeutung gewinnen sollte, mit einem experimentellen Beitrage zu der Lehre von den septischen Entzündungen in die Reihe der Redner, in welchem er nachwies, daß bakterienhaltige Flüssigkeiten in tierische Gewebe eingespritzt, tödliche septische Lungenentzündungen hervorzurufen vermöchten. Wie alle solche Fragen verlief auch die Besprechung des Bergmannschen Vortrages nicht ohne starken Widerspruch. — Auf demselben Kongresse behandelte Martini (Hamburg) einen verwandten Gegenstand, die Mikrokokkenembolien innerer Organe und die durch sie hervorgerufenen Veränderungen der Gefäßwand. Auch auf den nächsten Kongressen setzte sich das Für und Wider der Anschauungen über die beiden Hauptfragen: Ob die Bakterien die Wundkrankheiten erzeugen, oder sie wenigstens unterstützen, sowie ob die in zersetzten Geweben gefundenen Pflänzchen als einheitliche Art aufzufassen seien oder nicht, unverändert fort. Die Stellung, welche infolge der bis zu den Kochschen Entdeckungen immer noch sehr unvollkommenen Untersuchungs- und Beobachtungsmethoden ein großer Teil der Kongreßmitglieder im Gegensatz zu zahlreichen Rednern einnahm, kennzeichnete sehr gut eine Äußerung des geistvollen Humoristen der Gesellschaft Karl Thiersch aus Leipzig, der auf einem späteren Kongreß am Schlusse einer langen und erregten Debatte seine eigenen Bemerkungen mit den Worten schloß: „Mein Herz zieht mich zu den Bakterien, aber mein Verstand sagt: Warte noch!“
Die Kochschen Arbeiten, seine Reinkulturen der einzelnen Bakterienarten, die er nicht nur nach ihrer Form, sondern auch nach ihrem biologischen Verhalten unterscheiden lehrte, seine Färbemethoden für mikroskopische Untersuchungen, endlich seine Wiedergabe der gefärbten Pflänzchen in Lichtbildern führten überall einen mächtigen Anstoß zur Beschäftigung mit den neuen Erkenntnissen herbei und wirkten in hohem Maße klärend. Grundlegend für die weitere Entwicklung der Chirurgie wurden insbesondere die „Mitteilungen aus dem Kaiserlichen Gesundheitsamte[36] 1881, Bd. I.“, in denen die beiden Aufsätze R. Kochs: „Zur Untersuchung von pathogenen Organismen“ und: „Über Desinfektion“ von höchster Bedeutung waren, nicht weniger auch die seiner Mitarbeiter Georg Gaffky, Friedrich Löffler und vieler anderer. Mit einem Schlage waren alle Zweifel gelöst und nur ganz vereinzelt erhoben sich noch Stimmen gegen die Artverschiedenheiten der Bakterien, oder gegen ihre Auffassung als Krankheitserreger; und wenn auch die oft sehr verschlungenen und verdeckten Wege der Körpervergiftung im einzelnen nicht ohne weiteres klar zutage traten, so setzte doch nunmehr auf allen Gebieten eine so rüstige Forschungsarbeit ein, daß die Umrisse der die Chirurgie angehenden Bakterienkrankheiten in wenigen Jahren gezeichnet waren. Die Ausfüllung des Rahmens freilich machte noch manche mühevolle Untersuchung und eine durch die bisherigen Forschungen geschärfte Beobachtung am Krankenbette notwendig.
Diese Bemerkungen treffen auch auf die überaus wertvollen Arbeiten zu, welche im Jahre 1884 im II. Bande der „Mitteilungen“ veröffentlicht worden sind. Er enthält an erster Stelle Kochs berühmte Arbeit: „Die Ätiologie der Tuberkulose“, in welcher der staunenden Welt die Entdeckung des Tuberkelbazillus, über welche schon zwei Aufsätze vom Jahre 1882 berichtet hatten, in erweiterter Form und in meisterhafter Darstellung vor Augen geführt wurde. Die ganz vereinzelten Einsprüche gegen diese Großtat Kochs sind sehr schnell verstummt; und so bilden denn diese seine Arbeiten den Ausgang aller jener Bestrebungen, durch welche die schlimmste Geißel des menschlichen Geschlechtes bekämpft, in ihren Wirkungen eingeengt und der Heilungsmöglichkeit entgegengeführt worden ist. — Daneben enthält jener Band auch Löfflers ausgezeichnete Arbeit über den Diphtheriebazillus.
Der brennende Eifer, mit welchem die Mitglieder der Deutschen Gesellschaft für Chirurgie jede Bereicherung ihrer Kenntnisse aufnahmen, zeigte sich nicht am wenigsten in der Verfolgung der bakteriologischen Forschungen; denn daß die ganze Listersche Wundbehandlung mit ihrer bakteriologischen Grundlage stand und fiel, war im Beginne des neunten Jahrzehntes des 19. Jahrhunderts auch dem blödesten Auge klar geworden.
Vor allen Dingen suchte man die von Koch im wesentlichen an Tieren studierten Infektionskrankheiten auch am Menschen in ihrer bakteriellen Bedeutung zu erfassen. Freilich waren es meistens nur Nachprüfungen, welche der bei weitem größte Teil der Mitglieder sich erlauben durfte, selbst wenn die volle Beherrschung der bakteriellen Technik zuvor erworben worden war. Denn der in der praktischen Tätigkeit stehende und von ihr in vollstem Maße in Anspruch genommene Wundarzt, dem täglich und stündlich am Krankenbette neue Fragen auftauchten, mit denen er sich doch praktisch abzufinden hatte, behielt nur selten die Muße, um sich mit sehr zeitraubenden Untersuchungen auf dem Gebiete der Keimlehre abzugeben. Mehr und mehr wurde es daher Sitte, daß chirurgische Kliniken und große Krankenhausabteilungen wenigstens einen pathologisch-anatomisch und bakteriologisch völlig geschulten Gehilfen anstellten, dem die Sonderarbeiten auf diesen Gebieten übertragen werden konnten. Auch waren die Vertreter der bald auf allen deutschen Universitäten begründeten Professuren für Hygiene und Bakterienforschung meistens gern bereit, den chirurgischen Abteilungen die Arbeit entweder ganz abzunehmen,[37] oder doch zu erleichtern. Um so beachtenswerter ist es, daß auch aus chirurgischen Arbeitsstuben manche wichtige und fördernde Entdeckungen hervorgegangen sind. Vor allen anderen sind zwei jüngere Mitglieder der Deutschen Gesellschaft für Chirurgie zu nennen, deren Studien berechtigtes Aufsehen erregten.
Der junge Schwabe Fehleisen, damals Assistent an Ernst v. Bergmanns Universitätsklinik in Berlin, veröffentlichte im Jahre 1883 eine Einzelschrift unter dem Titel: „Die Ätiologie des Erysipels“, in welcher er den Nachweis erbrachte, daß die Wundrose durch eine in die Saftkanälchen und Lymphbahnen der Umgebung der Wunde gelangende Streptokokkenart erzeugt werde, die er Streptococcus erysipelatis benannte und als spezifisch ansah. In letzterer Beziehung hat er sich allerdings geirrt, da später durch andere Forscher nachgewiesen wurde, daß Fehleisens Kettenkokkus nichts anderes als der überall verbreitete und zahlreiche Krankheiten eitriger Art erzeugende Streptococcus pyogenes sei; dennoch bleibt Fehleisens Verdienst ungeschmälert, daß er jene Wundkrankheit auf eine ganz bestimmte Bakterienart zurückführte und deren Verbreitungswege erkannte und schilderte. Um so bedauerlicher ist es, daß der Entdecker wenige Jahre später verstimmt und unbefriedigt seinem Vaterlande den Rücken kehrte.
Ein Jahr später erschien eine noch bedeutungsvollere Arbeit von Friedrich Julius Rosenbach in Göttingen, damals Assistenzarzt der Königschen Klinik, in der er die Poliklinik leitete. Die unter dem Titel: „Mikroorganismen bei den Wundinfektionskrankheiten des Menschen“ erschienene Schrift teilt zunächst sehr sorgfältige Untersuchungen über die verschiedenen Schmarotzerformen mit, welche in fast allen eitrigen Erkrankungen des Menschen (mit Ausnahme der später zu erwähnenden kalten Abszesse) vorkommen. Er bespricht fernerhin die Entstehung der akuten Knochenmarkentzündung, die in den meisten Fällen durch den Staphylococcus pyogenes aureus, seltener durch den albus hervorgerufen werde, und macht darauf aufmerksam, daß diese beiden Schmarotzer durch das Vergrößerungsglas allein nicht zu unterscheiden seien, wohl aber im Impfstrich auf Gelatine schon durch die verschiedene Färbung leicht erkannt werden können; zeigt aber auch, daß noch andere Mikrobien, wie die Streptokokken, die Krankheit hervorzurufen vermögen. Demnach ist die Osteomyelitis, wie die ihr nahestehende Pyämie, keine einheitliche d. h. keine durch einen spezifischen Pilz erzeugte Entzündung. Mit gleicher Sorgfalt werden die Fäulnisvorgänge in den Geweben oder die septischen Erkrankungen geschildert, sowie dem von anderen Untersuchern bestätigten Gedanken Raum gegeben, daß nicht die bloße Vermehrung der Bakterien, sondern die von ihnen erzeugten Gifte (Ptomaine) die gefährlichen Zufälle veranlassen, und zum Schluß eine neue, ungefährliche Krankheit, das Fingererysipeloid, mit ihrem spezifischen Erreger geschildert; alles das unter sorgfältiger Benutzung und Besprechung früherer wertvoller Arbeiten, unter denen die des Engländers Ogston und Pasteurs hervorgehoben werden, die bereits mit menschlichem Eiter gearbeitet hatten. Auch ist Rosenbach der erste, der Fehleisens Streptococcus erysipelatis als einen spezifischen Krankheitserreger abweist.
Ein gewaltiger Schritt vorwärts war mit diesen beiden Arbeiten für die praktische Chirurgie getan worden. Wenn auch Rosenbachs[38] Tierversuche, sowie die mancher anderer Chirurgen zeigten, daß auch durch Einspritzung giftiger Reizmittel ohne Bakteriengehalt, wie des Krotonöles, eine Eiterung im Gewebe zu erzeugen möglich sei, so blieb diese Tatsache doch praktisch ohne alle Bedeutung. Vielmehr stand es nunmehr unumstößlich fest, daß der klinische Betrieb nur mit der Bakterienwirkung als Ursache der Eiterung und der verschiedenen Wundkrankheiten zu rechnen habe. Nur für den Wundstarrkrampf stand der naturwissenschaftliche Nachweis noch aus. Er sollte aber nicht zu lange auf sich warten lassen; denn noch gegen Ende des Jahres 1884 trat der erst 22jährige Nicolaier, Student der Medizin in Göttingen, mit einer im hygienischen Institut der Universität angefertigten Arbeit hervor, in welcher als Erreger des Wundstarrkrampfes ein in der Erde lebendes stecknadelförmiges Bakterium beschrieben wurde. So war auch diese Lücke in der Erkenntnis der Entstehungsweise der Wundkrankheiten glücklich geschlossen worden.
Nach dieser Abschweifung auf das Gebiet der Keimlehre kehren wir zu dem weiteren Ausbau der antiseptischen Wundbehandlung zurück. Volkmann war nicht der einzige Chirurg geblieben, der unter dem Einflusse der Schultzeschen Arbeit sich der neuen Behandlungsmethode zugewandt hatte. Dahin gehörte vor allen Dingen Adolf Bardeleben von der Berliner Charité, dessen Assistent der Stabsarzt Schultze damals noch war und der deshalb auf des letzteren Veranlassung die Listersche Wundbehandlung auf seiner Abteilung ziemlich streng durchführte, nachdem er schon einige Zeit zuvor tastende Versuche mit der Karbolpaste gemacht hatte. Auf dem gleichen Kongreß von 1874 konnte daher Bardeleben, im Anschluß an Volkmanns grundlegenden Vortrag, über ziemlich ausgedehnte Erfahrungen mit dem Listerschen Verbande berichten, ebenso Schönborn (Königsberg), Hüter (Greifswald) und Thiersch (Leipzig). Aber abgesehen von diesen Klinikern hatte das antiseptische Verfahren auch schon manche Krankenhausleiter zu Versuchen angespornt; so gehörte der kleine, überaus tätige Hagedorn (Magdeburg) schon frühzeitig zu seinen eifrigsten Vertretern. Es waren nicht nur die immer häufiger in der chirurgischen Literatur auftauchenden Besprechungen des neuen Verfahrens, welche werbend wirkten, sondern es kam noch ein anderer Umstand hinzu. Einzelne Kliniker und manche Krankenhausleiter folgten dem Beispiele Schultzes, indem sie sich in Edinburgh selber an der Quelle zu unterrichten suchten, oder wenigstens ihre Assistenten schickten. Als erster deutscher Kliniker trat Johann Nepomuk v. Nußbaum in München bald nach Schultzes und Volkmanns Veröffentlichungen die Reise an, von der er als ein begeisterter Anhänger der Neuerung zurückkehrte. Ihm in erster Linie galt daher der Besuch, den Lister im Jahre 1875 Deutschland abstattete, um sich persönlich von dem Stande seiner Lehre in diesem Lande zu überzeugen. Nußbaum und seine Schüler bereiteten ihm in seiner Klinik, die früher in ganz entsetzlicher Weise unter Pyämie und Hospitalbrand gelitten hatte, eine erhebende Feier, von der der englische Meister beglückt und befriedigt in seine Heimat zurückkehrte. — Unter den jüngeren Chirurgen schrieb Lesser schon im Jahre 1873[39] über einen Besuch bei Lister; ferner konnten auf dem Kongreß von 1874 Schönborn und besonders der Deutschrusse Reyher eingehend über das Gesehene berichten, während Madelung, Privatdozent und Assistent der chirurgischen Klinik in Bonn, und J. Israel, Assistent am jüdischen Krankenhause in Berlin, zwar in dem gleichen Frühling Edinburgh besuchten, aber mit ihren Beobachtungen zunächst noch zurückhielten. Im Februar 1876 machte auch E. Küster eine Reise nach Edinburgh, deren Frucht die Einführung der antiseptischen Behandlung im Berliner Augusta-Hospital unter genauester Beobachtung der Listerschen Methoden war. Nach diesen Reisen begann ein Strom besserer Erkenntnis sich von der fernen Stadt des Nordens über einen großen Teil von Europa zu ergießen; zumal in Deutschland bildeten sich immer zahlreichere Mittelpunkte, von denen die neue Lehre in immer weitere Kreise getragen wurde.
Aber in den kritisch angelegten Köpfen einzelner deutscher Chirurgen regte sich auch, früher wie in anderen Ländern, die Neigung zu Abänderungen und Vereinfachungen des immerhin etwas umständlichen, schwerfälligen und kostspieligen Verbandes. Dazu hatte freilich Lister selber die Bahn eröffnet, teils durch seine zahlreichen Verbesserungen, teils durch seinen Ausspruch, er hege die Hoffnung, daß die Chemie einen der Karbolsäure in der Wirksamkeit ebenbürtigen, aber von deren unangenehmen Eigenschaften freien Stoff zu finden imstande sein werde. Dem gleichen Gedanken gab Volkmann, wie oben erwähnt, schon in seinem ersten Vortrage Ausdruck; und auf demselben Kongresse machte sein damaliger Assistent Max Schede die Mitteilung, daß in Halle alle nicht ganz frischen Verletzungen erst einer Ätzung mit 8 %iger Chlorzinklösung unterzogen würden, ehe der Okklusivverband zur Anwendung gelange. Alles das hielt sich noch in dem von Lister selber vorgetragenen Gedankenkreise; wirkliche Neuerungen aber brachten schon bei diesem ersten Waffengange auf dem Gebiete der Antisepsis Bardeleben mit seiner, freilich etwas zurückhaltenden Empfehlung nasser Karbolsäureverbände anstatt der trockenen Listerschen, und Thiersch durch den Vorschlag, die Karbolsäure durch die von dem Chemiker Kolbe in Leipzig dargestellte Salizylsäure zu ersetzen. In der Tat hat das letztgenannte Mittel, zumal nach Veröffentlichung einer größeren Arbeit von Thiersch (Klinische Ergebnisse der Listerschen Wundbehandlung und über den Ersatz der Karbolsäure durch Salizylsäure in Volkmanns Sammlung klinischer Vorträge 84 und 85) vom Jahre 1875, für eine Reihe von Jahren Aufnahme gefunden und zwar sowohl als trockener, wie als nasser Watteverband bzw. in der Form der Berieselung bei sonst offener Wundbehandlung. Auch der Verbandstoff fand durch ihn, hauptsächlich aus Rücksichten der Verbilligung, eine Abänderung, indem er auf den Rat v. Mosengeils die Jute, einen aus den Fasern einer ostindischen Tiliazee hergestellten Stoff, als Grundlage des antiseptischen Verbandes in seiner Klinik einführte. Nunmehr häuften sich die Neuerungen. H. Ranke, Assistent der Volkmannschen Klinik, berichtete 1878 über den Ersatz der Karbolsäure durch Thymol, so daß bereits eine erhebliche Vielfältigkeit für die Abänderung des eigentlichen Listerverbandes vorlag. Eine eingehende Besprechung fand die Frage der Behandlungsform auf dem Kongreß von 1878, im Anschluß an einen Vortrag E. Küsters: „Über die giftigen Eigenschaften der Karbolsäure“, dessen Endbetrachtungen[40] darin gipfelten, daß dies Mittel zwar zunächst, als sicherstes der bisher angewandten antiseptischen Verbandmittel, noch nicht zu entbehren sei, daß es aber nur mit großer Vorsicht gebraucht werden dürfe, da es bei manchen Personen gefährliche und selbst tödliche Zufälle hervorzurufen imstande sei. In der Tat wurde bei der ausgiebigen Erörterung dieses Vortrages die Giftigkeit der Karbolsäure mehr oder weniger unumwunden fast von allen Rednern zugestanden.
Bald darauf, im Jahre 1880, erfolgte auch der erste kraftvolle Vorstoß gegen den Zerstäuber (Spray) durch Viktor v. Bruns (Tübingen) in einem Aufsatze unter dem Titel: „Fort mit dem Spray!“ Der Verfasser hatte bereits seit zwei Jahren, sowohl bei Operationen wie bei Verbandwechseln, auf den Sprühnebel verzichtet und sich auf nachträgliche kurze Bespülungen der Wunde mit Karbolsäure beschränkt. Die Ergebnisse waren vortrefflich. Freilich war der alte Doppelballon nach Richardson, der mit Hand oder Fuß in Bewegung gesetzt wurde, schon längst durch schmucke Dampfzerstäuber ersetzt worden; aber auch diese brachten recht große Unannehmlichkeiten für den Kranken sowohl wie für den handelnden Chirurgen und seine Gehilfen mit sich. Denn der Körper des Kranken, selbst wenn er sorgfältig mit reinen Leintüchern abgedeckt war, wurde doch bei längeren Eingriffen allmählich naß; und die ganze Umgebung des Operationstisches befand sich oft 1–2 Stunden lang in einem Sprühnebel, der alle freien Körperteile triefend machte und mit dem Atemstrome in die Luftwege eingesogen wurde. So waren Vergiftungen auf beiden Seiten möglich; und es hat nicht lange gedauert, bis die Ärzte selber die unangenehmen Wirkungen zu spüren bekamen, meist allerdings nur in Form dunklen Urins nach jedem langen Aufenthalte im Operationszimmer. Allein es sind in jenen Jahrzehnten und bald hinterher so viele Chirurgen an chronischen Nierenentzündungen zugrunde gegangen daß der Verdacht nicht ganz abgewiesen werden kann, sie seien als Opfer ihres Berufes und der neuen Behandlungsmethode gefallen. So hat auch dieser gewaltige Fortschritt zum Heile der Menschheit nur unter schweren Opfern erkämpft werden können.
Hiernach wird es begreiflich, daß nicht wenige Chirurgen sich von der lästigen Beigabe des Zerstäubers nach Bruns' Beispiel mit Freuden losmachten, zumal da die zerstäubte Karbolsäure in Haupt- und Barthaar der Ärzte so fest haftete, daß die Träger durch den Geruch schon auf weite Entfernungen gekennzeichnet waren. Andere freilich, und wohl noch auf Jahre hinaus die Mehrzahl, glaubten den Zerstäuber nicht entbehren zu können, wenn auch an die Stelle der giftigen und stark riechenden Flüssigkeit vielfach Salizyl- und Thymollösungen gesetzt wurden.
So war denn eine neue Bresche in den scheinbar so fest gefügten Wall der Listerschen Methode gelegt worden; aber da auch die letzten Veränderungen keineswegs allgemeine Befriedigung hervorriefen, so konnten weitere Versuche nicht ausbleiben. Insbesondere war es die mächtig emporblühende chemische Industrie, die immer neue Mittel mit antiseptischen Eigenschaften zu erfinden und den Chirurgen zur Prüfung anzubieten nicht müde wurde. Viele dieser neuen Mittel haben nur ein kurzes Dasein gehabt, so daß sich nicht einmal ihre Erwähnung lohnt; andere aber haben nicht nur jahrelang eine große Rolle gespielt, sondern sind auch heute noch nicht bis auf die letzte Spur aus unserem Behandlungsschatze ausgetilgt.
Zu letzteren gehört in vorderster Linie das Jodoform, welches[41] im Jahre 1880 zuerst von Mosetig v. Moorhof in Wien als ein ganz vorzügliches Pulver zur Behandlung tuberkulöser Wunden und Geschwüre empfohlen, aber schon im Jahre darauf auch auf nicht tuberkulöse Verletzungen und Operationswunden übertragen wurde. In demselben Jahre berichtete auch Mikulicz von Billroths Klinik in Wien über sehr gute Erfolge mit dem Jodoformpulververbande, den er als den größten Fortschritt seit der Einführung des Listerschen Verbandes ansah. In gleicher Weise sprach sich Franz König in Göttingen aus, dessen großes Ansehen vor allen anderen für die schnelle Verbreitung der Jodoformbehandlung ausschlaggebend wurde, zumal da er die Leichtigkeit der Anwendung und die Sicherheit des Verfahrens auch für solche Wunden betonte, die wie manche Höhlenwunden dem antiseptischen Okklusivverbande nicht zugänglich seien. Eine wahre Flut von begeisterten Schriften über den Wert des Jodoforms ergoß sich seitdem in alle medizinischen Zeitschriften; aber sehr schnell kam auch der Rückschlag. Schon Mikulicz hatte in dem obengenannten Aufsatze auf Jodvergiftungen hingewiesen. Da wurden fast gleichzeitig mit Königs Arbeit durch Henry (Breslau) bereits zwei Todesfälle durch Jodoformvergiftung mitgeteilt; und schon am 21. Januar 1882 war in einer Arbeit Max Schedes der Satz zu lesen: „Der anfängliche Enthusiasmus für das Jodoform ist längst verraucht und hat einer sehr vorsichtigen Beurteilung desselben Platz gemacht.“ Auch Ernst Küster sprach sich ungefähr gleichzeitig in einem Vortrage in der Berliner medizinischen Gesellschaft dahin aus, daß die Pulververbände, d. h. neben dem Jodoform auch die gepulverte Salizylsäure, zwar an sich ein ausgezeichnetes und dabei in der Anwendung sehr einfaches Mittel seien, welches für gewisse, schwer aseptisch zu haltende Wunden vorläufig noch nicht entbehrt werden könne; daß aber beide Pulverarten giftig seien und an Sicherheit dem strengen Listerschen Verbande nicht gleichkämen. Dabei ist es denn auch auf Jahre hinaus geblieben, davon abgesehen, daß an Stelle der Karbolsäure und der bald wieder verlassenen Salizylsäure- und Thymollösungen immer neue antiseptische Stoffe versucht wurden.
Den Anstoß dazu hatte schon im Jahre 1881 R. Kochs wichtige Untersuchung über Desinfektion gegeben, in welcher die gänzliche Wirkungslosigkeit öliger Karbollösungen, aber auch eine ungenügende Wirksamkeit der Karbolsäure in wäßriger Lösung von 5:100 nachgewiesen worden war, soweit es sich um Unschädlichmachung der bei den Versuchen hauptsächlich benutzten Milzbrandsporen handelte. Dagegen wurde das Sublimat schon in einer Lösung von 1:5000 als durchaus zuverlässig erkannt, wenn auch die Giftigkeit des Mittels gewisse Vorsichtsmaßregeln unerläßlich machte. So wurde denn Sublimat an die Stelle der Karbolsäure im Listerschen Verbande gesetzt und begann seinen Nebenbuhler allmählich mehr oder weniger zu verdrängen. Aber auch hier blieben üble Erfahrungen nicht aus, da das Sublimat selbst in schwacher Lösung sich als recht gefährlich erwies. Auch noch andere Arzneistoffe, außer den genannten, tauchten weiterhin auf, um gewöhnlich bald wieder zu verschwinden, meist als Pulververbände, wie das Naphthalin und das Bismuthum hydrico-nitricum. Daneben haben auch die Bemühungen fortgedauert, den teuren Baumwollenmull durch[42] billige Stoffe zu ersetzen; so entstanden die Versuche mit Torfmull (Neuber), Sumpfmoos (Hagedorn), Holzwolle (P. Bruns), Sand, Asche und Glaswolle (Kümmell), unter denen nur das Sumpfmoos (Sphagnum) und zum Teil die Holzwolle als bequem und billig sich einige Jahre eines gewissen Ansehens erfreut haben.
Schon längst hatte man den Gummidrain zur Ableitung der von der gereizten Wunde gelieferten Flüssigkeiten als eine unangenehme Beigabe des antiseptischen Verbandes empfunden, da er teils in die Wunde rutschte und dort als aseptischer Fremdkörper gelegentlich einheilte, teils den frühzeitigen Schluß einer sonst gut heilenden Wunde verzögerte, teils bei einer aus irgendeinem Grunde langsam vorschreitenden Heilung als Ansteckungspforte zu dienen vermochte. Es wurden daher schon seit dem Jahre 1878 die von Trendelenburg zuerst angegebenen resorbierbaren Drains, d. h. Röhrchen aus Knochen hergestellt, entkalkt und in antiseptischer Flüssigkeit (Spiritus) aufbewahrt, vielfach an ihre Stelle gesetzt. Aber auch dies Verfahren genügte nicht, sondern immer neue Versuche wurden angestellt, die Anwendung von Ableitungsröhrchen ganz überflüssig zu machen. Dies Ziel suchte man in doppelter Weise zu erreichen: einmal dadurch, daß man die starke Reizung der Wunden durch antiseptische Mittel einschränkte (Weglassung des Zerstäubers, einmalige kurze Waschung der Wunde), oder daß man, unter Beseitigung der Drains, nur die Wundwinkel offen ließ, wie es Albert (Innsbruck) schon 1884 versuchte, oder die Wunde ganz nähte, aber neue Öffnungen von einer Form schuf, die sich nicht leicht verstopfen konnten (Locheisenöffnung nach v. Esmarch und Neuber). Hierher gehört auch der Versuch, die Wunden durch versenkte Darmsaiten in der Tiefe zusammenzunähen, um sie dann bis auf den letzten Rest zu schließen und sie nur mit Jodoformkollodium zu bepinseln, also eine trockene Schorfheilung anzustreben (v. Esmarch, Werth, Karl Schröder, E. Küster, Neuber).
In ganz eigenartiger Weise suchte das gleiche Ziel, die Weglassung jedes Fremdkörpers aus der Wunde, die von Schede angegebene neue Behandlung unter dem feuchten Blutschorfe zu erreichen. Bis dahin hatte man die Ansammlung von Blut in der Wunde als eine Gefahr angesehen und die ganze Behandlung auf schnelle Beseitigung des aus den durchtrennten Gefäßen hervorsickernden Blutes zugeschnitten. Schede zeigte nun, daß der Blutpflock einer aseptisch bleibenden Wunde sich so schnell organisiere, insbesondere mit neugebildeten Gefäßen versehe, daß er zur Ausfüllung von Höhlen und Gewebsverlusten benutzt werden könne. Die nach Möglichkeit aseptisch gemachte Höhle, zumal im Knochen, wurde daher absichtlich mit Blut gefüllt, die Wunde bis auf die Wundwinkel durch die Naht geschlossen und durch einen Streifen Gummipapier, sowie einen ihn deckenden Sublimatverband geschützt. Inzwischen zeigte sich auch hierbei, daß die anfänglich gehegten Hoffnungen trogen; denn weder bei tuberkulösen Erkrankungen, noch bei der osteomyelitischen Nekrose erwies sich das Verfahren als zuverlässig. Demnach blieb seine Verallgemeinerung ausgeschlossen so vortrefflich es sich auch in manchen Fällen bewährte. Immerhin brachte es aber eine sehr dankenswerte Förderung und Erweiterung der bisherigen Anschauungen über die Vorgänge der Wundheilung.
Alle diese Änderungen bereiteten eine Wandlung in den Anschauungen[43] vor, die mit dem Anfange der neunziger Jahre zu einer grundsätzlichen Veränderung der Wundbehandlung führte, insofern, als man die bisher für unentbehrlich gehaltenen chemischen Mittel, die sich doch sämtlich als mehr oder weniger gefährlich erwiesen hatten, gänzlich zu verbannen suchte. Aber trotzdem hörte die Empfehlung neuer Antiseptika keineswegs gänzlich auf. So rühmte Salzwedel im Jahre 1894 die Behandlung phlegmonöser und ähnlicher Entzündungen mit dauernden Alkoholverbänden in der Form, daß der Entzündungsherd mit nur mäßig von Alkohol durchtränkten Wattelagen bedeckt und über diese eine durchlöcherte Schutzhülle gelegt wurde, um die Verdunstung des Mittels zwar einzuschränken, aber nicht ganz aufzuheben; so trat im Jahre 1896 Credé mit der Besprechung der ausgezeichneten Eigenschaften der Silbersalze vor den XXV. Kongreß, deren allgemeine Anwendung als eines keimtötenden und dabei ganz ungefährlichen Mittels er auf das dringendste anriet. So empfahl 1905 Schloffer (Innsbruck) den Perubalsam zur Behandlung unreiner Wunden. Im Jahre 1901 haben v. Bruns und Honsell auch noch einmal auf die Karbolsäure zurückgegriffen durch Empfehlung des Verfahrens des Amerikaners Phelps, der septische und eiternde Wunden mit reiner Karbolsäure zu ätzen und dann mit Alkohol zu waschen empfahl. Aber alle diese Dinge haben den ruhigen Gang der Entwicklung, wenigstens bei frischen Wunden, nicht mehr aufzuhalten vermocht; man strebte, unter steter Einwirkung der genaueren Kenntnis der Lebensbedingungen aller gefährlichen Schmarotzer, möglichster Vereinfachung der Behandlungsmethoden zu, bei der man nicht mehr auf die Beihilfe zweifelhafter und in ihren pharmakologischen Wirkungen unsicherer chemischer Mittel angewiesen zu sein wünschte. An die Stelle der antiseptischen trat fortan die aseptische Wundbehandlung, an die Stelle der Ströme antiseptischer Flüssigkeiten, welche die Operationsräume jahrelang überflutet und die Wundärzte zu besonderen, wasserdichten Fußbekleidungen gezwungen hatten, traten Dampfsterilisatoren und Kochapparate.
Wenn man auf die Zeit des Werdens der neuen Wundbehandlungsmethoden, die im Vorstehenden zu schildern versucht worden ist, einen prüfenden Rückblick wirft, so mag sie einem späteren Geschlechte als ein wissenschaftliches Chaos erscheinen, in welchem Erfindungssucht und Wagemut allein das Wort zu führen berufen waren. Indessen muß man sich vergegenwärtigen, in welchen Zustand die chirurgische Welt durch Listers Mitteilungen der ersten Jahre versetzt worden war. Die älteren, über eine große Erfahrung gebietenden Fachgenossen, die schon so manchen schönen Traum, so manche Hoffnung auf Besserung der Verhältnisse in ein Nichts hatten zerrinnen sehen, lächelten über die anscheinend kritiklose Begeisterung, mit der sich das jüngere Geschlecht den neuen Ideen hingab. Ihre Zweifel wurden wesentlich durch die Beobachtung unterstützt, daß Lister selber seine Erfindung fortdauernd[44] abänderte, sie also noch nicht als vollkommen ansah. Aber auch bei den überzeugten Anhängern führte die eigene Erfahrung doch immer wieder zu dem Schluß, daß die Methode schwache Seiten habe, demnach verbesserungsfähig sei. In dieser bald allgemein gewordenen Erkenntnis entwickelte sich nun ein edler, aber zuweilen fast atemlos machender Wettlauf um die Palme, die dem Sieger im Kampfe winkte. So waren es keineswegs Neuerungssucht oder blinder Ehrgeiz, von denen jene Entwicklungsperiode beherrscht wurde, sondern die ehrliche, im Kampfe mit Krankheit und menschlichem Elend gewonnene Überzeugung der Besten, daß über den gewonnenen Boden hinaus noch ein Höheres erreichbar sein müsse.
Es ist zweifellos unrichtig, zu sagen, daß von der eigentlich Listerschen Methode so gut wie nichts übriggeblieben, daß etwas ganz Neues an ihre Stelle getreten sei. Vielmehr läßt sich mit vollem Rechte behaupten, daß jene Behandlung mehr als nur eine Anregung gegeben habe, daß die Listerschen Grundsätze auch heute noch Gehirn und Hand des Wundarztes lenken. Nur hat die wachsende Erkenntnis gelehrt, daß zu dem erhabenen Ziele verschiedene Wege führen, daß es sich daher empfiehlt, je nach den Umständen bald diese, bald jene Straße einzuschlagen So hat denn auch die neueste Wendung der Dinge dem Ruhme des naturwissenschaftlich-philosophischen Kopfes auf dem schottischen Lehrstuhle für Chirurgie keinen Abbruch zu tun vermocht. —
Die Einführung der Asepsis bedeutet den Übergang von der bisher üblichen chemischen zur physikalischen Desinfektion durch Hitze, wie er gleichfalls schon durch R. Koch angebahnt und vorgezeichnet worden war. Den unmittelbaren Anstoß zu einem neuen Wechsel der Behandlungsmethode gab der Umstand, daß das von Koch empfohlene zuverlässigste Antiseptikum, das Sublimat, welches allmählich in sehr verstärkter Lösung von 1:1000 in Gebrauch gekommen war, doch so viele unangenehme und unerwünschte Nebenwirkungen hatte, daß man auch dies Mittel loszuwerden versuchen mußte. Dazu kam der Umstand, daß die durch Lister eingeführte, keimfrei gemachte Darmsaite, soviel man auch die Sicherheit ihrer Herstellung zu erhöhen sich bemühte, dennoch ein unzuverlässiges Unterbindungs- und Nahtmaterial geblieben war. Schon Volkmann hatte einen Fall mitgeteilt, in welchem er die Einimpfung von Milzbrand in eine Wunde durch Catgutfäden nachzuweisen vermochte. Im Jahre 1888 folgte die Mitteilung Kochers, daß eine Reihe von Mißerfolgen der Wundbehandlung in seiner Klinik auf unvollkommen sterilisierte Darmsaiten zurückgeführt werden konnte; er schlug daher vor, ein so unsicheres Material durch gekochte Seide zu ersetzen. Mehr und mehr rang sich die Erkenntnis durch, daß auch die besten antiseptischen Mittel nicht imstande seien, Krankheitserreger aus einer frischen Wunde fernzuhalten oder sie gänzlich und überall unschädlich zu machen, mehr und mehr aber auch die Einsicht, daß nicht, wie Lister gelehrt hatte, die in der Luft schwebenden Keime die Wunde am meisten bedrohen, sondern daß, im Sinne des unglücklichen Semmelweis, vor allen Dingen die Kontaktinfektion, die Einimpfung durch Berührung mit ungenügend entkeimten Fingern, Werkzeugen und Verbandstoffen, die Hauptgefahr darstelle. So begann denn eine neue, fieberhafte Arbeit unter den Chirurgen, um eine zuverlässige Methode zu finden, welche auch ohne chemische Mittel die frische[45] Wunde zu schützen imstande sei. Es bleibt ein unvergängliches Verdienst der v. Bergmannschen Klinik in Berlin, hierfür die Wege gewiesen zu haben, wenngleich manche deutsche Chirurgen vor ihm, wie Bardenheuer in Köln schon 1888, die Dampfsterilisation für Verbandstoffe eingeführt hatten.
Im Jahre 1891 veröffentlichte der viel zu früh dahingeschiedene Assistent jener Klinik, Kurt Schimmelbusch, der wenige Jahre später seinem Berufe zum Opfer fiel, eine Arbeit unter dem Titel: „Die Durchführung der Asepsis in der Klinik des Herrn Geheimrat v. Bergmann in Berlin“. Sie ist ein Markstein für die Entwicklung der Wundbehandlung geblieben; denn von dem Augenblick an war für alle frischen Wunden der Sieg der Asepsis über die Antisepsis entschieden. Nach Besprechung der Fehlerquellen, welche zu irrigen Auffassungen über die Desinfektionskraft der hauptsächlichen Antiseptika geführt haben, sowie nach Mitteilung eigener Versuche, welche deren Anwendung am lebenden Körper und in der Wunde als ein höchst unsicheres Verfahren kennzeichnen, kommt Schimmelbusch zu dem Schluß, daß nur die einfache Reinigung auf mechanischem Wege und die Hitze die Beseitigung aller gefährlichen Keime gewährleisten. Dann folgen genaue Vorschriften über Sterilisation der Verbandstoffe im heißen Dampfe, der Metallinstrumente in Sodalösung, sowie endlich über Entkeimung ärztlicher Bürsten, welche, in Verbindung mit der Angabe und Beschreibung sehr brauchbarer Apparate, in kürzester Zeit eine Ausbreitung fast über die ganze Erde erfahren haben. Mit dieser Arbeit war aber zugleich die sichere Grundlage für eine weitere Entwicklung geschaffen. Sie richtete sich in erster Linie auf die zuverlässige Keimbefreiung der Hände, die mehr und mehr als die verdächtigste Quelle der Wundinfektionen von Geburtshelfern und Wundärzten angesehen wurden. Schon seit Jahren hatten Fürbringer, Ahlfeld u. a. sich mit der zweckmäßigsten Form der Händesäuberung vor Operationen abgegeben; im Jahre 1897 empfahlen beide als das beste Verfahren die Heißwasser-Alkohol-Desinfektion oder das Waschen mit Alkohol und einem Antiseptikum, meist Sublimat. In dem gleichen Jahre wurde neben dieser Handpflege ein verstärkter Händeschutz bzw. Wundschutz angebahnt, indem Zöge v. Manteuffel (Dorpat) Handschuhe aus Gummi, Mikulicz (Breslau) solche aus Zwirn, Perthes von Trendelenburgs Klinik in Leipzig solche aus Seide empfahlen. Alle aber betonten, daß dem Anziehen der Handschuhe stets eine sorgfältige Reinigung der Hände voraufzuschicken sei. Mikulicz ging in diesem und dem folgenden Jahre in seiner Verstärkung des Wundschutzes noch einen Schritt weiter, indem er, um die Wunde vor den in feuchten Tröpfchen schwebenden Keimen aus den Atemorganen der bei einer Operation beschäftigten Ärzte zu schützen, deren Mund und Nase mit einer Binde bedecken ließ. Später hat man auch die in den Haaren der Ärzte haftenden Keime durch eine besondere Kappe abzuhalten versucht; und daneben spielte ein häufiger Wechsel frischgewaschener Mäntel, Hauben, Handschuhe usw. eine erhebliche Rolle. So wurde die äußere Erscheinung des modernen Wundarztes in seiner Hülle tadelloser weißer Wäsche gegenüber der des alten Chirurgen in seinem nie gewechselten, unsauberen Operationsrocke erheblich anziehender gestaltet, ein Wechsel, für den Billroth den Ausdruck der „Reinlichkeit bis zur Ausschweifung“ prägte. Demgemäß stieg der Wäscheverbrauch[46] chirurgischer Abteilungen allmählich zu einem sehr ansehnlichen Ausgabeposten an, bei dem Ersparnisse nur dadurch erzielt werden, daß man mehr den Besonderheiten des Einzelfalles Rechnung zu tragen gelernt hat und nicht überflüssigerweise den großen Apparat in Bewegung setzt, wo er nichts nützen kann. Auf diesem Stande hat sich die Wundbehandlung bis heute mit geringfügigen Abänderungen erhalten; sie bietet, abgesehen von ganz vereinzelten Mißerfolgen, die der menschlichen Unvollkommenheit und Ungleichmäßigkeit des Wesens in Rechnung gesetzt werden müssen, eine Sicherheit, die dem Kranken mit frischer Wunde einen fast vollkommenen Schutz gegen Infektionsgefahr gewährt.
Dagegen ist bei der Behandlung bereits eiternder unreiner Wunden, wie auch solcher, die gegen nachträgliche Verunreinigung wegen ihrer Lage nur schwer oder gar nicht geschützt werden können, dem persönlichen Ermessen ein erheblich breiterer Spielraum gelassen. Hier haben auch die chemischen Mittel noch keineswegs ihre Berechtigung verloren; insbesondere ist das Jodoform bei nicht aseptisch zu haltenden Operationswunden dauernd in Gebrauch geblieben.
Die große Umwälzung, welche in ihren Umrissen geschildert wurde und die auf den Kongressen der Deutschen Gesellschaft für Chirurgie jahrelang die lebhaftesten Besprechungen und Erörterungen hervorrief, traf die Gesellschaft auch in einer bemerkenswerten Umformung des äußeren Rahmens, in dem ihr geistiges Leben sich abspielte. Nachdem sie 20 Jahre lang als Gast der Berliner Universität ihre Hauptsitzungen in der Aula des Universitätsgebäudes abgehalten hatte, während die Demonstrationen meist in der chirurgischen Klinik stattfanden, schuf sie sich ein eigenes Heim, das Langenbeckhaus, in welchem fortan die Kongreßverhandlungen in vollem Umfange vor sich gingen.
Die Vorgeschichte dieses Baues ist aus dem Grunde von ganz besonderem Interesse, weil der Gedanke nicht von einem Mitgliede der Gesellschaft ausgegangen ist, sondern von der höchsten Frau des Deutschen Reiches, der Kaiserin Augusta. Die Ausführungen, welche E. v. Bergmann auf dem Kongresse von 1890 gegeben hat, bedürfen hiernach einer Ergänzung.
Von Anfang an hatte die hohe Frau, die schon während der drei voraufgegangenen Kriege und in deren Zwischenzeit mit menschenfreundlichen Gründungen in Form von Vereinen (Vaterländischer Frauenverein, Berliner Frauenlazarettverein) und Krankenhäusern (Barackenlazarett auf dem Tempelhofer Felde, Berliner Augusta-Hospital), unter Beihilfe ihrer gleichgesinnten Tochter, der edlen Großherzogin Luise von Baden, vorangegangen war, der neugegründeten Gesellschaft für Chirurgie ein außerordentliches Wohlwollen entgegengebracht. Das zeigte sich insbesondere in dem lebhaften Interesse, mit welchem sie alle Vorgänge in den Verhandlungen verfolgte, sowie in den alljährlich sich wiederholenden Empfängen, durch welche die Führer der deutschen Chirurgie immer von neuem ausgezeichnet und zu Äußerungen und kurzen Vorträgen über[47] schwebende Tagesfragen veranlaßt wurden. So entstand eine Wechselwirkung zwischen dem preußischen Königshause und der Gesellschaft für Chirurgie, die nach beiden Seiten anregend und belehrend wirkte und die von den Mitgliedern als eine hohe, der Gesellschaft angetane Ehre empfunden wurde.
Am 23. Mai 1877 überreichte die Kaiserin ihrem zweiten Leibarzte Dr. Schliep in Baden-Baden, mit dem sie tags zuvor eine eingehende Besprechung über die ärztlichen Verhältnisse Englands gehabt hatte, einen schriftlichen Entwurf mit dem Auftrage, ihn an B. v. Langenbeck weiterzugeben und diesem die Absichten der hohen Frau mündlich auseinanderzusetzen. Im Folgenden ist dies Schriftstück im Wortlaute und in der ursprünglichen Schreibweise mitgeteilt. Es enthält den Plan der Gründung eines Vereinshauses für die Deutsche Gesellschaft für Chirurgie, der erst 15 Jahre später seine Verwirklichung gefunden hat; denn wenn auch der scharf umschriebene Entwurf der Kaiserin bereits in klarer Fassung die Wege zur Aufbringung der Mittel bespricht, so waren doch die Bedenken hinsichtlich der Geldgrundlage eines so bedeutenden Unternehmens so stark, daß Langenbeck damit zunächst noch nicht vor die Öffentlichkeit zu treten wagte. Die Kaiserin aber hat den Gedanken niemals fallen lassen; denn fast bei allen Empfängen besprach sie die Angelegenheit mit den zu ihr berufenen Chirurgen und suchte sie, allen Schwierigkeiten zum Trotz, bei jeder Gelegenheit zu fördern.
Baden-Baden d. 23. Mai 1877.
Nr. 1
Das englische Surgeons College bewährt seine Leistungen in so erfreulicher Weise, daß in Deutschland ein ähnliches Unternehmen rathsam erscheint. Die Triumphe der Wissenschaft dienen dabei den Zwecken der Humanität und fördern die individuelle Wohlfahrt der Männer, welche als Träger der Wissenschaft dem großen geistigen Verbande aller Nationen und Systeme angehören.
Nr. 2
Die Gründung eines deutschen Chirurgen-Collegiums mit Bezugnahme auf die englischen Statuten müßte, dem deutschen Vereinswesen entsprechend, an geeigneter Centralstelle durch Mitwirkung Aller, welche den großen Zweck anerkennen und ihm dienstbar sein wollen, ins Leben gerufen werden.
Nr. 3
Hierfür wäre ein angemessenes Programm anzufertigen und zu verbreiten, ein Programm, das zunächst die Namen Langenbeck, Esmarch und Billroth als Empfehlung trüge, für Berlin speciell andere hervorragende Namen verschiedener Richtung mit an die Spitze zu stellen hätte. Dieses Programm würde das vorläufige Statut des Vereins und den Vorschlag zur Beschaffung des nöthigen Lokals (zunächst miethsweise) enthalten, worauf je nach erlangtem Erfolge dereinst der Beistand des Reiches in Anspruch genommen werden könnte.
Nr. 4
Es käme darauf an dem Unternehmen von vornherein die Popularität der Zweckmäßigkeit und des praktischen Nutzens zu erwerben, wozu der bestehende wichtige Chirurgen-Kongreß die beste Veranlassung bietet u. eine geschäftsmäßige Organisation die nöthige Vertretung gewähren muß.
Nr. 5
Es würde nach Beschaffung des Programms und vertraulicher Mittheilung desselben an die geeigneten Personen ein möglichst kurzer Termin zur Einsendung einer schriftlichen Begutachtung desselben festzusetzen sein, damit das Werk einheitlich demnächst in die Oeffentlichkeit trete und keine nachträgliche Diskussion zu gewärtigen habe. Ob die Form der einfachen Beiträge oder der Aktienausgabe dabei die angemessenste wäre, bleibt dem Urtheil der Fachmänner vorbehalten.
Die Kaiserin würde sich mit einem einmaligen Geschenke von „Eintausend Mark“ daran betheiligen.
Als Bernhard v. Langenbeck am 28. September 1887 starb,[48] richtete die Kaiserin ein Schreiben an den damaligen Kultusminister v. Goßler, welches den Vorschlag enthielt, statt eines Denkmales aus Erz oder Stein (wie es die Berliner Medizinische Gesellschaft plante) eine Stiftung von praktischer Bedeutung für die Entwicklung der Chirurgie anzustreben und durch deren Verknüpfung mit Langenbecks Namen das Andenken des großen Chirurgen dauernd zu ehren.
So ist der Gedanke eines Vereinshauses für die deutschen Chirurgen und des Namens, welchen es trägt, nicht nur ganz ausschließlich aus dem Kopfe der ersten Kaiserin des neuen Deutschen Reiches hervorgegangen, sondern sie hat auch die Wege gezeigt und die Kräfte in Bewegung gesetzt, auf welchen und durch welche das Ziel in erreichbare Nähe gerückt wurde. Das außerordentliche Wohlwollen aber, welches die Kaiserin Augusta den Bestrebungen der deutschen Chirurgen entgegenbrachte, hat sie auch auf ihre Nachkommen zu übertragen gewußt, wie Kaiser Wilhelm II. bei den verschiedensten Gelegenheiten und Kaiserin Augusta Viktoria bei den alljährlich sich wiederholenden Empfängen eines Teiles der zum Kongreß versammelten Chirurgen in reichem Maße dargetan haben.
Das bewundernswerte, unbeirrte Festhalten an der Verfolgung des einmal als richtig erkannten Zieles hatte schon vor dem Jahre 1890 die Durchführung des Baues gesichert; doch sollte die Kaiserin Augusta dessen Beginn nicht mehr erleben. Am 7. Januar 1890 schloß die edle Frau, die liebevolle Beschützerin und fleißige Mitarbeiterin an der Entwicklung der deutschen Chirurgie, nach einem Leben voll rastloser Tätigkeit die Augen. Ihr Name und ihr Wirken soll und kann unter den deutschen Chirurgen niemals vergessen werden, die beim Besuche des Langenbeckhauses durch eine Porträtbüste, ein Geschenk ihres Enkels, Kaiser Wilhelms II., an die hochherzige Freundin und Beschützerin deutscher Kunst und Wissenschaft erinnert werden.
In dem kraftvollen und umsichtigen Nachfolger v. Langenbecks auf dem Berliner Lehrstuhle für Chirurgie, in Ernst v. Bergmann, fanden die deutschen Ärzte den geeigneten Führer zur Durchsetzung des kaiserlichen Planes. Der livländische Pfarrerssohn von fast hünenhafter Erscheinung, mit scharfgeschnittener Hakennase und langgetragenem schlichtem Haar, war von Dorpat über Würzburg nach Berlin gekommen. Klug und begabt, mit mächtigen Stimmitteln ausgerüstet, deren Wirkung durch seinen scharfen baltischen Dialekt noch erhöht wurde, Beherrscher des Wortes, welches er in unerhörter Leichtigkeit und mit dichterischem Schwunge zu meistern wußte, Fest- und Gelegenheitsredner ohnegleichen, verband er mit allen diesen Eigenschaften eine Tatkraft, die vor keinem Hindernis zurückwich. Freilich kamen ihm in dem besonderen Falle mancherlei Umstände zu Hilfe. Zunächst hatte die Kaiserin Augusta durch letztwillige Verfügung der Deutschen Gesellschaft für Chirurgie eine Summe von 10000 Mark zum Bau eines Langenbeckhauses vermacht, welches bald nach ihrem Ableben in deren Besitz übergegangen war. Einen noch weit höheren Betrag von 100000 Mark schenkte der deutsche Kaiser Wilhelm II. Eine Sammlung von Beiträgen zu einem Ehrendenkmale für Bernhard v. Langenbeck, die von der Gesellschaft in Gemeinsamkeit mit der Berliner Medizinischen Gesellschaft für ihren langjährigen Vorsitzenden veranstaltet worden war, ergab[49] gleichfalls reiche Mittel in Höhe von fast 100000 Mark. Ungefähr die gleiche Summe konnte die Kasse der Gesellschaft aus ihren Ersparnissen beisteuern, so daß unter Hinzurechnung kleinerer Geschenke am 1. April 1891 eine Summe von mehr als 260000 Mark zur Verfügung stand. Zur Annahme und Verwaltung dieser Summen war die Gesellschaft durch die Erteilung der Korporationsrechte befähigt worden, welche der damalige Vorsitzende v. Bergmann schon am 8. April 1888 beantragt hatte.
So konnte denn an den Bau des Hauses herangetreten werden. Am 18. November 1890 wurde für den Preis von 540000 Mark der Bauplatz in der Ziegelstraße 10/11 erworben, dessen südliche, an die Spree stoßende Hälfte der Gesellschaft verblieb, während der nördliche Teil für 300000 Mark in den Besitz des Staates überging. Die technische Ausführung wurde dem Berliner Baumeister E. Schmidt übertragen, die Oberaufsicht führte der Geheime Oberregierungsrat Spieker vom Ministerium der geistlichen, Unterrichts- und Medizinalangelegenheiten. Am 4. April 1891 legte in feierlicher Weise der damalige Vorsitzende Karl Thiersch den Grundstein des Gebäudes, welches nunmehr so schnell gefördert wurde, daß es in wenig mehr als einem Jahre vollendet und gebrauchsfähig dastand.
Der XXI. Kongreß, den man in Rücksicht auf die Fertigstellung bis in den Juni verlegt hatte, wurde am 8. Juni 1892 mit der Einweihung des Langenbeckhauses eröffnet. Vor einer glänzenden Versammlung in welcher der Kaiser durch den Prinzen Friedrich Leopold, die Kaiserin durch den Kabinettsrat Bodo von dem Knesebeck, vertreten wurden, hielt der Vorsitzende Adolf v. Bardeleben die Eröffnungsrede, die in kurzen Strichen die Vorgeschichte des Baues darlegte. Ihm folgte Ernst v. Bergmann mit einem formvollendeten Rechenschaftsberichte, in welchem er in klangvollen Worten, wie sie diesem Meister der Rede bei jeder Gelegenheit zu Gebote standen, die neuen Aufgaben der Deutschen Gesellschaft für Chirurgie, die ihr mit dem Vereinshause erwachsen waren, vorzeichnete. Er schloß mit den Worten: „Wozu v. Langenbeck das Haus einst bestimmt hat, dazu wachse und blühe es: ein Hort der naturwissenschaftlichen Medizin, zur Ehre, Zier und Macht des ärztlichen Standes.“
So war das erste große ärztliche Vereinshaus Deutschlands seiner Bestimmung übergeben. —
Indessen blieb die Freude über das neue Heim, welches alle Mitglieder der Gesellschaft gleichmäßig erfüllte, nur wenige Jahre ganz ungetrübt. Es war wohl eine Folge des ungewöhnlich beschleunigten Baues und die Lage des Hauses auf einem wenig festen, moorigen Boden, daß die bei allen neuen steinernen Gebäuden unvermeidlichen Senkungen und Verschiebungen eine über das Mittelmaß hinausgehende Höhe erreichten. Fast alljährlich mußten mehr oder weniger erhebliche Summen für Ausbesserungen ausgegeben werden, welche den Jahreshaushalt zunehmend belasteten. Und dies war nicht einmal der größte Übelstand, sondern schon nach wenigen Jahren zeigte sich, daß die Fassungskraft des großen Sitzungssaales für die alljährlich anschwellende Mitgliederzahl in seinen Größenverhältnissen zu gering veranschlagt worden sei.
Auf S. 32 ist bereits von dem schnellen, fast lawinenartigen Anwachsen der Mitgliederzahl die Rede gewesen, die im Jahre 1900, also 8 Jahre[50] nach der Einweihung des Langenbeckhauses, das erste Tausend überschritt, um von da an ein immer schnelleres Zeitmaß einzuschlagen. Der Grund dafür ist nicht ausschließlich in dem Umstande zu suchen, daß alle Ärzte des deutschen Sprachgebietes in Europa, soweit sie sich mit Chirurgie befaßten, es allmählich als eine große Ehre einschätzen lernten, Mitglieder dieser Gesellschaft zu sein; vielmehr kam als wichtiger Umstand hinzu, daß die Satzungen auch allen fremdsprachigen Ausländern in weitherzigster Gastfreundschaft die Tore öffneten. Immerhin blieben solche Mitglieder, denen das Deutsche nicht Muttersprache war und die sich nicht als Deutsche fühlten, zunächst noch vereinzelt; aber mit der wachsenden Bedeutung der Verhandlungen und ihrer oft überaus wichtigen Entscheidungen in schwebenden Fragen schwoll der Strom der Ausländer mehr und mehr an, schickten nicht nur alle Völker Europas und der Kulturnationen Amerikas ihre Vertreter, sondern sie kamen aus allen Weltteilen. So haben lange Jahre die hervorragendsten Ärzte des bildungseifrigen Japans als Mitglieder unserer Gesellschaft angehört. Unter allen Fremden aber haben die slawischen Völker des europäischen Ostens stets den erheblichsten Bruchteil gestellt.
Es ist nicht ohne Wichtigkeit, sich klar zu machen, in welchem Umfange dieser Zustrom Nichtdeutscher zur Mitgliedschaft der Gesellschaft sich vollzogen hat. Eine Zählung ist allerdings dadurch sehr erschwert, daß weder Name, noch Wohnort des einzelnen einen sicheren Anhalt für sein Deutschtum zu geben vermag. Alle Personen zweifelhafter Nationalität sind daher als Deutsche gerechnet, so daß die aufgestellten Zahlen nur das Mindestmaß der Fremden wiedergeben. Die in Betracht kommenden Zahlen betrugen:
| 1872: | 130 | Mitglieder, | darunter | 1 | Fremder | = | 0,77 % |
| 1873: | 146 | „ | „ | 5 | Fremde | = | 3,42 % |
| 1880: | 278 | „ | „ | 21 | „ | = | 7,57 % |
| 1890: | 499 | „ | „ | 50 | „ | = | 10,02 % |
| 1900: | 1025 | „ | „ | 95 | „ | = | 9,26 % |
| 1910: | 2019 | „ | „ | 338 | „ | = | 16,74 % |
| 1913: | 2213 | „ | „ | 436 | „ | = | 19,70 % |
Die Übersicht zeigt nicht nur das ständige und seit 1890 ganz ungewöhnliche Wachstum der Gesellschaft an Mitgliederzahl, sondern zugleich die schon früher, seit 1880 einsetzende und unaufhörlich anschwellende Zunahme der Chirurgen fremder Volksstämme bis fast zum fünften Teile des Gesamtbestandes. Es ist das ganz gewiß ein Zeichen großen Vertrauens zu der wissenschaftlichen Chirurgie unseres Vaterlandes und daher als eine große Ehre zu betrachten; doch darf nicht übersehen werden, daß darin unter gewissen Umständen auch der Anlaß zu allerlei Unzuträglichkeiten gelegen sein könnte.
Gleichgültig, welche Gründe dabei mitwirkten, es blieb eine Tatsache, daß der zur Verfügung stehende Sitzungssaal für die Zahl der Besucher nicht ausreichte, zumal da man Jahre hindurch auch noch Freikarten für viele, nur vorübergehend in Berlin anwesende Ärzte ausgegeben hatte. Und wenn auch gewöhnlich nicht einmal die Hälfte der Mitglieder zu den Kongreßverhandlungen sich einstellte, so war selbst für diese der Raum schon unzureichend. Es blieb ein ungewöhnlicher und geradezu unerträglicher Zustand, daß die nach Berlin eilenden Mitglieder mit Sicherheit nicht einmal auf einen Stehplatz rechnen durften. Die Mißstände wurden endlich so erheblich und die berechtigten Klagen der Mitglieder so groß,[51] daß der Vorstand mehrfach bauliche Veränderungen versuchte, die zwar kostspielig waren, eine befriedigende Lösung aber nicht herbeizuführen vermochten, bis er sich endlich im Jahre 1911 entschloß, für den nächstjährigen Kongreß den größesten, in Berlin zur Verfügung stehenden Saal, den Beethovensaal der Philharmonie in der Köthener Straße, zu mieten. In ihm sind die Kongresse von 1912 und 1913 abgehalten worden; und, da auch hier besonders die Akustik zu wünschen übrig ließ, so wurde für das Jahr 1914 ein anderer Saal in der Akademischen Hochschule für bildende Künste in der Hardenbergstraße zu Charlottenburg gemietet. Hier hat der Kongreß von 1914 stattgefunden. Das mit vieler Mühe und großen Kosten erbaute Langenbeckhaus war demnach seiner eigentlichen Bestimmung entzogen und diente nur noch für die Vorstandsversammlungen und zur Aufbewahrung der allmählich, hauptsächlich durch Schenkungen mehr und mehr anwachsenden Büchersammlung der Gesellschaft. Auch dieser Notbehelf blieb auf die Dauer unerträglich. Alljährlich beschäftigte sich der Vorstand mit neuen Plänen, bis unter ihnen einer auftauchte, der langsam festere Gestalt annahm.
Bald nach dem Tode Rudolf Virchows am 5. September 1902, des langjährigen Vorsitzenden der Berliner Medizinischen Gesellschaft, hatte diese den Plan erwogen, gleichfalls ein eigenes Vereinshaus zu gründen und ihm den Namen Rudolf-Virchow-Haus beizulegen. Der Gedanke konnte nur unter der Bedingung Aussicht auf baldige Gestaltung gewinnen, wenn die Deutsche Gesellschaft für Chirurgie, deren räumliche Nöte nicht unbekannt geblieben waren, sich entschloß, mit ihren ziemlich reichen Mitteln als gleichwertige Teilhaberin in das Unternehmen einzutreten. Der Plan ging dahin, auf einem gemeinsam zu erwerbenden Grundstücke ein Langenbeck-Virchow-Haus zu errichten, dessen eine Hälfte je eine der beiden Gesellschaften zur ausschließlichen Benutzung erhalten sollte; nur der in der Mitte zu erbauende, möglichst umfangreich zu gestaltende Sitzungssaal sollte beiden Teilhabern zur Verfügung stehen. Die Verhandlungen haben sich jahrelang hingezogen, da die Chirurgen erst dann zu festen Abmachungen gelangen konnten, wenn das alte Langenbeckhaus zu einem annehmbaren Preise verkauft oder der Verkauf gesichert war. An diesem Punkte stockten die Verhandlungen, da das preußische Kultusministerium, hinter dem der Finanzminister stand, den Ankauf immer von neuem hinausschob. Inzwischen hatte aber die Berliner Medizinische Gesellschaft zwei Grundstücke in der Luisenstraße 58/59 erworben und drängte zum Abschluß, weil jede Verzögerung erhebliche Verzugszinsen kostete. Da sie sich während der Verhandlungen, in welchen die Umsicht und Tatkraft des ersten Schriftführers der Deutschen Gesellschaft für Chirurgie Werner Körte von ausschlaggebendem Einflusse war, auch bereit erklärt hatte, den gemeinsamen Saal mit etwa 900 Sitzplätzen und 100 Stehplätzen zu versehen, wie der Ausschuß der Chirurgen es forderte, so wurde am 3. Januar 1914 der bindende Vertrag zwischen beiden Gesellschaften abgeschlossen. Freilich war das Langenbeckhaus damals noch nicht verkauft; doch kam der Vertrag mit dem Kultusministerium am 20. März desselben Jahres endlich zustande. Im Mai 1915 dürfte der Neubau in Gebrauch genommen werden können und damit ein langjähriger Wunsch der an den Kongressen sich beteiligenden Chirurgen Erfüllung finden.
Unter den Entdeckungen und Erfindungen, welche im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts gleich einem mächtigen unterirdischen Strome, der plötzlich gewaltsam aus der Erde hervorbricht, die Chirurgie zu unerhörten Leistungen emporgetragen haben, ist zunächst nur die eine, die neue Form der Wundbehandlung besprochen worden. Und zwar mit Recht; denn auf ihr beruht weitaus in erster Linie der ungeheure Aufschwung der die rückschauende Seele mit freudigem Erstaunen erfüllt. Immerhin stehen neben ihr noch eine Anzahl anderer Kräfte, deren Besprechung zur Vervollständigung des entworfenen Bildes nicht übergangen werden darf.
Die Methoden zur Herbeiführung der Schmerzlosigkeit. Wir nennen an erster Stelle die Bemühungen, welche darauf abzielten, die wundärztlichen Eingriffe am menschlichen Körper entweder ganz schmerzlos oder wenigstens leicht erträglich zu gestalten; und zwar nicht nur deshalb, weil sie ein schon älteres, in die Zeit vor Listers Antisepsis zurückreichendes Hilfsmittel des Chirurgen darstellen, sondern zugleich aus dem Grunde, weil manche der durch die neue Wundbehandlung möglich gewordenen Eingriffe ohne sie dem Kranken nicht hätten zugemutet werden können.
Bis weit ins Altertum hinein lassen sich die in dieser Richtung angestellten Versuche verfolgen. Am häufigsten bediente man sich der Abkochungen narkotischer Mittel, die dem Kranken innerlich verabreicht wurden; und unter diesen stand in erster Linie ein aus der Atropa Mandragora bereiteter Trank, einer Pflanze, welche als zauberkräftige Alraunwurzel in deutschen Sagen und Märchen während des ganzen Mittelalters eine hervorragende Rolle gespielt hat. Durch Guy de Chauliac erfahren wir, daß auch narkotische Einatmungen schon von den Wundärzten des 13. Jahrhunderts angewandt worden sind; und selbst die Versuche örtliche Gefühllosigkeit zu erzeugen, reichen bis in das Altertum zurück. Aber alles das blieb in den Anfängen stecken, wurde später vergessen und erlebte erst unter der Entwicklung der Chemie im 19. Jahrhundert einen plötzlichen und nunmehr nachhaltigen Aufschwung.
Die damals beginnende Bewegung setzte sich die Herbeiführung einer[53] allgemeinen Gefühllosigkeit des ganzen Körpers zum Ziele. Die ersten Versuche betrafen Einatmungen des schon im Jahre 1776 von dem englischen Prediger Priestley entdeckten Stickstoffoxyduls, in Deutschland Lust- oder Lachgas genannt, auf dessen narkotische Eigenschaften im Jahre 1800 der Chemiker Humphry Davy hinwies. Sehr langsam indessen gewann der Gedanke durch Gaseinatmungen die Operationen schmerzlos zu gestalten, an Boden, wenn auch hier und da kleinere Eingriffe unter Beihilfe dieses Gases vorgenommen wurden. Aber die Unhandlichkeit der Verwendung und die Kürze der damit erzielten Betäubung standen einer schnellen Ausbreitung des Verfahrens im Wege. So konnte denn auch der amerikanische Zahnarzt Horace Wells, der sich seit 1844 der Sache besonders eifrig angenommen hatte, damit nicht durchdringen und endete durch Selbstmord, als er sich des Ruhmes seiner Anstrengungen durch das Emporkommen eines neuen Mittels entrissen sah. Dies neue Betäubungsmittel war der Schwefeläther, welchen als erster der deutsche Arzt Long in Athen im Anfange der vierziger Jahre als Hilfsmittel bei Operationen gebrauchte, seine Versuche aber so spät veröffentlichte, daß zwei Amerikaner, der Chemiker Jackson und der Zahnarzt Morton, denen sich späterhin als dritter noch der Wundarzt Warren vom Massachusettshospital in Boston hinzugesellte, als die Väter der Äthernarkose angesehen zu werden pflegen. Auch die beiden Erstgenannten wurden von der Erfindertragik ereilt: Jackson wurde geisteskrank, Morton starb im Elend. Denn inzwischen war auch dem Äther ein neuer und, wie sich bald zeigte, der gefährlichste Gegner erwachsen.
Das von Liebig in Gießen und Soubeiran in Paris im Jahre 1831 etwa gleichzeitig entdeckte Chloroform wurde nach Tierversuchen des Physiologen Flourens als ein sehr wirksames narkotisches Mittel anerkannt. Das Verdienst aber, solches in die medizinisch-chirurgische Praxis eingeführt zu haben, gebührt dem berühmten Edinburgher Gynäkologen James Young Simpson, der im März 1847 zuerst die Äthernarkose aufgenommen hatte, im November desselben Jahres aber bereits das Chloroform als Betäubungsmittel dringend empfahl. Ein eigentümlicher Zufall war, wie erzählt wird, nahe daran, noch im letzten Augenblicke der Menschheit die ihr bevorstehende Wohltat wenn auch nicht auf immer, so doch sicherlich für längere Zeit zu entziehen. Simpson wollte das neue Mittel zum ersten Male bei der Operation eines eingeklemmten Bruches versuchen; durch eine Ungeschicklichkeit ging aber der ganze Chloroformvorrat noch vor dem Beginne verloren. Als nun ohne Betäubung der erste Schnitt gemacht wurde, sank die Frau zusammen und starb. Es handelte sich um einen jener Fälle von tödlicher Nervenerschütterung, die in älterer wie in neuerer Zeit, wenn auch glücklicherweise sehr selten, beobachtet worden sind. Man stelle sich aber die Wirkung vor, wenn bei einer, wahrscheinlich sehr vorsichtigen und unvollkommenen Anwendung des Chloroforms, ein gleicher Vorgang sich ereignet hätte!
Von nun an trat das Chloroform, ungeachtet aller Anfeindungen, einen Siegeszug über die ganze Erde an. In Deutschland war es bereits im 7. Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts im allgemeinen und fast ausschließlichen Gebrauche, so vollständig, daß der Schwefeläther, dem doch Männer wie Dieffenbach in Berlin, Schuh in Wien und Pirogoff in[54] Petersburg eingehende Studien gewidmet hatten, nahezu in Vergessenheit geriet. Nur in den Vereinigten Staaten von Amerika, dem Mutterlande der Äthernarkose, ist man bis zur Gegenwart dem Äther niemals ganz untreu geworden.
Indessen dauerte es nicht allzu lange, bis auch die schlimmen Seiten des an sich so überaus wohltätigen neuen Mittels in die Erscheinung traten. Todesfälle, zuweilen in entsetzlicher Häufung und um so niederschmetternder, als sie nicht selten lange Reihen guter Erfolge ablösten, drängten den Wundärzten die Frage nach der Ursache solcher Erscheinungen mit brutaler Heftigkeit auf. Wohl gab es einzelne Chirurgen, die, durch gute Erfahrungen lange Zeit verwöhnt, alles auf Unachtsamkeit und Mißgriffe schoben, bis sie selber vom Schicksale ereilt wurden. So erging es Simpson, der erst nach langjähriger Tätigkeit den ersten Chloroformtod erlebte, so Gustav Simon in Heidelberg, der in seinen Vorlesungen immer die Schuld des Chirurgen betont hatte, so v. Dumreicher in Wien, der nach einem Chloroformtode auf der Nachbarklinik einen klinischen Vortrag gleicher Richtung hielt, aber im unmittelbaren Anschluß daran einen Kranken verlor. Keiner blieb auf die Dauer verschont, so daß die erfahrenen Ärzte stets mit einem leichten Gefühle des Grausens an die Narkose herangingen. Allein wie groß die Gefahr denn eigentlich war, das vermochte der einzelne Beobachter aus seiner eigenen Erfahrung heraus nicht zu beurteilen. Dazu gehörten große, umfassende Zahlen und diese zu beschaffen setzte sich die Deutsche Gesellschaft für Chirurgie zur Aufgabe.
Auf dem XIX. Kongreß von 1890 hielt Kappeler, leitender Arzt in dem schweizerischen Münsterlingen, einen Vortrag: „Beiträge zur Lehre von den Anästheticis“, an dessen Schluß er dem vom Vorsitzenden Ernst v. Bergmann lebhaft unterstützten Wunsche Ausdruck gab, die Gesellschaft möge eigene Erfahrungen in Gestalt einer Sammelforschung über verschiedene Betäubungsmittel aufzubringen versuchen. Die mühsame Arbeit der Sichtung und Zusammenstellung übernahm Ernst Gurlt, der auf dem Kongreß von 1891 seinen ersten, auf dem von 1897 seinen letzten zusammenfassenden Bericht erstattete. Er bringt ein Gesamtmaterial von 330429 Narkosen mit verschiedenen Betäubungsmitteln, die eine Sterblichkeit von 1 Todesfall auf 2429 ergeben. Davon entfallen auf das Chloroform 240806 Narkosen mit 116 Todesfällen, also 1 Todesfall auf 2075 Anwendungen, während 56233 Ätherbetäubungen 11 Opfer forderten, d. h. 1 auf 5112.
Schon aus diesen Zahlen erhellt die Erkenntnis, daß die Anwendung der Äthernarkosen, für welche schon auf demselben XIX. Chirurgenkongreß P. Bruns auf Grund seiner praktischen Erfahrungen und tachometrischen Pulsuntersuchungen entschieden eintrat, erheblich ungefährlicher ist als das Chloroform; denn wenn auch die Gurltsche Statistik noch wenig von den unangenehmen und nicht selten tödlichen Nachkrankheiten des Äthers im Bereiche der Luftwege zu sagen weiß, auf die man bald in immer stärkerem Maße aufmerksam wurde, so blieb doch der Eindruck, den sie einmal hervorgerufen hatte, mächtig genug, um dem Äther wiederum eine umfangreichere Verwendung zu sichern. Selbst Johann v. Mikulicz, der auf dem Kongreß von 1901 einen ausgezeichneten Vortrag: „Die Methoden der Schmerzbetäubung und ihre gegenseitige Abgrenzung“ hielt, in welchem er über 98539 Inhalationsnarkosen[55] und 103064 örtliche Anästhesien schlesischer Ärzte berichtet, stellt zwar, unter Berücksichtigung der Nachkrankheiten, für das Chloroform eine Sterblichkeit von 1:1683, für den Äther eine erheblich höhere Zahl von 1:1044 fest, nimmt aber dennoch auf Grund eigener Beobachtungen für das Chloroform eine größere Gefährlichkeit an, als sie dem Äther eignet. Die Neubersche Statistik von 1908, welche über 71052 Narkosen berichtet, hat diese Anschauungen im allgemeinen bestätigt; sie ergibt für Chloroform eine Sterblichkeit von 1:2060, für Äther von 1:5930, für Skopolaminmischnarkosen von 1:4762, für Mischnarkosen nach Schleich, Körte, Parker, freilich nur in der Zahl von 1748 Anwendungen, keinen Todesfall.
Hand in Hand mit dem Studium der Todesursachen in den einzelnen Fällen gingen die Versuche, den Gefahren durch eine aufmerksamere Darreichung des Betäubungsmittels zu begegnen. In den angelsächsischen Ländern bediente man sich schon seit Jahrzehnten des Kunstgriffes, eigene Gehilfen nur für die Betäubung zu erziehen, die ihre Aufmerksamkeit ausschließlich der Narkose zuzuwenden hatten und für deren guten Verlauf verantwortlich waren. Auch in Deutschland ging man hier und da zu diesem Verfahren über, mußte aber bald die Überzeugung gewinnen, daß eine nennenswerte Abnahme der Todesfälle dennoch nicht erzielt wurde. Vielmehr sah man ein neues schweres Bedenken in dem Umstände auftauchen, daß manche Gehilfen, um nicht mitten im blutigen Eingriffe eine Störung herbeizuführen, die Meldung gefahrdrohender Erscheinungen ungebührlich lange verzögerten. Eine große Zahl von neuen Darreichungsmethoden mittels zum Teil fein ersonnener Instrumente führten keineswegs zum ersehnten Ziele, wenn auch die wachsende Vorsicht manche Besserung der Verhältnisse erzwang. So gelangte man denn zu den Mischnarkosen, um die notwendige Menge des Einzelgiftes herabzumindern und dennoch die gleiche Wirkung zu erzielen. Diesen Weg betrat zuerst, schon im Jahre 1850, der Zahnarzt Weiger in Wien mit einer Mischung von 9 Teilen Äther auf 1 Teil Chloroform. Das englische Chloroformkomitee setzte dem Äther und Chloroform noch Alkohol im Verhältnis von 3:2:1 hinzu, welches Gemisch Billroth dahin veränderte, daß er auf Chloroform 100 je 30 Teile Äther und Alkohol fügte. Endlich stellte Karl Ludwig Schleich in Berlin verschiedene Flüssigkeitsmischungen von einem willkürlich gewählten Siedepunkte zusammen, von der Voraussetzung ausgehend, daß ein Betäubungsmittel um so leichter in den Körper aufgenommen, zugleich aber um so leichter wieder ausgeschieden werde, je flüchtiger es sei. Schleichs Siedegemische haben sich praktisch als brauchbar erwiesen, ohne indessen den genannten Mischungen überlegen zu sein; seine physikalischen Voraussetzungen aber sind nicht unbestritten geblieben (Honigmann, H. Braun).
Noch in einer anderer Weise hat man die Menge des zuzuführenden Betäubungsmittels und damit auch seine Giftwirkung zu verringern versucht, indem man nämlich ein Schlafmittel (Morphin, Skopolamin, Veronal) kürzere oder längere Zeit dem Narkotikum vorauf schickte. Es scheint in der Tat damit eine Herabminderung der Gefahren erreicht worden zu sein. Endlich ist durch Einführung des sogenannten Ätherrausches (Sudeck), der freilich nur bei ganz kurze Zeit dauernden Operationen angewandt werden kann, die Menge des Betäubungsmittels so verringert worden, daß fast jede Spur von Gefahr vermieden wird.
Daneben haben freilich die Versuche der durch die chemischen Fabriken[56] lebhaft unterstützten Ärzte, neue und immer weniger gefährliche Betäubungsmittel zu finden, niemals aufgehört. Wie auf einer Wandelbühne gingen, für den praktischen Wundarzt fast sinnverwirrend, immer neue Mittel auf, um nach einer kurzen Zeitspanne des Glanzes zu verlöschen und mehr oder weniger der Vergessenheit zu verfallen. Unter den zahllosen Neuerungen der zwei Jahrzehnte nach 1891 seien nur zwei genannt, das Bromäthyl und das Pental, ersteres, weil manche hervorragende Chirurgen längere Zeit an ihm festgehalten haben, letzteres, weil es wohl als das gefährlichste aller Betäubungsmittel angesehen werden muß. Die Gurltsche Statistik berechnet seine Tödlichkeit auf 1:213.
Blieben so Chloroform und Äther unverrückt auf ihrem hervorragenden Platze stehen, so erwuchs ihrer Anwendung doch von anderer Seite her eine überaus dankenswerte Ergänzung in den verschiedenen Maßnahmen, um eine örtliche Empfindungslosigkeit herbeizuführen. Schon seit dem Jahre 1866 war der Zerstäuber des Engländers Richardson dazu benützt worden, um durch den schnell verdunstenden Äther eine Vereisungs- und Erfrierungszone an der Körperoberfläche zu erzeugen in deren Bereich kleine, schnell ausführbare Eingriffe schmerzlos vorgenommen werden konnten. Die Methode ist, nur unbedeutend abgeändert, in dauerndem Gebrauch geblieben. Aber der durch sie wiederum angeregte Gedanke der Herbeiführung einer örtlichen Empfindungslosigkeit erhielt einen neuen Anstoß zu weiterer Ausgestaltung, die sich ganz an die Entdeckung des Kokains knüpft. Dies von den Andenindianern Südamerikas schon seit Jahrhunderten benutzte Mittel wurde in die europäische Medizin im Jahre 1884 durch den Wiener Arzt C. Koller eingeführt, zunächst nur zu dem Zwecke, Schleimhautflächen, insbesondere die Bindehaut des Auges, unempfindlich zu machen. Einige Chirurgen hatten auch bereits begonnen, das Alkaloid zu Einspritzungen unter die Haut zu verwenden, als Karl Ludwig Schleich vor den Kongreß von 1892 mit einer gut ausgearbeiteten Methode trat, welche auch ausgedehnte und langdauernde Operationen schmerzlos und fast ohne jede Gefahr auszuführen erlaubte. Es ist sehr bedauerlich, daß die mindestens etwas unvorsichtige Art des Einführungsvortrages den heftigen Widerspruch des damaligen Vorsitzenden Adolf v. Bardeleben und mit ihm des gesamten Kongresses hervorrief, wodurch Schleichs vorzügliche Idee auf ihrem Wege zur praktischen Betätigung für viele Jahre eine starke Behinderung erfuhr; aber durchgesetzt hat sie sich trotzdem und dem Erfinder ist der Ruhm geblieben, daß er die Chirurgie und damit die leidende Menschheit mit einem nahezu gefahrlosen örtlichen Betäubungsmittel beschenkt hat. Wenn es ihm auch nicht gelungen ist, die Einatmungsnarkosen zu verdrängen, wie er ursprünglich gehofft hatte, so hat er sie doch nicht unwesentlich eingeschränkt und damit die Narkosengefahr in sehr merkbarer Weise herabgesetzt. Die Schleichsche Infiltrationsanästhesie gehört zweifellos zu den Ruhmesblättern deutscher Chirurgie.
Es kann diesem Ruhme keinen wesentlichen Eintrag tun, daß die von Schleich ausgebildete Methode bereits vielfach überholt worden ist. Heinrich Braun (Zwickau), der in einer mustergültigen Arbeit vom Jahre 1905 (2. Aufl. 1907) alle bei der örtlichen Betäubung in Frage[57] kommenden Verhältnisse einer eingehenden Würdigung unterzog, hat durch Zusatz von Nebennierenpräparaten die Wirksamkeit und Dauer der Kokainanästhesie in ungeahnter Weise erhöht und damit nicht nur die Operationen fast unblutig gemacht, sondern auch die Vergiftungsgefahr ganz erheblich vermindert. Letztere ist auch dadurch noch weiter herabgesetzt worden, daß Ersatzmittel des Kokains, insbesondere das Novokain, gefunden wurden, welche an sich erheblich weniger giftig sind als das ursprüngliche Alkaloid. So ist das Verfahren selbst bei großen und eingreifenden Operationen fast vollkommen unschädlich geworden.
Die Braunschen Abänderungen haben sich auch für die Fortbildung anderer, älterer wie neuerer Verfahren sehr nützlich erwiesen: so zunächst für die von Oberst (Halle) schon im Jahre 1890 angegebene Methode der Fingeranästhesie mittels zweier Einspritzungen von Kokain längs des Verlaufes der beiden Fingernerven. Sehr viel wichtiger aber, weil in unendlich größerer Ausdehnung verwendbar, war die im Jahre 1899 beschriebene Methode August Biers, damals in Kiel, zur Anästhesierung des Rückenmarkes mittels Einspritzung des Betäubungsmittels in den Sack der harten Rückenmarkshaut, eine Methode, welche im Anschluß an Heinrich Quinckes Lumbalpunktion erdacht worden war. Wenn sich auch das Kokain als solches bald als zu gefährlich erwies, weil es allerlei schwere Erscheinungen, Nachkrankheiten, selbst Todesfälle hervorrief, so hat man doch von einem Verfahren nicht absehen zu müssen geglaubt, welches ursprünglich nur die Operationen bis zur Nabelhöhe, später aber in seiner Vervollkommnung einen noch größeren Teil des Körpers, bei Erhaltung des Bewußtseins, unempfindlich zu machen gestattete. Mittels Ersatzes des Kokains durch verwandte Stoffe (Novokain und Tropakokain) lernte man auch die Gefahren herabmindern, die schließlich auf dem Wege der Mischung des Betäubungsmittels mit Adrenalin (H. Braun — Zwickau) oder mit Strychnin (Jonnescu) oder einer zweiten Lumbalpunktion zur Verminderung des Flüssigkeitsdruckes (E. Küster) auf ein so geringes Maß herabgesetzt wurden, daß heute Biers Erfindung als eine glänzende Errungenschaft der neueren Chirurgie zur Bekämpfung der Operationsgefahren angesehen werden muß. Sie ist freilich in neuerer Zeit durch die weitere Ausbildung der örtlichen Betäubung in ihrer Anwendung etwas beschränkt worden.
Wenn wir zum Schluß auf all die zahlreichen Mittel, welche erdacht wurden, um dem Menschengeschlechte den Operationsschmerz zu ersparen oder zu lindern, einen prüfenden Rückblick werfen, so sind wir zu dem Geständnis gezwungen, daß deren keines vorhanden ist, welches, wie Mikulicz sich ausdrückt, im mathematischen Sinn, d. h. gänzlich und unter allen Umständen gefahrlos ist. Eines schickt sich nicht für alle. Der heutige Wundarzt weiß, daß er stets mit der ungeheuren individuellen Verschiedenheit zu rechnen hat, welche die Zellen des menschlichen Körpers jeder kraftmindernden Einwirkung, möge sie ererbt oder durch Alter, Verletzung und Krankheit erworben sein, an Widerstandskraft entgegenzustellen vermögen. Alle diese Veränderungen zu erkennen befähigt uns auch heute noch nicht eine aufs feinste entwickelte Diagnostik; aber sie hat den Arzt diesem Ziele wenigstens näher gebracht. Wenn ihm daraus die Möglichkeit erwachsen ist, jedem Kranken ohne Ausnahme den Schmerz zu ersparen, so doch auch zugleich die Pflicht, unter der Fülle der zur Verfügung stehenden Hilfsmittel das für den Fall passendste auszuwählen.[58] Das Studium der physiologischen Wirkungen aller Betäubungsmittel hat aber nicht allein die Möglichkeit geschaffen, unter ihnen von vornherein eine geeignete Wahl zu treffen, sondern auch die weitere, ein Mittel durch ein anderes zu ersetzen, sobald ersteres irgendwelche bedrohlichen Erscheinungen hervorruft. Nur auf diesem Wege ist eine Vervollkommnung der wissenschaftlich geleiteten Narkose noch zu erwarten; aber schon jetzt darf der Hoffnung Ausdruck gegeben werden, daß das drohende Gespenst des Narkosentodes, welches einst den Weg des handelnden Wundarztes bei jedem Schritte begleitete, zwar niemals gänzlich verschwinden, aber für gewöhnlich doch zu einer freundlichen Lichtgestalt sich umwandeln werde, die den Kranken und Elenden mit sanfter Hand über Schmerz und Qual hinaushebt.
Eins der schönsten Geschenke erhielt die Deutsche Gesellschaft für Chirurgie schon auf ihrem zweiten Kongreß vom Jahre 1873 in Friedrich Esmarchs, des berühmten Kieler Chirurgen, Mitteilung über seine Methode, künstliche Blutleere an den Gliedmaßen herbeizuführen und Operationen an ihnen dadurch vollkommen blutlos zu gestalten. Die Frage der Beherrschung eines allzu reichlichen Blutverlustes hatte die Chirurgen schon seit dem Altertum fast fortdauernd beschäftigt, selbst in solchen Zeiten, in welchen die Medizin methodische Blutentziehungen, sowohl am ganzen Körper, wie insbesondere an erkrankten Gliedern, nicht entbehren zu können glaubte. Des Rätsels Lösung, wie dies Ziel erreichbar sei, brachte Esmarchs Methode wenigstens für die Extremitäten.
Es ist müßig, zu erörtern, ob das Verdienst der Erfindung wirklich Esmarch, oder nicht vielmehr seinem damaligen Assistenten J. Petersen oder gar seinem Oberwärter Carstens zugeschrieben werden müsse, da letzterer eines Tages, wie erzählt wird, anstatt der bisher üblichen leinenen, eine elastische Gummibinde zum Einwickeln eines abzusetzenden Gliedes überreicht habe. Schon Jahre zuvor hatte Esmarch sich bemüht, durch sehr feste Einwicklung mit leinenen Binden und darauffolgende Abschnürung an einem höher hinauf gelegenen Punkte die Blutung an den Gliedmaßen auf ein bescheidenes Maß herabzumindern, wie es vor ihm wohl auch manche andere Chirurgen schon versucht hatten. Der Gedanke gehört also im wesentlichen ihm allein und für diese Auffassung spielt das bessere Material, welches ihm oder seinem Assistenten der Geistesblitz eines ungebildeten Mannes in die Hand legte, um so weniger eine Rolle, als der erfahrene Wundarzt sofort die großen Vorzüge, die weit überlegene Benutzbarkeit des neuen Stoffes erkannte. Mit fieberhafter Schnelligkeit und mit überraschenden Erfolgen wurde nunmehr die Methode ausgebildet, welche seitdem unzählige Kranke vor der durch starken Blutverlust erzeugten Schwäche bewahrt und ihnen Gesundheit und Leben erhalten hat. Sie gehört zum festen Bestande der Chirurgie der gesamten gebildeten Welt.
Daß Esmarchs elastische Binde auch weiter als Mittel zur vorläufigen Blutstillung benutzt und daß in seinen Samariterkursen das sehr einfache Verfahren zur Verhütung schwerer Blutverluste auch zahlreichen Laienhänden eingeübt wurde, sei nur nebenbei erwähnt.
In Friedrich Trendelenburgs Beckenhochlagerung vom[59] Jahre 1892 hat die Methode der Blutersparung einen neuen, höchst wertvollen Sproß getrieben, und durch die Anwendung der Nebennierenpräparate ist die Möglichkeit der Blutersparung für alle Operationen geschaffen worden.
Noch ein weiteres Verfahren entwickelte sich aus der in Schwang gekommenen Anwendung der elastischen Binde: ihre Benutzung zur Blutstauung, um dadurch heilend auf krankhafte Vorgänge verschiedener Art zu wirken.
Schon seit 1895 hatte Bier fortgesetzt Studien über „Hyperämie als Heilmittel“ gemacht, die er in verschiedener Weise, durch heiße Luft, heißes Wasser, endlich durch venöse Stauung, hervorbrachte und erprobte. Nach vielen kleineren Veröffentlichungen erschien unter genanntem Titel im Jahre 1905 eine Einzelschrift, welche seitdem viele Verbesserungen und Vermehrungen in zahlreichen Auflagen erlebte, als bester Beweis für den großen Anklang, den die neue Behandlungsmethode bei den Fachgenossen gefunden hat. Die Einfachheit und Zweckmäßigkeit des Verfahrens, welches die elastische Binde möglich machte und welches Bier bis in alle Einzelheiten praktisch ausgebildet hatte, gewann der Methode reichlich Anhänger, sowohl für die Behandlung akuter Entzündungen, zumal an den Fingern, als auch zur Heilung tuberkulöser Erkrankungen, in erster Linie der Knochen und Gelenke. Auch die „Biersche Stauung“ dürfte fortan als ein fester Bestand unseres Heilmittelvorrates zu gelten haben.
Zu den bisher besprochenen Hilfsmitteln der Chirurgie gesellt sich als letztes ein solches, welches weniger für die Behandlung als für die Erkenntnis der Krankheiten eine stets wachsende Bedeutung gewonnen hat. Im Dezember 1895 veröffentliche Wilhelm Röntgen, Professor der Physik in München, eine kleine Schrift, in welcher er die überraschende Mitteilung machte, daß es ihm gelungen sei, unter Benutzung der Hittorfschen Röhre Kathodenstrahlen zu erzeugen mit der merkwürdigen Fähigkeit, jeden Körper, dessen Schichten nicht gar zu dicht sind, zu durchdringen. Wie ein Geisterleib erschien der menschliche Körper nur in zarten Umrissen auf dem die Strahlen auffangenden Schirme und nur das Knochengerüst, sowie alle dicken metallischen Gegenstände und dichtgeschichteten Mineralien warfen deutliche Schatten Die Aufnahme des Verfahrens in den wundärztlichen Betrieb erfolgte zunächst langsam und zögernd. Zwar wurde es bald genug klar, welch ausgezeichnetes Mittel man in den Röntgenschen Kathodenstrahlen für die Erkenntnis der Besonderheiten der Knochenverletzungen und deren rechtzeitiger Beeinflussung während der Heilung besaß, daß auch Sitz und Eigenart der in den menschlichen Leib eingedrungenen Fremdkörper, soweit sie metallischer Natur waren, aufs genaueste festgestellt werden könnten; aber es dauerte doch mehrere Jahre, bis die Vervollkommnung der Apparate und das verfeinerte Studium der physikalischen Bedingungen auch die Zustände innerer Organe dem prüfenden Auge des vorgebildeten Beschauers zugängig machen konnten. Und wenn auch die sehr hochgespannten Hoffnungen der Laienwelt, daß es fortan möglich sein werde, die krankhaften Veränderungen des Körpers wie auf einer Landkarte zu sehen, sich nur zu einem kleinen Teile erfüllt haben, so war doch der Gewinn für die an eine genaue Erkenntnis geknüpfte[60] Behandlung chirurgischer und innerer Leiden so groß, daß weder die Regierungen der einzelnen deutschen Bundesstaaten, noch die Gemeindevertretungen, noch Vereine sich der Aufgabe entziehen konnten, ihre Kliniken, sowie große und kleine Krankenanstalten mit Durchleuchtungsvorrichtungen in vollem Umfange zu versehen. Die fast märchenhaft erscheinende Entdeckung Röntgens, welche den wissenschaftlichen Aufschwung des 19. Jahrhunderts würdig abschloß, hat sich von ihrem deutschen Mutterboden schnell über die ganze Erde verbreitet. Von ihr erhielten die wissenschaftliche und praktische Chirurgie und deren Schmerzenskind, die Unfallheilkunde, ferner die innere Medizin, die Geburtskunde, überhaupt fast sämtliche Gebiete der praktischen Medizin einen ungeheuren Auftrieb; und wenn auch die heilenden Eigenschaften der Röntgenstrahlen den Erwartungen, welche menschlicher Optimismus an sie knüpfte, zunächst nur in bescheidenem Maße gerecht geworden sind, so ist doch die Möglichkeit nicht ausgeschlossen, daß eine immer mehr sich verfeinernde Technik der leidenden Menschheit noch manche wertvolle und überraschende Gabe zum Geschenk machen werde.
Gleiches läßt sich von den beiden Stoffen sagen, die als Heilmittel in neuester Zeit mit den Röntgenstrahlen in Wettbewerb getreten sind, dem Radium und Mesothorium. Ihre unmittelbare Wirkung ist überraschend groß, Art und Dauer derselben aber noch zweifelhaft.
Die von Anfang an außerordentlichen Erfolge der neuen Wundbehandlung, die sich zudem noch von Jahr zu Jahr verbesserten, führten zunächst eine Umwandlung und Vermehrung der Werkzeuge, sowie wesentliche Veränderungen der operativen Technik herbei. Bald genug wurde es nämlich klar, daß die alten Instrumente mit Holz- oder Horngriffen, überhaupt alle aus mehreren Stücken zusammengesetzten Vorrichtungen, niemals mit Sicherheit keimfrei zu machen waren, weil der fettige, keimreiche Schmutz in den Spalten und Ecken weder durch chemische, noch durch physikalische Mittel sicher beseitigt werden konnte. Man verfiel daher, um der daraus erwachsenden Gefahr zu begegnen, auf ganz metallene Werkzeuge, entweder aus einem einzigen Stück gearbeitet oder, wenn dies aus irgendeinem Grunde nicht angängig war, mit einem Griffe aus einer dünnen Platte, die aufs sorgfältigste an das Hauptstück angelötet wurde. Alle Ecken und Winkel mußten nach Möglichkeit vermieden oder wenigstens abgerundet sein. So vorgerichtet konnten sie in Sodalösung gekocht, in einer antiseptischen Lösung abgekühlt und dann sofort mit der Wunde in Berührung gebracht werden.
Auch die Art zu operieren veränderte sich. In der Zeit vor Anwendung der Betäubungsmittel stand am höchsten im Ansehen der Wundarzt, der seinen Eingriff blitzschnell zu vollenden wußte; und diesem höchsten Ziele paßten sich auch die Operationsmethoden an. Sehr hübsch spiegelt sich diese übertriebene Wertschätzung der Technik in einer Anekdote wider, die Bernhard v. Langenbeck von seinem Oheim Konrad Martin Langenbeck in Göttingen zu erzählen liebte. Letzterer hatte für die Absetzung des Oberschenkels in der Mitte die Ovalärmethode angegeben und wegen der außerordentlich schnellen Ausführbarkeit dringend empfohlen. Ein älterer Kollege von einer Nachbaruniversität kommt nach Göttingen, um die Methode kennen zu lernen[61] und Langenbeck lädt ihn für den nächsten Tag zu einer solchen Operation ein. Der Kranke liegt auf dem Tisch, jener ergreift das Messer: da wendet sich der fremde alte Herr noch einmal ab, um behaglich eine Prise zu nehmen. Aber welches Entsetzen, als er bemerkt, daß die Absetzung inzwischen schon vollendet ist!
Mit der allgemeinen Anwendung der Betäubungsmittel verlor die Behendigkeit etwas an Ansehen, wiewohl der bei großen Eingriffen schwer vermeidbare Blutverlust immer noch zu einer gewissen Eile zwang. Als diese Unannehmlichkeit durch die elastische Binde, wenigstens an manchen Körperteilen, vollständig überwunden worden war, da glaubte man sich mehr Zeit lassen zu dürfen, bis die Vergiftungen unter Anwendung des antiseptischen Sprühnebels und die Gefahren, welche man aus langen Abkühlungen des Körpers erwachsen sah, die sorglos Langsamen von neuem aufrüttelten. Die aseptische Behandlung, das Operieren in warmen Zimmern und auf heizbaren Tischen haben auch diese Bedenken fast vollkommen zum Schwinden gebracht, wenigstens so weit, daß die Methoden nicht mehr ausschließlich nach der Schnelligkeit der Ausführung, sondern vorwiegend nach der größeren Zweckmäßigkeit gewählt werden. Aber daß eine langdauernde Operation gefährlicher als eine schnell vollendete ist, unterliegt gar keinem Zweifel; der Grundsatz: Eile mit Weile gilt deshalb auch heute noch für jeden Wundarzt. —
Die bisherigen Vorstellungen über Wundheilung mußten sehr bald einer erneuten Prüfung unterzogen werden. War doch bis dahin die Heilung durch erste Vereinigung und unter dem trockenen Schorfe, wie sie bei verwundeten Vögeln regelmäßig beobachtet werden kann, am menschlichen Körper eine ganz seltene und nur bei kleinen und oberflächlichen Wunden vorkommende Vereinigungsweise geblieben; der Ehrgeiz des Wundarztes ging also bei größeren Wunden auf kein höheres Ziel, als auf Herbeiführung eines Pus bonum et laudabile, d. h. eines geruchlosen gelben Eiters, und einer dabei langsam fortschreitenden Wundreinigung, da man diese Vorgänge als unbedingt notwendig zur Heilung, den Eiter sogar vielfach als heilungsbefördernd angesehen hatte. Über die Art, wie eine größere Wunde sich langsam schließt und über das Verhalten der einzelnen Körpergewebe bei diesem Vorgange hatten schon vor der Entdeckung, daß Bakterien die Wundeiterung erzeugten und unterhielten, zahlreiche Untersuchungen stattgefunden. Die durch mikroskopische Studien herbeigeführten Anschauungen hatten vielfach wechseln müssen, so nach Cohnheims Entdeckung der Auswanderung weißer Blutkörperchen durch die Gefäßwandungen hindurch, so nach Metschnikows Beschreibung des Wesens der Freßzellen. Beide hatten die Arbeiten über Wundheilung von Karl Thiersch und Karl Gussenbauer beeinflußt; aber in vollkommenster Weise wurde alles das zusammengefaßt und durch eigene Untersuchungen erweitert in der vortrefflichen Arbeit Felix Marchands: „Der Prozeß der Wundheilung mit Einschluß der Transplantation“ vom Jahre 1901. Der Verfasser unterscheidet zwar auch noch eine Heilung durch direkte Vereinigung und eine solche durch Regeneration, welch letztere früher ausschließlich unter dem Bilde der eitrigen Entzündung verlief, betont aber ausdrücklich, daß ein solcher Unterschied nicht mehr aufrecht erhalten werden könne, da jeder Heilungsvorgang ein Regenerationsvorgang sei, dem allerdings bei verschiedenen Wunden erhebliche gradweise Verschiedenheiten[62] zukommen. Diese Lehre wird an den einzelnen Körpergeweben geprüft und bestätigt, so daß Marchands Buch auch heute noch als Grundlage der herrschenden Anschauungen über die feineren Vorgänge bei der Wundheilung betrachtet werden muß.
Unter der großen Zahl von Wunden aller Art, welche dem Wundarzte unter die Hände kommen, haben, solange es eine Geschichte der Medizin gibt, die Schußwunden und seit der Erfindung des Schießpulvers vor allen anderen die Kugelwunden eine besondere Rolle gespielt, nicht etwa deshalb, weil, soweit es sich um Friedensverletzungen handelt, Entstehung und Verlauf gegenüber mancherlei Zufallsverwundungen einen sehr erheblichen Unterschied darböten, sondern nur der Begleitumstände wegen. Denn einerseits führt der Krieg, den Pirogoff eine „traumatische Epidemie“ genannt hat, zur räumlich und zeitlich beschränkten Anhäufung einer so ungeheuren Anzahl von Verwundungen, daß zu ihrer sachgemäßen Versorgung nach den Grundsätzen einer Friedensbehandlung die zur Verfügung stehenden Kräfte gewöhnlich in keiner Weise ausreichen; anderseits hat die Ausbildung der Waffen, die geeignet sind, den Gegner kampfunfähig zu machen, ein so schnelles Zeitmaß der Entwicklung eingeschlagen, daß sie fortdauernd neue Formen des Kampfes und neue Formen der Wundbehandlung erforderlich machte. So ist denn auch die Kriegschirurgie in neuerer Zeit zu einer Sonderwissenschaft geworden, deren Kenntnis jedem ins Feld ziehenden Arzte vertraut sein sollte. Freilich bilden nicht die Schußwunden allein den Inhalt der Kriegschirurgie; aber alle anderen Verletzungen, welche sonst noch im Kriege vorkommen, wie die Hieb-, Stich- und Quetschwunden, sind nur ein so kleiner Bruchteil der Kriegswunden, daß man die Schußverletzung als den Typus der Kriegswunde anzusprechen berechtigt ist.
Selbstverständlich kann es nicht unsere Aufgabe sein, die Geschichte der militärärztlichen Organisation, deren Ziel es war und ist, schon im Frieden eine für den Krieg ausreichende Zahl von Ärzten auszubilden und bereitzustellen, eingehend zu schildern; doch muß auch sie wenigstens gestreift werden, da sie in engster Beziehung zu dem Aufblühen der Kriegschirurgie steht. In Preußen, dessen Einrichtungen für die übrigen deutschen Staaten seit 50 Jahren vorbildlich geworden sind, war durch Errichtung einer militärärztlichen Bildungsanstalt, des Collegium medico-chirurgicum in der Pepinière zu Berlin im Jahre 1795 und dessen Erweiterung 1797, für geordneten Unterricht und wissenschaftliche Erziehung der jungen Militärärzte in ziemlich ausreichender Weise gesorgt worden. Auch für eine bessere Ausbildung des niederen Heilpersonals, welches bis dahin seine Kenntnisse und Fertigkeiten bei Badern und Barbieren erworben hatte, wurde durch endgültige Trennung des Barbiergewerbes von der Chirurgie mittels des Gesetzes vom 7. September 1811 ein wichtiger Schritt getan. Der hierdurch entstehende Mangel an Unterchirurgen konnte durch die Kabinettsorder vom Jahre 1820 ausgeglichen werden, durch welche die[63] jungen Ärzte und Wundärzte veranlaßt wurden, ihrer Dienstpflicht im Heere nicht mit der Waffe, sondern als Ärzte zu genügen. Die Gründung der Universität Berlin im Jahre 1810 drohte freilich eine Zeitlang dem genannten Kollegium den Untergang zu bringen; doch gelang es dem damaligen ersten Generalstabschirurgen des Heeres und Leiter des Militärmedizinalwesens Johann Görcke diese Gefahr abzuwenden und im Jahre 1811 eine neue Anstalt unter dem Namen einer medizinisch-chirurgischen Akademie für das Militär durchzusetzen, deren Zöglinge die Vorlesungen der Universitätsprofessoren zu hören berechtigt waren. Diese Akademie ist im Jahre 1852 für die wissenschaftliche Ausbildung der jungen Militärärzte der Universität gleichgestellt worden, während für deren praktische Erziehung die Charité benutzt wurde. Vom gleichen Zeitpunkte an hörten auch die langjährigen und zuweilen höchst gefährlichen Angriffe auf, welche gegen die Notwendigkeit der engeren militärärztlichen Ausbildung und damit gegen den Fortbestand der seit dem Jahre 1848 „Militärärztliches Friedrich-Wilhelms-Institut“ genannten Erziehungsanstalt gerichtet worden waren. Unter der tätigen Fürsorge des Generalstabsarztes Heinrich Gottfried Grimm erfuhr das Militärsanitätswesen einen besonderen Aufschwung, begünstigt durch die Erfahrungen der drei aufeinanderfolgenden Kriege von 1864, 1866 und 1870/71. Ihm verdankt es die Abschaffung des Kompaniechirurgentums, die Hebung des Standes der Lazarettgehilfen, die Einführung der Krankenwärter und Krankenträger, die Einrichtung einer Militärmedizinalabteilung im Kriegsministerium, der Chefärzte für Feld- und Friedenslazarette, die Bildung eines Sanitätskorps und die Bezeichnung der Militärärzte als Sanitätsoffiziere. In den Jahren 1905 bis 1910 ist die alte Friedrich-Wilhelms-Akademie unter dem Namen „Kaiser-Wilhelms-Akademie“ in ein neues, glänzend erbautes Haus an der Ecke der Invaliden- und Scharnhorststraße verlegt worden, ausgestattet mit den zweckmäßigsten Ausbildungsmitteln, gesunden Wohnungen und umfangreichen Versammlungs- und Festräumen. — Trotzdem ist auch heute der Zustrom junger Ärzte zum militärärztlichen Berufe den ungeheuren Anforderungen, welche die außerordentliche Vermehrung des stehenden Heeres nötig macht, noch nicht ganz entsprechend. Es ist wohl zu hoffen, daß auch in dieser Hinsicht eine Änderung eintreten werde, seitdem im Februar 1914 auf Betreiben des Generalstabsarztes v. Schjerning die Gleichstellung der Sanitätsoffiziere mit den Offizieren des Heeres fast vollkommen durchgeführt worden ist.
Wichtiger aber als dieser äußere Rahmen, in welchem sich die Entwicklung des militärärztlichen Standes in Preußen und in einem sehr großen Teile Deutschlands abgespielt hat, ist der Aufschwung der Kriegschirurgie. Ihre Förderung ist jenem Stande in erster Linie anheimgefallen, wenn auch die Mitglieder der Deutschen Gesellschaft für Chirurgie, der freilich auch zahlreiche Militärärzte schon seit ihrer Gründung angehört haben, diesem Zweige ihrer Wissenschaft stets ein sehr reges Interesse entgegenbrachten.
Schon auf dem II. Kongreß von 1873 trat W. Busch (Bonn) mit einem Vortrage über die Ergebnisse von Schießversuchen auf menschliche Leichen auf, zu welchen die Kriegserfahrungen von 1866 und 1870/71 mit ihren von den bisherigen Anschauungen vielfach stark abweichenden Verwundungen den Anstoß gegeben hatten. Gleichfalls über derartige[64] Versuche sprachen E. Küster (Berlin) und Schädel. Ersterer setzte seine Versuche weiterhin an lebenden Tieren fort und berichtete über sie in einer Sitzung der Berliner Medizinischen Gesellschaft vom Januar 1874. Seitdem wurden wiederholt die Geschoßwirkungen auf den menschlichen und tierischen Körper durch andauernde Versuche in allen Einzelheiten studiert; unter den zahlreichen Arbeiten dieser Art seien nur die von Bornhaupt, Kocher, Reger, Wahl und Paul v. Bruns hervorgehoben.
Immer von neuem wurden die Chirurgen gezwungen, diesen Fragen ihre Aufmerksamkeit zuzuwenden. Abweichend von dem Gebrauche des alten Vorderladers, welcher ursprünglich nur Rundkugeln, später auch Spitzkugeln entsandte, hatte Preußen schon im Jahre 1841 das Dreysesche Zündnadelgewehr eingeführt, welches in den beiden Feldzügen von 1864 und 1866 zur Verwendung kam, einen Hinterlader mit Einheitspatrone, Spiegelführung und Langblei von 14–15 mm Durchmesser. Mit ihm wurde durch Geschoßlänge und Pulverladung die Anfangsgeschwindigkeit, die Treffgenauigkeit, die Totalschußweite und die Streckung (Rasanz) der Flugbahn ganz erheblich erhöht. Aber man blieb dabei nicht stehen. Bald nach 1866 führte Frankreich das Chassepotgewehr mit einem Kaliber von 11 mm und einer Anfangsgeschwindigkeit von 420 m ein, dem in Deutschland das Infanteriegewehr von 1871 gleichfalls von 11 mm Laufweite folgte. Seit 1888 besitzt das deutsche Heer kleinkalibrige Gewehre von 7–8 mm, deren Bleigeschosse von einem Nickelmantel umgeben und deren Leistungsfähigkeit im übrigen noch durch Anwendung des rauchlosen Pulvers und zugleich dadurch gesteigert worden sind, daß sie Patronenkammern haben, welche als Magazingewehre eingerichtet und daher als Repetiergewehre benutzbar sind. In manchen Heeren ist man darüber hinaus noch zu einem Kleinstkaliber vorgeschritten; so besitzt Rumänien ein Mannlichergewehr von 6,5 mm Laufweite mit einem Geschoß von nur 22,74 g Gewicht, während das Zündnadelgeschoß 40 g, die Chassepotkugel noch 32 g wogen. Auch das im Russisch-Japanischen Kriege von 1904/05 vorwiegend zur Verwendung gekommene Arusakagewehr Modell 94 der Japaner ist ein Kleinstkaliber von 6,5 mm Laufweite. Die Leistungen dieses Gewehres für die oben genannten Ansprüche sind unübertrefflich gewesen; und dennoch hat, wie Paul v. Bruns in überzeugender Weise dargetan, der Mandschurische Krieg der weiteren Anwendung eines so kleinen Kalibers sehr vernehmlich Halt geboten. Denn in einer, und zwar einer sehr wichtigen, Beziehung hat das Kleinstkaliber die Grenze der kriegsmäßigen Verwendung bereits überschritten: seine Wirkung ist so wenig nachhaltig, daß eine übergroße Zahl der Getroffenen den Kampf nicht zu unterbrechen braucht. Voraussichtlich wird daher das deutsche Heer bei dem 8-mm-Geschoß bleiben. Für die menschenfreundlichen Bestrebungen aber, welche die unvermeidlichen Schrecken des Krieges nach Möglichkeit zu mildern suchen, mag es als ein Trost angesehen werden, daß die Feuerwirkungen der neuen Gewehre zwar die Todesfälle auf dem Schlachtfelde vermöge ihrer Durchschlagskraft vermehren, dafür aber die Gesamtverluste eher ab- als zugenommen haben; denn die Sterblichkeit der vom Schlachtfeld noch lebend kommenden Verwundeten ist ganz erheblich geringer geworden, wodurch mehr als nur ein Ausgleich gegenüber der unmittelbar tödlichen Geschoßwirkung herbeigeführt wird.
Alle diese Fragen sind schon im Frieden mit dem größten Eifer gestellt[65] und durch Versuche nach Möglichkeit beantwortet worden. An solchen Versuchen hat sich, außer den obengenannten Mitgliedern der Deutschen Gesellschaft für Chirurgie, in ganz hervorragender Weise die Militärmedizinalabteilung des preußischen Kriegsministeriums beteiligt, welches allen Veränderungen der kriegsmäßigen Ausrüstung des Heeres die größte Aufmerksamkeit zuwandte und durch sehr wertvolle Veröffentlichungen die gewonnenen Erfahrungen zum Gemeingute der Chirurgen machte. Auf den Chirurgenkongressen haben diese Fragen wiederholt ihre Erörterung gefunden. Eine der wichtigsten Mitteilungen ist die des Generalarztes Schjerning vom XXX. Kongreß 1901.
Noch in anderer Weise wurde für die Vermehrung der kriegschirurgischen Kenntnisse Sorge getragen und zwar durch Verbesserung und Förderung der Krankenpflege. Sie hing mit den Bestrebungen zusammen, das Los der Kriegsverwundeten auf dem Schlachtfelde und in den Kriegslazaretten etwas freundlicher zu gestalten als es bisher der Fall gewesen war. Auf Anregung eines von reinster Menschenliebe durchglühten Privatmannes namens Henry Dunant trat im Jahre 1863 in seiner Vaterstadt Genf ein aus Mitgliedern verschiedener Völker gebildeter Ausschuß zur Beratung über genannten Gegenstand zusammen, die am 22. August 1864 zum Abschluß der sogenannten Genfer Konvention führte. Durch sie verpflichteten sich die Staaten gegenseitig, die Kriegsverwundeten, sowie die Ärzte und das Pflegepersonal nicht mehr als Feinde zu behandeln, sondern ihnen gleiche Pflege und Behandlung angedeihen zu lassen wie den Angehörigen des eigenen Landes. Alle Staaten Europas sind im Laufe der Jahre der Konvention beigetreten, auch die Türkei unter dem Namen des roten Halbmondes, ferner der größere Teil der amerikanischen Staaten und Japan. Im Jahre 1906 ist sie einer Neufassung unterzogen worden. — Eine weitere Förderung erhielt die Kriegskrankenpflege durch Gründung von Vereinen, die sich ihre Entwicklung und Ausbildung im Kriege und im Frieden zum Ziele setzten. So entstand im Kriege von 1864 (6. Febr.) das Zentralkomitee des Preußischen Vereins zur Pflege verwundeter und erkrankter Krieger, im Jahre 1866 unter der Führung der Königin Augusta die Immediatlazarettkommission und, mit Ausbruch des Krieges am 16. Juni 1866, der Berliner Frauenlazarettverein; endlich nach Beendigung des Krieges am 11. November desselben Jahres der Vaterländische Frauenverein. Auch die anderen deutschen Staaten blieben in der Gründung ähnlicher menschenfreundlicher Vereine nicht zurück, so daß ganz Deutschland in immer steigendem Maße mit Vereinen sich überzog, deren Aufgabe es war, im Frieden wohltätige Einrichtungen aller Art zu fördern und zugleich ein gutgeschultes Heer von Pflegekräften zu erziehen die im Kriegsfalle sofort dem Heere zur Verfügung gestellt werden können. Besonders wirksam ist diese Einrichtung erst dadurch geworden, daß alle solche Vereine sich für den Krieg der Militärmedizinalabteilung zur Verfügung gestellt haben, so daß von einer Zentralstelle aus eine gleichmäßige Verteilung über die deutschen Heere und eine schnelle Ausfüllung aller entstehenden Lücken vorgenommen werden kann. So ist der ärztlichen Tätigkeit im Felde eine unübertreffliche Hilfe zuteil geworden neben dem ausgebildeten Sanitätspersonal, welches Haase schon 1892 auf 45000 Köpfe berechnet hat.
Aber auch die kriegsmäßige Ausbildung der Zivilärzte bildet eines[66] der Ziele dieser Vereine, die seit ihrer Gründung jeden nahen oder fernen Krieg benutzt haben, um wohleingerichtete Kriegslazarette mit Ärzten und Pflegepersonal den beiden kämpfenden Heeren zur Verfügung zu stellen. Ihre Bestrebungen konnten auch seitens der Deutschen Gesellschaft für Chirurgie gefördert werden, da diese nach Bernhard v. Langenbecks Tode von dessen Nachkommen ein wertvolles Geldgeschenk erhielt, dessen Zinsen dazu bestimmt waren, deutschen Ärzten im Falle eines Krieges, an dem das Deutsche Reich unbeteiligt bliebe, Gelegenheit zu kriegschirurgischen Erfahrungen und Studien zu geben. Zum ersten Male ist dieser Grundstock im Mandschurischen Kriege in Anspruch genommen worden, in welchem der preußische Oberstabsarzt Schäfer auf russischer Seite sehr wertvolle Beobachtungen anstellen und veröffentlichen konnte. — Vor allen Dingen aber war es die Militärmedizinalabteilung der deutschen Heere, welche jede Gelegenheit zur Ausbildung in den Kriegen der letzten Jahrzehnte durch Entsendung einzelner Militärärzte benutzt hat. So ist die Genfer Konvention eine höchst erfolgreiche Handhabe zur Förderung der Kriegschirurgie und zur Heranziehung eines Stabes vorzüglicher Kriegschirurgen geworden.
Alles das würde indessen nicht ausreichend gewesen sein, um auf dem Schlachtfelde selber oder in den nächstgelegenen Verbandplätzen jedem einzelnen Verwundeten eine zuverlässige Behandlung zu sichern, wenn es inzwischen nicht gelungen wäre, die Wunde in der einfachsten und am wenigsten zeitraubenden Weise unter einen vorläufigen Schutz zu stellen; denn hätte man die Tausende von Verletzten einer großen Schlacht in gleicher Weise behandeln wollen, wie es die umständliche Antiseptik oder Aseptik des Friedens verlangt, so wäre keine Macht der Erde imstande gewesen, zu verhindern, daß nur einem kleinen Bruchteile die Segnungen der neuen Wundbehandlung zuteil geworden wären, während alle übrigen nach wie vor den Unbilden der Verunreinigung, der Witterung, des Transportes, der Blutungen und der Hospitaleinflüsse ausgesetzt geblieben wären.
Die Lösung der hier gestellten Aufgabe ist sowohl von der Militärmedizinalverwaltung wie von den im Kongreß vereinigten deutschen Chirurgen aufs eifrigste und, soweit es die wechselnden Schwierigkeiten der Lage zulassen, mit bestem Erfolge in Angriff genommen worden. Zwei Wege waren es, auf welchen man das gesteckte Ziel, wenn nicht völlig zu erreichen, so doch ihm möglichst nahe zu kommen suchte.
Den ersten dieser Wege betrat man in Form der Krankenzerstreuung, von der auf S. 8 bereits die Rede gewesen ist. Dieses schon in früheren Kriegen übliche, aber systematisch wohl zuerst von dem hervorragenden russischen Chirurgen Pirogoff im Jahre 1847 in den Kriegslazaretten des Kaukasus in größerem Umfange angewandte Verfahren ist auch von deutscher Seite in den Kriegen von 1864, 1866 und besonders großartig 1870/71 benutzt worden. Auch auf diesem Felde hat aber die veränderte Geschoßwirkung des Kleinkalibers zu Abweichungen von der ursprünglichen Handhabung gezwungen, von denen wir teils aus der Deutschen Kriegssanitätsordnung, teils aus dem an das Zentralkomitee der deutschen Vereine vom Roten Kreuz gesandten Berichte Walter v. Öttingens vom September 1905 Näheres erfahren. Nach ihm wurden auf dem Sortierungspunkte in[67] Mukden die eingelieferten Verwundeten in drei Gruppen geteilt: Leichtverwundete, die so lange an Ort und Stelle verblieben, bis sie zu ihren Truppenteilen zurückkehren konnten, und Schwerverwundete, die bis zu ihrer Transportfähigkeit gleichfalls dort in Behandlung waren. Dagegen wurden die Zugehörigen zur dritten Gruppe, nämlich alle jene Fälle, die zwar eine lange Heilungsdauer erheischten, aber doch transportfähig waren, möglichst schnell rückwärts gesandt, nachdem man sie durch Gipsverband, Operation oder nur gutsitzende Verbände dazu fähig gemacht hatte.
Immerhin entspricht auch dies Verfahren bei weitem noch nicht den dringenden Anforderungen des Schlachtfeldes selber, wie sie an die ärztlichen Begleiter der Truppenteile und deren Krankenträger gelegentlich herantreten. In früheren Kriegen haben sich die jungen Ärzte wohl damit beschäftigt, Kugeln schon auf dem Kampfplatze auszuziehen und herauszuschneiden, weil dies von den Verwundeten selber aufs lebhafteste verlangt wurde. Das ist ein in keiner Weise zu billigendes Verfahren, weil es die Arbeitskräfte auf unwesentliche Nebendinge ablenkt und dem Verletzten niemals nützt, aber vielfach schadet. Überhaupt sollten die Operationen auf dem Schlachtfelde und in den ersten Verbandplätzen im allgemeinen verboten sein, oder doch sehr eingeschränkt werden. Nur die Verletzungen des Bauches und großer Gefäße machen eine Ausnahme, zumal wenn letztere so gelegen sind, daß ihnen durch Anlegung einer zentralwärts angebrachten elastischen Binde nicht beizukommen ist; denn sonst würde der Verwundete während des Transportes zum Lazarett sich voraussichtlich verbluten. Alle übrigen Wunden aber bedürfen nur eines schnell anzulegenden Schutzverbandes, die Knochenschüsse zugleich einer Schienung. Das sind die jetzt wohl allgemein geltenden Grundsätze der ersten Behandlung von Kriegsverletzungen.
Der Trieb, einen solchen ganz einfachen und doch wirksamen Verband herzustellen, hat die deutschen Chirurgen schon seit dem Bestehen der Deutschen Gesellschaft für Chirurgie beherrscht. Auf dem V. Kongreß von 1876 hielt Friedrich Esmarch einen Vortrag: „Die antiseptische Wundbehandlung in der Kriegschirurgie“, den er im Jahre 1879 vervollständigte. In beiden Reden legte er die Grundsätze dar, denen zwar einzelne Chirurgen in den vorangegangenen Kriegen, insbesondere B. v. Langenbeck, bereits gefolgt waren, ohne daß sie aber bei der Mehrzahl Anerkennung gefunden hätten — die Grundsätze: vor allen Dingen durch Fingeruntersuchung der Wunden und Sondeneinführung keinen Schaden anzurichten, die zerschossenen Knochen ruhigzustellen, endlich den in seiner ganzen Strenge auf dem Schlachtfelde und auf dem Notverbandplatze nicht durchführbaren antiseptischen Verband aufs äußerste zu vereinfachen. Esmarch wurde hier der Urheber des Verbandpäckchens, welches aus einem antiseptischen Ballen, einem dreieckigen Tuche und einer Binde bestehend, in die Uniform eingenäht, jedem ins Gefecht ziehenden Krieger mitgegeben wurde, um bei seiner Verwundung sofort zur Hand zu sein. Dies Päckchen hat sich, wenn auch vielfach verändert, bis heute erhalten; es wird noch in der Kriegssanitätsordnung vom Januar 1907 als zur Ausrüstung des Feldsoldaten gehörig aufgeführt.
Zahlreiche Chirurgen haben seitdem auf den Schlachtfeldern von vier Erdteilen jene Grundsätze praktisch erproben können. Als die ersten[68] sind aus dem Russisch-Türkischen Kriege von 1877 Karl Reyher aus Dorpat und Ernst v. Bergmann zu nennen, von denen ersterer auf dem kleinasiatischen Kriegsschauplatze, letzterer an der Donau tätig war. Während aber Reyher in einem wohlausgestatteten Lazarette des Roten Kreuzes arbeitete und deshalb den Forderungen der antiseptischen Behandlung in vollem Umfange genügen konnte, war Bergmann in den mörderischen Schlachten der russischen Donauarmee in wesentlich schwierigeren Verhältnissen, in welchen er dennoch durch Befolgung der Grundsätze einer konservativen Chirurgie in Verbindung mit einer den Umständen angepaßten aseptischen Behandlung ganz überraschende Erfolge erzielte. Er wird daher als Begründer der Asepsis in der Kriegschirurgie angesehen, was Esmarch gegenüber wohl nicht ganz gerecht ist; denn wenn dieser auch noch chemische Mittel in Anwendung zog, so ist doch das Verfahren beider sonst ziemlich gleich; und chemische Mittel sind auch heute noch nicht ganz aus der Kriegschirurgie geschwunden. So wird von Walter v. Öttingen die von R. Credé im Jahre 1896 zuerst empfohlene Behandlung mit Silbersalzen (Kollargol) für den ersten Verbandplatz außerordentlich gerühmt; und zwar geschah die Anwendung des gänzlich ungiftigen Mittels in folgender Weise: die Wunde und ihre Umgebung wurde nicht gewaschen, sondern letztere nur mit einer Harzlösung bestrichen, um die an Haut und Haaren klebenden Bakterien mechanisch festzuhalten, auf die Wunde eine Silbertablette gelegt und über dieser ein aseptischer Ballen mit einer Binde befestigt. An Einfachheit läßt dieser Verband gewiß nichts zu wünschen übrig.
Noch sei mit kurzen Worten auf die Bedeutung hingewiesen, welche Röntgens große Erfindung, die Aktinographie, auch für die Kriegschirurgie gewonnen hat. Sie hat vor allen Dingen die kriegschirurgische Erkenntnis aller Einzelheiten der Wunde möglich gemacht, insbesondere nach der Richtung steckenbleibender Fremdkörper und der Knochenverletzungen; und hat solche Feststellung ermöglicht, ohne Beunruhigung der Wunde und ohne Schmerz hervorzurufen. Selbstverständlich hat dabei auch die Behandlung gewonnen und zwar nicht allein der frischen Wunden; denn die Heilungsvorgänge verletzter Knochen lassen sich auch durch den Wund- und Gipsverband hindurch in regelmäßiger Wiederholung der Durchleuchtung beobachten. Der Wert des Verfahrens hat sich schnell als so erheblich erwiesen, daß die Militärmedizinalverwaltungen aller Länder sich zur Anschaffung entsprechender Apparate bewogen sahen. So besitzen wir denn zurzeit bereits aus sieben Kriegen Mitteilungen über diagraphische Untersuchungen, zuerst seitens der Italiener im abessinischen Feldzuge von 1896, in welchem die Studien freilich erst begannen, nachdem die Verwundeten die heimatlichen Lazarette erreicht hatten. Ebenso stammen die Berichte von Küttner und Abbott aus dem Griechisch-Türkischen Kriege von 1897 nicht vom Schlachtfelde, sondern aus Konstantinopel und Phalarus, betreffen also ältere Verwundungen. Dagegen haben die nachfolgenden Kriege der Engländer gegen die Afridis und im Sudan, der Spanisch-Amerikanische, der Burenkrieg (1899/1900), der Hererokrieg in Südwestafrika (1904/07), endlich der Russisch-Japanische Krieg von 1904/05 ein sehr reiches Beobachtungsmaterial sowohl vom Schlachtfelde, wie aus den Reservelazaretten gebracht. Alles das ist in dem vom Generalarzt Schjerning und seinen Mitarbeitern Thöle und Voß im Jahre 1902 herausgegebenen „Archiv[69] und Atlas der normalen und pathologischen Anatomie in Röntgenbildern (Abteilung: Die Schußverletzungen)“ zusammengefaßt und bearbeitet, der im Jahre 1913 bereits eine zweite, erweiterte Auflage erfahren hat. Das Werk ist eine ausgezeichnete Quelle der Belehrung über alle Formen der Schußverletzungen.
So hat denn die Kriegschirurgie nach allen Richtungen Förderung und Erweiterung erfahren. Die schnelle Aneignung und Verwertung aller auf dem Gebiete der wissenschaftlichen Chirurgie wie der gesamten Naturwissenschaften liegenden neuen Errungenschaften, die fleißige und unausgesetzte Arbeit der Militärmedizinalverwaltung und der Chirurgenkongresse haben sie auf eine Höhe gebracht, die weit von dem Zustande um die Wende des 18. zum 19. Jahrhundert verschieden ist und der die begründete Hoffnung zuläßt, daß sie im Falle eines neuen Krieges, trotz der ungeheuren Entwicklung der Waffentechnik, ihre Aufgaben voll und ganz zu erfüllen imstande sein werde.
Noch eine zweite Gruppe von Wunden und Verschwärungen macht eine eigene Betrachtung notwendig, nämlich solche, welche in tuberkulösen Geweben vorkommen. Zwar vermochte Köster in Bonn schon im Jahre 1869 das Vorkommen von Knötchen (Tuberkeln) in der Synovialhaut der Gelenke nachzuweisen; dennoch hatte man bis zur Entdeckung des Tuberkelbazillus im Jahre 1882 nur sehr unbestimmte Vorstellungen von dem eigentlichen Wesen gewisser Knochen- und Gelenkkrankheiten, die in der Unterscheidung kalter und heißer Abszesse, sowie in der Bezeichnung gewisser, sehr langsam verlaufender Gelenkleiden als Tumor albus, weiße Gelenkgeschwulst, ihre schüchterne Andeutung fanden. Diese und manche andere Erscheinungen, die Unterernährung des Körpers, die Blässe der Hautdecken, Lymphdrüsenschwellungen, die Neigung zu mancherlei Ausschlägen, zumal am kindlichen Körper, faßte man als Skrophulosis, Schweinchenkrankheit, zusammen, unter einem Ausdrucke also, welcher der Auftreibung des Halses durch Vergrößerung der zahlreichen dort eingebetteten Lymphdrüsenketten eine Ähnlichkeit mit dem kurzen, gedrungenen Halse des Ferkels beizulegen sich bemüht. Von einem Zusammenhange dieser „Skrofulose“ mit der Tuberkulose, der Knötchenkrankheit der Lungen, hatte man damals noch keine Vorstellung, selbst dann noch nicht, als die Tuberkel als regelmäßiger Befund bei Lungenphthise längst entdeckt waren. Erst auf der Münchener Naturforscherversammlung von 1877 und auf dem Chirurgenkongreß von 1878 (Karl Hüter) wurde wenigstens eine Verwandtschaft dieser Vorgänge wahrscheinlich gemacht. Ebensowenig wußte man Sicheres von der tuberkulösen Natur des Lupus, jener entsetzlichen Hautkrankheit, welche das menschliche Antlitz in eine abscheuerregende Maske verwandelt, obwohl Friedländer schon im Jahre 1872 Tuberkel in lupöser Haut beschrieben hatte. Aber nach der Entdeckung des Erregers der Tuberkulose folgten die Aufklärungen Schlag auf Schlag. Schon Anfangs 1883 konnte[70] Doutrelepont in Bonn über den Nachweis von Tuberkelbazillen im Lupusgewebe berichten; und nachdem Koch in seiner großen klassischen Arbeit von 1884 auch den Lupus in seine Besprechung miteinbezogen, die spezifischen Bazillen innerhalb der Riesenzellen nachgewiesen hatte, war ein Zweifel an der Tatsache, daß dieser eine rein tuberkulöse Krankheit sei, nicht mehr möglich. In gleicher Weise gelang der Nachweis des Tuberkelbazillus in Knochen, Gelenken und in allen Weichteilen, welche entweder durch kleine und größere Verletzungen von außen her, oder auf dem Wege des Blutstromes mit Bazillen oder ihren Sporen in Berührung kamen.
Es war selbstverständlich, daß mit dieser Feststellung den Wundärzten die Hoffnung wuchs, die einmal ausgebrochene Krankheit mit Hilfe einer immer zuverlässiger werdenden Wundbehandlung zu bezwingen. In der Tat hatte schon die Listersche Antisepsis manchen schönen Erfolg bei der Operation kalter Abszesse, durch Resektion „skrofulös“ erkrankter Gelenke, Beseitigung käsiger Knochenherde und ähnlicher Leiden aufweisen können; aber die Erwartung, alle mehr peripher gelegenen Krankheitsherde operativ und mit Hilfe der Antisepsis der Heilung zuführen zu können, mußte schon aus dem Grunde Schiffbruch leiden, weil, wie erst spätere Studien festgestellt haben, die Tuberkulose sehr häufig in vielen Herden auftritt, indem Ausbrüche an den verschiedensten Körperteilen entweder gleichzeitig oder nacheinander erfolgen. Dies Verhalten findet seine Erklärung in dem Umstande, daß oft ein tief verborgener käsiger Herd die Quelle für die auf dem Blutwege erfolgende Vergiftung des Körpers mit Tuberkelbazillen und ihren Fortpflanzungsorganen darstellt. Nicht einmal bei einer so oberflächlich gelegenen Erkrankungsform, wie dem Lupus der äußeren Haut, gelang in vorgeschrittenen Fällen die Heilung, die höchstens bei noch sehr wenig umfangreichen, aber frühzeitig erkannten Herden durch vollkommene Ausschneidung des veränderten Hautstückes in den meisten Fällen erreicht wurde. Die lupöse Hauterkrankung verhielt sich also dem Messer gegenüber ganz ähnlich, wie wir es weiterhin von den Hautkrebsen kennen lernen werden.
Immerhin ergab die antiseptische Behandlung schon aus dem Grunde erheblich bessere Heilungen, wie je zuvor, weil die Infektion tuberkulöser Wunden und Geschwüre mit eitererzeugenden Keimen ein üppigeres Wachstum der Tuberkelbazillen herbeizuführen scheint. Trotzdem blieb die Behandlung unbefriedigend, da doch die meisten Kranken, die wegen tuberkulöser Leiden einer Operation unterworfen waren, entweder örtlich Rückfälle bekamen, oder nach einiger Zeit gar einer allgemeinen Tuberkulose zum Opfer fielen. Billroth berechnete unter seinen wegen tuberkulöser Erkrankung ausgeführten Gelenkresektionen nicht weniger wie 27 %, König (1880) nach einer offenbar zu kurzen Beobachtungszeit immerhin schon 21,5 % Todesfälle an miliarer Ausbreitung des Leidens über den ganzen Körper. So wuchs denn die Sehnsucht nach einem spezifischen Mittel zur Unterdrückung wenigstens örtlicher Tuberkulose; und ein solches glaubte Mosetig v. Moorhof in Wien im Jahre 1880 in dem Jodoform gefunden zu haben. Überaus schnell kam das Mittel in Aufnahme. Man bestreute Wunden in tuberkulösen Geweben dick mit Jodoformpulver und nähte darüber zu, man entleerte kalte Abszesse mittels des Trokars oder der Pravazschen Saugspritze und füllte den[71] so entstehenden Hohlraum zum Teil mit einer Jodoform-Glyzerin-Aufschwemmung. Aber auch hier blieb eine gewisse Enttäuschung nicht aus, wie schon auf S. 41 geschildert worden. Denn einerseits forderten die Vergiftungen, welche das zumal in fetthaltigen Geweben aus der Gebundenheit des Jodoforms freiwerdende Jod hervorrief, zu immer größerer Vorsicht auf, anderseits wurden die antiseptischen Eigenschaften des Mittels immer zweifelhafter; und selbst die spezifische Wirksamkeit auf Tuberkelbazillen blieb nicht unangefochten, wenn sie auch niemals gänzlich bestritten worden ist. Man benutzte zwar das Jodoform, zuweilen auch reines Jod in Gestalt der Jodtinktur noch weiterhin als das beste Mittel gegen tuberkulöse Erkrankungen, hat aber die Vorstellungen von einer durchaus sicheren Einwirkung auf Entstehung und Ausbreitung der Bazillen, selbst in leicht zugängigen Geweben, längst aufgeben müssen. Noch im Jahre 1913 hat dieser Gegenstand den Chirurgenkongreß beschäftigt, in dem die schon früher von Rinne (1884) angeratene Behandlung eiternder Gelenktuberkulosen durch breite Eröffnung und halboffene Ausstopfung der Wunde mit Jodoformmull von neuem dringend empfohlen wurde. —
Aber noch einmal sollte der medizinischen Welt die Hoffnung auf ein spezifisches Heilmittel erweckt werden und zwar diesmal in Form einer Einwirkung auf bazillenhaltige Gewebe vom Blute aus. Die dabei sich abspielenden Vorgänge sind in einer Weise dramatisch belebt und erregend, daß sie wie der Höhepunkt einer Schicksalstragödie anmuten. Indessen wenn sie auch bei der allein in Betracht kommenden Krankheit zunächst mit einer Niederlage, einer grausamen Zerstörung uferloser Hoffnungen geendet haben, so wurden sie doch der Ausgang einer neuen Entwicklung, die auch der Chirurgie unendliche Vorteile gebracht hat, und deren weitere Folgen für die Zukunft noch in keiner Weise übersehen werden können.
Es war in der ersten Sitzung vom 4. August 1890 des in Berlin tagenden X. Internationalen medizinischen Kongresses, als Robert Koch den von ihm angekündigten und mit Spannung erwarteten Vortrag: „Über bakteriologische Forschung“ hielt. Darin teilte er mit, daß er schon bald nach der Entdeckung des Tuberkelbazillus angefangen habe, nach Mitteln zu suchen, welche sich zur Behandlung der Tuberkulose verwerten ließen. Solche Mittel müßten die Fähigkeit haben, nicht nur Reinkulturen von Bazillen in ihrer Entwicklung zu hemmen, sondern auch im lebenden Tierkörper die gleiche Wirkung zu entfalten; erst dann dürften Versuche am Menschen nachfolgen. Inzwischen sei es ihm gelungen, eine Flüssigkeit herzustellen, welche bei der Einverleibung in den Körper gesunder Meerschweinchen wirkungslos bleibe, dagegen bei hochgradig tuberkulösen Tieren die Krankheit völlig zum Stillstande bringe, ohne den Körper nachteilig zu beeinflussen.
Die Art der Zusammensetzung und der Herstellung des Mittels wurde zunächst noch verschwiegen. Dennoch rief schon diese Äußerung eine bedeutende Erregung hervor, da sie eine große Idee zur Heilung der entsetzlichen Krankheit ahnen ließ.
Unter Kochs und seiner Assistenten Leitung wurden nun sofort in verschiedenen Krankenanstalten, auch in der Charité und in v. Bergmanns chirurgischer Klinik Prüfungen des Verfahrens am lebenden[72] Menschen vorgenommen, von denen genug in die Öffentlichkeit drang, um die Erwartungen zur Siedehitze zu steigern. Auch fehlte es nicht an begeisterten Lobpreisungen der Erfindung und des Erfinders seitens aller an den Versuchen beteiligten Ärzte. So veranstaltete Ernst v. Bergmann am 16. November 1890 eine außerordentliche Sitzung der Freien Vereinigung Berliner Chirurgen, um über die bisherigen Beobachtungen Bericht zu erstatten und in Behandlung befindliche Kranke vorzuführen. Von nah und fern waren die besten Vertreter der Medizin in großer Zahl zusammengeströmt. „Seit den Zeiten des Hippokrates und Galen,“ so sagte v. Bergmann in seiner Einführungsrede, „war es keinem gegeben, gleichzeitig die Erscheinungen der Krankheit und ihre Ursachen zu erkennen, sowie ihre Heilung zu sichern. Es scheint, als ob in Robert Koch unserer Nation dies große Glück geschenkt worden sei. Wäre irgend ein anderer aufgetreten mit der Nachricht, daß er ein Heilmittel gegen die Tuberkulose gefunden habe, er würde bei uns kein Glück gehabt haben.“ Der also Gefeierte war allerdings allen Bemühungen zum Trotz der Versammlung ferngeblieben; aber wenige Tage zuvor, am 13. November, hatte er einen Aufsatz veröffentlicht: „Weitere Mitteilungen über ein Heilmittel gegen Tuberkulose“, in welchem er seine bisher gewonnenen Anschauungen niederlegte. Das Mittel (welches erst später den Namen Tuberkulin erhielt) bleibt in seiner Zusammensetzung noch unbesprochen. Fest stehe aber, daß es eine spezifische Wirkung auf tuberkulöse Prozesse habe, welcher Art sie auch immer sein mögen; es könne daher auch als diagnostisches Hilfsmittel für verborgene tuberkulöse Herde dienen. Wichtiger sei seine Bedeutung als Heilmittel; freilich töte es nicht die Tuberkelbazillen, sondern nur das tuberkulöse Gewebe, welches demnach zwar absterben, aber dennoch Bazillen weiterhin enthalten könne. Auf totes Gewebe, Käse, nekrotische Knochen wirke es nicht mehr; demnach sei es Aufgabe des Chirurgen, das abgestorbene Gewebe möglichst bald aus dem Körper zu entfernen. Da dies bei Tuberkulose innerer Organe, zumal bei Lungenphthisis schwer erreichbar sei, so könne letztere nur im Beginne mit Sicherheit geheilt werden. — Übrigens werde die Flüssigkeit den Ärzten, welche Versuche machen wollten, schon jetzt zur Verfügung gestellt.
Man wird sich später nur noch schwer eine Vorstellung davon machen können, welch ein Taumel des Entzückens, welch ein jubelnder Aufschrei der Wonne durch die ganze Ärztewelt ging; und nicht nur durch diese: die gesamte Menschheit, soweit sie den Kulturvölkern angehörte, war wie in einem Schwindel der Begeisterung gegenüber der nicht mehr bezweifelten Annahme, daß der heimtückische, schlimmste Feind des Menschen, dem alljährlich Hunderttausende nach entsetzlichem Siechtum zum Opfer fielen, nunmehr niedergerungen, zu Boden gestreckt, vernichtet sei. Hatte doch Koch gesprochen, der Mann, der noch niemals eine Entdeckung hinausgegeben hatte, ehe sie fest und unantastbar dastand. Gleich einem wilden, vom Gewittersturme aufgepeitschten Bergstrome überflutete die Erregtheit der öffentlichen Meinung alle Dämme, welche Vorsicht und Besonnenheit aufzurichten versuchten. Hunderte von Heilanstalten für Tuberkulöse erstanden über Nacht, die mit der Herstellung des Mittels beauftragten Ärzte waren der Nachfrage auch nicht entfernt gewachsen, die Glücklichen, denen es gelungen war, sich rechtzeitig eine angemessene Menge der heilenden Flüssigkeit zu sichern, wurden von[73] allen Seiten bestürmt, angefleht, selbst beschimpft, wenn sie sich weigerten, ein in seiner Zusammensetzung noch ganz unbekanntes Mittel aus der Hand zu geben, ehe sie selber vorsichtige Versuche damit angestellt hätten. Die medizinische, unterstützt von der politischen Tagesliteratur brachte fast in jeder Nummer Aufsätze über die Kochsche Behandlung, veranstaltete Sonderausgaben und steigerte die Aufregung. Um die Jahreswende 1890/91 schien es zuweilen fast, als habe sich die Welt unter der Einwirkung des Tuberkulins in ein Tollhaus verwandelt.
Der erste, aber sehr vernehmliche Halt wurde der Bewegung geboten, als Virchow am 7. Januar 1891 in der Berliner Medizinischen Gesellschaft über die Wirkung des Kochschen Mittels sprach, soweit er sie an Leichen von Menschen, die während des Lebens nach Kochs Vorschriften behandelt worden waren, bei der Leichenöffnung hatte feststellen können. Zum erstenmal wurde hier der bestimmte Verdacht ausgesprochen, daß die in den tuberkulösen Herden künstlich erzeugte Blutfülle und Erweichung die in den Geweben lagernden Tuberkelbazillen freizumachen und ihre Verschleppung in Nachbargewebe, selbst in weite Ferne, herbeizuführen vermöge. — Am 15. Januar erschien dann Kochs dritte Äußerung, welche mitteilte, daß der Stoff, mit welchem sein Heilverfahren geübt werde, ein Glyzerinextrakt aus den Reinkulturen der Tuberkelbazillen sei. Im übrigen hielt der Verfasser durchaus an seinem früheren Standpunkte fest und wies vereinzelte Behauptungen, daß die Behandlung nicht nur gefährlich werden, sondern geradezu schädlich sein könne, mit aller Entschiedenheit ab. Demgemäß wurden die Versuche am Menschen in Kliniken und Krankenhäusern ununterbrochen fortgesetzt.
Am 1. April 1891 wurde von dem Vorsitzenden Karl Thiersch der XX. Chirurgenkongreß in der Aula der Universität eröffnet, für dessen ersten Tag Ernst v. Bergmann einen „Einleitenden Vortrag zu der Besprechung über die Kochsche Entdeckung“ übernommen hatte. Robert Koch war zu dieser Sitzung eingeladen und hatte auf der ersten Sitzreihe, dem Rednerpulte gegenüber, Platz genommen. In der ihm eigenen schwungvollen Redeweise hob v. Bergmann als das Neue und Überraschende der Methode hervor, daß die Einverleibung des Mittels an entfernter Körperstelle eine Entzündung erzeuge und zwar eine solche, die sich auf tuberkulös erkrankte Gewebe beschränke. Für die Besprechung stellte er mehrere Thesen auf, deren Bedeutung er selber eingehend erörterte. Man merkte dem sehr gewandten Redner eine gewisse Befangenheit an, als er mit dem Geständnis schloß, daß man noch nicht so weit gekommen sei, einen wesentlichen und vollends den erhofften großen Gewinn für die Kranken aus dem neuen Verfahren zu ziehen. Er endete seine Rede mit der Hoffnung auf fleißige klinische Arbeit der Zukunft, die vielleicht anderes und Besseres bringen werde als bisher.
Als zweiter Redner trat Franz König auf, der hochgewachsene blonde Hesse mit dem nur noch wenig behaarten Schädel und dem spitzen Kinnbarte, ein ernster, aufrechter Mann, dessen Züge nur selten durch ein Lächeln gemildert wurden, während er doch ein menschenfreundliches Herz in der Brust trug; der immer nur die Wahrheit suchte und, falls er sie gefunden zu haben glaubte, sie rückhaltslos, zuweilen mit einer gewissen Herbheit, vertrat. Schon in seiner Göttinger Zeit hatte er sich, neben Richard v. Volkmann, die größten Verdienste um die[74] Ausbildung der Lehre von der Tuberkulose der Knochen und Gelenke erworben; er war also zweifellos zur Prüfung der aufgeworfenen Frage ganz besonders berufen. Noch mehr aber durch seinen lauteren Charakter; denn von Anfang an war er der Deutschen Gesellschaft für Chirurgie, zu deren Mitbegründern er zählte, ein volles Menschenalter hindurch der getreue Eckart, der scharf, klar und ohne Menschenfurcht jede Unvollkommenheit geißelte, jede Überschwenglichkeit dämpfte. In seiner ruhigen, geläufigen Redeweise gab er seine Meinung dahin ab, daß in derselben Form, wie er früher einmal eine Ausbreitung der Tuberkulose als Folge operativer Eingriffe beschrieben habe, das Tuberkulin gelegentlich zur Verschleppung der Bazillen und zu deren Aussaat über den ganzen Körper den Anlaß geben könne. Aber auch er wünschte dennoch einen, wenn auch sehr vorsichtigen Weitergebrauch des Mittels, unter gleichzeitiger Benutzung sowohl des Jodoforms, wie der Operation. Von ihm fiel der von vielen Zuhörern im stillen bestätigte Ausspruch, das Aussehen seiner Klinik sei im Laufe des letzten Winters so gewesen, daß er Gewissensbisse gehabt und sich vor fremden Menschen, denen er die Klinik zeigen sollte, geschämt habe. Weiterhin sprachen noch Schede (Hamburg), Lauenstein, v. Eiselsberg und Küster, von denen keiner für die unbedingte Fortsetzung der Versuche sich einlegte; sogar die Sicherheit des diagnostischen Wertes des Tuberkulins fand Anzweiflung, und Kochs Angabe, daß letzteres die die Bazillen einhüllenden Gewebe zum Absterben bringe, konnte auf Grund eingehender Untersuchungen von Schimmelbusch und Karg nicht einmal für den eigentlichen Tuberkel bestätigt werden. Nur die örtliche Blutfülle und Reizung wurde anerkannt. — Immerhin war die Gesellschaft auf Vorschlag des Präsidenten damit einverstanden, daß die weitere Besprechung des Gegenstandes auf den nächstjährigen Kongreß verschoben würde.
Während in dieser Weise die Beobachtung am Krankenbette durch den Mund ihrer Vertreter, selbstverständlich immer unter ausgesprochener Huldigung seines Genius, gegen Kochs Entdeckung und ihre Deutung die wuchtigsten Keulenschläge richtete, saß ihr Urheber bleich und wortlos, mit versteintem Gesichte, über welches nur hier und da ein Schatten, ein leichtes Zucken der Lippen flog, den Rednern gegenüber. Sah er doch in der fast einmütigen, wenn auch sehr zurückhaltenden Verurteilung seiner Methode durch die Vertreter der deutschen Chirurgie das Ergebnis langer mühsamer Forschung, wenn nicht vernichtet, so doch aufs äußerste gefährdet und ins Wanken gebracht. Und doch waren die Geschehnisse dem bisherigen und auch späteren Vorgehen Kochs so wenig entsprechend, daß man sich fragen muß, wie es möglich war, daß der überragende Geist, der bisher die großartigsten Geschenke an seine Wissenschaft und an die Menschheit erst herausgegeben hatte, nachdem jede, auch die entfernteste Möglichkeit einer anderen Deutung auf das Sorgfältigste erwogen und entweder abgetan oder richtig erklärt worden war, der also nur völlig reife und unantastbare Ergebnisse veröffentlicht hatte, in dieser so überaus wichtigen Frage mit einem unreifen, nicht abgeschlossenen Erzeugnis vor die ärztliche Welt getreten war. Die Erklärung liegt darin, daß Menschliches, Allzumenschliches sich in die stille Werkstatt des Gelehrten eingedrängt und seine Zirkel gestört hatte.
Koch selber hat dies mit den Worten angedeutet, es sei zu viel von seinen Untersuchungen durchgesickert, als daß sich die Veröffentlichung[75] habe aufschieben lassen. Nun stand im Sommer 1890 der Internationale medizinische Kongreß bevor, der zum erstenmal in der Hauptstadt des geeinigten Deutschen Reiches tagen sollte; da war es begreiflich, daß alle Beteiligten den brennenden Wunsch hatten, diese Zusammenkunft der medizinischen Gelehrsamkeit der ganzen Erde recht glänzend zu gestalten. Als daher der damalige Kultusminister v. Goßler, ein Mann von hoher Intelligenz und von ungewöhnlichem Verständnis für die Aufgaben naturwissenschaftlicher und medizinischer Forschung, durch v. Bergmann über Kochs Untersuchungen unterrichtet wurde, da erwuchs in beiden Männern der Gedanke, durch eine einleitende Rede des Forschers, die der Welt eine neue großartige Entdeckung bringe, den Verhandlungen der gelehrten Vereinigung einen besonders glanzvollen Auftakt zu geben. Koch weigerte sich zunächst mit aller Entschiedenheit, eine in keiner Weise abgeschlossene Untersuchung, welche dennoch die leidenschaftlichsten Erwartungen wachzurufen geeignet war, bereits in die Öffentlichkeit zu tragen; allein den immer stürmischer werdenden Überredungskünsten von beiden Seiten hat er auf die Dauer nicht widerstehen können. So ist es denn geschehen, daß in seinem Systeme nicht nur der Schlußstein, die Prüfung am menschlichen Körper, fehlte, sondern daß an den Tieren, welche er durch Tuberkulin geheilt zu haben glaubte, niemals Sektionen vorgenommen worden sind[1]. Diese Versäumnis, diese bedauernswerte Übereilung hat er mit einem Ikarischen Fluge und Sturze zu bezahlen gehabt, der zwar dem Andenken des unvergleichlichen Forschers kaum einen Eintrag zu tun vermag, der aber doch, wie heute zugestanden werden muß, unzähligen Menschen die Gesundheit zerstört und ein frühes Ende bereitet hat. Das tragische Schicksal dieser an sich so großartigen Erfindung bleibt für alle Zeiten eine ergreifende Warnung, wenn auch nicht leicht wieder so viele ungünstige Umstände zusammentreffen werden, um einen Genius gleich Robert Koch zu Falle zu bringen.
Das weitere Schicksal des Tuberkulins ist schnell erzählt. Der Kongreß von 1892 brachte nicht etwa eine Wiederaufnahme der Besprechung des Vorjahres, sondern an bescheidener Stelle, am Nachmittage des zweiten Sitzungstages einen Vortrag Franz Königs: „Die moderne Behandlung der Gelenktuberkulose“. Er enthält zunächst das Eingeständnis, daß eine ideale Heilung, d. h. eine Beseitigung aller Äußerungen der Krankheit an den Gelenken, wie an anderen Organen nicht erzielt werden könne und deshalb zu übergehen sei. „Weder bei den medikamentösen, noch bei den Impfversuchen (Tuberkulin) ist bis jetzt etwas herausgekommen. So sehr sie eine Zeitlang die Menschheit aufgeregt haben, sie müssen als Zukunftsmusik bezeichnet werden.“ Demnach sei die Gelenktuberkulose nach wie vor örtlich zu behandeln und zwar in dreifacher Weise: durch Absetzung der Glieder oder Ausschneidung der Gelenke, durch subkutane Einspritzung von Arzneistoffen (Jodoform); endlich durch funktionell-physikalische Einwirkung auf die Glieder. Die erstgenannte Gruppe, die Behandlung durch das Messer, sei nach Möglichkeit einzuschränken, aber keineswegs zu entbehren. — Die nachfolgenden Redner sprachen sich in ähnlicher Weise aus; so sagte v. Bergmann, durch die Einführung[76] der Jodoformeinspritzung sei wirklich mehr geschaffen, als durch das, was Koch, Liebreich, Schüller u. a. vom Blute aus auf die kranken Gelenke hätten bewirken wollen. — Die Sitzung wurde weiterhin dadurch denkwürdig, daß August Bier (Kiel) sein neues Verfahren einer konservativen Behandlung der Gelenktuberkulose durch Stauung vortrug.
So war denn für die Chirurgie das Tuberkulin vollständig abgetan und ist wenigstens als Heilmittel abgetan geblieben. Die dauernd fortgesetzten Versuche, die Kochschen Gedanken trotz allem auf anderen Wegen für die Menschheit nutzbar zu machen, können daher unser Interesse nur in sehr beschränktem Maße in Anspruch nehmen, da sie zur Chirurgie nie mehr ernstere Beziehungen gewonnen haben. Ob die in neuester Zeit wiederholt angestellten Versuche, die biologisch andersartigen Tuberkelbazillen niederer Tierarten zur Herstellung eines Heilmittels für den Menschen zu benutzen, greifbare Erfolge haben werden, läßt sich bisher noch nicht mit Sicherheit übersehen. Durch den Kochschen Zusammenbruch sind die Chirurgen zwar um eine glänzende Hoffnung ärmer, aber um eine belehrende Erfahrung reicher geworden.
Die Chirurgie ist zu der Behandlung, welche König im Jahre 1892 umrissen und Bier ergänzt hatte, zurückgekehrt und dabei geblieben. Man ist bescheidener in seinen Erwartungen geworden, man weiß, daß nicht alle Fälle heilbar und daß die anscheinend Geheilten vor früheren oder späteren Rückfällen nicht sicher sind; aber gegenüber dem traurigen Lose tuberkulöser Menschen in früheren Zeiten haben Antisepsis und Asepsis, Jodoform, physikalische Behandlung und Stauung Ergebnisse erzielt, durch welche das Schicksal der von Knochen- und Gelenktuberkulose Befallenen denn doch eine ganz erhebliche und sehr erfreuliche Milderung erfahren hat.
Durch das ganze 17. und 18. Jahrhundert ziehen sich in allen Kulturländern der Erde und selbst bei rohen Völkern Versuche, die darauf abzielen die Übertragung der Kuhpocken zu einem Heilmittel gegen die damals zu einer schlimmen Geißel des Menschengeschlechtes herangewachsene Blatternkrankheit zu machen. Sie fanden eine Zusammenfassung und Fortentwicklung zu einer geschlossenen Heilmethode seit dem Jahre 1798 durch den Engländer Edward Jenner, der sie erfolgreich in die medizinische Praxis einzuführen wußte. Die Kochsche Tuberkulinbehandlung beruht auf dem gleichen, wenn auch geläuterten Grundsatze der Einführung eines für den Menschen unschädlicheren Giftes in den Kreislauf, um damit einer gefährlichen Krankheit vorzubeugen, oder sie nachhaltig zu bekämpfen. Wenn aber auch die von Koch gewählte Form sich nicht bewährt hat, so ist doch der zugrunde liegende Gedanke so zwingend, daß die Versuche, ihn für solche ansteckende Krankheiten, deren Erreger entdeckt worden waren, zu verwerten, niemals aufgehört und vielfach die schönsten Früchte hervorgebracht haben, freilich zum Teil auf wesentlich anderen Wegen, als sie die Tuberkulinforschung betreten hatte. Wie weit diese Bemühungen zur Erzielung einer wirksamen Blutserumtherapie auch der Chirurgie Nutzen und Förderung gebracht haben, soll zunächst besprochen werden.
Der Bazillus der Diphtherie, jener furchtbaren Kinderkrankheit, der bereits im Altertum zahllose Kinder umfangreicher Länderstrecken[77] zum Opfer gefallen waren, wurde von Klebs schon vor 1883 mikroskopisch gesehen, von Löffler 1884 bakteriologisch festgestellt und eingehend beschrieben. An diese Entdeckung knüpften sich seit 1891 Emil Behrings Versuche einer Heilung diphtheriekranker Versuchstiere durch Einverleibung des Serums immun gewordener Tierkörper, die er zuerst mit Erich Wernicke zusammen unternahm. Aus den ersten Versuchen über die Anwendbarkeit einer solchen Serumbehandlung auf den Menschen ist das v. Behringsche Diphtherieheilserum hervorgegangen, welches eine der großartigsten Entdeckungen aller Zeiten auf dem Gebiete der Krankheitsheilungen darstellt. Auch die Chirurgie hat aus ihr ungeahnte Vorteile gezogen; denn die schweren Fälle des schrecklichen Leidens, welches seit der Mitte des 19. Jahrhunderts wiederum Hekatomben von kindlichen Opfern forderte, waren dem Messer des Chirurgen anheimgefallen, um den drohenden Erstickungstod durch einen rechtzeitigen Luftröhrenschnitt zu bekämpfen. In der Tat gelang es auf diese Weise, je nach der Schwere und den besonderen Eigentümlichkeiten der verschiedenen Endemien, 25–50 v. H. der Operierten und selbst darüber hinaus am Leben zu erhalten; aber in den siebziger und achtziger Jahren schien die Bösartigkeit des Leidens und damit die allgemeine Sterblichkeit sich noch immerfort zu steigern.
Diesen überaus traurigen und beängstigenden Zuständen hat Emil v. Behrings Diphtherieheilserum ein Ende gemacht. Freilich ist das neue Heilmittel, da die ärztliche Welt kurz zuvor die große Enttäuschung mit dem Tuberkulin erlebt hatte, ohne lebhaften Widerstand und heftige Erörterungen nicht aufgenommen worden; auch hat der unausrottbare Optimismus des menschlichen Geschlechtes, welches in jedem neuen Heilmittel sofort ein Allheilmittel zu erblicken sich anschickt, manche Enttäuschung herbeigeführt. Trotzdem ist das v. Behringsche Serum in wenigen Jahren zu einer starken und schneidigen Waffe gegen eine der verderblichsten Krankheiten geworden. Die Erkrankungsziffer ist, wahrscheinlich allerdings nicht ausschließlich unter dem Einflüsse der Heilserumbehandlung, erheblich heruntergegangen, die schweren Fälle mit ausgiebigen Zerstörungen der Weichteile sind fast verschwunden, weil zurzeit fast jeder Erkrankungsfall von dem behandelnden Arzte schon im ersten Beginn mit einer Einspritzung versehen wird, die allgemeine Sterblichkeit ist stark gesunken und die der Operation unterworfenen Fälle zeigen einen Verlust von höchstens noch 30 v. H., so daß die Operationsstatistik seit jener Zeit sich um etwa 40 v. H. gebessert hat. Krankenhäuser und Kliniken sind von der niederdrückenden Behandlung diphtherischer Kinder erheblich entlastet worden und der Wundarzt sieht die Erfolge seiner Operationen nicht mehr durch die langen Zahlenreihen der Todesfälle nach Tracheotomien entstellt.
Noch einen zweiten großen und unvergeßlichen Dienst hat Emil v. Behring der leidenden Menschheit durch Erfindung seines Heilserums gegen Wundstarrkrampf geleistet. Zur Bekämpfung der Wirkungen des im Jahre 1884 von Nicolaier entdeckten und im Jahre 1889 von dem Japaner Kitasato in Reinkultur gezüchteten Tetanusbazillus stellte v. Behring im Jahre 1895 nach den gleichen Grundsätzen wie beim Diphtherieheilserum ein Tetanusantitoxin dar, welches bei dieser zwar nicht eben häufigen, aber um so furchtbareren Krankheit seitdem allgemeine Anwendung gefunden hat. Wenn[78] auch das Mittel in vorgeschrittenen Fällen keineswegs imstande ist unter allen Umständen den tödlichen Ausgang zu verhindern, so gewinnt es doch an Sicherheit, je frühzeitiger die Einverleibung in das erkrankte Glied vorgenommen wird und scheint bei der auf S. 14 bereits erwähnten prophylaktischen Einspritzung einen fast vollkommenen Schutz gegen den Ausbruch der Krankheit zu gewähren.
Die auf fast alle, durch bekannte Mikrobien hervorgerufenen Krankheiten ausgedehnte Serumbehandlung kann hier nur so weit berührt werden, als chirurgische Leiden in Betracht kommen. Für diese stehen im Vordergrunde der Wichtigkeit die verschiedenen, in Deutschland, Frankreich und anderen Ländern hergestellten Streptokokkensera von etwas anderer Zusammensetzung, als die vorgenannten. Indessen ist das ganze Verfahren noch so wenig ausgebaut, daß von einer sicheren Heilwirkung noch nicht gesprochen werden kann. Immerhin wird man schon jetzt sagen dürfen, daß die Serumbehandlung, wie sie der Chirurgie schon bisher glänzende Erfolge eingebracht hat, ihr auch für die Zukunft noch manche beachtenswerte Förderung in Aussicht stellt.
Für einige, durch pflanzliche Schmarotzer hervorgerufene Krankheiten, wie Lepra und Aktinomykose, deren Erreger, der Leprabazillus, im Jahre 1884 von dem Norweger Armauer Hansen und der Strahlenpilz, zuerst von Bernhard Langenbeck gesehen, im Jahre 1877 von Bollinger in München genau beschrieben wurden, ist ein Heilmittel bisher noch nicht aufgefunden worden, soweit nicht chirurgische Eingriffe möglich sind.
Eine besondere Stellung nimmt die Syphilis ein, deren Erreger erst nach langer, von zahlreichen Forschern aufgebotener Mühe Schaudinn und Hoffmann im Jahre 1905 in einer Spirille, der Spirochaeta pallida, entdeckten und damit ihre ätiologische Selbständigkeit gegenüber den beiden anderen Geschlechtskrankheiten, dem weichen Schanker und dem Tripper, feststellten. Wenn auch diese drei Leiden, wenigstens in ihren ersten Anfängen, längst von der Chirurgie spezialistisch gesondert worden sind, so haben sie doch in ihrem weiteren Verlaufe so viele Berührungspunkte mit ihr, daß sie in einer Geschichte der Chirurgie nicht übergangen werden dürfen. So ist es denn auch für diese von hoher Bedeutung geworden, daß durch Paul Ehrlichs chemotherapeutische Untersuchungen ein zwar altes Mittel, das Arsen, aber in neuer Form als Salvarsan (Ehrlich 606), d. h. ein organisches Arsenpräparat, in Form von Einspritzungen in die Behandlung eingeführt wurde. Das Mittel hat sich als außerordentlich wirksam, zugleich aber als gefährlich erwiesen, indem es doch auch mehrfach Todesfälle veranlaßt zu haben scheint. Ob es möglich sein wird, durch Abänderung des Verfahrens diese zu beseitigen, oder wenigstens einzuschränken, ist gegenwärtig noch nicht zu beurteilen; doch ist wenigstens an der Wirksamkeit des Mittels ein Zweifel nicht mehr möglich.
Der Erreger der Gonorrhoe, der Gonokokkus, wurde 1879 von Albert Neißer in Breslau, der Erreger des weichen Schankers, der Streptobacillus ulceris mollis, 1889 von dem Franzosen Ducrey und etwas später, aber unabhängig von diesem, von den Deutschen Krefting und Unna entdeckt. Die Feststellung der Entstehungsart dieser Leiden hat deren Behandlung wesentlich wirksamer und sachgemäßer gemacht, als dies jemals vorher der Fall gewesen war, zugleich aber auch[79] der seit Jahrhunderten dauernden Verwirrung über Wesen und Zusammengehörigkeit der Geschlechtskrankheiten glücklich ein Ende gemacht.
Eine für die Chirurgie ungemein wichtige Krankheit, die durch Einwanderung der Zwischenform einer Bandwurmart, der Taenia echinococcus, in den menschlichen Körper hervorgerufene Echinokokkenkrankheit hat in den letzten Jahrzehnten eine nachhaltige und wirksame Bekämpfung gefunden. Seitdem durch den Berliner Peter Simon Pallas im Jahre 1760 die schon dem Altertume bekannten großen Blasen bei Ochsen und Schafen als tierische Schmarotzer erkannt, und von Bremser in Wien 1821 auch beim Menschen bestätigt worden waren, haben sich zahlreiche, vorwiegend deutsche Forscher, unter denen Küchenmeister, Heller und Leuckart zu nennen sind, mit der Aufklärung des Lebensganges des Hülsenwurmes, eine große Anzahl von Ärzten mit der klinischen Seite des Leidens beschäftigt. Die Behandlung blieb aber höchst unvollkommen, selbst nachdem in den sechziger Jahren des vorigen Jahrhunderts die operative Bekämpfung des Wurmleidens ihren Anfang genommen hatte. Erst die Antisepsis schuf auch hier Wandel, so daß ohne große Gefahren die operative Beseitigung der Blasen fast an allen Körperteilen hat in Angriff genommen werden können. Zu den erfolgreichsten Schriftstellern auf diesem Gebiete gehört Otto Madelung, 1885. Seitdem zählt die Ausräumung der gefährlichen Wurmhülsen zu den dankbarsten Aufgaben des Wundarztes.
Die bisher besprochenen Verwundungs- und Erkrankungsgruppen haben das Gemeinsame, daß bei ihnen der Nachweis der letzten Ursachen der Leiden zu einer höchst erfolgreichen, den Entstehungsbedingungen angepaßten Abänderung der Behandlungsweise geführt hat. Anders liegt die Sache mit einer letzten, höchst bedeutungsvollen Sippe pathologischer Veränderungen, den bösartigen Neubildungen, unter denen die Krebse und Sarkome wegen ihrer verhängnisvollen Einwirkung auf den menschlichen Körper an Wichtigkeit allen übrigen voranstehen.
Schon seit dem Beginne bakteriologischer und tierisch-parasitärer Forschungen hat sich immer von neuem der Gedanke aufgedrängt, daß die Ursache des Krebses in der Einwanderung pflanzlicher oder tierischer Schmarotzer in den Körper gesucht werden müsse. Indessen darf heute gesagt werden, daß diese Vorstellungen fast vollkommen Schiffbruch erlitten haben, indem alle Anstrengungen, ihre Wirklichkeit zu beweisen, gänzlich ergebnislos gewesen sind. So ist denn bis zum heutigen Tage, obwohl die pathologische Anatomie alles getan hat, um den feineren Aufbau, die Wachstumsverhältnisse und die biologischen Eigenschaften der bösartigen Neubildungen bis auf die letzte Einzelheit zu klären, das eigentliche Wesen des Krebses, soweit seine Entstehung in Frage kommt, noch fast so unbekannt, wie vor 2000 Jahren, als man ihn als einen dem Körper fremden Parasiten ansah. Gemeinsam ist in den Anschauungen der neuesten Zeit nur die Betrachtung des Krebses vom ätiologischen Standpunkte aus; aber darüber hinaus scheiden sich die Wege mit voller Entschiedenheit. Man braucht nur die Auffassungen[80] zweier Forscher, wie Ribbert und v. Hansemann, miteinander zu vergleichen, um darüber nicht im Zweifel zu bleiben.
Selbstverständlich kann an dieser Stelle auf die schwebenden Streitfragen nicht eingegangen werden. Es genüge daher zu bemerken, daß die Behandlung bösartiger Geschwülste davon bisher keinen bemerkenswerten Nutzen gezogen hat. Aus eigener praktischer Erfahrung heraus waren die Chirurgen schon seit Jahrzehnten zu dem Schluß gekommen, daß eine möglichst frühzeitige und möglichst ausgedehnte Ausschälung der wachsenden Geschwulst, wie sie insbesondere durch die schöne Arbeit Lothar Heidenhains vom Jahre 1889 für den Brustkrebs festgelegt worden ist, die sicherste und am meisten vor Rückfällen schützende Behandlung darstelle. Diese Anschauung ist von der pathologischen Anatomie in vollem Umfange bestätigt und von der biologisch-therapeutischen Forschung nicht erschüttert worden. So ist zurzeit noch alles Heil der von Krebs befallenen Unglücklichen an das rechtzeitig und geschickt geführte Messer gebunden; und die damit erzielten Ergebnisse sind wahrlich beachtenswert genug, da selbst bei einer so gefährlichen Form, wie dem Brustkrebse, 30–40 v. H. Dauerheilungen durch sorgfältige statistische Untersuchungen und Nachforschungen festgestellt wurden.
Dementsprechend kann vorläufig kein gewissenhafter Wundarzt die Verantwortung übernehmen, einem Kranken mit beginnender bösartiger Neubildung eine andere Behandlung als die der blutigen Operation zu empfehlen; denn weder die Durchleuchtung, noch die Behandlung mit Radium oder Mesothorium haben bisher verhältnismäßig gleich sichere Ergebnisse geliefert wie das Messer. Auch die von Ehrlich in den letzten Jahren eingeleiteten Immunisierungsversuche haben vorläufig noch keine verwertbaren Erfolge gezeitigt. Immerhin ist die Hoffnung nicht ausgeschlossen, daß auf dem einen oder anderen dieser Wege der Schutz zu haben sein wird, durch welchen dereinst eine der furchtbarsten Geißeln des menschlichen Geschlechtes erfolgreich bekämpft werden kann.
[1] Buchholtz, Ernst v. Bergmann. Leipzig 1911. — Die Angaben über die Ereignisse, wie sie oben geschildert worden sind, beruhen zum Teil auf mündlichen Mitteilungen v. Bergmanns an den Verfasser.
Die Wandlung der Anschauungen, welche sich unter der sicheren Hut der antiseptischen und aseptischen Wundbehandlung vollzog, hat auch zu einem völligen Umsturz der Behandlung in den Organgruppen und den einzelnen Organen geführt. Die Chirurgie trat einen Siegeszug an, der ohnegleichen in ihrer langen Geschichte ist, der vor keinem Hindernis Halt machte und eine große Anzahl von Krankheiten in ihren Bereich zog, an deren Zugehörigkeit zur inneren Medizin bisher kaum ein leiser Zweifel sich geltend gemacht hatte. So gibt es denn fast keinen Punkt mehr des menschlichen Körpers, den nicht chirurgische Werkzeuge am lebenden Menschen zu erreichen und unmittelbar oder mittelbar zu beeinflussen versucht hätten; und auf diese Weise vollzog sich eine Verschiebung der Örtlichkeit chirurgischer Erkrankungen, die der heutigen Chirurgie einen von dem vor einem halben Jahrhundert eingenommenen Standpunkte gänzlich verschiedenen Inhalt gegeben hat. Ihr Kennzeichen besteht darin, daß die meisten Lehrfächer der praktischen Medizin einen mehr oder weniger chirurgischen Anstrich bekommen haben.
Für die geschichtliche Besprechung können zwei Gruppen unterschieden werden: Krankheiten von Organen und Organsystemen, welche man bereits vor Einführung der Antisepsis sachgemäß zu behandeln begonnen hatte, bei denen also nur ein Ausbau und eine Vervollkommnung in Frage kam; und solche, bei denen chirurgische Einwirkungen erst durch die Listersche Behandlung möglich geworden sind. Sie bilden die glänzendste Seite der neuen Entwicklung der Wundarzneikunst.
Zur ersten Gruppe gehören die Bemühungen, angeborene oder erworbene Mängel der äußeren Decken oder der Organe durch Einpflanzung entsprechender Gewebe der gleichen oder ähnlichen Art zu beseitigen, die plastischen Operationen. Die ersten Versuche stammen schon aus dem Altertume; doch hat die Lehre eine so wechselreiche Geschichte durchzumachen gehabt, daß sie zeitweilig fast vollkommen vergessen war. Erst im 19. Jahrhundert ist sie durch Ferdinand v. Gräfe und Johann Friedrich Dieffenbach ganz erheblich[82] gefördert worden und erhielt nach Erfindung der Betäubungsmittel durch Bernhard v. Langenbeck einen neuen mächtigen Auftrieb, der unter dem Schutze der antiseptischen Wundbehandlung sich dahin auswuchs, daß sie zu einem Gemeingut aller Chirurgen geworden ist. Seitdem ist die operative Technik der plastischen Operationen durch so viele neue Ideen bereichert worden, daß ihre Leistungen weit über die Bemühungen früherer Zeiten sich erhoben und auf vielen Gebieten großen und dauernden Nutzen gestiftet haben.
Die meisten neueren Chirurgen bezeichnen alle plastischen Operationen ohne Ausnahme als Überpflanzungen, Transplantationen; nur einzelne unterscheiden freie und gestielte Überpflanzungen. Andere haben sich bemüht, die beiden Formen, in denen der Ersatz in die Erscheinung tritt, schon durch das Hauptwort kenntlich zu machen. Nach diesem ohne Frage zweckmäßigeren Verfahren heißt Überpflanzung (Transplantatio) nur eine solche Operation, bei welcher ein gestielter Lappen, aus der Nachbarschaft oder aus weiterer Entfernung entnommen, auf eine neue Wundfläche übertragen wird, um erst nach der Aufheilung, wenn überhaupt, von seinem Mutterboden gänzlich abgeschnitten zu werden. Dagegen heißt die Einpflanzung eines von seinem Mutterboden sofort vollkommen losgelösten Lappens, des Pfropfstückes, auf eine andere Körperstelle Pfropfung (Insitio), da dieser Vorgang mit der gleichnamigen Übertragung abgeschnittener Reiser auf andere Bäume Verwandtschaft hat. Die Überpflanzung ist das ältere Verfahren, welches schon durch Dieffenbach zu einer ziemlich hohen Vollendung gebracht worden ist. In B. v. Langenbecks Gaumennaht (Uranoplastik) hat es 1862 eine seiner schönsten Früchte gezeitigt, da es nicht nur einen die Sprache schwer beeinträchtigenden Fehler in vielen Fällen vollkommen zu beseitigen erlaubt, sondern auch für die Heilung mancher ähnlicher Störungen vorbildlich geworden ist. Überdies ist sie durch Edmund Roses Erfindung der Operationen am hängenden Kopfe vom Jahre 1874 zahlreicher Unannehmlichkeiten und Gefahren entkleidet worden. In neuerer Zeit hat die Transplantation an den verschiedensten Körperteilen durch den im Jahre 1902 verstorbenen Karl Nicoladoni in Graz eine außerordentliche Förderung erfahren. Als besonders fruchtbar erwies sich auch die Müller-Königsche Methode zum Ersatze von Schädeldefekten. An sie schließen sich die osteoplastischen Aufmeißelungen eiternder Höhlen an, wie sie Küster für den Warzenfortsatz, die Stirnhöhle und die von Osteomyelitis befallenen Markhöhlen der langen Röhrenknochen empfohlen hat.
Wesentlich jünger ist die Pfropfung völlig getrennter Hautstücke, welche auf Grund einer aus Indien stammenden Anregung für den Nasenersatz zum ersten Male von dem Anatomen und Chirurgen Bünger in Marburg im Jahre 1818 am lebenden Menschen und mit teilweisem Erfolge versucht wurde.
Die wertvollste Fortbildung erhielt die Methode, als Jaques Reverdin in Genf im Jahre 1869 mit seiner Epidermispfropfung (Greffe épidermique) hervortrat, die von Karl Thiersch mit Hilfe der inzwischen ausgebildeten antiseptischen Behandlung im Jahre 1886 zu einer erheblich brauchbareren Hautpfropfung umgeformt wurde, welche es erlaubte umfangreiche Hautverluste durch eine größere Anzahl von fettlosen Hautstreifen schnell zu heilen. Daneben hatte Thiersch sich schon 1874 mit der Aufpflanzung großer Hautstücke beschäftigt, welche[83] von J. R. Wolfe ein Jahr später als eine neue Methode der Plastik beschrieben worden ist. Sie ist seit 1893 durch Fedor Krause vielfach verbessert und in hervorragendem Maße gefördert worden. Auch sind erfolgreiche Versuche angestellt, nicht nur stundenlang vom Körper getrennte und in Kochsalzlösung aufbewahrte größere Hautstücke, sondern auch ganz oder fast ganz abgelöste Körperteile sofort wieder zur Anheilung zu bringen. In neuester Zeit hat die Pfropfung von Knochenteilen, Elfenbein, Zelluloid in Knochendefekte eine besonders große Ausdehnung gewonnen.
Beide Gruppen der Plastik haben für den Ersatz von Gesichtsdefekten, insbesondere für die Wiederherstellung verloren gegangener Nasen eine immer wachsende Bedeutung bekommen; die Verschönerung des menschlichen Antlitzes hat sich fast zu einer besonderen Kunst entwickelt, für deren Ausübung sogar Spezialisten auf den Plan getreten sind. —
Alt wie die Plastik sind auch die Eingriffe an großen Gefäßen, teils zur Blutstillung, teils zur Beseitigung gewisser Erkrankungen, insbesondere der Aneurysmen. An die großen Venenstämme hat man sich freilich in älterer Zeit nicht leicht herangewagt, da man mit Recht die von dem Unterbindungsfaden ausgehende Eiterung und die Fortschwemmung des verunreinigten Blutpflockes fürchtete. Ist man doch in dieser Furcht so weit gegangen, bei zufälligen Verletzungen großer Venen nicht diese, sondern die daneben liegende Hauptschlagader des Gliedes behufs Blutstillung zu unterbinden, also einen damals noch recht gefährlichen Eingriff zur Bekämpfung einer kaum größeren Gefahr zu setzen (v. Langenbeck, 1861). Die antiseptische und aseptische Wundbehandlung hat diese Furcht verscheucht. Man scheut sich nicht mehr, die großen Venenlichtungen in Amputationswunden zu unterbinden, man ist von der zeitweiligen Abklemmung seitlicher Venenwunden (E. Küster, 1873) zur seitlichen Venenunterbindung (Schede, 1882) und zur seitlichen Venennaht übergegangen, man öffnet die Venen seitlich, um sie behufs Wegschaffung septischer Gerinnsel auf längere Strecken zu durchspülen (E. Küster) oder Neubildungsthromben aus ihnen herauszuziehen (v. Zöge-Manteuffel) und um sie nachträglich durch die Naht wiederum zu schließen. Als der kühnste dieser Eingriffe an Gefäßen, welche Venenblut führen, ist Friedrich Trendelenburgs Eröffnung der Arteria pulmonalis zur Beseitigung eines das Gefäß verschließenden Embolus vom Jahre 1908 anzusehen.
Auch die Schlagaderversorgung zur Bekämpfung von Blutungen und Aneurysmen hat durch die neue Wundbehandlung ein anderes Ansehen bekommen. So bewundernswert die Kühnheit älterer Chirurgen erscheint, welche ihre Unterbindungsfäden selbst an den tiefsten Abschnitt der Bauchaorta und an die dem Herzen nahen großen Gefäßstämme herantrieben, so wurde sie doch nur selten durch Erfolg belohnt, der meistens durch Nachblutungen und Wundkrankheiten vereitelt worden ist. Die neue Chirurgie kennt solche Gefahren kaum noch. Ohne Bedenken wird der umschnürende Faden in der unmittelbaren Nachbarschaft eines stärkeren Seitenastes angelegt; und in der seitlichen Naht der Schlagadern hat die Wundarzneikunst ein Hilfsmittel gewonnen, um die Unterbindung in solchen Fällen zu umgehen, in denen die schnelle Ausbildung eines Kollateralkreislaufes nicht gesichert erscheint. Selbst die Zusammenfügung völlig[84] quer durchtrennter Arterienstücke hat schon gewisse Erfolge aufzuweisen. Aber als die glänzendste Widerspiegelung des mit Kühnheit gepaarten Wissens und Könnens deutscher Chirurgie ist Ludwig Rehns im Jahre 1897 kundgemachte und glücklich verlaufene Herznaht nach Herzverwundung anzusehen, welche seitdem bereits eine erhebliche Anzahl von Menschen, die dem sicheren Tode verfallen schienen, dem Leben zurückzugeben vermocht hat. Hierher gehört auch Anton v. Eiselsbergs Naht der durch Stich verletzten Arteria pulmonalis vom Jahre 1909.
Zu den ältesten Teilen der Chirurgie zählt die Augenheilkunde, deren operative Technik schon im Altertume eine beachtenswerte Grundlage erhalten hatte. Die enge Verknüpfung beider Lehren, welche in Deutschland durch August Gottlieb Richter angebahnt worden war, wurde indessen gelöst, als mit der Errichtung eigener Professuren der Augenheilkunde in Frankreich und Österreich deren selbständige Entwicklung anerkannt und begünstigt worden war. In Deutschland geschah dies erst mit Albrecht v. Gräfes Ernennung zum außerordentlichen Professor der Augenheilkunde an der Berliner Universität im Jahre 1857; denn damit wurde die Trennung von der Chirurgie, mit der sie bisher in einer Hand vereinigt gewesen war, endgültig vollzogen. Aber so sehr auch v. Gräfe und seine Nachfolger ihre Wissenschaft in allen übrigen Fragen gefördert haben: der vollständige Ausbau der Technik und deren Beherrschung ist der Ophthalmologie erst gekommen, seitdem Antisepsis und Asepsis ihren schützenden Schild über den erkrankten Augen hielten. —
Noch deutlicher tritt dies bei einer zweiten Tochterwissenschaft der Chirurgie hervor. Die deutsche Ohrenheilkunde, welche auch für andere Völker vorbildlich geworden ist, wurde seit 1855 durch Anton Friedrich Freiherrn v. Tröltsch, der seit 1860 dies Lehrfach an der Universität Würzburg vertrat, einer Erneuerung und Vervollkommnung zugeführt, bei der nicht nur die physikalischen Untersuchungsmethoden sondern auch die Anatomie und später die pathologische Anatomie als Hilfswissenschaften herangezogen sind. Indessen der häufigsten und gefährlichsten Krankheit des Ohres gegenüber, der eitrigen Entzündung des Mittelohres, der Höhle des Warzenfortsatzes und dieses Knochenteiles selber, welche nicht nur das Gehörorgan, sondern oft auch das Leben bedroht, blieben die Bemühungen zunächst ziemlich machtlos. Denn auch die Wiederaufnahme älterer Behandlungsmethoden, wie des Stiches durch das Trommelfell und der operativen Eröffnung des Warzenfortsatzes, vermochte das Verhängnis nur ausnahmsweise aufzuhalten, weil wenigstens die letztgenannte Operation, die schon 1649 von dem französischen Anatomen Jean Riolan vorgeschlagen wurde, bis dahin in ganz ungeeigneter Weise zur Ausführung gekommen war. Selbst die von H. Schwartze im Jahre 1873 angegebene Trepanation des Warzenfortsatzes hat sich nicht dauernd zu behaupten gewußt, da sie mit einem unzweckmäßigen Werkzeuge ausgeführt jede Übersicht des Operationsfeldes und der Ausdehnung der Knochenerkrankung vermissen läßt. Erst mit dem chirurgischen Grundsatze der breiten und übersichtlichen Eröffnung des Warzenfortsatzes mittels Meißel und Hammer, welchen im Jahre 1889 zuerst Ernst Küster einführte, bald darauf auch Ernst v. Bergmann befürwortete, wurde eine leistungsfähige Operationsmethode geschaffen, die später zwar mehrfache Abänderungen erfuhr,[85] aber in ihren Grundzügen doch unverändert blieb. Da sie zweifellos den bei weitem häufigsten blutigen Eingriff in der Ohrenheilkunde darstellt, so ist sie unter der fleißigen Arbeit der Ohrenärzte zu einem hochbedeutsamen Hilfsmittel für die Erhaltung des Gehörorganes geworden.
Die Nasen-, Rachen- und Kehlkopfkrankheiten, die sich gleichfalls zu einer sehr wichtigen Sonderwissenschaft entwickelt haben, verdanken nicht minder ihren Aufschwung der Einführung der Antisepsis. Am deutlichsten tritt dies bei den Kehlkopfkrankheiten hervor, die im Jahre 1857 von Türck in Wien und bald darauf auch von Czermak durch Einführung des Kehlkopfspiegels erst einer sachgemäßen Beobachtung und Behandlung zugeführt und durch Viktor v. Bruns in Tübingen im Jahre 1862 mit der endolaryngealen Operationsmethode beschenkt, doch erst nach Einführung der Antisepsis ihre volle Bedeutung für die chirurgische Pathologie errangen. Denn auf Grund von Tierversuchen, welche sein Assistent Vinzenz Czerny im Jahre 1870 angestellt hatte, wagte Theodor Billroth 1873 die erste vollkommene Ausschälung des krebsig erkrankten Kehlkopfes am lebenden Menschen und erzielte vollkommenen Erfolg. Der Fall wurde auf dem III. Chirurgenkongreß von 1874 von Karl Gussenbauer besprochen und zugleich ein von ihm erdachter künstlicher Kehlkopf vorgelegt, mit dem der seines Stimmorgans beraubte Mann laut, wenn auch eintönig zu sprechen imstande war. Spätere Abänderungen dieses Ersatzes, an denen sich Paul Bruns, Julius Wolff u. a. beteiligten, haben ihn bis zu einer solchen Vollkommenheit gebracht, daß auch eine beschränkte Modulation der Stimme möglich geworden ist.
Auch damit hat man sich nicht begnügt. Schon Billroth nahm im Jahre 1878 nur den halben Kehlkopf fort und Heine hatte bereits 1874 die sogenannte Resektion des Stimmorgans in Vorschlag gebracht, um nur wirklich kranke Teile zu beseitigen und die lästige Prothese überflüssig zu machen. Um ihren Ausbau hat sich vor allen anderen Eugen Hahn in Berlin verdient gemacht. So ist es denn gelungen, die Sterblichkeit stark herabzumindern, einen Ersatz überflüssig zu machen und selbst die Stimme bis zu einem gewissen Grade zu erhalten[2]. Damit hat die deutsche Kehlkopfchirurgie voraussichtlich den Gipfel ihrer Leistungsfähigkeit erstiegen. Daß es ihr nicht vergönnt gewesen ist, diese in dem Trauerspiele von 1887/88 zu erweisen, welches sich mit dem Namen des Engländers Mackenzie, unseligen Angedenkens, verknüpft, während wir uns mit Stolz unseres wackeren Fritz v. Bramann erinnern dürfen, der durch einen Luftröhrenschnitt unter den denkbar schwierigsten Verhältnissen wenigstens die Erstickungsgefahr von dem hohen Dulder, dem Kronprinzen des Deutschen Reiches, abzuwenden wußte, wird noch heute jedem Vaterlandsfreunde das Herz schwer machen.
Schließlich möge noch erwähnt sein, daß die durch Gustav Killian[86] seit 1902 eingeführte und zu hoher Vollendung gebrachte Bronchoskopie, behufs Beseitigung von Fremdkörpern aus den tiefen Luftwegen, eine bewundernswerte Erweiterung der Technik auf dem Gebiete der Krankheiten der Atemorgane darstellt.
Die Gynaekologie hat gleichfalls ihre eigenen Wege eingeschlagen; aber auch bei ihr beginnt ein höherer Flug erst von dem Augenblick an, in welchem sie ein chirurgisches Gewand anlegte. Das geschah freilich schon längere Zeit vor dem Beginne der neuen Wundbehandlung; und diese Wendung ist nicht auf deutschem Boden zustande gekommen, sondern dem angelsächsischen Geiste zu danken.
Es war in einem einfachen Holzhause eines Städtchens im Staate Kentucky, wo der in England vorgebildete amerikanische Arzt Mac Dowell im Jahre 1809 zum erstenmal die Operation der Oophorektomie an einer Negerin mit Vorbedacht ausführte und vollen Erfolg erzielte. Sehr langsam verbreitete sich die Operation in Amerika und weiterhin in England, wo bis 1842 erst 10 glücklich verlaufene Fälle bekannt geworden waren. Früher als dort wurde aber der Eingriff in Deutschland gewagt, so von Chrysmar in Isny (Württemberg) bis 1820 bereits 3mal. Ausschlaggebend wurde indessen erst der chirurgisch ausgebildete Engländer Spencer Wells, der, seit 1858 seine Laufbahn beginnend, schon zur Zeit des Auftretens Listers Hunderte von Operationen hinter sich hatte. Ihm ist die schnelle Ausbreitung des Verfahrens mit dem Beginne der neuen Wundbehandlung über alle Länder der Erde zu verdanken; sie ist ein Gemeingut aller operierenden Frauenärzte geworden.
MacDowells bewußte Eröffnung der Bauchhöhle reizte zur Nachfolge auch auf dem Gebiete der sehr häufigen Neubildungen der Gebärmutter, soweit sie nicht von der Scheide her angreifbar waren. Nach zahlreichen, nur durch diagnostische Irrtümer veranlaßten und vielfach unglücklich verlaufenen Operationen in verschiedenen Ländern wagte zum erstenmale im Jahre 1853 der Amerikaner Kimball eine Wegnahme der durch Fibromyom vergrößerten Gebärmutter, welche glücklich ablief. Später haben, immer noch in vorantiseptischer Zeit, der elsässische Alemanne Köberlé in Straßburg, Péan in Paris und vor allen anderen der Amerikaner Marion Sims die Erkenntnis und Behandlung dieser Neubildungen gefördert, deren Operation nach Einführung der antiseptischen Behandlung ganz erheblich an Sicherheit gewann. Unter den deutschen Gynäkologen sind insbesondere Wilhelm Alexander Freund als Erfinder der Ausrottungsmethode einer krebsigen Gebärmutter, Billroth mit seiner vaginalen Gebärmutterausschälung und Karl Schröder als Bahnbrecher auf diesem Gebiete zu nennen. Die operative Gynäkologie ist seitdem eine wohl abgerundete Wissenschaft geworden, mit der Fachchirurgen sich nur noch ausnahmsweise beschäftigen. Sie hat auch die ihr nahestehende Geburtshilfe dahin beeinflußt, daß der natürliche Vorgang der Entbindung von einer, zu manchen Zeiten und an manchen Orten recht hohen Lebensgefahr befreit worden ist. —
Eine besonders glänzende Eroberung stellt die Chirurgie der Harnorgane dar. Allerdings war der Blasenschnitt zur Beseitigung von Steinen und anderen Fremdkörpern des Hohlorganes schon eine uralte Operation, der im 19. Jahrhundert die Steinzertrümmerung, die[87] Lithothrypsie, als leistungsfähige Gehilfin an die Seite trat. Sie war auf Grund einer von dem Salzburger Arzte Gruithuisen im Jahre 1813 ausgehenden Anregung zum erstenmal im Januar 1824 von Civiale in Paris am lebenden Menschen mit Erfolg ausgeführt worden. Aber den nachhaltigsten Aufschwung nahm die Lehre von den Krankheiten der Harnorgane erst von dem Zeitpunkte an, als auch die Erkrankungen der Niere, die bisher nahezu unbestritten in den Händen der inneren Mediziner gewesen waren, in weitem Umfange von der Chirurgie in Anspruch genommen wurden. Es war am 2. August 1869, als Gustav Simon in Heidelberg wegen einer Harnleiter-Bauchdeckenfistel zum erstenmal am lebenden Menschen eine Nierenausrottung unternahm und damit vollen Erfolg erzielte. Erst zwei Jahre später machte er eine zweite Operation gleicher Art, die aber durch pyämische Ansteckung zum Tode führte. Die an Simons Vorgehen sich knüpfende schnelle Entwicklung der Nierenchirurgie, welche in kaum 15 Jahren den größten Teil der Nierenkrankheiten zu einem erfolgreich bearbeiteten Ackerlande der Wundärzte machte, würde aber wohl kaum möglich gewesen sein ohne die in die gleiche Zeit fallende Anerkennung der Listerschen Wundbehandlung, welche die Nierenausschälung schnell über die Grenzen ihres Heimatlandes hinausführte. So konnte schon im Jahre 1885 der Engländer Henry Morris vom Middlesexhospital in London ein Lehrbuch der chirurgischen Nierenerkrankungen schreiben, welchem Beispiele 1886 der Franzose Brodeur und 1889 Le Dentu gefolgt sind. In Deutschland gab erst 1893 Paul Wagner in Leipzig die erste, noch in bescheidenem Umfange gehaltene Nierenchirurgie heraus, der von 1896 bis 1902 Ernst Küsters umfassende Chirurgie der Nieren und 1901 James Israels Chirurgische Klinik der Nierenkrankheiten nachfolgten. Die von Eugen Hahn im Jahre 1881 erdachte, sehr wertvolle Methode der Anheftung beweglicher Nieren verdient besondere Erwähnung. Seitdem ist die Nierenchirurgie in Deutschland unter der eifrigen Arbeit junger Kräfte, unter denen Arthur Barth mit seinen vortrefflichen pathologisch-anatomischen Studien hervorzuheben ist, zu einer nahezu selbständigen Wissenschaft geworden. Sie wurden dabei unterstützt durch die schnelle Entwicklung der Blasenbeleuchtung, welche von Christopher Heaths und Gustav Simons Methode der schnellen Erweiterung der weiblichen Harnröhre zu des letzteren frühesten Versuchen des Harnleiterkatheterismus dann zu Nitzes Kystoskop und nach dessen Vervollkommnung durch Einführung der Edisonschen Glühlämpchen bald zu einer sicheren Methode des Harnleiterkatheterismus führte, um dessen Technik sich vor allen Guyon in Paris und Leopold Casper in Berlin große Verdienste erworben haben. Die überaus wertvolle Erfindung hat die Erkenntnis der Nierenkrankheiten und die Sicherheit operativer Eingriffe durch die Möglichkeit der getrennten Harnuntersuchung beider Nieren aufs beste gefördert; ihr dauernder Aufschwung ist durch Gründung urologischer Gesellschaften und durch Schaffung einer umfangreichen Literatur in sichere Aussicht gestellt worden. Diese Entwicklung der Lehre von den Nierenkrankheiten ist natürlich auch den unteren Harnwegen, den Erkrankungen der Harnleiter, der Blase, der Prostata und der Harnröhre zugute gekommen. Die bis dahin wenig beachteten Geschwülste der Harnblase wurden 1884 von Ernst Küster in einer pathologisch-anatomischen[88] und klinischen Studie eingehend besprochen. Daran hat sich eine schnelle Entwicklung der operativen Behandlung geknüpft, in deren Verlaufe die Ausschälung der ganzen Harnblase und die Auslösung von Prostatageschwülsten glänzende Marksteine des erfolgreichen Fortschreitens auf dem eingeschlagenen Wege geworden sind. —
Als letzte Sippe dieser Gruppe von Erkrankungen seien die der Knochen und Gelenke genannt. Allerdings hat ihre Behandlung keineswegs eine so grundstürzende Veränderung erlitten, als die der vorangehend besprochenen Leiden; immerhin sind auch hier recht erhebliche Umformungen zu verzeichnen, die, soweit sie die Pathologie betreffen, schon früher erwähnt wurden; es erübrigt also nur, der Wandlung der Behandlung und ihrer Erfolge mit wenigen Worten zu gedenken.
Die Absetzung der Glieder innerhalb der Gelenke oder mit Durchsägung der Knochen gehört zwar zu den ältesten Operationen, hat aber über 2000 Jahre lang unter den Schwierigkeiten der Blutstillung und unter den Gefahren der Wundkrankheiten schwer zu leiden gehabt. Die Unbehilflichkeit gegenüber der Blutung hat jahrhundertelang die Wundärzte zu höchst grausamen Verfahren, oder zur Absetzung nur am Rande abgestorbener Gliedteile gezwungen, bis durch Ambroise Paré und den Italiener Maggi die seit dem Altertum völlig vergessene Gefäßunterbindung eine Neubelebung erfuhr. In Deutschland wurde durch Wilhelm Fabry aus Hilden bei Düsseldorf (Fabricius Hildanus) diese Lehre um die Wende des 16. zum 17. Jahrhundert zuerst auf Amputationen im lebenden Gewebe übertragen; er machte auch die erste Exartikulation im Kniegelenke. Die trotzdem sehr zögernde Entwicklung der Absetzungslehre hat erst seit Listers Wundbehandlung und Esmarchs elastischer Binde einen schnellen und glänzenden Aufschwung genommen. Er war bedingt durch die Beseitigung der beiden erwähnten Gefahren, womit die Sterblichkeit nach solchen Eingriffen, eine richtige Anzeige und fehlerlose Ausführung vorausgesetzt, fast auf den Nullpunkt herabgedrückt wurde. Hierdurch verschwanden zunächst die lange fortgeführten Streitigkeiten über den Wert der Exartikulation gegenüber der Amputation; vielmehr trat der Grundsatz in seine Rechte, den Stumpf so lang zu erhalten, als Verletzung oder Erkrankung es eben erlaubten. Ebenso verschwanden die Erörterungen über die beste Absetzungsmethode, da die beiden, aus anderen Gesichtspunkten erdachten Amputationsformen, der Ovalär- und der Zirkelschnitt, hinter dem Lappenschnitte zurücktreten mußten, der für die Anlegung einer Prothese, wenigstens am Beine, die günstigsten Verhältnisse schuf. So wurde es denn auch möglich, die Absetzung ohne Gefahr bis unmittelbar an den Stamm heranzuschieben, oder gar auf diesen noch übergreifen zu lassen. Die Auslösung des Beines im Hüftgelenke sowie die Auslösung des Armes zusammen mit dem ganzen Schultergürtel haben dadurch für den Wundarzt die Schrecken verloren, welche einst mit solchen Eingriffen wegen ihrer sehr hohen Sterblichkeit verbunden waren.
Endlich sind auch die Operationsmethoden für jeden einzelnen Gliedabschnitt so vielgestaltig geworden, daß sie sich bequem der Forderung auf Erhaltung eines möglichst langen und tragfähigen Stumpfes anpassen lassen. Unter ihnen sind drei, welche vollständig neue Gesichtspunkte in der operativen Behandlung zur Geltung brachten, nämlich Nikolas Pirogoffs[89] osteoplastische Amputation des Unterschenkels (1853), die in der Fußamputation nach Wladimirow-Mikulicz (1880) und in August Biers plastischer Bildung eines künstlichen Fußes (1892) eine weitere Ausgestaltung gefunden hat, Edmund Roses Exartikulation im Hüftgelenke mit kleinen Schnitten und kleinem Messer (1890), endlich Ernst Küsters osteoplastische Exartikulation im Fußgelenke (1896) als Ersatz der von Le Fort (Paris) angegebenen osteoplastischen Amputation. Sie erfüllt das Bestreben der Erhaltung einer möglichst langen Körperstütze in weitgehendster Weise. —
Der neueren Zeit gehören die Ausschneidungen der Gelenke, die Resektionen an, welche auf den Engländer Charles White 1768 zurückgeführt zu werden pflegen, obwohl dieser nachweislich nur das obere Ende der Oberarmdiaphyse fortgenommen hat. Die Lehre wurde aber erst bald nach der Mitte des 19. Jahrhunderts durch Bernhard v. Langenbeck und Ollier (Lyon) mächtig gefördert; insbesondere hat ersterer für lange Jahre geltende Operationsmethoden ausgebildet, die freilich bei der damals noch unbekannten Natur der fungös-tuberkulösen Gelenkerkrankungen manchen Mißerfolg nicht zu hindern vermochten. Die Gelenkresektionen haben in neuerer Zeit wesentliche Einschränkungen erfahren, da einerseits Gelenkwunden weniger gefährlich geworden sind, als sie es vordem waren, und da anderseits die tuberkulösen Gelenke, welche einst im 8. und 9. Jahrzehnt des vorigen Jahrhunderts im Übermaße der Operation unterworfen wurden, späterhin durch eine schonendere Behandlung, insbesondere mit Jodoformeinspritzungen, in großer Zahl zur Heilung gebracht werden. Dafür haben aber die Gelenkeröffnungen ohne und mit Knochenverletzung zur Beseitigung krankhafter Vorgänge in der Gelenkhöhle an Zahl ganz erheblich zugenommen. Die Resektion ist bei Kapselerkrankungen vielfach auf die Ausschälung der erkrankten Synovialhaut beschränkt, die Beweglichkeit versteifter Gelenke durch Einpflanzung von Muskel- oder Fettlappen zwischen die Gelenkenden gesichert worden.
Außerordentliche Fortschritte hat auch die Orthopädie gemacht. Ihre Glanzleistung ist die Heilung der angeborenen Hüftgelenkverrenkung, die um 1890 durch Hoffa zunächst mittels blutiger Operation angestrebt, später von Lorenz (Wien), seit 1896, durch unblutigen Eingriff zu einem für viele Fälle ungemein segensreichen Verfahren ausgebildet wurde. Auch die Verpflanzungen von Muskeln, Sehnen und Nerven zur Heilung von Lähmungen und Kontrakturen sind zu einer vielgeübten und sehr heilsamen Methode fortentwickelt worden.
Die zweite Gruppe umfaßt die Krankheiten solcher Organe und Organsysteme, welche vordem in noch kaum merkbarer Weise dem chirurgischen Messer zugänglich gemacht worden waren; die also erst durch die Antisepsis in den Kreis des chirurgischen Schaffens gezogen worden sind. Daß freilich die hier vorgenommene Trennung nicht ganz scharf sein kann, liegt auf der Hand.
Zu ihr gehört vor allen Dingen das Gebiet der serösen Körperhöhlen, von denen die Gelenkhöhlen bereits in der vorigen Gruppe[90] besprochen worden sind. Unter ihnen steht nach der Häufigkeit und der Wichtigkeit der an ihr vorzunehmenden Eingriffe die Bauchhöhle im Vordergrunde; denn erst durch die Listersche Wundbehandlung ist sie in ganzem Umfange und mit allen von ihr umschlossenen Organen für die operative Einwirkung frei geworden.
Zahlreiche und zum Teil schwere Verletzungen des Bauches hatten die Chirurgen schon längst darüber belehrt, daß das Bauchfell keineswegs so empfindlich sei, als man fast überall anzunehmen pflegte. Auch zeigten die seit Anfang des vorigen Jahrhunderts sich ausbreitenden Operationen an Eierstock und Gebärmutter, daß die kunstgerechte Eröffnung des Bauchfelles zwar gefährlich sei, aber doch in einer ansehnlichen Zahl von Fällen eine schnelle und dauernde Heilung nicht ausschließe. Trotzdem waren die Wundärzte noch jahrzehntelang von der Vorstellung beherrscht, daß die in die Bauchhöhle eintretende Luft als die Ursache der in ihr sich abspielenden Entzündungs- und Eiterungsvorgänge anzusehen sei. Diese Vorstellung kam erst zu Fall, als Georg Wegner auf dem V. Kongreß von 1876 die Ergebnisse einer ausgezeichneten Versuchsreihe an Tieren besprach, aus der hervorging, daß man die Bauchhöhle von Kaninchen bis zur trommelartigen Auftreibung in wochen- und monatelang fortgesetzter Wiederholung mit atmosphärischer Luft füllen könne, ohne die Tiere dadurch an Leben und Gesundheit zu gefährden. Zugleich wies er nach, daß die Hauptgefahr bei stundenlanger Eröffnung des Bauchraumes in der starken Wärmestrahlung der vom Bauchfelle überzogenen Körperteile, in der sehr erheblichen Herabsetzung der Körperwärme zu suchen sei. Auch machte er auf die unheilvolle Bedeutung von Flüssigkeitsansammlungen in der Bauchhöhle bei deren operativer Eröffnung, sowie auf die heilsame Wirkung einer frühzeitigen Ableitung solcher Ergüsse aufmerksam. Wegners Arbeit ist für die Chirurgie der Bauchhöhle ein bedeutungsvoller Markstein geworden; denn wenn auch angelsächsische Frauenärzte schon 15 Jahre zuvor begonnen hatten, die Gefahren der Abkühlung durch Erwärmung der Operationszimmer und entsprechende Bekleidung der Kranken, die Flüssigkeitsansammlungen im Bauche durch Einrichtung einer Ableitung nach der Scheide hin zu bekämpfen, so hat doch erst Wegner die wissenschaftliche Grundlage für jene Verfahren geschaffen, die seit 1878 durch den Aufschwung der Bakteriologie verstärkt und befestigt wurden.
Die Entwicklung der Bauchchirurgie drängt sich in wenige Jahrzehnte zusammen; ihre geschichtliche Übersicht dürfte daher am klarsten werden, wenn man sie nicht chronologisch, sondern topographisch betrachtet.
Zu den am frühesten in Angriff genommenen Organen der Bauchhöhle gehört die Milz. Während man sich aber in früheren Zeiten bis zum 16. Jahrhundert zurück mit der Ausrottung des durch eine Wunde vorgefallenen Organs begnügte, war der Rostocker Wundarzt Quittenbaum der erste, der im Jahre 1826 die erkrankte Milz in der Bauchhöhle aufzusuchen wagte. Ihm folgte 1855 Küchler in Darmstadt; doch verliefen beide Fälle unglücklich. Die erste glücklich verlaufene Milzausrottung gelang in demselben Jahre dem Amerikaner Volney-Dorsay, dem Péan im Jahre 1867 eine zweite Heilung hinzufügte. Die antiseptische Wundbehandlung hat die Zahlen glücklicher Heilung außerordentlich vermehrt, zugleich aber die Anzeigen für die Operation klarer zu stellen und damit deren Sicherheit ungemein zu erhöhen erlaubt.
Die Chirurgie der Leber hat schon mit der Operation der in[91] diesem Organe besonders häufigen Ansiedlungen des Hülsenwurms, von dem auf S. 79 die Rede gewesen ist, ihren Anfang genommen. Seitdem hat auch dieser Zweig der operativen Betätigung eine wesentliche Ausbreitung gewonnen, die aber mit den Erkrankungen der Gallenwege und ihrer Bekämpfung eng verknüpft ist.
Die Chirurgie der Gallenblase und der Gallengänge nimmt ihren Ausgang von der ersten erfolgreichen Ausrottung einer steinhaltigen Gallenblase, welche Karl Langenbuch, Leiter des Berliner Lazaruskrankenhauses, am 15. Juli 1882 unternahm. Die Versuche freilich mit der erkrankten Gallenblase sich abzufinden, sind wesentlich älter; doch wagte man vor dem Eingriffe nur an dem mit der Bauchwand verwachsenen oder zur Verwachsung gebrachten Hohlorgane und auch nur in Form der einfachen Eröffnung zur Entleerung der Steine. Den ersten planmäßigen Angriff auf die verwachsene Blase machte schon der Franzose Jean Louis Petit in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts; die erste erfolgreiche zweizeitige Operation zur Anlegung einer Gallenblasenfistel wurde, bereits unter dem Schutze der Antisepsis, von Franz König in Göttingen 1882 ausgeführt. Aber erst Langenbuchs Operation gab den Anstoß zu einem bisher ungeahnten Aufschwunge chirurgischer Behandlung des so überaus häufigen und gefährlichen Leidens, der freilich in stetem Kampfe mit den meisten Vertretern der inneren Medizin zustande kam. Seitdem ist die chirurgische Literatur über Erkrankungen der Gallenwege ungemein reichhaltig geworden. Die Geschichte der in Betracht kommenden Operationen wurde insbesondere durch Courvoisier in Basel gefördert, der als erster Langenbuchs Operation nachmachte. Unter der fast erdrückenden Zahl von Schriften, welche die Lehre von den Gallensteinerkrankungen und deren zweckmäßigste Bekämpfung gefördert haben, mögen nur die Arbeiten von Werner Körte in Berlin und von Kehr in Halberstadt, später in Berlin, als besonders umfassend und belehrend hervorgehoben werden.
Unter den Organen der Bauchhöhle, welche erst durch die antiseptische Behandlung dem wundärztlichen Messer zugänglich gemacht worden sind, ist zunächst die Bauchspeicheldrüse zu nennen. Von einer Chirurgie des Pankreas kann erst seit 1883 gesprochen werden, als Karl Gussenbauer, damals in Prag, auf dem XII. Kongreß seinen schönen Vortrag: „Zur operativen Behandlung der Pankreaszysten“ gehalten hatte. Mit großem Eifer wurde auch dies neue Gebiet sofort in Angriff genommen. Indessen blieb man bei der Behandlung der Zysten, welche als häufigste chirurgische Erkrankung in erster Linie die Aufmerksamkeit auf sich gezogen hatten, keineswegs stehen; vielmehr erfuhren Anatomie und Physiologie, sowie die gesamte Pathologie des tief verborgenen und doch so wichtigen Organes sehr erhebliche Förderungen. Als deren bedeutungsvollste sind seine Beziehungen zur Zuckerruhr und zur Fettgewebsnekrose anzusehen. In seinem im Jahre 1898 erschienenen und bisher unübertroffenen Werke: „Die chirurgischen Erkrankungen und Verletzungen des Pankreas“ faßte Werner Körte den damaligen Stand der Dinge zusammen, der seitdem wohl kleine Verschiebungen und Erweiterungen erfahren hat, aber doch auch heute noch als maßgebend angesehen werden muß.
Zu dem zweifellos wichtigsten Abschnitte der Chirurgie der Bauchhöhle[92] haben sich, schon wegen ihrer außerordentlichen Häufigkeit, die Erkrankungen des Magendarmkanals entwickelt. Allerdings hatten auch in vorantiseptischer Zeit die so häufigen Brucheinklemmungen, große Fremdkörper im Magen, Verwundungen durch Stich und Schuß, ausnahmsweise auch Neubildungen, die Wundärzte zur Eröffnung der Bauchhöhle gezwungen, ohne daß, mit Ausnahme der Lehre von den Brüchen, es zu festen Grundsätzen für die Behandlung des Verdauungskanals gekommen wäre.
Der besseren Übersicht wegen beginnen wir die Besprechung vom Magen an nach abwärts, obwohl hierbei nicht immer die geschichtliche Reihenfolge gewahrt werden kann.
Den Anstoß zur Entwicklung der neueren Magendarmchirurgie gab der geistvolle und ideenreiche Pfarrerssohn der Ostseeinsel Rügen, Theodor Billroth, der auf seiner wissenschaftlichen Wanderung vom Meer zum Gebirge das letzte Drittel seines fruchtbaren Lebens in dem von Waldbergen umkränzten herrlichen Wien zubrachte. Billroth, der Mann mit dem vornehmen Kopfe, aus dem kluge und zugleich unendlich gütige Augen hervorleuchteten, ist wohl als der glanzvollste Vertreter deutscher Chirurgie in der neueren Medizin anzusehen; denn obwohl er der Listerschen Wundbehandlung jahrelang Widerstand leistete, so war er doch später einer ihrer besten Förderer. Und mit ihrer Hilfe wußte er auf allen Gebieten der Wundarzneikunst dem Reichtum seiner Ideen in einer Weise Geltung zu verschaffen, in der er weder vorher noch nachher von einem seiner Fachgenossen erreicht worden ist. In Wien hatte er eine Schar von Schülern um sich gesammelt, die mit feurigem Eifer und ausgezeichnetem Verständnis sich den umfassenden Gedanken ihres Meisters anzupassen und deren Umsetzung in chirurgische Taten vorzubereiten wußte. So schuf er eine Schule, aus der eine erhebliche Zahl hervorragender Chirurgen Deutschlands und Österreichs hervorgegangen ist. Zwei derselben, Karl Gussenbauer und Alexander v. Winiwarter, legten durch eine im Februar 1874 begonnene und unter dem Titel: „Die partielle Magenresektion“ im Jahre 1876 veröffentlichte experimentelle Studie den Grundstein des Gebäudes, welches, zunächst zur Bekämpfung des Magenkrebses errichtet, inzwischen zu einer großzügigen Magenchirurgie erweitert worden ist. Genannte Tierversuche erfuhren sofort eine Ergänzung in Vinzenz Czernys Heidelberger Klinik, dessen Assistent F. Kaiser mit Erfolg die vollkommene Ausrottung des Hundemagens unternahm. Daraufhin machten Péan in Paris, 1879, und Rydygier im westpreußischen Kulm im gleichen Jahre die ersten Resektionen am menschlichen Magen, die indessen beide unglücklich verliefen. Da trat Billroth selber auf den Plan. Am 29. Januar 1881 führte er die erste erfolgreiche Magenresektion am lebenden Menschen aus, der freilich bald zwei Mißerfolge sich anreihten, wie Mikulicz auf dem X. Chirurgenkongreß berichten konnte. Aber der Beweis der Möglichkeit einer Heilung war geliefert und fortan gab es kein Halten mehr auf dem einmal betretenen Wege. Bald wurde die Operation Gemeingut aller Fachchirurgen; und wenn auch ihre Endergebnisse, entsprechend der verderblichen Natur der Krankheit, gegen welche sie sich richtete, noch nicht in jeder Hinsicht befriedigend sind, so steht doch die Tatsache der Heilbarkeit eines so entsetzlichen Leidens durch chirurgische Hilfe nunmehr unerschütterlich fest. Der Ausbau des Verfahrens hat niemals einen Stillstand erlebt; selbst die Ausrottung des ganzen Magens ist mit[93] vollem Erfolge versucht und zu Ende geführt worden. Unter den zahlreichen Methoden aber, welche zur Bekämpfung der verschiedensten Magenleiden erdacht sind, hat sich die operative Verbindung zwischen Magen und Darm, die Gastroenterostomie, zu einem wenig gefährlichen, bei Krebs hinhaltenden, bei nicht krebsigen Erkrankungen meist zu dauernder Heilung führenden Eingriffe emporgearbeitet.
Lange vor diesem Aufblühen einer Magenchirurgie und nahezu 40 Jahre vor der ersten praktischen Verwertung der Listerschen Wundbehandlung hatte sich chirurgische Kühnheit bereits an die operative Behandlung der Darmkrebse herangewagt. Im Jahre 1833 machte Reybard in Lyon die erste, von Erfolg gekrönte Dickdarmresektion, deren Beschreibung erst 1844 der Pariser Académie de Médecine eingesandt wurde, unter gleichzeitiger Beifügung der Beschreibung von Darmresektionen bei Tieren. Der geheilte Kranke war 10½ Monate später an der Wiederkehr seines krebsigen Grundleidens gestorben. Trotz der vorläufigen Heilung hat aber Reybards kühnes Vorgehen zunächst keine Nachahmung gefunden; denn die schlimmen Zustände in den Krankenräumen damaliger Zeit, wie sie auf S. 15 und 16 geschildert worden sind, stempelten das Unternehmen zu einem so kühnen Wagnis, daß selbst der überzeugteste Wundarzt einer solchen Gefahr sich und seinen Kranken auszusetzen sich scheuen mußte. Hat doch Reybard selber seine erfolgreiche Operation nicht wiederholt; sie ist daher fast unbekannt geblieben, hat auch auf die spätere Entwicklung der Dinge keinen Einfluß ausgeübt.
Der neue Anstoß ging wiederum von der Billrothschen Schule aus. Die oben erwähnte, auf Tierversuche gestützte Studie über Magenresektion hatte noch nicht praktische Verwertung gefunden, als Karl Gussenbauer, der willensstarke, kluge und gelehrte Sohn des oberkärntnerischen Hochgebirges, damals Professor in Lüttich, sich im Dezember 1877, ohne Kenntnis der Reybardschen Operation, zu einer Übertragung seiner Versuche auf einen Fall von Dickdarmkrebs entschloß. Die erste, unter antiseptischen Vorsichtsmaßregeln unternommene Dickdarmresektion endete zwar schon nach 15 Stunden mit einer schnell verlaufenden Bauchfellsepsis; aber dennoch gab sie der Darmchirurgie einen mächtigen Antrieb. Die bis dahin nur selten und widerwillig gemachte Eröffnung des absteigenden Dickdarmes wegen Verschlusses in den noch tiefer gelegenen Darmabschnitten wurde schnell auch auf den Dünndarm übertragen (v. Langenbeck, 1878), die Darmresektionen auch zur Beseitigung brandiger Darmstücke nach Einklemmungen benutzt (Ernst Küster, 1878), die Ausschneidung und Naht von Dünndarmstücken zur Heilung des widernatürlichen Afters, mittels der von Max Schede im gleichen Jahre benutzten Methode der zeitweiligen Lagerung der genähten Darmschlingen außerhalb des Bauches, einem hohen Grade von Sicherheit zugeführt. Ganz erheblich wurde diese aber noch erhöht durch Vinzenz Czernys doppelreihige Darmnaht von 1880, die seitdem die beherrschende Methode für alle Darmoperationen geblieben ist; ferner durch Karl Gussenbauers Achternaht und die von Otto Madelung, 1881, vorgeschlagenen Verbesserungen. Erst an diese hat sich die Methode der Ausschaltung von Darmteilen ohne Ausschneidung geknüpft, welche die Umgehung verengerter Darmabschnitte durch Herstellung von Nebenleitungen gestattet. Alles das hat die Sicherheit der Technik auch nach der Richtung hin entwickelt und erhöht, daß der Wundarzt, welcher die Bauchhöhle öffnet, selbst unerwarteten[94] Befunden gegenüber stets gewappnet ist. So sind die Knickungen, Achsendrehungen, Einstülpungen und inneren Einklemmungen des Darmes nicht nur in ihren pathologischen Verhältnissen ganz erheblich geklärt und in ihrer Erkenntnis gefördert worden, sondern auch ihre chirurgische Bekämpfung ist bis zu einem hohen Grade der Vollkommenheit gediehen.
Die außerhalb des Bauchfells gelegenen unteren Abschnitte des Darmkanals waren schon seit Lisfranc, 1830, einer erfolgreichen Behandlungsmethode zugeführt worden. Dagegen blieben die oberen Teile des Mastdarmes und des S Romanum, sowie die unteren Teile des absteigenden Dickdarmes noch nach Einführung der antiseptischen Behandlung längere Jahre fast unantastbar. In Paul Kraskes (Freiburg i. B.) Operationsmethode hochsitzender Mastdarmkrebse vermittels Wegnahme der unteren Abschnitte des Kreuzbeins vom Jahre 1885 wurde aber ein Verfahren geschaffen, in dessen weiterer Ausbildung nicht nur der ganze Mastdarm, sondern auch die darüber gelegenen Darmteile dem chirurgischen Messer zugängig gemacht worden sind, zuweilen freilich erst nach gleichzeitiger Eröffnung der Bauchhöhle von der Vorderseite her. So ist denn der Darm in seiner ganzen Länge ein Feld für chirurgische Eingriffe aller Art geworden. —
Eine besondere Berücksichtigung erfordern zwei Krankheiten des Darmkanals, weil die von ihnen erzeugte Operationswelle im Laufe der letzten Jahrzehnte alle anderen an Zahl überflutet und zeitweilig etwas beiseite gespült hat: die Operationen am Wurmfortsatze und an den freien Brüchen.
Die Entzündung am Wurmfortsatze, die Epityphlitis, wie wir sie im Gegensatze zu der häßlichen amerikanischen, aber durch unsere Hauptschriftsteller leider auch in die deutsche Literatur eingeführten Wortbildung „Appendicitis“ nennen, ist in ihrer verhängnisvollen Bedeutung für den Bauchraum erst vor kaum 30 Jahren vollständig erkannt worden. Bis dahin hatte weder die pathologische Anatomie, noch die innere Medizin, deren Vertreter bis gegen Ende der achtziger Jahre fast ausschließlich die Behandlung leiteten, die Frage wesentlich gefördert; erst mit dem vollen Eintreten der antiseptischen und aseptischen Chirurgie ist sie nicht nur nach der pathologisch-anatomischen, sondern auch nach der Seite der Behandlung in dem Maße geklärt worden, daß gegenwärtig die Abtragung des Wurmfortsatzes zu den häufigsten Operationen eines beschäftigten Chirurgen gehört, von denen manche schon über eine Erfahrung von vielen Tausenden von Eingriffen verfügen können.
Die schon im Altertum bekannte Krankheit wurde durch Morgagni und Boerhave auf eine Kotstauung im Dickdarme bezogen und deshalb allgemein als Typhlitis stercoralis bezeichnet. Der Heidelberger Professor der inneren Medizin Puchelt führte im Jahre 1829 den Namen Perityphlitis ein, der seitdem neben der Typhlitis stercoralis in Gebrauch kam; letztere, als Name für eine bestimmte pathologische Vorstellung, ist im wesentlichen erst durch Sahli, den Direktor der inneren Klinik in Bern, im Jahre 1895 zu Fall gebracht worden. — Die Chirurgen haben sich, natürlich langsam und zögernd, erst im achten Jahrzehnt unter dem Schutze der Antisepsis wenigstens an die Eröffnung der in der Leistengrube entstehenden Eiteransammlungen herangewagt, dabei gelegentlich auch einen durchgebrochenen Kotstein ausgezogen. Trotzdem rückte die Entwicklung der Frage nur sehr langsam voran. Einen neuen Anstoß gaben die Vorträge, welche[95] Johann Mikulicz, damals in Krakau, bei Gelegenheit der Naturforscherversammlung zu Magdeburg (1885) und in demselben Jahre Rudolf Ulrich Krönlein in Zürich über die Eröffnung des Bauches bei eitrigen Bauchfellentzündungen hielten. Damit war der weitere Schritt, die Aufsuchung und Abtragung des erkrankten Wurmfortsatzes, aufs beste vorbereitet. Es ist nicht mehr mit Sicherheit festzustellen, ob Krönlein recht hat, wenn er sich die erste, mit Bewußtsein und Überlegung ausgeführte Operation dieser Art zuschreibt; aber sicher ist, daß verschiedene Wundärzte unabhängig voneinander zu dem gleichen Ergebnis gekommen sind. Das Hauptverdienst gebührt indessen unzweifelhaft Eduard Sonnenburg in Berlin, der seit der zweiten Hälfte des neunten Jahrzehntes kühn und bewußt diesem Ziele zusteuerte und der im Jahre 1894 die erste zusammenfassende Arbeit über den Gegenstand erscheinen ließ. Seitdem ist eine nahezu erdrückende Literatur über Epityphlitis und ihre operative Behandlung entstanden, die von Otto Sprengel in Braunschweig 1906 in einer inhaltsvollen, kritischen und an eigenen Erfahrungen reichen Arbeit, freilich unter dem leidigen Titel „Appendicitis“, zusammengefaßt worden ist. Um die Jahrhundertwende herum widerhallten die Mauern des alten Langenbeckhauses immer von neuem von erregten Erörterungen über den gleichen Gegenstand; unter den Wortführern mögen, außer den schon Genannten, noch Hermann Kümmell (Hamburg), Theodor Kocher (Bern) und der französische Schweizer Roux (Lausanne) genannt werden, abgesehen von den zahllosen Männern, die gleichfalls ihr mehr oder weniger erhebliches Scherflein zur Klärung der Frage beigetragen haben und unter denen auch andere Völker, Franzosen, Angelsachsen, Skandinavier usw., reichlich vertreten sind. Als Ergebnis all des heißen Bemühens sind folgende zwei Grundsätze festgestellt worden: 1. die akuten, zur Eiterung neigenden Erkrankungen sollen rechtzeitig, d. h. so früh wie möglich der Operation unterzogen werden; 2. die chronischen, milde verlaufenden Fälle können zunächst abwartend behandelt, müssen aber bei Wiederholung der Symptome ebenfalls, am besten im entzündungs- und schmerzfreien Intervall, operiert werden.
Damit ist die Behandlung der Epityphlitis im wesentlichen in die Hände des Wundarztes gelegt worden. Die Operation wird heutigentags über die ganze Erde hinweg alljährlich in vielen Tausenden von Fällen mit dem besten Erfolge geübt; sie gehört schon ihrer Zahl nach zu den wichtigsten Eroberungen der neueren Chirurgie.
Hatten wir es bei der Epityphlitis mit einer Erkrankung zu tun, zu deren Bekämpfung das chirurgische Messer erst vor einer kurzen Zeitspanne seine Wirksamkeit entfaltet hat, so geht die operative Behandlung der freien Brüche bereits weit in das Altertum zurück; denn schon zur Zeit der klassischen Höchstblüte griechischer Medizin scheint es handwerksmäßig gebildete und zu einer Körperschaft zusammengeschlossene Bruchschneider gegeben zu haben. Herumziehende Schneidekünstler machten während des ganzen Mittelalters Städte und Dörfer, zumal die Märkte und Messen unsicher; daß dabei aber keinerlei Förderung auch nur der gröbsten pathologisch-anatomischen Anschauungen herauskam, beweist schon die noch heute übliche Bezeichnung der Krankheit als Bruch (Ruptura), da man sie bis auf Matthäus Gottfried Purmann gegen Ende des 17. Jahrhunderts durch Zerreißung des[96] Bauchfells entstehen ließ. Die pathologische Anatomie und das Studium der Bruchpforten sind erst seit den Arbeiten des Franzosen Jules Cloquet 1819 zu ihrem Rechte gekommen, unter den Deutschen insbesondere durch Wilhelm Roser sehr gefördert worden, hauptsächlich allerdings immer nur im Hinblick auf eingeklemmte Brüche, während man die freien Brüche seit Erfindung der Bruchbänder nicht mehr anzugreifen wagte. Indessen begannen neue Bestrebungen in der Richtung der sogenannten Radikalheilung schon in vorantiseptischer Zeit, in Deutschland mit Franz Christoph v. Rothmund in München um 1843, die aber erst durch Otto Risel in Breslau im Jahre 1871 mit dem gleichzeitigen Aufkommen der Listerschen Wundbehandlung eine nachhaltige Förderung erhielten. Bald darauf operierte auch v. Nußbaum (München) in der Art, daß er den befreiten Bruchsack unterband und abschnitt. Weitere Förderungen brachte Vinzenz Czerny von 1877 an, der durch seine innere Naht bei angeborenen Leistenbrüchen einen neuen Grundsatz in die Operation einführte. In der Deutschen Gesellschaft für Chirurgie wurde der Gegenstand zuerst auf dem Kongreß von 1879 durch August Socin in Basel besprochen; er betonte die Notwendigkeit, auch eingeklemmte Brüche radikal zu operieren, was übrigens von anderen Chirurgen schon mehrfach geschehen war. Bemerkenswert ist die Äußerung des damaligen Vorsitzenden Bernhard v. Langenbeck, daß er an die Auffindung einer sicheren Methode zur dauernden Beseitigung eines Bruchleidens nicht zu glauben vermöge.
Darin hat sich der Altmeister deutscher Chirurgie glücklicherweise getäuscht. Von Jahr zu Jahr sind seitdem die endgültigen Ergebnisse besser und die Methoden sind so zahlreich geworden, daß auch die schwierigsten Bruchformen noch eine Heilung erhoffen lassen. Wenn unter letzteren hier und da noch Mißerfolge unterlaufen, so sind dafür die Brüche mit engerem Bruchhalse der dauernden Heilung fast mit voller Sicherheit zuführbar; und ein Mißerfolg bedeutet heute um so weniger, als die Ungefährlichkeit des Eingriffes immer wieder neue und bessere Versuche zuläßt. So ist die Radikaloperation der Brüche ein überaus häufiges Verfahren geworden und die lästigen Bruchbänder, einst eine Haupteinnahmequelle für die Händler, sind, wenn auch noch nicht gerade im Verschwinden begriffen, doch unendlich viel seltener geworden. —
Auch die Chirurgie der Brusthöhle mit ihrem Inhalte, insbesondere ihren drei serösen Höhlen, hat seit 40 Jahren einen gewaltigen Aufstieg genommen. Herz und Herzbeutel sind bereits besprochen worden; es erübrigt also nur, der Wandlungen in der Behandlung des Brustfells und der Lunge mit einigen Worten zu gedenken.
Unter den Erkrankungen der Brusthöhle hat am frühesten die Entzündung des Brustfells, zumal deren eitrige Form, das Empyem, chirurgische Hilfe herausgefordert. Indessen ist die in der Hippokratischen Schrift: „De morbis“ genau beschriebene blutige Eröffnung der Eiteransammlung mittels des Messers späterhin gänzlich vergessen gewesen. Erst der kluge und vielseitige Schwabe Wilhelm Roser in Marburg hat die Operation in Form der Resektion einer Rippe im Jahre 1859 empfohlen und im Jahr 1865 zum erstenmal am lebenden Menschen ausgeführt. Seitdem ist der Eingriff auch von anderen Chirurgen wiederholt[97] gemacht worden. Einen bescheidenen Anteil an der Weiterentwicklung glaubt auch der Verfasser in Anspruch nehmen zu dürfen, da er bei der seit 1873 von ihm geübten Operation nicht nur den neuen Grundsatz der systematischen Aufsuchung des tiefsten Punktes der eiternden Höhle zur Anwendung brachte, sondern auch für den Eingriff auf das wärmste zu einer Zeit sich einlegte, als die Vertreter der inneren Medizin sich noch vollkommen ablehnend verhielten. Mit Bewußtsein hat er auch zuerst Empyeme auf tuberkulöser Grundlage operativ angegriffen. Die späteren Methoden von Franz König, Wilhelm Baum und anderen Chirurgen befolgen genannten Grundsatz nicht, nötigen daher den Kranken zu langer Rückenlage. Auch das Verfahren der Resektion mehrerer Rippen zur Heilung alter Empyeme und Brustfisteln, welches von dem Schweden Estlander in Helsingfors 1879 veröffentlicht wurde, ist von Ernst Küster schon 1877 beschrieben, späterhin von Max Schede in besonders kühner Weise ausgebaut worden. Der Grundsatz einer frühzeitigen und zweckmäßigen Eröffnung der Brusthöhle hat glücklicherweise solche Zustände selten gemacht.
Das Verfahren der Rippenresektion erzielte auch bei Hülsenwurmerkrankungen des Brustfells und der Lunge, selbst des oberen Leberumfanges, ausgezeichnete Ergebnisse.
Die eigentliche Lungenchirurgie aber hat erst durch zwei Erfindungen einen hohen Aufschwung genommen, welche das Zusammenfallen der Lunge nach Eröffnung des Brustfellraumes verhindern und daher das ungestörte Weiteratmen erlauben. Auf dem Chirurgenkongreß von 1904 veröffentlichte Sauerbruch, damals Assistent an der Klinik Johann v. Mikulicz' in Breslau, seine Studien über Über- und Unterdruck an den Atemorganen und zeigte zugleich seine pneumatische Kammer vor, in welcher der Kranke unter der Wirkung eines Unterdruckes operiert werden konnte. Im Anschluß daran führte Brauer (Marburg) einen für den Wundarzt wesentlich bequemeren Apparat vor, der die Lungen des zu operierenden Kranken unter Überdruck setzte. Beide Methoden haben sich als brauchbar erwiesen, und mit ihrer Hilfe ist es gelungen eine der wesentlichsten Gefahren bei Eingriffen am Brustkorbe, das Zusammenfallen einer oder gar beider Lungen nach Eröffnung des gesunden Brustfells, auszuschalten. Seitdem sind Verwundungen und Erkrankungen des Herzens und der von ihm ausgehenden großen Gefäße, große Geschwülste am Brustkorbe, deren Beseitigung nicht ohne Eröffnung des Brustfellraumes geschehen kann, Lungenabszesse, Neubildungen und Hülsenwürmer der Lunge, selbst die auf einen Lappen oder gar die auf einen Lungenflügel beschränkte Tuberkulose (Friedrich) mit immer steigendem Erfolge operativen Eingriffen unterzogen worden. Auch die von Vinzenz Czerny auf Grund vorausgeschickter Tierversuche im Jahre 1877 zuerst mit glücklichem Erfolge am Menschen geübte Resektion der Speiseröhre erhielt damit einen neuen Anstoß zu befriedigender Entwicklung, die heutigentags durch kühne plastische Operationen an der Speiseröhre (v. Hacker) eine besondere Förderung erfahren hat. —
Die wechselseitigen Beziehungen zwischen innerer Medizin und Chirurgie, die sich seit dem Beginne der Listerschen Wundbehandlung angebahnt und nach beiden Seiten zu großartigen Erfolgen geführt hatten, zeigen sich im glänzendsten Lichte in der Entwicklung der Krankheiten des[98] Zentralnervensystems, wie des Nervensystems überhaupt. Sie haben erst den Aufbau einer Nervenchirurgie möglich gemacht, die an Kühnheit und Großartigkeit der Leistungen alle anderen Zweige der neueren Chirurgie mindestens erreicht, sie vielfach sogar übertrifft.
Von einer Chirurgie des Schädelinneren, insbesondere des Gehirns, kann, abgesehen von den so häufigen Kopfverletzungen, bei denen der Wundarzt auch dem Gehirn näher zu treten gezwungen war, bis zum Anfange des neunten Jahrzehnts des 19. Jahrhunderts kaum gesprochen werden. Immerhin hatte aber die antiseptische Wundbehandlung die Wirkung gehabt, daß die uralte Operation der Trepanation, im Laufe der Jahrhunderte zeitweilig übertrieben, dann wieder fast vergessen oder wenigstens mit berechtigtem Mißtrauen angesehen, von neuem aufgenommen wurde und bald genug ihre Schrecken vollkommen verlor. Die unbegrenzte Zugängigkeit zum Gehirn wurde aber erst im Jahre 1889 geschaffen, als der hochbegabte Hesse Wilhelm Wagner, damals Chirurg in Königshütte (Oberschlesien), seine temporäre Resektion des Schädeldaches veröffentlichte. Sie war durch Versuche an Tieren, wie sie lange zuvor Julius Wolff in Berlin anstellte, vorbereitet worden, ohne daß Wagner davon Kenntnis hatte.
Der erste Anstoß zur Erweiterung der Gehirnchirurgie erfolgte aber schon früher und zwar von medizinischer Seite. Fritsch und Hitzig schufen im Jahre 1870 die Lokalisationslehre der Hirnrinde und im Anschluß an sie erörterte Karl Wernicke, damals Privatdozent für Neuropathologie in Berlin, 1881 zum erstenmal die Möglichkeit, eine Neubildung des Gehirns durch operativen Eingriff zu beseitigen. Die erste Verwirklichung dieses Gedankens aber geschah durch die Engländer Bennet und Godlee (1885), allerdings mit unglücklichem Ausgange. Mit besserem Erfolge nahm Victor Horsley in London die Operation wieder auf und wußte ihr in kurzer Zeit allgemeine Anerkennung zu verschaffen. In Deutschland war zwar der Aufschwung etwas langsamer, entwickelte sich aber unter Hugo Oppenheims Gehirnforschungen und Ernst v. Bergmanns tatkräftigem Eintreten für die Gehirnchirurgie schon im letzten Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts zu hoher Blüte. In neuester Zeit ist sie am nachhaltigsten durch Fedor Krause gefördert worden, der in seiner „Chirurgie des Gehirns und Rückenmarks“, sowie in seinem Lehrbuche der chirurgischen Operationen 1914 eine ausgezeichnete Darstellung der chirurgischen Gehirnerkrankungen und der durch sie nötig werdenden Eingriffe am Gehirn gegeben hat. Er ist auch der Schöpfer einer zuverlässigen Methode zur Ausrottung des Gasserschen Nervenknotens bei schweren Neuralgien im Gebiete des Nervus trigeminus geworden. Lothar Heidenhains Umstechungsmethode der Kopfhaut hat, in Verbindung mit H. Brauns Suprarenin, den Blutverlust bei Schädel- und Gehirnoperationen wirksam zu beschränken gewußt. Unter den besten Förderern der Gehirnchirurgie müssen aber auch R. U. Krönlein in Zürich und Theodor Kocher in Bern genannt werden.
Etwas später erfolgte die Entwicklung der Chirurgie des Rückenmarkes. Auch hier kam der erste Anstoß von einem inneren Mediziner, indem Ernst Leyden, damals in Straßburg, schon im Jahre 1874 die am Rückenmarke auftretenden Geschwülste den Chirurgen zu überweisen empfahl. Der erste Wundarzt, welcher auf den Plan trat, war[99] wiederum der Engländer Horsley, der im Vereine mit Gowers im Jahre 1887 die erste erfolgreiche Ausrottung einer das Rückenmark beengenden Geschwulst der harten Rückenmarkshaut unternahm. Die hierzu nötige Voroperation, die Resektion einiger Wirbelbögen oder die Laminektomie, wie sie mit einem erbärmlich gebildeten Worte bezeichnet zu werden pflegt, gab auch für andere Krankheiten im Bereiche der Wirbelsäule und ihres Inhaltes dem Chirurgen eine wirksame Waffe in die Hand, mit der er in immer steigendem Maße Erfolge zu erzielen verstanden hat.
Früher als mit dem Zentralnervensysteme hat sich die Chirurgie mit den Erkrankungen der peripheren Nerven abgegeben. Indessen neben den erwähnten Großtaten erscheinen die Arbeiten in diesem Gebiete doch nur als Kleinwerk, obwohl auch hier mancher fruchtbare Gedanke in die Tat umgesetzt worden ist.
Zu den chirurgischen Großtaten der letzten Jahrzehnte ist auch der Ausbau der Pathologie und Behandlung der Schild- und Thymusdrüse zu rechnen, um so mehr, als bei ihnen die Kenntnis der Physiologie dieser Organe ursprünglich fast vollkommen versagte. Die Chirurgie hat hier die doppelte Aufgabe übernommen, nicht nur diese Lücke auszufüllen, sondern auch die an jenen Drüsen ohne Ausführungsgang auftretenden Erkrankungen mehr oder weniger unschädlich zu machen; sie ist in erstgenannter Aufgabe von Physiologen und inneren Medizinern aufs kräftigste unterstützt worden.
Unter dem Namen Kropf, Struma, hat man schon seit dem Altertum sehr verschiedenartige Schwellungen der Schilddrüse zusammengefaßt, die teils durch Druck auf die Luftröhre Gesundheit und Leben gefährden, teils das Äußere des Trägers als unangenehmer Schönheitsfehler beeinträchtigen. Beide Gründe haben bereits im 18. Jahrhundert das Messer des Chirurgen in Bewegung gesetzt; allein infolge der kaum zu beherrschenden Blutung wirkten doch diese Operationen so abschreckend, daß sie fast hundert Jahre lang nicht mehr vorgenommen worden sind. Erst Rudolf Virchows ausgezeichnete Besprechung der pathologischen Anatomie der Schilddrüsengeschwülste vom Jahre 1863 (Krankhafte Geschwülste, III) hat den Chirurgen wieder Mut gemacht, sich mit der Behandlung der Kröpfe abzugeben, zunächst freilich nur mit Operationen, wie Eröffnung oberflächlich gelegener Zysten, Jodeinspritzungen in die Geschwulst, Gefäßunterbindungen, welche heute als überwunden zu betrachten sind. Dafür hat man sich mit der Einführung der Antisepsis im achten Jahrzehnt an die Ausrottung der ganzen, oder eines Teiles der Drüse, oder einzelner Knoten herangemacht; und mit der damit herbeigeführten Gelegenheit zu Untersuchungen frischer Kröpfe wuchs auch die bessere Kenntnis der physiologischen und pathologischen Vorgänge. Anton Wölfler, damals Assistent an Billroths Klinik in Wien, förderte seit 1878 die Kenntnis vom Bau und der Entwicklung der Schilddrüse und stellte ein System der in der Drüse vorkommenden Geschwulstbildungen auf, welches im wesentlichen noch heute unseren Kenntnissen als Grundlage dient. Ein anderer Schüler Billroths, Anton Freiherr v. Eiselsberg, hat sich in neuester Zeit ganz besonders um die Physiologie und Pathologie der Schilddrüse verdient gemacht. Die Hauptergebnisse der von allen Seiten in Angriff genommenen Forschungen[100] sind folgende: die Kenntnis der Ausfallserscheinungen bei Verlust der ganzen Schilddrüse (Cachexia strumipriva) nach J. Reverdin in Genf und Theodor Kocher in Bern; die damit in Zusammenhang stehende Jod- und Organotherapie; die Kenntnis der Nebenkröpfe und der Nebenschilddrüsen, sowie der mit ihrem Ausfall verknüpften Tetanie; die Aufklärung der physiologischen Bedeutung der Drüse, sowie des Myxödems und des Kretinismus; endlich die bessere Kenntnis der Entstehungsursachen der Krankheit. In letztgenannter Beziehung bleibt allerdings noch am meisten zu wünschen übrig. — Inzwischen hat auch die Technik eine so vollkommene Entwicklung erfahren, daß die Kropfoperationen nahezu ungefährlich geworden sind und einen überaus häufig geübten Eingriff darstellen.
Die Fortschritte auf dem Gebiete der Schilddrüsenerkrankungen knüpfen sich, außer den schon genannten, an die Namen: Albert Lücke (Straßburg), Edmund Rose (Berlin) und August Socin (Basel). Aber auch zahlreiche andere Schriftsteller haben höchst dankenswerte Anregungen gegeben.
Der von dem Merseburger Arzte Karl v. Basedow im Jahre 1840 beschriebene Symptomenkomplex, in welchem die Veränderungen der Schilddrüse eine große, wahrscheinlich die entscheidende Rolle spielen, ist im Jahre 1880 zuerst durch den Pariser Chirurgen Tillaux der operativen Chirurgie gewonnen worden. Ludwig Rehn in Frankfurt war der erste deutsche Chirurg, der über Heilungen auf operativem Wege zu berichten wußte; weitere Förderungen brachten Johann v. Mikulicz, Theodor Kocher, R. U. Krönlein, Friedrich Trendelenburg u. a. Die Behandlung der Basedowschen Krankheit ist vorerst noch ein Grenzgebiet geblieben; doch neigen sich die Ansichten mehr und mehr dahin, die teilweise Ausschälung der Schilddrüse wenigstens in allen solchen Fällen als das zuverlässigste Verfahren zu betrachten, in welchen eine andere Behandlung versagt hat. Weitere Fortschritte sind erst nach völliger Aufklärung der Schilddrüsenfunktion zu erwarten.
Noch eine andere Drüse, die mit der Schilddrüse in einem bestimmten Zusammenhang zu stehen scheint, deren Erkrankung man neuerdings sogar die Hauptveranlassung zu den Basedowschen Erscheinungen beilegen möchte, die Thymusdrüse, ist 1906 durch Ludwig Rehn behufs Heilung der durch ihre Vergrößerung veranlaßten Verengung der Luftröhre chirurgischen Eingriffen zugeführt worden.
Auch hat sich an einer dritten, bisher in gänzlicher Verborgenheit lebenden Drüse eine Chirurgie der Hypophysis cerebri entwickelt, seitdem Otto Madelung auf dem Kongreß von 1904 zum erstenmal die allgemeine Fettleibigkeit, wahrscheinlich auch den Riesenwuchs (Akromegalie) auf Verletzungen und Veränderungen jenes Organes zurückzuführen vermochte. Die inzwischen aus den verschiedensten Veranlassungen vorgenommenen Operationen nähern sich bereits der Zahl 100; eine sehr brauchbare Methode zur operativen Freilegung der Drüse hat Schloffer angegeben.
[2] Verfasser operierte 1881 und 1889 wegen bösartiger Neubildungen des Kehlkopfes zwei Ärzte, deren Schicksale er weiterhin hat verfolgen können. Dem ersten wurde der halbe Kehlkopf weggenommen. Er bekam eine zwar rauhe, aber laute und meist tönende Stimme, die durchaus verständlich war und ihn weder in der Unterhaltung, noch im Berufe hinderte. Dem zweiten, der ein eben beginnendes Krebsgeschwür unter dem linken Stimmbande hatte, wurde nur letzteres bis auf den Knorpel umschnitten und ausgeschält. Einige Jahre später stellte er sich mit tönender Stimme vor, die ihm sogar zu singen erlaubte; das Stimmband hatte eine Neubildung erfahren. Beide haben nie einen Ersatz getragen, waren in ihrem Berufe lange Jahre tätig und sind noch heute am Leben.
Das Bild, welches wir in den beiden vorangehenden Abschnitten von dem Stande der Chirurgie in den letzten 50 Jahren zu entwerfen versucht haben, würde unvollständig bleiben, wenn es nicht durch eine Besprechung der in dieser Zeit sich entwickelnden rein chirurgischen Literatur seine Vervollständigung fände. Denn wie jede schnell aufblühende Wissenschaft teils als Verständigungsmittel, teils als Speicher der erworbenen Kenntnisse eine Literatur braucht, so hatte auch die uralte Chirurgie in dem Jungbrunnen der antiseptischen Wundbehandlung sich eine solche geschaffen, die in Fülle und Reichhaltigkeit des Inhaltes alle bisherigen Leistungen weit überstrahlte. Wenn diese Erscheinung auch in kurzen Abständen nacheinander in allen Kulturländern der Erde zu beobachten ist, so beschränken wir uns, entsprechend dem Plane des Buches, doch ganz auf eine Übersicht über die Entwicklung der chirurgischen Schriften in Deutschland.
An Hand- und Lehrbüchern der Wundarznei war Deutschland auch in der vorantiseptischen Zeit, zumal seit August Gottlieb Richters grundlegendem Werke, aus den Jahren 1789–1804 nicht eben arm gewesen. Die Lehrbücher aus der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts nehmen zuweilen die Form eines Handwörterbuches für Chirurgie und Augenheilkunde an, wie das von Joh. Nepomuk Rust 1830–1836, von Ernst Blasius 1836–1838 und ein drittes von Walther, Jäger und Radius aus den Jahren 1836–1840. Daneben aber erschienen nicht wenige Einzelbearbeitungen der Chirurgie, unter deren Verfassern die Namen Konrad Martin Langenbeck, 1822, Max Joseph Chelius, 1822, Philipp v. Walther, 1843, und insbesondere Wilhelm Roser, 1844, Ludwig Stromeyer, 1844, und Adolf Wernher, 1846, hervorzuheben sind; nach 1850 Viktor v. Bruns, 1854, Wilhelm Busch, 1857, und endlich Adolf Bardeleben mit seiner ursprünglichen Übersetzung von Vidals Chirurgie (seit 1852), welche in 7. Auflage bei selbständiger Bearbeitung ausschließlich unter Bardelebens Namen ging. Die nach 1860 erscheinenden Lehrbücher stehen mehr oder weniger bereits unter dem Einflusse der antiseptischen Wundbehandlung; unter ihnen ragt am meisten hervor Franz Königs Spezielle Chirurgie, die einen großen Einfluß ausgeübt hat und mehrfache Auflagen erlebte. Vortrefflich ist auch Erich Lexers Lehrbuch der allgemeinen Chirurgie, die bereits in 6 Auflagen erschienen ist.
Neben diesen zusammenfassenden Werken einzelner wurde durch[102] Theodor Billroth, der auch literarisch sein Leben lang unermüdlich tätig gewesen ist, eine neue Form der Veröffentlichungen ins Leben gerufen, die man als Sammellehrbücher bezeichnen kann. Sie waren notwendig geworden, weil das gewaltige Anschwellen des chirurgischen Könnens und Wissens es dem einzelnen Schriftsteller immer schwerer machte, das ganze Gebiet der klinischen Chirurgie wissenschaftlich und praktisch gleichmäßig zu beherrschen; es mußte daher eine Aufteilung des Stoffes an mehr oder weniger zahlreiche Mitarbeiter vorgenommen werden. Als das erste Beispiel dieser Literatur in Deutschland erschien in den Jahren 1865 bis 1882 das von v. Pitha und Billroth herausgegebene Lehrbuch der allgemeinen und speziellen Chirurgie. Indessen zeigte sich sehr bald als bedenklicher Nachteil dieses Verfahrens der Umstand, daß die zahlreichen Mitarbeiter mit sehr verschiedener Schnelligkeit arbeiteten, die einzelnen Abschnitte daher ganz unregelmäßig erschienen und die fleißigsten und frühesten Arbeiten oft schon überholt und veraltet waren, ehe das Sammelwerk noch seinen Abschluß gefunden hatte. So geschah es bereits bei diesem ersten Versuche, dessen Beendigung Billroth nicht abzuwarten die Geduld besaß; denn schon im Jahre 1879 erschien das erste Heft eines neuen Unternehmens, welches er in Verbindung mit Albert Lücke unter dem Namen: „Deutsche Chirurgie“ begründete. Dies Werk schleppt sich nun bereits 35 Jahre hin, ohne daß der Zeitpunkt der Beendigung auch nur mit einiger Sicherheit übersehen werden könnte. Die beiden ersten Herausgeber sind gestorben; an ihre Stelle traten Ernst v. Bergmann und Paul v. Bruns; und nachdem auch der Erstgenannte aus dem Leben geschieden ist, führt Bruns die Schriftleitung allein weiter. Auch die Mitarbeiter haben vielfach gewechselt, immer neue Teilungen des riesenhaften Stoffes haben sich als notwendig erwiesen und dennoch kann das Werk nur langsam vorankommen, da jeder neue Mitarbeiter sich erst einzuleben genötigt ist. So unerfreulich dieser Zustand auch sein mag, so scheint er doch bei einem derartig angelegten Unternehmen auf dem Gebiete einer schnell sich entwickelnden Wissenschaft fast unvermeidlich zu sein; und ungeachtet dieser Mängel ist die „Deutsche Chirurgie“ ein stolzes Denkmal deutschen Wissens und deutscher Gewissenhaftigkeit geworden.
Ein solcher Stand der Dinge mußte unfehlbar zu neuen Unternehmungen reizen, bei deren Anlage man die Fehler der älteren Werke zu vermeiden suchte. So erschien unter der Leitung von v. Bergmann, v. Bruns und v. Mikulicz in den Jahren 1898–1901 ein vierbändiges Handbuch der praktischen Chirurgie, welches 1903 bereits eine 2. Auflage benötigte. Die kürzere und möglichst zusammengedrängte Fassung, bei strengster Berücksichtigung alles Wissenswerten, hatte den Mitarbeitern eine rechtzeitige Ablieferung der übernommenen Artikel möglich gemacht. Es ist das führende Handbuch der Chirurgie geworden und eben in 4. Auflage in 5 Bänden erschienen. — Ein weiterer Versuch zur Vereinfachung und zu schneller Ablieferung ist die von Th. Kocher und Quervain in den Jahren 1902/03 herausgegebene Enzyklopädie der gesamten Chirurgie.
Neben diesen mehr oder weniger umfangreichen Sammelwerken über allgemeine und spezielle Chirurgie, den Krankenhausberichten, sowie den der Operationslehre gewidmeten Schriften steht eine schier unübersehbare[103] Menge von Einzelschriften aller Art, teils umfassenderen Arbeiten über besondere Gebiete, die sich nicht in den Rahmen einer Sammelchirurgie eingeordnet haben, teils kleineren oder größeren Artikeln, die in den Zeitschriften ihren Unterschlupf fanden. Bis zum Jahre 1860 gab es aber im ganzen Gebiete der deutschen Sprache so außerordentlich wenige ausschließlich chirurgische Zeitschriften, daß die meisten kleineren Aufsätze in den gewöhnlichen Wochenschriften erschienen, die unterschiedslos allen medizinischen Fächern gerecht zu werden sich bemühten. So konnte es geschehen, daß die wichtigsten chirurgischen Arbeiten über eine größere Zahl von Zeitschriften sich verstreuten, was deren Verbreitung in chirurgischen Kreisen nicht wenig im Wege stand. Um diesem Zustande ein Ende zu machen und der deutschen Chirurgie einen Sammel- und Treffpunkt zu bereiten, gründete Bernhard Langenbeck im Jahre 1861 das Archiv für klinische Chirurgie, dessen Hauptleitung Ernst Gurlt übernahm; unter dem geläufigeren Namen „Langenbecks Archiv“ hat es in der Tat lange Jahre eine Art von Sprechsaal für die deutsche Chirurgie gebildet und hat heute unter einer Schriftleitung, deren Hauptarbeit Werner Körte leistet, den hundertsten Band längst überschritten. Allein den wachsenden Bedürfnissen genügte auch diese Einrichtung bald nicht mehr, da zumal die jüngeren Chirurgen nicht ohne Grund die Klage erhoben, daß wegen Platzmangels die Veröffentlichung der von ihnen eingesandten Arbeiten ungebührlich lange hinausgeschoben würde. So konnten denn im Jahre 1872 Karl Hüter und Albert Lücke mit einem neuen Organe, der „Deutschen Zeitschrift für Chirurgie“ dem älteren Archiv einen Wettbewerb bereiten. Und da trotzdem nach einem Jahrzehnt die gleichen Klagen laut wurden, so konnte P. Bruns in den „Beiträgen zur klinischen Chirurgie“ im Jahre 1884 noch ein drittes Archiv gründen, welches in kurzer Zeit zahlreichen Kliniken und Krankenhäusern zu ihren Veröffentlichungen diente und zu hoher Blüte gelangte.
Zu diesen Sammelorganen kommen die Veröffentlichungen aus chirurgisch-wissenschaftlichen Gesellschaften. Unter diesen steht die Deutsche Gesellschaft für Chirurgie weitaus im Vordergrunde; ihre gedruckten Verhandlungen liefern alljährlich einen Band, der allmählich zu erheblichem Umfange angeschwollen ist und dessen Inhalt uns die Entwicklung der deutschen Chirurgie fast wie in einem Museum geordnet vor Augen führt. Dazu kommen die Verhandlungen der Freien Vereinigung der Chirurgen Berlins, die, seit 1888 bestehend, vor drei Jahren den Namen: Berliner chirurgische Gesellschaft angenommen hat. — Auch die Deutsche Röntgengesellschaft, die Deutsche Gesellschaft für Urologie und manche andere Vereinigungen geben besondere Sitzungsberichte heraus, da auch die sonderwissenschaftlichen Zeitschriften die Fülle des Stoffes nicht zu bewältigen imstande sind.
Und doch hat die Chirurgie durch Gründung besonderer Vereine für Nebengebiete mit den dazu gehörigen Zeitschriften eine ganz erhebliche Entlastung erfahren. Weit vorangegangen war die Augenheilkunde, bald auch die Ohrenheilkunde, die schon 1864 ein eigenes Archiv schuf, 1867 eine Monatsschrift hinzufügte. In ähnlicher fruchtbarer Weise ist die Sache in allen Sonderwissenschaften verlaufen, welche durch die antiseptische Wundbehandlung einen mächtigen und nachhaltigen Antrieb zur Weiterentwicklung erfahren hatten.
Als eine Erscheinung eigener Art sind die von Richard v. Volkmann[104] seit dem Jahre 1869 begründeten „Klinischen Vorträge“ anzusehen, in welchen das Ziel verfolgt wurde, den Fortschritten auf allen Gebieten der klinischen Medizin durch fortlaufende Veröffentlichungen von Vorträgen, wie sie dem jeweils neuesten Stande der Wissenschaft entsprechend in Kliniken und Vereinen gehalten waren, oder wenigstens sich der Form nach ihnen angliederten, Rechnung zu tragen. Der chirurgische Teil des Unternehmens wird noch heute von Otto Hildebrand geleitet.
Ähnlichen Gedankengängen paßt sich die von P. v. Bruns 1912 begründete „Neue deutsche Chirurgie“ an, von der diese Arbeit einen Teil bildet. Sie ist als Fortsetzung der „Deutschen Chirurgie“ gedacht und erscheint als eine zwanglose Sammlung von Einzelschriften, die allen Fortschritten unserer Wissenschaft Rechnung tragen sollen und die mit der Zeit eine wertvolle Fachbibliothek in sorgfältiger Auswahl und Bearbeitung werden dürfte. —
Eine etwas schwerflüssige und doch überaus wichtige Quelle der Belehrung bilden die klinischen Berichte aus Kliniken und Krankenhäusern. In deren älterer Form teilte der Berichterstatter nur mit, was ihm in seinen Erfahrungen besonders wichtig erschien, unter Auslassung alles dessen, was den Glanz seiner Tätigkeit zu verdunkeln geeignet war. Diese mehr oder weniger schön gefärbten Mitteilungen erfuhren durch Theodor Billroths rücksichtslose Wahrheitsliebe eine grundsätzliche Veränderung, indem er in den seit 1860 herausgegebenen Berichten über seine Kliniken in Zürich und später in Wien nicht nur das sogenannte Interessante besprach, dessen Begrenzung von jedem Leser in anderer Form vorgenommen wird, sondern einfach alles erwähnte, was er beobachtet hatte. Nur so war es möglich, einen klaren Überblick nicht allein über seine eigene Tätigkeit, sondern auch über die anderer Chirurgen zu gewinnen; und da es feststeht, daß eigene und fremde Fehler am meisten belehren, so hat Billroths Vorgehen eine nicht hoch genug zu schätzende Säule der chirurgischen Ethik geschaffen. Er fand bald Nachfolger, und heutigentags ist die Methode der unbedingten Wahrhaftigkeit so weit entwickelt, daß ein Berichterstatter es nur unter schweren Gefahren für Ruf und Ehre wagen dürfte, von ihren Grundsätzen abzuweichen. — Für das Studium von Einzelfragen bilden solche Berichte eine unschätzbare Grundlage.
Aus diesem Anschwellen der Literatur, welches einer geistigen Übererzeugung zuweilen bedenklich nahe kam, entwickelte sich nun ein neuer Literaturzweig mit der Aufgabe, die zerstreuten Arbeiten auf den einzelnen medizinischen Gebieten zu sammeln, zu ordnen und in Form einer kurzen, aber alles Wesentliche wiedergebenden Inhaltsangabe dem Leser darzubieten. Auf dem Gesamtgebiete der Medizin hatten Canstatts Jahresberichte bereits 25 Jahre lang dem Bedürfnis wissenschaftlich arbeitender Ärzte Rechnung zu tragen gesucht, als sie im Jahre 1866 durch die von Rudolf Virchow und August Hirsch herausgegebenen Jahresberichte über die Leistungen und Fortschritte in der gesamten Medizin ersetzt wurden. Aber für die auf Sondergebieten Belehrung suchenden Männer waren solche Übersichten auf der einen Seite zu umfassend, da sie das Auffinden bestimmter Arbeiten und die Erkenntnis ihres Zusammenhanges mit anderen ähnlichen erschwerten, auf der anderen Seite zu eng, da sie inhaltlich viel zu wenig boten.
Aus dem unabweislichen Bedürfnis heraus, dem Chirurgen seine literarischen[105] Arbeiten zu erleichtern, schufen daher L. Lesser in Berlin, M. Schede in Halle und H. Tillmanns in Leipzig, unter dem Rate und der tätigen Beihilfe Richard v. Volkmanns, im Jahre 1874 das Zentralblatt für Chirurgie, dessen allwöchentlich erscheinende Hefte nicht nur mehr oder weniger schnelle Berichte über die chirurgische Weltliteratur, sondern auch gewöhnlich kurze Uraufsätze und sogar öffentliche Anfragen brachten. So ausgezeichnet sich das Unternehmen bewährt hat, so ist es doch im Jahre 1913 durch ein unter ständiger Aufsicht der Deutschen Gesellschaft für Chirurgie stehendes Zentralblatt für die gesamte Chirurgie und ihre Grenzgebiete, dessen Schriftleitung L. Franz übernommen hat, nicht ersetzt, aber doch ergänzt worden. Das neue Blatt strebt nicht nur eine Vollständigkeit der Berichte aus der gesamten Weltliteratur, sondern auch deren denkbar schnellstes Erscheinen an.
Wie einst das Archiv für klinische Chirurgie, so hat auch das Zentralblatt für Chirurgie schnelle Nachahmung gefunden. Alle Nebenfächer der Wundarzneikunst, sogar die Grenzgebiete zwischen Medizin und Chirurgie haben ihr eigenes Zentralblatt erhalten, so daß eine eigene Literatur der Zentralblätter zustande gekommen ist. Daneben entwickelten sich noch weiterhin auf engere Gebiete beschränkte Jahresberichte, entweder über die ganze Chirurgie sich erstreckend, wie Otto Hildebrands seit 1895 erscheinender Jahresbericht der Chirurgie, oder zusammenfassende engere Berichte, wie die der Krankheiten des Urogenitalapparates seit 1906.
Das lebhafte Interesse, welches sich in diesen zahlreichen Gründungen und deren Gedeihen bekundet, hat die Arbeiten auf allen Gebieten der Chirurgie wesentlich erleichtert. Aber es ist nicht zu verkennen, daß diese Massenhaftigkeit der literarischen Neuschöpfungen doch auch ihre bedenkliche Seite hat. Die Anlegung einer chirurgischen Privatbücherei, welche alle wesentlichen Erscheinungen der neueren Literatur umfaßt, ist jetzt vom Gesichtspunkte des Raumes und der Kosten schon fast unmöglich geworden, selbst für einen Chirurgen mit eigenem Hause und großen Mitteln. Damit leidet aber die stille Gelehrtenstube früherer Zeiten; und der wundärztliche Schriftsteller, welcher öffentliche Büchereien in größerem Umfange zu benutzen gezwungen ist, verliert auch noch den letzten Rest der für die Sammlung der Gedanken so nötigen beschaulichen Ruhe, den ihm sein immer unruhiger und aufregender werdender Beruf eben noch gelassen hatte.
Trotz dieser etwas schwermütigen Betrachtung bietet auch das literarische Schaffen auf chirurgischem Gebiete in seiner Rührigkeit und seiner überquellenden Fruchtbarkeit ein überaus erfreuliches Bild dar.
Wir sind am Schluß unserer Darlegungen angelangt. Aber es ist kein geschichtlicher Abschluß, kein Wendepunkt, an welchem eine umschriebene Periode zu Ende geht, eine neue in Sicht steht, oder soeben begonnen hat; denn Listers System einer chemischen Wundbehandlung, für welche die Anfänge der Keimlehre die Grundlage darboten, ist zwar von Grund aus umgeändert und verbessert, aber doch nicht als vollendet und fortan unabänderlich anzusehen. Dazu sind weitere neue Gedanken und wissenschaftliche Erfindungen gekommen, deren Tragweite für das Gebiet der Wundarzneikunde noch keineswegs schon nach allen Beziehungen hin feststeht. Demgemäß sehen wir in der deutschen Chirurgie überall eine angespannte Arbeit, ein eifriges Streben, einen nie ermüdenden Fleiß. Das sind keine Zeichen eines Niederganges, sondern der klarste Beweis, daß die jetzt lebenden Chirurgen das Erbe ihrer Vorgänger gut verwalten, daß sie dem gleichen Boden, auf welchem jene tätig waren, im Schweiße ihres Angesichtes immer reichere Erträge zu entlocken sich bemühen. Noch ist fast alles im Fluß; wohin aber die stolze Bewegung in weiteren 50 Jahren geführt haben wird, vermag heute niemand auch nur zu ahnen. Immerhin dürfen wir die Hoffnung hegen, daß der Weg weiter aufwärts führt, selbst wenn unser Vaterland schweren Prüfungen entgegengehen sollte, denen mit Ruhe und Entschlossenheit zu begegnen das deutsche Volk auch in der hohen Entwicklung seiner Chirurgie eine nicht zu verachtende Waffe, besitzt.
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.
M.
N.
O.
P.
Q.
R.
S.
T.[110]
U.
V.
W.
Z.
Übersicht der Geschichte der Chirurgie und des chirurgischen Standes.
Von
Prof. Dr. H. HAESER.
Lex. 8o. 1879. geh. M. 1.20.
(Deutsche Chirurgie, Lieferung 1.)
Baas, Prof. Dr. J. H., Leitfaden der Geschichte der Medizin. Mit Bildnissen in Holzschnitt und Faksimiles von Autographen. Lex. 8o. 1880. geh. M. 3.60.
Baas, Prof. Dr. J. H., William Harvey, der Entdecker des Blutkreislaufes und dessen anatomisch-experimentelle Studie über die Herz- und Blutbewegung bei den Tieren. Kulturhist.-med. Abhandlung zur Feier des dreihundertjährigen Gedenktages der Geburt Harveys (1. April 1578). Mit Harveys Bildnis, Faksimile und den Abbildungen des Originals in Lithographie. Lex. 8o. 1878. geh. M. 5.20.
Bauer, Hofrat Prof. Dr. A., Naturhistorisch-biographische Essays. Mit 3 Tafelabbildungen, gr. 8o. 1911. geh. M. 3.80.
Brüning, Privatdoz. Dr. H., Geschichte der Methodik der künstlichen Säuglingsernährung. Nach medizin-, kultur- und kunstgeschichtlichen Studien zusammenfassend bearbeitet. Mit 78 Textabbildungen. Lex. 8o. 1908. geh. M. 6.—; in Leinw. geb. M. 7.20.
Dragendorff, Prof. Dr. G., Die Heilpflanzen der verschiedenen Völker und Zeiten. Ein Handbuch für Aerzte, Apotheker, Botaniker und Droguisten. Lex. 8o. 1898. geh. M. 22.—; in Halbfranz geb. M. 24.50.
Ebstein, Geheimrat Prof. Dr. W., Charlatanerie und Kurpfuscher im Deutschen Reiche. Lex. 8o. 1905. geh. M. 2.—
Ebstein, Geheimrat Prof. Dr. W., Die Gicht des Chemikers Jacob Berzelius und anderer hervorragender Männer. Mit 1 Abbildung. Lex. 8o. 1904. geh. M. 2.40.
Ebstein, Geheimrat Prof. Dr. W., Die Krankheiten im Feldzuge gegen Rußland (1812). Eine geschichtlich-medizinische Studie mit 1 Kärtchen. Lex. 8o. 1902. geh. M. 2.40.
Ebstein, Geheimrat Prof. Dr. W., Leben und Streben in der inneren Medizin. Klinische Vorlesung, gehalten am 9. November 1899. Lex. 8o. 1899. geh M. 1.—
Ebstein, Geheimrat Prof. Dr. W., Dr. Martin Luthers Krankheiten und deren Einfluß auf seinen körperlichen und geistigen Zustand. Lex. 8o. 1908. geb. M. 2.—
Ebstein, Geheimrat Prof. Dr. W., Die Medizin im alten Testament. gr. 8o. 1900. geh. M. 5.—
Ebstein, Geheimrat Prof. Dr. W., Die Medizin im neuen Testament und im Talmud. gr. 8o. 1903. geh. M. 8.—
Ebstein, Geheimrat Prof. Dr. W., Die Pest des Thukydides. (Die Attische Seuche.) Eine geschichtlich-medizinische Studie. Mit 1 Kärtchen. Lex. 8o. 1899. geh. M. 2.—
Ebstein, Geheimrat Prof. Dr. W., Rudolf Virchow als Arzt. Lex. 8o. 1903. geh. M. 2.40.
Fasbender, Prof. Dr. H., Entwickelungslehre, Geburtshülfe und Gynäkologie in den Hippokratischen Schriften. Eine kritische Studie. gr. 8o. 1895. geh. M. 10.—
Fossel, Prof. Dr. V., Studien zur Geschichte der Medizin. Lex. 8o. 1909. geh. M. 6.—
Greeff, Prof. Dr. R., Rembrandts Darstellungen der Tobiasheilung. Nebst Beiträgen zur Geschichte des Starstichs. Mit 14 Tafeln und 9 Textabbildungen. Lex. 8o. 1907. geh. M. 6.—
Hirsch, Prof. Dr. A., Handbuch der historisch-geographischen Pathologie. Zweite, vollständig neue Bearbeitung.[112] Drei Abteilungen.
| I. Abt.: | Die allgem. akuten Infektionskrankheiten. Lex. 8o. 1881. geh. M. 12.— | |
| II. Abt.: | Die chronischen Infektions- und Intoxikationskrankheiten. Parasitäre Krankheiten, infektiöse Wundkrankheiten und chronische Ernährungs-Anomalien. Lex. 8o. 1883. geh. M. 12.— | |
| III. Abt.: | Die Organkrankheiten. Nebst einem Register über die drei Abteilungen. Lex. 8o. 1886. geh. M. 14.— |
Politzer, Prof. Dr. A., Geschichte der Ohrenheilkunde. Zwei Bände.
| Band I: Von den ersten Anfängen bis zur Mitte des neunzehnten Jahrhunderts. Mit 31 Bildnissen auf Tafeln und 19 Textfiguren. Lex. 8o. 1907. geh. M. 20.—; in Leinw. geb. M. 22.— | |
| Band II: Von 1850-1911. Unter Mitwirkung bewährter Fachkräfte. Mit 29 Bildnissen auf 29 Tafeln. Preis geh. M. 24.—; in Leinw. geb. M. 26.— |
Koelsch, Kgl. Landesgewerbearzt Dr. F., Bernardino Ramazzini. Der Vater der Gewerbehygiene (1633–1714). Sein Leben und seine Werke. Mit einem Bildnis. Lex. 8o. 1911 geh. M. 1.40.
Marcuse, Dr. med. Jul., Bäder und Badewesen in Vergangenheit und Gegenwart. Eine kulturhistorische Studie. Lex. 8o. 1903. geh. M. 5.—
Marcuse, Dr. med. Jul., Hydrotherapie im Altertum. Eine historisch-medizinische Studie. Mit einem Vorwort von Prof. Dr. W. Winternitz. gr. 8o. 1900. geh. M. 2.—
Müllerheim, Dr. R., Die Wochenstube in der Kunst. Eine kulturhistorische Studie. Mit 138 Abbildungen. hoch 4o. 1904. kart. M. 16.—; in Leinw. geb. M. 18.—
Neuburger, Prof. Dr. M., Johann Christian Reil. Gedenkrede, gehalten auf der 85. Versammlung Deutscher Naturforscher und Ärzte in Wien am 26. September 1913. Mit einem Bildnis und 9 Textabbildungen. Lex. 8o. 1913. geh. M. 4.—
Neuburger, Prof. Dr. M., Geschichte der Medizin. Zwei Bände.
| I. Band. Lex. 8o. 1906. geh. M. 9.—; in Leinw. geb. M. 10.40. | |
| II. Band, I. Teil. Mit 8 Tafeln. Lex. 8o. 1911. geh. M. 13.60; in Leinw. geb. M. 15.— |
Neuburger, Prof. Dr. M., Die historische Entwickelung der experimentellen Gehirn- und Rückenmarksphysiologie vor Flourens. gr. 8o. 1897. geh. M. 10.—
Neuburger, Prof. Dr. M., Die Vorgeschichte der antitoxischen Therapie der akuten Infektionskrankheiten. Vortrag, gehalten auf der 73. Versammlung deutscher Naturforscher und Ärzte in Hamburg. In erweiterter Form herausgegeben. gr. 8o. 1901. geh. M. 1.60.
Opitz, Dr. K. Die Medizin im Koran. gr. 8o. 1906. geh. M. 3.—
Strunz, Privatdoz. Dr. F., Geschichte der Naturwissenschaften im Mittelalter. Im Grundriß dargestellt. Mit 1 Abbildung. Lex. 8o. 1910. geh. M. 4.—
Prof. Dr. E. HOLLÄNDER.
Die Karikatur und Satire in der Medizin.
Medikokunsthistorische Studie.
Mit 10 farbigen Tafeln und 223 Abbildungen im Text.
hoch 4o. 1905. kart. M. 24.—; in Leinw. geb. M. 27.—
Die Medizin in der klassischen Malerei.
Mit 272 in den Text gedruckten Abbildungen. Zweite Auflage.
hoch 4o. 1913. geh. M. 28.—; fein in Leinw. geb. M. 31.—
Plastik und Medizin.
Mit 1 Tafel und 433 Abbildungen im Text.
hoch 4o. 1912. kart. M. 28.—; elegant geb. M. 30.—
Der Gesichtsausdruck des Menschen.
1913 Von 1913
Dr. med. H. Krukenberg.
Mit 203 Textabbildungen meist nach Originalzeichnungen und
photographischen Aufnahmen des Verfassers.
Lex. 8o. 1913. Geheftet M. 6.—, in Leinwand gebunden M. 7.40.
Das vorliegende Werk gibt in allgemein verständlicher Form eine Übersicht über die Entwicklung und die einzelnen Formen der Ausdrucksweise des menschlichen Antlitzes In der Einleitung werden die Lehren und Irrlehren vom Gesichtsausdruck, wie sie sich in den Werken früherer Jahrhunderte bis auf Lavater und Gall vorfinden, behandelt, und es wird dann gezeigt, wie sich am menschlichen Antlitz nach bestimmten ehernen Gesetzen allmähliche Wandlungen vollziehen, wie sich nicht nur der Gesichtsausdruck des einzelnen, sondern auch der der ganzen Menschheit im Strome der Zeit allmählich verändert. Die Merkmale der einzelnen Rassen werden kurz berührt, ausführlicher werden die durch Alter und Geschlecht bedingten charakteristischen Gesichtsmerkmale behandelt. An einzelnen Beispielen wird die Entwicklung des Gesichtausdrucks vom Säugling bis zum Erwachsenen erläutert. Die durch den Ernährungszustand, durch Krankheit, durch geistige Verblödung und Geisteskrankheiten bedingten Veränderungen werden eingehend behandelt und durch zahlreiche zum Teil sehr markante Abbildungen erläutert.

Erika S. Freudiges Lachen. |

Erika S. Schalkhaftes Lachen. |

Erika S. Geschmeicheltes Lächeln. |

Unschön wirkende,
durch Ernährungsrückgang bedingte
Altersfalten.

Künstlerisch schön wirkende,
durch das Seelenleben bedingte
Altersfalten.
Weiter werden die Merkmale welche das Schicksal, die Kämpfe des Geistes
und der Seele dem Antlitz aufdrücken, behandelt, es wird gezeigt, wie
häufig wiederholte vorübergehende Ausdrucksformen des Antlitzes
allmählich dauernde Veränderungen hervorrufen, wie auch hier der Geist
es ist, der sich den Körper baut. Die einzelnen vorübergehenden
Veränderungen des Mienenspiels werden ausführlich behandelt und
analysiert und ihre Entstehung auf rein sinnliche Reize zurückgeführt.
Das Mienenspiel des Kindes wird in seiner rein elementaren Form dem
durch Erziehung und konventionelle Rücksichten modifizierten
Gesichtsausdruck des Erwachsenen gegenübergestellt. Es wird gezeigt, wie
beim Kinde noch rein sinnliche Eindrücke vorherrschen, während im
späteren Alter die seelischen Eindrücke, die Arbeit des Geistes und die
Lebensschicksale das Gesicht immer mehr modifizieren und ihre
unverwischbaren Spuren darin hinterlassen. Die Art und Weise, wie das
Gesicht auf plötzliche reelle oder ideelle Reize reagiert, wird an
photographischen Aufnahmen in drastischer Form demonstriert.
Der Verfasser verwirft die künstliche Hervorbringung gewollter Gesichtsausdrücke
als unzuverlässig, er hat sein Material ausschließlich nach wirklich
vorhandenen geistigen Erregungen gesammelt. Das, was der
Verfasser bietet, macht daher Anspruch auf absolute Naturwahrheit.
Der künstlerische Standpunkt wird darüber nicht vernachlässigt. Der Verfasser weist immer wieder darauf hin, welche Veränderungen des Gesichtsausdruckes durch das Seelenleben, welche durch rein zufälligen körperlichen Bau bedingt sind, welche unserm Schönheitssinn entsprechen und welche nicht. Auch der Schönheitssinn und die Verschönerungsversuche anderer Rassen werden berücksichtigt.

Knabe, anderthalb Jahre alt. |

Derselbe, acht Jahre alt. |

Derselbe erwachsen, neunzehn Jahre alt. |

Erika S. Süßer Geschmack.

Erika S. Widerwärtiger Geschmack.
Ohne den Boden der Allgemeinverständlichkeit zu verlassen, deduziert der
Verfasser die Entwicklung und die notwendigen Folgen der Veränderungen
des Antlitzes vom
streng wissenschaftlichen Standpunkte aus und wirft,
zuweilen nicht ohne treffenden Sarkasmus, die Lehren der
„Physiognomiker“ über Bord.
Für diejenigen, welche sich vom künstlerischen Standpunkte aus, seien es darstellende oder bildende Künstler, mit dem Gesichtsausdruck zu befassen haben, dürfte das Buch bald ein unentbehrlicher Ratgeber werden, für jeden Gebildeten, der sich mit den Gesetzen der äußeren Ausdrucksweise unseres Seelenlebens bekannt machen will, wird das Studium des Buches eine anregende und lohnende Lektüre bilden.
════════════════════ BESPRECHUNG. ════════════════════
Der Wert der physiognomischen Forschung ergibt sich ohne weiteres aus der Wahrnehmung, daß das Mienenspiel des Menschen in seinen Grundzügen bei allen Völkern das gleiche ist, daß aber Gesichtszüge wie auch Gesichtsausdruck mit der fortschreitenden Kultur gewisse Veränderungen erfahren haben, aus denen sich wichtige Schlüsse auf den vorherrschenden oder den augenblicklichen Gemütszustand ziehen lassen. Dr. Krukenberg zeigt nun an einer großen Anzahl vorzüglicher Bilder, daß der Grad, in dem sich seelische oder körperliche Reize im Gesicht zu erkennen geben, durch mehrere Faktoren bestimmt wird; dieser hängt nämlich von ihrer Stärke, von ihrer Plötzlichkeit und, soweit sie den Gesichtsausdruck dauernd verändern, außerdem noch von ihrer Nachhaltigkeit ab. Nicht nur Künstler, Richter und Ärzte, die der Physiognomik von Berufs wegen ihre Aufmerksamkeit zu schenken haben, sondern jeder Gebildete, der etwas tiefer in die Geheimnisse "Spiegels der Seele" eindringen möchte, wird in dem schönen Werke reiche Anregung finden.Köln. Zeitung 1913. 1206.
════════════════════ INHALTSVERZEICHNIS. ════════════════════
I. Einleitung. — II. Literaturverzeichnis. — III. Historisches. Kritik der bisherigen Schriften über Physiognomik. — IV. Mimik der Tiere. — V. Entwicklung der Physiognomie. Anthropologisches. Entwicklung der einzelnen Rassenmerkmale. Entwicklung des Individuums. Geschlechtsmerkmale. Altersmerkmale. Pathologisches. — VI. Entstehung des menschlichen Mienenspiels. Entwicklungsgeschichte. Physiologie. Ausfallerscheinungen. Pathologie. — VII. Die Haut. — VIII. Das Auge. — IX. Das Ohr. — X. Die Nase. — XI. Der Mund. — XII. Zusammenfassung der einzelnen Ausdrucksweisen. Register.

|

Angeborene Blindheit. |

Erika S. Wut. |
[116]

Fünfjähriges ausgehungertes Kind. |
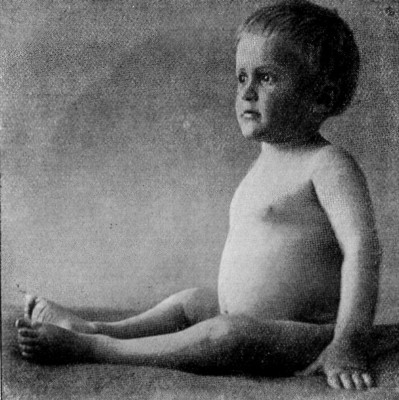
Dasselbe, vier Monate später nach Nahrungszufuhr. |
|
|

Erika S. Rührung (seelischer Schmerz). |
|
Die Schönheit des weiblichen Körpers
Den Müttern, Ärzten und Künstlern gewidmet.
Von Dr. C. H. STRATZ.
Zweiundzwanzigste, vermehrte und verbesserte Auflage
Mit 303 Abbildungen und 8 Tafeln. Lex. 8o. 1913. geh. M. 18.—, in Leinw. geb. M. 20.—
Die vorliegende Auflage der "Schönheit" ist um mehr als 30 neue Abbildungen durchweg
Photographien nach dem Leben bereichert und auch textlich erweitert worden. Die früheren
Auflagen des Werkes haben in der Presse die wärmste Anerkennung gefunden.
Das Werk kann in seinem geschmackvollen Gewande auch zu Geschenken für Künstler, Kunstfreunde,
Ärzte und Mütter, für welche Kreise es geschrieben ist, bestens empfohlen werden.
Zu beziehen durch jede Buchhandlung oder vom Verlag von FERDINAND ENKE in Stuttgart.
Druck der Union Deutsche Verlagsgesellschaft in Stuttgart.
***END OF THE PROJECT GUTENBERG EBOOK GESCHICHTE DER NEUEREN DEUTSCHEN CHIRURGIE***
******* This file should be named 39529-h.txt or 39529-h.zip *******
This and all associated files of various formats will be found in:
http://www.gutenberg.org/3/9/5/2/39529
Updated editions will replace the previous one--the old editions will be renamed.
Creating the works from public domain print editions means that no one owns a United States copyright in these works, so the Foundation (and you!) can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalties. Special rules, set forth in the General Terms of Use part of this license, apply to copying and distributing Project Gutenberg-tm electronic works to protect the PROJECT GUTENBERG-tm concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for the eBooks, unless you receive specific permission. If you do not charge anything for copies of this eBook, complying with the rules is very easy. You may use this eBook for nearly any purpose such as creation of derivative works, reports, performances and research. They may be modified and printed and given away--you may do practically ANYTHING with public domain eBooks. Redistribution is subject to the trademark license, especially commercial redistribution.
To protect the Project Gutenberg-tm mission of promoting the free distribution of electronic works, by using or distributing this work (or any other work associated in any way with the phrase "Project Gutenberg"), you agree to comply with all the terms of the Full Project Gutenberg-tm License available with this file or online at www.gutenberg.org/license.
1.A. By reading or using any part of this Project Gutenberg-tm electronic work, you indicate that you have read, understand, agree to and accept all the terms of this license and intellectual property (trademark/copyright) agreement. If you do not agree to abide by all the terms of this agreement, you must cease using and return or destroy all copies of Project Gutenberg-tm electronic works in your possession. If you paid a fee for obtaining a copy of or access to a Project Gutenberg-tm electronic work and you do not agree to be bound by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph 1.E.8.
1.B. "Project Gutenberg" is a registered trademark. It may only be used on or associated in any way with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few things that you can do with most Project Gutenberg-tm electronic works even without complying with the full terms of this agreement. See paragraph 1.C below. There are a lot of things you can do with Project Gutenberg-tm electronic works if you follow the terms of this agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg-tm electronic works. See paragraph 1.E below.
1.C. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation ("the Foundation" or PGLAF), owns a compilation copyright in the collection of Project Gutenberg-tm electronic works. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States. If an individual work is in the public domain in the United States and you are located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the work as long as all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg-tm mission of promoting free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg-tm works in compliance with the terms of this agreement for keeping the Project Gutenberg-tm name associated with the work. You can easily comply with the terms of this agreement by keeping this work in the same format with its attached full Project Gutenberg-tm License when you share it without charge with others.
1.D. The copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in a constant state of change. If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before downloading, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this work or any other Project Gutenberg-tm work. The Foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country outside the United States.
1.E. Unless you have removed all references to Project Gutenberg:
1.E.1. The following sentence, with active links to, or other immediate access to, the full Project Gutenberg-tm License must appear prominently whenever any copy of a Project Gutenberg-tm work (any work on which the phrase "Project Gutenberg" appears, or with which the phrase "Project Gutenberg" is associated) is accessed, displayed, performed, viewed, copied or distributed:
This eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this eBook or online at www.gutenberg.org
1.E.2. If an individual Project Gutenberg-tm electronic work is derived from the public domain (does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder), the work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charges. If you are redistributing or providing access to a work with the phrase "Project Gutenberg" associated with or appearing on the work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 or obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg-tm trademark as set forth in paragraphs 1.E.8 or 1.E.9.
1.E.3. If an individual Project Gutenberg-tm electronic work is posted with the permission of the copyright holder, your use and distribution must comply with both paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 and any additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked to the Project Gutenberg-tm License for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work.
1.E.4. Do not unlink or detach or remove the full Project Gutenberg-tm License terms from this work, or any files containing a part of this work or any other work associated with Project Gutenberg-tm.
1.E.5. Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic work, or any part of this electronic work, without prominently displaying the sentence set forth in paragraph 1.E.1 with active links or immediate access to the full terms of the Project Gutenberg-tm License.
1.E.6. You may convert to and distribute this work in any binary, compressed, marked up, nonproprietary or proprietary form, including any word processing or hypertext form. However, if you provide access to or distribute copies of a Project Gutenberg-tm work in a format other than "Plain Vanilla ASCII" or other format used in the official version posted on the official Project Gutenberg-tm web site (www.gutenberg.org), you must, at no additional cost, fee or expense to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon request, of the work in its original "Plain Vanilla ASCII" or other form. Any alternate format must include the full Project Gutenberg-tm License as specified in paragraph 1.E.1.
1.E.7. Do not charge a fee for access to, viewing, displaying, performing, copying or distributing any Project Gutenberg-tm works unless you comply with paragraph 1.E.8 or 1.E.9.
1.E.8. You may charge a reasonable fee for copies of or providing access to or distributing Project Gutenberg-tm electronic works provided that
1.E.9. If you wish to charge a fee or distribute a Project Gutenberg-tm electronic work or group of works on different terms than are set forth in this agreement, you must obtain permission in writing from both the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and Michael Hart, the owner of the Project Gutenberg-tm trademark. Contact the Foundation as set forth in Section 3 below.
1.F.
1.F.1. Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread public domain works in creating the Project Gutenberg-tm collection. Despite these efforts, Project Gutenberg-tm electronic works, and the medium on which they may be stored, may contain "Defects," such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a computer virus, or computer codes that damage or cannot be read by your equipment.
1.F.2. LIMITED WARRANTY, DISCLAIMER OF DAMAGES - Except for the "Right of Replacement or Refund" described in paragraph 1.F.3, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project Gutenberg-tm trademark, and any other party distributing a Project Gutenberg-tm electronic work under this agreement, disclaim all liability to you for damages, costs and expenses, including legal fees. YOU AGREE THAT YOU HAVE NO REMEDIES FOR NEGLIGENCE, STRICT LIABILITY, BREACH OF WARRANTY OR BREACH OF CONTRACT EXCEPT THOSE PROVIDED IN PARAGRAPH 1.F.3. YOU AGREE THAT THE FOUNDATION, THE TRADEMARK OWNER, AND ANY DISTRIBUTOR UNDER THIS AGREEMENT WILL NOT BE LIABLE TO YOU FOR ACTUAL, DIRECT, INDIRECT, CONSEQUENTIAL, PUNITIVE OR INCIDENTAL DAMAGES EVEN IF YOU GIVE NOTICE OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
1.F.3. LIMITED RIGHT OF REPLACEMENT OR REFUND - If you discover a defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can receive a refund of the money (if any) you paid for it by sending a written explanation to the person you received the work from. If you received the work on a physical medium, you must return the medium with your written explanation. The person or entity that provided you with the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a refund. If you received the work electronically, the person or entity providing it to you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy is also defective, you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem.
1.F.4. Except for the limited right of replacement or refund set forth in paragraph 1.F.3, this work is provided to you 'AS-IS', WITH NO OTHER WARRANTIES OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR ANY PURPOSE.
1.F.5. Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain types of damages. If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any provision of this agreement shall not void the remaining provisions.
1.F.6. INDEMNITY - You agree to indemnify and hold the Foundation, the trademark owner, any agent or employee of the Foundation, anyone providing copies of Project Gutenberg-tm electronic works in accordance with this agreement, and any volunteers associated with the production, promotion and distribution of Project Gutenberg-tm electronic works, harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees, that arise directly or indirectly from any of the following which you do or cause to occur: (a) distribution of this or any Project Gutenberg-tm work, (b) alteration, modification, or additions or deletions to any Project Gutenberg-tm work, and (c) any Defect you cause.
Project Gutenberg-tm is synonymous with the free distribution of electronic works in formats readable by the widest variety of computers including obsolete, old, middle-aged and new computers. It exists because of the efforts of hundreds of volunteers and donations from people in all walks of life.
Volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need are critical to reaching Project Gutenberg-tm's goals and ensuring that the Project Gutenberg-tm collection will remain freely available for generations to come. In 2001, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure and permanent future for Project Gutenberg-tm and future generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and how your efforts and donations can help, see Sections 3 and 4 and the Foundation information page at www.gutenberg.org
The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non profit 501(c)(3) educational corporation organized under the laws of the state of Mississippi and granted tax exempt status by the Internal Revenue Service. The Foundation's EIN or federal tax identification number is 64-6221541. Contributions to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent permitted by U.S. federal laws and your state's laws.
The Foundation's principal office is located at 4557 Melan Dr. S. Fairbanks, AK, 99712., but its volunteers and employees are scattered throughout numerous locations. Its business office is located at 809 North 1500 West, Salt Lake City, UT 84116, (801) 596-1887. Email contact links and up to date contact information can be found at the Foundation's web site and official page at www.gutenberg.org/contact
For additional contact information:
Dr. Gregory B. Newby
Chief Executive and Director
gbnewby@pglaf.org
Project Gutenberg-tm depends upon and cannot survive without wide spread public support and donations to carry out its mission of increasing the number of public domain and licensed works that can be freely distributed in machine readable form accessible by the widest array of equipment including outdated equipment. Many small donations ($1 to $5,000) are particularly important to maintaining tax exempt status with the IRS.
The Foundation is committed to complying with the laws regulating charities and charitable donations in all 50 states of the United States. Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort, much paperwork and many fees to meet and keep up with these requirements. We do not solicit donations in locations where we have not received written confirmation of compliance. To SEND DONATIONS or determine the status of compliance for any particular state visit www.gutenberg.org/donate
While we cannot and do not solicit contributions from states where we have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition against accepting unsolicited donations from donors in such states who approach us with offers to donate.
International donations are gratefully accepted, but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the United States. U.S. laws alone swamp our small staff.
Please check the Project Gutenberg Web pages for current donation methods and addresses. Donations are accepted in a number of other ways including checks, online payments and credit card donations. To donate, please visit: www.gutenberg.org/donate
Professor Michael S. Hart was the originator of the Project Gutenberg-tm concept of a library of electronic works that could be freely shared with anyone. For forty years, he produced and distributed Project Gutenberg-tm eBooks with only a loose network of volunteer support.
Project Gutenberg-tm eBooks are often created from several printed editions, all of which are confirmed as Public Domain in the U.S. unless a copyright notice is included. Thus, we do not necessarily keep eBooks in compliance with any particular paper edition.
Most people start at our Web site which has the main PG search facility: www.gutenberg.org
This Web site includes information about Project Gutenberg-tm, including how to make donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, how to help produce our new eBooks, and how to subscribe to our email newsletter to hear about new eBooks.