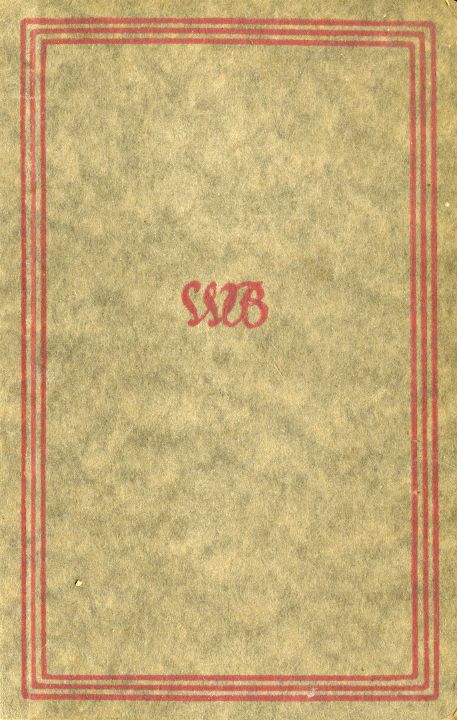
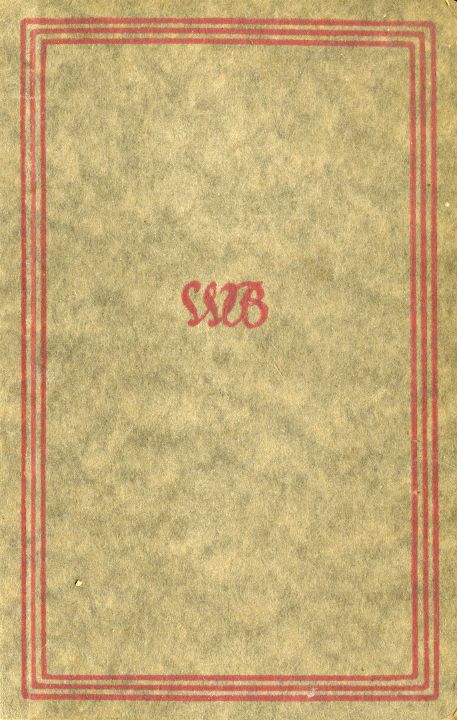
Anmerkungen zur Transkription:
Die Rechtschreibung und Zeichensetzung des Originals wurde weitgehend übernommen, lediglich offensichtliche Druckfehler wurden korrigiert. Bei der Kapitelzählung wurde im Original das elfte Kapitel übersprungen; diese Zählung wurde in der transkribierten Fassung übernommen. Am Ende des Textes befindet sich eine Liste korrigierter Druckfehler. Das Titelbild für Ebook-Betrachter wurde vom Bearbeiter erzeugt und in die Public Domain eingestellt.
Waldemar Bonsels / Blut
Waldemar Bonsels
Eine Erzählung

56. bis 58. Tausend
Deutsche Verlags-Anstalt Stuttgart
Berlin und Leipzig
1923
Die erste Ausgabe ist im Jahre 1909 erschienen
Copyright 1914 by Hesse & Becker Verlag in Leipzig
Druck der Deutschen Verlags-Anstalt in Stuttgart
Anne-Dore sah von ihren Fenstern aus am Rand eines niedrigen Buchenwaldes hin die rote Heide. In leichten Hügeln dehnte sie sich weiter hin, als das Auge reichte, und wenn die Sonne, die von drei Uhr nachmittags ab ihre Zimmer bewohnte, abends hinter die glühenden Schleier sank, die der Atem der Heide aus ihren letzten Strahlen wob, erschien dem Mädchen die Welt unendlich und vollkommen. Die kleinen Kiefern standen schwer und schwarz in rotem Gold, der Wald versank in graue Träume voller Geheimnisse und fremder Graun, nur die rötlichen Felsen fern hinter ihm, niedrig und zerklüftet, wie sie waren, wachten noch eine Zeitlang in den Farben der Abende, deren Stille berückend war, die Schläge der Herzen hörbar machte und die Augen mit großen, kühlen Träumen überschattete.
Seit einigen Jahren war Anne-Dore dies abendliche Bild gewohnt wie eine notwendige Lebenserscheinung, sie hätte sich ihr schlichtes und eintöniges Leben nicht mehr denken können, ohne daß die Weite der breiten Heide mit ihrem wechselnden Wesen, ihren frohen Lichtern und Farben und ihrer grauen Betrübnis, auch ihrem eigenen Wesen sein Gesicht, ihrem Herzen seine Stellung zu allen Dingen der Welt verliehen hätte. Aber auch die Hügel der Heide, ihre Sträucher und Kiefern, ihre armseligen Strohhütten und die Buchen des Waldes, der sie gegen Süden säumte, schienen Anne-Dore zu kennen und sie in der gleichen Treue zu lieben, in der ihnen das Herz des Mädchens gehörte. Geduldig trugen sie ihr weißes, winterliches Kleid, des neuen Frühlings gewiß, in dem sie für Anne-Dore grünen sollten, für Anne-Dore, die schon als ganz kleines Mädchen mit nackten Füßen und fliegendem Kleid durch ihre sommerliche Pracht gestürmt war.
Eigentlich immer allein. Tiefer im Tal, an den Hügeln, die das Landhaus von der Stadt trennten, standen kleine Bauernhäuser, zu klein und arm, um Gehöfte genannt werden zu können, und doch zu wohlgepflegt und säuberlich, als daß man sie mit den dürftigen Anwesen der Tagelöhner aus der Stadt verwechselt hätte. Mit den Kindern, die dort aufwuchsen, hatte Anne-Dore anfänglich wohl zuweilen gespielt, aber als die frühesten Kindertage vorüber waren, empfand sie einen Unterschied zwischen sich und den anderen, einen Drang nach sich selbst und ihrem Wesen, dem sie gehorchte. Man brauchte nur in ihre Augen zu sehen, in die tiefen, versonnenen Augen, deren Blau so schwer von langen Wimpern überschattet war, daß es nur selten in einem unerwarteten Lichtstrahl seine Farbe verriet. Dann glaubte man wohl zu verstehen, daß diesem Wesen darnach verlangte, ruhig auf sich versenkt, die stille Bahn zum eigenen Werden zu suchen, an dessen Entwicklung niemand Anteil zu haben schien.
Soweit Anne-Dore zurückdenken konnte, kannte sie ihre Mutter nicht anders als still, ergeben und schweigsam. Sie sprach leise und schleppend, ein wenig singend und matt, aber ohne jede Inbrunst des Ausdrucks. Man war dabei nie versucht, sie traurig zu nennen, o nein, eine bestimmte und tiefe Traurigkeit hätte ihrem Wesen vielleicht jene sanfte Würde verliehen, die Menschen adelt, die dem Leben gegenüber verzichtet haben und einen großen heimlichen Schmerz tragen. Nein, das war es nicht, viel eher hatte die Art etwas Schleichendes, eine qualvolle Tugendhaftigkeit und eine laue Anklage machten sich darunter breit. Anne-Dore liebte ihre Mutter nicht und ihr Vater war ihr fremd, denn er hatte die Jahre hindurch, in denen sie Kind war, in fremden Ländern zugebracht, in weiten Reisen, auf denen seine Gattin ihn später nicht mehr begleiten konnte, weil ihre Gesundheit es nicht erlaubte. Und etwas, das wie eine unsichtbare Schranke von je zwischen den Eltern und ihrem Kind gestanden hatte, war deren große Frömmigkeit. Es war eine Frömmigkeit von jener anhaltenden Inständigkeit, die wie eine laue Luft jeden ihrer Gedanken und jede ihrer Handlungen einhüllte. In ihr fanden sie Trost und Ersatz für alle Unbillen eines Daseins, dessen Kämpfen und Mühseligkeiten sie nicht gewachsen waren, in ihr barg sich alle Hoffnung auf eine bessere Zukunft in einem leuchtenden Reich steter Heimatlichkeit, das in einem Frieden ohne Angst ihr Leben vollenden sollte.
Nun, da Anne-Dore begann älter zu werden, und ihr bedächtiges Herz die Werte prüfte, die es in seine verschlossene Welt nahm, genügten ihr die verzichtreichen Betrachtungen der Eltern selten, der helle Glanz ihres irdischen Himmels erschien ihr wirklicher und köstlicher, als alle Strahlen aus jener zukünftigen Welt. Wohl nahm sie geduldig an allen Kirchgängen und Bibelstunden teil, die ihre Eltern besuchten, aber sie kehrte ermüdet und unbefriedigt in ihre ruhigen Zimmer zurück und in das Mißtrauen, das sie der stillen Freude ihrer Eltern entgegenbrachte, mischte sich langsam der Unwille einer leisen Verachtung.
Am Abendhimmel glühten ihre einsamen Träume, die seltsam wenig Gestalt gewannen, aber ihre Andacht war sinnenfroh und ohne Schranken. Sie behielt ihre Zweifel im Herzen verschlossen, aber sie überwachte jedes Wort und jede Gebärde ihrer frommen Eltern und schlief oft im Gefühl eines bösen Triumphes ein, wenn es ihr am Tage gelungen war, tiefgeheim die Mängel und Schäden der elterlichen Seelenwelt zu betasten.
Auf ihren bloßen Knien, im armseligen Schein der kleinen Nachtkerze, betete sie wohl immer noch vor ihrem Bett, bevor sie einschlief, aber ihre Augen wichen denen ihres ungeliebten Gottes aus, während sie sorgfältig und in mühsamer Sammlung ihre gewohnten Sätze sprach. Oft schloß sie ihr Gebet mit den Worten: »Du siehst in die Herzen der Menschen, Herr Jesus Christus, du willst keine Gaben und Opfer, die nicht ohne Vorbehalt gegeben werden, mache mit meinem Sinn, was du für gut hältst.«
Dann brachen oft ihre geflüsterten Worte ab und sie dachte unvermerkt: das ist eigentlich das mindeste, was man von Gott verlangen kann, wenn ihm daran liegt, daß man fromm und gerecht bleibt.
Aber solche Gedanken mied sie und schämte sich ihrer in verborgener Furcht. Erst der tiefblaue Nachthimmel mit der Überfülle seiner silbernen Sterne brachte ihr Ruhe und in ihre letzte Müdigkeit schien oft sein ewiges Licht als eine große Erlösung, voll unaussprechlicher Milde.
Die Morgensonne fand sie selten betrübt. Mit dem anbrechenden Tag war ihr Herz froh und von Licht erfüllt wie alle Dinge im Garten und im Hause. Sie tat ihre einfache Arbeit gern und liebevoll gegen jedermann, ertrug die bedächtige und lange Morgenandacht ohne Groll wie eine unvermeidliche Gewohnheit und blinzelte mit ihren Augen den Widerschein vom Goldschnitt der großen Bibel zu sich hinüber. Das Gesicht ihres Vaters war überladen von Andacht, und die gute Mutter neigte den Kopf in unverstandener Wehmut wie unter einer freundlichen Last. Die Gegenstände im Wohnzimmer waren alle mit ihr befreundet. Es waren prächtige alte Stücke darunter, die Frau Berta Wendel einst als Mädchen ihrem Gatten aus den Schätzen des eigenen Vaterhauses mitgebracht hatte. Braune Kommoden, blank und schwer beschlagen, an deren geschnitzten Ecken schon die jungen Blondköpfe mancher Generation sich gestoßen und deren dunkle, fast unergründliche Tiefen alle Geheimnisse geborgen hatten, die nur immer ihre kindlichen Herzen ahnen mochten. Die alte, hohe Uhr in der Ecke zwischen den niedrigen Fenstern war wohl der ehrwürdigste Besitz der Familie Wendel, sie zeigte nicht allein Stunden und Minuten, nein, auch die Tages- und Monatszahlen, hatte wandelnde Apostel, die zur Mittagsstunde herzutraten, einen blinkenden Sternhimmel und ein so volltöniges, tiefgoldenes Glockenwerk, daß Fremden unwillkürlich das Wort im Mund erstarb, wenn diese feierliche Stimme in ihre Rede fiel. Auf den niedrigen Wandschränken tanzten, in hellbunten Glasspitzen, mit süßem Lächeln und gespreizter Grazie feine Porzellanfigürchen; in ihrer eintönigen Lieblichkeit boten sie sich trüben Stunden oder hellen Blicken der Sonne dar.
Etwas, das Anne-Dore stets störte in dieser Harmonie von Tradition und Ehrwürde, waren die neumodischen Bibelsprüche, die in aufdringlichem Bunt oder in ihren Begräbnisfarben von Silber und Schwarz überall an den Wänden hingen, wo sie die Blicke einfingen und ihren Segen in die Gemüter zu leiten versuchten. Den Eintretenden grüßte der apostolische Segen, dem Platze des Gastes am Speisetisch gegenüber wurde der Herr Jesus eingeladen, die Mahlzeiten zu segnen, über dem schmalen und hochlehnigen Sofa, das wie eine hagere Jungfer jede Behaglichkeit mit energisch gespreizten Lehnen und Beinen von sich abwies, war der Spruch angebracht: »In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden.« Ein kleines leichtfertiges Hausmädchen, das längst entlassen war, hatte früher einmal zu Anne-Dore gesagt, daß dieser Spruch sehr gut über das harte Sofa passe, das einen bösen Charakter hätte und jedem Wesen Angst einflößte. Anne-Dore mußte oft daran denken, wenn sie in gemächlichem Frohsinn des Morgens den Staub aus den polierten Verschnörkelungen der hartgepolsterten Lehnen wischte. Der runde Spiegel mit verblichenem Goldrahmen war sehr hoch und derart angebracht, daß niemand hineinschauen konnte. Frau Berta Wendel hatte gemeint, ein Spiegel verführe zu müßigem Aufenthalt, nur weil man ihn hätte, sollte er seinen Platz im Zimmer haben. Sie war in solchen Dingen von einer schleppenden Entschiedenheit und setzte ihre Meinungen durch. Hoch über ihm, schräg gegen die dunkle Tapete, hing in silbernen Buchstaben, die von rosigen Blümchen durchwunden waren, das Wort des Apostels Paulus: »Wir sehen jetzt in einem Spiegel in einem dunklen Wort, dann aber von Angesicht zu Angesicht.«
Nein, diese Fülle bereitwilliger Gaben aus der Glaubenswelt ihrer Eltern hatte Anne-Dore nie recht behagt. Die Sprüche hatten im Laufe der Jahre durch die Gewöhnung längst ihren Geist und Sinn für sie verloren, doch sie empfand etwas wie eine Widrigkeit gegen das Wesen des würdigen, schönen Wohnzimmers. Aber ihre zaghaften Einwände wurden vom Vater mit der Begründung widerlegt, daß ein Herz, das recht zu seinem Heiland stünde, von solchen Kleinigkeiten nicht berührt werden dürfe.
Sein eigenes Zimmer war grau und nüchtern. Die Wände waren durch hohe schlichte Bücherregale verdeckt, deren Bände von grünlich-grauen und mürben Vorhängen verhüllt waren. Sein großer Schreibtisch nahm fast die ganze Schmalwand ein, in der das Fenster den Blick in den blühenden Garten führte, der Sessel war praktisch und hart. Der segnende Christus von Thorwaldsen sah auf die mühsame und zwecklose Geistesarbeit dieses braven Mannes nieder, der für sein Leben gern die Kräfte und die Gaben besessen hätte, seinem Herrn und Heiland in Amt und Würden zu dienen. Die Verhältnisse seines Vaterhauses hatten ihm jedoch sein Studium nicht erlaubt, und so war er früh mit einer dürftigen Bildung und einem opferfrohen Sinn als Missionar unter die Heiden gezogen. Sein Inspektor hatte ihm dann nach Jahren auf seine Bitte hin eine Frau ausgesucht und zur Gattin hinausgesandt. Berta Behneke hieß sie, mehr wußte er nicht von ihr. Dieser Name stand in einem Brief, der ihm die Abreise seiner zukünftigen Frau ankündigte, und er nahm sie hin, im Vertrauen auf seinen Inspektor und auf seinen Gott, dessen Willen er diese Führung zuschrieb. Anne-Dore war ihr einziges Kind geblieben, denn seine Frau erkrankte kurz nach der Geburt der Kleinen, da sie das tropische Klima nicht ertrug und er mußte um ihretwillen seinem Berufe bald entsagen. Es ergab sich nach dem Tode seiner Schwiegereltern, der kurz darauf erfolgte, daß ein kleines Vermögen vorhanden war, von dem das Häuschen erbaut werden konnte, das sie nun bewohnten. Auch blieb außer einer geringen Pension der Missionsgesellschaft noch genug übrig, um sie vor drängenden Sorgen zu schützen und die Verwaltung eines Waisenhauses, sowie mancherlei andere Arbeiten im Weinberge des Herrn sicherten Herrn Wendel und seiner kleinen Familie ein bescheidenes Auskommen.
Vielleicht waren es die beschränkten Mittel, vielleicht auch eine übertriebene Besorgnis den Gefahren der fremden, großen Welt gegenüber, daß Herr und Frau Wendel sich nicht entschließen konnten, Anne-Dore für einige Zeit aus dem Hause zu geben. Es boten sich mancherlei Gelegenheiten, aber über zögernden Erwägungen wurden sie verpaßt, und Anne-Dore drängte eigentlich ihre Eltern nicht, da sie keine Abwechslungen begehrte und ihre Heimat liebte. Wohl träumte sie zuweilen von einem andern Leben voller Farben, Glanz und irdischer Freuden, aber ihre durch geduldige Gewohnheiten tiefbegründeten Anschauungen ließen ihr solche Begierden als unziemend und anmaßend erscheinen. Sie hatte kürzlich die Erlaubnis erhalten, einem Vortrag beizuwohnen, der durch eine Fülle von Lichtbildern aus dem Süden Italiens, von den Inseln Capri und Sizilien bereichert wurde. Sie sah dieses üppige und glanzvolle Leben an sich vorüberziehen, die strahlenden Toiletten der beglückten Frauen und Mädchen, für die es solche Herrlichkeiten auf Erden gab, und ihre Gedanken führten sie zuweilen in dieses Land hinüber, an der Seite eines geliebten Mannes, sorglos, frei, ganz in Sonne gehüllt, und dem Grau des Elternhauses für alle Zeit entrückt. Aber diese Sehnsucht schmerzte nicht, sie vertrieb die Zeit und lockte in die Zukunft, im Grunde waren es andere Dinge, die ihr Innenleben ganz in Anspruch nahmen und ihre Stirn in gestaltlose Träume senkten. Aber sie verbarg das Weh ihrer heimlichen Erfahrungen und all ihren Drang nach neuen Klarheiten und Erkenntnissen lange tief in ihrem eigenen Herzen, in einer fruchtbaren und ernsten Geduld, aus der ihre schwerblütigen Hoffnungen lichtlos emporblühten.
Oft, in einer schmerzhaften Ratlosigkeit suchten ihre Blicke im Angesicht des Heilands, aber unberührt und still schaute sein Leidensantlitz über ihre einsamen Kämpfe hin. Und sie fühlte dann wohl, daß die nächtlichen Geheimnisse ihres jungen Körpers und alle drängenden Erwartungen, die sie mit sich brachten, dies heilige Bild befleckten. Sie weinte und verstand ihre Tränen nicht, bis sie sich endlich nach einem verzweifelten Kampf gegen ihren brennenden Stolz in großen Ängsten ihrer Mutter vertraute. Das milde, überlegene Lächeln voll lauer Güte, das ihr dankte, empörte sie bis auf den Grund ihrer Seele. Sie wünschte sich inbrünstig, alles in frechen Lügen widerrufen zu können, aber die Mutter kam ihr umständlich zuvor und klärte sie darüber auf, daß dies eine Strafe sei, mit der Gott alle Mädchen und Frauen züchtige und daß ein geduldiges Ertragen dieser Heimsuchung den Herrn versöhnen würde, dessen heiliges Blut die Menschen von allen Sünden reinwüsche.
Von diesem Tage an haßte Anne-Dore ihre Mutter. Sie verteidigte ihr Herz eigensinnig gegen die Bitternis dieses Gefühls, das brennend emporstieg, aber sie verschloß sich mehr als je und es kränkte sie hart, daß nichts dies geschenkte Vertrauen rückgängig machen konnte.
Draußen blühte die Welt. Anne-Dore flüchtete in dieser Zeit häufiger und oft für viele Stunden in die ruhige Pracht der heimatlichen Heide. Auf verlassenen Wegen, die niemand kannte, ließ sie sich mit einem Buch am Waldesrand nieder, versank im Summen der Bienen in tiefe, warme Gedanken und überließ sich ganz dem goldenen Willen der Sonne. Oft konnte sie lange Zeit dem bedächtigen Gang eines Käfers durch die Sträucher des Heidekrauts folgen, befriedigt und beglückt, aber zuweilen überfielen sie seltsame und fremdartige Gelüste, wie mit einem heidnischen Lachen und doch in einem tiefen Zusammenhang mit allem Drängen und Werden in der Natur, das um sie her glühte. Anfangs widerstand sie furchtsam und gequält, aber je mehr sie empfand, daß kein Sonnenstrahl darüber seine Herzlichkeit, kein Schmetterling seine leichte, selige Farbenpracht verlor, um so mehr folgte sie sorgloser und sorgloser ihren Wünschen. Sie entkleidete sich und legte sich nackt in die Sonne, lachte fröhlich, wenn ein Schmetterling sich ihre kleine, weiße Brust zur Rast ersah und überließ dem Wind und dem Spiel der Gräser und Heidezweiglein ihren jungen Körper. Eine Herzensscheu von unaussprechlicher Keuschheit ließ seine Geheimnisse ruhn, ihr erschien gut und rein, was sie erkannte und sie ergab sich demütig und begierig der blühenden Vollendung, die ihm geschah.
Um diese Zeit war es, als eines Morgens Herr Wendel seine Tochter mit einem vielsagenden Lächeln beim Morgenkaffee begrüßte. Anne-Dore verhielt sich seinen neckischen Scherzchen gegenüber meist in etwas abwartender Reserviertheit, diesmal hatte sie aber sogleich den Eindruck, daß es sich um etwas Besonderes handeln müsse. Sie nahmen das Frühstück an den warmen Frühlingstagen, die es schon gab, des Morgens auf der kleinen Veranda ein, in die man vom Wohnzimmer aus gelangte und deren Seiten hellgrüne, durchsichtige Wände aus Efeu und Wein bildeten. Eine schmale Holztreppe führte in den Garten.
Dore setzte sich erwartungsvoll, die Mutter fehlte noch, wie meistens, denn sie schlief häufig des Nachts nicht und versäumte dann selten, die verlorene Ruhe den Morgen hindurch nachzuholen. Es war klarer Frühsonnenschein, die Sperlinge schrien am Dach und Hähne krähten in der blühenden Ferne. Es kam kühl, ein wenig taufeucht und duftend vom Walde herüber zu den beiden.
»Nun?« fragte Dore und goß ihren Kaffee ein.
Die milde weiße Hand des Vaters lag gewichtig auf einem geöffneten Brief, dessen Ecken unter seinen Fingern hervorschauten.
»Wir erhalten Besuch,« sagte er.
»Tante Helene?« fragte Dore enttäuscht.
»Nein, Kind, hör einmal zu.« Und dann begann der Vater umständlich zu berichten, er und die Mutter hätten sich immer schon gesagt, daß das schöne Fremdenzimmer gar nicht so recht zu seiner verdienten Geltung komme, und da sich nun gerade durch die Empfehlung einer lieben und befreundeten Familie Gelegenheit geboten, hätten sie ein Anerbieten angenommen und würden für die kommenden Monate einem jungen Kandidaten der Theologie ihr Haus öffnen.
»Was will der hier?« fragte Dore.
»Kind,« beschwichtigte der Vater die leise Herausforderung, die er in der Stimme seiner Tochter zu finden glaubte, »du weißt, wir müssen ein wenig rechnen und wie die Dinge nun einmal liegen, nicht daß ich unzufrieden wäre, aber der Mutter käme die kleine Pension, die solche jungen Herren zahlen, recht zustatten. Er will sich hier in ländlicher Ruhe auf sein Examen vorbereiten und ich hörte, er sei ein braver und charakterfester Jüngling.«
»Wie heißt er denn?« fragte Dore, etwas versöhnlicher gestimmt.
»Helferich Friedberg ist sein Name. Ich glaube wenigstens ... wenn ich mich nicht irre ...« Und er blätterte das Schreiben hin und her, bis er bestätigen konnte: »Helferich Friedberg, ja.«
Dore rührte ihren Kaffee um, schwieg eine Weile und meinte dann gelassen, wie sie fast immer war: »Helferich? Was ist das für ein Name?«
»Kind, der Name tut doch nichts zur Sache, wie? Ich habe ihn zwar auch noch nicht gehört, aber ...« Das lächelnde Kinn des Vaters neigte sich schräg über seinen Teller nieder und er meinte mit einem milden Handschlag auf die Tischdecke: »Mir scheint, für einen jungen Seelenhirten ist er ganz geeignet.« Er stellte sein Lächeln etwas befangen ein, da Anne-Dore es nicht teilte. »Und Friedberg?« meinte er dann ein wenig unsicher.
»Friedberg geht an«, urteilte Dore.
»Nun, siehst du, mein Töchterchen, und ich hoffe, du wirst dich in die kleine Veränderung fügen, die unserem Hause geschieht. Ich hege die zuversichtliche Hoffnung, daß es beiden Parteien zum Segen ausschlagen wird.«
Dore wollte noch allerlei fragen, aber sie unterließ es, sie klingelte dem Mädchen zur Morgenandacht, und als die drei über dem Bibelkapitel, das für diesen Tag bestimmt war, still um den Kaffeetisch herumsaßen, stieg draußen aus der glitzernden Heide eine Lerche in den sonnigen Himmel empor.
Und während Dores Gedanken dem neuen Gast des Hauses mißtrauisch entgegengingen, hörte sie die Stimme ihres Vaters lesen:
»Aber Gott ist treu, der euch nicht lässet versuchen über euer Vermögen, sondern macht, daß die Versuchung so ein Ende gewinne, daß ihr's könnt ertragen.«
Eines Mittags, als Anne-Dore von ihrem gewohnten Heidegang zurückkehrte und den Feldweg an den letzten Büschen ihres Gartens entlangschritt, sah sie durch die Zweige einen großen, schwarzgekleideten jungen Mann auf der Veranda ihres Vaterhauses sitzen. Sie blieb stehen, bog die Äste vorsichtig zur Seite und beobachtete, ob er ihr Kommen bemerkt hätte. Es schien nicht. Er saß ruhig da und schaute in den Garten. Anne-Dore betrachtete ihn neugierig. Sie sah ein sehr großes, weißliches und volles Gesicht mit einem mächtigen Kinn, das ganz unvernünftig weit nach unten ausholte und die kurze dicke Nase und die freundlichen blauen Augen in ihren Rechten zu beeinträchtigen drohte. Ein ganz schmaler, kaum sichtbarer Kragen machte sich unsicher am Halse zu schaffen und suchte mühsam eine Verbindung mit dem dicken schwarzen Gehrock, der nach allen Richtungen hin vom Körper abstrebte. Nur auf den breiten Schultern ruhte er gelassen, offenbar gewann er mit ihrer Hilfe seinen einzigen Halt. Am erstauntesten aber betrachtete das Mädchen die Beine dieses fremden Mannes, von denen eine so redliche Bescheidenheit ausging, daß sie gerührt ihr Köpfchen schütteln mußte. Es kam vielleicht nur durch diese verletzend unschuldige Haltung seiner beiden Füße, deren Spitzen sich derb und gesund näherten, während die beiden Fersen feindselig auseinanderwichen. Dabei berührten sich die Knie zutraulich und boten seinen breiten roten Händen bereitwillig eine Ruhestatt.
Das ist Helferich Friedberg, schloß Anne-Dore.
Nichts sprach gegen sein gutes Herz, aber sie freute sich doch darüber, daß ihr ein Zufall Zeit gelassen hatte, sich an den Anblick des neuen Hausfreundes zu gewöhnen. Wenn er so ganz plötzlich dagestanden wäre ..., dachte sie. Dann ging sie durch die Haustür hinein und wurde im Korridor vom Vater empfangen.
»Unser junger Freund ist gekommen«, sagte er ein wenig verlegen und ein wenig erregt. »Wenn du ihn begrüßen willst? Oder ...« Er sah über Annes Kleid hin, über ihre Figur, mit einem heimlichen Stolz, den er nicht wußte, und seine Blicke blieben an ihren Haaren haften. »Wie unordentlich du aussiehst«, sagte er.
»Ich ziehe mich zum Essen um«, meinte sie.
An der Treppe hielt er sie noch einmal an: »Höre doch, Kind, ich habe es dir immer schon sagen wollen, habe auch mit der Mutter darüber gesprochen, deine beiden Zöpfe kannst du jetzt nicht mehr gut tragen. Du mußt dir die Haare künftig aufstecken. Mutter meinte, auch schon wegen der hellen Sommerbluse wäre es praktischer. Wie?«
Anne-Dore blieb stehen.
»Heute kann ich es nicht mehr gut«, meinte sie zögernd und etwas betrübt. »Ich müßte erst Nadeln und Kämme kaufen.«
»Es eilt auch nicht so«, entschied der Vater, froh darüber, daß sie scheinbar so leichten Herzens von ihrer gewohnten Haartracht ließ. Eigentlich war es ihm selbst ein kleiner Kummer, denn Anne-Dores dunkles Haar war wunderschön und die beiden schweren Zöpfe reichten weit über die Hüften nieder und waren ihr kostbarer Schmuck.
Es war in der Tat Helferich Friedberg, der junge Kandidat der Theologie aus Pommern, der auf der Veranda des Wendelschen Hauses Platz genommen hatte und dort auf die Mittagsmahlzeit wartete. Er war einen Tag zu früh erschienen und eigentlich ohne genaue Anmeldung; es lag daran, daß seine gute Mutter daheim das Zimmer, das er bewohnt hatte, einen Tag früher brauchte, und in Missionar Wendels Zusagebrief hatte auch gestanden: »Sie sind uns täglich willkommen, junger Freund.« Er hatte seine Handkoffer selbst gleich mitgebracht, eine Kiste mit Wäsche und Büchern war auf der Bahn unterwegs. Gegen zehn Uhr fand er sich ein und wurde vom Hausherrn in sein kleines Zimmer gebracht, das gottlob schon hergerichtet war. Von dort hatte er sich nach flüchtiger Toilette ins Wohnzimmer begeben und die beiden Herren waren einander in längerem Gespräch nähergetreten. Herr Wendel nahm die Familieneinzelheiten mit Interesse entgegen, in allen Berichten hatte er eine schlichte und rechte Gesinnung zu finden geglaubt, und auch über die innerliche Stellung des Jünglings zu seinem Gott war er schon unterrichtet. Es hatte sich bei einer Gelegenheit, als der Gast vom Tode seines Vaters sprach, so gemacht, daß man das Gespräch unaufdringlich auch auf diesen Gegenstand bringen konnte, und Herr Wendel war in allen Stücken beruhigt und befriedigt. Er teilte dies auch erfreuten Herzens seiner Frau mit. »Man will doch gern wissen, mit wem man unter einem Dache schläft«, meinte er, und sie nickte mit einem weinerlichen Geräusch ihrer belegten Stimme und bekundete damit ihre Übereinstimmung.
Als man sich am Mittagstisch zusammenfand, wurde Anne-Dore vom Vater Herrn Friedberg vorgestellt. Er machte eine tiefe Verbeugung, die über die ganze Länge zweier niederhängender Arme unterrichtete, und die Manschetten sanken ihm auf die Handknöchel. Während des Tischgebets versuchte er sie wieder in die Ärmel einzuschachteln, was Frau Wendel mißfiel. Als dann alle saßen, füllte die Hausfrau die Suppenteller, und mit einem freundlichen: »Nehmen Sie vorlieb«, reichte sie dem Gast zuerst. Er wollte ihn an Anne-Dore weitergeben, aber leider hatte sein Daumen sich zu tief in den Teller gewagt, und er zog ihn deshalb der jungen Dame wieder fort und sagte: »Pardon«. Herr Wendel hoffte mit einem gefälligen Räuspern über diese kleine Unannehmlichkeit fortzuhelfen, was ihm sicher auch gelungen wäre, wenn nur Herr Friedberg gewußt hätte, ob er seinen benetzten Daumen in den Mund oder in die Serviette schieben sollte. Er entschloß sich für den Mund, da das blendende Weiß des frischen Leinens ihn abschreckte, lächelte befangen und schaute Anne-Dore an. Sie erwiderte sein Lächeln, um ihm zu helfen, und weil er ihr leid tat in seinem Ungeschick.
Was für ein freundliches Mädchen, dachte Helferich Friedberg und schaute von nun ab nur noch in das Gesicht des Hausherrn, der ihn in ein Gespräch zog. Es handelte sich um einen für die Gemeinde der Neustadt sehr wichtigen Fall, um die Besetzung der vakanten Pfarrstelle in der Nikolaikirche. Wendels rechneten sich dieser Gemeinde zu, und Herr Friedberg erfuhr, daß schon zwei Herren ihre Probepredigt gehalten, beide eigentlich ohne daß sie ein rechtes Wohlwollen gefunden hatten. Morgen war nun der Sonntag des dritten Bewerbers, eines noch jungen Pfarrers Jacoby, der sich von einer Kreisstadt aus hierher wählen lassen wollte.
Als der Name fiel, kam ein unerwartetes Leben in den Kandidaten.
»Jacoby sagten Sie? Sagten Sie nicht Jacoby?«
Missionar Wendel bestätigte es.
»Ich kenne ihn«, rief Friedberg und schwenkte die Hand. »Ich kenne ihn bestimmt. Oder«, fügte er hinzu, »es müßte ein anderer Pfarrer Jacoby sein.«
Die nächsten Einzelheiten ergaben, daß es in der Tat ein Bekannter war, nicht ein persönlicher Freund, aber er hatte ihn predigen hören. Herr Friedberg begeisterte sich ganz über Gebühr für diesen Mann. »Sie müssen ihn hören«, rief er immer wieder. »Es wäre ein großer Segen für unsere Gemeinde, wenn er erwählt würde.« Sonst wußte er wenig bezeichnende Eigenarten zu nennen, aber es war klar, daß diese Bekanntschaft großen Eindruck auf sein Gemüt gemacht haben mußte. »Ich verdanke ihm viel — alles sozusagen«, versicherte er zum Schluß.
Über der Abmachung, daß alle morgen zusammen den Gottesdienst besuchen wollten, ging man auf ein anderes Thema über. Anne-Dore sprach von den Schönheiten der Gegend, aber sie verriet keine besondere Liebe, sondern rühmte ihre rote Heide unbewußt nur soweit, als sie annahm, daß das gute Herz des neuen Hausfreundes sie würdigen könnte.
Sie ging an diesem Abend mißvergnügt und traurig in ihr Zimmer und wußte keine Erklärung für ihre tiefe Verstimmung. Nachmittags war sie mit dem Kandidaten im Wald gewesen, hatte ihr ruhiges Land und seine Wege preisgegeben, und während sie an dies und jenes dachte, hatte die etwas schnarchende, grobe Stimme des großen jungen Mannes sie ohne Aufhör in ihre matten Töne gehüllt. In der Abendsonne sangen Rotkehlchen und Finken, es glühte von rotem Gold hinter dem jungen Grün und auf den Zinnen ihrer lieben Berge. Ihr silberner Bach dämpfte im Wald die frische Stimme über der braunen Erde und den welken Blättern, frei und lieblich lud die Natur alle Herzen zu sich ein, aber Helferich Friedbergs derbe Schuhe benutzten ungefüge und breit die Wege, die durch sie hindurch führten, und er sprach immer nur von Pastor Jacoby und seiner Wirksamkeit. Ach, wie gern glaubte ihm das Mädchen alles, aber gab es nicht mehr, nicht tausend andere Dinge in der großen Welt, aus der er kam? Ihre Augen suchten in seinem ausdruckslosen und gutmütigen Gesicht, das immer »Pastor Jacoby« sagte. Nein, bei ihm gab es auch nur dies eine, das nun so lange schon ihre Welt bedrängte, und sie empfand etwas, das ihre jugendlichen Hoffnungen tötete, einen feinen Gram und die bitterliche Erkenntnis, daß noch für lange Zeit ihr nichts die stille und graue Welt verdrängen sollte, in der ihre Seele herangewachsen war.
Sie waren dann bald zur Ruhe gegangen, der Herr Kandidat nach manchem schlecht unterdrückten Gähnen, der Vater und die Mutter genau auf die Art, wie sie es schon seit vielen, vielen Jahren taten. Vorher wurde die Uhr aufgezogen, deren Stimme sich auch niemals änderte, und sogar der Schlüssel der Verandatür kreischte geduldig seinen alten Ton im etwas rostigen Schloß.
Nun war es Nacht. Anne-Dore hatte beide Flügel ihrer Fenster weit geöffnet und hörte auf den Wind. Unter den Sternen her kam er über die Heide, ließ ihrem klaren Glanz die ewige Stille und bewegte die Zweige der Bäume, so daß sie flüsterten und sich neigten. Hin und wieder fielen Blüten aus dem Kirschbaum lautlos und langsam auf den dunklen Rasen.
Die Morgensonne weckte Anne-Dore und der goldene Gesang eines Waldhorns hoch im Buchenwald der grünen Berge. Sie erwachte jäh und ohne Besinnen, richtete sich fast erschrocken auf, geblendet vom Glanz des Sonnenlichts und wie im Jubel eines großen unverstandenen Glücks. Wie schön war die hohe, warme, goldene Welt, — was gab es nur, was war geschehn? Langsam stiegen die Bilder des vergangenen Tages vor ihrer Seele empor. Nein, sie wollte sie nicht. Sie wollte allein dem angehören, was hier im Licht und im Gesang der Vögel in ihr Zimmer drängte. Sie hatte ein unendlich frohes Gefühl tiefer Zugehörigkeit an dies Neue und Frische, das der heraufsteigende Tag verkündete. Noch hatte keine Pflicht und kein Recht ihres nützlichen Tages die jugendliche Andacht dieses Herzens überredet. Sie warf die Haare heftig und in lachendem Zorn ihres Kraftbewußtseins in den Nacken zurück, sprang aus dem Bett und stellte sich in das Licht der Fenster. Sie sah die Sonnenstrahlen schräg auf das Dach der Veranda fallen, im Garten ruhten sie im Blühn, und unter den Bäumen auf den feuchten Wegen schritt schwarz und feierlich Helferich Friedberg, den Hut in der Hand und die Nase in einem kleinen, dicken Buch.
Wie das ernüchterte. Sie trat vorsichtig so weit zurück, daß nur sie ihn erblicken konnte, und erkannte mit leisem Schreck, daß er eine Brille trug. Ach Gott, dachte sie, auch das noch. Weniger froh kleidete sie sich langsam an, hatte aber doch das Gefühl, diesem guten Menschen etwas abbitten zu müssen. In diesen Dingen war ihr Vater groß. Er hatte für alles ein Einsehen, für jedes eine Entschuldigung, und nichts war seiner Güte zu gering. Immer bemühte er sich, bei den Menschen nur das Gute zu sehen und Schwächen in Liebe zu verdecken oder zu verzeihen.
Sie sah sich im Spiegel und zog langsam den Kamm durch die dunkle Fülle ihres schweren Haars. Sie lächelte sich im Spiegel an. Ihre Augen waren unnatürlich blau in diesem Reichtum von Licht.
Vielleicht hat er geringe Ansprüche, schloß sie zögernd weiter und sah in Gedanken das milde Lächeln ihres Vaters. Wie es quälte, solchen Gedanken folgen zu müssen, zu deren letztem Schluß sie weder den Mut noch die Erfahrung hatte. Ihr Herz drängte heiß nach Sicherheit und Erkenntnis, aber sie fühlte, schneidend und voll bittrer Angst, wie man Fesseln fühlt, daß ihr Blut in einen seltsamen Bann gesprochen war. Jedesmal nach solchen Stunden des Grübelns und Sehnens stieg eine Bitterkeit gegen ihre Eltern in ihr auf, die sie geflissentlich unterdrückte, und sie bemühte sich dann oft selbstquälerisch und voll Eifer in verdoppelter Liebe gegen sie gutzumachen, was ihr Herz an Schuld zu tragen glaubte.
Nun hörte sie die Glocken hinter den Hügeln, die ihr heimatliches Tal von der Stadt trennten. Ein undeutlicher, schwerer, summender Morgengesang. Die Dorfglocken von Hildenrot antworteten hell und harmlos. Sie dachte an das Forsthaus dort am Waldrand, sah aus dem Fenster über die Heide hin nach den Bergen und wünschte sich, dorthin zu dürfen, statt in die graue Stadtkirche mit ihren hundert fremden frommen Menschen.
Sie hörte dann die Stimme ihres Vaters im Garten, als sie die helle Bluse mühsam hinten zuknöpfte, sie zupfte sie über der Brust zurecht und wurde vor dem Spiegel ein wenig unsicher, als sie ihre Figur prüfte. Sie faltete die Hände an den Fingerspitzen, preßte sie auf ihre Brust und zog sie fest an den Körper, die weißen Zähne auf der Lippe. Es half nichts. Ich werde eine große Frau, dachte sie, gab ihrem Kopf eine gezierte und steife Würde der Haltung und blickte hochfahrend und ernst auf ihr Gesicht im Spiegel. Es ist wahr, dachte sie dann und senkte den Kopf nach hinten, die Zöpfe kann ich nicht mehr tragen. Sie wickelte sie leicht und prüfend um den Kopf, eine schwere dunkle Krone von mächtiger Fülle ruhten sie um ihre Schläfen, machten ihr Gesicht bleicher und kleiner und senkten feine blausilberne Schatten auf die bedächtigen Lider der reinen Augen.
Schnell ließ sie sie fallen und eilte zum Kaffee hinunter.
Sie hatten schon begonnen, als sie eintrat. Die Bibel für die Morgenandacht lag bereits neben dem Platz des Vaters. Helferich Friedberg erhob sich, als sie eintrat, kaute angestrengt und heimlich, während sie ihren Vater küßte, versuchte zu schlucken und mußte dann doch mit vollem Mund sein »Guten Morgen, gnädiges Fräulein« sagen.
»O o,« meinte der Vater, »wir lassen es besser bei einem einfachen Fräulein Wendel.« Und er schaute ein klein wenig strafend auf den Kandidaten, als wäre da mit ihm ein ganz falscher Ton in die Gemeinschaft ihres schlichten Familienlebens gedrungen.
Schade, dachte Dore, und wußte nicht recht, warum sie diese Änderung bedauerte. Er wird sonst am Ende zu weltmännisch, schloß sie ihren Gedanken, und ein ganz feines Lächeln, das niemand sah, huschte zu kurzer ungewohnter Rast über ihren kindlichen Mund. Sie mußte sich etwas beeilen und trank flüchtig ihren Kaffee, Herr Wendel schob dem Gast die Bibel in freundlichem Ernst neben den Teller und bat ihn, diese liebe Pflicht für heute zu erfüllen. Es lag wohl etwas Respekt vor dem studierten Manne in seiner Aufforderung und doch auch die Herablassung eines, der aus Brüderlichkeit und Bescheidenheit gern auf ein Vorrecht Verzicht leistet.
Herr Friedberg kämpfte in diesem besonderen Fall seine Befangenheit mit Erfolg nieder. Hier spielte etwas in seinen Beruf hinüber und streifte den Gang seiner heiligsten Pflichten. Er forschte bescheiden:
»Ich weiß nicht, wie Sie es in Ihrem Hause zu halten pflegen, Herr Missionar.«
»Folgen Sie ganz Ihrem Herzen«, sagte Herr Wendel und lächelte und nickte ermutigend. »In diesen Dingen gibt es kein Gesetz, und wir wollen dankbar sein, wenn Sie uns eine neue Art zeigen, in der wir vor den Herrn treten können.«
Anne-Dore wurde dunkelrot. Ihr Zorn, als sie es fühlte, änderte diese verräterische Erscheinung nicht zugunsten. Niemand sah es. Herrn Friedbergs breite Finger suchten am Goldschnitt, er besann sich, schlug dann kurz entschlossen im Neuen Testament eine beliebige Stelle auf und suchte seine Brille.
»Wollen Sie das Losungsbuch?« fragte Herr Wendel.
Friedberg schüttelte nur den Kopf, denn er war schon im Bann seiner Pflicht, deren Erfüllung ihn ganz erheischte. Er las ein Kapitel des Apostel Paulus an die Römer, in dem er einer langen Reihe von Gemeindemitgliedern Grüße bestellen ließ. Anne-Dore hörte all die fremdartigen und sonderbaren Namen, die sie wenig erbauten. Der junge Mann las mit tiefem Ernst und einer singenden Eindringlichkeit, als wäre jede Zeile von großer Wichtigkeit und voll tiefer Weisheit. Dann betete er das Vaterunser, und als er Amen gesagt hatte, schaute er Anne-Dore an. Er klappte die Bibel zu, ohne seine Erleichterung zu verraten, und der Brille wurden ihre beiden Nickelflügel über den gläsernen Leib gelegt, so daß sie in das Etui paßte, das nicht mehr ganz neu und innen mit hellblauem Papier beklebt war.
Es war spät geworden, und man mußte sich für den Kirchgang beeilen. Frau Wendel war nicht erschienen, und so zogen die drei anderen miteinander über den niedrigen Berg in die Stadt, durch den Morgensonnenschein und durch den Gesang der Vögel. Es war eine gute halbe Stunde Wegs, und man fürchtete, daß die Kirche sehr voll sein würde, bei einer so wichtigen Gelegenheit, wie es eine Probepredigt war. Anne-Dore ging zwischen den beiden Herren, hin und wieder trat der Kandidat zurück und ließ ihr auf dem schmalen Weg den Vortritt, aber für gewöhnlich sah sie neben sich diese dunklen, dicken, steigenden Beine und den melancholischen Fall der langen, schwarzen Sonntagsröcke. Man sprach wenig. Anne-Dores Empfindungen waren matt und geteilt, keine sonderliche Erwartung hielt sie im Bann, es würde sein wie immer. Vielleicht war die Predigt wirklich ein wenig unterhaltender, vielleicht blieb der Herr Pfarrer auch in seiner Rede stecken. Aber nein, das war wohl nicht anzunehmen, obgleich sie es oft gefürchtet hatte und manchmal sogar heimlich gewünscht, nur damit ein wenig Leben in die alten Wahrheiten der Kanzel käme, die so gar nichts Neues in ihr Dasein bringen konnten.
Sie hielt erschrocken in ihren Gedanken inne. Der Versucher geht dicht neben mir und raubt mir die Andacht und die rechte Stellung des Herzens, fürchtete sie. Dann stellte sie sich vor, der Satan habe die Gestalt des Herrn Helferich Friedberg angenommen, sie wußte, daß er in vielerlei Gestalt die Herzen versuchte, aber als die Füße ihres Nachbarn wieder neben ihr auftauchten, stellte sie heimlich fest, daß solche Stiefel, wie er sie trug, stets den rechten Weg gingen. —
Die Kirche war überfüllt, und es war kein Gedanke daran, einen Platz zu finden. Zwar forschte Herr Friedberg eifrig hier und dort, um wenigstens für Anne-Dore ein Plätzchen ausfindig zu machen. Er tat es mit der Sicherheit eines, der im eigenen Hause schaltet, aber seine selbstlosen Bemühungen erregten nur Unwillen und störten. So stellten sie sich denn nebeneinander an eine breite Säule dicht am Ausgang, das junge Mädchen mit dem Rücken gegen die getünchten Steine, die ihr ein wenig Halt boten. Gerade in den bunten Farbwegen standen sie, die das Sonnenlicht durch die hohen Fenster nahm, rote, blaue und goldene Kreise malten sich in Anne-Dores Kleid. Sie neigte den Kopf und schloß die Augen, bis ihr Friedberg die Nummer des Liedes zuraunte, das gesungen wurde. Herr Wendel flüsterte seinem Gast ins Ohr, sie hätten sonst hier eigene und feste Plätze, aber die Bänke seien heute für die Kirchenältesten reserviert, die über die Wahl des neuen Pfarrers entscheiden sollten. Dann setzte die Orgel ein, milde und als wollte sie die Bewegung und die dämmerigen Geräusche beschwichtigen, die stets von einer feierlich versammelten Menge ausgehen, wie der Odem einer gedämpften Erwartung.
Nun brauste das Lied voll befreiender Inbrunst durch das breite Schiff der alten Kirche:
Steil und dornig ist der Pfad,
Der uns zur Vollendung leitet.
Selig ist, wer ihn betrat
Und im Namen Jesu streitet.
Die ernste Feierlichkeit nahm auch Anne-Dore in ihren Bann. Neben ihr behauptete sich Friedbergs Stimme. Er verschwand für sie in dieser bewegten Menge, wurde das unpersönliche Glied in einer Gemeinschaft Gläubiger und verlor für sie darüber seine armselige Körperlichkeit. Ihm dagegen, der heimlich auf sie hinschaute, erschien das Mädchen seltsam verschönt und verklärt. Er empfand eine Gemeinschaft und eine Übereinstimmung mit ihr, die sie einander geschwisterlich näherte. Das schöne farbige Licht auf ihrem geneigten Scheitel und ihrem weißen Kleid tat dazu das Seine, und er fühlte sich eigenartig beglückt und wundervoll geborgen unter den Menschen.
Es war das zweite Lied. Der Altardienst war schon beendet, die Predigt stand bevor, und vom dritten Vers ab wandte die Aufmerksamkeit der Andächtigen sich der kleinen Tür in der Sakristei zu, durch die Pastor Jacoby kommen sollte. Anne-Dore konnte dorthin nicht sehen, sie erblickte den Pfarrer erst, als er langsam und scheinbar tief in Gedanken die offene Treppe zur Kanzel emporstieg. Dort sah sie ihn nur kurz und undeutlich, denn er kniete sogleich nieder, um zu beten und sie sah nur seinen Scheitel, der dunkelblond und schlicht über dem schweren Samt der großen Bibeldecke lange still und unbeweglich im matten Licht der Kirche ruhte. Als er sich aufrichtete, sang die Gemeinde den letzten Vers, und Anne-Dore hatte Muße, das Gesicht des Geistlichen zu betrachten. Seine Augen lagen im Schatten der sehr bleichen Stirn, und ein dunkler Bart verdeckte klein und weich den Mund und das Kinn. Die gerade Nase war von vornehmem und fast zartem Schnitt. Seine Blicke glitten ruhig über die Versammlung hin, verweilten hier ein wenig, dort einen Augenblick, gelassen und klug, in einem Prüfen, das fast etwas Trauriges hatte. Anne-Dore fand dies Gesicht sehr schön.
»Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von des Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen.«
Was war das für eine Stimme? Anne-Dores Herz erzitterte vor der Inbrunst und Eindringlichkeit, die diese Worte mit unendlich klarer Selbstverständlichkeit in die Halle der Kirche sandten. Der Pfarrer hatte sie ohne Ankündigung und ohne die Stelle zu nennen, in der sie in der Bibel standen, plötzlich in die große Stille der Wartenden hineingerufen. Mit heller, fast leidender Stimme und doch mit so ehernem Nachdruck, als hinge Leben und Tod von ihrer Wahrheit ab.
Alles war ungewöhnlich, das Niederknien auf der Kanzel, der unvermittelte Text und dies Warten nun. Dies Warten, das kein Ende nehmen wollte. Anne-Dore schlug in heißer Angst die Augen nieder. Er weiß den Anfang nicht, dachte sie und zitterte. Die Unruhe aller Herzen wuchs, wurde qualvoll, man hörte die Stille des gefüllten Gotteshauses wie ein Sausen. Anne-Dore schaute hinauf, und als sie nun sein Gesicht sah, wußte sie plötzlich, tief ergriffen, und still bis auf den Grund der Seele: Er weiß den Anfang.
Und nun begann er, fast zu leise und sagte nur die Worte: »Herr Jesus, sei mitten unter uns.« So begann er sein Gebet. Anne-Dore konnte keinen Blick von ihm wenden, während er sprach. Sie hatte nie ein Gesicht gesehen, so zermartert von Sehnsucht und Gram, so entstellt von Inbrunst. Seine Hände krampften sich so ineinander, daß sie weiß wurden, sie schaukelten hin und her und auf und nieder, als rängen sie miteinander, als wollten sie nicht ein Tröpflein Blut mehr in sich dulden. Es war, als schaute er voll hinein in das Angesicht des Heilands, als sähe er das Blut unter der Dornenkrone des Gekreuzigten niederrinnen, als habe er Macht, den Geist seines auferstandenen Gottes in dies Haus zu beschwören, als hoffe er auf eine Antwort, als er rief: »Herr, höre mich, wie ich dich zu uns rufe.« Nach dem Amen sank seine hochaufgereckte Gestalt mit einem tiefen Seufzer der schwachen Brust zusammen. Er legte beide Hände um die Bibel und begann seine erste Predigt an die Gemeinde der Nikolaikirche.
Die Menge war wie in einen Bann gesprochen. Anne-Dore zitterte und stützte sich an ihren Vater, der seinen grauen Kopf schüttelte in tiefem Erstaunen, in Abwehr und Zweifel, ja fast wie in Besorgnis. Niemand rührte sich. Es war, als wäre nach diesem Gebet die Person des Heilands gegenwärtig, jeder glaubte heimlich ihn neben sich zu wissen. Man wartete wie auf ein Wunder, auch die Gleichgültigsten harrten beklommen. Was waren das für neue allmächtige Worte? Wer war die Gemeinde der Heiligen, von der es dort oben hieß, sie würden mit Christus herrschen tausend Jahre? Seit wann war es notwendig, seinen Gott von Angesicht zu Angesicht zu kennen, zu wissen, ob man seiner Gnade teilhaftig war oder nicht? Wie Flammen sengten diese Worte sich in die erschrockenen Herzen, Anne-Dore hatte niemals geglaubt, daß eine so leuchtende Gewalt der Sprache auf der Menschenerde möglich sei. Die Worte Jesu Christi gewannen durch diese bleichen Lippen, durch die verzehrende Inbrunst dieser Glaubenszuversicht ein ganz neues Leben. Welch tiefen Sinn von zerschneidendem Ernst und edler Hoheit bekamen plötzlich die Worte der Apokalypse: »Ach, daß du kalt oder warm wärest! Weil du aber lau bist, und weder kalt noch warm, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde.« — Wie ein Triumph ewiger Wahrheiten leuchtete es von dieser schmerzvollen Stirn.
Es wurde still. Dann klang das Amen leise und menschlich einfach, die Orgel setzte ein. Immer noch lag dort oben der Mann auf den Knien, als schon die ersten Verse zaghaft und bedrückt, in ganz neuer Scheu, und wie veränderten Sinnes erklangen. —
Auf dem Heimwege war Kandidat Friedberg in jeder seiner Bewegungen und im Gehabe all seiner gewaltsam bescheidenen Sätze nur die eine herausfordernde und rechtsfrohe Äußerung: Was habe ich gesagt? Habe ich es nicht gesagt?
Missionar Wendel hatte seine Brauen vorsichtig gelichtet, mit festgeschlossenem Mund und beruhigten Blicken, die nicht wanderten, meinte er nur: »Der Mann ist noch sehr jung. Ich kenne diesen Erweckungseifer und kann meine Sorgen nicht ganz von der Hand weisen. Aber Gott wird zulassen, daß alles nur zum Segen ausschlägt. Er wird wohl gewählt werden.«
Anne-Dore ging still und tief ergriffen zwischen beiden. Bei den Worten ihres Vaters hatte sie den bestimmten Eindruck, als redete er von einem ganz anderen Gott als jener Mann auf der Kanzel, der den Heiland der Menschen im eigenen Herzen erlitten, der ihn liebte und für ihn ein Streiter ohne Furcht und Zögern war. Ihr guter Vater sprach von seinem alten braven Hausgott, der ganz grau geworden war von lauter verbrauchter Güte, die man täglich soweit annahm, als man sie gerade nötig hatte; aber die Worte dessen, der ihr Herz in Feier hielt, kamen aus einer Seele, tief geneigt und geheiligt durch den Martertod des Herrn Jesu Christi. »O, daß du warm wärest oder kalt«, klang es in ihr nach, und ihr Herz glühte. Mit einem feinen schmerzlichen Lächeln voll geheimer Seligkeit verloren ihre Blicke sich im Sonnenschein und im warmen Wind. Sie fühlte sich zu neuen Kämpfen, zu neuem Wesen wunderbar bestimmt, bereit und allein. Ihr war zumut, als habe sie im Halbschlaf auf den Tag geharrt und auf ein neues Licht. »Ströme lebendigen Wassers«, sagte sie ganz leise nur mit den Lippen.
Neben ihr sprach Friedberg, und über sie hin, mit ihrem Vater. »Ich versuche mir in diesen Fragen einen offenen Sinn zu bewahren«, meinte er, »Prüfet alles und behaltet das Beste. Solange man wie ich in einer Zeit des Lernens und Werdens steht, ist einem jede Abart der Auffassung willkommen, und ich bin unbesorgt, es wird alles zu meiner Erziehung dienen.« Er betrachtete Dore, während er sprach, besorgt, daß sie ihm zuhörte.
Missionar Wendel schien durch diese Worte beruhigt. Er sprach lauter und scheinbar fröhlicher. Nur hin und wieder glitten seine Augen über die Züge seines Kindes, und er wußte nicht, daß etwas wie eine ganz feine, leise Eifersucht in seinem alten Gesicht stand, das immer gütig und fast ein wenig traurig erschien, wenn Anne-Dores Angelegenheiten ihn besorgt machten.
Die häuslichen Pflichten ernüchterten das junge Mädchen seltsam. Am liebsten hätte sie sich in ihr Zimmer zurückgezogen, wäre jedem ausgewichen, um sich ganz, rasch und auf einmal mit allem abzufinden, das ihr Innerstes bestürmte. In ihr war von je ein seltsam bestimmtes Bedürfnis, im Haushalte ihrer Seele Ordnung zu wahren, Unsicherheit und ein halbes Bewußtsein waren ihr qualvoll. Sie konnte sich krank fühlen bis zu einem Hang ins Schwermütige, wenn ihrem Suchen eine Klarheit versagt blieb. Sie war den Tag hindurch wie auf der Flucht. Die Fragen ihrer Mutter machten sie zornig. Ihr Wunsch, freien Herzens das Empfangene weiterzugeben, selbstlos, froh und schwesterlich, rang heiß mit ihrem Stolz und ihrem Bedürfnis, Empfundenes im Herzen zu bewahren. Sie weinte sich abends in Schlaf. —
Im Traum stand Friedberg vor ihr, suchte mit den dicken, weißen Fingern am Goldschnitt der Bibel und las endlich mit seiner geruhsamen Stimme, die immer etwas mit Heiserkeit kämpfte:
»Wer aus der Wahrheit ist, der hört meine Stimme.« —
Es war kein Zweifel, durch wen die Pfarrstelle der Nikolaikirche besetzt wurde.
Mit dem Einzug Pastor Jacobys in die Stadt brach eine neue Ära im Geistesleben ihrer Bewohner an. Soweit die beiden alten, schlichten Türme der Nikolaikirche Ort und Land überwachten, vollzog sich in den Herzen aller Beteiligten eine seltsame Wandlung. Aber nicht nur die Gemeinde der Gläubigen wurde von ihr betroffen, sondern die neuen Regungen griffen weit um sich und zogen auch Außenstehende und Unkirchliche in ihr umstrittenes Interessengebiet. Eine ganz neue Bewegung erhob sich, trennte entschieden und schroff die Gemeinde in zwei Parteien, und es schien, als sollten die neuen Glaubensgewißheiten in ihrer Wirkung bis in das intimste Familienleben die Worte Christi seltsam bewahrheiten: »Ihr sollt nicht wähnen, daß ich kommen sei, Frieden zu senden auf die Erde. Ich bin nicht kommen, Frieden zu senden, sondern das Schwert.« Und als einmal gar nach einer Predigt von einschneidendem Ernste das Bibelwort: »Wer Vater und Mutter mehr liebt, denn mich, der ist mein nicht wert; und wer Sohn oder Tochter mehr liebt denn mich, der ist mein nicht wert«, die Herzen entzündete, schien der Verwirrung kein Ende mehr. — Die ersten Wochen hindurch wurde die Kirche gestürmt, die Geistlichen der anderen Gemeinden sprachen vor leeren Bänken, nur alte Leute behaupteten dort noch im Halbschlummer die gewohnten Plätze. Dann räumte eine verständliche Reaktion, die in Haß ausartete, die Nikolaikirche aus. Aber langsam begann sie sich wieder zu füllen, und eine gefestigte und scheinbar unerschütterliche Glaubensgemeinschaft verband die Andächtigen unter dieser Kanzel. Man nannte sie die »Gemeinde der Heiligen«, aber sie ertrugen Spott und Geringachtung mit dem glücklich ergebenen Lächeln Geborgener und Erlöster. Ihr innig und aufrichtig geschlungener Bund und seine Schicksale erinnerte in vielen Erscheinungen an die ersten Gemeinden der Apostel in Rom und Griechenland. Man empfand Grauen und Ehrfurcht, ihre geduldige Heilandsliebe peinigte und forderte rohen Widerspruch heraus. Ja, es kam zu Tätlichkeiten und die Polizei mußte einschreiten. Pastor Jacobys Ruf drang weit über die Grenzen der Provinz ins Land hinein. Es schien, als sei das Bibelwort seiner ersten Predigt zum Wahlspruch und Kampfruf erhoben: »O daß du kalt oder warm wärest. Weil du aber lau bist, und weder kalt noch warm, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde.«
Wenig Herzen durchlitten alle tiefinnerlichen Wandlungen so inbrünstig, so ganz der neuen Wahrheit ergeben und so aufrichtig wie Anne-Dores. Ihre neue Frömmigkeit hatte nichts mehr gemein mit jener kleinlichen Beschränktheit von Menschen, die ihren Glauben als eine Schranke vor ihrer Dürftigkeit, ihrer Armut und ihrer engherzigen Selbstsucht aufrichten. Das ruhige und feste Glück ihrer reinen Augen wich jedem falschen Schein und aller Knechtschaft einer niedrigen Demut aus. Es ging ein Glanz von großer und freier Liebe mit ihren Schritten aus, ohne Dünkel und kleine Maße, warm, aus Freude und wie aus lauter Licht. Ihr Wesen schien völlig verändert und wollte es weder wissen noch verkünden, es war, als erkämpfte für sie ein neuer Streiter Klarheit und Erkennen in alle Finsternis ihrer suchenden Seele, deren Flügel auftauchten in die verborgenen Seligkeiten und Geheimnisse einer zukünftigen Welt. Ja, es war im Laufe der kommenden Zeit so, als teilte sich ein Schein dieses neuen Glücks, in dem ihr Wesen ruhte, auch ihrem Äußern mit. Ihr Gesicht wurde schmaler und bleicher, ihre Bewegungen von jener leichten Scheu weltfremder Hoheit und von einer Anmut, für die es keinen irdischen Namen gibt.
Handlungen und Lebensgewohnheiten, die sonst allein durch den tiefbegründeten und eingeborenen Geschmack eines reichen Herzens ihren Adel gewinnen, stellten sich bei ihr ein, als schlüge ein neues Herz in ihrer Brust. Als habe eine neue Kraft, voll unergründlicher Schönheit, sie eng und wie an Kindes Statt in den edlen Gang ihres Waltens gezogen, sie ganz für sich genommen und herrlich bereitet für eine glückselige Zukunft.
Herr und Frau Wendel sahen die Veränderung nur in ihrer Wirkung, die bis in die kleinsten Einzelheiten der nüchternen Tage reichte. Ihre anfängliche Besorgnis wich einer frohen Bewunderung. Die neue und stille Freude, die das Wesen ihres Kindes verklärte, warf ihren Schein auch über ihre Stunden, beglückt und zuversichtlich dankten sie ihrem Gott. Da Anne-Dore niemals über ihre inneren Erlebnisse und über die Seelenvorgänge sprach, die sie bewegten, niemals einen Versuch machte, jemanden anders als durch ihr Tun von der Schönheit dessen zu überzeugen, dem sie diente, blieb ihre Welt unangetastet wie ein Heiligtum.
Einen tiefen Eindruck hinterließen diese Erscheinungen, die sich durch Wochen hindurch vollzogen, auch bei Helferich Friedberg. Anfänglich gab er dem unklaren Drang seiner geteilten Gefühle Anne-Dore gegenüber Ausdruck. Er meinte einmal, als sie miteinander von einem Kirchgang heimkehrten, es wäre eigentlich Christenpflicht, sich nicht so einseitig beeinflussen zu lassen, ob sie nicht einmal zu einem anderen Prediger gehen wollten und nicht immer zu Pastor Jacoby, der übrigens auch anfinge sich zu wiederholen.
Dore schüttelte den Kopf. Sie ginge zu Pastor Jacoby, solange sich ihr Gelegenheit böte. Er würde wohl kaum lange bei dieser Gemeinde bleiben. Aber er, Friedberg, tue sicher recht daran, diesem Gefühl zu folgen, wenn er es ehrlich glaube.
Er sprach wieder, dachte aber nicht an seine Sätze, sondern an ihre letzte Bemerkung, und darüber ertappte er sich bei der Erkenntnis, daß sein Vorschlag nicht ganz selbstlos und ehrlich gewesen war. Er schwieg dann, um ungehindert seinen Gedanken folgen zu können. War es wirklich so, daß ihn davor bangte, Anne-Dore möchte allzu tief und allzu menschlich im Bann dieses Mannes stehn, den er bewunderte mit heimlichem Neid? Ja, er hatte wahrhaftig den Wunsch, Anne-Dore möchte auch ihn ein wenig anders beachten, als nur auf jene freundlich gelassene Art, in der sie ihm hin und wieder flüchtig gehörte. Meistens nur dann, wenn er über Pastor Jacoby und dessen Auslegungen sprach, wenn er sie mit anderen Auffassungen verglich und dem Mädchen bestätigen konnte, daß keine feinsinniger und tiefer erfaßt waren als die seinen. Und unbewußt war ihm Pastor Jacoby beinahe um dieses einen Umstandes willen lieb geworden.
Nun, da er so neben ihr hinschritt, schämte er sich plötzlich dieser Wahrheit, und tief in seinem Herzen tauchte ein neues Bewußtsein auf, das ihn eigen und wehmütig erregte. Wie nun, wenn er die Führung seines Gottes darin erkennen durfte, daß er gerade in dieses Haus und an die Seite dieses Mädchens gekommen war? Daß ihm der Herr in seiner unergründlichen Freundlichkeit hier einen Fingerzeig für sein künftiges Leben gab und eine Bestimmung sie zusammengeführt hatte und einst ganz vereinen wollte?
Er erschrak und wies den Gedanken von sich. Er lag ihm anfänglich doch zu nah bei seiner Bewunderung für ihre Frömmigkeit. Ihm war, als betaste er mit solchen Wünschen ein Eigentum des Erlösers, als versündige er sich gegen ein erwähltes Kind des Himmels. Aber der Gedanke kehrte wieder und immer wieder und überwand ihn. Er war neben einen Schatz von viel Schönheit und Tugend gestellt worden, und gewiß nicht ohne eine Fügung des Himmels. Und unter Gebeten und wohlverborgen allen Menschen, beschloß er diesen Schatz zu heben.
Alle Ideale eines vollkommenen Christentums und alle Vorstellungen von einer untadeligen Gattin vereinigten sich ihm mehr und mehr in der Person Anne-Dores, und machten ihm bald das Herz warm in Form von langen inbrünstigen Gebeten und bald in einer sehnsüchtigen Schwärmerei. Und beide Formen flossen wehmütig ineinander über, und ihn verlangte bald nicht mehr sonderlich heiß nach ihrer klaren Trennung.
Es war in diesen Wochen gewesen, als eines Mittags ein kleiner hoher, zweirädriger Wagen von bestechender Eleganz und fast zerbrechlicher Leichtigkeit in der Nähe des Wendelschen Wohnhauses auf dem schmalen Fahrweg hielt. Anne-Dore stellte ihre Arbeit im Garten ein, wo es am Weinstaket der Veranda zu tun gab, und schaute neugierig hinüber, angezogen durch helle, feste Stimmen und frohes Lachen. Sie sah zwei junge Herren in englischen Anzügen, fein und knapp gekleidet, wie sie vom Wagen sprangen, der eigentlich in federnder Schwebe zwischen den hohen Rädern nur ein einziges Sitzbrett hatte. Der Jüngere von ihnen warf die Zügel um eine kleine Kiefer am Wegrand, wobei er das Bäumchen nicht gerade sonderlich schonte, und dann schritten die beiden über das unbebaute Stückchen Heideland, das schmal und verwildert Wendels Garten vom Wald trennte. Dieser Landstrich gehörte der Stadt, soviel Anne-Dore wußte, sie pflegte dort ihre Wäsche zu trocknen und zu bleichen. Die Herren schienen etwas zu vermessen, sie gingen auf und ab, zählten die Schritte, schauten nach dem Stand der Sonne und prüften den Boden. Hin und wieder verstand das Mädchen ein lauteres Wort, konnte aber die Absichten der beiden nicht erraten. Der Ältere zeichnete in sein Notizbuch, steckte Stöckchen in den Boden und schien mit seinen Erfahrungen zufrieden. Der andere langweilte sich scheinbar bald dabei, er hieb nachlässig mit seinem Stock in die jungen Huflattichblätter am Wegrand, klopfte dem Pferd den schlanken glänzenden Hals und sah hin und wieder zu ihr in den Garten hinüber. Er konnte sie nicht erblicken, nur das Haus schien ihm zu gefallen, er ging ein paar Schritte am Garten entlang und schaute zu den umgrünten Fenstern hinauf.
»Mark,« rief da der andere von oben, »schreibe auf: zehn Schritte vom Waldrand und zwanzig vom Weg. Es geht ausgezeichnet!«
Der Angeredete winkte ab.
»Kind,« gab er zurück, »wozu hast du dein Notizbuch!« Und er fing an, am Zaun des Wendelschen Gartens Heckenrosen abzuschneiden. »Verflucht«, hörte sie dann plötzlich und gleich darauf das zwitschernde Geräusch von saugenden Lippen an seinem Finger.
Anne-Dore hatte schon darüber lachen müssen, daß er diesen großen Menschen da oben mit »Kind« anredete, aber das hätte wahrhaftig auch auf Friedberg gepaßt. Nun, da er sich auch noch gestochen hatte, wurde ihr ordentlich lustig zu Sinn. Das schadete ihm nichts, so frech wie er war. Daß er geflucht hatte, war ihr gar nicht recht ins Bewußtsein gedrungen, sie hätte es sicher nicht verziehen, aber er hatte es mit einer Stimme gesagt, bei deren Klang es so seltsam wie ein natürlicher Schmerzenslaut wirkte, daß es jedenfalls auch ihrem Vater nicht aufgefallen wäre.
Jetzt sah sie sein Gesicht. Er hörte gar nicht auf, ihre Blumen zu stehlen, hatte schon einen ganzen Strauß und schnitt unbesorgt weiter, bog Äste nieder und knickte sie ab, rücksichtslos und erfreut. Dore fand es nett, daß er Blumen mochte, darüber verzieh sie ihm seinen Raub. Und auch, weil sein Gesicht ihr gefiel. Sie gestand es sich nicht zu, aber es zog sie an, schmal und leicht gebräunt wie es war, mit Augen, die ihr grau erschienen, und braunem Haar, das unter der englischen Kappe hervordrängte, weich und voll.
Das Pferd riß sich los. Es warf den Kopf unruhig, scheinbar gequält durch ein Insekt. Dann hob es sich rasch und schmerzvoll mit erregtem Schnauben, schlug und bäumte.
Mit zwei, drei Sprüngen war der Blumendieb beim Wagen.
»Verdammte Canaille!«, rief er hell und fing die flatternden Zügel mit sicherer Hand. »Schmeiß mir die Karre noch kaput, dummes Luder!«
Aber dann sprach er beruhigend und gütig auf das zitternde Tier ein, suchte nach der Ursache seiner Angst, ohne sie zu finden. Wieder stieg es schnaubend empor. Wie fest die schmale, weiße Hand den Zügel hielt. Jetzt wurde es ernst. Der Rosenstrauß flog auf und zerflatterte wild in der Luft und am Boden. Es gab ein zorniges Ringen. Von oben lief der Freund in langen Sprüngen herbei.
Sie bändigten das scheue Tier. Eine Pferdebremse mußte die Ursache gewesen sein. Dann saßen sie rasch und sicher von zwei Seiten wieder nebeneinander oben und das Tier zog mit kräftigem Ruck an, befreit und in weitausholendem Trab.
Da lagen die schönen Rosen im Staub der Straße. Anne-Dore schickte Lotte und ließ sie holen. Es wäre schade um die Blumen gewesen, wenigstens sollten sie nun den Mittagstisch schmücken, rasch verwelkt, wie sie sein würden.
Beim Essen erzählte sie den kleinen Vorfall, der sie seltsam erregt hatte. Sie war ihrem pochenden Herzen mit der Hand zu Hilfe geeilt, als der junge Mensch sich so kühn und mit der Gefahr vertraut um das bäumende Tier bemühte. Und doch war sein Erfolg ihm leicht und selbstverständlich gewesen. Sie schaute freundlich auf die Blumen, die Lotte ins Wasser getaucht hatte, um sie vom Staub zu säubern. Sie strömten nun im Schatten schwach und fein ihren zärtlichen süßen Geruch von Honig und Sonne aus.
Friedberg wußte Bescheid. Es würde wohl gebaut werden. Natürlich. Was denn sonst? Und die beiden Herren waren der Baumeister und der Besitzer gewesen.
Anne-Dore widersprach. So sähe kein Baumeister aus. Sie wußte nicht recht, weshalb, aber einen solchen Mann stellte sie sich viel älter vor, mit einem Vollbart und einer leichten Neigung zu Kopfschmerzen.
Herr Wendel mußte lachen.
»Aber ich glaube auch nicht, daß dort gebaut wird«, meinte er. »Es gibt schönere Orte in der Nähe, auch ist ja hier kaum Platz für einen Garten, den will man doch für gewöhnlich.«
Man einigte sich nicht, obgleich man fast unermüdlich bei diesem Thema blieb, Friedberg, um Anne-Dore zu ehren, die es begonnen hatte, und Herr Wendel, weil ihm ehrlich der Wunsch am Herzen lag, man möchte ihm dort kein Haus zwischen seinen hübschen Besitz und den Wald bauen.
Noch am Abend mußte Anne-Dore immer an den Vorfall denken und an seinen Helden, der Mark hieß. Sie konnte nicht einschlafen, wollte sich zwingen und verlor darüber den Rest ihrer Müdigkeit. Es war schon spät und eine warme Nacht. Der Mond stand in wandernden Wolken, aber man hörte keinen Wind. Sie hatte ihr Licht gelöscht, und im Bann einer ganz fremden Traurigkeit schaute sie ruhig von ihren Kissen aus, wie am Boden bald klar und weiß der helle Schein vom Himmel lag, wie es bald grau und still über ihn hinzog und wie darüber lautlos ihr Zimmer versank. Wenn es dunkel wurde, wünschte sie sich, er käme wieder, der weiße Schein, sie sah dann die Gegenstände im Zimmer, die schliefen, die Sprüche an der Wand, ihren Schreibtisch und die bunten Rücken ihrer Bücher auf dem kleinen Wandbrett. Sie konnte sie alle erkennen, am Tischrand lag aufgeschlagen ein Predigtbuch des Engländers Spurgeon, das Friedberg ihr in einer neuen Übersetzung geschenkt hatte. Was er dazu sagte, hatte ihn verraten. Es war ihm daran gelegen, ein Gegengewicht gegen den Einfluß Pastor Jacobys zu bieten, dessen Wirkungen ihm zu nachhaltig wurden. Sie mußte lächeln. Er war wirklich allzu besorgt, der Brave. Wieder senkte sie Müdigkeit lau in halbe Träume, in Träume, die Gedanken waren, und in Gedanken, die von Träumen überwunden wurden.
Warum erschien es ihr, als betaste die unbedachte, von keinerlei Harm und Milde geschwächte Kraft, die ihr heute so neu und frisch entgegengelacht hatte, die feierliche Schönheit ihrer Seelenwelt? Es lagen vage Sehnsüchte in ihr miteinander im Streit. Irgendwie wurde ihr Glück verhöhnt, nicht frech und mit bewußter Anmaßung, auch nicht mit Groll und Haß, nein, wie mit dem Achselzucken einer jugendlichen Erdensicherheit. Konnte denn solche Kraft bestehen, eine Gewalt, so aller Freude gewiß, so gesund und froh, neben den blutigen Siegen des Erwählten, der die Welt überwunden und der auch ihren Frieden hüten wollte?
Sie ertappte sich darüber bei der seltsamen Vorstellung, die sie bisher von gottlosen Weltmenschen gehabt hatte. Von Weltmenschen, wie ihr guter Vater sie sah und wie ihre Mutter sie fürchtete. Nur durch den Trotz der Sünde waren diese Gestalten erhoben, an ihren Stirnen brannte das Mal der Verfluchten, und sie eilten in einem Rausch falscher Freuden über die Erde, wie von der Unrast eines bösen Gewissens gehetzt und ohne einen Schein wahren Glücks.
Ein Gefühl von tiefer Beschämung beschlich sie. Nein, so hatte sie sich diese Menschen doch nicht ganz gedacht, aber sie merkte nun, daß sie keine klaren Bilder von ihnen und ihrem Wesen kannte. War das nicht ein böser Fehler im Haushalte ihrer Weltbetrachtung? Ihr war, als sei sie plötzlich nur deshalb von einem Feinde überrascht worden, weil sie es nie für gut befunden hatte, seine Art und seine Macht unbefangenen Sinns zu prüfen.
Es wurde wieder hell im Zimmer, ein klarer Glanz siegte, weiß, rasch und doch feierlich. — Nun schritt sie im Mondlicht am Garten entlang, brach mit eigensinnigen Fingern die Knospen der Heckenrosen, die Zweige raschelten, wenn sie zurückschnellten, und die verblühten Rosen entblätterten sich ins Laub. Mit einem Schmerzensruf zog sie die Hand zurück und sah aus ihrem Finger rote Tropfen steigen, einen nach dem andern. Sie legten einen kleinen blutigen Weg um ihren Finger zurück und zersprangen im Staub der Straße. Ratlos schützte sie mit der anderen Hand ihr langes weißes Kleid, das im Mond glänzte, und erschrak furchtbar, als sie erkannte, daß es ihr Hemd war. Da kam über den Weg mit raschen festen Schritten der Fremde vom Mittag, er ergriff ihren Arm, neigte sich über ihre Hand und sie fühlte, wie er die Wunde an ihrem Finger zupreßte.
Mit einem Schauer erwachte sie und mit einem lauten Schrei.
Das Zimmer war tief in Finsternis gehüllt, sie erkannte kaum das Fenster. Man hörte den Wind sausen, die Bäume schüttelten sich, jählings erwacht, und ihr war es, als schlügen Tropfen auf das Verandadach.
»Ich bin traurig«, sagte sie leise und wunderte sich über ihre Worte, die sie nicht hatte sagen wollen.
Was wollte dieser seltsame Traum, der ihre Gedanken überholt hatte, als fände er sie gestaltlos und krank? Hilflos und von einer fremdartigen Angst gequält, die sie nicht kannte, die etwas von den Nächten ihrer ersten einsamen Erfahrungen hatte, stand sie auf und tastete nach dem Licht. Da sie es nicht fand, ließ sie sich im Dunkeln vor ihrem Bett auf die Knie nieder und über ihrem Gebet schlief sie ein, die Schläfe auf den gefalteten Händen und schwer auf den alten Sessel gestützt, auf dem ihre Kleider lagen.
Nun kam wieder der Mond, zögernd, als schiene er durch feine Schleier, dann blendend und klar wie in einem ehrlosen Triumph ohne Neid und Güte.
Sie hatten nun erfahren, Herr Missionar Wendel und Kandidat Friedberg, daß ihre Schlüsse falsch und ihre Besorgnis unnötig gewesen waren, denn die Arbeiten, die drüben am Waldrand nach wenigen Tagen begonnen wurden, unterrichteten sie darüber, daß ein Tennisplatz angelegt wurde. Die Vorbereitungen gingen rasch und sicher vonstatten, bald erhoben sich hohe dünne Drahtstakete vor dem Grün des Waldes, der Boden wurde prächtig geglättet und mit Lehm überstampft, durch schmale eingesenkte Holzleisten in große und kleine Rechtecke eingeteilt, und ein hübscher kleiner Zaun aus gekreuzten Weidenstämmchen und Zweiggeflecht trennte dies Heiligtum irdischer Lust von der schmalen Fahrstraße, die schon ein paar hundert Schritte weiter in einen Feldweg überging. Vierzehn Tage hindurch schnarchten kleine Sägen schon früh bei Sonnenaufgang, Handbeile zersplitterten frisches Gebälk, und Hämmern und Klopfen weckte die Bewohner des ruhigen und verschonten Hauses. Frau Wendel war nicht sehr erbaut durch diese Erscheinungen, aber da der Vater sie mit gutem Humor ertrug und sogar einmal den beiden jungen Leuten die Hoffnung machte, auch für sie möchte sich nun wohl Gelegenheit bieten, einmal mitzuspielen, ließ auch die Mutter beruhigter diesen Dingen ihren Lauf, die in der genußsüchtigen Welt nun einmal nicht zu ändern waren.
Eines Tages klingelte es gegen Mittag unfreundlich und eindringlich. Anne-Dore sah im Wohnzimmer den Freund ihres Blumendiebes im Gespräch mit ihrem Vater, und erfuhr später, daß um die Erlaubnis nachgesucht worden war, das Tennisnetz und die Bälle über Nacht im Hause unterbringen zu dürfen. Herr Missionar Wendel hatte es gern erlaubt, Lotte würde es ihnen stets auf Wunsch aushändigen, und für den Fall einmal alle ausgeflogen wären, würden die Herren ihre Geräte im Gartenhaus verwahrt finden, wohin sie leicht durch das Hinterpförtchen gelangen könnten.
»Es war wirklich ein höflicher und liebenswürdiger junger Mann, der aus gutem Hause sein muß«, erzählte er den andern. »Es ist ja verständlich, daß sie uns bitten, wie umständlich wäre es, das schwere Netz jedesmal hin und her zu schleppen.«
Das wäre nun freilich keine allzu große Mühe gewesen, denn sie kamen bald darauf für gewöhnlich in ihrem kleinen Wagen, bald auch zu Rad, und manchmal fuhren sogar mehrere Droschken vor, ein Luxus, der Herrn Wendel ungebührend und bedauerlich erschien. »So junge Leute ... «, sagte er mit Kopfschütteln.
Nichtsdestoweniger schaute er ihrem bunten Spiel gern und oft zu. Es war ein prächtiger und für Anne-Dore ganz ungewöhnlicher Anblick, der sie an ihre alten Träume von leichtfertiger Daseinslust und großem Leben erinnerte. Dies helle Lachen war verführerisch, wie das Lied der Waldvögel einem gefangenen Sänger im Käfig erscheinen mußte, es lockte heimlich an und überredete das Herz zu neuen Wünschen. Sie sah die geschmeidigen jungen Körper dort drüben wie im Flug ihrer fröhlichen Rufe. Das Lachen klang in den Sonnenschein, wie der Triumph einer Lebensfreude, die unbestechlich war und nie zu überreden. Jugend hieß das große helle Recht, das dort selbstherrlich und ohne Bedacht den Beglückten die Brust weitete, und aus den frohen Blicken leuchtete es wie Licht, wie Glück. Anne-Dore beobachtete alles, sie sah die prächtigen hellen Kleider der jungen Damen, Kostüme, die einzig für dieses Spiel erdacht schienen, das goldene Blondhaar in der Sonne, bestürmt vom seligen Eifer kindlicher Kämpfe, die leichten weißen Anzüge der jungen Herren, ihre feinen bunten Hemden, deren weicher Fall den schlanken Körpern ihr Recht an Luft und Sonnenschein ließ. Wie schwerfällig und müde erschien ihr darüber oft ihr eigener Körper, und ihrer Seele ward oft der Flug so schwer, heim, in das Dämmerland früher Würde und kühler Resignation. —
»Die Damen kreischen, manchmal kreischen sie verletzend und springen zu hoch«, sagte Friedberg, und wußte nicht, daß er Anne-Dore mit diesen Erkenntnissen zu trösten hoffte. Er ereiferte sich für die eigene Welt, für ihre Welt, wie er sie nannte, und ahnte nicht, wie sehr sein Lob ihr den Glanz der himmlischen Güter trübte. Anne-Dore fühlte sein Bedürfnis, in dem er wieder und immer wieder ein Gefühl von Gemeinschaftlichkeit zu betonen suchte, das sie und ihn in ihrem Glauben verband, und empfand es wie einen Mißbrauch, der sie quälte. Sie kämpfte ihre Mißachtung nieder, aber ihr schien, als ehrten ihre heimlichen Siege ihn wenig, und sie wünschte sich ein Zartgefühl bei ihm, das ihr solche Milde erließ.
Sie saßen miteinander im Garten, an einem warmen Nachmittage in diesem schönen Frühling, der nun schon auf den Sommer zuging. Drüben wurde Tennis gespielt, die hellen knappen Zurufe und der lustige Zorn mancher harmlosen Streitigkeit flatterte über den trägen Strom ihrer eintönigen Unterhaltung hin. Anne-Dore dachte daran, wie sie diesen Morgen zu dreien miteinander in die Kirche gegangen waren, feierlich, schwarz und still, gerade als drüben die beiden Freunde mit ihrem Wagen zum Spiel anlangten. Sie hatten gegrüßt, fast ohne sie anzuschauen, und Anne-Dore war rot geworden. Sie hatte es mit Angst und Herzeleid gefühlt. Wie herausfordernd trug Friedberg sein Gesangbuch, so bekenntnisfroh und glaubenssicher. War er zu beneiden? Gewiß nicht. Wie er nun wieder so kränkend zuversichtlich von seiner Innenwelt sprach, in der ihn niemand bedrängte, deren einfältige Kraft sicher in den Beschränkungen ruhte, die seine derben und schlichten Anlagen ihm zogen. Sie mußte an das Wort Christi denken: »Wer da hat, dem wird gegeben«, und fand die Lösung nicht, die angesichts dieses Verschonten ihre Kämpfe und ihr Schmerz erheischten. War ihm nicht alles gegeben, das nur immer ein gläubiger Christ sich wünschen konnte? Aber nun plötzlich wußte sie und ihre Stirn sank ein wenig: die Gaben und ihre Herrlichkeit, von denen hier die Rede war, hatten nichts gemein mit jener selbstgefälligen Genügsamkeit und ihrem Glück. Es bedurfte anderer Reichtümer, denen noch gegeben werden sollte, und diese Gaben waren so bitter und belastet mit zeitlichem Herzeleid, daß über ihnen eine ewige Krone unberührbarer Schönheit in ein künftiges Reich hinüberglänzen sollte. In ein Reich, das nicht verging, in dem wohlverwahrt jedes Leid gekannt wurde, als dürfte es nie verloren gehen, als habe die Erde nichts getragen, das hoheitsvoller gewesen wäre und der göttlichen Liebe vertrauter. Und sie schämte sich ihrer Kämpfe nicht mehr, und kein Kummer schien ihr zu gering, und keine weltliche Freude barg einen Ersatz.
In ihre Gedanken hinein, von denen Friedberg im matten Eifer seiner Beredsamkeit nichts ahnte, und in die durchsonnte Stille des mittäglich schlummernden Gartens flog es da plötzlich mit hellem Rascheln durch die Baumzweige, schlug auf am Wegrand und sprang mit rotem Lachen in das dunkelgrüne Laub des Efeus. Ein Tennisball! Er rollte vor die Laube, besann sich noch ein Weilchen in leichtem Schaukeln und lehnte sich dann beruhigt an Friedbergs Stiefel.
Der Kandidat sprang auf und zog ein Gesicht, als habe man ihn beleidigt. Seine Arme glichen in der Luft irgend etwas aus. Er stellte fest:
»Der ist hier herübergeflogen, der Ball, von drüben offenbar.«
Das war nicht zu bestreiten, Dore mußte über seinen Schreck lachen und hob die rote elastische Kugel auf, wog sie in der Hand und prüfte mit dem Daumen ihre Federung.
»Hübsch sind die«, meinte sie. »Wollen Sie ihn nicht zurückwerfen, Herr Friedberg?«
»Zurückwerfen? Das könnte man. Aber eigentlich sollten sie ihn sich selber holen. Sie tun, als gehörte ihnen die ganze Welt!«
»Das tut sie auch«, sagte das Mädchen und erschrak über ihre eigenen Worte.
Aber Friedberg verstand sie vollkommen: Das war ein Scherz gewesen, der nur seine Meinung bestätigen sollte.
Da krachte das Staket gefährlich, und die Büsche rauschten unter einem heftigen Niedersprung. Ein wenig gebückt, mit raschen Bewegungen, frech über die Blumenbeete und den Rasen hin, schritt hastig und suchend der junge Störenfried ihres einsamen Traums. Er war im gestreiften, weißen Tennisanzug, hatte geflochtene Ledersandalen an und das Racket flog stürmisch und ohne Rücksicht in die Zweige der Büsche und schlug sie zur Seite.
Friedberg war in heller Empörung aus dem Schatten der Laube getreten, und nun begegneten sich die beiden auf dem Weg. Der Kandidat hatte den Ball in der Hand und kniff ihn, so fest er konnte, zusammen, denn irgendwo mußte sein Verdruß sich Luft machen. Einfach so in den Garten zu springen! Er vergaß nicht, »Guten Tag« zu sagen, fügte dann aber gleich hinzu: »Ich hätte Ihnen das Ding da schon zurückgeworfen.«
»Darauf kann ich nicht warten«, sagte der andere frech. »Geben Sie her. Übrigens ist ›das Ding da‹ ein Tennisball.«
Friedberg gehorchte, völlig eingeschüchtert durch diese Anmaßung. Er sah das Lächeln des anderen nicht, der wirklich gern höflich gewesen wäre, aber die Anrede, die ihn empfangen hatte, ließ es nicht zu.
»Danke«, sagte der Fremde kurz und drehte sich um.
Friedbergs geknickter Grimm war auf der Jagd nach Worten jählings durch etwas ganz Außerordentliches unterbrochen worden und hatte einem maßlosen Erstaunen Platz gemacht. Ehe noch der Fremde zwei Schritte gemacht hatte, hörte er hinter sich:
»Mark Enz! Ist es möglich? Dahin ist es also mit dir gekommen!«
Der Angerufene hielt inne, rutschte ein Stückchen auf dem Weg, weil er schon zum Laufen angesetzt hatte, drehte sich um, starrte Friedberg an und brach ohne weiteres in ein schallendes Gelächter aus.
»Der Helferich!« rief er jubelnd. »Gott schickt mir wahrhaftig deine graue Seele noch einmal über den Lebensweg. Gib die Hand, Dicker, laß dich umarmen. Natürlich, wer hätte das auch anders sein können, einem wegen eines Sprungs in den Garten moralisch zu kommen. Was tust du hier in diesem Bethaus?«
»Mäßige dich, Mark«, rief Friedberg entrüstet, lachte aber doch in der Freude dieses Wiedersehens und begrüßte den Kameraden aus der Schule und von der Universität herzlich. Er hielt seine Hand fest, drehte ihn um, und nun stand der Fremde vor Anne-Dore.
Niemals in seinem Leben hat Markus Enzheim den Eindruck vergessen, den dies Bild in seine Seele grub. In der gedämpften Sonnenhelle der Laube hob sich vom dunklen Laubgrund schmal und bleich ein Mädchengesicht, tief überschattet von einer mächtigen Fülle dunkler Haare, deren Nacht die weißen Augenlider in einen matten Schein von silbrigem Schattenblau legte. Tiefschwarz tauchten die langen Wimpern in das bekümmerte Blaß der Wangen. Voll, breit, fast ein wenig zu groß schien ihm dieser schüchterne, schlafende Mund, und das Oval des Gesichts schimmerte, weißlicher Marmor, ohne einen Schatten und ohne eine Linie über dem dunklen Kleid, nie berührt, von keiner Güte und keiner Glut, kindlich und rein, ein Eigentum dessen, der es erschaffen.
Es war nur ein rasches Bild gewesen, aber eindringlich und erhaben, wie ein Zuruf des Lebens selber an die Begnadeten, die es seiner Schönheiten würdigt. Dann hatte ihm Friedberg ihren Namen genannt und ihr den seinen. Mark Enz, das wäre nur eine Abkürzung aus der Jugendzeit, von der Schule her, eigentlich hieße er Markus Enzheim.
Anne-Dore gab ihm die Hand. Darüber und als er sie ergriff, versank ihm das Bild, das ihn überrascht hatte, als wäre plötzlich in einer Kirche ein Vorhang von einer Seitennische gehoben, und als hätte aus dem Glanz der heiligen Geräte im Dämmerlicht der bunten Scheiben Maria selbst ihn angeschaut. Nun war alles wirklich. Es war ihm lieb, daß Friedberg ihn mit Fragen und Einzelheiten überschüttete; die nahmen ihn nicht in Anspruch, aber sie hielten ihn hier fest. Erst trat er noch kurz aus der Laube, schwang den Ball, und mit einem lauten Zuruf schleuderte er ihn in einem weiten Bogen zurück auf den Spielplatz. Es war, als ob seine hellen klaren Worte die rote Kugel mit sich rissen und trugen, wie sie hoch das lichte Blau des Himmels durchschnitt, eintauchte in den grünen Hintergrund der Bäume und sich, nach lautlosem Aufschlag am Boden, bei ihrem Sprung im Drahtnetz verfing. Man sollte für ihn eintreten, er käme sogleich. Fragen kamen zurück, ohne sie zu beantworten, trat er wieder zu den beiden und nahm den Gartenstuhl, den ihm Friedberg über den Tisch hob.
Er saß gegen das Licht. Nun da er mit dem Kandidaten sprach, anfangs immer ein wenig zurückhaltender und kühler als jener, sah Anne-Dore, daß er schlanker und kleiner war, als er beim Schreiten und unter seinen Bewegungen erschien. Gegen den helleren Eingang der Gartenlaube erblickte sie sein Gesicht nur undeutlich, zuweilen aber sein Profil, das ihr weich und vornehm im Schatten erschien, aber herb und fast scharf, wenn bei einer Biegung seines Kopfes ein Lichtschein darüber hinglitt. Sie lauschte auf seine Stimme, fast ohne auf das zu achten, was er sagte. Was konnte es wohl viel sein, da es doch Friedberg galt. Diese Stimme war sonderbar melodisch und veränderbar, wie das Schatten- und Lichtspiel unter dem Laub der Büsche am Boden. Sie fügte sich dem Sinn seiner Worte, als wollte sie jedem seinem Wesen nach ein anderes Gewand geben, und seine Bewegungen, die Wendungen seines Kopfes, die Gebärden seiner Hand schlossen sich diesem feinen Spiel in so vollkommener Harmonie an, daß Anne-Dore eigentlich nur einen Eindruck hatte, den einer lebensvollen, ein wenig bedächtigen und warmen Musik. Manches erschien ihr von großer Anmut, wurde aber wieder und wieder so keck und gleichgültig durch eine abweisende Energie der Bewegung verworfen, daß es ihr niemals weichlich erschien. Hier zeigte sich ihr zum erstenmal ein Wesen, das nicht um die Tugend seiner Gebärden zu ringen schien, sondern das sie zu verbergen trachtete.
Würdigte er denn wirklich Friedberg all dieser Liebenswürdigkeit, dieses feinen Eingehens auf jedes seiner Worte? Auch der Kandidat wühlte befangen im Schatze seiner Erinnerungen. Er kannte Mark Enz nicht wieder. War das der rücksichtslose und spöttische Kamerad, der es nie für der Mühe wert erachtet, ihn ernst zu nehmen, der ihn früher nur gebraucht hatte, um seinen Fehlern zur Lust der andern ihre treffenden Namen zu geben, der in Schweigen verfallen wäre, wenn er mehr gefordert hätte, und der hochmütiger gewesen war, als auch die eifrigste Liebe ertrug?
Friedberg entschloß sich, etwas unsicher, zu der Ansicht, daß Mark Enz sich doch sehr zu seinem Vorteil verändert haben mußte, obgleich er undeutlich empfand, daß jener auch damals schon anders hätte sein können, wenn es nur sein Wille gewesen wäre.
Nun wandte Mark Enz sich an Anne-Dore, und plötzlich, wie er nun in seiner Unterhaltung mit ihr jeden, aber auch jeden Einwand Friedbergs ignorierte, erkannte der Kandidat bestürzt den alten Gefährten wieder, den er gehaßt und geliebt hatte. Undeutlich empfand er, tief verstimmt, die Rolle, die er hier eben hatte spielen müssen, gerade wie einst, diesem geschmeidigen Willen ergeben, der zu seinem Erfolg mißbrauchte, was immer ihm gefiel, und dem jede Anmut, jede Lüge und jede Tugend zu dienen schienen. Alle Liebenswürdigkeit, die da vor ihm aufgeboten worden war, hatte nicht ihm gegolten, wollte nichts von ihm.
›Pfui‹, dachte Friedberg, bitter und erbost. Er beschloß, durch dumpfes Schweigen zur Last zu fallen und keine Frage mehr zu beantworten. Aber es wurde ihm nur für seinen ersten Plan Gelegenheit geboten.
Jedoch die Liebenswürdigkeit und das bezwingende Lächeln des andern waren wie ausgelöscht. Er sprach ernst, fast zögernd, ja beinahe abwesend, schien es nur gezwungen zu tun, und aus Höflichkeit und der Ausdruck seines Gesichts war fast traurig. Gierig verfolgte Friedberg jede Regung, aber er erkannte keine Absichten. Da lächelte er ironisch und überlegen und verschränkte die Arme. Mark Enz sah es und zog mit innerlichem Lächeln einen Schluß daraus.
Da Anne-Dore dem Fremden anfangs nur schüchtern und leise antwortete, ließ er ihr Zeit und erzählte. Erst vom Spiel. Aus seinen Augen lachte die Freude daran, er schien ihm mit Hingabe und Leidenschaft ergeben; dann, ganz von selbst und ohne Stocken, kam er auf andere Dinge, sein Eifer schien kindlich, seine Worte waren bunt. Anne-Dore entstanden Bilder unter diesen raschen biegsamen Sätzen, die, wunderbar geschmeidig und zäh gefügt, allein notwendig in dieser Form und sicher, wie mit heimlichem Zauber, ihr Herz in die Welt seiner Gedanken hoben.
Auch sie begann nun, wie ohne ihre Absicht und doch bereitwillig, zu sprechen. Er kam ihren scheuen Gedanken entgegen, gab ihnen ohne erkennbare Hilfsbereitschaft ihre rechten Namen, und antwortete ihr auf eine Art, die seine Achtung vor jedem ihrer Gefühle verriet. Nur eins konnte er nicht, sie fühlte es rasch und versöhnt mit jeder seiner Gewandtheiten: er konnte keine Zugeständnisse machen. Nie ließ er sich herbei, um ihr in Dingen recht zu geben, die er nicht liebte, wie sie. Wohl erschien es ihr, als wünschte er ihr zu gefallen, aber er setzte mit Selbstbewußtsein voraus, daß dies nur möglich sei, wenn er seine Art betonte und seine Welt heilig sprach. Das war es, was sie ihm heimlich dankte.
Einmal widersprach sie ihm, ja sie unterbrach in einem Eifer, der ihr fremd war, seine Worte und heischte eine Erklärung. Er besann sich, dann meinte er kurz:
»Ich kann sie Ihnen heute nicht geben. Bei Ihrer Jugend darf ich die Erfahrung nicht voraussetzen, die für ihr Verständnis notwendig wäre.«
Sie schwieg. Friedberg war für sie gekränkt. Er mischte sich hinein und sagte mit einem Ton milder, fast väterlicher Überlegenheit in der Stimme:
»Nun, wo da von Erfahrung die Rede ist, lieber Mark, meine ich doch, daß eine menschliche Reife den Ausschlag gibt, und ob wir da nicht auf verschiedenen Wegen zu ganz ähnlichen Höhen gelangen können, ist fraglich. Gerade was die Reife betrifft, weiß ich bei dir nicht recht. Auf welche Wissenschaft stützest du dich, bei deiner Sicherheit, die vielleicht ein wenig ... nun weißt du ... ich will sagen — vorschnell ist ....«
Er hatte bei seinen Worten die Hand erhoben, und Mark betrachtete, während jener sprach, ruhig diesen zahmen weißen Finger, wie er sich warnend und langsam in der Luft hin und her bewegte. Er folgte ihm gelassen mit den Augen, schien Friedberg ganz zu vergessen und unterbrach ihn nicht. Das erstaunte den Kandidaten, er geriet ins Stocken und betrachtete seinen Finger auch. Darauf senkte sich dieses hilfsbereite Glied tölpelhaft und beschämt, machte sich am Knie allerlei zu schaffen, und sein Gebieter wurde langsam rot.
»Wie?« fragte er und sah Mark Enz durch die Brille an.
»Ich habe nichts gesagt«, antwortete jener. Aber er ließ nun den Finger des Kandidaten mit seinen Blicken los und sah in den Garten hinaus, weil ihn die Verlegenheit seines Gegners quälte.
Friedberg lachte. Seine ganze Niederlage lag in diesem Lachen voller Zugeständnisse an den einfachen Sieg seines Gegners, und es gefiel Anne-Dore wohl, daß Enzheim keine Miene machte, seinen Erfolg in kleinlichem Triumph einzustreichen.
Friedberg wurde redselig, ihm lag an einem Ausgleich. Es war, als fühlte er sich nun dem alten Freunde gegenüber wieder am rechten Platz. Und Mark Enz überließ ihm diesen Platz und die Unterhaltung.
Die veränderte Stellung der drei zueinander und Friedbergs Worte nun, wirkten auf Anne-Dore wie eine plötzliche Stille. Sie sah mit Schrecken und Furcht auf den Fremden, der jetzt ein wenig geneigt, und den dunklen Kopf auf die Hand gestützt, schweigend auf seine Schuhe niedersah. Nun da er ihr wieder fremd erschien, fremder als je, verstand sie nicht, mit welchem Recht und dank welcher Kräfte er ihr eben noch nah gestanden hatte, wie ein vertrauter Freund. Als gäbe es Mächte in ihrer Seele, deren Leben zu erwecken nicht in ihrer Kraft stand. Ja es war ihr, als sei jener von einer Gewalt begabt, deren Rechte in seinem Geschlecht und Wesen ruhten und älter waren, als Menschengedanken zurückreichen. Aber dieser Glaube tröstete sie fast. So war nicht seine Willkür allein in ihr verschlossenes Reich gedrungen, sondern ein Wille, höher als seiner und stärker als der ihre, eine Vorsehung, der sie beide ergeben waren. Sie empfand nur unbestimmt, wie dies Wunderbare über sie gekommen war, aber ihre scheuen Regungen, die sie nicht verstand, spielten hinüber zu ihm, der sie erweckt, und ließen über seinem Scheitel einen ersten Dank ihres Herzens, der unschuldiger war, als daß ihn irdische Gedanken ereilen.
Stand er denn auf? Ging er fort? Selbstverständlicherweise und höflich gelassen, als sei nur dies noch nötig? Als er ihre Hand drückte, flog etwas in ihrer Seele auf wie Zorn. Nahm er denn wissenlos und ohne Dank nun alles mit fort? Auf seine Frage, die sie nur undeutlich zu hören glaubte, antwortete sie verwirrt; ja, es wäre ihr lieb, wenn er wiederkäme. — Mußte man das nicht, schon aus Höflichkeit? Er war sicher reich und aus vornehmem Hause, da durfte man nicht undankbar erscheinen, wenn er eine Freundlichkeit anbot. — O wie diese flachen grauen Gedanken plötzlich mit lügnerischem Ernst ihren Sinn beschatteten.
Friedberg begleitete den Freund an die Gartenpforte.
»Höre,« sagte Mark Enz, »du tust das Deine, damit es mir möglich wird, hier hin und wieder vorzusprechen.« Er sprach erregt, sein Atem ging hart. Er schien seine Worte zu bereuen.
»Ich will mich gerne bemühen, Mark, aber was kann ich denn tun? Ich bin in diesem Hause selbst ein Fremdling. Und welchen Sinn hätte es schließlich auch, du und diese Leute.«
Enzheim blieb stehen. Sie waren weit genug von der Laube fort.
»Dicker, sei löblich«, sagte er barsch. »Du denkst natürlich, ich täte dir nun den Gefallen, zu sagen: ›Lieber Helferich, nur du und deine Freundschaft ziehen mich in dieses Haus.‹ Ich gedenke dies nicht zu versichern. Denn erstens wäre es eine Lüge, und zum andren hättest du das bestimmte Gefühl, mich durchschaut zu haben. Ich komme einzig deshalb, weil ich Fräulein Wendel, oder wie sie heißt, näher kennen lernen möchte.«
Friedberg fühlte sich sehr unbehaglich. Er beschloß einen Anlauf zu seiner alten Würde, die er in Jahren der Trennung mühsam errungen hatte, verwarf ihn aber rasch und sagte fast bittend:
»Laß das sein, Enz. Es hat keinen Sinn. Wirklich nicht. Die Gesinnung der Dame macht auch jede Annäherung unmöglich, daß du es weißt.«
»So? Was für eine Gesinnung hast du entdeckt?« fragte Enzheim in einem Spott, der nur in seiner Höflichkeit lag.
»Sie ist eine gläubige Christin und sehr fromm«, sagte Friedberg mutig. Er machte heimlich Fäuste und wartete trotzig auf die Antwort.
Sie kam leise und freundlich:
»Du gottsverfluchter Heuchler von einem Kandidaten. Schiebt der Kerl wahrhaftig die Bibel als Riegel vor sein Jagdgebiet. Gib das auf, Dicker, hast du gehört?«
Friedberg war wütend.
»Ich werde mich keine Minute besinnen, Markus Enzheim, Fräulein Dore Wendel von deinen Worten Mitteilung zu machen. Das ist eine Infamie! Solange ich in diesem Hause wache, betrittst du es nicht wieder.«
»So«, sagte Enzheim, »also du machst dem Mädchen Mitteilung von meinen Absichten und meiner Bitte. Sieh mal, das ist es, was ich wollte.« Er sagte es ruhig und stillvergnügt, und war sicher, daß der andere nun auf Tod und Leben schweigen würde.
»Also auf Wiedersehen, Dicker. Lerne Scherz ertragen. Und Grüße an die junge Dame.«
Er ging leicht und rasch über den Weg und schien alles vergessen zu haben. Friedberg spürte noch den festen Druck seiner Hand. Der Freund erschien ihm sicher, gelassen und unvorsichtig zugleich. Als wären seine angewandten Kräfte des Gegenstandes nicht wert, oder der Gegenstand ihrer flüchtigen Unterhaltung seiner Kräfte nicht. Aber er hatte immer schon zu zwecklosen Betrachtungen herausgefordert, voller Widersprüche, wie er war. Und was hatte er da vorhin nicht über die Bibel gesagt?! Friedberg erkannte aufs neue, daß dieses Buch den Gottlosen ein Dorn im Auge war, und daß jeder, der sich zu ihm bekannte, Anfechtungen und Bedrängnisse erdulden mußte.
Drüben brachen die anderen auf, und da er gerade am Pförtchen stand, nahm er einem der jungen Herren das graue zusammengelegte Tennisnetz ab, zog höflich seinen Hut, verbeugte sich, als habe man ihn beschenkt, und ging nachdenklich in die Laube zurück, fest entschlossen, durch kein übereiltes Wort das heraufziehende Unheil zu verschlimmern.
Anne-Dore war fort.
In den kommenden Tagen malte sich Friedberg ohne Ermüden heimlich die Niederlagen aus, die Mark Enz bei seinen Annäherungsversuchen erleben würde. Er sah, wie jener unter Anne-Dores Blick und Wort zusammenschrak, plötzlich verstummte, wie vor der Hoheit eines Heiligenbildes, wie er beschämt und betroffen den Rückzug antrat und auch einmal die Kraft an der eigenen Seele spürte, die von denen ausgeht, die wahrhaftig dem Reiche Gottes angehören. Seine Phantasie arbeitete froh und angestrengt, ganz über ihr gewohntes Vermögen. Er sah Bilder, lebendig im Pathos des Erhabenen, das sie darstellen. Anne-Dores erhobener Arm wies mit kriegerischer Milde den Eindringling ab, er knickte scheu nach hinten zusammen unter dem ruhigen Glanz ihrer Augen, und fern, in einem Nebel aus Licht, erhob sich hinter ihr das Kreuz und strahlte. Er hatte einmal ein ähnliches Bild gesehen, die Erinnerung half gefällig nach, Mark Enz verdarb und ward nicht mehr gesehen.
Er redete solche Bilder laut vor sich hin, berauschte sich an ihrer Hoheit und ihr Trost beruhigte ihn. Aber hinter ihnen wohnten Gedanken, furchtbarer und martervoller, als daß er ihnen anfänglich Gestalt zu geben wagte. Furchtsam empfand er bald, daß diese Gedanken es waren, die, tief unter den anderen, seine trostvollen Visionen nötig machten, ja erschufen, als liebten sie hämisch die Täuschung, als spielten sie spöttisch mit ihrer dämonischen Gewalt, als wollten sie sein armes Herz verhöhnen mit falschem Trost. Er geriet außer sich, wenn nur ein geringes Anzeichen, grau wie eine Ahnung, ihr dunkles Wirken verriet. Und doch verschlang im Lauf der kommenden Zeit und unter ihren Ereignissen dieser finstere Abgrund alle hellen Bilder. Er wußte nun seine Todesangst um Anne-Dore und nannte sie bebend bei Namen. Seine Zuflucht wurde das Gebet. Nie in seinem Leben hat Helferich Friedberg mit solcher Inbrunst seinen Gott angerufen, wie in dieser Zeit.
Als er einmal auf eine Art, die er unauffällig nannte, bei Anne-Dore das Gespräch auf Markus Enzheim brachte, wies ihr Gesicht ihn ab. Der Zug darin setzte ihn anfänglich in große Verlegenheit und trug ihm ein Schuldbewußtsein ein, später quälte er ihn hart. Denn dieses Ablenken, mit dem ihn das Mädchen in seiner Sorge allein ließ, hatte nichts von jener liebevollen Nachsicht gehabt, die er für gewöhnlich ihre Freundlichkeit nannte. Ich bin ein armer Tölpel, dachte er, und schalt auf Enzheim, der ihm sein schönes Selbstbewußtsein für lange erschüttert hatte, und fragte sich wieder und wieder, was beide nur auszeichnen möchte, jenen und Anne-Dore, daß er sich ihnen gegenüber fremd, benachteiligt und armselig fühlte. Und da seine eigene Innenwelt im Grunde keinen Namen trug, fand er nirgends Zuflucht und Trost gegen dies Gefühl, und auch kein Bewußtsein von stolzem Verzicht öffnete ihm das Reich der Einsamkeit, in dessen Frieden niemand einzieht, dessen Seele nicht reich von Geburt ist.
Es wunderte ihn, daß Enzheim nicht kam. Er erwartete ihn täglich, hatte sich jede Antwort zurechtgelegt und alle Aussagen formuliert, die er Anne-Dores Eltern über diesen gefahrvollen Menschen machen wollte. Ohne Aufhör forschte er im Gesicht des Mädchens, dessen Züge, verschlossen und fest, ihm nichts verrieten. Ihm schien, als sei sie bleicher als je. Er sah ihre Augen erschrecken, wenn ein Vorfall sie hob, der außergewöhnlich war oder unerwartet kam. Seine erste große Beteiligtheit am Leben machte ihn empfindsam und klarsichtig, er litt sein erstes Leid unvorbereitet und hilflos. Zu allem brachten seine religiösen Urteile ihm die Pein eines bösen Gewissens. Er vergaß sich so weit, daß er nachts an ihrer Tür lauschte, aber unter dem qualvollen Pochen des eigenen Herzens und dem Beben seines Körpers hörten seine Ohren die ganze Welt sausen, und er schlich fort auf seinen grauen Socken, bis sein gesunder Schlaf ihn befreite.
Aber dieser Zustand der Ungewißheit nahm im Laufe der Wochen so schmerzhaft überhand, daß er es im ersten Augenblick beinahe wie eine Erlösung empfand, als er eines Abends spät das junge Mädchen im Gartenhaus mit Mark Enz überraschte.
Da er anfangs nur Anne-Dore sah, die das weiße Gesicht im Halbdunkel über ihre Hände neigte, die auf dem Tisch ruhten, erschrak er furchtbar, als er plötzlich im Hintergrund der Laube den roten Feuerpunkt einer Zigarette gewahrte, der aufglühte und ihm im Bereich seiner rauchenden Seele für eine Sekunde das verhaßte Gesicht zeigte.
»Ich störe wohl — —«, stotterte er fassungslos.
»Ja«, sagte die Stimme mit dem gelassenen Klang und der infamen Lieblosigkeit. Sonst nichts. — Er konnte doch nun so nicht fortgehen. Es schmerzte ihn schneidend, daß Anne-Dore nicht sprach, daß sie das duldete, daß er, kalt und lieblos bei einer höflichen Frage genommen, fortgeschickt werden sollte wie ein Schuljunge. Sein Herz überströmte von einem schmerzhaften Mut.
»Fräulein Wendel ....«, sagte er flehentlich.
Sie antwortete nicht. Da sah er, als wieder kurz und tückisch von drüben die Zigarette in das Schweigen einbrannte, ganz flüchtig, aber mit grausamer Deutlichkeit, daß sie weinte, daß sie mit dem Schluchzen kämpfte, um ihm antworten zu können. Ihn schwindelte. Da fühlte er ihre Hand an seinem Arm. Unsagbar zart und liebevoll war die kaum spürbare Entschiedenheit, in der sie ihn fortschob. Als hätte sie ihr Leben lang nichts erlitten, als nur den Schmerz, zurückgewiesen zu werden, und wüßte, wie keiner auf der Welt, wie weh das tut. —
Diese Nacht schlief Friedberg nicht. Er hatte sich zum Essen entschuldigen lassen und schrak gegen Mitternacht heftig zusammen, als ein leises Pochen an der Tür ihn an seinem Schreibtisch emporriß. In einem richtigen Instinkt für die Bedeutung dieses außergewöhnlichen Vorfalls schwieg er und schlich rasch und bedachtsam auf den Zehen an die Tür, die er leise öffnete. Es wurde ihm vorsichtig von außen geholfen, er fühlte den Druck einer Hand an der Klinke, die zögernd und schwer jedes Geräusch des Schlosses zu hindern trachtete. Dann sah er Anne-Dore im Rahmen der Tür stehen, in weichen Hausschuhen und ohne die dunkle Krone ihres Haares. Er ließ sie zitternd ein, putzte sein Licht und zog sprachlos und leise das Fenster zu. Nun sah er, daß ihr Haar in zwei Zöpfen niederhing, gestrafft an den Schläfen, sank es glänzend und schlicht vom Scheitel nieder. Wie das ihr Gesicht veränderte. Er glaubte an einen Traum und fand keine Fassung. Sie winkte ihn traurig lächelnd aber gelassen auf seinen Stuhl und ließ sich auf seinem Bettrand nieder.
Ihr Kommen begründete sie in keiner Vorrede und entschuldigte es nicht. Er solle versuchen, ruhig zu sein und sie anzuhören.
»Was soll ich tun?« fragte er mit verstörtem Gesicht. »Sind Sie es wirklich, Anne-Dore?«
Sie beachtete nicht, daß er sie bei ihrem Vornamen nannte. Sie schien auf nichts acht zu haben, war ganz im Bann ihres Plans, den sie auszuführen schien, ohne zuvor die Kraft zu einer Überlegung gefunden zu haben. Friedberg entsann sich später deutlich des Eindrucks, den sie anfänglich auf ihn machte, er hatte die bestimmte Vorstellung, sie wandelte in einem Traum, dessen schläfriges Feuer sie langsam verzehrte.
»Friedberg,« sagte sie, »Sie müssen mir versprechen, zu schweigen. Begreifen Sie, es ist nötig, daß Sie schweigen ...«
Es wurde still. Er wollte, seinem Herzen gehorsam, in dem es warm emporwallte, ihr seine eifrigsten Versicherungen geben, denn ihm schien allein darin eine rasche Hilfe für sie zu liegen, aber seltsam und unzertrennbar miteinander verbunden, überwältigten ihn seine Selbstsucht und seine religiösen Vorstellungen. War ihm hier nicht, wunderbar vom Herrn gefügt, eine ganz andere Aufgabe gesetzt, als die, einen falschen und gefährlichen Dienst zuzusagen? Kam Anne-Dore nicht zu ihm, wie von einer höheren Macht getrieben, die sich seiner bediente, um die Verirrte auf den rechten Weg zurückzuweisen? Seine Erregung verdarb seinen Zweifeln alle Kraft, er ließ sich treiben in diesem dumpfen Drang, und als er dem Mädchen antwortete, mochte seine haltlose Angst in ihrem Fieber wohl wirken wie das Beben einer inneren Ergriffenheit.
»Anne-Dore, was fordern Sie von mir? Wollen Sie mich zum Mitschuldner an Handlungen machen, die Sie in Abgründe reißen? So wahr mir Gott helfen wird, werde ich nichts unversucht lassen, um Ihr betörtes Herz auf den rechten Weg zurückzuweisen.«
»Sprechen Sie leise«, sagte das Mädchen. »Wenn Sie noch ein lautes Wort sagen, lasse ich Sie allein.«
Friedberg mäßigte sich.
»Ja ich will leise reden,« sagte er, mehr und mehr im Bann seines geplanten Rettungswerkes, »aber Sie müssen mich bis zu Ende anhören. Wollen Sie? Ja, ich sehe, Sie wollen. Ich fühle, daß Sie des Zuspruchs bedürfen und danke Gott, der mich ausersehen hat, meine schwache Kraft in den Dienst seiner Sache zu stellen. Um Ihretwillen Anne-Dore. Wie herrlich ist das für mich. — Ich kann keine großen Worte machen, aber er, Anne-Dore, unser Heiland, hat sie für mich gemacht und ihrer Kraft wollen wir uns vertrauen. O, er wird helfen. Er, der gesagt hat: Der Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer denn alles, und niemand kann sie aus meines Vaters Hand reißen.«
Das Mädchen sprang auf, als habe der Mann vor ihr sie mit Feuer bespien. Sie floh an die Tür, wie von einem Sturm erfaßt, mit einem Schreckensangesicht, in dem auch die Lippen bleich waren, wie im Tode. Beschwörend riß sie die Arme gegen ihn empor und ihr Mund stieß keuchende Laute aus, die Worte bedeuten sollten.
In einem Taumel von Siegesbewußtsein und Todesangst wußte Friedberg im ersten Augenblick nur eins: eine Welt von Kämpfen und Schmerz in der Seele des Mädchens lag zwischen jenem ersten Tag im Garten und dieser Nacht. Und im Mittelpunkt aller Not stand der verhaßte Spötter mit seiner geschmeidigen Würde und seiner ruchlosen Sicherheit. Der Kandidat preßte die Fäuste gegen die Augen und fühlte den Namen, wie er sich einbrannte in das flimmernde Dunkel vor ihm. »Teufel,« stöhnte er, »Teufel! Wer hat dich ausgerüstet?« Dann riß ihm ein wütender Mut die Hände vom Gesicht. Er sah Anne-Dores Arme hinter ihr an der Tür Halt suchen, sprang herzu und stützte sie.
»Ruhe, Ruhe,« bat er, »beruhigen Sie sich. Es ist nichts verloren. Es wird alles gut. Ich habe es nicht so gemeint, wie konnte ich auch wissen ...«
Er führte sie an das Bett, sie ließ sich schwer nieder und schien nun erst zu empfinden, daß er sie berührt und geleitet hatte. Ihre Schultern schüttelten die Erinnerung an seine plumpen Hände ab, sie gewann Sicherheit, weil sie seine Hilflosigkeit sah, besann sich mit einem Lächeln, das ausgleichen sollte, aber schmerzlich war, wie vom ewigen Heimweh erschaffen.
»Lassen Sie gut sein«, sagte sie und winkte ihm die begonnenen Worte von den Lippen. Er brach ab und starrte sie an. »Ich wollte nicht das, hören Sie mich«, fuhr sie fort. »Glauben Sie, ich sei gekommen, um mir einen Rat bei Ihnen zu holen? Ich wollte Ihnen nur den Rat geben zu schweigen. Und Sie werden es tun. Greifen Sie nicht in Dinge ein, die ihren Gang haben wollen. Wenn ich durch meine Eltern gehindert würde, meinen Weg zu gehen, gäbe es ein größeres Unglück, als sonst geschehen kann. Sprechen Sie jetzt nicht, seien Sie still. Meine Eltern werden mich nicht hindern können. Es würde ein furchtbarer Schmerz in ihr armes Leben kommen. Begreifen Sie doch, nicht meinetwegen komme ich, auch nicht seinetwegen, am wenigsten Ihretwegen, Herr Friedberg. Ich komme meiner Eltern wegen. Ich bin gekommen, um für ihre Ruhe zu sorgen, denn was leistete mir Gewähr, daß Sie nicht eine Dummheit machen würden, ich meine, daß eine unüberlegte Güte von Ihnen, eine voreilige Hilfsbereitschaft alles zerstörte. — Es wäre nachher nichts mehr gutzumachen.«
Er hatte sie niemals so anhaltend, so sicher und bewußt sprechen hören. Während sie redete, konnte er keinen Gedanken fassen und nun, da sie schwieg, mit einem Ausdruck drohender Entschlossenheit, erst recht nicht.
»Anne-Dore,« sagte er und bedeckte sein Gesicht mit den Händen.
Sie schwieg, gequält durch diesen Flehenden, der eben noch so streitbar vor ihr gestanden, gequält durch den Gedanken an ihre Niederlage und daß sie sich ihm hatte verraten müssen unter jenem Wort, das in ihre geheimen Kämpfe geleuchtet hatte. Nein, ihr waren keine Gaben verliehen, den Brutalitäten des Daseins geschmeidig zu begegnen. Kein Sieg ihrer Jugend verlieh ihrem Gefühl Festigkeit und ihrem Innenleben Stete, das erst um seinen Namen rang, und ihr waren keine Kräfte geblieben, um sich nach außen hin Rettung zu schaffen. Wachten nicht Engel über dem blutigen Streit eines hilflosen Herzens, es wäre traurig um jenen Ruhm bestellt, den der Himmel denen verheißt, die überwinden.
Anne-Dore wußte, daß etwas geschehen mußte, um ihre Stellung zu Friedberg auch für die künftige Zeit zu sichern. Wie leicht wäre es ihr geworden, wenn sie hätte lügen können, jene feinen, liebevollen und barmherzigen Lügen, die oft so viel schöner scheinen als die Wahrheit, und jedes Schicksal um sein Recht betrügen möchten. Sie konnte es nicht. So sagte sie nur:
»Ich muß allein sein, Friedberg, sehen Sie, mit allem, muß mich abfinden. Ich glaube Ihnen, daß Sie mir helfen möchten. Wollen wir nicht Freunde sein? Bin ich Ihnen um so viel Glück voraus, daß Sie nicht können?«
Seine Angst um sie und sein Haß gegen Enzheim siegten über seine Verwirrung. Er raffte sich zusammen und ballte die Fäuste ...
»Leise, leise,« flüsterte das Mädchen, als sie sein Gesicht sah.
»Freunde?« keuchte er, »haben Sie Freunde gesagt? O, wie wäre ich wert, Ihr Freund zu sein, wenn ich schwiege! Ich habe Sie reden lassen, jetzt will ich reden. Wissen Sie, wer dieser Mann ist, dem Sie vertrauen, dessen Einfluß Sie zu erliegen drohen? Ihr unschuldiger Sinn, der in der argen Welt nicht erfahren hat, irrt und fehlt, ist verwirrt worden. Glauben Sie, ich wüßte das nicht? Ich kenne Mark Enz. Wieviel Unschuld seiner bösen Verstellungskunst schon erlag, ahnen Sie nicht. Ich weiß es. Ich habe mit ihm gelebt, habe gesehen, wie er Tränen verlachte, Schmerzen verspottete und gewissenlos auch das Heiligste betastete. Er, der alles bejahen und verneinen kann, der keinen Gott kennt, und dem kein Gewissen in der Brust schlägt, lebt schamlos und ruchlos nur seinem Genuß. O, er kann alle Register ziehen und geht zu Werk im Kleid jeder Tugend. Unschuldig kann er tun wie ein Knabe, gefühlvoll wie ein schüchternes junges Mädchen, männlich wie der Charaktervollste, der je für hohe Sitte und edlen Kampf verantwortlich war. Nichts an ihm ist arglos oder rein, er ist berechnend und kalt in jeder Bewegung. In jeder! Er kann sogar rot werden, wenn er will ...«
Was war das? — Anne-Dore lachte.
Nichts hätte ihm seine ganze Ohnmacht deutlicher vor Augen führen können. Zwar besann sie sich gleich, glich aus mit einem freundlichen Zugeständnis. Es wäre ihr verständlich, daß Enzheim manchen so erscheinen müßte, die ihn nicht kennten, aber er dürfe darüber nicht vergessen, daß es Menschen geben könnte, die sich hinter mancherlei Gebärden versteckten, weil sie sich den Tag hindurch ihrer Umgebung nicht preisgeben wollten ...
Ach, sie glaubte ihren seichten Worten selber nicht. Aber ihre Verachtung für diese plumpe Erkenntnis des erbosten jungen Mannes vor ihr war zu groß, als daß sie ihm auch nur noch einen Schatten ihrer eigenen Angst hätte verraten können. Und ohne daß sie recht wußte, wie es geschah, gelang es ihr, ihn zu beruhigen. Ihr Herz brannte ihr unter den eigenen Worten, die lau und flach alles auf ein träges Mittelmaß stellen mußten, um diesen Einfältigen zu beschwichtigen. Was sollte sie tun? Das Unheil war einmal geschehen. Sie sah in seiner Entdeckung beides, eine Warnung und eine Gefahr. O, es war kein Zufall gewesen, daß dieser Verschonte, der für sein Tun nicht zur Verantwortung gezogen werden konnte, ihr mit jenem Bibelwort entgegentreten mußte.
Gepeinigt durch die schale und unsinnige Lage, in der sie sich befand, stand sie auf und reichte ihm widerstrebend ihre Hand hin.
»Morgen,« winkte sie ab, als er reden wollte.
»Ich bin auch nur ein Mensch,« stotterte er. »Fühle ... leide — ach, entschuldigen Sie.«
Sie nickte ihm zu, hilfloser als er.
»Der liebe Gott behüte Sie,« sagte er traurig.
Mit ihnen schritt ein Dritter durch die Nacht. —
»Hast du mich lieb?« fragte Mark Enz.
Anne-Dore schwieg, weiß wie das Tuch, das ihre Hände preßten. Seine Worte sanken in die blutige Dämmerung ihrer Seelenqual, in ihrer Kühnheit erlösend wie Licht und schmerzhafter als der bittere Tod. Nun war ihr, als habe sie all ihre Zweifel und all ihre Not geliebt, grausamer und allgewaltiger als sie, erschien ihr, was nun kommen sollte. Und als er seine Frage wiederholte, traurig, wie nur er fragen konnte, eindringlich, als hinge sein ganzes Heil von ihrer Antwort ab, stöhnte sie auf, wie ein gemartertes Kind und flüsterte klanglos:
»Hilf mir.«
Wen bat sie? Sie wußte es nicht mehr.
Sie waren des Nachts miteinander im Wald. Nachdem sie in der Laube entdeckt worden waren, hatte Anne-Dore gebeten, er möchte dorthin nicht mehr kommen, und er hatte ihr gesagt, er würde am Waldrand auf sie warten, spät, wenn das Haus schlief. Nun schritten sie miteinander im Mondlicht dahin. Hellgraues Silber legte, geheimnisvoll bewegt, die schmalen Waldwege in lichte Nebel. Wenn sie hinaustraten in die Lichtungen der Waldwiesen, wurden ihre Stiefel naß, es war dort kühler und das Gras duftete, feucht und ein wenig nach verwehtem Rauch. Unter den Bäumen war es noch warm vom Tage, sie schliefen tief in ihren grünen Kleidern, die der Sommer noch nicht gedunkelt hatte.
Er blieb stehen, legte seinen Arm um ihren Hals und um ihre schweren Zöpfe, die kühl und schwarz waren wie Erde; so blieb auch sie stehen, suchte Halt in ihrer heißen Bedrängnis, bis ihre Stirn seine Schulter fand.
Er wußte viel mehr als sie ahnen konnte, sie, die nie zu ihm gesprochen hatte. Wie oft hatte sie erschrocken gelauscht und selig gezweifelt: Woher kannte er sie und den scheuen Weg ihres geteilten Herzens? War ihre Welt ihm nicht fremd?
Er hörte ihren Hilferuf und wußte wohl, was sie verschwieg und um was sie bat.
»Anne-Dore,« sagte er langsam, »ich liebe dich. Mich verlangt nach dir. Du bist Ruhe, Heimkehr, Halt für mich. Du bittest mich um Hilfe und hast gefühlt, wie sehr ich ihrer bedarf. Wenn du deine Liebe nicht schenken kannst, sei gütig. Mein Herz ist zerrissen und meine Hoffnung bei dir, Anne-Dore.«
Er wußte wohl, welcher Worte sie bedurfte, er empfand, wie viel zu schwer sie litt, als daß sie Leiden ungestillt lassen konnte. Und als er sich nun niederbeugte über ihr regloses Gesicht, empfingen ihre Lippen, bleich und kalt, seinen heißen Mund.
»Vertraue mir,« bat er. »Sieh deinen Trost in meiner Heilung. Was soll ich tun, daß du nur einmal lächelst? Kind, sprich, glaubst du, ich wäre nicht bei dir? Die Welt, in der du glücklich warst, kann niemals meine werden. Nie. Aber ich kann uns einen neuen Himmel schenken für den, den ich dir geraubt habe.«
Sie zitterte und machte sich los.
»Nichts hast du mir geraubt,« flüsterte sie angstvoll. »Sprich nicht so. Ich kann nicht dein eigen sein, wenn ich ... ach, versteh mich, Mark. Bin ich ein Kind, sag, bin ich? Ich weiß, wofür ich einstehe, und meine Liebe zu Ihm ist stark durch Seine Kraft. Du bist ihm fremd und feind. Du hast es mir oft gesagt. O, es ist schön, daß du wahr bist, wie lieb hab ich dich darum ...«
Wieder fühlte er, wie oft zuvor, seinen Fehler, sie in diesen Dingen zu ernst genommen zu haben. Aber sein empfindsames Wesen erlag ihrer unschuldigen Wahrhaftigkeit und der Schönheit ihres kindlichen Ernstes. Leicht tat er jedem Hindernis Gewalt an, aber jede Schönheit, die ihm begegnete, war stärker als er. Er hatte im Leben zu viel empfangen, als daß die schale Lust einer blinden Gabe ihm begehrenswert erschien. Was ihm die Seele in Gluten hob, war der Kampf mit jener fernen, lichten Kraft, die es für ihn erst wahrhaftig gab, seit dieses Kinderherz ihrer bedurfte und sie empfing. Ihm war, als gelte es einen Zweifel der eigenen Brust zu überwinden.
So war ihm in heimlichem Grauen und wie in einer Liebe zu unbekannter, neuer Gefahr, als schritte ein Dritter mit ihnen durch den nächtlichen Wald. Ein Spiel mit Schuld und unsichtbaren Waffen glitt wie ein heißes, schmerzendes Feuer durch sein drängendes Blut.
Und wieder wußte Anne-Dore, erbebend, was der geliebte Mann sie gefragt hatte. Wie aufgescheucht floh ihre Seele vor der Antwort, die ihr Blut ahnte und die ihr Mund verschwieg. Sie hätte ihre beiden Hände auf seine Lippen pressen mögen, um seine Worte zu hindern, die sie ersehnte und fürchtete. Und was sie fürchtete und ersehnte, sagte er.
»Anne-Dore, wie klein ist der Himmel deiner Liebe, wenn er meine große Sehnsucht nach dir zurückstößt. Ich weiß, was mich zu dir drängt und ist dein Reichtum so gering, daß du Angst vor dem hast, was du meine Armut nennst?«
»Schweig,« stieß sie hervor. »Du lügst.«
Wie ruhig er blieb.
»Ich kenne mein Herz,« sagte er fest. »Ich lüge nicht, wenn ich seiner Glut die Tore öffne mit jedem Mittel. Aber du — du schwankst und bist nicht kalt noch warm. Dir ist die Gefahr verhaßt, weil du fühlst, wie schwach die Herrlichkeit deiner Heiligtümer ist, die dem Zorn meiner Liebe in dir erliegen. Du hast auf meine Frage nicht geantwortet. Willst du, daß ich dir die Antwort erlaß für alle Zeit und dir deine selbstsüchtige Seligkeit lasse, die über meiner Not triumphiert? Keine Sünde ist größer in der Welt, als der Ungehorsam gegen ein starkes Gefühl. Und dein Gefühl, Anne-Dore, an dem du dich versündigst, gehört mir.«
»Du bist kalt«, sagte sie schwach von Zweifeln.
»Ich verstehe dich nicht«, antwortete er ihr hart und heftig. »Heißt das, ich teilte deine himmlische Liebe nicht, heißt es, ich sei nicht fromm, nicht gläubig wie du? Nein, ich bin es nicht wie du, und werde es nie sein. Sei stolz auf deine lieblose Liebe, wenn du es kannst. Mein Herz ist vielleicht schwächer wie dein's, aber größer und reicher.«
Er trat von ihr zurück und mit veränderter Stimme sagte er aus dem Schatten:
»So geh. Der Friede, den dir dein Gott verschafft, wird dich trösten. Meinen nimmst du für immer mit.«
»Was willst du von mir?« stöhnte sie in Todesangst.
»Dich«, sagte er. Ihre Schultern schmerzten, so fest griff er zu. Aber sie fühlte, daß seine Hände zitterten.
Plötzlich durchfuhr sie, wie ein rotes Licht, grell die Erkenntnis dessen, was seine Ansprüche sein möchten. Wie geblendet, mit blinden Händen, die ihr Ziel verfehlten, suchte sie ihn zurückzustoßen. Die ganze dunkle und drohende Macht der Sünde erschien ihr verkörpert in ihm. Aber gleichzeitig, und wunderbar verschmolzen mit ihrer Todesangst, weckte die Kraft seiner kühnen Hände ein neues Leben in ihrem Blute auf, schwermütig, süß und brennend begann sein singendes Licht. Sie schloß die Augen und stöhnte. Gebrochen hing sie in seinem Arm.
Aber es war ein Dritter mit ihnen im Wald, gleich nah beiden, als liebte er keinen geringer. Mark Enz hob sie auf, zärtlich, liebevoll und fest. Er küßte ihre bleiche Stirn, die schon der Mond vor ihm geküßt, zurückhaltend in jeder Bewegung, stützte er sie auf eine Art, in der sie seine Arme als gut und brüderlich empfand und führte sie zurück zum Haus ihrer Eltern. Wunschlos und wie befreit empfand er nichts als seine Pflicht sie zu schützen, auch vor sich selbst. Kein Zug seines Herzens verwünschte die schöne Schwäche, in der er nicht zu nehmen vermochte, was nicht bewußt gegeben wurde.
Es schoß ihm heiß in die Augen, als sie an der Gartentür bebend fragte:
»Du kommst doch wieder?«
Er nickte nur.
Der Mond tauchte nieder in den Dunst der Heide, versank in ihrem Atem und gab sein Reich den letzten Sternen hin, in deren blassem Glanz der schlafende Wald den neuen Tag erwartete.
Herr Missionar Wendel kränkelte in diesem Frühjahr ein wenig. Auch seine Gattin lebte schweigsamer und zurückgezogener als je. Oft schritt er langsam und in Gedanken versunken gebeugt und müde die Wege seines Gartens entlang, den er angelegt, unter den Bäumen hin, die er gepflanzt hatte, und der Ausdruck seines Gesichts stimmte zu seinem grauen Haupt. Gegen Anne-Dore war er zärtlicher als je und so nachsichtig, wie sie ihn noch nie gekannt hatte. Er zeigte sich besorgt um kleine Einzelheiten, die ihr fehlen mochten, einmal fragte er sie sogar, ob es ihr wohl gefallen würde, eine kleine Reise zu machen, das Nötige ließe sich erübrigen, und er lächelte sein gutmütiges Lächeln, etwas herablassend, bedeutungsvoll und doch ein wenig unsicher. Sie lehnte es ab. Er dankte ihr innerlich für ihren bescheidenen Sinn, ohne zu ahnen, welch schwere Bedeutung sein Kind diesem harmlosen Vorschlage beilegte, in dem ihr geängstigtes Herz einen Ausweg zu sehen glaubte, den ihr barmherzig der Himmel erschloß.
Oft sah sie in kleinen Zeichen einen Wink der Vorsehung, in nichtigen Dingen eine verhaltene Drohung. Es kam dazu, daß Friedberg, der trübsinnig und schweigsam seine Tage lebte, die Abendandachten mit ihren Bibeltexten zu offenkundigen Anspielungen mißbrauchte. Als sie nach jener Nacht mit Mark Enz spät aus dem Walde heimkehrte, sah sie Licht in seinem Zimmer; er mußte die Treppe unter ihren zaghaften Füßen gehört haben, es war kein Zweifel, so laut wie sie knackte, in diesen unsagbar stillen Nächten. Am andern Morgen las er mit wehmütiger Überwindung seines Stolzes den Spruch ihrer gemeinsamen Nacht und Anne-Dore hörte es den ganzen Tag: »Niemand wird sie aus meiner Hand reißen.«
Ruhiger Hoheit und fester Güte voll strömte es mit der Feier dieser göttlichen Zuversicht in ihre Seele. Sie konnte sich der überwindenden Gewalt dieses Heilandwortes nicht entziehen, wie in ein Licht sah ihre Seele in den reinen Trost dieser starken Worte empor. —
Eines Abends an einem Wochentage, an dem Pastor Jacoby eine Bibelstunde angekündigt hatte, schritt sie durch die Frühlingsdämmerung mit Friedberg über die Berge in die Stadt. Sie waren es gewohnt, diese Stunden und die mehr persönlich gefärbten als allgemein gedachten Auslegungen des geliebten Predigers miteinander anzuhören, ja, sie hatten bestimmte Plätze, an denen sie niemals fehlten. —
Aus den großen blassen Farben des sinkenden Abends traten sie miteinander in den geräumigen flachen Saal des christlichen Vereinshauses, in dem die Versammlungen abgehalten wurden, die die eifrigsten Gemeindemitglieder vereinigten. Das gelbe, schale Licht der singenden Gasflammen kämpfte an der Flucht der niedrigen Scheiben mit der letzten Sonnenkraft und legte sich unfreundlich und hart in die stillen und bedachten Gesichter der Wartenden. Der Saal war wie gewöhnlich überfüllt, denn Pastor Jacoby war in diesen Wochen bei der Auslegung der Apokalypse angelangt und seine Worte galten auch heute jenen geheimnisvollen und prophetenhaften Visionen des Apostels Johannes. Die Stimmung war gedrückt, in allen Zügen stand ein qualvolles Bewußtsein für den Ernst dieser drohenden Verheißungen, die die Plagen voraussagten, mit denen das Reich des Antichristen heimgesucht werden sollte, vor der Wiederkunft des Herrn Jesu Christi.
Finstere Gestalten, in funkelndes Erz und in die Farben des Feuers getaucht, sprengten dahin wie die Vorzeichen endloser Plagen nach gerechtem Gericht, Sinnbilder einer leuchtenden Macht, der auch der Tod erlag, triumphierende Boten einer ewigen Herrlichkeit.
Anne-Dore hatte die Augen geschlossen und wartete. Neben ihr kritzelte Friedberg in sein Notizbuch. Er schrieb sich alles auf, um es wohl zu behalten. An ihren Augen zogen gigantisch und in umrauchten Farben die Bilder vorüber, die sich aus den letzten Stunden wie für alle Zeit in ihre Seele gegraben hatten.
›Und also sah ich die Rosse im Gesichte, und die darauf saßen, daß sie hatten feurige und bläuliche und schwefellichte Panzer; und die Häupter der Rosse waren wie die Häupter der Löwen; und aus ihrem Munde ging Feuer und Rauch und Schwefel.‹
Dies geschah zu einer künftigen Zeit, in der vier Engel zu ihren Taten gelöst werden sollten, Engel, von denen es hieß, daß sie den dritten Teil aller Menschen töten würden.
Sie hatte nicht verstanden, was diese düsteren Symbole besagen wollten. Konnte je ein Mensch es wissen? Aber die gigantischen Figuren und Gestalten, funkelnd aus Nebel von Flammen, Rauch und Blut, hatten sich ihr unauslöschlich eingeprägt. Ihm, dem Antichristen, dem großen Verführer und dem allmächtigen Feind des geschlachteten Lammes, des himmlischen Erlösers, galt dieser furchtbar gerüstete Zug unüberwindlicher Streiter, ihm und seinen verfluchten Gesellen. Und es galt das Erlösungswerk vollkommen zu machen, das Licht für alle Zeit von jeder Finsternis zu scheiden und denen, die überwunden hatten, von Ewigkeit zu Ewigkeit den leuchtenden Himmel ihres Heils zu bereiten. Den Erwählten, von denen es hieß. ›Und ich sah ein gläsern Meer, mit Feuer gemenget, und die den Sieg behalten hatten, stunden an dem gläsernen Meer und hatten Harfen Gottes.‹
Sie, die erlöst von aller Pein der Erde eingehen sollten in das befreite Reich des Lichtes, in jenes Land, das zwölf Tore hatte wie zwölf Perlen, und dessen Gassen von lauter Gold waren, klar wie durchscheinendes Glas. Kein Tempel war darinnen, und es bedurfte der Sonne nicht und nicht des Mondes, die Herrlichkeit Gottes, verklärt im Blut des Gekreuzigten, durchleuchtete seinen unaussprechlich hohen Frieden. —
Ein Schauer holdseliger Verzückung hob tief und hell die Brust des Mädchens, in ihren Träumen versank die kleine Welt ihrer zeitlichen Kämpfe. Wer auch wollte ihr die Herrlichkeit rauben, die für sie bereitet war, in die ihre Liebe sie hob und die Liebe dessen, der für sie gelitten?
Die Geräusche des Saals dämpften sich, eine Stille der Erwartung trat ein. Als sie aufschaute, stand Pastor Jacoby schon hinter dem kleinen Rednerpult, das auf einem Podium am Ende des Saals unter einem schimmernden Kruzifix errichtet worden war. Er hatte in diesen Stunden seine Amtstracht niemals angelegt, sondern kam in einem schlichten dunklen Rock, der anfänglich seine ganze Erscheinung menschlich näher zu rücken schien, der ihn nahbarer machte und erbittlicher. Auch sprach er für gewöhnlich rascher, ohne jenes eindringliche Pathos, das seinen Kanzelreden die mitreißende Gewalt verlieh, er sprach persönlicher und im Tone eines, der irren konnte, wie alle Menschen. Um so stürmischer aber überwältigte es, wenn mitten im Gang einer wohlgesetzten Rede plötzlich sein heiliger Eifer alle Schranken zerbrach, wenn er plötzlich, hingerissen durch die Glut der Visionen, die seine verzückte Seele schaute, seiner entfesselten Inbrunst allen Sturm ließ. Es schien, als zersprengte sein Wille mitzuteilen und einzuwirken die geschlossene Menge zu seinen Füßen, es war, als redete er nur noch zu einem Menschen, und jeder im Saal hatte erbebend den Glauben, er, er allein, sei jener einzige, den diese Stimme meinte.
Niemals hatte Anne-Dore ihn so gesehen wie heute. Oft blieben seine Arme minutenlang, halb erhoben, in beschwörender Haltung. Bleich und entstellt von Ergriffenheit, ereiferte sich zwischen ihnen sein bewegliches Gesicht, ein erregter Widerschein dessen, was seine Seele erglühen machte. Von den Sünden der Menschheit, die den Zorn Gottes entluden, war er in seiner Rede auf jene eine Sünde gekommen, die nach dem Ausspruch Christi nicht vergeben werden konnte: auf die Sünde gegen den Heiligen Geist.
Seltsam, mitten aus dem Fieber ihrer höchsten Spannung und Hingabe sank die Aufmerksamkeit Anne-Dores plötzlich herab in die Gelassenheit einer völligen Apathie. War es, daß ihre verstörten Sinne nicht mehr die Kraft besaßen zu folgen, oder setzte bei ihr ein Wille ein, der stärker als sie war, sie wußte es nicht, aber die Worte des Geistlichen klangen plötzlich inhaltlos und hohl über sie hin, hatten allen Sinn verloren und wiegten sie nur ein, wie eine erregte, ungeordnete Musik, die aus der Ferne her die Sinne halb verwundet, halb betäubt. Und wie graue Gewitterwolken über hellgrünem, beschienenem Frühlingsland, zogen die dunklen Bilder und ihre Schrecken dahin und verschwammen und ließen ihr Raum für andere Erscheinungen, für die Erlebnisse ihrer letzten Wochen mit Mark Enz.
In einer seligen Ermüdung, von tausend Kämpfen geheilt, gab sie sich ganz dem holden lichten Spiel hin, das für sie kam. Sie sah den geliebten Mann wieder vor sich stehen in der blühenden Heide am Waldrand, sah, wie sie miteinander über die Felder schritten, durch den Wald, bis Hildenrot, wo er wohnte. Er hatte sich dort im Forsthaus ein Zimmer gemietet, und als sie ihn erstaunt fragte, wie denn das käme, und warum er sich gerade dort niedergelassen habe, sagte er einfach: ›Ihretwegen‹. Er hatte sie wiedersehen wollen, denn seit der ersten Begegnung war ihm gewesen, als dürfte er sich nie mehr von ihr trennen, als sei sie für ihn und nur für ihn in der Welt. In der grünen Welt, die er liebte. Welches Glück hatte es für sie bedeutet, mit ihm die Herrlichkeit ihrer schönen Wälder zu teilen. Er liebte sie auf gleiche Art. Ihm war jede Schönheit vertraut, als sei sie sein Eigentum und er das ihre. Niemals hatte sie für möglich gehalten, daß ein Mensch mit so schlichter, wahrhaftiger und warmer Inbrunst die Wälder, die Heide und den Himmel lieben könnte. Freilich ihren Himmel nicht, aber mit wieviel Feingefühl ließ er ihrem Glauben sein Recht, damals, wie ging er vornehm und liebevoll auf alle Regungen ein, die ihr Herz von Anfang kannte, wie achtete er ihre Welt, so fremd sie seiner war. — Aber dann versanken ihr jene ersten Stunden, in denen sie gelernt hatte, ihm zu vertrauen. Gern folgte sie seinem Wunsch, daß sie einander häufig im Wald treffen möchten. Auf wie seltsam selbstverständliche Art wurden aus einzelnen Spaziergängen regelmäßige Zusammenkünfte, Stunden, deren Unterbrechung sie nicht ertrug. Erst als er einmal zur verabredeten Zeit nicht kam, fühlte sie mit Furcht und Schrecken, wie nötig ihr Herz seine Art hatte, die reich und liebevoll und ihrem Wesen verwandt, wie eine ganz neue, selige Offenbarung von Menschengemeinschaft beglückte. — Aber dann hatte sein Verhalten sich langsam verändert und mit ihm sein Gesicht. Dies Gesicht, das ihr schöner erschien als alles, was sie in der Welt kannte, das in edler Nahbarkeit ihr täglich mehr anvertraute, als sein beredter Mund es je gekonnt hatte. Es kam nun oft ein harter, fester Zug hinein, etwas, das war, als fordere er ihren Dank, als wappne er sich zu Taten, die durch alles Vergangene erst eingeleitet worden waren.
Eine bittere Scheu zog in ihre Seele ein, aber mit Zittern fühlte sie, daß er ihr um dieser Kraft willen lieber wurde, die sich wie eine verborgene Drohung ankündigte. — Nun waren sie in der Gartenlaube des Elternhauses. Er beugte sich über sie und küßte ihren Mund. Ein heißer Schreck lähmte sie, bis Tränen sie erlösten. — Der Weg erklang. Friedberg stand im Eingang der Laube. Das war wieder Marks Stimme: ›Ich kann niemandem etwas ersparen, der sich in Liebe zu mir stellt.‹ — Nun zogen wieder Wolken, die Sonnenhelle ihrer Bilder versank. Graue Tage und böse Nächte ohne Schlaf, ausgefüllt mit Zweifeln, Kämpfen und heimlichstem Leid, zogen vorüber, bis jene Nacht kam, deren Ereignisse im Walde grelle Deutlichkeit, unbarmherziges Licht in allen Widerstreit ihrer Seele warfen. Zwei Ufer tauchten auf, ein dunkler Strom riß sie dahin, sie fühlte, daß es unerbittlich galt, sich zu entscheiden, daß es lau war in der Mitte, voller Gefahr zu versinken, falsch und trüb. Ihr einziger vager Trost war, daß in dem dumpfen Rauschen des Stroms, der sie fortriß, etwas erklang wie ein Heimweh nach dem Unendlichen.
Friedberg kritzelte neben ihr in dieser Bibelstunde, in der sie träumte. Einmal, als er flüchtig und vorsichtig zu Anne-Dore hinüberschielte, um sich der Wirkung einer drohenden Verkündigung zu vergewissern, sah er sie lächeln, versunken und glücklich.
›Mein Gott‹, dachte er und machte sich bemerkbar. Aber das junge Mädchen rückte nur ein wenig beiseite.
Plötzlich hörte sie, und die Gasflammen tauchten auf, die Köpfe der Andächtigen, das Kruzifix zu Häupten des Pastor Jacoby:
»Wer aber den Heiligen Geist lästert, der hat keine Vergebung ewiglich, sondern ist schuldig des ewigen Gerichts.«
Emporgerissen erbebte sie und lauschte angestrengt. Wie legte er diese Worte aus, deren Sinn unter dieser Deutung klar wurde wie eine erlebte Wahrheit? Wer die Kräfte des zukünftigen Reichs im eigenen Herzen erfahren hatte, wer alle Herrlichkeit und die göttliche Herkunft Jesu Christi geschmeckt hatte in unantastbaren Gewißheiten und wie von Angesicht zu Angesicht, und wer dennoch abfiel vom Glauben, im vollen Bewußtsein dessen, was er tat, wer in wissendem Frevel zum zweitenmal den Heiland der Welt kreuzigte, in dessen Liebe er geborgen war, der beging jene Sünde, die nicht vergeben werden konnte. Nein, wer sich fragte: ›Tat ich es?‹ in Zweifeln und Sorge, der war ihrer nicht schuldig. Wer sie begangen hatte, der wußte es, klar, ohne Einwand, graunvoll gewiß, teuflisch sicher und ohne einen Schein von Reue. Seine Stirn zeichnete grell, als ein ewiger Haß ohne Rast, der Stempel einer untilgbaren Feindschaft. Wer der Gemeinde der Heiligen angehört hatte auf der Erde, als ein Sachwalter und Verweser des vergossenen Blutes Christi, der konnte sie begehen, kein Ungläubiger, kein Zweifler und Heuchler, kein beliebiger Sünder, nur wer schon versiegelt war zur heiligsten Gemeinschaft und wurde dennoch ein Kind des Satans, des in Ewigkeit Verfluchten. —
Anne-Dore wußte plötzlich, daß sie Markus Enzheim nie wiedersehen durfte.
›Ich bin nicht fromm wie du und werde es nie sein.‹ Sie glaubte seine Stimme zu hören. Und was er geheim von ihr forderte, war Sünde, sie fühlte es erschauernd und bleich von Traurigkeit. Er gehörte jener Schar der Ungläubigen an, aus deren Bereich es für sie keine Wiederkehr mehr gegeben hätte. Und lockte sein drängender Ernst nicht ohne Aufhör ihre Seele in die gelassene Lust seiner Welt? Nie hätte sie halb und unwahr, nie im Segen ihres himmlischen Guts sein Eigen werden können. Erst jetzt erkannte sie die dunkle Gefahr, die ihr gedroht hatte. —
Auf dem Heimwege empfand sie einen so starken Widerwillen gegen den Kandidaten Friedberg, daß es sie fast wie ein körperliches Unwohlsein berührte. Ohne Aufhör zog ihr wieder und wieder der Ruf des Paulus durch den Sinn:
›Ich habe Lust zu scheiden, um bei Christo zu sein, welches auch viel besser wäre.‹
Es war in der Umgebung und im Hause Wendel nicht verborgen geblieben, daß ein junger Herr Enzheim sich im Forsthause von Hildenrot einquartiert hatte. Ereignisse waren in dieser entlegenen Gegend selten, und das nicht eben gewöhnliche Gebaren des Fremden tat das Seine zu allerlei Gerüchten. Anne-Dore mußte sich von Lotte belehren lassen, und sie hörte ihr stumm und lächelnd zu, wenn sie erfuhr, der junge Herr sei gern gesehen in Hildenrot; nicht weil er reich und freigebig wäre, nein, er sei sozusagen zutraulich und behandelte die Leute, als ob sie seinesgleichen wären. Die Dorfkinder von Hildenrot wären ihm befreundet, aber er hätte auch Umgang mit den vornehmen Herrschaften aus der Stadt, denen der Tennisplatz gehörte, und man müßte fast sagen, wenn er zu ihnen kam, war es, als gehörte alles ihm. Aber von Hochmut wäre keine Spur zu finden.
›Ist jemand in der Welt hochmütiger als du?‹ dachte Anne-Dore, und unter Lottes eifrigen Berichten tauchte Mark Enz' Gesicht vor ihr auf. ›Aber auch dies ist wahr,‹ sann sie, ›was träfe nicht zu bei dir?‹ Sie sah ihn vor Friedberg, dann seinen Freunden gegenüber, und dachte an alle wechselvollen Stunden, die sie mit ihm durchlebt. Es war ihr fast, als formte jede neue Umgebung, jede flüchtige Gemeinschaft ihn neu, und doch blieb er im Grunde derselbe, spröder als alle.
War auch etwas von ihren Beziehungen zu ihm bekannt geworden, oder war es ein Irrtum, sahen nur ihre heißen Befürchtungen in Lottes Gesicht eine lauernde Aufmerksamkeit? Jedenfalls wußte Lotte über Enzheim Bescheid. »Mein Ideal wäre er nicht,« meinte sie, »ihm ist doch nicht zu traun, im Grunde, wissen Sie. So den Tag über, da will ich nichts sagen, aber schon, daß er allein lebt. Alle Menschen, die allein leben, sind falsch. Man sieht es auch an den Augen.«
»So?« fragte Dore, um etwas zu sagen, »was treibt er denn?«
»Was er treibt, das ist die Frage eben. Er malt mit dem Stock Figuren in den Sand und verwischt sie wieder, schreibt in Notizbücher und verliert sie. Manchmal starrt er eine Stunde lang ein paar Enten an, oder Tauben ... wirklich! Sehen Sie hier,« fuhr sie geheimnisvoll fort und holte ein kleines Büchlein aus der Schürzentasche.
»Was ist das?« fragte Anne-Dore schnell und erschrocken, »geben Sie her.«
»Wollen Sie es? Man kann nichts lesen. Er hat es verloren.«
»Woher haben Sie das?«
Lotte war erstaunt darüber, daß Anne-Dore plötzlich ihre Gefühle nicht mehr zu teilen schien. Sie war erregt und sprach beinahe ärgerlich. Lotte sagte:
»Von Christel, die alles erzählt.«
»Vom Milchmädchen?«
Lotte nickte. »Im Wald lag es.«
»Laß es zurückbringen«, sagte Anne-Dore ernst. »Heute noch, gleich. Hast du gehört? Wie kannst du wissen, ob es nicht wichtige Dinge enthält?«
Das erschien Lotte sehr übertrieben. Sie zuckte die Achseln: »Wichtige Dinge.« Schließlich gehorchte sie, wie es sich für sie gehörte.
Auch bei Tisch war einmal von Enzheim die Rede. Friedberg bewies Zartgefühl und unterdrückte das aufkommende Interesse so energisch, daß Missionar Wendel aufmerksam wurde. Anne-Dore empfand einen so heftigen Verdruß darüber, daß der Kandidat glaubte, ihr seine Hilfe anbieten zu dürfen, und dadurch ein Bewußtsein von Gemeinschaftlichkeit mit ihr einzuheimsen hoffte, daß sie ihn zwang zu bekennen:
»Sie tun so, als sei Ihnen Herr Enzheim unbekannt«, sagte sie stolz und herausfordernd, »im Garten haben Sie ihn doch als Freund begrüßt?«
Es wäre sicher besser gewesen, sie hätte geschwiegen. Aber irgend etwas übermannte sie. Jener seltsame Mut, den eine geheime tiefe Traurigkeit geben kann, der wenig mit der Erkenntnis und mit der Besinnung eines Menschen zu tun hat. Ihr Herz war seit dem letzten Abend gewillt, alles preiszugeben. Wer wagte es, ihren Schmerz zu teilen?
Friedberg war fassungslos.
Herr Wendel fragte, ob denn der Fremde im Hause gewesen sei.
Anne-Dore klärte ihn auf, in einer Gelassenheit, die dem Kandidaten Schauer von Entsetzen und Hochachtung einbrachten. Es hätte sich um einen Tennisball gehandelt. — Er wußte nicht, ob er es mit Wahrheitsliebe oder mit höchster Frivolität zu tun hatte. Aber er fühlte sich wie mit Fußtritten zurückgestoßen. Da er den Einfluß des Freundes im Gebaren des jungen Mädchens zu spüren glaubte, stachelten sein Haß und seine Scham ihn auf:
»Wenn Sie einen Grund für meine ablehnende Haltung wissen möchten«, sagte er derb, »so suchen Sie ihn bitte in meiner Abneigung gegen die Denkungsart und gegen den Charakter dieses jungen Herrn.«
Anne-Dore sah ihn ruhig und traurig an, so daß er seine Worte bereute und nicht wußte weshalb. Erst als er wieder mit sich allein war, beschloß er ernstlich, den begonnenen Kampf erneut aufzunehmen und ihn mit aller Kraft zu Ende zu führen, nicht seinetwegen, sondern ihretwegen, die er liebte, und um seines Gottes willen, dem er zu dienen glaubte. —
Für Anne-Dore kam an diesem Nachmittag eine der schwersten Stunden, die sie in ihrem Leben durchkämpft hatte. Nur mit großer Mühe war sie noch eben ihrer Tränen mächtig geworden, als ihr Vater seine Hand auf ihren Kopf legte und sie fragte:
»Du bist doch nicht krank, liebes Kind?«
Nein, nein, sie sei es gewiß nicht, nur ein wenig müde. Und mit einem nachdenklichen Gesicht hatte er sie ziehen lassen müssen. Er war seit einiger Zeit besorgt. Da die Stimmung in einem Haushalt sich selten nach denen richtet, die ihn leiten, sondern für gewöhnlich nach denen, die am meisten geliebt werden, lag es seit einigen Wochen wie ein heimlicher Druck auf den Gemütern, eine leise Beklemmung, die zuweilen einer ganz ungewohnten Heiterkeit weichen konnte. Friedbergs Gebaren trug dazu bei, das Verhältnis der Hausgenossen zueinander befremdlicher zu gestalten; seiner beschaulichen Einfalt stand die düstere Grübelei wenig, in der er sich jetzt häufig gefiel. Und da er es nicht liebte, seinen Kummer allein zu leiden, trug er ihn in Gegenwart der anderen zur Schau, hier Mitleid heischend, dort warnend und anklagend. —
Für Anne-Dore rückte nun der Augenblick heran, an dem Mark Enz sie wieder im Wald erwartete. Als sie ihr Zimmer erreichte, brachen ihre Tränen sich mit ungestümer Gewalt Bahn, als hätte die gute Hand ihres Vaters sie gelöst. Draußen war ein Tag, so reich an Sonne und frohem Glänzen, daß es war, als wagte der Kummer sich nicht aus der Brust der Menschen, und als lastete er nun um so drückender. Ach, hinauseilen zu dürfen unter die Bäume, in die Heide! ›Wo gibt es Heilung in der Welt, wenn nicht in der Natur‹, hatte Mark Enz ihr einmal gesagt. Aber es war ihr jetzt die Stimme des Versuchers, die lockte, die sich jedes Mittels bediente, um sie zu überwinden.
Sie warf sich in ihrem Zimmer auf die Knie und betete unter Tränen. Aber mitten in ihren heißen, flehenden Worten übermannte sie ein Taumel von Ohnmacht. Ihre Gedanken verloren sich in einem leeren Schein, sie sah plötzlich ihre kleine silberne Uhr in ihrer Hand vor den getrübten Blicken, und schluchzte auf in einem so heißen Weh, daß sie glaubte, ihre verstörten Sinne würden sich nie wieder zu ruhiger Harmonie zurückfinden.
Mit frohem, spöttischem Lachen hielt ihr Mark Enz die Bibel hin und zeigte ihr Worte darin, die sie verbrannten wie mit Feuer. Seine Hände faßten leicht und gelassen das große Buch, seine Hände, die auch sie gehalten, leicht und froh. Und doch voll Liebe, wie man ein Eigentum hält, das tief und von Ewigkeit her der Seele verbunden ist durch Sehnsucht und durch Blut. So hatte er sie damals gehalten. O sie war sich dessen wohl bewußt geworden, daß sie in jener Nacht in seine Gewalt gegeben war, daß er Macht gehabt hätte, zu nehmen, was immer er nur gewollt hätte. Sie würde damals alles erlitten haben. — Hätte er es getan, dachte sie plötzlich, hätte er mich zerbrochen, dann wüßte ich heute wenigstens, daß er schlecht ist. Er war nicht schlecht. Nie würde sie dulden, daß ein Mensch es sagte. Wie groß, ruhig und einfach erschienen ihr nun plötzlich seine überredenden Worte. Von jenem Verzicht her, in dem er sie geschont hatte, erhielten sie ihr warmes Licht.
Sie empfand klar, daß sie seine Handlungen nicht liebte, weil seine Worte es wollten, sondern daß sie jedes seiner Worte erst durch seine Handlungen recht verstehen gelernt hatte. Er war nicht stark und war nicht schwach, stets schien ihr, als sei er beides zugleich. Und wo ihr Herz blutete im Ringen nach Klarheit, vor den tausend Widersprüchen seines Wesens, da war bei ihm sein freies, zuversichtliches Lächeln. Die ruhige Kraft, in der er dem Augenblick gebot, den er benutzte, die Sicherheit, in der er das Gegenwärtige zum Unabwendbaren umgestaltete, die beinahe kindliche Wahrhaftigkeit, in der er sich auch der kleinsten Regung hingeben konnte, die schienen ihr alle Widersprüche zu jener starken Harmonie zu lösen, der sie wie einer jauchzenden Kraft erlag.
Sie fühlte mit heimlichem Graun: seit seine Stimme sie zum erstenmal erreicht, war ihre Seele wie verwandelt diesem Klang gefolgt. Ihr war, als habe sie sich eingestellt und neu geschickt, um sein Wesen empfangen zu können. Wie einer süßen Gefahr gab sie sich ganz der Erinnerung an seine Worte hin. Sie hatten etwas wie vom Schwung und Blitz sicherer Degenklingen, konnten dennoch warm und liebevoll sein und breiteten ihr Herz vor ihm aus. Überallhin reichten sie, gaben den Dingen ein eigenes neues Licht, schön und kühn erschienen sie ihr, wie sein betörend feiner Mund.
Und nun sah sie ihn traurig und wußte plötzlich, daß er um vieles gefährlicher war, wenn er bekümmert schwieg, und alles erschien so, als warte er auf sie. Als läge es nur an ihr, ihn wieder reich und stark und froh zu machen. Das hatte sie nie gekonnt. Sie hatte nur mit ihm gelitten, denn wenn er traurig war, versank ihr die ganze Welt. Der letzte Halt schien ihr zerbrochen, wenn er bekümmert und ruhlos in seine dunklen Gedanken versank, die sie nicht teilen durfte. Darüber kam ihr in den Sinn, daß er nie über ein Leid gesprochen hatte, das ihn bedrückte. Nur einmal hatte sie ihn gefragt, weil er ihr einsam und verlassen erschien, ob sie ihm nicht Trost geben könnte mit ihrer Freundschaft und Liebe. Sie hatte seine Antwort nicht vergessen, es war sein erstes Geständnis gewesen:
›Die Einsamkeit ist keine Beschaffenheit, die durch Gaben anderer, durch Liebe und Güte, aufgehoben wird, Anne-Dore. Nicht wer keine Liebe findet, ist unter den Menschen einsam, sondern wer nicht lieben kann wie sie.‹
Aber später war sie doch ruhiger geworden. Die Worte konnten ja unmöglich so gemeint sein, als träfen sie auf ihn zu. Mehr wie alle anderen Menschen, die sie kannte, konnte er lieben. Liebte er nicht alles, was ihm begegnete, auf seltsam hingebende Art, die Wälder, den Himmel, ja die kleinsten Pflanzen und Tiere, die man für gewöhnlich kaum beachtete. In ihre neue Beruhigung hatte sich damals wohl ein ferner Zweifel gemischt, als wäre irgendwo ihr Schluß unvollkommen, als habe sie ihn doch nicht verstanden, und endlich, als sei er ihr fremder und unerklärbarer als nur ein Mensch. Aber kein Mißtrauen, kein Grübeln und kein Bewußtsein von Fremdheit taten ihrer Liebe Gewalt an, die emporblühte über seiner Schönheit und Schuld, als bedürfe er auf der Welt nur ihrer noch.
Unvermerkt hatte sie sich angekleidet in einer Hast, die durch ihre letzten Gedanken etwas Frohes empfing. Vor dem Spiegel, als sie ihren Strohhut steckte, fuhr sie zusammen. Aber ehe die Not des alten Kampfes begann, befreite sie ein kurzer Entschluß. Sie wollte zu ihm gehen, um Abschied von ihm zu nehmen. Es wäre unter allen Umständen unschön gewesen, ihn in Unsicherheit und Zweifel zu lassen, er mochte ihr Geständnis anhören. Wie konnten seine Entgegnungen ihr eine Gefahr bedeuten?
Ohne es zu wissen, redete sie laut, sprach sich Mut ein und tröstete sich, zählte auf, was alles für diesen Schritt sprach und wie gewiß Mark Enz sie verstehen und ihre Handlungen billigen würde. Aber ihre Worte gingen in ein Schluchzen über, sie warf sich auf ihr Bett und stöhnte laut.
Da tauchte in ihre verstörten Sinne ein Licht, unaussprechlich wohltätig in seinem Glanz, der sie nicht erschreckte und nicht blendete. Vor ihr erhob sich Christus, hoch und weiß. Ein wenig gebeugt stand er ruhig da, seine Augen und seine Hände suchten sie.
Sie sah die Dornenmarter, seine Kreuzesnot, auf ihre Hände fielen Tropfen von seiner schmerzvollen Stirn. Es war ihr wieder, als spräche dieser göttliche Mund und fragte sie und sagte ihr seine himmlische Liebe, die ihr das Reich einer ewigen Herrlichkeit erschlossen, nicht fern und fremd, sondern heimatlich vertraut und von lauter Frieden hell. Und nun ward seine traurige Mahnung zum Trost: ›Niemand soll dich aus meiner Hand reißen. Mein Vater, der dich mir gegeben hat, ist größer als alles.‹ Sie sah über seinem Haupt den Strahlenkranz des Erwählten Gottes, der überwunden, unter dessen Licht die Ewigkeiten verbrannten wie Minuten und die Zeit nicht mehr war, und Herzeleid und Trübsal nicht mehr waren ... Dann drohten, schaukelnde rote Flammen aus dunklem Rauch, die Verheißungen der Apokalypse am Horizont. Weiß und verklärt, ein fließender Lichtstrom, der den Himmel suchte, zogen die Erwählten des Heils ihrem lieben Herrn entgegen, um bei ihm zu sein für alle Zeit, aber für die Verfluchten begann der Tag der Vergeltung. O keine Marter, die ihr Sinn nur immer erdenken konnte, schreckte sie, alles hätte sie um den Preis ihres irdischen Glücks erduldet, aber daß die Liebe des Herrn Jesu Christi nicht mehr ihr Eigentum sein sollte und nicht mehr ihre Freude, das war schmerzvoller als jede andere Not.
Ohne daß eine Bitterkeit ihre Worte trübte, betete sie leise, als spräche sie zu einem Menschen, dessen Güte sie vertraute:
»Warum quälst du mich so sehr? Gibt es keinen Ausweg für mich? Tu ein Wunder, Herr Jesus.«
War denn in der Welt niemand, der ihr helfen konnte, niemand, bei dem sie Rat und Zuflucht finden würde? — Plötzlich dachte sie an Pastor Jacoby. Sie wollte zu ihm gehen. Wer anders als er würde ihr raten, würde ihr den rechten Weg zeigen und ihr sagen können, was recht und unrecht, was gut und schlecht sei. Sie atmete auf wie erlöst. Da ihr Rettung aus ihrem Plan winkte, betäubte sie jeden Einwand ihres Herzens in einem Aufbruch, der nichts als eine Flucht vor ihrer Einsamkeit und ihren Kämpfen war. Alles würde sie ertragen lernen, nur sollte dieser graunvolle Widerstreit ihrer Seele enden, der sie zerstörte. —
Auf dem Wege in die Stadt stellte sie sich sein Gesicht vor, seine Gebärden, wenn er predigte, seinen tiefen, klaren Ernst, die begnadete Hoheit, die mit seiner Schönheit ausging, als habe der Heiland selber ihn zu seinem Jünger und zum Sachwalter seiner Barmherzigkeit erwählt. — Sie schritt eilig dahin durch die ruhige Straße der kleinen Vorstadt, mit einem ganz eigenen Lächeln auf dem Gesicht und beinahe ein wenig geziert. Wer sie erblickt hätte, dem wäre sicher der Gedanke gekommen: Jugend ist leichtfertig, fröhlich, fähig sich unbedacht einem Glück hinzugeben. —
Anne-Dore nahm sich fest vor, sich nicht auf ihre Worte vorzubereiten. Es sollte alles kommen, wie es nun einmal mußte. Nur eins beschloß sie mit zuversichtlichem Glauben an ihre Kraft dazu, sie wollte Mark Enz nicht preisgeben, ihn weder nennen noch verraten. Sie blieb plötzlich stehen: er wartete bei der Waldlichtung unter Hildenrot, lag sicher wie sonst im Gras am Rand der Heide in dieser Sonne, die auch sie erreichte ... Nun lief sie beinahe. Als sie vor dem Pfarrhause stand, das in einer Nebengasse im Schatten der Nikolaikirche lag, klingelte sie in einer seltsamen Gelassenheit, in einer schläfrigen Bedachtheit, die etwas von den Bewegungen hatte, wie man sie aus Träumen kennt. Sie wartete, daß man ihr öffnen möchte, und wartete im Grunde doch nur auf ein Wunder.
Sie wurde in ein kleines nüchternes Besuchszimmer geführt, das für alle bestimmt schien; nebenan hörte sie sprechen und lachen. Da sie dem Dienstmädchen ihren Namen genannt hatte, begrüßte Pastor Jacoby sie herzlich und ohne Fragen, weil er die geachtete Familie ihres Vaters kannte.
»Ich möchte Sie in einer wichtigen Sache um Ihren Rat bitten,« sagte Anne-Dore.
Er nickte. In seinem Arbeitszimmer spielte sein kleines blondes Töchterchen, und er wandte sich in gleichgültigen Fragen bald an Anne-Dore, bald an sein Kind. Vielleicht hatte er erkannt, daß das junge Mädchen erregt und schüchtern war, und er hoffte so, ihr Gelegenheit zur Sammlung zu geben und die Möglichkeit, sich ein wenig mit der Umgebung und mit den Erscheinungen abzufinden. Er sprach von ihrem Vater, erkundigte sich nach dem Befinden ihrer Mutter, ohne zu ahnen, was in diesen Augenblicken in der Seele Anne-Dores vorging.
War dieser bewegliche und gesprächige Mann mit den etwas zärtlichen, sympathischen Zügen Pastor Jacoby, der Geistliche, der ihr Wesen verändert und ihr Herz so oft in Gluten von Liebe und Andacht getaucht? Sie traute ihren Sinnen nicht mehr und starrte ihn an, als habe er sie tödlich beleidigt. Sie wollte nicht acht haben auf diese Äußerlichkeiten, die ihn ihr in so völlig anderem Lichte zeigten, aber sie drängten sich ihr auf, mit qualvoller nüchterner Deutlichkeit. Jedesmal wenn er mit seiner wohlklingenden Stimme einen Satz gesagt hatte, umglitten seine kleinen weißen Hände einander, als müßte sein großes Wohlgefallen an allen irdischen Dingen, die nun verklärt vom Licht des versöhnten Himmels waren, irgendwie einen Ausdruck finden. Dabei räusperte er sich häufig ganz leise und andächtig tief im Hals mit kurzen Tönchen, die etwa vermittelten: Es gibt auch noch allerlei andere Freuden, die den Gläubigen vom Herrn erlaubt sind. Wir wollen sie gern genießen.
In einem Zorn der Enttäuschung, der ihr fast Tränen in die Augen trieb, stand sie schwer und todmüde auf, wandte sich ab und stellte sich an das Fenster vor die hellen bunten Blumen, die dort in der Sonne blühten. Pastor Jacoby spielte mit seinem Kind.
Ihre Hände suchten sich. Was hatte dieses vergnügte Männlein mit ihrem Herzeleid zu schaffen? Flimmernde Schleier sanken ihr brennend vor die starren Augen. Ich bin allein, dachte sie, die Menschen sind anders. Mir kann niemand helfen.
Da tauchte es schmal aus dem feuchten Glanz vor ihren Blicken, und sie keuchte, jählings gestrafft in einer heldenhaften Traurigkeit:
»Mark Enz, dein Gesicht!« Sie sah es vor sich, bitter von Sehnsucht, von Kämpfen bleich, mit einem Lächeln, als mache Einsamkeit reich, und verzehrt wie von gesühnter Schuld. Und in einem plötzlichen heißen Taumel, der ihr jedes Bewußtsein für Zeit und Ort raubte, wie in der Wut eines stummen singenden Geschreis, fuhr es empor in ihr und riß sie mit:
»Dich, dich lieb ich allein in der Welt! Nie werde ich einsam in deiner Nähe sein. Deine Sünde lieb ich, deine Sünde gehört mir. Deine Schuld und dein Schicksal sind auch meine Schuld, und ich will kein Schicksal für mich, nur deins. Meine einzige Bestimmung in der Welt ist, dein Eigentum zu sein.«
Ihr schwindelte. »Deine Sünde,« sagte sie noch einmal, als läge in dem, was sie so bei ihm genannt, ihr ganzes Heil. Rettung suchend streckte sie die Arme aus wie in einem Traum, der Boden schaukelte wild, das Licht kreiste.
Da hörte sie eine lachende Kinderstimme und die neckischen Zurufe des Pastor Jacoby, der sie unbeachtet gelassen hatte, um ihr Zeit zu lassen. Wie unter einem Stoß kam sie zu sich und tief aufatmend gewann sie Sicherheit.
›Ich will keinen Halt, nur mein glühendes Herz,‹ hatte ihr Mark einmal gesagt.
In hellem Triumph erhob sich ihr neuer Stolz, einsam und fest. Im Glückstaumel eines, der alles verlor und der nun alles zu gewinnen hat, fühlte sie sich unaussprechlich jung und zu jedem Schicksal bereit. Als wären mit allen Gütern, die ihr versunken waren, auch alle Kämpfe um sie für immer dahin.
Da sie sich umgewandt hatte, glaubte Pastor Jacoby, der Augenblick der erbetenen Unterredung sei gekommen. Er nahm sein Töchterchen bei der Hand und führte es aus dem Zimmer. Draußen begann es ein jämmerliches Weinen und er beruhigte es noch durch die Türspalte.
Ernst, mit kleinen festen Schritten, kam er nun auf Anne-Dore zu, reichte ihr erneut die Hand und war jetzt, ihr gegenüber auf einem Sessel ein wenig vorgebeugt, ganz hilfsbereite Aufmerksamkeit. Sein Lächeln war verschwunden und kam nicht wieder, nur spärlich und als Führer einer warmen Güte. Seine Züge nahmen etwas von jenem Ausdruck an, den sie von der Kanzel her bei ihm kannte; dies prophetenhaft Entrückte und jene schmerzhafte Versunkenheit; nicht mehr das Kleine seiner menschlichen Befangenheit und Armut herrschte, sondern die sichere Gegenwärtigkeit und die fast hoheitsvolle Demut dessen, der würdig war, ein Stellvertreter Jesu Christi auf der Erde zu sein. Und unter seinem Angesicht gewannen die Jesusworte plötzlich wieder ihr furchtbar ernstes Leben, das Blut des Heilands rann unter der Dornenkrone nieder über sein Leidensangesicht, dies Blut, das vergossen war auch für sie, ja das vergossen worden wäre nur für sie, so über alles wichtig war dem Vater im Himmel ihr Kindesrecht an sein ewiges Reich. Und ehe ein Wort fiel, empfand Anne-Dore, daß ihre Kämpfe niemals ruhen würden. Eine unaussprechliche Traurigkeit senkte ihr das hilflose Haupt, und sie sagte leise mit strengen Lippen und ohne Willen, ganz in der Gewalt ihrer alten schwermütigen Sehnsucht das Wort des Jüngers, flüsternd, mit toten Lauten und verstörtem Blick:
»Ich habe Lust zu scheiden, um bei Christo zu sein, welches auch viel besser wäre.«
Hatte sie es wahrhaftig gesprochen? Keine Miene des Geistlichen verriet es, auch schaute sie nicht mehr in sein Gesicht. Ein einziger Begriff hielt sie in seinem Bann, breitete sich aus in düsteren Nebeln, rot wie die Sonne am Abend, glühend und allgewaltig: Blut war für sie geflossen, Blut warb um sie. Und nun plötzlich taten ihre Lippen ihr wieder seltsam Gewalt an, preßten einander süß und spitz wie zu einem Kuß. Sie atmete tief auf in schwerem Stoßen ihrer Brust, bis ein einziger Schauer, der kein Glied ihres Körpers verschonte, sie zu einem Gefühl unfaßbar seliger und tödlich wollüstiger Schmerzen befreite.
Pastor Jacoby, der anfangs ruhig gewartet hatte, war aufgesprungen. Ganz gegen seine Gewohnheit eilfertig und befangen und hatte die Magd um Wasser angerufen. Nun reichte er dem Mädchen, das schwer gegen die Lehne des Sessels hing, ein kühles Glas an die Lippen, und sie trank, gierig und stumm.
»Es geht Ihnen schlecht, liebes Kind«, sagte er eindringlich und gütig. »Ich glaube, ich werde Ihnen jetzt wenig bedeuten können. Wollen Sie mir erlauben, Sie heute abend zu besuchen? Sagen Sie es Ihrem Vater, er wird mich willkommen heißen.«
Anne-Dore schüttelte den Kopf. — Wie war nur dieses Fremdartige so rasch gekommen und möglich gewesen? Was war es? Ihr war wohl und nüchtern zumute. Sie antwortete klar und einfach, sie würde morgen kommen, es täte ihr herzlich leid, ihn erschreckt zu haben, auch eile ihre Angelegenheit nicht, und wenn er es erlaube, so käme sie lieber ein andermal.
Besorgt sah er in ihr blasses Gesicht, das ihm wunderschön erschien und wie zum Ruhm des Leids erschaffen, als ahnte er etwas von den geheimen Vorgängen und ihrer Not. Aber er wagte es nicht, in sie zu dringen. Vielleicht war es bei ihm ein Verständnis dafür, daß Blut und Seele einander auf verschlungenen Wegen begegnen, vielleicht hinderte ihn nur die Zurückhaltung eines, der weiß, daß kein schweres Geständnis sich erbitten läßt. Jedenfalls ließ er ihr den Willen, geleitete sie liebevoll und ohne ein flaches Trostwort an die Haustür und reichte ihr väterlich die Hand zum Abschied.
Anne-Dore begriff nicht, wie wohl und leicht ihr zumute war, als sie langsam und ohne daß schwere Gedanken ihre Schatten sandten, müde und froh durch die lebhaften Straßen schritt im Schein der warmen Nachmittagssonne. Unter den alten Kastanien des Kirchplatzes spielten Kinder mit lustigem Geschrei und ausgelassenem Lachen. Sie blieb stehen und schaute ihnen zu. Die Farben der hohen Kirchenfenster der Nikolaikirche erschienen von außen dumpf und erloschen, sie erkannte die Figuren nur undeutlich und betrachtete sie prüfend. Seltsam gelassen erschien ihr alles, das früher so überreich an Beziehungen und Erinnerungen gewesen war. Alle Dinge schienen weit fern, von ihrer Innenwelt getrennt, schön, gut zu betrachten und bereit, ihr auf freundliche Art zu gefallen. Selbst das christliche Vereinshaus, in dem die Bibelstunden stattfanden, war ein Gebäude geworden wie alle anderen, eigentlich war es grau und unfreundlich, wie gut hätte man Pflanzen und Blumen in diesem kleinen Vorgärtchen pflegen können, das kahl und verstaubt, nur ein wenig Rasengrün bot. Wie üppig und fruchtbar war der feuchte durchsonnte Schatten ihres heimatlichen Waldes, wie warm und unberührt, wie wild und dennoch milde die rote Heide. Hoch und grün waren die Buchen von Hildenrot.
Dorthin würde sie nun gehen.
Sie beschleunigte ihre Schritte, faltete plötzlich im Schreiten zitternd vor Glück und Hoffnung die Hände, preßte sie an ihre Brust und sagte:
»Ich komm zu dir. Ich komm zu dir.«
Das Forsthaus von Hildenrot war in die Ruine einer alten Burg eingebaut, die auf einem bewaldeten Hügel dicht vor dem Dorfe lag und die dem Gutssitz und der kleinen Ortschaft ihren Namen gegeben hatte. Der hohe, zackige und begrünte Mauerwinkel, den zwei noch wohlerhaltene Wände der Burg bildeten, war zum Bau des Forsthauses verwandt worden. Ein dunkler, riesenhafter Efeustamm verband nun schon lange mit tausend grünen Armen die neuen Wände mit den alten Mauern und diese mit dem rötlichen Fels, den seine jüngsten Sprossen erkletterten, über die wirren, zerbröckelten Zinnen hin.
Der Förster bot zuweilen Sommergästen Aufenthalt in seinem Hause. In diesem Jahre war Markus Enzheim sein einziger Gast. Die beiden rechteckigen und niedrigen Fensterchen seines Zimmers, das zur ebenen Erde lag, ließen den Blicken die weite Heide über eine hügelige Waldlichtung hin, die grüne Fülle der hohen Buchen gegen Süden und die blühende Pracht eines weitausgebauten und dichten Stakets von verwilderten Rosen. Wenn man sich ein wenig vorbeugte, sah man in den verschwiegenen steinernen Hof, der in tiefem Schatten ruhte und dessen bewachsene Mauern ihn erschlossen wie ein Gemach. Durch ein verwittertes Tor hin, das im Frühling ganz eingehüllt war in den lichtfarbigen lila Schaum blühender Glyzinien, verlor sich der Blick durch diesen klaren Bogen, in der Wirrnis des Waldes.
Versteckt im Dämmergrund der dichten Holundersträuche, sprang an der Hofmauer ein Quell aus einem steinernen Löwenmaul in eine bemooste Holzrinne. Mit fröhlich wechselnden Lauten und in unveränderbarem, immer gleichem Klang rann das Wasser in sein dunkles Brunnenbecken, das geheimnisvoll verborgen, ein lieber Freund des Mondes, die Flut in den Wald leitete.
Mark Enz hatte Anne-Dore an diesem Nachmittag vergeblich erwartet, und er schritt nun langsam unter den sommerlichen Bäumen hin, tief in Gedanken, die keine Gestalt gewinnen wollten, die bald wie Licht und bald wie Wolken, bald wie ein Lied zerflatterten, haltlos und in milder Müdigkeit.
Im Wald sangen Kinder, er sah sie nicht. Ihre Stimmen klangen zärtlich und verschwommen, kein Wind zerteilte sie, nur die Wärme des nachmittäglichen Sonnenscheins nahm ihre Seligkeit in seinen Glanz und der Himmel, den sie lobten. Nun verstand er und lauschte:
»Des Sommers goldner Segen
liegt auf den Feldern still und heiß,
wir finden Mohn und Ehrenpreis
auf unsern lieben Wegen.«
Kam schon der Sommer, die große reiche Zeit der warmen Ruhe, in der der Wandel der Natur sich seiner Unschuld freut, wehmütig und seiner Treue froh? Wo es den Herzen der Menschen erscheinen mag als fragte die Welt: Wohin geht ihr? Seid ihr des einen Glücks eures Lebens gewiß, dieses Glücks, in dem ich erfüllt bin und das mich heiligt, weil ich unter ewige Liebe gebeugt der letzten Mahnung gefolgt bin?
Diese Wege war er oft mit Anne-Dore geschritten. Alles erinnert ihn an sie, nun um so mehr, da es erscheinen mochte, als gedächte sie seiner weniger. Und er sprach zu ihr, als schritte sie neben ihm, Worte, die er nicht gefunden hätte, wenn sie an seiner Seite gewesen wäre. Worte, die im Grunde ihn selber meinten, seine Hoffnung und seine Zukunft, die seiner Liebe Gestalt schufen und doch ihm selber galten.
Nach einer Weile blieb er stehen und sah den Waldweg entlang, der still im Spiel der rötlichen Sonne und im Blätterschatten ruhte, braun, und grün überdacht. In der Weite verlief alles in einem goldbläulichen Hauch von Sonne, Grün und Ferne. Anne-Dore kam nicht mehr. —
Nun war es Nacht geworden über Hildenrot. Er hatte noch spät in der langsamen Dämmerung mit dem Förster im Hof gesessen, über dies und jenes geplaudert, wie man es wohl tun mag, fast nur um sich der nahenden Ruhe gewiß zu bleiben, gedankenlos und bedächtig. Als er gegen Mitternacht sein Licht löschen wollte, klopfte es leise an sein Fenster. In einer seligen und wehen Ahnung, in der noch kein Schein von Freude war, öffnete er die Scheiben ganz langsam und so heftig zitternd, daß das lose Glas des Fensterflügels leise klirrte wie er es weit geöffnet hielt und sich am Rahmen stützte und Anne-Dore draußen erkannte im reinen Mond, gegen die schlafenden Rosen, schwarz und still und mit tiefgeneigtem Haupt, ganz nah, ganz nah. Keinen Gruß auf den Lippen und keine Hand für seine suchenden Hände. Die Nachtstimmen der Bäume hatte sie um ihr Haupt und das Murmeln des Brunnens und das Silber des Himmels, dessen Sterne leuchteten, und den Duft der Walderde. Alles warb um sie und schien für sie zu bitten, überredete sie dennoch, und war um ihr Wesen, wie das Weinen ihres Herzens.
Wie klar der Brunnen rauschte, lauter als je zuvor, und wie hoch schien diese weite Nacht. Ihm war plötzlich, als überblickte er die ganze Erde, als eine Stimme sein Ohr traf und er die Worte hörte:
»Hilf mir.«
Ihr leiser Ruf befreite ihn, denn er hatte vergessen, daß es ihn und sein Glück galt. Er hatte vergessen, daß er mehr tun sollte, als in Andacht schauen und fühlen, wie schön das Leben der großen Erde ist. Aber doch war ihm nun zumute, als sei er tief hinabgesunken von einer hocherhöhten Warte, nun, da er seine zitternden Arme um ihren Nacken legte und ihr Gesicht an seine Brust preßte und seine Lippen in ihr Haar.
»All meine Hoffnung ruht auf dir,« sagte er so leise, daß sie es nicht verstand, »o erlöse mich, führ mich zurück zu einem einfachen Menschenglück, in die Armut deiner blinden Schönheit, zu der reinen Hingabe, die ich gehabt habe, als ich ein Kind war. Laß mich vergessen, mach mich arm, damit ich wieder reich werde.«
»Komm«, sagte er, hilflos vor Freude. Er umschlang sie mit beiden Armen, hob sie ein wenig, und sie stieg gebückt und leise zu ihm ein. Es war nicht ganz leicht, denn das Fenster war niedrig und der Efeu sponn es ein, und sie lächelten beide über ihr bebendes Ungeschick, dies heiße, traurige Lächeln, das nur in unendlichem Jauchzen Erlösung findet, oder im Tode. —
Die Nacht gab ihrem Schlummer Kühle, und die Düfte der blühenden Pflanzen erschufen ihre Träume, und alle Sehnsucht über ihnen spielte hell und langsam das große Lied ihres ewigen Triumphes.
Als der erste fahle Schein der erwachenden Dämmerung über das Land zog, brachte Mark Enz Anne-Dore über die Heide hin und durch den Wald zurück in das Haus ihrer Eltern. Sie gingen langsam und schweigend, eng umschlungen und aneinander gepreßt. Nun brauchte das Mädchen nur noch über den schmalen Fahrweg, und die Gartenbäume ihres Vaterhauses boten ihr Schutz. Als sie am Tennisplatz anlangten, der beinahe traurig in seiner leeren Verlassenheit ruhte, immer noch etwas zu bunt und neu, um sich unauffällig in die Natur einzufügen, mußten beide lächeln. Ein vergessener Ball lag im Gras am Rand des Drahtstakets, naß und leblos.
Vorsichtig öffnete Dore die Gartenpforte im blauen Morgenlicht, die eiserne Klinke war kühl und naß vom Tau der Nacht. Sie zog sie sacht hinter sich zu und sah zum Fenster ihres elterlichen Schlafzimmers hinauf. Es ruhte blaß und stumm mit seinen weißen Vorhängen, im Schmuck des grünen Weins. Dann verklang dem horchenden Mark ihr lieber Schritt hinter der Hausecke. Er glaubte die Verandatür noch zu hören ...
Wie still es war. Noch schliefen alle Vögel, es regte sich nichts im Walde. Ihm war zumute, als störte er und er trat unwillkürlich leise auf. Aber dann übermannte ihn plötzlich ein Gefühl unaussprechlichen Lebenstriumphes, weitete ihm hell und stürmisch die Brust und ließ ihn alle Müdigkeit vergessen. Er schritt ihren gemeinsamen nächtlichen Weg zurück, obgleich ein anderer ihn früher nach Hildenrot gebracht hätte. Was lag an Zeit und Schlaf, was an Ordnung und Ruhe. Ein langsamer Schauer von seligem Kraftbewußtsein durchschüttelte ihm alle Glieder und straffte sie. Welch ernste Augen alle große Freude hat, dachte er, jugendlich ergriffen und stolz vor Glück. Die goldene Glut der Erde war seinem Blut verwandt und heiligte es in dieser schönen Stunde zu aller Unschuld.
Freundlich nahm ihn die rote Heide in ihre erste Feierstunde auf und darauf wieder der nachdenkliche Wald. Das Dach, unter dem nun Anne-Dore schlafen mochte, war längst hinter Grün und Hügeln versunken. Vielleicht wacht sie und begleitet mich, dachte er, faltete die Hände und preßte sie an die Stirn. —
Lieblich verwirrt und so fein wie Licht stand über seinem Weg und über seinen Gedanken ihr scheues Lächeln, verriet und verschwieg zugleich, gab und dankte. Er schritt einher im freien Leuchten ihrer Gunst, nun, da auch das Licht des Tages begann und die Pflanzen erwachten und der Tau fiel.
Mark Enz blieb stehn und starrte in die silbergraue schläfrige Morgenruhe der dämmrigen Heide hinaus. Er wußte nicht, zu wem er sprach und was ihn zu seinen Worten überredete, die aus seiner fessellosen und durch Lust erlösten Seele brachen:
»Von wieviel Täuschung machst du mich gesund. Du lehrst mich neu, daß unser Herz im Grunde allen Prunk verachtet und den tönenden Rausch. Das Herz des Menschen ist einfach, arbeitsam um der Schönheit willen und ohne Liebe zum Schein, wie deins, Anne-Dore. Es lauscht hinüber auf den Widerhall aus der Ewigkeit ...«
Nun lag ein roter Glanz über den wogenden Kornfeldern, die Sonne ging auf, am Waldrand blühte Mohn, von Tau gebeugt. Meisen zirpten und Buchfinken riefen. Es war Tag geworden über der Erde der Menschen.
Anne-Dore war am anderen Tage mit schweren Sinnen, müde und hilflos zu Mark Enz in den Wald gegangen, in die Heidelichtung, wo er sie erwartete. Ihr war gewesen, als seien ihre Seele und ihr Leib bedeckt mit schmerzenden Wunden, sie hatte geglaubt, ihn still und ernst zu finden, und nun lag er da neben ihr in der Heide, auf dem Rücken, die Knie hochgezogen, lustig und gesprächig, ja beinahe ausgelassen, wie sie ihn nie gesehen hatte, und tat, als sei nichts geschehen als beiden eine große Freude. Ihre tiefe Melancholie und all ihre Traurigkeit verflogen rasch in dieser Heiterkeit, die er ihr durch sein Wesen gab, wie das köstlichste Heilmittel, das nur ein Mensch ersinnen konnte. Sein Lachen flog über sie hin wie Sonnenschein, in dem ihre schweren Gedanken sich langsam zerteilten zu jener seligen Lebenswichtigkeit, die Genesende beglückt.
O, wie dies Lachen heilte. —
Es erschien ihr fast unmöglich, daß er so dalag, ein wenig spöttisch gegen die Mitwelt gestimmt, zu jeder Torheit ausgelegt und unbedacht, wie ein großes Kind. Wie der Inbegriff aller Lebenskraft und aller Daseinsfreude erschien ihr dies wandelbare, immer sichere Wesen, das Schmerz und Freude aufnehmen konnte, als seien beide allein herrlich und nichts als das. Sie dachte an sein Gesicht in der verflossenen Nacht und glaubte es nicht wiederzuerkennen. Ihre Welt, die in tausend Vorurteile eingeschränkt gewesen war, versank ihr arm und klein im Lachen seiner Augen, die keine Grenzen schauten, die frohlockten und trauerten auf gleiche Art, wie es die unschuldige Erde tat mit ihren Schönheiten, ihren Gefahren und ihren reinen Schicksalen.
Jubelnd gab ihr ganzes Sein sich dieser freien Kraft seiner Seele hin. Sie fühlte ihre Liebe zum erstenmal als ein Glück ohne Schranken und ohne einen anderen Halt, als seine junge unbedachte Kraft.
Daß man lachen durfte, laut und fröhlich lachen über all die Dinge, die man sonst zunächst einmal verzeihen, dann verstehen und endlich bedächtig ablehnen mußte.
»Höre du,« sagte er plötzlich sehr ernst, »ihr bedenkt mich gar zu reich aus eurer Friedensgemeinschaft. Neulich hat man mir aus eurer Behausung ein Notizbuch gesandt, das wahrscheinlich eurem Glaubensgenossen Friedberg angehört.«
Anne-Dore lachte und bekannte sich schuldig.
»Außen geht es an,« fuhr Mark fort, »aber innen enthält es einen Entwurf zu einer Bußpredigt, scheint mir. Gott sei Dank ist sie zum größten Teil stenographiert. Sie bemüht sich um eine Auslegung von Lukas 12, Vers 25: ›Welcher ist unter euch, ob er schon darum sorget, der da könnte eine Elle seiner Länge zusetzen.‹ — Dieser lange Kerl paßt unter kein Kanzeldach und wählt sich wahrhaftig diesen Predigttext. Er ist ganz von Gott verlassen.«
Die großen ruhigen Bäume mit ihrer Geduld und ihrer Würde schauten auf Anne-Dore nieder, die sie schon lange kannten, die sie schon seit Jahren gesehn, als ein kleines Mädchen, und später als sinnendes Jungfräulein, viel zu ernst und viel zu allein. Aber sie wunderten sich nicht über das helle glückliche Lachen, das sie verbergen mußten. Denn der Wind der Erde und der Wald und das Meer und die Berge sind über den Schicksalen der Menschen alt geworden und jung darüber geblieben, so daß sie nie erstaunen.
Mark Enz drehte Zigaretten.
»Willst du?« fragte er und hielt ihr eine hin.
Sie versuchte. Es ging nicht.
»Was bist du für ein Barbar«, sagte er traurig.
»Übrigens Friedberg«, fuhr er fort. »Ich kenne nicht allein seine Jugendgeschichte, sondern auch die Einzelheiten seiner Abstammung. Die muß man wissen. Das Licht vom Scheitel seiner Väter erleuchtet dies verstauchte Kandidatengehirn bis tief hinein in seine Weltanschauung, in der der Verfall aller Naturgesetze triumphiert. Du hast nicht genug Überblick, Dore, aber du mußt es mir glauben. Höre zu: Sein Vater war Missionar, er verehelichte sich in Jahren unbedachten Gottvertrauens und zog in die Südsee, nach Samoa, um die Kaffern zu bekehren, die dort so viel ich weiß in den Wüstenprovinzen ihr schwarzes Unwesen treiben. Ich bin nicht genau über ihre Eigenart unterrichtet, aber sie fressen Menschen. Also der alte Friedberg reckte über ihre Ansiedlungen und über ihren sündhaften Appetit seine Missionsbibel, mißverstand sie freudig und legte sie in Demut aus. Sie wollten sich aber nicht bekehren. Sie fingen an einem sonnigen, warmen Sonntag die Frau dieses Missionars Friedberg, brieten sie und fraßen den geprüften Mann ledig.
Aber vorher hatte die legitime Verbindung eine Frucht gezeitigt: den Helferich. Der alte Friedberg drückte den Säugling an sein Herz und bestieg ein Schiff zur Heimreise, weil er eine neue Mutter für sein Kind finden wollte. Dies gelang ihm nicht. Darüber starb er. Helferich wurde eine Missionswaise. Dieser Umstand hat ihm die Mittel zu seinem Studium verschafft. — Hier ist übrigens sein Buch, gib es ihm zurück. Solche Predigt schreibt man nur einmal im Leben.«
Anne-Dore küßte ihn stürmisch. Ungewußt empfand sie seinen befreienden Spott als eine Rache an aller Unterdrückung, die ihre Natur, ihre Entwicklung und ihr Urteil beeinträchtigt hatte. Etwas wie Seligkeit an Sünde, das verzehrend süße Bewußtsein eines bösen Gewissens und ihr Wille, dem Geliebten alle alten Güter darzubringen wie ein einziges großes Opfer, erhöhte ihr neues Lebensgefühl zu heißem Glück.
Woche für Woche, Nacht für Nacht lief Anne-Dore durch den Buchenwald nach Hildenrot. Die Stimme des Brunnens empfing sie im Schweigen der Nacht. Sie fand den Weg in dunklen stürmischen Nächten, und oft auf dem Heimweg schlich sie sich früh durch das Hinterpförtchen des Gartens, erst wenn schon das Morgengrauen sein stählernes Lächeln, bläulich und frei wie ein Schein der Ewigkeit, am Horizont erhob. —
Wie rasch alle Bedenken der seligen Gewißheit dieser einen Pflicht wichen. Sie spürte weder Müdigkeit am Tage, noch senkte ein Bewußtsein von Schuld ihr die Blicke. Im roten Sturm ihres erwachten schweren Bluts hob ihre junge Jugend alle verschonte Kraft zugleich in einem Übermaß von Lebenstriumph und Glut.
Wie sie die dunklen Bäume ihrer Nächte liebte, die ihre Hoffnung und ihr Bangen kannten. Auf dem Heimweg war ihr oft, als hätte der schwere duftende Schatten, der das Licht erwartete, auch ihrer geharrt; mit geöffneten Kleidern und losem Haar lief sie durch die versinkende Nacht unter den verglimmenden Sternen dahin und vertraute der reinen Kühle umher den letzten Rausch ihres singenden Bluts an.
Niemals begegnete ihr hier ein Mensch, auch hatte sie in Dickicht und Heidegrund ihre eigenen Wege. Sie wich den Orten vorsichtig aus, die ihr Gefahr bringen konnten, viel weniger aus Furcht vor einer Entdeckung, als vielmehr um dieser Einsamkeit willen, in der die Natur, unter dem Abschied ihrer funkelnden Nacht, die pochende Sehnsucht ihres Körpers heilte, ihr Glück forttrug und bis zu neuen Erfüllungen barg.
Es war ihr in ihrem veränderten Leben oft so, als begegneten alle Erscheinungen ihres Alltags ihr nur im Traum, die Wirklichkeit begann für sie erst, wenn sie in den Armen und am Herzen ihres Geliebten erwachte. Es kam dazu, daß der heimatliche Haushalt durch die Abreise ihrer leidenden Mutter Veränderungen erfahren hatte, die ihr manche Pflicht erließen und andere erleichterten. Die kränkelnde Frau nahm in der Regel ohne Aufhör die Dienste der Hausgenossen in jener leicht erregbaren Empfindlichkeit in Anspruch, die oft bei Kranken auftritt, deren Zustand niemals ganz schlecht und auch niemals ganz befriedigend wird. Seit sie fort war, waren alle sich auf ganz neue Art selbst überlassen, und besonders Anne-Dore atmete auf, denn das im Grunde selbstsüchtige und unausgesetzt nörgelnde Interesse, das ihre Mutter ihr zu zeigen pflegte, war ihr nie so qualvoll erschienen, als in der letzten Zeit, in der sie wieder und wieder genötigt war, Fragen mit Lügen zu beantworten. Ihr Vater war anders in diesen Einzelheiten, er ließ ihr den Willen in allen kleinen Dingen; vielleicht hätte er einem Sohn weniger Freiheiten eingeräumt, aber Anne-Dore gehörte neben seiner Liebe auch seine heimliche Bewunderung, und ihre Angelegenheiten waren ihm fremdartig und heilig, wie ihr Geschlecht es ihm in seinem ereignisarmen Leben im Grunde nun einmal geblieben war.
Friedberg schien ganz in seine Arbeit vertieft, er führte seine Denkerstirn mit schweren Kummerfalten durch das Gartengrün, und nur hin und wieder ließ er sich in kurze Gespräche mit Missionar Wendel ein, die in der Regel den Ernst des Lebens betonten und die Vergänglichkeit alles Irdischen.
Anne-Dore hatte fast ausnahmslos eine völlig humorlose Abneigung gegen diese gewaltsamen Unaufrichtigkeiten ihres jungen Hausgenossen bekommen. Er erschien ihr armselig und feige, und alle Entschuldigungen, die sie früher lächelnd für ihn gefunden hatte, verwarf sie jetzt als schwach und falsch. Überhaupt mied sie in verborgenem Haß alles, was auch nur ein leises Zugeständnis an ihre versunkene Innenwelt enthalten konnte. Zwar nahm sie ihrem Vater zulieb an allen Hausandachten teil und besuchte wie früher die Gottesdienste mit ihm, aber sie träumte dort in einem Halbschlummer ohne Anteilnahme ihre eigenen Träume, die stets begannen mit einem goldenen Sonnenjubel weit über warmes, sommerliches Land hin und über Seligkeit und Schmerzen fort in einem wilden, uferlosen Meer von Blut versanken.
Die erhabene Kraft dieser glühenden Vereinsamung in einer einzigen Leidenschaft gab ihrem Wesen nun früh eine stolze Sicherheit des Gefühls und ein klares Urteil über alle Dinge, die sie allein danach einschätzte, wie sie ihrem Glück förderlich oder hindernd sein möchten. Sie lernte leicht und rasch verwerfen, was ihrer einen Sehnsucht nicht Genüge tat, und lebte ihre Tage und Nächte allein um der Stunden willen, die ihr junges neues Recht in tausend Gluten und seliger Not bestätigten.
»Ich habe nur noch dich,« sagte sie Mark an einem späten Abend im Wald. Sie sprach es aus, als fragte sie ihn etwas.
»So wie ich kannst du dich nie verlieren,« fuhr sie leise und ohne Vorwurf fort, und plötzlich übermannte es sie und sie küßte ihn heiß und rief: »Ich bin darum viel reicher als du.«
»Schöner bist du,« sagte er innig. »Deine Welt ist vollkommen und du in ihr. Deine Hände sind schwach, aber sie tragen deine ganze Welt, dein Auge reicht so weit, als ihre Höhen und Tiefen gehn; dein Herz ist wie der Heiland deiner Welt, es kann sie ganz erlösen und wird sie gerecht richten. Du bist schön.«
Er merkte, daß sie ihn nicht ganz verstanden hatte.
»Du kannst dich hingeben, ganz, ohne Einwand und ohne Bedacht, darum bist du schön,« fuhr er fort. »Dich überredet keine Zukunft, wenn es gilt, der Gegenwart zu gehorchen, du bist dir treu.«
Über ihnen leuchtete der Himmel in nächtlichem Blau, erfüllt von Sternen, über ihnen waren die Zweige der schlafenden Waldbäume und der Friede ihrer Nächte, den sie um seiner schweigsamen Güte willen liebten, die ihrer Eintracht günstig war. Mark richtete sich ein wenig auf, legte ihren Kopf auf den weichen Waldboden, auf dem sie ruhten, mit beiden Händen strich er ihre dunklen Haare aus der schimmernden Stirn und senkte seine Blicke in ihre großen suchenden Augen, als fände er darin den Himmel wieder, der über ihnen war, die Waldbäume und auch den Frieden ihrer Nacht.
»Mein Dank für deine Liebe ist meine Sehnsucht,« sagte er.
Sie verstand ihn, weil sie seine geliebten Hände an ihren Schläfen fühlte, sie verstand ihn, weil seine Blicke in ihren Ruhe fanden und weil seine Gedanken ihr Herz riefen. Sie schloß die Augen in einem tiefen Schauer von Glück, das ihr nicht mehr so erschien, als sei es allein ihr eigen, sondern ihr war, als habe die Nacht daran teil, die reiche Natur, die sie umgab, das Licht des Himmels und die unendliche Weite der großen Welt, in der sie erwacht war zu ihrer jungen Liebe. Diese fremde Kraft, die ihr Geliebter seine Sehnsucht nannte, gewann im Suchen ihrer seligen Traurigkeit Gestalt, und sie sah sie als einen Engel, der sein Haupt beschirmte, und der ihn in seine Zukunft führte, die weiter reichen und schöner sein sollte, als ihre Gedanken und als ihr Tun. Und sie faltete ihre Hände, die wie alles an ihrem Leibe und an ihrer Seele nicht mehr ihr Eigentum waren, und schaute zu dem Engel auf: »Ich bin nicht dein Ziel,« sagte sie zu ihm, »aber schlag auch für kurz deine beiden hellen Flügel um mich.«
Wie veränderbar sein Wesen war. Wie herb er sich ihr oft verschloß, obgleich nichts ihn hinderte, gelassen seine Ansprüche vor ihr zu erheben. Oft hatte er sie tiefernst, traurig und grüblerisch verlassen, fast bitter und ohne einen Schein von Glück in den Augen. Dann legte sie sich mühevoll und heiß besorgt die Worte zurecht, prüfte ihre kindlichen Hände, wie sie ihn trösten möchten, und empfing ihn ernst und zu jedem Opfer bereit. Aber dann flog ihr oft sein leichtsinniges Lachen unerwartet und jugendlich entgegen, über all ihre Sorge hin. Seine Stirn schien dann niemals gebeugt und sein Mund nicht schmerzvoll gewesen zu sein.
Aber keine seiner Stimmungen hielt an, sie verflogen wie Licht und Schatten an stürmischen Wolkentagen, um die der Sonnenschein kämpft. Sie wechselten zuweilen sogar in einer kurzen Stunde ihres heimlichen Beisammenseins, nur wenn er scheinbar allen Erlebnissen seines Tages fern, seine Gedanken mitbrachte, die ihn beschäftigten, war er beständig und immer liebevoll. Aber sie empfand dann so, als sei er entfernt, auch noch, wenn seine heißen Worte, in denen er ihr seine Welt enthüllte, nur ihr zu gelten schienen. Sie fühlte sich dann oft wunderbar beglückt und zugleich mißbraucht. Aber nur er kannte sie, das bedeutete ihr mehr als jede Tugend.
Ihr kindliches und unerfahrenes Herz empörte sich niemals. Nur einmal, als sie mit ihm darüber sprach, lächelnd, und bereit, ihm jeden Einwand zu verzeihen, erschreckte sie seine Antwort, die er in einem seltsamen Leichtsinn aussprach, in einer Aufrichtigkeit, die schwermütig und unvorsichtig war, die er sicher vermieden haben würde, wenn ihn die eigene Gewißheit nicht auf neue Art überwunden hätte:
»Wenn mir einmal die Liebe einer Frau begegnet,« sagte er, »die so beschaffen ist, daß ich mich ganz an sie verlieren könnte, so würde ich sie und mein Glück zerstören. Sicherlich, ich würde es tun. Ja, wenn ich in die tiefste Schmach flüchten müßte ...«
Er besann sich plötzlich und brach ab. Betroffen sah er ihr bekümmertes Gesicht, und nun erst schien ihm klar zu werden, vor wem er gesprochen hatte.
Aber er machte keinen Versuch, etwas gutzumachen, obgleich es ihm vielleicht gelungen wäre. Aus ihren gequälten Zügen sah sein Schicksal ihn an und lächelte barmherzig.
»Vergib mir,« sagte er ruhig, »ich habe dich nicht kränken wollen.«
»Wie hast du es gemeint,« fragte sie traurig, »bin ich dir so wenig?«
Er sagte nur:
»Ich erscheine dir undankbar.«
»Kannst du niemand recht lieb haben?« fragte sie, und nun sah er, daß sie weinte, denn sie konnte ihre Tränen nicht mehr verbergen.
Er schwieg.
»Ach, antworte mir doch,« bat sie heftig und schluchzte. »Laß mich nicht allein.«
Gedemütigt durch ihren Schmerz, der ihn zugleich beglückte, sagte er und suchte die Worte mühsam:
»Vielleicht ist in meinem Herzen mehr Liebe als in vielen anderen, aber ich kann sie nicht auf einen Menschen ausschütten wie ein einziges Geschenk. Mich bewahrt eine Kraft, deren Sinn und Ziel ich noch nicht kenne, der ich mich ganz vertrauen muß.«
Ohne Hoffnung, mit einem Mut der Verzweiflung, sagte sie fast zornig:
»Ich versteh dich nicht.«
Mochte er darauf in sein stolzes Schweigen verfallen, die Achseln zucken und sich ein wenig mitleidig abwenden. Ja, mochte er gehn, wenn er wollte. Ihr blieb doch die bittere Genugtuung, daß ihre Schmerzen größer waren als sein Stolz.
Aber nichts von alledem geschah. Er kniete neben ihr nieder, suchte ihre Hände, legte sein Gesicht hinein und vergrub es in ihrem Schoß. Ihre Lippen sanken in sein Haar und ihr Herz brannte vor Beschämung und Glück. Bebend und heiß verwirrt dachte sie nur immer wieder: Was ist es denn, das ihn so plötzlich überredet hat? Gab er ihr nun nicht mehr, als er je mit Worten würde geben können? Und sie fühlte, wie unberechenbar und ohne Halt und Willen sein Herz schien, das doch in Kräften über ihrem Dasein schlug, die stark wie das Leben waren und stark wie der Tod.
Morgens wenn die Frühsonne den besprengten Garten trocknete, duftete die Welt warm im leisen Summen der Bienen nach dem Sommer. Die Tage zogen strahlend hell und wunderbar still herauf, der gewohnte Weg, den die Sonne durch das Haus nahm, war grün und dicht bekränzt an offenen Fenstern, sommerlich hell im ruhigen Haus und in den Herzen der Menschen von großäugigen Träumen umlächelt.
Anne-Dore wachte oft des Morgens auf, ehe die Sonne da war; noch befangen von der Güte der tiefen Nacht, trat sie ins blaue Licht der Dämmerung ans Fenster, schaute über die Hügel ihrer Heide, wie sie es einst als Kind getan, und wie ein kühles neues Wunder tauchte ihr aus den versinkenden Fesseln ihres Schlafs die Gewißheit empor, daß sie ein Mensch auf dieser Erde war.
Die Bäume im Garten, die sie kannten, grüßten sie in der Stimme des ersten Windes, der flüsternd mit dem Licht erwachte, und sie fühlte in seiner reinen Kühle ihren jungen Körper, den sie liebte, weil er den geliebten Mann beglückte, dem sie ihn ganz zu eigen gab. Einmal überwältigten ihre sehnsüchtigen Gedanken sie, sie kleidete sich hastig an in dieser seligen Dämmerung der stillen Welt und eilte über die versteckten Waldwege hin nach Hildenrot. Aber dicht vor dem Forsthaus kehrte sie erschrocken um, angstvoll besorgt, die Leute im Haus möchten sie sehn und ihr Geheimnis entdecken.
Mit der heraufsteigenden Glut der Sonne begann ihr träumerischer Tag, der wenig Wirklichkeiten für sie brachte. Sie schritt, ihre leichte Hausarbeit verrichtend, durch die so lange schon bekannten Räume ihres Elternhauses, in dem alles in unerschütterlichem Gleichmaß seinen guten Gang ging. Immer noch tanzten mit süßem Lächeln und gespreizter Grazie die feinen Porzellanfigürchen in hellbunten Glasspitzen ihren Reigen auf dem Wandschrank, sie erschienen ihr wie verblaßte Erinnerungen aus einer fernen toten Zeit. »In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden«, stand immer noch in silberner Schrift über dem altmodischen Sofa, aber der Sinn der Worte war erstorben und sein Leben gehörte einer versunkenen Zeit an.
Oft hielt sie sinnend inne und eine tiefe Verwunderung machte ihr die Augen starr und still: alles blieb beim alten in den Behausungen der Menschen und weit um sie her, mochte ein Herz schlummern, jubeln oder bluten. Das gab eine so eigen wehmütige Gewißheit, als wanderten die Menschen klein und arm und flüchtig nur für kurz durch ihr irdisches Bereich, und nichts umher veränderte sich, wie ihr Sinn und ihre Hoffnung. Was bleibt, fragte sie sich angstvoll und dachte an ihre große Liebe. Dann verstand sie wohl und dachte lange daran, was ihr Mark Enz einmal in einer traurigen Stunde gesagt hatte:
»Glaubtest du, ich würde mich je begnügen? So unmöglich ein Mensch das Vollkommene erreicht, so unmöglich ist die Ruhe meines Herzens auf der Erde.«
Oft glaubte sie, all ihre Liebe gehörte allein seiner Seele, seinem tiefsten Wesen und der Glut seines Gefühls, aber dann wußte sie in ihrer Erinnerung plötzlich, daß es sein Mund war, den sie liebte, seine Hände, sein Haar. Ach, wer war sie, was sollte sie tun und werden, welches Ziel heiligte ihr heißes flüchtiges Tun und seine Inbrunst? Ihr war oft, als wäre ihre Liebe größer, als daß ein Mensch allein sie tragen könnte, als drängte sie über den Geliebten hinaus, weit, weit. Nicht zu einem andern, o nie, das wußte sie gut. Aber ihr war, als wünschte sie sich, leiden zu dürfen.
Von ihm sollte ihr Gewißheit kommen, ihn wollte sie fragen. Ihn, der stets bereit schien, sich zu zerstören, nie aber sich zu vergnügen, und dessen Wesen doch Lebenskräfte umschloß, die über jede Gefahr zu triumphieren schienen. Das betäubte sie in ihren Liebesstunden fast völlig, in ihrer Erinnerung war ihr, als seien sie vom Tode überwacht und vom Schicksal durchtrauert, von einem Schicksal, das sich vor ihr erhob in Gestalt eines bronzenen Engels mit Flügeln, die im Sonnenlicht verströmten, und mit Augen, die über sie, die Ringenden und Ergebenen, fortsahen, weit fortsahen, gelassen am blauen Horizont der Zukunft ruhend. Alle Mächte, an deren Einwirkung und an deren Gewalt sie glaubte, nahmen in ihrer Vorstellung die Gestalt von Engeln an, wie es einst Engel gewesen waren, die früh an ihrer Kinderwiege gewacht und die die Welt ihrer Vorstellungen bevölkert hatten.
Jede Erinnerung an die Stunden ihrer Liebe senkte ihr die Blicke in eine starre Verlorenheit. Fast fürchtete sie sich vor der Zeit, in der sie Kraft und Ernüchterung genug gefunden haben würde, ihrer gelassener zu gedenken, bewußter und erkennender. Aus Furcht davor, ihre alten Kämpfe möchten sich neu erheben, suchte und liebte sie die flimmernde Versunkenheit, in die ihre Träume sie tauchten, wie in ein Meer von rotem Licht und Blut. Erschauernd ging sie in diesen Wirbeln von Furcht und Glück unter, körperlos fast, wie aufgelöst in lauter Lust.
Auch weil ihre Befürchtungen sie nicht eine Stunde verließen, waren ihr solche Erinnerungen unklarer und betäubender Art. Seit einst zum erstenmal Mark Enz ihren Mund geküßt hatte, bis heute, wo er alles genommen, was sie zu geben vermochte, war sie seiner nicht einen Augenblick sicher gewesen. Nichts an ihm schien ihr Gewähr zu bieten, daß er ihr eigen sei, wie sie doch ganz sein Eigentum geworden war. Und irgendwo, unerreichbar durch alle Gedanken, blieb eine Fremdheit zwischen ihnen. Sie nannte sie in glücklichen Augenblicken ihre Achtung, ihren Respekt vor ihm und seiner Überlegenheit, suchte die Gründe in allem, das ihr noch neu, gefährlich und besonders an ihm erschien, aber sie kannte Nächte, in denen dies Bewußtsein sie bitterlich schmerzte. Als habe er sie wohl an sein Herz genommen, aber als bliebe ihr dies Herz verschlossen.
Dies Empfinden verlieh ihrer körperlichen Hingabe mit der Zeit eine so sehnsüchtige und wilde Verlorenheit, daß er erschrak. Aber ihre Hoffnung, deren Drängen sie nur erduldete und nicht erkannte, riß alle Tore ihres Blutes und ihrer Seele vor seinen Wünschen auf. Je mehr ihr Gewißheit darüber wurde, daß er sich ihr verschloß, um so inbrünstiger trachteten ihre Gaben danach, ihn ganz in das Bereich ihrer Liebe zu ziehn.
Und so erlitt sie im Grunde immer noch seine Liebe. Gerade wie am ersten Tage und ohne die triumphierende Zuversicht eines großen Rechts. Nie lachte ihre Lust sinnenfroh und gesunden Blutes unbedacht auf, es war fast, als hätten ihre alten Glaubenssätze und alle Mysterien einer ergebenen Hingabe an ihre Religion ihrer irdischen Liebe den Weg bereitet, den sie nun schreiten mußte, wie im Schatten eines Sündebewußtseins und einer Knechtschaft.
Mark sagte es ihr auch einmal:
»Dein Blut ist in einen seltsamen Bann gesprochen. Meins peitscht ein heidnisches Lachen auf, deins fließt wie unter den Klängen einer Kirchenorgel.«
Er hatte dazu gelächelt und ihren Mund geküßt, als wären seine Worte beiläufig und ohne Belang. Er hatte versucht sie auszugleichen, weil er sie bereute, aber Anne-Dore lauschte mit einem heimlichen Graun, das sie wiedererkannte, auf die Antwort, die ihre Seele wußte und die ihr Mund verschwieg.
War es das, was sie tiefinnerlich zu trennen drohte?
»Könnte ich schlecht sein«, dachte sie und hatte das Gefühl, als verlöre sie sich ganz und für alle Ewigkeit. Aber wollte er denn das? Ihre Angst erpreßte ihr Geständnisse. Sie sagte einmal, als er gegen Mitternacht in Hildenrot in ihrem Arm erwachte und sie fortschicken wollte:
»Ich möchte sein wie du. So frei, so schrankenlos, so einzig dem ergeben, was für den Augenblick dein Glück bedeutet, deinen Genuß. Du bist schön, frei bist du, ganz frei ...«
Er sah an ihren Augen, daß sie gewacht hatte, empfand, wie tief diese Fragen und Wünsche sie beschäftigten, und richtete sich nachdenklich auf, wach und bereit. Er verstand, und kalt und ohne Erbarmen sagte er:
»Laß solche Ansprüche. Was du bei mir schön und frei nennst, das wäre bei dir schlecht, nur schlecht und nichts als das. Ich will dich nicht anders als du bist. Du liebst und ehrst mich in deiner Liebe nur, wenn du sie in ihrer Art heilig sprichst.«
»In ihrer Art ...«, wiederholte sie zögernd.
Er legte ihren Kopf an seine Schulter, liebevoller, als daß auch nur ein Schatten von Schmerz in ihrer Seele blieb, strich über ihren Scheitel, hinunter über ihr loses Haar, unter dem er die Formen ihrer Schultern und ihrer reichen Hüften spürte:
»Du schläfst«, sagte er langsam.
Sie rührte sich nicht. Seine Worte bewegten sie, als würde sie still in barmherzige Nacht gebettet. Sie verstand seine seltsame Ergriffenheit nicht, die so zärtlich seine schnelle Härte abgelöst hatte; sie wußte nur, was er empfand, galt ihr, das war ihr Liebe genug.
»Wenn du erwachst, bist du zu Haus«, sagte er leise.
»Zu Hause?« fragte sie schüchtern. »Ich bin es nur bei dir. Wo sollte ich es sonst sein in der Welt?«
»Bei deinem Kind«, antwortete er, tief in Gedanken.
Sie erschrak nicht und fragte ihn nicht. Es brach ihr hell aus den Augen und lief über seine Brust. Sie hatte ihm nie so vertraut, als nun, da sein Mund diesen neuen Namen genannt hatte, der ihre Heimat werden sollte.
Herr Wendel hatte Anne-Dore eines Tages auf sein Zimmer rufen lassen. Es war ihm sehr schwer geworden, dies Gespräch zu beginnen, weniger vielleicht, weil es seiner Art fern lag, als vielmehr weil er sich vor dem Ende fürchtete, das es nehmen möchte. In einer ungewissen und uneingestandenen Furcht, die ihm seine Anforderungen beinahe schwer machte, und die durch kein Pflichtbewußtsein zu überreden war. —
»Vater, bitte mich nicht. Ich vermag es dir nicht zu sagen, wie ich möchte, aber mit dir zum heiligen Abendmahl kann ich nicht gehn.« Anne-Dore war sehr bleich.
Tiefbesorgt schaute Missionar Wendel seiner Tochter ins Gesicht. Gewiß ließ er ihr gern in allen kleinen Dingen den Willen, aber hatte in der letzten Zeit schon manches ihn befremdet, so gab nun diese Weigerung bitter schmerzend den Ausschlag.
»Dore,« sagte er betrübt und eindringlich, »ich habe mich in den verflossenen Wochen oft bemüht, dich recht zu verstehn, habe nichts gesagt, Kind, wenn mir das Herz schwer wurde; höre, willst du dich heute deinem Vater nicht vertraun? Es meint es kein Mensch so aufrichtig gut mit dir. Komm, bitte, setz dich hier neben mich, so, gib deine Hand, schau mich an ... verdient meine Liebe dein Vertrauen nicht?«
Anne-Dore legte ihre Hand in einer ergebenen Müdigkeit in seine beiden, die ein wenig zitterten. In diesem Augenblick hätte sie alles für ihn tun können, alles, nur damit ein Schein von Freude in sein gutes Gesicht kam, in dem so traurig der Wunsch stand, seine Liebe möchte nicht verachtet werden. Aber sie fand keinen Ausweg. Es war ihr nicht schwer gewesen, sich in mancher Lage zu helfen, wenn ihr Herz nicht beteiligt war, aber wo sie empfand, konnte sie nicht lügen. Als er ihr gestern mitgeteilt hatte, er wollte in dieser Woche noch mit ihr und Friedberg in gewohnter Weise zum Tisch des Herrn gehn, war plötzlich ihr Blut erstarrt in einem Graun, wie vor der bösesten Gefahr, die ihr nur immer begegnen konnte. Wie unter einer machtvollen Drohung tauchte es vor ihr auf, aus dem Reich der göttlichen Liebe empor, die sie verraten und verloren hatte.
Nun sprach ihr Vater wieder:
»Drückt dich eine Schuld, mein Kind? Wenn du sie deinem irdischen Vater nicht sagen kannst, so bring sie deinem himmlischen. Sieh, ein erster Anfang ist die große Gefahr für uns alle. Lassen wir nur ein einziges Mal etwas zwischen uns und den Heiland kommen, so ist dem Versucher das Tor unserer Seele geöffnet. Und es gibt keine Schuld, die das Blut unsres Herrn Jesu Christi nicht abwaschen könnte vom Kleid unsrer Seele, die sein Eigentum ist für alle Ewigkeit. Kind, ich habe Sorge um dich. Seit vielen Wochen seh ich dich verändert. Ich weiß gut, daß wir alle bösen Anfechtungen ausgesetzt sind, aber es streitet für uns der rechte Mann, weißt du es nicht, muß ich es dir sagen? Es gab eine Zeit, Dore, da habe ich von dir gelernt. Sieh, ich scheue mich nicht, es dir zu sagen. Aber was ist nun mit dir geschehn? Meinst du, ich, dein Vater, der keine andere Sorge kennt, als die um dich, sähe nicht, wie du verändert bist? Auch bist du oft blaß und es scheint mir, als ob du geweint hast. Sprich zu mir, mein Kind.«
Und als Anne-Dore schwieg, fuhr er fort:
»Ich schließ auch dein Wohl heiß in meine Gebete ein. Gewiß, man soll niemanden zwingen, zum Tisch des Herrn zu gehn, seine Mahnungen und Warnungen sind so ernst, wie seine Verheißungen Seligkeit und Frieden verkünden. Wer unwürdig sein heiliges Blut trinkt und seinen Leib ißt, der ißt und trinkt sich selber das Gericht, sagt uns die Schrift. Aber Kind, das heißt etwas ganz anderes, als wir armen sündigen Menschen oft denken. Wer mit gläubigem Herzen hinzutritt, seine Sünde aufrichtig bereut und fest den Willen hat, sie in Zukunft nicht wieder zu begehen, der nimmt vom heiligen Kelch die Gewißheit mit, daß all seine Sünde vergeben ist, daß Gott versöhnt ist durch dies vergossene Blut seines Sohnes, das er uns gibt. — Was ist dir? Deine Hand zittert. Nicht wahr, meine Worte haben dich neu darin bestärkt, daß wir gemeinsam der höchsten Gabe bedürfen, die uns der Herr zurückgelassen hat?«
Anne-Dore nahm sich gewaltsam zusammen, sie sagte stockend und schwer, den Blick gesenkt und die Stirn von Traurigkeit gebeugt:
»Muß nicht ein jeder selbst wissen, Vater, wann es ihn treibt, zu gehn? Und wenn man zweifelt, ist es nicht besser, zu warten?«
»Nein, Kind, dann ist es Zeit zu eilen.«
Nun erst, da Anne-Dore auf ihrer Weigerung beharrte, empfand ihr Vater das ganze Gewicht seiner Betrübnis. Ihm vermischte sich, ohne daß er es wußte, seine Sorge um ihr irdisches Wohl mit der Furcht um ihr ewiges Heil. Nun war ihm, als sei auch ihr Leib in Gefahr, als gelte es nicht allein, ihre Seele zu retten. Eine jähe Angst befiel ihn und ein schmerzhaftes Gefühl seiner Ohnmacht. Er ließ ihre Hand fahren und schaute sie lange tieftraurig und voll Liebe an.
Als Anne-Dore ihre Blicke hob, sah sie in seinen Augen Tränen, die er zu verbergen trachtete. Sie liefen über seine Wangen in den grauen Bart und auf seine gefalteten Hände.
»Vater,« rief sie, sprang empor und legte ihre Arme um seinen Hals, »ich geh mit dir. Gewiß. Gewiß. Vergib mir, ich habe töricht gezweifelt. Ich weiß, daß keine Sünde zu groß ist, daß ich kommen darf, wie ich bin, daß er barmherzig ist, gut — daß er versteht — vergibt. — Vater, weine doch nicht.«
Sie trocknete ihm die Tränen mit ihrem Tuch und er ließ es geschehen, wie eine Wohltat, die er im Leben noch nie erfahren hatte. Und er sagte und wußte nicht, wie schön seine himmlische Sorge und Liebe in irdischem Licht erglänzte:
»Dich kann ich nicht verlieren, mein liebes Kind.«
Ich habe etwas gegen mein Gewissen getan, empfand Anne-Dore, als sie allein war. Nicht allein ihr Versprechen lag ihr im Sinn, sondern der Gedanke an ihren ohnmächtigen Widerwillen, als sie ihren Vater hatte weinen sehen. Sie erschrak vor der Erkenntnis, daß sie sich hätte abwenden können, von nichts erfaßt, als von einem Mitleid mit seiner Schwäche. Wo lagen die Gründe dafür, daß ihr das Ereignis im Grunde nur peinlich, und nichts als das, gewesen war? Sie fühlte klar und zuversichtlich, daß sie nichts mehr mit ihm und seiner Empfindungswelt zu schaffen hatte, daß sie im Grunde nie sein eigen gewesen war, und daß er sie ganz verloren hatte, wenn auch sein Sinn sich nun in neuer Gewißheit tröstete.
Wem gehören wir an in der Welt? dachte sie. Nur Oberflächliche suchen Halt und finden ihn im Glauben an Gemeinschaft. Jeder ist allein. Es stieg ihr bitter empor: die sich täuschen können, sind glücklich, die nicht beanspruchen, die sich begnügen, die wenig empfinden. Und sie dachte an Mark Enz, den sie mehr liebte als ihr Leben und als ihre Hoffnung, und nie hatte sie so schmerzhaft gewußt wie nun, daß auch er allein war, einsamer vielleicht, als ihr Herz bisher geahnt. Auch meine größte Liebe erhöht den Wert meiner Gaben nicht, die ich ihm darbringe, dachte sie bebend; über allen Wünschen, die uns unsere Liebe bringt, geht der Weg dahin, den Seelen zu ihrer seltenen Gemeinschaft finden. Nur Augenblicke gibt es, Augenblicke ... Sie preßte plötzlich in einem Aufwallen verwundeter Begierde und wie in einem wehen Drang nach Erkenntnis ihre Hände in den Schoß, brach nieder in ihre Knie und stammelte:
»Erlöse mich durch dein Blut von meinem, Herr Jesus.« —
Was war das für ein böses Gebet gewesen, das sie ausgestoßen hatte wie einen Schrei? Taumelnd erhob sie sich. Wie kam ich dazu, was trieb mich, was zerriß mich, welche Sehnsucht riß mich mit sich fort?
»Du bist allein, mein Liebster«, sagte sie leise. »Wer gibt dir deine Kraft? Du bist fröhlicher als die Menschen, die ich kenne, und trauriger, dein Herz führt dich Wege, die nicht einmal du selber kennst. Alles ist fremd an dir, alles liegt miteinander im Streit. Wohin gehst du? Sag es mir, denn ich möchte mit dir. Deine Reichtümer und deine Schulden sind zu schwer für meine Schultern, ich kann sie nicht ertragen. Was bist du für ein Mensch, daß ich dich immer und immer lieben muß und immer nur dich, und bin doch allein bei dir, wie du bei mir. Wenn ich dich betrachte in meinen armen Gedanken, verwirrt sich mein Sinn, aber wenn du zu mir sprichst, ist der Himmel weit und hell geöffnet, als gäbe es keinen Kampf, keinen Zweifel, keine Unrast, als gäbe es nur Harmonie und beständige Seligkeit. Warum hilfst du mir nicht? Ich kann dich nie verlieren, mein Geliebter.«
Sie erschrak. Solch letzte Worte hat auch ihr Vater gesprochen. Eben noch. — War es überall in der Welt dasselbe, sollte nichts gestillt, kein Glück vollkommen sein und keinem Drängen nach Gemeinschaft Erfüllung werden?
»Sprichst auch du solch schmerzhafte Worte, Liebster? Zu wem sprichst du sie?« fragte sie mit großen leeren Augen. »Nicht zu mir. Ach, sprächst du einmal so zu mir, littest du nur einmal um mich, ich würde dies Leid so überglücklich mit allem segnen, was ich habe, ich würde glauben, daß eine Gemeinschaft zwischen uns möglich ist, daß ich dich halten kann.«
»Leb wohl«, sagte sie plötzlich fest und seltsam feierlich. »Ich gehe. Weißt du, wohin ich gehe? Ich will für den da sein, der um mich leidet. Für meinen Vater. Wenigstens einmal noch, und für den anderen, der mich ruft und der auch um mich gelitten hat. Vergib mir, ich komme wieder. Du wirst fühlen, daß du mich nicht mehr heilen kannst. Aber ich gehe, denn ich habe keine Sünde begangen, die nicht vergeben werden könnte, und ich werde künftig keine Sünde mehr tun. Es wird mich niemand strafen für mein Leid um dich, mein Liebster.«
Die Abenddämmerung trug still und warm die Klänge der Kirchenglocken von St. Nikolai über die Stadt und das Land. Es waren die großen Glocken nicht, die riefen, sondern nur kleine, wie sie beim Tode Armer geläutet werden, oder an Sonntagen in der ersten Frühe. — Die Welt umher lebte noch in jenen seltsam wachen und doch verlorenen Lauten, die nach heißen Tagen aufsteigen, wie von der nahenden Kühle getragen. Kinderstimmen, ein langer, fremdartiger Ruf, der Schrei eines müden Lasttiers oder der dumpfe Fall eines schweren Tors. — Die Geräusche flogen alle gesondert auf, wie vereinsamt, sammelten sich nicht mehr wie am Tage zum Geräusch des Treibens der Menschen, sondern ermahnten zur Rast und waren, als ob sie dem sinkenden Licht nacheilen wollten.
In der Nikolaikirche brannten vereinzelte Gasflammen, bei der Orgel, über dem Gestühl des Chors, und den Hauptgang entlang, der zum Hochaltar führte. Nur die Sakristei war erleuchtet, immer drei und drei brannten die leise singenden Flammen. Schlichte, dünne Eisenarme reckten sich an plumpen Leuchtern empor. Am Hochaltar blinkte das Marmorkreuz und der Leib des gekreuzigten Heilands schimmerte leidensbleich über den Prunk der silbernen Geräte hin in das dämmerige Kirchenschiff hinein. Es war kaum noch ein schüchterner Schein vom Tag hinter den hohen bunten Scheiben zu erkennen.
Ebenmäßig, grau und gerade hoben sich die Säulen der Seitengänge empor in die Dämmernacht, die unter der gewölbten Decke herrschte. Die Kanzel ruhte leblos, nur der breite Goldschnitt der Bibel, die dort auf ihrem niedrigen Holzpult lag, blinkte.
Im verengten Kirchenschiff, vor dem Hochaltar, waren rechts und links zwei Stuhlreihen in breiten Kurven aufgestellt. Die ersten Abendmahlsgäste versammelten sich, langsam und schwarz schritten sie bedächtig und bedrückt an ihre Plätze, sie schienen den Widerhall ihrer Schritte zu fürchten, der hohl, laut und wie von weither aus den toten Räumen der Kirche zurückkam. Hoch auf der Galerie bei der Orgel versammelten sich die Chorknaben, das grelle Schurren eines Stuhls und polternde Laute verrieten sie, die Wände schienen das Echo verdoppelt und verschärft zurückzuwerfen, und jeder Laut erhöhte, lang ausgedehnt, die bedrückende Allmacht der feierlichen Stille.
Pastor Jacoby hatte dies Abendmahl angesagt. Die Plätze waren bald besetzt, zur Rechten und zur Linken des Altars zwei mattbewegte schwarze Reihen; es wurden noch Stühle für neue Gäste hinaufgebracht, die Kirchendiener gingen auf den Fußspitzen, mit ernsten und wichtigen Mienen taten sie ihre Pflicht und schienen zu eilen, wenn sie die Sakristei wieder verließen.
Anne-Dore und ihr Vater hatten mit Friedberg schon zu den ersten gehört, die angekommen waren. Das Gesicht des jungen Mädchens war von einer so unbewegten und starren Blässe, daß es auffiel, und manche Blicke besorgt und in bewundernder Andacht darauf ruhten. Friedberg glaubte nie in seinem Leben etwas so Schönes gesehen zu haben, wie diese ruhigen, klaren Züge, deren Linien, wie die Linien des Marmors, unbeweglich und doch lebensvoll erschienen und so von geheimer Trauer verklärt waren, daß es vielen erschien, als ob ihr eigenes Leid gering sei.
Der Kandidat hatte mit großer Spannung darauf gewartet, ob Anne-Dore an dieser Feier teilnehmen würde oder nicht. Nun war ihre stille Hingabe ihm eine Bestätigung seiner liebsten Hoffnung, die ihn mit Glück und neuer Zuversicht füllte. Nun wußte er wieder, welchem Herrn sie im Grunde allein diente, jenem Friedensfürsten, der auch sein Gott war, dem Heiland der Welt, der alle Schuld der Menschen trug. Ein heimlicher Triumph weitete ihm die Seele, durchwärmte seine Andacht bis zu überschwenglicher Hingabe an die Sache dessen, der den Sieg behalten hatte. O, er hätte auf sie zutreten und ihre Hand drücken mögen; wenn doch eine Kraft auf Erden wäre, die ihm ihr Herzeleid aufbürden könnte, gern wäre er zu jedem Opfer willig und zu jeder Tat der Bruderliebe bereit gewesen.
Wie still und kühl war ihr Gesicht, verborgen und scheu suchten seine Blicke darin zu lesen. Er sah ihre geneigte Stirn und ihre gesenkten Augen halb von der Seite. Unter der Krone des überreichen schweren Haars und über dem schwarzen Kleid hob es sich ab, beinahe leuchtend ... Hatte Mark Enz wohl jemals diesen Mund geküßt, diesen Mund, der nun, wie auch der seine, den Leidenskelch des Heilands an seinen Lippen spüren sollte? Nie, nie! Wie konnte es möglich sein. »Maria war nicht reiner als du«, sagte er mit unhörbarem Flüstern und seine Sinne versanken ihm in andächtiger Scheu. —
Hell in die große Stille des Wartens hinein, siegreich und klar, ein himmlischer Glanz, brach hoch wie vom Himmel her der Knabenchor ein. Eine göttliche Erlösung, rein in seiner seligen Feier, beschwingt und erhebend. Er trug die Herzen aus der schwülen Bedrückung ihrer irdischen Niedrigkeit in Gottes Huld empor:
»Aus tiefer Not schrei ich zu dir,
Herr Gott, erhör mein Rufen.«
Klein, vergänglich und arm war nun die Welt mit ihrer Trübsal; den Mühseligen stand der Himmel auf. In einer Gebärde unaussprechlicher Güte hob ein geliebter Engel den Kelch über alle Not, den Kelch, der das Blut des geschlachteten Lammes von Golgatha umschloß, die hohe Bürgschaft eines unvergänglichen Friedens.
Als Anne-Dore aufsah, stand Pastor Jacoby schwarz und stumm hart an der letzten oberen Stufe, die zum Altar führte. Sein schlichter Talar, der fast ganz ohne Falten bis auf seine Füße niedersank, machte seine Gestalt beinahe überschlank; vom gestickten Purpur der Altardecke hob sie sich ruhend und aufrecht ab, in diesem lieblosen Licht der Gasflammen, die den Schein der Altarkerzen verdrängten. Ihr Spiegelglanz warf sich vom Hochaltar auf die geneigten Gesichter der Andächtigen, überbleich erschienen sie, qualvoll entstellt, als wäre kein Opfer groß genug, um der himmlischen Gaben würdig zu werden, die sie erflehten.
Es war Anne-Dore, als sähe sie heute Pastor Jacoby nach langer Trennung zum erstenmal wieder. Unentwegt schaute sie ihn an, sie tauchte ihr Gesicht hinein in den Klang seiner Worte, als er nun sprach, in diesen Klang, der einst ihre Seele zu ihrer ersten Zuversicht erweckt hatte. Aber keine Erinnerung gewann Gestalt, ihre großen, ruhigen Augen suchten sein Gesicht, dies Angesicht, das sie einst bewundert und verehrt hatte, und das ihr nun so eigen vertraut erschien und doch so fern, so traurig weit entrückt, wie ihre versunkene Hoffnung.
Aber seine Stimme war ihr lieb. Unter diesem eindringlichen und traurig hellen Ton war ihr zumute, als schaute sie von einem heißen Weg, den ihr Fuß gehen mußte, zurück in das feierliche Tal ihrer Heimat, die sie verlassen hatte.
Aber zwischen heute und damals lag, wie ein einziges heißes, wildwogendes Chaos, die Zeit ihrer Kämpfe und ihres Wandels. Sie wußte darüber nichts mehr, es war, als ob die schwer geheilten Wunden ihre Seele unempfänglich gemacht hätten. Das alles konnte nie wieder kommen, o, es machte glücklich, das zu fühlen; welch böses Schicksal auch immer nahte, schlimmer konnte auf der Erde nichts mehr werden, als jene Zeit, in der zwei Mächte um sie gerungen hatten. Wie war es zuletzt gewesen? Als ob die Flügel ihrer Seele, die Jesu Blut verklärt hatte, in das rote warme Blut ihrer irdischen Liebesnot niedergetaucht wären.
Nun hörte sie wieder die feierlich flehende Stimme über sich:
»Denn der Herr Jesus, in der Nacht, da er verraten ward, nahm das Brot, dankte, brach's, und sprach: Nehmet, esset, das ist mein Leib, der für euch gebrochen wird; solches tut zu meinem Gedächtnis. Desselbigen gleichen auch den Kelch nach dem Abendmahl, und sprach: Dieser Kelch ist das Neue Testament in meinem Blut; solches tut, so oft ihr's trinket, zu meinem Gedächtnis.«
Sie lauschte mit Anstrengung, kämpfte matt um den Sinn der Worte, lächelte dann fein und übermüde und schloß die Augen, während der Geistliche seine kurze, ernste Ansprache begann, nach welcher die heilige Handlung vollzogen werden sollte.
Die Kirche schien wie erstorben. Es war so still, daß die Stimme des Predigers wie in einem Grabgewölbe erscholl; nur wenn er die langen Pausen machte, die er liebte, hörte man das Singen der Gasflammen und leise und nah das Atmen seines Nachbarn.
Aus ihrer Erstarrung befreite sich Anne-Dores Sinn noch einmal unter dem Christuswort:
»Welcher nun unwürdig von diesem Brot isset, oder von dem Kelch des Herrn trinket, der ist schuldig an dem Leib und Blut des Herrn — — denn welcher unwürdig isset und trinket, der isset und trinket ihm selber das Gericht ... darum sind auch viel Kranke unter euch und ein guter Teil schlafen.«
»Isset und trinket, isset und trinket ...« klang es ihr nach, wie ein Echo, mit irgendeinem Lächeln, gütig, spöttisch, sehr traurig und wie durch ein Flimmern heißer Luft.
Dann war ihr plötzlich, als sähe sie Mark Enz langsam durch das dämmerige Kirchenschiff kommen. »Was willst du hier?« wollte sie fragen. Nein, er war es nicht. Doch — nun erkannte sie ihn deutlich, nun, da das Licht der Gasflammen ihn empfing und erst nur sein Gesicht, dann langsam seine Gestalt deutlich wurde. »Geh leise«, wollte sie rufen.
Plötzlich sprang er vor, nahm die Marmorstufen zur Sakristei mit einem Satz, vorgebeugt sprang er, die Arme ausgestreckt. Er ergriff die schwere, rote Altardecke mit sehniger Hand, schwang kreisend die Faust, so daß das dunkle Tuch, ein goldgestickter Schlangenleib, sich um seinen Arm wand, und riß den Purpur nieder, daß die heiligen Geräte mit Klingeln auf den Steinfliesen der Sakristei umhertanzten ...
Sie riß die Augen auf.
Die Stuhlreihe vor ihr war leer. Die ersten knieten schon am Altar, auf der niedrigen, gepolsterten Schemelbank, im Halbkreis, gebeugt, stumm, den Schein der Altarkerzen auf den Häuptern. Sie sah, wie Pastor Jacoby eine schlanke Silberkanne neigte und den Kelch mit Wein füllte. »Mit Blut«, dachte Anne-Dore. »Ihr alle dort seid würdig.«
Nun erhob sich ihr Vater. Allzubesorgt, die einfachen Regeln genau zu befolgen, schritt er langsam voran, hinter ihm Friedberg, und nun mußte auch sie aufstehn, um beiden zu folgen.
Friedberg ließ dem jungen Mädchen den Platz neben ihrem Vater, dann kniete er an ihrer Seite nieder, sie spürte seine Schulter an der ihren.
»Wie herzlich lieb hab ich dich gehabt, Herr Jesus«, dachte Anne-Dore. Sie sagte es flüsternd, mit kalten Lippen, neigte den Kopf und lauschte wie mit erstorbenen Sinnen, wartete in einer heißen, süßen Erregung, und war sich nicht klar darüber, worauf. Vielleicht war so der Augenblick, in dem man seinen Tod kommen fühlte. Eine geheime Gewalt begann plötzlich ihre Brust in weher Tiefe fein und grausam zu stoßen. Ihr war, als müßte sie ein aufsteigendes Lachen unterdrücken oder ein eigensinniges Weinen, das grundlos begann.
»Nehmet hin und esset«, hörte sie über sich. Sie sah, wie ihr Vater den Mund öffnete, wie eine welke, große Hand mit dicken Adern ihm eine weißliche Oblate zwischen die Lippen schob. Das war der alte Prediger Bunsen, der beim Abendmahl Hilfsdienste leistete. Dann kam er zu ihr und ihr geschah ein gleiches. — Oben sangen sie ohne Aufhör leise und fern, gedämpfte Stimmen, die wie aus dem Himmel herüberklangen und alles in Güte einhüllten.
Die Oblate blieb ihr am Gaumen kleben. Sie versuchte sie mit der Zunge zu lösen. Es ging nicht. Die alte zittrige Stimme und die unsichere Hand waren bei Friedberg.
Dann hörte sie zu ihrer Linken plötzlich die klaren Worte Pastor Jacobys:
»Nehmet hin und trinket alle daraus.« Oben setzte der Chor neu ein, schwermütig und klar.
Sie sah den silbernen Becher, eine Hand hielt den schlanken Stiel, die andere stützte den Kelch. Als er sich an den Mund ihres Vaters neigte, sah sie, daß er innen golden war. Er blinkte und blendete. Ihr Vater trank. Sein Gesicht war todtraurig und dabei ängstlich besorgt.
Nun stand Pastor Jacoby vor ihr.
»Dieser Kelch ist das Neue Testament in meinem Blut ...«
Der harte, blanke Rand neigte sich gegen ihren Mund. Als sie das kühle Metall spürte, preßte sie plötzlich beide Lippen fest zusammen, fest, und die Zähne auch. Es rann kalt über ihre beiden geschlossenen Lippen, über ihr Kinn ... War denn Mark Enz nicht da, um ihr zu helfen? Sie spitzte fein den Mund ... nun kamen seine Lippen — — — suchten die ihren ...
»Küß mich — — küß mich, Herzliebster!«
In einem wilden feinen Schauern fuhren plötzlich ihre beiden Arme empor. Mit lautem trillerndem Schrei sprang sie auf und zurück, taumelte zwei, drei Schritte rückwärts, so daß es aussah, als flatterte erschreckt und verstört ein riesiger schwarzer Vogel auf, todwund, mit letzter Flügelkraft. Dann sank sie gerade, beinahe steif, hinten herüber und schlug mit einem dumpfen Knall auf die Steinfliesen. Die Kirche hallte noch wider von ihrem hellen Schrei und nun warfen die hohen Hallen einander dunkel das neue Echo zu. Dann wurde es langsam still, als habe der Tod es geboten.
Wie schön das war: gefaßt und ruhig stellte der junge Prediger den Kelch auf den Altar, raffte mit beherrschter Hand den langen schwarzen Talar, schritt die niedrige Steinstufe nieder und hob Anne-Dore in seine Arme. Schwer und mühsam trug er sie ohne ein Wort langsam in das kleine Kämmerchen hinter dem Altar.
Das Entsetzen der Abendmahlsgäste hatte sich in eine sinnlose Verwirrung aufgelöst. Der alte Pastor Bunsen rang ratlos die Hände und hob sie zum Kruzifix empor. Die Kirchendiener waren herangestolpert, aus den Gruppen der versprengten Andächtigen klang hier und da ein krampfhaftes bitterliches Schluchzen. Friedberg stützte mühsam den völlig fassungslosen alten Herrn Wendel, der kläglich entstellt und mit tastenden Armen hinter den Altar wankte.
Pastor Jacoby schickte den Kandidaten nach einem Wagen, er selber schritt nach kurzen Worten der Beruhigung an den Vater zurück zu der wartenden Schar. Er bat sie leise und traurig gefaßt, mit ihm zu beten. Die meisten knieten nieder, mehr aus Ergriffenheit und Schwäche als aus Andacht. Er entließ sie mit dem apostolischen Segen. Und während die Worte seines flehenden und doch zuversichtlichen Gebets die Herzen notdürftig beschwichtigten, kniete Missionar Wendel mit tränenlosem Schluchzen neben seinem Kind, völlig verstört, ohne einen einzigen Gedanken fassen zu können, nur immer wieder stammelnd:
»Stirb nicht, mein Kind! Gott, Gott im Himmel, hilf meinem Kind ...«
Anne-Dore lag bleich und gerade auf den Steinfliesen der kleinen Kammer, in der unsicher eine schaukelnde Gasflamme, durch leisen Zugwind bewegt, lautlose Schatten warf. Das Mädchen sah aus, als ruhte sie im Tode. Um ihren leicht geöffneten Mund war ein Lächeln von einer grauenhaften Seligkeit, süß und traurig, wie aus einem Bereich des Glücks und der Pein, das die Erde nicht kennt.
Unter ihren Kopf hatten sie ein Bündel silbergestickter Altarbezüge geschoben, über deren matten Glanz ihr schwarzes Haar halb gelöst dahinfloß, ein dunkler, ruhender Strom.
Als Pastor Jacoby zurückkam, richtete er den zitternden alten Mann fest und liebevoll auf, schob ihm einen Stuhl unter die bebenden Knie und tröstete ihn. Es sei nichts Ungewöhnliches, nur eine Ohnmacht, von der sie bald genesen würde.
»Aber man schreit doch nicht, wenn man in eine Ohnmacht sinkt«, sagte Missionar Wendel stotternd und rauh, häßlich im Gesicht vor Angst. »Helfen Sie doch, beten Sie ... ich bitte Sie so sehr ich kann, Sie haben doch gewiß Einfluß droben beim Herrn ...«
Er wußte nicht mehr, was er sagte. Er rutschte wieder von seinem Stuhl, kroch auf den Knien bis zu Anne-Dore heran und stöhnte in seine Hände:
»Ich trage alle Schuld, ich, allein ich.«
Friedbergs derbe Schritte klangen. Als er Anne-Dore sah, prallte er zurück.
»Tot?« keuchte er schaukelnd.
Pastor Jacoby beruhigte ihn. Die Kirchendiener brachten Tücher und einen Mantel, aus zwei langen Fußbänken hatten sie eine Tragbahre hergestellt. Draußen wartete der Wagen.
Am andern Morgen in aller Frühe eilte der Kandidat Friedberg ruhlos und immer noch verstört und mit völlig ungeordneten Gedanken über den Berg in die Stadt, um Sanitätsrat Claußen aufzusuchen. Die steile vornehme Villenstraße, die von der Berghöhe in die städtischen Anlagen niederführte, legte er laufend zurück. War es auch sicher nicht so über alles eilig, so betäubte diese Anstrengung doch die bohrenden Gedanken, in die kein klärendes Licht fallen wollte. Er rannte an den Gittern der kleinen wohlgepflegten Vorgärten vorbei, sah die Rosen im Morgentau stehn, in diesem halben Frühsonnenschein und in dieser wartenden Stille. Unten wurde die Straße gesprengt, es roch nach Staub und schwüler Feuchtigkeit und es erschien ihm, als würden vergessene Dinge des alten Tages neu aufgestört.
Alle Beklemmung nach einer schlaflosen Nacht, die frostige Öde hinter der Stirn und die ruckweise Fahrlässigkeit seiner Schlüsse beherrschten ihn wie ein schales Fieber.
Was war das für eine böse Nacht, die zurücklag, er entsann sich kaum einer schlimmeren in seinem Leben. Gerade schienen alle ein wenig ruhiger geworden zu sein, man war still zu Bett gegangen, wie auch Anne-Dore, die wohl noch blaß und seltsam abwesend gewesen war, aber man hatte doch wieder ein Lächeln gewagt, mit ein wenig Trost im Herzen. Da hatte es gegen zwei Uhr begonnen. Türen schlugen, Lotte lief treppauf, treppab, und die Stimme Missionar Wendels klang gedämpft und erregt. Friedberg hatte sich geängstigt und sich langsam angekleidet, aber doch keine Einmischung gewagt. Erst gegen Morgen wurde an seine Tür geklopft. Er möchte doch gleich aufstehn und zum Arzt eilen. Anne-Dore läge im Fieber.
Es war Herr Wendel, der ihn bat. Er schien kaum überrascht, den Kandidaten schon in den Kleidern zu finden.
»Lotte hat Kaffee gemacht, trinken Sie bitte erst einen Schluck, ehe Sie gehn«, sagte er zu dem jungen Mann. Draußen wurde es hell.
Er schritt hinter ihm her die Treppe hinunter, und unten hatte er sein Angebot schon vergessen. Er hakte dem Kandidaten den Mantel vom Ständer, den jener ablehnte und wieder forthing, gab ihm seinen Hut und schloß mit zitternden Händen die Haustür auf. Aber dann hielt er ihn noch einmal fest und beschrieb ihm umständlich die Lage des ärztlichen Hauses. Übrigens könne er ja auch fragen, es seien sicher schon Leute auf, Straßenkehrer oder Bäckerjungen. Claußen hieße er, Sanitätsrat Claußen.
Friedberg fragte:
»Ich habe plötzlich nachts ihre Stimme gehört, dann hab ich an der Tür gelauscht und endlich bin ich hineingegangen. Sie gab mir keine klaren Antworten. Wäre nur die Mutter da ...«
Er schwieg einen Augenblick und schien mit sich zu kämpfen:
»Herr Friedberg, wer ist denn Mark Enz?«
»Mein Gott ...« sagte der Kandidat.
»Erschrecken Sie? Warum erschrecken Sie? Bitte, unterrichten Sie mich doch. Ist es nicht der junge Mann, von dem einmal bei Tisch die Rede war?«
»Ja, ich glaube,« stotterte Friedberg und eh eine neue Frage kam, fügte er rasch hinzu:
»Sie kann ihn doch nur flüchtig kennen, glaube ich, hoffe ich ... ein Tennisball flog in unsern Garten ...«
Missionar Wendel schien beschwichtigt.
»Gleichgültige Dinge gewinnen oft im Fieber ein merkwürdiges Gewicht,« meinte er erklärend und zur eigenen Beruhigung. Er schien seine Frage zu bereun und doch um Mut zu einer neuen zu ringen. Aber dann sagte er nur noch abbrechend:
»Nun gehn Sie, bitte, gehn Sie gleich.« —
Am Eingang zu den städtischen Anlagen, die er nun durchqueren mußte, hielt Friedberg einen Augenblick inne und schöpfte Atem. Die bestaubten Blätter der Büsche am Straßenrand hingen ermüdet und mattfarbig nieder. Die bunten Zierbeete auf den wohlgepflegten Rasenplätzen sahen unecht und albern aus in diesem einsamen Morgenwind. Auf einer Bank unter Fliederbüschen schlief ein Arbeiter, seine Stiefel waren zerrissen und sein Hut lag am Boden. Friedberg entdeckte darüber plötzlich, daß er wieder seinen guten Anzug angezogen hatte, den langen schwarzen Rock von der gestrigen Feier und die Manschetten und den schwarzen Bindeschlips ... Es war Sommer. Eventuell konnte man draußen schlafen. Es war nachts nur kurze Zeit dunkel. Wie schön war es im Sommer ... Man wird denken, ich käme erst jetzt von einer Festlichkeit heim, ging ihm durch den Kopf. Ein Gefühl der Scham ließ ihn sich umschauen, aber dann verwarf er seine Befürchtungen unwirsch.
»Daran denke ich nun, wo so wichtige Dinge vorgehen sollten,« schalt er sich.
Wäre nur jener Name nicht gefallen, eben, als er fortgeeilt war. Dieser Name, den er angstvoll in den schlaflosen Stunden dieser Nacht mit den schaurigen Vorfällen in Zusammenhang gebracht hatte, die gestern geschehn waren.
»O dich kenn ich!« rief er grimmig und ballte die Fäuste. »Aber auch meine Stunde kommt. Wehe dir! Wehe dir!« Er glaubte seiner Drohung alle Macht, verschärfte sie böse und vergaß Anne-Dore fast völlig im Rausch seines Zorns. Aber alle heimlichen Schmähungen, die er aneinanderreihte, verwarf er, lenkte ein, verdoppelte sie wieder hämisch und suchte alle seine Erlebnisse mit Mark Enz herbei, um sie zu belegen. Aber schließlich stand er im heißen Widerstreit seiner Erkenntnisse vor einem bösen Nichts. Er blieb stehn und sagte laut:
»Das ist es alles nicht. Anne-Dore hat dich lieb. Wer bist du?«
Und unter dieser heißen Gewißheit, die wie eine unerkennbare, schleppende Krankheit schmerzte, sah er plötzlich das verhaßte Angesicht in einen Schein von Hoheit gelegt, in einer heldenhaften Feier über sein eigenes, armes Vermögen erhoben, und aller Liebe würdig. — Sein Haß schien ihn zu necken, aber er erlag dieser neuen Regung, sah sich selber traurig und arm, weit abgestellt, ein verschmähter Diener.
Doch, doch, das mußte jeder Neid dem andern lassen, er war stark, selbständig und eigenwillig. Was er wollte, erreichte er. Aber unwürdig war er doch, ein schlechter Sachwalter seiner Gaben, deren Reichtum er nicht verdiente, ein lässiger Verweser der Geschenke, mit denen ein unvernünftiges Schicksal ihn betraut hatte. Er hielt nichts auf sich, das war es. Und Friedberg wußte, beinahe beruhigt, eine Reihe von Ereignissen, die ihm seine Erkenntnis bekräftigten. Und keinen Stolz hat er, das soll man nicht vergessen. Wer etwas auf sich hält, kann sich nicht so rasch herbeilassen, folgt nicht so unbedacht jeder Regung des Herzens.
Und Friedberg langte eigen erhoben und neu gefestigt am Hause des Arztes an: er hält nichts auf sich. Er ist keiner Liebe wert. Ein reiches und großes Herz beugt sich dankbar unter die Gunst des Lebens und kann Empfangenes bewahren und achten.
Stärker als je wuchs der Wille in ihm empor, all seine Kräfte einzig in den Dienst nur einer Sache zu stellen: Anne-Dore aus diesen unwürdigen Händen zu reißen. Noch erschien es ihm nicht zu spät, und ein neues Geschick schien sich ihm grausam und doch liebevoll zu verbinden. — Aber seltsam gelassen schaute es ihn aus den Drohungen heraus an, die die bösen Begebenheiten enthielten, mit kalten, hellen Augen, die hart lächelten und verschwiegen triumphierten. Es kommt alles anders, wußte er plötzlich in einem Gefühl widerwärtiger und ruchloser Begierde, die die Zähne aufeinanderpressen ließ und das Blut peinvoll fühlbar machte, giftig und süß. —
Herr Sanitätsrat Claußen folgte dem Ruf erst gegen zehn Uhr am Vormittag. Das Vorfahren seines Wagens wirkte wie eine Lösung auf alle Wartenden. Lotte war inzwischen noch einmal geschickt worden, kehrte aber unverrichteter Sache heim, da der Arzt seine Wohnung schon verlassen hatte. Nun mußte man sich gedulden. Herr Missionar Wendel hatte still und eifrig mit kalten Umschlägen die heiße Stirn seiner Tochter gekühlt, ihre Hände gehalten, die sich nicht wehrten, und flehende Gebete vor den Thron seines Gottes geschickt, dessen Walten ihm in diesen unverständlichen Vorfällen unergründbar erschien.
Als der Wagen vor dem Garten hielt, eilte Herr Wendel selbst an die Haustür, um zu öffnen. Und nun, da der Arzt ohne viel Fragen, in einschüchternder Sachlichkeit und scheinbar grausam anteillos sich in Anne-Dores Zimmer hatte führen lassen, schritt er stumm, mit geneigtem Kopf und ruhlos besorgt in seinem kleinen Garten auf und ab.
Die Luft wartete auf Regen, es war nicht warm und nicht kalt und kein Wind bewegte die Zweige der Bäume, an denen die Früchte zu reifen begannen und die mit dem Land auf Regen zu hoffen schienen, geduldig und gut. Die Rosen neigten sich an ihren hohen, wohlgepflegten Stöcken, senkten die vollen Kelche und trugen Tautropfen, die kühl vom Wind der hellen Nacht waren.
Wie quälte die stille Geduld der Pflanzen und das graue Zögern des Himmels. Es überredete die Seele, aber vergeblich erhoben die großen Mahnungen der heilenden Natur sich vor der Qual dieses zitternden Herzens. Der alte Mann starrte mit schmerzvollem Gesicht in den Morgen hinaus. — Ein großäugiger Engel schien zögernd in den Frieden seines Heimes eingekehrt, herrschsüchtig und still. Er verriet der fragenden Seele nicht, ob sein Wesen Huld oder Strenge, Licht oder Finsternis barg, wie ein schweigender Bote eines nahenden Schicksals, der wider Willen verkündete, wer ihn gesandt hatte. Seine lautlose Gegenwart erinnerte das schwache Herz jählings daran, daß die Welt keine Zuflucht bietet, wenn ein Leid hereinbricht, und daß keine Macht im Himmel und auf der Erde den dunklen Zug der Schmerzen hindern kann, die die Seele eines Menschen erwählt haben.
Lange nach allen Ereignissen, spät und im Schatten seines Lebensabends, gedachte Herr Wendel dieser Stunden und alles Kommenden, in jener bösen und beinahe unversöhnbaren Deutlichkeit, die die einzigen und schwersten Ereignisse des ganzen Lebens behalten können. Und immer blieb in der Erinnerung etwas von jenem Schwindel, in die grausame und harte Schicksale ein Herz bringen können. Alle wilde Klarheit, die diese Geschehnisse aus der Welt seiner Vorstellungen und Erlebnisse rückte, ließ doch die seltsam bedrückende Angst im Herzen zurück, als wären seine Augen verbunden gewesen und als hätten die Sinne in einem schrecklichen, wachen Schlaf gelegen. Wie demütigte diese Huld einer fremden Güte tief, die mit den Menschen umging, als seien sie törichte Kinder, und die sie zugleich bewahrte, als seien sie törichte Kinder. —
»Mach mein Herz demütig«, betete er im stillen, als er ins Wohnzimmer eintrat, in das der Arzt ihn nun hatte bitten lassen, und in dem er erfahren sollte, wie es um sein Glück stand und um alle Freude seines Lebens.
Das Gesicht, in das er forschend schaute, verriet ihm nichts. Der Herr Sanitätsrat rückte ihm einen Stuhl hin. Es war ganz augenscheinlich, er kokettierte ein wenig mit der Macht, die ihm für kurz die Umstände einräumten, dieser Herr, der sich in seiner Gelassenheit wichtig fühlte und gefiel, und dem die bangende Hoffnung schmeichelte, die jetzt von seinem Ausspruch ihr Heil oder ihren Untergang erwartete.
Er wies Herrn Wendel mit sehr beherrschter und höflicher Gebärde auf den Stuhl, auf den jener sich sinken ließ, ohne recht zu wissen, daß er es tat, und immer die Blicke im Gesicht des andern. Seine hastige Frage schien jener zu überhören, er ordnete irgendein blinkendes, fremdartiges Instrument in ein Taschenetui ein und sagte:
»Sprechen wir mit viel Ruhe miteinander, lieber Herr Missionar, das ist in jedem ernsten Fall das erste Gebot Einsichtiger, die helfen möchten.«
Herr Wendel stand auf:
»Sagen Sie mir, ob meine Tochter in Gefahr ist oder nicht.«
»Bitte, beruhigen Sie sich. Ich müßte Ihnen die bedeutsamsten Einzelheiten vorenthalten, wenn ich Ihrer Gelassenheit kein Vertrauen schenken dürfte. Und in diesem Fall hängt viel von einer sachkundigen und besonnenen Behandlung ab. Zunächst bedarf es der Pflege einer geschulten Kraft, ich lasse Ihnen noch heute mittag eine barmherzige Schwester aus dem Ursula-Spital senden, unter den protestantischen Schwestern wird kaum eine abkömmlich sein. Es wird Ihnen nichts ausmachen, denke ich ...«
Er kritzelte, kurzsichtig vorgeneigt, auf seinem Rezeptblock. Eigentlich war genug gesagt. Herr Wendel zitterte so heftig, daß er nicht sprechen konnte, seine Hände flogen. Er preßte sie auf die Knie und wartete in heißer Angst.
»Der junge Herr, den Sie im Hause haben, hat mich über die Geschehnisse in Kenntnis gesetzt, die zurückliegen, und denen wir diesen bösen Fall verdanken. Es liegt eine so schwere Gehirnerschütterung zugrunde, daß beim Stand des heutigen Fiebers wohl kaum so bald auf eine Wiederkehr des Bewußtseins gerechnet werden kann.«
»Lieber, lieber Gott«, stöhnte Herr Wendel auf.
»Es liegt kein Grund vor, alle Hoffnung fahren zu lassen, aber ich halte es für meine Pflicht, Sie zu unterrichten. Wir Ärzte machen in der Regel die übelsten Erfahrungen mit jedem falschen Trost, den wir gewähren ...«
Herr Wendel war aufgesprungen und taumelte im Zimmer umher, so daß der Arzt ihn stützen mußte, beinah erstaunt über soviel Mangel an Selbstbeherrschung, wo es doch galt, die Kräfte für ernste Hilfsbereitschaft zu sparen.
»Es ist nicht dies allein«, sagte er nachdenklich und scheinbar unentschlossen, während er, die Hände auf dem Rücken und die Stirn in strenge Falten gelegt, im Zimmer auf und ab schritt, immer an Herrn Wendel vorbei, der schwer und wie gebrochen, wortlos auf seinen Stuhl gesunken war. Nun war er auf dem Fußboden und man hörte seine wichtig knarrenden Stiefel, nun dämpfte der Teppich seinen Schritt. Nun war es umgekehrt.
»Sie peinigen mich«, sagte Herr Wendel leise. »Bitte, sprechen Sie ausführlich, sagen Sie mir alles, ich muß es ja tragen, wie es nun kommen soll.«
Er fuhr mit den Händen durch seinen grauen Bart, rang mühsam um Fassung und suchte sich den Anschein zu geben, als sei er wohl beherrscht und stark. Aber seine Gebärden waren beinahe drollig in ihrer Hilflosigkeit. Niemand führte sie und niemand verstand, was sie bekundeten.
»Es kommt noch etwas hinzu,« fuhr der Arzt in einem Tone fort, der nicht an die Bitte des andern anschloß, sondern nur seine Nachdenklichkeit verriet und sein Bewußtsein für den Ernst seines Berufs, »es kommt zu ungeeigneter Zeit und ist ein böses Zusammentreffen. Aber darüber spreche ich wohl besser mit der Mutter.«
Herr Wendel hob den Kopf.
»Meine Frau ist verreist .. sagen Sie es zu mir.«
»Sie wollen, daß ich es Ihnen sage? — Nun, es ist wohl auch meine Schuldigkeit: Ihre Tochter ist im dritten Monat schwanger.«
Er bereute es sofort, der Sanitätsrat, eigentlich schon, bevor er ausgeredet hatte. Man hätte, so gefahrvoll die Dinge nun einmal lagen, auch warten können. Aber nun war es mitgeteilt, nun mußte es ertragen werden.
»Was?« fragte der Mann vor ihm mit einem so trostlosen Ausdruck von Schreck und Angst in den Augen, daß der Arzt um seinen Verstand zu fürchten begann. Und noch einmal: »Was?« Aber er hatte verstanden.
Er erhob sich schaukelnd mit einem beinahe kindischen Lachen, winkte mit der Hand hoch in die Luft, als gäbe er jemanden den Rat, sich fern zu halten, und stotterte:
»Sie irren sich, mein Herr! Ärzte irren zuweilen ... es ist vorgekommen, daß Ärzte Irrtümer begangen haben. Was Sie sagen, ist ganz unmöglich, merken Sie es sich ...«
Aber er wußte schon selber, daß hier eine Wahrheit ausgesprochen worden war. Er wußte es plötzlich mit dem klaren Instinkt eines Liebenden, der lange in qualvollen Zweifeln gelitten hat, und der nun die furchtbare Wahrheit glauben muß, weil er mit allem Schmerz zugleich auch ihr Erlösendes fühlt, ihre befreiende Kraft von der schweren Finsternis einsamer Zweifel. Aber dann übermannte ihn doch jählings die ganze Bitternis dieser schrecklichen Wirklichkeit; mit trockenem, ruckweisem Schluchzen trat er vor, seine schwachen, zitternden Fäuste geballt, und blieb so vor dem Arzt stehn und mit bebenden Lippen schrie er lallend:
»Warum — haben Sie mir — das gesagt? — Nein, nein, nein, das durften Sie mir nicht sagen, das nicht. O später — wenn wir einmal vor Gott stehn, vor dem Thron Gottes, wir beide, dann sollen Sie mir Rede stehn, warum Sie mir das gesagt haben ...«
Die Ergriffenheit und die Verlegenheit des Arztes schlugen in Zorn um, weil er merkte, daß er nicht mehr gutmachen konnte, was er voreilig angerichtet hatte. Wie kam man ihm hier aber auch entgegen, ihm, dem Sanitätsrat Claußen! Ich bin ein Opfer meines schweren Berufs, dachte er und schritt aufgeregt im Zimmer umher. Hatte er etwa seine Pflicht vernachlässigt?
Erst als er sah, daß Herr Wendel still und gebrochen in seine Hände weinte, ohne den alten, drohenden Zorn und ohne Anklage, gewann er seine gelassene Ruhe wieder, versuchte zu trösten und zu erklären. Es wäre nun einmal so in der argen Welt und die Jungen machten es nicht besser, als früher die Alten es gemacht hätten. Aber alles sei menschlich und sähe sich nur anfangs so schlimm an. Ach, er glaube ja gar nicht, an wie vielerlei die Menschen sich gewöhnen könnten.
Nein, gegen dies ratlose Weinen kam niemand an. So gab denn der Arzt Herrn Friedberg und dem Dienstmädchen die nötigsten Anweisungen, versprach, die barmherzige Schwester selbst sofort zu bestellen und zu unterweisen, und sagte seinen erneuten Besuch für den Abend zu.
Dann kam jener klare kühle Sommermorgen, der strahlend und hell über Hildenrot heraufzog, den Mark Enz wie einen Blitz erkannte, als er jählings erwachte. Farbenreich, grün, rot und hoch und jubelnd vor Frische, eingetaucht in die blausilberne Seide der sinkenden Dämmerung, lag vor seinen weit offenen Fenstern die Welt.
Aber was war es, das ihn so wild emporgerissen hatte? Nun wieder: ein dumpfes Poltern, dann rief eine Stimme rauh, häßlich und heiser seinen Namen. Es wurde roh und stürmisch an seine Tür geschlagen, und als er emporsprang und sie aufriß, schaukelte derb und schwarz der Kandidat Friedberg ins Zimmer, rang mit lautem Keuchen nach Atem, fuchtelte mit den Armen durch die Luft und wies hinter sich:
»Anne-Dore stirbt!« schrie er.
Und nun half er Mark Enz beim Ankleiden, überhastig und völlig verstört, eher hinderlich als fördernd. Er trug ihm die Stiefel herbei und suchte seinen Rock, gab ihm den Hut und zog ihn förmlich mit sich heraus.
»Du mußt kommen, rasch, rasch! Sie will es«, keuchte er, als sie über die Waldwege liefen. »Sie hat mich gebeten, mich hat sie gebeten, dich zu holen. Ich habe es getan, nun .. das siehst du ja —. Aber bitte, versteh mich .... nur rasch, rasch!«
Er war völlig erschöpft und wie von Sinnen.
»Warum bist du nicht eher gekommen?« fragte Enzheim.
Da brach Friedberg mitten auf dem Wege zusammen und stöhnte wild. Er umklammerte die Knie des andern, der ihn aufrichten wollte, und wand sich wie ein Besessener.
»Vergib mir!« schrie er, »vergib! Auch dir wird man vergeben müssen, auch dir. Sei barmherzig, ich habe nicht gekonnt. Ich habe geglaubt, es meinem Gott schuldig zu sein, daß ich dich fernhielt. Ich weiß alles ... man hat mich beschuldigt, daher weiß ich, daß du ..., daß Anne-Dore Mutter wird. Höre mich zu Ende: Ich habe geschwiegen — sie — hat mich — schon vor — drei Tagen gebeten, auch nachts, dich zu holen, aber ich habe — sie belogen.«
Mark Enz wurde totenblaß. Er riß die Hände des Wimmernden von seinem Körper und sprang zurück, als fürchte er, sich an ihm zu vergreifen.
»Dein Gott mag dein Richter sein,« stotterte er in einem Grauen, das ihn schmerzte. Dann wandte er sich ab, kurz, hart, die Schultern flogen, und stürmte den Waldweg hinunter, wie auf der Jagd um sein Leben. —
Der unschuldige Wald ward wieder morgendlich still und voll heimlicher Feier, als habe er alles wohl vergessen, was Menschen in ihn hineingetragen. Helle Vogelstimmen in kurzen jubilierenden Lauten, die kein Lied mehr wurden, tönten aus dem niedrigen Buschwerk und hoch aus den feinbewegten Kronen. Langsam stieg die goldene Sonne höher, ihr Licht wurde weißer und alles verhieß einen langen, heißen Tag. — Quer über den schmalen, grauen Fußweg, das Gesicht und die Hände im Laub, lag dunkel und schwer ein großer junger Mensch, schwarz und still, als sei er tot. Nur die stoßende Brust verriet sein Leben, und ein wenig weiter, auf Missionar Wendels Landhaus zu, lag am Wegrand ein Hut im Gras.
Alle im Hause Wendel schienen vorbereitet, als nun Mark Enz es betrat. Er begegnete niemandem, als dem Dienstmädchen, das ihm weinend und stumm den Weg wies. Im Halbdunkel des Schlafzimmers sah er, wie schwarz, mit einer schimmernden weißen Haube, eine Krankenschwester sich wortlos erhob, dann Anne-Dore vorsichtig und schonend etwas zuflüsterte, die Tür hinter ihm zuzog und ihn mit dem Mädchen allein ließ. Auch die Schwester schien eingeweiht und mit den andern dem Schicksal ergeben, das dieser Mann über dies Haus heraufbeschworen hatte. Ja, sie war es gewesen, die Missionar Wendel überredet hatte, seinem sterbenskranken Kinde den Willen zu tun. Sie, die an manchem Bett gesessen, dessen Leidende sich ihr vertraut, sagte schluchzend zu dem alten Mann: »Sie versündigen sich, wenn Sie Ihrem Kinde nicht diesen Wunsch erfüllen, den letzten vielleicht. Sie bittet nicht mehr, das ist das Schreckliche. Aber ihre Augen, ihr Herz, ihre Hände — — Gott, es ist wahrhaftig so, als bluteten sie vor Verlangen.«
Da hatte Herr Wendel genickt, mit einem Gesicht, als sei ihm für immer seine Welt in einer neuen fremden versunken, in der sich sein Kopf nicht mehr zurechtfinden konnte, und noch weniger sein verarmtes Herz. —
Mark Enz hörte seinen Namen, ein Stöhnen, das ihn bedeuten sollte. Schmal und weiß tauchten zwei fiebernde Arme aus dem Dämmern empor und suchten ihn. Er beugte sich unter ihrem matten Liebesgruß und kniete an ihrem Bett.
»Mark, Mark, muß ich sterben?« stöhnte sie in sein Haar.
Durch ihr loses Hemd, über Schultern und Brust hin, hatte er flüchtig ihren Körper gesehn, schnell und mit jähem, furchtbarem Erschrecken. War es möglich, daß in so kurzer Zeit ein Mensch so völlig verändert werden konnte?
In einem Taumel von namenloser Wut und kaltem Entsetzen fühlte er: so kommt der Tod. Nicht wie die jugendlichen Träume unserer Kraft ihn sehn, sondern so, schleichend, allgewaltig, gemein, lieblos. Er konnte seine Opfer klein und erbärmlich machen, bevor er sie in seine ewige Nacht dahinraffte. Er entkleidete sie ihrer Schönheit und Wärme, erbarmungslos zerstörte sein Odem den jugendtrunkenen Glauben an Hoheit und fromme Hingabe an sein Friedensreich.
Mark Enz kämpfte einen harten Kampf gegen sein Mitleid, das stärker zu werden drohte, als jedes andere Gefühl. Es war ein Mitleid, in dem er seine ganze Ohnmacht erkannte, seine Todesangst vor der Macht, die hier wirkte und seinen Haß gegen sie. Erst als sie sprach, war er befreit, denn ihre Stimme war ganz die gleiche geblieben wie früher, nur erreichte sie ihn langsamer und trauriger, aber sie gehörte doch noch dem Leben an, auch seinem Leben, ihr Klang war Hoffnung, und wenn auch nur ein matter Abglanz.
Er hatte ihr nicht geantwortet. Da sagte sie deutlich und leise mit schwerfälligen Lippen:
»Wer bist du, ich kenn dich nicht, Mark. Was hast du von mir gewollt und was hast du aus mir gemacht? Ich habe geglaubt, ich sollte alles finden. Was nur? Mark, sag es. — Willst du es mir nicht sagen? Warst du auch betört wie ich, und hast mich in deine Torheit gezogen? — Sieh, es ist alles halb geblieben und ich bin verloren. Weil du bist, weil du lebst und führst, einhergehst, darum kann ich nicht mehr umkehren. Oft möchte ich, aber ich muß immer auf dich schauen. Warum bist du nicht gekommen? Es ist schon so spät ...«
Er besann sich und faßte sich:
»Hat es dir Friedberg nicht gesagt, mein Liebling?«
»Ja, er hat gesagt, du seist fortgereist.«
»So war es«, antwortete er bebend. »Ich mußte reisen.«
Sie lächelte flüchtig, ein wenig in Gedanken an Friedberg und auch, weil sie von ihrer Furcht befreit war, Mark hätte nicht kommen wollen.
Aber dann sagte sie ernst, ganz versunken in ihre schwermütige Traurigkeit:
»O, du bist nicht groß und stark, wie ich geglaubt habe, du bist haltlos und schwach. An dir ist alles halb, alles wankelmütig, und dein Herz ist ohne Hingabe. Warum hast du mich auf deinen bösen Weg gelockt, der kein Ziel hat? Wohin gehst du? Mein Weg war vielleicht leer und arm — du weißt es nicht, nur ich weiß, wie er war, er war einfach und führte zu meiner Ruhe, er ließ mir mein Wesen und ich wäre vielleicht glücklich erwacht. Du bist fremd ...«
Er richtete sich auf, hielt sie mühsam und sah sie an. Sie beugte sich immer noch gegen ihn, stützte sich schwach und hinfällig an seiner gebeugten Schulter, kniend in ihrem Bett. Es sah aus, als versänke sie weiß und erstorben, wenn nicht ihre beiden kraftlosen Arme, deren Hände sich in seinem Nacken falteten, an seinem Hals Halt gefunden hätten.
Ganz nah vor seinem Gesicht flüsterte sie fort:
»Wenn du mein eigen geworden wärst ... aber du hast mir niemals gehört.«
Sie sah sein Gesicht und in gequälter Hast fuhr sie fort:
»Glaube nicht, ich hätte dich nicht lieb gehabt, Mark. O, ich will dir ja nichts nehmen, du sollst alles behalten. Aber bitte, sag es mir doch heute, nun wird es dir ja nicht mehr Schaden tun: du hast mich nicht sehr lieb gehabt, nicht wahr? Nur ein wenig ...«
Er sah sie an, ohne zu antworten. Die tiefe Trauer in seinem Gesicht schien befleckt wie durch Gedanken. Es war, als könnte er sich auch seinem Schmerz nicht hingeben.
»Muß es denn so unter den Menschen sein, so, und nicht anders?« fragte sie wieder sehr leise. »Ist es nicht möglich auf der Erde, daß durch Liebe Kräfte erstehn, die unsere Armut zu Vollkommenem ergänzen? Daß alles gut ist und die Sehnsucht still wird, daß sie Flügel hat und ihren Weg weiß ...«
Da hörte sie ihn qualvoll aufschluchzen, als würde seine Brust in einer Demut gebeugt, der sie trotzte. Er schlug seine Hände vor das blasse Gesicht und weinte, weinte laut und haltlos und ungestüm, wie ein verstörtes Kind.
»O, o,« rief sie zitternd, »doch, doch?« Sie richtete sich mühevoll auf, aber ganz hell im Gesicht vor Seligkeit und wie von geheiltem Gram. Sie nahm seine Hände von den Augen, zog sie nieder, und küßte die ersten Tränen, die sie je bei ihm gesehn, von seinem Gesicht, mit den letzten Küssen, die sie geben sollte.
Da hob er sie auf und bettete sie stark und gefaßt in ihre Decken, ruhig und so liebevoll, wie nur einer sein kann, dessen ganzer Stolz seine Einsamkeit ist. Es war, als schmiegte sie sich noch einmal in seine Hände. Ein Glanz reicher und ruhiger Freude lag in ihrem Gesicht, als habe aller Widerstreit ihrer Seele Erlösung gefunden, als hätten ihre Augen eine Zukunft geschaut, der auch sie gedient, als wüßte sie nun wohl, warum alles so und nicht anders hatte sein müssen: nun gehe ich gern zu meiner Ruhe, da ich es kann im Glauben an das, was ich geliebt habe.
Ob es eine letzte irdische Gewißheit war, die sie beglückte, oder ein erster Traum aus einem Land, in dessen Frieden alle Sehnsucht heilt; niemand hat auf der Erde ihren Kindersinn darum befragt, auch er nicht, der ihre Hände hielt, bis sie bleich in seinen schliefen, und ihren bebenden Druck nicht mehr erwidern konnten, wie einst den ersten.
Immer standen im Hause die Türen auf, es zog durch die offenen Fenster, eine blasse Ratlosigkeit herrschte überall. Die alltäglichsten Dinge nahmen eine seltsame Würde an und behaupteten sich gewichtig und in einem neuen Licht. Vielleicht lag es daran, daß seit Tagen alle Ordnung und die gewohnte sichere Lebensführung zerstört waren. Lotte fühlte sich tief bedrückt dadurch, daß niemand mehr ihre alten Pflichten von ihr verlangte, nur rasche, unerwartete, aufregende Handlungen forderte man, Dienste, die nicht beachtet wurden. Sie hatte das Bedürfnis, diese offene Tür zu benutzen, um zu flüchten, fort aus diesen Räumen, deren Öde von Verfall sprach. Wäre nur alles erst vorüber, dachte sie, alles.
Denn daß es sich zum besten wenden möchte, daran glaubte niemand mehr, nur der Sanitätsrat sagte es, und die andern wiederholten es. Gott, was ließ sich nicht alles mit Worten wiederholen. — Die Herzen schwiegen und warteten. Irgendwo schlich eine Freude in den Winkeln umher, eine widerwärtige Freude, etwas wie ein hämischer Triumph. Er war hinter einem, gebar lüsterne Gedanken und schuf ein Lebensbewußtsein, das man verachten mußte. Das drohende Etwas im Hause galt Anne-Dore, die andern blieben verschont, konnten in den sonnigen Garten gehn, wenn sie wollten, über die Straße, in die laute Stadt, wohin sie mochten. Und morgen auch noch, o, noch lange. Es kicherte in der Luft, machte das warme Blut des Körpers auf ganz neue Art fühlbar, rückte den großen Schmerz beiseit, wie eine schwere, niederströmende Wolke wurde er, die man in sicherer Behausung vorüberziehen sah. Erst der Gedanke an die Erinnerung, die man an ihm haben mochte, lockte die Tränen.
Frau Wendel kam nicht. Lotte mußte an jeden Zug, der sie irgend bringen konnte. Es war noch nicht einmal Nachricht von ihr angekommen, und man fürchtete ernstlich, daß die Botschaft Unheil angerichtet hätte. Aber sie hatte dringend sein müssen, weil sie erst im letzten Augenblick abgegangen war, immer noch war Hoffnung geblieben, die Mutter ganz verschonen zu können. —
Missionar Wendel rang einsam in seinem Zimmer auf den Knien mit seinem Gott. »Erhalte mein Kind,« betete er, »du bist getreu, der uns nicht läßt versuchen über unser Vermögen, sondern macht, daß die Versuchung so ein Ende gewinne, daß wir's können ertragen.« Und er fügte stotternd und im Fieber seiner furchtbaren Angst ein trostreiches Bibelwort an das andere. Aber das in mühseliger Ergebung in so vielen Jahren errichtete Gebäude seiner Glaubenszuversicht stürzte unter dem kalten Angesicht der Todesfurcht zusammen, die ihn schüttelte. Sein gemartertes Herz verwirrte ihm jeden Gedanken und mitten in die zerfahrene Inbrunst eines gestammelten Gebetes hinein schrie der alte Mann laut:
»Anne-Dore, mein Kind, mein einziges Kind, das ich hab. Ich hab sonst nichts.«
Und dann kam ihm plötzlich in den Sinn, daß er ihr einst verboten hatte, ihre Zöpfe noch zu tragen, damals, als Friedberg ins Haus genommen wurde. Das war ihr sicher ein Kummer gewesen, sie hatte gewißlich heimlich Freude daran gehabt und er hatte sie ihr verdorben. Auch hatte sie nie so schöne Kleider besessen wie die vornehmen Damen beim Tennisspiel, und konnte deren Freude niemals teilen. Aber wieviel gab es nicht, das er ihr hätte als Ersatz bieten können, und es war unterblieben; wie unachtsam war seine Liebe gewesen. Diese kleinen Dinge ihres alltäglichen Zusammenlebens! Sie drängten sich vor und marterten ihn; die schweren bösen Ereignisse, seine letzte bittere Erfahrung schienen ihm gering dagegen, nichts als eine Gelegenheit, vergeben zu können. Heimlich dankte er ihr fast für jede Schuld, die sie begangen hatte, als ruhte darin ein Schein von Trost für ihn und seine geringe Liebe. Wenn nur das Schreckliche vorüberzog, das sein Haus bedrohte.
Grausam zertrümmerte ihm das Gespenst des nahenden Todes alle stillen Altäre seines Glaubens, die ihn in gelassener Zeit so oft mit Trost und Segen bedacht hatten. Lautlos zerbarsten sie im Odem der Nacht, die heraufzog, deren Gewalt sein Leben noch nicht in der eigenen Seele erfahren hatte.
Nun wünschte er sich, seine Gattin wäre da. Ihr ruhiges Gottvertrauen, ihre unerschütterliche Kraft, sich dem Willen des Allmächtigen zu fügen, würde auch ihm Halt gegeben haben. Aber dann war ihm plötzlich, als habe er im Grunde nie mit ihr geteilt, auch seine Liebe zu Anne-Dore nicht, als sei sie ganz anders wie er, nicht gläubiger und nicht stärker, sondern armseliger. Es stieg etwas wie eine Verachtung gegen sie in seinem Herzen auf und der Wunsch, seine Schmerzen mit ihr zu teilen, war nicht mehr da. Zerfiel denn alles? Welch eine Kraft war in seinen Wandel eingebrochen? Ihm war, als schaute er auf eine endlose Kette von Täuschungen zurück und er fühlte sich grenzenlos verlassen, bis aus diesem Gram, im kurzen Sonnenschein seiner verlorenen Jugend, das Bild seiner toten Mutter stieg. Er hatte sie längst vergessen, als wäre ihre Treue nie sein Eigentum gewesen, und ganz plötzlich, als ein grimmiger und süßer Kummer, wurde ihm klar: auch du hast keine Mutter gehabt, meine Anne-Dore. Nur mich hast du gehabt, aber was bin ich dir gewesen?
Und ihn, den Fremden, hatte sie gehabt, der sie betrogen und gar verlassen hatte, den mußte sie sehr, o, von Herzen geliebt haben. Er hatte ihren Tod verschuldet und doch rief sie ihn an ihr Leidensbett. Haßte er denn diesen Fremden? Nein, es war kein Haß, es war eine Scheu, ein Graun. Wie konnte ein Mensch den Reichtum solcher Liebe, wie sein Kind sie gab, ertragen, wie konnte er verantworten, ihn zu verachten, wie konnte er ihn missen, diesen Reichtum? War jener stark und reich, segnete ihn dies wunderbare und unverständliche Leben? — Er wußte es nicht. Er empfand nur, daß er selber bitterlich arm war, weil er nie das Vertrauen seines Kindes besessen hatte, nie in ihre Seele geschaut, nie ihr Weh und ihre Lust geteilt hatte. War er denn am Leben vorübergegangen in all seinen langen Jahren? Unter seinen Tränen erstarrten ihm die müden Augen und er sah, wie eine Vision ferner Regionen des Seins, die Gestalt des jungen Fremden sein Haus betreten, bleich und hastig, eine böse Gelassenheit im Gesicht, sicher, als gäbe es kein Recht für ihn, dessen Pflichten er nicht erfüllt hätte. Und dann war er kurz darauf fortgegangen, ohne ein Wort für ihn oder die anderen, ungebeugt, und doch ging eine Traurigkeit von ihm aus, die keine Vernunft fassen konnte. Und er ließ sein Kind liegen und sterben und ging, um sein Leben zu leben....
»Gott, Gott, sei du sein barmherziger Richter«, stöhnte der alte Mann.
Stürme von Hoffnungslosigkeit wechselten mit einer leeren Ruhe, in der kleine, törichte Gedanken kamen und ihn zu verspotten schienen. Da hob der gequälte Mann den segnenden Christus von seinem Wandbrett, umklammerte die tönerne Figur mit seinen großen, zitternden Händen und ließ in verwirrten Gebeten seine Tränen auf diesen unberührbaren Scheitel tropfen. Aber die Hoheit der machtvollen Liebesworte, die dieser Mann der Menschheit gesagt hatte, wurden ihm von Schmerz und Not in dieser Stunde in hohle Phrasen verwandelt. Eine endlose Öde der Bekümmernis gähnte den Betenden aus der Zukunft her an, ein Weg, leer an Liebe und Glück, bis zum Abschluß seines armen Lebens. Da preßte sich aus seinem ringenden Leib, von der schwer atmenden Brust gestoßen, der erste Fluch über seine Lippen, den er im Leben ausgestoßen hatte. Er hob die Faust gegen das Heilandsbild und sank gebrochen und von kaltem Fieber geschüttelt auf den bunten Strohteppich seines Zimmers. Aber keins seiner Gebete und kein Fluch, der seinem Munde entfahren war, bewirkten, daß auch nur ein Schein von Linderung die Züge seines sterbenden Kindes glättete. —
Es war am Mittag desselben Tages, da erlitt Anne-Dore ihren schweren Tod. Niemand war bei ihr, als ihre Nacht heraufzog. Die Stimmen der Ihren an ihrem Bett reichten nicht mehr zu ihr, an die Ufer des finsteren Reichs hinüber, das schweigend seine Schatten um ihr beschlossenes Dasein legte.
Sie starb ohne Bewußtsein, in furchtbarem Ringen um ihre letzten Atemzüge, man mußte sie im Bett halten, und ihre Brust keuchte noch, nachdem schon lange ihre Augen erloschen schienen. Zuletzt wollte sie sich noch einmal aufrichten, es war, als ließe das schwere Haar es nicht zu, so hoben sich nur ihre Arme, und vor ihnen und höher als sie, die schmalen Hände, deren Tasten schwach und schaurig war. Ihre großen leeren Augen suchten über ihr. Man öffnete die Fenster und ließ das volle Tageslicht in den Raum, den Glanz des strahlenden Mittags, der die erfüllte Erde sommerlich beglückte.
Da kam ein schmerzvolles Lächeln in das verlöschende Licht ihrer Züge. Sie schloß die Augen. Es sank rot und schimmernd auf ihren letzten irdischen Traum. Ein gewaltiges Meer von Rosen brauste leuchtend heran, im Klingen eines Lichts, das über die Erde zog. Es überwältigte in betäubend bitterer Allmacht und begrub ihre kurze Jugend und brauste fort.
An ihrem Sterbelager betete ihr Vater, lallend, und von Schluchzen überwunden:
».... denn unsere Trübsal, die zeitlich und leicht ist, schafft eine ewige und über alle Maßen wichtige Herrlichkeit. Schaff sie meinem Kind, du Heiland der Welt, Herr Jesus Christus.« —
Mark Enz schritt durch den Wald; die Felder nahmen ihn in ihrer reifenden Fülle auf, wieder der Wald und endlich die breite, rote Heide, ein blühendes Meer. Es zog eine Schar Kinder singend mit ihrer Lehrerin dahin, immer zwei und zwei schritten sie und hatten sich bei den Händen gefaßt. Die weißen Kleidchen und die Blondköpfe leuchteten über dem Korn und am grünen Hintergrund der Buchen. Er hörte die hellen Stimmen, die fein und inbrünstig erklangen, der Sonne und dem schönen Tag dankbar, da blieb er stehn und lauschte:
»Des Sommers goldner Segen
liegt auf den Feldern still und heiß.
Wir finden Mohn und Ehrenpreis
auf unsern lieben Wegen.«
Das Lied verklang im Heidegrund, und der Wald nahm die kindlichen Sängerinnen in seinem Schatten auf. Die Welt ward still.
Ende.
Liste korrigierter Druckfehler:
Seite 27, Komma eingefügt (In der Abendsonne sangen Rotkehlchen und Finken, es glühte von rotem Gold)
Seite 99, "Erlösunswerk" geändert in "Erlösungswerk" (Und es galt das Erlösungswerk vollkommen zu machen,)
Ab Seite 118 änderte sich im Original die Schreibweise des Namens "Jacoby" in "Jakoby". Die Schreibweise wurde durchgehend angeglichen.
Seite 134, Punkt am Satzende hinzugefügt (daß unser Herz im Grunde allen Prunk verachtet und den tönenden Rausch.)
Seite 145, "wäer" geändert in "wäre" (obgleich es ihm vielleicht gelungen wäre)
Seite 177, "klare" geändert in "klaren" (Sie gab mir keine klaren Antworten)
Seite 199, Komma ergänzt (Grausam zertrümmerte ihm das Gespenst des nahenden Todes alle stillen Altäre seines Glaubens, die ihn in gelassener Zeit so oft mit Trost und Segen bedacht hatten)