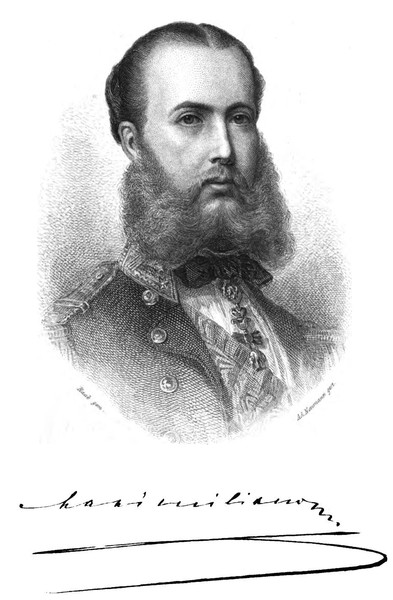
Verlag von Duncker & Humblot in Leipzig.
The Project Gutenberg EBook of Mein erster Ausflug, by
Ferdinand Maximilian von Österreich
This eBook is for the use of anyone anywhere in the United States and most
other parts of the world at no cost and with almost no restrictions
whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of
the Project Gutenberg License included with this eBook or online at
www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you'll have
to check the laws of the country where you are located before using this ebook.
Title: Mein erster Ausflug
Wanderungen in Griechenland
Author: Ferdinand Maximilian von Österreich
Release Date: November 21, 2014 [EBook #47412]
Language: German
Character set encoding: ISO-8859-1
*** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK MEIN ERSTER AUSFLUG ***
Produced by The Online Distributed Proofreading Team at
http://www.pgdp.net (This book was produced from scanned
images of public domain material from the Google Print
project.)
Mein erster Ausflug.
Alle Rechte vorbehalten.
Die Verlagshandlung.
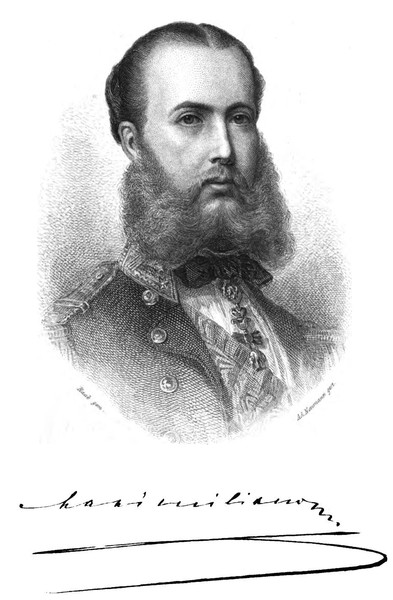
Verlag von Duncker & Humblot in Leipzig.
Wanderungen in Griechenland
von
Maximilian I.
Ferdinand Maximilian
Erzherzog von Oesterreich.
Mit einem Portrait des Verfassers in Stahlstich,
nach einem Miniatur-Gemälde von Raab.
Leipzig,
Duncker & Humblot.
1868.
| Seite | |
| Vorwort | VII |
| Triest | 1 |
| Der erste Tag auf griechischer Erde | 10 |
| Eine Landreise durch Griechenland | 23 |
| Athen | 77 |
| Ein Besuch in der Moschee von Smyrna | 147 |
| Ein Besuch auf dem Sklavenmarkte von Smyrna | 159 |
| Der Bazar von Smyrna | 164 |
| Ein türkisches Bad | 173 |
| Ein Morgen beim Pascha von Smyrna | 181 |
| Ein Ausflug nach Burnabà | 205 |
| Beim Anblick von Corfu | 216 |
| Zwei Tage in den Bocche di Cattaro | 221 |
| Ragusa | 234 |
| Der vierte October auf offener See | 251 |
Die gegenwärtigen Blätter, welche eigentlich den Reigen der unter dem Titel »Aus meinem Leben« veröffentlichten Reisetagebücher des verewigten Kaisers Maximilian hätten eröffnen sollen, erscheinen durch eine eigene Verkettung der Umstände an deren Schluß und unter einem selbstständigen Titel. Jene jüngst publicirten Bände nehmlich waren bereits früher als Manuscript gedruckt und nur dem kaiserlich österreichischen Hofe, speciell den dem Erzherzog Ferdinand Maximilian Nahestehenden zum Geschenk gemacht worden. Das vorliegende Tagebuch über des Erzherzog-Kaisers erste Reise nach Griechenland (der Prinz zählte damals 18 Jahre) war ursprünglich von dem hohen Autor in seiner Bescheidenheit selbst nicht für bedeutend genug erachtet worden, um dessen Veröffentlichung wünschenswerth erscheinen zu lassen. Jetzt indessen, nach dem Scheiden des Kaisers Maximilian, glaubten wir den zahlreichen Verehrern seines Charakters, wie seiner Muse, keine freundlichere Gabe bieten zu können, als die Blätter seines Erstlingswerkes, die den für alles Gute und Schöne warm erglühenden kaiserlichen Jüngling trefflich kennzeichnen.
Die Reise nach Griechenland fällt noch in die Studienzeit des jungen Prinzen; es war ein Ferien-Ausflug, der ihm, wie seinem jüngern Bruder, dem Erzherzog Carl Ludwig, vom Kaiser wie den kaiserlichen Eltern gestattet worden war. Die Reisegesellschaft bestand aus dem Erzherzog Max, dem Erzherzog Carl, dem Fürsten Jablonowsky (seitdem in der Blüthe seiner Jahre gestorben), dem Grafen Coudenhove (jetzigem Obersten in der Armee), dem Baron Koller, dem Archivarius Kaltenbeck (als Herausgeber gelehrter Schriften bekannt – seitdem gleichfalls verstorben), dem Professor Geiger (einem talentvollen und hochgeachteten Maler) und dem Doctor Fritsch (kaiserlichem Leibarzte, und von Seiner Majestät dem Kaiser Franz Joseph, seinen Brüdern beigegeben). Den Dampfer Vulcan, der die Prinzen beförderte, befehligte der jetzige Vice-Admiral und Commandant der Marine, damaliger Capitain Julius Vissiak, während sich Dr. Ilek, jetzt Marine-Stabsarzt und der unglücklichen Kaiserin Charlotte bis zu Ihrem Abschiede von Miramar ärztlicher Rathgeber, als Schiffsmedicus auf der Corvette befand. Die Reise sollte keinem wissenschaftlichen Zwecke dienen; sie war im eigentlichen Sinne eine Lustreise. Erzherzog Max sowohl wie sein eben erst in das Jünglingsalter eintretender Bruder gehörten damals noch nicht dem »Dienste« an. Der Erstere trat bald darauf in die Marine ein, und mußte während der italienischen Reise (im Jahr 1851) schon seine Schiffswacht halten. – Es existirt in Miramar ein hübsches Bild von Professor Geiger, welches die Vorstellung beim Pascha von Smyrna*) darstellt, und auf dem die beiden Erzherzoge in weißer Uniform erscheinen.
*) S. 181.
Die Leidenschaft des Prinzen Max für die See und die Tropen tritt in den nachfolgenden Blättern schon bedeutend in den Vordergrund – sie hat ihn nie verlassen. Die Cajüte war sein liebster Aufenthaltsort; er hat sich in Miramar aus seinem eigensten Gemach fast eine Cajüte geschaffen; die Wogen des Meeres, die an das Schloß anschlagen, vervollständigten die Täuschung. Es ist ein großes viereckiges Zimmer, wohl kaum mehr als 9 Fuß hoch, und eines der anmuthigsten und interessantesten Gemächer im Schlosse. Außer dem leeren Fleckchen auf dem Schreibtische, dessen der Erzherzog-Kaiser nicht entbehren konnte, war kaum ein freies Plätzchen zu finden. Er war, wie dies schon aus dem nachfolgenden Tagebuche hervorgeht, ein leidenschaftlicher Sammler: die Symbole und Producte aller Länder und Meere füllten Tische, Schränke und Gestelle in diesem Gemache. Indessen fehlten demselben auch die behaglichsten Möbel nicht. Nach Tische pflegte der Erzherzog hier mit den Herren seiner Umgebung eine Cigarre zu rauchen, während seine hohe Gemahlin, nur durch wenige Zimmer getrennt, in dem Kreise Ihrer Damen weilte; oft ging er ab und zu, um die hohe Frau durch heiteres und kurzweiliges Gespräch zu erfreuen.
Es möge uns gestattet sein, hier einige wenige biographische Skizzen über den verewigten hohen Verfasser zu geben: Ferdinand Maximilian wurde am 6. Juli 1832 geboren; er hat somit, da er am 19. Juni 1867 schied, sein 35stes Lebensjahr nicht vollendet. Er ward von seiner Familie mit dem zweiten Namen genannt, den er auch als Kaiser von Mexico ausschließlich führte. Er war ein so schwaches und wenig hübsches Kind, so unbeweglich und theilnahmlos, daß nur das Auge der Mutter in seinem lebhaften Blicke das Erwachen des Geistes wahrnahm. Zwei Züge aus seiner frühesten Kindheit seien hier mitgetheilt, obgleich diese Zeilen nur die äußersten Umrisse seines Erdenlebens geben sollen: Als Max eben sprechen gelernt hatte, zeigte man den erzherzoglichen Kindern einen der Zwerge, die ihre Kindergestalt beibehalten haben, in deren Gesicht sich aber das vorgerückte Alter ausspricht. Der kleine, etwa zweijährige Knabe lief zu seiner Aja in das andere Zimmer und sagte: »Draußen ist ein altes Kind!« Das war der erste Geistesblitz. Sein Herz sprach auf eine noch schönere Weise. Zu der Zeit, als die jungen Erzherzoge unter männliche Aufsicht gestellt werden sollten, war das Herz des kleinen Max von Schmerz erfüllt, sich von Fräulein v. Sturmfeder, der erzherzoglichen Kinder Aja, trennen zu sollen. Fräulein v. Sturmfeder liebte den zwei Jahre älteren, viel hübscheren und aufgeweckteren Bruder Franz viel mehr, als den mageren, blassen, stillen Knaben. Als sie nun gehen wollte, stürzte sich Max ihr um den Hals, und weinend rief er aus: »Ich liebe Dich so – so sehr – wie Du den Franzi liebst.«
Der Erzherzog wuchs heran; er gewann sich durch sein frisches, warmes Wesen, durch seinen lebendigen, empfänglichen Geist die Liebe und Achtung aller Derer, die mit ihm und neben ihm lebten. Es war eine durchaus gerade, wahre Natur. Er wollte nie mehr sein, als er war; weniger Fürst als Mensch, hielt er doch sehr viel von seiner hohen Stellung, erkannte aber die Pflichten an, die sie ihm brachte. Zahlreiche Stellen aus seinen Schriften beweisen dies. Männer, die ihm nahegestanden, wissen nicht genug seine Leutseligkeit, seinen hohen Sinn zu rühmen. Aber auch über seine Festigkeit, seine Kenntnisse und die Umsicht, mit der er sich den ihm zugetheilten Aufgaben unterzog, herrscht nur eine Stimme.
Bald nach der Rückkehr aus Griechenland trat Ferdinand Maximilian in die Marine ein. Er gehörte ihr an, bis er sein Schloß Miramar auf immer verlassen sollte und seine Wirksamkeit als Obercommandant derselben hat den Grund zu dem ruhmreichen Siege von Lissa gelegt. – Zu Ende eines Manövers, welches die Flotte vor Seiner Majestät dem Kaiser Franz Joseph ausführte, ernannte ihn sein erhabener Bruder zum General-Gouverneur der Lombardei und Venetien. – In diese Zeit (1856) fällt seine Verlobung mit der von ihm innig verehrten Prinzessin Charlotte von Belgien. Im Jahre 1857 siedelte er mit seiner jungen Frau nach Mailand über, wo sie im rosengeschmückten Garten von Monza ein glückseliges Leben führten. Welterschütternde Ereignisse riefen ihn nach zwei Jahren von diesem Posten ab. Was er gelitten in dieser Zeit, geht aus einem Ausspruch hervor, den er gethan. Er hatte in seiner Bibliothek eine Tafel aufgestellt mit der Inschrift: »Memento Verona!« Er sagte: »Dieses Memento lese ich, wenn ich mich trübe gestimmt fühle; denn unglücklicher, als ich damals war, kann ich nicht werden!«
Was später geschehen ist, gehört der Geschichte an. Unsäglich mag er, ferne von Allen, die ihm theuer waren, gelitten haben. Seine Gemahlin, die heldenmüthige Gefährtin seiner erschütternden Leiden während der Zeit seiner Regierung, wähnte er gestorben. Man darf hoffen, daß sein Geist in der Todesstunde von einer Art Verzückung gehoben war; denn als man ihm die Augen verbinden wollte, sagte er: »Nein, nein, dann könnte ich meine Mutter nicht mehr sehen.« – Die Augen gen Himmel gerichtet, erwartete er den tödtlichen Schuß.
Auf ihn lassen sich treffend seine eigenen Worte anwenden:
Triest den 2. September 1850.
Den schönsten Anblick von Triest genießt man unstreitig am Fuße des Obelisken von Optschina; man fährt stundenweit durch die steinigen Wüsten des Karstes, auf dem ein schwerer Fluch zu lasten scheint; die Felsenstücke bilden graue Gestalten und man wähnt Ruinen von Häusern und ganzen Dörfern zu sehen; dürres Gesträuch streckt die Arme aus und nirgends erfreut Leben das menschliche Auge; das Grau des Unentschiedenen und Geheimnißvollen ist über den Karst gebreitet, bis sich endlich nach langer Fahrt das ermüdete Auge beim Anblick des Obelisken neu belebt, der wie ein Zeichen der Hoffnung dasteht. Man ist noch im Jammerthale, aber drüben ist's herrlich, südlich und lebendig; man treibt mit Ungeduld den Postillon, und rasch fliegt man die letzte kleine Anhöhe bis zum Obelisk heran, und nun liegt das Bild der Unendlichkeit zu den Füßen des entzückten Reisenden, das der Contrast mit dem todten Steinmeere zum Naturleben noch entzückender macht. Zu den Füßen des Wanderers liegt dort das Meer und wie Schwäne ziehen die schimmernden Segel durch die Fluthen, die im Halbkreise von fruchtbaren terrassenförmigen Ufern, mit schönen Villen besät, umfaßt werden, und endlich die Handelsstadt mit der Rhede wie eine Karte ausgebreitet; eine zweite schwimmende Stadt bilden die Schiffe mit ihrem regen Leben und Treiben. Die Aussicht von Optschina ist wohl eine der schönsten der Welt. Eine vortreffliche Straße mit sehr geringem Fall führt im Zickzack den Berg hinab. Zwischen Weingärten und Landhäusern sieht man immer mit neuer Begeisterung das schöne Meer vor sich und genießt den ersten Vorgeschmack des Südens; man ahnt Italien. Die Stadt selbst ist neu und trägt den Stempel einer Handelsstadt; die Gebäude sind groß, massiv und reinlich, aber ohne schöne Architektur, die Straßen von langweiliger Regelmäßigkeit, und einander zu ähnlich um interessant zu sein. Auch in geschichtlicher Hinsicht bieten sie wenig Bemerkenswerthes. Nur in der Nähe der hochgelegenen Domkirche findet man einige römische und altchristliche Alterthümer; doch sind sie ohne große Bedeutung. Natürlich sucht jeder Ankömmling in Triest an den Quais zu wohnen, daher auch wir das Hôtel National, mit der Aussicht auf das Meer bezogen, das eins der besten Gasthäuser ist, die ich kenne. Da wir Triest schon früher besucht hatten, brauchten wir uns mit den sogenannten kalten Merkwürdigkeiten nicht zu plagen, und konnten das Leben der Stadt vorzugsweise ins Auge fassen, das uns während eines kurzen Aufenthaltes manches Interessante bot. Nach einem vortrefflichen Mittagsessen mit frischen Seefischen, erfuhren wir in dem reichhaltigen chinesischen Gewölbe, daß das Schiff »Wellington«, welches chinesische und indianische Matrosen an Bord hat, den Hafen erst morgen verlassen würde, um nach London zurückzukehren; wir ließen uns daher durch ein Boot an Bord des Wellington bringen und stiegen, nachdem wir uns so gut als möglich mit den Matrosen in englischer Sprache verständigt hatten, über eine schmale kleine Strickleiter auf das Verdeck; hier glaubten wir einen Bestandtheil der »Vieuxlac«-Bilder auszumachen, so ganz sahen wir uns in die chinesische Welt versetzt. Ungestalte Männer von mittlerer Größe mit fahler gelber Haut, starken Backenknochen, runder Nase, schiefen Augen und einem mehrere Fuß langen schwarzen Zopf, der von der Mitte des sonst kahl geschorenen Kopfes herab hing, umgaben uns. Ihre Kleidung bestand aus einem sackähnlichen Spencer und weiten Hosen von demselben farblosen Stoffe; einige trugen parasolartige Hütchen aus Rohr; Nacken und Füße waren unbedeckt; dies die Matrosen des Schiffes. Sie sahen plump aber gutmüthig aus; das Gesicht wäre schlaff und dumm gewesen, wenn nicht kluge, dunkle Augen daraus hervorgeblitzt hätten. Die Leute waren freundlich, fast schelmisch und nicht im mindesten verlegen. In einiger Entfernung, abgesondert und scheuer standen magere schmächtige Männchen mit dunkler, öhlig glänzender Gesichtsfarbe und edleren Zügen, aus denen aber Mißtrauen sprach, schwarzem Haar und funkelnden Augen; bis auf die turbanartige Kopfbedeckung waren sie wie die Chinesen gekleidet. Ihr Ausdruck war schwärmerisch düster, ihre Art zurückhaltend und ernst; es war die indianische Bemannung, die durch drei bis vier Europäer vervollständigt wurde, unter denen sich der englische Kapitän befand, dessen Grobheit und Unverbindlichkeit einen eigenen Gegensatz zu der freundlichen Aufnahme der Chinesen bildete. Anfangs schien er uns gar nicht bemerken zu wollen; erst später brummte er auf unsere Anrede eine Erwiederung. Wir bestiegen die interessantesten Theile des Schiffes und konnten die Chinesen und Indianer in den verschiedensten Lagen sehen. Einige saßen mit untergeschlagenen Beinen, Andere lagen der Länge nach ausgestreckt, noch Andere waren wie ein unförmlicher Knäuel um das Küchenfeuer zusammengekauert und entzündeten ihre kurzen Pfeifen an der Gluth. Man muß anerkennen, wie naturgetreu die Chinesen zeichnen, denn jede Stellung, jeder Zug war uns schon von den Tapeten her bekannt, die europäische Boudoirs zieren; manchmal glaubten wir die trägen Pagoden mit ihrem taktmäßig wackelnden Kopfe, oder die fahlen Speckmännchen mit verrenkten Gliedern und langem, majestätischen Zopfe zu sehen; auf diesen, in Europa verpönten Appendix halten die Verehrer des Confuzius besonders viel; er ist so lang, daß sie ihn während der Arbeit um Hals und Körper schlingen. Das Alter dieser Leute scheint zwischen Dreißig und Vierzig gewesen zu sein, die Muskulatur war bei allen gleich stark plump und zum Rundlichen neigend. Einer unter ihnen, der sich besonders liebenswürdig zeigte, und uns immerwährend gutmüthig und verschmitzt anlächelte, sprach gebrochen englisch. Wir fragten ihn, ob er nichts von seinen Landesprodukten zu verkaufen habe, worauf er einen Pack kleiner Stäbchen brachte, die, wie er mit Geberden zu verstehen gab, beim Gebete angezündet werden. Als wir es zu Hause versuchten, brannten die schmalen Stäbchen wirklich eine geraume Zeit und dufteten sehr angenehm. Von den Indianern interessirten uns hauptsächlich zwei Gestalten: ein alter Mann mit schönem, weißem Barte, vorstehender Nase, dicken Lippen und schwärmerisch leidenden, halbgeschlossenen Augen. Um das kleine Haupt war ein weißer Turban geschlungen, der zur dunkeln Hautfarbe gut stand; sein Anblick erinnerte an den eines schwer belasteten schläfrigen Kameles. Der zweite war ein junger, kleiner, fast schwarzer Mann von geschmeidigem Bau; sein glänzendes, gelocktes Haar hatte die reine schwarzblaue Färbung; seine Züge waren edel und schön, die Gesichtshaut glänzend, und aus den dunkeln Augen sprühte ein düsteres, melancholisches Feuer; sein Blick war abstoßend und anziehend zugleich, wie man es auch bei Zigeunern, Ungarn und Juden findet. Beim Abschied theilten wir unter die Asiaten einige blanke Silberstücke aus, was einen sehr guten Eindruck zu machen schien; denn als wir von der Schiffswand abstießen, steckten die freundlichen Chinesen die Köpfe zu den Luken heraus und winkten auf das herzlichste, was ich ebenso erwiederte. Tags darauf hatte ich den Genuß, bei einem schönen, sonnigen Tage zum erstenmale im Meere zu schwimmen; wer sich im stehenden Wasser gleich einem Pudel abgearbeitet hat, um sich auf der Oberfläche zu erhalten, und großer Schwimmproben nur wie einer mühsamen Uebung gedenkt, der fühlt sich auf der Salzfluth wie ein Schwan von den blauen Wellen getragen und erfrischt; dazu schien die Sonne so freundlich auf den prächtigen Hafen, daß es eine Lust war, sich in diesen Gewässern zu bewegen. Nachdem wir das Bad gestärkt verlassen hatten, fischte man noch einige Zeit im reichen Meere, und zog auch Austern heraus, die wir sogleich verzehrten. Von dort begaben wir uns zu einer nicht so entzückenden, aber sehr merkwürdigen Produktion. Ein Taucher sollte vor unsern Augen die Tiefe des Meeres ergründen; es war ein schauerlicher Anblick, und hätt' ich vorher geahnt, wie die Sache vor sich geht, nimmermehr hätt' ich es zu sehen gewünscht. Wir stiegen aus das Schiff, auf dem sich der arme Taucher befand, der einzige unter achtzigtausend Menschen, der den Muth hat, dieses Geschäft zu betreiben; er saß schon, in ein Kautschuk-Gewand gekleidet auf einer Bank. Man setzte ihm einen luftdichten Helm von schwerem Eisen auf die Schultern, den man an den eisernen Saum des Kleides anschraubte; für die Augen befinden sich zwei Glasscheiben in dieser Kopfbedeckung, hinten die Oeffnung, in welche eine Kautschukröhre eingeschraubt wird, durch die man ihm mittelst einer Pumpe Luft zuführt. Schon der Anzug ist schauerlich; alles wird so zusammengepreßt und geschraubt, daß man an ein Ersticken denken muß; nun wurde ein schwerer Anker in die tiefe See geworfen, an dem der Taucher auf dem Grunde einen Strick befestigen sollte; es war freilich prosaischer als wenn er »den goldenen Becher« aus den Fluthen geholt hätte, aber das Wagstück war nicht minder groß. Schillers schöner Jüngling durfte Mantel und Gürtel wegwerfen, diesem armen jungen Manne wurden noch schwere Gewichte angehängt, um ihn unter dem Wasser zu erhalten; auch begeisterten ihn nicht die glühenden Augen einer holden Prinzessin; er stieg an einer Strickleiter hinab und verschwand in den Fluthen; nur die stets weiter und weiter werdenden Wasserringe zeigten, wo er versunken war. Lange, lange gab er kein Zeichen; es war für uns eine peinliche schreckliche Zeit; es drängte sich uns der Gedanke auf, der arme Mann könne ein Opfer unserer Neugierde geworden sein; hätte ich mich nicht vor denen geschämt die dieses Schauspiel kannten, so hätte ich gefleht, daß man den Mann von seiner gewagten Arbeit zurück rufen solle; als unsre Angst aufs höchste gestiegen war, gab er endlich das Zeichen, daß seine Arbeit vollendet sei; nun wurden die Maschinen in Bewegung gesetzt, und man zog den schwerbelasteten herauf, und schraubte ihm schnell die drückende Bürde ab; er war aufs höchste ermattet und erschöpft.
Er gestand, daß es ihm jedesmal Ueberwindung koste, sich den Fluthen anzuvertrauen; besonders das erste Mal sei ihm das Brausen der einströmenden Luft in den metallenen Helm furchtbar gewesen; einmal ward ihm am Grunde des Meeres übel, doch konnte er seinen Zustand durch ein Zeichen kund geben; er bleibt aber immer mancherlei Gefahren ausgesetzt – der Schlag kann ihn vor Hitze rühren; wird zu rasch gepumpt und zu viel Luft eingelassen, so erstickt er, was auch geschieht, wenn das Wasser einen Eingang in seine Kopfbedeckung findet. Die Dirigenten gestanden mir, daß keiner von ihnen das Wagstück versuchen würde; ich glaubte es gerne, sagte mir dasselbe und bewunderte den Muth des Tauchers um so mehr; er ist ein kaiserlicher Matrose und heißt Nicolo Rendich; er hat edle, aber krankhaft ernste Züge, und ist von feiner, fast schmächtiger Gestalt. –
Die Erscheinung einer Fata morgana auf dem Meere, die ich schon längst zu sehen gewünscht hatte, wurde mir eines Morgens in Triest zu Theil, obwohl sie in diesem Hafen nicht sehr häufig ist. Wir waren nach dem Frühstück auf den Balcon getreten, von welchem man die Aussicht auf die weite See genießt, als ich über dem Horizonte eine zweite Wasserfläche zu sehen glaubte, an deren unterer Seite Segelschiffe umgestürzt dahinflogen, und nie gesehene Küsten sich dem Auge zeigten; es war der zauberhafte Anblick eines Doppelmeeres, in dessen Scheidung sich die verschiedenartigsten Gegenstände darstellten; die schönste Sonne beschien das Schauspiel, das lange genug dauerte, um dasselbe mit Muße betrachten zu können; zuletzt zerrann das Bild wie ein schöner Traum in blauen Dunst. – Wir hielten uns nur anderthalb Tage in Triest auf und durchschnitten dann am schönsten Morgen auf dem prächtigen Dampfer Vulkan die adriatischen Fluthen, um ins schöne Hellas zu schwimmen.
Mein Gefühl, als der Hafen unsern Blicken entschwand, war das eines Siegers; denn mein liebster Wunsch ward in diesem Augenblicke erfüllt. Tausend Pläne und Hoffnungen durchkreuzten unsere Köpfe, so daß dieser Abschied einer von den heitersten war, den ich je erlebte.
Den 8. September 1850.
Gegen fünf Uhr Morgens trat ich auf das Verdeck und ward fast überwältigt von dem herrlichen Anblick, der sich mir darbot. In milden, rosenfarben Umrissen ruhte der wundervolle, weit ausgedehnte Golf Patras in der Dämmerung. Die Berge des Peloponnes und die hohen Felsenspitzen von Rumelien glühten im Wiederscheine der kommenden Sonnenstrahlen; zauberhaftes Halbdunkel lag auf den Ufern des blaugrünen ruhigen Meeres. Der südliche Himmel wölbte sich ins Unbegrenzte; die Farben waren in großen, massenhaften Tönen aufgetragen, vom tiefsten Blau der fernen Gebirge bis zum glänzendsten Rosenroth der leuchtenden Felsen; Man rühmt als das Schönste in der Natur einen Morgen in den Alpen; ich habe ihn gesehen, und es ist fürwahr ein großes Schauspiel; doch bleibt die Pracht und Gluth des Südens unerreicht, und die leichten Nebel in den tiefen Thälern ersetzen nicht den Zauber des Meeres. Links von uns sahen wir Missolunghi schimmern, wo die dankbaren Griechen Lord Byron ein Denkmal gesetzt haben; er starb hier, zum Befreiungskampfe für ein Land gerüstet, dessen Reize er in unsterblichen Gedichten besungen hat. Vor uns lag in dunklen Umrissen Patras; ihm zur Linken der Eingang des Meerbusens von Lepanto, den der Schimmer des jungen Tages in ein Silberband verwandelte. Plötzlich stieg in der Richtung von Korinth die Sonne empor, und die Natur jauchzte in neuem Leben. Kaum aber sahen wir die goldenen Strahlen auf den Wogen tanzen, als die Schnelle unseres Dampfers schon die hohen Gebirge von Patras zwischen uns und die Sonne legte; dann sahen wir sie noch einmal aufgehen, und diesmal blieb sie uns treu und erfreute uns mit ihrer südlichen Kraft. Nun sahen wir auch die Stadt vom Grün üppiger Weingärten umgeben. Von einer venetianischen Festungsruine gekrönt, zieht sich ihre lange, aber nicht sehr breite Häusermasse längs der Schiffsrhede hin. Da wir seit Pola nicht gelandet waren, zeigte sich uns der Süden ohne Uebergang. Die Berge waren meist entwaldet und felsig, desto lachender die Ufer; bald umgaukelten unser Schiff leichte Fischerbarken mit neugierigen Hellenen in weißen Fustanellas und malerischem Fessi, die nach den neuen Ankömmlingen spähten. Wie Schwäne durchzogen sie mit ihren dreieckigen kleinen Segeln die hellgrünen, durchsichtigen Fluthen. Als wir ungefähr zweihundert Schritte vor der Stadt Anker geworfen hatten, näherten sich mehrere Bote mit der Bitte, unser Schiff besehen zu dürfen, was aber nicht gestattet wurde, weil wir erstens keine pratica hatten, und diese Besuche für die beweglichen Gegenstände etwas gefährlich sind. Nachdem der Anker, der Erste von uns, auf griechischer Erde Fuß gefaßt hatte, konnten wir die Stadt und ihr Treiben von weitem betrachten; es war ein ausgesucht schöner Tag, wie man sich ihn zum ersten Blicke in ein heißersehntes Land nur wünschen kann; auch bemächtigte sich meiner die nur dem Reisenden bekannte Wonne, wenn er das Ziel seiner Wünsche erreicht hat. Der äußere Anblick der Stadt hat einen süditalienischen Anstrich; die Häuser sind in unregelmäßigem, malerischen Gemenge gebaut, und überall blickt die freundliche Rebe zwischen den Mauern durch. Patras ist an den Rücken einer Anhöhe gelegt, die sich unmittelbar an das hohe Gebirge lehnt; die untersten Häuser reichen bis an das Meer. Im Alterthum war es von geringer Bedeutung; es enthält auch mit Ausnahme einiger Sarkophage keine Erinnerungen an dasselbe; unter den Venetianern ward es durch das ziemlich bedeutende Fort wichtig; in der Geschichte Neugriechenlands aber wird es unvergessen bleiben; denn das der Stadt nahe Kloster Megasderion war die Wiege des aufstrebenden Hellas. Hier wurde von dem Erzbischof der Stadt der Kampf gegen die Ungläubigen für heilig erklärt, und das Panier mit dem weißen Kreuze aufgesteckt. Auch durch die Zahl der Einwohner und durch den Seehandel, dessen Hauptgegenstand getrocknete Trauben sind, ist Patras eine der bedeutendsten Städte Griechenlands. Von Tag zu Tag vergrößert sich sein Umfang. – Da es Sonntag war, so trafen wir die ganze Bevölkerung in malerischem Putz und regem Leben; Hunderte von Griechen mit den weiten Fustanellen sah man den Quai entlang dem Ton der Glocken, die zur Messe riefen, folgen; auch die Zahl der um uns kreisenden Barken nahm von Minute zu Minute zu. Anmuthig und stolz lagen die schönen Söhne von Hellas darin; die Soldaten in blauem, mit Silber gesticktem Spencer, engem rothen Gürtel, faltenreicher Fustanelle, gestickten blauen Gamaschen und rothen Schuhen. Die Züge der Griechen sind edel, ihr Haupt ruht frei auf dem stolzen Nacken, und ihr schöner Bau wird durch die Tracht hervorgehoben.
Nachdem ein Boot von unserm Schiffe zu dem Consul gesendet worden war, entfaltete sich plötzlich über einem Gebäude am Meere das geliebte österreichische Banner; bald brachte uns auch ein griechisches Boot die pratica, und gleich darauf kehrte das Unsere mit dem Consul zurück. Es war ein magerer, schmächtiger Italiener, dessen hoher grauer Hut, gleich ihm selbst, gar manche Jahre zählen mochte; spießige graue Haare hingen vom Kopfe herab, die spitze, scharfe Nase reichte fast bis ans Kinn; von der Zahl seiner Zähne mag die Vergangenheit erzählen; um den langen, vorgebeugten Hals schlang sich eine weiße, schnupftuchähnliche Cravatte, und den dürren Leib umhüllte ein dunkelgrüner Diplomatenfrack, dessen lange Schöße die Wichtigkeit seines Postens versinnlichten; bei alledem erfuhren wir, daß er gegen die Oesterreicher sehr freundlich ist, und ihnen allerlei Festlichkeiten zu geben pflegt. Wir luden ihn zum Frühstück ein, während dessen er erzählte, daß er Officier in der österreichischen Armee war, unter Haynau und Radetzky gedient habe, später am Kampfe unter Ibrahim Pascha betheiligt gewesen, dann nach Nubien gereist, und zuletzt als Consul nach Patras gekommen sei, wo er nun schon seit 18 Jahren weilt. Wenn er ins lebhafte Gespräch kam, konnte man ihn für einen italienischen Improvisator halten. In der letzten Zeit hatte er Gelegenheit seine diplomatische Geschicklichkeit zu zeigen; eine Menge italienischer und ungarischer Flüchtlinge hatten sich nach Patras gezogen, ihn anfangs mit geringer Achtung behandelt, aber später mit Bittschriften an seine Regierung bestürmt, – um in die Heimath zurückkehren zu dürfen. – Zwei unserer Herren begleiteten ihn bald nach dem Frühstück in seine Barke; wie beneideten wir sie, die so bald das gelobte Land betreten durften, während wir, bei diesem herrlichen Tage, bis Nachmittag warten mußten; die Herren versprachen uns bald abzuholen und uns von den herrlichen, in griechischer Sonne gekochten Trauben und Feigen mitzubringen. Professor G. brachte die Zeit auf dem Räderkasten zu, mit der Zeichnung des Golfpanorama's beschäftigt, das denn auch, wie alles, was er zeichnet, vortrefflich glückte. Wir andern sprachen über zukünftige Reisepläne, ergötzten uns an dem immerwechselnden Schauspiele der Natur, an den kommenden und gehenden Barken und ergänzten unsere Tagebücher; ein Schifflein voll Musikanten umschwirrte mit lieblichen Gesängen unser Schiff; dennoch dünkte uns die Zeit lange, ehe wir das Boot des Consuls erblickten; den beiden Herren merkte man es an ihren muntern Gesichtern und ihrer lebhaften Beschreibung an, wie befriedigt sie von ihrem Ausfluge waren. Wir wurden leider noch einige Zeit durch einen Unternehmer, den der Consul mitgebracht hatte und mit dem wir einen Contract wegen unserer Landreise nach Korinth und Nauplia abschließen mußten, auf dem Schiffe zurück gehalten. Um halb zwei Uhr wurden wir endlich flott und alles was Hände und Füße hatte sprang in die Boote des Vulkans. Jauchzend schaukelten wir zwischen malerischen Kauffahrern dem Lande zu; Wonne durchzuckte mich, als ich zum ersten Male den Fuß auf hellenische Erde setzte. Acht Tage waren es erst, daß ich von Freude berauscht und lachend vom alten Freunde, dem Stephansthurm, Abschied genommen hatte, und nun stand ich schon, durch den Dampf, die Triebkraft der Neuzeit, befördert, auf dem im voraus geliebten Boden der Vergangenheit; die Schnelligkeit des Ueberganges wirkte zauberisch. Da standen wir plötzlich auf einem Platze von Patras, umringt von Bildern, deren Beschreibungen nur schwache Schatten wieder geben können. Da saß eine Gruppe reicher Griechen mit blendender Fustanelle oder faltigen dunkelblauen Beinkleidern, am Eingange eines Kaffeehauses ihre langen Pfeifen schmauchend; daneben standen andere und spielten mit ihren rosenkranzartigen Kugelschnüren, welche die immerbewegte Hand des echten Hellenen nie verlassen. Dort trieb der Sohn der Berge, in farblose Fetzen gehüllt, einen Zug von Pferden und Eseln, die die süßen Trauben, seinen einzigen Erwerb, in Körben und Säcken von den höhern Weinbergen herab tragen; hier feilschte ein Trupp lustiger Bursche im Sonntagsstaat um die auf der Erde aufgehäuften Früchte des Landes; dort wogte eine Gruppe schreiender Kinder um einen greisen Popen mit wallendem Barte; weiterhin durchkreuzte ein Trupp fröhlicher Soldaten mit gleichem Schritt und Tritt die Menge. Diese Bilder wurden von den verschiedenartigsten Gebäuden umrahmt; einige zeichneten sich durch netten Bau und reinere Farbe aus; sie gehörten den reichen Kaufleuten, die hinter den grünen Jalousien in den heißen Stunden der Siesta pflegten; andere waren von Holz in verfallenem Zustande; unter den Häusern liefen, von hölzernen Säulen gestützte Gallerien, wo sich Buden im farbenreichsten Durcheinander befanden, in denen man die den Sitten des Landes angemessenen Gegenstände verkaufte. Das Interessanteste waren alte Waffen, und typische auf Holz gemalte Heiligenbilder, von denen ich mir eins kaufte. Die Gassen sind ziemlich breit, laufen über Berg und Thal, und bieten dem civilisirten Fuß sehr unbequeme Steinparthieen, auf welchen sprudelnde Quellen kleine Wasserfälle bilden; hin und wieder stößt man auf einen Platz, in dessen Mitte sich gewöhnlich einige Bäume mit einem echt orientalischen Brunnen befinden, an welchem die Weiber mit ihren irdenen Krügen, alttestamentlich lagern; zwei dieser Plätze tragen die Namen des Königspaares. Auf meinen Wunsch schritten wir einem Garten zu, der auf einer Anhöhe lag; auf unebnem Wege, an niedrigen Hütten vorbei, welche aus morschem Gebälk aber von Weinreben umschlungen waren, schritten wir der Höhe zu. Als wir sie erreicht hatten, wurden wir durch die zauberhafteste Aussicht auf den Golf überrascht. Zu unsern Füßen lag die Stadt, dann die Schiffe auf einem Spiegel, umkränzt von den grünen Bergketten des Parnaß.
Wir standen auf einer terrassenartigen Fläche, unter welcher sich tiefe, vor grauen Zeiten erbaute Gewölbe in den Berg hineinziehen sollen, die den Schakalen zur Wohnung dienen; eine Gruppe mächtiger Feigenbäume war von Kürbissen umrankt; auf die Erde waren Weinbeeren gestreut, welche die Sonne zu jenen süßen Rosinen austrocknete, die in den nordischen Gebäcken eine so wichtige Rolle spielen; so muß in den verschiedensten Himmelsgegenden wachsen und gedeihen was den Gaumen kitzelt, und man schlingt den Bissen hinunter, ohne an dessen Geschichte und weite Reisen zu denken. Hier behandelt man die Rosinen nicht mit so viel Achtung wie in unsern Küchen: sie werden haufenweise, mit dem Staube der Erde vermengt, in weite schmutzige Körbe geworfen, dann dem hier so häufigen Langohr auf den Rücken gepackt, der, unter der schweren Last ächzend, sie nach der Rhede bringt, wo sie mit den Füßen in Tonnen eng verstampft und nach dem Westen eingeschifft werden. Der erwünschte Garten war mit einer Mauer umschlossen, durch deren gewölbte Thüre wir eintraten; wir standen in einem Saal von Weinreben, der durch die herrlichsten, schattigsten Gänge durchschnitten war. Steinerne Säulen stützten die sich emporschlingenden Ranken, leichte hölzerne Stangen bildeten das Gerippe zum dichtesten Rebendache, durch das nur hin und wieder der tief blaue Himmel freundlich durchblinkte. Tausende von Trauben hingen lockend von der leichten Wölbung herab, von einer Größe, wie sie nur die Mythe beschreibt. Die Säulen des Blätterdoms stützten sich auf niedrige Mauern, welche auf einer Seite in einem Gartenhäuschen endigten. Der Boden des breiten schattigen Platzes vor diesem war mit großen Marmortafeln gepflastert, und auf einer denselben umgebenden Steinbank ruhten zwei Gärtner, in malerischer Stellung auf weiche Felle hingestreckt; um die Idylle zu vollenden, stand ein tiefer klarer Brunnen in der Mitte, in dem sich das Grün des Laubdaches und die Bläue des Himmels wiederspiegelten; am Rande desselben kosten zwei weiße Tauben. Auf der Erde lagen blaue Früchte, die wir für Pflaumen hielten; es waren aber die herabgefallenen Beeren der fabelhaft großen Trauben, die wir mit Lust verzehrten. Wir durchschritten nun die einzelnen Laubgänge, mit denen sich üppige Orangenhaine kreuzten; leider waren die Früchte, mit denen diese prachtvollen Bäume überladen waren, noch nicht reif. Pflanzen, die man bei uns verkrüppelt im warmen Glashause findet, wuchern hier in malerischer Abwechslung; auch die Art der Anpflanzung ist in einem genialen Durcheinander gehalten; man glaubt im Paradiese zu wandeln; eine solche Vegetation hatte ich noch nie gesehen, solche Früchte noch nie gekostet. Der Reiz dieses üppigen Gartens ward durch den Blick auf das Meer noch erhöht; der Konsul war über unser Entzücken hoch erfreut und stimmte in dasselbe ein. Wie selten mag er in den achtzehn Jahren mitfühlenden Reisenden die Wunder dieser Gegend gezeigt haben! War er doch wieder einmal unter seines Gleichen, unter civilisirten Menschen. Endlich kehrten wir durch belebte Straßen zurück und machten der Gemalin des Konsuls einen Besuch im österreichischen Konsulats-Gebäude; sie ist eine recht artige zierliche Venetianerin in mittleren Jahren, und spricht gut und gern französisch. Man brachte uns in ihren etwas vernachläßigten Salon Gürtel aus Silber und Gold gestickt, in denen das Volk die Waffen trägt, da ich einen solchen zu kaufen wünschte. Nachdem uns die Frau vom Hause zum Abend eingeladen hatte, nahmen wir den Konsul in einer Barke des Vulkans zum Speisen mit auf das Schiff. Wir waren in unserem großen Räderkasten wie die Häringe eingepreßt, was die ohnehin starke Hitze noch vermehrte. Nach Tische führte uns der gute alte Herr zu einer Musik, die auf dem Vorraume des oben erwähnten Gartens von der Bande eines irregulären griechischen Infanteriebataillons ausgeführt werden sollte, und der die Bevölkerung der ganzen Stadt in reichem Kostüme beizuwohnen pflegte; wir unterschieden schon vom Schiff aus die weißen Fustanellen und hörten die Töne zu uns herüber rauschen. Die Siesta war vorüber; schöne Frauen mit reichem Haarwuchs und malerischer Kleidung zeigten sich im Vorübergehen auf den Balkonen – auch in den Straßen begegneten wir den reizendsten Patraserinnen, die am Arme imposanter und edelgestalteter Männer leider schon den Rückweg einschlugen; wir schritten rasch vorwärts und fanden doch noch einen ziemlich bedeutenden Kreis um das Musik-Corps versammelt, das eben nicht spielte und sehr armselig ausgestattet war. Der Anblick des Volkes, unter dem kein Klassenunterschied wahrzunehmen ist, war interessant. Alle sind Brüder eines Stammes, welche früher unter demselben Joche geschmachtet und es vereint abgeschüttelt haben. Die Theilung von Leid und Freud begründet die Gleichheit. Ueberall wo ein Volk von einem andern unterjocht wird, findet sich diese Gleichheit der Zusammengehörigen, wenigstens in der Gesinnung gegen die Unterdrücker. Alles strebt einem Ziele der Befreiung zu und vergißt sein eignes Ich. Die einzige etwas höhere Stellung nehmen jene Familien im Lande ein, deren Väter mit besonderer Auszeichnung im Freiheitskriege gekämpft haben. Nach unserer Ankunft spielte die Musik noch ein Stück, worauf alles seiner Wege ging. Die Sonne war hinter den äußersten Spitzen von Rumelien verschwunden, und die Abenddämmerung dauerte kaum eine Viertelstunde; wir erreichten also gerade vor der tiefen Nacht das Haus des Konsuls. Seine Gemalin empfing uns im Kreise ihrer Kinder; man unterhielt sich, so gut man konnte; etwas später kam der Klavierlehrer des Hauses mit seiner reizenden jungen Gattin in der Nationaltracht. Die Konsulin hatte sie wahrscheinlich eingeladen, um uns einen Begriff von den schönen Töchtern Griechenlands zu geben. Leider sprach dieses liebliche Wesen, das an meiner Seite Platz nahm, nur seine Muttersprache; der Gemal spielte mit gutem Vortrage einige bei uns schon veraltete Melodien; später löste ihn die eilfjährige Tochter des Hauses in ziemlicher Selbstzufriedenheit mit einem eingewerkelten Stückchen ab. Die Produktionen der enfants prématurés sind mir von jeher zuwider gewesen, zumal wenn man der Mutter wegen eine entzückte Miene annehmen muß. Nach und nach füllte sich das Zimmer mit den Honoratioren der Seestadt; unter ihnen war der französische Konsul, den man seinem Aeußern nach eher für einen Lastträger hätte halten können; man trank Thee, das Vereinigungsmittel aller Geselligkeit im neunzehnten Jahrhundert; außerdem wurde ein gräßliches nationales Getränk aus zerquetschten Kürbiskernen herumgegeben; der Hausherr bot den Herren lange Pfeifen an, und zum Schluß führten die Damen und die Kinder, nach langem Bitten, einen griechischen National-Reigen auf, der einen einförmigen düstern Charakter hatte. Wir dankten den Hauswirthen herzlich und fuhren bei herrlicher Sternennacht auf unseren Vulkan zurück.
Der Kontrakt mit dem Manne, welcher unseren Zug durch Hellas führen sollte, war abgeschlossen worden; unser Schiff sollte uns in Nauplia wieder finden, und wir traten die Landreise dorthin am herrlichsten Morgen an; unsere Dienerschaft ließen wir bis auf einen Bedienten an Bord zurück; auch das Gepäck schränkten wir auf das Nothwendigste ein. Wir hatten uns für die Strapatzen des Weges in die bizarrsten Anzüge geworfen, und als wir uns versammelten, um in die Kähne zu steigen, hätte man glauben sollen, eine Komödianten-Gesellschaft sei im Begriff, eine Wanderung anzutreten; einige hatten hohe Stiefel an, andere hielten die Blousen durch Gürtel zusammen, und waren gegen Raubanfälle mit Schlägern, Dolchen und Flinten, gegen die Sonnenhitze aber mit Regenschirmen bewaffnet. Der Verfasser zog vor, nur ein chinesisches parasol von außerordentlich leichtem Stoffe mitzunehmen, das ihm trotz des Gespöttes der Uebrigen sehr gut zu Statten kam; für Zeiten des Unwetters hatte man sich schon in Triest mit den eigenthümlichen istrianischen Marinaros von braunem Leder und Kapuzen versehen. Die Pferde erwarteten uns vor der Wohnung des Konsuls, der uns im Frühnegligé an den Stufen seines Hauses empfing. Nur einige der Thiere und ihre Zäumungen waren erträglich anzusehen; die armen Gäule befanden sich im Zustande furchtbarster Magerkeit, und ihr Geschirr war aus Ketten, Stricken und Lederflecken zusammengeflickt.
Der Unternehmer, den wir den Lesern unter dem Namen Demetry vorstellen, war aufs eifrigste bemüht, die Thiere unter die Reiter zu vertheilen und denselben ihre außerordentlichen Eigenschaften anzupreisen, wobei ihn der Konsul, dessen equestrische Begriffe etwas schwach zu sein schienen, auf das angelegentlichste unterstützte. Die Packpferde wurden so sehr mit Speisen und Vorräthen beladen, daß sie unter denselben fast unseren Blicken entschwanden. Um dreiviertel auf Sieben verließ der lange Zug, der Sicherheit wegen von Gensd'armen eskortirt, die Stadt Patras. Zuerst ging es zwischen den fruchtbarsten Weinbergen, die sich hinter der Stadt hinziehen, über kleine Anhöhen fort; überall beschäftigte man sich auf das fröhlichste mit der reichen Weinlese. Längs dem Wege waren Laubhütten errichtet, um die Früchte zu schützen, ich wunderte mich, auf den Anhöhen, zwischen Reben, Orangen und Granaten Schilfgruppen von ungewöhnlicher Höhe zu finden. Die Aussicht auf den blauen Golf und die Berge von Rumelien war reizend; eine zauberhafte Ruhe lag auf der Landschaft und alles glänzte im frischen Duft des Morgens; der von Steinen, Wassern und Büschen durchkreuzte Weg senkte sich nach einiger Zeit und führte durch die ausgetrockneten Betten breiter Gießbäche, in welchen zu unserem Erstaunen die Vegetation am üppigsten war. Der Oleander wuchs in großen dunkelgrünen Gruppen, aus denen die schönen rosenfarbenen Blüthen hervorragten; auch die stille, liebliche Myrte mit ihrem tief grauen Laube bildete Gebüsche von solcher Fülle und Ueppigkeit in diesem sandigen Grunde, daß, wer sie nur in Töpfen gesehen hat, sie kaum wieder erkennt; unsere Richtung lief parallel mit dem Ufer des Meeres; zum letztenmale zeigten sich die Umgebungen von Patras im Morgensonnenlichte. Am Golf von Lepanto, durch die Seeschlacht berühmt, sahen wir die Stadt desselben Namens liegen. Sie ist zwischen hohen Bergen und dem Meere eingeengt; vor derselben liegt das Fort Rion auf einer Landzunge, und auf unserer Seite tritt die Befestigung Antirion ebenfalls in die Fluthen heraus; beide Werke haben griechische Besatzungen. Der wichtige Sieg Don Juan d'Austria's wird hier recht anschaulich; man erkennt, wie der türkischen Flotte kein Ausweg mehr blieb, als sie diese schmale Meereslinie überschritten hatte; noch einmal spielte Lepanto eine wichtige Rolle im Freiheitskampfe; jetzt ist es von gar keiner Bedeutung mehr.
Ein schönes Bild nach dem andern entfaltete sich vor unseren Augen; denn wo die Fluthen des Meeres schäumen, und die Vegetation dem Reisenden immer Unbekanntes bietet, fehlt es nie an neuem Reize; und je mehr wir uns dem Meere näherten, je mehr nahm er zu. Nach einem dreistündigen Ritt war trotz Enthusiasmus und Scherz, die uns begleiteten, der Körper ermüdet, der Magen leer, das Auffassungsvermögen geschwächt; wir waren daher sehr zufrieden, als Demetry uns einen hellen Punkt auf grünem Grunde, am Saume einer lieblichen Bucht als den Kani bezeichnete, in dem wir unser Gabelfrühstück verzehren sollten. Als wir vor der Hütte ankamen, wurden die Pferde den Knechten übergeben und wir lagerten uns im Schatten des Gebäudes. Die Marinaro's vertraten die Stelle von Kissen und ein Tischtuch wurde auf den Erdboden ausgebreitet; Flaschen und Gebäcke holte man aus den Säcken und nach alter Sitte nahmen wir liegend ein stärkendes Mahl ein, und ruhten dann noch eine Stunde am frischen Meeresufer aus. Einige der Herren schickten sich zur Siesta an; mein Bruder, Dr. F. und ich beschlossen einen kleinen Streifzug in die herrlichen Umgebung zu machen. Unmittelbar am Hause war die Pflanzenwelt durch teichartig ausgebreitete Quellen erfrischt, wodurch sich knapp am Meere ein dichter fast undurchdringlicher Hain gebildet hatte. Wo nicht die reich beblätterten Aeste den Weg versperrten, erschwerten die schönsten Schlingpflanzen den Durchgang; mit Mühe durchbrachen wir diese neckischen Ketten. Unser Hauptzweck war Schildkröten zu fangen, deren wir zwei unterwegs aufgelesen hatten; doch gelang es uns nicht. Eine mächtige dürre Platane fiel uns auf, an der sich statt der Blätter ein Wald von wildem Wein herauf gewunden hatte; wie ein grüner Wasserfall fielen die zierlichen Ranken herunter; die geübteste Gartenkunst hätte diese Kränze nicht so schön knüpfen können. Gerne hätte ich diese Fülle frischen Lebens, das die todten Glieder umspann, gezeichnet, wenn ich Zeit dazu gehabt hätte. Wir kosteten von den Früchten der wilden Reben und fanden, daß sie an Süßigkeit unsern Gartentrauben gleichkommen. Als wir an den Strand zurückkamen, fanden wir Professor G. beschäftigt, die Bucht mit ihrer Umgebung mit gewohnter Genialität zu zeichnen. Archivarius K. saß im Schatten eines Olivenbaumes und schrieb ein Gedicht. Die Uebrigen verschliefen die schöne Zeit zum Theil, einige aber hatten sich in den Wellensand des Meeres gesetzt; wir gesellten uns zu ihnen. Die Tiefen des Meeres wirken mit einem mystischen Reize auf mich, mächtig und unwiderstehlich zieht mich die unergründete Fluth an, und Alles was ihr angehört erfreut mich. So auch die kleinen Muscheln, die ich im Sande wühlend fand; man hätte nicht eifriger Goldstücke suchen können, wie ich jetzt diese lieblichen Kleinigkeiten. Doch bald wurde das Zeichen zum Aufbruch gegeben und man schwang sich, oder man kroch, je nach der Korpulenz, auf die Sättel. Immer neue Gegenden kamen und schwanden, es folgte Bucht auf Bucht; bald gingen wir auf dem feinen Sande des Meeres, bald durch Buschwerk und malerische Hohlwege, bald über leicht gewellte Höhen.
Man kann das Land wild und unkultivirt nennen, aber es liegt ein großer Reiz in dieser ursprünglichen Natur, wenn auch große gelbe Erdflecke brach liegen, so steht doch dicht daneben die feine, schlanke Pinie mit ihrer Nadelkrone, die grüner ist als das frischeste Laub, die üppige Platane, die ihre breiten Aeste den Schlingpflanzen und Reben zur Stütze darreicht, und die liebliche Myrte mit dem poetischen Lorbeer verschlungen. Diese grünen Anhaltspunkte für das Auge sind noch hundertmal schöner, wenn die kalte Hand des nutzensuchenden Menschen nicht ihre geraden Ackerlinien dazwischen gezogen hat. Ein großartiger Friede herrscht auf solcher Erde, die der Pflug nicht durchwühlt hat; kein Schiff stört den Spiegel des tiefen blauen Meeres, kein Kirchthurm, keine Ruine lenken den Blick von den stolzen, südlich glühenden Gebirgsmassen ab; wer über die Monotonie dieser Länder klagt, hat ihren Reiz nicht empfunden, und ich kann das Gemüth nur beklagen, das sich hier nicht in Wonne aufschließt und die Luft des alten Hellas mit Entzücken schlürft. Bald that die griechische Sonne ihre Wirkung, und nach abermaligem dreistündigen Ritt sehnten wir uns nach Erquickung; man näherte sich wieder einem Kani, welches von großen Olivenbäumen umwaldet war; einzelne Weingärten befanden sich in der Nähe, und wir drückten daher unseren Führern den Wunsch aus, uns an den griechischen Trauben zu laben; bald war eine Fülle derselben und eine herrliche Melone herbeigeschafft. Schon unterwegs hatten wir Gruppen zu dreien und vieren, auf Eseln reitend getroffen, die Trauben zum Trocknen in Schläuchen auf den Markt größerer Städte brachten. Diese Reiter haben ein höchst pittoreskes Aussehen; die Art wie sie sich kleiden, der eigenthümliche Sitz auf dem Esel, die edle Haltung gaben uns einen hohen Begriff von der Schönheit des griechischen Volkes. Wir fanden mehrere dieser Männer im Kani; die Meisten waren stark bewaffnet, was ihre natürliche Würde erhöhte. Als sie Dr. F. schnupfen sahen, baten sie ihn um eine Prise, für welche sie mit Grazie dankten. Sie ließen uns ihre Kleider ohne Verlegenheit betrachten und behielten ihre stolze, selbstbewußte Haltung bei. Im Innern des Kani war ein budenähnlicher Raum, in welchem die für das genügsame Land nöthigen Gegenstände, Gläser, Schalen und Töpfe, feil geboten wurden; da darunter auch Liqueure von wenig einladendem Geruche waren, so hielten wir den Rest unserer Rast im Freien.
Im Weiterreiten zeigte es sich, daß mein Gaul mich ziemlich rasch von der Stelle brachte, was nicht bei allen der Fall war. Archivarius K. behauptete, der seinige sei wild und schlüge aus; indessen hatte er nur einen Zuckfuß; der arme Herr hatte nie geritten und mußte nun sein Probestück durch zwölf Stunden auf schlechtem Sattel machen. Zwei Gensd'armen eröffneten unsern drolligen Zug; sie waren ein Gemisch von Baiern und Griechen, der Kopf gehörte dem Vaterlande an, Gewand oder Uniform war griechisch; hinter ihnen ritt in unzerstörbarer Ruhe Graf C., rauchend und stumm die neuen Eindrücke in sich aufnehmend; dann folgten Fürst J. und Baron K.; der erste spähte vergebens nach comfortablen Villas mit schönen Bewohnerinnen; der letzte dressirte, als echter Reitersmann, die Pferde des armen Demetry. Dr. F. machte den Weg mit gemächlicher Ruhe, und ergötzte uns durch interessante Erzählungen, die er uns liebenswürdig vorzutragen wußte; zuweilen erfrischte er sich durch eine Prise; mein Bruder ritt gewöhnlich neben ihm und schützte sich durch einen großen Regenschirm vor der Sonnenhitze. Nun kam G., zwischen die ledernen Schanzen seines türkischen Sattels eingepfercht; beim Auf- und Absteigen mußten ihm mitleidige Seelen Hülfe leisten, denn auch er war des Reitens ungewohnt, schickte sich jedoch recht gut in die anhaltende Bewegung. Ich schwärmte auf meinem feurigen kleinen Schimmel von dem Einen zum Andern, mein chinesisches parasol als Siegesfahne in der Hand, und ergötzte mich an dem lustigen Witze der Gesellschaft. Als wir wieder einmal längs dem Meere und zuweilen auch darin ritten, wurden wir plötzlich von einem vorübergehenden Gußregen überfallen und mußten in einer elenden Hirtenhütte Obdach suchen; der Regen kühlte und reinigte die Luft, und der Abend an unserem Ufer war desto herrlicher, während in Rumelien schwarze Wolken den Parnaß umhüllten. Von einem Städtchen angefangen, das wir anfangs für unser Nachtquartier hielten, wurde die Gegend wasserreich; wir hatten manchen Bach zu durchwaten, in dessen Mitte der Oleander blühte. Bei einem dichten Busche begann das Pferd des vor uns reitenden Gensd'armen sich zu bäumen, das Pferd des Fürsten, neben dem ich gerade ritt, erschrak ebenfalls; doch kamen wir glücklich vorüber; der Fürst aber forderte mich auf, zu beobachten, wie es den Uebrigen bei diesem verhexten Strauche gehen würde; da erblickte ich unsern armen Archivarius, der auf dem dünnen Halse seines Braunen einen verzweifelten Gleichgewichtstanz auszuführen genöthigt war – endlich lag er unrettbar im Grase. Ein mit Schilf bedeckter Esel war's, der diesen Schrecken verbreitete; die Pferde hatten vor der beweglichen Masse gescheut. Ich sprengte zu meinem lieben Archivarius, dem zum Glück nichts geschehen war und der sogar auf das Schnellste wieder im Sattel saß und über seinen Unfall lachte. Etwas vor Sonnenuntergang erblickten wir unser Nachtquartier, das Städtchen Vostizza. Was die Ufer dieses Golfs so überraschend schön macht, sind die in das Meer vorspringenden Erhöhungen, welche die kommenden Buchten verbergen und die schon durchwanderten Meeresküsten den Blicken entziehen. Vostizza liegt auf einer solchen malerischen Erhöhung. Mein Bruder und ich ritten nun mit Fürst J. rasch unserem Ziele entgegen; wir hatten ein breites Flußbett zu passiren, dann ging es eine steile Anhöhe hinan, die wie eine Sandbank ausgewaschen ist; es scheint, daß das Meer einst bis dahin, folglich bei dreißig Klaftern höher als jetzt, gereicht hat. Zwischen dieser Wand und dem Meere dehnt sich eine freundliche grüne Fläche aus, mit Weingärten übersät; einige Häuser erstrecken sich bis an das Meer; mitten unter diesen ragt eine mächtige Platane empor, die die Sage aus den Zeiten des Pythagoras herabstammen läßt. Wir ritten in den oberen Theil der durchaus unregelmäßigen Stadt ein. Der vorausgeeilte Koch des Demetry leitete uns in das Haus, in dem wir die Nacht zubringen sollten. Es stellte ein Wirthshaus vor. Zu ebener Erde befand sich ein großer Raum, der eine breite Oeffnung auf die Straße statt eines Fensters hatte, und als Küche, Keller, Vorrathskammer und Magazin diente; unsere im Entstehen begriffenen Speisen waren von tausend und abermals tausend Fliegen bedeckt, was nicht ermunternd wirkte. Außer den Fliegen hatten sich noch einige neugierige Städter versammelt, deren Geplapper mit dem Gesumme der Insecten ein verwirrendes Concert gab. Ueber eine zitternde Holztreppe stolperten wir in das obere Stockwerk, das zwei sogenannte Zimmer enthielt, in welchen man sich nicht über die neumodische Möbelfülle beklagen konnte; vier nackte Wände waren nicht einmal weiß zu nennen, so hatte sie der Schmutz bedeckt. Auch die Nase wollte sich nicht in die griechische Zimmeratmosphäre finden; dies war keine sehr tröstliche Aussicht nach einem zwölfstündigen Ritt; ich meinte indessen, mit Stroh und unseren Marinaros könnten wir uns wohl behelfen; der Fürst aber behauptete, diese Unterkunft sei dem Contracte nicht gemäß, den wir mit Demetry abgeschlossen hätten; auch sei es unter unserer Würde, unser Hauptquartier in solchen Räumlichkeiten aufzuschlagen. Ich stellte vor, es sei am einfachsten bei der herrlichen Nacht im Freien zu campiren; der Fürst jedoch bestand auf einer ernsten Unterredung mit Demetry, und ich setzte mich unterdessen auf die Brüstung des untern Fensterraumes und betrachtete mir das Treiben der Hellenen. Es zogen einige Züge von beladenen Eseln, Pferden und Maulthieren langsamen Schrittes vorbei. Da es, außer in Athen, in Griechenland gar keine Wagen giebt, so begegnet man dergleichen auf allen Straßen, die auch mitten in den Orten erbärmlich sind. Unsere Erscheinung lockte sehr bald mehrere Honoratioren der Stadt herbei. Seit der englischen Blokade sind Fremde ein seltenes Schauspiel für griechische Augen; ich muß aber gestehen, daß die Einwohner artiger als in unseren fein civilisirten Ländern sind; nickt man ihnen freundlich zu, so danken sie gleich mit dem Gruß des Landes, indem sie die Hand auf Herz und Stirn legen. Nach einiger Zeit kam Demetry mit den Zurückgebliebenen an, und nun machte man seine Forderungen an ein besseres Nachtquartier geltend; statt aller gefürchteten Einwendungen sprach er mit einigen gut gekleideten Städtern, und bat uns ihm zu folgen. Er führte uns in den höher gelegenen Theil der Stadt und introducirte uns mit großer Pfiffigkeit in das schön gelegene Haus eines königlichen Beamten, der nicht wenig erstaunt gewesen sein muß, sich plötzlich von einer so großen Gesellschaft überfallen zu sehen. Dennoch gewährte er uns die orientalische Gastfreundschaft im vollsten Maße. In zwei großen, einigermaßen möblirten Zimmern des zweiten Stockwerkes, die uns eingeräumt wurden, nisteten wir uns auch bald ein. Der Hausherr war selbst zugegen, um auf das schnellste für alles Nöthige zu sorgen, und drückte sich in gebrochenem Französisch auf das freundlichste aus. Aus dem größeren Zimmer führte ein hinfälliger, fast lebensgefährlicher Balcon mit der herrlichsten Aussicht auf die jenseitige Bucht; es war eine südliche Nacht in ihrer vollen Milde und Pracht, die Sterne funkelten wie Diamanten und das Schiff des Mondes schwamm ruhig im blauen Aether; die Stadt mit ihren schönen Gärten lag in stiller Abendruhe, das Meer schimmerte im Wiederschein des Mondes; die Natur feierte einen jener geheimnißvollen Augenblicke der Erholung, in welchem kein Blatt es wagt zu rauschen. Ueber mich kam ein innerliches Sichgehenlassen nach der überstandenen Tageshitze, und erquickend wehte von der See her ein Lüftchen über das schlafende Land; – unterdessen war das Abend- und Mittagsmal in einer Person aufgetragen worden, und wir sprachen ihm, trotz der Fliegenschaaren tapfer zu. Der Hausherr holte aus seinem Keller den besten Wein, den er besaß, und sah mit Erwartung zu, als wir die Gläser ansetzten, um ihn zu kosten; aber nur die Gegenwart unseres liebenswürdigen Wirthes hielt uns zurück unser Entsetzen ganz auszudrücken; es war ein süßlich saures Getränk, das aber durch den Geschmack des Bockschlauches, in dem es aufbewahrt wird, untrinkbar geworden; überhaupt konnte ich mich, so sehr ich für Hellas schwärme, mit seinen Weinen nicht befreunden. Ein heiteres Gespräch verschönte unser Mal; doch endlich forderte der Körper seine Rechte und wir begaben uns zur Ruhe. Es waren nur ein Bett und zwei Divans vorhanden; ein Theil der Gesellschaft richtete sich auf dem Fußboden ein. Gegen fünf Uhr war schon Reveille; es wurde rasch ein Frühstück eingenommen, nach welchem man uns in einen Keller führte, wo zwei sehr schöne antike Statuen lagen. Die Kunstpflege in Vostizza scheint nicht sehr vorgerückt, da man diese schönen Marmorgebilde zwischen Unrath in der größten Dunkelheit liegen läßt. Das eine war eine weibliche Figur, wahrscheinlich eine Ceres mit vortrefflichem Faltenwurf; doch fehlte leider das Haupt; das andere eine schlanke Jünglingsgestalt, deren Glieder ein schönes Ebenmaß zeigten; ein schöner Männerkopf mit edlen festen Zügen lag neben den beiden Statuen; der Marmor war durchsichtig wie der, den man, wie man uns sagte, in Penthelikon brach; daß diese Kunstwerke dem Auge der Bewunderer entzogen, in so unwürdiger Umgebung liegen, beweist, daß bei den Neugriechen, wenn sie auch Muth, Verstand und List von ihren Vorgängern geerbt haben, doch der schaffende Genius nicht mehr weilt; die Blume jeder Kunst ist erstorben, und selbst von den Wurzeln derselben finden wir keine Spur mehr, so daß man auf ein neues Wachsthum nicht ferner hoffen darf.
Als wir in unsere Herberge zurückkehrten, fanden wir unsere Pferde schon vor derselben. Wir dankten unserem freundlichen Wirthe und setzten unseren Weg fort. Man durchstreifte einige Straßen, denen von Patras in malerischem Wirrwarr ähnlich; um halb sieben Uhr verließen wir die Stadt; die Sonne war prächtig über den Bergen von Korinth aufgegangen und kündigte einen sehr heißen Tag an. Am Ende des Ortes sahen wir die erste Palme, die sich majestätisch, fünf Klafter hoch über einen wüsten Kirchhof erhob. Das Sinnbild des Friedens war den Leichen entwachsen, um mit seinem schlanken Schafte den Lebenden zu zeigen wo ihre Zukunft sei. Der untere Theil der ehemaligen Blätter bildet die schuppige Rinde des Stammes, der jedes Jahr eine neue Krone ansetzt, die nur an der höchsten Spitze einen grünen, korbähnlichen Busch hat. Von der Stadt an führt der Weg langsam abwärts in eine breite mit Weingärten bedeckte Fläche, die bis an die höhern Gebirge eben fortläuft. Mehrere trockene Flußbetten mit reichen Oleanderbüschen, durchkreuzten sie, und mündeten in das Meer; die Weingärten waren voll Leben, und wir begegneten häufig Zügen von Arm und Reich in den buntesten Gewändern auf Maulthieren und Eseln reitend, entweder aus den Laubhütten mit gesegneter Rebenernte kommend oder in dieselben ziehend; diese Winzerhütten bieten ein orientalisches Bild; einige Weiber mit verworrenen schwarzen Haaren kochen das frugale Mal in denselben; vor ihnen steht der Herr in ganzer männlicher Schönheit, malerischem Kleid und reichen Waffen, die Kinder kriechen in den großen Melonenhaufen umher, die zwischen den Reben zu voller Süßigkeit und Feinheit heranwachsen, und deren Vortrefflichkeit ich hier erst kennen lernte. Daneben stehen die Gruppen der Lastthiere mit Bocksschläuchen und Körben bepackt, um den gepreßten Most und die vollen Trauben aufzunehmen; die Rebe wird nicht, wie bei uns, an Stöcken gezogen, sie bildet entweder schattige, von leichten Stangen gestützte Dächer, oder sie wirft ihre grünen Ketten von Baum zu Baum; auch schleicht sie auf der Erde hin, und webt ein frisches grünes Netz über die Ebene. Diese freundliche Fläche ist nur so lang wie die Stadt; sobald diese zu Ende ist, rücken die Berge wieder bis an das Ufer des Meeres, so daß sich der Weg zuweilen auf schwindelnden Felsen fortzieht. Wir staunten, wie geschickt die Pferde, katzengleich, ohne zu straucheln, über die steilsten Spitzen hinüber klettern; manchmal lief der Weg wirklich gefährlich an der Wand dahin, deren Fuß die Wellen bespülten, aus denen Felsenspitzen nicht sehr einladend mit ihren phantastischen Köpfen herausragten; mitunter sieht man statt der Felsen Sandkegel, die auf die bizarrste Weise ausgewaschen dastehen. Mich unterhielt es, das schalkhafte Getreibe der Wellen zu beobachten, wie sie solche Höhen bald schmeichelnd, bald stürmisch erklimmen, und ihren Grenzen einen fortwährenden Krieg erklären; die Steine sind oft wie geschliffen; der Weg ging so steil hinunter, daß wir absitzen mußten und die Pferde uns nachliefen; dies ging jedoch bald vorüber, auch ward die glühend heiße Luft durch einen Regen gekühlt. An den hohen Felswänden wuchsen meist Pinus, Lorbeer und die immergrüne Eiche, die sich nur strauchartig erhebt, und kleine glänzende mit Stacheln geränderte Blätter hat; die Frucht übertrifft an Größe bei Weitem unsere Eicheln. In unsern Wiener Gärten ist dieser Baum nicht eingeführt; doch hatte ich die Freude, mehrere Zweige, die ich mitbrachte, zu Hause Wurzel schlagen zu sehen. Die Aeste, die sich malerisch über unsern Weg beugten, waren von Schlingpflanzen umstrickt, von denen ich so viel Samen in meine Reisetasche sammelte, als ich konnte, um wo möglich davon für meinen Garten Nutzen zu ziehen. Nachdem wir noch einige Baien umritten hatten, zogen sich die Felsen weiter vom Meere zurück, und wir befanden uns auf einer zwischen zwei Buchten gelegenen Fläche, die mit Wein und Oliven bedeckt war; auch kamen wir vor dem stärksten und schönsten Feigenbaume vorbei, den ich noch gesehen habe; er stand in der Mitte eines Weingartens, seine Aeste waren mit Körben beladen voll der schönsten Früchte; unsere griechischen Begleiter stürzten auf den Baum los und versahen uns mit den vortrefflichsten Feigen und Trauben, die uns erhitzten und ermüdeten Wanderern eine wahre Labung gewährten; nur wurde leider das Maß nicht ganz eingehalten. Es giebt aber auch auf der Welt nichts süßeres und verführerisches als das griechische Obst, und besonders die honigreiche Feige.
Das Gebirge endigt unmittelbar und ziemlich gefährlich für den Reiter an einem Flusse, über den eine schöne alte Brücke führt; da jedoch derselben ein Bogen fehlte, mußten wir durch das Wasser reiten. Dann ging es eine lange Zeit durch eine schöne Fläche mit üppigen Weingärten; ein feines summendes Gezirpe begleitete uns auf dem ganzen Wege; manchmal wurde es so laut und durchdringend, daß wir es für den Gesang eines Vogels hielten, den wir, einer Wachtel ähnlich, häufig erblickten; als wir das Geschwirr aber von einem einzelnen Olivenbaume herabschallen hörten, und keinen Vogel darauf entdeckten, überzeugten wir uns, daß der Ton von einer Zikade herrührte. Den übermäßigen Durst hatten wir durch Feigen und Trauben gestillt; als sich nun aber auch der Hunger meldete, waren wir froh, von Demetry zu hören, daß sich am Ufer der sich vor unsern Augen neu aufrollenden Bai ein Häuschen befände, in dem wir unser Frühstück einnehmen könnten. Es war im Fluthensande gebaut, wenige Schritte vom Meere, dessen kühlender Wind uns zu Gute kam; denn die Hitze war außerordentlich gestiegen. Das Dach dieses Kani war durchlöchert wie der Hut eines Bettlers; die übrige Einrichtung ganz den früher beschriebenen Herbergen ähnlich. Vor den beiden elenden Gemächern des obern Stockes war ein Balcon, unter dem wir unser Frühstück einnahmen, das aus Kuchen, Eiern und kaltem Fleische bestand. Was dem Male fehlte, ersetzte die gute Laune, obwohl sich einige Stimmen erhoben, die auf mehr Reisebequemlichkeit gehofft hatten. Dr. F. klagte als echter, behaglicher Wiener über Speise und Trank; Professor G. und ich kämpften als echte Reise-Enthusiasten und Hellas-Verehrer eifrig dagegen. Unterdessen zankten und schrien unsere Führer, was uns Gelegenheit gab, den Klang der Landessprache kennen zu lernen; mich begeisterte dieselbe so sehr, daß ich mich auf den wankenden Balcon über uns schwang, und auf unsere Gesellschaft in einer Rede, die den Klang der griechischen Sprache nachahmte, herabdonnerte, was die Heiterkeit sehr vermehrte und sogar die Aufmerksamkeit der Griechen erregte. Die neugriechische Sprache entbehrt im Munde des Volkes des Wohllautes, der ihr, von Gebildeten gesprochen, eigen ist; sie erinnert an das Altgriechische; auch suchen die gebildeten Kreise die klassischen Worte immer mehr wieder einzuführen, und das slavische Element auszumärzen.
Nach kurzer Ruhe setzten wir uns wieder in Bewegung. Ich nahm mit Professor G. die Spitze der Colonne ein, und im ruhigen, innigen Gespräche brachten wir die angenehmsten Nachmittagsstunden zu. Hauptsächlich besprachen wir die magische Wirkung der Farbentöne dieses Landes; er äußerte sich als echter Künstler darüber und ich labte mich an seinem gesunden, tiefdurchdachten Urtheile; während des Gesprächs ritten wir fast immer durch den feinen Sand des Ufers, was den Reiz seiner Reden noch erhöhte. Die blauen Tiefen und hellgrünen Verflachungen des ewig bewegten Wassers fesselten uns unwiderstehlich und lieferten den Beweis, wie richtig er urtheilte; wie ergötzte es uns, in den Wellenschlag hineinzureiten und dies unerschöpfliche Schauspiel ganz nahe vor uns zu haben; welch ein Zauber liegt in der Betrachtung der sich bäumenden Wellen und ihres innern Lebens. Die stärkern unterdrücken und überrollen die schwächern, und ihre herrliche Kraft und Macht verläuft sich zuletzt sanft und lieblich auf dem glänzenden reinen Sande in einem leichten, weißen, eilig vorwärtstrippelnden Schaum; plötzlich zieht sich dann die mystische Fluth zurück und nur die keckesten Ausläufer zerrinnen auf dem Sande. Kaum glaubt man sich im Trocknen, so wälzt sich rasch eine noch mächtigere Welle, wie ein Schwarm zügelloser Pferde, heran und leckt noch weiter wie die vorige mit ihren Zungen in das Land hinein, um abermals in eitlem Schaum zu vergehen, wie das Streben einer stürmenden Seele, das Drängen eines übermüthigen unbefriedigten Gemüths, das gleich den Wellen im Sande verrinnt. Es lag ein wilder Reiz darin, die ängstlichen Pferde in das tobende Element zu führen, und die Wellen an ihren Hufen zerschellen zu lassen. Manchmal wurden die Thiere durch die Kraft der Wogen zurückgedrängt, doch brachten sie unsere Mahnungen bald wieder hinein, und wir genossen mit vollen Zügen das Leben der Fluth. Einen Augenblick wand sich der Pfad aufwärts, und es rollten sich neue Bilder vor uns auf; dies wiederholt sich, da in das Meer hineingeschobene Höhen das ebene Ufer unterbrechen; es war ein interessanter Anblick, wie die Gestalten unserer Reisegefährten sich erst auf dem gelben Sande des Gesteins abgrenzten, dann langsam hinaufklimmend auf der Höhe wie Silhouetten im Blau des Aethers erschienen und dann zwischen zwei Felsen verschwanden; die phantastischen Gestalten bildeten einen romantischen Gegensatz zu der majestätischen Ruhe der Natur. Auf einer dieser Höhen trafen wir auf die Ruinen eines Hauses, oder einer Veste, die durch die Wuth der Türken zerstört worden war.
Man findet im armen Hellas sehr häufig Spuren, die beweisen, wie furchtbar die Hand der Moslim über den christlichen Ländern gelegen hat, und wie schwer sie im Unterliegen noch Rache an den Kämpfern geübt haben; noch lange wird das Land an seinen Wunden bluten, und es wird einer festen Hand bedürfen, um es auf jenen Standpunkt zu bringen, auf dem es den blutig erkämpften Sieg benutzen kann. Von diesem Felsen herab, der wie ein Sockel im Wasser steht, gelangten wir wieder durch Buschwerk und Reben reitend an das Gestade, das wir nicht mehr verließen, bis wir um fünf Uhr in den kleinen Ort Sakoly kamen, der zur Nachtstation bestimmt war. Er ist auch im Ufersande erbaut und hat eher ein türkisches als ein griechisches Ansehen; die Rauchfänge blinkten uns wie Minarets entgegen; außer diesem kleinen Schmucke ist in diesem Dorfe alles ärmlich und auf der untersten Kulturstufe. Wieder wurde uns in der Mitte des Dorfes ein Kani angewiesen, in welchem sich ein kleines Zimmer mit zwei hölzernen Ruhebetten befand; bis das Mal bereitet war, gingen wir am Strande spazieren, und die Kühle des Abends war im Vergleiche mit der vorangegangenen Hitze des Tages so fühlbar, daß wir uns nicht lange an der immer stärker werdenden Brandung ergötzen konnten; die Sonne war herrlich untergegangen und mit dem in Griechenland so gefährlichen Temperaturwechsel trat auch die Dunkelheit ein; noch vor der Malzeit schrieb ich an meinem Tagebuche. Das unbequeme Lager und die Insekten waren schuld, daß wir erst spät einschliefen; wir waren wie die Häringe zusammengepackt, was Anlaß zu manchem Streit und manchem Scherz gab. Kaum hatte ich einige Stunden geruht, als Archivarius K. mich weckte, weil er selbst nicht schlafen konnte und sich daher langweilte; natürlich ließen wir nun auch den Andern keine Ruhe mehr; man brachte das Frühstück und eine ziemliche Zeit vor Sonnenaufgang verließen wir unser Nachtquartier.
Mir war sehr unwohl und nur aus Rücksicht für die übrige Gesellschaft zwang ich mich mitzureiten; mit Sehnsucht erwartete ich die warmen Strahlen der Sonne. Die kahlen Bergspitzen entzündeten sich in reinster Gluth; gegen Korinth wurde das Purpurband der Dämmerung immer klarer und wärmer, bis es sich endlich in dem Augenblick, als die Sonne erschien, in ein goldenes Strahlenmeer verwandelte; die See schickte im Augenblicke, als der Tag erschien, goldene Schäume an das Ufer, die Weinberge glänzten im lichtesten Grün und die Pinie schwang sich leichter in der neu belebten Luft. Doch mein Unwohlsein nahm immer zu, und eine Stunde nach Sonnenaufgang mußte ich mich im freien Felde am Strande lagern. Der liebe Dr. F. hüllte mich in Mäntel und Marinaros ein, und stellte mich so weit her, daß die Caravane nach einer Stunde ihren Weg fortsetzen konnte. Er führte längs dem immer schöner werdenden Golfe hin, zwar eben, aber durch mannigfaltiges Gestrüpp behindert; wir stießen heut öfter auf Häuser, die aber meist verlassen waren, auch biblische Brunnen sahen wir häufig nahe dem Meere. An dem Kani, wo wir frühstücken sollten, standen eine Menge Maulthiere mit Trauben beladen; meine Begleiter stürzten sogleich auf dieselben los, ich aber ging, des Reitens müde zu Fuße voraus. Gegen Mittag erreichten wir Sizia, einen kleinen Ort am Gestade, wo uns Demetry ein für diese Gegend recht nettes, bunt angestrichenes Haus anwies; eine Terrasse hatte die Aussicht auf das Meer; und das Zimmer schien ein Gemisch von orientalischem Geschmack und europäischer Civilisation; es fanden sich darin Divans, goldberahmte Spiegel, etruskische Vasen und Steh-Uhren; doch das Schönste und anregendste war die liebenswürdige Cousine des jungen Hausherrn; sie mochte wohl eine Ahnung von unserer Ankunft gehabt haben, denn ihr Feß saß zu nett auf den braunen Haaren, und der Stoff des mit Pelz verbrämten Kleides war zu prachtvoll für den alltäglichen Gebrauch. Sie schien es gern zu sehen, daß man ihre schöne Erscheinung bewunderte. Wir begaben uns in den Salon und konnten hier die Einrichtung eines wohlhabenderen griechischen Hauses betrachten. Im Orient ist Alles auf glänzende Farben und Pracht berechnet; so gab man uns goldgestickte Handtücher; doch fehlt neben dem verschwenderischen Luxus die gewöhnlichste Bequemlichkeit, während es bei uns eher umgekehrt ist. Fast in allen hellenischen Zimmern hingen die Porträts des Königspaares und der Freiheitskämpfer in einfachen hölzernen Rahmen, wie auch Scenen aus dem Kampfe gegen die Türken; die Bilder aber sind der Männer und ihrer Thaten nicht würdig, und zeugen von geringer Kunstfertigkeit.
Nach kurzer Rast setzten wir unseren Weg gegen Korinth fort, der wieder durch eine reich mit Weingärten bebaute Ebene am Meere hinführt; gegen Abend lag das stolze Akrokorinth mit der Stadt Korinth an der äußersten Spitze des Golfs vor uns. Je näher das Meer ans Ufer tritt, desto dunkelblauer wird seine Farbe und desto ruhiger seine Oberfläche. Die Bauart der Häuser, wie der Schlag und die Tracht der Menschen änderte sich in dieser breiten Ebene; Gesichtsfarbe und Züge nehmen etwas Zigeunerhaftes an, und die Bekleidung ist leicht und von genialster Unordnung; man zieht Stunden dahin, ohne daß man sich der Stadt merklich nähert. Beim Untergang der Sonne erglühte Akrokorinth und einige der höchsten Spitzen in unaussprechlicher Schönheit; andere Berge waren orangenfarb und violett, und nur die entferntesten Höhen hüllten sich in jenes mystische Schwarzblau, das die Sehnsucht und Phantasie über sie hinaus trägt. Die Farbe des Meeres war von einem Blau, wie ich es in der Natur noch niemals gesehen habe; wir ritten still und bewundernd durch die frischgrüne Farbenpracht der Ebene, zwischen der die gelbe Erde an vielen Stellen hervorleuchtete. Unterhalb Korinth flammten die äußersten Spitzen des Oelbaumes zum letzten Male in rosiger Gluth, worauf die Sonne hinter den Bergen von Patras verschwand und der stille Duft der kurzen Dämmerung über die Gegend zog.
Nachdem wir schon glaubten, Korinth sehr nahe zu sein, floh es vor uns wie ein zauberhaftes Trugbild; wir ritten und ritten und konnten es nicht erreichen; die Luft nach dem Sonnenuntergang auf der Ebene war beängstigend, und es bemächtigte sich unser wirklich ein unheimliches Gefühl. Als gerade der Uebergang zur Nacht eingetreten war, nahten wir uns endlich unserem Ziele. Schauerlich, ja entsetzlich erschienen die Ruinen und tiefen Schlünde unterirdischer Gewölbe auf dem fahlen, wüsten, gelben Boden; wir ritten in einem Meer von Steinen; aus den schwarzen Tiefen schien ein giftiger Hauch hervorzuquellen; einzelne Gestalten krochen wie böse Schatten von Trümmer zu Trümmer; es war ein Bild der Zerstörung und des Fluches – wir glaubten durch eine Stadt des Todes zu gehen; endlich kamen wir in einen etwas gesitteteren Stadttheil, wo wieder Leben zu herrschen schien. Wir hielten auf einem kleinen Plätzchen vor einem hellerleuchteten, recht gut aussehenden Hause, das uns wie ein Stern aus trüber Nacht entgegen leuchtete. Es gehörte der Familie N., bei welcher uns unser Wirth ohne unser Wissen angekündigt hatte. Wir wußten uns anfangs nicht recht in unsere Lage zu finden, bis wir zu unserem Entzücken deutsche Laute hörten. Im selben Augenblick kam durch die dunkle Nacht eine große Gestalt auf uns zu und lud uns in deutscher Sprache ein abzusitzen und bei der Familie N. die Nacht zuzubringen. Wir folgten dieser Stimme in der Wüste, die uns in diesem Augenblicke wirklich wie die eines Propheten erschien, und traten unter die Thür des Hauses; hier waren Männer und Frauen in Nationaltracht, offenbar von unserer Ankunft benachrichtigt, versammelt. Der Deutsche war ein seit mehreren Jahren hier wohnender Arzt, Namens H. Er führte uns in einen reinlichen, hübsch eingerichteten Saal im ersten Stock, und stellte uns hier der Tochter des Hauses vor. Eulalia, so hieß die Holde, erschien in einem prachtvollen Kostüme, das ihre blendende Schönheit noch hob – und Helena selbst möchte, wenn sie hätte wiedererscheinen können, die Schönheit der griechischen Frauen nicht würdiger vertreten haben. Sie war eine Glanz-Erscheinung in der ersten Jugendblüthe, ihre schlanke, hohe Gestalt im vollsten Ebenmaße zeigte das herrliche Bild südlicher Vollendung. Die Züge waren die einer antiken Kamee; auf der elfenbeinartigen Haut des Gesichts zeichneten sich mit stolzer Schärfe die dunklen Brauen über den großen, langgeschnittenen Augen, ab. Ihr prachtvolles Haar trug sie in Wellen um die blendenden Schläfe, und auf dem Haupte saß der dunkle Feß mit der langen Quaste, die um ihre Schultern spielte. Leider sprach sie nur griechisch und Dr. H. mußte den Dolmetscher machen. Ihr Vater ist Minister des Innern in Athen, und bald wird auch sie dorthin ziehen, um einen Doctor zu heirathen. In ihrer Begleitung waren noch mehrere Hausgenossen und ein Bruder ihres Vaters, der einige Monate nach unserer Anwesenheit, in einem Parteistreite, von den Bauern umgebracht wurde. Nachdem wir wieder allein waren, setzten wir uns, ziemlich ermüdet von unserem Ritte, um den Theetisch. Archivarius K. war unwohl, und Dr. H., den wir zur Tafel gebeten hatten, lohnte uns die Höflichkeit mit sehr interessanten Erzählungen über die Zustände von Hellas. Diese Erzählungen fielen nicht zum Besten der Einheimischen aus; übrigens übte er nur Wiedervergeltung; denn der Haß der Griechen gegen die Fremden ist so groß, daß sie für dieses Gefühl ein eigenes Wort in ihre Sprache eingebürgert haben; nur vor den Aerzten haben sie einen ängstlichen Respekt, weil sie von ihnen Schutz vor den fürchterlichen Fiebern erwarten, die gerade jetzt in Korinth sehr stark herrschten. Das Baden im Meere und die Luft während der Dämmerung sind gefährlich; bei der Mäßigkeit der Einwohner, und dem sonst guten Klima sind andere Uebel selten. Gefährlicher als das Fieber sind die Räuber; nach den Angaben des Dr. H. treibt der größte Theil der Bevölkerung dieses Handwerk, und es sollen sich ehemalige Genossen dieser Zunft, bis in die Hofatmosphäre erhoben haben. Da alle Männer aus dem Befreiungskriege, Palikaren (Helden) genannt, das Recht haben Waffen zu tragen, so wird ihnen das Rauben außerordentlich leicht gemacht. Oft wird mitten in der Stadt ein Haus gemüthlich belagert; so war unser Nachtquartier in Vostizza einst von einer Bande, während einer ganzen Nacht gefährdet. Reisende thun daher wohl, sich von einer Anzahl von Gensd'armen begleiten zu lassen. Werden solche gefährliche Männer eingefangen, so solle es geschehen, daß sie nach kurzer Haft zu Ehren und Auszeichnung gelangen, da die Protection und Bestechlichkeit noch größer ist, als in den gebildeten Ländern; so kommt es, daß die Höchsten des Landes nicht immer von der ausgesuchtesten Gesellschaft umgeben sind. Auch Parteiungen sollen in einem hohen und traurigen Grade das Land zerwühlen. Der Hauptstreit entspinnt sich zwischen den Familien, die sich im Freiheitskampfe ausgezeichnet haben, und die ein Surrogat für unsere Aristokratie bilden. In jeder Stadt hat eine derselben die Oberhand, während die andern sich bestreben, ihnen diese Macht zu entreißen. In Korinth sind es unsere freundlichen Wirthe, die N., welche die Wahlen leiten und eine Art Herrschaft ausüben. Diese Familie findet ihre Stütze in der Gnade des Königs; der Vater der schönen Eulalia ist, wie schon gesagt, Kriegsminister, ein Bruder desselben Palikare und Flügeladjutant des Königs. Zieht dieser die Hand von ihnen ab, so sind sie, nach der Behauptung des Dr. H., keine Stunde mehr sicher in ihren vier Mauern. Wenn auch die Erzählungen des Doctros nicht ganz von Uebertreibung frei gewesen sein mögen, so waren sie doch immer interessant, zumal da es das erstemal war, daß wir mit Offenheit über das Land und seine Gebräuche reden hörten. Als er die Schrecken des herrschenden Fiebers beschrieb, verschwand unser Archivar plötzlich, und nach vollendetem Abendessen, fanden wir ihn in starker Aufregung; er klagte über heftige Schmerzen im Knie und sah in der That fieberhaft aus; im Innern glaubte er wohl ein Opfer der schrecklichen Epidemie zu sein; er war sehr aufgeregt, wollte aber dennoch den Rath des Arztes nicht hören. Wir zwangen ihm kalte Umschläge auf, und gingen erst zur Ruhe, als er sich etwas erholt hatte. Die Betten waren breit und gemächlich, und die Einrichtung für dieses Land luxuriös; man sah, daß wir sub umbra alarum, im Hause eines Mannes waren, welcher in der Gnade des Monarchen stand. Wir schliefen nach der großen Ermüdung vortrefflich; doch trotz der schwellenden Kissen und dem goldgestickten Leinenzeug, fanden wir am Morgen die Spuren eines blutgierigen Zwergenheeres auf unsern scheckigen Körpern; Pracht und Marter nebeneinander! Schon in aller Frühe erschien der freundliche H. mit unsern Pferden, um uns nach einem kräftigen Frühstück auf das stolze, berühmte Akrokorinth zu führen. Es war fünf Uhr früh, und eine erfrischende Morgenluft ließ uns einen schönen Tag erwarten. Das zunehmende Licht zeigte uns erst recht die Trümmer der einst so blühenden Stadt, aus denen uns, trotz des mildernden Tageslichts, dennoch der Fluch des Himmels entgegengrinste. Wo waren die Paläste, wo die herrlichen Cypressenwälder, wo die zahllosen Denkmale der alten Griechen? Wo wandelten die erhabenen Gestalten der Priesterinnen? Alle Reize, die wir in den Klassikern beschrieben finden, sind verschwunden; des Menschen Geist hat aufgehört zu herrschen, und es sind nur noch die Elemente in ihrer Macht, die uns Bewunderung einflößen. Das Meer, der Himmel und die Berge ziehen unsere Blicke von der zweimal zerstörten Stadt ab, in der nur noch einzelne Ueberreste der Nachwelt die einstige Größe zeigen. Zuerst geleitete uns der Arzt zu den Trümmern des Neptuntempels; sie bestehen nur noch aus vier bis fünf niedrigen Säulen, die im Zerfallen selbst mächtig sind. Zwei derselben sind durch einen horizontalen Steinblock verbunden; einer davon droht ein baldiger Untergang, da aus dem unteren Theile ein großes Stück ausgebrochen ist, das man mit schlechten Steinchen und zerbröckeltem Mörtel ersetzt hat. Stünde der Tempel in England oder Frankreich, so würden ihn die Archäologen mit einem Glaskasten überdecken – denn wo Mangel ist, achtet man den Besitz, und wo, wie hier, die Fülle ist, beachtet man sie kaum. Man kauft hier die niedlichste etruskische Vase um ein Spottgeld, und hebt sie dann zu Hause im Museum als ein Juwel auf; auch ich versäumte die Gelegenheit nicht, einige dieser schön geformten Gefäße an mich zu bringen.
Hinter den Ruinen des Neptuntempels fängt das Erdreich an sich zu heben; wir konnten außerhalb der Stadt, bis zu den Ruinen von Akrokorinth reiten; alles um uns herum war wüst, mit Ausnahme eines mächtigen Feigenbaumes, der einen schönen türkischen Brunnen mit in Stein gehauenen Koransprüchen beschattete; ein mageres Mohrenweib füllte an demselben seine irdenen Krüge. Dr. H. erzählte uns, daß noch einige dieser Kinder des Aequators aus den Zeiten Ibrahim Pascha's hier übrig geblieben sind, während der größte Theil durch die Wuth der fanatischen Hellenen fiel. Ueberhaupt sind in Korinth die gräßlichsten Greuelscenen vollbracht worden; die Muselmänner schlachteten die Wehrlosen mit tyrannischer Hand, und sind später von den siegenden Griechen mit heißem Rachegefühl gemordet worden.
Vom Brunnen aus ward der Weg immer steiler, und bald schwebten wir dem mächtigen Felsen entlang auf schroffer Höhe; die Stadt verloren wir einige Zeit aus den Augen, und von der südlichen Seite der Höhe erblickten wir die außerordentlich starken Festungswerke, die dem steilen Eingange gegenüber stehen. Mauern, Thürmchen und Batterien sind mit kühnem Geiste und praktischem Sinne auf die einzelnen Felsenvorsprünge gepflanzt, ein der venetianischen Macht würdiges Werk. Vor dem ersten schauerlichen Thore stiegen wir von unseren Pferden ab, und mußten das Ende des mühseligen Weges zu Fuß zurück legen. Wir pochten an das große dunkle Thor und ein recht schön uniformirter griechischer Husar öffnete uns von Innen die geheimnißvolle Pforte. Durch einen düsteren Bogen, vor welchem sich die alte Fallbrücke befindet, gelangten wir an ein kleines Häuschen, das jetzt der stolzen Besatzung der mächtigen Festung zur Wohnung dient; sie besteht aus zehn bis zwölf kümmerlich aussehenden Männern, denen nach den Begriffen des Landes der Titel Soldat zukommt. Vor der Kasernenhütte lagen sechs bis sieben venetianische Kanonen ohne Lafetten, als hätten sie sich's, des langen Wartens müde, bequem gemacht. Akrokorinth ist auf der ganz unregelmäßig, sehr großen Oberfläche des Felsens erbaut und umgiebt deren Saum mit einer Mauer, auf der sich von Strecke zu Strecke kleine Thürmchen erheben. Abgebrochene Felsenstücke, große Haufen von Trümmersteinen, nackte Wände kleiner Häuschen, einzelne Kanonen, Menschen- und Thierknochen liegen hier im buntesten Gewirre durcheinander; von irgend einer Ordnung oder von gangbaren Wegen ist keine Rede. In einer der vielen Felsenvertiefungen, in der Nähe des Einganges, befinden sich die meisten Häuserruinen, und in ihrer Mitte eine kleine Kapelle, um welche Feigenbäumchen sprossen. In diesen Hütten suchten die Einwohner von Korinth eine Zufluchtstätte, nachdem die Griechen die Festung das erstemal den Türken abgerungen hatten. Dr. H. machte uns auf zwei, zwischen diesen Trümmern häufig wuchernde Pflanzen aufmerksam: die eine ist die giftige Eselsgurke, deren Früchte bei der geringsten Berührung die Samenkörner mit großer Gewalt herausschleudern, was dem Unvorsichtigen, der das Auge darüber hält, augenblicklich die Sehkraft kosten kann; ich schloß die meinen und stieß mit dem Fuße an die Frucht, worauf ich die Samenkörner an den obern Theil meines Hutes anprallen hörte. Die andere Pflanze umspann das Gestein mit schönem dunkelgrünem Laube; ihre Blüthe war von zauberhafter Weiße und mit einer zahllosen Menge feiner Staubfäden gefüllt; der sanfte liebliche Geruch entsprach der zarten Blume; die Frucht war länglich und gleich einer kleinen grünen Gurke, das Innere derselben war mit rothen Körnern gefüllt. Doch weder Blume noch Frucht geben der Pflanze ihre Bedeutung, sondern die kleinen dunkelgrünen Knöspchen, welche unter dem Namen – der Leser hat es wohl schon errathen – der Kapern auf den europäischen Tafeln ihre Stelle finden.
Wir hatten noch ein gutes Stück längs der Umfangsmauern zu ersteigen, bis wir endlich auf der höchsten Spitze Hellas, wie auf einer Karte ausgebreitet, vor uns liegen sahen. Gegen die tiefliegende Stadt gewendet, sahen wir das dunkle, schmale Band des Isthmus, zwischen zwei von der Sonne beleuchteten Spiegelflächen, die wie zwei, gegen einander gestellte Hyperbeln anzusehen waren. Diese fruchtbare Landenge ist leider unbewohnt und unkultivirt, und nur einzelne Pinienwälder unterbrechen die Fläche des gelben Bodens, der als unbenutzter Schatz daliegt. Es war im Plan, die Landenge mit Deutschen zu bevölkern; doch scheiterte derselbe durch Mangel an Energie der Regierung, dem Fremdenhasse der Griechen gegenüber. Deutscher Fleiß hätte ein ganz schönes Ländchen für die Kultur erobern können, und die vierhundert dazu bestimmten Familien, würden den Nachbarn gezeigt haben, wie reich und wie glücklich man auf einem solchen Boden werden kann.
Die Breite des Isthmus, an sich unbedeutend, schrumpft von hier oben gesehen, noch mehr zusammen. Jenseits des Meeres erhoben sich, unmittelbar am Ufer, himmelhoch die Gebirge von Rumelien und Livadien; die Felsen sind von Bäumen entblößt, der Sonne widerstandslos ausgesetzt, erhalten aber dadurch jene zaubervolle, rosige Gluth, die je nach der Entfernung vom Violett ins Schwarzblau überzugehen scheint. Die Berge können, wie die Menschen, gemein oder würdevoll erscheinen; die Höhen von Hellas erheben sich in edlen Formen, wie seine antiken Heldengestalten; ein Helikon, ein Libetrius, eine Cythero, ragen wie die Manen einer schönen Zeit hervor. In der Richtung von Salamis und Athen hinderten uns Dünste die Gegenstände genau zu unterscheiden; an den gegenüber liegenden Ufern des Meeres sahen wir an unserer Seite des Isthmus, Lutraki, eine kleine Ansiedlung mit einem Dépot des östreichischen Lloyd und einem für die Passagiere des Dampfers bestimmten Wirthshause; jenseits der Landenge liegt Kalamachi, wo die Reisenden wieder von einem Dampfer aufgenommen werden, um nach Athen zu gelangen. Zu unseren Füßen lag Korinth, von dieser Höhe betrachtet, weniger schreckhaft, und trefflicher zu übersehen, wie auf jeder Karte; man sieht von hier mehrere Thürme, mit denen die Türken die Stadt umgeben haben. Der Boden senkt sich von der Stadt sanft zum Meere herab, das ungefähr in einer kleinen halben Stunde zu erreichen sein mag. Vom Felsen von Akrokorinth bis gegen Sigia, erstreckt sich eine ziemlich bedeutende Ebene, auf der, gegen das Meer zu, große, frische Weingärten liegen, während sich, dem Gebirge von Morea zu, ein Olivenwald wohl eine Stunde weit zieht, dessen Früchte den verschiedenen Eigenthümern jährlich eine Gesammtsumme von 50,000 Thlr. einbringen sollen. Die Bäume dieses Haines sind auf eine ziemliche Entfernung von einander, gesetzt und gleichen an Höhe und Form großen Weiden; ihre Farbe ist ernst, und je nach der Sorgsamkeit der Pflege, farbloser oder dunkler; in Dalmatien, so bei Ragusa, wo man den Oelbaum mit besonderer Umsicht behandelt, hat das Blatt einen dunklen, grünblauen Ton. – Die Ebene vor uns verläuft südwärts in einen schauerlich felsigen Engpaß, durch dessen Mitte die Straße nach Nauplia einem Flusse entlang führt. Der Blick, der uns in das Innere von Morea geöffnet war, fiel auf hohes Gebirg, das aber in ungünstiger Beleuchtung farblos und wild erschien, obwohl seine Umrisse höchst interessant sind. Der Gesammteindruck des Rundbildes war erhaben, wild und einsam; nur selten gewahrte man die Spuren der Menschenhand; besonders sah Morea wie eine stille Urgegend aus, die der Mensch noch nicht geknechtet hat. Da unsere Zeit sehr beschränkt und der Weg nach Nauplia lang war, so mußten wir diesen reichen Punkt bald verlassen, nahmen aber unseren Rückweg zum Eingangsthor auf der entgegengesetzten östlichen Seite, von der man Morea und den andern Theil der Festung bequem übersehen kann; er führte uns an einem, in den Felsen gehauenen Brunnen mit trefflichem Wasser vorbei, an dem Korinth überhaupt reich ist; auch eine kleine Kaserne, in der einst Baiern hausten, stieß uns auf; sonst war Alles nackt und felsig. Einige Soldaten schlichen in schrecklicher Uniformirung herum. Der Grieche in Nationaltracht und der Grieche in fränkischer Uniform sind himmelweit verschieden; so stolz, schlank und graziös er in Fustanella und Feß erscheint, so ärmlich, mager und erbärmlich sieht er in der Uniform aus. Durch dasselbe Thor, durch das wir eingetreten waren, verließen wir die Festung, welche die Griechen den Türken nur durch List zu entreißen vermochten. Schade, daß dieses große Werk der Venetianer nun gänzlich zu Grunde geht. Die Mauern zerfallen, und aus den meisten Kanonen mit dem stolzen Markuslöwen ließ die Regierung Geld prägen. Akrokorinth gegenüber ragt zwischen dem Gebirge von Morea noch eine Felsenspitze mit einem festen Schlosse hervor, das der Familie N. gehört. Wir legten den steilen Theil des Rückweges zu Fuße zurück; erst in der Nähe des türkischen Brunnens bestiegen wir unsere Pferde wieder. Vor dem Hause N. fanden wir den Archivarius und Professor G., die großer Ermüdung wegen in der Stadt zurückgeblieben waren; sie hatten sich die Merkwürdigkeiten derselben besehen, und hatten so viel davon zu erzählen, daß mein Bruder, Dr. F. und ich beschlossen, sie in aller Eile noch zu besichtigen. Dr. H. führte uns eine Stiege hinauf in einen halbkreisförmigen Felsenausschnitt von ein bis zwei Klaftern Tiefe, unter dessen Vorsprung die berüchtigte Grotte der Aphrodite liegt. In der Mitte derselben befindet sich eine schmale, niemals ergründete Oeffnung, aus der eine Quelle des frischesten Wassers hervorsprudelt und in einer Aushöhlung des Felsens etliche Schuh über den Grund herabrieselt. In dieser Quelle badeten die zweideutigen Priesterinnen der Venus, deren Tempel gerade über dem Felsenabhange stand; jeder berühmte Grieche, besonders Feldherr, mußte ein Mädchen als Priesterin in diesen Tempel stiften. In dem Innern der Höhle verbreitet das frische Wasser eine wohlige Kühle, mit der das sanfte Plätschern lieblich harmonirt; den Boden bedeckt der feinste Sand, und aus allen Felsspalten sproßt frisches Grün; von der Höhe, wo einst der Tempel stand, senkt sich zu beiden Seiten der Boden allmählig in Hufeisenform herab, so daß man vom Lande aus im Innern der Höhle nicht gesehen wird und nur die herrliche Aussicht auf das Meer genießt. In der Türkenzeit baute ein Pascha dorthin, wo der Tempel einst stand, einen Palast und ließ eine Steintreppe in den untern Raum führen, den er als Bad benutzte. Nun sind Tempel und Palast verschwunden, vor Gottes Zorn über diese sündige Wirthschaft, und die Gärten, Tempel und Theater sammt den 300,000 Einwohnern des alten Korinth sind zu Staub und Schutt geworden. Das jetzige Korinth ist nicht größer als ein deutsches Dorf.
Als wir zurückkamen, stand die schöne Eulalia unter dem Thorbogen, und bezauberte Alle mit ihren Blicken; wir verabschiedeten uns bei ihr, dankten für die gütige Aufnahme, schwangen uns auf die Pferde und ritten gen Nauplia; nur Professor G. saß nicht auf und glaubte zu Fuße leichter fortzukommen; doch außerhalb der Stadt arbeitete er sich mit Mühe und unter fremder Hülfe auf den Sattel; wir brachten ihn auf, behauptend, er habe die Lust am Gehen nur vorgeschützt, um nicht vor den Augen der Braut von Korinth die Sattelhöhe stürmen zu müssen. Es war wirklich gut, daß wir aus Eulaliens Bereich kamen; denn die Gestalt dieser Zauberin hatte berückend auf uns Alle gewirkt. Diesmal begleitete uns eine größere Anzahl Gensd'armen, weil die Felsschluchten, die wir zu durchziehen hatten, den Räubern willkommene Schlupfwinkel bieten. In Nauplia erfuhren wir später, daß die Nacht vor unserer Durchreise, eine Gesellschaft von achtzehn Personen in einem dieser Engpässe geplündert worden war. Das Rauben ist in Griechenland eine hergebrachte Sache. Es scheint, daß die Moralität der Griechen nicht durch die Ideen von König, Vaterland und Nächstenliebe gehoben wird; der eigne Vortheil ist ihr Leitstern; sogar die Heirathen werden nicht aus Liebe, sondern durchgängig aus Convenienz geschlossen, und der Gedanke, an Andern ein Unrecht zu begehen, verschwindet vor dem Vergnügen, den eigenen Säckel zu füllen.
Bald hatten wir die wüste Ebene von Korinth auf schlechten, steinigen Wegen durchschritten; an dem Flusse angekommen, befanden wir uns in einem schmalen Thale, das wir bis Nauplia nicht mehr verließen. Die Höhen rechts und links vom Wege sind pittoresk, aber kahl und schauerlich; nur selten erfreuten uns Piniengruppen und Oleandergebüsche im Flußbette; wie begreift man, daß hinter diesen Feldern von Felsstücken, diesen unzähligen Erhöhungen und Schluchten, der Räuber das bequemste Spiel hat! Die kleinste Schaar kann aus sicherem Hinterhalt die Reisenden überfallen und wenn's Noth thut, spurlos verschwinden machen. Man kann sich keine Gegend vorstellen, die mehr den Stempel des Schreckens und der wüsten Rauheit an sich trägt. Der Karst allein wäre mit dem Anfang unseres Weges zu vergleichen. Von Zeit zu Zeit fanden wir Piquets der Land-Miliz zu unserem Schutze aufgestellt; wir zählten deren sieben; die guten Leute aber sahen in der ärmlichen Landestracht, mit den langen Flinten bewaffnet, so wenig einladend aus, daß wir das erste Piquet für einen Haufen Räuber hielten. Leider machten wir die Bekanntschaft von erklärten Wegelagerern nicht, obwohl mancher dieser Genossenschaft bei uns vorbeigeschlichen sein mag; aber die Gensd'armen verdarben ihnen die Lust; jeder von uns hätte seine heimliche Freude an einem kleinen unschuldigen, urwüchsigen Abenteuer gehabt. Zur Entschädigung kreisten fünf mächtige Adler über unseren Häuptern, und zwei von ihnen hatten die Gewogenheit, uns so nahe zu kommen, daß man jede Feder unterscheiden konnte; dies waren die würdigen Bewohner dieser Steinwüste. Wir hofften an einem derselben die Gewehre prüfen zu können, die wir auf der ganzen Reise mitgeschleppt hatten; doch ehe wir angelegt hatten, waren die Fürsten der Luft der Schußweite entschwunden. Die Hitze war so unerträglich geworden, daß ich meinen Durst an dem Wasser eines romantisch gelegenen, halb verfallenen Mühlenkanals löschen mußte. So schön die Oleander und Reben waren, die diese Fluth umfächelten, so wenig rein und klar war diese selbst. Endlich öffnete sich das schmale Thal und stieg sanft zum Gebirge aufwärts. Ich ward hier lebhaft an unser heimisches Alpenland erinnert, namentlich an das Naßfeld bei Gastein; doch nur an die Punkte, wo die Baumvegetation und die frischen Wiesen aufhören. Hier war es, wo wir eine große Heerde uns unbekannter Ziegen trafen, die, wie die »King Charles« Hunde, lange schwarze, glänzende Haare mit feuerfarbener Zeichnung hatten. Es wäre der Mühe werth, diese schöne Race bei uns einzuführen. – Gegen Ende des Thales nahmen wir unser Gabelfrühstück im Hause eines Gensd'armerie-Piquets neben einer Kapelle, ein. Diese unglücklichen, von einem Feldwebel kommandirten Menschen werden nur alle sechs Monate abgelöst; in dieser Gegend eine Ewigkeit! Der größte Theil der Mannschaft hatte das Fieber, und auch der Kommandant, ein sehr hübscher, freundlicher, junger Mann mußte schwer an dieser Krankheit leiden. Er empfing uns mit großer Artigkeit, und wollte sich uns auf alle mögliche Weise verständlich machen, was ihm aber doch nicht gelang; seine Freude war jedoch groß, als Archivarius K. eine an die Wand geheftete Verordnung, mit Hülfe des Altgriechischen, laut zu lesen und zu übersetzen versuchte. Sein Zimmer, in dem wir frühstückten, war mit den verschiedenartigsten kleinen Kupferstichen und Holzschnitten behangen, was immerhin beweist, daß der Bewohner Bücher in der Hand gehabt haben muß. Die Kapelle neben dem Hause bestand, wie alle griechischen kleinen Gotteshäuser, aus nackten, höchstens vier bis fünf Schuh hohen Wänden, die durch eine lochartige Thüre unterbrochen werden; an der Seite steht auf einem Steine ein hölzernes, meistens mit Heiligen bemaltes Kästchen, das die Stelle einer Armenkasse vertritt; es muß eine große religiöse Scheu dem sonst so räuberischen Volke innewohnen, da nicht das kleinste Kettchen die Brettertruhe an den Stein befestigt. – Nach einer Rast von ungefähr einer Stunde setzten wir unseren Weg fort; bald hatten wir eine stolz geformte Gebirgskette dicht vor uns. Das Thal hatte sich nun zur Schlucht verengt, und wieder war rechts und links vom Flusse alles mit Felsenstücken übersäet, die aber nicht aller Vegetation entbehrten, wodurch die Landschaft zwar rauh, aber nicht mehr so traurig erschien; die Schlucht wurde immer enger, die Quelle des Wassers, das wir lange verfolgt hatten, schien in der Nähe einer Mühle dem Boden zu entspringen; diese lag da wie eine Oase, ein kleiner Raum voll fetter, bewässerter Erde, von Tausenden grüner Felsspitzen umgeben, von denen sich das herrliche dichte Laub der Granaten, Feigen, Reben und das hohe Rohr sonderbar abhob. Um die Mühle sprudelten eine Unzahl von Wässerchen; Olivenbäume neigten freundlich ihr schattiges Haupt, und Hühner pickten eifrig auf der freigebigen Erde. So schattig und südlich erschien alles dem Ankommenden, daß es ihm ein Ersatz für die Steinöde ringsum war. Wir stärkten uns mit trefflichem Wasser und verließen die freundliche Oase, die mit Ruinen von im Freiheitskampfe zerstörter Häuser umgeben war. Dieser Engpaß bildete den Schauplatz einer fürchterlichen Metzelei; Tausende von Türken fielen hier durch das Racheschwert der Griechen. Unser Weg wendete sich ein wenig, und wir gelangten auf eine schmale Straße, auf welcher wir uns zwischen himmelhohen Gebirgen durchwanden. Die bei der Mühle entspringende Fluth fließt in den Meerbusen von Lepanto, während wir sogleich zu einer von den schönsten Sträuchern umgebenen Quelle kamen, deren zum bedeutenden Bache angeschwelltes Wasser, das wir bei zwanzigmal zu durchwaten hatten, sich in den Golf von Nauplia ergießt; die Wasserscheide ist daher außerordentlich schmal; der Weg blieb noch eine lange Strecke von den langsam absteigenden Gebirgen eingeengt; die Wildheit der Gegend hatte jedoch schon bei den Quellen des Baches geendet, die Felsen verschwanden, und das üppigste Gebüsch umgab das Wasser, das wir scherzweise den Amphibien-Bach nannten, da er von Fröschen und an seinen Ufern lagernden Schildkröten wimmelte; diese wurden besonders häufig, als sich der Paß wieder zum Thale erweiterte und sich rechts und links vom Flusse dürre, mit kleinem Buschwerk bewachsene Felder ausbreiteten. Als ich Demetry fragte, warum das Volk diese Thiere nicht zur Speise verwendete, gab er mir zur Antwort, daß man sie für heilig halte. Die Engländer aber lassen sich durch diesen Glauben nicht abhalten, ihre Schiffe damit zu beladen, und sie nach Alt-England zur Bereitung der leckeren turtle soup zu bringen. Da sie einen Monat ohne Nahrung aushalten, so bekommen sie unterwegs nichts zu fressen. Auch wir nahmen einige mit; die Kleinsten waren größer, als das Innere der Hand, die Größten über einen Schuh im Durchmesser; es war nicht ganz leicht, diese Thiere zu fangen, da sie trotz ihres unbehülflichen Baues ziemlich schnell fortkommen.
Das Thal zog sich noch einige Stunden gleichförmig dahin, bis wir endlich um vier Uhr, ziemlich ermattet, den Ausgang erreichend, eine herrliche Aussicht genossen. Es war ein schöner duftiger Nachmittag; die Sonne glänzte im blauen Aether und warf deutliche Schatten auf die schöne Ebene von Napoli di Romania, das in hellen Farben glänzte. Die das schmale Thal bildenden Bergketten liefen zur linken Seite in malerischen Bogen, bis an den klaren Spiegel des Golfs, und endeten in dem schön geformten Palamides, dessen Fuß an der Meerstadt Nauplia wurzelt. Jede Zacke dieser gekrönten Höhe zeichnete sich auf dem blauen Hintergrunde ab. Rund um denselben schimmerte es von Häusern und mächtigen Bäumen, die im lieblichen Farbenspiel verschwammen; gerade vor uns breitete sich die gesegnete Ebene bis an den Rand des Meeres aus, und erinnerte mich an die lombardischen Gefilde; Bäume, Weingärten und Felder wechselten hier im buntesten Gewirre; zur Rechten schloß der stolze Argos, dessen festes Schloß ebenfalls auf einem Felsen ruht, die Bergreihe; der Ort Argos lehnt sich an dessen Fuß. Jenseits des schönen Golfes zeigen sich in dunklen Umrissen die Gebirgsketten, deren letzte Ausläufer das Kap St. Angelo und das Kap Matapan bilden; zu unsern Füßen, kaum ein paar hundert Schritte entfernt, lag am Fuße des Berges Mycene, die ehemalige Residenz Agamemnons; – jetzt ist sie ein kleiner verfallener Ort auf einem wüsten Abhange. Ein Felsen birgt die Höhle, in welcher der Atriden Sohn begraben sein soll. Leider durften wir das alles nicht näher betrachten, da die Entfernung bis Nauplia zu groß war.
In einem Hause, am Beginne der Ebene, die nun vor uns lag, fanden wir zu unserer angenehmen Ueberraschung den östreichischen Konsul, welcher nach seiner Aussage, seit achtundzwanzig Stunden mit einigen Wagen auf uns gewartet hatte und zu befürchten anfing, daß wir, wie unsere achtzehn Vorgänger, von Räubern angepackt worden seien. Der Mann war italienischer Race; er trug einen blauen Paradefrack, und auf den Haaren ruhte eine Kappe, wie sie die Marine-Offiziere tragen, doch mit einem ungeheuren Lederschirm versehen; seine außerordentliche Beweglichkeit verrieth seine Nationalität, und wurde durch eine merkwürdige Zungenfertigkeit unterstützt; wir erfuhren später, daß er, außer dem Amte eines Konsuls, auch noch das eines Apothekers verwaltete; ich werde ihm für seine Aufmerksamkeit, uns Wagen entgegen zu bringen, ewig dankbar sein; denn wenn wir auch über Stock und Stein ganz jämmerlich und halsbrecherisch tanzen mußten, so war es doch eine Wohlthat, nach dem ermüdenden Ritt auf schlechten Satteln, von Sonnengluth gebraten, fahren zu können. Wir waren bei vortrefflicher Laune und schickten uns lachend in die kleinen Unannehmlichkeiten unserer Lage. Mein Bruder, Fürst J., Baron K. und ich nahmen eines dieser gebrechlichen, wankenden und schwankenden Wägelchen mit Sturm ein. Wir preßten uns möglichst in den engen Raum zusammen, und fort ging's in sausendem Galopp; die alten Gäule streckten und reckten ihre Glieder, und unser Hypolitos erhielt sie mit einer langen Gerte und furchtbarem Geschrei in Bewegung. Denkt man sich unter unserem Pferdelenker einen schlanken, athletisch gebauten Helenen mit dem antiken Götterfunken auf der hohen leuchtenden Stirne, so ist man ganz auf dem Holzwege; er erhob sich kaum einige Schuh über die Erde, ersetzte jedoch, was ihm an Größe fehlte, durch ein ungeheures Feß, das er anders, als seine griechischen Brüder, wie eine phrygische Mütze steif aufgestülpt trug; eine schwarze Kravatte schnürte ihm den Hals zu, aus der, gleichfalls der Landestracht ganz fremde Hemdkragen, wie Scheuleder hervorragten; im Uebrigen war er mit der Fustanella, dem Spencer und den Gamaschen bekleidet. Baron K. suchte ihm auf italienisch, welches die Verbindungssprache im Oriente ist, begreiflich zu machen, daß er nicht so unsinnig über alle Hindernisse dahin jagen solle; er aber hieb immer mehr in seine Renner ein und erschreckte sie durch mißtönendes Geheul; bald entdeckten wir, daß er weder seine Thiere, noch die Richtung, die wir bei dieser steeple chase einhalten sollten, sehen konnte, da sein großer Lederschirm weit über seinen Augenpunkt hinaus ragte; plötzlich erhob er sich, streckte das Kinn mit dem rothen Bart weit vor, faßte seinen Schirm mit beiden Händen und blickte mit Erstaunen auf die rasenden Gäule herab; dann wendete er sich zu uns und fragte uns – in deutscher Sprache, ob es uns gefalle, etwas langsamer zu fahren. Baron K. versicherte ihm, daß dies unser heißester Wunsch sei. Wir erfuhren nun, daß er von baierischen Soldaten etwas deutsch gelernt hatte; seit der Emanzipation vom deutschen Joche! und dem neu angefachten Fremdenhasse schien er seine Studien ziemlich vernachläßigt zu haben. Kurz vor der Stadt, bei dem Anfange einer schönen Allee, hielten wir, um die Ruine der altgriechischen Festung Tyrene zu besehen. Ihr Ursprung verliert sich in die Zeit der Mythen, und die Mauern scheinen Cyklopen-Arbeit; man glaubt sich eher in einem Haufen von vulkanischen Auswürfen, als in einem von Menschenhänden zusammengestellten Baue, und die Vollbringer desselben machen dem Geburtsorte des Herkules alle Ehre; aber der Tag begann schon zu sinken und wir konnten uns auch hier nicht so lange aufhalten, als das Interesse des Ortes es erfordert hätte. Die obenerwähnte Allee giebt dem Eingange von Nauplia ein civilisirtes Ansehen; wir hielten am Thore, um die Stadt zu Fuß zu durchwandern; leider aber dunkelte es schon – dennoch schien uns Räumlichkeit und Bauart der Festung, Patras zu übertreffen, und eher das Gepräge eines italienischen Städtchens zu tragen, was bei Patras nur in der äußeren Lage der Fall ist; dieses ist aber viel herrlicher und von der Natur begünstigter gelegen, als Nauplia. Da die Nacht uns nicht erlaubte in Einzelnheiten einzugehen, so ließen wir uns zum Hafen führen, wo uns eine Barke des uns vorausgeeilten werthen »Vulkan« aufnahm und an Bord brachte.
Das Gefühl, das uns bei dem Betreten unseres Schiffes beschlich, war, als ob wir nach langer Trennung, in das heimathliche Haus zurückgekehrt wären; wir freuten uns Abends, nach merkwürdig durchlebten Tagen, auf das Verdeck zu treten, und dann in stiller Nacht, in den kleinen traulichen Kabinen unsere Gedanken zu sammeln, und die frisch und mannigfaltig eingeprägten Bilder vor unserem Geiste vorbeiziehen zu lassen. Nirgends läßt sich's besser nachdenken, als in solch einem kleinen Bretterraum, zwischen Himmel und Wasser, und jedem Philosophen möcht' ich rathen, seinen Wohnort in dem Winkel eines Schiffes aufzuschlagen. Im sogenannten Räderkasten, in welchem wir gewöhnlich unsern Imbiß einnahmen, fanden wir das herrlichste Obst, welches die Frau des Apotheker-Consuls dem Kapitän übergeben hatte; ein wahres Wunder der Natur war darunter, eine zwei Schuh lange Traube, die uns natürlich an das Prachtexemplar von Kanaan erinnerte, welches die mannaphagen Hebräer von Kanaan in ein eben so gottseliges Entzücken gebracht haben mag, wie uns. Wir hingen dieses Wunder der Naturkraft unangetastet an die niedere Decke des Raumes, so daß die unteren Beeren bis auf den Tisch reichten. Als ich am späten Abend auf das Verdeck trat, schien der Mond in südlicher Pracht auf den Golf und dessen romantische Ufer; seine Strahlen tanzten sanft auf den leicht bewegten Wellen, hinter denen aus dem mystischen Dunkel einer südlichen Nacht die Dächer und Spitzen der Stadt hervorragten, über der sich, gleich einem riesigen Wächter, der graue Palamides erhob. In der Mitte des Silberspiegels lag, von den Wellen sanft bespült, das vom geisterhaften Mondlicht erleuchtete Festungswerk If, dessen Bauart und Name den türkischen Ursprung verräth. Jetzt ist dieser, auf kleinen Riffen sich erhebende Thurm, ein Gefängniß. Es war ein Bild wie aus einem Walter Scott'schen Roman, und jeden Augenblick erwartete man den taktmäßigen Ruderschlag eines Retterbootes; doch heute Nacht mußten die armen Gefangenen vergebens seufzen, und ich glaube auch, daß sich unter diesen hier kaum einer befand, der würdig gewesen wäre, der Held eines Romans zu sein. – Bald ward es auf dem Verdecke immer stiller; der Schlaf breitete seine Fittige über die lustigen Reisenden; zuweilen nur hörte man halb im Traum, das beruhigende: »Alles wohl« des wachsamen Nachtpostens. Erst am hellen Tage erwachte die Gesellschaft zu neuen Unternehmungen gestärkt; der Vormittag war der Besichtigung von Nauplia bestimmt. Die Stadt bestand schon, wenn auch ohne Bedeutung, unter den alten Griechen; ihre großartigen Festungswerke verdankt sie dem überall schaffenden Geiste der venetianischen Republik, und auch über ihren Thoren prangt der Markuslöwe mit seinen sich weit ausbreitenden Schwingen. Den türkischen Händen wurde sie durch die Griechen entrungen. Hier war es, wo sie ihren neuen Herrscher zum erstenmale begrüßten, welcher lange Zeit in einem schlichten Hause auf einem kleinen Platze dieser Stadt residirte, und erst in den folgenden Jahren, Athen zu seiner Hauptstadt erkor. – Zuerst wurde das Arsenal besichtigt; es steht auf dem von den Venetianern schon dazu bestimmten Platze. Da die Griechen alle Kriegsbedürfnisse aus dem Auslande kommen lassen, so genügen die an den Umfangsmauern aufgestellten Hütten, um die beschädigten Waffen auszubessern, und allenfalls einige Kleinigkeiten neu anfertigen zu lassen. Die Räumlichkeiten sind keineswegs sehenswerth, und nur als rührende Bestrebung eines so lang unterdrückten Volkes kann dieses Arsenal denjenigen interessiren, der Antheil an dem Aufkeimen des Hellenenreiches nimmt. Da die Kommandanten die Güte hatten, uns überall herumzuführen und Alles zu erklären, so machte Fürst J. als ausgezeichneter Militär einige Bemerkungen, die ihnen sehr schmeichelhaft waren. Von hier gingen wir durch Straßen, die schon anfangen das Gepräge des Orients zu tragen, nach dem Landthore der Festung, und waren nach einer kleinen Strecke am Fuße des berühmten Palamides. Mächtig und stolz steigt der Fels aus dem Schoße der Erde; nur von einer Seite steht er mit der Gebirgskette in Verbindung; seine Farbe spielt vom Gelb in das Rothe, hin und wieder umwuchert ihn der fleischige, gelbblühende Kaktus, dessen Frucht von den Einwohnern sehr gerühmt wird. Gegen die Meerseite führt die, mit einem Parapet versehene und mit Batterien bespickte Marmorstiege zur Festungskrone hinauf; leider trübte sich das Wetter immer mehr, und zuletzt fiel gar ein feiner Regen. Wir ließen uns aber doch nicht abhalten, die 692 Stufen, die in das Innere des Adlernestes führen, unter der Leitung des Kommandanten zu erklimmen. Eine Wache griechischer Jäger empfing uns an der Pforte. Von den oberen Batterien übersieht man die Stadt in Vogelperspective. Dieselbe verbindet sich mit dem Fuß des Felsens und breitet sich auf einer Landzunge aus, die der Golf umspült. Die Häuserhaufen scheinen uns von diesem Standpunkt, für das so arm bevölkerte Land, ziemlich bedeutend; vor unseren Augen entwickelte sich ein enges Netz von Straßen und Plätzen, in denen die Bevölkerung emsig hin und her zog – Kirchen, Häuser, Baumplätze, alles erschien kleiner, als es ist, scharf begrenzt von den mächtigen Venetianer-Mauern, und der Stadtplan konnte nicht deutlicher aufgenommen werden, als er uns von der Höhe des Palamides erschien. Von der Stadt aus führt eine Erdenge zwischen Meer und Felsen zur Ebene, von der aus sich eine zweite Stadt mit freundlichen Häusern an den Berg zu lehnen scheint. Am Fuße dieser neuen, mit Gärten umgebenen Ansiedlung, steht ein großer Felsblock, in dessen eine Seite das kolossale Bild eines verwundeten Löwen gehauen ist. Es wurde von König Ludwig zur Erinnerung an die in Hellas gefallenen Baiern errichtet. – In der Ferne sahen wir durch einen leichten Nebelschleier Argos und die felsigen Riesenmauern, aus denen wir Tags zuvor durch einen schmalen Thorweg herausgetreten waren. An der Rückseite des Palamides erheben sich noch höhere Gebirge, die vom Inneren der Festung nur durch einen großen, in Stein gesprengten Graben getrennt sind. Nach der neueren Taktik müßte zur Sicherung des Platzes ein Außenwerk auf dieser dominirenden Höhe angebracht werden; doch hier kämpft man noch Mann gegen Mann den muthigen Kampf des Alterthums, und schickt sich nicht die von ferne zerstörenden Geschosse zu; auch ward der Palamides von den Venetianern nur wegen der Sicherung des Hafens befestigt. Das Innere des Platzes ist mit Wohnhäusern und Kasernen angefüllt, die auf dem unregelmäßigsten Boden stehen; fast so bemerkenswerth, wie die mächtigen venetianischen Ruinen, ist die maßlose Unordnung, die hier herrscht; die Soldaten sehen wie die Hühnerdiebe aus, und selbst der Kommandant hatte etwas Rohes und Ungebildetes. – Nachdem wir das ganze Terrain mit seinen Bastionen, Erhöhungen und Vertiefungen abgegangen hatten, stiegen wir die vom Regen schlüpfrig gewordenen 692 Stufen wieder herab und durchwanderten dann die Straßen der Stadt. Die Häuser sind fast alle hoch und schmal, und in jedem Stockwerk mit einem Balcon versehen; zu ebener Erde sind offene Buden, die an den engen, finsteren Straßen hinlaufen. Die ziemlich zahlreichen Kirchen sind im alt-byzantinischen Style erbaut; auch ein katholisches Gotteshaus von ziemlich unkirchlicher Außenseite ward uns gezeigt. Der Konsul sagte uns, daß die Katholiken in dieser Stadt auf jede Weise verfolgt werden. Die Altkirchler verbreiten die lächerlichsten Mährchen über sie; so erzählen sie, daß die Geistlichen jeden Sterbenden beim Administriren erdrosseln. Die Bevölkerung stört den Gottesdienst, wo sie nur kann. Auf einem der kleinen Plätze sahen wir einen ziemlich plump gearbeiteten Marmorsarkophag, der die Reste Ypsilantis enthält, und diesem Helden von seinem Bruder gesetzt worden ist. Das Haus und der Platz, wo König Otto gewohnt hat, sind unbedeutend, hingegen interessirte uns ein anderer, auf dem noch Häuser aus der Türkenzeit stehen, die nur noch durch ein Wunder zusammenhalten; denn die Stützen und Gitter der balconartig hervorragenden ersten Stockwerke – einer Bauart angehörend, die wir später in Smyrna verherrlicht sahen – waren zum Einstürzen morsch und faul; dennoch ist der Anblick dieser bizarren Formen und lebhaften Farben malerisch. Schon dies Alles erfüllte meine Phantasie; wie aber ward sie angeregt, als ich aus einer der wenigen Oeffnungen eine schöne, in schwarze europäische Kleidung gehüllte Dame herausblicken sah! Ein schlanker Mann im französischen Frack stand hinter ihr; woher diese traumhafte Erscheinung kam, blieb uns unerklärt; höchstens könnte ein Engländer-Paar die Idee fassen, sich unter diesen Trümmern begraben zu lassen. Auf einem der Festungswälle, unmittelbar am Meere, steht eine herrliche dreihundertjährige Dattelpalme, deren imposante Höhe sich aber leider nicht ganz geltend machen kann, da ein großer Theil des schlanken Stammes, in der Erde verschüttet ist; auf unseren Wunsch, einige der in der Krone wachsenden Früchte zu erlangen, stieg ein langer Grieche, in weiten blauen Pluderhosen, mit großer Fertigkeit den schlanken Stamm hinan, und warf die grünen Früchte, zum Jubel der untenstehenden Bevölkerung hinab. So schön das Klima ist, so werden die Datteln doch nicht ganz reif und fallen nutzlos zur Erde. Unmittelbar neben der Palme ist in der Festungsmauer ein schöner türkischer Brunnen mit fein gearbeiteten Koransprüchen angebracht, die der religiöse Sinn der Mohammedaner überall einfügt; auch muß man ihr Talent, schöne Punkte für die Brunnen zu finden, bewundern, wie es hier am Fuße der Palme mit der Aussicht auf den schönen Golf in so hohem Maße geschehen ist.
Wir kehrten zum Quai zurück, ruderten an Bord des Vulkans und sagten Napoli di Romania »Ade«, um dem Pyräus zuzusteuern.
Den 14. September 1850 angekommen.
Um fünf Uhr Morgens wurde ich in meiner kleinen Kabine mit dem Rufe geweckt: »man sieht Athen«! War's doch wie in den Kreuzzügen beim Anblick von Jerusalem; alles stürzte auf die Brücke des Schiffes, um das Hauptziel unserer Reise schon von Weitem zu begrüßen. Neugierde und Freude malte sich auf jedem Gesichte, und weithin schweifte der prüfende Blick. Die azurblauen Wogen des schäumenden Meeres spielten an eine breite, gelbe Küste, die sich bald eben, bald etwas erhoben mit dem Lande verbindet. Pflanzenleer und doch großartig lief die Fläche weithin fort, bis sie endlich von einem Halbkreise himmelhoher Berge begrenzt wurde. Am Ende dieser Ebene sahen wir, von hohen Felsen umgeben, Athen als einen weißen Punkt; hinter diesem den Hymetus, die Akropolis und die andern geschichtlich denkwürdigen Höhen, und weiter noch den Penthelikon hervorragen; der Anblick war keineswegs so freundlich feenhaft, wie der von Patras, sondern, kahl, ernst und erhaben. Es war ein Bild der Vergangenheit, auf dem die Erinnerung großer Begebenheiten ruht. Unser Schiff hatte sich dem kahlen Ufer genähert, auf dem man uns einen Haufen Steine als das Grab des Themistokles zeigte. Plötzlich wendeten wir, und liefen in einen kaum einige hundert Schritt breiten Kanal ein, der sich zwischen den niedrigen felsigen Ufern durchwindet und keinen Ausweg zeigt, bis sich ein breites Wasserbecken aufthut, und man in dem friedlichen Pyräus einläuft. Ein Halbkreis von neugebauten Häusern umgiebt den Hafen, in dem eine bedeutende Anzahl Schiffe ankerte. Am Quai und auf dem Wasser ist reges Leben, ein Anblick, der freudig ergreift, wenn man bedenkt, daß noch vor wenigen Jahren nur einzelne Häuser an diesen Ufern standen, der Hafen leer von Schiffen war. Jetzt ist nur noch die Umgebung kahl und todt. – Wir fanden zwei französische Lloyddampfer und ein französisches Geschwader vor, das von einer Fregatte mit einem Admiral angeführt wurde. Wieder umkreiste uns, wie in Patras, gleich nachdem wir geankert hatten, eine große Anzahl von Barken, mit einem einzigen lateinischen Segel von einem Schiffer mit großer Geschicklichkeit gelenkt, der dasselbe bald rechts, band links herumlegte, und pfeilschnell dahin schoß. Diese niedlichen Schiffchen sind ein Schmuck des Hafens. Ein Boot wurde, um die Erlaubniß landen zu dürfen, ausgesendet; dann begrüßte uns Graf J., der östreichische Geschäftsträger. Gleich nach ihm erschien General G., Hofmarschall des Königs, begleitet vom Hauptmann M., einem geborenen Triestiner, der uns während unseres Aufenthalts in Athen zugetheilt wurde; diese beiden Herren luden uns ein, im königlichen Schlosse eine Wohnung zu beziehen, ein Anerbieten, das mit Dank angenommen wurde. Wir verließen daher, nachdem wir unseren Anzug ein wenig geordnet hatten, auf mehrere Tage den geliebten Vulkan. Am Quai erwartete uns ein vierspänniger Wagen der Königin; es war die erste Equipage, die wir seit langer Zeit gesehen hatten. Blaue moderne Livree, große mecklenburgische Pferde und eine elegante Calesche paßten wohl zusammen, machten aber einen sonderbaren Gegensatz zu der wüsten Umgebung.
Wir sprangen mit heißen Erwartungen in den Wagen, und wurden auf weichen Federpolstern auf der berühmten Straße von Pyräus nach Athen geführt, ein dreiviertel Stunde langer, außerordentlich breiter, guter Weg, auf dem uns nur der fürchterliche Staub belästigte. Die Stadt war, seit der Einfahrt in den Piräus unseren Blicken entschwunden, und erst am Ausgange eines Olivenwaldes, durch den wir fuhren, erschien sie wieder. Dieser Hain ist wegen seiner Ausdehnung und der Menge seiner Früchte berühmt im Lande; doch war er dieses Jahr in schlechtem Zustande, da die Bäume durch den vorjährigen strengen Winter gelitten hatten, und man erst in einigen Jahren ihre vollständige Heilung hofft. Von Strecke zu Strecke stand ein Wirthshaus an der Straße, vor dem sich die interessantesten Gruppen von Einwohnern zeigten; auch hier begegneten wir einzelnen Zügen aus Eseln und Maulthieren, und sogar einigen schlechten Wagen. Nahe dem Pyräus sind noch Ueberbleibsel der altgriechischen Befestigungen von Athen. Weingärten und Olivenanpflanzungen wechseln ab; der Hain lichtet sich und der Eindruck wird freundlicher und großartiger zugleich. Wir durchstrichen eine Ebene, auf der ein berühmter Kampf gegen die Türken gekämpft wurde, und welche ein Monument schmückt. Endlich zeigt sich die, durch die Geschichte geweihte Stadt, in der die Phantasie begierig nach den Erinnerungen einstiger Größe sucht. Vor allem Andern wird der Blick durch einen mächtigen Felsen gefesselt, der wie auf marmornem Sockel eine Krone sonder Gleichen trägt: die Akropolis mit ihren säulenreichen Tempeln und ihren hundert Mahnungen an ihre große Vergangenheit; sie leuchtet mit erhabenem Stolze von ihrem Felsen herab; und wie man von den Gesichtszügen auf die Seele des Menschen schließen kann, so spricht dieses Denkmal die Größe der Zeit aus, in der es entstand. In der Ebene zeigte sich zu unserer Rechten im schönsten künstlerischen Ebenmaße der Theseustempel, dessen gelblicher Marmor wie mattes Gold erscheint. Vor uns lag die Stadt, deren Umfang nicht sehr bedeutend ist; sie wird durch eine lange, ungepflasterte Straße durchschnitten, die der höher gelegene königliche Palast schließt, die aber anfangs nur niedrige und unansehnliche Häuser begrenzen; erst in der Nähe des Palastes nimmt sie ein städtisches, besseres Aussehen an; doch schmückt sie gleich anfangs eine hohe prächtige Palme; auch ist die Metropolitankirche, im byzantinischen Style, durch ihr typisches Aussehen ehrwürdig, und erinnert an die altchristliche Zeit; sie erhebt sich kaum vier Klafter über den Erdboden und ist von geringem Umfange, was sonderbar mit dem königlichen Palaste kontrastirt. Vielleicht ist es, wie im hebräischen Reiche, auch erst dem Nachfolger des ersten Königs vergönnt, dem Herrn einen würdigen Tempel zu bauen, während der jetzige Regent, wie David, nur für seine eigene Unterkunft zu sorgen hat.
Die Häuser gleichen denen von Patras, nur sind sie etwas mehr mit den Bedürfnissen der Kultur versehen; der untere Theil ist meist zu Verkaufsläden verwendet; das Leben wird immer bewegter, je mehr man sich dem großen Platze nähert, an dem der königliche Palast auf einer Anhöhe steht; auf der linken Seite hat ein Triestiner ein schönes Gebäude im griechischen Geschmacke gebaut; die rechte Seite ist leer und läßt einen Blick auf den neuen Theil der Stadt offen, in dem sich einige recht nette Häuser befinden. In der Ferne glänzt das Meer und auf demselben zeichnen sich in klarer Luft die herrlichen Säulen des Jupiter-Tempels ab; auf dem Platze selbst sind große, regelmäßige Pflanzungen von Cactus, Aloën und Cypressen angelegt, in deren Mitte ein Weg, mit breiten Marmorstiegen zum Palaste hinan führt; rechts und links sind Alleen mit Fahrwegen. Diese Pflanzungen stehen im Einklange mit den architektonischen Linien des Palastes, der in ziemlich schmucklosem, griechischen Style dasteht; nur leuchtet an den Wänden, Fenstern, Balconen und Terrassen der weiße griechische Marmor statt aller Zierrath hervor. Der ganze Bau ist ein längliches, zweistöckiges Viereck; an der Front, gegen die Stadt, tragen dorische Säulen einen Balcon über der Einfahrt; von dieser führt eine herrliche freischwebende Marmorstiege in das obere Stockwerk. Auf der Meeresseite wird eine Terrasse von Säulen gestützt, die zu ebener Erde einen offenen Gang bilden, von dem aus breite Stufen zur Straße hinabführen; jenseits derselben liegt der mit den herrlichsten südlichen Gewächsen geschmückte Garten der Königin; auf der Rückseite, gegen die Gebirge zu, schwebt wieder ein Balcon über der hinteren Einfahrt, von der aus eine Wendeltreppe aus Marmor und Bronce hinaufsteigt. Da das Aeußere des Palastes wenig verziert ist, so hat er von weitem leider ein kasernenartiges Ansehen, welches der Reichthum des Materials erst in der Nähe mildert; auf jeden Fall ist er aber viel zu groß für die kleine Stadt, ja sogar für das kleine Land. Augenblicklich merkt man den leitenden Geist des Königs Ludwig von Baiern, welcher die Bauten nicht dem Bedürfniß anpaßte, sondern sie um ihrer selbst willen hinstellte. So müssen auch das griechische Reich und seine Hauptstadt, sein Hof und seine Dynastie, erst in diese Palasträume hineinwachsen. Die inneren Gemächer sind prachtvoll; ein herrliches Thronzimmer für den König, ein gleiches für die Königin, große in Fresco gemalte Speisesäle, wundervolle von Gold strotzende Tanzsäle, Salons und große Fremdenzimmer eröffnen sich dem erstaunten Auge. Das Ganze ist in vortrefflichem Geschmacke und bis zu Leuchter und Tafelgeschirr im griechischen Style eingerichtet; ein schöner Gedanke, der besonders den Zimmern der Königin ein zugleich freundliches und künstlerisches Gepräge giebt; man sieht ihnen an, daß hier ein liebenswürdiger Geist waltet; dieser ist es auch, der die Existenz in diesem Lande mit seinem Zauber umgiebt. Wir sahen diese schönen Räumlichkeiten erst im Laufe unseres Aufenthaltes, und wurden anfangs in die uns angewiesenen Zimmer geführt, wo wir der Audienz bei der Königin harrten; unsere Fenster gingen auf den Garten gegen das Meer zu; doch gewährte mir ein Eckzimmer auch den Anblick der Stadt und der Akropolis. Man kann sich nichts Schöneres und Interessanteres denken, als die Aussicht von dieser Höhe auf die malerische Umgebung mit ihren Denkmalen. Die klare Luft des Südens ließ alles deutlich und scharf erkennen, und über die Spitzen der um den Palast stehenden hohen Palmen hinweg sah man ein Gemisch südlichen Zaubers und edler Einfachheit; es ist, als ob die Natur hätte zeigen wollen, wie edle Formen auch ohne üppige Fülle, nur von Werken der Kunst gekrönt, das Gemüth ergreifen können; die hiesigen Gegenden sind hohen und erhabenen Schönheiten zu vergleichen, während die lieblichen Thäler unseres theuren Deutschlands mehr einen naiven freundlichen Eindruck hervorbringen. Der Garten der Königin, in dem das Streben bemerklich ist, die südliche Vegetation mit der nördlichen in schönen Gruppen zu verbinden, giebt einen trefflichen Vordergrund zu der bedeutungsvollen Aussicht, und einen malerischen Gegensatz zu den hellgelben kahlen Umrissen, die das Meer würdig schließt.
Nachdem unser Gepäck aus dem Pyräus angelangt war, setzten wir uns in Uniform und wurden nun zur Königin-Regentin geführt. Im kunstreich verzierten Thronsaale stand der weibliche Hofstaat; hier blieben unsere Reisegefährten; mein Bruder und ich wurden in den anstoßenden Salon geführt, wo uns die Königin in einer eleganten geschmackvollen Morgentoilette empfing. Sie ist von mittlerer Frauengröße, und weiß Würde und Anmuth in seltenem Maße in ihrem Wesen zu vereinigen. Ihre Züge drücken Geist und Charakterstärke aus; ihr Gespräch ist liebenswürdig und geistreich und steigert sich zum Enthusiasmus, wenn die Rede von ihrem theuren Hellas ist. Sie ist die wahre Mutter ihres Volkes; denn nur eine Mutter kann mit so vielem Interesse von jeder Einzelnheit sprechen, die sich auf ihre Kinder bezieht. Auch genießt die Königin die verdiente Gegenliebe ihres Volkes, und wird überall, wo sie erscheint, mit Begeisterung empfangen; von ihrer kräftigen und einsichtsvollen Regentschaft hört man aller Orten mit Bewunderung sprechen. Ich hätte nicht geglaubt, daß eine deutsche Prinzessin, gewöhnt an die angenehmen Bequemlichkeiten ihres Vaterlandes, sich so ganz in die griechischen Sitten schicken, und es sogar in der Sprache zu solcher Vollendung würde bringen können. Nach einem Gespräch von einer viertel Stunde, führte uns die Königin in den Thronsaal und stellte uns ihre Damen vor, worauf ich ihr unsere Reisegefährten nannte. Die Oberhofmeisterin der Königin, Frau von P., ist unter den Höhergestellten am Hofe die einzige Deutsche; sie macht durch ihr freundliches Benehmen und ihren heiteren Geist ihrer Nation Ehre. Außer ihr hat die »Basilissa« (so wird die Königin im Lande genannt) noch zwei Griechinnen zu Hofdamen. Fräulein Photanie M. und Fräulein Penelope L. Dieselben kleiden sich griechisch und bestätigen die so berühmte Schönheit der Frauen ihres Landes. Sie sprechen ziemlich gut französisch, und scheinen überhaupt nicht ungebildet zu sein. Nachdem man uns zu einem Spazierritt, auf fünf Uhr, eingeladen hatte, wurden wir von der Königin entlassen. Der übrige Hofstaat ist ziemlich unbedeutend, und ich will hier nur noch des Hofmarschalls Generals G. erwähnen, welcher, wie es deren an allen Höfen giebt, eine Art Factotum ist; er ist einer der Wenigen, welchem der König sein ganzes Vertrauen schenkt; auch soll er bei der verhängnißvollen Revolution sehr viel Charakterstärke bewiesen haben. Seine Vergangenheit ist jedoch etwas dunkel, und es giebt böse Zungen, welche derselben räuberische Gelüste zuschreiben. Sein Aeußeres entspräche dieser letzten Behauptung; er hat eine finstere, etwas gemeine Physiognomie, Hautfarbe und Haare sind außerordentlich dunkel; dagegen gewinnt seine Erscheinung durch die herrliche griechische Tracht. – Um fünf Uhr versammelten wir uns in einem, gegen die Meerseite gelegenen, niedlichen Cabinete; die Königin schritt die breiten Marmorstufen hinab und schwang sich mit großer Leichtigkeit auf ein türkisches Pferd, welches ihrer harrte. Wir folgten ihrem Beispiel, und nun ging es in lançadirendem Galoppe bei der Hauptwache des Palastes vorbei, über den Schloßplatz, durch einen Triumphbogen von Myrten, der zur morgigen Feier der Revolution errichtet worden war, die lange Straße hinunter zum Theseustempel. Die Königin wollte uns einen Ueberblick der Merkwürdigkeiten Athens geben. In der Straße wurde sie mit Jubelruf empfangen, und Alles grüßte mit dem Ausdrucke der größten Verehrung. Die Königin zu Pferde ist eine wahrhaft anmuthige und schöne Erscheinung. Sie reitet ganz vortrefflich, hat einen festen Sitz und führt das Pferd im schnellsten Galopp über Stellen, welche mancher berühmte Reiter bei uns kaum im Schritt passiren würde. Die Pferde des griechischen Hofes sind meist aus den asiatischen Gebirgen, haben einen schuhartigen Beschlag und klettern wie Gemsen über schwindelnde Höhen. Wenn sie keinen Fuß fassen können, rutschen sie auf den Hinterfüßen über Felsplatten, ohne zu stürzen. Auch macht die Königin ihre weitesten Reisen zu Pferde, da von einem Fortkommen zu Wagen bis jetzt noch keine Rede ist. – Der Theseustempel ist eines der besterhaltenen Monumente in Griechenland, und vielleicht eines der schönsten des Alterthums. Er ist ziemlich groß, alle seine Säulen und der größte Theil der inneren Mauern und des Daches sind erhalten. Der Marmor, aus dem er gebaut ist, war ehemals weiß, hat jedoch durch Zeit und Wetter einen schönen gelben Glanz erhalten, der diesen großen Massen vortrefflich läßt. Der Styl ist einfach und durchaus rein. Außerordentlich wird dieses Kunstwerk durch den freien Raum gehoben, auf dem es sich befindet; leider sieht man in den Säulen und den Wänden Spuren von den nichts verschonenden türkischen Kugeln. In den Metopen sind nur wenige Basreliefs, und diese nicht gut erhalten; man glaubt, daß sie die Thaten des Theseus vorstellen. Der innere Tempelraum ist ganz mit Mauern umgeben, während im Alterthum nur drei Seiten eingefaßt waren; die vierte Mauer ward errichtet, als dieser herrliche Tempel dem christlichen Gottesdienst gewidmet wurde. Zur Zeit sind alle kirchlichen Geräthe wieder heraus geräumt worden und man hat das Innere mit ausgegrabenen Kunstschätzen ausgefüllt, die aber, des nicht sehr großen Raumes wegen, ohne viel Sorgfalt aufeinander gehäuft sind; doch sieht man immer hier lieber die Götter der alten Mythe, als das Bild unseres Erlösers, welches keineswegs in diese Mauern paßt. Der Haupteingang von der Stadtseite ist jetzt geschlossen. An der Seitenwand, die der Akropolis zugewendet liegt, öffnet sich ebenfalls eine Thüre, an welcher ein griechischer Archäolog die Königin und uns empfing.
Wir konnten nur im Fluge die inneren Kunstschätze an uns vorüber ziehen lassen, die ich erst später, nach sorgfältigerer Betrachtung, erwähnen werde. Von hier aus folgten wir der Königin durch die engen Seitenstraßen von Athen, zwischen die verschiedenartigsten Hindernisse durch, im gestreckten Galopp zu dem Tempel der Winde, einem Octogon aus Quadern, in welchem unter dem Dache die Winde in einem Basrelief dargestellt sind; eine einzige Thüre führt in das Innere desselben, Fenster sind nicht vorhanden. Der Boden, auf welchem dieses Gebäude steht, ist um eine Klafter vertieft, was uns beweist, wie viel vom alten Athen verschüttet ist. Die Ruinen eines Aquaducts führen zu diesem interessanten Tempel, von welchem ich ebenfalls später Gelegenheit haben werde, näher zu sprechen. Von da kamen wir zur sogenannten Laterne des Diogenes, eigentlich dem Monumente des Lysokrates. Es ist ein nicht sehr breites, ungefähr zwei Klaftern hohes Thürmchen, dessen mit schönen aber sehr kleinen Basreliefs versehenes Dach auf vier bis fünf niedlichen Säulen ruht, ehmals aber frei gestanden haben mag. Die Spitze des Daches formt ein bouquetartiger Knopf, aus Delphinen gebildet. In dem neu vermauerten, inneren Säulenraum scheint früher eine Büste oder Statuette gestanden zu haben. Das Ganze ist eine sehr zierliche und feine Arbeit. Von dort ging es zum Areopag und Pnyx; es sind dies massive Felsenparthien, in welchen man noch Stufen bezeichnende Linien eingehauen findet. In diesem Felsen zeigt man den in den Stein gearbeiteten gefängnißartigen Raum, in welchem das Grab des Sokrates gewesen sein soll, welche Angabe jedoch nicht die geringste Wahrscheinlichkeit für sich hat. – Hierauf besahen wir das sogenannte Marktthor, einen Porticus von vier Säulen. Fälschlich hat es seinen Namen von einem großen Stein bekommen, welcher bei demselben aufgestellt ist, und auf den die unter Hadrian gesetzlichen Marktpreise eingehauen sind; dies war aber eine Gewohnheit alter Zeiten, der man bei sehr vielen antiken Thoren begegnet. – Noch berührten wir die Kolonnade und das Thor des Hadrian, die Ueberreste des Tempels des Jupiter, das Grabmal des Philopopus und die Stelle, auf welcher die Gärten des Plato standen. Die Kolonnade des Hadrian besteht aus sechs, vor einer aus Quadersteinen erbauten Mauer stehenden, römischen Säulen, auf welchen Vorsprünge ruhen, die mit der Mauer in Verbindung stehen. Eine siebente Säule steht frei; es scheint, daß die sechs anderen ehemals mit Statuen geziert waren. An der Quadermauer sieht man noch Ueberreste einer christlich-typischen Freskomalerei, da auch hier eine Kirche angeklext war. Vor den Säulen ist eine Mauer gezogen, und in diesem von der Straße abgeschlossenen Raume befinden sich ebenfalls ausgegrabene Alterthümer. Das Thor des Hadrian, in der Nähe des Jupitertempels, ist ein großer breiter Bogen, dem man den römischen Ursprung ansieht, und der einem zweiten von vier Säulen getragenen Thore als Fundament dient. Dieses an sich schöne Kunstwerk wird durch die Pracht und Größe der Säulen des Jupitertempels verdunkelt; ihre Höhe mag 20 Klafter betragen, ihr Umfang entspricht der Höhe und trotz dieser Dimensionen haben sie ein schönes und vollkommenes Ebenmaß; es mögen bei 15 sein; 12 derselben sind in einer nähern Gruppe beisammen, während drei in ziemlicher Entfernung abseits stehen. Die größere Gruppe ist noch durch einzelne große Steine verbunden, sonst ist vom Dache nichts mehr übrig. Auf einem der Säulencapitäle sieht man noch die Reste einer Steinhütte, welche einem fanatisch asketischen Derwische 20 Jahre als Wohnung gedient hat, während welcher Zeit er niemals auf die Erde herabkam, sondern es vorzog, in diesen höhern Regionen einem Storche gleich zu nisten, und sein frugales Mal an einem Seile aufzuziehen. Zu seinen Füßen wurde unterdessen Geschichte gemacht, und nicht wenig mußte sich der alte Herr wundern, als einstens statt seiner Glaubensgenossen siegreiche Rajas erschienen, und er der einzige Diener des Halbmondes in Athen verblieb, die einzige Stimme des Propheten in der Wüste. – Die Ausdehnung des Jupitertempels muß außerordentlich gewesen sein; auch kann man noch die festen Fundamente desselben in weiter Entfernung von den Säulen sehen.
In der Nähe derselben, im Felsen, befindet sich eine Quelle, in welcher sich Calliope, die schöne Muse, gebadet hat; daher führt dieses wildromantische Wasser ihren Namen. Die antike Lieblichkeit des Ortes ist entschwunden und es sind nur mehr die nackten, pittoresk geformten Felsen, zwischen welchen das Wasser rieselt, vorhanden. Das Monument des Philopopus liegt auf einem hohen Hügel, ziemlich entfernt von der Stadt, gegen das Meer zu; es ist eine schirmartige, etwas gegen außen zu gekrümmte Mauer aus Quadersteinen, an deren unterer Seite sich ein sehr beschädigtes Basrelief befindet, den Triumphzug eines römischen Imperators darstellend; über demselben sind Säulen angebracht, zwischen welchen sich arg verstümmelte sitzende Figuren befinden. Die Erhöhung, auf welcher dieser Bau steht, heißt der Musäusberg und ist nach dem griechischen Dichter dieses Namens benannt. Von dem Garten des Plato, auf der entgegengesetzten Seite, sieht man nur mehr den etwas erhobenen Platz, der von einer kleinen Kapelle gekrönt ist. Zwischen Weingärten und der Promenade Athens, einer breiten Allee, mit sehr schmächtigen Bäumen, kamen wir nach Sonnenuntergang zum Palaste zurück, worauf man sich gleich nach einer für die Damen fabelhaft schnellen Toilette versammelte, um das Essen einzunehmen. Das Gesammtministerium und die Hofchargen waren zur Tafel gezogen. Die Königin war so gnädig, mir die hellenischen Staatenlenker selbst vorzustellen. Einige unter diesen Herren hatten einen europäischen Anstrich, und waren sogar im Stande, französisch oder italienisch zu sprechen, was für mich von großer Erleichterung war, da ich es hasse, mich mittels eines Dragomans verständlich zu machen; man ist bei dieser Art der Unterhaltung immer verkauft, und kann nicht wissen, wie sie den Sinn in den Worten der andern Sprache wiedergeben. Doch beim Minister des Innern, dem Vater der schönen Eulalia von Korinth, mußte ich die Hülfe fremder Zungen in Anspruch nehmen. Dieser Herr trägt das gewöhnliche Landeskostüme und ist dem Greisenalter nahe; seine Faust schien mir eher für das Schwert und den Pflug, als für die administrirende Feder geschaffen; doch bei dem ziemlich primitiven Zustande des Landes mag diese Urnatur wohl geeignet sein, für sein Inneres zu sorgen; nur wäre es gut, wenn noch zuweilen das verrostete Palikarenschwert gezogen würde, um das Land von den Räuberbanden zu säubern. Doch wo bliebe dann der letzte Zuflucht der Romantik? Ein Griechenland ohne Räuber wäre eine Schweiz ohne Berge. Auch ist es ganz angenehm, wenn man in die Heimath zurückgekehrt, beim traulichen Theetische erzählen kann, man habe die schauerlichsten Gegenden durchwandernd, an den Felsen das Blut der unglücklichen Schlachtopfer herunter rieseln sehen. So lange es nicht persönliche Bekanntschaft mit diesen Helden der Romantik gemacht hat, ist das Volk der Reisenden egoistisch genug, sich beim Durchwandern der übelberüchtigten Gegenden eines heimlichen und selbstgefälligen Schauers zu erfreuen. Darum lassen wir die Spinnen ihr Netz über das rostige Schwert weben, und danken wir dem Gesammtministerium für die Rettung und zukünftige Erhaltung der Räuberbanden! – Vielleicht gab ja selbst einer der würdigen Männer, die hier bei Tische saßen, den Stoff zu einer Episode der Klephtenpoesie. – Das Diner wurde schnell und elegant servirt, die Zubereitung der Speisen war vortrefflich, und nach dem langen Ritt unser Appetit ebenso. Auf den Wänden des Eßzimmers sind Früchte, Wildpret und Fische in sinnreiche Arabesken verflochten. – Nach dem Essen entließ uns die liebenswürdige Hausfrau, und wir konnten einer erquickenden Ruhe genießen.
Der andere Tag war ein Sonntag, und wir hatten Gelegenheit um acht Uhr in der Kapelle des Königs die Messe zu hören. Gleich nach dem katholischen Gottesdienst ward alles, was sich auf die Gebräuche unserer Kirche bezieht, weggeräumt, und der Pastor der Königin mit seinem einfachen Ritus, zog ein. Zuweilen, wenn öffentliche Feste es erheischen, wohnt das Königspaar auch den griechischen Funktionen bei.
Um die Sitte eines Landes und insbesondere einer Stadt kennen zu lernen, kann es wohl nichts Erwünschteres geben, als die Abhaltung eines öffentlichen Festes; dies wurde uns heute zu Theil. Am 16. September, nach griechischem Kalender am 3., feiert Jung-Hellas die an diesem Tage begonnene Revolution.
Als wir uns vom Palast in die Hauptstraße begaben, hatte die Königin schon den Triumphbogen von Myrtenreisern durchfahren und befand sich im Dome, wo ein feierliches Gebet den Mittelpunkt des Festes ausmachte. Die Gasse entlang bildeten griechische Linientruppen Spalier; ihr Aussehen war unmilitärisch; man sah ihnen an, wie die Tracht europäischer Soldaten das freie Wesen dieser Leute beengte. Die feste Halsbinde, der plump geschmückte Csako, gaben dem ernsten Sohne der südlichen Berge einen düster-kränklichen Anstrich. Ein Körper, der an die flatternde Jacke und die faltenreiche Fustanella gewöhnt ist, mag sich unter griechischer Sonne gar peinlich in dem bis oben zugeknöpften Tuchrocke und den langen inexpressibles fühlen; und so schlüpfen Hellas Jünglinge aus dem malerischen Costüme des Vaterlandes, um sich in eine Gliederpuppe zu verwandeln, und hierdurch große Aehnlichkeit mit unseren Nationalgarden zu bekommen; doch die europäische Civilisation erfordert es so, und da muß der Schönheits-Enthusiast des 19. Jahrhunderts schweigen. Das Bataillon in Landestracht sieht dagegen sehr schön und kriegerisch aus, und trägt sich in gleicher Farbenpracht wie die Truppen, die wir schon Gelegenheit hatten in Patras zu bewundern. – Zwischen den bewaffneten Reihen wogte das Volk im bunten Gewimmel; bald sah man europäische Trachten, bald zeigten sich die buntesten Gewänder des Landes; die Balcone und Fenster waren mit dem schönsten Schmucke Neu-Athens geziert; es zeigten sich hier die Frauen und Mädchen in reichster Farbenpracht. An den funkelnden Augen und schönen regelmäßigen Zügen konnte man gar leicht die Vermischung des südslavischen und altgriechischen Blutes erkennen. Unter den reizenden Trachten des weiblichen Geschlechtes waren für uns die der Hydriotinnen neu. Statt des rothen Feß tragen die reizenden Inselbewohnerinnen einen leichten gazeartigen Schleier in zarten künstlichen Falten um Haupt, Nacken und Brust. Die Kleider sind, wie die ihrer Schwestern vom festen Lande, aus grellgefärbtem Seidenstoffe. – Trotz der Bedeutung des Tages war das Volk ruhig; kein enthusiastischer Jubel, ja selbst keine neugierige Schaulust, waren bemerkbar; es sah eher aus, als befänden sich die Leute aus bloßer Gewohnheit da.
Nachdem wir den bunten Schimmer der Häuser, welchen die glühende Sonne erhöhte, betrachtet hatten, begaben wir uns in den für eine Liliput-Hauptstadt allenfalls passenden Dom. Schon an der Pforte empfing uns ein Qualm drückender Hitze und unsere Ohren vernahmen den monotonen Gesang der griechischen Geistlichkeit. In der Mitte der Letzteren thronte der Archimandrit, eine würdige Gestalt vergangener Zeiten mit wallendem schneeweißen Barte. An der rechten Seite der Kirche, vor einem Thronsessel, stand gleich einem Marmorbilde, die Königin-Regentin in reichem, pelzverbrämten Gewande; war auch etwas malerische Phantasie in dieses Kostüme hineingerathen, so hatte es doch in seinen Grundzügen den orientalischen Schnitt. Da wir gerade gegenüber, hinter den Säulenbogen einen etwas erhöhten Platz eingenommen hatten, so konnten wir die erhabene Frau mit Muße betrachten. Ihre Gestalt schwamm in einem Goldmeere reicher Stickerei. Auf dem Haupte glänzten im braunen Haare funkelnde Diamanten; so war auch Brust und Nacken mit diesem Gesteine bedeckt; doch der Ausdruck des Gesichtes und die ganze Haltung war kalt, und unbeweglich; es drückte sich fast Widerwillen in den sonst so anmuthsvollen, freundlichen Zügen aus. Die arme Dame mag gar wohl gedacht haben, wie ihr aufblühender Thron vor Jahren an diesem schreckensvollen dritten September gebrandmarkt worden ist. Gewiß schwebte ihr das Bild der schreienden Horden und wankenden Rathgeber vor den Augen; und nun sollte sie für die Erhaltung derjenigen Institutionen beten, welche ihr geliebtes Hellas dereinst in das Verderben stürzen mußten! Auch preßten sich ihre Lippen krampfhaft zusammen, statt sich zum Gebete zu öffnen.
Wir verließen bald den dumpfen Raum, um die Königin nach Beendigung der Hymnen an uns vorüberfahren zu sehen. Ich hatte mir bei dieser Gelegenheit, wenn auch keinen prachtvollen, doch einen originellen Zug gedacht; statt dessen fuhren zwei vierspännige baierisch zugestutzte Kutschen vor, in welchen die Königin mit einem Theil ihres Hofstaates fast gänzlich den Blicken entschwand; einige vereinzelte sehr reich gekleidete Adjutanten und ein Trupp Lanciers umschwirrten den Wagen, und plötzlich war der ganze Zug unseren neugierigen Blicken entschwunden. Die Königin entledigte sich ihrer drückenden Kleiderpracht, worauf wir uns bei ihr zum Frühstück in einem Garten-Pavillon versammelten. Derselbe besteht aus einem Holzgitter mit leichtem Dache, und ist über einem herrlichen Mosaïk erbaut, welches man auf demselben Platze ausgegraben hat, und das sich rühmt, das größte der Bekannten zu sein; es ist außerordentlich gut erhalten und scheint nach den Arabesken und der Form zu schließen, sich in einem antiken Badezimmer befunden zu haben. Als wir uns zum vortrefflichen Gabelfrühstück setzten, bemerkte die Königin, daß unsere Zahl dreizehn sei; augenblicklich ward ein Katzentisch bereitet, und der arme uns zugetheilte Adjutant mußte mit einer Ecke des Laubpavillons vorlieb nehmen. Zwei Gründe mögen dieses komische Verfahren bei der so geistreichen Königin entschuldigen: erstens ist das griechische Volk außerordentlich abergläubisch, und es scheint nicht gerathen, offen diesen Sonderbarkeiten entgegen zu treten; zweitens trug sich vor einigen Jahren ein eigener Zufall am griechischen Hofe zu: man speiste zu dreizehn, in der kürzesten Zeit darauf starb einer der Tafelrunde; einige Tage darnach war die Gesellschaft wieder vereinigt und abermals in der ominösen Zahl. Ein junger Engländer, der beide Male zugegen war, äußerte im Scherze, wer wohl diesmal das Opfer sein würde; abermals verging eine nicht lange Zeit, und der junge Britte war eine Leiche.
Nach dem Frühstücke ließ die Königin eine kleine Pony-Equipage vorfahren, in der sie meinen Bruder und mich eigenhändig führte, und uns Gelegenheit gab, ihr Talent zum Kutschiren zu bewundern. Die übrige Gesellschaft folgte ihr zu Fuße. Eine kleine Menagerie, bestehend aus Dammhirschen und Gazellen, wurde uns gezeigt; hierauf geleitete uns die Königin durch ihren Garten, welcher ihr ganzes Vergnügen und ihren ganzen Stolz ausmacht; auch pflegte sie ihn scherzweise immer ihr kleines Reich zu nennen. Ehe sie die Regentschaft des größeren Reiches übernahm, bildete dieses selbstgeschaffene und gepflegte Athene-Eldorado ihr Hauptvergnügen; nun wird leider der Garten unter den wichtigeren Geschäften etwas leiden müssen. Die Anlagen desselben sind im englischen Geschmacke; zwischen Palmen und Orangen wird mit Mühe das deutsche Bäumchen gehegt und gepflegt. Die Blicke aus den einzelnen Partien auf die Ueberreste altgriechischer Kunst sind herrlich und könnten nicht malerischer gewählt sein. Es fehlt nur an schattigen Plätzen und an grünen Rasenflecken, um den Garten vollkommen zu nennen; der erste Fehler wird sich jedoch mit der Zeit geben, da die ganze Schöpfung erst das Werk einiger Jahre ist; im älteren Theile steht schon eine Baumgruppe, in deren kühlem Schatten das königliche Ehepaar zu frühstücken pflegt; für den zweiten ist weniger zu hoffen, da die Strahlen der Sonne zu glühend sind, um das üppige Wachsthum des Grases zu erlauben. Für Athen ist jedoch der Hofgarten ein Wunder; er ist so zu sagen der einzige Punkt, wo das frische Grün des Laubes, und der Wechsel der Blumenpracht zu sehen ist. Für uns, die wir aus kühleren Ländern stammen, waren die Gewächse des Südens von besonderer Merkwürdigkeit. Die keimenden Palmen und saftigen Aloën waren in solcher Menge unserem Auge neu. Die letztere Pflanze nimmt sich besonders vortheilhaft in den schneeweißen Marmorvasen aus, welche sich auf den breiten Stufen gleichen Gesteines befinden, die von der linken Palastseite, von Terrasse zu Terrasse in den Garten hinunterführen. Die erste Terrasse ist als breiter Raum zum Vorfahren vor den Kolonnaden-Gang bestimmt. Die zweite etwas tiefer liegende, ist mit sehr schönen Blumenanlagen zwischen Orangenbäumen besetzt, die aber im vorigen Winter von der strengen Kälte so sehr gelitten hatten, daß man sie bis zum Boden schneiden mußte; doch das Wachsthum unter südlicher Sonne ist so kräftig und rasch, daß sie nun schon die Höhe von 4 bis 5 Fuß erreicht haben. Die Erndte ist jedoch auf einige Jahre hinausgeschoben. In dem ziemlich bedeutenden Umfange des Gartens wurden einige sehr schöne Alterthümer ausgegraben, welche auf einem eigenen Platze desselben aufbewahrt sind. Vor wenigen Jahren stieß man auf eine reichhaltige antike Wasserleitung, die nun theilweise den Pflanzen das so nothwendige Labsal bringt; auch glaubt man den Platz gefunden zu haben, auf welchem Socrates gelehrt haben soll: die Kontraste der Jahrhunderte bringen den Schulplatz des größten Philosophen in eine englische Parkanlage! – Da uns die glühende Mittagshitze gar bald aus dem Garten trieb, ward es uns gegönnt, die Gemächer des Königs und der Königin genau zu betrachten. Dieselben vereinigten Pracht mit Wohnlichkeit und manch sinnige Idee und hübsche Fresko-Malerei fand ich zwischen den griechischen Zierrathen; doch überall leuchtete der Münchner Königsbau durch, und wirklich findet im hiesigen Klima diese Bauart ihre größere Berechtigung. In des Königs Arbeitszimmer sieht man unter dem Plafond die berühmten Männer des alten Griechenlands; in einer Ecke steht ein Gipsabguß des Apoll von Belvedere, als Repräsentanten der antiken Kunst; in einem andern Saale des Palastes sieht man dagegen die Brustbilder der Helden neugriechischer Geschichte. An den Wänden befinden sich zwei große Oelgemälde vom Münchner Maler Heß, den Einzug des Königs in Nauplia und Athen darstellend; die Bilder sind kräftig gemalt und enthalten viele für das Land interessante Porträts. Noch ist in diesem Raume, der den hervorragenden Werken der neueren Zeit gewidmet ist, kein Repräsentant der vaterländischen Kunst zu sehen; auch wäre es schwer in Neu-Griechenland einen solchen zu finden. – Die große Stiege, die an diesen Saal stößt, ist, wie schon erwähnt, von Bronce und weißem Marmor aus dem Pentelikon; ein herrliches Werk! Die Steinstufen sind so fest eingefügt, daß die Doppelstiege längs der Mauer frei und ohne stützende Säulen dahin läuft. Die Königin erzählte uns, daß es langer Zeit und großer Mühe bedurfte, bis man Marmorblöcke fand, welche so gänzlich ohne Sprünge waren, daß man dieses Meisterstück wagen konnte. Diese breiten, wahrhaft majestätischen Stufenreihen führen in eine Halle, die sich unmittelbar an der großen Einfahrt in der Mitte des Palastes befindet. Die schönsten Räume im Schlosse sind jedoch unstreitig die zwei großen Tanzsäle im entresol, die durch alle Stockwerke die Höhe des Schlosses erreichen. Die Hauptfarbe derselben ist roth, mit reichen goldenen Verzierungen bedeckt. Die Möbel sind mit den Wänden und Plafonds übereinstimmend und so aufgestellt, daß den Tanzenden genug Raum bleibt. Ein Maler war gerade beschäftigt, den oberen Theil des einen der beiden Säle mit mythischen Figuren zu füllen. Wenn die schweren Kronleuchter und reichen Wände in tausendfarbigem Lichte schimmern, und die bunten schöngestickten orientalischen Trachten sich bei der Tanzmelodie hin und her bewegen, so mag der Anblick wirklich etwas feenhaftes haben; auch werden diese Feste von allen Fremden als wahrhaft pracht- und geschmackvoll gerühmt. Ob diese Feierlichkeiten den Gewohnheiten und Geldmitteln des Landes entsprechen, getraue ich mich nicht zu beurtheilen. Von hoher Seite versicherte man mich übrigens, daß das griechische Volk die Pracht und den Glanz seines Thrones liebe.
Die Königin, welche die Merkwürdigkeiten ihres Landes auf eine so graziöse und geistreiche Art zeigte, lud uns auf heute Nachmittag zu einer Fahrt nach dem berühmten Eleusis ein. Die ganze Gesellschaft wurde in zwei großen, bequemen Wagen untergebracht, und so rollten wir vom Schlosse aus durch einen abgelegenen Theil der Stadt, worauf wir bald die heilige Straße erreichten, welche unter den alten Griechen von Athen aus zum Tempel des unbekannten Gottes führte. Anfangs fährt man zwischen Olivenbäumen und Weingewinden dahin, bald aber geräth man in eine romantische wüste Gegend; man muß ein enges schluchtartiges Thal durchfahren, um auf die andere Seite der Gebirgskette zu kommen, in welcher sich der Meerbusen befindet, an dessen Ende Eleusis liegt. Links und rechts von der Thalstraße liegen auf gelber Erde unzählige Felsstücke, zwischen denen einzelne Pinien-Gruppen gleich kleinen Oasen hervorragen, deren Nadeln von lebhafterem Grün sind, als das Laub unserer Bäume. Außer mehreren langsam dahin kriechenden Schildkröten sahen wir keine Spur des Lebens, bis wir mitten in dieser interessanten Wildniß an das verfallene Nonnenkloster Daphne kamen. Noch stehen einige Theile der festen fränkischen Ringmauer, der Kirche und der erbärmlichen Hütten der Nonnen. Ursprünglich ward hier ein Schloß für die Herzöge von Athen, aus der Familie Laroche gebaut, deren Nachkommen noch in Baiern bestehen sollen. Die Mauern deuten augenblicklich auf die nordischen Schöpfer derselben; später wurde das Schloß zum Kloster eingerichtet und die Kirche im byzantinischen Style noch später gebaut. In der Kuppel befindet sich ein großes Mosaïk, ein Christuskopf im typischen Styl. Da die Kirche dem griechischen Kultus geweiht ist, so befindet sich hier natürlich die stark vergoldete Wand zwischen der Gemeinde und dem Altare. Lange dicke Kerzen auf hohen, freistehenden, bunten Leuchtern, warfen ein düsteres Licht auf die großen, auf einzelnen Pulten aufgeschlagenen Evangelium-Bücher, und auf das dunkle vom Rauche geschwärzte Gemäuer. Die Stille und Leblosigkeit dieses Gotteshauses gab dem Ganzen einen mystischen Anstrich. In einer Seitenkapelle sind noch einige Gräber, auf deren einem das in Marmor gehauene Wappen der Laroche zu sehen ist. So findet man in der Umgegend von Athen alle Geschichtsperioden durch die merkwürdigsten Denkmale verewigt. In dem Klosterhofe sieht man noch einige Reste gothischer Verzierungen. Die Mauern sind alle so massiv, daß es scheint, als ob diese Herzöge sich nicht ganz sicher gefühlt hätten. – Kaum waren wir einige Zeit in dem verfallenen Gemäuer herumgeklettert, so regte es sich plötzlich, und schwarze, unheimliche, hexenartige Gestalten erschienen. In Fetzen nur zur Noth gehüllt, mit wirren grauen Haaren und dürren Gliedern, gehörten sie ganz zu den leblosen Ueberbleibseln aus vergangenen Zeiten; es fehlten nur Kessel und Besen, um das Bild zu vollenden. Es waren dies die frommen Schwestern von Daphne, welche gerade im Begriffe waren, türkischen Weizen und andere Hülsenfrüchte auf den Boden auszustreuen und zu trocknen. Mit ihrer Heiligkeit soll es jedoch nicht sehr weit her sein; wenigstens ist der Erzbischof von Athen, ihr geistlicher Vorstand, dieser Ansicht. Auf jeden Fall war ihr Aeußeres nicht nur abstoßend, sondern sogar unschicklich, und sie scheinen eher eine Rotte roher Bettlerinnen, als in sich gekehrter Nonnen. Wir verließen die malerischen Ruinen, nachdem die schwarzen Gespenster der Königin mildspendende Hand Segen kreischend geküßt hatten. Bald waren wir am Ausgang des Thales, und mit Wohlgefallen ruhte das Auge auf dem Meerbusen, dem Dorfe Eleusis und den hohen schön geformten Gebirgen. Man beginnt die Spuren der heiligen, in den Felsen gehauenen Straße zu sehen, da sich der Weg ziemlich knapp zwischen dem Meere und den höheren Felsen hinzieht. Man sieht aus diesen Spuren, wie auch auf der Akropolis und an mehreren anderen Orten in Griechenland, daß die Alten nur Geleise in den Stein hieben, und daß die Räder, welche gleiche Achsenbreite hatten, in denselben liefen, so daß sich die Pferde auf dem nackten Felsen forthelfen mußten. Noch interessanter jedoch wie diese Straßenreste sind die Süßwasser-Seen, welche sich unmittelbar an der rechten Seite der Straße befinden, während die linke von den Wogen des Meeres bespült wird. Diese kleinen Seen sind ebenfalls noch aus uralter Zeit; ihre Tiefe beträgt höchstens fünf Schuh, sie liegen einige Schuh höher, als das Meer, in welches sie unter der Straße abfließen. Diese ist nur durch eine kleine sehr niedrige Mauer von den Seen getrennt. Es scheint, daß der Zweck dieser Wasseranlagen die Aufbewahrung von Fischen war. Der Zufluß kommt wahrscheinlich von unterirdischen Quellen. –
Am Eingange von Eleusis ließ die Königin halten, und man stieg aus. Zuerst besichtigten wir eine kleine, außerordentlich niedrige griechische Kapelle, welche aus Trümmern von dem berühmten Tempel des unbekannten Gottes gebaut wurde. Im Innern derselben befinden sich auch noch einzelne Theile von alten Statuen und Inschriften, für einen Archäologen, der diese Zeichen versteht, von großem Interesse. Als wir beschäftigt waren, diese Trümmer schönerer Zeiten zu bewundern, strömte die Bevölkerung des Dorfes die Anhöhe herab und umringte die geliebte »Basilissa«, welche sie mit den freundlichsten Worten in der wohltönenden griechischen Sprache begrüßte. Eine schöne Sitte ist es, daß, wenn das griechische Königspaar in die Nähe eines Dorfes kommt, die ganze Gemeinde jubelnd entgegenzieht, und ihr »zito« in die Lüfte schallen läßt. Die Bevölkerung dieses Ortes, besonders die Frauen, waren wieder ganz anders gekleidet, als in der Umgebung von Athen; ich möchte sagen noch poetischer und geschmackvoller. Die Frauen tragen lange dunkelgefärbte Röcke; über denselben haben sie bis zum Knie herab einen weißen mit schwarzen Schnüren geschmackvoll gestickten Oberrock; auch das Mieder ist reich und bunt gestickt, Kopf und Hals hüllt ein weißer Schleier ein, aus welchem lange Flechten über den Nacken, oft bis auf den Boden hängen. Der reiche Haarwuchs ist der Stolz dieser Frauen; sie helfen sich auch künstlich durch das Eindrehen von brauner Wolle. Die Mädchen tragen statt des Schleiers ihre Aussteuer auf dem Haupte, welche in einer helmartigen Kappe besteht, mit Sturmband und Quästchen, deren Bestandtheile durchlöcherte Silber- und Goldmünzen bilden; oft recht interessante kleine Münzensammlungen. Man findet türkische, griechische, österreichische und spanische Geldstücke im buntesten Gemisch. Diese ganz originelle Kopfbedeckung kleidet aber die regelmäßigen, ernsten orientalischen Züge vortrefflich. Eine große Anzahl der Frauen trägt goldene Ringe mit den schönsten antiken Cameen, welche sie beim Ackern zwischen den Schollen finden. Wir wanderten nun von der ganzen Gemeinde gefolgt auf einen felsigen Hügel, der die Grundlage des Tempels bildete. Man findet nur noch einzelne Mauertrümmer und Stücke von marmornen Säulen des berühmten Heiligthums, in welchem die eleusischen Feste gefeiert wurden, und es regt sich der Wunsch, daß Ceres wieder einmal in dieser Gegend ihr geliebtes Kind suchen möge und wenn sie käme, könnte man leider zum zweitenmale wieder singen:
So streicht die Hand der Zeit über die berühmtesten Gegenden dahin, und oft ist mir schon in Griechenland das Gedicht Rückert's von dem Thale eingefallen, in welchem eine Stadt, dann Wüste, Felder, See und endlich wieder eine Stadt gestanden hat. Ein wehmüthiger Gedanke war es uns, der Jugend der Neuzeit, über die gebrochenen Steine dahin zu hüpfen, die einst das gebildetste Volk der Welt mit Mühe zusammentrug, um ein Götterwerk zu schaffen, welches der Ewigkeit trotzen sollte, und in welchem die antike Jugend die mystischen Reigen der Ceres ausführte.
Wir wurden nun in zwei Häuser von Landbewohnern geführt, in welchen die prachtvollsten Mosaïk's dem Spiele der Kinder und dem Wühlen der Schweine ausgesetzt waren; quer über einen derselben läuft sogar die Hausmauer. So werden diese herrlichen Werke durch unwissende Menschen dem Verderben preisgegeben, da man sie doch mit der kleinsten Mühe vor der Unkenntniß der Bevölkerung schützen könnte. Leider stehen dem griechischen Monarchen, der den besten Willen zur Erhaltung dieser Schätze hat, nicht die Mittel zu Gebote, diesen Wunsch auszuführen. – Als wir aus der zweiten Behausung heraustraten, bildeten die schlanken, romantisch gekleideten Frauen und Mädchen von Eleusis einen Halbkreis vor der Königin und stimmten nach einer ziemlich monotonen Melodie einen rasch improvisirten Gesang an, zu welchem sie, die Arme kreuzweis haltend, einen ernsten schwingenden Tanz ausführten. Langsam neigten sie sich mit einem Schritte vorwärts, worauf sie zwei kleine Schritte rückwärts machten; nach jeder Strophe traten sie im Tacte mit den Sandalen auf den harten Boden. In diesem Tanze erkannte man die Nachkommen der alten Helenen. Es waren die Reigen, wie man sie auf den Vasen des alten Griechenlands gemalt sieht, ein interessanter schöner Anblick! Die Königin sagte mir, daß sich der Gesang auf ihre Anwesenheit bezöge. Im ersten Liede drückten sie ihre Freude aus, daß wir Fremde der Königin die Nachricht der baldigen Ankunft des Königs brächten; im zweiten wurde die »Basilissa« mit einem Orangenbaum verglichen, an dessen Fuß eine frische Quelle sprudle. Das Volk soll eine eigene Gewandtheit in diesen lieblichen Improvisationen haben! –
Wir besahen nun noch einen altgriechischen Hafendamm, welcher sich am Fuße des Städtchens auf eine kleine Strecke in das Meer hineinzieht. Er zeichnet sich durch seine außerordentlich großen Quadersteine aus. Hierauf lud uns die Königin zu einem Imbiß ein, welchen Vorschlag wir dankbar annahmen. Es war ein gouté champêtre. Man brachte in aller Eile einen schlechten Tisch und einige Feldsessel; ein Koffer, der die erwünschte Ladung enthielt, wurde eröffnet, und wir stärkten uns mit kaltem Fleische, Eiern und Wein, angesichts des welthistorischen Eleusis. So ist das unglückliche Menschengeschlecht! Geist, Herz und Magen sind leider ein nothwendiges Triumvirat, welches in diesem armen Erdenleben nie getrennt werden kann. – Nach dem kurzen Mahle wollten die Männer von Eleusis ihren Frauen nicht zurückstehen und vollführten ebenfalls einen Tanz, dem der Frauen ähnlich, nur lebhafter und wilder. Der beste Tänzer des Ortes führte den Reigen an und machte höchst possierliche, drehende Sprünge, mit denen eines Gemsbocks vergleichbar, und an die bacchantischen Geberden antiker Darstellungen erinnernd. Nachdem dies einige Zeit bewundert worden war, ließ die Königin die Kinder des Dorfes um sich schaaren, stellte einige Fragen im freundlichsten Tone an sie, und vertheilte hierauf unter dieselben die vom Mahle übrig gebliebenen Eier. Es war ein hübsches Bild, die zarte Frau mitten unter den frischen, stürmischen Kindern zu sehen; alle drängten sich um sie, ein jedes wollte eine der Gaben haben; die Ungestümen wies sie mild mit der Hand zurück, den Bescheidenen theilte sie ermunternd aus. Das war ein Geschrei und ein Jubel! So weiß sie durch liebenswürdige Art mit den einfachsten Mitteln das Herz ihres Volkes zu gewinnen. Die ganze Bevölkerung, jung und alt, stürzte uns bis zum Wagen nach, und die Königin verließ den interessanten Ort unter dem weithin schallenden Jubelruf: »zito Basilissa«! – Die besonders enthusiastische Jugend lief noch einige Zeit jauchzend neben dem Wagen her. Man sieht deutlich, daß es die Königin ist, welche durch ihre Persönlichkeit den neu errichteten Thron von Griechenland im Herzen des Volkes stützt. –
Als wir durch die schönen Weingärten dahin fuhren, warfen die einzelnen Landbewohner die schönsten Trauben ihres Besitzthums in den Wagen, welche die Königin dankend annahm; und dieses Zeichen der Liebe wurde nicht, wie bei uns, mit feilem Geld belohnt; das freundliche Nicken der Königin war den Bauern der liebste Dank. Das Volk in Griechenland ist durch und durch monarchisch, und kennt den Werth der fürstlichen Huld und Gnade, ohne daß man ihm dieselbe durch thatsächliche Bezahlung zu beweisen braucht. Am späten Abend bei funkelnden Sternen kehrten wir nach Athen zurück. –
Des andern Morgens nahmen wir das Frühstück in unseren Zimmern ein; hierauf fuhren wir um 9 Uhr in die in der Nähe des Palastes gelegenen Stallungen des Königs; sie sind geräumig und rein gehalten, und beherbergen eine schöne Auswahl orientalischer Pferde; die ausgezeichnetesten derselben wurden uns im Hofe vorgeführt. Der König und die Königin lieben es sehr, muntere Thiere zu reiten.
Daß die Pferde häufig lançadiren und in beständigem Springen und Capriolen die Reitkunst des Königs dem staunenden Volke zeigen, gehört zum griechischen guten Ton. – Den sämmtlichen Stallungen steht ein ehemaliger bairischer Offizier vor, der sich auf die Reitkunst sehr gut zu verstehen scheint. – Von hier aus begaben wir uns zur neuerbauten Universität; sie ist im altgriechischen Geschmacke; der große, noch nicht gänzlich vollendete Saal wird durch einige sehr schöne Säulen aus weißem Marmor geziert. Das ganze Institut ist erst im Werden; doch nimmt man ein erfreuliches Streben nach Bildung wahr, und die Bibliothek, welche meist aus Geschenken des Inlandes und der Fremde besteht, ist wirklich nicht ohne Bedeutung. Von diesem Symbole neuen Lebens fuhren wir zur Krone alter Größe und Pracht hinan, zu der auf stolzem Fels erbauten Akropolis, welche Alles überragt, was wir bis jetzt von antiker Kunst gesehen haben. Vom Fuße der Erhöhung bis zu dem Thore der Umfassungsmauern geht der Weg über kahle Erdpartien und ist nach neugriechischer Sitte sehr schlecht; man muß sich mit Mühe durch den Staub der Erde hinaufarbeiten, wo vor den alles zerstörenden Zeiten der antike Grieche mit Begeisterung und heiligem Schauer auf Marmorstufen zum selbstgeschaffenen Göttersitz emporschritt. Schon aus der Ferne leuchteten dem Anbeter der hehren Minerva im blauen Aether, gleich einer Sonnenburg, die stolzen Propyläen entgegen. Eifriger beflügelte er seine aufwärts strebenden Schritte und bald befand er sich in einem Säulenwalde, in welchem die Werke eines Phidias, als Perlen der menschlichen Kunst, ihm Begeisterung für seine Götterbilder und Bewunderung für sein mächtig schöpferisches Geschlecht zustrahlten. Mit enthusiastischer Kunstliebe betrachtete er die milden ernsten Züge der Göttin, die jener aus dem nahen Steinblocke des Pentelikons geschaffen, und die sein poetischer Geist sich selbst zur Schützerin bestellt hat. Keine ernsten, stillen Gebete in Furcht und Andacht vor dem höchsten Wesen konnten diesen Lippen entquillen; ihre Stelle vertrat schallender Jubel bei der Darbringung blumenbekränzter Opfer, die der Ausdruck des poetischen Naturergusses waren, deren eigentlichen Sinn aber das Lob des eigenen Selbst bildete. Die christliche Furcht vor dem lenkenden Schöpfer der Welten, nahte sich ihnen nur in den ihnen unerklärlichen Naturerscheinungen und im Tode! Die Akropolis war ein Diadem, mit welchem die stolze Menschheit das eigene leuchtende Haupt schmückte. Doch dieser Krone fehlte der reine erlösende Segen; die Spangen des eitlen Schmuckes brachen, und der Alles versinnlichende Geist wich vor dem dornengekrönten Erlöser, in dessen Sinne die Jünger ihr künstlerisches Streben zu Domen vereinten, welche sie, statt mit Perlen antiker Zeit, mit dem schlichten Sinnbilde des Kreuzes schmückten. Die Spangen brachen, die Perlen wurden von den Fluthen der Zeit hinweggespült, und dennoch erkennt man in den Ueberbleibseln, daß die Geister, die diese Werke schufen, groß und erhaben gewesen waren; in diesen Ruinen lebt noch jetzt ein poetischer Reiz und eine unwiderstehliche Macht, die auch der Eigenliebe eines Christen des 19. Jahrhunderts schmeichelt. Die Seele wird unwillkürlich von Stolz ergriffen bei dem Gedanken, diese Werke haben einst Menschen geschaffen, aus Fleisch und Blut wie du; und da die Attribute des heidnischen Kultus in den weiten stillen Räumen fehlen, so hat die Phantasie freies Spiel, und auch das christlichste Gemüth kann sich an den Malen des alten Hellas erfreuen. – Wir traten in das Thor der Umfassungsmauer ein; nachdem wir dasselbe durchschritten hatten, kamen wir zu einem Wachthäuschen, welches leider theilweise aus Ueberbleibseln von Kunstschätzen erbaut ist; rechts und links lagen zusammengefallene Steine, gebrochene Säulen; dann gelangten wir durch eine pfortenartige Maueröffnung in das Bereich der herrlichen Propyläen. Noch heute erkennt man die mächtigen Stufen, die bis zu den Fluthen des Meeres gereicht haben sollen. Rechts und links erheben sich gigantische Säulen, welche mehrere Eingangshallen zu dem eigentlichen Sanctuarium bilden. Einst waren in den marmornen Boden derart Furchen gezogen, daß man zwischen den Stufen hindurch fahren konnte. Die Säulenreihen werden von dem Innersten der Akropolis durch große Quadermauern getrennt; in der Mitte befindet sich ein dreifacher Eingang. Rechts von den Propyläen ragt auf einem Felsenvorsprunge der zierliche Tempel der Victoria hervor, welchem wir nun zuerst unsere Aufmerksamkeit schenkten; seine Dimensionen sind sehr gemessen und stehen im vollsten Einklange; vier Wände mit dorischen Säulen verziert, bilden das Gebäude, an dessen einer Seite eine schöne Pforte in das Innere desselben führt. Um das Gesimse laufen fein gearbeitete Basreliefs in sehr kleinem Maßstabe. Der Tempel hat durch seine freie Lage den reinen, blauen Aether als Hintergrund, und durch seinen Miniaturbau, der in der letzten Zeit hergestellt worden ist, etwas außerordentlich Anziehendes. Im Inneren fanden wir ein ausnehmend schönes Basrelief der Siegesgöttin an die Wand gelehnt. Die Athenienser, um den Sieg zu fesseln, bauten nicht nur der Göttin dieses Denkmal, sondern nannten es auch den Tempel der »flügellosen Victoria«, in der Meinung, daß die Siegbringende ihnen dann nicht entfliehen könne. – Hierauf begaben wir uns auf die linke Seite der Propyläen, wo sich auf dem linken Felsenvorsprung ein großes Gemach befindet, in welchem im Mittelalter die Herzoge von Athen hausten. Jetzt wird dieses Gemach und der unmittelbar davor befindliche Raum der Propyläen als Sammelort für die aus der Erde gegrabenen Alterthümer gebraucht. Hier sieht man steinerne Füße, Hände, Arme, Köpfe aufgeschichtet; nur einiges davon ist von größerer Bedeutung; doch wie gerne hätten wir, wenn auch nur den kleinsten Theil der werthlosesten Statue als Andenken mitgenommen! Dies ist aber, wie natürlich, auf das strengste verboten, da Griechenland so schon durch die Kunstliebhaber des gebildeten Europa seiner schönsten Sculpturen und Vasen beraubt worden ist. Einige Mitglieder unserer Gesellschaft erlaubten sich daher nur einzelne kleine Marmorstücke von Säulen oder Mauern im Stillen als Andenken an den historischen Platz einzustecken. Wie schade, daß der griechischen Regierung und den Erhaltungsgesellschaften das Geld, und dem Volke die Kunstliebe mangelt, alle diese Schätze entweder systematisch in eigenen hierzu erbauten Localen zu ordnen oder die übrigen in verschiedenen Richtungen zerstreuten Theile mit verständigem Sinn und nach alter Ordnung zu sammeln und zu fügen, und so wenigstens theilweise den Schatten alter Prachtdenkmale herzustellen. Man hebt eine Erdscholle, sieht zwischen dem Schutt der Jahrhunderte die Formen eines herrlichen Torso erscheinen, Athen und Europa jubeln über den großen Fund und der Torso erhält seinen traurigen Ehrenplatz zwischen den andern Bruchstücken; man erzählt Wunder von dem neuaufgefundenen Meisterwerke, schreibt es einem Phidias zu, lobt es in den Kunstblättern, zeigt das wehmüthige Conterfei in Kupfer gestochen den Blicken der neugierigen Außenwelt, während in unmittelbarer Nähe der vom Rumpfe abgebrochene Kopf, die schon längst vorgefundenen Hände und Füße hier den Blicken der staunenden Reisenden als sinnlose Bruchstücke gezeigt werden. Könnte nicht ein fleißiger Künstler diese vor Jahrhunderten zusammengehörenden Glieder wieder zu einem vollendeten Götterbilde vereinen, das ein oder das andere fehlende kleine Glied mit seinem, durch das Vorbild begeisterten Meißel ergänzen? oder sollte nicht ein geschickter Architect, der sich in die Linien alter Kunstwerke hineingelebt hat, die einzelnen großen, herumliegenden Säulenstücke durch das scharfmessende Künstlerauge zusammenfügen können? doch es fehlen leider die Mittel zu einem solchen großartigen Unternehmen, und bis jetzt sind nur einzelne kleine Versuche gemacht worden, deren Gelingen jedoch gerade den Beweis giebt, wie lohnend dieses großartige, wenn auch schwierige Werk wäre. Man wundert sich, wie der faltenreiche Körper einer von ihrer alten glänzenden Stellung verdrängten Göttin auf der Akropolis ruht, während ihr lieblicher Kopf in der Ebene ausgegraben wurde und nun vielleicht im Theseustempel gezeigt wird; und doch ist dies auf ganz natürlichem, wenn auch barbarischem Wege geschehen; der grause Türke fand dieses Standbild der mythischen Dame auf der von ihm blutig erstürmten Burg, ihn erfüllte keine Begeisterung bei der Betrachtung des steinernen Kunstbildes, das Schwert seines Propheten hatte er nur zur Zerstörung gezogen; bald hatte die eiserne Faust des Barbaren ihren Zweck vollendet; der Kopf, dem Phidias mit Begeisterung Leben einhauchte, und dem er durch seinen Meisel den Ruhm einer Gottheit ertheilte, wich von dem blendenden Nacken, und nun war es ein gar artiges Spiel, dieses vom Rumpf getrennte Haupt unter Siegesjubel über die Felsen des gewonnenen Platzes in die Ebene rollen zu lassen. Doch nicht allein durch Mahommed's Söhne fielen diese Opfer des Barbarismus, sondern auch die Knechte christlicher Staaten wußten sich zu solchen Lustbarkeiten zu schicken. Nun geziemte es den Kunstfreunden des 19. Jahrhunderts im Schweiße ihres Angesichts ihren respectiven Musen ein Opfer zu bringen, die Gebeine ihrer Götter zu sammeln, und sie auf den Platz des alten Ruhmes wieder siegend aufzustellen; doch dies geschieht nicht, und soll nicht geschehen; so lehrt es die Geschichte von Jahrtausenden. Jede Periode hat auf dieser Erde ihre bestimmten Glanzpunkte, die in den Kunstdenkmalen die Bewunderung der Mitmenschen auf sich ziehen; die Aufgabe der Zeit ist es dann, diese Werke zu zerstören und der Nachwelt die Ruinen zu überlassen, damit sie ahne – lerne – und selbst schaffe. –
Durch die Pforten der Propyläen traten wir auf einen mit Steinen übersäten Raum, den eigentlich der alten Götterwelt geweihten Platz der Burg. Hier findet man noch in einem breiten großen Marmorblocke die Merkmale des Punktes, auf welchem die berühmte Minerva gestanden hatte; hier zeichnet sich in herrlichen Formen der Tempel der Erekthea; hier steht das großartigste Meisterstück griechischer Architectur, das säulenreiche gigantische Parthenon, in welchem einst der aus Gold und Elfenbein gebildete Zeus des Phidias thronte. Gleich links, wenn man aus den Propyläen tritt, ruhen, an eine große Quadermauer angelehnt, eine Anzahl aus den Metopen des Parthenon entnommener Basreliefs von seltener Schönheit; sie stellen einen Triumph- oder Heereszug dar, in dem man die wundervollsten Gestalten entdeckt; sie sind aus der Blüthe alter Kunstzeit. Doch den Hauptschatz dieser Basreliefs hat, wie bekannt, Lord Elgin, der Vertreter seiner kaufmännischen Nation nach London in das brittische Museum geschafft. Aus Dankbarkeit für den gelungenen Raub hat er dem armen Athen einen erbärmlichen Glockenthurm gebaut. So weit die mächtigen Klauen des Leoparden reichen, so weit schlagen sie Wunden, um das Herzblut zu gewinnen; und daß die Klauen des Leoparden weit reichen, zeigen die Schätze in seinem heimischen Lager.
Wir traten mit Begeisterung vor das erhabene Parthenon; die Façade ist noch ziemlich gut erhalten und giebt der Phantasie die Umrisse und Hauptpunkte an, aus welcher sie sich auf leichte Weise das herrliche alte Bild ergänzen kann. Eine breite Kolonnade im einfachsten grandiosesten Style umgiebt den geschlossenen, ebenfalls mit Säulen verzierten Tempelraum. Der First des Tempels ist leider schon sehr beschädigt, und man sieht nur aus zwei kopf- und armlosen Figuren, daß einst in demselben eine Marmorgruppe gestanden haben muß. Noch einige zerstückte Metopenspuren zeigen sich zwischen dem Dache und den Säulen. So zierlich und klein die Dimensionen beim Victoria-Tempel sind, so majestätisch und groß sind sie bei diesem Werke alter Kunst; doch stehen beide in gleich reizendem, poetisch architectonischem Einklange. Es liegt ein hinreißender Zauber in diesen Marmor-Ruinen; die Werke sind mit gesundem Sinn durchdacht und mit Begeisterung geschaffen worden; es bleibt uns ein Räthsel, wie die Männer alter Zeiten die Kräfte und Mittel hatten, jene Steinmassen auf einander zu thürmen; ja diese großen Künstler machten sogar architectonische Berechnungen, an die unsere arme schwache Zeit gar nicht gewohnt ist zu denken. So schützten sie ihre aus colossalen Steinen und ohne Mörtel errichteten Wunderbauten vor dem im Süden häufigen Erdbeben, indem sie allen Säulen eine etwas schiefe Neigung gegen das Innere des Tempels gaben, so daß die breiten gegen einander gestützten Quersteine denselben einen Halt darboten; so gaben sie den Grundlinien des Parthenon eine gegen die Mitte etwas einwärts gebogene Richtung, wodurch eine optische Täuschung entsteht, und sie diese herrlichen Bauten den Blicken größer erscheinen lassen. Für die Gestalt eines Zeus konnte kein besseres Werk als Göttersitz gewählt werden; denn es spricht aus demselben der Ernst und die Größe eines Donnergottes, und zu gleicher Zeit das poetisch Anziehende eines Nymphen-Anbeters. – Wir traten in das Innere. Wo einst das Dach war, quillt nun das hellste Licht aus blauem Aether auf den durch die Zeit in ein Goldgelb verwandelten Pentelikon-Marmor. Das Dach, zu dem das Rauchwerk der Opfernden emporwallte, liegt in Stücke geborsten auf dem Boden, über den einst das Blut der Opferthiere in reichlichem Maße floß. Auch von dem reichgeschmückten Bewohner dieser alten Marmorburg, vom Zeus des Phidias hat man keine Spuren mehr. Den goldenen Haarwuchs und Mantel wird irgend ein Eroberer zur Rundung und Auspolsterung seines Säckels gebraucht haben. Man hat im Innern zwei alte ausgegrabene Marmorthrone aufgestellt. Hier sitzen des Königs und der Königin Majestät bei archäologischen Festen, die zuweilen in diesen Räumen gefeiert werden. Wir dachten uns in die Zeiten des atheniensischen Volkes zurück, als es mit dem Fall des Kreon die Könige abschaffte; Professor K. aber nahm in antiker Begeisterung Platz auf dem Königssitze, und nun wurde ein von unserer Gesellschaft langgehegter Wunsch zur Ausführung gebracht – wir hatten nämlich vom Beginne der Reise an, eine Flasche österreichischen Weines mit aller Sorgfalt aufgehoben; nun ward sie an das Tageslicht gebracht, und ihr Inhalt wurde auf das Wohl des Vaterlandes ausgeleert. Die südlichen Gebräuche vermählten sich mit den nordischen. – Archivarius K. saß gleich einem Barden aus alter germanischer Zeit, mit dessen grauen Locken der Wind sein Spiel treibt, auf dem marmornen Thronsessel. Wir bildeten um ihn einen Kreis, worauf er einen der Stimmung des Augenblicks entsprechenden Trinkspruch mit weit vernehmbarer Stimme ausbrachte, der unserem Vaterlande einen Gruß weihte. Wir hörten seinen Worten mit Begeisterung und Rührung zu. Es war ein poetischer, der Vaterlandsliebe geweihter Augenblick, der die schöne großartige Umgebung noch erhebender machte. Wir hatten unseren Vorsatz erfüllt, auf Attika's fester Burg von den heimischen Weinbergen einen Trunk zu thun, in welchem wir in Liebe unseres theuren Vaterlandes gedachten. Ehe wir den Saft gesunder Oesterreicher-Trauben an unsere Lippen setzten, brachte ich, im Angesichte der Ueberreste alter Größen, auf der vor dem Throne befindlichen Steinplatte, nach antiker Sitte und Gebrauch den mythischen Göttern, deren kunstvollen Bildern einst in diesen Räumen gehuldigt worden war, eine Libation. Nun that Jeder einen kräftigen Schluck, worauf ich die Flasche, um sie vor künftiger Entweihung zu bewahren, an dem Marmor zerschellte. Die griechischen Officiere, welche uns begleiteten, sahen dieser Scene verwundert zu; doch als sie ihnen erklärt wurde, bückten sie sich und lasen von der zerbrochenen Flasche Ueberbleibsel als Andenken auf. Es scheint, daß unser Patriotismus den ihrigen ebenfalls aufgefrischt hatte. – Mein Bruder konnte leider dieser Feierlichkeit nicht beiwohnen, weil ihn ein leichtes Unwohlsein zu Hause hielt.
Vom Parthenon aus gingen wir durch ein Meer von Trümmern zum Tempel der Erekthea. Auf einem massiven, um den nicht sehr großen Raum herumlaufenden Mauerwerke von Marmorquadern erheben sich schlanke Karyatiden, welche den mit Steinmetzarbeit geschmückten Oberbau auf ihren Häuptern tragen. Der reiche Faltenwurf des aufgeschürzten Gewandes, das volle wallende Haar und die ernsten Züge dieser Figuren machen einen künstlerischen, architectonisch vortrefflichen Eindruck. Die Formen und die reichen Verzierungen des niedlichen malerischen Tempelchens erinnern unwillkürlich an die schön geschnitzten Schränke der Cinquecento-Zeit. An diesem reizenden kleinen Werke hat Neugriechenland sich angestrengt und einige fehlende Karyatiden durch neue gelungene Bildhauerkunst ersetzt. Auch bei diesem Tempel, wie bei allen, mit Ausnahme des dem Theseus geweihten, fehlt das Dach, wodurch sich die Ruinen mit noch schärferen Conturen auf dem Himmel abzeichnen. Die hintere Seite ist an eine Quadermauer angelehnt, wodurch die Aehnlichkeit mit einem Wandschrank noch mehr erhöht wird. Auf der andern Seite der Mauer befindet sich ein ziemlich großer Raum, der von zwei Seiten mit schönen korinthischen Säulen umgeben ist. Welcher griechischen Säulengattung der Vorzug zu geben ist, kann ich nicht entscheiden; doch entzückten mich die des Parthenon, in ihrer massiven und doch schlanken Form am meisten. Kein Schnörkelwerk, keine unnütze Zierrath verdirbt den großartigen Eindruck; es ist auch hier wie bei allem Großen und Schönen, das keines Schmuckes bedarf, um zu imponiren und zur Bewunderung hinzureißen.
Wir wendeten unsere Schritte in den Tempelbau, welchen die Alten den beiden Hauptbeschützern Athens, Neptun und Minerva, geweiht haben; doch das ernste, majestätische Götterweib, das aus Jovis dräuendem Haupte entsprungen war, erhielt die Oberhand über den wilden Wassermann, indem das kluge Volk von Athen Minerva's Geschenk, den Oelbaum, dem Neptun's, der das Roß aus den Wellen entspringen ließ, vorzog. Das Schönste an diesen Tempelüberresten ist die reich verzierte Eingangspforte, in deren Nähe man uns eine im Felsen befindliche Vertiefung zeigte, aus welcher Neptun mit seinem Dreizack eine Quelle gestoßen haben soll.
Der griechische Archäolog, ein sehr liebenswürdiger Gelehrter, führte uns in ein Haus, in welchem sich eine bedeutende Sammlung ausgegrabener Geschirre und anderer Gegenstände befindet. Griechenlands irdene Vasen zeichnen sich durch ihre graziösen und doch so einfachen Formen, und durch ihre schön gewählten schwarz und rothen Farben aus. Schwung und Poesie finden sich bei den Ueberresten dieser Zeit in allen Gestalten wieder. – Bemerkenswerth ist noch das an dem untern Theile der gegen die Meerseite zugekehrten Seite des mächtigen Felsens gelegene Theater des Herodes, welches nun langsam aus dem Schutte der Erde dem Tageslichte wiedergegeben wird, so daß man schon die alte Circusform, wie sie so herrlich in Verona zu sehen ist, wahrnehmen kann; dasselbe wurde von einem Krösus errichtet, der noch in den glücklichen Zeiten lebte, in denen man manchmal des Geldes zu viel hatte. Ihm war es wie folgt gegangen: er hatte einen Schatz gefunden, was damals auch schon zu den Annehmlichkeiten des Lebens gehörte; er wußte keinen Gebrauch von den Massen Goldes zu machen; er wendete sich in seinem Drangsal an Kaiser Hadrian, welcher ihm den Gedanken einflößte, den ihm so lästigen Schatz zu verbauen.
Wir verließen die Akropolis mit dem erhebenden Gedanken, Großes – Unvergängliches gesehen zu haben. Wir fühlten uns der Zeit näher, in welcher ein Perikles gewaltet, und ahnten den Schöpfungsgeist unerreichter Künstler. Mit Bewunderung verließen wir eine Stelle, auf welcher die größten Geister Griechenlands sich bewegt hatten, und unsere Seele nahm den Schatten des Bildes der Akropolis auf, wie sie war, als noch Einheit und Leben in diesen Räumen herrschte, als noch der Weihrauch der reichen Opfer zu dem ungetrübten Aether stieg, und der Jubel der freudetrunkenen Schaaren in das ewig grüne üppige Thal niederrauschte.
Von der Poesie ging es zur Prosa über, und ich hatte nun die nicht sehr angenehme Aufgabe, das diplomatische Corps zu empfangen. Dergleichen Dinge waren kalte Douche auf den poetischen Enthusiasmus, in welchem das Herz über alte Größe schwelgte.
Um halb fünf Uhr setzte ich mich mit der Königin zu Pferde, um wieder einen kleinen Ausflug in die merkwürdige Umgebung Athens zu machen. Das Wetter hatte sich bedeutend getrübt; die Gegend, durch welche uns die leichten orientalischen Pferde trugen, bot in der düstern Beleuchtung ein Bild der Melancholie. Nacktes, tiefgefärbtes Hügelwerk machte den Eindruck des Erstorbenen, da ihm der Wiederschein der glühenden Sonne fehlte. Die Oliven mit ihrem düstern Grau brachten kein Leben in die schwermüthige Landschaft, welche sich bald in ein weites Thal öffnete.
Am Eingange desselben stand in der Nähe der grauen Bäume ein kleines Kapellchen; vor demselben lagen im wüsten Durcheinander Steinblöcke. Hier war es wo Byron dichtete, wo sein Mädchen von Athen entstand. Die weite Aussicht, welche sich von diesem Punkte dem Blicke eröffnet, zeigt gleich einem Spiegel, die Seele des großen Dichters: Wehmuth und glühende Sehnsucht, die von einem brennenden Sonnenstrahle zur ahnungsvollen tiefen Gluth entzündet werden. Doch heute war es der griechischen Sonne nicht gegönnt, diese Hügel und die weite Ebene mit dem Farbenschmelz des Südens zu bemalen; solche Tage sind es nicht, die der glühenden allzufeurigen Dichtung günstig sind; an Tagen wie heut kann das liebeskranke Herz des Dichters nur in melancholischen Tönen singen. Es war ein Bild des schmachtenden, nicht des siegestrunkenen Byron. Nur ein einziger Punkt der Hoffnung schimmerte in weiter Entfernung in diesem trüben Bilde: ein weißes Kirchlein, umgeben von einigen Häusern und üppigen Bäumen, war dem Auge ein Trost; mit inniger Freude erfuhr ich, daß eine Colonie deutscher ausgedienter Soldaten dort wohne.
Für die Verehrer alter Bauten sind in diesem Thale zwei Aquaducte das Merkwürdigste; sie stammen aus der Römerzeit und sind aus Ziegeln erbaut; den größten Theil der Pfeiler hat jedoch die Zeit schon verschlungen. Was bei diesen zwei Wasserleitungen für den die Natur beugenden Willen der Erbauer am meisten Staunen erregt, ist, daß sie in demselben Thale in entgegengesetzter Richtung laufen. Der Zweck dieser Bauten hat aufgehört, und die Pfeiler stehen nur mehr als traurige Merkmale einstiger Kultur da. Mit einigem Kostenaufwande ließen sich diese Aquaducte wohl wieder herstellen, was dem armen, dahingestorbenen Lande wenigstens einiges neue Leben bringen würde. – Kaum hatten wir diese Ruinen angestaunt, so überfiel uns ein ziemlich starker Regen; die Königin spannte einen Schirm auf, die Pferde wurden in ein lebhaftes Tempo versetzt und nun gings eilends einem kleinen in der Nähe befindlichen königlichen Maierhofe zu, der sich an den Ufern eines frischen Baches befindet. Das Auge erblickt mit Freude in seiner Umgebung einige saftige Kleefelder und Obstbäume. Im Hofe des nach deutscher Weise eingerichteten Gebäudes verließen wir die Pferde; mit Stolz zeigte uns die Königin einen herrlichen Kuhstall, der für die, nach deutscher Sitte den Kaffee Trinkenden, die Sahne liefert; auch hat man sich am Hofe wirklich nicht über die Milch zu beklagen, welche sonst in südlichen Ländern den nordischen Bewohnern so sehr abgeht. Eine breite üppige, von einem einzigen Weinstocke gebildete Laube vor den Zimmern des Maiers schützte uns vor dem Regen. Die Königin, welche sich einen vortrefflichen Appetit durch die häufige Reitbewegung zu erhalten weiß, ließ von der deutschen Hausfrau Pfannkuchen backen, welche in einem kleinen finstern Zimmer verzehrt wurden; indeß waren Wagen von Athen gekommen und wir konnten trocken nach Hause fahren. Im Fluge wurde Toilette gemacht, worauf man zum Diner ging, bei welchem Capitän W. von unserem Geschäftsträger Grafen J. der Königin vorgestellt wurde. Da die lebhafte Majestät fand, daß man am heutigen Tage noch zu wenig Bewegung gemacht hatte, so wurde nach Tisch noch à la guerre gespielt. Die ganze Herrengesellschaft befleißigte sich, ihr Spieltalent zu entwickeln, was jedoch Manchem auf sehr komische Weise mißlang, wodurch es dem geübten Billardspieler Dr. F. ein Leichtes wurde, obzusiegen. Mit diesem Triumphe der Wiener Kunstfertigkeit endigte der heutige Tag.
Tags darauf besuchten mein Bruder und ich noch einmal in Begleitung des Grafen C., des Archivarius K. und der beiden uns zugetheilten Adjutanten den herrlichen Theseustempel, dessen im Innern befindliche Kunstschätze wir noch nicht zur Genüge betrachtet hatten; am heutigen Morgen konnten wir alles mit Muße beschauen, ohne von den, mit Ausnahme des Professor G., für Kunst minder schwärmenden Reisegenossen gestört zu werden; dabei unterstützte uns die angenehm belehrende Erklärung des griechischen Archäologen. Der merkwürdigste im Tempelraume befindliche Gegenstand ist das Basrelief einer Heldenfigur aus der Zeit des Xerxes; es stellt Aristion, einen Verwandten des Theseus vor. Diesem seltenen Denkmale wenigstens schenkte man etwas Fürsorge, und barg es in einem gläsernen Kasten vor dem Einflusse der Luft. Man sieht aus dem Profil dieses Heldenbildes, in wie früher Zeit man in Griechenland schon ein Gefühl für Kunst hatte; ist die, späteren Zeiten vorbehaltene, schöpferische Kraft in diesem Werke auch noch gebunden, so läßt sich doch ersehen, daß einem Volke, welches schon in der Kindheit solches zu leisten vermochte, eine herrliche Zukunft bevorstehen mußte. Die Züge und Gliedmaßen der Figur sind noch steif und ungehobelt, und man konnte aus denselben schließen, wie der Funke der Kunst von den alten ernsten, steinernen Aegyptern auf das jugendfrische, lebhafte Volk der Griechen übergegangen war, und erst hier unter den Einflüssen einer glücklichen und kräftigen Natur sich zu dem hehren allbewunderten Flor entfaltet hat. Wenn wir dieses älteste Denkmal griechischer Sculptur verlassen, so finden wir schon nebenan Grabsteine aufgehäuft, welche durch die sinnreiche Idee, die ihnen innewohnt, und durch die Ausführung an Hellas Blüthezeit erinnern.
Denn nach den granitenen, schon wegen des schwer zu bearbeitenden Materials, kalten und steifen Bildern der ägyptischen Schule, hat das jüngere Streben dem weichen weißen Marmor des Pentelikon einen neuen Geist eingehaucht. Der Künstler hat schon Scenen aus dem Leben mit seinem mythischen Glauben verbunden und den mystischen Schleier gelüftet, so daß der Beschauer den Ausdruck des Gedankens, der ihn geleitet, findet. Die auf den Grabsteinen befindliche Figur des Sterbenden ist immer in sitzender Stellung und hüllt sich in einen Schleier, um das Scheiden von der Welt darzustellen; um ihn herum stehen Verwandte und Freunde, welche durch ihre Gebete die schmerzliche Trennung hindern wollen. Ist es eine Mutter, die in dem Kreise der Ihrigen stirbt, so hat der Künstler ein Kind zu ihren Knieen hingestellt, das einen Vogel im Händchen hält, wodurch er die hinfliehende Seele der geliebten Mutter versinnlicht. Dieser Grabsteine sind sehr viele aufbewahrt, und die mannigfaltigen Figuren auf denselben sind nicht typisch, es ist Fleisch und Blut vom reichsten Faltenwurfe umwallt. Unter den übrigen Gegenständen sind noch ein Sarkophag und eine treffliche Statue bemerkenswerth. Die letztere stellt einen Jüngling vor, den man als Apollo bezeichnet; ob mit Recht, weiß ich nicht, wiewohl der Gliederbau desselben eines Gottes würdig wäre. Eine ziemlich colossale Statue mit ägyptischer Bekleidung trägt die Spuren späterer Kunst in der Art ihrer Bearbeitung. Der Archäolog sagte uns, sie stellte Antinous, den Liebling des Hadrian vor. Sie ward auf dem Felde von Marathon gefunden; ich glaubte gern, daß dieses Werk der römischen Periode angehört, da man den leichten Gliederbau griechischer Kunst darin vermißt. In der Kolonnade des Hadrian, wohin wir uns nun begaben, sind in deren vorderem abgeschlossenen Raume ebenfalls Alterthümer aufbewahrt, unter denen wir noch mehrere Grabsteine nach Art der eben beschriebenen fanden.
Wir kehrten auch noch einmal zum Tempel der Winde zurück, der in meinen Augen durch die Erklärungen des Archäologen sehr an Interesse gewann. Zu diesem Gebäude führt, wie ich schon oben bemerkte, ein Aquadukt, dessen nunmehr vertrocknete Wässer vor Zeiten eine Broncestatue des Neptun so gleichmäßig bewegten, daß er den Mittelpunkt eines Uhrwerks bildete, das nach dem Lauf der Stunden Figuren zum Vorschein brachte, deren Alter und Größe mit der Stundenzahl wuchs. Im ersten Zeitabschnitte zeigte sich ein kleines Mädchen mit einem Füllhorn, in dem sich Knospen befanden; in dem zweiten eine Jungfrau mit aufblühenden Knospen; zuletzt erschien die Gestalt eines Weibes mit ganz erschlossenen Blüthen. – Auch befindet sich an diesem Tempel eine Sonnenuhr, in deren Mittagspunkt ein Strich anzeigt, daß der Lauf der Erde sich seit zwei Tausend Jahren nicht im mindesten geändert hat; denn noch heute werfen die Strahlen der Sonne genau um Mittag den Schatten der Eisenstange auf dieses dem Stein eingefügte Merkmal. In den Windrichtungen des Octogons befinden sich große Basreliefs, welche die verschiedenartigen Winde mit ihren Eigenschaften darstellen; die kalten oder schädlichen haben ältere, bärtige Gesichter, um die Rauheit des Elements darzustellen. Die lauen Frühlingswinde erscheinen in Jünglingsgestalt; daß dieselben barfuß sind, soll in versinnlichender Weise der Griechen ausdrücken, wie leicht dieselben über die Blumenteppiche der neu erwachten Natur fortschreiten. Manche dieser Figuren tragen musikalische Instrumente in der Hand, als Zeichen ihrer Lieblichkeit; manche bringen Blumen und Früchte, als Merkmale, daß sie dieselben hervorrufen. Der den Atheniensern verhaßteste Wind hält mit der Hand eine große Muschel vor den Mund, wodurch sein tönender Lärm ausgedrückt wird.
Von dem Tempel der Winde begaben wir uns in ein ehemals von den Türken zu einem Dampfbade verwendetes Gemach; in welchem jetzt die Gypsabdrücke aller nicht mehr in Griechenland vorhandenen Kunstschätze gezeigt werden. Hier befinden sich auch die Abdrücke der von Lord Elgin gestohlenen Basreliefs des Parthenon. Old England hatte die Gnade, den armen Griechen dieselben zu schicken, um sie dadurch aufmerksam zu machen auf das, was sie verloren haben. – Von hier fuhren wir zu dem sogenannten Marktthore, welches eigentlich, einige schon verkürzte herumstehende Säulen mit inbegriffen, einen Rest des Tempels der Minerva bildet; der jetzige Name ist diesem Porticus fälschlich beigelegt. Wir besuchten auch noch die in der Nähe dieser Ruinen befindliche katholische Kirche. Sie ist klein und im höchsten Grade unansehnlich, so daß wir in diesem Punkte von den Anglicanern übertroffen werden, welche sich ein recht nettes gothisches Kirchlein erbauten, während zum katholischen Gotteshause eine Moschee umgewandelt wurde. – Um ein Uhr fuhren wir mit der Königin in einem char à banc dem Gebirge zu. Bald aber trafen wir die königlichen Pferde, welche des uns bevorstehenden schlechten Weges halber bestiegen werden mußten. Das Wetter begünstigte uns am heutigen Nachmittage außerordentlich, so daß die interessanten Gebirgs-Parthieen noch malerischer hervortraten.
Die Kultur mangelte fast gänzlich; doch glänzte um so schöner das frische Grün der Pinien zwischen den Steinmassen und über der gelben südlichen Erde. Bald mußten unsere Pferde über die schlüpfrigen Felsen zu steigen anfangen. Als wir auf der ersten Höhe anlangten, empfingen uns die »zito's« der uns entgegengeeilten Bewohnerschaft des Dorfes Cassia, welches wir in dem sich nun erweiternden Thale, zwischen einer der felsigen Gegend mit Mühe abgewonnenen Vegetation, berührten. Es war ein hübscher, pittoresker Platz, dessen, zwischen den grauen Massen vertheiltes Grün dem Auge wohl that. Die Freude der Bevölkerung, die Königin zu sehen, war so groß und laut, daß das Pferd der Letzteren einigemal scheu zurückwich. Das Kostüme der Dorfbewohner war dem von Eleusis ganz ähnlich; je tiefer man in das Land eindringt, je höher man die Felsenburg erklimmt, desto orientalischer, desto urwüchsiger werden das Land und seine Bewohner; es sind kernige, an alle Entbehrungen gewöhnte Menschen, fest in ihrem abgeschlossenen Glauben, kräftig an Körper und Seele, und dadurch frei und stolz in ihrer Haltung, in jeder Bewegung natürlich graziös. Spukte nicht die Verschmitztheit der alten Griechen und die Schlauheit des Slaven in diesem ungezwungenen Gebirgsvolke, so würde ich es mit den felsenfesten Tyrolern vergleichen. Diese dunkle Wolke wirft auf den Hirten der bergigen Halbinsel einen trüben Schatten. Doch gerade, daß diese Berge in ihren Ausläufern am Gestade des Meeres Hafen bilden, mag diesem Volke die List des Krämers gegeben haben. Ihr kriegerisch blutiger Sinn, welcher sie dahin brachte, sich hinter ihren Felsburgen schützend, den Feind mit lang genährter Rachelust aus dem Lande zu jagen, hat sich nicht, wie beim Tyroler, nach errungenem Siege friedlich gelegt; der Kampf war zu lang und blutig, und mit der Zuthat des listigen Elementes ist er in Räuberei ausgeartet, von welcher man selbst bei solchen größeren Ausflügen, wie wir ihn machten, nicht ganz sicher zu sein scheint; denn wir sahen heute an mehreren Punkten des Weges Gensd'armen aufgestellt. Zwar versicherte die Königin, es sei eine unnöthige Dienstbeflissenheit; doch glaube ich wahrlich nicht, daß diese Maßregel ohne Grund genommen wurde. Schon im Umfange des Ortes verengte sich der Weg durch steinige Hindernisse; doch die Königin, an dergleichen durch ihre großen Reisen im Innern des Landes gewöhnt, setzte leicht darüber hinweg, und es ging bald zu noch steileren, mit Pinien und Felsenspitzen malerisch besäeten Höhen hinauf, bald darauf abwärts über gänzlich ungeebnetes Gestein, über einen Pfad, dem man in unseren Landen nicht einmal den ehrenwerthen Titel »eines Fußsteiges« geben könnte; und hier wußten die Pferde steigend und rutschend vorwärts zu kommen. Je mehr wir uns unserem Ziele, der alten Grenzfestung Phila näherten, desto wilder und enger wurden der Weg, und desto mannigfaltiger die Formen der Felsen. Ueberall ragten die Pinien freundlich hervor. Mich erinnerten diese Punkte an unser Salzkammergut und unser Tyrol. Noch mußten wir über unregelmäßige Steinplatten, zwischen einer Felswand und einem steilen Abhange, reiten und Angesichts der Feste eine Thalschlucht passiren; dann befanden wir uns beim herrlichsten Wetter an dem pittoresk und hochgelegenen Ziele unseres Ausflugs. Zwischen zwei Thalengen auf der Endspitze eines breiten, ziemlich üppig bewachsenen Plateau's liegen die Ruinen dieser interessanten Feste; sie bestehen aus einem nicht sehr ausgedehnten Vierecke von kolossalen schmucklosen Quadermauern; an den Ecken befinden sich vier Thürme, deren einer rund ist, was uns bezeugt, daß schon die griechischen Architekten die runden Mauern zu errichten verstanden. Phila war ein Zufluchtsort der dreißig Tyrannen, in welchem sie sich vor dem thätlichen Unwillen des atheniensischen Volkes sicherten. Man sieht, daß die Idee eines felsenfesten buon retiro's nicht erst im Mittelalter entstand. Die dreißig Herren konnten von diesem Adlerneste aus, auch ohne Plößl'schen Tubus, die ihnen gefährliche Stadt Athen mit dem den Hintergrund bildenden Azurspiegel des Meeres durch den Einschnitt der Gebirgsmassen betrachten. Die Ketten der Tyrannen sind gebrochen, die schützenden Mauern zerfallen, und nun spinnt der friedliche Epheu, der gewöhnliche Todtenschleier, wie ein wundersam üppiges grünes Netz über das alte Gemäuer; die gefürchtete Burg ward ein romantisches Ziel für Spaziergänger. Die Aussicht auf Athen, auf die Akropolis und das herrliche Meer war wahrhaft bezaubernd; zwischen der dunkleren Gebirgsmasse schien es ein in Rahmen gefaßtes Miniaturbild zu sein.
Nachdem sich die Pferde etwas von der Anstrengung erholt hatten, brachen wir auf. Anfangs ritten wir wieder auf dem halsbrecherischen Felsenwege, der sich an den Gebirgen längs des schmalen Thales hinzieht; wir verließen jedoch bald die auf dem Herwege eingeschlagene Richtung, um, wenn möglich, noch bedeutendere equestrische Gefahren zu bestehen. Es ging über den Bergrücken, von dem wir auf einer für Gemsen allenfalls guten Promenade uns abermals gegen ein schmales Thal abwärts senkten. Vor uns öffnete sich die steinige Schlucht, um uns ragten Felsen aus dem niedern Gestrüppe, und wir selbst schwebten auf den halb rutschenden, halb vorwärts schreitenden Pferden von Stein zu Stein längs des steilen Abhanges; ein Fehltritt des eifrigen Thieres und das betreffende Opfer ist ein Kind des Todes; dies sind die Unterhaltungs-Ritte der schaulustigen Europäer im alten Hellas, dem einstigen Sanctuarium der Civilisation und des Fortschrittes. Die Schlucht ward immer enger, und umsonst suchte mein Auge die Mauern des Klosters, welches das Ziel der nunmehrigen Todesgefahren sein sollte. Statt dessen entdeckte ich, daß derjenige Theil der Karavane, der sich hinter der Königin, meinem Bruder und mir befand, der Gefahr, in welcher wir schwebten, innegeworden zu sein schien; denn nordische und südliche Reiter, von deren Wagnissen man oft sprechen hört, hatten den Sattel verlassen, und führten gemüthlich ihre Pferde am Zügel. Sie zogen es vor, ihre Füße zu strapaziren, anstatt in der Luft über den Abhängen zu schweben. Für's theure Leben war diese Maßregel freilich besser; doch da wir sahen, daß die kühne Basilissa die Gefahr nicht scheute, blieben mein Bruder und ich sattelfest. Die merkwürdigste Stelle war uns noch vorbehalten. Da ich »Pfad« nicht sagen kann, so werde ich mich des Ausdruckes Richtung bedienen: wir kamen von der steilen Anhöhe, und unsere »Richtung« sollte nun dem Innern der Schlucht zugehen; der Punkt zum Umwenden bestand aber nur aus einem Felsenvorsprung, auf welchem ein Pferd gerade Platz zum Stehen hatte. Das Pferd der Königin gelangte auf diesen schwindelnden Raum; da ward die hohe Frau plötzlich der Gefahr inne, Roß und Reiterin wollten nicht vorwärts, doch ein Schritt zurück, führte unfehlbar den Sturz in die Schlucht herbei. Die Lage war peinlich; bald nahte jedoch die hülfreiche Hand des deutschen Stallmeisters, welcher das Pferd der Königin am Zügel vorwärts führte, worauf wir ebenfalls diesen furchtbaren Punkt, Gott sei Dank! glücklich passirten. Wir konnten nun das Ende der Schlucht, in welcher ein Wasser rauschte, wahrnehmen; doch wo war das Kloster? Die Welt schien mit Brettern verschlagen; wo sollten wir hier zwischen Felsen und Pinien, in dieser Urnatur ein Werk menschlicher Hände entdecken? Da sahen wir plötzlich nach der Wendung des Pfades, daß die Richtung, die wir einschlugen, am Ende der Schlucht in noch sehr bedeutender Höhe durch eine kleine Mauer zwischen den abhangenden Felsenmassen abgeschlossen war; doch wo sollten wir das Kloster finden? Die Schlucht ging zu Ende, die kleine Mauer war nur als eine Wegsperre zu betrachten; das Räthsel wurde immer spannender, wir standen vor dem Holzthor dieser Mauer, die Angeln knarrten und wir fanden uns plötzlich als Staffage im romantisch lieblichsten Bilde stiller Einsamkeit. Wir waren wie mit einem Zauberschlag in den Klosterhof versetzt. Von Außen drohte die Wildniß, von Innen spann sich ein großer Weinstock wie ein zarter Schutz über den stillen Frieden des Gebetes; nur das reine, blaue Auge des Himmels hatte Einlaß in diese Zuflucht frommer Seelen. Der heutige Ritt mag das Bild des Lebens von so manchem Mönche gewesen sein: er verläßt den häuslichen Herd, wo er noch zwischen den Blumen des Gartens die frohen Kinderjahre zubrachte; er tritt hinaus in die Welt, die sich ihm als eine breite Thalebene, in weiter Ferne mit malerischen Bergen begrenzt, darstellt; muthig schreitet er vorwärts, der Weg ist ja so flach, die Häuser der Freunde und Beschützer so nahe! Doch es zieht ihn zu den Bergen; er will die in der Ferne schimmernden blauen Höhen erklimmen, er naht ihrem Saume; das Werk ist leicht, so spricht er zu sich, denn mein Auge kann ja den Weg übersehen, es reicht vom Ausgangspunkte bis zum Ziele; doch die arme Seele vergißt des Fußes, der sie hintragen soll, sie vergißt, daß ein Fuß auch straucheln kann, daß, wo Höhen sind, auch Abgründe gähnen; er folgt den Sinnen und traut der Festigkeit seines Trittes. Das Thal wird enger, die Fläche steigt empor, der Erde entwachsen spitze Felsen, doch ist die Gefahr noch klein, er schreitet muthig vorwärts; die Sonne steigt am Firmamente, und wirft ihre glühenden Strahlen; der Pfad wird immer rauher; der Wanderer beginnt die Abgründe zu erblicken. Anfangs steigert dies seine Schaulust; er sieht ein Dorf vor sich, die Bewohner kommen ihm mit Freudengeschrei entgegen, sein Stolz hebt sich; doch ist er noch nicht befriedigt, er muß über die letzten Ansiedlungen wohlwollender Menschen hinaus; ihn treibt es stürmisch vorwärts; nach Ruhm geht sein Begehren: die Felsenburg muß er erklimmen, sein Blick muß über Regionen schweifen, wo nur der Adler haust; er achtet nicht der Gefahren, denn schon glaubt er den ersehnten Punkt von weitem zu erblicken; die Schluchten werden enger, schwindelnder die Höhen, er strebt empor – er hat das Ziel erreicht und findet eine Ruine gefallener Größe. Da ergreift ihn zuerst die Mattigkeit, da schwindelt ihm vor dem grausen Abgrund; in trüber Verzweiflung irrt er in der Wildniß fort, seine Wünsche sind vereitelt, seine Hoffnungen sind gebrochen; immer drohender wird die Gefahr, todtbringender jeder Schritt, immer steigt sein Weg, er kommt dem Abgrund immer näher; da tritt er auf eine Felsenspitze, ihn umgibt rauhe Wildniß, die frische Vegetation hat ihn verlassen, er steht allein im grauen Steinmeere! Jetzt sinkt sein Muth, jetzt ist er vernichtet, seine Noth aufs Höchste gestiegen. Da erblickt er eine Mauer mit einem verschlossenen Thore; mit Reue im Herzen stürzt er entkräftet an der Schwelle hin, er pocht an die Thüre, er weiß nicht, was sie ihm öffnen soll, – da knarren die Angeln und der müde Wanderer befindet sich im stillen Klosterhofe; die Rebe breitet ihre Arme zum kühlen Schatten aus, das Kirchlein ladet ihn zum reuigen Gebete ein, ernste Freunde reichen ihm die Hand und nehmen ihn in ihre friedliche Mitte auf. –
Dieses Kloster, dessen Andenken mich noch heute bewegt, ist, wie ich schon früher bemerkt, mit einer Mauer umgeben, und hängt gleich einem Schwalbenneste auf einem Felsenvorsprunge an dem steinigen Gebirge. Der kleine, innere Raum derselben ist so gut eingetheilt, daß er dem besten englischen Reise-Necessaire Ehre machen würde. Kleine steinerne Häuschen, welche das treueste Bild der menschlichen Abtödtung sind, finden an dem Felsen und der Mauer angelehnt Platz. In dem winzigen Hofe befindet sich noch eine etwas erhöhte Terrasse, welche unter dem reichen Rebendache eine malerische Bewegung in das ganze Bild bringt. Ueber diese Terrasse begiebt man sich zu dem den Hintergrund bildenden Kirchlein. Wir traten mit der Königin in dasselbe ein. Es trägt den Typus der byzantinischen Gotteshäuser; ein mystisches Dunkel herrscht im Innern, welches daher rühren mag, daß das Ende des Kirchleins in dem Felsen eingehöhlt ist. – Als wir hierauf im reizenden Hofe, in welchem man nichts von den nahen Abgründen ahnt, kurze Zeit ruhten, bildete die Karavane die pittoreskeste Skizze für einen nach Originalität haschenden Genremaler.
Europas fade Dandy-Kleidung, Frankreichs elegante Amazonentracht, Neugriechenlands reiche Gewande fanden sich verkörpert in einem altorientalischen, der Entsagung geweihten Klosterhofe. Man hatte sich auf die Steine niedergelassen; es rappelte und trappelte im niedern dunklen Klostergemäuer, und eine hagere vergessene Mönchsgestalt trat mit freundlicher Miene zwischen die bunte, jugendliche Welt. Der weiße Bart des altersschwachen Mannes wallte über einen dunklen kurzen Kaftan, unter dem blaue Pumphosen zum Knie reichten. Bein und Fuß waren in weiße Strümpfe und schwarze Schuhe gekleidet. Auf dem gebückten Haupte saß eine Art persischer Mütze; von den Schultern bis zur Hand waren die Arme weiß bekleidet. Wie in den Klöstern des Occidentes brachte uns auch dieser Mönch freundliche Gaben der Natur, in Honig, Brot und Trauben bestehend. Wir erkundigten uns, wo die übrigen frommen Brüder wären. Man benachrichtigte uns, daß sie mit der Feldarbeit beschäftiget seien. Im Ganzen wohnen deren sechs in dieser Einsamkeit; ihre Einrichtung besteht so zu sagen aus nichts; sind die Wohnungen im Gegensatze zu Oesterreichs herrlichen Abteien stallähnlich, so ist auch der Geist im Vergleiche mit dem unserer reichen Benedictiner von höchster Einfalt; doch paßt diese Einfalt zu dem rauhen wilden Lande, und der alte fromme Sinn, der hier herrscht, macht keinen geringern Eindruck, als die hohe Wissenschaft in den Klöstern unseres Vaterlandes.
Bald setzten wir uns wieder zu Pferde, und verließen die uns so interessant gewordene Schlucht, an deren Ende eine Höhle sein soll, in welcher, wie uns die Königin sagte, der österreichische Gesandte, Freiherr von Prokesch einen großen Schatz an alten Vasen gefunden hat. Auf einem nicht minder malerischen Wege kamen wir wieder zu dem Dorfe Cassia zurück. Hier wurde von Neuem auf einem herrlichen mit Pinien bewachsenen Plätzchen gelagert. Feldsessel und ein kleiner Tisch wurden aufgestellt, und ein stärkendes Mahl eingenommen. Der Platz war lieblich, und die Ruhe that wohl. Ich machte die Bemerkung, daß Griechenlands uncultivirtes Volk gleich den europäischen Brüdern eine große Neigung hat, dem Essen hoher Personen zuzusehen. Ich dachte mir schon oft, daß die Leute sich einbilden müssen, daß Königinnen auf andere Art essen, wie die übrigen Menschenkinder; doch hier war das Interesse gegenseitig, denn auch für uns Reisende waren die griechischen Zuseher interessant zu betrachten. Nachdem wir von unserem Lager aufgebrochen, sprach die Königin im lieblichsten Griechisch zu den Kindern der Gemeinde. – Wir setzten nun unseren Weg zu Pferde fort; als wir in die Ebene gelangten, brach die Nacht herein und ein neues Schauspiel bot sich unseren Blicken; mit mildem, ernstem Antlitze erschien der Mond im Chor der Sterne. Wie Alles im Süden heller, feuriger, begeisterter ist, so blinken auch die Gestirne mit einem eigenthümlichen, bezaubernden Glanze herab. Im Norden scheint der Mond im Blau des Himmels seine Stütze zu finden, während er in Attika's Gefilden frei im Aether schwebt und das entzückte Auge noch in eine weitere unbekannte Entfernung zu blicken glaubt. So hell leuchtete das Gestirn durch die Nacht, daß die muthige Königin im raschen Galoppe, trotz der schlechten Straße zur Hauptstadt reiten konnte. Die Wagen, welche uns entgegen gekommen waren, wurden zu meinem großen Vergnügen nicht benutzt, und frisch dahin sausend, kamen wir durch die herrliche südliche Nacht zum königlichen Schlosse. Mit Bewunderung gesteh' ich es, daß die kühne Basilissa es versteht, ihren Gästen das Land und seine schönen Punkte zu zeigen und schätzen zu lehren.
Wir waren erschöpft von dem langen, sieben Stunden währenden Ritte; aber nur der Körper war etwas müde, der Geist thätig, und so brachte uns der herrliche, südlich laue Mondschein zum Entschluß, noch einmal unsere etwas angestrengten Glieder in Bewegung zu setzen. Es lag eine enthusiastische Unersättlichkeit der Kunstliebhaber darin, die sie hinderte, sich die Müdigkeit zuzugestehen. L'appétit vient en mangeant – und daher war auch die kleine Anzahl der Philhellenen und Antiquitäten-Verehrer wirklich selig, noch diesen Genuß zum Schlusse des thatenreichen Tages zu haben. Zur erhabenen Freude an den griechischen Kunstwerken kam auch etwas Bosheit; wir ergötzten uns nämlich weidlich an den verzweifelten Mienen der prosaischen Comforthelden. – Das vortreffliche Diner ward rasch eingenommen, und wir stürzten uns hierauf, von der Basilissa angeführt, in die königlichen Kutschen. Schon während der Fahrt hatten wir Gelegenheit das klare, mild hingegossene Mondlicht zu bewundern und die Vortheile einer solchen Beleuchtung zu würdigen. Alles wirklich Erhabene tritt hell hervor, während der niedere Erdenwust im Dunkeln liegt. Die einzelnen Farben verschwinden, dem Ganzen einen sanften Ton eingebend, und die Formen der Gegenstände unterscheiden sich nur durch ihre Schatten. Am hochliegenden Thore der Akropolis wären wir fast, in Bewunderung versunken, ein Opfer unserer Kunstliebe geworden. Die Pferde, welche unseren Enthusiasmus nicht zu theilen schienen, wollten den heiligen Weg (via sacra) nicht weiter fortschreiten, und unser Wagen rutschte bedachtsam gegen die, dem steilen Wege nahen Abhänge. Die Neugriechen, welche diese Straße aus gänzlichem Mangel an Wagen nie befahren, sorgen nicht einmal für die Beruhigung der Reisenden; kein Geländer gab uns die süße Illusion einer Rettung. Die Königin ergriff daher unter verzweiflungsvollem Angstrufe das einzige uns Übrigbleibende Mittel, und stürzte sich aus dem Wagen. Das Hoffräulein, welches durch die für eine Griechin ungewohnte Emotion in eine Ohnmacht verfiel, wurde dem helfenden Lakai, einem dicken Baiern, in die Arme geworfen. Carl und ich retteten uns ebenfalls durch das von der Königin angegebene Mittel. Der Wagen, von unserer Wucht befreit, konnte durch die Pferde erhalten werden, und zu Fuß traten wir nun in das Thor des erhabenen Göttersitzes ein.
Vom Vorhofe aus hatten wir den ersten zauberhaften Anblick auf das in einen Silberspiegel verwandelte Meer. Mein Auge ruht immer mit gehobenem Gefühle auf der weiten See; wie erst, wenn sie vom Vollmonde aus griechischem Himmel beleuchtet ist?
Von jeher sehnte ich mich nach und träumte ich von dem Süden; nun fand ich meine Träume verwirklicht und weit übertroffen. Mit welch' stolzem Gefühle schritt ich über die hellglänzenden Stufen der Propyläen, deren Säulen gleich Riesen aus der Götterzeit um uns standen! Schwarz und eckig entwuchs der dunklen Erde der zierlose Frankenthurm; klein und doch lieblich erhaben, schwebte zwischen Meer und dunkelblauem Himmel der zarte Victoria-Tempel, gleich einer Phantasie aus südlichen Träumen. Herrlich thürmte sich das stolze Parthenon, als sei es durch ein Götterwort erstanden. Leicht stützten die Caryatiden den Tempel der Nymphe Erecthea. Alles so schön, so groß, so phantasiereich und alles – doch nur Ruinen!
Unwillkürlich fiel mir in diesem Raum voll Trümmern, vom Monde schwärmerisch beleuchtet, der Gedanke ein: hier sei der Kirchhof der Geschichte. Fünf Völkerperioden wälzten sich über diesen Platz, und nur die erste füllt uns noch mit staunender Bewunderung. Die tiefe Poesie, welche in den Werken der Griechen liegt, konnte ihnen kein anderes Volk einhauchen. Der Römer ist groß, aber erdrückend schwer; der Franke eckig, stark und plump, und von des Türken gräulicher, fanatischer Verwüstung zeugen nur kahle Schädel. Mit talentvollem Enthusiasmus führte uns die Königin auf die glücklichst gewählten Standpunkte, von wo wir die einzelnen Werke in ihrer ganzen Pracht sehen konnten. Sie betrachtet als Königin der Hellenen einen Theil des Ruhmes, der den alten Werken anhängt, als ihr Erbtheil. Stundenlang hätt' ich an diesen verschiedenen Punkten, meinen Gedanken selbst überlassen, weilen mögen – aber die Gesellschaft war zu groß, zu viel Unbedeutendes mischte sich hinein. Ich hatte das Gefühl, hier könnte ich dichten, Gedichte der Sehnsucht und Begeisterung. – Wir traten auf eine der Endspitzen des reich beladenen Felsens, von wo wir die neue Stadt sehen konnten. Sie war in ruhiger Stille ausgebreitet, und nur die beleuchteten Fenster zeigten, daß Leben in ihr walte. Wie wenn ein unmündiges Kind am Fuß des Thrones seines berühmten Ahnen sitzt, lag sie da; und die an unserer Seite stehende Basilissa, ist der Genius, der das Band zwischen Einst und Jetzt knüpft. – Wir schieden mit vollem Herzen; meine Seele hatten Töne anderer Zeiten durchrauscht. Die Königin, um die Ausdauer der Gesellschaft zu prüfen, schritt nun, zu meiner großen Freude, von hier aus zum Areopag, auf den Fels, von welchem der heilige Paulus zu den Atheniensern vom unbekannten Gotte sprach. Auch hier war es himmlisch. Die Königin hüpfte auf den Felsblöcken so munter herum, als hätte sie den ganzen Tag geruht, zum großen Aerger der Comforthelden, welche lieber in weichen Dunen vom rosigen Champagner geträumt hätten. Als wir den Areopag verließen, sahen wir plötzlich, gegen die Meerseite zu, ein herrliches Meteor fallen, so mächtig, als stürzte der Mond herunter. Es verwandelte seine Farben in Grün und Roth, und zeichnete seinen Weg durch einen langen Funkenstreif. Man stieg in die ominöse königliche Kutsche und fuhr zu den Säulen des Jupiter. Sie sind groß, wie alles Römische; nur fehlt ihnen der liebliche poetische Hauch der griechischen Götterwerke; Pracht ohne Grazie.
Durch das Thor Hadrians kehrten wir in den königlichen Palast zurück. Mein Wunsch war, augenblicklich auf den »Kirchhof der Geschichte« zurückkehren zu können, obwohl ich den ganzen Tag in Bewegung gewesen war. So lange ich lebe, werde ich dieses Abends, und der Basilissa gedenken.
Der erste Morgen in Kleinasien, der erste Morgen im osmanischen Reiche, lachte uns freundlich entgegen; da lag der Orient mit seinen Reichthümern, mit seiner Vegetation, mit seinen tausend Sinnenblendungen vor uns. Asiens Blüthe hatte sich vor uns entfaltet, die Welt lang gehegter Träume erschlossen. Am reinen Meeresspiegel, auf leichter Erhöhung, ruhte die Stadt mit ihren tausend und abermals tausend Häusern im buntesten Farbengewirre vor uns. Schlanke Minarete, die Wegweiser des Mohammedanismus, erhoben sich in ihrer eigenthümlich graziösen Bauart neben den Kuppeln der Moscheen. Reiche Cypressen-Wälder beschirmen auf der Anhöhe mit stillem, majestätischem Ernste die Gräber der Türken. Auf dem höchsten Punkte liegt wie auf einer Terrasse die Ruine eines festen Schlosses, welches man aus diesem, an geschichtlichen Erinnerungen so reichen Boden, Alexander dem Großen zuschreibt. Im Hintergrunde erhebt sich das Gebirge mit seinen tausendfältigen Formen, umschließt wie ein Halbmond den klaren Golf und bildet an dem Ufer desselben die grünsten Abhänge und Thäler, aus welchen einzelne Ortschaften hervorblinken. Das schönste dieser Thäler führt von alten Zeiten her, dem tapferen Helden Richard Löwenherz zu Ehren, den Namen Cordeleon; auf dem andern, dem linken Ufer zeigt sich auf einer kleinen Landzunge ein von den Türken erbautes Fort, und über alle diese Pracht erhebt sich der blaue ungetrübte Azur. Jedes Minaret, jede Cypresse, jede schön gewölbte Kuppel, jedes farbenreiche Haus war für uns eine neue Erscheinung, und spannte unsere Neubegier; selig priesen wir uns daher, als die Barke an der Schiffswand herunter gelassen wurde, und wir mit mächtigem Ruderschlage über die Wellen hinhüpfend uns den Zauberbildern näherten. Der Ausdruck des Geistigen, die Verkörperung höherer Ideen ist das Erste, welches der Reisende im fremden Orte suchen muß; in diesem Sinne bildeten daher das ernste Minaret und die Moschee unser erstes Ziel auf Asiens Wunderboden. Geblendet, und vom Uebermaße des Entzückens verwirrt, schritten wir durch die Straßen und Bazare zu einem, an deren Ausgange gelegenen, erhöhten Platze, auf welchem in malerischen Formen die Moschee Kiltgezagi steht. Vor den Aufgangsstufen zu der erhöhten Terrasse, die das Fundament des unseren Augen so nahen Gebäudes bildet, steht ein von Bäumen umgebener Brunnen, welcher dem Totaleindrucke Frische und Leben gewährt. Ein schöner Gedanke ist es, daß man an den Stufen des Gotteshauses die im Oriente so seltene Erfrischung von Wasser und Bäumen bietet. Auf dem mit einem Steingitter umgebenen erhöhten Platze steht die aus einer großen Kuppelwölbung bestehende Moschee. Rechts erhebt sich das schlanke Minaret, in dessen Innerem eine kleine finstere Treppe zu der, unter dem in eine Spitze auslaufenden Ende befindlichen Gallerie führt, von welcher herab der Muezin fünfmal im Tage die Betstunde ausruft. Sowohl Minaret, als Moschee, scheinen von einem graugelblichen Sandstein gebaut zu sein. Vor den drei Eingangsthoren befindet sich eine schöne Stufenreihe, welche auf eine Terrasse mündet, die den Mohammedanern vor dem Eintritt in die Moschee als Raum zu dem Vorbereitungsgebete dient. Ueber dem Mittelthore erhebt sich ein kleines Thürmchen mit einem niedlichen Balkon, von dem herab der Iman seine Gebete ertönen läßt. – Der Consul ersparte uns das Ausziehen unserer Fußbekleidung beim Eintritte, wodurch wir jedoch nach mohammedanischen Begriffen ein Sacrilegium begingen. Erwartungsvoll betraten wir den der Erbauung gewidmeten Raum und wurden augenblicklich an die im Perrückenstyle erbauten Kirchen erinnert. Säulenreihen scheiden den Raum in drei Theile, über deren mittleren und größten sich die Kuppel erhebt. Mauern und Säulen sind mit Gold und Farbenverzierungen geschmückt, die Grundfarbe aber ist weiß; in mehreren Theilen des Gebäudes sind Koransprüche angebracht. In der Mitte der dem Thore gegenüber stehenden Wand befindet sich der Platz, wo der obenerwähnte Iman, der türkische Seelenhirt, die Hauptgebete spricht. Auf der Wand hinter demselben sind die Goldverzierungen mit größerer Verschwendung angebracht, und sowohl dieser Theil, als auch der Boden, sind mit reichen Teppichen geschmückt. Der übrige marmorne Fußboden ist mit feinen Rohrmatten bedeckt, eine Einrichtung, welche für die christlichen Knie und Füße ebenfalls sehr vortheilhaft wäre. Auf jener Stelle, an welcher in unseren Kirchen sich gewöhnlich der Altar befindet, hängen drei Bilder; das mittlere stellt das Grab des Propheten dar, rechts sieht man Medina und links Mecca mit seinen Minarets und Kuppeln. Diese Bilder sind in einer eigenthümlichen, nicht ganz mißglückten Vogelperspective ausgeführt. Das Material scheint eine Art Wasser- oder Deckfarbe zu sein. Diese Conterfei's der für die Mohammedaner heiligen Orte sind das Einzige, was von türkischer Malerei besteht; denn anderes darf der wahre Gläubige nach dem strengen Ausspruche des Korans nicht darstellen. Dies mag ein Grund sein, daß man in Europa so lange über die Sitten und Gebräuche des inneren türkischen Lebens im Dunkeln blieb, während der mohammedanische Koloß durch den Umstand, daß er keine Abbilder von Menschen, also keine religiösen, und keine Sittenbilder besitzen durfte, dazu beitrug, ihn vor fremden Einflüssen zu bewahren. Diese Befehle und Verbote des weisen Propheten und seiner Ausleger vereinigten sich, wie eine aus tausenden von Steinen zusammengesetzte Scheidewand, um die Ungläubigen scharf von der treuen Heerde des Propheten zu trennen. Nun beginnt die Aufklärung auch in diese Gauen einzudringen; man findet die Idee des religiösen Gehorsams eine lächerliche Unbequemlichkeit, über die man sich hinaussetzen muß; man beginnt die kleineren Steine aus dem trefflich gefügten Verbande zu rücken, und bedenkt nicht, daß die größeren gar bald nachstürzen müssen. Man fängt unter dem Titel Mißbräuche auszurotten, an, alles dasjenige zu entfernen, dessen offenbaren Nutzen man nicht augenblicklich einsieht, bis das durch das erstere Gestützte, zur Erhaltung des Ganzen Nothwendige, entweder mit vollem Bewußtsein gestürzt wird, oder zum Erstaunen der Neuerer ebenfalls verschwindet. – Rechts von diesem mit Bildern geschmückten Platze erhebt sich eine schmale Stufenreihe und führt in ein von vier Säulen getragenes Thürmchen. Der Eingang in dieses kleine, zierlich errichtete Schilderhaus ist durch einen rothen Vorhang geschlossen. Ein, in eine Spitze auslaufendes Dach ragt hoch an der Hauptwand empor und trägt diesem Häuschen zum Schutze am äußersten Ende den Halbmond, dieses einst so furchtbare Sinnbild der Mohammedaner, das gleich einer Sichel Stämme und Völker ohne Schonung dahin mähte. In diesem reichgeschmückten, hocherhobenen Häuschen ist es des Imans Aufgabe, für das Wohl des Sultans zu beten; ein Gebrauch, der für einen monarchisch absoluten Staat, dessen Oberhaupt zugleich der Vorsteher der Kirche ist, wie geschaffen erscheint; denn unwillkürlich muß es dem Volke einen großen Eindruck machen, daß sein Herrscher einen eigenen, von allen andern Menschenkindern abgeschlossenen Raum hat, zu welchen man nur wie auf einer Jacobsleiter emporsteigen kann, und zwar auch nur der Priester, damit dieser in höheren Regionen, wie aus den Wolken herab, das Gebet für den Nachfolger Mohammeds ertönen lasse. Diesem Häuschen gegenüber, auf der linken Seite der Wand, befindet sich eine reiche, weiß und goldverzierte Kanzel, auf welcher den Mohammedanern ihr Buch der Bücher, oder vielmehr das einzige ihnen bekannte Buch vorgelesen wird. Alle diese Einzelheiten der Moscheen haben große Aehnlichkeit mit denen unserer katholischen Kirchen. Dieses reich verzierte kleine Gebäude erinnerte an unser Sacraments-Häuschen; die Kanzel ist ganz, selbst der Form und den Zierrathen nach, denjenigen, welche wir in unseren Gotteshäusern haben, ähnlich; ja selbst unseren Chor finden wir über dem Eingangsthore wieder; nur erhebt sich statt der Orgel in der Mitte eine große vergitterte Abtheilung, in welcher der Sultan dem Gottesdienste beiwohnt. Als wir den Chor bestiegen, fanden wir wie natürlich den für den Großherrn bestimmten Raum geschlossen; auch in dieser Einrichtung zeigt sich ein Beweis richtiger Berechnung; das andächtige Volk ahnt die Nähe des Herrschers, und doch ist die Person desselben den fragenden Blicken entzogen, wodurch die Neugier und eine Art mysteriöser Verehrung in der Menge genährt wird. Bemerkenswerth ist die große Anzahl von Lampen, Straußeneiern und Hirschgeweihen, welche in der Moschee hängen, und ihr hiedurch den echt orientalischen bunten Reiz gewähren; man fragt natürlich, was Straußeneier und Hirschgeweihe in einem Gotteshause zu thun haben? Auch wir thaten diese Frage, und lernten hiebei ein Stück mohammedanischen Aberglaubens kennen; die Rechtgläubigen hängen diese Gegenstände in ihre Moscheen auf um das schadenbringende Lob der Ungläubigen unschädlich zu machen; tritt nämlich ein Christ in die Moschee und lobt die Schönheit des Baues oder die Pracht der Ausstattung, so muß sein herumschweifender bewundernder Blick unwillkürlich auf die Jettatura fallen, und das Unglück, welches seinem Lobe folgen müßte, ist verhütet. Dieser Glaube, so bizarr er ist, schadet nicht dem Effekte, den die Gegenstände auf den Beschauer machen. Der Total-Eindruck, den eine Moschee mit ihrer hohen Kuppel, mit ihren Säulenreihen und Seitengallerien macht, ist erhebend, still und großartig; nichts Abstoßendes trifft das Auge des Christen, kein überladener Prunk, keine allzugroße Entblößung versetzen den Beschauer in eine unangenehme Stimmung. Nur ein Kleinod vermißt das Auge des Christen: es ist der Altar. Dieser trostbringende Platz für eine bedrängte Seele, fehlt dem mohammedanischen Gotteshause, und dieser Mangel ist es, der für uns den Gottesdienst kalt und gefühllos macht; es fehlt die Einigung, das alles umfassende, jedes Gebet einschließende Opfer. Hiedurch entsteht eine Leere im Gotteshaus; es drängt sich einem der Gedanke auf, daß man sein Gebet eben so gut zu Hause feiern könnte; daß man hiezu keiner Synagoge, keiner Moschee und keines Bethauses bedarf. Der Jude ist's, der dies am wärmsten fühlt; sein Tempel ist zerstört, sein Opferplatz vernichtet, die Perle seiner Religion geraubt, und nachdem er nur glaubte in Sion opfern zu können, so fühlt er jetzt in seiner Synagoge nur eine haltlose Sehnsucht, ein klagendes Verlangen nach dem einstigen Glücke der Väter. Uns Jüngern des Messias war es vorbehalten, im prachtvollsten Tempel, wie in der kleinsten Kapelle etwas Höheres zu finden, als es je im Weltwunder Salomons vollbracht wurde. Mit Wehmuth suchen wir daher im Gotteshause der Andersgläubigen den verehrten Platz, zu welchem sich die Blicke der betenden Schaar während der heiligen Handlung wenden. Obwohl es Freitag, also der türkische Festtag war, erlebten wir in den Mauern der Moschee dennoch keinen Gottesdienst. Die Stunde war zu früh und noch kein Betender im Inneren angelangt. Eine Art Iman führte uns in den Räumen herum; er trug einen Turban, einen gestreiften Seidenkaftan mit einer Binde und einen Oberrock. Zu dieser Kleidung ein indolentes Gesicht mit gelber Hautfarbe und schüttern Bart, gaben ein ganz charakteristisches Bild. Als wir die Moschee verließen, um das Minaret zu besteigen, hatten wir auf der zum Vorbereitungsgebete bestimmten Terrasse den erhebenden Anblick eines im Gebete versunkenen Türken. Derselbe kniete auf einem nach türkischer Gewohnheit selbst mitgebrachten Teppiche; sein Anzug bestand in einem violettrothen faltenreichen Kaftan und einem schneeweißen Turban; die Schuhe hatte er ausgezogen und neben sich gestellt; in den Händen bewegte er den im Oriente so beliebten Kugelkranz, vom braunen Gesichte wallte über die Brust ein schneeweißer Bart, seine Augen waren in tiefster Andacht niedergeschlagen, seine Züge ernst und gesammelt; es war ein ergreifendes Bild. Nur zuweilen blickte er schmerzlich, ängstlich herum, und durch unser vielleicht zu lautes Gespräch gestört, fielen seine dunklen schwärmerischen Augen einen Augenblick auf uns. Als er die Neugier und geringe Achtung der Ungläubigen bemerkte, verfiel er in ein herzzerreißendes Weinen und sang leise und schmerzlich wimmernd seine Gebete vor sich hin. Es war nicht der Ausdruck des kalten gehässigen Vorwurfs gegen die neugierigen Christen, es war ein wehmüthiges Bedauern, ein stilles Jammern über den unbewußten Frevel, den wir wahrscheinlich in seinen Augen begangen. Mit Rührung, Mitleid und Achtung vor diesem frommen Beter verließen wir den Platz und betraten die kleine finstere Steintreppe, welche uns in das schmale kleine Minaret führte. Wir stiegen nicht bis auf die ganze Höhe, sondern verließen auf einem Ausgangspunkte das Minaret und seine mysteriöse Stiege, um uns auf die Seitendächer der Moschee zu begeben. Herrlich zeigte sich uns von hier aus Smyrna, die stolze Fürstin des Orients; reich entwickelte sich der von Menschenhänden geschaffene Schmuck, reicher der, den Mutter Natur ihr gönnte. Weithin streckten sich des silberblauen Kleides schöne Flächen, und majestätisch ruhte das gekrönte Haupt mit den Zacken und farbigen Gestirnen seines Schmuckes auf grünem Pfühle. Mitten im Häusermeere zeichnete sich der zu unseren Füßen gelegene kleine Platz, welcher den Bazar-Gassen als Ausgangspunkt zum Gotteshause dient, als besonders belebt und charakteristisch. Gedrängt füllten ihn Menschen in den verschiedensten Trachten, in den mannigfaltigsten Haut- und Kleiderfarben, um die ungläubigen Gäste zu erblicken, denen zu Ehren der Pascha eine Truppenzahl vor die Moschee gestellt hatte. Als wir das Gewirre zu unseren Füßen mit Interesse betrachteten, hörten wir plötzlich ein eigenthümliches Glockengeläute; neugierig warteten wir deß was da kommen würde. Plötzlich theilte sich die Menge und wir sahen braune Massen im pathetischen gleichförmigen Schritt und Tritt sich einherbewegen. Es war ein Zug eigenthümlicher Art, ein Zug aus tausend und einer Nacht, ein Bild, oder vielmehr eine Reihe von Bildern, wie sie Horace Vernet malt; eine Erscheinung, die man sich mit der glühendsten Phantasie nicht vorstellen, die man mit der beredtesten Feder nicht beschreiben kann; denn nur im tiefsten Orient, in den Gefilden Asiens, in den reichen lebensvollen Bazaren von Smyrna, Damaskus und Bagdad, nur da, wo Mohammeds Schwert regiert, wo die Palme grünt und der Halbmond durch die Wüste schimmert, sieht man, was wir sahen: einen mit Waaren und Früchten reich beladenen Zug von – Kamelen. – Sie erschienen vor uns, die Herolde, die Repräsentanten des ältesten Welttheils. Dies Thier, welches des Arabers dürftige Familie gleich einem Schiffe durch die Sandwellen trägt, welches ihm Milch zum einfachen Mahle giebt, welches ihm als schützende Mauer gegen den Samum dient und in der äußersten Bedrängniß als Opfer fällt, um den Gebieter den verborgenen Keller zu erschließen. Sollte da der Ankömmling nicht verwundert fragen, warum dieses Thier, eines der nützlichsten welches Gott schuf, so häßlich, ja fast geisterhaft schauerlich ist? Die Antwort, daß das wahrhaft Nützliche, das streng Genügsame, gar oft auf dieser Erde in einem widrigen, rauhen Kleide erscheint, muß genügen. Alles ist an diesem Thiere eigenthümlich; schwankend und doch nicht ohne Würde tritt der weiche Polsterfuß auf den heißen Boden; lang dehnt sich am magern Halse der schlangenartige Kopf, hoch wölbt sich gleich einem kahlen formlosen Berge der schwerbeladene Rücken. Bald passiv, bald wuthentbrannt ist das kluge Auge, ledern ist die dicke Haut, braun und doch eigentlich farblos der ganze mißgeformte Körper. Bald verschwanden die Söhne der Wüste in den Straßen des Bazars. – Wir kehrten auf das Minaret zurück, nachdem wir, während wir die Dächer beschritten, auch das Innere der Kuppel auf einer Gallerie besehen hatten, die rings um das Innere läuft und einen so niederen Rand hat, daß Jeder, der an Schwindel leidet, es aufgeben sollte, den Moscheenraum in der Vogelperspektive zu betrachten. Als wir das Minaret verlassen hatten, war unser Türke aus dem Vorhofe verschwunden und schien bereits in die Moschee eingetreten zu sein. Wir verließen die terrassenartige Erhöhung und verloren uns im bunten Leben des Bazars.
Wir hatten den heiteren, lebensvollen Bazar einige Zeit durchwogt, als ich mich an meinen Dragoman mit der Frage wandte, wo sich der Sclavenmarkt befinde. Er ward verlegen und versicherte mich, es existire keiner mehr in Smyrna. Da ich das Gegentheil gehört hatte, begnügte ich mich natürlich mit dieser Antwort nicht und wendete mich an die Beamten unseres Consulates, welche mir zu verstehen gaben, daß die Türken vor den Christen so thäten, als gäbe es keinen mehr, indem doch die Gebildeteren eine Art von Schamgefühl über diesen barbarischen Menschenverkauf hätten. Ich dachte mir aber, daß man, aus Rücksicht für die Muselmänner, einen so interessanten Punkt zu sehen nicht unterlassen dürfe, und bestand beharrlich auf meinem Wunsche. Bald gab uns auch einer der Consulat-Beamten das Zeichen in ein Thor einzutreten. Wir verstanden ihn, und folgten seinen Schritten. Im Schutze eines Thorbogens, der unter einem Hause durchging, befanden sich in reicher türkischer Kleidung die Menschenhändler. Sie rauchten, an die Wand gelehnt, mit einem kalten, fast stupiden Ausdruck ihre Pfeifen und Nargilés. An ihrer Seite standen einige männliche Sclaven in weiße Linnentücher und braune Lodenstoffe gehüllt. – Diese schwarzen Männer unterzogen sich unseren neugierigen Blicken mit stumpfer Ruhe. Ihre Gesichtszüge sind abstoßend, ihre Gestalt ist mager und schmächtig, ihre Haltung, wie die aller Südländer, frei und fast edel. Aus dem Thorgange traten wir nun in den inneren großen Hof. Hier bot sich uns ein Bild des entsetzlichsten Jammers und Elendes dar. Auf dem grauen, theilweise kothigen, theilweise staubigen Boden, lagen Gruppen von halb nackten, graufarbigen Negerweibern. Zu fünf bis sechs waren sie an mehreren Stellen, in den verschiedenartigsten Haltungen, auf Rohrmatten hingestreckt. Ihre spärliche Bekleidung bestand aus blaugrauen Kotzen, in welche sie nach Möglichkeit den mageren Leib hüllten. Manche hatten um die wolligen Haare Tücher gebunden, alles war auf diesem entsetzlichen Platze grau und wieder grau; die Hautfarbe der Menschen, die Kleidung derselben, der Boden, die spärlichen Pflanzen, die den Platz begränzenden verfallenen Hütten, alles ein Ton des Entsetzens.
Einige dieser Weiber lachten mit grinsendem, dummem Ausdruck und machten mit ihren langen, dürren Händen possierliche Bewegungen. Es scheint, daß unser Aeußeres auf sie einen komischen Eindruck ausübte. Einige jedoch starrten mit nichtssagenden Blicken unbeweglich in die Welt hinaus. Sie schienen Körper ohne Seele.
Andere standen an den verfallenen Thüren ihrer Wohnungen, die in Europa für einen Stall zu schlecht wären. Eines der Weiber hatte an seinem Fuße, durch das lange Gehen in der furchtbaren Hitze, die Elephantiasis; hülflos schmachtete dieses arme Wesen dahin; der Anblick machte mich fast krank vor Mitleid und Ekel. In der Mitte des Platzes stand ein dürrer Baum, an dessen Aesten ein grauer Käfig mit drei grauen Papageien hing, welche ein Türkenknabe feilbot, zu 23 frs. das Stück. So wird Mensch und Thier auf einem Raume dem Nebenmenschen verkauft; – ein erniedrigender Gedanke. –
Und mancher philantropisch winselnde Christ, der alle Tage den Grundsatz der Liebe zum Nebenmenschen loben hört und mitlobt, kauft um ein maßloses Geld eine solche gefiederte Bestie, während sein Nebenmensch um wenig Geld verschachert wird. Falsch wäre es jedoch, wenn man glaubte, daß diese Menschen durch das Freikaufen glücklich gemacht würden; dazu müßte mehr geschehen, als es gewöhnlich der Fall ist. In ihrem Vaterlande leben diese Menschen in einem thierisch wüsten Zustande, und nur durch die tiefe Stufe, auf welcher sie stehen, ist die Möglichkeit gegeben, sie einzufangen, um sie dann zu verkaufen.
Man müßte also durch Missionen und Civilisirung des Inneren von Afrika Hülfe zu bringen suchen; aber der Mensch will so selten auf den Grund gehen und begnügt sich gewöhnlich nur mit momentaner scheinbarer Abhülfe! – Wirklich elend sind diese Menschen schon von dem Augenblicke, in dem sie von den Muselmännern gekauft werden. Nackt werden sie aus ihrem Vaterlande bis zu den Thoren Smyrna's gleich einer Heerde getrieben; erst auf dem Markte bekommen sie dieses blau-graue Tuch. Die Nahrung, welche ihnen die Sclavenhändler geben, ist ein grauer Brei. – Diese »bêtes feroces«, wie sie der christliche Dragoman nannte, kosten als Kinder, wenn sie lenksam sind, 100-150 frs., sind sie aber stutziger Natur, nur 40-50 frs. – Einer der Mohrenknaben, welcher schon besser gehalten schien und im türkischen Kostüme war, spuckte auf uns, als wir ihn näher betrachten wollten, mit dem Ausdruck des bittersten Unmuthes. Weiße Sclaven kommen sehr selten auf den Markt. Wir sahen unter allen diesen gräulichen Erscheinungen nur ein hellfarbiges, sehr schönes Weib, welches in reichem, eigenthümlichem Kostüme Speisen herumtrug. Einige behaupteten, es sei eine jüdische Aufseherin, andere sagten es sei eine zum Kauf dargebotene Circassierin. Ihre Züge waren edel: schön gewölbte feine Brauen, lange scharf geschnittene Augen, mit einem melancholisch tiefen Ausdruck, eine echt orientalische Nase und ein zarter länglicher Mund; ihr Teint war blaß und etwas broncirt; die Gestalt schön und wohlgebaut; ihr braunes Haar umfing ein goldener Reif, der einen feinen Schleier hielt, welcher sie feenartig umhüllte. Mieder und Kleid waren von bunten orientalischen Stoffen, und so war sie die einzige lichte Erscheinung in diesem Meere von grauen Farben. Ich ließ mir erzählen, daß die Sclaven nach dem Ankaufe eine ziemlich gute Existenz hätten. Sie werden wie Diener behandelt und das orientalisch patriarchalische Verhältniß erstreckt sich auch auf sie. Dies gab mir einigen Trost und einige Beruhigung bei dem Scheiden von diesem Platze des Entsetzens. Auch gewahrte ich wirklich später auf dem Bazar einige Mohrenweiber, in Begleitung ihrer verschleierten Herrinnen, mit recht wohlgerundeten fröhlichen Gesichtern.
Das furchtbare Elend ist schon im Urzustande dieser Menschen vorhanden und dem könnte man nur durch Civilisation abhelfen.
Wer hat nicht »tausend und eine Nacht« gelesen? Wer hat nicht geträumt von türkischem Luxus, orientalischer Fülle und Pracht? und der mageren Traumgestalt des Schätze tragenden Kamels? Wer hat nicht vom nutzbringenden Hausfreunde des Orientalen, dem fleißigen Langohr gehört? Alles dieses findet der Leser vereinigt in einigen mit Holz und Tüchern bedeckten Straßen von Smyrna, welche die Moslemin Bazar nennen. Als ich mich das erste Mal in diesen langen, hohen, vor der Sonnenhitze geschützten Straßen befand, glaubte ich zu träumen. Alles wogt in bunten Farben und mit dem verwirrendsten Geschrei durcheinander. Auge, Ohr und Nase werden auf einmal in Anspruch genommen, und es braucht lange Zeit, bis man anfängt sich zurecht zu finden; und noch dann verwischt ein Bild das Andere, so daß es mir außerordentlich schwer wird, den Eindruck, den das Ganze auf mich machte, wieder zu geben. – Der Bazar befindet sich zwischen der Türken- und der Frankenstadt. Er nimmt einen großen Raum ein und seine Gassen kreuzen sich nach allen Richtungen. Inmitten derselben befinden sich auf kleinen Plätzen Moscheen, Baumgruppen mit marmornen Brunnen und öffentliche Badeorte, wodurch bei der unendlichen Anzahl von Buden eine angenehme und malerische Abwechslung hervorgebracht wird. Daß sich diese öffentlichen Gebäude im Mittelpunkt der Kaufwelt befinden, hat darin seinen Grund, daß der Bazar das Leben der Stadt, ja der ganzen Provinz vereinigt. So leer die Gassen der eigentlichen Türkenstadt sind, so überfüllt sind diese Räume. Alle Geschäfte werden hier abgeschlossen, alle Wünsche hier befriedigt. Die Sendboten der entfernten Gegenden sind die genügsamen Kamele, welche unter immerwährendem Läuten der Glocken an ihrem Halse, gewöhnlich zu fünfen hinter einander angebunden, schwer bepackt die Straßen durchziehen; den nöthigen Raum um die Menge zu durchschreiten, verschafft ihnen das Geschrei des mohammedanischen Treibers, welcher, im buntesten Kostüme seinen Tschibuk rauchend, auf einem kleinen Esel die Spitze der Caravane bildet. Oft ist man genöthigt, sich vor einem solchen Zuge in die Buden zu flüchten. Die meisten der Letzteren befinden sich in hölzernen Räumen, welche sich an einander reihen und auf deren oberem Theile sich das Dach stufenweise von einer Seite zur andern aufbaut. Das Gebälke ist überall sichtbar und hat die Naturfarbe. Gegen die Gasse zu befinden sich große breite Oeffnungen, wie bei unsern Jahrmarkt-Buden, nur in einem viel größeren Maßstabe. Der eine Theil derselben erstreckt sich bis auf den Boden und bildet hierdurch die Thüre, welche eine Stufe von der Erde trennt. Vor dem andern Theile befindet sich ein langer kistenartiger Auslagetisch, auf welchem zwischen den aufgeschichteten Waaren gewöhnlich der Mohammedaner mit untergeschlagenen Beinen sitzt, pathetisch seine Nargilé raucht und seinen Kaffee aus kleinem Schälchen schlürft. Den regelmäßig edel gebauten Kopf desselben umgiebt ein aus langen Tüchern graziös gewundener Turban; von dem Kinn wallt der mächtige Bart auf den geöffneten pelzverbrämten Kaftan; die Beine bekleiden bis zu den Knien weite faltenreiche Hosen; der untere Theil ist bei den ärmeren Leuten gewöhnlich entblößt, bei den reicheren mit weißen Strümpfen bedeckt. An den Füßen tragen sie schwarze Schuhe, oder in gebogene Spitzen auslaufende gelbe Pantoffeln. Der Eindruck, den ein Mohammedaner im alten Kostüme, vom Aermsten bis zum Reichsten macht, ist würdevoll und malerisch. – Die Oeffnung der Kaufläden umgeben hölzerne Stangen, an welchen die Waaren im buntesten Gewirre hängen; die schönsten sind die, in welchen man türkische Stoffe, Teppiche und Kleidungsstücke verkauft. Wir traten in mehrere derselben ein und ergötzten uns an der Ruhe und Unbeweglichkeit, welche die Türken während dem Verkaufe beibehalten. Sie haben ein edles Vertrauen in die Ehrlichkeit des Käufers, während die griechischen Kaufleute von einer außerordentlichen Beweglichkeit und Geschwätzigkeit sind, und schlau jede Bewegung des Käufers mit ihren dunkeln, verschmitzten Augen verfolgen. Die Teppiche, deren wir mehrere kauften, sind meist aus Persien und zeichnen sich durch Frische der Farben und schöne Zeichnung aus; die Weichheit und Wärme derselben ist bekannt.
Kleiderstoffe und Echarpen werden gewöhnlich in einer Fabrik in Brussa verfertigt; sie sind sehr fein und schmiegsam. Der Preis derselben ist außerordentlich niedrig; nur anfangs erschraken wir über die großen Summen von Piastern, welche die Türken für jeden Gegenstand fordern; bald waren wir jedoch hierüber aufgeklärt, indem wir erfuhren, daß zehn dieser Piaster nur 1 Gulden in Conventionsmünze ausmachen.
Eine besonders schöne Auswahl und geschmackvolle Farbenpracht findet man in gestickten Stoffen, welche für Pantoffeln, Kappen, Kissen und Beutel verwendet werden. Eine feine gelbe Seide, mit goldenen Fäden untermischt, giebt ihnen einen lebhaften Schimmer, welcher gegen den schwarzen, rothen oder blauen Grund sehr gut contrastirt. Erst von den Kaufläden aus hatten wir etwas mehr Muße, das Getreibe um uns in den Straßen zu betrachten. Türken, Griechen, Armenier und Juden umwogten uns. – Die Letzteren stachen gewaltig durch ihren geistreichen, schlauen Ausdruck hervor, welcher zu den gutmüthigen Türken in lebhaftem Gegensatze steht, besonders da beide Nationen fast ein und dasselbe Kostüme tragen. Zwischen dem männlichen Volke erschienen die Frauen der Türken, Stirn, Aug' und Nase mit schwarzem Flor umhüllt, der, wie man mir sagte, mit dem Alter immer undurchsichtiger wird. Von dem Kopfe um das Kinn und den Leib schlingt sich ein weißes Tuch; unter demselben erscheinen beim Knöchel blaue weite Beinkleider, welche in gelben oder violetten Pantoffeln enden. Den Frauen folgen gewöhnlich schwarze Sclavinnen, welche sich nur in ein weißes Tuch hüllen und ihre dicken aufgeschwollenen Gesichtszüge den Blicken der Männer Preis geben. Zu den merkwürdigsten Erscheinungen der Bazarwelt gehören die berühmten türkischen Lastträger. Diese Leute haben ein matratzenartiges Kissen über Rücken und Schultern, auf welchem sie in vorgebeugter Stellung Lasten von fünf Zentnern tragen. Man sagte uns, daß einer auf diese Art ein ganzes Clavier trage. Professor G. begegnete einem, welcher eine complete Hauseinrichtung fortschleppte. Auch zu vieren tragen sie an schweren Stangen kreuzweise außerordentliche Lasten. Oefters trafen wir auf Mohammedaner mit grünem Turban, was besonders gut aussieht; es sind dies Abkömmlinge des Propheten, die jetzt Melonen und Feigen in den Straßen Smyrna's verkaufen; so steigen und sinken die irdischen Größen. –
Wir unternahmen eine vollkommene Entdeckungsreise in die verschiedenen Theile des Bazars. Das erste, was uns auffiel, waren die Vegetabilien, welche hier verkauft werden. Ganze Berge von Melonen häufen sich auf den Straßen, tausende von Schachteln mit Feigen gefüllt, welche die Muselmänner mit dem Daumen kneten, sind für die europäischen Leckermäuler aufgeschichtet. Lager von herrlichen Sultanatrauben, breite Kuchen von Honig und Mehl, alles dies lockt das Auge des Hungrigen an, und bringt gar manchen Piaster zu Tage. Eigenthümlich sind eine Art Restaurateurs, welche in ihren Boutiquen zwei aufrecht stehende Spieße immerwährend drehen. An dem einen derselben befinden sich aneinander gepreßte glühende Kohlen in Säulenform, an dem andern sind hunderte von Fleischstückchen aufgespießt; durch diese zwei beweglichen Colonnen wird das Hammelfleisch für die Moslemin gebraten.
Einige der Bazarstraßen sind mit Juwelieren gefüllt, bei welchen man die schönsten gravirten Steine findet. Ich kaufte mir einige derselben, unter andern einen Talisman, in dem ich mir aber meinen eigenen Namen in türkischen Lettern von einem Mohammedaner in der Nähe einer Moschee einstechen ließ.
Diese kunstreichen Arbeiten werden mitten unter dem Volke in freier Luft gemacht. In den Straßen der Juweliere erfreuten wir uns an einem Zuge türkischer Ehrlichkeit. Fürst J. sah in einem gläsernen Kasten einen silbernen Ring mit grünem Talisman; ihn lockte die Form des Geschmeides, und er gedachte es zu kaufen. Der Besitzer des Ringes war jedoch nicht gegenwärtig. Da kamen die Nachbarn, erbrachen den Kasten und gaben einen Preis an. Der Fürst fand ihn zu hoch, man kam ins Handeln, worauf der Kauf ohne Beisein des Herrn abgeschlossen wurde. Auf dem Wiener Kohlmarkte könnte man sich auf diese Art nicht helfen; gleich würde die Sicherheitswache herbeieilen und über Diebe und Räuber schreien; nur in barbarischen und uncivilisirten Ländern ist so etwas möglich.
Wir mußten sehr lachen, inmitten dieses Geschreies Lärmens und lebhaften Treibens auch eine Schule anzutreffen, welche sich ebenfalls in einem Kaufladen befindet, indem die Schullehrer einen Handel mit der Gelehrsamkeit treiben; doch muß die mohammedanische Jugend viel fleißiger sein, als die unsere, da sie in dem Mittelpunkt des Weltgebrauses koranfest wird. Das Geschrei, welches dem Munde der Jugend entfuhr, war außerordentlich; vielleicht, daß sie auf diese Art die Zerstreuungen der Welt zu übertönen suchen.
Besonders reizend in dem Bazar ist es, wenn der Blick durch die langen, gedeckten, bunt ausstaffirten Räume schweift und am Ende auf einem, von Bäumen beschatteten Plätzchen ausruht, welches der Centralpunkt von vier bis fünf Straßen ist. Einzelne Strahlen der Sonne und blaue Himmelsblicke dringen in diese Lichtungen ein und erhöhen den orientalischen Farbencontrast; doch neugierig späht wieder das Auge unter die Bretterdächer und blickt in das Halbdunkel der sich öffnenden Straßen; überhaupt finden sich die schönsten Farbeneffekte und Wechsel von Licht und Schatten in diesen südlichen Regionen; vom Kleide des Menschen bis zur Wolke am Himmel zeichnet sich alles kräftig und lebendig, und darum findet hier der Maler ein dankbares und doch schweres Feld für seine Kunst; denn nur wenige Bilder habe ich in Europa gesehen, welche den Ausdruck des orientalischen Lebens wahr wieder geben; die wenigen aber, in denen dies gelungen ist werden leicht als übertrieben gescholten.
Aus dem Bazar geriethen wir durch ein Seitengäßchen auf einen Lagerplatz der Kamele. Ein höchst merkwürdiger Anblick, 40 bis 50 dieser Thiere in den verschiedensten Gruppen beisammen zu sehen. Ihre gelbe Erdfarbe vermischte sich geisterhaft mit dem unebenen Boden, auf welchem sie lagerten. Der Raum war von verfallenen schmutzigen Häusern umstellt. Viele ganz junge Thiere schritten pathetisch unter den erwachsenen umher, und komisch war es, wie diese höchstens vier Schuh hohen Kleinen auf ihren langen, mageren Stelzfüßen, sich an ihre großen, unförmlichen Mütter anschmiegten. Einige unserer Begleiter holten eines dieser Jungen aus dem Thierknäuel heraus, so daß wir es ganz in der Nähe besehen konnten. Es hatte einen höchst gutmüthigen Ausdruck und ließ ruhig Alles über sich ergehen; dagegen schoß uns die Mutter wüthende, unheimliche Blicke zu. Die Kamele, deren gegen 10,000 sich in Smyrna und seiner Umgebung befinden sollen, werden aus der Krimm gebracht, wo sich bedeutende Gestüte befinden. Die Höhe dieser Thiere ist sieben Fuß, die Länge vom Kopf bis zum Schweif mag gegen acht Fuß betragen. Der Leib ist erdfarb, zeigt das ganze Knochensystem und ist mit einer dicken räudigen Haut mit sehr wenigen Haaren bedeckt. Zum Reiten werden im Oriente nur die Dromedare benützt, deren es in Smyrna keine giebt. Die Kamele werden nur zum Lasttragen gebraucht. Ihr hoher Höcker wird mit einer Decke umhüllt, an welcher rechts und links große mit Riemen befestigte Körbe herabhängen. Hier werden diese Thiere mit einem getrockneten Brei von schlechtem Mehl und Wasser genährt. Als wir unser Gefallen an der possierlichen Kameljugend dem Dragoman des Pascha's ausdrückten, versicherte er uns, Seine Hoheit Halil Pascha würde uns eins derselben verehren. Einige der Reisegefährten fanden dieses Anerbieten sehr hübsch und den Transport des Thieres auf dem Dampfschiffe sehr leicht ausführbar, die Mehrzahl sträubte sich jedoch dagegen. – Nach dieser Episode kehrten wir wieder auf den Bazar zurück, um unsere mannigfachen Einkäufe der türkischen Landesprodukte fortzusetzen; ein immer neues Interesse fanden wir an den wechselnden Bildern, welche sich auf einem türkischen Bazar dem Blicke des Beschauers darbieten.
Aus den Moscheen und dem bunten Gewimmel des Bazars begaben wir uns zu dem für uns in Bereitschaft gesetzten Badehause. Dasselbe liegt im Bazar und ist in Kuppelform gebaut, mit einfachen türkischen Verzierungen. Vor dem Eingange befindet sich eine Terrasse, wie bei den Moscheen. Sie war von einer großen Menschenmenge im buntesten Kostüme umringt, welche vermuthlich durch eine Compagnie tückischer Militärs angezogen wurde, die uns zu Ehren vor dem Badehause Wache hielt.
Wir traten etwas befangen in den echt orientalischen Raum; er befindet sich unmittelbar vor dem Badelokal und dient zur Entkleidung. Das Gemach endet in einer schön gewölbten Kuppel; an den Wänden laufen steinerne Ruhebänke herum, welche bestimmt sind den Muselmännern bei den Vorbereitungen zum Bade zu dienen. Ueber denselben sind hölzerne Stangen angebracht, die, wenn man einzelne Abtheilungen zu haben wünscht, mit Wollzeugen überhängt werden. Dem Eingange gegenüber befindet sich ein Empor mit Divans, welches höher gestellten Personen dient. Dasselbe war heute zu unserem Gebrauch mit den herrlichsten orientalischen Stoffen geschmückt. Goldgestickte Polster, Cachemirs, leichte Baumwollzeuge wechselten in den buntesten Farben, und ihre Gruppirung zeigte den lebhaften, graziösen, türkischen Geschmack. Weiche, elastische Teppiche aus Persien waren zur Wahrung des entkleideten Fußes über die marmornen Steinplatten ausgebreitet. An den Stufen des Empors erhebt sich ein Becken, aus dessen oberer Abtheilung ein in elf Strahlen getheilter Springbrunnen das klarste, kühlendste Wasser unter lieblichem Geräusch in den Marmor wirft. An dem Rande des Beckens dufteten die schönsten Blumensträuße mit südlicher, balsamischer Kraft. Der Gouverneur Halil Pascha hatte sie gleich den übrigen luxuriösen Einrichtungen geschickt. Es war ein echtes Bild türkischer Sinnenblendung, ein liebliches Durcheinander, welches doch einen inneren reizenden Einklang hatte. Das Gemach war mit Dienern Halils, welche die kostbarsten Pfeifen und Nargilés bereit hielten, und mit gewöhnlichen Badedienern gefüllt. Man mußte an die Beschreibungen aus Tausend und eine Nacht denken, welche man in unseren Gegenden für übertrieben hält, während sie mehr Wirklichkeit als Traum sind. Man gab uns fortwährend Winke, auf die Divans zu steigen und uns zum Bade zu entkleiden. Ich genirte mich gewaltig, meine Toilette coram publico zu machen und mußte mich auch erst etwas an diese lebhaften Eindrücke gewöhnen. Daher fing ich damit an, mich nur auf dem Divan niederzulassen und den vortrefflichen Taback des Paschas aus den reichen Pfeifen zu schmauchen. Diese Rauchapparate kosten, wie man uns sagte, zwischen 1000 und 3000 Gulden. Die Mundstücke sind aus eiergroßem Bernstein, mit funkelnden Diamanten besetzt. Während dieser Zeit versammelte sich unsre ganze Reisegesellschaft, welche noch auf dem Bazar mit Einkäufen beschäftigt gewesen war. Zum Bade entschlossen sich nur Baron K., mein Bruder und ich. Die übrige Gesellschaft war befangen und fürchtete sich vor der Hitze, welche bei einer solchen orientalischen Körper-Reinigung herrschen soll. Alles was nicht Theil nahm, begab sich nun auf die vor dem Badehause befindliche Terrasse, schmauchend und Scherbet trinkend. Mein Princip ist es, auf Reisen Alles mitzumachen, was das Land eigenthümliches bietet, da man ja um zu sehen und um zu lernen reist. Auf dem Divan kam mir die Toilette lächerlich vor, daher begab ich mich mit meinem Kammerdiener und dem mir zugetheilten Bade-Famulus in das erste Vorbereitungsgemach. Beängstigt trat ich ein und wurde von einem Schwall von feuchter Hitze fast erstickt. Zu meiner Beruhigung fand ich Baron K. schon in seinem Badekostüme postirt. Ich entkleidete mich, und die dienenden Muselmänner schlangen mir um die Lenden eine weiche Baumwollbinde und behingen mich mit einem weißen Mantel aus gleichem Stoffe. An die Füße erhielt ich erhöhte Sandalen, die vor dem auf dem Marmor befindlichen Wasser schützen sollen. Ich wurde hierauf auf einem mit Kissen belegten Stein-Divan installirt, und man reichte mir eine Pfeife. Nun hatte ich Gelegenheit das Gemach zu betrachten. Es war von Stein und hatte die Form eines länglichen nicht sehr großen Rechteckes. Längs der Wände waren ebenfalls Ruhebänke angebracht. Den Boden bedeckte eine halbe Zoll hohe Fluth von Wasser, welche, da die Hitze von unten kommt, der Luft einen so hohen Grad von Feuchtigkeit giebt. Kaum war ich in Transpiration, so begann die Arbeit der Badediener. In diesem Vorbereitungszimmer kneten sie den Körper, um ihn in stärkeren Schweiß zu bringen. Es schien hiebei magnetischer Einfluß vorhanden zu sein; auch spricht die äußere Erscheinung dieser Männer sehr für diese Behauptung. Es sind meist junge Leute mit unendlich tiefen, schwarzen Augen, welche im ersten Augenblicke einen nichtssagenden Eindruck machen; das innere Auge ist aber schwärmerisch, melancholisch, und diesen ihren tiefen Blick heften sie unverwandt und starr auf das Opfer, welches sie unter ihren Händen haben. Ihre Gesichtsfarbe ist fein, aber gelblich fahl; es fehlt ihnen jene jugendliche Frische, die ihnen das Leben in der nassen Hitze nimmt. Ihre Gesichtsform ist wie bei allen Muselmännern, lang und eckig. Um den fein geschnittenen, meist geschlossenen Mund, spielt oftmals ein wehmüthig spöttisches Lächeln, das wohl hauptsächlich uns Europäern gegolten haben mag, die wir uns in diese türkischen Gebräuche gewiß recht unbeholfen geschickt haben. Ihre Gestalt ist schlank und schmächtig, die Hände sind durch das Kneten auffallend ausgebildet; die Haare tragen sie, nach mohammedanischer Sitte gegen vorn zu, kurz geschoren. Ihre Bekleidung ist außerordentlich einfach: gleich den Badenden tragen sie um die Lenden blaugraue mit rothen Streifen versehene Wolltücher, auf den Schultern hängt der weiße Mantel und auf dem Kopfe haben sie weiße anliegende Käppchen. Als die Transpiration, während welcher wir immer liegend rauchten und mit Kaffee bewirthet wurden, durch das Kneten und die ungeheuere Hitze den gehörigen Höhepunkt erreicht hatte, legte man uns wieder die Sandalen an die Füße und wir wurden nun, von der türkischen Bedienung gestützt, in das dritte, das Hauptlokal geführt. Unsere europäische Bedienung ließen wir, da sie uns jetzt nichts mehr nützte, in dem früheren Gemache zurück. Die armen Leute, welche ihre Kleidung nicht so leicht einrichten konnten, waren fast vor Hitze vergangen. Die Temperatur in diesem dritten Gemache aber glaubten wir kaum aushalten zu können; doch einmal schon so weit gekommen, wollten wir das Ganze aus Neugierde überstehen. Wir klapperten mit den Sandalen auf dem feuchten Boden muthig vorwärts. Dieser Saal ist wieder von einer großen, kühn gewölbten Kuppel gekrönt. In der Mitte befindet sich eine runde Erhöhung des Fußbodens; sie beträgt nur ungefähr 2 Schuh und dient als Ruheplatz. An vier Punkten der runden Wand sind kleine Bade-Cabinette errichtet; die Wände derselben bilden gegen den Mittelpunkt des Hauptgemaches zu schiefe Winkel, welche mit kleinen Eingangsbögen endigen: sie dienen nur zur Absonderung; denn gleich spanischen Wänden beträgt ihre Höhe höchstens 1½ Klafter. Der obere Theil ist gegen die Kuppel offen. Wir wurden nun jeder in ein solches Cabinet geführt. Im Inneren desselben befand sich eine hölzerne Pritsche und zwei Hähne für warmes und kaltes Wasser, welche in ein Marmorbecken mündeten. Die steinerne Wand war mit tausenden von Schwaben tapeziert, welche aber bei der menschlichen Annäherung, Gott sei Dank, flohen. Mein Badediener nahm mir den Mantel ab, nachdem er sich auch des seinigen entledigt hatte; ich mußte mich auf die Pritsche ausstrecken, worauf er meine Glieder mit einer blauen weichen Bürste tüchtig rieb. Nachdem er das einige Zeit so fortgetrieben hatte, nahm er ein großes Bündel aus Aloefasern, erzeugte in demselben, mittelst warmen Wassers und Seife, eine große Menge weißen Schaumes, deutete mir mit Zeichen an, die Augen zu schließen und übergoß mich nun wiederholt vom Wirbel bis zur Zehe, indem er immer den Schaum mit heißem Wasser wegspülte. Während dieser Operationen, reichte er mir mit indolenten Gebärden ganz vortreffliche Scherbet-Limonade, welche in diesem furchtbaren Dunst sehr erfrischend wirkte. Bei diesem Reinigungsvorgang kamen die Dragomanen öfter zu den kleinen Cabinetten, um nach unserem Befinden zu fragen. Mehrmals wiederholten sie, ob wir das Bad gänzlich nach türkischer Sitte nehmen wollten? Ich versicherte sie fortwährend, daß es unser Wunsch sei, und ließ daher alles lautlos über mich ergehen. Als der Badediener mich für gehörig gereinigt hielt, schlang er mir ein weißes Linnentuch turbanartig um die feuchten Haare, machte mir durch Zeichen begreiflich, aufzustehen, warf mir den Mantel um die Schulter, reichte mir die Sandalen und führte mich nun in das allererste Gemach, wo die erhöhten Divans zeltartig mit weißen Baumwollstoffen umgeben waren, um uns den Blicken der Neugierigen zu entziehen. Carl und ich streckten uns auf die schwellenden Kissen, ließen uns mit goldgestickten Tüchern behängen und sollten uns nun nach der ungewöhnlichen Transpiration etwas abkühlen. Man reichte uns Pfeifen, Kaffee, Scherbet und vortreffliches Wasser. Die Badediener knieten an unserer Seite, uns knetend und bedienend. Das Ganze war stattlich und gab uns ein recht lebhaftes Bild von orientalischer Ueppigkeit. Unsere übrigen Reisegesellschafter besuchten uns zuweilen und lachten über unser türkisches Aussehen. – Da die Transpiration nicht aufhören wollte und wir dem Besuch des Pascha auf unserem Schiffe entgegen sahen, so zogen wir uns an und verließen triefend das Badehaus. Ich könnte nicht sagen, daß das Bad eine angenehme Wirkung auf mich gemacht hätte; man schwitzt so fürchterlich und kommt in eine beängstigende Unruhe und Mattigkeit; für faule Mohammedaner, die nach einer solchen Operation Stunden und Stunden im dolce far niente zubringen, ihren Taback schmauchend und den Kaffee in langen Zügen schlürfend, mag es recht gut sein.
Der Pascha hatte uns auf eine so freundliche und zuvorkommende Weise seinen Besuch abgestattet, daß wir uns durch unseren Consul erkundigen ließen, wann wir unseren Gegenbesuch machen könnten. Er hatte uns auf heute Morgen zu sich gebeten, mit der Ankündigung, uns ein alt-türkisches Essen geben zu wollen. Man kann sich unsere Freude denken, auch diesen originellen Moment einer Reise im Orient durchkosten zu können. Wir legten bei unserem Consul um 11 Uhr Mittags die volle Parade an, was sich ziemlich komisch zu dem orientalischen Kostüme und dem bunten Gewimmel auf den Straßen ausnahm, und begaben uns auf den schlechten, ziemlich vernachläßigten Quai; hier wartete unser das aus dem schönsten geschnittenen Holze verfertigte lange, aber ziemlich schmale Boot des Pascha, bemannt mit zwölf türkischen Matrosen, welche in ihren weißen Hemden und rothem Feß ein plumpes und sehr nüchternes Aussehen hatten. Das Einsteigen in das schmale Schiff unter das scharlachrothe Dach war mit Säbeln und Sporen ziemlich beschwerlich; auch fand nur ein Theil der Gesellschaft darin Platz. Für die Andern war eine zweite minder pompöse Barke bereit. Wir stießen ab und im Fluge ging es über die schäumenden Wogen der Türkenstadt zu, an deren Anfang Paläste und Kasernen sich befinden. Die Ruderer bewegen ihre schön geschnitzten langen Ruder mit außerordentlicher Kraft und mit so viel Takt, als seien sie nach dem Metronom einstudirt. Ich ließ mir erzählen, daß diese Leute ganze Tage in einem fort unter der glühendsten Hitze rudern, ohne abzusetzen, so daß sie zuletzt in eine Art fieberhafter Extase gerathen, und, fast ihrer Sinne beraubt, in gleichmäßigen dumpfen Lauten stöhnen.
Ich saß in der Barke auf einem rothseidenen eleganten Kissen, des kleinen Raumes wegen mit gekreuzten Füßen, was in der europäischen Kleidung einen nicht sehr malerischen Anblick gegeben haben muß. Wir näherten uns dem Landungsplatze vor dem Palaste. Die Garden waren aufgestellt und echt türkische Musik, in verwirrten wilden Tönen, ließ sich bei unserem Anblicke vom Ufer hören. Als wir das Land betraten, wurden uns mit prachtvollen blauen, gold- und silbergestickten schweren Schabraken und mit herrlich ciselirten Zäumen versehene arabische Pferde des Pascha vorgeführt. Wir zogen jedoch vor, die kurze Strecke zu Fuß zu machen. Die Garden umringten uns, es erscholl eine von allen möglichen Instrumenten ausgeführte wirbelnde Musik, und so zogen wir mit orientalischem Pompe unter Zuströmen der Menge in die inneren Palast-Räume Halil Paschas ein.
Längs des ganzen Weges, bis zur Stiege des Gouverneurs, war eine große Anzahl bewaffneter Diener in alttürkischem Kostüme aufgestellt. Sie waren mit den schönsten Waffen, meist in gediegenem Silber, beladen. Die uns begleitenden Garden trugen leider nicht mehr das alte Kostüme, und sahen in ihrem neuen ganz erbärmlich aus. So plump, so farblos, nichtssagend, hängt ihnen der schmutzige Rock am Leibe, während das alte Kostüme etwas ehrwürdiges, geschichtlich interressantes und den lebhaften Farben des Morgenlandes entsprechendes hat. Das Sprichwort »Kleider machen Leute«, zeigt sich hier als wahr, nur im umgekehrten Falle wie in Europa; denn das Volk hält sich in Smyrna, wie man sagt, noch viel mehr wie in Constantinopel, an die alten Vorschriften, wodurch es einen imposanten, ernsten Eindruck macht, da dieses Kleid den Gesichtszügen, dem Bart und der Gestalt der Mohammedaner wohl ansteht, während sich Autoritäten und Militär sehr kleinlich in ihren modernen Anzügen ausnehmen; wenn man sie ansieht, muß man unwillkürlich an den Verfall des türkischen Reichs denken; denn mit solchen Figuren, welche sich unter dem Volke matt verwischen, verliert die himmlische Pforte ihre Stützen, und die Christen des türkischen Reichs werden bald aufhören, vor einem solchen europäisch behosten Pascha oder Bey, der ihnen sonst eine Geißel Gottes war, zu zittern; und so verliert sich die große Idee eines osmannischen Reiches, gleich der deutschen Rheinfluth, im Sande: Kleider machen Leute. –
Der Palast Halil's ist nach türkischer Art von Holz, da die Moslim nach ihrem Koran ihre Häuser nur als vorübergehende zeltartige Ruhestätten ansehen; denn sie haben mit den Christen nur Waffenstillstand, nicht Friede geschlossen, da es ihre eigentliche Bestimmung ist, mit Feuer und Schwert den Koran über den Erdball zu verbreiten. An den untersten Stufen der hölzernen Treppe empfing uns mit einer bedeutenden Anzahl Diener ein Großer des Reiches, nach dem Pascha der erste Würdenträger in der Stadt. Er bekleidete eine Art Polizeistelle, und schien ein gutmüthiger mohammedanischer »Spitzel« zu sein, der in Wien für diese Race, glaub' ich, zu unbedeutend gewesen wäre. Halil dürfte seine politischen Eigenschaften wohl erkennen, da er den ganzen Morgen außerordentlich freundlich mit ihm war. Der arme Mann fürchtet sich vermuthlich vor einem mißliebigen Berichte an das Constantinopolitanische Ministerium, welches so nicht gut gelaunt gegen den Pascha sein soll, weil er der türkischen Reaktion angehört. Da wir die Bezeichnung »Zopf« hier nicht anwenden können, so wollen wir ihn einen mohammedanischen Langbart nennen; dieser ist nämlich das Symbol des alten Regimentes. Wir nannten diesen orientalischen Spitzel kurzweg türkische Excellenz, weil ihn Gouverneur und Dragoman immer »son excellence« titulirten. Er schlug wiederholt, als Zeichen der größten Hochachtung, auf Bauch, Mund und Stirne. Wollte er damit ausdrücken, daß der Magen sein entwickeltester Theil und das Gehirn ihm und dem Munde nachsteht – ich weiß das nicht; aber gewiß ist es, daß uns der Pascha am obern Rande der Stiege mit demselben Zeichen bewillkommnete. Das Aeußere des Paschas trägt den Ausdruck der Gutmüthigkeit; er ist nicht sehr groß aber außerordentlich fett, und um seinen Mund spielt ein freundliches Lächeln. Sein Kopf ist breit und stark, sein Auge mild und nicht ohne Geist. Aus dem Feß, welches ihm alle Augenblicke herunter zu rutschen drohte, wobei er eine sehr komische Handbewegung machte, guckten ihm einige braune Locken heraus. Um sein Kinn trägt der arme Mann, als Beamter der Neuzeit, nur einen mäßigen und kurzen Bart. Bei uns muß man sich gerade im Gegensatze, wenn man Minister oder wenigstens Ministerial-Rath werden will, als fra diavolo arrangiren. Dort bannt man die schwarze Reaktion mit ihren Derwischartigen (jesuitischen) Umtrieben durch das Verkürzen des Kinnwaldes, und bei uns thut sich das freie Ich, das liberale Bewußtsein der Neuzeit, in der möglichsten Gesichtsverlängerung durch den Bart kund. Ueberall unterwirft sich der Mensch den selbst aufgedrungenen Formen.
Der Rock, den er trug, war von dunkelblauem Tuche mit außerordentlich reicher Goldstickerei. Die inexpressibles von weißem Tuche mit Goldstreifen. Um den Hals trug er das Zeichen, welches ihm als Schwager des Sultans gebührt. Es besteht aus einer Diamanten-Schnur und zwei kleinen eben solchen Quasten, wie auch den in Brillanten gefaßten Namenszug des Sultans. Seine Brust schmückte der auf gleiche Art gefaßte russische Andreasorden, den er erhielt, als er in dem Jahre 1827 als Friedensbote nach Petersburg geschickt wurde, nachdem er sich in diesem Kriege sehr ausgezeichnet hatte und der Einzige war, vor dem sich die Russen fürchteten. Um die Lenden hatte er einen herrlichen Säbel in peau de chagrin und Diamanten gegürtet. In dem ersten geräumigen Stiegenhause war eine noch größere Anzahl von Dienern versammelt; überhaupt macht die Menge der Diener und Sklaven den Stolz der Türken aus. Halil führte uns mit dem Zeichen der größten Aufmerksamkeit in einen an das Stiegengemach anstoßenden Salon, dessen lange Fensterreihen eine prachtvolle Aussicht auf das wogende Meer darboten, und von diesem immer schönen Elemente die wohlthuendste Brise einließen. Wände und Plafond des Gemaches waren hellgrau angestrichen; in den Ecken liefen Goldstreifen mit orientalischen Verzierungen. Auf zwei Seiten waren Fenster an Fenster, nur durch leichte Balken getrennt. Auch ein Theil der Stadt und der ganze Hafen waren durch dieselben sichtbar. An den Fensterbrüstungen standen Divans, Sofa und Lehnstühle. Zwischen den zwei in gerundeten Ecken befindlichen Eingangsthüren ist die Wand außerordentlich reich mit Gold verziert; in der Mitte derselben befindet sich der Namenszug des Sultans mit goldenen Zügen auf blauem Grunde; unter diesem sind in dem Holzgetäfel kleine Schubladen angebracht, in welchen man die werthvollsten Kleinodien, Andenken und Schriften aufbewahrt. Es scheint dies das Familien-Sanctuarium zu sein, und es hat auch durch einen großen, schrankartigen Tisch, welcher sich vor demselben befindet, Aehnlichkeit mit einer Kapelle. Auf dem Boden liegen feingearbeitete Matten. Die oben angeführten Möbel beziehen die Türken aus Triest und Wien. In diesem Gemache waren sie aus braunen, hübsch geschnitzten Nußbaumholz mit schwarzem Roßhaarstoff überzogen. Der Pascha wies meinem Bruder und mir Lehnstühle an der Fensterwand, gegen die Stadt zu, an, so daß wir in das Innere des Gemaches und auf das Meer sehen konnten. Halil setzte sich an unsere Seite, die übrigen Herren, die im ersten Boote gefahren waren, vertheilten sich auf den Divans. Es entspann sich nun zwischen uns und dem Gouverneur ein Gespräch mit Hülfe des Dragoman, welcher in französischer Sprache verdolmetschte.
Den Fragen Halils merkte man an, daß er nicht ohne Bildung sei, und seine echt türkischen Schmeicheleien waren gut gewählt, blumenreich und fast witzig. Bald nach uns kam die Gesellschaft, welche im zweiten Boote Platz gefunden hatte, an; die Herren wurden vom österreichischen General-Consul dem Pascha vorgestellt, welcher ihnen mit den freundlichsten Worten sagte, er hoffe, Alle würden ihre Pflicht thun, nur der Doctor möchte niemals Gelegenheit dazu haben. Ich konnte mich über die Verwunderung meiner Freunde kaum des Lachens enthalten. Die eckigen, schlichten, häßlichen Fracks nahmen sich mitten im orientalischen Luxus so äußerst komisch aus, und ein dicker, liebenswürdiger Haus-, Hof- und Staats-Archivarius Seiner apostolischen Majestät, dem man die Lachlust im Gesichte ansehen konnte, einem Gouverneur und Pascha einer asiatischen Provinz der himmlischen Pforte gegenüber, gab ein gar mächtiges Genrebild. Nachdem auch diese Herren sich niedergelassen hatten, strömte auf ein gegebenes Zeichen ein Haufe von Dienern herein, welche außerordentlich schöne, sieben bis acht Schuh lange Tschibuks lanzenartig im Arme trugen. Sie vertheilten dieselben unter uns, faßten unsere Stellung scharf ins Auge und wußten die duftenden Pfeifenköpfe so geschickt auf den Boden zu stellen, daß das Mundstück gerade in die Richtung unserer Lippen kam. Dieser Handgriff gehört zum bon ton der türkischen Dienerschaft. Nun knieten sie nieder, legten unter jede Pfeife eine Metalltasse und fachten das vortreffliche Lieblingskraut der Osmanli mittels Kohlen zur dampfenden Gluth an. Alles dieses geschieht mit außerordentlicher Fertigkeit; nur Schade, daß diese Diener ebenfalls die neuere Kleidung tragen. Wir erkannten die Pfeifen aus dem Bade her; nur erstaunten wir jetzt über die Menge, welche den außerordentlichen Luxus verräth, den man in diesem Punkte in der Türkei treibt. Der Sultan ließ schon einst ein Verbot gegen die große Verschwendung in Pfeifen ergehen, da sich mehrere seiner Paschas im vollsten Sinne des Wortes durch diesen Artikel ruinirt haben. Für unsern guten Halil ist dies nicht zu fürchten, indem er sehr reich ist; seine Einkünfte schon als Gouverneur von Smyrna betragen bei 80,000 Gulden. Während des Gespräches rief er plötzlich unseren lieben Dr. F. zu sich, und ließ ihm durch den Dragoman bedeuten, er möge ihm den Puls greifen, indem es ihm eine Ehre sei, daß er an ihm dasselbe vollziehe, was er täglich an uns ausübe. Der Arzt that wie ihm befohlen wurde, und versicherte Seiner Hoheit, daß der Puls außerordentlich stark und gesund sei, worüber unser freundlicher Wirth in ein sehr lebhaftes Gelächter ausbrach. Er befrug auch noch den Medicus, ob denn kein Mittel gegen die Cholera gefunden sei. Als man ihm verneinend antwortete, schien er nicht sehr zufrieden; denn die Furcht vor dieser Krankheit ist im Orient ungeheuer groß. – Wieder erschienen die Diener und brachten Kaffee.
Im Oriente wird dieses so oft gebrauchte Getränk in kleinen Schälchen aufgetischt, welche sich in eierbecherförmigen Gestellen befinden. Gewöhnlich sind diese Gefäße aus Porzellan; hier waren sie aus rosenfarbenem Email mit Diamanten. Der Kaffee wird sehr warm, mit Satz und ohne Zucker getrunken und ist nicht so schlecht wie man glaubt. Als die Pfeifen zur Hälfte geraucht waren, wurden sie von den Dienern hinausgetragen, und frisch gefüllt zum neuen Gebrauche wieder hereingebracht. Plötzlich hörte man Schellen klingen und drei stattliche, bunt geschmückte Kameele erschienen, umgeben von malerisch gekleideten Treibern, auf dem Platze vor dem Palast. Es sollte uns ein Schauspiel ganz neuer Art geboten werden: ein Kameelkampf, von dem ich in Europa nicht einmal reden hörte. Gegen das Spätjahr zu, besonders im Monat Dezember, kommen die männlichen Thiere in eine eifersüchtige Wuth, so daß sie sich gegenseitig jagen, beißen und schlagen, gleich den Hähnen bei den Wettkämpfen in England. Leider mißglückte der heutige Versuch, indem es noch zu früh im Jahre war. Nur das stärkste dieser Thiere ging einmal, gereizt durch die Treiber, auf ein schwächeres los, biß es ein paarmal, wobei ihm der Schaum aus dem Maul lief; der Gegner jedoch stöhnte nur einigemale jämmerlich und wich dann feige zurück. War auch dieser Spaß dem Pascha mißglückt, so hatte uns doch der Anblick dieser mächtigen Thiere sehr interessirt; plötzlich verschwand der Gastgeber, aus welchem Grunde ist uns bis jetzt noch nicht bekannt. Einige Zeit nachdem er außer Athem zurückgekehrt war, lud er uns zur Tafel ein. Er ging vor uns, wie es überhaupt im Orient Sitte zu sein scheint, mit würdevollem Anstand in das Stiegengemach, wo ihn die immer fortgesetzten Bücklinge seiner treuen Diener empfingen. Von hier aus führte er uns durch eine kleine mit einem schweren Vorhange versehene Thüre in das Speise-Kabinet. Dies bot ein liebliches Bild des phantastisch graziösen Morgenlandes. Die Wände und der Plafond waren zeltartig mit weißen moirirten Tapeten bedeckt, welche mit rothen Streifen und zierlichen Bouquets geschmückt waren. Auf der einen Seite befand sich wieder eine hohe, lange Fensterreihe, unter welcher sich ein breiter, grüner, schwellender Divan hinzog. Holzgitter schützen vor den neugierigen Blicken des Volkes. Auf dem Boden lagen Rohrmatten und außerdem noch reiche Teppiche, in der Mitte des Zimmers befanden sich zwei große geränderte Vermeil-Platten auf Dreifüßen, welche mit reichen Stoffen behängt waren. Diese bildeten die Eßtische, an denen nach türkischem Brauch immer nur sechs bis sieben Personen Platz nahmen. Die Gesellschaft theilte sich demnach in zwei Theile. Wir ließen uns auf kleine weiche Sitze nieder, mit der gespanntesten Erwartung auf das kommende Mahl. Halil Pascha, Fürst J., Baron K., der General-Consul, mein Bruder und ich saßen an einer dieser Platten. Jeder der Gäste hatte einen schwarzen und weißen mit Corallen besetzten Löffel vor sich, ein goldgesticktes Handtuch aus Battist, welches mit einem Schnupftuche viel Aehnlichkeit hatte, ein feines Weißbrot, dessen eine Hälfte in längliche Rechtecke geschnitten war, und mehrere in Vermeil und Silber elegant gearbeitete Untertäßchen, auf welchen sich köstliche Sultana-Trauben, Sardellen, Caviar, Gurkensalat mit saurer Milch, Wasser- und süße Melonen befanden. Die letzteren waren durch die südliche Sonne so gereift, daß sie auf der Zunge wie Zucker zerflossen. Diese verschiedenen hors d'oeuvres ißt man nach Belieben während des Speisens, was keine schlechte Einrichtung ist, da man beim orientalischen Mahle süße und saure Speisen durcheinander bekommt. Man schlang uns um Brust und Schooß goldgestickte Linnentücher, was uns ein sehr spaßhaftes Aussehen gab; diese Maßregel ist jedoch höchst nothwendig, da man nur die ganz flüssigen Speisen mit dem Löffel ißt, während man alles andere mit den Händen zerreißt. Kaum hatten wir uns niedergesetzt, so füllte sich das ganze Gemach mit Dienern, die sich weidlich an unserer Verwunderung und unserem ungeschickten Benehmen ergötzten. Man legte nun in die Mitte der Tafel ein kleines, rundes, ledernes Kissen, auf welches man die Speisen, deren Zahl über 20 war, der Reihe nach in großen, weißen und blauen chinesischen Porzellan-Schüsseln setzte. Da es einige europäische Gourmands interessiren könnte, so lasse ich den Speisezettel folgen. Den Eingang machte eine Nudelsuppe, welche jedem französischen Koch Ehre gebracht hätte; hierauf folgte ein Schöpsenbraten mit Reis gefüllt, welcher sich durch sein zartes und vortreffliches Fleisch auszeichnete. Die Suppe hatte man mit dem Löffel gegessen, in diese Speise jedoch fuhr der Pascha mit seiner weichen dicken Hand, und gab uns zu verstehen, wir möchten seinem kühnen Beispiele folgen. Alles stürzte nun gleich wilden Thieren auf diesen Braten los, und bald waren die triefenden Fasern abgelöst und mit etwas Ungeschick in den harrenden Mund gebracht; aus besonderer Bevorzugung und Artigkeit riß der Gouverneur einen saftigen Knochen ab, den er mir mit liebenswürdigem Lächeln gleich einer Blume überreichte. Wir waren einigermaßen verlegen, indem wir nicht wußten, wohin die überbleibenden Knochen legen; der Pascha half uns jedoch bald aus dieser Ungewißheit, indem er uns andeutete, nur alles auf die goldene Platte tropfen und fallen zu lassen; diese beaux restes des orientalischen Magenluxus bleiben die ganze Tafel hindurch den nicht sehr erbauten Augen der Gäste Preis gegeben. Darauf kam eine flache, sehr breite Mehlspeise von Butterteig, welche die Türken Börek nennen. Halil benutzte eine glückliche Gelegenheit, während wir nicht auf die Speise achteten, lüftete die Mitte derselben, worauf zu unserer großen Verwunderung ein Stieglitz scheu herausflog. Unser heiterer Wirth lachte über diesen Beweis türkischen Witzes, mit einem maßlosen Gebrülle; es scheint, daß diese naiven Ueberraschungen in Smyrna noch der höchste Grad von gutem Geschmacke sind, denn der Pascha bat mich, ich möchte dieses Intermezzo in meinem nächsten Briefe an meine Verwandten erwähnen.
Um diese Speise auf eine angenehme Art zu verschlingen, nahm er die fetten Blätter des Kuchens und rollte sie so zu einer Kugel, welche er dann mit Grazie in den weit aufgerissenen Mund warf. Nach diesem Gerichte brachte man Limonade-Scherbet, in sehr eleganten, wahrscheinlich französischen oder sächsischen porzellanenen Rococo-Tassen. So schlecht dieses aus Citronen bereitete Getränk im Occident ist, so erfrischend und vortrefflich ist es im Orient. Die Speisen wurden außerordentlich rasch gewechselt, so auch verschwand der labende Trunk nur zu bald. Ihn ersetzte ein gebackener Fisch mit kleinen Rosinen. Diese Zusammenstellung ist zwar etwas gewagt, aber in der Wirklichkeit nicht so schlecht, wie man glaubt; dann folgte eine sehr gute Mehlspeise, Kataif genannt, dann Patlitscha, ein Gericht Fleisch mit einem Gemüse Macedoine, dessen Hauptbestandtheil eine in der hiesigen Gegend vorkommende sehr schmackhafte, paprikaartige Pflanze ist. Bei diesen Speisen in halbweichem Zustande hilft man sich mit den rechteckig geschnittenen Brotstücken, welche man auf den Zeigefinger legt, und so mit diesem und dem Daumen sich bedient. Viele zarte Europäerinnen und fein gebildete Dandys werden über dieses naturgemäße Verfahren erschrecken. Ich erlaube mir nur die Bemerkung, daß es kein großer Unterschied ist, mit rein gewaschenen, eigenen Fingern aus einer so großen Schüssel zu essen, in welcher man, wenn man einigermaßen geschickt ist, mit seinem Nachbar gar nicht in Berührung zu kommen braucht, oder in einer zartfühlenden europäischen Gesellschaft die Speisen mit Bestecken zum Munde zu führen, deren sich schon Hunderte von Menschen bedient haben. Es kommt alles nur auf Einbildung und Gewohnheit an. Der Gouverneur erzählte uns, daß ihm das Essen mit dem Bestecke in St. Petersburg sehr schwer gefallen sei; die Türken lachen über die Sitten der ungläubigen Franken ebenso, wie wir über die Ihrigen. Nach dem Patlitscha brachte man gute, gebratene Meerfische. Hierauf krapfenartige Reiskugeln, bei welchen die Türken Mittel finden, sie auf einmal mit der platten Hand in den Mund zu drücken. Nach diesen kam Reis mit Paradiesäpfeln. Hierauf Hallioa, eine geléeartige, sehr süße und gute Honigspeise, dann erschien Bombar, bestehend aus vortrefflichen Würsten mit Reis gefüllt. Dies war vielleicht eine der schmackhaftesten Speisen. Der Pascha nöthigte uns durch die freundlichsten Worte, von allem zu genießen. Als Fürst J. einmal, ganz außer Athem, aussetzen wollte, versicherte er ihn gleich, ein Militär müsse noch mehr als die andern Leute zu sich nehmen. Nun tischte man Lokma, einen durchsichtigen, meerfarbigen Strudel auf, welcher durch seine Süßigkeit fast widrig war. Hierauf kam Lammfleisch, dann Kalbsragout, diesem folgte Tank-goksi, ein weißer Brei, welchen man aus fein gestoßener Hühnerbrust und Mandeln macht. Ich fand diese Speise furchtbar, einige der Gesellschaft lobten sie jedoch außerordentlich. Dann erschien ein Gericht aus Truthahn. Bei einem der angeführten Fleische winkte Halil einem Diener, welcher mit den Händen in die Speise fuhr, um sie zur leichteren Behandlung der Essenden auseinander zu reißen. Ein kurzes und praktisches Verfahren. Nun kamen Maccaroni mit Käse, ganz nach europäischer Sitte. Hierauf vortreffliches Pfirsich-Kompott, dann Kabak dolma, aus gefüllten Kürbissen zubereitet, eine Speise, welche die europäischen Feinschmecker sehr gut aufgenommen hätten, wenn sie nicht unmittelbar nach dem süßen Kompotte gekommen wäre. Das Ende des reichen und gemischten Mahles, machte der Pilau, ein großer Reishaufen, bestreut mit kleinen Rosinen. Nach geschlossener Speisenreihe wurde Urchas, ein schwimmendes Kompott in eleganten gläsernen Schalen servirt. Dieses ziemlich starke, aber nicht sehr angenehme Getränk vertritt bei den Mohammedanern die Stelle des Weines. Während der Tafel gelang es mir nur zweimal sehr frisches gutes Wasser zu bekommen. Nun war das Mahl, dieses interessante Reiseereigniß, beendet. Wir setzten uns auf den an der Fensterreihe befindlichen grünen Divan, und man brachte uns in herrlichen Kannen und Becken von Vermeil Wasser und Seife, um eine sehr nothwendige Händereinigung vorzunehmen, bei welcher der Pascha, der sich übrigens auch das Gesicht einseifte, ein Gebet zu murmeln schien. Nachdem diese Toilette vollendet war, führte uns Halil wieder in den grauen Salon, und abermals brachte man die Tabackspfeifen.
Jetzt lernten wir eine neue, den türkischen Großen höchst eigene Sitte kennen; man vernahm nämlich in dem wohlgefüllten Bauche des Paschas ein dumpfes Rollen und Tönen wie vor einem herannahenden Gewitter. Plötzlich dröhnte das ganze Zimmer von einem Schall, welcher dem holdseligen Munde des kaiserlichen Schwagers entfahren war. Da diese bauchrednerischen Betonungen bei uns keineswegs üblich sind, so mußten wir in den großen Mundstücken der Tschibuks Hülfe suchen, um nicht in ein Gelächter auszubrechen. Von der türkischen Seite aus wurde dieser Beweis eines zu copiösen Diners sehr gleichgültig aufgenommen und die Osmanli schienen gar nicht verlegen. Im Gegentheil, kaum war Smyrnas Pascha zu Ende, so hörten wir auf der andern Seite des Zimmers ebenfalls einen lauten Seufzer über die Thorheit, so viel gegessen zu haben. Es war die Gemüthsäußerung der türkischen Excellenz, welche am zweiten Tische während des Mahles präsidirt hatte. Nun konnte unser convulsivisches Lachen kaum mehr verborgen bleiben; erst später erfuhren wir, daß diese etwas lebhaften Magenäußerungen im Oriente nicht im geringsten unartig seien, sondern so behandelt würden, wie bei uns allenfalls das Niesen. Unsere Gedanken wurden von diesem sehr komischen Thema durch einen ägyptischen Mohrentanz abgelenkt, welchen der Pascha auf demselben Platze, wo der Kamelkampf verunglückt war, aufführen ließ. Die Neger spielten selbst eine monotone Musik mit Trommeln und Cinelli. Der Tanz war eigenthümlich, graziös und kriegerisch. Die Neger schlugen mit Stöcken gegen einander und machten mitunter Sätze wie wilde Tiger. Ein National-Tanz ist immer von großem Interesse, da sich in demselben meist der Charakter des Volkes ausspricht. Die Tarantella ist voll wilder Gluth, der Bolero edel und feurig, die Mazurka voll leichtfertiger Anmuth, und in diesem Tanze sieht man die wilde, kriegerische Horde, welche um die Leiche der Feinde oder um den erlegten Löwen tanzt.
Als wir einige Zeit dies Schauspiel betrachtet hatten, fragte uns der Pascha, ob wir nicht die Kaserne und die Truppen sehen wollten, welches Anerbieten wir sehr gerne annahmen. Zum Abschied traten wir zu dem Schreine, unter dem Namenszug des Sultans, der nun mit Champagner, Feigen, Trauben und köstlichen Sultaninen überfüllt war. Ich ergriff ein Glas mit dem sprudelnden Frankenwein und bat den Pascha, ob wir nach unserer europäischen Sitte auf sein Wohl trinken dürfen; er erwiederte unseren Toast, indem er ebenfalls einen auf das Wohl unseres Monarchen ausbrachte. Den Namen des Kaisers lispelte er nach türkischer Sitte nur mit leisen Worten. Nun trank er noch auf unsere Gesundheit, und wir auf die des Sultans. Ich sah bei dieser Gelegenheit, daß die Türken, trotz des Korans, dem perlenden Champagner keineswegs abhold sind; sie entschuldigen diese stille Leidenschaft durch die Behauptung, dieser Wein sei nach Mohammeds Tode erfunden worden. Wir verabschiedeten uns nun bei unserem herzlichen, freundlichen Wirthe, den wir in der kurzen Zeit ganz lieb gewonnen hatten, und wurden mit denselben Ceremonien entlassen, mit denen man uns empfangen hatte. Wir begaben uns in die Kaserne; ein sehr geräumiges zweistöckiges Gebäude, aus einem Mittel und zwei Seitentrakten bestehend; gegen die vierte Seite zu ist es offen und ein Gitter schließt den großen Hof, unmittelbar am Rande des Meeres, ab, wodurch auch die Luft in den schönen fensterreichen Räumen immer gesund und frisch ist. Der in dem Gebäude kommandirende General, welcher seiner Charge nach über zwei Regimenter gesetzt ist, hatte in diesem Augenblicke nur ein Regiment in der Kaserne, das andere war auf dem Marsche. Jedes Regiment hat zwei Oberste, vier Oberstlieutenants, zwölf Majors und vier und zwanzig Lieutenants. Die Mannschaft ist in vier Bataillone eingetheilt, das Bataillon in zwei Compagnien.
Der General, welcher den Titel Militär-Gouverneur führt, empfing uns unter dem Thore des dunkelroth angestrichenen Gebäudes. Wir besuchten die Räume des ersten Stockes; die Gänge sind außerordentlich hoch, breit, luftig und von lobenswerther Reinlichkeit, die Zimmer geräumig und nett; vierzig bis sechzig Menschen haben in demselben Platz. Der Mann hat einen magern Strohsack, ein kleines Kissen und eine Wolldecke, alles von dunkler Farbe; das ganze Bett hat in seinem Tornister Platz. Die Leute liegen am Boden ziemlich dicht neben einander. Die Kleidung des Soldaten besteht aus einem rothen niedern Feß, einem blauen Tuchspenser und weißen Leinwandhosen; die Füße sind nur außerhalb der Caserne mit schwarzen Schuhen bekleidet; in der Kaserne gehen die Leute bloßfüßig herum, was viel zur Reinlichkeit beitragen mag. Das Riemzeug ist von weißem Leder, die Patrontasche ziemlich umfangreich. Die Gewehre sind groß und braun geschäftet, die Tornister schmal und hoch, mit braunem Leder überzogen. Ich konnte dem General nicht genug meine Bewunderung ausdrücken und versicherte ihn, daß man selbst in Europa sich die Reinlichkeit des Militärgebäudes zum Beispiel nehmen könnte, was dem Kommandanten sehr zu schmeicheln schien. Man führte uns nun in eine Art großen Erkers, welcher in der Mitte des mittleren Traktes im ersten Stock ein Gastzimmer enthält, von wo aus wir gebeten wurden, einigen Bewegungen des Regimentes zuzusehen; wir versicherten die Herren, daß wir, statt auf den schwellenden Kissen des Divans zu ruhen, uns lieber in den Hof begeben wollten, um die Truppen in der Nähe bewundern zu können. Diese Aufmerksamkeit freute die zuvorkommenden Türken außerordentlich, was ich später durch einen Brief aus Constantinopel erfuhr. Von ihrem Sultan sind sie keiner so nahen Betrachtung gewürdigt. Für Seine osmanische Majestät ist nämlich ein prachtvolles Zimmer im zweiten Stock eingerichtet; in jeder Kaserne ist ein solches für ihn bestimmt, von wo er dann die gläubigen Kinder Mohammeds wie aus den Wolken betrachtet, das heißt nur sein Körper zeigt sich bei diesem kriegerischen Schauspiele, denn der abgestumpfte Geist des jugendlichen Fürsten erfreut sich nicht an dergleichen Dingen; er ergeht sich lieber im Genusse des umhüllenden Tabacksrauches und denkt lieber an das Heer seiner 700 Frauen, als an seine bewaffnete Armee; wenn auch der Dragoman mit gewandtem Sinne mir sagte: »Cette chambre est réservée pour le Grand-Sultan, puisque les soldats sont ses enfants et le père doit toujours loger parmi ses enfants«, was recht hübsch klingen würde, wenn es nicht eine leere Redensart wäre. Das Regiment war im großen Hofe aufgestellt, alle Offiziere waren zu Fuß; ich glaube, daß nur dem General ein Pferd zusteht. Die vier Bataillone standen in einer Front, und es begann ein kurzes Exerciren im Feuer. Zuerst schoß jedes Bataillon der Reihe nach, wobei das erste Glied nach alter Art niederkniete, wodurch alle drei Glieder feuern konnten. Hierauf kam eine Décharge der ganzen Front, ein Lauffeuer und dann die Formirung eines ganzen Quarrés. Im Feuer exercirten sie vortrefflich, die Déchargen waren wie ein Schlag und das Laden fabelhaft rasch; mit den übrigen Bewegungen ging es minder gut; dieselben werden noch nach dem Beispiele eines Flügelmannes gemacht. Besonders schlecht fiel das Defiliren aus, bei welchem ein langer schwarzer Neger-Lieutenant die Richtung angab; die Musik tönte hierzu gar wild und eigen. Einmal versuchten die guten Leute etwas aus Flotow's »Martha« zu spielen, was aber ganz und gar mißlang. Das Commando der Türken in der Landessprache ist wohltönend und laut, und wird rasch von den Truppen ausgeführt.
Nirgends kann man den Gesichtscharakter einer fremden Nation besser beurtheilen, als in ihren Heeres-Abtheilungen. Wo alles gleich gekleidet ist, nach gleicher Größe gerichtet wird, da fällt einem auch die Gleichheit der Züge auf und es wird möglich, aus diesen neben einander gereihten Gestalten einen allgemeinen Typus zu entnehmen. Der türkische besteht in einer ziemlich kurzen, etwas zurück gelegten Stirne; starken, schön gewölbten Augenbrauen, scharfen, lang geschnittenen Augen, einer langen, schmalen an der untern Spitze gerundeten Nase, einem großen, schlaffen Munde mit starker Unterlippe, und einem langen, ovalen Kinn; die Haut ist olivenartig. Nur der Schnurrbart wird bei den türkischen Truppen getragen; der volle Bart wäre, wie wir oben gesagt haben, zu reactionär, und würde zu viel an den Janitscharen-Absolutismus erinnern. Nach der Defilirung der Truppen drückten wir dem Generale unsere Bewunderung und unseren Dank aus und verließen hierauf die schöne Kaserne.
Es scheint, daß die Türken die Erfahrungen, die sie aus den Revolutionen schöpften, gut zu benützen wußten, indem sich der Palast des Gouverneurs in unmittelbarer Nähe der Behausung der Truppenmacht befindet. Ist auch die türkische Monarchie im Innern morsch und schwach, so ist sie es doch nicht durch die Revolution, und das Hinsterben eines alten Kolosses, der eine große Vergangenheit hat, ist nicht so erbärmlich, als die furchtsame Schwäche der europäisch christlichen Staaten, die die Revolution hassen, sie gerne umbringen wollten, aber die Mittel hierzu mit kindischer Schwäche scheuen und nur manchmal hinterrücks einen Ausfall wagen. Die religiöse Idee ist es, die dies Reich noch zusammenhält. Ist Mohammed einmal begraben, so leuchtet auch sein Halbmond nicht mehr über den schönsten und reichsten Länder der Erde. Soll die Türkei untergehen, so untergrabe man ihre Religion. Will man die europäischen Nationen stürzen, so säge man fleißig am Kreuze.
Da während des Morgens das Meer ziemlich bewegt geworden war, schlug man unserer Gesellschaft vor, den Rückweg zum Consulate auf den Pferden des Pascha durch die Stadt zu machen. Wir nahmen das Anerbieten nicht an, da es uns in Verlegenheit setzte, auf diesen herrlich geschmückten Pferden zum Schauspiel für ganz Smyrna zu werden; wir hätten auch in voller Uniform zu Fuße in der glühendsten Hitze auf dem schlechten Pflaster eine lange Strecke gehen können. Ich aber liebe das bewegte Meer, und tanze gerne auf den mächtigen Wogen, bestimmte mich daher die Fahrt wieder in der Barke Halils zurück zu machen. Ein herrliches Vergnügen versprach ich mir von diesem wonnevollen Schaukeln durch den zauberhaften Hafen von Smyrna. Meinem Beispiele schlossen sich mein Bruder, Graf C., der General-Consul und der Dragoman an. Den Uebrigen schien das Heben und Sinken der schäumenden Wogen nicht zu behagen; sie zogen es vor, recht mühselig zu Fuße zu schleichen. Wir stießen frisch vom Ufer ab, und ich freute mich meines Einfalles; rasch schwebten wir über Berg und Thal im kühlenden Meerwinde dahin, die lustigsten Hafenscenen beobachtend. Das rothe Dach schützte uns vor den sengenden Strahlen und mit der größten Muße konnten wir das herrliche Panorama der Stadt betrachten. Lange schon ruhten wir wieder auf den Sopha's im Consulatsgebäude in angenehmer Erinnerung des heitern und merkwürdigen Morgens, als unsere Freunde keuchend und halbtodt von Hitze und Müdigkeit daher kamen. Wir bedauerten sie, daß sie nach einem so copiösen Male, so lange über das halsbrecherische Pflaster hatten hinken müssen. Ich lachte und dachte in meinem Innern, die hüpfenden Wellen sind doch besser als der holprige Weg.
Smyrna den 20. September 1850.
Es war einer der schönen hellen Tage des Südens, der Himmel rein, die Luft warm und doch nicht drückend. Alles dies lud uns ein, das Anerbieten des Consuls und Pascha's, einen Spazierritt nach Burnabá zu machen, anzunehmen. Um drei Uhr Nachmittag, nach einem stärkenden Gabelfrühstück verließen wir das Verdeck des Vulkan. Bald hatte uns die Barke an Asiens Strand gebracht, von wo uns einige Schritte zum Hause unseres Consuls führten. Hier warteten unserer die Pferde des Pascha; es waren herrliche Thiere, in der reichsten Zäumung; die langen und breiten Schabracken strotzten von reichen Goldstickereien, die Zäume waren aus goldig glänzender Bronce, und die Steigbügel aus demselben Metall stellten ganze Waffentrophäen vor. Wir setzten uns hoch zu Rosse und umgeben von einem bedeutenden Schwarm türkischer Offiziere und einer Art irregulären Garde des Pascha, durchzogen wir mit majestätischem Pferdegetrappel die Straßen von Smyrna. Wir kamen durch die Armenier-Stadt, um der Anhöhe entlang in das freie Land zu gelangen. Alles stürzte zu den Fenstern und vor die Thüren, die herrlichsten orientalischen Physiognomien zeigten ihre neugierigen, fein geschnittenen Augen hoffend, daß sie einen asiatischen Fürsten im herrlichsten Anzuge einherziehen sehen würden, während sie nur, o Ironie! ein paar armselige Europäer in quadrilirten Sommertrachten bedeckt mit schwarzen Cylindern, auf den luxuriösen Pferden Halil Pascha's erblickten. Bald waren wir auf einem gar schönen, und – schenkt man den Historikern Glauben – interessanten Punkte, auf dem höheren Theile Smyrnas, angelangt. Es ist dies der von Platanen umschattete heilige Ort, an welchem der erste Musensohn, der erste, von dem wir wissen, daß er der Sprache die bezaubernden Rosenfesseln des Rhythmus angelegt hat, an welchem Homer das Licht der Welt erblickt hat. Ist es auch nicht der wahre Punkt, an welchem der von den Göttern begeisterte Sänger geboren ist, so ist doch wenigstens die geschichtliche Fabel trefflich ersonnen; denn gar reizend wölbt sich die Platane mit ihrem edlen schlanken Wuchse, ihren feinen glatten Aesten, und der breiten, leichten, vielfach gezackten Blätterkrone an dem diesseitigen Ufer eines Gewässers, während jenseits der stille, ernste toderfüllte Cypressenhain zum Himmel ragt; zudem erheben sich als Symbole der späteren Geschichte zwischen den spitzen dunklen Bäumen gleich weißen Geistergestalten die merkwürdigen Türken-Gräber, während über den Fluß die für Smyrna so wichtige eigenthümlich gebaute und mit lebhaften Farben bemalte Caravanenbrücke führt, über welche tausend und tausende von Kamelen die reichen Naturgaben auf den Stapelplatz der orientalischen Gewässer bringen. Wir überschritten dieses alte Bauwerk und begaben uns in den Todtenhain der Muselmänner. Ein eigenthümlicher Ernst, eine ergreifende Würde herrscht in diesen Räumen; in guter Ordnung und gehöriger Entfernung stehen die hohen Cypressen, diese lebenden und doch die Todesruhe verkündenden Minarets des Pflanzenreiches. Zwischen denselben sind die zahllosen Gräber, welche aus aufrecht stehenden Steinplatten bestehen, die meist auf und abwärts in einen Winkel auslaufen. Die Gräber der Männer bezeichnen auf dem obern Theil angebrachte Turbane; die der Frauen sind ungeschmückt wie überhaupt der Frau im Oriente keine Rolle eingeräumt ist. Vor mancher der Steinplatten erstreckt sich eine niedere Steineinfassung, wie sie bei uns im Gebirge öfter von Holz gemacht wird. Die neueren Gräber sind mit grellen Farben bemalt und statt dem Turban sieht man schon den türkischen Feß darauf. Auf den Steinplatten stehn der Name des Todten und Sprüche aus dem Koran. Zwei Dinge gefallen mir bei den Türken: daß sie nie die Gräber ihrer Vorfahren mit eigener Hand aufreißen und vertilgen, sondern dies Geschäft der Zeit überlassen, und daß sie keine steinerne, beklemmende Platte den Gebeinen der Verstorbenen aufdrücken, sondern sie dem Schooße der Mutter Erde anheimstellen. Ich ziehe einen solchen Türkenfriedhof den unserigen weit vor; man findet hier viel mehr Gediegenheit, Einfachheit und Naturreiz als in unseren Kirchhöfen, wo man oft eher geneigt ist zu glauben, man sehe ein theatralisch heidnisches Freudenmonument, als eine christliche Grabstätte, oder endlich gar, wie bei den Italienern, wo man auf einem großen mit Arkaden umgebenen Platz die Reichern aufschichtet, während man dem Armen nur auf freiem Felde einen Raum gönnt und sein Grab von dem eines Hundes nur durch eine kleine nummerirte Holzmarke unterscheidet; will man Namen und Auskunft über einen Todten finden, so muß man in einem Bibliothekkasten, einen Katalog nachschlagen lassen. Dies sind die Ergebnisse unserer großen materialistischen Zeit, in welcher sich die Menschheit selbst als eine von einem ungekannten Fluidum durchströmte Fleischmasse betrachtet und hiedurch, wie natürlich, die Achtung vor den todten Gebeinen verliert. Unsere Vorfahren kannten noch den schönen Sinn, der sich in den Türkenfriedhöfen zeigt, und man findet denselben noch in manchen Theilen des hohen Gebirges.
Wir verließen die großen Cypressenhaine, bestiegen wieder unsere schimmernden Rosse, und setzten unseren Weg nach Burnabá fort. Wir durchstreiften die fruchtbarste Gegend mit der üppigsten Vegetation; man konnte sich hier den richtigsten Begriff von dem Reichthume der türkischen Länder machen; die herrlichsten Reben schlingen sich um die kräftigen Feigenbäume; die berühmten Zuckermelonen von Smyrna wachsen zwischen dem kornreichen türkischen Weizen; alles hat den Anstrich der Fülle, doch sieht man, daß Mutter Natur die Hauptkünstlerin in dieser herrlichen Kultur ist. Häufig begegneten wir Kamelzügen und Maulthieren, mit den Früchten des Landes beladen; von allen Seiten ward das Auge gespannt, überall erblickte man Neues und Fesselndes. Als wir in eine breitere, nur mit einzelnen Bäumen bewachsene Ebene geriethen, fingen die mit langen Flinten und Säbeln bewaffneten und bizarr gekleideten Garden des Pascha an, uns zu umschwirren; immer rascher trieben sie ihre Pferde an, und hoben sie ihre Stimmen zu wildem Geschrei; der Staub wirbelte unter den fliegenden Hufen auf, und nach den verschiedenen Richtungen gegenseitig ihre Wege durchkreuzend, gaben sie uns ein Bild kriegerischer Kämpfe; es nimmt sich ganz gut aus, wenn solch ein brauner Sohn des Orients in der malerischen Tracht, auf seinem kleinen feurigen Renner, zwischen den Bäumen stäubend dahin fliegt, den Säbel schwingt, die lange Muskete zum Schusse anlegt, sich in den kühnsten Bewegungen hin und her schwingt und das wilde Schlachtgeschrei ertönen läßt. Wie bedauerte ich, daß wir auf unseren Parade-Rossen dergleichen nicht thun konnten; doch leider dürfen diese Repräsentations-Thiere nach türkischer Sitte nur im Schritte geritten werden, indem sie der Pascha blos bei großen Gelegenheiten, wie beim Einzuge in die Moschee braucht. Aus Artigkeit für den freundlichen Halil waren wir also verdammt, den ersten Theil des Weges im imposanten Einzugsschritte mit zeitweiligen nicht sehr dazu passenden Lançaden zu machen. Doch ward uns nach einiger Geduldprobe Hülfe verschafft; wir kamen in eine Papiermühle und versicherten dort auf die artigste Weise den türkischen Herrschaften, daß wir gesonnen seien, diesen herrlichen Thieren eine besondere Schonung angedeihen zu lassen. Artiger konnten wir die Sache nicht wenden. Die Türken schienen hierüber keineswegs böse zu sein, wir sprangen von unseren Pferden ab und nahmen dafür leichtfüßigere Thiere aus dem Gefolge, und nun ging es zu unserem Vergnügen bald in einem schärferen Tempo, und lachend und scherzend kam unser großer Schwarm im lebhaftesten Gewühle nach Burnabá. Dieser Ort, der Sommeraufenthalt der Franken, die elegante villeggiatura, in welcher sich die verschiedenartigsten Stämme Europa's dem Sommervergnügen hingeben, liegt am Gebirge und sieht durch seine vielen und reichbepflanzten Gärten gar lieblich und heiter aus. Die Ortschaft ist groß; nur Schade, daß, wenn man in das Innere eindringt, man von der Pflanzenfülle und dem Häuser-Comfort gar wenig steht, indem alles mit hohen Mauern nach orientalischem Schnitte abgeschlossen ist. Im türkischen Theile befindet sich ein Bazar, welcher jedoch schmutzig und von kleiner Ausdehnung ist, so daß das Innere der Straßen gar wenig Interessantes darbietet. Uns war es jedoch vergönnt einen tiefern Blick in die Pracht und den Comfort der Bewohner dieser südlichen Länder zu thun. Ein charakteristischer Unterschied zwischen dem orientalischen und dem europäischen Volke ist es, daß die Bewohner Europa's mit ihren Schätzen prunken, ihre Gärten den Schaulustigen öffnen, gar häufig mit dem, was sie durch ihr Geld erkauft haben, prahlen und alles Mögliche thun, um Leute zu finden, welche das von ihnen Geschaffene bewundern. Der Orientale dagegen häuft seine Schätze mit stiller Eifersucht zwischen den vier schützenden Mauern auf, schafft sich daselbst ein Paradies, und genießt es im Stillen mit den Eingeweihten des Hauses; höchstens erlaubt er der Fama, daß sie von den geheimnißvollen unsichtbaren Wundern seines Hauses spricht. Dadurch wird im Oriente das Niegesehene immer von Neuem bewundert, wenn in Europa der Blick der Menge längst davon gesättigt ist. Durch die Güte des General-Consuls erhielten wir in den Garten eines sehr reichen Banquiers, Namens B., eines gebornen Triestiners, Einlaß. Der Besitzer empfing uns auf das Zuvorkommendste und führte uns in einen, in seinem Garten gelegenen reizenden Salon, welcher uns das lebhafteste Bild des luxuriösen Geschmacks des Orients gab. Der mit Marmor belegte Boden war in zwei Abtheilungen getrennt, so daß der eine Theil erhöht war. Hier lief längs der Wand ein Divan, zu dessen Füßen reiche Teppiche gebreitet waren. An den mit einer großen Anzahl Fenstern durchbrochenen Wänden hingen Armleuchter mit in Goldrahmen gefaßten Hohlspiegeln; in dem unteren Theile des Salons befand sich ein fein gearbeitetes marmornes Doppelbecken, in welches eilf Springquellstrahlen mit lieblichem Geplätscher niederrieselten. Das abfließende Wasser derselben bildete außerhalb des Gebäudes einen mit Bäumen beschatteten Teich, dessen von Stein ummauerte, über den Boden erhobene, von Goldfischen belebte Wasserfläche sich unmittelbar an der Fensterflur befindet. Durch diese Wasserfülle ist es, daß diesen reizenden Salon eine immerwährende wohlthuende Kühle durchweht. Der Garten ist mit Orangenbäumchen und andern üppigen Gewächsen des Südens bepflanzt. Nachdem wir ihn durchschritten hatten, wurden uns in dem angenehmen Gartenhause die herrlichsten Erfrischungen gereicht. Sie bestanden aus Gefrornem und dem berühmten in Smyrna eingemachten Obste; es ist Sitte, dieses in allen Häusern bei der Ankunft fremder Gäste zu reichen. Hierauf besuchten wir das Haus eines Armeniers, von dessen Dachzimmer aus man die herrlichste Aussicht auf das Thal, die Stadt und den prächtigen Golf hat. Glücklich die Menschen, die dies Zauberbild von den Fenstern ihres Hauses aus sehen können.
Auch der Garten des Armeniers ist üppig und giebt reichen Schatten; doch das Schönste, was wir an reizender Natur sahen, war bei Herrn W., einem reichen Engländer, der ebenfalls Kaufmann und Banquier ist. Als wir in den Garten traten, fanden wir auf einem vor dem Hause gelegenen mit Cypressen und anderen herrlichen Pflanzen reich umgebenen Platze eine elegante Gesellschaft versammelt. Es war ein Bild des Wohllebens, wie diese Herren und Damen in der herrlichen Abendluft sich dem Dolce far niente ergaben, wie an ihrer Seite die Blumen den herrlichsten Duft verbreiteten, ein Papagei sein lebhaftes Gefieder mit Stolz schüttelte, die Bäume still und ruhig zum blauen endlosen Himmelsgewölbe ihr stolzes Haupt erhoben, wie das schöne mit einem Perron versehene Haus sich zwischen dem Grün zeigte, und alles dies mit dem südlichen Dufte und der reinsten Abenddämmerung in einem stillen frohen Einklange stand; ein solches Bild prägt sich in das Herz des Fremden ein und er denkt sich die Leute glücklich, welchen ein solcher Wohnort zu Theil wird. Mistreß W., die Schwiegertochter des Besitzers, eine schöne, wenn auch etwas zu starke Frau mit einem gar sanften, engelguten Ausdrucke und regelmäßigen Zügen, kam uns entgegen und führte uns in die Gemächer ihres Hauses. Hier herrschte europäischer Luxus, in südlich wonnigem Klima. Die feinsten reichsten Möbel waren mit Geschmack und Comfort gestellt; man sah es, daß hier englischer Geist herrsche. Nach einem ziemlich alltäglichen Gespräch begab man sich wieder in den Garten, welchen uns Mistreß W. auf die freundlichste Art Gelegenheit gab zu bewundern. Von einer Terrasse aus hatten wir abermals eine herrliche Aussicht auf das Thal und die hohen Gebirge; diese schimmerten zauberhaft im brechenden Lichte der vorgerückten Dämmerung. Als wir zurückkehrten, wurden uns auch hier Confituren angeboten und Mr. W. Sohn, ein mageres komisches Männchen mit weißer Jacke und weißem Hute, stellte sich uns vor; ein eigenthümlicher Kontrast zu seiner schwarzgekleideten, etwas starken und doch schönen Frau. Nachdem wir den Garten verlassen und noch einen andern durchschritten hatten, hielten wir uns noch einige Zeit bei Herrn B. auf, worauf wir uns auf unsere Pferde schwangen und den Rückritt antraten. Es war Nacht geworden, aber eine Nacht, wie keine Phantasie des Nordens sie malen kann, eine Nacht, wie man sie nur an dem üppigen Strande Kleinasiens mit Bewunderung genießt; klar bis in die Unendlichkeit war das Himmelsgewölbe, kein Laut ließ sich hören, Ruhe herrschte auf der weiten Erde, Ruhe auf dem weiten Meere, und als Sieger über den heißen lebensvollen Tag, stieg mächtig hinter Smyrna's edelgeformten Höhen der große, volle Mond auf. Scharf begränzten sich die Schatten, silbern schimmerte es durch das Laub, und wie mit einem Zauberschlag war das Land in eine Märchengegend umgewandelt.
Bald spornten wir unsere Pferde an, und im raschen Galopp ging es wunderlich, grauenhaft heimlich, im unentschiedenen zitternden Mondlichte der Stadt zu; wie ein Geisterreigen erschienen die Türkengräber zwischen den dunklen, wehmüthigen Cypressen; und nun ging's bis an die Stadt durch einige ihrer engen Straßen, und bald waren wir auf dem Verdecke des lieben Vulkan, wo wir nach genossenem Male uns noch des herrlichen Anblicks auf das silberglitzernde Meer, die weißen, scharf beleuchteten Minarets und Kuppeln, die großen Häusermassen und die entfernten Berge erfreuten.
Der Morgen graute, die Sonne kam und ergoß einen tiefen Frieden über die silberne Fluth und die hohen Berge Albaniens. Eifrig rauschte unser Dampfer durch die salzigen Wellen. Rasch flogen wir an den kleineren Jonischen Inseln vorbei, welche sich wie die Rücken großer Meer-Unthiere aus dem Wasser erhoben; dann erblickten wir die äußersten Spitzen der gesegneten Insel Corfu. Eine ziemliche Strecke fährt man längs ihrer Ufer, bis man das Festungswerk gewahrt, welches die Stadt krönt; dies englische Colonial-Fort ließe sich jedoch nur mit einer Dornenkrone vergleichen. Die Insel besteht meist aus bergigem Terrain, und ist mit den frischesten, schönsten Waldungen bewachsen; sie gewährt dem Auge einen wohlthuenden Anblick. Das ganze Land gleicht einem großen Park, in welchem sich einzelne freundliche Ortschaften befinden. Auch diese sehen nett und wohlgebaut aus; sie machen nicht den traurigen Eindruck mancher griechischer Dörfer, welche vereinzelt daliegen und sich in unregelmäßigen Formen aus dem uncultivirten Boden erheben. Es ist ein erfreulicher Anblick, schön erbaute Villen inmitten der südlichen, von des Gärtners Auge gepflegten Vegetation zu sehen. Dazu kontrastiren die schön geformten Felsen an der Meeresküste vortrefflich. Man muß gestehen, daß die Engländer es verstehen, allem, was ihnen unterworfen ist, Cultur und Schönheit aufzuzwingen; denn auch das felsige Malta soll mit dem frischesten Grün übersponnen sein. Je näher man der Stadt kommt, desto mehr nehmen die Landhäuser zu. In einiger Entfernung von der Stadt war ein englisches Schiff geankert, welches auf einen im Meere schwimmenden schwarzen Punkt Scheiben schoß. Dieses kleine Seemanöver amüsirte mich außerordentlich; es war komisch zu sehen, wie die Kugeln zehn bis zwanzig mal hinter der Scheibe im Meere wieder aufhüpften, so daß es wie Springbrunnen schäumte. Nicht sehr oft trafen die seekundigen Britten ihr freilich sehr kleines Ziel. Da wir die Schußlinie passiren mußten, hegten einige die Besorgniß, wir könnten getroffen werden; doch hielt das Schießen, während wir durchfuhren, einige Zeit ein. Die, die Stadt deckenden Felsen schwanden nun immer mehr und das schöne Absteigquartier der Britten entwickelte sich vor unseren Blicken. Schroff zeichnete sich das hohe, spitze Fort auf dem blauen Himmel ab, terrassenförmig breiteten sich um dasselbe die herrlichsten Gärten und schönst-gebauten Häuser. Am Fuße dieser, die Stadt dominirenden Veste reihen sich steinerne Bastionen aneinander, welche den Fluthen entwachsen; auf einer derselben, welche die äußerste Ecke bildet, befindet sich der prachtvolle Garten des Gouverneurs, mit außerordentlich vollen und großen Bäumen. Am Ende desselben gegen die Stadt zu, steht ein großer, aus mehreren Trakten bestehender, grauer, steinerner Palast, dessen Räume hohe grüne Jalousien vor der Hitze schützen. Dieses weitläufige ernste Gebäude ist der Sitz des Zwingherrn, welchen die freie brittische Macht über die armen Insulaner als Protector gesetzt hat. – Man glaubte in der Stadt, daß wir landen würden. Wir steuerten aber in eine Art breiten Canals, welcher durch eine kahle, felsige Insel unmittelbar vor der Stadt gebildet wird. Diese selbst hat ein elegantes, reinliches Aussehen. Große, schön gebaute Häuser deuten auf Wohlhabenheit und geben einen Beleg zu Englands praktischem Luxus und kaufmännischem Comfort. – Den Ort umschließen die lieblichsten dunkel grünen Hügel, aus denen die freundlichen Cottages der Britten einladend entgegen schimmern. Auf der, der Stadt gegenüber liegenden Insel befindet sich ebenfalls ein Befestigungswerk, in welches kein Fremder eingelassen wird. Man erzählte uns, daß alle Morgen hundert englische Soldaten aus der Stadt in Kähnen auf diese Insel gebracht werden und Abends wieder zurück kehren. Sie sollen der Regierung einen Schwur abgelegt haben und Niemand weiß, was sie auf diesem mysteriösen Punkte zu thun haben – man munkelt jedoch, daß sie durch einen Tunnel die beiden Inseln unter dem Meere verbinden wollen. Unmittelbar vor der Stadt hielten wir einen Augenblick an, um von einem dort ankernden Lloyd-Dampfer Nachrichten einzuholen, und sogleich kam John Bull, mit weiß angezogenen Matrosen dahergeschwommen; es war der Hafen-Kapitän, der uns auf bereitwillige Weise die Pratica brachte, um bei dieser Gelegenheit ein tüchtiges Trinkgeld einzustecken. Als man ihm antwortete, daß wir auf keinen Fall landen würden, wollte er durchaus von unserem Kapitän erfahren, wer sich auf dem Schiffe befinde und als er dies nicht erfuhr, ruderte er mit einem sehr finstern Gesicht wieder ab. Während dieses Ruhepunktes konnten wir die Stadt mit aller Muße betrachten; da es die Zeit der Siesta war, sah man außerordentlich wenig Bewegung in den Straßen. Auch die Zahl der Schiffe auf der Rhede war sehr klein, da die Cholera auf den jonischen Inseln grassirte und hiedurch der Handel auf einige Zeit gehemmt war. Bald schäumten wieder unsere Räder und fort ging es im Fluge.
Gegen das Ende der Insel nahen sich ihre Ufer der albanischen Küste; in der Mitte dieses engen Gewässers befindet sich eine ganz kleine, bizarr geformte Felsen-Masse, auf welcher ein ebenfalls ganz kleiner Leuchtthurm ruht. Er führt einen sehr unappetitlichen Namen, man nennt ihn den »krätzigen«, vermuthlich nach der eigenthümlichen Felsenbildung. Ein Invalide vegetirt auf diesem kleinen Raume. Bald entschwanden die letzten Spitzen der Inseln und fröhlich steuerten wir unserem theuren Vaterlande zu.
Schon am frühesten Morgen warf ich mich in meine Kleider und war der Erste auf dem Verdecke. Eine gesunde frische Luft, von Oesterreich's geliebtem Boden, den ich zum erstenmal wieder erblickte, stärkte meine Glieder und mit stiller Wonne betrachtete ich den herrlichen Sonnenaufgang über den dunkelblauen Bergen Dalmatiens. Ein leichter, duftiger Nebel ruhte auf den stillen Wassern und gab dem kommenden Gestirn einen rosig zauberhaften Schein; doch bald fielen die hüllenden Dünste und groß und prächtig schien mir die Sonne in's dankbare Auge. Nun gab auch das neue Licht den melancholischen Gebirgen Farbe und Leben; Felsen, Wälder und einzelne kleine Ortschaften zeigten sich dem Blicke, der mit Ergötzen im Anschauen des theuren Vaterlandes ruhte. Bald langten auch die Reisegefährten an und herzlich begrüßten wir uns auf österreichischem Gewässer. Es erschien mir als eine gute Vorbedeutung, daß gerade bei der Ankunft im Vaterlande die Sonne uns so prachtvoll und hell entgegenkam. Wir nahmen unser Frühstück auf dem Verdecke in der heitersten Laune, und so kamen wir unter munteren Gesprächen zu dem Eingange der berühmten Bocche di Cattaro. Durch einen ziemlich schmalen Canal kommt man in die erste seeartige Meerenge. Der Eindruck ist still und groß, wie der eines ruhigen reizenden Binnensee's; man vergißt das große Meer hinter sich und vertieft sich mit Lust in den Anblick der neuen lieblichen Landschaft. Hier sind nicht mehr die nackten Felsen und gelben Flächen von Hellas, hier herrscht buntes, frisches Leben und mäßige glückliche Civilisation. Man sieht nicht mehr die öden menschenleeren Räume; aus den üppigen Wäldern erheben sich Häuser, deren Wohlstande man anmerkt, daß sie unter dem österreichischen Scepter stehen; und doch hat auch der uncivilisirte Zustand Griechenlands seine besondern Reize! Die belebte Landschaft unter südlichem Himmel und die kahlen rosenfarbenen Gebirge am blauen schäumenden Meere von Lepanto, welch' ein Kontrast! Gegen das Innere des Landes zu erheben sich hohe, felsige Berge in äußerst malerischen Gestalten, welche wohl ebenfalls in den höheren Regionen kahl sind, jedoch mehr das Gepräge des nördlichen Gesteines tragen. Gegen das Meer zu ist das Gebirge niedrig und hat runde, nicht sehr schöne Formen. Dasselbe ist meist von Myrten überwachsen. An den Ufern ziehen sich frische grüne Weinberge mit einigen Villen im italienischen Geschmacke hin. Zwei Punkte sind es jedoch, die das Auge am meisten fesseln: das malerisch gelegene Städtchen Castelnuovo mit seinen eckigen Forts, und das in byzantinischem Styl erbaute griechische Kloster Sabina; ein hell erleuchteter Punkt im üppigsten Grün. Unser Schiff ankerte beim Lazareth von Castelnuovo, welches sich eine halbe Stunde vom Städtchen unmittelbar unter dem Kloster am Meeresstrand befindet. Nachdem wir uns einigermaßen anständig gekleidet hatten, fuhren wir ans Land und betraten mit Jubel nach so vielen Erlebnissen zum erste Mal wieder den festen werthen Boden Austria's. Unser erstes Ziel war das Kloster, welches unsere Neugierde schon vom Schiffe aus gewaltig gereizt hatte. Wie angenehm waren wir überrascht, die deutsche Eiche (quercus germanica) neben dem üppigen Lorbeer zu finden und uns in deren wohlthuenden Schatten zu laben. Auch Wiesen sahen wir nach so langer Zeit wieder, frische grüne Wiesen, welch' Entzücken! Und auf diesen Wiesen sprossen große Orangen-Bäume, umarmt vom nordischen Epheu! Es war ein stilles, liebliches Plätzchen, das unmittelbar vor dem Klosterthor lag: die lieblichste Vermälung der Schönheit des Nordens mit der Glut des Südens. Die heißen Strahlen der Sonne wurden durch das Blätterdach der Eiche in ein wohlthuendes Licht verwandelt, hie und da blickte das tiefe Blau durch die Aeste auf einen weichen Sammetteppich. Eine stolze Cypresse ragte in die reinen Lüfte und zu ihrer Seite, an einer alten Mauer, wiegte sich ein in der Frucht stehender Orangenbaum, dessen Aeste den saftigen Reben zur Stütze dienten; spielend neigte sich die glühende Granate an ihren zarten biegsamen Aesten herab. Am Fuße des leichten Abhanges öffneten sich die herrlichsten Blicke auf die ruhige, spiegelklare See. Wir traten durch einen steinernen Bogen in einen terrassenförmigen Hof. Eine große, eine kleine Kirche und das Kloster erheben sich auf diesem Platze.
Durch Vermittelung unseres gefälligen Kapitäns ließ man uns in das Innere der Kirchen eintreten. Die zwei in dem Kloster wohnenden griechischen Mönche führten uns umher. Einer derselben, ein ältlicher Mann mit langem grauen Bart, sprach gebrochen italienisch, so daß wir uns einigermaßen mit ihm verständigen konnten. Im Inneren des Gotteshauses ist, der griechischen Sitte gemäß, eine reich vergoldete Holzwand mit typischen Bildern vor den Altar gezogen. Alle Christus- und Madonnenköpfe haben dieselben lang gedehnten, nicht sehr schönen orientalischen Züge. Außerdem findet man noch den geharnischten Georg und mehrere andere Heilige dargestellt. Einige der hier befindlichen Bilder sind nicht ohne Kunstwerth. Von der Wölbung hingen reiche silberne Lampen, Straußeneier und plumpe Verzierungen aus Baumwolle, goldenen und farbigen Bändern herab. Da ich den Mönch mit Erstaunen um deren Bedeutung fragte, erwiederte er mir, daß jeder Schiffer, beim Auslaufen eines neuen ihm gehörigen Schiffes, einen solchen geschmacklosen Zierrath an die Kirche spende. In der kleinen Kapelle, welche die zuerst erbaute auf diesem Orte ist, befinden sich sehr schöne fromme Gaben, unter welchen sich besonders ein fein geschnitztes Kreuz und mehrere mit Juwelen besetzte Bilder auszeichnen. Das Innere des Klosters, welches aus nur wenigen Zimmern besteht, ist klein und in einem kläglichen Styl gebaut. Im Refectorium hängen einige alte schlechte Oelgemälde von russischen gekrönten Häuptern.
Wir nahmen Abschied von dem lieben alten Manne, der uns durch die heiligen Räume geleitet hatte, betrachteten noch einmal die herrliche Aussicht vom Klosterhofe aus, und setzten unsern Weg durch den Eichenhain nach Castelnuovo fort. Unterwegs lockte uns eine kleine Capelle auf einer mit Aloën bewachsenen Anhöhe an. Hier hatten wir den umfassendsten Rundblick. Tief zu unseren Füßen die begrenzte See; über den mit Myrten bewachsenen Hügeln schimmert silbern am blauen Horizont das unendliche Meer durch die höheren Spitzen getheilt. Auf der einen Seite die mit Epheu umsponnenen Mauern von Castelnuovo, nicht unweit davon türkisches Gebiet, auf der andern Seite die Wasserstraße zu den übrigen Bocche, an deren Ufern die lieblichsten Villen hingestreut lagen, alles dieses von dem herrlichen blauen Himmel überwölbt und von der mächtigen Sonne durchglüht! Wendete man sich um, so war die Aussicht groß, aber düster; die bizarrsten, bis in den Himmel langenden, schauerlich grauen Felsengruppen zeichneten sich scharf auf schwarzer Gewitterluft. Nur einzelne Häuser hängen an der steinigen Wand, umgeben von dunklen Cypressen. Das Ganze war geisterhaft, und doch zog es das Auge mit dunkler Macht an. Diese Bergwände schließen, bis in die Wolken ragend, die lieblichen Ufer der Bocche von dem düstern Montenegro ab, welches theilweise schon auf den Bergspitzen beginnt. Die Aussicht war so erhaben, einerseits mit südlichen Reizen bezaubernd, andererseits durch stolze Abgeschiedenheit Wehmuth erregend, daß ich zu meinen Reisegefährten sagte, dieser Platz locke mich an, mir hier einst eine Villa in venezianischem Geschmacke zu bauen, von deren Fenstern, Balkonen und Terrassen man jedesmal eine andere Aussicht genösse. Dieser Vorschlag wurde einstimmig mit Enthusiasmus aufgenommen. Wenn man reist, findet sich so mancher Fleck auf der Erde, wo man in feuriger Bewunderung ausruft: »Hier laßt uns Hütten bauen!« und viel zu thun hätte man, wenn man überall diesen heimlichen Wünschen nachgäbe. Den Hauptreiz dieser Gegenden bildete das glückliche Zusammentreffen der verschiedensten Naturerscheinungen: großes Meer, stille, seeartige Gewässer, Vereinigung der südlichen und nördlichen Vegetation, Palme und Eiche, Mittelgebirg und riesige Felsen.
Durch Weingärten und Haine bald steigend, bald sinkend, kamen wir endlich zum Fort spaniol, welches Castelnuovo krönt. In der Nähe desselben sahen wir ein verlassenes, dachloses Haus, dessen Wände dermaßen mit Epheu bewachsen waren, daß das Haus, wie die französischen Hecken, aus Bäumen geschnitten schien. Gleich daneben saß auf dem Wege ein uraltes Weib, eine hexenartige Gestalt; sie ging uns um Almosen an; als wir sie näher betrachteten, fanden wir, daß ihr ganzes Gesicht mit kleinen Kreuzchen bemalt war. Sie versicherte uns, der Pfarrer hätte sie so gezeichnet; vermuthlich geschah dies, um die arme Frau vor dem Aberglauben des Volkes, welches in diesem Punkte in Dalmatien noch sehr zurück ist, zu schützen. Vielleicht ist dies Mütterchen der böse Geist, der in dem verfallenen, mit Epheu besponnenen Gebäude haust. Auf dem der Sonne ausgesetzten Castel war eine glühende, drückende Hitze. Doch erfreute uns der so lange entbehrte Anblick österreichischer Soldaten. Die Weißröcke nehmen sich halt überall gut aus, im tiefsten Süden wie im höchsten Norden. Wir besahen die einzelnen Theile der Befestigungen, welche unter Carl V. von spanischen Truppen gegen die Muselmänner gebaut wurden, nachdem der Kaiser das Städtchen Castelnuovo den Venezianern genommen hatte. Die vier Eckthürme sind von einer außerordentlichen Festigkeit. In dem einen derselben befindet sich eine sehr gut gebaute Cisterne; über dem Eingangsthore ist eine sehr schön ciselirte türkische Inschrift, welche von den Mohammedanern gesetzt wurde, als sie das Fort den Spaniern abgerungen hatten. Beim Eingange der Stadt befindet sich ein freier Raum, von welchem die Volkstradition erzählt, er sei für die oft vorkommenden Zweikämpfe zwischen Spaniern und Muselmännern bestimmt gewesen. Die Stadt ist ärmlich und klein, mit engen und steilen Gäßchen. Am Ende derselben, gegen das Meer, liegt abermals ein aus starken Quadern erbautes Fort, welches in türkischen Händen war; wir besuchten es ebenfalls. Auf allen diesen erhabenen Punkten genießt man der schönsten Aussicht. Die innere Stadt ist ebenfalls mit einer hohen Mauer umschlossen, durch die ein sehr steiles Eingangsthor führt. Ueber diesen abschüssigen, schlecht gepflasterten Thorweg soll einst ein Bey im gestreckten Laufe hinunter gesprengt sein, man findet es fast unglaublich; doch so unbehülflich ein Türke zu Fuße ist, so gewandt und keck ist er auf dem schuhartig beschlagenen Wüstenrosse. Man zeigt auch dem Reisenden eine roth bemalte Stelle der Stadtmauer, auf welcher die Moslemin die blutigen Köpfe der Christen dem schaudernden Volke wiesen. Wir verließen die Stadt, fast verschmachtend vor Hitze, und kehrten durch die kühlenden Haine bei sinkender Sonne an den Mauern des uns so lieb gewordenen Klosters vorbei, zum Lazareth zurück. Nun ging es sich gar lieblich im stillen, friedlichen Abend. Erde, Meer und Lüfte ruhten vom schaffenden Tagesleben aus; und so thaten auch wir. Wir kehrten auf unser Schiff zurück und stärkten unsere müden Körper durch das auf dem Verdecke aufgetragene Mittagsmahl. Nach Tisch verfingen wir uns in einen politischen Streit, welcher einen Theil der Gesellschaft noch bis gegen eilf Uhr wach erhielt. Des andern Tages in der Frühe setzte sich unser Dampfschiff wieder in Bewegung, um uns in die übrigen Theile der Bocche zu bringen. Kaum hat man die Bucht, in welchem sich Kloster und Lazareth befinden, aus dem Auge verloren, so öffnet sich ein neuer, vom Meere gebildeter See. An Schönheit wohl der geringste, aber dennoch lieblich und freundlich. Die Berge, die ihn umgeben, sind sanfter gewölbt, und sind Vegetation und Cultur üppiger; fruchtbare Olivenwälder und reiche Weingärten, in denen sich die heiteren Campagnen befinden, bedecken die sanft aufstrebenden Ufer. Dieser Theil trägt mehr das Bild einer naiven Landschaft; den Gegensatz dazu bildet die nächstkommende Bocche. Das Meer verengt sich zu einem mit hohen Felsen umgebenen Canal; die laue Luft wird kalt und fast beengend, man glaubt sich in ein Felsenlabyrinth ohne Ausweg verirrt zu haben. Plötzlich erweitert sich das schroffe Ufer und man befindet sich in einem stillen melancholischen Gewässer, welches einem abgelegenen Gebirgssee vergleichbar ist. Die kahlen, rauhen Felsen zeichnen sich wiederspiegelnd in den tiefen blauen Fluthen ab. Dem Eingang gegenüber hängt ein niedlicher Ort an der steinigen Wand. Auf diesem freundlichen Punkte ruht das Auge mit Wohlgefallen; er gleicht einem zierlich gebauten Neste, an ernster Kirchenwand. Auf dem blauen Spiegel ruhen zwei Inseln, auf welchen sich Kirchen befinden. Der sonntägige Glockenschall begrüßte uns mit christlichem Ernste; da wir auch eine Messe hören wollten, hielten wir mit dem Dampfer, setzten uns in ein Boot und steuerten diesem Orte, Namens Perasto, zu. Derselbe ist von den Venezianern erbaut und erinnert im Kleinen an einzelne Theile der Hauptstadt des kaufmännischen Volkes. Die Sitze der Nobili, zierlich erbaute Paläste mit Balkonen und maurisch gemischten Fenstern, wechseln im lieblichen Gewirre mit einer für diesen Ort sehr großen Anzahl schön erbauter Kirchen, zwischen welchen sich einige schlanke Cypressen erheben. Als wir an das Land stiegen, fanden wir eine ziemliche Menge Volkes am Quai versammelt. Einzelne unter ihnen zeichneten sich durch ihr schönes eigenthümliches Kostüme aus. Die Trachten in Dalmatien sind, wie überall im Süden, sehr mannigfach und originell. Als wir nach einer Messe fragten, verwies man uns auf eine spätere Zeit. Wir benützten daher die Gelegenheit, einen Besuch auf einer dieser Inseln zu machen, welche durch ihre Madonnenkirche berühmt ist. Das ganze kleine Eiland gleicht einer schönen Terrasse, auf welcher die mit einer Kuppel versehene Kirche im byzantinischen Styl ruht. – Ein Fischer fand der Legende nach das Madonnenbild auf einem kleinen unter der Terrasse befindlichen Felsen; nachdem durch dieses Bild einige Wunder geschehen waren, beschloß man, auf dem Gestein eine Kirche zu erbauen; da aber der Raum zu klein war, warfen die frommen Bürger von Perasto so lange Steine in das Meer, bis sich aus dem Grunde hervor die kleine Insel bildete, auf der sie nun die Kirche bauen konnten, welche in ihrem Innern mit sehr hübschen marmornen Altären geschmückt ist. Doch damit die Fluthen nicht wieder verschlingen, was mühselig zusammen geschleppt wurde, muß jeder Schiffsbesitzer sein mit Steinen gefülltes Fahrzeug bei der Insel in die Fluthen ausladen. Als wir nach Perasto zurückkehrten, kündigte man uns an, daß wir die Messe für heute versäumt hätten. Wir bestiegen wieder unseren Dampfer und fuhren gen Cattaro. Aus dieser felsigen, melancholischen Bocche kommt man in eine andere, an deren einem Ufer die schroffen Felswände bis Cattaro fortlaufen, während sich an dem andern eine der reizendsten Landschaften dem Auge darbietet. Welcher dieser Bocche der Vorzug gebührt, ist schwer zu entscheiden; unstreitig ist aber die letzte die belebteste, denn Haus an Haus steht längs dem Abhange, mit zierlichen Gärten umgeben, in denen Palmen mit Cypressen und Orangenbäume mit Granaten wechseln. Einen besonderen Eindruck macht die Cypresse, welche bei den so häufigen griechischen und katholischen Kirchen überall gen Himmel zeigt. – Die Häuser, welche im frischesten Grün liegen, deuten alle auf Wohlstand; sie gehören auch meist reichen Schiffskapitänen, deren Weiber zu Hause am Spinnrocken plaudern, während die Männer in den amerikanischen Gewässern mit den Wogen kämpfen. Neben manchen Gebäuden sieht man auch Schiffe, welche auf eine glückliche Zurückkunft deuten sollen, in kleinen, gerade für die Größe des Fahrzeugs passenden Docks liegen. Ganz am Ende dieser großen, langen und schönen Bocche liegt das Städtchen Cattaro an einer Felswand angelehnt, auf welcher sich in schwindelnder Höhe das Fort befindet. Neben demselben geht eine, von der österreichischen Regierung gebaute, sehr kunstreiche Straße nach Montenegro, die bestimmt ist, den Verkehr zu erleichtern; – die Montenegriner aber lassen sie unbetreten und ziehen es vor, die steilen Felsen hinunter zu klettern. Da Cattaro eine Festung ist, sieht man beim Ankommen nur wenig von der Stadt, die auf einen sehr engen Raum gebaut ist; man wäre fast geneigt, es für das Ende der Welt zu halten, so umgeben es die drohenden Felsenmassen. Wir ließen unser Fahrzeug auf einige Stunden halten. – Auf der Rhede waren mehrere Schiffe, unter andern der Dampfer Curtatone von der Kriegsmarine. Als wir gelandet hatten durchliefen wir die Stadt, welche außer einem hübschen, halb gothischen, halb byzantinischen Domportale und einigen im venezianischen Style erbauten Häusern nichts Bedeutendes aufzuweisen hat. Gegen vier Uhr kehrten wir auf dem Wege, den wir am Morgen gekommen waren, bei der herrlichsten Abendbeleuchtung zurück. Das Licht war gemildert und die Konturen zeigten sich schärfer. Die verschiedenen Gegenstände hatten noch den südlichen Anstrich, wenn gleich nicht in der Stärke und Wärme wie Griechenland. Dem felsigen Ufer, welches wir des Morgens unberücksichtigt gelassen hatten, nahten wir uns jetzt mehr und sahen, daß es große Naturreize aufweist, und an mehreren Orten mit den freundlichsten Dörfchen geschmückt ist. Abends ankerten wir wieder in der Bucht des Lazarethes. Das Gefühl, welches sich in uns beim Anblick der Bocche geregt hatte, war Staunen, daß man bei uns in der Heimat nicht mehr von dieser herrlichen Gegend wisse. Alles strömt nach Nizza, Florenz und andern halb südlichen Gegenden, während man nicht ahnt, daß man im eigenen Vaterlande so viel Schönes hat, welches allen Reiz der Vegetation vereinigt, und sich des herrlichsten, immer sanften Klima's erfreut. Die venezianischen Paläste stehen leer, sie verlangen nur um 800 bis 1000 Gulden gekauft, und dann bewohnt zu werden, um den Besitzern die herrlichsten Räumlichkeiten und lieblichsten Aussichten darzubieten; aber nein, man rast in die Ferne, läßt sein Geld in Massen unter fremden Völkern aufgehen, und begnügt sich mit einer schlechten Wohnung, nur um in der Fremde zu sein; fühlt sich glücklich weil man sich modern findet und seufzt über das uninteressante langweilige Vaterland. Freilich ist die Civilisation in diesen südlichen Gegenden von Oesterreich nicht sehr fortgeschritten. Entschließt sich aber einmal ein reicher, an Comfort gewöhnter Mann, seine Wohnung hier aufzuschlagen, so ist der Grund gelegt, und die Gescheidten werden sich glücklich fühlen, ein solches Paradies, wo Palme und Eiche brüderlich wachsen, ihr eigen nennen zu können.
Während des frühsten Morgens, im besten Schlummer, fuhren wir in den Hafen von Gravosa ein, dem Hauptankerplatz der Stadt Ragusa. Als wir das Verdeck erstiegen, sahen wir uns von sehr lieblichen Ufern umgeben; sanfte begrünte Hügelketten schlingen sich um die tiefblaue Fluth, am Strande des Meeres erheben sich Villen im venezianischen Geschmacke, umgeben von Cypressen und andern südlichen Gewächsen. Man kann nicht sagen, daß die Gegend großartig imposant ist, aber sie ist sanft und lieblich. Den Anblick der Stadt Ragusa deckt die Höhe von Bella vista, wir mußten uns daher an dieser Gegend begnügen lassen, was übrigens für einen Freund der Natur, wie ich es bin, vollkommen lohnend war; der prachtvolle Morgen war blau, mild und wonnig. Erst gegen Mittag besuchten wir die Stadt. So sehr ich mich auf den Anblick dieses historisch interessanten Ortes freute, war ich doch recht froh, den Morgen in der würzigen frischen Luft, umgeben von der freundlichen Gegend, auf dem Verdecke zuzubringen; wie sehr ich auch auf Reisen dafür bin, jeden Augenblick zu benützen, um sich umzusehen und seine Kenntnisse zu bereichern, so ist es mir doch nicht unlieb, zuweilen einige Stunden unter angenehmen Eindrücken in Ruhe zu verleben; denn es muß dem Reisenden, der die Reise genießen will, die Möglichkeit werden, die erlebten Begebnisse an seinem Geiste vorbeiziehen zu lassen, und sie in sein Tagebuch aufzuzeichnen; nur durch solche Mittel prägen sich die gesehenen Gegenstände fürs Leben in das Gedächtniß ein, und wenn man lange wieder am heimischen Herde sitzt, so blühen dann lebhaft und frisch die Erinnerungen an das Erlebte auf. Ich machte es so, und arbeitete fleißig an meinem Tagebuch. Mein Bruder mußte leider diesen prächtigen Tag im Bette zubringen, da er sich in der Bocche di Cattaro an dem Abend, als wir Castelnuovo besahen, erkältet hatte. Dr. F. blieb den ersten Theil des Morgens bei ihm, später wanderte er mit K. über die Bella vista in die Stadt. Fürst J. und Baron K. waren schon seit dem Morgen dort, um sich die dem Lande eigenthümlichen Waffen zu kaufen und den, auf dem Schiffe in folge des ziemlich großen Verbrauches mangelnden Wein, durch sehr schlechten Dalmatiner zu ersetzen. Graf C. und ich blieben allein bei meinem Bruder. Der aufmerksame Dr. F. hatte kaum die Stadt besehen, so kehrte er wieder zurück und löste uns beim Kranken ab. Wir ruderten nun in einer kleinen Barke auch dem Lande zu, und setzten uns in eine Calesche, dem einzigen Wagen von Ragusa, um auf der vortrefflich gebauten, aber wie früher erwähnt, ziemlich unnützen Kaiserstraße die Hügelspitze Bella vista zu erreichen. Mit Recht führt der Punkt diesen wohlklingenden Namen, da dort oben das Meer dreimal dem entzückten Blick erscheint. Von dem Punkt aus stürzen rasch die Felsen in die See hinunter, welche brausend und schäumend gegen die braunen zackigen Massen tobt. Auf denselben wachsen hunderte von Aloën, welche das Gepräge des Südens erhöhen; zur Rechten sieht man den lieblichen Hafen von Gravosa, ein Bild des Frohsinns; zur Linken erscheinen die Kuppeln der Stadt, welche in einem kleinen Raume, am Fuße einer Anhöhe erbaut ist. Auf dieser stehen Villen an Villen mit den freundlichsten Gärten umgeben, deren Zierde Palmen, Lorbeeren, Granaten, Sensitiva's und andere südliche Gewächse sind. An der äußersten Spitze der Stadt ragt ein hoher Felsen aus dem Meere, auf welchem das Fort S. Pietro liegt. Der kahle Kamm der Anhöhe ist von dem Fort Napoleone (oder Fort imperial) gekrönt. Dies liebliche, durch das herrlichste Wetter hervorgehobene Bild erinnerte mich lebhaft an die Beschreibungen und Zeichnungen von Sicilien, während es von den griechischen Ansichten ganz verschieden war. Auf dieser hier ruhte der Stempel des grandiosen und doch lieblichen Italien, während die allgemeine Auffassung von Hellas schönen, melancholischen, sehnsüchtigen Ernst ausdrückt. Wir waren aus dem Wagen gestiegen und legten unsern Weg nach der Stadt zu Fuße zurück. Die Straße senkt sich ziemlich rasch, von Villen eingefaßt, zu den mächtigen venezianischen Stadtmauern hinab. Man machte uns aufmerksam, daß die Landhäuser durch eine Strecke leer und leblos aussehen; sie wurden 1805 von Russen und Montenegrinern vereint geplündert. Die Franzosen vertheidigten sich damals im Innern der Stadt. Da das Land arm und die Macht der Nobili gebrochen ist, diese aber, weil ihre Besitzungen Majorate sind, dieselben nicht verkaufen können, so sind die nackten Mauern der langsamen Zerstörung der Zeit ausgesetzt. Durch zwei schief hinter einander stehende massive Steinthore gelangten wir in eine breite, mit weißen Quadern gepflasterte Straße der innern Stadt. Wir glaubten nach Venedig versetzt zu sein. Gleich am Beginne steht das im byzantinisch-gothischen Style erbaute Kloster der Franziskaner; demselben folgt die schönste Reihe von Palästen der alten Nobili. Ragusa war im Kleinen eine Republik wie Venedig, von Adeligen beherrscht, an deren Spitze ein Doge stand, welcher jedoch alle Monate neu aus den Senatoren gewählt wurde. Während der kurzen Dauer seiner Würde durfte er die Räume des schön eingerichteten Dogenpalastes nicht verlassen; nur bei einer bestimmten Festlichkeit zeigte er einen seiner Füße außerhalb der Thüre; diese Freiheit ist für einen Präsidenten der Senatoren fast einem Gefängniß zu vergleichen; und doch riß sich jeder um die Würde. Damit aber keiner der Adeligen im Staate übermächtig werde, mußte ein Jeder seinen Besitz im Gebiete der Ragusanischen Republik an verschiedenen Theilen zerstreut haben. In der Blüthezeit französischer Herrschaft wurde dieses aristokratische Institut aufgehoben; mit den übrigen venezianischen Landen kam auch diese einst selbständige Stadt mit ihrem Gebiete an die österreichische Krone. Nun lebt nur mehr der Name der Nobili in deren Söhnen, die sich in den Prachtgebäuden ihrer Väter ärmlich erhalten. Der Glanz ist geschwunden, aber der Haß zwischen den einzelnen Parteien der Republik lebt noch in den machtlosen Enkeln fort. Wie sich alle inneren Feindseligkeiten ausgleichen, wenn es gilt, sich gegen eine dritte Macht zu vereinigen, so kokettirte im Jahre 1848 auch eine Partei in Ragusa mit dem aufrührerischen Venedig, mit dem die Stadt sonst in der größten Feindseligkeit lebte. Von der an Palästen reichen Straße ziehen sich schmale, finstere Gäßchen in die übrige Stadt, und selbst diese engen Verbindungen sind wieder durch schöne Paläste gebildet. Die breite Straße, deren gutem Pflaster man ansieht, daß es nie befahren wird, mündet auf den pittoresken Platz der Moneta. Auch hier kann sich das Auge an der schönen Architektur nicht satt sehen. Am bemerkenswerthesten ist das Münzgebäude, mit den leichten venezianischen Bogenfenstern; die Hauptwache und neben derselben ein schöner steinerner Brunnen, in dessen zierlich gearbeitete Becken leichte Springquellen das klarste und beste Wasser werfen; eine architektonisch schöne, wenn auch nicht große Kirche, dem heiligen Blasius, Schutzpatron von Ragusa, geweiht. Wir besuchten das Innere derselben, in welchem mir am meisten die Stellung der Orgel auffiel, da sie unmittelbar hinter dem Hochaltar an der Wand schwebt. Wir begaben uns dann auf die Piazza del duomo, auf welcher der Dogenpalast, das Miniaturbild des venezianischen und die Domkirche stehen; diese ist aus einem weißlichen Steine im römischen Style gebaut. Man führte uns in eine mit Goldzierrathen überfüllte Kapelle in der Nähe des mittleren Schiffes, in welcher sich eine unendliche Masse von Reliquien befinden, die durch Alter und geschmackvolle Fassung merkwürdig sind. Etwas unangenehm zu sehen war der ganze Körper eines Heiligen, dessen Hülle, mit Farbe und Wundmalen des Todes in Wachs bossirt gezeigt wird. Die Geistlichkeit schien jedoch den Leib dieses Heiligen besonders zu verehren. Mit Stolz zeigte man uns diese Sammlung und wirklich habe ich auch noch nie so viele heilige Reliquien auf einem Orte vereinigt gesehen. Unter den vielen sehenswerthen Dingen fiel mir eine goldene Kanne nebst Becken auf; in diesem befanden sich die Symbole des Meeres in dunklem Metall auf das zierlichste gearbeitet. Man sah Fische, Eidechsen, Krebse, Molche und dergleichen Gethier. Ein Geistlicher drückte mir sein Bedauern aus, daß die Maschinerie dieses Kunstwerkes verdorben sei, indem einst bei den Waschungen, in dem Augenblick als das Wasser auf das Becken traf, die Thierchen durch die Kraft des Wasserdruckes lieblich kreisten.
In der Perrückenzeit liebten die Geistlichen dergleichen bizarre Kunstschätze, und in vielen Klöstern findet man noch Gegenstände dieser Art. Von der Kirche gingen wir in den Dogenpalast. Zu ebener Erde läuft eine breite leichte Säulengallerie mit maurischen Bogen; einer der Pfeiler ist aus dem Aesculaptempel von Epidaurus – das heutige Ragusa vecchia, – sein Capitäl ist mit sinnigen haut-reliefs geziert, welche sich auf die Kunst des heilenden Halbgottes beziehen. Einst hatte der Palast einen zweiten Stock, welcher aber in dem furchtbaren Erdbeben 1760 einstürzte. Im inneren Hofraume führt eine freie, sehr schöne Arkadenstiege in den ersten Stock. Am Fuße derselben steht die hölzerne, leicht mit Blech überzogene Büste eines Bürgers der Republik, welcher derselben eine sehr große Summe vermachte. Für eine solche patriotische That ist ein jeder Staat immer außerordentlich dankbar. Die Pracht der innern Palast-Räume ist ganz verschwunden, und statt eines Dogen herrscht jetzt in denselben ein Bezirkshauptmann, bei welchem wir unsere übrigen Reisegefährten antrafen. Sie hatten keine besonderen Waffengeschäfte gemacht. Der Kreishauptmann führte uns auf eine am Gebäude befindliche Terrasse, von der man eine schöne Aussicht auf einige Paläste, das Meer und den kleinen Hafen der Stadt hat. Als wir den Herzogssitz verließen, gingen wir an dem schönen, aber ziemlich verfallenen Dominikaner-Kloster vorüber, aus der Stadt hinaus. Man wollte uns das am Meere befindliche Lazareth und den Türken-Bazar zeigen. Der letztere ist ganz das Gegentheil von dem in Smyrna; ein wüster, leerer Raum, auf welchem die Türken dreimal die Woche mit den Ragusanern Handel treiben. Zu meiner Freude sah ich einige Mohammedaner in ihrer schönen Tracht hier versammelt, die mich an mein liebes, schönes Smyrna erinnerten. In die Stadt zurückgekehrt, durchstreiften wir noch einige palastreiche Gassen und beschlossen unseren kurzen Aufenthalt in Ragusa mit einem Besuche im Franziskaner-Kloster, welches sich an der Stadtmauer befindet. In der Kirche sind einige schöne Marmor-Altäre. Das Interessanteste im Kloster ist jedoch ein Kreuzgang im reinsten Style gebaut, welcher an den Wänden des Hofraumes herum läuft, und auf dessen leichten byzantinischen Säulen eine breite Terrasse mit fein ciselirter Steinbalustrade ruht; sie dient den Mönchen zum Spaziergange. In der Mitte des Hofes erhebt sich ein mächtiger Orangenbaum. Der freundliche, äußerst wohlwollende Prior zeigte uns jeden einzelnen Theil des Klosters, worunter die neu errichtete Bibliothek von einiger Bedeutung ist. Beim Thore fanden wir wieder unsere kostbare Kalesche und kehrten mit dem Bezirkshauptmann über die Bella vista nach Gravosa zurück. Ragusa hatte mir mit seinen vielen historischen Erinnerungen einen sehr bedeutenden Eindruck gemacht. Die Lage ist so schön, das Klima mild und die Stadt überdieß an Gegenständen reich, die das kunstliebende Auge ergötzen. Der Bezirkshauptmann begleitete uns auf das Schiff, da er uns nach Tisch die berühmten Platanen von Canossa zeigen und des andern Morgens nach Curzola und Sabioncello begleiten wollte. Wir hätten uns gleich in Bewegung gesetzt, da die Maschine schon geheizt war, aber unser guter K. hatte sich so sehr in die Bibliotheken der Stadt vertieft, daß er erst spät, zwischen einem Franziskaner und Weltpriester, wie ein Sträfling am Ufer erschien und noch lange im Eifer des wissenschaftlichen Gespräches des Kahnes nicht achtete, welchen wir um ihn sandten. Als er sich endlich wieder an Bord einstellte, verließen wir Gravosa und steuerten zwischen den Inseln Callamota, Mezzo und Giupana nach Canossa, wo wir schon nach gesunkener Sonne ankamen. Der Bezirkshauptmann erzählte uns, daß man noch heut zu Tag auf der Insel Mezzo einen mantelartigen Ueberwurf Kaiser Carl's V. zeige: ein hoher Beamte dieser Gegend machte seine Aufwartung bei dem Kaiser, derselbe empfing ihn in der Eile in diesem Mantel und erlaubte dem Aufwartenden, sich eine Gnade auszubitten; da damals noch Bewunderung für die kaiserliche Person herrschte, bat sich der Beamte den weiß seidenen Mantel, der des Kaisers Schultern bedeckte, zum Geschenke aus. – Die nächstfolgende Insel St. André ist rauh und kahl; die einzigen Bewohner waren wenige Mönche in einem kleinen Kloster. Doch das Eiland ist durch eine rührende Geschichte, welche sich auf demselben zutrug, berühmt geworden. Ein junger Nobile, der sich in den Mauern des Klosters befand, wurde von einem Bauernmädchen, die das gegenüber am Festlande liegende Val di noce bewohnte, geliebt. Das Mädchen schwamm alle Abende über die weite Meerstrecke an einen Punkt, welchen ihr der junge Mönch durch ein Licht anzeigte. Die Brüder des Mädchens bekamen Kenntniß von diesem Verhältniß und eines Abends, da die Schwester den Geliebten besuchen wollte, eilten sie ihr in einem Kahne voraus. Als sie das Wasser von der Bewegung, die sie im Schwimmen machte, rauschen hörten, zündeten sie ein Licht an. Das Mädchen folgte dem leuchtenden Punkte und schwamm mit ängstlicher Hast auf denselben zu. Die wilden Brüder eilten jedoch immer weiter, die Schwester dem Lichte nach, bis sie endlich zum Tode ermattet, in die Fluthen versank. Sieht man die melancholische Gegend, das sanfte, blaue Meer, auf welchem sich die letzten Strahlen der scheidenden Sonne brechen, so macht diese traurige Geschichte einen tiefen Eindruck. –
Canossa ist der Landaufenthalt eines Ragusaner Nobile. Ueber einen felsigen, äußerst steilen Weg klimmten wir zum Eingange des Gartens hinan. Hier herrschte wieder die südliche Ueppigkeit im vollsten Maße. Mauerdichte Laubgänge von Lorbeer und Buchs durchschnitten Wälder von blaugrünen Oliven; gegen das Meer hin zogen sich lange Terrassen auf die schroffen Felsen gebaut, und von Arkaden mit lieblichen Traubengewinden gekrönt. Die frische, jugendkräftige Natur zeigte sich noch blühender im mystischen Abendlichte. Wie wir die Haine mit stiller Bewunderung durchwanderten, blieben wir plötzlich von Ueberraschung bewältigt stehen: wir befanden uns vor der größten Eiche, die ich jemals gesehen habe. Zum Himmel strebt der regelmäßige Stamm des riesigen Baumes, und erst in beträchtlicher Höhe breitet er seine mächtigen Arme aus, die herumstehenden Bäume mit seinem Dache schützend. Diese Eiche soll erst 150 Jahre zählen. Ihr grünes, reiches Laub wird also noch manche Generation erfreuen, da ja das Sprichwort sagt: »hundert Jahre wachse, hundert Jahre stehe und hundert Jahre sterbe dieser Baum,« auch trotzt er noch jetzt mit ganz jugendlicher Kraft den Stürmen der Zeit. Hätte nur auch die deutsche Eiche diese Kraft, die dem Baume von Canossa innewohnt! Wir lenkten unsere Schritte zu einem mit einem steinernen Neptun gezierten Bassin. Die Springbrunnen, welche einst die reichen Ahnen entzückten, fehlen den verarmten Enkeln, das steinerne Werk einstiger Größe zerfällt nun zur Ruine; doch eben das gab diesem Punkte ein melancholisch malerisches Aussehen. Durch die Risse des Gemäuers strebten Pflanzen aller Art und die Ketten des immer frischen Epheu's hielten die lebensmüden Steine und schlangen sich um die verwitterten Glieder des trauernden Wassergottes. Es war eine gar wilde, reizende Unordnung in der Umgebung dieses Platzes, aus der man sah, mit welcher Lust die Natur sich der Kunst entledigt. Im stillen Abende rauschten und flüsterten die Blätter der Myrten und Granaten und erzählten sich wohl gar manches von der einstigen Pracht, welche in diesem Orte waltete, als noch die Senatoren die freien Herrscher des Landes waren. An den die künstlichen Brunnen ehemals speisenden Quellen stehn die weitgerühmten Wunder der Gegend: die Platanen von Canossa. Es sind die zwei riesigsten Bäume Europa's. Mit ihren verzweigten, schattigen Aesten bilden sie ein Gewölbe, unter welchem einmal ein ganzes österreichisches Regiment lagerte. Für ihre ungeheure Größe sind sie noch jung, denn sie zählen ebenfalls nicht über 150 Jahre. Der Umfang der ältern beträgt 27, der der jüngern 30 Schuh. Jeder Hauptast hat die Dicke eines beträchtlichen Baumes. Zwei Aeste der beiden Bäume sind in einander gewachsen. Die Rinde des Hauptstammes ist frisch und glatt, und nirgendwo bemerkt man Spuren von Alter. Die Platane ist schon an und für sich ein herrlicher Baum, wie zauberhaft erscheint sie erst in einer solchen Größe!
Als wir aus dem Garten auf unser Schiff zurückkehrten, war es finstere Nacht; der reine, blaue Himmel hatte sich rasch mit schwarzen Wolken umzogen. Wir fuhren nun die Nacht über der Insel Curzola zu. Als wir Morgens erwachten, befanden wir uns vor dem Städtchen, welches den Namen der Insel Curzola führt. Das Wetter war trübe und regnerisch, was keiner Gegend vortheilhaft steht, besonders wenn sie so kahl ist, wie die Umgebung der Stadt. – Nach eingenommenem Frühstücke fuhren wir ans Land. Auch in diesem Orte ist alles nach venezianischem Muster gebaut: hübsche kleine Balkons, maurische Bogen mit graziösen Verzierungen und dergleichen Schmuck, welcher dem Bürgerhause einen unwiderstehlichen Reiz giebt. Unsere Vorfahren haben diese Kunst verstanden und mit Recht konnte der ärmste Städter das Aeußere seines Hauses malerisch, das Innere desselben wohnlich nennen, wogegen die jetzige Architektur, selbst bei den Palästen kalt, steif und unwohnlich ist. Nicht die gerade gemessene Linie und die glatte Wand befriedigt den Schönheitssinn: das Auge sucht nach zierlich geschlungenen Linien und heimlichen Ruhepunkten. Das altdeutsche Haus mit Erker und Thürmchen und der venezianische leicht geschwungene Fensterbogen, der auf den traulichen Balkon führt, sind mir lieber, als das kasernenartige, weiß angestrichene Gebäude des 19. Jahrhunderts, welches an die Kinderhäuser aus Pappe erinnert. Mit den Zinsspekulationen und überhaupt mit den Miethwohnungen hat die Poesie in diesem Fache aufgehört. Auch der Dom dieser kleinen Stadt erweckt durch seinen Bau Interesse. Als wir in denselben eintraten, spielte irgend ein patriotischer Künstler zu unserer Bewillkommnung den Radetzky-Marsch auf der Orgel, was sich in diesen heiligen Räumen und auf diesem Kircheninstrumente gar sonderbar ausnahm. Doch höre ich immer diesen Schwanengesang des verstorbenen Strauß, wo es auch sei, außerordentlich gern. Das Innere des Gotteshauses war düster, aber ehrwürdig. In einer Seitenkapelle zeigte man uns, hinter Säulen versteckt, einen schönen Titian. Wir bewunderten auch in diesem Bilde die Farbenpracht und würdevolle Composition des großen Meisters. Beim Durchschreiten der engen und ernsten Gassen bemerkten wir an der Thüre eines verfallenen Palastes einen prachtvollen Thorhammer aus korinthischem Metalle, welcher in künstlerisch ausgezeichneter Arbeit Neptun mit zwei Meer-Rossen darstellt. Die Schönheit dieses Werkes ergriff uns Kunstliebhaber so sehr, daß wir von dem Instrumente Gebrauch machten, um den allenfallsigen Bewohner der verfallenen Räume heraus zu beschwören, da es in unserer Absicht lag, dieses Kunstwerk wo möglich an uns zu bringen.
Auf den ersten wohltönenden Klang des Metalles erschien kein dienstbarer Geist, erst als wir anfingen stärker zu poltern, öffnete sich die morsche Thür und es zeigte sich eine gutmüthige Hexe mit einem blinden Manne, ob des Besuches sehr verwundert. Es mag auch schon lange Zeit verstrichen sein, seit menschliche Wesen sich um diesen alten Herrn mit seiner Dienerin erkundigt haben. Wir lobten den Meergott, was die Leute zu entzücken schien; als wir jedoch um den Preis fragten, wollte der alte Herr nichts davon wissen. Er versicherte, daß ihm schon ein Engländer so viel Silber geboten habe, als der schwere Hammer wiege. Dies erschreckte uns einigermaßen und wir empfahlen uns augenblicklich, um uns aus den Stadtmauern hinaus auf den Schiffsbauplatz zu begeben. Hier werden sehr viele und ganz vortreffliche Schiffe gebaut, welche der Stadt einen Ruf und einen Werth geben.
Das Material kommt aus der Herzegovina und aus dem Thale der Narenta. Der einzige Reichthum der Dalmatiner beruht auf dem schäumenden, ewig wechselnden Elemente, mit welchem sie ausdauernd im Kampfe stehen; sie müssen auf den Fluthen ihr Glück suchen, da der größte Theil des Landes ihnen nur glühende, unfruchtbare Steinpartien bietet. Wir kehrten nun auf unser Schiff zurück und näherten uns der Halbinsel Sabioncello. Das Meer war wieder bewegter geworden, daher der größere Theil der Gesellschaft nicht den tanzenden Kahn besteigen wollte. Nur Graf C., Professor G. und ich sprangen in das schaukelnde Fahrzeug und hüpften beim stärksten Regen über Berg und Thal dem Lande zu. Den Ort Sabioncello hatte man uns wegen der merkwürdigen Kostüme der Frauen gerühmt; es ist eigentlich nur eine Reihe einzelner am Meere liegender Häuser, welche von üppigen Gärten, in denen Palmen grünen, umgeben sind. Sie gehören reichen Schiffsbesitzern, die den größten Theil ihrer Jugend auf Weltreisen zubringen und erst dann mit Schätzen beladen einen gemächlichen häuslichen Herd gründen. Wir traten in das Haus des Podesta, welcher ebenfalls einst ein reisender Kapitän war und dessen zwei Brüder sich noch in diesem Augenblicke in Amerika befinden. Der Zweck unseres Besuches war, eine der Trachten zu sehen, welche die Frauen dieser Halbinsel schon seit Jahrhunderten unverändert tragen. Man wies uns Stühle in einem recht reinlichen und anständigen Salon an, welcher mich an die Romane von Marryat erinnerte. An der Wand hingen Kupferstiche in einfachen Rahmen, Seekarten und Perspective erhöhten den Schmuck des seemännischen Zimmers, die Möbel waren von leichtem Holz und Rohr und mögen wohl ehemals in der Cajüte eines Schiffes gebraucht worden sein. Der Boden war, wie auf einem Verdecke, auf das reinste gescheuert. Eine Glasthür führte auf einen Balkon, welcher die Aussicht auf das Meer gab und von wo gewiß manchmal die Gattin dem kommenden Kauffahrer entgegen gesehen haben mag; und noch jetzt ist es das Interesse und Vergnügen des alten Kapitäns, mit seinem guten Fernrohr den Lauf der kommenden und gehenden Schiffe zu verfolgen. Wir warteten nicht lange, bis die auffallend hübsche Tochter des Podesta in der eigenthümlichen Tracht erschien. Auf dem Kopfe hatte sie einen hohen Strohhut nach Männerart, an dessen schmalem Rande sich ein sehr breites, farben- und faltenreiches Band aufstülpte und so denselben fast ganz deckte. An der einen Seite des Hutes befanden sich fünf bis sechs verschiedenfarbige große Straußfedern. Vom Rande des Hutes hingen an beiden Seiten, in der Nähe der Ohren, kirschrothe leicht geschlungene Bändchen herab. Zwei rabenschwarze Locken bildeten einen schönen Gegensatz zur blendend weißen Haut des feinen Gesichtes. Im reichen Zopfe steckten goldene Nadeln nach Art der Römerinnen. Um den weißen Nacken schlangen sich verschiedenartige Ketten von demselben Metalle; den Obertheil des Körpers bedeckte ein brauner Spenser und ein kleines Tuch aus den schreiendsten Farben zusammengesetzt. Das Mieder war ebenfalls vielfarbig und mit goldenen Ketten und Münzen geschmückt. Der Rock bestand aus einem rothen, blauen und gelben breiten, horizontalen Streifen. Die kleinen Füßchen steckten in zierlichen Lederschuhen mit großen Bändermaschen geziert. Das Ganze war ein Gemenge von bunten und schreienden Farben; wäre der bizarre Hut nicht gewesen, so könnte man die Tracht schön nennen. Bei Witwen ist alles Farbige schwarz, doch die Form der Kleidung bleibt dieselbe. Graf C. wollte als galanter Ritter das schöne bescheidene Mädchen ansprechen, leider verstand sie aber keine unserer Sprachen.
Unter einem reichen Erguß des Himmels kehrten wir befriedigt in unseren schwimmenden Palast zurück und neckten die zurückgebliebenen Wasserscheuen mit dem schönen Anblicke, der uns im Hause des Podesta zu Theil geworden war.
Um acht Uhr war die Stunde zur Abfahrt vom Hafen von Zara bestimmt. Es war der Tag des Namensfestes unseres vielgeliebten Monarchen. Schon gestern waren wir zu einem großen Diner beim Stellvertreter des Gouverneurs eingeladen; derselbe brachte während des Speisens einen Toast auf den Kaiser aus, welcher mit Jubel unter dem Schall der Musik und dem Donner der Kanonen aufgenommen wurde. Heute kam noch in aller Frühe der liebenswürdige Gastgeber, mit den übrigen Generalen der Stadt, auf einer Barke zum Vulkan, um von uns Abschied zu nehmen. Wir dankten ihm herzlich für die rührende Freundlichkeit, welche er während der zwei Tage unserer Anwesenheit für uns gehabt hatte; denn er hatte alles aufgeboten, um uns auf irgend eine Art zu unterhalten und uns das Andenken an diesen kleinen Ort angenehm zu machen. Einen Tag war Soirée und Theater, den zweiten führte er uns selbst in dem Städtchen herum, um uns die einzelnen Merkwürdigkeiten desselben zu zeigen. Nach dem großen Diner, welches er uns gab, machte er mit uns eine Promenade in die nicht uninteressanten Umgebungen von Zara. Am gestrigen Abend ließ er die Musik im beleuchteten Volksgarten spielen. Er hatte das Talent, diese kleinen Feste wie aus der Erde zu zaubern; dadurch wurde uns der Aufenthalt in Zara wirklich recht angenehm. Die Sehenswürdigkeiten des Städtchens sind nicht groß, obwohl es, wie alle Orte, welche unter der venezianischen Botmäßigkeit standen, einige interessante Kirchen und Festungswerke hat. Das Merkwürdigste der Neuzeit ist eine bombenfeste Kaserne, welche sich durch ihren zweckmäßigen und schönen Bau auszeichnet. Auch sehr schöne Cisternen befinden sich unter dem Titel cinque pazzi innerhalb der Festungsmauern.
Alle Flüssigkeiten aus der Stadt vereinigen sich hier, werden mittelst Sand filtrirt, und kommen in genießbarem Zustand heraus. Der Gedanke ist, wenn auch nicht appetitlich, doch äußerst sinnreich. Durch die porta della terra ferma, welche im außerordentlich schönen venezianischen Style aus schweren goldgelben Steinen aufgebaut ist, gelangt man, wie der Name derselben ausdrückt, in das Land, welches in der Nähe der Stadt sehr flach und monoton ist. Das Meer jedoch, welches jede Gegend mit einem eignen Zauber hebt, die zahlreichen Inseln und die großen Bergketten, welche Dalmatien von der österreichischen Militärgrenze trennen, geben der Landschaft besonders gegen Abend einen schönen melancholischen Ausdruck. Die häuser- und baumleeren Flächen erhalten durch die sinkende Sonne eine Lilafarbe, welche ihnen einen schwermüthigen Anstrich giebt, der zur Seele, wenigstens zu meiner, spricht und sie mit einem süßen Weh erfüllt. Die Vegetation ist arm und der Mangel an Wäldern erinnert an die drückende, ausraubende Herrschaft der See-Republik. Das Aufkommen neuer Baumkultur vermindert leider die große Anzahl von Ziegen, welche außer den Eseln die Hauptviehzucht des Landes ausmachen. Durch den Mangel an Vegetation sengt die Sonne überall und die Quellen sind versiegt.
In diesem Punkte, wie in vielen andern sind Dalmatien und Griechenland vergleichbar. Beide sind in dieser Hinsicht zu bedauern und die Abhülfe ließe sich nur mit Gewaltmaßregeln durchführen, deren Nutzen das Volk erst nach langen Jahren fühlen würde; aber der Egoismus ist in der Welt zu weit vorgedrungen. Alles denkt nur an den Augenblick. Und für die Regierung, wenn sie nicht vom Volke unterstützt wird, sind solche Maßregeln eine schwere Sache. Es gehörte hierzu der zähe, eigensinnige Wille einer Frau, wie Englands Elisabeth, die in ihrem Eilande alle häßlichen und fehlerhaften Pferde umbringen ließ, um die Race zu heben; es ward durchgesetzt, aber freilich freuten sich erst die Enkel dessen.
Als es acht Uhr schlug und die Räder unseres Schiffes zu rauschen anfingen, brachten uns die freundlichen Generale noch vom Ufer aus ein dreimaliges Hoch, und unter dem Donner der Kanonen und den Tönen der Volkshymne, welche dem Lande den Namenstag des Kaisers verkündeten, verließen wir mit aufgehißten Wimpeln die Stadt Zara. Es war ein imposanter Augenblick, und stolz hob sich unser österreichisches Selbstbewußtsein. Groß ist der Gedanke, daß so ein Tag von den kalten Endspitzen Galiziens, bis in den tiefsten Süden Dalmatiens gefeiert wird! Der Morgen war leider etwas trüb, das Meer jedoch zur großen Freude der Aengstlichen außerordentlich ruhig. Den Vormittag brachten wir theils auf dem Verdecke, theils in den Cajüten zu, wozu uns ein unangenehmer Regen zwang, der das Verdeck überschwemmte. Man schrieb Journale, rief politische Dispute hervor, welche gewöhnlich vom Graf C. ausgingen, und brachte so recht angenehm und heiter einige Stunden zu. Als wir noch auf dem Verdecke dem schlechten Wetter trotzen wollten, ward uns ein Schauspiel zu Theil, welches allgemeines Bedauern erregte. Wir segelten gar weit vom Lande, als plötzlich ein armes Rothkehlchen ängstlich um unsere Köpfe schwirrte; es suchte überall einen Ruhepunkt für seine matten Glieder, doch kaum hatte es sich auf ein Tau gesetzt, um sich etwas Ruhe zu gönnen, so wich es wieder scheu vor den ihm neuen Gegenständen zurück. Zu einer Rückkehr auf das Land war keine Möglichkeit mehr. Es hatte sich zu weit über die trügerischen Fluthen gewagt. Mehrmals verloren wir es aus dem Auge, doch bald erschien es wieder von Mattigkeit überwältiget; endlich entschwand es unseren Blicken und fand vermuthlich in den Wellen den Tod. Es erinnerte so lebhaft an den Eingang zu Lenau's Faust. Der große Dichter schildert dieses Bild mit so viel inniger Wärme und tiefer Melancholie. Gern hätten wir das arme Thierchen gerettet, doch ihm beizukommen war keine Möglichkeit. Gegen die Essenszeit heiterte sich das Wetter zu unserer großen Freude auf und wir konnten den schönen Tag nach Möglichkeit feiern. Wir ließen die Tafel auf dem frisch geputzten Verdecke bereiten, und setzten uns in voller Parade zum Male. Der Kapitän befahl, die großen Kanonen zu laden um im Augenblicke des Toastes die Laute des Geschützes über die Fluthen des österreichischen Meeres donnern zu lassen. Aus der Kellerprovision wurde der letzte gute Wein gereicht, mit dem man während der Reise nicht sehr gespart hatte. An diesem Tage mußte alles glänzend sein; auch war er ja einer der letzten unserer schönen Reise, die wir nur der Huld des Monarchen zu danken hatten. Alle Officiere des Schiffes hatten wir zur Tafel gezogen. Um fünf Uhr versammelte man sich. Die schweren Wolken, welche den Morgen getrübt hatten, zerstreuten sich an Oesterreichs schönem Horizonte; alles war in der heitersten fröhlichsten Laune. Selbst mein Bruder, welcher vom hitzigen Fieberanfalle, Gott sei Dank, wieder hergestellt war und der arme Kapitän, der sich seit einigen Tagen leidend fühlte, erschienen. Heute wollte ja Niemand fehlen. In der Mitte des Males erhoben wir uns, die Matrosen stiegen auf die Raen. Ich brachte den Toast auf das Wohl des Kaisers mit innigem, vollem Herzen aus und von allen Seiten des Schiffes, von oben und unten, tönte der freudige Jubelschall, unterstützt vom Donner der Kanonen, und in demselben Augenblick schwanden die Nebel und das Tagsgestirn stand glühend und prächtig auf dem reinen Spiegel der sanften Fluthen. Himmel und Meer erglänzten in goldener Pracht, und so vereinigte sich Wasser und Luft und die scheidende Sonne, deren letzte Strahlen auf unseren hoch erhobenen Champagner-Gläsern wieder glitzerten, zur Feier des Tages. Nun folgte Toast auf Toast und eine stille Wehmuth ergriff uns bei dem Gedanken, daß wir zum letztenmal an froher Tafelrunde auf dem theueren Vulkan säßen. Auf jeden neuen Jubelruf scholl die Antwort der Matrosen, welche auf dem Takelwerk geblieben waren, gleich einem Echo, bis auch sie an die Reihe kamen und mit Wein beschenkt wurden. Der Genuß des feurigen Rebensaftes verfehlte seine erheiternde Wirkung nicht, vom Ersten bis zum Letzten waren alle guter Dinge, wie es sich an einem solchen Tag geziemt. Obwohl wir aus südlichen Ländern kommend, die Kühle empfindlicher spürten, blieben wir doch noch bis zum späten Abend auf dem Verdecke. Als es schon völlig dunkel war, erscholl noch das »Gott erhalte« von den muntern und dankbaren Matrosen in italienischer Sprache gesungen. Nachdem sie noch einige Liedchen ausführten, begaben wir uns alle zur Ruhe der letzten Nacht, welche unsere Reisegesellschaft hier zubrachte. Wie froh war ich, daß wir wenigstens den Abend noch so heiter und zufrieden verlebt hatten.
Druck von Bär & Hermann in Leipzig.
Das Originalbuch ist in Frakturschrift gedruckt. In dieser Transkription wird gesperrt gesetzte Schrift "gesperrt" wiedergegeben, und Textanteile in Antiqua-Schrift sind "in Grotesk-Schrift hervorgehoben".
Der Text des Originalbuches wurde grundsätzlich beibehalten, einschließlich uneinheitlicher Schreibweisen wie beispielsweise "Balcon"/"Balkon", "Caravane"/"Karavane", "Caserne"/"Kaserne", "Costüme"/"Kostüme", "Feste"(Burg)/"Veste", "Gebärden"/"Geberden", "Mahl"/"Mal", "Meisel"/"Meißel", "Piräus"/"Pyräus",
mit folgenden Ausnahmen,
Seite 70/71:
"Retterbottes" geändert in "Retterbootes"
(erwartete man den taktmäßigen Ruderschlag eines Retterbootes)
Seite 77:
"keinesweg" geändert in "keineswegs"
(der Anblick war keineswegs so freundlich feenhaft)
Seite 98:
"frückstücken" geändert in "frühstücken"
(das königliche Ehepaar zu frühstücken pflegt)
Seite 111:
"enem" geändert in "einem"
(bald befand er sich in einem Säulenwalde)
Seite 115:
"von" geändert in "vom"
(während in unmittelbarer Nähe der vom Rumpfe abgebrochene Kopf)
Seite 121:
"Ueberbleisel" geändert in "Ueberbleibsel"
(lasen von der zerbrochenen Flasche Ueberbleibsel als Andenken auf)
Seite 134:
"." eingefügt
(ein romantisches Ziel für Spaziergänger. Die Aussicht auf Athen)
Seite 136:
"eben falls" geändert in "ebenfalls"
(worauf wir ebenfalls diesen furchtbaren Punkt)
Seite 145:
"bber" geändert in "aber"
(Der Römer ist groß, aber erdrückend schwer)
Seite 152:
"Beiweis" geändert in "Beweis"
(in dieser Einrichtung zeigt sich ein Beweis richtiger Berechnung)
Seite 155:
"Mosche" geändert in "Moschee"
(Als wir die Moschee verließen, um das Minaret zu besteigen)
Seite 185/186:
"inexbressibles" geändert in "inexpressibles"
(Die inexpressibles von weißem Tuche mit Goldstreifen)
Seite 194:
"uaturgemäße" geändert in "naturgemäße"
(Dandys werden über dieses naturgemäße Verfahren erschrecken)
Seite 256:
"," hinter "das" entfernt
(erscholl noch das »Gott erhalte«)
End of the Project Gutenberg EBook of Mein erster Ausflug, by
Ferdinand Maximilian von Österreich
*** END OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK MEIN ERSTER AUSFLUG ***
***** This file should be named 47412-h.htm or 47412-h.zip *****
This and all associated files of various formats will be found in:
http://www.gutenberg.org/4/7/4/1/47412/
Produced by The Online Distributed Proofreading Team at
http://www.pgdp.net (This book was produced from scanned
images of public domain material from the Google Print
project.)
Updated editions will replace the previous one--the old editions
will be renamed.
Creating the works from public domain print editions means that no
one owns a United States copyright in these works, so the Foundation
(and you!) can copy and distribute it in the United States without
permission and without paying copyright royalties. Special rules,
set forth in the General Terms of Use part of this license, apply to
copying and distributing Project Gutenberg-tm electronic works to
protect the PROJECT GUTENBERG-tm concept and trademark. Project
Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you
charge for the eBooks, unless you receive specific permission. If you
do not charge anything for copies of this eBook, complying with the
rules is very easy. You may use this eBook for nearly any purpose
such as creation of derivative works, reports, performances and
research. They may be modified and printed and given away--you may do
practically ANYTHING with public domain eBooks. Redistribution is
subject to the trademark license, especially commercial
redistribution.
*** START: FULL LICENSE ***
THE FULL PROJECT GUTENBERG LICENSE
PLEASE READ THIS BEFORE YOU DISTRIBUTE OR USE THIS WORK
To protect the Project Gutenberg-tm mission of promoting the free
distribution of electronic works, by using or distributing this work
(or any other work associated in any way with the phrase "Project
Gutenberg"), you agree to comply with all the terms of the Full Project
Gutenberg-tm License available with this file or online at
www.gutenberg.org/license.
Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg-tm
electronic works
1.A. By reading or using any part of this Project Gutenberg-tm
electronic work, you indicate that you have read, understand, agree to
and accept all the terms of this license and intellectual property
(trademark/copyright) agreement. If you do not agree to abide by all
the terms of this agreement, you must cease using and return or destroy
all copies of Project Gutenberg-tm electronic works in your possession.
If you paid a fee for obtaining a copy of or access to a Project
Gutenberg-tm electronic work and you do not agree to be bound by the
terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or
entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph 1.E.8.
1.B. "Project Gutenberg" is a registered trademark. It may only be
used on or associated in any way with an electronic work by people who
agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few
things that you can do with most Project Gutenberg-tm electronic works
even without complying with the full terms of this agreement. See
paragraph 1.C below. There are a lot of things you can do with Project
Gutenberg-tm electronic works if you follow the terms of this agreement
and help preserve free future access to Project Gutenberg-tm electronic
works. See paragraph 1.E below.
1.C. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation ("the Foundation"
or PGLAF), owns a compilation copyright in the collection of Project
Gutenberg-tm electronic works. Nearly all the individual works in the
collection are in the public domain in the United States. If an
individual work is in the public domain in the United States and you are
located in the United States, we do not claim a right to prevent you from
copying, distributing, performing, displaying or creating derivative
works based on the work as long as all references to Project Gutenberg
are removed. Of course, we hope that you will support the Project
Gutenberg-tm mission of promoting free access to electronic works by
freely sharing Project Gutenberg-tm works in compliance with the terms of
this agreement for keeping the Project Gutenberg-tm name associated with
the work. You can easily comply with the terms of this agreement by
keeping this work in the same format with its attached full Project
Gutenberg-tm License when you share it without charge with others.
1.D. The copyright laws of the place where you are located also govern
what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in
a constant state of change. If you are outside the United States, check
the laws of your country in addition to the terms of this agreement
before downloading, copying, displaying, performing, distributing or
creating derivative works based on this work or any other Project
Gutenberg-tm work. The Foundation makes no representations concerning
the copyright status of any work in any country outside the United
States.
1.E. Unless you have removed all references to Project Gutenberg:
1.E.1. The following sentence, with active links to, or other immediate
access to, the full Project Gutenberg-tm License must appear prominently
whenever any copy of a Project Gutenberg-tm work (any work on which the
phrase "Project Gutenberg" appears, or with which the phrase "Project
Gutenberg" is associated) is accessed, displayed, performed, viewed,
copied or distributed:
This eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with
almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or
re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included
with this eBook or online at www.gutenberg.org
1.E.2. If an individual Project Gutenberg-tm electronic work is derived
from the public domain (does not contain a notice indicating that it is
posted with permission of the copyright holder), the work can be copied
and distributed to anyone in the United States without paying any fees
or charges. If you are redistributing or providing access to a work
with the phrase "Project Gutenberg" associated with or appearing on the
work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.E.1
through 1.E.7 or obtain permission for the use of the work and the
Project Gutenberg-tm trademark as set forth in paragraphs 1.E.8 or
1.E.9.
1.E.3. If an individual Project Gutenberg-tm electronic work is posted
with the permission of the copyright holder, your use and distribution
must comply with both paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 and any additional
terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked
to the Project Gutenberg-tm License for all works posted with the
permission of the copyright holder found at the beginning of this work.
1.E.4. Do not unlink or detach or remove the full Project Gutenberg-tm
License terms from this work, or any files containing a part of this
work or any other work associated with Project Gutenberg-tm.
1.E.5. Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this
electronic work, or any part of this electronic work, without
prominently displaying the sentence set forth in paragraph 1.E.1 with
active links or immediate access to the full terms of the Project
Gutenberg-tm License.
1.E.6. You may convert to and distribute this work in any binary,
compressed, marked up, nonproprietary or proprietary form, including any
word processing or hypertext form. However, if you provide access to or
distribute copies of a Project Gutenberg-tm work in a format other than
"Plain Vanilla ASCII" or other format used in the official version
posted on the official Project Gutenberg-tm web site (www.gutenberg.org),
you must, at no additional cost, fee or expense to the user, provide a
copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon
request, of the work in its original "Plain Vanilla ASCII" or other
form. Any alternate format must include the full Project Gutenberg-tm
License as specified in paragraph 1.E.1.
1.E.7. Do not charge a fee for access to, viewing, displaying,
performing, copying or distributing any Project Gutenberg-tm works
unless you comply with paragraph 1.E.8 or 1.E.9.
1.E.8. You may charge a reasonable fee for copies of or providing
access to or distributing Project Gutenberg-tm electronic works provided
that
- You pay a royalty fee of 20% of the gross profits you derive from
the use of Project Gutenberg-tm works calculated using the method
you already use to calculate your applicable taxes. The fee is
owed to the owner of the Project Gutenberg-tm trademark, but he
has agreed to donate royalties under this paragraph to the
Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payments
must be paid within 60 days following each date on which you
prepare (or are legally required to prepare) your periodic tax
returns. Royalty payments should be clearly marked as such and
sent to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation at the
address specified in Section 4, "Information about donations to
the Project Gutenberg Literary Archive Foundation."
- You provide a full refund of any money paid by a user who notifies
you in writing (or by e-mail) within 30 days of receipt that s/he
does not agree to the terms of the full Project Gutenberg-tm
License. You must require such a user to return or
destroy all copies of the works possessed in a physical medium
and discontinue all use of and all access to other copies of
Project Gutenberg-tm works.
- You provide, in accordance with paragraph 1.F.3, a full refund of any
money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the
electronic work is discovered and reported to you within 90 days
of receipt of the work.
- You comply with all other terms of this agreement for free
distribution of Project Gutenberg-tm works.
1.E.9. If you wish to charge a fee or distribute a Project Gutenberg-tm
electronic work or group of works on different terms than are set
forth in this agreement, you must obtain permission in writing from
both the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and Michael
Hart, the owner of the Project Gutenberg-tm trademark. Contact the
Foundation as set forth in Section 3 below.
1.F.
1.F.1. Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable
effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread
public domain works in creating the Project Gutenberg-tm
collection. Despite these efforts, Project Gutenberg-tm electronic
works, and the medium on which they may be stored, may contain
"Defects," such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or
corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual
property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a
computer virus, or computer codes that damage or cannot be read by
your equipment.
1.F.2. LIMITED WARRANTY, DISCLAIMER OF DAMAGES - Except for the "Right
of Replacement or Refund" described in paragraph 1.F.3, the Project
Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project
Gutenberg-tm trademark, and any other party distributing a Project
Gutenberg-tm electronic work under this agreement, disclaim all
liability to you for damages, costs and expenses, including legal
fees. YOU AGREE THAT YOU HAVE NO REMEDIES FOR NEGLIGENCE, STRICT
LIABILITY, BREACH OF WARRANTY OR BREACH OF CONTRACT EXCEPT THOSE
PROVIDED IN PARAGRAPH 1.F.3. YOU AGREE THAT THE FOUNDATION, THE
TRADEMARK OWNER, AND ANY DISTRIBUTOR UNDER THIS AGREEMENT WILL NOT BE
LIABLE TO YOU FOR ACTUAL, DIRECT, INDIRECT, CONSEQUENTIAL, PUNITIVE OR
INCIDENTAL DAMAGES EVEN IF YOU GIVE NOTICE OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
1.F.3. LIMITED RIGHT OF REPLACEMENT OR REFUND - If you discover a
defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can
receive a refund of the money (if any) you paid for it by sending a
written explanation to the person you received the work from. If you
received the work on a physical medium, you must return the medium with
your written explanation. The person or entity that provided you with
the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a
refund. If you received the work electronically, the person or entity
providing it to you may choose to give you a second opportunity to
receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy
is also defective, you may demand a refund in writing without further
opportunities to fix the problem.
1.F.4. Except for the limited right of replacement or refund set forth
in paragraph 1.F.3, this work is provided to you 'AS-IS', WITH NO OTHER
WARRANTIES OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR ANY PURPOSE.
1.F.5. Some states do not allow disclaimers of certain implied
warranties or the exclusion or limitation of certain types of damages.
If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the
law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be
interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by
the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any
provision of this agreement shall not void the remaining provisions.
1.F.6. INDEMNITY - You agree to indemnify and hold the Foundation, the
trademark owner, any agent or employee of the Foundation, anyone
providing copies of Project Gutenberg-tm electronic works in accordance
with this agreement, and any volunteers associated with the production,
promotion and distribution of Project Gutenberg-tm electronic works,
harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees,
that arise directly or indirectly from any of the following which you do
or cause to occur: (a) distribution of this or any Project Gutenberg-tm
work, (b) alteration, modification, or additions or deletions to any
Project Gutenberg-tm work, and (c) any Defect you cause.
Section 2. Information about the Mission of Project Gutenberg-tm
Project Gutenberg-tm is synonymous with the free distribution of
electronic works in formats readable by the widest variety of computers
including obsolete, old, middle-aged and new computers. It exists
because of the efforts of hundreds of volunteers and donations from
people in all walks of life.
Volunteers and financial support to provide volunteers with the
assistance they need are critical to reaching Project Gutenberg-tm's
goals and ensuring that the Project Gutenberg-tm collection will
remain freely available for generations to come. In 2001, the Project
Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure
and permanent future for Project Gutenberg-tm and future generations.
To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation
and how your efforts and donations can help, see Sections 3 and 4
and the Foundation information page at www.gutenberg.org
Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive
Foundation
The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non profit
501(c)(3) educational corporation organized under the laws of the
state of Mississippi and granted tax exempt status by the Internal
Revenue Service. The Foundation's EIN or federal tax identification
number is 64-6221541. Contributions to the Project Gutenberg
Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent
permitted by U.S. federal laws and your state's laws.
The Foundation's principal office is located at 4557 Melan Dr. S.
Fairbanks, AK, 99712., but its volunteers and employees are scattered
throughout numerous locations. Its business office is located at 809
North 1500 West, Salt Lake City, UT 84116, (801) 596-1887. Email
contact links and up to date contact information can be found at the
Foundation's web site and official page at www.gutenberg.org/contact
For additional contact information:
Dr. Gregory B. Newby
Chief Executive and Director
gbnewby@pglaf.org
Section 4. Information about Donations to the Project Gutenberg
Literary Archive Foundation
Project Gutenberg-tm depends upon and cannot survive without wide
spread public support and donations to carry out its mission of
increasing the number of public domain and licensed works that can be
freely distributed in machine readable form accessible by the widest
array of equipment including outdated equipment. Many small donations
($1 to $5,000) are particularly important to maintaining tax exempt
status with the IRS.
The Foundation is committed to complying with the laws regulating
charities and charitable donations in all 50 states of the United
States. Compliance requirements are not uniform and it takes a
considerable effort, much paperwork and many fees to meet and keep up
with these requirements. We do not solicit donations in locations
where we have not received written confirmation of compliance. To
SEND DONATIONS or determine the status of compliance for any
particular state visit www.gutenberg.org/donate
While we cannot and do not solicit contributions from states where we
have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition
against accepting unsolicited donations from donors in such states who
approach us with offers to donate.
International donations are gratefully accepted, but we cannot make
any statements concerning tax treatment of donations received from
outside the United States. U.S. laws alone swamp our small staff.
Please check the Project Gutenberg Web pages for current donation
methods and addresses. Donations are accepted in a number of other
ways including checks, online payments and credit card donations.
To donate, please visit: www.gutenberg.org/donate
Section 5. General Information About Project Gutenberg-tm electronic
works.
Professor Michael S. Hart was the originator of the Project Gutenberg-tm
concept of a library of electronic works that could be freely shared
with anyone. For forty years, he produced and distributed Project
Gutenberg-tm eBooks with only a loose network of volunteer support.
Project Gutenberg-tm eBooks are often created from several printed
editions, all of which are confirmed as Public Domain in the U.S.
unless a copyright notice is included. Thus, we do not necessarily
keep eBooks in compliance with any particular paper edition.
Most people start at our Web site which has the main PG search facility:
www.gutenberg.org
This Web site includes information about Project Gutenberg-tm,
including how to make donations to the Project Gutenberg Literary
Archive Foundation, how to help produce our new eBooks, and how to
subscribe to our email newsletter to hear about new eBooks.