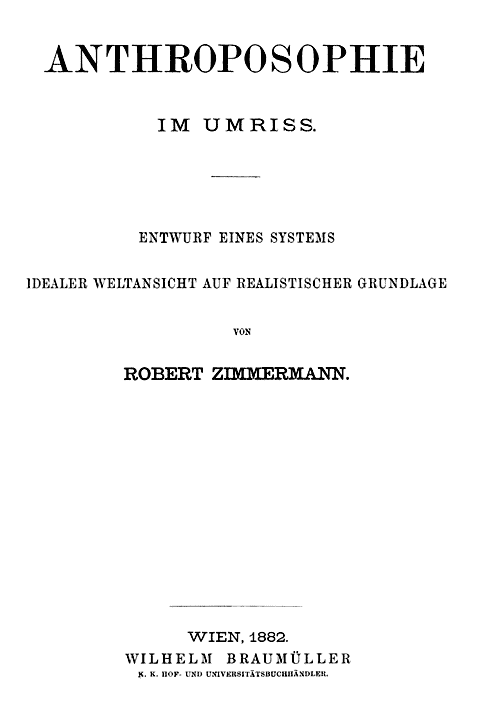231. Was überhaupt Wirkliches, dass irgendwie
Wirkliches, und was oder welcher Art das Wirkliche sei, ist weder so
ausgemacht, noch so leicht auszumachen, als diejenigen, welche es
lieben, die Wissenschaft vom Wirklichen als allein wirkliche
Wissenschaft den „hohlen Träumen der Speculation”
entgegenzusetzen, zu glauben sich anstellen oder Andere gern
überreden möchten. Sofern und so lange es gewiss ist, dass
der Weg zum Wirklichen für das wirkliche Vorstellen nur durch das
wirklich Scheinende d. i. durch den Schein des Wirklichen führt,
der Schein der Wirklichkeit für das Bewusstsein früher
gegeben ist und demselben näher steht als die, wenn überhaupt
vorhandene, hinter demselben stehende Wirklichkeit selbst: so lange
bleibt es unbestreitbar, dass die Wissenschaft vom Wirklichen
zunächst und vor allem mit dem anscheinend Wirklichen sich aus
einander zu setzen hat, wenn sie nicht in Gefahr gerathen soll, blos
scheinbar Wirkliches für das Wirkliche selbst, oder, was in den
Ohren der Freunde der Wirklichkeit noch befremdender klingen
müsste, den Schein für das einzige Wirkliche zu halten.
232. Ersteres ist die Ansicht des (gemeinen empirischen)
Realismus, letzteres jene des (gleichfalls empirischen, obgleich nicht
eben gemeinen) Idealismus. Jener geht davon aus, dass das wirklich
Scheinende das Wirkliche, dieser davon, dass der Schein eines
Wirklichen das einzige Wirkliche sei. Vom Gesichtspunkt des Realismus
aus sind die Dinge nicht nur, wenn, sondern sie sind auch das,
was sie zu sein scheinen; von dem Gesichtspunkt des Idealismus aus sind die
Dinge, die scheinen, die einzigen, welche
sind. [142]Jener schliesst jede
Möglichkeit eines Zwiespaltes zwischen Schein und Wirklichkeit aus
dem Grunde aus, weil das scheinbar Wirkliche mit dem Wirklichen
identisch, dieser dagegen aus dem Grund, weil ausser dem Schein kein
Wirkliches vorhanden ist.
233. Ersterem steht die Thatsache im Wege, dass es
wirklich Scheinendes gibt, dem doch keine
Wirklichkeit entspricht, letzterem der Umstand, dass, wenn dem Schein
kein Wirkliches gegenübersteht, es auch keinen Schein geben kann.
Der Mond, der am Horizont emporsteigt, scheint wirklich grösser
als derselbe Mond, wenn er im Zenith steht, ohne dass daraus folgte,
dass er wirklich grösser sei. Der wirklich vorhandene Schein ist
in diesem Fall eine nothwendige Täuschung, welche dadurch, dass
sie nothwendig ist, nicht aufhört, Täuschung zu sein. Die
scheinbare Bewegung des gestirnten Himmels um die Erde, welche der
wirklichen Bewegung der Erde um ihre Axe gerade entgegengesetzt ist,
ist der Schein einer Wirklichkeit, aber nicht diese selbst. Wie in den
angeführten Fällen vertreten in allen sogenannten
Sinnestäuschungen, denen entweder ein Anderes als das scheinbare
Wirkliche (Illusionen), oder überhaupt kein Wirkliches entspricht
(Hallucinationen), anscheinende die Stelle der
wirklichen Dinge, während in den sogenannten Sinnesqualitäten
(Färbung, Klang, Geruch, Geschmack, Härte, Weichheit u. dgl.)
anscheinende Eigenschaften, die ihren Grund nur in der Beschaffenheit
des wahrnehmenden Sinnesorgans, die Stelle wirklicher Eigenschaften
vertreten, die ihren Grund in der Zusammensetzung, inneren und
äusseren Structur, oder in der Beschaffenheit der Oberfläche
der Körper selbst haben. So ist die Farbe, die dem gemeinen
Realismus als eine wirkliche Eigenschaft der Körper gilt, in
Wahrheit nur eine scheinbare Eigenschaft derselben, weil sie denselben
nur insofern und nur unter der Voraussetzung zukommt, inwiefern und
dass ein sehendes Auge vorhanden sei, welches den Eindruck des von der
Oberfläche des Körpers reflectirten Lichts auf der
empfindlichen Netzhaut empfängt und in Empfindung der Farbe
verwandelt. So ist der Klang, der nach derselben Anschauungsweise zu
den realen Eigenschaften des tönenden Körpers gehört,
nichts weiter, als die in Folge innerer oder äusserer
Erschütterung der kleinsten Theile desselben hervorgebrachte
periodische Wellenbewegung der atmosphärischen Luft, welche dem
Hörnerven sich mittheilt und im Centralorgan des empfindlichen
Nervensystems in die Sprache des Bewusstseins, in dem Reiz heterogene
aber correspondirende [143]Empfindung, aus Gehörreiz in
Gehörsempfindung sich umsetzt. Ohne Augen, lässt sich sagen,
wäre das All der Dinge dunkel, ohne Gehörsorgan stumm.
Sämmtliche sogenannte wirkliche Eigenschaften, welche der
Körperwelt Sinnlichkeit, sichtbare Gestalt für das Auge,
hörbaren Reiz für das Ohr und entsprechende Wahrnehmbarkeit
für die übrigen Sinnesorgane verleihen, werden denselben viel
mehr von dem aufnehmenden mit Sinnesorganen ausgerüsteten
Träger des Bewusstseins aufgeprägt, als diesem von jenem
übermittelt, und verdienen daher mit weit grösserem Recht
anscheinende d. h. den Dingen nur scheinbar anhaftende, in Wirklichkeit
denselben nur angedichtete Eigenschaften zu heissen.
234. Folgt aus obiger Betrachtung, dass nicht alles
wirklich Scheinende wirklich, so folgt daraus
doch nicht, dass der Schein des Wirklichen das
einzige Wirkliche sei. Jene Erwägung begründet den
Unterschied eines scheinbar Wirklichen, dem Wirkliches, und eines
ebensolchen, dem kein Wirkliches entspricht; letztere Behauptung
möchte denselben verwischen und alles wirklich Scheinende in
blossen Schein eines Wirklichen, somit das Wirkliche selbst in ein
Unwirkliches verwandeln. Dieselbe geht von der Ansicht aus, dass, was
nicht im Bewusstsein gegenwärtig, auch nicht für dasselbe
vorhanden sei; dass aber, weil das im Bewusstsein vorhandene nichts
anderes sein kann als Bewusstseinsvorgang, auch das für dasselbe
Vorhandene ausschliesslich Bewusstseinsvorgänge sein können.
Da nun, was im Bewusstsein (also als Vorstellung) vorhanden sein kann,
nicht das Wirkliche selbst (die von der Vorstellung der Sache
verschiedene Sache), sondern nur der Schein eines solchen (die als
wirklich gedachte Sache d. i. der Gedanke der Sache) zu sein vermag, so
könne alles für das Bewusstsein Vorhandene unmöglich das
Wirkliche selbst, sondern nur dessen Schein, somit für dasselbe
das einzige Wirkliche ausschliesslich der Schein eines Wirklichen sein.
Statt daher hinter dem Schein ein imaginäres Wirkliches zu suchen,
trachtet der Idealismus den Schein als nur scheinbar Unwirkliches, in
Wahrheit als einziges Wirkliches festzuhalten, so dass, mit dem
Realismus verglichen, das Verhältniss des Scheinbaren zum
Wirklichen sich umkehrt, das in den Augen des Realismus Unwirkliche
(der Schein, die Vorstellung, idea) für wirklich, dagegen das in
dessen Augen Wirkliche (die Sache, dasjenige, was mehr als blosse
Vorstellung ist, res) für unwirklich erklärt wird.
235. Die Widerlegung des Realismus bestand darin, dass
in dem scheinbar Wirklichen, welches derselbe seinem Grundsatz
gemäss, [144]dass zwischen dem Inhalt des wirklich
Scheinenden und jenem des Wirklichen kein Unterschied bestehe, für
wirklich erklärt, Fälle aufgezeigt wurden, in welchen das
anscheinend Wirkliche unmöglich für wirklich genommen werden
konnte. Die Widerlegung des Idealismus, wenn sie denselben Weg
einschlüge und in dem Inhalt des Scheins, den der letztere
für das einzig Wirkliche erklärt, Widersprüche
nachwiese, hätte damit nur dargethan, dass sich im Schein, also im
Unwirklichen, keineswegs aber, dass sich im Wirklichen, also in dem,
was mehr ist als Schein, Widersprüche vorfinden. Die bekannten
Antinomien, welche Kant in Bezug auf die Möglichkeit aufstellt,
dass die Welt Grenzen im Raum und einen Anfang in der Zeit, aber auch,
dass sie keine Grenzen im Raume und keinen Anfang in der Zeit habe,
stammen daher, weil die eine wie die andere beider einander
ausschliessender Behauptungen einem Gegenstande gilt, welcher als
solcher nicht der realen, sondern der Scheinwelt angehört, von
einem solchen aber sich gleichzeitig einander Ausschliessendes
behaupten lässt, ohne dadurch mit der Natur des Scheines, der ja
als solcher ein Unwirkliches ist, also das Widersprechende
erträgt, in Widerstreit zu gerathen.
236. Die Widerlegung des Idealismus, wenn überhaupt
möglich, muss auf anderem Wege gesucht werden. Kann dieselbe nicht
aus dem Umstande geschöpft werden, dass der Inhalt des Scheines in
seinen Bestandtheilen sich unter sich selbst, so kann sie vielleicht
ihren Ausgangspunkt nehmen von der Betrachtung, dass der Begriff eines
Scheines, der neben sich selbst kein Wirkliches zulässt, sich
selbst widerspricht. Da nun ein Scheinen undenkbar ist ohne ein Etwas,
welches scheint (objectiver Schein) oder ein Etwas, welchem es scheint
(subjectiver Schein) vorauszusetzen, so muss entweder dasjenige,
welches scheint (das Object) und dasjenige, welchem scheint (das
Subject) abermals Schein und als solcher eines weiteren, sei es
Objects, sei es Subjects des Scheinens bedürftig sein, welcher
Regressus sich sofort in infinitum wiederholt, oder es muss, sei es das
Object, sei es das Subject, näher oder entfernter etwas anderes
als Schein d. i. ein Wirkliches sein, womit die Behauptung des
Idealismus, dass Schein das einzige Wirkliche
sei, sich von selbst aufhebt.
237. Allerdings nur unter der Annahme, dass das nach den
Gesetzen des Denkens Undenkbare unmöglich d. h. dass das nach den
Gesetzen des Denkens nicht als wirklich Denkbare auch nicht wirklich
sei. Folgt aus der Natur des Denkens zwar, dass der [145]Denkende einen gewissen Denkinhalt mit
Nothwendigkeit denken müsse, so folgt daraus keineswegs, dass der
Seinsinhalt mit diesem nothwendigen Inhalt des Denkens eins sein
müsse. So lange es kein Mittel gibt, den Inhalt des Seins mit dem
Inhalt des Denkens zu vergleichen, um denjenigen Denkinhalt, der mit
dem Seinsinhalt als congruent sich herausstellt, als Wissen zu fixiren
(und dass es kein solches gibt, hat die Betrachtung der logischen Ideen
zur Evidenz gebracht), so lange bleibt die Möglichkeit offen, dass
die Dinge in der Wirklichkeit sich anders verhalten, als die Gesetze
des Denkens letzteres nöthigen, das Verhalten derselben mit
Nothwendigkeit zu denken d. h. dass der unvermeidliche und durch die
Gesetze des Denkens demselben aufgenöthigte Denkinhalt des Denkens
und der um seiner Unzugänglichkeit willen stets unbekannt
bleibende Inhalt des Seins unter einander nicht übereinstimmen, ja
vielleicht, was weder wahrscheinlich, noch unwahrscheinlich, sondern
eben nur möglich ist, sich unter einander sogar widersprechen.
238. Erst ein späterer Anlass wird Gelegenheit
bieten, von der aus obiger Betrachtung fliessenden Einschränkung
Gebrauch zu machen. Aus der Widerlegung des Realismus folgt, dass die
Wissenschaft des Wirklichen, wenn sie nur Wirkliches besitzen will, aus
dem wirklich Scheinenden alles dasjenige ausscheiden muss, was nur den
Schein der Wirklichkeit hat. Aus der Widerlegung des Idealismus folgt,
dass der „Traum der Speculation”, wenn er aufhören
soll, „Traum” zu sein, zu dem Schein, der ihm zufolge das
einzige Wirkliche ist, ein Wirkliches, sei es im subjectiven Sinne, als
Träger des Scheins, sei es im objectiven Sinne, als Ursache des
Scheins, hinzufügen muss. Erstere Operation, durch welche im
wirklich Scheinenden der Schein des Wirklichen
vom Wirklichen gesondert wird, ist eine kritische, letztere, durch
welche zu dem ursprünglich allein vorhandenen Schein des
Wirklichen ein Wirkliches hinzugethan wird, ist eine ergänzende.
Jene führt in das wirklich Scheinende
neben der Betrachtung des Wirklichen, welches
scheint (des Objects), die Betrachtung eines anderen Wirklichen ein,
welchem es scheint (des Subjects); diese geht von der Betrachtung des
ihrer ursprünglichen Ansicht nach allein wirklichen Scheins zu
dessen Erklärung, sei es aus einem
Wirklichen (dem Subject) oder durch ein
Wirkliches (Object) fort.
239. Die Einführung des Subjects, welchem das
Wirkliche scheint, um aus dem Zusammenwirken beider, des Objects,
welches scheint, und des Subjects, dem es scheint, das wirklich
Scheinende [146]als deren Product begreiflich zu machen,
bedeutet die Einfügung eines idealistischen Elements in die
realistische Betrachtung. Die Hinzufügung eines Wirklichen, sei es
als Träger (Subject), sei es als Ursache (Object) des Scheins zu
diesem selbst, um, sei es durch jenen, sei es durch diese, dessen
Schein der Wirklichkeit begreiflich zu machen, bedeutet die
Einführung eines realistischen Elements in die idealistische
Betrachtungsweise. Durch die allmälige Ausbreitung des ersteren im
Realismus wird dieser dem Idealismus, durch die allmälige
Vertiefung des letzteren im Idealismus wird dieser dem Realismus
näher gebracht. Der gemeine oder empirische Realismus nimmt in
Folge kritischer d. i. philosophisch sichtender Behandlung
idealistischen, der gemeine oder empirische Idealismus nimmt in Folge
der ergänzenden d. i. philosophisch erklärenden Behandlung
realistischen Charakter an.
240. Schon der Vater des gemeinen Realismus, Bacon, hat
die Bemerkung gemacht, dass das wirklich Scheinende Elemente
umschliesst, welche nicht aus dem Wirklichen, sondern aus dem dasselbe
wahrnehmenden und auffassenden Subjecte stammen, und, weil sie jenem
als wirklich von diesem nur angedichtet sind, dieselben treffend als
„Idole” (Fictionen) bezeichnet. Dass unter denselben auch
solche sich vorfinden, welche, wie die von ihm sogenannten „Idola
tribus”, dem auffassenden (menschlichen) Subject vermöge
dessen Gattungscharakter angehören und daher bei sämmtlichen
Individuen derselben Gattung (also zum Beispiel bei allen Menschen) zu
deren Auffassung des ihnen wirklich Scheinenden in stets gleicher Weise
beitragen müssen, kann als ein Vorspiel zu der von Kant
nachdrücklich hervorgehobenen Betheiligung des transcendentalen
(d. i. des Gattungs-) Subjects an dem Zustandekommen der Erfahrung, als
des Productes zweier Factoren, eines subjectiven und eines objectiven,
angesehen werden. Wie diesem zufolge „die Welt der
Erscheinung” d. i. das wirklich Scheinende zwar der
„Materie” d. i. dem Stoffe nach aus dem Object, welches
scheint, der „Form” nach jedoch aus dem transcendentalen
Subjecte stammt, dem es scheint, so setzt sich nach Bacon die Welt des
wirklich Scheinenden zusammen einerseits aus demjenigen, was aus dem
Wirklichen stammt (der Erfahrung), und demjenigen, was diesem von dem
auffassenden Gattungssubject nur angedichtet wird (der Scheinerfahrung
der „Idola tribus”).
241. Allerdings mit dem Unterschied, dass der eine, der
Realist, diese subjective Hinzuthat im wirklich Scheinenden als eine
[147]Verunreinigung der Wissenschaft vom Wirklichen
angesehen hat, von welcher dieselbe so bald und so gründlich als
möglich befreit werden müsse, um die Erfahrung d. i. das
Wirkliche rein zu erhalten, während der andere, der Idealist,
gerade in dieser aus dem Gattungssubject herkommenden und daher allen
auffassenden Individuen derselben Gattung in gleicher Weise eigenen
subjectiven Hinzuthat im wirklich Scheinenden das Mittel erblickt hat,
dieses aus einer nur individuellen in eine für alle Individuen
derselben Gattung der Form nach identische Scheinwelt und dadurch aus
einer nur individuell giltigen in eine allgemeine und nothwendige
Erfahrung zu verwandeln. Bacon ging darauf aus, das subjective, also,
vom Standpunkt des Realismus aus angesehen, idealistische Element im
wirklich Scheinenden gänzlich aus demselben zu entfernen, und nur
dasjenige, was in demselben nicht sowol Schein
eines Wirklichen, als Schein des Wirklichen
ist, für Erfahrung gelten zu lassen. Aber schon dessen Nachfolger
Locke hat gezeigt, dass die sogenannten secundären Eigenschaften
der Körper, wie Farbe, Klang, welche jener als Schein des
Wirklichen gelten liess, nur als Schein eines
Wirklichen gelten dürfen d. h. nicht, wie jener glaubte, am
Wirklichen wirklich vorhanden, sondern von einem anderen Wirklichen,
dem auffassenden Subject, als scheinbare Eigenschaften den Körpern
angedichtet seien. Werden dieselben, als blosser Schein eines
Wirklichen, aus dem wirklich Scheinenden ausgeschieden, so bleiben in
diesem als Schein des Wirklichen nur mehr die sogenannten primären
Eigenschaften (wie Gestalt, Ausdehnung, Grösse) und als Kern alles
wirklich Scheinenden und κατ’
ἐξοχήν Wirkliches das
(übrigens unbekannte) Substrat des Scheins und Träger der
Eigenschaften, die sogenannte Substanz, als alleiniges Object einer
wirklichen Wissenschaft vom Wirklichen übrig. Das von Bacon
vergebens zu verdrängen gesuchte idealistische Element hat seine
Stelle im Realismus mit Gewinn zurück erobert.
242. Aber auch ein skeptisches ist damit in den
Vordergrund getreten. Wenn die sogenannten secundären
Eigenschaften nur den Schein eines Wirklichen, aber nicht eine
Erscheinung des Wirklichen darstellen, dann ist die sinnliche
Erfahrung, welche dieselben als Schein des Wirklichen zeigt, eine
trügerische, den Schein an die Stelle der Wirklichkeit setzende
Vorstellung des Wirklichen, nicht sowol eine Erkenntniss der, als eine
fortgesetzte Täuschung über die Wirklichkeit. Die
nächste Folge dieser Einsicht kann keine andere sein, als dem
Sinnenschein, welcher die Basis aller [148]sinnlichen Erfahrung
ausmacht, und damit dieser selbst, die auf so ungewisser Grundlage sich
aufbaut, mit Misstrauen entgegen zu kommen.
243. Dasselbe muss sich naturgemäss in demselben
Grade steigern, als sich der Umfang des idealistischen Elementes d. i.
der subjectiven Hinzuthat im wirklich Scheinenden erweitert. Die
Ausbreitung desselben hat zuerst Locke’s idealistischer
Fortsetzer Berkeley herbeigeführt durch die Behauptung, dass die
sogenannten primären Eigenschaften der Körper, welche
derselbe als wirkliche ansah, nicht weniger scheinbar als die
sogenannten secundären Eigenschaften, und, ebenso wie diese,
Hinzuthaten des vorstellenden Subjects im wirklich Scheinenden d. i.
durch das vorstellende Subject, keineswegs durch das Object des
Vorgestellten hervorgebrachter Schein, also zwar Schein eines
Wirklichen, aber nicht selbst Wirkliches seien. Dieselbe erreichte den
höchsten Grad dadurch, dass Berkeley die weitere Bemerkung
hinzufügte, dass der Körper nichts anderes als die Summe
seiner Eigenschaften, die Annahme einer den Kern desselben ausmachenden
Substanz als Träger der Eigenschaften eine an sich völlig
überflüssige, von dem vorstellenden Subject, wenn auch nicht
willkürlich, aber doch unwillkürlich gemachte grundlose
Voraussetzung, die sogenannte Substanz daher eben so wol wie die
sogenannten primären und secundären Eigenschaften zwar der
Schein eines Wirklichen, aber eben so wenig wie diese ein Wirkliches
sei. Letztere Behauptung verwandelte, da der Körper fortan nichts
weiter als die Summe seiner (primären und secundären)
Eigenschaften, diese aber als Summe von nicht wirklichen, sondern nur
scheinbaren Eigenschaften selbst nur eine Scheinsumme sein sollte, den
angeblich wirklichen Körper in blossen Schein eines Körpers,
die sogenannte Welt des Wirklichen in blossen Schein einer wirklichen
Welt und löste somit den gesammten Realismus in Idealismus, die
gesammte Sinneswahrnehmung als Basis der sinnlichen Erfahrung in
Sinnestrug, und damit jene selbst aus einem Spiegel der wirklichen Welt
in die leere Vorspiegelung einer solchen auf.
244. Diese äusserste mögliche Ausdehnung des
idealistischen Elementes im Gebiete des Realismus musste die Ausdehnung
der Skepsis auf den ganzen Umfang der sinnlichen Erfahrung zur
unausbleiblichen Folge haben. Hatte der Idealismus sämmtliches
wirklich Scheinende in innerlich hohlen Schein eines Wirklichen
verkehrt, so musste die Aussicht auf Erkenntniss des Wirklichen auf dem
[149]Wege der Erfahrung sich in die trostlose
Einsicht in die Unmöglichkeit einer solchen, auf Grund
völligen Mangels eines Wirklichen verwandeln. Nicht nur die
Bestandtheile des wirklich Scheinenden d. i. die Elemente, aus welchen
die scheinbare Welt bestand, waren sofort zu blossem Schein eines
Wirklichen herabgesetzt, sondern auch die Verknüpfung derselben
unter einander und zu einem Ganzen konnte nur eine scheinbare, das
durch dieselbe hergestellte Ganze nur dem Schein nach ein Ganzes sein
d. h. die gesammte angeblich wirkliche Welt mit ihren vermeintlich
wirklichen Bestandtheilen und deren vermeintlich wirklichem und
wirksamem Zusammenhang unter einander (dem Causalverband) musste sich
dem Auge des Denkers als eine Scheinwelt, deren Bestandtheile als
elementarer Schein, deren Zusammenhang unter einander als zwar
anscheinend, aber nicht wirklich vorhandener d. i. vom vorstellenden
Subject in die Welt der Phänomene hineingelegter, keineswegs (wie
die Erfahrung von ihren sogenannten Naturgesetzen behauptet) aus
derselben herausgelesener Zusammenhang darstellen.
245. Hume ist es, der diese Consequenz des Skepticismus
aus dem in bodenlosen Idealismus umgewandelten Realismus seiner
Vorgänger gezogen hat. Dieselbe wird nicht verbessert dadurch,
dass an die Stelle des realen Zusammenhanges zwischen den Erscheinungen
von ihm die subjective Gewöhnung des vorstellenden Subjectes
gesetzt wird, in Folge wiederholten nach einander Auftretens gewisser
Phänomene jedesmal, sobald das eine derselben (das antecedens)
wiederkehrt, das andere (das consequens) zu erwarten und daher ersteres
als Ursache, letzteres als Wirkung zu bezeichnen. Denn es muss
einleuchten, dass zwar, wenn der eine jener Vorgänge der reale
Grund, der andere die reale Folge ist, das Eintreten des ersten
jedesmal jenes des zweiten nach sich ziehen muss, keineswegs aber, dass
in umgekehrter Weise das (vielleicht ganz zufällige) Vorausgehen
der einen, Nachfolgen der andern Erscheinung als genügender Beweis
dafür gelten darf, dass die erste die Ursache der zweiten sei.
Während die Auseinanderfolge zweier
Phänomene deren Aufeinanderfolge
nothwendig, macht deren Aufeinanderfolge den Schluss auf die
Auseinanderfolge nur möglich; die Behauptung der letzteren (des
Causalzusammenhanges) in Folge einer durch öfter beobachtete
Succession beider Erscheinungen im Vorstellenden erzeugten Gewohnheit,
beide unter einander in Verbindung stehend zu denken, kann daher
niemals völlige (apodiktische), sondern höchstens sogenannte
moralische (problematische) [150]Gewissheit d. i. mehr oder weniger
Wahrscheinlichkeit erlangen.
246. Diese Folgerung war es, welche Kant, wie er selbst
sagt, „aus seinem dogmatischen Schlummer geweckt hat”,
nicht aus dem des Wolf’schen Rationalismus, über welchen er
längst hinaus, sondern aus dem des Locke-Newton’schen
Empirismus, in welchem er damals (1770) noch völlig befangen war.
Dass es auf dem von Hume eingeschlagenen Wege, der auch ihm als die
natürliche Fortsetzung der Bahn seiner Vorgänger galt,
schliesslich dahin kommen müsse, dass auch die allgemeinen
Naturgesetze, durch welche der Gang der Natur und die Einheit des
Weltalls zusammengehalten wird, ihre strenge und ausnahmslose
Nothwendigkeit und Allgemeinheit einbüssen und sich in blosse,
mehr oder weniger wahrscheinliche und mit mehr oder weniger Zuversicht
ausgesprochene Vermuthungen des die Natur auffassenden und in seiner
Vorstellung zusammenfassenden Subjects verkehren müssen, erschien
Kant so unausweichlich, zugleich aber für ein auf Erkenntniss des
Wirklichen, wie es ist, statt auf Einbildung einer blossen Scheinwelt
gerichtetes Denken, wie das seinige, so unerträglich, dass er um
deswillen mit dem zum Skepticismus entarteten Empirismus brach und von
dem Ergebniss einer nicht nur subjectiven, sondern auch nur
particulär giltigen und blos wahrscheinlichen Naturauffassung zu
der sofortigen Erforschung und Feststellung der Bedingungen einer zwar
gleichfalls nur subjectiven, aber schlechterdings allgemeinen und
nothwendigen Erfahrung überging.
247. Wie die bisherige Betrachtung das allmälige
Eindringen des idealistischen Elements in den Realismus und dessen
allmälige, schliesslich denselben überfluthende Ausbreitung
in diesem blossgelegt hat, so legt die Entwicklungsgeschichte des
Idealismus in umgekehrter Weise nicht nur das Eindringen, sondern das
stetige Anwachsen des realistischen Elements im Idealismus als
unvermeidlich dar. Schon dem Vater des gemeinen Idealismus, Berkeley,
ist die Schwierigkeit nicht entgangen, die für denjenigen, der die
gesammte wirklich scheinende Welt nur als im vorstellenden Subject
vorhandenen Schein einer wirklichen Welt ansieht, aus dem Umstande
erwächst, dass in den verschiedenen vorstellenden Subjecten, wenn
unter denselben Uebereinstimmung und Mittheilung möglich sein
soll, diese nur in ihrem jeweiligen Vorstellen existirende Scheinwelt
in sämmtlichen Vorstellenden die nämliche, nach Inhalt und
Form unter sich harmonirende Welt sein muss, ohne dass sich die Frage
beantworten [151]liesse, warum, da in jedem seine eigene Welt
entsteht, diese Welt in allen als die gleiche entstehen müsse.
Leibnitz hat diese Frage, die sich auch ihm aufdrängen musste,
weil jede „fensterlose” Monas in ihrem Innern eine
„Welt als Vorstellung” enthält, mit der Berufung auf
die durch Gott prästabilirte Harmonie aller Monaden und somit auch
ihrer sämmtlichen, obgleich von einander unabhängigen inneren
Vorstellungswelten beantwortet. Der Bischof von Cloyne, von dem es
zweifelhaft ist, ob er von Leibnitz etwas wusste, sucht die Lösung
des Problems, wie die vorgestellten Welten der einzelnen Vorstellenden
unter einander correspondirend gedacht werden können, gleichfalls
in Gott, welchen er als den Urheber der im Vorstellenden vorhandenen
Vorstellungswelt und dadurch zugleich als Veranstalter der
Uebereinstimmung zwischen den in den verschiedenen Vorstellenden
vorhandenen Vorstellungswelten bezeichnet. Die nur als Schein eines
Wirklichen im Bewusstsein vorhandene wirkliche d. i. der Schein einer
wirklichen Welt, ist sonach schon bei Berkeley, dem Urheber des
Idealismus, nicht das einzige Wirkliche, sondern derselbe setzt nicht
nur das vorstellende Subject (den Geist), in dem er existirt d. i. dem
er scheint, sondern überdies seinen Urheber, Gott, durch den er
existirt d. i. der in ihm scheint, als Wirkliche voraus d. h. der
Schein ist weder, wie der strenge Idealismus will, das einzige
Wirkliche, noch mit jenen beiden Wirklichen, dem vorstellenden Subject
einer- und der den Schein erzeugenden Gottheit andererseits verglichen,
überhaupt wirklich (real), sondern nur ideal (unwirklich),
während der Geist und Gott die eigentlich Wirklichen d. i. real
Existirenden sind.
248. Das realistische Element, das Wirkliche neben dem
Schein, als einzigem Wirklichen, ist sonach schon in die
ursprünglichste Gestalt des Idealismus, und zwar so von Seite des
Subjects, dem er scheint (des Geistes), wie von jener des Objects, das
ihm scheint (der Gottheit), eingedrungen. Von jener aus angesehen,
tritt das Wirkliche auf als Träger, von dieser aus angesehen, als
Ursache des im Bewusstsein schwebenden Scheins. Während aber in
dieser Gestalt des mit realistischen Elementen versetzten Idealismus
der Träger des Scheins sich leidend (receptiv), die Ursache des
Scheins allein thätig (spontan) sich verhält, sind daneben
Auffassungen denkbar, nach welchen entweder der Träger sich
gleichfalls wie die Ursache thätig, oder der Träger sich
thätig, aber zugleich als einzige Ursache sich verhält,
während eine dritte von jener ursprünglichen nur dadurch sich
unterscheidet, dass als die Ursache des Scheins [152]nicht ein geistiges d. i. ein solches Object, in
dessen Natur es liegt, Subject d. i. vorstellendes Wesen zu sein,
sondern ein seiner Qualität nach beliebiges Wirkliches betrachtet
wird, dessen Beschaffenheit unbekannt bleibt, dessen Existenz jedoch
von derjenigen des Subjects als Träger des Scheins völlig
unabhängig ist.
249. Wird der Träger des Scheins d. i. das
vorstellende Subject ebenso wie die Ursache des Scheins d. i. das
vorgestellte Object als thätig d. i. jedes derselben als wirklich
d. i. wirkend betrachtet, so stellt der im Bewusstsein schwebende
Schein eines Wirklichen, die scheinbar wirkliche Welt (die Welt als
Phänomenon), ein Product aus zwei Factoren, dem Subject des
Vorstellens und dem Object der Vorstellung, dar, dessen Beschaffenheit
sonach als solches von der Beschaffenheit seiner Factoren als solcher
nothwendig abhängen muss. In dem Einfluss des Subjects auf die
Beschaffenheit dieses Products besteht die Herrschaft des
idealistischen, in dem Einfluss des Objects auf dieselbe jene des
realistischen Elements in der phänomenalen Welt. Je nachdem jener
Einfluss zur Vorherrschaft des einen oder des andern wird, nimmt diese
Scheinwelt selbst vorwiegend idealistischen, auf die Seite blossen
Scheines der Wirklichkeit, oder realistischen, auf die Seite der
Wirklichkeit selbst hindeutenden Charakter an.
250. Der Einfluss des realistischen Objects auf das
Zustandekommen der phänomenalen Welt im Bewusstsein ist der
geringste, wenn dasselbe als Wirkliches durch seine Thätigkeit
nichts weiter bewirkt, als dass überhaupt Schein, der als Material
zum Aufbau einer phänomenalen Welt durch das vorstellende Subject
verwendet werden kann, im Bewusstsein vorhanden ist. Dieser Fall tritt
in jener Gestalt zu Tage, welche Kant dem Idealismus gegeben hat, und
die Rolle, die das Object in obiger Darstellung spielt, ist die
nämliche, die Kant seinem „Ding an sich” zugewiesen
hat. Dasselbe hat ihm zufolge keine andere Bestimmung, als die
Existenz, keineswegs aber die Qualität des im Bewusstsein
schwebenden Scheins eines Wirklichen begreiflich zu machen.
Dass ein Wirkliches ausser und neben dem
vorstellenden Subjecte sei, wird durch die Thatsache der Existenz des
Scheins eines solchen im Bewusstsein unzweifelhaft gemacht.
Was das Wirkliche, das nebst und ausser dem vorstellenden
Subjecte existirt, seiner Qualität nach sei, dagegen kann aus der
Qualität des im Bewusstsein schwebenden Scheins nicht ausgemacht
werden, weil diese letztere lediglich von der Qualität des
vorstellenden Subjects abhängig ist. Das [153]reale Object, „das Ding an sich”,
ist der Grund, dass überhaupt im Bewusstsein Sinnesempfindungen
(wie Gesichts-, Gehörs-, Geruchs-, Geschmacks- und
Tastempfindungen) vorhanden sind; die
Qualität des realen vorstellenden Subjects dagegen ist der Grund,
dass im Bewusstsein gerade Empfindungen (wie
Farben, Töne, Wohlgerüche, Wohlgeschmäcke, Härte,
Weichheit) vorhanden sind. Wäre das erste nicht, so entstünde
überhaupt kein Schein, wäre das letztere ein anderes, als es
ist, so entstünde anderer Schein. Wie die Existenz des Scheins von
jener des Objects, so hängt die Qualität des Scheins von
jener des Subjects ab; der im Bewusstsein wirkliche Schein in seiner
qualitativen Eigenthümlichkeit ist daher nur durch das gemeinsame
Zusammenwirken des Dings an sich und der specifischen Organisation des
vorstellenden Subjects d. i. (wie Kant nach der alten Terminologie
seiner Wolf’schen Schulung sich ausdrückte) „des
Erkenntnissvermögens” erklärlich.
251. Erklärlich aber auch, dass bei dieser Sachlage
der jeweiligen thatsächlichen Beschaffenheit des sogenannten
Erkenntnissvermögens an dem Zustandekommen und der Gestaltung der
phänomenalen Welt der Löwenantheil zufallen muss. Liefert der
objective Factor, das Ding an sich, nichts weiter als den Stoff, ja
nicht einmal diesen selbst, sondern nur die Veranlassung, dass ein
solcher, aus welchem die phänomenale Welt aufgebaut werden soll,
überhaupt im Bewusstsein vorhanden ist, so muss der Grund der
gesammten Form, in welcher der Stoff zum Aufbau zusammengeordnet, ja
sogar der Form, in welcher derselbe zum Baue verwendet wird,
gänzlich in dem subjectiven Factor d. i. in der Beschaffenheit des
vorstellenden Subjectes d. i. in jener seines sogenannten
Erkenntnissvermögens gesucht werden. Letzteres, als Baumeister der
phänomenalen Welt, baut sozusagen auf eigene Hand, nicht nur nach
eigenem Plan, sondern auch mit selbstgeformtem Material; das
„Ding an sich” als Bauherr ist nur die Ursache, dass
überhaupt gebaut wird und dass die erforderlichen Mittel zum Baue
vorhanden sind.
252. Der Organismus des sogenannten
Erkenntnissvermögens ist es, welchen Kant seiner „Kritik der
reinen Vernunft” zu Grunde gelegt und als dessen nothwendige
Folgen die kritischen Ergebnisse dieser letzteren entsprungen sind.
Insofern derselbe den idealistischen Factor der phänomenalen Welt
repräsentirt, hat Kant seine Philosophie als Idealismus, insofern
deren Ergebnisse auf die Betrachtung desselben als der Quelle der
Bedingungen aller Erkenntniss gestützt sind, [154]als
Transcendentalphilosophie, und jenen Idealismus selbst (im Gegensatz zu
dem gemeinen, empirischen) als transcendentalen Idealismus bezeichnet.
Die Differenz seines und des empirischen Idealismus beschränkte
sich jedoch nicht auf den genannten Unterschied, sondern wurzelte
zugleich in der Verschiedenheit des vorstellenden Subjectes, welches
den idealistischen Factor der phänomenalen Welt ausmacht, und
welches im empirischen Idealismus das individuelle Einzelsubject, in
dem seinen dagegen das allgemeine Gattungssubject, oder, nach
Kant’s Ausdruck, das sogenannte transcendentale Subject ist.
Folge davon ist, dass die Form der phänomenalen Welt, insofern
dieselbe aus der Beschaffenheit des vorstellenden Subjectes stammt, im
empirischen Idealismus nur eine individuelle, zufällige, für
die Vorstellungswelt des Einzelsubjectes bestimmende, im
transcendentalen Idealismus dagegen eine allgemeine und nothwendige,
die Vorstellungswelt aller vorstellenden Einzelsubjecte derselben
Gattung bestimmende sein muss. Durch diese Einführung der Form als
einer allgemeinen und nothwendigen an der Stelle der blos
zufälligen und singulären überwindet Kant den
Hume’schen Skepticismus, der sich an die Sohlen des empirischen
Idealismus geheftet hat, und verwandelt die phänomenale Welt d. i.
die Welt der Erfahrung aus einer nur für den Einzelnen giltigen
und nur zufällig (durch dessen individuelle Gewöhnung)
entstandenen in eine für Alle identische und nothwendig (d. i. als
unausbleibliche Folge der allen gemeinsamen Organisation des
Erkenntnissvermögens) entstehende Erfahrung.
253. Die beziehungsweisen Antheile des idealistischen
Factors d. i. des in Allen identischen transcendentalen Subjectes
einer- und des realistischen Factors d. i. des für Alle
identischen (als seiner Qualität nach unbekanntes x hinter der
phänomenalen Welt stehenden) Dings an sich an dem Zustandekommen
einer allgemein giltigen Erfahrung sind es, welche Kant als das a
priori und das a posteriori der Erfahrung bezeichnet. Zu dem letzteren
gehört nach der Auffassung Kant’s nichts weiter als der
sinnliche Stoff, zu welchem das „Ding an sich” den
äusseren Anstoss gegeben hat; zu dem ersteren gehören
sämmtliche Formen, welche demselben in aufsteigender Reihe durch
die (im Sinne der alten Wolf’schen psychologischen Theorie)
einander übergeordneten Stufen des sogenannten
Erkenntnissvermögens, des Sinnes, des Verstandes und der Vernunft
zu Theil werden sollen. Als solche betrachtete Kant bekanntlich die
zwei von ihm sogenannten „reinen Anschauungsformen”, welche
dem Sinn, die (zwölf) von ihm construirten
„Urtheilsformen”, [155]welche dem Verstande, und die
(drei) von ihm anerkannten (Schlussformen), welche der Vernunft erb und
eigen seien. Durch die Anwendung der erstgenannten, und zwar der reinen
Anschauungsform des Raumes d. i. des Nebeneinander auf den durch die
äusseren Sinne, der reinen Anschauungsform der Zeit d. i. des
Nacheinander auf den durch den sogenannten inneren Sinn gegebenen Stoff
entsteht der Schein räumlich und zeitlich
verschieden angeordneter Gruppen sinnlichen Vorstellungsmaterials,
welche durch die Anwendung der reinen Urtheilsformen und der daraus
deducirten Stammbegriffe (Kategorien) des Verstandes den Schein wirklicher Einzeldinge, und zwar solcher erhalten,
die als Substanzen Träger von Eigenschaften, und entweder als
Ursachen Urheber von anderen ihresgleichen als Wirkungen, oder selbst
als Wirkungen durch andere ihresgleichen als Ursachen hervorgebracht
sind. Durch die Anwendung endlich der reinen Schlussformen und der
daraus abgeleiteten Ideen der Vernunft entsteht der Schein solcher Wirklicher, die entweder (wie die Seele) das
einheitliche Subject zu allen möglichen Prädicaten, oder (wie
die Welt) die Totalität aller Ursachen und Wirkungen, oder (wie
die Gottheit) als ens realissimum die Summe aller möglichen
Prädicate darstellen.
254. In dem Nachweis der Nothwendigkeit der Entstehung
obiger Gattungen des wirklich Scheinenden besteht das positive, in dem
gleichzeitigen Erweis, dass obige Gattungen des wirklich Scheinenden nur eben so viele Gattungen
vom
Schein eines Wirklichen seien, das negative
Resultat des Transcendentalidealismus. Hauptsächlich um des
letzteren willen ist Kant der „alles Zermalmer” genannt
worden. Es ist aber nicht zu übersehen, dass von anderer Seite aus
angesehen Kant’s Philosophie dem negativen Ergebniss des
Idealismus, der alles sogenannte Wirkliche in Schein auflöst,
gegenüber ein sehr positives Ergebniss durch die
nachdrückliche Betonung der Unentbehrlichkeit einer realen
Unterlage der phänomenalen Welt in der Existenz des „Dings
an sich” bietet, durch welche sich, wie Schopenhauer richtig
gesehen hat, die zweite Auflage der „Kritik der reinen
Vernunft” sehr merklich von der ersten, welche fast
ausschliesslich der Hervorkehrung des idealistischen Factors gewidmet
ist, unterscheidet. Nachdem diejenigen Wirklichen, welche Kant selbst
als die eigentlichen Gegenstände der alten Metaphysik bezeichnet
hat, Seele, Welt und Gott, sich unter dem Prisma der Kritik in blosse
Scheinwirkliche aufgelöst haben, bleibt als Rest des Wirklichen
das Ding an sich allein übrig, welches man [156]mit
Recht als den Rest der alten Metaphysik in Kant’s Philosophie,
und dessen zu einem Minimum zusammengeschrumpfte Beschreibung man als
den Inhalt dessen betrachten kann, was im eigentlichen Sinne des Wortes
Kant’s Metaphysik heissen darf.
255. Dieselbe setzt sich mit Ausnahme der Behauptung der
leeren Existenz durchaus aus negativen Prädicaten zusammen. Dem
Ding an sich können weder quantitative noch qualitative
Bestimmungen beigelegt werden. Dasselbe kann in ersterer Hinsicht weder
als Eins, noch als Vieles, in letzterer Hinsicht weder als raumlos,
noch als räumlich (also auch weder als unendlich, noch als
endlich, weder als ausgedehnt, noch als unausgedehnt), noch als
zeitlos, oder zeitlich (also auch weder als in der Zeit entstanden,
noch als ewig), noch als geistig (immateriell) oder körperlich
(materiell) bezeichnet werden. Alles, was der transcendentale
Idealismus von demselben weiss und auszusagen berechtigt ist,
beschränkt sich darauf, zu behaupten, dass
es sei, aber nicht, was es sei.
256. Aber auch dies nur aus dem Grunde, weil der
sinnliche Stoff als wirklicher Schein eine im Bewusstsein vorhandene
Wirkung ist und daher als solche zur Ursache ein Wirkliches haben muss.
Die Voraussetzung, dass jede Wirkung ihre zureichende Ursache haben
müsse (das von Leibnitz sogenannte principium rationis
sufficientis) gehört zu den fundamentalen Axiomen des Denkens,
nach Kant insbesondere zu den dem Organismus des
Erkenntnissvermögens wesentlichen Urtheilsformen des Verstandes.
Aus ersterem folgt, dass sich ein Denken, für welches obiger Satz
fundamentale Geltung besitzt, von einem in dieser Hinsicht anders
geartet sein sollenden Denken d. i. einem solchen, für welches
derselbe jene Giltigkeit nicht besässe, schlechterdings keine
Vorstellung zu machen im Stande sei. Aus letzterem folgt, dass ein im
Kantschen Sinn organisirtes Erkenntnissvermögen der Folgerung,
dass jeder angeblichen Wirkung eine derselben genügende Ursache
entsprechen müsse, schlechterdings nicht zu entrathen vermag, ohne
sich selbst aufzuheben. Beides zusammen macht einleuchtend, dass die
auch vom Idealismus unbestrittene Thatsache der Existenz wirklichen
Scheins zu dem Schlusse führen muss, dass auch als Ursache
desselben irgend ein Wirkliches existire.
257. „Wie der Rauch auf die Flamme, deutet Schein
auf Sein”; in diesen Worten Herbart’s ist obiger Schluss am
prägnantesten ausgesprochen. Allerdings mit dem Seitenblick, dass
dieses angedeutete Sein nicht inner-, sondern ausserhalb desjenigen
Wirklichen, [157]welches den Träger des Scheins darstellt,
d. i. des vorstellenden Subjects zu suchen sein möchte. Hier ist
der Punkt, wo die Nachfolger Kant’s, die, wie er, auf dem Boden
des Transcendentalidealismus stehen, in die einander entgegengesetzten
Richtungen eines Idealismus, der sich auf das Subject des Scheins (den
idealistischen Factor) d. i. eines idealistischen, und eines solchen,
der sich auf das Object des Scheins (den realistischen Factor)
stützt, d. i. eines realistischen Idealismus (der im Vergleiche
mit jenem auch Realismus heissen kann) aus einander gehen. Aber auch
die Stelle, wo diejenigen, die nicht wie Kant auf dem Boden des
transcendentalen Idealismus beharren, sondern mit Umgehung des
idealistischen Factors das Wirkliche unmittelbar, weder durch einen
Schluss von der Wirkung auf die Ursache, noch überhaupt durch
einen Act eines wie immer gearteten Denkens, sondern auf einem von
diesem gänzlich verschiedenen Wege (etwa durch das Gefühl wie
Jacobi, oder durch den Willen wie Schopenhauer) ergreifen zu
können glauben, sich von jenen trennen und zu einem das Denken
transcendirenden (deshalb fälschlich transcendental genannten) Realismus gelangt sind.
258. Darin stimmen beide, der idealistische und der
realistische Idealismus, mit einander überein, dass der Schein als
wirklicher eine Ursache und zwar ein Wirkliches zur Ursache haben
müsse; aber darin gehen sie beide aus einander, dass der erstere
diese Ursache innerhalb, der andere dieselbe ausserhalb des
Bewusstseins sucht. Der „Jude Kant’s”, Salomon
Maimon, war es, der zuerst die Bemerkung machte, dass die Annahme des
Dings an sich von Seite Kant’s auf einem Fehlschluss beruhe. Wenn
der Satz, dass jede Wirkung eine Ursache haben müsse, wie die
kritische Organisation des Erkenntnissvermögens lehrt, nichts
anderes ist als eine dem vorstellenden Subject, und zwar dessen
Verstande innewohnende Urtheilsform, so folgt, dass das Subject zwar
niemals umhin kann, wo es eine Erscheinung als Wirkung betrachtet, eine
Ursache derselben vorauszusetzen, dass aber daraus, dass das Subject
durch die Natur seines Erkenntnissvermögens zu diesem Vorgang
gezwungen ist, auf keine Weise gefolgert werden darf, dass eine
derartige Ursache auch wirklich vorhanden sei. Wenn daher Kant aus der
Existenz der Empfindungen auf die nothwendige Existenz des Dings an
sich als deren Ursache schliesse, so begehe derselbe eine mit seinen
eigenen Principien im Widerspruch stehende Erschleichung, indem aus den
letzteren keineswegs die Existenz des Objects, [158]sondern höchstens für das Subject die
Nothwendigkeit sich ableiten lasse, ein solches vorauszusetzen. Als
Fichte’s Wissenschaftslehre mit der Behauptung hervortrat, dass
Kant durch die Zulassung des Dings an sich als Ursache des Stoffs der
phänomenalen Welt mit sich selbst in unhaltbaren Widerspruch
gerathe, war ihm jener mit der gleichen schon vorangegangen. Fichte
aber war es, welcher aus obigem Selbstwiderspruch zuerst die Folgerung
zog, dass die Annahme der Existenz eines Dings an sich als eines vom
Träger des im Bewusstsein wirklichen Scheins unterschiedenen
Wirklichen gänzlich fallen gelassen d. h. dass der realistische
Factor des Transcendentalidealismus, das Object, welches scheint, entfernt werden müsse.
259. Nach dem Verschwinden des realistischen bleibt von
den beiden Factoren, durch deren Zusammenwirken die phänomenale
Welt des transcendentalen Idealismus entsteht, nur der idealistische
Factor, nach der Entfernung des Objects, welches scheint, von den beiden Wirklichen, deren
gemeinsames Product die Welt des Bewusstseins ist, nur das Subject,
welchem scheint, übrig, geht der
transcendentale Idealismus in einen solchen des Subjects (subjectiver Idealismus) über. Statt zweier
Wirklicher, welche die Basis des transcendentalen Idealismus bilden,
hat der subjective Idealismus zu seinem Substrat ein einziges
Wirkliches, welches zugleich die Rolle des idealistischen und des
realistischen Factors der phänomenalen Welt übernimmt d. h.
der phänomenalen Welt nicht nur (wie der erste) die Form gibt,
sondern auch (wie der letztere) den erforderlichen Stoff (das sinnliche
Empfindungsmaterial) selbst erzeugt. Während daher im
transcendentalen Idealismus der Träger des Scheins, das wirkliche
Subject, gegen die Ursache desselben, das wirkliche Object, sich
leidend, letzteres gegen ersteres sich thätig verhält, stellt
derselbe im subjectiven Idealismus als Träger (Subject) zugleich
die Ursache (Object) des Scheins in einem identischen Wirklichen dar,
verhält sich das nämliche Wirkliche zugleich als Subject
leidend gegen sich selbst als Object und thätig als Object gegen
sich selbst als Subject d. h. als Subject-Object. Den Anstoss, welchen
im transcendentalen Idealismus das Subject vom Object empfing, um
Empfindung d. i. Material der phänomenalen Welt im Bewusstsein
hervortreten zu lassen, empfängt dasselbe nunmehr nicht von einem
von ihm unterschiedenen Andern, sondern von sich selbst. Das von ihm
unterschiedene Andere (Object), welches der transcendentale Idealismus
noch als ein wirklich Anderes (d. i. als ein anderes Wirkliches) ansah,
ist in den Augen des subjectiven [159]Idealismus nur mehr ein
scheinbar Anderes, in Wirklichkeit kein Anderes als das Subject,
welches das erste und einzige Wirkliche zugleich ist. Dasselbe,
insofern es die Rolle des wirklichen realistischen Factors, des
Objects, spielt, producirt nicht blos sämmtlichen Stoff der
phänomenalen Welt, sondern es schafft auch den Schein, als sei
dieser Stoff durch ein Anderes als es selbst d. h. es schafft den
Schein eines realen Objects, welches den Stoff der phänomenalen
Welt producirt. Letzterer, als vom Subject geschaffener Schein eines
von diesem unterschiedenen Objects und daher dieses selbst, ist sonach
in der That nichts weiter als eine Schöpfung d. i. eine durch
einen Setzungsact des Subjects entstandene und daher von diesem
abhängige Setzung desselben, eine Fiction, aber nichts Wirkliches.
Wird diese seine fictive Natur vorübergehend verkannt, der Schein
eines Objects für dessen Wirklichkeit genommen, das scheinbare
Object, als ob es ein Wirkliches wäre, dem Subject
entgegengesetzt, so muss diese Täuschung, welche, weil das Subject
das einzige Wirkliche ist, nur eine Selbsttäuschung des Subjects
sein kann, einmal ein Ende nehmen, das scheinbare Object als blosser
Schein eines Objects erkannt und das vermeintlich vom Subject
unterschiedene, als von ihm unabhängig wirklich bestehendes
gedachte Object als von ihm abhängiges und nur durch dessen eigene
Setzung entstandenes vom Subjecte zurückgenommen werden.
260. Setzung des Objects durch das Subject, Verkennung
des scheinbaren Objects, indem dasselbe für wirklich gehalten
wird, und Wiedererkennung des fälschlich für wirklich
gehaltenen Objects als eines nur scheinbar vom Subject Verschiedenen
sind die drei Momente, in welchen die innere Entwickelungsgeschichte
des einzigen Wirklichen, welches der subjective Idealismus stehen
gelassen hat, des Trägers des Scheins im Bewusstsein sich
vollzieht. Dieselbe stellt gleichsam den Fortschritt einer dramatischen
Handlung dar, in welcher das ursprünglich Geschehene durch den
Schein des Gegentheils vorübergehend verdunkelt und am Schlusse
aus der Verdunkelung wieder hergestellt wird. Wie in der letzteren das
wirklich Geschehene vor dem Beginn d. i. ausserhalb der sichtbaren
Handlung gelegen, also der Kenntniss des Zuschauers anfänglich
entzogen ist, so liegt im obigen Process innerhalb des Bewusstseins das
wirklich Geschehene, die Setzung des scheinbaren Objects durch das
Subject, vor dem Beginn d. i. ausserhalb des erwachten Bewusstseins und
bleibt auf diese Weise der Kenntniss des Subjects d. i. dessen eigenem
Bewusstsein über sich selbst verborgen. Aus ersterem folgt,
[160]dass beim Beginne des Dramas die sichtbare
Handlung das Gegentheil dessen zeigt, was wirklich geschehen ist; aus
dem letzteren folgt, dass beim Erwachen des Bewusstseins der Inhalt
desselben das Gegentheil dessen aufweist, was wirklich der Fall ist;
jene stellt das Geschehene als nicht geschehen, diese stellt das vom
Subject gesetzte Object als nicht gesetzt durch das Subject dar. Die
schliessliche Lösung erfolgt, wie in der dramatischen Handlung
durch die Aufhellung des Geschehenen, so in obigem Bewusstseinsprocess
durch die Selbstaufhellung d. i. durch das Bewusstwerden des Subjects
über sich selbst und seine eigene Setzung des Objects, d. i. durch
das Selbstbewusstsein.
261. Dieses Subject, das einzige Wirkliche und folglich
Wirkende ist es, welches der Urheber der Wissenschaftslehre das
„Ich” genannt und dessen in den drei auf einander folgenden
Stufen der Thesis, Antithesis und Synthesis sich entwickelnde Natur
derselbe als niemals rastendes Thun (d. i. unablässiges Wirken)
bezeichnet hat. Dasselbe setzt im Lauf seiner Entwickelung sein eigenes
Gegentheil, das Nicht-Ich, und nimmt es im Verfolge derselben als von
ihm selbst gesetztes d. h. als Ich in sich wieder zurück. Der
erste Theil dieses Processes, welcher sich vor dem Bewusstwerden
vollzieht, stellt die bewusstlose d. i. die Naturseite (Nachtseite) der
Entwickelung des Ich, der zweite Theil desselben, weil er sich bei
Bewusstsein vollzieht, stellt die bewusste d. i. die Geistesseite
(Tagseite) derselben und, da das Ich das einzige Wirkliche ist, jener
Abschnitt zugleich die Entwickelung des Wirklichen als eines
bewusstlosen d. i. als Natur, dieser jene des nämlichen Wirklichen
als eines bewussten d. i. als Geist dar. Die Gliederung der gesammten
Wissenschaft vom Wirklichen vom Standpunkt des subjectiven Idealismus
aus in eine solche vom Ich als Natur (Naturphilosophie) und vom Ich als
Geist (Geistesphilosophie), aber auch die Möglichkeit einer
solchen, welche beide Seiten der Entwickelung des Ich als
Entwickelungsseiten eines und des nämlichen Ich, als identisch
betrachtet (Identitätsphilosophie), so wie einer weitern, welche
die Betrachtung des Entwickelungsgesetzes des Ich als eines nicht nur
selbst innerlich nothwendigen, sondern diese Entwickelung nothwendig
fordernden, der Betrachtung des wirklichen Entwickelungsganges
desselben als Natur und Geist voranstellt (Dialektik, metaphysische
Logik) ist dadurch vorgezeichnet.
262. Je nachdem das Ich als Wirkliches (agens), oder als
blosser Infinitiv, als Wirken (agere) bestimmt, das erstere entweder
[161]als endliches oder als unendliches (absolutes)
Ich aufgefasst wird, gliedert sich der Idealismus des Subjects in die
drei Stufen des (im engeren Sinn sogenannten) subjectiven Idealismus
(Fichte), absoluten Idealismus (Schelling) und Panlogismus (Hegel).
Jener besteht darin, dass als einziges Wirkliches ein endliches Ich
(das transcendentale Subject); der zweite darin, dass als einziges
Wirkliches ein absolutes Ich (die Gottheit, das absolute Subject); der
dritte darin, dass als einziges Wirkliches das unpersönliche
Wirken und zwar, da das einzige Wirkliche des Idealismus das
vorstellende (denkende) Subject ist, das unpersönliche Denken, die
Vernunft angesehen wird. Die Entwickelungsgeschichte des ersten d. i.
der Inhalt der gesammten Wissenschaft stellt den Bewusstseinsprocess
dar, mittels dessen das endliche Ich zum Bewusstsein seiner selbst, zum
Selbstbewusstsein gelangt d. i. Geist wird. Jene des zweiten macht den
immanenten Entwickelungsprocess aus, mittels dessen das absolute
Subject durch die vorläufigen Phasen der Natur- und der
Weltgeschichte hindurch zum Bewusstsein seiner selbst d. i. zum
Bewusstsein seiner Göttlichkeit, zum absoluten Bewusstsein gelangt
d. i. absoluter Geist, Gott wird. („Am Ende der
Weltgeschichte”, sagte Schelling, „wird Gott sein”.)
Der Panlogismus endlich repräsentirt den dialektischen Process,
mittels dessen die unpersönliche (objective) Vernunft (die
logische Idee) durch ihr Gegentheil, das vernunftlose Sein (die Natur),
hindurch zur persönlichen (subjectiven) Vernunft (zum absoluten
Geiste) wird. („Aufgabe der Philosophie ist”, sagte Hegel,
„die Substanz zum Subjecte zu machen”.)
263. Alle drei Formen des Idealismus des Subjects kommen
darin überein, das Wirkliche sei, aber auch, dass nur ein Einziges
wirklich sei. Wird daher dieses als einziges Wirkliches von einem
Widerspruch betroffen, welcher entweder verhindert, dasselbe
überhaupt anzunehmen, oder doch hindert, dasselbe als wirklich
gelten zu lassen, so werden sämmtliche Formen jenes Idealismus von
demselben zugleich betroffen. Derselbe ging von dem Satze aus, dass der
Schluss des transcendentalen Idealismus von dem Schein als Wirkung auf
ein Object als Ursache desselben ein Selbstwiderspruch sei, aus dem
Grunde, weil die Folgerung von der Wirkung auf die Ursache nur eine
Urtheilsform des Verstandes, und daher die Consequenz, dass der Schein
im Bewusstsein eine Ursache haben müsse, zwar für den
Verstand unvermeidlich, aber darum nichts weniger als (objectiv) giltig
sei. Gleichwol hat diese Einsicht, wenn sie den Namen verdient, den
Idealismus nicht gehindert, von der Thatsache [162]des
im Bewusstsein schwebenden Scheins auf eine erzeugende Ursache
desselben zurückzuschliessen, nur mit dem Unterschied, dass er
dieselbe nicht ausserhalb des Bewusstseins (in
ein Object), sondern in den Träger des Bewusstseins (in das
Subject) verlegt d. h. dieses selbst zur Ursache des Scheines macht.
Wenn nun, wie der Idealismus behauptet, der Schluss von der Wirkung auf
eine Ursache als blosse Verstandesform überhaupt unberechtigt ist,
so ist der Schluss von der Wirkung auf eine innerhalb des Bewusstseins
gelegene, sogenannte innere Ursache mindestens ebenso unberechtigt, wie
jener von der Wirkung auf eine ausserhalb des Bewusstseins gelegene,
sogenannte äussere Ursache. Der subjective Idealismus hat daher
von diesem Gesichtspunkt aus ebensowenig das Recht, das Subject als
Wirkliches, wie der objective Idealismus seiner Meinung nach ein
solches besitzt, ein vom Subject unterschiedenes Object als Wirkliches
anzunehmen.
264. Wie man sieht, hat der Idealismus des Subjects, der
gewöhnlich kurzweg mit dem Namen Idealismus bezeichnet wird, in
diesem Punkt dem Idealismus des Objects, kurzweg Realismus genannt,
nichts vorzuwerfen. Derselbe hat nicht nur nicht mehr und nicht weniger
ein Recht, als erzeugende Ursache des Scheins ein Wirkliches, er hat
überdies, was bedenklicher ist, kein Recht, das von ihm
angenommene Wirkliche als wirklich anzunehmen. Letztere Annahme
fällt, wenn dasjenige, was als wirklich gedacht werden soll, mit
einer Eigenschaft behaftet ist, welche verhindert, dasselbe als
wirklich zu denken. Dieser Fall tritt aber ein, wenn dasjenige, was als
wirklich gedacht werden soll, in sich einen Widerspruch einschliesst.
So gewiss aus dem Umstand, dass ein als wirklich zu Denkendes keinen
Widerspruch einschliesst, nur geschlossen werden kann, dass es
möglich, keineswegs, dass es wirklich sei, so gewiss muss aus dem
Umstand, dass ein als wirklich zu Denkendes in sich einen Widerspruch
enthält, die Folgerung gezogen werden, dass dasselbe
unmöglich d. i. auf keine Weise je wirklich sei. Das einzige
Wirkliche des Idealismus, das Ich, nun soll in der Weise gedacht
werden, dass dasselbe zugleich sein eigenes Object und sein eigenes
Subject sei, den Stoff seiner phänomenalen Welt zugleich empfange
und erzeuge, also zugleich gegen sich selbst als Leidendes und auf sich
selbst als Thätiges sich verhalte d. h. es soll so gedacht werden,
dass es zugleich seine eigene Ursache und seine eigene Wirkung (causa
sui), also dass es im strengsten logischen Sinn des Wortes
Entgegengesetztes d. i. sich [163]unter einander Ausschliessendes
zugleich und als jedes von beiden sein eigenes Gegentheil, um es mit
einem Wort zu sagen, der lebendige Widerspruch sei. Ein solcher aber
kann nicht als wirklich gedacht werden.
265. Auch dann nicht, wenn die Erfahrung ihn zu
bestätigen scheint. Die Thatsache, welche der Idealismus
anzuführen liebt, um durch dieselbe zu erweisen, dass ein sich
zugleich als Thätiges und Leidendes Verhaltendes, eine causa sui,
wirklich, und daher, was auch die Logik dagegen einwenden möge,
möglich sei, ist das Phänomen des Selbstbewusstseins.
Dasselbe, so schliesst der Idealismus, als factisches Bewusstsein des
Selbst von sich selbst, ist thatsächlich Subject und Object,
Leidendes und Thätiges, Ursache und Wirkung zugleich: das
Ich stellt sich vor und das Ich stellt
sich vor. Als jenes ist es das Vorstellende
(Subject), als dieses das Vorgestellte (Object), als beider
Identität ist das Ich Vorstellendes und Vorgestelltes zugleich
(Subject-Object). Durch diese unbestreitbar scheinende psychologische
Thatsache, d. i. durch die Wirklichkeit eines im logischen Sinn mit
einem inneren Widerspruch Behafteten ist nach der Meinung des
Idealismus die Möglichkeit, ein in sich Widersprechendes als
wirklich zu denken, erwiesen; der Einspruch der Logik, dass
Widersprechendes nicht als wirklich gedacht werden könne,
abgewiesen.
266. Gegenüber dem Canon: a non posse valet
conclusio ad non esse, geht der Idealismus von dem entgegengesetzten
aus: ab esse valet conclusio ad posse. Die Richtigkeit seiner Folgerung
hängt von dem Umstande ab, ob und dass die angebliche Thatsache
des Selbstbewusstseins wirklich eine Thatsache, oder, was eben so viel
ist, ob und dass die Behauptung, das Ich stelle
sich vor, auf einer wirklichen Erfahrung oder
auf einer blossen Einbildung beruhe. Die Thatsache, welche den
Widerspruch zu stürzen bestimmt ist, darf
nicht selbst wieder auf einen Widerspruch sich stützen. Dieselbe muss, um gegen die Einrede der Logik
Stand zu halten, eine selbst widerspruchsfreie, evidente, nicht
nichtanzuerkennende Thatsache sein.
267. Es fehlt viel, dass die sogenannte Thatsache des
Selbstbewusstseins dieser Forderung genügte. Wenn, wie der
Idealismus einräumt, das Phänomen des Selbstbewusstseins
nichts weiteres in sich schliesst als das „Sich sich
Vorstellen” (se sibi repraesentare) des Ichs, so enthält das
Sich (se) abermals nichts anderes als das Ich d. h. das Sich sich
Vorstellen, das Sich (se) in diesem aber [164]das nämliche
„Sich sich Vorstellen” zum dritten, und das sich darin
wiederholende Sich dasselbe zum vierten Male u. s. f., d. h. es
entsteht ein regressus in infinitum. Das Ich erweist sich als eine mit
der Forderung, eine unendliche Reihe vorzustellen, behaftete, demnach
als eine im wirklichen Vorstellen schlechthin unvollendbare Vorstellung
d. h. als eine solche, die niemals Thatsache d. i. wirkliche
Vorstellung sein kann. Einer Thatsache aber, die keine sein kann,
gegenüber steht der Einwand der Logik, dass in sich
Widersprechendes niemals wirklich sein könne, aufrecht.
268. Der Widerspruch, welcher den Idealismus
ausschliesst, liegt sonach nicht darin, dass er als Ursache des im
Bewusstsein schwebenden Scheins ein Wirkliches setzt, sondern darin,
dass er als solche ein in sich Widersprechendes d. h. ein Wirkliches
setzt, das nicht als wirklich gedacht werden darf. Indem der
Idealismus des Objects, der Realismus, von dem im Bewusstsein schwebenden Schein als
Wirkung auf eine denselben erzeugende Ursache schliesst, thut er nichts
anderes, als, wie oben gezeigt, auch der Idealismus thut; indem
derselbe als solche jedoch nicht ein in sich Widersprechendes, sondern
ein solches setzt, das ohne Einsprache der Logik als wirklich gedacht
werden kann, thut er wirklich anderes und
besseres, als jener that. Derselbe begnügt sich weder, im
Gegensatz zum Idealismus des Subjects, die Annahme des Ich als des
einzigen Wirklichen abzulehnen, noch, in Uebereinstimmung mit Kant, die
Unerlässlichkeit der Annahme eines übrigens in jeder Hinsicht
unbekannten realen x, des von jeder denkbaren quantitativen und
qualitativen Bestimmtheit entblössten „Dings an sich”,
zuzugeben, sondern schreitet im Gegensatze zu beiden zu der eben so wol
realistischen als pluralistischen Behauptung fort, dass nicht nur
Wirkliches sei, sondern unbestimmt viele Wirkliche seien d. h. dass die
Voraussetzung solcher auf Grundlage und zur Erklärung des
thatsächlich im Bewusstsein schwebenden Scheins nicht nur nicht
widersprechend, sondern im Gegentheil, das Gegentheil derselben der
Forderung eines logischen Denkens widersprechend sei.
269. Weshalb die Annahme, es gebe Wirkliches, nicht nur
nicht widersprechend, sondern vielmehr die gegentheilige Annahme, es
gebe kein Wirkliches, widersprechend sei, ist schon oben gezeigt
worden. Von dem „Rauche” des Scheins gilt der Schluss auf
die „Flamme” des Seins. Wo nichts Wirkliches wäre,
könnte auch keines scheinen; keineswegs aber gilt auch der
umgekehrte Satz, [165]dass, wo kein Wirkliches scheint, auch kein
Wirkliches vorhanden sei. Denn es lässt sich sehr wol denken, dass
Wirkliches sei, auch ohne zu scheinen. Die Setzung des Wirklichen auf
Grundlage des vorhandenen Scheins ist eine bedingte; das Gesetztsein
des Wirklichen aber ist ein durch dessen Setzung auf Grundlage des
Scheins nicht bedingtes, also unbedingtes. Dasselbe wird gesetzt, weil der Schein gesetzt ist; aber es
wäre gesetzt, auch wenn der Schein nicht
gesetzt wäre. Die Setzung desselben erfolgt nicht, wie jene des
(scheinbaren) Objects im Idealismus, durch das Ich, welches setzt,
sondern besteht, wie der von seinem Gedachtwerden unabhängige
Denkinhalt, auch ohne Subject, welches setzt. Die Position des
(scheinbaren) Objects durch das Subject (im Idealismus) ist eine
relative; mit dem Subject fällt auch das Object. Die Position des
Wirklichen im Realismus ist eine absolute;
dieselbe hört nicht auf, auch wenn das Subject aufhört.
270. Nur die letztere Position ist wahre, die relative
ist keine Position. Das eigentlich Ponirte ist in der relativen
Position nicht das Gesetzte (das Object), sondern das Setzende (das
Subject); die Position des Ponirten ist daher nur eine scheinbare; die
wahre Position ist die des Ponirenden. Dieses allein ist wahrhaft, das
von ihm Gesetzte nur dem Anschein nach wirklich; das einzige Wirkliche
sonach nicht das Gesetzte, das Object, sondern das Setzende, das
Subject. Soll das Object das Wirkliche d. i. nicht nur dem Schein nach,
sondern in Wahrheit wirklich sein, so muss es von seiner Setzung durch
das Subject unabhängig gesetzt d. h. es muss als das, was es ist,
auch dann gesetzt sein, wenn weder eine Setzung desselben durch ein
Subject, noch überhaupt ein von demselben unterschiedenes Subject
je wirklich vorhanden ist.
271. Die absolute Position ist der Ausdruck des Seins.
Durch dieselbe ist das Sein, wie von jeder Setzung durch das Subject,
so auch von der Setzung durch jedes, wie immer geartete Denken
unabhängig. Dasselbe ist, wie Bonaparte zu Campoformio von der
französischen Republik sagte: „wie die Sonne, wehe dem, der
sie nicht sieht!” Dem Denken bleibt nichts übrig, als das
Sein als das, was es von vornherein ist, als Sein anzuerkennen; das
Sein aber als solches bedarf dieser Anerkennung durch das Denken nicht.
Das Sein ist nicht, wie Schelling sagte, „vor” dem Denken, aber es bestünde auch
ohne das Denken.
272. Ein Denken, welches das Wirkliche nicht als absolut
d. i. als von ihm unabhängig gesetzt dächte, hätte
dasselbe nicht als [166]Sein, sondern als Schein gedacht. Derselbe
Grund, welcher das Denken nöthigt, ein Wirkliches zu denken,
nöthigt es auch, dieses letztere als unbedingt gesetzt d. i. als
seiend zu denken. Der Grund aber, der für das Denken die Annahme
eines Wirklichen unvermeidlich macht, ist die Thatsache des Scheins des
Wirklichen d. i. das — nicht willkürlich durch den Willen
des Denkenden, sondern unwillkürlich, ohne, ja selbst wider den Willen
des Denkenden — Gegebensein des Scheins des Wirklichen. Der
Inhalt dieser durch die Thatsache des Scheins des Wirklichen d. i.
durch die Erfahrung bedingten Setzung ist das
unbedingt Gesetzte.
273. Dass das Wirkliche, was es
auch immer sei, unbedingt gesetzt, nicht aber, was das Wirkliche, wenn gesetzt,
seinem Was nach sei, ist damit ausgesprochen.
Nur so viel lässt sich folgern, dass, wie auch das Was des
Wirklichen gedacht werden möge, dasselbe nicht so gedacht werden
dürfe, dass dessen unbedingtes Gesetztsein dadurch unmöglich
gemacht wäre. Dies aber würde der Fall sein, nicht nur wenn
das Was des Wirklichen in irgend einer Weise von der Natur eines
dasselbe Setzenden abhängig gedacht, sondern auch dann, wenn
dasselbe durch das Gesetztsein eines Andern bedingt gedacht würde.
Dasselbe darf in ersterer Hinsicht daher nicht so beschaffen gedacht
werden, wie das vermeintlich Setzende (z. B. das vorstellende Subject)
seiner Beschaffenheit nach ist d. h. etwa als vorstellend, weil dieses
letztere vorstellt, oder als fühlend, oder wollend, weil dieses
letztere fühlt und will. Es darf aber auch in letzterer Hinsicht
nicht so gedacht werden, dass dessen Gesetztsein das Gesetztsein eines
Anderen bedingt, also nicht als zusammengesetzt d. i. aus Theilen
bestehend, weil dann dessen Gesetztsein durch das Gesetztsein jedes
einzelnen dieser Theile bedingt, also nicht unbedingt wäre. Aus
ersterem folgt, dass das Was des Wirklichen in keiner Weise aus dem Was
etwa des vorstellenden Subjects als des vermeintlich dasselbe Setzenden
erschlossen werden könne. Aus dem letzteren folgt, dass das Was
des Wirklichen, weil unbedingt gesetzt, nicht zusammengesetzt d. i.
nicht aus Theilen bestehend sein dürfe, sondern streng
einfach sein müsse.
274. Jedes wahrhaft Wirkliche ist daher einfaches
Wirkliches. Dasselbe ist nicht nur, wie das sogenannte physikalische
Atom, scheinbar, sondern wirklich „atom” d. i. untheilbar;
nicht blos, wie jenes, weil es mit den vorhandenen Werkzeugen nicht
mehr getheilt werden kann, oder für den gegebenen Zweck nicht mehr
[167]weiter getheilt zu werden braucht, sondern, weil
es schlechthin keine Theile hat. Dasselbe schliesst seiner Einfachheit
halber zwar nicht jede Vielheit, aber doch jede
Vielheit einander coordinirter Glieder von sich aus d. h. dasselbe ist
weder ein Bündel einander nebengeordneter Eigenschaften, noch eine
Summe ebensolcher sogenannter Kräfte oder Vermögen. Es kann
sein Was weder verlieren noch verändern, ohne (was unmöglich
ist bei einem unbedingt Gesetzten) selbst aufzuhören. Dasselbe
kann daher weder qualitativ ein anderes als, noch quantitativ ein mehr
oder weniger dessen werden, was es ist; dasselbe ist, sobald es ist,
sowol ewig als unveränderlich; weder dessen (unbedingtes, also von
jeder Bedingung unabhängiges) Gesetztsein, noch dessen einfaches,
jeder Zuthat oder Abtrennung von Theilen, jedes Wachsthums wie jeder
Abnahme unfähiges Was kann einen Wechsel erleiden. Die
unvermeidliche Consequenz der absoluten Position und der Einfachheit
des Was ist die Erhaltung des wandellosen
Selbst jedes Wirklichen.
275. Im Begriffe des Wirklichen liegt, dass es Wirkendes
ist d. i. wirkt d. h. dass dessen Sein und dessen einfache
Qualität von dessen Wirken d. i. sich Bethätigen
unabtrennlich ist. Weder ein Wirkliches, das nicht wäre, noch ein
Seiendes, das nicht wirkte, wäre ein wahrhaft Wirkliches; jenes
wäre nur der Schein eines Wirklichen, dieses wäre ein Todtes,
also nicht Wirkliches. Die Zusammengehörigkeit beider darf nicht
so gedacht werden, als wäre das Sein und die Qualität das
Substrat des Wirkens d. h. als besässe das Wirkliche als
seiende, aber nicht wirkende Qualität seine besondere, als seiende, aber wirksame
Qualität wieder seine abgesonderte Wirklichkeit d. h. als stellte
die seiende Qualität nach Abzug des Wirkens gleichsam das
Residuum, das caput mortuum des Wirklichen dar. Die unbedingt gesetzte
einfache Qualität und das Wirken sind nicht nur im Begriffe des
Wirklichen, sondern in diesem selbst unzertrennlich eins, so dass das
Wirkliche weder gedacht werden kann, ohne dasselbe als wirkend zu
denken, noch als Wirkliches sein d. h. wirklich sein kann, ohne zu
wirken.
276. Ebensowenig wie die absolute Position, das
unbedingte d. i. bedingungslose Gesetztsein, darf das mit derselben im
Wirklichen in Eins verschmolzene Wirken von einer, wie immer gearteten
Bedingung abhängig gedacht werden. Weder kann dessen Beginn, noch
dessen Aufhören an einen Zeitpunkt geknüpft werden, vor
welchem und nach welchem zwar das unbedingt Gesetzte, aber nicht als
Wirkendes, sondern als Wirkungsloses bestünde, noch darf
[168]dasselbe so verstanden werden, als setzte es
einen besondern, noch weniger einen von ihm, dem Wirklichen,
unterschiedenen Stoff voraus, um sich als Wirken zu bewähren. Die
Frucht des mit der absolut gesetzten einfachen Qualität
unauflöslich und unablösbar verbundenen Wirkens des
Wirklichen ist dessen Wirklichkeit.
277. Nothwendige Wirkung des mit dem Wirklichen seiner
Natur nach verbundenen Wirkens ist, dass etwas geschieht. Das
Gegentheil, die Annahme, dass nichts geschehe, ungeachtet gewirkt wird,
widerspricht sich selbst. Denn ein Wirken ohne wie immer beschaffenen
Erfolg hätte nichts bewirkt d. h. wäre kein Wirken gewesen.
Nothwendige Folge der Einfachheit und Unveränderlichkeit der
Qualität des Wirklichen ist, dass, was immer geschehe, weder eine
Setzung, noch Aufhebung der absoluten Position eines Wirklichen, noch
die, sei es quantitative, sei es qualitative Abänderung der
Qualität eines Wirklichen, weder der eigenen, noch einer fremden
sein kann; daher alles, was wirklich geschieht, weder die
Qualität, noch das Gesetztsein des Wirklichen, sondern nur das mit
demselben unablöslich verschmolzene Wirken des Wirklichen angehen
kann d. h. dass alles, was wirklich in Folge des Wirkens geschieht, nur
eine Aenderung (Modification) dieses Wirkens selbst, beziehungsweise
dessen Zunahme oder Abnahme, Förderung oder Hemmung, Erhaltung in
der bisherigen, oder Ablenkung nach einer andern Richtung bedeuten
kann.
278. Dass überhaupt Wirkliches ist und, was
wirklich ist, wirkt, macht die realistische, dass mehr als ein einziges
Wirkliches, eine unbestimmbare Menge von Wirklichen sei, die
pluralistische Seite des Realismus aus. Wie das erstere aus dem Satze,
dass scheinbar Wirkliches, so folgt das letztere aus der Thatsache,
dass der Schein eines vielfachen Wirklichen gegeben ist. Während
der Schluss dort lautet: ohne Sein kein Schein, lautet er hier: ohne
Vielheit und Vielfachheit des Seins keine Vielheit und Vielfachheit des
Scheins. Die entgegengesetzte Annahme, dass aus der Einheit und
Einfachheit des Seins der Schein der Vielheit und Vielfachheit des
Seins hervorgehe, widerspricht sich selbst. Dieselbe lässt
unerklärt, warum, wenn das Erzeugende, der realistische Factor,
die Ursache der Empfindung, das nämliche ist, die Wirkung
derselben, die Empfindung, bald diese, bald jene sei, das „Ding
an sich”, von welchem der Anstoss zur Empfindung ausgeht, bald
eine Gesichts-, bald eine Gehörsempfindung, und wieder einmal die
Empfindung des Blauen, ein anderes mal die des Rothen verursache, dabei
aber selbst als [169]Ursache immer dasselbe bleibe. Wird an die
Stelle des Dings an sich das Wirkliche d. i. eine absolut gesetzte,
einfache Qualität substituirt, so erhöht sich die
Schwierigkeit, zu begreifen, wie diese letztere, welche als einfach
jede Vielheit coordinirter, aber unter einander qualitativ
verschiedener Wirkungsweisen ausschliesst, doch zugleich Ursache
qualitativ verschiedener Wirkungen d. i. z. B. qualitativ
unterschiedener Empfindungen werden könne; dieselbe führt
daher mit Nothwendigkeit dazu, so viele und so vielerlei qualitativ
verschiedene Ursachen vorauszusetzen, als und so vielerlei qualitativ
verschiedene Wirkungen gegeben sind d. h. wo die Thatsache vielfachen
qualitativ unterschiedenen Scheins gegeben ist, auch die Existenz eines
vielfachen und qualitativ unterschiedenen Wirklichen zu postuliren.
279. Wie durch die Betonung der realistischen Grundlage
des Scheins dem Idealismus, so ist durch die Betonung der
pluralistischen Grundlage des Scheins der Realismus jedem wie immer
gearteten Monismus d. i. jeder All-Eins-Lehre entgegengesetzt. Jener,
er sei subjectiver, absoluter oder Panlogismus, entbehrt eines wahrhaft
Wirklichen; dieser, er sei idealistisch oder selbst realistisch,
entbehrt einer wahren Vielheit des Wirklichen. Jenem zufolge ist das
Wirkliche blosser Schein (Phantasmagorie) welchen sich entweder das
endliche oder das absolute Ich, oder die absolute Vernunft vorspiegelt,
um mittels desselben zum Bewusstsein seiner, beziehungsweise ihrer
selbst zu kommen d. i. Geist zu werden. Diesem zufolge ist jede
Vielheit und Individuation des Seins blosser Schein (Phantasmagorie),
welchen das eine und einzige Wirkliche (es sei nun Spinozistische
Substanz oder Schopenhauer’scher Allwille) entweder (wie die
beiden genannten) mit blinder Nothwendigkeit, oder (wie das
Hartmann’sche „Unbewusste”) zu dem Zwecke sich
vorgaukelt, um mittels desselben zum Bewusstsein und sei es durch
Selbstverneinung oder durch werkthätigen Anschluss zur Realisirung
des Weltzwecks zu gelangen. Während der erstere begreiflich zu
machen unterlässt, wie aus demjenigen, was selbst nicht einmal den
Schatten der Wirklichkeit besitzt, auch nur der Schein einer solchen
entspringen könne, setzt der letztere dem Bedenken, wie aus
demjenigen, was selbst nicht einmal eine Spur der Vielheit in sich
schliesst, auch nur der Schein einer solchen und der Vielfachheit des
Wirklichen hervorgehen könne, vorsichtiges Stillschweigen
entgegen.
280. So viel wirklicher Schein, so viel wirkliches Sein
— lautet der Satz des Realismus, aber nicht, wie viel wirkliches
Sein. Derselbe [170]begnügt sich, zu behaupten, dass um der
Vielheit und Mannigfaltigkeit des durch die Erfahrung gegebenen Scheins
willen eine eben solche Vielheit und Mannigfaltigkeit des Wirklichen
gesetzt, aber er enthält sich, der Versuchung nachzugeben,
bestimmen zu wollen, welche (ob endliche oder unendliche) Vielheit des
Wirklichen gesetzt werden müsse. Eben so wenig wie das Quantum,
wagt er das Quale des Wirklichen anders als durch die schon oben
angeführte, aus dem Begriff der absoluten Position abgeleitete
Folgerung der qualitativen Einfachheit zu bestimmen. Wie die Vielheit
des Scheins zwar die Annahme einer Vielheit des Wirklichen, aber nicht
die Bestimmung der Vielheit des Wirklichen, so erlaubt die
Mannigfaltigkeit des Scheins zwar die Annahme einer Mannigfaltigkeit
des Wirklichen, aber nicht die Bestimmung des Mannigfaltigen des
Wirklichen. Dass vieles und mannigfaltiges Wirkliches sei, weder aber
wie vieles, noch welcherlei Art das Wirkliche sei, vermisst sich der
Realismus anzugeben.
281. Die Mannigfaltigkeit ist die geringste d. h. die
Gleichartigkeit des Wirklichen ist die denkbar grösste, wenn
dessen Verschiedenheit nicht in einer sogenannten inneren
(Eigenschaft), sondern nur in einer sogenannten äusseren
Beschaffenheit, also in einer solchen gelegen ist, welche weder
Aehnlichkeit noch Gegensatz, überhaupt keinerlei Verwandtschaft
des Wirklichen voraussetzt, sondern auch bei übrigens völlig
disparaten Wirklichen stattfinden kann. Von dieser Art sind die
räumlichen und zeitlichen d. i. diejenigen Bestimmungen eines
Wirklichen, welche sich ändern können, ohne dass dieses
letztere selbst dadurch eine Aenderung erfährt, obgleich andere
Wirkliche dadurch eine solche erfahren mögen. Der in seiner
Umlaufsbahn und Umlaufszeit sich um die Sonne bewegende Planet erleidet
durch seine Fortbewegung in seinen inneren Eigenschaften keinerlei
Veränderungen, während die Wirkungen, welche er selbst auf
andere Planeten ausübt (z. B. die sogenannten Störungen)
wesentlich durch die Stellung d. i. durch den Ort bedingt werden,
welchen derselbe in einem jeweiligen Zeitpunkt im Verhältniss zu
ihnen im Weltraum einnimmt. Eben so wenig erleidet der Weltkörper,
wenn nicht andere Ursachen in und an demselben Veränderungen
bewirken, durch den blossen Abfluss der Zeit, innerhalb welcher er
seine Bahn zurücklegt, eine Veränderung, obgleich, wenn eine
solche an ihm vorgegangen und er demungeachtet derselbe geblieben sein
soll, dies nur unter der Voraussetzung denkbar ist, dass seine
Beschaffenheit vor und seine [171]Beschaffenheit nach obiger
Veränderung in verschiedene Zeitpunkte fallen. Die vielen und
verschiedenen Wirklichen sind daher am wenigsten verschieden, jedoch in
keiner Weise nicht verschieden, wenn deren Verschiedenheit lediglich in
der Verschiedenheit d. i. in der Nichtidentität ihrer
räumlichen und zeitlichen Bestimmungen d. i. des Wo und des Wann
ihrer Wirklichkeit d. i. ihres Wirkens gelegen ist. Dieselben sind
verschieden, insofern ihre Orte im Raum verschieden d. h. ausser
einander, dagegen nicht verschieden, insofern sie Wirkliche d. i.
Wirkende sind. Dieselben sind verschieden, insofern je nach der
Verschiedenheit ihres Aussereinander (d. h. der räumlichen Distanz
ihrer Orte) ihr Wirken verschieden, dagegen nicht verschieden, insofern
sie Wirkende sind. In Bezug auf die Zeit sind sämmtliche Wirkliche
als unbedingt Gesetzte insofern nicht verschieden, als ihr Gesetztsein
von jeder, also auch von jeder zeitlichen Bedingung unabhängig
ist; dagegen können sie als Wirkende insofern verschieden sein,
als ihr Wirken sich ändert, während sie selbst dieselben
bleiben und diese Aenderung nur unter der Annahme möglich ist,
dass das eine zu einer, das anders geartete Wirken dagegen zu einer
andern Zeit stattfindet.
282. Wirkliche, die sich durch räumliche und
zeitliche Bestimmungen unterscheiden, können im Uebrigen eben so
wol unterschieden als nicht unterschieden, sie werden trotzdem
unterschiedene d. i. Einzelwesen und, da dieselben als unbedingt
gesetzte, einfache Qualitäten, Atome d. i. untheilbare Wesen sind,
Individuen sein. Dieselben müssen als räumlich (d. i. dem Ort
nach) verschiedene, ausser einander, beziehungsweise neben einander
sein; das Wirken derselben, insofern es in einem und demselben
Individuum ein verschiedenes sein soll, kann nur nach einander,
beziehungsweise auf einander erfolgen. Da dieselben ausser einander d.
h. da ihre Orte, wenn sie selbst unterschiedene sein sollen, nicht
dieselben sein sollen, so muss es der Orte wenigstens eben so viele
geben, als es Wirkliche gibt. Da das Wirken eines jeden derselben, wenn
es ein anderes sein soll, in einen anderen Zeitpunkt fallen muss, so
muss es der Zeitpunkte wenigstens eben so viele geben, als in demselben
Wirklichen Abänderungen seines Wirkens gegeben sind. Mit der
Unbestimmbarkeit der Zahl der Wirklichen ist daher zugleich die
Unbestimmbarkeit der Zahl der Orte, mit der Unbestimmbarkeit der Zahl
möglicher Abänderungen des Wirkens eines und desselben
Wirklichen zugleich die Unbestimmbarkeit der Zahl der Zeitpunkte
gegeben. Wie die Menge des auf Grundlage des durch die Erfahrung
[172]gegebenen Scheins anzunehmenden Wirklichen, so
lässt sich die Menge der auf Grundlage des angenommenen Wirklichen
anzunehmenden Orte, so wie jene der auf
Grundlage der durch Erfahrung gegebenen Abänderungen des Wirkens
des Wirklichen anzunehmenden Zeitpunkte je nach Bedürfniss ins
Unbestimmte erweitern.
283. Der Inbegriff des gesammten auf Grundlage des durch
die Erfahrung gegebenen Scheins jeweilig anzunehmenden Wirklichen d. i.
der Inbegriff sämmtlicher Atome macht den Stoff, der Inbegriff des
von sämmtlichen Wirklichen ausgehenden Wirkens die Kraft, der
Inbegriff sämmtlicher Orte den Raum, und jener sämmtlicher
Zeitpunkte die Zeit aus. Da der in jedem gegebenen Augenblick dem
Bewusstsein durch Erfahrung aufgedrungene Schein eines Wirklichen ein
bestimmter, und insofern endlich, in jedem gegebenen Augenblick aber
ein anderer seinerseits abermals bestimmter und insofern endlicher ist,
so folgt, dass das Quantum des Wirklichen, da dessen Annahme nur auf
Grund des gegebenen Scheins eines solchen erfolgt, nur dann ein
unendliches sein muss, wenn der gegebene Schein die Annahme eines
solchen fordert, im Uebrigen aber über dasselbe keine andere
Bestimmung möglich ist, als dass das Quantum des Stoffs dem
Quantum des durch Erfahrung gegebenen Scheins proportional sein muss.
Da nun der Schluss vom Schein auf das Sein keineswegs verlangt, dass
unendlich, sondern nur, dass unbestimmt viele Wirkliche dessen reale
Grundlage ausmachen sollen, so kann auf Grund der gegebenen Erfahrung
über das Quantum des anzunehmenden Stoffs nichts weiter ausgesagt
werden, als dass dasselbe ein verhältnissmässiges, mit dem
Wachsthum des durch Erfahrung gegebenen Scheins für das
Bewusstsein in stetem Wachsen begriffenes, an sich aber, da das
Wirkliche als unbedingt gesetztes keinerlei Abänderung seines
Gesetztseins fähig ist, ein unveränderliches sein muss.
284. Wie das Quantum des Stoffs, so ist das Quantum der
Kraft zugleich als veränderlich d. i. der
Zunahme fähig, und als unveränderlich, einer solchen unfähig anzusehen.
Ersteres, insofern die Annahme wirklichen Wirkens nur auf Grund des
durch die Erfahrung dargebotenen scheinbaren Wirkens und sonach die
Bestimmung des Quantums des ersteren nur im Verhältniss zu dem
erfahrungsmässig gegebenen Quantum des letzteren statthat,
letzteres, insofern das Wirken nichts anderes als die Verwirklichung
der im Wirklichen unbedingt gesetzten einfachen Qualität und
folglich, da diese letztere unveränderlich ist, die Summe der
Verwirklichungen [173]sämmtlicher einfacher Qualitäten
des Wirklichen eben so wie die Summe dieser selbst immer dieselbe
bleiben muss. Das Gesetz der Unveränderlichkeit des Quantums
wirklichen Wirkens d. i. der Erhaltung der
Kraft ist nur die unvermeidliche Folge des Gesetzes der
Unveränderlichkeit des Quantums des Wirklichen d. i. der
Erhaltung des Stoffs. Dagegen ist das Quantum
der aus dem jeweilig durch Erfahrung gegebenen scheinbaren Wirken
erschlossenen Kraft eben so wie das Quantum des auf Grund des durch die
jeweilige Erfahrung dargebotenen scheinbaren Wirklichen erschlossenen
Stoffs der Veränderung, und zwar eines im richtigen
Verhältniss zu der allmälig anwachsenden Erfahrung
zunehmenden Wachsthums bedürftig und fähig.
285. Der Grund, weswegen letzteres, das jeweilige
Quantum des scheinbaren mit dem des wirklichen Wirkens weder jemals
identisch ist, noch werden kann, liegt in der Verschiedenheit,
beziehungsweise dem Gegensatz der individuellen Wirklichen und der
daraus fliessenden Verschiedenheit, beziehungsweise des Widerstreits
ihres Wirkens. In der Natur der Sache liegt es, dass verschiedene, ganz
oder theilweise der Qualität nach entgegengesetzte Wirkliche auch
in ihrem Wirken ganz oder theilweise einander entgegengesetzt sind d.
h. dass ihr Wirken sich gegenseitig ganz oder theilweise zwar nicht
vernichtet, weil die unbedingt gesetzte und selbst unveränderliche
Qualität des Wirklichen der Vernichtung unfähig ist, aber
ganz oder theilweise hemmt, so dass der Schein entsteht, als werde
nichts oder als werde weniger gewirkt, während thatsächlich
gewirkt, und zwar mehr gewirkt wird als gewirkt zu werden scheint. Das
auf diese Weise gehemmte, also scheinbar nicht wirklich, in der That
aber wirklich, jedoch im — durch entgegengesetztes Wirken —
gebundenen Zustande vorhandene Wirken ist gleichsam latentes, schlummerndes, dagegen
das ungehemmte, durch ganz oder theilweise Entgegengesetztes nicht
gebundene, also freie Wirken offenbares,
lebendiges Wirken. Die Summe des letzteren
muss, da unter der Summe des Wirkenden jedesmal ein bestimmter
Bruchtheil unter sich entgegengesetzten Wirkens vorhanden sein muss,
nothwendig kleiner ausfallen als die Summe des überhaupt (im
gehemmten und ungehemmten Zustande) vorhandenen Wirkens und zwar desto
kleiner, je grösser die Summe des unter sich entgegengesetzten,
also sich hemmenden Wirkens im Verhältniss zur Summe des Wirkens
überhaupt ist. Die Wirklichen selbst, deren Wirken gehemmt ist,
die also, um dieses Gehemmtseins [174]willen, nicht zu wirken, also
nicht wirklich zu sein scheinen, während sie doch wirkend, also
wirklich sind, stellen zusammengenommen den Inbegriff desjenigen
Wirklichen dar, welches zwar wirklich, dem Scheine nach aber nicht
wirklich d. h. für die aus dem Scheine des Wirklichen auf die
Wirklichkeit folgernde Beobachtung so gut wie nicht vorhanden ist d. h.
den Inbegriff des latenten, jeweilig nicht nur seiner Qualität
nach unbekannten, sondern auch seiner Existenz nach ungekannten
Wirklichen.
286. Letzterer liefert den Vorrath sowol zur Vermehrung
des sichtbaren, wie zur Erweiterung des Umfanges des aus gegebenem
scheinbaren erschlossenen wirklichen Wirkens. Indem bisher gebundenes
Wirken aus irgend einem Anlass frei d. h. ungehemmtes Wirken wird,
tritt es aus dem latenten in den Zustand offenbaren Wirkens d. h. es
tritt selbst, wenigstens scheinbar, als neues, bisher nicht
wahrgenommenes Wirken zu der Summe des bisher sichtbar gewesenen
Wirkens hinzu; indem es als offenbar gewordenes, also den Schein des
Wirkens erzeugendes Wirken vor das Bewusstsein tritt, ruft es in diesem
den unvermeidlichen Schluss auf wirkliches Wirken d. i. eine
Erweiterung des bisherigen Umfanges bekannten Wirkens hervor. Wie durch
den ersteren Umstand die Summe des sichtbaren Wirkens, so wird durch
den letzteren die Kenntniss wirklichen Wirkens vermehrt, durch jenen
die Summe der in der Totalität des Wirklichen lebendig
thätigen, im Verhältniss zur Summe der in derselben leblos
schlummernden Kräfte, durch diesen die Summe des auf Grund
erweiterter Erfahrung erschlossenen Wirklichen gegenüber dem auf
Grund der bisherigen Erfahrung als wirklich gekannten, ebenmässig
vergrössert.
287. Da das Quantum des überhaupt vorhandenen
Wirkens nach Obigem unveränderlich, die Summe des jeweilig
ungehemmten Wirkens aber veränderlich ist, so folgt, dass jede
Zunahme der Summe des sichtbaren von einer entsprechenden Abnahme der
Summe des gebundenen Wirkens und umgekehrt jede Zunahme dieser von
einer Verminderung jener begleitet sein muss. Könnte die Abnahme
sichtbaren Wirkens je so weit sich erstrecken, dass jedes ungehemmte
Wirken sich in gehemmtes, also jedes wirkliche Wirken in scheinbares
Nichtwirken verkehrte, so müsste an Stelle des Scheins eines
Wirklichen vielmehr der entgegengesetzte Schein der Abwesenheit irgend
eines Wirklichen d. h. es müsste der Schein der Wirklichkeit des
Nichts (Nihilismus) entstehen, welches sich selbst widerspricht. Sollte
dagegen in umgekehrter Weise die Zunahme [175]des sichtbaren
Wirkens so weit fortschreiten, dass sämmtliches gebundenes sich in
freies Wirken verwandelte, also jeder Schein eines Nichtwirkens sich in
den entgegengesetzten Schein des Wirkens auflöste, so müsste,
da jede Hemmung eines Wirkens nur aus der Verschiedenheit,
beziehungsweise dem Gegensatze der Wirkenden entspringt, der Schein
entstehen, als sei zwischen den Wirkenden überhaupt keine
Verschiedenheit d. h. als seien überhaupt nicht unterschiedene
Wirkliche (Pluralismus, Individualismus), sondern nur ein einziges,
schlechterdings unterschiedloses Wirkliches (Monismus, All-Eins-Lehre)
vorhanden; welcher Schein, da, wie oben gezeigt, die Annahme eines
einzigen Wirklichen auch nicht einmal die Entstehung des Scheins einer
Vielheit ermöglicht, sich selbst widerspricht. Da sonach von
diesen beiden Fällen keiner als jemals möglicher Weise
eintretend gedacht werden darf, ohne etwas sich selbst Widersprechendes
zu denken, so folgt, dass weder die Abnahme des sichtbaren Wirkens
jemals so weit gehen kann, dass völlige Ruhe (Leblosigkeit), noch
die Zunahme desselben je so hoch sich steigern kann, dass
durchgängige Lebendigkeit (Bewegung) im ganzen Umkreis des
Wirklichen herrsche, sondern dass immer Ruhe und Bewegung, Leblosigkeit
und Lebendigkeit zugleich, jedes in einem mehr oder weniger weit
reichenden Theile des Wirklichen vorhanden sei.
288. Wie den Quantis des Stoffs und der Kraft, kommt den
Quantis des Raumes und der Zeit Wandelbarkeit zugleich und
Wandellosigkeit zu. Wenn der erstere nichts anderes ist als der
Inbegriff der Orte des Wirklichen, so folgt, dass dessen Quantum weder
grösser noch kleiner sein kann als das Quantum des Wirklichen. Da
nun das letztere, wie gezeigt, in einer Hinsicht veränderlich, in
einer andern dagegen unveränderlich ist, so folgt, dass in Bezug
auf das Quantum des Raumes dasselbe stattfinden muss. Jede Erweiterung
des bisher bekannten Umfanges des Wirklichen durch die Annahme neuer
Wirklicher macht die Annahme neuer Orte und damit die Vermehrung des
bisherigen Quantums des Raums nöthig. Die Erhaltung des Quantums
des Stoffs d. i. des Inbegriffs aller Wirklichen, deren jedes seines
von dem jedes andern unterschiedenen Orts bedarf, macht die Erhaltung
des Quantums des Raums unvermeidlich. Wenn die Zeit nichts anderes ist
als der Inbegriff der Zeitpunkte d. i. derjenigen Bedingungen, unter
welchen allein das Wirken eines Wirklichen jeweilig ein anderes
geworden, das Wirkliche selbst aber dasselbe geblieben sein kann,
[176]so folgt, dass jedes Anderswerden der Wirkung
mindestens zwei Zeitpunkte, denjenigen, in welchen das
unveränderte, und denjenigen, in welchen das veränderte
Wirken fällt, fordere, und daher das Quantum der Zeitpunkte nicht
kleiner sein könne als das Quantum der eingetretenen
Veränderungen des Wirkens. Da nun das Quantum des Wirkens
überhaupt, also auch das Quantum der in demselben enthaltenen
Abänderungen des Wirkens einerseits, wie aus der Erhaltung des
Stoffs folgt, immer dasselbe, andererseits, wie aus der
Veränderlichkeit des scheinbaren Wirkens folgt, veränderlich
ist, so folgt, dass auch das Quantum der Zeit einerseits, so weit
dasselbe durch das Quantum der überhaupt wirklichen
Abänderungen des Wirkens bedingt ist, immer dasselbe, dagegen, so
weit dasselbe von dem jeweilig im Bewusstsein schwebenden Quantum
scheinbaren Wirkens abhängig ist, veränderlich sein muss.
289. Aus dem Begriff des Raumes folgt, dass er
erfüllter Raum sei d. h. dass es einen sogenannten leeren Raum
nicht geben könne. Da derselbe nichts anderes ist, als der
Inbegriff der Orte, die Setzung eines Orts aber nur auf Veranlassung
und im Gefolge der Setzung eines Wirklichen, dessen Ort er ist,
erfolgt, so kann es weder Orte geben, in welchen kein Wirkliches, noch
Wirkliche, für welche kein Ort gesetzt ist. Die an verschiedenen
Orten befindlichen Wirklichen können daher zwar nicht nur
ausser einander, sondern es können auch
zwischen ihren Orten andere Orte gelegen d. h. sie müssen nicht
an einander sein; keineswegs aber dürfen
die zwischen ihren Orten gelegenen Orte als leer d. h. als solche
gedacht werden, in welchen kein Wirkliches befindlich ist. Folge davon
ist, dass eine sogenannte actio in distans d. h.
ein Wirken durch den leeren Raum hindurch schon aus dem Grunde
unmöglich wird, weil die Voraussetzung derselben, der leere d. h.
mit Wirklichen nicht erfüllte Raum eine in sich widersprechende,
folglich im Umfang des auf Grundlage des Wirklichen gesetzten Raums
niemals zutreffende Annahme ist.
290. Da der Ort jedes Wirklichen, so lange deren
individuelle Unterschiedenheit von ihren räumlichen und zeitlichen
Bestimmungen abhängig gedacht wird, nur ein einziger sein kann, so
bleibt derselbe so lange unbestimmt, als sich auch nur ein einziger Ort
angeben lässt, welcher demselben Wirklichen mit gleichem Recht
zugesprochen werden kann. Dieses aber ist der Fall, wenn das Wirken des
Wirklichen als eine Function seines Aussereinander mit anderen
Wirklichen gedacht und sonach der Ort desselben als [177]lediglich durch die Entfernung von dem Ort eines
anderen Wirklichen bestimmt vorgestellt wird. Denn sodann findet sich
nicht nur ein einziger Ort, sondern es finden sich unzählige Orte,
welche mit gleichem Recht als Ort jenes Wirklichen angenommen werden
können, da sie alle von dem zweiten die gleiche Entfernung haben,
nämlich alle diejenigen, welche die Oberfläche einer Kugel
bilden, deren Mittelpunkt das zweite Wirkliche und deren Radius der
Abstand des ersten vom zweiten ist. Soll daher aus diesen
unzähligen ein einzelner als Ort des Wirklichen ausgeschieden
werden, so müssen zu der Angabe der Entfernung weitere Angaben
hinzukommen, deren eine darin besteht, in welcher der unzähligen
Kreisebenen, welche durch den Mittelpunkt jener Kugel gelegt werden
können, deren zweite dahin lautet, in welchem der in jener
Kreisebene vom Mittelpunkt an die Peripherie gezogenen Radien der Ort
jenes Wirklichen zu suchen sei. Erst durch die letztgenannte dieser
Angaben ist der Ort des Wirklichen völlig und dergestalt bestimmt,
dass schlechterdings kein zweiter angebbar ist, welcher mit ihm die
nämlichen räumlichen Bestimmungen theilte. Dieselben sind
daher für jeden unter obigen Bedingungen gesetzten Ort eines
Wirklichen dreifach und zwar durch dessen Beziehungen zu drei auf
einander in demselben Punkte senkrechten Richtungen (den sogenannten
Coordinaten) fixirt, der auf solche Weise gedachte Raum daher als ein
dreidimensionaler, nach den Richtungen der Länge, Breite und Tiefe
ausgedehnter, vorgestellt.
291. Da letztere Vorstellung nur unter der Annahme
erfolgt, dass das Wirken des Wirklichen eine Function der Entfernung
desselben von einem anderen Wirklichen sei, so leuchtet ein, dass deren
Nothwendigkeit schwindet, sobald an die Stelle obiger Annahme eine
andere gesetzt, das Wirken des Wirklichen z. B. statt von der
Entfernung desselben von einem andern Wirklichen, von dessen
Nichtentferntsein von letzterem d. h. statt von dem räumlichen
Aussereinander von dem örtlichen Ineinander beider Wirklichen
abhängig gedacht wird. In diesem Falle wäre nämlich der
Ort des Wirklichen auch durch die Angabe seiner Lage im Raume nach
allen drei Dimensionen desselben noch nicht bestimmt, da sich noch
immer ein zweiter Ort angeben liesse, welcher ganz die nämliche
Lage im Raume besässe, nämlich jener des zweiten Wirklichen,
von welchem das erste der Annahme zufolge „nicht entfernt”,
sondern mit welchem dasselbe „in einander” sein soll. Es
müsste also, wenn die Wirklichen dennoch verschieden sein sollten,
entweder [178]der Raum eine weitere, sogenannte vierte
Dimension besitzen, nach welcher Orte desselben, deren Lage nach
Länge, Breite und Tiefe identisch ist, dennoch verschieden sein
könnten, oder die Verschiedenheit der Wirklichen dürfte nicht
mehr blos in deren räumlichen (oder zeitlichen) Bestimmungen,
sondern sie müsste in deren sogenannter innerer Beschaffenheit
gelegen sein. Obige Annahme, dass das Wirken des Wirklichen eine
Function der Entfernung, um so mehr die fernere enger begrenzte, dass
dieselbe in einer Abnahme der Wirkung mit der Entfernung, so wie die
engste, dass diese Abnahme im Quadrat der Entfernung erfolge, hat schon
Kant in seinen „Gedanken von der wahren Schätzung lebendiger
Kräfte” (Werke Hart. VIII. 26) für eine
„willkürliche” erklärt, an deren statt an sich
eben so gut eine andere, z. B. dass mit der Entfernung eine Zunahme des
Wirkens eintrete, oder die Abnahme im Cubus der Entfernung erfolge etc.
hätte gedacht werden können. Dieselbe wird eben nur deshalb
gedacht, weil wir uns von einem Raume, der unter einer anderen Annahme
entsteht, z. B. von einem vierdimensionalen, eben, wie Kant gleichfalls
p. 27 bemerkt, keine Vorstellung zu machen im Stande sind, und die
gegebene Erfahrung des scheinbar Wirklichen mit der Annahme des
dreidimensionalen Raums und der Abnahme der Wirkung im Quadrate der
Entfernung am vollkommensten übereinstimmt.
292. Wie der Raum unter der Annahme, dass das Wirken
eine Function der Entfernung sei, eine dreidimensionale, so hat die
Zeit unter der Annahme dass das Wirkende vor und nach der
Abänderung seines Wirkens dasselbe sei, nur eine eindimensionale
Ausdehnung. Wie jeder Ort im Raum durch sein Verhältniss zu einem
andern nach drei in demselben auf einander senkrechten Richtungen, so
ist jeder Punkt in der Zeit durch sein Verhältniss zu zwei andern
mit ihm in derselben Richtung gelegenen, deren einer vor, der andere
hinter ihm liegt, so lange vollkommen bestimmt, als nicht an die Stelle
des ersten ein zweites Wirkliches getreten ist. Denn nur unter der
letztern Voraussetzung, dass es sich nicht mehr um eine Abänderung
des Wirkens desselben, sondern eines anderen Wirklichen handelt, ist es
möglich, dass es noch einen zweiten Zeitpunkt gibt, welcher in der
nämlichen Richtung von einem vor und einem hinter ihm gelegenen
Punkte die nämliche Entfernung besitzt wie jener erste.
293. Mit der Annahme, dass das Wirken überhaupt
keine Function der Entfernung, also von dieser unabhängig, jedes
Mass [179]der Entfernung für das Mass der Wirkung
gleichgiltig sei, hat sich der Mysticismus, der an die „Wirkung
in die Ferne” glaubt, mit der Voraussetzung, dass der Raum eine
vierte Dimension besitze, der moderne in ein exactes Gewand sich
drapirende Spiritismus, mit der Hypothese endlich, dass die
Verschiedenheit der individuellen Wirklichen nicht sowol in deren
räumlicher und zeitlicher Bestimmtheit, als vielmehr in deren
innerer qualitativer Unterschiedenheit zu suchen sei, der (im
Unterschied vom quantitativen sogenannte) qualitative Atomismus
(Leibnitz, Herbart, Lotze) zu schaffen gemacht. Der erste geht von dem
Grundsatz aus, dass zwar die Orte der Wirklichen verschieden, also die
Wirklichen ausser einander, das eine z. B. wie Ennemosers magnetisirte
Frau in St. Petersburg, das andere, der Magnetiseur, in München
seien, die Entfernung beider Orte jedoch für die Wirkung
gleichgiltig d. h. diese auch bei der grössten Entfernung
ungeschwächt und die nämliche sei. Der zweite lässt, und
darin besteht seine Uebereinstimmung mit der einmal angenommenen Basis
der exacten Naturwissenschaft, welche bewirkt, dass derselbe auch
für Naturforscher verlockende Kraft besitzt — der zweite
lässt die Annahme, dass das Wirken eine Function der Entfernung d.
h. der Verschiedenheit der Orte der Wirklichen sei, gelten, besteht
aber darauf, dass die Orte zweier Wirklichen, deren räumliche Lage
nach allen drei bekannten Abmessungen des Raumes identisch ist, dennoch
verschiedene seien d. h. dass der Raum eben noch eine, die vierte
Dimension, besitze. Der qualitative Atomismus aber, welcher die
räumliche und zeitliche Verschiedenheit der Wirklichen nur als
eine Folge der qualitativen Verschiedenheit derselben ansieht d. h.
deren räumliches Ausser- und zeitliches Nacheinander nicht als die
Bedingung, sondern als die Folge der Wechselwirkung der letzteren
betrachtet, daher statt die Wirkung als eine Function der Entfernung zu
definiren, dieselbe vielmehr (wie der Mysticismus) nur unter
Voraussetzung völligen „Ineinanders” der Wirklichen
für möglich hält, kommt dadurch dahin, die
räumliche und zeitliche Ausdehnung für blossen (wenngleich
objectiven) Schein, die Totalität sämmtlicher individueller
Wirklichen für räumlich und zeitlich ungeschieden, sonach (in
räumlicher und zeitlicher, also quantitativer Hinsicht) als eins
und doch ihrer Beschaffenheit nach als geschieden: d. h. (in
qualitativer Hinsicht) als vieles zu setzen.
294. Mit der Entwickelung der Dreidimensionalität
des Raums aus der „willkürlichen Annahme”, dass das
Wirken Function der [180]Entfernung sei, hat die Wissenschaft vom
Wirklichen die Grenze desjenigen, was sich aus der Thatsache des
Scheins des Vielen und Vielfachen auf philosophische d. i. auf
nothwendige Weise, oder so aussagen lässt, dass eine gegentheilige
Behauptung das Denken selbst aufheben würde, überschritten.
Dass Wirkliches, und zwar Vieles und Vielfaches, demnach, wenn nicht
anders, doch wenigstens als durch seine räumliche und zeitliche
Bestimmtheit Unterschiedenes gedacht werden müsse und nicht nicht
gedacht werden könne, ohne das Denken mit sich selbst d. i. mit
seinen eigenen Normen in Widerspruch zu versetzen, folgert der
Realismus aus der Thatsache des Scheins vieler und vielfacher
Wirklichen mit Nothwendigkeit; dass das Wirken des Wirklichen eine
Function der Entfernung der Orte des Wirklichen, zu der Erklärung
des ersteren demnach die Annahme der Dreidimensionalität des
Raumes erforderlich sei, folgert derselbe aber nur als
Möglichkeit, neben welcher andere Möglichkeiten, und auf
Grund der gegebenen Erfahrung als eine Wahrscheinlichkeit, neben
welcher diese anderen als Unwahrscheinlichkeiten bestehen. Weder die
Annahme des Mysticismus, dass das Wirken keine Function der Entfernung,
noch jene des Spiritismus, dass der Raum vierdimensional sei, hat, so
lange nicht zahlreichere und besser als die bisherigen beglaubigte
Thatsachen deren Möglichkeit erweisen, die Wahrscheinlichkeit
für sich; der qualitative Atomismus, welcher dahin gelangt, die
Vielen (quantitativ) als eins und (qualitativ) als viele zu setzen, hat
den Widerspruch, dass eins = vieles und vieles = eins sein soll, und
damit die Möglichkeit gegen sich.
295. Aber auch der Versuch, das Denken selbst zu
verleugnen und mit dessen Umgehung auf einem anderen Wege des
Wirklichen sich zu bemächtigen, wie ihn der das Denken
transcendirende und darum wol auch (obgleich, wie oben bemerkt,
fälschlich) sogenannte transcendentale Realismus wagt, führt
zu keinem andern Ziel. Derselbe stützt sich entweder, um der
Nothwendigkeit zu entgehen, dasjenige, was vom Denken als seiend
anzunehmen verboten wird, ablehnen, oder, was von diesem als wirklich
anzunehmen geboten wird, annehmen zu müssen, auf den trivialen
Satz, dass dasjenige, was durch das Zeugniss der Sinne bestätigt,
wahr, was durch dasselbe verworfen werde, falsch sei, gleichviel ob das
erstere den Normen des Denkens entgegen, das letztere durch dieselben
zu denken geboten sei, und fällt dadurch auf den längst
kritisch überwundenen Standpunkt des gemeinen empirischen
Realismus zurück. Oder er [181]beruft sich, um den
Forderungen des Denkens auszuweichen, auf ein vom Vorstellen (dem
Intellect) wesentlich und der Art nach verschiedenes Organ, über
welches die Gesetze des logischen Vorstellens (die Normen des
Intellects) keine Gewalt haben, dem sie daher auch weder zu gebieten,
noch zu verbieten berechtigt sein sollen. Als ein solches wird von der
einen Schule des transcendenten Realismus (Gefühlsphilosophie:
Jacobi) das Gefühl, von der andern (Willensphilosophie:
Schopenhauer) das Wollen bezeichnet. Jener zufolge ergreift im
Gefühl der Fühlende das Wirkliche (übersinnlich Reale)
unmittelbar, ohne Dazwischenkunft und folglich zwar ohne die Hilfe,
aber auch ohne die Mängel des Intellects; dieser zufolge weiss das
Subject, indem es sich selbst als wollendes weiss, damit zugleich das
einzige wahrhaft Wirkliche, den Willen, unmittelbar, ohne
Dazwischenkunft und folglich auch ohne das Trügerische der
Vorstellung. Von der ersteren gilt, dass, da im Gefühl
Gefühltes und Fühlen ununterscheidbar zusammenrinnt,
derjenige, der blos fühlt, eben darum nicht weiss, und daher
blosses Fühlen eben so wenig wie blosses „Ahnen”
(Fries) Princip und Grundlage einer Wissenschaft werden kann. Von der
letzteren gilt, dass, wie schon Herbart treffend bemerkt hat,
unmittelbares Wissen wie seiner selbst als Wollenden, so des Wirklichen
als Willen, ein Wissen, folglich die Möglichkeit zu wissen, und
schliesslich, da Wissen eben nichts anderes als eine Art des Denkens d.
i. wahres Denken ist, das angeblich mit Umgehung des Denkens erfolgte
Ergreifen des Wirklichen, um überhaupt möglich zu sein, das
Denken voraussetzt.
296. Letzterer Einwand, welcher die Möglichkeit,
mit Umgehung des Denkens zu dem transcendenten Sein, dem Wirklichen
selbst zu gelangen, überhaupt trifft, wird nicht widerlegt,
sondern nur umgangen durch die Behauptung, dass die Natur des
Wirklichen auf dem Erfahrungswege zwar nicht der gemeinen,
sinnenfälligen, aber einer nicht gemeinen, mystischen Empirie
erkannt d. h. dass das „speculative Resultat” die
Erkenntniss des Wirklichen seinem Wesen nach, „auf inductivem
Wege” d. i. an der Hand exacter Thatsachen erreicht werde.
Ersteres wäre nur dann der Fall, wenn entweder der
„Erfahrungsweg” das Denken aus- oder der angeblich
„inductive Weg” exacte Thatsachen einschlösse. Jenes
findet so wenig statt, dass vielmehr die Kritik des sogenannten
empirischen Realismus eben nichts anderes betrifft als das Verbot, sich
des sogenannten Erfahrungsweges ohne vorläufige Sichtung
[182]nach den Normen des logischen Denkens zu
bedienen, dieses aber bleibt wenigstens so lange und für alle
diejenigen zweifelhaft, als und für welche die angeblichen
Erscheinungen der Naturheilkraft des Hellsehens, des Instincts u. s. w.
den Werth unbestrittener Erfahrungsthatsache entweder noch nicht
erreicht haben, oder, was eben so möglich, ja vielleicht
wahrscheinlicher ist, niemals erreichen werden.
297. Mit obiger Grenzüberschreitung ist aber auch
der Punkt erreicht, wo die philosophische Wissenschaft vom Wirklichen
der Erfahrungswissenschaft von demselben die Hand zu bieten vermag.
Jene, die von der Erfahrung aus-, aber auf Grund in deren Inhalt
gelegener Nöthigung über dieselbe hinausgeht, hat mit der
letzteren, die nicht nur wie jene auf der Erfahrung fusst, sondern auch
innerhalb derselben verharrt, die Aufgabe gemein, die Erfahrung
begreiflich zu machen. Seitens der letzteren geschieht dies, indem sie
das gesammte Wissen vom Wirklichen auf den Boden der Erfahrung zu
stellen, seitens der ersteren, indem sie den Boden der Erfahrung selbst
sicher zu legen unternimmt. Beide, die philosophische und die
empirische Wissenschaft vom Wirklichen gleichen Arbeitern, welche von
den entgegengesetzten Seiten eines Berges her, unsichtbar für
einander, aber auf gemeinsamen Voraussetzungen fussend und einer
gemeinsamen Methode sich bedienend, einen Tunnel durch das Innere
desselben zu bohren unternehmen, in der Hoffnung, wenn ihre
Voraussetzungen giltig und ihre Berechnungen richtig sind, irgendwo in
der Höhlung desselben zusammenzutreffen. Jene schreitet von den
allgemeinen Begriffen und Principien des Wirklichen und seines Wirkens
in der Richtung gegen die erfahrungsmässig gegebenen Erscheinungen
der scheinbaren Wirklichkeit nach vorwärts, diese, von der
Erscheinungswelt der Erfahrung in der Richtung gegen deren allgemeinste
und oberste reale und gesetzliche Voraussetzungen nach
rückwärts. Wenn beider methodische Grundsätze giltig und
ihre Folgerungen zutreffend sind, werden beide früher oder
später irgendwo an der Grenze einerseits des Denknothwendigen,
andererseits des Erfahrbaren einander begegnen müssen.
298. Einen thatsächlichen Beweis für die
Richtigkeit dieser Annahme liefert die Herrschaft, welche die Atomistik
einerseits als philosophische über die philosophische,
andererseits als physikalische über die empirische Wissenschaft
vom Wirklichen gewonnen hat. In der ersteren ist dieselbe als zugleich
realistische und pluralistische [183]Grundlegung der
phänomenalen Welt an die Stelle der sowol idealistischen als
monistischen einstigen „Naturphilosophie”, in der letzteren
ist sie, wie Fechner eben so gründlich als scharfsinnig
ausgeführt hat, längst mit Recht an die Stelle der (noch von
Kant begünstigten) einstigen dynamischen Naturauffassung getreten.
So wenig, wie Fechner selbst zugestanden hat, die philosophische
Atomenlehre mit der physikalischen identisch, so gewiss ist dieselbe
mit der letzteren verträglich d. h. bietet die Existenz einer
unbestimmten Vielheit einfacher wirklicher und unausgesetzt wirkender
Wesen einen realen Anknüpfungspunkt dar für die
Zurückführung der gesammten Phänomene der
körperlichen Welt auf die Existenz unbestimmt vieler untheilbarer
und daher gleichfalls „einfach” genannter, mit rastlos
thätigen Kräften ausgestatteter Elemente. Dass die letzteren
ihrer behaupteten Einfachheit ungeachtet von Fechner als
„körperliche” bezeichnet werden, ist nur als Beleg
anzusehen, dass die empirische Wissenschaft vom Wirklichen, welche
innerhalb der Grenzen des sinnlich Erfahrbaren bleibt, der
philosophischen, welche von Haus aus über dieselben hinaus
führt, zwar stetig sich nähert, aber sie noch nicht
berührt.
299. Aber nicht nur der empirischen Wissenschaft von der
körperlichen, auch jener von der Bewusstseinswelt sowol des
Einzel- wie des gesellschaftlichen Subjects bietet die philosophische
Wissenschaft vom Wirklichen, jener in dem einfachen Wirklichen eine
reale, dieser in der unbestimmten Menge realer Bewusstseinsträger
eine reale und pluralistische Grundlage dar. Wie die unbestimmte
Vielheit einfacher Wirklicher den haltbaren Boden für den aus
einer eben so unbestimmten Vielheit atomistischer Elemente
zusammengesetzten Stoff der physischen Welt, so bildet das einzelne individuelle
Wirkliche den haltbaren Mittelpunkt, in welchem der aus einer
unbestimmten Menge elementarer Bewusstseinsvorgänge bestehende
Stoff der psychischen
Welt im Phänomen der Einheit des Ich’s wie in einem
Brennpunkt zusammenfliesst, und macht die Vielheit individueller
Wirklichen der letztgenannten Art, deren jedes für sich ein
Bewusstseinscentrum abgibt, die unentbehrliche Grundlage dessen aus,
was als Vereinigung durch ein gemeinsames Band unter einander
verknüpfter, bewusster oder doch bewusstseinsfähiger
Individuen den Stoff der Gesellschaft und der Entwickelung derselben in den Grenzen
des Raums und in der Folge der Zeit d. i. der Geschichte ausmacht. [184]
300. Letzteren, den dreifachen Stoff, den die
Betrachtung der körperlichen, der Bewusstseins- und der
geschichtlichen Welt liefert, aber vermag die Wissenschaft vom
Wirklichen nicht der philosophischen, sondern nur der empirischen
Wissenschaft von diesem zu entlehnen. Der philosophischen Wissenschaft
vom Wirklichen kann es nicht beikommen, die unausgefüllte Kluft,
welche zwischen den äussersten erlaubten Consequenzen des
Denknothwendigen und den äussersten Grenzen des Erfahrbaren
übrig bleibt, durch Conjecturen ausfüllen, oder den Uebergang
von dem einen zum andern durch Einbildungen ebnen zu wollen, welche
weder mehr in der Nothwendigkeit des Denkens, noch schon in der
Möglichkeit der Erfahrung eine Rechtfertigung zu finden im Stande
sind. Dieselbe hat zwar die Aufgabe, die Erfahrung zu befragen und,
wenn deren Antwort ihr unbefriedigend, sei es der Form nach
unvollkommen, sei es dem Inhalt nach unvollständig dünkt,
dieselbe den Normen des Denknothwendigen gemäss der ersten nach zu
berichtigen, dem zweiten nach deren Ergänzung abzuwarten, aber sie
hat weder die Mittel dieselbe aus Eigenem zu ersetzen, noch, wenn sie
nicht vom Taumel orphischen Hochmuths ergriffen ist, jemals die
Anmassung, die Erfahrung überflüssig machen zu wollen. Indem
sie sonach an die selbst aus der Erfahrung geschöpfte Eintheilung
des erfahrbaren Wirklichen in ein solches, dessen Kenntniss aus der
sogenannten äusseren (Physisches) ein solches, dessen Kenntniss
aus der sogenannten inneren (Psychisches), und in ein solches, dessen
Kenntniss aus der äussern und innern Erfahrung zugleich stammt
(Sociales, Geschichtliches) sich unbedenklich anschliesst, begnügt
sie sich, jedes der drei genannten Gebiete des Erfahrbaren mit dem auf
Grund der Erfahrung, aber durch Hinausgehen über dieselbe als
denknothwendig erkannten, wahren Wirklichen zu vermitteln und in einer
an logischem Faden ungezwungen fortlaufenden Anordnung des durch die
Erfahrung gebotenen Stoffs eine systematische Uebersicht des
erfahrbaren Wirklichen in der Körper-, in der Geistes- und in der
geschichtlichen Welt zu entwerfen. Jenes macht den Inhalt der
philosophischen Betrachtung der sogenannten bewusstlosen Welt, oder des
Nicht-Ich, das zweite den Inhalt der Betrachtung der bewussten Welt,
des Ich, das dritte den Inhalt der Betrachtung einer gleichfalls
bewussten, aber in dem Bewusstsein einer Mehrheit zur Einheit
verknüpfter, bewusster Individuen d. i. einer Gesellschaft sich
abspielenden Welt des socialen oder geschichtlichen Ich aus.
[185]
301. Die Betrachtung des Nicht-Ich beginnt mit jener des
letzten, was auf dem Wege der Erfahrung, oder vielmehr schon nur durch
einen Sprung, der über die wirkliche Erfahrung hinausführt,
erreichbar ist, des Atoms. Dasselbe ist nach der Ansicht der Physiker
(Ampère, Moigno u. A.) zwar einfach aber doch
„körperlich” (Fechner); jenes bedeutet, dass dasselbe
untheilbar oder doch wenigstens für jetzt nicht weiter als
getheilt angesehen sein soll, dieses, dass dasselbe nichts desto
weniger als materiell d. i. dem körperlichen Stoff (Materie),
dessen letzten Bestandtheil es ausmacht, als gleichartig gelten soll.
Erstere Eigenschaft nähert, letztere dagegen entfernt das
physikalische Atom von dem philosophischen, welches letztere zwar im
strengsten Sinn des Wortes seiner Qualität nach als einfach,
dessen Qualität selbst aber als schlechterdings unbekannt d. h.
auch nicht, wie jene des physikalischen Atoms, etwa als materiell zu
denken ist. Je nachdem empirische Naturbetrachtung von der Ansicht
ausgeht, dass sämmtliche Atome unter einander der Qualität
nach gleich, oder einige derselben ursprünglich und
unveränderlich ihrer qualitativen Beschaffenheit nach von jener
der anderen verschieden sind, scheidet sich dieselbe in eine rein
quantitative und in eine ganz oder doch zum Theile qualitative
Atomistik, deren erstere nicht nur alle Verschiedenheiten der
Körper, sondern auch sämmtliche Erscheinungen der
körperlichen Welt aus den Verschiedenheiten rein quantitativer
Beziehungen unter der Qualität nach homogenen, die letztere
dagegen dieselben ganz oder doch theilweise aus der verschiedenen
qualitativen Natur die Elemente der Körper, so wie die Grundlage
körperlicher Erscheinungen ausmachender, unter einander
heterogener Atome abzuleiten bemüht ist.
302. Die erfahrungsmässig gegebenen
Verschiedenheiten der Körper d. i. der räumlich und zeitlich
begrenzten zusammengehörigen Gruppen von Atomen, also die
Unterschiede einerseits des belebten (organischen) oder leblosen
(unorganischen) Körpers, ferner die Unterschiede der letzteren,
als zusammengesetzte, die sich in weitere, der Qualität nach
verschiedene Bestandtheile zerlegen, und einfache (die sogenannten
einfachen Stoffe der Chemie), die sich in solche nicht weiter
auflösen lassen, ferner die Unterschiede der letzteren selbst je
nach ihrer qualitativen Beschaffenheit (z. B. des Sauerstoffs vom
Wasserstoff, des Stickstoffs vom Kohlenstoff, des Calcium vom Magnesium
u. s. w.) werden von der qualitativen Atomistik auf eine fundamentale
qualitative Verschiedenheit der den Stoff der [186]Körper ausmachenden letzten Elemente
zurückgeführt, so dass dieselben bei den organischen
Körpern andere als bei den unorganischen und ebenso bei jedem der
einfachen Körper, welche die letzten qualitativ unterschiedenen
Bestandtheile der zusammengesetzten abgeben, andere als bei den
übrigen seien. Dieselbe betrachtet als sogenannte biologische
Atomistik jeden belebten Körper als bestehend aus gleichfalls
lebendigen Atomen, den sogenannten Zellen, während der leblose
Körper bis in seine letzten Elemente hinab aus gleichfalls
leblosen Elementen bestehend vorgestellt wird. Als sogenannte chemische
Atomistik sieht dieselbe nicht nur den zusammengesetzten Körper,
z. B. das Wasser, für bestehend aus qualitativ verschiedenen und
zwar aus Atomen von zweierlei Art an, davon die einen sauerstoff-, die
andern wasserstoffartig und davon jene mit diesen nach einem bestimmten
Verhältniss, so dass auf je zwei Atome Wasserstoff ein Atom
Sauerstoff (H2O) gerechnet wird (dem sogenannten
stöchiometrischen Verhältniss), unter einander verbunden
sind. Wird letztere Ansicht auch auf die sogenannten organischen
Körper ausgedehnt, so dass diese als zusammengesetzt aus einfachen
Stoffen gedacht werden, welche unter andern Verhältnissen die
Bestandtheile unorganischer Körper ausmachen z. B. aus Sauerstoff,
Wasserstoff, Kohlenstoff und hauptsächlich Stickstoff, so
schwindet zwar der qualitative Unterschied zwischen belebten und
unbelebten Körpern, aber derjenige zwischen den einfachen
Körpern bleibt bestehen d. h. die Atome des Sauerstoffs sind nach
wie vor qualitativ verschieden von jenen des Wasserstoffs, die des
Azots von jenen des Carbons u. s. w. Zeigen nun Körper, ungeachtet
die qualitativen Bestandtheile derselben die nämlichen sind,
dennoch verschiedene Eigenschaften (die sogenannte Isomerie), so
werden, da diese Verschiedenheit nicht mehr aus der Verschiedenheit der
qualitativen Beschaffenheit der Elemente sich erklären lässt,
quantitative Verschiedenheiten der (qualitativ gleichen) Körper
und zwar solche, welche entweder aus dem arithmetischen Gesichtspunkt
der Menge oder aus dem geometrischen der (räumlichen) Lage der
Elemente entlehnt sind, zur Erklärung herangezogen. (Wie dies z.
B. bei der Weinsteinsäure, welche auf die Polarisationsebene des
Lichtes eine drehende Wirkung ausübt, bei der Thatsache der Fall
ist, dass eine Gattung derselben unter übrigens ganz gleichen
Verhältnissen jene Ebene nach rechts, eine andere dagegen dieselbe
nach links dreht. In diesem Falle wird angenommen, dass die Atome der
rechtsdrehenden Weinsteinsäure [187]eine Lagerung nach
rechts, jene der letzteren eine solche nach links besitzen.)
303. Das Charakteristische der quantitativen Atomistik
besteht darin, dass sie diejenige Hypothese, welche die qualitative nur
in Ausnahmsfällen, wie z. B. in jenem der Isomerie, zu Hilfe ruft,
der gesammten Erklärung der Körperwelt als alleinige zu
Grunde legt. Während dieser zufolge die Verschiedenheit der
Körper in der Regel auf der qualitativen Verschiedenheit ihrer
Elemente d. h. auf der Verschiedenheit ihres Stoffes und nur in einigen Fällen auf der
Verschiedenheit der Zusammensetzung ihrer übrigens gleichen
Elemente d. i. auf jener der Form beruht, macht
jene letztere Ausnahme zur Regel d. h. betrachtet die Isomerie als eine
Grund- und gemeinsame Eigenschaft aller sonst wie immer unterschiedenen
Körper und leitet sämmtliche Verschiedenheiten der letztern
ausschliesslich aus der Verschiedenheit ihrer Zusammensetzung aus
übrigens gleichen Elementen d. i. aus der Form ab. Ihr zufolge
sind daher nicht nur die Elemente des belebten nicht von jenen des
unbelebten Körpers, sondern auch die Elemente irgend eines
einfachen Stoffes nicht von jenen jedes beliebigen andern Stoffes
verschieden. Letzteres setzt voraus, dass die gleichwol unbestreitbare
Unterschiedenheit sowol der nächsten — durch die Analyse
organischer Körper erreichbaren — Bestandtheile von den
— durch Analyse sogenannter unorganischer Körper
darstellbaren — Stoffen (z. B. des Eiweissstoffes, des
Proteïns, des Caffeïns, Theïns u. dgl. von Oxygen,
Hydrogen, Gold, Eisen, Platin u. s. w.) wie die gleichfalls unleugbare
Unterschiedenheit der einfachen Stoffe selbst gleichwol nur eine
scheinbare, der Grund derselben lediglich in der verschiedenen Art der
Verbindung ursprünglich durchaus homogener Elemente zu einem
Ganzen zu suchen, der sogenannte organische Körper zwar in seinen
nächsten und näheren, keineswegs aber in seinen entfernten
und entferntesten Bestandtheilen von den unbelebten unterschieden, so
wie dass die ganze bekannte und noch zu ergänzende Reihe
sogenannter einfacher d. i. weiter nicht zerlegbarer Stoffe nur als
eine Reihe der Form nach unterschiedener Umbildungen eines einzigen
(sei es eines der bereits bekannten Stoffe oder eines bisher
unbekannten Stoffes) anzusehen sei. Erstere Behauptung, die der
stofflichen Identität der lebendigen und leblosen Körper, hat
in der Naturwissenschaft unserer Tage bereits weite Verbreitung
gefunden; letztere Behauptung, welche auf einem weiten Umwege in
exacter Weise die Ansicht der Urmutter der Chemie, [188]der
Alchymie, von der Transformationsfähigkeit der verschiedenen
Körper in einander erneuert, hat in der sogenannten
„Philosophie der Chemie” (J. B. Dumas) ihren Platz und
durch die Aufstellung der sogenannten Typentheorie und die Entdeckung der sogenannten typischen
Körper, durch welche von Einigen die grosse Zahl der bisher als
einfach angenommenen Stoffe bereits bis auf acht herabgemindert scheint
(Ciancian), bereits eine empirische, wenigstens annähernde
Bestätigung erhalten.
304. Die Aufgabe einer logischen Uebersicht des
empirischen Stoffs kann es nicht sein, über die Geltung der einen
oder der andern beider entgegengesetzten Formen der Atomistik,
über welche nur Thatsachen zu entscheiden vermögen, einen
Ausspruch zu thun. Die logische Consequenz d. i. die innere
Uebereinstimmung mit der durch die philosophische Wissenschaft vom
Wirklichen gelegten realen Grundlage der phänomenalen Welt hat,
wie es augenscheinlich ist, die quantitative Atomistik in höherem
Grade als die qualitative für sich. Ist es überhaupt richtig,
dass die vielen unbedingt gesetzten einfachen Wirklichen unter einander
die kleinste denkbare qualitative Verschiedenheit d. i. keine andere
besitzen als diejenige, welche in deren räumlichen und zeitlichen
Bestimmtheiten sich ausdrückt, so ist es nur folgerichtig, auch
die Gesammtheit der letzten realen Elemente, welche zusammengenommen
den Stoff der Körperwelt ausmachen, der physikalischen Atome, als
einen Inbegriff qualitativ gleichartiger Elementarbestandtheile der
Körper zu betrachten. Das elementare Atom, dessen Qualität
eben diejenige des einzigen wirklichen Grundstoffs ist, wird sodann
gleichsam die unterste Stufe einer aufsteigenden Reihe bilden, als
deren einzelne Glieder nach einander die Atome der bisher sogenannten
einfachen Stoffe (das Sauerstoff-Atom, das Stickstoff-Atom, das
Gold-Atom u. s. w.) auftreten würden, deren jedes für sich
durch eine eigenthümliche Combination, sei es von Atomen des
Urstoffs, sei es von solchen, die selbst schon durch dergleichen
gewonnen wären, repräsentirt würde. Die Aufstellung
dieser Reihe, welche die übliche Zerlegung organischer und
unorganischer Körper in deren sogenannte einfache Bestandtheile
über die Grenze der bis zu diesem Augenblicke als einfach
betrachteten Stoffe hinaus durch die erreichte oder doch versuchte
Zerlegung dieser selbst bis zu dem schlechterdings letzten nicht blos
relativ, sondern absolut einfachen Grundstoff ausdehnt, würde
sodann das Ziel der Chemie als Wissenschaft ausmachen. [189]
305. Wie der quantitativen Atomistik für die
stoffliche Beschaffenheit sämmtlicher Elemente der Körperwelt
eine einzige Qualität, so genügt ihr für die Art und
Weise des Wirkens derselben ein einziges Gesetz; die qualitative
Atomistik, insofern sie eine Mehrheit qualitativ unterschiedener
Classen körperlicher Bestandtheile zulässt, bedarf für
die qualitativ verschiedene Art des Wirkens jeder einzelnen derselben
eben so vieler specifisch verschiedener Gesetze. So lange die Elemente
organischer Körper selbst als organisch, die unorganischer
Körper dagegen als unorganisch gelten, kann das Gesetz, welches
das Wirken der erstern, mit jenem, welches das der letzteren
beherrscht, so wenig wie das Wirken jener „lebendigen”
Elemente (die Lebenskraft) mit jenem der „leblosen”
Elemente (der todten Naturkraft) identisch sein. Eben so wenig kann das
Wirken, welches seinen Grund in der qualitativen Verwandtschaft
(Affinität) der Körper hat (chemische Anziehung) das
nämliche sein mit demjenigen, das auch bei völliger
Nichtverwandtschaft (Disparatheit, Heterogeneität) der Körper
erfolgt (mechanische Anziehung) und folglich eben so wenig das Gesetz,
welches jenes (Affinitätsgesetz, Wahlverwandtschaft), identisch
mit demjenigen, welches dieses regelt (Gravitationsgesetz, Schwere).
Mit der Aufhebung qualitativer Verschiedenheit der Körper tritt
der umgekehrte Fall ein. Das Gesetz, welches das Wirken der Elemente
organischer Körper bestimmt, braucht fortan von demjenigen, von
welchem das Wirken der Elemente unorganischer Körper abhängt,
eben so wenig verschieden zu sein, als das Wirken, das seinen Grund in
der Verwandtschaft der Körper hat, als das Wirken der
ursprünglichen Elemente d. h. als dasjenige betrachtet werden
kann, für welches Gleichartigkeit oder Ungleichartigkeit derselben
gleichgiltig und das daher eben so wenig durch die qualitative
Aehnlichkeit wie durch den qualitativen Gegensatz der Körper
bedingt ist. Sind die Elemente belebter und unbelebter Körper
qualitativ dieselben, so ist auch deren Wirken und folglich dessen
Gesetz dasselbe; ist das Wirken in Folge der Verwandtschaft nicht
dasjenige der ursprünglichen Elemente, so ist auch dessen Gesetz
nicht mit dem Gesetz des Wirkens dieser letzteren, und da diese die
wahren, weil letzten Elemente der Körper sind, nicht mit jenem der
wahren Körperelemente identisch. Wird daher, wie die quantitative
Atomistik thut, auf die in der That letzten Bestandtheile der
Körperwelt, die unter einander qualitativ nicht weiter
unterschiedenen Atome zurückgegangen, so muss das Gesetz, welches
das Wirken dieser letzteren [190]regelt, das nämliche und
einzige für das Wirken der gesammten Körperwelt sein. Die
Aufstellung dieses Gesetzes, welches die Zerlegung der scheinbar unter
einander grundverschiedenen Wirkungsweisen der scheinbar von einander
qualitativ unterschiedenen Körper bis zur Auflösung der
ersteren in die überall in gleicher Weise erfolgende Wirkungsweise
der wahren d. i. in allen Körpern qualitativ identischen Elemente
der Körperwelt verfolgt und dadurch die gesammte phänomenale
Welt als unter der Herrschaft eines und desselben, wenn gleich nicht
selten in so verwickelter Form auftretenden Gesetzes, dass es den
Anschein eines neuen Gesetzes erhält, stehend erweist, müsste
das Ziel der Physik als mechanischer Wissenschaft ausmachen.
306. Als dieses Gesetz sieht die moderne
Naturwissenschaft das Gravitationsgesetz Newton’s an. Die
philosophische Wissenschaft vom Wirklichen bestimmt, wie oben gezeigt,
das Wirken der Atome als eine Function ihres räumlichen Abstandes
von einander. Die empirische geht über diese Allgemeinheit des
Inhalts hinaus und bestimmt letztere näher als Abnahme des Wirkens
im Quadrate der Entfernung. Dieselbe bleibt jedoch keineswegs bei der
Bestimmung des Wirkens seinem Quantum nach stehen, sondern schreitet zu
der Erweiterung derselben seinem Quale nach fort, indem sie dasselbe in
den relativ grössten Abständen der Atome von einander als
Anziehung, Attraction, in den relativ kleinsten als Abstossung,
Repulsion charakterisirt. Erstere bewirkt, dass die Atome auch in den
relativ weitesten Abständen von einander noch zusammengehalten,
letztere macht, dass dieselben in Eins zusammen zu fallen verhindert
werden. In Folge der Attraction bilden sämmtliche durch dieselbe
an einander geknüpfte Atome ein nicht nur in Gedanken, sondern
durch ein physisches Band zusammenhängendes Ganzes; in Folge der
Repulsion bilden dieselben, weil die letztere die Annäherung der
Atome an einander über das Mass einer gewissen (kleinsten)
Entfernung hinaus unmöglich macht, ein discretes Ganzes.
Während der Raum, der philosophischen Wissenschaft vom Wirklichen
zufolge, demnach stetig mit „philosophischen” Atomen d. i.
im strengsten Sinne des Wortes einfachen Wirklichen erfüllt
gedacht werden muss, erscheint derselbe in der empirischen Wissenschaft
vom Wirklichen nur in der Weise mit „physikalischen” Atomen
d. i. mit im physikalischen Sinn letzten Elementen der Körperwelt
erfüllt, dass zwischen je zwei derselben leerer Raum d. h. ein
Zwischenraum vorhanden ist, in dem keine weiteren [191]„physikalischen” Atome sich
befinden. Dass mit der Einschiebung desselben die Schwierigkeit des
Begreifens einer actio in distans d. i. eines Wirkens durch den leeren
Raum hindurch wiederkehrt, pflegt, da dieselbe ja nur eine
„philosophische” ist, der empirischen Physik selten
Verlegenheit zu bereiten.
307. Dagegen hat sich dieselbe auf Grund der sogenannten
„Imponderabilien” veranlasst gesehen, durch die
Einführung eines weiteren gleichfalls körperlichen, jedoch,
mit den physikalischen Atomen verglichen, relativ
„unkörperlichen” Stoffs, des sogenannten
„Aethers”, in die leer gelassenen Zwischenräume der
physikalischen Atome, welche letzteren in demselben gleichsam, wie die
Sterne am Firmament, zerstreut zu schweben, oder, wie die Fische im
Wasser, in unregelmässigen Abständen zu schwimmen scheinen,
der Ansicht der philosophischen Wissenschaft vom Wirklichen von dem
stetigen Erfülltsein des Raumes durch einfache Wirkliche, um einen
beträchtlichen Schritt näher zu kommen. Die Elemente
desselben, die sogenannten Aetheratome, verhalten sich zu den
physikalischen gleichsam wie Atome zweiter zu solchen erster Ordnung.
Dieselben werden zwar eben so wenig wie diese ohne leere
Zwischenräume, letztere selbst aber werden im Verhältniss zu
diesen als „unendlich klein” und das von den Aetheratomen
ausgehende Wirken wird zwar gleichfalls wie das der Körperatome
als Anziehung und Abstossung, jedoch als nur in der kleinsten
Entfernung wirksam vorgestellt. Jedes Körperatom erscheint wie von
Aetheratomen eingehüllt, welche dasselbe in Gestalt einer
Sphäre von allen Seiten umgeben und mit jenem zusammen unter der
Form winziger Kügelchen, deren vergleichsweise dichten Kern das
Körperatom, deren dünnere Peripherie die Aetheratome
ausmachen, die reale durch den Raum discret vertheilte Grundlage der
sogenannten Materie bilden.
308. Je nachdem die erfahrungsmässig gegebenen
Phänomene der körperlichen Welt auf die Körperatome
allein ohne Berücksichtigung des deren Zwischenräume
ausfüllenden Aethers, oder auf die Aetheratome allein als
Bestandtheile des die Zwischenräume der physikalischen Atome
ausfüllenden Stoffs zurückgeführt werden, ergeben sich
zwei Hauptclassen physischer Phänomene, deren eine das Wirken und
die Zustände des im engern Sinn sogenannten körperlichen
Stoffs, die andere das Wirken und die Zustände des Zwischenstoffs
d. i. des Aethers umfasst. Jene begreift, je nach der Grösse der
Abstände der Körperatome unter einander und der davon
abhängigen Menge dieser letzteren selbst innerhalb [192]bestimmter räumlicher Grenzen (Volumen),
dreierlei Gattungen von Körpern, deren eine bei einem gewissen
Volumen die relativ grösste, deren dritte bei demselben Volumen
die relativ kleinste Menge von Körperatomen enthält,
während die zweite eine im Verhältniss zu jenem Volumen
mittlere Menge von Atomen einschliesst. Folge davon ist, dass in den
Körpern der ersten Gattung die Abstände der einzelnen Atome
von einander relativ die kleinsten, dagegen bei Körpern der
dritten Gattung relativ die grössten sein müssen,
während bei den Körpern der Mittelgattung die Distanz der
Atome eine mittlere ist. Die Atome von Körpern der ersten Gattung
werden daher, da die anziehende Kraft je kleiner die Entfernung desto
stärker wirkt, am festesten, die Atome von Körpern der
dritten Gattung werden, da die Anziehung mit der Entfernung abnimmt, am
lockersten unter einander zusammenhängen; die Atome der
Körper der Mittelgattung werden, da die Entfernung und folglich
die Anziehung eine mittlere ist, einen mittleren Grad des Zusammenhangs
darstellen. Bei Körpern der ersten Art wird daher nicht nur das
Verhältniss der Menge der Atome (der Masse) zu der räumlich
begrenzten Grösse des Inhalts (dem Volumen) d. i. die relative
Dichtigkeit die grösste, sondern auch der
Widerstand, welchen dieselben der Trennung der Atome entgegensetzen, in
Folge der starken Anziehung der Theile unter einander (der
Cohäsion) der relativ bedeutendste, bei Körpern der dritten
Art dagegen aus demselben Grunde die Dichtigkeit die geringste und der
Widerstand gegen die Trennung der mindestbedeutende sein, während
den Körpern der zweiten Art mit einer mittleren Dichtigkeit auch
ein mittlerer Widerstand d. h. ein solcher, welcher die Trennung der
Atome weder erschwert noch erleichtert, also gegen dieselbe sich
gleichgiltig verhält, eigen ist. Körper der ersten Art, als
deren Repräsentant die Erde angesehen wird, werden als feste,
Körper der dritten Art, als deren Repräsentant die
atmosphärische Luft gilt, als luft- oder gasförmige,
Körper der mittleren Art, deren Typus das Wasser darstellt, werden
als flüssige bezeichnet.
309. Weder die Grösse des räumlichen Volumens,
noch jene der Masse, oder der Abstände der Atome von einander,
absolut betrachtet, macht hiebei einen Unterschied. Das Gesetz, welches
die Atome der grossen Weltkörper, der Nebelflecke und Sternhaufen
zusammenhält, ist genau das nämliche, welches auch die Atome
des kleinsten Bruchtheils eines festen Körpers auf der Erde an
einander bindet; die Atome des Weltmeeres hängen in keiner
[193]andern Weise zusammen, als jene des
Wassertropfens; und die Atmosphäre, welche entfernte
Weltkörper umhüllt, ja die ganze durch den Weltraum
ausgebreitete, verdünnte Luftmasse zeigt mit jener der irdischen
Lufthülle verglichen nur graduell verschiedene Structur. Zwischen
den drei genannten Gattungen von Körpern aber herrscht dabei das
Verhältniss, dass einerseits der luftförmige Körper
durch Verminderung der Abstände seiner Atome unter einander
zuerst, wenn dieselbe den mittleren Grad der Entfernung erreicht, in
flüssigen, wenn sie denselben überschreitet, allmälig in
festen Zustand übergehen d. h. sich verdichten, umgekehrt der
feste Körper durch Vergrösserung jener Abstände
seinerseits in flüssigen und allmälig in luftförmigen
Zustand übergehen d. h. sich verdünnen kann. Je nachdem
hiebei die zeitliche Aufeinanderfolge der genannten Zustände
verschieden, also entweder der feste, oder der luftförmige, oder
der flüssige als der (zeitlich) erste gedacht wird, aus welchem
die andern sich entwickelt haben, so dass im ersten Fall aus der
Verdichtung allmälig die Verdünnung, im zweiten aus der
Verdünnung allmälig (durch Niederschlag) die Verdichtung, im
dritten aus einer mittleren Dichtigkeit durch Verdichtung einerseits
das Feste, durch Verdünnung andererseits das Luftförmige
hervorgeht, gliedern sich die verschiedenen physikalischen Kosmogonien,
als deren Repräsentanten schon im Alterthum erscheinen: die
Atomistiker, welche das Feste (die körperlichen Atome), die
jonischen Naturphilosophen Anaximenes und Diogenes von Apollonia,
welche das Luftartige, und Thales, welcher das Flüssige für
das der Zeit nach Erste erklärten, aus dem alles Uebrige
entstanden sei.
310. In allen genannten Fällen ist die Verbindung
der Atome unter einander eine mechanische, durch ein und dasselbe
allgemeine Gesetz der Anziehung nach dem umgekehrten Quadrate der
Entfernung beherrschte, welche so lange besteht, als dieses seine
Geltung behauptet, und daher jeder willkürlichen Aufhebung, sie
komme von welcher Seite immer, entzogen ist. Die zum Körper
vereinten Atome erscheinen unter der Pression dieses Gesetzes selbst zu
einem mehr oder minder lockern Gefüge comprimirt, also gleichsam
einem von aussen kommenden Drucke unterworfen. Die Elemente der
Körper selbst stellen zusammengenommen einen durch Vereinigung
(Association) entstandenen räumlich begrenzten Haufen, eine Menge
gemengter (nicht gemischter) Bestandtheile dar, deren jeder
undurchdrungen von dem andern und undurchdringlich für die
[194]andern für sich und zugleich im Verbande
mit den andern als Glied eines physischen Ganzen besteht. Auf
qualitative Verschiedenheit der zum Ganzen des Körpers verbundenen
Theile konnte bisher schon aus dem Grunde keine Rücksicht genommen
werden, weil die quantitative Atomistik eine solche bei den
ursprünglichen Elementen der Körperwelt, den primitiven
Körperatomen, nicht kennt. Soll daher dennoch von qualitativ
unterschiedenen Elementen der Körper die Rede sein, so können
diese nicht selbst primitiv, sondern sie müssen aus der allerdings
primären Verbindung primitiver Atome gleichsam als Atome
höherer Ordnung entstanden sein. Von dieser Art wären, wenn
die Ansicht der quantitativen Atomistik die richtige und die darauf
fussende Behauptung der „philosophischen” Chemie, dass alle
scheinbar heterogenen Stoffe Umbildungen eines Grundstoffs seien,
giltig sein sollte, die bisher sogenannten einfachen Stoffe d. i.
Körper wie Sauerstoff, Wasserstoff, Kohlenstoff u. s. w.
aufzufassen, deren jeder demzufolge aus Atomen bestehend gedacht
würde, welche selbst eine eigenartige Gruppirung der primitiven
Atome in sich schlössen. Das sogenannte Sauerstoffatom wäre
sonach zwar im Verhältniss zu dem sogenannten Kohlenstoffatom,
keineswegs aber im Verhältniss zu den primitiven Atomen als
wirklich atom d. i. als theillos zu bezeichnen, da dasselbe zwar eben
so wenig aus weiteren Sauerstoffatomen wie das Kohlenstoffatom aus
weiteren Kohlenstoffatomen, keineswegs aber, wie es im Begriff des
primitiven Atoms liegt, überhaupt nicht aus weiteren Atomen
bestehend gedacht wird. Wie das primitive einfaches, so wäre
demnach das Sauerstoffatom zusammengesetztes d. i. aus zu einem Ganzen
verbundenen primitiven Atomen bestehendes Atom (Molecul) und der
(feste, flüssige oder luftförmige) Körper, bei dessen
Zusammensetzung die qualitative Beschaffenheit seiner Bestandtheile in
Frage kommt, ist sonach als ein in seinen nächsten Bestandtheilen
nicht aus einfachen, sondern aus zusammengesetzten Atomen bestehender
anzusehen.
311. Wie die Verbindung der Atome im mechanisch
zusammengesetzten Körper eine mechanische, so ist sie in dem
chemisch zusammengesetzten Körper, derselbe bestehe nun aus
einander homogenen oder heterogenen Elementen, eine chemische, auf der
Anziehung derselben in Folge ihrer qualitativen Verwandtschaft
(Affinität) beruhende. Dieselben stehen wie die Bestandtheile des
mechanischen Körpers unter der Herrschaft eines allgemeinen
Gesetzes, nur dass dieselbe nicht sowol, wie dort, einem von aussen
[195]ausgeübten Drucke,
als vielmehr einem von innen aus der Beschaffenheit der Atome
stammenden Zuge sich vergleichen lässt,
vermöge dessen die Atome wie Glieder einer und derselben Familie
sich zu einander hingezogen, oder wie Glieder heterogener Rassen (z. B.
Weisse und Farbige) sich von einander abgestossen fühlen. Wie die
Verbindung blutsverwandter Familienglieder eine innigere ist als die
blos gesellige Zusammenkunft einander gleichgiltiger Genossen, so ist
die chemische Vereinigung qualitativ Verwandter inniger, als jene blos
mechanische indifferenter Atome und wird deshalb als Verschmelzung im
Gegensatz zur blossen Summation, als „Mischung” im
Gegensatz zur blossen Mengung bezeichnet. Letzterer Ausdruck ist
insofern ungenau, als er zu dem Irrthum verleiten kann, eine
völlige „Durchdringung” der einzelnen Atome als
möglich anzunehmen, während doch nur eine
„Durchdringung” der sich unter einander verschmelzenden
Körper (z. B. Kohlenstoff und Sauerstoff zu Kohlensäure) in
der Weise stattfindet, dass mit jedem Atom des ersteren zwei Atome des
letzteren sich verbinden, also ein neues Gemenge gleichsam höherer
Art entsteht, dessen Atome je eine binäre Verbindung zwischen O
und C darstellen, die einzelnen, sowol Kohlenstoff- als
Sauerstoffatome, dagegen für einander undurchdringlich
bleiben.
312. Sowol der mechanisch wie der chemisch
zusammengesetzte Körper hat die Eigenschaft, dass, sobald der
dessen Bestandtheile zusammenhaltende Druck oder Zug aus was immer
für einem Grunde erlischt, derselbe in seine Elemente zerfallen
oder sich auflösen muss. Wird statt dessen auf Grund einer im
Körper selbst enthaltenen Veranlassung jene zusammenhaltende Kraft
ununterbrochen erneuert, entweder indem überhaupt neuer Stoff,
welchem dieselbe Anziehung, oder neuer qualitativ verwandter Stoff,
welchem derselbe Zug innewohnt, von neuem herbeigeschafft wird, so
entsteht im Gegensatz zu jenem aus Mangel an Erneuerung abgestorbenen
leblosen (unorganischen) der belebte (organische) Körper. Die
Eigenthümlichkeit, welche denselben von dem mechanischen
Körper unterscheidet, besteht darin, dass der letztere, sobald die
Bestandtheile desselben durch andere ersetzt werden, nicht mehr
derselbe, sondern ein neuer, wenngleich dem vorigen gleicher, der
organische Körper dagegen auch nach dem Ersatz derjenigen seiner
Bestandtheile, deren Anziehung unter einander erloschen ist, durch
andere, noch immer derselbe wie früher d. h. ein blos erneuerter
ist. Die Eigenthümlichkeit, welche denselben vom chemischen
Körper [196]unterscheidet, dagegen besteht darin, dass der
organische Körper niemals, wie der einfache chemische homogen,
sondern stets heterogen d. h. aus verschiedenen Stoffen zusammengesetzt
sein muss, aber nicht, wie andere chemische Körper, aus beliebigen
(z. B. Wasser aus Sauerstoff und Wasserstoff, atmosphärische Luft
aus Sauerstoff und Stickstoff, Kalk aus Calcium und Sauerstoff,
Kochsalz aus Chlor und Natrium), sondern jedesmal nur aus gewissen
Stoffen zusammengesetzt sein darf. Folge der ersteren Eigenschaft ist,
dass ein Theil des organischen Körpers, nämlich derjenige, in
dem die Veranlassung liegt, dass sich der übrige Theil ohne
Schädigung des Ganzen zu erneuern vermag, diesem letzteren
gegenüber eine ausgezeichnete Stellung behauptet, insofern er den
bleibenden, dieser dagegen den wechselnden Bestandtheil des
Körpers ausmacht, jener also denjenigen, durch welchen der
Körper immer derselbe bleibt, dieser denjenigen, durch welchen
derselbe unaufhörlich ein anderer wird. Folge der letzteren
Eigenschaft ist, dass, wo gewisse einfache chemische Körper
mangeln, als welche die Erfahrung bisher Sauerstoff, Wasserstoff,
Stickstoff und hauptsächlich Kohlenstoff hervorzuheben gelehrt
hat, die Entstehung organischer Körper, auch wenn alle
übrigen Bedingungen und die grösste Fülle anderweitiger
chemischer Körper vorhanden wäre, unmöglich ist. Finden
beide Bedingungen vereinigt bei der kleinstmöglichen Anzahl
körperlicher Atome Erfüllung, so entsteht der denkbar
kleinste belebte Körper, das organische Atom, die sogenannte
Zelle, während aus der Verbindung von solchen, sei es mit, sei es
ohne Zuhilfenahme unorganischer Bestandtheile, der Zellenorganismus d.
i. der — wie der mechanische Körper aus mechanisch
verbundenen mechanischen, wie der chemische Körper aus chemisch
verbundenen chemischen, so aus organisch verbundenen organischen
Elementen bestehende — organische Körper hervorgeht.
313. Die ausgezeichnete Stellung des beharrenden Theils
gegenüber dem wechselnden im belebten Körper äussert
sich nicht blos darin, dass er selbst (er sei nun ein einzelnes Atom
oder eine Gruppe von solchen) während der ganzen Dauer des
organischen Körpers (Lebensdauer) immer derselbe bleibt, sondern
auch darin, dass in ihm die Ursache enthalten ist, um welcher willen
und durch welche nicht nur stets neuer und zwar zu seiner Erhaltung
passender Stoff (Leibesnahrung) herbeigeschafft, sondern auch der
Neuheit des Materiales zum Trotz die ursprüngliche Form
(Leibesform) im Wesentlichen unverändert erhalten wird. Derselbe
stellt [197]daher gleichsam den beherrschenden Mittelpunkt
(„die Seele”) dar, zu welchem die Gesammtheit des
übrigen den Körper jeweilig ausmachenden Stoffs sich als
beherrschtes, zur Erhaltung des Ganzen verbrauchbares Material
(„als Leib”) verhält. Da derselbe beherrschend nur im
Verhältniss zu dem von ihm Beherrschten, mit dem Aufhören der
Herrschaft aber zwar Beherrschendes wie Beherrschtes nach wie vor
vorhanden, aber nicht mehr als Herrscher und Beherrschtes vorhanden
sind, so hört mit dem Erlöschen des organischen Bandes
zwischen der „Seele” und dem „Leibe” des
belebten Körpers d. i. mit dem Tode auch der bisher herrschend
gewesene Bestandtheil desselben auf, Seele eines Leibes, wie der bisher
beherrscht gewesene Bestandtheil desselben aufhört, Leib einer
Seele zu sein; das Atom oder die Atome, welche bisher den bleibenden,
so wie diejenigen, welche bisher den jeweiligen veränderlichen
Bestandtheil des organischen Körpers ausgemacht haben, hören
jedoch dadurch keineswegs auf, als Atome d. i. zwar aus ihrer
bisherigen Verbindung ausgelöst, aber fähig und bereit, neue
Verbindungen einzugehen, sei es wieder als „Seele” eines
Leibes (Metempsychose) oder als Leibtheil einer Seele (Palingenesie),
zu existiren.
314. Je nachdem der organische Körper als am Orte
haftend, oder mit der Fähigkeit begabt, denselben beliebig zu
wechseln, so wie, je nachdem derselbe als sich oder anderes vorstellend
oder überhaupt nicht als vorstellend gedacht wird, wird derselbe
im ersten Falle, da die Erfahrung an der sogenannten Pflanze weder
freie Bewegung, noch Zeichen vorstellender Thätigkeit aufweist,
als pflanzenartiger, im zweiten Fall, da die
Erfahrung am sogenannten Thiere zwar freie Beweglichkeit, aber
(wenigstens bei den niedersten Thiergattungen) keine Spur von
vorstellender Thätigkeit zeigt, als thierartiger, im dritten Fall, wenn sich nicht nur die
Fähigkeit, anderes, sondern (wie schon bei den höheren
Thiergattungen) sogar die Fähigkeit äussert, bis zu einem
gewissen Grade sich selbst vorzustellen, da die Erfahrung letztere
Eigenschaft (die Vorstellung des Ich) hauptsächlich am Menschen
kennt, als menschenähnlicher bezeichnet
werden. Mit dem Erwachen des Ich d. i. derjenigen Vorstellung, durch
welche der belebte Körper andere, sei es belebte oder leblose
Körper, von sich unterscheidet d. h. als Anderes als er selbst,
als Nicht-Ich sich gegenüberstellt und dadurch sich zu diesem und
dieses zu sich in ein Verhältniss bringt, welches je nach dem Mass
seiner im Vergleich zu der Kraft jenes Andern und nach der
Beschaffenheit seiner Bedürfnisse im Vergleich [198]zu
den Bedürfnissen jenes Andern zu einem überlegenen oder
unterliegenden, zu einem freundlichen oder feindseligen, zu friedlichem
Genuss oder zum Kampfe ums Dasein werden kann, ist das Reich des
Bewusstlosen, des Nicht-Ich, abgeschlossen.
315. Wie die Atome, so üben auch die Körper
eine Wirksamkeit auf einander aus, welche je nach der Beschaffenheit
derselben entweder mechanischer, chemischer oder organischer Art ist.
Erstere äussert sich als Schwere, indem ein Körper den andern
vermöge seiner überlegenen Masse, die zweite als
Wahlverwandtschaft, indem ein Körper den andern vermöge
seiner innigeren Verwandtschaft, die dritte als Geschlechtsneigung,
indem ein Körper den andern in Folge des geschlechtlichen
Gegensatzes an sich zieht. Wie durch die erstere eine Ablenkung des
angezogenen Körpers, wenn derselbe bewegt ist, von seiner
ursprünglichen Richtung, wenn er unbewegt ist, eine
Annäherung an den Ort des anziehenden Körpers, in beiden
Fällen jedoch, wenn kein anderweitiges Hinderniss, z. B. die
widerstrebende Eigenbewegung des angezogenen Körpers, dazwischen
tritt, eine Vereinigung des angezogenen mit dem anziehenden und dadurch
eine Vergrösserung der Masse des letzteren herbeigeführt
wird, so wird durch die zweite eine Auflösung der bisherigen
Verbindung des angezogenen Körpers und die Entstehung einer neuen
Verbindung durch die Verschmelzung desselben mit dem anziehenden
veranlasst, auf dem dritten Wege aber durch die organische Vereinigung
zweier geschlechtlich entgegengesetzten belebten Körper ein neues
organisches Individuum auf Kosten und aus dem Stoffe der Zeugenden
erzeugt. Jene, die mechanische Anziehung associirt bisher getrennte
Körper zu einem neuen, welcher dieselben in sich begreift; die
zweite trennt nicht zusammengehörige Körper, die vereinigt,
und führt zusammengehörige zusammen, die getrennt waren; die
dritte leitet aus bisher vereinzelt gestandenen organischen Individuen
durch Zusammenschluss derselben ein neues, in keinem derselben für
sich allein, aber in beiden zusammengenommen wol- und
vollbegründetes Individuum ab. Das Wirken der ersten wie der
zweiten Art bringt als producirende Thätigkeit zwar nicht dem
Stoff, aber der Form nach neue Körper, die letztgenannte als
reproducirende weder dem Stoff, noch der Form nach neue, sondern
denjenigen, aus welchen sie entstanden sind, gleiche Körper d. h.
sie bringt das in der Zeugung untergegangene in einem neuen Individuum
wieder hervor. Während durch die erstere, die schaffende
(„die Phantasie der physischen Welt”) Thätigkeit der
[199]gegebene Stoff in vorher nicht gegebener Gestalt
umgebildet, wird durch die letztere, die fortpflanzende („das
Gedächtniss der Materie”) Thätigkeit die Spur des
einmal vorhanden Gewesenen in allem Folgenden mehr oder minder getreu
aufbewahrt und dessen Andenken durch dasselbe erneuert. Auf ersterem
Wege bilden sich aus dem im Weltraum gleichmässig vertheilten
Stoffe durch locale Verdichtung frei schwebende, sogenannte
„kosmische Wolken”, durch Anhäufung desselben um einen
dichtern Kern sogenannte „Nebelflecke” und
„schweifende Kometen”; wachsen durch Vereinigung kleinerer
Weltkörper allmälig jene im Weltraum zerstreuten Massenkugeln
heran, die andern als Central- und, wie es das Niederstürzen von
Sternschnuppen und Meteorsteinen auf deren Oberfläche beweist, zum
Sammelpunkte dienen. Auf dem zweiten Wege bildet sich jener
wirthschaftliche Haushalt in der Natur, durch welchen die von den
pflanzlichen Organismen aufgenommene Kohlensäure im Inneren
derselben zersetzt, der Kohlenstoff zurückbehalten und der
Sauerstoff durch die Lungen der Pflanze, die Blätter, ausgeathmet,
von den thierischen Organismen dagegen eingeathmet und in den Lungen
zur Oxydirung des Blutes verwendet wird. Auf dem letztgenannten Wege
endlich werden wenigstens in den höheren pflanzlichen und
thierischen Gattungen die unzähligen Nachkommen gezeugt,
während auf den niederen Stufen der vegetabilischen Organismen die
Fortpflanzung durch Keimzellen (Sporen) und Sprossen, bei den
animalischen durch Theilung und Zerfällung der ursprünglich
zu einem einzigen vereinigt gewesenen in mehrere selbstständige
Individuen die Stelle der sexualen Generation vertritt.
316. Wie die Atome, so sind die Körper in
verschiedenen regelmässigen oder unregelmässigen
Abständen durch den Weltraum ausgestreut, so dass einzelne
derselben unter einander, wie die Atome zu Körpern, so die
Körper zu Systemen und weiter diese selbst wieder zu ihrerseits
unter sich zu einem Ganzen verknüpften Aggregaten von Systemen
gehören, während andere keinem in sich geschlossenen
Körperverband einverleibt, sei es aus dem Gebiet eines in das
eines anderen Körpersystems hinüberstreifen, theils frei
durch den Weltraum irren. Zu den ersteren gehören die Systeme
einzelner Centralkörper mit ihren in ihren Bewegungen von ihnen
abhängigen Begleitern, welche ihrerseits wieder von solchen
begleitet sein können. Dieselben bilden im Weltmeer des mit
Körpern erfüllten Raumes gleichsam „Weltinseln”
und können ihrerseits mit anderen ihresgleichen zu einem
„Inselmeer” d. i. zu einem Archipelagos [200]von
Weltsystemen vereinigt sein. Ein solches bildet allem Anschein nach der
selbst um einen, sei es idealen, sei es realen (nach Mädler Alpha
Herculis) Mittelpunkt gravitirende Weltring der sogenannten
Milchstrasse, von welchem unser Sonnensystem mit seiner Centralsonne,
seinen Planeten und Planetoiden, deren Trabanten und Ringen, sowie mit
den theils gleichfalls ringförmig angeordneten, theils zerstreut
rotirenden Asteroiden, Sternschnuppen und Meteormassen einen
Bestandtheil ausmacht. Der Inbegriff sämmtlicher Weltkörper
bildet das sichtbare Universum, das mechanisch durch das Gesetz der
Gravitation beherrscht und chemisch, wie die Spectralanalyse gezeigt
hat, durchgängig aus solchen Stoffen zusammengesetzt ist, welche
auch auf oder innerhalb der Erde vorkommen. Flüssige und
luftartige Bildungen (Meere und Atmosphären) sind auch auf von der
Erde verschiedenen Weltkörpern beobachtet, dagegen Spuren
organischen Lebens bisher nur auf dieser wahrgenommen worden, daher von
vegetabilischen und animalischen, so wie von menschenähnlichen
Bewohnern erfahrungsgemäß bisher nur auf dieser die Rede
sein kann.
317. Sowol die Zwischenräume zwischen den Welt-, so
wie jene zwischen den festen und flüssigen Körpern auf der
Erde sind von luftartigen Körpern (auf der Erde von einem aus
Sauerstoff und Stickstoff, so wie einigem Ozon bestehenden
Luftkörper, der sogenannten atmosphärischen Luft)
ausgefüllt, deren Gegenwart auch in den scheinbar leeren Theilen
des Weltraums durch die Widerstände, welche bewegte
Weltkörper mittels derselben erlitten haben (z. B. durch die
allmälige Verengung der Bahn des Enke’schen Kometen),
erwiesen ist. Die Zwischenräume der physikalischen Atome werden,
wie oben bemerkt, durch Atome des sogenannten Weltäthers
erfüllt gedacht, auf dessen Zustände diejenigen
Phänomene, welche sonst je specifisch verschiedenen sogenannten
„unwägbaren” Stoffen (Imponderabilien), z. B. die
Lichterscheinungen einem Lichtstoff, die magnetischen einem
magnetischen Fluidum u. s. w. zugeschrieben wurden, nunmehr als auf
deren gemeinsamen Träger zurückgeführt zu werden
pflegen. Dieselben zerfallen in solche, bei welchen die qualitative
Beschaffenheit der Körperatome gleichgültig, und solche
für welche dieselbe bestimmend ist. Zu den ersteren gehören
die Licht- und Wärmeerscheinungen, die sich deshalb (wenngleich in
unzähligen Graden der Abstufung) zwischen und in allen
Körpern des Weltalls vorfinden; zu den letzteren lassen sich die
sogenannten, magnetischen und elektrischen Erscheinungen zählen,
deren erstere [201]an die Gegenwart eines bestimmten chemischen
Stoffs (des Eisens), deren letztere an die Gegenwart und gegenseitige
Berührung mindestens zweier qualitativ heterogener Stoffe (z. B.
Zink und Kupfer) gebunden ist. Der Zustand des Aethers selbst wird als
kleinste periodische Bewegung der Aetheratome (Schwingung) in
verschiedener Menge und Richtung vorgestellt, wobei der Unterschied
stattfindet, dass diejenigen, welche als Träger des
Lichtphänomens angesehen werden, an der Oberfläche der
Körper (mit Ausnahme der durchsichtigen oder durchscheinenden)
stattfinden und diese daher im Inneren dunkel erscheinen, während
diejenigen, welche die Träger des Wärmephänomens sind,
auch im Inneren der Körper statthaben, diese daher je nach dem
Grade derselben innerlich erhitzt oder erkältet erscheinen. Bei
den magnetischen und elektrischen Erscheinungen lässt sich die
Betheiligung des Aethers in der Weise verschieden denken, dass derselbe
in dem Körper, welcher den erforderlichen Stoff, das Eisen
enthält, an zwei entgegengesetzten Enden, den Polen,
angehäuft erscheint, wobei die Erfahrung zeigt, dass gleichnamige
Pole einander abstossen, während bei den elektrischen
Erscheinungen an den zu ihrer Entstehung erforderlichen heterogenen
Körpern der Aether an zwei einander der Richtung nach
entgegengesetzten Enden (+ und -) sich anhäuft, wobei die
Erfahrung zeigt, dass entgegengesetzte Pole sich anziehen. Inwieweit
bei den elektrischen Strömen, von welchen Muskelcontractionen
begleitet zu werden pflegen, sowie bei den Erscheinungen des
sogenannten thierischen Magnetismus und der thierischen
Elektricität eben so wie bei jenen der sogenannten animalischen
Wärme die Betheiligung des Aethers eine Rolle übernehme, muss
um so mehr dahingestellt bleiben, als mit Ausnahme der elektrischen
Muskelströme und der thierischen Wärme die übrigen
sogenannten Thatsachen noch allzu sehr der empirischen Bestätigung
bedürfen. Insofern jene dem Weltäther zugeschriebenen
Phänomene, mit den auf die physikalischen Atome
zurückgeführten Erscheinungen verglichen, dem der groben
Masse der letzteren gegenüber verfeinerten Charakter ihrer
materiellen Grundlage entsprechend selbst einen gleichsam
„vergeistigten” Stempel tragen, sind sie es, welche durch
ihre Gegensätze der Helligkeit und der Finsterniss, der Hitze und
der Kälte, der magnetischen und elektrischen Spannung und
Lösung der Physiognomie der physischen Körperwelt ein an die
wechselnden Stimmungsgegensätze des menschlichen Gemüthes
mahnendes Gepräge aufdrücken und daher als Bilder und
Gleichnisse für die letzteren mit [202]Vorliebe pflegen
verwendet zu werden. Steigern sich dieselben so weit, dass sie namhafte
Veränderungen in der Welt der physischen Körper verursachen,
die Lichterscheinung als Brand, die Wärmeerscheinung als Explosion
oder Eruption, der Magnetismus als magnetisches, der elektrische Strom
als atmosphärisches Ungewitter auftritt, so nimmt deren Wesen eine
an die plötzliche, aber auch vorübergehende Natur der von
unwillkürlichen Körperbewegungen begleiteten
Gemüthserschütterungen, der sogenannten Affecte, an und
liefert für diese („flammender Zorn”,
„leidenschaftlicher Ausbruch”) das treffendste
Gleichniss.
318. Wie dem denknothwendigen das durch die Erfahrung
gegebene Wirkliche, so steht dem denknothwendigen das empirisch
gegebene Wirken gegenüber. Die Vorstellung des letzteren
unterliegt um so mehr logischen Schwierigkeiten, als weder der Begriff
eines Wirkens durch den leeren Raum, wie er durch die discrete
Vertheilung der Atome im Raume gefordert ist, noch der Begriff eines
Dinges, welches eins und zugleich der Träger vielfach sich
ändernden Wirkens, noch endlich jener der Veränderung d. h.
eines Dinges, welches anders geworden und doch dasselbe geblieben sein
soll, und jener der unter den letztgenannten fallenden Bewegung als
Ortsveränderung ohne schwerwiegende kritische Bedenken bleibt.
Erstgenannter ficht durch die Einsicht in die Unmöglichkeit, dass
von dem angeblich Einfachen Theile sich loslösen und durch einen
Sprung über das Leere hinüber einem andern eben so Einfachen
einverleibt werden könnten, streng genommen die Möglichkeit
so wol der Anziehung wie der Abstossung und damit die Basis des
physischen Zusammenhangs unter den Elementen der Körperwelt an.
Die Einheit des Dinges, während dessen Wirken ein vielartiges sein
soll, ruft den Widerspruch, wie Eins = Vielem gedacht werden
könne, die Identität des Dinges, nachdem es ein anderes
geworden, ruft den Widerspruch, wie Eines und dasselbe zugleich nicht
dasselbe sein könne, wider sich hervor und nöthigt, dem
ersteren durch die Annahme, dass das Wirken eines Dinges das Product
nicht eines einzigen Atoms, sondern des Zusammenseins einer Gruppe
mehrerer Atome sei und demnach, wenn die Bestandtheile dieser Gruppe
verschiedene seien, sehr wol ein Verschiedenes nicht nur sein
könne, sondern sein müsse, dem zweiten dagegen durch die
Bemerkung zu begegnen, dass, weil jedes sogenannte „Ding”
nur eine Gruppe von Atomen, also ein Ganzes sei, dasselbe durch das
Ausscheiden einzelner und Eintreten anderer, während der Rest
[203]derselbe geblieben ist, sehr wol eine
Veränderung erlitten und doch (in Bezug auf obigen Rest) seine
Identität aufrecht erhalten haben könne. Bezüglich der
Bewegung als Ortsveränderung aber gilt, dass dieselbe nur dann
einen Widerspruch einschliesse, wenn dieselbe in dem Sinn verstanden
wird, dass das Bewegliche im selben Zeitpunkt an einem und demselben
Orte befindlich und nicht befindlich, keineswegs aber, wenn dieselbe so
aufgefasst wird, dass das Bewegliche in jedem stetig auf einander
folgenden Zeitpunkt in einem anderen Orte befindlich sei. Dieselbe
setzt daher eben so nothwendig die Zeit als den Raum voraus und wird
durch das Verhältniss des in einem gewissen Zeitabschnitt
zurückgelegten Raumes d. i. durch die Geschwindigkeit
gemessen.
319. Das in der Zeit vor sich gehende
erfahrungsmässig gegebene Geschehen, die Veränderung des
Zustandes der Körperwelt, ist eine dreifache, und zwar tritt
dasselbe, je nachdem entweder nur der Ort des Körpers, wobei
dessen Form sowol als Stoff dieselben bleiben, oder nur die Form des
Körpers, während der Stoff unberührt bleibt, oder
schliesslich auch dieser eine Veränderung erleidet, als Orts-,
Form- oder Stoffwechsel auf. In ersterer Hinsicht kann die Bewegung der
Richtung nach entweder eine fortschreitende, wie bei dem Stoss und
Wurf, oder eine in sich zurückkehrende, wie bei den rotirenden
Weltkörpern und den Blutkörperchen im Blutkreislauf, oder
eine zugleich fortschreitende und in sich zurückkehrende Bewegung,
wie bei dem um die Erde sich drehenden und zugleich mit dieser um die
Sonne bewegten Monde sein. Der Qualität nach kann dieselbe
entweder eine in gleichen Zeitabschnitten auf gleiche Weise sich
wiederholende (gleichförmige) oder in gleichen Zeiträumen
abnehmende (retardirende) oder zunehmende (accelerirende) Bewegung, in
ersterer Hinsicht überdies entweder eine am selben Ort sich
gleichförmig wiederholende (schwingende), oder dabei zugleich im
Raume fortschreitende, entweder nach der nämlichen, oder
abwechselnd nach entgegengesetzten Richtungen von der Fortschrittslinie
gleichförmig ausschlagende Bewegung sein: jene ergibt die
periodische Bogen-, diese die Wellenbewegung. Hinsichtlich des
Formenwechsels findet beim mechanischen und chemischen Körper ein
Uebergang des festen in den flüssigen und luftartigen Zustand,
oder des flüssigen in den festen und luftförmigen, oder des
letztgenannten in den festen und flüssigen statt, während
beim organischen die sogenannte Transformationslehre (Darwinismus) im
Gegensatz gegen die Theorie von der Constanz der Arten und Gattungen
[204]es mehr als wahrscheinlich gemacht hat, dass
nicht nur in der vegetabilischen Natur die Arten und Gattungen der
Organismen durch allmälige Umbildung einer oder weniger
ursprünglichen Pflanzentypen („Urpflanze”,
„Metamorphose der Pflanze”: Goethe), sondern auch in der
animalischen Welt die Arten und Gattungen des Thierreichs durch
allmälige Umbildung eines oder einiger ursprünglicher
Thiertypen („Bathybios”, „Gastraea”: Haeckel),
sei es auf dem Wege immanenter Teleologie (Goethe), sei es auf dem
natürlicher Zuchtwahl (Darwin), oder unwillkürlicher,
reflexartiger Nachahmung („Mimicry”: Wallace) in einander
übergehen. Was den Stoffwechsel betrifft, so hat die Erfahrung bis
heute zwar die Vermuthung, dass der unorganische chemische Stoff nur
eine Umbildung des primitiven mechanischen Stoffs sei, durch die
chemische Typentheorie wahrscheinlich zu machen, für die
Behauptung aber, dass der organische Stoff nur eine Umbildung des
unorganischen, der belebte Naturkörper aus leblosen, etwa
durch Urzeugung (generatio æquivoca),
entstanden sei, eben so wenig einen jeden Zweifel ausschliessenden
Beweis durch Thatsachen zu führen vermocht, wie für die
weitere, dass das „Phänomen der Empfindung”, durch
welches der (anderes und sich selbst) vorstellende Organismus sich von
dem nicht vorstellenden, obgleich ebenfalls organischen Körper
unterscheidet, nichts anderes als eine Umbildung des derselben
entsprechenden „Nervenreizes” und demnach als psychischer
oder Bewusstseinsvorgang von diesem als physiologischem d. i.
Nervenzustand, eben so wenig wie dieser als organischer Vorgang von den
unorganischen Vorgängen der mechanisch-chemischen Körper dem
Wesen nach verschieden sei. Insbesondere was die letztgenannte von den
positivistischen und materialistischen Gegnern einer weder mit Biologie
noch mit Phrenologie und Physiologie identischen Psychologie immer von
neuem wiederholte, aber niemals bewiesene Versicherung betrifft, haben
ausgezeichnete Physiologen (Ludwig, Fick) ein offenes: ignoramus, einer
der ausgezeichnetsten (Dubois-Reymond) sogar ein eben solches:
ignorabimus ausgesprochen.
320. Wie die Gesammtheit der im Weltraum vertheilten
(unorganischen und der auf einem oder dem andern derselben
anzutreffenden organischen) Körper in ihrer gegenseitigen
physischen Zusammengehörigkeit mit und in ihrer Abhängigkeit
von einander, so weit dieselben unserer Erfahrung zugänglich sind,
das physische Weltall, den Kosmos, so macht die Gesammtheit des in und zwischen
denselben in der Zeit vor sich gehenden Geschehens, deren periodischer
[205]und nichtperiodischer Orts-, Formen- und
Stoffwechsel von der unmessbaren, primitiven Oscillation des Aethers
bis zu den Umläufen der Weltkörper und dem schwankenden
Gleichgewicht einander äquilibrirender Weltsysteme, von der
Zerlegung des Wassertropfens durch den elektrischen Funken in seine
Elemente bis zu den ein System von Weltkörpern erleuchtenden und
erwärmenden Verbrennungsprocessen gasförmiger Centralsonnen,
von der molecularen Anziehung und Abstossung primitiver Stofftheile bis
zu den verwickelten mechanisch-chemischen Processen, welche die
Erscheinung des Lebens und das Erwachen des Bewusstseins bedingen,
herauf, so weit dasselbe unserer Erfahrung zugänglich ist, die
Naturgeschichte der physischen Welt, die
Geschichte des Weltalls aus. [206]