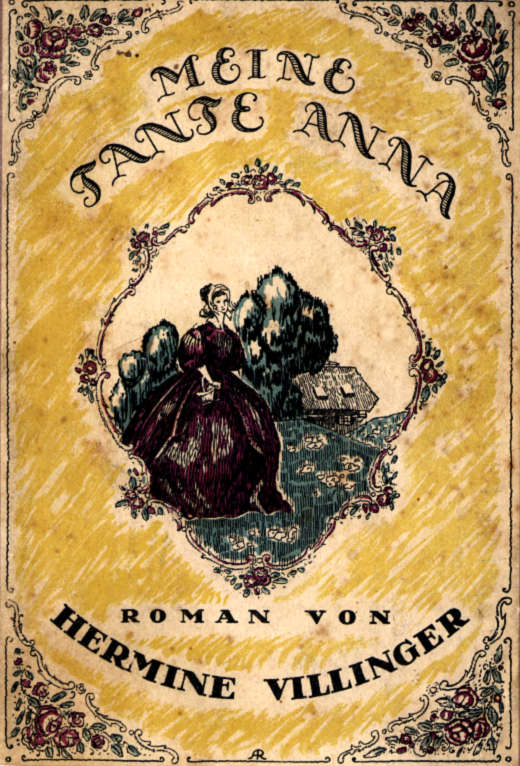
This eBook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this eBook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you'll have to check the laws of the country where you are located before using this ebook.
Title: Meine Tante Anna
Author: Hermine Villinger
Release Date: March 8, 2017 [eBook #54305]
Language: German
Character set encoding: UTF-8
***START OF THE PROJECT GUTENBERG EBOOK MEINE TANTE ANNA***
Anmerkungen zur Transkription
Das Original ist in Fraktur gesetzt.
Im Original gesperrter Text ist so ausgezeichnet. Im Original in Antiqua gesetzter Text ist so markiert.
Weitere Anmerkungen zur Transkription befinden sich am Ende des Buches.
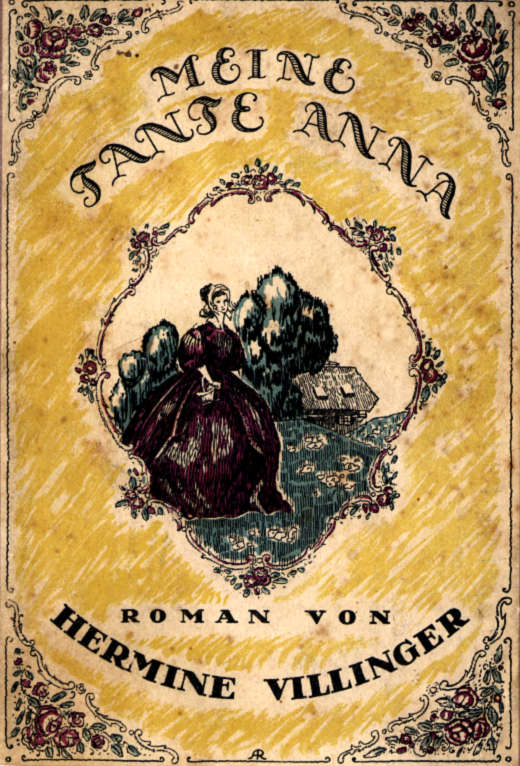
Meine Tante Anna

Alle Rechte, auch das der Uebersetzung, vorbehalten.
Copyright 1917 by August Scherl G. m. b. H., Berlin.
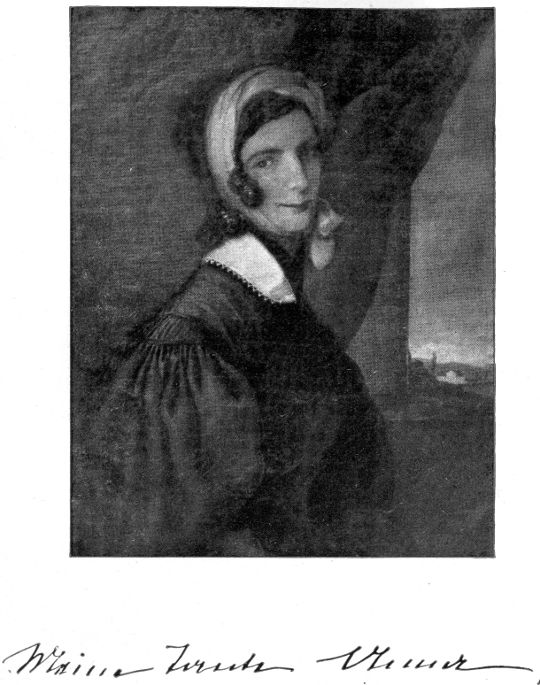
Roman
von
Hermine Villinger
6. bis 8. Tausend
Druck und Verlag August Scherl G. m. b. H.
Berlin
Unter den verwitterten Grabstätten des alten Friedhofs zu Rastatt befindet sich ein dicht mit Efeu umsponnenes Grab, dessen schlichter roter Sandstein noch keine Spuren von Verfall zeigt. Schiebt man den Efeu ein wenig zur Seite, ist auch die Inschrift noch deutlich zu lesen:
Anna Villinger.
Mein Bruder war's, der während seiner Garnisonszeit zu Rastatt das Grab der Schwester unseres Vaters entdeckte und den verfallenen Grabstein der längst Verewigten durch einen neuen ersetzen ließ.
Wir haben Tante Anna nie gekannt, nur viel von ihr gehört. So wußte mein Bruder auch, daß sie in Rastatt als Institutsvorsteherin gewirkt hatte und da verstorben war.
Jetzt aber ist auch meine Zeit gekommen, der eigenartigen und so mutigen Seele ein Denkmal zu setzen, indem ich sie aus ihrer stillen Gruft ins Leben zurückrufe – ich, die letzte, allein übriggebliebene der langen Reihe von Angehörigen, deren Bilder die[6] Wände meines Arbeitszimmers zieren. In ihrer Mitte, meinem Schreibtisch gegenüber, hängt das Ölbild von Anna Villinger. – Ein schmales Gesicht, von roten Locken umrahmt, in die sich ein weißes Band schlingt. Unter der schön ausgebildeten Stirn kluge dunkelblaue Augen voll Geist und warmer Güte. Die ausdrucksvollen Mundwinkel zeigen das feine Lächeln liebevollen, überlegenen Humors. Sie trägt ein dunkelblaues Kleid mit bauschigen, an den Schultern aufgefaßten Ärmeln. Den Hals umschließt ein breiter weißer Kragen.
Sie war zur Zeit, als sie gemalt wurde, Ende der Zwanzig.
Im Hintergrund des Bildes sieht man durch ein offenes Fenster ein schloßähnliches Gebäude mit kleineren Nebengebäuden inmitten eines Gartens. Dahinter blaues Gebirge.
Das Gemälde stammt von der Hand des Barons O., des Schloßherrn, in dessen Haus Anna Villinger Erzieherin war.
Im Besitz ihres Tagebuchs und einer Anzahl von Familienbriefen habe ich daraus schon früher so manches entnommen. Unter anderm die Polenzeit 1832. – Allein, wie es so geht. Das einmal Erschaute kommt nicht selten wieder, um reicher und vertiefter von neuem zu erstehen.
Anna war das fünfte Kind des Oberamtmanns Villinger in Zell im Wiesental. Alle sieben Kinder – zwei starben schon früh – wurden hier geboren, in dem kleinen freundlichen Landstädtchen an der dem Feldberg entspringenden Wiese, zwischen bäuerlichen Obstgärten, mit gelben Blumen übersäten Matten.
Ein nicht weniger liebliches Paradies fanden die Kinder bei der Versetzung des Vaters in Staufen. Das kleine Amtsstädtchen liegt am Eingang des Untermünstertals im Schwarzwald. Reben umgeben die Stadt und pflanzen sich in dichter Fülle die Berge hinan, von deren Häuptern die Überreste alter Burgen grüßen.
Das Schönste aber für die Kinder war das Amtshaus. Ein gar stattliches Gebäude, dessen Front der Turm trennte, mit der gewundenen Steintreppe. An der Außenseite des Turmes wuchs der Efeu in dichten Massen bis zum letzten Fensterchen hinan. Im Hause hohe, schöne Räume, von deren Fenstern man in den Garten schaute, der sich mit seinen alten Bäumen und saftigen Wiesen fast wie ein Park ausnahm. Obst und Gemüse gab's da die Menge, und die Oberamtmännin in einer stets sauberen, stattlich ausgebogten Haube und der breiten weißen Halskrause stand am Herd und kochte das Obst ein, den einzigen Überfluß des Hauses. Denn sonst mußte tüchtig[8] gespart werden. Die beiden älteren Töchter, so jung sie noch waren, verfertigten unter der Leitung der Mutter die eigenen Kleider und die der jüngeren Geschwister. Sie kehrten und fegten, weiße Tüchlein um den Kopf, Stuben und Kammern. Denn die Magd hatte genug mit der groben Haus- und Gartenarbeit zu tun.
Neben der tätigen, allezeit wohlgemuten Mutter hätte der Vater vielleicht einen allzu ernsten Eindruck gemacht, wenn dessen regelmäßiges, ansprechendes Gesicht nicht jenen Ausdruck von Milde und Güte besessen hätte, wie ihn die Männer der vormärzlichen Zeit aufwiesen. Mit seinem schlichten aschblonden Haar gaben er und die schwarzhaarige Gattin ein äußerst stattliches Paar ab.
Xaver, der älteste Sohn, voll Leben und Tatkraft wie die Mutter, besuchte, noch nicht siebzehnjährig, die Universität in Freiburg, um die Rechtswissenschaft zu studieren, lehnte jede Unterstützung von zu Hause ab und bestritt seinen Unterhalt durch Nachhilfestunden bei unbegabten Gymnasiasten.
Aber wenn er des Sonntags heimkam nach Staufen, da konnte sich die Oberamtmännin nicht genug tun in der Bewirtung des Sohnes, denn wenn er auch stolz zu Roß in Staufen einritt, das Bild eines flotten Studenten, das Mutterherz grämte sich unablässig ob[9] seiner Magerkeit und war überzeugt, er maß der dem Körper so notwendigen Nahrung zu wenig Bedeutung bei.
Ihre Sorgen sollten nur zu berechtigt sein. Jung verheiratet in Karlsruhe, zu Beginn einer vielversprechenden Karriere, raffte den überarbeiteten, so wenig widerstandsfähigen jungen Mann ein Nervenfieber schnell dahin.
All diesen Kindern am Tische des Oberamtmanns, stand nicht einem jeden schon damals das künftige Schicksal auf der Stirne geschrieben? So Theresen, der Ältesten der Mädchen. Mit ihrem immer bereiten: »Wie Sie wünschen, Mamale« – blieb sie der jüngern Geschwister wegen von der Schule weg, um der schwergeplagten Mutter hilfreich zur Seite zu stehen.
Anders Caton, die zweite Tochter. Sie nahm sich ihren Anteil am Leben, ohne lang zu fragen. Schwarzhaarig, mit dunkelsprühenden Augen, war sie das Ebenbild der Mutter, sowohl an Frische als an Kraft – diese lebendige Kraft, die Mutter Villinger befähigte, den Ihren ein Heim zu schaffen, wie man sich's nicht liebevoller denken konnte.
Ihre beiden jüngsten Kinder: Hermann glich Caton, und Anna, das überzarte, beinahe schmächtige Nannele, war trotz des schweren Leidens, das ihrer zarten Kindheit anhaftete, die Lebendigste von allen,[10] die Reichste an Geist und Gemüt und übersprudelnder Phantasie.
Wie oft in der Nacht stand die Oberamtmännin auf, wenn sie das leise Stöhnen des Kindes vernahm, das in seinem Bett aufsitzend, von schwerem Asthma gequält, nach Atem rang. Und einmal entfuhr es der Mutter unter Tränen: »O du mein arm's Nannele, warum grad' dir das?« »Aber Mutter,« verwunderte sich das Kind, »müssen wir nicht dem lieben Gott danken, daß es nur in der Nacht kommt und nicht am Tag, sonst könnt' ich ja nicht in die Schul'.«
Anna zählte elf Jahre, als der Vater als Kreisrat nach Freiburg versetzt wurde. Also lebten die landgewohnten Kinder in einer engen Gasse in engen Räumen. In Freiburg gab's keine Dienstwohnung wie in Staufen, keinen Garten mit Obst und Gemüse. Auch mußten die heranwachsenden Töchter jetzt anders gekleidet gehen als früher. Allein die tapfere Mutter Villinger wußte Rats. Und so war's in kurzer Zeit bei Kreisrats nicht weniger behaglich als bei Oberamtmanns im ehemaligen Schlößle zu Staufen.
Man hatte eine große Wohnung genommen und gab jungen Studentlein ein Heim im Hause. Mutter und Töchter teilten sich in die Arbeit des großen[11] Haushalts, nur von einer geringen Magd unterstützt. Aber niemand sah es ihnen an, was sie geleistet, wenn sie Punkt Zwölf am wohlgedeckten Speisetisch erschienen.
Nannele, das im schwarzen Kloster in kurzer Zeit die beste Schülerin war, hatte der Mutter unter dem Siegel der tiefsten Verschwiegenheit das Geständnis gemacht, daß sie nur darum so eifrig lerne, um später Klosterfrau werden zu dürfen.
Der schöne Traum sollte nicht lange währen.
Die Klosterfrauen, Annas Klassenlehrerinnen, kamen einmal zur Mutter zum Kaffee. Glückselig bediente das Kind die geliebten Frauen und zog sich später auf den Wink der Mutter ins Nebenzimmer zurück. Sie nahm ihr Reißbrett, um die Rokokouhr auf der Kommode abzuzeichnen, ein schon begonnener Versuch.
Plötzlich horchte sie auf. Mutter sprach in einem Ton, den Anna nie an ihr gehört. Die Tür war nur angelehnt, daher jedes Wort zu verstehen.
»Um Caton ist mir nicht bang, liebe Frau Stephanie,« sagte die Mutter, »wohl aber um Therese und Anna. Was soll aus ihnen werden? Man weiß ja, wie apprehensiv die Menschen, hauptsächlich die Männer, gegen rote Haare sind. Und wir haben kein Vermögen, unsre Kinder haben nichts zu erwarten,[12] wenn unsre Zeit gekommen ist. Wie oft kann ich in der Nacht nicht schlafen und mache mir Vorwürfe, daß ich Therese so früh aus der Schule behalten. So kann sie nicht einmal Erzieherin werden, und wie soll ich sie mir in einer untergeordneten Stellung denken! Xaver versichert mir zwar immer wieder, er werde Sorge für seine Schwestern tragen, deren Wohl ihm mehr am Herzen liege als das eigene. Aber das kann ich doch nicht von diesem Sohn verlangen, der jetzt schon daran denkt, sich eine Häuslichkeit zu gründen.«
»Frau Kreisrat,« nahm Frau Stephanie das Wort, »vertrauen Sie auf Gott, Sie haben brave Kinder. Nanneles Leiden ist zwar eine traurige Mitgabe für das Kind, aber das hindert sie nicht, in ihrer Klasse die beste Schülerin zu sein. Ohne ihr Leiden wäre sie uns eine hochwillkommene Kraft im Kloster. Aber warum soll sie nicht eine ausgezeichnete weltliche Lehrerin werden, da sie alle Anlagen dazu hat?«
Mutter Villinger schaute wie gewöhnlich, bevor sie ins Bett ging, nach ihrem Nannele, das in einem winzigen Zimmerlein neben den Eltern schlief.
Ganz still lag sie, während ihr die Tränen unaufhaltsam über die Wangen flossen.
Als die Mutter zu ihr trat, schluckte das Kind mit aller Gewalt seinen Schmerz hinunter und schlang den Arm um den Hals der Mutter.
»Sie können ruhig schlafen, ganz ruhig, Mutterle, ich werd' eine ausgezeichnete Lehrerin und verdien' viel, viel Geld. Dann ist auch für Therese gesorgt, und wir brauchen unserm Xaver nicht zur Last zu fallen.«
Und nun soll ihr Tagebuch, sollen ihre Briefe für sie sprechen. Freilich muß ich hier und dort, oft sogar, ergänzend eingreifen, um zur Lebendigkeit des Gesamtbildes möglichst beizutragen, indem ich das Gehörte und auch die eigene Phantasie zu Hilfe nehme.
Mein Tagebuch,
angefangen an meinem 16ten Geburtstag 1827.
Ich wollte schon vor Jahren ein Tagebuch beginnen, aber da war ich noch ein Schulkind, und die Kamarädle ließen mir keine Ruhe. So habe ich damals nur Selbstgespräche gehalten in der Nacht, wenn das Schnaufen kam, Asthma genannt.
Jetzt bin ich aber aus den jüngeren Jahren in ein reiferes Alter hinübergeschritten, habe die Klosterschule verlassen und mein deutsches und französisches Examen gemacht. Wenn die Hausarbeit getan ist, darf ich die französische Konversationsstunde im Kloster weiter besuchen, und zu meinem heutigen Geburtstage wurde ich von meinen gütigen Eltern mit der Erlaubnis überrascht, mein Zeichentalent weiter bilden zu dürfen. Oh, Xaver, mein unvergeßlicher, geliebter Bruder,[14] hätte ich statt deiner sterben können! An mir hätte die Welt, hätten die Meinen nichts verloren. Aber das Los hat ihn getroffen. Mit sechsundzwanzig Jahren, beim Beginn einer vielversprechenden Laufbahn, mußte er von seiner jungen Frau, von seinen Eltern und Geschwistern scheiden. Mit ihm starb mir ein großer Teil meines Lebensglücks. Wir klagten uns unsern Schmerz nicht in lauten Ausbrüchen, sanft weinend sprachen wir von unserm Abgeschiedenen miteinander, so in dumpfer Zurückgezogenheit nur unserm Schmerz lebend. Aber die Freunde kamen und führten uns hinaus in die schöne Natur, und wir konnten uns ihrer wieder freuen. Ja, wir mußten uns aufraffen, denn war Caton nicht Braut, hatten wir nicht an ihrem edlen, vortrefflichen Ludwig einen neuen Bruder gewonnen!
Wie schön war unsre Schwester bei ihrer Vermählung! Es war ein unvergeßlicher Augenblick in dem sonnendurchleuchteten Münster, als die beiden jungen, so schönen Menschen das heilige Jawort auf den Stufen des Altars tauschten.
Ach, nur zu bald schlug die Abschiedsstunde, und fort rollte der Wagen mit der geliebten Schwester. Im fernen Norden, in Hannover, wird fortan ihre Heimat sein.
1. 6. Mit welcher Sehnsucht erwarteten wir die ersten Nachrichten von Caton. Schon drei Tage vor dessen Ankunft erwarteten wir ihren Brief, an dem letzten aber mit Gewißheit. Die Mutter lud deshalb unsere intimsten Freundinnen mit ihren Müttern ein, Fromherzens und Ruofs und Malchen und Lenchen, teilzunehmen an einer zu erwartenden Freude oder uns zu trösten über deren Ausbleiben. Aber sie blieb nicht aus! Es kam Kunde von Caton. Sie war gesund und glücklich, zeitweiliges Heimweh abgerechnet. Oh, wie schwammen die Tränen der Wonne in jedem Auge! Mutter in ihrer Freude sprang auf und holte den noch vorhandenen großen Efeukranz, der an Catons Hochzeit die Wände zieren half. Mit diesem Kranz umkreisete sie den teuern Brief der Schwester, daß er, so in grünem Schmuck prangend, den Freundinnen entgegenlachen sollte. Und sie kamen und lachten und weinten ein wenig vor Rührung beim Vorlesen des Briefes.
Bei dieser Gelegenheit will ich eure Namen in mein Tagebuch einschreiben, ihr Freunde meines Herzens und unsres Hauses, damit ich mich eurer Freundschaft freue, so oft ich dieses Blatt durchlese.
Zuerst die mir am nächsten stehenden: Lenchen von Mohr, die arme Lotte, unseres Xavers Frau, und deren Schwester, mein kluges Malchen Roth. Malchen[16] Wänker, Mutters Jugendfreundin, die Hofrätin, Amanns, Holzhauers, Fromherzens, Ruofs, Gräfle, Kalm, Schaffroth, Molitor, Fr. von Berg, Metz, Baumgärtner und meine Lehrerinnen, die Klosterfrauen. Ihr alle, die ihr uns liebreich beigestanden seid bei dem so schmerzlichen Verlust unsres geliebten Xaver, bei unsres guten Vaters Krankheit und bei Catons Scheiden aus der Heimat, in ewiger Dankbarkeit werde ich eurer gedenken.
30. 6. Oh, daß ich so viel Gewalt über mich vermöchte, meinem Gemüte eine ruhigere Haltung zu geben! Mit Paulus möchte ich ausrufen: »Was ist es, das ich nicht will, daß ich tue, das tue ich; und das ich tun will, das tue ich nicht!« Meine zu große Offenheit, mein unüberlegtes Sprechen und Lachen, wie viele bittere Stunden danke ich schon von der Schule her dieser unglückseligen Eigenschaft. Auch heute habe ich wieder Ursache, mit mir unzufrieden zu sein. Die Hofrätin war zum Kaffee da. Wie oft bin ich ihretwegen schon geschmält worden, wie viele sanfte Fußtritte ernte ich unter dem Tisch von Therese, wenn ich, was alle paar Augenblicke geschieht, der Hofrätin den Knäuel suche, wobei ich den Faden nicht selten mit Vorliebe verwirre, um meiner Lachlust frönen zu können.
Wie soll man aber auch ernst bleiben!
Kugelförmig kommt sie zur Türe hereingeschossen, auch beim schönsten Wetter behauptend, sie komme durch »der dicker Dreck.«
»Ja, Kreisrätin, über dich geht mir halt nix, wenn mei Herz voll ist – guter Tag, Kinderle, jetzt denke au, mei Hofrat selig isch mir heut Nacht wieder im Traum erschiene. Recht zufriede würde er im Himmel sein. Ich soll doch auch kommen. Jetzt wird mir's nimmer besser – mir pressiert's nit. Mei Leine isch noch beim Weber, mei Garn nit auf der Bleich. He, do möcht mer zipfelsinnig werde. ›Komm doch au‹ – grad' wie früher, der nämlich bockbeinig Hofrat, nit ein Brösele g'scheiter.«
Der Knäuel fiel unter den Tisch, ich flugs hinter ihm her, dabei stieß ich den Kopf an.
»O Herrjegerle, Nannele,« rief die Hofrätin aus, »du dauerst mich. Der Hofrat selig hat allemal g'sagt, ihn treff' noch der Schlag mit der lumpige Knäuelsucherei alleweil. Aber ich hab' ihm d' Nas' drauf 'tunkt: dei Schwester hat sechs lebendige Mädle und isch die größt' Schlamp in der Stadt. Wo soll denn da e Aussteuer herkomme? Ja, wenn ich kei G'wisse hätt' – aber ich hab' eins, und so kriegt e jed's sei Bett, sei Leine für Hemde, Hose, Nachtjacke, Bettücher, Tischtücher, Serviette und Handtücher und ebenso drei[18] Dutzend Strümpf'. Mei Geld kriege sie nit, mei Geld kriegt mei leibliche Schwester und ihr Bube. Ich bin halt für Bube. Alle Abend bet' ich ein Vaterunser, daß im Hofrat seine Nichtene unter d' Haub komme. Ach, wenn doch einer käm' und des bös' Karolin' mitnähm' – am liebste bis nach Amerika nei. Aber ich fürcht', die wüscht' Nas', die's hat, verdirbt jedem der Guschto, und des boshaftig' Mädle bleibt uns auf'm Hals – Nannele, Nannele,« sie drohte mit dem Finger, »um dich ist mir's au ein wenig bang – 's heißt allgemein, du lernsch zu viel. Gib acht, gib acht, das tut der Weiblichkeit Abbruch. G'scheite Frauenzimmer bekomme kei Mann, seiner Lebtag nit.«
»Und Caton,« fragte ich, »ist Caton vielleicht nicht gescheit – und erst die Mutter, Frau Hofrätin?«
»He jo, he jo,« lachte sie auf, »weisch noch, Kreisrätin, wie wir klein ware und sind vom Schloßberg 'runter g'saust auf unsre Schlittele, und über einmal, bums, fliegt dei Schneeballe einem Herr an der Kopf. ›Mädele‹, sagt er und schaut dich zornig an, ›sag, was verdiensch jetzt?‹ ›He‹, hasch g'sagt, ›e Schokoladtäfele‹ – Und hasch richtig eins kriegt.«
Alsdann heißt's: »Kinderle, ich muß gehe – wo sind meine Handschuh – ach Gott, mei Schirm, mei Mantel – richtig, 's fehlt mir e Stricknadel – schaut[19] her, rutscht mir nit der falsch Zopf – lehnt mir e Haarnadel – Kreisrätin, 's tut mir leid, aber du magsch sage, was du willsch, mei Weber isch doch besser als deiner, da beißt kei Maus der Fade ab.«
Vater nennt die Hofrätin »die heitere Person«, und wirklich, sie ist ein rechter Segen für uns, wenn Mutter wieder in ihre Sorgen um unsre Zukunft verfällt und sich darob grämt. Ein Nachmittag mit der Hofrätin kuriert sie besser als alle unsre Vorstellungen.
20. 7. Heute sagte Mutter: »Ich will am Nachmittag nach der Hofrätin sehen, sie war schon so lang' nicht da. Ich hab' mir's überlegt, ihr Leine ist wirklich schöner als meins. So will ich's denn mit ihr besprechen, und 's mit ihrem Weber versuchen.«
Wir waren gerad' mit dem Mittagsmahl fertig, als die Magd von der Hofrätin eintrat und heulend ausrichtete: »Eine schöne Empfehlung und Sie solle gleich komme, Frau Kreisrätin, d' Frau Hofrätin will sterbe.«
»Daß sie's will, glaub' ich meiner Lebtag nicht«, sagte Mutter, indem sie mit zitternden Händen ihren Hut aufsetzte. Ich half ihr beim Anziehen, und obwohl sie sagte: »Bleib du nur daheim« – ließ ich sie nicht allein gehen.
Als wir bei der Hofrätin eintraten, saß der geistliche Rat am Krankenbett, so daß wir gleich wieder umkehren wollten. Aber die Hofrätin rief mitten aus dem Beten heraus: »Nur bleibe, nur bleibe, bin glei fertig –« sprach ein kräftiges Amen und schickte den Geistlichen hinaus zur Magd, sie zu zanken, daß sie das Garn noch nicht zum Weber und das Tuch nicht auf die Bleiche getan.
»Sage Sie's ihr nur recht, Hochwürde – hinsitze und heule isch der größt' Zeitverlust – d' Kreisrätin bleibt bei mir, bis ich mei letzter Seufzer tu, wenn's Gott's Wille isch – auf alle Fäll' aber muß vorher Ordnung in mei'm Sach sein, eh' ich ins Jenseits geh' –«
Der Geistliche ging, und Mutter und ich setzten uns zur Hofrätin ans Bett. Das Herz klopfte mir, Mutter liefen die Tränen über die Wangen. Zu den beiden Fenstern schien die Sonne herein.
»Schön's Wetterle,« sagte die Hofrätin, »geh, lang mir au mei Stricket, Nannele, bin grad' am Ferse – und lupf mich ein weng.« Ich tat's, und sie begann eifrig zu stricken.
»Wirsch endlich zugebe, Kreisrätin, daß dein Weber mei'm Weber nit's Wasser reicht?«
»Ach ja, ja«, preßte die Mutter hervor.
Die Hofrätin sah von ihrem Strickzeug auf:
»O Herrjegerle, ich glaub' gar, du heulsch, Kreisrätin – horch, ich geb' dir ein guter Rat – laß es lieber bleibe, ich glaub', 's isch wieder mit der ganze Sterberei nix. Der Doktor isch e alte Kuh – dreimal hat er mich schon aufgebe und mei ganzer Haushalt in Unordnung versetzt. Ich hab' gute Luscht und mach' ein neuer Pakt. Geh, hol mir au ein Glas Wein, Nannele – So –«
Sie trank's mit einem Zug leer. Alsdann wendete sie sich gegen die Wand, schlief ein und schnarchte sogar. Mutter und ich blieben halb ängstlich, halb vergnügt am Bett sitzen.
Als der Doktor kam, warf er einen raschen Blick auf die Hofrätin, dann noch einen, schüttelte den Kopf und brach in lautes Lachen aus.
Sie erwachte.
»So,« sagte sie, »au noch lache, wenn einer nix kann – Ihne sterb' ich wieder!«
Darauf sind Mutter und ich so heiter nach Haus gekommen, als kämen wir von einer Hochzeit.
28. 7. Trotz aller Vorsätze, ich habe keine Freude an mir. Meine Fortschritte im Guten sind nur winzig; meine Opfer – z. B. Küchenarbeit – werden nur zögernd vollbracht, der unsagbar großen Freude am Lesen zuweilen, wenn auch nur auf Minuten,[22] heimlich nachgegeben. Meine Weichlichkeit hat mich noch nicht verlassen. Mein Hingeben an die Phantasie und mein behagliches Schwimmen in ihr, besonders nach dem Erwachen, bevor ich aufstehe, hat mir schon manche Stunde geraubt, in der ich rüstig etwas Nützliches hätte tun können. Oh, warum ist man auch beim Erwachen so dumm! Oder bin ich's nur? Ich sagte mir schon beim Einschlafen: morgen will ich früh aufstehen, auf Ehre! Hätte mich die Übertretung ehrlos gemacht, wie oft wäre ich's schon gewesen. Ich nahm mir vor, beim Erwachen ein mahnendes Wort, das arge Wort Schande zu sagen, überzeugt, daß mich das plötzlich aufrütteln würde. Ich erwachte, sagte richtig Schande, Schande, kehrte mich um und überließ mich von neuem meinen Träumereien.
Hier kann nur ein rascher Entschluß, ein kühner Sprung aus dem Bett helfen. Morgen und fortan will ich diesen Sprung tun. Ich will.
10. 8. Gestern in großer Gesellschaft bei St. Ottilien gewesen, am schönsten Frühlingstag der Welt. Eine ganze Karawane von Hofräten, Kreisräten, Professoren und Doktoren samt Gattinnen, Müttern und Tanten. Voran die ledigen Professoren und Studenten in Gesellschaft der hellgekleideten[23] jungen Mädchen, unter denen Amalie v. Berg, Pauline von Marschall und Marie von Rotteck die schönsten waren.
Auf dem Gipfel des Schloßberges machte man halt, um Umschau zu halten. Alle Bäume und Gesträuche, soweit das Auge sehen konnte, prangten in ihrem jungen Grün. Über das sich im Hintergrund erhebende Gebirge breitete sich ein zarter Duft von lichtem Blau, das in das dunklere Blau des Himmels hinüberzufließen schien. Zu unseren Füßen lag unser liebes Freiburg, in dessen sich majestätisch zum Himmel erhebendem Dome eine tiefe Glocke zur Andacht rief, während auf dem Karlsplatze die um diese Zeit exerzierenden Soldaten ihr »Eins, zwei« bis zu uns heraufschallen ließen. Wer zählt all die Dörfle, die wir überall im Sonnenschein aufblitzen sahen? Das Lorettobergle drüben, das Schaumburgische Schlößchen, die Eichhalde, der Hebsack und andere Landhäuser spielten hinter wilden Kastanienbäumen und Pappeln Versteckens miteinander, und dunkle Tannenwälder umsäumten die lichtgrünen Wiesen im Tal. Ich lernte auf dem Weg nach St. Ottilien die Professoren Monz und Schmidt kennen. Der erstere ist Professor der Geschichte an der Universität, Schmidt ist Geistlicher. Vom Sehen kannte ich beide, letzteren besonders durch seine herrlichen Predigten im Seminarium.[24] Mehr als einmal fiel mir beim Zuhören ein: Zum Seraph fehlen ihm nur die Flügel. Nun schritt er ganz schlicht neben mir her, ein wenig schüchtern fast, denn mit dem lebhaft redenden Professor Monz schien er nicht wetteifern zu wollen, und obwohl ich sehr gern den Reden des gelehrten und weitgereisten Mannes lauschte, im geheimen war mir der stille, sinnig blickende Professor Schmidt doch interessanter, wie der tiefe, undurchdringliche Brunnen mehr zum Nachdenken reizt als das klar dahinfließende Wasser. Wir kamen auf Lektüre zu sprechen, und Schmidt erklärte, Erhabeneres als Klopstocks Messiade gäbe es nicht, worauf Monz lächelnd meinte: »Vielleicht für Freiburg, aber die Welt ist groß.«
Schmidt schien mir unmutig zu erröten. Ich stellte mich sofort auf seine Seite, indem ich erklärte:
»Vielleicht hat die große Welt nicht immer den besten Geschmack.«
»Aber sie geht mit Meilenstiefeln im Vergleich zu Freiburg«, sagte Monz.
»Ist das ein Glück?«
»Es fragt sich, was Sie unter Glück verstehen«, sagte Monz. »Für mich ist Glück gleichbedeutend mit Fortschritt, Entwicklung, Macht.«
Ehe ich noch darüber nachdenken konnte, sprach er[25] von Humboldt, Goethe, Platen. – Alle diese Großen seien noch nicht eingedrungen im Süden Deutschlands. Körners Freiheitslieder, die den Norden aufgerüttelt zum Handeln, in dem zerstückelten Deutschland, sie hätten noch kein Echo gefunden. Und er sprach mit erhobener Stimme:
Ich fragte, von wem das sei.
Er sagte: »Von mir, für Schinznach gedichtet.«
Ich schwieg. Also ein Dichter, wenn auch nicht mein Dichter. –
So kamen wir im Schatten des ganz vom lichten Buchenwald umschlossenen St. Ottilien an. Lautes Leben umgab die alte Wallfahrtskapelle. Die Tische waren gedeckt. Aus dem kleinen Wirtshaus brachten sie Kaffee und Tunkes die Menge. Professor Monz sowie Schmidt setzten sich zu Villingers an den Tisch, auch Hofrat Amann. Lenchen sagte mir leise ins Ohr:
»Du, so gescheit rede kann ich nit« – und lief davon.[26] Als dann Vater, Monz und Amann ernste Politik trieben, machte auch ich mich aus dem Staube und ging zur Kapelle. Lenchen kam zu mir, und wir schritten die beiden Steinstufen hinab in die nur schwach vom Tageslicht beleuchtete Grotte. Ich hörte Tritte, wußte sofort, daß es Professor Schmidt war, und wurde rot.
»Ich bin gerne hier,« sprach er, »im Reiche dieser Legende,« nahm vom Wasser, das aus dem Felsen fließt, und benetzte sich Augen und Stirne. »Es ist nicht die Tatsache an und für sich, die Legende der jungen Christin Odilie, die, verfolgt von ihrem heidnischen Freier, zu Gott rief vor diesem starren Felsen, dessen hartes Gestein sich alsbald öffnete und hinter der Jungfrau wieder schloß. Seither sind Hunderte von Jahren dahingegangen, wenige Menschen nur wissen noch von dem Wunder, das Gott an der heiligen Odilie getan, und doch pilgern wir nach wie vor zu dem wundertätigen Quell, an dessen für das Auge so heilsame Kraft wir nicht aufhören zu glauben. Denn wenn diese Kraft auch nur illusorisch wäre, sie ist das Symbol von der Lichtquelle, die dem Leben eines heiligen Menschen entquillt, und in der wir unbewußt wandeln und uns besser fühlen. Haben Sie das Gedicht von Professor Monz ›St. Ottilien‹ gelesen?« wandte er sich an mich.
Ich sagte nein.
»O, so lesen Sie es nicht,« sprach er, »der fromme Ort würde Ihnen dadurch entweiht.«
Ich nahm mir fest vor, dieses Gedicht nie zu lesen, allein, o Himmel, auf dem Heimwege fing Professor Monz mit einem Mal an zu deklamieren:
Eingedenk der Worte Professor Schmidts nahm ich all meinen Mut zusammen, indem ich ausrief:
»Halten Sie ein, Herr Professor, unsere heilige Ottilie ist uns lieber als die Ihrige.«
Worauf er lachte, während Professor Schmidt, der vor uns herging, sich umwandte und mir zunickte.
30. 5. Ist es vermessen oder anmaßend oder undankbar, daß ich mich trotz allem, was ich an Liebe empfinde und besitze, doch immer noch heimlich nach einer Seele sehne, die ich bewundern, zu der ich aufsehen kann? Monz, den ich nun öfter sehe, ist wohl zu[28] bewundern, denn mit ihm kommen neue Interessen in unser engbegrenztes Leben, was nicht hoch genug zu schätzen ist. Aber ihm fehlen die Grazien. Er ist rücksichtslos und doziert immerfort, als habe außer ihm kein Mensch etwas zu sagen, und besonders kränkt mich seine fast geringschätzige Art Schmidt gegenüber. Und es rührt mich in tiefster Seele, daß dieser die Demütigungen von seiten des Weltmenschen so wenig empfindlich, ja geradezu freundlich hinnimmt. Ach, ich weiß wohl, daß er der Bessere ist. Zugleich aber fürchte ich mich vor ihm, denn würde ich mich diesem seinen Einfluß ganz überlassen, so dürfte ich ja die Bücher nicht lesen, von denen Monz spricht, und die doch einen so heißen Wissensdurst in mir wachrufen.
3. 2. Wie wunderbar ist dieses schnelle und unverhoffte Sichfinden zweier verwandter Seelen! Es war auf einem thé dansant bei Herrn von Rotteck, wo ich Maria von Verleb kennen lernte. Sie tanzte nicht, und da ich auch nicht tanze, führte uns Herr von Rotteck zusammen, uns zu einem Schwätzwalzer engagierend, was mir ein reichlicher Ersatz war für alles Tanzen der Welt.
Herr von Rotteck erzählte uns von der neuen Oper »Oberon« von Karl Maria von Weber, und wir bekamen so den ganzen, überaus reizenden Text zu[29] hören. Hierauf sprach er von Jean Paul. Ach, und ich hatte nichts von diesem großen Dichter gelesen, konnte nur mit hungriger Seele den Herrlichen preisen hören.
Als wir allein waren, fragte mich Frau von Verleb, ob ich Jean Pauls Schriften nicht kenne. Ich sagte: »Ach nein, noch nicht.«
Oh, wer beschreibt meine Freude, als mir Frau von Verleb mit einer geradezu unbeschreiblichen Liebenswürdigkeit ihre Bibliothek zur Verfügung stellte. Ich kann es auch wirklich nicht verkennen, daß ihr Blick mit fortgesetztem Wohlbehagen an mir hing.
Sie ist schön. Dunkelblonde Locken, leicht wie Schaum, umgeben ihr bleiches Gesicht, dessen Ausdruck immerzu wechselt zwischen leuchtender Freude und plötzlicher Wehmut. Sollte sie einen Kummer haben? Herr von Verleb sieht seiner jungen Frau jeden Wunsch von den Lippen ab, und die Freunde des Hauses, darunter Professor Monz, wetteifern, ihr eine Freude zu bereiten. Monz soll ihr eifrigster Verehrer gewesen sein. Sie zog ihm Verleb vor, der eine ungemein leichte, heitere und liebenswürdige Gemütsart hat.
Als er mich neulich fragte, wie mir »Hesperus« gefallen, mußte ich bekennen, daß ich erst einen kleinen Teil des herrlichen Buches gelesen habe. –
»Erlauben Sie, das begreife ich nicht«, rief Herr von Verleb aus.
Ich machte es ihm aber begreiflich, indem ich ihm offen sagte, daß es in unserm Haus viel zu viel Arbeit gebe, als daß ich mir gestatten dürfte, unter Tags zu lesen, die Mutter aber so gut sei, mir oft des Nachts im Bett vorzulesen, während ich beim Nachtlicht Handarbeiten mache.
»Mein braves Villingerle«, sagte Frau von Verleb, als wir allein waren, »gib mir die Hand, wir wollen uns du sagen, denn siehst du, meistens sind die tüchtigen Leute langweilig und voll Eigendünkel, aber du bist heiter wie ein Kind, eine Wohltat für mich, die ich mich so nach Heiterkeit sehne.«
10. 3. Es scheint, ich habe den Namen meiner Freundin Maria Verleb zu oft auf den Lippen getragen, und so habe ich die Erfahrung machen müssen, es ist besser, das Herz behält sein Lieben für sich.
Karoline und ich rieben uns aneinander seit unserer Kindheit in scherzhaften, sehr oft auch heftigen Kampfgesprächen. Mit vielen Talenten und einem zierlichen Figürchen begabt, mußte sie oft Spott wegen ihrer Nase erleiden, dem Entenschnabel, wie ihre Tante Hofrätin sagt.
Wirkliche Neigung habe ich nie für Karoline empfunden, aber durch alle Klassen saßen wir Seite an Seite und gingen dann auch gewohnheitshalber miteinander nach Hause.
So auch heute nach der französischen Konversationsstunde im Kloster. Unglücklicherweise entschlüpfte mir unterwegs der Name Maria von Verleb.
Alsbald warf mir Karoline mit einem wahren Hohn vor, ich habe ein Herz wie ein Theater. Nicht genug an meinen Schwestern und zahllosen Freundinnen, sei ich zu jeder Zeit bereit, mein Herz an eine neue Kreatur zu hängen. Und nicht genug, ich liebe auch Männer, sei nicht modest in deren Gegenwart wie andere junge Mädchen, sondern habe die Kühnheit, mich in Gespräche mit ihnen einzulassen und meine Meinung zu verteidigen – sogar gegen einen Professor Monz und Schmidt. In den letzteren sei ich überdies verliebt, was meine Augen deutlich verrieten.
Ich erschrak so heftig, daß ich kein Wort hervorbrachte, sondern sie nur ansah. Sie wich von mir zurück, indem sie das Gesicht mit den Händen bedeckte:
»Ich fürchte dich«, schrie sie, »ich fürchte dich, du machst so schreckliche Augen.«
O armselige Herzen voll unbilligen Vorurteils, wie seid ihr hart und ungerecht! Aber so schuldlos ich[32] auch bin, in einer Beziehung war mir diese verwundende Berührung heilsam – sollte ich wirklich zu viel Entgegenkommen für Professor Schmidt gezeigt haben? Er ging neulich, als es regnete, ohne Schirm an unserm Haus vorbei, und ich lief hinunter und brachte ihm einen. Das also ist bemerkt und übel gedeutet worden.
Ach, der Mensch ist doch so ohnmächtig, denn wenn sich meine Augen freuen, wie soll ich das wissen und bemeistern können?
Und warum nicht viele Menschen liebhaben, warum nicht neue Freundinnen neben den alten gewinnen dürfen? Liebt nicht auch eine Mutter alle ihre Kinder und wenn sie noch so viele hat? Als unser geliebter Xaver starb, war Mutters Schmerz so tief und gewaltig, als habe sie mit diesem einen Kind ihr einziges verloren. Als Hermann, unser Benjamin, in schwerer Krankheit lag, war's da anders? Und hielt sie nicht Caton in der Trennungsstunde so fest in den Armen, als könne sie von diesem Kind nimmer lassen?
Wenn Mutter Theresens Schultern klopft, sagt sie nicht: meine Beste, meine Brävste? Und wenn ich leide in der Nacht und Mutter kommt, bin ich da nicht ihr geliebtestes einziges Kind? Nein, ich verschließe mein Herz nicht, und ich kann es nicht verschließen,[33] weil mich alles Große, Gute, Herrliche, weil jede Vortrefflichkeit mich mit unendlicher Bewunderung erfüllt.
Und was ich mir schon so oft vorgenommen, diesmal halte ich's: Mit der Freundschaft für Karoline ist es zu Ende.
Im Hause ist Freude und Glückseligkeit. Immer von neuem fließen die Tränen – Freude- und Dankestränen gegen Gott – Caton, unsere heißgeliebte Caton hat einen Sohn! Schön und bedeutungsvoll ist der Geburtstag des jungen Weltbürgers. Er kam am Tage der unschuldigen Kindlein zur Welt.
4. 4. Wir sind unendlich glücklich in unserer neuen Wohnung in Oberlinden. Es sind eigentlich zwei Wohnungen, eine rechts und eine links. Vater wohnt in der einen mit Hermann und den Studentlein, Mutter, wir Mädchen und zwei junge Pensionärinnen schlafen auf der andern Seite. Lorchen und Annele sind Waisen, reiche Wirtstöchter aus Heitersheim, die bei uns Schliff lernen sollen und Französisch. Wie fühle ich mich mit einem Male so wichtig und innerlich zufrieden in meiner neuen Stellung als Respekt einflößende Lehrerin, denn auch[34] unsern jungen Franzosen unterrichte ich in der deutschen Sprache. Er macht mir mehr Vergnügen als unsere unendlich schwer kapierenden Landpommeränzle. De Ber fragte mich gleich in der ersten Stunde: »Wie heißt je vous aime?« Ich sagte ihm: »Ich verehre Sie.« Nun verehrte er mich alle zehn Minuten, und bei Tisch ging die Verehrung erst recht los. Alles, was ihm schmeckte, verehrte er. Wir kamen aus dem Lachen nicht heraus.
Auch die andern jungen Leute sind nett und bescheiden, ganz anders als welche, die wir schon hatten, die die größten Ansprüche auf Bildung machten oder überbildet waren und abgeschmackt blumig in ihren Reden. Wie unbehaglich fühlten wir uns in solcher Gesellschaft, wie fürchteten wir uns vor ihrer Wortdeuterei und Scharfrichterei. Jetzt fürchte ich mich nicht mehr, ich hatte sogar die Kühnheit, meine ganze Familie an Kühnheit zu überbieten. Die Eltern konnten sich nicht überwinden, den jungen Akademikern zu sagen, daß sie mit sauberen Händen zu Tisch kommen möchten. Da entdeckte ich eines Tages zu meinem Vergnügen an Lorchens Fingern Tintenkleckse. Ich machte mein ernsthaftestes Lehrerinnengesicht und gebot Lorchen, den Tisch zu verlassen und mit sauberen Händen zurückzukommen. Unsaubere Hände bei Tisch seien ein Greuel. Lorchen erhob sich[35] blutübergossen, Vater und Mutter sahen mich erschrocken an, Therese schlug die Augen nieder. In diesem peinlichen Augenblick sprang de Ber plötzlich auf: »Ick auch verehre saubere Hände« – und lief zur Türe hinaus, die andern Jünglinge hinter ihm drein. Und seitdem haben wir nicht mehr zu klagen.
Den 7. Mai feierten wir Oberlindner das hundertjährige Alter unseres Lindenbaums.
Mutter in ihrer Voraussicht hatte zwei große Kuchen gebacken und eine tüchtige Platte voll Sträuble. Gleich nach Tisch kamen die Freunde, und nicht nur diese, sondern auch alle Bekannte bis ins dritte und vierte Glied; auch Rotteck mit seinem lieblichen Töchterlein. Natürlich war mein ganzes Herz bei Maria von Verleb, aber ich konnte ihr nur zunicken, so viel gab's zu tun, um all die Gäste zu bedienen. Kamarädle Lenchen, Malchen Roth und Malchen Wänker, Baurittele und Fromherzle halfen uns getreulich.
Als auf dem Platz drunten die Schulkinder anmarschierten und eng die Linde umstanden, deren Zweige mit rot und gelben Schleifen geschmückt waren, die lustig im Sonnenschein flatterten, huben die jungen Stimmlein zu singen an.
Alles drängte sich auf den Altan oder an die Fenster, und man fand sich zusammen, wie man zusammen[36] gehörte – die Hof-, Gerichts- und sonstigen Räte samt hochlöblichen Gemahlinnen, die Studentlein mit den jungen Mädchen, die alten Damen und die Hofrätin mit dem Strickstrumpf.
Unten der Gymnasialdirektor hielt eine Rede über die schöne Sitte, Bäume bei besonderen Anlässen zum bleibenden Gedächtnis einzupflanzen.
Er sagte uns: »Einen hervorragenden Platz nimmt in dieser Hinsicht die Linde ein. So hat die alte Zähringerstadt Freiburg im Breisgau zwei Plätzen die Namen Oberlinden und Unterlinden gegeben. Nach schriftlicher Überlieferung wird die obere Linde schon in einer Urkunde von 1291 erwähnt. Kriegszeiten und Friedenszeiten spielten sich unter diesen ehrwürdigen Bäumen ab, die nach ihrem Ableben immer wieder durch eine Nachfolgerin ersetzt wurden.«
Der Rede folgte ein Lied, an das sich die Austeilung der Brezeln anschloß. Die Kinder lärmten und schrien nach Lust. Zum nahen Schwabentor drängten die Bauersleute herein in ihren farbigen Trachten; darüber der tiefblaue Himmel in seinem strahlenden Sonnenglanz. Es war ein ungemein lebhaftes Bild, dem Maria und ich Arm in Arm vom Fenster aus zuschauten. Ich konnte nicht umhin, zu bemerken, daß Marias sonst so leuchtender Blick einen besonders[37] müden, ja fast leidenden Ausdruck hatte. Es fiel mir schwer auf die Seele, allein ich überwand mich, und indem ich wohl innerlich litt, suchte ich Maria durch allerlei Späßle aufzuheitern, was mir Gott sei Dank gelang. Ich hatte, ganz von dem einen Wunsch beseelt, ihr liebes Gesicht zum Lächeln zu bringen, nicht gehört, daß sich die Türe öffnete, als plötzlich Professor Monz und Professor Schmidt vor uns standen. Ich ärgere mich noch jetzt über meine große Verwirrung in dem Gefühl meines tiefen Errötens. Aber beim Anblick von Professor Schmidt fielen mir unglücklicherweise Karolinens Worte ein, daß meine Augen nur zu deutlich verrieten, was ich empfinde. So fehlte mir im ersten Augenblick alle Haltung, und ich war nahe daran, in Tränen auszubrechen. Marias erstaunter Blick trug noch zu meiner Verwirrung bei, so daß ich ganz unvermittelt, bloß um etwas zu sagen, an Professor Schmidt die Frage richtete, ob er am nächsten Sonntag im Seminarium wieder predige, und fügte hinzu, ich hätte manchmal die Empfindung, als sei mir Gott in einer schlichten Kirche näher als in einer prächtigen.
»Wie stellen Sie sich Gott eigentlich vor?« wandte sich Monz mit einem gewissen Lächeln an mich.
Äußerst befremdet, gab ich ihm etwas empört zur Antwort, daß ich mir darüber noch keine Vorstellung[38] gemacht habe. Ich wollte mehr sagen, fühlte jedoch, daß mich Professor Schmidt ansah, und wünschte darum sehnlichst, diesem Gespräch ein Ende zu machen. Aber schon erklärte Professor Monz, die meisten Menschen dächten sich Gott als einen bürgerlichen Mann, der fortwährend über dem Schuldbuch sitze und subtrahiere und addiere und jeden Heller dreimal umdrehe.
Da mußte ich unglückseliges Nannele wieder einmal zur Unzeit lachen, obwohl ich recht wohl fühlte, daß Professor Schmidts Augen auf mir ruhten. Er sagte mir beim Abschied:
»Ich hätte anderes von Ihnen erwartet!«
Ich verneigte mich zustimmend, wagte jedoch die Frage: »Warum treten Sie bei solchen Gesprächen nicht für mich ein, da es Ihnen doch ein leichtes wäre, Professor Monz zu überzeugen?«
»Von mir weiß er, wie ich denke,« sagte Professor Schmidt, »darum meiden wir dergleichen Gespräche.«
Ach, so unaussprechlich ernst, fast mißbilligend klang sein »Leben Sie wohl«, und doch, wie hat er in seiner letzten Predigt in der Seminarkirche zur Freude ermuntert. Wie ein Johannes, von himmlischer Menschenliebe begeistert, sprach er, und seine Rede ist voll Gefühl, voll Überzeugung, Kraft und Wärme. Er zeigte, in wie schönem Einklang die[39] Freude mit der Tugend stehe. Wie darum Gott die Welt so herrlich geschaffen und in wechselnden Gestalten darin die Freude, damit des Menschen Herz sich daran ergötze. So ungefähr sprach er, nur ganz anders, das heißt schöner, verständiger und deutlicher.
1. 5. Ich war des Morgens in der Küche beschäftigt, das Kraut schön fein zu schneiden, was ich nämlich gar nicht gern tue. Dabei träumte ich von der Möglichkeit, für den Nachmittag ein halbes Stündchen erübrigen zu können, um meine liebe Maria aufzusuchen, und verwünschte im voraus jeden unverhofften, mich aufhaltenden Kaffeebesuch.
Die Küchentüre ging auf, und Karoline stand auf der Schwelle. Wir hatten uns, seit wir hart aneinandergeraten waren, nicht mehr gesprochen. Ich wußte nur, sie war kurz darauf nach Straßburg gereist, um sich dort in der französischen Sprache auszubilden.
»So,« sagte ich, »du bist wieder hier?«
»Ja,« sagte sie, »ich muß dich notwendig sprechen; aber du hast zu tun?«
»Ja,« sagte ich, »ich kann nicht weg.«
Sie nahm ein Messer von der Anrichte und half mir. So schnitten wir eine Weile darauflos. Ich dachte: Was will sie nur? Denn sie sah so feierlich[40] aus, was so spaßig zum Krautschneiden paßte, daß ich Mühe hatte, nicht zu lachen. Da sagte sie:
»Ich bin gekommen, um dich um Verzeihung zu bitten. Professor Schmidt hat mir's zur Buße auferlegt.«
»Wie,« rief ich aus, »du hast bei Professor Schmidt gebeichtet?«
»Ja,« sagte sie, »ich beichte jedesmal bei einem andern, bis mir einer paßt. Professor Schmidt ist aber der ärgste, er hat mich so verdonnert, daß mir's wie einem Häufle Unglück zumute war.«
»Hast du ihm denn alles gesagt?« fragte ich mit einem von Entsetzen erfüllten Herzen.
»Ja, alles, jedes Wörtle, das ich zu dir im Zorn gesagt«, gab sie zur Antwort und sah mich schadenfroh an.
Zorn und Verdruß preßten mir Tränen heraus.
Karoline lachte. »Ich sei nicht wert, dir die Schuhriemen aufzulösen, hat er gesagt. Aber gottlob, ich mach' mir nichts daraus. Du warst immer so eine Gewissenhafte, was hat man denn davon? Die Händ' würdest du über dem Kopf zusammenschlagen, wollt' ich dir von meinen Abenteuern in Straßburg erzählen. Aber ich war immer anständig, ich kann's beschwören. Nur heiraten hab' ich wollen – denn wenn ich auswärts keinen krieg', daheim[41] krieg' ich erst recht keinen. Sechs Mädle und kein Geld, dazu die Schlamperei, die ganz Freiburg kennt. Und Tante Hofrätin stirbt auch nicht, daß man endlich einmal was erben könnt'.«
Das Kraut war geschnitten. Karoline setzte sich auf die Küchenbank.
»Einen Trost hab' ich,« sagte sie, »du kriegst auch keinen, wenn ich keinen krieg'.«
»Du bist einfach ein böser Mensch«, fuhr ich auf.
»He woher,« meinte sie und schaukelte mit der Bank, »ich sag' halt, was ich denk' – hast du das erst jetzt bemerkt? Das Edeltun ist mir ein Graus.«
Sie schüttelte sich, und das war so komisch, daß ich lachen mußte.
Und als sei nichts vorgefallen, sprach sie leise, den Finger auf den Mund legend: »Ich will dir was anvertrauen – sonst hab' ich's noch keinem Menschen gesagt – ich schlag' dem Schicksal ein Schnippchen – eine alte Jungfer werd' ich nit – und wenn's unser Herrgott zehnmal will. Ich geh jetzt noch für ein halb's Jahr nach Straßburg, bild' mich völlig im Französischen aus und genieße noch ein bißle 's Lebe. Entweder ich komm' mit einem Bräutigam, oder ich geh' ins Kloster – dann hab' ich mein Auskommen und mein Ansehen und spazier' vor euch allen zur Tür herein – Etsch!«
Damit ging sie.
Ich lachte und weinte auch ein wenig vor Verdruß, als Mutter in die Küche kam. Ich erzählte ihr mein Erlebnis mit Karoline und daß ich so gar nicht begreife, wie man so bös sein könne.
»Närrle,« sagte die Mutter, »hast du das nie bemerkt – von Kind auf war sie dir neidig. Ein ärgeres Leiden gibt's aber nicht als den Neid – also bedaure sie.«
Leider habe ich an unsern Hauskindern Lorchen und Annele wenig Freude, trotzdem Lorchen partout Französisch parlieren lernen will. Der Traum ihres Lebens ist ein Offizier, und darum muß sie notwendig eine gebildete Frau werden. Daß man zum Lernen aufpassen muß, ist ihr jedoch nicht klarzumachen. Ich bekomme für die Stunde 12 Kreuzer, auch vom kleinen Mändelin. Von de Ber 24 Kreuzer. Ich kann somit so ziemlich meine Toilette und die kleinen Geschenke für Geschwister und Kamarädle bestreiten. Freilich, wenn Hermann mit seinem bescheidenen Taschengeld nicht auskommt, was meistens geschieht, muß ich ein wenig aushelfen, und dann reicht mein Verdienst nicht aus, besonders wenn es sich wie jetzt um einen Wintermantel handelt. Mein alter grüner Mantel wurde schwarz gefärbt und zu einem Kleid verarbeitet, in dem ich wie eine Äbtissin aussehen soll.[43] An der Messe bekam ich dann einen hübschen bronzefarbenen Circasien, und ich habe in die Ecken des obern und untern Kragens von derselben Farbenplattseide einen Arabeskenschnirkel gestickt. Auch die Hutsorge wäre erledigt; ich sollte einen neuen haben, wollte aber Mutters Beutel nicht zu sehr strapazieren und für diesen Winter noch Verzicht leisten. Nun gab's einen edlen Wettstreit. Mutter wollte mir durchaus ihren schönen neuen Hut aufdringen, aber ich blieb standhaft und hatte gleich darauf Gelegenheit, dem immer gütig gegen mich verfahrenden Geschick dankbar zu sein. Schwägerin Lotte schickte Theresen aus Karlsruhe einen Hut zum Geburtstag. Sehr schön, aber meinem Farbensinn nicht entsprechend, denn dies ist mein eigensinnigster Sinn, der Therese und mir schon manch widerwärtig Stündlein verursachte. So wieder jetzt, als ich das Vermächtnis ihres eigenen, noch schönen Hutes antrat, der dunkelgrün ist, und von dem ich das braune Band weg haben wollte, was Therese gar nicht begriff. Aber ich kann steifbetteln, wie sie sagt, und so gab sie nach, und es ging ein sehr erfreuliches Exemplar aus ihren geschickten Händen hervor.
Wie immer im Herbst habe ich eben wieder mit ganz besonders schlechten Nächten zu tun. Ach, dieses Übel, so gefahrlos es auch sein mag, ist doch so beängstigend,[44] daß ich lieber Schmerzen ertragen wollte als diese furchtbare Beklemmung, diese Hemmung des Atmens. Ich kann darauf zählen, daß, wenn ich den Abend in einem lustlosen heißen Raum zugebracht, ich das immer ganz besonders büßen muß. Darum aber lasse ich meinen Theaterplatz doch nicht im Stich. Zweimal im Monat wird mir dieses große Vergnügen zuteil, als Ausgleich für die Bälle. Ich habe neulich den berühmten Komiker Wurm gesehen und fühlte mich sehr enttäuscht, wahrscheinlich, weil seine Kunst so über alle Begriffe gepriesen wurde. Er spielte im »Juden« den Juden Schewa, eine sich mehr dem Tragischen als Komischen nähernde Rolle. Vielleicht war ich auch schon deshalb enttäuscht, weil ich ihn lieber in einer komischen Rolle gesehen hätte.
Eben gastiert eine bis in die Wolken erhobene Sängerin, genannt Madame Kainz, die deutsche Catalani. Leider nur bei aufgehobenem Abonnement, also muß ich mich mit dem Hörensagen begnügen.
10. 10. Die Eltern sind mit Therese und Lorchen auf dem Kasinoball. Ich durchwache meistens die Ballnacht, schreibe, lese und treibe, was ich mag. Heute ist Annele bei mir geblieben. Wenn ihr auch die französischen Regeln recht schwer in den Kopf gehen, um so[45] klüger, d. h. alles verstehender ist ihr Herz. Oft, wenn ich bei der Zimmerarbeit ein wenig mutlos den Kopf hängen lasse, wer erscheint mit dem Abwischtuch in der Hand unter der Tür und schäffelt mit mir darauf los, daß schon nach einer Stunde die ganze Bergesarbeit überwunden ist?
So blieb sie auch heute abend bei mir, und es war eine meiner vergnügtesten Ballnächte. Haben wir doch wie die Kinder, den Großen gleich, auch getanzt, soupiert, einfältig vornehm geplaudert, wieder getanzt in Gestalt eines überaus zierlichen Menuetts und noch einmal colaziert, eine süße Speise, namens Charlotte, ein Überbleibsel vom gestrigen Mittagsmahl, bei dem wir Hofrat Amann und Professor Bouger zu Gast hatten. Mit dieser Charlotte aßen wir Schmollis miteinander, denn bisher hieß nur ich sie du. Dann sangen wir noch eine Stunde mit Begleitung der Gitarre ein komisches Quodlibet, Annele wurde zu Bett geschickt, und ich warte auf die Meinen, indem ich lese und diese Abhandlung schreibe.
24. 3. Man lacht nicht selten in der Familie über meinen Zeitgeiz, aber was soll aus meinen Lieblingsbeschäftigungen werden, zum Beispiel dem Zeichnen, wenn ich nicht alle Hebel in Bewegung setze, um mir[46] eine Stunde im Tag dafür zu erübrigen. Ich bin darauf angewiesen, mich jetzt allein weiterzubilden. Ach, und ich kann noch so wenig, und es wäre meines Herzens höchste Wonne gewesen, mich weiterbilden zu dürfen, wie Amalie von Berg es darf, diese Glückliche! So ist die kleine Zeichnung von unsrer geliebten Caton im großen Florentiner Schlapphut, der ihr immer so gut stand, eben doch nicht so ausgefallen, wie ich mir vorstelle, daß es sein könnte. Trotzdem sind die Eltern, denen ich das Bildchen zum Namenstag dargebracht (wir feiern beider Namensfest zugleich) – sehr glücklich darüber, und auch der Rahmen, den ich selbst aus Holz verfertigt und bemalt, erregte großen Beifall.
Oh, geliebteste Caton, wie oft und schmerzlich vermisse ich dich!
Unzulängliche Mitteilung der Briefe – sagen viele. Oh, mir genügte sie, könnte ich nur Gebrauch machen von dem Gebotenen. Aber wie könnte man bei uns, ohne auffallendes Vorenthalten, einen Brief einschließen, der nicht zuvor bei der Familie, wenn eben nicht die Zensur, doch sehr die Kritik passiert.
Wenn du wüßtest, wie wir oft im Winter in der warmen trauten Stube allesamt meinen, jetzt müßte unser heiteres, singendes Catonle plötzlich bei uns eintreten. Und erst jetzt im Frühling, in der knospenden,[47] herrlichen Natur! Wie würdest du dich freuen über den Verschönerungsgeist, der plötzlich in Freiburg erwacht ist und sich über die ganze Umgebung erstreckt und schöne Spaziergänge dem Genuß bietet. Der neueste führt auf ganz geebneten, nur sachte hinansteigenden Pfaden über den Schloß-, Hirsch- und Johannisberg durchs Immental bei Herdern herunter, wo es im Gasthaus zum Schwanen nun beinahe so lebhaft zugeht wie in Günterstal. Am schönsten aber sind meine einsamen Spaziergänge des Morgens um sechs – mit Lenchen oder Hermann. Bei einem solchen Spaziergang hat mir das arme Brüderle unter Tränen mitgeteilt, daß er nun endgültig seine Sehnsucht, Offizier zu werden, zu Grabe tragen müsse. Vater habe ihm ein für allemal erklärt, ein Sohn aus seinem Hause dürfe niemals unter die Müßiggänger gehen. Ich tröstete mein liebes Brüderle so gut ich konnte. Ich sagte ihm, daß auch ich auf manches verzichten müsse, und nun erst die Eltern, die um ihrer Kinder willen sich unablässig sorgten und mühten, ohne sich die geringste Annehmlichkeit zu gönnen.
Als Hermann meinte, Xaver habe es doch so flott getrieben, gab ich ihm einen kleinen Puffer mit der Bemerkung:
»Du weißt recht gut, daß unser herrlicher Bruder sich alles selbst verdient hat durch Stundengeben.«
»Hm,« sagte mein Brüderle nach einigem Besinnen, »so werd' ich Auditor und bin doch beim Militär und kann mir sogar vielleicht ein Pferd halten.«
Wie haben's die Männer so gut.
Ich möchte mich noch nicht schlafen legen, ohne das Erlebnis mit Dortel einzubuchen, das mir einen tiefen Eindruck gemacht.
Fünfzehnjährig kam sie zu uns, das Kind armer Eltern in Herdern. Ein wenig scheu, fast unfreundlich, tut sie ihre Arbeit, aber ohne daß ihr je etwas zu viel wäre, und verliert auch nie den Kopf, selbst wenn's kurz vor Tisch heißt: Dortel, es kommen noch Gäste. Dies alles haben wir so selbstverständlich hingenommen und hinter der Äußerungsarmut der Dortel keine weiteren Empfindungen vermutet. Darum war ich sehr erstaunt, Dortel Sonntag abend mit einem geradezu strahlenden Gesicht von Herdern zurückkehren zu sehen, und konnte mich deshalb nicht enthalten, zu fragen: »Dortel, was ist Ihr denn Schönes begegnet?«
»Endlich,« sagte sie, »hab' ich's de Eltern abzahle könne, was i ihne so lang schuldig bliebe bin.«
»Was war Sie ihnen denn schuldig, Dortel?«
»Ha, wie ich uf d' Welt kumme bin – 's Wochebett von der Muetter und dann d' Koscht und's G'wand bis zu fufzehne.«
30. 5. Der Abend bei Verlebs war noch schöner, als sich's meine kühnsten Phantasien vorgestellt. Ich fand Maria am Klavier. Sie trug ein weißes Mullkleid, über dem Ausschnitt ein mit Spitzen besetztes Fichu. Sie hatte keine Neigelocken wie auf dem Ball, sondern das volle aschblonde Haar fiel ihr leicht gewellt, mit einem weißseidenen Band gehalten, bis über die Schultern. Wunderbar verträumt, fast sehnsüchtig, war der Ausdruck ihrer dunkelblauen Augen, während ihre Hände dem Klavier meist schwermütige oder leidenschaftliche Weisen entlockten.
Ich hatte mich ihr gegenüber in eine Ecke gesetzt und verglich sie im stillen mit der heiligen Cäcilia.
Da sprang sie auf:
»Nannele, komm und mach mich froh! –«
»Wenn ich das könnte! –«
»Ja, ja, das kannst du – und ich will dir auch eins verraten: nach meiner Ansicht kann man gar nichts Besseres tun in der Welt als Heiterkeit verbreiten –«
»Aber denke dir die großen Taten der Männer –«
»Ja,« sagte sie, »das gehört auch mit in die Welt, aber denen, die uns das Alltagsleben erheitern, bin ich doch am dankbarsten, vor allem Jean Paul. Oh, der Weise, der Gütige, der Warmherzige, wie liebe ich ihn, wie bin ich ihm dankbar! Ist er nicht mein größter Wohltäter, da er mir Lachen schenkt und[50] Weinen in einem Atem, denn er gibt uns sein ganzes Herz, dessen Jubel, dessen Schmerz uns wie eigener Jubel, eigener Schmerz berührt! Um Himmels willen, Nannele, laß dir diesen Herrlichen nicht durch Monz verkleinern. Ich weiß, er stellt Goethe über ihn« – sie lachte laut. »Irgend jemand über Jean Paul stellen, das kann nur dieser trockene Monz, der keinen Funken Humor hat. Oder«, fragte sie unvermittelt, »hast du ihn am End' gern?«
Sie sah mich so ängstlich an, daß ich lachend den Kopf schüttelte.
»Ich bin ihm dankbar,« sagte ich, »denn er teilt mir gern aus dem reichen Schatz seines Wissens mit. Außerdem ist er ein Dichter. Goethe hat ihm einen ermutigenden Brief geschrieben.«
»Jean Paul hätte ihm einen vernichtenden geschrieben«, fiel mir Maria ins Wort; »aber ich bin froh, Nannele, ach so froh –« sie nahm mich um die Schulter und tanzte mit mir durchs Zimmer – »ich hatte ja so Angst, deine Verwirrung neulich beim Lindenfest, als Monz und Schmidt eintraten – ich war voll Angst, Monz habe dir's angetan. Aber warum bist du denn so in Verwirrung geraten, als die beiden eintraten?«
Sie sah mich scharf an.
»Nun, es war wegen Schmidt«, gestand ich und erzählte[51] ihr Karolinens Äußerung, daß meine Augen deutlich verrieten, was ich für Professor Schmidt empfinde.
»Also du empfindest für ihn, Nannele,« rief Maria aus, »eine unglückliche Liebe?«
Ich mußte lächeln.
»Unglücklich, nein, aber seine Begeisterung auf der Kanzel, seine Schlichtheit und seine Demut – was weiß ich, ich muß ihn lieber haben als Monz, der mir doch so viel gibt. Auf das Liebhaben verzichten, das kann man nicht, aber damit fertig werden, das kann man.«
»Oh, Nannele, glaub' nicht, daß du das kannst!« rief Maria aus.
»Man muß es können,« sagte ich, »wenn man ein Leiden hat. Das ist doch nur selbstverständlich.«
»Ich habe es nicht können«, sprach Maria in leisem Tone und barg das Gesicht in beiden Händen. –
Mir lagen jetzt, wie schon oft bei solchen Anspielungen, dringliche Fragen auf den Lippen – was ihr fehle, woran sie leide. Aber ich beeilte mich, Maria zu versichern, daß mein Edelmut nicht sonderlich bewundernswert sei, da mich ja keiner wolle. – »Doch,« sagte sie, gleich wieder heiter, »Monz will dich, er erzieht dich, er erzieht dich jetzt schon zu seiner Gattin. Das macht er so, wenn ihm ein Mädchen gefällt, du kannst[52] es mir glauben.« – »So lang er mir schöne Bücher leiht, hab' ich nichts dagegen«, meinte ich lachend. – Und sie drohte mit dem Finger: »Nannele, Nannele, bist du deiner wirklich so sicher?« – »Ich wär's vielleicht nicht,« gab ich zu, »wenn Monz Schmidt wäre.« – Herr von Verleb kam, und man ging zu Tisch. Es ist gar schön gedeckt; in einer kristallenen Vase stehen Blumen, eine feine Jungfer serviert. Herr von Verleb zeigte eine rührende Sorgfalt für seine Frau, legte ihr vor, bat sie inständig zu essen, und erst als sie zu seiner Zufriedenheit tat, was er wünschte, wandte er sich an mich, indem er über einen Aufsatz Rottecks in der »Freisinnigen« loszog. Nach seiner Ansicht habe ein Abgeordneter der Ersten Kammer überhaupt keine freisinnige Zeitung herauszugeben. Rottecks beständiger Eifer gegen ein stehendes Heer sei ebenso unstatthaft als sein geradezu rücksichtsloses Eintreten für die Universität, indem er seine Anforderungen für diese von Jahr zu Jahr steigere. – »Aber«, fiel ich ihm wohl allzu lebhaft ins Wort, »verdankt die Universität nicht hauptsächlich ihre Erhaltung den kräftigen Vorstellungen Rottecks, und haben wir ihm dafür nicht im höchsten Grade dankbar zu sein – denn was wäre Freiburg ohne seine Universität? Gibt es für die Menschen überhaupt etwas Wichtigeres als Universitäten?« setzte ich fragend hinzu. – »Ja, wenn[53] man den ewigen Frieden verbrieft hätte«, sagte Herr von Verleb. – In diesem Augenblick trat die Jungfer ein und berichtete, Herr Professor Monz lasse anfragen, ob er nach dem Nachtessen für ein Stündchen willkommen sei. – Maria wendete lebhaft den Kopf zurück: »Eine Empfehlung an den Herrn Professor, und ich bedauere sehr, ihn nicht herbitten zu können, ich sei zu leidend heute abend.«
»Nicht böse sein«, wandte sie sich an ihren Mann. »Denke dir, Anna, neulich, als mir seine Gelehrsamkeit derart auf die Nerven ging, daß mir fast übel wurde, bat ich ihn: ›Darf ich ein wenig Musik machen, Herr Professor, zum Kalmieren?‹ Er sagte: ›Sehr angenehm.‹ Und ich setzte mich ans Klavier. Glaubst du, er hätte geschwiegen? Im Gegenteil, er schrie immer lauter, je stärker ich spielte.«
Sie lachte, und so herzlich, daß ihr Mann sie ganz glückselig anschaute.
O wie schön war sie in diesem Augenblick! Und als errate sie meine Gedanken, nickte sie mir mit leuchtenden Augen zu.
»Ja, Annele, das Schöne, das Heitere – einschenken, Männle – das Schöne, das Heitere soll leben –«
Sie spielte noch wunderschön und hätte wohl stundenlang so fortgespielt, wenn Herr von Verleb ihr nicht Einhalt geboten hätte.
»Deine Wangen glühn, Kind,« sagte er voll Besorgnis, »und deine Hände sind eiskalt.«
Hermann holte mich ab. Der Himmel war sternenklar, als wir heimgingen.
18. 10. Die Weihe des Erzbischofs ist vorüber; ich bin ganz müde von lauter Schauen und Hören. Gestern nachmittag sah ich den Großherzog, die Markgrafen und den Fürsten von Fürstenberg durch die große Straße fahren. Das Bild war unendlich lebendig, ein Hin- und Herwogen von Tausenden von Menschen zu Fuß, zu Wagen, zu Pferd. Die Landleute in ihren bunten Trachten, die Städter im Wichs, kuriose Erscheinungen von Gott weiß woher. Abends war große Beleuchtung, ein herrliches Schauspiel, wie ich nie etwas dergleichen gesehen. Alle öffentlichen Plätze und Gebäude glänzten in ihrem Brillantfeuer mit den schön gewählten Inschriften. Am besten gefiel mir die Darstellung des Münsters am Herderschen Hause mit seiner sinnreichen Inschrift:
»Konrad, der Ahne, rief des Domes Bau, den herrlichsten, ins Leben.«
Und links: »Ludwig, der Enkel, hat vollendend ihm den schönsten Schmuck gegeben.«
Schön und ideenreich war der über dem Fischbrunnen angebrachte haushohe Tempel, in dem die feuerumfluteten vier Ahnen prangten: Konrad, Berthold, Karl und Ludwig. Prachtvoll war das Rathaus, die alte Universität, das Erzbischöfliche Palais, die Darstellung des schwebenden Genius auf Minister Andlaws Balkon, bei Domherrn Hug ein in lichten Wolken schwebender Genius, in der Hand die Petrusschlüssel und Bischofsmütze. Wie ein Traum erhob sich auf dem Schloßberg ein Opferaltar, der gleichsam hoch über dem Karlsplatz in der Luft zu hängen schien, da der Berg im Dunkel lag. Hermann hatte seine besondere Freude an dem Spruch in der Wolfshöhle: »Wohn' ich gleich in einem Loch, So illuminier' ich doch –«
Am folgenden Morgen fand die Einweihung statt. Sie dauerte von acht bis halb zwölf. Ich war die ganze Zeit über mit Mutter auf dem Münsterplatz bei Herrn von Mohr, während Vater mit Therese und unsern Pflegebefohlenen sich unter der Menschenmenge befand.
Wir frühstückten eben zum zweitenmal, als der feierliche Zug unter dem gewaltigen Geläute der Münsterglocken den Dom verließ, voran mit Kreuz und Fahnen die Schuljugend, deren vielstimmiger[56] Gesang sich in dem feierlichen Glockengeläute verlor. Die ganze Geistlichkeit folgte, die Domherrn in ihrem violetten Ornate, der Erzbischof von Köln, in Gold strotzend, an seiner Seite zwei Weihbischöfe, nicht minder prachtvoll gekleidet. Ihnen folgte die hohe, majestätische, Ehrfurcht gebietende Gestalt des neu erwählten Erzbischofes. Seine Kleidung war anscheinend minder reich als die seiner Vorgänger; wenn diese von lauterem Gold, bestand jene, Mütze, Gewand und Schuhe, von weißem, reich mit Gold und Edelsteinen verziertem Stoffe. In seiner Linken hielt er den goldenen Stab, und mit der Rechten segnete er das in Bewunderung und Rührung hingesunkene Volk.
In geringer Entfernung folgten die Herren des Hofgerichts, die Professoren, der Magistrat. Den Fürstlichen voran ritten zwei rote Husaren, die Wämser reich mit Gold und Pelz verbrämt. Es waren die Heiducken der ihrer Schönheit wegen viel bewunderten Markgrafen. Aber das Volk hielt die reich gekleideten Heiducken für die Markgrafen und jubelte jenen zu.
Wir sahen auch die vier langen Tafeln im Rathaus, wo die Erzbischöfe und Bischöfe, der Landesfürst und die Markgrafen von der Stadt regaliert wurden.
Hermann meinte beim Anblick all der Herrlichkeiten und dem Dutzend von Gläsern an jedes Gastes Platz: »Herrgott, Nannele, ich werd' Erzbischof. –«
Des Abends um acht Uhr war großer Ball im Kasino. Ich setzte mich des Nachmittags an meine Zeichnung, eine Kopie des hl. Johannes, als Mutter eintrat und mich schmälte, daß ich Therese nicht half, die so viel noch an ihrem Ballstaat zu tun habe. Und ob ich mein Versprechen vergessen, diesmal mit auf den Ball zu kommen, und was ich eigentlich vorhabe, anzuziehen.
Ich ließ Mutters Frage unbeantwortet, in der stillen Hoffnung, letzten Augenblicks in Ermangelung eines passenden Kleides zu Hause bleiben zu dürfen. Denn wenn mich meine Freundinnen auch oft bereden, auf das Kasino zu gehen, um mit ihnen in einem so glänzenden Raum zusammen zu sein, so hat das doch eigentlich keinen rechten Sinn, da ich des Unmuts nicht immer Herr werde: Warum muß ich bei den Müttern sitzen, jung wie ich bin, und kann nicht tanzen wie die andern? Daß gerade das lebhafte Bewegen in geschlossenem Raum mein Leiden sofort hervorruft, ist ein eigenes Geschick. Da ich mich darüber nur bei mir selbst beklage, so ahnen die Meinen freilich nicht, wie schwer es mir wird, einen Ball zu besuchen.
Ich hatte Therese frisiert, so wie sie's eigentlich[58] nicht gern mag und es ihr doch so ausgezeichnet steht. In die buschigen Neige-Locken steckte ich zwei herrliche weiße Rosen. Therese kann es in der Kunst des Blumenmachens mit der ersten Modistin aufnehmen. Auch die von ihr verfertigten Ballschuhe sowie die Stickereien an ihrem weißen Kleid sind Meisterwerke ihrer Hand. Ich wollte schon, als Mutter hereintrat, mich empören, daß sie nicht ihr Blauseidenes, das ihr so gut steht, anhatte, sondern das schon etwas verbrauchte Schwarzseidene, als sie mich lachend in ihr Schlafzimmer zog, wo das blaue Seidenkleid ausgebreitet auf dem Bett lag, Mutters schönster Spitzenkragen daneben. Sofort erriet ich, wie es gemeint war, und flog Mutter unter Tränen um den Hals.
»Bisch ein Närrle«, sagte sie.
Und so stieg ich, sehr solide geputzt, mit den Eltern und Therese in eine Chaise, die Hermann hatte holen müssen, denn es regnete in Strömen. Auf dem Bock saß zum Unglück ein kreuzdummer Fuhrmann, der nicht einmal das Münster, geschweige das Museum finden konnte. Und so gelangten wir endlich nach einer halbstündigen Spazierfahrt durch alle möglichen Gassen zum Museum, ich ganz der Komik der Situation hingegeben, Therese voll Angst, keine Tänzer mehr zu bekommen. Alles im Museum war schon versammelt und erwartete den Großherzog und die[59] Markgrafen. Da man nun das Anfahren hörte, glaubte man, es sei der Großherzog, und wir wurden von zwanzig Bedienten mit silbernen Leuchtern, den Vorstehern des Museums und einer Masse von Offizieren auf das ehrenvollste empfangen. Nachdem wir diese angeschmiert hatten, begaben wir uns hinauf in den Tanzsaal und schmierten noch den ganzen Adel an, der im Vorzimmer Spalier stand.
Der Ball war wundervoll. Dieses glänzende Getreibe, diese herrlichen Männer- und Frauengestalten an mir vorüberschweben zu sehen, wurde mir zu einem so großen Genuß, daß ich mich darüber ganz und gar selbst vergaß. Für mich war Therese eine der vornehmsten Tänzerinnen, und ich dachte im stillen: wie seid ihr Menschen doch so dumm, rotes Haar häßlich zu finden. Ich fand es direkt schön, wenn Theresens leuchtendes Haupt unter all den blonden und hell- und dunkelbraunen Haaren auftauchte. Ihr Gesicht ist blaß und schmal, ihre Augen sind dunkel. Aber ach, wie konnten diese sonst so stillen Augen aufleuchten, wenn Oberleutnant A. sie zum Tanze holte. Und er holte sie sehr oft. Ohne Klage, ohne sich je auszusprechen, trägt Therese das schwere Leid des Verzichtens mit sich allein. Denn wenn auch Vater imstande wäre, eine Kaution zu stellen, ich glaube, die Heirat mit einem[60] Offizier würde nie seinen Beifall finden. Aber die Freude, eine der gefeiertsten Tänzerinnen des Museums zu sein, tut ihr doch wohl. Sie lebt im Tanze, sie schwebt, ihre Füße scheinen den Boden nicht zu berühren. Markgraf Max holte sie zweimal, und ich fürchtete für Theresens Lunge, denn statt einmal, wie mit den andern Damen, tanzte er mit ihr jedesmal dreimal herum. Auch der Fürst von Fürstenberg tanzte mit Therese. Es war den Eltern eine große Freude.
Ich war übrigens auf meinem isolierten Plätzchen durchaus nicht verlassen. Nach jeder Tour erschienen meine Kamerädle, um mir mit erhitztem Gesicht von den Annehmlichkeiten des Tanzes zu erzählen. Lenchen natürlich erschien am häufigsten. Malchen Wänker, Malchen Roth, Caton von Mohr, Fromherzle, Baurittele, Marie Ruof – kurz, sie brachten mich in so gute Stimmung, daß ich mir's gefallen ließ, daß die rosigen schimmernden, schwebenden Gestalten, die dunkle in ihre Mitte nehmend, mit ihr in einer Pause den Saal entlang spazierten.
Ich hatte mein Ballkärtchen und war auf fünf Schwätztouren engagiert, von Monz, Hofrat Amann, Welcker, Professor Zell, Reichlin. Auch Herr von Rotteck erfreute mich mit seinem Besuch, und Verleb, der mir Grüße von Maria brachte, die ihr Vorhaben, zu[61] kommen, ihres weniger guten Befindens wegen hatte aufgeben müssen. Ich wollte, als ich das erfuhr, gleich den Ball verlassen und Maria Gesellschaft leisten, aber Mutter sagte: »Nannele, du bleibst jetzt bei uns.«
Amalie von Berg kam auch zu mir, gleich nach ihrem sehr späten Erscheinen, und fragte nach Maria, die sie zu treffen gehofft.
Ich bewundere Amalie von Berg. Es ist etwas so prachtvoll Gelassenes an ihr. Andre Mädchen springen sofort auf beim Beginn der Tanzmusik. Sie blieb ruhig sitzen und ließ ihren Tänzer warten. Hochgebildet, eine talentvolle Malerin, spricht sie, sobald sie meiner habhaft wird, sofort von ihrer Kunst, wohl empfindend, wie lebhaft mein Verständnis dafür ist. So ist unsre Unterhaltung immer nur auf diesen einen Punkt gerichtet und sehr ernst. Meine Heiterkeitsmöglichkeit, ich möchte sagen das Beste in mir, wird nicht geweckt, so daß es mir geht wie einem Kind, das traurig ist, weil sein Püpple keine Anerkennung findet. Bei Maria ist das ganz anders. Ich weiß nicht, wie sie's macht, aber sie versteht es, Heiterkeit bis zum Übermut in mir zu erwecken. Jedenfalls sind diese beiden Frauen die Sonntagsfreude meines Herzens, und obwohl sie nicht viel älter sind als ich, macht sie ihre Gewandtheit und Erfahrenheit in weltlichen Dingen[62] meiner Einfältigkeit gewaltig überlegen. Amalie von Bergs Selbständigkeit kommt wohl auch daher, daß sie Waise ist, also früh auf ihr eigenes Urteil angewiesen war. Sie lebt hier bei ihrem Bruder, dem Hofgerichtsadvokaten Berg – ach, einem Kollegen unseres Xaver. –
Wie schön ist das Los dieser beiden Frauen, die sich so ganz der Kunst, die sie lieben, hingeben dürfen. Ob sie's auch recht beherzigen?
Ich weiß eigentlich nicht, was ich für ein Temperament habe, aber ich glaube ein sanguinisches, ob es auch leicht von außen gestimmt, ja, verstimmt wird. Man darf mich nur wie ein Instrument an einen kalten Ort bringen. Doch bin ich meist froh und betrachte alles von der lachenden Seite und in besonderen Augenblicken sogar von einer geradezu glückseligen. Ich weiß nicht, woher diese Augenblicke kommen, und warum sie kommen. Es ist plötzlich, als erwarte mich bei der nächsten Biegung um die Ecke irgendein großes, unbeschreibliches Glück. Oder wenn ich zur Abendstunde ins Münster trete und so leise als möglich durch die dämmrige Säulenhalle schreite und die Stille so groß ist und nur ein paar alte Mütterle da und dort beten – da kommt es auch, daß mir das Herz erzittert, als müsse mir plötzlich eine große, mich unbeschreiblich glücklich machende Gewißheit werden.[63] Und doch weiß ich nicht, was es ist, und die dunklen, tief im Schatten liegenden Ecken bleiben dunkel, und das in Licht getauchte Wunderbare tritt nicht hervor. Ob's allen Menschen so ist? Und doch mag ich nicht davon sprechen, aus Angst, es könnte Unsinn sein.
Schon habe ich meine drei liebsten Kamerädle dazu verführt, an schönen Tagen morgens um sechs mit mir in die Berge zu wandern. Am schönsten aber ist's mit Lenchen allein. Es ist ein Genuß, wieviel Sinn sie hat für die Natur. Jedes Landhäuschen, jede Naturgruppe, jedes niedliche Gräschen im Moose begrüßt sie mit ihrem hellen Stimmchen. Sie hat ihre Arbeit im Ridikül, ich mein Skizzenbuch. Es fällt uns aber durchaus nicht ein, den gewöhnlichen nächsten Weg auf den Schloßberg zu gehen, der wäre uns schon zu gemein: sondern viel weiter hinten, gegen den Johannisberg, wo er viel höher und die Aussicht noch weiter und mannigfaltiger ist und man sich mühvoll durchs Gestrüpp hinaufarbeiten muß, erklimmen wir alle Gipfel, atmen alle Wohlgerüche ein und jubeln, was wir können, allein, weil die Freiburger vor den Kopf geschlagen sind und nichts von Morgenspaziergängen wissen wollen, überhaupt nichts von täglichen Spaziergängen, sondern nur von zeitweiligen Ausflügen mit Einkehren. Und darum heißt's bei den Frau Basen: 's Villinger Nannele[64] macht alleweil alles anders als d'andere Leut' – kei Mensch kann d'Kreisrätin begreife, daß sie im Nannele au so wenig wehre tut. –
Gottlob, unsre Mutter wird oft nicht begriffen, und zwar zu unserm Glück und ihrem Ruhm.
Auch Caton und Petersen habe ich aufgestiftet, ihrer bescheidenen nordischen Natur die Ehre anzutun, sie zu durchwandern. Die neue Ansiedlung unsrer Lieben, das hannoveranische Städtchen Celle, liegt dicht an der Heide. Die liebende, nirgends reizlose Natur schmückt gewiß auch diese, so daß man sich auch fern von allen Bergen höher und freier fühlen kann.
Unendlich interessiert mich die Beschreibung Catons von dem nicht weit von Celle liegenden Schloß Ahlden, und tief ergreift mich das Schicksal der armen Prinzessin von Ahlden, der unglücklichen Sophia Dorothea, der Gemahlin des grausamen, kaltherzigen Kurfürsten von Hannover. Wenn ich auch eine so große Leidenschaft nicht recht begreife; denn wenn die Prinzessin ihren Mann auch nicht liebte, hatte sie nicht Kinder? Trotzdem geht mir ihr Schicksal so nahe, daß ich nicht ohne Tränen an sie denken kann. Ob es wohl in Celle noch Menschen gibt, die von Hörensagen noch manches von der armen Gefangenen zu erzählen wüßten? Oh, ich hätte keine Ruhe, ich müßte es erforschen.[65] Wenn es uns Menschen doch gegeben wäre, uns leicht von einem Ort zum andern zu bewegen.
Weißt du noch, Caton, wie wir noch klein und dumm waren, so hätten wir, du und ich, aber jedes für sich, so gern etwas erfunden, aber wie wir auch sannen und uns anstrengten, es war schon alles da, denn etwas noch nicht Existierendes kam uns nicht in den Sinn. Aber, oh Himmel, in der Nacht, im Traum kam mir's – das Herrlichste von allem, was bisher der Menschengeist je erfunden hatte – ich bin zu dir ins Bett geschlüpft und hab' dir's ins Ohr gesagt: Menschenflügel –
»Aber wer soll sie denn machen?« hast du noch halb im Schlaf gesagt. »Ich kann's nicht.«
Ich auch nicht, aber wie dauert mich oft der arme zottlige Körper, wenn er daheim bleiben muß, während der freie Geist auf seinen Riesenschwingen unendliche Fernen kühn durchfliegt, ja, vorwitzig sich gar bis vor die Himmelstore wagt. Aber allzulange würde ich mich dort keineswegs aufhalten, indem mir ja die liebe Erde noch gar so viel des Sehenswerten bietet.
14. 5. Am liebsten gehen wir des Nachmittags auf unser eingebildetes Landgütchen, wie wir den sogenannten Stahl tauften. Eigentlich ist's ein Stall und davor eine große, uralte Laube, in der wir residieren. Wir bringen Löffel, Gläser und Weckle mit, die Bäuerin versorgt uns mit frischgemolkener Milch. Wir Frauenswesen nehmen unsre Handarbeiten vor, und der Vater liest uns herrliche Aufsätze von Rotteck und Welcker aus der »Freisinnigen«. Wir erfahren, wie man in der Residenz in der Kammer den Reden dieser Männer lauscht, und sind stolz auf sie und freuen uns ihrer.
Oft auch stehle ich mich weg und ersteige den hinter dem Stahl liegenden Berg, in dessen Gewirr von Brombeerstauden und Farnkraut ich einen Pfad gefunden, der zur Karthause führt. Die frommen Brüder haben doch recht verstanden, immer das schönste Erdenplätzle für ihre Klöster ausfindig zu machen. Sie waren eben zu jener Zeit offenbar gescheiter als die andern Leut'.
Jetzt ist die Karthaus ein herrschaftlicher Besitz. Hinter dem zur Bergeshöhe führenden Garten hat man einen herrlichen Ausblick ins Tal, über Ebnet weg mit dem Gaylingschen Schlößle, hinüber nach Littenweiler und von da ins blaue Gebirg', das sich prächtig aufbaut hinan zum Himmel. Von dem[67] Höchsten des Landes, dem kaum zu besteigenden Feldberg, sieht man nur mehr die Spitze. Ach, ihm gilt meine Sehnsucht, das heißt, sie gilt dem verklärten Bruder, der als Student mit jungen Freunden sich erkühnte, den unwegbaren Berg zu ersteigen. Ein paar Tage waren sie unterwegs, die Eltern schon in Angst um unsres Xaver Leben, da plötzlich erschien er mit rotverbranntem Gesicht, laut und froh trat er ein, begeistert von seinem Erlebnis, das er uns mit der ganzen Lebendigkeit seines Wesens schilderte. Stunden hatten sie gebraucht, vom frühen Tag bis zum Sonnenuntergang, bis sie durch tiefe Waldungen führende Holzwege Schritt für Schritt vorwärts kamen. Oft hörten diese Wege auf, und sie mußten sich durch dichtes Gestrüpp arbeiten, steilen Abhängen entlang, aus denen wilde Wasser rauschten. Zuweilen standen die hohen schwarzen Tannen so dicht, daß sie wie in Nacht gingen. In den Lichtungen tauchte Wild auf, ganze Familien, und über den Wäldern kreisten Raubvögel. Endlich schien der Weg ebener zu werden. Sie schrien vor Freude laut auf, als sie den Rauch eines Kohlenmeilers gewahrten. Erhitzt und todmüde kamen sie vor einer Holzhütte an. Auf ihr Rufen erschien ein Mann mit geschwärztem Gesicht. Er konnte sich nicht genug wundern, daß Städter, die's doch nicht nötig hatten, auf den »wüschte Berg« klettern[68] mochten. Mordsfrisch sei's gewesen. Die jungen Leute machten sich ein Feuer und holten ihren Proviant hervor. Der Kohlenbrenner brachte ein schwarzes Stück Speck herbei. Mit Wein und Brot waren die Studenten genugsam versorgt. Der Mann, der, wie er sagte, lang keinen so guten Tag gehabt, wies ihnen den Weg zur nächsten Viehhütte. Dort erhielten sie ein Nachtlager im Heu, schliefen prächtig, tranken in der Frühe frische Milch und setzten ihren Weg fort, von einem Kohlenmeiler zum anderen, von Viehhütte zu Viehhütte, überall nach ihrem Ziel, der Spitze des Feldberges, fragend. Die dichten Tannenwälder machten allmählich weiten Flächen Platz, mit hochstengligem Lattich, dessen gelbe und lila Blüten weithin leuchteten. Dann wurde der Boden karg. Herden weideten mit Glocken um den Hals. Die Hirten, ungewaschene, borstige Gesellen, sahen wie die Räuber aus. Auf die Frage nach der Spitze des Berges deuteten sie zum rötlichen Abendhimmel. Erst ging's noch durch eine Mulde – es kam eine zweite, dritte – dann aber – ein Rausch des Entzückens erfaßte die jungen Leute, als sie auf der Spitze des Berges ankamen. Die weißen Zacken, die sich längs des Firmaments hinzogen, hielten sie zuerst für Wolkengebilde. Plötzlich aber erkannten sie an der Unveränderlichkeit und dem harten Glanze dieser Gebilde,[69] daß sie es nicht mit Wolken zu tun hatten, sondern es war die Alpenkette der jenseitigen Schweiz, die sich in wunderbarer Klarheit vor ihnen enthüllte.
Da brachen sie, überwältigt von dem Anblick einer so herrlichen, nie geahnten Natur, in Tränen aus, knieten nieder und huben an zu singen. Hätten wohl auch so bis in die Nacht hinein gesungen, aber es kam ein Hirte, der ihnen sagte: »Mache, daß ihr heimkumme, ihr Herre, wenn d' Alpe am Himmel stohn, isch der Rege nit wit.« –
Damals bat ich den Bruder: »Gelt, Xaver, nimm mich das nächstemal mit?«
Und er versprach's: »Ja, ja, Nannele, das nächstemal nehm' ich dich mit.«
Und jetzt ist mir der Feldberg, dessen Spitze so stolz alle anderen Berge unseres Landes überragt, nicht weniger fern als der teure, noch höher wohnende Bruder.
27. 7. Ich habe gestern meinen Namenstag gefeiert. Mein erstes Beginnen war, in das Münster zu gehen und meinem Schöpfer zu danken für alle Wohltat, die er mir, seit ich lebe, in seiner Gnade zukommen ließ. In einer solch einsamen Stunde, in der der Mensch nur Gott und sich selber angehört, in der man zurückschaut auf das verflossene Jahr und wohl[70] auf seine ganze Lebensbahn – in einer solchen Stunde feiert das Gemüt seinen stillen Festtag. Wie vieles hat sich zugetragen in den letzten Jahren – Xaver nicht mehr auf Erden, die geliebte Schwester im fernen Norden – Vaters Krankheit – Mutter, die durch Nachtwachen um alle Kraft gekommen war – ach, nach so einem Puff des Schicksals, wie froh ist man, wenn er überstanden ist, wie dankbar, wenn nicht der Püffe noch mehrere folgen. Leider ist für mich ein kleines Püffle zum Namenstag nicht ausgeblieben – von Caton keinen Brief! Ich weiß ja, das liebe Schwesterle ist ein wenig saumselig, und doch kränkt's. Außerdem ist mir bang, Caton und Petersen vielleicht durch eine Ungeschicklichkeit verletzt zu haben, indem ich ihnen in meinem letzten Brief den Vorschlag machte, sie möchten mir in diesem Jahr nichts schicken, im nächsten auch nicht, im dritten Jahr aber was Rechtes, z. B. ein Jean Paulsches Werk, wie »Hesperus« oder »Quintus Fixlein«. Oder ein Herdersches: den »Cid« oder Schulzes »Zauberrose« oder Ehrenbergs »Würde der Frauen«.
O wie fürchte ich nun, diese meine Ansprüche könnten zu groß gewesen sein, und meine Unbescheidenheit möchte Verdruß erregt haben.
Die schöne Feier meines Festes half mir über diese Stimmung Herr werden, schon der Anblick des[71] herrlich geschmückten Frühstücktisches, in dessen Mitte eine ungeheure Brezel thronte. Die Kamerädle Lenchen und die Malchens nahmen am Frühstück teil, nachdem de Ber mit der Gitarre erschien und mir zum Geburtstag die Gnadenarie in deutscher Sprache vorsang. Da er aber immer statt Gnade – Dade aussprach und dabei die Augen zum Himmel hob wie ein Verzweifelter, wollte das böse Mädchenvolk vor Lachen fast gar bersten.
Als besonderes Benefiz durfte ich den Morgen mit Lesen und Stricken zubringen und meine Gratulanten und deren Geschenke in Empfang nehmen. Ach, und es wurde mir mehr zuteil, als ich je zu hoffen gewagt. Herr von Verleb überreichte mir im Namen seiner Frau nicht mehr und nicht weniger als – Schillers Werke! Ich nahm sie in Tränen ausbrechend in meine Arme und wäre am liebsten damit durch alle Zimmer gelaufen, in die Küche, zur Mutter. Aber es waren der Bändlein so viele, daß etliche davon auf den Boden kollerten, und wir zu tun hatten, bis alle glücklich auf meinem Namenstisch aufgestellt waren. Herr von Verleb lud mich ein, nächsten Sonntag mit ihm ins Suggenbad zu fahren, wo Maria schon drei Wochen zur Kur weilt, und die Aussicht, sie wiederzusehen, war vielleicht noch das Kostbarste meiner Geschenke.
Professor Schmidt beschenkte mich mit Klopstocks »Messiade«, Professor Monz mit Herders »Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit«, und es berührte mich sehr eigen, Monz über Schmidts Geschenk ein wenig wegwerfend lächeln zu sehen, während dieser beim Weggehen mir leise, aber mit eindringlichen Worten riet, das Herdersche Buch nicht zu lesen, es eigne sich nicht für ein junges Mädchen. Er wollte ein Versprechen, allein ich schwankte und erbat mir Zeit zum Überlegen.
Es ist nicht anders zu verstehen, als daß mich Monz weiterbilden, Schmidt aber zurückhalten möchte in jener Unschuld des Nichtswissens, von der er neulich auf der Kanzel sprach, immer wieder darauf zurückkommend: Was nützt es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, an seiner Seele aber Schaden leidet. Und ist es nicht wie eine Schickung Gottes, daß nicht er, sondern Monz es ist, der meiner so regen Wißbegierde Vorschub leistet? Den Herder habe ich einstweilen ganz zu unterst im Weißzeugschrank vergraben.
Bei Tisch hielt de Ber eine deutsche Rede auf das Namensfest seiner Lehrerin, die alle Ursache hatte, auf ihren Schüler stolz zu sein. Mein bescheidenes Annele hatte mir eine in französischer Sprache verfaßte Gratulation unter den Teller gelegt – halt so so – und[73] Lorchen, die bei ihren künftigen Schwiegereltern in der Residenz ist, schickte mir eine Schokoladentorte und ein Brieflein, in dem sie aber das Gratulieren vergaß, vor lauter Glück über ihr eigenes Glück, das in einem Leutnant besteht, der sie nächstens zum Altar führen wird.
Den Nachmittag und Abend bis neun Uhr brachte ich im Kreise der Meinen und der Freunde im neuen Tivoli in Herdern zu, wo zu Ehren sämtlicher Freiburger Annen eine glanzvolle Beleuchtung stattfand.
4. 8. Heute mit Professor von Verleb ins Suggenbad gefahren. Ich fand ihn unterwegs sehr ernst, fast gedrückt, was mich nicht wenig ängstigte, indem ich Marias Befinden damit in Verbindung brachte. Ich erlebte jedoch die angenehmste Enttäuschung. Nie habe ich Maria so rosig und heiter gesehen, ja, ihre Augen hatten geradezu einen überirdischen Glanz. Sie hat sich's gar herzig und behaglich im Suggenbädle eingerichtet und hat nur eine Klage – daß die Wirtsleute gar zu sehr der Meinung seien, ihr immerfort Gesellschaft leisten zu müssen, kaum habe sie sich's bequem gemacht an ihrem lauschigen Waldplätzle. Einmal, sie sei ganz vertieft in Tiedges »Urania« gewesen, als bei der schönsten Stelle:
»Was meinener zure brotene Dube mit Knöpfli, Frau Professor?« mitten in die Poesie hinein die Stimme der Wirtin ertönte.
Wir lachten, lachten den ganzen Tag, daß es eine Lust war.
Maria schrieb mir auch auf das Albumblatt, das ich zu diesem Zwecke mitgenommen hatte, die Stelle aus der »Urania«:
10. 8. Wir putzen und waschen und klopfen und bügeln. Frische Vorhänge werden aufgemacht, Mutter näht neue Houssen, Therese und ich schneidern herzige Kinderkleidle, und Vater geht besorgt umher, überzeugt, daß Caton nie zur Postzeit fertig sein wird und deshalb möglicherweise überhaupt nicht ankommen könne. Ich sage: »Haben Sie vergessen, Papale, daß Caton das Talent hat, immer eine Hilfe zu finden, wenn sie eine braucht?«
Therese, Hermann und ich hatten ausgemacht, Caton bis Emmendingen mit der Post entgegenzufahren. Vater legte ein Veto ein. Er wünscht, daß wir ihr alle miteinander bis Zähringen entgegengehen. Mutter solle dann Catons Platz in der Post einnehmen, und die Schwester mit uns zu Fuß zurückkehren.
24. 9. Das Projekt unserer Oberländer Fußreise, so lang schon entworfen und nie zur Wirklichkeit geworden, tauchte plötzlich wie aus heiterem Himmel von neuem in unsern sehnsüchtigen Herzen auf, und Caton war's, die mit Bitten nicht nachließ, bis Mutter erklärte: »Ja ja, Papale, lassen wir sie ziehen.«
Und so gingen wir wirklich in Reisekleidern und den Sonntagsschlapphüten, mit einem vollgestopften Ridikül und unserm Beschützer Hermann, der unsere Wäsche im Ränzlein trug, zum Tor hinaus, am 18. September, dem glänzendsten Herbsttag der Welt.
Vater begleitete uns eine Strecke Wegs, uns Lehren, Klugheitsregeln und Empfehlungen mit in die Fremde gebend. Alsdann, kaum hatten wir unsere Wanderschaft angetreten, saß Caton, die sich unter heißen Tränen von ihren Büblein verabschiedet hatte, schon hoch droben auf einem Leiterwagen, so daß Hermann, vom Ränzlein beschwert, neidisch ausrief: »Die klettert ja wie ein Bub!« Ich brachte es nur bis auf die hintere Deichsel des Wagens, war aber auch damit zufrieden und bedauerte Therese und Schwägerin Lotte, die den sonnigen Weg zu Fuß zurücklegen mußten.
Lotte sieht mit ihren vierundzwanzig Jahren wieder so jung und hübsch aus wie zur Zeit, da sie Xavers Braut war. Sie trägt wieder helle Kleider,[76] und ich sah's ihren Augen wohl an, daß sie lieber zu Caton auf den Wagen geklettert wäre, als ernsthaft mit Therese einher zu wandeln.
Um halb zwölf kamen wir in Kirchhofen an, wo wir im Pfarrhause von Herrn Dekan auf das herzlichste empfangen und prächtig bewirtet wurden. Wir dankten und machten uns gestärkt auf den Weg nach unsrer nächsten Station, dem lieben Staufen. Wie zwei Kinder ergaben sich Lotte und Caton der Passion des Kleeblättersuchens, bei jedem Glücksfund laut aufschreiend und das liebliche Tal weithin mit ihrem Gelächter erfüllend.
Hermann machte sich an den Obstbäumen zu schaffen, und ich blieb erst recht zurück, indem ich versuchte, den sich immer mehr nähernden Schloßberg von dieser Seite in meinem Skizzenbuch festzuhalten. Theresens Mahnen wurde jedoch immer dringender, denn schon verkündete ein frischerer Luftzug den nahen Abend, und nur das Städtchen, dem wir zustrebten, lag noch im Glanze der untergehenden Sonne. Oh, wie kam uns da mit dem Anblick der befreundeten Wiesen, Berge und Hügel mit einem Male die erste freudige Erinnerung an unsere Kinderzeit!
Wir stürmten auf den Marktplatz mit dem alten Marktbrunnen und dem stattlichen, mit einem Dachreiter gekrönten Rathaus. Aber weiter, weiter, die[77] Gasse hinunter, an der sich langziehenden Mauer vorbei – und wir standen vor dem lieben Haus mit dem efeuumsponnenen Turm – und gegenüber an der Gartenmauer der liebe kleine Brunnen. – Hermann lief gleich darauf zu, um zu trinken, Caton schwang den Hebel. – »Wißt ihr noch,« rief sie, »wie oft wir geschmält worden sind, wenn wir's zu arg mit unserer Puppenwäscherei trieben?«
Dann ging's die Turmtreppe hinauf – oh, ein Gezwitscher, Gelächter, ein Getrippel unbeschreiblich ungeduldiger Füße. Der Herr Oberamtmann erschien mit dem Zereviskäpple:
»Was ist denn los?«
»'s Villingers«, schrien wir aus einem Mund, »'s Villingers!«
»Potztausend,« rief er aus, »Frau, Frau, so komm au, 's Villingers!«
Oh, wie liebreich wurden wir empfangen, und unbeschreiblich war das Erstaunen über das nun erwachsene Volk, das einstmals als unmündiges Kindervölklein von hinnen gezogen war. Während die Schwestern mithalfen, die Betten aufschlagen, ging ich mit Hermann zu unserm ehemaligen Lehrer Kiesel, der ganz außer sich vor Freude war und behauptete, er habe meine Stimme schon im Dunkeln auf der Treppe erkannt. Er wollte gleich wieder fort in die[78] Reben rennen und mir Trauben holen. Als Hermann ihn um ein Nachtlager bat, weinte er fast vor Freude und rief seine Frau, die mit schon mehligen Händen herbeikam, weil sie gleich Kuchen für uns backen wollte. – »Aber einen recht großen!« schrie Hermann mit nachgemachter Kinderstimme.
»Oh, Hermännle,« rief sie, »du sollsch in zehn Täg nit damit zu End komme!«
Der Herr Lehrer führte mich in sein Arbeitszimmer, wo eine Menge der unvergleichlichsten Kupferstiche fast bis zur Unordnung das kleine Zimmer dekorieren. Wie oft ergötzte ich mich als Kind an ihrer Schönheit, aber wie ganz anders bewunderte ich jetzt diese so fein ausgeführten Kunstwerke. Hermann mahnte und mahnte, ich konnte mich nicht trennen. Und der Lehrer sagte lächelnd: »Ich hab' dich allemal nausschmeiße müsse, ehnder bisch nit gange, und ich hab' damals gedacht, du wirst gewiß noch eine Malerin.«
»Ach, lieber Herr Lehrer,« sagte ich mit einem Seufzer, »nur zu einer Lehrerin langt's.«
Worauf er mich ansah und sagte: »Es ist ein heiliger Beruf, Nannele.«
Als wir auf die Straße traten, standen eine Menge Leute da und erdrückten uns fast vor Freude. Wir waren ganz berauscht von all der Menschengüte,[79] die uns zuteil wurde, als wir am wohlversorgten Oberamtmannstisch saßen. Jetzt handelte es sich noch um Kriechbaums, unsere ehemaligen Schulkamerädle Lenele und Karolinele. Hin und her rieten wir, wie sie überraschen.
Caton schlug vor: »Wir wollen ihnen ein Mondscheinständle bringen.«
»Und tun, als seien wir eine Scheuernpurzlerbande«, rief Lotte.
Oh, die beiden, wie die jüngsten Mädele staffierten sie sich heraus. Ich nahm die Gitarre, Hermann einen Blechkessel mit Kochlöffel. Und wir sangen das alte Lied, das wir früher so oft gesungen:
Also sangen wir unter Kriechbaums Haus, und unsere gravitätische Therese nahm ihr Schaltuch und improvisierte einen wunderschönen Mondscheintanz, der feenhaft wirkte. Oben standen sie am Fenster und lachten und fragten, und 's halb' Städtle lief zusammen.[80] Da ging Hermann mit dem Hut in der Hand herum und sammelte Kreuzer, bekam aber nur einen – und ging dann ins Haus und wir hinterher. Herr Kriechbaum, der gleich zu merken schien, daß es sich nicht um Scheuernpurzler handelte, öffnete weit die Tür des freundlich beleuchteten Zimmers, und da ich nur große Leute gewahrte, rief ich in ungeduldiger Freude: »Lenele, Karolinele, wo seid ihr denn?«
Ach Gott, sie waren erwachsen und standen vor mir und wollten's ihrerseits nicht glauben, daß ich das Nannele sei, mit dem sie auf der Gasse gespielt. Da lag auch schon Caton am Hals der Großmutter, die weinte und lachte und behauptete, sie habe nie in ihrem Leben ein Weibsbild so lieb gehabt wie's Cattung. Und wohl oder übel mußten wir ein zweites Nachtmahl genießen, dem aber nur Hermann die nötige Ehre antat – und wandelten dann des Nachts, von den Kamerädle begleitet, unzähligemal hin und zurück, in Kindheitserinnerungen schwelgend, und fanden erst ein Ende, als der Nachtwächter uns antutete: »Die Uhr hat zwölfi g'schlage« – und hinzusetzte: »Marsch ins Bett, marsch ins Bett!«
Den anderen Morgen begleiteten uns die Kamerädle noch bis ins Münstertal, zu Bergmeisters, wo wir Mittag machten und zu unsrer großen Freude vor dem Haus ein Rößlein vorfanden, auf dem wir uns[81] abwechselnd von der Mühsal des Wanderns ausruhen sollten. Es hatte aber keinen Frauenzimmersattel, was Caton jedoch nicht genierte, gleich saß sie oben und winkte mir, neben ihr Platz zu nehmen. Aber da ich nun einmal ein Hintenach-Gescheiterle bin, kam mir Lotte zuvor und stieg auf. Der Führer meinte: »Seid alleweg noch nit halb so schwer wie der Müller.«
Immer steiler und wilder wurde nun die Landschaft. Wie gern hätte ich diesen oder jenen Punkt gezeichnet, aber es gab kein Aufhalten, wenn ich die Gefährten nicht verlieren wollte.
Nach einer Stunde traten Caton und Lotte Theresen den Klepper ab, so daß diese die mühsamste Strecke reitend zurücklegen durfte. Nach einer Viertelstunde sah ich sie oben am Berg, am Waldrand, sich höchst schön ausnehmen, unserer wartend.
»Nannele, du dauerst mich,« rief sie mir zu, »mai, es ist auch herrlich, das Reiten.«
Aber ich hatte ja mein Catonele zur Seite, wahrlich, das ging mir über den Gaul. Trotz des mühsamen Steigens, wir konnten nicht fertig werden mit Erzählen, und ich hatte wieder jenes beglückende Gefühl seelischer Erleichterung durch Catons sonnige, das Leben so leicht nehmende Natur.
»Ich bin wieder ein Mädele,« sagte sie, »fast vergeß'[82] ich, daß ich zwei Büble hab'« – und begann laut zu singen, mußte aber schnell aufhören, denn fast senkrecht ging's nun in die Höhe. Die Mittagssonne brannte heiß. Hermann mit seinem Ränzlein keuchte hinter uns her und führte auch noch Lotte am Arm, die laut stöhnte und nach dem Gaul jammerte. Ich schlug vor, ein Weilchen zu rasten, holte aus meiner Reiseapotheke Hoffmännische Tropfen, die Lotte sofort neu belebten. Schön war's, zurückzublicken auf die Gebirgskette und das wildschöne, mit Strohhütten übersäte Tal. Neu gestärkt von der kurzen Ruh, erklommen wir den Rest des Berges. Therese erwartete uns und wollte mir den Klepper abtreten, aber es waren nur noch fünf Minuten bis zum Bildstöckle, und nicht um vieles hätte ich den Triumph hergegeben, als Heldin des Tages hervorzugehen. Hermann, dem man den Gaul antrug, wies ihn höchst beleidigt mit den Worten zurück: »Ich bin doch ein Mann!« Und so stieg Lotte auf, bekam aber Hermanns Ränzle mit auf den Gaul.
Nach ungefähr einer Stunde waren wir am Ziel, das wir laut jubelnd begrüßten. Ein kleines Wirtshaus nahm uns auf, und wir stillten unseren ungeheuren Hunger an gerösteter Suppe, gesottenen Erdäpfeln und einer herrlichen Kratzede. Weiter zogen wir, mutig wie junge Rößlein. Durch dichtes Buchengehölz[83] führte nun der Weg, an einem lustigen Bach vorbei, der sich über unzählige grünbemooste Felsenstücke ergoß. Gelbgrüne Weidberge taten sich vor uns auf, Ziegen und Schafe kletterten und sprangen umher, ein Hirte pfiff auf einer Pfeife. Dies brachte uns auf die Idee zu singen, da die Musik der Menschen Füße hebet, und wir marschierten so im Takt wohl ein Stündlein einher. Aber in Alpenschwand mußte der Lebensdocht wieder etwas geschürt werden. Ich bat die Vogtfrau zu melken, und nie auf der Welt ist eine Milch gieriger hinuntergeschlürft worden. Ein wenig seufzend machten wir uns auf den Weg. Es galt nun wieder zu steigen, und zwar über den Zeller-Blauen, in dessen Wäldern sich ein unheimliches Dämmern entfaltete, so daß wir uns alle bei den Händen nahmen und einen kräftigen Gesang anstimmten, mit verstellten Baßstimmen, von wegen der im Hinterhalt steckenden Räuber. Himmel, und was sahen wir jetzt auf einem nahen Hügel – brennende Männer waren's, die sich dehnten und sprühten, aneinander- und wieder zusammenkrochen. Wie lebt' ich jetzt wieder in Zell und seinen Märchen – verkohlende Erdäpfelstauden waren's, die wir von unserer Kinderstube aus erblickten und für böse, strafwürdige Dämonen hielten.
Wir standen auf dem Gipfel des Blauen, die Luna[84] glänzte in voller Glorie, und die herrlichste Landschaft tat sich vor uns auf, wenn auch die Ferne bereits in düstere Nachtschleier gehüllt war.
Plötzlich erblickten wir Zell, das Ziel unserer Wanderschaft, ganz nah, wie in einem Bergschacht vor uns liegen. Ein Freudenschrei entfuhr uns insgesamt; die Füße wußten nichts mehr von Müdigkeit, wir stürmten ins Städtle, das unser aller Geburtsort war.
Aber merkwürdig, unsere Freude verstummte plötzlich. Das Städtchen war wohl hübscher geworden, aber es gefiel uns nicht mehr wie ehedem. Wo unser Haus gestanden, steht nichts mehr. Nur der Steg, der über den Bach zu Monforts führte, heimelte mich noch an. Aber die lieben Verwandten Monfort hatten sich in ihrer Herzlichkeit nicht verändert. Die Bäsle brachten uns behagliche Hausschuhe für unsere müdgelaufenen Füße, und wenn wir auch kreuzlahm waren, so waren wir auch kreuzfidel. Onkel Förster sagte: »Was, 's Caton soll verheiratet sein? Isch's nit noch grad' so übermütig wie 's jüngst' Mädele?«
Und ich erzählte, wie Therese immer mahne: Caton, so gib doch acht auf deine Kinder – und wie der kleine Rudolf, der vom Stuhl fiel, erst vorwurfsvoll der Mutter zurief: Mama, so gib doch acht auf mich! – und dann erst losbrüllte.
Wir hatten gleich am andern Morgen weitermarschieren[85] wollen, allein die Verwandten ließen es nicht zu, wir mußten den Pfarrer und Lehrer und alle möglichen Bekannten besuchen, und nach einem ungemein fröhlichen Mahl fuhr uns Onkel Förster mit seinen zwei schönen Rappen nach Wehr. Wie schön ging's nun durchs anmutige heimatliche Wiesental, und so ohne alle Mühseligkeit, unter heiterem Plaudern. Oh, die Welt kann ein Paradies sein – aber ein paar Rößle gehören freilich dazu.
Als wir am Wehrer Schloß anfuhren, empfingen uns die Domestiken mit der Nachricht, die Herrschaft sei in Säckingen, komme aber vor Abend zurück. Der Verwalter erschien, dienerte höflich und schloß uns den unteren Saal auf, mit der Frage, ob wir übernachteten. »Natürlich«, sagte Caton, die dem Herrn offenbar ganz besonders gefiel, denn er schob ihr extra einen Fauteuil hin, und wir wurden mit Wein, Konfekt und Tee bewirtet. Wir waren gerade mitten beim Schmausen, als Baron Wolfgang erschien und gleich darauf die ganze Familie mit allen Söhnen und der Stiftsdame, und es war eine große Freude für uns, wie der alte Herr von Schönau, dann seine Frau und so eines nach dem andern hereinstürzte mit dem Ausruf: »Wo ist der Villinger, wo ist er denn?« –
Und so viele unser auch waren, sie konnten sich nicht zufriedengeben, und bei Tisch hieß es einmal[86] um das andere: »Ach, daß Ihr Vater nicht mitgekommen ist!«
Herr von Schönau erzählte, wie behaglich und vertraulich der Verkehr mit unsern Eltern gewesen sei, als diese im nahen Zell lebten. Und Frau von Schönau fügte hinzu:
»Eure Mutter hat damals genau so wie Caton ausgesehen, wie sie als junge Amtsmännin in Zell einzog.«
»Therese und Anna gleichen meinem lieben Villinger«, erklärte der Baron. »Kinderle, auf eurer Eltern Wohl!«
Das ging so fort, wir hatten alle rote Köpfe, aber die Stiftsdame trank tapfer mit, und Hermännle gegenüber gab ich manchmal einen kleinen Fußtritt, daß er des Guten nicht zu viel tue. Die Barönle aber vergaßen sich immer wieder und duzten uns wie früher, als wir noch Versteckens mit ihnen im Schloß spielten.
Kaum waren wir aus dem Speisezimmer in den großen Saal getreten, als auch schon die Stiftsdame am Klavier saß und einen gemütlichen Ländler aufspielte. Und siehe, da schwebte auch schon Therese mit Baron Wolfgang durch den mit Kerzen beleuchteten Saal. Baron Otto, der scharmanteste von allen, hatte Caton geholt, Baron Albert Lotte. Ein wenig verlegen[87] stand Hermann unter der Tür, als die Frau Baronin ihn aufforderte, ein Tänzlein mit ihr zu wagen.
»Er macht seinen Schwestern Ehre«, sagte sie, als er sie mit einem etwas ungeschickten Diener auf ihren Platz zurückbrachte.
Herr von Schönau hatte mich zum Tanze führen wollen, allein ich hatte schon die Gitarre vom Nagel genommen und machte mich als Musikantin wichtig. Einen Anfall meines Übels in der Nacht befürchtend, blieb ich auch standhaft gegen das Andrängen der Söhne, die mich immer wieder zum Tanze verführen wollten. Es gefiel mir an meinem Platze neben der Stiftsdame. Ihre paar Tanzweisen, die sie immer wieder von vorne anfing, konnte ich nach zweimaligem Anhören prächtig mit der Gitarre ergänzen, dabei nickte mir die Stiftsdame, die schon uralt sein muß, denn sie war schon alt, als wir noch Kinder waren, immer wieder freundlich zu. Wir plauderten auch zuweilen, denn die Musik ging von selbst. So fragte ich sie nach dem großen Bild an der Wand gegenüber, das eine herrliche, volle Frau darstellte – mit roten Haaren. Die Stiftsdame sagte mir, es sei eine Kopie nach Rubens, die sie in ihren jungen Jahren im Stift gemalt. Sie setzte hinzu: »Du mit deinen frischen Farben und roten Haaren wärest recht nach dem Geschmack eines Rubens gewesen.«
Nun freute ich mich über die Maßen, daß ein so großer Künstler rote Haare schön fand und ich mich meines Geschmackes nicht zu schämen brauchte.
Bei näherer Betrachtung fand ich jedoch, daß das Bild nur einzelne wohlgelungene Partien aufwies, von recht mediokeren zuweilen unterbrochen. Ich fragte die Stiftsdame, ob sie bei ihrem so ausgesprochenen Talent nicht Lust gehabt hätte, sich bei einem Meister ausbilden zu lassen.
Sie lächelte und meinte dann: »So etwas ist in unserer Position doch nicht möglich.«
Erst nach ein paar Augenblicken wurde mir klar, was sie damit meinte, und ein tiefes Erstaunen erfaßte mich bei diesem neuen Erkennen. Also nicht nur bei den Bürgerlichen, deren Mittel beschränkt sind, ist das arme Talent gefährdet, auch bei den Adligen hat es keine Heimat, und zwar als eine nicht ebenbürtige Dreingabe. Nun denke ich nicht länger: O ihr glücklichen, durch Sparerei so wenig bedrückten Menschen, denen alles erreichbar ist – ihr habt auch euer Brett, und ein gehöriges. –
Aber ich merkte bald, unter den Tanzenden nahm der Übermut gar mächtig zu. Ein paar Gläser Punsch waren rasch hinuntergestürzt worden, die Gesichter glühten. Hermann tanzte ganz allein um sich selbst herum, mit den Armen Bewegungen machend, als befinde[89] er sich im Freiburger Schwimmbädle. Therese mit Baron Wolfgang schwebte zwar immer noch schön und ruhig dahin, ohne jedes Echauffement, wie das ihre Art war, aber mein Catonle und Lotte mit ihren Tänzern, da ging's ein wenig allzu toll her für eine junge Frau mit Kindern und eine Witwe.
War ihnen alles in Vergessenheit geraten?
Oh, der schlimme Baron Otto. Einmal beim Tanzen hob er Caton hoch in die Höhe. Baron Albert machte es mit Lotte nach, was nicht so gut gelang. Herr von Schönau und seine Frau lachten Tränen. Die steifen alten Fingerle der Stiftsdame hackten immer rasender auf die Tasten ein. Herr des Himmels, lag da nicht Otto vor Caton auf den Knien und rief im höchsten Pathos: »Caton, ich habe dich immer geliebt, liebe auch mich!«
Und sie – o sie war zum Fressen – legte das Händlein auf die Brust und flötete mit nicht zu beschreibender Schalkhaftigkeit:
Außerdem hab' ich zwei herzige Büble« – setzte sie auflachend hinzu.
»Auch noch zwei«, schrie Baron Otto.
Die Musik verstummte, und unter lautem Gelächter[90] brachte uns die ganze Familie, jedes mit einem Leuchter, in unsre Schlafgemächer. Da hatten wir alle schon öfters genächtigt als Kinder mit unseren Eltern, und so fühlten wir uns gleich heimisch, indem sich jedes das Bett aussuchte, in dem es früher schon geschlafen hatte.
Am andern Morgen holten sie uns wieder ab zum Frühstück, und es entstand ein großes Lamento, als wir erklärten, gleich nachher unsre Wanderschaft fortsetzen zu wollen. Es kam uns freilich hart an, aber Vater hatte uns ans Herz gelegt, die Güte unsrer Gastgeber so wenig als möglich in Anspruch zu nehmen. Baron Otto bat sich aus, wenigstens unser Fuhrmann bis Säckingen sein zu dürfen, was wir mit unverstellter Wonne annahmen. Baronin von Schönau sagte beim Abschied zu Therese: »Frage doch deine Mutter, ob sie dich mir nicht überlassen könnte.«
Aber Therese schüttelte entschieden den Kopf: »Mutter braucht mich zu nötig.«
Die Fahrt war herrlich frisch. Wir hatten alle ein wenig Kopfweh vom Punsch. So waren wir nicht ausgelassen wie am Abend zuvor, aber angenehm heiter und gemütlich. Baron Otto sagte beim Abschied zu Caton: »Sagen Sie nur immer gleich jedem, daß Sie zwei Büble haben.« –
Wir kamen kurz vor Tisch in Säckingen, unserm[91] Hauptziel, an. Ach, in unserer lieben Stiftsmühle, unsrer wohl sechsten Heimat auf dieser Erde, denn wo nicht überall haben wir eine Heimat durch herzensgute Menschen? Vaters Bruder, der Stiftsmüller, ist ebenso dick, als Vater schlank ist, und ebenso laut, als dieser leise ist. Mit dröhnender Stimme jammerte er uns während des ganzen Mittagessens von den alten österreichischen Zeiten vor, daß er halt an die dreißig Johr seinem Kaiser, dem Franzele, angehangen und halt den Franzele nit vergessen kann, aber au nit vergesse mag, wennschon der Herr Bruder, der Herr Kreisrat, ein badischer Beamter worde sei; der Kreisrat sei halt kei ordentlicher Säckinger mehr, sondern früh in die arg Welt naus komme, wo's die Leut' mit der Treu nit so ernst nehme. Aber in Säckingen, da halt' man am Alte bis zum letzte Schnapper und drum am Kaiser, am Franzele – der Großherzog könnt' jo eneweg der Provisor sein, da hätt' er, der Stiftsmüller, nit's geringste dagegen. Aber – und er legte den Finger an die Nase – der Kaiser isch der Öberscht.
Die Stiftsmüllerin, die mir wohl ansah, daß ich eine Einwendung machen wollte, gab mir einen kräftigen Tritt unter dem Tisch und flüsterte mir zu, während ihr Mann lautschnaufend den Braten tranchierte: »Loß en rede, loß en rede.«
Und der Stiftsmüller sprach weiter: »Ich sag jo nit, daß es der Großherzog nit nett macht, sei Regierung ischt nit übel, aber wenn's au der Franzele nit halb so nett g'macht hätt', der Franzele isch halt der Franzele, und zu Säckinge isch ein Denke, und wollt ihrs nit glaube, so goht zu dene alte Huzle, die üwrige Stiftsdame, do könne ihr was erlebe an Hüle und Zähneklappere nach de alte österreichische Zite, und drobe im Wald, die Wälder, die glaube 's noch hüt nit, daß sie nimmer zu Österreich g'höre, und sie glaube 's au in fufzig Johr noch nit.«
Und alle saßen wir still und schwiegen, lächelten nur ein wenig, wenn die alte Geschichte aufs Tapet kam, waren aber im Innern dem herzensguten Onkel nicht böse.
Ach, liebe Eltern, wie sind wir doch so glücklich und auch so dankbar für diese so wundervolle Reise. Güte, Wohlwollen, prachtvolle Ausflüge, deliziöse Gerichte, himmlische Betten – wo aufhören mit all dem Segen! Und was mir so wichtig ist – auch stille Stunden, die Möglichkeit, alles Erlebte an die Eltern zu berichten, damit sie sich mit uns freuen, und diese Briefe dann noch schnell in mein Tagebuch abzuschreiben. Oder mit Caton am Rhein entlang zu gehen, in vertrauten Gesprächen, dabei das Auge labend an den grünlich dahinziehenden Wogen. Ich schüttete ihr mein Herz aus,[93] und für alles hatte sie ein lachendes Wort und schob, was mir schwierig dünkte, mit der Hand nur so weg, daß ich schließlich über meine eigenen Nöte lachen mußte.
Und ich will nie vergessen, was sie mir sagte: »Du und Therese, ihr seht manchmal Lotte so verwundert an, wenn sie ausgelassen ist. Soll sie ewig um Xaver trauern? Ich bin der Meinung, daß sie wieder heiraten soll.«
»Nach Xaver!« rief ich aus. »Ist das möglich?«
»Bei Lotte ja,« sagte Caton, »bei dir wär's nicht möglich. Aber Lotte braucht einen Halt, eine Pflicht. Unglücklichsein ist keine Lebensaufgabe. Sie soll nicht denken, wir halten sie zurück, sie soll denken, wir freuen uns, wenn sie einen neuen Wirkungskreis findet.«
Ich war ganz erstaunt. Hatte sie nicht recht?
»Wie kurzsichtig war ich!« rief ich aus.
Und Caton nickte: »Aus lauter Bravheit.«
Große Fahrt in Oberamtmann Eichroths Wagen nach Laufenburg, wo gerade Jahrmarkt war und wir Gelegenheit hatten, das bunteste Treiben von Menschen zu beobachten – Hauensteiner, Schweizer und sonst noch der ländlichen Trachten mehr. Wir hatten aber nur Zeit zu einem Frühstück. Unser Ziel war[94] Waldshut. Dort winkten uns die Freunde der Eltern, Turbans und Holzmanns, schon aus den Fenstern entgegen. Therese, Lotte und Hermann wohnten bei den letzteren, Caton und ich im gastlichen Turbanshaus. Ach, welche Tage verlebten wir hier an Traulichkeit und wieder unnennbarem Entzücken im Beschauen der paradiesischen Aussicht – vom Rhein, den Dörfern und Bergen und weiterhin, jenseits des Ufers, der eisigen Jungfrau und des majestätischen Rigi.
Des Abends versammelte sich die Waldshuter Jugend bei Turbans; es wurden Gesellschaftsspiele gemacht, deklamiert, gesungen, und ich hatte nicht selten Gelegenheit, zwei Finger gegen Caton zu erheben, wenn die Hofmacherei ein wenig gar zu lebhaft wurde.
Herrn Turbans Güte und Unternehmungsgeist verdanken wir den schönsten, jedenfalls interessantesten Teil unserer Reise. Den herrlichen Rheinfall bei Schaffhausen durften wir sehen, gleichsam die Krone unserer Erlebnisse.
Auf dem Wege dahin beschauten wir die dortige Schmelze, einen tief in die Erde gegrabenen Feuerofen, aus dem eine gräßliche Brunst in allen möglichen Farben hoch und wild aufloderte. Unwillkürlich mußten wir an Schillers »Fridolin« denken.
Auf dem Fußpfade längs des Rheinufers, der uns zum Wasserfall bringen sollte, bildeten sich Brandungen,[95] die von der Gewalt des Sturzes brausend gegen das Ufer schlugen. Noch ein paar Schritte, und der mächtige Rheinfall stürzte von seiner Höhe herab ins wirbelnd aufzischende Wasser. Wir bestiegen einen Kahn und glitten, gefährlich auf und nieder gewiegt, auf dunkelblauer Wogenflut dem tosenden Sturz immer näher – zaghaft und still, von heiligem Schauer durchbebt. Am jenseitigen Ufer, am waldigen Felsberg, auf dem das Schloß Laufen steht, landeten wir und fielen uns voll Dankbarkeit, einer so großen Gefahr entronnen zu sein, freudig in die Arme. Nur Hermann lachte und verbat sich jeden Kuß. Wir stiegen auf einem mit Geländer versehenen Fußpfade höher und höher, tief hineinschauend in das schäumende Wogenmeer, dessen urgewaltige Stimme jeden Laut ringsumher verschlang.
»Schöneres werden wir nie wieder sehen«, sagte Therese und weinte ein wenig.
Caton rief aus: »Oh, mein Männle, wärst du doch hier!«
Und Hermann erklärte: »Ich mach' einmal meine Hochzeitsreise hierher.«
Herr Turban nahm einen Wagen, und wir fuhren nach Schaffhausen. Die Stadt überstieg meine Erwartung an Größe und Schönheit. Ist sie auch im Vergleich zu Freiburg etwas düster, so geben ihr doch[96] die hohen, meist mit Erkern versehenen Häuser ein großartiges, altehrwürdiges Ansehen.
So waren wir um vieles Erleben reicher geworden, wofür wir Gott nicht genug danken können. Der liebe gütige Herr Turban kutschierte uns nach einem schmerzlichen Abschied von Waldshut nach St. Blasien, über die hohen, dunkelbewaldeten Berge hinweg, an hoch und niedrig gelegenen Dörfern vorbei, schönen Tälern, Landhäusern und Bauernhütten.
In St. Blasien mieteten wir uns im Gasthaus ein. Herr Turban schied nach dem Mahle dankbeladen von uns, und ein anderer Kollege meines Vaters nahm uns in Empfang. Er führte uns zuerst in den herrlichen Tempel der ehemaligen Benediktiner-Abtei, einen unendlich großartigen Bau, so recht in die dunklen Wälder dieses Gebirges passend. Hierauf gingen wir zu dem äußerst galanten Herrn von Eichtal, dem Besitzer der Fabrik, die sich in dem weitläufigen, ein mächtiges Viereck bildenden Klostergebäude heimisch gemacht. Welches Getreibe in den unzähligen, unabsehbaren Sälen. Wie das durchsichtigste Spinnengewebe, einem Spitzenschleier ähnlich, löste sich die schneeige Baumwolle von der schlichtenden Karte und quoll wie Milchrahm in hohe blecherne Trichter. Gar schön sind die breiten Gänge, die gewundenen Treppen mit den kostbaren Eisengittern und die reiche[97] Stuckatur am Plafond und oberhalb der Türen. Bei der Familie Eichtal beim Tee machten wir die Bekanntschaft der St. Blasier Honoratioren, und es entstand ein Gerisse, bei wem wir das Nachtmahl nehmen sollten. Man zog Hälmle, und ich war sehr froh, daß das Los den lieben Kollegen unseres Vaters traf. Wir waren recht müde und sehnten uns nach Ruhe.
Frühmorgens ging's mit dem Einspänner nach Menzenschwand, wo die eigentliche Fußreise wieder begann. Hermann, als Führer, führte uns, um den Weg abzuschneiden, über bahnlose Pfade, über Abdachungen mit Gestrüpp und gefällten Bäumen, so daß wir, darüber hinkletternd, rutschend und glitschend, fortwährend in Gefahr waren, Hals und Bein zu brechen. Hermann selber standen die Härle nach allen Seiten, die Reisemütze war in einen Abgrund gerutscht, denn der arme Kerl hatte bald Therese, bald Lotte vom Boden aufzulesen oder sie an glitschigen Stellen zu stützen und zu führen, wobei es Vorwürfe, daß er sie solchem Ungemach aussetze, nur so hagelte.
Nach fünfstündiger Strapaze machten wir in der Posthalde halt. Atemlos traten wir ins Wirtszimmer, verstaubt, echauffiert, die Hüte im Nacken, Lotte in Tränen vor Erschöpfung, Hermann ein wenig fluchend – und blieben bestürzt stehen vor einem gedeckten Tisch mit Flaschen voll gelben Weines.
»Für wen ist der Tisch gedeckt?« fragten wir die Wirtin.
Sie lächelte.
»Um Gottes willen, jetzt Freiburger,« rief Therese, »und wie sehen wir alle aus!«
»Ja, Freiburger«, tönte es aus dem offenen Nebenzimmer, und Vater und Mutter traten herfür und schlossen ihre schmutzigen Kindlein samt und sonders unter deren Jubelgeschrei in die Arme. Und fast gar erstickten wir die teuren Eltern mit der Wucht unseres unsagbaren Dankes.
1832. Armes, unbeschreiblich bedauernswürdiges Polen! Wie anders ist es doch, menschliches Elend – unverschuldetes oder durch hohe Überzeugung sich zugezogenes – mitanzuschauen, als die treuste Schilderung solchen Unglücks. O wehmutsvolle schöne Zeit einer allgemeinen Begeisterung für große Taten, einer allgemeinen Vergessenheit des eigenen Selbst, eines allgemeinen Wohlwollens und Wohltuns!
Aber nicht nur mitweinen, auch mittun durften wir. Es mangelte den geflüchteten Polen die weiße Wäsche so gänzlich, daß sich Frau Hofrätin Welcker flugs der Sache annahm und einen Mädchenverein bildete. Innerhalb dreier Tage hatten wir sechs[99] Dutzend Hemden, Unterbeinkleider, Taschentücher und Socken zustande gebracht. Die Ausgaben wurden von dem ebenfalls von Frau Welcker gegründeten Freiburger Polenkomitee bestritten.
Um die Beherbergung der edlen Polenjünglinge setzte es wahre Kämpfe ab. Therese und ich hatten den ganzen Tag zu tuscheln, denn wir führten nichts weniger im Schilde, als einen Polen zu beherbergen. Theresens Zimmer wurde dazu ausersehen, ihr Bett kam zu mir herüber. Der schönste Teppich, das beste Bett und frische Vorhänge – alles war bereit, den hohen Gast aufzunehmen. Und unser kühner Traum wurde zur Wahrheit.
Um elf Uhr in der Nacht klopfte Hermann an unsere Tür und rief:
»Steht auf, ich habe einen Polen!«
Wir flogen aus den Betten und warfen uns in die Kleider. Therese besorgte eine kleine Erfrischung, Hermann und ich führten den ersehnten Gast in sein mit Blumen geschmücktes Gemach und verließen ihn mit einem feurigen: »Polen hoch!«
Er heißt Zarembecki, ist Oberleutnant bei den Ulanen, hat blaue, geistvolle Augen und einen braunen Schnurrbart. Schön ist der ruhige Ernst seiner Gesichtszüge. Man hat gleich Vertrauen zu ihm.
Die Eltern, Therese und unsere jungen Leute begrüßten ihn erst beim Frühstück, welches durch die Erzählung Zarembeckis weit in den Morgen dauerte. Ganz hingerissen lauschten wir seinen ergreifenden Schilderungen, als die Türe aufflog und die Hofrätin hereindampfte, einen jungen Mann am Arm.
»Da schaut her,« rief sie, »ich hab' auch ein – Schreiber heißt er und kann Deutsch, un glei zum Kaffee hat er drei Töpfle Eingemachts vertilgt – aber 's macht nix – Pole hoch!«
»Hoch Deutschland!« schrie Schreiber – »und«, setzte er hinzu, »welch ein Bett – bis zum Plafond – ein Gebirge von einem Bett.« – »He,« fiel ihm die Hofrätin ins Wort, »wo soll ich denn die fünf Matratze von meine Nichtene sonst hintu als ins Fremdenbett.« – »Nur ein Turner vermag's zu ersteigen«, sagte Schreiber, »ich bin gottlob ein guter Turner.« Er öffnete die Türe, nahm vom Gang aus einen Anlauf und sauste mit einem großen Sprung über den Tisch. – »So geht's«, sagte er. – Wir lachten wie toll.
»Ich hab' der Allerlustigscht«, schrie die Hofrätin, »e herzige Kerle – für den gäb' ich alle meine Nichtene her.«
Schreiber küßte ihr die Hand, worauf die Hofrätin erklärte:
»D' Freiburger sind Stoffel – da beißt kei Maus der Fade ab. Pole hoch!«
Alsdann nannte uns Schreiber Kochana Siostra (liebe Schwester), und wir mußten ihn und Zarembecki Kochany Braciszek (lieber Bruder) nennen.
Noch im Laufe des Tages machten wir aus, daß ich Zarembecki in der deutschen Sprache Unterricht erteile und er mir in der polnischen.
Es kommt mir ganz merkwürdig vor, dieses plötzliche Aufleben nach einer Zeit, die mir so viel der Schmerzen und der Verluste gebracht – vor allem Marias Tod. Du himmlische Erscheinung in meinem Leben, du Heilige jetzt, wohl lebe ich weiter mit dir und spreche mit dir und teile dir mit, was mein Inneres bewegt, aber wie ich auch nach dir rufe und mich sehne, deine liebe Stimme ertönt mir niemals wieder auf Erden … – Dann kam der Abschied von Professor Schmidt. Sein neuer Aufenthalt ist Köln. Er sprach die Worte zu mir: »Soll ich mit dem Gedanken von Ihnen scheiden, daß ein Freigeist Ihr bester Freund ist?«
»Was wollen Sie von mir?« fragte ich.
»Daß Sie mit ihm brechen«, sprach er hart.
Ich schüttelte den Kopf: »So kann ich nicht sein.«
Er sah mich vorwurfsvoll an: »Also Sie brechen lieber mit mir, der ich das Heil Ihrer Seele will?«
Ich sagte: »Ich breche nicht mit Ihnen, und ich breche nicht mit Professor Monz …«
O dieser letzte Besuch – dieses so wenig herzliche Scheiden – Gott allein weiß, wie nah es mir gegangen ist –
Der Freundeskreis wird immer kleiner. Auch die beiden Malchen haben uns verlassen als glückliche, junge Frauen – um so fester schloß ich mich an Lenchen an.
Sie hat mir durch ihre Teilnahme, ihr heiteres Gemüt über die schwerste Enttäuschung meines Lebens hinweggeholfen. Es handelte sich um meine Gesundheit. Der Arzt meinte, eine Kur in Baden vermöchte mein Übel zu heben.
O diese blütenschwere Hoffnung, dieser Lichtpunkt, der sich vor mir auftat – daß mir war, als berührten meine Füße nicht den Boden, wenn ich Badens bezaubernde Umgebung durchschritt. –
Es sollte nicht sein. – Mein Aufenthalt in Baden brachte mir keine Besserung. Was wir so heiß ersehnt, ich und die Meinen, erfüllte sich nicht.
In jener Zeit tiefster Entmutigung und Herzenseinsamkeit las ich Herders »Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit«. Das Buch hat mich außerordentlich gefesselt und erhoben. Es war ein Studium, ich kam nur schrittweise vorwärts und errang[103] nur durch wieder und wieder Lesen das völlige Verständnis. Ich weiß nun und verstehe, warum Professor Schmidt nicht wollte, daß ich dieses Buch lese. Es ist wohl möglich, daß die Darlegung und Auseinandersetzung des physischen Organismus des Menschen nicht jedem Mädchen fromme, ein Wissen, das aber nicht in Anschlag zu bringen ist gegen das damit verbundene Eindringen in das Schöne, Wahre, Göttliche. Wenn er von der reinen Humanität, von der Unsterblichkeit und der engen Verbindung zwischen hier und jenseits spricht, so weiß ich nicht, was man Besseres soll lesen können. Diese so überzeugende Sprache befestigte und kräftigte mich mächtig. So hoch war die Empfindung, die mir dieses Buch mitteilte, daß sich meinem damals so gebeugten Gemüt mehr als je die Gnade Gottes offenbarte.
Maria hat mir die Werke ihres liebsten Dichters Jean Paul zum Andenken hinterlassen, und da ich jetzt etwas mehr freie Zeit habe als früher, so weiß ich mir nichts Schöneres, als mich in die reiche Welt dieses Dichters zu vertiefen.
Nach Anneles Hochzeit, die unsern Haushalt so ziemlich auf den Kopf stellte, sprach Mutter das erlösende Wort aus, daß wir ferner keine jungen Mädchen, sondern nur noch junge Leute aufnehmen wollten. So waren Therese und ich des ewigen Chaperonierens[104] ledig, das so zeitraubend und wenig erquicklich für uns war. Hermann, unserm flotten Studenten, fällt jetzt die Aufgabe zu, sich unsrer jungen Leute anzunehmen.
Unter Stundengeben, Zeichnen, Übersetzen und Hausarbeit gingen meine Tage ohne innern Herzensanteil dahin – als Polens Schicksal sich wie ein Feuerbrand über unser kleines Freiburg verbreitete.
4. Juni. Als ich heute in eine Gesellschaft kam, in der Polen aufgeführt waren, wurde mir doch ein wenig verlegen zumute, angesichts der Unmenge von Stammblättchen, Ordensbändern und Rosenknospen, die nur so um die Jünglinge flogen, die dafür ihrer Haarlocken und Westenknöpfe beraubt wurden. Ich konnte nicht umhin, mehreren Polen zu Gemüt zu führen, daß nur ihre Tapferkeit und ihr Unglück sie auf diese Stufe der Verehrung stellten.
Aber leider gibt es Mädchen – oh, wie habe ich mich schon darüber geärgert – die den Enthusiasmus, den man für große Taten haben darf und soll, durch Unverstand und abgeschmackte Übertreibung herabziehen, ja, lächerlich machen.
»Fürchten Sie nicht,« sagte mir Zarembecki, »daß wir die allzu große Güte der Deutschen anders als ein unverdientes Glück auffaßten. Wir sind ja keine Sieger,[105] wir sind ein armes, geschlagenes, nur noch als Trümmer weiterlebende Volk, der Willkür des russischen Wüterichs und unsrer eigenen Verzweiflung preisgeben.«
Unerforschlicher Gott, wie soll ich an deiner Barmherzigkeit nicht irr werden! Warum sendest du nicht ein furchtbares Gericht, das Ungerechtigkeit und unverdientes Glück, Tugend und unverschuldete Elend ausgleiche. Darf Rußland sein unheilbringendes Machtgebot hier ungestraft geltend machen? Und warum stehen nicht alle Völker gegen diese Übeltäter auf? O Menschheit, wie bist du so flau. –
Dir, vertrautes Tagebuch, darf ich solches sagen, weil du verschwiegener bist als ich selbst. Ach, kaum bin ich imstande, meine Ansichten für mich zu behalten, denn wie tadelt man es hart, wenn ein Frauenzimmer in solchen Dingen eine Ansicht haben will. Ich will es ja auch gar nicht, meine Unkenntnis in politischen Dingen verbietet mir's von selbst. Aber teilnehmen an der Brüder Wohl und Weh, das lasse ich mir nicht verbieten, mag die Welt sagen, was sie will.
10. Juni. Nun hab' ich auch Monz verloren. Ich habe Mutter nichts gesagt von meinem Erlebnis. Ach, ein vorwurfsvoller Blick hätte mich gewiß getroffen,[106] wenn auch kein Vorwurf in Worten. Und die Ruhe, die jetzt in mir ist, wäre vielleicht in Reue und Schmerz verwandelt worden. Und diese Ruhe, ja, ich möchte sagen Heiterkeit, ist sie nicht ein Beweis, daß, was ich tat, das richtige war?
Die Meinen gingen zu einem Nachmittagskaffee, und ich blieb zu Hause, um mich von einer besonders schlechten Nacht zu erholen. Ich zeichnete, da klopfte es an die Türe, und auf mein Herein trat Monz über die Schwelle.
Er nahm Platz mit einem Gesicht, das einen sehr erregten, beinahe wütenden Eindruck machte.
»Ich halte es in diesem polentollen Nest nicht mehr aus,« sagte er, »oder gehören Sie am Ende auch zu den Narren, die Polen in den Himmel heben und am liebsten gleich gegen Rußland marschierten, um sich für das edle Volk hinzuopfern?« –
Er lachte unbändig. In mir kochte es.
»Wie ist es möglich,« preßte ich hervor, »sollten Sie kein Herz für dieses unglückselige Polen haben?«
»Nein, nein, nein,« unterbrach er mich, »ich will es nicht glauben und nicht dulden, daß auch Sie zu der unvernünftigen Horde gehören, die sich durch ihre Polenschwärmerei für alle Zeiten lächerlich macht.«
»Polens gerechte Sache«, fiel ich ihm ungestüm[107] ins Wort, »ist die Sache aller menschlich empfindenden Herzen.«
Er legte wie beschwichtigend die Hand auf meinen Arm: »Ich bin nicht gekommen, um mit Ihnen über Polen zu streiten, darüber können wir uns später auseinandersetzen. Jetzt drängt die Zeit. Ich reise morgen nach Stuttgart. Mein Wirken hier ist zu Ende. Es gibt kein Auskommen mehr zwischen mir und meinen Kollegen.«
Er schwieg, sah mich an, und ich fühlte, ahnte plötzlich, was jetzt kommen würde.
»Bevor ich gehe,« sagte er in leisem Tone, »möchte ich eine ernste Frage an Sie richten.«
Abermaliges Schweigen.
In diesem kurzen Augenblick übersah, überlegte und überdachte ich alles – der Eltern Aufatmen – die schwere Last, von der ich sie zu befreien vermochte – ich selber aber – da – ein rettender Gedanke. Du stellst ihn auf die Probe, und wenn er sie besteht – dann, ja dann –
»Sie sind erregt«, flüsterte er.
Und ich: »Immer nach solch einer Nacht.«
»Hatten Sie eine schlechte Nacht?« fragte er wie abwesend.
»Es ist mein Los, sehr oft schlechte Nächte zu haben durch – mein Leiden«, sagte ich.
»Sie haben ein Leiden?« fragte er.
»Wußten Sie das nicht?« gab ich ihm zur Antwort. »Ich leide an Asthma – nach Ausspruch der Ärzte ein unheilbares Leiden.«
»Wirklich unheilbar?«
Ich zögerte einen Augenblick, dann sagte ich: »Ja.«
»So.« – Er sah vor sich nieder, eine ganze Weile. Mir klopfte das Herz.
»Das tut mir leid«, sagte er aufblickend. »Ich danke Ihnen.«
Wir verabschiedeten uns mit einem Händedruck.
Ich konnte all die Tage Mutter nicht ansehen, ohne sie im stillen um Verzeihung zu bitten, denn hatte ich sie nicht eines großen Glückes beraubt? Aber konnte, durfte ich anders handeln? Und dann, so wie Monz ist, hätte ich nicht in ewiger Unmündigkeit neben ihm her wandeln und mich in allem seinem Urteil, seinen Ansichten fügen müssen? Kann man das ohne große Liebe?
O Nannele, danke Gott, er hat dich behütet!
15. Juni. Samstag wurde »Oberon« gegeben zu Ehren der Polen. Amalie von Berg hatte mich in ihre Loge eingeladen. Wir Mädchen saßen auf den vorderen Plätzen. Hinter Amalie Kozlowski, hinter mir[109] Zarembecki. Der Eintritt der Polen wurde mit einem stürmischen »Vivat Polonia« begrüßt. Amalie hatte sich erhoben, sie schwenkte das Taschentuch, ihr wunderschönes Gesicht leuchtete vor Begeisterung. Sie zitterte, als sie sich niedersetzte. Kozlowski beugte sich zu ihr. Sein edles Gesicht war leichenblaß. Und ich fühlte – ja, es war eine Gewißheit in mir, hier flammten zwei Herzen zusammen in unaussprechlicher Liebe. Ach, und schon erkannte ich den Widerstand, der ihrer wartete, den mißbilligenden Blick aus ihres Bruders Augen, der in der Loge nebenan saß und seine, sich ganz ihrer Begeisterung hingebende Schwester etlichemal anrief. Aber sie hörte nichts.
Grotecki hatte sich in Welckers Loge erhoben und hielt eine französische Anrede, worin er Deutschlands Freiheitseifer pries und diesen durch die Schilderung seines unglücklichen Vaterlandes noch höher entflammte. Er teilte mit, daß der polnische Feldherr Kosinski jeden Augenblick eintreffen könne, und er darauf brenne, Freiburg den Edelsten der polnischen Helden vorzustellen.
»Oh«, rief er aus, trat ein wenig zurück und wies auf Frau Welcker, die schlicht und bescheiden in der Ecke ihrer Loge saß, »wie soll ich sie nennen, diese Edelste der Frauen, unsre Vorsehung will ich sie nennen – unsern Kindern wollen wir ihren Namen[110] verkünden, und unsre Kinder sollen ihn weiter segnen von Geschlecht zu Geschlecht – Madame Emma Welcker. Verwundete Polen liegen in ihrem Haus, die sie pflegt, wie nur eine Mutter pflegen kann. Unbemittelte polnische Studenten finden Unterstützung bei ihr, hilfreiche Güte. Wer hat an verschiedenen Stationen, wo unsere armen Emigranten haltmachen müssen, gastfreie Häuser ausfindig gemacht, die die Flüchtlinge in Empfang nehmen und wieder weiter befördern? Madame Emma Welcker. Und was tat sie für unsere armen verlassenen Kleinen? Eine Lotterie hat sie ins Leben gerufen zugunsten der verwaisten Polenkinder, eine Aufforderung an alle Stände Badens, teil an dieser Lotterie zu nehmen, zu der sie ein kostbares Korallenhalsband als Preis stiftete. O diese unermüdliche, edelste der Frauen – leitete sie nicht die Emigration verschiedener Kinder und Frauen aus Polen über Breslau und Dresden zu ihren verbannten Vätern und Gatten nach der Schweiz, nach Frankreich? Übervoll ist mein Herz von Dankbarkeit, Ehrfurcht und Liebe für diese hochherrliche Frau. Sie lebe – hoch lebe Madame Emma Welcker – Vivat Germania!«
Unsere Musensöhne schrien:
»Vivat Polonia!« – und stimmten Bundes- und Freiheitslieder an. Wir Frauen sangen mit, weinten[111] und umarmten einander. Mitten in diesem Tumult ertönte der Ruf: Kosinski. –
Er erschien an der Rampe der Welckerschen Loge. Eine unbeschreibliche Begeisterung ging los. Er verneigte sich und grüßte mit der Hand, mit einer Würde, einem Anstand und auch wieder mit einer solchen Trauer, daß alles in Tränen ausbrach.
In diesem Augenblick erhob sich der Vorhang, ein Sänger trat vor und brachte einen von Professor Reichlin für die Polen gedichteten Gesang zum Vortrag.
In der nächsten Pause kam Grotecki in unsre Loge. Kozlowski stellte ihn mir vor:
»Graf Grotecki, Hauptmann bei den Ulanen.« (Auf seinen und Kozlowskis Kopf sind dreitausend Dukaten als Preis gesetzt.) Grotecki kann nicht Deutsch; wir sprachen Französisch. Er ist groß, schlank, von unbeschreiblicher Beweglichkeit, aus seinen Augen sprüht ein Feuer, dem der Blick kaum standzuhalten vermag. Er sprach so, als hätten wir uns schon unzählige Male gesprochen. Er sagte ungefähr: »Schon den ganzen Abend erfreute ich mich an der Leuchtkraft Ihres Wesens.«
Ich dachte an Mutters großen Spitzenkragen, an meine roten Haare.
Als lese er mir die Gedanken ab, lächele er mit[112] einem lebhaften: »Nein, nein, nein, so ist's nicht gemeint, Äußerlichkeiten haben keinen Wert für mich. Es ist der Ausdruck. Ihre Seele spricht aus jedem Zug Ihres Gesichtes – die liebenswürdigste Seele« –
Meine Verlegenheit war grenzenlos. Ich besann mich auf eine abwehrende Antwort und sagte: »Das Theater ist sehr voll heute abend.«
Er lachte laut auf, erklärte jedoch im nächsten Augenblick, er werde sehr gesetzt sein, mein Blick hätte deutlicher gesprochen als meine Worte.
»Seien Sie mir nicht böse,« fuhr er zu sprechen fort, »wenn ich Sie durchaus vollkommen haben möchte, aber dieser Mund, so fein geformt, darf eine Sprache nicht anders als vollendet sprechen. Ihr Französisch ist grammatikalisch durchaus richtig, aber Ihre Aussprache ist die eines Menschen, der nie in Frankreich war.«
Ich vergaß meine Befangenheit: »Wie recht Sie haben – ich fühle das – ich habe manchmal schon an Straßburg gedacht.«
Er schüttelte Kopf und Hände: »Bewahre Sie der Himmel – Paris, Nancy, nichts anderes.«
Ich mußte lachen.
Die Musik unterbrach unsre Unterhaltung, der Vorhang ging in die Höhe, zugleich fiel mir ein, daß Zarembecki hinter mir saß – dieser Feinste, dieser[113] Beste von allen, ja, das wußte ich, daß er das war – und ich hatte ihn ganz vergessen.
Es sind kaum vier Wochen, daß ich »Oberon« zum erstenmal sah. Ich rückte damals mein Stundengeld daran, um Therese und mir diesen Genuß zu ermöglichen, und glaubte wahrlich in meinem Leben nichts Schöneres gesehen und gehört zu haben. Damals hatt' ich halt noch keine Polen gesehen. Jetzt – immer wieder suchten meine Augen wider meinen Willen den bald in dieser, bald in jener Loge auftauchenden Grotecki im schlichten Flausüberrock, dem dunklen Schnurrbart und dem herrisch gebietenden Blick.
Nachher war zum Vorteil der Polen großer Ball im Kaufhaussaal, wozu alle Freigesinnten eingeladen waren. Mutter ging mit mir nach Haus. Vater nahm natürlich mit Therese und Hermann am Feste teil. Therese tanzte nur mit Polen. Hermann hatte die Weisung, sich auf Stammbuchblättchen, die ich ihm gegeben, die Namen wenigstens der interessantesten Polen aufschreiben zu lassen und von jedem einen Knopf zu erbitten.
Heute vor Tisch rückte eine Studentenschar durchs Schwabentor. Professor Reichlin, der Vater besuchte, ging mit uns auf den Altan, worauf die Studenten Professor Reichlin, als dem Dichter des Polenliedes,[114] ein stürmisches Hoch brachten, das wir mit einem »Polen hoch!« erwiderten. Schnell wurden die Hüte aufgesetzt, und wir zogen hinter der jungen Männerwelt drein, die singend durch die Stadt marschierte, den polnischen Helden entgegen. Auf dem Marktplatz erfolgte das Zusammentreffen. Man hatte den Wagen die Pferde ausgespannt, die Studierenden zogen die polnischen Helden unter dem Zujauchzen der Volksmenge einher, vier Fahnen mit den polnischen Farben voraus.
Rotteck sprach, Welcker, zuletzt Grotecki. Die Begeisterung war unbeschreiblich.
Was ist es nur, was aus ihm sprüht? Überdenke ich mir die Worte, die er spricht, so kann ich nicht umhin, mir zu sagen – durch sie kann unmöglich dieser Taumel der Begeisterung entstehen, besonders wenn er ein paar unvollkommene deutsche Sätze stammelt. Es ist also die Seele, die uns hinreißt, die große Seele eines großen Unglücklichen.
Die Polen wurden von dem Offizierskorps zu einem Mittagsmahl in die »Stadt Wien« eingeladen. Wir baten Mutter, uns auf einen Kaffee auch dahin zu führen. Professor Reichlin bot sich als Begleiter an. Aber oh weh, alle Stuben waren schon mit Studenten angefüllt, die sangen und stritten und uns viel zu bezecht erschienen, als daß uns ihre Gesellschaft hätte zusagen[115] können. So wollten wir wieder schweren Herzens heimzotteln, als Grotecki unserer ansichtig wurde, herbeieilte und uns, mir nichts, dir nichts, in den Speisesaal führte, wo sich sämtliche Offiziere und Polen uns begrüßend erhoben. Man brachte uns einen kleinen runden Tisch. Mutter bestellte Kaffee. Kaum saßen wir, erschien Amalie von Berg mit Kozlowski und nahm mit einem Lächeln bei uns Platz. Sie ist noch schöner geworden durch die grenzenlose Begeisterung, die ihren dunkelblauen Augen entstrahlt, während ihr feiner Mund, oft merkbar zitternd, die Kämpfe ihres Innern verrät. Um den Mann ihrer Liebe kämpft sie, von dem die Ihren nichts wissen wollen. Warum denn nicht, um Himmels willen, warum sollten diese beiden so wahrhaft schönen Menschen nicht zusammenkommen? Es ist ja nicht wie bei Therese – Oberleutnant K. hatte sich neben sie gesetzt, und ich mußte mir sagen: Diese müssen sich fügen, die Kraft fehlt ihnen, um über das Herkömmliche Herr zu werden. Aber bei jenen andern, bei Amalie von Berg und Kozlowski, ist Kraft und Leidenschaft genug, um der ganzen Welt entgegenzutreten.
Grotecki sprach. Er ließ die Frauen Badens leben, deren warme Teilnahme Balsam sei für die so schmählich besiegten Polen. »Ce sont nos funérailles et ce sont vos beaux coeurs qui les embellissent«, sagte er,[116] sich gegen die anwesenden Frauen verneigend. Mit brechender Stimme schilderte er das erbarmungswürdige Geschick seiner Landsleute – auch sein eigenes – der Vater nach Sibirien geschleppt, Mutter und Schwestern in ihren Schlössern verbrannt oder herausgeschleppt – mißhandelt, niedergetreten. – Der Ton seiner Stimme war so ergreifend, daß selbst die Offiziere in Tränen schwammen, und sie und die Polen umarmten einander unter dem Rufe: »Polen hoch! Deutschland hoch!«
Wie durch einen Schleier sah ich Amalie von Berg aufstehen und das Lied anstimmen:
»Noch ist Polen nicht verloren.« –
Leidenschaftlich brauste der Gesang durch den Speisesaal. Die Studenten aus den Nebenzimmern eilten herbei und sangen mit. Auf der Straße sammelten sich die Leute, alle erregt, unter Tränen singend, immer von neuem:
»Noch ist Polen nicht verloren.« –
Ach, erst im Umgang mit diesen Helden kann man ganz ihre Größe schätzen, ihr Unglück erfassen.
Beim Gehen war plötzlich Grotecki an meiner Seite.
»Merken Sie nicht,« flüsterte er, »oh, Sie merken nichts – nur für Sie sprach ich – nur Ihnen habe ich[117] mein jammervolles Geschick mitgeteilt. – Was liegt mir an all den andern.« –
Ich nahm Mutters Arm, ich hatte ein Gefühl, als trügen mich die Füße nicht mehr. Ich brachte beim Nachtmahl keinen Bissen hinunter und zog mich gleich auf mein Zimmer zurück.
Mutter kam. Ich dachte: wenn sie mich fragt, was mir sei – was soll – was kann ich ihr antworten?
Sie fragte nicht. Sie sagte nur: »Närrle, nimm nicht alles gar so ernst.« –
1. Juli. Wie lebhaft, wie hochinteressant geht es nun des Nachmittags zur Kaffeestunde bei uns zu. Ganz wie selbstverständlich, ohne daß wir sie eingeladen hätten, erschien eines Nachmittags Amalie von Berg und mit ihr Kozlowski. »Dürfen wir?« sagte sie zur Mutter und weiter nichts. Und Mutter schloß sie in die Arme. Nun sind sie immer da und können ungeniert miteinander reden in dem lauten Kreis – laut durch die Gegenwart der Hofrätin mit ihrem Schreiberle, wie sie den jungen Polen nennt, der nun statt meiner unter den Tisch zu schlüpfen und den Knäuel zu suchen hat.
Meine Aufgabe ist – ach, sie ist entsetzlich schwer – Zarembecki nicht merken lassen, wie sehr, sehr es mich zu Grotecki zieht. Gleich als er das erstemal[118] in unser Haus kam, sozusagen auf den ersten Blick, entdeckte er meine kleinen Zeichnungen von Mutter und Caton über der Kommode. Er fragte, von wem sie seien.
»Von mir«, sagte ich.
»Sehen Sie denn nicht,« rief er aus, »mit allem Talent, dem größten Fleiß – nichts vermögen Sie zu erreichen ohne die Kenntnis des menschlichen Körpers.« – Er deutete mit der Hand bald hierhin, bald dorthin: »So sitzt kein Arm, – diese Schulter steht falsch, – sonst vieles sehr, sehr gut. – Ich habe eine Schwester –«
Er brach plötzlich ab: »Mein Gott, was wird ihr Schicksal sein?« – Tränen liefen über seine Wangen. Er ging. Unter der Türe traf mich sein Blick. Welch ein Blick!
Es gab mir einen Ruck – ich konnte nicht anders – ich wollte ihm nacheilen.
Da legte Zarembecki plötzlich die Hand auf meinen Arm: »Kochana Siostra haben mich vergessen, habe noch nicht gehabt Kaffee.« –
Ich führte ihn zum Tisch und bediente ihn. Ich konnte gar nicht genug tun, so dankbar war ich Zarembecki, daß er mich von einem unbesonnenen Schritt zurückgehalten. Ich nahm mir vor, auf meiner Hut zu sein, – mit aller Gewalt, aller Kraft.
Ich betete, betete mit aller Inbrunst, als ich im Bett lag. Einmal schluchzte ich so laut, daß Therese erwachte.
»Hast du geweint?« fragte sie.
»Geträumt«, gab ich zur Antwort.
»Ich auch,« sagte sie, »mir träumte von der weißen Pelerine des Fräuleins von Berg. Etwas abgetragene Kleider kann man mit solch hübschen weißen Pelerinen wieder ganz auffrischen. Hast du gesehen, sie trug am Halse statt einer Krause ein weißseidenes Krawättchen, mit einer Agraffe befestigt. Ich werde Fräulein von Berg um das Muster ihrer Pelerinen bitten. – Du, Nannele, ich schäme mich ein wenig über die laute Art der Hofrätin. Hast du nicht bemerkt, wie Grotecki lächelte? Ich glaube, daß er mokant ist und es sehr spießig bei uns findet.«
Ich wunderte mich über meine eigene Stimme. als ich antwortete: »Ich glaube es auch.«
Aber warum, warum, wenn ich so von ihm denke, kommen meine Gedanken nicht los von ihm? Es gab eine Zeit, da verstand ich die Prinzessin von Ahlden nicht, die Mann und Kinder, Ruh und Ehre hingab für ihre Liebe. In dieser Nacht wurde es mir klar, daß so etwas möglich ist. Ich erkannte das entsetzliche Unglück einer Leidenschaft, und ich sagte mir: Es gibt nur eines: Kampf oder Untergehen.[120] Ich hätte nicht gedacht, daß so etwas mich ankommen könne, – mich. – Ich hielt mich für gefeit, – warum eigentlich? War das nicht Hochmut, und muß ich darum klaftertief in meiner eigenen Achtung sinken? Schande der Geschichte meines Herzens, wenn ich es nicht über mich bringe, jeder ferneren Begegnung mit Grotecki aus dem Wege zu gehen. Was will er von mir? Eine neue Eroberung, weiter nichts. Hermann sagte mir, Grotecki stehe im Rufe eines Don Juan …
Ich konnte nicht umhin, Caton eine lebhafte Beschreibung zu machen von unserer herrlichen Polenzeit und der tiefen Teilnahme, die Freiburg an Polens schwerem Schicksal nimmt. Ich legte einige Blätter der »Freisinnigen« bei, in der Rotteck, Welcker und Grotecki fulminante Artikel in die Welt sandten über Polens Unglück, seinen Edelmut und seine Freiheitsliebe.
Zu meinem Erstaunen schrieb mir Petersen statt Catons, es sei offenbar sehr notwendig, meine hohen Ideen von den Polen etwas herunterzustimmen, deren Edelmut in Norddeutschland weniger Eindruck mache, da man hier wisse, daß die Polen in Paris mit einem Haufen Franzosen gegen Philipp rebelliert hätten. Das weibliche Politisieren habe übrigens keinen Sinn, da die notwendige geschichtliche Grundlage fehle und[121] nur subjektive Empfindungen aus dem Politisieren der Frauen redeten.
Ich anerkannte und dankte Petersen für seine gute Absicht, mich bessern zu wollen, entschuldigte mich aber nicht, sondern erklärte, ich könne teilnehmendes Aussprechen unserer Gefühle, treffe es den einzelnen oder das Allgemeine, nicht politisieren nennen. Bezüglich der Rebellion gegen Philipp führte ich an, daß das, was zwei oder auch zwanzig Polen verschuldet, nicht dem ganzen Polenvolke könne angerechnet werden. Alsdann packte mich, wie so oft, der Humor zur Unzeit, indem ich von diesem ernsten Thema einen Sprung in den plattesten, weiblich romantischen Stil machte, so auf Petersens Mahnung eingehend, daß wir Frauenzimmer das Barometer der Politik doch lieber unberührt lassen und uns nicht männliche Interessen anzueignen hätten.
Ich schrieb also ungefähr: »Im übrigen freue ich mich über das schöne Wetter, weil man spazierengehen kann und die Natur bewundern, die grünen Bäume, das bunte Obst und die flatternden Vögelein und murmelnden Quellen. Aber auch das Regenwetter hat sein Gutes, weil Äuglein und Füßlein dann ruhig bleiben müssen, damit die Nadel flinker geht, um Kleider, Wäsche und Strümpfe in gehöriger Ordnung zu halten. Sonst weiß ich jetzt nichts mehr,[122] als daß der süperbe Sommer leider auch einmal zur Neige geht, worüber ich sehr traurig bin, denn wie sehr die Partien oft auch fatiguiren, so sind sie doch noch amüsierender als die langen Winterabende beim Unschlittlicht usw. usw.«
Mein sonst so großdenkender, edler Schwager faßte meinen Spott nicht humoristisch auf, so wie es gemeint war. Er glaubte, ich mache mich über ihn lustig, während ich ihm nur zeigen wollte, wie ein Frauenzimmer ohne höhere Interessen sich ausdrücken möchte.
Ach, wäre man nur nachsichtiger, so brauchte man gar nicht so vorsichtig zu sein!
Petersen, mich so falsch beurteilend, wählte ein zu starkes Mittel zu meiner Besserung – nicht an mich selbst, sondern gleichsam anklagend, wandte er sich an die Eltern, sie möchten die übermütige Amazone an die ihr zuerst zukommende Tugend der Bescheidenheit verweisen.
Ich weinte bitterlich, als Vater diesen Passus vorlas. Aber, o Glück, ich hatte beide Eltern auf meiner Seite, und Mutter erklärte, sie selber wolle die Sache mit Petersen in Ordnung bringen, denn wenn sie mit meiner Bescheidenheit zufrieden sei, so sei sie der Meinung, daß auch er es könne.
Immerhin, es hat mir wehe getan, von einem so[123] schätzenswerten Mann wie Petersen verkannt und gekränkt zu werden. Ich konnte nicht umhin, Welcker, den ich bei Mohrs traf, mein Erstaunen mitzuteilen, wie wenig man in Norddeutschland unsere Anteilnahme an Polens Unglück verstehe.
»Das glaube ich,« sagte Welcker und lächelte sarkastisch.
»Aber«, rief ich aus, »müßten wir Deutsche denn nicht ein Herz und eine Seele sein?« Er nickte: »Was wollen wir denn andres.«
Den 3. Juli hatte trotz allem Abraten und Untersagen von oben ein kleines Freiheitsfest in St. Ottilien stattgefunden. Rotteck, Welcker und auch mein Vater waren nicht dabei. Er meinte, wir sollten auch zu Hause bleiben, aber Mutter hatte Amalie von Berg und noch anderen jungen Mädchen versprochen, sie zu chaperonieren. Ebenso hatte es sich Frau Welcker nicht nehmen lassen, dem Ausflug beizuwohnen. Sie ging voraus zwischen einem Schwarm von Polenjünglingen, die, wo sie auch immer erschien, nicht müde wurden, der gütigen Frau ihr Leid zu klagen. Ich hatte mir fest vorgenommen, Grotecki mit so viel Würde zu begegnen, daß er weder einen Handkuß noch eine Schmeichelei wagen würde. Aber als wir die Herren oben im Walde trafen, küßte[124] er mir die Hand gleich zweimal, und aus meiner Würde wurde eine totale Verlegenheit. Ich nahm Lenchens Arm, an meiner anderen Seite schritt Zarembecki; so fühlte ich mich geborgen – wußte aber, ach, nur zu genau, daß Grotecki dicht hinter mir dreinging, nachdem er mir einen zornig-wütenden Blick zugeworfen hatte. – Auf dem ganzen Weg zur Wallfahrtskapelle wurden Freiheitslieder gesungen. Eine unbeschreibliche Erregung erfüllte aller Herzen. Ich mußte weinen, und Lenchen weinte mit mir. Aber dann mußten wir auch wieder lachen. Schreiber schleppte die Hofrätin neben uns her. – »O du mei' liebes Herrgöttle,« stöhnte sie, »isch des e' Schnauferei – aber 's macht nix – dafür keuch' ich gern der Berg 'nauf, daß mer so honett behandelt wird – in Freiburg kräht kei' Hahn nach de alte Weiber, aber sechs Pole springe, wenn ich mei' Knäuel falle laß' – Pole hoch! Die Freiburger sind Stoffel. –«
Die Kapelle der hl. Ottilie blieb unbesucht diesmal. Reden wurden gehalten, gesungen und wieder gesungen. Ich sah Amalie von Berg in einem himmelblauen Schaltuch da und dort unter den Männern auftauchen, einer Freiheitsgöttin gleich, leuchtend vor Begeisterung und Schönheit.
Der Redakteur der Freisinnigen Zeitung sprach von dem herrlichen Fest in Hambach, auf der uralten[125] Kestenburg mit der prachtvollen Aussicht auf die Rheinebene – von Worms bis Straßburg – zwanzigtausend Menschen, auch Polen und Franzosen, lauschten hier den feurigen Reden Wirths, eines wahrhaft deutsch gesinnten Mannes, der in der deutschen Einheit das höchste Ziel seines Lebens erkannte.
Grotecki sprang auf die Rednerbühne. Mit aller Kraft, mit aller Leidenschaft eiferte er gegen Fürsten und Fürstendiener. Er sprach wie ein Gott. Mit der schwarzrotgoldenen Fahne sollte sich die polnische vereinen, um den russischen Barbaren gemeinsam zu vernichten, Rußland zu Fall zu bringen, seine schrankenlose Willkür, seinen unersättlichen Ehrgeiz zu brechen.
Er sprach und sprach. – Zu meinem Erstaunen blieb ich ungerührter als alle um mich her, die weinten und sich umarmten und sich wie Trunkene gebärdeten. Waren es jene mich so tief verletzenden Worte, die Monz sprach, und die mir plötzlich in den Sinn kamen – sein Auflachen, als er sagte: »Gehören Sie am Ende auch zu den Narren, die sich durch ihre Polenschwärmerei für alle Zeiten lächerlich machen?«
Ich sah Lenchen an, die mir am Arm hing.
»Du weinst auch nicht?« fragte ich.
»Ich wein' doch nicht, wenn du nicht weinst«, gab sie zur Antwort.
Ich mußte lachen – herzlich lachen.
Um uns her küßte sich alles. »Polen hoch! Deutschland hoch!« Der Tumult wurde mir fast zu arg – da, ein Schatten – ich schaute auf – Grotecki stand vor mir.
»Rache ist süß«, sagte er, und eh' ich mich's versah, preßte er mich an sich – und küßte mich.
Es war so, als drehte sich die Erde mit mir. Ich taumelte, ich hatte keinen Willen mehr. Ich kann es nicht beschreiben, Stimmen tönten an mein Ohr – ein polnisches Wort, heftig, schneidend – Zarembecki war's. Er nahm meinen Arm, Grotecki trat uns in den Weg, Worte flogen zwischen den beiden hin und her – ein Drohen – Aufflammen.
Ich raffte mich auf, ließ Zarembeckis Arm los und eilte zur Mutter.
Welch ein Heimweg zwischen Mutter und Lenchen – beide führend, mit zitternden Knien, nach Atem ringend, dem Weinen nahe und doch wieder voll Angst, mich zu verraten.
Und Lenchen, die erzählte:
»Denk' au, Nannele, der Schreiber, der Schlingel, kommt daher und gibt mir einen Kuß –, 's küßt sich ja alles, sagt er und will noch einmal anfange, da hat er aber e' Watsch 'kriegt, daß er au g'schrie hat.«
Sie lachte und schwätzte weiter. Und mir fiel's[127] wie ein Vorwurf auf die Seele: Warum hast du's nicht auch so gemacht, warum hast du still gehalten?
Ach, so meiner selbst sicher war ich abgezogen, innerlich meiner Würde gewiß. Und was geschah? Fand ich Worte der Empörung, zwangen meine Blicke den Unverschämten einzuhalten?
Welch ein Heimweg.
Sie gingen vor uns her wie ein wandelnder Wald – fünfhundert Menschen. Alle trugen große Eichenäste, die sie im Triumphe schwangen. Auf den Schultern trugen sie Grotecki.
So ging's durch die Stadt. Welcker kam uns im Wagen entgegen. Seine Frau nahm neben ihm Platz. Die Studenten machten Spalier. Einige sprangen hinten auf den Wagen, in den auch Grotecki gestiegen war. Die jungen Männer hielten kreuzweis ihre Zweige über die Freiheitsmänner, von denen jeder eine Rede hielt.
Und wieder wehte das blaue Schleiertuch von Amalie von Berg inmitten der erregten Männerschar, und ihre Augen leuchteten, ihre Lippen sprachen – eine Priesterin der Begeisterung – so erschien sie mir.
Therese schlief längst, ich saß noch immer am Fenster und sah auf die stille Linde hinunter, über die der Vollmond sein bleiches Licht goß. Ich konnte nicht denken und hielt nur den Kopf. Erst als die Tränen[128] kamen und ich weinen konnte, wurde mir ein wenig leichter.
Ich traute meinen Ohren nicht, als ich an der Türe ein Klopfen zu hören vermeinte. Es klopfte ein zweites Mal; als ich öffnete, kam Hermann herein, zitternd, mit zerwühlten Haaren. Er könne nicht schlafen, er habe versprochen, nichts zu sagen, aber er halte das Schweigen nicht aus – Zarembecki duelliere sich in der Frühe mit Grotecki. Sie seien im Tivoli hart aneinandergeraten dadurch, daß Zarembecki Grotecki vorwarf, er schade Polens Sache durch die Unwürdigkeit seines Betragens.
Hermann fügte hinzu: »Denke dir, er hat zwei jungen Mädchen den Kopf verdreht.«
Es war gottlob fast dunkel im Zimmer. –
Wir blieben die ganze Nacht am Fenster sitzen. Ich wickelte Hermann in ein Tuch; er fror vor Aufregung. Ein Schreiben von Zarembecki, das er mir zeigte, war ein Vermächtnis für uns. Hermann sollte seine Pistolen bekommen, eine prachtvolle russische Beute, Therese einen Orden, ich seinen Ring.
Schon um fünf des Morgens machte sich Hermann auf den Weg. Er hatte keine Ruhe. Ich auch nicht. Um sechs sollte das Duell stattfinden. Fiebernd vor Aufregung tat ich alle mögliche Hausarbeit, als Hermann strahlend vor Glück mit der Nachricht zurückkehrte:[129] »Beide unversehrt.« Unter der Bedingung, daß Grotecki sofort abreise, hatten sie Frieden gemacht. Er ist schon unterwegs.
Ich bat die Mutter, mir zu erlauben, ein paar Tage auf unserem Landgütle zubringen zu dürfen.
O liebliche, so still verlebte Tage im heimeligen Waldasyl, abgeschlossen vom Geräusche des Stadtlebens, von all den seelenbeklemmenden Eindrücken, die dort auf mich gewartet hätten. Gibt es etwas, das unser Herz mehr beruhigen kann als so ein Bauernhaus, in dessen Hof die Hühner scharren, zuweilen ein Hahn kräht oder ein friedliche ›Muh‹ aus dem Stallfensterchen ertönt.
Seligkeit ist diese Stille, Balsam einem Gemüt, das nicht zu denken, nicht zu überlegen, nicht einmal zurückzublicken, sondern eben nur das Zunächstliegende ins Auge zu fassen vermag.
In der guten Stube der Bäuerin hatte ich mein Nachtquartier aufgeschlagen, ein wenig hart, zur Toilette mußte ich mir das Wasser aus dem nahen Brunnen holen. Exkursionen in den nahen Wald, – das eigenhändige Zubereiten meines kleinen Mahles aus Eiern und Milch, in die ich das harte Bauernbrot tunkte. Und endlich die Arbeit, das Aufsuchen von Motiven oder vielmehr das Auswählen, denn dieser[130] kleine Erdenwinkel barg der lieblichen Bilder mehr als genug.
Am vierten Tag meiner Einsamkeit kam Hermann. Ich sah ihm entgegen, wie er den Waldweg einherschritt, ein gar herziger Student jetzt. Das Röckle am Stock, die Mütze im Nacken, seine braunen Augen lachten mir von weitem entgegen.
Gottlob und Dank, ich konnte auch wieder lachen!
Frische Butter hatte die Bäuerin eben im Fäßle. Ich konnte ihn herrlich bewirten.
Daß Amalie von Berg mit Kozlowski als Verlobte bei uns waren, war das erste, was mir Hermann mitteilte.
Dann: »O Nannele, denk' dir, Zarembecki hat mir zum Abschied einen prachtvollen russischen Säbel geschenkt.«
»So ist auch er gegangen?« fragte ich.
»Alle fast«, sagte Hermann. »Es sei gegen ihre Ehre, Freiburgs Gastfreundschaft noch länger in Anspruch zu nehmen. Sie sprachen von Frankreich, wo sie sich eine Existenz zu gründen hoffen. Halb Freiburg gab den scheidenden Helden das Geleite. Männer und Frauen weinten laut. Nur einige besonders unbemittelte Polenjünglinge sind zurückgeblieben. Frau Welcker hat nicht geruht, bis die Stadt versprach, ihnen Brot und Arbeit zu geben.«
Ich fragte, ob Amalie von Berg mit Kozlowski Freiburg verlasse, und freute mich, als mir Hermann mitteilte, daß er als Bibliothekar bei der Universität angestellt werde.
Die Eltern und Geschwister holten mich heim.
»Jetzt bist du wieder mei' alt's Nannele«, sagte Mutter, nahm meinen Arm, und wir schritten hinter den andern drein.
Nun wird sie mich wohl fragen, was mir war, dachte ich voll Angst.
Aber Mutter sagte nur: »Kommsch grad' recht zur große Wäsch'.«
Unendliche Freude gewährte mir ein Brief Petersens. Er tat mir Abbitte. Er sei zu hart und scharf gewesen, ein echter Nordländer, wie wir ihn zu nennen pflegten. Was er tun solle, um auch den letzten Rest meines Grollens gegen ihn zu tilgen.
So und nicht anders konnte er sprechen. Ich wußte es wohl, denn von herrlichen Menschen erwartet man nie zu viel Herrliches.
Tief berührt mich ein Gerede, das über Monz im Umschwang ist. Man wirft ihm vor, der ehemals so laute Freiheitsprediger sei ein Jüstemilieuaner geworden und lasse sich vom König von Württemberg für fürstenknechtige Dienste bezahlen. Ich wollte es[132] nicht glauben und fragte bei ihm brieflich an, was es mit diesem Gerede auf sich habe. Er antwortete mir, daß er allerdings die Stelle eines Bibliothekars in Stuttgart bekleidet. Seine letzte Zeit in Freiburg habe seinen Glauben an wahre Freundschaft und vernünftige Menschen geschwächt. Da er sich gegen die Polen aussprach, seien ihm seine früheren Freunde ausgewichen, als schmälere sein Umgang an ihrer Ehre, sogar ich sei ihm kalt höflich begegnet. Er hoffe, sich in Württemberg ein Heim zu gründen, und schloß mit dem Wunsch, ich möchte ihm meine Freundschaft nicht entziehen.
Mit dem Brief kam der erste Band seiner gesammelten Gedichte. Eines darin ist an mich: »Anna Villinger – das weibliche Zartgefühl« betitelt.
Ein sehr minderwertiges, kühles Gedicht, während das auf den Tod von Maria von Verleb schön und warm empfunden ist. Er vergleicht sie mit der heiligen Cäcilia. Und wie er sie geliebt, zeigt ein Vers:
Und wenn er mein »weibliches Zartgefühl« auch nicht schön besang, so ist es doch wahrlich zu preisen, denn mir ward ahnungsvoll inne, daß eine Vernunftehe[133] von beiden Seiten zu viel der Vernunft für eine Ehe gewesen wäre.
Es wundert mich, ob grausame Tyrannen oder Weltverfinsterer mehr zu verantworten haben?
Es sollen künftig keine öffentlichen Predigten mehr im Seminarium stattfinden, weil die Alumnen als künftige Landpfarrer der aufgeklärten Musterpredigten der Professoren nicht bedürften.
O ihr armen, verkürzten Jünglinge! Wohl mag mancher unter euch Gedankenfülle und Rednertalent besitzen, aber die Kunst, diese Gedanken zu formen, daß sie Eingang finden ins menschliche Herz, die ist euch genommen, da man euch das Vorbild entzogen. Denn wenn irgendwo die Form nötig ist, so ist es in der Rede. Diese Neuerung hat mich auf das bitterste betrübt, denn auch wir sind verkürzt, denen diese Predigten geistvoller Professoren bisher ein wahres Seelenfest waren.
Armes Freiburg, was hast du verschuldet, daß du wie ein zweites Sodom und Gomorra büßen sollst? Ist es ein Verbrechen, daß du eine Anzahl Redlichdenkender, den großen, herrlichen Rotteck, Welcker, Reichlin in dir bergest? Die Volksvertreter, so geehrt und geliebt von uns allen, sind entlassen. Die »Freisinnige Zeitung« ist aufgehoben. Die Aristokraten[134] triumphieren. Die Machthaber verkünden ja nun ihre zehntausend Gebote: Du sollst nicht schreiben, nicht sprechen, nicht singen und so fort. Der Todesengel der Freiheit posaunet es durch die Länder, daß die Volksstimme – Gottesstimme – verstumme. Die Stadt verliert das Regiment. Man spricht auch von einem möglichen Verlust des Hofgerichts, der Wegnahme des Bistums. Was soll aus uns werden, beraubt von allem, was uns bisher Anregung und Bereicherung gab. Ja, ich weine auch der Militärmusik nach, deren muntere Klänge mir die Seele erfrischten wie den Körper das kaltklare Wasser.
5. Nov. Die Stille jetzt in Freiburg!
»Mer isch wie e begossener Pudel«, sagte die Hofrätin.
Es will mir jedoch scheinen, daß, wenn sie da ist, Mutter und sie sich trotz aller Zeitereignisse so gut wie gar nicht verändert haben.
Aber es kommt mir vor, als hätten Therese und ich uns verändert. Sie zu ihrem Vorteil, denn sie ist entschieden heiterer, in ihrem Wesen gleichmäßiger seit der Versetzung des zum Hauptmann avancierten K. Dieses sich immer wieder Begegnen reißt die Wunden einer doch hoffnungslosen Liebe stets von neuem auf. So ist es Therese offenbar viel leichter geworden, ferner[135] dem Tanzen zu entsagen, als sie sich's vorgestellt. Davon gesprochen hat sie nicht, eine große Schweigerin, die sie ist, im Gegensatz zu mir, die nur im Aussprechen Labsal findet. Therese sprach sich im Tanzen aus. Ich glaube, im Dahinschweben fühlte sie sich aller Pflichten und Besorgnisse ledig. Sie vergaß sogar eins ihrer Hauptkümmernisse – wenn Caton lange nicht geschrieben. Denn wenn ich mich auch darob kränken und recht sehr ärgern kann, so verloren und unglücklich sein, wie Therese über das Ausbleiben von Catons Nachrichten ist, das kann ich nicht. Weiß ich doch aus Erfahrung, daß, wenn wir eben auf dem Punkt angekommen sind, Petersens samt und sonders am Rande des Grabes zu vermuten, kommt da nicht plötzlich ein kreuzfideler Brief Catons mit einer köstlichen Beschreibung aller möglichen Feste? So ist eben nun einmal unser Catonele.
Ich habe viele Schüler angenommen für Nachhilfestunden im Deutschen, auch für französische Stunden. Aber ich gebe diese nicht mehr mit dem alten guten Gewissen, seit ich das Französisch der Polen gehört. Wie aber nach Frankreich kommen? Das ist die Frage, die jetzt Tag und Nacht mit mir umgeht. Mein Leben und alles, was ich tu und lasse, kommt mir jetzt so passabel vor – ich kann es nicht anders ausdrücken. Ich, sonst so vom Zeitgeiz besessen, eile jetzt[136] mit Weile, und wie ein Traum kommt es mir vor, daß ich einst mit edlen, leidenschaftlichen Menschen geglüht und geweint. –
Grotecki, du Rätsel meines Lebens! Von andern kann ich deinen Namen noch nicht aussprechen hören. Aber denken kann ich jetzt an ihn und ihn zu verstehen suchen – und mich selber auch. Was war das? O Himmel, wenn ich einen Menschen fragen könnte, was das war! Wie es nur möglich ist, wenn man sich anders für ein rechtliches Geschöpf gehalten, plötzlich für einen Augenblick seiner selbst nicht mehr mächtig zu sein. Unwürdig, ja unwürdig war dieser Zustand, einer reinen Seele unwürdig.
Grotecki, du hast mich mit deinem zügellosen Beginnen nicht gewonnen, sondern verloren, du hast mich vor mir selber erniedrigt. Ich schäme mich, so lang ich lebe vor Zarembecki. Ich bete zu Gott, daß er mich ferner bewahre. Es war nichts Gutes. Das habe ich gefühlt in aller Verwirrung.
Arme Prinzessin von Ahlden, kam auch dir eines Tages die Einsicht, erwachtest auch du aus dem Rausche deiner Leidenschaft? Du großer Gott, wenn dir das geschah! Nach deinen Kindern hast du verlangt und durftest sie nicht wieder sehen. Ein Menschenleben lang mußtest du in Einsamkeit büßen für ein Gefühl, das wie eine fremde Gewalt den Menschen[137] überfällt und ihn bezwingt. Habe ich den Arm zurückgestoßen, der mich umfing? –
Arme Prinzessin von Ahlden … Wär' ich anders gewesen, als du es damals warst! –
Grotecki war ein Mensch, der mit einem Blick alles übersah. Ich lernte durch ihn, was mir fehlt.
Ich habe Mutter gegenüber ein paar Worte fallen lassen von der Notwendigkeit, daß ich mir die richtige Aussprache in Frankreich holen müsse. Sie schlug die Hände zusammen.
»Kind, Nannele, du, in Frankreich allein!«
Ich sagte ihr: »Bedenken Sie eines, Mutter, ich darf mit einem guten Französisch ganz andere Ansprüche machen.«
»Willst du wirklich?« fragte sie unter Tränen.
»Muß es nicht sein,« sagte ich, »und ist mein Beruf nicht eine längst ausgemachte Sache?«
»Nannele, wenn du gesund wärst!«
»Ich habe Mut, das ist noch mehr. Und, Mutter, denken Sie, wenn ich's erreichen könnte, daß Sie sich um Theresens und um mein Los nicht mehr zu grämen brauchten.« –
Sie nahm sich zusammen, versuchte zu lächeln und ging.
Aber der Anfang ist gemacht.
Ich schrieb an de Ber in Nancy.
Eine Insel hat sich in Freiburg gebildet, wo alle die, welche einst von Freiheit träumten und um das Los der armen Polen litten, sich wieder finden, einander kennend, vom Vergangenen schweigend, ihre Seelen aber neuen Interessen öffnend.
Es ist im Hause von Amalie von Berg, der Madame Kozlowska. Ich staune die beiden herrlichen Menschen wie höhere Sterbliche an.
Die Frage kommt mir wohl zuweilen: Warum haben die einen alles und die andern nichts? Hätte sie nicht genug an Schönheit und Liebe? Aber auch die Kunst ist ihr Eigentum. Bilder, die ich nicht genug anstaunen kann, zieren die Wände ihres Gemaches, in dem sie, eine vollendete Weltdame, ihre Gäste empfängt und bewirtet. Sehr oft trägt sie das polnische Nationalkostüm und hat sich selbst konterfeit in der pelzverbrämten Tschapka, ein Bild, das alle Herzen in Brand stecken könnte, wenn sie nicht einzig und allein nach der Liebe ihres Kozlowski verlangte. Und er, dieser königliche Mann, hält er in uns nicht das Andenken aufrecht an das ritterliche, dem Schönheitssinn so wohlgefällige Benehmen der edlen Polenjünglinge? Wie hätte doch der Umgang mit diesen eine[139] Bildungsschule werden können für einen großen Teil unserer jungen Männer, die man leider so oft eines ungehobelten Benehmens zeihen muß, wenn auch nicht selten ihr Wissen ein erfreuliches ist. Ich spreche von unserer Jugend, nicht von der älteren Generation mit ihren etwas altväterlichen, so rührend chevaleresken Manieren. Vor allen dem edlen, feingesinnten Rotteck, der mir vorbildlich bleiben wird, so lang ich lebe.
Ich sehe es für ein ganz besonderes Glück an, ihn und Welcker an Kozlowskis Empfangstag zu treffen. Die beiden Herren sind immer gleich frisch und voll der Pläne. Eine gemeinsame Arbeit, die Herausgabe des »Staats-Lexikons«, beschäftigt sie bis hinein in die Geselligkeit, und ich kann gar nicht nahe genug bei ihnen sitzen, um ihren oft ungeheuer sarkastischen Reden und Gegenreden zu lauschen. Wenn ich die Regierung wär', wahrlich, diese Köpfe hätte ich mir für den Staat erhalten. Aber wie Schiller sagt:
»Es liebt die Welt das Strahlende zu schwärzen« –
Amalie Kozlowska hat mir den Vorschlag gemacht, bei ihr zu malen; es würde ihr Freude machen, ihre Erfahrung meinen Arbeiten angedeihen zu lassen.
Oh, ich verstehe, sie allein ahnt wohl, was sonst außer Zarembecki niemand geahnt. Nun will sie[140] wohl, so glücklich jetzt, ein wenig von dem Zuviel, das ihr zuteil geworden, an eine weniger Glückliche abgeben.
Ich dankte ihr.
3. Januar 1835. So wäre es nun entschieden. Im April nehme ich einen einjährigen Aufenthalt in Nancy bei den Eltern de Bers. Es soll mir dort jede Möglichkeit gewährt werden, mich im Französischen zu vervollkommnen. Seine Stiefgeschwister, ein Mädchen von vierzehn und ein Knabe von dreizehn Jahren, sind meiner Erziehung anvertraut.
Mir ist seltsam befreit zumute, da ich nun weiß, der Stein ist ins Rollen gekommen. Ja, ich bin heiter und versuche, den Meinen, deren Herz schon jetzt ob des Abschieds blutet, mit gutem Beispiel voranzugehen. Wir sind eifrig mit meiner Aussteuer beschäftigt, Therese und ich. Die gute Mutter will mir alle Wäsche neu mitgeben, damit mich in der Fremde keine Flickerei belästige und an meiner Aufgabe hindere. Also wird drauflosgeschneidert, -genäht und -gestickt, und ein Ballen schönster Hausmacherleinen muß dran glauben. Großes Kopfzerbrechen verursachen die Kleider. Das gute Blaue, meint Mutter, könne für die Werktage dienen, für den Sonntag riet sie zu einem schwarzen. Dafür reichte mein Stundengeld prächtig[141] aus. Für etwaige Gesellschaften bot mir Therese eines ihrer weißen Mullkleider an, das sie mir mit schwarzen Samtschleifen gar hübsch ausgarnierte. Hut und Mantel lassen vielleicht zu wünschen übrig, aber das macht nichts. Mutter beglückte mich mit ihrem seidenen Schal für die kühlen Sommerabende, und ein Peterle für gewöhnlich machte mir Therese aus einem alten Mantel zurecht. Immer wieder brachten sie etwas aus ihren Schränken herbei, das ich haben sollte, und ich mußte mich ernstlich wehren, daß sie sich nicht völlig beraubten. Wie weh mir innerlich ist, soll den Lieben erspart bleiben. Will's durchbrechen im Herzen, mache ich einen Weg durch unsre lieben Gäßle, schau alles mit ganz neuen Augen an, möchte weinen vor Schmerz, von all dem Gewohnten zu scheiden, wenn nicht ein Gefühl brennender Neugier, die Frage: Zukunft, was wirst du mir bringen? mich auch wieder beglückte.
Besonders schwer wird mir der Abschied von Lenchen werden, denn nächst den Meinen wird sie mich am meisten vermissen.
Hermann hat noch nie so viele Dummheiten gemacht, aber ich weiß, es geschieht, um uns allen über den Gedanken an den Abschied wegzuhelfen. Er hat die Flegeljahre, die nicht immer lieblich waren, glücklich überstanden, und ich bin stolz auf unsern bildhübschen[142] Akademiker, den die jungen Mädchen im Kasino den Lord nennen, weil er wirklich ein ausgezeichnetes Benehmen hat. Ich hab's ihm auch nicht wenig eingeschustert.
2. März 1835. Große Ereignisse bringen uns über unsre eigene Persönlichkeit weg. Denn ist es nicht ein großes, unbegreifliches Ereignis, wenn ein schönes, uns unerreichbares Glück plötzlich jäh vor unsern Augen zusammenbricht? Unerforschlicher Gott! Auch mit zuckendem Herzen, verständnislos müssen wir das Haupt beugen. Amalie von Berg – Amalie Kozlowska ist nicht mehr.
Es hat mich hineingetrieben in ihr schönes, von ihr so geliebtes Heim. Es war still am Haus. Ich ging die Treppe hinauf. Es traf mich ein Lichtschein, dem ich beklommenen Herzens entgegenging. War es nicht unbescheiden, dieses Eindringen, konnte nicht jeden Augenblick jemand kommen und mich aus dem Hause weisen? Aber der Augenblick auf der Schwelle ihres Totenzimmers war mir wie ein Geschenk, das mir eine heilige Erinnerung fürs ganze Leben bleiben soll.
Da lag die Schönheit im Sarge, von einem Schleier umhüllt, der nur die obere Hälfte ihres Gesichtes[143] frei ließ. Wie aus Marmor war diese klare Stirn gemeißelt, das geschlossene Augenpaar, die feinen Linien der Wangen. In ihrem Arm unter dem Schleier lag ein kleines Köpfchen an ihrer Brust, so klein und zart, daß man's kaum entdeckte.
Über dem Sarg an der Wand – ich mußte mein Herz mit beiden Händen halten – denn ach, da hing das lebensfrohe, strahlende Bild Amaliens – ihr Selbstporträt in der Tschapka.
Ein leises Stöhnen brachte mich zu mir selber. Das dunkle Etwas auf dem weißen Totenkleid waren Kozlowskis Hände. Zur andern Seite des Sarges kniete er, ein völlig gebrochener Mann, bleich wie die Tote selber – die Augen geschlossen.
Wie wechselt doch Freud und Leid im Leben! Wenn ich Hochzeit machte, könnten mir nicht lieblichere und schönere Geschenke zuteil werden. Ich bin beschämt und beglückt. Diese Liebe, diese Teilnahme hebt uns alle wie mit Samthänden über Schmerz und Trennungsweh weg. Wir bestaunen die köstliche Vervollkommnung meiner Aussteuer, immer wieder freuen und umarmen wir uns. Lenchen hat mir einen Spitzenkragen gestickt, wie ihn eine Königin nicht schöner hat. Ridiküls sind's ein halbes Dutzend.[144] Die Hofrätin schenkte mir eine sechsreihige Granatkette mit silbernem Schlößchen. Von Caton kam ein Marie-Antoinette-Fichu mit echten Spitzen – kurz, es ist nicht zum Aufzählen. Ich werde den größeren Koffer nehmen müssen.
Auf dem Wege meiner Abschiede und Dankvisiten traf ich bei der Hofrätin Karoline im Klostergewand – jetzt Frau Martina. Es sind Jahre, daß wir uns nicht gesprochen. Gesehen habe ich sie wohl zuweilen im Klostergarten, aber wir gingen uns aus dem Weg. Nun kam mir alles Vergangene kindisch vor, und ich ging herzlich auf die ehemalige Mitschülerin zu. Sie erhob sich nicht, sondern gab mir mit einer gewissen Gönnermiene die Hand.
»Du tust mir recht leid, Nannele,« sagte sie, »daß du in die böse Welt hinausgestoßen wirst.«
»Ich gehe von selber,« gab ich zur Antwort, »niemand stößt mich hinaus.«
»Eben die Verhältnisse,« meinte Frau Martina in mitleidigem Ton, »ich werde für dich beten.«
Ich dankte ihr, und dann war's ganz nett. Wir sprachen von den alten Schulzeiten, und Frau Martina gab sogar zu, daß ich sie in allen Fächern überflügelt habe.
Ein paar Damen erschienen, begrüßten sie vor mir und erwiesen ihr als Klosterfrau mehr Aufmerksamkeit als mir. Sie war ganz glücklich, strahlte, drückte mir die Hand, nannte mich ihre beste Freundin und nahm den rührendsten Abschied von mir.
Hierauf erhob sie sich, und da ich auch gehen wollte, ließ ich der Klosterfrau den Vortritt. Erhobenen Hauptes schritt sie an mir vorbei, stolperte über die Stufe und flog mit wehendem Schleier auf den Gang hinaus.
Da haben wir aber so gelacht und waren wieder Kinder und sind so voneinander geschieden.
Herr von Verleb wird sich verheiraten.
Es heißt, daß es auf eine glückliche Ehe schließen lasse, wenn der Mann nach dem Tode der Gattin sich bald wieder vermähle, weil ihm das Leben ohne sorgende Gefährtin nicht mehr möglich sei.
Du, liebe Caton, hast mir einmal ein beherzigendes Wort gesagt: »Unglücklich sein, ist keine Lebensaufgabe«. Also will ich das Gefühl überwinden, das mich bei dem Gedanken überkommt: Eine andere wird Marias schönes Heim bewohnen.
Ich bin froh und danke Gott, daß ich fort sein werde, wenn Verleb mit seiner Braut Visite macht.
Nun kurz vor meinem Weggehen wird Therese krank. Entsetzlich überkommt es mich: Wie kann ich denn gehen? Wer soll Mutter beistehen, wenn sie ihrer Stütze beraubt ist? Dieser Kampf ist noch das ärgste: Soll ich, darf ich gehen? Oder müßte ich bleiben? … Es geht besser. Therese muß nur noch zu Bett bleiben, um ihren Katarrh nicht der rauhen Märzluft auszusetzen. Nun ist es Mutter, die mich von allen Zweifeln, ob ich gehen oder bleiben solle, heilt. »Närrle,« hat sie gesagt, »wann denkst du ans Packen?« –
Wie doch Mutter das Aufrichten versteht! Wir sitzen an Theresens Bett und besprechen ganz heiter alles Nötige für die bevorstehende Reise. Lenchen kommt auch dazu. Wer kommt nicht? Man sollte meinen, es wäre eine Prinzessin krank, die täglich große Cour hält, wo sie alle Stadtbegebenheiten und Staatsangelegenheiten erfährt. Der großherzogliche Leibarzt fühlt ihr täglich den Puls, Hermann hat sie als Vorleser anzustellen geruht, wobei er noch gratis die Stelle eines Hofnarren übernahm. Ich bin als Nachtwächterin nicht eben hervorragend zu loben, da ich Therese stets meine Dienste anbiete, wenn sie schläft, während ich fest schlafe, wenn sie meiner Hilfe bedürfte.
30. März. Es will mir fast scheinen, als habe Theresens Krankheit eigens kommen müssen, um uns allen den Abschied zu erleichtern. Eine neue Sorge hatte unsere, auf einen Punkt gerichteten Gedanken plötzlich in Anspruch genommen, und nun wir jene los sind, legt sich's wie ein Gefühl der Dankbarkeit auf das kommende Weh.
Ich bin auf unserm lieben heimeligen Friedhof gewesen, wo da und dort auf den Gräbern schon Schneeglöckle und Aurikele sich hervorwagen. Zwei Kränze hatte ich geflochten für zwei teure Gräber – Maria von Verleb steht auf dem einen Kreuz. Auf dem andern, nahe bei der Kapelle: Amalie Kozlowska.
Aus dem Glanze ihres Daseins, beneidet von so vielen, waren sie abgerufen worden. – Und ich, die ich voll liebender Bescheidenheit die beiden Gottbegnadeten angestaunt, ich bin noch da, ich stehe an ihrem Grab, genieße das Licht der Sonne, sehe das junge Grün der Bäume sprossen und höre der Vögel Jubeltöne durch den stillen Friedhof schallen. – Mein Gott, der Du mir das schöne Leben noch ließest, wie danke ich Dir! –
Dinglingen, den 3. April 1835.
Unschätzbarste Eltern!
's ist eins, meine Gedanken sind doch bei Euch, warum soll ich sie Euch nicht sagen dürfen, da ich sie bekanntlich einmal nicht bei mir behalten kann. Noch dazu, da mir das Herbeischaffen des Schreibgerätes gar keine Umstände macht. Ich schreibe in einem abgelegenen Tanzsaal des Postgebäudes, mit einem Schreibepulver, in das ich die Feder nur ein einziges Mal zu tunken brauche, um einen noch längeren Brief zu schreiben, als dieser ausfallen wird, denn in einer halben Stunde geht die Post weiter. So wisset denn, Gott hat gleich wieder so viel Komisches auf meinen Lebensweg geschüttelt, daß es dem Abschiedsweh zur Unmöglichkeit wurde, mich zu übermannen, und ich wollte nur, Ihr hättet nach einer Stunde unsrer Trennung so herzlich lachen können wie ich über meine possierliche Reisegesellschaft im gelben, alterswackeligen Postwagen.
Die Insassen bestehen aus einer impertinenten Marquisin, die kein Deutsch kann, einem überaffektirten Tanz-, Fecht- und Schulmeister, der fortwährend mit seinen feinen Tanzschuhen, die aber zerrissene Sohlen haben, kokettiert, und einem jungen Blut von[149] einem Bürschlein, das von Freiburg bis Dinglingen von einem Lachkrampf in den andern verfiel. Ich selbst hätte am liebsten mitgehalten, wenn ich mir nicht ganz ernstlich gesagt hätte: Nannele, jetzt ist's aus mit dem »dummen Mädele sein«; du hast jetzt als Muster der Vernünftigkeit, als kommende Erzieherin in die Fremde zu segeln, also muckse nicht. –
Und so machte ich Ihnen, geliebte Eltern, alle Ehre, indem ich die Impertinenzen der Marquisin nicht mit gleichem, sondern mit einer geradezu hoffähigen Artigkeit erwiderte, im Innern mich so auf mein künftiges Mundhalten einübend, das mir bislang meistens nicht gelungen ist.
Den armen Fecht- und Tanzmeister mit seinem vor Höflichkeit grinsenden Gesicht nannte die Marquisin den maigre et pauvre homme, und da er sich den Anschein gab, Französisch zu verstehen, nickte er nach jedem Satz, den die Marquisin sprach, auf das höflichste: »Oui, madame«, auch als die Marquisin meinte, er sei gewiß mit seiner roten Krawatte ein durchgegangener Sträfling. Ich nahm ihn lebhaft in Schutz, indem ich die böse Sieben auf seine ehrlichen Augen aufmerksam machte. Sie meinte lächelnd, ob ich etwa verliebt in ihn sei. Meine Antwort wäre vielleicht etwas derb ausgefallen, wenn das junge Kerlchen in seiner Ecke nicht durch einen neuen, ganz[150] besonders lebhaften Lachanfall unsre Aufmerksamkeit auf sich gezogen hätte.
»Imbécile,« herrschte ihn die Marquisin an, »haben Sie gehört, imbécile!«
»He nei,« preßte er erstaunt hervor, »Baptist Will heiß i.«
»Was sagt er?« stieß mich die Marquisin an. Aber ich lachte so, daß ich nur stoßweise hervorbrachte, der Bursche habe geglaubt, sie nenne ihn beim Namen.
»Ist auch sein Name – imbécile« – »Baptist Will«, beharrte er.
Sie zog einen halben Kipfel aus der Tasche und zeigte ihn dem Bürschlein mit den Worten:
»Den hättest du bekommen, wenn du kein solcher Imbécile wärst« – und aß ihn selber auf.
Alsdann lehnte sie sich in ihre Ecke zurück und schloß die Augen.
Ich benützte meine Freiheit, indem ich dem Fecht- und Tanzlehrer das kleine Fläschle Wein anbot, das mir Therese ins Ridikül spediert hatte. Das Bürschle bekam einen ganzen Kipfel.
»Sie hät eso e Bart«, flüsterte er mir zu.
Der maigre et pauvre homme trank das Fläschle in einem Zug, versteckte es dann aber schnell in seinem Rockärmel, denn die Marquisin schlug die Augen auf.
»Er ist ein Dieb!« rief sie aus. »Ich sah etwas in seinem Ärmel verschwinden.«
»Oui madame«, sagte er, ehrerbietig an seinen Hut greifend.
»Und dieser Imbécile, was ißt er da, hat er mir etwas aus meine Ridikül genommen?«
Ich klärte sie über ihren Irrtum auf, indem ich ihr versicherte, daß sie sich in einer absolut ehrlichen Gesellschaft befinde.
»Ah,« fiel sie über mich her, »Sie halten zu diesen Menschen gegen mich!«
Jetzt kochte es in mir.
»Es sind ja meine Landsleute«, gab ich zur Antwort.
»Bah«, machte sie, »ich habe in Freiburg Ihre Landsleute kennen gelernt; es ist ein wildes Land, und seine Bewohner sind Wilde. Nur Baden-Baden ist ein Paradies, und nur die Königin Hortense und die Großherzogin sind gens de qualité – warum? Weil sie nicht aus diesem barbarischen Lande stammen, in dem der Adel ein Französisch spricht, das für das Ohr einer Französin horrible ist. Überhaupt, außer Frankreich, einem Stückchen von Italien und Baden-Baden ist die ganze Welt abominable.«
»Sehen Sie, diese Wilden«, unterbrach sie sich, als wir viehtreibenden Landsleuten begegneten.
»Tragen bei Ihnen, Madame, die Viehtreiber Glacéhandschuhe?« fragte ich und nahm, da sie nicht gleich eine Antwort bereit hatte, ein Buch aus dem Ridikül.
Nun rückte sie hin und her, stellte immerzu Fragen an den armen Fecht- und Tanzlehrer, schrie das junge Kerlchen an, das aber friedlich wie in seinem Bett schlief, und ließ endlich, nur um mich vom Lesen abzubringen, den ganzen Inhalt ihres Ridiküls auf den Boden fallen. Der Fecht- und Tanzmeister war glücklich, ihr alles aufheben zu dürfen. Ich rührte mich nicht.
In Dinglingen machten wir Mittag. Ich bestellte mir Suppe und ein Stückchen Kalbfleisch.
Die Marquisin rümpfte die Nase:
»Echt deutsch, sich schon um Mittag den Magen zu füllen« – und bestellte sich Eier.
Mir gegenüber am Tisch saß der Tanzlehrer.
»Ach,« flüsterte er mir zu, indem er sich durch die Haare fuhr, »das Geld ist mir ausgegangen.«
»Hat er Ihnen eine Liebeserklärung gemacht?« fragte die Marquisin.
Ich sagte ja und bestellte beim Kellner Suppe und Rindfleisch für den pauvre et maigre homme.
Als uns die Marquisin speisen sah, gelüstete sie[153] alles, und sie tauchte in alle Schüsseln, versuchte, schnitt ein Gesicht und versuchte wieder.
Sie hätte wahrlich eine Ohrfeige verdient, so impertinent ungezogen benahm sie sich.
Nun kam aber der Hauptspaß – sie mußte über die Hälfte mehr als ich bezahlen.
Der Wirt sagte: »Sie hät jo von allem g'hat, und der Kellner hat springe müsse für zehne.«
Als sie ihm mit einem empörten »Worüm?« die Rechnung hinwies, verneigte er sich und sagte: »Dorüm«.
Fortsetzung in Offenburg, aber auch während der ganzen Fahrt, liebe Eltern, wird Ihr Nannele bei Ihnen sein.
Offenburg.
Die Marquisin befliß sich bei der weiteren Reise einer absoluten Höflichkeit. Sie bot mir sogar von ihren Pfefferminztäfele an. Ich nahm eines und dankte höflich. Diese Höflichkeit steckte die neuen Insassen der Post an, so daß eine Frau, die schnarchte, immer wieder von ihrem Gegenüber geweckt wurde mit dem Bemerken: »Lent doch euer Muusik«. –
Wie unerquicklich wäre diese Reise ausgefallen, hätte ich der Marquisin gegenüber meinem Ärger[154] Luft gemacht und sie mit Sottisen bombardiert, wie sie verdient hätte. Nun hatte ich Genuß an ihrem schönen Französisch, sie tätschelte mir wiederholt die Schulter, und ich wurde ob der Ehre, die mir widerfuhr, von sämtlichen Insassen der Post angestaunt.
Der Fecht- und Tanzmeister hatte seinen Sitz auf dem Deck des Postwagens genommen, nachdem er mir gesagt, die französische Sprache sei ihm auf die Dauer zu anstrengend.
»Ich bin«, setzte er hinzu, »jetzt in einer traurigen Lage, aber sobald ich eine Stelle habe, werde ich in Freiburg bei Ihren Eltern meine Schuld entrichten.«
Wie anständig, nicht? Eigentlich sind alle Menschen besser, als man voraussetzt, vielleicht auch die Marquisin – wer weiß.
Wir kamen gegen sieben Uhr in Offenburg an. Als wir an der Post ausstiegen, fragte mich die Marquisin, ob ich ein besonderes Zimmer haben wolle.
»O ja«, sagte ich, denn ich war wirklich zu müde, um ihr bis in die Nacht hinein zu huldigen.
Als Abend- und Nachtessen nahm ich Kaffee, und ein bescheidener Knabe von Kellner bediente mich in meinem kleinen Zimmerchen, in dem ich jetzt schreibe.
Da morgen Sonntag ist, fährt die Post erst um neun Uhr, so daß ich genügend Zeit haben werde, einer hl. Messe beizuwohnen, das Städtle anzusehen[155] und noch einen Morgengruß an die lieben Eltern zu schicken. Gute Nacht denn.
Noch eine gute Stunde bis zur Abfahrt der Post. Wie höchst interessant ist doch das Reisen! Möchten Sie doch, meine ungemein lieben Eltern, sich keinen Augenblick um Ihr Nannele sorgen, denn wenn mir auch das Heimweh nicht geschenkt ist, so bin ich von der Vielseitigkeit meiner Erlebnisse doch so in Anspruch genommen, daß ich weit davon entfernt bin, die Flügel hängen zu lassen.
Also ich wandelte höchst einsam durch die sonntagsstille Hauptstraße der Stadt Offenburg, mich bemühend, Sehenswürdigkeiten zu entdecken. Der helle Klang einer Glocke lockte mich in eine schmale Seitengasse, so daß ich plötzlich am Ende derselben vor einem klosterähnlichen Gebäude mit einer Kirche stand. Eine Frau, die mit ihrem Gebetbuch des Wegs kam, sagte mir, das alte ehemalige Franziskanerkloster sei jetzt das Mädcheninstitut der congrégation Notre-Dame. Soeben fange die heilige Messe an.
Ich schritt durch das uralte Eingangsportal in die halbdunkle Kirche und nahm meinen Platz vor dem Altargemälde der Himmelfahrt Marias. Ein paar Stufen führen zum Chor, das hell und licht erglänzte[156] durch die vielen Kerzen am Altar, wo die heilige Messe zelebriert wurde.
In den Bänken knieten die Schülerinnen, rechts und links in den Chorstühlen die Klosterfrauen. Ein rührendes Bild für mich, die ich einst so gern mich der Schar der Gottgeweihten einverleibt hätte! Nun führt mich der Weg hinaus in die Fremde, wo ich es nicht so gut haben werde wie diese von der Welt abgeschlossenen Frauen, die sich, aller Sorgen ledig, der Erziehung ihrer Zöglinge hingeben können.
Denken Sie nicht, liebe Eltern, daß diese Betrachtung etwa aus einem ängstlichen Herzen kommt. Im Gegenteil! Als ich unter dem Gesang der Klosterkinder in den hellen Tag hinausschritt, war ich äußerst begierig auf das neue Stück Welt, das sich vor mir auftun sollte.
Straßburg.
Groß war die Freude der Marquisin, als wir elsässischen Boden unter den Füßen hatten. Es stieg gleich ein Bauer ein, ein alter Mann, der einen fürchterlichen Knaster rauchte. Das hätte sich einer jenseits der Grenze erlauben sollen!
Sofort redete sie den Elsässer mit einem Schwall von Liebenswürdigkeiten an, dabei mit beiden Händen[157] gestikulierend, vor Glück, endlich einen compatriote anzutreffen.
Der alte Bauer maß sie mit zusammengekniffenen Augen.
»He,« stieß er mich an, »was babbelet's au, des old Fegnascht – isch 'm vielleicht 's Raache nit racht?«
Er sah wütend nach der Marquisin hin.
Ich beeilte mich, ihm zu sagen, daß die Dame eine Französin sei und gehofft habe, mit ihm Französisch sprechen zu können.
»I rad kei Französisch, i rad Dütsch«, brummte er neben seiner Pfeife heraus.
»Was sagt er – was reden Sie mit diesem Mann?« drängte die Marquisin. »Wie können Sie überhaupt Deutsch mit ihm reden? Er wird Sie nicht verstehen.«
»Ich fürchte, er versteht nicht Französisch«, sagte ich, meine Heiterkeit durchaus nicht verbergend.
Nun fuhr sie auf: »Nicht möglich – unmöglich – monsieur,« fiel sie über den Mann her, und ihre Empörung ergoß sich wie ein Wasserfall über den Ahnungslosen.
Jetzt erhob auch er sich, nahm die Pfeife aus dem Mund, spuckte und traktierte die Marquisin mit einer[158] Auswahl von Schimpfwörtern, wie ich sie nie in meinem Leben gehört. –
Sie wurde still und fragte nicht einmal: »Was hat er gesagt?«
Avricourt.
Soeben Abschied genommen von der Marquisin. Sollte man's glauben, sie umarmte mich, weinte und umarmte mich wieder. Sie sagte mir, daß sie mich gleich beim ersten Blick zu den gens de qualité gezählt habe, trotzdem ich sehr unmodern sei und einen Hut habe wie eine Vogelscheuche. Aber in Nancy würde man mich modernisieren; in Nancy, dem petit Paris, könne man so etwas gar nicht sehen.
»Und noch eins, ma chère,« rief sie mir beim Gehen zu, »nehmen Sie sich vor den Franzosen in acht!«
Sie legte den Finger auf den Mund und schlug lachend die Augen zum Himmel, warf mir eine Kußhand zu, und gleich darauf hörte ich sie mit einem Mann, der sich ihres Gepäcks – man sage drei Koffer – bemächtigt hatte, laut schelten und streiten.
Nancy, 8. April.
Meine geliebten Eltern!
Nun hier, nun angekommen, Gott sei Dank!
De Ber holte mich an der Post ab mit der Chaise. Ich fand ihn sehr verändert, nicht zu seinem Vorteil. Weder von seinem Übermut noch von dem einstigen Respekt für die Lehrerin ist noch etwas vorhanden. Seine familiäre, nachlässige Art widerstrebte mir. Er brachte mich in sein elterliches Haus, verabschiedete sich und überließ mich der Sorge eines hübschen jungen Dienstmädchens, das mich artig, aber mit seltsam lächelndem Blick auf mein Zimmer führte und mein Gepäck heraufkommen ließ.
Ich möchte Toilette machen, sagte sie, um sechs Uhr sei das Diner. Ich will nicht unterschlagen, daß mir das Herz pochte bei dem Gedanken meines ersten Erscheinen in der Familie. Aber der Anblick meines sehr netten, mit dem reizendsten Kattun ausgarnierten Zimmers machte andrerseits den angenehmsten Eindruck auf mein für alles Schöne so empfängliche Herz. Ich mußte sogar lachen: nicht weniger als drei Spiegel, einen ganz großen, in dem man sich vom Kopf bis zu den Füßen sieht, und zwei kleinere. Einige Kupferstiche aus »Paul et Virginie« hängen an den Wänden, und auf dem Waschtisch stehen so[160] viele Büchslein und Glasschalen, daß ich Landkonfektle neugierig davorstand, unfähig deren Zweck zu erraten.
Daß ich Toilette machen sollte, verursachte mir nicht wenig Kopfzerbrechen. Um alles in der Welt wollte ich mich nicht allzu schön machen – (oh, ich Dummerle) um nicht gleich beim ersten Erscheinen den Eindruck von Unbescheidenheit zu erwecken. Andrerseits wollte ich der Würde meiner neuen Stellung nicht Abbruch tun, indem ich zu wenig Wert auf mein Äußeres legte, sintemalen das Sprichwort sagt: Kleider machen Leute.
Ich wählte also das neue, schwarze Kleid – fast mit etwas Gewissensbissen, da es doch Werktag war, und wählte den zweithübschesten Spitzenkragen – nicht den von Lenchen, der wäre mir viel zu pompös erschienen.
Die Familie befand sich im Salon, als ich mit Aufgebot meiner ganzen Energie versuchte, nicht allzu schüchtern einzutreten.
Aber die Dame des Hauses empfing mich mit so großer Liebenswürdigkeit und sprach so lebhaft auf mich ein, daß ich gar keine Zeit fand, mich zu genieren.
Wie mir die Reise bekommen – wie ich mich befinde – ob mir der Kopf nicht weh tue – ob mich[161] die Glieder nicht schmerzen. – »Sehen Sie hier Marie, Ihre kleine Schülerin, und dies ist Paul – keine Grimassen, Paul. Sorge, daß du das Deutsche so gut wie dein Bruder lernst. Unser ältester Sohn Justin hat sehr profitiert bei Ihnen. Monsieur ist sehr zufrieden mit Justin – das Geschäft beansprucht Sprachkenntnisse. Ein großes Exportgeschäft, wissen Sie, Mademoiselle. Unser ältester Sohn besorgt die englische und deutsche Korrespondenz. Ich wäre glücklich, wenn Paul bei Ihnen so profitierte, daß ich ihn nicht fortschicken müßte. Er ist ein wenig enfant gâté. Was Justin von der deutschen Kost erzählt, würde Paul kaum zusagen. Ich meine, die deutsche Kost im allgemeinen. Es ist ja alles Gewohnheitssache.«
Da saß noch ein junger Mann, der mir vorgestellt wurde.
Cousin Sormont.
Und dann ging die Tür auf, und eine große stattliche Frau trat über die Schwelle, von den Kindern mit Handküssen begrüßt: Grand'maman.
Auch hier wurde meine Begrüßung durch die lebhafte Gegenrede der alten Dame erstickt.
De Ber kam mit seiner jungen Frau. Dann Monsieur.
Man setzte sich zu Tisch. Hier endlich fand ich[162] Zeit, mich ein wenig in dem Kreis umzusehen, in dem ich fortan leben soll. Man ließ mich völlig in Ruhe, sprach unausgesetzt, und ich machte sehr bald die Bemerkung, daß die Ankunft einer neuen Gouvernante kein Ereignis im Hause war. Nur die kleine Marie sah manchmal mit einem etwas bedenklichen Blick nach mir hin. Ein blasses Kind, mit nichtssagenden Augen, das faul ißt und die Hälfte auf dem Teller liegen läßt. Paul verschlingt.
»Esse nicht wie ein Ogre«, mahnte seine Mutter.
Sie sprach fast unausgesetzt. Monsieur nickte zuweilen zerstreut mit dem Kopf. De Ber machte einen abwesenden, übellaunigen Eindruck, seine Frau einen bedrückt schüchternen. Grand'maman allein mutete behaglich an. Sie hatte einen Zipfel ihrer Serviette in den Ausschnitt ihres Kleides gesteckt und gab sich ganz dem Genuß des Diners hin. Es war aber auch danach! Ich schämte mich fast ein wenig unserer Schweinebraten mit Sauerkraut und Leberknöpfle. Andererseits glaube ich, daß unseren Männern, die soviel größer und starkknochiger sind, die so kleinen, feinen Platten nicht genügt hätten wie den Herren an diesem Tisch, die schmal und mager, kaum von mittlerer Größe sind. Jede Speise wurde lebhaft kritisiert.
Nach Tisch sagten die Kinder gute Nacht. Als ich[163] ihnen folgen wollte, hielt mich Madame zurück, man nähme den Kaffee im kleinen Salon bei Großmama, die Bonne sorge für die Kinder.
Der kleine Salon ist zugleich das Schlafzimmer der Großmama. Man saß um einen runden Tisch. Die Herren wurden plötzlich sehr lebhaft. Bei der Schnelligkeit ihres Sprechens und den mir noch neuen Redewendungen verstand ich oft nichts, merkte aber bald – es war besser, sehr oft nichts zu verstehen. Großmama und Madame amüsierten sich köstlich, und es schien keinen Eindruck zu machen, daß ich nicht auch lachte. Bei dieser Gelegenheit merkte ich, daß ich von nun an niemand mehr bin. Nicht leicht für jemand, der vielleicht im eigenen Nestle eine allzu große Rolle gespielt. Aber die liebe Mutter darf sich darum nicht grämen, denn ihr Nannele hat ja die Gabe, allem eine komische Seite abzugewinnen, so auch diesem Abend mit seinem unerquicklichen Anfang. – Die Herren rauchten und griffen zur Zeitung. Grand'maman hatte ihr drittes Täßchen Kaffee geschlürft und begann:
»Wir haben einen großen Bekanntenkreis, Mademoiselle. Da ist vor allem Monsieur Simon, Industrieller. Ein Mann wie in einem Roman. Man kann sich nicht genug vor ihm in acht nehmen. Er hat nie eine Frau kennen gelernt, die sich nicht sofort[164] in ihn verliebt hätte. Seine Laufbahn ist die denkbar interessanteste. Sein Vater war der Sohn eines député. Seine Mutter – mein Gott, was war sie doch für eine Geborene? Ich habe ihren Neffen gekannt. Er hat zu gleicher Zeit mit mir geheiratet; ein großer charmeur. Seine Frau war die Nichte eines entfernten Verwandten unsres Hauses, dessen Großmutter – mein Gott, wie war doch ihr Name? Ihren Mann, denken Sie, nannte ganz Nancy den schönen Antoine – O oui.« –
Da sie einen Augenblick schwieg, fragte ich: »Und Herr Simon, Madame?«
Ich erschrak über den Effekt, den meine Frage hervorbrachte. Die Herren sahen von ihren Zeitungen auf und lachten, die junge Frau de Ber wurde rot, und Madame hustete und machte sich an ihrem Armband zu schaffen, während Grand'maman mich erstaunt fragte: »Wollte ich denn etwas von Monsieur Simon erzählen?«
»Aber Grand'maman, das hast du ja getan,« gab ihr Madame im liebenswürdigsten Ton zur Antwort, »Mademoiselle meinte nur, sie habe nicht recht verstanden. Mademoiselle ist des Französischen noch nicht mächtig.«
Das war mein erster Abend in der Fremde. Ich kann nur sagen, daß ich ein Bett habe wie eine Prinzessin und mich trotz der ermüdenden Reise heute frisch und wohl fühle.
Der Diener trägt die Briefe des Hauses um acht Uhr auf die Post. Ich hoffe, die Länge des meinen rechtfertigt das teure Porto.
Sie können also, teuerste Eltern, ganz ruhig über mein Los sein. Es fehlt hier sogar nicht an einer Hofrätin, wie Ihr aus der Beschreibung der Grand'maman erseht.
Und so nehme ich denn Abschied von Ihnen und den geliebten Geschwistern, mit der Bitte, unsrer Caton meinen Brief zu schicken, nachdem ihn auch Lenchen und die anderen Kamerädle gelesen haben.
Ihr dankbarste Nannele.
… bei Nancy, 27. Juni 1835.
Meine liebe Caton!
Deine Zeilen haben mir so wohl getan. Du, die mich so kennt wie niemand, hast wohl bemerkt, was alles in meinem Brief an die Eltern ungeschrieben geblieben ist. Aber leidet Mutter nicht schon genug durch mein Fortgehen, hätte ich ihr durch das Geständnis meines großen Heimwehs das Herz noch[166] schwerer machen sollen? Ich werde also den Eltern alles nur im besten Lichte hinstellen und nur zu Dir von den Schattenseiten meines Exils sprechen. Es wird das für mich eine große Seelenerleichterung sein, in dem Bewußtsein, daß Dein Herz, so weich es ist, doch auch die nötige Kraft und Stärke besitzt, über Ungemach nicht zu verzweifeln. Und noch eins, Caton, mache es Dir zur heiligen Aufgabe jetzt, so oft als möglich an die Eltern zu schreiben. Sie brauchen Trost, da ihnen die Trennung von einem zweiten Kind nicht wenig schwer fällt.
Wir sind seit dem 1. Juni auf dem Lande in der Nähe von Nancy, ungefähr eine Fahrt von drei Stunden bis hin. Es ist ein schönes, großes Landhaus mit hohen Fenstern und großen Räumen. Ich residiere im Reiche der Mansarden, die nicht schräg sind wie bei uns, sondern genau so grad' wie die Zimmer der unteren Stockwerke, nur etwas niedriger. Meine beiden Sorgenkinder, Marie und Paul, haben ihre Zimmer rechts und links von mir. De Ber und seine junge Frau bewohnen die übrigen Mansardenräume.
Also die Sorgenkinder. Ob Marie etwas denkt oder nichts denkt, ob sie eine Vorliebe für etwas hat oder nicht – es ist kein Klugwerden aus ihr. Ich bin an ihre Schritte geheftet von morgens bis abends. Wenn mich Madame nur einen Augenblick allein sieht,[167] sofort fragt sie vorwurfsvoll: »Wo ist Marie?« Nach ihrer Ansicht kommen kleine Mädchen, wenn sie sich selbst überlassen sind, auf unnütze Gedanken. Ich sprach mich einmal über Maries mir so ganz unbegreifliche Teilnahmlosigkeit aus. Madame lachte.
»Meine Tochter ist genau so, wie ich war. Man wird sie jung verheiraten, und ihre Teilnahmlosigkeit wird sich in das Gegenteil verwandeln.«
Ich fragte: »Glauben Sie, daß alle jungen Frauen glücklich sind?«
Madame zuckte die Achsel: »Man muß sich zu helfen wissen.«
Meine Augen wurden plötzlich sehend, ich weiß nicht, wie's zuging, und so sah ich, wie sie sich zu helfen wissen. Madame macht Ausfahrten mit dem Cousin, von denen sie immer ganz besonders animiert zurückkehrt.
De Bers Gleichgültigkeit gegen seine junge Frau wurde mir durch den Besuch eines jungen Ehepaares aus der Nachbarschaft klar. Madame Lejeune war kaum im Salon erschienen, als de Ber im Handumdrehen zu dem jungen, übersprudelnden Menschen wurde, wie ich ihn in Freiburg gekannt. Und nun weiß ich auch, warum seine junge Frau immer so traurig ist bei seinen tagelangen Ausritten, und warum Monsieur, Madame und Grand'maman immer[168] ein wenig ärgerlich auf die junge blasse Frau zu sprechen sind, die es offenbar nicht versteht, sich zu helfen. Es scheint das hier eine Schande zu sein, denn Grand'maman erklärte neulich: »Eine Frau muß eroberungsfähig bleiben bis in ihr höchstes Alter, sonst ist sie ein überflüssiges Wesen, wenn sie nicht mehr begehrt wird.« –
Und Grand'maman macht sich schön, hat wundervolle, schwarze Haare, und ihre Wangen schwimmen in Milch und Blut.
Das ist der Kreis, in dem ich lebe, und ich muß hinzufügen, daß die Liebenswürdigkeit, mit der ich behandelt werde, nichts zu wünschen übrig läßt. – Und doch, welche Kluft zwischen ihnen und mir – daß ich doch auch jung bin und möglicherweise einer Anlehnung, einer Aussprache bedürfte – wem fiele das ein. Aber ich glaube, sie selber brauchen das nicht. Sie sind immer heiter und zufrieden, wenn sie sich nur amüsieren. Und es scheint, von Gewissensbissen wissen sie gar nichts, sondern gehen ruhig mit ihren schuldbeladenen Herzen in die Kirche. Ob sie beten? Die schöne, alte Franziskanerkirche mit ihren zahlreichen Grabmonumenten und Statuen, dem viel zu buntfarbigen Altar und der viel zu heiteren Kirchenmusik – ich selber habe es hier noch nie zu einem herzinnigen Gebet gebracht. Die elegante Welt[169] rauscht während des ganzen Gottesdienstes die Bankreihen entlang. Man nickt sich zu, man lacht und flüstert. Ach, Caton, weißt Du noch unser Plätzle im Münster, wie wir da einmal abends vor dem Muttergottesaltar knieten, halb im Dunkeln, während die Abendsonne durch die dunkelrote Rosette glühte und das ganze Schiff des Münsters durchflutete. –
So fromm wie damals war mir hier noch nie zumute. Ja, manchmal erschrecke ich und komme mir selber anders vor in dieser andern Welt.
Von der Kirche ging's dann immer auf die Pepiniere, eine prachtvolle Promenade – denke Dir's Freiburger Nannele inmitten dieser Großstadtmenschen, von deren Eleganz man daheim sich nichts träumen läßt. Dazu diese herrliche Stadt mit ihren prachtvollen Gebäuden, Schlössern, Standbildern und dem monumentalen Toreingang von der Altstadt in die Neustadt. Tief bewegt hat mich die Grabstätte von Stanislaus Leszczynski, dem Exkönig von Polen, und seiner Gemahlin Marie Leszczynska in der Bon-Secours-Kapelle.
Ich habe sie öfters besucht, der armen Polenjünglinge gedenkend, deren so geliebte Heimat jetzt unter dem russischen Joch seufzt.
Ach, im Halbdunkel dieser kleinen Kapelle kam mir das Erleben jener Zeit wieder so recht zum Bewußtsein.[170] Wie schön war jenes hochgespannte Empfinden, jene tiefe Ergriffenheit für fremdes Leid, das zu lindern uns als die heiligste Aufgabe erschien. Oh, ich gebe diese Erinnerung nicht her, nicht um alles in der Welt!
Was ich damals erlebt, hat mich gereift, ich habe an Einsicht gewonnen, bin der Enge meiner Anschauungen entwachsen und kann unterscheiden. Hätte ich das können, wenn mir das Herz nicht in Schmerz und Demut geblutet hätte? Wäre ich nicht mit dummen, unerfahrenen Kinderaugen in diese neue Welt getreten, unfähig, deren Leere und Oberflächlichkeit zu durchschauen? O Caton, ich habe einmal so groß und heiß empfinden müssen, um für alle Zeiten gefeit zu sein. Wenn ich auch einsehe jetzt, daß Dein Mann recht hatte und diese romantisch veranlagten, so wenig praktischen Polen nicht imstande sind, ihr Land vor dem Untergang zu retten, so wie es Preußen 1813 getan. – Aber ich schäme mich meiner Vaterstadt nicht und ihrer damaligen etwas weltfremden Teilnahme für Polens erschütterndes Schicksal. Ist es uns doch in der edelsten Gestalt näher getreten, und ich kann jener heimatlosen Helden nur mit der innigsten Teilnahme gedenken. – Durch Lenchen habe ich erfahren, daß nur noch wenige Polen in Freiburg zurückgeblieben sind. Zwei von ihnen haben eine Anstellung[171] in der Kunzerischen Zichorienfabrik gefunden. Darunter Schreiber. Durch ihn hat Lenchen von dem Schicksal jener erfahren, mit denen wir einst verkehrten. Zarembecki, der edelste von allen, schlägt sich in Paris ärmlich durch mit Unterrichtgeben in der polnischen Sprache. Grotecki ist wegen einer Frau im Duell gefallen. Feldherr Kosinski ist verschollen. Von Kozlowski, Amaliens Gatten, weiß man nur, daß er sich aus Schmerz über den Tod seiner Frau in ein Kapuzinerkloster in Polen zurückgezogen hat.
Was mir unsäglich leid tut – Frau Welcker, diese so edelmütige Frau, die alles daransetzt, um der Polen Los zu lindern, was hat sie erfahren müssen! Welckers Bruder in Bonn kam dahinter, daß in Dresden einige Gauner sich die Güte der Polenfreunde zunutze machten und diesen Geld abzuschwindeln verstanden. Die Ernüchterung nach dem Überschwange soll groß sein.
20. Juli. Du siehst, Schwesterle, eine lange Pause, aber mein Leben auf dem Lande ist ganz anders angestrengt als in der Stadt. Dort ging Paul ins College, und Marie wurde von ihren Tanten häufig zum Spazierenfahren oder in Kindervisiten abgeholt. Es fiel also manches freie Stündle für mich ab, das ich dazu benütze, Briefe zu schreiben oder mir Nancy[172] anzusehen. Eine Gouvernante ist ja kein junges Mädchen, dem man hier nicht gestattet, ohne Begleitung auch nur über die Straße zu gehen. Nun, ich mache in meiner Circasienne mit dem, wie die Marquisin sagte, abscheulichen Hut einen offenbar so solid unerfreulichen Eindruck, daß ich bis jetzt nicht den Schimmer eines Abenteuers zu berichten hätte. So habe ich von Nancy in kurzer Zeit mehr gesehen, als vielleicht meine Hausdamen von ihrer Heimatstadt überhaupt wissen. Die Altstadt im Norden mit ihren unregelmäßigen Baulichkeiten und engen Gäßle tat mir's besonders an, wegen gewisser Ähnlichkeit mit Freiburg, das ich eben nicht eine Stunde des Tages vergessen kann. Überhaupt Heimweh! Ich mußte manchmal irgend etwas Kleinstädtisches tun, nur um wieder einmal das eigentliche Nannele zu sein – z. B. ich stahl mich mit meinen zerrissenen Schuhen im Ridikül heimlich zum Haus hinaus und suchte mir einen Schuhmacher. Davon hatt' ich einen ganz besonderen Profit. Der Schuhmacher war nämlich nicht zu Hause, nur die Frau, und die bediente mich. Auch andre Leute zugleich mit mir, und ich machte die Entdeckung, daß sie die Sache genau so gut wie ihr Mann verstand, immer wußte, wo es fehlte, hier trennte, dort einem Lehrjungen den Fehler wies – kurzum ein ganzer Schuhmacher ist. Dies machte[173] mir Lust, daß ich's mich aus purer Neugier ein paar Groschen kosten ließ, um bald einen Bleistift, bald sonst eine Kleinigkeit zu kaufen, und immer hatte ich Gelegenheit, mich der Tüchtigkeit der Frauen des Bürgerstandes zu freuen.
Ich denke manchmal – in Stunden des Heimwehs – daß ich möglicherweise nicht mehr nach Nancy zurückkehre, um früher als vor einem Jahr – Gott, Caton, ich darf es nicht ausdenken. Was ich gewollt – eine gute Aussprache – habe ich ja schon erreicht. Es wird mir täglich gesagt – wozu also länger bleiben? Ich bin manchmal geradezu krank vor Sehnsucht nach Mutter. Ich glaube, ich müßte in einem Strom von Tränen aufgehen, wenn einer darherkäme und ein wahrhaftiges Deutsch spräche.
Es gibt Stunden, Caton, da zanke ich mich ernstlich, denn ich habe es ja doch sehr gut, besonders da mein Leiden, seit wir auf dem Lande sind, mich kaum mehr in der Nacht belästigt. Also was will ich denn? Was können die Kinder dafür, daß ich mir in meinem Eifer lauter Idealkinder vorgestellt habe, die mich unendlich lieb hätten und die ich zu wahren Vollkommenheiten heranbilde. Ojele, Nannele, ich muß froh sein, wenn wir's nur einigermaßen miteinander aushalten, und ich bin für jedes Lächeln dankbar, das[174] gelegentlich in dem gleichgültigen Gesichtchen der kleinen Marie auftaucht. Sie ist wenigstens gehorsam – freilich aus keinem anderen Grund, als weil sie zu faul ist, irgend etwas zu wollen. Mit Paul dagegen lebe ich in einem unausgesetzten heißen Kampf um meine Übermacht, in dem ich nur dann siege, wenn ich den querköpfigen Bengel wie einen Erwachsenen behandle, Monsieur zu ihm sage und mich unbeschreiblich wundere, wenn er sich wie ein ungezogenes Kind beträgt. Da bekommt er plötzlich Rückgrat, macht ein ernsthaftes Gesicht und geruht so von oben herab nachzugeben. Aber ich hab das Bürschle trotzdem gern, denn wir können gelegentlich recht herzlich miteinander lachen, und es ist merkwürdig, wie Lachen verbindet. Bei Marie setzt dieses befreiende Mittel nie ein. Aber sie bekommt allmählich etwas Farbe und Appetit, veranlaßt durch unsern einstündigen Spaziergang vor Tisch. Madame ist die Liebenswürdigkeit selbst, seit Marie gut aussieht. Denn – gut aussehen und sich amüsieren ist die erste Lebensbedingung in diesem Hause. Daß man sich das erstere durch Bewegung in frischer Luft leicht verschaffen kann, wird jedoch nicht eingesehen, sondern man glaubt das Äußerste an Bewegung getan zu haben, wenn man ein wenig im Garten herumtrippelt. Im übrigen wird gefahren.
In letzter Zeit gehe ich mit den Kindern Pilze suchen im nächsten Wäldchen. Solche Wäldchen zerstreuen sich über die ganze Ebene hin. Sonst fruchtbares Land mit Getreide und Weinfeldern. Ferne blaue Hügel begrenzen das Tal. Ach, diese Hügel, Caton! Ich muß mir immer sagen, du hast es ja auch durchmachen müssen und kamst aus unseren Bergen in die Lüneburger Heide. Aber wenn Dir's Herz ein wenig schwer war, dann hattest Du Deinen lieben, klugen, Dich auf den Händen tragenden Mann, für den unser Catonele gern alle Berge der Welt hingeben würde. Wie anders ist das bei mir, die ich im Hause pour une personne très sérieuse gelte, weil ich darauf bestehe, die Lehrstunden einzuhalten, und Madame ernste Vorstellungen mache, wenn sie mir bei jeder Gelegenheit den Unterricht unterbricht mit dem Vorschlag zu irgendeinem Vergnügen.
Daß mich dieses Streng-vernünftig-und-alt-sein-Müssen nicht leicht ankommt, kannst Du Dir denken, Schwesterle. Ich versichere Dir, nach nichts auf der ganzen weiten Welt sehne ich mich so sehr als nach Mutters tadelndem »Du Närrle«. –
27. Juli. Solltest Du glauben, liebe Schwester, als ich gestern morgen ins Lesezimmer trat, fand ich da eine ganze Versammlung zu meinem Namenstag[176] vor. Madame, Grand'maman, de Ber und seine Frau, die Kinder, alle brachten Rosen, sagten mir die liebenswürdigsten Dinge und führten mich zu den Geschenken, die für mich ausgebreitet lagen. Ein seidenes Kleid, weißseidene Fil-d'écosse-Handschuhe, weißseidene Strümpfe, die feinsten Schuhe und ein unsagbar entzückendes Ridikül. Ich verlor die ganze Tapferkeit meines Wesens und brach in Tränen aus. Da lachten sie alle; de Ber war plötzlich wieder wie in Freiburg, stellte sich vor mich hin und hielt eine deutsche Rede, die ich zwar nicht recht verstand, aber doch die eine Stelle: »Es ist die deutsch Natur, wo Franzose lacht, heult die Deutsch« – was mich so ergötzte, daß ich meinen Dank mit dem lachendsten Gesicht abzustatten vermochte.
Auch die Kinder suchten mich zu erfreuen. Marie durch ein Lächeln, Paul versprach: »Heute werfe ich beim Fahren nicht um.«
Er fährt uns nämlich alle Tage mit seinem Pony spazieren, und da er das Tierchen unvernüftig behandelt, wirft er regelmäßig ein- oder zweimal während der Fahrt um. Glücklicherweise ist der kleine zweisitzige Wagen sehr niedrig, so daß das Herauskollern nichts weiter auf sich hat.
Es war mir eine wirkliche Namenstagsfreude, daß[177] das Fahren an diesem Tag in der Tat glatt vonstatten ging, indem Paul meine, wie ich glaubte, in den Wind gesprochenen Mahnungen befolgte und das Tierchen mit Rücksicht behandelte. So tat es seine Pflicht, und ich ließ mir von Paul das Versprechen geben, bei seiner jetzigen Behandlung zu bleiben. Der erste, einzige Fortschritt, den ich bei ihm zu verzeichnen habe.
Die Abende sind so schön jetzt. Nach den heißen Tagen streicht ein frisches Lüftle über die weite, mondbeschienene Ebene. Aber man sitzt drinnen in Grand'mamans kleinem Salon, bei geschlossenem Fenster, ganz wie in der Stadt, und Grand'maman erzählt wie dort von irgendeinem wunderschönen Mann und dessen Verwandtschaft bis ins dritte und vierte Glied.
Eines Abends aber nahm Villingers Nannele plötzlich ihre ganze Wohlerzogenheit beim Schopf, verneigte sich und ging. Und als ich merkte, daß der Fall nicht das leiseste Aufsehen erregte, schalt ich mich ein kreuzdummes Ding, und bin nun jeden Abend draußen. Es ist ein Aufatmen, ein Hingeben an die Phantasie, ein Schwimmen in Heimweh, ungeniertem Weinen und auch wieder kräftigem Ausschreiten im abendlichen Wind. Ein Alleinsein endlich, nachdem ich den lieben langen Tag die kleine stumpfe Marie nicht von der Seite lassen durfte.
Lache nicht, ich habe sogar ein Kamerädle gefunden[178] im nächtlich einsamen Garten – freilich nur ein vierbeiniges – es ist die schöne weiße Angorakatze, Courtes-bottes genannt. Sobald sie meine Schritte hört, kommt sie aus dem Gärtnerhaus und geht mit mir spazieren. Manchmal laufen wir wie verrückt zwischen den Beeten dahin, wie zwei Kinder, die »Fangis« spielen. Zuweilen unterhalten wir uns miteinander.
»Gelt, du bist auch so ein Einsames wie ich, Courtes-bottes?«
»Miau.«
»Nicht nur der Mensch, auch ein Tierle braucht ein wenig Güte und Liebe und Zärtlichkeit – gelt, Courtes-bottes?«
»Miau.«
O Caton, wie bin ich so glücklich, daß ich Dir anvertrauen darf: Ich hab Heimweh, Heimweh, Heimweh. –
4. August. Also, liebe Caton, ich trage das schönste Kleid zum Diner, so oft wir Gesellschaft haben, und all die Menschen, die mich früher nicht bemerkten, machen plötzlich ein Wesens von mir, und ich bekam so viel Schmeichelhaftes zu hören, daß es eine Lüge wäre, wollte ich sagen, ich bliebe unempfindlich. Im[179] Gegenteil, es freute mich, wenn man mir sagte, daß mein Äußeres apart und vornehm sei und mein verpöntes rotes Haar mich wie eine goldene Krone kleide. Grand'maman klopfte mir auf die Schulter: »Tiens, tiens, sie wird uns gefährlich werden.« Worauf de Ber mit einer gewissen Geringschätzung erklärte: »Sie ist zu deutsch, Grand'maman.« – »Ich danke Ihnen für dieses schöne Kompliment«, sagte ich zu meinem früheren Schüler.
1. September. Liebe Schwester! Hast Du gewußt, daß Mutter krank war? Daher, o gewiß daher meine große Unruhe all die Zeit. Ich wußte mir gar nicht zu helfen und hatte so große Not, meinen Pflichten nachzukommen mit dieser Angst im Herzen, die ich nicht zu deuten wußte. – Da kommt heute ein Brief der Mutter. Ach, ich bin so froh. Ich geb ihn nicht aus der Hand, werde ihn Dir abschreiben. Ihre Schrift ist noch sehr wackelig. O du Mutterschrift, du liebe, ich muß sie küssen und weinen. De Ber würde wieder sagen: »Es ist die deutsche Natur, die heult, wenn der Franzose lacht.« Ja, ich bin zu deutsch oder zu bürgerlich oder Gott weiß was. Und wenn sie mich mit Geschenken überschütten, und wenn, und wenn –. Schau, Caton, man muß von seiner Seele geben können, ich glaube, dann hält man alles aus.[180] Und weißt Du, es hat bei uns jeder seine eigene Sprache, so wie er ist, daß man ihn gleich kennt, aber es kommt mir vor, als hätten die Franzosen nur eine Sprache, die so schön und vollendet ist wie ihre Mode, bei der man auch nie weiß, was dahintersteckt.
Lebwohl und gell, gräm' Dich nicht um mich, Du weißt, wie schnell ich unten und wie schnell ich wieder oben bin. Du mußt's machen wie der Beichtvater. Er grämt sich auch nicht und gibt die Absolution. Schnell noch Mutters Brief:
Liebs, herzigs Nannele!
Höchst erfreulich war mir Dein lieber letzter Brief, der mich im Bett traf. Wir hatten alle die Grippe, und müssen wir Gott danken, daß Vater wieder vollkommen gesund ist und sich recht kräftig erholt hat. Bei mir hat sie fast Krach gemacht und gab mir zu verstehen, meine Lebensweise mit aller Vorsicht einzurichten. Therese nimmt sich viel Recht über mich, um mich ganz aus der Küche zu bannen. Doch muß auch ich sorgen, daß dieses gute Kind nicht mehr auf sich nimmt, als ihre Kräfte erlauben. Mit Vater ist nun harter Kampf, indem wir darauf bestehen, er komme um seine Pension ein, um doch noch einige Jährle den wohlverdienten Ruhestand zu genießen. Es soll noch so lang hingezogen werden, bis Hermann[181] sein Examen über- und gut bestanden hat. Es sind dann die Ausgaben nicht mehr so groß, die Kostgänger werden an die Luft gesetzt, und wir nehmen eine kleinere Wohnung. Aber es muß wohl so sein, die Sorgen hören nicht auf, so lange man lebt. Hermanns warmes Blut macht ihm das Sitzen und strenge Studieren nicht leicht, und ich hab ihn viel zu verteidigen, da Vater die Strapazen der Warmblütigkeit nicht kennt, die mir mein ganzes Leben zu schaffen gemacht. Caton hat die richtige Dosis abbekommen, während ich um Dein warmes Geblüt und Herzle eine Hauptsorge in mir trage. So war Deine Nachricht über die Besserung des körperlichen Ungemachs eine nicht zu beschreibende Freude für mich, für die ich Gott alle Tage inständig danke.
Samt den Deinen läßt Dich auch die Hofrätin grüßen, die jetzt leider arg schwerhörig geworden und so verkehrte Antworten gibt, daß mein Nannele vor Lachen gar nicht mehr unter dem Tisch hervorkäme, denn ich selber kann mir oft nicht helfen, so traurig es ist, wenn ich ihr zum Beispiel sage: »Heut haben wir Holz kriegt,« und sie nickt und sagt: »'s best Frühstück.«
In dem Augenblick ist Herbst hier, unsäglich viele Trauben, aber immer schlechte Witterung, keinen Sommer, den Wein zu veredeln. Alle Getreide stehen[182] in leidlichem Wert, nur das Fleisch ist teuer. Sage sechs Kreuzer das Pfund Kalbfleisch!
Von Vater, Schwester und Bruder die herzlichsten Grüße, und nicht mehr für heute als eine Umarmung im Geiste von
Deiner Mutter Villinger.
St…, 6. Dezember 1837,
Liebe Schwester!
Du hast Dich über den Bericht über meinen hiesigen Aufenthalt mehr als nötig beunruhigt. Das tut mir von Herzen leid, um so mehr, als ich wohl in meiner jetzigen Stimmung zu schwarz sehe, indem ich leider noch nicht fähig bin, Menschen und Dinge im Lichte des Humors zu betrachten. O Caton, immer von neuem danke ich dem Himmel, daß ich in Nancy meiner heißen Sehnsucht nach der Heimat nachgegeben und mich durch alles Bitten und Beschwören nicht habe zurückhalten lassen. Es war wie ein Fingerzeig von oben, daß ich mit aller Sicherheit wußte – heim, nur heim. So habe ich doch in meiner tiefen Trauer den stillen Trost, daß ich Mutter pflegen und erheitern durfte und ganz kurz vor ihrem Ende noch einmal das[183] liebe »Närrle« hörte, weil meine Augen wohl gar so ängstlich auf ihrem teuern Antlitz ruhten.
Daß ich dann noch Vater und Therese bei der Auflösung des großen Haushaltes beistehen konnte und sie nun in der schöneren Hälfte unsrer Wohnung untergebracht weiß, mitsamt der getreuen Dortel, ist mir viel wert.
Ach, ich kann mich auch noch heut nicht in den Gedanken finden, daß unsre Mutter nicht mehr unter uns weilt, und so bin ich auch mit meinem Innern eigentlich gar nicht da, wo ich sein sollte, und darum wohl auch nicht so recht fähig zu wirken.
So viel weiß ich aber doch, daß meines Bleibens in diesem Hause nicht von Dauer ist, ja, ich habe vor, womöglich schon im Frühjahr meine Stelle zu wechseln, und würde dann, Deiner liebevollen Vorwürfe eingedenk, auch meinerseits einige Bedingungen stellen. Ich bin ja nun auch kein Neuling mehr und wundere mich oft selber über mein selbständiges Auftreten, wenn es gilt, auf meinem berechtigten Willen zu beharren. Mit den Kindern wollte ich ja immer und überall fertig werden, aber die Eltern! Man hat ja keine Ahnung, wie es um diese in der Welt steht, wenn man aus einem Haus kommt wie das unsrige. Ob es noch so eine Mutter gibt – die Hände wollte ich ihr unter die Füße legen. O Gott, ich weiß nicht,[184] was ich ihr alles zuliebe täte, fände ich eine solche Frau. –
Du sagst, liebe Caton, Nancy bleibt mir ja immer offen, sollte ich sonst nichts Passendes finden. Es rührt mich ja auch geradezu, wie anhänglich man meiner dort gedenkt, und wie sehr man meine Rückkehr wünscht. Natürlich waren die Verhältnisse dort angenehmer, als ich sie hier gefunden, das Leben leichter und heiterer. Aber, Caton, so wie ich jetzt bin, wäre es mir ein Ding der Unmöglichkeit, mich in jenes oberflächliche, meinem innersten Sinn so wenig entsprechende Dasein zurückzudenken. Im eigenen Land sein ist eben doch etwas andres. Das Heimatbrot schmeckt besser als die feinsten Delikatessen in der Fremde. Mir wenigstens. So einsam, wie ich mich dort gefühlt, fühl ich mich hier nie, wo ich auf Tritt und Schritt die lieben Heimatlaute höre.
Außerdem weißt Du ja, daß ich mir auf der Welt nichts sehnlicher wünsche als die selbständige Stelle einer Schulvorsteherin. Bin ich aber außer Landes, könnte ich bei den Behörden leicht in Vergessenheit geraten oder selbst den richtigen Augenblick verpassen, mich zu melden.
Ich soll Dir von der Stadt, von den Leuten erzählen, mit denen ich lebe. Nun, St. ist kein zweites Paris wie Nancy, aber eine hübsche deutsche Residenz, von Rebhügeln und waldigen Höhen umrahmt. Mit Ausnahme des alten Stadtteils ist die Stadt regelmäßig gebaut, mit zum Teil sehr schönen, breiten Straßen. Das Schloß mit seiner mittelalterlichen, turmfesten Burg und der Schloßplatz sind großartig, ebenso die Anlagen. Von der sehr schönen, bergigen Umgebung habe ich auch schon einiges gesehen.
Wir wohnen in einer der schönen Straßen, in der Bel-Etage. Elf meist große, luftige Räume stehen der Familie zur Verfügung, aber die Gouvernante muß in einem Loch schlafen, dessen schmales Fenster auf einen dunklen, feuchten Hof geht. Kein Wunder, daß unter solchen Umständen mein Asthma wieder zunimmt, luftbedürftig wie ich bin.
Ich habe natürlich gegen mein Unterkommen aufbegehrt, worauf die Gnädige erstaunt erklärte, von jeher habe die Gouvernante neben den Kindern geschlafen, und dabei müsse es bleiben. Als ich mich nicht zufrieden gab, beruhigte sie mich mit der Versicherung, sie wolle sich die Sache überlegen.
Damals wußte ich noch nicht, was es mit dem Überlegen dieser Frau auf sich hat. Sie überlegt überhaupt nicht, sondern ist ein unerzogenes, grenzenlos[186] egoistisches und in ihrer Art auch wieder liebenswürdiges Kind. Wolltest Du glauben, Caton, die Mädchen nennen ihre Mutter nie anders als »Kleines«, und täglich kann man sie fragen hören: »Was hast du wieder angestellt, Kleines?« Eine allerdings sehr berechtigte Frage, denn es vergeht kein Tag, an dem die Gnädige nicht durch ihre grenzenlose Schlampigkeit den Zorn ihres Mannes erregt. Die Kinder sind dann immer auf ihrer Seite und nennen den Vater einen alten Brummbär.
Ich sehe immer mehr, welch ein Umschwung sich in der Welt vollzog, seitdem man die Eltern duzt. Oder ist es nicht das allein, sind es nicht vielmehr die Eltern, die, ob man ihnen Du oder Sie sagt, in jedem Fall imstande sein müßten, Respekt einzuflößen? Und wenn sie 's nicht können wie diese, urteile, wie es um den Respekt für die Gouvernante steht.
Die Kinder sind begabt, besonders Elli. Sie machen gute Fortschritte im Französischen, zu dem die verschiedenen ein- und ausfliegenden Gouvernanten, meist Französinnen, bisher einigen Grund gelegt. Das Deutsche hat in den Augen der Gnädigen, also auch in denen der Kinder, keinen Wert.
Einmal, als die Mutter die Mädchen wieder von der deutschen Stunde erlösen wollte, sagte ich zu Elli, die vergnügt ihr Buch zuklappte: »Gut, lassen wir die[187] Stunde, aber du wirst trotz allem Französisch niemals in der Welt für einen gebildeten Menschen gelten, wenn du nicht imstande sein wirst, einen fehlerlosen Brief zu schreiben.«
Die Gnädige ist es nämlich nicht. Ist ihr dieser Mangel schon empfindlich gewesen? Es scheint doch, denn die Kinder werden nicht mehr aus der deutschen Stunde geholt.
Noch von einer Szene will ich Dir erzählen. Der Herr kam in großem Zorn ins Speisezimmer gestürzt, man saß schon bei Tisch, und warf seiner Frau eine Schlafhaube ins Gesicht.
»Statt Taschentücher legt man mir dieses Zeug in die Schublade, und ich blamiere mich vor der ganzen Sitzung, als das Gebändel zum Vorschein kommt. Schämst du dich nicht? Ob du dich nicht schämst?« schrie er sie an.
Sie bog sich vor Lachen: »Das ist ja köstlich – nein, denkt euch, Kinder, er zieht eine Schlafhaube aus der Tasche.« –
Die Kinder wußten sich nicht zu helfen vor Lachen, und schließlich lachte auch der Herr.
»Was soll man da machen?« sagte er zu mir.
Ich hätte ihm wohl sagen können, was da zu machen gewesen wäre, aber wollte er es hören? Ich bin zu der Überzeugung gekommen, daß sich die Männer[188] viel weniger vor einer Kugel als vor einer Szene fürchten.
Jedenfalls ist diese kleine blonde Frau mit dem hübschen, nichtssagenden Gesichtchen die Stärkere. Sie soll Millionen in die Ehe gebracht haben. Wo aber geht das Geld in den Händen dieser Frau hin, die es sich nicht einfallen läßt, ihre Rechnungen zu bezahlen, überhaupt etwas zu bezahlen. Von meinem Gehalt habe ich noch nichts gesehen, dagegen muß ich ihr bei Ausfahrten oder bei Stadtgängen bei jeder Gelegenheit aus meiner kleinen Barschaft aushelfen. Das vergißt sie natürlich. Ich habe mir deshalb eine Liste angelegt mit meinem Soll und Haben, durchaus gesonnen, dieser Millionärin keinen Kreuzer zu schenken.
Man muß, um in das Speisezimmer zu gelangen, durch einen kleinen Salon gehen, in dem die Familienbilder hängen. Meine angeborene Pünktlichkeit erlaubt mir, mich gelegentlich hier aufzuhalten und umzusehen, wie denn Porträts für mich von jeher das größte Interesse hatten.
Es hängt hier das lebensgroße Bildnis der Mutter der Gnädigen. In strotzendem, schwarzem Seidenkleid, eine dicke, goldene Kette um den Hals, macht sie trotz des Aufputzes einen durchaus bürgerlich gediegenen Eindruck. Sie war die Frau eines Mannes, der seine Millionen erst verdiente, und hat ihm sicherlich[189] brav und tüchtig als gewissenhafte Hausfrau zur Seite gestanden. So sieht sie aus. Im übrigen ist das Gesicht ganz leer, hübsche, kleine Züge, gute Farben. Aber kein Lachfältchen weit und breit, nicht die Spur irgendeines tieferen Eindrucks. Weder gut noch bös, möchte man als Motto unter dies Bild schreiben.
Derselbe Maler hat die Tochter als Braut gemalt, an der Seite des Bräutigams; ein großes, schönes Bild. Beide sehr jung, allzu jung, er groß, kräftig, mit klugen, zuversichtlichen, ein wenig trotzigen Augen, ein ganzer Mann, an den sich ein holdseliges Weibchen lehnt mit schmachtendem Blick, ganz die Mutter, fein, nichtssagend, die Wangen rosig; nur ist der Mund nicht weich wie bei jener, sondern schmal, eigensinnig.
Was hat sich dieser Mann, der auf seinem Jugendbild so zukunftssicher in die Welt schaut, mit dieser Millionenheirat angetan! Er tut mir in der Seele leid, denn ich sehe, welche Not er hat, in der grenzenlosen Unordnung seines Hauses nicht unterzugehen. Seine Tüchtigkeit, sein Verstand berechtigen ihn zu einer glänzenden Karriere. Er soll ein schneidiger Jurist sein. Zu Hause ist er verdrossen, von einer nicht zu beschreibenden Ungeduld. Die beiden Mädchen fürchten ihn; der Sohn, ein Tunichtgut, ist auf dem Land bei einem Pfarrer.
Die Gnädige erzählte mir, daß der Vater den armen Gustel oft halb tot geschlagen habe.
»Aber,« setzte sie listig hinzu, »es wird schon gesorgt, daß mein Bub nicht Not leidet, nur darf's mein Mann nicht wissen.« –
Wie soll man sich das Innere eines solchen Wesens vorstellen – sie liebt ihren Mann und betrügt ihn zugleich. Sie ist von einer fanatischen Eifersucht, lädt nur ältere oder häßliche Frauen ein und duldet keinen hübschen Dienstboten im Haus. Ich kann nicht sagen, wie viele Magdgesichter ich in diesem einen Jahr meines Hierseins schon habe auftauchen und wieder verschwinden sehen.
»Es ist immer mein Mann«, sagte die Gnädige mit einem Achselzucken.
Nun ja, er kommt in die Küche geschossen:
»Liederliches Pack, kein Hemd gebügelt, keine Kragen, keine Manschetten – wozu seid ihr da – marsch, hinaus.«
Mit Fragen gibt er sich nicht ab, wohl aus Angst, zu erfahren, daß nicht an den Mädchen, daß an der Frau die Schuld lag, wenn nicht geschah, was geschehen sollte.
Aus Mitleid mit dem armen Mann nehme ich mich des Haushaltes an, bin dadurch aber nicht wenig[191] angestrengt, daher die lange Pause seit meinem letzten Brief. Ich kann auch diesen nur in Absätzen schreiben.
Ich wagte einmal eine kleine Anspielung, ob nicht etwas mehr Ordnung auch mehr Zufriedenheit zur Folge haben würde, und schlug eine Wirtschafterin vor.
»Eine solche Person,« schrie die Gnädige auf, »die mich in der ganzen Stadt verschwätzt.«
Ich fragte: »Glauben Sie, daß das die Dienstmädchen nicht auch tun?«
»Er ist ja gleich wieder zufrieden, wenn ein gutes Essen auf den Tisch kommt«, war ihre Antwort.
Das Essen wird aus dem gegenüberliegenden Hotel geschickt. Es sind oft Gäste da; die Gnädige sitzt dann sehr hübsch gekleidet oben am Tisch; die beiden Mädchen dürfen nie anders als in weißen Kleidern erscheinen. Ein Kellner serviert, es fehlt an nichts, und jeder hat den Eindruck, als sei hier die glücklichste Familie beisammen.
Die Gäste sind meist Beamte und Offiziere mit ihren Frauen. Von den älteren Herren wird entsetzlich umständlich politisiert, wobei mein demokratisches Herz wahre Folterqualen aussteht, besonders wenn es sich um unsere so schwer mißverstandenen Freiheitsmänner Rotteck und Welcker handelt.
Die Offiziere sind fast alle frisch und lebendig, und[192] ich bin immer froh, wenn ihr leichtes Geplauder den Sieg über die Philister davonträgt.
Von den Büchern ist nie die Rede, und daran merke ich so recht, wie groß der Vorzug ist, in einer Universitätsstadt zu leben.
Was ich durch den Umgang mit wirklich bedeutenden Männern und durch die Lektüre wertvoller Werke von zu Hause mitbekommen, das liegt jetzt unbegehrt im tiefsten Innern meines Herzens, und ich habe nur Muße, in den Nachtstunden dieser reichen Zeiten zu gedenken.
Ich muß über mich lächeln, wie ich mich im Anfang bemühte, die jungen, mir anvertrauten Gemüter in die Welt einzuführen, in der wir uns einstens so glücklich gefühlt.
»Fräulein Villinger,« unterbrach mich Elli mit einem überlegenen Lächeln, »wir sind doch keine Kinder mehr.«
Sie ist zehn Jahre alt, die Kleine acht.
So gibt es fortan kein Appellieren an das Gemüt meiner Schülerinnen, wenn ich nicht durch Ellis naseweise Bemerkungen aufs trockene gesetzt werden will.
Die abscheuliche Resignation, die mich zuweilen überkommt, ist noch das Schlimmste von allem. Erzähle mir von Deinen Kindern, Caton, von ihren Fortschritten in der Schule, und sage mir, ob es Dir[193] gelingt, sie in der alten, schlichten und wahrhaften Art unseres Elternhauses zu erziehen. Gott helfe Euch!
Deine Anna.
Halt – noch eins. Es wird Dich interessieren, Monz ist seit einem Jahr in Rom. Seine Frau ist eine Karlsruherin. Lotte kennt sie gut.
St., den 3. März 38.
Liebe Caton!
Eigentlich sollte ich Dir zürnen, daß Du Vater mit dem Inhalt meines letzten Briefes bekannt gemacht. Nun seid ihr alle so gut und freundlich, d. h. weniger streng verständlich als wohltuend herzlich, indem ihr wünscht und mir ratet, daß ich das Glück des Daheimlebens nicht um so geringen Preis dahingeben soll, ja, mich dessen solang' als möglich nicht begeben solle. Wie schön und angenehm für mich, wenn ich diesem Wunsche nachkommen könnte. Wenn dann aber einmal die Notwendigkeit zu verdienen an mich herantritt, könnte alsdann das verblichene Wissen so bald aufgefrischt werden, und wo fände ich gleich den Jemand, der mir, wie man sagt, etwas Passendes auf dem Präsentierteller brächte?
Zudem, liebe Caton, irrst Du Dich sehr, wenn Du[194] glaubst, daß Vaters Pension von 800 Fl. für eine kleine Familie ein gemächliches Auskommen sei, und daß ja früher die selige Mutter und Du und wir alle im elterlichen Hause nichts von Mangel gespürt. Du hast doch wohl die Plagen und Opfer unserer guten Eltern nicht vergessen, um mit dem mühsam gewonnenen Miet- und Kostgeld dem Haushalt aufzuhelfen? Zudem war damals gegen jetzt noch eine wohlfeile Zeit. Hauszins, Holz- und Mundvorräte haben sich um die Hälfte verteuert. Urteile, ob es bei den obwaltenden Umständen nicht vernünftig von mir ist, durch meine Entfernung dem guten Vater nicht nur ein wenig sparen zu helfen, sondern mir selbst womöglich einen Sparpfennig zu erübrigen für die Tage, da man nicht mehr wirken kann.
Nicht minder sorgenvoll sehe ich Theresens Zukunft entgegen.
Therese hätte das schöne Los zuteil werden können, die Gattin des gediegenen, älteren Mannes zu werden, den wir als lieben Gast so oft in unserm Haus gesehen und geschätzt haben. Was aber soll aus Vater werden, kränklich und hilfsbedürftig, wie er jetzt ist? Unsere Therese hat keinen Augenblick geschwankt, wo ihr Platz ist. Wenn aber einmal ein trauriges Verhängnis sie aus diesem kindlichen Pflichtenkreis herausreißen sollte, dann muß ich imstande sein[195] können, ihr eine Heimat zu bieten, ihr, die mehr als wir alle an unsern Eltern getan.
Gutmütig, aber höchst unvernünftig ist Dein zweiter Vorschlag, ich möchte, wenn nicht zum Vater, so doch zu Dir kommen. Ach, Caton, Du bist und bleibst halt unser unpraktisches Catonele, das man liebt und über das man liebevoll lächelt. Du wirst mich eine Stolze schelten, wenn ich Dir sage, daß ich kein Tantenleben, sondern mein eigenes, selbständiges und arbeitsreiches Leben zu führen im Sinne habe. Und darum vorwärts! –
Es sind mir inzwischen nicht weniger als drei Stellen angeboten worden durch vermittelnde Bekannte in Freiburg. Ich habe mich für Baron Ö… in J…heim entschlossen, des Landlebens wegen. Ein Töchterchen und zwei noch kleine Knaben. Eine Schule gibt es nicht, so ist das Unterrichten ganz mir anheimgegeben, was mir sehr lieb ist. Das Gehalt ist das größte, das ich bisher bekommen; mein Zimmer soll nichts zu wünschen übriglassen. Auf Schattenseiten bin ich gründlich gefaßt; schlimmer als hier kann ich es ja wohl kaum wo anders treffen. Ging doch meine halbe Gesundheit in dieser Unordnung und beständigen Hetzerei zugrunde. Da die Gnädige von meiner Kündigung durchaus nichts wissen wollte, sondern mich einfach auslachte (wart', ich will dir[196] zeigen, daß du mit mir nicht auch machen kannst, was du willst), habe ich eine Stunde ihrer Abwesenheit benutzt, um den Herrn in seinem Zimmer aufzusuchen.
Er nickte: »Begreife, daß man nicht auf einem lecken Schiff bleiben mag«, meinte er, nachdem ich mein Anliegen vorgebracht.
Ich legte ihm sodann meine Liste vor, mit dem Verzeichnis meines Soll und Haben.
Er wurde dunkelrot: »Das hätten Sie mir längst sagen sollen.«
Er tat mir leid, ich sagte schnell: »Wollen Sie, bitte, mit der gnädigen Frau sprechen. Ich habe mich bereits engagiert und muß den ersten April an meinem Bestimmungsort eintreffen. Drei Reisetage sind erforderlich.«
»Natürlich«, sagte er, sich verneigend.
Ich bin nun, nachdem ich mein Gehalt in den Händen habe, in der Lage, meiner Toilette etwas aufhelfen zu können, denn da ich auf mein Gehalt gerechnet, hatte ich nur das Nötigste von zu Hause mitgenommen. O Caton, das allerschwierigste auf der Welt ist doch, Menschen dienen zu müssen, vor denen man keinen Funken Respekt haben kann. Ich weiß ja, ich habe es ja nun erfahren, daß nicht alle Eltern wie die unsrigen sind. Damit muß man rechnen und nicht, wie ich's im Anfang meiner Gouvernantenlaufbahn[197] tat, von allen Menschen verlangen, daß ihr Denken und Handeln so sei, wie wir's von zu Hause gewohnt sind. Ich muß jetzt lachen, daß ich einmal solches wähnte. Es wär' ja auch gar nicht in der Ordnung, da Mannigfaltigkeit in der Welt sein muß. Es gehört halt nur viel Weisheit dazu, um sich das klarzumachen, statt zu verzweifeln.
Nun haben wir schon den 26., und der arme Mann hat noch immer nicht den Mut gefunden, mit seiner Frau über mein Fortgehen zu sprechen. Ich habe ihn heute gemahnt. Er nickte wieder: »Natürlich.« –
Ich glaube aber nicht mehr an dieses »natürlich« und habe nun folgenden Entschluß gefaßt: Ich gehe unwiderruflich den 27., und wenn es heimlich geschehen müßte. Ich werde dann einen Brief hinterlassen, in dem ich dartue, daß meine Kündigung regelrecht erfolgt sei, ich aber aus dem Gebaren der gnädigen Frau schließen müsse, daß ich damit ihre Unzufriedenheit erregt und sie es darum wohl lieber sehe, ich gehe, ohne durch ein Abschiednehmen zu stören. Mag er dann sehen, wie er mit seiner Frau fertig wird, der Held. –
Den 26ten.
Mein Koffer ist gepackt. Ich war an der Post, habe mir einen Platz genommen – diesmal den etwas teurern vornen beim Postillion, weil ich nichts wünsche als Ruhe und Stille nach dieser letzten Zeit innerer Aufregung und peinlicher Unentschlossenheit.
Der Hausknecht wird morgens halb sieben den Koffer abholen. Ich öffne das Tor. Es ist um diese Zeit noch niemand wach im Haus.
Ich nehme diesen Brief mit, um Dir an der ersten Station das weitere zu berichten. Ich bin sehr in Angst. Dieses heimliche Auf- und Davongehen wird mir nicht leicht. Gestern und heute versuchte ich vergebens, mit dem Herrn zu sprechen. Er weicht mir aus. Die Gnädige hatte wieder nur ein Lachen, als ich ihr mein Gehen plausibel zu machen suchte. Nun, zum Kuckuck, wollen sie nicht hören, so sollen sie's fühlen.
Ich schreibe dies in der Nacht; ich kann nicht schlafen. Eine Kerze brennt. Aus dem Spiegel gegenüber sieht mir ein blasses, verhärmtes Gesicht entgegen. O Mutter – weißt Du, ich denke gar nichts andres als immer nur: o Mutter, Mutter.
U…, den 28ten, früh morgens.
Gestern fiel ich nur so ins Bett, aber ich schlief die ganze Nacht, und das hat gut getan. Es ist also alles geschehen, wie ich's vorhatte. Der Hausknecht kam, und ich lief hinter ihm her durch die noch stillen Straßen. Es war ein schrecklicher Weg – Gewissensbisse, ob ich recht tat, die Furcht: Was wird die Zukunft bringen?
Im Posthause trank ich Kaffee, setzte mich neben den Postillion, und fort ging's unter lustigem Blasen. Als ich die Stadt hinter mir hatte, hätte ich gern geweint vor Erleichterung, aber ich schämte mich ein wenig vor dem jungen Burschen neben mir und schenkte ihm lieber einen Sechser, damit er sich eine gute Zigarre kaufe. Ich drückte mich in meine Ecke, schlief viel und sah wenig von der Welt. Dachte wohl auch der Zeit, als ich zum erstenmal mit so lebhaftem Interesse in der Postkutsche davonfuhr und mich jedes Menschenkind interessierte. Wie müde hat mich meine kurze Gouvernantenlaufbahn schon gemacht!
Also nun geht's ins Bayerische, gleich an der württembergischen Grenze. Ich werde dann nach meiner Ankunft Vater schreiben und, wie mein neuer Aufenthalt auch ausfallen mag, nur solches berichten, was unsern guten Vater über mein Schicksal beruhigen kann.
Dir, liebe Caton, schreibe ich dann erst, wenn ich das, was mich erwartet, ruhigen Gemüts zu beurteilen vermag.
So leb' denn wohl, meine gute Caton, grüß Deinen lieben Mann und küß mir Deine Büble.
Deine Anna.
J… (Bayern), 29. April 1838.
Meine liebe Schwester!
Eure herzliche Teilnahme an meinem Geschicke hat mich innig gerührt: ich wußte es wohl, daß mir solche, mit dem besten Rat verbunden, von Euch werden würde, weshalb ich mich ja auch so offen gegen Euch abgesprochen. Aber nun, Gott sei Dank, kann ich diesmal bei weitem Angenehmeres berichten als bisher. Ja, wahrhaftig, ich atme, ich lebe auf, denn ich hätte mir eine erfreulichere Herrschaft kaum auszudenken vermocht. Der Baron, schön, heiter, ist geradezu mit Talenten gesegnet. Er hat eine prachtvolle Stimme, und seinem Gesang und seinem Klavierspiel zu lauschen, ist ein großer Genuß. Es ist auch ein Genuß, ihn auf dem Pferde sitzen zu sehen. Der eleganteste Reiter, aber sein Aussehen kümmert ihn nicht im geringsten. Er trägt einen dunkelgrünen Jagdkittel, Kniehosen, graue Strümpfe, auf dem Kopf eine[201] zerknitterte Mütze mit einem verschossenen, grünen Band. Eine Anzahl Jagdhunde begleiten ihn, wo er steht und geht. Er regiert sie mit einem Blick. Im Park macht er sich an den Bäumen zu schaffen, die ihm so lieb sind wie seine Hunde. Zuweilen auch galoppieren zwei, drei Pferde ohne Sattelzeug um ihn herum, und man hört ihn mit ihnen sprechen wie mit einem Menschen.
Im großen Saal, dessen Laden gewöhnlich geschlossen sind, und dessen gelbdamastene Kanapees und Lehnstühle unter weißen Houssen stecken, hängen die von der Hand des Barons gemalten Familienbilder. Ich weiß natürlich nicht, wie ein Künstler von Beruf diese Porträts beurteilen würde; ich für meine Person finde sie erstaunlich und bei weitem hervorragender als die der Amalie von Berg. Wie er den Ausdruck, den Charakter trifft, bewundere ich am meisten. Geradezu ein Meisterstück ist das Bild seiner Tochter, meines Zöglings.
Ach, Caton, dieses Kind; wenn ich aufwache, wenn ich zu Bett gehe, immer liegt es mir wie ein Alp auf der Seele: Werde ich mit diesem unberechenbaren Geschöpf fertig werden oder nicht?
Sie ist jetzt zwölf Jahre alt. Als der Baron sie malte, war sie zehn. Elferl nennt er sie, und mit Recht; schlank wie ein Gertlein, den Kopf voll brauner[202] Locken, große, dunkle, leidenschaftliche Augen, der Mund trotzig. Wie eine kleine Elfe steht sie da, schon halb auf der Flucht ins Waldesdickicht, das den Hintergrund des Gemäldes bildet.
Das Bild der Baronin ist konventionell. Auf dem schweren, weißseidenen Kleid spielen helle und dunkle Lichter. Der Hals des schmalen, fast zu ernsten Gesichtes ist von einer feinen Spitzenkrause umschlossen. In schweren Flechten liegt das dunkle, leicht gekrauste Haar um ihren Kopf. Diese Frisur trägt sie immer. Sonst, wenn ich des Morgens meine Promenade mache, sehe ich die Baronin im kurzen Rock und hohen Reitstiefeln, auf dem Kopf ein Hutexemplar, nicht schöner als das des Gatten, und gleich ihm von einer Anzahl laut bellender Hunde gefolgt, das Haus verlassen. Einmal habe ich um Erlaubnis gebeten, sie begleiten zu dürfen. Etwas abseits, rechts vom Schlosse, liegen die Ökonomiegebäude. Langgestreckte Ställe in einem großen Hof, Wohnungen der Dienstleute, Obstgärten und Wiesen rings umher. Der Verwalter erwartet die Baronin am Parktor. Gleich dahinter ist das Forsthaus. Im ebenerdigen Raum, dessen Wände unzählige Hirschgeweihe zieren, nimmt die Baronin die Berichte ihrer Untergebenen entgegen. Sachlich, kurz, fast streng klingt ihre Rede. Die Leute stehen im tiefen Respekt vor ihr. Gleich unterbricht sie, wenn[203] deren Rede auch nur einen Schein von Unklarheit enthält. Große Rechenbücher liegen auf dem Tisch. Weiber, die Klage zu führen haben, werden vorgelassen. Die Baronin geht in die Häuser der Klagenden. Wehe diesen, wenn die Reinlichkeit zu wünschen übrig läßt, die Kinder schlecht gehalten sind. Ich war schon dabei, wenn neue Leute engagiert worden sind, Männer und Frauen; Fragen und Befehle der Baronin sind haarscharf, jeder weiß sofort, was er zu tun und zu unterlassen, wem er zu gehorchen hat. Der Baron ist bei solchen Anlässen nie gegenwärtig. Er malt, er reitet, befindet sich in seinem Park, in seinem Jagdrevier. Sie tut die Arbeit. Und was so wunderschön ist, keines beugt sich vor dem andern, ganz klar und wahr geben sie sich, verstehen sich und lächeln übereinander.
»Mama,« kann er zu ihr sagen, wenn sie von ihrem Morgengang zurückkommt, »du bist wohl wieder bei jeder Kuh im Stall gewesen, so sehen deine Stiefel aus.«
Und sie nickt und sagt: »Ja, Rudi, bei jeder Kuh.«
Auch ich genieße eine Freiheit, wie ich sie bisher nie gekannt. Komme ich von meinem Morgenspaziergang nach Hause, finde ich Punkt acht Uhr das Frühstück auf meinem Zimmer, das groß ist und luftig, und in dem ausrangierte, aber prachtvolle, uralte Möbel[204] stehen, Lehnstühle, in denen man förmlich ertrinkt, ein Schreibtisch, an den sich drei Menschen nebeneinandersetzen könnten, und der so viele Fächer und Schubladen hat, daß ich sie noch gar nicht gezählt habe. Ich bewohne eine Giebelstube, von der aus ich das ganze Anwesen so ziemlich übersehe: Im Schloßhof den Springbrunnen, die Hundezwinger und dahinter den prächtigen, wohlgepflegten Park. Durch eine Gittertür geht's in den Wald, der mächtig ansteigt; links davon kann ich das Dorf sehen. Mein Weg führt mich oft durchs Dorf, dessen Kirchlein inmitten des Friedhofes ein Turmdach hat wie eine Zwiebel. Das Pfarrhaus daneben, zweistöckig, ragt hoch über die niedrigen Bauernhäuschen. In dem unteren Stockwerk wohnen Schullehrers. Der Pfarrer mit der »Tant'« bewohnt das obere Stockwerk.
Die Lehrersfrau kommt immer schnell aus dem Haus gelaufen, wenn sie mich sieht, an den Füßen Holzschuhe, den Putzlumpen hält sie hinten am Rücken.
»I bitt,« redet sie mich an, »gelt', machens Hannerl recht schön gebüld – wissens, 's soll halt a so e Gouvernant'n werd'n wie Sie, so will's der Mann; o mei, ihm is halt d' Büldung so gar viel wert. I bin nit gebüld', aber er laßt mich's nie nit merk'n – i schaff halt, daß sie's gut hab'n, die zwei, nur halt ins Schloß kann i nit z'weg'n der Büldung.«
So ungefähr ist der Dialekt hierzulande, natürlich nur ungefähr.
Das Lehrerstöcherchen nimmt nämlich die französischen Stunden im Schloß mit, ein braves, schwerfälliges Kind, mit weit vom Kopf abstehenden Zöpfen und hochrotem Gesichtchen.
Der Lehrer, ein rührend bescheidenes, spindeldürres Männle, ist zuweilen des Sonntags mit dem Pfarrer und dessen »Tant'« zum Abendessen ins Schloß eingeladen. Stotternd entschuldigt er jedesmal seine Frau, sie könne halt wieder nicht kommen, sie habe 's Zahnweh.
Worauf des Pfarrers »Tant'«, de unbewußt laut zu denken pflegt, jedesmal sagt: »Die Zähn' sein's nit, 's ist der Anstand, den s' nit hat.«
Der Lehrer hört während des ganzen Essens nicht auf, sich für alle möglichen Wohltaten zu bedanken. Zuerst beim Baron, der ihn aber gleich unterbricht: »Schon gut, schon gut, was bilden Sie sich nicht alles wieder ein, ich bin ja ganz unschuldig.«
»Ach nein, nein, Herr Baron, das sein S' nie, nie«, ereifert sich der Lehrer, alsdann richtet er seine Danksagungen an die Baronin.
Zuletzt kommt's an mich, indem er mir mit feuchtschimmernden Augen immer von neuem versichert:[206] »Wissen S', was Sie für mein Hannerl tun, heilig möcht' ich Sie nennen, heilig!«
Inzwischen läßt sich's der Pfarrer prächtig schmecken, und sobald er den Teller füllt, seufzt die Tant': »O mei, schon wieder, und ich muß zuschaun und vertrag nix nit.«
Es wird von der Predigt gesprochen, die man am Morgen gehört, und die die Schloßherrschaft ungemein befriedigt hat. Auch der Lehrer bekommt sein Kompliment für Orgelspiel und Kindergesang während der heiligen Messe. Das Wohl und Weh der Dorfleute wird in Betracht gezogen, wo's dem einen fehlt, was dem andern nützlich wäre, die Gesundheit des kleinsten Kindes ist wichtig. Gleich sagt der Baron: »Ich hol' den Doktor.« Sie sind mir dann so lieb, denn ist es nicht ihr höchstes Bestreben, die Menschen, die von ihnen abhängen, glücklich zu machen?
Freilich, was sonst in der Welt vorgeht, davon ist nicht viel die Rede. Auch mit den Standesgenossen, die im Schloß verkehren, dreht sich die Unterhaltung meist um Alltägliches; zuweilen auch wird die Politik berührt, aber nur vorübergehend. Was ein gutes, herrliches Buch für die Welt bedeutet, davon scheint hier niemand eine Ahnung zu haben. Wenn ich gefragt würde, für was ich mich interessiere, was ich schon erlebt, ich könnte es ihnen gar nicht sagen; denn[207] mein Denken und Erleben und was ich an Begeisterung empfunden, kommt mir fast selbst überschwenglich vor in diesem eng umschlossenen, selbstsicheren Kreis.
Ach, einmal wieder unter meinesgleichen ich selbst sein dürfen – Caton, Caton, ob ich's erlebe? –
Und doch, wie anders lerne ich die Menschen kennen durch dieses intime Zusammenleben, als wenn ich nur von ihnen hörte. Wirklich, man sollte nicht so leichthin aburteilen, wenn es sich um Menschen andrer Kreise handelt. Wir wissen gar nichts, wenn wir nicht unter ihnen gelebt haben.
Wenn ich nur ein wenig mehr Freude an meinen Zöglingen haben könnte! Clothilde haßt jeden Zwang und will immer fertig sein. Hannerl ist nicht vom Fleck zu bringen, ehe sie nicht eine Sache kapiert hat. So muß ich immer nur vermitteln zwischen diesem so ganz und gar ungleichmäßigen Gespann.
Noch schlimmer ist's, wenn ich Clothilde allein habe. Ihre schönen, leuchtenden Augen werden, sobald die Rechenstunde beginnt, zu dunkel blitzenden Unsternen. Sie hört nicht, begreift nicht, will nicht begreifen.
Um meine Autorität als Lehrerin nicht zu verlieren,[208] halte ich an mich mit aller mir zu Gebote stehenden Macht, mit Sanftmut meine Lektion immer wieder von neuem wiederholend. Umsonst. Meine Versuche, an Clothildens Pflichtgefühl zu appellieren, scheitern ebenfalls. Es ist ein unglückseliger Zufall, daß, wenn Clothildens Mutter in den Lehrstunden erscheint, jene oft gerade ihren starrköpfigen Paroxismus hat. Dann fällt der Hauptfehler auf die Gouvernante, die keine Autorität zu behaupten, keinen Gehorsam einzuprägen weiß. Das Kind wird durch eine sinnliche Entbehrung gestraft, die Gouvernante aber hat die moralische Folter zu bestehen, ihrer Aufgabe nicht zu genügen.
Es war gerade nach einem solchen Vorfall eine Landpartie projektiert, wozu mich die Baronin einladen ließ.
Nach dem, was geschehen, hatte ich nicht die geringste Lust, daran teilzunehmen, und ließ danken. Auch sollte die Baronin wissen, daß ich nicht gleichgültig gegen ihren Tadel bin, daß ich zwar wie ein Stein schweigen könne, aber nicht selber einer sei.
Es klopfte an meine Tür, und der Baron kam mit Clothilde.
»Wissen Sie, Mama muß eben ein wenig zanken,« sagte er, »ich werde ja auch den ganzen Tag gezankt. Das macht doch nichts! Nun, was habe ich dir gesagt,[209] Elferl,« fuhr er in liebevollem Ton seine Tochter an, »wirst du gleich –« –
Sie reichte mir die Hand mit einem: »Bitte, verzeihen.«
Ich wollte nicht empfindlich erscheinen und beeilte mich, dem Drängen des Barons: »Schnell, schnell, machen Sie sich fertig« Folge zu leisten.
Die Fahrt ging durch Wälder und Dörfer. Überall lachte uns der Frühling entgegen, und seine zwingende Macht ließ mich bald alles vergessen, daß ich froh wurde wie ein Kind. Hatte ich doch den kleinen Rudi zur Seite, der sonst mit seinem jüngeren Brüderchen ganz der Fürsorge der Bonne anheimgegeben ist, die schon ein schiefes Gesicht schneidet, wenn ich mir nur ein Händchen von ihm geben lassen will. Er ist zart, und seine großen Augen quellen über in unendlicher Liebe für alles Lebende.
Immer wieder suchte sein Blick die laut kläffend hinter dem Wagen her eilenden Hunde. »I bitt, Papi, nicht so schnell,« bat er, »schau, wie sie laufen – das ist doch gewiß nicht gesund.« –
Der Baron lachte und fuhr langsamer.
Ein Wagen kam des Weges, hoch beladen mit Säcken. Ein magerer Gaul zog ihn müde einher.
»Zieht das Pferd gern so schwer?« erkundigte sich[210] Rudi. »Man muß es fragen. Halt an, Papi, ich steige schnell aus« –
Da der Baron weiterfuhr, vergoß Rudi bittere Tränen, wurde jedoch durch eine Schar barfüßiger Kinder schnell von seinem Schmerz abgelenkt. Die Kleinen knicksten vor der Herrschaft. Clothilde warf ihnen Backwerk zu. Rudi aber erkundigte sich voll Besorgnis: »Tun ihnen die Steine nicht weh am bloßen Fuß? Wir müssen ihnen Schuhe schenken, Papi.« –
Die Fahrt ging weiter, und ich suchte Rudi mit der Versicherung zu beruhigen, daß Barfußgehen ein Vergnügen für die Kinder sei.
»Wir wollen sie fragen«, sagte er etwas ungläubig.
Das geschah sofort, als wir vor einem Dorfwirtshaus ausstiegen. Kinder umstanden den Wagen, und Rudi ging auf das erste beste kleine Mädchen zu.
»I bitt, gehst du gern barfuß?« fragte er, dabei artig das Hütchen ziehend.
Über und über rot, nickte die Kleine lebhaft mit dem Kopf, auch die andern Kinder nickten lachend.
Da kam er selig auf mich zugelaufen: »Sie gehen gern barfuß.«
Das ganze Haus lief zusammen, um die Herrschaft[211] zu begrüßen, und da war niemand bis zur zahnlückigen Köchin, dem nicht ein liebenswürdiges Wort zuteil geworden wäre.
Der Pfarrer kam, der Lehrer und seine Familie; in kurzer Zeit war die ganze Wirtsstube voll Menschen, die alle zum Kaffee eingeladen wurden.
Ein sonderbarer Umstand drang mir eine schmerzliche Erinnerung an die selige Mutter auf. Der Wirtin, die das blau und rot gewürfelte Tuch über den langen Tisch ausbreitete, strahlte ein so herzliches Wohlwollen aus den braunen Augen, daß ich für einen kurzen Augenblick die Mutter vor mir zu sehen glaubte. Ich konnte mich nicht bemeistern und zog mich deshalb von der fröhlichen Gesellschaft unbemerkt in eine Fensternische zurück, wo ich weinen mußte. Ein lautes Aufschluchzen brachte mich in die Gegenwart zurück. Rudi hielt mich umfaßt. »Sie weint,« schrie er, »sie weint, kommt schnell, schnell und helft, daß sie nicht mehr weint.« –
Der Baron und die Baronin waren sofort an meiner Seite und fragten mich, was mir fehle. Ich gestand ihnen, um nicht mißdeutet zu werden, was mich betrübte; sie nahmen den herzlichsten Anteil, führten mich zum Tisch zurück, und ich gab mir alle Mühe, mein unstatthaftes Benehmen durch besondere Heiterkeit vergessen zu machen.
Die Baronin fragte mich, wie lange es her sei, daß ich Mutter verloren. Ich sagte ihr, daß es zwei und ein halbes Jahr sei, und ich weiß nicht, wie's kam, ich fing an, von Mutter zu reden. Wie lange habe ich das ersehnt, einmal von zu Hause reden zu dürfen, von unserm schönen Leben – unserer Heimat – o Caton, gibt es eine schönere – von der Herzlichkeit zwischen Eltern und Kindern – wie wir arbeiteten und doch wieder Zeit hatten zu allen möglichen herzerquickenden Zerstreuungen – von unserm Verkehr mit den Professoren der Universität – und wie eben immer und überall die Mutter den Mittelpunkt bildete, und nicht nur die Eigenen, auch alle, die ins Haus kamen, an diesem warmen, menschenfreundlichen Herzen eine Heimat fanden.
Da fiel mir ein – hast du nicht zu viel gesprochen? Der Pfarrer und der Lehrer schauten mich wohl alle gütig und voll Verständnis an, aber die Baronin – bei ihrem Anblick erfaßte mich plötzlich ein Gefühl der Beschämung.
Daß ich doch immer noch nicht hinlänglich genug Lebensweisheit besitze und gleich bereit bin, mich durch ein freundliches Wort, einen freundlichen Blick zu allzu großem Vertrauen hinreißen zu lassen.
In diesem Augenblick ging die Tür auf, und ein großgewachsener, gebietend blickender Herr trat über[213] die Schwelle. Er wurde vom Baron mit dem Ausruf: »Was, Graf, Sie sind wieder hier?« begrüßt.
Dem Grafen war ein ungemein langer und schmaler Jüngling gefolgt, dem Arme und Beine wie lose am Körper zu hängen schienen, so daß ich Mühe hatte, nicht zu lachen, als Clothilde ausrief: »Da kommt der Hampelmann!«
Es wurde nun ganz anders. Der Graf vertiefte sich, ohne von der übrigen Tischgesellschaft Notiz zu nehmen, mit dem Baron und der Baronin in ein Gespräch über Pferde. Der Pfarrer und der Schullehrer verabschiedeten sich unter linkischen Verbeugungen. Ich selbst kam mir nicht weniger überflüssig vor. Sonderbar – wehe uns Bürgerlichen, wenn es uns am richtigen Benehmen den Adligen gegenüber gebricht. Aber wissen diese sich uns gegenüber immer richtig zu benehmen?
Später.
Du siehst, liebe Caton, es fehlt mir nicht an Zeit zum Schreiben. Ich habe hier nicht, wie in meiner letzten Stelle, mich neben der Erziehung der Kinder um einen unordentlichen Haushalt zu kümmern, und bin nicht, wie in Nancy auf Schritt und Tritt an meinen Zögling gekettet. Clothilde eilt nach ihren Lehrstunden[214] mit ihren vierfüßigen Freunden in den Park oder reitet mit den Eltern aus. Sie setzen dann nacheinander mit ihren herrlichen Pferden über das Parktor weg, das laut kläffende Hundevolk hinterher. Ein ganz herrlicher Anblick.
Ich wollte Dir aber noch von einem merkwürdigen Erlebnis am Schluß jenes Ausfluges erzählen.
Ich hatte die Wirtsstube mit Clothilde verlassen, als uns der junge Graf nachkam.
»Noch so ungnädig?« fragte er.
»Immer und ewig«, gab ihm Clothilde zurück und lief wie der Blitz in den Wald hinein.
Der junge Mann wandte sich mit einem Lächeln an mich: »Lassen wir den Wildfang laufen, wir wollen uns ein wenig unterhalten. Wissen Sie, die Jugend hat eigentlich gar keinen Reiz für mich. Ernste Frauen sind mir lieber. Ich möchte sehr gern lange und ernst mit Ihnen – zum Beispiel über die Liebe sprechen.«
Ich nahm mich sehr zusammen, um so ernsthaft wie möglich zu antworten: »Sie sind sehr liebenswürdig, Herr Graf, vielleicht ein anderes Mal, jetzt ruft mich die Pflicht« – ließ ihn stehen und eilte in den Wald hinein, nach meinem Zögling rufend.
Ich fand ihn lange nicht, endlich machte mich ein[215] Kichern aufsehen. Clothilde saß auf einem Baumzweig, sich lachend darauf hin und her schaukelnd.
»Wenn er bricht«, schrie ich auf.
»Dann bin ich um so schneller unten.«
Es tat einen Krach – mehr fliegend als fallend stand sie im nächsten Augenblick triumphierend vor mir.
Es war gut abgelaufen; ich tat ihr nicht den Gefallen, ihr meine Angst zu zeigen, sondern wendete mich von ihr ab, um weiterzugehen.
Sie hielt mich plötzlich fest: »Fräulein Villinger, würden Sie einen Hampelmann heiraten?«
Ihre Augen glühten, sie sah mich wie gewissenerforschend an.
Ich hielt ruhig stand: »Wie kommst du auf diese Frage?«
»Weil ich ihn heiraten soll«, sprach sie in hartem Ton.
Ich zog ihre Hand in meinen Arm, und wir gingen nebeneinander her im leise rauschenden Wald; die Vögel sangen von allen Zweigen.
»Horch, wie schön,« sagte ich, »mein Gott, Kind, was geht dich denn jetzt schon das Heiraten an – so genieße es doch, daß du noch ein Kind sein darfst – oh, wenn ich's nur für eine Stunde wieder sein dürfte, wie wollte ich mich freuen.«
Eine Weile war es still, dann stieß Clothilde in heißem Zorn hervor: »Aber die Gouvernante, die vor Ihnen da war, hat es mir doch gesagt.«
»Was hat sie dir gesagt?« drang ich in sie.
»Daß es die Eltern ausgemacht, ich müsse den Hampelmann heiraten, den ekelhaften.«
»Woher wollte sie das wissen, Kind?«
»Sie hat gelauscht.«
»Großer Gott«, fuhr es mir durch den Kopf.
Ich hatte bisher immer nur das Los der Erzieherinnen bedauert. In diesem Augenblick wurde mir klar: Wem vertrauen die Eltern ihre Kinder oft an?
Clothilde gegenüber nahm ich die Sache leicht. Bei ihr muß jeder Gemütston vermieden werden.
»Hast du nie von Menschen gehört, die sich allerlei einbilden und schließlich meinen, es sei wahr?« fragte ich sie. »Denn niemals glaube ich, daß deine Eltern so etwas untereinander ausgemacht. Da kenne ich sie besser. Oder es könnte auch sein,« setzte ich hinzu, »frage dich einmal, mein Kind, hast du jene Gouvernante vielleicht in der Rechenstunde auch so gequält wie mich?«
Sie gab keine Antwort.
»Nun, dann hat sie sich am Ende ein wenig rächen wollen, weil sie merkte, daß du den Hampelmann nicht magst.«
Ob sie meinen Worten Glauben schenkte, war an nichts zu ersehen, aber ich nahm mir vor, mit den Eltern über diese Angelegenheit zu reden.
Nach dem Abendessen, wenn Clothilde gute Nacht gesagt, halten mich die Eltern zum Plaudern zurück. Besonders der Baron. »Erzählen Sie uns doch etwas, Fräulein Villinger; ich könnt' Ihnen den ganzen Tag zuhören«, behauptet er. Dann kommt regelmäßig das Erziehungsthema aufs Tapet. Hier gehen die Eltern ganz und gar aneinander. Die Baronin meint, durch Autorität, Sanftmut und Konsequenz müsse Clothildens leidenschaftliches Temperament schließlich der besseren Einsicht weichen. Der Baron zuckt die Achseln.
»Das Mädel ist nächstens dreizehn – hat deine Methode bisher etwas genützt, nachdem sie zehn Gouvernanten gehabt, die alle nach deinem Rezept handelten? Ich bin für die Reitpeitsche. Meine Pferde, meine Hunde, alle haben sie einmal gekostet, aber dies eine Mal half's.«
»Geh, damit ist dir's doch gar nicht Ernst,« sagte die Baronin, »dein Elferl und die Reitpeitsche.«
»Bin ich vielleicht ein schwacher Vater?« brauste er auf.
Wir lachten beide.
»So,« ereiferte sich der Baron, »aber in der[218] Klavierstunde nehme ich mir die Freiheit und werfe ihr die Noten an den Kopf – o diese Klavierstunden!« Er fuhr sich in die Haare.
»Ihr habt beide keinen Funken Geduld,« sagte die Baronin, »aber immerhin solltest du mit gutem Beispiel vorangehen, Rudi.«
»Fällt mir gar nicht ein,« erklärte er, »Fräulein Villinger hat eine Engelsgeduld, was hilft's. Gar nichts hilft's.«
Ich fand den Augenblick günstig, den Eltern mein Erlebnis mit Clothilde bezüglich des Hampelmanns mitzuteilen.
»Natürlich soll sie ihn heiraten«, sagte der Baron.
»Aber es ist mir sehr fatal, daß sie davon weiß«, sagte die Baronin.
»Werden wir machen«, beruhigte sie der Baron, »soll ihr gründlich ausgetrieben werden, verlaß dich auf mich.«
Andern Tags, bei Tisch, kam die Sache gleich zum Austrag. »Ja, nun geht der Hampelmann nach München zum Militär,« sagte der Baron, »wo er Arme und Beine hübsch eingerenkt bekommt. Paßt auf, was das für ein schmucker Kerl wird – ob er dann nicht Glück bei der schönen Irmgard hat, famoses Mädel, er liebt sie heiß.«
»Er liebt sie?« erkundigte sich Clothilde. »Ist's wirklich wahr?«
»Heiß, Elferl,« nickte der Baron, »brennend heiß.«
»Herrlich,« rief sie aus, »o Papi, ich möchte am liebsten gleich um den Tisch herum tanzen.«
»Tanz, mein Elferl, ist sehr nett von dir, soviel Anteil an ihm zu nehmen.«
Sie lachte vor sich hin und blieb sitzen.
Mir kommt es oft vor, als habe sie das Zeug in sich zu irgendeiner Ausnahmestellung in der Welt. Sie wird schön, ist musikalisch wie ihr Vater; von ihrer Stimme, die jetzt hell und zart ist, sagt er, daß sie herrlich werden wird. Dazu diese Grazie, dieser Mut, diese Kraft und Entschlossenheit. – Neulich auf der Landstraße fiel ein großer, schwerfälliger Metzgerhund über die beiden aneinandergeketteten Windhunde her, die Clothilde auf Schritt und Tritt begleiten. Sie kamen zu Fall, der Hund hielt sie mit beiden Tatzen fest. Ich wollte mit meinem Schirm herbeieilen – zu spät. Schon hatte sich Clothilde über die Tiere gebeugt, und zu meinem großen Erstaunen gab schon im nächsten Augenblick der Unhold die Windspiele frei und torkelte davon.
Ich fragte, was sie ihm denn getan habe.
»Die Kehle zusammengedrückt«, erwiderte sie.
In den Lehrstunden leider nach wie vor der alte Starrkopf.
Man soll's halt nicht zu gut haben in diesem Leben.
J…, den 12. Dez. 1838.
Meine liebe Caton!
So haben wir kein Elternhaus mehr. Therese sagt, daß sich Vater ohne Unterlaß nach Mutter gesehnt und seine letzte Lebenszeit für ihn keine leichte gewesen sei. Wohl ihm, daß er erlöst ist – für uns – welch ein Verlust. Du mußt nicht sagen, daß Du von allen Kindern den Eltern am wenigsten habest sein können. Das ist nicht wahr, Caton. Sie labten sich an Deinem Glück und freuten sich alle Tage ihrer Enkel, wenn auch nur aus der Ferne. Nein, lasse Dir Deinen Schmerz nicht durch Gewissensbisse verkümmern. Das ist ja so unwesentlich jetzt, ob Du etwas mehr oder weniger geschrieben hast. Das rechnen Dir unsere lieben, gütigen Eltern im Jenseits ganz gewiß nicht an. Sie wollen nicht, daß wir verzweifeln, sondern in treuem, dankbarem Gedenken an sie unser Tagewerk mutig weiter tun.
Ja, das ist gut sagen; erst jetzt, fast vier Wochen nach unseres guten Vaters Tod, bin ich einigermaßen[221] imstande, meinen Pflichten wieder Aufmerksamkeit zu schenken. Bisher tat ich, was ich mußte, ohne selbst irgendwelchen Anteil daran zu nehmen. Da fiel mir einmal in der Nacht ein, welch schlimme Folgen jener teilnahmlose Zustand damals nach Mutters Tod für meinen Beruf hatte, und daß ich gewiß viel vernachlässigte, was nicht wieder gutzumachen war. Denn hätte ich meinen Zöglingen Liebe statt Gleichgültigkeit geschenkt, wer weiß, ob nicht vieles besser geworden wäre. Die Kinder waren nicht böse, nur sehr verwöhnt.
So habe ich mich denn aufgerafft und bitte Dich, meinen verzweifelten Brief nach Vaters Tod nicht aufzubewahren wie die andern, sondern der Vernichtung preiszugeben.
Ich bin ja auch nun über Theresens Los beruhigter, seit ich weiß, wie liebevoll Freunde und Verwandte sich ihrer angenommen. Unsere Therese hat förmlich das Geriß. Frau von Schönau, Baurittels, Fromherzens, alle boten ihr eine Heimat an. Daß Therese vorzog, beim Onkel in Säckingen ihre Zuflucht zu suchen, ist mir eine ganz besondere Erleichterung. Die Stiftsmüllerin ist leidend und Burgele kaum imstande, mit der Pflege und dem großen Haushalt allein fertig zu werden. Da ist Therese recht am Platz, und ihrer vornehmen Seele wird das Bewußtsein,[222] mehr zu geben als zu empfangen, eine stille Genugtuung sein.
Daß Hermann nun sein Auskommen hat als Referendär in Waldkirch, ist auch ein Lichtstrahl. So wollen wir denn zufrieden sein und dankbar. Das Leben geht weiter, und wir müssen mit …
Ich will diesen Brief nicht abschicken, ohne noch eine liebe kleine Episode mitzuteilen, weil ich weiß, daß ich Dir damit eine Freude mache. Das Erscheinen des kleinen Rudi des Morgens im Hof ist nämlich ein Ereignis fürs ganze Haus. Sofort sind alle Mägde an den Küchenfenstern, sobald Rudis helles Stimmchen ertönt. Niemand kümmert sich um den dicken, kleinen Günther auf dem Arm der Bonne, Rudi ist der erkorene Liebling aller. Die Hunde stürmen ihm entgegen und werfen ihn auch gewöhnlich um.
»Ihr Sakra«, schreit der große Stallknecht und eilt herbei.
»I bitt, nicht schlagen, Sixtl,« fleht ihn Rudi an, »schau, sie können nichts dafür. Und gelt, Sixtl, i bitt, heb mich zur Köchin hinauf, ich muß ihr ein Handerl geben.«
Bis zur letzten Küchemagd, alle kriegen eines, und sie jubeln dem Kleinen zu, den der Sixtl hoch hält, und die Hunde streben an ihm hinauf, die[223] Eltern stehen am Fenster, Clothilde und ich, und es ist ein Rufen, Winken, die Bonne will ihn weiter zerren, er fleht: »I bitt, laß mich allen guten Morgen sagen« und wirft Kußhändchen nach rechts und links. Und plötzlich steht der Baron unten und nimmt ihn auf den Arm und küßt und herzt ihn und fängt an zu schelten:
»So ein dummer Bub das – immer ›i bitt, i bitt‹ – den Soldat möcht ich sehen, den der Rudi abgibt. Was wird er zum Pferdl sagen: i bitt, i bitt. Wird's Pferdel gehorchen? 's wird grasen und geht nicht vom Fleck, 's wird denken, du bittst mir lang, ich lach dich aus. – So einen dummen Buben hab ich.«
Und der Rudi drückt das Köpfchen gegen die Wange des Vaters und lacht und lacht und weiß recht wohl, wie's gemeint ist.
Ich wäre längst zu dem Resultat gekommen, Clothilde habe kein Herz, wenn dieses Kind nicht wäre. Aber mit Rudi kennt sie keinen Stolz, keinen Trotz, nur zärtliche, über alle Begriffe demütige Liebe.
10. Januar 40.
Tage des Schreckens liegen hinter uns. Rudi fing an zu husten: man brachte ihn zu Bett. Er bekam einen Kruppanfall, und der Baron fuhr schleunigst[224] fort, um den Arzt zu holen. Ich nahm den kleinen Günther zu mir aufs Zimmer, um ihn vor Ansteckung zu bewahren. Die Baronin wich nicht von Rudis Bett.
Die Bonne lief schluchzend von einem Kind zum andern.
»Er wird ersticken, er wird ersticken,« jammerte sie, »wenn der Arzt nicht gleich kommt.«
Er kam. Alles war unten mit Rudi beschäftigt, ich allein bei dem Kleinen. Noch eben schien er mir gesund. Da mit einem Male schüttelte sich das Kind wie im Fieberfrost, und ein schrecklicher Husten, rauh, bellend, drang ihm aus der Kehle. Dann ein mühsames Atemholen, das Gesichtchen wurde dunkelrot, die Händchen klammerten sich an mir fest.
Was tun – o Caton, es war entsetzlich – ich läutete, es kam niemand, ich wußte nicht, sollte ich das Kind allein lassen. – Der Glockenzug blieb mir in der Hand, als ich wiederum und allzu heftig daran zog, der Husten setzte von neuem ein, das Gesicht des Kindes färbte sich blau, es rang nach Luft. Auf mein Geschrei kam endlich die Bonne. Geisterbleich starrte sie auf das Kind. Ich stieß sie zur Türe hinaus. »Den Arzt – den Arzt!« –
Und nun tat ich etwas – gab mir's der Himmel ein – oder was war's – ich goß dem Kind das Öl des[225] Nachtlichtes in den röchelnden Mund. Erst ein Würgen, dann ein Schrei – und noch einer; nicht diese heiseren Töne mehr, die mich so erschreckt. Als der Arzt eintrat, schrie das Kind aus vollem Halse.
Er betrachtete den Kleinen, dann fragte er: »Was haben Sie getan?«
Ich sagte: »Er war am Ersticken, da goß ich ihm das Öl des Nachtlichtes in den Mund.«
»Das hat ihn gerettet.«
Aber es zeigte sich keine Freude. Der Baron und die Baronin standen, sich bei den Händen haltend, unter der Türe, bleich beide bis in die Lippen.
Draußen hörte ich Clothilde weinen, herzbrechend – »Rudi, Rudi« –
»Rudi«, tönte es durchs Haus.
Da wußte ich – er war nicht mehr.
J…, 14. Februar 1840.
Du hast mir wohlgetan, liebe Caton. Du tust immer wohl. Du hast so viel von der seligen Mutter. Ich bin fast ein wenig krank gewesen nach den tiefen Gemütsbewegungen in der letzten Zeit, da hat es mich recht erfrischt, als Deine kleine Predigt kam, mit[226] der Behauptung, daß ich meine Kräfte für eine schöne, erfreuliche Zukunft aufzubewahren habe und sie nicht ganz für Fremde hingeben dürfe. Aber mir sind die Menschen, mit denen ich lebe, liebe Caton, nicht fremd, trotz der großen Verschiedenheit unserer Lebensanschauungen. Darum sind sie doch liebenswert. Auch habe ich viel bei ihnen gelernt. Denn seitdem ich mich frei in der gegebenen Form zu bewegen weiß und den letzten Rest kindischer Ehrfurcht vor diesen Äußerlichkeiten abgestreift habe, bin ich viel freier und sicherer in meinem Auftreten. So wird das Errungene gewiß auch meiner ferneren Laufbahn zugute kommen. Ich fühle immer mehr, wie dankbar wir unseren Eltern zu sein haben für den Geist der Freiheit und Duldung, den sie uns anerzogen. Das ist die Hauptsache, das übrige läßt sich lernen. Die Gegensätze in dieser Welt sind gewiß nicht durch Unduldsamkeit zu unterdrücken. Da fällt mir der kleine Rudi ein. Ich sah einmal, wie er die große, harte Faust des Stallknechtes Sixtus küßte. Der Mann grinste vor Verlegenheit, lachte verschämt und sagte, indem er mir die Faust hinstreckte: »Küßt hat er's – er hat's küßt.« – Beim Begräbnis unseres Lieblings mußte sich der starke, gewaltige Sixtus mit seinem Schmerz hinter die Friedhofsmauer flüchten, weil er zu laut war.
Du fragst, ob der Baron und die Baronin mir Dank wüßten, weil ich nach Ausspruch des Arztes dem kleinen Günther das Leben gerettet. Ob sie jetzt ganz anders seien? – Aber Caton, aus Dankbarkeit seine Natur ändern, das wäre doch ein wenig zu viel verlangt. Es geht alles anscheinend seinen gewöhnlichen Gang weiter, und doch scheint mir in der Tiefe alles anders geworden zu sein. Der Sonnenschein fehlt. Man vermißt ihn auf allen Gesichtern. Wenn ich mich früher bemüht habe, der Tränen um den guten Vater Herr zu werden, jetzt werden verweinte Augen kaum mehr bemerkt, denn wer hat nicht geweint in den langen Nachtstunden?
Auch an meinem Zögling ist Rudis Tod nicht spurlos vorübergegangen. Es hat seitdem keine Szenen mehr in den Lehrstunden gegeben. Sie hört wenigstens zu jetzt, wenn der Gegenstand sie auch nicht interessiert. Neulich feierte sie ihren dreizehnten Geburtstag. Die Geschenke hatten kaum Platz auf dem großen Tisch inmitten ihres Zimmers. Im Hof wurde ihr ein neues Pferd vorgeführt, prächtig aufgezäumt, ein kleiner Korbwagen stand dabei.
Weißt Du noch, Caton, wir pflegten vor Rührung zu weinen, wenn wir eine Merinoschürze und ein schönes Buch bekamen.
Clothilde sah sich ihre Geschenke ruhigen Blickes an und sagte dann mit einem Seufzer:
»Jetzt ist's aus mit dem Elferl.« –
Ich wußte nicht recht, was sie damit meinte, aber dann sah ich mit einem Mal, daß irgend etwas an ihrem Wesen anders war. Ja, sie erinnerte mich plötzlich an ihre Mutter, ich weiß nicht recht inwiefern, aber ich konnte sie mir, was ich früher nicht gekonnt hätte, mit einem Mal als eine Gutsherrin vorstellen – so wie ihre Mutter eine ist. Sie hat mir nie von ihrem Schmerz um Rudi gesprochen, aber sie schleppt den ganzen Tag das Rudi-Hündchen herum, das auch in der Nacht in ihrem Zimmer schlafen muß.
Wenn ich auch nicht imstande war und bin, aus Clothilden das zu machen, was ich gewünscht hätte, so geht es allmählich mit dem Hannerl so prächtig vorwärts, daß ich eine wirkliche Freude an diesem Kinde haben kann. Hier ist Entwicklungsfähigkeit in hohem Grade, nach einem langsamen, geistigen Erwachen. Clothilde war von Anfang an fertig. –
Ich muß Dir noch sagen, daß ich einen Brief aus Nancy bekommen habe. Marie hat sich verlobt, und Mutter und Tochter beschwören mich auf das liebevollste, im Sommer zur Hochzeit zu kommen. Das hat mich wirklich gerührt. –
Nun liegt der Brief schon acht Tage, und Du wirst mich der Schreibfaulheit zeihen, liebe Caton. Es kam so. Der Baron hat mich inständig gebeten, mich malen zu dürfen. Als er mit dem Bilde des kleinen Rudi fertig war, überkam ihn in seiner Untätigkeit von neuem die Verzweiflung, und die Baronin, die ihren Schmerz wie eine Heldin trägt, brachte ihren Mann auf den Gedanken, mich zu malen.
Nun ist er ganz eifrig dabei. Ich legte sogar für das Bild auf seine Bitte die Trauer ab und trage mein altes Blaues mit einem weißen Kragen.
Die Schülerinnen haben während des Malens ihre französische Konversationsstunde. Dem Baron ist das recht, besonders da ich mich dabei wenig rühre und hauptsächlich lausche.
Therese führt wieder einmal Klage, daß Schwester Caton nicht schreibt. Da muß ich ja ein wenig schelten. Sonst, Du kennst sie ja, klagt sie über nichts, aber ich lese ihr großes Heimweh aus jeder Zeile, aus jedem Wort, das sie schreibt. Eigentlich spricht sie nie von Säckingen, sondern immer nur von Freiburg – von ihrem lieben, guten, himmlischen Freiburgle. –
Von eben diesem Freiburgle schreibt mir Lenchen, es sei die langweiligste Stadt geworden auf der Welt, und ich würde mich kurios wundern, wenn ich wiederkäme – 's sei alles wie verschlafe, seit 's Villingers[230] nimmer in Oberlinden wohnten mit ihrer Gastfreundschaft und ihrem Humor und den netten Herrle alleweil. – Und sie hätten jetzt 's Dortel – Dortel – und alle Abend säßen sie beisammen in der Küch und heulten über die vergangenen Zeiten, und's Dortel blieb dabei: »I sterb nit, ehnd i unsri Kinder nit noch emal g'sehe – und wenn i 's verzwinge müßt von unserm Herrgott.« –
J…, den 12. April 1840.
Caton, Caton, ach mir ist wie im Traum – vor mir liegt ein Schreiben – schwarz auf weiß steht in deutlichen Buchstaben, die Stelle der Vorsteherin der Rastatter höheren Töchterschule sei vakant, ob es mir beliebe, sie anzunehmen.
Erst habe ich müssen einen Gang durch den Park machen, so haben meine Hände gezittert und hat mein Herz gejubelt und doch auch wieder geblutet – ach, daß die Eltern es nicht erlebt – alle Kinder versorgt, alle eine Heimat. – So viel des Glücks – kaum zu fassen …
In den Sommerferien werde ich erwartet – die Schule ist im Rastatter Schloß, auch die Wohnung. Und denk dir mein Wirken darf in der Heimat sein. Das ist ja noch das allerschönste. Ich finde mich so gottbegnadet;[231] mein ganzes Leben ging dahin wie unter einem Strahl der Güte Gottes.
Die Antwort nach Rastatt liegt schon da. Ich habe mich zusammennehmen müssen, um rein sachlich zu bleiben, denn meine Feder ist jetzt von einem Hymnus der Freude und Dankbarkeit von unten bis oben angefüllt. – »Närrle« – gelt, so würde Mutter sagen. –
Die Nachricht an Therese liegt auch schon da. Sie wird still weinen vor Glück. So ist sie. Und Hermann soll's auch gleich erfahren.
Nur vor einem bangt mir, Caton – wie werden sie's hier aufnehmen? – Es wird ihnen und mir nahgehen. Das weiß ich, und davor fürchte ich mich. Wie hat sich der Baron an meinem Bild abgeplagt, bis ihm der Ausdruck gelang, und nun soll ich's ganz sein, alle sagen's, ich auch. Und er hat es mir geschenkt, wobei seine Augen ganz feucht waren. Er dachte wohl an Rudi. Die Baronin sagte, sie wolle nicht zurückstehen, und steckte mir eine wundervolle Brosche an.
Und nun gehe ich mit solchen Gedanken unter ihnen herum.
10. Mai.
Liebe Schwester, denke Dir, ich habe noch immer nichts gesagt, und es ist doch die höchste Zeit, wenn ich Anfang Juli reisen will. Ach Gott, wär's nur schon heraus!
Therese will nichts davon wissen, daß ich nach Freiburg komme und ihr beim Transport unsres Haushaltes beistehe. Das wolle sie alles allein machen, auch die Einrichtung in Rastatt sei ihre Sache. Ich müsse alles fix und fertig vorfinden, befiehlt sie.
24. Mai.
Nun ist's heraus. Der Baron war ausgeritten; vor dem fürchte ich mich nämlich am meisten, die Baronin ist sachlicher. Also trat ich mit dem Rastatter Brief bei ihr ein und legte ihn vor sie hin.
Sie las und meinte aufblickend: »Aber Sie nehmen doch nicht an?«
»Ich muß es wohl, Frau Baronin,« gab ich ihr zur Antwort, »eine Schule ist das Ziel meines Lebens.«
»Aber Sie können uns doch nicht verlassen – könnten Sie das wirklich, Liebe, um einer Schule willen? Was haben Sie von einer Schule?«
»Meine Selbständigkeit, Frau Baronin, und damit die Möglichkeit, meiner Schwester ein Heim zu bieten.«
»Ihrer Schwester?«
»Ja, sie ist durch Vaters Tod heimatlos geworden.«
»Davon sagten Sie uns nichts.«
Ich mußte ein wenig lächeln.
Die Baronin verstand sofort, sie wurde rot, sah einen Augenblick vor sich hin und streckte mir dann in herzlicher Freimütigkeit beide Hände entgegen.
»Was wir an Ihnen verlieren, läßt sich nicht ausdrücken.«
Tränen erstickten meine Stimme, ich ging.
Der Baron tobte, als er's erfuhr. »Das ist doch zu machen, das ist doch zu machen«, meinte er immer wieder.
Jeden Abend setzte ihm seine Frau auseinander, daß es nicht zu machen sei, und am Morgen stellte er seine Behauptung von neuem auf.
Wenn Therese nicht wäre, Gott weiß, ob ich nicht schwach würde. Clothilde ist ganz verstört, sie, die eigentlich nie ein herzliches Wort für mich hatte, zerschlug ihre Reitpeitsche an der Stuhllehne, als sie von meinem Entschluß hörte, und lief dann in den Park, um sich den ganzen Nachmittag nicht mehr sehen zu lassen. Hannerl saß allein in der französischen Stunde und konnte vor Weinen weder lesen noch sprechen.
Der Baron stürzte herein: »Wo ist Clothilde – sehen Sie, was Sie anstellen, Fräulein Villinger – was soll denn aus diesen Mädels werden. Ich frage Sie, können Sie das verantworten? Das Kind wird sich im Park totweinen.« –
Er stürmte davon.
Es läßt sich nicht sagen, wie sie mich quälen. Aber gottlob, an der Baronin habe ich einen Halt. Sie hilft mir wahrhaft mit ihrer Ruhe und macht mir das Scheiden insofern leichter, als sie mir sagte, sie wolle Hannerl im Hause behalten und von einer neuen Gouvernante absehen. Übers Jahr soll Clothilde dann in dasselbe Institut kommen, in dem sie ihre Mädchenjahre zugebracht, und Hannerl mit ihr.
Ob ich zufrieden sei, setzte sie hinzu.
Ich konnte ihr gar nicht genug danken, indem ich ihr sagte, daß auch Hannerls Zukunft mir am Herzen liege. Wir redeten wie Freundinnen über beide Kinder und auch der Baron hat seinen Trotz aufgegeben, weil ich versprochen, noch bis Anfang August zu bleiben.
Wir lachen auch wieder, und oh, wie bin ich froh, daß ich den Empfindungen meines sich oft beleidigt fühlenden Stolzes nie Worte verliehen und mir die[235] Anerkennung, die ich zu verdienen glaubte, nicht zu ertrotzen versucht. Jetzt fällt mir alles von selbst in den Schoß und wahrlich, mehr Liebe fast, als ich wünsche.
Rastatt, den 20. Oktober 1840.
Endlich eine freie Stunde! O Caton, ich bin wieder in unserm Ländle, ich atme Heimatluft, die Heimatsprache tönt mir auf Tritt und Schritt ins Ohr. Sie ist nicht schön, ich weiß wohl, lieber Schwager. Aber auf meinen Knien danke ich Gott, daß ich sie wieder hören darf und das heiß ersehnte Ziel erreicht habe. Solche eine Stunde zu erleben, wie die Post vor dem Gasthaus hielt und Therese dastand – leibhaftig stand sie da, unsre liebe, liebe Schwester. Und's Dortel denke Dir, unsre Dortel aus dem Elternhaus. Ich zitterte, als ich aussteigen wollte. Da nahm sie mich in ihre Arme und stellte mich, als sei ich ein kleines Kind, vorsichtig auf die Erde. Alsdann schritt ich an Theresens Arm durch die breite, sonnenbeschienene Gasse, sah wie durch einen Schleier niedrige Häuslein, zwischen denen große, stattliche Brunnen auftauchten.
»Nannele,« sagte Therese, »gib acht, gleich biegen wir in die Schloßstraße ein.«
Mir klopfte das Herz. Noch ein paar Schritte, und vor mir lag meine künftige Heimat. Prachtvoll, in der Abendsonne, wie in Blut getaucht, stand das Großherzogliche Schloß da. Ein rampenartig ansteigender Zugang führt zum Vorplatz hinan, dessen Balustraden aus Sandstein geformte Statuen schmücken.
Der Bau zeigt den späteren Barockstil. Lieber Schwager, Sie hätten Ihre Freude an dem reichen architektonischen Schmuck dieses doch wieder in einfacher Schönheit prangenden Baues, dessen Kuppel auf seiner höchsten Spitze den blitzeschleudernden Jupiter trägt.
Es würde zu weit führen, wollte ich mich auf eine Beschreibung dieses mächtigen, in Hufeisenform angelegten Schlosses einlassen. Ich ziehe vor, Ihnen gelegentlich davon eine Zeichnung zu verfertigen, so wie ich's eben kann. Freilich, die wundervollen, leider zum Teil schon recht beschädigten Stuckarbeiten an den Wänden und der Decke des Vestibüls entziehen sich einer Wiedergabe. Überhaupt, als ich diese Flucht von Sälen durchwanderte, mit den prachtvollen Familienbildern an den Wänden, und überall, besonders im Ahnensaal des markgräflichen Hauses, mir die Trophäen des Erbauers begegneten, des Türkenbezwingers Ludwig – ganz betrübt[237] wurde mir zumute, so wenig imstande zu sein, Euch dieses Schlosses Herrlichkeit zu beschreiben. Es brauchte dazu eines eingehenden Studiums, nicht nur des Baues, auch der Geschichte seiner ehemaligen Erbauer, wozu mir wenigstens fürs erste alle Zeit fehlt. Denn Ihr könnt Euch wohl denken, liebe Geschwister, ein ganzer Berg liegen gebliebener Arbeiten wartet der neuen Vorsteherin. Ich bin darum leichter über den Abschied weggekommen. Der Baron und die Baronin waren nicht minder bewegt als ich, als sie mir zum letztenmal die Hand schüttelten. Besonders der Baron brachte nicht ein Wort über die Lippen. Ich auch nicht. Hannerl lief noch ein ganzes Stück laut weinend neben der Post her, und es brauchte eine lange Zeit, ehe ich imstande war, meinen Tränen Einhalt zu tun. Daß Clothilde im letzten Augenblick nicht zu finden war und ich abreisen mußte, ohne ihr Lebewohl gesagt zu haben, hat mich geschmerzt, auch weil ich mir eingestehen mußte: du gehst, ohne daß es dir gelungen ist, dieses Kind, das dir anvertraut war, kennen gelernt zu haben. Ist sie gut, ist sie nicht gut – du weißt es nicht.
Aber wie gesagt, die Arbeit, die ich hier vorfand, die Pflichten, denen ich mich mit heißem Eifer hingebe, das alles bringt mir jene Zeit mehr und mehr[238] in Vergessenheit, und nur das liebe, herzige Rudi-Stimmle mit seinem »i bitt« tönt mir noch als das lieblichste und vielleicht einzig Unvergeßliche aus jenen Tagen.
Therese hat Dir geschrieben, liebe Caton, daß wir ja nun Lenchen in unser nächsten Nachbarschaft in Baden haben. Mit dem Tod ihrer Mutter bleibt ihr nichts andres übrig, als ihre Zuflucht bei der verheirateten Schwester zu nehmen. Sie hat uns neulich besucht.
»Weisch, Nannele,« sagte sie zu mir, »ich bin halt jetzt's fünft Rad am Wage, aber ich tu nit krächze, ich lach – und mach d' Kommissionen und klatsch ein bißle. Was soll ich sonst mache; aber jetzt, da du in der Näh bisch, mein' ich alle mal beim Aufwache, ich hab's große Los g'wonne.« –
Wie leid tut mir's, daß sich Lenchens Los nicht anders gestaltet hat. Für mich ist und bleibt sie ein Stückle Heimat, und wir wollen beisammen sein, so oft es geht.
Denke Dir, Monz schickte mir als Einweihungsgeschenk ins neue Heim Goethes Gedichte. Aber o Himmel, auch seine eigenen Gedichte mit dazu. Und was das ärgste ist, wünscht meine Meinung über beide Bücher zu erfahren. Einen einzigen Blick habe ich in das seine getan und schwelge seither, so oft ich[239] einen freien Augenblick habe, in Goethes Gedichten. Gott, es ist eine Beseligung! Im Anfang machte es mir fast Gewissensbisse, stundenlang über einem Buch zu sitzen. Aber wie schnell gewöhnt man sich an die langentbehrte, eigentlich nie besessene Freiheit.
Und weißt Du, Theresens leichten Schritt im Nebenzimmer zu hören, wie sie kommt und geht und sorgt und mir sogar des Morgens das Frühstück aufs Zimmer bringt.
»Bleib nur liegen, Nannele, ich bring dir's Kaffeele ins Bett.« –
So was wieder zu hören und miteinander des Abends nach Herzenslust von unseren Lieben plaudern zu können bei der Näherei, denn ich muß ganz neu ausstaffiert werden, da ich mir seit Jahren nichts angeschafft habe und mein bestes schwarzes Kleid nun schon gehörig spiegelt.
Ich höre meine liebe Caton in höchster Ungeduld ausrufen – »aber wie und wo wohnt ihr denn, meine Schwestern? Wie geht's mit der Schule, mit deinem Umgang – gibt es so nette Leute in Rastatt wie hier in Celle?«
Das alles höre ich mein Catonele fragen, aber hab' ein wenig Geduld, das Einzelne muß sich erst aus dem Ganzen herausschälen. Zu viel der Eindrücke sind's, mit denen ich zu tun habe, so daß ich[240] nicht weiß, wo anfangen, und doch auch nicht alles auf einmal sagen kann.
Dies Schloß ist wie ein Bienenkorb, in dem eine Unmasse Wesen sich's heimisch machen und kommen und gehen und ihr Tagwerk betreiben.
Da sind die Herren vom Hofgericht mit ihren Familien, die die rechte Seite des Schlosses bewohnen – das Wasser- und Straßenbau-Amt, der Schloß-Architekt, der Oberförster – alle mit Familien – da ist eine Bildergalerie, das Offizierkasino, das Museum, der Theatersaal – die Militär-Wache. –
Endlich, im nordöstlichen Flügel des Schlosses, dem sogenannten Sibyllenbau, ist meine Schule – die Höhere Töchterschule, mit einem Seiteneingang durch einen kleinen, viereckigen Hof – ein Höflein wie ein Traum, besonders wenn der Mond hineinscheint und an den hohen, wettergeprüften, schon ins Hellrot spielenden Mauern bald dunkle Schatten, bald lichte Streifen hinziehen; dazu eine Stille wie im Grab. Das Leben in den Hauptteilen des Schlosses ist durch hohe Mauern von hier abgeschnitten, unser kleines Reich ist ganz für sich, da der äußere, um das Schloß herumführende Balkon teilweise schwer beschädigt, also nicht mehr benutzbar ist.
Ich habe zwei Klassen, je mit zwei Abteilungen, in die sich zweiundfünfzig Schülerinnen verteilen –[241] die Kinder der Beamten, Offiziere und Honoratioren des Städtchens.
Als ich das erstemal den Katheder betrat, um meine kleine Welt zu begrüßen, hüpfte mir das Herz vor Freuden beim Anblick dieser zaghaft zu mir aufblickenden Augen, dieser schüchternen, mich so durchaus bürgerlich anmutenden Geschöpfchen. Gott sei Dank, keine Ausnahmekinder, sondern schlichte, unverdorbene Kleinstädterle habe ich vor mir.
Freilich, ich sehe wohl, daß es in meiner neuangetretenen Pflanzung gar vieles zu säen, zu begießen und auszujäten gibt, manche Auswüchse zu beschneiden, ineinander verwirrte, schlaffhängende oder widerspenstig ausgespreizte Ranken zu lichten, zu heben und zu stützen. Doch ich hoffe, da der Same gut und Eifer und Einsicht des Gärtners das ihrige tun, daß auch Gott das Gedeihen und seinen Segen dazu geben werde. Habe ich doch mehr und mehr eingesehen, welch eine Pflichtschwere eine Erzieherin sich aufbürdet. Ihr Beruf ist Lehren und Ermahnen – sollte da nicht auch ihr Leben eine Lehre sein, frei von allen großen und kleinen Fehlern, ja von störenden Gewohnheiten und Manieren?
Es ist ein heiliger Beruf, Nannele, hat Lehrer Kiesel zu mir gesagt, aber o Himmel, seine Manieren – waren diese nicht eher alles andere als nachahmungswürdig?[242] Und Frau Klementine in der Klosterschule, erinnerst Du Dich, Caton, wie wir heimlich kicherten, wenn sie sich blitzschnell umdrehte, um zu schnupfen, und dann mit Daumen und Zeigefinger die Spuren des Schnupftabaks von ihrem weißen Vortuch wegschnellte? –
Wir Lehrer müssen wissen, daß es nichts Grausameres und Spottlustigeres gibt als Kinderaugen, und uns danach richten. Schon mancher kleine Ellenbogen hat sein behagliches »Über-den-Tisch-Lungern« aufgegeben angesichts meiner Haltung auf dem Katheder, und manche rauhe, ungebührliche Kinderstimme hat sich auf die freundliche Art meiner Rede gestimmt.
Und welch eine Entdeckung machte ich neulich. Ein Fingerchen erhob sich, und die Anzeige wurde gebracht: »Es hat d' Schul' g'schwänzt.«
»Es« war Forstmeisters Linele, ein ganz herziges Kind. Die Kleine gestand unter Tränen, daß sie an der Murg drunten Püpplewäsch g'habt. Ich nahm ihr die Händchen vom Gesicht, sie schluchzte herzbrechend.
»Warum hast du so Angst, Kind?«
»Vorem Sibylleloch.« –
Große Stille. Alle Kinderaugen hingen mit ängstlicher Spannung an meinem Gesicht.
»Was ist das Sibyllenloch?« fragte ich. »Warum hast du so Angst davor?«
»Wir werde neing'sperrt, wann wir bös sind.«
»Nach der Stunde zeigt ihr mir den Ort.«
Von den andern Kindern gefolgt, führte mich die Kleine zu einer Tür im Erdgeschoß, am Ende eines großen Raumes, in dem das Brennholz aufgespeichert lag. Im Schloß der Tür steckte ein Schlüssel. Ich öffnete und sah in einen dunklen, kellerartigen Raum, aus dem moderige Dünste stiegen.
»Welch eine Luft«, entfuhr es mir unwillkürlich.
»Und geistere tut's au«, meinte ein kleines Mädchen.
Ich warf die Tür zu, schloß ab und steckte den Schlüssel in die Tasche.
»Damit ist's aus«, sagte ich, worauf alsobald ein wilder Freudentanz entstand, an dessen glückseliger Verzücktheit ich nur zu gut erkannte, wie groß die Angst und das Grauen gewesen sein mußten, dem diese armen Kleinen durch eine so unmenschliche Strafe bisher ausgesetzt waren.
Welche Macht haben doch die Lehrer, und wie mancher unter ihnen wendet diese nicht zum Heil, sondern zum Unheil der Kinder an. Wie oft fällt mir Hermanns Verzweiflung über den Mathematiklehrer ein. Wenn Mathematik auf dem Stundenplan stand,[244] kam der arme Kerl schon mit einem finsteren Gesicht zum Kaffee, und die Mutter sagte: »Iß ein zweites Brötle, Bubele, zur Stärkung«, während Vater mit gerunzelter Stirn ein sorgenvolles »Hm« hören ließ, im voraus der roten Ohren gedenkend, die unser Jüngster regelmäßig aus der Mathematikstunde mit heimbrachte.
Weißt Du noch, Caton, ohne Dir viel Mühe mit dem Lernen zu machen, warst Du stets der erkorene Liebling Deiner Klassenlehrerin, ich aber hatte an Frau D. eine strenge Widersacherin und sollte einmal den Boden küssen – auch eine unwürdige Strafe – weil ich Lenchen in der Geographiestunde mit Einsagen geholfen. Ich weiß nicht, wie's geschah, aber statt des Bodens küßte ich den Rocksaum der Klosterfrau, die darob in die größte Verlegenheit geriet und von Stunde an sich weniger hart gegen mich zeigte.
Ach, sollte es für den Lehrer nicht der schönste, der größte und heiligste Ehrgeiz sein, den Kindern die Schule liebwert zu machen, daß sie mit frohen Gesichtern kommen und mit frohen Gesichtern gehen?
Übrigens, da hab' ich ein dickes Kätterle in der Klasse, dem fiel neulich die Schultasche auf den Boden, und aus ihr kollerte eine solche Menge von Brot, Äpfeln und Nüssen, daß ich erstaunt fragte: »Aber, Kätterle, das kann doch nicht alles für dich sein?«
»Doch,« sagte das Kind, »'s isch alles für mich.«
»Ja, wollen denn deine Eltern, daß du das alles ißt?«
»Ja,« nickte die Kleine, »der Vater sagt: ›Iß recht, Kätterle, ich hab' Hunger leide müsse daheim‹.« –
So kommt wohl der Wechsel ins Leben. Haben die Eltern gehungert, bekommen die Kinder zuviel. Und wenn die Kinder unter dem Zuviel einst zu leiden haben, werden sie nicht ihre Kinder davor zu bewahren suchen? Und ist es nicht am End so mit allem in der Welt, daß sich mählich jeder Druck ins Gegenteil verwandelt?
Aber ich weiß, Du willst keine Reflexionen, sondern vor allem wissen, wie wir leben, ob wir glücklich sind.
Ja, Caton, wir sind's; und ist das Tagewerk getan, kommt's zuweilen sogar zu einem lauten Freudenausbruch meinerseits, daß ich mit ausgebreiteten Armen durch alle unsere Stuben eile, gleichsam fliegend mein Hochgefühl zum Ausdruck zu bringen suchend. Und wenn dann Therese sagt: »Nannele, du bist ein Närrle«, so falle ich ihr weinend und lachend um den Hals, so dankbar, ach so dankbar, daß ich nun eine Heimat habe und ein Herz dazu, das mich begreift und mir erlaubt, zu sein, wie ich bin, sogar ein[246] wenig unvernünftig. Du solltest uns einmal in unserem schönen, großen Wohnzimmer sitzen sehen, inmitten der lieben, wohlerhaltenen Elternmöbel, die so vertraut uns anheimeln und von unsern Lieben reden, die wir nicht mehr haben, und von denen, die noch mit uns dieselbe liebe Gottesluft atmen.
Es ist unsere Freude, daß Dein Ältester das Fach seines Vaters erwählen und Architekt werden will. Und merkwürdig dünkt uns, daß Hermanns Patenkind, Euer Hermännle, sich darauf kapriziert, Offizier zu werden, als sei ihm mit der Patenschaft die Sehnsucht des Onkels zum Militärstand eingeimpft worden.
Unser Jüngster prangt jetzt als feines Auditörle und im Hochbesitz eines Pferdes in der lieben Freiburger Heimatstadt, und nach seinen Briefen zu schließen, möchte er mit keinem König der Welt tauschen.
Unsere Wohnung, Caton, ist einfach fürstlich. Weite Gemächer mit gewölbten Plafonds und so hohen Fenstern, daß wir die ganze Zeit dabei sind, unsern Vorhängen die nötige Länge anzusetzen. Merkwürdigerweise nehmen sich in dieser äußeren Pracht unsere großen, massiven Möbel gar nicht schlecht aus; ja, noch nie hat mir Mutters gelbe Kirschholzkommode mit den schwarzen Säulchen so gut gefallen wie hier, zwischen den beiden Fenstern. Ganz wie daheim hat die große Wiener Rokoko-Uhr ihren[247] Platz auf der Kommode, und zu Theresens Kummer bleibt jene unwiderruflich bei ihrem alten Fehler, stets vorzugehen, wie auch unsre liebe Caton dabei bleibt, Theresens ängstliches Schwesterherz immer von neuem durch allzu lange Schreibpausen zu betrüben.
Gleich dem Wohnzimmer liegen auch das etwas kleinere Eßzimmer sowie unsere sehr geräumigen Schlafzimmer nach Osten, mit dem Blick auf den sich weit ausdehnenden Schloßgarten mit seinen prachtvollen, uralten Kastanienalleen. Die lichtblauen Ausläufer der Badener Berge ziehen sich am Horizont hin und erwecken manchen Seufzer der Sehnsucht nach den höheren und dunkelblaueren Bergen unserer geliebten Heimat. Die Schulräume befinden sich auf einem besonderen Korridor gen Westen. Einige unbewohnte Räume sind auch noch da, liegen unter Schloß und Riegel. Wer weiß, ob man sie nicht eines Tages öffnen wird? – Denk, ich träum' das zuweilen, o Caton, und wir malen's uns aus, Therese und ich, wie das wäre, wenn Petersens sich entschließen würden, einen Sommer bei uns zuzubringen. Es wäre ein so hohes Glück, daß wir nur leise daran zu rühren wagen.
Von den Nordfenstern meines Eßzimmers sehe ich zu dem stattlichen Bau hinüber, dem ehemaligen Piaristenkloster und jetzigen Lyzeum. Aus rotem[248] Sandstein wie das Schloß, leuchtet es zwischen den beiden mächtigen, uralten Linden hervor, die seine Flanken zieren. Über dem Ganzen liegt ein wunderbarer Hauch alten Klosterfriedens, dem ich mich an stillen Mondscheinabenden nur zu gern hingebe.
Muß mich doch die Schönheit dieses Schlosses und der eigenartige Zauber, der von ihm ausgeht, für gar manches entschädigen, denn ich glaube nicht, daß die in meinem Innern stets so rege Sehnsucht nach Menschen, zu denen ich aufblicken dürfte, hier jemals eine Befriedigung finden wird.
Einstweilen wenigstens sieht es nicht danach aus. Ein Hauskreuz ist mir gleich in Gestalt der Unterlehrerin, die ich vorfand, als Geduldsprobe zur Seite gegeben.
Fräulein Plump benimmt sich gegen mich durchaus artig – d. h. falschartig, gegen Therese aber führt sie die dreisteste Sprache. Aus Eifersucht, meines Erachtens, denn Therese, die die Kinder manchmal in der freien Viertelstunde beaufsichtigt, erfreut sich der ganzen Zuneigung meiner Zöglinge, die für Fräulein Plump so gut wie nichts übrig haben.
Ich muß auf Theresens Befehl des Morgens zwischen den drei Stunden, die ich zu geben habe, ein Ei nehmen, saß also gerade im Eßzimmer, als die[249] Tür des Wohnzimmers aufflog und Fräulein Plumps Stimme ertönte.
»Ich will Ihne nur sage,« schrie sie Therese an, »das laß ich mir net g'falle – Sie mache mir die Kinder abspenstig und hetze geger mich – und jetzt ist auch der Schlüssel von Sibylleloch weg, und wenn ich der nit hab, werd ich gar nimmer Meister – und so gebe Sie ihn gleich auf der Stell' raus.« –
»Fräulein Plump,« sagte ich, »der Schlüssel bleibt, wo er ist. Sie müssen versuchen, den Kindern durch Ihren Charakter zu imponieren, nicht durch eine so menschenunwürdige Strafe wie bisher.«
»So,« meinte sie verlegen, »wie Sie wünschen, Fräulein Villinger« – und griff nach der Türklinke.
Eben das ist mir so furchtbar widerwärtig an dem Mädchen – sobald man ihr dezidiert entgegentritt, ist sie feig, sonst so frech als möglich.
Noch warte ich zu. Fräulein Plump ist ohne Vermögen, also von ihrem kleinen Gehalt abhängig. Sollte sie sich jedoch als wirklich böse entpuppen, werde ich mich durchaus eines solchen Elementes zu entäußern suchen, um so mehr, als ihre Kenntnisse so gering sind, daß sie nicht einmal für die unterste Klasse genügen. Einstweilen soll sie bemerken, daß sie beobachtet wird. Es ist mir schon aufgefallen, daß Fräulein Plump gegen die Herren, die mit[250] meiner Schule zu tun haben, die Untertänigkeit in Person ist. Damit ließe sich vielleicht rechnen, daß sie unter einem männlichen Vorgesetzten etwas besser am Platz wäre.
Ich habe in der kurzen Zeit meines Hierseins doch schon soviel Vertrauen zu erringen vermocht, um einigermaßen selbständig handeln zu dürfen. Herr von Stockhorn würde mir gewiß nie etwas in den Weg legen. Er gehört zum hiesigen Hofgericht und hat eine Art Oberaufsicht über die Töchterschule. Oft bringt er sein Töchterchen selbst in die Klasse und wohnt einer französischen oder deutschen Stunde bei, und wiederholt hat er mir seine Zufriedenheit über die Art meines Lehrens ausgedrückt. Die Kinder lieben ihn unbeschreiblich und jubeln ihm schon von weitem zu. Der liebenswürdige Kinderfreund hat immer die Taschen voll reizender Papierpüppchen, die er unter die Kleinen verteilt, die keinen heißeren Wunsch haben, als ein Stöckhörnle zu besitzen.
Ach, ein so ganz anderer ist unser Professor. Er gibt in der oberen Klasse Rechnen, Naturgeschichte und Zeichnen. Aber er behandelt die Mädchen nicht anders als seine Lyzeumsschüler, teilt Ohrfeigen und Stockschläge aus und fängt seine Stunde gewöhnlich mit einem knurrenden: »d' Konzepte raus« – an. Oder: »Ufpaßt heut, zum Donnerwetter.« –
Von Manieren hat er keine Ahnung.
»I weiß, i bin saugrob,« sagt er von sich selbst, »aber z'leid bin ich's.«
Er ist nämlich voll Wut über die Behörden von Karlsruhe, die so lange säumen, ihn an das Lyzeum einer größeren Stadt zu berufen. Davon spricht er immerzu und kann sich nicht genug tun an Schelten und Nörgeln.
Trotz allen Ärgers, den mir sein ungattiges Wesen verursacht, muß ich doch auch wieder über ihn lachen, denn er kommt daher, als träte er direkt aus dem schönsten Regenbogen heraus. Alles strahlt in Farbenpracht an diesem untersetzten, dickköpfigen Mann. Der Rock königsblau, die Weste orangegelb, die Halsbinde karminrot und die Hose hellgrau. Auf den schwarzen Löckchen sitzt ein schiefer, breitrandiger Zylinder, unter dem grelle, blaue Augen beleidigt in die Welt schauen. Auch die Kinder lachen heimlich über ihn, während es weder ihnen noch mir einfällt, über Fräulein Plump zu lachen. Sie ist zu böse. Wie sie los werden, ohne ihr zu schaden? Diese Frage steht mit mir auf und geht mit mir zu Bett.
Rastatt, den 7. April 1842.
Liebste Caton!
Dein Hermännle und unser Hermann, sie leben hoch zu ihrem heutigen Namenstag! Eine mächtige Linzertorte ist nach Freiburg zum Auditörle gewandert. Als kleiner Bub hat er einmal ein Stückchen Linzertorte gestohlen und es mir in seiner Aufrichtigkeit gebeichtet. So geht's im Leben, jetzt hat er eine ganze.
Ich bin sehr aufgeräumt, wir hatten eine prächtige Geographiestunde auf der Plattform des Schlosses. Köstlich, das Gewusel von kleinen Mädchen zu Füßen des vom Jupiter beherrschten großen Laternenturmes. Die Rundsicht, die sich da oben bietet, ist prachtvoll, und meine Kinder lernen auf die angenehmste Weise ein gutes Stück unseres Landes kennen, und ihre jungen Augen sind gar eifrig im Auffinden der fernsten Punkte. Rings um das Städtchen werden jetzt Wälle aufgeworfen, von allen Seiten kommen Steinfuhren zum Bau der großen Festung, die Tausende von Arbeitern beschäftigen soll. Einstweilen sieht es recht unordentlich in der nächsten Umgebung Rastatts aus. Nun, wir sehen darüber weg ins sich weitöffnende Murgtal mit den dunklen Schwarzwaldbergen – Ebersteinburg,[253] der Merkur, die Badener Höhe grüßen herüber. Wir erblicken in der endlosen Rheinebene das Straßburger Münster und gen Süden die Vogesen, gekrönt von der Hochkönigsburg. Nach Norden entdecken wir über das Häusermeer von Karlsruhe hinweg den Dom von Speier, den Durlacher Turmberg und beinahe noch den Melikobus im Odenwald – so klar war die Luft.
Beschäftigen wir uns mit der Geschichte Rastatts, versäumen wir nicht, das berühmte Friedenszimmer aufzusuchen mit seinen kostbaren Holzvertäfelungen. Hier haben die denkwürdigen Friedensverhandlungen stattgefunden zwischen Prinz Eugen und dem Marschall Villars, die den langen Erbfolgekrieg zum Abschluß bringen sollten. Und einige Jahrzehnte später tagte hier der Reichsfriedenskongreß unter Markgraf Karl Friedrich.
Diese geschichtlichen Ausführungen interessieren vielleicht Deine jetzt gewiß eifrig mit Geschichte beschäftigten Knaben, daher meine Ausführlichkeit.
Und nun zu Deinen Fragen, Caton. – Nein, es hat sich bis jetzt kein Verkehr für uns gefunden. Die bürgerlichen Mitbewohner des Schlosses leben alle mehr oder weniger ganz abgeschlossen für sich. Des Abends sieht man wohl die Beamten im Zereviskäpple, das Pfeifle im Mund, unter dem Fenster[254] liegen und spazieren schauen; die Frauen scheinen äußerst fleißig und rührig zu sein. Therese trifft sie schon in aller Frühe auf dem Markt. In ihren vier Wänden bewegen sich Mütter und Töchter im Bettkittel, weshalb ein Besuch großes Unbehagen hervorruft. Ich habe eine solche Aufregung einmal verursacht, als ich die Mutter einer meiner Schülerinnen sprechen wollte. Sie erschien im Mantel mit der Behauptung, eben nach Hause gekommen zu sein. Anders scheint sich das Leben auf der rechten Seite des Schlosses abzuspielen, wo die Hofgerichts- und Militärbehörden wohnen. Wenn Musik im Museumsgarten ist, sieht man die jungen Offiziersfrauen in neumodischen Kleidern paradieren, wie sie im nahen Baden die Mode des Tages mit sich bringt. Therese und ich genießen mit Wonne die Militärmusik und promenieren zwischen dieser uns fremden Welt, von der Menge kaum beachtet, aber immer freundlich begrüßt von Herrn von Stockhorn, der nach wie vor meiner Schule das wärmste Interesse zeigt.
Er hat mir sogar im Vertrauen mitgeteilt, daß er im stillen alle Schritte tue wegen der Versetzung des Professors. Bis jetzt freilich noch ohne Erfolg.
Ach, und unsre Plump! Dieser täglich von neuem aufzunehmende Kampf mit meiner Antipathie! – Weiß ich doch, wie eifrig sie bemüht ist, mir in Rastatt[255] zu schaden, wo sie kann. Aber meine Kinder werden als meine guten Engel für mich eintreten, das weiß ich auch. Die Freude, die mir meine Schule gibt, nimmt überhaupt mit jedem Tag zu. Immer mehr gewinne ich Einfluß auf die mir anvertrauten jungen Gemüter. Ich bin eben eifrig daran, ihnen den Aberglauben auszutreiben, die Markgräfin Sibylla gehe im Schloß um.
Ich habe mich genau über deren Leben erkundigt. Herr von Stockhorn stellte mir Bücher aus der Schloßbibliothek zur Verfügung, aus denen ich ersehen konnte, welch eine vortreffliche Regentin die Markgräfin nach dem frühen Tod ihres Gemahls, des Türken-Louis, war. Wie gütig und großmütig sie sich der Armen annahm, und wieviel sie tat, um die Nachwehen der so lange auf Rastatt lastenden Kriege für ihre Untertanen erträglich zu machen. Und hat sie diesen ein größeres Geschenk machen können als durch die Errichtung von Bildungsstätten für Rastatts Jugend? Eine Fürstin ohne inneren Wert, der das Wissen gleichgültig ist, stiftet keine Schulen.
Dann kommen mir freilich die Kinder mit der Frage: »Wenn sie nichts Böses getan, warum steht in der Vorhalle der Schloßkirche im Boden eingeschrieben: ›Betet für die große Sünderin Sibylla 1733.‹ – Warum hat sie im Park des Lustschlosses Favorite die[256] Eremitage erbaut und sich gegeißelt und Buße getan?«
Ich konnte den Kindern nichts anderes sagen, als wie ich mir selbst im eigenen Innern das Schicksal dieser hervorragenden Frau deute. War ihr Leben nicht umdüstert durch schwere Kriegszeiten, daß sie Schreckliches an Greueln erleben mußte im eigenen Land und wohl noch Schrecklicheres durch die Habgier, Grausamkeit und Falschheit des Feindes? So kam im Alter die Müdigkeit über sie und die Sehnsucht, einer Welt zu entfliehen, die soviel des Argen in sich barg. Sie ergab sich Gott; wer sich aber Gott ergibt, der wirft alle Hoffart von sich, und sein Denken und Tun ist Demut bis zur Selbstentäußerung. Sie will nichts mehr scheinen, sie fragt nicht nach dem Urteil der Welt. Diese Welt hat Christus geschmäht; sie will um seinetwillen auch geschmäht, verkannt und verhöhnt werden.
So deute ich mir die Empfindungen, welche die Markgräfin Augusta Sibylla am Schluß ihres Lebens leiteten. Soviel man eben deuten kann, denn das Rätselhafte in eines Menschen Brust bleibt uns verborgen und ist doch vielleicht das Ausschlaggebende für sein Handeln.
So ungefähr sprach ich zu den Kindern. Die Gedanken, wie ich sie ihnen ausdrückte, sind mir in der[257] Hofkirche gekommen, die die Markgräfin erbaut und auf das kunstsinnigste ausstattet hat. Gleich beim Eingang rechts in dem kleinen Kapellchen ist ihre letzte Ruhestätte. Und eine schönere, weihevollere hätte sie sich nicht erwählen können. Ein jeder schreitet in der Vorhalle über die Bodenplatte, in die mit Messingbuchstaben jene Worte eingelassen sind: »Betet für die große Sünderin Sibylla Augusta 1733.«
Und indem ich für sie bete, kann ich nicht umhin, mich immer wieder mit ihrer seltsamen Wandlung zu beschädigen. In dem herrlichen Deckenfresko der Kirche ist die Auffindung und Verehrung des Kreuzes Christi durch Kaiserin Helena dargestellt.
Die fromme Kaiserin zog nach Jerusalem, um unter dem Schutte, der seit der Zerstörung der heiligen Stadt die geweihte Stätte bedeckte, das Kreuz des Heilandes aufzusuchen. Man grub drei ganz ähnliche Kreuze aus; welches mochte das richtige sein? Man ließ eine vornehme Frau aus der Stadt, die dem Tode nahe war, die drei Kreuze berühren. Schon hatte die Sterbende zwei Kreuze berührt, ohne Wirkung. Da sie das dritte berührte, stand sie auf und war gesund. Nun konnte für Helena kein Zweifel mehr sein; überglücklich sinkt die Kaiserin vor dem heiligen Kreuz in die Knie.
Diesen Augenblick bringt der Künstler in seinem[258] Werk, und als Kaiserin Helena hat er die Erbauerin der Kirche, Markgräfin Augusta Sibylla, dargestellt, eine schöne, königliche Frau.
Sollte in dieser ihrer Beschäftigung mit heiligen Dingen, an ihrer offenbar genauen Kenntnis des Lebens der Heiligen, deren Abbilder überall an den Wänden und Decken der Kirche angebracht sind, sollte dieser Verkehr mit dem Überirdischen nicht den Grundstein gelegt haben zu dem späteren Leben der Markgräfin, so daß es ihr erging wie Saulus, der immer wieder von Christus gehört und so viel von ihm hörte, bis ihn einstens eine Stimme vom Himmel in Paulus, den eifrigsten aller Christus-Jünger, verwandelte.
Hat nicht auch Sibylla eine solche Stimme vernommen, wie alle jene, die plötzlich der Welt entsagt und ihr Leben Gott und der Einsamkeit geweiht? –
Eine solche Stimme, wie unbeschreiblich zwingend, wie niederschmetternd und von hoher Gewalt muß sie sein, daß sie den, dem sie ertönt, aus dem gewohnten Lebenskreis herausschleudert und eine an Herrschen und Wohlleben gewohnte Fürstin zur armen, büßenden Sünderin macht.
Nun habe ich mich wieder einmal ganz in meine Phantasien verloren, und mein armes Catonele, das all das lesen muß, wird kopfschüttelnd sagen: Was[259] geht mich diese alte, vor mehr als hundert Jahren verstorbene Markgräfin Sibylla an? Nein, das sagst Du nicht, sondern lächelst in Deiner liebevollen Art, wohl wissend, daß Dein Nannele den Dingen eben gar so gern auf den Grund geht.
Noch zum Schluß die Ursache, warum Dortel durchaus des Sonntags dem Militärgottesdienst beiwohnen muß, was uns nämlich nicht so ganz paßt. »He nei,« sagte sie auf meine Frage, ob sie nicht ebensogut zu einer andern Zeit in die Kirche gehen könne, »he Gott bewahr, do hätt' ich jo nit der halb G'nuß, denn nur in der Militärmeß kann i's so recht spüre, wie sich unser Herrgott freut, wann's zur Wandlung trummelt.«
14. Oktober 1842.
Wirklich, man sollte mehr Vertrauen haben und sich nicht den Kopf zerbrechen: wie helfe ich diesem, wie helfe ich jenem ab. Man muß auch nicht immer handeln wollen, sondern auch dem Schicksal etwas überlassen. Gerade war ich wieder einmal auf dem Gipfel meiner Verzweiflung, sowohl durch den Professor als durch Fräulein Plump. Denn suche ich nicht das Beste und Feinste, was ich habe, meinen Kindern einzuprägen, der geringsten Roheit den Krieg erklärend, Wahrhaftigkeit als das Endziel aller meiner[260] Bestrebungen hinstellend? Und ihre Augen leuchten, sie verstehen mich, sind voll des guten Willens. Da kommt der Professor, und alle Kinderroheit ist nichts im Vergleich mit der seinen, und was ich ihnen über die Schönheit der Wahrhaftigkeit gesagt, in dem verlogenen, unaufrichtigen Wesen des Fräuleins Plump erkennen sie das Gegenteil.
So dachte ich, als eines Tages an die Türe gepocht wurde, und der Professor über die Schwelle unsres Wohnzimmers trat. Er blieb zu meinem Erstaunen mitten im Zimmer stehen und erging sich in einer Rede in lateinischer Sprache, die ich nicht verstand. Alsdann schloß er: »Sagt Cicero – was ungefähr soviel heißt als: Was lange währt, wird endlich gut. Nota bene, ich bin an die Knabenschule in Konstanz berufen. Gott sei Dank, das Mädle-Unterrichten hört auf. Das zimperliche Geschlecht ist mir fatal. Trotzdem ist es meine Absicht, als Ehemann meine neue Stellung anzutreten. Merkt der geneigte Leser was?«
Er legte den Finger an die Nase und sah mich mit zusammengekniffenen Augen an.
»Ich habe mir nämlich ein Weib erkoren«, sprach er feierlich.
Ich gratulierte ihm herzlich.
»Ja, wissen Sie«, fiel er mir in die Rede, »wen[261] ich mir erkiese – zum Weib erkiese? Sie – einfach Sie.«
»O Gott«, entfuhr es mir.
»Sie sind überrascht, ich merk's, sehr überrascht, aber hoffentlich angenehm überrascht, denn wenn der Mann ein Weib erkiest, so ist das eine Ehre für sie. – Nun, so reden Sie – Heiratsanträge sind nicht mein Gusto.«
»Herr Professor,« stotterte ich, »seien Sie mir nicht böse, aber – ich heirate nicht.«
»Waas«? schrie er. »Wenn Sie aber doch einer will.«
»Auch dann nicht. Ich fühle mich glücklich in meinem Beruf.«
»So – hm –.« Er besann sich einen Augenblick, und ich wurde mit Vergnügen gewahr, daß ihm die Sache durchaus nicht tiefer ging.
»Dann nehme ich die Schwester«, sagte er; »holen Sie Ihre Schwester.«
»Warum meine Schwester?« fragte ich, mit aller Mühe meine Lachlust unterdrückend, »Fräulein Plump ist doch viel jünger.«
»Ja, aber so zutunlich; ich mag zutunliche Frauenzimmer nicht leiden.«
»Sie will Ihnen eben zeigen, daß sie Ihnen gut ist.«
»So – hm – vielleicht verstehen Sie das besser,« meinte er nach einer Pause, »das weibliche Geschlecht ist mir eine Terra incognita. Aber es macht sich besser, wenn ich als Ehemann in Konstanz auftrete; man hat mir das geraten; auch habe ich das Wirtshausessen satt. Glauben Sie, daß die betreffende Person etwas vom Kochen versteht?«
»Wenigstens erzählt sie mir oft, was für gute Speisen sie sich köchelt, und ihr Aussehen straft ihre Worte nicht Lügen.«
»Ja«, nickte er, »sie ist ein korpulentes Frauenzimmer« …
Kurz und gut, er besann sich ein paar Tage, und jetzt sind sie verlobt. Fräulein Plump ist glückselig, und wir sind noch nie so gut gestanden wie jetzt, indem wir ihr alle möglichen Ratschläge für die künftige Einrichtung geben, und täglich kommt sie und schreibt Theresens Kochrezepte ab. Fast dauert sie mich ein wenig, denn der Professor behandelt sie nicht anders, als er bisher seine Dienstmagd behandelt hat. Aber sie ist fügsam wie ein Hündlein.
»Die Rastatter sind jetzt ganz anders geger mich, seit sie wisse, daß ich Frau Professor werd'«, erzählte sie.
Dortel brachte dieser Tage mit verweinten Augen die Suppe auf den Tisch. Als ich sie fragte: »Wo[263] fehlt's, Dortel?« bekam ich die Antwort: »I bin so neidig auf d' Plumpe – der Professor hätt' doch auch eins von meine Fräule nemme könne.« –
Wir mußten herzlich lachen und suchten sie zu trösten. Sie bleibt aber dabei, daß er eins von »uns hätt' nemme könne.« –
Du fragst, ob sie mich in J…heim ganz vergessen hätten. Bewahre, immer von Zeit zu Zeit kommen Nachrichten von der Baronin. Eine besonders erfreuliche kam mir von Hannerl, die mir eine sechs Seiten lange Dankepistel schrieb, indem sie behauptet, nur mir und meiner Lehrmethode habe sie es zu verdanken, daß man sie im Institut als Lehrerin zurückbehalten und sie nun ihr Auskommen habe und den Eltern eine Stütze sein könne. Auch ihr Vater, der Lehrer, schrieb mir: »Wie sollen wir Gott genugsam danken und nächstdem Ihnen, der vortrefflichen, Geist und Gemüt gleichwertig ausbildenden Lehrerin unseres Kindes, daß selbiges noch in jungen Jahren so großer Ehren teilhaftig geworden, nebst des Verdienstes, sich hoher Bildung zu erfreuen. Oh, ich kann es oft nicht fassen, so ist meine Wonne groß, da Bildung die Sehnsucht meines Lebens ist gewesen von klein auf, indes die Mittel fehlten.«
Daß es solche Menschen gibt, Caton, das ist nach meiner Ansicht der größte Segen Gottes, denn wie[264] soll die Welt existieren ohne sie – was würde aus den Großen, den Reichen, den geistigen Arbeitern, ohne diesen mächtigen Wall – den Braven in der Welt! – Dem guten Acker sind sie vergleichbar, auf dem uns das köstliche Lebensbrot wächst.
Rastatt, 10. September 1843.
Endlich kann ich Deinen Wunsch erfüllen und Dir einen Modebrief schreiben. Groß waren die Vorbereitungen für den Tag in Baden, der mir ja auch ein Wiedersehen mit Monz und zugleich die Bekanntschaft mit seiner Frau bringen sollte. Da wir nicht als völlige Landpomeränzle in dem eleganten Baden erscheinen wollten, entschlossen wir uns, etwas tiefer in meinen nicht mehr so leeren Beutel zu greifen, und schafften uns neue Kleider an. Zum erstenmal seit dem Tod der Eltern wieder farbige, und zwar wählten wir dunkelblauen Barege, der leicht ist und darum angenehm, weil die Röcke jetzt von größerem Umfang sind. Die Gigot-Ärmel sind zu Grabe getragen. Man hat aber doch noch die Wahl zwischen dem ganz enganliegenden und dem etwas gepufften Ärmel, welch letzteren ich mir erwählte, ebenso die etwas losere, mit einem Gürtel zusammengefaßte Taille. Therese hat sich für Schnepptaille und enge Ärmel[265] entschieden. Eine große Rolle spielt die Mantille. Aus Mutters achteckigem schwarzen Kaschmirschal ließen sich prächtig zwei Mantillen herstellen, eine für Dich und eine für Therese. Für die Deine muß aber noch eine Ausgarnierung erfunden werden. Meine Mantille wurde aus meinem ehemaligen blauen Seidenkleid, das ich aus Nancy mitgebracht, verfertigt. Therese hat sich nicht wenig den Kopf zerbrochen, bis sie die Form herausbekam. Aber es gelang. Die Mantille ist wohl etwas schmal, aber mit langen Enden. Rüschen vom selben Stoff sind der Aufputz.
Uns wunder wie fein wähnend, fuhren wir am letzten Sonntag mit der Frühpost nach Baden. Ach, wie verblaßte die Pracht unserer Gewänder gegen die, welche wir auf der Promenade vorfanden! Schleunigst ließen wir das letzte Fünkchen Eitelkeit von dannen fahren und sperrten Mund und Augen auf beim Anblick all der herrlichen Erscheinungen, die vor uns auf und ab promenierten. Denke Dir ein schwarzes Atlaskleid, unten mit einem wohl eine halbe Elle breiten Besatz von Zobelpelz. Um die Mantille einen ebensolchen, nur etwas schmaler. Reifartig, in schweren Falten steht der Rock von der Person ab; die Wespentaille hat einen viereckigen Ausschnitt, und aus dem hoch mit Federn garnierten Hut wallen langgeschweifte Seitenlocken fast bis auf die Mitte[266] der Taille. Weite, bauschige Röcke, wo man hinsieht, die Hüte nicht mehr das halbe Gesicht zudeckend, sondern der Rand weit offen bis in die Mitte des Kopfes, so die Frisur und den Kopfputz freilassend, der oft aus ganzen Rosengärten besteht. Sehr viel sieht man die sogenannte Ferroniere, ein dünnes Goldkettchen, welches ein kleines Juwel, eine Perle oder dergleichen in der Mitte der Stirne festhält. Ach, Caton, es ist mir nicht möglich, aus dem Chaos von übertriebenen Toiletten noch mehr zu beschreiben. Ich wurde bald des Schauens müde und kann Dir nur sagen, für unsereins ist hier nichts zu suchen, also hat es gar keinen Wert, sich weiter in die mysteriöse Welt der Mode zu versenken. Ich plauderte mit meinem lieben Lenchen, freute mich der trauten Freiburger Sprache, und wir schwelgten in der Vergangenheit bei den lustigen Walzerweisen der Kurkapelle. Wir sind auch durch die Spielsäle gegangen, ach, und mir wurde wund ums Herz beim Anblick dieser eleganten Herren und Damen, so jung noch und oft so alt, die für nichts Sinn hatten, als den Haufen Goldes, das der Croupier einstrich oder einem Gewinner hinzählte. Welch eine Welt! Sie widerte mich bis ins Innerste an, ein seltsames Heimweh ergriff mich nach dem Guten, dem Schlichten und wahrhaft Schönen in der Welt. Ich drängte[267] Therese und Lenchen zu den Spielsälen hinaus und ruhte nicht, bis wir fort vom Konversationshaus auf einem herrlichen Bergwald ankamen, von dem aus man das einzig schöne Tal inmitten seiner Berge liegen sieht. Nie habe ich die Natur so geliebt als jetzt, nachdem ich einen Blick getan in diese trostlose, oberflächliche Welt von Modepuppen und Hasardspielern.
Jetzt führe ich Dich in den Gasthof der drei Könige, wo wir zu einem frühen Nachtmahl geladen sind von Geheimrat Monz und Gemahlin.
Das Rendezvous war längst zwischen uns ausgemacht, aber sie hatten unterwegs ein Malheur mit der Post und kamen darum erst heute statt gestern an.
Monz war immer ein wenig feierlich, jetzt ist er der Geheimrat in seiner unantastbaren Würde. Seine Haare sind etwas grau geworden, aber seine Augen blicken mit der alten Schärfe durch die Brillengläser, und auch sein Lächeln, das nie zum herzlichen Lachen wird, ist sich gleichgeblieben.
Seine Frau, die mit residenzlicher Würde ihren prachtvollen Federnhut trägt, im ganzen aber einen behaglichen, gutlaunigen Eindruck macht, begrüßte mich mit den Worten: »Also so sehen Sie aus – wirklich ganz anders, als ich gedacht hätte – Sie glauben nämlich nicht, wie neugierig ich war, die[268] Frau kennenzulernen, die sozusagen meinem Mann den Weg zu seinem ferneren Wirken wies.«
Ein wenig erstaunt, wandte ich Monz den Blick zu.
»Ja, ja,« nickte er, »Sie waren mir eine liebe, äußerst interessante Schülerin; Ihre unbedingte Anerkennung hat mich allerdings auf die große Empfänglichkeit der weiblichen Psyche aufmerksam gemacht. Sie waren damals in Freiburg eine Ausnahme, jetzt sind meine Unterrichtsstunden in der Mädchenschule ein Ereignis für die Jugend. Als Königlicher Geheimrat bin ich mit der Oberaufsicht der höheren Mädchenschulen betraut. Aber noch bin ich nicht zufrieden, möchte ich mehr erreichen.«
Er sprach und sprach, zuweilen ärgerliche Blicke auf einen vorübereilenden Kellner oder fremde Ankömmlinge werfend, die sich unterstanden, in der Nähe unseres Tisches laut zu sprechen.
Mir war recht wunderlich zumute; ich fragte mich: Hat er denn früher schon dieses Gönnerhafte an sich gehabt, das mir jetzt so unangenehm auffällt?
»Jetzt kommt die eigentliche Sache,« sagte er, »die Sache, um die es sich handelt – nämlich, ich bin mit der Bildung einer neuen höheren Mädchenschule beschäftigt. Eine horrende Arbeit, selbstverständlich. Was aber würden Sie sagen, Fräulein Villinger,[269] wenn ich in dieser Angelegenheit an Sie gedacht hätte?«
»Wieso?« fragte ich. »Ich habe doch meine Töchterschule in Rastatt.«
»Das lassen Sie natürlich sein,« sagte er, »das wollen wir schon machen. Einer kleinen Prüfung müßten Sie sich bei mir freilich noch unterziehen. Dann aber sollen Sie unter meiner Leitung zu einer geradezu exemplarischen Lehrerin heranreifen. Das ist meine Überzeugung. Nun, was sagen wir zu diesem Vorschlag?«
Nur mit Mühe konnte ich annähernd artig antworten: »Ich bin aufrichtig überrascht, Herr Geheimrat, aber meine jetzige Stellung ist mir so lieb, daß ich sie um keinen Preis aufgeben möchte.«
»Ist das Ihr Ernst – Anna Villinger – sind Sie denn nicht mehr die Alte?«
»Nein, ich bin viel älter geworden,« gab ich ihm lachend zur Antwort, »älter und selbständiger, Herr Geheimrat.«
»Selbständiger?« fiel er mir in die Rede. »Eine Frau ist von Natur nie selbständig, dazu ist der Mann da, mit seinem Wissen, seiner Erfahrung und seiner geistigen Überlegenheit, die sich eine Frau niemals zu erringen vermag. Liebe Freundin, Sie befinden sich meines Erachtens auf einer abschüssigen[270] Bahn, und ich rate Ihnen, die Hand zu ergreifen, die sich Ihnen wohlwollend entgegenstreckt.«
Gottlob, Lenchen kam, um uns zur Post abzuholen.
Als wir den Gasthof verließen, hing sich mir die Geheimrätin an den Arm.
»Das freut mich jetzt so, Fräulein Villinger,« hub sie an, »daß Sie eine eigene Meinung haben und nicht wie ein Taschenmesser vor meinem Mann zusammenklappen. Die Frauenzimmer verderben ihn mir ganz mit ihrer Bewunderung, und wissen Sie, das verträgt keiner auf die Dauer, drum ist ihm die heutige Niederlage recht gesund. Es ist sonst gut mit ihm auskommen, und ich war recht glücklich, wenn die dummen Frauenzimmer ihn in Ruh ließen. Bleiben Sie wirklich bei Ihrer Meinung?« fragte sie.
»Durchaus.«
Sie schüttelte mir die Hand: »Alle Achtung.«
Monz sagte, indem er mir in den Postwagen half: »Sie besinnen sich noch anders, ich weiß, bitte recht baldigen Bescheid.«
Wir fuhren davon.
»Ach Gott, Nannele, ich war in Todesangst«, sagte Therese.
Ich lachte sie aus: »Glaubst du wirklich, ich habe[271] Lust, meine schöne Selbständigkeit an den Nagel zu hängen und wieder Schülerin zu werden?«
Nein, wirklich, Caton, so war er nicht, so war er früher nicht. Es überkam mich eine plötzliche Angst, so daß ich Therese bat, mir doch ja immer zu sagen, wenn ich unrecht habe, damit ich nicht auch solch ein Narr werde.
Sie lachte und versprach's.
Es ist aber gar nicht zum Lachen, denn da der Lehrer seinen Schülern gegenüber notwendigerweise stets recht haben muß, so liegt die Gefahr nicht weit, sich dieses Immer-recht-haben-Wollen als etwas Selbstverständliches anzugewöhnen. Monz soll mir als abschreckendes Beispiel dienen.
Rastatt, den 7. Juni 1844.
Die Kinder singen im Hofe:
Aus dem Unterland, wo die Eisenbahn jetzt fährt, kommt das Versle angeflogen.
Jetzt geht sie von Karlsruhe nach Offenburg, und schon im nächsten Jahr soll sie bis Freiburg gehen.
Weißt du noch, Caton, wie wir als Kinder von[272] Menschenflügeln träumten? Sollte das jetzt noch schwerfällige Dampfroß der Anfang sein, aus dem in späteren Zeiten sich allmählich ein leicht flatterndes Flügelpaar entpuppt? Einstweilen wollen wir indes mit dem, was uns jetzt beschert ist, zufrieden sein. O Gott, beglückt bis in die letzte Faser unsres Herzens. Welch ein Umschwung für die Menschen, die nach einem Wiedersehen schmachten – o Caton, Luftschlösser steigen aus dem Grunde meiner Seele in bisher ungeahnter Pracht auf. Die Möglichkeit eines Wiedersehens rückt näher und näher. Sechzehn Jahre fast liegen seit unserm letzten Beisammensein im Elternhaus. Die Jugend ging, aber die Liebe blieb.
Siehst Du, was alles aus der sparsamen Führung eines Haushaltes entstehen kann an Freude und Glück, wenn der Sparpfennig langt? Heil unsrer Therese, die es versteht, am rechten Fleck hauszuhalten, ohne Engherzigkeit, aber mit dem Überblick einer erfahrenen Hausfrau. So haben wir die Ellenbogen frei, brauchen nicht ängstlich zu rechnen, sondern dürfen uns mit unaussprechlicher Genugtuung sagen: Auch für die Freude ist etwas übrig. Habe ich einen solchen inneren Jubel jemals mit achtzehn Jahren erlebt wie jetzt in meinen dreißiger Jahren?
Nämlich wir wollen im nächsten Frühjahr – ach, Caton, der heiße Wunsch unsres Herzens –, wir[273] wollen unser Freiburgle wiedersehen – die Ostergesänge im Münster wieder hören, in das freudige, weltbezwingende Halleluja mit den Sängern auf dem Chor einstimmen – die geliebten Gassen durchschreiten – unsre Gäßle, Caton – und am Grabe der Eltern beten. –
Aber bis dort ist es noch lang, und inzwischen haben wir wieder viel erlebt. Freilich behauptet Therese, ich mache aus jedem Stecknadelknöpfle ein Erlebnis, aber diesmal ist es etwas Wichtiges – denn gibt es etwas Wichtigeres, als daß meine Schule nicht länger unter dem Joch unwürdiger Lehrer zu seufzen hat, sondern einem schönen, erfreulichen Aufblühen entgegensieht unter dem Einfluß des ernsten, wohlwollenden Mannes, der mir nun zur Seite steht – eines Mannes, der allein schon durch sein Wesen Respekt einzuflößen vermag.
Auch mit der noch sehr jungen Hilfslehrerin kann ich zufrieden sein, um so mehr, als ich selbst noch bildend und fördernd auf sie einwirken kann, uns also ein freundliches Band verknüpft.
O Caton, und der Professor hat ein überaus herziges, ganz prächtiges Fraule. Sie wohnen in der Herrenstraße, zunächst dem Schloß, und täglich sehe ich sie mit ihren fünf Buben am Lyzeum vorbei in den Schloßgarten ziehen. Von der zierlichsten Gestalt,[274] wie ein junges Mädele, hört man sie lachen und schelten inmitten ihrer die Mutter eng umdrängenden Buben, von denen sie einer schon überragt.
Eines Tages trafen wir uns im Schloßgarten, der Professor war mit dabei und machte mich mit seiner Frau bekannt. Gleich beim ersten Blick nahmen wir uns an und plauderten miteinander, als kennten wir uns schon Jahre. Sie ist eine Schwäbin mit prachtvollen braunen Augen, die so viel Herzensgüte und Heiterkeit ausstrahlen, daß man schon froh wird bloß durch ihren Blick. Kurzum ein Mensch – und ein lieber, lieber –
O Caton, Du weißt nicht, aber jetzt kann ich Dir's gestehen, so manchesmal, wenn ich vom Schloß in die Gassen hinunterschritt, die breit sind und still wie ausgestorben, suchte mein Blick wohl in jedes dieser niedrigen Häuslein einzudringen mit der sehnsüchtigen Frage: Braucht denn hier niemand Wohlwollen, niemand Liebe und Mitempfinden in Freud und Leid? – O ihr geschlossenen Häuser und Seelen, klagte es in mir, euer Kinder Wohl vertraut ihr mir an, aber um mein Wohl kümmert sich auch nicht eine Seele.
Und jetzt, siehst Du, Caton, jetzt hat das Fraule allem ein Ende gemacht. Es kommt die Treppe herauf, wie 's jüngste Mädele und will alles wissen und will immer helfen und tut, als ob's gar nicht mehr[275] sein könnt, ohne täglich im Sibyllenbau einzukehren, sein Herz auszuschütten und mich zu dem Aussprechen meiner Gedanken zu bewegen. – Mein Ölbild von Baron Ö., das über der Komode hängt, sah sie lange an. »Dieser Mann hat Sie geliebt,« sagte sie. Ich fuhr ganz erschrocken auf: »Wie kommen Sie auf diesen Gedanken?« Sie lächelte: »Das ist nicht schwer. Aber wie schön, daß er's nicht merken ließ, und Sie's nicht merkten.«
Gottlob, Gottlob – ach wie versinkt das alles im Zusammensein mit den prächtigen Buben und ihrem flinken Mütterle, an dem sie mit rührender Liebe hängen.
Vor dem Vater haben sie einen gewaltigen Respekt, vielleicht gerade, weil er sich nicht viel mit ihnen abgibt, sondern die Erziehung der Söhne der Frau überläßt. Er muß Ruhe haben, denn neben seinen vielen Schulstunden arbeitet er an einem naturwissenschaftlichen Werk für die Jugend, und manchmal teilt er mir ein wenig aus seinen Arbeiten mit – immer ein Fest für mich.
So leb ich ferner nicht mehr einsam in meinem verwunschenen Schloß, dessen Geistern nachspürend, die einst in Fleisch und Blut seine Räume durchwandelt. Ade sage ich ihnen, macht dem warmen Leben Platz, den kräftigen Fußtritten junger Gesellen[276] und dem herzlichen Lachen des liebenswürdigsten Mundes.
Rastatt, den 21. April 1845.
Es hat Dich wundergenommen, liebe Caton, daß ich Dir von Freiburg keinen Brief schrieb. Du dachtest, von da müsse einer kommen, wie noch nie einer da war. Ich habe es eigentlich auch gedacht, aber es kam anders.
Das Gefühl der Sehnsucht, das Gefühl der unbeschreiblichen Ungeduld, die Heimat wiederzusehen, wurde durch die Erfüllung nicht gesteigert. So schnell, ja, bänglich schnell uns der Zug dahintrug, es ging uns noch immer nicht schnell genug. Aber die Ängstlichkeit der Mitreisenden steckte uns doch auch ein wenig an. Sie fuhren alle, wie wir, zum ersten Male mit der Eisenbahn, und so oft der Zug mit einem plötzlichen Ruck an einer Station hielt, schrien sie laut auf und stießen mit den Köpfen gegeneinander. Zwei alte Damen waren von einem Eisenbahnunglück so überzeugt, daß sie während der ganzen Fahrt mit hochgezogenen Knien auf ihrem Sitz saßen und uns aufforderten, das gleiche zu tun, man habe ihnen gesagt, daß, wenn es ein Unglück gäbe, man wenigstens auf diese Weise seine Beine rette.
Du kannst Dir denken, wie uns war, als wir von Hermann, den wir zum ersten Male in Uniform sahen, von Baurittels und Fromherzens am Bahnhof begrüßt wurden – ach und die alte Heimatluft wieder atmeten. Wir weinten schrecklich – das war unsere erste Leistung. Der junge Mann mit den zweisternigen Epauletten, den rabenschwarzen Haaren und dem rabenschwarzen Bärtchen, dessen Augen so braunlachend in die Welt schauen, und dessen Wangen dasselbe leuchtende Rot zeigen wie das der Schwester Caton – solltest Du glauben, es brauchte eine ganze Weile, bis ich mit unserm Hermännle wieder ins alte Geleise kam?
Vieles war ja, wie wir's uns ausgemalt, Therese und ich. Sie wohnte bei Baurittels, ich bei Fromherzens, aufgehoben wie in Abrahams Schoß. Und als wir drei Geschwister am Grabe der Eltern standen – laß mich über diese Stunde schweigen. –
Ohne die Meinen suchte ich später zwei wohlbekannte Kreuze auf und wunderte mich, wie verwittert und verblaßt mich die Namen der einst so innig geliebten Freundinnen: Maria von Verleb und Amalie Kozlowska – anblickten.
Stille Wehmut ergriff mich, aber der Schmerz, der damals mein Jungmädchenherz so gewaltsam an dieser Stelle erschütterte – damit war's vorbei.
Auch vor Rottecks Grab stand ich, der Zeit seines Wirkens gedenkend, die ich erleben durfte, und die vielleicht das Beste in meinem Inneren wachgerufen. Ach, daß ich diesen feinsinnigen, edlen Volksfreund nicht mehr am Leben fand, um ihm zu sagen, wieviel Gutes er mir und so vielen andern getan – Schmach meiner Heimat, wenn sie ihm kein Andenken bewahrt. –
Auch polnische Namen fand ich da und dort auf einem Grabstein. Wie diese Zeit wieder vor mir auftauchte – Grotecki – Du weißt, wie's einmal um mich stand, Caton! – Da liest man zuweilen, wie alte Frauen in Tränen zerfließen, wenn sie dem Mann ihrer ersten Liebe wieder begegnen. So etwas kommt gewiß nur in Romanen vor. Wenn Grotecki plötzlich vor mir auftauchte, was wär dann? Ich weiß nichts mehr von jener Leidenschaft, die mich einst durchschauert, ich begreife sie nicht mehr. – Gott, dieses Erkalten, wie entsetzlich für jene, die ihrer Leidenschaft zum Opfer geworden! – Arme Prinzessin von Ahlden, winkst du mir auch wieder aus deinem alten Schloß im Norden, wo dir soviel Zeit gegeben war, deiner unseligen Liebe zu gedenken? Hast du sie gesegnet, oder begreifst du sie auch nicht mehr – arme Prinzessin von Ahlden. –
Ach, die vielen bekannten Namen auf dem Friedhof, wie fehlten sie mir in den Gassen. Fremde Gesichter auf allen unsern Wegen. Therese sagte: »Man fühlt sich ja gar nimmer daheim.«
Wir wohnten ja nicht beisammen, und doch trafen wir immer wieder zu jeder Tagesstunde in Oberlinden zusammen, vor unsrer einstigen Wohnung. Dann berieten wir, wollen wir in den Flur treten, wollen wir die liebe, liebe Treppe hinaufgehen und an irgendeine Tür klopfen, mit der Bitte, eintreten zu dürfen, nur um einmal wieder einen Blick in unsre ehemaligen Stuben zu tun? – Aber dann hatten wir wieder Angst, es könne drinnen alles so ganz anders sein als früher, und das würde uns doch mehr kränken und enttäuschen – so daß wir schleunigst den Flur verließen und wieder auf die Gasse traten und davongingen mit einem letzten schüchternen Blick zum Altan hinauf. Und Therese sagte: »Erwartest du nicht auch immer, es müsse etwas kommen?«
»Ja, Therese – ach ja.«
»Und dann kommt man wieder und wieder, und es ist immer dasselbe.«
»Immer dasselbe – was soll denn auch kommen, Therese?«
»Richtig, da seid ihr wieder.« –
Hermanns Stimme war's, des Bruders liebe, lebensfrohe Erscheinung, und es war so, als führe er uns aus den düstern Schatten der Vergangenheit in die frische, lebendige Gegenwart hinein.
Noch eins. Bei meiner Rückkehr von Freiburg fand ich ein Geschenk des Barons vor, ein ganz köstliches Aquarell: Clothilde als schönes, schlankes Mädchen an der Seite eines hochgewachsenen, bildhübschen Offiziers. Darunter steht: »Elferl und Hampelmann im siebenten Himmel.«
Über den beiden aber schwebt ein Engelchen, das des kleinen Rudis Züge trägt.
Es hat mich tief ergriffen.
Rastatt, 1. Mai 1845.
Liebste Caton!
Petersens Vorschlag soll uns recht sein, da er es für durchaus nötig findet, daß Du in aller Ruhe die Ferien ohne Deine Söhne mit uns genießest. Du weißt ja, wie sehr sich die Schwestern Deines Mannes freuen, ihren geliebten Neffen für eine Weile die Mutter ersetzen zu dürfen, also kannst Du Deine Reise, wenn auch mit dem unausbleiblichen Trennungsschmerz, aber doch sorgenlos antreten. Gesegnet[281] sei die Eisenbahn, die Dich schon in wenigen Tagen ans Ziel bringt, das mit der Post kaum in zehn Tagen zu erreichen war.
Mach' Dir's um Gottes willen nur recht klar, daß die Eisenbahn nicht so gefällig ist wie die Post und auf ihre Reisenden wartet. Nun, Petersen wird Dir wohl alles genugsam einprägen. Ach, ich bin ihm so dankbar, es gibt keine Worte, die ihm meinen so heißen Herzensdank genugsam auszudrücken vermöchten. Nicht leicht wird es ihm werden, auf Wochen das geliebte Weibele entbehren zu müssen, damit endlich, endlich die so lang getrennten Schwestern sich wiedersehen. Und nicht genug des Glücks – der teure Schwager holt Dich in den Herbstferien ab und kommt nicht allein, kommt mit unsern heißgeliebten Neffen.
Die beiden, bisher hinter Schloß und Riegel liegenden Wohnräume sind weit geöffnet, und die Sonne durchwärmt die nicht länger kahl und leer stehenden Zimmer, die wir, einem seligen Vogelpärle gleich, zum behaglichsten Nestle einrichten, und es ist wundernett, wie oft Therese und ich unter der Türe zusammenstoßen mit irgendeinem Gegenstand, weil wir immer wieder etwas finden, das unserm Schwesterle zur Fremde dienen soll. Und dann lachen wir. Und weißt Du, wer mitlacht und alles Fehlende[282] an Möbeln und Teppichen und Sonstigem herbeischleppt, daß wir uns nur wehren müssen, aber ohne Erfolg? – 's Fraule, Caton, das liebe, herzige Fraule! – Und wie gut kommt uns ihre Hilfe, denn wir müssen gleich beide Zimmer einrichten, da auch Hermann nicht erwarten kann, die langentbehrte Schwester zu begrüßen.
»Sag, Tante Anna, spreche am End' deine Neffe Hochdeutsch?« fragte gestern der Älteste vom Fraule. Und als ich nickte: »Das werden sie wohl« – erklärte er: »Dann prügeln wir sie so lang, bis sie's nimmer tun.«
Ich stifte jetzt schon Frieden.
O Caton, mit der Briefschreiberei hat's nun ein Ende.
Du große Güte Gottes – ein Wiedersehen, ein Beieinandersitzen und wieder ganz jung werden. Mutter würde sagen: »Du Närrle.« – Und so ist mir auch, ich muß, bevor ich in die Klasse trete, meinem Gesicht erst den nötigen Ernst geben; ich muß mich selber ganz fest in die Hand nehmen und die Grammatik dazu, denn ich möchte am liebsten den Kindern sagen: »Denkt euch, Caton kommt – und Caton ist wie die Sonne, die alles lebendig macht – und – und – und – kurzum.«
Therese läßt Dir sagen, Du sollst Dir wegen der Sommertoiletten keine grauen Haare wachsen lassen. Wir haben nämlich durch Lenchen – Du, wie sich Lenchen freut – also durch sie Gelegenheit, aus einem bescheidenen Geschäft in Baden die schönsten Stoffe zu bekommen, zum billigsten Preis. So wartet Deiner ein gelblich-brauner Barege; der Rock ist schon fertig, sehr weit, die Erde berührend; aber ob Du noch eine Wespentaille hast, das ist ein wenig die Frage, und darum kann die Taille erst bei Deinem Hiersein fertiggemacht werden. Die Mantille aus Mutters achteckigem Schal liegt, wie Du weißt, schon bereit. Du wirst staunen über Theresens Meisterwerk. –
Wir werden überhaupt staunen, uns ältlich wiederzufinden, nachdem wir uns zuletzt jung und blühend in die Augen geschaut. Aber haben wir nicht auch gewonnen an Lebenseinsicht und Herzensreife, und werden es nicht einzig schöne Tage und Abende sein, an denen wir einander von neuem kennenlernen?
O Caton, und wenn wir Arm in Arm durchs Schloß schreiten – denn ich hab' es ganz in Besitz genommen, kenne Weg und Steg, verkehre im Geiste mit seinen Fürsten und Fürstinnen; und was einst ihnen gehörte, gehört jetzt mir, dem Habenichtsle,[284] aus keinem andern Grund, als weil ich lebe und mich von ganzer Seele an dieser Herrlichkeit erfreue.
Dem Besitzlosen gehört die Welt nicht weniger als dem andern – denn was das Auge umfassen und das Herz zu lieben vermag, gehört ihm an.
O Caton, mir ist, als müsse ich an die Brust schlagen mit der zagenden Frage: Gott, Gott, ist es nicht zuviel der Wonne auf meinen Teil, daß ich sagen darf:
Auf Wiedersehen
Du meine Herzensschwester.
Verlag August Scherl G. m. b. H., Berlin
Die neuesten Romane
Die Opferschale
Roman von Ida Boy-Ed
Die Dichterin hat sich in ihrem neuesten Werke von den gewaltigen Erscheinungen und Begebnissen unseres Weltkrieges anregen lassen. Alles, was in diesem großzügigen Buche geschieht, was das Schicksal der Menschen lenkt und entscheidet, entwickelt sich aus dem furchtbaren Völkerringen. Und doch ist es kein Kriegsroman im allgemeinen Sinne, sondern ein echter Zeitroman mit tiefbewegenden Herzensgeschichten edler und tapferer Frauen, der eindringlich empfinden läßt was die Dichterin dem Buch als Leitmotiv mitgeben wollte: Unsere gewaltige Zeit trägt die Frau über ganze Strecken ihrer Entwicklung und Kämpfe hinweg, fort von irreführenden Wegen, vorbei an falschen Zielen, um sie wieder auf den Thron der reinen Weiblichkeit zu erheben.
In künstlerischem Geschenk-Einband 5 Mark. Elegant broschiert 4 Mark.
Die das Leben zwingen
Zwei Erzählungen von Sophie Kloerss
Die Verfasserin schildert in der inhaltschweren ersten Geschichte aus schwerer Zeit »Niemand hat größere Liebe« die Not Ostpreußens vor einem Jahrhundert. Im Mittelpunkt der Handlung steht der Pfarrer eines kleinen Dorfes am Kurischen Haff, ein Held, der in Wort und Schrift das Volk zum Kampfe gegen den Korsen aufrüttelt. Ihm zur Seite eine echte deutsche Frau mit unerschütterlichem Glauben an des Vaterlandes kommende Größe. Ein Hauch der Wehmut zieht durch den Schluß. – Der sich anschließende gediegene Roman »Der Hoferbe« spielt an der mecklenburgischen Wasserkante. Er behandelt den Zwiespalt in einer Bauernfamilie, der aus dem starren Willen der Eltern entsteht, das Schicksal ihrer Kinder gewaltsam gestalten zu wollen.
In künstlerischem Geschenk-Einband 4 Mark. Elegant broschiert 3 Mark.
Das Barbiermädel
Soldaten-Roman aus Österreich
von Johannes Thummerer
In dem Welttrauerspiel ein Rest von Übermut sich zu bewahren, ist eine köstliche Kunst. Und diesen Übermut so zu äußern, daß er nicht kränkt, sondern erfreut, das ist dem Verfasser trefflich gelungen. In seinem Roman tummelt sich eine Fülle lebensvoller Hechtgrauer, Deutsche und Slawen, alle mit einem Stich ins Humorvolle, aber im Kern tüchtige Kerle. Und dazwischen als wahrhafte Heldin da tapfere Lieserl, das den vermeintlichen Zusammenbruch seiner Liebesseligkeit in nimmermüde Vaterlandsliebe ummünzt, sich als Krankenpflegerin ihren Schatz wiedererobert. Ein Buch voll Wärme und Licht.
Elegant broschiert 1 Mark.
Romane
König und Kärrner.
Roman von Rudolph Stratz. Ein Preislied auf den sonnigen Humor der fröhlichen Pfalz und die quellende Riesenkraft der deutschen Friedensarbeit. Geheftet 4 Mark. Künstlerisch gebunden 5 Mark.
Der große Rachen.
Roman von Olga Wohlbrück. Ein moderner Berliner Roman, der mit packender Anschaulichkeit, bezwingender Darstellungskraft und fesselndem Humor die Spielwut schildert, die Lust und Leidenschaft zum Totalisator, die Existenzen verschlingt und Familien zugrunde richtet. Geheftet 4 Mark. In künstlerischem Einband 5 Mark.
Die werdende Macht.
Roman von Otto von Gottberg. Die Geschichte der Liebe und jungen Ehe eines Seeoffiziers. Aus der lebendigen Wirklichkeit vor Ausbruch des Krieges. Wir lernen alle Typen unserer Kriegsschiffe kennen, den schweren Dienst an Bord, die Stählung zu den kommenden Heldentaten. Geheftet 3 Mark. In künstlerischem Geschenk-Einband 4 Mark.
Die Wacht im fernen Osten.
Roman von Richard Küas. Ostasiatischer Roman, der in Schanghai und Tsingtau spielt. Im Mittelpunkt das Geschick eines Deutschen, dessen Träume vom Weltbürgertum der Weltkrieg vernichtet. Geheftet 3 Mark. Künstlerisch gebunden 4 Mark.
Unter den Blutbuchen.
Roman von Emmi Lewald. Die Schicksale junger Mädchen in einer Kleinstadt. Voll Humor und Tragik zugleich. Von der bekannten Verfasserin meisterhaft geschildert. Geheftet 3 Mark. Künstlerisch gebunden 4 Mark.
Cornelie Arendt.
Roman aus Alt-Berlin von Felix Philippi. Eine spannende Erzählung vom Menschenglück und Menschenleid aus dem Berlin der sechziger Jahre mit seinem eigenartigen Zauber trauter Heimlichkeit, verschwiegener Reize und verträumter Schönheiten. Geheftet 2 Mark. In künstlerischem Einband 4 Mark.
Hotel Gigantic.
Roman von Felix Philippi. Das buntbewegte internationale Leben und Treiben in einer der größten und prunkvollsten Karavansereien der Schweiz bei Ausbruch des Weltkrieges. Inmitten der Handlung der Kampf einer verführerisch schönen Spionin gegen einen deutschen Diplomaten, der mit wichtigen Dokumenten nach Berlin unterwegs ist. Geheftet 3 Mark. Künstlerisch gebunden 4 Mark.
Der Rosenhof.
Roman von Lisa Wenger. Die Geschichte einer Jugendliebe. Nach Leiden und Freuden, Entfremdung und Trennung endlich die Vereinigung. Geheftet 3 M. Künstlerisch gebund. 4 M.
Kriegs-Abenteuer
Seine Hoheit – der Kohlentrimmer.
Die Kriegsheimfahrt des Herzogs Heinrich Borwin zu Mecklenburg. Von Johann zur Plassow. Der Herzog, der als naturfreudiger Sportsmann alljährlich gerne einige Wochen unter den Cowboys verbringt, wird drüben vom Ausbruch des Krieges überrascht. Die Engländer erschweren die Rückkehr des in Amerika wohlbekannten Fürsten durch Aussetzen eines Fanggeldes von 2000 Pfund. Zahlreiche Spione heften sich dem kostbaren an die Fersen. Aber mit stählernder Willenskraft kämpft sich der Herzog durch alle Schwierigkeiten und Gefahren hindurch, er scheut nicht vor der mühseligsten Arbeit, nicht vor der schmutzigsten Verkleidung zurück und gelangt über New York, Kirkwall und Kristiania glücklich in die bedrohte Heimat. Die Erzählung besticht durch ungekünstelte frische Wiedergabe. Mit zwei Aufnahmen. – Preis 1 Mark. Vorzugs-Ausgabe: geheftet 3 Mark, gebunden 4 Mark.
Kriegsgefangen – über England entflohen!
Von Lt. d. R. Robert Neubau. Der Verfasser, der nun schon seit Monaten als Offizier im Osten kämpft, war in französische Gefangenschaft geraten. Schlicht und vom Geiste reiner Vaterlandsliebe durchdrungen, erzählt er seine Schicksale in Feindesland und die ihm mit geradezu indianerhafter List gelungene Flucht. – Inhalt: Gefangen – Im Gefangenenlager in der Bretagne – Die deutsche Zeitung aus Paris – Arbeit und Unterhaltung – Fluchtgedanken – Der Fluchtplan zunichte – Im Arrest – Das schwere Los des Hafenarbeiters – Neue Fluchtgedanken – Die Flucht – Auf einem englischen Dampfer versteckt – Vierundzwanzig Stunden im Warenstapel auf dem Kai – Englische Wachtposten überlistet – An Bord nach England – Aus dem englischen Hafen nach Schweden – Heimwärts. – Preis 1 Mark.
Fremdenlegionär Kirsch.
Von Kamerun in den deutschen Schützengraben. Von Hans Paasche. Wahrheitsgetreue Erzählung der abenteuerlichen Erlebnisse des tapferen jungen Deutschen. Dem Buche sind authentische Bilder und Dokumente beigegeben. Inhalt: Bei Kriegsausbruch in Kamerun – Meuterei an Bord der »Marina« – In englischer Kriegsgefangenschaft an der Goldküste – Die Flucht durch den afrikanischen Busch – Wie ich den Franzosen in Dahome in die Hände fiel – Als Kohlentrimmer von Dahome nach Senegambien – Als Rekrut der Fremdenlegion nach Marokko – Von Marokko nach Bordeaux – Beim Ersten Fremdenregiment in Bayonne – Fluchtversuch in den Pyrenäen – Vor dem Kriegsgericht – Im Gefängnis – Nach Lyon – Auf dem Schießplatz von La Valbonne – Fluchtversuch nach der Schweiz – In den französischen Schützengräben – Im Hexenkessel auf französischer Seite – Als Ueberläufer in den deutschen Schützengraben. – Geheftet 1 M. Elegant gebunden 2 M.
Deutsche Helden der Luft
Immelmann †. Meine Kampfflüge.
Selbsterlebt und selbsterzählt von Oberleutnant Max Immelmann. – Das mit 25 Originalaufnahmen versehene Buch enthält die Erlebnisse eines unserer ruhmreichsten Kampfflieger, von ihm selbst lebendig und packend in Briefen an seine Mutter geschildert. Immelmann hatte die Herausgabe dieser Briefe noch kurz vor seinem Tode vorbereitet und sie, »um der Jugend Enttäuschungen zu ersparen, die nüchternen Aufzeichnungen eines Fliegers« genannt. Aber sie sind weit mehr: nämlich das unvergängliche Denkmal glänzender Taten, wie sie früher die kühnste Einbildungskraft nicht für möglich gehalten hätte. Preis 1 Mark. Gebunden 2 Mark.
Doppeldecker »C 666«.
Als Flieger im Westen. Von Oberleutnant Heydemarck. Der Verfasser will aus dem unmittelbaren, täglichen Erleben uns in der Heimat und den feldgrauen Kameraden ein Bild von der Tätigkeit der Fliegerei geben. Er greift einen kleinen, aber interessanten Abschnitt heraus: Die Fernaufklärung. – Inhalt: Vorwort – Fernaufklärung – Durch die Wolken – Bomben auf Bahnhof Yvocourt – Minus 30° – Gehetzt – Nachtflug – Bange Minuten – Und doch! – Motorpanne – In den Nebel hinein – Der letzte Flug von »C 666«. – Geheftet 1 Mark. Elegant gebunden 2 Mark.
»Z 181«. Im Zeppelin gegen Bukarest.
Von dem Ersten Offizier eines »Z«-Luftschiffes. Einer unserer jungen Zeppelin-Offiziere hat als erster die Erlaubnis erhalten, seine Erlebnisse bei einem erfolgreichen Luftangriff gegen Bukarest zu erzählen. Natürlich gibt er keine Phantasieschilderungen, sondern Tatsachen; er schreibt als Fachmann, aber mit der Lebendigkeit und Anschaulichkeit eines Schriftstellers. Und der Leser erlebt mit tiefer Anteilnahme die höchst dramatischen Augenblicke eines Luftangriffes. – Geheftet 1 Mark. Gebunden 2 Mark.
Kriegs-Album der »Woche«
Enthält aus der Fülle der photographischen Berichterstattung mehrere hundert Bilder der heldenhaften Kämpfe unserer verbündeten Armeen und die amtlichen Meldungen der Heeresleitungen.
Erster Band (22. Sonderheft der »Woche«): umfaßt die Zeit vom Beginn des Krieges bis Ende November 1914. In künstlerischem Einband 3 Mark.
Zweiter Band (23 Sonderheft der »Woche«): umfaßt die Zeit von Anfang Dezember 1914 bis Ende April 1915. In künstlerischem Einband 3 Mark.
Dritter Band (24. Sonderheft der »Woche«): umfaßt die Zeit von Anfang Mai bis Ende Oktober 1915. In künstlerischem Einband 3 Mark.
Vierter Band (25. Sonderheft der »Woche«): umfaßt die Zeit von Anfang November 1915 bis Ende April 1916. In künstlerischem Einband 3 Mark.
Weitere Anmerkungen zur Transkription
Offensichtliche Fehler wurden stillschweigend korrigiert. Die Darstellung der Ellipsen wurde vereinheitlicht.
Korrekturen:
S. 43: strapezieren → strapazieren
Mutters Beutel nicht zu sehr strapazieren
S. 108: Unmüdigkeit → Unmündigkeit
in ewiger Unmündigkeit neben ihm her wandeln
***END OF THE PROJECT GUTENBERG EBOOK MEINE TANTE ANNA***
******* This file should be named 54305-h.htm or 54305-h.zip *******
This and all associated files of various formats will be found in:
http://www.gutenberg.org/5/4/3/0/54305
Updated editions will replace the previous one--the old editions will be renamed.
Creating the works from print editions not protected by U.S. copyright law means that no one owns a United States copyright in these works, so the Foundation (and you!) can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalties. Special rules, set forth in the General Terms of Use part of this license, apply to copying and distributing Project Gutenberg-tm electronic works to protect the PROJECT GUTENBERG-tm concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for the eBooks, unless you receive specific permission. If you do not charge anything for copies of this eBook, complying with the rules is very easy. You may use this eBook for nearly any purpose such as creation of derivative works, reports, performances and research. They may be modified and printed and given away--you may do practically ANYTHING in the United States with eBooks not protected by U.S. copyright law. Redistribution is subject to the trademark license, especially commercial redistribution.
To protect the Project Gutenberg-tm mission of promoting the free distribution of electronic works, by using or distributing this work (or any other work associated in any way with the phrase "Project Gutenberg"), you agree to comply with all the terms of the Full Project Gutenberg-tm License available with this file or online at www.gutenberg.org/license.
1.A. By reading or using any part of this Project Gutenberg-tm electronic work, you indicate that you have read, understand, agree to and accept all the terms of this license and intellectual property (trademark/copyright) agreement. If you do not agree to abide by all the terms of this agreement, you must cease using and return or destroy all copies of Project Gutenberg-tm electronic works in your possession. If you paid a fee for obtaining a copy of or access to a Project Gutenberg-tm electronic work and you do not agree to be bound by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph 1.E.8.
1.B. "Project Gutenberg" is a registered trademark. It may only be used on or associated in any way with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few things that you can do with most Project Gutenberg-tm electronic works even without complying with the full terms of this agreement. See paragraph 1.C below. There are a lot of things you can do with Project Gutenberg-tm electronic works if you follow the terms of this agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg-tm electronic works. See paragraph 1.E below.
1.C. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation ("the Foundation" or PGLAF), owns a compilation copyright in the collection of Project Gutenberg-tm electronic works. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States. If an individual work is unprotected by copyright law in the United States and you are located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the work as long as all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg-tm mission of promoting free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg-tm works in compliance with the terms of this agreement for keeping the Project Gutenberg-tm name associated with the work. You can easily comply with the terms of this agreement by keeping this work in the same format with its attached full Project Gutenberg-tm License when you share it without charge with others.
1.D. The copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in a constant state of change. If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before downloading, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this work or any other Project Gutenberg-tm work. The Foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country outside the United States.
1.E. Unless you have removed all references to Project Gutenberg:
1.E.1. The following sentence, with active links to, or other immediate access to, the full Project Gutenberg-tm License must appear prominently whenever any copy of a Project Gutenberg-tm work (any work on which the phrase "Project Gutenberg" appears, or with which the phrase "Project Gutenberg" is associated) is accessed, displayed, performed, viewed, copied or distributed:
This eBook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this eBook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you'll have to check the laws of the country where you are located before using this ebook.
1.E.2. If an individual Project Gutenberg-tm electronic work is derived from texts not protected by U.S. copyright law (does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder), the work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charges. If you are redistributing or providing access to a work with the phrase "Project Gutenberg" associated with or appearing on the work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 or obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg-tm trademark as set forth in paragraphs 1.E.8 or 1.E.9.
1.E.3. If an individual Project Gutenberg-tm electronic work is posted with the permission of the copyright holder, your use and distribution must comply with both paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 and any additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked to the Project Gutenberg-tm License for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work.
1.E.4. Do not unlink or detach or remove the full Project Gutenberg-tm License terms from this work, or any files containing a part of this work or any other work associated with Project Gutenberg-tm.
1.E.5. Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic work, or any part of this electronic work, without prominently displaying the sentence set forth in paragraph 1.E.1 with active links or immediate access to the full terms of the Project Gutenberg-tm License.
1.E.6. You may convert to and distribute this work in any binary, compressed, marked up, nonproprietary or proprietary form, including any word processing or hypertext form. However, if you provide access to or distribute copies of a Project Gutenberg-tm work in a format other than "Plain Vanilla ASCII" or other format used in the official version posted on the official Project Gutenberg-tm web site (www.gutenberg.org), you must, at no additional cost, fee or expense to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon request, of the work in its original "Plain Vanilla ASCII" or other form. Any alternate format must include the full Project Gutenberg-tm License as specified in paragraph 1.E.1.
1.E.7. Do not charge a fee for access to, viewing, displaying, performing, copying or distributing any Project Gutenberg-tm works unless you comply with paragraph 1.E.8 or 1.E.9.
1.E.8. You may charge a reasonable fee for copies of or providing access to or distributing Project Gutenberg-tm electronic works provided that
1.E.9. If you wish to charge a fee or distribute a Project Gutenberg-tm electronic work or group of works on different terms than are set forth in this agreement, you must obtain permission in writing from both the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and The Project Gutenberg Trademark LLC, the owner of the Project Gutenberg-tm trademark. Contact the Foundation as set forth in Section 3 below.
1.F.
1.F.1. Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread works not protected by U.S. copyright law in creating the Project Gutenberg-tm collection. Despite these efforts, Project Gutenberg-tm electronic works, and the medium on which they may be stored, may contain "Defects," such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a computer virus, or computer codes that damage or cannot be read by your equipment.
1.F.2. LIMITED WARRANTY, DISCLAIMER OF DAMAGES - Except for the "Right of Replacement or Refund" described in paragraph 1.F.3, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project Gutenberg-tm trademark, and any other party distributing a Project Gutenberg-tm electronic work under this agreement, disclaim all liability to you for damages, costs and expenses, including legal fees. YOU AGREE THAT YOU HAVE NO REMEDIES FOR NEGLIGENCE, STRICT LIABILITY, BREACH OF WARRANTY OR BREACH OF CONTRACT EXCEPT THOSE PROVIDED IN PARAGRAPH 1.F.3. YOU AGREE THAT THE FOUNDATION, THE TRADEMARK OWNER, AND ANY DISTRIBUTOR UNDER THIS AGREEMENT WILL NOT BE LIABLE TO YOU FOR ACTUAL, DIRECT, INDIRECT, CONSEQUENTIAL, PUNITIVE OR INCIDENTAL DAMAGES EVEN IF YOU GIVE NOTICE OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
1.F.3. LIMITED RIGHT OF REPLACEMENT OR REFUND - If you discover a defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can receive a refund of the money (if any) you paid for it by sending a written explanation to the person you received the work from. If you received the work on a physical medium, you must return the medium with your written explanation. The person or entity that provided you with the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a refund. If you received the work electronically, the person or entity providing it to you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy is also defective, you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem.
1.F.4. Except for the limited right of replacement or refund set forth in paragraph 1.F.3, this work is provided to you 'AS-IS', WITH NO OTHER WARRANTIES OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR ANY PURPOSE.
1.F.5. Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain types of damages. If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any provision of this agreement shall not void the remaining provisions.
1.F.6. INDEMNITY - You agree to indemnify and hold the Foundation, the trademark owner, any agent or employee of the Foundation, anyone providing copies of Project Gutenberg-tm electronic works in accordance with this agreement, and any volunteers associated with the production, promotion and distribution of Project Gutenberg-tm electronic works, harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees, that arise directly or indirectly from any of the following which you do or cause to occur: (a) distribution of this or any Project Gutenberg-tm work, (b) alteration, modification, or additions or deletions to any Project Gutenberg-tm work, and (c) any Defect you cause.
Project Gutenberg-tm is synonymous with the free distribution of electronic works in formats readable by the widest variety of computers including obsolete, old, middle-aged and new computers. It exists because of the efforts of hundreds of volunteers and donations from people in all walks of life.
Volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need are critical to reaching Project Gutenberg-tm's goals and ensuring that the Project Gutenberg-tm collection will remain freely available for generations to come. In 2001, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure and permanent future for Project Gutenberg-tm and future generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and how your efforts and donations can help, see Sections 3 and 4 and the Foundation information page at www.gutenberg.org.
The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non profit 501(c)(3) educational corporation organized under the laws of the state of Mississippi and granted tax exempt status by the Internal Revenue Service. The Foundation's EIN or federal tax identification number is 64-6221541. Contributions to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent permitted by U.S. federal laws and your state's laws.
The Foundation's principal office is in Fairbanks, Alaska, with the mailing address: PO Box 750175, Fairbanks, AK 99775, but its volunteers and employees are scattered throughout numerous locations. Its business office is located at 809 North 1500 West, Salt Lake City, UT 84116, (801) 596-1887. Email contact links and up to date contact information can be found at the Foundation's web site and official page at www.gutenberg.org/contact
For additional contact information:
Dr. Gregory B. Newby
Chief Executive and Director
gbnewby@pglaf.org
Project Gutenberg-tm depends upon and cannot survive without wide spread public support and donations to carry out its mission of increasing the number of public domain and licensed works that can be freely distributed in machine readable form accessible by the widest array of equipment including outdated equipment. Many small donations ($1 to $5,000) are particularly important to maintaining tax exempt status with the IRS.
The Foundation is committed to complying with the laws regulating charities and charitable donations in all 50 states of the United States. Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort, much paperwork and many fees to meet and keep up with these requirements. We do not solicit donations in locations where we have not received written confirmation of compliance. To SEND DONATIONS or determine the status of compliance for any particular state visit www.gutenberg.org/donate.
While we cannot and do not solicit contributions from states where we have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition against accepting unsolicited donations from donors in such states who approach us with offers to donate.
International donations are gratefully accepted, but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the United States. U.S. laws alone swamp our small staff.
Please check the Project Gutenberg Web pages for current donation methods and addresses. Donations are accepted in a number of other ways including checks, online payments and credit card donations. To donate, please visit: www.gutenberg.org/donate
Professor Michael S. Hart was the originator of the Project Gutenberg-tm concept of a library of electronic works that could be freely shared with anyone. For forty years, he produced and distributed Project Gutenberg-tm eBooks with only a loose network of volunteer support.
Project Gutenberg-tm eBooks are often created from several printed editions, all of which are confirmed as not protected by copyright in the U.S. unless a copyright notice is included. Thus, we do not necessarily keep eBooks in compliance with any particular paper edition.
Most people start at our Web site which has the main PG search facility: www.gutenberg.org
This Web site includes information about Project Gutenberg-tm, including how to make donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, how to help produce our new eBooks, and how to subscribe to our email newsletter to hear about new eBooks.