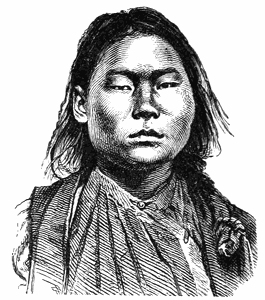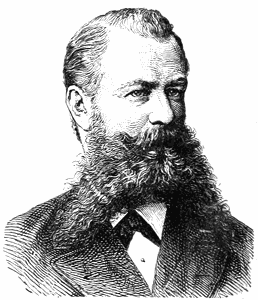SAMOAFAHRTEN von Dr. O. FINSCH.

REISEN IN KAISER WILHELMS-LAND
UND
ENGLISCH-NEU-GUINEA
IN DEN JAHREN 1884 U. 1885
AN BORD DES DEUTSCHEN DAMPFERS »SAMOA«
VON
Dr. OTTO FINSCH.
MIT 85 ABBILDUNGEN NACH ORIGINALSKIZZEN VON Dr. FINSCH, GEZEICHNET VON
M. HOFFMANN UND A. von ROESSLER, UND 6 KARTENSKIZZEN.
HIERZU EIN EINZELN KÄUFLICHER
»ETHNOLOGISCHER ATLAS, TYPEN AUS DER STEINZEIT NEU-GUINEAS«,
24 LITHOGR. TAFELN NACH ORIGINALEN GEZEICHNET VON O. UND E. FINSCH.
MIT TEXT VON Dr. O. FINSCH.

LEIPZIG,
FERDINAND HIRT & SOHN.
1888.
ALLE RECHTE VORBEHALTEN.
Nur wenige Jahre sind es her, daß die früher vereinzelten Bestrebungen für Deutschlands Kolonialbesitz immer mehr Anhänger fanden und sich, in den verschiedensten Kreisen der Nation, wie in allen Teilen des Reichs, eine lebhafte und ernstgemeinte Bewegung dafür organisierte. Noch war es nicht ganz zu spät! Und als, wie auf ein gegebenes Zeichen, europäische Großmächte die letzten Reste sogenannten herrenlosen Landes zu verteilen begannen, da ging Deutschland nicht leer aus. Dank der hervorragenden Machtstellung durfte es seine Hand auf gewisse Gebiete legen, in denen der deutsche Handel längst Fuß gefaßt und eine zum Teil dominierende Stellung errungen hatte. Zu diesen Gebieten gehörte auch die Südsee, wo die Plantagen Samoas und zahlreiche Stationen auf meist herrenlosen Inseln beredtes Zeugnis von der Energie deutscher Kaufleute ablegten, die an gar manchen Plätzen im friedlichen Wettstreit der Konkurrenz Sieger geblieben waren und das Feld allein beherrschten. Aber bei dem besten Willen konnte der, mit sich selbst schon zur Genüge beschäftigte, Handel nicht auch zugleich für ausgedehnteren Kolonialerwerb sorgen, sondern mußte sich darauf beschränken, solchen mit anbahnen zu helfen. Wenn daher in dieser Richtung die Lösung der schwierigsten Aufgabe überhaupt versucht wurde, so ist dies vor allem einem Manne zu verdanken, der sich schon längst mit Plänen dafür beschäftigte, dem Geheimen Kommerzienrat Adolph von Hansemann[S. 6] in Berlin, und einigen Gleichgesinnten, die mit für das nationale Unternehmen eintraten.

Bald nach der Heimkehr von meiner fast vierjährigen Südseereise (Ende 1882) an den Vorarbeiten mitwirkend, wurde mir 1884 der ehrenvolle Auftrag, die inzwischen zur Reife gediehenen Pläne auszuführen, als Leiter einer ersten Untersuchungs-Expedition. Zu dem Zwecke war per Kabel in Sydney der britische Schraubendampfer »Sophia Ann« erworben worden, welcher unter der neuen Flagge den Namen »Samoa«[1] erhielt. Zur Führung desselben konnte ich einen erprobten Vertreter unserer Handelsmarine empfehlen, den Kapitän Eduard Dallmann aus Blumenthal bei Bremen, rühmlichst bekannt durch seine glücklichen Fahrten als Whaler im Pacific, wie in unbekannten Gewässern des arctischen und antarctischen Ozeans. Der vielerfahrene Schiffer bewährte auch auf diesen Reisen seinen alten Ruf, und wenn die »Samoa« mancherlei Fährlichkeiten, an riffreichen unbekannten Küsten, entging, so ist dies, wie die Erfolge der Expedition überhaupt, der geschickten und vorsichtigen Führung von Kpt. Dallmann zu danken[2]. Mit ihm langte ich am 29. Juli (1884) in der Hauptstadt von Neu-Süd-Wales an, wo unser erster Besuch natürlich der Samoa in Johnsons Bai galt. Da der Dampfer bisher Passagierdienst versehen hatte, mußten mancherlei Veränderungen vorgenommen werden, so daß wir erst am 11. September Sydney[S. 7] verlassen konnten. Nachdem wir zunächst Mioko, in der Herzog-York-Gruppe (Neu Lauenburg) erreicht und hier das schwer beladene Schiff von Vorräten erleichtert hatten, waren wir endlich so weit, um mit den eigentlichen Zwecken und Zielen der Expedition zu beginnen. Sie gipfelten in den folgenden Hauptpunkten: »Untersuchung der unbekannten oder weniger bekannten Küsten Neu Britanniens, sowie der Nordküste Neu Guineas bis zum 141. Meridian, um Häfen ausfindig zu machen, mit den Eingeborenen freundlichsten Verkehr anzuknüpfen und Land im weitesten Umfange zu erwerben«. Diesen, gewiß nicht ganz so leichten Aufgaben ist, soweit es Mittel und Umstände erlaubten, nach besten Kräften entsprochen worden. In Zeit von neun Monaten unternahmen wir sechs Reisen nach Neu Guinea, dampften längs des größten Teiles der Nord- und Südküste Neu Britanniens und besuchten Neu Irland vier mal. Von den nahezu tausend Meilen Küste, welche die Samoa, allein in Neu Guinea befuhr, gehörten nur 260 Meilen zu den besser bekannten. Aber eine fast ebenso lange noch unbekannte Strecke konnte als frei für Schiffahrt, für letztere außerdem sieben Häfen und ein schiffbarer Strom, nachgewiesen werden. Ausgedehnte Striche fruchtbaren Landes, für Kulturen, Viehzucht, wie Ansiedelung überhaupt geschickt, wurden aufgefunden, zum Teil gleich erworben und überall mit den Eingeborenen friedlicher und freundlicher Verkehr eröffnet. Als daher deutsche Kriegsschiffe Anfang November 1884 im Archipel von Neu Britannien im Namen Seiner Majestät des deutschen Kaisers die Reichsflagge hißten, konnten sie diesen feierlichen Akt auch gleich in Neu Guinea vollziehen. Die weitere Entwickelung ist bekannt. Wie zu erwarten, einigten sich Deutschland und Großbritannien über die Grenzen, und »Kaiser Wilhelms-Land« und der »Bismarck-Archipel« gingen laut Kaiserlichen Schutzbrief vom 17. Mai 1885 in die Verwaltung und den Besitz der »Neu Guinea Kompagnie« in[S. 9] Berlin über. Diese neuen Schutzgebiete, die später noch durch einige der westlichen Salomons-Inseln Zuwachs erhielten, umfassen (ohne die letzteren) ein Areal von 231,427 qkm (= 4203,13 d. g. ☐M.), repräsentieren daher ein respektables Besitztum, wenig kleiner als die alten Provinzen des Königreichs Preußen (ohne Schlesien).

Die Erlebnisse der »Samoafahrten«, ihre Ergebnisse und Entdeckungen in zusammenhängender Form in Wort und Bild zu schildern ist der Zweck dieses Buches. Es wird, nach den unmittelbaren Eindrücken und Beobachtungen, wie ich sie an Ort und Stelle niederschrieb, ausgearbeitet zum erstenmale[3], über Land und Leute längs wenig bekannter, zum Teil neu erschlossener Küsten eingehendere Kunde bringen, und so manches Stück ernsten und heiteren Südseelebens kennen lehren. Die reiche illustrative Ausstattung, durchaus auf Grundlage eigener Aufnahmen beruhend, ist der besonderen Fürsorge des Herrn Verlegers zu danken, und wird gewiß willkommen sein. Wenn die Rekognoszierungsfahrten der Samoa somit wesentliche Lücken der Kenntnis Neu Guineas ausfüllen helfen und schon dadurch allgemeines Interesse bieten, so im besonderen für Deutschland, das bisher über die drittgrößte Insel der Welt und ihr dortiges Besitztum kein Originalwerk besaß.
Als ein weiterer Beitrag und zur Ergänzung des erzählenden Teiles ist ein ethnologischer Atlas beigegeben, welcher uns »Typen der Steinzeit« vorführt, jener hochinteressanten Periode, die auch in Neu-Guinea unaufhaltsam ihrem Ende entgegengeht. Denn überall, wo sich der Weiße dauernd festigt, verschwindet die Originalität der[S. 10] Eingeborenen. Durch eigene Erfahrung von dieser Thatsache überzeugt, bemühte ich mich, überall wo es anging, Belegstücke für die Wissenschaft zu sichern. Die »Samoafahrten« sind daher auch für die Völkerkunde ersprießlich geworden und führten u. A. dem Kön. Museum in Berlin[4] über 2000 Stücke zu. Die ausgewählten Typen des Atlas veranschaulichen Erzeugnisse, die für die Intelligenz, den Kunstfleiß und den Schönheitssinn der Papuas beredtes Zeugnis ablegen, und, in Anbetracht der geringen Hilfsmittel der Steinperiode, ganz besonderes Interesse, nicht selten Bewunderung verdienen.
| Seite | |||
| Einleitung | 5 | ||
| Erstes Kapitel. | |||
| Von Sydney nach Mioko | 17 | ||
| Zweites Kapitel. | |||
| Astrolabe-Bai | 28 | ||
| Drittes Kapitel. | |||
| Friedrich-Wilhelms-Hafen | 70 | ||
| Viertes Kapitel. | |||
| Längs der Maclayküste | 112 | ||
| Fünftes Kapitel. | |||
| Vom Mitrafels bis Finschhafen | 136 | ||
| Sechstes Kapitel. | |||
| Englisches Gebiet | 194 | ||
| I. | Trobriand | 205 | |
| II. | D'Entrecasteaux-Inseln | 210 | |
| III. | Ostkap bis Mitrafels | 230 | |
| IV. | Milne-Bai bis Teste-Insel | 262 | |
| Siebentes Kapitel. | |||
| Kaiser Wilhelmsland | 288 | ||
| I. | Längs der unbekannten Nordküste | 288 | |
| II. | Humboldt-Bai und heimwärts | 347 | |
| Register | 380 | ||
| Seite | ||
| 1. | Dr. Otto Finsch (Titelbild) | — |
| 2. | Die Samoa (Separatbild) | 6 |
| 3. | Ausguck | 17 |
| 4. | Frauen von Bongu (Astrolabe Bai) | 40 |
| 5. | Häuser mit Barla in Bongu | 46 |
| 6. | Telum Mul in Bongu | 49 |
| 7. | Papuaschweine | 52 |
| 8. | Papuahund | 53 |
| 9. | Aufbruch zum Feste (Astrolabe-Bai) | 55 |
| 10. | Aimaka, am Dschelum auf Bilibili | 73 |
| 11. | Dschelum, Tabuhaus auf Bilibili (Separatbild) | 74 |
| 12. | Krieger von Bilibili | 76 |
| 13. | Töpferin auf Bilibili | 82 |
| 14. | Handels-Kanu, von Bilibili | 84 |
| 15. | Stutzer von Grager, Friedrich Wilhelms-Hafen | 87 |
| 16. | Hansemann-Berge, aus Nordost | 100 |
| 17. | Haus auf Tiar, Prinz Heinrich-Hafen | 101 |
| 18. | Tabuplatz auf Tiar, Prinz Heinrich-Hafen | 103 |
| 19. | Junges Mädchen, Friedrich Wilhelms-Hafen | 108 |
| 20. | Terrassenland mit Basiliskschlucht, Maclayküste | 122 |
| 21. | Kanzel und Bienenkorb, Maclayküste | 126 |
| 22. | Festungshuk, Maclayküste | 128 |
| 23. | Aufhissen der Reichsflagge in Mioko (Separatbild) | 140 |
| 24. | Herkulesfluß, Herkules-Bai | 146 |
| 25. | Mitrafels aus Nordwest | 151 |
| 26. | Adolphshafen mit Ottilienberg | 153 |
| 27. | Mann von Parsihuk, Huon-Golf | 155 |
| 28. | Häuptlings-Haar, Huon-Golf | 157 |
| 29. | Finschhafen aus Süd | 161 |
| 30. | Moru in Finschhafen (Separatbild) | 162 |
| 31. | Haus mit Grab (Vorderseite), Finschhafen | 173 |
| 32. | Haus (Rückseite), Finschhafen | 174 |
| 33. | Gabiang (Vorderseite), Holzfigur in Ssuam | 175 |
| 34. | Gabiang (Rückseite), Holzfigur in Ssuam | 176 |
| [S. 14]35. | Im Dorf Ssuam, Finschhafen (Separatbild) | 176 |
| 36. | Scheinangriff, Finschhafen | 178 |
| 37. | Häuptling von Finschhafen | 179 |
| 38. | Kanu von Weihnachtsbucht, Normanby | 214 |
| 39. | Häuser in Weihnachtsbucht, Normanby | 217 |
| 40. | Kanuhaus auf Goulvain, Dawsonstraße | 224 |
| 41. | Häuser auf Fergusson-Insel | 227 |
| 42. | Ostkap aus Nordwest | 231 |
| 43. | Catamarans (Ostkap) | 232 |
| 44. | Junger Mann von Bentley-Bai | 235 |
| 45. | Haus in Bentley-Bai | 237 |
| 46. | Fingerspitze, Chads-Bai | 241 |
| 47. | Drachenfels in Bartle-Bai | 244 |
| 48. | Pyramidenhügel in Goodenough-Bai | 245 |
| 49. | Kap Vogel aus Süd | 248 |
| 50. | Trafalgar-Berg (bei Kap Nelson) | 249 |
| 51. | Familienhaus in Hihiaura, (bei Ostkap) (Separatbild) | 250 |
| 52. | Station Blumenthal, (bei Ostkap) | 256 |
| 53. | Missionsstation Aroani, Killerton-Inseln (Separatbild) | 262 |
| 54. | Vor der Kirche Aroani (Separatbild) | 266 |
| 55. | Kirärauchen, Dinner-Insel (Samarai) | 268 |
| 56. | Baumhaus in Milne-Bai | 272 |
| 57. | Tätowierte Frau von Rogia (Heath-Insel) | 278 |
| 58. | Glockenfels | 279 |
| 59. | Häuser und Grab auf Teste-Insel | 280 |
| 60. | Junges Mädchen von Teste-Insel | 283 |
| 61. | Junger Mann von Teste-Insel | 283 |
| 62. | Aufgezeichnete Tätowierung, Teste-Insel | 284 |
| 63. | Mann im Kanu, Venushuk | 292 |
| 64. | Bewohner der Hansemannküste (Hammacherfluß) | 299 |
| 65. | Häuptling vom Caprivifluß | 302 |
| 66. | Kopfbedeckung in Dallmannhafen | 306 |
| 67. | Haus in Gaußbucht | 308 |
| 68. | Tabuhaus in Rabun, Gaußbucht | 310 |
| 69. | Mann von Guap-Insel | 317 |
| 70. | Auf Palmblättern in See (Tagai) | 323 |
| 71. | Haartracht eines Häuptlings von Tagai | 325 |
| 72. | Gefesseltes Schwein | 327 |
| 73. | Langenburg-Spitze, Torricelli-Gebirge | 329 |
| 74. | Eingeborener von Massilia, Finschküste | 333 |
| 75. | Ziernarben | 334 |
| 76. | Kap Concordia und Berg Bougainville | 335 |
| 77. | Krieger von Angriffshafen | 337 |
| 78. | Auf Baumwurzeln am Sechstroh | 344 |
| 79. | Einfahrt in Humboldt-Bai, aus Ost | 349 |
| 80. | Pfahldorf Tobadi, Humboldt-Bai (Separatbild) | 352 |
| [S. 15]81. | Damen von Humboldt-Bai | 354 |
| 82. | Tabuhaus in Tobadi (Separatbild) | 358 |
| 83. | Tätowierte Frau, Humboldt-Bai | 362 |
| 84. | Insel Blosseville aus West | 365 |
| 85. | Hansa-Vulkan aus West (Separatbild) | 366 |
| 1. | Übersichtskarte von Neu-Guinea und dem Bismarck-Archipel | 8 |
| 2. | Astrolabe-Bai und Maclayküste | 30 |
| 3. | Friedrich Wilhelm- und Prinz Heinrich-Hafen | 93 |
| 4. | Kartenskizze vom Huon-Golf | 143 |
| 5. | Finschhafen | 163 |
| 6. | Nordküste von Kaiser Wilhelms-Land | 290 |
| Tafel | Fig. | |
| I | 1–8. | Steingerät (Äxte und Axtklingen). |
| II | 1–3. | Häuser (Grundrisse). |
| III | 1–4. | Hausgerät (Kopfstütze, Haken, Schüsseln). |
| IV | 1–10. | Töpferei (Töpfe, Töpfebrennen, Werkzeuge). |
| V | 1–8. | Verschiedenes Gerät (Kalkkalebasse, Spatel, Schaber). |
| VI | 1–8. | Kanus (Konstruktion, Ruder). |
| VII | 1–9. | " (Schnitzerei, Verzierungen). |
| VIII | 1–10. | " (Segel, Mastverzierungen). |
| IX | 1–9. | Fischereigerät (Falle, Haken, Schwimmer). |
| X | 1–4. | Strickereien (Tragbeutel und Muster). |
| XI | 1–7. | Waffen (Speerspitzen, Wurfstock, Keulen, Dolch). |
| XII | 1–2. | " (Schilde). |
| XIII | 1–5. | Musikinstrumente (Trommeln, Flöte). |
| XIV | 1–4. | Masken (und Amuletmasken). |
| XV | 1–8. | Tabu (geschnitzte Figuren, sogenannte »Götzen«). |
| XVI | 1–9. | Bekleidung (Tapabinden von Männern, Grasröcke für Frauen). |
| XVII | 1–8. | Schmuck (Kämme, Haarbinden, Ohrringe). |
| XVIII | 1–5. | " (Haarkörbchen, Kniebinde, Armbänder). |
| XIX | 1–4. | " (Gravierungen von Schildpatt- und Muschelarmbändern). |
| XX | 1–8. | " (für die Nase). |
| XXI | 1–5. | " (für Hals und Brust). |
| XXII | 1–6. | " (Brust-Kampfschmuck). |
| XXIII | 1–2. | " ( " " ). |
| XXIV | 1–8. | " (Leibschnüre). |
☛ Dieser Atlas ist gebunden in Halbfranz zum
Preise von 16 M. einzeln käuflich. ☚
Abreise von Sydney. — Schlechter Willkomm in See. — Tierleben. — Schwalbensturmvogel. — Der ausdauerndste Flieger. — Temperaturveränderungen. — Mioko. — Ralum-Plantation. — Handel im Bismarck-Archipel. — Traderstationen. — »Labourtrade«. — Massacres. — Kopra. — Handelsflotte. — Rückschritte der Eingeborenen.
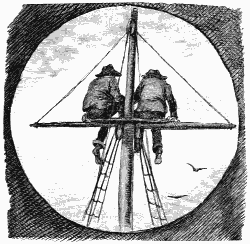
Es war fast dunkel geworden, als wir aus dem gewaltigen und imposanten Felsenthor des Sydney-Hafens, den »Heads«, in den »Stillen Ozean« eintraten, der sich indes gar nicht still zeigte. Mächtige Wogenberge, deren weiße Schaumköpfe, auch im Zwielicht erkennbar, unheimlich leuchteten, empfingen den kleinen Wagehals Samoa recht unwirsch, als wollten sie ihm den Garaus machen. Welle über Welle ergoß sich über das ohnehin fast zu schwer beladene Schiff, dessen Deck schon bei ruhiger See den Wasserspiegel kaum sechs Fuß überragte und fast fortwährend überschwemmt wurde. Oft schien das Schiff mehr unter als[S. 18] über Wasser zu gehen. Unsere Schafe mußten in der kleinen Kajüte untergebracht werden, um sie vor dem Schicksal der Insassen des Hühnerkastens, dem Ertrinken, und für die Tafel zu retten. In der Kajüte selbst ging es drüber und drunter: überall Bewegung und Geklapper! Waffen und andere an den Wänden aufgehängte, aber noch nicht seeklar befestigte Gegenstände pendelten hin und her, Schubladen öffneten und entleerten ihren Inhalt von selbst, ja schwere Kisten tanzten lustig von einer Seite zur anderen, kurzum es war eine heillose Wirtschaft.
Da hatte ich denn alle Hände voll zu thun, um wenigstens den Inhalt der Pantry, Porzellan und Glas, vor völligem Untergange zu sichern, denn unser Steward lag hilflos an der Seekrankheit danieder, und die übrige Mannschaft hatte andere, wichtigere Dinge zu thun. Es stellte sich nämlich heraus, daß die Luke zur Maschine nicht dicht hielt und jede Welle diesem Raum Wasser zuführte, das selbst durch angestrengtes Pumpen sich nicht verminderte, weil die letzteren verstopft, ihren Dienst versagten. Da mußten denn Eimer zu Hilfe genommen werden, bis es nach achtzehnstündiger harter Arbeit gelang, des Wassers im Raume Herr zu werden.
Im übrigen verlief die Reise ohne besondere Zufälle in gewohnter Einförmigkeit des Seelebens und der See selbst, die wie ich schon aus Erfahrung wußte, in diesen Breiten wenig bietet und je näher dem Äquator immer ärmer wird. Vergebens späht man nach Waltieren und ist schon zufrieden, wenn gelegentlich Scharen lustiger Delphine das Schiff eine Zeitlang umspielen, oder fliegende Fische ihr Element verlassen, um nach kurzer Luftreise wieder in dasselbe einzutauchen.
Am häufigsten zeigte sich noch die Vogelwelt; aber auch von ihr ließ sich oft einen ganzen Tag lang kaum ein Vertreter sehen. Albatrosse, die charakteristischen Erscheinungen des südlichen Halbrunds, welche in drei Arten (Diomedea melanophrys, culminata und exulans) noch außerhalb Sydney-Hafens das Meer belebten, waren immer seltener geworden und verließen uns mit etwa dem 25. Breitengrade Süd ganz. Dunkle Meerschwalben (Sterna fuliginosa) und Noddies (Anous[S. 19] stolidus), von welchen einzelne der letzteren zuweilen nächtlich auf den Schiffsmasten einen Ruheplatz suchten, waren im ganzen nicht häufig, wie Tropikvögel, jene charakteristischen Vogelgestalten der Meere zwischen den Wendekreisen. Wir hatten den des Steinbocks längst passiert ohne einen Tropikvogel gesehen zu haben, und erst unterm 12. Breitengrade wurde ein einzelner (Phaëton aethereus) beobachtet, der wie fast immer durch seine eigentümlichen kreischenden Stimmlaute die Aufmerksamkeit erregte. Aus der artenreichen Familie der Sturmvögel (Procellariidae) ließ sich nur selten ein Puffinus oder Tauchersturmvogel blicken, der, meist in weiter Ferne einsam über die Wogen streifte, bald in einem Wogenthale verschwindend, bald über dem Scheitel der Welle schwebend, dieselben gleichsam mähend, wie dies der englische Name »shearwater« so treffend bezeichnet. Nur einer der kleinsten Vertreter der Familie, ein Schwalbensturm- oder Petersvögelchen (engl. Petrel) blieb der fast stete Begleiter des Schiffes, und wenigstens einige Pärchen desselben konnte man immer im Kielwasser beobachten. Es war dies die weit über die Südsee verbreitete Thalassidroma grallaria, ein kaum stargroßes, dunkelgefärbtes Vögelchen, eine gar liebliche Erscheinung jener ozeanen Breiten. Mit ausgebreiteten Flügeln, fast ohne dieselben zu bewegen, schweben diese Vögel so nahe über der Woge, daß sie auf derselben scheinbar hüpfen und man sie jeden Augenblick erfaßt glaubt. Aber nur zuweilen berühren die Zehenspitzen der ausgestreckten Ständer das Wasser, während die Flügel demselben stets mit bewundernswerter Geschicklichkeit auszuweichen wissen. Ja, diese Sturmvögelchen tragen die Beziehung zum Namen »Schwalbe« mit Recht. Denn ähneln sie den letzteren auch nur scheinbar in der Form ihrer Flugwerkzeuge, so übertreffen sie dieselben doch noch bedeutend in Flugkraft und Ausdauer. Nie, so oft ich auch früher und später Gelegenheit hatte, diese Vöglein zu beobachten, nie sah ich sie ausruhen, stets waren sie lebendig und je mehr die See unruhig, um so lebhafter, ja soweit die einbrechende Dunkelheit dem Auge zu sehen erlaubte, immer noch erschaute es die lieblichen Gestalten über die Wogen hüpfend. Ich wüßte in der[S. 20] That keinen Vogel, der sich in Ausdauer des Flugvermögens mit diesem zu messen vermöchte, denn selbst der gewaltige Albatross scheint ihm gegenüber ein Stümper. Und von was nähren sich diese kleinen Ozeanbewohner? Zwar versammeln sie sich an über Bord geworfenen Küchenresten, aber nie sah ich sie wirklich mit dem Schnäbelchen etwas aufpicken, und Exemplare selbst erhielt ich nicht. Wer wollte auch diesen trauten Begleitern über das unendliche Wogenmeer des Ozeans ein Leid anthun? Sind sie es doch, die in die Meeresöde wenigstens einiges Leben bringen und deren bewundernswerten Spielen man nicht müde wird zuzuschauen.
Die angenehme bekömmliche Temperatur des australischen Winters hatte sich allmählich geändert und die Tropen fingen an, sich bemerkbar zu machen. Unterm 25. Grade (südlicher Breite) zeigte das Thermometer in der Kabine noch 15° Reaum.; drei Tage später war es schon um 4 Grad gestiegen und nach weiteren fünf Tagen um 6 Grad mehr, so daß es in der kleinen Kajüte recht ungemütlich warm wurde. Wir kamen eben immer tiefer in die Tropen hinein, und bald zeigten sich die mir wohlbekannten Landmarken unseres Reisezieles: zuerst die hohen in Wolken gehüllten Berge der Südspitze Neu-Irlands, später Neu-Britannien mit dem Berg Beautemps-Beaupré, der Südtochter und Mutter. Wir waren somit im St. Georgs-Kanal, der breiten Meeresstraße, welche die beiden Hauptinseln des Bismarck-Archipel, Neu-Britannien und Neu-Irland, oder wie sie jetzt heißen: Neu-Pommern und Neu-Mecklenburg, trennt, und näherten uns dem ersten Haltepunkte, der Insel Mioko. Am fünfzehnten Tage ihrer Abreise von Sydney ging die Samoa hier glücklich zu Anker und hatte mit dieser ersten Reise von ca. 2000 Meilen[5] zwar ihre Seetüchtigkeit bewiesen, zugleich aber auch, daß sie kein solcher Schnelldampfer war, wie sie nach dem Certifikat sein sollte und wie es für ein Expeditionsschiff zu wünschen gewesen wäre. Statt der angeblichen 11 Meilen in der Stunde waren im günstigsten Falle mit Dampf und Segeln zusammen kaum acht erzielt[S. 21] worden, aber immerhin kamen wir, auch bei ungünstigen Verhältnissen, vorwärts, wenn auch langsam. Solche ungünstige Verhältnisse bietet gerade der St. Georgs-Kanal sehr häufig in Windstillen und Strom, welche Segelschiffe hier zuweilen über Gebühr zurückhalten. So brauchte z. B. das deutsche Schiff »Sophie« von Sydney bis zum Kap St. George, der Südspitze Neu-Irlands, nur 18 Tage, von hier bis Mioko, eine Strecke, die nur 45 Meilen beträgt und die wir mit der Samoa schlimmsten Falls in 8 Stunden zurücklegten, 21, schreibe einundzwanzig Tage! Anderen Schiffen erging es noch schlechter! Die Bark »Etienne«[6] kreuzte Ende 1877 30 Tage im Kanal und ein Schuner mußte schließlich wieder nach Mioko zurückkehren, weil der Proviant zu Ende ging.
Mioko ist eine der kleineren Inseln von den dreizehn, welche die Herzog York-Gruppe, neuerdings »Neu-Lauenburg« umgetauft, bilden und kaum mehr als einen Quadratkilometer groß, aber wegen seines trefflichen Hafens wichtig. Es hatte sich seit meinem letzten Hiersein, kaum zwei und ein halbes Jahr her, gar manches verändert. Ich vermißte zunächst die frühere Godeffroysche Station an der gewohnten Stelle; kaum daß sich noch erkennen ließ, wo die Häuser gestanden. Die letzteren waren mit der früheren Station des Engländers Thomas Farrell vereint von der »Deutschen Handels- und Plantagen-Gesellschaft der Südsee-Inseln zu Hamburg« übernommen worden, welche das Farrellsche Besitztum gekauft und es diesem ermöglicht hatte, 1883 in Blanche-Bai, auf dem Festlande Neu-Britanniens, die »Ralum-Plantation« zu gründen, das erste derartige Unternehmen im Bismarck-Archipel überhaupt. Ich besuchte die sehr gut gehaltene, freundliche Anlage, die mancherlei Reminiscenzen an das abenteuerliche Kolonialunternehmen des Marquis de Rays (1879 bis 1883) aufzuweisen hat. Das stattliche aus Wellblech errichtete Koprahaus stand früher in der „Baie Française‟, das Büffet im Wohnhause war der einstige Altar der Kirche in Port Breton, zu welcher[S. 22] fromme Gemüter in Frankreich die Mittel hergaben. Dieser Altar hatte indes nie seinem heiligen Zwecke gedient, denn die Kirche war nicht gebaut worden und figurierte nur auf dem Papier. Statt Meßgefäßen zeigte der Altar jetzt in äußerst profaner Weise Gin- und Whiskyflaschen, eine Bestimmung welche die gläubigen Stifterinnen gewiß niemals für möglich gehalten haben würden.
Was die Pflanzung selbst anbelangt, so fand ich eine ziemliche Fläche mit bereits tragender Baumwolle bestellt, sowie den Versuch einer Kaffeeplantage in ein paar Beeten mit wenigen Zoll hohen Kaffeepflänzchen. In dem etwas früher von Farrell ausgegebenen Prospekt der: »Western Pacific Plantation and Trading Co.«, welche in Australien mit einem Grundkapital von 40000 £ in shares von 500 £, auf seinem Besitztum gegründet werden sollte, wurden 100 Acres mit »Sea-Island-Cotton« und als neu gepflanzt 5 Acres Kaffee und 2 Acres Aloë angegeben. Späteren Nachrichten zufolge hat die Ralum-Plantage jetzt »200 bis 250 preußische Morgen unter Baumwollenkultur und 8 Morgen mit Kaffeepflanzungen besetzt«, über Erträge verlautet aber noch nichts. Der unermüdliche Farrell war übrigens abwesend und in San Francisco, um diesmal in Amerika Interesse für seine Unternehmungen zu gewinnen. Er kehrte von dort im folgenden Jahre nicht allein mit einem Dampfer (120 Tons) und zahlreichen Tradern (Kleinhändlern) zurück, sondern war überdies »amerikanischer Bürger« geworden, um den Plackereien der englischen Gesetze bezüglich der Arbeiteranwerbungen zu entgehen. Die anglo-amerikanische Firma machte also den deutschen bedeutend Konkurrenz, wenigstens damals, aber inzwischen mögen sich die Verhältnisse wohl geändert haben, wie dies namentlich in der Südsee so häufig der Fall ist. Mit Ausnahme der eben genannten Firma ist der Handel im Bismarck-Archipel, wie dem westlichen Pacific überhaupt, lediglich in deutschen Händen und zwar der beiden Hamburger Häuser: »Robertson u. Hernsheim« und der schon erwähnten »Handels- und Plantagen-Gesellschaft«, sowie Friedrich Schulle in Neu-Irland. Dem seiner Zeit so mächtigen Hause Johann Cesar Godeffroy u. Sohn in Hamburg gebührt übrigens das Verdienst, 1874[S. 23] zuerst Stationen in diesem Gebiete gegründet zu haben. Wie überall in der Südsee machte nur allein der Reichtum an Kokosnüssen, welche geschnitten und getrocknet den jetzt bekannten Exportartikel Kopra liefern, die Gründung solcher Stationen überhaupt möglich, und dieses Naturprodukt ist immer noch das einzige von Bedeutung geblieben. Wie Mioko für die Handels- und Plantagen-Gesellschaft, so ist Matupi, auf der kleinen Henderson-Insel in Blanche-Bai, die Centralstation für das Konkurrenzhaus. Zweigstationen sind an der Küste errichtet, aber gegenüber dem Ganzen hat der Handel übrigens nur in engbegrenzten Gebieten Fuß gefaßt. In Neu-Britannien sind es die Küsten von Blanche-Bai etwas südlich über Kap Gazelle hinaus, die äußerste Nordostküste westlich bis Weberhafen, in Neu-Irland die äußerste Nordwestecke von der Insel Nusa bis Langunebange, ein Strich von ca. 25 Meilen, welche eine beschränkte Anzahl solcher kleinen Handelsplätze, Traderstationen genannt, aufweisen. Im Jahre 1885 besaßen die beiden deutschen Firmen in Neu-Britannien je 6 bis 7 Traderstationen, Farrell vier, in Neu-Irland gab es drei, gegenüber 10 im Jahre 1881. Das letztere Gebiet war fast ausschließend in Händen von Friedrich Schulle auf Nusa, der früher als Geschäftsführer von Hernsheim zuerst mit Stationen in Neu-Irland gründete. Gerade in diesem Gebiete wechseln die Stationen, wie ihre Leiter, die Kleinhändler oder Trader, welche den Einkauf von Kopra besorgen, am meisten, und eine kurze Spanne Zeit bringt oft große Veränderungen. Hier muß eine Station aufgegeben werden, weil der Trader am Klimafieber starb, erschlagen oder verjagt wurde, dort wird eine andere von den Eingeborenen angezündet, als Repressalie gegen »gekochte«, d. h. seitens Weißer niedergebrannter Hütten, oder sie wird freiwillig verlassen, weil sie sich nicht bezahlt macht. Das klingt freilich ziemlich entmutigend, ist aber in Wahrheit nicht so schlimm, denn eine Traderstation ist leicht errichtet und man muß sich von einer solchen keine großen Vorstellungen machen. Mit Proviant im Werte von 300 Mark zu Sydney-Preisen und ebensoviel für Tauschwaren ist sie meist ausgerüstet, und zum Aufbau läßt sich einheimisches Material trefflich verwenden. Handelt[S. 24] es sich doch im wesentlichen um ein kleineres, höchst bescheidenes Wohn- und größeres Koprahaus, einen Zaun und ein paar eiserne Wasserbehälter (tanks), da alle diese Stationen, die Hauptstationen in Matupi und Mioko nicht ausgeschlossen, für ihren Bedarf an Trinkwasser, sowie zum Schiffsgebrauch, nur auf Regen angewiesen sind. Als Trader eignen sich am besten Seeleute, die an Salzfleisch gewöhnt, keine großen Ansprüche machen und mit einem Segelboot umzugehen verstehen, da sich nur mit solchen die Küste erfolgreich bearbeiten läßt. Der Handel ist selbstredend nur Tauschhandel, und amerikanischer Stangentabak (Nigger-head), Beile, Messer, Angelhaken, Glasperlen und einige andere Kleinigkeiten sind die Hauptartikel zum Ankauf von Kokosnüssen oder Kopra, da jetzt Gewehre und Schießbedarf, welche früher am meisten begehrt waren, verboten sind. Dieses Verbot erstreckt sich glücklicherweise auch auf das Anwerben von Eingeborenen als Arbeiter, die sogenannte „Labourtrade‟, welche in diesen Gebieten wie überall, soviel Unheil anrichtete und wesentlich mit zu den blutigen Zwisten mit den Eingeborenen beitrug, an denen keineswegs immer die letzteren schuld waren. Während meines früheren achtmonatlichen Aufenthaltes[7] in Neu-Britannien wurden in meiner Nachbarschaft allein fünf Weiße erschlagen, die wie später Theodor Kleinschmidt auf Mioko ihr Schicksal provoziert hatten. Nachweislich ist übrigens bis jetzt im Bismarck-Archipel kein Weißer verzehrt worden, wenn auch die Eingeborenen noch heut Kannibalen sind, wie ich noch 1881 mit eigenen Augen sah[8]. Seitdem der erste Trader den Boden Neu-Britanniens betrat und den ersten Eingeborenen erschoß, um damit die hier geltenden Rechte der Blutrache einzusetzen, ist gar viel Blut im Bismarck-Archipel geflossen und Mord von beiden Seiten verübt worden. Der im Jahre 1878 unter der Ägide der Wesleyanischen Mission, oder vielmehr[S. 25] des Rev. George Brown, unternommene Vergeltungskrieg forderte allein zahlreiche Opfer unter den Eingeborenen, die nicht vergessen wurden. Wer die Verhältnisse draußen kennt, weiß wie schwer es ist zu strafen, und zwar so, daß wirklich die Schuldigen getroffen werden. Man kann sich daher nur freuen, daß die neue deutsche Ära auch hierin Wandel schaffen und dem willkürlichen Eingreifen einzelner gegen Leben und Eigentum von beiden Seiten strenge Schranken setzen wird. Denn erst dadurch kann die neue Kolonie zu gedeihlicher Entwickelung, namentlich der Plantagenwirtschaft, gelangen. Wie bereits erwähnt, ist in letzterer Richtung bis jetzt nur ein Versuch zu verzeichnen und der Handel, der Koprahandel,[9] der einzige Vermittler zwischen Weißen und Eingeborenen. Der Gesamtertrag an Kopra im Bismarck-Archipel bewegt sich, um dies noch zu erwähnen, zwischen 1000 bis 1500 Tonnen (à 200 Pfd. engl. pro Jahr) und ist nicht minder Schwankungen unterworfen als die Koprapreise selbst, welche in Europa je nach der Konjunktur zwischen 280 und 370 Mark variieren. Die im Bismarck-Archipel beschäftigte Handelsflotte weist unter deutscher Flagge zwei Schuner (von zusammen 180 Tons) und einen Kutter (30 Tons) von Hernsheim und einen Schuner (60 Tons) der Handels- und Plantagen-Gesellschaft, unter amerikanischer Flagge der Firma Farell einen Schuner (70 Tons) und einen Dampfer auf. Bis zum Jahre 1882 unterhielten die beiden deutschen Häuser auch je einen kleinen Dampfer, gaben dieselben aber auf, da sich trotz der geringen Größe (ca. 70 Tons) die Unkosten zu hoch stellten. Seitdem haben sich die Verhältnisse jedenfalls schon dadurch bedeutend verändert, daß die Neu-Guinea-Compagnie ihre drei Dampfer nach dem Bismarck-Archipel schickt.
Wer in der Südsee reist, muß vor allem Geduld besitzen! Dies erfuhren wir gleich in Mioko, wo das Löschen und Laden viel mehr Zeit erforderte, als wir wünschten. Denn auch in dieser Richtung[S. 26] hatten sich die Verhältnisse, nur nicht zum Besseren, geändert. Die Eingeborenen, welche früher gegen einen Tagelohn von einem Stück Tabak im Wert von vier Pfennigen willig bei solchen Arbeiten halfen, waren bei weitem anspruchsvoller geworden und verlangten andere und bessere Tauschartikel. Ja, was weit schlimmer war, es hielt, trotz der höheren Preise, überhaupt schwer Arbeiter zu erlangen, deren Zahl sich durch die rücksichtslose Ausfuhr der Werbeschiffe[10] ohnehin vermindert hatte. Wie in Faulheit, so waren die guten Neu-Lauenburger, wie sie jetzt heißen sollen, auch im übrigen dieselben geblieben, und Fortschritte in der Civilisation nicht bemerkbar, außer in gewissen Tauschartikeln. Statt der gewöhnlichen weißen Thonpfeifen verlangte man jetzt schwarze »Negerköpfe« (negro-heads), statt ordinärer Äxte (Fan-tails) teure amerikanische u. s. w. Perkussions-Musketen, früher das Ziel des höchsten Wunsches eines Kanaker, waren kaum mehr begehrt. Dagegen Hinterladerbüchsen (Snider-Rifles) sehr gefragt, weit mehr als z. B. Bekleidungsgegenstände. Letztere werden eben nur von einzelnen, an den Hauptstationen beschäftigten Kanakern zuweilen getragen. Aber die große Masse unserer neuen Landsleute in Neu-Lauenburg, Neu-Pommern und Neu-Mecklenburg läuft noch jetzt, und zwar in beiden Geschlechtern, im adamitischen Kostüm umher und findet dasselbe bei weitem einfacher und bequemer, wogegen sich bei einigem Verständnis mit dem Leben und Wesen der Eingeborenen nichts einwenden läßt. Auch die Mission (australische Wesleyan) hat in der von ihr so sehr protegierten Bekleidungsfrage, außer bei ihren unmittelbaren Zöglingen, die sich nach mehr als zehnjähriger Thätigkeit auf kaum 200 Bekehrte[11] belaufen, keinen Einfluß ausgeübt, ja schien überhaupt Rückschritte gemacht zu haben. So wenigstens auf Mioko und der Insel Utuan, der York-Gruppe, wo die beiden samoanischen[S. 27] Lehrer (Teachers) nur noch wenige Eingeborene als Mitglieder der Kirche besaßen. Außer der allgemeinen Lauheit gegenüber der christlichen Lehre, wie jeder Lehre überhaupt, mochte hieran auch der unter der Leitung von Thomas Farrell 1883 wirkungsvoll geführte Feldzug mit schuld sein, der die Eingeborenen für die Ermordung von Theodor Kleinschmidt und seiner beiden weißen Genossen strafte und einer großen Anzahl Eingeborenen, darunter auch Kirchengängern, das Leben kostete.
Abreise nach Neu-Guinea. — French-Inseln. — Forestier-Insel. — Verkehr mit den Eingeborenen. — Fregattvögel und Tölpel. — Spärliche Nachrichten über Astrolabe-Bai. — Von Miklucho-Maclay. — Herrliche Küste. — Gelbe Bäume. — Der mysteriöse Deutsche. — Eine Südsee-Aventure. — Berthold und der Marquis de Rays. — »Nouvelle France.« — Herr Canar. — Eine wahre Robinsoniade. — Unter Menschenfressern. — In Port Constantin. — Erstes Zusammentreffen mit Eingeborenen. — Sa-ulo. — Vermeintlicher Überfall. — Besuch in Bongu. — Die Damenwelt. — Haartrachten. — Anthropologisches über Papuas. — Haar — wächst nicht büschelförmig. — Hautfärbung. — Individuelle Verschiedenheit. — Bewohner von Bongu. — Krankheiten. — Pockennarben. — Bekleidung und sonstiger Ausputz. — Gestrickte Beutel. — Das Dorf Bongu. — Bauart der Häuser — innere Einrichtung. — Die Barla. — Buambrambra oder Versammlungshaus. — Barum, Signaltrommel. — Telum-Mul, ein Kunstwerk der Steinzeit. — Ahnen, keine Götzen. — Beschneidung. — Reminiscenzen an Maclay. — Eingeführtes Rindvieh. — eine Plage der Eingeborenen. — Schweine. — Hund — rätselhafte Herkunft desselben — sowie des Haushuhnes. — Plantagen. — Urbarmachung. — Kulturpflanzen der Papuas — zugleich Zeugnis der höheren Gesittung. — Genußmittel. — Tabak. — Cigarren. — Betel. — Freundschaftszeichen. — Zierpflanzen. — Keu, gleich Kawa. — Eingeführte Kulturpflanzen. — Russisch in Port Constantin. — Bemerkungen über Tauschhandel. — Eisen- und Steinbeil. — Fischerei und Kanus. — Einfluß des ersten Weißen. — Der Mann des Mondes. — Erster Landerwerb. — Begründung der deutschen Schutzherrschaft. — Geringe Bevölkerung. — Beschränkte Landeskunde der Eingeborenen. — Gutes Einvernehmen mit denselben. — Abschieds-»Mun«.
In den ersten Tagen des Oktober war die Samoa endlich seeklar und dampfte ihrem Ziele, Astrolabe-Bai, an der Nordostküste von Neu-Guinea, entgegen. Wir gingen um die Nordostspitze Neu-Britanniens und näherten uns am zweiten Tage der French- oder Französischen-Gruppe, die aus einer Anzahl kleiner Inseln besteht und gleichsam eine nordwestliche Fortsetzung des unbenannten Archipels bildet, in welchem Willaumez die bedeutendste Insel ist.[S. 29] Wie Neu-Britannien selbst, so sind auch diese Inseln offenbar vulkanischen Ursprungs, ihre kegelförmigen Berge erloschene Krater, die jetzt mit üppiger Baumvegetation bedeckt, hie und da größere kahle Flächen, Plantagen der Eingeborenen zeigen. Auf Forestier-Insel sahen wir größere Bestände Kokospalmen, unter denen es sich zu regen begann. Mit dem Glase erkannte man Menschen, und bald kamen etliche Kanus ab, um leider nur zu bald in weiter Ferne eine beobachtende Stellung einzunehmen. Die Leutchen trauten uns eben nicht, und so gelang es uns nur mit großer Mühe, sie wenigstens so weit heranzulocken, daß wir mittelst eines langen Bambus in allerdings beschränkter Weise in Tauschverkehr treten konnten. Leere Flaschen und Streifen roten Zeuges[12] fanden den meisten Beifall, weniger Glasperlen, und Tabak wurde ganz verschmäht. An Bord wagte sich trotz aller Verlockungen keine der vor Furcht zitternden Gestalten, im Gegenteil, man suchte in unverkennbarer Weise klar zu machen, uns zu entfernen und sie ungeschoren zu lassen. Die Leutchen mochten daher wohl üble Erfahrungen mit den ersten Civilisatoren gemacht haben, welche kurze Zeit vor uns hier vorgesprochen und »rekrutiert« hatten, wie die sehr passende Südseebenennung dafür lautet. Denn bekanntlich handelt es sich bei der sogenannten »Labourtrade«, wie das Anwerben von Eingeborenen als Arbeiter kurzweg heißt, nicht immer um Freiwillige.
Die Eingeborenen selbst unterschieden sich im Rassentypus übrigens durchaus nicht von Neu-Britanniern, gingen wie diese völlig nackt, sprachen aber eine ganz andere Sprache. Im Ausputz war mir manches neu, darunter ein Brustkampfschmuck und sehr elegante Armbänder mit einem zweiblättrigen Anhängsel, Formen, die, wie ich später kennen lernte, für die ganze Nordostküste Neu-Guineas (vergl. Atlas T. XXII) charakteristisch sind und so die enge Zusammengehörigkeit dieser Völkerstämme bekunden. Die an der Basis mit knochenförmiger Schnitzerei versehenen, im übrigen glatten[S. 30] Wurfspeere, die einzige Waffe, welche diese Eingeborenen mit sich führten, ähnelten ganz denen in Blanche-Bai, aber ihre Kanus waren viel armseliger und für weitere Reisen jedenfalls ungeeignet.
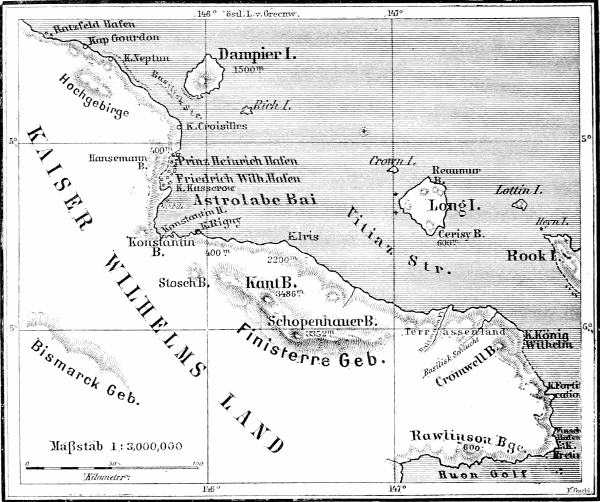
Nach diesem kleinen Intermezzo dampften wir in westlichem Kurs weiter, sichteten die Nordwestspitze Neu-Britanniens mit der Insel Rook und gingen später ganz nahe unter der Nordküste von Crown-Insel hin, ohne irgend eine Spur von Eingeborenen zu bemerken. Alle diese Inseln, wie Rich und Dampier, sind gebirgig, dicht bewaldet und offenbar erloschene Vulkane, die sich in einer Reihe von Neu-Britannien bis zu den Le Maire-Inseln erstrecken. Wie so häufig in diesen Breiten, war die See glatt wie ein Spiegel und[S. 31] nur selten ließen sich schwarze Meerschwalben, (Anous, Sterna anasthaeta), Tölpel oder Fregattvögel (Tachypetes) blicken. Größere Flüge der letzteren pflegen nicht selten, nach Art unserer Störche weite Kreise beschreibend, in der Luft zu schweben, ein gar hübsches Schauspiel, während Tölpel (Sula fusca) es hauptsächlich auf Treibholzstämme abgesehen haben. Auf solchen ruhend, ähneln sie zuweilen einem Kanu mit Eingeborenen in weiter Ferne so auffallend, daß wir hier, wie für die Folge, öfters getäuscht wurden.
Mächtiger Feuerschein hatte uns schon in der Nacht die Nähe des Festlandes von Neu-Guinea angedeutet und zum Abhalten genötigt. Der anbrechende Morgen, des vierten Tages, seitdem wir Mioko verließen, zeigte uns die Küste sehr nahe: wir befanden uns bereits in Astrolabe-Bai! So heißt eine an 15 Meilen breite Buchtung südlich vom 5. Breitengrade, die im Jahre 1827 von Dumont d'Urville mit der französischen Korvette »Astrolabe« zuerst gesichtet wurde. Erst 44 Jahre später landete der russische Reisende Nikolaus von Miklucho-Maclay mit dem russischen Kriegsschiff »Vitiaz« in »Port Constantin« und brachte mit zwei Begleitern (einem weißen Matrosen und einem Samoaner) 15 Monate hier zu, bis ihn das russische Kriegsschiff »Izumrud« wieder abholte. Die wenigen, hauptsächlich anthropologischen und ethnologischen Mitteilungen,[13] welche der Reisende veröffentlichte, sind sehr schwer zugänglich, zählen aber mit zu den besten wissenschaftlichen Arbeiten, die wir über Papuas überhaupt besitzen. Eine eingehendere Darstellung[14] des interessanten Gebietes fehlte bis jetzt noch.
Der Anblick der Küste von Astrolabe-Bai überraschte und befriedigte uns alle gar sehr. Das waren nicht die langweiligen, in gleichmäßiges Grün gekleideten Berge, wie wir sie aus dem Bismarck-Archipel gewohnt waren, sondern die Landschaft wurde je[S. 32] weiter wir in die Bai hineinkamen um so ansprechender. Sie ist rings von hübschen, dicht bewaldeten Bergreihen umschlossen, hinter denen gegen Süden stattliche Gebirgszüge hervorragen, von denen die höchsten an 10000 Fuß hoch sein mögen und wohl zum System des Finisterre-Gebirges gehören. Die in den Schluchten lagernden weißen Wolkenmassen, welche so sehr weißen Schneeflecken ähnelten, gaben diesem schönen Gebirgsbilde einen erhöhten Reiz. Wir passierten die kleine Insel Bilibili, deren Bewohner in großen, kunstvoll gebauten Kanus herbeieilten und in freundlicher Weise Verkehr anzuknüpfen suchten. Aber wir mußten diesmal ihren Versuchungen ausweichen, galt es doch zunächst Port Constantin aufzusuchen, wie sich später zeigte, keineswegs ein Hafen, sondern eine kleine Buchtung, welche wenig Sicherheit gewährt. — Vergebens spähten wir nach Siedelungen, aber das mit dichtem Urwald bekleidete Ufer war wie ausgestorben! Wie sich später zeigte, liegen die Dörfer im Dickicht des Urwaldes versteckt und verraten sich dem Kenner meist durch nichts als kleine Gruppen Kokospalmen und eine besondere Baumart, welche sich durch die einfarbig, lebhaft gelbe Belaubung auszeichnet. Diese »gelben Bäume«, welche sich übrigens an der ganzen Ostküste Neu-Guineas finden, markieren sich in dem dunklen Grün des Urwaldes sehr auffallend und erregen schon von weitem Aufmerksamkeit. So wurde von unseren Seeleuten die besonders hohe und dichte Gruppe gelber Bäume bei dem Dorfe Bogati oder Bogadschi, welches die Karten deshalb als »gelbes Dorf« bezeichnen, anfänglich für ein Segel gehalten.
»Wem konnte es angehören?« war eine Frage, die zu allerlei Betrachtungen führte, denn einem »on dit« zufolge, durften wir möglicherweise einen Weißen, ja einen Landsmann hier treffen. Es sollte nämlich in Astrolabe-Bai ein deutscher Händler (Trader), »Schmidt geheißen«, leben, von dem man in Mioko aber nichts wußte. Die mysteriöse Existenz dieses Schmidt löste sich später in eine jener hübschen Aventuren auf, die in der Südsee mehr als anderwärts vorkommen und die deshalb hier mitgeteilt werden soll, weil dieselbe so sehr das Leben und den Charakter gewisser hier lebender Weißen[S. 33] kennzeichnet. Im Jahre 1882 hatte ich in Neu-Britannien unter anderen unglücklichen Opfern, welche sich von dem gewissenlosen Schwindler de Rays zur Gründung einer Kolonie in Neu-Irland verleiten ließen, auch einen Deutschen gesehen. Er war mit der ersten Expedition im »Chandernagor« 1880 herausgekommen, hieß Berthold und stammte aus Berlin. Wie so viele andere, darunter eine Menge Deutsche, hatte sich auch Berthold, trotz der Warnung des deutschen Konsuls in Antwerpen, auf fünf Jahre verpflichtet. Freilich mochten wohl manche der hoffnungsvollen »Kolonisten« gewisse Gründe haben, um der Alten Welt überhaupt den Rücken zu kehren. Berthold, seines Zeichens ein Kellner, trat als »terrassier cultivateur« ein. Dieser Kategorie von Kolonisten war bei freier Station ein Monats-»Taschengeld« von fünf Frank zugesichert. Nach Ablauf von fünf Jahren erhielten sie aber 15 Hektaren Land, die je nach den guten Diensten des Individuums bis auf 50 gesteigert werden konnten. Alle hatten also die Aussicht, glückliche Grundbesitzer in einem Lande zu werden, das selbst die Leiter des Unternehmens nur nach der Karte kannten. Außerdem hatte die Gnade des Marquis allen Gliedern des Freistaates »Nouvelle France« pro Rata ihres Grades Anteil am Reingewinn versprochen; denn schon aus Naturprodukten, wie Schildpatt, Perlschalen, wertvollen Hölzern u. s. w., erwartete man mit Zuversicht reiche Erträge. So lauten die Bestimmungen des mir vorliegenden Kontraktes, eines in der Kolonialgeschichte merkwürdigen Dokumentes,[15] das die eigene Unterschrift des »Monsieur Ch. du Breil, Marquis de Rays, Fondateur-Directeur de la Colonie libre du Port Breton, Océanie« trägt und am 21. August 1879 zu Antwerpen unterzeichnet wurde. Bekanntlich ging gleich dieses erste ebenso leichtsinnige als gewissenlose Unternehmen[16] des Marquis elend in die Brüche, indem der Leiter des[S. 34]selben »le Baron P. Titeu de la Croix de Villebranche, Aide de camp du Marquis de Rays, Commandant de Port Breton« eines schönen Tages sich mit dem Chandernagor auf und davon machte und die etwa 70 unglücklichen Kolonisten sitzen ließ. Ende Juli 1880 besuchte ich sie in Lakiliki-Bai an der Ostseite von Kap St. Georg, dem damaligen Sitze des Freistaates, in einer Gegend die mit ihren steilen Bergen für Ziegen, aber nicht für Menschen paßt. Eine Baracke und Teile einer Dampfmaschine das war alles, außer etwa zwanzig, meist von Fieber und Krankheiten entkräfteten Männer. Die übrigen waren von Kapitän Ferguson, der noch in demselben Jahre in den Salomons von den Eingeborenen erschlagen wurde, gegen Bezahlung von je einem Winchester-Rifle (damals ca. 140 Mark Wert) nach der nahen Missionsstation in Port Hunter auf der Herzog York-Insel gebracht worden und hatten sich von hier aus in alle Winde zerstreut. Eine Anzahl fanden Stellung als Händler (Trader), und unter diesen auch der erwähnte Berthold, für den sich also, kaum dem Hunger und Elend entronnen, plötzlich glänzende Aussichten eröffneten. Nach einer der neuen, von Friedrich Schulle an der Nordostspitze von Neu-Irland errichteten Koprastationen versetzt, verdiente er schönes Geld. Aber die Freude dauerte nicht lange, denn bald wurde Berthold aus triftigen Gründen entlassen und verbannt, das heißt nach Australien geschickt. Von hier begab er sich unter dem neuen Namen Canar nach Samoa und erhielt Stellung bei einem deutschen Hause, dessen Chef leichtgläubig genug war, seinen Erzählungen Glauben zu schenken. Freilich klangen seine Berichte von dem selbstgesehenen Koprareichtum Neu-Guineas gar zu verlockend, und als er vollends Briefe seines Freundes Schmidt aus Astrolabe-Bai aufwies, der dort in Kopra u. Perlschalen schier erstickte, da war die Ausbeutung dieser Schätze eine beschlossene Sache. Glücklicherweise fand sich gerade kein Schiff disponibel, als Berthold, jetzt[S. 35] Herr Canar, Neu-Britannien wiederum beglückte, und so mußte er sich bis zu passender Gelegenheit mit einer Traderstelle begnügen. Diese Verzögerung war für ihn natürlich sehr fatal, denn es konnte nicht ausbleiben, daß sein wahrer Name und seine Vergangenheit in Samoa bekannt werden mußten; wußte man doch bereits in Neu-Britannien, daß er nie in Astrolabe-Bai gewesen war! Harmlose Fragen nach dem einen oder anderen Häuptling u. s. w. von jemandem, der Neu-Guinea ebenfalls nur nach der Karte kannte, hatten auf leichte Weise den Beweis geliefert. Es fing also an, ungemütlich auszusehen, und Canar zog es vor, die Entwickelung der Dinge nicht abzuwarten, sondern drückte sich eines schönen Tages. Dieses Ereignis war kurz vor unserer Ankunft passiert und bildete noch das Tagesgespräch. Denn der brave Berthold hatte das Boot und Tauschwaren der ihm anvertrauten Station im Betrage von 400 Dollars mitgenommen, außerdem einen anderen deutschen Trader, Namens Freudenthal, zu überreden gewußt. Wie es hieß, wollten die Ausreißer nach Neu-Guinea zu Freund Schmidt gehen. Das schien unglaublich! Denn nur Wahnsinnige konnten in einem offenen kleinen Boot, ohne Kenntnis und Hilfsmittel von Navigation, eine Reise von 450 Meilen wagen. Wie sich später herausstellte, war Berthold natürlich nicht nach Neu-Guinea gegangen, sondern hatte die immerhin abenteuerliche und gefährliche Fahrt nach dem früheren Schauplatz seiner Thaten, dem ihm wohlbekannten Neu-Irland, angetreten. Das kleine Boot mit seinen zwei Insassen war allen Gefahren, auch den Kannibalen auf Sandwich-Insel, die selbst vor dem Angriff eines Dampfers nicht zurückschreckten, glücklich entgangen und näherte sich der Mausoleum-Insel, dem Szelambiu der Eingeborenen, wo Canar bekannt war. Damit schien den Flüchtigen, die auf einer Reise von über 140 Meilen, in offenem Boot unter Tropenglut, gewiß nicht wenig ausgestanden hatten, sichere Rettung zu winken. Aber das Schicksal hatte es anders beschlossen! Beim Landen kenterte das Boot in der Brandung, wobei Freudenthal seinen Tod fand, und Berthold rettete nur das Leben, und zwar buchstäblich das nackte Leben. Denn die Eingeborenen zogen ihm die Kleider aus, und nur[S. 36] dem Umstande, daß er bei ihnen als »Sullis lik«, d. h. der kleine Schulle, bekannt war, schützte ihn vor dem Erschlagenwerden. Aber vor dem Namen Schulle haben die Eingeborenen hier herum großen Respekt, und so wurde Berthold geschont. Freilich so einige Wochen nackend mit in den Plantagen der Eingeborenen arbeiten und wie diese leben zu müssen, unter der nicht eben erbaulichen Voraussicht, eines Tages doch noch erschlagen zu werden, mag eben keine angenehme Sache sein. Das Schicksal dieses wirklichen Robinson stellt daher das seines fingierten Vorgängers jedenfalls in den Schatten. Es dauerte nämlich einige Zeit, ehe Friedrich Schulle in Nusa Kunde von einem schiffbrüchigen, unter den Eingeborenen lebenden Weißen erhielt, zu dessen Rettung er sich sogleich aufmachte. Das Wiedersehen soll freilich kein allzufreudiges gewesen sein, aber was blieb Schulle übrig, als Canar, den ihm nicht eben angenehmen Bekannten, zu befreien. Drei Stück Bandeisen im Werte von 15 Pfennigen genügten übrigens, den Todeskandidaten einzulösen, denn so hoch taxierten die Eingeborenen diesen Träger der Civilisation. — Daß die Briefe von dem angeblichen Schmidt gefälscht waren und von letzterem in Astrolabe-Bai sich auch nicht eine Spur fand, brauche ich wohl nicht erst zu erwähnen? Mir war es sehr lieb, weder diesen noch einen anderen jener zweifelhaften Weißen anzutreffen, deren Auftreten gewöhnlich das Vertrauen der Eingeborenen gleich im Anfang erschütterte und für Nachfolgende ein friedliches Einvernehmen meist erschwert.
Aber wo steckten die Eingeborenen, nach denen uns am meisten verlangte? Schon geraume Zeit lagen wir in Port Constantin wenige Kabellängen vom Ufer vor Anker, aber immer noch blieb es still. Nur einige Vogelstimmen tönten aus dem Gelaube der Urwaldsbäume und auch diese noch spärlich genug. Denn die heiße Nachmittagssonne brannte mächtig herab, und dann schweigt die Vogelwelt meist: nur das Schäckern des nimmermüden Lederkopfes (Tropidorhynchus), die tiefe Baßstimme des Raben (Corvus orru), kreischende Papageien und Kakadus lassen sich vernehmen. — Plötzlich wird die Ruhe durch den Ruf »Kanaka! Ka[S. 37]naka!« unterbrochen! Die scharfen Augen unserer Neu-Britannier hatten ihre schwarzen Brüder im Dunkel des Uferdickichts entdeckt. Und wirklich! Da hockte eine lange Reihe dunkler Gestalten, laut- und bewegungslos wie Bildsäulen, die uns wahrscheinlich schon lange beobachtet hatten. Jetzt wurde es lebendig! Ich nahm meinen ganzen Sprachschatz des hiesigen Idioms zusammen, und bald schallte es: »Korvetta!« oh! aba! (Freund), oh! tamole! (Männer), oh! mem! (Vater), oh! »Maclay« hin und wieder. Die hiesigen Eingeborenen scheinen nämlich seit der Anwesenheit des russischen Reisenden in jedem seiner Nachfolger einen »Maclay« zu erblicken. Herr Romilly, der englische Regierungs-Kommissar, war so genannt und als Bruder behandelt worden und mir widerfuhr dieselbe Ehre. Ich ließ sogleich das Boot klar machen und mich ans Ufer rudern. Aber unsere Schwarzen hatten keine Eile, denn sie fürchteten sich, wie stets bei solchen Gelegenheiten, und unseren Matrosen ging es nicht besser, nachdem sich die Krieger im vollen Waffenschmucke zeigten, der hier neben dem Wurfspeere, auch in Pfeil und Bogen besteht. »Es ist doch nicht egal, ob man in die Brust oder den Rücken gespeert wird«! meinte Peter und drehte seine Vorderseite den gefürchteten »Wilden« zu, als wir ihnen längst in Pfeilschussweite nahe waren. Und den »Wilden« ging es ebenso, das heißt, sie fürchteten sich nicht minder! Kaum stieß das Boot auf Grund, so sprang ich ins Wasser, ging unter unsere neuen Freunde, verteilte allerlei Kleinigkeiten, schüttelte dem und jenem die Hand und hatte in kurzer Zeit ihr Vertrauen so gewonnen, daß ich gleich eine ganze Bootsladung Eingeborener mit an Bord brachte. Bald erschien auch Sa-ulo, der sogenannte »König« von Bongu, eine nichts weniger als königliche Erscheinung, der sich von seinem Gefolge nur durch Korpulenz und Elephantiasis im rechten Bein auszeichnete. Der schwarze Anstrich des Gesichtes und Körpers, welcher wie bei allen Papuanen Trauer bezeichnete, machte sein Äußeres nicht anmutiger, aber der alte Herr hatte ein so gemütliches, freundliches Gesicht, daß man ihn gleich liebgewinnen mußte. Einige Geschenke machten ihn und die Seinigen noch glücklicher, und so schieden sie bei einbrechender[S. 38] Dunkelheit in der Überzeugung, daß der neue »Maclay-Germania« wie ich später zum Unterschied von dem russischen »Maclay-Ruschia« und Romilly dem »Maclay-inglese« hieß, am Ende doch kein so übler Mensch sei, mit dem sich wohl umgehen lasse, dieselbe Ansicht, welche ich bezüglich der Eingeborenen gewonnen hatte. Aber unsere Leute teilten dieselbe nicht, sondern fühlten sich keineswegs behaglich, zumal da unsere Schwarzen allerlei Schaudergeschichten aus ihrem Leben am Bord von Labourtradern zu erzählen wußten, welche die Gemüter erhitzten. Das scharfe Ohr eines Schwarzen wollte Ruderschläge gehört haben und bald kam die Meldung, daß sich eine ganze Flotte von Kanus in der Dunkelheit der Nacht genähert und unter den überragenden Zweigen der Uferbäume verborgen habe. Die furchterregte Phantasie unserer Schwarzen konnte sich von der Überzeugung, daß wir überfallen werden würden und müßten, nicht freimachen und hatte diesen Spuk auf unsere Leute übertragen, von denen sich einige schon mit Koffernägeln bewaffneten. Die angestellten Untersuchungen ergaben, daß es sich nur um Hirngespinste handelte, denn auch nicht ein Kanu war vorhanden und nur der glucksende Ton des Scharrhuhnes (Talegallus), das Kreischen fliegender Hunde, das Klappern der Laubfrösche und Gezirpe der Cikaden tönte in die Nacht hinein.
Gleich am andern Morgen besuchten wir unsere neuen Freunde in ihrem Dorfe Bongu, dem größten in diesem Teile von Astrolabe-Bai, das wie fast stets hinter dem Uferwaldsaume versteckt liegt. Eine Anzahl Männer erwartete uns auf dem schmalen Sandstrande niederhockend, schweigend wie es die Landessitte erheischt, und half erst auf meinen Wunsch das Boot mit aufs Ufer schieben, da die Landung unbequem ist, wie überhaupt an dieser Küste. Unsere Ankunft im Dorfe brachte zuerst unter den Weibern große Aufregung hervor, von denen nur wenige alte beherzt genug waren zurückzubleiben, aber durch einige kleine Geschenke beruhigt, die übrigen bald zurückriefen. Der Reisende wird stets wohl thun, sich zunächst die Gunst der alten Damen zu erwerben; sie haben oft einen sehr erheblichen Einfluss, der von großer Wichtigkeit werden kann. Freilich[S. 39] ist das nicht immer eine angenehme Sache, denn Papuafrauen in vorgerückten Jahren sind freilich keine Schönheiten mehr und nichts weniger als appetitlich, aber deswegen braucht Häßlichkeit der Weiber nicht als Rassencharakter hingestellt zu werden, wie dies meist in allen Lehrbüchern geschieht. Man muß eben fremde Menschenrassen nicht nach unseren Begriffen von Schönheit messen, und dann wird man Papuaninnen sehr passabel finden. Junge Mädchen sind, wenn auch im ganzen klein und schmächtig, häufig von sehr angenehmer Gestalt und zeigen zuweilen tadellose Formen, aber sie verblühen schnell, wie alle Tropenbewohnerinnen. Schon mit der ersten Niederkunft verschwindet die Jugendfrische, die meist wohlgeformte Büste verliert sich, und mit weiterem Kindersegen geht es rasch abwärts. Frauen, die bei uns noch als in guten Jahren gelten, sind dort bereits alt, mager und runzlig, was sich leider nicht wie bei Kulturvölkern durch Kleidung und Toilettenkünste verbergen und auffrischen läßt. Nach unseren Schönheitsbegriffen verunziert auch die Haartracht das weibliche Geschlecht noch mehr. Das Haar wird von älteren Personen meist kurz abgeschnitten und mit schwarzer Farbe eingeschmiert. Bei jüngeren Frauen und Mädchen gelten dicht verfilzte Locken, die von Farbe, Schmutz und Fett starren und an der Stirn oft bis über die Augen herabfallen, als besonders elegant, wie dies die beigegebene Abbildung (S. 40) zweier Frauen von Bongu mit ihren unzertrennlichen Begleitern, Hund und Schweinchen zeigt.
Weit größere Sorgfalt verwendet das putzsüchtigere männliche Geschlecht auf das Haar, namentlich die noch unverheirateten »Malassi«, und einem Papuastutzer kostet die Frisur seines Haares allein mehr Zeit als einer Modedame bei uns. Das Haar wird mittelst eines langzinkigen Instruments aus Bambus, einem sogenannten Kamme, sorgfältig bearbeitet und aufgezaust, so daß es eine weitabstehende Wolke bildet, außerdem mit Farbe, Erde u. dergl. eingerieben, sowie mit Blumen und Federn geschmückt. Tamos oder ältere Männer sind weniger eitel, legen aber Wert auf ihre Gatessi d. h. in den Nacken herabhängende, durch Schmutz und andere[S. 40] Mittel künstlich erzeugte, dichtverfilzte Haarzotteln. Kunst hat also auch hier ihren Einfluß auf das Haar ausgeübt, wie dies mehr oder minder bei allen Völkern der Fall ist. Die Textabbildungen veranschaulichen eine ganze Reihe künstlicher Papua-Haartouren.
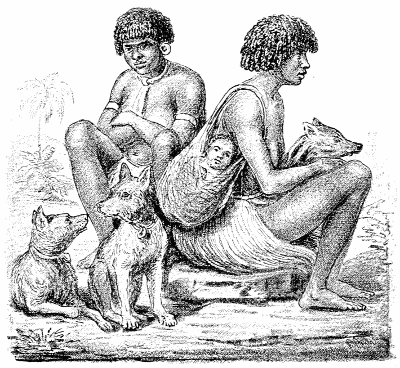
Dies führt mich zu einigen allgemeinen Bemerkungen über die anthropologisch meist noch sehr verkannte Rasse der Papuas oder Melanesier,[17] für welche gerade die Haarbildung besonders wichtig wird. Das Haar wächst beim Papua anfangs gerade wie bei uns und fängt erst an, sich nach einiger Zeit, wenn es etwas länger wird, zu krümmen, d. h. mehr oder minder eng spiralig zu drehen, ähnlich den Windungen eines Korkenziehers. Bei gewisser Länge verfilzen[S. 41] sich die einzelnen Haare leicht in- und untereinander, namentlich an den Enden, wo sich Klümpchen bilden, und so entstehen eine Art Locken, aus denen sich je nach der Behandlung dichte Strähne, Zotteln oder die eben beschriebene Wolke entwickeln. Die letztere ist aber keineswegs ein Rassencharakter des Papua, wie so häufig angegeben wird, sondern höchstens die Neigung zur spiraligen Drehung des einzelnen Haares, wodurch die Gesamtheit ein kräusliches Ansehen erhält, das zuweilen bei dichtem und kurzem Haare an den Wollkopf eines echten Negers erinnert. Wenn in unseren neuesten Lehrbüchern die büschelweise Anordnung des Papuahaares, das ähnlich wie bei einer Bürste gruppiert verteilt sein soll, als ein Hauptcharakter der Papua-Rasse hervorgehoben wird, so ist dies ein völliger Irrtum, der leider, gegenüber berichtigenden neueren Untersuchungen, noch heut dem Engländer Windsor Earl gedankenlos nachgeschrieben wird. Ich habe so viele Papuaköpfe untersucht, solche eigens zu dem Zwecke rasiert, um das Wachstum zu beobachten und weiß daher zur Genüge, daß die Haare beim Papua in gleicher Weise wie bei Europäern hervorsprießen. Aber meine Untersuchungen haben mich auch gelehrt, daß es schwierig ist, einen durchgreifenden diagnostischen Charakter des Papuahaares zu finden, da gar so viele individuelle Abweichungen vorkommen, sowohl in Haarbildung als Färbung. So sind Locken- und Krausköpfe nichts Ungewöhnliches, ja ich habe unter reinen Papuas sowohl in Neu-Guinea als anderwärts sanft gewelltes wie schlichtes Haar angetroffen, hinsichtlich der Färbung natürlich fuchsrotes. Nächst dem Haare ist es besonders die Hautfärbung, welche für diese Menschenrasse wichtig, aber bisher meist so sehr mißverstanden wurde, daß ein paar Worte hierüber nicht schaden können. Wenn hervorragende Anthropologen, die freilich Papuas nicht aus eigener Anschauung kennen, diesen eine schwarze, ja »bläulich schwarze« Färbung zuschreiben, so ist dies eben falsch. Man kann sich noch nicht daran gewöhnen, innerhalb einer Rasse so erhebliche Färbungsverschiedenheiten zu finden, die gerade bei der papuanischen mehr als bei anderen vorzukommen scheinen. Wenn auch im allgemeinen[S. 42] eine dunkle Färbung vorherrscht, so kann Schwarz doch keineswegs als ein Charakter der ganzen Rasse gelten. Wie das vorzugsweis vorhandene satte Braun sich durch Tiefbraun bis zur Schwärze des typischen Negers steigert, so geht es andrerseits bis zu den lichten Tönen des Polynesier und selbst des Malayen herab. Auch weiße Papuas[18] lernte ich kennen, so weiß als Europäer, und insofern nicht Albinos im gewöhnlichen Sinn, als manche auch am Tage scharf zu sehen vermochten. Zu diesen Verschiedenheiten in Hautfärbung wie Haar tritt noch eine große individuelle der Physiognomie, wie die mit besonderer Sorgfalt ausgewählten, naturgetreuen Illustrationen von papuanischen Charakterköpfen am besten zeigen werden. So ist es daher schwer, auch in dieser Richtung einen durchgreifenden Rassencharakter zu fixieren. Jedenfalls stehen die Papuas den echten Negern am nächsten, und wenn auch im allgemeinen der negerähnliche Typus vorherrscht, so finden sich doch so vielerlei Abweichungen, nicht nur in derselben Landschaft, sondern demselben Dorfe, ja Familie, daß gerade dieses Unbeständige mit charakteristisch wird. Man darf daraus auf eine stattgehabte Vermischung mit anderen Rassen, zunächst den benachbarten Ozeaniern und Malayen, schließen, aber historisch nachweisbar ist dies nicht. Selbst in solchen Küstenstrichen, wo schwerlich solche Nachbarvölker eingedrungen sein können, ja auch bei den Bergstämmen, die ich an der Südküste von Neu-Guinea kennen lernte, tritt diese Verschiedenheit in der Färbung hervor, bald einzeln, bald häufiger; hier trifft man eine vorwiegend dunkle, dort eine hellere Bevölkerung, die man anfänglich für eine ganz andere Menschenrasse hält. Aber es darf nicht vergessen werden, daß sich helle Individuen in allen melanesischen Gebieten finden, einzeln nicht selten in dunklen Familien, ähnlich wie bei uns blonde und brünette Individuen in ein und derselben Familie vorkommen. Die Gelehrten werden sich daher daran gewöhnen müssen, an den früheren Auffassungen von Stabilität der Färbung nicht allzustarr festzuhalten und wohlthun, geistreiche Be[S. 43]trachtungen über die Entstehung solcher Abweichungen durch Mischung lieber zu unterlassen, da dieselben doch nur ins Gebiet der Spekulation verfallen und die exakte Wissenschaft nicht weiterbringen. Daß bei farbigen Völkern Färbungsnüancierungen viel stärker hervortreten als bei sogenannten weißen, darf nicht verwundern, aber sie sind sehr häufig rein individueller Natur, und wer lange unter Papuas gelebt hat, wird die oft erheblichen Färbungsverschiedenheiten als etwas Gewöhnliches und Selbstverständliches betrachten, welche eben mit zum Charakter der Rasse gehören.
Da unsere Reisen uns nur mit Papuas zusammenführen, so war es notwendig, über diese Rasse einige Mitteilungen zu machen, die zum besseren Verständnis derselben beitragen dürften.
Auch die Bewohner von Astrolabe-Bai sind echte Papuas, im ganzen ziemlich lichtdunkelbraun, oder hellchocolatbraun gefärbt und von nicht sehr kräftigem Körperbau. Stattlichere Männer zählten zu den Ausnahmen, aber gerade die Bevölkerung von Bongu schien überhaupt schwächlicher und armseliger. Ringwurm (Psoriasis), jene Hautkrankheit, welche sich in Schnörkeln oft über den ganzen Körper einfrißt, war ziemlich häufig vertreten, genierte aber ebenso wenig als Schuppenkrankheit (Ichthyosis) und selbst Elephantiasis. Letztere hindert die Bewegung gar nicht, und der brave Sa-ulo lief trotz seines Alters und dicken Beines (vom Knie bis zu den Zehen) so schnell wie ein junger. Diese mehr oder minder bei allen Südseevölkern verbreiteten Krankheiten überraschten mich natürlich nicht, umsomehr aber Pockennarben, welche ich hier zum erstenmale, später aber wiederholt an der Küste Neu-Guineas beobachtete. Wie mochte diese Krankheit hierher gekommen sein? Jedenfalls hat sie viele Opfer gefordert und wesentlich mit zu der im allgemeinen so geringen Bevölkerung beigetragen.
Im Vergleich mit Neu-Britanniern war die äußere Erscheinung der Bewohner von Konstantinhafen schon deshalb ansprechender, weil sie alle wenigstens eine gewisse Bedeckung haben, während jene völlig nackend einhergehen, wie wir dies zuletzt auf den French-Inseln sahen.
[S. 44] Die Männer tragen den Mal, d. h. ein oft mehrere Meter langes Stück Zeug aus geschlagener Baumrinde, ähnlich der Tapa der Polynesier, sorgfältig um die Hüften und zwischen den Beinen durchgezogen (vergl. Atlas T. XVI 3.), und nur kleine Knaben gehen völlig nackt. Dagegen sind noch sehr kleine Mädchen bereits mit einem Lendenschurz bekleidet, der ebenfalls Mal heißt und sich in dieser Form über ganz Neu-Guinea als das einzige Bekleidungsstück des weiblichen Geschlechtes (vergl. Abbild. S. 40) verbreitet. Als Material dient die gespaltene Blattfaser der Kokos-, für feinere die der Sagopalme. Letztere werden häufig buntgefärbt, meist rot oder mit roten, schwarzen und gelben Längsstreifen und kleiden junge Mädchen sehr artig. Der Lendenschurz geht entweder um den ganzen Körper und bildet dann eine Art bis über die Knie herabreichendes Röckchen, oder er bedeckt nur gewisse Teile vorder- und hinterseits und ist dann mehr Schürzen zu vergleichen.
Hinsichtlich des übrigen Ausputzes der hiesigen Papuas ist wenig zu bemerken, da sie im ganzen arm zu sein scheinen. Armbänder, aus einer Art Gras oder Liane (Lynosia) geflochten, Sagiu, zieren wie überall den Oberarm bei beiden Geschlechtern; die Männer tragen zuweilen noch ähnliche Bänder fest unter dem Kniee umgeflochten. Diese Arm- und Kniebänder sind zuweilen hübsch mit kleinen Kaurimuscheln (vergl. Atlas XX. 4) verziert, wie Muscheln hauptsächlich zu Schmuck- und Zieraten verwendet werden. So namentlich die zu Scheiben geschliffenen Basisteile der Conusmuscheln, aus denen man Halsketten verfertigt. Weit wertvoller sind Hundezähne, die überhaupt bei allen melanesischen Stämmen als Material zu Schmuck eine so hervorragende Stelle einnehmen und bereits bei unseren Vorfahren gleichen Zwecken dienten. Die Weiber müssen sich gewöhnlich mit ein paar Hundezähnen als Zierat der Ohren begnügen, während die Männer breite Ringe aus Schildpatt (Atlas XVII. 4) tragen, wie außerdem eine Menge anderer Dinge. Aber bei allen Naturvölkern schmückt sich das männliche Geschlecht eben weit mehr als das weibliche. Tätowierung, die, da wo sie Sitte ist, vorherrschend den Körper des Weibes verziert, ist hier, wie an der[S. 45] ganzen Küste unbekannt. Dagegen bemerkte ich zuweilen, und zwar an beiden Geschlechtern, Ziernarben, die, wie in den Gilberts-Inseln und anderswo, durch kleine Brandwunden hervorgebracht werden. Kämme (Atlas XVII. 1) dienen nur dem Haare des Mannes als Schmuck und werden von den Frauen nicht getragen. Wie erwähnt, benutzt man diese Kämme (Gatiassem) übrigens nicht zum Kämmen, sondern zum Aufzausen der Haare, als Kopfkratzer und gelegentlich als — Gabel, an welche das schmale, langzinkige Instrument am meisten erinnert. — Der kostbarste Brustschmuck der Männer besteht aus Eberhauern (Atlas XXI. 2), während die Frauen mit einer Eiermuschel (Ovula ovum) zufrieden sind. Aber für gewöhnlich sieht man außer den erwähnten Armbändern wenig Zieraten bei der hiesigen Bevölkerung, dagegen scheinen kleinere oder größere Beutel, zierlich aus festem Bindfaden in Filetmanier gestrickt, unzertrennliche Begleiter. Die Männer tragen kleine, dicht gestrickte Brustbeutel, Jambi, in welchen sie meist Tabak, Talismane, Betelnüsse und sonstige Kleinigkeiten verwahren, und größere, Gumbutu, auf der Schulter, die für die Kalkbüchse (Atlas V. 1) zum Betel, Löffel, Betelnußbrecher aus Knochen (Atl. V. 7), Muscheln zum Schneiden und Schaben (Atl. V. 8) dienen, Requisiten, welche jeder Papua als unentbehrlich stets bei sich trägt. Die Beutel der Weiber, Nangeli-Gun, sind viel größer, sackartig und werden an einem Tragbande auf dem Vorderkopfe getragen, wie dies die Papuafrauen meist thun. Sie sind diese Methode schon von so früher Jugend an gewöhnt, daß sie ohne Mühe beträchtliche Lasten aufladen. Denn nur die Weiber sind es, denen der Transport der Feldfrüchte von den Pflanzungen nach dem Dorfe obliegt, die Wasser und Holz herbeitragen, wie sie außerdem in kleineren Beuteln noch häufig Säuglinge, sowie junge Hunde und Schweinchen mit umherschleppen.
Nach dieser Bekanntschaft mit der äußeren Erscheinung der Papuas im allgemeinen und der hiesigen im besonderen, wollen wir uns nach Bongu zurückwenden, um auch Siedelungen und Häuser kennen zu lernen. Wie fast alle Papuadörfer in Neu-Guinea, verteilen sich die etwa 30 Häuser unregelmäßig über einen freien Platz,[S. 46] der unmittelbar vom Urwald eingeschlossen ist. Bei den Häusern stehen spärliche Kokospalmen, sowie einige Bananen, Zierpflanzen und Cayennepfeffersträucher (jau). Gewöhnlich teilen sich die Dörfer in mehrere Häusergruppen, die durch schmale Pfade durch den Urwald miteinander verbunden sind und eigene Namen haben. Die Plantagen, auf welche ich später zurückkommen werde, sind oft in beträchtlicher Entfernung von den Siedelungen angelegt. Was die Häuser in Bongu selbst anbetrifft, so unterscheiden sie sich im Baustil von den meisten Papuahäusern dadurch, daß sie auf dem Erdboden stehen, daher richtiger als Hütten zu bezeichnen sind. Sie bestehen, wie die Abbildung zeigt, im wesentlichen aus einem seitlich etwas gerundeten, breiten stumpfwinkeligen Dache, mit gerader Firste, das bis zum Erdboden herabreicht. An der vorderen Giebelseite befindet sich die kleine Thür, die zuweilen überdacht und mit einer schmalen Plattform versehen ist. Da die Häuser hauptsächlich[S. 47] nur zum Aufenthalt während der Nacht sowie bei schlechtem Wetter dienen, ist die innere Einrichtung sehr einfach. Ein paar Bänke aus gespaltenem Bambus, Barla genannt, dienen als Schlafstätten der Männer sowie zur Aufnahme des wenigen Hausrates (Töpfe, hölzerne Schüsseln), Lebensmitteln u. s. w. An den Dachbalken hängen gewöhnlich Körbe und Bündel, welche, in Blätter eingepackt, feinere Sachen (z. B. Federschmuck) enthalten. Zum besseren Schutz gegen Mäuse, sind oft Horden darüber errichtet, namentlich auch für Speisen. In der Mitte des Hauses befindet sich die Feuerstätte, weniger zum Kochen, was meist im Freien geschieht, als um überhaupt Feuer zu erhalten. Denn sonderbarerweise scheinen die hiesigen Eingeborenen kein Mittel zu besitzen, um Feuer zu erzeugen. In den Hütten werden daher stets glimmende Kohlen eines sehr langsam brennenden Holzes erhalten, so daß in einem Papuadorfe das Feuer nie ausgeht. Sollte es dennoch geschehen, so holen die hiesigen Küstenbewohner aus den Bergdörfern Feuer, deren Bewohner die Kunst, Feuer zu machen, verstehen. Bei dem sorglosen Umgehen mit Feuer muß man sich nur wundern, daß nicht alle Augenblicke die so leicht entzündbaren Häuser in Flammen aufgehen, aber merkwürdigerweise scheinen Brandunglücke im ganzen selten zu sein.
Freund Sa-ul hatte uns am Eingang des Dorfes begrüßt und geleitete uns mit den übrigen Männern nach der Barla (vergl. Abbild. S. 46), einem großen, auf vier Pfählen ruhenden Gerüst, ähnlich einem großen Tisch, das in keinem dieser Dörfer, ja fast vor keinem Hause, fehlt. Die Barla bildet den beliebten Ruhe- und zugleich Eßplatz der Männer, die hier, unbehelligt von den zudringlichen Schweinen, ihre Mahlzeiten und darauf ihr Schläfchen halten. Frauen dürfen die Barla nicht benutzen, sondern höchstens unter derselben hocken. Wie die meisten Papuadörfer, besitzt Bongu auch ein Versammlungshaus, hier Buambrambra genannt, das als Schlafstätte für die unverheirateten Männer, wie als Empfangshaus fremder Gäste dient. Dieses Gebäude, in der Form der gewöhnlichen Häuser, aber viel größer und an beiden Giebelseiten offen, schien erst seit kurzem fertig geworden zu sein. Außer einigen Unterkiefern von Schweinen,[S. 48] zur Erinnerung an Festlichkeiten, und einigen Eierschalen (von Megapodien), enthielt es keinerlei Ausputz, aber einige Barum waren hier untergebracht. So heißen die großen Holztrommeln (vergl. Atl. XIII 1.), welche dickwandigen Trögen ähneln und, mit einem dicken Knüppel geschlagen, als Signalinstrumente dienen. Ihr dumpfer Ton ist, namentlich in der Stille der Nacht weit, oft mehrere Meilen (engl.), hörbar und teilt alle Begebenheiten den Nachbardörfern mit, die an der Art der Schläge sogleich erkennen, ob es sich um einen Angriff, einen Todesfall oder eine Festlichkeit handelt. Die Samoa hat später gar oft das Barum in Thätigkeit gesetzt, wie unsere Ankunft ebenso durch Rauchsäulen, in der Nacht durch Feuer signalisiert wurde.
An dem soeben erwähnten Buambrambra war übrigens keinerlei Verzierung in Holzschnitzerei angebracht, aber ich entdeckte bei meinem Durchstöbern der Hütten zufällig ein hervorragendes Werk des Kunstfleißes in Holzbildnerei, einen sogenannten Telum oder Tselum. So heißen hier besondere, meist aus Holz gefertigte Figuren, die in der Regel einen Menschen darstellen. Ich sah in Bongu übrigens auch kleine, aus einer erdigen aber festen Masse geschnitzte Telum. Das erwähnte Holzbildnis verdiente schon wegen seiner Größe Bewunderung, denn es war an 8 Fuß hoch und aus einem Stück Holz geschnitzt, soweit sich dieser Ausdruck für die Steinzeit anwenden läßt, die ja keine Messer, also auch nicht eigentliches Schnitzen kennt. Diese Kolossalfigur, von der die Abbildung (S. 49) eine getreue Vorstellung giebt, wurde »Telum Mul« genannt. Sie repräsentierte einen Papua, dessen Kopf allein über die Hälfte der ganzen Länge einnahm, aber trotz den groben Fehlern in den Proportionen doch ein Kunstwerk ersten Ranges und eine Leistung, welche dem Alter der Steinzeit zur höchsten Ehre gereicht. Man staunt, unter voller Berücksichtigung der primitiven Werkzeuge, nicht nur über den Fleiß und die Ausdauer, sondern fast noch mehr über den idealen Zug im Geiste des Papua, welcher selbst vor einer solchen Riesenarbeit nicht zurückschreckte. Denn ohne Zweifel waren es geistige Interessen, welche die sonst so lässigen Menschen zur[S. 49] Verkörperung einer Idee begeisterte, die keinen praktischen Hintergrund hat. Missionäre, welche in den unschuldigsten bildlichen Darstellungen meist Zeichen des Heidentums erblicken, würden eine solche wie hier jedenfalls als einen besonders schrecklichen Götzen deuten, dessen Vernichtung als Gott wohlgefällig betrachten. Aber ohne Zweifel haben die Telums nichts mit Religion, wohl aber mit Geschichte der Papuas zu thun, da sie ähnlich wie unsere Denkmäler berühmte Personen, Ahnen, darstellen und somit nur für die Wissenschaft von höchster Bedeutung sind. Wer es verstünde die Geschichte dieser Telums zu ergründen, von denen es in den Dörfern von[S. 50] Astrolabe-Bai eine ganze Menge giebt, die alle durch Eigennamen unterschieden werden, würde möglicherweise Aufschluß über die Herkunft des Volkes oder Stammes geben können. Aber wahrscheinlich ist die Geschichte vieler Telums bei der jetzt lebenden Bevölkerung bereits verloren gegangen, denn manche scheinen sehr alt zu sein. Auch der Telum-Mul hatte wahrscheinlich schon Generationen gesehen und nur dem festen, den weißen Ameisen widerstehenden Holze seine Erhaltung zu danken. Die gegenwärtige Generation sorgte übrigens schlecht für ihn, denn er war in einer fast verfallenen Hütte untergebracht, in welcher sich nur noch wenig altes Gerümpel befand, darunter ein paar alte Blechgefäße und Fäßchen, die noch von Maclay herrührten. Unter dem Gerümpel befand sich übrigens noch ein sehr interessanter, an 12 Fuß langer Balken mit kunstvollem Schnitzwerk, der am Boden lag und so mit Schmutz und Staub bedeckt war, daß ich ihn in dem ohnehin dunklen Räume erst nach geraumer Zeit entdeckte. Jedenfalls diente der Telum nicht als »Götze« der öffentlichen Verehrung, und der Umstand, daß die Bevölkerung ihn so sehr vernachlässigte, deutete das geringe Interesse überhaupt an. Meine Bemühungen, diesen Schatz für das Berliner Museum zu erstehen, scheiterten an der Uneinigkeit der Männer. Denn ohne Zweifel war der Telum Mul Gemeindeeigentum nicht nur von Bongu, sondern die Männer von Korendu und Gumbu hatten ebenfalls mitzubeschließen.
Wir werden für die Folge mehr solcher wunderbaren Erzeugnisse des Kunstfleißes der Papua kennen lernen, die meist auf Ahnen zurückzuführen sind und höchstens mit einem gewissen »Tabu«, aber nichts mit Religion zu thun haben. Dies gilt auch in Bezug auf die Beschneidung, welche bei der Bevölkerung von Astrolabe-Bai herrscht und selbstredend keinerlei Beziehungen zum Rituale des Judentums hat, da sich diese Sitte ja auch anderwärts bei Naturvölkern findet.
Die Bewohner von Bongu, wie Astrolabe-Bai überhaupt, lebten übrigens bei unserem Dortsein noch völlig im Alter der Steinzeit, denn das von Maclay zuerst hierhergebrachte Eisen hatte in keiner Weise Veränderungen hervorgerufen. Im ganzen war auch blut[S. 51]wenig von Gerätschaften zu sehen, welche der russische Reisende hier zurückließ. Einige alte Stemm- und Hobeleisen, Blechgefäße, russische Uniformknöpfe sowie wenig Glasperlen blieb alles, was wir bemerkten, obwohl uns die Eingeborenen auf jedes Stück mit dem Ausruf »Maclay« aufmerksam machten.
Auch eine Nangeli (Frau) oder Kringa (Mädchen) »Maclay«, wurde uns gezeigt, ein kleines, pockennarbiges Frauenzimmer von ca. 16 Jahren, bei welchem Maclay jedenfalls Pate gestanden, d. h. ihr als Kind den Namen gegeben hatte, eine Gunst, um welche die Eingeborenen den Reisenden öfters ersuchten. Was unsere Aufmerksamkeit übrigens am meisten erregte, war etwas, das wir hier am allerwenigsten erwartet haben würden, nämlich etwas Lebendes in Gestalt von Rindvieh! Ein Bulle und eine Kuh der indischen Zeburasse glotzten uns erstaunt über den fremden Besuch eine Weile an und nahmen dann Reißaus. Miklucho-Maclay hatte diese Tiere im Jahre 1883 an Bord des russischen Kriegsschiffes »Skobeleff« hierhergebracht und den Eingeborenen geschenkt. Auf der Reise nach Sydney begriffen, traf er dieses Kriegsschiff zufällig in Batavia und ließ sich trotz der späten Stunde beim Kommandanten, einem Admiral, melden. Derselbe war auch gleich bereit, einen Abstecher nach Neu-Guinea zu machen, und brachte seinen gelehrten Landsmann, noch in den Admiralitätsinseln und Palau vorsprechend, nach Luçon, von wo das Kriegsschiff die Reise nach dem Amur fortsetzte. Die bei dieser Gelegenheit eingeführten Ziegen waren spurlos verschwunden; das Rindvieh aber für die Eingeborenen ein rechtes Danaergeschenk. Bekanntlich sind Wildschweine und Kängurus die größten Vierfüßler, welche Neu-Guinea aufweist, und diese machen schon die Umzäunung der Plantagen notwendig, den Eingeborenen also Mühe und Last genug. Aber diese Zäune erweisen sich Rindern gegenüber natürlich als unzureichend, und so haben die Tiere nur die Arbeitslast der Eingeborenen Bongus vermehrt, ohne ihnen irgend welchen Nutzen zu bringen. Denn was sollen Vegetarianer mit Haustieren anfangen, deren Pflege sie nicht verstehen und deren Verwertung ihren Bedürfnissen nicht entspricht! Menschen, die in erster[S. 52] Linie und fast ausschließend von dem Ertrage ihrer Plantagen leben, also Ackerbauer sind, können sich nicht mit einemmale zu einem Hirtenvolke aufschwingen. Die einzigen Haustiere, welche von den Eingeborenen hier, wie überhaupt, gehalten resp. gezüchtet werden, sind Schweine und Hunde. Die ersteren, in der Bongusprache »Bul-bul« genannt, sind Abkömmlinge der Wildschweine, von welchen Neu-Guinea zwei eigentümliche Arten besitzt: Sus papuensis und Sus niger. Erstere Art (unten linke Figur) kennen wir nur nach der ungenügenden Darstellung Lessons. Sie ist rostbräunlich gefärbt, an der Unterkinnlade, Brust, Bauch, Innenseite der Beine und Fesseln weißfahl, an Schnauze und ums Auge schwärzlich; die Jungen sind ähnlich wie Frischlinge unseres Wildschweines braun und rostgelb längsgestreift. Die zweite von mir (Proc. Zool. Soc. London 1886 S. 217) beschriebene Art (oben rechte Figur) zeichnet sich, auch in der Jugend, durch die einfarbig schwärzliche Färbung aus. Beide Arten werden im Alter gewaltige Tiere mit mächtigen Hauern,[S. 53] die bei den Papuas als Schmuck sehr geschätzt sind. Die beigegebene Abbildung wurde nach den lebenden Exemplaren gezeichnet, welche ich für den Zoologischen Garten in Berlin mitbrachte, bisher die ersten, welche Europa erreichten, und stellen Tiere in noch jugendlichem Alter dar. Ferkel sind nebst jungen Hunden die erklärten Lieblinge der papuanischen Damenwelt, und ich sah nicht selten Frauen außer ihrem Kinde noch ein kleines Schweinchen säugen. Die Tierchen werden daher auch bewundernswert zahm, folgen, sofern sie nicht im Tragbeutel mitgeschleppt werden, ihren Pflegerinnen auf Tritt und Schritt, und eine Papuafrau würde sich von ihrem Lieblinge ebensowenig trennen, als eine Dame von ihrem Schoßhündchen.

Die Abstammung des Papuahundes bleibt auf einer Insel, wo kein einziges Raubtier vorkommt, ein Rätsel, dessen Lösung innigst mit der Herkunft des hier lebenden Menschen zusammenhängt, eine Frage, welche eine viel größere Bedeutsamkeit hat, als es vielen scheinen dürfte. Auf Grund des Vorhandenseins von Hunden als Haustier hat die Annahme Berechtigung, daß die Papuas überhaupt ein eingewandertes Volk sind. Über das »Woher?« will ich hier indes weiter keine Betrachtungen aufstellen. Der Papuahund, in Bongu »Ssa« genannt, gehört übrigens jener eigentümlichen Rasse an, wie sie sich allenthalben in Neu-Guinea findet, und die sich am meisten mit einem kleinen Dingo vergleichen läßt. Er ist glatthaarig, von kleiner unansehnlicher Statur, hat einen fuchsähnlichen Kopf, aber mit stumpfer Schnauze und aufrechtstehenden, spitzgerundeten Ohren. Der Schwanz ist stark nach links gedreht, wird aber beim Anblick eines Fremden aus Furchtsamkeit meist hängend getragen. Die Färbung variiert außerordentlich, und schon hieraus spricht die lange Domestikation am deutlichsten. Im allgemeinen herrscht eine rostfahle Färbung vor, mit weißer Schnauze, Stirnmitte, Kehle, Bauch und Schwanz[S. 54]spitze, aber es giebt auch dunkelbraune Exemplare, solche mit weißem Kopfe und schwarzgefleckte, kurzum nicht zwei Exemplare sind völlig gleich. Die Abbildung ist nach einem jungen Exemplare gezeichnet. Eine besondere Eigentümlichkeit des Papuahundes ist, daß er nicht bellt, sondern nur heult, aber ich hörte die Hunde in Astrolabe-Bai nicht jene regelmäßigen Heulkonzerte aufführen, bei dem sich alle Hunde vereinigen, und welche nicht gerade zu den Annehmlichkeiten von Port Moresby gehören. Der Papuahund ist übrigens von scheuem, feigen Wesen, sehr diebisch und schon wegen seiner geringen Größe nicht zur Jagd geeignet, wie er kein guter Wächter ist. Gewöhnlich pflegen sich bei Annäherung von Fremden die Hunde des Dorfes lautlos wegzuschleichen. »Wie der Hund, so der Herr« gilt auch für Neu-Guinea, insofern als beide keine Jäger, wohl aber Vegetarianer sind. Wie sein Herr nährt sich der Papuahund vorzugsweise von Pflanzenstoffen, frißt z. B. mit Vorliebe Kokosnuß, und sein bei den Papuas so sehr beliebtes Fleisch mag infolge dessen wohl nicht übel schmecken. Man hält den Hund eben des Essens wegen. Hunde und Schweine werden übrigens nur bei Festen aufgetischt, welche die Papua sehr lieben und mit großer Beharrlichkeit, oft mehrere Tage lang, feiern. Da wird gar manchem Borstentiere der Garaus gemacht und die Festteilnehmer bringen oft von weither ihren Anteil zu dem Picknick herbeigeschleppt. Wie die Abbildung zeigt, wird dabei mit den Schweinen nicht gerade glimpflich und im Sinne unserer Tierschutzvereine verfahren, aber jedenfalls ist die Befestigung mit Lianen praktisch. Ländlich, sittlich! Transportieren doch, was weit empörender ist, die Neu-Irländer oder jetzigen Neu-Mecklenburger ihre Kriegsgefangenen, wie Schulle auf Nusa mit eigenen Augen sah, in derselben brutalen Weise und zu der gleichen Bestimmung des Aufessens!
Wie die Abstammung und Herkunft des Hundes, so ist die des Haushuhnes eine noch ungelöste Frage, die nur wie jene erklärt werden kann. Hühner sind an dieser Küste, wie in Neu-Guinea überhaupt, nicht Haustiere im Sinne der unseren, werden auch nicht[S. 55] des Fleisches und der Eier, sondern hauptsächlich, übrigens immer in sehr beschränkter Anzahl, der Federn wegen gehalten. Hahnenfedern, namentlich weiße, sind nämlich ein beliebter Kopfputz der Malassi oder jungen Leute. In manchen Dörfern sah ich an Geflügel nur ein paar weiße Hähne (Kakaru). In der Färbung neigen sie häufig zu Albinismus, während die meist im Walde versteckt lebenden Hennen[S. 56] (Tutu) mehr dem wilden Bankivahuhn ähneln. Ich will hier noch bemerken, daß das Halten von Vögeln bei den hiesigen Papuas, wie an der ganzen Nordostküste, nur ausnahmsweise vorkommt. Es überraschte mich dies, weil an der Südostküste zahme Papageien (Eclectus) und Kakadus, schon der Federn wegen, fast in jedem Dorfe gehalten werden.
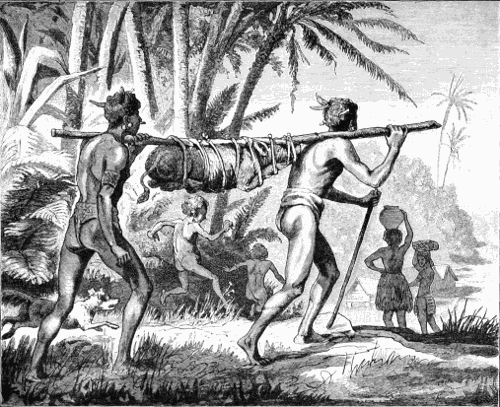
Auf unseren Ausflügen lernten wir auch die Plantagen der Eingeborenen kennen, die, wie erwähnt und wie dies fast überall in Neu-Guinea und Melanesien überhaupt der Fall ist, weit von den Dörfern, meist an Berghängen oder mitten im Urwalde angelegt sind. Die Urbarmachung eines oft mehrere Hektaren großen Stück Landes ist für Menschen, die noch in der Steinperiode leben, gewiß eine höchst mühevolle und gewaltige Arbeit, nicht minder die Einzäunung desselben. Soviel das Feuer auch hilft, einen Urwald kann es nicht vernichten, und so bleibt noch viel Arbeit für die Steinäxte der Männer übrig, welche die kleineren Bäume umhauen, von den großen, zum Teil von Feuer gefällten, die Äste abhacken, so daß nur die Stämme übrig bleiben, die dem Klima nicht allzulange Widerstand leisten. Wie bei der groben Arbeit des Umhauens und eigentlichen Urbarmachens, so vereinigen sich sämtliche Dorfbewohner beim Bau der Einzäunung. Sie wird in dem hiesigen Distrikte aus etwa mannshohen Stäben des wilden Zuckerrohres gefertigt, die durch ihr späteres teilweises Ausschlagen der Wurzeln dem Ganzen besondere Festigkeit verleihen. Thore oder Thüren sind aus Rücksicht auf das Eindringen der wilden Schweine nicht freigelassen, aber gewisse Vorrichtungen zum leichteren Überklettern angebracht. Das von der Einfriedigung umschlossene Land ist nach Größe der Familien verteilt, deren weibliche Glieder die Bearbeitung zu besorgen haben. Das eigentliche Umgraben, wozu man sich nur eines spitzen Stockes, Udja (Udscha) bedient, geschieht durch die Männer, die feinere Bearbeitung des Bodens durch die Weiber, die dazu eine Art schmaler Schaufeln (Udja-sab) benutzen. Ich fand in den Plantagen dieselbe musterhafte Wirtschaft, wie ich sie schon von der Südküste Neu-Guineas und aus Neu-Britannien kannte. Das Erdreich[S. 57] sah, sorgfältig aufgelockert, wie gesiebt aus. Die Ranken des Jams wanden sich an regelmäßig eingesteckten Stangen, zwischen denen andere Pflanzen wuchsen, wie in einem Hopfenfelde empor. Es war jetzt gerade die Zeit der Jamsreife, da der Landbau der Papuas eine Reihe von Feldfrüchten in abwechselnder Aufeinanderfolge zeitigt. Das Hauptnahrungsmittel bildet übrigens der am meisten beliebte Taro, »Bau« (Collocasia), von März bis August, demnächst Jams, »Ajan« (Diascorea), von August bis November. Außerdem werden noch süße Kartoffeln, »Degargol« (Convulvulus), Zuckerrohr, »Den«, Bananen, »Moga«, eine Art kleiner Bohnen, »Mogar« und Tabak »Kas« kultiviert. Ein ebenfalls nur infolge von Kultur vorhandener Nutzbaum ist die Kokospalme, die in ganz Astrolabe-Bai spärlich vorhanden, besonders in diesem Teile rar ist und manchen Dörfern z. B. Gumbu ganz fehlt. Kokosnüsse, »Munki« sowie Sago »Bom« haben daher für dieses Gebiet nur untergeordnete Bedeutung, während sie in anderen mit zu den Hauptnährmitteln gehören. Damit sind ungefähr alle Kulturpflanzen der Papuas in ganz Neu-Guinea, wie Melanesien überhaupt, genannt, und ich werde hierüber, wie über Bodenbearbeitung selbst wenig mehr zu sagen haben, da sich dieselbe im wesentlichen überall gleich bleibt.
Man ersieht aus dem Vorhergehenden, daß die so oft gepriesenen Tropen nicht dem Garten Edens zu vergleichen sind, in welchem der Mensch ohne alle Mühe und Sorge herrlich und in Freuden lebt, sondern daß er sich überall im Kampfe ums Dasein bemühen und quälen muß. Selbst diejenigen vereinzelten Menschenstämme, welche, wie z. B. die Australier, gar keinen Anbau kennen, und lediglich auf die Erzeugnisse der Natur angewiesen sind, müssen sich ihren Lebensunterhalt mühselig erwerben und werden, wie schon ihr Äußeres zeigt, nicht fett dabei.
Für die Papuas liegt übrigens schon in der Bodenbearbeitung ein charakteristischer Zug der ganzen Rasse, durch welche sie die höhere Stufe ihrer Gesittung so vorteilhaft bekundet, und die weder durch Nacktheit noch Kannibalismus gewisser Stämme abgeschwächt werden kann. Letztere beiden Übel sind ja nur in unseren Augen[S. 58] solche, in Wirklichkeit aber durch Usus überkommene Gewohnheiten unabhängig von Gesittung wie Moral.
Selbstredend benutzen, wie alle Papuas und Menschen überhaupt, auch diejenigen von Astrolabe-Bai einige Pflanzen, welche die Natur selbst bietet, als Nahrung. So verschiedene Früchte, Nüsse, ja selbst Knospen und Blätter gewisser Gewächse. Sie spielen indes, wie der in Astrolabe-Bai überhaupt nur spärlich vorkommende Brotfruchtbaum, Boli, eine untergeordnete Rolle.
Um Wiederholungen zu vermeiden, will ich gleich an dieser Stelle zweier Genußmittel gedenken, die mit wenig Ausnahmen über ganz Melanesien verbreitet und eng mit dem Leben des Papua verbunden sind, nämlich: Tabak und Betelnuß! Der erstere ist entweder, wie Hund und Haushuhn, bei der Einwanderung der Papuas mitgebracht worden oder eine einheimische Pflanze, war aber in jedem Falle vor der Ankunft von Weißen den Eingeborenen schon bekannt. Wie Maclay in Konstantinhafen bereits Tabak vorfand, so ging es uns später an Plätzen, die wir zuerst berührten. Die früher von mir von der Südküste mitgebrachten Herbarproben zeigten die Identität der von den Papuas kultivierten Pflanze mit dem gewöhnlichen Bauerntabak (Nicotiana tabacum), mit dem sie in Aussehen wie Blüte durchaus übereinstimmt. In allen von mir besuchten Gebieten an der Nord- und Südostküste Neu-Guineas, fand ich Tabakbau, deren Erträge selbst einem Teil des Tauschhandels der Eingeborenen untereinander bilden. Auch die armen Bergdörfer im Innern von Port Moresby besaßen ihre sorgfältig eingezäunten Gärtchen mit Tabakspflanzen, während an der Küste selbst diese Kultur durch eingeführten Tabak im Verschwinden begriffen oder wie in Port Moresby so gut als verschwunden ist. Hier hat der bekannte Twist, (Niggerhead) oder amerikanische Stangentabak, das gangbarste und unentbehrliche Tauschmittel[19] im Verkehr mit allen Südsee[S. 59]stämmen überhaupt, bereits Wert und lebhafte Nachfrage. Die Eingeborenen der Südostküste besitzen auch ein eigenes Rauchgerät, den »Baubau«, auf den wir noch zurückkommen werden, welches die sonst überall beliebte und begehrte Thonpfeife nicht zu verdrängen vermochte. Die Eingeborenen an der ganzen Nordostküste kennen kein Rauchgerät und wiesen aus diesem Grunde auch unsere Thonpfeifen zurück. Sie wickeln aus den unfermentierten, etwas getrockneten Blättern eine rohe Zigarre oder Zigarette, der ein grünes Baumblatt als Decker dient. Diese Zigarren glimmen selbstredend sehr schlecht, und es bedarf immer glühender Kohlen, um sie in Brand zu halten. Aber die Papuas sind keine Raucher in unserem Sinne; ein paar volle Züge genügen, und die Zigarre wandert von Mund zu Mund. Wir konnten uns mit dieser Sitte unserer neuen Freunde in Konstantinhafen natürlich nicht befreunden, die in oft ergötzlicherweise dem einen oder anderen von uns die brennende Zigarre aus dem Munde nahmen, um sich an ein paar Zügen zu erlaben. Wir vertrösteten die Leutchen daher immer auf die Stummel, die bald ein gesuchter Artikel und den Eingeborenen lieber als der harte Stangentabak waren, obwohl sie diesen bereits durch Maclay kannten. Wie in Port Moresby »Kuku lassi?« (keinen Tabak haben?) die stehende Redensart, gleichsam Begrüßungsformel bei Begegnung mit Eingeborenen ist, so hier »kas! kas!« (Tabak, Tabak!). Aber die Leute waren lange nicht so bettelhaft und zudringlich als in dem von Civilisation schon zu sehr übertünchten Port Moresby.
Nächst dem Tabak ist der Genuß des Betel über ganz Melanesien verbreitet und wird von Mann und Frau, alt wie jung, leidenschaftlich geliebt, ja scheint fast unentbehrlich. Betel ist bekanntlich die Frucht der Betelpalme (Areca), der schönsten der hier vorkommenden Palmen, deren gerade Stämme sich auch trefflich als Baumaterial eignen. Die Betelpalme zeitigt traubenförmige Büschel[S. 60] grüner bis gelber Früchte, von der Größe einer kleinen Walnuß oder Mirabelle. Nach Entfernung der äußeren dichten Faserhülle, mittelst eines meißelförmigen Instruments (Dongan) aus Knochen, kommt ein fester Kern zum Vorschein, der in Aussehen und Form einer Muskatnuß ähnelt. Dieser Kern oder Nuß ist es, welcher gegessen wird, aber nicht allein, sondern im Verein mit pulverisierten Kalk (aus gebrannten Korallen gewonnen) und den Blättern oder Blüten einer Pfefferpflanze, in derselben Weise also, wie dies überall geschieht. So verbreitet sich der Betelgenuß bekanntlich weit über Ostindien und die malaiischen Inseln, hier Sirie genannt. Aber es würde voreilig sein auf dieses gemeinsame Genußmittel, die ursprüngliche malaiische Herkunft der Papuas abzuleiten, da kein Grund vorliegt zu bezweifeln, warum die letzteren nicht selbst auf den Betelgenuß gekommen sein sollten. Für Europäer ist Betel übrigens eben kein Genuß! Er schmeckt beißend-säuerlich, zieht das Zahnfleisch zusammen, hinterläßt aber einen erfrischenden Nachgeschmack und erleichtert das Atmen. Irgend eine betäubende Wirkung hat Betel übrigens nicht, dagegen eine färbende, indem er Zunge, Lippen, Speichel und Zähne rot, bei längerem Gebrauch letztere braun bis schwarz färbt. Aus welchen Gründen die Betelnuß überall nur im Verein mit Pfeffer und Kalk gegessen wird, wäre interessant zu erfahren, scheint aber noch nicht wissenschaftlich aufgeklärt. Die gewöhnliche Bezeichnung »Betelkauen« rührt übrigens daher, daß erst nachdem die Nuß mit den Zähnen zerkaut ist, derselben Kalk und Pfeffer zugesetzt wird. Zum Aufbewahren des Kalks benutzt man hier, wie fast überall in Neu-Guinea, flaschenförmige, unten zugerundete Kalebassen (Atlas V. 1), die wir zuerst auf den French-Inseln fanden. Es verdient dies deswegen Beachtung, weil man im Bismarck-Archipel diese Art Kalkbehälter nicht kennt. Die Kalkkalebassen sind übrigens oft kunstvoll verziert, wie die dazu gehörigen sogenannten »Löffel«, welche diese Bezeichnung sehr mit Unrecht tragen. Sie stellen vielmehr einen langen, schmalen Spatel aus Holz oder Knochen dar, an dessen abgeflachter, im Munde befeuchteter Spitze der Kalk hängen bleibt. Das hindert die Eingeborenen natürlich[S. 61] nicht, den Spatel gemeinschaftlich zu benutzen, ja es ist selbstverständlich, fremden Gästen vor allem Betel und die Kalkbüchse als Zeichen der Freundschaft anzubieten. Wenn ich dasselbe hier wie überall höflich zurückwies, so wurde dies übrigens nirgends als eine Beleidigung aufgenommen, und die Leute wunderten sich nur über die Dummheit des Fremdlinges, einen so köstlichen Genuß zu verschmähen. Die Betelpalme ist übrigens in Konstantinhafen sehr selten, und hier wie anderwärts bilden Betelnüsse »Pinang« einen Tauschartikel.
Die Palme selbst gehört hie und da mit zu den Kulturgewächsen, von der man einzelne Exemplare, sorgfältig eingezäunt, in vielen Dörfern findet. Dasselbe gilt bezüglich gewisser Zierpflanzen, von denen hauptsächlich buntblättrige Croton, Draceen und Euphorbiaceen und Hibiscus angepflanzt werden. Die schönen roten Blumen des letzteren werden in das Haar, die bunten Blätter in die Arm-, Hals- und Kniebänder gesteckt und bilden den gewöhnlichen Aufputz der jungen Leute, zumeist der Männer.
Wie der Betel auf Malaiasien hindeutet, so die Kawa auf Ozeanien. Aber in beiden Fällen würde eine etwaige Schlußfolgerung auf die dadurch angedeutete Herkunft der Papuas eine irrige sein. Denn Kawa ist bis jetzt nur in diesem beschränkten Teile von Neu-Guinea beobachtet, also sicherlich nicht aus Ozeanien herübergebracht worden. Die Pflanze aus welcher der »Keu« und zwar in derselben Weise wie in Ozeanien bereitet wird, ist wie Kawa eine Pfefferart und wohl identisch mit Piper methysticum. Auch die Gebräuche und Zeremonien beim Keutrinken, über die Maclay ausführlich berichtet, sind ganz ähnlich wie in Ozeanien. Aber statt junger Mädchen kauen junge Burschen die Zweige, Blätter und Wurzeln der Pflanze; und Keu wird nur bei besonders feierlichen Gelegenheiten und allein von den Tamos, Männern, getrunken, das widerliche, durch seine Bereitung vollends ekelhafte Getränk, aber nicht Fremden als besondere Auszeichnung kredenzt. In Astrolabe-Bai sahen wir auch den Melonenbaum (Carica papaya), »Papaia«, Zuckermelonen und Kürbisse, beide »Arbus« genannt, an deren Namen man schon den fremden Ursprung erkennen konnte. Auf Befragen hieß es gleich »Maclay«, denn dieser war es, der zuerst[S. 62] Kulturgewächse, (darunter auch Mais, »Kukurus«) einführte, Geschenke, welche übrigens nicht in der Weise, wie der Philanthrop erwartete, von den Eingeborenen gewürdigt wurden. Jedenfalls nützen sie ihnen aber mehr als die Rinder, nach dem russischen »Bika« genannt. Nie wäre es mir in den Sinn gekommen zu glauben, daß mir die wenigen russischen Wörter, welche ich auf meiner sibirischen Reise gelernt hatte, unter den sogenannten Wilden in Neu-Guinea noch einmal nützlich werden könnten, aber es war doch so! »Gleba« (Chljeb = Brot), »Taporr« (= Beil), »Schirau« (Ssjekrá = Axt), Noscha (Nosh = Messer) lauteten die sich stets wiederholenden Wörter im Sprachschatze der Papuas, welche aber auch zugleich ihre Kenntnis des Russischen erschöpften. Als Leute, die genug zu leben haben, verlangten sie indes kein Brot, ja kosteten dasselbe kaum, sondern nur Eisen, und für alles, auch die geringsten Dinge, wollten sie »Taporr« oder »Schirau« haben. Um »Noscha« gaben sie weniger, und andere Tauschartikel wie Spiegel, Glasperlen, Fingerringe u. dergl. machten eigentlich nur Frauen und jungen Leuten Spaß. Die Naturkinder, obwohl in vieler Hinsicht Kinder, sind meist doch viel praktischer als Kinder, und schon der kleine Papuaknabe wird unbedenklich ein Stück gewöhnliches Bandeisen einer Handvoll Glasperlen vorziehen. Da ich für die Folge noch sehr oft von dem Tauschhandel oder besser Schacher mit den Eingeborenen zu sprechen habe, so will ich gleich hier einige allgemein gültige Bemerkungen vorausschicken. Bunter oder glänzender europäischer Tand, wie man ihn sich bei uns als höchst wirkungsvoll denkt, erregt bei den sogenannten »Wilden« vielleicht Aufmerksamkeit, bildet aber gewiß nur für kurze Zeit Nachfrage. Ihr Sinn richtet sich eben auf Praktisches, und was könnte daher wohl Menschen, die noch tief im Steinalter leben, willkommener sein als Eisen! — Nicht Roheisen u. dergl., da sie keine Idee von schmelzen oder schmieden haben, sondern Eisen in irgend einer passenden Form. So ist z. B. schon ein großer Nagel ein begehrter Gegenstand, aus ihm läßt sich ein brauchbares Gerät herstellen und zwar mittelst Schleifen, das allen Eingeborenen von ihren Stein- und Muscheläxten wohlbekannt ist. Da letztere nun bei allen Stämmen[S. 63] der Steinperiode das wichtigste Gerät bilden, so paßt ihnen zum Ersatze der Steinklinge ein Stück flaches Eisen am besten. Am begehrtesten von allen europäischen Tauschartikeln sind daher ca. sechs Zoll lange, zwei Zoll breite und ca. zwei Linien dicke Stücke sogenannten Flacheisens, in Ermangelung Hobeleisen, ja selbst starkes Bandeisen. Solche Eisenstücke lassen sich ganz in derselben Weise an die knieförmigen Holzstiele ihrer Steinbeile befestigen, wie die selbstgefertigten Steinklingen und werden unbedenklich europäischen Beilen überall da vorgezogen, wo die Eingeborenen zuerst mit Weißen in Verkehr treten. Die Klinge der meisten Steinäxte ist nämlich mit der Schärfe quer zum Stiele befestigt (vergl. Atlas I 3), ganz wie bei den Beiteln der Schiffszimmerleute, und steht nicht in gleicher Flucht mit dem Stiele, wie bei gewöhnlichen Beilen. Aus diesem Grunde verstehen daher die Eingeborenen mit den letzteren nicht umzugehen, und erst wenn sie dies gelernt haben, ziehen sie gewöhnliche Äxte den in ihrer Weise mit einer Eisenklinge montierten vor. Übrigens ist das Steinbeil keineswegs ein so ganz primitives Gerät, wie wir meist annehmen, dafür legen die vielen ebenso gewaltigen als zum Teil kunstvollen Arbeiten der Papuas das beste Zeugnis ab. Ich habe an der Südküste Neu-Guineas in bewundernswert kurzer Zeit Kanus nur mit Steinbeilen anfertigen sehen und fand es noch in der Hand solcher Eingeborenen, welche eiserne Äxte längst kannten und besaßen. So offerierte ich einst einem Häuptlinge in Neu-Irland vergebens eine gute amerikanische Axt für sein mit einer Klinge von Mitramuschel versehenes Beil, mit welchem er gerade an einem Kanu zimmerte. — Die in Port Konstantin erhaltenen Steinbeile (Angam) waren übrigens ziemlich roh und klein (Atlas I, 1, 2, 3), denn die großen, welche meist Gemeindeeigentum sind, brachten sie schlauerweise nicht an den Tag. Wir werden solche übrigens später kennen lernen. — Messer, um dies noch zu erwähnen, sind bei noch wenig berührten Eingeborenen viel minder begehrt und führen sich erst nach und nach ein. Zum Schneiden von Fleisch leistet ein scharfkantiges Stück Bambu treffliche Dienste; im übrigen genügen Muscheln. Letztere, sowie Steinsplitter und scharfe Zähne bilden,[S. 64] außer Steinbeilen und meißelartig zugeschliffenen Steinstücken, den ganzen Reichtum der Papuas an Werkzeugen. Als Raspeln bedient man sich überall der Rochenhaut; sägeartige Instrumente sind unbekannt.
Wie alle Küstenbewohner betreiben auch die von Konstantinhafen Fischfang, sowohl mit Netzen, als Haken und Speeren, scheinen aber in diesem Gewerbe minder bewandert, als dies sonst meist der Fall ist. Dasselbe gilt in Bezug auf Schiffahrt, denn ich bemerkte nur kleine Kanus. Dieselben bestehen, wie fast überall, aus einem ausgehöhlten Baumstamme, mit einem Auslegerbalken, der von zwei dünnen Querbalken getragen wird, wie dies ein Blick auf Taf. VI (Fig. 1) des ethnolog. Atlas am besten zeigt. Zuweilen ist auf den Baumstamm jederseits ein Brett aufgelascht, d. h. festgebunden, was dann an Stern wie Bug ebenfalls ein Querbrett erfordert. Dasselbe ist zuweilen mit Schnitzerei in durchbrochener Arbeit verziert (vergl. Atlas VI, 7), ebenso die Ruder (VI, 8).
Wie die wenigen russischen Wörter bei den Bewohnern von Port Konstantin noch lange fortleben werden, so namentlich auch die Erinnerung an den ersten Weißen, Maclay selbst, dessen Name uns noch auf Dampier-Insel (Karkar) genannt wurde. Es ist nicht so schwer, mit den Eingeborenen umzugehen, als es scheint, wie ich früher und später zur Genüge selbst erfuhr, und es läßt sich mit den gefürchteten »Wilden« überall da gut verkehren, wo nicht bereits die Begegnung mit Weißen unliebsame Erinnerungen zurückließ. Wie die letzteren Haß und Rachsucht, so erzeugt eine gute Behandlung Freundschaft für die Weißen. Das Auftreten des ersten Fremdlings ist daher von nachhaltiger Bedeutung, wie er selbst bei klugem Betragen bald großen Einfluß gewinnt. Und diesen hat Maclay, der »Kaaram-Tamo« (Mann des Mondes), wie er in der Umgebung von Konstantinhafen hieß, ohne Zweifel gehabt. Irgend ein Feuerwerkskörper, ein Blaufeuer oder dergleichen, für die Eingeborenen eine neue und unerklärbare Erscheinung, gab die Veranlassung zu diesem mysteriösen Namen. Das Wesen des Sonderlings selbst trug noch mehr dazu bei, den geheimnisvollen Schleier, der sich nach und nach[S. 65] um seine Person hüllte, immer dichter zu weben. So herrschte bald allgemein der Glaube, Maclay besitze übernatürliche Macht, könne Regen machen, wenn er nur wolle, ja selbst fliegen! Wie mir der Reisende selbst erzählte, kam das so! Maclay pflegte stets unbewaffnet, nur mit einem Stocke zum Abwehren der oft bösartigen Schweine versehen, die Umgegend allein und möglichst ungesehen zu durchstreifen. Hörte er auf den einsamen Pfaden des Urwaldes das Herannahen von Eingeborenen, so suchte er sich zu verbergen und erschien dann oft so unversehens im Kreise der überraschten Dorfbewohner, daß diese nur in einem übernatürlichen Wesen Deutung zu finden vermochten. Alle abwehrenden Versicherungen konnten diesen Glauben nicht erschüttern.
»Einsiedelei-Point«, nicht weit von Konstantinhafen, und ca. eine halbe Stunde von dem nächsten Dorfe Bongu, muß in der That eine rechte Einsiedelei gewesen sein. Hier hatte das Haus gestanden, ein Besitztum, das auf der Landseite durch eine feste Umzäunung, gegen die Wasserfront durch Korallfelsen vor der Zudringlichkeit der Eingeborenen geschützt war. Mit Blattstreifen verzierte Stangen, welche auf den Wipfeln einiger hohen Bäume angebracht waren, hatten uns schon bei der Ankunft auf diesen Platz als etwas Besonderes, aufmerksam gemacht, der sich als die frühere Besitzung Maclays erwies. Vom Hause selbst war natürlich keine Spur mehr zu sehen, aber eine Wildnis von süßen Kartoffeln, einige Bananen und Melonenbäume zeigten die Stelle, deren Umfang die Eingeborenen noch sehr wohl zu bezeichnen wußten und die sie als fremdes Eigentum noch jetzt respektierten.
Es herrschte also volles Verständnis, als auch ich ein Stück Land von den Eingeborenen erwarb, auf dem wir ein Haus oder vielmehr einen Schuppen zum Lagern von Kohlen errichteten. Die Bewohner der drei Dörfer Bongu, Korendu und Gumbu, welche durch Verwandtschaft eng verbunden, auch politisch zusammengehören und dieses Gebiet beherrschen, halfen redlich dabei und sahen es nur ungern, wenn Fremde sich auch mit beteiligen wollten. Der alte Sa-ulo nützte uns übrigens wenig und schien wegen seines Alters[S. 66] obwohl nicht gebrechlich, viel an Einfluß verloren zu haben. Dagegen unterstützten uns Jago und Dam am meisten und schienen die angesehensten Häuptlinge von Bongu zu sein. Es herrschte ein geschäftiges und fröhliches Treiben. Unter den wuchtigen Axthieben unserer Schwarzen fielen Bäume. Weiber und Kinder reinigten den Platz von Unkraut und Steinen, schleppten Riedgras (Tura) und Lianen (Mangau), die sich trefflich zum Festbinden eignen, herbei, während die Männer Stangen fällten und Kokospalmblätter, ein für die hiesige Gegend rares Material, in Kanus heranbrachten. Auch ohne besondere Sprachkenntnis ließ sich, wie dies überall der Fall ist, mit den sehr anstelligen Eingeborenen, die alle Absichten leicht begriffen, trefflich auskommen. Aber man muß sie vor allem gut behandeln, immer ein freundliches Gesicht machen und ihren Gewohnheiten Rechnung tragen. Die Arbeit wird oft unterbrochen; einige müssen rauchen, Betel essen, kochen oder ein bißchen schlafen, wie sie dies bei ihren eigenen Arbeiten gewohnt sind, und daran muß man sich gewöhnen, wenn überhaupt etwas geschehen soll. Denn diese Naturkinder kennen anhaltende Arbeit in unserem Sinne natürlich nicht, und bei allen Papuas und Kanakas überhaupt lodert der erste Eifer mächtig auf, erlischt aber eben so schnell.
Als das »Buam« (Haus) fertig war, schleppten die Eingeborenen einen mächtigen an 20 Fuß langen Bambu herbei, an welchem die deutsche Handelsflagge befestigt, bald lustig an der Spitze eines hohen Baumes im Winde flatterte. Die erste deutsche Station an der Küste von Neu-Guinea war somit begründet und damit zugleich die spätere deutsche Schutzherrschaft, die sich jetzt allein im Kaiser Wilhelms-Land über ein Gebiet von 179250 qkm (= 3255 d. g. qm) oder größer als die Hälfte des Königreichs Preußen erstreckt. Der 17. Oktober 1884 wird also in der Kolonialgeschichte Deutschlands für immer ein denkwürdiger Tag bleiben! Hatten auch die Eingeborenen über die Tragweite dieses Vorganges nicht die entfernteste Ahnung, so begriffen sie doch sehr gut, daß derselbe auch für sie etwas zu bedeuten habe, wie die neue Flagge selbst, deren Farben (kum = schwarz, aubi = weiß, suru = rot) sie wohl zu unterscheiden[S. 67] wußten. Und daß dieser Vorgang auf das engste mit der Wiederkehr der neuen weißen Freunde, wofür schon das Haus gewährleistete, zusammenhing, wußten sie ebenfalls. In jedem Gesichte sprach sich daher Freude darüber aus, und das »kerre-kerre« (sehr gut) wollte kein Ende nehmen. War doch nach dem praktischem Urteil der Leute das Erscheinen der Weißen identisch mit viel »Taporr«, »Schirau«, »Nosche«, sowie anderen nützlichen und begehrten Dingen, und das konnte ja nur mit Freuden begrüßt werden. Der Besitz eiserner Werkzeuge hat notwendigerweise größeren Reichtum und somit Überlegenheit zur Folge, und deshalb ist jeder Stamm so sehr bemüht, diese Vorteile für sich allein zu erlangen. Unsere neuen Verbündeten huldigten dieser bekannten Eingeborenen-Maxime und warnten uns, wie dies stets der Fall ist, vor ihren Nachbarn, die von Bilibili, Bogadschi und anderen Küstenplätzen in Kanus herbeikamen, um uns zu sehen und zu schachern. Als besonders schlecht (borle-borle) wurden die Bewohner weiter im Inneren bezeichnet. Kein Bongumann wollte z. B. mit nach dem Dorfe Eglam mana gehen, obwohl sonst gegenseitiger Verkehr stattfindet und das Dorf wenig mehr als eine deutsche Meile entfernt liegt. Aber die schlauen Küstenleute waren nur darauf bedacht, den Absatz der erhaltenen Tauschwaren für sich nach dorthin zu sichern.
Das Wort »Mana« heißt im Bongudialekt Berg und bezeichnet dem Ortsnamen angehängt, eines jener kleinen Dörfer, die in den Bergen bis zu einer Erhebung von 1200–1500 Fuß verstreut liegen. Sie sind, wie ich dies auch im Inneren von Port Moresby fand, armseliger und kleiner als die Küstendörfer und zählen oft kaum mehr als 10–20 Hütten mit 40 bis 50 Einwohnern, während z. B. Bongu an 150 bis 180 Seelen haben mag. Aber die ganze Bevölkerung von Astrolabe-Bai ist überhaupt nicht bedeutend und wird von Maclay auf nicht mehr als 3500–4000 geschätzt, die sich auf einige 80 Siedelungen verteilt. Ich erfuhr die Namen von etwa 15 Dörfern, aber wie bereits erwähnt, werden alle kleineren Häusergruppen eines Dorfes, die oft nur aus drei bis vier Häusern bestehen, besonders benannt.
[S. 68] Der Urwald, welcher sich längs dem Ufer dieses Teiles der Küste hinzieht, ist weniger dicht, als ich ihn sonst meist in Neu-Guinea fand, und besitzt weniger Unterholz und Gestrüppdickichte. Auch ist die Ausdehnung dieses Waldgürtels in der Breite nicht bedeutend, und man stößt nach kurzer Wanderung auf den schmalen aber gut gangbaren Pfaden bald auf offenes, mehr oder minder hügliges bis ebenes Land, das sich bis zu der dichtbewaldeten Gebirgskette erstreckt, welche sich parallel mit der Küste hinzieht. Wie von Maclay mitteilt, ist diese steile Gebirgskette unbewohnt und bildet für die Eingeborenen die äußerste Verbreitungsgrenze nach dem Inneren, welche sie niemals überschritten. Es giebt dies einen neuen Beweis von der äußerst beschränkten Kenntnis des Landes seitens der Eingeborenen selbst, die, abgesehen von gewissen Küstenstrichen, ihre nächste Umgebung selten weiter als etliche Stunden weit kennen, Verhältnisse, wie ich sie auch an der Südostküste fand und auf welche ich noch zurückzukommen habe.
Der erste günstige Eindruck, welchen die Umgegend von Port Konstantin landschaftlich auf uns gemacht hatte, war bei näherer Bekanntschaft nur befestigt worden. Das von verschiedenen kleinen Wasserläufen durchzogene Land zeigte überall fruchtbaren Boden und für Niederlassungen geeignete Lokalitäten, so daß ich schon damals dieses Gebiet als sehr günstig für eine Station[20] nach Berlin empfehlen konnte. Aber etwas mangelte und zwar ein guter Hafen, denn Kapitän Dallmann war mit Port Konstantin gar nicht zufrieden; unsere nächste Aufgabe galt also der Aufsuchung eines solchen.
Der zuerst durch von Maclay angebahnte freundschaftliche Verkehr mit den Eingeborenen war von uns in derselben Weise fortgesetzt worden und ließ nichts zu wünschen übrig: noch nie hatte ich so gutmütige und anstellige Leute als hier getroffen! Das Verständnis mit ihnen wurde von Tag zu Tag leichter, und es gelang mir ohne Schwierigkeit sie am Abend vor unserer Abreise zu einem »Mun« zu vereinigen. So heißen hier jene aus Tanz und Gesang bestehenden[S. 69] Aufführungen, welche den Glanzpunkt der Feste bilden und sich in ähnlicher Weise überall in Neu-Guinea, ja ganz Melanesien wiederholen. Nach unseren Begriffen ist freilich der Tanz nichts als eine arge Trampelei, und mit dem Gesang ist es nicht besser bestellt als mit der Musik, bei welcher die sanduhrförmige Holztrommel, Okam, (vergl. Atlas XIII. 2), eine so große Hauptrolle spielt, aber es war mir doch interessant, auch hier diese Gebräuche kennen zu lernen. Die Bereitwilligkeit, uns auch in außergewöhnlicher Zeit einen »Mun« zum besten zu geben, zeugte überdies von dem guten Einvernehmen mit den Eingeborenen und war als eine besondere Auszeichnung und Ehre für uns anzusehen.
Wenn es sonst Sitte bei den Papuas ist, scheidenden Freunden Geschenke mit auf den Weg zu geben, so machten die braven Konstantiner bei uns eine Ausnahme. »Nehmen ist seliger denn Geben« lautet auch ihre Lebensregel, wie fast bei allen Papuas, und selbst der biedere König Sa-ul ließ sich jede Kokosnuß, mit der er uns in seiner Residenz bewirtete redlich bezahlen, ja, auch der Junge, welcher die Nüsse pflückte, verlangte ein Trinkgeld. »Backschisch, Backschisch!« hier wie überall.
Bogadschi und seine Bewohner. — Ein Dieb. — Hansemann-Berge. — Schönes Kulturland. — Gorimafluß. — Insel Bilibili. — Besuch derselben. — Dschelum, das große Versammlungshaus. — Hochinteressanter Kunstbau der Steinzeit. — Kein Tempel. — Häuser. — Wir sollen Krieg führen. — Waffen. — Wurfspeere. — Pfeil und Bogen. — Kein Pfeilgift. — Keulen. — Schilde. — Exkursion an der Küste. — Zuckerrohr. — Musterhafter Landbau. — Sago. — Geologisches. — »Gold«-Flimmern. — Lobenswerte Moralität. — Töpferei. — Kanus und Schiffahrt. — Bilibili sehr versprechend — namentlich für Mission. — Jambom (Colomb-Insel). — »Dreißig« Inseln. — Im »Archipel der zufriedenen Menschen«. — Grager (Fischel-Insel). — Unruhige Nacht in Elisabeth-Bucht. — Marsap, großes Fest. — Festschmuck der Männer. — Bemalen. — Hundezähne. — Kunstvolle Zieraten. — Kampf-Brustschmuck. — Physiognomische Verschiedenheit. — Wir entdecken Friedrich-Wilhelms-Hafen. — Beschaffenheit desselben. — Vogelleben. — Exkursionen. — Armut an Blumen. — Urwaldbild. — Prinz Heinrich-Hafen. — Ausdehnung des Archipels. — Port Alexis. — Tiar (Aly-Insel). — Dasem, Versammlungshaus. — Sonderbare Schnitzereien. — Fischerei. — Bilia (Eickstedt-Insel). — Ein Verrückter. — Szirit, Versammlungshaus. — »Tohn«, ein verehrtes Instrument. — Tabugebrauch aus Schlauheit. — Verkehr mit den Eingeborenen. — Große Schamhaftigkeit. — Festschmuck der Frauen. — Tabir, Schüsseln. — Sprachgewirr. — Bäumefällen. — Geringe Körperkräfte der Eingeborenen. — Wir hissen die deutsche Handelsflagge. — Abschied von Friedrich- Wilhelms-Hafen.
Die Samoa dampfte längs der Küste von Astrolabe-Bai langsam vorwärts. Sie gleicht einer weiten offenen Rhede[21], rings von einem Sandstrande eingefaßt, an welchem auch bei ruhigem Wetter Dünung das Landen erschwert, z. T. ganz hindert. Die Bewohner des »gelben Dorfes« Bogadschi (Bogati) eilten in ihren Kanus herbei, um zu schachern und brachten allerlei neue und interessante Sächelchen,[S. 71] darunter breite, hübsch mit eingraviertem Muster ornamentierte Armbänder aus Schildpatt, (vergl. Atlas XIX 2), Brustschmucke aus Cymbiummuschel (Koambim), sehr eigentümliche Leibschnüre aus aufgereihten Abschnitten einer Septariamuschel, Gogu genannt, (Atl. XXIV 1.), die äußerst wertvoll schienen, sogar ein paar Telum, (Atl. XV. 1) jene Holzfiguren, die meist als »Götzen« gedeutet werden. Schon an den Namen gewisser gewöhnlicher Tauschsachen ließ sich die Verschiedenheit des hiesigen Dialekts mit dem von Bongu leicht erkennen. So hieß der Bogen statt Aral hier »Manembu«, Pfeil statt Gé »Kolle«, um nur ein paar Beispiele zu nennen. Obwohl manche Eingeborene sich nur mit Zittern und Zagen an Bord wagten, fand doch bald ein reger Verkehr statt und die Leute zeigten sich dabei minder gut als in Konstantinhafen. Dort war uns nicht das Geringste abhanden gekommen, hier wurde gleich ein Dieb in flagranti erwischt. Er hatte soeben seinen Genossen im Kanu ein Hobeleisen zugesteckt, natürlich nicht mit den Händen, sondern mit den — Zehen. Ich kannte diese beliebte Manier, mit der fast nackte Menschen trotz strengster Aufsicht zu eskamotieren wissen, schon längst, drehte dem jungen Mann, der sich unbemerkt glaubte, in sein Halsstrickchen fassend, sanft die Kehle zu, und das gestohlene Gut wurde sogleich zurückgegeben. Der vor Schreck erbleichte Sünder (denn auch farbige Menschen erbleichen sichtbar) drückte sich nach diesem mißglückten Versuche stillschweigend unter Spott und Gelächter seiner Landsleute.
Hinter Bogadschi treten die Berge weiter zurück, es zeigt sich mehr mit dichtem Urwald bestandenes Vorland, das hinter Gorima-Huk sich zu ebenfalls dicht bewaldetem Flachland, einer Art Ebene, ausdehnt, die nördlich von einer niedrigeren Bergkette begrenzt wird. Es ist die etwa 1200[22] Fuß hohe von mir »Hansemann-Berge« benannte Kette, die Guntowa Mana der russischen Karte, inland des »Archipels der zufriedenen Menschen«. Allem Anschein nach wird dieses flachere Land zwischen Gorima und Bilibili das schönste Kulturland in Astrolabe-Bai abgeben und von Wichtigkeit werden, zumal[S. 72] da es nicht an Wasser fehlt. Wir bemerkten mehrere kleine Flüsse, von denen der Gorima der größte und die erwähnte Ebene zu bewässern scheint. Seine Mündung wurde jetzt durch ausgedehntes Röhricht angedeutet, aber bei einem späteren Besuche im Monat Mai sehen wir das Wasser der Bai auf eine ziemliche Strecke trüb grün gefärbt.
Wir steuerten Bilibili zu, einer kleinen ca. eine halbe Seemeile langen Insel, etwa vier Meilen nördlich von Gorima-Huk, die gleichsam den Anfang des »Archipels der zufriedenen Menschen« bildet, wie derselbe von dem Entdecker Maclay benannt wurde. Hervorragend hohe, mächtige Bäume, deren dichte Belaubung fast die ganze Insel wie mit einem Dache überdeckt, kennzeichnet dieselbe schon von weitem. Sie besteht, wie fast die ganze Küste von Astrolabe-Bai aus gehobenem Korallfels, der an der Ost- und Nordseite z. T. Steilufer bildet, an welchem das Meer mächtig bricht. Aber an der Westseite dehnt sich ein flacher weißer Sandstrand aus, auf dem nicht weniger als 13 stattliche Kanus, bunt bewimpelt und mit allerlei Ausputz verziert, lagen. Das gab im Verein mit den idyllisch unter dem Gelaube mächtiger Bäume versteckten und von Kokospalmen beschatteten Häusern des Dorfes ein gar liebliches Bild. Dazu das Gewimmel fröhlicher brauner Menschen, die mit grünen Zweigen winkten und bald in Kanus abkamen und uns an Land einluden.
Wir eilten ihnen zu folgen und waren überrascht von der Fülle neuer und interessanter Eindrücke. Alles zeugte hier von Wohlhabenheit und Reichtum. Die Häuser waren größer und stattlicher als die bisher gesehenen, wie die mit reichem Ausputz versehenen Eingeborenen selbst. Sie zeigten sich anfangs ziemlich scheu und zurückhaltend. Namentlich kostete es Mühe, die schlanken, braunen Mädchen heranzulocken, die in ihren bunten Grasschürzchen und reich mit Schmuck aus Muscheln und Hundezähnen behangen, das Haar mit brennendroten Hibiscusblumen geschmückt, gar niedlich aussahen. Einige kleine Geschenke machten sie bald zutraulicher und eine um die andere kam zögernd heran, um ihre Gabe an Glasperlen oder rotem Zeugstreifen in Empfang zu nehmen und dem weißen[S. 73] Fremdlinge schüchtern die Hand zu geben. Unter diesen Mädchen gab es übrigens viele recht hübsche Gestalten von tadellosem Körperbau und mit recht artigen Gesichtchen.
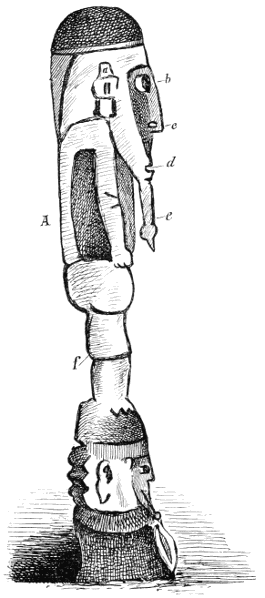
Unsere Aufmerksamkeit wurde aber bald von allem andern abgelenkt, als wir das große Versammlungshaus erblickten, von welchem das beigegebene, nach meiner Skizze gezeichnete Separatbild (S. 74) eine gute Vorstellung giebt. Ähnlich dem Buambrambra von Bongu besteht auch dieses Haus, Dschelum genannt, im wesentlichen aus einem bis zum Boden herabreichenden Dache, dessen offene Vorderseite von einer an 25 Fuß hohen, durchaus in durchbrochenem Schnitzwerk ausgearbeiteten Mittelsäule[23] getragen wird. Diese Schnitzerei, Aimaka genannt, repräsentiert vier männliche und zwei weibliche übereinanderstehende nackte Papuafiguren, die auf weißem Grunde rot und schwarz bemalt sind, und von denen die beigegebene Abbildung die auf einem Kopfe stehende unterste zeigt. Sie wurde wie die übrigen männlichen Figuren »Mini« d. h. Mann genannt (A); die angegebenen Buchstaben[S. 74] bezeichnen nur die verschiedenen Körperteile (a, Tingilan, Ohr, b Mal, Auge, c Uina, Nase, d Bule, Mund, e Balan Zunge, f Niän, Bein). An den Querbalken des Giebels hingen aus Holz geschnitzte Tiergestalten, die in kenntlicher Weise Fische, Vögel, Eidechsen und Schildkröten, ebenfalls bunt, darunter auch mit Grün bemalt, darstellten. Die an 30 Fuß langen Balken, welche jederseits das Dach trugen, waren jedenfalls der kunstvollste Teil des merkwürdigen Gebäudes. Jeden dieser beiden Balken zierte die an vier Fuß hohe Figur eines Papua, die in staunenswerter Weise aus dem Balken selbst gezimmert war und an diesem gleich dem Gliede einer Kette hing. In der That ein wahres Kunstwerk für Steinäxte und Muschelwerkzeuge, wie ich es in dieser Weise weder vor noch nachher in Neu-Guinea wieder zu sehen bekam, und das nur derjenige zu würdigen wissen wird, der sich in vollem Verständnis der Steinzeit ganz in dieselbe hineinzudenken versteht. Ob unsere prähistorischen Vorfahren wohl auch auf einer so hohen Stufe standen? Die Überreste der Pfahlbauten geben darüber keine Auskunft! Aber es wäre im Interesse der Wissenschaft von ungeheurer Bedeutung, wenn wenigstens eins dieser nur noch so spärlich vorhandenen Denkmäler der Baukunst der Steinperiode gerettet würde. Ich konnte es leider nicht und mußte mich mit der Skizze begnügen, deren Aufzeichnung die Eingeborenen mit Staunen zusahen. Wie sie mir, so spendete ich ihnen Lob, das sie sehr wohl verstanden, denn jeder deutete mit Stolz an, daß er am Bau mitgeholfen habe.
Der untere Teil der Giebelseite war etwa in Mannshöhe durch eine Mattenwand geschlossen, durch welche nur eine kleine Öffnung als Thür diente. Man gestattete uns den Eintritt gern; aber wie üblich zeigte das Innere nur wenige Gegenstände. So die großen und kleinen Trommeln, die wir schon von Bongu her kennen. Bemerkenswert waren große runde, mit Schnitzerei und Malerei verzierte Schilde (Atlas XII. 1.) und sehr roh aus Baumästen gefertigte niedrige Bänkchen, die beim Schlafen dem Kopfe als Unterlage dienen, aber mit »Kopfkissen« in unserem Sinne nichts zu thun haben. Zahlreiche Unterkiefer von Schweinen waren auch hier wie allenthalben[S. 75] in Melanesien als Erinnerungszeichen großer Feste aufgehangen. Den Hauptteil des Inneren bildete eine an acht Fuß hohe Plattform aus gespaltenem Bambu, welche als Schlafstätte für die unverheirateten jungen Männer, wie für fremde Gäste dient. Auch Maclay hatte hier geschlafen, so wurde mir angedeutet. Denn diese großen Häuser sind nicht nur Junggesellenhäuser, sondern überhaupt die Klubhäuser der Männer. Aus diesem Grunde ist dem weiblichen Geschlecht der Zutritt verwehrt, ein Verbot, das durch besondere Tabuform erhöhte Bedeutung erhält und so leicht zu mythischen und religiösen Deutungen verleitet. Aber ein Tempel war dieses Gebäude ebensowenig als die Holzschnitzereien Götzen, wie jeder Missionär sogleich interpretiert haben würde. Wenn die Deutung eines Telum, d. h. einer einzelnen menschlichen Figur als Repräsentant eines Ahnen richtig ist, so stellte dieser »Aimaka« vermutlich eine ganze Ahnenreihe dar, wie sich dies bei den Maoris Neu-Seelands und anderen Naturvölkern in ähnlicher Weise wiederfindet. Beachtenswert ist die völlige Nacktheit aller dieser menschlichen Darstellungen, der Telum und wie sie sonst heißen, gegenüber der sorgfältigen Lendenbekleidung ihrer Verfertiger.
Wir wenden uns zu dem Dorfe zurück, das aus 20 bis 25 Häusern besteht, die viel größer als die in Port Konstantin, auch eine etwas abweichende Bauart zeigten und mich am meisten an die in dem Dorfe Keräpuno in Hoodbai erinnerten. Wie diese sind sie auf starken Pfählen etwas über dem Erdboden errichtet, besitzen ein Vestibüle mit Plattform an der Vorderfront, zu der ein angelehnter Baumstamm als Aufgang dient und sind überhaupt sehr solide gebaut. Im Inneren, das offenbar mehreren Familien Unterkunft giebt, ist ein Bodenraum, zu dem eine rohe Leiter führt. An den Häusern selbst findet sich keinerlei Schnitzwerk, und nur vor der Thür eines Hauses sah ich eine an vier Fuß hohe, buntbemalte menschliche Figur, ähnlich den Telums in Konstantinhafen. Die Häuser des Dorfes waren, wie immer, in kleinen Gruppen verstreut und bei einer derselben entdeckten wir ein zweites Versammlungshaus der Männer mit ganz ähnlichen Schnitzereien, aber kleiner.
[S. 76] Nachdem ich mit der Besichtigung und dem Studium des Dorfes, fertig war, machten wir einen Spaziergang durch die Insel, die einem malerischen Park der Tropen zu vergleichen ist. Aus den gewaltigen Baumriesen, darunter viele und sehr große Brotfruchtbäume, tönte der dumpfe brummende Ruf der weißen Fruchttauben (Carpophaga spilorrhoa), von denen uns bald eine Menge zur Beute fielen. Wie überall bei diesen Naturkindern, hatte der erste Schuß immer dieselbe Wirkung: allgemeines Geschrei und wilde Flucht! Aber bald gewöhnte sich die reifere Jugend an den Knall und bewunderte staunend die Wirkung der ihnen unbekannten, unheimlichen Waffe. Bei einem späteren Ausfluge an der Küste bemühten sich die schlauen[S. 77] Bilibiliten bereits unsere Überlegenheit in ihrem Interesse nutzbar zu machen: wir sollten einen ihnen feindlichen Stamm bekämpfen und vernichten! Das oft geäußerte Wort »mate« oder »imate«, soviel wie »tot«, oder »töten«, das wie einige andere Wörter[24] vielen polynesischen und melanesischen Sprachen gemeinschaftlich angehört, ließ diese Absicht nur zu deutlich erkennen. Zahlreiche kampfgerüstete Krieger hatten sich unserem Zuge angeschlossen, und ihnen verdanke ich die Skizzen, welche dem vorhergehenden Bilde als Grundlage dienen.
Wir wurden bei dieser Gelegenheit auch mit den Waffen der hiesigen Eingeborenen bekannt, die im wesentlichen mit denen in Bongu, wie in Neu-Guinea überhaupt gebräuchlichen übereinstimmen. Die Hauptwaffe ist auch hier, wie in ganz Melanesien, der Wurfspeer, eine runde sieben bis zehn Fuß lange, oft ziemlich schwere Stange, meist: aus Palmenholz gefertigt. Das Basisende ist verdünnt, das Spitzenende etwas verdickt und hier zuweilen ein paar Kerbzähne oder eine Furche eingeschnitten. Solche Wurfspeere heißen in Konstantinhafen »Schadga« und sind die gewöhnlichste im Kriege gebrauchte Art Waffen. Eine zweite Art Wurfspeere, Serwaru genannt, besteht ebenfalls aus einem langen Holzstocke, ist aber mit einer breiten lanzettförmigen (ca. 70 cm langen) Spitze aus Bambu versehen, und dadurch eine sehr gefährliche Waffe. Die Bambuspitze ist mit feingespaltenem Rohr festgebunden und die Verbindungsstelle oft sehr kunstvoll mit Federn, Kuskusfell und dergl. verziert. Wirkung und Tragweite dieser Wurfspeere werden meist sehr übertrieben geschildert, denn nach meinen Beobachtungen sind sie wohl selten über 40 bis 50 Schritt hinaus gefährlich. Dasselbe gilt in Betreff von Pfeil und Bogen, die wie überall, eine minder wichtige Rolle als der Wurfspeer spielen. Der Bogen ist aus Palmenholz gefertigt ca. sechs Fuß lang, meist glatt, ohne allen Ausputz und mit einer Sehne aus gespaltenem Rotang versehen. Dagegen zeigen die Pfeile oder vielmehr die Spitze derselben mancherlei Verschiedenheit. Sie[S. 78] sind fast ausnahmslos aus leichtem Rohr gefertigt, mit einem runden Spitzenteile, der ca. ein Drittel oder Viertel der ganzen Länge (1,30 bis 1,40 m) beträgt. Die im Feuer gehärtete Spitze ist öfters mit verschiedenartig geschnitzten Kerb-, Sägezähnen oder Widerhaken verziert, und besteht selten aus einem zugespitzten Flügelknochen eines Vogels. Eine andere sehr bestimmte Art von Pfeilen, zeichnet sich durch eine breite, lanzettförmige Bambuspitze aus und findet sich in dieser Form über ganz Neu-Guinea. Ebenso die sechs bis siebenspitzigen Pfeile, welche zum Schießen von Fischen benutzt werden. Vergiften der Pfeil- oder Speerspitze kennt man, wie überhaupt in ganz Neu-Guinea, nicht. Schleudern, sonst eine so beliebte Waffe der Südseevölker, habe ich nicht wahrgenommen. Aber es giebt, jedoch im ganzen selten, Keulen. Sie sind aus schwerem, meist Palmenholz gefertigte, ein bis ein einhalb Meter lange, flache, schmale, Latten, unten meist etwas verbreitert, am Handgriff etwas verschmälert und zuweilen mit vertieften Mustern ornamentiert. Auch diese Form der Holzkeulen findet sich fast über ganz Neu-Guinea, dagegen sind die mit durchbohrten, oft sehr kunstvollen, Steinknaufen bewehrten Keulen nur gewissen Gebieten der Südostküste eigen und fehlen hier wie an der ganzen Nordostküste durchaus. Es verdient dies ganz besonders erwähnt zu werden, namentlich weil Steinkeulen sonst nur noch im Osten Neu-Britanniens auftreten. — Die mächtigen runden Schilde auf Bilibili »Dimu« genannt, habe ich bereits angeführt. Sie scheinen wohl nur ausnahmsweis den Krieger in den Kampf zu begleiten, da sie dafür schon viel zu schwer sind. Manche haben einen Durchmesser von 90 cm und ein Gewicht von 10 Kilo. Wahrscheinlich dienen sie mehr zur Verteidigung des Dorfes selbst bei feindlichen Überfällen und werden deshalb meist in den Versammlungshäusern aufbewahrt, vermutlich auch weil sie Gemeindeeigentum sind. Ich sah übrigens auch kleine Schilde von nur 40 cm Durchmesser, die in einen Filetbeutel eingestrickt waren, um sie leichter tragen zu können.
Unsere Küstenexkursion verlief durchaus friedlich und machte uns vor allem mit der außerordentlichen Fruchtbarkeit des Bodens[S. 79] bekannt. Das Land gegenüber Bilibili ist meist flach, von niedrigen Hügelreihen eingefaßt und mit Urwald bedeckt. Im Dickicht desselben liegen die ausgedehnten und trefflichen Plantagen der Bilibiliten, in denen jetzt hauptsächlich Jams und Zuckerrohr gedieh. Von letzterem fanden sich oft größere Bestände in ausgezeichneter Entwickelung. Rohr von 2½ Zoll Durchmesser, in Knotenabständen von 4½ Zoll und einer Länge von 12–14 Fuß war nichts Seltenes! Solches Zuckerrohr ist jedenfalls doch erst durch fortgesetzte Kultivation veredelt worden und diese den Eingeborenen und ihrem Fleiß zu danken. Auch die Bananen standen trefflich, wie der sorgfältig aufgehäufelte Jams, zwischen dem buntblättrige Ziersträucher angepflanzt waren; alles zeigte eine musterhafte Ordnung, wie man sie bei uns nicht besser verlangen konnte. Ja, ja! diese »Wilden« verstehen Feldbau ganz ausgezeichnet, und was mehr ist, trotz ihren primitiven Werkzeugen auch mit dem Urwalde fertig zu werden. Wir sahen dies am besten an solchen Stellen, wo mit Urbarmachen erst begonnen worden war. Mächtige Bäume lagen am Boden, um zu verfaulen. Die abgehackten Äste waren verbrannt worden, die Stämme selbst hatte man etwa in Mannshöhe stehen lassen, und diese ganze Riesenarbeit war nur mit Steinäxten geschehen, die in der Hand des Eingeborenen gar nicht so primitiv sind, als man meint. Über den Fleiß der Bewohner wird man daher nicht mehr so absprechend urteilen, als dies meist geschieht, wenn man solche Anlagen mit eigenen Augen sehen und bewundern konnte. Freilich dürfte dieser Fleiß dem einstigen Ansiedler wohl kaum zu statten kommen, denn der Eingeborene wird wohl nur schwer als Arbeiter für andere zu erziehen sein.
Eigentliche Dörfer trafen wir auf unserer Wanderung nicht, sondern nur eine kleine Siedelung von fünf Häusern, die unbewohnt zu sein und den Bilibiliten zu gehören schienen. Sie dienten offenbar zum Aufenthalt und Schutz der Insulaner während der Bearbeitung und Ernte in den Plantagen, in welchen überhaupt fast stets kleine Hütten errichtet sind. Gerade während der Feldarbeit pflegen am ersten Überfälle stattzufinden, weil sich dann in der allgemeinen Verwirrnis[S. 80] am leichtesten ein paar Frauen oder Kinder erschlagen lassen, was jeder Papuakrieger als sehr ruhm- und ehrenvoll betrachtet. Die Männer pflegen daher, wie fast stets, ihre Waffen bei sich zu tragen, um sie auch in den Plantagen immer bereit zu halten. Eine der großen hölzernen Trommeln war auch in dieser kleinen Siedelung vorhanden, um bei einem feindlichen Überfall die Inselbewohner zu alarmieren und herbeizurufen. Kokospalmen fanden sich wie überhaupt nur wenig; aber wir sahen ein paar Melonenbäume (Carica) und Kürbisse; gleich hieß es auch hier »Maclay!« Wir trafen einen hübschen Bach mit klarem fließenden Wasser, an welchem die Sagopalme vorzukommen scheint. Wenigstens stießen wir auf eine Stelle, wo Sago gemacht worden war. Die von Mark entleerten Stämme lagen umher; Rippen des Basisteiles des Blattes hatten als Tröge zum Auswaschen des mehlhaltigen Markes gedient, das Fabrikat selbst hing in ca. zehn Pfund schweren runden, in Bananenblättern eingehüllten Klumpen im Schatten der Bäume zum Trocknen. Dieser Papua-Sago hat aber, um dies noch zu erwähnen, nichts mit dem, wie wir ihn aus unseren Suppen u. dergl. kennen, gemein. Statt rundlicher Körner bildet er eine weißliche, mehlartige, fest zusammengebackene Masse, die beim Gebrauch erst zerklopft werden muß. Die Eingeborenen bereiten den Sago meist in Form von Klößen, die in Wasser gekocht nichts weniger als zart werden. Aber ein Papuamagen kann ungeheure Quantitäten dieser harten Klöße vertragen, und »Bom« gilt in solchen Distrikten, wo er rar ist, als eine besondere Delikatesse.
Als wir nach unserem Boote zurückkehrten atmete der Schwarze den ich dabei, vorsichtigerweise mit ungeladenem Gewehr, zurückgelassen hatte, wieder auf, denn diese Neu-Britannier konnten sich von dem weit besseren Charakter ihrer dunklen Brüder in Neu-Guinea noch immer nicht überzeugen.
Der Strand besteht hier, wie fast überall an der Küste von Astrolabe-Bai, aus feinem Sande, auf welchem es in der Sonne zuweilen wie Gold flimmerte. Leider rührte das Flimmern nicht von Gold, sondern Eisenglimmer her. Sonst fanden sich nur kleine runde Rollsteinchen,[S. 81] Jaspis, Hornstein u. dergl., offenbar durch Regenbäche weiter aus dem Innern angeschwemmt, denn die geologische Beschaffenheit der Küste weist auf korallinische Bildungen hin. Überall kann man, gleich erratischen Blöcken, isolierte Madreporenstücke beobachten, wie dies auch in Konstantinhafen der Fall ist und die wahrscheinlich, wie die ganze Küste, vulkanischen Hebungen des Meeresbodens ihr Dasein verdanken.
Zahlreiche Kanus gaben uns das Geleit, als wir nach dem Dampfer zurückkehrten, der keinen Ankerplatz gefunden hatte und daher an- und ablegen mußte, wobei er beinah auf Riff geraten wäre. Die etwa zwei Meilen breite Meeresstraße zwischen Bilibili und dem Festlande, scheint nicht ganz »rein«, wie der Seemann sagt, d. h. frei von Korallriffen.
Die Eingeborenen waren inzwischen noch zutraulicher geworden und brachten sogar ihre Frauen mit, um ihnen die Fremden zu zeigen und Geschenke zu empfangen, die sie mit einer Würde entgegennahmen, als sprächen täglich Dampfer hier vor. Aber an Bord kam natürlich keine, denn hier, wie in Bongu oder wohin ich sonst in Neu-Guinea kam überall zeigte sich die größte Moral und Decenz, in welchen Papuas vielen Kulturmenschen als leuchtende Beispiele dienen könnten. Ein Mann brachte seine ganze Familie mit, die aus einer Frau und drei Kindern bestand, niedliche Geschöpfe, wie die meisten Papuakinder — und dabei so artig! Da könnten viele unserer Mütter etwas lernen! Mit den Gegengeschenken sah es wie immer äußerst dürftig aus, obwohl Kanus voll Bananen und Zuckerrohr das Schiff umlagerten. Wie gewöhnlich fielen nur einige Kokosnüsse ab, aber vergebens bemühte ich mich, ein Schwein zu erhandeln, mit denen das Dorf so gesegnet war als mit Kindern.
Ja, dieses Bilibili ist eine reiche Insel und ihre Bewohner, die ich auf ca. 200 bis 250 schätze, sind die Patrizier von Astrolabe-Bai, die sich ihre Stellung jedenfalls oft zu erkämpfen hatten. Davon zeugten die oft häßlichen Speer- und Pfeilwunden, die ich am Körper so manches Kriegers bemerkte. Wenn die Wehrhaftigkeit, die aus dem ganzen Aussehen dieser Männer spricht, ihnen die dominierende[S. 82] Stellung über die Küstenstämme verschaffte, so haben sie diese auch der geschützten Lage ihrer Insel zu verdanken, die behagliche Wohlhabenheit aber ihrem Fleiße und ihrer Betriebsamkeit. Denn nicht nur als treffliche Ackerbauer lernten wir die Bilibiliten kennen, sondern auch als ausgezeichnete Schiffsbauer und Industrielle. Die Insel ist nämlich berühmt wegen ihrer Töpferei. Das Gewerbe ruht wie überall in Neu-Guinea ausschließend in den Händen der Frauen und geschieht in derselben einfachen Weise als an der Südostküste. Die[S. 83] Töpfe werden nur mit Hilfe eines flachen Steines und eines kleinen Holzschlegels verfertigt, gleichsam aus dem Klumpen Lehm getrieben, was ein ganz wunderbares Augenmaß erfordert. Das Brennen geschieht in derselben einfachen Weise wie in Port Moresby im Freien, indem die sorgfältig im Schatten getrockneten Töpfe leicht mit Holz überdeckt und beim Anzünden desselben kurze Zeit einer scharfen Glut ausgesetzt werden. Aber das Fabrikat scheint im ganzen besser und haltbarer, z. T. eleganter, als das an der Südostküste. So sah ich unter anderem mit Buckeln ornamentierte Töpfe. Aber die unbedeutenden, häufig durch Nägeleindrücke hervorgebrachten, Muster sind wohl kein Ornament, sondern wie in Port Moresby Handelsmarke. Wie meine Skizze eine Töpferin in der Arbeit zeigt, so auch die eigentümliche kugelige Form der Töpfe, die fast über ganz Neu-Guinea dieselbe ist. Auch hier werden vorzugsweis zwei Sorten Töpfe angefertigt, eine mit weiter Öffnung zum Kochen (Bodi) und eine mit enger, als Wassergefäße (Io). Wie Port Moresby an der Südostküste Neu-Guineas das Centrum der Töpferei und des Topfhandels bildet, so Bilibili für Astrolabe-Bai und wahrscheinlich weiter darüber hinaus. Die »Wab« (Töpfe), welche wir in Konstantinhafen sahen, stammten von hier, wie die unternehmenden Bilibiliten, als sie uns dort wiederholt besuchten, gleich ganze Kanuladungen ihres Fabrikates mitbrachten.
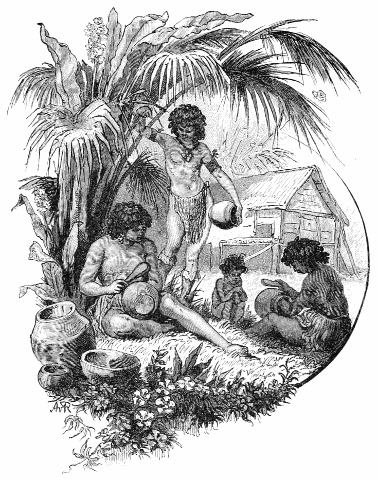
Zum Vertriebe desselben dienen ihre trefflichen Kanus, die besten in ganz Astrolabe-Bai. Sie bestehen wie überall im wesentlichen aus einem 20 bis 30 Fuß langen ausgehöhlten Baumstamm, dem aber jederseits ein oft zwei Bretter aufgelascht sind, so daß das Fahrzeug dadurch bedeutend höher und tragfähiger wird. Diese Seitenborde schmückt öfters bunte Malerei, Figuren von Fischen, Schildkröten, Vögeln darstellend. Der Baumstamm, welcher den Hauptteil des Fahrzeuges bildet, läuft jederseits in eine Spitze aus, die Bordplanken in einen S förmig gebogenen Schnabel. Das Auslegergerüst besteht aus zwei langen Querhölzern und einem ca. 14 Fuß langen, ziemlich schwachen Auslegerbalken (Balancier). In der Mitte des Kanu ist eine Plattform angebracht, auf welcher sich zuweilen ein Aufbau,[S. 84] gleich einem großen Käfig erhebt, und der nicht selten überdeckt, eine Art kleiner Hütte bildet. Hier werden Waren (Töpfe), Vorräte und Waffen untergebracht; auch steht hier ein Topfscherben mit glimmenden Kohlen. Das Fahrzeug besitzt einen, zuweilen zwei Maste, mit mächtigem Segel aus Mattengeflecht. Die Spitze des Mastes ist häufig mit einem roh aus Holz geschnitzten Vogel verziert oder mit rotbemalten Nautilusmuscheln, sonst ist kein Schnitzwerk vorhanden. Der Anker besteht aus einem Stück Baumstamm, an welchem die abgehackten Äste die Haken bilden, und wird mit Steinen beschwert; als Ankertau dient ein starker Rotang. Diese Fahrzeuge segeln sehr gut, und halten sich selbst bei unruhiger See trefflich, aber die Bilibiliten sind im ganzen wie alle Papuas keine großen Seefahrer, obwohl sie ihre Fahrten bis Karkar (Dampier-Insel)[S. 85] ausdehnen. Sie verlieren aber auch bei dieser nur 40 Meilen weiten Fahrt Land nie aus Sicht und pflegen bei unruhigem oder drohendem Wetter überhaupt nicht auszugehen. Überdies ist ja das Meer hier im ganzen meist ruhig. Kleine Kanus sind übrigens, um dies noch beiläufig zu erwähnen, ganz so wie in Bongu (Taf. VI, 1).

Nur zu schnell mußten wir von dem schönen und interessanten Bilibili scheiden, zum größten Leidwesen der Bewohner selbst, mit denen wir die beste Freundschaft geschlossen hatten, was ja auch zu den Aufgaben unserer Expedition gehörte. Zwei weitere Besuche auf der Insel bewiesen uns dies am deutlichsten und unsere Freunde Ur und Kaschom, die mit zu den ersten Häuptlingen Bilibilis zu gehören scheinen, werden uns in so gutem Andenken behalten, wie wir sie. Für Missionsunternehmen giebt es übrigens keinen besseren Platz als Bilibili, aus Gründen, die ich hier nicht weiter erörtern will, und so kann ich die Insel der deutschen Mission, die am ersten dazu berufen ist, Licht in jene Regionen zu bringen, nur bestens empfehlen.
Nordwärts von Bilibili passierten wir drei kleinere, dichtbewaldete Inseln, von denen nur die mittlere, Jambom der Eingeborenen (Colomb-Insel[25] der deutschen Karten), bewohnt ist, und deren Bewohner uns durch Winken mit grünen Zweigen ans Land einluden. Wir konnten uns aber nicht aufhalten, sondern dampften längs der Küste weiter, die mit dichtem Urwald bedeckt ist und wenig bewohnt scheint, denn wir sahen nur ein Dorf und auch sonst keinen Rauch oder Anzeichen von Menschen. Wir näherten uns den »Dreißig Inseln oder dem Archipel der zufriedenen Menschen« ein Labyrinth von Inseln und Wasserstraßen, von dessen Charakter man erst bei näherer Untersuchung Kunde erhält. Gleich hinter der ersten etwas vorspringenden Ecke, die ich später Kap Kusserow nannte, öffnet sich eine Meeresstraße, die uns sehr der Untersuchung wert schien. Das Whaleboot wurde daher rasch klar gemacht, und Kapitän Dallmann[S. 86] und ich ließen uns, vorsichtig das Lot werfend, hineinrudern. Bald zeigte es sich, daß das rechte nördliche Ufer nicht Festland, sondern eine Insel war, deren Bewohner in nicht geringe Aufregung gerieten. Die großen Signaltrommeln ließen bald ihren dumpfen Klang ertönen, dazwischen rief die Muscheltrompete die Krieger herbei und bald nahten sich bewaffnete Kanus. Obwohl hier eine ganz andere Sprache gesprochen wird als bei Port Konstantin und selbst auf dem kaum sieben Meilen entfernten Bilibili, machte ich den Leuten unsere friedlichen Zwecke bald klar, und mittelst einiger Geschenke hatte ich mir schnell neue Freunde erworben. Wir fanden an der Westseite der Insel, Grager oder Gragr der Eingeborenen (»Fischel-Insel« der deutschen Karten), eine hübsche Bucht, vollkommen geschützt und weit besser als Konstantinhafen, die ich nach einer lieben Freundin Elisabeth-Bucht nannte. Wir eilten mit dieser froher Kunde nach der Samoa zurück, die gerade noch vor Dunkelwerden glücklich hier in 4½ Faden Tiefe zu Anker gebracht wurde. Wir hatten übrigens eine sehr unruhige Nacht in Elisabeth-Bucht und unsere Schwarzen fürchteten sich vorn zu schlafen. Auch die Eingeborenen waren die ganze Nacht auf den Beinen; wir konnten sie beim Scheine großer Feuer sehen und sogar sprechen hören, dazu der Lärm großer und kleiner Trommeln, Muscheltrompeten dazwischen und von oben herab mächtiger Donner! Schwere, schwarze Wolken schienen sich fast auf die Mastspitzen herabzusenken, jeden Augenblick erwarteten wir den Ausbruch des heftigsten Platzregens, aber wie so oft in den Tropen blieb es nur bei Donner und Wetterleuchten, das letztere in so intensiver Stärke, wie man es selten anderswo sehen wird. Fast ununterbrochen zuckten die grellen Lichter, so daß momentan das Dorf deutlich sichtbar war; in der That eine großartig schauerlich schöne Erscheinung, die Neulingen wohl Furcht einflößen konnte. Da man Eingeborenen nie trauen darf, so waren Vorsichtsmaßregeln getroffen, besonders Blaufeuer und Raketen zurecht gelegt, die allemal den gewünschten Erfolg haben. Am anderen Morgen setzten die Eingeborenen ihre Trommelei und Singerei unverdrossen fort, denn sie feierten, wie uns ein Besuch an Land sogleich lehrte, eines[S. 87] jener Feste, die oft mehrere Tage und Nächte dauern. Wie alle Inseln des Archipel der zufriedenen Menschen besteht auch Grager aus dichtem Korallfels und ist dicht bewaldet, hat aber nur wenig Kokospalmen aufzuweisen; ich zählte nur 70. Die Insel besitzt zwei kleine Dörfer, von je 12 bis 15 kleinen Häusern, Grager und Tebog, von denen die erstere etwas größere der Insel den Namen verschaffte. Denn gewöhnlich haben die Eingeborenen keine Eigennamen für Landstriche oder Inseln, sondern benennen solche nach den hervorragendsten Siedelungen. In jedem Dorfe war ein Versammlungshaus, klein, unbedeutend und ohne allen Schmuck von Schnitzereien. Im Inneren befanden sich nur die bekannten Lagerstätten, Holztrommeln, Schilde und Schweinekinnladen. Ein paar der letzteren dienten, wie einige Stücke gekochten fetten Schweinefleisches, sorgfältig in Blätter eingepackt aufgehangen, als Erinnerung des soeben begangenen Festes, eines »Marsap«, wie diese Feste hier statt des »Ai« in Konstantinhafen heißen. Da an solchen die Frauen nicht teilnehmen, ja kaum die Töne der dabei gebrauchten Instrumente hören dürfen, so verwunderte mich deren Abwesenheit nicht im geringsten, aber[S. 88] die Bewaffnung der Männer erschien außergewöhnlich und als eine Vorsichtsmaßregel angesichts des ungewöhnlichen Besuches. Das Fest hatte übrigens viel Teilnehmer von den Nachbarinseln versammelt, die mit reichgefüllten Schüsseln sich in ihren Kanus heimwärts begaben und gewiß viel über die Fremdlinge zu erzählen wußten. Wie überall giebt nur ein Fest Gelegenheit, Papuas in vollem Aufputz zu sehen; ich ließ dieselbe nicht ungenützt vorübergehen. Hier einige Aufzeichnungen, welche zugleich für den ganzen Archipel, ja Astrolabe-Bai allgemein gültig sind und junge Stutzer (wie S. 87) in vollem Staate betreffen. Das Haar, sorgfältig in eine weit abstehende Wolke aufgezaust, ist rot gefärbt und wird von zwei »Dedal« festgehalten. So heißen ca. 3–5 mm schmale zierlich durchbrochen gearbeitete Bändchen, aus fein gespaltener Pflanzenfaser oder dergl., mittelst Kalk weiß gefärbt, die ganz wie gehäkelt aussehen und mit zu den reizendsten Zieraten der Papuas gehören (vergl. Atl. XVII 7, 8). Ich fand sie nur in diesem Gebiet. Jederseits hinter dem Ohr steckt ein Kamm (XVII. 1) aus Bambu, »Gatentaun«, in der Form dem unserer Frauen ganz ähnlich, dessen ca. 5–6 cm breiter Rand zierlich durchbrochen gearbeitet und rot bemalt ist. Dieser Kamm wird hinterseits mit einem Büschel Kasuarfedern (Tuar), frischen, grünen, feinen Farn, wohlriechenden Kräutern oder mit dem »Ssi« geschmückt. Letzterer ist ein zierlich mit abwechselnd gelb, rot und schwarz gefärbtem Gras umwundenes kurzes, dünnes Stäbchen, zuweilen mit einer weißen Hahnenfeder versehen, das auch sonst im Haare getragen und für die hiesige Jugend charakteristisch wird. Im Ohr hängt ein aus Schildpatt gebogener breiter Reif, »Damala«, (XVII 4) häufig mit eingraviertem Ornament, rotem Anstrich und besonderen, sehr hübschen Anhängseln aus Schnüren feiner dünner Muschelplättchen, einem halbdurchgeschnittenem Fruchtkern und einigen Hundezähnen als Bommel. Ein paar der letzteren dienen auch als seltener Schmuck durch die Nasenscheidewand, für gewöhnlich steckt aber nur ein bleistiftdickes rundes kurzes Stückchen Holz in derselben oder ein aus Tridacna geschliffener Stift, »Gin«, genannt. Am seltensten ist ein sehr kunstvoll aus Perlmutter geschnitzter Nasenschmuck (wie Taf.[S. 89] XX 5). Junge Leute lieben ein glattes Gesicht und reißen daher die hervorsprießenden Barthaare sorgfältig aus wie die Augenbrauen. Sie rasieren auch (mit einem scharfen Bambu oder Muschelstück) das Stirn- wie Nackenhaar ab, damit recht viel rote Farbe, »Bähm«, zur Geltung kommen kann, denn diese ist zum Festschmuck eines Papua-Swell unbedingt erforderlich. Gewöhnlich genügt ein Längsstrich über Stirn und Nase und ein paar Querstreifen über die Backen, zuweilen wird noch ein weißer Ring ums Auge gemalt. Wo man aber recht viel der teuren roten Farbe übrig hat, da wird nicht gespart, und das ganze Gesicht, zuweilen auch der Rücken erhalten den beliebten roten Anstrich. Ja, auch Armbänder, Ohrringe, Pfeil- und Speerspitzen werden noch bemalt, denn Rot ist die Freudenfarbe der Papuas und nur ausnahmsweis Zeichen des Krieges. Der gewöhnlichste Halsschmuck für junge Leute sind Schnüre, mit zierlich aufgereihten, kleinen weißen Kauris (einer Art Nassamuschel), »Darr« genannt, die als Material zu Schmucksachen hier, wie fast überall in Neu-Guinea, eine so hervorragende Bedeutung haben. Aus gleichem Material werden auch Stirnbinden getragen, da solche aus den kostbaren Hundezähnen für junge Leute meist zu teuer sind. Kleine schon bei Bongu erwähnte filetgestrickte Brusttäschchen sind auch hier unzertrennlich mit dem Ausputz eines jeden Mannes und werden in sehr hübscher Weise mit zierlich eingestrickten Querschnitten der Samenkerne von Coix lacrymae angefertigt und mit Troddeln von gleichem Material behangen. Selten kann sich ein junger Mann einen Brustschmuck aus Hundezähnen erlauben, die in der Form eines Triangels (vergl. Abbild. S. 87) aufgereiht, an einem Strickchen um den Hals getragen werden. — Ich will gleich hier bemerken, daß wenn von »Hundezähnen« die Rede ist, damit allemal nur die Eckzähne gemeint sind, wovon jeder Hund nur vier besitzt, daß also dieses Material mit Recht als wertvoll gilt, wie dies in ganz Melanesien der Fall ist und bei unseren prähistorischen Vorfahren der Fall war. Sehr reich und geschmackvoll wird der Oberarm geschmückt. Statt der gewöhnlichen Grasbänder werden bei Festen die wertvollen »Ari« getragen (Atlas XVIII, 3). Sie bestehen ebenfalls aus rotgefärbtem[S. 90] feinem Grasgeflecht, sind aber sehr breit (bis 14 cm) und am Rande mit Kauris, sowie flachen Ringen, aus dem Basisteile eines Conus geschliffen, sehr geschmackvoll besetzt. »Suar« heißen die breiten Armbänder aus einem gebogenem Stück Schildpatt, die in der That mit zu den feinsten Kunstarbeiten (Atl. XIX. 2) der Papuas überhaupt zählen. Wie mir ein tüchtiger Fachmann versicherte, erfordert schon das gleichmäßige Rundbiegen eines bis 14 cm langen und 7 bis 8 cm Durchmesser haltenden Stück Schildpatts mittelst Erhitzen eine große Sorgfalt und Geschicklichkeit, die bei uns nicht jeder Arbeiter besitzt. Diese Armbänder sind nun überdies mit sehr verschiedenartig eingravierten Ornamenten in geschmackvoller und schwungvoller Zeichnung verziert, die bei uns Beifall finden würden und denselben weit mehr verdienen, wenn man bedenkt, daß nur Muschelbruchstücke, spitze Steine oder scharfe Eberzähne als Werkzeuge dienten. Aber die »Wilden« schrecken selbst nicht vor härterem Material als Schildpatt zurück, wie die schmalen Armringe, »Bio« genannt, kaum 7 mm breite Basisabschnitte von Trochus niloticus zeigen, deren Außenrand zuweilen schöne Gravierung tragen (XIX. 4). Um die letztere besser hervortreten zu lassen, ist das Vertiefte mit roter Farbe, bei den Schildpattarmbändern mit weißer (Kalk) eingerieben, was trefflich wirkt und gewiß für den guten Geschmack dieser Künstler des Steinalters spricht. Ich glaube kaum, daß unsere Pfahlbauer derartige Kunstsachen anfertigten, wozu ihnen ja auch schon das Material fehlte. — Wie um das Fesselgelenk, so ist zuweilen unterm Knie ein breites Band von rotem Stroh umgeflochten, seltener das Fußgelenk bis zur halben Wade herauf. Letzteren Schmuck sieht man kaum bei jungen Leuten, die dagegen mit Vorliebe einen ca. 10 cm breiten Leibgurt, »Ja sigilon«, aus gleichem Material tragen (ähnlich Atlas XVI. 3 a). Derselbe wird so fest als möglich gleich um den Leib geflochten und schnürt die Taille in unnatürlicher und nach unseren Begriffen in gesundheitsschädlicher Weise ein. Ich schnitt einem kräftigen jungen Manne von ca. 27 Jahren einen solchen Gurt vom Leibe, der nur 65 cm Umfang zeigte. Aber dieses Einschnüren ist auch an der Südostküste Neu-Guineas[S. 91] beliebt und gilt als äußerst »fesch«. Außer diesen Leibgurten werden zuweilen aber selten noch schmale Leibschnüre getragen, unter denen solche aus Delphinzähnen, »Bali«, und die schon bei Bogadschi erwähnten Gogu, die hier »Popok« heißen, am wertvollsten sind. Daß bei einem Feste wie dem soeben gefeierten besonders feine, rotgefärbte, zum Teil hübsch gemusterte Mal in der Weise, wie dies Fig. 1 (Taf. XVI des Atlas) zeigt, angelegt werden, ist selbstverständlich; auch an buntem Blätterschmuck in Armband und Haar fehlt es nicht. Dagegen war Federschmuck (»Kalun«) seltener; am häufigsten weiße Hahnenfedern, sowie Kakaduhaubenfedern oder rote Schwanzfedern vom Weibchen und grüne vom Männchen des Edelpapageis (Eclectus polychlorus). Schmuck aus Kasuarfedern sieht man hier wenig, vermutlich weil der Kasuar (Tuar) selten ist. Die jungen Leute müssen sich meist mit einer Hahnenfeder begnügen, denn nur den Männern scheint reicherer Federschmuck zuzukommen, wie einige besondere Schmuckgegenstände. Darunter steht für alle Krieger ein eigentümlicher Brustschmuck (vergl. Atlas Taf. XXII. 4, 5) oben an, sehr geschmackvoll aus zwei Ovulamuscheln und einem fein geflochtenem blatt- oder herzförmigen, mit Kauris besetzten Anhängsel gefertigt. Er ist gleichsam ein Attribut des waffenfähigen Mannes und verbreitet sich in dieser Form weit über gewisse Teile Neu-Guineas, für welche dieselbe charakteristisch ist. Dieser Brustschmuck wird beim Kampf vom Krieger in den Zähnen gehalten, um den Gegner herauszufordern und schrecklicher zu erscheinen, ein Gebrauch, der sich in allen von mir bereisten Gegenden von Neu-Guineas wiederfindet. Ein weit seltenerer und kostbarer Schmuck ist ein fast zirkelrund gebogener Eberhauer[26] »Sual«, so kostbar, daß ihn eigentlich nur Häuptlinge erschwingen können. Minder reiche Leute begnügen sich mit einer Imitation aus Tridacnamuschel geschliffen oder zwei gewöhnlichen großen Eberzähnen. Wie erwähnt schmücken sich ältere Leute weniger als junge, ganz wie dies bei uns der Fall ist, und wie überall[S. 92] der Mensch mit dem Vorrücken der Jahre immer weniger Gefallen an den Eitelkeiten dieser Welt findet. So bedienen sich ältere Männer kaum mehr roter Bemalung und schwärzen höchstens das Kopfhaar (comme chez nous!).

Eine größere Versammlung von Eingeborenen giebt auch am besten Gelegenheit zu anthropologischen Studien. Ich überzeugte mich auch hier aufs neue von der großen Verschiedenheit in den Gesichtszügen und doch waren diese Papuas gewiß frei vom Einfluß fremder Beimischung. Aber auch bei diesem Naturvölkchen ist es wie bei uns, und es herrscht eine ebenso große individuelle Abweichung! So waren typische Judengesichter nichts Seltenes; andere erinnerten durch ihre gebogenen Nasen an Indianer und einzelne unterschieden sich, abgerechnet Hautfärbung und Haar, kaum von Europäern.
Wahrscheinlich noch in Festesstimmung zeigten sich übrigens die neuen Freunde recht dreist, erkletterten in hellen Haufen das Schiff, so daß ich genug zu thun hatte, um Ordnung zu halten und die Überzahl sanft von Bord zu spedieren. Sie hatten wie immer wenig zu vertauschen und Bananen und Schweine, nach denen uns am meisten gelüstete, selbst aufgezehrt.
Dem Gewimmel der Eingeborenen wurde übrigens ein jähes Ende gemacht, als Kapitän Dallmann gegen Mittag von seiner Bootexkursion mit der frohen Kunde zurückkehrte, daß der bislang vergebens gesuchte Hafen gefunden sei, und zwar ein ganz vortrefflicher. Schnell wurde Anker gehievt, und kaum eine halbe Stunde später lagen wir in dem herrlichen Bassin, das wir zu Ehren Seiner Kaiserlich und Königlichen Hoheit dem Kronprinzen »Friedrich-Wilhelms-Hafen« benannten. Das war am 19. Oktober! Die Erinnerungen, welche sich an den vorhergehenden Tag knüpfen (Geburtstag des Kronprinzen, Schlacht bei Leipzig), durften dem neuen deutschen Hafen als gutes Omen gelten, das demselben hoffentlich dauernd günstig bleiben wird. Denn, wenn erst Kaiser-Wilhelms-Land denjenigen Aufschwung nimmt, den wir alle wünschen, wird auch »Friedrich-Wilhelms-Hafen« diejenige Bedeutung erlangen, welche[S. 94] er so sehr verdient. Jedenfalls gehört er mit zu den besten Häfen in Deutsch-Neu-Guinea, ist aber leider mehr mit Fieber behaftet als andere Gebiete, Verhältnisse, die sich bei der einstigen Urbarmachung ebensogut bessern werden, als dies z. B. bei Soerabaja und anderen tropischen Häfen der Fall war. Friedrich-Wilhelms-Hafen ist, wie die vorhergehende Kartenskizze zeigt, eigentlich eine langgestreckte Lagune, von 1½ bis 2 Meilen Breite und 8 Meilen Länge, die von der Dallmann-Einfahrt, wie ich die Straße zwischen Grager und der Schering-Halbinsel benannte, knieförmig tief ins Land nach Südwest einschneidet. Sie ist, was der Amerikaner »land-locked« nennt, d. h. rings von dichtem Urwald umschlossen, also vollkommen gegen alle Winde geschützt. Dabei sind keine »Patches« d. h. untiefe Korallstellen vorhanden und selbst das größte Panzerschiff kann sicher einlaufen, ankern und schwingen. Die von der Samoa gemachten Lotungen hatten dieses günstige Resultat schon ergeben, welches später durch die sorgfältigen Aufnahmen der deutschen Kriegsschiffe (Elisabeth und Hyäne) nur Bestätigung fanden. Die Tiefen halten sich in der Mehrzahl der Lotungen zwischen zwanzig und einigen Meter und fallen nur an wenigen Stellen bis zu vierzehn; die Dallmann-Einfahrt bewegt sich meist in den dreißigen. Der Observationspunkt der Kriegsschiffe auf der Schering-Halbinsel liegt unter Breite 5°, 14,5′ Süd; Länge: 145,47 Ost; der Unterschied zwischen Hoch- und Niedrigwasser beträgt ¾ Meter.
Die Samoa war das erste Schiff, welches in diesem Hafen ankerte, dessen erhabene Ruhe uns allen wohlthat. Und als die Nacht sich herniedersenkte und die Kakadus mit ihrem widerlichen Gekreisch zur Ruhe gebracht hatte, schlief auch ich unter dem eintönigen Gezirp der Cikaden und dem Kastagnettengeklapper der Laubfrösche so schön wie lange nicht; wozu die Befriedigung über die neue Entdeckung nicht wenig beitrug. War es doch der erste Hafen, den wir gefunden hatten, und somit die Begeisterung verzeihlich.
Vogelstimmen verkündeten den anbrechenden Tag, denn um diese Zeit sind auch die Tropenvögel wie die unsrigen am lebhaftesten. Sie waren mir alle alte Bekannte von der Südostküste. Den meisten[S. 95] Lärm machten wie immer weiße Kakadus (Cacatua Triton) und Papageien (Eclectus polychlorus); Loris (Lorius erythrothorax) und Sittiche (Trichoglossus Massenae) ließen pfeilschnell die Luft durchschießend ihren schrillen Lockruf vernehmen; dazwischen tönte das tiefe: arr, arr, raab, raab, aai, aai des Raben (Corvus orru), und das dumpfe Brummen der weißen Fruchttaube (Carpophaga spilorrhoa), das tiefe »balebakú« ihrer grünen Base (Carpophaga poliura); das mannigfach modulierte Geschwätz des nimmer müden Lederkopf (Tropidorhynchus Novae Guineae). Aber nicht alle Teilnehmer dieses tropischen Vogelkonzerts tönen dem Ohre unangenehm entgegen, manche lassen Wohllaute erklingen, die sehr ansprechend sind. So die reinen, wie abgestimmten Pfiffe, welche das Gegurgel und Geplärr der Krähenwürger durchsetzen, von denen sich der einfarbig schwarze Cracticus Quoyi am meisten hervorthut, so der melodische Glockenton einer Pirolart (Mimeta), und vor allem die vollen und abwechselnden drosselartigen Strophen einer Pinarolestesart, die den Namen »Neu-Guinea-Nachtigall« verdient und wie diese ein unscheinbares, braunes Vögelchen ist, das freilich zu einer ganz anderen Familie gehört. Mächtiges Rauschen, ähnlich dem Brausen einer Lokomotive, übertönt zuweilen das Gesamtkonzert und verwundert schaut der Neuling umher. Ein paar Nashornvögel (Buceros ruficollis) durcheilen die Luft und erzeugen durch die mächtigen Schläge ihrer kurzen Flügel jenes fremdartige, fast erschreckende Geräusch, so laut wie es kein Adler hervorbringt. Aber Raubvögel sind selten: einige schwarzohrige Milane (Milvus melanotis), ebenso träge als ihre schön gefärbten Vettern, Haliastur girrinera, sitzen hie und da auf dem dürren Aste eines Urwaldriesen, noch seltener sieht man einen weißbauchigen Seeadler (Haliaetus leucogaster), den größten Raubvogel Neu-Guineas, hoch in den Lüften seine Kreise beschreiben. Das ist so ungefähr alles, was sich von der Vogelwelt bemerkbar macht, denn wie der geschlossene Hochwald bei uns, so ist auch der Urwald ärmer als freieres Terrain. Aber wo bleiben die Paradiesvögel? höre ich fragen, von denen man sich in Neu-Guinea jeden Baum voll träumt. Ja! die hatte ich schon in Konstantinhafen gehört und gesehen,[S. 96] aber ich konnte sie so wenig erlangen als hier, denn es gab eben Wichtigeres zu thun. Übrigens ist es eine der Paradisea apoda und papuana verwandte Art mit gelben Seitenbüscheln, wie mir die wenigen von den Eingeborenen gebrachten schlechten Bälge zeigten, bei denen der Vogel hier »Do« heißt.
Wie zu erwarten, dauerte die wohlthuende Ruhe infolge des Fehlens der Eingeborenen nicht lange, denn fast mit den ersten Vogelstimmen, früh 5½ Uhr, hörten wir auch die unserer Freunde und Gönner von Grager, und bald hatte sich eine Anzahl Kanus um den Dampfer gesammelt. Ich konnte mich aber zu ihrem großen Leidwesen weniger mit ihnen beschäftigen, denn vor allem war uns an einer näheren Untersuchung des Hafens, seiner Dependenzen und Umgebung zu thun. In der letzteren Richtung ließ sich wenig thun, da ein Gürtel dichter Mangrove (Rhizophoren), welcher den Strand bildet, undurchdringliche Schranken setzt. In dem äußersten westlichen verschmälerten zipfeligen Ende des Hafens, der hier Korallriff zeigt und nur mit Boot passierbar ist, setzt ein schmaler Kanal in die Tiefe des Urwalds hinein. Wir befuhren ihn im Boot, blieben aber bald sitzen und überzeugten uns, daß hier keine Flußmündung sei. Das Wasser war brackig und in dem Dickicht der Nipapalmen, deren Wedel überall den Weg versperrten, kaum durchzudringen. Dabei rührte in dem fast stagnierendem Wasser jeder Ruderschlag neue moderige Dünste verfaulender Pflanzenstoffe auf; eine rechte echte Fieberluft, die man förmlich riechen konnte. Übrigens fanden wir die Spuren der Eingeborenen in betretenen Pfaden, die uns später zu wohlgepflegten Plantagen führten. Sie gehören den Inselbewohnern, denn das Festland um Friedrich-Wilhelms-Hafen scheint ganz unbewohnt zu sein. Der Boden ist auch in diesem Gebiet ein sehr fruchtbarer, dessen korallinische Bildung die allenthalben umherliegenden Koralltrümmer deutlich erkennen lassen. Die Baumvegetation war eine entsprechend üppige, aber das Auge sucht vergebens nach jenen lieblichen Kindern Floras, den Blumen, die so mannigfach abwechselnd unsere Wälder zieren. Hie und da sieht man ein lilienartiges Staudengewächs mit plumper Blume, oder hoch in dem[S. 97] Gelaube die schön roten Blumen gewisser Schlingpflanzen guirlandenartig von Baum zu Baum ranken; seltener eine Orchidee. Diese Blumenarmut ist eben für alle Urwälder dieser Tropenregion charakteristisch, wie der Reichtum an Lianen und anderen Schlingpflanzen. Letztere umstricken große Bäume häufig so dicht, daß die sonst schönen Formen bizarr und phantastisch aussehen. Die zahllos herabhängenden, oft armsdicken Enden, und die dünnen, mit häßlichen feinen Dornen besetzten Ranken bereiten häufig unüberwindliche Hindernisse. Diese rankenden Lianen, die sich anfangs, unschuldig wie unser Epheu, gleichsam schutzsuchend, an dem Baumstamme emporwinden, saugen an seinem Lebensmark bis sie ihn schließlich ganz ersticken. Hunderte von Parasitenarmen, zu gewaltiger Dicke angewachsen, umklammern und halten den morschen Riesen noch zusammen, an dessen Zerstörung Milliarden geschäftiger Ameisen mithelfen, bis ihn ein Windstoß ganz zu Boden streckt. Das ist so in wenigen Strichen das Bild eines Urwaldes, wie ich es im großen und ganzen überall in jenen Regionen fand, und das meist sehr von den Vorstellungen abweicht, welche sich der Laie macht. Ja, diese Urwälder sind großartig, interessant durch die Menge neuer Eindrücke, welche sie dem Neuling bieten, der manche Begriffe von Baumwuchs, Üppigkeit und Vegetationsfülle zu verbessern haben wird, aber ein harmonisches Ganzes wie unsere Hochwälder bieten sie nicht. Wer so lange, wie ich, in diesen Urwäldern lebte, unter ihnen seine Hütte aufschlug und täglich mit Schling- und Rankengewächsen zu kämpfen hatte, wie dies bei meinem früheren Aufenthalte an der Südostküste Neu-Guineas und der Kap Yorkhalbinsel der Fall war, dem werden die heimischen Wälder erst recht lieb geworden sein und nach allen meinen Welterfahrungen muß ich offen bekennen: »Der deutsche Wald ist der schönste!« Freilich ist das ein individuell-nationales Urteil, in welches nicht alle einstimmen werden und brauchen. Ich erinnere mich hierbei eines geborenen Australiers, eines Kolonisten aus Neu-Süd-Wales, mit dem ich von Melbourne nach Sydney reiste. Er kam eben von einer Vergnügungstour aus Europa, und war auch in Deutschland gewesen. Aber unsere schönen Eichen und Buchen[S. 98] hatten keinen Eindruck auf ihn gemacht; das Herz ging ihm erst auf, als er die unschönen Eukalypten mit ihren sperrigen Ästen, der zerfetzten Rinde und graugrünlichen dünnen Belaubung sah, — »the finest trees in the world!« —
Es war sehr schwer, sich über die hydrographische Beschaffenheit unseres neuen Gebietes zu orientieren, und wir vermißten schon hier, wie später noch so oft, den Mangel einer Dampfbarkasse auf das schmerzlichste. Aber die meist unter Führung von Kapitän Dallmann unternommenen Bootfahrten machten uns mit den Gewässern nördlich bis über die Insel Tiar hinaus bekannt und zeigten uns die unrichtige Lage der »Thirty Islands« nach der flüchtigen Aufnahme der russischen Kriegsschiffe (Admirality Chart No. 1084), bis dahin dem einzigen kartographischen Hilfsmittel. Nördlich von unserer nächsten Insel Bilia (Eickstedt-Insel der deutschen Karte), die durch eine so schmale Bootspassage vom Festlande getrennt ist, daß die Zweige der beiderseitigen Bäume ein förmliches Dach bilden, öffnet sich ein zweites geräumiges Bassin, welches sich trefflich als Hafen eignet und später von unseren Kriegsschiffen »Prinz-Heinrich-Hafen« genannt wurde. Dieser Hafen erhält nordöstlich durch eine etwas größere Insel (Götz-Insel) und eine ganz kleine (Koch-Insel), beide dichtbewaldet und unbewohnt, und das dieselbe verbindende Korallriff, vollkommenen Schutz und ist nur durch die Dallmann-Einfahrt zugänglich. Beide Häfen bilden prächtige Verstecke, in welchen sich viele Schiffe verbergen können. Nördlich von der Koch-Insel bis Tiar (Aly-Insel der deutschen Karten) sind viele flache Stellen; östlich ziehen sich Riffe hin, mit heftiger Brandung, sichtbaren Treibholzstämmen und einem schwarzen Felsen, wodurch unseren beiden Häfen eine zweite Schutzmauer gesichert ist. Zugleich wird dadurch eine Einfahrt nördlich von Grager kaum möglich, in welcher Richtung noch zwei weitere Inseln zu folgen scheinen, die aber nach den Aufnahmen unserer Kriegsschiffe nur Teile der ersteren sind. Im übrigen haben die Dampfbarkassen der Kriegsschiffe sich ungefähr in denselben Grenzen gehalten, welche wir mit unserem Segelboot erreichten und ebensowenig als wir eine Flußmündung entdeckt. Übrigens[S. 99] fehlt es nicht ganz an Frischwasser, und es sind wenigstens Tümpel mit solchen vorhanden. Ein Fluß könnte möglicherweise etwas westlich von Tiar münden; wenigstens deuten dichte Bestände von Nipapalmen darauf hin. Wir konnten aber die seichte Bucht nicht näher untersuchen, in der wir, wie schon vorher in einer Seitenbucht von Friedrich-Wilhelms-Hafen, Vorrichtungen zum Fischfang bemerkten, die wir nicht zerstören wollten. Ein dichtes Rickelwerk von eingesteckten Pfählen hinderte den Durchgang, wie für uns so für Fische, und führte die letzteren in Reusen, mit welchen die freigelassenen Öffnungen versehen waren, ganz in der Weise, wie dies allenthalben geschieht.
Nach von Maclay besteht der Archipel aus etlichen dreißig Inseln, aber ich vermochte mir auch bei den Eingeborenen keine Aufklärung zu verschaffen. Ein jedenfalls sehr bewanderter Mann nannte mir zweiundvierzig Namen, die wohl aber weniger Inseln, sondern die oft sehr kleinen, nur aus ein paar Häusern bestehenden Siedelungen betreffen. Ein anderer wußte siebenundzwanzig, ein dritter nur sechs Namen aufzuzählen, die ich aber ohne weiteres übergehen kann, da sie hier doch keinerlei Interesse haben. Aus den Nachrichten der Eingeborenen schien übrigens hervorzugehen, daß die unmittelbare Umgebung der beiden Häfen nicht bewohnt ist, daß aber weiter nördlich »Panu«, Dörfer vorkommen. Nach unseren Erfahrungen dürfte der die Häfen einfassende Urwaldgürtel nicht allzubreit sein und dahinter sich vermutlich schönes Land finden. Wenigstens sahen wir auf den Hansemann-Bergen, die eine gute Landmarke für ansegelnde Schiffe bilden, zahlreiche »Kulturflecke«, d. h. Plantagen. Dies war bei einem späteren Besuch (Mai 1885), bei welchem wir ganz nahe unter der Küste dampfend einen besseren Einblick in diese so schwierigen hydrographischen Verhältnisse erlangten. Der Archipel der zufriedenen Menschen scheint sich von Kap Kusserow ca. 10 Meilen nördlich zu erstrecken, bis zu dem sogenannten Kap Juno von d'Urville, das sich nur schwer erkennen läßt. In diesem Gebiete zählte ich sechzehn kleine Inseln, die alle niedrig, anscheinend unbewohnt und dicht bewaldet sind, wie die Festlandsküste selbst,[S. 100] welche oft schwer zu unterscheiden ist. Verschiedene dieser Inseln sind durch Riff verbunden und dürften bei näherer Untersuchung vielleicht brauchbare Ankerplätze geben. Die Einfahrt zu einem anscheinend sehr geräumigen, trefflichen Hafen sah ich südlich von Juno-Point, wir hatten aber keine Zeit, denselben zu untersuchen, und mußten dies schon aus Mangel an einer Dampfbarkasse aufgeben. Wie ich später durch Güte von Herrn Friederichsen erfuhr, ist dieser Hafen im Jahre 1883 von dem russischen Kriegsschiff »Skobeleff« besucht und »Port Alexis«[27], die davor liegende Insel »Skobeleff« benannt worden. Ihr nördlichster Punkt wurde zu 5°, 4′, 6″ Süd und 145°, 48′, 21″ Ost bestimmt.

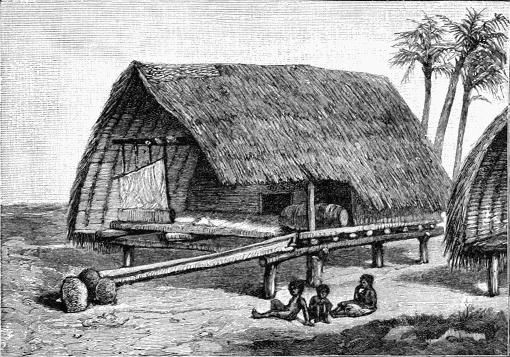
Auf den von unserer Admiralität publizierten Karten sind nördlich von Grager (Fischel-Insel) nur zwei größere Inseln: Örtzen und Follenius, und zwischen[S. 101] beiden etwas westlich, eine kleine, Franz-Insel, verzeichnet, alle übrigen Inseln weiter nördlich aber weggelassen. Tiár, oder Dsiár, wie es manche Eingeborene aussprechen, (Aly-Insel der deutschen Karten) ist bedeutend kleiner als Grager, dicht bewaldet, mit wenig Kokospalmen, hat aber eine zahlreiche Bevölkerung, welche im Archipel eine dominierende Stellung zu behaupten scheint, denn auch die Grageriten fürchteten sich vor Tiar. An dem Sandstrande der Westseite landeten wir und besichtigten das Dorf. Die Häuser desselben liegen wie immer sehr zerstreut, sind groß, sehr gut gebaut und stehen niedrig auf Pfählen. Vor der Thür ist ein breiter, von dem seitlich weit herabhängenden Dach mit bedeckter Vorplatz, wie dies die beigegebene Abbildung am besten zeigen wird. Ich entdeckte auch das etwas abseits unter Bäumen versteckte Versammlungshaus der Männer, »Dasem« genannt. Es enthielt ein paar Holz-Signaltrommeln, hier »Do«, von kolossaler Größe (vergl. Atlas XIII. 1.),[S. 102] dadurch neu, daß an dem einen Ende ein großes Loch durchgebohrt war, um, wie die Männer andeuteten, einen Strick durchziehen und so das schwere Instrument leichter bewegen zu können. Außer den üblichen Unterkiefern von Schweinen, hing an einem der Querbalken eine Holzschnitzerei, wie ich sie bisher nicht gesehen hatte. Sie war ziemlich groß, aus einem Stück geschnitzt und stellte einen an den zusammengebundenen Vorderbeinen aufgehangenen, schwarz und weißen Hund oder vielmehr eine Hündin dar, wie drei Reihen Säugewarzen zeigten. Das Tier wurde »Agaun« genannt (Taf. XV. 2), aber wie ich erwartet hatte, nicht verkauft. Die Eingeborenen sahen es aber gern, daß ich ihr Kunstwerk abzeichnete. Die Bedeutung dieser merkwürdigen Figur, die nicht wohl im Zusammenhang mit Ahnenkultus stehen kann, vermochte ich natürlich nicht zu ergründen, aber Laune und Phantasie der Papuas schaffen zuweilen Werke der Holzbildnerei, die ihr Entstehen Zufälligkeiten zu verdanken haben und denen keine tiefere Bedeutung zu Grunde liegt. So sah ich in Neu-Britannien einmal ein Stammstück, auf welchem sehr kenntlich ein Haifisch in Relief ausgezimmert war. Ich dachte natürlich an Haifisch-Verehrung und dergl., erfuhr aber, daß bei Gelegenheit des Fanges eines großen Hais ein Kanaker zum Spaß dessen Bildnis gezimmert hatte, um für seinen Fleiß »Diwarra« (Muschelgeld) einzusammeln. Ähnlichen Ursprunges waren vielleicht die aus Holz geschnitzten Fische, welche wir auf Tiar nicht weit vom Versammlungshause entdeckten, und die, wie die Abbildung zeigt, ebenso sehr durch die Ausführung als namentlich auch die sonderbare Art der Aufstellung überraschten. Sie steckten oder hingen nämlich an langen und dicken Bamburohren, die einen freien Platz schmückten, der unter gewissem »Tabu« zu stehen schien, denn anfänglich wollten die Eingeborenen nicht dulden, daß ich mir das merkwürdige Denkmal näher betrachtete. Als sie aber sahen, daß ich nichts mitnahm, was sie vielleicht gefürchtet hatten, ließen sie mich ruhig zeichnen und verkauften mir sogar einen der Fische. Diese »Ji«, (= Fisch) (XV. 3) waren zum Teil in beträchtlicher Größe (60 cm bis 1 m 80 cm), aus einem Stück Holz gezimmert, bemalt und so natürlich nachgebildet,[S. 103] daß man an einzelnen die Gattung erkennen konnte. So unter anderen Makrele, Hemiramphus, Chaetodon, Pagrus — auch ein Delphin (Phocaena) war dabei. Eine solche, sehr deutlich wiedergegebene, Makrele, hielt einen anderen kleinen Fisch im Maul, eine andere einen Menschenkopf. Auch die Bemalung war im ganzen ziemlich naturgetreu; unter den benutzten Farben Grün bemerkenswert, weil es sonst so selten im Malkasten der Papuas vorkommt und metallischen Ursprungs zu sein scheint. — Holzschnitzereien von Fischen, die wir ja schon in Bilibili sahen, sind übrigens im ganzen Archipel häufig und offenbar Wahrzeichen des Fischereigewerbes, welches hier so sehr floriert. Dafür sprachen die schon erwähnten[S. 104] Reusen, die großen Fischnetze, welche besonders Tiar auszeichneten sowie hübsche Fischhaken »Aule«. Sie bestehen aus einem rundgeschliffenem Stifte aus Tridacna, an welchem mittelst Bindfaden ein Haken aus Schildpatt oder Bein befestigt ist, oder sind ganz aus Schildpatt. Diese Art Fischhaken (vergl. Atlas T. IX, 3–7) finden sich in derselben Weise an der ganzen Nordostküste Neu-Guineas und weichen sehr erheblich von den in Mikronesien gebräuchlichen aus Perlmutter ab. Aber ich erhielt von Banab (Ocean-Island) Fischhaken, die sonderbarerweise in der Form ganz mit denen von Neu-Guinea übereinstimmen, nur daß der Stiel aus Kalkspat besteht, ein Beweis, wie unabhängig voneinander in verschiedenen Lokalitäten dieselben Erfindungen gemacht werden. Eiserne Angelhaken fanden übrigens nicht den Beifall der Eingeborenen, wie dies überall zuerst der Fall ist, wo sie den Vorteil derselben noch nicht kennen. Die Bewohner Tiars scheinen in Bezug auf Schiffsbau und Schiffahrt übrigens mit Bilibili zu rivalisieren, wie die am Strande liegenden Kanus zeigten. Sie stimmen in der Bauart ganz mit denen Bilibilis überein, haben aber keine S-förmig gebogenen Schnäbel, sondern an der Spitze ist ein gekrümmter Stock angebracht, an welchem Nautilus-Muscheln befestigt sind. Dieser letztere Schmuck soll übrigens nur Kanus von Häuptlingen zukommen.

Bilia (Eickstedt-Insel) obwohl größer als Tiar, hat eine viel geringere Bevölkerung und ist in jeder Weise ärmer. Eine Gruppe Kokospalmen zeigte, wie immer, das Bewohntsein an, aber in dem dichten Walde, welcher die ganze Insel bekleidet, fanden wir das Dorf erst als wir die enge Einfahrt an der Nordostspitze entdeckten. Sie führt zu einer hübschen Lagune, welche das Centrum der Insel bildet, die dadurch ganz zu einem Miniatur-Atoll wird; nur daß das Festland viel höher als bei eigentlichen Atolls und mit gutem Boden bedeckt ist. An der Ostseite des inneren Lagunenrandes stehen die wenigen, ziemlich ärmlichen und kleinen Häuser (Aab) die nichts Bemerkenswertes zeigten. Die Leute waren sehr freundlich; nur ein Mann stellte sich sehr ungebärdig und schrie wie ein Verrückter — und war in der That ein solcher, übrigens eine seltene Erscheinung[S. 105] unter Eingeborenen, die mir nur wenigemal vorkam. — Töpferei wird auch auf Bilia betrieben, aber das Fabrikat ist nicht so schön als auf Bilibili. Ein Versammlungshaus war ebenfalls vorhanden, und hier entdeckte ich etwas Neues. Dieses Haus, Szirit genannt, war den Verhältnissen des Dorfes entsprechend klein, im Baustil gleich den großen auf Bilibili. Die beiden Giebelseiten waren fast ganz mit Mattengeflecht aus Kokosblatt zugedeckt, so daß nur eine kleine Thür zum Hineinkriechen frei blieb. In der offenen Giebelspitze hingen aus Holz geschnitzte Fische (hier Ing), ähnlich denen von Tiar, aber schlechter und kleiner. Im Inneren fehlte das bekannte Schlafgerüst (Barim) und die große Trommel (Do) nicht, aber ich entdeckte zufällig ein Gerät, welches die Eingeborenen sehr hochzuhalten schienen und das sie offenbar nur ungern in meinen Händen sahen. Es war dies ein ca. 30 cm langes flaches, spatelförmiges Stück Bambu, in der Form ganz wie ein Falzbein, auf der einen Seite mit fein eingraviertem, zierlichem Muster ornamentiert, von welchen ich schon früher an Bord eine ganze Menge eingehandelt hatte. Ich hielt diese »Tonde« genannten Spatel (vergl. Atlas V, 5, 6) anfänglich für sogenannte Kalklöffel; da sie aber nicht zu diesem Zweck benutzt wurden, glaubte ich, daß sie zum Aufbrechen von Betelnüssen oder dergleichen dienten. Angesichts der Geheimnisthuerei, mit welcher die hier aufbewahrten Spatel, »Tohn« genannt, behandelt wurden, erschien auch diese Deutung unzutreffend, denn niemals sind mir Gegenstände vorgekommen, die von den Eingeborenen offenbar so hoch verehrt wurden als diese. Trotz hoher Gebote wurde nicht einer der zwölf Tohn abgegeben, obwohl dieselben Instrumente außerhalb des Szirit von Bilia kaum von Wert schienen. Zweck und Bedeutung sind mir daher nie recht klar geworden, und erst später fiel es mir ein, daß die Tohn vielleicht mit der Beschneidung, welche auch auf einigen Inseln dieses Archipels herrscht, in Beziehung stehen mögen, obwohl dies aus verschiedenen anderen Gründen kaum glaublich scheint. Wahrscheinlicher dürfte sein, daß sie gleich unseren Spachteln zum Bereiten der roten Farbe (Behm), resp. zum Bemalen dienen, wie das vertiefte Muster in Wahrheit als Stempel benutzt[S. 106] wird, um mit Kalk bepudert als Festschmuck auf die Backen gedruckt zu werden. Rote Farbe, Federschmuck und andere Putzrequisiten waren neben den Tohn im Szirit vorhanden, das ja wie alle diese Versammlungshäuser den Vorbereitungen, zum Teil den Festen der Männer selbst gilt. Wenn die Papuas Neu-Guineas auch kein rechtes Wort für das »Tabu« der Ozeanier zu haben scheinen, so ist die Sitte doch vorhanden. Nicht nur Gegenstände, sondern Häuser, Bäume, ja gewisse Distrikte können für kürzere oder längere Zeit unter »Tabu« gestellt, d. h. unantastbar gemacht werden, wie z. B. zeitweilig die Kokospalmen. Für das weibliche Geschlecht sind die Versammlungshäuser stets tabu, wie das meiste, was sie enthalten. So dürfen, wie ich dies schon in Neu-Britannien beobachtete, gewisse Musikinstrumente der Männer, vor allem die großen Signaltrommeln, nie von einem Weiberauge gesehen werden. Wenn daher auch Frauen ungescheut beim Versammlungshause vorübergehen oder vor demselben stehen bleiben, das Innere betreten sie nicht. Man hat ihnen davor eine so große Furcht eingeflößt, daß jede Frau glaubt, der bloße Anblick einer Trommel würde genügen, sie zu töten, ja selbst der Ton wirkt schon erschreckend und treibt die Weiber in das Innere ihrer Hütten. Diese Furcht hat nichts mit Götzenkultus, Heilighaltung und dergleichen zu thun, sondern ist von den Männern nur aus Klugheit ersonnen worden, damit sie ungestört von den Frauen und Kindern ihre Feste feiern und ihre Schmausereien halten können. Damit erklärt sich das mysteriöse Dunkel sehr einfach und praktisch. Und vergessen wir doch nicht, daß im Leben der Kulturmenschen die Männerwelt vielfach bevorzugt ist und in ihren Klubs, Logen u. s. w. heitere und ernste Versammlungen abhält, an denen die Damen nicht teilnehmen dürfen und die für sie ebenfalls »tabu« sind.
Trotz des von Siedelungen abgelegenen Ankerplatzes war es doch stets lebendig um die Samoa; das Kommen und Gehen von Kanus nahm kein Ende. Alle wollten gern schachern, aber an Lebensmitteln (Taro, Jams, Kokosnüssen) wurde trotz des anscheinenden Überflusses kaum Nennenswertes gebracht. Dabei zeigte sich, wie dies stets der Fall ist, die gegenseitige Eifersucht der Insulaner untereinander;[S. 107] die Grageriten warnten vor Tiar, die Tiariten vor Grager, alle machten sich gegenseitig schlecht und keiner gönnte dem anderen etwas. Ja, auch diese »zufriedenen« Menschen schienen öfters recht unzufrieden, und Streitigkeiten, die mit den Waffen ausgefochten werden, kommen ebenfalls vor. Lebt doch nirgends der Naturmensch in jener paradiesischen Unschuld und Glückseligkeit, in welcher Rousseau und andere Schwärmer denselben schildern, und überall hat der Mensch im Kampfe ums Dasein zu streiten.
Die zufriedenen Menschen sind übrigens in ihren Rassencharakteren echte Papuas, erschienen aber, wie die Bilibiliten, kräftiger und ein feinerer Menschenschlag als die Bewohner von Port Konstantin, hauptsächlich wohl infolge der besseren Ernährungsverhältnisse. Die Höhe der von mir gemessenen Männer bewegte sich zwischen 1,47 und 1,62 Meter. Wir kamen übrigens trefflich mit den Leuten aus, und wie wir sie an Bord der Samoa gut behandelten, so erwiderten sie dies in ihren Dörfern. Freilich zeigten sich die Frauen (Pein) nur verstohlen, aber nach und nach kamen sie mit ihren Männern längsseit, um sich das fremde Ungeheuer und dessen Bewohner anzusehen. Wie ich dies schon in Astrolabe-Bai bemerkt hatte, scheint auch hier, dem sonstigen Brauch vieler Melanesier entgegen, keine Vielweiberei zu herrschen, denn immer stellte uns der Mann nur eine bessere Hälfte vor. Die Leute führen also einen sehr moralischen Lebenswandel, wie ich dies bei allen von der Civilisation noch unberührten Eingeborenen gefunden habe. Dabei herrscht eine Decenz, die vielen Kulturmenschen zum Muster dienen könnte. Als sich einst einer unserer Leute beim Baden unbekleidet zeigte, verbargen alle Frauen und Mädchen scheu ihre Gesichter, und ich will diesen einen Fall nur deshalb anführen, weil man gewöhnlich geneigt ist, von sogenannten Wilden gerade ein entgegengesetztes Betragen vorauszusetzen.

Die Eitelkeit des weiblichen Geschlechts verleugnete sich auch bei diesen Naturkindern nicht, die in ihrem schönsten Staat erschienen, wovon die nachfolgende Abbildung eines jungen Mädchens eine Probe giebt. Die Frauen trugen ihre besten Grasröcke, »Nai«, junge Mädchen vorn und hinten ein buntes Schürzchen (ähnlich T. XVI 9)[S. 108] zuweilen mehrere volantartig übereinander, welche die hübschen braunen Gestalten in der That gut kleideten. Und so ein bißchen Kokettieren verstehen selbst Papuamädchen, das ist ein Erbteil des ganzen weiblichen Geschlechts! Das Haar hing in sorgfältig gedrehten dünnen Strähnen, gleich Polkalöckchen, vorn bis zu den Augen, hinten bis in den Nacken herab und glänzte im schönsten Rot. Schon daran konnte man die Wohlhabenheit erkennen, an dem sonstigen Ausputz aber Reichtum. Den Hals zierten lange Schnüre aufgereihter Samenkerne von Coix lacryma, die an matte Schmelzperlen erinnern, die Brust mehrere große flache Ringe aus dem Basisteil eines Conus, ebensolche waren an den breiten Arm- und Kniebändern aus rotem oder gelbem Grasgeflecht befestigt. Ich habe selten in Neu-Guinea so reich geschmückte Mädchen gesehen als hier, aber es war nur eine Ausnahme, die der besonderen feierlichen Gelegenheit galt. Die Männer hatten mit Beendigung der Feste bereits wieder ihr Alltagsgewand angelegt, d. h. einen gewöhnlichen Lendenschurz, Mal, umgebunden; Armband und Halsstrickchen vollendeten das einfache Kostüm. Ein etwa fingerdicker Halsstrick bezeichnete übrigens einen Häuptling oder angesehenen Mann überhaupt und war unverkäuflich. An Waffen hatten sie Überfluß und verkauften davon am liebsten. Ihre Waffen sind übrigens dieselben als in ganz Astrolabe-Bai (Wurfspeer, Bogen »Fi«, Pfeil »Tu«), aber besser gearbeitet als z. B. in Bongu. Ungern gaben sie dagegen die schön mit erhabener Schnitzerei verzierten runden Schilde her, die ganz so sind, wie die auf Bilibili, die aber hier »Gubir« oder »Gubil« (Taf. XII, 1) heißen, da r und l meist gleichlauten[S. 109] wie in allen Papuasprachen. Die Kunstfertigkeit in Holzarbeiten zeigten besonders die sanduhrförmigen Handtrommeln (Dubuag oder Dugag), deren Henkel zuweilen sehr geschmackvoll durchbrochen gearbeitet waren (vergl. T. XIII 2 u. 3), und kahnförmige oder ovale Schüsseln, Tabir, die mit zu den Wertgegenständen gehören, z. B. den Brautpreis hauptsächlich mit ausmachen. Diese Tabir sind sehr sauber gefertigt, am Rande mit erhabener Schnitzerei verziert und mit einer glänzenden metallischen Masse geschwärzt, die Mangan oder Graphit zu sein scheint. Alle diese Gegenstände waren Repräsentanten der Steinperiode, welche bei unserem Besuche in Friedrich-Wilhelms-Hafen noch voll und ganz herrschte. Von dem durch die Russen zurückgelassenen Eisen sahen wir nichts mehr. Die hiesigen Steinäxte, »Ihr«, sind übrigens ganz so wie die in Bongu.
An Lebensmitteln war kaum etwas zu erlangen, und ohne eigene Vorräte kann der Fremde in diesen reichen Tropengebieten beinahe verhungern. Diese überall in Neu-Guinea herrschende Knappheit an Nahrungsmitteln des Landes ist auch für Inlandexpeditionen, namentlich im Hinblick auf das eingeborene Trägerpersonal, sehr hinderlich und erschwert solche ungemein. Jams heißt in Friedrich-Wilhelms-Hafen »Dabel«, Banane »Fud«, Betel »Jeb«, Schwein »Bor« oder »Bol«, Kokosnuß »Niu«, letzteres ein polynesisches Wort, aber weit über Neu-Guinea verbreitet. Ich führe diese wenigen Wörter nur an, um die große Verschiedenheit der Sprache von Grager und Bongu zu zeigen, Lokalitäten, die kaum 20 Meilen entfernt voneinander liegen und zwischen denen noch fünf oder sechs verschiedene Dialekte gesprochen werden; zugleich ein Beispiel des heillosen Sprachgewirrs in Neu-Guinea und Melanesien überhaupt.
Um für die etwa nachfolgenden Kriegsschiffe Zeichen unseres Besuches zu hinterlassen, beschlossen wir eine Flagge aufzuhissen und klärten zu diesem Zweck eine Stelle auf der die Südseite von Friedrich-Wilhelms-Hafen bildenden Halbinsel, die später auch von den deutschen Kriegsschiffen benutzt und »Flaggenhalbinsel« benannt wurde. Die Eingeborenen sahen diesen Arbeiten mit Vergnügen zu, denn nichts imponierte ihnen mehr als die Wirkung der eisernen Haugeräte.[S. 110] Ja, das ging freilich schneller als mit ihren Steinäxten, und es gab allemal ein lautes Freudengeschrei, wenn unter den Schlägen der schweren amerikanischen Äxte ein großer Baum sich neigte und krachend zusammenbrach, mit seinem Falle andere Bäume niederschmetternd. Wir hatten zu thun, um die Kanus in gehöriger Entfernung zu halten. Denn daß Bäume so schnell gefällt werden konnten, schien den Eingeborenen unglaublich, und sie stoben erst in wilder Flucht auseinander, wenn das erste Geknister das baldige Fallen signalisierte. Als eine besondere Auszeichnung wurde es betrachtet, wenn ich dem einen oder anderen ein Beil anvertraute, denn alle wollten sich gern mit an dem Vernichtungswerk beteiligen. Aber die Kräfte der Eingeborenen reichten nur hin, um dünneres Unterholz, Äste und dergleichen abzuhauen, denn abgesehen, daß sie ein Beil überhaupt nur schlecht zu hantieren verstanden, so fehlte es ihnen namentlich an physischer Stärke, denn alle diese Naturmenschen haben ihre Muskeln wenig ausgebildet und sind infolgedessen nur schwach. Mit betrübtem Gesicht legten die meisten nach wenigen Schlägen die Äxte nieder und deuteten an, daß diese ihnen zu schwer seien. Ja, die Eingeborenen selbst werden bei der einstigen Urbarmachung und Klärung dieses Landes wohl wenig nützen, und man wird, wie überall, auf ihre Hilfe nicht sehr zu rechnen haben. Romillys drastische Neubenennung des »Archipel der zufriedenen Menschen« in »Archipelago of useless idle men« trifft mit wenig Worten das Richtige, und er kennt Kanaker besser als irgend jemand. Große Freude erregte das Aufhissen der Flagge selbst, deren Farben (schwarz »sed«, weiß »ruo«, rot »fiar«) den Eingeborenen besonders zu gefallen schienen, weil es dieselben sind, welche sie kennen. Bald sollten sie ganz unter den Schutz dieser mächtigen Trikolore gestellt werden, denn gerade einen Monat später (am 20. November 1884) entfaltete sich an derselben Stelle die Flagge der deutschen Kriegsmarine.
Wir hatten zum großen Leidwesen das von den Eingeborenen so sehr gewünschte und erwartete Panu (Dorf) nicht gebaut, und mußten sie auf »Wiederkommen« vertrösten, wofür schon die Flagge bürgte, die ich[S. 111] den ersten Häuptlingen Malbag, Szebog, Telom von Grager, Kuram von Bilia, Karun und Amang von Tiar übergab, welche, wie wir später sehen werden, in vollem Verständnis trefflich für die Erhaltung sorgten. So verließen wir denn Friedrich-Wilhelms-Hafen, eine Kanuflottille mit fröhlichen Eingeborenen im Schlepptau, die alle »o! Maclay! ujan-ujan« (sehr gut) riefen und uns erst in der Dallmann-Einfahrt verließen.
Küste bis Kap Croissilles. — Es giebt kein Kap Duperrey. — Karkar, oder Dampier-Insel. — Wir umschiffen dieselbe. — Neues »Giebacht-Inselchen«. — Eingeborene. — Zusammentreffen mit denselben. — Treffliche Lokalitäten für Deportation. — Bismarck-Gebirge. — Längs der Maclayküste. — Geringe Kenntnis derselben. — Gabinafluß. — Vulkanische Anzeichen. — Küstengebirge. — Schönes Land. — Spärlich bevölkert. — Kleine und verlassene Dörfer. — Sareuak-Buchtung. — Erste Begegnung mit Eingeborenen. — Finisterre-Gebirge. — Heimatliche Landschaft. — Pfahldörfer. — Teliata-Huk. — Das merkwürdige Terrassenland. — Exkursion dahin. — Dallmannfluß. — Die Terrassen sind gehobener Korallfels — haben ausgezeichneten Boden — trefflich für Weiden. — Temperatur. — Geringes Tierleben. — Basilisk-Gorge — Rook und Lottin. — Cape King William nicht aufzufinden. — Auffallende Schluchten. — »Meerfall«. — »Kanzel«. — »Bienenkorb«. — Festungs-Huk. — Siedelungen schwer bemerkbar. — Geringe Bevölkerung. — Zusammentreffen mit derselben — deren Verwandtschaft mit Huon-Golf. — Keine Menschenfresser. — Andenken Verstorbener. — Rückblick auf die Maclayküste. — Vorzüge derselben. — Keine Häfen. — Hinüber nach Neu-Britannien. — Unrichtigkeit der Karten. — Längs der unbekannten Südküste — verspricht wenig. — »Hansabucht«. — Eingeborene. — Rückkehr nach Mioko.
Karkar, Dampiers »Isle Brûlante«, die später den Namen dieses großen Seefahrers erhielt, war unser nächstes Ziel und schien angesichts der so kärglichen Nachrichten über dieselbe wohl einer Rekognoszierung wert. Wir dampften nordwärts bis Kap Croissilles hinauf, längs einer Küste, die einen ganz anderen Charakter als die bisher gesehene von Astrolabe-Bai zeigte. Sie erscheint wie ein ausgedehntes, dichtbewaldetes Vorland, an welches sich weiter inland niedrigere Bergketten anschließen. Kokospalmen fehlen diesem Gebiete leider fast ganz und damit auch der Mensch, dessen Existenz mit dem Vorkommen und der Häufigkeit der ersteren in so innigem[S. 113] Zusammenhange steht. Nur gegen das Kap zu bemerkten wir unter dem Schatten einiger Kokospalmen ein Dorf; die Bevölkerung dieses ca. 15 Meilen langen Küstenstriches ist daher jedenfalls nur sehr spärlich. Die Ungenauigkeit der vorhandenen Karten wurde uns schon auf dieser kurzen Strecke klar. Vergebens suchten wir Kap Duperrey[28] und auch Kap Croissilles markiert sich in der gleichförmigen Küstenlandschaft nur wenig.
Dampier-Insel erscheint vom Süden aus gesehen wie ein mächtiger, dicht bewaldeter, stumpfer Kegel, dessen Höhe auf 5000 Fuß angegeben wird und der schon in weiter Ferne die vulkanische Bildung deutlich erkennen läßt. Als Dampier Anfang 1700 die Insel entdeckte, fand er den Vulkan in voller Thätigkeit und gab der Insel deshalb den Namen die »brennende«. Jetzt ist der Krater längst erloschen; nur die den Spitzenteil verhüllenden Wolken, welche meist hier lagern, erinnern zuweilen an mächtigen Rauch.
Wie es scheint ist die Insel seit Dampier nicht mehr betreten worden, und auch wir mußten uns auf eine Umschiffung derselben beschränken, denn nirgends fanden wir einen Hafen- oder Ankerplatz, noch sonst eine Stelle, welche aus praktischen Gründen zu einer Landung verleiten konnte. Überall zeigte sich dichter Urwald, von der Wasserkante des Ufers bis zur höchsten Spitze, in einer Üppigkeit wie man selten Urwald zu sehen bekommt, nirgends geklärte Stellen mit Plantagen, selten flacheres Vorland und dann nur in geringerer Ausdehnung. An der Nordwestseite der Insel sahen wir hie und da felsiges Steilufer, Basalt, aus dem die Insel zu bestehen scheint. Nur wenige Male hatten wir Korallriffen auszuweichen, aber an der Nordspitze entdeckten wir kaum eine halbe Seemeile von der Küste ein kleines Inselchen, das keine Karte verzeichnet, und von welchem sich ca. 3 Seemeilen ein Riff mit Brandung und einem einzelnen[S. 114] kahlen schwarzen Fels nach Ost hinzieht. Ich benannte das Inselchen, immerhin groß genug um das größte Schiff zum Scheitern zu bringen, »Giebacht-Insel«. Vom Norden aus gesehen, bietet Dampier übrigens ein ganz anderes Bild als vom Süden und erscheint als ein langgestreckter Gebirgsrücken mit zwei hohen stumpfen Kegeln, beides erloschene Vulkane.
Wir waren an der Leeseite, also von West nach Ost um die Insel gegangen und beobachteten nur an dieser unbedeutende Siedelungen der Eingeborenen; die Ostseite schien unbewohnt. Die größte der westlichen Siedelungen zählte etwa 10 Häuser, die übrigen zehn je 2–4 Häuser, verdienten also kaum den Namen von Dörfern. Aus der geringen Anzahl von Kokospalmen konnte man schon mit ziemlicher Sicherheit auf die geringe Bevölkerung schließen, wie sich das meist überall wiederholt. Einzelne Siedelungen besaßen kaum mehr als etliche, die größte nur 30 Kokospalmen, das war alles!
Die wenigen Eingeborenen, welche uns am Ufer mit Staunen betrachteten, gaben sich durch Schreien alle erdenkliche Mühe uns an Land einzuladen, aber nur bei dem einen Dorfe kamen etliche Kanus ab, so daß wir die Maschine stoppten, um die Leutchen kennen zu lernen. »Oh! Maclay« war ihr erstes Wort und »Kai« (Eisen) ihr zweites, dies aber auch alles was ich verstand, denn auf Karkar wird eine ganz andere Sprache gesprochen. Sie klang viel rauher als in Astrolabe; dabei schrieen und spektakelten die Leute sehr viel, so daß man oft kaum das eigene Wort verstehen konnte.
Armselig wie ihre, roh aus einem Baumstamm gezimmerten, Kanus waren die Insassen selbst. Sie brachten nichts als ein paar alte vertrocknete Kokosnüsse, einige Betelnüsse und Tabakblätter, hatten aber keinerlei Waffen und von sonstigen Arbeiten nicht viel mehr. Dabei wollten sie für jeden schlechten Bambukamm oder Kalkkalebasse nur Hobeleisen haben. Einer hatte es auf meinen Feldstecher abgesehen und verlangte, daß ich ihm denselben ins Kanu reichen sollte, denn an Bord wagte sich keiner. Nun habe ich Eingeborenen stets gern Spaß gemacht, und mir war auch wegen des Zurückgebens nicht bange, aber ich wußte auch, daß diese Freundlichkeit nur unnützen[S. 115] Zeitverlust bereiten würde. Hat nämlich der eine durchgesehen und wirklich etwas gesehen, denn gewöhnlich wird das Glas soweit ab oder so dicht gehalten, daß überhaupt nichts gesehen werden kann, dann will jeder in das geheimnisvolle Ding gucken und die Sache nimmt kein Ende. Zudem lassen die meist nicht sehr reinlichen Finger Spuren zurück, an deren Vertilgung man lange putzen kann.
Äußerlich unterschieden sich übrigens diese Insulaner durch nichts von den Bewohnern des Festlandes; es gab dunkle und hellgefärbte, und auch hier schienen die Gatessi, d. h. lang in den Nacken herabhängende Zottelstränge, eine besondere Zier. Außer dieser besaßen sie aber nicht viel: ein schlechter Lendengurt (Mal), dito Armband, ein dünner Nasenpflock aus einem Rohrstäbchen, etliche Schildpattohrringe, nebst Bambukamm und der Ausputz ist fertig. Einzelne hatten die Haarkämme mit Büscheln Kasuarfedern verziert, ein Beweis, daß die Insulaner mit den Küstenbewohnern in Verkehr stehen, wofür auch drei große Kanus, in der Bauart ganz mit solchen von Bilibili übereinstimmend, sprachen, die ich am Ufer bemerkte.
Wir hatten ca. 6 Stunden Zeit gebraucht, um von der Südspitze bis zur Mitte der Ostseite zu dampfen, und schon daraus wird man ersehen, daß Dampier-Insel nicht ganz so klein ist. In der That beträgt ihr Längsdurchmesser ca. 20 Meilen (= 5 deutsche M.) ihr Flächeninhalt 272 qkm., ist also immerhin noch etwas bedeutender als der der Freien- und Hansestadt Bremen. Letztere zählt aber über 150000 Bewohner, Dampier nach meiner allerdings nur oberflächlichen Schätzung, denn Volkszählungen sind in allen diesen Gebieten noch nie gemacht worden, wenn's hoch kommt — 500! Da können allerdings noch viel Menschen Platz und ausreichend Nahrung finden, denn ohne Zweifel ist die Insel äußerst fruchtbar, und in gewisser Höhe auch gesund. Aber schwerlich werden sich freiwillige Zuzügler finden, um die Urwälder zu lichten; eben kein kleines Stück Arbeit! — Und doch könnte es gehen, — so meditierte ich angesichts der Insel, — wenn man jene Freiwilligen aufforderte, welche die unfreiwillige Arbeit in Kerkermauern gern mit solcher in Gottes freier[S. 116] Natur vertauschen würden. »Eine Verbrecherkolonie«? höre ich viele im stillen ausrufen! — Nun ja denn! eine Verbrecherkolonie oder besser Deportation solcher Freiwilligen unserer überfüllten Zuchthäuser, die für den Rest ihres Lebens dem Kulturstaate nur eine Last sind, in solchen neuen Gebieten aber noch ganz nützlich werden könnten, sowohl dem großen Ganzen, als sich selbst. Wer die Geschichte der Gründung Australiens kennt, wird wissen, welchen gewichtigen Faktor das Deportationssystem in den ersten Jahrzehnten der Kolonien durch die Beschickung mit billigen Arbeitskräften einnahm. In der That so wichtig, daß die jüngste Kolonie, West-Australien, noch in den vierziger Jahren beim Parlament[29] um Deportierte petitionierte, weil es eben an Arbeitern mangelte. Und diese werden für jedes neue Kolonisationsgebiet stets die Lebensfrage bleiben, am dringendsten jedoch für ein Land mit so geringer und für Arbeit in unserem Sinne nicht geeigneter Bevölkerung als Neu Guinea. Da würde ein Depot brauchbarer Arbeiter recht am Platze sein, und Dampier-Insel oder Rook, oder eine andere jener isolierten fruchtbaren Inseln unserer neuen Schutzgebiete, geeignete Localitäten zur Gründung eines solchen abgeben.
Doch kehren wir nach dieser Abschweifung auf die Samoa zurück, die in früher Morgenstunde wieder nach der Küste zu dampft, in Sicht von Bilibili und Astrolabe-Bai, deren herrliche Landschaftsbilder gerade jetzt so schön hervortraten, wie noch nie. Die Kammlinien der Gebirge erschienen in derjenigen Klarheit, auf welche man in diesen Breiten meist nur gegen Sonnenaufgang, so gegen 6 Uhr, rechnen darf. Heut sahen wir alles in seltener Deutlichkeit vor uns liegen, ja dieselbe brachte eine unerwartete Überraschung. Weit hinter den uns schon bekannten Gebirgen ragte nämlich im Süden eine gewaltige Gebirgskette hervor, die wir früher nicht gesehen hatten und die wahrscheinlich überhaupt nur wenige[30] erblickt haben. Wir[S. 117] befanden uns damals noch ca. 25 Meilen von der Küste, aber dieses Gebirge mußte noch weit im Inneren, nach Schätzung an 70 bis 80 Meilen von uns abliegen, und dementsprechend taxierten wir die Höhe auf 14000–16000 Fuß! Wie unsere späteren Reisen zeigten ist diese Gebirgskette, die wir nur noch einmal zu sehen bekamen, die höchste an der ganzen Nordostküste von Neu-Guinea, und ich erlaubte mir deshalb sie zu Ehren unseres großen Reichskanzlers »Bismarck-Gebirge« zu benennen. Die Frage: »wie mag es dort aussehen«? drängte sich unwillkürlich in die Gedankenflut des stummen Bewunderers; ja, wer das beantworten könnte! Denn wie viele Zeit wird noch darüber hingehen, ehe der weiße Mann nur bis zum Fuße jener gewaltigen Gebirgskette vordringt, geschweige auf deren Scheitel gelangt.
Wir passierten Port Konstantin, nahe genug um unsere Flagge lustig winken zu sehen, und steuerten in östlichen Cours längs der Maclayküste (vergl. Karte S. 30). Sie erstreckt sich von Astrolabe-Bai bis Teliata-Huk, ca. 100 Meilen weit und wurde zuerst 1871 von dem russischen Reisenden von Miklucho-Maclay mit dem russischen Kriegsschiffe »Vitiaz« befahren, fünf Jahre später bei seinem zweiten siebzehnmonatlichen Aufenthalte näher durchforscht, trägt also seinen Namen mit Recht. Leider hat aber der Reisende selbst kaum mehr als eine flüchtige Notiz über seine Forschungen publiziert und Kapt. Moresby[31], der 1874 längs dieser Küste westwärts dampfte, sagt nicht mehr über dieselbe. Die folgenden Nachrichten dürften daher als die ersten ausführlicheren willkommen sein.
Gleich ostwärts von dem Dorfe Gumbu und Novosilsky-Point nimmt die Gegend einen total verschiedenen Charakter an. Der Urwald verschwindet vom Ufer und eine spärlich mit Krüppelholz bestandene Ebene tritt an die Stelle, welche treffliches Land für Kultur wie Viehzucht zu bieten und sehr der Beachtung wert scheint. In dieser Niederung sahen wir die Mündung zweier Flüsse, die jetzt in der trockenen Jahreszeit indes nur schmale Rinnsale bis ins Meer[S. 118] führten, in der Regenzeit aber sehr ansehnlich sind. So fanden wir bei einem spätern Besuch im Mai den westlichsten und größten Gabinafluß, gleich ost von Novosilsky-Huk, weithin das Meer trübend. Mit Maragum-Huk beginnen wieder Hügel und Berge, die gegen das, übrigens nur schwer erkennbare, Kap Rigny (Tevalib) und weiterhin bedeutend höher werden und zugleich einen sehr eigentümlichen Charakter bieten. Die Berge zeigen Schluchten, zuweilen jähe Spalten, mit senkrecht abfallenden Wänden, wie Erdrutsche; eine wilde, malerische Landschaft. Dabei fehlt an manchen Bergabhängen fast alle Vegetation und das Ganze macht den Eindruck, als wenn hier gewaltsame Veränderungen durch Erdbeben[32] stattgefunden hätten.
Wir waren am Abend bis etwa 6 Meilen ost von Cap Rigny gekommen und begannen unsere Fahrt mit Anbruch des folgenden Tages an derselben Stelle, eine Methode, die stets an unbekannten oder wenigbekannten Küsten von uns befolgt wurde, damit kein Teil derselben uns entgehen konnte. Die Landschaft blieb im ganzen dieselbe, aber das Gebirge wurde höher und zeigte bis auf die Kammhöhe dichte Baumvegetation. Diese Hauptkette ist sehr steil, von fast senkrechten Schlürfen und Rinnen durchsetzt und mag eine Höhe von 6000–7000 Fuß erreichen. Aber man sieht die Kammlinie auch an sonnenhellen Tagen selten frei, denn gewöhnlich sammeln sich schon gegen 8 Uhr die kleinen weißen Nebelflecke zu großen Wolken, die in weniger als einer Stunde den Scheitel des ganzen Gebirges ziemlich weit herab vollständig einhüllen. Häufig bleibt nur die Basis des Hauptstockes frei, aber an denselben lehnt sich ein dichtbewaldetes Mittelgebirge, das in ansehnliche grüne, mit Gras bedeckte Vorberge ausläuft, die sich sanft bis zum Meere herabsenken, dessen Ufer von einem schmalen dichten Baumgürtel eingefaßt wird. Dies ist so im wesentlichen der Hauptcharakter dieser Küstenlandschaft östlich von Kap Rigny und 10 Meilen über[S. 119] Lemtshug Point hinaus. Sie macht mit ihren ausgedehnten, infolge Abbrennens hie und da braun und schwarz gefleckten, grünen Matten, ihren mit Baumstreifen bestandenen Schluchten ganz den Eindruck kultivierten Landes und würde offenbar ausgezeichnetes Weideland abgeben. Aber diesem ganzen Küstenstrich schienen wie Kokospalmen so auch Menschen zu fehlen. Erst ca. 4 Meilen ost von Iris Point, das wir, ohne es mit Sicherheit ausmachen zu können, passiert hatten, sahen wir seit Gumbu das erste Haus, weiterhin die ersten Dörfer, wie alle Siedelungen stets schon von weitem an einer kleinen Gruppe Kokospalmen und jenen gelben Bäumen kenntlich, die ich bereits in Astrolabe-Bai erwähnte. Von nun an waren fast in jeder der sanften Buchtungen, die ohne bedeutendere Vorsprünge das Ufer bilden und charakteristisch für diese ganze Küste sind, Siedelungen bemerkbar, meist nur aus wenigen Häusern bestehend, überdies mehrere in Verfall oder bereits ganz verlassen. Da, wo sich bei den Häusern Menschen zeigten, schienen sie keine Kanus zu besitzen, denn erst in der Sareuak-Buchtung, einige 60 Meilen östlich von Port Konstantin, kam ein Kanu mit sieben Männern ab, deren: »oh! Maclay« schon von weitem entgegenschallte und die Bekanntschaft mit dem Reisenden bewies, dessen Namen wir übrigens weiter ostwärts nicht mehr nennen hörten.
Die Leute boten uns wahrscheinlich als Friedenszeichen ein paar kleine Kokosnüsse an und schienen überhaupt sehr ärmlich und schlecht genährt. Im Armband trugen sie Blätter des gelben Baumes, vermutlich auch Zeichen des Friedens, sonst nur Halsstrickchen und schlechte Schamgürtel (Mal). Sie führten Pfeil und Bogen mit sich, betrugen sich aber sehr still und bescheiden. Das einzige Interessante, was ich bei ihnen bemerkte, war ein mit Hundezähnen garnierter filetgestrickter Tragbeutel, der meinen begehrlichen Blicken aber gleich entzogen und selbst für ein Beil nicht hergegeben wurde. Ihr Kanu führte Mast und ein schlechtes Mattensegel; als Feuerplatz diente ein Topfscherben.
Wie Wolken die Hauptkette des an 7000 Fuß hohen Küstengebirges verhüllten, so verdeckte das letztere die mächtige Kette[S. 120] des Finisterre-Gebirges (Moresby's) selbst, das bei einem Abstande von 20 Meilen so nahe unter der Küste überhaupt nicht zu sehen ist. Aber als wir uns bei einem spätern Besuche in Astrolabe noch ca. 30 Meilen von der Küste befanden, da lag das Gebirge in voller Klarheit vor uns, zeigte aber in der ziemlich gleichmäßig verlaufenden Kammlinie so wenig Abwechselung, daß wir die höchsten über 11000 Fuß hohen Spitzen Kant und Schopenhauer Maclay's (resp. Gladstone und Disraeli von Moresby[33]) nur mit Mühe ausmachen konnten.
Westlich von der Sareuak-Buchtung beginnt wieder niedrigeres Vorland, das sich stellenweis zu Ebenen ausdehnt, die, wie die oft bis zum Meere herabreichenden 1000 bis 1200 Fuß hohen Vorberge, reich mit Gras bedeckt sind; alles sehr versprechendes Land von ganz europäischem Gepräge. In der That, es fehlen bloß Dörfer, Viehherden, Wege, und man könnte sich in die Heimat versetzt fühlen.
Auch an Wasser mangelt es nicht. In der jetzigen trockenen Jahreszeit zeigten sich die in den Schluchten herabkommenden Wasserläufe freilich nur als Bäche, aber immerhin war Wasser vorhanden, und das ist von größter Wichtigkeit. Wie schön würde sich dieses Land im Besitz von viehzüchtenden Stämmen entwickelt haben, aber die armen Papuas fanden außer dem Schwein kein zur Domestikation brauchbares Tier vor und mußten sich mit Anbau des Bodens begnügen. Bei der zweifellosen Fruchtbarkeit desselben überrascht die Spärlichkeit der Bevölkerung gerade dieses Gebietes und mag in besonderen außergewöhnlichen Ursachen ihren Grund haben. Angesichts der verfallenen und verlassenen Dörfer dachte ich an Verheerungen durch Erdbeben oder Epidemien und die in Konstantinhafen gesehenen Spuren von Pocken machen diese letztere Annahme nicht unwahrscheinlich.
Die bisher gesehenen Häuser waren ansehnlich groß, in der Bauart denen in Astrolabe-Bai ähnelnd, aber mit dem Dorfe Singor, ca.[S. 121] 90 Meilen ost von Port Konstantin, begegneten wir einem ganz anderen Baustile. Die schmalen Häuser, dicht aneinander gebaut, standen auf hohen Pfählen, glichen also ganz den Pfahldörfern, wie ich sie von Port Moresby her bereits kannte, nur daß sie nicht im Wasser, sondern auf dem Trockenen errichtet waren. Das größte derselben, Teliata, (Village Island der englischen Admiralitätskarte), vielleicht 20 Häuser zählend und überhaupt das größte an der ganzen Maclayküste, liegt auf einer kleinen, aus kahlem Korallfels gebildeten Insel, der ersten, die wir seit Bilibili trafen, die durch Riff mit der naheliegenden Teliata-Huk verbunden ist. Letztere (etwas über 100 Meilen ost von Port Konstantin) bildet den am meisten bemerkbaren Vorsprung, von welchem die Küste sich mehr O. S. O. wendet und wenige Meilen davon einen durchaus verschiedenen Landschaftscharakter annimmt, den der Terrassenbildung. Hinter dem mit Buschwerk, seltener einem Baumgürtel begrenzten, nicht sehr ausgedehntem Ufersaume, erhebt sich das Land in drei bis vier horizontalen, scharf abgesetzten Terrassen[34], die auf ihrem Scheitel breite Grasflächen bilden, deren oberste sanft ansteigend, allmählich mit dem Hauptstock des Küstengebirges verläuft. Das letztere ist sehr steil, dicht bewaldet, aber an seiner Basis, zuweilen weit hinauf, mit Gras bekleidet, wie die Terrassen selbst, die von zahlreichen Schluchten durchschnitten, nur längs diesen Baumpartien, oft längere bewaldete Säume zeigen. Die Höhe der Terrassen mag zwischen 800 bis 1000 Fuß betragen, sinkt aber an manchen Stellen bedeutend herab, so daß die erste Terrasse zuweilen das Meeresufer selbst bildet. Wir hatten schon einige Meilen westlich von Teliata-Huk Anfänge dieser merkwürdigen Bildung bemerkt, aber ein paar Meilen östlich davon zeigte sie sich wie mit einem Schlage in der prägnantesten Weise und setzte sich ununterbrochen über 20 Meilen weit nach Osten fort, ein Amphitheater, wie ich es nirgends in Neu Guinea, ja überhaupt der Welt zu sehen bekam.

[S. 123] Eine Rekognoszierung dieses merkwürdigen Terrassenlandes schien schon deshalb sehr wünschenswert, um die geologische Beschaffenheit festzustellen, und so machten wir uns mit dem Notwendigsten ausgerüstet auf den Weg. Eine Sandbank nahe dem Ufer ließ auf eine Flußmündung schließen und versprach die Möglichkeit zu landen, was sonst an dieser Küste nicht immer leicht, oft ganz unmöglich ist. Wie erwartet, mündete gleich hinter der Sandbank der Fluß, auf dem unser Boot aber nur eine kurze Strecke vorwärts kam, denn bald befanden wir uns in einer Felsschlucht, in welcher der Fluß über mächtige Korallblöcke in Kaskaden herabbrauste, ein gar liebliches Rauschen, das wir lange nicht gehört hatten und welches nach dem fortwährenden Meeresbrausen gar sehr anheimelte. Dazu die malerische Umgebung. Zu beiden Seiten der Schlucht üppige Baumvegetation mit undurchdringlichen Lianen- und Unterholzdickichten und zuerst wieder Tierleben. Auf der ganzen Meerfahrt hatten sich nur einzelne Meerschwalben (Sterna Bergii) und braune Tölpel (Sula fusca) gezeigt, sonst nichts. Hier entwickelte sich ein ziemlich reiches Vogelleben; Kakadu und Edelpapageien (Eclectus) ließen sich hören, ein Seeadlerpärchen (Haliaetus leucogaster) erhob sich von dem Baume, auf dem das mächtige Nest stand, das Gurren der niedlichen Flaumfußtauben (Ptilopus) tönte aus dem Gelaube und auch an Kleingevögel fehlte es nicht. Wir füllten ein Fäßchen des herrlichen kühlen Wassers, um es dem guten Kapitän Dallmann mitzunehmen, dem zu Ehren ich den Fluß benannte, und gingen dann wieder zurück, um einen besseren Aufstieg der Terrassen aufzufinden. Vom Flusse mit seinen fast senkrechten Felswänden war dies eben nicht möglich; er bildete ein Chaos von Rollsteinen und Geschiebe, die Regengüsse mit herabgebracht hatten, und angespülte Baumstämme zeigten den beträchtlichen Hochwasserstand in der Regenzeit. Wie die Wände der Schlucht, so ließ gleich die erste, ca. 10 Fuß hohe Terrasse die geologische Beschaffenheit erkennen: dichten Korallfels! Ganz ebenso verhielt es sich mit der zweiten, an 30–40 Fuß hohen, schwieriger zu erklimmenden Terrassenstufe und soweit wir überhaupt kamen, vielleicht 400–500 Fuß.
[S. 124] Wie am Fuße Lager großer Austernschalen (Ostrea), so zeigten die auf den Flächen der Terrassen verstreuten Fragmente von Marinemuscheln überall den gehobenen Meeresboden, jedenfalls infolge vulkanischer Vorgänge. Derjenige, welcher diese merkwürdigen Terrassen selbst kennen lernte, wird kaum begreifen, wie Wilfred Powell hier Basaltformation und die großen Anhäufungen von Bimsstein gefunden haben will und wird auch in Bezug auf andere seiner Nachrichten[35] immer ernstere Bedenken nicht zu unterdrücken vermögen. An der korallinischen Felsbildung kann gar kein Zweifel sein. Sie unterschied sich in nichts von der, wie ich sie zur Genüge von den Atollen her kannte. Aber hier war der Fels nicht wie bei den letzteren von einer nur wenige Zoll hohen Humusschicht überzogen, sondern die Flächen der Terrassen trugen eine Bodenschicht, die bei mehr als zwei Fuß tiefen Graben kein Ende zeigte, und wie die später gemachten chemischen Untersuchungen[36] erwiesen, von ausgezeichneter Beschaffenheit ist. Dabei wurde der Boden, je höher wir kamen, um so besser und feiner und mit ihm das Gras. Letzteres erreicht im Ufervorlande fast Mannshöhe und ist von grober Beschaffenheit, eignet sich also nur für Rindvieh, während das kurze feinhalmige Gras der Terrassen trefflich für Schafe paßt. Er bildet übrigens keinen ununterbrochenen Rasenteppich, sondern steht büschelweis wie das sogenannte »Buffalogras« der Prairien, oder wie ich es am Haleakala auf der Insel Maui sah, wo Tausende von Schafen weiden. Wenn hier die unzähligen scharfkantigen Lavatrümmer das Begängnis der Schafe nicht hindern, so würden sich dieselben auch auf den Terrassen mit[S. 125] den vielen verwitterten Korallknollen, die dem Fußgänger zuweilen recht hinderlich sind, abzufinden wissen. Außer einer Schlingpflanze, ein paar anderen bescheidenen Blumen, und einzelnen Cycaspalmen, zeigte die Flora nichts Bemerkenswertes, aber die Ränder der Schluchten sind häufig mit Gebüsch und kleinen Baumgruppen gesäumt, welche Schafen trefflichen Schutz gegen die Mittagshitze bieten würden. Obwohl dieselbe 28° R. betrug, so war sie unter dem mildernden Einfluß einer hübschen Brise doch erträglich, aber als wir wieder in die Uferebene herab in die schwüle Luft einer Temperatur von 32° R. kamen, da war es schier zum Ersticken. Wir fanden hier einen kleinen Teich mit einem Dickicht von Schraubenbaum (Pandanus), in welchem weiße Fruchttauben (Carpophaga spilorrhoa) und bunte Sittiche (Eos fuscata) zu einem leider vergeblichen Jagdversuch reizten und somit die Hoffnung auf einen frischen Braten vereitelten. Das Jagen in den Tropen hat eben seine großen Schwierigkeiten, von denen man sich daheim schwer eine Vorstellung machen kann. Einige Wachteln (Coturnix sinensis), die unser Tritt aus dem Grase aufscheuchte, war alles Lebende, was wir auf den Terrassen erblickten. Außerdem bemerkten wir nur noch Fährten wilder Schweine, sahen uns aber vergebens nach Kängurus um, die übrigens hier nicht wohl zu erwarten waren. Sie lieben, soweit meine Erfahrungen in Neu-Guinea reichen, keine offenen Ebenen, sondern mehr kupiertes Terrain, während gewisse Arten (z. B. Dorcopsis luctuosus) nur den dichtesten Urwald bewohnen.
Nahe dem Teiche stießen wir auf einen Pfad und bemerkten später elf Eingeborene, die uns wahrscheinlich schon lange beobachtet hatten, aber keine Lust zeigten heranzukommen. Ich ließ einige kleine Geschenke zurück, um sie unserer guten Absichten zu versichern, und sie werden später wahrscheinlich ihre Zurückhaltung sehr bedauert haben.
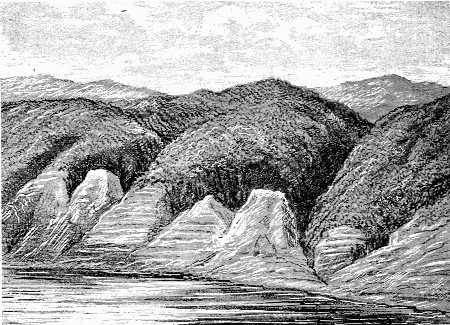
An Bord zurückgekehrt und wieder unter Dampf, wurde das Auge nicht müde, das malerische Terrassenland mit seinen braunen und grünen Stufen zu bewundern, die sich mit einer Regelmäßigkeit, wie mit der Meßkette gezogen, für Meilen und Meilen nach[S. 126] Ost fortsetzen. Der Reiz dieser Landschaft wird durch wild romantische Schluchten noch erhöht, unter denen sich ganz besonders eine auszeichnete, die gleich wie ein gewaltiger Messerschnitt das Gebirge trennt und offenbar durch Erdbeben hervorgebracht wurde. Diese Schlucht, von der unsere Abbildung (S. 122) nur eine schwache Vorstellung giebt, ist jedenfalls die »Basilisk-Gorge« von Moresby dessen Beschreibung »huge break in the mountains« auf keine Stelle der Küste besser als auf diese paßt und mit wenigen Worten das Richtige trifft. Auch Backbord (links) zeigten sich anziehende Bilder, und der Blick wandte sich oft von der packenden Küstenlandschaft ab und schweifte über das Meer hinüber nach Rook- und Lottin-Insel, die wir schon lange sichteten. Die erstere lag einigemal klar vor uns; ein mächtiger, mehrere tausend Fuß hoher Kegel mit drei Kuppen und wie das kleine Lottin erloschene Vulkane. Letztere Insel, obwohl viel niedriger als Rook, war meist in Wolken gehüllt,[S. 127] wie die ganze Kammlinie des Küstengebirges selbst, trotz des vollkommen klaren Himmels, eine Erscheinung, die bei allen Gebirgen dieser Breiten fast zur Regel wird. Wie spätere Besuche lehrten nimmt die Höhe des Küstengebirges von West nach Ost allmählich ab, mag aber längs dem Terrassenlande immer noch an 4000 bis 5000 Fuß betragen. Den 7700 Fuß hohen Berg Cromwell von Moresby suchten wir bei dieser wie bei späteren Gelegenheiten vergebens, nicht minder Dampiers »Cape King William«, das noch heut auf allen Karten figuriert, aber, wie schon Moresby erwähnt, nicht auszumachen und für die Folge besser ganz wegzulassen ist: es giebt an dieser Küste überhaupt kein Kap! —
Längs dem Terrassenlande sahen wir noch vier armselige Dörfer, Pfahldörfer wie das vorher beschriebene Singor, die sich durch ihre Lage auf kahlem Korallufer (das eine, Sus, auf einer kleinen Felsinsel) auszeichneten. So frei und bar von allem Sonnenschutz hatte ich noch niemals Siedelungen von Eingeborenen gesehen, und es wäre interessant gewesen, die Gründe zur Wahl dieser anscheinend so ungünstigen Lokalitäten zu erfahren. Aber die Bewohner sahen das dampfende Ungetüm stumm vorüber gleiten, und machten keinerlei Zeichen, ja erhoben sich nicht einmal. Ich erwähne dies deshalb besonders, weil dieses Betragen sehr im Widerspruch mit der sonst üblichen Gewohnheit der Eingeborenen steht, die eine so seltene Erscheinung mindestens mit lauten Rufen begrüßen. Jedenfalls besaßen aber diese Pfahlbauer keine Kanus, und auch wir mußten uns einen Besuch versagen, weil der steile, felsige Uferrand kaum zu landen erlaubt haben würde und wir überdies Eile hatten.
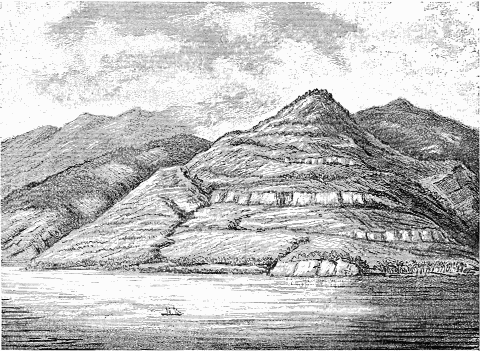
Ungefähr fünf Meilen ost von dem kleinen Inselpfahldorf Sus wird die Terrassenbildung undeutlicher, das Küstengebirge tritt näher ans Ufer und das Landschaftsbild erhält einen ganz anderen Charakter, der hauptsächlich in wild zerklüfteten Schluchten der Vorberge gipfelt. Den Anfang dieser wildromantischen Küste bildet die sanfte Waldbucht, wo der dichte Wald des Küstengebirges sich fast bis ans Gestade herabzieht. Über das ca. 10 Fuß hohe Steilufer, fällt hier ein kleiner Wasserfall direkt ins Meer, eine sehr kenntliche Stelle[S. 128] und die einzige derartige an der ganzen Küste, welche ich deshalb »Meerfall« benannte. Weiter nach Ost erregt eine besonders merkwürdig markierte Schlucht Aufmerksamkeit, deren fast senkrechten Wänden ein mehrere hundert Fuß hoher Berg vorliegt, als wäre er aus dem Gebirge herausgeschnitten (S. 126). Sein Gipfel ist horizontal, seine Westseite schroff bis zur Thalsohle abfallend, während die in der oberen Hälfte ebenfalls fast rechtwinkelig abgesetzte Ostseite sich an einen spitzwinkeligen Berg anlehnt und mit diesem gleichsam ein Ganzes bildet, dem ich den Namen »Kanzel« gab. Mit dieser sonderbaren Küstenmarke rivalisiert etwas weiter östlich der »Bienenkorb«, ein sehr hoher steiler, stumpfer Kegel, welcher ebenfalls aus dem Gebirge herausgeschnitten scheint. An dem letzteren bemerkt man, höher als die Spitze des Bienenkorbes, inmitten der dichten Vegetation eine senkrechte, kahle, weißliche Felswand. Die beiden soeben genannten Schluchten sind die interessantesten dieses ganzen Gebietes und ohne Mühe zu erkennen. Sie waren auch in der jetzt trockenen[S. 129] Jahreszeit wie die übrigen Einschnitte und Vorberge mit dichtem frisch grünem Graswuchs bekleidet, was den malerischen Effekt ungemein erhöhte. Manche dieser Schluchten sind übrigens ansehnlich breit und bilden schmale grüne Thäler, die sich vielleicht weit ins Gebirge hineinziehen mögen. Da wo die interessanten Schluchten aufhören, wird das grasige Vorland breiter und an den fast baumlosen, ebenfalls in saftiges Grün gekleideten Bergen machen sich wiederum terrassenförmige Absätze bemerkbar, die mit Festungshuk in prägnantester Weise ihren Abschluß finden. In der That bildet dasselbe den kenntlichsten Punkt an der ganzen Küste, und Moresby hätte keinen passenderen Namen als »Fortification-Point« wählen können. Die einige hundert Fuß hohe grüne Pyramide, zugleich der letzte Ausläufer des Küstengebirges, wird von mehreren horizontalen, kahlen, stufenförmigen Absätzen, Resten der Terrassenbildung, durchzogen, die frappant Fortifikationen ähneln, ja bei lebhafter Phantasie vermag man mit leichter Mühe in einigen schwarzen Felsstücken, die am Rande der Terrassen hie und da verstreut liegen, Geschütze zu erkennen. Etwas Baumgestrüpp bedeckt die kuppig abgesetzte Spitze, wie dichtester Baumwuchs die Basis des Berges umgürtet, die von 10 bis 20 Fuß hohem Steilufer gebildet wird. Eine größere kahle Stelle des letzteren mit nacktem weißlichen Korallfels ist die »white Cliff« der Karten, welche sich aber bei weitem nicht so deutlich markiert, als man erwarten durfte. Von der Westseite gesehen zeigt Festungshuk übrigens die eigentümliche Bildung, welche ihr den Namen verschaffte, bedeutend geringer. Die ungefähre Lage dieses kennbaren Küstenpunktes wird von Moresby zu 6° 20′ S., 147° 48′ O. angegeben. Er bildet übrigens kein Kap, sondern nur eine sanft vorspringende Huk (Ecke), von welcher die Küste südlich verläuft.
Mit dem Schluchtengebiet waren auch Dörfer oder Siedelungen überhaupt verschwunden, und die ganze Küste erschien menschenleer; nur gegen Festungshuk hin bemerkten wir einige Bananenplantagen, sahen uns aber vergebens nach Häusern um. Erst bei einem späteren Besuche entdeckte ich, aufmerksam gemacht durch die erwähnten gelben Bäume, die überall Begleiter der Menschen zu sein scheinen,[S. 130] zwei Häuser, die unter Bäumen hart am Rande einer Schlucht so versteckt standen, daß sie nur schwer zu erkennen waren. Bei meinen späteren Fahrten längs dieser Küste, welche ich noch fünfmal passierte, richtete sich daher mein ganzes Augenmerk auf Siedelungen, aber es gelang mir nur noch zwei weitere von je zwei bis drei Häusern zu erspähen. Um so ausgedehnter sind aber die Plantagen, welche sich sowohl im Ufervorland als an den Hängen der Schluchten hinziehen, und die erkennbar mit Jams und Bananen bestellt, oft mehrere Morgen groß sein mochten. Sie waren, wie immer, sorgfältig eingezäunt, zuweilen stand eine Hütte dabei. Angesichts dieser Plantagen[37] muß die Bevölkerung auch zahlreicher sein und die Siedelungen liegen vermutlich in den Schluchten, unsichtbar von der Küste aus, versteckt. Aber nennenswerte Dichtigkeit der Bevölkerung fehlt auch hier; denn mehr als ein Dutzend Eingeborene sahen wir niemals zusammen und fünfzig blieb die höchste Ziffer während eines ganzen Tages. Es wurden zweimal Buchtungen westlich von Festungshuk untersucht, schon um Ankerung zu finden, aber das steile Felsufer verhinderte das Landen. Das Steilufer schneidet hie und da etwas tiefer ein und bildet durch vorgelagerte Felsen, an denen das Meer bricht, zuweilen Buchten, welche Kanus Schutz gewähren. In solchen bemühten sich auch einigemal die Eingeborenen im Kanu abzukommen, aber hoher Seegang ermöglichte ihnen überhaupt nur in zwei Fällen die Brandung zu passieren, obwohl sie recht gute Segelboote besaßen. Die letzteren zeichneten sich durch Schnitzwerk am Seitenrande der Plattform, am Vorder- und Hintersteven und durch zierliche Malerei der Bordplanken aus. Die im allgemeinen ziemlich dunkel gefärbten Leute, waren so still[38] und bescheiden, wie ich selten Eingeborene fand, und der Tauschhandel mit ihnen ging ruhig wie noch nie. Sie brachten nur einige Betelnüsse,[S. 131] schlechte Bananen, aber keine Kokosnüsse, da sie solche wahrscheinlich selbst nicht besitzen, denn diese Palme ist, wie an der ganzen Küste, eine seltene Erscheinung. Neu für uns war, daß sie unter Gesang und Trommelschlag abkamen, wahrscheinlich um sich selbst Mut zu machen, wie dies später noch öfter vorkam. Auch ethnologisch boten sie neben Bekanntem, wie z. B. Kampfbrustschmuck (P. XXII. 3) mancherlei Neues, Sachen, die wir später erst in Huon-Golf kennen lernten, wie z. B. schön geschnitzte Holztrommeln (Onge), Ruder mit kunstvoll geschnitztem Griff, Zieraten und Tragbeutel, reich mit Hundezähnen ornamentiert, und dergleichen, alles Gegenstände, welche für die nahe Verwandtschaft mit den Bewohnern Finschhafens und weiter südlich sprechen. Am deutlichsten zeigten dies jene hohen Kopfbedeckungen aus rotgefärbtem Baumbast (Tapa), die für Huon-Golf so charakteristisch sind, und welche wir hier zuerst sahen. Im Tausch waren ihnen, wie stets, Hobeleisen am liebsten; aus Tabak, den sie kannten, machten sie sich so wenig als aus Spiegeln, die, obwohl neu für sie, kaum des An- resp. Hineinsehens wert schienen. Interessant war es mir, hier eine Art feines Muschelgeld aus dünngeschliffenen aufgereihten Muschelplättchen zu finden, welches ganz mit dem sogenannten »Miokogeld« in Neu-Britannien übereinstimmt. Es gelang mir mit vieler Mühe, einen alten Mann, wie die hohe Tapamütze zeigte, den Häuptling, an Bord zu locken, wo einige kleine Geschenke seine Furcht bald zerstreuten. Er getraute sich sogar in die Kajüte und gab seine stumme Verwunderung über die vielen nie gesehenen Dinge dadurch zu erkennen, daß er den Daumen der einen Hand zwischen die Zähne nahm und sich mit der anderen auf den Bauch klopfte. Die letztere Pantomime sollte übrigens keineswegs menschenfresserischen Gelüsten Ausdruck geben, wie Unkundige leicht glauben würden, denn auf der ganzen Reise habe ich nirgends nur die leisesten Anzeichen von Kannibalismus[39] beobachten können. In Bongu sah ich einmal ein paar Menschenschädel an einem Hause aufgehangen[S. 132] und in Gumbu wurde mir ein menschlicher Unterkiefer zum Kauf angeboten, gewiß für viele deutliche Beweise von Menschenfresserei! Aber dieser Schluß würde sehr irrig sein; denn solche Reliquien sind nicht Siegestrophäen erschlagener Feinde, sondern Andenken lieber Verstorbener, da die Pietät gegen Tote bei allen diesen Stämmen sehr groß ist. Wenn oberflächliche Beobachter an dem Fehlen sichtbarer Grabstätten sich gleich zu kühnen Schlüssen verstiegen, daß die menschenfressenden Papuas sogar ihre eigenen Toten nicht verschonen, so liegt die Sache in Wahrheit ganz anders. Man bestattet nämlich die Toten sehr oft in der Hütte, um nach ca. 10 Monaten die Knochen wieder auszugraben, ganz wie ich dies schon von Neu-Britannien her kannte. Wie man dort die Schädel als teure Andenken verwahrt, so legt man in Astrolabe-Bai besonders auf den Unterkiefer Wert, der, wie wir dies später sehen werden, nicht selten als Armband dient.
Der freundlichen Einladung des alten Häuptlings, ihn und die Seinen an Land zu besuchen, konnten wir leider nicht folgen, denn unsere Kohlen gingen zu Ende, und so mußten wir ca. 6 M. südlich von Festungshuk für diesmal Abschied von der Küste Neu-Guineas nehmen.
Wir hatten zu der ca. 140 M. langen Strecke von Port Konstantin bis hierher ca. 2½ Tag gebraucht und dabei einen Landstrich kennen gelernt, der mit zu den besten in Neu-Guinea zählt, und für Agrikultur wie Viehzucht gleich versprechend ist. Vor allem fehlt es, wie ich bereits erwähnte, nicht an Wasser. Ich zählte in der trockenen Jahreszeit allein die Mündungen von 19 Flüssen oder besser Flüßchen, die alle den Charakter von Gebirgswässern tragen, und deren es gewiß in diesem ausgesprochenen Gebirgslande viel mehr giebt. Die höher gelegenen Flächen dürften sich namentlich für Schafzucht eignen und werden voraussichtlich ein für Europäer günstiges Klima besitzen. Die Bevölkerung fanden wir allenthalben sehr spärlich, denn ich zählte im ganzen 24 meist sehr kleine z. T. verlassene Siedelungen, deren Bewohner zusammen mit 1500 Seelen hoch geschätzt sind. Das ganze Küstengebirge scheint kaum bewohnt zu[S. 133] sein, denn nirgends fanden wir jene Kulturflecke urbargemachten Landes, die sich sonst schon so weit hin markieren. Für Schiffahrt ist die ganze Küste rein, d. h. frei von Korallriffen, Inseln und Sandbänken, aber das Meer fällt in wenig Abstand in bedeutende Tiefen zwischen 300 bis 400 Faden ab, und was das schlimmste ist, nirgends findet sich eine geeignete Ankerung[40], geschweige denn ein Hafen. Die ganze Küste besteht aus sanften Einbuchtungen, meist Flachufer mit Waldrand, hie und da Sandstrand oder mäßigem Felssteilufer. Freilich zeigte sich überall nur schwache Brandung, aber wir befanden uns im Südostmonsun, und während des Nordwest wird dies wahrscheinlich anders sein. Glücklicherweise ist das Meer meist ruhig und frei von jenen häßlichen Böen die z. B. das Marshallmeer so ungemütlich machen. Die Verhältnisse sind daher im ganzen recht günstige und weit besser als an vielen anderen Küsten, wo trotz Ungunst sich ein reges koloniales Leben entwickelte.
In der Nacht wurde nach der schon am Tage sichtbaren Küste von Neu-Britannien hinübergedampft, die wir am andern Morgen in der Gegend von Kap Anns, der südwestlichen Spitze, erreichten. Gleich hier zeigte sich die vollständige Unzuverlässigkeit der Karten, die freilich noch von Dampier (1700) und d'Urville (1827) herrühren, welche mit ihren Segelschiffen weit von der Küste abhalten mußten und so eine Menge Kaps[41] benannten, ohne sie astronomisch festzulegen, die gar nicht existieren. Das war freilich sehr mißlich, denn gar keine Karte ist immer noch besser als eine unrichtige, aber der trefflichen Führung von Kapitän Dallmann gelang es die erste Rekognoszierungsfahrt längs dieser ca. 240 Meilen langen, unbekannten Küste bis Kap Orford glücklich durchzuführen, wozu die Samoa freilich drei Tage brauchte. Es zeigte sich dabei, daß die angeblichen Kaps meist aus vorgelagerten Inseln bestehen, die von weitem wie[S. 134] Vorsprünge aussehen, denn selbst Südkap vermochten wir nicht mit Sicherheit auszumachen. An Riffs war übrigens kein Mangel, und da uns leider eine Dampfbarkasse fehlte, so mußten wir manche, vielleicht praktikable Buchten ununtersucht lassen. Aber das ganze Land schien überhaupt zu wenig einladend; nichts als dicht bewaldete, steile, vulkanische Berge, mangrovereiches, dichtbewaldetes Vorland, unzählige Inseln, die mit ihren Riffs zuweilen zum Abbiegen nötigten, wenig Kokospalmen und somit auch Menschen, das sind so die Hauptzüge dieser Küste, wie ich hier nur mit wenigen Strichen skizzieren will. Die kleinen Siedelungen schienen meist auf den Inseln zu liegen, und da wir Eile hatten, konnten wir sie nicht besichtigen. Nur einmal kamen Eingeborene in Kanus ab, in einer Bucht, die zwischen Süd-Kap und Kap Roebuck der Karten liegt und die ich »Hansabucht« benannte. Ich zählte acht bis neun kleine Siedelungen in dieser Bucht, den bevölkertsten Distrikt an der ganzen Küste bis Spacious-Bai. Die Leute waren sehr scheu, und kamen erst nach und nach näher, als ich ihnen leere Flaschen mit einem daran gebundenen Streifen roten Zeuges zuwerfen ließ, wagten sich aber längsseit gekommen nicht an Bord. Anthropologisch echte Papuas zeigten sie ethnologisch die meiste Zusammengehörigkeit mit Neu-Guinea, so in ihren Schamschurzen, Kalkkalebassen, Schmuck aus Schweinezähnen, filetgestrickten Tragbeuteln, breiten Schildpattarmbändern und dergleichen. Einige trugen Kopfbinden aus einer Art Flachs, ganz wie ich solche bei Festungshuk gesehen hatte. Muschelgeld, ganz wie das Diwarra von Blanche-Bai, schien auch eine große Rolle zu spielen, und sie gaben es nur ungern her. Sie führten keinerlei Waffen mit sich und waren ruhige Leute, mit denen sich sehr gut handeln ließ, bekamen aber oft untereinander Streit. Sie besaßen einige sehr eigentümliche Sachen, darunter besonders einen hübschen Kampfbrustschmuck aus zwei Eberhauern und Muschelgeld. Ihre Kanus waren sehr roh, alles Schmuckes bar, aber zum Teil sehr lang. Das eine mochte über 40 Fuß messen und trug 16 Mann. Interessant war es mir zuerst wieder bei einigen Männern schwache Tätowierung, schmale Strichelchen über Stirn und Backen, zu sehen;[S. 135] bei einigen machte sich künstliche Deformation des Schädels bemerkbar. An Produkten besaßen sie außer Betelnüssen und Tabakblättern nichts, nicht einmal Kokosnüsse.
In den letzten Tagen des Oktober trafen wir glücklich wieder in Mioko ein, nicht wie es in Schiffsberichten gewöhnlich heißt »an Bord alles wohl«!, sondern sieben Mann lagen am Fieber darnieder, darunter der Schreiber dieser Zeilen, ein Andenken, das uns wahrscheinlich Friedrich-Wilhelms-Hafen mit auf den Weg gegeben hatte. Nun, war es doch nicht mein erstes Tropenfieber! Masqui!
Massacre der »Mioko«. — Ursachen. — Ein schwarzer Kriegsgefangener. — Strafexpedition der »Hyäne«. — Ankunft der »Elisabeth«. — Aufhissen der deutschen Reichsflagge in Matupi und Mioko. — Fieberträume. — Abreise nach Neu-Guinea. — Luard-Inseln. — Fliegende Hunde. — Herkulesfluß. — Scheue Eingeborene. — Menschenleer. — Basiliskbucht. — »Bleichröder«-Fluß. — Verräter-Bai. — Spreefahrt. — Kasuarinen. — Mitrafels. — Eine verlassene Niederlassung. — Owen Stanley. — Adolphshafen. — In Huon-Golf. — Parsi-Huk. — Verkehr mit Eingeborenen. — Eine seltene Haarlocke. — Markhamfluß. — Rawlinson-Gebirge. — Kap Cretin. — Herrliches Land. — Ich entdecke einen Hafen. — Finschhafen. — Trefflich geeignet zur Niederlassung. — Ankunft der »Hyäne«. — Flaggenhissen. — Betrachtungen über die Eingeborenen. — Diebstähle. — Ist Civilisation möglich? — Freiheitstrieb unvereinbar mit derselben. — Dorf Ssuam. — Häuser. — Abumtau Gabiang. — Gräber. — Ethnologisches. — Kanus. — Kakadus. — Jagd und Tierleben. — Exkursion auf dem Bumifluß. — Eine Krokodiljagd. — Abschied von Finschhafen. — Eine Explosion. — Mohrenkönig und Krone. — Long-Insel. — Begegnung mit Eingeborenen. — Wasserhose. — Schönes Land bei Kap Raoul. — Längs der Nordküste Neu-Britanniens. — Nusa in Neu-Irland. — Friedrich Schulle. — Rückkunft nach Mioko. — Rückblicke in Betreff der Entwickelung von Finschhafen.
In dem sonst so stillen Hafen von Mioko herrschte ungewohntes Leben; das deutsche Kanonenboot »Hyäne« (Kommandant Kapt.-Lt. Langemack) und ein Hamburger Dreimastschuner lagen bei unserer Rückkehr vor Anker und wechselten mit der Samoa die üblichen Grüße durch dreimaliges Senken der Flaggen.
Das Kriegsschiff verließ uns aber sehr bald wieder, um eine jener Strafexpeditionen auszuführen, die in der letzten Zeit unsere Kriegsschiffe in diesen Gebieten so häufig beschäftigten und zu denen oft längst geschehene Vorfälle die Veranlassung sind. Auch hier war dies[S. 137] der Fall, denn es galt die Eingeborenen zu züchtigen, welche im vorhergehenden Jahre in Metelik, an der Südostspitze Neu-Irlands, den deutschen Schuner »Mioko« überfallen und nach Niedermetzelung der Mannschaft verbrannten. In Metelik oder Likelike-Bai hatten schon die berüchtigten Unternehmungen des Marquis des Rays bei den Eingeborenen die bösesten Erinnerungen an Weiße zurückgelassen und spätere Besuche von Werbeschiffen, die hier rekrutierten, d. h. Menschen wegführten, diese Eindrücke nur zu lebhaft wieder aufgefrischt.
Die sogenannten »nackten Wilden« sind eben Menschen wie wir, und es ist ihnen selbstredend nicht gleichgültig, wenn Familien- und Stammesangehörige, nicht immer in legaler Weise, entführt werden, die zu häufig ihre Heimat niemals wiedersehen. Die »Labourtrade«, Arbeitshandel, hat daher überall, wo sie betrieben wurde, den nachteiligsten Einfluß ausgeübt und so häufig die Veranlassung zu jenen Massacres gegeben, welche fast ausnahmslos der Blutgier und Wildheit der Eingeborenen zugeschrieben werden und für die gewöhnlich Unschuldige auf beiden Seiten zu büßen haben. Die »Mioko« war eins dieser unglücklichen Opfer der Vergeltung der Eingeborenen, die selbstverständlich alle Weiße für identisch halten und an dem ersten besten, der in ihre Hände fällt, ihre Rache für ihnen durch Weiße zugefügtes Leid zu kühlen suchen. Da kein Papua ein großer Held ist und offenen Kampf stets zu vermeiden sucht, so handelt es sich gewöhnlich um den, mit Hinterlist und Verräterei gepaarten, überlegten Mord. In Gegenden, wo Werbeschiffe ihr Wesen trieben, heißt es daher doppelt auf der Hut sein. Denn gar oft ist das freundliche Wesen der Eingeborenen nur Maske, und in den meisten Fällen gelingt der Handstreich nur infolge zu großer Sorglosigkeit. So erging es leider auch der »Mioko«. Das kleine, ca. 50 Tons große Fahrzeug, mit nur fünf Mann an Bord, war auf der Reise von Sydney nach Mioko durch Windstillen und Strömungen im St. Georgs-Kanal aufgehalten worden und hatte in Metelikhafen vorgesprochen, dessen Eingeborene sich sehr freundlich zeigten. Dabei ist jedenfalls vom Kapitän, der in jenen Gebieten durchaus[S. 138] Neuling war, die nötige Vorsicht außer acht gelassen worden. Als die Eingeborenen vollends merkten, daß keine Waffen an Bord waren, welche das Schiff unbegreiflicherweise erst am Bestimmungsort erhalten sollte, hatten sie leichtes Spiel. Man kann es ihnen nicht verdenken, wenn sie eine so günstige Gelegenheit nicht unbenutzt vorübergehen ließen. Daß dabei die Habsucht durch Plünderung des Schiffes mit befriedigt wurde, ist ebenfalls leicht erklärlich. Deshalb sind die Eingeborenen noch lange nicht jene notorischen Räuber und Mörder[42], für welche sie nach einem solchen Vorgange meist erklärt werden, da ja nach der gewöhnlichen Auffassung Raub und Mord gleichsam in ihrem Blute liegen, denn dafür sind es ja eben »Wilde«! Ein solches Urteil würde aber kein gerechtes sein! Ich kann aus meinen eigenen Erfahrungen Fälle anführen, wo Eingeborene eben so menschlich als wir handelten. So brachte im Jahre 1881 ein deutsches Schiff einen jungen Franzosen nach Matupi mit, den es bei Cap Hunter an der Südwestküste Neu-Irlands aufgenommen hatte. Der Genannte war »Soldat« der Colonie libre des Marquis des Rays gewesen, mit einem anderen Vaterlandsverteidiger desertiert und hatte bereits mehrere Wochen unter den Eingeborenen gelebt, bis ihn zufällig dieses Schiff erlöste.
Aus Furcht vor Strafe waren die Übelthäter von Metelik verzogen und zwar nach Lombom oder der kleinen Wallis-Insel bei Port Praslin, und dahin ging nun die Expedition der »Hyäne«. An Bord befand sich bereits ein Eingeborener, welcher der Teilnahme an dem Massacre der »Mioko« bezichtigt war, wohl verwahrt in Eisen. Der arme Schächer konnte einem wirklich leid thun, denn wurde er auch an Bord gut behandelt, so machten sich doch häufig Schiffsleute[S. 139] den Spaß, ihm durch Pantomimen des Hängens oder Erschießens sein mutmaßliches Schicksal vorauszusagen. Es war kein Wunder, wenn ihm aus Furcht Appetit wie Schlaf verging. Dabei behauptete er durchaus unschuldig zu sein und gar nicht in Lombom, sondern in Lamassa oder Coconut-Island, ca. 10 Meilen weiter nördlich, zu Haus zu gehören und bat flehentlich, ihn nach dort zu bringen, wo sich seine Behauptung durch seine Familie von selbst als richtig erweisen werde. Aber man hatte »einen Löffel« von der Mioko bei ihm gefunden, und dann — fürchtete er sich so! Kein Wunder! War der Mann doch sehr unfreiwillig in die Handschellen geraten und zwar durch die Verräterei eines schwarzen Bruders, eines Salomon-Eingeborenen, der für ein deutsches Haus an der Küste von Blanche-Bai Kopra einkaufte. Dieser Brave hatte den Arglosen zu einem freundschaftlichen Besuche bei sich eingeladen, ihn statt dessen aber gefesselt nach Mioko gebracht, Beweis, daß auch Europäer zuweilen jene Mittel billigen, welche sie bei den Eingeborenen so sehr verabscheuen. Aber das ist Südseeleben! Während sonst kaum auf das Zeugnis eines Schwarzen Wert gelegt wird, wurde es in diesem Falle als vollgültig angenommen, denn der Salomonsmann war ja wohl der einzige Belastungszeuge. Die Expedition der »Hyäne« verlief übrigens in der gewöhnlichen Weise. Trotz aller Vorsicht waren die Vögel in Lombom ausgeflogen! Pulver und Blei konnten also diesmal gespart werden, denn Streichhölzer genügten um die Häuser anzuzünden, die, im Verein mit vernichteten Kanus und Plantagen, den Eingeborenen in üblicher Weise zur Warnung dienen sollten, obwohl damit der beabsichtigte Zweck ernstlicher Schädigung nur sehr unvollkommen erreicht wird. Für Muschelgeld lassen sich leicht Kanus wieder anschaffen, und der Aufbau solcher Häuser, als wie die hiesigen, macht auch nicht sonderliche Mühe. In der That fand ich einige Zeit später die Bewohner des devastierten Dorfes ganz gemütlich an einer anderen Stelle wieder angesiedelt.
Die »Hyäne« kam viel schneller, als erwartet wurde, wieder zurück und zwar ohne Coconut-Island besucht zu haben, was jener arme Gefangene gewiß am meisten zu beklagen hatte. Denn dadurch[S. 140] unterblieb die ihm versprochene Untersuchung in seiner Heimat und er wurde später mit einem Arbeiter-Transportschiff nach Samoa geschickt. Dort ist er wahrscheinlich auch nicht aufgehangen worden, sondern verrichtet vermutlich noch heut Zwangsarbeit in Plantagen, wenn ihn nicht inzwischen das Heimweh, wie so manchen Kanaker hingerafft hat. Die Lamassaner werden aber dort vorsprechende Weiße wahrscheinlich nicht sonderlich höflich aufnehmen und dem Andenken des entführten Löffelmannes bei Gelegenheit ein Opfer bringen; denn das ist der Fluch der bösen That, der sich namentlich in der Südsee so anhaltend fortspinnt.
Ein besonderes Ereignis hatte übrigens die »Hyäne« so plötzlich zurückbeordert und zwar das unerwartete Eintreffen eines großen Kriegsschiffes, das wir zu unserem Erstaunen plötzlich, im Kanal Matupihafen zudampfend, erblickten. Durch die bald darauf ankommende »Hyäne« erfuhren wir, daß das Schiff S. M. gedeckte Korvette »Elisabeth« sei und begaben uns sogleich an Bord der »Hyäne« nach Matupi, um den Kommandanten Kapitän z. S. Schering zu begrüßen. Wir hörten frohe Botschaft: die deutschen Besitzungen im Archipel von Neu-Britannien sollten unter den Schutz des Reiches gestellt werden, welcher feierliche Akt am 3. November in Matupi unter den entsprechenden Ceremonien vor sich ging. Es war ein schönes Schauspiel, als 250 Mann in bewundernswerter Eile und Ordnung landeten und in dem weiten Hofe des Hernsheim'schen Etablissements Aufstellung nahmen. Kapitän Schering verlas dann auf Befehl Seiner Majestät des Kaisers die kurze Proklamation, die Truppen präsentierten und unter den Klängen des »Heil dir im Siegerkranz«, dem Donner der Geschütze und einem dreimaligen Hoch auf Seine Majestät ging die Reichsflagge der deutschen Kriegsmarine in die Höhe! Am folgenden Tage wiederholte sich dieselbe Feierlichkeit in dem Etablissement der Handels- und Plantagen-Gesellschaft auf Mioko, wohin diesmal auch die verschiedenen Häuptlinge der Herzog York-Inseln eingeladen waren, denen die Bedeutung der Handlung klar gemacht wurde. »Bye and bye you kill white man, man of war kill you« (wenn du einen Weißen tötest, tötet dich das Kriegsschiff),[S. 141] ein Argument, das die Eingeborenen sehr wohl verstanden, wenn es ihnen auch weniger begreiflich scheinen mochte, daß sie sich fortan der eigenen Gerichtsbarkeit Weißen gegenüber gänzlich enthalten sollten. Jedenfalls hatten sie darüber ihre eigenen Ansichten und zwar auf Grund unliebsamer Erfahrungen, die ihnen lehrten, daß der schwarze Mann wohl selten Recht erhält, und konnten sich nicht gleich zu dem Glauben aufschwingen, daß dies nun mit einem Schlage anders, besser werden sollte. Natürlich versprachen sie alles, wie das Kanaker stets thun, und der Frieden schien für ewige Zeit besiegelt. Freilich mit der Handvoll Eingeborenen der Herzog-York-Insel hat es keine Not, denen ist die blutige Sühne für die Ermordung Kleinschmidts noch in gutem Gedächtnis. Aber in Neu-Britannien und Neu-Irland, da liegen die Verhältnisse ganz anders, und es wird wohl noch lange dauern, ehe die Eingeborenen sich jener Botmäßigkeit bewußt sind, welche für gute Unterthanen selbstverständlich ist. In der That wurde nicht lange nach dem Aufhissen der Kriegsflagge an der Nordküste der Gazelle-Halbinsel ein Eingeborener, der für ein deutsches Haus handelte, umgebracht, seine Vorräte geplündert. Die Kriegsmarine bekam dadurch wieder zu strafen, was durch die bekannten Vorgänge des Kanonenbootes »Albatross«, unter dem Kommando des energischen Graf von Baudissin, gründlich besorgt wurde. Aber seitdem hat sich wohl kein weißer Händler mehr in den verrufenen Gebieten von Kabakadai und Kabaira niedergelassen, wo der mächtige Häuptling Toberinge (Tuberingai) herrscht; denn wegen ein oder zwei Koprahändler kann doch nicht immer ein Kriegsschiff zur Stelle sein.
Mit dem Aufhissen der deutschen Kriegsflagge war übrigens der Grundstein zu unseren jetzigen Südsee-Kolonien gelegt und ein Akt vollzogen worden, der die lebhafteste Freude hervorrief, in der Heimat gewiß mehr als im Kreise gewisser Kolonisten.
Das neue deutsche Besitztum gefiel Kommandant Schering, wie den Herren der Elisabeth überhaupt, unendlich viel besser als dasjenige, welches sie kaum drei Monate früher (am 7. August) erworben hatten, und von wo das Kriegsschiff mit kurzem Aufenthalt in Kapstadt[S. 142] und Sydney direkt herkam: Angra Pequeña! »Lüderitzland«! die vielbesprochene und besungene erste deutsche Kolonie, welche den neuesten Berichten zufolge hoffentlich bald durch ihren »Goldreichtum« thatsächlich den so oft getäuschten Erwartungen entspricht. Die ersten Besucher konnten davon freilich keine Ahnung haben und Dr. Nachtigals Ausruf beim Betreten des gelobten Landes: »Oh! meine Sahara!« war jedenfalls berechtigt.
Die Erfolge der Samoa in Astrolabe-Bai machten die Anwesenheit der deutschen Kriegsschiffe zu demselben Zwecke als in Neu-Britannien und Neu-Irland auch in Neu-Guinea nötig, und auf Wunsch des Kommandanten begleitete Kapitän Dallmann dieselben als Lotse für Friedrich-Wilhelms-Hafen. Unter der Behandlung von Dr. Frerichs von der »Hyäne« hatten sich unsere Kranken soweit erholt, um wieder Dienst zu thun, und so konnten wir in der ersten Hälfte des November die zweite Reise nach Neu-Guinea antreten, um hier verabredetermaßen mit den Kriegsschiffen wieder zusammenzutreffen. Mir selbst war, schon des Fiebers wegen, am meisten daran gelegen, wieder in See zu kommen, weil ich aus Erfahrung wußte, daß Luftveränderung das beste Mittel ist, wenn auch Seeluft nicht allemal gegen das Fieber hilft, welches mir diesmal bös zugesetzt hatte. In meinen phantastischen Träumen spielte die zuletzt befahrene Küste Neu-Britanniens die Hauptrolle. Ich sah stets neue Kaps voraus, welche sich in Inseln auflösten und so rasch aufeinander folgten, daß ich nicht mehr im stande war alle aufzuzeichnen, und dies beängstigte mich außerordentlich. Ja! ja! das Fieber vermag gar wunderliche Bilder hervorzuzaubern, und ich freute mich, daß ich sie los war und die Küste diesmal in Wirklichkeit vor Augen hatte. Sie blieb, häufig durch Wolken und Regenböen verschleiert, mit ihren eintönigen Bergrücken und anscheinenden Kaps fast drei Tage lang in Sicht, denn die Samoa machte infolge von Gegenströmungen und Böen nur langsam Fortgang.
In der Frühe des vierten Tages kam Neu-Guinea, wie immer, beim Annähern von Land, in wechselnden Bildern, zum Vorschein. Zuerst zeigte sich eine mäßig hohe, blaue Bergkette, über eine dichte[S. 143] weiße Wolkenschicht vorragend, welche unmittelbar auf der Wasserfläche zu lagern schien, aus welcher nach und nach Inseln auftauchten. Letztere verflossen allmählich ineinander und erwiesen sich als der eigentliche, flache, dichtbewaldete Küstensaum, vor dem aber später thatsächlich kleine Inseln sichtbar wurden. Welche mochten es wohl sein? war eine Frage, die uns zunächst am lebhaftesten beschäftigte. Daß wir uns in Huon-Golf befanden wußten wir freilich, aber hier[S. 144] erstrecken sich eine ganze Reihe solcher kleinen Inseln längs der Küste und ohne Ortsbestimmung ließ sich die Frage eben nicht ausmachen. Glücklicherweise brachte der Mittag klaren Himmel und nach den Beobachtungen erwiesen sich die vor uns liegenden Inseln als die Luard-Gruppe von Moresby. Ich ging sogleich mit Hinrich Sechstroh, dem ersten Offizier der Samoa, welcher während der Abwesenheit von Kapitän Dallmann den Dampfer führte, im Walboot ab, um eine Untersuchung vorzunehmen. Die acht Inseln sind alle klein, dichtbewaldet und haben zum Teile eine Sohle felsigen Steilufers, welches aus einem ganz anderen Gestein als dem bisher gesehenen besteht. Es ist eine Art Konglomerat oder Breccie, aber die Korallformation ebenfalls vertreten. So lag der Strand der kleinen Insel, auf welcher wir landeten, voll von Koralltrümmern, Rollstücken von Madreporen u. s. w. Ein halb im Sande verwehtes Kanu, sowie eine Kokospalme, mit leider verkrüppelten Nüssen, deuteten an, daß früher Menschen hier verkehrt hatten; sonst bemerkten wir keine Spur von ihnen.
Aber eine andere unerwartete Erscheinung überraschte uns: Hunderte fliegender Hunde erhoben sich aus dem Gelaube der Bäume und unsere Schüsse scheuchten weitere Scharen derselben auf. Mit Ausnahme einer Lokalität auf der Karolineninsel Kuschai hatte ich in der That nie soviele fliegende Hunde beisammen gesehen. Sie schienen hier einen gesicherten Platz für die Tagesruhe gefunden zu haben, von wo aus sie bei Einbruch der Dunkelheit ihre Streifzüge unternehmen, um die Plantagen zu plündern, für die sie eine wahre Plage werden. In manchem Baume hingen mehr als zwanzig dieser Tiere, in der üblichen Weise mit dem Kopfe nach unten und mit den Hinterfüßen an einem Aste festgeklammert, so daß sie bei der Dunkelheit der dichten Belaubung nicht immer leicht zu sehen waren. Die Jagd hat also gewisse Schwierigkeiten, umsomehr als die fliegenden Hunde ein sehr zähes Leben haben und angeschossen meist in den Zweigen hängen bleiben. Zur Freude unserer Schwarzen wurde aber bald eine Anzahl erlegt, denn fliegende Hunde sind bei diesen sehr beliebt und sollen auch, nach der Versicherung[S. 145] englischer Marineoffiziere, in der That sehr gut schmecken. Da sich die Tiere nur von Vegetabilien, am liebsten Brotfrucht und Bananen nähren, ist dies sehr erklärlich. Aber trotzdem konnte ich mich niemals entschließen, das Fleisch zu kosten, weil die Tiere einen so widerwärtigen iltisartigen Geruch haben, der selbst den präparierten Häuten noch anhaftet, durch Einlegen in Essig aber ganz verschwinden soll. Die Art ähnelt übrigens dem »Anganau« Neu-Britanniens (Pteropus melanopogon) am meisten und erreicht eine Flügelspannung von mehr als 4½ Fuß, ist also mit eins der gewaltigsten Flugsäugetiere.
Die Untersuchung der Inseln hatte übrigens keinen Ankerplatz ergeben, und einen solchen, oder besser einen Hafen, zu finden, war unsere erste Aufgabe. Freilich weist Moresbys Karte, dessen treffliche Aufnahmen damals die einzige Quelle für das Gebiet von Huon-Golf und der Nachbarschaft bildeten, nicht einmal einen solchen auf. Aber deswegen brauchte die Suche noch nicht aufgegeben zu werden, denn Moresby konnte in diesem Teile nur oberflächliche, mehr fliegende Aufnahmen machen und mußte manches übersehen.
Es wurde beschlossen, zunächst bis zum Mitrafels längs der Küste von Herkules-Bai zu gehen, die sich sehr gebirgig zeigte. Neue, am vorhergehenden Tage nicht gesehene Gebirge traten hervor, von denen sich nach und nach drei Ketten unterscheiden ließen, deren innerste und höchste an 6000 Fuß erreichen mochte, sich aber bald mit Wolken bedeckte. Schon in einer Entfernung von mehr als zehn Meilen von der Küste hatte uns wiederholt trübgefärbtes, ganz wie Riff aussehendes Wasser, zum Stoppen und Loten veranlaßt, wobei sich indes zeigte, daß dasselbe nur von Süßwasser herrühren konnte. Dafür sprachen auch die häufigen, in der Nacht übrigens nicht ungefährlichen, Treibholzstämme, welche sich mehrten, je mehr wir uns der Küste näherten. Daß also ein Fluß und zwar ein größerer irgendwo in der Nähe münden mußte, daran war kein Zweifel. Wirklich fanden wir ihn bald darauf ca. 5 Meilen Südost von den Luard-Inseln, leider aber durch eine Barre gesperrt, über die es mächtig brandete. Als wir uns bei einer späteren Gelegenheit dieser[S. 146] Flußmündung bis auf eine halbe Seemeile näherten, ließ sich selbst hier noch kein Grund zum Ankern finden, so daß die Barre jedenfalls außerordentlich steil in die Tiefe abfällt. Die Breite des Flusses mochte 100 bis 150 Schritt betragen; seine Ufer waren, wie die Abbildung zeigt, von dichtem Urwald eingerahmt, die Strömung sehr ansehnlich. Innerhalb der Barre schien das Wasser ganz ruhig, aber durch Treibholzstämme unklar, so daß der Fluß wohl nur für Boote praktikabel sein dürfte. Er wurde Herkulesfluß genannt, nach der Bai, welche Kapitän Moresby nicht nach dem mythologischen Helden, sondern nach Sir Herkules Robinson, S. C. M. G., so benannte.
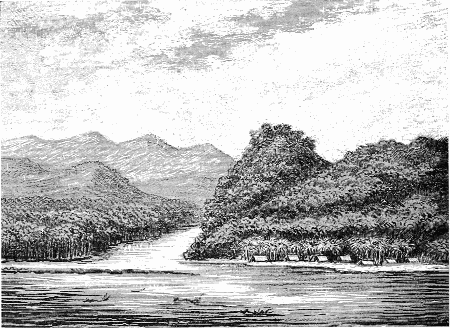
Am linken Ufer des Herkulesflusses standen ca. ein Dutzend Kokospalmen, die ersten welche wir, seit der einzigen auf der Insel der fliegenden Hunde, an dieser Küste sahen. Das ließ auf Menschen schließen, und wirklich zeigten sich bald Eingeborene, deren Zahl nach und nach Hundert und mehr betragen mochte. Sie liefen anscheinend[S. 147] in großer Aufregung hin und her, und es dauerte lange, ehe zwei Kanus abkamen mit ca. einem Dutzend beherzter Männer. Sie trugen sonderbaren Ausputz von Kasuarfedern, Ovulamuscheln, Arm- und Kniebänder, um den Leib Rotangstreifen, führten aber keinerlei Waffen mit sich. Leider waren sie so furchtsam, daß sie sich nicht bis an den Dampfer heranwagten, sondern plötzlich Reißaus nahmen und selbst die roten an Flaschen gebundenen Zeugstreifen, welche ich ihnen zuwerfen ließ, nicht beachteten. Dies sonderbare Benehmen hatte sicherlich nicht in früheren Besuchen von Arbeiterschiffen seinen Grund, wie dies sonst meist der Fall ist, sondern die Leutchen mochten überhaupt noch kein Schiff und Weiße gesehen haben, da sie allem Anschein nach nicht an der Küste, sondern weiter im Inneren zu Haus gehörten. Dafür sprachen die Form der schlechten Kanus und Paddel, die nur für Flußfahrten tauglich schienen, sowie die Armseligkeit der schuppenartigen Hütten am Ufer, die nur einem vorübergehenden Aufenthalt dienen mochten. Diese Ansicht wurde ziemlich zur Gewißheit, als wir ein paar Tage später den Platz wieder besuchten und zu unserem Erstaunen denselben völlig verlassen fanden; nur unsere Stimmen machten den Urwald widerhallen! So entging mir leider die Bekanntschaft dieser gewiß interessanten Eingeborenen; wiederum ein Beweis, daß ein Reisender jede Gelegenheit benutzen soll. Aber bei unserem ersten Besuche konnten wir uns aus Rücksicht für die Weiterreise nicht lange aufhalten und damals natürlich nicht voraussehen, das Nest später leer zu finden. Jedenfalls wohnen diese Eingeborenen weiter aufwärts am Flusse und kommen nur gelegentlich der Fischerei wegen bis ans Meer. In der That fanden wir die Küste von Herkules-Bai bis zum Mitrafels total unbewohnt, selbst solche Lokalitäten wie Kriegsgesang-Huk (Warsong-Point) und Verräter-Bai (Traitors-Bay), wo der »Basilisk« vor zehn Jahren noch zahlreich bevölkerte Dörfer angetroffen hatte. Die herausfordernde Haltung der Eingeborenen, welche Moresby damals zwang auf dieselben zu schießen, war die Veranlassung des odiösen Namens, zu dem übrigens bemerkt sein mag, daß niemand zu Schaden kam, und daß ein einziger Schuß die Krieger in wilde Flucht jagte.[S. 148] Wie ein zweiter Besuch dieses Gebietes lehrte, ist die von Moresby beschriebene Verräter-Bai, in welcher der Basilisk ein paar Tage verweilte, um Feuerholz zu schlagen, wohl nicht identisch mit der großen, gleichnamigen der Karten, sondern nur eine sanfte Buchtung wenige Meilen westlich vom Clydefluß. Sie verdient einen eigenen Namen und mag als »Basilisk-Bucht« unterschieden werden. Die südöstliche flache Huk ist Ambush-Point von Moresby und 5½ Meilen W. bei N. von Kap Ward-Hunt. Wir lagen hier im April des folgenden Jahres (1885) mit der Samoa zu Anker, an einer Stelle, die ganz mit Moresbys Beschreibung übereinstimmt. Ich machte von hier eine Bootexkursion, die ich gleich an dieser Stelle mit einfügen will. Wie der Clyde östlich von Basilisk-Bucht, so mündet ein ähnlicher durch eine Barre versperrter Fluß westlich von derselben, den ich »Bleichröder« benannte. Beide Flüsse sind übrigens möglicherweise nur Arme eines weit größeren, in der eigentlichen Verräter-Bai mündenden Flusses, den ich »Spree« benannte, denn dieses ganze Mündungsgebiet scheint ein Delta zu sein. Das niedrige Land hat ein sumpfiges Ansehen und ist vegetativ durch vorherrschende Bestände von Kasuarinen ausgezeichnet, welche meist den unmittelbaren Ufersaum bilden. Dieser durch seine schwarzgrüne Belaubung am meisten an Nadelholz, zumal an unsere Lärchen, erinnernde Baum, wird für dieses Gebiet besonders charakteristisch und scheint in sumpfigem Terrain heimisch. Die Bäume selbst standen übrigens keineswegs dicht, waren nicht sehr hoch und hatten ein kränkliches Aussehen, wahrscheinlich infolge der Lianen, welche die meisten Bäume bedeckten und sie nach und nach töten. Je tiefer wir in die Bai hineinkamen, die an fünf Meilen breit sein mag, um so großartiger gestaltete sich das Vegetations- und Landschaftsbild. Eine breite Barre, auf der mächtige Treibholzstämme die Untiefen, gleich Schiffahrtszeichen, markierten, versperrte den größten Teil des Mündungsgebietes und ließ nur einzelne für Boote passierbare Kanäle frei. Wir gingen den östlichsten, hart am rechten Flußufer laufenden hinauf, der für sich selbst einem kleinen Fluß glich und wenigstens im Anfange eine beträchtlich starke Strömung zeigte. Gewaltige Laubbäume,[S. 149] die oft so dicht mit großblättrigen Schlingpflanzen bedeckt waren, daß sie förmliche Waldkulissen darstellten, untermischt mit einer nicht sehr hohen schlankstämmigen Palme, einer Cycasart ähnlich, bildeten den Hauptteil der üppigen Urwaldsvegetation. Selbstverständlich fehlte es nicht an der im Wasser wachsenden Nipapalme, die mit ihren gewaltigen Wedeln und kolossalen Früchten sich oft zu großen, boskettartigen, grotesken Gruppen vereinte, während anscheinend grüne Wiesenufersäume oder Inseln sich bei näherer Untersuchung als eine acht bis zehn Fuß hohe, das Wasser ca. zwei Fuß überragende, Grasart erwiesen. Der zwischen 30 bis 50 Fuß breite Flußarm breitete sich zuweilen zu weiten, teichartigen Wasserbecken aus, in welche verschiedene Kanäle mündeten, und es war bei der allmählichen Strömungsabnahme nicht leicht in der Hauptader zu bleiben. Der Gedanke, in vorher nie betretene Gebiete einzudringen, erzeugt selbst bei Erfahrenen ein seltsames, prickelndes Gefühl, das sich beim Befahren eines neuen Flusses noch bedeutend erhöht.
Bei jeder Biegung hofft man auf etwas Neues, erschaut aber fast ausnahmslos dieselbe Einförmigkeit, denn beinahe alle solche, durch urwaldbedeckte Ebenen, fließenden Wässer zeigen denselben Charakter. Wie sehr schien nicht gerade dieses Flußgebiet zum Aufenthalt von Krokodilen geeignet; aber auch hier blieb mein sehnlichster Jägerwunsch, ein solches Ungetüm zu erlegen, unerfüllt. Lautlos glitt unser Boot über den Wasserspiegel, auf dem sich nicht einmal Reiher, Purpurhühner oder anderes hier zu erwartendes Geflügel zeigte. Wie gewöhnlich blieb es bei Papageien, Tauben, Glanzstaren und Raben, welche den Uferwald, übrigens auch unerreichbar für unsere Gewehre, belebten, mich aber nicht reizten, denn alles waren bekannte Arten. Auf Paradiesvögel darf man im Flachland kaum rechnen, da sie den Bergen angehören. Weiterhin schienen solche das Delta zu begrenzen, und hier wohnen jedenfalls auch die Menschen, von welchen wir am Fluß auch nicht eine Spur bemerkten, denn mit dem Glase sah man an den Bergen deutlich Kokospalmen, und wo diese, sind auch Menschen.
[S. 150] Leider konnten wir nicht bis zu ihnen vordringen und mußten uns mit dieser flüchtigen Rekognoszierung begnügen, zu der in ausgedehnterer Weise eine Dampfbarkasse nötig gewesen wäre. Jedenfalls ist dieser Fluß, von dem wir nur einen unbedeutenden Nebenarm kennen lernten, recht ansehnlich. Eine genauere Erforschung desselben dürfte sich sehr nützlich erweisen und vielleicht für kleine Fahrzeuge eine Wasserstraße ergeben.
Als wir mit Einbruch der Dunkelheit an Bord zurückkehrten, bereiteten uns abermals fliegende Hunde, aber einer anderen Art als der auf der Insel gesehenen angehörend, ein seltenes Schauspiel, das namentlich für den Zoologen interessant und neu war. In großer Anzahl umschwärmten sie das Schiff und schossen zuweilen aus der Luft bis zur Wasserfläche herab, wie Seeschwalben die nach Fischen stoßen. Fliegende Hunde (Pteropen), welche fischen? Davon ist wohl noch nie berichtet worden, und ich will die Gewähr dafür auch nicht übernehmen. Denn jedenfalls hatte das auffallende Gebaren der Tiere nichts mit Fischen zu thun. Es gelang uns leider nicht ein Exemplar zu erbeuten, um durch Untersuchung des Magens die Sache aufzuklären. Vermutlich nippten die Tiere nur Seewasser, um zu trinken.
Doch kehren wir wieder zu unserer Reise auf die Samoa zurück, welche sich dem südöstlichen Endziele, dem Mitrafels nähert. Er ähnelt von weitem einem Pfeiler und besteht aus einem isoliert aus dem Meere aufsteigenden, etwa 40–50 Fuß hohen, kegelförmigen Felsen, der auf dem Scheitel mit grünem Buschwerk bewachsen ist. Riff verbindet ihn mit der etwa eine Meile entfernten Küste, dem Kap Ward-Hunt[43] Moresbys. Es wird von einem etliche hundert Fuß hohen Bergrücken gebildet, der steil bis zum Meere abfällt, und dessen dichte Bewaldung sich durch den Mangel von Kasuarinen auszeichnet. Sehr nahe der Küste steht ein zweiter, weit niedriger Felsenpfeiler, gleichsam als Wächter des großen. Es giebt wohl kaum einen[S. 151] so charakteristischen, leicht zu erkennenden Punkt als Mitrafels, der wie eine natürliche Bake weithin sichtbar ist. Die Kommission, welche später die deutsch-englischen Grenzen feststellte, hätte keinen besseren Markstein wählen können, dessen Wichtigkeit als solcher mir schon bei diesem ersten Besuche klar war. Mitrafels bezeichnet übrigens mit ziemlicher Genauigkeit den 8. Grad südlicher Breite, ist also auch deswegen interessant. Was wir westlich vom Grenzfelsen sahen erschien nicht sehr verlockend, soweit das Auge reicht steil abfallende, bewaldete Bergketten, und wie wir später sehen werden, hat Deutschland jedenfalls den besseren Teil erwählt. Das Deltagebiet zwischen Clyde und Spree scheint gutes Land, aber ziemlich sumpfig zu sein, obwohl sich darüber nach einem flüchtigen Besuche nicht entfernt entscheiden läßt.

Ich landete diesmal in der Nähe von Alligator-Point Moresbys, an einer Stelle, wo anscheinend verlassene Hütten die Neugier besonders rege machten; vielleicht konnten wir dennoch Eingeborene hier antreffen! Heftige Dünung erschwerte das Landen und nötigte das Boot wieder vom Ufer abzuhalten, welches wir nur zu zweien, von einem schwarzen Jungen begleitet, durchstreiften. Ängstlich prüfte[S. 152] das scharfe Auge des letzteren den schwarzen Ufersand nach Menschenspuren, aber nirgend zeigte sich ein Fußtritt, und nur Eidechsen und Krabben hatten ihre bekannten Schlängelspuren zurückgelassen. Die etwa neun Hütten ähnelten in der Form ganz den am Herkulesflusse gesehenen und waren nichts als rohe, mit Blättern der Nipapalme bedeckte Stangengerüste, 10 bis 30 Fuß lang und etwa mannshoch. Niedrige Bänke aus gespaltenen Stangen deuteten an, daß diese Hütten als Schlafstätten benutzt worden waren; sonst fand sich nichts bei denselben als ein paar verkohlte Holzstücke und Fetzen alter Kokosnußfaser. Da diese Palme selbst an dieser ganzen Küste nicht vorkommt, so sprachen diese Reste nur zu deutlich von gelegentlichen Besuchen der Inlandsbewohner, wie ich dies schon im Vorhergehenden erwähnte. Aber wo mochten die Menschen, welche Moresby vor 10 Jahren noch so zahlreich hier antraf, hingekommen sein, und von deren Dörfern wir selbst keine Spur mehr entdeckten? Schon das Fehlen von Kokospalmen schien diese Frage zu beantworten, noch mehr der Charakter des uns vorliegenden Landes, das eben nicht sehr versprechend aussah. Das was uns von weitem als Gras erschien, erwies sich als dichtes, auf dem Sande hinkriechendes Windengeranke, der Uferwaldsaum als sehr schmal, und hinter ihm dehnte sich sumpfiges, reichlich mit Nipapalmen und anderen Bäumen bestandenes Land aus, das zu betreten durchaus nutzlos gewesen wäre.
Wiederum hatten wir auf unserer Reise nordwestwärts imposante Gebirgsbilder, mit grellen Tinten in Schwarz, Violettschwarz, Dunkelblau und zartem Grün vor uns, ja eine frühe Morgenstunde zeigte uns einmal in der Gegend von Traitors-Bay, fern, fern in Südwest ein Hochgebirge, das wohl kein anderes als die Owen-Stanleykette sein konnte. Trotz der Entfernung von etlichen 60 Meilen in der Luftlinie scheint bei der bedeutenden Höhe von über 13000 Fuß eine solche Annahme wohl möglich. Ich kannte zwar den Owen-Stanley von der Südostküste her sehr gut, aber wer vermöchte aus so großer Entfernung ein Gebirge wiederzuerkennen?

Wir hatten die Luard-Inseln wieder erreicht und versuchten es[S. 153] nochmals wenigstens einen Ankerplatz zu finden, und wurden diesmal durch die Entdeckung eines hübschen Hafens belohnt, (18. November 1884). Er bildet ein geräumiges, länglich rundes Becken mit gutem Ankergrund von 10 bis 20 Faden Tiefe, das rings von steilen bewaldeten Bergen umschlossen wird. Unter diesen zeichnet sich, wie die Skizze unten zeigt, besonders eine ca. 1000 bis 1200 Fuß hohe, pyramidenförmige Kuppe aus, welche W. S. W. die Einfahrt giebt. Ich benannte sie »Ottilienberg« nach Frau von, den Hafen selbst »Adolphshafen«, nach Herrn von Hansemann in Berlin, der bekanntlich die Samoa-Expedition ins Leben rief. Nach den Ortsbestimmungen Sechstrohs liegt Adolphshafen unter 7° 44′ Süd und 147° 44′ Ost. Wie sich schon die Einfahrt durch schmutzig gefärbtes Süßwasser auszeichnet, so der Hafen selbst, eine Eigentümlichkeit, die zur Reinigung eiserner Schiffe wichtig werden kann. Im übrigen ist die Umgebung des Hafens für Ansiedelung wenig versprechend. Das Vorland des westlichen Ufers erwies sich als[S. 154] sumpfiges, mit Pandanus, Kasuarinen, Ried und Binsen bestandenes Terrain, die zum Teil stagnierende Mündung eines Flusses, dessen Hauptarm nördlich von einer Landzunge herauszukommen schien. Auf der letzteren zeigten sich plötzlich etliche Eingeborene, von denen wir im Hafen selbst keine andere Spur als ein paar verfallene Gerüste gefunden hatten. Es waren sieben, anscheinend total nackte Männer, die gewaltige Schilde und Speere mit sich führten, uns aber durch Winken mit grünen Zweigen ans Land einluden. Das ging nun leider nicht, da um die Spitze der Landzunge eine gewaltige Strömung schoß und der einbrechende Abend uns zur Rückkehr an Bord nötigte, wo wir noch eben vor Eintritt der Dunkelheit eintrafen. Auf diese Weise profitierten leider die Entdecker des neuen Hafens selbst nicht einmal die Nachtruhe in demselben, sondern mußten wie gewöhnlich von der Küste abhalten, um sich recht gründlich durchschütteln und durchrütteln zu lassen, Eigenschaften, welche die kleine Samoa in schadenfroher Weise gerade diese Nacht mehr als je zum Ausdruck brachte.
Mit den Luard-Inseln beginnt jene tiefeinschneidende westliche Einbuchtung der Küste, welche 1793 von d'Entrecasteaux, nach seinem berühmten Landsmann Huon Kermadec, »Huon-Golf« benannt wurde, in welcher aber erst Moresby einige Punkte bestimmte und benannte. Er hielt sich hauptsächlich drei Tage lang in einer von ihm »Death-Adder-Bay«[44] benannten Bucht (7° 29′ S., 147° 25′ O.) auf, um Feuerholz zu schlagen, und schloß damit seine unvergleichlich wichtigen, für Neu-Guinea epochemachenden Küstenaufnahmen. Wir konnten denselben kaum etwas hinzufügen, denn böiges Wetter und trübgrün gefärbtes Wasser ließ es Steuermann Sechstroh rätlich erscheinen, außerhalb jener Reihe von Inselgruppen zu halten, welche sich von den Luard-Inseln bis Solitary-Island, in einem Abstande von drei bis sechs Meilen, über 40 Meilen parallel mit der Küste hinziehen. Sie sind alle klein, hügelig, dichtbewaldet, manche nur mit Buschwerk begrünte Felsen, und scheinen alle unbewohnt. Nur bei Saddel-Island (»Longuerue« von d'Entrecasteaux), der größten dieser Inseln, zwei ein[S. 155] halb Meilen lang und ca. 700 Fuß hoch, versuchten uns vergeblich ein paar Segelkanus einzuholen, und auf Solitary-Island bemerkte ich Kokospalmen, so daß vermutlich hier Menschen wohnen. Soweit wir die Küste zu sehen bekamen, besteht dieselbe aus steilabfallenden, dichtbewaldeten Bergen mit wenig Vorland, hie und da scheinen Buchten[45] einzuschneiden. Wie gern hätte ich dieselben untersucht! Aber Steuermann Sechstroh, auf dem die Verantwortung der Schiffsführung doppelt lastete, wollte von dem Insellabyrinth um so weniger etwas wissen, als sich nicht selten Brandung zeigte. Und unter unseren Verhältnissen war Vorsicht jedenfalls besonders geboten. Mit Solitary-Island hatten wir uns der Küste wieder genähert und bald Rawlins-Point von Moresby vor uns, wo eine schöne Bucht einschneidet, die ich Ki-Bucht benannte. Dieselbe wird nördlich von einer langgestreckten, bergigen, bewaldeten Insel begrenzt, die, wie wir später bemerkten, aber durch einen schmalen, dichtbewaldeten Streifen niedrigen Landes mit der Küste zusammenhängt und somit eine Landzunge bildet. Es ist Parsi-Point, von Moresby nach der eigentümlichen Kopfbedeckung der hiesigen Eingeborenen benannt, welche an die hohen Mützen der Parsis oder Feueranbeter erinnert, und welche die Abbildung veranschaulicht.

Schon von weitem hatten wir an den Bergen Kulturflecke, d. h. Stellen urbar gemachten Landes, am Ufer endlich wieder einmal[S. 156] Kokospalmen bemerkt, und bald umringten uns die Eingeborenen selbst in zahlreichen, zum Teil mit Segeln versehenen, Kanus (Atlas VIII 6). Es waren nicht sehr dunkle Leute, von weniger negerartigem Typus als z. B. Neu-Britannier oder Salomons-Insulaner, die sich sehr manierlich betrugen, aber schon wegen ihrer geringen Bekleidung (vergl. Atlas XVI 4, 5) keinen guten Eindruck machten. Sie kamen singend und handelten singend, wahrscheinlich um sich Mut zu machen, denn viele zitterten vor Angst. Freilich mochten wohl die wenigsten je einen Weißen gesehen haben, denn keiner verstand nur ein Wort Englisch oder besaß irgend etwas von europäischem Tande. Aber Eisen schienen sie zu kennen, und als ich Hobeleisen zum Vorschein brachte, da erschallte einstimmiges Freudengeschrei, und »Ki, ki« (Eisen) war die Losung. Für die geringste Kleinigkeit verlangte man jetzt nur Eisen. Die braven sogenannten »Wilden« sind in der Regel sehr praktisch und im Handel nicht minder gewandt; auch bei ihnen gilt das Prinzip viel für wenig zu erhalten.
Die Parsen hatten übrigens allerlei hübsche Sächelchen, darunter oben anstehend breite Armbänder von Schildpatt mit zierlich eingravierten, sehr eleganten Mustern, wie ich dieselben schon (S. 90) von Astrolabe-Bai erwähnte, hübsche mit Muscheln besetzte Armbänder, Brustschmucke von Flechtwerk, zum Teil reich mit Hundezähnen verziert, und eigentümliche Schildpattohrringe (Atlas XVII. 5, 6). Von besonderer Kunstfertigkeit zeugten auch die in bunten Mustern filetgestrickten Tragbeutel (vergl. Atlas X. 3), wie Holzschnitzerei bei ihnen auf einer hohen Stufe steht. So z. B. die Verzierungen an den stattlichen, seetüchtigen Kanus, deren Seitenborde zuweilen buntbemalt waren (Atlas VII. 9). Die feingeschnitzten »Kopfkissen«, welche freilich wenig mit den unseren zu thun haben, verdienen ebenfalls besondere Beachtung. Sie bestehen nämlich nur aus einem soliden Stück Holz, das beim Schlafen als Stütze dient (vergl. Atlas III, 1), und sich in ähnlicher Weise bei vielen Völkern, z. B. auch in Afrika und China wiederfindet. Wie die zahlreichen, sehr gut gearbeiteten Fischhaken, die übrigens ganz mit solchen von Astrolabe-Bai übereinstimmen, und Netze zeigten, scheinen diese Eingeborenen[S. 157] tüchtige Fischer zu sein. Sie brachten aber auch etwas grünen Blättertabak, Bananen, wenige Kokosnüsse und boten mir als Freundschaftszeichen einen Hund an, den ich aber dankend ablehnte. Ich kannte die nächtlichen Heulkonzerte dieser lieben Tiere eben zur Genüge, um die ohnehin knapp bemessene Nachtruhe nicht noch durch einen solchen Störenfried schmälern zu lassen. Und bei allem Verlangen nach frischem Fleisch konnte mich doch Hundebraten, zu welchem Zweck das Geschenk bestimmt war, nicht reizen. — Merkwürdigerweise führten die Leute keinerlei Waffen mit sich.

Übrigens trugen nur die wenigsten die sonderbaren Parsenmützen aus Tapa (geschlagenem Baumbast), sondern die meisten das Haar unbedeckt, in allen möglichen Stadien der Entwickelung, von ganz kurz geschorenem, bis zu dem gewaltigen Zottellockenkopfe meiner Skizze. Derartiges Haar hatte ich noch nie bei Papuas gesehen! Es hing in 18 Zoll langen, bleistiftdicken, dichtverfilzten Strähnen, wie ungezupftes Roßhaar, bis zur Brustmitte herab, und die wenigen Träger solcher Haarmassen schienen große Leute, Häuptlinge, zu sein, wie ich dies noch öfters in Neu-Guinea bemerkte. Was war erklärlicher als der Wunsch ein paar dieser Locken des hehren Hauptes zu besitzen! Der Eigentümer hatte meine Pantomime richtig begriffen und trennte, noch ehe ich ihm eine Schere reichen konnte, mit eigener Hand einige seiner Staatslocken mit einem Steinbeil ab, das ich sogleich dazu kaufte. Im Museum für Völkerkunde[S. 158] zu Berlin sind diese Schätze jetzt zu sehen, für solche, die sich etwa dafür interessieren sollten.
Wie die Ki-Bucht[46] südlich, so begrenzt die Ungimé-Bucht nördlich die Parsi-Landzunge; aber wir konnten von beiden nur Einblicke gewinnen, denn zu einer Untersuchung fehlte uns die Zeit, und es drängte uns vor allen den Nordrand von Huon-Golf zu erreichen. Und daran war Moresby schuld, welcher diese Gegend, allerdings nur mit wenigen Worten, als gut bevölkert, reich an Palmen und Wasserläufen beschreibt. Wir fanden von all dem so gut wie nichts und unsere Erwartungen gar sehr enttäuscht. Der Charakter der Küste bleibt sich im großen und ganzen gleich: Berge und Gebirge, von der Sohle bis zum Gipfel dichtbewaldet, wie das Vorland, welches durch Zurücktreten der Berge zuweilen sich ansehnlich weit ausbreitet. In diesem Vorlande oder der Thalsohle bemerkt man gewöhnlich auch einen oder mehrere Flußläufe; es fehlt also nicht an Wasser. Allein alle diese Flüsse scheinen reißende Gebirgswässer, und ihre Mündung ist meist durch Barren oder andere Hindernisse versperrt. So wurde eine Meile von der Mündung des von Moresby »Markham« benannten Flusses viereinhalb bis fünf Faden Tiefe gefunden, wogegen an anderen Stellen der Dampfer oft so nahe dem Ufer ging, daß man fast Zweige von den Bäumen pflücken konnte, ohne daß Ankergrund zu finden war. Das Rawlinson-Gebirge[47] am Nordrande des Golfes ist übrigens wenig höher als die »Kuper-Kette« längs dem westlichen Ufer und mag zwischen 3000 bis 4000 Fuß ansteigen. Wir sahen die Kammlinie übrigens, selbst beim hellsten Sonnenschein, nur selten frei, dann aber drei hintereinander liegende Gebirgszüge, alle dichtbewaldet, wie dies fast ausnahmslos bei den Gebirgen der Fall ist. Das eintönige, dunkle Grün ermüdet durch seine Einförmigkeit sehr bald, denn vergebens forscht das Auge[S. 159] nach grotesken und malerischen Felspartien, steilen Schründen und Schluchten und dergleichen Abwechselung.
Wenn das Vorherrschen von Wäldern übrigens Kultivationen in Huon-Golf zu erschweren scheint, so dürfte möglicherweise diese Fülle an Holz zu verwerten sein und, sofern dasselbe Brauchbares liefert, sich vielleicht die vorhandenen Wasserkräfte zur Anlage von Sägemühlen gut verwenden lassen.
Was die Bevölkerung anbelangt, so ist dieselbe, wie wir gesehen haben, eine sehr geringe und Parsi-Landzunge scheint das Hauptcentrum nicht nur für Huon-Golf, sondern bis Mitrafels, innerhalb eines Küstengebietes von ca. 150 Meilen. Möglicherweise ist aber das Inland bevölkert. Abgesehen von einzelnen Hütten, mehrten sich die Anzeichen des Vorhandenseins von Eingeborenen, erst als wir uns im östlichen Ende des Nordrandes von Huon-Golf, False-Island, näherten. Hie und da zeigten sich kleine Gruppen, meist kränklich aussehender, Kokospalmen, zuweilen Häuser unter denselben, an den steilen Berghängen eingezäunte Plantagen. An einer Stelle kamen auch eine Menge Kanus mit Eingeborenen ab, die im Aussehen und allem was sie besaßen, ganz mit den gestern bei Parsi-Landzunge gesehenen übereinstimmten. Wie diese boten sie vorzugsweis gut gearbeitete Fischhaken (ganz mit denen auf Tafel IX des Atlas übereinstimmend) zum Kauf an, sprachen aber eine ganz andere Sprache, in welcher das Wort »Kas« wie in Port Konstantin Tabak bezeichnete. Ein Mann trug drei Ringe kleiner grüner krystallfarbener Glasperlen in der Nase, das Erste was ich auf dieser ganzen Reise an europäischen Erzeugnissen bemerkte.
Die Ostspitze von Huon-Golf bildet das von d'Entrecasteaux benannte »Kap Cretin«, ein schwierig auszumachender Punkt, indem gerade hier einige kleine, dichtbewaldete Inseln hart an der Küste liegen, von denen wahrscheinlich die südlichste das bewußte Kap ist. Aber die Bestimmungen der älteren Seefahrer sind meist sehr oberflächlich und unzuverlässig.
Mit Kap Cretin erhält die Landschaft übrigens wie mit einem Schlage ein anderes Ansehen. Statt der höheren, dichtbewaldeten[S. 160] Gebirge in Huon-Golf begrenzen hier niedrige, nur etliche hundert Fuß hohe Hügelreihen das Ufer, auf denen hellgrüne Hänge und Matten mit größeren und kleineren, dunkelgrünen Wäldern, Hainen und Baumpartien in der mannigfachsten Weise abwechseln. In der That eine gar liebliche und versprechende Gegend, wie wir sie bisher in Neu-Guinea nicht erschauten. Sie macht ganz den Eindruck eines verwilderten Parkes, und es fehlen nur Villen, geebnete Wege und Viehherden, um sich an die Ufer eines heimischen Sees versetzt zu fühlen, denn der Charakter der Vegetation hat gar nichts Tropisches. Nur hie und da sieht man eine kleine Gruppe Kokospalmen am Ufer, aber keine Niederlassungen dabei. Dagegen zeigen die zahlreichen und oft ausgedehnten Pflanzungen in den Bergen, daß die Gegend ziemlich gut bevölkert sein muß, wenn sich auch nur selten ein Haus erkennen läßt. Interessant war es mir, auch hier Baumhäuser, in der Art der Kohoros an der Südostküste, wahrzunehmen. Die Dörfer mögen eben versteckt in den Schluchten und Buchtungen liegen und sind von See aus nicht sichtbar. Dagegen erkennt man deutlich schon die Anfänge jener Terrassenbildung, welche westlich von Festungshuk so prägnant hervortritt, und die ich bereits eingehend beschrieb. Auch das zum Teil steile Felsufer zeigt unverkennbar die korallinische Bildung, welche ich in Huon-Golf nirgends beobachtete, wo überhaupt ganz andere geologische Verhältnisse zu herrschen scheinen.
Gleichwie in einem Zaubermärchen eine neckische Fee die verheißene Prinzessin erst nach vielen Prüfungen erringen läßt, so erging es uns an dieser Küste bezüglich eines Hafens oder Ankerplatzes überhaupt. Denn wir alle sehnten uns nach wenigstens einer ruhigen Nacht, die wir nach anstrengender Tagesarbeit wohl bedurften. So an dreizehn Stunden, oft länger, auf Deck zu stehen, unausgesetzt durchs Fernrohr zu sehen, Notizen zu machen, und diese dann noch ins Reine zu schreiben, ist eben kein Kinderspiel. Und das Sprichwort »nach gethaner Arbeit ist gut ruhen« war der kleinen »Samoa« durchaus unbekannt, die ohnehin aufgeregt und nervös, sich von der leisesten Dünung zum wildesten Tanze verleiten ließ. Sie rollte[S. 161] und schlingerte eben ganz fürchterlich, zumal wenn abends Dampf abgeblasen und die Schraube außer Thätigkeit gesetzt worden war. Kein Wunder, daß selbst dem Seemann diese kontinuierliche Nachtschunkelei zuviel wurde, denn die »Samoa« machte es wirklich oft zu arg. Und dann wollten wir doch auch gern den Kriegsschiffen einen guten Hafen anbieten, da Adolphshafen zu weit ablag und uns überhaupt nicht genügend erschien. Wir hatten daher unsere ganze Hoffnung gerade auf diese Küste gesetzt, die allerdings sehr wenig aussichtsvoll schien. Hinter False-Island geht zwar eine Bucht hinein, aber sie ist zu klein und die Untersuchung der weit versprechenderen Inseln von Kap Cretin[48] konnte nicht ausgeführt werden, denn entweder fiel gerade eine Bö ein oder wir vermochten dieselben überhaupt nicht zu erreichen. Und daran war der Nordweststrom schuld, welcher sich gerade an dieser Küste, namentlich bei Festungshuk, in einer Stärke von zwei bis drei Meilen die Stunde so sehr bemerkbar macht.[S. 162] Er versetzte uns in der einen Nacht bis hinter Festungshuk, in der folgenden gar bis in die Nähe der Low-Islands bei Rook, 30 Meilen zu Nord von dem Punkte, an welchem wir bei Anbruch des Tages zu sein hofften. Da hatten wir freilich ein unvergleichlich prächtiges Panorama der Küste mit dem Terrassenlande vor uns, aber es dauerte immer lange, ehe dieselbe wieder erreicht wurde. So gelangten wir erst am vierten Tage an eine bestimmte Stelle, etwas Nord von Kap Cretin, wo sich eine Öffnung, oder wie der Seemann sagt, ein »Loch«, in der Küste zeigte, welche der Untersuchung wert schien. Ich hatte es schon bemerkt und skizziert, als wir diese Küste zum erstenmale passierten, aber nicht gedacht, daß es die Einfahrt zu einem später bekannten Hafen (vergl. Abbild. S. 161) sein würde.
(S. 162.)

Infolge der Enttäuschungen der letzten Tage war mein Zutrauen freilich gering, als ich mit Obersteuermann Sechstroh ins Boot stieg, aber kaum waren wir etwas tiefer in die weite sackartige Bucht gekommen, da tönte es häufiger hin und wieder: »Sieh! nicht übel! — tein Fam! — ganz famos! nich? — twalf Fam! — wer hätte das gedacht? — sestein Fam!« u. s. w. Vor uns lag eine Landzunge mit einem Hause ganz wie dies meine Skizze zeigt, wie wir später erfuhren Moru genannt, wo wir zunächst landeten. Aber die Eingeborenen, mit denen ich noch kurz zuvor in See gehandelt hatte, waren uns in ihren Kanus vorausgeeilt, nicht uns festlich zu empfangen, sondern um schleunigst auszureißen. Das mußte in gar großer Eile geschehen sein, denn hier stand noch ein Topf mit Essen auf dem Feuer, dort quiekte ein Ferkelchen oder knurrte ein junger Hund, da selbst diese erkorenen Lieblinge der Damen in der Eile vergessen worden waren. Wir fanden noch ein paar Häuser im Dickicht der Halbinsel, aber alles Rufen und Schreien nach ihren Insassen blieb erfolglos. Sie hatten sich rückwärts konzentriert, und zwar zu Wasser; denn hinter der Halbinsel setzte sich das äußere Hafenbassin in ein zweites schmäleres fort. So begnügte ich mich damit hie und da bei den Häusern kleine Geschenke niederzulegen, nicht wie es sonst so häufig von sammelnden Forschern geschieht, als Entgelt für mitgenommene Ethnologica, sondern nur, um den Leutchen unsere guten[S. 163] Absichten zu zeigen. Und dafür mußten auch die roten Bändchen sprechen, mit denen ich verschiedene der kleinen Borstentiere geschmückt hatte, was die gute Wirkung nicht verfehlte. »Wer unsere Schweinchen liebt, liebt uns« mochten die Papuas denken; und so war gleich von Anfang an das beste Einvernehmen hergestellt. Für jetzt hatten wir keine Zeit uns mit den neuen Freunden abzugeben, denn wir mußten wieder hinaus, um die »Samoa« zu holen, die noch[S. 164] an demselben Abend (Sonntag den 23. November 1884) in den neuen Hafen in 11½ Faden Mudd zu Anker ging.

Ich hatte denselben in meinem Tagebuch »Deutschland-Hafen« genannt, aber die Herren Kommandanten unserer Kriegsschiffe erwiesen mir die Ehre, ihn nach mir »Finschhafen« zu taufen, so daß auch mein Name[49] mit einem Punkte in Deutsch Neu-Guinea verknüpft ist.
Die beigegebene Kartenskizze nach den Aufnahmen S. M. Kanonenboot »Hyäne« (Kommandant Kapt.-Lt. Langemack) überhebt mich einer weiteren Beschreibung. Es genügt zu sagen, daß der Hafen ringsum von einem Mangrove-Waldgürtel eingefaßt wird, die Umgebung aber aus sanft ansteigenden Hügeln und Bergen bis vielleicht 1200 Fuß Höhe mit parkartigem Charakter und gutem Boden besteht, wie die Plantagen der Eingeborenen am besten zeigten. Auch an Süßwasser und zwar murmelnden Gebirgsbächen mit trefflichem Trinkwasser fehlt es nicht, so daß sich hier eine Menge günstiger Verhältnisse zur Niederlassung von Europäern in seltener Weise vereinen. Dazu gehörten auch vor allen Dingen die klimatischen Vorzüge dieses Platzes, die mir selbst bei dem kurzen Aufenthalte anderen Plätzen gegenüber sehr günstig erschienen und sich in der That seither trefflich bewährt haben. Ja, wo würde sich am besten anfangen lassen? »Die kleine Insel Madang ist jedenfalls der am meisten gesicherte und am leichtesten gegen die Angriffe der »Wilden« zu verteidigende Punkt« denkt der Neuling. »Ach was! Wilde!« antwortet der Praktiker, »mit denen wollen wir schon fertig werden! botter the natives! Oben am Berge ist es jedenfalls besser und gesunder! Und wenn die Eingeborenen auch sonst nicht viel taugen, einen Weg werden sie schon noch mit anlegen helfen, dazu ist ihnen Bandeisen noch zu verlockend. Und später wird man doch gleich Pferde herbringen müssen.« — »Pferde? Und die sollen das harte mannshohe Gras fressen?« frägt wieder der Neuling. »Natürlich! und[S. 165] gern dazu!« antwortet der Praktiker, welcher das treffliche Gedeihen dieser Tiere unter schlechteren Verhältnissen bei Port Moresby kennen lernte. »Freilich, das »Regierungsgebäude« wird am besten auf der Halbinsel liegen, die Arbeiterwohnungen auf der Insel — und« — so und in ähnlicher Weise gingen mir die Gedanken durch den Kopf. Hatte ich doch zunächst über Brauchbarkeit des Platzes nicht nur als Hafen, sondern überhaupt zu berichten. Und je mehr ich denselben kennen lernte, um so mehr wurde es bei mir zur Gewißheit: »hier laßt uns Hütten — und Häuser bauen«! Aber aus recht gutem Holz, damit sie nicht gleich von den weißen Ameisen gefressen werden. Denn »billig und schlecht« rächt sich in den Tropen am meisten und in jeder Weise. Freilich am Hafen als solchen fand Kapitän Dallmann später einiges auszusetzen, namentlich, daß er gegen den Nordwest völlig offen sei, aber da konnten ja gewisse Verbesserungen geschehen, und dann bot ja, schon nach unseren ersten Auslotungen, das hintere Hafenbassin für kleinere Fahrzeuge mit ca. 9 Fuß Tiefgang vollkommene Sicherheit. Dasselbe zeigte bei näherer Untersuchung südlich noch ein drittes sackartiges, kleineres Endbassin, welches, wie andere seichte Stellen des Hafens, durch ein Fischwehr der Eingeborenen abgesperrt war. Hier zeigte, bei geringer Tiefe von ein bis zwei Faden, der Meeresgrund ein reiches Tierleben: weiße, bräunliche und rötliche Korallen, zwischen deren Verästelungen herrlich saphirblaue und schwarz und weiß gestreifte Fischchen spielten, häßliche, schmutzig grüne, gelbgestreifte Seewalzen (Holothurien) ihren plumpen Körper ausstreckten und große stachlige Seeigel neben schön buntgefärbten kleinen Seesternen ein friedliches Dasein führten. In der That ein natürliches Aquarium, wie man es sich schöner nicht denken konnte, obwohl es immer noch weit hinter jenen Schilderungen überschwenglicher Beschreiber zurückblieb, die wahrscheinlich selbst lebende Korallriffe wohl nicht gesehen haben.
Den meist aus Mangrove bestehenden Uferwaldsaum fanden wir glücklicherweise überall nur schmal. Gleich hinter ihm dehnt sich schönes Land mit fettem schwarzen Boden aus. Hier liegen die Plantagen, in welchen hauptsächlich Taro, Bananen und Zuckerrohr, auch[S. 166] etwas Tabak gezogen wurde, und die auch hier die musterhafte Ordnung und den Fleiß der Eingeborenen bekundeten. Die Ostseite des Hafens wird, wie ich später vom Berge aus sehen konnte, von einer schmalen Halbinsel, Salankaua, gebildet, hinter der sich südlich noch eine zweite Bucht zeigte. Das flache Uferland hat übrigens nirgends bedeutende Ausdehnung, sondern steigt bald zu Hügeln an, welche aus gehobenem Korallfels oder Kalkstein überhaupt bestehen und deutlich terrassenförmige Bildung erkennen lassen. Wie im eigentlichen Terrassenlande sind auch diese Erhebungen mit schwarzer Erde und Büschelgras bedeckt, das je höher nach oben, um so feiner wird. »Ja, hier müßten Pferde, noch besser Esel oder Maultiere, trefflich leben und sich mit solchen überall leicht hinkommen lassen können! Und wie wäre es mit Zebus, den leichtfüßigen, leicht zu ernährenden Zwerg-Zebus, die ich von Ceylon her kannte? Ja, die wären noch besser und billiger; hier!« — »Hier wird nicht in Zukunftsmusik gemacht, sondern aufs Meer geschaut«, unterbrach der mich begleitende Eingeborene meine Reflexionen, nicht mit Worten, sondern Pantomimen, indem er mit der Hand aufs Meer hinauswies. Und richtig: ein kleines schwarzes Pünktchen mit Rauch; kein Zweifel, unsere Kriegsschiffe! Hurra!
Selbstredend eilten wir so schnell als möglich den Berg hinab an Bord, und bald dampfte die Samoa mit 150 Schraubendrehungen in der Minute in See, als gälte es die Konkurrenz von Bugsierdampfern zu schlagen. Die »Hyäne« kam übrigens allein, denn eine Menge Fieberfälle hatten es Kommandant Schering rätlich erscheinen lassen, Friedrich-Wilhelms-Hafen wie Neu-Guinea überhaupt möglichst rasch wieder zu verlassen und nach Mioko zurückzukehren. Von hier setzte die Elisabeth, an deren Bord sich allein etliche vierzig Kadetten befanden, die Reise nach Japan fort.
Kapt.-Lt. Langemack, der uns Kapitän Dallmann wieder mitbrachte, war natürlich über den funkelnagelneuen Hafen sehr erfreut, denn er brauchte gerade einen solchen, um Feuerholz zu schlagen, da seine Kohlen sehr auf die Neige gingen. Nun, Holz gab es ja, Gott sei Dank, in Hülle und Fülle und umsonst! Gleich auf der Halbinsel[S. 167] gegenüber dem Ankerplatz der »Hyäne« lagen bereits einige alte Waldriesen am Boden, die nur zersägt und zerhauen zu werden brauchten. Aber mit etlichen Kappbeilen läßt sich nicht viel schaffen, und anderes hatte S. M. Kanonenboot nicht an Bord. Glücklicherweise konnte die Samoa mit schweren amerikanischen Äxten und großen Sägen aushelfen, und bald ging es an ein fröhliches Baumfällen und Holzspalten, wobei sich »all hands«, auch die Herren Offiziere beteiligten, daß es eine Lust und Freude war.
Da hatten die biederen Eingeborenen, nachdem sie sich über den ersten Schreck des großen neuen Schiffes und die vielen weißen Menschen beruhigt, wieder etwas zu sehen und wohl noch nie eine so bewegte Zeit als diese erlebt; fast wußten sie nicht, wo zuerst anfangen. Und nun gar, als eine stattliche Abteilung Matrosen in Waffen auf der Flaggenhalbinsel, dem sonst so stillen Moru, landete und die Feierlichkeit des Aufhissens der deutschen Reichsflagge stattfand (27. November), wozu ich schon die vorgehenden Tage eingeladen hatte. »Nur ruhig, Kinder! es geschieht euch ja nichts! recht so! immer ran und hiergeblieben!« Und sie blieben, bis das Kommando zum Aufpflanzen der Seitengewehre gegeben wurde. Das konnten sie nicht vertragen und es kostete mir viele Mühe wenigstens die Beherzteren wieder zusammenzubringen, da setzte der Hornist sein Instrument an den Mund, ein »teterädä«! und weg waren meine Helden wie weggeblasen. Ja freilich, ich habe Eingeborene auch vor dem ausgespreizten Stativ mit der Camera obscura ausreißen sehen! Und die Furcht der hiesigen Eingeborenen war um so erklärlicher, da sie wohl kaum vor uns einen Weißen bei sich gesehen hatten. Wenigstens fand ich nie nur eine Glasperle bei ihnen, wie außerdem nur in dem einen erwähnten Falle in Huon-Golf. Diese Glasperlen waren jedenfalls nicht durch Labourtrader hierher gelangt, welche jene ungangbaren Sorten wohl nie führen. Denn auch in dieser Richtung herrscht bei den Eingeborenen ein sehr verschiedener Geschmack, und oftmals finden solche Sorten, welche wir für die besten und teuersten halten, bei den guten Naturkindern gar keinen Beifall.
Ja, Naturkinder! und zwar solche der besten Sorte, die noch unbeleckt[S. 168] von der Civilisation, ja ungewohnt des weißen Mannes, dennoch in kürzester Zeit gelernt haben, mit ihm umzugehen, zu feilschen, zu schachern, aber nicht für ihn zu arbeiten, als solche zeigten sich die Bewohner von Finschhafen damals voll und ganz. Der Verkehr mit ihnen war also nicht schwer, denn sie begriffen leicht, wo sie begreifen wollten, und wurden bald so zutraulich, daß sie uns in ihren Dörfern nach und nach das schöne Geschlecht zeigten, weil dabei doch stets einige Glasperlen (Gemgem) und andere Kleinigkeiten abfielen. Denn »Nehmen ist seliger als Geben« scheint auch dem Kanaker in der Schule des Naturmenschen die eigentliche Lebensweisheit; ein Spruch, der sich ja wie ein roter Faden durch das ganze Kanakertum der Menschheit zieht, wie das Nehmen überhaupt. »Fehlt Ihnen vielleicht eine Ölkanne?« fragte ich den Maschinisten, als ich eine solche auf dem breiten Schnabel eines längsseit liegenden Kanus stehen sah. »Nee! — ja doch! der Kerl hat sie gestohlen!« lautete die Antwort. »Gott bewahre! nur mitgenommen, vermutlich als Andenken, denn wäre dieser Sohn der Natur ein bewußter Dieb, er würde das Corpus delicti doch nicht so offen hinstellen«. Natürlich langte der freundliche Mann die Ölkanne gleich wieder herauf mit einer Miene, als wenn er sagen wollte: »Entschuldigen Sie gütigst! Ich wußte nicht, was das Ding war und erlaubte mir nur, es etwas näher ansehen«! Noch ein anderer Fall. Ich vermißte eines schönen Morgens mein Etui mit Bleistiften. Natürlich konnte es ja nur gestohlen worden sein und zwar am Abend zuvor in dem Dorfe Ssuam, wo ich unter der andächtigen Zusicht der Bewohner skizziert hatte. Als nun all die Kanus der Ssuamiten mit Anbruch des Tages versammelt waren, da sprach ich zu dem Volke: — »Ja, konnten Sie denn in den paar Tagen schon mit ihnen sprechen«? Natürlich! ich hatte bereits an 150 Wörter aufgeschrieben, und das bedeutet für eine Kanakersprache, in welcher man mit 350 bis 400 Wörtern schon einen Roman schreiben kann, immerhin etwas, und dann wo bliebe das Volapük, die Zeichensprache? Also das macht man so: man zeigt einen Bleistift und einen Finger; dann fünf Bleistifte und fünf Finger; öffnet und schließt im Geiste ein Kästchen, ganz wie es die[S. 169] Leute gestern gesehen hatten. Dann deutet man an, daß dieses Kästchen mit den fünf Bleistiften verschwunden sei, und sieht dabei einen recht scharf an, der wieder zurückblickt, als wollte er sagen: »Ich? nein, ich habe es nicht!« Das geht nun so die Reihe herum; Keiner hat es. Also das Kästchen muß im Dorf sein. »Er wird es irgendwo haben stehen lassen«, denken die Leute und zischeln miteinander; »sie werden sich untereinander verraten«, denke ich; und schon gehen ein paar Kanus nach dem Dorfe ab. Aber sie kommen mit leeren Händen zurück, deuten an, daß ein fremder Besucher das Ding mitgenommen haben müsse, denn bei ihnen sei es nicht, und alle scheinen sehr bestürzt über den Fall. »Heuchelei!« denke ich wieder, unter Meditationen über die Erbsünde, — da finde ich das Kästchen zufällig unter ein paar Büchern in der Kajüte, wohin es verlegt worden war. Ja, ja! Jedenfalls wissen diese Menschen recht gut, daß Stehlen immerhin unrecht ist, aber sie besitzen darin noch längst nicht das Raffinement des Weißen und lernten dasselbe erst. Denn Menschen bleiben Menschen und sind sich überall im großen und ganzen gleich. Jedenfalls haben diese Naturkinder so gut ihre Licht- und Schattenseiten, wie wir, doch merkt man von beidem weniger. Aber was diese Menschen vor allem so vorteilhaft auszeichnet ist ihre große Moral, wie ich dies bei allen noch unberührten Völkern gefunden habe. So kennen sie z. B. nichts von Trunkenheit und jenen bösen Krankheiten, welche unter anderem Cook als erstes, leider bleibendes Geschenk der Civilisation den guten Hawaiiern mitbrachte. Leidenschaftsloser als wir, sind sie auch glücklicher, das ist gar kein Zweifel, und ich muß immer über das Bedauern der civilisierten Welt lächeln, welche alle Menschen durch unsere Civilisation glücklich zu machen meint. Das geht eben nicht überall; am wenigsten können diese Naturmenschen mit einem Satze in die Civilisation, und dankbar für die Wohlthaten derselben, hineinspringen, wie man dies so häufig erwartet. Freilich den Tand des weißen Mannes nehmen sie gern, besonders das ihnen neue und so nützliche Eisen, aber das ist auch alles. Daß der weiße Mann, sofern er die Eingeborenen gut behandelt, gern gesehen ist, daß man ihm willig[S. 170] einen Platz zur Ansiedelung verkauft, um ihn festzuhalten, ist ja sehr erklärlich. Deshalb sind einzelne Missionäre und Händler die willkommensten und begehrtesten Fremden und werden in weit aus den meisten Fällen gut behandelt. Sie inkommodieren die Eingeborenen nicht, bringen stets etwas ein, und deshalb ist der »Schrei nach dem Evangelium« ein oft so lebhafter. Das bißchen Kirchegehen lernt sich bald, da braucht man nichts zu thun; und dazu ist der Kanaker stets bereit, denn so sehr pressiert ist er ja nie in seiner Zeit. Ganz anders verhält sich aber die Sache, wenn es sich um Arbeit handelt. Freilich, im Anfang da hilft der Eingeborene stets gern, freiwillig, fast ohne Entgelt. Es macht ihm Spaß mit neuen Werkzeugen zu hantieren, und alles arbeitet plötzlich mit einem Eifer, der leider nur zu schnell verfliegt. Bald verlangt der Eingeborene Bezahlung, wobei er auch gern auf Akkordarbeit eingeht, aber auch diese Periode geht rasch vorüber. Und warum? Hat nicht der Kanaker inzwischen an der Arbeit und dem daraus erzielten Gewinn Vergnügen gefunden, ist es ihm nicht zum Bedürfnis geworden? I Gott bewahre! Er hat eben bereits leere Bierflaschen, Glasperlen, Messer, Beile und dergleichen genug, und weiß sie selbst in dem engen Kreis seines Verkehrs nicht mehr unterzubringen, wozu sollte er mehr zusammenscharren? Fehlt es ihm doch eben an Bedürfnissen, und ehe sich nicht solche herausbilden, ist an ein Handinhandarbeiten des schwarzen und weißen Mannes in jenen Gegenden nicht zu denken. Auch das Gefühl der größeren Sicherheit unter den Fittichen des Weißen, mit seinen Schießgewehren und anderen energischen Waffen wird wohl nur in seltenen Ausnahmefällen ein Argument von Bedeutung für den Kanaker sein. Denn jede kleine Gemeinschaft derselben ist sich selbst genug, um ihr Besitztum wie die Vorfahren zu verteidigen — oder sie verändert eben den Wohnplatz. Und dann scheint ihnen so ein bißchen Kriegführen auch Spaß zu machen, ja, wie bei uns mangelt es auch ohne Zeitungen nicht an alarmierenden Nachrichten, und wie bei uns, kann es täglich losgehen. Freilich handelt es sich nicht um große Kriege, wobei Tausende ihr Leben einbüßen, wie bei uns, sondern nur um kleine Fehden, am liebsten Überfälle, wobei[S. 171] auf leichte Weise ein paar Menschen, ganz gleich ob Frauen oder Kinder, erschlagen werden. Denn das macht den Papua zum Mann, zum Krieger, und dieser regiert die Welt. Warum sollte es nicht auch im Kanakertum so ein bißchen Chauvinismus geben? sind die Leute doch so gut Menschen als wir, wenn es auch bei ihnen im großen und ganzen bei weitem friedlicher hergeht als bei uns. Denn auch Kanaker können nur im Frieden gedeihen oder sich wenigstens dann in einer gewissen Stärke erhalten und sind daher mehr friedliebend als kriegerisch. So leben sie, der Mehrzahl nach, ein stilles, ruhiges Völkchen, nach der Weise ihrer Väter, fleißig im Feld wie Handel, soweit es ihre Verhältnisse erheischen. Und diese bedingen wohl stets eine mäßige, unter Umständen vielleicht sogar angestrengte Thätigkeit, aber niemals das, was wir unter Arbeit verstehen. Der Kanaker, welcher noch nie einen Menschen vom frühen Morgen bis zur späten Abendstunde fast unausgesetzt arbeiten sah, wird einen solchen als Sklaven höchstens bemitleiden, — bewundern und ihm nacheifern nie! Wozu auch? Dazu ist er von seiner frühesten Jugend an viel zu sehr diejenige persönliche Freiheit gewöhnt, die ihn schon zeitig selbständig machte und auf eigenen Füßen stehen lehrte, und die für den Naturmenschen ein Gut ist, dessen Wert wir ebensowenig kennen, als er unseren rastlosen, nie ermüdenden Fleiß zu schätzen und würdigen versteht. »So wird sich also aus dem jetzigen Eingeborenen nie ein brauchbarer Mensch in unserem Sinne erziehen lassen?« Ja, wer das beantworten könnte? Erziehen vielleicht wohl, aber nur in der Jugend, und welche Zeit wird darüber hingehen! Denn selbst die redlichen und aufopfernden Arbeiten der Mission haben in jenen Gebieten nicht entfernt den Wandel geschafft, den man mit Recht gerade von diesem segensreichen Institut erwarten durfte. Darüber kann, trotz aller gegenteiligen Behauptungen, kein Zweifel[50] herrschen, am allerwenigsten bei denen, welche die Verhältnisse[S. 172] eingehender kennen zu lernen Gelegenheit hatten. Wirkliche Arbeiterschulen werden statt des nutzlosen sogenannten Schulunterrichtes jedenfalls besser wirken, aber auch hier stellen sich eine Menge Hindernisse entgegen, deren Erörterung mich hier zu weit führen würde.
Ja, so sehr sich auch die Eingeborenen über uns freuten und zum Bleiben aufforderten, mit ihrer alten Gemütlichkeit ging es zu Ende, sobald erst unser Nachschub dauernd hier Fuß gefaßt hatte, das war mir schon damals klar; aber das ist einmal so der Welt Lauf. Überall muß der sogenannte Naturmensch sich der Civilisation unterordnen oder derselben weichen, wenn ihm das erstere, wie dies fast ausnahmslos der Fall ist, nicht möglich ist. Deswegen braucht es noch nicht zu blutigen Kämpfen und einem Vernichtungskriege zu kommen, wenn auch kleine Reibereien stattfinden mögen, denn in diesem Lande ist noch gar viel Raum für Menschen. Wenn daher den eigentlichen Besitzern die neuen Eindringlinge unbequem zu werden anfangen, da giebt es ein einfaches Mittel, welches die Papuas Neu-Guineas gar wohl kennen und anwenden: auszuwandern! Sie gehen mit Sack und Pack, Kind und Kegel weiter inland oder in ihren Kanus nach einem anderen passenden Platze der Küste und die Sache ist zu beiderseitiger Befriedigung erledigt. Um große Völkerwanderungen handelt es sich ja dabei nicht, denn was bedeutet die ganze Bewohnerschaft eines Gebietes wie das von Finschhafen, obwohl es mit zu den besser bevölkerten in Neu-Guinea gehört.
Die unmittelbare Umgebung zeigte nur wenige kleine Siedelungen von zwei bis sechs Häusern, und die Eingeborenen wußten mir überhaupt nur etwa ein Dutzend Namen aufzuzählen, womit ihre Ortskenntnis erschöpft war. Das Hauptbevölkerungs-Centrum bildete offenbar das schon erwähnte Dorf Ssuam, außerhalb des eigentlichen Hafens am nordwestlichen Eingange der Buchtung im Dickicht des Urwaldes versteckt. Es mochte an 25 Häuser zählen, und ihre Bewohner waren jedenfalls in diesem ganzen Gebiete am dominierendsten. Aber weiter nach Nordwesten sollen noch zwei Buchtungen mit je einer Flußmündung und ansehnlichem Dorfe vorhanden sein, mit[S. 173] deren Bewohnern die Ssuamiten trotz der unbedeutenden Entfernung in Fehde zu leben schienen, wie dies so häufig vorkommt.

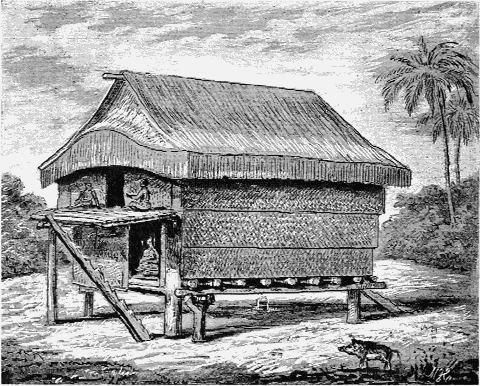
Die Häuser sind im ganzen recht stattliche Pfahlbauten und ähneln so ziemlich denen der Motu an der Südostküste, nur daß sie durchgehends viel sorgfältiger und mit Wänden aus Brettern erbaut sind, wie dies z. B. meine Abbildung (S. 180) zeigt. Nicht selten sind diese Bretter mit Malerei verziert, rühren aber dann von Kanu-Seitenborden her, die so gern zu diesem Zwecke benutzt werden. Ein besonders großes Haus, welches meinem Freunde dem Häuptling Makiri in Ssuam, einem alten würdigen Greise, gehörte, stellen meine Abbildungen und zwar von der Vorder- und Rückfront (S. 174) dar, den Grundplan des Hauses giebt der Atlas (T. II, 3). An der Rückseite ist die nur für Papuas praktikable Stiege, aus einem mit Kerben versehenen Baumstamme, bemerkenswert, welche zum ersten Stockwerk dieses soliden und in seiner Art einzigen Bauwerkes führt. Die[S. 174] Seitenwände bestehen aus Mattenflechtwerk von Kokospalmblatt und lassen sich in praktischer Weise je nach dem Wetter leicht versetzen oder ganz entfernen. Eine besondere Zier im hiesigen Baustil sind die langen, vom Dachrande herabhängenden Franzen aus zerschlissener Pflanzenfaser. Schnitzereien waren übrigens an dem Hause nicht angebracht, das offenbar als Versammlungslokal der Männer, im oberen Stockwerk als Schlafraum für die jungen Leute diente. Übrigens fehlten die freistehenden Plattformen, wie ich dieselben von Port Konstantin beschrieb, und die dort Barla heißen, auch hier nicht. Auch etwas dem Telum Mul von Bongu Äquivalentes war in Ssuam vorhanden und erregte meine vollste Bewunderung. Es waren dies zwei weit übermannshohe menschliche Figuren, und mußten schon deshalb ein besonderes Interesse erregen, weil sie gleich aus den noch in der Erde wurzelnden Baumstämmen gezimmert waren, Denkmäler der Steinaxtperiode, wie ich sie weder[S. 175] vor noch nachher zu sehen bekam. Die beigegebenen Abbildungen werden die beste Vorstellung dieser hochinteressanten Bildhauereien geben, wobei besonders auf die trefflich gelungene Darstellung des Krokodils (Oa) auf der Rückseite (S. 176) aufmerksam gemacht werden muß. An der Basis der Vorderansicht ist der Kopf einer Eidechse (Monitor) deutlich kennbar. Diese beiden, übrigens so ziemlich gleichen Figuren wurden »Abumtau Gabiang« genannt und lassen, da Abumtau »Häuptling« heißt, keinen Zweifel, daß es sich hier nicht im entferntesten um Götzenbilder, sondern Ahnenfiguren handelt, wie ich dies schon bei den Telums in Konstantinhafen annahm. Freilich würde wohl jeder Missionär diese Gabiang für mächtige Idole der »Heiden« und in Verbindung mit Krokodilkultus u. s. w. gedeutet haben, und es ließe sich da in der That ein artiges Geschichtchen zusammenreimen.
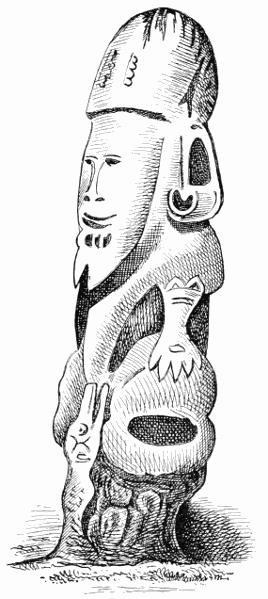
Daß, wie fast bei allen Melanesiern, die Ahnen- resp. Totenverehrung[S. 176] auf einer hohen Stufe steht bekundeten auch die hiesigen Eingeborenen durch die Art der Gräber. Gleich neben den Bildsäulen (S. 180) sieht man einen viereckigen Holzrahmen, der mit weißem Sand ausgefüllt ist und eine Grabstätte bezeichnet. Vielleicht ist es die des berühmten Häuptling Gabiang, wahrscheinlich eines gewaltigen Helden, dessen Andenken das Volk der Ssuamiten durch diese bewundernswerten Denkmäler ehrte. Ein anderes Grab, in der Form eines Miniaturhauses, zeigt die Abbildung des Hauses (S. 173) rings von einem Zaune aus Steinen umgeben, innerhalb dem buntblättrige Ziersträucher angepflanzt waren. Jedenfalls sind Menschen, welche ihren Toten solche Pietät beweisen, keine Wilde. Aber ich habe manchem großen Kanakerbegräbnis beigewohnt und will gleich hier einfügen, daß es sich in einem solchen Falle stets um Vornehme, Reiche handelte. Mit Unbemittelten und Armen macht man, wie bei uns, nicht viel Federlesens, um sie unter die Erde zu bringen;[S. 177] deswegen gehen die Dorfbewohner nicht wochenlang mit geschwärztem Gesicht oder wie es sonst die Trauergebräuche der Papuas erheischen.
(S. 176.)

Ich fand bei den Bewohnern Finschhafens so ziemlich dieselben Gegenstände, welche ich schon früher in Huon-Golf, ja selbst Astrolabe-Bai, gekauft hatte, und von denen sich viele durch außerordentlich kunstvolle Arbeit und geschmackvolle Ornamentierung auszeichneten. So u. a. ein Kampfbrustschmuck (T. XXII 6), die breiten, zum Teil durchbrochen gearbeiteten Armbänder aus gebogenem Schildpatt, Simassim, (Atl. XIX), die fein eingravierten Armringe aus Trochus niloticus, Bii, (XVIII 5, und XIX 4), die schwungvoll geschnitzten hölzernen Kopfkissen, Palim, (Taf. III 1), und länglich-ovalen, mit einer Art Metall (Graphit oder Mangan) geschwärzten Holzschüsseln, Ssu, (III 3), alles Dinge, welche außerordentlich mit den in Astrolabe-Bai üblichen übereinstimmen oder identisch sind. Besonders schön waren auch die Schnitzereien der Ruder, Holztrommeln, Ong, (XIII 4) und Doppelhaken zum Aufhängen von Gegenständen über dem Feuer oder im Hause, letztere zum Teil menschliche Figuren, Buam, (Taf. III 2), darstellend. Sehr reich sind die verschiedenen Schmuckgegenstände, zu denen neben Scheiben aus dem Spitzenteil von Conusmuscheln, besonders kleine Kaurimuscheln, Ssanem, eine Art Cypraea, und Hundezähne das hauptsächlichste Material bilden. Jabo, d. h. fast kreisrunde Eberhauer galten auch hier als der kostbarste Schmuck (vergl. Atl. XXI 2). Neu war mir eine, jedenfalls künstlich, hochgelb gefärbte Grasart, Ssemu, aus welcher elegante Armbänder, Stirn- und Leibbinden (XXIV 5), zum Teil mit Hundezähnen garniert, geflochten werden, die wenn neu, wie Goldbrokat leuchten. Als ich am 20. Dezember 1885 die hohe Ehre hatte unserem erhabenem Kaiserpaar eine Auswahl von Gegenständen der Eingeborenen Neu-Guineas zu zeigen und zu erläutern, waren die Allerhöchsten Herrschaften auf das äußerste überrascht[51]. Und in der That, diese[S. 178] Arbeiten sind staunenswert, und ich freue mich wenigstens einige derselben im Bilde bringen zu können.
Die Waffen sind die gewöhnlichen und im ganzen schlecht. So kleine Bogen (Talam) mit Sehne (Teko) von gespaltenem Rotang, und Pfeile (Sob), ziemlich rohe Speere (Gim) und flache lange Holzkeulen (Ssing). Aber es gab Schilde von sehr eigentümlicher Form, wie ich dieselben nur hier gesehen habe. Sie bestehen aus einem konkav gebogenem Stück Holz, so lang und breit, daß es fast einen Mann zu decken vermag, wie dies am besten aus der beigegebenen Abbildung eines Kriegers beim Scheinangriff ersichtlich ist, welche auch die eigentümliche Verzierung in bunter Malerei andeutet.
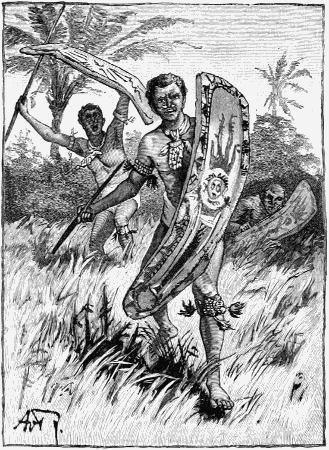
Sehr geschickt sind auch die in bunten Mustern (Atl. X. 2), oft mit Hundezähnen garnierten, Beutel gestrickt, in welchen verschiedene Kleinigkeiten aufbewahrt werden, darunter kleine Büchschen aus Bambu mit einem graulichen Pulver (Da), — Zahnpulver! Man sieht, daß die Finschhafener bereits sogar in Toilettenkünsten entwickelt sind, wenn sie sich auch äußerlich wenig von ihren sonstigen Stammesgenossen unterscheiden und ebenso schmierig als die ganze Papuagesellschaft erscheinen. Dazu trägt hauptsächlich eine schmutzige Halsstrickelei[S. 179] bei, welche die meisten tragen, und der häufig sehr unzureichende Schamschurz aus Tapa (Opo), die ganz denen von Huon-Golf (Atlas XVI, 4, 5) ähneln. Tapa wird auch zu eigentümlichen Kopfbedeckungen der Männer benutzt. Der ehrenwerte Herr auf meiner Abbildung mit dem kostbaren Brustschmuck aus Hundezähnen zeigt eine solche Mütze (Opo), welche zugleich den Abumtau oder Häuptling bezeichnet. Andere Kappen von kegelförmiger Gestalt, Parung genannt, werden ganz aus Menschenhaar hergestellt und ähneln durchaus einer Derwischkappe. In der That, kein Anthropolog würde auf einem Bazar in Stambul oder Alexandrien einen Ssuamiten in solcher Kopfbedeckung für einen Papua, sondern ohne allen Anstand für einen frommen Moslem und Mekkapilger halten. Das bringt mich auf die äußere Gestalt! Und da will ich nur erwähnen, daß auch die hiesige Bevölkerung so erheblich individuell abweichend ist, wie überall in Neu-Guinea. Aber jedenfalls findet sich der negroide Typus weniger als sonst, dagegen trifft man nicht selten echt semitische Gesichter, wozu der Bart, welchen die meisten älteren Männer stehen lassen, nicht wenig beiträgt.

Die Bewohner von Finschhafen scheinen sehr betriebsam, namentlich[S. 180] auch in der Fischerei, wie die Unmasse gutgearbeiteter Fischhaken (Ing) beweisen, wovon Tafel IX des Ethnol. Atlas eine ganze Reihe darstellt. Auch die schönen großen Netze (Uh) und namentlich ihre Kanus (Uang) sprechen dafür. Letztere sind oft von bedeutender Größe (60 bis 70 Fuß lang), haben zuweilen drei Seitenbretter und zwei Plattformen übereinander, zwei Maste mit großem viereckigen Mattensegel und sind an den Schnäbeln reich mit Schnitzerei, an den Seiten mit bunter Malerei verziert. Sie nähern sich in der Bauart schon mehr den großen Kanus, wie ich sie später in den d'Entrecasteaux kennen lernte, und die total von der in Polynesien gebräuchlichen abweicht. Es kann daher gar keine Rede davon sein, daß die Polynesier die Lehrmeister der Melanesier in der Schiffsbaukunst waren, wie manchmal von Gelehrten behauptet wird. Wie so oft bedauerte ich ganz besonders hier, daß es nicht möglich war, ein solches Kanu nach Berlin schicken zu können, wie mir dies seiner Zeit mit einem großen seetüchtigen Kanu der Marshall-Inseln gelang. Es würde am besten zeigen was die unscheinbare Steinaxt in der Hand des Eingeborenen zu leisten vermag, denn jedermann würde über die technisch ausgezeichnete Bauart und die Eleganz und stilvolle Ausschmückung staunen. Wie lange wird es dauern und kein solches mit Steinwerkzeugen gearbeitetes Kunstwerk wird mehr zu haben sein! Für die Erhaltung der Werkzeuge selbst ist durch meine Sammlungen gesorgt worden. Die Steinäxte der hiesigen Eingeborenen (vergl. Atlas I, 4), meist mit einer Klinge aus einem dioritischen Gestein (Ki) oder Tridacnamuschel (Gadi) versehen, ähneln am meisten den »Lachela« von Hood-Bai an der Südostküste, welche sich durch die Drehbarkeit der Klinge auszeichnen. Die Leute thaten übrigens ziemlich rar mit Steinäxten, um so begehrlicher aber gegenüber unseren Hobeleisen, die sie ebenfalls »Ki« nannten und welche, wie überall, bald der gesuchteste Artikel waren. Ich versprach einem jungen Burschen, unter der Bedingung ihn zurückzubringen, wenn er mitgehen wolle, ein ganzes Dutzend Äxte (claw hatchets), konnte ihn trotz dieser enormen Versuchung aber doch nicht verlocken.
[S. 181] In Besitz so ausgezeichneter Fahrzeuge unternehmen die Finschhafener auch Handelsreisen und stehen mit Tami oder den Cretininseln, einem anscheinenden Atoll, in Verbindung, wie wahrscheinlich mit Rook, das bei unbedecktem Himmel von unserem Ankerplatz aus sichtbar war. Wir sahen später große Segelkanus, die von Rook-Insel nach Finschhafen zu standen und wurden dort von den Tamiten selbst besucht. Ja, ja! auch in so abgelegenen Gegenden wird die Ankunft von Fremden viel schneller bekannt, als man glauben sollte. Übrigens sind die Entfernungen keine großen, da Rook nur ca. 40, die Tami-Inseln 15 Meilen von Finschhafen liegen. Ob in dem Verkehr vielleicht Töpfe als Tauschartikel eine Rolle spielen, vermochte ich nicht auszumachen. Aber Töpfe sind in Finschhafen in Gebrauch. Sie zeichnen sich durch die oben weite, mehr halbkugelige Form (T. IV. 5) aus, ähnlich wie ich sie später in Teste-Island traf, und sind am Rande mit erhabenen Knötchen verziert.
Wir waren in Ssuam stets gern gesehene Gäste, schon weil wir die Bewohner von einer Plage befreien halfen, der der Kakadus. Diese Vögel (Cacatua Triton) thaten den Pflanzungen der Eingeborenen viel Schaden und verschonten selbst Kokosnüsse nicht. Kokospalmen (Niep) sind übrigens keineswegs in großer Anzahl vorhanden, wenn auch zwischen Mitrafels und Astrolabe-Bai das Gebiet von Finschhafen immerhin noch am reichsten daran ist. Schon bei meinem ersten Besuche war mir die große Menge verfaulend am Erdboden liegender Kokosnüsse aufgefallen, durch deren Schalen ein wie mit einem Meißel geschlagenes Loch ging. Im Dorfe selbst sah ich an den Fruchttrauben der Palmen Stricke angebracht, deren Zweck ich mir nicht zu erklären vermochte. Bald sollte ich denselben kennen lernen, denn laut kreischend flogen Kakadus herbei, die sich an die Nüsse hingen und sich durch das Schütteln mit dem Bindfaden wenig beirren ließen. Unsere Schüsse öffneten ihnen die Augen, oder vielmehr verschlossen ihnen dieselben auf immer, sehr zum Jubel der Eingeborenen, die mit Steinwürfen und Flitzbogen wenig ausrichten können. Aber Kakadus sind bei den Papuas sehr beliebt und zwar ihrer gelben Haubenfedern wegen, welche den beliebtesten Haarschmuck[S. 182] des Mannes bilden. Ich dachte aber, daß diese reizenden Federn einem eleganten Damenhütchen, mit einem niedlichen Gesicht darunter, auch nicht übel kleiden müßten, und rettete so verschiedene aus den Krallen der Papuajungen. Übrigens ist ein Kakadu zum Essen auch nicht zu verachten, für solche die seit Wochen nur Büchsenfleisch gegessen haben. Ich rate dann aber die Vögel nur als Suppe verkochen zu lassen. Delikat! d. h. die Suppe; das Fleisch kann man ruhig einem Kanaker geben, dessen Zähne besser damit fertig werden.
Das Jagen in diesen Urwäldern ist übrigens nicht so leicht, schon wegen der bedeutenden Höhe der Bäume, für welche unsere gewöhnlichen Flinten häufig nicht ausreichen und die deshalb weittragende »chok-bore« Läufe erfordern. Und selbst für solche sind die Waldriesen oftmals zu hoch und dicht belaubt. So schoß Kapitän Dallmann bei einer Gelegenheit dreimal nach demselben Kakadu, traf ihn jedesmal, und doch flog der Vogel noch weg, um unauffindbar zu verenden. Und das passiert gar häufig, denn gerade das Auffinden der Beute macht die größte Mühe und bleibt oft resultatlos. Gut dressierte Hunde nützen, wie ich aus eigener Erfahrung weiß, wenig und werden in den Tropen bald unbrauchbar. Unendlich viel besser sind eingeborene Jungen als Jagdhunde zu gebrauchen und stets bereit den Jäger zu begleiten, wenn sie die erste Furcht vor dem Knall überwunden haben. Zum Aufspüren sind sie fast unentbehrlich, denn nur das scharfe, geübte Auge des Eingeborenen vermag in dem Dickicht die Beute zu erspähen, eine Gabe, die der Europäer nicht so leicht erlernt. Wie oft hört man nicht das Gurren einer Taube und bemüht sich vergeblich, ihrer ansichtig zu werden. Da weiß ein schwarzer Junge stets auszuhelfen. Übrigens gab es nicht viel zu jagen, auch wenn man dazu Zeit gehabt hätte, denn Finschhafen ist ein sehr tierarmes Gebiet. Die Vogelwelt machte sich auch hier besonders in den Arten bemerkbar, welche wir schon in Friedrich-Wilhelms-Hafen (S. 95) kennen lernten und wie dort war mir, im Vergleich mit der Südostküste Neu-Guineas, die Spärlichkeit von Kleinvögeln auffallend. Doch hörte ich den wohlbekannten Ruf des[S. 183] »Rifle-bird«, einer zu den Paradiesvögeln gehörenden, farbenprächtigen Ptilorisart, des raketschwänzigen Eisvogels (Tanysiptera), und das sonderbare Getriller eines anderen Eisvogels (Syma torotoro). Auch ein alter, lieber Bekannter aus der Heimat ließ sich zuweilen blicken: der trillernde Wasserläufer (Actitis hypoleucos), der nach Beendigung seines Brutgeschäftes im hohen Norden hier gemütliche Winterruhe hält und von mir nicht gestört wurde. Doch was flattert dort schwankenden Fluges durch das Gelaube? schon greift man an das Gewehr, läßt es aber gleich wieder sinken, denn es ist nur ein Schmetterling, aber ein wahrer »mocking bird«, der selbst das geübte Auge momentan zu täuschen vermag. Freilich übertrifft er in der Flügelbreite, welche an sechs Zoll beträgt, gar manches Vögelchen, aber er ist auch der größte Tagfalter, die weit über die Papuaregion verbreitete Ornithoptera aruensis. Das Männchen gehört dabei mit zu den schönsten Faltern, während das ansehnlich größere Weibchen unscheinbar schwarz und weiß gefärbt ist. — Nach der häufigen Verwendung von Kasuarfedern bei den Eingeborenen zu urteilen, muß dieser gewaltige Vogel nicht selten sein, allein er liebt das Dickicht der Wälder, ist sehr scheu und deshalb nur sehr ausnahmsweise zu sehen. Doch beobachtete ich nicht einmal die leicht kenntliche Fährte von Kasuaren, häufiger dagegen die von Wildschweinen. Das war aber auch alles was ich von Säugetieren zu sehen bekam, denn niemals erblickte ich ein Känguru, die an der Südostküste doch zu den gewöhnlichen Erscheinungen gehören. Alle übrigen Säugetiere Neu-Guineas sind ja, mit Ausnahme einiger Flugtiere und Nager, durchgehends Beuteltiere mit nächtlicher Lebensweise und schon deshalb nur durch Zufall sichtbar.
»Aber Schlangen, die giebt es wohl in Menge und die sind wohl recht gefährlich«? Nun! auch diese inkommodieren und erschrecken so wenig als bei uns, denn man begegnet ihnen nur sehr selten. Abenteuer mit Riesenschlangen, und reißenden Tieren überhaupt, sind also nicht zu bestehen, und die Herren Offiziere waren froh, wenn sie mit ein paar Kakadus, grünen Papageien oder Tauben von der so erwartungsvollen Tropenjagd zurückkehrten.
[S. 184] Aber einmal erlegten die Herren vom Kriegsschiff sogar ein Krokodil, das natürlich verloren ging, da diese Saurier regelmäßig im Wasser untersinken und nur zu erhalten sind, wenn sie am Lande gleich auf der Stelle tödlich getroffen werden.
Also es gab Krokodile! Das freute mich sehr, als ich mit Steuermann Sechstroh eine Bootfahrt nach dem Bumi unternahm. So heißt ein hübscher Gebirgsfluß, der etwas oberhalb Ssuam in eine flache Bucht mündet. Die Eingeborenen hatten hier sorglicher Weise ein Fischwehr angebracht, öffneten dasselbe aber in ihrer bekannten freundlichen Manier, und ein paar der hervorragendsten Abumtaus gaben uns das Geleit. Der Fluß war anfangs sehr versprechend, mit üppiger Vegetation, darunter Sagopalmen (Labi), am linken Ufer senkrechte Wände eines bläulichen Mergels mit zahlreichen recenten Muschelresten. Bald kamen aber Untiefen, Stromschnellen, über welche wir das Boot in tieferes Wasser schleppten, bis die fröhliche Gondelei, bei der wir fast mehr das Boot zu tragen hatten, als das letztere uns, überhaupt das Ende erreichte. Der Fluß wurde hier, von beiden Seiten durch steile Felswände mit üppigem Baumwuchs eingeengt, zum völligen Gebirgswasser, in welchem wir noch ein gutes Stück watend vorwärts kamen. Kreischende Weiberstimmen unterbrachen das angenehme Murmeln bei der sonst so wohlthuenden Stille. Wir hatten um eine Ecke biegend eine Schar arglos fischender Mädchen aufgescheucht, die nun wie die Gemsen an den Felswänden emporkletterten und ihre Fischhamen eiligst im Stiche ließen. Leider enthielten sie keine Tafelfische, sondern nur wissenschaftliche Ausbeute, ein paar kaum fingerlange Gobius-artige Fischchen mit Kehlsaugapparat, ähnlich wie ich sie in den Gebirgswässern Mauis erhalten hatte. Ja, der paar Fischelchen wegen brauchte sich kein Krokodil hier herauf zu bemühen, und so verzichtete ich abermals auf die Beute, wie der Fuchs auf die Trauben. Da war es in Konstantinhafen noch besser gewesen! Da lag ich einmal mit dem Boot gerade über einem solchen Ungetüm, wohl zehn Fuß lang, dessen Umrisse ich deutlich unterscheiden konnte. Ins Wasser kann man wohl schießen, aber mit dem Treffen ist es dann so eine eigene[S. 185] Sache. So hieß es denn abwarten; das brave Tier schien den Fall in demselben Lichte zu betrachten und zu denken: »ich hab' Zeit! Dor! Dor ligt de Donnerslag!« sagte der Matrose, welcher mein Boot ruderte! »Ja! Man stille, stille! ich sehe ihm ja!« Und wir warten wieder — das Krokodil unten behaglich im Wasser, wir in der glühenden Sonnenhitze! Da, plötzlich: »Dor geit he hen«, eine mächtige Wolke Schlamm trübte das Wasser, und Roß und Reiter sah man niemals wieder! Das ist eine Krokodiljagd in Wirklichkeit, nicht wie sie gewöhnlich beschrieben wird. In Neu-Guinea und Neu-Britannien giebt es, wenigstens nach meinen Erfahrungen, herzlich wenig Krokodile, das darf ich jeden versichern, und das ist ja im ganzen kein Fehler. Freilich Herr Powell beschreibt Flüsse in Neu-Britannien, in welchen es von Krokodilen förmlich wimmelt[52], große, mittlere, kleine; man brauchte sie sich nur auszusuchen. Wahrscheinlich hielten die Tiere gerade Volkszählung und alle Krokodile von Blanche-Bai bis Kap Glocester waren hier zur Kontrollversammlung. Aber Herr Powell sah auch »fischende« Kasuare, und »fliegenschnappende« Krokodile!?
Die Zeit unseres Abschiedes nahte, sehr zum Bedauern der Eingeborenen, deren Häupter natürlich Andenken erhielten, darunter mein alter braver Freund Makiri ein äußerst ungewöhnliches, wie ich es noch nie einem Freunde gab, noch geben konnte. In einer Ecke der Kajüte besaßen wir ein Seltzogen, d. h. einen jener bekannten Apparate, in welchen man künstliche kohlensaure Wasser bereitet. — »Und den bekam der Wilde?« wird vielleicht mancher Leser denken. Natürlich nicht, sondern nur einen Teil desselben. Die Sache war nämlich so gekommen. Wir hatten an Bord einen schwarzen Burschen, einen schneidigen Jungen, der den weißen Mann und seine Finessen aus dem Grunde kannte. Er verstand einen Riemen zu ziehen, Gewehre und Tischgerät zu putzen, aß bereits Schiffsbrot, noch lieber eingemachte Früchte oder Sardinen in Öl, woran sich alle Kanaker so schnell gewöhnen, mit einem Wort, er war ein sehr[S. 186] gebildeter junger Mann. Sogar einen Selterswasser-Apparat wußte er kunstgerecht zu füllen. »Oh! me sabi! that fellow white paura likelike, that other fellow mangero!« (O, ich weiß, von diesem weißen Pulver wenig, von dem andern viel). Richtig, er hatte die Sache los, nicht wahr, was nicht so ein Kanaker alles lernt! Das Kohlensaure, in den Tropen eine wahre Erquickung, war also bald fertig und sollte eben probiert werden. Da, auf einmal ein Krach, als ginge eine kleine Kanone los! Ich dachte natürlich zunächst an den Kessel, aber glücklicherweise so schlimm war es nicht, sondern nur das Seltzogen explodierte. Da lag die Bescherung! das daumendicke Glas zersprengt und Hunderte feiner Splitterchen überall ins Holzwerk geflogen. Das mußte ein wahres Sprühfeuer von Glassplittern gewesen sein, denn die Kajüte war ja nicht groß (8 Fuß bei 5) und wirklich ein Glück, daß sich gerade niemand in derselben aufhielt. »Boy! you look« Knabe, betrachte dies!? — »Aipua! me make that fellow mangero mangero good! that fellow bottle not all same strong paura« (O weh! ich habe es zu gut gemacht; die Flasche war nicht so stark als das Pulver). Da hatte er ebenfalls recht, und wir waren beide um eine Erfahrung reicher; er, daß es auch weißes »Paura« (= Powder, Schießpulver) giebt, welches im Wasser »bum« macht; ich, daß man niemals einem Schwarzen einen Selterswasser-Apparat ansetzen lassen soll.
Mit dem Kohlensauren war es nun aus, und nur das hohe birnförmige Drahtgeflecht übrig, das mit rotem Zeug umwunden in der That eine aparte Kopfbedeckung bildete, welche meinen Freund Makiri mit Stolz und Freude erfüllte. Gut, daß wir übrigens bald darauf weggingen, denn jeder Abumtau wollte jetzt eine solche Mitra haben. Dieser Vorfall erinnert mich übrigens an eine andere ähnliche Geschichte aus meinem Südseeleben, die noch komischer ist und deshalb hier mitgeteilt werden mag. Aber ich schweife da wieder ab —! »Schadet nichts, nur zu!« »Nun Sie wollen es! also gut!« Als ich im Jahre 1880 auf Jaluit in der Marshallgruppe weilte, war für Lebon Kabua, den damaligen »Oberhäuptling und Herrn von Radak und Ralik« ein Herrscherornat von Hamburg eingetroffen, Theatergarderobe,[S. 187] unter welcher sogar die Krone nicht fehlte. Der vergoldete, reich mit Glassteinen besetzte, zackige Reif imponierte dem guten Kabua freilich nicht wenig. Aber er sollte ihn, wie die ganze königliche Gewandung bezahlen, und da hieß es natürlich gleich: »i bane! edschilok dala ao!« (ich kann nicht! kein Geld mein). Krone, Scepter und Purpur lagen nun daher, bis sich ein passender »King« finden würde, an welchen ja in diesen Regionen kein Mangel ist. Und er kam. Eines schönen Tages brachte ein deutscher Dampfer gar wunderliche fremde Gesellen, dunkel, mit Krausköpfen, ja, die mußten ja weit her sein aus dem Morgenlande. Nein, aus dem Abendlande, denn sie kamen mehr aus West, da wo von Jaluit aus die Sonne untergeht, aus Neu-Irland. Darunter war nun auch ein König, ein wirklicher Mohrenkönig, den ersten, welchen ich sah. Freilich brachte er weder Gold, Weihrauch noch Myrrhen, sondern nur seine eigene Haut, die wie bei dem Mohrenkönige jenes Märchens, mit dem unsichtbaren, aus nichts gewebten Stoffe umhüllt war, wodurch sich dem blöden Auge des gewöhnlichen Sterblichen also jedes vom Ringwurm abgenagte Fleckchen deutlich zeigte. In der That gerade keine sonderlich königliche Auszeichnung, welcher seine beiden Begleiter sich auch erfreuten, denn Ringwurm und Schuppenkrankheit sind ja Nationaleigentum der ganzen braunen und schwarzen Südseegesellschaft. Um nun Majestät von den Ministern einigermaßen auszuzeichnen, damit sie nicht immer verwechselt wurden, bekam nun der König die Krone, natürlich als Geschenk, vielleicht nur leihweis, denn womit hätte er bezahlen wollen? König und Krone waren unzertrennlich wie beim Kartenkönig, und es sah urkomisch aus, die lange hagere Gestalt in vollständiger Nacktheit mit dem funkelnden Kopfschmuck umherwandeln zu sehen. Selten ist wohl eine Krone soviel gebraucht, fast möchte ich sagen strapaziert worden als diese, denn die schwarze Majestät behielt sie auch auf, wenn sie sich schlafen legte. Freilich wäre ihm der Purpurmantel weit praktischer, jedenfalls viel lieber gewesen, aber er mochte denken: Na! eine geschenkte Krone ist auch nicht ohne!
Wir verließen Finschhafen an demselben Morgen wie die »Hyäne«,[S. 188] welche südlich ging, um die Bucht hinter Finschhafen zu untersuchen, die ich schon vom Berge aus gesehen hatte. Sie erwies sich später als praktikabel und erhielt den Namen »Langemack-Bucht«. Wir gingen bis Kap Cretin, sechs durch Riff verbundene Inseln, die immer der Untersuchung wert erschienen, aber nur vorgemerkt werden konnten. Dann dampften wir nordwärts bis Long-Insel, an deren Ostseite wir entlang gingen. Sie zeigt einen ähnlichen Charakter, wie Dampier, ist durchaus vulkanisch mit mehreren erloschenen Vulkanen, von deren drei hervorragendsten Kegeln zunächst Coriz-Pik vor uns lag. Er mag an 4000 Fuß hoch sein und ist wie die übrigen Berge dichtbewaldet. Gegenüber Coriz-Pik an der Nordostseite liegt der etwas niedrigere Berg Réaumur, aber Findlay (Pacific Directory S. 931) irrt, wenn er sagt, beide Berge seien durch ein tiefes Thal getrennt. Die ganze Insel ist vorzugsweise bergig, mit sehr wenig flachem Land und nur mäßigen Schluchten oder Thälern durchzogen. Die Küste erschien sowenig versprechend als das Land selbst, das sich übrigens leichter zur Kultivation eignen dürfte wie Dampier-Insel, da es nicht so dichten Urwald, sondern mehr mit Gestrüpp bedeckte Striche zeigt. Das Ufer war meist ein nicht sehr hohes felsiges Steilufer, zuweilen etwas abfallend und sanfte Buchtungen bildend, die wohl aber kaum als Hafen brauchbar sein dürften, wenigstens nicht an der Ostküste, die wir befuhren. Nirgends waren Plantagen bemerkbar, aber in der zweiten Buchtung bemerkte ich einen gelben Baum und etliche Kokospalmen, die einzigen, welche wir auf der ganzen Insel sahen. Und — »da sind sie ja die schwarzen Kunden!« sagte der Steuermann. Wirklich ein Segelkanu mit acht Insassen kam langsam aus der Bucht heraus, aber noch längst nicht nahe heran. Da hatten die Lungen unserer Mioko-Schwarzen wieder Arbeit. »Good ship that fellow! plenty kaikai! (Essen), plenty tobacco! plenty papine! (Mädchen) plenty lavalava (Lendentücher)! Kjap (Kapitän) very good! uti! alut! alut! aijap! (kommt! schnell, schnell)!«, wie sie es an Bord von Arbeiterwerbeschiffen, welche sie begleitet hatten, gewohnt waren. Nur daß diesmal das »me kulia men« (wir kaufen Leute) wegfiel, denn damit hatte sich die Samoa[S. 189] glücklicherweise nicht zu befassen. Das machte freilich auf die Long-Insulaner keinen Eindruck, denn sie verstanden von dieser Sprache soviel wie wir von der ihren: nichts. Und damit kamen wir, als sich das Kanu endlich längsseit gewagt hatte, auch ganz trefflich aus. Die Leute, übrigens echte Papuas und ganz wie die Bewohner des Festlandes von Neu-Guinea, waren bescheiden, und es ließ sich gut mit ihnen schachern. Aber sie hatten nicht viel, übrigens alles Gegenstände, wie sie in Astrolabe-Bai vorkommen, so geflochtene Armbänder (XVIII 4), Brustschmuck, (XXII 1, 2) auch die gleiche Art Bogen und Speere. Als so ziemlich ausverkauft war, gaben sie den Ausputz ihres Kanus her und schnitten selbst die bemalten Seitenborde ab. Darunter waren gar merkwürdige Sächelchen: so auf der Mastspitze ein Triangel mit roh geschnitzten Vögeln, ein sonderbares Gestell auf dem Ausleger (vergl. Atlas VI 6 und VIII 1, 2) u. s. w., alles Gegenstände, die jetzt im Museum für Völkerkunde in Berlin zu sehen sind, das wohl vorher kein Stück von Long-Island besaß. An Lebensmitteln wurden nur einige alte Kokosnüsse und etwas Blättertabak gebracht. Stangentabak schienen die Leute nicht zu kennen, dagegen Glasperlen und Eisen, das hier mit dem Ausruf »Gari« begrüßt wurde. Im Eifer des Handelns fiel einem der Männer das eben erstandene Messer ins Meer. Da konnte man ein betrübtes schwarzes Gesicht sehen, denn für ein solches Naturkind ist das gar nicht zum Lachen. Nun, ich sehe gern zufriedene Menschen, da schenkte ich dem Manne ein anderes Messer, und nun konnte man sich wieder an einem fröhlichen schwarzen Gesichte freuen. Vermutlich stehe ich noch heute bei den Long-Insulanern in gutem Andenken; denn wie des Bösen erinnert sich der Schwarze auch etwas des Guten, und wahrscheinlich erzählt man noch von dem fremden Schiffe ohne Segel und dem weißen Manne mit dem roten Barte. Muß der reich gewesen sein! Ja, an Messern hat es mir von meinen Knabenjahren an nie gemangelt, am allerwenigsten auf der Samoa, die unzählige Gros an Bord führte.
Von Long-Island standen wir in Sicht der Inseln Lottin, Rook, Tupinier und Vulcano, nach der Nordküste Neu-Britanniens hinüber, deren an 6000–7000 Fuß hoher Pik bei Kap Glocester nur eine[S. 190] Fortsetzung dieser vulkanischen Inseln zu sein schien. Denn hier sind eben alle Berge Vulkane, die wir freilich sämtlich erloschen[53] fanden. In der Nähe von Lottin hatten wir die seltene Gelegenheit eine Wasserhose zu beobachten. Sie zeigte sich nicht in der gewöhnlichen Gestalt eines Geiser, wie sie gewöhnlich abgebildet wird, sondern anfangs wie eine nicht hoch über dem Wasser schwebende Rauchwolke, aus der plötzlich ein hoher, schiefer, dunkler Strahl hervorschoß. Dieser Strahl verdünnte sich nach und nach an der Basis und nahm die Form einer etwas gebogenen Feder an, bis sich nach und nach das Ganze auflöste. Die Erscheinung mochte 10 bis 12 Minuten dauern und zeigte sich in einem dicht mit Regenwolken bedeckten Horizont, hinter dem die Insel eben auftauchte.
Zwischen Kap Gauffre und Kap Raoul liefen wir längs der Küste Neu-Britanniens nach Osten bis Weberhafen. Sie stimmt in der Konfiguration wenig mit der Karte überein, die allerdings einen großen Teil der Küstenlinie nur punktiert zeigt. Ost von Kap Raoul fanden wir auf eine Strecke von ca. sechs Meilen schönes, offenes Land, das sich trefflich zu Kulturen eignen dürfte, und das beste scheint, welches wir in Neu-Britannien überhaupt sahen. Da wir, schon in Rücksicht auf unsere Kohlen, die Küste nur rekognoszieren konnten, so mußten wir dies schöne Land diesmal ununtersucht lassen und bis zu einer anderen Gelegenheit aufsparen. An diesem Teile der Küste sind mehrere kleine Inseln vorgelagert, die durch Riff verbunden scheinen, doch kamen die Eingeborenen in ihren Kanus durch die Brandung heraus, das einzigemal, daß wir mit solchen an dieser Küste in Verkehr traten. Weiter ostwärts fanden wir das Land weniger versprechend, meist bergig, dichtbewaldet, wenig oder gar keine Anzeichen von Bevölkerung und dazu zahlreiche Riffe. Von Willaumez-Insel bis Kap Lambert kamen wir in das zuerst durch[S. 191] Wilfred Powell zum Teil eingehender beschriebene Gebiet, welches er im Jahre 1879 oder 1880 mit der Ketch »Star of the East« (15 Tons) explorierte und (mit nur zwei Eingeborenen) kartographierte. Schon die Beschreibung seines Kap Campbell, der Ostspitze von Willaumez, stimmte wenig mit der Wirklichkeit, und vor allem mußte es befremden, auf seiner Karte »High-Island« verzeichnet zu finden, da dies doch nur der hohe Pik im Südwesten der Insel Willaumez[54] ist. Andere Punkte ließen sich überhaupt nicht ausmachen oder waren nicht aufzufinden[55].
Von Weberhafen sprachen wir noch an der Nordwestspitze Neu-Irlands vor, wo sich Friedrich Schulle seit Mitte des Jahres auf der Insel Nusa wieder gefestigt hatte und Koprahandel betrieb. Und wer war dazu besser geeignet als er; hatte er doch früher als Geschäftsführer von Hernsheim & Co. fast all die Stationen in jenem damals durchaus neuen und ergiebigen Gebiet errichtet. Als Schulle im Jahre 1881 wegging bestanden noch ein Dutzend solcher Kopra-Stationen, jetzt gab es nur noch zwei. Und was war die Ursache dieses Rückganges? Die Labourtrade, welche hier vorzugsweis von Queensländer Schiffen in rücksichtsloser Weise betrieben, soviel Unheil angerichtet hatte. Kein Wunder, wenn die Eingeborenen, wirklich wild geworden, nach Rache dürsteten. Ganz besonders galt dieselbe einem weißen Händler, einem Deutschen, der noch mit dem Chandernagor des Marquis des Rays herausgekommen war, und es sehr profitabel fand Arbeiter an die Werbeschiffe zu besorgen, wobei es nicht immer sauber hergegangen sein mag. Als der Erwähnte vollends einen Häuptling erschoß, da war es den Eingeborenen endlich doch zu viel: sie griffen an, brannten die Station nieder, und er rettete nur das Leben. Dafür wurden die Eingeborenen später von einem Kriegsschiffe gestraft, aber der Anstifter — nun der ging leer aus. So geht es in[S. 192] der Südsee, und da ließe sich noch gar manches erzählen. Aber diese gefürchteten Wilden müssen doch wohl nicht so schlimm als ihr Ruf sein! Friedrich Schulle lieferte den besten Beweis dafür, denn er lebte ganz allein, nur mit drei Farbigen, unter ihnen und zwar so gemütlich, als man damals in Neu-Irland überhaupt leben konnte. Und dabei faßte er die Eingeborenen nicht mit Glacéhandschuhen an, sondern es kam ihm, wenn notwendig, nicht darauf an Krieg zu erklären und denselben ganz allein durchzuführen. Freilich mögen sich die Verhältnisse inzwischen wieder geändert haben, da seitdem durch unsere Kriegsschiffe noch weitere Strafexpeditionen in jenen Gebieten unternommen wurden.
Wir dampften längs der Westküste von Neu-Irland, die ausnahmslos aus zum Teil sehr steilen, dichtbewaldeten Hügeln und Bergen besteht, die wenig versprechend aussehen, da es hier nur äußerst wenig Kokospalmen giebt, und trafen am 9. Dezember wieder in Mioko ein.
Drei Jahre sind bereits verflossen seitdem ich mit der Samoa Finschhafen entdeckte. Die Idylle, wie sie meine Abbildung (S. 162) zeigt, ist verschwunden, denn der weiße Mann hat seinen Einzug gehalten, um sich dauernd hier niederzulassen. Etwa elf Monate (18. Oktober 1885) nach uns, lief das erste deutsche Segelschiff die Brigg »Lübken« aus Hamburg mit Vorräten und Kohlen im Finschhafen ein, fand aber zu ihrem Erstaunen nur die Eingeborenen, denn erst Anfang November (5.) langten die beiden Dampfer der Neu-Guinea-Kompanie »Samoa« und »Papua« an, mit einer Anzahl Beamten, malayischen von Java importierten Arbeitern, und damit konnte erst die eigentliche Gründung der Niederlassung beginnen. Seitdem sind noch mehr Segelschiffe nach dem auf allen Seekarten verzeichneten Finschhafen gekommen. Die Dampfer der Kompanie unterhalten einen regelmäßigen Dienst mit der nächsten Post- und Telegraphenstation Cooktown in Queensland; Briefe nach Finschhafen sind dem Weltpostverkehr übergeben. Weitere Beamte und eine größere Anzahl malayischer Arbeiter haben eine größere Anzahl Häuser nötig gemacht,[S. 193] darunter das mit allem Komfort ausgestattete des Landeshauptmanns. Denn Finschhafen ist Sitz der Landesverwaltung, die Hauptstadt von Kaiser-Wilhelms-Land und dem Bismarck-Archipel geworden. Es giebt hier ein Gericht, Seemannsamt, Standesamt, Postamt, kurzum alle Institute eines geordneten Staatswesens. Selbstverständlich fehlen auch Gastwirtschaften, die sich streng an die von der Kompanie vorgeschriebenen Tarife zu halten haben, nicht. Auf Kap Bredow ist eine Bake errichtet, die flache Stelle im Hafen durch Bojen markiert worden. Mit Kulturen und Versuchsplantagen hat man auch in der benachbarten Langemack-Bucht angefangen, wie Pferde, Rindvieh, Ziegen und Schafe eingeführt; alles gedeiht trefflich, und was die Hauptsache ist, auch die klimatischen Verhältnisse sind sehr befriedigend. Der Boden wird wie der Hafen allgemein gerühmt, kurzum alle Hoffnungen und Erwartungen, welche ich an diesen Platz knüpfte, sind so ziemlich erfüllt, zum Teil übertroffen worden, in der That eine Genugthuung, die mir der schönste Lohn ist für viele ernste und schwere Sorgen und anstrengende Thätigkeit. Auch die Mission hat ihr Werk begonnen. Am 12. Juli 1886 traf der lutherische Missionär Johann Flierl ein und gründete später die Station Simbang in der Langemack-Bucht, dem seitdem drei Kollegen deutscher Missionsgesellschaften (von Barmen und Neuendettelsau) folgten.
Und so wollen wir Finschhafen recht von Herzen eine allseitig glückliche Weiterentwickelung wünschen! »Was ist aber aus den Eingeborenen geworden? Die helfen wohl tüchtig mit arbeiten?« höre ich fragen. Nein, die sind der Mehrzahl nach ausgewandert, so z. B. die Bewohner der Dörfer Ssuam und Kedam in corpore. Hoffentlich werden bald nützlichere und brauchbarere Menschen ihre Plätze einnehmen: Ansiedler. Bis jetzt fehlt dieses wichtigste Element der Kolonisation noch ganz; aber bereits können Leute mit genügenden Mitteln Land pachten, auf fünf Jahre. Nun da wird hoffentlich bald der Anfang gemacht und damit erst die eigentliche Kolonie begründet werden. Möge diese Zeit bald anbrechen!
Geringe Kenntnis Neu-Guineas. — Schwierigkeiten ins Innere vorzudringen — sind nicht unüberwindlich. — Armut an Naturprodukten — bis jetzt kein Eldorado. — Schiffsverkehr in Mioko. — Arbeiterwerben. — S. M. Kreuzerkorvette »Marie«. — Unfall derselben. — Auf der Suche nach Steinkohlen. — Kriegszustand mit Neu-Irland. — Port Breton. — Trauriges Ende der französischen Kolonie. — Reminiscenzen an dieselbe. — Port Praslin. — Schwierigkeiten zu strafen. — Englisches Gebiet. — Erst durch Moresby erschlossen.
Während der »schwarze Kontinent«, Afrika, in den letzten Jahrzehnten nach allen Richtungen erfolgreich durchkreuzt wurde, blieb das Innere seiner östlichen Schwester, der mächtigen schwarzen Insel Neu-Guinea, so gut als unbetreten, und nur zu Wasser wurden bisher ansehnliche Distanzen zurückgelegt. So 1876 durch den kühnen Italiener d'Albertis, welcher den Flyfluß an 450 engl. Meilen weit mit einer Dampfbarkasse befuhr, und neuerdings auf dem Kaiserin-Augusta-Fluß, über dessen Entdeckung durch die Samoa ich noch zu berichten habe. Zu Land sind gegenüber anderen Erdteilen und Inseln nur unbedeutende Vorstöße zu verzeichnen. In dem am meisten explorierten Gebiete von Port Moresby an der Südostküste, gelangten unternehmende, meist vom Golddurst getriebene Pioniere, darunter auch unser Landsmann Karl Hunstein, nur bis in die Region des Owen-Stanley-Gebirges, in der Luftlinie gemessen, kaum weiter als 40 engl. Meilen von der Küste. Auf der äußersten Südostspitze überquerte der Reverend Chalmers die kurze Strecke von Südkap (Stacey-Island) bis Milne-Bai, während Dr. A. B. Meyer als der Erste den Isthmus[S. 195] zwischen der Geelvink-Bai und dem Golf von Mac Cluer kreuzte, jener schmälsten Stelle der ganzen Insel, deren Breite hier kaum mehr als 5 Seemeilen beträgt. Wir kennen also noch heut ungefähr nur die Küsten Neu-Guineas, und auch mit der Erforschung dieser hat es lange genug gedauert, wenn man bedenkt, daß über 360 Jahre seit der Entdeckung Neu-Guineas durch den Portugiesen de Meneses (1526) verflossen. Man war stets geneigt diese geringen Erfolge den besonderen Schwierigkeiten, welche gerade Neu-Guinea wegen seines mörderischen Klimas und seiner wilden blutdürstigen Bevölkerung bieten sollte, zuzuschreiben, indes sehr mit Unrecht. Das Klima hat sich im ganzen nicht schlechter als anderwärts in den Tropen erwiesen, und die gefürchteten Eingeborenen sind auch bei weitem besser als ihr Ruf, sie haben sich fast überall da, wo sie von dem verderblichen Verkehr mit Weißen unberührt blieben, als harmlose Menschen gezeigt. Die Hauptschwierigkeiten eines tieferen Eindringens zu Land liegen weder im Klima noch den Eingeborenen, sondern ganz wo anders: einfach in dem Mangel an landeskundigen Führern und ganz besonders Trägern, und sind noch genau dieselben geblieben als vor 300 Jahren. Die Schuld daran trägt hauptsächlich die Isoliertheit der Bevölkerung! Die Bewohner der Küsten, ohne andere Stammeszusammengehörigkeit als der kleinerer Dorfgemeinden, schon in Entfernung von oft nur wenigen Meilen in ganz verschiedene Sprachen zersplittert, fast in steter Fehde lebend, wagen sich über das engbegrenzte Gebiet der ihnen befreundeten Dörfer nicht hinaus und kennen mit Ausnahme gewisser durch Kanufahrten in Verkehr stehender Küstenpunkte ihr Heimatsland am wenigsten. Mit dem Inneren besteht kaum Verbindung, ja es fehlen sehr häufig selbst Pfade, und da Neu-Guinea vorherrschend dichtbewaldetes Gebirgsland ist, so ergeben sich schon daraus gewaltige Hindernisse. Wer wie ich selbst an der Südostküste Neu-Guineas, in bekannten Gegenden, mit großen Schwierigkeiten kaum 15 M. weit ins Innere gelangen konnte, wird diese Verhältnisse am besten zu würdigen wissen und sich damit trösten können, daß selbst besonders begünstigte Reisende, wie z. B. Chalmers, kaum mehr als noch einmal soweit vordrangen. N. von Miklucho-Maclay[S. 196] kam während eines fünfzehnmonatlichen Aufenthaltes in Astrolabe-Bai nicht über das Litoral hinaus. Und warum? Überall die nämliche alte Geschichte: die Eingeborenen fürchten sich, weiter als bis zu den nächsten Dörfern, selten mehr als eine Tagereise mitzugehen und sind als Träger, weil ungewohnt mit dieser Beschäftigung oder zu faul, wenig wert. Größere Reisen in das Innere werden sich daher nur mittelst importierten, geschulten Trägerpersonals ausführen lassen und mit einer Ausrüstung, wie sie bisher keine der vielen Expeditionen aufzuweisen hatte. Wer über Mittel verfügen könnte, wie seiner Zeit Stanley in Afrika, dem würde es auch in Neu-Guinea an Erfolg nicht fehlen, und die Zeit ist hoffentlich nicht fern, wo diese Erfolge thatsächlich erzielt werden. Ein »Neu-Guinea-Stanley« wird sich schon finden, wenn erst der »Neu-Guinea-Bennett« da ist, welcher das Geld dazu hergiebt. Denn das bleibt schließlich die Hauptsache, wenn auch längst nicht soviel Mittel erforderlich sein würden als bei jener ewig denkwürdigen Riesentour durch den schwarzen Kontinent. Wie weit selbst ein Einzelner in Neu-Guinea ungefährdet vorzudringen vermag, das hat Karl Hunstein am besten bewiesen, der nur von einem Südseefarbigen begleitet in die Rhododendron-Region des Owen-Stanley[56] gelangte und hier mehrere Wochen mit Sammeln von Vogelbälgen, darunter herrlichen neuen Paradiesvogelarten, zubrachte. Freilich gehört dazu ein mit Land und Leuten so gut bekannter Mann als Hunstein, der unter den ersten Goldsuchern am weitesten eindrang und mit zu den besten Pionieren Neu-Guineas zählt. Freilich, die Gebirge, die Gebirge! Sie werden stets gewaltige Hindernisse bieten, würden aber bereits überwunden worden sein, wären Schätze zu holen gewesen. Wenn kühne Männer zuerst in die Wildnis der Felsgebirge und anderer unwirtlichen Gegenden eindrangen, so fanden sie ihre Anstrengungen durch die Ausbeute an wertvollen Pelztieren, später Erzen reichlich belohnt, aber Neu-Guinea bietet ja in der Tierwelt nichts als Paradiesvögel, die trotz ihrer Federpracht[S. 197] doch nur wissenschaftlichen Wert haben. Der Mangel an lukrativen Naturprodukten ist es eben, welcher Neu-Guinea so lange verschlossen hielt, und wir würden ganz anderen Verhältnissen dort begegnen, wenn der Goldreichtum wirklich gefunden worden wäre, von welchem heut noch so viele träumen. Namentlich in Queensland wird Neu-Guinea als das wahre Eldorado betrachtet, und nicht bloß auf das »we know it« des Reverend Mac Farlane hin, sondern von professionellen Goldgräbern, die ja im Geiste immer die größten Erwartungen hegen. Nun, die Zeit wird ja lehren, ob diese bis jetzt nur schwach begründeten Hoffnungen[57] sich verwirklichen!
Ich hatte selten in einem Südseehafen eine so große Anzahl von Schiffen gesehen als bei unserer Rückkehr nach Mioko. Vier Fahrzeuge lagen zu Anker, aber in einer Weise, die selbst dem Laien ungewöhnlich erschien. Da mußte etwas Besonderes vorgehen, und so verhielt es sich auch. Man war nämlich beschäftigt ein Schiff zu heben, einen kleinen Kutter von 50 Tons, der infolge von Altersschwäche nicht mehr schwimmen, sondern absolut sinken wollte. Das geschah denn auch und zwar glücklicherweise unmittelbar vor der Station, in wenig tiefem Wasser. Es gelang daher den Trotzkopf zu bändigen und heraufzuholen, der jetzt wahrscheinlich wieder lustig auf den Wellen tanzt; hatte er doch erst 34 Jahre! mitgemacht. Eine solche Flotte von Handelsschiffen unter deutscher Flagge, die damals selbst in Sydney zu den Ausnahmen gehörte, konnte dem Unkundigen wohl imponieren und ihm Respekt vor dem deutschen Handel in jenem entlegenen Südseewinkel einflößen. Aber es war nur ein größeres Schiff aus Deutschland darunter, welches noch viel Kopra hätte laden können, wenn sie eben vorhanden gewesen wäre; die anderen Fahrzeuge waren nur kleine Kutter und Schuner von 50–60 Tons. Sie dienen dazu Kopra von den Küstenplätzen zusammenzuschleppen, was oft bedeutende Schwierigkeiten hat, zeitweis gar nicht möglich ist, oder sind im Werbegeschäft thätig, da Mioko das[S. 198] Centraldepot für Samoa ist. Von hier aus wurden 1883–84 allein aus Neu-Britannien und Neu-Irland 700 angeworbene Arbeiter nach dort verschifft. Der Schuner Ninafou[58] gehörte zu diesen Werbeschiffen und war eben von einer Reise aus dem Nordwesten zurückgekehrt, hatte aber im Rekrutieren wenig Glück gehabt. Zwanzig Eingeborene waren das ganze Resultat einer elfwöchentlichen Kreuzfahrt, und der Kapitän, welcher für jeden angeworbenen Arbeiter fünf Dollar Prämie erhält, schien wenig zufrieden damit. Aber die Verhältnisse haben sich eben überall verschlechtert. Das Rekrutieren ist immer schwieriger geworden, da die Eingeborenen nicht mehr weg, und weder nach Queensland noch nach Samoa, gehen wollen, was man ihnen ja auch im Grunde genommen nicht verdenken kann. Auch die neuen Ankömmlinge mit der Ninafou, Eingeborene von den Admiralitäts-Inseln, Hermites und Gott weiß woher, schienen die Bedeutung ein Kreuzchen auf ein Stück Papier gekritzelt zu haben, welches sie drei Jahre von ihrer Heimat reißt und zur Arbeit zwingt, erst jetzt einzusehen, denn von den zwanzig liefen gleich sieben weg. Nun, Mioko ist eine kleine Insel, da können sie nicht weit kommen und schließlich giebt es ja auch Handschellen. Das ist freilich ein durchaus neues Gerät für Eingeborene, welche die ersten Weißen wie das Mädchen aus der Fremde betrachten, das jedem eine Gabe in Gestalt von Glasperlen, Kaliko und Tabak mitteilt. Ja, das anscheinend so uneigennützige Schenken und Hätscheln der Eingeborenen hört gar bald auf, wenn sie erst das verhängnisvolle Kreuzchen, ihre erste und einzige Schreibprobe, gemacht, oder wie es in der Werbersprache heißt, »gezeichnet« haben. Die weiß-schwarze Fraternité hat plötzlich einen Riß bekommen, und statt des freundlichen »come on, my good fellow« heißt es plötzlich: »work! you nigger!« Freilich Leute, welche die Südsee nie gesehen haben, die nur »die Knute der amerikanischen Baumwollenbarone«[S. 199] nach Tante Stowe kennen, die wissen über solche Verhältnisse am besten zu schreiben und zu sprechen; die denken nicht an Handschellen und was sonst Häßliches mit der »Labourtrade« zusammenhängt. Wer aber selbst, irgendwo in der Südsee, Eingeborene, die rechte Hand an die linke, in Handschellen paarweis, wie siamesische Zwillinge, aneinander gekettet umhergehen sah, nicht für einen Tag sondern wochenlang, der wird so recht an Onkel Toms Hütte erinnert worden sein. Handelte es sich doch nicht um Verbrecher, sondern nur um Ausreißer oder nach unseren modernen Begriffen um Leute, die sich ihrem Dienstverhältnis zu entziehen versuchten, was bei uns ja wohl nur eine Ordnungsstrafe nach sich ziehen würde.
Die vielen Schiffe, zu denen bald darauf noch S. M. Kreuzerkorvette Marie, Kommandant Kapitän z. S. Crokisius, einlief, nutzten uns übrigens in Bezug auf die so nötige Briefbeförderung nichts, und so blieb nichts anderes übrig, als selbst nach Cooktown, dem nächsten, ca. 1000 Meilen entfernten, australischen Hafen mit Post- und Telegraphenverbindung abzudampfen. Die Samoa wurde also so rasch als möglich seeklar gemacht, und wir begaben uns wieder auf die Reise, diesmal in hoher Gesellschaft, denn wir liefen mit der Marie zugleich aus. Im freien Fahrwasser des Georgs-Kanal nahmen wir Abschied, Hüte und Tücher wurden geschwenkt, die Flaggen senkten sich dreimal zum Gruß und die »Marie« dampfte Matupi zu, während wir unseren Kiel nach Süden wendeten. Ein gar herrlicher Anblick so ein stattliches Kriegsschiff von mehr als 2000 Tons und einer Besatzung von mehr als zweihundert Mann an Bord! Wie klein und unbedeutend erschien die »Samoa« neben diesem Riesen! Aber auch einem so stolzen Fahrzeuge drohen die heimtückischen Bauten der Korallentierchen mit Verderben, wie die Marie leider zu bald erfahren sollte: kaum eine Woche später saß sie auf dem Riff bei Nusa an der Nordwestspitze von Neu-Irland. Eine plötzlich aufspringende schwere Böe hatte das stolze Schiff[59] gerade beim Passieren der engen Nissel-Durchfahrt,[S. 200] in dem ohnehin gefährlichen Fahrwasser, auf das Riff getrieben, und nur unter den größten Anstrengungen gelang es, dasselbe abzubringen und vom Untergange zu retten. Freilich war es arg beschädigt, der Hintersteven und das Ruder geknickt und verbogen. Aber alle die Schäden wurden nach harter zweimonatlicher Arbeit soweit repariert, daß das Schiff die Reise nach Sydney fortsetzen konnte, eine Leistung unserer Marine, auf die wir stolz sein dürfen und welche seitens der englischen die vollste Anerkennung fand.
Ich hatte Nachricht über das Vorkommen eines reichen Kohlenschiefers in Port Breton an der Südspitze von Neu-Irland erhalten und beschloß hier vorzusprechen, um mich von der Wahrheit zu überzeugen, an der ich allerdings starke Zweifel hegte. Aber mir lag die Analyse dieses Kohlenschiefers von einem Professor in Sydney vor, und jedenfalls war die Sache umsomehr der Untersuchung wert, als es sich nur um einen kleinen Abstecher handelte. Wir sollten also den Schauplatz der Thaten des Marquis de Rays oder vielmehr seiner schwindelhaften Kolonisationsversuche kennen lernen, da er selbst ja nie dieses Land der Verheißung betrat. Der Herr Reichskommissar hatte freilich ernste Bedenken gegen einen Besuch jenes Platzes, wo die Hyäne erst vor kurzem zu strafen versuchte, denn er fürchtete, wir könnten infolge dieses Vorfalles von den Eingeborenen überfallen werden. Aber ich kannte die letzteren doch besser und wußte, daß der Rauch der Samoa genügen würde, sie schleunigst in die Berge zu jagen. Da war auch wenig Aussicht den gefürchteten Häuptling »Wallace« zu erwischen, dessen Inhaftnahme für das deutsche Reich wichtig sein sollte! Denn wir lebten ja mit Neu-Irland in Krieg, was die wenigsten gewußt haben werden; hörte ich doch selbst zu erstenmale von dieser bedenklichen politischen Lage. Aber die Samoa konnte es auch ohne Kanonen mit ganz Neu-Irland aufnehmen, deswegen brauchte ich mir keine Sorge zu machen; so dampften wir denn dem Feinde ruhig in den Rachen. Dieser Teil der Küste Neu-Irlands ist womöglich noch weniger versprechend als die nordwestliche, welche wir bisher kennen lernten. Nichts als steile,[S. 201] ziemlich hohe Gebirgsrücken, vom Fuße bis zum Scheitel dicht bewaldet, zuweilen etwas unterwaschenes Felsufer, selten schmaler Sandstrand, nirgends Kokospalmen oder andere Anzeichen menschlicher Siedelungen, das ist der Charakter dieser Küste. Port Breton ist um kein Haar besser und schlechter als Likelike (Lavinia-Bai), wo ich 1880 die letzten Reste der ersten französischen Expedition antraf. Zwei unbedeutende Einbuchtungen, von Carteret schon 1767 entdeckt und Irish- resp. English-Cove benannt, von den Erfindern des »Nouvelle France« aber in »Baie Française« und »Port St. Joseph« umgetauft, bilden den sogenannten Hafen Breton. Wir gingen nicht ohne Mühe vor Anker, da der Grund sehr unklar ist und ein Schiff kaum Raum zu schwingen hat, so daß es am besten gleich an den Uferbäumen festlegt. Durch die im Süden vorgelagerte Wallis-Insel (Lombom) wird der Ankerplatz übrigens vollständig geschützt.
Auch diese Insel ist hoch, dichtbewaldet und besteht wie die Küsten des Festlandes aus Korallfels, gehobenem Meeresboden, denn ich bemerkte an den Felswänden, weit höher als der Meeresspiegel, tote Austernbänke. Das sah wenig nach Kohlen aus! Von Maragano, »au Roi de Lam-Boum«, kaufte Kapitän Rabardy im Jahre 1882 ganz Neu-Irland, obwohl der Marquis schon drei Jahre früher 600000 Hektaren dieses Landes in Europa verkauft hatte und dasselbe später noch einmal in Manilla zu versilbern versuchte. Der Preis einer Hektare Landes oder vielmehr Steingerölls war von 5 Francs inzwischen auf 50 und höher gestiegen. Wir befanden uns also in dem berüchtigten Port Breton, der einstigen Hauptstadt Neu-Frankreichs, wo so viele Vermögen, Gesundheit, ja das Leben eingebüßt hatten. Die Emigranten, welche mit der vierten Expedition 1881 von Barcelona aus hinausgingen, gehörten zu einer ganz anderen Klasse von Leuten als die der vorhergehenden, die, zum großen Teil Abenteurer, sich längst in alle Winde verstreut hatten. Jetzt kamen gut situierte Leute heraus mit der festen Absicht, unter dem Banner des souveränen Marquis, für sich und ihre Familien eine neue Heimat zu gründen. Da finden wir unter anderen Herrn Tilmont mit Frau, vier erwachsenen Töchtern und zwei Knaben, der sein Vermögen von 25000 Francs[S. 202] flüssig gemacht hatte, wie in gleicher Weise die Familie Pitoy und soviele andere, die alle hier ein ungestörtes und behagliches Dasein zu finden hofften. Vater Pitoy studierte auf der Karte stillvergnügt sein neues Besitztum von 700 Hektaren. Es sollte nach seiner Heimatsstadt »Nancy« genannt werden, das kleine kühle Wässerchen »Moselle«! Ach, welche Enttäuschung für diese armen Leute, als sie nun endlich im gelobten Lande anlangten und ringsumher nichts als steile dichtbewaldete Berge erblickten! Da mag manchem das Herz gesunken sein, schon im Gedanken an Frau und Kinder, und für viele sollten sich diese Befürchtungen nur zu rasch erfüllen. Vater Pitoy fand unter seinen siebenhundert Hektaren Land nicht einen Daumen breit kulturfähiges, und den übrigen ging es nicht besser. Sie waren eben alle in der schändlichsten Weise betrogen worden, und Kummer und Elend, unterstützt von Fieber, raffte gar viele dahin, denen es daheim an nichts fehlte. Der brave Pitoy und seine Frau starben; ihre drei hilflosen Waisen blieben zurück, anderen erging es noch schlimmer, und die Feder sträubt sich niederzuschreiben, wie weit sich durch den Tod ihrer Angehörigen verlassene und alleinstehende Frauenspersonen erniedrigen mußten, nur um das bißchen Leben zu fristen. Und der Mann, welcher alle diese Leichtgläubigen verführt und ins Unglück gestürzt hatte, was wurde ihm dafür? Als die französischen Gerichte den Schwindler endlich erwischten, verurteilten sie ihn, nicht zum Galgen oder auf die Galeere, sondern er kam mit sieben Jahren Gefängnis davon, das war alles!
Ich ging wohlbewaffnet mit Kapitän Dallmann an Land, um nach dem Kohlenflötz zu forschen, das hier an einen mir näher bezeichneten Platz zu Tage treten sollte, aber unser Forschen war vergeblich. Die Kohlen, welche jener Analyse zu Grund lagen, mochten allerdings von hier, aber aus von den Franzosen zurückgelassenen Vorräten stammen. Das Flötz selbst existiert ebensowenig als die famose »Mine de cuivre« der Karte von Port Breton, welche im Journal »La Nouvelle France« publiziert wurde, jenem schwindelhaften Organ des Marquis, welches durch seine pomphaften Ankündigungen so viele Opfer auf den Leim lockte. Da ist neben zahlreichen Baulichkeiten[S. 203] und kultiviertem Terrain eine »Route carrossable«, ein »Parc à bestiaux« verzeichnet, aber alles existierte eben nur auf dem Papiere. Die fahrbare Straße erwies sich als ein schmaler Eingeborenenpfad; der Tierpark als ein kleines an der Bachmündung angeschwemmtes Inselchen, auf dem keine Ziege leben konnte und für ein »Plateau à défricher« ist überhaupt nirgends Platz vorhanden. Denn unmittelbar hinter dem kaum ein paar Tausend Schritt breiten Ufersaum steigen gleich die steilen Berge empor. Auch das kleine Flüßchen, welches man jetzt überall durchwaten konnte, windet sich bald durch Berge, und nirgends ist eine Spur jenes herrlichen Thales vorhanden, von welchen mir der Kapitän Rabardy, »Gouverneur provisoire« 1881 in Matupi erzählt hatte. Hier waren die Kaffeeplantagen projektiert, zu deren Anlage der »Genil« einige kümmerliche Pflänzchen mitbrachte, während die Wasserkraft des Bächleins, welche der sanguine Franzose auf 700 Pferdekraft schätzte, allerlei gewerbliche Anlagen treiben sollte. Wie schnell die gewaltige Fruchtbarkeit der Tropen, selbst in dem schlechten, mit Koralltrümmergestein besäten Boden von Port Breton, die Spuren des Menschen verwischt! Kaum mehr als zwei und ein halbes Jahr waren verflossen, und nur mit Mühe ließen sich einzelne Rudera der früheren Herrlichkeit entdecken. Niemand würde geglaubt haben, daß hier einmal eine Ansiedelung von ein paar Hundert Weißen bestand. Von der »Débarcadère« waren noch einige Pfähle vorhanden, sonst fanden wir nichts als etliche Bretter, Scherben, eine eiserne Trommel und die Sohle nebst Absatz eines einst eleganten Damenschuhs, den ich zum Andenken mitnahm. Welcher reizenden Französin mochte er angehört haben? Und welche Leidensgeschichte würde er erzählen können? Vielleicht ruhte die Trägerin auf dem Kirchhofe, von dem sich keine Spuren mehr erkennen ließen, da auch hier die üppige Vegetation der Tropen alles überwuchert hatte. Keine Tafel, kein Stein mit einem Kreuz bezeichnet mehr die Stelle, wo so viele brave Leute, fern von der Heimat, in Trübsal, Hunger und Elend ein frühes Grab fanden, verdorben und vergessen wie Port Breton, dessen traurige Geschichte für viele neu und nicht uninteressant gewesen sein dürfte.
[S. 204] Wir hatten bei unserer Landtour nur Fußspuren der Eingeborenen und eine kleine Taroplantage gesehen; als wir aber durch die Straße von Lombom dampften, ruderte ein Kanu eilig von der Insel nach dem Festlande, wo sich bald eine Anzahl Bewaffneter versammelten. Da wurden gewiß alle Vorkehrungen zu einem warmen Empfange getroffen und das Deck gefechtsklar gemacht? Ja, natürlich! Ich bewaffnete mich mit einem langen Fetzen roten Zeuges und rief so kräftig, als es meine Lungen erlaubten, nach Marango, dem Könige von Lombom, und dem gefürchteten Häuptling Wallace. Sie hüteten sich wohl der freundlichen Einladung zu folgen und beschränkten sich darauf, außer Schußweite mit ihren Speeren und Keulen zu fuchteln. Eine Kugel aus einem Winchester würde die Gesellschaft schnell auseinandergebracht haben. Aber vor mir waren sie sicher, ich habe niemals auf Eingeborene geschossen. Ja, ich würde auch den braven Wallace gut behandelt, ihm vielleicht ein Stück Tabak und dergleichen gegeben und gesagt haben: »Wallace dear! you no kill white men! bye and bye me make you all same« d. h. töte keinen Weißen, sonst machen wir es so: Pantomime des Aufhängens! Von dem durch die »Hyäne« zerstörten Dorfe sahen wir übrigens kaum eine Spur mehr, dagegen fanden wir die Übelthäter der Mioko lustig in dem nahen Port Praslin angesiedelt, sie gaben aber gleich Fersengeld. In solchen Lokalitäten vermag freilich kein Kriegsschiff etwas auszurichten, ja es kann selbst für Bewaffnete gefährlich werden, den Eingeborenen in das Dickicht dieser Berge zu folgen, in denen sich nur der Sohn der Wildnis behend zu bewegen weiß. Mit Strafexpeditionen hat es daher seine Schwierigkeiten; sie verlaufen meist wie vor 300 Jahren, als Don Pedro Sarmiento, der General von Mendana, die Eingeborenen der Salomons züchtigen wollte. Schon damals flüchteten sie unerreichbar in das Dickicht, und der General mußte sich, wie dies noch heute geschieht, mit Abbrennen und Vernichten der Siedelungen begnügen.
Von Kap St. George, der Südspitze Neu-Irlands, suchten wir einen südlichen Kurs zunächst nach der Gruppe Kirvirai oder dem Trobriand der Karten, da ich den östlichen Teil des Englischen Gebietes[S. 205] kennen lernen wollte, über welches wir nur durch Kapitän Moresby unterrichtet waren. Ihm ist (1873–74) die Aufnahme der Küste von Heath-Insel bis Huon-Golf, in der Luftlinie auf eine Strecke von 340 Meilen, zu verdanken, die bis dahin nur an ein paar Punkten von d'Entrecasteaux (1793) und Simpson (1872) gesichtet wurde. Durch Moresby erfuhren wir zuerst, daß nicht Südkap das äußerste Ende Neu-Guineas ist, sondern daß die Ostspitze eine ganz andere Konfiguration hat, wie sich am besten aus einer Vergleichung seiner Karte mit den früheren ergiebt. In der That, wohl keine Expedition hat soviel zur besseren Kenntnis von Neu-Guinea beigetragen, als die des »Basilisk« unter Kapitän (jetzt Admiral) Moresby und seiner trefflichen Offiziere.
Wir werden im folgenden den größten Teil dieses Gebietes kennen lernen, wohin ich drei verschiedene Reisen mit der Samoa unternahm, die nicht allein dem bloßen Besuche bei unseren Nachbarn, sondern auch anderen, wichtigeren Zwecken galten, denn damals hatte England sein Protektorat nur bis Ostkap erklärt. Um Wiederholungen zu vermeiden, gebe ich die Erlebnisse dieser verschiedenen Reisen hier vereint.
Kartographische Unkenntnis. — Längs der Westküste. — Eingeborene. — Eigentümlichkeiten derselben. — Haifischfang. — »Kaikai«. — Riesen-Yams. — Kanus. — Lagrandiere. — Otto Riff. — Lusancay-Lagune.
Schon in der Frühe des zweiten Tages seit unserer Abreise von Port Breton wurde Land gesichtet, dichtbewaldete, niedrige Inseln wie lange Waldstreifen, über welche die Karte nur sehr ungenügend Auskunft gab. Denn so wie Trobriand vor fast 100 Jahren von d'Entrecasteaux auf der Karte eingetragen wurde, so findet es sich heute noch verzeichnet, d. h. nur punktiert. Und doch ist die Hauptinsel Trobriand nicht unbedeutend, denn ihre Länge beträgt 20 bis 25[S. 206] Meilen. Wir gingen an der Westseite herab, an welcher ein guter Ankerplatz sein soll, konnten denselben aber nicht finden, weil der Kapitän noch vor Einbruch der Dunkelheit wieder in freiem Fahrwasser sein wollte, da es an Riffen hierherum eben nicht mangelt. Der Grund weshalb diese schöne Insel den weißen Mann bisher nicht reizte, war angesichts derselben sehr leicht zu begreifen und besteht in dem Mangel von Kokospalmen. In der That erblickten wir auch nicht eine Palme, obwohl solche gewiß vorkommen; nichts als dichter Urwald säumte gleich einem Gürtel ununterbrochen das Ufer, welches zuweilen aus kahlem Fels, seltener aus Sandstrand besteht. Aber hinter diesem Urwaldsgürtel befindet sich ausgedehntes, fruchtbares Land, in welchem die Eingeborenen ausgezeichneten Yams zeitigen, jenes stärkemehlhaltige Knollengewächs, welches in diesem Teile der Tropen die Kartoffel ersetzt. Trobriand wird daher zuweilen von kleinen Handelsfahrzeugen besucht, die hier in der günstigen Jahreszeit in wenigen Tagen eine ganze Ladung einhandeln können, wie mir aus meinen früheren Erfahrungen von Neu-Britannien her wohlbekannt war.
Wir hatten uns der Nordwestspitze der Insel kaum genähert, als sich schon Kanus mit Eingeborenen zeigten, die trotz der Brandung und dem hohen Seegang abkamen und nicht lange darauf den Dampfer umlagerten. Das waren gar eigentümliche Gesellen, die dem Anthropologen Kopfzerbrechen machen konnten. Nach dem vorherrschend schlichten Haar mußte man sie als Ozeanier ansprechen, aber es gab auch Individuen mit melanesischen Wollköpfen, ja Haarwolken, und man zieht sich am besten aus dieser verzwickten Frage heraus, wenn man die Trobriander für eine Mischlingsrasse erklärt. Dafür sprach auch die erhebliche individuelle Verschiedenheit in der Physiognomie, wenn auch hier ozeanischer Typus vorzuherrschen schien. Die Leute waren übrigens nicht dunkler als z. B. die Gilberts-Insulaner, aber so helle Papuas findet man überall.
Sie trugen in eigentümlicher Weise ein breites Stück Pandanusblatt zwischen den Schenkeln durchgezogen, das wulstartig in einem dicken Leibstrick befestigt war. Vielen genügte indes hinter- und[S. 207] vorderseits ein Blatt in dem letzteren befestigt als Bekleidung. Der übrige Körperschmuck war gleich Null: Halsstrickchen, geflochtene Armbänder, hie und da ein Reif aus Schildpatt im Septum. Es gab demnach wenig einzuhandeln, dieses Wenige war aber sehr interessant. So runde, flache Holzschüsseln mit eingravierter Randverzierung, desgleichen Wasserschöpfer, kugelrunde Kalkkalebassen in äußerst schwungvollen, eingebrannten Mustern ornamentiert, besonders schöne Fischnetze und hölzerne Schilde in ganz eigentümlicher Form und kunstvoller Bemalung, wie sie Fig. 2 Taf. XII des Ethnologischen Atlas zeigt. An Waffen besaßen die Insulaner außerdem nur noch Speere, zum Teil mit Schnitzerei verziert, sowie kurze, schwertartige Handkeulen (ganz wie Atl. XI, 4), darunter Exemplare aus Ebenholz, das auf Trobriand vorkommen soll. An den Schilden konnte man sehen, daß auch diese friedlichen Inselbewohner nicht immer in Frieden leben, denn in dem einen zählte ich nicht weniger als elf abgebrochene Speerspitzen. Eine Menge Gegenstände (z. B. die schönen Kalkkalebassen) werden jedoch von Woodlark-Insel eingetauscht, deren Bewohner mit ihren großen, seetüchtigen Kanus weite Handelsreisen unternehmen. Fischerei scheint übrigens ein Haupterwerb von Trobriand und namentlich der Fang von Haifischen betrieben zu werden. Dafür sprachen die großen, an anderthalb Fuß langen hölzernen Haken (T. IX, 9), welche die Eingeborenen nur sehr ungern weggaben. Man konnte an diesen Haken deutlich die Spuren der Zähne sehen, welche die Seeungeheuer zurückgelassen hatten, und die Eingeborenen wußten in sehr drastischer Weise pantomimisch die vergeblichen Anstrengungen des gefangenen Hai darzustellen, bis er endlich erschlagen wird. Zum Anlocken des Hais bedient man sich besonderer Rasseln, die aus einem hölzernen Reif bestehen, an welchem eine Anzahl halbdurchschnittener Kokosnußschalen befestigt sind, wie ich dieselben schon aus Neu-Britannien kannte.
Unsere eisernen Angelhaken, selbst die großen mit Kette versehenen Haifischhaken, machten übrigens keinerlei Eindruck auf die Eingeborenen, die nach ihrer Methode jedenfalls bessere Erfolge erzielen. Werfen doch selbst Europäer, welche lange in der Südsee[S. 208] leben, unsere Fischhaken beiseite und bedienen sich der der Eingeborenen.
Man konnte übrigens nicht bemerken, daß viele Schiffe hier vorsprechen, da die Eingeborenen weder Glasperlen noch sonst etwas von europäischen Erzeugnissen besaßen und selbst Rauchtabak nicht kannten und verlangten. Ihr ganzer englischer Sprachschatz bestand in den Wörtern: Tomihawk (Beil), knife (Messer) und beads (Perlen). Aber was sie hauptsächlich verlangten, war »Toke«, d. h. Hobeleisen oder Flacheisen, die ihnen lieber waren als Beile. Aus Glasperlen machten sie sich nichts, ebensowenig aus Zeug, und Spiegel flößten ihnen Furcht ein. Auch das Wort »Yams« kannten sie und »kaikai«! Wie mich das anheimelte! Es ist dies ein aus Ostpolynesien stammendes Wort, das sich durch Schiffsverkehr bis Neu-Britannien verbreitet hat, und der erste Ausdruck, welchen der Kanaker im Verkehr mit Weißen oder umgekehrt, lernt, denn es bedeutet »essen«! Wie oft hatte ich dieses »kaikai« gehört! Dort suchen z. B. Weiber häßliche, schwarze Sumpfschnecken; man fragt wozu: »kaikai«; hier bringt ein Junge einen widerlichen Tintenfisch und sagt vergnügt »kaikai«, ein anderer streichelt eine Buschratte mit »kaikai«, unter »kaikai« werden große Käferlarven aus mulmigem Holz ausgegraben, und als ich mich einst in Neu-Irland nach einem Menschenschädel erkundigte, der an einem Baumaste hing, riefen alle schmunzelnd »kaikai«! Ja, dieses »kaikai« ist charakteristisch, aber in Neu-Guinea nicht bekannt.
Von Yams brachten die Leute übrigens eine Menge an, darunter wahre Riesenexemplare von 12 bis 17 Pfund Schwere und fast sechs Fuß Länge. Danach zu urteilen, muß die Insel äußerst fruchtbaren Boden besitzen. Auch Pandanus und Bündel großer Bananen wurden zum Kauf angeboten, aber keine Kokosnüsse, obwohl dieselben vorkommen, wie die Wassergefäße und Körbe zeigten. Interessant für den Ornithologen waren lebende Exemplare des grünen Papageis (Eclectus polychlorus) und einer eigenen kleinen Kakaduart mit gelber Haube (Cacatua Trobriandi, Finsch).
Jedenfalls ist die Insel bisher von Werbeschiffen verschont geblieben, denn die Eingeborenen kamen ohne Scheu an Bord, wenn[S. 209] auch mit Widerstreben in die Kajüte. Aber man mußte vor ihren Fingern auf der Hut sein, wie ich erst bemerkte, als ich denselben Wasserschöpfer zum zweitenmale kaufte. Ja, Diebsgelüste scheint einmal in der ganzen Menschheit zu stecken. Die Leute waren zwar recht laut und lärmend, wozu ein eigentümliches Bellen als Zeichen der Verwunderung nicht wenig beitrug, aber durchaus harmlos. In der Begrüßung zeigten sie sich zu meiner Überraschung als »Nasenreiber«, was wiederum für Polynesien spricht, ethnologisch zwar sehr interessant, aber in der Praxis nicht gerade ganz angenehm ist. Ich spielte daher lieber den Dummen, denn ich wußte aus Erfahrung, daß die Sache kein Ende nimmt, wenn man erst mit einem auf diese Weise Brüderschaft gemacht hat.
Zu den ethnologischen Eigentümlichkeiten gehörte übrigens auch die besondere Bauart der Kanus, sowie die Form der Ruder, im übrigen stimmten die meisten Gegenstände, auch die Bekleidung mit denen überein, wie wir sie in den d'Entrecasteaux und an der Ostspitze Neu-Guineas kennen lernten. Jedenfalls wird Trobriand von Normanby, Welle und Woodlark-Insel aus besucht, da die Trobriander wohl selbst keine Handelsreisen unternehmen. Schon ihre Kanus ohne Segelgeschirr sind für größere Seefahrten ungeeignet. Einige derselben waren an den Schnäbeln mit Schnitzerei verziert, wovon der Atlas (T. VII 6) eine Probe giebt. Das Wort »Kirvirai«, wie bei den Eingeborenen die Insel heißen soll, kannte übrigens keiner, und ich habe den Namen derselben überhaupt nicht erfahren können, denn Kebole oder Kaibol bezeichnete offenbar nur das Heimatsdorf der Leute in den Kanus.
Wir gingen um Kap Denis an der Ostseite von Trobriand herab, die aus Steilufer besteht und für Schiffe unzugänglich scheint, wie Lagrandiere, das nur durch eine schmale Straße von der ersteren Insel getrennt wie eine Fortsetzung derselben erscheint und genau denselben Charakter zeigt. Wir wollten von hier einen westlichen Kurs nach der Küste von Neu-Guinea steuern, fanden aber unseren Weg durch ein Riff vorgeschrieben, dem wir über 30 Meilen bis fast zu den Amphlett-Inseln in südlicher Richtung folgten, und welches[S. 210] unsere Navigateure Otto-Riff tauften. Es bildet die Südostgrenze der Lusancay-Lagune, nach Findlay der größten der Welt, die sich über drei Längen- und ein und ein viertel Breitengrad erstreckt. Dieses Riff ist bis heute noch ebenso unbekannt geblieben als die nördliche Grenze der Lagune, das Lusancay-Riff, welches die Karten nur nach den flüchtigen Aufnahmen von d'Entrecasteaux (1793) wiedergeben.
Ungenügende Kenntnis. — Welle-Insel. — Nordküste von Normanby. — Weihnachtsbucht. — Unsere Weihnachtsfeier. — Scheu der Eingeborenen. — Verfall der Steinzeit. — Eigentümliche ethnologische Provinz. — Ausgezeichnete Fahrzeuge. — Bekleidungsmatten. — Spondylus-Muschelplättchen. — Liebenswürdigkeit der Eingeborenen. — Urgestein. — Hausbau. — Auf totem Riff. — Ostküste von Normanby. — Kolossale Kokosnüsse. — Gutheil-Bucht. — Friedliche Eingeborene. — Kap Ventenat. — Göschen-Straße. — Westküste von Normanby. — Dawson-Straße. — Exkursion. — Goulvain oder Ulebubu. — Eingeborene — sind Kannibalen. — Ostspitze von Fergusson. — Besuch eines Dorfes. — Musterplantage. — Manucodia Comrii. — Südküste von Fergusson. — Herrliches Kulturland — Kap Mourilyan. — Blick auf Goodenough.
Wir hatten den an 6000 Fuß hohen Berg Kilkerran auf Fergusson-Insel schon von Trobriand aus gesehen, und jetzt entfalteten sich die malerischen Gebirge der d'Entrecasteaux-Inseln immer deutlicher vor unseren Augen.
Die nach ihrem Entdecker benannte Gruppe wurde von diesem (1793) nur gesichtet und erst 80 Jahre später durch Moresby genauer aufgenommen. Durch ihn erhielten wir zuerst Nachweis über die richtige Lage der drei Hauptinseln: Normanby, Fergusson und Goodenough, die alle von vulkanischer Formation und vorherrschend gebirgig sind. Moresby hat uns übrigens nur mit der Westküste bekannt gemacht, und die östliche ist bis heute nur sehr unvollkommen aufgenommen. Der Naturaliensammler Andrew Goldie besuchte 1882 von Port Moresby in seinem kleinen Schuner Alice Mead die Westseite von Normanby und Fergusson, hat aber über diese[S. 211] interessante Fahrt, wie seine vielen Reisen in Neu-Guinea überhaupt, wenig publiziert. Und was Moresby mitteilt ist auch nur sehr gering, so daß die nachfolgenden Blätter umsomehr von Interesse sein dürften, als sie einige bisher nicht besuchte Lokalitäten besprechen.
Wir dampften längs der Ostseite von Welle, einer langen, dichtbewaldeten, niedrigen Insel, mit wenigen grünen Hügeln, und sahen die tiefe Bai vor uns, welche von der knieförmigen Einbuchtung der Nordseite von Normanby gebildet wird, wo wir einen Ankerplatz zu finden hofften. Und wir fanden ihn. In einer hübschen, malerisch von Bergen umschlossenen Bucht, mit dicht von Kokospalmen bestandenem Ufer, unter denen freundliche Häuser hervorguckten, ging die Samoa zu Anker, gerade am Weihnachtstage, dem zu Ehren wir dieselbe Weihnachtsbucht benannten. War es doch der Tag, an welchem daheim sich Millionen anschickten, das liebe Christfest zu feiern. Uns war kein Weihnachtsbaum beschieden, keine Feier bereitet. Und dennoch als die Sonne hinter den Bergen verschwand, als die eigentümlichen grünlichen, bläulichen und rötlichen Tinten des Zodiakallichtes allmählich in das tiefe Schwarz der Nacht verflossen, da begann auch unsere heilige Nacht. Das Firmament hatte seine Millionen Lichterchen angezündet, Sterne und Sternchen flimmerten; vor allem bemerkbar der Orion und der liebe Gefährte der südlichen Nacht, das südliche Kreuz. Kein feierlicher Glockenton rief zur Mette; nur das Zirpen der Cikaden, das rauhe Gequiek fliegender Hunde und andere Tierstimmen tönten vom Ufer herüber, bekannte Laute, die unsere Gedanken nicht abzulenken vermochten. Wo dieselben weilten? Das ist wohl unschwer zu erraten. Weit, weit weg vom südlichen Kreuz, von den Kokospalmen, vom Gekreisch der fliegenden Hunde, da, wo man an diesem Abende in trautem Kreise am warmen Ofen sitzt und sich des lieben Christfestes freut, während draußen die Schneeflocken herabwirbeln. Dort weilte jeder mit seinen Gedanken still für sich, — und als die letzte Pfeife verglommen, suchte jeder das Lager und versuchte auszuruhen von den Mühen und der Hitze des Tages. Das war unser Christfest in den Tropen! Für uns gab es keine Feier, kein Feiern! — Aber die[S. 212] Mannschaft durfte sich etwas anthun, und wohl zum erstenmale hörten die alten Kokospalmen und die scheuen Eingeborenen aus kräftigen deutschen Kehlen die »Wacht am Rhein« und »Stille Nacht! Heilige Nacht«! Eine gar wundersame heilige Nacht, eine Tropennacht!
Die Eingeborenen zeigten sich anfangs sehr scheu, kein Kanu kam längsseit, wie dies sonst gewöhnlich zu geschehen pflegt, und als ich zum erstenmale an Land ging, fand ich die Häuser verlassen. Die Leute waren geflüchtet, da sie uns wahrscheinlich für Werber hielten, die offenbar hier gehaust hatten. Das ließ sich an den vielen europäischen Erzeugnissen erkennen, welche die Eingeborenen besaßen, als sie nach und nach in Verkehr mit uns traten. Obwohl sie kein Wort Englisch verstanden, fand doch Tabak, und was merkwürdiger war, auch Thonpfeifen und Spiegel Nachfrage. Eisen war weniger begehrt, denn jeder Mann, ja selbst der Knabe besaß eine Axt; auch zwölfzöllige Messer kannte man bereits. Mit der guten alten Steinzeit war es daher vorbei und diese Eingeborenen bereits in dem Civilisationsstadium von Bandeisen. Mit solchen statt der früheren Steinklingen waren diese Äxte (Ira) bewehrt und zwar in einer eigentümlichen Weise, die für ganz Ost-Neu-Guinea charakteristisch wird. Die Schärfe der Klinge steht nämlich nicht quer zu dem Stiele, wie sonst (vergl. S. 63), sondern in gleicher Flucht mit dem letzteren. Die Abbildung des Atlas (T. I, 8) zeigt eine solche Axt. Der hölzerne mit Schnitzerei verzierte Stiel stammt noch aus der Steinzeit, die hier vielleicht noch wenige Jahre vorher regierte. Aber man sah, daß solche Arbeiten schon rar wurden, denn sobald Eingeborene erst Eisen haben, ist es mit ihrer Kunstfertigkeit zu Ende, statt geschickter und fleißiger werden sie ungeschickt und faul, das ist eine Thatsache, die sich überall wiederholt, und die mich weiter nicht verwunderte. Von guten Sachen konnte ich nur noch Reste sammeln, welche von der bewundernswerten Kunstfertigkeit der Eingeborenen Zeugnis ablegten. Hervorragend sind die schwungvollen Muster der eingravierten Verzierungen an Holzgeräten, die meist aus eleganten Schnörkeln bestehen und für ganz Südost-Neu-Guinea charakteristisch werden. In der That bilden die d'Entrecasteaux,[S. 213] mit Trobriand, der Ostspitze Neu-Guineas und dem vorgelagerten Archipel bis Teste-Insel hin, wahrscheinlich auch die Louisiade mit einbegriffen, eine eigene ethnologische Provinz, die sich durch manche Eigentümlichkeiten auszeichnet. Dahin gehört die besondere Ornamentik, von der die Abbildungen des Atlas (III, 4, XI, 4, 5) Proben geben, welche sich selbst bei kleinen Gegenständen (wie z. B. T. V. 2, 3) wiederholt, die Befestigung der Steinbeilklingen, das Verwenden von roten Muschelplättchen (Spondylus) zu Schmuck, die hohe Entwickelung in der Baukunst von Fahrzeugen und — vorgreifend, die weniger angenehme Sitte — der Kannibalismus!
Was die Fahrzeuge anbetrifft, so erheben sich dieselben weit über die bisher gesehenen und übertreffen selbst die berühmten seetüchtigen Kanus, wie sie früher in den Marshall-Inseln gemacht wurden, mit denen sie aber nichts gemein haben. Zwar besteht auch bei den hiesigen Kanus der Kiel aus einem mächtigen, ausgehöhltem Baumstamme, aber an demselben sind halbrunde Querhölzer als Rippen und an diese klinkerförmige Seitenbretter befestigt (wie dies der Querschnitt Atl. VI, F. 3 zeigt). Dadurch wird das Fahrzeug eben viel weiter und erinnert mehr an ein Schiffsboot nach europäischem Muster als an ein gewöhnliches Kanu (wie z. B. Fig. 1 von Bongu). Die Seitenborde sind an Stern und Bug mit einem senkrechten Brett verbunden, das häufig mit Schnitzwerk verziert ist. Alle Teile des Fahrzeuges sind zusammengebunden und die Verbindungsstellen mit einem Kitte verschmiert; doch muß, wie bei allen Kanus, fleißig geschöpft werden. Sehr eigentümlich und charakteristisch erscheint das Auslegergeschirr. Der Auslegerbalken, fast so lang als das Fahrzeug selbst, ist ungeheuer dick und so groß, daß sich aus ihm allein ein gewöhnliches Baumstamm-Kanu zimmern ließe. Dieser Balancier ist durch 10 Querstangen, mittelst eingeschlagener doppelter Stützen, (vergl. VI. 4) mit dem Kanu verbunden, aber ungewöhnlich nahe, wie wir dies zuerst in Trobriand sahen. Die Entfernung zwischen Kanu und Balancier beträgt nämlich nur einen Meter, und da die Querstangen dicht mit Stäben belegt sind, so wird dadurch an einer Längsseite des Kanus eine Plattform gebildet. Die Spitze des Kiels[S. 214] ragt an beiden Seiten wenig vor und ist je mit dem Querbrett an Bug und Stern durch ein senkrechtes Längsbrett verbunden, das mit, oft durchbrochen gearbeiteter, Schnitzerei verziert ist (Taf. VII, 7). Außerdem sind an den Spitzen Ovulamuscheln, Faserbüschel von Pandanusblatt und dergleichen angebracht, auch die Seitenborde häufig mit Malerei geschmückt (z. B. rot und schwarze Fische T. VII. 8). Diese Kanus führen ein sehr großes, oblonges Segel (VIII. 8) aus Mattengeflecht und laufen sehr schnell vor dem Winde. Sie sind bis 20 Meter lang, also sehr respektable Fahrzeuge, und dienen für Handelsfahrten und Kriegszüge, da sie eine große Anzahl Menschen transportieren können.

Die Bewohner der Weihnachtsbucht besaßen übrigens nur sehr kleine Kanus, wahre Einspänner, denn sie vermögen nur einen Erwachsenen zu tragen, wie dies unsere Abbildung zeigt. Ein solches Kanu ist aber auch nur drei Meter lang, übrigens eine sehr geschickte Arbeit, von welcher ein von mir mitgebrachtes Stück das Berliner Museum ziert.
Die Bekleidung der Männer erregte ebenfalls als neu mein Interesse. Sie bestand, statt aus der sonst üblichen Tapa (Baumrinde), aus einer Matte von Pandanusblatt (Gigi), die um die Lenden geschlagen wird und von weitem ganz wie eine Badehose kleidet. Diese Matten sind zusammengenäht und zuweilen in hübschen Mustern marmoriert, die durch Eindrücke in das noch grüne Blatt hervorgebracht werden[S. 215] und sehr elegant aussehen. Auch diese Bekleidungsmatten (T. XVI. 6) gehören zu den Charakterstücken der genannten ethnologischen Provinz.
Schmuck war, wie gewöhnlich, nur wenig zu sehen, darunter aber Halsketten aus den erwähnten roten Muschelplättchen, die auch als Ohr- und Nasenschmuck, wie sonst vielfach, Verwendung finden. Diese Muschelscheibchen sind flach, rund, durchbohrt, etwa so groß als ein Chemisettknopf und schon des Materials wegen wertvoll. Die Spondylusmuschel, eine Klappmuschel, lebt nämlich nur in tieferem Wasser und ist, da sie mit der unteren Schale obendrein am Gestein festsitzt, nicht so leicht zu erlangen. Es verdient Beachtung, daß an der ganzen Nordostküste Neu-Guineas, wie im Bismarck-Archipel, Spondylusschmuck nicht benutzt wird, dagegen erst wieder in Mikronesien, in den Marshalls und Karolinen, eine hervorragende Rolle spielt. Unter den prähistorischen Resten, welche ich in den Ruinen auf Nanmatal auf Ponapé ausgrub, fand ich eine Menge solcher Muschelschalen. Die gegenwärtigen Bewohner Ponapés pflegten sich mit den Überbleibseln des Kunstfleißes ihrer Vorfahren zu schmücken, da sie die Anfertigung bereits verlernt hatten. Spondylusscheibchen haben an der ganzen Südostküste von Neu-Guinea Wert und bilden überall ein geschätztes Tauschmittel. Noch ein anderes, welches mir ebenfalls von dort bekannt war, fand ich in Weihnachtsbucht, nämlich Armringe aus dem Querschnitt einer großen Kegelschnecke (Conus millepunctatus), die unter die Kostbarkeiten der Papuas zählen. In Port Moresby wird ein solches Armband, Toia genannt, gleich 350 Pfund Sago gerechnet. Zirkelrunde Eberhauer (T. XXI 2), bekanntlich der kostbarste Schmuck, welche früher in den d'Entrecasteaux häufig waren, gab es nicht mehr.
Die äußere Erscheinung der Papuas von Weihnachtsbucht war keine vorteilhafte, zumal Schuppenkrankheit (Ichthyosis) unter ihnen sehr florierte. Im ganzen erschienen sie klein und schwächlich; am meisten die Weiber, unter denen es wenig passable Gesichter gab, desto niedlicher waren aber, wie immer, die Kinder. Die Männer trugen das Haar meist in eine Wolke aufgebauscht; im Nacken aber[S. 216] mit Vorliebe verfilzte Haarzotteln, in langen Strängen bis in den Nacken herabhängend, die an der ganzen Ostspitze beliebt sind (vergl. Abbildung eines Mannes von Teste-Insel Nr. 60), übrigens auch in Astrolabe-Bai vorkommen (vergl. S. 39). Neben kräuslichem und lockigem Haar beobachtete ich hier auch durchaus schlichtes und natürlich fuchsrotes, wie wir es in Europa kennen, eine Färbung, welche ich bisher bei Papuas nicht gesehen hatte.
Nachdem die Eingeborenen ihre erste Furcht überwunden und unsere friedlichen Absichten begriffen, wurden sie bald zutraulich und zeigten sich als die liebenswürdigsten Menschen. Bei unseren Ausflügen waren wir stets von einer Anzahl Freiwilliger begleitet, die sich unserer in einer Weise annahmen, wie ich dieselbe bisher nicht kennen gelernt hatte. Unsere Führer suchten jedes Hindernis zu beseitigen, indem sie im Wege stehende Äste wegbogen oder abhackten und uns bei jeder beschwerlichen Stelle zeigten, wo wir den Fuß hinsetzen sollten; in der That eine Aufmerksamkeit, die dem civilisiertesten Menschen Ehre gemacht haben würde. Und da wird noch von Wilden gesprochen und geschrieben!
Obwohl das Ufer überall Korallformation verriet, so bestanden die steilen Berge doch aus Urgestein, und zwar einem quarzreichen Glimmerschiefer, der mehr als anderwärts für das Vorkommen von Gold zu sprechen schien. Aber leider hatten da Katzen gesessen; ich fand nur »Katzengold«! Wie im Ufervorland fehlte es auch in den Bergen nicht an gutgepflegten Plantagen, die mit Vorliebe an den steilsten Abhängen angelegt werden, wie wir dies später überall an der Südostspitze fanden. Neben Landbau wird, wie fast allenthalben, Fischfang betrieben, wie die schönen Netze zeigten. Die hölzernen Schwimmer derselben waren zuweilen mit Schnitzwerk versehen (vergl. Atlas IX, 2), aber noch von früher her, denn jetzt erfüllten gewöhnliche Holzstückchen den Zweck. Von Waffen sah ich nur Speere (Gita) und kurze hölzerne Handkeulen (Atlas T. XI, 4, 5); auch kennt man die Schleuder. Pfeil und Bogen, sowie Schilde sind unbekannt.
Die Siedelung in der Weihnachtsbucht war übrigens keine große, aber die Häuser zeigten eigentümliche Bauart, wie die Abbildung am[S. 218] besten veranschaulicht. Die Häuser sind alle klein und zeichnen sich durch Schmalheit, wie die sattelförmige Einbiegung der Dachfirste aus. Gewöhnlich ist die ganze Vorderseite offen und wird mit Matten verhangen. Schnitzerei fand sich an den Häusern nicht. Bei den Häusern konnte man auch die Grabstätten erkennen, einige Schieferplatten mit bunten Blattpflanzen (Crotons) umgeben. In den Ästen eines sehr großen, an vier Fuß hohen Croton bemerkte ich eine sonderbare Röhre aus den Blattscheiden der Sagopalme, die ich natürlich untersuchen mußte, obwohl die Eingeborenen sehr dagegen waren. Sie enthielt sechs Schädel, wohl von Anverwandten, da sie nicht verkauft wurden. Hunde und Schweine gab es nur spärlich. Die ersteren unterschieden sich von der vorher (S. 53) beschriebenen Rasse durch geringere Größe und erinnerten an unsere Terriers; auch hatte man den Tieren Ohren und Schwanz abgeschnitten und dadurch ihre Schönheit eben nicht erhöht.
Die Wünsche unserer neuen Freunde auf Verlängerung unseres Besuches wären, sehr gegen unseren Willen, bald erfüllt worden, denn die Samoa befand sich plötzlich auf totem Riff, das dem Seefahrer kein Warnungszeichen durch Brandung giebt. Unter dem Kiele zeigte sich der mit grünlichen, bräunlichen und weißlichen Korallen wie gepflasterte Meeresboden, ein zwar sehr interessanter aber unheimlicher Anblick, auf den man gern verzichtet. Es sind die sogenannten Pilzkorallen (mushroom-corals) der englischen Seefahrer, die aus Tiefen von 20 bis 30 Faden bis nahe unter den Wasserspiegel wachsen. Wenige Zoll können da unter Umständen für das Wohl oder Wehe des Schiffes entscheidend werden, und jeder atmete freier auf, als die trügerischen Gebilde wieder verschwunden waren. Die Aussicht, möglicherweise in der Weihnachtsbucht bei Kokosnüssen und dergl. tropischer Verpflegung auch Ostern feiern zu müssen, hatte durchaus nichts Verlockendes. Selbst bei der größten Vorsicht ist in jenen Gewässern die Möglichkeit des Festsitzens vorhanden, und auch die Samoa entging nur mit knapper Not dieser Gefahr, indem sie ein paarmal das Riff streifte. Dabei kamen Kapitän Dallmann und sein erster Offizier oft tagelang nicht aus dem luftigen Sitz auf der großen[S. 219] Raa (vergl. Abbild. S. 17) herab, der durch ein Brettchen nicht sonderlich bequemer gemacht worden war. Riffe lassen sich nämlich nur von einem erhöhten Punkte aus beobachten, sind dann oft auf zwei bis drei Meilen sichtbar, während sie vom Schiffsbord oder Boot aus manchmal auf 20 Schritt unbemerkt bleiben. Freilich kommt es hauptsächlich auf die Beleuchtung und den Stand der Sonne an; bescheint die letztere das Wasser zu grell, so wird totes Riff häufig erst sichtbar, wenn sich das Schiff bereits auf demselben befindet, wie in diesem Falle mit der Samoa.
Wir hatten Kap Pierson passiert und dampften längs der Südostküste von Normanby herab, die durchgehends bergig bis gebirgig ist, aber viel Kulturland und Kokospalmen, oft wahre Wälder von solchen aufzuweisen hat. Überall sieht man ausgedehnte Plantagen, Kokoshaine und Fußpfade bis hoch in die Berge hinauf, aber trotz diesen deutlichen Zeichen des Bewohntseins im ganzen wenig Siedelungen und Menschen. Die letzteren zeigten sich sehr mißtrauisch, und nur in dem am meisten bevölkerten Küstenstriche um Kap Pierson kamen Eingeborene in fünf Kanus ab, die Kokosnüsse anboten und dafür Messer, Tabak und Streichhölzer verlangten. Aber nur einer vermochte diese Wünsche in englischen Vokabeln auszudrücken, ein gar seltsamer Kumpan in doppelter Wollgarnitur, die er jedenfalls der Freigebigkeit eines englischen Kriegsschiffes verdankte. Ja, wenn erst das Wollregime auch bei den Tropensöhnen sich in dieser Fülle eingeführt hat (der Mann trug allein drei Hemden übereinander!), dann wird diese Industrie einen ungeahnten Aufschwung nehmen. Zahlungsfähig sind die Leute ja, denn sie brachten Kokosnüsse von ungewöhnlicher Größe, die man für Kürbisse halten konnte. Manche Nüsse wogen acht bis elf Pfund und maßen 68 bis 73 Centimeter im Umfange; versprechende Aussichten für Koprastationen.
Da der Kapitän das riffreiche, schwierige Fahrwasser südlich von Kap Ventenat nur in der günstigsten Tagesbeleuchtung passieren wollte, so mußte für die Nacht ein passender Ankerplatz gesucht werden, obwohl es erst drei Uhr nachmittags war. Ein solcher findet sich nicht immer so leicht, und der in den Tropen so früh einbrechende[S. 220] Abend mahnt zu größerer Eile, denn gewöhnlich fängt es schon nach sechs Uhr an dunkel zu werden. Glücklicherweise brauchten wir diesmal nicht lange zu suchen, und konnten bald in einer flachen Bucht, die ich »Gutheil« benannte, zu Anker gehen. Sie besteht aus bewaldetem Vorland, das rings von steilen Bergen, längs der Wasserkante von einem breiten Sandstrande begrenzt wird, und ist in der südlichen Ecke durch einen mit Buschwerk begrünten Felsen, Small-Island der Karten, kenntlich.
Das Fehlen von Kokospalmen ließ dasselbe auch hinsichtlich der Bewohner erwarten, aber kaum hatten wir den Fuß ans Land gesetzt, so erschienen auch Eingeborene, hielten sich jedoch in respektvoller Ferne. Erst nach und nach gelang es einige beherzte Burschen heranzulocken, die sich als Führer in die Berge anboten. In der nördlichen Ecke mündet, durch Treibholz und Barre versperrt, ein hübscher Fluß, an dem wahrscheinlich die Siedelungen der Eingeborenen liegen, denn die scheuen Mädchen verschwanden in dieser Richtung. Auch am südlichen Ende der Bucht mündet ein Fluß, dessen rechtes Ufer zum Teil von steilen Felswänden gebildet wird. Sie bestehen aus einem quarzreichen Schiefer, aber ich suchte in dem ausgetrockneten Flußbett, wie zu erwarten, vergebens nach »Nuggets« (Goldkörnern); denn im Goldsuchen habe ich ja niemals Glück gehabt. Dagegen fand ich in den Bergen hübsche Baumfarne, die mir neu waren, aber nichts nützten. Eingeborene hatten sich inzwischen in großer Anzahl angesammelt, betrugen sich aber sehr artig und überreichten uns buntblättrige Crotons und rote Hibiscusblumen. Ein glatzköpfiger Alter hielt mir in erregter Weise eine Standrede, deren Sinn sich wohl begreifen ließ. Es handelte sich wieder um die alte Geschichte: Rekrutieren von Arbeiter-Werbeschiffen! Solche Vorgänge können für friedlich nachfolgende Weiße, wie wir es waren, oft verhängnisvoll werden, und es ist in der That zu verwundern, daß uns niemals etwas zustieß. Als z. B. Kapitän Dallmann und ich keuchend den Berg hinaufkletterten wäre es für die Eingeborenen ein leichtes gewesen uns zu erschlagen. Ich kann es daher in dankbarer Erinnerung nicht oft genug aussprechen:[S. 221] »Wahrlich, jene nackten Söhne der Wildnis sind längst keine Wilden!« Und als nach Einbruch der Dunkelheit allenthalben an den Bergen Feuer blinkten, bei deren Scheine die Eingeborenen von den weißen Fremdlingen plaudern mochten, da fiel mir das schöne Schriftwort ein: »Selig sind die Friedfertigen!« denn auch diese braunen Brüder werden Gottes Kinder heißen!
In der Frühe des anderen Morgens passierten wir Kap Ventenat, die Südostspitze von Normanby, und damit traten nicht nur nach Süd, sondern auch nach West neue interessante wechselnde Landschaftsbilder hervor. In dem Gewirr von Riffen, Sandbänken, Inselchen und Inseln dampften wir zunächst am Nordrande des »Galgenriffs«, an dem so leicht ein Schiff hängen bleiben und den Hals brechen kann, der Göschen-Straße zu, welche Neu-Guinea von der Normanby-Insel trennt. Der Südrand der letzteren erhebt sich zu dem 3000 bis 3500 Fuß hohen Prevost-Gebirge, das viel kultiviertes Land der Eingeborenen zeigt, ebenso wie die malerische an 1000 Fuß hohe Lydia-Insel, die eigentlich aus drei Inseln besteht. Nach Süd begrenzt gebirgiges Land den Horizont; es sind die Inseln des Moresby-Archipel, die d'Entrecasteaux bereits 1793 auf 28 Meilen Entfernung sichtete, aber in nur zu leicht begreiflicher Weise für die Ostspitze Neu-Guineas hielt.
Wir werden die letztere noch kennen lernen, dampfen aber jetzt, einen späteren Besuch der d'Entrecasteaux an dieser Stelle einschaltend, der Westküste von Normanby zu. Ihre südlichste Ecke, Kap Prevost, mit dem gleichnamigen, an 3500 Fuß hohen, steilen Berge, bildet die höchste Erhebung, die nach Norden allmählich abfällt und in der Gegend von Duchesse-Insel nur noch etliche Hundert Fuß beträgt. Von hier an werden die Gebirge bis zur Dawson-Straße wieder höher und erreichen über 3000 Fuß. Einige Meilen nördlich von Duchesse-Insel säumte ein ausgedehntes Kopragebiet die Küste; sonst waren nur kleinere Bestände Kokospalmen, aber größere Flecke urbar gemachten Landes im Waldesdickicht der Berge zu sehen. Hier liegen vermutlich auch die Siedelungen versteckt, denn wahrscheinlich ist die Bevölkerung nicht ganz so gering, als es den Anschein hat.
[S. 222] Nach einer unruhigen Nacht dampften wir am anderen Morgen in die schöne Straße, welche Normanby und Fergusson trennt und zu Ehren des, um die Erforschung Neu-Guineas hochverdienten, Lieutenants Dawson vom Basilisk benannt wurde. Ihre landschaftlichen Schönheiten traten erst hervor als sich die Wolken verzogen und wir die steilen Gebirge von Normanby in der Nähe betrachten konnten. Sie sind von malerischen Schluchten durchzogen und mit üppigem Baumwuchs bekleidet, machen aber nicht den Eindruck der Wildnis, wie er sonst gewöhnlich gegenüber tropischer Landschaft fühlbar wird. Denn, wie überall in den d'Entrecasteaux, zeigen sich auch hier allenthalben Plantagen, Kokoshaine, einzelne Häusergruppen bis ein paar Tausend Fuß in die Berge hinauf. Das sieht alles so kultiviert, ja civilisiert aus und heimelt so sehr an, gerade wie dies Moresby vor zehn Jahren fand, nur daß Menschen fehlten. Während der Basilisk damals von Hunderten von Kanus mit zutraulichen Eingeborenen umlagert war, die alle eifrig handelten, sahen wir nur hie und da ein paar, die aber scheu verschwanden. Kein Zweifel, daß auch hier Werbeschiffe gehaust und die Bevölkerung geschädigt hatten.
Die Samoa war in einer Art kleinen Bucht zu Anker gegangen, und ich unternahm mit Obersteuermann Sechstroh eine Exkursion im Whaleboot, um die bisher ununtersuchte östliche Einfahrt von Dawson-Straße anzusehen. Wir gingen längs der Nordseite von Normanby, die ihren vulkanisch bergigen Charakter beibehält und überall Kultivationen, Kokospalmen oft noch über 1000 Fuß hoch zeigt. Hie und da breitet sich ein schmales, meist dichtbewaldetes Vorland aus, mit Sandstrand, der viel Eisen und Glimmer, aber auch Bimsstein enthält, wie das Geschiebe der Bäche, das meist aus Schiefer und Quarz besteht. Das spricht wieder für Gold! In der That, wenn irgendwo in dieser Region Gold vorkommt, so glaube ich noch am ersten in den d'Entrecasteaux, will aber damit keinen »rush« hervorrufen. Von Eingeborenen sahen wir nur einen, der in einem kleinen Einspänner-Kanu sich vor unserem Boote retten wollte und mir nun am Strande in die Hände fiel. Er war so sehr erschrocken, daß er meine[S. 223] Geschenke zurückwies und sich nach einigen Redensarten, vermutlich Entschuldigungen (oder sollten es Verwünschungen gewesen sein?) seitwärts in die Büsche schlug. Ja, wir Weißen standen hier in keinem guten Renommé, das war mir immer mehr klar, und das Warum leicht zu erklären. Angesichts dieser Wahrnehmungen schien Vorsicht auch für uns ratsam, denn drei einzelne Weiße in einem Boot machen nicht den Eindruck, als wenn ein Schiff in der Nähe ist. Dies fiel mir ein, als wir die Nordostspitze von Normanby erreicht hatten und nach dem vor uns liegenden Goulvain hinübersegelten. Es ist dies die größte der drei Inseln, welche den Osteingang von Dawson-Straße beengen, und kennzeichnet sich schon von weitem durch einen eigentümlichen Berg. Derselbe hat die Form eines langgestreckten Napfkuchens und ist wie ein solcher von zahlreichen Längsrinnen durchzogen. Sie lassen keinen Zweifel, daß wir es mit einem Vulkan zu thun haben und zwar einem noch nicht allzulang erloschenen, denn der Berg ist in seiner oberen Hälfte kahl, was gegen die dichte Bewaldung des unteren Teiles und der übrigen Insel scharf absticht.
Unsere Absicht, ungestört auf der Insel zu frühstücken, wurde vereitelt, denn kaum daß wir uns derselben näherten, zeigten sich Eingeborene in hellen Haufen. Das hohe Ufergras schien förmlich Menschen zu gebären. Sie waren zwar unbewaffnet, aber ich hatte wohl bemerkt, daß sie viele Speere im Grase niederlegten, ein beachtenswertes Zeichen, welches immer zur Vorsicht mahnt. Wir ruderten längs der Küste bis zu einem Dorfe, wo sich inzwischen eine große Anzahl Eingeborener, wohl mehrere Hundert, versammelt hatten. Sie schienen über unsere Ankunft sehr geteilter Ansicht zu sein, denn während einige mit grünen Zweigen zum Landen einluden, machten die anderen abweisende Gesten, die mich an die im Gras versteckten Speere erinnerten. Unser Verlangen zu landen wurde durch den unklaren steinigen Grund, der unserem schlanken Boote leicht gefährlich werden konnte, gezügelt, und schließlich fiel es uns ein, daß es vielleicht besser wäre zu bleiben, wo wir waren. Wahrscheinlich würden wir auch hier gut aufgenommen worden sein, aber[S. 224] wer will immer voraussagen, wie es kommen kann, und wer konnte wissen, was vor uns hier passiert war? Im Boot ließ sich ein Überfall leicht und ohne Blutvergießen vermeiden, denn ein paar Schüsse genügten, die Menge zu verjagen, aber an Land war dies ganz etwas anderes. Da brauchten nur ein paar Eingeborene ihre Speere zu erheben, und unsere tapferen Neu-Britannier wären unfehlbar mit dem Boote auf und davon gegangen, ohne sich um uns zu kümmern. Und was hätten wir drei, selbst mit Waffen, in einem solchen Knäuel von ein paar Hundert Speerwerfern anfangen wollen? Mir war es schon um Kapitän Dallmann zu thun. Wo hätte der einen anderen Steuermann herkriegen wollen? und als Opferlämmer waren wir ja überhaupt nicht hergekommen.

Unter den im Schatten der Bäume versteckten Häusern machte sich besonders eins bemerkbar, ein langer, niedriger Schuppen, in welchem ein großes Kriegs-Kanu untergebracht war. Vergl. Abbild.[S. 225] (S. 224). Es zeigte über der Thür einen gar besonderen Schmuck, eine kraniologische Sammlung, die ich gar gern den meinen einverleibt hätte. Schädel von Goulvain! die besaß Geheimrat Virchow gewiß noch nicht, und da mußte jedenfalls ein Versuch gewagt werden. Ich deutete daher auf meinen Kopf und nach jenen Schädeln, sowie auf einige Tauschwaren, und die Sache war eingeleitet. Die Goulvainer begriffen, daß ich nicht den meinen einverleiben, sondern ihr anthropologisches Material haben wollte, und bald war der Handel im Gange. Freilich meine »Kilam« (Hobeleisen) waren schnell zu Ende, aber die Eingeborenen nahmen auch Tabak und andere Tauschwaren, bis die Weiber den schnöden Schacher plötzlich zum Schluß brachten und den Rest des Mausoleums mit einer Matte bedeckten. Die guten Geschöpfe schienen sehr aufgebracht, und da es immer rätlich ist wütenden Weibern auszuweichen, so schieden wir von Goulvain, wo wir ohnehin nichts mehr zu suchen hatten. Wußte ich doch jetzt, daß die Insel bei den Eingeborenen Ulebubu, das Dorf vor dem wir lagen, Nuakarau heißt, sowie manches andere über Insel und Bewohner, von denen bisher kein Bericht vorlag. Jedenfalls hatten die Eingeborenen aber schon Weiße gesehen, denn sie kannten: »matches« (Streichhölzer), »pipe«, »knife« und titulierten uns selbst »manwar« (man of war = Kriegsschiff). Ulebubu muß sehr bevölkert und sehr fruchtbar sein; selbst an den Abhängen der steilen Kraterschluchten waren Plantagen zu sehen, wie es die Papuas überhaupt lieben, gerade an solchen Stellen zu kultivieren. Kokospalmen gab es in Masse, darunter auch solche mit den kleinen, orangefarbenen Nüssen, welche auf Ceylon »King-nuts« heißen und einer besonderen Art anzugehören scheinen. Die Eingeborenen unterschieden sich übrigens durchaus nicht von den bisher (z. B. in Weihnachtsbucht) gesehenen und machten schon deshalb keinen guten Eindruck, weil soviel Schuppenkrankheit unter ihnen herrschte. Wenn sonst Totenschädel, welche man bei Eingeborenen sieht, meist solche von Anverwandten sind, so verhielt sich dies hier doch anders, und die von mir erstandenen Schädel sprechen schweren Verdacht aus. Mit Ausnahme eines einzigen, zeigten alle 15 Schädel das Hinterhaupt zertrümmert, ganz so wie Kannibalen zu thun pflegen[S. 226] um die größte Delikatesse, das Gehirn, zu erlangen. Ja, ja! ihr Männer von Ulebubu, ich kann euch nicht rein waschen, so gern ich auch möchte, ihr seid Kannibalen, gar kein Zweifel! »Aber die anderen auch«! höre ich euch antworten. Ja wohl, ihr seid nicht schlechter als der Rest, denn die ganze braune Bewohnerschaft der d'Entrecasteaux, der Ostspitze Neu-Guineas, des Moresby-Archipels bis hinunter auf die Louisiade, sie alle sind Menschenfresser, und dieser Brauch bildet sogar einen eben nicht empfehlenswerten Charakter dieser ethnologischen Provinz.
Wir standen unter Segel nach Fergusson hinüber, stießen hier aber bald auf ausgedehntes Riff, das auch südlich von Goulvain die Straße zu versperren scheint. Doch konnten wir dies nicht ausmachen, denn es setzte hier scharfe Strömung ein, gegen welche vier Ruderer nicht ausreichten. Die Nordwestseite von Goulvain besteht aus Steilufer, so daß hier vielleicht eine Durchfahrt für kleinere Schiffe möglich ist, aber nördlich liegen noch zwei andere flache Inseln, die auf Riff schließen lassen. Sie zeigten dichte Bestände von Kokospalmen, wie ein großer Teil der Küste von Fergusson, die hier meist aus Flachland mit Hochgras besteht. Gleich einer alten Festungsruine erhebt sich hier ein, meist kahler, vulkanischer Berg, gleichsam ein Pendant zu dem Krater von Goulvain. Aber wir bemerkten kein kultiviertes Land an ihm, wie die ganze Küste der äußersten Südspitze von Fergusson kaum bevölkert schien. Das änderte sich aber mit einem Schlage, als wir westlich von der Landzunge in eine ausgedehnte Bucht einfuhren, die rifffrei und selbst für Schiffe praktikabel ist. Hier säumt ein breiter Streif von Kokospalmen den Sandstrand, auf dem sich Dorf an Dorf reihte. Ich zählte an ein Dutzend, die aus je 10 bis 15 Häusern bestanden. In der Tiefe der Bai, nahe einer kleinen Insel aus Korallfels, landeten wir inmitten von etlichen 20, sehr schönen Kanus, bei einem Dorfe, dessen Bewohner sich anfangs sehr fürchteten und zum Teil ausrissen. Das weibliche Geschlecht machte den Anfang und kam selbst später, trotz den Aufforderungen der Männer, nicht zurück, und so mußte ich diesen die Geschenke für die schüchternen Schönen übergeben. Das[S. 227] Dorf mochte ungefähr 15 Häuser zählen, die sich durch die eigentümliche Bauart, wie sie meine Skizze zeigt, auszeichneten. Sie ruhen doppelt auf Pfählen, d. h. auf der unteren Plattform erhebt sich das Haus noch besonders auf kurzen, wie gedrechselten Füßen. Die schmale hohe Giebelfront ist sorgfältig aus Pandanusblatt gefertigt und zuweilen bunt bemalt, wie das Haus links in rot und schwarzem Schachbrettmuster. Alles sah sauber und reinlich aus, auch der Platz um die Häuser, auf dem ich Obsidian fand. Und nun gar erst die ausgedehnte Plantage hinter dem Dorfe! Sie war eine Musterfarm und konnte an Akkuratesse mit einer Ziergärtnerei bei uns konkurrieren. Man fühlte sich wie in einen Hopfengarten versetzt,[S. 228] so regelmäßig erhoben sich die Ranken des Yams an Stangen, aus reichem schwarzen Humus, der durchgesiebt schien. Zwischen dem Yams stand Taro, Zuckerrohr, Bananen und bunte Blattpflanzen, alles in schönster Ordnung und in größere Familienfelder eingeteilt. Merkwürdigerweise fehlte ein Zaun um die Plantage, wie dies sonst stets der Fall ist, was vermuten läßt, daß Wildschweine selten vorkommen. Allerdings sah ich gezähmte bei den Häusern, aber in Verschlägen; auch hatte man ihnen, um das Wühlen zu verhindern, sorglicherweise eine Liane durch die Nasenlöcher gezogen. Leider blieben meine Versuche, eins dieser Borstentiere zu erstehen, erfolglos. Die Eingeborenen werden sie selbst wohl gern essen, verschmähen aber auch den einzigen Vertreter der Familie Bimana (Homo sapiens, Linné) nicht, denn ich erhielt fünf am Hinterhaupt zerschlagene Schädel und sah ein menschliches Becken an einem Hause. Dabei waren diese Menschenfresser aber nicht allein sehr fleißige, sondern auch liebenswürdige Leute, und es that mir ordentlich leid, sie durch ein paar Schüsse in Furcht jagen zu müssen. Aber in einem hohen Baume zeigten sich sonderbare Vogelgestalten, nach denen ich schon lange gefahndet hatte. Als der Schuß krachte, lag ein prachtvoll stahlviolett schimmernder Vogel, so groß als eine Dohle, zu meinen Füßen, — Manucodia Comrii — der schönste Vertreter der Paradieskrähen. Die Art ist, wie ein wirklicher Paradiesvogel mit roten Seitenbüscheln (Paradisea decora), den d'Entrecasteaux eigentümlich, die zoologisch sehr ungenügend bekannt, ohne Zweifel manches Neue liefern werden.
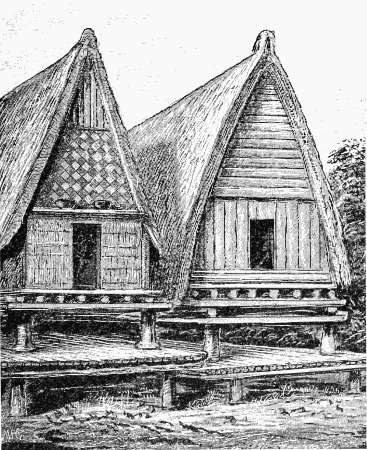
Der günstige Eindruck, den uns diese Exkursion von Fergusson verschafft hatte, wurde am folgenden Tage noch bedeutend erhöht, an dem wir längs der Südküste bis Kap Mourilyan dampften. Sie besteht im wesentlichen aus einer ca. 1000 bis 1500 Fuß hohen Strandkette, hinter welcher sich unmittelbar dichtbewaldetes Hochgebirge, mit sanft gerundeten Kuppen, zuweilen mit stumpfen Spitzen, erhebt. Der an 6000 Fuß hohe Kilkerran scheint der Mittelpunkt dieses Gebirges, das den größten Teil der Insel bedeckt und ihr, wie den übrigen, vorwiegend Gebirgscharakter verleiht. Wenn es[S. 229] auch noch lange dauern wird, ehe Forscher in das Innere dieser Gebirge eindringen, so ist vielleicht die Zeit nicht so fern, wo das Küstengebirge nähere Untersuchung findet und dieselbe voraussichtlich reichlich belohnt. In der That hier sieht es gar sehr versprechend aus, und ich wüßte kein Gebiet in der ganzen östlichen Papuaregion, das sich mit diesem messen könnte. Gegenüber von Kap Dawson bis Kap Mourilyan, einem Küstenstrich von fast 20 Meilen, hat man fast nichts als kultiviertes Land vor sich, das einen heimatlichen Eindruck macht. Allenthalben sieht man bis hoch in die sanft ansteigenden Berge ausgedehnte Plantagen, sorglich eingezäunt, grüne Matten, einzelne Häuser und kleine Häusergruppen; Fußpfade führen hin und wieder und über die Berggrate, während die Thäler und Hänge mit Wald und Buschwerk bestanden sind. Gar liebliche Bilder, die durch den Reichtum an Kokospalmen ein erhöhtes praktisches Interesse gewinnen! Längs dem weißen Sandstrande ziehen sich oft meilenweite Palmwälder hin, und selbst an den Bergen reichen ansehnliche Bestände über 1000 Fuß hinauf; ein Kopragebiet, wie es nur selten vorkommt. Und doch ist dasselbe bisher noch unbearbeitet geblieben, worüber sich die Eingeborenen am meisten freuen können. Wir sahen zwar am Strande verschiedene, auch größere Siedelungen, aber von den Bewohnern auch nicht Einen! Diese Küste schien wie verzaubert, nicht einmal ein Kanu ließ sich blicken. Sehr malerisch ist Kap Mourilyan, der Ausläufer eines zwischen 2000 bis 3000 Fuß hohen erloschenen Vulkans, der bis zu dem kahlen, steilen Kraterrande dicht mit Kultivationen bedeckt ist. Wir mußten hier leider Abschied von den d'Entrecasteaux nehmen, die für England ohne Zweifel viel wichtiger und versprechender sind, als Port Moresby und der größere Teil der Südostküste Neu-Guineas und vielleicht noch einmal Bedeutung erlangen. Sie werden sich für Plantagenwirtschaft, wie Viehzucht gleich günstig erweisen und bieten bereits etwas Exportfähiges in den reichen Kopragebieten.
Von Goodenough-Insel bekamen wir wenig zu sehen; sie blieb, wie der gleichnamige, an 7000 Fuß hohe Berg, meist in[S. 230] Wolken gehüllt, und wir erblickten sein majestätisches Haupt nur ein paarmal während unserer Küstenfahrt, zu der wir jetzt zurückkehren.
Ostkap. — Catamarans. — Bentley-Bai. — Anzeichen von Kannibalismus. — »Hallelujah«. — Tamate. — Scheu der Eingeborenen. — Äußeres. — Ausputz. — Freundliche Mädchen. — Häuser. — Catharine-Insel. — Begegnung mit einem Kanu. — Chads-Bai. — Koom und Poru. — Albino. — Schönes Land. — Eine Liebesgeschichte. — Fingerspitze. — Herrliche Gebirgslandschaft. — Kap Frere. — Wasserfälle. — Gebirgsplantagen. — Bartle-Bai. — Goodenough-Bai. — Basilisk-Gebirge. — Flower- und Sclaterspitze. — Pyramidenhügel. — Geringe Bevölkerung. — Bedeutende Meerestiefen. — Gebirgsbewohner. — Kap Vogel. — In trübem Wasser. — Victory und Trafalgar. — Kap Sud-Est. — Geringe Bevölkerung. — Küste von Kap Nelson bis Mitrafels. — Hihiaura-Bucht. — Familienhaus. — Wir bauen. — Native-Häuser. — Verkehr mit den Eingeborenen. — Gomira Taga und Tohde. — Wir landen Vieh. — Blumenthal. — Ethnologisches. — Schaukeln. — Fischfang. — Kein Salz. — Stellung der Frauen. — Tägliche Beschäftigung. — Kochen. — Mahlzeiten. — Gemütliches Leben. — Schwierigkeit zu civilisieren — und die richtigen Leute zu finden. — Schattenseiten des Tradertums.

Wie erwähnt ist die Aufnahme dieser in der Luftlinie über 200 Meilen langen Küste ein Verdienst Moresbys, das niemand besser würdigen lernte als wir, die auf der Samoa seinem Kurse folgten. Auch in diesem Abschnitt fasse ich die Resultate dreier Fahrten an diesen Küsten zusammen, die, bei der ohnehin so knappen Behandlung unseres Vorgängers, einen Beitrag zur besseren Kenntnis derselben in Wort und Bild geben werden. Wir haben Lydia passiert und sehen die Ostspitze Neu-Guineas immer deutlicher hervortreten. Sie wird von der Halbinsel gebildet, welche Milne-Bai nach Norden begrenzt und läuft in eine schmale Landzunge aus, die mit einem sanften, ca. 400 Fuß hohen Hügel endet, vor dem zwei kleine, durch Riff verbundene Inselchen lagern. Unsere Skizze zeigt eine derselben, Anker-Insel, mit Ostkap aus Norden, kein großartiges, aber ein liebliches Bild, anheimelnd durch die Plantagen auf dem Hügel und die Palmenhaine, welche den Strand einfassen. An dem letzteren standen Hütten und Kanus; auch Eingeborene zeigten sich hie und da, nahmen[S. 231] aber von dem Dampfer keine Notiz. Das reiche Kultivations- und Kopragebiet, welches an der Ostseite von Normanby seinen Anfang nimmt, setzt sich, mit gewissen Unterbrechungen, von Ostkap bis nahe an Bentley-Bai fort. Aber der Bergrücken, die Stirling-Kette, welcher die schmale Ostkap-Halbinsel bildet, deren Breite selten fünf Meilen überschreitet, wird allmählich höher. Damit steigert sich der Reiz des Landschaftsbildes, das in der von hübschen Bergen umschlossenen Bai zu einem besonders ansprechenden wird. Von Eingeborenen war wenig zu bemerken; sie hielten sich zurückgezogen und beachteten unsere Einladungen gar nicht. Jedenfalls hatten sie seit dem freundlichen Besuche Moresbys vor 10 Jahren, der die Ostkap-Leute »als die liebenswürdigsten Wilden«, welche er kennen lernte, bezeichnet, üble Erfahrungen mit dem weißen Manne gemacht. Hie und da huschte ein Catamaran über die spiegelglatte Wasserfläche, eine sonderbare Art Wasserkutsche, die wir einzeln schon in Normanby kennen gelernt hatten. Sie besteht aus drei vierkantig behauenen, vier bis fünf Meter langen Baumstämmen, die mit Lianen aneinandergebunden, ein ca. ein Meter breites, an beiden Enden stumpfzugespitztes Floß bilden. Diese Catamarans sind an der ganzen Ostkap-Halbinsel,[S. 232] wie in Milne-Bai, die gebräuchlichsten Fahrzeuge und ersetzen zum Teil die im ganzen seltenen Kanus. Es versteht sich von selbst, daß ein solches Floß nur längs der Küste und bei ruhiger See benutzt werden kann, denn selbst bei solcher nimmt es fortwährend Wasser über. Es ist daher zuweilen ein etwas erhöhter Sitz angebracht, um Tauschwaren einigermaßen trocken zu halten. Wir haben die Geschicklichkeit, mit welcher die Eingeborenen dieses primitive Fahrzeug zu hantieren wissen, stets aufs neue bewundert. Die Sache sieht nämlich viel leichter aus, als sie ist und geht bei knieender Stellung noch am besten. Aber aufrechtstehend erfordert es viel Übung die Balance zu halten; eine ungeschickte Bewegung, und das Floß kippt um, was unseren Leuten später, zum Gaudium der Eingeborenen, öfters passierte.

Solche Catamarans, die übrigens nur einen bis zwei Menschen tragen, gaben uns das Geleit, als wir in Bentley-Bai einliefen, hielten sich aber in respektvoller Ferne. Nur eine[S. 233] resolute Frau spornte ihre stärkere Hälfte an, längsseit zu paddeln, um einige Geschenke zu empfangen. Sie gab mir dafür ein paar Früchte des Melonenbaumes (Carica papaya), ungefähr alles was die Eingeborenen besaßen, denn Kokospalmen werden in Bentley-Bai schon spärlicher. Der furchtsame Gatte erregte durch einen besonderen Haarschmuck meine Aufmerksamkeit. Er trug im Nacken eine Zopfzottel, an der ein Halswirbel befestigt war, welche Zier ich natürlich gern für das Berliner Museum erworben hätte. Aber der Mann schien davon nichts wissen zu wollen. Es blieb mir daher nichts übrig als Raub; denn, was thut man nicht alles im Dienst der Wissenschaft! Ein Schnitt mit der Schere und der Zopf war mein, worüber die kleine Frau gar sehr schimpfte. Ihre zornfunkelnden Augen gingen aber bald in freudestrahlende über, als ich ihr einen goldenen Ring im Wert von zehn Pfennigen, ihrem Gemahle ein Messer schenkte. Die spätere Untersuchung hat den Knochen als einen menschlichen Atlas nachgewiesen, wodurch auch diese guten Eingeborenen den Verdacht Kannibalen zu sein auf sich laden. In Ermangelung besserer Beweise spreche ich diesen Verdacht übrigens nur mit Vorbehalt aus, und will hinzufügen, daß ich derartigen Zopfschmuck nur wenigemale hier, aber auch in den d'Entrecasteaux und um Ostkap beobachtete. Halswirbel vom Schwein und Dugong werden am häufigsten benutzt, besonders aber Ovulamuscheln, zuweilen auch sonderbare Fischgebisse, so daß es sich bei weitem nicht immer um Trophäen von erschlagenen Feinden handelt. Selbst in diesen abgelegenen Gegenden pflegen sich die Gegensätze zu berühren. Kaum war der Vertreter des menschenfressenden Heidentums mit seiner Ehehälfte weggepaddelt, da tönte es »Hallelujah! Jesus!« und wir begrüßten den ersten Christen, der sich schon durch ein früher weißes Hemd von der übrigen Gesellschaft auszeichnete. »Missionaly[60] Tamate Natuna!« Aha! der Herr Missionär dieses Namens, würde jeder gedacht, aber geirrt haben, denn der Zusammenhang dieser Worte[S. 234] war nur dem verständlich, welcher die Südostküste Neu-Guineas kennen lernte. Hier ist von Freshwater- bis Milne-Bai ein Weißer unter dem Namen Tamate überall bekannt und beliebt, der Rev. James Chalmers in Port Moresby, der einflußreichste Mann an dieser ganzen Küste. Schon 10 Jahre lebt er unter den Eingeborenen, die ihn alle als einen Vater verehren. Kein Wunder daher, daß auch dieser braune Hemdenmatz sich Tamate Natuna, d. h. Kind von Chalmers nannte, dem er wahrscheinlich in einer Missionsstation in Milne-Bai begegnet war. Mit »Missionaly« (Missionär) pflegt sich gern jeder Eingeborene zu bezeichnen, der nur einmal eine Mission besuchte und deswegen noch keineswegs Christ zu sein braucht, da in Neu-Guinea das Wort Loto (= Christentum) unbekannt ist.
Ich durfte mich dem Kinde Tamate's gegenüber, das eigentlich Tau pa-uri hieß, als Tamate Wariga, Freund von Chalmers einführen, mit dem ich in Port Moresby so oft zusammen gewesen war, und manche Tour gemacht hatte. Der neue Freund erwies sich übrigens von keinem Nutzen und riß mit der übrigen Menge aus, als ich das Land betrat. Das kostete wieder Mühe sich anzupirschen! Ich hatte den Leuten lange am Strande zu folgen, manchen Bach zu durchwaten, ehe einige beherztere Burschen standhielten. Stückchen Tabak, die ich ihnen zuwarf, kirrten sie vollends, und endlich ließ sich einer die biedere Rechte schütteln. »So, nur Courage! sei doch kein Frosch, ich bin ja Finsch aus Bremen, ihr kennt mich ja!« — und die Leute wurden zutraulicher, kamen nach und nach heran, bis uns ein dichter Haufen umgab. Auch Mütter mit ihren Säuglingen fehlten nicht, und meine alte Praxis, die letzteren mit roten Bändchen zu schmücken, machte den gewünschten Eindruck. Auch Papuafrauen besitzen Mutterstolz und freuen sich, wenn man die braunen Papuaengelchen streichelt und lobt. Und diese Kinderchen sind im allgemeinen viel artiger als unsere, denn sie schreien viel weniger und fürchten sich gar nicht so vor dem »weißen Manne«. Die Eingeborenen von Bentley-Bai, wie um Ostkap, sind von ziemlich heller Hautfärbung und gehören zu denen, welche von Unkundigen als malayische Mischlinge erklärt werden. Aber mit Unrecht,[S. 235] denn sie sind echte Papuas, wobei uns das individuelle Vorkommen von lockigem, selbst schlichtem Haar nicht zu genieren braucht. Gewöhnlich wird es kurz gehalten, bei den Frauen meist abrasiert, aber junge Stutzer, wie der auf der Abbildung, zausen sich eine mächtige Wolke auf. Er ist im Gesicht zierlich mit schwarzen Strichen bemalt, trägt Blätter und eine künstlich zerschlissene Centropusfeder im Haar, am Arm eines jener kolossalen Armbänder (Bakibakira), die wir zuerst hier kennen lernten. Sie sind halbrund aus gespaltenem, schwarz gefärbtem Rotang geflochten und werden auf der hohlen Innenseite mit Moos und wohlriechenden Pflanzenstoffen ausgefüllt. Sie verbreiten sich über die ganze Ostspitze Neu-Guineas und dienen zum Teil als Trauerschmuck. Als solchen lernte ich, außer dem üblichen Schwarzmalen, auch breite zierlich aus Gras geflochtene Bänder kennen, die von beiden Geschlechtern kreuzweis über die Brust getragen wurden. Viele Eingeborene litten an Ichthyosis, wie sie überhaupt in Gestalt, wie Ausputz einen ärmlichen Eindruck machten. Das Septum war bei beiden Geschlechtern durchbohrt, aber gewöhnlich wurde ein Holzstift durchgesteckt, seltener ein aus Muschel geschliffener. Im Ohr trugen die Männer meist einen zusammengerollten Streifen Pandanusblatt, zuweilen einige Spondylusscheibchen oder kleine Schildpattringe. Halsstrickchen (Maura) und gewöhnliche Grasarmbänder (Ohame) bildeten, wie immer, den Hauptputz; in dem letzteren wurde häufig ein Stück Badeschwamm (zum Waschen!) getragen. Stutzer befestigen am Armbande, wovon auch solche aus Muschel (Conus und Trochus) vorkamen, zuweilen einen langen Streifen aus künstlich zusammengenähten[S. 236] Pandanusblatt, der gleich einem Bande herabflattert und Päropäro heißt. Als seltenen Knie- und Armschmuck sah ich aufgereihte mittelgroße, weiße Cypraea-Muscheln (Bunidoga); mit Ausnahme kleiner Knaben waren alle bekleidet. Die Männer trugen die eigentümlichen Pandanusmatten, Ahra (S. 214), die häufig an einer Schnur, zuweilen einem dicken Wulst (Apara) von Menschenhaar befestigt sind, von dem Schnüre aus gleichem Material mit Ovulamuscheln (Dunara), portepéeähnlich herabbommeln (vergl. Taf. XVI 6). Frauen, selbst kleine Mädchen, sind mit schweren Grasröcken (Nogi) aus gespaltener Kokosfaser bekleidet, wie dies die Abbildung (S. 237) zeigt. Mit der Steinzeit war es auch hier vorbei, denn die Eingeborenen besaßen bereits Äxte mit Bandeisenklingen (S. 212), begehrten jedoch am meisten Tabak und Pfeifen. Sie hatten aber wenig in Tausch abzugeben oder vielmehr gaben das wenige Gute, z. B. hübsche Holztrommeln und Holzschilde (Ragena) nicht her. Als Waffe besaßen sie nur rohgearbeitete Speere (Jera), keine Pfeile und Bogen. Neu waren mir sehr hübsch geflochtene, runde, schachtelförmige, Tragkörbe (Au-utu), mit drei Einsätzen, und eine sonderbare Art Fischfallen (Mahaba, T. IX. 1). Als Material zu Strickarbeiten wird die durch Klopfen bereitete Faser aus den Luftwurzeln des Schraubenbaumes (Pandanus) benutzt, die ich schon in Normanby bemerkte. Sie stellt an Haltbarkeit und Länge des Fadens die besten unserer Faserstoffe in den Schatten und würde einen trefflichen Exportartikel abgeben, wenn größere Quantitäten zu haben wären.

Außer Kokosnüssen und Papayafrüchten war an Lebensmitteln nichts aufzutreiben. Wir betrachteten wehmütig die schönen Schweine (Poru), von denen sich die Leute nicht trennten. Und doch hatte Moresby hier eine Menge erhandelt, aber die Bevölkerung ist seitdem offenbar geringer und ärmer geworden.
Das weibliche Geschlecht, im ganzen häßlich und unansehnlich, zeichnete sich durch besondere Zuthunlichkeit und Liebenswürdigkeit aus, wie ich sie selten bei Eingeborenen gefunden habe. So beschenkte mich ein kleines, nettes Mädchen mit einer Bekleidungsmatte, so schön, daß sie einem Bräutigam Ehre gemacht haben würde[S. 237] übrigens das einzige Geschenk, welches ich jemals von einer Papuaschönheit erhielt. Ich hatte aber auch ein paar Handvoll Glasperlen weggegeben und die Damen noch besonders erfreut, indem ich meinen Arm entblößte. Die Verwunderung über die Weiße der Haut wollte unter dem sanften und melodischen Ausdruck des Erstaunens »agai-i« gar kein Ende nehmen, das Befühlen und Streicheln gab ihr aber bald einen dunklern Ton.
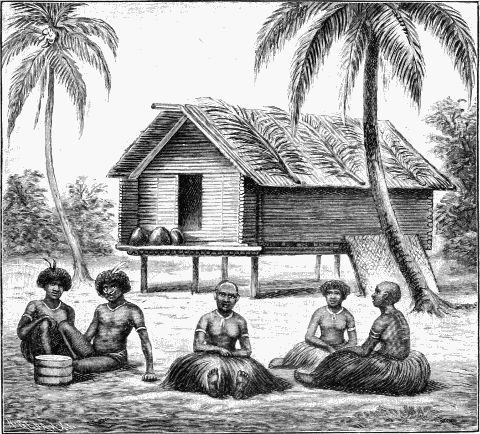
Der hiesige Pfahlbaustil ist am besten aus der Abbildung ersichtlich, und nur hinzuzufügen, daß das Material aus Bambu besteht und die Grasdächer mit toten Palmblättern belegt werden, um ihnen mehr Festigkeit zu geben. Die Diele ist meist aus Planken hergestellt. Auf dem Vorplatz, vor der Thür stehen gewöhnlich Töpfe[S. 238] (Nau), deren Anzahl zugleich den Reichtum bekundet, denn sie sind ein teurer Artikel und kommen weit her, von Teste-Insel. Neben den Häusern erheben sich kleinere Pfahlbauten oder Gerüste als Vorratskammern und die kleinen Siedelungen sind zuweilen mit einer lebendigen Hecke aus Croton und dergleichen eingezäunt. Gewöhnlich liegen auf dem freien Platze um die Häuser, der zuweilen auch mit Rollsteinen belegt ist, große Schieferplatten, auf denen die Eingeborenen gern zu sitzen pflegen. Ich vermute, daß diese Steine Gräber bedecken, sah aber später ein Grab in Form eines kleinen Hauses, ganz wie in Finschhafen (S. 173). Wie fast stets waren Crotons bei demselben gepflanzt. Ein hier, wie an der ganzen Ostspitze üblicher Gebrauch ist der, bei den Siedelungen oder am Strande Kokosnüsse an eigens dazu errichteten Pfählen aufzuhängen. Oft sieht man künstliche Bäume ganz voll von Kokosnüssen, die wahrscheinlich zum Anpflanzen dienen. Bentley-Bai ist nur schwach bevölkert und zählt etwa ein Dutzend ziemlich versteckter Siedelungen, von denen die größte, Tagoreüa, nur aus acht Häusern besteht. Aber einzelne Häuser finden sich, wie Plantagen, in den Bergen, die sehr steil und an 2000 Fuß hoch sind und von denen man einen schönen Blick auf Milne-Bai hat, denn die Breite der Halbinsel beträgt hier kaum mehr als drei Meilen. Schiffen ist übrigens Vorsicht anzuraten, da namentlich die östliche Seite der Bai nicht frei von Riffen und Felsen ist. Am westlichen Eingange liegt eine flache mit Mangrove bedeckte Insel (Catharine-Isl.), hinter der sich ein geschütztes Becken (Annie-Inlet) öffnet, das aber wegen Untiefen als Hafen unbrauchbar ist. Für Kanus mag es freilich gut genug sein, wenigstens flüchteten zwei solche, denen wir kurz vor Kap Ducie begegneten, eiligst in die Bucht, während ein drittes, mit zehn Mann Besatzung, längsseit kam. Die Leute verstanden kein Wort englisch und hatten nichts als etliche Stücke Obsidian zu verhandeln, kamen also wohl von Moresby-Straße herüber, wo diese Lava, die zum Rasieren überall beliebt ist, häufig sein soll.
Zwischen Cap Ducie und Excellent-Point erstreckt sich ein zwei und eine halbe Meile langes Vorland, dessen nördlicher Rand von[S. 239] Small-Bai bespült wird. Dieses Vorland ist meist mit Mangrove bestanden, erhebt sich aber nach Westen zu dichtbewaldeten Bergen von 400 bis 500 Fuß Höhe. Als wir diese westliche Ecke, Excellent Point, passiert hatten, sahen wir die ausgedehnte Chads-Bai, von malerischen Bergen umrahmt, vor uns. An ihrem östlichen Ufer machten sich dichte Bestände Kokospalmen bemerkbar, sowie Eingeborene, die uns zu Ehren flaggten, d. h. einen Lappen Zeug an einer langen Stange befestigten und damit winkten. Wir folgten ihrer freundlichen Einladung und gingen kaum zwei Kabel vom Ufer in 13 Faden zu Anker. Was oft nicht wenige Meilen Entfernung thun können! Während es in Bentley-Bai noch so schwer war, mit den Eingeborenen zu verkehren, zeigten sie sich hier viel weniger scheu, ohne Zweifel, weil sie noch keine üblen Erfahrungen mit Werbeschiffen gemacht hatten. Mein Freund Tamate war hier nicht bekannt, aber in aller Munde tönte das Wort »Toom!« Wer mochte wohl dieser Tom sein, der die Gemüter der Eingeborenen so bewegte? Endlich hatte ich es heraus. Nicht Toom, sondern »Koom« (Kokosnuß) meinten die Leute, und ob wir solche haben wollten? Natürlich, ja! — »Ein Schwein wäre mir lieber!« meinte Kapitän Dallmann, schüttelte aber bedenklich mit dem Kopfe, als ich ihm sagte, dasselbe sei bereits bestellt. Aber die Sache war sehr einfach, nachdem ich durch Imitation von Grunzen erst wußte, daß Poru auch hier Schwein heißt, wie Kiram Axt. Ich zeigte grunzend die letztere, und unter verständnisvollem Gegengrunzen paddelten die Leute nach dem Dorfe. Mit dem Wiederkommen dauerte es freilich etwas lange, und ich wollte mich eben selbst aufmachen, um dem Hohn zu entgehen und vielleicht mit einem Schusse nachzuhelfen, denn diese Papuaschweine sind oft sehr obstinat. Da tönte ein durchdringendes Gequieke herüber, daß alle Spötter zum Schweigen brachte, der Koch wetzte sein Messer und sagte: »Kaptain! De Doctor het regt! Sieh'! dor brengt de zwarte Jaantjes dat Swin!« Und so war es. Wie stand ich nun da! He? Selbst der Kapitän gratulierte zu dem Erfolge, der uns nach langer Zeit einmal frisches Fleisch und sein Leibgericht: »suur Swinfleesch en Arwgen« brachte.
[S. 240] Wir gingen an Land, zunächst nach dem Dorfe, wo uns die ganze Bevölkerung, etliche 30 Köpfe, sitzend erwartete, ärmlich aussehende, aber bescheidene, nette Leute, die sich über jede Kleinigkeit unendlich freuten. Das Dorf bestand nur aus fünf Häusern, die ganz mit denen in Bentley-Bai übereinstimmten, wie die Eingeborenen selbst, mit Ausnahme eines einzigen, eines Albino. Er war so hell als ein sonnverbrannter Europäer, mit geröteten Wangen und Lippen, hatte rotbraunes Haar in eine mächtige Wolke aufgezaust, und braune, keineswegs lichtscheue Augen, wie sie sonst meist Albinos eigen sind. In europäische Kleider gesteckt, würde niemand in diesem Manne den Papua erkannt haben; man ersieht hieraus, was ein bißchen Hautfärbung thun kann. Jedenfalls ist es sehr merkwürdig, daß von dunklen Eltern zuweilen ganz helle Kinder abstammen, während umgekehrt wohl kaum ein solcher Fall bekannt sein dürfte. So lernte ich an der Südostküste Neu-Guineas eine Papuafamilie kennen, von der die sehr dunkel gefärbten Eltern zwei dunkle und zwei helle Kinder, so weiß als europäische, besaßen. Die Eingeborenen haben übrigens solchem Naturspiel gegenüber kein Vorurteil, was bei uns im entgegengesetzten Falle ohne Zweifel recht bedenklich hervortreten würde. In Begleitung der Männer machten wir eine Exkursion und schritten auf engen Pfaden längs einem kleinen Flüßchen oder in dem Bette desselben, bis wir auf eine grasige Hochebene gelangten, die savannenartig mit Schraubenbaum bestanden war und sich bis Bentley-Bai hinzuziehen schien. Sie würde sich wegen ihres nicht zu hohen, saftigen Grases trefflich zu Viehweiden eignen, besitzt aber auch guten, schwarzen Boden. Längs einem anderen Flüßchen, an dem schöne Plantagen lagen, kehrten wir gegen Abend wieder an die Küste zurück, wo wir von den freundlichen Leuten Abschied nahmen. Als wir ins Boot steigen wollten, gab es noch eine unerwartete Scene, denn erst mußte noch eine dunkle Dame gewaltsam entfernt werden, die sich unter einer Bank versteckt hatte und absolut mit an Bord wollte. Das war selbst mir in meiner Papuapraxis noch nicht vorgekommen, aber »es hilft nichts, meine Gnädige, Sie müssen raus!« Da stand sie händeringend, um die hartherzigen weißen Männer zu erweichen,[S. 241] von denen keiner nur ein Fünkchen Mitleid fühlte. Ja, wer mochte dieser zartbesaiteten Seele die Ruhe geraubt, es ihr angethan haben? Sicher keiner von uns vier Weißen, denn ein solcher läßt schwarze Damen stets kalt, aber unsere Ruderer, kannibalisch schöne Neu-Britannier, die konnten in ihren roten Flanellhemden wohl Eindruck machen und ein so unschuldiges Herzchen berücken. Aber galant waren diese schwarzen Stutzer auch nicht, denn als ich einen Tommy oder Bob fragte »you like this fellow papine?« (»magst du das Mädchen leiden?«) sagte er verächtlich: »bata! what fore? no all same avakak papine Mioko!« (nein! warum? nicht so schön als Mioko-Mädchen). Ja, ja! diese Schwarzen haben auch so ihren eigenen Geschmack, und dunkle Haut allein thut es nicht.
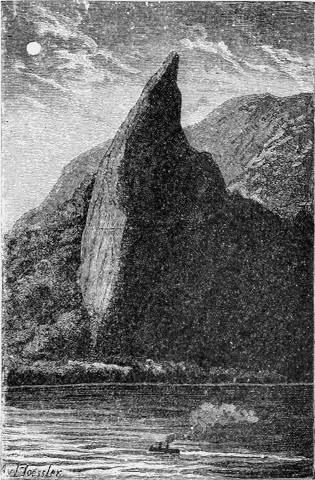
Merkwürdige Felsen, die zwei übereinander stehenden Mauern ähneln, begrenzen die etwa drei Meilen breite Chads-Bai nach Westen, können aber übersehen werden, da eine sonderbar geformte Bergspitze, die ihresgleichen sucht, das Auge fast ausschließend gefangen hält. Unter den massigen, mit grünem Gras bekleideten Kuppen erhebt sich ein isolierter, schlanker, fast senkrechter, an 3000 Fuß hoher grüner Pik, die »Fingerspitze« Moresby's, ein gewaltiger und imposanter Bergobelisk, von dem diese Abbildung nur eine[S. 242] schwache Vorstellung zu geben vermag. Mit dieser charakteristischen Partie entwickeln sich weiter westlich bis in die Tiefe von Goodenough-Bai, auf eine Länge von fast 50 Meilen, immer neue und großartigere Gebirgsbilder, ein wunderbares Küstenpanorama, das wir einen ganzen Tag mit Entzücken betrachten konnten. Ohne Zweifel ist dieser Teil landschaftlich der schönste, den ich in Neu-Guinea kennen lernte, und wahrscheinlich für die ganze Insel überhaupt. Es würde ein unnützes Bemühen sein, eine Beschreibung zu geben, und ich muß mich auf einige kurze Bemerkungen beschränken, um wenigstens die charakteristischen Züge dieses Küstengebirges zu skizzieren. Dasselbe ist zunächst als eine noch unbenannte Fortsetzung der Stirlingskette zu betrachten, die nach Westen zu allmählich höher wird und sich von 3000 bis an 5000 Fuß erheben mag. Dieses Gebirge fällt fast allenthalben schroff und steil bis zur Küste ab, die nur hie und da beschränktes, meist mit Wald bedecktes Vorland aufzuweisen hat. Das Gebirge zeigt in seiner Kammlinie viele malerische Kuppen und Spitzen, zeichnet sich aber ganz besonders durch steile Schluchten und Schlünde aus, die auf ihrem Rücken schroffe Grate bilden. Trotz dieser markigen Gliederung fehlt das Wildromantische der eigentlichen Alpenlandschaft, weil nur selten größere Felspartien hervortreten, dagegen fast überall saftig grünes Gras die Seiten der Berge bekleidet, die nur in den Schluchten und im obersten Viertel oder Fünftel der Kammhöhe mit Wald bedeckt sind. Dieser Kontrast zwischen dem hellen Grasgrün und dem dunklen, fast schwarzen Waldesgrün gehört zu den Eigentümlichkeiten dieses Gebirges, das sich außerdem durch zahlreiche Wasserfälle auszeichnet. Sie treten besonders gegen Kap Frere in oft überraschender Fülle hervor, einem gewaltigen an 3000 bis 4000 Fuß hohen, massigen Gebirgsrücken mit fast horizontaler Kammlinie, dessen spaltenklaffende Seiten beinahe senkrecht ins Meer fallen. Zuweilen erblickte das Auge acht solcher Wasserfälle auf einmal, die freilich nur dünnen Silberfäden glichen, denn wir hatten noch trockene Jahreszeit (Dezember), aber gerade deshalb besonders merkwürdig erschienen. In der That ist es schwierig, für diese Menge von Wasser[S. 243]läufen von den Bergen herab eine genügende Erklärung zu finden, umsomehr als wir an der ganzen Küste kaum ein halbes Dutzend, jetzt meist vertrockneter Flußmündungen antrafen. Da noch niemand den Scheitel dieser Küstengebirge betrat, so ist es nicht unmöglich, daß sich von hier aus südlich bis zu den nur sechs bis acht Meilen entfernten höheren Gebirgsketten des Owen-Stanley-Systems (Mt. Thompson u. a., über 6000 Fuß) Hochebenen hinziehen, auf welchen diese nördlichen Wasserläufe entspringen. Auch die besonderen Verhältnisse, unter denen sich das Vorkommen des Menschen hier zeigt, scheinen dafür zu sprechen. Mit Chads-Bai fingen Palmwälder und Siedelungen an spärlicher zu werden, nur selten zeigten sich einzelne Hütten mit einer kleinen eingezäunten Plantage im Ufervorlande. Desto häufiger konnte man dieselben an den Hängen hoch in den Bergen mit dem Glase erkennen und erstaunte über die Häufigkeit der kultivierten Flächen in jenen Regionen. Wie immer waren mit Vorliebe besonders steile Stellen ausgesucht worden, und über die schroffsten Grate konnte man die halsbrechenden Pfade der Eingeborenen verfolgen, die in diesem interessanten Gebiete so recht eigentliche Gebirgsbewohner, wie die Koiäri im Innern von Port Moresby, zu sein scheinen. Mit dem Fernrohr ließen sich deutlich alte und neu angelegte Plantagen unterscheiden, aber nirgends war ein Mensch sichtbar, höchst selten ein Haus, dagegen zuweilen Rauch oft unmittelbar unter der Waldregion, in Höhen von über 2000 Fuß. Kap Frere ist jedenfalls der großartigste Teil dieses Küstengebirges und bietet namentlich von der Westseite, Bartle-Bai, höchst romantische Partien, wie die beigegebene Skizze des »Drachenfels« (S. 244), wenigstens andeutet. Die mit grünem Grase bekleidete, senkrechte Wand, an der ein Wasserfall herabstürzt, ist auf ihrer Spitze mit Felsmauern und Buschwerk gekrönt, wie mit einer märchenhaften Burgruine. Sehr reich an pittoresken Schönheiten ist Goodenough-Bai, der wir kaum eine Meile von der Küste entfernt, auf nahezu 25 Meilen in W.-N.-W.-Kurse folgten. Das herrliche Gebirge, welches ich zu Ehren des »Basilisk« benenne, wird höher und zeigt imposante Kuppen, Spitzen und Hörner, von denen wenigstens zwei Namen[S. 244] verdienen. Sie begrenzen die Einsattelung, welche ca. 20 Meilen west von Kap Frere das Gebirge durchschneidet. Die Ostseite der tiefen Schlucht bildet, eine regelmäßige Pyramide, die Flowerspitze, während die Westseite von einem auffallenden, schiefabstehenden Felsenhorn, der Sclaterspitze, begrenzt wird, beide benenne ich nach zwei hervorragenden englischen Naturforschern. Vor dieser charakteristischen Gebirgseinsattelung dehnt sich ein breiteres Vorland mit sonderbar geformten Vorbergen aus, die, wie schon[S. 245] Moresby[61] erwähnt, auffallend der Tafel eines Atlanten ähneln, welche die Gebirge der Welt darstellt, ein wahres Chaos von kleineren und größeren Pyramiden, die sich zuweilen giebelartig aneinander reihen. Diese mehrere hundert Fuß hohen Pyramidenhügel sind alle kahl und zeigten jetzt eine bräunliche Färbung, die nur durch spärliche Baumvegetation in den Schluchten unterbrochen wurde. Wenn übrigens Moresby dieses Land, wie den ganzen Strich, für ausgezeichnet für Kulturen wie Viehzucht erklärt, so kann ich damit nicht übereinstimmen. Und zwar aus dem einfachen Grunde, weil das Land fast nur aus Gebirgen, dabei sehr steilen Gebirgen, besteht und zu wenig Ufervorland bietet. Daß das letztere selbst von den Eingeborenen fast gemieden wird, ist freilich höchst sonderbar und auffallend, denn immerhin könnten Tausende hier leben. Von den zahlreichen Dörfern,[S. 246] welche Moresby erwähnt, sahen wir, abgesehen von einzelnen Häusern, nur vier, davon das erste (acht Häuser) ca. acht Meilen west von Chads-Bai, und dann erst wieder zwei noch kleinere in Bartle-Bai. Diese Häuser waren nicht »oval«, wie sie Moresby beschreibt, sondern von gewöhnlicher Form und standen zum Teil auf niedrigen Pfählen. Noch seltener als Siedelungen und Häuser (die ja auch ganz versteckt liegen können) trafen wir Eingeborene und kamen nur einmal mit ihnen in Berührung, oder vielmehr sie sehr unfreiwillig mit uns. Es war ca. 12 Meilen west von Chads-Bai, als plötzlich ein gewöhnliches Baumstamm-Kanu vor uns auftauchte, dessen fünf Insassen, offenbar in großer Angst, so ungeschickt vor dem Buge des Dampfers manövrierten, daß eine Kollision nicht zu vermeiden war. Die Leute retteten sich aber im letzten Moment durch Herausspringen, schöpften ihr Fahrzeug, das glücklicherweise keinen Schaden gelitten hatte, wieder aus und paddelten dem Ufer zu, ohne sich nur nach uns und den ins Wasser geworfenen Geschenken, roten Zeugstreifen an leere Flaschen gebunden, umzusehen. Ganz ebenso machte es eine Anzahl Weiber, die wir an einer fast ausgetrockneten Flußmündung überraschten, ein Mann in einem Kanu in Bartle-Bai und vier Kanus mit je drei Insassen in Goodenough-Bai, alles, was wir an Menschen überhaupt trafen und zu sehen bekamen. Bei den Häusern und Siedelungen beobachteten wir sonderbarerweise nie ein menschliches Wesen. Und doch zählte Moresby an einer Stelle in Bartle-Bai über 100 Eingeborene, die zwar scheu, aber freundlich waren und unter anderem einen Opferhund sowie ein Schwein überreichten. Es hat sich also offenbar seitdem vieles verändert und zwar nicht infolge des üblen Einflusses von Werbeschiffen (Labourtrade), die dieser Küste wohl fern blieben. Sie eignet sich nämlich wegen großer Meerestiefen[62] und Mangel von Häfen nicht sonderlich für Schiffsverkehr und wird schon aus diesem Grunde Ansiedelungen wenig begünstigen. Es ist zu bedauern,[S. 247] daß Moresby die Plantagen der Eingeborenen im Gebirge unerwähnt läßt. Wir sahen sie in Goodenough-Bai allenthalben, ja hier in noch bedeutenderen Höhen als vorher, nicht selten in 4000 Fuß, unmittelbar unter der Waldregion, welche die Kammhöhe bedeckt, und selbst auf den höchsten Kuppen ließen sich mit dem Glase Kultivationen, Fußpfade, grüne Wiesen und einzelne Häuser, wie Sennhütten, erkennen. Wer zu ihnen vordringen und über dieses sonderbare Gebirgsland und seine Bewohner Auskunft geben könnte! Hat doch bis jetzt kaum ein Forscher jene Küste, geschweige denn die einsamen Gebirgspfade des braunen Mannes betreten. Aber hoffentlich wird auch für dieses Gebiet bald die Zeit herankommen, wo diese Lücken ausgefüllt werden.

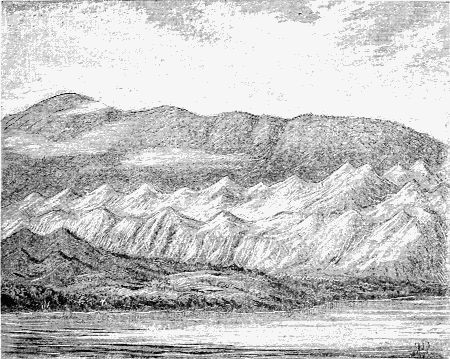
Gegen Abend näherten wir uns dem Nordrande von Goodenough-Bai, der ähnlich wie Huon-Golf von West nach O.-N.-O. verläuft, aber nur 25 Meilen lang ist und mit niedrigeren, meist bewaldeten Höhenzügen bedeckt ist, hinter denen die majestätischen Gebirge von Goodenough-Insel hervorragten. Am anderen Morgen befanden wir uns in Ward-Hunt-Straße, welche die letztere Insel vom Festlande trennt und näherten uns Kap Vogel (S. 248), das Moresby nach dem früheren Premierminister von Neu-Seeland Sir Julius Vogel benannte. Es wird von einem ca. 400 Fuß hohen, steilen Hügel gebildet, der gleich einer grünen Wand die Nordostspitze der Kap Vogel-Halbinsel säumt, welche aus schönem Kulturland zu bestehen scheint. Am Strande zeigten sich dichte Bestände Kokospalmen, aber wir bemerkten nur ein Dorf, dessen Bewohner keine Kanus zu besitzen schienen und von uns gar nicht Notiz nahmen. Grüne Flächen und Hügel treten jetzt an Stelle der Hochgebirge und die ganze Küste nimmt einen anderen Charakter an. Seit Catharine-Insel sahen wir zuerst wieder kleine Inseln vorgelagert, die meist niedrig, dicht mit Mangrove bestanden und häufig durch Riff mit dem Festlande verbunden sind. Während es in Goodenough-Bai nicht ein Riff giebt, wurden solche von jetzt an häufiger und mahnten den Schiffer zur Vorsicht. Diese ist umsomehr geboten, als wir fast an dieser ganzen Küste bis Mitrafels hinauf noch in einer Entfernung von vier Meilen[S. 248] trübgefärbtes Wasser beobachteten, das selbst den sorgfältigen Ausguck illusorisch machte. Nicht selten wühlte die Schraube in klarem Wasser, während die Oberfläche des Meeres weit und breit schmutzig-grün erschien, was auf zahlreiche Süßwasserzuflüsse schließen läßt. Die Möglichkeit auf totes Riff zu rennen liegt daher nahe, und auch der Samoa drohte diese Gefahr ein paarmal, glücklicherweise kamen wir aber mit dem Schrecken davon. Das schmutzige Wasser veranlaßte auch Kapitän Dallmann der riffreichen Collingwood-Bai auszuweichen, deren Küsten wir schließlich ganz aus Sicht verloren. Was wir im östlichen Teile derselben sahen, war niedriges Hügelland, anscheinend mit viel grünen und braunen Kulturflecken, die wohl aber nur kahles Land sind, längs dem Ufer ein dichter Gürtel Mangrove.
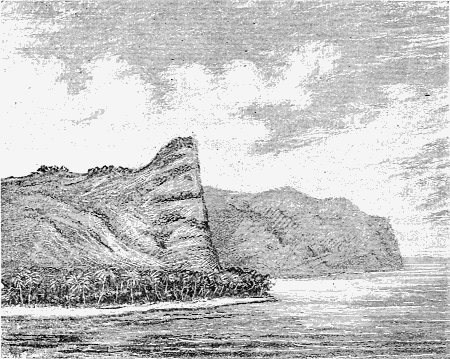
Nach wenigen Stunden kam wieder Land in Sicht und entwickelte sich bald zu einem sehr malerischen Gebirgspanorama, dem[S. 249] Nelson-Gebirge mit seinen beiden hervorragendsten, an 4000 Fuß hohen Spitzen, Victory und Trafalgar. Sie sind wie das übrige Gebirge dicht bewaldet, laufen aber in grasige schiefe Flächen aus, die von dichtbewaldeten Schluchten durchzogen sind, und wahrscheinlich Flußläufe aufzuweisen haben. So zeigt der Berg Trafalgar an seiner Nordostseite einen hübschen Wasserfall und wird durch eine tiefe Schlucht in zwei Hälften geteilt, wie dies meine Skizze veranschaulicht. Die Küste schneidet in mehrere mangrovebestandene Buchten ein, die nicht frei von Felsen sind, wie es auch an Riffen nicht mangelt. So malerisch dieses Land aussieht und so sehr es für Kulturen geeignet scheint, Anzeichen des Vorhandenseins von Eingeborenen fanden wir nicht und verbrachten daher eine ruhige Nacht in Porlok-Bai, etwas westlich von dem schwer auszumachenden Kap Nelson. In dieser Gegend hatte auch der Basilisk eine Nacht geankert, und Moresby gedenkt zahlreicher Eingeborener und deren besonders[S. 250] konstruierten, sehr großen Kanus, von denen manche 30 bis 40 Mann trugen. Wir hatten das letzte in der Nähe von Kap Vogel gesehen und trafen überhaupt erst wieder an der Ostspitze von Dyke-Acland-Bai, vor dem sogenannten Kap Sud-Est (von d'Entrecasteaux) mit Menschen zusammen, wie sich schon von weitem an einem Kokoshain erwarten ließ. Es entwickelten sich hier nach und nach vier größere Dörfer, von je einem Dutzend Pfahlhäusern, aber Eingeborene zeigten sich nur wenig, und diese wenigen kamen nicht, obwohl sie Kanus besaßen. Weiter nordwestlich begegneten wir keinen Siedelungen mehr, was, wenn auch vereinzelte übersehen worden sein können, immerhin zu dem Schlusse berechtigt, daß diese ganze, von Chads-Bai an nach ihrem Verlauf gemessene, an 270 Meilen lange Küste nur äußerst spärlich bevölkert ist. Und wie es auf deutschem Gebiete in Huon-Golf und längs der Maclay-Küste damit bestellt ist, haben wir aus Kap. 5 und 4 ersehen. In der That sind alle bisherigen Angaben über die Einwohnerzahl Neu-Guineas durchaus illusorisch und entbehren jedes sicheren Anhaltes. Aber bei der Genauigkeit unserer geographischen Lehrbücher müssen ja auch solche Zahlen ausgefüllt werden, selbst wenn sie auch nicht entfernt zuverlässig sein können. Was die Beschaffenheit der Küste selbst anbelangt, so ähnelt dieselbe im ganzen der von Herkules-Bai. Von der Kap Nelson-Halbinsel bis Kap Killerton ziehen sich inland ununterbrochen Gebirgsketten von 2000 bis 4000 Fuß Höhe, die von da an zu niedrigeren Höhenzügen herabsinken, während das Ufer westlich von Dyke-Acland-Bai meist mit dichten Kasuarinenbeständen gesäumt ist. Solche finden sich in den verschiedenen Buchten längs der sogenannten Holnicote-Bai, die übrigens kaum den Namen »Bai« verdient.
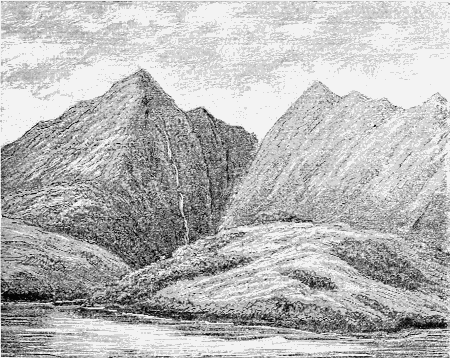
Von Mitrafels kehren wir zu einer späteren Zeit wieder nach Bentley-Bai zurück, deren Bewohner uns diesmal als Freunde begrüßten und am liebsten ganz behalten hätten. Bei nochmaliger genauer Prüfung erwies sich aber dieser Platz, aus verschiedenen Gründen, zur Anlage einer Station, um die es sich diesmal handelte, nicht geeignet. Wir mußten also unser Heil anderwärts probieren und untersuchten die Küste bis Ostkap wiederholt. Sie wird von[S. 251] mehreren kleinen, palmumrahmten Buchten gebildet, von denen sich aber nur die von Hihiaura brauchbar erwies, weil hier wenigstens kleine Schiffe ankern können. Diese Bucht, ca. eine Meile ost von Bentley-Bai und neun Meilen west von Ostkap, ist von malerischen Bergen umgeben, unter denen der über 1300 Fuß hohe Killerton der höchste ist. Trotz der Steilheit sieht man überall im Waldesdickicht noch hoch hinauf urbar gemachte Stellen, Plantagen der Eingeborenen, die im Verein mit den luftigen Kokoshainen des Strandes ein gar liebliches Bild geben. Bald wurde es lebendig; zahlreiche Catamarans paddelten heran, und eine große Menge Eingeborener hatte sich am Ufer versammelt, als wir landeten. Offenbar war schon von Bentley-Bai Kunde über uns hierher gelangt, denn die Leute zeigten sich, obwohl immerhin mißtrauisch, doch längst nicht so scheu als zuerst dort. Die Siedelung Hihiaura ist, wie alle an dieser Küste, sehr klein und zählte nur acht Häuser, darunter aber ein ungewöhnlich großes. Es war 40 Fuß lang, 18 breit und bis unter die Giebelspitze 25 Fuß hoch, dabei äußerst akkurat gebaut, und ich freue mich, auch dieses bemerkenswerte Bauwerk der Steinzeit hier in der Abbildung geben zu können. Nicht lange und man wird vergeblich nach einem derartigen Denkmal der Baukunst des sogenannten Naturmenschen suchen. Auch die hiesigen hatten die Steinaxt beiseite gelegt und dachten nicht daran, die beginnenden Schäden des Hauses auszubessern, wie der Eingeborene überall nachlässiger wird, sobald er erst eiserne Werkzeuge besitzt. Das bewußte Gebäude war übrigens ein Familienhaus, in welchem vier Familien, der größere Teil der Bevölkerung Hihiauras, wohnten. Für uns, die wir im Begriff standen selbst zu bauen, hatte dieses Haus, bei dem keine Säge, kein Bohrer, kein Nagel, ja überhaupt kein Eisen benutzt oder verwandt worden war, natürlich ganz besonderes Interesse, und selbst unsere Zimmerleute gaben ihrer Bewunderung als Sachverständige Ausdruck. Bald kam die Reihe des Erstaunens an die Eingeborenen, als sie sahen, was drei Weiße mit ihren Werkzeugen und vier Schwarzen zu schaffen vermögen. Während letztere den gekauften Platz klärten und mit wuchtigen Axthieben Bäume, z. B. die größte Kokospalme[S. 252] in zehn Minuten, zu Boden streckten, suchten die Zimmerleute im Walde nach passenden Bäumen zu Pfählen, denn auch unser Haus sollte ein Pfahlbau werden, wobei es hauptsächlich auf die Träger ankommt, auf denen der Fußboden ruht. Sie müssen von Hartholz (Mangrove und dergleichen) sein, das Fäulnis und weißen Ameisen widersteht und durch eine Blechkappe und Teeranstrich weiteren Schutz erhält. An Baumaterial hatten wir nur Pfosten und Latten für Gestell und Dachstuhl, Bretter zur Diele und Fensterladen mitgebracht, alles übrige mußte von einheimischem Material beschafft werden. Die Eingeborenen holten dasselbe herbei und erwiesen sich, soweit Kanaker überhaupt fleißig sein können, als recht fleißig. Freilich giebt es da immer mehr Zuschauer als Arbeiter, aber freundliches Zureden und ein freundliches Gesicht vermag auch die Trägen aufzumuntern, ja zuweilen fährt eine wahre Arbeitswut unter die Leute. Ein Teil schleppt Büschelgras für das Dach herbei, andere flechten Matten aus gespaltenen Blättern der Kokospalme zu den Seitenwänden, Kinder säubern den Platz von Steinen und holen Lianen zum Binden, aber alle wollen schließlich bezahlt sein und zwar gleichmäßig. Darin sind Kanaker reine Sozialdemokraten; denn wer immer nur etwas mitgeholfen hat, verlangt dasselbe als der, welcher wirklich arbeitete und der Knabe soviel als der Häuptling. Nun, ich will gleich hier bemerken, daß die Arbeitslöhne keine großen Summen repräsentieren, handelt es sich doch um Tabak, und einige Stangen mehr oder minder fällt nicht ins Gewicht. Ja, ein paar Stück mehr thun oft Wunder, erhalten die Leute in Stimmung, und nicht selten beginnen etliche freiwillig zu helfen, die bisher nur gafften. So schnell der Eifer des Kanakers plötzlich für eine Sache auflodert, so schnell verfliegt er auch, aber glücklicherweise wird so ein Haus ja ziemlich rasch fertig, wie die Entwickelung des unsrigen zeigt. Erster Tag: Bäumefällen und Klären eines Platzes von 120 Fuß Breite und 170 Fuß Tiefe; Graben von 24 Löchern und Einrammen so vieler Pfähle; zweiter Tag: Diele legen, Pfosten und Dachstuhl aufsetzen; dritter Tag: Fenster und Thüren einsetzen, Dach decken; vierter Tag: Dach vollendet, Innenwände gemacht; fünfter Tag: Seitenwände gemacht[S. 253] — und fertig war das Haus! Nicht wahr, das geht schnell? »Wird auch danach gewesen sein?« höre ich Zweifler einwerfen. Ja, ein Palast war es freilich nicht, aber, wie die Abbildung (S. 256) zeigt, immerhin ein Haus (40 Fuß lang, 14 breit und 16 hoch), das für die hiesigen Verhältnisse einen ausgezeichneten Bau repräsentierte, der die meisten Traderstationen, wie sie im Bismarck-Archipel üblich sind, bei weitem überragte. Ach ja, solche Stationen entsprechen in den meisten Fällen gar wenig dem, was man sich gewöhnlich darunter vorstellt und unterscheiden sich oft kaum von Hütten der Eingeborenen. Sogenannte »Native-Häuser«, d. h. aus Material des Landes, sind übrigens gar nicht zu verachten, und wenn gut gebaut, solchen aus Brettern und Wellblechdach, schon der größeren Kühle wegen, vorzuziehen. Dabei stellen sie sich bedeutend billiger, denn Bretter sind in Australien teuer, besonders Hartholz, das allein den weißen Ameisen widersteht, die mit gewöhnlichem Fichten- und Tannenholz gar bald fertig werden. »Billig und schlecht« rächt sich in den Tropen daher am meisten, aber gewöhnlich wird erst viel Lehrgeld gezahlt, ehe man dies einsieht.
Mit den Eingeborenen hatten wir uns bald auf das freundlichste gestellt. Sie waren mit unserem Plane ganz einverstanden und brachten gleich das erste Schwein als Opfer der Freundschaft, welches bei allen Eingeborenen bedeutungsvoll ist. Große Freude machte es ihnen auch, daß ich nach alter Praxis jedes Wort aufschrieb, welches ich hörte. Und als ich erst »goanajai« (= wie heißt das?) fragen konnte, da ging es mit der Verständigung schneller. Aber diese ersten Worte machen eben die meiste Mühe. Namentlich ist es schwer, die Namen der Leute zu erfahren, weniger wer die Hauptpersonen sind. Denn das hatte ich in Hihiaura bei meiner Findigkeit schon am ersten Tage heraus. Und auch dies ist nicht immer so leicht, da sich ein »Gomira«, wie Häuptling hier heißt, äußerlich kaum von der übrigen Gesellschaft unterscheidet. Aber da der schwatzhafte Alte, mit den verschmitzten Augen, den ich wegen seines Zwickelbartes den Schneider nannte, der hat etwas zu bedeuten. Er entpuppte sich später als Gomira Taga! Und dann der behäbige Herr,[S. 254] mit dem gutmütigen, freundlichen Gesicht, der gehört auch zu den Honoratioren, obwohl er wenig spricht, stets Ernst und Würde bewahrt und nie lacht, denn so verschieden sind auch die Charaktere bei den Papuas. Ich hatte das Richtige getroffen: es war Gomira Tohodo oder Tohde, der größte und beste Häuptling Hihiauras, der sich uns stets hilfreich und freundlich erwies. Er war ein Mann von Besonnenheit und Nachdenken, und deshalb schienen ihm unsere Kühe und Schafe, die jetzt gelandet werden sollten, viel Sorgen zu bereiten. Solche Ungeheuer hatten die guten Leute noch nie gesehen, und namentlich flößte ihnen der Widder mit seinen gewaltigen Hörnern Angst und Schrecken ein. Und von was mochten sich diese Monstra nähren? vielleicht spießten sie Menschen auf, um sie später gemächlich zu verschlingen? Das waren offenbar alles Fragen, die durch Tohdes Kopf gingen, als ich mit ihm einen Ausflug machte, um einen passenden Platz für das Vieh ausfindig zu machen. Bald fanden wir mit Gras bestandene Berghänge, die sich für unsere Zwecke trefflich eigneten. Ich hielt, so gut ich konnte, einen Vortrag über Rindvieh und Schafe, den mein brauner Freund vollkommen zu begreifen und der ihn zu beruhigen schien. Sorgsam raffte er ein Grasbündel zusammen, dessen Zweck ich anfänglich nicht begriff. Aber da im Dorfe, vor dem versammelten Volke, da demonstrierte er mit dem Grase in der Hand die fremden Tiere, die nun unter Jubel gelandet wurden. Hei! wie das auseinanderstob, wenn der Widder einen Seitensprung machte, und gar erst als eine Kuh nach ihrem Kalbe brüllte; da war es mit der Courage wieder vorbei. Aber die Leute wußten nun, daß die Tiere Gras fressen und bezeugten ihre Genugthuung darüber durch einstimmiges »dewadewa« (sehr gut). Auch ich schloß mich im stillen diesem »dewadewa« an; war es mir doch vorbehalten gewesen, die ersten Nutztiere nach diesem Teile Neu-Guineas zu bringen, und daß sich wenigstens das Rindvieh trefflich halten würde, darüber war mir kein Zweifel. Freilich mußte das erst versucht werden, wie die ganze Anlage ein Versuch war, auch in diesem Gebiete freundliche Beziehungen mit den Eingeborenen anzuknüpfen und dasselbe für Handel und Civilisation zu eröffnen. Dabei kam der Umstand[S. 255] zu statten, daß die Eingeborenen bereits Bedürfnisse besaßen, z. B. nach Tabak und Pfeifen verlangten, deren Benutzung an anderen Orten erst nach und nach eingeführt werden muß. So kannten z. B. die Neu-Irländer vor wenigen Jahren Tabak noch gar nicht; heute ist er dort, wie überall, das gangbarste Tauschmittel. Wie die Eingeborenen bereits etwas verlangten, so hatten sie auch etwas abzugeben, ihren Reichtum an Kokosnüssen, mit dem es an der ganzen Ostküste von Neu-Guinea sonst gar ärmlich aussieht. Denn wo die Eingeborenen gar nichts abzugeben haben, da kann auch kein Tauschhandel aufkommen, wie dies leider meist der Fall ist. Hier boten sich günstigere Verhältnisse und ein weites Arbeitsfeld, das sich bei geeigneten Hilfsmitteln bis auf die nahen d'Entrecasteaux-Inseln ausdehnen ließ. Blumenthal, wie ich die Station (S. 256) nach dem Heimatsorte von Kapitän Dallmann benannte, sollte dafür die Grundlage bilden und wurde einem erprobten Manne, Karl Hunstein (vergl. S. 196), den ich glücklicherweise in Cooktown getroffen und engagiert hatte, übergeben. Er war mit mir im Inneren von Port Moresby gewesen, und ich wußte aus Erfahrung, daß keiner besser verstand mit Eingeborenen umzugehen als er. Einem solchen Pioniere, der bereits sieben Jahre unter den Eingeborenen Neu-Guineas lebte und niemals in Konflikt mit ihnen kam, brauchte man keine Instruktionen zu geben, der wußte selbst am besten, was er zu thun und zu lassen hatte.
Die Eingeborenen waren übrigens ganz so, wie wir sie in Bentley-Bai kennen lernten, und ich habe dem dort Gesagten (S. 235) wenig hinzuzufügen. Neu war mir ein eigentümlicher Trauerschmuck, ein Reif dicht mit Ovulamuscheln besetzt, den Frauen über die Brust auf der Achsel trugen, zugleich ein Hoheitszeichen, das nur Häuptlingsfrauen zukommt. Eine andere Auszeichnung bemerkte ich an einem Manne, der die eine Brustseite tätowiert hatte, eine Körperverzierung, die sonst an dieser ganzen Küste nicht üblich ist. Aber an der Südostküste hatte ich ganz gleiche Tätowierung bei Männern gesehen, die dort als Zeichen dient, daß der Betreffende einen Feind im Kampfe schlug, was vermutlich auch für hier gültig sein wird.[S. 256] Im ganzen schienen die Bewohner von Hihiaura aber sehr friedliche Leute, bei denen man selten eine Waffe (Speer) sah und die ihre Kampfschilde verkommen ließen, wahrscheinlich weil dieselben nicht mehr gebraucht werden. Statt Speerwerfen vergnügte sich jung und alt mit Schaukeln, die ganz wie die unseren aus zwei Stricken bestanden und an Bäumen angebracht waren. Ackerbau und Fischfang bildeten wie überall auch hier die Hauptbeschäftigungen. Letzterer wurde von Catamarans aus mit Netzen betrieben und galt hauptsächlich einer kleinen, sprottenähnlichen Fischart, die sehr häufig war. Wenn sich der Kreis des engmaschigen Garnes enger zog, versuchten die Fischchen gewöhnlich mit großer Behendigkeit durch[S. 257] Überspringen zu entrinnen, so daß die Fischer meist vollauf zu thun hatten, dies zu verhindern. Ihr Gewerbe wird noch durch gefräßige Schmarotzer-Milane (Milvus melanotis) erschwert, die, ohne sich um den Mann auf dem Catamaran zu kümmern, von diesem bereits erbeutete Fische im Fluge wegzustehlen wissen, was oft gar ergötzliche Scenen giebt. Es mag noch bemerkt sein, daß die Eingeborenen diese kleinen Sprotten ganz gut zu räuchern verstehen und an Stöckchen aufgereiht zum Verkauf bringen. Die Ware hält sich aber nicht lange, da man kein Salz kennt und alle Speisen ohne solches zubereitet, wie dies für die ganze Südsee[63] gilt.
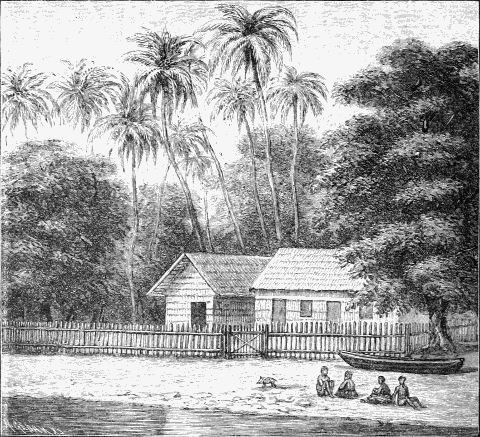
Ich habe bereits erwähnt, daß alle Papuas nur gekochte Nahrung genießen, aber noch einiges über das Kochen nachzuholen. Dabei mag der Stellung der Frau gedacht sein, die so häufig durchaus falsch beurteilt wird. Da hört man nichts als von einem Sklaventum der Frauen, die nur die Lasttiere zu spielen haben, schlechter behandelt werden als das liebe Vieh, mit einem Wort, die bedauernswertesten Geschöpfe unter der Sonne sein sollen. Aber so schlimm ist es bei weitem nicht; denn auch die Papuafrau erfreut sich eines menschenwürdigen Daseins und spielt in ihrer Weise, unter Berücksichtigung des allgemeinen Bildungsgrades, eine so wichtige Rolle als bei uns. Giebt es doch in Neu-Guinea auch Königinnen! Im ganzen haben es Papuafrauen besser als das weibliche Geschlecht der ärmeren Volksklassen bei uns, auf dem nicht allein Hauswesen und Kindererziehung lasten, sondern das auch meist noch tüchtig arbeiten muß. Das weiß freilich nicht jeder bei uns, wer aber kennen lernte, wie sehr sich das arme weibliche Geschlecht in Europa plagen muß, der wird ihre dunklen Schwestern in Melanesien nicht beklagen. Betrachten wir das Tagewerk einer Papuafrau! In einer Zone, wo der Tag ungefähr zwölf Stunden dauert, darf man es nicht als Frühaufstehen bezeichnen, wenn die Menschen mit der Sonne[S. 258] munter werden. Gewöhnlich lassen Eingeborene dieselbe erst ordentlich aufgehen, ehe sie auf der Bildfläche erscheinen, denn Morgenfrische und Tau sind der empfindlichen nackten Haut sehr unangenehm. Es ist also meist sechs Uhr vorüber, bis sich die ersten Eingeborenen vor den Hütten zeigen, um sich zunächst von den Sonnenstrahlen durchwärmen zu lassen. Die Frauen zünden dann Feuer an, um Reste vom vorhergehenden Abend aufzuwärmen oder frisches Essen zu kochen, holen Wasser in Kokosnußschalen und beginnen dann mit Kehren, ganz wie dies bei uns geschieht. Dabei wird nicht nur die Hausdiele, sondern auch der freie Platz um die Häuser, zuweilen der Strand gefegt; es herrscht daher eine Reinlichkeit, die vielerorts bei uns zum Muster dienen könnte. Gegen acht Uhr trollen die Frauen mit den Kindern, Schoßschweinchen und Hunden in die Plantagen ab. Dort wird vielleicht etwas Erde aufgewühlt, Yams ausgegraben, gepflanzt und dergleichen, aber nicht das verrichtet, was bei unserer ländlichen Bevölkerung Arbeit heißt, die oft nach des Tages Last und Mühe noch den Abend benutzen muß, um ein Stückchen Land zu bestellen. Gegen drei oder vier Uhr sehen wir die Frauen aus den Plantagen heimkehren, mit Früchten und Feuerholz beladen, schier niedergedrückt von der Last. Aber was ist dieselbe gegenüber derjenigen, welche Frauen bei uns zu schleppen haben, die Kiepen, wie wir sie in Thüringen finden, oder Körbe und Eimer, wie sie im Bremischen noch dazu auf dem Kopfe getragen werden. Jetzt beginnt das Holzzerkleinern in sehr einfacher Weise, indem man die dürren Aststücke auf einem Stein zerschlägt, und das Kochen kann seinen Anfang nehmen. In Ermangelung von Lappen wird der Topf mit einem Bananenblatt ausgewischt und ist nun zur Aufnahme von Lebensmitteln fertig. Mittelst Muschelschalen schälen die Frauen Bananen und Brotfrucht, schneiden solche in Würfel und füllen den Topf damit, eine Arbeit, bei der sich die zahmen Schweinchen sehr zudringlich und lästig erweisen, da sie von allem ihr Teil abhaben wollen. Jetzt wird mit dem gezähnelten Rande einer Muschel Kokosnuß gerieben und die ölreiche, breiige Masse, welche das Fett ersetzt, über den Inhalt des Topfes ausgeschüttet, der nun[S. 259] mit Süßwasser gefüllt und Bananenblättern zugedeckt, auf das Feuer gesetzt wird. Drei Steine stützen den unterseits runden Topf, unter dem bald ein lustiges Feuer lodert. Ist das Essen gar, so bekommt jeder sein Teil auf einem Bananenblatte serviert und häufig essen die Frauen mit den Männern zusammen. Letztere schämen sich übrigens keineswegs vor Küchenarbeit, und jeder Mann versteht ebensogut zu kochen als die Frau. Nach dieser Hauptmahlzeit, die nach englischer Sitte zwischen fünf bis sechs Uhr abends stattfindet, und bei der nur Wasser als Getränk dient, begiebt man sich meist zur Ruhe. Denn inzwischen ist gewöhnlich der Abend hereingebrochen und das Tagewerk des Papuas vollendet, des glücklichen Menschen, der nichts von vierzehnstündiger Arbeitszeit und Nachtarbeit weiß, ohne welche Millionen bei uns kaum ihr bißchen Leben zu fristen im stande sind. Aber mondhelle Nächte sehen auch den Papua, der das Dunkel der Nacht fürchtet, thätig, ja unermüdlich; es gilt aber dann nur fröhlichem Spiel und Tanz. Damit kann der Papua oft halbe Nächte zubringen und darf sich dies erlauben. Ist er doch ein freier Mann, dem Niemand am frühen Morgen zuruft: »Stehe auf und arbeite«! Ja, das wird noch lange dauern, ehe sich der Papua unserer Civilisation der Arbeit anbequemt hat, und ich fürchte, die Mehrzahl ist vorher darüber zu Grunde gegangen. Wie schwer es schon hält den civilisierten Papua, der bereits im Bunde der Christenheit steht, auf die Beine zu bringen, nur um der kurzen Andacht beizuwohnen, das habe ich in Port Moresby oft genug erlebt. Da nützte die Glocke, mit welcher ein Knabe durchs Dorf bimmelte, oft sehr wenig, und erst wenn der energische Rua, ein eingeborener Lehrer, in Person die Hütten visitierte und die Lässigen, wohl nicht immer mit bloßen Worten, aufmunterte, schlenderten sie nach dem Gotteshause. Freilich, wenn gerade ein Kriegsschiff da ist, dann kommen sie alle, die Bekehrten und solche, die es werden wollen, in zum Teil geborgten Feierkleidern, denn sie wissen ja, daß bei solchen Gelegenheiten meist etwas abfällt. Und solche läßt sich der Papua als praktischer Mann nicht entgehen, denn Eigennutz bildet einen hervorragenden Zug seines Charakters, während der Erwerbssinn,[S. 260] zumal wenn mit einiger Mühe verknüpft, fast gar nicht vorhanden ist.
Trotz der Liebenswürdigkeit der Bewohner Hihiauras wußte ich schon im voraus, daß das nicht so bleiben würde, sobald erst der Dampfer weg war. Aber Hunstein gegenüber brauchte ich unbesorgt zu sein, und wir werden später erfahren, wie sehr er sich unter schwierigen Verhältnissen als der richtige Mann bewährte. Und deren giebt es gar wenige. Vor allem erfordert es einen nüchternen Mann, der sich mit der eingeborenen Damenwelt nicht einläßt, was in der Regel die Ursache von Feindseligkeiten ist, ferner einen Mann, der die Eingeborenen zu behandeln versteht, sich nicht fürchtet, aber auch bei etwaiger drohender Haltung nicht gleich dazwischen feuert, wie dies so häufig geschieht. Ruhe und Nüchternheit sind daher Hauptbedingungen; außerdem aber noch eine Menge praktischer Fertigkeiten erforderlich, die sich nur im Buschleben erlernen lassen. Leute, welche solchen Anforderungen entsprechen, giebt es aber gar wenige, und man darf sich nicht wundern, wenn die noch so junge Geschichte der Handelsniederlassungen im westlichen Pacific bereits so viele blutige Dramen zu verzeichnen hat, während die Mission, mit ein paar Ausnahmen, überall friedlich durchkam. Das hat eben an den betreffenden Vertretern gelegen. Die Art und Weise im Betragen und Auftreten des ersten Weißen ist daher von großer, folgeschwerer Bedeutung für das weitere Einvernehmen mit den Eingeborenen. Über das Tradertum der Südsee ließe sich allein ein Buch schreiben, denn es setzt sich aus Elementen zusammen, deren Vergangenheit häufig eine sehr dunkele war, und unter denen Abenteurer der verschiedensten Art vorkommen. Man muß diese »Whistling Jacks«, »Kings of the Macaskills«, und wie sie sich sonst mit Vorliebe nennen lassen, kennen und wird zugeben müssen, daß sie den Eingeborenen selten als Vorbilder dienten. Ich erinnere mich dabei u. a. eines Traders auf Pleasant-Island, eines weggelaufenen Matrosen, dessen Halbblutsohn »Agua-Ardente« gar nicht erst englisch lernte, weil dies der Vater für einen »Kanaker« überflüssig hielt. Und solche weiße Kanaker, »Pákeha Maoris«, wie sie auf Neu-Seeland heißen,[S. 261] rekrutieren sich nicht immer, wie in dem letzteren Falle, aus ungebildeten Berufsklassen. Nein! gar manche haben etwas gelernt und waren Leute in guter Lebensstellung. Aber der Gin, der Gin! Da liegt meist das Übel! er spielt im Leben des Südsee-Traders eine gar große, böse Rolle, und wie wenige giebt es, die sich mit mäßigem Schnapsgenusse begnügen. Wenn die Eingeborenen Melanesiens in dieser Richtung nicht dem Beispiele des Weißen folgten, so liegt es daran, weil sie Spirituosen nicht mögen, die in anderen Südseegebieten z. B. den Gilberts bereits eine erschreckende Verbreitung gefunden haben. Aber auch in anderen Beziehungen waren Weiße nicht immer Vorbilder für die moralische Erziehung der Eingeborenen, die nicht nur in rohen Matrosen, sondern auch in Leuten der gebildeten Klasse zuweilen üble Lehrmeister erhielten. Was muß der Kanaker denken, wenn ihn ein Weißer beauftragt, gegen Bezahlung einen anderen Weißen umzubringen, wie dies in Neu-Britannien vorkam. Der Anstifter dieser grausigen That, ein Kapitän L...[64], war damals einer der hervorragendsten Weißen und ließ jenen Trader nur erschlagen, um dessen sogenannte Frau, eine Samoanerin, zu erlangen, wie einst David Bathseba. Solchen Beispielen gegenüber ist es leicht begreiflich, daß die Mission mit ihren braunen Lehrern (teachers), beschränkten, aber nüchternen und ordentlichen Menschen, weit mehr für Civilisation leistete als der Handel, dessen Träger nur in seltenen Fällen etwas dafür thaten. Hätte der Handel aber von Anfang an über ähnliche gute Hilfsarbeiter verfügen können, dann würde auch er für die Eingeborenen und deren Hebung dasselbe erreicht haben als die Mission, denn er ist ebenso gut dazu berufen segensreich zu wirken als die letztere. Ja, in gewisser Beziehung noch mehr, denn der Handel kann die Eingeborenen zugleich zu einer für beide Teile ersprießlichen Thätigkeit anspornen und ermuntern, hat aber in dieser Richtung bisher wenig geleistet. Und jetzt ist es an vielen Orten bereits zu spät. Die Eingeborenen zum Teil[S. 262] schlecht behandelt und durch das oft gewaltsame Wegführen von Arbeitern erbittert, haben das Vertrauen zum weißen Manne verloren, und dieses wird sich nur sehr schwer wieder erringen lassen.
Ich wußte Blumenthal in guten Händen, besonders da Hunstein einen tüchtigen Gefährten in einem schottischen Zimmermann erhalten hatte, und so dampften wir befriedigt Ostkap zu.
Killerton-Inseln. — Missionsstation auf Aroani. — Die Londoner Mission in Neu-Guinea. — Farbige Lehrer (teacher) — die wahren Pioniere. — Betragen der Eingeborenen. — Stellung der Lehrer. — Günstiger Einfluß der Mission. — Ein Sonntag in der Mission. — Christliche und heidnische Kunst. — Kirärauchen. — Beschaffenheit der Insel. — Ein schöner Sänger. — Milne-Bai. — Mita. — Higiba. — Schilde. — Häuser. — Baumhaus. — Eingeborene. — Chinastraße. — Moresby-Archipel. — Dinner-Insel. — Ein »Dimdim«. — Bestrafte Arbeiterwerber. — Tripang und Tripangfischer. — Missionsstation. — Eingeborene. — Tätowierung. — Basiraki. — Glockenfels. — Chas oder Teste-Insel. — Häuser. — Verschiedener Baustil. — Prähistorische Töpferei. — Reger Handelsverkehr. — Ethnologie. — Eingeborene. — Haartrachten. — Tätowieren. — Bekleidung und Schmuck. — Einfluß der Mission. — Idande der Lehrer. — Die verunglückte Sylvesterbowle. — Nach Cooktown. — Aufregung.
Die Südseite der Ostkap-Landzunge zeigt eine ähnliche Beschaffenheit als die nördliche. Aber die Hügel und Berge fallen zum Teil steiler ab und haben ausgedehnteres Kulturland, längs dem Strande dichtere Kokospalmbestände aufzuweisen; trotzdem bemerkt man wenig Siedelungen und Menschen. Bald sahen wir die Killerton-Inseln vor uns. So heißt eine Gruppe von drei kleinen und acht bis zehn sehr kleinen Korallen-Inselchen, die zum Teil untereinander und mit der Küste durch Riff verbunden, den nördlichen Eingang von Milne-Bai säumen. Mit Ausnahme der östlichsten Insel, Aroani oder Merari, sind sie unbewohnt, und auch diese ist erst durch die Londoner Mission besiedelt worden, welche hier ihre östlichste Station in Neu-Guinea besitzt. Chalmers nennt sie »a perfect model farm, splendidly laid out«; was man sich dabei für Vorstellungen zu machen[S. 263] hat, wird meine Abbildung zeigen. Die beiden Hauptgebäude sind links die Kirche, rechts das Lehrerhaus; die übrigen Häuser und Hütten (an 15 und mehr) dienen ca. 60 Missionszöglingen zur Unterkunft. Diën, der Lehrer (teacher), der uns schon in Hihiaura besuchte, kam uns in seinem Boote entgegen, um den besten Ankerplatz gegenüber der Station anzuweisen, der übrigens auch nicht frei von Korallriffen ist. Bald folgte in Kanus und Catamarans die Gemeinde, Eingeborene von der Küste, die mit der Mission leben, teilweise als Bekehrte oder weil es ihnen überhaupt bequemer ist. Sie waren meist heller gefärbte Menschen als ihr Lehrer, der von der Insel Lifu (Loyalitätsgruppe) stammte und den dunklen melanesischen Typus repräsentierte. Dennoch hatte er schlichtes Haar, was auf Lifu sehr häufig ist und mich weniger verwunderte, als rothaarige Individuen unter den Eingeborenen, weil natürlich-rotes Haar bei Papuas zu den höchst seltenen Ausnahmen gehört.
(S. 262.)

Das Bekehrungswerk in Neu-Guinea ist bekanntlich in Händen der Londoner Gesellschaft, der größten und reichsten der Welt, die hier im Jahre 1871 die ersten Missionslehrer einsetzte. Jetzt verfügt sie über etliche dreißig, die in gewissen Gebieten der Südostküste, von Saibai bis Milne-Bai, in etwa 25 Stationen verteilt sind. Die Centralstation mit dem »Institute« zur Erziehung eingeborener Lehrer ist auf Erub (Darnley-Isl.), in der östlichen Torresstraße, unter der Leitung von ein bis zwei englischen Geistlichen, zwei andere residieren in Port Moresby, dem Centrum für Neu-Guinea selbst. Alle übrigen Stationen sind mit sogenannten Lehrern (teachers) besetzt, Südsee-Insulanern, die entweder von der Loyalitäts-Gruppe (Lifu und Maré) oder aus Ost-Polynesien (Savage-Island, Rarotonga u. s. w.) herstammen. Das Missionswerk hat diesen dunklen Sendboten unendlich viel zu verdanken und ihre Verdienste sind bei uns viel zu wenig bekannt. Sie waren und sind die eigentlichen Pioniere nicht nur der Mission, sondern der Civilisation überhaupt, die es wagten, sich als Erste unter sogenannten »Wilden« niederzulassen, die noch niemand kannte, mit denen niemand zu sprechen verstand, und von denen kein Mensch voraussehen konnte, welche Aufnahme den Fremdlingen[S. 264] zu teil werden würde. Wie dem Händler (Trader) ein notdürftiges Haus gebaut wird, in welchem man ihn mit einigen Vorräten und Lebensmitteln seinem Schicksale überläßt, bis das Schiff wiederkehrt, so machte es auch die Mission[65]. Während aber dem Händler schon die weiße Hautfarbe stets ein Übergewicht verleiht, fällt dieser Rassenvorteil beim farbigen Missionslehrer weg, denn der Eingeborene hat vor seinesgleichen, wenn auch in europäischer Kleidung, natürlich nicht den Respekt als vor dem weißen Manne. Die Geschichte der Missionsgründung in Neu-Guinea liefert den besten Beweis, daß es mit der so arg verschrieenen Wildheit der Papuas nicht so schlimm bestellt ist. Auch sie haben sich meist als Menschen gezeigt, indem sie die Fremdlinge, welche man auf unbestimmte Zeit ihrer Obhut anvertraute, nicht nur unbehelligt ließen, sondern dieselben hie und da noch unterstützten. Auch das Missionsschiff blieb zuweilen länger aus als erwartet, und die Lehrer waren mitunter lediglich auf die Eingeborenen angewiesen. Wenn es auch nicht an Bedrohungen fehlte, die selbst das zeitweilige Verlassen einer Station nötig machte, so verdient doch hervorgehoben zu werden, daß bei der Gründung der Mission nur auf Bampton-Insel, nahe der Mündung des Flyflusses zwei Lehrer zu Märtyrern[66] wurden, während die Tücke des Klimas eine Menge Opfer forderte. Diese Thatsache lautet gewiß sehr zu Gunsten der Eingeborenen und sollte in goldenen Lettern allgemein Anerkennung finden; aber wer spricht von den »Wilden« um sie zu loben? Wer das Wesen des Eingeborenen kennt, wird freilich wissen, daß dies gute Betragen nicht aus purer Humanität entsprang, sondern daß, wie so häufig im menschlichen Leben, Eigennutz die Triebfeder zu dieser Handlungsweise war. Schon der weiße Mann, welcher die fremden, braunen Gäste installierte, verlieh den letzteren in den Augen des Eingeborenen einen[S. 265] gewissen Nimbus. Aber man wußte auch, daß das Schiff zurückkommen würde und fürchtete Bestrafung für etwaige Missethaten. Mehr als diese Furcht wirkte jedoch das Auftreten der Sendlinge selbst zur Anknüpfung guter Beziehungen. Sie waren ruhige Leute, welche die Eingeborenen nicht inkommodierten, und die letzteren fanden sich schon aus Neugierde beim Gottesdienst ein, der ihnen ja etwas durchaus Neues war. Bald erkannte der Eingeborene auch den praktischen Nutzen der Mission, die ihm zuerst eiserne Geräte, allerlei Tand, und ganz besonders Tabak zuführte und dem betreffenden Dorfe dadurch ein Übergewicht verschaffte. Der nüchterne, berechnende Kanaker-Vorstand fand schnell heraus, daß eine solche Zufuhrsquelle erhalten werden müsse, und man hütete sich daher wohl, die Gans mit den goldenen Eiern umzubringen. Die geringen Vorräte einer Missionsstation vermögen die Habsucht der Eingeborenen auch nicht in dem Maße zu reizen, wie dies gegenüber den viel reicheren Handelsstationen eintreten kann, um durch einen Handstreich auf einmal in den Besitz von Schätzen zu gelangen. Bald hatte die Mission hie und da durch den Einfluß eines Häuptlings unterstützt, die in Neu-Guinea meist wenig bedeuten, Freunde unter den Eingeborenen und gewann dadurch immer festeren Boden. Selbst entferntere Dörfer verlangten nach einem Missionär, um gleiche Vorteile zu genießen und darauf ist so häufig der »Schrei nach dem Evangelium« zurückzuführen. Diese Erfolge sind zum großen Teil den farbigen Lehrern zu verdanken, da die weißen Missionsleiter ja nur in längeren Zwischenräumen die über neun Längengrade ausgebreiteten Stationen besuchen können. Während die Mission bisher glücklicherweise keinen Europäer verlor, hat der Tod unter den eingeborenen Lehrern um so reichere Ernte gehalten, denn gar viele erlagen dem Klimafieber. Fern von der Heimat und ohnehin fatalistisch veranlagt, ist der energielose Kanaker viel weniger widerstandsfähig als der Europäer, ja mancher stirbt, weil er sterben will. Das klingt freilich paradox, ist aber wahr, und gilt auch für die braunen Sendboten des Evangeliums, die trotz ihres civilisatorischen Anstriches doch Kanaker blieben. Wenn so ein Mensch[S. 266] plötzlich erkrankt und die Medizin, welche man ihm zurückließ, nicht bald hilft, dann hält er sich häufig für verloren, giebt sich selbst auf und unterliegt nicht selten einer Krankheit, die ein Europäer bei einiger Behandlung überwinden würde. Der Missionslehrer stirbt in vollem Gottvertrauen und in der Beruhigung eines gottergebenen Lebens, der Tod hat also keine Schrecken für ihn. In der That verdient die Selbstverleugnung dieser Leute die größte Anerkennung, denn sind sie auch meist von geringer Herkunft, so standen sie sich doch meist in ihrer Heimat besser. Mancher hatte hier ansehnlichen Besitz, andere lernten die Welt als Matrosen kennen, und für die wenigsten sind daher die zwanzig Pfund Sterling (400 Mark), welche ein Missionslehrer an Jahresgehalt empfängt, gleichwertig seiner früheren Lebensstellung. Aber das neue Amt verschafft ihm ein ganz anderes Ansehen. Früher gewohnt zu gehorchen, kann er jetzt kommandieren und sich zum Herrn und Gebieter einer Gemeinde aufschwingen, wie dies den meisten Lehrern sehr bald gelingt und wiederum für die gute Art der Eingeborenen spricht. Sie sind es, welche gegen geringes Entgelt in Tauschwaren das Feld mitbestellen helfen, das die Lehrerfamilie ernährt, die ja an Eingeborenenkost gewöhnt, nur wenig Bedürfnisse hat. Im Verein mit gelegentlichen kleinen Nebeneinnahmen sind sogar noch Ersparnisse möglich. Die farbigen Lehrer der Londoner Missionsgesellschaft stehen sich daher weit besser, als die der Wesleyaner im Bismarck-Archipel, die außer Kleidung (d. h. Lavalava oder Lendentücher) nur mit etwas Tabak und vier Pfund Glasperlen jährlich ihren Unterhalt zu bestreiten haben. Wenn gegenüber dem Aufwande an Mühe und Kosten, den Verlusten an Menschenleben und Gesundheit, die Bekehrungserfolge[67] auch keine großen sind, so läßt sich das segensreiche Wirken der Mission doch nicht verkennen und verdient volle Anerkennung. Eine Missionsstation ist stets ein Hort des Friedens, namentlich in solchen Gebieten,[S. 267] wo der Verkehr mit den Eingeborenen durch Weiße gestört wurde, deren Betragen nicht selten auch die Mission in bedrohliche Lage brachte.
(S. 266.)

Ein Besuch auf der Insel Aroani zeigte das Leben und Treiben, wie es an jeder Missionsstation herrscht. Alles eilte herbei, um dem weißen Fremdlinge die Hand zu geben und ihn mit »denani« zu begrüßen; einzelne ließen wohl auch ein »good morning« und den leisen Wunsch nach Tabak einfließen, ohne eigentlich zu betteln. Eine Menge Wörter der hiesigen Sprache zeigte übrigens nahe Verwandtschaft mit dem Motu von Port Moresby. Es war gerade Sonntag, und jeder erschien im besten Staate, aber gerade daran konnte der Erfahrene merken, daß wir uns an einer entfernten Nebenstation befanden. Denn während am Sabbath in Port Moresby Kanakerinnen nicht selten in Kleidern mit Volants paradieren, mußten sie sich hier mit den landesüblichen Volant-Grasröcken begnügen. Nur wenige besaßen außerdem ein Kattunjäckchen oder ein Strohhütchen mit künstlichen Blumen, wie die possierlich ausstaffierten Mädchen in der lebensvollen Gruppe unserer Abbildung. Sie zeigt so recht den Gegensatz zwischen den Anfängen einer mit europäischem Plunder übertünchten Civilisation und der ursprünglichen Eingeborenentracht. Die letztere dürfte dabei als die vorteilhaftere erscheinen, da die rot und gelben Grasröcke, aus Blattfasern der Sagopalme, die braunen Gestalten in der That trefflich kleiden. Tätowierung ist in Milne-Bai nicht Sitte, und die damit verzierten Frauen unseres Separatbildes waren Gäste von Dinner-Insel. Die Vorderseite der Kirche giebt einen weiteren interessanten Vergleich christlicher und heidnischer Kunst, die ebenfalls zum Vorteil der letzteren ausfällt. Denn die skelettartige Karikatur über der Thür ist nur aus schwarz und weißgefärbtem Pandanusblatt verfertigt, hat also wenig Mühe gemacht, während wir in dem Aimaka auf Bilibili (S. 73) noch solide Holzbildhauerei kennen lernten. Und wenn ich hier auf die Decenz beider Darstellungen eingehen dürfte, dann hätte ich für beide drastische Bemerkungen zu machen. Die Kirche war im übrigen ein solider Pfahlbau, welchem ein mit Kerben versehener Baumstamm als[S. 268] Treppe diente. Bald läutete der Lehrer zum Gottesdienst, dem einige 40 Eingeborene, meist weiblichen Geschlechts mit Kindern und Säuglingen, beiwohnten. Nach den Regeln der Londoner Mission wurde in der Landessprache geredet und gesungen, denn die Eingeborenen lernen Singen gar schnell. Im übrigen herrscht natürlich am Sonntage die Ruhe der englischen Kirche, welche den Missionszöglingen aber wenigstens das Rauchen gestattet. Die Londoner Gesellschaft ist überhaupt viel toleranter als z. B. die amerikanische in Mikronesien, welche nicht allein das Rauchen verbietet, sondern auch die Tracht der Eingeborenen durch allerlei Satzungen verändert und dadurch bald alle Originalität auslöscht. Was würde sie erst zu dem eigentümlichen Rauchgerät sagen, das ich nach langer Zeit zuerst hier wiedersah, und welchem der Eingeborene wahrhaft frönt! Es ist dies der an der ganzen Südostküste bekannte Baubau, hier Kirä genannt, ein langes Stück Bambu mit einem Loche. Das letztere dient zur Aufnahme[S. 269] einer kleinen mit Tabak gefüllten Blattdüte, einer Art Zigarette. Ist die letztere angezündet, so wird das Rohr voll Rauch gesogen, dann die Zigarette herausgenommen und aus dem kleinen Loch der Rauch eingesogen oder vielmehr verschlungen, wobei der Kirä von Mund zu Mund wandert. Ich darf versichern, daß diese Rauchmethode sehr wirkungsvoll ist, denn sie betäubt förmlich, aber kleine Kinder sind bereits daran gewöhnt, und der »Baubau« ist unzertrennlich mit dem Leben des Papuas der Südostküste Neu-Guineas verknüpft.
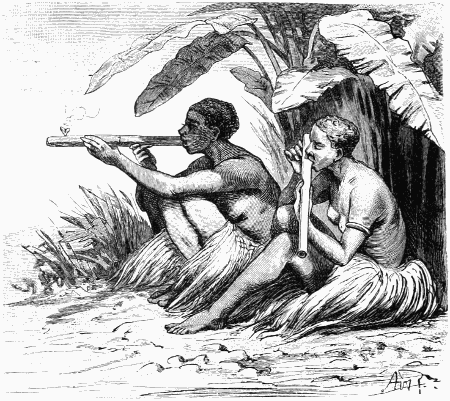
Das Haus des Lehrers war ein ähnlicher Bau als die Kirche und, wie diese, von Eingeborenen gemacht worden. Es enthielt im Inneren drei Abteilungen und außer selbstgefertigten Tischen und Bänken den üblichen Wandschmuck, Bilder aus London Illustrated News, Graphic, Modezeitungen u. s. w., sowie einige Kisten und Kasten, denn auch der Hausrat eines Missionslehrers ist meist sehr bescheiden. Aber Diën baute an einem neuen Wohnhause, das sehr gut zu werden versprach. So wurden die Wände außen mit Kalk (aus Korallen gebrannt), verputzt und sollten innen tapeziert werden und zwar — mit Segeltuch, was sich freilich schon der Kosten wegen unausführbar erwies.
Aroani, zum großen Teil von Mangrove-Lagunen eingeschlossen, mit schlechtem korallinischem Boden, ist jedenfalls sehr ungesund. Aber ich erstaunte, trotz des kümmerlichen, korallbesäten Erdreiches so gute Plantagen zu finden. Außer den üblichen Feldfrüchten Yams, Taro, Bananen und Zuckerrohr wurden auch Kürbisse, Wassermelonen und Mais angebaut; alles schien trefflich zu gedeihen, bis auf die wenigen jungen Kokospalmen.
Lieblicher Vogelgesang, eine Seltenheit in den Tropen, den ich schon von Bord aus gehört hatte, und der mir mit seinen nachtigallähnlichen Strophen durchaus neu war, reizte den Urheber zu erlangen. Bald war er in meinen Händen, ein unscheinbares Vögelchen, Ptilotis sonoroides, das bisher nur auf Waigiu und Mysol beobachtet wurde. Sonst erlangte ich nur noch wenige Kleinvögel, denn die großen Fruchttauben waren zu scheu, und so mußte ich mich mit der kleinen Ptilinopus aurantiifrons begnügen, einem jener[S. 270] reizenden, kleinen Täubchen, welche Neu-Guinea in so überraschender Fülle und Farbenpracht eigen sind.
Milne-Bai bildet eine an 20 Meilen lange und ca. 10 breite Einbuchtung im Ostende Neu-Guineas, deren Nordrande wir bis über die Hälfte folgten, um dabei ein Kopragebiet von seltenem Reichtum kennen zu lernen. Das Vorland an dieser Seite der Ostkap-Halbinsel ist viel ausgedehnter als an der nördlichen und zeigt stellenweis förmliche Wälder von Kokospalmen. Nach der Aussage der Lehrer würde sich dieses Kopragebiet in noch größerer Ausdehnung bis in die Tiefe und längs dem West- und Südwestrande der Bai erstrecken, so daß dasselbe reiche Ausbeute verspricht, deren Verwertung inzwischen schon in Angriff genommen sein dürfte. Trotz dieses Überflusses schien die Bevölkerung unbedeutend. Nur selten zeigte sich ein einzelnes Haus am Strande, und an den grünen Vorbergen wurden Kultivationen seltener. Das allmählich höher ansteigende Stirlings-Gebirge ist, wie sich schon an der dichten Bewaldung erkennen ließ, unbewohnt.
In Mita, ca. fünf Meilen von Aroani, der zweiten Missionsstation, ließ ich mich an Land setzen und wurde von Dick, dem Lehrer, einem dunklen Maré-Mann, begrüßt. Hilfreiche Hände zogen das Boot durch die Brandung und reichten geöffnete Kokosnüsse als Willkommen, noch ehe wir das Land betreten hatten. Die Station ist viel kleiner als die auf Aroani und besteht nur aus zwei Häusern, von denen eins als Kirche dient; auch war der Anhang von Eingeborenen viel geringer. Unter den letzteren zeichnete sich ein mit Hemd, Hose und Filzhut bekleideter ältlicher Mann aus, der König, denn er sagte wiederholt »me king«, alles, was er an englischen Worten wußte, und empfing natürlich den üblichen Tribut in einigen Stücken Tabak. In Begleitung des »Königs« und Dicks Sohn Joana, einem fixen Knaben, der ziemlich englisch sprach, ging ich nach dem nächsten Dorfe, um wenigstens etwas von Land und Leuten kennen zu lernen. Der Weg führte teils durch Urwälder, in denen außer anderen Vogelstimmen sich auch die von Paradiesvögeln (Paradisea Raggiana) vernehmen ließen, teils durch Plantagen,[S. 271] welche den Reichtum und die Fruchtbarkeit des Bodens bekundeten. Joana erzählte, daß ein anderer »King« seinem Vater nach dem Leben trachte, aber gleich ausreißen würde, wenn er mich mit dem Gewehre sähe. Bald kamen wir an eine hübsche Bucht, welche zur Anlage einer Station wie geschaffen scheint, besonders da sie auch für Segelschiffe sichere Ankerung bietet. Längs dem Sandstrande dieser Bucht gelangten wir zuerst zu dem kleinen Dorfe Higiba, (Higäbei), das nur aus drei Häusern besteht, weiterhin, einen seichten Fluß durchwatend, nach dem etwas größeren Baragom, das sich durch einen großen Kanuschuppen auszeichnete. Er stimmte ganz mit dem auf Goulvain (S. 224) überein, und wie wir solche in Hihiaura und an der Ostkap-Landzunge kennen lernten. Diese Kanuschuppen scheinen, in Ermangelung anderer Baulichkeiten, zugleich als Versammlungshaus der Männer zu dienen, in welches man Fremde nicht gern eintreten läßt. Außer dem Kanu, das Eigentum des Häuptlings oder der Gemeinde ist, enthielt der Schuppen nur eine Anzahl großer hölzerner Kampfschilde, die ganz mit denen in Bentley-Bai übereinstimmten. Von diesen Schilden giebt es zwei Formen, länglich-ovale und rechteckige (ca. 1 m hoch und 40 cm breit), die zum Teil mit erhabener Schnitzerei und bunter Bemalung verziert sind und mit zu den besten Erzeugnissen des Kunstfleißes zählen.
Die Häuser unterschieden sich von denen in Bentley-Bai (S. 237) hauptsächlich dadurch, daß sie auf sehr hohen Pfählen wohl zehn Fuß über der Erde stehen und aus Sagopalmblatt gebaut sind, deren lohfarbene Färbung sie schon von weitem auszeichnet. Ich sah übrigens auch Häuser auf niedrigen Pfählen und solche von ovaler Form, denen gewisse Häuser auf Aroani wohl als Muster gedient hatten. Besonders überraschte mich ein Baumhaus, das noch im Bau begriffen war, wie dies die Abbildung (S. 272) zeigt. Solche Baumhäuser, die ich aus dem Inneren von Port Moresby kannte, gehören zu den kunstvollsten Bauwerken der Steinzeit. Denn es ist nicht so leicht in den Ästen und im Wipfel eines Baumes, oft in einer Höhe von 50 bis 60 Fuß, ein Haus zu bauen, das den Winden widersteht.[S. 272] Diese Häuser dienen als Festen und Warten, in welche sich die Dorfbewohner bei einem feindlichen Überfall zurückziehen. Die primitive Leiter aus Lianen, welche zu dem luftigen Bau führt, wird hinaufgezogen und die Festung ist zur Verteidigung fertig. Sie enthält[S. 273] außer Wasservorräten Unmassen von Wurfgeschossen in Gestalt von Speeren und Steinen, womit gar mancher Sturm abgeschlagen werden kann, wenn auch das Dorf in Flammen aufgehen sollte.

Die Eingeborenen, welche inzwischen zahlreich herbeigeeilt waren, unterschieden sich in nichts von denen in Bentley-Bai und Hihiaura, sprechen auch fast dieselbe Sprache. Sie brachten außer Büscheln buntblättriger Crotons kaum etwas zum Tausch, und ich erlangte mit Mühe wenige Schilde und Steinklingen, da auch hier die Steinzeit ihrem Ende entgegengeht. Die Eingeborenen von Milne-Bai, erwiesenermaßen Kannibalen, stehen in keinem guten Ruf. Aber auch sie sind weit besser als der letztere, wie ich von Hunstein weiß, der länger unter ihnen lebte und sehr gut mit ihnen auskam. Moresby, der zuerst hier war, fand überall freundliche Aufnahme. Aber die Gewaltthätigkeiten der Werbeschiffe, welche hier rekrutierten, und das zuweilen brutale Auftreten von Tripangfischern haben seitdem auch hier dem Weißen keinen guten Ruf verschafft; man darf sich daher über etwaige Massacres als Repressalie nicht wundern.
Die Samoa war inzwischen herangekommen und wir setzten unseren westlichen Kurs noch etwas weiter fort, bis wir die Tiefe der Bai sehen konnten, die aus Flachland zu bestehen scheint. Hier liegen die Dörfer Maivara und Gihara, die wie Wagawaga (Discovery-Bay), am Südwestrande, stark bevölkert sein sollen. Wir wandten dann unseren Bug ostwärts und dampften, im Angesicht der 1500 bis über 3000 Fuß hohen Gebirge am Südrande der Bai, Chinastraße zu, Moresby gab ihr diesen Namen, weil sie einen kürzeren Seeweg zwischen Australien und China eröffnet, der sich in der Praxis aber nicht bewährte. Wir hatten North-Foreland, die Nordspitze der südlichen Halbinsel von Milne-Bai passiert, die aus steilen, an 1800 Fuß hohen Gebirgen besteht, ohne Siedelungen und Kokospalmen, und sahen die malerischen Inseln des Moresby-Archipel vor uns. Sie sind alle bergig, mit zahlreichen Kultivationen der Eingeborenen bedeckt, am Strande dicht mit Kokospalmen gesäumt, und mögen danach zu urteilen ziemlich gut bevölkert sein. Bald hatten wir die kleinen Inseln Meckinley (Maivara) und Paples an Backbordseite und sahen[S. 274] in die Tiefe von Jenkins-Bai, die fast hufeisenförmig von der gebirgigen Basilisk-Insel (Urapotta), nebst Hayter (Sáriwa oder Sariba) umschlossen wird. Am Nordwestrande der letzteren Insel passierten wir Possession-Bay, wo Moresby am 24. April 1873 zum erstenmale die Flagge hißte und im Namen Englands von den Inseln Besitz ergriff. Die Straße erreicht nun ihre schmalste, kaum eine Meile breite Stelle und schien am südwestlichen Ende durch Heath-Insel (Rogia, Logia) geschlossen, aber bald öffnete sich der Blick nach Südost und wir hatten die kleine Dinner-Insel (Samárai) vor uns. Sie ist kaum eine Meile lang, ca. 200 Fuß hoch, und war, ehe die Londoner Missionsgesellschaft (1876 oder 77) eine Station errichtete, unbewohnt. Jetzt siedeln hier an 30 bis 40 Eingeborene der Nachbarinseln, meist von Rogia, die unter der Obhut von Ipunessa, eines Lifumannes, eine kleine Gemeinde bilden.
»Dimdim stop mission« (ein Weißer lebt im Missionshause) sagte ein Zögling, der gleich mit dem ersten Kanu längsseit und an Bord gekommen war; es stand uns also eine Überraschung bevor, als wir an Land ruderten. Und in der That, unter der uns erwartenden Menge war ein Dimdim, ein wirklicher Weißer. Er stellte sich in englischer Sprache als »Harry Smith« vor und erkundigte sich zunächst nach der Nationalität unserer Flagge. Als er hörte, daß es die deutsche sei, da entpuppte er sich plötzlich als ein Landsmann von der Ostsee, der den englischen Namen, Gott weiß aus welchem Grunde, nur angenommen hatte. Ja, ja, so werden Deutsche über die ganze Welt umhergeschleudert, und man wundert sich an irgend einem Orte keinen Deutschen zu finden. Von Nordkap und Nord-Sibirien an bis auf den entlegensten Inselchen im Indischen und Stillen Ozean, wie z. B. Diego Garcia, in den Gilberts u. s. w., allenthalben habe ich Landsleute angetroffen, nicht immer mit besonderer Freude. Daß Harry als früherer deutscher Matrose die deutsche Flagge nicht kennen sollte oder wollte, durfte befremden und der Umstand, daß er zur Besatzung des berüchtigten Werbeschiffes »Hopeful« gehört hatte, war ebenfalls als keine Empfehlung zu betrachten. Die gegen Eingeborene verübten Unthaten dieses Sklavenschiffes[S. 275] kamen zufälligerweise einmal heraus, ein seltener Fall in der Geschichte der Labourtrade. Die Missionslehrer hatten Anzeige gemacht, und die Urheber wurden diesmal wirklich vor Gericht gestellt. Der in Brisbane verhandelte Fall, bei welchem die Lehrer die Haupt-Belastungszeugen bildeten, machte damals großes Aufsehen in Australien. Das Urteil sprach nämlich den Kapitän, Steuermann und Arbeiteragent oder »Agent of immigration«, wie er euphonistisch heißt, des Todes schuldig. Drei Weiße wegen einer Handvoll Niggers!! Ein solcher Fall war noch nie dagewesen und erschien so ungeheuerlich, daß die Zeitungen ein furchtbares Geschrei erhoben. Schließlich sind denn auch die Übelthäter dem Galgen entronnen und zu lebenslänglichem Kerker (davon drei Jahre in Ketten!) begnadigt worden.
Harry führte übrigens hier im Hause des Missionars ein beschauliches Leben als Händler (Trader), kaufte Kokosnüsse, um Kopra zu machen, und war dabei, eine Tripangstation zu errichten. Tripang oder Bêche de mer —?? — ja das wollte ich ja eben sagen —, heißen jene zur Ordnung der Stachelhäuter (Echinodermata) gehörenden Meerestiere der Gattung Seewalzen oder Seegurken (Holothuria), wenn sie gehörig zubereitet und getrocknet sind. Diese Tiere bilden im Leben einen langgestreckten, runden, walzenförmigen Körper von einhalb bis drei Fuß Länge und erinnern an runzlige, plumpe, kolossale Würste, die träge auf dem seichten Grunde des Korallriffs liegen (daher englisch »Sea slug«) und wenig animalisches Leben verraten. Beim Anfassen entleeren sie eine Menge Wasser und in langen, schleimigen, klebrigen Fäden ihre Eingeweide, wodurch das Unappetitliche ihrer Erscheinung nur noch erhöht wird. Die Bereitung von Tripang ist im ganzen nicht schwierig. Die Tiere werden in großen, flachen, eisernen Pfannen in Seewasser gekocht, am andern Tage der Länge nach aufgeschnitten, vollends gereinigt, etwas an der Sonne getrocknet und dann geräuchert. Man errichtet zu diesem Zwecke ein höchst primitives Räucherhaus, in welchem der »Fish«, wie die Tripangfischer auch Holothurien nennen, auf übereinanderliegenden Horden getrocknet wird. Es erfordert dies große[S. 276] Aufmerksamkeit, da es hauptsächlich auf ein allmähliches, recht langsames Trocknen ankommt. In diesem Zustande hält sich die Ware jahrelang. Sie geht hauptsächlich nach Hongkong und zwar meist von Cooktown oder Thursday-Insel aus. In China bildet Tripang, für uns nur ein trockenes, lederartiges, unangenehm riechendes Produkt, eine große Delikatesse der Tafel, auf der sie in verschiedener Zubereitung erscheint.
Man unterscheidet in der Südsee drei bis vier Arten Tripang, die im Preise von 40 bis 110 Lstl. (800 bis 2200 Mark) per Tonne (2200 Pfund engl.) variieren. Tripang ist also ein wertvoller Artikel, an dem die Fischer reich werden müssen, sollte man denken! Aber das letztere kommt wohl kaum vor, denn es giebt keine größeren Abenteurer als diese Tripangfischer. In kleinen, schlechten Fahrzeugen, nicht selten einem offenem Boote, gehen sie mit wenigen Leuten, meist von Cooktown, nach der Küste Neu-Guineas bis zur Louisiade, um nach Fischereigründen zu suchen und ihre ambulante Station aufzuschlagen. Mit einigen Tafeln Wellblech läßt sich da schon viel thun, und eine solche sogenannte Station ist das primitiveste, was man sich denken kann. Aber ohne die Hilfe der Eingeborenen läßt sich nichts machen. Sie sind es, welche die Holothurien bei Ebbe auf dem Riff oder tauchend sammeln, welche Feuerholz zum Räuchern herbeischleppen, wozu große Quantitäten erforderlich sind, und sonst allerlei Dienste leisten. Glasperlen und andere Kleinigkeiten erhalten den Eifer der Eingeborenen bis zum Abschluß der einige Monate dauernden Campagne rege, mit der die eigentliche Bezahlung stattfinden soll. Aber gar häufig verschwindet der biedere Weiße ohne dieselbe, vielleicht noch unter Mitnahme einiger Eingeborenen, die anderswo gratis zu arbeiten haben, manchmal ihre Heimat überhaupt nicht wiedersehen. Das merken sich die Eingeborenen natürlich, und gar mancher Tripangfischer hat für die Missethaten seiner Fachgenossen, wenn nicht für eigene, büßen müssen. Am Dubu in Maupa an der Südostküste sah ich selbst die Schädel neun chinesischer Tripangfischer, die durch brutales Betragen ihr Schicksal verschuldet hatten, ein Fall, der von einem englischen[S. 277] Schiffe untersucht, aber zu Gunsten der Eingeborenen entschieden wurde.
Das Missionshaus auf Dinner-Insel, ganz aus Wellblech, auf hohen Pfählen erbaut, mit wirklichen Glasfenstern, erschien gegenüber der schuppenartigen Kirche gleich einem Palast. Die Bekehrten und die Missionszöglinge waren in zwei großen Grashäusern untergebracht, und die ganze Station machte einen sehr freundlichen Eindruck. Von der Insel selbst läßt sich dies nicht sagen. Sie besteht an der Westseite meist aus Sand und nur die Hügel der Nordostseite besitzen kulturfähigen Boden, während das flache Innere zur Regenzeit in eine Lagune verwandelt wird, die jedenfalls einen gesundheitsschädlichen Einfluß ausübt. Infolge des steilen Bodens giebt es mehr Gestrüpp als Bäume auf der Insel, wie auch die Kokospalme nur kümmerlich gedeiht. Umso reicher an letzteren sind die Nachbarinseln Rogia und Sariba, wo die Mission auch Filialen und Plantagen besitzt.
Von diesen Inseln ruderten bald Eingeborene heran, in Kanus, die zum Teil nur in einem ausgehöhlten Baumstamm, ohne Ausleger, bestanden. Sie brachten nur wenig zum Tausch, darunter kleine Schilde (Jessi) aus weichem Holz, die jetzt eigens für den Handel gemacht werden, aber auch noch einiges aus der guten alten Zeit. Darunter Gaiagaia, Armbänder aus einem menschlichen Unterkiefer, die von nahen Anverwandten herstammen und als teure Andenken getragen werden. Dagegen schienen einige Schädel (Romaroma) Trophäen erschlagener Feinde zu sein, wie noch vor wenigen Jahren Kannibalismus auf diesen Inseln herrschte und vielleicht im Kriege mit den Festlandsbewohnern noch heute im stillen betrieben wird. Am meisten überraschte es mich, hier Tätowierung zu finden, die ich auf allen unseren bisherigen Reisen nicht beobachtet hatte, und die selbst auf den nahen d'Entrecasteaux und in Milne-Bai fehlt. Es zeigt dies wiederum, daß manche Sitten und Gebräuche außerordentlich lokalisiert verbreitet sind. Die Tätowierung der Frauen und Mädchen, denn nur solche wenden diesen Körperschmuck als Verschönerungsmittel an, ist eine sehr eigentümliche und reiche, die[S. 278] zuweilen in Grecmuster Gesicht, Arme und die Vorder- und Rückseite des Körpers bedeckt. Die beigegebene Abbildung einer Frau von Rogia zeigt diese charakteristische Tätowierung und zugleich kostbare Armringe (Massuoro) aus dem Querschnitt einer großen Kegelschnecke (Conus millepunctatus), wie wir dieselben schon auf Normanby (S. 215) kennen lernten.

Ich beschloß Teste-Insel (Chas oder Tschas der Eingeborenen) anzulaufen, die äußerste, südöstlichste Insel des Moresby-Archipel, welche zuweilen schon zur Louisiade gerechnet wird. Sie liegt ziemlich isoliert und scheint ein Überbleibsel des großen gesunkenen Barrier-Riffs zu sein, das sich von Neu-Guinea bis auf die Louisiade erstreckt, dessen Brandung die ersten Seefahrer so lange von der Entdeckung der Südostspitze Neu-Guineas abhielt. Wir genossen auf dieser Reise den Anblick herrlicher, fruchtbarer Inseln, die sich fast ununterbrochen von West nach Ost erstrecken, unter denen Moresby (Basiraki, Wasilaki) mit seinem über 1200 Fuß hohen Bergrücken besonders hervortritt. Eine hübsche Abwechselung gewährten die flinken Segelkanus der Eingeborenen (Atlas VIII. 9), die sehr rasch vor dem Winde laufen und mit zu den besten Fahrzeugen der Südsee gehören.
Bald zeigte sich Teste-Insel mit seiner charakteristischen Landmarke, dem Glockenfels, (S. 279) einem über 400 Fuß hohen, isoliert aus dem Meere aufsteigenden Fels, wie ihn die Skizze zeigt. Die 2½ Meilen lange Insel selbst gleicht an der Nordseite, wo die »Samoa« ankerte, einem langgestreckten, grünen Hügel, mit viel urbargemachtem Lande, am Strande von Bäumen und Kokoshainen eingefaßt. Auf der kahlen ca. 500 Fuß hohen Mittelkuppe machen[S. 279] sich drei hohe Bäume schon von weitem bemerkbar und kennzeichnen die Insel. Obwohl die Nordseite unbewohnt ist, so war unsere Ankunft doch bemerkt worden, und Eingeborene erwarteten uns am Strande als Führer nach dem Dorfe und der Missionsstation. Redensarten in gebrochenem Englisch, wie »How is that Captain me no smok?« oder »What for you no pay me cigar?« zeigten, daß die biederen Insulaner gut mit Weißen bekannt, und das Verlangen nach Zigarren, Holzpfeifen und zwölfzölligen Messern, daß sie bereits verwöhnt sind. In der That wird Teste-Insel häufig von kleinen Handelsfahrzeugen, namentlich Tripangfischern besucht, und verschiedene Eingeborene haben an Bord von solchen sogar Cooktown kennen gelernt. Von der Höhe des Hügels eröffneten sich dem Auge schöne Fernblicke auf die kaum 20 Meilen entfernten Moresby-Inseln, die Engineer-Gruppe bis Normanby hin, aber Neu-Guinea war nicht sichtbar. Seine Südostspitze liegt noch etliche 30 Meilen ab und die Gebirge derselben sind nicht hoch genug.
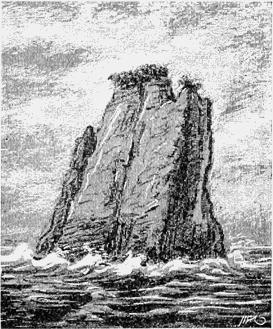
Durch reiche Plantagen, namentlich von Bananen, gelangten wir nach der Siedelung Kasadekaua, der größten der vier, welche die Insel besitzt. Ich war erstaunt über die prächtigen Pfahlbauten, große Häuser, wie man sie auf einer so kleinen Insel nicht erwartet. Sie ähneln im ganzen denen von Normanby, sind aber viel stattlicher, ruhen auf soliden behauenen Pfählen, die zum Schutz gegen Ratten u. s. w. oberseits mit einer runden tellerartigen Scheibe versehen sind. Die Seitenwände bestehen aus Kokosmatten, welche sich praktischerweise verstellen lassen. Das sattelförmig eingebogene Dach ist aus einer Art Schilf gefertigt und mit toten Palmblättern belegt. An ein paar Häusern sah ich Giebelleisten mit etwas buntbemaltem[S. 280] Schnitzwerk, jedoch keine Darstellung menschlicher Figuren. Unsere Abbildung zeigt den vorherrschenden Baustil dieser Insel nebst einer Grabstätte, in Form eines Miniaturhauses, wie sie in ähnlicher Weise auch an anderen Plätzen Neu-Guineas (vergl. S. 173) vorkommen. Aber nicht alle Häuser sind so stattlich, sondern es giebt auch kleinere, lottrig gebaute, sowie ein ganz besonderes Haus. Dasselbe steht ebenfalls auf Pfählen, ist sehr groß (wohl 40 Fuß lang) und zeichnet[S. 281] sich durch ovale Form[68], mit hohem schüsselförmigen Dach aus, ein Stil, der mir bisher nicht vorgekommen war und ethnologisch von ganz besonderem Interesse ist.
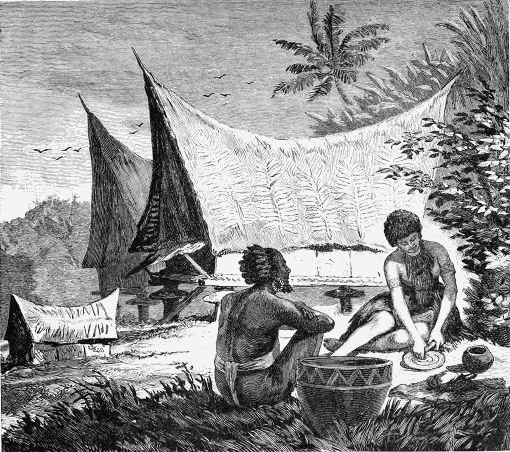
Außer den Häusern hat sich auf Teste-Insel aber noch eine andere hochinteressante ethnologische Eigentümlichkeit erhalten, nämlich die Töpferei, welche hier schwungvoll betrieben wird. Die geologische Formation, verwitterter Basalt, mit viel, zum Teil kristallinisch eingesprengten Schörl, liefert dafür in einem reichen Wackenthon treffliches Material. Ich ließ sogleich ein paar Frauen kommen, in deren Händen auch hier, wie überall, allein das Töpfergewerbe ruht, und war hoch erfreut, eine ganz besondere Manier kennen zu lernen. Die Töpfe werden nämlich nicht wie in Bilibili (S. 83) oder Port Moresby aus einem Klumpen Lehm mittelst eines Steines und Klopfers getrieben, sondern nur mit den Händen geformt. Wie unsere Skizze einer Töpferin bei der Arbeit (S. 280) zeigt, macht dieselbe eine wurstförmige, etwa daumendicke Rolle aus Thon, die spiralig aufgebaut und mit den Fingern, sowie einer kleinen Muschelschale (Tellina) platt gestrichen wird. Das Verfahren ist also genau dasselbe, wie es bei unseren pfahlbauenden Vorfahren war, deren keramische Überreste und Fragmente so manchen Gelehrten beschäftigen und sorgfältig zusammengekittet zu den kostbaren Schätzen der Museen zählen. Hier konnte ich prähistorische Töpferei noch von Lebenden gehandhabt, vom Kneten des Lehmes bis zu dem einfachen Brennprozeß (IV. 7) studieren. Die Form des hiesigen Fabrikats ist (vergl. Abbild. S. 280 und IV. 6) eine eigentümliche und erinnert an tiefe Näpfe oder Schüsseln mit rundem Boden. Der obere senkrechte Rand zeigt verschiedene einfache Randmuster (IV. 10), die mit gabelförmigen Instrumenten aus Bambu (IV. 9) eingekratzt werden und nicht als Ornament, sondern als Handelsmarke dienen. Denn auch hier hat jede Frau ihr eigenes Merk (Kulikulikuto), mit dem sie ihr Fabrikat kennzeichnet. Dasselbe findet weithin, bis auf die d'Entrecasteaux, nach Chads-Bai, Südkap (Suau), Woodlark-Insel[S. 282] (Murua, Mulua), vielleicht auch auf der Louisiade, Absatz. Das kleine Chas wird dadurch ein Centrum des Tauschhandels für alle diese Gebiete, denen Töpferei unbekannt ist. Kaum mit brauchbarem Holze zum Hausbau versehen, müssen die Insulaner solches, wie eine Menge fertiger Geräte und Waffen, ja einen Teil der Lebensmittel von anderswo eintauschen, Verhältnisse, die sich inzwischen sehr verändert und zum Teil in andere Bahnen gelenkt haben. Durch den Verkehr mit Weißen und die Mission ist es auf Teste nämlich bereits mit der Steinzeit vorbei und ein großer Teil Originalität verloren gegangen. Ich konnte daher nur letzte Reste einer untergegangenen Kulturepoche retten. So, eigentümliche Holztrommeln, große flache Holzschüsseln (Gaibe) mit hübscher Randverzierung (T. III. 4), kolossale an drei Meter lange, ruderförmige Rührlöffel (Kolopale) für Sago, mächtige Steinbeilklingen (Gune) bis 32 cm lang und 16 cm breit, kurze Handkeulen (Bossim) aus Knochen des Spermwal, die an Meri der Neu-Seeländer erinnern (T. XI, 6), schön geschnitzte Speere (Womari) und Schilde, letztere ganz in der Form, wie die in Milne-Bai (S. 271) und einiges andere. Ein Teil dieser Gegenstände kommt oder kam von den d'Entrecasteaux (Duau und Kulala), von woher ich selbst Obsidian auf Teste sah, andere, darunter die großen, schönen, seetüchtigen Segelkanus von Mulua oder Murua, das in lebhaftem Verkehr gestanden zu haben scheint und worunter die 150 Meilen entfernte Woodlark-Insel zu verstehen ist. Wie in Port Moresby aus dem Papuagolf ganze Handelsflotten eintreffen, um gegen Sago Töpfe einzutauschen, so kommen die Bewohner Muruas nach Teste, um dieses wichtige Küchengerät zu erstehen. Ich beobachtete übrigens, daß die erhandelten Kanus zum Teil erst auf Teste vollendet werden und hier ihren Schmuck an Schnitzereien erhalten. Die letzteren sind in sehr schwungvollen Mustern vertieft gearbeitet und mit roter und schwarzer Farbe ausgeschmiert, wozu man sich eines eigentümlichen Instruments (Keginiß T. VI. 5) aus Muschel (Pinna nigra) bedient. Es mag noch bemerkt sein, daß auf Teste einzeln noch Catamarans benutzt werden; auch sah ich die eigentümlichen Fischfallen von Bentley-Bai (T. IX, 1), hier Wuba genannt.


[S. 283] Was die, stark mit Ichthyosis behafteten, Eingeborenen anbelangt, so sind sie echte Papuas, die sich von denen des Festlandes in nichts unterscheiden, wie das beigegebene Porträt eines jungen Mannes zeigt. Er trägt das Haupthaar in der üblich aufgezausten Wolke, im Nacken lange Zottelstränge, die mit Cypraeamuscheln verziert sind. Ich beobachtete übrigens, wie fast allenthalben, auch vereinzelt schlichthaarige Individuen, nicht selten Kinder mit blondem Haar (ohne Einwirkung von Kalk) und ganz europäische Physiognomien, alles individuelle Abweichungen die, wie besonders erwähnt sein mag, mit Vermischung nichts zu thun haben, denn es giebt auf Teste kein Halbblut. Die Haartracht des weiblichen Geschlechts ist ähnlich wie die des männlichen, und dichtverfilzte Nackensträhne, die Polkalöckchen ähneln, sind auch bei ihm beliebt. Unsere Abbildung veranschaulicht eine junge Schönheit, deren fransenartiger Brustlatz aus fein geflochtenen Strickchen einen Trauerschmuck darstellt, wie er in ähnlicher Weise auch in Finschhafen vorkommt. Eine besondere Art Trauerschmuck heißt Sapisapi, und besteht aus einem dicken Polster von Haaren, mit Spondylusscheibchen verziert, das auf der linken Brustseite getragen wird. Ich offerierte einer Frau hohen[S. 284] Preis, aber vergeblich, da das Haar von ihrer verstorbenen Schwester herrührte, gewiß ein schöner Beweis von Pietät gegen Verstorbene. In derselben Weise wurden früher hier Unterkiefer naher Anverwandten als Armbänder getragen, welche für Unkundige gewöhnlich als Zeichen von Kannibalismus gelten. Diese Armbänder sind durch die Mission abgeschafft worden, aber man muß es der Londoner Gesellschaft nachrühmen, daß sie anderen »heidnischen« Schmuck duldet. So die Tätowierung, die beim weiblichen Geschlecht hier sehr verbreitet ist, in Mustern, welche so ziemlich mit den auf Rogia und Sariba gebräuchlichen übereinstimmen. Ich sah kleine Mädchen noch im Kindesalter, bei denen mit dieser, übrigens wenig schmerzhaften, Körperverzierung bereits begonnen war. Die beigegebene Abbildung zeigt Tätowierung im ersten Stadium des Aufzeichnens, was mit Ruß aus gebrannter Kokosnußschale mittelst eines Hölzchens geschieht. Die schwarze Farbe wird dann mit einem spitzen Instrument (Dorn) in die Haut eingeschlagen und erscheint, nachdem der leichte Schorf abgeheilt ist, viel blässer, (wie dies die Abbild. S. 278 zeigt). Die Bekleidung der Insulaner ist ganz so wie überall an der Ostspitze Neu-Guineas, aber die jungen Mädchen (darunter sehr niedliche), paradierten in besonders feinen, rot- und schwarzgestreiften Faserschürzchen in Volants mit Schärpe (T. XVI. 8). Schmucksachen (Ohrringe und Halsketten) aus Spondylusscheibchen, die von Murua kommen, waren nicht selten, aber meist unverkäuflich, wie die eleganten, etwas gekrümmten Nasenstifte (Panaiate) aus dem Schloßteil einer Hippopusmuschel, mit denen namentlich junge Mädchen kokettierten (vergl. Abbild. oben).

Moresby, der 1872 als der erste Weiße Teste-Insel betrat und sehr freundlich empfangen wurde, sah noch zahlreiche Schädel erschlagener[S. 285] Feinde als Trophäen an den Häusern aufgehangen. Die Insulaner waren damals kriegerisch und wie alle Bewohner des Archipels (und der Louisiade) Kannibalen. Das hat jetzt glücklicherweise aufgehört, die Bewohner brauchen keine Waffen mehr und führen unter der Ägide der Mission ein friedliches Leben, sind aber seitdem an Zahl bedeutend zurückgegangen und auf ca. 300 Köpfe zusammengeschmolzen. Die hiesige Sprache ist, um dies noch zu bemerken, sehr nahe mit der von Rogia und den übrigen Inseln des Moresby-Archipels verwandt. Der farbige Lehrer, Idande, ein dunkler Lifumann, hat großen Einfluß und regiert die, meist der Mission angehörenden, Eingeborenen als der erste Häuptling. Seine Station war sehr gut gehalten, die Kirche aber, wie so häufig, das schlechteste Gebäude. Es mag dabei bemerkt sein, daß die Lehrer die Häuser ohne besondere Entschädigung zu bauen haben. Außer Hühnern, die überall an Missionsstationen gehalten werden, aber selten zu haben sind, besaß Idande auch Gänse und Schweine europäischer Rasse, sowie treffliche Hunde. Letztere sind auch durch Tripangfischer nach der Ostspitze Neu-Guineas gebracht worden und haben hier an manchen Orten die eingeborene Rasse bereits verdrängt. Ich übernachtete bei Idande, der als früherer Matrose auf einem Walfischfahrer mancherlei zu erzählen wußte und sich als geborener Franzose mit lebhaftem Interesse nach dem deutsch-französischen Kriege erkundigte, über den ich ihm zu seiner Freude aus eigener Anschauung berichten konnte. Er gehörte zu den Veteranen der Mission, welche 1871 zuerst von den Rev. Murray und Mac Farlane in Neu-Guinea eingesetzt wurden und die im Anfange gar viel durchzumachen hatten. Mit Dankbarkeit erinnerte er sich Kapitän Moresby's, der ihn, wie so manchen der schlecht versorgten Lehrer, fast vom Hungertode[69] rettete. Wie Missionslehrer gewöhnlich zu thun pflegen, klagte auch Idande, infolge des langen Ausbleibens des Missionsschiffes, über Mangel verschiedener notwendiger Provisionen, wie Salz, Zucker, Streichhölzer, Mehl, Petroleum, Tabak, und ich freute[S. 286] mich, ihm aushelfen zu können. Als Gegengeschenk ließ er zum Abschiede zwei alte Hähne und eine Ananas an Bord bringen, die erste und einzige, welche ich auf unseren bisherigen Fahrten gesehen hatte. Ich bestimmte sie zu einer Bowle, mit der wir Silvester feiern wollten, aber es kam, wie so oft, anders! In Bewunderung der spiegelglatten See und eines herrlichen Zodiakallichtes, das mit Untergang der Sonne 6 Uhr 21 Minuten den westlichen Himmel bis 7, 23 in verschiedenen zarten Tinten färbte, saßen wir gemütlich auf dem kleinen Quarterdeck. Die Bowle stand auf dem Kajütstische und war im Wasserfilter angerichtet. Eben wollte ich den letzteren vorsichtshalber festbinden, da machte das Schiff eine Bewegung — krach! und mit unserer Bowle und Silvesterfeier war es vorbei!
Teste-Insel liegt nur etwa 400 Meilen von Cooktown entfernt, unserem damaligen Reiseziel, wo die Ankunft eines Dampfers unter deutscher Flagge große Aufregung verursachte. Man erging sich in allerlei wunderlichen Vermutungen, hatte aber die Beteiligung der »Samoa« bei der Besitzergreifung Deutschlands in Neu-Guinea bald heraus.
Und daß man, bei den damaligen Ansichten der Kolonisten, darüber nicht eben erbaut war, läßt sich begreifen; betrachtete doch Australien, besonders Queensland und Victoria, die Papuaregion, insonderheit Neu-Guinea als ihr angestammtes Erbe. In der Town-Hall wurde ein »Indignation-Meeting« unter dem Vorsitz des Mayor abgehalten und Englands Politik, die Übergriffe Deutschlands überhaupt zugelassen zu haben, auf das ärgste getadelt. Da man den armen Gladstone nicht bei der Hand hatte, konzentrierte sich der ganze Unmut von Presse und Publikum auf mein Haupt. Während die erstere einmal faktisch drohte, mich mitsamt der »Samoa« in die Luft zu sprengen, hörte ich nicht selten beim Vorübergehen die Worte »that is the fellow who stol us New Guinea«! Wahrhaftig, wer die Kolonien mit ihrem »free and easy« nicht gekannt hätte, konnte sich in Cooktown unbehaglicher als unter Wilden fühlen, die wenigstens keinen Dynamit besitzen.
[S. 287] Aber ich kümmerte mich nicht um die Leute und ließ sie reden, was sie wollten. Wußte ich doch zur Genüge, daß es nicht schlimm werden würde, und daß ich nichts zu fürchten hatte. Dafür bürgte schon der mächtige Schutz der deutschen Flagge und der Respekt vor unserem großen Reichskanzler, der, wie sich die Leute nicht ausreden ließen, den Doktor mit der »Samoa« ausgesandt haben sollte.
Unsere Vorgänger. — Vulkan-Insel. — Weithin schmutzig gefärbtes Meer. — Bei Venushuk. — Eingeborene. — Ethnologisches und Anthropologisches. — Bedenken gegen die Weiterreise. — Schouten und le Maire. — Längs unbekannter Küste. — Wir entdecken den Kaiserin Augustafluß. — Hansemann-Küste. — Zusammentreffen mit Eingeborenen. — Krauel-Bucht. — Eingeborene am Caprivifluß. — Albino. — Kap Dallmann. — Neue Buchten. — Prinz Alexander-Gebirge. — Dallmannhafen. — Eingeborene. — Landexkursion. — Dorf Rabun. — Hausbau. — Frauen. — Tabuhaus. — Gastfreundschaft. — Ein Papuadinner. — Papuanische Auffassung europäischer Utensilien. — Spielzeug. — Elektrisiermaschine. — Ich soll Häuptling werden. — Muschu. — Insel Guap. — Eingeborene derselben. — Brustbeutel. — Äußerer Ausputz derselben. — Inhalt. — Waffen. — Kanus. — Wiedersehen. — Pâris oder Aarsau. — Finschküste. — Neue Flüsse. — Kaskadefluß. — Malgari und seine beiden Söhne. — Macht der Musik. — Wieder neue Flüsse. — Tagai. — Auf Palmblättern. — Pfeil und Bogen. — Paradiesvögel. — Kolossales Haar. — Torricelli-Gebirge. — Kein Passier-Point. — Sainson-Inseln. — Berlinhafen. — Sanssouci. — Kopradistrikt. — Neue Flüsse. — Große Lagune. — Schacher mit Eingeborenen. — Ethnologisches Sammeln. — Kein Karan-Riff. — Massilia. — Eingeborene. — Berg Bougainville. - Angriffshafen. — Eingeborene — im Kriegsschmuck. — Neues ethnologisches Gebiet. — Enorme Nasenkeile. — Anthropologisches. — Pfiffigkeit. — Aussicht auf Humboldt-Bai. — Germaniahuk. — Zu Anker am Sechstrohfluß. — Eingeborene. — Vorsicht nötig. — Schwieriger Handel. — Ethnologisches. — Eßbare Erde.
Von allen Küsten Neu-Guineas war wohl keine weniger bekannt als die nordöstliche zwischen Astrolabe- und Humboldt-Bai, eine Strecke, die, in der Luftlinie gemessen, sechs Grade oder nahezu 360 Meilen deckt. Was die Karten hier verzeichneten, ist den Entdeckungsreisen der französischen Kriegsschiffe »Coquille« unter Duperrey (1823) und »Astrolabe« unter Dumont d'Urville (1827) zu[S. 289] verdanken, wie schon aus der französischen Namengebung hervorgeht. Sie bezieht sich, außer richtig festgelegten Inseln, auf 16 vorspringende Punkte der Küste, Kaps oder Huks, mit erheblichen Lücken dazwischen. Für große Strecken hatten die Schiffe nämlich so weit vom Lande abzuhalten, daß sie die Küste nur sichteten, an wenigen Stellen kamen sie ihr näher, nirgends betraten sie dieselbe. Nur einmal war dies überhaupt geschehen, aber lange, lange vorher und zwar bei der denkwürdigen Weltreise von Jacob le Maire und Willem Schouten (sprich: Schauten), die im Juli 1616 an einem nicht mehr genau auszumachenden Punkt, auf den wir noch zurückkommen, als die Ersten und Letzten wirklich landeten. Das Schicksal hatte uns vergönnt in die Fußstapfen der glorreichen niederländischen Seehelden zu treten, denn unsere bisherigen Reisen ließen in Kaiser Wilhelmsland nur jene oben erwähnte Küste übrig, die unbekannteste überhaupt. So bezeichnete sie Robidé van der Aa, der beste Kenner der Litteratur über Neu-Guinea, noch Ende 1883. Das beigegebene Kärtchen (S. 290)[70] wird, im Verein mit der Übersichtskarte, wenigstens soweit zur Orientierung dienen, um unserer Reise einigermaßen folgen zu können.
Beinahe hätte ich diese Reise überhaupt nicht mitmachen können und unfreiwillig eine andere machen müssen, die jedem früher oder später einmal bevorsteht. Wie ein Dieb in der Nacht kam nämlich ganz plötzlich ein Choleraanfall über mich, und hätte den Namen meines kleinen Hauses in Mioko »onverwacht« (unerwartet) bald in einer Richtung wahr gemacht, die mir bei der Verleihung am allerwenigsten vorschwebte.
[S. 290] Mit aller Macht wurde zu der bevorstehenden großen Reise gerüstet. Wie fast immer in Mioko ging dies aber, schon des Kohlenladens wegen, nicht so rasch und erst am 5. Mai (1885) verließ die »Samoa« seeklar, den Hafen. Sie führte, »all hands« gerechnet,[S. 291] 18 Mann an Bord, eine Macht, die es auch ohne Kanonen mit den Eingeborenen aufnehmen konnte, wegen denen wir uns überhaupt keine Sorge machten. Aber was wir in unserer diesmaligen Ausrüstung mit Bedauern vermißten, waren Hunde, da die von Sydney und Cooktown mitgebrachten leider, meist an Hitzschlag, eingegangen waren. Hunde sind namentlich für kleinere Schiffe nützlicher als Kanonen, und nichts hilft wirkungsvoller das Deck von Eingeborenen klären, als ein kläffender Köter.
Für Abergläubige bot gleich der Anfang unserer Reise ungünstige Vorzeichen. Denn kaum waren wir außerhalb der Passage, so stand die Maschine still, bald darauf ein zweites Mal! Glücklicherweise gelang es aber Meister Nielsen beidemale, sie wieder in stand zu setzen, so daß wir wenigstens nicht umzukehren brauchten. In der Frühe des vierten Tages zeigte sich hohes Land, die in Wolken eingehüllte Insel Vulkan, bald darauf Lesson und erst später, gleich einem schmalen blauen Streif am Horizont, die Festlandsküste. Wir dampften ihr zu und sahen die bisher isolierten Hügel bereits zu Ketten vereint, als plötzlich das Kommando »stopp« die Fahrt unterbrach. Eine besondere Erscheinung veranlaßte dasselbe, denn soweit das Auge reichte, war auf einmal grüngefärbtes Wasser voraus, das von dem dunkelblauen, wie mit einem Messer, durch einen weißen Streif abgeschnitten erschien. Der ganze Eindruck war der eines ungeheuern Riffs und mahnte zur Vorsicht wie zum Loten. Aber »sechzehn Faden und kein Grund«, ließ sich der Mann mit der Leine unabänderlich vernehmen, und so dampften wir durch die Kabbelung des weißen Gischtstreifes in das trübe grüne Wasser hinein. Es schmeckte wenig salzig und ließ keinen Zweifel, daß wir es mit Auswässerung von Flüssen zu thun hatten, wie dies Unmassen von Treibholz, darunter ganze Baumstämme mit Ästen und Blättern, vollends bewiesen. Nach der Küste zu steuernd, die wie ein ununterbrochener Waldstreif erschien, später reiche Palmenbestände zeigte, gingen wir gegen Abend kaum mehr als zwei Meilen vom Ufer in fünf Faden Mudd zu Anker. Eine Gruppe besonders hoher Kasuarinen ca. sechs Meilen zu West war Venus-Point der Karten, eine[S. 292] andere ganz ähnliche, noch weiter westlich Cap de la Torre[71]. Vor uns am Ufer lagen, versteckt unter Kokospalmen, drei Dörfer, deren Bewohner mächtige Feuer anzündeten und bald in Kanus abkamen. Schon die letzteren zeichneten sich durch merkwürdigen Putz der Mastspitze aus. An der einen war die Nachbildung eines Fregattvogels aus Federn (Atlas VIII. 4), an einer anderen sonderbarer Faserschmuck mit einem Kreuz an der äußersten Spitze (VIII. 3) befestigt. Noch mehr interessierten uns aber die Insassen selbst, deren sonderbare Haartracht am meisten auffiel. Sie vereinigt das Haar am Hinterkopf zu einem abstehenden, dichtverfilzten Zopf, der häufig in einem zierlich geflochtenen konischen Körbchen (XVIII. 1) steckte, das oft noch besonders geschmückt war. Neben diesem Haarputz imponierten gewaltige Zwickelbärte, wie ihn der Mann auf der Abbildung[S. 293] zeigt, der zugleich mit einem jener reichverzierten Schamschurze aus Tapa bekleidet ist, die ich nur hier beobachtete. Für gewöhnlich sind sie, zwar sorgfältiger und decenter als sonst, viel einfacher (wie T. XVI. 2). Der übrige Körperausputz war sehr mannigfach. Schnüre aufgereihter kleiner Muscheln (Nassa) und Hundezähnen, um Stirn, Hals oder Hüfte geschlungen, spielten eine hervorragende Rolle. Kopfputz aus Wülsten von geschorenen Kasuarfedern, ganz wie solcher an der Südostküste vorkommt, war auch hier vorhanden. Selbstredend fehlten Armbänder nicht und zwar waren gewöhnliche, aus Pflanzenfaser geflochten, am häufigsten; es gab aber auch solche aus gebogenem Schildpatt, mit kunstvoller Gravierung, wie wir sie in Astrolabe (XIX. 2) kennen lernten. Ohr- und Nasenschmuck war kaum vertreten und statt des Ohrläppchens der Ohrrand durchbohrt. Kunstvolle Rosetten aus Hundezähnen (XXI. 4) als Brustschmuck erschienen mir neu, ebenso Leibschnüre (XXIV. 4) aus eigentümlich auf Baststreifen geflochtenen Muscheln (Nassa), die wahrscheinlich auch als Geld dienen. Ich sah auch sehr hübsche Frauenfaserschurze, in der bekannten Weise rot, gelb und schwarz gefärbt, aber sehr elegant mit Muscheln und Ringen aus Conus verziert. Die meisten Männer trugen hübsche, zuweilen reich mit Scherben von Cymbiummuschel verzierte, gestrickte Brustbeutel und führten noch eine besondere Art Tragkörbe[72] mit sich. Sie waren aus Pandanus- oder Kokosblatt geflochten und in eigentümlicher Weise mit buntgefärbter, kurzgeschorener Pflanzenfaser, plüschartig besetzt, außerdem mit kleinen Muscheln verziert.

Die Leute schienen ganz unbewaffnet, waren aber doch für alle Fälle vorgesehen und brachten nach und nach Unmassen Speere und Wurfpfeile zum Tausch, die sie sorgfältig in den Kanus versteckt hatten. Diese Wurfspeere, 1,60 bis 2,40 Meter lang, waren aus Rohr, mit langen Holzspitzen, zum Teil in sehr verschiedenartige und kunstvolle Kerbzähne und Widerhaken ausgeschnitzt. Für den Handwurf zu leicht, für den Bogen zu schwer, wußte ich anfangs nicht recht,[S. 294] wie ich diese Speere deuten sollte, bis die Frage durch ein besonderes Gerät gelöst wurde. Dasselbe bestand in einem ca. 70 cm langen Stück Bambu mit feingeschnitzter hölzerner Handhabe und erwies sich als Wurfstock (T. XI. 3), zum Werfen jener Pfeile (XI. 2), eine Methode, die bisher nicht in Neu-Guinea beobachtet wurde und ethnologisch ganz besonderes Interesse verdient. Bogen fehlten; aber ich beobachtete schöne Dolche aus Kasuarknochen. In Schnitzarbeiten schienen die Leute sehr geschickt, wie dies namentlich ihre Kanus zeigten, deren Schnäbel und Borde zuweilen in kunstvoller Weise damit verziert waren. Krokodilfiguren kamen dabei nicht selten und zwar in recht naturgetreuer Darstellung vor. So sehen wir auf der Abbildung (S. 292) an einem solchen Kanuschnabel ein Krokodil, dessen Schwanz in den Kopf eines Nashornvogels (Buceros) übergeht und im Atlas (VII. 5) einen Krokodilkopf in Verbindung mit einem Menschengesicht, dem Augen aus Perlmutter eingesetzt waren. Die Kanus bestanden übrigens nur in 20 bis 30 Fuß langen ausgehöhlten Baumstämmen und ähnelten in der Bauart denen von Astrolabe-Bai. Einzelne trugen 18 Mann.
Die eigentümlichen Haarzöpfe gaben diesen Eingeborenen ein mikronesisches Ansehen, aber sie waren echte Papuas, etwas heller als Neu-Britannier gefärbt, wie die meisten Papuas Neu-Guineas. Sie erschienen im ganzen kräftiger als die an der Ostspitze, und es gab wenig Hautkrankheiten unter ihnen, aber ich beobachtete bei einzelnen Pockennarben. Obwohl sehr lärmend und untereinander häufig streitend, ließ sich doch gut mit den Leuten handeln. Sie besaßen nichts an europäischen Sachen[73], interessierten sich weder für rotes Zeug, Glasperlen noch Tabak, gaben nichts um Messer, erhoben aber ein Freudengeschrei, als ich Bandeisen (kiram) zeigte. Sie brachten sehr schöne große Kokosnüsse, etwas Taro, Bananen und Unmassen aufgereihter zweischaliger Flußmuscheln (Batissa violacea und Finschii), die gegessen werden. Außer Betel und Tabak, der in derselben[S. 295] Weise wie in Astrolabe (S. 59) geraucht wird, beobachtete ich hier zuerst eßbare Erde und — einen Kolben Mais. Er war sehr klein und wurde von einem Manne als Zierat im Haar getragen. Es wäre sehr interessant gewesen, heraus zu bekommen, ob dieser Mais angebaut wird, denn bisher kannte man diese Nutzpflanze nicht aus Neu-Guinea. Aber Maclay brachte sie nach Astrolabe-Bai.
Wie auf ein gegebenes Zeichen verließen uns die Eingeborenen vor Sonnenuntergang, wahrscheinlich um noch vor Einbruch der Dunkelheit durch die Brandung zu kommen. Sie schieden als Freunde, denn unser Bündnis war durch eine besondere Ceremonie besiegelt worden. Ein Häuptling nahm ein Kokosblatt, an dem die Fiedern bis auf einen kurzen Basisteil abgeschnitten waren und spaltete dasselbe in zwei Längshälften, wovon die eine am Mast seines Kanus befestigt, die andere mir als Friedenszeichen übergeben wurde. Auch ich ließ dasselbe am Maste anbinden, was den Leuten sichtliche Freude machte.
Es war ruhig geworden, aber wir konnten diese Ruhe und den wunderbar schönen Sonnenuntergang mit darauffolgendem herrlichen Zodiakallicht nur wenig genießen, da andere wichtigere Betrachtungen uns zu lebhaft beschäftigten. Sie betrafen die Weiterreise, wegen der Schiffsrat gehalten wurde. Wir waren in jener Region, wo trübgefärbtes Wasser unsere Vorgänger veranlaßt hatte, der Küste auszuweichen, und Kapitän Dallmann neigte anfangs sehr dazu d'Urville's Beispiel zu folgen. Als Schiffsführer verantwortlich, durfte es ihm gewagt erscheinen, die Fahrt in Gewässern fortzusetzen, deren unsichtbaren Gefahren (toten Riffen u. s. w.) nur wenig Sicherheitsmaßregeln gegenüber gestellt werden konnten. Denn Lotungen genügten nicht, um ein Aufrennen zu verhindern und das einzige wirksame Hilfsmittel, eine Dampfbarkasse, fehlte leider. Aus naturwissenschaftlichen Gründen konnte ich wohl mit ziemlicher Gewißheit den Mangel von Korallriffen infolge des geringen Salzgehaltes des Meerwassers begründen, aber nicht zugleich auch das Fehlen von Felsen und anderen Schiffahrtshindernissen garantieren. Freilich fuhren wir nicht zum erstenmale in trübgefärbtem Wasser und lagen auch hier bereits in[S. 296] solchem gemütlich vor Anker, aber wer konnte voraussagen, ob die Verhältnisse immer so günstig bleiben würden. Zu einer unfreiwilligen Robinsoniade verspürte ich selbst, wie alle, zwar auch keine Lust, aber eine Fortsetzung der Reise weitab von der Küste hatte überhaupt keinen Zweck und schließlich mußte doch überhaupt einmal der Anfang gemacht werden, dieselbe auch in der Nähe kennen zu lernen. Der Gedanke, kurz vor jenen Flüssen wieder umzukehren, über deren Vorhandensein hier herum schon Schouten und le Maire berichteten, war zu niederdrückend und ihr leuchtendes Vorbild konnte mit als Argument dienen. Sie waren die Ersten, welche am 6. Juli 1616 die brennende Insel »Vulkanus« entdeckten und durch Mangel an Lebensmitteln und Wasser gezwungen mit ihrem Segelschiff »de Eendracht« (Eintracht) in das trübgefärbte Wasser hinein bis an die Küste zu gehen, wo man am 9. und 10. Juli in einer Bucht ankerte. Sie erhielt später den Namen Cornelis Kniers-Bai, läßt sich aber nicht mehr mit Sicherheit ausmachen. Nach meinem Dafürhalten muß sie ca. 50 Meilen West von Kap de la Torre (Vlaken Hoek) liegen, denn damit stimmt noch am besten das Wenige überein, was Schouten über die Eingeborenen sagt. Sie waren (wie wir es auch fanden) freundlich, hatten aber nur wenig Kokosnüsse, und gaben »für einen Faden Leinwand nur vier Stück«. Ja, ja! das waren noch Entdeckungsreisen! und niemand konnte die Thaten der alten Seefahrer besser beurteilen und würdigen als wir an dieser Stelle. Gegen Sonnenuntergang kam die Spitze des Berges frei von Wolken und erschien wie die ganze Insel in wunderbar scharfer Beleuchtung. Rosiger Schein umfloß den Kraterrand, dessen im Westen eingestürzter Trichter deutlich eine feurige Stelle, wie einen brennenden Spalt zeigte, die nach Einbruch der Dunkelheit weit intensiver hervortrat, bis nach und nach Wolken den Berg verhüllten. Aber er hatte zu uns gesprochen im Geiste le Maire's und Schouten's, die vor mehr als 250 Jahren vielleicht auch hier herum über die Weiterreise nachdachten. Und wir, mit einem Dampfer, hätten umkehren sollen? nimmermehr! Die Erinnerung an die kühnen Niederländer gab den Ausschlag, und die Reise wurde am anderen Morgen längs der Küste[S. 297] fortgesetzt. Sie erscheint flach, dicht bewaldet, mit niedrigen Hügelreihen, weiter inland einer höheren Bergkette und dürfte brauchbares Kulturland aufweisen. Berg Jullien der Karten ließ sich nicht sicher ausmachen.
Wir hatten jetzt Broken-Water-Bay vor uns, von Powell so benannt, der aber im übrigen nichts über dieselbe berichtet, (l. c. S. 512). Zahlreiche Treibholzstämme und die von Grün in ein trübes Lehmbraun übergehende Farbe des Meeres zeigten immer deutlicher, daß Flußmündungen nicht fern sein konnten. Wirklich passierten wir bald darauf eine solche[74] und etwa fünf bis sechs Meilen weiter westlich einen anderen ansehnlichen Fluß, den ich Prinz Wilhelmfluß zu nennen mir erlaubte. Da sich vor demselben Brandung zeigte, so hielten wir nach Kap de la Torre zu, einem nicht sehr auffallenden Küstenvorsprung mit einer Gruppe höherer Bäume. Aber noch ehe wir das Kap erreichten, färbte sich das Wasser wieder trüb braun, und bald darauf zeigte sich die Mündung eines bedeutenden Flusses, vor der die »Samoa« ca. zwei Meilen in fünf Faden bereits in Süßwasser ankerte. Mit dem ersten Offizier Sechstroh machte ich sogleich im Walboot eine Rekognoszierung, aber die Strömung nahm bald so zu, daß sich mit Rudern nicht gegen dieselbe ankämpfen ließ. Glücklicherweise erlaubte eine aufspringende Brise Segel zu setzen und so war es möglich, bis in die eigentliche Mündung vorzudringen, deren Breite wir auf ca. eine halbe Meile schätzten. Die Ufer zeigten, wie die der ca. vier Meilen breiten Mündungsbucht dichten Baumwuchs, darunter viel Nipapalmen, die auf sumpfige Beschaffenheit schließen lassen. Am linken Ufer bemerkten wir zuerst ein paar schlechte Hütten, dann zwei größere Häuser, deren Bewohner aber in ihren großen Kanus eiligst flüchteten. Später sammelten sich circa fünfzig bewaffnete Eingeborene auf der mit viel Treibholz besetzten Sandbank des rechten Ufers, aber da hier gerade der stärkste Strom läuft, so war es nicht möglich,[S. 298] mit ihnen zu verkehren oder ihnen nur Geschenke zuzuwerfen. Überhaupt hatten wir auch Wichtigeres zu thun, nämlich zu loten, und kamen dabei zu dem wichtigen Resultat, daß der Fluß vollkommen frei und für Schiffe wie die »Samoa« (mit ca. drei Meter Tiefgang) voraussichtlich befahrbar sein dürfte. Wie weit? blieb freilich späteren Untersuchungen vorbehalten, da wir selbst natürlich an eine solche nicht denken konnten. Aber der seit mehr als 250 Jahren hier herum vermutete Fluß war endlich gefunden, und wahrscheinlich zugleich der größte, nicht nur in Kaiser Wilhelmsland, sondern an der ganzen Ostküste Neu-Guineas überhaupt. Mit der Entdeckung eines solchen Flusses durften Hoffnungen auf eine praktikable Wasserstraße, fruchtbare Uferstrecken u. s. w. verknüpft werden, die sich seitdem zum Teil erfüllten. Der »Kaiserin Augustafluß«, wie ich ihn benannte, ist wiederholt und ohne Schwierigkeiten mit Dampfern, zuletzt 380 Meilen weit, befahren, und seine Wasserstraße größer als die des Rheines geschätzt worden. Er bietet einen Weg zur Erschließung des Binnenlandes bis nahe zur Grenze des holländischen Gebietes von eminentester Wichtigkeit. Ja, wer in Australien einen solchen Fluß entdecken könnte, dem wäre geholfen!
Am anderen Morgen (10. Mai) dampfte die »Samoa« in W.-N.-W.-Kurs längs jener bisher nur punktiert auf den Karten eingetragenen, 65 Meilen langen Küste weiter, die ich, nach dem eigentlichen Urheber der Samoafahrten und der deutschen Kolonisation in Neu-Guinea, Hansemann-Küste benannte. Sie verläuft ohne tiefere Buchten gleich- und einförmig waldgesäumt, dürfte aber für Kulturzwecke einmal hohe Bedeutung erlangen, denn nirgends hatte ich bisher so ausgedehntes Flachland angetroffen als an dieser Küste, die nur weiter inland niedrige Hügelreihen zeigt. Sie scheint wenig bewohnt, denn nur an der Mündung zweier Flüsse (Hammacher- und Eckardtstein-Fluß), die das Meer weithin trüb färbten, beobachtete ich Kokospalmen und zählte fünf Siedelungen. Die Landungsverhältnisse der Hansemannküste scheinen übrigens nicht günstig, da wir längs derselben Brandung beobachteten. In der Nähe des Hammacher-Flusses circa zehn Meilen West von Kap de la Torre kamen sechs Segelkanus[S. 299] (T. VIII, 5, 7) mit Eingeborenen ab und längsseit; doch getrauten sich die letzteren nicht an Bord. Sie glichen den zuerst gesehenen von Venushuk und trugen wie diese das Haar in einem Körbchen oder wie der Mann auf der Abbildung einen dicken Zopf, der mit Binden aus Hundezähnen und Blättern verziert ist. Der weitere Ausputz besteht in einem Brustschmuck aus einer konkaven Scheibe von Cymbiummuschel, mit Kettchen aus schwarzen Samenkernen und Kauris, der mit das Wertvollste zu sein scheint. Am Backenbart sind Stückchen Perlschale, Hundezähne oder Muschelringe befestigt, im durchbohrten Ohrrande wie in den Nasenflügeln stecken grüne Blattstückchen. Andere Männer trugen eigentümliche, reichverzierte, lange Kämme (T. XVII, 2) mit Kettchen und Federn im Haar und besonderen Nasenschmuck aus Perlmutter (XX, 5).

Zu meiner Freude erhielt ich auch einen jener kostbaren zirkelrunden Eberhauer (S. 91), welche die Eingeborenen bei Venushuk um keinen Preis hergeben wollten. Dieser Zahn war noch außerdem in der Mitte zierlich mit rotem Strohgeflecht umwickelt, das dazu diente — die Fälschung zu verdecken, denn er bestand aus zwei Stücken. Ja! nicht alle können echte Brillanten tragen, und auch bei den Papuas muß sich mancher[S. 300] mit Simile behelfen. — Alle waren mit Schamschurzen aus Tapa bekleidet. Ein eigentümliches Musikinstrument interessierte mich besonders deshalb, weil ich es in ganz gleicher Weise auch an der Südostküste (Port Moresby) erhalten hatte. Es besteht aus einem Stück Bambu mit einem zungenartigen Einschnitt und dient zum Taktschlagen bei Begleitung der Gesänge. An Waffen sah ich dieselben als vorher (S. 293) beschriebenen, aber auch schwerere Wurfspeere mit kunstvoll geschnitzter, reich verzierter Spitze (T. XI. 1) und sehr eigentümliche, mit Halswirbeln vom Kasuar verzierte. Die guten Leute fürchteten sich anfangs sehr, was man ihnen gewiß nicht verdenken konnte, denn offenbar hatten sie vorher keinen Weißen gesehen. Zu meiner Verwunderung kannten sie nämlich kein Eisen, und erst als ich praktisch den Nutzen eines Beiles zeigte, schien es bei ihnen aufzudämmern und jeder verlangte nun »maiang«! Um andere Dinge wie Glasperlen, Spiegel, Streichhölzer gaben sie nichts, jedenfalls weil sie den Zweck noch nicht recht begriffen, eine Erfahrung, die ich häufig gemacht habe. Das Erstaunen des sogenannten Wilden beim ersten Anblick von Weißen ist überhaupt in der Regel viel minder lebhaft, als gewöhnlich angenommen wird, sein Interesse, obwohl in erster Linie praktisch, unberechenbar und individuell sehr verschieden. Dem einen gefällt dies, dem anderen jenes, gerade wie dies bei uns und allenthalben der Fall ist.
Von Kap de la Torre verläuft die Hansemannküste ca. 30 Meilen in westlicher Richtung und wendet sich dann W.-N.-W. bis zu Kap Dallmann, welches die weite Krauel-Bucht, oder besser Bai nach Westen begrenzt. Das bergige Kap erschien von weitem wie eine Insel, bei der wir gute Ankerung zu finden hofften, hierin aber getäuscht wurden. Ein heftig aufspringender Ost nötigte überdies zurückzugehen und an der Küste einen passenden Platz zu suchen, den wir auch vor der Mündung eines Flusses, des Caprivi, kurz vor Sonnenuntergang fanden. An seinem linken Ufer waren zwei kleine Siedelungen, deren Bewohner die ganze Nacht Feuer unterhielten, und schon vor Anbruch des Tages (11. Mai) in ihren Kanus herbeieilten. Ganz ungeniert und ohne Zeichen von Furcht kamen sie sogleich[S. 301] an Bord, obwohl auch sie offenbar noch keine Weißen gesehen hatten und Eisen anfänglich verächtlich zurückwiesen. Man sieht, wie verschieden das Betragen Eingeborener beim ersten Zusammentreffen mit Fremdlingen sein kann, zuweilen furchtsam und zurückhaltend, zuweilen furchtlos und offen bis dreist und unverschämt. Das letztere ließ sich nun von diesen Eingeborenen nicht sagen, denn nirgends hatte ich vorher so liebenswürdige und manierliche »Wilde« kennen gelernt als hier. Da gab es kein wüstes Schreien, wie dies sonst meist der Fall ist, sondern die Leute verhielten sich ruhig, ja sprachen mit leiser Stimme, und zwar nicht etwa infolge von Angst. Auch hielten sie uns nicht für Götter, wie sich Weiße dies meist einbilden, kümmerten sich um die Blässe unserer Haut nicht im mindesten, gaben aber ihrem Erstaunen durch ein eigentümliches Schnalzen mit der Zunge Ausdruck, wobei sie die Backen aufbliesen. Da den Leutchen natürlicherweise alles und jedes an Bord neu war, so wollte das Schnalzen gar kein Ende nehmen. Meine bisherigen Erfahrungen, daß dem Kanaker »schenken« unbekannt ist, wurde übrigens hier zum erstenmale glänzend widerlegt, denn zu meinem Erstaunen kamen die Capriviten nicht mit leeren Händen. Sie brachten einen Korb mit etwas Yams, Kokosnüsse (die auch hier Niu heißen), gekochten Sago in Blätter gehüllt, spanischen Pfeffer, gekochtes und geräuchertes Schweinefleisch, in Stücke geschnitten und in eigentümlicher Weise zwischen Stöckchen gepreßt, sowie frische Holothurien (S. 275) und boten dieses alles als wirkliche Geschenke an, d. h. ohne Gegengabe dafür zu verlangen. Eine solche Freigebigkeit mußte natürlich belohnt werden, aber ich fürchte, daß die ersten Wohlthaten der Civilisation den Samen der Zwietracht in die Herzen dieser noch unberührten Naturkinder säten, denn da nicht alle gleichmäßig bedacht werden konnten, so werden Neid und Mißgunst wohl nicht ausgeblieben sein. Bei einem so kurzen Aufenthalte als dem unseren merkte man davon freilich nichts, sondern es herrschte eine Harmonie, wie sie schöner nicht gedacht werden kann. Aber ich weiß aus Erfahrung, daß eine solche Idylle gewöhnlich nicht von langer Dauer ist, selbst wenn[S. 302] in formeller Weise Friedenszeichen ausgetauscht wurden. Das der hiesigen Eingeborenen bestand in einem ca. 45 cm langen, schmalen Streif Kokosblatt, in welches ein alter Mann acht Knoten knüpfte und mir denselben überreichte. Ob dabei die Zahl acht irgend eine symbolische Bedeutung hatte, vermochte ich natürlich nicht zu erörtern, denn für solche Fragen läßt die Zeichensprache im Stiche. Die Biedermänner vom Caprivi waren übrigens im allgemeinen schwächlich aussehende Leute, aber echte Papuas, meist so dunkel gefärbt als Neu-Britannier (zwischen Nr. 28 und 29 der Broca'schen Farbentafel), zuweilen heller, ja ich hatte wieder einmal die Freude, einen Albino kennen zu lernen. Mit Ausnahme der von der Sonne stark geröteten Stellen (Brust und Schultern) war seine Färbung so hell, als bei einem Europäer (Nr. 23 bis 25 von Broca), sein Haar blond; aber die lichtscheuen Augen konnten die Sonne nicht vertragen, wie dies meist bei Albinos der Fall ist.

Im Ausputz unterschieden sich die hiesigen Eingeborenen wenig von den vorher gesehenen (S. 293). Haarkörbchen waren aber seltener und schienen mehr eine Auszeichnung der Häuptlinge zu sein, während die Mehrzahl das Kopfhaar geschoren oder in der gewöhnlichen verfilzten und verzottelten Weise der Papua wachsen ließ. Die Abbildung zeigt einen solchen Häuptling, dessen Haarkörbchen in origineller Weise mit Streifen des weiß und rostgelb gefleckten Felles eines Beuteltieres (Phalangista orientalis) verziert ist, wie solche auch mit Vorliebe als Anhängsel der Armbänder benutzt werden. Der Zwickelbart des Mannes ist mit zwei der Länge nach gespaltenen[S. 303] und dünn geschliffenen Eberhauern geschmückt, die an dieser ganzen Küste sehr beliebt sind. Ein Sack und kleinerer Brustbeutel (mit Placunamuscheln als Zierat) vollenden die Ausstaffierung. Unter sonstigen Kostbarkeiten der hiesigen Eingeborenen bemerkte ich schön gravierte Armbänder aus Schildpatt (Taf. XIX. 3) und Imitationen gebogener Eberhauer aus Tridacna geschliffen (T. XXI. 3).
Von dieser größten aller jetzt lebenden Meeresmuscheln liefert bekanntlich der breite Schloßteil ein weit über die Südsee verbreitetes und allgemein hochgeschätztes Material, nicht nur für Schmuckgegenstände (Brust- und Armringe, Nasenkeile), sondern namentlich auch für Axtklingen, die häufig solchen von Stein vorgezogen werden. Da der Schloßteil einer 66 cm langen Tridacnamuschel kaum 6 cm breit ist, so kann man sich danach eine Vorstellung von der ungeheuren Größe solcher Exemplare machen, aus denen sich ein Ring von 13 cm Diameter herstellen ließ, wie ich sie hier sah. Da ein solcher Ring, bei ca. 1 cm Dicke, 10 cm im Lichten vollkommen kreisrund gearbeitet ist, so verdient, unter Berücksichtigung der bedeutenden Härte des Materials, der Fleiß und die Geschicklichkeit dieser Künstler der Steinzeit volle Bewunderung. Auf der Insel Ponapé in den Karolinen erhielt ich früher sauber gearbeitete Axtklingen aus Tridacna von 50 cm Länge, 11 cm Breite und neun Pfund Schwere. Sie stammten noch aus der guten alten Zeit und gehören wohl mit zu den kolossalsten Stücken, welche aus diesem Material hergestellt wurden.
Die langen, sehr schmalen Kanus der Capriviten zeigten, neben gewissen Eigentümlichkeiten in der Bauart, auch hübsche Verzierungen in Schnitzarbeiten (ähnlich T. VII. 4). Einzelne Kanus führten Mast und Segel; die größten trugen zwölf Mann.
Mit dem Caprivifluß endet das Flachland, und Berge säumen nun die Küste, ein Charakter, den sie bis Humboldt-Bai beibehält. Wir dampften längs den niedrigen Hügeln, welche an der Westseite von Krauel-Bai ziemlich steil bis zum Meere abfallen und deren dichte Bewaldung stellenweis durch grüne Flächen unterbrochen wird, welche der Landschaft ein liebliches Aussehen verleihen. Hie und da waren[S. 304] auch an steilen Abhängen Plantagen sichtbar, sowie einzelne Häuser. Aber Siedelungen, und zwar sehr kleine, die sich schon von weitem durch gelbe Bäume kenntlich machten, trafen wir erst in den Buchten vor Kap Dallmann. Es sind deren drei: Ritter-, Buchner- und Nachtigal-Bucht, die dicht hintereinander folgen und von denen namentlich die letztere einer genaueren Untersuchung wert scheint. Mit Kap Dallmann, einem ca. 400 Fuß hohen, steil abfallenden, dicht bewaldeten Hügel, bekamen wir d'Urville-Insel in Sicht und sahen eine weite Bai vor uns. Wie sich später zeigte, zerfällt sie in drei Buchten: Dove, Jannasch und Gauß, und wird im Westen durch Bessels-Huk begrenzt. Dieser ganze Küstenstrich, dicht mit Laubwald bedeckte Hügel und Vorland, hie und da mit sanft ansteigenden Grasflächen, scheint sehr versprechend, aber wenig bewohnt, wie sich schon aus dem Mangel von Kokospalmen schließen läßt. In der That bemerkten wir nur bei Kap Dallmann ein Dorf von ca. zehn Häusern und bei Sahl-Huk etliche Kokospalmen und Eingeborene. Doch werden jedenfalls mehr Ansiedelungen vorhanden sein, die ja häufig unter Bäumen versteckt unbemerkt bleiben. Die landschaftlichen Schönheiten dieser Küste erhalten durch ein weiter inland liegendes Gebirge, das Prinz Alexandergebirge[75], erhöhten Reiz, dessen malerische Kuppen sich über 3000 Fuß erheben mögen. D'Urville-Insel, ein langgestreckter, dichtbewaldeter Bergrücken, mit einem grünen Vorland, das sich als Gressien-Insel erwies, trat immer näher heran, und als wir die kleine Meta-Insel, etwas nördlich von Bessels-Huk passierten, öffnete sich der Blick auf eine breite Meeresstraße, die Dallmannstraße, mit zwei Inseln an ihrem westlichen Eingange. Gegenüber Gressien bemerkten wir eine hübsche Bucht, die im Osten durch das von Meta-Insel sich ausdehnende Riff einen schönen Hafen bildet, den Dallmannhafen. Wir ankerten hier sehr zur Freude von Eingeborenen, die uns in drei Kanus schon seit einer Stunde unverdrossen folgten. Auch am Ufer wurde es lebendig: Knaben[S. 305] winkten mit grünen Zweigen, und eine Menge Eingeborener harrte sehnlichst auf unsere Ankunft. Bald wurde ihr Wunsch erfüllt, und sie sahen, wohl zum erstenmal, europäische Bleichgesichter unter sich. Denn auch diese Eingeborenen kannten kein Eisen, und der Gebrauch von Beilen und Messern mußte ihnen erst gezeigt werden. Ja, wie sollten solche unverfälschte Naturkinder der Steinzeit auch wissen, was ein Beil ist? Uns würde es in Bezug auf die Benutzung gewisser Geräte der Eingeborenen ebenso gehen, und unsere Museen besitzen gar manche Belegstücke dafür, deren Bezeichnung »Zweck unbekannt« häufig für immer unerklärbar bleibt. Das ungenierte Wesen, mit dem wir von diesen Eingeborenen ohne Scheu und Mißtrauen empfangen und behandelt wurden, war erstaunlich, und wer möglichst unverdorbene Menschen studieren will, dem ist Dallmannhafen zu empfehlen. Freilich würde der gute Rousseau manche seiner Vorstellungen über die Glückseligkeit des Naturmenschen zu verbessern gehabt haben, da sich eine solche überhaupt nirgends findet. Aber soweit sie überhaupt möglich ist, erfreuten sich diese guten Eingeborenen derselben, ein Völkchen, das, weiß Gott seit welchen Zeiten, ohne Civilisation ein sorgenfreies, behagliches Dasein führt. Für mich war es wiederum eine Freude, dieses fröhliche Leben und Treiben zu beobachten, denn es wird ja mit jedem Tage schwieriger, auf diesem Erdenrunde noch ein Fleckchen zu finden, wo man solche Beobachtungen machen kann. Wenn diese Eingeborenen als Typen möglichst unverdorbener Naturmenschen gelten dürfen, so ist Freigebigkeit eine angeborene Tugend des Menschengeschlechts und Bettelei erst später entstanden. Denn diese Leute schenkten mir freiwillig einige ihnen gewiß wertvolle Dinge, so einen schönen Knochendolch, einen Brustbeutel u. a., ohne gleich die Hand nach einer Gegengabe auszustrecken, wie dies sonst unabänderlich Kanakerbrauch ist. Meine bisherigen Erfahrungen hatten mich gelehrt, mit der Annahme von Geschenken Eingeborener vorsichtig zu sein, denn was sie heute schenken, erwarten sie morgen vielfältig zurückerstattet. Hier schien alles ohne die sonst übliche Berechnung, mit der man die Wurst nach der Speckseite wirft, und es herrschte vom ersten Begegnen[S. 306] an ein Ton, als wären wir lang erwartete liebe Freunde und schon seit Jahren in traulichem Verkehr.

In ihrem Äußeren stimmten diese Eingeborenen ganz mit denen vom Caprivi überein, ebenso hinsichtlich ihres Ausputzes. Cuscusfell (von einer Phalangista-Art) war häufig als Schmuck, für Glatzköpfe zuweilen auch als Kopfbedeckung verwendet. Außer den bekannten Haarkörbchen, die übrigens nur einzeln vorkamen, gab es noch eine andere besonders auffallende Kopfbedeckung, durch welche sich ein Mann auszeichnete. Er trug, wie die Abbildung zeigt, eine ca. 40 cm lange Röhre aus Pandanusblatt und ich freute mich, die Urform des Cylinders bei den Papuas entdeckt zu haben. In der That fehlt nur Deckel und Krämpe und die Angströhre ist fertig. Die Befestigung derselben geschieht mittelst Nadeln aus Vogelknochen, die in dem dichten Haarpelz sehr gut haften. Besondere Sorgfalt war auch auf Bartschmuck in Form von allerlei Breloques (wie S. 299) verwendet, und einzelne hätten sich damit bei uns für Geld sehen lassen können. So mein Freund Wulim, ein biederer Oberhäuptling, dessen sorgfältig mit kleinen Muscheln umwickelter, an der Spitze in Rohr eingeflochtener Zwickelbart eine Röhre von 35 cm Länge bildete. Der gute Alte schien meine Gedanken erraten zu haben, denn er erlaubte mir, die nicht wiederzuersetzende Körperzier abzuschneiden. So konnte ich, auch ohne Oberons Zauberhorn, einen Bart mit nach Hause nehmen, wie ihn der Kalif von Bagdad schwerlich besessen haben dürfte, und gleich mit Zähnen daran, freilich nicht die des Trägers, sondern Eberhauer, die auch hier als Schmuck sehr beliebt sind.
[S. 307] Unter Führung der Eingeborenen marschierten wir über schönes, fruchtbares Grasland nach ihren Niederlassungen, die an der Westseite von Gauß-Bucht liegen, da Dallmannhafen, mit Ausnahme von ein paar Häusern, unbewohnt ist. Unweit dieser Siedelungen in Gauß-Bucht mündet ein hübscher, leider unzugänglicher Fluß, der Herbert. Treffliche Kultivationen, in denen hauptsächlich Bananen und Tabak (Sagum) gezogen wurden, lehnten sich unmittelbar an das für papuanische Verhältnisse ebenso große als schöne Dorf Rabun oder Labuhn. Es zählte, von Bäumen und Kokospalmen beschattet, an 20 Häuser, solide und stattliche Bauten, denen nur Fenster fehlten, um gar manche viel armseligere Hütte daheim zu übertreffen. Einzelne dieser Pfahlhäuser (Rum) waren 40 bis 50 Fuß lang, 24 Fuß breit und bis unter die Giebelspitze an 20 Fuß hoch. Das Dach bestand aus Ried oder Gras, die Seitenwände aus sehr sauber befestigten, zuweilen rot und schwarz bemalten Blattscheiden der Nipa- oder Sagopalme, die Diele aus gespaltenen Latten von Betelpalmen. Charakteristisch für den hiesigen Baustil ist das Fehlen eines Vorplatzes oder einer Plattform, da die Treppe gleich unter der in eigentümlicher Weise verschiebbaren Thür liegt (vergl. Abbildung S. 308). Die im Inneren der Häuser herrschende Dunkelheit erlaubte erst allmählich Orientierung, ließ aber die gewöhnliche Einfachheit der Einrichtung erkennen: in der Mitte die Feuerstelle, aus einem mit Sand gefüllten Rahmen bestehend, an den Seiten Lagerstätten aus gespaltenem Bambu mit Kokosmatten belegt und Töpfe. Letztere stimmten in der Form (T. IV. 3, 4) mit denen von Bilibili überein und wie ich sie auch am Caprivi sah; es gab aber auch Töpfe von kolossaler Größe, die als Behälter für Sago dienten. Keramik schien auch hier eine Quelle des Wohlstandes und Reichtums, denn es gab Töpfe im Überfluß; so waren unter anderem auch besondere an Stricken befestigte Horden mit solchen versehen. Große Häuser enthielten zwei Abteilungen und werden, wie schon die doppelte Feuerstelle andeutete, wohl von mehr als einer Familie bewohnt. In einem Hause bemerkte ich eine roh geschnitzte Holzfigur, einen sogenannten Götzen, ähnlich den Telums von Astrolabe (T. XV. 1), aber ohne die für jenes Gebiet[S. 308] charakteristische langausgestreckte Zunge. Wenn auch Holzschnitzereien an den Häusern fehlten, so fanden sich doch andere Arbeiten, welche von der Geschicklichkeit der hiesigen Eingeborenen in diesem Genre zeugten. So die kolossalen trogförmigen Signaltrommeln, die, (wie auf der Abbildung), gewöhnlich vor den Häusern standen, also wohl nicht tabu sein mochten, sowie die Spitzen der[S. 309] Kanus. Einzelne waren in sehr naturgetreuen Figuren, Krokodil und Menschengesichter darstellend (wie T. VII. 4) ausgeschnitzt, und diese Verzierungen häufig sorgfältig eingepackt, um sie vor Bestoßen zu schützen. Auch sonst stimmten die Kanus in der Bauart mit denen am Caprivi überein. Als Mastschmuck dienten Bastbüschel und artig aus Pflanzenfaser geflochtene Ketten; als Segel war, wie auch anderwärts, der zeugartige Bast von der Basis der Blattscheide des Kokosblattes verwendet. Waffen irgend welcher Art kamen mir nicht zu Gesicht, werden aber ohne Zweifel nicht fehlen. Von Musikinstrumenten sah ich Holztrommeln in der gewöhnlichen sanduhrartigen Form (ähnlich T. XIII. 2), mit Eidechsenhaut (von Monitor) überzogen.

Bei unserer Ankunft flüchteten die Weiber und Kinder eiligst in die Häuser, deren Thüren zugeschoben, aber gar bald wieder etwas geöffnet wurden, denn die so berechtigte Neugier, welche dem ganzen Menschengeschlecht eigen ist, überwand auch hier die Furcht, und nach und nach kamen, aufgemuntert durch die Männer, die Schönen zum Vorschein. In der That gab es sehr hübsche Gestalten von tadellosen Formen unter diesen braunen Mädchen, die in ihren bunten Faserschürzchen (T. XVI. 9) gar niedlich aussahen. Sie trugen das Haar meist kurz geschoren, in Form runder Pelzkäppchen, Frauen durch schwarze Farbe verschmierte Zotteln, ähnlich wie in Astrolabe-Bai (S. 40). Kleinen Kindern von drei bis fünf Jahren war der Kopf meist rasiert, bis auf eine Skalplocke zur Befestigung von Schmuck aus Muschelringen und dergleichen.
Außer den vorherbeschriebenen Häusern entdeckte ich übrigens noch zwei besondere, von ganz eigentümlicher Form, wie sie mir in Neu-Guinea sonst nirgends vorkamen. Sie waren lang und schmal mit schüsselförmigem Dach, standen auf niedrigen Pfählen (vergl. Abbild. S. 310), und hatten an jeder Seite eine Thür mit spitzwinkeligem Vorplatz, den vom Dachrande herabhängende, lange Blattfasern wie mit einer Portière verhüllten. Aus Rücksicht für die Eingeborenen, die sich sehr ängstlich zeigten, und deren Geduld ich ohnehin schon genug auf die Probe gestellt hatte, ließ ich das Innere[S. 310] unbetreten. Der Zweck dieser Gebäude blieb daher unaufgeklärt, aber ich werde wohl nicht irren, wenn ich sie für jene Versammlungs-, Junggesellen- oder Tabuhäuser halte, wie sie sich in verschiedenen Formen allenthalben in Melanesien finden.
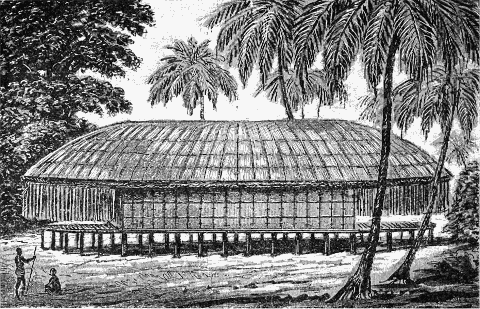
Die Höflichkeit der hiesigen »Wilden« übertraf übrigens alle bisher erfahrene und jedenfalls die meinige in der Erwiderung. Man würde es bei uns und mit Recht als Zeichen geringer Achtung und Bildung auslegen, wenn ein Gast den angewiesenen Ehrenplatz (hier ein mit weißem Sand bestreuter Platz vor dem Hause) und die angebotenen Erfrischungen (hier Betel, »Bu« und Naturzigaretten) zurückweist, wie ich es that. Aber es gab soviel zu sehen und aufzuzeichnen, daß ich im Interesse der Wissenschaft selbst gegen die bei Papuas herrschende Etikette verstoßen mußte. Die guten Leute mochten von dem ersten Weißen, der ruhelos umherlief, überall unverständliche Zeichen aufkritzelnd, wohl einen sonderbaren Begriff bekommen und ich würde es ihnen nicht übel nehmen, wenn sie mich für übergeschnappt gehalten hätten. Sie[S. 311] zeigten sich aber über mein Gebaren nicht unwillig, ja ihre Höflichkeit steigerte sich bis zur Gastfreundschaft, eine bisher von mir bei Kanakern niemals beobachtete Tugend. Die Pantomime des Kauens ließ im Verein mit behaglichem Klopfen und Streicheln der Magengegend keinen Zweifel, daß ein Festschmaus geplant wurde. Am Ende sollten wir als Schlachtopfer dafür dienen, wird vielleicht mancher denken, der da meint, Kannibalen machten allemal ähnliche Zeichen, ehe sie ihre Beute abmurksen! Ach, nein! das thun sie niemals; die braven Rabuniten waren überdies keine Kannibalen, und wenn sie auch solche gewesen wären, so würde uns dies wenig geniert und das Gefühl der Sicherheit nicht im mindesten alteriert haben. Zum großen Leidwesen der Bewohner schieden wir von dem freundlichen Rabun, und wenn wir auch für diesmal der zugedachten gastronomischen Prüfung entgingen, so ereilte uns doch das Schicksal im nächsten Dorfe. Hier wurden wir förmlich überrumpelt und mußten wohl oder übel an dem bereits servierten Festmahle teilnehmen. Ich gebe hier das Menu. Erster Gang: rötliche Sagoklöße (zähkleistrig, unkaubar, daher nach Angabe der Eingeborenen nur ganz zu verschlingen, was uns nicht gelang); zweiter Gang: kleine sprottenartige Fische mit den Eingeweiden geröstet (nicht übel); dritter Gang: gekochte Tiere einer kleinen Muschel (Neritina), mit den Zinken der Haarkämme aus der Schale gezogen (indifferent), dazu als Konfekt eßbare Erde, als Getränk Wasser und frische Kokosnußmilch. Das war freilich keine Bremer Schaffermahlzeit, aber das Hauptstück der Tafel, ein in der Erde zwischen heißen Steinen gedünstetes Schwein (Bohr), sollte ja erst zubereitet werden. Aber wir hatten keine Zeit darauf zu warten, obwohl uns damit ein Genuß entging. Denn ich darf versichern, daß in dieser Manier gar gemachtes Fleisch nicht zu verachten ist und getrost auf unserer Tafel erscheinen dürfte, wenn nicht das für uns unentbehrliche Salz fehlte. Mit Kokosnüssen beladene Eingeborene geleiteten uns, diesmals längs dem Strande, der meist aus Korallen besteht, wovon wir auch ausgedehnte Riffe in Gaußbucht beobachteten, die sich deshalb als Ankerplatz kaum eignen dürfte. Als wir bei unserem Boot anlangten, packten es unsere[S. 312] Freunde fast voll mit Kokosnüssen, was uns auch noch niemals passiert war. Erst jetzt verteilte ich die Gegengeschenke, und erwähne dies deshalb, weil dadurch erst die lobenswerte Uneigennützigkeit der Eingeborenen im rechten Lichte erscheint. Daß uns die guten Leute auch an Bord folgten, ist wohl selbstverständlich. Sie waren inzwischen klüger geworden und brachten allerlei zum Tausch, darunter neue und interessante Gegenstände. So groteske, buntbemalte, aus Holz geschnitzte Masken, mit meist kolossalen, oft vogelschnabelartigen Nasen, häufig mit Bart aus wirklichem Menschenhaar besetzt, wovon Taf. XIV (1, 2) gute Stücke repräsentiert, und kleine Holzgötzen (T. XV. 4, 5, 6). Sie stellen männliche wie weibliche Nachbildungen von Eingeborenen dar, öfters mit Haarkörbchen, zuweilen sogar mit Gesichtsmasken ausgeschnitten und sind jedenfalls keine Idole, wie jeder Missionär deuten würde, sondern mehr als Talismane zu betrachten. Die Leute gaben sie ohne Zögern her und hatten solche sogenannte Götzen nicht selten, wie Miniaturmasken (vergl. T. XIV. 3) als Zierat an ihren Brustbeuteln befestigt. Neu waren auch eigentümliche Kopfruhebänkchen, sogenannte Kopfkissen, aus Holz mit Schnitzerei und Beinen aus Bambu.
Um mich für die freundliche Aufnahme an Land zu revanchieren, versuchte ich die Eingeborenen mit allerlei Erzeugnissen der Civilisation bekannt zu machen. Außer Zigarrenstummeln ließen Genußmittel ziemlich teilnahmslos. Wie gewöhnlich wurde aus Höflichkeit von dem und jenem gekostet, ohne jedoch an den Speisen Geschmack zu finden, ganz so wie es uns im entgegengesetzten Falle geht; aber die Leute gaben zu verstehen, daß Zucker mit Zuckerrohr identisch sein müsse. Mehr Interesse erregten Nützlichkeitsgegenstände, und ich hatte auch hier wieder Gelegenheit, die individuell verschiedene Auffassung zu beobachten. Das Ticken einer Taschenuhr ruft meist freudiges Erstaunen, wie bei Kindern, aber auch nicht selten Schreck hervor, ganz so wie dies mit der Musik einer Spieluhr der Fall ist. Aber die fröhlichen Weisen, welche ich auf einer Mundharmonika vorspielte, fanden überall Beifall und erregten die Bewunderung der Eingeborenen. Streichhölzer versetzen immer in Erstaunen, dagegen[S. 313] May'sche Streichwachslichte (Vestas) meist in Furcht, weil sie beim Entzünden knallen. Spiegel, und zwar jene runden Taschenspiegel in Blech- oder Zinnfassung, wie sie hauptsächlich üblich im Tausch, werden sehr verschieden beurteilt. Manchmal machen sie viel Spaß, häufig aber werden sie nur für eine glänzende Zierat, Brust- oder Stirnschmuck, gehalten. Denn der Naturmensch muß ja erst lernen sein Abbild im Spiegel zu erkennen, den er gewöhnlich so nahe oder so entfernt hält, daß dies nicht möglich ist. Dasselbe gilt bezüglich des Sehens durch einen Feldstecher, dessen Gebrauch noch mehr Unterricht erfordert. Einen viel größeren Eindruck machen Brenngläser; aber auch bei diesen weiß der Eingeborene den Brennpunkt nicht leicht zu finden und sie machen nur Mühe, denn jeder will das Brennen auf seiner Hand fühlen. Zur Belohnung gab ich den Rabuniten noch eine Extravorstellung meiner Spielsachen zum besten, wie ich zuweilen bei besserer Bekanntschaft mit Eingeborenen zu thun pflegte. Kinderspielzeug, Tiere aus Guttapercha, deren Quitschtöne zuweilen Krieger erschreckt über die Reiling jagten, fanden hier wenig Anklang, ebenso erging es dem Kaleidoskop. Dagegen machte ein Kreisel mit Musik viel Spaß, der sich, wie überall, unendlich steigerte, als ich eine schöne, gut angekleidete Mädchenpuppe mit Haar zeigte. Und nun gar erst die Freude über das Gegenstück dieser Europäerin, eine niedliche kleine Negresse, mit Wollkopf, rotem Röckchen und Perlhalsband! Eine Diva bei uns kann nicht mehr applaudiert werden, als diese Puppe hier; jeder wollte sie besitzen und würde alles dafür gegeben haben. Nicht wahr? Die Wünsche dieser »Wilden« sind oft unberechenbar. Wie bei allen Vorstellungen hatte ich das Glanzstück zum Schluß vorbehalten, und zwar die Elektrisiermaschine. Sie bildete wie überall, wo ich Eingeborene mit ihr bekannt machte, auch hier den Knalleffekt und ihre Wirkung äußerte sich in derselben Weise. Die Leute wollten schier vor Lachen zerbersten, wenn der erste Kühne, welcher die Metallkolben in den Händen hielt, sprachlos vor Überraschung anfing, allerhand Grimassen zu schneiden und Sprünge zu machen. Aber kaum hatte ich den ersten erlöst, so nahm ein zweiter seine Stelle ein, unerwartet, aber[S. 314] doch erklärlich. Denn auch diese Naturkinder machten es ganz so wie es in ähnlichen Fällen bei uns zu geschehen pflegt. Nämlich, jeder sagte dem anderen, daß die Sache sehr schön sei, und so fielen am Ende alle der allgemeinen Heiterkeit zum Opfer.
Die Freude der Eingeborenen verwandelte sich übrigens in Leid, als am anderen Morgen (12. Mai) Vorbereitungen zur Weiterreise getroffen wurden. Die guten Leute schienen uns bereits als die Ihrigen zu betrachten und erwarteten alles Ernstes, daß wir uns dauernd bei ihnen niederlassen würden. Ja, ich hätte hier ein Glück machen können, wie es mir nie in meinem Leben angeboten war, noch je wieder angeboten werden wird! Ich sollte Kokospalmen und Schweine, Haus, Hof und Land und, als ich alles dies zurückwies, sogar ein Mädchen erhalten. Da die Ablehnung desselben die Leute vermutlich glauben ließ, daß mir eine Frau zu wenig sei, wurde gleich eine zweite bewilligt, denn man versuchte alles, um mich festzuhalten. Ja, ich brauchte nur zuzugreifen, um Schwiegersohn der angesehensten Häuptlinge und selbst »Negerfürst« zu werden. Aber die Wichtigkeit der weiteren Küstenforschung ließ mich auf alle diese herrlichen Aussichten verzichten, ein Verzicht, den die Eingeborenen gewiß nicht als Klugheit deuteten.
Es kostete übrigens Mühe, die Honoratioren von Rabun von Bord zu bringen, denn einige wollten partout mit, immer noch in der Hoffnung, daß wir uns anders besinnen würden. Wir dampften langsam durch Dallmannstraße, an Gressien-Insel, Muschu der Eingeborenen, vorbei, hinter der sich Kairu (d'Urville-Insel) erhebt, mit einem ansehnlichen Bergrücken, ohne besonders markierte Kuppen. Kairu ist an acht Meilen lang und sehr fruchtbar. Muschu mit sanften, grünen Grasflächen scheint für Viehzucht wie geschaffen. Es besitzt an der Westseite drei kleine Dörfer, deren Bewohner sich sehr im Gegensatz zu den Rabuniten scheu versteckten. Aber hinter »Pomone-Point« (von d'Urville), einer sanften, mit Kasuarinen bestandenen Huk der Festlandsküste, die hier aus Vorland mit ca. drei kleinen Siedelungen besteht, kamen Eingeborene in Kanus ab, um uns einzuholen. Mit der Ausdauer der Rabunleute würden sie uns erreicht haben, denn[S. 315] bald darauf nötigten Regen und dickes Wetter zu ankern. Dies geschah in Dallmannstraße unweit der kleinen Guap-Insel, die ca. eine Meile östlich vor dem etwas größeren Pâris (von d'Urville), Aursau oder Aarschau der Eingeborenen, liegt. Guap ist kaum zwei Meilen lang, niedrig, dicht bewaldet, besitzt sehr viel Kokospalmen und muß sehr stark bevölkert sein, denn ich zählte nicht weniger als 37 Kanus am Sandstrande der Südseite, der wir gegenüber lagen. Derartige Inseln, nahe der Küste, bilden häufig Bevölkerungscentren, weil sie ihren Bewohnern größere Sicherheit gegen Überfälle bieten und somit eine ruhigere und gedeihlichere Entwickelung ermöglichen. Nicht selten benutzen so günstig situierte Insulaner aber auch ihre Überlegenheit, um an der Küste Raubzüge auszuführen. Allem Anscheine nach waren die Guapiten, welche uns bald in ihren Kanus umringten, gut situierte Leute. Daß sie keinen Mangel litten, ging schon aus der Unmasse Yams hervor, den sie körbeweis zum Ankauf anboten. Da Guap für einen solchen Reichtum viel zu klein ist, so gehören die schönen Plantagen, die wir an der Südseite von Kairu (d'Urville-Insel) erblickten, vermutlich diesen Insulanern. Sie verlangten aber nichts als »Pore«, Eisen, das sie übrigens nur in Form von Bandeisen zu kennen schienen, denn sie machten sich nichts aus Äxten. Da konnte geholfen werden, denn Meister Nielsen, der Maschinist, schlug alte Kistenreifen in Stücke, die weggingen wie warme Semmeln. Da derartiges Bandeisen sehr dünn ist, so müssen die Stücke so kurz sein, daß man sie nicht mit den Fingern biegen kann. Denn jedes Stück wird von den Eingeborenen sorgfältig geprüft und wenn biegbar, zurückgegeben. Ich bemerkte übrigens einen Steinaxtstiel, der mit einem Stück Eisen montiert war. Es schien ein altmodischer Meißel, vielleicht noch aus der Zeit der ersten Seefahrer, aber sein Besitzer gab das Stück für kein Beil her, weil er ein solches eben nicht kannte. Gar gern hätte ich dieses Bastardgerät der Stein- und Eisenzeit erstanden, aber ich durfte mit den unverfälschten Steinäxten schon zufrieden sein. Die Eingeborenen besaßen davon schöne Exemplare in eigentümlicher Holzfassung (wie T. I, 7), mit rechtstehender Steinklinge (wie um Ostkap), aber auch solche mit querstehender[S. 316] Muschelklinge. Hölzerne Masken und sogenannte Götzen, öfters zu mehreren zusammengebündelt, wurden ebenso häufig als in Dallmannhafen zum Kauf angeboten.
Diese Figuren enden zuweilen in eine lange Spitze (wie T. XV. 7), um mit derselben in die Erde gesteckt zu werden, da sie zum Teil als Talismane für gute Ernten dienen. Auch aus Holz geschnitzte, buntbemalte Tierfiguren, z. B. sehr erkennbare Eidechsen (Monitor), sowie eine neue Form Holzschüsseln, mit Schnitzerei, darunter unter anderem die Darstellung eines fliegenden Hundes, erhielt ich, ebenso breite Schildpattarmbänder mit Gravierung, die weiter westlich nicht mehr vorzukommen scheinen. Ein besonders feines Stück, aus einer 32 cm langen und 15 cm breiten Platte gebogen, ist im Atlas (Taf. XIX. 1) abgebildet. Wie hier östliche ethnologische Formen ihr Ende zu erreichen scheinen, so trafen wir hier zuerst charakteristische westliche. So unter anderm Brustkampfschmuck in Form eines breiten herzförmigen Schildes aus Eberhauern mit roten Abrusbohnen (wie T. XXIII. 2) und eine andere sehr merkwürdige Art aus Eberhauern und Ovulamuscheln. An Federschmuck kamen Paradiesvögel, sowie die schönen roten Federn des Borstenkopfpapageis (Dasyptilus Pequeti) vor. Im übrigen zeigte Ausputz wie Bekleidung der Leute nichts Besonderes. Als letztere diente ein zuweilen buntbemalter Streif Tapa, in der gewöhnlichen Weise um die Hüften geschlagen. Haarkörbchen sah ich nicht mehr, sie mögen aber vorkommen. Man trug das zu einem dichtverfilzten Zopfansatz verlängerte Kopfhaar mit Binden aus Pandanusblatt umwickelt oder die bereits bekannten Angströhren, die hier (wie auf Muschu) ihre eigentliche Heimat zu haben scheinen. An Bartschmuck in der vorher beschriebenen Weise (S. 299), fehlte es auch nicht, wie die nachfolgende Abbildung (S. 317) zeigt.

Der Korb ist diesem Manne aber nur aus Versehen des Zeichners in die Hand geraten, denn er stammt von Venushuk (vergl. S. 293). Dagegen zeigt der reich mit Platten aus Cymbiummuschel verzierte Brustbeutel die übliche Form. Die hiesigen Eingeborenen excellieren in der Anfertigung solcher Beutel, die aus feinem, sehr haltbarem[S. 317] Bindfaden, teils in weitmaschiger Filetmanier, teils ganz dicht geknüpft, zuweilen wahre Muster zierlicher und geschmackvoller Arbeit sind. Sie haben natürlich sehr verschiedene Größe (bis 50 cm breit und 30 hoch) und zeigen für gewöhnlich einfache, bunte Muster (in Kirschbraun, Braun, Schwarz, Blaugrau). Häufig werden aber artige Muster aus kleinen Muscheln (Nassa) oder aus ganzen und halb durchschnittenen Samenkernen (Coix lacrymae) gleich mit dem Bindfadenmaterial eingeknüpft (vergl. T. X. 4). Der äußere Ausputz dieser Brustbeutel, die nur den Schmuck des Mannes bilden, ist zuweilen sehr mannigfach. Ich gebe hier ein Verzeichnis solcher Papua-Breloques: Troddeln aus Bindfaden, Klingel aus einer Muschel (Cypraea lynx) als Klöpfel ein Stückchen Koralle, Platten von Placuna- und Cymbium-Muscheln, letztere zuweilen mit aufgelegter durchbrochener Schnitzerei aus Kokosschale, bearbeitete Stücke Schildpatt, kleine Holzfiguren (wie XV, 5) und Amuletmasken (T. XIV. 4), Kalebasse zu Kalk, Bambumesser, Nasenschmuck aus Perlmutter (wie XX. 5) oder Eberhauern (XX. 8), feine, aus Gras geflochtene Kettchen, mit Anhang von schwarzen Fruchtkernen und Papageifedern, Streifen Cuscusfell, und als Talismane: Stückchen Massoirinde[76], Ingwer oder Pflanzenbüschel. Da der[S. 318] Papua in einem solchen Beutel seine notwendigsten Habseligkeiten und Requisiten bei sich trägt, so werden wir dieselben am besten aus dem Inhalt kennen lernen, der sehr verschiedenartige Sächelchen entwickelt. An nützlichen Gegenständen: Löffel aus Kokos, Schaber aus Perlschale (V, 8), Muschelschalen (Batissa) zum Schneiden, Brecher aus Knochen (V. 7), Raspel aus Rochenhaut, Feile aus Koralle, Nadel aus einem durchbohrten Fischknochen, Bogensehne von Rotang, Ring zur Befestigung derselben, etwas Bindfaden; an Geld: aufgereihte Hundezähne und Nassa-Muscheln, an Zieraten: Nasenschmuck (wie vorher), rote und gelbe Erde zum Bemalen; an Genußmitteln: Betelnüsse, dazu Kalk und Pfefferblätter, Tabak in Blättern, dazu Baumblätter als Umlage für Zigaretten, eßbare Erde; an Talismanen: kleine Holzfigur (wie vorher), runde Kiesel (meist aus dem Magen der Kronentaube, Goura, und Jägerzeichen), Massoirinde und Ingwer. Nicht wahr? Der Mensch der Steinzeit hat bereits eine Menge Bedürfnisse und weiß Naturprodukte auszunutzen, die dem Kulturmenschen als wertlos erscheinen. Ich vergaß noch einen seltenen Fund anzuführen, den ich später in einem der Brustbeutel von Guap machte, nämlich, sorgfältig in ein Blatt gebunden: acht kleine rote Glasperlen! Dies verwunderte mich umsomehr, als die Eingeborenen Glasperlen gar nicht zu kennen schienen. Nicht unwahrscheinlich ist es, daß dieses europäische Erzeugnis von der benachbarten d'Urville-Insel herstammte, wo Sir Edward Belcher (im Juli 1840) mit dem »Sulphur« den schönen Victoriahafen auffand und aufnahm.
Die Guapiten waren übrigens ruhige und manierliche Leute, mit denen sich gut schachern ließ, Stück um Stück, Hand um Hand, aber »schenken« kannten sie nicht. Die Unmassen Waffen, welche sie mit sich führten, zeigten ihre Wehrhaftigkeit und Kampfbereitschaft. Ich erhielt hier flache lattenförmige Keulen (ganz wie die von Astrolabe), Bogen, schöne Pfeile mit fein geschnitzten Holzspitzen und Kerbzähnen, zum Teil mit aufgeklebten Federn und Coixkernen, und lange (2,80 m) Wurfspeere aus Palmholz, in der Mitte mit eigentümlichem Ansatz, der wahrscheinlich zum Schleudern dient. Schwere[S. 319] über drei Meter lange, mit Kasuarfedern reich verzierte Lanzen schienen Häuptlingsattribute. Die kleine Silhouette auf Tafel VIII, 10 zeigt einen derartig distinguierten Würdenträger auf seinem Kanu aus der Ferne gesehen. Diese Kanus haben in der Mitte einen tischartigen Aufbau zum Teil mit Schnitzarbeit, ganz wie die am Caprivifluß, und sind wie jene so schmal, daß die Ruderer nicht beide Füße nebeneinander stellen können. Selbstverständlich besitzen auch diese Kanus einen Ausleger, aber ich beobachtete keine mit Segel.
Aus den fremdartigen Stimmlauten um uns her, tönte plötzlich ein bekanntes Wort: »Doktor! Doktor!« Erst glaubte ich mich verhört zu haben, aber nein, es war keine Täuschung. »Also auch hier schon bekannt«! dachte ich und sah mich nach den Rufern um, drei Eingeborenen, die in ihrem Kanu längsseit lagen und sogleich an Bord zu klettern versuchten. Als ich sanft abwehrte, schienen die Leute nicht wenig bestürzt, und aus ihren vorwurfsvollen Blicken ließ sich der Sinn ihrer Rede erraten. »Nette Menschen, diese Weißen! Gestern ließen sie sich bei uns noch abfüttern, und heut will uns der Doktor schon nicht mehr kennen!« so ungefähr mochten sie sagen und hatten recht. Aber Eingeborene sehen einander meist verzweifelt ähnlich, und so war es verzeihlich, wenn ich unsere Freunde von gestern nicht gleich wieder erkannte. Ich suchte meinen Fehler gut zu machen, denn die Anhänglichkeit dieser Leute, uns trotz des Regenwetters, das Kanaker gar nicht lieben, zu folgen, verdiente Belohnung. Freilich machten mir die treuen Seelen von Rabun wieder neue Mühe, denn sie kamen wieder mit der alten Geschichte: Schweine, Haus, Mädchen etc., und als wir am andern Morgen (13. Mai) abdampften, gab es nur eine Wiederholung der Abschiedsscene. Ich atmete daher auf, als die Versucher endlich betrübt in ihr Kanu kletterten und wegpaddelten, denn der Verkehr mit Eingeborenen ist gar anstrengend.
Der starke westliche Strom, welcher auffallender Weise am Nachmittag (4 Uhr) des vorhergehenden Tages nach Ost umsetzte, führte uns ohne Dampf durch Dallmannstraße. Wir passierten Aarsau (Pâris), eine niedrige, dichtbewaldete Insel, ohne Kokospalmen, die wenig[S. 320] bewohnt scheint, gleich dahinter das kleine unbewohnte Unei und sahen in Nordwest die von d'Urville, Guilbert und Bertrand benannten Inseln vor uns, welche dichtbewaldeten Atollen ähneln. Da die Hansemannküste mit Pomone-Huk endet, so wurde die weitere Fortsetzung derselben westlich bis zum 141 Grade von Kapitän Dallmann als Finschküste unterschieden. Sie zeigt von Pomone-Huk an unausgesetzt dicht mit Laubwald bedeckte, hie und da von Grasflächen unterbrochene Hügelketten, dahinter höhere Bergreihen (600 bis 1000 Fuß hoch) und scheint wenig bevölkert. Nur an einem Flusse (Virchow) circa fünf Meilen West von Aarsau bemerkten wir zwei Dörfer. Aber weiterhin zwischen Sapa Point (von d'Urville) und einer neuen Huk (Guido Cora[77]), die beide nur sanft vorspringende, steile Uferhügel sind, zählte ich acht Küstendörfer (von je 12 bis 20 Häusern) hintereinander, ohne jedoch Menschen und Kanus bei denselben wahrzunehmen. Das war mir lieb, denn wir entgingen dadurch Aufenthalt, der bei unserem Kohlenvorrat ohnehin mehr als mir lieb war, beschränkt werden mußte. Aber hätten wir bei jedem Küstendorf halten wollen, dann wären wir wohl nie nach Humboldt-Bai und zurück gekommen. Trüb lichtgrün gefärbtes Wasser zeigte, wie dies fast stets der Fall war, daß wir uns wieder Mündungen von Flüssen näherten. Auf einen kleineren (Petermann) Fluß folgte ein größerer (Kaskade), der wie über ein Wehr ins Meer fällt und von dem der nahe Behmfluß vielleicht nur ein Arm ist. Am Kaskadefluß zeigten sich zwei bis drei kleine Siedelungen, wie stets, mit den entsprechenden Hainen der Kokospalme.
Aber nur ein Kanu wagte abzukommen und verschaffte uns eins jener gemütlichen Zusammentreffen, in welchen man das Wesen unberührter Naturmenschen in voller Ursprünglichkeit und Harmlosigkeit am besten kennen lernt. Das Kanu brachte nämlich nur einen[S. 321] alten Mann mit zwei hübschen Knaben, von etwa zehn und acht Jahren, wie sich später herausstellte, seine beiden Söhne, Amus und Mambas, aus dem Dorfe Wanua. Papa Malgari war in vorgeschrittenen Jahren, durch Pockennarben entstellt, trug Vollbart, einen kurzen Zopf, sonst nichts als den üblichen Tapalendenstreif und eine Eulenfeder im Haar. Desto feiner waren aber von Mama die beiden Sprossen für den Besuch bei den unbekannten Gästen herausgeputzt, wozu sie wahrscheinlich eigenen Schmuck hergeliehen. So die schönen Halsketten aus Nassa mit Muschelring (T. XXI 5), und die großen Schildpattohrringe, ebenfalls mit Muschelplatte aus Conus, während der Knochendolch, welcher im Grasarmbande des älteren Amus steckte, wohl Papa gehören mochte. Amus war bereits mit dem Tapastreif bekleidet, sein Bruder ohne einen solchen, aber beide trugen kreuzweis über die Brust schmale zierlich geflochtene Bänder, mit kleinen Samenkernen wie mit Perlen besetzt. Das Haar der Knaben war mit Ausnahme zweier Wirbelzöpfchen kurz gehalten. In den durchbohrten Nasenflügeln steckten Holzstiftchen, bei dem jüngeren Bruder sogar ein solches in der Nasenspitze, denn schon gar früh muß sich der junge »Wilde« dem eisernen Zwange der Mode unterwerfen. Ich forderte die guten Leutchen auf, an Bord zu kommen und Papa Malgari hatte nach einigem Zögern auch Lust dazu, wurde aber von seinen Söhnen zurückgehalten. Sie sprachen wahrscheinlich davon, daß Mama dies ausdrücklich verboten habe, daß ihm was geschehen könne, kurzum tyrannisierten ihren Vater förmlich, wie sich dies Kanakerväter von ihren Kindern gern gefallen lassen. Ich hielt den obstinaten Knaben eine Standrede; gleich drehten sie mir, mit wütenden Blicken, den Rücken zu, als wollten sie sagen: »Du hast hier gar nichts dreinzureden! das ist unser Vater, und wir wissen am besten, was ihm gut ist.« Endlich überwand die Neugierde alle Bedenken, und trotz der Lamentation seiner Söhne kam der Alte an Bord, sogar in die Kajüte. Ja! da gab es was zu sehen und der Zeigefinger, als Zeichen des Erstaunens, kam gar nicht mehr zwischen den Zähnen hervor. Und nun vollends gar, als ich dem Alten einen Spiegel schenkte und unter entsprechender Belehrung,[S. 322] eins jener Rasiermesser, die samt Etui in Sydney 40 Pfennige kosten! Seine Augen glänzten vor Freude; aber ich fürchte, die Silberstahlklinge wird gegen den struppigen Bart, der bisher nicht einmal einen Kamm kennen lernte, wenig ausgerichtet haben. Voll Freude eilte Papa an die Reiling, um seinen Sprossen von all den Herrlichkeiten und Wundern zu erzählen, wurde aber nur angeschnauzt. Denn alle Überredung schien den beiden Trotzköpfen gegenüber vergeblich, bis ich mich ins Mittel legte. Man wird vielleicht denken, mit Anranzen! I Gott bewahre! das hilft bei Kanakerknaben am allerwenigsten, aber ein kleines unansehnliches Instrument, eine Mundharmonika, wirkte dieses Wunder. Bei ihren Tönen wandten sich die verbissenen Gesichter um, erst unwillig und finster dreinschauend, nach und nach freundlicher, belebter, und als ich sie jetzt mit lächelnder Miene einlud, da konnten sie nicht länger widerstehen.
Musik, diese Gabe des Himmels, auch von den Metallzünglein einer Mundharmonika, hatte den Sieg errungen, um diese kleinen »Wilden« zu bändigen. In stummer Verwunderung betrachteten sie alles; als ich aber jedem ein Lendentuch von türkisch Rot umgebunden und ein Beil in die Hand gegeben hatte, da hielt es sie nicht länger, sie eilten, gefolgt vom Vater, ins Kanu und paddelten heimwärts, wahrscheinlich aus Besorgnis, die Schätze könnten ihnen nur zum Spaß gegeben sein und wieder abgenommen werden. Ich aber freute mich, glückliche Menschen gemacht und mit zwei Eisenbeilen im Wert von zusammen M. 1,20 die Zukunft zweier hoffnungsvoller Knaben der Steinzeit begründet zu haben.
Etwas westlich vom Kaskadefluß werden die Berge höher und entsenden mehrere Flüsse (Breusing, Lindeman, Albrecht), die in dichtbewaldetem Vorlande münden, das in einer Länge von kaum acht Meilen ebensoviel, zum Teil große Siedelungen (bis zu 20 Häusern) zählt. Bei der westlichsten, Tagai, wurde, nicht weit vom Albrechtflusse, geankert. Es ist dies ein ansehnliches Gebirgswasser, mit viel Kasuarinen an den Ufern, das zur Anlage von Sägemühlen wie geschaffen scheint, besonders deshalb, weil sich hier bedeutende Bestände[S. 323] prächtiger Hochbäume finden, wie wir sie bisher in Neu-Guinea nicht gesehen hatten.
Kaum war der Anker gefallen, so kamen die Eingeborenen ab in Kanus und sonderbaren Wasserkutschen, deren eigentliche Beschaffenheit sich von weitem nicht recht ausmachen ließ. Es schien, als sitze eine dunkle Gestalt im Wasser, bald bis an die Brust untertauchend, bald wieder auftauchend, aber stetig näher kommend. Da löste sich denn endlich das Rätsel und das Gefährt entpuppte sich, wie die Abbildung zeigt, als eins der denkbar einfachsten.
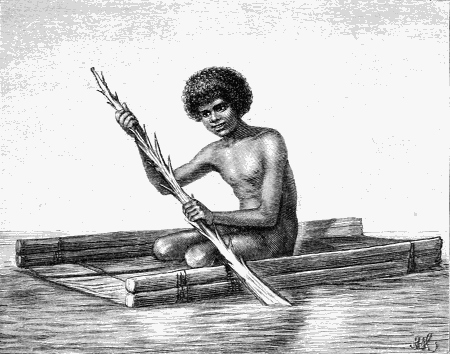
Es bestand nämlich nur aus zusammengebundenen Palmblattstielen, auf denen sich je ein Knabe oder junger Bursche anderthalb Meilen weit in See wagte, nur um das dampfende Ungetüm zu sehen. Sachen irgend welcher Art ließen sich auf einem solchen Floß freilich nicht mitbringen, denn es ging mehr unter als über dem Wasser und schien höchstens für Schiffbrüchige empfehlenswert.[S. 324] Als Paddel diente ebenfalls ein Palmblattstiel. Die Kanus erwiesen sich übrigens als trefflich gebaute Fahrzeuge von eigentümlicher neuer Konstruktion. Sie hatten Seitenborde und zeichneten sich vorder- und hinterteils durch einen oft mit Schnitzerei verzierten Schnabelaufsatz (T. VII 3), einen gewaltigen Plattformaufbau (VI 2) und zwei sehr lange Querträger des Auslegergestelles aus. An jeder Seite der Plattform war ein hoher, schmaler Kasten aus Gitterwerk angebracht, der zugleich als Sitz diente, im Kriege aber eine gute Brustwehr abgeben mag. Einzelne Kanus waren sehr groß, an 30 bis 40 Fuß lang, und trugen etliche zwanzig Personen, wovon 14 allein auf der Plattform Platz fanden. Solche Fahrzeuge mit Mast und Segel schienen zugleich Kriegskanus in voller Ausrüstung, denn die Seitenkasten der Plattform waren mit Waffen gefüllt. Letztere bestanden fast nur in Bogen und Pfeilen, aber so schönen, sauber gearbeiteten und reich verzierten, wie ich sie in ähnlicher Weise sonst nirgends in Neu-Guinea traf. Die Pfeile (60 cm lang), wie gewöhnlich aus Rohr, mit äußerst kunstvollen, zum Teil durchbrochen gearbeiteten Spitzen aus Holz oder Bambu, zeichneten sich durch einen feingeflochtenen Knauf aus, der mit aufgeklebten Federn und Coixkernen verziert war, ähnlich wie auf Guap. In vollem Einklange mit den Pfeilen standen die (1,70 Meter) langen Bogen, aus Holz der Betelpalme, mit Sehne von Rotang, die durch einen zierlich geflochtenen Knauf festgehalten wird. Sie sind mit fein eingraviertem Muster ornamentiert und haben Troddeln von dünnem Bindfadengeflecht mit daran befestigtem Federschmuck. In dem letzteren spielen Papageienfedern (Haubenfedern von Kakadus, Eclectus, zuweilen Köpfe der letzteren, wie von Lorius) die Hauptrolle, und darunter wiederum die prachtvollen, rot und schwarzen Federn von Dasyptilus Pequeti. Dieser sonst so seltene Papagei muß hier herum häufig vorkommen, denn seine Federn waren auch in Kopfputzen am meisten vertreten, außerdem die gelben Seitenbüschel vom Paradiesvogel. Von letzteren wurden auch Bälge, für die öfters lange Bamburöhre als Behälter dienten, von den Eingeborenen in größerer Anzahl als irgendwo vorher zum Tausch angeboten. Die Art ist der[S. 325] Paradisea minor aus West-Neu-Guinea nahe stehend, fiel mir aber gleich durch ihre Kleinheit auf und erwies sich später in der That als neu Paradisea Finschii. Wie geschickt Eingeborene allerlei Naturprodukte zu benutzen wissen, zeigte sich wiederum an diesen Vogelbälgen, die ohne eiserne Messer präpariert, natürlich sehr zerfetzt waren. Man hatte die Häute über eine Art Pflanzenmark gespannt und mit sehr spitzen Nadeln festgesteckt, die sich als Stacheln eines Landschnabeltieres (Echidna) erwiesen. Von anderen Paradiesvögeln sah ich hier zum erstenmale Federn des seltenen Xanthomelus aureus.
An sonstigem Schmuck und Zierat besaßen die Tagaiten im ganzen nicht viel: Halsketten aus Nassa mit Conusscheiben, schöne Brustringe aus Tridacna, Brustschilde aus Eberhauern (wie XXIII. 2), schmale Schildpattreifen mit Schnüren von Coix als Ohrringe und eigentümlichen Nasenschmuck aus Perlmutter (T. XX. 6). Haarkörbchen kamen hier nur vereinzelt vor, zuweilen mit einem Kranz aus Kasuarfedern verziert, aber im Haarwuchs selbst wurde Erstaunliches geleistet. Einzelne Männer schienen eine Alongeperücke aus der Zeit Louis XIII. zu tragen; es war aber alles eignes Haar, eine dichtverfilzte Masse, die 30 cm breit und 20 cm lang den ausrasierten Nacken deckte. Selbstredend durfte nichts unversucht bleiben, eine solche Monstreperücke zu sichern, und ich freue mich, das Bild des Trägers derselben noch in ungeschorenem Zustande geben zu können.

Es war ein stattlicher Kerl, mit wertvollem Muschelring als Halsschmuck und eigentümlicher Bemalung der Brust in Grau, die ich[S. 326] hier zuerst bemerkte. Im Haar trug er einen weit über die Stirn vorragenden, sogenannten Kamm, mit Haubenfedern der Krontaube (Goura) verziert, auf dem Scheitel zwei Seitenbüschel von Paradiesvögeln, wohl für lange Zeit zum letztenmal. Denn schon hielten mein Helfershelfer, der Steuermann, und ich die Waffen bereit, harmlos aussehende Scheren, die diese Eingeborenen ja noch nicht kannten, und ehe das Opfer noch recht ja oder nein sagen konnte, setzten wir an, und der seltene Schatz war für die Wissenschaft gerettet. Das Stück ziert jetzt das Berliner Museum, sofern es überhaupt zur Aufstellung gekommen ist. Als ich den Mann seine Veränderung im Spiegel betrachten ließ, machte er freilich ein verblüfftes und anscheinend nicht sehr erfreutes Gesicht, aber ich schenkte ihm den Spiegel und einiges andere dazu, unter der Versicherung, daß die Haare ja wohl wieder wachsen würden. Ich irre aber gewiß nicht, wenn ich eine derartige Perücke als Häuptlingsschmuck ansehe, denn unter fast ein paar Hundert Tagaiten, die uns in etlichen zwanzig Kanus umlagerten, trugen kaum mehr als ein halbes Dutzend solchen Haarwuchs. Die übrigen hatten gewöhnliches Papuahaar, in Form einer wolligen oder zottligen Kappe, und waren auch sonst echte Papuas, aber viele von ziemlich heller Färbung (wie Nr. 29 bei Broca). Hautkrankheiten zeigten sich nur wenig, aber ich beobachtete bei einzelnen Pockennarben. Die Männer trugen als Bekleidung die bekannten Tapastreifen, und auch bei Mädchen sah ich hier zum erstenmale Tapaschürzen statt der sonst üblichen Faserröckchen. Die Sprache war, wie fast überall, wo wir auf dieser Reise mit Eingeborenen verkehrten, verschieden von der vorher gehörten, das Betragen der Leute ein lobenswertes. Ohne Scheu kamen sie gleich an Bord, und ein Arbeiter-Werbeschiff hätte hier in der kürzesten Zeit ein wertvolles Cargo Rekruten mitnehmen können. Für alles wurde übrigens »Bodé« — Eisen, verlangt, wie dies immer der Fall ist, wenn Eingeborene solches erst kennen lernen. Außer wenigen Kokosnüssen, etwas Yams und Betel brachten sie nur zwei Hühner und ein Schwein (Bor), in dem Seite 327 dargestellten gefesselten Zustande. Es war leider ein junges und kaum des Schlachtens wert;[S. 327] nach vielen Verhandlungen holten die Leute dann noch ein zweites größeres. Man sieht daraus, daß es in Neu-Guinea mit Lebensmitteln des Landes in der Regel gar schlecht bestellt ist und man ohne eigenen Proviant verhungern könnte.
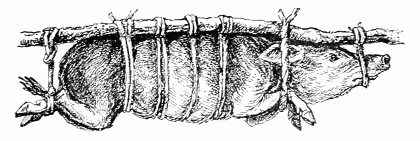
Schon vom Kaskadefluß an machte sich weiter inland eine höhere Bergkette bemerkbar, die nach und nach bedeutender wurde und sich zu einem Gebirge entfaltete, das d'Urville nach dem großen, italienischen Physiker Torricelli benannte. Es bildet einen dichtbewaldeten, in seiner Kammlinie ziemlich einförmig verlaufenden Rücken und mag an oder über 3000 Fuß Höhe erreichen. Als wir in der Früh (14. Mai) von unserem Ankerplatz bei Tagai westlich dampften, trat dieses Gebirge besonders deutlich hervor mit einer sehr markierten Kuppe, der Langenburg-Spitze[78], wie sie die beigegebene Abbildung (S. 329) darstellt. Diese Bergspitze zeichnet sich durch ein paar kahle Stellen aus, die von Erdrutschen oder ähnlichen Erscheinungen herzurühren scheinen. Von Tagai verläuft der Ufersaum weiter West in einem breiteren, dicht bewaldeten Vorlande und scheint noch ca. drei Meilen ziemlich bewohnt, soweit sich dies aus einzelnen Häusern mit kleinen Palmgruppen schließen läßt.
»Bei Passier-Point sind ausgedehnte Lagunenriffe und mehrere kleine Inseln« sagt Powell in dem Vortrage[79] über seine Reise an[S. 328] dieser Küste (?). Ja wohl! auf den Karten ist hier sogar eine zwei Meilen lange und breite Landzunge oder ein Riff verzeichnet, nach welcher wir vergebens Ausguck hielten. Herr Powell wird daher wohl etwas weitab gewesen sein, denn sonst müßte er gesehen haben, daß Passier-Point überhaupt nicht existiert. Ein isolierter Bestand dunkler Kasuarinen, welcher plötzlich in den sonst herrschenden Laubwaldscharakter der Küste einsetzt, war höchstwahrscheinlich die Ursache, daß d'Urville hier eine Huk verzeichnete. Schiffe, welche wie die Astrolabe weiter von der Küste segeln, können durch solche Kasuarinenhaine leicht getäuscht werden, da dieselben sich wegen der dunklen Färbung schärfer als die übrige Küste markieren und von weitem wie vorspringende Felsenkaps aussehen. Bald zeigten sich kleine Inseln, die Sainson-Gruppe, von d'Urville aus Nord gesichtet, auf welche wir, immer der Küste folgend, zuhielten. Durch eine vollkommen rifffreie Straße, die Babelsbergstraße, lief der Dampfer in die schöne Lagune ein, welche von diesen Inseln gebildet wird. Im Osten derselben liegen Faraguet und Sainson, niedrige, dichtbewaldete Inseln, von denen nur die letztere an der Südseite Kokospalmen und drei Siedelungen besitzt, und die durch Riff verbunden, ein hufeisenförmiges Becken umschließen, das ich Berlinhafen benannte. An der Südwestspitze von Sainson und durch Riff verbunden, schließt ein Inselchen, Sanssouci, das Hufeisen. Es ist kaum eine Viertelmeile lang, besteht aber fast nur aus Kokospalmen und Häusern, deren Bewohner sich jedoch versteckt hielten, während von Sainson ein Segelkanu abzukommen versuchte. Ähnlich reich an Kokospalmen und Bevölkerung ist die Küste, welche ausgedehntes Waldvorland, dahinter niedrigere bewaldete Hügel- und Bergreihen zeigt. Dieses Kopragebiet, das einzige von einiger Bedeutung an der ganzen Nordostküste Neu-Guineas, scheint sich an zehn Meilen weit bis Lapar-Point hinzuziehen. Dieser letztere von d'Urville benannte Küstenpunkt ist nur ein dichtbewaldeter, etwas vorspringender Uferhügel, durch schwarze Felsen und Steine ausgezeichnet, welche sich bis Dudemain-Insel hinzuziehen und uns den direkten Weg westwärts zu versperren schienen. Wir versuchten also, den nach der Karte[S. 329] durch Riffe geschlossenen Durchgang zwischen Faraguet und Dudemain, fanden ihn aber glücklicherweise vollkommen frei (16 Faden und kein Grund!) und gelangten wieder einmal in klares dunkelgrünes Wasser. Dudemain mit dicht bewaldeten Korallfelsen erscheint wie eine hohe Insel; an der Südseite sind ein paar kleine Siedelungen, an der Nordseite ziemlich viel Kokospalmen.
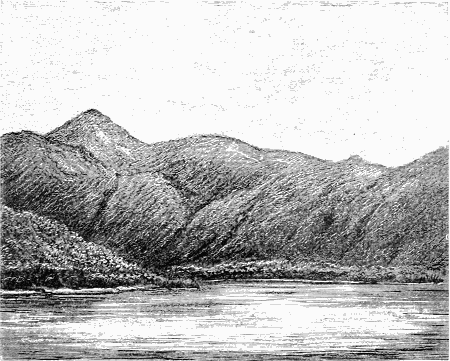
Von Lapar-Point verläuft die Küste fast geradlinig nach W.-N.-W. bis zu einer sanftgerundeten Ecke, der Baudissin-Huk[80]. Auch dieser an 20 Meilen lange Strich, ausgedehntes, dichtbewaldetes Vorland, von bewaldeten Hügeln begrenzt, hinter denen höhere Berge folgen, scheint sehr beachtenswert. Ich notierte vier Flüsse, (Arnold-, Joest-, Bastian- und Lagunenfluß), deren Mündungen indes wie bei fast allen vorhergehenden unzugänglich erschienen. Zwischen dem Joest-[S. 330] und Lagunenflusse gab es wieder ziemlich viel Kokospalmen, aber ich beobachtete nur wenig Siedelungen. Der Lagunenfluß ist der Ausfluß eines großen Wasserbeckens, das vom Mast aus wie ein ausgedehnter See erschien, mit einer bewaldeten Insel in der Mitte; auch Dörfer, Pfahlbauten, ließen sich mit bloßem Auge im Wasser erkennen. Gewiß eine sehr interessante Gegend und der Untersuchung wert, für die wir leider keine Zeit hatten. Diese Lagune dehnte sich scheinbar bis zu einer Hügelkette aus, hinter welcher weiter inland wohl an 3000 Fuß hohe Kuppen vorragten.
Mit dem Lagunenflusse beginnen wieder einmal Kasuarinen das Ufer zu säumen, welche, im Gegensatze zu Kokospalmen, fast ausnahmslos das Fehlen von Menschen andeuten. Ich bedauerte dies nicht im mindesten, als wir am Abend ca. fünf Meilen West von dem Flusse zu Anker gingen, denn eine ruhige Nacht that mir nach den Anstrengungen der vorhergehenden Tage mehr als je not. Den ganzen Tag Notizen zu machen und zwischendurch mit den Eingeborenen zu verkehren, um Sachen einzutauschen, ist ein gar hartes Stück Arbeit, denn schon die Zeichensprache ist ermüdend und erfordert mehr geistige Anstrengung als irgend eine andere, und vor allem Geduld, die Geduld eines Engels. Wie oft merkt man nicht heraus, daß die Eingeborenen sehr gut begreifen, was man will, sich aber nur absichtlich dumm stellen, wie ein Beispiel aus dem Verkehrsleben mit ihnen am besten zeigen wird. Zahlreiche Kanus mit Eingeborenen lagern um den Dampfer und fischen die roten Lappen auf, die zunächst als Köder über Bord geworfen werden. Aber sie haben nichts Rechtes; schlechte Speere, alte geflickte Tragbeutel, verschlissene Grasarmbänder, ein paar schlechte Muscheln und ähnlichen Plunder. Das Gute, die feinen Sachen, sind noch versteckt, denn es ist erstaunenswert, was so ein spärlich bekleideter, nach unseren Begriffen nackter Mensch alles an seinem Körper verbergen kann. Wie ich wohl weiß, liegen aber die besten Sachen in Blätter und Tapastreifen eingepackt, unsichtbar für uns, am Boden des Kanu. Um wenigstens mit dem Handel zu beginnen, fange ich an Plunder zu kaufen; aber die Eingeborenen wollen gegen rotes Zeug, Glasperlen[S. 331] und dergleichen nicht recht etwas hergeben. Mein Kennerblick hat die ganze Gesellschaft gemustert; nur einer unter ihnen trägt als begehrenswert einen hübschen Ring, aus Muschel gearbeitet, an einem Strickchen um den Hals. Wohlgefällig ruht mein Auge auf diesem Schmucke, ich deute durch Zeichen an, ihn zu kaufen. Aber der Eingeborene hat ebenfalls begriffen, was mich reizt, und als mein einen Moment abgewandter Blick den Träger sucht, findet er ihn nicht mehr. Er ist verschwunden! nämlich der Schmuck; zuerst auf den Rücken gedreht, dann abgebunden und im Kanu verborgen. Vergebens suche ich klar zu machen, was ich wieder haben will. Man versteht mich sehr gut, aber der Mann, der das kostbare Stück überhaupt nicht verkaufen will, stellt sich dumm und zeigt allerlei Dinge, nur nicht das Gewünschte. — Das ist eine kleine Probe im Geduldsspiel »Schacher mit Eingeborenen«, dessen Früchte später, wenn alles gut geht, unsere Museen zieren. Ja, ja, man sieht es den oft sehr bescheidenen Dingen nicht an, welche Mühe ihre Erwerbung kostete; alles im »Dienste der Wissenschaft«, aber im Schweiße des Angesichts errungen und erschachert.
Ist man endlich die Eingeborenen glücklich los, dann bleibt noch die nötigste Arbeit, die erhaltenen Stücke mit dem Fundort zu bezeichnen und — last not least — das Gesehene und Erlebte selbst ins Tagebuch zu schreiben. Das hat mir manche Nachtstunde gekostet und geht auf rollendem Schiffe nicht so bequem als daheim im Studierzimmer. Freilich meinen die Herren des letzteren gar häufig, daß ethnologisches Sammeln reines Kinderspiel sei, aber da haben sie wohl nicht selbst praktische Erfahrungen gemacht, denn es kauft sich nicht so leicht wie auf einem Bazar bei uns. Eine so anstrengende Lebensweise stellt, im Verein mit der Hitze, welche meist einen Teil der Nachtruhe raubt, bedeutende körperliche Anforderungen, die das ewige Einerlei der Schiffskost mit Konserven und immer wieder Konserven nicht befriedigen kann. Ein tüchtiger Koch vermag freilich viel, aber das war der unsere nicht, mit dem überhaupt sehr zart umgegangen werden mußte. Schon am dritten Tage der Abreise machte er mich darauf aufmerksam, daß alles Wasser[S. 332] an Bord vergiftet sei. Das ließ keinen Zweifel, daß wir es mit einem Verrückten zu thun hatten. In der That stellte sich immer mehr heraus, daß der Mann an Verfolgungswahnsinn litt, und ein solches Mitglied an Bord zu haben, ist eben nichts Angenehmes.
Mit gewohnter Pünktlichkeit wurde am anderen Morgen (15. Mai) aufgebrochen, und kaum hatten wir Baudissin-Huk passiert, so zeigte sich wieder weithin trüb lehmfarbenes Wasser voraus. Es wird durch den Goßler erzeugt, einen ansehnlichen, aber ebenfalls durch Barre versperrten Fluß, dessen Mündung wir bald darauf erblickten. Der weiße, scharf abgesetzte Schaumstreif, welchen die Kabbelung dieser Flußauswässerung hervorbringt, mag im Verein mit den hellgefärbten Felsen der Uferbasis der darauf folgenden Küste die Veranlassung gewesen sein, daß d'Urville ein ausgedehntes Riff vor sich zu sehen glaubte. In Wirklichkeit existiert das 12 Meilen lange Karan-Riff der Karten aber nicht. Diese ganze Küste zeichnete sich übrigens durch intensive Einförmigkeit, ja Langeweile aus; überall dieselben niedrigen, eintönig dunkelgrünen Hügelketten, die wie mit einer einzigen Laubholzart bewaldet scheinen, keine Kokospalmen und damit keine Menschen. Erst viel weiter westlich, nachdem wir noch eine Flußmündung (des Thorspecken) passiert hatten, zeigten sich wieder Palmen und damit Eingeborene, obwohl sich von ihren Siedelungen nichts bemerken ließ. Sie mochten im Dickicht des Urwaldes verborgen sein, aber jedenfalls kamen Kanus ab und zwar eine ganze Anzahl, so daß gestoppt wurde. Diese Fahrzeuge unterschieden sich im wesentlichen von den gestern gesehenen durch den Mangel eines Schnabelaufsatzes und einer erhöhten Plattform, waren kleiner, aber eigentümlich durch aufgebundene Randleisten und Bemalung der Seiten (vergl. T. VII 1). Einzelne Kanus führten auch Segel[81] und als Verzierung der Mastspitze einen Büschel Kasuarfedern.

[S. 333] Von den Eingeborenen selbst wird die beigegebene Abbildung eines jungen Kriegers die beste Vorstellung geben. Er trägt eines der geschmackvollen Brustschilde aus Platten von Eberhauern mit roten Abrusbohnen und Nassa besetzt (XXIII. 2), um den Arm Ringe aus Querschnitten von Trochusmuschel, durch die Nasenscheidewand zwei längsgespaltene und dünn geschliffene Eberhauer (T. XX. 8), die im Verein mit der schwarzen und weißen Bemalung des Gesichtes, die übrigens als Verschönerung dienen soll, ein gar wildes Aussehen verleihen. Im linken Ohr steckt ein runder Ball aus Cuscusfell, im rechten sind Schnüre aufgereihter Coixkerne befestigt. Ein breiter Gürtel aus Baumrinde, mit welchem der Leib unnatürlich eng eingeschnürt wird, und ein Tapastreif um die Lenden würde den Ausputz eines hiesigen Eingeborenen vollenden. Breite Kopfbinden aus Cuscusfell waren hier auch sehr beliebt, wie eine besondere Art eleganter Leibschnüre von schwarzen Perlen aus Kokosnußschale und Conusringen (T. XXIV. 3). Sonst sah ich nur bereits Bekanntes. So Bogen wie von Tagai (S. 324), aber ohne Federschmuck, und Pfeile wie von Guap (S. 318). Haar und Bart erfreuten sich keiner besonderen Pflege; doch beobachtete ich noch einzelne verfilzte Haarperücken und bei jungen Leuten eine Haarwulst längs der Scheitelmitte, eine Frisur, die in Neu-Irland sehr häufig ist und an die Raupe des bayerischen Helmes erinnert. Nicht selten waren jene erhabenen Narben, die durch wiederholtes Einschneiden der Haut hervorgebracht werden, eine sehr schmerzhafte Operation, die als Verschönerung weit über Melanesien verbreitet ist. Figur a der Abbildung (S. 334) zeigt die[S. 334] blattförmige Ziernarbe eines hiesigen Kriegers und zugleich die Art und Weise, wie der Dolch aus Kasuarknochen in den Armbändern von Trochusreifen getragen wird.
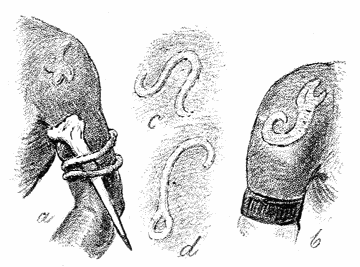
Die Leute hatten viel Tabaksblätter in Bündeln, sonst kaum etwas anzubieten. Neu waren mir aber in eigentümlicher Form geräucherte Fische, die ich anfänglich für irgend eine Art Armbänder oder dergleichen hielt. Wie eine Spirale windet sich, an einem Stocke befestigt, Fisch an Fisch, jeder mit der Schwanzspitze die Schnauze berührend, eine Methode, die ihrer Originalität halber, auf einer Ausstellung gewiß ausgezeichnet werden würde. Der Geschmack dieser Fischkonserve konnte indes nur Papua reizen.
Diese Eingeborenen betrugen sich übrigens längst nicht so manierlich als ihre Rassengenossen der vorhergehenden Tage; sie lärmten gar sehr und kriegten oft untereinander Streit. Doch ließ sich ganz gut mit ihnen kramen, und sie waren anfänglich sogar mit rotem Zeuge zufrieden. Als ich aber Eisen, Hobeleisen, zum Vorschein brachte, da wurden sie, wie der Kapitän zu sagen pflegt, förmlich »wild«, das heißt vor Freude. »Massilia!« und »Massilia« ertönte es ohne Ende, ein Name, dessen Bedeutung mir zwar unklar blieb, den ich aber kartographisch mit dieser Stelle verbinde. Sie ist jetzt wenigstens auffindbar, falls jemand Lust haben sollte, hierher zu gehen, um Aufklärungen über Massilia zu geben.
Weiter nach West behält die Küste denselben Charakter, zeigt keine Spuren von Bevölkerung, und das einzige, was wir entdeckten, waren zwei Flüsse, (Ratzel und Neumayer) die vielleicht nur Arme eines und desselben sind, und drei Inseln, nahe der Küste, oder vielmehr[S. 335] Inselchen, so klein, daß ich sie »Däumlinge« nannte. Wenn sich nicht etwa Gold oder »Sowas« auf ihnen findet, wird diese Entdeckung ziemlich wertlos bleiben, aber nichtsdestoweniger eine Entdeckung. Hinter der dichtbewaldeten Uferhügelkette traten jetzt höhere Berge hervor, einförmige Rücken, die im Westen durch einen Berg von eigentümlicher Form, wie ihn die nachstehende Skizze (rechts) zeigt, einen vorläufigen Abschluß fanden. Es ist der circa 3000 Fuß hohe Bougainville von d'Urville und, wie sich später erwies, identisch mit dem Mount Eyries von Belcher. Der Hügel gleich im Vordergrund meiner Skizze ist Kap Concordia, das uns schon längst aufgefallen war und hinter dem wir einen Ankerplatz für die Nacht zu finden hofften. Wirklich zeigte sich hier der Eingang zu einer kleinen hübschen Bucht, welche unserem Wunsch durchaus entsprach. Es war die »anse de l'attaque«, von d'Urville am 11. August 1827 nur gesichtet, aber nicht besucht[82], in der wir bald[S. 336] wohlbehalten ankerten. Sie bildet ein rings von bewaldeten Bergen umschlossenes rundes Becken, mit freier, jederseits durch Riffe geschützter Einfahrt, gutem Ankergrunde (7 bis 15 Faden) und giebt einen prächtigen und sicheren Hafen ab. Längs dem Sandstrande, welcher Angriffshafen säumt, sind dichte Reihen Kokospalmen, aber keine Siedelungen, die, wie wir später bemerkten, westlich von Reiß-Huk in der angrenzenden schmalen Friederichsen-Buchtung liegen.
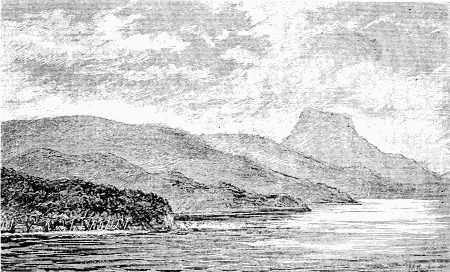
Ganz wie zu d'Urvilles Zeiten kamen, noch ehe der Anker fiel, Eingeborene in ihren Kanus angerudert; zehn, zwanzig, bis eine ganze Flotte von dreißig bis vierzigen den Dampfer umlagerte. Die Leute stellten förmliche Wettrudern an, als solle das Schiff gleich genommen werden und führten, wie damals, Unmassen von Waffen mit sich. Ich kannte die Art der Eingeborenen aber besser und wußte, daß ich bald eine Menge ihrer Armaturstücke einhandeln und daß ev. ein Gewehrschuß genügen würde, die Flotte in wilder Flucht auseinander zu jagen.
Die Kanus schienen im ganzen klein und trugen drei bis sieben Mann; doch waren einzelne mit Mast und Segel versehen; letzteres aus dem bastartigen Zeug von der Basis des Kokospalmblattes. Die Fahrzeuge zeichneten sich übrigens durch einige Besonderheiten aus. So ist die anscheinende Randborte nicht aufgebunden, sondern in einem Stück mit dem Kanu aus dem Baumstamm gezimmert (vergl. T. VII 2). Außer eingravierten Verzierungen der Seiten, sind die Enden der Kanus häufig mit einem kunstvoll geschnitzten, buntbemalten, S förmigen Schnabel versehen, der gewöhnlich in einen Vogelkopf endet und angebunden wird. Kanuspitzen mit Schnitzereien von Krokodilen (wie VII 4, 5) kommen hier und weiter westlich nicht mehr vor. Zwei auf dem Ausleger befestigte Stöcke, die nach innen zu in einen Haken enden, öfters ebenfalls bemalt und zierlich ausgeschnitzt, dienen wie ein schmaler Gitterkasten an der entgegengesetzten Seite zur Aufbewahrung der Waffen, die hier sehr handlich liegen. Sie bestanden hauptsächlich in Bogen und Pfeilen, wie wir sie schon in Tagai (S. 324) kennen lernten, indes ohne Federschmuck, aber ich war erfreut, hier auch Schilde zu finden und noch[S. 337] mehr durch Kürasse überrascht, die, wie ich glaube, bisher nur im Inneren des Flyflusses beobachtet wurden. Diese Armaturstücke verleihen, wie die Abbildung zeigt, dem hiesigen Krieger im vollen Staate ein gar martialisches Aussehen. Die Schilde zeichnen sich durch besonders schöne, erhaben geschnittene Ornamentik aus und gehören mit zu den besten Kunstleistungen des Papuafleißes. Die Kürasse sind feine Modelle sauberer Korbflechtarbeit aus gespaltenem Rotang und werden durch Bänder über die Achsel festgehalten. Für unsere Panzerreiter würden sie freilich, schon ihres Umfanges wegen, nicht passen, denn es gehören Leute von weniger als 83 cm Hüftenweite dazu, um hineinzuschlüpfen. Lendenbinden aus Tapa, wie sie die Krieger, (siehe Abbildung) gürten, gehörten zu den Ausnahmen. Die meisten Männer begnügen sich nämlich mit einer Kalebasse (T. XVI. 7), die ich einzeln schon in Massilia gesehen hatte, und die für hier, wie weiter westlich, als Bekleidung charakteristisch ist.
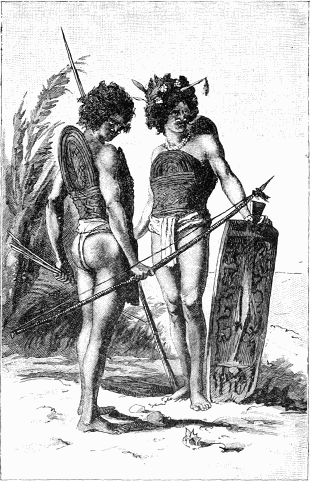
Auch in den übrigen Sachen der Eingeborenen zeigten sich[S. 338] allerlei Veränderungen, und man konnte bemerken, daß wir uns in einer neuen ethnologischen Provinz befanden. Hundezähne und Cymbiumscheiben, die weiter im Osten eine so hervorragende Rolle spielen, waren kaum mehr zu sehen, dagegen sind für dieses Gebiet die schönen roten (auch stahlblauen) Paternosterbohnen (von Abrus precatorius) als Material zu Zieraten charakteristisch. Ihre geschmackvollste Anwendung finden sie bei den schon (S. 316) erwähnten Kampfbrustschilden (XXIII. 2), aber auch bei Stirnbinden und Armbändern. Es verdient dabei Beachtung, daß diese Bohnen stets mittelst einer Art Harz aufgeklebt, nicht aufgereiht und aufgeflochten werden, wie dies mit den Samen von Coix lacrymae geschieht, die im hiesigen Schmuck ebenfalls häufige Verwendung finden. So sah ich hübsche Stirnbinden aus Coix, in feines Flechtwerk eingeknüpft, wie überhaupt eine Menge eigenartiger Zieraten. Reich vertreten waren schöne Leibgürtel, (wie Fig. 8, T. XXIV), und dünne Leibschnüre aus Coix und Kokosperlen (wie XXIV, 7), oder eigentümliche, rot gefärbte, aus einem feinen Fasermaterial (wohl vom Blatt der Sagopalme), zum Teil mit Coixsamen durchflochten und mit einzelnen Federn aus den Seitenbüscheln des Paradiesvogels. Gravierte breite Schildpattarmbänder fehlen hier, wie diesem westlichen Gebiet überhaupt, aber schmale, dünne Schildpattreifen sind sehr in Mode und werden, oft in großer Anzahl, im Ohrläppchen getragen. Sie sind häufig noch mit langen Troddeln aus Bindfaden und Coixkernen verziert, ebenso wie die sogenannten Haarkämme, die hier (vergl. T. XVII. 3) in eigentümlicher neuer Form auftreten. Als Nasenschmuck fanden, außer den (S. 333) erwähnten Eberhauern, besonders dicke Keile, aus Rohr (T. XX. 4) oder sehr sauber aus Tridacnamuschel (XX. 3) geschliffen Verwendung. Wenn man bedenkt, daß ein solcher Muschelkeil bei 11 cm Länge bis 17 mm dick ist und 60 Gramm wiegt, so kann man ermessen, was den hiesigen Nasen zugetraut wird. Eine Ausdehnung der Nasenlöcher auf 55 mm in der Runde ist gewiß keine Kleinigkeit, wobei bemerkt sein mag, daß diese Körperöffnung beim Papua keineswegs so unverhältnismäßig viel größer ist als beim Mittelländer, denn ich kenne Nasen von[S. 339] Weißen, die bis auf die Couleur sich in nichts von denen gewisser Papuas unterscheiden. Aber »Hoffart will Zwang haben« gilt auch beim Kanaker, und so unterwirft er sich willig der Mode, wie dies, trotz mancher Inkonvenienzen bei uns auch geschieht. Denn ein solcher Nasenschmuck ist ja eine Zier des Mannes und verschönert ihn, — wie? — zeigen die Figuren 1 und 2 Taf. XX. Aber hinsichtlich der Ziernarben (vergl. S. 334, Fig. b) verhält es sich ja ebenso.
Charakteristisch für dieses westliche ethnologische Gebiet sind auch die Steinäxte und zwar durch den Stiel. Derselbe besteht nämlich nicht in einem knieförmig gebogenen, rechtwinkeligen Aste, sondern in einem geraden runden Holzstück (vergl. T. I. 5), in welchem das Holzfutter mit der Steinklinge in einem Bohrloche steckt. Für Menschen der Steinperiode ist es schon ein äußerst schwieriges Stück Arbeit, ein so weites Bohrloch anzufertigen. Wie wollten wir wohl ohne Bohrer damit fertig werden? Diese Manier der Befestigung der Klinge bietet übrigens den Vorteil, daß die letztere drehbar ist. Manche der hiesigen Axtklingen schienen, soweit sich nach dem Auge urteilen läßt, Nephrit zu sein. Filetgestrickte Brustbeutel sind im westlichen Gebiet zwar vorhanden, aber viel seltener als im östlichen und entbehren meist des reichen Ausputzes, in welchem Scheiben aus Cymbiummuschel gar nicht mehr vertreten sind. Eigentümlich waren aus Kokosblatt geflochtene Tragkörbe, in besonders reicher und eigentümlicher Ausschmückung (darunter Faserbüschel, Paradiesvogelfedern, Krebsscheren und bemalte Tapa).
Außer Kokosnüssen und etwas Yams brachten die Angriffshafener Blättertabak, geräucherte Fische und verschiedene Nährmuscheln (Batissa violacea und angulata, sowie Neritina petiti und rhytidophora), die hier sehr beliebt zu sein scheinen, sowie etliche schlechte Paradiesvögelbälge.
Anthropologisch zeigten sich auch die hiesigen Eingeborenen als echte Papuas von gewöhnlicher, dunkler Hautfärbung (zwischen Nr. 28 und 29 Broca's), und erschienen im allgemeinen als kräftige und gut gebaute Menschen. Mit vieler Mühe gelang es mir, einige[S. 340] zu messen, denn sie hatten schreckliche Furcht und zitterten wie Espenlaub, schier als solle es ihnen an den Kragen gehen. Die gewöhnliche Höhe ergab 1,57 Meter, wie dies sonst bei Papuas[83] der Fall ist; die stärksten Männer maßen 1,67 bis 1,70 Meter. Schuppenkrankheit und Ringwurm waren sehr verbreitet, aber ich sah keine Pockennarben. Bezüglich des Kopf- und Barthaars gilt das bei Massilia gesagte (S. 333); rote Erde war nicht selten ins Kopfhaar geschmiert, sonst sah ich wenig Bemalung.
Obwohl ich bei den Leuten nur eine Glasperle als einziges europäisches Erzeugnis beobachtete, die sehr alt zu sein schien und an einem Kamm befestigt war, so schienen sie doch Eisen zu kennen. Denn sie machten die Pantomime des Schneidens und nahmen sonderbarerweise Messer, die sonst am wenigsten begehrt sind, lieber als Hobeleisen.
Durften die Massilianer schon als Radaumacher gelten, so waren es diese Eingeborenen in erhöhtem Maße. Jeder wollte zuerst seinen Kram los werden, und dabei wurde geschrieen, daß man kaum das eigene Wort verstehen konnte, ein wahrer Höllenspektakel! Und nach des Tages Last und Hitze sehnte man sich wirklich nach Ruhe und bedurfte derselben; aber der hereinbrechende Abend schien den Handelsgeist der Leute nicht im mindesten abzuschwächen. Hundertmal hatte ich ihnen angedeutet, daß nichts mehr gekauft würde, aber immer wieder wurden Sachen, oft dieselben Stücke angeboten. Da ist z. B. ein langer Kerl, der um jeden Preis seinen schlechten Knochendolch zu hohem Preise los sein will, obwohl ich ihn schon so viele Male zurückgewiesen. Das Stück erscheint immer aufs neue und in verändertem Aussehen auf der Bildfläche. Bald ist es mit grünen Blättern, bald mit Baststreifen verziert oder mit roter Farbe angeschmiert, aber immer wird es durch einen anderen offeriert. Nicht wahr, diese Schwarzen sind pfiffige Leute? Aber wir waren es[S. 341] auch, und zwar in einer den braven Eingeborenen durchaus neuen Weise. Ein paar Worte mit dem Maschinisten und plötzlich gellte die Dampfpfeife. Hei, wie sie das Wasser schaufelten und in wilder Hast heimwärts stürmten! »Ja, nicht wahr? der Schreck ist euch in die Glieder gefahren« dachte ich, als mit dem Pfiff Luft geschafft worden war und zündete mir ein Pfeifchen an, um bei der matten Kajütenlampe und 27° R. Wärme die Erlebnisse des Tages niederzuschreiben. Prioritätsrechten zufolge muß diesem Hafen der odiöse Name verbleiben, der lehrt, wie verschieden die Aufnahme an ein und demselben Platze sein kann, zu der allerdings das Auftreten der Fremden nicht selten die Veranlassung giebt. Kap »Eintracht«, in Erinnerung an das gute Einvernehmen mit uns, wird die Angriffshafener etwas versöhnen, denen ich noch außerdem das Epitheton »Lärmonkels« stifte.
Auch auf der Weiterreise (16. Mai) zeigte die Küste denselben einförmigen Charakter: dichtbewaldete Hügel, die steil bis ins Meer abfallen, hie und da mit kahler Felssohle, im Hintergrunde höhere Berge. Wir hatten Angriffshafen noch nicht lange verlassen, als sich westlich von einer sanft gerundeten Huk (Robidé), in weiter Entfernung höheres, in Wolken gehülltes Land zeigte, daß sich später als Teil des Cyclopgebirges erwies. Humboldt-Bai, das Endziel unserer Reise war also nicht mehr fern und der Eingang zu derselben deutlich zu erkennen, nachdem wir Robidé-Huk[84] passiert hatten. Das Meer zeigte hier wieder seine eigentliche tiefblaue Farbe, aber einige Meilen weiter erschien es, soweit das Auge reichte, aufs neue scharf abgesetzt grün, wie ein großes Riff. Wir hatten diese Erscheinung aber bereits so häufig beobachtet, daß der Kapitän ohne Zögern in das grüne Wasser hineindampfte, welches bald schmutzig lehmfarben wurde. Es mußte also in der Nähe ein Fluß münden, nach dem der Kapitän zu suchen schien. Statt nach dem Eingange von Humboldt-Bai, die mit Kap Bonpland so deutlich voraus lag, wurde nämlich O.-S.-O. gesteuert, in eine Art sanfte Bucht, die östlich[S. 342] von einem steilen, dichtbewaldeten Hügel begrenzt wird. Ich nannte ihn später Germania-Huk, weil sie den letzten Küstenvorsprung auf deutschem Gebiete bezeichnet. Bald sahen wir die erwartete Mündung eines Flusses, des Sechstroh, (nach unserem ersten Offizier). Obwohl sich die Unzugänglichkeit desselben schon jetzt erkennen ließ, so fehlen der Kapitän, welcher wie immer aus der Marsraae[85], die Navigation leitete, doch Absichten mit diesem Flusse zu haben. Es wurde ein Boot ausgesetzt, fleißig gelotet und — »schmiet daal!« — da rasselte der Anker in die Tiefe. »Willkommen in Humboldt-Bai« hieß es, als Kapitän und Steuermann aus ihrer luftigen Höhe wieder an Deck festen Fuß faßten. »Humboldt-Bai? I, Gott bewahre! die liegt ja dort, noch über fünf Meilen zu West« — Und so verhielt es sich auch; übrigens ein verzeihlicher Irrtum, da keine Spezialkarte dieser Bai an Bord war, die ich diesmal besser kannte. Hatte ich mich doch einmal mit Humboldt-Bai eingehend zu beschäftigen gehabt, als ich vor vielen Jahren mein erstes Buch[86] über Neu-Guinea schrieb, eine jener gutgemeinten Kompilationen, in denen trotz aller Sorgfalt eine Menge Fehler unterlaufen. Ich konnte damals freilich nicht ahnen, daß ich noch einmal Gelegenheit haben würde, dieselben an Ort und Stelle zu korrigieren. Da lagen wir nun, kaum drei Viertel Meilen, in sieben Faden Schlick, vor dem neuen Flusse, dessen Mündung sich durch mächtige Brandung und Treibholzstämme kennzeichnete, aber ebenso wenig versprechend aussah, als die Küste selbst. Sie zieht sich als dichtbewaldetes Flachland, an dem es brandet, anscheinend bis Kap Bonpland hin, das durch mehrere hellgefärbte Flecke, kahlen Fels, so kenntlich ist. Das Kap bildet den steilabfallenden Ausläufer einer bewaldeten Hügelkette, welche das Vorland begrenzt und auf deren Kammlinie sich zwei Kuppen (Alexander-Spitze, ca. 1200 Fuß und Aimé-Kuppe, ca. 1000 Fuß) besonders markieren. Bei der sehr bedeckten Luft war Kap Caillié nicht deutlich auszumachen, wohl aber die Ausläufer des[S. 343] Cyclopgebirges und die Berge in der Tiefe von Humboldt-Bai zu erkennen. Der Mangel von Kokospalmen an der Vorlandsküste ließ auf den gleichen an Menschen schließen, und so konnte eine Revision der Maschine, welche zum Bleiben nötigte, in aller Ruhe vorgenommen werden. In Humboldt-Bai wäre das, wie wir später sehen werden, gewiß nicht mehr möglich gewesen. Der unfreiwillige Aufenthalt hier erwies sich daher als eine Fügung des Himmels, für die wir in jeder Beziehung dankbar sein konnten. Freilich dauerte die Ruhe nicht lange, denn bald zeigten sich bekannte dunkle Gestalten am Ufer, die mit grünen Zweigen winkend, uns schreiend an Land einluden. Der Kapitän wollte aber seinen Leuten einmal etwas Ruhe gönnen und hatte überdies nicht Lust, ein Boot zu gefährden, da die Landungsverhältnisse nicht eben sehr günstig aussahen. Die Eingeborenen riefen ohne Aufhören weiter und gaben sich alle erdenkliche Mühe; sie wateten brusttief ins Wasser und erkletterten die Treibholzstämme, auf denen bald eine ganze Reihe, wie brüllende Seelöwen hockte. Die armen Kerle besaßen gewiß keine Kanus und hätten die seltenen fernen Gäste doch so gern gesehen! Ach was! die werden sich schon zu helfen wissen. Und sie halfen sich! Bald sah man braune Körper, auf irgend etwas sitzend, durch die Brandung gondeln und mit der Strömung nach dem Dampfer treiben. Ja, das waren wirklich die denkbar einfachsten Fahrzeuge, Baumwurzeln, jederseits ein dicker Bambu angebunden. Aber, wie die Abbildung (S. 344) zeigt, die Sache ging prächtig. Als wären sie erwartet, ließen die ersten Ankömmlinge ihr Gefährt treiben, um gleich an Bord zu klettern, wovon ich sie jedoch sanft zurückhielt. Bei den mancherlei Arbeiten auf Deck lag allerlei Gerät umher, was für Kleptomanen doch zu verführerisch gewesen wäre. Auch ist es im allgemeinen nicht rätlich Eingeborene, die man noch nicht genauer kennt, an Bord umherschnüffeln zu lassen, und ich hielt stets darauf, diesen Grundsatz durchzuführen, da Vorsicht ja niemals schaden kann. Übrigens wußten sich diese Fouriere trefflich zu akkomodieren, und konnten, an Ruder oder Ankerkette sich festhaltend, gemütlich die Kanus abwarten, welche bald durch die Brandung tanzten. Sie brachten je[S. 344] zwei bis vier, höchstens zehn Eingeborene, in jeder Weise echte Brüder der Angriffshafener, nur daß sie noch viel mehr lärmten. Sie kamen nicht aus Wißbegierde, kümmerten sich weder um den Dampfer noch unsere weiße Haut, sondern ihr einziger Zweck war[S. 345] schachern und — stehlen. Da wir zu gut aufpaßten, so blieb es in Bezug auf das letztere bloß bei Versuchen, aber schon diese ließen die Gewandtheit der Leute zur Genüge erkennen. So machte es mir viel Spaß, einen Eingeborenen im stillen zu beobachten, der sich bemühte, eine leere Flasche durch die Klüse zu eskamotieren und sie ihm gerade im letzten Moment abzunehmen. Auch beim Schacher hieß es scharf aufpassen, denn hielt man das Tauschobjekt des Eingeborenen nicht bereits mit der einen Hand fest, so durfte man das seinige nicht aus der anderen lassen. Wurde doch ohnehin schon versucht, Sachen aus der Hand zu reißen oder zum Ansehen gegebene zu behalten. Nach diesem in meinem bisherigen Verkehr mit Eingeborenen durchaus neuen, nicht eben sehr angenehmen Betragen zu urteilen, hatten wir es hier mit einem wilderen Stamme als bisher zu thun. So würden nämlich die meisten urteilen; aber ich denke, die hiesigen Eingeborenen lernten diese üblen Manieren erst in Humboldt-Bai, wo sie gewiß schon Schiffe gesehen hatten. Sie warnten uns übrigens vor Lintschu, wie sie die Bai nannten, ein Name, den ich in ihr selbst nicht hörte, aber nur aus Spekulation, um den Eisensegen allein einzuheimsen. Denn ihre einzige Losung war »Szigo« (Eisen), und sie wußten die Gelegenheit, die ihnen wohl zum erstenmal ein Schiff direkt vor ihre Barre führte, nach besten Kräften auszunutzen. Analog unserem Hurra ertönte hier aus allen Kehlen ein kräftiges »i, i, i — jáh«, jedesmal als Zeichen, daß sie wiederum ein Hobeleisen erschachert hatten. Die Leute besaßen übrigens schöne Sachen, zumeist identisch mit denen von Angriffshafen. So die Kanus (mit Pandanus-Mattensegel), Waffen, Steinäxte, Töpfe (T. IV. 1, 2), Schmuck (darunter die bekannten Brustschilde) und sonstige Zieraten.
Unter den letzteren erhielt ich einige neue Leibschnüre; so eigentümliche aus aufgereihten Vogelknochen (meist von Buceros) und Krebsbeinen mit großen kugelförmigen Samenkernen (T. XXIV. 2), und sehr elegant aussehende von Coixsamen, abwechselnd mit den kirschbraunen Samen von Adenanthera pavonina (XXIV. 6). Letztere waren auch zu langen Schnüren als Hals- und Brustketten aufgereiht.[S. 346] Eine neue Art Collier bestand in zwei kolossalen Eberhauern (Taf. XXI. 1), die einen Ring von 12 cm Durchmesser bilden. Neu war auch ein Nasenschmuck aus Tridacna geschliffen (XX. 7). Zirkelrunde, abnorm gewachsene Eberhauer (wie XX. 2), scheinen diesem westlichen Gebiete zu fehlen und wurden in Krauel-Bai zuletzt beobachtet. Ein neues Steingerät waren Sagoklopfer mit gleichem Holzstiel wie Steinäxte (T. I. 5), aber mit einem ca. 12 cm langen, konischen, runden, sauber bearbeiteten Stein. An Waffen erhielt ich nur Bogen und Pfeile. Letztere (1,45 bis 1,80 Meter lang), zeichnen sich durch mehrere schwarzgemalte Ringe auf dem Rohrschafte aus, dessen erster Abschnitt mit hübschen eingebrannten Mustern verziert ist; bunte Bemalung und Federschmuck fehlen daran. Dolche aus Kasuarknochen waren sehr häufig, und manche zeichneten sich durch kunstvolle Gravierung aus, wie das schöne Stück auf T. XI. 7. Die Bekleidung der Männer bestand ausnahmslos in den (S. 337) erwähnten Kalebassen, zuweilen mit zierlich eingebrannten Mustern, und viel reicher als die Kalkkalebassen ornamentiert. Die Bambubüchsen für Tabak zeigten hübsche Gravierungen. Fischhaken sah ich (wie seit Astrolabe) auch hier nicht, erhielt aber Fischspeere in der bekannten Form, mit mehrzinkiger Holzspitze, wie sie sich überall findet. Beiläufig mag erwähnt sein, daß die Speerstange deshalb ausnahmslos aus Bambu besteht, weil eine solche schwimmt. — Ziernarben waren auch hier häufig (vergl. S. 334 Fig. c, d). An Sonstigem wurden nur wenig Kokosnüsse, Pandanusfrüchte, ein paar junge Hunde der echten Papuarasse und eßbare Erde[87] angeboten, letztere in Form flacher, 20 cm breiter Kuchen, mit einem Loch in der Mitte, um ein Tragband hineinzuknüpfen. Als Jagdtrophäe erhielt ich den Unterkiefer eines Krokodil. Das Fleisch des letzteren ist bekanntlich bei den Papuas sehr beliebt, aber sie werden sich dieses Bratens wohl nur[S. 347] selten erfreuen. Wie ich selbst auf all diesen ausgedehnten Reisen nur ein paarmal Krokodile zu sehen bekam, so wurde mir von den Eingeborenen, außer hier, nur noch einmal auf Guap ein Schädel dieses Sauriers angeboten, und später sah ich einen in Humboldt-Bai.
Da die Leute noch vor Einbruch der Dunkelheit durch die Brandung mußten, so machten sie sich, Gott sei Dank! nach und nach auf den Weg und ich pries den Himmel als das letzte »i, i, i-jah« verhallte. Ja, das war wieder einmal ein schwerer, aufreibender Tag gewesen, dessen Errungenschaften, unter Geduldproben der härtesten Art erworben, hauptsächlich das Museum für Völkerkunde in Berlin bereichern halfen, das aus diesem Gebiete vorher kaum etwas besaß.
Von d'Urville gesichtet. — Alte Glasperlen. — Einfahrt von Humboldt-Bai. — Samoa-Cove. — Erster Eindruck der Eingeborenen. — Besuch von Beccari-Cove. — Pfahldörfer im Wasser. — Merkwürdiger Baustil. — Inneres eines Hauses. — Frauen. — Taschendiebe. — »Tempel« in Tobadi. — Sein Inneres. — Staunenswerte Konstruktion. — Kein Tempel, sondern Versammlungshaus. — »Heilige« Flöten. — Holzschnitzereien. — Äußerer Schmuck. — Großartiges Bauwerk der Steinzeit. — Betrachtungen über die Erbauer. — Hollands Hoheitszeichen. — Wißbegierde. — Dörfer und Bevölkerung. — Zurück an Bord. — Wieder Tätowierung. — Tauschhandel unmöglich. — Wieder in See. — Le Maire-Inseln. — Blosseville. — Lesson. — Vulkanische Thätigkeit. — Hansa-Vulkan. — Wieder an der Küste. — Laing-Insel. — Hatzfeldthafen. — Eingeborene. — Ethnologisches. — Versprechendes Land. — Wieder in Astrolabe-Bai. — Kuram und die Flagge. — Hauptresultate der Reise. — Heimwärts. — Meerestiere. — Vögel. — Delphine. — Dolphin und Bonite. — Fliegende Fische. — Schildkröten. — Wiedersehen in See. — Befreite Sklaven. — Wieder in Blumenthal. — Auflösung der Station. — Abschied von der Samoa.
Der Eingang zu der Bai, vor welcher wir lagen, wird keinem Schiffe entgehen können, das von Angriffshafen nahe der Küste westlich segelt. Dumont d'Urville befand sich im August 1827 auf seiner Weltreise mit der Astrolabe in diesem Falle. Er benannte das geschlossene Becken nach unserem großen Landsmanne, Humboldt-Bai;[S. 348] die beiden Felsvorsprünge, welche die Einfahrt so kenntlich markieren, nach seinen eigenen: Kap Bonpland und Kap Caillié, und dabei blieb es. Denn erst dreißig Jahre später (1858) lief das holländische Kriegsschiff »Etna« zum erstenmal in die Bai ein, und so erhielten wir vier Jahre später die erste Kunde über dieselbe. Jedenfalls haben aber schon Portugiesen und Spanier im sechzehnten Jahrhundert diese Küste bereits berührt, wenn sich darüber auch keine sicheren Nachweise mehr erbringen lassen. Wie aber schon Schouten 1616 auf den Arimoa-Inseln eiserne Kessel von spanischer Arbeit bei den Eingeborenen vorfand, so erhielt ich am Sechstroh Belegstücke aus jenen Zeiten der ersten Entdeckungsfahrten. Bei einer Musterung der dort gekauften Brustschilde (XXIII. 2) fand ich zu meiner Überraschung unter den landesüblichen Abrusbohnen auch zwei fremde Gegenstände aufgeklebt. Sie erwiesen sich als Hälften einer schönen länglich runden (12 cm langen) Mosaikglasperle, merkwürdigerweise ein und desselben Stückes, welche ich sogleich als eine altvenezianische erkannte, was von Professor Salviati später bestätigt wurde. Von ähnlicher Herkunft ist ohne Zweifel das berühmte »Palau-Geld«[88]; während dasselbe aber dort noch heute als kostbar betrachtet wird, ist die Wertschätzung für alte Glasperlen im Laufe der Zeit bei den Papuas verloren gegangen und ich rettete wahrscheinlich ein paar der letzten Reste.
In der Frühe des anderen Tages (17. Mai) brachen wir von unserem Ankerplatze auf, passierten die kaum mehr als zwei Meilen entfernte holländische Grenze, ohne von Zollbeamten aufgehalten zu werden und dampften nach Humboldt-Bai, welche bald den folgenden Anblick bot (S. 349).
Der Hügel im Vordergrund links, mit den kahlen (rot und weiß gefärbten) Felsflecken ist Kap Bonpland (wohl nicht höher als 500 bis 600 Fuß), die Bergpyramide in der Tiefe der Mera, eine treffliche Landmarke für aus Ost kommende Schiffe und Wegweiser zum[S. 349] besten Ankerplatze. Er mag an 800 bis 1000 Fuß hoch sein und erhielt den bezeichnenden Namen mera = rot, weil sich in der dichten Bewaldung ein ziegelroter Streif schon von weitem bemerkbar macht, der von rotem Thon herrührt. Kap Caillié, die nordwestliche Ecke der Einfahrt, trat erst später deutlich hervor als ein ca. 400–500 Fuß hoher, steiler, dichtbewaldeter Hügel, mit einer kahlen Felsstelle an der Basis. Die Entfernung zwischen den beiden Kaps beträgt ca. vier Meilen, die Tiefe der ziemlich halbkreisförmigen Bai, deren Pforten sie bilden, etwa ebenso viel. Da uns, wie erwähnt, eine Spezialkarte fehlte, so mußten wir in diesem ausgedehnten Wasserbecken erst einen Ankerplatz suchen. Die Aussichten dafür sahen nicht eben günstig aus: soweit das Auge reichte, nichts als Sandstrand mit Kokospalmen und — Brandung. Als wir aber den letzten hügeligen Vorsprung (Hagenaarshoek) passierten, öffnete sich in Südost eine hübsche kleine Buchtung, mit einigen kleinen Inseln (Muskiet- und Meeuweneiland) oder vielmehr bewachsenen Felsen am Eingange und in diese schlüpfte die Samoa hinein und ankerte in fünf Faden. Da lagen wir gar prächtig und vor allem ruhig; denn nur Vogelstimmen ertönten aus dem dichten Urwalde, welcher die »Samoa-Cove«[S. 350] (wie ich sie später nannte) säumt, und nirgends waren Anzeichen von Menschen zu sehen oder zu hören. Und das sollte Humboldt-Bai sein mit den wunderbaren Pfahlbauten, den lärmenden und zudringlichen Eingeborenen, über die ich selbst geschrieben hatte? Das war freilich schon lange her, und in zwanzig Jahren kann das Gedächtnis über so entfernte Gegenden, die man nicht aus eigener Anschauung kennt, wohl wackelig werden. Ja, ganz richtig! ich hatte mich geirrt und die gesuchte Binnenbai mußte ja gerade in entgegengesetzter Richtung in West liegen. Sehen konnte man sie freilich nicht; nur kahle grasige Berge, sanft abfallende Ausläufer des Cyclopgebirges[89], dessen Gipfel häufig Wolken einhüllten, traten dem Auge wenig anlockend entgegen, aber hinter einem felsigen Hügel, da mußte das gesuchte Ziel liegen.
Diesmal irrten wir uns nicht, denn noch während des Ankerhievens wirbelten Rauchsäulen in jener Gegend auf, zum Zeichen, daß auch wir bemerkt waren. Und als wir längs der Küste, die aus einem fast ununterbrochenen Kokoswald zu bestehen scheint, in Fahrt waren, da kamen hinter jenem Felsenhügel bereits Kanus hervor, — eins, zwei, — sechs, — eine ganze Menge! Als handle es sich um eine Regatta, suchte ein Kanu das andere zu überholen, denn jedes wollte ja das erste längsseit sein, um zuerst beschenkt zu werden, wie dies die Eingeborenen im Verkehr mit Weißen gelernt hatten. Ja, diese Leute kannten bereits Schiffe, das konnte man schon am Ersten sehen, der herankam. Er wußte gleich, wo er sich festhalten müsse, um an Bord zu voltigieren, und ich hatte wieder Arbeit, um schmutzige Papuafinger, die sich bereits an die Reiling klammerten, los zu machen und ihre Besitzer ins Kanu zurück zu spedieren. Ganz nahe des felsigen Hügels, der, wie sich später zeigte, das Ende der Landzunge Anessau (Rotshoek der holländischen Karte) ist, ankerte die »Samoa« heut zum zweitenmal. Da hatten wir nun bald die gefürchteten Humboldtianer in jeder Auswahl um uns, und immer mehr Kanus[S. 351] brachten neue Zuschauer um jene Felsenecke heran. Auch aus Nord von den Mathilden- und Magdalenen-Inseln vor Challenger-Cove zeigten sich Segel. Der erste Eindruck dieser Leute war allerdings, auch für das an Papuas gewöhnte Auge, kein günstiger, schon deshalb weil sie, mit Ausnahme des bekannten Halsstrickchens und Grasarmbandes, total unbekleidet waren. Doch bemerkten wir auch bei ihnen einzeln die bereits (S. 337) erwähnten Kalebassen. Hautkrankheiten, namentlich Ichthyosis, waren nicht so häufig als anderwärts aber ich bemerkte eine Menge Leute mit Pockennarben, anscheinend vierzig Jahre alte Individuen. Im übrigen waren aber auch diese Eingeborenen echte Papuas, im allgemeinen vielleicht von etwas dunklerer Hautfarbe als an der Ostspitze, aber es gab, wie überall, auch hellere Individuen (bis Nr. 30). Der vorherrschende Färbungston hielt sich zwischen Nr. 28 und 29 aber mehr zu 28 neigend. Das wenig gepflegte Haar ist echt melanesisch. Powells Angabe, die hiesigen Eingeborenen seien »von mehr malayischem Typus«, fand ich daher nicht zutreffend, auch war keiner, der ein holländisches, geschweige ein englisches Wort verstanden hätte. Die guten Leute schienen übrigens ziemlich verblüfft, nicht an Bord kommen zu dürfen, betrugen sich aber nicht schlimmer als ihre Nachbarn am Sechstroh. Die Kanus, ganz in der Bauart wie dort, und mit ebensolchen geschnitzten Schnabelaufsätzen, trugen meist nur drei bis sechs, höchstens acht Mann. Ein alter pockennarbiger Kerl offerierte mir sehr bereitwillig seine Wasserdroschke, um mich in die Nebenbai zu rudern, was ich aber freundlich ausschlug, da ich mein Leben bereits zweimal in solchen Seelentränkern riskiert hatte. Freilich »der Ausleger verhindert das Umschlagen«, steht in den meisten Büchern, aber wer so manches Kanu umkippen sah wie ich, der weiß das besser. In unserem Whaleboot konnte das nicht passieren, welches zur Fahrt soeben klar gemacht wurde, zu der sich auch unsere Mioko-Schwarzen als Ruderer in den besten Staat werfen mußten. Sie sahen bald in roten englischen Uniformröcken, Mützen der »Heilsarmee«, Sachen, die ich für derartige Gelegenheiten eigens in Sydney gekauft hatte und in weißen Pantalons gar stattlich aus, machten aber betrübte, lange Gesichter.[S. 352] »Doctor! me like Market!« (ich wünsche eine Muskete), sagte Jimmy, »bye and bye Kanaker he fight, me kill« (damit ich die Kanaker totschießen kann, wenn sie uns angreifen). — »Ja, nicht wahr? das möchtest du wohl, so ein bißchen schießen, aus purer Angst! es wäre auch groß schade, wenn einer von euch erschlagen würde!« gab ich ihm tröstlich zur Antwort — und »down! pull« (rein! rudert!) da gingen wir schon dahin. Aber nicht in Windeseile, denn unsere furchtsamen Kanaker ließen sich Zeit und bemühten sich nicht, eine Wettfahrt einzugehen, zu welcher die uns begleitenden zum Teil nur von Frauen geführten Kanus so sehr reizten. Übrigens setzt bei Ebbezeit, wie wir sie hatten, ein starker Strom um die Felsenhuk, den die Eingeborenen, sich dicht am Ufer haltend, vermeiden konnten. Alle Erwartungen waren gespannt, als wir um die verhängnisvolle Ecke in die kleine Nebenbai einbogen, die ich später Beccari-Cove nannte. Sie zeigt im Norden dichtbewaldete Felsenhügel, zum Teil mit Plantagen, weiter West höhere Berge; der südlichere Kokosuferstreif endet in eine ausgedehnte Sand- und Schlickbank, die bei Hochwasser überflutet wird. Noch zeigte sich nichts von Siedelungen, aber dort, hinter einer zweiten Huk, in einer kleinen Buchtung, da standen Häuser im Wasser, nur sieben, das Dorf Ungrau. Ja, solche Pfahlbauten hatte ich in Neu-Guinea noch nirgend gesehen; sie erschienen gegen die armseligen Hütten an der Südostküste (P. Moresby, Hood-Bai etc.), wie Paläste. Das Separatbild S. 352 zeigt einen Teil des Dorfes Tobadi (auch Tobari ausgesprochen), der Perle von Humboldt-Bai und des Pfahlbauertums der Steinzeit überhaupt, wie ich es an Ort und Stelle skizzierte. Das Dorf liegt ebenfalls in einer kleinen Einbuchtung versteckt, der nächsten von Ungrau, und machte mit seinen düsteren, von Wetter und Rauch gebräunten Häusern, einen äußerst fremdartigen Eindruck. Von weitem glaubt man ungeheuer große Wigwams, oder Ostiaken-Dschums, im Wasser schwimmend zu erblicken, aber bald sehen wir, daß es solide auf Pfählen ruhende Bauten sind, die im wesentlichen aus einem spitzen, meist viereckigen Dache bestehen, dessen Spitze 30 Fuß und mehr Höhe erreichen mag. Sie ist häufig mit einer runden Holzscheibe[S. 353] gekrönt, auf der als besonderer Schmuck eine roh geschnitzte, menschliche Figur, in sitzender Stellung hockt. Diese aus Ried oder Gras sehr sorgfältig gedeckten Dächer ruhen auf ca. fünf Fuß hohen Seitenwänden aus gespaltenem Bambu und haben zwei gegenüber liegende Eingänge, vor denen Plattformen errichtet sind. Letztere ragen (bei Ebbe) an sieben bis neun Fuß über die Wasserfläche und stehen ebenfalls auf Pfählen. Dabei darf man sich aber nicht Pfähle nach unseren Begriffen, starke, gerade, behauene Stammstücke vorstellen, sondern schiefe, krumme Stämmchen, die gegenüber dem gewaltigen Bau unverhältnismäßig dünn erscheinen.
Ohne viel zu fragen, voltigierten wir, über den Rücken eines Schwarzen, auf die Plattform, deren Betreten allerdings Vorsicht erheischt, da sie aus morschen, wackeligen Brettern (Seitenborden alter Kanus) besteht, und treten, ein Heck überkletternd, ins Innere. Zunächst ist natürlich nicht viel zu sehen, denn die Thüren und die Öffnung in der Dachspitze spenden nicht viel Licht, aber das Auge gewöhnt sich nach und nach an die Dunkelheit. So konnte ich denn den Grundriß eines solchen Hauses skizzieren, wie ihn Taf. II. 2 des Atlas darstellt. Es ist ein Familienhaus mit Scheidewänden in jeder Ecke, beherbergt also voraussichtlich vier Familienverbände. Die Feuerstellen bestehen aus viereckigen mit Sand gefüllten Rahmen und sind mit Töpfen besetzt, die überhaupt einen hervorragenden Teil des Hausrates bilden und zu denen der Mera das Material liefert. Diese Töpfe (Uro) haben dieselben Formen als am Sechstroh (IV, 1, 2), sind oft von bedeutender Größe und zuweilen mit bunter Malerei, in Schwarz, Weiß, Rot, zum Teil Figuren von Vögeln und Fischen darstellend, verziert. Den meisten Hausrat hatte man hängend, zum Teil auf großen Horden untergebracht und noch besonders mit etwas höher befestigten, großen hölzernen Scheiben bedeckt, um die Vorräte vor den Ratten zu sichern, von denen es unter solchen Grasdächern wimmelt. Da der beständige Rauch alles schwärzt, so sind die meisten Gegenstände, wie dies überhaupt Papuasitte ist, in Blätter oder Tapa eingeschlagen. Doch bemerkte ich schöne Fischnetze und weitmaschige Netze aus dicken Stricken, die bei den Treibjagden[S. 354] auf Wildschweine dienen; an Waffen nur lange Speere (keine Keulen, Schilde und Kürasse). Gerüste zum Schlafen fehlen, da dafür die sehr saubere und ebene Diele benutzt wird, welche aus schmal gespaltenen (ca. drei Zoll breiten) Latten (wohl von der Betelpalme) besteht. Als Kopfunterlage dienen die bekannten kleinen Bänkchen (S. 312).
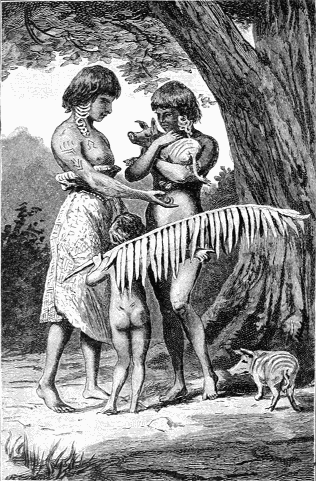
Die Eingeborenen betrugen sich übrigens sehr anständig, ja sogar gastfrei, denn eine alte Frau gab uns etliche geröstete, sehr gute Yams und in einer Schöpfkelle aus Kokosnuß Wasser zum Trinken. Das galt aber nicht als Begrüßungszeremonie, sondern geschah nur ganz zufällig. Es ging uns also besser als den Besuchern vom »Challenger«, die nicht einmal in ein Haus gelassen wurden. Freilich machten wir nicht viel Umstände, und andererseits hütete ich mich wohl, die Hobeleisen, Messer und Glasperlen, die ich in einer Tasche bei mir trug, zu zeigen, sonst wäre es mit Notizenmachen aus gewesen und gewiß zu einem Radau gekommen. Ich begnügte mich, nur alte Weiber mit Streifen roten Zeuges zutraulich zu machen, und diese lockten dann auch die anfangs schreiend ausreißende[S. 355] jüngere Damenwelt herbei, von welcher die vorherige Abbildung Typen zeigt.
Verheiratete tragen ein großes Stück Tapa, mit einem Strick um die Hüften befestigt, das sehr dezent und ganz wie die Lavalavas der Polynesier kleidet. Diese Tapa ist zuweilen weiß gebleicht oder in bunten Mustern bemalt; zum Festbinden dienen manchmal hübsche Schnüre aus Coix- und Adenanthera-Kernen, mit allerlei Anhängseln. Unverheiratete begnügten sich, wenn auch schon in heiratsfähigem Alter, mit dem bescheidenen Kostüm Evens vor dem Fall. Aber die Mädchen eilten bei unserer Ankunft ihre Blöße, durch ein Stück Tapa oder ein Faserschürzchen zu decken. Auch diese hübschen, dunklen Gestalten wurden mit roten Streifen bedacht, machten dem Vorrate aber bald gegen meinen Willen ein Ende. Die Zeugfetzen folgten nämlich Dallmanns seidenem Taschentuche nach, das schon im ersten Hause gestohlen worden war. Ja, das mahnte zur Vorsicht; denn diese lieben Naturkinder verstanden so geschickt als ein großstädtischer Taschendieb zu stehlen.
Von großen spitzdachigen Familienhäusern waren in Tobadi[90], das im ganzen nur 32 Baulichkeiten zählte, nur ein Dutzend vorhanden, die anderen hatten die gewöhnliche Hausform mit schrägem, meist geradfirstigem, zuweilen sattelförmigem Dach.
Über einen nichts weniger als bequemen Steg, aus einem unbehauenen Baumstamme, turnten wir nach der Plattform des merkwürdigsten Bauwerkes von Tobadi, dem sogenannten »Tempel« hinüber. Schon diese an den Längsseiten ca. 50–60 Fuß messende Plattform, war ein gewaltiges Werk, konnte ihren Zweck als Tanzplatz aber nicht mehr erfüllen, da sie bedenkliche Senkungen zeigte.
Wie in der Beschreibung der Etnaexpedition zu lesen, hatten sich die ersten Besucher nur dadurch Erlaubnis zum Eintritt verschafft, daß sie als Zeichen der Verehrung vor dem Tempel niederknieten, wovon die Papuas wohl wenig begriffen haben dürften. Wir aber[S. 356] machten keine langen Faxen. Ich sagte den Leuten auch hier, »daß ich Finsch aus Bremen« und ein »Wapimé« (Freund) sei, und hie und da einen auf die Schultern klopfend, andere sanft zurückdrängend, befanden wir uns bald im Heiligtum. Diesem »fait accompli« gegenüber konnten die Eingeborenen nichts Besseres thun, als die gewöhnlichen Friedenszeichen anzubieten: niederzusitzen und Betel, was wir durch einige Zigarrenstummel erwiderten. Es litt mich aber nicht lange auf dem Baststück, das hier die Stelle von Matten vertritt, zu hocken, sondern ich begann, wie stets, sogleich mit Aufzeichnungen, denen der Grundriß (T. II. 1) sein Entstehen verdankt. Ein schräger Steg führte von der Plattform auf die etwas höher liegende Hausdiele, die 40 bis 50 Fuß Durchmesser haben mochte und so schön war als in den Familienhäusern. Erst im Innern konnte man recht die staunenswerte Konstruktion des an 60 Fuß hohen Daches bewundern, um so besser, als die im obersten Teil offene Spitze ziemlich viel Licht einließ. Das ist ein Gewirr von schiefen und geraden Stützen und Querhölzern in allen Richtungen, in welchen man, auch ohne Architekt zu sein, doch System erkennen konnte, und dabei waren alle Teile nur mittelst Lianen oder Stricken zusammengebunden. Dem ganzen merkwürdigen Turmbau schienen übrigens nur vier Hauptpfeiler als Grundfesten zu dienen; die niedrigen Seitenwände des von außen achteckigen Gebäudes schlossen in den Ecken gerundet ab, so daß das Innere fast kreisförmig erschien. Feuerstätten und Kopfbänkchen zeigten, daß das Haus auch als Wohnung dient und zwar für die unverheiratete junge Männerwelt, denn alte Junggesellen giebt es bei den Papuas wohl im ganzen wenig. Der so berühmte »Tempel« hat eben mit Religion nichts zu thun und ist einfach eins jener Versammlungshäuser der Männer, wie sie überall in Melanesien vorkommen und die aus bekannten Gründen für das weibliche Geschlecht »tabu« sind. Ja, in diesem Tempel mochte schon manches Festessen gehalten worden sein, denn wohl ein paar Hundert Schweineschädel, in allen Stadien der Verräucherung, waren in Querleisten eingesteckt und bildeten den hauptsächlichsten Ausputz. Wie das stärkere Geschlecht bei den Papuas in ungalanter[S. 357] Weise die Damenwelt am Bankett nicht teilnehmen läßt, um das »Poro« (Schwein) allein verzehren zu können, so besorgt es auch den Tanz ohne die schöneren Hälften. Das übliche Begleitinstrument, die Holztrommel (Meschink), in der bekannten Form, fehlte auch im »Tempel« nicht, ebenso wenig als das unerläßliche Lärmrequisit, eine Signaltrommel (Kaduar). Sie war außerordentlich groß, wohl 10 bis 12 Fuß lang, kanuförmig und der besseren Resonanz wegen aufgehangen. Bald hätte ich die Flöten (Ariho) vergessen, auf denen »die Jünglinge des Tempels bei den religiösen Tänzen musizieren«, wie es in der Etnareise heißt. Ich versuchte sogleich eine dieser »heiligen« Flöten, was die guten Eingeborenen-Seelen unendlich amüsierte, denn ich brachte keinen Ton hervor. Hätte ich es gewagt, ein Hobeleisen hervorzuholen, so würden sie mir gern eine solche Flöte verkauft haben, so mußte ich mich mit einer Abbildung (XIII. 5) begnügen. Es waren eben Flöten, Rohrflöten, wie anderwärts in Melanesien, ohne alle religiöse Bedeutung, sind aber wahrscheinlich wie manche andere Instrumente für die Frauen »tabu«. Waffen sah ich nicht, wahrscheinlich weil die Männer alle Vorräte mit in die Kanus geschleppt hatten; ebenso wenig hier, wie in irgend einem anderen Hause, Menschenschädel. Bloß unter den Talismanen, welche an den Brustschilden befestigt werden (meist Stückchen Rinde, Blätter und Vogelknochen) habe ich ein paarmal ein menschliches Schlüsselbein gesehen. Figuren, sogenannte »Götzen«, die man doch eigentlich in einem »Heidentempel« erwartet, fehlten ebenfalls. Nur im Vestibül standen drei kleine, anscheinend aus dem weichen, zelligen Stamme von Cycas roh geschnitzte Figuren (T. XV. 8), wohl die schüchternen Versuche angehender Künstler der Holzbildnerei. Dafür diente der »Tempel« außerdem als Werkstatt, und ich hatte die seltene Freude, Holzschnitzer der Steinzeit noch in voller Thätigkeit zu sehen. Mehrere junge Leute arbeiteten an einem ca. 15 Fuß langen Fries (Drom), der Figuren von Eingeborenen, Eidechsen und Fischen zum Teil zierlich durchbrochen ausgearbeitet zeigte. Mit Flußmuscheln (Batissa) und Raspeln aus Rochenhaut schabten und feilten noch einige daran, während andere bereits mit Bemalen begonnen hatten. Die[S. 358] Farben (schwarz, weiß, rot und ockergelb) waren in Topfscherben oder Kokosnußschalen angerieben und wurden mit Federn als Pinsel aufgetragen. An sonstigem Ausputz bemerkte ich nur noch lange Büschel von Pflanzenfaser, ebenfalls Erinnerungszeichen an gehaltene Feste.
Die alte Schuld der total unrichtigen Abbildung des »Tempels« aus dem Reisewerk der Etna durch Kopie zur weiteren Verbreitung verholfen zu haben, konnte ich nach fast zwanzig Jahren sühnen durch eine an Ort und Stelle aufgenommene korrekte Skizze (vergl. Separatbild). Derselben sind nur einige Worte zur Beschreibung des Äußeren hinzuzufügen. Die vier Absätze des achteckigen Bauwerkes tragen buntbemalte Holzschnitzereien, Friese, wie wir sie im Innern soeben arbeiten sahen; vom unteren Dachrande hängen lange Fransen aus Palmfaser und (wie auch an anderen Stellen) Festons von aufgereihten Eierschalen (wohl Krokodil oder Megapodien), im Dache selbst stecken Palmwedel und verschiedene buntbemalte Tierfiguren. Sie stellen Vögel, Eidechsen und besonders kenntlich Fische dar; auf der äußersten Dachspitze thront eine menschliche Figur, darüber ein Vogel, in fliegender Stellung, auf dem lärmende Glanzstare (Lamprotornis metallicus) lustig ihr Wesen trieben. Gleich neben dem Tabuhause baute man an einem anderen ähnlichen großen Gebäude, das schöne Gelegenheit zu Pfahlbau-Studien gab. Ich will aber nur erwähnen, daß das Gerüst (Hauptbild S. 352 in der Mitte des Hintergrundes) mit unseren baupolizeilichen Verordnungen sehr im Widerspruch stand und eben für Papuas praktikabel war, die im Klettern Großartiges leisten. Voll Bewunderung nahm ich Abschied von dem Bauwerk. Wenn der Ankömmling die Verfertiger desselben, draußen in der Bai in ihren Kanus, als »nackte Wilde« bezeichnen durfte, so mußte er ihnen das angesichts dieser Leistung im stillen abbitten. Menschen, die derartiges fertig bringen, sind gewiß keine Wilden mehr, sondern haben sich bereits auf die Stufen einer Kultur hinaufgeschwungen, die nur zu wenig bekannt ist, um Anerkennung zu finden. Dem civilisierten Herrn der Schöpfung ist es eben mit der Civilisation eingeimpft, seine nacktgehenden Speciesgenossen für wild und schamlos[S. 359] und wo möglich für bildungsunfähig obendrein zu halten. Das sind die Papuas nun aber keineswegs. Ob sich diese Bürger der Steinperiode jedoch in dem von uns gewünschten Sinne entwickeln lassen werden, das ist freilich eine ganz andere Frage, deren Beantwortung bis jetzt nur sehr ungenügend versucht wurde. An Bildungsfähigkeit mangelt es ihnen gewiß nicht, aber es ist zu bezweifeln, ob sie die Notwendigkeit, eine höhere Bildungsstufe zu erlangen, überhaupt einsehen und bei gebotener Gelegenheit benutzen werden. Jedenfalls fühlt sich der Papua im Kulturzustande der Steinzeit sehr wohl; warum sollte er also eine Änderung wünschen, die nur nach unseren Anschauungen eine Aufbesserung seiner Verhältnisse ist. Daß solche sogenannte Naturmenschen viel mehr zu leisten verstehen und leisten, als ihre geringen Bedürfnisse erheischen, das zeigte sich wieder einmal recht deutlich angesichts dieser Bauwerke. Wozu diese hohen, mühsam herzustellenden Dächer? kleine unbedeutende Hütten genügen ja anderwärts! Aber auch dem Papua wohnt Schönheitssinn inne. Er beseelt ihn eine Menge Dinge zu verzieren und auszuschmücken, die ohne diesen Kunstfleiß ihren Zwecken ebenso gut entsprechen würden.
(S. 358.)
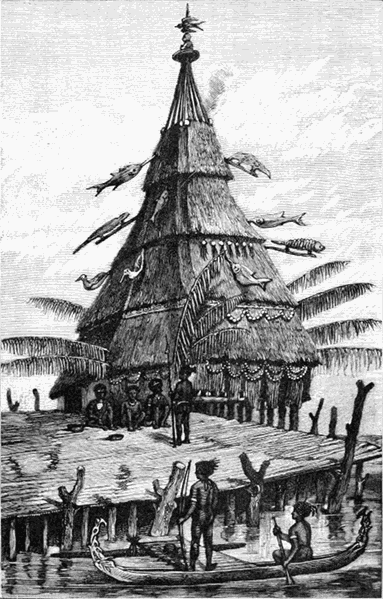
Zu den großartigsten Denkmälern dieses Kunstfleißes der Steinzeit zählt ohne Zweifel das Tabuhaus in Tobadi. Von einer Handvoll Menschen, nur im Besitz von Steingeräten, errichtet, ist es für diese Periode ebenbürtig einer Pyramide zu vergleichen, und würdig der Bewunderung, welche wir jenen Riesenbauten zollen. Wie viele solche Denksteine aus dem Wiegenalter der Menschheit sind aber bereits dahingeschwunden, unergründet für die civilisierte Welt, und wie bald werden ihnen diese nachfolgen. Schon hängt das Damoklesschwert auch über dieser bisher fast unberührten Oase der Steinzeit. Denn, wenn der Plan einer regelmäßigen Dampferfahrt nach Humboldt-Bai zur Ausführung gelangt, dann werden auch hier bald die letzten Reste jener Periode verschwunden sein.
Kommerzielle Erfolge dürfte eine solche Dampferlinie wohl kaum zu erwarten haben, da außer dem bißchen Kopra, das vielleicht den einen oder anderen Trader ernährt, sich wenig holen lassen wird.[S. 360] Aber die niederländisch-indische Regierung will wahrscheinlich ihre Herrschaft auch einmal in anderer kräftigerer Weise als mit dem bloßen »Je maintiendra« ihres Wappenschildes zeigen. Wir entdeckten dieses ziemlich nutzlose Symbol, womit Holland bis jetzt fast ausschließend seinen Besitz, aber nicht zugleich seine Macht, in Neu-Guinea kennzeichnet, ganz zufälligerweise. Das »wapenbord«, eine gußeiserne Platte mit dem holländischen Wappen und der obigen Devise, war sorgfältig mit Rotang an einem Hauspfosten befestigt, und schien nach den frischen Farben zu urteilen noch neu[91] zu sein. Ja, diese Wappenschilde haben den holländischen Kriegsschiffen schon manchmal etwas zu thun gegeben, den Eingeborenen aber ein paar starke Nägel verschafft. Denn das scheint nach ihrer Auffassung der einzige Zweck, und auch die hiesigen Eingeborenen würden mir das nutzlose Gußeisen, das sie überhaupt gar nicht als »szigo« (Eisen), anerkannten, für irgend eine Kleinigkeit verkauft haben. Ich suchte ihnen aber die hohe Bedeutung dieses Tabuzeichens des weißen Mannes klar zu machen und belobte sie für die gute Verwahrung desselben.
Häuptlinge von irgend welcher Bedeutung scheinen in Humboldt-Bai, wie meist in Neu-Guinea, zu fehlen. Aber einige schwarz- und rotbemalte Kerls mit viel roten Hibiscusblumen im Haar, wahrscheinlich Honoratioren Tobadi's, hatten sich bald angefreundet und spielten die Führer, inkommodierten indes mehr, als sie nützten. Die Wißbegierde dieser Leute war wirklich lobenswert; sie wollten alles sehen, in die Hand nehmen und — selbst Taschenuhr, Feldstecher und ähnliche Dinge — geschenkt haben. So zog mir einer den Schuh aus, während ich den Tempel zeichnete, indes ein anderer meine Taschen zu visitieren versuchte. Auffallenderweise schienen sie Gewehre und und deren Wirkung nicht zu kennen.
Mit einigen der neuen Freunde kletterten wir ins Boot um an Bord zurückzukehren, da sich die Dörfer links am Eingange von[S. 361] Beccari-Cove doch nicht erreichen ließen. Ich sah hier ein größeres, aus acht großen und acht kleinen Häusern bestehend, das Ingros genannt wurde, dahinter auf einer kleinen Insel (Janus-Eiland) noch einige Häuser: Kai. Diese Dörfer lagen jetzt bei Ebbe unnahbar auf einer großen Sand- und Schlammbank, welche die Beccari-Cove nach Süd zu schließen schien. Doch ließ sich in der nördlichen Ecke hinter Tobadi noch eine kleine Insel, Timsau (Slavante-Eiland der holländischen Karte) erblicken, auf der anscheinend Häuser stehen. Beccari-Cove zieht sich übrigens bei Hochwasser noch ziemlich weit nach Südost, hinter dem schmalen Kokosuferstreif hin, ist aber für Schiffe unzugänglich. Alles in allem mag es, mit Einbegriff der Siedelungen in Challenger-Cove, elf Dörfer in Humboldt-Bai geben, hinsichtlich deren Namen zum Teil noch arge Verwirrung herrscht. Die Gesamtbevölkerung schätze ich auf 1500 bis 1800, gegen 5000 in dem Etnareisewerk. Dieser Unterschied rührt wohl weniger von dem Rückgange der Bevölkerung her, sondern liegt hauptsächlich an den viel zu hoch gegriffenen Schätzungen der ersten Besucher.
Die kleine »Samoa« war von weitem kaum zu erkennen; nur Masten und Schornstein ragten aus einer wirren Masse von Kanus hervor. Herr, du meine Güte! welch ein Gewimmel! etliche siebenzig Kanus lagen um den Dampfer, als wäre Jahrmarkt, und es kostete Mühe, sich durchzuarbeiten. Ja, ich wollte gern glauben, daß der Steuermann und die Zehn, welche ihm noch geblieben waren, alle Mühe aufwenden mußten, um die Gesellschaft von Bord abzuhalten. Jetzt kam Hilfe, denn ich besaß ja einigermaßen Erfahrung, um das Geschäft mit übernehmen zu können. Da die »Samoa« so niedrig über Wasser lag, daß ein im Kanu stehender Mann mit dem ausgestreckten Arme den Deckrand erreichen konnte, so war es den Eingeborenen freilich leichter gemacht als auf den sieben Kriegsschiffen, welche sie bisher kennen lernten. Bald an Steuer- bald an Backbord zum Rechten sehend, hatte ich gute Gelegenheit, das interessante Bild zu betrachten. Die Männer glichen ganz den vorhergesehenen, und der junge Krieger von Massilia (S. 333), könnte ebenso gut als Type eines Humboldtianers gelten. Gewöhnlich war ihr Ausputz[S. 362] aber nicht so reich als an diesem, und rote Bemalung, oft das ganze Gesicht und Brust bedeckend, bildete einen hervorragenden Teil desselben, wie Hibiscusblumen und Blätterschmuck. Ziernarben, oft sehr regelmäßige auffallend erhabene Figuren bildend, fanden sich nicht nur an Männern, sondern auch bei Frauen. Die beigegebene Abbildung zeigt eine solche Ziernarbe auf der linken Achsel und zugleich die eigentümlichen Muster der Tätowierung. Ich hatte diese Körperverschönerung seit Dinner-Insel nicht mehr gesehen und freute mich, sie hier wieder zu finden. Übrigens schienen nur Frauen tätowiert und trugen das Haar in dünnen, rotgefärbten Strähnen, ganz wie die Mädchen in Friedrich-Wilhelmshafen (S. 108). Bei der Mehrzahl der Weiber war auf das Haar keine Pflege verwendet. Wenige hatten auch einen so reichen Ohrschmuck an dünnen Schildpattreifen aufzuweisen als die hübsche Frau unseres Bildes. Es gab übrigens mehr niedliche Gesichter, und Humboldt-Bai scheint in ganz Neu-Guinea die schönsten Frauen zu besitzen.
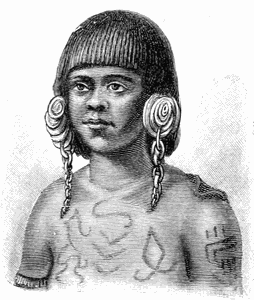
Die guten Geschöpfe kamen gleich kanuweis an und brachten eine Menge Bananen, Yams, Taro, Zuckerrohr, wenig Kokos (Niu) und geräucherte Fische, die sie gern los sein wollten. Aber an Tauschhandel war bei dem Gewimmel gar nicht zu denken. Wollte man irgend etwas haben, dann kletterten gleich so viele herauf, daß man Last hatte, sie wieder herunterzuwerfen. Dazu ein Rufen und Streiten untereinander, kurzum ein unbeschreiblicher Lärm. Es war gut, daß ich meine Einkäufe am Sechstroh gemacht hatte, und ich konnte mein ethnologisches Gewissen beruhigen, indem alle Gegenstände, Geräte, Schmucksachen u. s. w. mit den dortigen ganz übereinstimmten. Da die Gesellschaft nicht an Bord kommen durfte, also nicht stehlen[S. 363] konnte, wurde sie immer zudringlicher. »Whistle«! (pfeife) Da schrillte die Dampfpfeife, aber diesmal wirkungslos, denn die Leute kannten ja ihren Ton. Etwas mehr Luft schaffte Abblasen des heißen Wasserdampfes aus den Ventilen an Bordseite. Da wurde im Augenblick Platz gemacht, und es gab ein Drängeln und Stoßen, wobei mancher Ausleger abknackte. Aber die Sache erwies sich als ganz harmlos und wurde bald unter brüllendem Beifall als Scherz aufgefaßt. Trotz aller Vorsicht war eine Konservebüchse gemaust, dem Thäter der Raub aber sofort abgejagt worden. Er zeigte sich sehr beleidigt und legte schon einen Pfeil auf die Bogensehne, aber gleich wieder nieder, als ihm einige plattdeutsche Flüche an den Kopf flogen. So ein bißchen Anlegen ist ja noch nicht geschossen, das muß man nicht so übel nehmen; es war gewiß nicht bös gemeint. Hatten die Leute Absicht, uns anzugreifen, dann würde nicht ein einzelner angefangen haben, sondern es giebt gleich einen ganzen Hagel von Pfeilen. Und dazu fehlte es nicht an Gelegenheit und Material, da sie ein wahres Arsenal an Bogen und Pfeilen mit sich führten. Da wir mit dem Gesehenen zufrieden sein konnten, so war ein weiteres Abmühen mit den Eingeborenen, das schließlich doch vielleicht zu ernsterem Streit führen konnte, nutzlos und wir lichteten Anker. Eigentlich sollte weiterhin ein ruhigerer Platz für die Nacht aufgesucht werden, aber die Leute schienen unseren Plan zu erraten. Was Hände hatte, versuchte sich am Schiffe festzuhalten und an Bord zu klettern, kurzum die ganze Flottille folgte uns nach. Diese Hetzjagd schien den brüllenden Insassen gerade ein besonderes »Gaudi«, wie der Wiener sagen würde. Das sah wenig nach Ruhe aus, und da wir an dem Lärm und Spektakel gerade genug hatten, so nahmen wir Abschied von Humboldt-Bai und dampften seewärts. In wohlthuender Stille ließ ich die Erlebnisse des Tages an meinem Geiste vorüber ziehen und kam hinsichtlich der Eingeborenen zu dem Schluß, daß auch die vielgeschmähten und verleumdeten Humboldtianer besser sind als ihr Ruf. Überall wird ihre Hinterlist und Verräterei hervorgehoben, aber bis jetzt liegen keinerlei Beweise dafür vor. Schreien und ein mehr als ungeniertes Wesen, das ist ihnen eigen, wie sie auch nicht[S. 364] von Stehlsucht freizusprechen sind. Aber daran sind hauptsächlich die ersten Besucher mit schuld, die sich soviel gefallen ließen und die Schwächen der armen, nackten »Wilden« zu rücksichtsvoll über sich ergehen ließen. Wenn auf Kriegsschiffen allerlei, selbst anscheinend gesicherte Gegenstände gestohlen wurden, wie wäre es da wohl der kleinen »Samoa« ergangen, wenn wir die Gesellschaft an Bord gelassen hätten? Es wurde aber immer gut aufgepaßt, und so kamen während aller unseren Reisen nur ein paar unbedeutende Diebstähle durch Eingeborene vor.
Wir waren wieder einmal in offener See; unter uns tiefblaues Meer, über uns lichtblauer Tropenhimmel, der sich an einem Morgen sogar fast durchaus wolkenlos zeigte, was ich deswegen bemerke, weil dies in diesem Teile der Tropen äußerst selten vorkommt. Der nicht unerhebliche Weststrom, gegen den die »Samoa« tapfer arbeitete, ließ es Kapitän Dallmann, im Hinblick auf den Kohlenvorrat, rätlich erscheinen, direkt nach Mioko zurückzukehren. Aber noch blieb zur Vollendung unserer Küstenfahrt die Strecke von Vulkan-Insel bis Kap Croissilles übrig, und diese Lücke von lumpigen 70 Meilen durfte doch unmöglich ungesehen bleiben. So willigte der Kapitän ein, O.-S.-O. zu steuern, nach jenen Inseln, die sich von Vulkan, ca. 20 Meilen von der Küste, an 80 Meilen weit nach W.-N.-W. hinziehen. D'Urville benannte sie Schouten-Inseln, was deshalb eine Neubenennung nötig macht, weil gleichnamige Inseln an der Küste Neu-Guineas (in Geelvinks-Bai) schon viel früher so getauft wurden. Der Name Le Maire's, des verdienstvollen Gefährten Schouten's, dessen Andenken bis jetzt kein Name auf der Karte Neu-Guineas ehrt, soll deshalb die Stelle des Irrtum erregenden fortan ersetzen.
Wir hatten am zweiten Tage D'Urville-Insel gesichtet und nach und nach kamen auch Roissy, Deblois und Jacquinot zum Vorschein, von denen die erstere die größte und an sechs Meilen lang sein mag. Diese westlichen Le Maire-Inseln erscheinen als dichtbewaldete, mäßig (400–600 Fuß) hohe Bergrücken, von wenig vulkanischem Gepräge, das in Garnot schon deutlicher hervortritt. Diese Insel bildet einen ebenfalls dicht bewaldeten stumpfen Kegel, ca. 600 bis 800 Fuß hoch,[S. 365] scheint aber keine Kokospalmen zu besitzen. Aber eine kleine Insel ca. anderthalb Meilen Südwest davon, die ich Hirt-Insel benannte, ist fast ganz mit solchen bewachsen und voraussichtlich stark bevölkert.

Das Bild eines typischen Vulkans zeigt Blosseville, ein steil aus dem Meere aufsteigender, dichtbewaldeter, ca. 1200 Fuß hoher Kegel, der immer interessanter wurde, je mehr wir ihm näher kamen. Da zeigten sich die kahlen grünen und braunen Flecke als Plantagen, zum Teil mit Kokospalmen, und oben am Kraterrande stand ein großes Dorf mit 20 Häusern, etwas weiter von demselben zählte ich noch zwei Siedelungen von sechs, resp. vier Häusern. Diesen Häusern fehlten nur blinkende Glasfenster und man würde sich in die Heimat versetzt gefühlt haben. Das muß ein luftiges und lustiges Wohnen sein, da oben in ca. 1000 Fuß Höhe, wenn man erst oben ist. Wie die Leute überhaupt hinaufkommen, blieb mir unerklärlich,[S. 366] denn von irgend einem Pfade war, auch mit dem Fernrohr, keine Spur zu entdecken. Wenn die andere Seite der Insel nicht günstigere Verhältnisse bietet, dann können die Bewohner nur in den beiden fast senkrechten Schluchten, wie in einem Schornsteine emporklettern. Aber gesichert sind sie hier, das ist kein Zweifel, und es wird wohl noch lange dauern, ehe ein Weißer auf diesem Hort der Steinzeit mit Bandeisen und Glasperlen erscheint, um Civilisation einzuführen. Schon einige Meilen West von Garnot waren wir aus tiefblauem in scharf abgesetzt tiefgrünes Wasser gekommen und sahen ca. zehn Meilen Südost von Blosseville einen weißen Schaumstreif voraus, hinter dem wir an sieben Meilen durch trüb lehmbraun gefärbtes Wasser dampften. Dasselbe rührt vom Kaiserin Augusta-, Prinz Wilhelm- und Ottilienfluß her, die sich noch 15 Meilen von der nur schwach erkennbaren Küste in dieser Weise kennzeichnen, Färbungsverhältnisse, die nach dem jeweiligen Wasserstande natürlich sehr variieren. Die Kabbelung des östlichen Schaumstreifes »kochte«, wie der Schiffer sagt, so stark, daß Spritzwellen auf Deck schlugen, eine Erscheinung, die wir sonst nirgends beobachteten. Treibholz[92] gab es in Menge, darunter ganze Baumstämme, die Schiffen oft gefährlich werden können. So geriet der »Basilisk« neun Meilen Nordwest von Lesson in ein Gewirr von Treibholz, aus dem er mit Mühe und nicht ungeschunden herauskam. An solchen Kabbelungen pflegen sich Scharen von Fischen zu tummeln und, durch sie angelockt, Vögel (Sterna Bergii, Anous, Fregattvögel und Tölpel), die sich auch gern auf Treibholz niederlassen.
Lesson-Insel, die wegen bedeckter Luft erst später zu sehen war, ist ein getreues Abbild von Blosseville, nur bedeutend größer, an 1800 bis 2000 Fuß hoch und in der oberen Hälfte kahl. Die Wolken, welche meist den Gipfel bedecken, lassen über die vulkanische Thätigkeit Zweifel, aber einmal glaube ich sicher Rauch gesehen zu haben.
Noch vor Sonnenuntergang winkte uns das Feuer von Vulkan-Insel[S. 367] seinen Gruß entgegen, und in der Früh des anderen Tages passierten wir Hansastraße, welche Vulkan und die kleine Aris-Insel im Nordwesten zwei Meilen breit trennt. Letztere Insel ist nichts als ein ca. 200 Fuß hoher, dichtbewaldeter toter Krater, in den man an einer eingestürzten Randstelle förmlich hineinsehen kann. Sie scheint unbewohnt, wie die Nordwestspitze von Vulkan. Wir gingen hart längs der Westküste und sahen die Insel in ihrer ganzen imposanten Schönheit vor uns. Als die Maschine gestoppt wurde, konnte man die unterirdischen Kräfte arbeiten hören, gewaltiges, immer stärker werdendes Brausen, das in ein schwächeres Stöhnen und Ächzen überging, bis es eine Weile ganz schwieg, um bald aufs neue zu beginnen. Das wundersame, unheimliche Geräusch erinnerte an einen Riesenblasebalg und oben, aus der Esse, da wälzten sich gewaltige weiße Rauchmassen; wahrlich eine unterirdische Werkstatt der Natur, die den Beobachter mit stummer Bewunderung erfüllt.
Der stattliche, in seiner Form an den Stromboli erinnernde, aber höhere Berg mag über 4000 Fuß erreichen und ist bis zum oberen Drittel dichtbewaldet, am unteren Teile mit ausgedehnten grünen Flächen und ein paar grünen Hügeln versehen. Das Bett eines alten Lavastromes, den man bis zum Meere verfolgen kann, bildet eine gewaltige Schlucht und weiterhin sieht man die fast senkrechte kahle Wand des gegenwärtigen Hauptkraters, der etwas niedriger als die eigentliche Spitze liegt. Kokospalmen und Menschen, deren Häufigkeit Schouten 1616 gedenkt, waren nur spärlich vertreten. Denn nur an drei Stellen bemerkten wir einige Eingeborene, die mit Zweigen winkten und uns in Kanus einzuholen versuchten. Aber später sahen wir an der Ostseite viele Anzeichen von Bewohntsein in Plantagen und Rauch, und die sanft abfallenden, ausgedehnten Flächen hier werden ohne Zweifel treffliches Kulturland bieten. Die Landungsverhältnisse scheinen übrigens nicht günstig, und wie es in Bezug auf Wasser aussieht, bleibt noch zu ermitteln. Da es bereits an der Westspitze von Neu-Britannien eine Vulkan-Insel giebt, so verdient diese, um Verwechselung vorzubeugen, eine Sonderbezeichnung. Ich nenne sie daher Hansa-Vulkan, die nordwestliche Spitze Bremen, die südwestliche Hamburg, die nordöstliche[S. 368] Lübeck, zu Ehren der altehrwürdigen Hansestädte, deren Bürger ich bin.
Stephanstraße überquerend, begannen wir die weitere Küstenreise, da wo die Karten »Laing-Insel« verzeichnen, hinter der sich eine hübsche Bucht mit viel Kokospalmen in der Tiefe hineinzieht. Wir hatten aber keine Zeit, und ich mußte mich mit der Tagebuchnotiz »wäre sehr der Untersuchung wert«[93] begnügen.
Mit Laing-Insel endet das Flachland und hinter dem dichtbewaldeten Ufer beginnen wieder Hügelketten, deren ausgedehnte grüne Grasflächen der Landschaft ein »liebliches und civilisiertes Aussehen« verleihen, heißt es in meinem Tagebuche. »Urbargemachtes Land läßt auf Bevölkerung schließen«. Wirklich erblickten wir schon in der nächsten Buchtung, die »wahrscheinlich guten Ankerplatz bietet«[94] mehrere hübsche Dörfer, mit oft beträchtlichen Kokoshainen. Die Küste bildet jetzt eine sanfte Huk (»Podbielsky«: v. Schleinitz), hinter der sich eine kleine, dicht bewaldete Buchtung, Davidabucht und eine größere Bucht (»Prinz Albrechthafen«: v. Schleinitz) öffnet, die ebenfalls dichte Kokosbestände und vier größere Dörfer (bis zu zwanzig Häusern) zählt. Ihre Bewohner winkten mit grünen Zweigen und versuchten in Kanus abzukommen, aber wir durften uns nicht aufhalten. Vor der letzten Bucht liegen zwei kleine, bisher nicht notierte Inseln, die ich nach unserem Maschinenmeister Nielsen-Inseln benannte. Sie sind, wie die folgenden zwei Legoarant-Inseln, dicht bewaldet wie das Ufer, hinter dem sich immer noch grüne, ca. 500 bis 600 Fuß hohe, Hügelketten hinziehen, die fast nur in den Schluchten mit Gehölz bestanden sind. Aber weiter östlich nehmen die etwas höheren Hügelzüge wieder vorherrschend Waldcharakter an, wie die Küste selbst. Sie verläuft bis zu zwei kleinen Inseln, welche sich jetzt voraus zeigten, in fünf sanften Buchtungen, die vielleicht[S. 369] auch gute Ankerplätze geben dürften und scheint weniger bevölkert, denn ich zählte von den Legoarants an nur neun Siedelungen. Die erwähnten beiden Inseln schienen anfangs durch Riff versperrt, aber wir fanden eine treffliche Einfahrt und lagen bald darauf in einem nicht minder guten Hafen zu Anker. Er erhielt den Namen Hatzfeldt-Hafen, die westliche Insel Mahde (»Tschirimotsch« der Eingeborenen), die östliche Sechstroh (»Patakai« der Eingeborenen), nach unseren Steuerleuten.
Bald hatten wir wieder einmal Kanus mit Eingeborenen, nach und nach achtzehn, um das Schiff, immer dieselben Papuagestalten wie überall. Aber gerade aus Humboldt-Bai kommend, erschienen mir die hiesigen Eingeborenen doch etwas lichter gefärbt (zwischen Nr. 28 und 29, aber mehr zu 29 hinneigend). Sie unterschieden sich von den zuletzt gesehenen Humboldtianern überdies in einem wesentlichen Punkte, und zwar sehr vorteilhaft, durch ihr ruhiges Wesen und musterhaftes Betragen. Da mußte wieder einmal an Bord eingeladen werden; und erst nach vieler Mühe wagte es einer hereinzukommen in die gute Stube, die Kajüte. Die Leute schienen aber Eisen zu kennen, denn sie machten die Pantomime des Schneidens; doch beobachtete ich kein einziges Stück bei ihnen. In Bekleidung (Taf. XVI. 3), und Ausputz, wie Haar- und Bartschmuck, glichen sie ganz den bei Laing-Insel gesehenen Eingeborenen, wie denen von Venushuk (S. 292). Aber ich bemerkte keine anderen Waffen bei ihnen als Speere, darunter sehr reich mit Kasuarfedern und Cuscusfell verzierte. Solche Felle, und zwar mit Schwanz und Beinen daran, dienten einzelnen als sonderbare Kopfbedeckung. Als Brustkampfschmuck waren auch hier große Cymbiummuscheln mit allerlei Breloques (wie T. XXIII. 1, von Laing-Insel) das Wertvollste. Sonst erhielt ich noch schöne, äußerst reich verzierte Brusttaschen (vergl. X. 1) und hübsche Äxte mit Muschelklinge (T. I. 6) von Hippopus. Die Kanus weichen nur unbedeutend von denen bei Venushuk ab. Ziernarben waren häufig, oft in schwungvollen Schnörkeln auf Schulter und Achsel.
An Land, wohin ich bald eine Exkursion unternahm, sah es ganz versprechend aus. Hinter dem schwarzen Sandstrande, an welchem[S. 370] sich leicht landen läßt, dehnte sich ein weites, mit Hochgras und Bäumen (hauptsächlich Pandanus) bestandenes Vorland aus, das von dichtbewaldeten Bergen begrenzt wird, die hie und da Plantagen zeigen. »Das Land ist sehr der Untersuchung wert« schrieb ich damals unterstrichen in mein Tagebuch. Heute ist Hatzfeldt-Hafen eine Station der Neu-Guinea-Kompanie, mit Versuchsplantagen, namentlich für Tabak, auf dessen Kultur ich als besonders wichtig und versprechend wiederholt hinwies. Die Eingeborenen boten eine Menge Blättertabak an, den sie, wie in Port Konstantin »Kas« nannten, außerdem spärlich Kokosnüsse (Niu). Zahlreiche Speerträger, darunter auch bewaffnete Knaben, gaben mir das Geleit und zeigten sich ganz zutraulich. Auch hier herrschte, wie überall in Melanesien, die unserem Geschmack wenig behagende Umgangsform, Fremde am Arm oder der Hand zu halten. Es ist ein Zeichen der Freundschaft, von dem ich mich aber stets losmachte, denn man behält doch lieber die Hände frei, um wenigstens nicht ganz wehrlos erschlagen zu werden. Die Leute wollten uns nach ihrem Dorfe haben, das etwas östlich hinter einem Flüßchen lag, aber die anbrechende Dunkelheit nötigte an Bord zurückzukehren. Statt nun das Boot flott machen zu helfen, bemühten sich die Eingeborenen dasselbe festzuhalten, wahrscheinlich aus Freundschaft, was uns nicht hinderte, die Finger zu lösen.
Östlich von Hatzfeldt-Hafen sind die Uferberge wieder vorherrschend dicht bewaldet, und weiter Inland wird ein höheres Waldgebirge[95] sichtbar, das sich O.-S.-O. bis Pallas-Point und vielleicht weiter zu erstrecken scheint. Zwischen Samoahuk und Kap Gourdon, die wie stets an dieser Küste nur sanft gerundete Vorsprünge bilden, findet sich wieder vorzugsweise sehr versprechend aussehendes Grashügelland, ebenbürtig, ja vielleicht schöner als das, welches wir von Laing- bis östlich den Legoarant-Inseln sahen. Dieser ganze Küstenstrich[S. 371] darf überhaupt als der beste in ganz Kaiser Wilhelmsland bezeichnet werden, und ist zugleich der am dichtesten bevölkerte. Ich zählte von Laing-Insel bis etwas östlich von Kap Gourdon 35 Siedelungen und, nur so im Vorüberfahren, neun Mündungen, allerdings meist kleiner Flüsse, so daß auch kein Mangel an Wasser sein wird. Es dürften sich daher in keinem Teile von Kaiser Wilhelmsland günstigere Verhältnisse für Ansiedelung und Kulturen finden als gerade an dieser ca. 30 Meilen langen Küste, die sich auch trefflich zu Viehzucht eignet.
Franklin-Bai ist von bewaldeten Hügelketten gesäumt, die bei Neptun-Point sich in eine höhere, sanft ansteigende Kuppe von ca. 1500–1800 Fuß erheben, welche einige größere grüne Flecke zeigt. Hellblau gefärbtes Wasser, vielleicht von Riffen oder Flüssen herrührend, nötigte den Kapitän ein paarmal von der Küste abzuhalten, so daß wir »Pallas-Point« der Karten nicht mehr deutlich ausmachen konnten, da überdies der Abend hereinbrach. Schon bei Neptun-Point unwirsch von einer steifen Brise aus S.-O. empfangen, hatte die »Samoa« jetzt gegen den heftigen Weststrom anzukämpfen, welcher zwischen Dampier und dem Festlande durch die Izumrudstraße setzt. Da die Kohlen auf die Neige gingen, so rollte das zu leicht beladene Schiff viel ärger als sonst. Aber das war man ja gewöhnt, und auch dabei läßt sich ausgezeichnet schlafen, zumal in einer so kühlen Nacht als dieser mit nur 21° R.
Bei Anbruch des Tages (23. Mai) befanden wir uns in der Nähe von Kap Croissilles und dampften längs der Küste, um zunächst unseren Freunden in Friedrich-Wilhelmshafen einen Besuch abzustatten. Wie beim erstenmale ertönten dumpfe Signaltrommeln, als wir Dallmanns-Einfahrt einliefen, aber nicht um die Krieger herbeizurufen, sondern das freudige Ereignis »Maclay ist wieder da«! über die Inseln zu verbreiten. Das gab wirklich ein gar herzliches Wiedersehen, wenn die Leute bei aller aufrichtigen Freude auch nicht vergaßen an Tabak zu erinnern. Ich besuchte natürlich zuerst die Flaggenhalbinsel. Da war alles noch so wie damals; Kakadus kreischten in den Bäumen mit anderen Vogelstimmen um die Wette, es fehlte nichts als die Flagge. »Ja,[S. 372] die werden die Eingeborenen zu Stirnbinden oder Ähnlichem benutzt haben!« — Nein, da kannte ich meine guten Friedrich-Wilhelmshafener besser! — Sie errieten auch gleich, nach was mein Auge suchte, »Die Flagge! ja, die hat Kuram von Bilia«, so verstand ich die Leute, »die ist gut aufgehoben.« Und so war es auch. Da im »Szirit«, dem Rathause, da wickelte Kuram die »Kellkell« aus einem Blätterbündel, in welchem sie mit den hochverehrten »Tohn« (S. 105), tabu wie diese, verpackt war. »Tabu! Nicht wahr, einen besseren Platz konnte die Flagge nicht bekommen?«, schien sein freudestrahlendes Auge zu sagen. Und, nicht wahr? füge ich hinzu, das würde niemand von »Wilden« erwartet haben. Aus dem »Panu« (Dorf), dessen Anlage die Eingeborenen diesmal mit aller Bestimmtheit erwarteten, wurde wieder nichts, — ich mußte sie auf später vertrösten. Wir durften uns nicht lange aufhalten, um noch bei den anderen Freunden in Astrolabe, auf Bilibili und in Bongu vorzusprechen, die sich nicht minder freuten, uns wiederzusehen und so sehr zum Bleiben nötigten.
Da konnte ich noch einmal das Dschelum und den Telum Mul bewundern, für den man ein neues Haus errichtet hatte und dann dampften wir, Nord um Neu-Britannien, nach Mioko ab, wo die »Samoa« am 28. Mai wohlbehalten zu Anker ging. So war denn eine Reise glücklich vollendet, deren Hauptresultate in dem Nachweis der sicheren Befahrbarkeit einer 250 Meilen langen Küste auch für Segelschiffe, eines schiffbaren Stromes, vier schöner Häfen und ausgedehnten kulturfähigen Landes gipfelten, Ergebnisse, auf die wir mit Befriedigung zurückblicken durften.
Aber nun nach Haus, wo ich zur persönlichen Berichterstattung verlangt wurde, zunächst also nach Sydney, da die »Samoa« ohnehin einer gründlichen Reparatur ihrer Maschine bedurfte. Aber ich mußte erst noch die Station Blumenthal auflösen, die nach der inzwischen erfolgten Teilung Neu-Guineas zwischen Deutschland und Großbritannien dem letzteren Reiche zugefallen war. Die Einförmigkeit des Seelebens lag wieder vor uns, ging aber an mir, wie immer, spurlos vorüber, da stets reichlich vorhandene Arbeit Langweile nie aufkommen[S. 373] ließ. Die Beobachtung des Tierlebens raubte davon nur wenig Zeit, denn das Tropenmeer bietet auf seiner Oberfläche nicht viel, sondern will in der Tiefe untersucht sein.
Vögel zeigen sich meist nur vereinzelt und in wenigen Arten. Da wo größere Scharen meist dunkler Seeschwalben (Sterna fuliginosa und anasthaeta, Anous) sich versammeln, sind sie von anderen Seetieren angelockt worden. Bald durch Züge von Fischen, meist Makrelen, die, wohl infolge des Laichgeschäftes, oft in ungeheurer Menge erscheinen, bald von Delphinen, die in »Schulen« vereint an die Oberfläche kommen, um zu atmen. Dadurch werden unzählige kleine Meertierchen aufgescheucht, und diese, sowie die Auswurfstoffe der großen, sind es, welche die Seeschwalben beständig schreiend beschäftigen. Man sieht sie dann unaufhörlich aufs Wasser niederschießen, aber von allen Arten taucht nur Sterna Bergii wirklich unter. Fregattvögel, welche zuweilen bei diesen Vogelversammlungen erscheinen, beteiligen sich nicht selbst bei der Fischerei, sondern lassen die Seeschwalben dafür sorgen, indem sie ihnen die Beute abjagen. Wie ich Fregattvögel niemals tauchen sah, so auch niemals schwimmen, obwohl sie Schwimmfüße besitzen. Aber die Natur scheint oft sonderbar und richtet sich nicht nach den Systematikern und ihren Einschachtelungen. Sind schon größere Züge von Fischen im ganzen selten, so gilt dies noch mehr von den Meeres-Säugetieren. Den Wasserstrahl (spout) von Walfischen und zwar des Sperm- oder Potwal (Physeter), einer Art, die früher in dieser Region erfolgreich gejagt wurde, habe ich während diesen ganzen Reisen nur einmal beobachtet. Häufiger waren Tümmler oder Delphine (Delphinus), die Schweinfische (Porpoises) der Seefahrer, darunter zuweilen eine größere dunkle Grampus-Art, deren mächtiges Schnauben und Blasen gewöhnlich Aufregung an Bord hervorruft. Dann wird nach dem Gewehre gegriffen, obwohl man im voraus weiß, daß die Jagd erfolglos bleibt. Hierbei mag erwähnt sein, daß der »Delphine liebliche Scharen« nicht die treuen Begleiter des einsamen Schiffes sind, wie es irgendwo im Liede heißt, sondern daß sie nur für kurze Zeit demselben zu folgen pflegen. Sie scheinen meist Eile zu haben und[S. 374] steuern einen Kurs, der manchmal gerade unter dem Kiele des Schiffes weg führt. Zuweilen halten sie sich länger an einer Stelle auf, um zu spielen. Denn so erscheint das lustige Springen, mit denen die mächtigen Körper sich oft überschlagend hoch aus dem Wasser schnellen; ein gar hübsches Schauspiel. Der »Delphin« (Dolphin) der Seefahrer hat übrigens mit dem soeben erwähnten »Delphin der Landratte« nichts zu thun, sondern ist, wie das Attribut Neptuns, ein wirklicher Fisch (Coryphaena equisetis) und zwar ein sehr schöner, von merkwürdiger Gestalt und Färbung. Die Rückenseite ist goldgrün, zuweilen goldgelb, die Bauchseite gelb, beide schön himmelblau punktiert. Dabei wechselt die Färbung des sterbenden Fisches in wunderbar zarten Metalltönen, von denen alle Abbildungen nur eine schwache Vorstellung zu geben vermögen. Glücklicherweise erfreut dieser Fisch nicht nur durch sein Farbenspiel, sondern den materiellen Menschen auch durch sein wohlschmeckendes Fleisch und macht somit eine rühmliche Ausnahme unter den meist wenig empfehlenswerten Südseefischen. Wir erhielten übrigens nur ein paarmal Delphine (Coryphaena), wovon der eine drei Fuß lange sieben Pfund, der andere vier Fuß lange aber merkwürdigerweise sechzehn Pfund wog. Im ganzen blieben die Resultate der Fischerei überhaupt sehr hinter den Erwartungen zurück, obwohl sich Kapitän wie Steuerleute viele Mühe gaben und überall, wo es anging, Leine und Haken am Stern aushingen. Abgesehen von abgebissenen oder abgerissenen Leinen blieb der wirkliche Fang eines Fisches immer ein Ereignis. In den meisten Fällen war es dann eine »Bonite« oder »Albacore«. So nennen die Seeleute jene großen Makrelen oder Thunfische, von welchen die Südsee mehrere Arten besitzt, unter denen Thynnus germo am häufigsten scheint. Wenigstens beißt er noch am ersten an die Angel, der nur ein weißer Lappen Zeug als Köder dient. Trotz dem trockenen Fleische bildet ein solcher Fisch in dem ewigen Einerlei von Konserven immerhin eine erwünschte Abwechselung und eine hübsche Zugabe der Küche. Handelt es sich doch meist um beträchtlich große Fische, da eine kaum drei Fuß lange Bonite 18 Pfund wiegt. Auf Grund meiner genauen zoologischen Notizen kann[S. 375] ich leider über den Hai, »des Meeres Hyäne«, wenig berichten, obwohl sonst fast jeder Seereisende nicht genug von solchen zu erzählen weiß. Aber ich muß, wie mit Krokodilen, auch mit Haifischen Pech gehabt haben. Denn ich bekam während unserer ganzen Reisen nur wenige Male einen Hai zu sehen, und gefangen wurde überhaupt keiner. Wir hielten zwar immer die Haiangel bereit, aber selbst der kleine Geselle, welcher im Miokohafen sich häufig beim Schiffe zeigte, schien Vorsicht als Mutter der Weisheit bereits zu kennen und vermied trotz des verlockenden Speckstückes den Haken ängstlich. Dagegen schnappte er lustig nach allem Eßbaren, welches nicht mit dem verräterischen Haken verbunden war. Und die kleinen Fische, die machten es ebenso. Zu Hunderten spielten sie oft um den Kiel, so lange wir zu Anker lagen, fraßen alles, was über Bord fiel, aber eine Angel — I, Gott bewahre! da thaten sie so, als wollten sie sagen: »die kennen wir!« Ja, was solche Kanaker, selbst unter den Fischen, nicht klug sind! Die fliegenden Fische, welche so gern bei Nacht dem Lichtschein folgen und dadurch nicht selten an Bord eines Schiffes aufs Trockene geraten, schienen gegenüber der »Samoa« dieselbe Klugheit zu beobachten. Nur einige Male konnte ich der Schiffskatze einen fliegenden Fisch abjagen. Und doch war die »Samoa« sehr niedrig über dem Wasser und fliegende Fische, wenn auch nicht eine tägliche, so doch häufige Erscheinung. Da mußte ich mich denn begnügen ihre Flugübungen zu bewundern, die allerdings ganz erstaunlich sind. Die lieben Tiere! gebraten sind sie noch besser! »Aber Schildkröten! die muß es doch häufig geben«? fragt vielleicht mancher, indem er dabei an »turtle soup« und »turtle steaks« als nicht seltene Kost der Kajütentafel denkt. Ja, Schildkröten giebt es gewiß in Menge; die wären auch nicht verachtet worden, sicher nicht, wenn wir nur welche bekommen hätten. Aber, halt! da ist eine Schildkröte! — und damit verschwindet ein dunkler Fleck im Wasser. Das war alles, was wir gelegentlich von dem leckeren Suppentier zu sehen, aber nicht zu schmecken bekamen.
»Schiff voraus!« — hieß es plötzlich, als wir, von Trobriand herunterkommend um Kap Ventenat dampften. Und wirklich, da,[S. 376] hinter dem Gallow-Riff bei den Lydia-Inseln, zeigte sich ein Schiff und ein Dampfer dazu; das zweite Fahrzeug, welches wir überhaupt in See antrafen. Da wurde geguckt, und Gläser und Fernrohr gingen aus einer Hand in die andere, denn jeder wollte ja die seltene Erscheinung betrachten. Der Dampfer hielt recht auf uns zu, und als er näher kam, konnte man viele braune Gestalten an Deck sehen, Eingeborene. Sollte es ein Labourtrader sein? Aber das Schiff war zu groß und führte die Queensland-Flagge. Auch Weiße lehnten an der Reiling und als wir in Sprechweite waren, schallte es »Welcher Name?« in Englisch herüber. »Deutscher Dampfer »Samoa«!« — »Woher?« — »Von Mioko, Neu-Britannien!« — »Ist Doktor Finsch an Bord?« — »Yes!« — Da ging ein Boot zu Wasser, das bald fünf Herren in Civil längsseit brachte; alles fremde Gesichter. Aber der in Uniform, mit der goldbordierten Mütze, der am Steuer saß, den mußte ich schon gesehen haben! Und richtig, es war mein Freund Mr. Chester, der frühere Police-magistrate von Thursday-Island, unter dessen gastlichem Dache ich gewohnt hatte. Das war ein unerwartetes Wiedersehen, sollte aber nicht das einzige bleiben. Denn Mr. Romilly, den ich in Cooktown kennen zu lernen das Vergnügen hatte, ließ mich an Bord der »Victoria« einladen, da er wegen eines Fußübels kein Boot besteigen konnte. Dort erwartete mich eine neue Überraschung. »Doctor! you sabi me?« (kennen Sie mich?) sagte ein Kanaker, indem er mir die Hand reichte. »Halloh! Charly Tett von Honolulu!« — Ob ich ihn kannte, diesen biederen Matrosen, der mich vor drei Jahren, damals »Kapitän« der »Mairi«, auf der Fahrt von Port Moresby in Torresstraße nahezu ertränkt hatte. Nicht wahr, wie merkwürdig sich zuweilen Menschen nicht bloß auf der Terra firma, sondern sogar auf dem Wasser begegnen können! — Die meisten der Herren waren übrigens Reporters australischer Blätter, die über mich schon gar manches, nicht eben empfehlendes, geschrieben haben mochten. Dem »German East-Cap settlement«, das in den Kolonien soviel Staub aufgewirbelt hatte, galt natürlich die erste »interview«. Wie viele Soldaten dort wohl seien? ob Kanonen? und ähnliche Fragen stürmten auf mich ein. Die Jünger der Presse brauchten[S. 377] nicht viel aufzuschreiben[96]. Sie machten sehr verwunderte Gesichter, als sie hörten, daß das ganze »settlement« (Niederlassung) nur aus zwei Weißen bestehe, die wir unterwegs waren, abzuholen, was vollends beruhigte.
Das Kanakergewimmel an Bord der Victoria bestand wirklich aus Arbeitern, befreiten Sklaven. Die traurigen Enthüllungen beim Prozeß gegen das Werbeschiff »Hopeful« (S. 275) schrieen so laut zum Himmel, daß die Regierung einer genaueren Untersuchung der Verhältnisse nicht länger ausweichen konnte. Dabei stellte sich heraus, was ja längst jedermann wußte, daß, trotz der »Agenten für Einwanderung«, viele Eingeborene nicht besser als gestohlen waren. Diese Opfer des gewerbmäßigen Kidnappertums, 400 an der Zahl, wurden nun, sehr zum Mißvergnügen der Pflanzer, nach ihrer Heimat zurückbefördert. Und diesmal unter den Augen des »acting special commissioner for New-Guinea« (Romilly), also jedenfalls sicher, was sonst bei solchen Rücktransporten nicht immer der Fall zu sein pflegt. Wir begegneten später am Ostkap verschiedenen Befreiten, welche, trotz der reichen Geschenke von seiten der Regierung, auf Queensland nicht gut zu sprechen waren. Und das konnte man ihnen gewiß nicht verdenken. So ein paar Jahre Sklaverei lassen sich nicht so leicht wettmachen. Freilich erschienen die Leute jetzt als vollendete Gentlemen, die in Schuhen zwar erst wieder laufen lernen mußten, aber sie hatten auch vierzehnzöllige Messer zum Andenken erhalten. Damit läßt sich schon etwas anfangen, bei Massacres gegen Weiße, wobei solche Freigelassene gewöhnlich Rädelsführer spielen.
Blumenthal schien ausgestorben, und ich hegte schon allerlei Befürchtungen. Aber glücklicherweise war Hunstein und sein Gefährte bis auf etwas Fieber, das in jenen Regionen ja selten ausbleibt,[S. 378] wohlauf. Die Kühe hatten sich vortrefflich gehalten, aber die Schafe waren sämtlich, vermutlich am Genuß giftiger Pflanzen, eingegangen. Weniger erfreulich lauteten die Nachrichten über die Eingeborenen, welche sich nach Weggang der »Samoa« keineswegs als nette Kerle erwiesen, wie dies häufiger vorkommt. Zu so viel Waren gehörten eben mehr als zwei Weiße. Vor allem hatte der Reichtum von ein paar hundert Pfund Tabak die Habsucht der Eingeborenen gereizt, die einen Einbruch versuchten und untereinander bereits von Anzünden der Station wisperten. Aber ein Mann mit Hunsteins Erfahrungen wußte auch mit solchem Gesindel ohne Schießerei fertig zu werden. Übrigens war nur eine Minderzahl Eingeborener durch Gomira Taga, den Schneider, aufgereizt worden. Der Anstifter dieser feindlichen Pläne kam jetzt heran und begrüßte mich unter Freudenthränen des Wiedersehens, denn solches Schauspielertalent im Verstellen geht selbst Kanakern nicht ab. Ich that natürlich, als wenn ich von nichts wüßte, und es herrschte ein brüderliches Einvernehmen wie früher. Als aber nach der Kopra auch die übrigen Vorräte an Bord geschafft wurden, da machten die Eingeborenen lange Gesichter und suchten alles aufzubieten, um uns zu halten. Bei den meisten war die Betrübnis eine aufrichtige, denn jeder sah wohl ein, daß ihnen ein großes Brot von der Hänge fiel. Da richtete sich denn der Ärger gegen Taga, den Anstifter des Übels, und die Verwünschungen gegen ihn nahmen kein Ende. Während ich den guten Gomira Tohodo und andere Getreue zum Abschiede beschenkte, hielt ich dem Schneider eine Standrede. Da kam viel von: papoi (schlecht), itanem (stehlen), numa (Haus), Hihiaura, anahiri majau (anzünden), hirage (totschießen) u. s. w. vor, eine Rede, die sehr wohl begriffen wurde, denn noch am selbigen Abend rissen die Männer von Hihiaura, die guten wie die schlechten, mit Kind und Kegel aus. Sie hatten eben ein böses Gewissen und fürchteten wahrscheinlich, ich würde Hihiaura noch vor der Abreise in Flammen aufgehen lassen. Aber diese Drohung hatte doch soviel genützt, daß Kapitän Dallmann bei einem viel späteren Besuche Blumenthal unversehrt fand.
[S. 379] So schieden wir, unter Zurücklassung der Rinder, die inzwischen ohnehin halbverwildert, wahrscheinlich noch zu Stammeltern wilden Rindviehs in Ost-Neu-Guinea werden dürften.
Am 4. Juli trafen wir in Cooktown ein, um die Post und Kabeltelegramme aufzugeben und setzten dann die Reise südlich fort. Aber vor Townsville brach etwas an der Maschine und nötigte einzulaufen. Da gerade ein Dampfer nach Sydney bereit lag, so nahm ich Abschied von der »Samoa«, auf welcher ich über 11000 Meilen Südsee durchgekreuzt hatte. Und somit enden die »Samoafahrten!« — Kaioni!
Druck von August Pries in Leipzig.
[1] Die noch jetzt in Diensten der Neu-Guinea-Kompagnie thätige »Samoa« ist ein sehr stark gebautes, hölzernes, gekupfertes Schiff. Nach dem Flaggenattest wurde es 1883 in Tomalei (Neu-Süd-Wales) erbaut; die Länge beträgt 121, die Breite 21, die Tiefe 8 Fuß (engl.), der Raum 111 Tons reg. (= 164 groß), die Maschine hat 35 Pferdekraft (nom.).
[2] Da in Sydney Schiffsoffiziere deutscher Nationalität nicht immer zu haben sind, so hatte Kapitän Dallmann gleich einen ersten Steuermann, Hinrich Sechstroh aus Warfleth an der Weser und einen ersten Maschinist, Laars Nielsen aus Flensburg, mitgebracht. Die übrige Mannschaft (zweiter Steuermann, zweiter Maschinist, Koch, 4 Matrosen, 3 Heizer und ein Junge) zusammen 14 Personen, (mit Ausnahme eines Matrosen) alles Deutsche, wurde in Sydney angemustert.
[3] Bisher wurden von mir nur publiziert: 1. Die kurzen Berichte in „Nachrichten über Kaiser Wilhelms-Land‟ (2. 3. u. 4. Heft 1885); 2. Sechs Aufsätze in der „Gartenlaube‟ (1886 No. 5, 11, 21 u. 1887 No. 18, 28 u. 33); 3. Ein Aufsatz in „Über Land u. Meer‟ (No. 19, 1888). — Das dankenswerte Interesse des Herrn Verlegers hat die trefflichen Holzschnitte aus den obigen Artikeln der Gartenlaube (von A. v. Rößler) durch Erwerbung für dieses Buch zu sichern gewußt.
[4] Vergl. „Katalog der ethnologischen Sammlung der Neu-Guinea-Compagnie, ausgestellt im Kön. Museum für Völkerkunde‟ (Berlin 1886) und dasselbe „Katalog II‟.
[5] Alle Entfernungen sind nach Seemeilen, 4 = 1 geogr. Meile gerechnet.
[6] Powell läßt dieses Schiff gleich „3 Monate‟ lang gegen den Strom ankämpfen, um eine Distanz von 20 M. zu überwinden.
[7] Vergleiche meine Original-Mitteilungen, die in den „Hamburger Nachrichten‟ unter dem Titel „Aus dem Pacific. IX. Neu-Britannien‟ (30. Juni, 1., 2. u. 4. Juli) erschienen.
[8] Vergl. „Menschenfresser in Neu-Britannien‟: Illustrirte Zeitung 17. November 1883 mit Bild.
[9] Über diesen wie über Handel und dessen Produkte überhaupt vergleiche meine Abhandlung: „Über Naturprodukte der westlichen Südsee besonders der deutschen Schutzgebiete‟, welche das 7. Heft der „Beiträge zur Förderung der Bestrebungen des Deutschen Kolonialvereins‟ (1887) bildet.
[10] Nach Parkinson wurden im Bismarck-Archipel von englischen und deutschen Werbeschiffen allein 2200 Eingeborene weggeführt, vergl.: „Der Bismarck-Archipel‟ S. 35, sowie die übrigen, nicht eben sehr erfreulichen Erfahrungen des Verfassers hinsichtlich der „Labourtrade‟.
[11] Vergl. Parkinson l. c. S. 90, 91.
[12] „Turc-Red‟ ein dünnes hochrotes Baumwollenzeug, wovon die englische Elle (Yard) in Sydney ca. 25 Pf. kostet; sehr beliebtes und unentbehrliches Tauschmittel für die Südsee.
[13] Über seinen zweiten siebenzehnmonatlichen Aufenthalt (1876 u. 77) an dieser Küste hat der Reisende bis jetzt so gut als nichts publiziert. Vergl. Petermanns Geograph. Mitteilungen 1878 S. 407.
[14] Die kurzen Tagebuchnotizen von Romilly in „The Western Pacific and New Guinea‟ (221–230) sind noch das beste; Powell (Proc. R. Geogr. Society London 1883 S. 511) sagt so gut als nichts.
[15] Ein anderes Souvenir jener traurigen Gründung handelte ich von einem Eingeborenen ein. Es ist die rot und weiß seidene, mit Goldborten verzierte Fahne des „4me Bataillon‟ der Armee von Port Breton, die wie der ganze Freistaat nur auf dem Papier existierte.
[16] Eine wahrheitsgetreue Darstellung dieser wie der übrigen traurigen Expeditionen giebt das interessante Buch: „L'aventure du Port Breton et la Colonie libre dite Nouvelle France. Souvenirs personnels et documents par A. Baudouin, Médecin de la 4e Expédition (Paris, Maurice Dreyfous, Éditeur).‟ Der Leser, welcher jene Gebiete auch nicht aus eigener Anschauung kennt, wird schwer begreifen, wie Frankreich einen solchen Unfug, welcher so viel Unglück herbeiführte, überhaupt dulden konnte.
[17] Ausführliche Mitteilungen finden sich in meinen: „Anthropologische Ergebnisse einer Reise in der Südsee und dem malayischen Archipel in den Jahren 1879–1882‟ (Berlin, A. Asher & Co. 1884).
[18] Vergl. „Zeitschrift für Ethnologie‟ Jahrg. 1883. S. 205–208.
[19] Es kann nichts Praktischeres geben als diesen Tabak, welcher vollständig unsere Scheidemünzen ersetzt, aber gar sehr von dem bei uns gebräuchlichen abweicht. Twist hat die Form einer dünnen flachen Stange Siegellack und bildet eine fest zusammengepreßte schwarze Masse, welche mit einem scharfen Instrumente auseinander gebrochen werden muß. Jedes Stück besteht aus zwei übereinander geflochtenen Hälften, läßt sich also leicht teilen. Auf das Pfund werden 22 bis 26 Stücke gerechnet. Der Preis beträgt in Sydney (ohne Steuer) ca. 1 Mk. 8 Pf., in Mioko 3, in Neu-Irland und anderen neuen Plätzen 8 Mark!
[20] Dieselbe ist seitdem gegründet worden (Juni 1886).
[21] Wilfred Powell (l. c. S. 511) hat Astrolabe-Bai wohl nicht recht kennen gelernt, wenn er meint, sie würde einen „guten Hafen‟ abgeben.
[22] „440 Meter‟ deutsche Admiralitäts-Karte. — Wo nicht, wie hier, besonders bemerkt, sind die Höhenangaben nur nach Schätzungen.
[23] Sehr ähnlich ist das von Guppy abgebildete „Tambu-Haus‟ auf der Insel Santa Anna in den Salomons.
[24] Zum Beispiel „Manu‟ Vogel; „Niu‟ Kokosnuß; „Mata‟ Auge; u. a. m.
[25] Die südlich von derselben ist „Gronemann‟-, die nördliche „König-Insel‟ genannt worden. Vergl.: „Annalen der Hydrographie etc. Herausgegeben von dem Hydrographischen Amt der Admiralität‟. 1885. Heft IV. T. 7.
[26] Vergl. Finsch: „Abnorme Eberhauer, Pretiosen im Schmuck der Südseevölker‟ in: Mitteil. der Anthropol. Gesellsch. in Wien, Band XVII, 1887, Taf. VI.
[27] In der Kartenskizze von Hauptmann Dreger (Nachrichten aus Kaiser Wilhelmsland. Heft II 1887) ist dieser Hafen ca. 3 M. südlicher verzeichnet; zwischen diesem und Prinz-Heinrichs-Hafen noch ein neuer: Prinz-Friedrich-Karl-Hafen.
[28] Auch Kapit. z. S. Schering bemerkt: „Kap Duperré ist gar nicht vorhanden‟ und ich weiß nicht aus welchen Gründen Hauptmann Dreger „K. Duperré‟ an Stelle von K. Kusserow setzt, da es nach der engl. Admiralitäts-Karte doch 4 Meilen nördlicher verzeichnet ist.
[29] Die Regierung beeilte sich diesen Wunsch zu erfüllen und bis zum Jahre 1868 wurden nahezu 10000 Sträflinge der Kolonie als willkommene billige Arbeitskräfte zugeführt.
[30] Herr Romilly, der im Jahre 1881 mit dem Kriegsschuner »Beagle« Astrolabe-Bai besuchte, gehört zu diesen wenigen, wie er mir selbst erzählte.
[31] „Discoveries and Surveys in New Guinea etc. of H. M. S. Basilisk. By Capt. John Moresby‟ (London 1876).
[32] Wie von Maclay mitteilt, ist dies thatsächlich der Fall gewesen. Vergl. „Petermanns Geogr. Mitteil. 1878 S. 408‟.
| Disraeli: | 11000′: | Moresby | ; | 6118 | Meter!: | Friederichsen. |
| Gladstone: | 11400′ | " | ; | 5725 | " | " |
[34] Wilfred Powells Darstellung (l. c. S. 510) als dehnten sich die Terrassen bis zum Finisterre-Gebirge („15000′‟ hoch) aus, ist eine durchaus irrige. Ebenso finden sich keine „granite boulders‟ an der Küste.
[35] So ist es in diesem Terrassenlande wohl kaum möglich „eine beträchtliche Distanz inland zu reisen‟ wie Powell gethan haben will, wo er „Bewässerungsanlagen aus Bamburöhren‟, Häuser in beträchtlicher Anzahl, in „Bienenkorbform‟ fand (l. c. S. 510). Wer aber Neu-Britannien kennt und Powells Buch („Wanderings in a wild Country‟), der wird sich nicht mehr über die abenteuerlichsten Angaben wundern, denn die famosen Geschichten, wie die Eingeborenen Knochenbrüche behandeln (S. 165) und den „künstlichen Zähnen aus Perlmutter‟ (S. 166) wird wohl jedermann für lustige Münchhauseniaden halten. Man vergl. auch: Parkinson „Im Bismarck-Archipel‟ S. 39, 58 und 63.
[36] Nach denselben ist dieser Boden „als ein an Humus, Stickstoff, Kali, Kalk- und Phosphorsäure sehr reicher anzusehen‟.
[37] Powell (l. c. p. 510) läßt dieselben von „slaves taken in battle from the inland tribes‟ bearbeiten, aber von Inland kann hier kaum die Rede sein, und Sklaverei ist bei den Papuas Neu-Guineas wohl überhaupt noch nicht beobachtet worden.
[38] Sehr im Widerspruch damit bemerkt Powell (l. c. p. 510): „they shout and sing, making warlike gestures, with their spears, bows and arrows and tomahawks‟! Das habe ich nirgends gefunden und „Tomahawks‟ besitzen die Eingeborenen überhaupt nicht.
[39] Maclay erwähnt nur an einer Stelle: „das Gebiet der Menschenfresser Erempi‟, in der Nähe von „Cap Croissilles‟, das ich selbst nicht kennen lernte.
[40] Wie ich später von Kapitän Dallmann erfuhr, dürfte ca. 11 Meilen Ost von Teliata voraussichtlich ein „guter Hafen‟ vorhanden sein.
[41] Man kann ermessen, was dabei herauskommt, wenn jemand auf solche dürftige Angaben hin eine Länderbeschreibung wagt, wie z. B. Meinicke („Die Inseln des Stillen Ozeans‟ I. S. 134–136).
[42] Nach den mir durch einen „Pionier-Trader‟ im Jahre 1880 in Neu-Britannien gewordenen statistischen Notizen wurden in der Periode der ersten Niederlassung weißer Händler von 1875 bis Ende 1880 im ganzen dreizehn Morde durch Eingeborene verübt. Davon an zwei Weißen, offenbar wegen Raub, an fünf Weißen infolge Provokation, an zwei Weißen auf Anstiften und im Auftrage von Weißen, an vier farbigen Missionslehrern (Teachers); nur die letzteren sind verzehrt worden, aber keiner der Weißen. In derselben Zeit wurden übrigens an Bord von Schiffen fünf Morde, meist von farbigen Schiffsleuten untereinander begangen.
[43] Identisch mit „Richie-Isl.‟ von d'Entrecasteaux, welches dieser Seefahrer 1793 für eine Insel hielt.
[44] „Deaf-Adder-Bay‟ auf der englischen Admiralitätskarte.
[45] Die trefflichen Untersuchungen des Freiherrn von Schleinitz haben in der That eine Menge guter Buchten und Häfen nachgewiesen. Vergl. „Nachrichten über Kaiser Wilhelms-Land‟ I. Heft 1887 nebst „Kartenskizze von Huon-Golf‟.
[46] Seitdem vom Freiherrn von Schleinitz besucht und „Bayern-Bucht‟, die folgende „Samoahafen‟ benannt.
[47] Es ist wohl nur ein Druckfehler, wenn Moresby im Text zu seinem Reisewerke (S. 284) die Höhe zu „9000 Fuß‟ angiebt.
[48] Hier sind später vom Freiherrn von Schleinitz zwei Häfen (Dreger- und Schneider-Hafen) entdeckt worden.
[49] An der Nordwestküste von Holländisch Neu-Guinea giebt es auch ein: „Kap Finsch‟.
[50] Man vergleiche u. a.: Parkinson „Im Bismarck-Archipel‟ (1887, S. 60), wonach in jenem Gebiete in sieben Jahren im ganzen 215 Eingeborene, die beiläufig 350000 Mk. kosteten, bekehrt wurden.
[51] Als ich u. a. zeigte, wie die geschmackvollen Kniebinden (vergl. Atlas Taf. XVIII, F. 2) getragen werden, bemerkten Seine Majestät: „Ja, die haben ja schon ordentlich einen Hosenbandorden!‟
[52] „Wanderings in a wild Country‟ (S. 202).
[53] Dampier sah am 24. März 1700 nur Vulcano-Island in Eruption, aber Powell spricht 1879 oder 1880 von: „innumerable vulcanos small and large, all in violent eruption; land seemed all fire‟ (Wanderings S. 230). Ja, der trifft allenthalben etwas Besonderes!
[54] Ist keine Insel, sondern eine Halbinsel, wie Herr v. Schleinitz neuerdings nachwies.
[55] Ähnlich ging es Parkinson in Bezug auf den „good sized freshwater-lake, with a small Island in the centre‟, welchen Powell im Innern der Gazelle-Halbinsel beschreibt, und welcher sich nur als ein „Tümpel von ca. 8–10 Meter Durchmesser‟ erwies. (Im „Bismarck-Archipel‟ S. 61).
[56] Vergl. Finsch und Meyer: „Vögel von Neu-Guinea‟ (Zeitschr. f. die gesammte Ornithol. 1885. S. 369–373).
[57] Die telegraphische Nachricht, daß in Huon-Golf Gold gefunden sei, hat sich als irrig erwiesen.
[58] Parkinson (Im Bismarck-Archipel S. 31) erhebt gegen dieses Schiff, wie andere deutsche, schwere Anklagen wegen Gewaltthätigkeiten gegen die Eingeborenen und führt Fälle an, die in der That empörend sind, und leider noch 1883 vorkamen.
[59] Ausführlicher hierüber in der „Kölnischen Zeitung‟ (Nr. 192, 13. Juli 1885) „Der Unfall der Glattdeckkorvette »Marie«‟.
[60] r und l sind in den meisten Papuasprachen gleich, da viele kein r aussprechen können.
[61] l. c. S. 265, aber hier an unrichtiger Stelle und zu früh notiert.
[62] Nach Moresby längs dieser ganzen Küste von Ostkap bis Kap Vogel zwischen 500 und 600 Faden.
[63] Die Koiäri, Bergbewohner des Innern von Port Moresby, sind sehr begierig nach Salz, gebrauchen es aber nicht als Speisewürze, sondern mehr im Sinne einer Delikatesse. In ähnlicher Weise gedenkt von Miklucho salzwasserdurchtränkten Holzes, welches bei den Bewohnern von Astrolabe-Bai beliebt ist.
[64] Powell (l. c. S. 267) erzählt den Fall und das Ende von Kapitän L..., der schließlich von einem Trader erschossen wurde, ganz der Wahrheit gemäß
[65] Wie schlecht es den unzureichend versorgten Teachers zuweilen ging, darüber berichtet Moresby (l. c. S. 35).
[66] Das Massacre in Kalau (Hood-Bai), wobei zwölf der Mission angehörige Farbige von den Eingeborenen gespeert wurden, fand viel später (März 1881) statt, nachdem die Mission längst hier gefestigt war, und hatte seine besonderen Ursachen.
[67] So mußten u. a. die vier im Inneren von Port Moresby errichteten Stationen wieder aufgegeben werden und zwar nicht wegen „Wildheit‟ der Eingeborenen, sondern weil sich dieselben zu teilnahmslos zeigten.
[68] Die Abbildung bei Powell (l. c. S. 9) ist ganz unrichtig.
[69] Vergl. auch Moresby l. c. S. 165.
[70] Eine große Küsten-Kartenskizze (Maßstab 1 = 300000) ist nach meinen Materialien von dem talentvollen Kartographen Louis von der Vecht in Berlin gezeichnet, aber bisher nicht publiziert worden. Da die »Samoa« fast ununterbrochen nahe der Küste dampfte, so konnten schon deshalb die bisherigen Aufnahmen vielfach berichtigt und Lücken ausgefüllt werden, wenn auch für spätere Kartierung noch viel zu thun bleibt. Aber man darf nicht vergessen, daß wir nur eine erste Rekognoszierungsfahrt machten, und unsere Navigateure nur zehn Punkte nach Peilungen bestimmen konnten. Findlay's „South Sea-Directory‟ verzeichnete damals aber für ganz Neu-Guinea nur 38 astronomische Aufnahmen, darunter eine für diesen Teil der Küste.
[71] Von d'Urville nach dem spanischen Seefahrer Bernardo de la Torre benannt, der übrigens mit der Entdeckung Neu-Guineas nichts zu thun hatte.
[72] Ein solcher Korb ist weiter zurück abgebildet, aber aus Versehen des Zeichners einem Manne von Guap in die Hand gegeben.
[73] In einem Tragbeutel fand ich später ein kleines, 7 cm langes Stück verrostetes Bandeisen von einer Kiste.
[74] Ottilien-Fluß des Freiherrn von Schleinitz, dem mit Hauptmann Dreger die genauere Aufnahme der Küste von Irishuk bis Kap de la Torre zu verdanken ist. (Nachrichten aus Kaiser Wilh. Land 1887. Heft II).
[75] Seiner Königlichen Hoheit dem Prinzen Alexander von Preußen zu Ehren benannt.
[76] Von Cinnamomum Kiamis oder Sassafras goesianum.
[77] In meinem ersten Reiseberichte („Nachrichten für und über Kaiser Wilhelmsland‟ Oktoberheft 1885) hat sich hinsichtlich der geograph. Lage dieses Punktes ein bedauerliches Versehen eingeschlichen. Auf S. 11 wird nämlich Guido Cora-Huk als östlich der Sainson-Inseln angegeben, während die betreffende Stelle des Textes, in Übereinstimmung mit der Karte, auf S. 10 hinter „Sapa Point‟ folgen sollte.
[78] Nach dem hochverdienten Präsidenten des Deutschen Kolonialvereins Fürst Hermann zu Hohenlohe-Langenburg.
[79] l. c. S. 512, übrigens die erste Erwähnung eines Punktes an der ganzen ca. 140 Meilen langen Küste von Broken Water-Bay an. Von den Eingeborenen wird nur gesagt, daß sie zu glauben schienen, die Fremden wären von der Sonne herabgekommen.
[80] Nach Graf Baudissin, damals Kapitän-Leutnant an Bord S. M. S. »Albatross«.
[81] Powell (l. c. S. 513) erwähnt von dieser Küste Segel, die in der Ferne „den Flügeln eines fliegenden Fisches‟ ähneln, sowie den reichen Ausputz an Schnitzerei und Muscheln der Kanus. Ich habe davon ebensowenig etwas gesehen, als von den ausgezeichneten Häfen, dem Reichtume an Kokospalmen und Muskatnußbäumen, von denen Powell spricht.
[82] „Weil sich hier dem Schiffe (Astrolabe) 20 Piroguen, jede mit drei bis acht bewaffneten Leuten, näherten und von der vordersten ein Pfeil auf das Schiff entsendet wurde. Eine Gewehrsalve und ein Kanonenschuß trieben die Böte zur sofortigen Flucht‟. (Lindeman in Geogr. Blätter 1888, S. 358).
[83] Einige vierzig Messungen, die ich an Papuas der Südostküste machte, ergaben für Männer 1,52 bis 1,78 m, (Frauen: 1,39–1,49 m); in Astrolabe-Bai für Männer 1,47–1,62 m.
[84] Nach dem ausgezeichneten Kenner Neu-Guineas Robidé van der Aa im Haag.
[86] „Neu-Guinea und seine Bewohner‟ (Bremen 1865).
[87] Nach qualitativer Untersuchung des Herrn Venator in Trier besteht die etwas fettig, wie getrockneter bläulichgrauer Thon aussehende Masse aus: „vorherrschend Magnesia, Eisenoxyd, Thonerde, Kieselsäure und Spuren von Kalk und Phosphorsäure‟. Sie dient den Eingeborenen übrigens nicht als Nahrung, sondern als Leckerei, die allerdings nicht nach unserem Geschmacke ist.
[88] „Journ. des Mus. Godefroy‟ Heft IV, S. 49 T. II. — Unbegreiflicherweise erklärt Kubary dieses „Geld‟ als „natürliche Emaillen‟! als wenn die Natur irgendwo farbige Mosaikglasperlen hervorbrächte.
[89] Die Höhe desselben ist mit 6000 Fuß zu hoch angegeben und beträgt wohl nicht mehr als 4000.
[90] Im Reisewerk der Etna-Expedition, wie so manches, übertrieben zu 90 Häusern angegeben, wofür in der engen Buchtung schon der Platz fehlt.
[91] Es wurde am 6. September 1883 durch die Expedition des Dampfers Sing Tjin errichtet und auf Janus-Eiland an einen „Tjamarabaum‟ genagelt.
[92] Powell fischte aus solchen gleich Kampferholz auf.
[93] Herr v. Schleinitz, dem die genaue Aufnahme dieser Küste von Kap Gourdon bis zum Augustafluß zu verdanken ist, benannte sie „Hansabucht‟ (vergl. Nachrichten über Kaiser Wilhelmsland Heft II 1887, mit Karte von Hauptmann Dreger).
[94] „Potsdam-Hafen‟: von Schleinitz. Am Eingange, liegt die kleine „Potsdam-Insel‟, die auf meiner ersten Kartenskizze (Nachrichten etc. Heft IV. 1885) unrichtig verzeichnet ist.
[95] Wenn Powell (l. c. S. 512) die Küste nördlich von Astrolabe- bis Broken-water-Bay als „hoch und steil; mit zahlreichen Bergströmen und Kaskaden, welche Hauptzüge derselben bilden‟ beschreibt, so wird man mit Recht zweifeln können, ob er sie überhaupt gesehen hat. Auch fehlt „terrace formation‟ hier durchaus.
[96] Sie hatten es aber doch gethan; denn später las ich Berichte im „Sydney Morning Herald‟ über dieses Zusammentreffen, die recht schön, aber nicht eben wahrheitsgetreu ausgeschmückt waren. Da sollte ich große Vorräte an Schnaps und Waffen (natürlich für die Eingeborenen) in Blumenthal gehabt haben und dergleichen Unsinn mehr. Ich war das aber von der australischen Presse, die sich damals viel mit mir beschäftigte, bereits gewohnt. So wurde in der „Geographischen Gesellschaft‟ in Melbourne einmal berichtet, ich hätte ganz Neu-Guinea für eine Flasche Rum gekauft.
Probe der Abbildungen
aus:
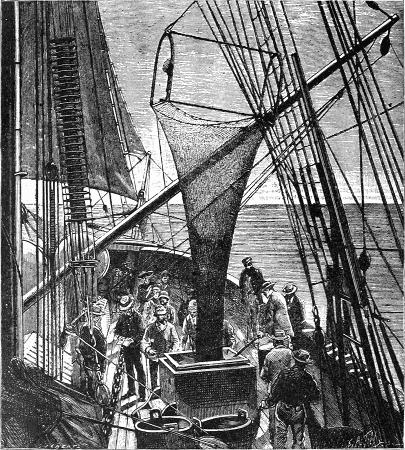
Marshall,
Die Tiefsee und ihr Leben.
(Siehe die folgende Seite.)
[S. 393] Verlag von Ferdinand Hirt & Sohn in Leipzig.
In Vorbereitung befindet sich für den Herbst d. J.:
Die Tiefsee und ihr Leben.
Nach den neuesten Quellen dargestellt von
William Marshall,
Professor an der Universität Leipzig.
Mit sehr vielen Abbildungen.
Folgende ältere Werke seien geneigter Beachtung empfohlen:
Die Expedition des Challenger.
Eine wissenschaftliche Reise um die Welt.
Von W. Spry, deutsch von H. von Wobeser.
Mit 12 Tonbildern, 35 Abbildungen im Text und Reisekarte.
Geheftet 12 M., gebunden 14 M.
Nach den Victoriafällen des Zambesi.
Von Eduard Mohr.
Mit Porträt des Verfassers, vielen Illustrationen in Holzschnitt und Farbendruck, Karte
und einem kommerziellen und astronomischen Anhang.
2 Bände. Geheftet 20 M., gebunden 24 M.
Die Eingeborenen Süd-Afrikas,
ethnographisch und anatomisch beschrieben
von Prof. Gustav Fritsch, Dr. med.
Mit zahlreichen Holzschnitten, größtenteils nach Originalphotographien und Zeichnungen des
Verfassers, 20 lithogr. Tafeln mit Abbildungen von Skelettteilen etc. und einer Karte der
Wanderungen der südafrikanischen Völkerstämme.
Hierzu ein
☛ Atlas, enthaltend 60 in Kupfer radierte Porträtköpfe. ☚
Preis der beiden Bände (gebunden) 75 M.
Verlag von Ferdinand Hirt in Breslau.
Kutzen, Prof. J., Das deutsche Land in seinen charakteristischen Zügen und seinen Beziehungen zu Geschichte und Leben der Menschen. Dritte Bearbeitung von Prof. Dr. Koner. Geh. 8 M. Geb. 10,50 M.
Delitsch, Prof. Dr. O., Deutschlands Oberflächenform. Versuch einer übersichtlichen Darstellung auf orographischer und geologischer Grundlage zu leichterer Orientierung im deutschen Vaterlande. Mit 3 Karten. 1,60 M.
Avé-Tallemant, Dr. R., Wanderungen durch die Pflanzenwelt der Tropen. 4 M.
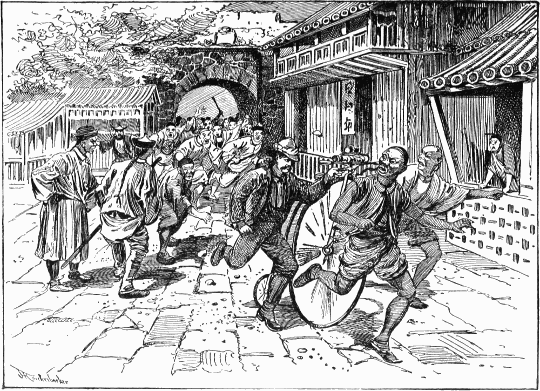
Probe der Abbildungen aus Stevens, Um die Erde auf dem Zweirad. II. Teil (Schluß)
(Siehe die folgende Seite.)
[S. 395] Verlag von Ferdinand Hirt & Sohn in Leipzig.

Probe der Abbildungen
aus
Brassey, Familienreise.
Reiseschilderungen der Weltumseglerin Lady Annie Brassey,
für das deutsche Publikum bearbeitet von A. Helms:
Eine Familienreise von 14000 Meilen in die Tropen und durch die Regionen der Passate. Mit 290 Abbildungen u. 7 Karten. In Prachtband 8,50 M. Geheftet 6,60 M.
Sonnenschein und Sturm im Osten. Seefahrten und Wanderungen vom Hyde-Park zum Goldenen Horn. In Prachtband 8,50 M. Geheftet 6,60 M.
Eine Segelfahrt um die Welt. Pracht-Ausgabe. Gebunden 15 M. Geheftet 12 M. — Billige Ausgabe. (Fünfte Auflage.) Gebunden 8,50 M. Geheftet 6,60 M.
☛ Die Schriften der kürzlich auf hoher See verstorbenen kühnen Weltumseglerin Lady Brassey sind auch in Deutschland nicht minder günstig aufgenommen worden, als in England. Die inhaltliche Gediegenheit, wie auch die vornehme Ausstattung haben diese, in vielen Auflagen vorliegenden Bücher allenthalben in den gebildeten Familien heimisch gemacht.
Schriften von P. G. Heims, Kaiserl. Marinepfarrer.
Unter der Kriegsflagge des Deutschen Reichs.
Erste Reihe:
Rund um die Erde. Bilder und Skizzen von der Weltreise S. M. S. »Elisabeth« (1881–1883). Mit mehreren Karten der Reise. Zweite Aufl. Sehr reich gebunden 8 M., geheftet 6 M.
Zweite Reihe:
Kreuzerfahrten in Ost und West. Bilder und Skizzen von der Reise S. M. Kreuzer-Corvette »Nymphe« (April 1884 bis Oktober 1885). Sehr reich gebunden 8 M., geheftet 6 M.
Seespuk.
Aberglauben, Märchen u. Schnurren.
In Seemannskreisen gesammelt u. bearbeitet.
Illustriert von Joh. Gehrts.
Reich gebunden 6 M., geheftet 4,50 M.
☛ Das außergewöhnliche Erzählertalent des Marinepfarrers Heims dürfte genugsam bekannt sein. Seine Schilderungen sind wahr und lebenstreu und verdienen wegen ihres für Jung wie Alt belehrenden Inhalts die allgemeine Beachtung.
In dritter (unveränderter) Auflage liegt folgendes, originelle Reisewerk bereits vor:
Um die Erde auf dem Zweirad.
Nach dem Englischen des Th. Stevens,
übersetzt von Dr. F. M. Schröter.
Teil I: Von San Francisco nach Teheran. Mit Porträt des Verfassers und vielen Abbildungen im Text. Reich gebunden 8,50 M.
Teil II (Schluß): Von Teheran nach Jokohama wird in Kürze zur Ausgabe gelangen.

[S. 397]Verlag von Ferdinand Hirt & Sohn in Leipzig.
In mehr als 13,000 Bänden hat folgendes Prachtwerk bereits Verbreitung gefunden:
Nordland-Fahrten.
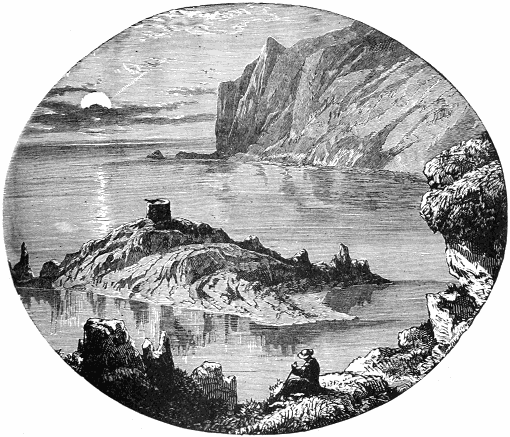
Malerische Wanderungen durch Norwegen u. Schweden, Irland, Schottland, England, Holland u. Dänemark.
Mit besonderer Berücksichtigung von Sage und Geschichte, Litteratur und Kunst
geschildert durch Prof. Dr. Adolf Brennecke, Francis Broemel, Friedrich von Hellwald, Dr. Hans
Hoffmann, Richard Oberländer, Joh. Prölß, u. Dr. Adolf Rosenberg.
Mit mehreren Hunderten von Abbildungen nach Originalzeichnungen der hervorragendsten Künstler. In 4 ganz selbständigen, einzeln käuflichen Bänden. In Prachtband je 20 Mark.
Band I: Norwegen, Schweden, Irland u. Schottland. Einbd.: Norweg. Gebirgslandschaft. Zeichng. von C. Römer. 2. Aufl.
Band II: Wanderungen durch England u. Wales. Einband: Englische Burgruine. Zeichnung von C. Römer.
Band III: England und die Kanalinseln. Einband: Englische Felsenküste. Zeichnung von C. Römer.
Band IV: Holland und Dänemark. Einband: Holländische Winterlandschaft. Zeichnung von W. Georgy.
Die bis auf wenige Exemplare vergriffenen Bände II u. III dieses Unternehmens finden Ersatz durch das folgende, kürzlich in gleicher Ausstattung erschienene Werk:
Alt-England. Eine Studienreise durch London und die Grafschaften zwischen Kanal u. Piktenwall. Von Adolf Brennecke. Mit zahlreichen Abbildungen nach Zeichnungen hervorragender Künstler. Prachtband 20 M.
☛ Der Text beschränkt sich nicht auf vereinzelte geographische und geschichtliche Mitteilungen, sondern er bringt in fesselnder Darstellungsweise das geistige, gesellschaftliche und künstlerische Leben, die Entwickelung der Baukunst, die Industrie und den Weltverkehr Englands (mit statistischen Nachweisen) zur Behandlung. Überall sind die neuesten und zuverlässigsten Quellenwerke benutzt worden.
[S. 398]Proben aus Ferdinand Hirts Geographischen Bildertafeln. (Siehe die folgende Seite.)


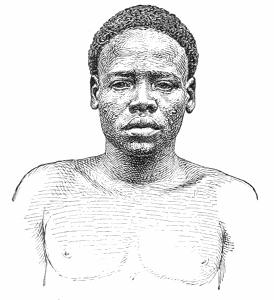


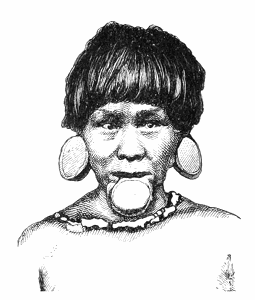
[S. 399] Geographische und geschichtliche Werke für Jung u. Alt.
Ferdinand Hirts Geographische Bildertafeln.
Für die Belebung des erdkundlichen Unterrichts und die Veranschaulichung der Hauptformen der Erdoberfläche mit besonderer Berücksichtigung der Völkerkunde und Kulturgeschichte, herausgegeben von Dr. Alwin Oppel und Arnold Ludwig.
Teil I: Allgemeine Erdkunde.
Herausgegeben unter Mitwirkung von
Prof. Dr. G. Fritsch (Berlin), Dr. G. Leipoldt (Dresden), Prof. Dr. R. Perkmann (Wien), R. Waeber (Liegnitz) und vielen anderen hervorragenden Fachmännern.
Mit 319 Abbildungen auf 25 Tafeln.
Zweite Auflage.
Geheftet 3,60 M. Gebunden 4.75 M.
Erläuternder Text 1 M.
Teil II: Typische Landschaften.
Herausgegeben unter Mitwirkung von
J. Kanitz (Wien), Dr. Karl Müller (Halle), Richard Oberländer (Leipzig), Prof. Seibert (Bregenz) und vielen anderen hervorragenden Fachmännern.
Mit einführendem Text und 29 Bogen Abbildungen
178 Landschaftsbilder enthaltend.
Zweite Auflage.
Geheftet 5 M. Gebunden 6,50 M.
Teil III: Völkerkunde.
(In 3 Abteilungen.)
Herausgegeben unter Mitwirkung von
Dr. J. Baumgarten (Coblenz), C. Bock (Christiania), Prof. Dr. Kan (Amsterdam), J. Kanitz (Wien), Dir. Dr. Müller (Antwerpen), Prof. Dr. Partsch (Breslau), Prof. Seibert (Bregenz).

Abteilung 1: Völkerkunde von Europa.
Mit 300 Holzschnitten auf 30 Tafeln und einem kurzen erläuternden Text. Geheftet 5,50 M. Geb. 7 M.
Abteilung 2: Völkerkunde von Asien und Australien.
Mit 27 Tafeln Abbildungen und einem kurzen erläuternden Text. Geheftet 6,50 M. Geb. 8 M.
Die Abteilung 3: Völkerkunde von Afrika und Amerika ist in Vorbereitung und beschließt das Unternehmen.
Als ein erweiterter, erläuternder Text zum II. Teile ist erschienen:
Landschaftskunde. Versuch einer Physiognomik der gesamten Erdoberfläche in Skizzen, Charakteristiken und Schilderungen von Dr. A. Oppel. Geheftet 12 M. Gebunden 14,50 M.
Empfohlen seien auch folgende geographischen Charakterbilder:
Umschau in Heimat und Fremde. Ein geographisches Lesebuch von Prof. Dr. Hentschel und Dr. Märkel. Mit vielen Bildern. Teil I: Deutschland. Geh. 2,50 M. Geb. 3,30 M. Teil II: Europa (Mit Ausschluß d. Deutschen Reichs). Geh. 3,60 M. Geb. 4,50 M.
Ein Seitenstück zu den vielverbreiteten »Geographischen Bildertafeln« bilden:
Ferdinand Hirts Historische Bildertafeln.
Für die Belebung des geschichtlichen Unterrichts
herausgegeben von mehreren praktischen Schulmännern und Gelehrten.
Teil I: Das Altertum bis zum Untergange des Heidentums. 2,50 M.
Teil II: Von den Anfängen d. Christentums bis zum Beginn d. XIX. Jahrh. 2,50 M.
Teil I u. II in einem Bande, nebst erläuterndem Text (einzeln 1 M) geh. 6 M, geb. 7,50 M.
[S. 400] Proben aus Ferdinand Hirts Geographischen Bildertafeln. (Siehe die vorhergehende Seite.)