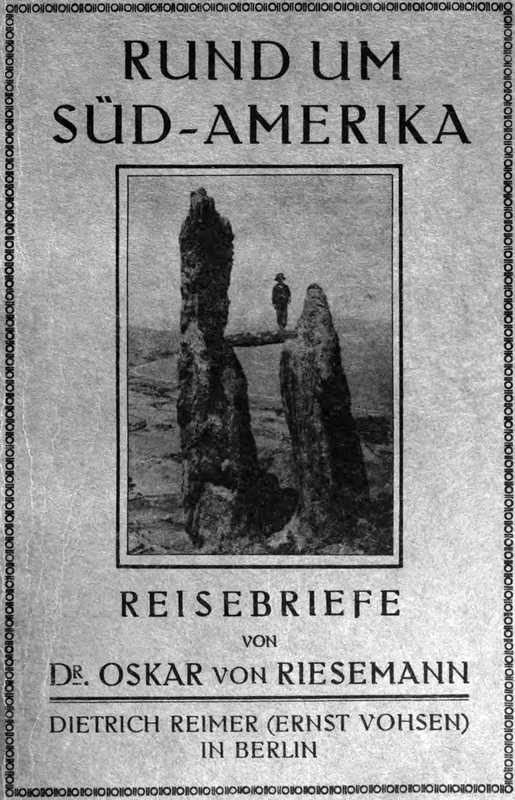
This eBook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this eBook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you'll have to check the laws of the country where you are located before using this ebook.
Title: Rund um Süd-Amerika
Reisebriefe
Author: Oskar von Riesemann
Release Date: August 23, 2017 [eBook #55419]
Language: German
Character set encoding: ISO-8859-1
***START OF THE PROJECT GUTENBERG EBOOK RUND UM SüD-AMERIKA***
| Note: | Images of the original pages are available through Internet Archive. See https://archive.org/details/rundumsdamerik00ries |
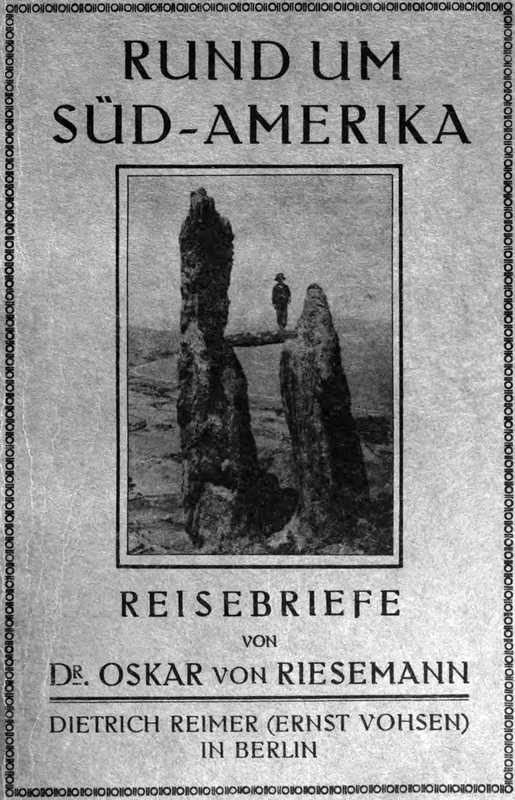
REISEBRIEFE
VON
DR. OSKAR v. RIESEMANN
MIT 43 ABBILDUNGEN AUF 16 TAFELN
DIETRICH REIMER (ERNST VOHSEN)
BERLIN 1914
ALLE RECHTE VORBEHALTEN
DAS BILD AUF DEM UMSCHLAG STELLT
»FELSBLÖCKE AM TITICACA-SEE« DAR
SR. DURCHLAUCHT
FÜRST PETER LIEVEN
DEM TREUEN REISEGEFÄHRTEN IN
HERZLICHER FREUNDSCHAFT UND DANKBARKEIT
FÜR MANCHE ANREGUNG ZUGEEIGNET
Die vorliegenden Briefe erschienen während meiner Reise vom Dezember 1912 bis zum Juli 1913 in der »Moskauer Deutschen Zeitung«. Auf wissenschaftliche Gründlichkeit, oder Vollständigkeit in irgend einer Beziehung können sie nicht die geringsten Ansprüche erheben. Trotzdem habe ich mich entschlossen, sie gesammelt der Öffentlichkeit zu übergeben.
Die Reiseliteratur über Süd-Amerika ist sehr arm. Bevor ich meine Reise antrat, habe ich die besten Buchhandlungen in Petersburg, Berlin und London abgesucht, ohne irgend etwas Brauchbares zu finden. Infolgedessen hoffe ich, daß selbst diese oberflächlichen Schilderungen Reisenden, deren Ziel Süd-Amerika ist, nützlich sein können. Sie enthalten die frischen Eindrücke eines Reisenden, dessen Amerika-Fahrt keinen anderen Zweck verfolgte, als den: Land und Leute außerhalb Europas ein wenig kennen zu lernen.
Irgend ein System oder irgend eine Tendenz sucht man in diesen Blättern vergeblich. Ich bin ein Freund von planlosen Reisen und hatte das Glück einen gleichgesinnten Reisekameraden zu finden. Während der Reise wurde das nächste Ziel immer erst beim Verlassen des vorhergehenden bestimmt. Von Zeit- und Raumrücksichten waren wir unabhängig. Infolgedessen haben wir sicherlich vieles Schöne und Naheliegende nicht gesehen, dafür aber manche vielleicht nicht weniger lohnende Gegenden aufgesucht, an denen Bädeker-Reisende höchst wahrscheinlich achtlos vorübergefahren wären. Man betrachte das Büchlein mit Nachsicht. Es ist von keinem Reise-»professional« geschrieben.
Den Bilderschmuck hätte ich gerne reicher und interessanter gestaltet, doch bin ich im Photographieren – Dilettant. Einige der besten Aufnahmen haben mir unsere Reisegefährten in Bolivien, Herr Werner Schmidt-Valparaiso und Herr Bergassessor Wenker liebenswürdiger Weise zur Verfügung gestellt. Ich sage ihnen dafür auch an dieser Stelle meinen aufrichtigen Dank.
Moskau, Dezember 1913.
Dr. O. v. RIESEMANN.
| Vorwort | 7 | ||
| 1. | Der Steamer »Arlanza«. – Vigo. – Lissabon | 11 | |
| 2. | Die Insel Madeira | 16 | |
| 3. | Pernambuco. – Bahia | 21 | |
| 4. | Rio de Janeiro und brasilianische Karnevalsfreuden | 25 | |
| 5. | Buenos Aires | 29 | |
| 6. | Die argentinischen Pampas. – Das Weinland von Mendoza | 33 | |
| 7. | Die Kordilleren | 38 | |
| 8. | Chile. – Allgemeine Eindrücke | 43 | |
| 9. | Temuco. – Ein Aufzug der Araucaner-Indianer | 49 | |
| 10. | Der Mapuche (Araucaner) chez soi | 54 | |
| 11. | Süd-Chile – ein zweites Deutschland | 59 | |
| 12. | Chilenisches Gesellschafts-, Bade- und Sportleben | 64 | |
| 13. | Von Valparaiso nach Antofogasta. – Die chilenische Salpeter-Industrie | 70 | |
| 14. | Bolivien. – Oruro. – La Paz | 76 | |
| 15. | Im tropischen Bolivien | 83 | |
| 1. | Von La Paz bis Achecachi | 83 | |
| 2. | Von Achecachi nach Sorata | 89 | |
| 3. | Von Sorata nach San Carlos | 95 | |
| 4. | San Carlos | 108 | |
| 5. | Mapiri und Guanay | 115 | |
| 6. | Die Rückkehr | 128 | |
| 16. | Im Schnellzug durch Peru. – Der Titicaca-See. – Mollendo. – Lima | 135 | |
| 17. | Panama und eine Alligatorjagd | 140 | |
| 18. | Von Panama nach New York. – Jamaika. – Cuba | 149 | |
| 19. | New York | 153 | |
| 1. | Der erste Eindruck | 153 | |
| 2. | Hotels, Zeitungswesen, Reklame | 159 | |
| 3. | Polizeiwesen, Detektivs, Verbrecherkneipen und Opiumhöhlen | 165 | |
| 4. | Amerikanischer Sport und amerikanische Vergnügungen | 175 | |
| 5. | Das Jugendgericht | 181 | |
| 20. | Der »Imperator« | 187 | |
| 1. | Puente del Inka (Anden) | 40 |
| Kordilleren-Landschaft | 40 | |
| 2. | Das Christusdenkmal auf der Grenze Argentinien-Chile | 40 |
| Nebenan ein Maultier-Skelett | 40 | |
| »Hotel« in Juncal | 40 | |
| 3. | Bergsee in den Kordilleren | 40 |
| Blick auf den Aconcagua | 40 | |
| 4. | Araucanische »Ruca« (Chile) | 56 |
| Araucanischer Friedhof | 56 | |
| Interieur einer »Ruca« | 56 | |
| Araucanerin zu Pferde | 56 | |
| 5. | Oruro (Bolivien) | 80 |
| Straßentypen in Oruro | 80 | |
| Lamas in Ängsten vor dem »Kodak« | 80 | |
| 6. | Proben altspanischer Architektur in La Paz (Bolivien) | 80 |
| 7. | »Balza« auf dem Titicaca-See (Bolivien) | 88 |
| Flötenblasender Indianer | 88 | |
| 8. | Bolivianische Postkutsche | 96 |
| Das »Grand Hotel« Tola Pampa | 96 | |
| 9. | Die Hazienda »San Carlos« (Bolivien) | 104 |
| Indianer in Poncho vor einem Bananen-Haine | 104 | |
| 10. | Anzapfen eines »Gummibaumes« | 112 |
| Abschälen der »China-Rinde« | 112 | |
| 11. | Eine »Balza« auf dem Mapiri | 120 |
| Unser »Wohnhaus« in Guanay | 120 | |
| 12. | Die »Stadt« Mapiri | 120 |
| Stromaufwärts! | 120 | |
| 13. | Sonnenaufgang beim »Yalhazani-Paß« (Bolivien) | 128 |
| Frühstückspause | 128 | |
| Indianisches Denkmal | 128 | |
| 14. | Indianisches Stubenmädchen in Sorata | 128 |
| Der Balzero »Sonnenschein« | 128 | |
| Indianerin beim Maismahlen | 128 | |
| 15. | Indianer im Feststaat (Bolivien) | 136 |
| 16. | Jamaika | 152 |
Am 3. Januar (21. Dez.) hieß es, zum ersten Male Abschied von Europa nehmen. In Southampton, das den überseeischen Weltverkehr Londons vermittelt, erwartete uns der Steamer »Arlanza«, der neueste und schönste Riesendampfer der Royal Mail Steam Packet Company, kürzer R.M.S.P. Diesem schwimmenden Koloß, der, wie sich auf den ersten Blick feststellen ließ, alle Vorzüge eines luxuriösen Weltstadt-Hotels in sich vereinigte, galt es, seine sterbliche Hülle bis Rio de Janeiro anzuvertrauen. Man tut es gerne, denn der Dampfer mit seinen sieben Etagen über dem Wasserspiegel, den zahlreichen, höchst komfortabel ausgestatteten Gesellschaftsräumen, dem pompösen Speisesaale, Turnhallen und Promenadendecks macht einen sehr vertrauenerweckenden Eindruck. Die prächtig eingerichtete Kabine, die uns aufnahm, verhieß mit ihrem geräumigen Badezimmer und einem mechanischen Wunderwerk von Douche-Vorrichtungen, sogar für die Äquatorialzone ein erträgliches Leben. Mit einigen Handgriffen kann man so ungefähr den halben Ozean zu sich heraufpumpen, wenn es zu heiß wird. Immerhin eine erfrischende Aussicht.
Die erste Sorge, wenn man einen Dampfer zu einer 21tägigen Seereise betritt, gilt natürlich – der Seekrankheit. In diesem Fall war die Frage ganz besonders brennend, galt es doch den berüchtigten Golf von Biscaya zu durchqueren. Dieser Golf von Biscaya verursachte mir schon vor Beginn der Reise ein Gefühl, das mit Seekrankheit nahe verwandt ist. Jedermann, der von meiner Reise hörte, fühlte sich verpflichtet, die Augenbrauen bedenklich hochzuziehen und mit vielsagendem Kopfschütteln prophetisch auszurufen: »Nun, nun, aber der Golf von Biscaya!« Das taten alle, von den besten Freunden bis zum Hotelkellner in London und Gepäckträger in Southampton. Kein Wunder, daß einem dieses Schreckgespenst »Golf von Biscaya« zum Halse herauswuchs, noch bevor er in Sicht war. Zum Überfluß hatten in der Woche vor meiner Abreise drei englische Schiffe im Golf von Biscaya umkehren müssen, und ein italienisches war mit Mann und Maus untergegangen.
So erwartete ich ihn denn mit Todesverachtung – den ominösen Golf von Biscaya, zumal das Schiff im Ausgange des Kanals bedenklich zu »stampfen« anfing. Aber die Meergötter hatten Erbarmen mit mir, wahrscheinlich fanden sie mit Recht, daß ich schon vorher genug Qualen dank dem Golf von Biscaya ausgestanden hatte. Oder war es das neuerfundene »Delphinin«, das mich vor der Seekrankheit bewahrte. In dem Falle empfehle ich es allen Seereisenden aufs wärmste.
Dafür habe ich vom Golf von Biscaya einen wundervollen Natureindruck davongetragen. Merkwürdig beengt erscheint der Horizont, denn die mächtigen Wogen, die von allen Seiten heranrollen, versperren überall hin die Aussicht. Ein herrliches Farbenspiel entwickelt sich bei Sonnenschein in diesen durchsichtigen gläsernen Bergen, die bald grün, bald grau, bald bläulich-weiß schimmern, während sie bei Sonnenuntergang wie ein Gemisch von Blut und Gold erscheinen. Eine unheimliche Kraft wohnt in den Wogen des Atlantischen Ozeans. Drohend nahen sie in geschlossenen Reihen, und wenn sich ihnen ein Hindernis in Gestalt eines Dampfers in den Weg stellt, so zerschellen sie empört daran und senden ihren weißen Gischt hinauf bis aufs fünfte und sechste Deck. Ein Schiff von fast 16 000 Tons, gleich der »Arlanza«, ist ein willenloses Spielzeug ihrer drängenden Gewalt und vermag scheinbar nur mit Mühe seinen Weg durch die ihm entgegenschäumenden Fluten fortzusetzen.
Der erste Haltepunkt nach glücklicher Durchquerung des Golfes von Biscaya war der spanische Kriegshafen Vigo. Die ersten Laute, die mir in der malerischen, von sanft gewellten Gebirgszügen eingeschlossenen Bucht entgegenschlugen, waren folgende: »dawai russki moneta!« Und zwar entstieg dieser Anruf dem nimmer ruhenden Mundwerk einer spanischen Obsthändlerin, die ihr ganzes Warenlager in ein Segelboot verstaut hatte und an unseren Dampfer anlegte. Er galt, wie sich nachher herausstellte, einer Schar russischer Emigranten, die vom Hinterdeck der »Arlanza« waschechte 15- und 20-Kopekenstücke in Körben hinabließen und dagegen als Äquivalent eine geringere oder größere Anzahl von Birnen, Orangen, Feigen und anderen Früchten erhielten. Ihr verzweifelter Ruf nach »Gurken« verhallte allerdings ungehört. Diese russischen Emigranten – Sektierer aus Transkaukasien – sind ein überaus sympathischer und ernster Menschenschlag. Sie ziehen nach Montevideo in Brasilien, um dort »das Reich Gottes« aufzurichten, da sie auf das Jenseits keine Hoffnung setzen. Vielleicht werde ich noch einmal Gelegenheit haben, die tiefsinnigen moralischen und ethischen Grundsätze dieser bemerkenswerten Menschen näher zu beleuchten. In Brasilien und in Argentinien gibt es eine große Zahl russischer Sektierer-Kolonien. Die »Duchoborzy« haben es dort bekanntlich zu großem Ansehen und beträchtlichem Wohlstande gebracht.
Die »Arlanza« hielt in Vigo nur zwei Stunden. Wir, d. h. mein Reisekamerad und ich, waren die einzigen Passagiere, die in einem Dampfkutter an Land gingen, da ich einige wichtige Korrespondenzen aufzugeben hatte. Es war ein Sonntag, 3 Uhr nachmittags, und am Hafenkai, der zugleich der fashionable Boulevard des kleinen Städtchens ist, entwickelte sich ein äußerst bewegtes, buntes Leben und Treiben. Schöne Spanierinnen – übrigens alle stark geschminkt, egal ob sie 40 oder 16 Jahre alt sind – in malerischen schwarzen »mantillas« und schwatzhafte Gecken, in möglichst leuchtende Farben gekleidet, flanierten den breiten Hafenkai auf und ab. Als Führer diente uns ein durchtriebener kleiner spanischer Bursche, der unter »Sehenswürdigkeiten« der Stadt die merkwürdigsten und überraschendsten Dinge verstand. Übrigens konnte auch er einige Worte russisch. Das verdankt man der »Kulturträgerarbeit« der russischen Kriegsschiffe, die ständig in Vigo stationieren.
Lissabon ist eine wundervolle Stadt. Alexander v. Humboldt nennt sie bekanntlich die »Königin aller Seestädte«. Und nach meinen bisherigen Erfahrungen bin ich unbedingt geneigt, ihm Recht zu geben. In einer Länge von mehr als 10 Kilometer zieht sich das im Januar-Sonnenschein blendend weiß schimmernde Häusermeer um die Bucht. Die Stadt ist terrassenmäßig angelegt – auf sieben Hügeln. Jede Stadt, die etwas auf sich hält, ruht auf sieben Hügeln, auch Rom und Moskau.
Da uns nur wenige Stunden zur Verfügung standen, konnten von den Sehenswürdigkeiten der Stadt nur wenige und auch die nur flüchtig in Augenschein genommen werden. Eine Autofahrt in die Kreuz und in die Quer ließ uns wenigstens von den Straßenbildern Lissabons einen ziemlich vollständigen Eindruck mitnehmen. Es gibt unbeschreiblich reizvolle und pittoreske Partien in der Stadt, Gebäude von sonderbarer, halb maurischer, halb romanischer Bauart, die uns als der »stilo Manuele« vorgestellt wurde, bezaubernde Palmenhaine wechseln mit breiten, pompösen Avenüen und Plätzen ab, oft öffnet sich in einer unscheinbaren Querstraße ein herrlicher Ausblick auf das leuchtende Meer mit seinen bunten Segeln und dem regen Dampferverkehr. Zwischen dem steinalten verwitterten Gemäuer in engen, steilen Straßen nimmt sich das blendende Blau des Meeres und des Himmels natürlich besonders reizvoll aus.
Einen unauslöschlichen Eindruck macht das nicht weit von der Stadt gelegene, von malerischen Palmengruppen umsäumte Kloster Belem (sprich Beleng, im Portugiesischen gibt es, glaube ich, keinen einzigen Laut, der nicht nasal ist). Es ist ein im echtesten Manuel-Stil erbauter riesiger Gebäude-Komplex aus weißem, marmorähnlichem Gestein, das zu feinstem Spitzenfiligran verarbeitet ist. Der Klosterhof mit seinen Kreuzgängen ist eines der vollendetsten architektonischen Gebilde, das mir je zu Gesicht gekommen ist. Die Eingeborenen freilich lachen über die »Zuckerbretzeln« des »stilo Manuele«. Jetzt dient das Kloster 800 Waisenknaben zum Aufenthaltsort. Sie hatten gerade Freistunde und vollführten einen Höllenspektakel im stillen Klosterhofe, der eigentlich ganz anderen Zwecken, der inneren Sammlung und Ruhe, dienen sollte. Als besondere Sehenswürdigkeit – echt portugiesisch, dieses Volk hat für Unappetitlichkeiten eine besondere Vorliebe – wurde ein Knabe gezeigt, dem die Schädeldecke fehlte und der mit seiner Blechkapsel, die diese ersetzte, devot grüßte. Der Bursche war höchst vergnügt und unbändig stolz auf seinen blechernen Schädel, den Gegenstand der Achtung und des Neides seiner 799 Mitschüler. In einem Raum des Klosters befindet sich das wundervoll gearbeitete Grabdenkmal des portugiesischen Historikers Alessandro Herculeo. Kein König hat in Lissabon solch ein Grabmonument. Es gibt also doch ein Volk, das seine Denker ehrt.
Apropos, die portugiesischen Könige. Jetzt gibt es keine mehr. Aber die früheren werden Neugierigen auch heute noch gezeigt. Ich schäme mich fast, daß ich sie mir auch angesehen habe. In einer Begräbniskapelle, die einer alten Rumpelkammer ähnlich sieht, stehen Särge über Särge gestapelt. Sie bergen die sterblichen Überreste der portugiesischen Könige und brasilianischen Kaiser. Der hinkende Wächter dieser entschwundenen Herrlichkeit holte aus altem Gerümpel eine Holztreppe hervor und hieß uns an die »interessantesten« Särge hinansteigen. Da grinsten uns durch die Glasscheibe des oberen Sargdeckels die weißlich verschimmelten Gesichter des Königs Carlos und des unglücklichen Thronfolgers Don Louis entgegen, die dem Attentat 1909 zum Opfer fielen, und der einst so prächtig charaktervolle Kopf des Kaisers Don Pedro von Brasilien, der sein Land zu dem gemacht hat, was es ist. Am Fußende eines der Särge lag eine zerbrochene Königskrone aus Goldblech – ein vielsagendes, warnendes Symbol.
Sic transit gloria mundi!
Die Portugiesen sind unsagbar stolz auf den Kopf der Republik, der jetzt auf ihren neugeprägten Münzsorten prangt.
Möge jeder jemals von mir aufgenommene Tropfen des flüssigen Goldes, durch das dieser Ort zuerst berühmt geworden ist, mir helfen, die zauberische Schönheit der Insel Madeira in Farben zu schildern, die ebenso glühend und feurig sind, wie der Wein, der auf ihren fruchtbaren Bergabhängen wächst.
Am 8. Januar um 5 Uhr morgens warf die »Arlanza« auf der Außenreede von Funchal, der Hauptstadt der Insel, Anker. Veder Napoli e poi morir – das hat ein Mann gesagt, der Madeira sicherlich nicht gesehen hat. Der Anblick der Insel vom Meere aus bietet ein unvergeßliches Bild. Von hohen Bergketten umschlossen, öffnet die Bucht von Funchal ihren gastlichen, geschützten Hafen den Schiffen. Trotzig und zackig ragen hier schroffe Felsabhänge in den Ozean hinein, sanft gewellte Hügel, von immergrünen Hainen bedeckt, ziehen sich dort den Strand entlang. Und zwischen hineingestreut, als hätte man einen Sack Zucker ausgeschüttet, liegen die schneeweißen Würfel der Häuser und Villen Funchals. In blendendem Morgensonnenschein blitzen und funkeln die Fensterscheiben bis weit übers Meer herüber. Trotz der frühen Morgenstunde herrscht ein reges Leben auf der Bucht von Funchal. Unser Dampfer ist im Nu umringt von einer Unmenge schmaler Ruderboote und kleiner Dampfkutter. Ein ähnliches Gewimmel umgibt einen anderen prächtigen Ozeanriesen, der sich nicht weit von uns auf den Wellen schaukelt. Er rüstet sich zur Weiterfahrt nach Afrika und von Zeit zu Zeit läßt er den aufregenden Schrei seiner Dampfpfeife ertönen. Für den Stil unserer Reise übrigens war es charakteristisch, daß wir einen Augenblick lang ernstlich daran dachten von unserem Amerikadampfer auf jenen Afrikadampfer überzusiedeln. Er sah mit seinem sauberen hellgrauen Anstrich so einladend und unternehmend aus. Und in Afrika ist es sicherlich auch sehr interessant. Nach »reiflicher« Überlegung, die 5 Minuten währte, entschieden wir uns jedoch zu bleiben, wo wir waren. Ob zu unserem Glück oder Unglück – wer weiß es.
Vor einigen Jahren noch mag es schwer, ja unmöglich gewesen sein, in der verhältnismäßig kurzen Zeit von sechs Stunden die Schönheiten Madeiras auch nur einigermaßen gründlich kennen zu lernen, jetzt geht das leichter, wenn es einem nämlich gelingt, eines der wenigen Autos habhaft zu werden, die von unternehmungslustigen Madeiranern wohl speziell für durchreisende Fremde angeschafft worden sind. Gelingt einem das jedoch nicht, so ist man verloren, das heißt auf die vorsintflutlichen Vehikel angewiesen, mit denen der gewöhnliche Straßenverkehr auf Madeira besorgt wird. Der Wissenschaft halber habe auch ich eine Strecke in solch einem Fuhrwerke zurückgelegt und wurde dabei lebhaft an die Moskauer Iswostschiki im März erinnert. Solch eine Madeira-Droschke ist nämlich ein – Schlitten, der von zwei trägen Ochsen über das holperige Pflaster der Stadt gezogen wird. Die Kufen werden mit Fett eingeschmiert (so weit ist man in Moskau noch nicht), um leichter über die Steine zu gleiten. Wenigstens ist für einigen Komfort gesorgt. Die Schlitten haben Federn, und vor der Sonne wird der Fahrgast durch einen auf vier Stangen ruhenden Baldachin aus buntem Kattun geschützt. Das Tempo solch eines Fuhrwerkes ist das Largo des Totenmarsches aus »Saul«. Zwar läuft ein brauner Junge, der unter seinem Riesenstrohhut fast verschwindet, voran und reizt die Ochsen vermittelst eines Flederwischs zu temperamentvolleren Leistungen. Doch hilft das nur wenig. Die Ochsen wären ja wirklich welche, wenn sie vor dem kleinen Buben mit seinem weichen Besen Respekt hätten.
Nein, ein Auto auf Madeira ist vielleicht stillos, aber für Reisende, deren Dampfer Eile hat, ist es unter allen Umständen vorzuziehen.
Unser Chauffeur, ein Stockportugiese, der außer den häßlich-näselnden, faulen Lauten seiner Sprache, leider keinen Ton in einem verständlicheren Idiom hervorbringen konnte und auch keinen verstand, führte uns zuerst auf die Ostseite der Insel. Der Weg windet sich bergan, zwischen Zuckerrohrfeldern, durch Alleen von Platanen, vorbei an Palmenhainen und Bananenpflanzungen, wo, noch jetzt im Januar, die goldigen Früchte im saftig grünen Laub schimmern. Lange Strecken des Weges bilden Legionen von Kakteen mit glühendroten Knollen und Blüten eine natürliche Hecke und bieten als origineller Stachelzaun Schutz vor Wegelagerern. Freilich auf der Straße selbst ist man vor ihnen nicht sicher, und sie stellen sich auch bald ein in Gestalt von braunhäutigen, barfüßigen und barhäuptigen Kindern, die ein Blumenbombardement auf den Wagen eröffnen. Wundervolle dunkelviolette Iris, Rosen, Azaleen-Blüten, Magnolien und sonderbare leuchtend rote Sternblumen fielen uns in den Schoß. Die Kinder laufen hinterdrein und haschen Kupfermünzen. Ihre schwarzen Korintenaugen blitzen wie glühende Kohlen und in ihren Gesten äußert sich ein beängstigend feuriges Temperament. Der Weg wird von Minute zu Minute schöner und romantischer. Auf der einen Seite hat man die Berglandschaft mit entzückenden Ausblicken, bizarren Felsformationen, schäumenden Wasserfällen, malerischen Viadukten, auf der anderen öffnet sich eine unendliche Fernsicht auf den im frühen Sonnenlichte silbern schimmernden Ozean. In violettem Dunst zeichnen sich am Horizonte die Umrisse der anderen kanarischen Inseln ab.
Auf dem höchsten Punkte des Weges machten wir Halt. Man mochte sich nicht losreißen von dem unbeschreiblich schönen Bilde, das sich nach allen Seiten hin bot. Einige regelrechte Kanarienvögel gaben uns im nahen Pinienhaine ein Morgenkonzert. Nun ging es denselben Weg zurück durch die jetzt schon ein wenig belebteren, meistens ziemlich winkeligen und engen aber immer malerischen Straßen Funchals. Es gibt eine Menge Villen, die sich durch ihre geschmackvolle Bauart auszeichnen. Sie liegen in blühenden Gärten, deren üppige tropische Vegetation einen geradezu märchenhaften Eindruck macht. Riesige Farrenbäume, Palmen, Rhododendren, Azaleen von der Größe junger Birken, Magnolien, Gummibäume – alles wächst dort in buntem und wirrem Durcheinander. Die meisten Häuser sind eingehüllt in das Dickicht irgend einer Schlingpflanze mit wundervollen leuchtend violetten Blüten, die so dicht wachsen, daß ihre Farbe fast wie ein lustig bunter Anstrich wirkt.
Auf der Westseite der Insel erreichten wir nach zirka 20 Kilometern ein kleines Fischerdorf, das auf steil abfallenden Felsen ins schäumende und brausende Meer hineingebaut ist. Es schien nur von Kindern bevölkert zu sein, die unser Auto in unheimlich anwachsenden Scharen umringten. Weder durch Geld noch durch gute Worte, noch durch Drohungen und Püffe konnte man sich von dieser schmutzigen braunen Bande befreien, die ein außerordentliches Verlangen nach Rauchwerk hatte und der die russischen Papiros leider sehr gut zu schmecken schienen. Für unsere milden Gaben revanchierten sie sich wenigstens durch die Vorführung von erstaunlichen Taucherkunststücken. Wie die Frösche sprangen sie von der hohen Felsküste ins Meer und verfehlten nie die ihnen zugeworfenen Münzen, nach denen sie oft metertief tauchten.
Die richtigen Madeira-Taucher sahen wir jedoch erst bei unserer Rückkehr aufs Schiff. Um den Dampfer herum herrschte ein solches Gewimmel von Booten, daß der kleine Kutter sich nur mit Mühe einen Weg zum Fallrepp bahnte. In jedem der hunderte von Booten saßen einige halbnackte braune Kerle und machten sich unter wüstem Geschrei anheischig, ihre Künste zu zeigen. Sämtliche Altersstufen von 10-40 Jahren waren unter diesen Tauchern vertreten, die mit unglaublichem Geschick ihr Geschäft besorgten. Gleich Affen kletterten sie an Tauen, die man ihnen hinabließ, bis aufs sechste Promenadendeck hinauf und von dort, d. h. von der Höhe eines zirka siebenstöckigen Gebäudes, warfen sie sich ins Meer. Es ist ein schönes, aber aufregendes Bild, wenn diese braunen Pfeile in die Tiefe schießen. Meterhoch spritzt das Wasser auf. Der Schlag auf die Wasserfläche muß ein mörderischer sein. Mit blutigroten Schultern tauchen die kühnen Burschen aus der Tiefe wieder auf, und zwischen den Zähnen halten sie unfehlbar das Geldstück, dem ihr Sprung galt. Die tollkühnsten von ihnen schwimmen übrigens nach dem Sprung unter dem Dampfer durch. Man kann ihnen alle Hochachtung nicht versagen, wenn man bedenkt, was für einen Tiefgang solch ein 16 000 Tonnenschiff hat. Einigen von den Tauchern fehlte diese oder jene Extremität, es gab eine Menge einarmiger und einbeiniger unter ihnen. Die fehlenden Gliedmaßen haben seinerzeit den Haifischen der Bucht von Funchal als leckere Mahlzeit gedient. Trotz der Gefahr, sich das Genick zu brechen oder von Haien angefressen zu werden, sind die Burschen nicht teuer. Sie springen schon gerne für 200 Reis. (Als Mittel gegen Schlaflosigkeit empfehle ich, portugiesische Münzsorten etwa in russisches Geld umzurechnen, ein Reis ist in Brasilien ungefähr 7/1000 Kopeken, in Portugal 3½ mal so viel; beim Versuch, irgend eine Summe – etwa 18 Millreis, 300 Reis – in Mark oder Rubel umzurechnen, schwindelt einem, und jetzt hat die republikanische Regierung noch zum Überfluß eine neue Münzsorte, Centavos = 10 Reis, eingeführt, und prägt Münzen von 50 Centavos. Um hier nicht übers Ohr gehauen zu werden, muß man ein Rechenkünstler vom Range eines Arago sein.)
In Madeira, dessen Zaubergärten viel zu schnell dem Blick entschwanden, nahmen wir für Wochen Abschied vom Lande. An den kahlen, von senkrechtem Sonnenbrande durchglühten Inseln Cap Verde, St. Vincenz und St. Antonio, fuhren wir stolz vorüber. Erst an der brasilianischen Küste, in Pernambuco, werden wir wieder Land sichten.
Sieht man tagaus tagein über die endlose Wasserfläche des Ozeans hin, über dem sich als einziges Zeichen organischen Lebens von Zeit zu Zeit ein glitzernder Schwarm fliegender Fische erhebt, so kehren die Gedanken immer wieder zu dem Märchenlande Madeira zurück, das wie eine Fata Morgana nur für Stunden aus dem Ozean auftauchte und sich dem Gedächtnis doch unauslöschlich eingeprägt hat.
In Pernambuco sichtete die »Arlanza« zum ersten Male die südamerikanische Küste. Mit einem aus Bedauern und Beruhigung gemischten Gefühl sah man den hellen Streifen über dem Horizont, der uns als »Amerika« vorgestellt wurde, immer breiter werden. Man bedauerte, daß nun bald das Götterleben auf dem Schiff mit der unbegrenzten Möglichkeit zu allen Arten des »dolce far niente«, mit dem amüsanten »board-tennis« und Ringspiel, mit den je nach Bedarf kräftigen oder kühlen »drinks« im Rauchsalon, mit den phantastischen Äquator-Maskenbällen und allerhand anderem gesellschaftlichem Ulk ein Ende haben würde. Man war beruhigt, weil man nun tatsächlich mit Amerika Bekanntschaft machte und nicht mit dem Seeboden.
Doch mußten sich die Passagiere, die zwölf Tage keinen festen Boden unter den Füßen gespürt hatten, hier noch mit dem Anblick des Landes begnügen, ohne es zu betreten. Nur Reisende, deren Bestimmungsort Pernambuco war, wurden ausgeladen. Dieses Wort ist keine Hyperbel, sondern entspricht den Tatsachen. Der Seegang und die Brandung ist in der Bucht von Pernambuco so stark, daß kein Boot und kein Dampfkutter ohne die Gefahr sofortiger Havarie dicht an die großen überseeischen Schiffe anlegen kann. Sie halten sich, von unmutigen Wellen hin und her geworfen, in respektvoller Entfernung. Die Passagiere aber werden wie Warenballen in großen Körben an den Riesendampfkränen des Schiffes in den Ozean hinabgelassen, wobei es gilt, eines dieser schwankenden Böte zu treffen.
Diese Beförderungsart ist keineswegs erheiternd, zumal das Schiff von zahllosen mächtigen Haifischen umtanzt wird, die ihre gierigen Rachen nach allem aufsperren, was in die Nähe der Wasserfläche kommt. Zur Freude der Schiffsmannschaft gelang es übrigens, eine dieser gefräßigen Bestien zu »angeln«, ein wahres Prachtexemplar von fast 4½ Meter Länge. Der Angelhaken, den diese Hyäne des Ozeans ohne Besinnen verschluckte, hatte die Größe eines mäßigen Schiffsankers. Vielleicht war es auch einer, ich habe nicht genau hingesehen.
In Bahia, einem der wichtigsten Handelszentren des äquatorialen Südamerika, betraten wir zum ersten Male den neuen Kontinent. Vom ersten Schritt an konnte kein Zweifel darüber walten, daß man sich nicht in Europa befand. Die Bevölkerung scheint auf den ersten Blick, wenigstens im Hafenviertel, ausschließlich aus Mohren zu bestehen. Allmählich beginnt man jedoch die feineren Unterschiede zu bemerken und unterscheidet die Mulatten, die in allen Schattierungen, sogar gefleckt, vertreten sind, von den ganz Schwarzen, dann die »Weißen« von den Mulatten. Allerdings was man hier einen »Weißen« nennt, könnte in Europa noch ganz gut als etwas verblichener Neger passieren. Die sengende Kraft der Sonne ist unglaublich. Merkwürdigerweise lähmt sie jedoch die Energie keineswegs. Obgleich man ununterbrochen Ströme von Schweiß vergießt, kann man selbst um 12 Uhr mittags in der Sonne spazieren gehen, vorausgesetzt, daß der Kopf durch einen hohen Panamahut geschützt ist. Schatten gibt es um diese Tageszeit keinen, weder Häuser, noch Mauern, noch Menschen können sich eines solchen rühmen. Die Sonne steht im Zenith und ihre Strahlen fallen genau senkrecht. Der Schatten eines Menschen nimmt nur den Raum ein, den seine Fußsohlen bedecken. Es kommt einem ganz merkwürdig vor, den kleinen schwarzen Fleck zwischen den Füßen als den eigenen Schatten anzusehen. Die Eingeborenen vermeiden es natürlich tunlichst, sich um diese Tageszeit auf der Straße zu zeigen. Besonders die Mohren geben sich in dem Handelsviertel, das sie sich in den Querstraßen des Hafens errichtet haben, dem ihnen, ach so lieben Nichtstun hin. Sie sind übrigens ein gutmütiges und zugängliches Volk, von Kultur allerdings nur sehr oberflächlich beleckt. Einer dieser schwarzen Handelsherren, der sich am Stamm einer prächtigen Palme ein mehr als originelles Magazin von alten Kleidern, Hüten, Stiefeln eingerichtet hatte, und, längelang auf einer Holzbank hingestreckt, sein wohlassortiertes Lager bewachte, fragte, als ich meinen Kodak nach ihm zückte, weinerlich – ob es schmerzen würde, war aber doch viel zu faul, um aufzustehen und sich der Gefahr des Photographiertwerdens zu entziehen.
Furchtbar, schauerlich, wahrhaft grausig sind die Negerweiber, besonders wenn sie alt sind. Sie sehen samt und sonders aus wie verkleidete Männer. Ihre Putzsucht ist sprichwörtlich. Sie geben sich die erdenklichste Mühe, ihre teuflischen Fratzen durch phantastischen Kopfputz und grellfarbige Kleidung noch auffallender zu machen. Unter den kniekurzen knallrosa oder knallblauen Röcken starren die schwarzen Beine hervor, einem weißen Spitzenhemdchen entragt das meist nicht sehr üppige schwarze Décolleté. Ein bunter Sonnenschirm vervollständigt diese Toilette, die einen glauben macht, man befände sich auf einem exotischen Maskenball.
Bahia ist eine echt brasilianische Stadt, als solche viel charakteristischer als die Hauptstadt Brasiliens, Rio de Janeiro, von der im nächsten Briefe die Rede sein soll. Die Häuser sind flach, kastenartig, ohne architektonische Pretensionen, sie scheinen nur aus Fenstern zu bestehen, die auf der Sonnenseite mit Bastmatten verhängt sind. In den engen Straßen der Innenstadt, deren schneeweiße Mauerflächen das grelle Sonnenlicht blendend zurückstrahlen, herrscht reges, von südlichem Temperament bewegtes Leben. Maultiertreiber, Straßenhändler, Zeitungsverkäufer vollführen ein wüstes Geschrei.
Ein europäisches »Lokal« habe ich in Bahia nicht ausfindig machen können. Es soll dort einen deutschen Klub geben – der Großhandel liegt hier, wie in ganz Brasilien fast ausschließlich in deutschen Händen – doch gelang es mir nicht, bis zu ihm vorzudringen. Es galt also, um satt zu werden, in einem brasilianischen Restaurant Einkehr zu halten. »Grutta Bahiana« hieß dieser denkwürdige Ort. Nach langen, fruchtlosen Versuchen eine der vielen brasilianischen Nationalspeisen, die auf der Speisekarte verzeichnet waren, herunterzubringen, mußte dieses redliche Bemühen eingestellt werden. Die Frage bleibt offen, wie ein Europäer es anstellt, in Brasilien nicht zu verhungern. Essen kann man die Dinge, die einem dort serviert werden, schon aus dem Grunde nicht, weil man sich am ersten Bissen, den man die Unvorsichtigkeit hat herunterzuschlucken, Mund, Speiseröhre und alle Eingeweide verbrennt. Die Brasilianer kennen nur ein Gewürz, das aber gründlich – den Pfeffer. Man kann sie dafür nicht einmal dahin verwünschen, wo er wächst, denn das ist ja hier zu Lande. Die Eingeborenen vergießen während der Mahlzeit helle Tränen, und finden das genußreich, vielleicht weil der »pimento« im tropischen Klima hygienisch sein soll. Nachher spülen sie ihr Inneres mit einem gräßlichen Schnaps aus, an dem der Name das einzig Gute ist. Er heißt »mata bicho«, das bedeutet »töte das Biest«, womit aber nicht der Brasilianer selbst gemeint ist, sondern der gefürchtete Fieberbazillus.
Alle Leiden, die man während des Essens zu erdulden gehabt hat, werden jedoch bald darauf durch einen kulinarischen Genuß allerersten Ranges wettgemacht. Der brasilianische Kaffee! Man möchte ein Klopstock sein, um ihn zu besingen. Leider wird er, wie alles Gute im Leben, in sehr homöopathischen Dosen serviert, denn leider ist er, wiederum wie das meiste Gute im Leben, dem Herzen nicht zuträglich. Ein Täßchen, kaum größer als ein Fingerhut, bis zum Rande gefüllt mit feinem Rohzucker, der so rasch zergeht, daß man nicht einmal einen Löffel zum Umrühren braucht. Nein, dieser Kaffee! Schwarz wie der Tod, süß wie die Liebe, heiß wie die Hölle! Im kleinen Café, wo man diesen Göttertrank zu sich nimmt, herrscht übrigens ein tolles Leben nach der Mittagstunde. Freiheit und Gleichheit. Auf niedrigen schemelartigen Stühlchen hockt der Börsenfürst neben dem Eseltreiber. Vor diesem Kaffee schwinden alle Rangunterschiede hin, wie das Häufchen Rohzucker, das man in die Tasse tut. Das Lokal ist gepfropft voll. Mit affenartiger Geschicklichkeit voltigieren um alle die in sämtlichen Himmelsrichtungen ausgestreckten Beine Niggerboys in einst weiß gewesenen Anzügen. Über dem Kopf schwingen sie die langgeschnäbelten Kannen. Mit verblüffender Sicherheit trifft der schwarze Kaffeestrahl die winzige Tasse. Aber nur Herzathleten wagen es, sie zum zweitenmal füllen zu lassen.
Sehenswürdigkeiten hat Bahia, außer sich selbst, keine. Die »vornehmen« Stadtviertel werden sorglich in Ordnung gehalten. Auch um die Volksgesundheit kümmern sich die Stadträte in höchst lobenswerter Weise. Am Ausgangstor des Riesenaufzugs, der die obere Stadt mit dem Hafenviertel verbindet, steht ein merkwürdiges Denkmal: zwischen zwei himmelhochragenden Säulen ein mächtiges Plakat, frei in der Luft schwebende gigantische Lettern bilden folgende Inschrift: »606! Cura Syphilis! 606!« Dieses in seiner Offenherzigkeit erfrischende, aber keineswegs erfreuliche Wahrzeichen krönt, weithin sichtbar, die Stadt, hoffentlich bewirkt der gute Rat wenigstens, was er bezweckt.
Weiß jemand von meinen verehrten Lesern, was eine »bisnaga« ist? Nein? Nun, hoffentlich wird er sich diese Kenntnis nie durch eigene Erfahrung erwerben. Eine »bisnaga« ist ein modernes Folterwerkzeug, unbekannten Ursprungs, in Brasilien zur Karnevalszeit – leider – in allgemeinem Gebrauche. Das Ding sieht sehr unschuldig aus, und bevor man damit Bekanntschaft gemacht hat, ahnt man nicht, welche infamen Eigenschaften es besitzt. Man denke sich ein mittelgroßes Glasflakon, das an einem Ende mit einem Siphonverschluß versehen ist. Der Inhalt besteht aus stark parfümiertem Äther und der Zweck der ganzen Maschine ist, sich diesen Äther gegenseitig in die Augen zu spritzen. Es ist nicht schwer, dieses Kunststück zu vollbringen, denn die bisnaga entlädt ihren Inhalt in feinem Strahl auf viele, viele Meter Entfernung, und man kann sich sein Opfer auswählen ohne sofortige Rache zu befürchten. Trifft nun solch ein bisnaga-Strahl, so wird der Gegner für die Dauer von zwei bis drei Minuten blind, hat das Gefühl, daß ihm die Augen ausfließen, und dieser klägliche Zustand wird dann zu weiteren heftigen Attacken vermittelst Konfetti, Pritschen, Luftschlangen, Niespulver und ähnlichen harmlosen aber peinvollen Scherzartikeln benutzt.
Ich habe mancherorts das tollste Karnevalstreiben miterlebt, doch verbleicht selbst München und Paris im Vergleich zu dem karnevalistischen Wahnwitz, den sich die Brasilianer in Rio de Janeiro leisten.
In der Avenida centrale, einer wundervollen Straße von der Breite des Newski-Prospekt in Petersburg, herrscht ein derartiges Gedränge, daß man eine Stunde braucht, um zehn Schritte vorwärts zu kommen. Auf dem Fahrdamm reiht sich Automobil an Automobil, von wo aus phantastisch kostümierte Männer und schöne Frauen einen wütenden Luftschlangen- und bisnaga-Kampf mit den Kopf an Kopf gedrängten Fußgängern ausfechten. Ein betäubender Ätherdunst erfüllt die Luft, tausende von sinnlich erregten Augenpaaren blitzen sich gegenseitig an, Geschrei und Gelächter schallt von hüben und drüben, zwischen den Beinen der Fußgänger flitzen die kleinen, braunen, unglaublich geschickten bisnaga-Verkäufer mit ihrem stereotypen Ruf: »seicente grammas un milreis cinquente!«
Ein wahnwitziger Taumel scheint alle Welt ergriffen zu haben. Ehe man sich's versieht, hat man einen Ätherstrahl in den Augen, dann eine Wagenladung Konfetti im Rockkragen, Pritschenschläge hageln auf Kopf und Schultern nieder.
Das alles vollzieht sich bei einer Temperatur von 30° Réaumur abends zwischen 9 und 12. Ozeane von kühlenden Getränken, einfachem Eiswasser, Kokosmilch und mehr oder weniger raffinierten Sorbets werden in den zahllosen Cafés, die die ganze Avenida einsäumen, vertilgt. In dieser Hauptstraße geht es zwar toll genug, aber immerhin gesittet zu. Doch braucht man nur einige Schritte in die Querstraßen zu tun, um Zeuge von allerhand wenig schönen Szenen und wüsten Schlägereien zu sein.
Im Dunkel abgelegener Straßen ist der Brasilianer chez soi und kehrt sein wahres Gesicht hervor, auf dem alle Leidenschaften und Todsünden verzeichnet stehen, im europäischen Glanz der Avenida legt er dagegen sofort die lächelnde Maske Pariser Halbkultur an.
Ja Brasilien! Es ließe sich gar viel darüber sagen. Besonders über die neue republikanische Regierung und ihre »Geschäftsprinzipien«. Jetzt will sie dem Kaiser Dom Pedro II, der Brasilien zu seinem unerhört raschen kulturellen Aufschwunge verholfen hat, ein Denkmal setzen. Seinerzeit, als der republikanische Staatsstreich gelang, wurde der alte Mann, der ein großer Gelehrter und einer der feinsten Köpfe des 19. Jahrhunderts war, auf ein altes halbzerfallenes Schiff gesetzt und nach Europa expediert, wobei die sichere Hoffnung bestand, daß der alte Kasten, der den Kaiser trug, statt in Europa auf dem Seeboden anlangen würde. Als diese Hoffnung fehlschlug, erfolgte das Dekret, daß nie mehr ein Mitglied des Hauses Braganza den Boden Brasiliens betreten dürfe. Dieses Dekret hat nun unvorhergesehene Folgen. Die gemäßigte republikanische Partei will die Leiche Dom Pedros aus der Lissaboner Begräbniskirche nach Rio überführen, um sie hier zu bestatten. Die Regierung muß sich dem widersetzen, denn Dom Pedro ist, obzwar tot, – doch ein Braganza!
Was soll ich über Rio de Janeiro sagen? Man müßte ein Buch schreiben, wollte man einen richtigen Begriff von dieser Stadt vermitteln. Landschaftlich ist sie paradiesisch schön. Die Natur hat alle Herrlichkeiten, die sie hervorbringen kann, auf diesen Fleck Erde zusammengetragen. Das Panorama der Bucht ist einzig in seiner Art. Hohe Bergzüge von bizarren Formen umsäumen die Stadt. Mitten in der Bucht erhebt sich der sogenannte »Zuckerhut«, ein violetter Bergkegel, der bisher als unzugänglich galt. Seit einigen Wochen erreicht ihn eine Schwebebahn, deren kühnes Projekt – echt amerikanisch! – vor fünf Monaten noch nicht entworfen war. Die Bergabhänge sind von unglaublich üppigem tropischen Urwald bedeckt. Herrlich sind die enormen Kaiserpalmen, die eine Höhe von 40 Metern erreichen und die mächtigen Bambusbüsche, die aussehen, wie riesengroße grüne Fontänen. Eine großartig angelegte Automobilstraße hat vor nicht langer Zeit den Reisenden die nächste Umgegend Rios erschlossen. Sie führt über den Bergrücken des Tijuka durch dichten Urwald, in dem man hin und wieder einen Papagei aufscheucht und wo sich die märchenhaften blauen Riesenschmetterlinge auf den leuchtenden Blüten der tropischen Bäume wiegen. Die Ausblicke, die sich auf dieser Straße nach allen Richtungen hin bieten, sind – zu schön, denn man glaubt nicht an ihre Realität. Man meint, sich mitten drin in einer Dekoration einer phantastischen Zauberoper zu befinden. Weder Klingsors Zaubergarten, noch die Märchenhaine eines Tschernomoren können reicher und üppiger gemalt werden. Es fehlt dieser ganzen Landschaft nur die Seele, die Stimmung. Oder vielleicht verstehen wir Nordländer sie nicht. Man fühlt sich fremd in dieser unerhörten Tropenpracht, die man bewundern kann, ohne sie zu lieben.
Die Stadt Rio hat zwei Gesichter, ein weißes und ein schwarzes. Der fabelhafte Luxus des Europäerviertels umgibt das erbärmliche Elend des Negerhügels, der sich mitten in der Stadt erhebt.
Die Neustadt übertrifft in der Anlage stellenweise selbst Paris. Was wollen z. B. die Champs elysées sagen im Vergleich zu dem 14 Kilometer langen asphaltierten, mit Steinquadern ausgelegten Kai, der die ganze Bucht von Rio de Janeiro umsäumt und die Stadt mit dem Badeort Leme verbindet! Und doch wieviel schöner ist der kleinste Winkel von Paris, als der ganze blendende Talmiglanz des modernen Rio. Denn ein Talmiglanz ist es. Man spürt es jeden Augenblick, daß man sich auf dem Boden eines Landes, das keine Geschichte hat, bewegt. Geld – das ist die einzige treibende Kraft Brasiliens. So glanzvoll alles nach außen hin ist, so fehlt doch jede innere Kultur. Es ist nichts echt, alles – Nachahmung. In der bodenlosen Geschmacklosigkeit vieler Bauten, ihrer überladenen Pracht, dem völligen Mangel jeden Stilgefühles zeigt sich das kulturelle Niveau ihrer Erbauer nur zu deutlich. Dennoch sind die Brasilianer mit einigem Recht stolz auf Rio. Allerdings äußert sich ihr Selbstgefühl mitunter in der lächerlichsten Weise. Auf dem berühmten Theatro Municipale stehen in großen goldenen Lettern drei Namen: Goethe, Molière, – A. Penna. Was sollen die Deutschen und Franzosen dazu sagen! Penna ist ein kleiner einheimischer, übrigens ganz vergessener Komödiendichter, gegen den etwa Kotzebue ein Shakespeare war. Nationalitätsgefühl ist eine gute Sache, doch sei man vorsichtig in seinen Äußerungen, sonst wird man ridikül oder taktlos.
Wollte man sine ira et studio eine Schilderung der Hauptstadt Argentiniens entwerfen, wie sie sich dem Reisenden auf den ersten Blick präsentiert, so würde kein Mensch glauben, daß der Brief aus Amerika kommt. Buenos Aires hat nichts, aber auch gar nichts »amerikanisches« an sich. Es ist nichts anderes als eine vorzüglich gelungene Kopie sämtlicher Hauptstädte Europas zusammengenommen. Wenn man die Straßen der argentinischen Hauptstadt durchwandert, so glaubt man bald in Berlin, bald in Paris, in Petersburg, in London, meinetwegen in Hamburg, in Frankfurt, München oder sonst irgendwo zu sein, nur nicht in Südamerika, dem Lande, das sofort die Vorstellung von Indianern, Prärien, Pampas, wilden Tieren oder breitnasigen Patagoniern erweckt. Von alledem ist in Buenos Aires natürlich nicht das allergeringste zu sehen. Die Stadt bedeckt einen enormen Flächenraum, ihr Weichbild ist größer, als dasjenige Londons, obgleich Buenos Aires kaum halb so viel Einwohner (ca. 3 Millionen) zählt. Die abgezirkelt rechtwinklige Anlage der Straßen erinnert an das Friedrichstraßen-Viertel in Berlin, nur daß sich hier die einzelnen Straßen noch viel ähnlicher sehen und infolgedessen noch viel langweiliger sind. Was nützt die architektonische Pracht einzelner Bauwerke, wenn sie sich immer wiederholt! Man mag einen noch so guten Ortssinn besitzen und die Stadt noch so viele Male durchquert haben – dennoch weiß man nie, an welcher Straßenecke man sich befindet. Sie sehen alle genau gleich aus.
Etwas besser ist es um die öffentlichen Plätze bestellt. Sie haben mehr Charakter, und man unterscheidet sie schon dadurch untereinander, daß auf jedem ein anderer erzener oder steinerner argentinischer Reitergeneral, oder sonst irgend eine Lokalberühmtheit in mehr oder weniger kühner Denkmalspose verewigt ist.
Kommt man dagegen zur berühmten Avenida del Mayo, dem Stolz der Argentinier, so ist man wieder in Paris. Der Boulevard des Capucines, wie er leibt und lebt! An das Paris vor zehn Jahren erinnern auch die zahllosen ein- und zweispännigen Droschken, die hier noch nicht, wie in Rio de Janeiro, von Automobilen verdrängt sind. Und schaut man sich die fabelhaft luxuriösen Läden an, so liest man auch dort auf den breiten Schaufenstern dieselben Namen wie in Paris. Die ganze Rue de la Paix ist hier vertreten, meistens sogar besser und reicher als an Ort und Stelle. Das gilt besonders von den Juwelierläden.
Die Argentinier haben nämlich viel Geld, unglaublich viel Geld und bezahlen mit dem Stolze aller plutokratischen Parvenüs kaltlächelnd Unsummen für allerhand Luxusgegenstände. Warum sollten sie auch nicht? Das Land selbst, das doppelt so groß ist als Europa, bietet ja unerschöpfliche Reichtümer. Und immer wieder erschließen sich neue. Man braucht sie nur zu nehmen. Von den enormen Viehzüchtereien, den in einzelnen Händen befindlichen Latifundien von der Größe mäßiger Königreiche, von der fabelhaft rasch emporgeblühten Weinkultur, die in wenigen Jahren unberechenbare Vermögen geschaffen hat, von den Erzreichtümern der Kordilleren usw. werde ich noch zu erzählen haben, wenn ich ins Innere des Landes hineinkomme. Augenblicklich ist man hier sehr erregt durch die Nachricht, daß sich im Süden Argentiniens zu allem Übrigen noch außerordentlich ergiebige Naphthaquellen erschlossen haben. Man nimmt an, daß dadurch den kaukasischen und nordamerikanischen Quellen eine sehr ernsthafte Konkurrenz auf dem Weltmarkt entstehen wird.
Doch ist es nicht meine Sache, darüber zu berichten. Ich sehe mir das Land mit den Augen eines gewöhnlichen Reisenden an, und wirtschaftliche Studien liegen mir fern.
Die Einwohner von Buenos Aires haben ebenso wenig charakteristisches an sich wie die Straßen der Stadt. Aussehen, Kleidung, Gebaren – alles ganz europäisch. Natürlich überwiegt der südländische spanisch-italienische Typus. Man sehnt sich ordentlich nach den prachtvollen Mohren von Bahia und nach den interessanten Mischlingen, die die brasilianische Bevölkerung so bunt und anziehend machen. Russen und Deutsche gibt es in Buenos Aires genug, um einige mittelgroße europäische Städte damit zu bevölkern. Die russische Kolonie zählt gegen 100 000 Köpfe, die deutsche mehr als das Doppelte. In Buenos Aires erscheinen zwei große deutsche Zeitungen, von denen die »La-Plata-Zeitung« sogar, wie man sagt, eine nicht unwichtige politische Rolle spielt. Der einen hier erscheinenden russischen Zeitung kommt eine solche natürlich nicht zu. Doch ist es immerhin viel, daß sie überhaupt existiert.
Die sogenannte »gute Gesellschaft« glänzt augenblicklich – im Sommer – durch Abwesenheit in Buenos Aires. Wer nicht in Europa ist, kühlt sich die erhitzten Glieder wenigstens an der Küste des Atlantischen Ozeans, in dem Seebadeorte Mare la Plata, dem »Ostende Argentiniens«, wie dieser schöne, aber märchenhaft teure Strandort genannt wird. Buenos Aires bietet an landschaftlichen Schönheiten gar nichts. Ein einziger Park, »Palermo« mit Namen, gewährt abends etwas Kühlung, wenn nämlich vom La Plata-Strome ein erfrischender Wind weht. Die ziemlich kümmerliche Vegetation dieses Parkes wird mit großer Kunst gepflegt, und immerhin ist es dort abends angenehmer als in den staubigen, drückend heißen Straßen der Stadt. Es gibt in Palermo sogar einen »See«, der anderswo freilich Teich heißen würde. Doch schwimmen darauf leibhaftige schwarze Schwäne. Und das sieht allemal sehr stolz und majestätisch aus.
Will man aber mehr haben, so muß man schon ganze 40 Kilometer weit mit der Bahn fahren. Doch lohnt sich die Strapaze. Erstens hat man während der Reise den La Plata-Strom als Gefährten zur Seite. Und der ist, wenn auch nicht schön, so doch originell mit seinen gelbbraunen, von violetten Lichtern durchsetzten Fluten, die sich unabsehbar weit zum Horizont hinziehen. Das andere Ufer ist natürlich nicht zu sehen, denn der Fluß ist hier ca. 45 Kilometer breit. Aus der Entfernung, bevor man die Bewegung des Wassers beobachten kann, macht er den Eindruck einer ungeheuren sonnendurchglühten Sandfläche. Der Ort, den es zu erreichen gilt, heißt Tigre. Ein Nebenfluß des La Plata gleichen Namens bildet ein landschaftlich überaus reizvolles Delta. Die Inseln sind mit üppiger Vegetation, blühenden Fruchtgärten, schattigen Laubwäldern, sogar Palmenanpflanzungen bedeckt. Macht man die sehr genußreiche »volta« um alle Inseln herum, was im Motorboot ungefähr zwei Stunden beansprucht, so kann man selbst von überhängenden Zweigen köstliche Pfirsiche und saftige Reineclauden pflücken – vorausgesetzt, daß das Gewissen es zuläßt. Tigre ist das Zentrum für den argentinischen Wassersport. Man sieht dort wundervoll ausgestattete Motor- und Segeljachten der beau monde von Buenos Aires. Auch Ruderboote mit mehr oder weniger entkleideten Insassen schießen auf den Flußarmen hin und her.
Mit gemischten Gefühlen setzt man sich wieder in den staubigen Bahnzug, und empfindet es als Schicksalstücke, daß man nach Tigre fliehen muß, wenn man das haben will, wie die Stadt, in die man zurückkehrt, heißt – buenos aires, zu deutsch »gute Luft!«
Wenn man als abenteuerlustiger Amerika-Reisender neue Eindrücke, unbekannte Situationen, europafremde Lebensbedingungen, interessante Erlebnisse sucht, so kehrt man Buenos Aires, diesem Talmi-Paris, ohne viel Herzschmerzen den Rücken. Die Hoffnung, daß man im Inneren des Landes Eigenartiges, Charakteristischeres zu sehen bekommt, als in der vielgepriesenen Hauptstadt Argentiniens, wird in der Tat nicht getäuscht.
Die südamerikanischen Pampas – jedem Knaben, der je mit heißen Backen seinen Mainried gelesen hat, haben sie einst als höchstes und einziges Ziel der Sehnsucht vorgeschwebt. Die Sehnsucht würde wahrscheinlich vergehen, bekäme er sie in Wirklichkeit zu Gesicht.
Noch vor wenigen Jahrzehnten waren die unendlichen Prärien, die sich hunderte und aberhunderte von Kilometern nach allen Richtungen hinziehen, eine vollständige terra incognita nicht nur für den Europäer, sondern auch für den eingeborenen Südamerikaner. Jetzt durchquert sie eine Eisenbahn, und eine Strecke, für die man früher Wochen beschwerlichsten Reisens brauchte, legt man heutzutage in 24 Stunden zurück. Gibt man noch 12 Stunden dazu, so kommt man sogar über die Kordilleren hinüber bis an die Küste des Stillen Ozeans.
Nur ein kleines Gebiet im Zentrum des tropischen Südamerika ist bisher von den Invasionen neugieriger und gewinnsüchtiger »Kulturträger« verschont geblieben. Das ist der sogenannte Gran Chaco. Dorthin haben sich die Überreste der stolzen Indianerstämme, die einst den ganzen Riesenkontinent bevölkerten, zurückgezogen. Sie leben dort ihr Leben, wie sie es vor tausend Jahren gelebt haben, ein Leben, dessen Grundlage eine wunderbar sinnvolle, natürliche Moral ist. Durch die selbstzufriedene Kulturarbeit der »Weißen«, deren Hauptwerkzeug das »Feuerwasser« ist, wird die unendlich höher stehende moralische Kultur dieser Wilden, die sich ihrer Nacktheit nicht schämen, langsam aber hoffnungslos untergraben. Wer das nicht glaubt, lese das wundervolle Reisebuch Elmar Nordenskjölds, der zwei Jahre lang das Leben dieser Chaco-Indianer in ihrer Mitte gelebt hat und jene Zeit zu der schönsten, »moralinfreiesten« seines Lebens zählt.
Der Zug, der von Buenos Aires quer durch die Pampas nach dem Westen fährt, der hier jedoch nicht so wild ist wie in Nordamerika, trägt den stolzen Namen: Ferro Carril Transandino International. Nach europäischen Begriffen ist es eine miserable Sekundärbahn, als Gegenstand des Spottes der »Fliegenden Blätter« jedem Deutschen genugsam bekannt. Die Schienenspur ist wenig mehr als einen Meter breit, die Waggons sind eng und unbequem; auch die sogenannten Schlafwagen, die bis zum Fuß der Anden verkehren, lassen in bezug auf Bequemlichkeit so ziemlich alles vermissen. Nur langsam gewöhnt man sich an die »argentinische Küche« des Waggon-Restaurants, deren Hauptingredienzen Safran und roter Pfeffer sind.
Doch alles das erträgt man gerne, denn was man links und rechts durch die Waggonfenster sieht, ist interessant und neu genug, um einen zeitweilig alle europäischen Bedürfnisse vergessen zu machen. Endlos zieht sich die gelbgrüne Fläche der Pampas hin, der Horizont scheint in kaum erreichbare Fernen entrückt zu sein. Das Gras ist nicht hoch und erweckt auch nicht den Anschein, als ob es besonders fett wäre. Dennoch finden zehntausendköpfige Rinderherden dort ihre Nahrung. Bekanntlich versorgt Argentinien ganz Südamerika mit Fleisch und die ganze Welt mit »Liebig-Extrakt«. Es gibt in Buenos Aires nicht eines, sondern mehrere Schlachthäuser, von wo aus bis zu 2000 Stück Vieh täglich in ein besseres Jenseits, d. h. in die Mägen hungriger Argentinier, Brasilianer und Peruaner befördert werden. Vom nächsten Jahr ab wird auch Europa zu den Abnehmern des argentinischen Fleischmarktes gehören. Während ich in Buenos Aires war, langte die Freudenbotschaft an, daß es gelungen war, 3000 Hammel in tadellosem, natürlich künstlich gefrorenem Zustande nach Hamburg zu bringen. Darob herrscht unter den Viehherdenbesitzern Argentiniens natürlich eitel Freude und Seligkeit, und die Landpreise der Pampas steigen.
Wenn man die Stationsgebäude, die den Schienenstrang der transandinischen Eisenbahn einsäumen, und die Wohnhäuser der Pampasbewohner mit den Augen eines Russen ansieht, so schwellt einem einiger Stolz die Brust. Gegen diese erbärmlichen, aus Lehm, Schmutz und Stroh aufgeführten Domizile sind die Hütten der ärmsten russischen Bauern fürstliche Paläste. Der ganze Reichtum des Landes zieht sich hier nach den Hauptstädten hin, im Inneren ist und bleibt es wüst und leer.
Die Vegetation der Pampas verändert sich ungefähr in der Mitte des Weges aufs auffallendste. Statt der Wiesen und des Präriegrases sieht man weite Sandwüsten mit kümmerlichem, verkrüppeltem Buschwerk bestanden. Eine Unmenge von Kakteen mit wunderschönen weißen Sternblüten macht den Anblick exotischer. Hin und wieder grüßen als alte Bekannte einzelne hypertrophisch ausgebildete Exemplare von Sonnenblumen. Die Rinder- und Hammelherden hören auf, statt dessen sieht man merkwürdige langhalsige Vögel über das Buschwerk streichen und graue Strauße über den Sand spazieren.
Nun beginnt auch die fürchterlichste Plage der Pampas-Fahrt: der Staub. Ein Staub, so fein und dicht, daß er überall durchdringt, man mag die Fenster noch so sorglich verschlossen halten. Jetzt versteht man auch den merkwürdigen Aufzug der Mitreisenden, die man anfangs für Mönche oder Mitglieder irgend einer geheimen Sekte hielt. Alle stecken sie von Kopf bis zu Fuß in langen weißgrauen Staubmänteln, und man muß seine schnell erworbenen Reisefreunde buchstäblich an der Nasenspitze erkennen.
Übrigens hatten wir Glück. Abends um 9 Uhr erlebten wir in der staubreichsten Gegend ein Gewitter von einer derartigen Heftigkeit, daß der Weltuntergang nahe schien. In den Pampas, wo alles immer nach Wasser dürstet, soll das eine große Seltenheit sein. Wer nie einen Pampasregen gesehen hat, macht sich keinen Begriff davon, was das ist. Nicht eimer-, sondern kübelweise scheint das Wasser vom Himmel herabgegossen zu werden. Die Waggons der stolzen Transandino-Bahn hielten diesen Fluten nicht stand, in brausenden Wasserfällen strömte das Wasser durch die Waggondecke auf unsere Häupter herab, und nur mit Hilfe einer genial erfundenen Wasserleitung aus Bettüchern und Eimern gelang es mir, mich und meinen Reisekameraden vor dem Ertrinken zu retten. Ein wundervolles Bild gewährten die grenzenlos weiten Flächen der Pampas im bläulich-blendenden Licht der Blitze, die fast pausenlos aufeinander folgten. Ebenso plötzlich, wie er gekommen, war der ganze Zauber verschwunden.
Hat man die interessanten, aber öden Pampas glücklich durchquert, so erlebt das Auge eine angenehme Überraschung. Man fährt in die fruchtbare Weinebene von Mendoza hinein. Soweit der Blick reicht, ruht er auf saftig grünen, hochkultivierten, endlos sich hinziehenden Reihen von Weinstöcken aus. Das sind die Goldfelder des Landes, auf denen in den letzten Jahrzehnten Millionen und Abermillionen verdient worden sind.
Mendoza selbst ist ein freundliches Städtchen, mit breiten, von einstöckigen Häusern eingerahmten Straßen, üppigen Parkanlagen und blühenden Gärten. Warum die Häuser alle einstöckig sind, wurde mir klar, als ich den Prospekt des uns empfohlenen Hotels durchlas. Dort lautete der erste Satz: »l'édifice est construit spécialement contre tremblements de terre«. Alle zwei bis drei Monate »bebt« es nämlich in Mendoza, nicht allzu gefährlich, aber immerhin so stark, daß mehrstöckige Gebäude den Bodenschwankungen nicht standhalten. Auch das Baumaterial ist höchst eigenartig, ein Gemisch aus Schmutz und Stroh, das man an Ort und Stelle euphemistisch »ungebrannte Ziegel« nennt. Holz fehlt vollständig. Das konnte man schon an der Bahnlinie beobachten. Sämtliche Telegraphenpfosten sind aus Eisen. Die krüppligen Stämme der Weinstöcke würden zu diesem Zwecke freilich schlechte Dienste leisten.
Dank der Liebenswürdigkeit des Direktors der Deutschen Bank in Mendoza hatten wir Gelegenheit eine der größten Wein-»Fabriken« des Gebiets in Augenschein zu nehmen. Zwanzig Minuten Bahnfahrt und zehn Minuten in einem omnibusartigen Wagen, wie sie hier dem Landverkehr dienen, brachten uns nach dem Weingute der deutschen Weinindustriellen S. und H. In liebenswürdigster Weise wurde uns der ganze Betrieb der »Bodega L'Allemana« gezeigt, obzwar die Ernte noch ausstand, und die Fabrik ruhte. Es würde mich zu weit führen, wollte ich alle Einzelheiten dieses enormen Betriebes schildern. Einige Zahlen mögen genügen. Mendoza produziert jährlich 4 Millionen Hektoliter Wein, wovon auf unsere Gastfreunde 100 000 Hektoliter entfallen. Die Firma steht an fünfter oder sechster Stelle. Der Löwenanteil von über 1 Million gebührt einem Italiener, der als armer Erdarbeiter ins Land gekommen, und heute noch Analphabet ist. Die geniale Idee, in Mendoza Wein zu bauen, rührt von ihm her. Die ganze Kultur ist erst einige Jahrzehnte alt. Der Wein ist von ganz vorzüglicher Qualität, »alte«, »abgelagerte« Sorten gibt es natürlich noch nicht. Die Weingutsbesitzer bewahren nur wenige Flaschen zum eigenen Gebrauch auf. Die gesamte Produktion wird bis auf den letzten Tropfen in Argentinien konsumiert. Nicht ein Faß gelangt zum Export. Unsere liebenswürdigen Gastwirte setzten uns einige Flaschen der ältesten Jahrgänge dieses köstlichen Mendoza-Weines vor, und ohne Übertreibung muß zugestanden werden, daß er getrost mit den besten europäischen Weinsorten konkurrieren kann. Das Aroma ist ein ganz eigenartiges, der Wein ein Mittelding zwischen schwerem Burgunder und gut gelagertem Rheinwein.
Mendoza wird mir unter anderem unvergeßlich bleiben durch den ersten argentinischen »Kunstgenuß«, den ich dort erlebte: eine spanische Operette »Marina del mare« mit Namen. Nachdem ich sechs Wochen lang keine Musik gehört hatte, schien mir jeder Ton ein Labsal. Unter den Sängern waren einige vorzügliche Stimmen. Erquickend nach dem europäischen Begriff des »Künstlerischen« war die bodenlose Naivetät, mit der hier Dekoration und schauspielerische Aktion behandelt wurden. Die ganze Darstellung war sozusagen »schematisch«, die Phantasie des Zuhörers hatte nach allen Richtungen hin freien Spielraum. So wurde man unvermutet vor eine schwierige ästhetische Frage gestellt. Doch will ich meine Leser nicht mit ihrer Lösung langweilen.
Als ich vor Jahren die Dolomiten zu Fuß durchwanderte, kam mir oft der Gedanke: so ungefähr müssen die Kordilleren aussehen. Woher diese Überzeugung stammte, weiß ich nicht. Wahrscheinlich war es die abenteuerliche rosa-rote Färbung des Gesteins und die stellenweise exotische Vegetation, die die Vorstellung von außereuropäischen, tropisch angehauchten Gebirgsgegenden wachrief. Es kam mir damals nicht in den Kopf, daß es mir jemals vergönnt sein würde, die Dolomiten und die Kordilleren tatsächlich miteinander zu vergleichen. Soll ich es als Merkmal einer mir bisher nicht bewußten Divinationsgabe auffassen, daß, als mir die ersten Gebirgszüge der Kordilleren zu Gesichte kamen, mir nichts anderes übrig blieb, als auszurufen: Genau so sehen ja die Dolomiten aus!
Da ich in der Geologie nicht bewandert bin, will ich es unterlassen, zu untersuchen, warum sich die Dolomiten und die Kordilleren so ähnlich sehen. Es genügt mir, diese nicht zu bestreitende Tatsache festzustellen, übrigens sei der Genauigkeit halber angemerkt, daß es in diesem Falle eigentlich unzulässig ist, in Bausch und Bogen von den Kordilleren zu reden. »La Cordillera« nennt man hier nur den mittelsten und höchsten Bergrücken des Gebirges, das nicht nur Südamerika, sondern auch Mittel- und Nordamerika durchzieht. Der Teil der Cordillera, den ich meine, sind die Anden, das Gebirge, welches Chile von Argentinien trennt.
Um weiteren Mißverständnissen vorzubeugen, muß ich noch hinzufügen, daß Ähnlichkeit ein sehr dehnbarer Begriff ist. Und wenn man von der Ähnlichkeit der Kordilleren und der Dolomiten redet, so ist das dieselbe Ähnlichkeit, die etwa ein Tiger und eine Katze miteinander haben.
Die ersten Ausläufer der Kordilleren erblickt man, wenn man in dem Ferro Carril Transandino, jener schon erwähnten putzigen Witzblatt-Bahn, das gelobte Land Mendoza verläßt. Der Zug muß sich gewaltig anstrengen, um die Berge hinaufzuklettern. Eine Lokomotive zerrt von vorne, eine andere schnauft von hinten, und die ganze Mühe gilt vier kleinen Waggons, die spickevoll besetzt sind mit in Staubmänteln vermummten Passagieren. Die Geschwindigkeit, die dabei entwickelt wird, ist kaum größer als fünf bis zehn Kilometer die Stunde. Doch hat man keine Ursache, dieses Schneckentempo zu bedauern. Was langsam kommt, kommt gut, und hier von Minute zu Minute immer besser und herrlicher.
Es ist ein undankbares Geschäft, wenn man versuchen will, die unerhörte Pracht dieser grandiosen Gebirgswelt zu beschreiben. Selbst der Pinsel des genialsten Malers müßte hier versagen. Die Lokomotiven keuchen und stöhnen. Immer höher geht es hinan. Die einzigen Reste organischen Lebens sind einige wenige grüngelbe Grasbüschel, die sich im Geröll der Abhänge verbergen. 2800 Meter Höhe sind erreicht. Hier machen wir Halt. Mögen andere, die Eile haben, weiterfahren. Das scheinen, außer meinem Reisekameraden und mir, sämtliche Passagiere des Zuges zu sein. Hier gibt es – gelobt sei die abschreckende Wirkung einer zwanzigtägigen Seefahrt – noch keine »Touristen« aus Europa. Man schämt sich fast, die einzigen Vertreter dieser im allgemeinen verabscheuungswürdigen Menschenspezies zu sein. Aber alle Unbequemlichkeiten, die daraus erwachsen, daß Südamerika dem Touristenverkehr noch nicht erschlossen ist – z. B. das vollständige Fehlen irgendwelcher Reisehandbücher à la Bädeker – erträgt man nur zu gerne.
Der Ort, in dem wir den Zug verlassen, heißt Puente del Inca (Brücke des Inka), auf Geographiekarten wird man ihn vergeblich suchen. Außer dem Stationsgebäude und einem kleinen Hotel sind nur einige Zelte, die Nachtquartiere von Eisenbahnarbeitern, zu erblicken. Ringsumher kein Baum, kein Strauch. Ein reißender Gebirgsstrom hat sich seinen Weg in schäumender Lust quer durch einen Felsenhügel gebahnt. Der dadurch entstandenen natürlichen Felsbrücke verdankt der Ort seinen Namen.
2800 Meter sind in Europa schon eine ganz respektable Höhe, für die Höhenverhältnisse der Kordilleren sind sie eine Bagatelle, die kaum der Rede wert ist. Dennoch merkt ein Flachländer schon ganz bedeutend die Wirkung der verdünnten Atmosphäre. Aber trotzdem ergreift einen sofort noch eine andere Gebirgskrankheit, die sich in dem einen Wunsch äußert: Höher, höher! Und eine Stunde, nachdem wir den Zug verlassen hatten, saßen wir schon auf Maultieren, um einen nahen Berggipfel, den »11. Febrero«, zu erklimmen. Dieser und einige andere kleinere Ausflüge waren das notwendige Training, um uns für ein anderes größeres Unternehmen vorzubereiten. Die Eisenbahn ist, wie gesagt, für Leute da, die Eile haben. Will man dagegen die Schönheit der Gebirgswelt genießen, so greift man zu anderen Verkehrsmitteln. Wir beschlossen, den Übergang über den Andenpaß auf Maultieren zu machen. Statt einigen Stunden, dauert das freilich einige Tage, doch nimmt man dafür Eindrücke mit, die man nicht vergißt, auch wenn man das Alter Methusalems erreicht.
Frühmorgens machten wir uns auf den Weg. Voran der Führer, ein ernsthafter, vertrauenerweckender Argentinier, der sich in seinem Torreador-Hütchen und wehenden Poncho gar malerisch ausnahm. Mit mächtigen, mittelalterlichen Rittersporen, wie man sie sonst nur auf der Bühne an den Beinen irgend eines Don Quichote sieht, trieb er sein Maultier zu schneller und energischer Gangart an. Uns mit unseren unbewaffneten Stiefelabsätzen gelang das erheblich schlechter. Unser erstes Ziel, das freilich einen Umweg bedeutete, waren die Kupferminen von Navarro. Unermüdlich greifen die braven Maultiere aus. Der Weg wird steiler und steiler. Die letzten Spuren jeglicher Vegetation verschwinden. Über Steingeröll und Felsplatten immer höher und höher. Links und rechts öffnen sich gähnende Abgründe. Immer beschwerlicher wird das Klettern. Immer beschwerlicher wird auch das Atmen. Der Puls hämmert wie ein Schmiedewerk. Im Kopf spürt man einen leichten Druck. Und mit einem Male stellt sich auch der Schrecken aller ungeübten Bergsteiger ein – das Gefühl des Schwindels. Man schaut schon lieber nicht mehr zur Seite, sondern krampfhaft auf den Sattelknauf. Kein Laut ist ringsumher zu vernehmen. Nur das Knirschen der Hufe im lockeren Geröll und das leise Schnauben der Maultiere. Man segnet und verflucht zugleich diese vierbeinigen Gefährten. Zu Fuß wäre der Anstieg sicherlich noch ungemütlicher, aber dieses quälend langsame Tempo der Reittiere macht einen auch nicht wenig nervös. Es scheint eine halbe Stunde zu dauern, bis das Tier mit dem Hufe eine Stelle aussucht, die ihm sicher genug dünkt, um den Fuß draufzusetzen. Und vor einem starrt drohend, scheinbar unerreichbar der Gipfel, den es zu übersteigen gilt. Gestattet es das Gelände, wird Rast gemacht. Und nun ist mit einem Schlage alle Mühsal vergessen! Sprachlos blickt man in die sich immer herrlicher entfaltende Pracht dieser unerhört großartigen Gebirgswelt hinein. Die kühnste Phantasie kann sich derartige Bilder nicht ausmalen. Das Merkwürdigste an den Bergspitzen und Abhängen der Anden ist ihre Färbung. Tiefschwarz, blutigrot, grünlichgrau, violett, leuchtend rosa, in sattem Orange schillert das Gestein dieser phantastischen Bergriesen. Es ist ein zauberisches Bild, wie man es weder in der Schweiz, noch in den Alpen jemals erblicken kann. Mächtige Gletscher unterbrechen hier und dort das farbenfreudige Bild, über alles hinweg grüßt im leuchtend blauen Himmel der schneeweiße, strahlende Gipfel des Aconcagua, des Goliath unter den amerikanischen und europäischen Bergen.
Und trotz dieses bunten, lichttrunkenen Bildes wird man keinen Augenblick das Gefühl der grauenvollen Öde, die hier herrscht, los. In herrlicher Majestät, aber auch in drohender, ungebeugter Kraft blicken die Berge auf das armselige Menschengesindel herab. In Europa hat sich der Mensch die Berge untertan gemacht. Hier sind sie die Herrscher, und wehe dem, der ihnen zu nahe kommt. Ihre mächtigste Waffe sind die Steinlawinen. Auch wir hörten eine mit dumpfem Grollen niedergehen. Glücklicherweise kreuzte sie nicht unseren Weg. Gar finster starrte der Krater eines Vulkans herüber. Mächtige Steinhaufen in unordentlichem Gewirr und weither verstreute Lawablöcke kennzeichneten seine Tätigkeit.
Die Kupferminen von Navarro sind nicht durch ihre Ergiebigkeit bemerkenswert. Wohl aber dadurch, daß sie in der unfaßlichen Höhe von zirka 4200 Metern ausgebeutet werden. Wie die Menschen es dort monatelang aushalten, ist unbegreiflich. Vielleicht gewöhnt sich der Körper mit der Zeit an den verminderten Luftdruck. Beständig weht ein eisiger Wind, und selbst jetzt im Hochsommer bei Mittagssonne fror einem trotz sweater und Lederjacke. Im Winter liegen die Minen von aller Welt hoffnungslos abgeschnitten in tiefster Vergessenheit da. Einen schauerlichen Eindruck machte die einfache Erzählung von drei Arbeitern, die die sechs Wintermonate als Hüter der Maschinen oben blieben. In den Schneemassen vergraben, gleich lebendigen Toten erwarteten sie von Tag zu Tag das Nahen des Frühlings. Wer kennt die grausige Novelle »L'Auberge« von Maupassant? Mir fiel sie ein, als ich diesen drei wetterharten Gestalten in die Augen blickte.
Am dritten Tage, nachdem wir unsere Ansprüche in bezug auf Nachtlager und Nahrung auf das Niveau bescheidener Haustiere herabgedrückt hatten, erreichten wir die Chilenische Grenze. Auf dem Gipfel des Passes, dem sogenannten »Cumbre« ist vor einigen Jahren eine Kolossalstatue, eine Christusfigur ans Kreuz gelehnt, errichtet worden. Sie dient als Wahrzeichen des Friedens zwischen Chile und Argentinien, den beiden feindlichen Nachbarländern, die jahrzehntelang ununterbrochen Zwist und Hader miteinander hatten. Auf beide Seiten hin, nach Chile und Argentinien öffnet sich ein wundervolles Gebirgspanorama. Einen abstoßenden Eindruck machen gerade auf dieser Stelle die überall umherliegenden Kadaver von Maultieren, die dem atmosphärischen Druck während des Überganges nicht standgehalten haben.
Einen letzten Blick warfen wir auf den Aconcagua, der uns in diesen Tagen ein lieber und vertrauter Freund geworden war und den wir schwerlich wiedersehen werden. Der Abstieg in die chilenischen Täler wurde zu Fuß unternommen. Von den unbequemen, breiten mexikanischen Sätteln, die hier in allgemeinem Gebrauche sind, hat man nach vier Tagen gerade genug. In Juncal erreichten wir den Zug, der uns in schneller Fahrt über kühne Viadukte, durch zahllose Tunnels, entlang dem schäumenden Rio Branco immer weiter talabwärts führte.
Im idyllischen chilenischen Städtchen Los Andes, wegen seines idealen Klimas – es regnet dort nie – ein gesuchter Luftkurort, gönnten wir uns zwei Ruhetage, zu wenig noch, um die einzigartigen, großartigen Eindrücke dieses Andenüberganges zu verarbeiten. Sollten sich im weiteren Verlaufe der Reise die Eindrücke in ähnlicher Weise häufen, so könnte, fürchte ich, bei aller Elastizität, die Aufnahmefähigkeit endlich versagen.







Wenn man von der Ostküste des Kontinents in Chile einfährt, so hat man das Gefühl, als käme man von Amerika nach Europa zurück. Das gilt nicht nur von der Landschaft, sondern auch von dem ersten Eindruck, den das Land mit seinen Sitten, Gebräuchen, Lebensgewohnheiten macht, und von den ersten, oberflächlichen Äußerungen des Volkscharakters, denen man begegnet.
Brasilien ist das Land ungesunder, mörderischer, klimatischer Bedingungen, das Land der dunklen Ehrenmänner, das Land, in dem ein faules, faulendes Leben gelebt wird. In Argentinien herrscht das Geldfieber in so erschreckendem Maße, daß alle übrigen Lebensinteressen zurückgedrängt erscheinen. Geld ist der einzige Lebensnerv dieses Volkes. Für Geld kann man so ziemlich alles haben, und nur was Geld kostet hat Wert, je mehr es kostet, desto größer ist der Wert. Die Rechnung ist ganz einfach und klar. Geld ist der einzige Maßstab, den man an die Erscheinungen des Lebens anlegt. Dinge, die man für Geld nicht haben kann – nach altmodischen Begriffen die einzig wertvollen – hat der Argentinier aus seinem Lebensbudget ein für alle Male ausgeschieden.
Chile ist in dieser und auch in mancher anderen Beziehung weit hinter dem modern-fortschrittlichen Nachbarstaate zurückgeblieben. Vielleicht macht es deswegen solch einen anheimelnden Eindruck auf einen nicht nach spezifisch amerikanischen Begriffen erzogenen Europäer. Das Volk ist hier ein ganz anderes. Das spürt man in der ersten Stunde auf chilenischem Boden. Man begegnet wieder freundlichen Blicken und freundlichen Worten, die der Europäer natürlich um so höher einschätzt, weil er nicht so und so viele Pesos dafür zu zahlen braucht. Die Menschen messen sich aneinander, und die Dicke des Portemonnaies ist nicht die ausschlaggebende unbekannte Größe, die den Chilenen bei dieser Rechnung unsicher macht.
Im indigenen Chilenen überwiegt, im Gegensatz zum Argentinier, das spanische über dem italienischen Blute. Aber die chilenische Rassenmischung ist – rein menschlich betrachtet – augenscheinlich die bessere. Das Volk ist gutmütig, gefällig, ein bißchen faul, aber durchaus nicht arbeitsscheu, heiter, aber im Genusse nicht maßlos, wie der Argentinier. Ich lebe seit vierzehn Tagen in Chile und habe in dieser Zeit in Stadt und Land noch keinen Betrunkenen gesehen.
Trotz des Friedensdenkmals, das auf dem Cumbre der Anden zwischen Chile und Argentinien aufgestellt ist, herrscht keine große Freundschaft zwischen beiden Ländern. Man bekriegt sich nicht, aber man liebt sich auch nicht. In Argentinien spricht man in höchst wegwerfendem Tone von Chile, man verachtet das Land, weil es in kultureller Beziehung angeblich um hundert Jahre zurückgeblieben ist. Nach außen hin ist dieser Vorwurf nicht unberechtigt, nur vergißt man, daß es neben der äußeren auch noch eine innere Kultur gibt, und an Stelle der Argentinier würde ich lieber nicht untersuchen, welches Volk hierin dem anderen überlegen ist.
Aber, wie gesagt, nach außen hin haben die Argentinier einiges Recht, die Nase über ihre rückständigen Nachbarn zu rümpfen. Schon das Straßenbild der größeren chilenischen Städte unterscheidet sich sehr wesentlich von dem, was man von Argentinien her gewohnt war. Die üppigen Paläste der argentinischen Parvenüs, die wolkenkratzerartigen Geschäftshäuser fehlen. Das hat nun freilich, auch außer den nicht vorhandenen Millionen einen anderen guten Grund. Oder vielmehr einen schlechten Grund und Boden, der in Chile durchweg vulkanisch ist. Die Bevölkerung lebt in beständiger Furcht vor Bodenschwankungen. Noch ist das große Erdbeben, das vor fünf Jahren ganz Valparaiso zerstörte und 25 000 Menschen das Leben kostete, frisch in aller Gedächtnis. Man hört grauenvolle Erzählungen von jenen schauerlichen drei Minuten, in denen Glück und Wohlstand unzähliger Familien vernichtet wurde. Angesichts dieser Gefahr baut man in Chile selten höher als zweistöckig. Dadurch erhalten natürlich die größeren Städte, z. B. Santiago, die Hauptstadt des Landes, eine enorme Ausdehnung. Gleichzeitig erhält aber auch das architektonische Bild einen sehr ausgeprägten Charakter. Man kann sogar von einem spezifisch chilenischen Baustil reden. Und in diesen niedrigen, langgestreckten, oft von schlanken Säulen getragenen Fassaden steckt mehr künstlerischer Geschmack, als in den überladenen Prachtbauten von Buenos Aires.
Inbezug auf Reisebequemlichkeiten muß man seine Ansprüche in Chile allerdings stark zurückschrauben. Die besten Hotels sind immer noch nicht so gut, wie etwa die mittelmäßigen in einer altmodischen deutschen Stadt. Von irgend einem Komfort und den Errungenschaften moderner Einrichtungstechnik, z. B. warmem fließenden Wasser, Telephon u. dergl. ist keine Rede. Die Verkehrsmittel entsprechen auch nicht einigermaßen verwöhnten Ansprüchen. In ganz Santiago, einer Stadt von zirka 400 000 Einwohnern, war kein Automobil aufzutreiben. Den Straßenverkehr vermitteln ausschließlich Droschken, die in Santiago noch ganz propper aussehen und mit guten Pferden bespannt sind. In den kleineren Städten dagegen, Conception oder Temuco, verkehren vorsintflutliche Vehikel von fabelhaften Dimensionen. Drei bis vier elende Klepper ziehen diese Riesenkarossen mühsam über das holperige Straßenpflaster, das noch nicht einmal überall die guten alten Knüppeldämme – die heutzutage eine Erfindung des Teufels scheinen – ersetzt hat. Auf den Eisenbahnen in Chile herrschen Zustände, die geradezu phantastisch genannt werden müssen. Hat man das Unglück, ein größeres Gepäckstück zu besitzen, so wird es einem auf dem Bahnhofe entrissen und ohne Quittung oder sonstige Sicherheit in den Gepäckwagen verstaut. Auf der Endstation muß man es selbst wieder heraussuchen. Doch kann man ebensogut jeden anderen Koffer als den seinigen bezeichnen. Jedes Gepäckstück, auf welches man mit dem Finger hinweist, wird einem anstandslos ausgeliefert.
Und trotzdem bestehe ich darauf, daß Chile europäischer ist als Argentinien. Man hat das Gefühl, einer Kultur gegenüberzustehen, die sich zwar langsam, dafür aber von innen heraus entwickelt. Infolgedessen halten viele Chile für den eigentlichen Zukunftsstaat von Südamerika. Hier ist alles vielleicht ein wenig ungeschickt, aber fest gefügt. Man baut in Chile keine Kartenhäuser, und der amerikanische Begriff des »bluff« ist hier unbekannt.
Von außeramerikanischen Einflüssen ist in Chile bei weitem am stärksten der deutsche vertreten. Vielleicht trägt dieser sehr merkliche Umstand dazu bei, einem das Land so vertraut und sympathisch zu machen. Manchen Institutionen des öffentlichen Lebens ist der Stempel »made in Germany« sogar ein wenig zu deutlich aufgedrückt. Vor allem dem Militär. Dafür ist es allerdings anerkanntermaßen das weitaus beste in ganz Südamerika. Die chilenische Armee wird seit Jahrzehnten von deutschen Instruktionsoffizieren gedrillt. Es ist eine Freude die strammen Soldaten anzusehen. Die Uniformen sind bis auf alle Einzelheiten, den Schnitt der Mäntel und Mützen, die Form der Epaulettes und Kokarden, deutschen Mustern nachgebildet. Anfangs glaubte ich, es wimmele in Chile von deutschen Militärattachés, denn alle chilenischen Leutnants hielt ich für Deutsche.
Sehr stark vertreten ist das deutsche Element in der industriellen und geschäftlichen Welt Chiles. Ein höchst wichtiger spiritus rector des Geldverkehrs in Chile ist die Deutsche Transatlantische Bank, die ihre Filialen in allen kleinen Städten des Landes hat und mit ihrer vorzüglichen Organisation einen kleinen Staat für sich bildet. Seit wir in Chile sind, reisen wir sozusagen als Postpakete der Deutschen Bank. Die Liebenswürdigkeit dieser Herren hat keine Grenzen. Überall werden uns von ihnen die manchmal allerdings recht rauhen Wege geebnet. Wer Südamerika bereist und sich der Deutschen Bank anvertraut, ist in Abrahams Schoße aufgehoben.
Von den indigenen Bevölkerungselementen sind am interessantesten natürlich die Indianerstämme der araukanischen Rasse, von denen in einem besonderen Artikel die Rede sein wird.
Soll ich nun den chilenischen Frauen ein Loblied singen? Auf den ersten Blick erscheinen sie stolz und unnahbar. Ob sie es in Wirklichkeit sind, kann erst eine längere Erfahrung lehren. Ihre auffallendste Charaktereigentümlichkeit ist für den sich im Anfangsstadium des Beobachtens befindlichen Durchreisenden – ihre ostentativ zur Schau getragene Frömmigkeit. Wenn man in Chile morgens auf die Straße geht, glaubt man alle Frauen seien Nonnen oder gehörten einer geheimen Sekte an. Sämtliche Personen weiblichen Geschlechts tragen hier nämlich bis zum Mittag eine Art Uniform, einen schwarzen, seidenen Schleier, der das Haupt und die ganze Gestalt verhüllt, und, kunstvoll geschlungen, nur das Gesicht frei läßt. Das ist das Kirchgangkostüm der Chileninnen, die demnach alle täglich morgens die Kirche zu besuchen scheinen. Wenigstens tun sie so als ob, und man kann es ihnen nicht übel nehmen, denn zu dem matten, elfenbeinfarbenen Teint ihrer oft auffallend hübschen Gesichter gibt der schwarze Schleier einen außerordentlich kleidsamen Rahmen ab. Abends tragen diesen schwarzen Schleier, den sogenannten Manton, nur kleine Bürgersfrauen und – Demimondainen. Dieser Umstand hat auch eingeborene Chilenen schon manchem verhängnisvollen Mißverständnis zugeführt.
Was Chile vor allen übrigen Staaten Südamerikas auszeichnet, ist die außerordentliche landschaftliche Schönheit des Landes. Der Norden erinnert etwa an die malerischen Partien von Oberbayern. Mittelchile, das Gebiet der interessanten Araukanerstämme, ist verhältnismäßig flach. In den Süden, die eigentliche Schweiz des Landes, deren romantische Schönheit über alles gerühmt wird, komme ich erst nach einigen Wochen. Santiago liegt in einem tiefen Talkessel, umgeben von schneegekrönten Höhenzügen. In der Mitte der Stadt erhebt sich ein, in einen prächtigen Park verwandelter Bergkegel, S. Lucia, von dem aus man einen herrlichen Rundblick ins Land hinein genießt. Wenn man Glück hat, kann man dort bei Sonnenuntergang das herrlichste – Kordillerenglühen erleben.
Eine berühmte Sehenswürdigkeit des nördlichen Chile ist der sogenannte Lota-Park. Er liegt unweit des Städtchens Conception am malerisch zerklüfteten Ufer des Stillen Ozeans. Auf dem Wege dorthin passiert man, nebenbei gesagt, die zweitlängste Eisenbahnbrücke der Welt, die, mehr als 2 Kilometer lang, über den jetzt im Sommer total versandeten Strom Bio-Bio führt. Der Lota-Park befindet sich in Privatbesitz, und es ist nicht leicht, die Erlaubnis zu seiner Besichtigung zu erhalten, da seine Besitzerin, die einer der vornehmsten und reichsten Familien des Landes angehört, in diesem Punkte von der hier üblichen, nach unseren Begriffen fast lächerlichen Exklusivität ist. Der Deutschen Bank verdankten wir, wie vieles andere noch, den Schlüssel zu diesem Sesam. Die vegetative Pracht des Parkes ist vielleicht einzigartig in der Welt, schon ob ihrer Mannigfaltigkeit, denn von den herrlichsten Palmen und Magnolienbäumen bis zu unserer bescheidenen Kiefer und Edeltanne, die sich in der exotischen Umgebung ganz besonders malerisch ausnehmen, ist dort jede Baumart vertreten, die im tropischen und gemäßigten Klima gedeiht. Die Erhaltung des Parkes muß einen enormen Aufwand von Kosten und Mühe beanspruchen. Nur eins sucht man dort vergeblich – unverfälschte Natur! Das Ganze nimmt sich wie ein künstlich hergerichteter botanischer Garten aus, was es im Grunde genommen ja auch ist. Die sauber geharkten Kieswege, die tausende von Statuen – vom Apollo von Belvedere bis zur plastischen Darstellung der Lieblingshunde der Besitzerin –, allerhand künstliche Grotten, aus Wurzeln und Schlingpflanzen hergerichtete Pavillons und Laubengänge verjagen den letzten Rest von Naturstimmung. Von all diesen Dingen bis zu Störchen und Zwergen aus Porzellan ist nur ein Schritt. Und das am Ufer des Stillen Ozeans, zu dem der Zugang durch einen kostbaren Zaun verbarrikadiert ist! Nein, das ist nicht das Richtige. Beim Durchwandern des Lota-Parkes schwand der Respekt vor dem Natursinn und dem künstlerischen Geschmacke der Besitzerin und ihrer Berater langsam aber sicher.
Wir verließen den Lota-Park in einem Extrazuge, den uns der Direktor der Bahnlinie in einem unverständlichen Anfalle von Liebenswürdigkeit zur Verfügung gestellt hatte. Um den einzigen Waggon des Zuges führte eine Galerie. Wir schoben uns Feldstühle hinaus und atmeten ordentlich auf, als wir, von den Strahlen der untergehenden Sonne begleitet, in die naturechten Wiesen und Wälder der chilenischen Landschaft hineinfuhren. Mein Reisekamerad nahm den Hut ab und grüßte jede Butterblume am Wege. Es gehört sicher mehr dazu, als Millionen und Vornehmheit, um nicht zu verderben, was die Natur mit ihrem eigenen Kunstsinn erschafft.
Mitten im Herzen Chiles, wo die westlichen Ausläufer der Anden-Kordilleren sich nach dem Stillen Ozean hinziehen, an einer Stelle, die vor dreißig Jahren von dichtem Urwald bestanden war, liegt heute die rasch emporgeblühte, obzwar noch kleine Stadt Temuco. Auf den meisten Karten Chiles, außer den allerneuesten, steht sie noch nicht einmal verzeichnet. Dennoch bietet gerade dieses Städtchen dem reisenden Europäer besonderes Interesse. Nicht wegen seiner landschaftlichen oder sonstigen Schönheit. Temuco an sich ist immer noch ein recht elendes kleines Nest, mit langweilig geraden, schlecht oder gar nicht gepflasterten Straßen und den für Chile charakteristischen einstöckigen Erdbeben-Häusern aus Holz oder Lehm. Von der Sonne gelb gebrannte Wiesen umgeben die Stadt, auf einigen Hügeln stehen noch Reste des niedergebrannten Urwaldes, halbverkohlte Baumstämme mit phantastisch gekrümmten Astarmen, niedriges gelbgrünes Buschwerk. Diese ungemütlich-monotone, trostlos arme Landschaft verleiht dem Ort keinen Reiz. Was Temuco interessant macht, ist die unmittelbare Nähe der immer noch halbwilden Araukanerstämme, eines Indianervolkes, das seit urvordenklichen Zeiten die Chilenische Ebene, in einem Umkreis von einigen hundert Kilometern um Temuco herum, bevölkert.
Als wir in Temuco anlangten, wurde dort gerade ein wissenschaftlicher Kongreß von chilenischen Gelehrten abgehalten. Anfangs konnten wir nicht umhin, diesen Congreso scientifico und alle seine Teilnehmer zu verwünschen, denn das einzige Hotel Temucos, das für Europäer in Betracht kommt, war derart überfüllt, daß wir mit einem höchst primitiven Nachtlager vorlieb nehmen mußten, nachdem wir uns geweigert hatten, ein kleines Zimmer mit drei keineswegs vertrauenerweckenden Chilenen zu teilen. Am nächsten Tage jedoch schon hatten wir Ursache, den Congreso reumütig zu segnen, statt ihn zu verfluchen.
Gegen Mittag begann eine uns anfangs unerklärliche Aufregung und Bewegung in der Stadt zu herrschen. Als wir auf die Straße hinaustraten, sah man von allen Richtungen her endlose Züge von Reitern nach dem Mittelpunkte der Stadt, der sogenannten »Plaza des armes«, die in keiner südamerikanischen Stadt fehlt, hinziehen. Es stellte sich heraus, daß es sich um einen Aufzug der Araukaner oder Mapuches, wie man sie hier auch nennt, handelte, der zu Ehren der Kongreßmitglieder in Szene gesetzt wurde. Immer bunter, immer bewegter, immer interessanter wurde das Bild, das sich nach und nach auf dem Platze entwickelte. Größere und kleinere Trupps von Reitern nahten im Galopp, im Trab oder im Schritt. Endlich mögen weit über Tausend versammelt gewesen sein. Im blendenden Sonnenscheine flimmerte der aufgewirbelte Staub, blitzte der Silberbeschlag des Zaumzeugs und der Steigbügel, die Reiter sitzen wie angewachsen auf den dicht aneinandergedrängten, ungeduldig stampfenden Pferden. Alle tragen sie den bunten oder einfarbigen, gestreiften, gewürfelten, oder mit anderen, oft schönen Mustern bedeckten Poncho, das für Reiter höchst bequeme, hier unentbehrliche Kleidungsstück, eine Art Plaid, durch den durch einen Schlitz in der Mitte der Kopf durchgesteckt wird, während der Stoff von allen Seiten frei am Körper herabhängt. Breitrandige Hüte aus Stroh oder farbigem Filz bedecken die Köpfe. Unter den Hüten schaut manches interessante Gesicht hervor. Blitzende, braune Augen, gerade Nasen, starke Backenknochen; der Bart im Gesicht, wenn er überhaupt wächst, wird ausgezupft, bis auf einen schmalen Haarstreif am äußersten Rande der Oberlippe. Weit malerischer noch und eigenartiger, als die Männer, sind die Frauen gekleidet. Auch sie sind fast alle zu Pferde, hier und dort sieht man zwei auf einem braven Tier sitzen – natürlich rittlings, ohne Steigbügel, denn die Araukanerfrauen tragen nie einen Stiefel. In der Kleidung bevorzugen sie zwei Farben, schwarz und dunkellila, was zu ihrer gelbbraunen Gesichtsfarbe und dem tiefschwarzen Haar schön aussieht. Reicher Silberschmuck bedeckt die Brust, ein großes Tuch, das die Schultern verhüllt, wird von einer silbernen Nadel, in Form eines Pfeiles, zusammengehalten, das Haar ist von silbernen Schnüren durchflochten, hin und wieder sieht man das Haar, im Nacken geteilt, in zwei aus Silber geschmiedeten Röhren stecken. Je reicher die Mapuchesfrau ist, desto mehr Silberschmuck trägt sie, Ohrgehänge, Ringe, Gürtel zu allem übrigen.
Ununterbrochene Rufe: »Viva la raça araucana« gellten von allen Seiten. Dazu kamen bald andere ohrenzerreißende Töne, die die Aufmerksamkeit auf sich lenkten. Man verleugnet nie seinen Beruf. Mein Instinkt sagte mir, daß diese Töne Musik vorstellen sollten. Ich ging ihnen nach, was nicht leicht war, da es galt, sich durch eine lebendige Mauer von Köpfen und Hinterteilen der Mapuchespferde durchzudrängen. Richtig – an der gegenüberliegenden Seite des Platzes hatte ein araukanisches »Orchester« Aufstellung genommen. Heilige Cäcilie! da mögen Dir die Ohren weh getan haben! Das einzige musikalische Element dieser Musik war der Rhythmus, der vermittelst einer Trommel – ein ausgehöhlter Baumstumpf mit Schafhaut bespannt und schön bemalt – aufrecht erhalten wurde. Von Melodie, oder gar Harmonie keine Spur, nicht einmal von musikalisch fixierbaren Intervallen. Ich hatte schon Notizbuch und Bleistift in Bereitschaft, um die araukanische Nationalmusik nachzuschreiben, mußte dieses Vorhaben jedoch als absolut undurchführbar aufgeben. Auf endlosen Schilfrohren, an deren Ende ein Kuhhorn angebracht war, und auf kleinen Pfeifen, deren Ton einem angeblasenen Hausschlüssel ähnelt, blies jeder was er wollte, oder was das Instrument gerade hergab. Die Musiker, zum größten Teil blinde Greise, machten dazu mit dem Körper Bewegungen im Rhythmus der Trommel, der der einzige Ruhepunkt im unentwirrbaren Chaos der Töne war. Musik und Tanz gehören zusammen. Bei halbkultivierten Rassen ist der Tanz überhaupt der einzige Daseinszweck der Musik. Es dauerte auch gar nicht lange, da fanden sich zwei alte Mapuchesfrauen ein, die der Versuchung nicht widerstehen konnten und anfingen, sich nach dem monotonen, unbeirrbar gleichbleibenden Takt der Trommel zu drehen. Die jüngeren Frauen hielt augenblicklich ihr Schamgefühl vom Mittun ab. Der Tanz der beiden Alten sah gar putzig aus. In halb hockender Stellung, mit extatisch verdrehten Augen, wirbelten sie ziemlich schnell jede um die eigene Axe, von Zeit zu Zeit unterbrachen sie die Bewegung, um aufeinander loszuspringen und sich mit langen Zweigen, die sie in der Hand hielten, an Kopf oder Schulter zu berühren. Den Sinn des Tanzes konnte mir niemand erklären. Man sah ihn in Temuco zum ersten Male, und er erregte große Sensation. Alle Bäume der Plaza um die beiden Alten herum waren bis in die Kronen mit Schaulustigen besetzt.
Das Defilée der Mapuches dauerte fast drei Stunden. Natürlich mußte der »Kodak« respektive der »Tenax« ununterbrochen arbeiten. Mein Reisekamerad und ich fanden uns bald auf dem Dache einer der vorsintflutlichen temucaner Droschken, bald in halsbrecherischer Stellung an ein Fenstergesims geklammert, mit gezückten Apparaten, wieder.
Dem Europäer stechen natürlich die zum Teil sehr kunstvoll und originell gearbeiteten Schmucksachen der Araukanerfrauen mächtig in die Augen. Doch ist es nicht leicht, dieser Gegenstände habhaft zu werden. Ab und zu findet man sie in den Versatzämtern von Temuco. Denn diesen Segen der Kultur kennt der Indianer schon, wenngleich er sich nur höchst ungern und nur im alleräußersten Notfalle von seinem Hab und Gut trennt. Fast unmöglich ist es, araukanische Ringe in seinen Besitz zu bringen. Sie müssen für die Träger irgend einen besonderen, vielleicht symbolischen Wert haben. Mit einem jungen Araukaner, den ich zufällig in einem Versatzamt von Temuco traf, war ich schon handelseinig geworden, obgleich er einen Phantasiepreis für seinen Ring verlangte. Er hatte ihn schon vom Finger gezogen, um ihn gegen die entsprechenden Pesos einzutauschen, da drehte er sich plötzlich, ohne ein Wort weiter zu verlieren, um, steckte den Ring an seine Hand, sprang aufs Pferd und war verschwunden, ehe ich mir über den Vorgang klargeworden war. Fast ebenso schwierig ist die Beschaffung von Musikinstrumenten. Einem Europäer werden sie für nichts in der Welt abgegeben. Der Araukaner ist, wie gesagt, außerordentlich mißtrauisch, und da er es nicht versteht, was für einen Wert diese an sich wertlosen Dinge für unsereinen haben können, wittert er irgendeine boshafte Absicht, wenn man ihm sein Instrument abnehmen will. Man bedarf dazu der Vermittlung irgend eines von der temucaner Kultur schon erfolgreich beleckten Stammesgenossen. Solch ein Araukanerjüngling unternahm in unserem Auftrage einen zweitägigen Ritt in die Kordillere, brachte dann allerdings einige wunderschöne Instrumente mit, eine Trommel mit roter Farbe – wahrscheinlich Schafsblut – prächtig verziert, eine Pfeife und das Staatsstück – eine mehr als vier Meter lange Trompete, ein so gut gearbeitetes und erhaltenes Exemplar, wie man sie selten sieht. Die Freude war natürlich groß. Nach eifrigem Üben gelang es mir sogar, dieser musikalischen Riesenschlange einzelne Töne zu entlocken, die die Mitte hielten zwischen dem Timbre eines Kontrafagotts und dem Brüllen einer Kuh. Viel Kopfzerbrechen machte nachher allerdings uns und der chilenischen Eisenbahnbehörde die Verpackung und Versendung dieses Trompetenmonstrums.
Nach den interessanten Eindrücken, die der Aufzug der Mapuches in Temuco hinterließ, erwachte natürlich der Wunsch, den Indianer chez soi zu sehen. Der Wunsch wurde Wirklichkeit.
Dank der Liebenswürdigkeit eines deutschen Mitgliedes des Congreso scientifico in Temuco, des Meteorologen Dr. K., wurde es uns ermöglicht, einen Einblick in das Leben und Treiben der Mapuches-Indianer bei sich zu Hause zu gewinnen. Dr. K. hatte eine Tour ins Araukanergebiet vor, unter Führung eines anderen Kongreßmitgliedes, des noch sehr jungen chilenischen Professors M., der insofern der geeignete Mann zu diesem Unternehmen war, als er selbst einer Araukanerfamilie entstammt und die Sprache der Indianer vollkommen beherrscht. Solch ein Führer ist notwendig, denn die Indianer sind überaus mißtrauisch, lassen Fremde nur ungern in die Nähe ihrer Behausungen und haben besonders vor dem Photographiertwerden eine Heidenangst. Dr. K. hatte in dieser Hinsicht einst schlimme Erfahrungen machen müssen. Bei einem selbständig unternommenen Ausfluge hatte ihn ein alter Mapucheshäuptling in seiner Hütte eingesperrt, und nur mit großer List und viel Überredungskunst war es ihm gelungen, sich aus dieser heiklen Situation zu befreien.
Wir schlossen uns den beiden Herren an. Eines schönen Morgens um fünf brachen wir auf, voran die beiden Gelehrten in einem zweirädrigen Karren, der auch den Proviant beherbergte, hinterdrein wir zwei zu Pferde. Zuerst ritten wir nach einem alten indianischen Friedhof. Die Araukaner bestatten ihre Toten ohne Särge und setzen ihnen hölzerne Denkmäler, hohe Pfähle, in die oben eine Figur hineingeschnitzt ist, die ein stilisiertes Menschengesicht vorstellen soll, was jedoch kein Nichtaraukaner erraten kann, wenn es ihm nicht gesagt wird. Obwohl den Indianern jetzt befohlen ist, ihre Toten auf den allgemeinen Friedhöfen zu bestatten, so denken sie doch nicht daran, es zu tun, wie sie denn die Gesetze überhaupt nur respektieren, soweit es ihnen bequem ist. Neben alten, halbzerwühlten Gräbern mit altersgrauen, zerfaulenden Denkmälern, sahen wir auch einige frisch aufgeworfene. Nach zweistündigem Ritt erreichten wir den ersten indianischen Rancho. Prof. M. machte uns auf einen treppenartigen Aufbau aufmerksam, der vor dem Hause stand. Das ist das Zeichen, daß in dem Hause ein »Medizinmann« wohnt, respektive eine »Medizinfrau«, denn bei den Araukanern wird das ärztliche Gewerbe vorzugsweise von alternden Weibern betrieben. Auf dem Dache des Hauses erhebt sich auf hoher Stange ein gebleichter Tierschädel – um die Hexen abzuschrecken, die Menschen und Tieren sonst viel Unheil zufügen können. Beim Besuche dieses und anderer Indianerranchos ging stets Prof. M. als Pionier voran. Erst nach längeren Unterredungen, die auf araukanisch geführt wurden, durften wir vorsichtig nachdringen, den »Kodak« sorglich verborgen. Doch wurden wir dann meist recht freundlich begrüßt, mit Händedruck und Willkommengruß: »Maremare«. Ein indianischer Rancho ist ein höchst primitiver Bretterbau mit Stroh gedeckt. Drei Wände umgeben einen Raum, dessen Größe je nach dem Reichtum der Familie variiert. An der vierten Seite ist das Haus offen, wodurch sonstige Türen und Fenster überflüssig gemacht werden. Dieser eine Raum dient dem Araukaner nicht nur als Wohnhaus, sondern auch als Schweine- und Hühnerstall, vorausgesetzt, daß er über solche Reichtümer verfügt. Außerdem enthält er in malerischer Unordnung alles für den Araukaner zum Leben notwendige. In der Mitte ist der Feuerplatz, umgeben von allerhand merkwürdig geformten Kochgeschirren. An Stangen und Schnüren, die den ganzen Raum nach allen Richtungen durchziehen, hängen getrocknete Maiskolben, Tierhäute, Felle, kunstvoll arrangierte Gedärme, daneben stehen die mit bunten Decken bezogenen Betten der meist recht zahlreichen Familienmitglieder, Säcke mit Mehl und Getreide dienen als Sitzgelegenheiten, von der Decke herab hängen die kunstreich gezimmerten »Behälter« für Brustkinder, die die Araukanerfrauen auf dem Rücken tragen, wenn sie das Haus verlassen. In einer Ecke steht der Webestuhl, eine sehr primitive Maschine, auf der die Araukanerfrauen alle Stoffe für den Hausgebrauch selbst anfertigen. Manche von diesen Stoffen, die zu Ponchos und Decken verwandt werden, sind wunderschön in Farbe und Musterung. Bei einem alten Araukanerhäuptlinge sahen wir über dem Feuerplatze zwei – Skalpe hängen, ein schwarzes und ein blondes, augenscheinlich von einem »Milchgesicht« stammendes – ein alter Familienbesitz, der jedoch in Ehren gehalten wird, obwohl diese Indianer jetzt friedlicher sind und, besonders keinerlei Gelüste nach den Kopfhäuten ihrer Mitmenschen mehr hegen.
In einem der Ranchos, die wir besuchten, trafen wir eine indianische »Medizinfrau«. Sorgenvoll behandelte sie einen Araukaner, dem von einem Gegner im Streite ein Bein zerbissen war. Sie hatte den Mann ans Feuer gesetzt und das kranke Bein so nahe zur Flamme geschoben, daß es den Eindruck erweckte, die kunstreiche Ärztin wolle es braten. Übrigens wurde die kluge Frau, wie sie unserem Führer gestand, von schweren Sorgen geplagt: in ihrer Praxis waren ihr bis jetzt nur Hundebisse begegnet und sie wußte nicht, ob die dagegen angewandte Therapie auch bei Menschenbissen heilkräftig sei. In einem schwarzen Kessel auf dem offenen Herde brodelte ein köstlicher Kräuterbrei, der von Zeit zu Zeit »bemurmelt« wurde. Hoffentlich hilft er dem wunden Krieger, damit er sich bald an seinem bissigen Gegner rächen kann.
Die beste Aufnahme wurde uns bei einem alten Araukanerhäuptlinge zuteil. Der Mann – auf araukanisch nennt man ihn »Cazike« – schien überhaupt kultivierter zu sein, als die übrigen. Er baute sich gerade aus schönem Rotholz ein neues Haus. Dies war die einzige Araukanerfamilie, die ich ohne Gefahr, eingesperrt zu werden, photographieren konnte. Bei den anderen wurden die unglaublichsten Listen angewandt, damit ich meinen Kodak ein oder das andere Mal heimlich funktionieren lassen konnte. Meist wurden es dann – Rückenaufnahmen. Aber dieser alte Häuptling stellte uns nicht nur seinen beiden Frauen und seinen zehn Töchtern vor, sondern ließ sich gerne als stolzer Hahn im Korbe, inmitten der zwölf Frauenspersonen seiner Familie photographieren. Die Mädchen zogen dazu ihre schönsten Gewänder an und behängten sich mit reichem Silberschmuck. Auch ließ es sich der brave Mann nicht nehmen, die »Nomelofcien« – so heißt auf araukanisch jeder Nichtindianer, gleichviel ob er aus Temuco oder Moskau stammt – mit frischen Eiern zu bewirten. Weitere Gänge des araukanischen Diners wiesen wir, angesichts der mehr als primitiven Methoden ihrer Zubereitung, höflich aber bestimmt zurück. Dafür trank der Alte, ebenso wie seine zehn Töchter, gerne und viel von dem mitgebrachten Rotweine.
Die Araukaner sind, trotz eifrigen Bemühens der englischen Missionen, fast alle noch Heiden, das heißt bis zu einem gewissen Grade. Einige höchst unchristliche Sitten, z. B. die Vielweiberei, die jedoch mit den sozialen Verhältnissen des indianischen Lebens eng verknüpft sind, wird es wohl noch lange nicht gelingen, aus der Welt zu schaffen. Und wenn die Missionen darauf hinarbeiten, so begreifen sie nicht, daß sie damit gleichzeitig die Moral dieses Indianervolkes untergraben. Denn die Moral der Araukaner ist absolut einwandfrei, trotz der Vielweiberei höher stehend als in manchem Kulturlande. Dem Vater liegt daran, seinen jungen Sohn als Arbeiter ans Haus zu fesseln. Dazu gibt es nur ein Mittel: er muß ihm eine Frau – kaufen. Denn hier werden die Frauen noch »gekauft«, für 25-80 Schafe, je nach dem Alter, kann man eine haben. Also der Vater kauft seinem 15jährigen Sohne eine Frau, die billig sein muß, also wenigstens 35 Jahre alt ist. Der Junge lebt mit seiner Frau glücklich bis zu seinem 25. Jahre. Dann ist seine Frau schon alt und verwelkt, er selbst hat sich aber schon etwas erspart und kann sich eine Frau kaufen, die ungefähr ebenso alt ist wie er. Mit der lebt er weitere 20 Jahre, dann ist er reich geworden und kann sich ein junges Weib von 15 Jahren leisten. Wenn er als 65jähriger Greis stirbt – länger lebt der Indianer fast nie – ist seine dritte Frau 35 und taugt gerade dazu für einen Burschen von 15 Jahren gekauft zu werden. So schließt sich der logische Ring des merkwürdigen araukanischen Eheinstituts ganz von selbst. Eifersucht kennt die Araukanerfrau nicht, sie geht in der Sorge um die meist sehr zahlreichen Kinder auf. Ein Araukaner mit drei Frauen lebt in den glücklichsten und ruhigsten Familienverhältnissen. Solch ein durch jahrhundertelange Tradition geheiligter, aus den sozialen Verhältnissen eines Volkes sich ganz von selbst ergebender Gebrauch läßt sich natürlich nicht durch einen Federstrich der Regierung aus der Welt schaffen, worauf die englischen Missionen mit Gewalt hinarbeiten. Dazu sind Jahrzehnte und Jahrzehnte sorglicher, verständiger und verständnisvoller Kulturarbeit notwendig.
Diese und manche anderen interessanten Aufschlüsse über Sitten und Gebräuche, Psychologie und Lebensbedingungen der araukanischen Indianer verdanke ich einer Persönlichkeit, die originell genug ist, um sie meinen verehrten Lesern vorzustellen. Es ist ein Franziskanermönch, Padre Hieronymo, einer der merkwürdigsten Menschen, die mir je in meinem Leben begegnet sind. Auf den ersten Blick scheint der Padre Hieronymo nur aus seiner braunen Kutte und einem mächtigen roten Bart, der bis an die Gürtelschnur herabreicht, zu bestehen. Sieht man näher hin, so entdeckt man hinter Brillengläsern ein Paar leuchtend blaue, intelligente, freundlich und doch ein wenig listig blickende Augen. Der Padre ist Bayer. Hier lebt er seit zehn Jahren, hat eigenhändig, fast ohne fremde Hilfe unweit Temucos eine Schule für Indianerbuben aufgebaut. Dort haust er, umgeben von 80-100 Araukanerknaben, die er zu vernünftigen, denkenden Menschen erzieht, ohne sie gewaltsam den eigenen Sitten und der eigenen Kultur zu entfremden. Einige Monate im Jahr durchstreift er zu Pferde das ganze Araukanergebiet, ist überall gerne gesehen, da er fließend araukanisch spricht, und holt sich die Jungen von 8-14 Jahren, die ihm jetzt überall mit Freuden anvertraut werden. Mit einer umfassenden, festgegründeten Bildung verbindet Padre Hieronymo eine überaus feine Menschenkenntnis, eine Weitherzigkeit und Vorurteilslosigkeit, die bei einem bayrischen Franziskanermönch geradezu verblüffend ist. Über alle Fragen der Politik, Literatur und Wissenschaft ist er orientiert. Unser erstes Gespräch drehte sich um russische politische Verhältnisse und die Bücher von Gorki und Tolstoi. Man denke – ein deutscher Mönch in den chilenischen Urwäldern! Manche höchst anregende und interessante Stunde verdanke ich dem Padre Hieronymo. Gerne würde ich seine feinsinnigen Beobachtungen über das Leben der Araukaner mitteilen, doch würde mich das viel zu weit führen.
Die Araukaner-Indianer sind ein Thema, das sich auf diese Weise doch nicht erschöpfend behandeln läßt. Der Zweck dieser Zeilen konnte nur eine flüchtige Umrißzeichnung sein. Man sieht auch daraus, daß der Gegenstand einer anderen Behandlung wert wäre.



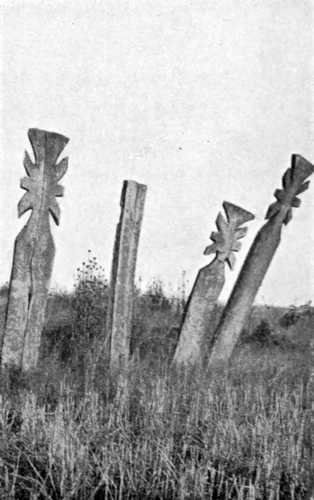
Wenn man in Europa an Chile denkt – wer tut das überhaupt und wann? – so macht man sich von der Ausdehnung des Landes schwerlich einen ganz richtigen Begriff. Auf die Karte von Europa projiziert, würde Chile von Norden nach Süden eine Strecke einnehmen, die etwa von Kopenhagen bis Zentral-Afrika reicht. Dieser Umstand bedingt natürlich eine Variabilität der wirtschaftlichen Verhältnisse, wie sie außerdem vielleicht nur noch in Rußland vorkommt. Die Grenzgebiete sind hier im hochgelegenen steinigen Norden, wo kein Baum und kein Strauch mehr gedeiht, die ungeheure Salpeterindustrie, – im Süden, der in die gemäßigte Zone hineinreicht, die ausgedehnten Schafzüchtereien. Dazwischen liegen die üppigen Ebenen von Santiago und Liai-Liai, wo der herrliche chilenische Wein wächst – überhaupt ein Fruchtland par excellence, das dem »gelobten« der Bibel in nichts nachzustehen scheint – und weiter südlich am Valdivia und Ossorno herum das märchenhafte Weizengebiet, dessen Fruchtbarkeit jeden europäischen Landwirt gelb vor Neid machen muß. Die klimatischen Unterschiede in den einzelnen Landstrichen Chiles sind natürlich außerordentlich fühlbare. Das merkt man als Reisender, und noch dazu als eilig Reisender, ganz besonders – leider, denn wenn man den Norden bei herrlichstem Sommerwetter und nie aussetzendem Sonnenschein verläßt, kommt man im Süden in den grauen, trüben und kühlen Herbst hinein, ehe man sichs versieht. Eine Redensart behauptet vom südlichen Chile, daß es ein Land sei, in dem es dreizehn Monate im Jahr regnet. Dagegen kann nur der Kalendermann aus Pedanterie protestieren. Dennoch wird man als Reisender von Ort zu Ort immer südlicher geschickt. Denn die Chilenen sind mächtig stolz auf den Süden ihres Landes, auf die malerischen Schönheiten, die das Seengebiet der südchilenischen Kordillere bietet. Aber was nutzen einem die herrlichsten Berge, die Schneekoppen phantastischer Vulkane, wenn sie von schweren, grauen Wolken bedeckt sind, oder die herrlichsten Seen, wenn ein dichter undurchsichtiger Regenschleier sie verhüllt! Man läßt die Einwohner von den zauberischen Schönheiten ihres Landes erzählen und muß ihnen aufs Wort glauben. Oder man muß den vierzehnten Monat des Jahres für seine Reise abwarten. Dann präsentiert sich vielleicht die ganze Gebirgsszenerie in ihrer vollen Pracht.
Beim Durchfahren der Bahnstrecke Valdivia–Ossorno–Puerto Montt wird es einem, ebenso wie beim Aufenthalte in den genannten Städten, zuweilen schwer zu glauben, daß man sich irgendwo in Chile befindet und nicht in Deutschland, freilich in einem Deutschland vor fünfzig oder fünfundsiebzig Jahren (wie man sich das so vorstellt). Selbst der Piccolo auf den Stationen fehlt nicht: »Glas Bier gefällig?« Nur heißt das hier »una cerveza«. Es ist kein Zweifel: in ganz Süd-Chile sind die Deutschen das absolut dominierende Bevölkerungselement. Wenn auch nicht der Zahl, so jedenfalls der wirtschaftlichen und kulturellen Bedeutung nach, die sie hierzulande erlangt haben. Allein drei Viertel des gesamten Grundbesitzes befinden sich in deutschen Händen, zuweilen sind es Latifundien, deren Ausdehnung sogar in Rußland Respekt erregen würde. Güter von 40-50 000 Hektar sind keine Seltenheiten. »Es gibt in Chile keinen armen Mann«, behauptet eine Redewendung, die ich oft gehört habe. Glückliches Land, wenn das stimmt. Und das scheint zu stimmen. Wohlstand und Genügen, wohin man blickt, wenigstens unter den Deutschen, die im Konkurrenzkampf mit dem trägen unentschlossenen Chilenen leichtes Spiel haben. Der Hauptgrund dieses auffallenden Wohlstandes ist natürlich der beispiellos fruchtbare Boden des Landes. In Chile wächst alles, was man in die Erde steckt. Und wie wächst es! Ich habe siebenjährige Fruchtbäume gesehen, die doppeltmannhoch unter der Last der Früchte buchstäblich zusammenbrachen. Die Äste der Pflaumen- und Birnbäume sehen aus wie Riesentrauben und Riesenbeeren, Frucht an Frucht gedrängt, kein Blättchen hat dazwischen Raum. Und daneben wächst Tabak, Mais, oder Sonnenblumen von fabelhafter Größe, dann wieder Pfirsiche, Erdbeeren und friedlich nebeneinander stehen Kokospalmen und Edeltannen. Aber das eigentliche Gold des Landes ist der Weizen. Der Landwirt baut ihn fast ausschließlich. Er läßt seine Felder lieber drei bis sechs Jahre ganz ruhen, um sie dann wieder unter Weizen zu bringen. Den Begriff der Düngung kennt man hier nicht. Und was für Ernten gibt es hier! Eine Ernte, die das fünfundzwanzigste bis dreißigste Korn abwirft, gilt als mittelmäßig. In Ossorno lernte ich einen deutschen Landwirt kennen, der soeben eine Weizenernte eingebracht hatte, die ihm das fünfzigste Korn ausgab. Damit war er freilich selbst zufrieden. Trotzdem der ganze Weizenexport in den Händen von nur zwei großen Firmen liegt, die merkwürdigerweise englisch sind und die Preise auf ein Minimum herabdrücken, ist das Weizengeschäft so lohnend für die Landbesitzer, daß nichts anderes daneben bestehen kann.
Die einzige Mühe, die der Landwirt hier hat, ist die – das Land urbar zu machen. Ist das einmal geschehen, so braucht er sich um nichts mehr zu kümmern. Das übrige besorgen der Boden und das Klima ganz von selbst. Aber diese Urbarmachung zwingt einen, gehörige Schwierigkeiten zu überwinden, und die Energie, die dazu verbraucht wird, verdient die allerhöchste Bewunderung. Enorme Strecken des Landes sind von undurchdringlichem Urwald bedeckt. Den gilt es auszuroden. Hier hat sich nun eine ganz merkwürdige Technik ausgebildet, die – nebenbei gesagt – tausende von Kilometern weit auch den landschaftlichen Charakter des Landes bestimmt. Sie besteht in folgendem. Es werden künstlich Waldbrände in Szene gesetzt. Vorerst um das Unterholz zu vernichten, denn sonst ist ein Eindringen in den Wald überhaupt unmöglich. Der erste Brand vernichtet jedoch den Wald noch nicht, er trocknet ihn nur aus. Nun wartet man ein Jahr oder zwei, dann zündet man den Wald wieder an. Und so weiter, bis endlich nur noch verkohlte Stämme in dichten Reihen gen Himmel starren und das zu Asche gewordene Unterholz in schwärzlich-brauner Schicht den Boden bedeckt. Dieses landschaftliche Bild verfolgt einen durch ganz Chile. Es sieht trostlos aus, am wenigsten darnach, daß hier der Mensch bei einer Kulturarbeit ist. Nun gilt es noch, die Bäume zu fällen und die Wurzeln zu heben, dann kann man ruhig und unbesorgt um das Resultat seinen Weizen säen. Doch hin und wieder widersetzt sich der Wald. Es gibt Stämme und Baumstrünke, denen weder mit der Hand noch mit Maschinen beizukommen ist. Der Landweg zwischen Puerto Varras und Puerto Montt ist mit niedergebranntem Wald eingesäumt, der seit fünfzig Jahren brach liegt. Sieht man die Stümpfe der Riesenbäume, von denen manche drei bis vier Meter im Durchmesser aufweisen, so begreift man, daß hier alle Arbeit umsonst wäre.
Ein Feind des Landwirts ist hier auch – die Brombeere. Die Deutschen haben sie vor einigen Jahrzehnten erst selbst eingeführt. Jetzt werden sie die Geister, die sie riefen, nicht mehr los. Die Brombeere wuchert überall in solchen Massen, in solch üppigem Gewirr, daß sie droht, das ganze Land mit einer undurchdringlichen Hecke zu überziehen. Ein wahrer Vernichtungskampf gegen sie hat begonnen, der viel Mühe kostet und doch nur wenig nutzt.
War es vor fünfzig Jahren fast ausschließlich die Landwirtschaft, die die Deutschen hier stark machte, so dringt ihr Einfluß jetzt in alle Gebiete des wirtschaftlichen, sozialen, ja sogar politischen Lebens hinein. Übrigens sind die Chilenen weit entfernt davon, unzufrieden zu sein. Kürzlich fiel mir eine spanische Zeitung in die Hand, aus der ich, zur Orientierung, folgendes wörtlich übersetzte Zitat mitteilen möchte: »Deutsch sind unsere Unterrichtssysteme und deren Leiter, deutsch sind unsere Elektrizitätswerke, deutsch ist unser Militärwesen, deutsch beinahe die ganze Salpeterzone von Tolo und Taltal, deutsch die meisten und wichtigsten unserer Banken, in deutschen Banken sind unsere Goldreserven deponiert, auf deutschen Schiffen fahren unsere Staatsangehörigen, wenn sie ihr Land auf einige Zeit verlassen, auf deutschen Schiffen kommen die für unseren Gebrauch nötigen Waren an, mit deutschem Spielzeug spielen unsere Kinder, deutsche Artikel beherrschen unseren Markt und sogar unsere Zeitungen sind auf deutschem Papier gedruckt, oder wenigstens auf Papier, das durch deutsche Kaufleute in den Handel gebracht wird. Ich habe deshalb gesagt, daß, wenn eines Tags eine andere Nation an unseren Türen pocht, man ihr antworten wird: besetzt!« So weit der chilenische Publizist. Dazu kann man noch hinzufügen: deutsch, ausschließlich deutsch ist hier, wie übrigens auch anderswo das Dreigestirn Doktor, Apotheker, Wurstmacher und deutsch sind alle, wenigstens alle guten Hotels. Letzteren Umstand kann der Reisende, zumal der deutsche, nicht hoch genug preisen.
Und allen diesen Deutschen geht es, wie gesagt, gut. Verkrachte Existenzen kommen kaum vor. Ein Graf R., der sich hier so durchhochstapelt und ein Fürst v. F., der in einer Valdivianer Brauerei Flaschen wäscht, werden als Sehenswürdigkeiten gezeigt.
Nun entsteht die Frage: fühlen sich die Deutschen hier als Deutsche, oder sind sie zu Chilenen geworden, wollen sie es werden. Es ist dasselbe Dilemma, vor das die Deutschen auch – anderswo gestellt werden. Ich fragte einen hiesigen Einwohner darnach, einen prächtigen bayrischen Wurstfabrikanten in Temuco, dessen Söhne sich schon etwas chilenisch ausnahmen. Ich fragte ihn: »Tut es Ihnen nicht leid, wenn Ihre Kinder das deutsche Heimatsgefühl verlieren?« Er zuckte die Achseln, und ein ganz leichter Schatten legte sich auf sein Gesicht. »Das Einzige, was ich von meinen Kindern verlange, ist, daß sie anständige und ehrliche Menschen sind.«
Der Nachahmungstrieb, wenn er nicht auf innerem Verständnis und wirklichem Bedürfnis beruht, sondern auf Eitelkeit und Parvenü-Ehrgeiz, ist eine gefährliche, ja verhängnisvolle Eigenschaft. Er führt zu geistigen Fälschungen, zieht in der Regel Zwang und Unfreiheit nach sich und bedingt das betrübliche Schauspiel, wie Sinn in Unsinn verkehrt wird.
Einen Beleg für diese Behauptung bietet das Leben der chilenischen beau monde, wie es sich dem europäischen Beobachter darstellt.
Sobald der Südamerikaner – hier ist speziell vom eingeborenen Chilenen die Rede – zu Gelde kommt, packt ihn die Eitelkeit, es in allen Dingen den hochmütigen Europäern nicht nur gleich-, sondern womöglich zuvorzutun. Da ihm die eigenen Ideen fehlen – wo sollte er sie auch herhaben – muß er sich aufs Nachahmen verlegen. Und da entsteht jenes ergötzliche Bild, das die Kritik herausfordert, auch wenn man kein Mephistopheles ist: »wie er sich räuspert, wie er spuckt ...«
Schon auf den südamerikanischen Ozeandampfern, in den großen Hotels der argentinischen und chilenischen Hauptstädte, fällt die stahlgepanzerte Reserve auf, die von Vollblut-Chilenen Europäern gegenüber zur Schau getragen wird. Sie entspringt jedoch keineswegs dem Überlegenheitsgefühl und dem sprichwörtlichen Rassenhochmut der stolzen Spanier, sondern hat vielmehr in dem Gefühl der inneren Unfreiheit und gesellschaftlichen Unsicherheit ihren Grund. Weil der Chilene nicht genau weiß, wie er sich in jeder gegebenen Situation »europäisch« zu betragen hat, beträgt er sich lieber gar nicht, d. h. bleibt stocksteif, stumm und unbeweglich. Die Angst, irgend eine gesellschaftliche Dummheit zu begehen, benimmt ihm die Bewegungsfreiheit.
Amüsanter noch als dies ist, daß sich dieselben Gesichtspunkte hier auf das gesellschaftliche Leben übertragen, auch wenn die Chilenen unter sich sind. Weiß man doch von seinem gesellschaftlichen Partner nicht ganz genau, was für »europäische« Begriffe er sich angeeignet hat. Von Leuten, die in den hiesigen Verhältnissen gut versiert sind, hört man einstimmig behaupten, daß in der chilenischen Gesellschaft eine arge Korruption herrscht. Es fällt schwer, das zu glauben, denn nach außen hin ist nicht das allergeringste davon zu merken. Im Gegenteil, ein sittenstrengeres Gebaren, als es die Chilenen allenthalben zur Schau tragen, läßt sich kaum denken. Hier herrscht zwischen Innen und Außen augenscheinlich dasselbe Verhältnis, wie etwa in der Kleidung der bolivianischen Indianerfrauen. Nach außen hin sehen sie sauber und appetitlich aus, und nur der Eingeweihte weiß, daß unter dem schönen neuen Kleiderrock unzählige alte, schmierige und zerfetzte stecken.
Je strenger ein Dogma eingehalten wird, desto mangelhafter ist es meistens um sein Verständnis bestellt. Das hat hier nicht nur auf die Dogmen der katholischen Kirche Anwendung, die mit einer unerbittlichen Strenge und peinlichster Genauigkeit befolgt werden, sondern auch auf die von Anno dazumal übernommenen Dogmen des europäischen gesellschaftlichen Lebens. Wichtig ist hier wie dort nur, wie die Sache nach außen hin aussieht, doch darf man ihr beileibe nicht einen Millimeter breit auf den Grund gehen.
Da ist z. B. das Straßenleben abends in Valparaiso. Man tritt auf die Avenida del Independencia hinaus. Die Straße ist schwarz von Menschen. Im ersten Augenblick glaubt man, daß sich ein Schadenfeuer oder sonst irgend ein aufregendes Ereignis abspielt. Erst wenn man näher kommt, erkennt man, daß sich hier nichts anderes vollzieht, als die regelmäßige Abendpromenade der sogenannten »guten« Gesellschaft der Stadt. Und zwar ist es wirklich die gute Gesellschaft, und nicht wie etwa in Berlin auf der Friedrichstraße oder auf dem Newski in Petersburg die jeunesse (und vieillesse) dorée nebst der dazugehörigen Demimonde. Auch das wird einem anfangs schwer zu glauben. Der einzige Unterschied zwischen der halben und der ganzen Welt hier ist der, daß die erstere im Aussehen ehrbarer und im Benehmen distinguierter ist, denn sie stammt meistens wirklich aus Paris. Diese Abendpromenade der chilenischen Gesellschaft ist, wenn man die Sache beim rechten Namen nennt, eigentlich nichts anderes, als ein ordinärer Heiratsmarkt. Nur gibt sich jedermann den Anschein, als merke er nichts davon. Mütter stellen ihre unmündigen Töchter und mündige Jungfrauen und Frauen stellen sich selbst zur Schau. Zu diesem Zwecke staffiert man sich nicht nur mit unerhörten Toilettenkünsten heraus, sondern läßt auch alle Mittel – und nicht einmal nur die geheimen – der Kosmetik springen. Jedes weibliche Wesen in Chile, das sich zur Abendpromenade begibt, schminkt sich oder wird geschminkt – ganz egal ob es zwölf oder vierzig Jahre zählt. Auch das ist ein Beispiel für das Mißverstehen europäischer »Kulturerrungenschaften«. Nach unseren Begriffen sehen diese bemalten Kindergesichter, die all ihren natürlichen Liebreiz verlieren, abschreckend, ja ekelerregend aus. Der Chilenin erleichtert diese Sitte die Konkurrenz, denn auf diese Weise haben sie alle mehr oder weniger das gleiche Aussehen. Und dann resultiert daraus ein wundervolles taktisches Prinzip: die Chilenin macht einfach so, als ob sie schön wäre und benimmt sich so. Darin liegt vielleicht das Geheimnis ihrer Reize für den geschmacksunsicheren chilenischen Jüngling. Die Toiletten und Hüte, die bei dieser abendlichen Promenade zur Schau getragen werden, sind von exquisitem Luxus. Man sieht ihnen die Pariser Herkunft unschwer an. Leider fehlt den chilenischen Frauen nur das, was man »portée« nennt. Sie erwecken oft den Eindruck wandelnder Kleiderstöcke. Einer anderen, als der Augensprache dürfen sich die Angehörigen verschiedenen Geschlechts nicht bedienen. Von der allerdings wird ausgiebiger Gebrauch gemacht. Sonst verbietet der sittenstrenge gesellschaftliche Kodex jeden Verkehr. Männlein und Weiblein wandeln in säuberlich getrennten Gruppen, und wehe dem, der einen Annäherungsversuch macht. Unwillkürlich denkt man an die Sonntagspromenaden der Mädchen und Burschen in den russischen Dörfern. Es muß ein geheimnisvoller Zusammenhang zwischen dem allgemeinen Kulturniveau und der Freiheit des gesellschaftlichen Verkehrs zwischen beiden Geschlechtern bestehen.
Der europäische Begriff der Geselligkeit scheint hier überhaupt in seinen gewöhnlichsten Formen unbekannt zu sein. Man vergleiche z. B. das muntere ungezwungene Leben, das in einem beliebigen europäischen Badeorte herrscht, mit dem, was man in dem fashionablen chilenischen Seebade Vina del Mar sieht. Dieser Badeort zeichnet sich schon dadurch vor allen übrigen aus, daß kein Mensch dort badet. Außer einigen Kindern, meistens Straßenjungen, geht niemand ins Wasser. Das Meer wird höchstens als Schauspiel genossen, und auch das mit Maß. In Vina del Mar wohnt während der Sommermonate die gesamte vornehme Welt Chiles und jeder, der gern dazu gehören möchte. Das Badeleben beschränkt sich darauf, daß man zweimal täglich in seiner blankgeputzten Equipage spazierenfährt, das heißt was man so spazierenfahren nennt. In langen Reihen bewegen sich die eleganten Wagen die staubigen Straßen des Städtchens entlang. Oft bleiben sie stehen, doch nicht um den Insassen Gelegenheit zu einem Spaziergange zu geben. Das wäre der kostbaren Toiletten und fabelhaften Hüte wegen schon nicht zu empfehlen. Die Herrschaften bleiben in den Wagenpolstern ruhen, und die Equipage hält nur, damit die Insassen bequemer lorgnettieren und sich lorgnettieren lassen können. Und der wundervolle Strand mit seinem schneeweißen Dünensande, der endlos sich dehnenden glänzenden Fläche des stillen Ozeans und den verführerisch schäumenden Flutwellen bleibt um jede Tageszeit gleich leer – ein Tummelplatz für die lustige Straßenjugend, die es nicht nötig hat, auf alle Fälle »fein« zu sein. Dieses Feinseinwollen à tout prix ist das Unglück der Chilenen, es unterbindet jedes Vergnügen und ist auch der alleinige Grund ihres absurden, tödlich langweiligen Badelebens. Niemand wagt es, an den Strand zu gehen, denn man muß täglich und womöglich stündlich zeigen, daß man eine Equipage besitzt und sich einen Kutscher in Livree mit weißen Lackstiefeln leisten kann. Da der Strand von niemandem besucht wird, braucht man ihn natürlich auch nicht zu pflegen. Badeeinrichtungen sind nur in so primitiver Form vorhanden, daß in dieser Hinsicht das letzte Fischerdorf der Ostsee ein Ausbund von Luxus dagegen ist. Vor fünf Monaten ist am Strande von Vina del Mar ein großer chilenischer Passagierdampfer gescheitert. Die Trümmer liegen noch überall herum. Als ich eines Tages daran vorüberwanderte, erfolgte plötzlich ein fürchterlicher Knall, und das Wrack spie einen Regen von Holz- und Eisensplittern aus, die mir um die Ohren flogen. Der Schiffsrumpf wurde mit Dynamit auseinandergesprengt, wie sich herausstellte. Da jedoch nie ein Mensch sich am Strande zeigt, hielt man es nicht einmal für nötig, irgend welche Vorsichtsmaßregeln, etwa in Gestalt von Warnungstafeln, anzubringen. Fünfhundert Schritte weiter hat man die städtischen Abfallgruben, die einen bestialischen Gestank verbreiten. Räudige Hunde suchen dort ihre spärliche Nahrung unter halbverfaulten Maisstrünken und Melonenschalen, alte zerlumpte Bettelweiber sammeln zerbeulte Sardinenbüchsen auf, die von der Flut angespült werden.
Und dies alles geht an einer Stelle vor sich, die wie geschaffen dazu wäre, damit sich dort das herrlichste ungebundenste Strandleben mit all seinen Reizen und Freuden entwickeln könnte! O ob der Kurzsichtigkeit des Nachahmungstriebes!
Fehlt Vina del Mar somit der eigentliche Sinn des Badelebens, so ist der Unsinn, in seinen »chicken« Formen natürlich reichlich vertreten. Dazu rechne ich, außer dem erwähnten Toilettenluxus, das krampfhaft gesteigerte Interesse für Rennsport mit all seinen Ausgeburten. Der Turf frißt hier nicht weniger Existenzen auf als anderswo. Sportlich stehen die Rennen, mit geringen Ausnahmen, auf keiner sehr hohen Stufe, um so glänzender blüht dagegen das Totalisator-Geschäft. Betritt man den Paddok und schaut sich die chilenische Rennwelt an, so erlebt man manche Überraschung. Vor allem die, daß die Jockeys in ihren bunten Jacken meist Knaben von 12-18 Jahren sind. Zu einem Rennen sah ich einen Knirps von höchstens 10 Jahren hinausreiten, seine winzigen Händchen umspannten kaum die Zügel. Vom »Sport« kann unter solchen Umständen wohl kaum die Rede sein. Die jugendliche Jockey-Gesellschaft muß die Pferde von vornherein durchgehen lassen, und jeder sorgt nur dafür, daß er im Sattel bleibt, sonst wird weiter keine Reitkunst angewandt. Nur zu den hochdotierten Rennen (z. B. im Preise von Vina del Mar, 25.000 Pesos) erscheinen etwas ernsthaftere Leute am Start, und man sieht sportlich hervorragendere Leistungen. Gerade das erwähnte Rennen wurde vorzüglich geritten, oder vielleicht schien es nur so nach der naiven Karriere-Wurstelei der Jockey-Säuglinge. Amüsant ist es, wenn ein edles Vollblut auf eigenes Risiko vor dem Startzeichen das Rennen beginnt und die Bahn durchrast, ohne daß der Reiter die Möglichkeit hat, es vor Ende der Strecke zum Stehen zu bringen. Die übrigen Pferde warten, bis der Durchgänger zum zweiten Mal – meist unter frenetischem Applaus des Publikums – die Startlinie passiert und nehmen dann das Rennen auf. Wie lustig dabei die Kombinationen am Totalisator sind, läßt sich denken, beinahe so lustig, wie das Bild des Rennens. – Freilich nicht für Jedermann.
Auf der südlichen Halbkugel muß man sich an die verkehrte klimatische Rechnung gewöhnen, daß es um so heißer wird, je höher man nordwärts kommt. Aus dem Herbst in Süd-Chile war ich in den Sommer von Valparaiso geraten, nun ging es in den Norden den Tropen zu. Der Dampfer »Thuringia« der deutschen Kosmos-Gesellschaft nahm uns auf, um uns bis Antofogasta zu bringen. Er war dabei so menschenfreundlich, nie weiter, als 4-5 Kilometer vom Ufer zu fahren, so daß man während zweieinhalb Tagen stets das schönste Gebirgspanorama vor Augen hatte. Die Kordillere zieht sich hier in ziemlicher Höhe bis dicht ans Gestade des Ozeans heran. Die Landschaft ist einförmig, aber dennoch immer reizvoll. Es ist kaum glaublich, welch eine Unmenge von verschiedenen, immer zarten und weichen Farbentönen diese mit grauem Sand und rötlich-braunem Gestein bedeckte Gebirgskette annehmen kann. An sich ist sie das ödeste, was es überhaupt gibt. Stein und Sand, Sand und Stein, nicht die leiseste Spur von vegetativem oder organischen Leben. Aber aus der Ferne im wechselnden Licht der Sonne, oder gar bei Mondschein, nimmt sich das alles aus wie ein Zauberland. In weich opalisierendem Glanz heben sich die schönen und ausdrucksvollen Konturen des Gebirgszuges vom leuchtenden blauen Himmel ab. In den Tälern und Klüften lagern dunkle violette Schatten. Das ganze Bild hat etwas Unirdisches – ein Eindruck, der sich noch verstärkt, wenn bei aufgehendem Mond die Farben ins Bläulich-Silbergraue zu spielen beginnen.
Wenn man dieses lockend und verführerisch scheinende Land betritt, gibt es freilich eine arge Enttäuschung. Antofogasta ist ein grauenhaftes kleines Nest, wichtig nur als außerordentlich gut geschützter Handelshafen und als Zentrum des chilenischen Salpeterexportes. Sonst bietet es nichts, außer einem lärmenden Anlegeplatz mit Dampfkrähnen, die nach allen Richtungen in die sonnendurchglühte Luft starren, prustenden Lokomotiven, schreienden »lancheros«, die heftig gestikulierend ihre Boote anpreisen, staubigen ungepflasterten Straßen, kümmerlichen häßlichen Bauten und einem steinigen Strand, der hier, wie überall in Chile, in eine übelriechende Kloake verwandelt ist.
Aber der Salpeter, der Salpeter – der ist wichtig genug, um Antofogasta unter allen Städten der Republik einen höchst bemerkenswerten Platz einzuräumen. Der Salpeter ist der eigentliche Lebensnerv der chilenischen Wirtschaftspolitik. In der Geschichte des Landes hat er eine hervorragende Rolle gespielt. Er war es, der den casus belli im letzten »Kriege« zwischen Chile und Bolivien abgab. Die Geschichte dieses Krieges ist überaus charakteristisch für die südamerikanischen Verhältnisse und wohl wert, erzählt zu werden.
Die ergiebigsten und umfangreichsten Salpeterfelder liegen in der Hochebene der Kordillere, die Chile von Bolivien trennt. Antofogasta war ein bolivianischer Hafen, Chile hat seine Rechte darauf dem Nachbarstaate abgetreten unter der Bedingung, daß Bolivien nie eine Ausfuhrsteuer auf Salpeter erheben würde. Ein Weilchen ging alles höchst vorzüglich. Bolivien hatte seinen Hafen, und Chile exploitierte ungeschoren seine Salpeterfelder. Aber nicht lange vermochte Bolivien, dem mit fabelhafter Leichtigkeit gewonnenen Wohlstande des Nachbars zuzuschauen. Es brach den Vertrag und belegte ein Quintal (ca. 36 kg) Salpeter mit der allerdings sehr bescheidenen Steuer von 10 Centavos. Da hatte es aber die Rechnung ohne den Wirt gemacht. Denn der Wirt der Companie de Selitres de Antofogasta war niemand anderes als die chilenische Regierung, da sich die Hauptaktien dieser Gold- d. h. Salpeterfelder natürlich in Händen chilenischer Minister befanden. Als Antwort auf sein schönes Steuerprojekt erhielt Bolivien von Chile ein militärisches Ultimatum. Die bolivianische Regierung darauf, auch nicht faul, erließ den Befehl, die Salpeterwerke zu versteigern, um auf diese Weise zu der Steuer zu gelangen. Nun setzte Chile 500 Soldaten auf ein Kriegsschiff und schickte diese gewaltige Heeresmacht nach Antofogasta. Darauf war Bolivien nicht vorbereitet. So wurde denn Antofogasta mit viel Kriegsgeschrei, aber ohne Blutverlust »erobert«. Das war nicht schwer, denn die Einwohnerschaft der Stadt bestand zu zwei Dritteln aus Chilenen, zu einem Drittel aus Ausländern, und der einzige Bolivianer – der Präfekt – hielt es für ratsam, keinen Widerstand zu leisten. Damit war der Krieg zu Ende. Jetzt hat Chile seine Salpeterfelder und den Hafen Antofogasta, Bolivien dagegen nichts, als das – Nachsehen.
Es bedarf von Antofogasta aus einer sechsstündigen Eisenbahnfahrt, um die chilenischen Salpeterfelder zu erreichen. Selbst wenn man sich für Salpeter nicht besonders interessiert, wird man diese Strapaze nicht bereuen. Denn eine Strapaze ist es. Unter den sengenden Strahlen der Tropensonne schleicht der Zug bergaufwärts. Die chilenischen Waggons erster Klasse ähneln in der Konstruktion den Trambahnwagen mit quer gestellten Bänken. Wirklich bequem kann man sich auf keine Weise hinsetzen, besonders wenn man lange Beine hat.
Ringsum – eine Wüste, eine regelrechte Wüste. Über dem grau-gelben Sande vibriert die glühende Luft im Sonnenglast. Hin und wieder unterbricht ein erbärmliches Stationsgebäude aus Zinkblech die einförmige Öde. Zu essen gibt es nichts außer einem scheußlichen chilenischen Nationalgericht, den sogenannten »empanadas«, einer Art Pastetchen, deren undefinierbare Farce hauptsächlich aus süßen Zwiebeln, Safran, Weintrauben, irgend etwas Fleischähnlichem und unmenschlich viel Pfeffer besteht. – Allmählich beginnt der Wüstensand weißlich zu schimmern. Der Salpeter naht! Auf einer der nächsten Stationen hieß es »aussteigen!« Die Officina »Annibal Pinto« war erreicht.
Ich hatte schon vielfach die chilenische Gastfreundschaft rühmen hören, bis dahin jedoch keine Gelegenheit gehabt, sie selbst zu erproben. Hinter der Wirklichkeit blieben alle hochgespannten Erwartungen weit, weit zurück. Auf der Station empfingen uns – wir waren telephonisch angemeldet – drei Mitglieder der Betriebsleitung. Einer bemächtigte sich meines Reisekameraden, ein anderer meiner, der dritte unseres Koffers, und von dem Augenblicke an waren wir der Gegenstand so ausgesuchter bezaubernder Liebenswürdigkeit, wie wir sie bis dahin nicht erlebt hatten, obgleich man in dieser Beziehung als Tourist in Südamerika, besonders seitens der Deutschen, nicht wenig verwöhnt wird. Als Nachtquartier wurde uns die ganz luxuriös eingerichtete Wohnung des Generaldirektors, der gerade Europaurlaub hat, angewiesen; die exquisiten Diners und Dejeuners, herrliches eisgekühltes Bier, kostbare chilenische und französische Weine, die fabelhaftesten »drinks« und »cocktails« in allen Farben spielend, von goldbraun bis rosarot, wie die Berge der Kordillere, – alles das erweckte den Anschein, das man sich zum mindesten im Plaza-Hotel von Buenos Aires befände. Die ans Märchenhafte grenzenden Revenuen der Salpeterwerke erlauben es, hier oben in der Wüste einen Luxus zu treiben, wie er sonst auf tausend Meilen im Umkreise, weder in Chile noch in Bolivien, zu finden ist.
Einige von den mir bereitwilligst zur Verfügung gestellten Zahlen mögen das Gesagte erläutern. Das Aktienkapital, mit dem die fünf »Officinas«, d. h. Betriebe der Gesellschaft gegründet wurden, beläuft sich auf 16 Millionen. Schon im ersten Betriebsjahre wurde dieses Anlagekapital getilgt, da der Reingewinn 18 Millionen (!) betrug. Und auch jetzt noch, obgleich der Betrieb stetig vergrößert wird, tragen die Aktien eine Dividende von 100-120 Prozent. Natürlich sind nicht alle Salpetergesellschaften so glänzend gestellt, wie die, deren Gäste wir waren, doch ist der Salpeter unter allen Umständen das lukrativste Geschäft in Chile. Auch für den Staat, der jetzt den Salpeterbetrieb selbst besteuert hat und daran ca. 180 Millionen Pesos (1 Peso ist mehr als ein Franc und nicht ganz eine Mark) gewinnt. Wie wichtig dem Staate die Salpeterindustrie ist, erhellt aus dem Umstande, daß der chilenische Senat einen Preis von zehn Millionen Pesos ausgesetzt hat für rationelle Verwertung der Salpeterüberbleibsel. Die »Compania de Selitres« verdankt ihre kolossale Rentabilität der wahrhaft ingeniösen Betriebsanlage ihres Hauptingenieurs Senor Louis B., der während der Besichtigung unseren liebenswürdigen Führer abgab. Trotz der enormen Salpeterproduktion (5000 Quintals aus 45 000 Quintals salpeterhaltiger Erde täglich), beschäftigt der Betrieb nur 1200 Arbeiter, die nebenbei gesagt, auch ihre 8-13 Pesos täglich verdienen.
Wie wird der Salpeter gewonnen? Nichts einfacher als das: man hat ihn nur zu nehmen, er liegt ja überall herum, der ganze Boden kilometerweit im Umkreise ist weiß davon. Das erste Stadium der Salpetergewinnung scheint trotzdem das schwierigste zu sein, denn nur dort sieht man arbeiten, alles weitere vollzieht sich ganz von selbst. Ein halbstündiger Ritt führte uns in die »Pampa« hinaus, wo wir die »calicha«, d. h. salpeterhaltige Erde im Urzustande sahen. Links und rechts um uns stiegen von Zeit zu Zeit mächtige Rauchsäulen in die Luft, ein dumpfer Knall verriet sie, auch wenn man ihnen den Rücken zukehrte – die calicha wird mit Dynamit auseinandergesprengt, um leichter geschaufelt werden zu können. Riesige von Maultier-Troikas gezogene Wagen bringen die Erde zum Schienenstrange, auf kleinen »carretos« wird sie zu Zerkeinerungsmühlen gebracht, von dort geht es weiter zu den Kesseln, in denen die Erde mit jodhaltigem Wasser gekocht wird. Die Erde bleibt in den Kesseln zurück, von wo sie von fast ganz nackten Arbeitern bei einer Temperatur von 50-75° herausgeschaufelt wird, die salpeterhaltige Lösung fließt in ein ganzes Arsenal voluminöser Reservoirs ab, wo sich der Salpeter an der freien Luft kristallisiert. Dann wird das gelbliche Wasser wieder abgeleitet, und in den Reservoirs liegt meterhoch schneeweißer reiner Salpeter. An Ort und Stelle wird er in Säcke verpackt, auf Plattformen verladen, an die Station, von dort nach Antofogasta gefahren und am Anlegeplatz der Compania in die mächtigen Bäuche der Europadampfer verstaut. Und an seiner Stelle strömt das Gold in die Kasse der Compania zurück. Der Prozeß ist, wie man sieht, höchst einfach.
Einen wundervollen, mystisch geheimnisvollen Anblick gewähren die »Officinas« bei Nacht im Lichte der unzähligen elektrischen Lampen (denn hier wird Tag und Nacht schichtweise gearbeitet). Der ganze Horizont dieser bei Tage unendlich öden Wüste belebt sich. Eine Kette roter leuchtender Sterne scheint ihn einzusäumen. Im Mondlicht (das hier nie zu fehlen scheint) zeichnen sich die gespenstischen, phantastischen Konturen der Fabrikgebäude ab, die wie riesige Gerippe in den Nachthimmel ragen. Dieses Bildes konnte man nicht müde werden, obgleich unsere liebenswürdigen Führer zum letzten »drink«, auf den noch ein allerletzter folgte, drängten. Als ich um Mitternacht endlich im Himmelbette des Generaldirektors lag, kam es mir erst zum Bewußtsein, daß ich zehn Stunden lang ununterbrochen Spanisch geredet hatte, wenigstens mußte ich es geredet haben, denn außer diesem Idiom war auf der Officina kein anderes bekannt. Sonderbar. Bis jetzt glaubte ich kein Spanisch zu verstehen. Man erfährt auf Reisen die merkwürdigsten Dinge. Jedenfalls kommt mir noch heute die Geschichte von meinem Spanisch höchst – spanisch vor.
Wenn man auf die Karte von Südamerika blickt, scheint Bolivien das Stiefkind unter den südamerikanischen Republiken zu sein. Ohne Zugang zum Meere liegt es eingeschlossen zwischen den unwegsamen Einöden der Küstenkordillere und den Schreckensgebieten des Gran Chaco, die auf den besten Karten noch weiß, weil »unexplored«, sind, wo wilde Indianer hausen, die, wie man hier mit Sicherheit behauptet, zum Teil noch Menschenfresser sein sollen, und über die überhaupt die abenteuerlichsten Gerüchte zirkulieren von vergifteten Pfeilen und ähnlichen für reisende Europäer wenig erheiternden Scherzartikeln.
Auf den Reisenden, der von der Küste des Stillen Ozeans her ins Land hereinfährt, macht Bolivien anfangs einen trostlosen Eindruck. Man kann nichts ahnen von den Reichtümern und Herrlichkeiten, die das Land birgt und die seinen Einwohnern unter allen Umständen eine höchst angenehme Existenz sichern, obgleich sie von aller Welt abgeschnitten zu sein scheinen.
Vierzig Stunden lang klettert der Eisenbahnzug von Antofogasta aus in die bolivianische Hochebene hinauf. Der Laie bemerkt an der Wüste von Gestein und Geröll, die ihn umgibt, nichts Außergewöhnliches, außer der bunten Färbung der Berge, ihren zum Teil pittoresken Formen. Sie sehen so aus, als hätte der liebe Gott sie anmalen wollen und aus Versehen seinen Farbenkasten umgeworfen. Rote, blaue, gelbe, grüne, violette Klexe überall. Noch sieht man stellenweise den schlanken Kegel irgend eines Vulkans rauchen, von ferne her grüßen die Schneekoppen der Hauptkordillere.
Für den Geologen dagegen ist das ganze Gebiet, das man durchfährt, eine Quelle ununterbrochenen Entzückens. Zuerst geht es durch die Salpeterfelder mit ihrer weißlich schimmernden »caliche«; dann durchquert die Bahn das Becken prähistorischer Gebirgsseen, die aussehen, als seien sie mit Zucker bestreut. Es ist reiner Borax, der einer englischen Kompanie, die diese Felder ausbeutet, hübsche Sümmchen jährlich abwirft. Sieht man den Schnee gelb schimmern, so weiß man, daß dahinter reiche Schwefelgruben stecken, und von den Zinn- und Silberminen, die ihren Besitzern fabelhafte Reichtümer einbringen, von den merkwürdigen Schichten, in denen das kostbare Wolfram-Metall gefunden wird, läßt man sich von gesprächigen Mitreisenden Wunderdinge berichten. Staunend hört man die Erzählungen über Silberminen, die durch unrationellen Betrieb dahingebracht werden, daß das Grundwasser sie rettungslos zerstört. Die Arbeiter hämmern, bis an die Brust im Wasser stehend, das kostbare Erz los, bis das steigende Wasser sie oder die Mine ersäuft. Hier herrscht ja überall fast noch reiner Handbetrieb. Große Maschinen lassen sich in die fabelhaften Höhen, in denen das Erz lagert, nicht hinauf bringen. Versucht man es, so kann es einem gehen, wie einer englischen Gesellschaft im tropischen Goldgebiete Boliviens. Sie machte eine Maschinen-Anlage für Goldwäschereien am Benifluß, die Millionen und Abermillionen kostete und nicht betrieben werden kann, weil alle wirtschaftlichen Vorbedingungen dazu fehlen. Und die englischen Ingenieure mit dem verpulverten Kapital müssen dasitzen und zusehen, wie irgend ein alter Inländer gegenüber am Fluß sozusagen mit einem Tellerchen seine 500 Pesos Gold monatlich aus dem Beni herauswäscht, während ihre kostbare Patentbaggermaschine hoffnungslos versandet.
Sitzt man im Eisenbahnzuge Antofogasta–Oruro, so merkt man von Stunde zu Stunde mehr, daß Höhengrade erreicht werden, für die unsere europäischen Lungen ganz und gar nicht eingerichtet sind. Ohrensausen, Kopfschmerzen, die ersten Anzeichen der Bergkrankheit stellen sich mit tödlicher Sicherheit ein. Ein Gang aus dem Pullman-Car in den Speisewagen raubt einem nicht nur den letzten Rest von Atem, sondern leider auch den Appetit. Oruro liegt 4000 Meter hoch. Das schreibt sich leichter hin, als es sich ertragen läßt. Nur langsam gewöhnt man sich daran und an die damit verknüpften verrückten klimatischen Verhältnisse, tagsüber brennt einem die Tropensonne senkrecht auf den Kopf, abends wird es schneidend kalt, und kein Überzieher ist dick genug gegen die dünne Luft. Dann greifen alle Einwohner der Stadt zu einem auch anderwärts bekannten Remedium gegen Kälte – dem Alkohol. Wenn die Sonne untergeht, findet man in den Bars an der Plaza kein Plätzchen mehr. Die gesamte männliche Einwohnerschaft Oruros versammelt sich dort, um dem Körper vermittelst unzählbarer Cocktails die nötige Wärmemenge zuzuführen. Und die ganze Plaza wiederhallt vom Klappern der Würfel, mit denen an allen Tischen diese Cocktails ausgespielt werden. So ohne weiteres bezahlt nämlich in Bolivien niemand sein Getränk. Jedermann würfelt mit 5-10 Gesinnungsgenossen die »Runden« aus. Und wenn man Pech hat, kann man vor dem Essen seine 15-20 Pesos in Cocktails anlegen.
Äußerlich bietet Oruro gleich den meisten anderen bolivianischen Städten ein merkwürdiges Bild. Anzeichen altspanischer Kultur vermengen sich mit moderner Physiognomielosigkeit, ein gewisser behäbiger Wohlstand mit primitiver Armut. Neben würdevollen Ziegelbauten in maurischem Stil stehen elende strohgedeckte Lehmhütten. An den Haustüren sind überall noch die guten alten Türklopfer zu sehen, davor strahlen abends elektrische Bogenlampen. Über die zum größten Teil ungepflasterten Straßen poltern vorsintflutliche Riesendroschken mit Maultieren bespannt und halten vor den Portalen hellerleuchteter Kinematographen-Theater. Die Bevölkerung besteht hauptsächlich aus Indianern und Angehörigen der Mischrasse, die wenigen Europäer sind Angestellte der ausländischen Banken und größeren Handelshäuser.
Die bolivianischen Indianer sind als Menschenschlag nicht häßlich. Jedenfalls sind sie Schönheiten im Vergleich zu den chilenischen Mapuches, an deren schlitzäugig-mongolischem Aussehen, wie man sagt, ein in unvordenklichen Zeiten gestrandetes Schiff mit chinesischer Bemannung Schuld sein soll. Dieser mongolische Typus fehlt unter den bolivianischen Indianern vollständig, sie haben runde Gesichter mit weichen Zügen. Zu der kupferbraunen Haut und den kohlschwarzen Haaren sehen die grellbunten Ponchos, die allen ausnahmslos über die Schultern hängen, famos aus. Dank der farbenfrohen Kleidung der Indianer ist das Straßenbild in den bolivianischen Städten außerordentlich belebt. Männer und Weiber wetteifern in der Auswahl der leuchtendsten Farben für ihre Ponchos respektive Kleiderröcke. Sieht man sich dieses Giftgrün, Knallgelb, Feuerrot in der Nähe an, so tun einem die Augen weh. Eine der schönsten und beliebtesten Farben ist ein sattes, ziemlich helles Violett. Der übrige Anzug besteht bei den Männern aus ebenso bunten gestrickten Zipfelmützen, auf denen außerdem ein weißer Filzhut aus dem Stoff der Bajazzomützen sitzt, und Hosen, die unten bis zur halben Wade geschlitzt sind und in zwei Bahnen am Fuß herabhängen. Diese merkwürdige Fasson erklärt sich durch die Notwendigkeit, die Hosen jeden Augenblick aufkrempeln zu müssen, nämlich bei den Übergängen über die Flüsse und reißenden Bäche, von denen Weg und Steg im Gebirge durchkreuzt sind, und von denen auch ich bald ein Lied singen lernen sollte. Die Frauen sehen von den Hüften abwärts alle wie verkappte Ballerinen aus. Sie tragen eine Unzahl Röcke, ziehen immer einen über den anderen und nie einen aus, wird der oberste schlecht, so wird er durch einen neuen nur verdeckt, nicht ersetzt. Das ist weder appetitlich noch hygienisch, dafür aber bei dem hiesigen Klima zweckmäßig, weil wärmend. Auf dem Kopfe sitzt den Weibern ein hellgelber, kesselförmiger Strohhut, darunter hängen immer zwei wundervolle, festgeflochtene schwarze Zöpfe hervor. Das ganze Ensemble sieht aberwitzig aus, besonders bei den Cholofrauen, d. h. Mischlingen, die als Rasseabzeichen hohe Schnürstiefel mit spitzigen hohen Hacken unter den halblangen Röcken tragen. Vollblut-Indianer und Indianerinnen gehen immer barfuß.
»Sehenswürdigkeiten« im europäischen Sinne bietet keine der bolivianischen Städte. Sie sind selbst in ihrer Eigenart sehenswürdig genug. La Paz, die Hauptstadt des Landes, Sitz der Regierung und des Präsidenten, hat genau denselben Charakter wie Oruro. Das Klima ist besser, denn La Paz liegt »nur« 3600 Meter hoch. Übrigens ist die Lage der Stadt vom malerischen Standpunkt aus wundervoll. Tiefeingeschlossen in einem Talkessel, umrahmt von pittoresken Felsblöcken liegen die Häuser da, geordnet in winkelige Straßen, die mitunter unglaublich steil bergauf und bergab führen. Sogar für die »Plaza« hat man keine wagerechte Ebene finden können. So sieht dieser schräg abfallende Platz aus, als sei er eben durch ein Erdbeben aus dem Gleichgewicht gebracht. Keines der Gebäude, das ihn umgibt, hat eine gerade Fassade. Auch schimmert in La Paz hin und wieder das Grün schöner Platanen zwischen den Häusern, während Oruro kahl wie ein Greisenschädel ist. Das Schönste in La Paz aber ist der »Illimani«, der Riese der bolivianischen Kordillere, dessen leuchtend weißes Haupt sich 7500 Meter hoch in den azurblauen Tropenhimmel erhebt.
Der Zugang zur Stadt ist erst seit einigen Jahren erleichtert worden durch eine elektrische Bahn (ich glaube, die einzige in ganz Bolivien), die 400 Meter herab vom sogenannten »Alto« zur Stadt hinunter führt. Als ich die schwindelnden Kurven dieser Bahn hinabfuhr, fiel mir eine ergötzliche Geschichte ein, die mir ein bolivianischer Parlamentarier auf dem Dampfer zwischen Valparaiso und Antofogasta erzählt hatte. Vor nicht allzulanger Zeit machte sich der englische Ministerresident in La Paz höchst unbeliebt. Als sein Treiben den Bolivianern zu bunt wurde, entledigten sie sich seiner auf eine sehr drastische Weise. Sie setzten ihn rückwärts auf einen Esel, gaben ihm den Schwanz in die Hand und führten ihn so zur Stadt hinaus zum Alto hinauf. England schnaubte Rache, doch was sollte man mit dem kleinen vorwitzigen Bolivien machen, dem zu einer Flottendemonstration, die England so liebt, die Meere fehlen! Da nahm man in London die Karte Südamerikas zur Hand, strich Bolivien einfach aus und schrieb an seine Stelle das einzige aber vielsagende Wort »savage« hin. So die Überlieferung.
Ja, was soll man mit Bolivien machen, wenn es sich Dreistigkeiten herausnimmt, die anderswo nicht ungerochen bleiben würden. Strategisch ist das Land von allen Seiten her absolut unzugänglich. Darauf bauend hat die Regierung sich bis zur letzten Zeit auch wenig um militärischen Schutz gekümmert. Erst die traurige Geschichte vom Verluste Antofogastas, die ich im vorigen Briefe erzählte, hat diese Frage mehr in den Vordergrund des Interesses gerückt. Man gönnt Chile den Hafen nicht, und will ihn auf alle Fälle zurückerobern. Dazu braucht man aber Soldaten, die man bis vor kurzem in Bolivien nicht hatte. Da hat man endlich mit der Erziehung einer Armee begonnen. Zuerst wurde diese schwierige Aufgabe – gilt es doch hauptsächlich Indianer zu drillen, die ausnahmslos Analphabeten sind und außer ihren zungenbrechenden Idiomen »Aimara« und »Quechoa« keine Silbe verstehen – französischen Instruktoren anvertraut. Erst als damit gar nichts erreicht wurde, berief man nach dem Beispiel Chiles deutsche Offiziere. Diese haben in der bolivianischen Armee wahre Wunder zustande gebracht. Davon durfte ich mich selbst überzeugen. Auf die freundliche Einladung des Generalissimus der bolivianischen Armee, des preußischen Majors K., wohnten mein Reisekamerad und ich einer Manöverübung in Oruro bei. Die Übung war gleichzeitig Schlußprüfung für sogenannte Dreimonate-Rekruten, die nicht länger von ihrer Feldarbeit ferngegehalten werden sollen. Was diese Burschen auf allen Gebieten militärischen Drills leisteten, war tatsächlich erstaunlich. Die Exaktheit, mit der nicht nur Gewehrgriffe, sondern auch komplizierte Bewegungsmanöver ausgeführt wurden, hätten einem beliebigen europäischen Regiment zur Ehre gereicht. Famose Schützen sind die Indianer mit ihren sprichwörtlichen Adleraugen natürlich allesamt. Eine Aufmerksamkeit, die uns der liebenswürdige Oberkommandierende bei dieser Gelegenheit erwies, möchte ich noch erwähnen. Beim Flaggensignalisieren zwischen zwei Truppenteilen überreichte uns der leitende Offizier die erste signalisierte Parole. Sie lautete: »Boshe Zarja chrani«. Diese Worte – der Anfang der russischen Nationalhymne – mögen in der bolivianischen Hochebene inmitten rothäutiger Indianersoldaten zum ersten Male gehört worden sein.
In La Paz hatten wir später Gelegenheit, die bolivianische Kadettenschule zu besichtigen. Sie untersteht ebenfalls der Leitung eines deutschen Offiziers, des Hauptmanns M. Es ist eine Freude zu sehen, mit welcher Lust diese kräftigen braunen Jungen turnen, mit welch einem geradezu akrobatischen Geschick sie die schwierigsten Evolutionen an Reck und Barren ausführen. Diese Vorführungen fanden zu Ehren einiger chilenischer Minister statt, die in diplomatischer Mission in La Paz weilten. Als die Gesellschaft nachher bei einem Glase Champagner zusammensaß oder vielmehr stand – der erste Toast galt übrigens wieder dem russischen Zaren – passierte mir ein peinliches Mißverständnis, an das ich noch jetzt ungern zurückdenke. Ich unterhielt mich mit einem Herrn, der mir als S. Exzellenz der Herr Kriegsminister genannt worden war. In der sichern Annahme, es sei der chilenische, erging ich mich in Lobeshymnen über das chilenische Militär, das ich in Santiago und Valparaiso gesehen hatte. Das Gesicht meines Partners wurde dabei zu meinem Erstaunen immer länger, seine Miene immer saurer. Endlich unterbrach er meinen Redeschwall: »Sie mögen recht haben, aber warum sagen Sie gerade mir das?« Sprachs und drehte mir den Rücken. Es war der bolivianische Minister. Man muß das übertünchte Freundschaftsverhältnis beider Republiken kennen, um die Tragik dieser Anekdote zu verstehen.
La Paz, im Herzen Boliviens liegend, wird für uns der Ausgangspunkt einer sechswöchigen Tour in die Tropenebene das Landes. Man hält hier solch einen Ausflug für ein gewagtes Unternehmen. Wir wollen sehen, ob unsre Erlebnisse die Befürchtungen unsrer bolivianischen Freunde rechtfertigen werden.





Vom Anfang unserer Reise an war es beschlossene Sache einen Ausflug ins tropische Bolivien zu machen. Die einzige Frage, die uns Sorge machte, war die, von welcher Seite dieses Wunderland am besten zu erreichen sei. Der ursprüngliche Plan, von Argentinien aus durch den sogenannten »Gran Chaco« in die Urwälder Boliviens einzudringen, mußte aufgegeben werden, weil er in der Zeit, die uns zur Verfügung stand, nicht ausführbar war. Bei den hiesigen Verkehrsverhältnissen muß man sich daran gewöhnen, daß Wochen, ja Monate als »quantités négligeables« behandelt werden. Reisen werden durch die Jahreszeiten bestimmt, wenn überhaupt. Es heißt etwa: »wenn Sie jetzt losgehen, können Sie noch im Winter da und da anlangen«, ob das aber im Juni, Juli oder August sein wird, darüber wagt man keine Vermutungen. Anfangs hält man diese sehr unsicheren Zeitangaben für eine Folgeerscheinung von Denkfaulheit, Indolenz und jenes trägen »laisser aller, laisser passer«, an dem die Südamerikaner der lateinischen Rasse allerdings leiden. Hat man jedoch die Wege und Verkehrsverhältnisse im Innern des Kontinents aus eigener Anschauung kennen gelernt, so ist man geneigt, selbst diese primitiven Zeitbestimmungen für unbegreiflichen Leichtsinn zu halten.
Schneller als durch die argentinische Ebene ist das tropische Bolivien von der Küste aus zu erreichen, obgleich es hierbei gilt, den gewaltigen Höhenzug der Hauptkordillere zu übersteigen. Diesen Weg entschlossen auch wir uns zu nehmen. So wurde La Paz zum Ausgangspunkt unserer »Expedition«. Dieser Ausdruck klingt etwas laut und anmaßend, man sieht gleich ganze Herden bepackter Kamele und Lamas, Regimenter eingeborener Sklaven vor sich, denkt an blutige Kämpfe mit wilden Stämmen nackter Indianer, Tigerjagden und Riesenschlangen. Dieses Bild bot unsere Reise freilich nicht, obgleich sie für europäische Verhältnisse immerhin noch interessant genug verlief.
Als einzige ernste Gefahr, abgesehen von den Strapazen der Reise, wurde uns in La Paz warnend das überall im tropischen Bolivien herrschende Fieber vorgehalten. Davor glaubten wir jedoch durch eine rationelle Chinin-Prophylaxe ausreichend geschützt zu sein. Leider war dies nicht der Fall, denn bei unserer Rückkehr nach La Paz erkrankten doch zwei Mitglieder unserer Reisegesellschaft, glücklicherweise nur leicht, an einer Form des Tropenfiebers, der sogenannten Tertiana.
Neben der Beschwerlichkeit, überhaupt in jene Gegenden vorzudringen, ist das Fieber wohl der Hauptgrund, weshalb der mit allen Reichtümern der Natur gesegnete Landstrich des tropischen Boliviens verhältnismäßig so wenig Anziehungskraft auf den Unternehmungsgeist der Bevölkerung ausübt. Wer nicht unbedingt muß, steigt nicht in die Tropen hinunter, zumal er vorher beinah in den Himmel, nämlich auf den Rücken der Hauptkordillere hinaufsteigen muß. Von regelmäßigen Verkehrsverhältnissen zwischen dem in der Hochebene gelegenen und dem tropischen Teile Boliviens ist unter solchen Bedingungen natürlich keine Rede. Daher der hochtönende Name »Expedition« für jede Reise, die ins Innere des Landes führt.
Auf eigene Faust eine solche Expedition zu wagen, ist für einen mit den Landesverhältnissen nicht vertrauten Europäer nicht nur schwer, sondern einfach unmöglich. Auch uns wäre sie nicht gelungen, hätten nicht wieder einige Herren von der Deutschen Überseeischen Bank, der deutsche Konsul und Vizekonsul in La Paz, uns wenigstens im ideellen Sinne die Wege geebnet.
Die Reisegesellschaft bestand aus vier Personen. Von unserem Unternehmungsgeist angesteckt, schlossen sich zwei deutsche Herren dem Ausflüge an, der preußische Bergassessor W. und der allzeit liebenswürdige und lebenslustige Prokurist der Deutschen Bank in Valparaiso, Sch.
Am 5. April, 7 Uhr morgens, ging die Reise los. Ein kurzes Streckchen noch durften wir die Errungenschaften der Kultur genießen. Wenn man das genießen nennen kann. In einer »Elektrischen«, bei der der Fußboden aus den Stiefeln anderer Leute zu bestehen schien, und alles übrige aus Ellbogen und Knieen, ging es eine halbe Stunde hinauf durch die brauenden Morgennebel nach dem sogenannten »Alto« von La Paz. Es ist der Endpunkt der Eisenbahn, die nach La Paz führt, 400 Meter über der eigentlichen Stadt. Dort fanden wir unsere weiteren Fahrgelegenheiten vor. Unsere beiden Reisegefährten stiegen in eine »Diligence«, die einmal wöchentlich den Verkehr zwischen La Paz und dem zehn bis zwölf Stunden entfernt liegenden Städtchen Achecachi besorgt. Ich hatte es mir nicht gedacht, daß ich solch einen herrlichen alten Postwagen wirklich noch einmal leibhaftig vor mir sehen würde. Zwölf Menschen nahmen in ihm Platz, Säuglinge an der Mutter Brust, oder hier auch, nach der indianischen Sitte, auf der Mutter Rücken, ungerechnet. Auf hohem Bock thront ein Kutscher, in beiden Fäusten den Wirrwarr von Leinen, mit denen er seine sechs langgespannten Pferde lenkt. Der schöne Wagen ist einst rot gewesen, jetzt schon etwas verwittert und nicht ganz bestimmbar mehr in der Farbe: sein Aussehen leidet auch ein wenig durch das Chaos undefinierbarer Gepäckstücke, das sich auf dem Dache emportürmt. Für uns stand eine vorsichtigerweise bestellte Extrakutsche bereit. Die ist zwar zehn Mal teurer, dafür aber auch zwanzig Mal bequemer. Allerdings hat sie nur vier Pferde. Doch unseren Kutscher beseelte ein löblicher Ehrgeiz, der ihm dazu verhalf, das Wettrennen bis Achecachi richtig mit einer Wagenlänge zu gewinnen. Daß wir dabei einen Federbruch erlitten und die »Diligence« ein Rad verlor, beeinträchtigte den Spaß nur wenig.
Herrlich ist solch eine Wagenfahrt durch die bolivianische Hochebene! Die ganze »Puna« – so lautet der spanische Ausdruck für dieses Gebirgsflachland – ist von warmem Sonnenschein überflutet. Man genießt ihn in der ruhigen Zuversicht, daß es nie drückend heiß werden kann, denn das läßt die Höhe von 4200 Metern selbst in der tropischen Zone nicht zu. Solange die Wege gut und eben sind, werden die Pferde nicht geschont, meist geht es im Galopp, Troika-Stil. Bei den Flußübergängen – und ihrer sind zahllose – haben sie Zeit sich auszuruhen. Dann rumpelt der Wagen über das Geröll der breiten jetzt zu Anfang des Winters ausgetrockneten Flußbetten. Hin und wieder freilich gilt es, die Beine hochzuziehen, denn das Wasser überflutet doch zuweilen das Fußbrett des Wagens.
Die Landschaft bleibt sich den ganzen Tag über gleich und dennoch wird man nicht müde, sie anzusehen. Nach drei Seiten hin dehnt sich unübersehbar weit die Puna aus. Nur im Osten hat man die ganze Zeit den stolzen Zug der »Königskordillere« zur Seite. Mit Recht trägt dieser Teil des südamerikanischen Gebirges seinen Namen. Es sind wirklich zwei Könige der Gebirgswelt, der 7600 Meter hohe Llampu und der 7500 Meter hohe Illimani, die diesen Höhenzug im Süden und im Norden begrenzen. Zwischen ihnen recken in geschlossener Kette ihre zahllosen weißhäuptigen Trabanten, die zum größten Teil namenlos sind, ihre blitzenden Schneekronen in den tiefblauen Himmel hinein.
Viel Leben und Abwechslung freilich sucht man auf der »Puna« vergebens. Von Zeit zu Zeit begegnet man einem Trupp Indianern, die ihre mit nickenden Mais- und Weizenbüscheln beladenen Esel nach La Paz treiben. Lustig sieht es aus, daß auf jedem Esel ein Huhn, resp. ein Hahn als stolzer Reiter sitzt. Die Indianer nehmen auf diese Weise stets ihre ganze Hühnerzucht mit sich, um die frischen Eier für horrende Preise in der Stadt zu verkaufen.
In noch größeren Abständen passiert man eine und die andere indianische Ansiedlung. Elende aus Lehm zusammengeknetete Hütten. Auf vielen steckt als Zeichen der siegreichen katholischen Kirche, meistens schief, ein mit Bindfaden zusammengebundenes Kreuz aus zwei Holzstäbchen. Und dennoch verrät sich in diesen ärmlichen Behausungen und in den Lehmmauern, von denen sie umgeben sind, eine Art Stil. Es ist ein einheitlicher Zug in der kunstlosen Architektur, in den Mustern der groben Friese, mit denen die Mauern und die Simse der fensterlosen Hütten geschmückt sind. Eine dieser Mauern sahen wir übrigens im Vorüberfahren plötzlich lebendig werden. Es war eine Million riesengroßer Erdratten, die daran hinauf, herunter, hinein und herauskrabbelten. Für zarte Gemüter kein sehr erfreulicher Anblick. In seinem prächtigen Buche über die Chaco-Indianer behauptet Nordenskjöld, daß die Erdratte dort an einem Stäbchen schön gebacken als besondere Delikatesse bei Festessen gilt. Hier scheint das nicht der Fall zu sein, sonst könnten sich diese gräßlichen Tiere nicht in so erschreckender Weise vermehren.
Gegen Mittag wurde in einem dieser Indianerdörfer umgespannt. Die vier flinken Pferde machten ebenso vielen zwar weniger schnellen, dafür aber ausdauernden Maultieren Platz. Die Reisenden konnten sich unterdessen mit heißem Tee aus Thermosflaschen und einem kalten Hühnerbein stärken. Nach Überwindung einiger nicht bedeutender Steigungen, bekamen wir beim Örtchen Posadas zum ersten Mal den Titicaca-See zu Gesicht, und zwar gleich in nächster Nähe. Von der Ebene aus gesehen, hat er noch nicht die wundervolle intensiv indigoblaue Farbe, in der sein Wasserspiegel nachher ins Hochgebirge hin aufleuchtet. Doch gibt sein hier unten grünlich schimmerndes Wasser mit dem rosenroten Gestein der umgebenden Hügel, dem blauen Himmel und dem violetten Dunst, der das ganze Bild verschleiert, immer noch eine ganz unwahrscheinlich schöne Farbensymphonie ab.
Außer seiner Schönheit ist der Titicacasee durch seinen Wildreichtum berühmt. Für jedermann, der etwas Jägerblut in den Adern hat, ist das der Ort zum toll und rasend werden. Das sollte ich am eigenen Leibe erfahren. Mein Gewehr ruhte wohlverpackt in seinem Futteral, die dazu gehörigen Patronen steckten in den tiefen Gründen irgend eines Koffers. Trotzdem und trotz der Proteste des ehrgeizigen Kutschers, der sich durchaus nicht vom Postwagen überholen lassen wollte, wurde das ganze Schießzeug auf offener Straße in Bereitschaft gesetzt. Ich ließ Wagen Wagen sein und Kutscher Kutscher, zumal wir der »Diligence« um mindestens 5-6 Meilen voraus waren und stieg zum Uferschilf hinab, in und über dem ich es schwärzlich wimmeln sah. Das Resultat rechtfertigte diese Eskapade. In weniger als einer halben Stunde hatte ich eine Beute von 15 Wasservögeln von acht verschiedenen Sorten beisammen, darunter 5 Enten, einen prächtigen Reiher und das Staatsstück – einen schwarzen Adler. Allerdings muß ich meinen Jägerruhm durch die Bemerkung schmälern, daß die Vögel des Titicacasees augenscheinlich keine Ahnung davon haben, was eine Flinte und ein Jäger sind, denn ich habe keinen Schuß weiter als auf 20 Schritte abgegeben. Und von den Enten – herrliche fette Tiere mit schwarzem Gefieder und roten Schnäbeln, über deren Eßbarkeit die Gelehrten allerdings noch streiten – hätte ich ebenso leicht 50 statt 5 haben können, denn nach jedem Schuß setzten sie sich wieder friedlich im Kreise rings um mich herum. Nur dem Reiher mußte ich nachstellen, und zwar gelang mir das mit Hilfe eines Indianers, der nach dem ersten Schuß eiligst in seiner schwanken schmalen, aus Bast geflochtenen »Balza« durchs Uferschilf herangestakt kam. In wildem Jagdeifer vertraute ich mich ohne weiteres diesem seelenverkäuferischen Fahrzeuge an, kniete darauf nieder und ließ mich, kunstvoll balancierend, in den See hinaus rudern, was der Indianer hinter mir stehend, mit zwei Händen ein Ruder handhabend, außerordentlich geschickt besorgte. Fast hätte ich bei dieser Fahrt das Schießen vergessen. Unter mir das tiefe klare Wasser, dem man bis auf den Grund sehen konnte, von dem aus sich wunderbar geformte grünlich-blaue Wasserpflanzen emporrankten, zu beiden Seiten das hohe Schilf, das über unseren Köpfen zusammenschlug und darinnen ein Geschwirr von bunten Libellen, winzigen Vögeln, Käfern und allerhand zirpendem Getier. Eine liebliche Sommermittagstimmung! So recht geschaffen, um sich in dem schmalen Kahne auszustrecken und alles ringsumher zu vergessen ...
Der Kutscher empfing mich trotz der vielen schönen Vögel, die ich mitbrachte, mit Gebrumm. Einen Aufenthalt hatten wir wegen des erwähnten Federbruches schon gehabt und in der Ferne zeigte sich schon die »Diligence«. Die armen Maultiere mußten daran glauben. Mit Hott und Hüh ging es über Stock und Stein. Wenigstens kam man auf diese Weise schnell vorwärts. Fast gleichzeitig hielten beide Wagen vor dem Hotel in Achecachi. Nicht alles was so heißt, ist ein Hotel. Dieses war z. B. keines. Nicht einmal eine Herberge. Über einen dunklen Hof arbeiteten wir uns durch ein Gewirr von Maultierschnauzen zu einer baufälligen Treppe durch, die zum einzigen Fremdenzimmer dieses »Hotels« führte. Zerschlagen von der langen Wagenfahrt ließen wir die müden Glieder auf ein Kanapee fallen. Diese Unvorsichtigkeit war mit einigen blauen Flecken zu büßen. Trost brachte ein aus rotem Landwein artistisch gebrauter Grog. Es ist, wie ich erklärend beifügen muß, in dieser Höhe abends hundekalt.
Eine in einen Rahmen gespannte Tapete, eine Art Theaterdekoration, teilte das Fremdenzimmer des Hotels in Salon und Schlafgemach. Ein amüsanter Zufall wollte es, daß die Wand über meines Gefährten Bett ein Porträt des russischen Zaren schmückte. Ich ruhte unter dem sanften Blick Abdul-Hamids ebenso gut.


Wir waren in Achecachi in der Dunkelheit angekommen, konnten die Stadt also erst am nächsten Morgen in Augenschein nehmen, nachdem uns der achtjährige, einzige Kellner des »Hotels« prompt mit dem ersten Hahnenschrei geweckt hatte. Viel Zeit raubte diese Besichtigung der Stadt nicht. Es gibt in Achecachi ein einziges Gebäude, das wert ist, angesehen und photographiert zu werden. Das ist eine alte Kirche aus der Zeit, als die spanischen Jesuiten den freien Geist Boliviens unterjochten. Fast in allen bolivianischen Städten sieht man noch die festgefügten Baudenkmäler dieser finsteren Zeit. Sie sind ohne Zweifel das Beste, was die Jesuiten hierzulande zuwege gebracht haben. Doch haben sie sich dadurch bei der indianischen Bevölkerung keine größere Beliebtheit erworben, als anderswo. Für den Indianer ist der katholische Priester heutzutage noch ein Zauberer, der mit Zauberformeln, die niemand verstehen kann, Geburt, Ehe und Tod des Menschen »bespricht«. Heute noch halten die Indianer hartnäckig an ihrem Aberglauben fest, dem nach die Jesuiten in den Monaten nach der Ernte als Gespenster, eine Art Vampyre, nachtwandeln und den Indianern nicht etwa das Blut, sondern das Fett aussaugen. Daher stammen, nach Ansicht der Indianer, die, auch hier häufigen, Embonpoints der Geistlichkeit. Wehe dem unglücklichen Priester, der nachts im März oder April einem Indianer in den Weg läuft.
Von der nächsten Station, dem Städtchen Sorata, das zum eigentlichen Ausgangspunkte unseres Tropenausfluges werden sollte, waren uns Maultiere entgegengeschickt worden. Da wir einen achtstündigen Ritt vor uns hatten, mußten wir uns beeilen. Gleich wenn man aus Achecachi hinausreitet, öffnet sich ein wundervoller Blick auf den Llampu (in Geographiebüchern wird dieser indianische Name meist durch den spanischen »Sorata« ersetzt). In seiner ganzen Pracht liegt der Riese da. Die Kappe von blendendweißem jungfräulichen Schnee scheint sich bis zu der Höhe herabzuziehen, auf der wir uns befinden. Mit einer Deutlichkeit, als schaue man durch ein Zeissobjektiv, zeichnet sich jede Schneefalte der enormen Gletschergefilde vom blitzblauen Himmel ab. Noch ist seine einsame Höhe von keines Menschen Fuß entweiht worden. Weder der Illimani, noch der Llampu sind bestiegen. Es hat's kaum jemand versucht. Oder doch! Vor wenigen Jahren erschien in Begleitung zweier handfester, schweizer Bergführer eine gletschersüchtige Engländerin in Bolivien, um die beiden Herrscher der Kordillerenwelt zu bezwingen. Sie kam jedoch nicht weiter als bis zum ersten Schneesattel des Illimani, der aus unerfindlichen Gründen den Namen »Paris« trägt. Dieser Paris fand an der unternehmenden Britin keinen Gefallen. Er jagte sie mit allen Schrecken der Gletscherwelt, Schneestürmen, Bergkrankheit und Frost in die Flucht. Sie verschwand sang- und klangloser als sie gekommen war aus Bolivien, und ist vielleicht eben dabei ihren Spleen am Gaurisankar auszulassen.
Drei Stunden lang geht der Weg direkt auf den Llampu zu. Er führt, vollständig eben, über eine Art Damm, der im sumpfigen Ufergelände des Titicacasees aufgeworfen ist. Diese Straße ist außerordentlich belebt, da sie die Verbindung mit allen Indianerdörfern am jenseitigen Ufer des Titicacasees herstellt. Ununterbrochen begegnen uns Trupps eseltreibender Indianer. Die Frauen sind hier meist ganz dunkel gekleidet, bis an die Fußspitzen verhüllt. Aus den Rückentüchern hört man das Wimmern von Säuglingen. Um so bunter angetan sind die Männer. Ein Poncho in irgend einer Farbe, vor der die Augen weh tun, eine bunte gestrickte Schlafmütze, an der lange Ohrenklappen herabhängen, oft mit Perlen bestickt, darüber noch ein runder weißlichgelber Filzhut. Aus den geschlitzten Leinenhosen schauen ein paar kräftige, kupferrote Beine hervor. Man sieht hier besonders unter den jüngeren Indianern Gestalten von außerordentlicher Schönheit. Die Frauen laufen ausnahmslos zu Fuß, wenn jemand reitet, so ist es der Mann.
Wir hatten den ganzen Weg über, und später noch viel mehr, Gelegenheit uns zu überzeugen, wie unglaublich flinke und ausdauernde Läufer die Indianer sind. Obgleich wir stundenlang Trab ritten, blieb unser Führer, ein Vollblut-Indianer, der sogar kein Wort spanisch sprach, nicht um einen Meter hinter uns zurück. Eine willkommene Abwechslung waren die uns häufig begegnenden Lamatrupps. Ich kenne kein komischeres Tier, als dieses »aristokratischste der Lasttiere«, wie es ein französischer Schriftsteller nennt. So ein Lama sieht aus wie ein Schaf, dessen Urahne ein Techtelmechtel mit einem Kamel gehabt hat. Die Dummheit des Schafes verbunden mit dem Größenwahn des Kamels bildet eine höchst ridiküle Mischung. Die altjüngferliche Koketterie und prüde Indignation, mit der jedes einzelne den begegnenden Reiter mustert, reizt einen jedesmal unwiderstehlich zum Lachen. Die Verteidigungsart dieser vierbeinigen Aristokraten ist übrigens keine sehr vornehme. Sie wehren sich gegen Angriffe durch Spucken.
Um von Achecachi nach Sorata zu kommen, muß man einen Paß von ca. 4½ tausend Meter überschreiten. Für bolivianische Verhältnisse ist dies ein Kinderspiel. Uns schien der Fall doch schon recht ernst. Statt des ebnen Weges hatten wir bald eine ziemlich steil aufsteigende Wüste von Geröll, Schiefersplittern und vom Wasser kugelrund gewaschenen Kieseln vor uns. In einem Indianerdorfe machten wir Halt, um zu frühstücken und die Tiere ausruhen zu lassen. Zu welchem Zweck sich die Indianer in dieser Höhe, in dieser öden Wüste, wo es weder Baum noch Strauch gibt, ansiedeln, ist mir bis zum heutigen Tage rätselhaft. Auch, wovon sie leben, bleibt unklar. Tatsache ist, daß man weder für Geld noch für gute Worte irgend etwas Eßbares von ihnen erhandeln kann, nicht einmal einen Maiskolben oder eine Handvoll Reis, von Brot ganz zu schweigen. Außerhalb der Städte ist der Reisende hier ganz auf sich selbst, beziehungsweise auf seinen mehr oder weniger gut assortierten Eßkorb angewiesen. Nur unserem Indio gelang es für einen Silberling eine Handvoll trockener Kokablätter zu erstehen. Er erklärte uns durch Zeichen, daß er für den ganzen Tag weiter keine Nahrung bedürfe. Der Nährwert der Kokablätter, aus denen die Indianer ihre Kraft – im wahren Sinne des Wortes – saugen, muß demnach eine außerordentliche sein. Schmecken tun sie dahingegen abscheulich, etwa wie ein Gemisch von Tee und Chinin. Gourmandise kann man den Indianern also auf keinen Fall vorwerfen.
Je höher man steigt, desto schöner wird der Blick nach allen Seiten. Endlich sieht man auch den ganzen Titicacasee wie ein himmelblaues Tuch zwischen den Bergen ausgebreitet, daliegen. Man bedauert, daß man nicht schielt, um die ganze Zeit über mit dem linken Auge den See, mit dem rechten den Llampu anschauen zu können. Doch wird es noch schöner. Wenn man den Paß überschritten hat, öffnet sich der Blick auf das 2000 Meter tiefer liegende Sorata, das wie das sauber aufgestellte Spielzeug eines artigen Kindes aussieht. Zwischen dem saftigen Grün der Gärten blitzen die weißen Blechdächer in der Sonne. Der Abstieg ist sehr steil und dauert drei Stunden, doch wird er einem nicht zu lang.
Sorata hat ein wundervolles Klima und wäre es leichter zu erreichen, so stände es unter den Luftkurorten der Welt wahrscheinlich an erster Stelle und hätte allenfalls nur die Konkurrenz von Madeira zu befürchten. Durch die Berge von Winden geschützt, aber durchaus nicht eingeengt, liegt Sorata ca. 2500 Meter über dem Meeresspiegel. Die Tropensonne zaubert bei ewig blauem Himmel eine Vegetation von unglaublicher Üppigkeit und halbtropischem Charakter hervor. Alle Bergabhänge sind bedeckt mit Feldern und Anpflanzungen, sie sehen wie phantastische Schachbretter aus, jedes Fleckchen ist ausgenutzt. Soviel Agrikultur, wie im Tale von Sorata, habe ich sonst in ganz Südamerika nicht beisammen gesehen.
Wir reiten durch – buchstäblich – mannshohe Weizenfelder, Reis- und Maispflanzungen. Die Blumenpracht zu beiden Seiten des Weges ist unbeschreiblich. Leuchtend rote Kakteen, Büsche gelber und weißer Margueriten, Hecken herrlicher weißer Rosen, Magnolien, Gardenien von unwahrscheinlicher Größe, Fuchsien-Haine, irgendwelche leuchtend violette Schlingpflanzen, die sich bis hoch in die Baumkronen hinaufziehen. Der Weg ist zum Lachen malerisch. Bald führt er an überhängenden Felsgrotten vorbei, bald windet er sich, von Sturzbächen zerfressen, an steilen Abgründen hin. Hier steht eine alte zerfallene Wassermühle von wucherndem Grün fast begraben, dort zwischen hohen Maisstauden eine verwitterte Indianerhütte. Immer wieder öffnet sich der Blick auf Sorata. Die Sonne ist im Untergehen. Tief herabhängende rosa-violette Wolken schweben auf den Bergkämmen. Als Introduktion nicht übel! Man durfte auf das Weitere gespannt sein.
Wir erreichen Sorata noch vor Einbruch der Dunkelheit.
Im gastlichen Hause des deutschen Großkaufmanns G., den man scherzweise »El Rey de Sorata« nennt, fanden wir freundliche Aufnahme. Auf dem Hofe sahen wir zum ersten Mal die großen schwarzen Gummiklumpen zu mächtigen Haufen zusammengetürmt daliegen – der erste handgreifliche Gruß aus den Gebieten, in die wir uns hineinwagen sollten. Wir vergnügten uns ein Weilchen mit harmlosem Ballspiel, wozu sich die Rohgummi-Ballen als sehr geeignet erwiesen, um dann noch lange auf der Gartenterrasse des Hauses die balsamische Abendluft zu genießen.
In Sorata galt es, den Plan zur Weiterreise reiflich zu überlegen und alles dazu Notwendige sorgfältig, mit Liebe und Verstand vorzubereiten. Dank dem außerordentlich freundlichen Entgegenkommen des Herrn G. gelang es uns, in der für bolivianische Verhältnisse merkwürdig kurzen Zeit von zwei Tagen reisefertig zu sein.
Vorerst mußte das nächste Reiseziel festgesetzt werden. Das tropische Bolivien – ja, aber das tropische Bolivien ist groß. Wo kann man dort irgend etwas in der Art eines Unterkommens finden, wo läuft man am wenigsten Gefahr, am Beri-Beri, gelben Fieber oder irgend einem sonstigen Tropenkoller zu Grunde zu gehen? Gleich diese Frage entschied unser liebenswürdiger Wirt mit dem Vorschlage, nach seinen Gummi- und Kaffee-Plantagen im Gebiete des Mapiriflusses zu gehen und eine seiner Haziendas, San Carlos, zum Ausgangspunkte weiterer Ausflüge und Unternehmungen zu machen.
Damit war uns das nächste Reiseziel gegeben. Obgleich der Ort Mapiri selbst als total verseuchtes Fiebernest gilt, sollte es in der weiteren Umgebung des Mapiriflusses nicht so schlimm mit dieser Gefahr stehen. Außerdem schluckte ja jeder von uns schon seit La Paz täglich sein halbes Gramm Chinin.
Nun hieß es, einen »Ariero«, d. h. Maultierreisen-Unternehmer, gefügig zu machen, uns das nötige vierbeinige Material zur Verfügung zu stellen. Das war auch leichter gedacht, als getan. Die Arieros sind auf diese Art Unternehmungen schlecht zu sprechen, da die Tiere dabei kolossal strapaziert werden und nicht selten als Beute für die Kondore und Aasgeier im Gebirge liegen bleiben. Wir passierten nachher manches häßliche Knochenfeld. Dank den energischen Bemühungen des Herrn G. fand sich endlich doch ein Mann, der den Kontrakt unterschrieb, uns mit vier »mulas de sella« (Reittieren) und vier »mulas de carga« (Lasttieren) nach San Carlos und zurück zu bringen. Leider unterließen wir es dabei, den Rückweg genau zu bestimmen, und mußten daher denselben Weg zurückkommen, den wir gegangen waren, da der Ariero sich weigerte, einen anderen durch das Tal des Goldflusses »Tipuani« zu nehmen, der allerdings, wie es hieß, kaum passierbar sein sollte.
Nachdem diese beiden wichtigen Fragen zu allseitiger Befriedigung gelöst waren, wurde die Ausrüstung in Angriff genommen. Auch hiermit wären wir ohne Herrn G. nicht weit gekommen. Außer seinen Gummi-Latifundien von der Größe eines mitteldeutschen Herzogtums besitzt dieser »König von Sorata« nämlich noch »den« Kaufladen der Stadt. Er ist nicht nur der König, sondern auch der »Wertheim« von Sorata. Das war ein lustiges Einkaufen! Am liebsten hätten wir alles mitgenommen. Aus La Paz hatten wir nur unsere Feldbetten und Schlafsäcke nach Sorata geschickt. Nun ging es ans Verproviantieren, Legionen Knorrscher Suppentafeln, Bouillonwürfel, Maggi – alles Dinge, die mir bisher nur aus dem Annoncenteil der »Lustigen Blätter« bekannt waren – Erbswürste, Gemüsekonserven, Corned beef, Sardinen und andere Herrlichkeiten türmten sich auf dem Ladentisch auf und wurden säuberlich in Kisten verpackt, dazu Spirituskocher, Kessel, Kannen, Becher, Pfannen usw. An jede Kleinigkeit mußte gedacht werden. In der Nacht noch sprangen wir abwechselnd auf, um einen vergessenen Korkenzieher, Büchsenöffner, oder sonst etwas zu notieren. Brot und Zwieback wurden in zwei mächtige Blechkasten verlötet, und jedes Stück Brot kostete nachher einen zerschlagenen Daumen, oder ein zerschundenes Handgelenk. Lichte und Streichhölzer wurden in Glasflaschen verschlossen, da sie sonst in der feuchten Tropenhitze sofort unbrauchbar werden. Endlich das Zaumzeug und die Sättel, von denen ich noch ein Lied singen werde, Decken, regendichte Ponchos, kurz alles für die persönliche Bequemlichkeit erforderliche, nicht zu vergessen eine umfangreiche Apotheke, vor allem Salmiak und sonstige Mittel gegen Moskitosstiche, sowie – last not least – den Alkohol, Whisky und Kognak, in ausreichender Quantität, die sich nachher dennoch als knapp erwies, als wir auf dem Rückwege den Kordillerenpaß im Schneesturm passierten.
Mit einigem Bangen für die Mularücken sahen wir zu, wie unser Gepäck abends auf dem Hofe des G.'schen Hauses zusammengestapelt wurde. Man sollte meinen, daß es für ein Regiment Soldaten gereicht hätte. Vier gesunde Männer konsumieren in 4-5 Wochen was ganz Erkleckliches. Noch nach dem Schlafengehen waren wir mit unseren sorgenden Gedanken in der »Tienda«, d. h. im Kramladen, und von Zeit zu Zeit hörte man einen der Schläfer von gefülltem Weißkohl, petit pois, Bismarckheringen und ähnlichen, schönen Dingen murmeln.
Am 8. April um 7 Uhr morgens war unsere kleine Karawane reisefertig. Abenteuerlich genug sahen die vier Reiter aus: auf dem Kopfe ein Tropenhelm oder ein breitkrempiger spanischer Torreadorhut, um den Hals in kunstvollen Windungen geschlungen die »Cancha«, ein breiter endlos langer Schal – in der Höhe ein absolut unentbehrliches Kleidungsstück – hohe spanische Schnürstiefel mit mächtigen Zackensporen, wie man sie in Europa nur noch auf Porträts von Don Quichote sieht, Revolver und Messer im Gürtel, auf dem Rücken Büchse oder Gewehr, resp. Feldstecher oder -flasche. So stak jeder in seinem Sattel, wie eine Fischgabel im Etui. Sitzen ist ein Ausdruck, der nicht anwendbar ist auf die Lage, in der sich der Reiter auf einem bolivianischen Gebirgssattel befindet. Man ist zwischen eine Art Brust- und Rückenwehr eingeklemmt, die Füße hängen senkrecht herunter, sie stecken in zwei aus Holz geschnitzten oder aus Leder genähten Steigbügeln, die man anfangs verflucht, und die man nachher, wenn selbst in strömendem Regen die Füße trocken bleiben, nicht genug segnen kann. Überhaupt muß man diesen Sätteln nachsagen, daß sie mindestens ebenso praktisch wie unbequem sind. Was geht da nicht alles dran und drauf und drunter. Unten kommen zwei Decken hin, hinten wird der Poncho angeschnallt, solange man ihn nicht braucht. Ebendort hängen zwei geräumige Satteltaschen, in denen man die notwendigsten Gegenstände unterbringen kann, etwas Proviant und die unentbehrliche Whiskyflasche. Vorne sind drei Riemen angebracht, an die man am zweckmäßigsten den Kodak, den Trinkbecher und die Patronentasche anhängt, auf dem Sattel liegt eine kleine Decke aus Schaffell, die man bei Nacht als Kopfkissen verwendet. Elegant ist das Gesamtbild einer derartig gesattelten Mula mit dem Reiter darauf nicht, dafür ist man aber gegen alle möglichen Vorkommnisse gewappnet.
Mit gesenkten Köpfen stehen die Lasttiere da, sie tragen schwerer als die Reitmulas unter den Bettsäcken, Proviantkisten und Felleisen, sogenannten »petacas«, die unsere übrigen Habseligkeiten enthalten. Große Geschäftigkeit entwickelt die »Mannschaft«, nämlich der Ariero, ein Cholo, d. h. Halbblutindianer, der spanisch spricht, obzwar kaum besser, als wir selbst und zwei waschechte Rothäute, deren Hauptbeschäftigung nachher darin bestand, die entlaufenen »Carga-Mulas« wieder einzufangen, wobei sie mit affenartigem Geschick die halsbrecherischen Felsabhänge hinauf und hinunter klettern, um den Tieren den Weg abzuschneiden, denn von hinten läßt sich keine Mula, die etwas auf sich hält, einfangen, wie ich aus eigener bittrer Erfahrung weiß. Der Weg nach San Carlos war auf vier Tagereisen veranschlagt. Jeden Tag waren 45 bis 50 Kilometer zurückzulegen, was bei den kolossalen Steigungen als recht gute Leistung zu bezeichnen ist, weniger für uns als für die Tiere. Die täglichen Wegstrecken mußten genau eingehalten werden, da außer den vorgemerkten Nachtquartieren keine Behausungen weiter unterwegs anzutreffen waren.
Gleich am ersten Tage galt es, den Paß der Hauptkordillere zu überschreiten. Es ist der höchste Gebirgspaß in ganz Südamerika, ich glaube nicht, daß er mit seinen 5500 Metern überhaupt irgendwo seinesgleichen hat. Mit Lust und Energie begannen die Maultiere den Aufstieg, hinterher mit Hott und Hüh die »Carga« nebst den Indios. Aber das Vergnügen dauerte nicht lange.
Ist jemals einer meiner verehrten Leser auf einer Mula einen steilen Berg hinaufgeritten? Nur dann kann er nachfühlen, was man dabei zu leiden hat. Die Maultiere sind zwar sehr brave und ausdauernde Geschöpfe, aber Reiter von nervösem Temperament können sie rasend machen. Je nach dem Steigungswinkel bleiben sie alle zwanzig, zehn oder fünf Schritte stehen, um Atem zu schöpfen. Anfangs hat man Mitleid, denn man fühlt, wie die Flanken des Tieres unter einem schlagen. Man wartet also, bis es von selbst weitergeht. Beim nächsten Mal jedoch wird man schon ungeduldig. Man versucht es mit Zungenschnalzen, Pfeifen und allen spanischen Schmeichelnamen, die einem im Moment einfallen. Keine Reaktion. Nun schwingt man die Zügel und zieht dem Tiere mit dem, wie bei den russischen Iswoschtschiki verlängerten Ende der Leine, eins hinten über. Keine Reaktion. Jetzt wird man heftig und fängt mit den Sporen an zu bohren und am Haarschopf zu ziehen. Nichts hilft. Nun bleibt einem nichts übrig, als mit dem Revolver zu schießen, oder ruhig abzuwarten. Das erstere wäre unklug, aber das zweite ist für ungeduldige Gemüter nicht leicht, zumal wenn andere Reiter mit kräftigeren Tieren einen hohnlachend überholen. Man steigt also ab und geht zu Fuß. Nun fängt man an die Mula zu verstehen. In dieser Höhe ist es nämlich tatsächlich unmöglich, mehr als zehn Schritte zu machen, ohne nach Luft zu schnappen. Wir waren vor der Bergkrankheit, der sogenannten »Saroche« gewarnt. Also steigt man doch lieber auf und wappnet sich mit Geduld, denn ruhig im Sattel hockend, spürt man die Wirkung der dünnen Luft fast gar nicht. Aber kalt wird es, empfindlich kalt. Man greift nach dem »Poncho«, wickelt den Schal fester, aber je höher es geht, desto kälter wird es. Nur eines hilft – der Sweater – wenn man einen hat. In einem Anfall von Hellseherei hatte ich meinen von Moskau mitgenommen.
Nach achtstündigem Aufstieg ist der höchste Punkt des »Yachazani«-Passes erreicht. Schon den ganzen Weg über hatten wir wundervolle Gebirgslandschaften vor uns gehabt. Hier oben läßt sich der Blick mit gar nichts vergleichen, was ich früher – auch in den Kordilleren – gesehen hatte. In greifbarer Nähe steht der Llampu vor einem. Wir hatten Glück. Kein Wölkchen verhüllte sein majestätisches Haupt. Am liebsten hätte man sich stundenlang von diesem Anblick nicht losgerissen. Aber es ist schneidend kalt, und wenn man im Schnee herumtanzte, um sich zu wärmen, ging einem doch sofort der Atem aus. Außerdem trieb der Ariero erbarmungslos zur Eile. Wir waren verspätet oben angekommen. Damals wußten wir noch nicht, was für Folgen eine jede Verspätung in diesen Gegenden hat. Die müden Tiere werden also wieder bestiegen und weiter geht es, eine lange Strecke durch einen ziemlich eben scheinenden Gebirgskessel, dann abwärts. Es ist schon 5 und noch haben wir ein tüchtiges Stück zu reiten. Ohne Erbarmen werden die Mulas wieder in Trab gesetzt. Aus dem Tal steigen dicke weiße Nebelwolken hervor und hüllen die ganze Landschaft ringsumher in einen undurchdringlichen Schleier. Es wird immer dunkler. Um 6 ist es mit gewohnter Tropenpräzision stockfinstere Nacht. Das letzte Stück des Weges – glücklicherweise nur 1¾ Stunden – hat wohl niemand von uns als besonders gemütlich empfunden. Unsere einzige Hoffnung waren die Mulas. Zu Fuß war kein Schritt möglich, da man in dieser sternenlosen Tropennacht nicht die Hand vor den Augen sah. Rechts hörte man das Brausen eines Gebirgsflusses, aber wo und wohin er fließt, sieht kein Mensch. Von Zeit zu Zeit erschallt in der Dunkelheit die Stimme des Ariero, der die Richtung angibt. Man segnete die Spürnase der Mulas, die Vorsicht, mit der sie Schritt vor Schritt machten und gelobte, am nächsten Tage die Sporen abzuschnallen.
So langten wir im Indianerdorfe »Injenio« an, ohne es zu merken, denn nicht einmal die Konturen der Häuser ließen sich in dieser rabenschwarzen Nacht unterscheiden. Aber die Mulas kannten ihren Weg. Als sie stehen blieben, wußten wir, daß wir angelangt waren und abzusteigen hatten. In Injenio steht ein altes verlassenes und zerfallenes Haus, das einst einen wohlhabenden Besitzer gehabt haben muß, und jetzt, was selten genug vorkommt, von durchreisenden Fremden als Nachtquartier benutzt wird. Wir installierten uns in einem Zimmer, das zwar nur noch Fragmente von einem Fußboden, dafür jedoch Reste von Tapeten an den Wänden aufwies. Von Tischen, Stühlen oder sonstigen Bequemlichkeiten natürlich keine Spur. Wir erleuchteten dieses Gemach sofort prächtig vermittelst zweier »bolivianischer Nachtleuchter«, d. h. einfacher Stearinkerzen, die mit der ganzen erwärmten Längsseite an die Wand gepappt wurden. Schnell wurden die Feldbetten aufgeschlagen, da sie zugleich Tische und Stühle ersetzen mußten. Ein alter Indianer, den der Ariero unterdessen aufgestöbert hatte, brachte Reisig, und im Nebenzimmer, das schon gar keine Andeutungen einer Bretterdiele mehr aufwies, wurde ein Feuer angemacht. Appetit hatte niemand von uns. Das pflegt einem am ersten Tage nach erlittenen Strapazen immer so zu gehen. Man begnügte sich mit einer Tasse Tee oder Kakao, und konnte nicht schnell genug die müden Glieder in den Schlafsack und diesen und sich selbst auf das Feldbett strecken. Durch die zerbrochenen Fensterscheiben hörte man den Wind ums Haus gehen. Auf dem Hofe schnauften die Mulas, zwischen ihren Zähnen knirschte die frische Gerste, die wir ihnen vorgesetzt hatten. Sie hatten sie verdient. Guten Appetit!
Am nächsten Morgen um ½5 Uhr hieß es: aufstehen! Jetzt waren wir durch die Erfahrung gewitzigt und wären auch noch früher aufgesprungen, um einer Verspätung aus dem Wege zu gehen. Es ist nicht leicht, in der Dunkelheit die Mulas einzufangen, sie zu satteln und zu bepacken. Während wir unseren Morgenimbiß einnehmen, fängt es an zu dämmern. Wir sehen uns unser Nachtquartier an. Jetzt erscheint es schon weniger einladend, als gestern abend. Der Fußboden, oder das was ihn ersetzt, hat vielleicht vor zwei Jahren zuletzt eine Bürste gesehen. Wenn man ihn näher untersucht, läßt sich das Menü früherer Reisegesellschaften mit ziemlicher Sicherheit bestimmen. Über der Tür hängt die Hälfte eines faulenden Balkons. Keine Fensterscheibe ist heil. (Während ich dies niederschreibe, denke ich lächelnd daran, daß, als wir fünf Wochen später nach Injenio zurückkehrten, mein Reisekamerad vor diesem Hause ausrief: »Gott sei Dank, endlich wieder ein anständiges Lokal!«)
Von den indianischen Ansiedlungen Boliviens ist Injenio unstreitig eine der interessantesten. Es ist ein altes Inka-Dorf. Aus dem Fluß, den wir am Abend vorher hatten rauschen hören, haben vor langen Zeiten die »Söhne der Sonne« unermeßliche Reichtümer an reinem Golde herausgewaschen. Jetzt ist der Vorrat versiegt. Nur mit großer Mühe gelang es, von einem alten Indianer einige Körner Flußgold zu erstehen. Oben in den Bergen hofft man, noch Gänge des edlen Erzes zu finden. Eine amerikanische Gesellschaft ist eben dabei, mit kolossalem Kostenaufwande oberhalb Injenios einen maschinellen Goldminenbetrieb einzurichten. Heute noch sieht man beim Durchschreiten des Dorfes, wie wert den Inkas Injenio gewesen ist. Imposante Dammarbeiten durchziehen die Gegend, Mauern aus mächtigen Quadern, in denen die Jahrhunderte keinen Stein haben lockern können. Von Zyklopen errichtet scheinen auch einzelne Häuser zu sein. Die Inkas wollten hier für die Ewigkeit bauen. Sie konnten es nicht wissen, daß sie selbst so viel früher zugrunde gehen würden, als ihre Werke. Noch eine lange Strecke außerhalb Injenios sieht man am Ufer des Flusses und an den Hängen der Berge die verlassenen Ruinen alter Inkaherrlichkeit einsam dastehen.
Der Weg, der anfangs am Fluß entlang führt, beginnt wieder sich einen Berg hinaufzuschlängeln. Bald ist die Vegetationsgrenze erreicht. Nur große weiße Sternblumen, gleich verkrüppelten Margueriten ohne Stengel, und rote und violette Gebirgsglocken, unseren Alpenveilchen nicht unähnlich, bedecken die Abhänge.
Diese zweite Tagereise ist ermüdender, als die erste, geistig noch mehr als körperlich. Es geht ununterbrochen bergauf und bergab, ohne daß man einen merklichen Höhenunterschied überwindet. Was man eben gewonnen hat, büßt man in den nächsten fünf Minuten wieder ein. Schließlich wird man resigniert. Es ist den ganzen Tag über neblig. Keine Spur von Aussicht. Man sieht nicht weiter, als hundert Schritte. Gleich feuchten Treibhausdämpfen steigen die Nebel empor. Sie kommen aus Palmenwäldern und Bananenhainen. Der Weg wird immer schlechter. Sogar die Mulas stolpern. Alle Augenblicke muß man absteigen, damit die Mula nicht sich selbst die Beine und dem Reiter den Hals bricht.
Gegen Mittag setzt ein feiner Regen ein, der immer stärker und stärker wird. Endlich schüttet es wie aus Eimern. Der Weg ist so schlüpfrig und glatt, daß man jetzt selbst bei den gewagtesten Passagen den Mulahufen mehr vertraut, als den eigenen Stiefelsohlen. Man reitet gesenkten Hauptes, von der Hutkrempe geht es von Zeit zu Zeit wie ein Sturzbach nieder. Gegen diesen Wolkenbruch schützt auch der »regendichte« Poncho nicht. Man fühlt sich langsam aber sicher durchweicht, und sorgenden Blicks sieht man, daß dasselbe Schicksal auch die Schlafsäcke auf den »carga-Tieren« erreicht.
Wenigstens verspäten wir uns nicht. Um 5 Uhr ist das zweite Nachtquartier, das »Grand Hotel« Tola Pampa, erreicht.
Giftiger Hohn hat einer Scheune, die einsam auf Bergeshöhe steht, einst diesen hochtönenden Namen gegeben, der ihr seither anhaftet. Als wir das Haus von Ferne sahen – 50 Kilometer im Umkreise gibt es kein anderes – erhoben sich unsere Lebensgeister. Voller Energie ritten wir darauf zu.
Prosit Mahlzeit! Besetzt!
Das »Grand Hotel« – vier Mauern mit einem Dach darüber – besteht aus zwei Räumen. In einem hatten sich sechs Bolivianer niedergelassen, so fragwürdigen Aussehens, daß man unwillkürlich nach dem Revolver griff. Im anderen, kleineren, hockten frierend fünf Indianer. Was war zu machen? Die Bolivianer-Festung im Sturm zu nehmen, trauten wir uns nicht zu. Also mußten die armen Indios daran glauben. Macht geht hier überall vor Recht, den Indianern gegenüber natürlich ganz besonders. Wir konnten ihnen nicht helfen, die armen Burschen mußten hinaus und sich unter der Dachtraufe niederlassen. Der eine mußte sogar noch den Fußboden aus gestampftem Lehm reinfegen. Wenigstens sind die Braven an Trinkgeldern nicht zu kurz gekommen. Dem einen kauften wir für 2 Bobs (zirka 4 Mark) einen Arm voll trocknen Holzes ab, das er, weiß der Himmel von wo hergenommen hatte, dem andern einige Stück Brot, wobei allerdings ein ganzer Bob für jedes Stück zu erlegen war. Der dritte holte uns Wasser von einer ziemlich entfernten Quelle. Jede Flasche erzielte annähernd den Preis von Münchener Export-Bier!
Wenigstens waren wir bis auf weiteres vor Wind und Wetter geschützt. Das hatten wir aber auch sehr nötig. Schlafsäcke und Betten waren total durchweicht, wir selbst ebenfalls, das einzige Trockne waren die Decken, die unter den Sätteln gelegen hatten. In keineswegs sehr gehobener Stimmung ließen wir uns auf unseren nassen Betten nieder. Im Raume nebenan schwelte das bolivianische Lagerfeuer. Der Rauch drang durch die Mauerritzen und beizte uns die Augen. Einen Schornstein, oder wenigstens ein Loch in der Decke hatte das »Grand Hotel« Tola Pampa nicht. Dennoch machten auch wir in unserer »Nummer« ein Feuer an, was schwierig war, da man sich in dem Räume, nachdem die Betten aufgestellt waren, kaum herumdrehen konnte. Immerhin hob sich der Lebensmut ganz beträchtlich, als wir in zwei Kesseln, die kunstreich an einem nassen Stabe übers Feuer gehängt waren, das Wasser brodeln hörten. Nun stellte sich zu unserer freudigen Überraschung heraus, daß preußische Bergassessoren auch mehr können, als Minen-Gutachten abgeben – nämlich Suppe kochen! Unser Assessor W. jedenfalls braute aus Knorrs Suppentafeln, Liebigs Fleischextrakt, Wurstresten, Cornedbeef, Erbsenkonserven und den Überbleibseln einer einst sehr schönen Hammelkeule eine Suppe zusammen, die dem maître d'hotel bei Adlon Tränen kollegialer Rührung in die Augen getrieben hätte. Dieses Meisterwerk der Kochkunst war unerreichbar. Und als dann das Wasser im zweiten Kessel sich in Grog verwandelt hatte, der immer mit Whisky »verdünnt« wurde, ward uns immer »wöhler« zu Mute, wie man hierzulande sagt. Um 8 Uhr lagen wir auf den nassen Betten, der Ariero, der übrigens seinem ominösen Namen – Don Botello (die Flasche) – alle Ehre machte, als Wächter quer vor der Türe.
Um 4 Uhr am nächsten Morgen rasselte der sorglich auf einem Emailleteller aufgestellte Wecker. Nicht ohne Bangen traten wir vor das Portal des »Grand Hotel«. Regnet es immer noch? Nein. Dem Schicksal sei Dank. Ein wolkenloser Sternenhimmel von großartiger Pracht spannt sich über die Berge. Noch ist es Nacht.
Als wir zum Ausritt bereit waren, begann ein Naturschauspiel von unvergeßlicher, geradezu berückender Schönheit – der Sonnenaufgang. Im Westen am dunklen Himmel erblich der Mond, im Osten, von tiefschwarzen Silhouetten der Berge eingesäumt, begann der Himmel sich rot zu färben, ein Rot von so dunklem satten Ton, als rührte es von einem mächtigen Kohlenfeuer her. In dieser Farbe leuchteten plötzlich die Schneekoppen der Hauptkordillere auf. Zu unseren Füßen dehnte sich unübersehbar weit ein brauendes Nebelmeer aus, das sich wie die Wellenbrandung eines märchenhaften Ozeans durcheinanderschob, milchig, von fast bläulichem Weiß, bis auch hier der Lichtschein hindrang und die ganze grenzenlose Fläche rosenrot färbte. Es war schwer hierbei seine fünf Sinne beisammenzubehalten und noch dazu auf die Mula aufzupassen, die im unsicheren Morgenlichte schnuppernd ihren Weg suchte.
In der Ferne auf dem Kamm eines Berges sah man die winzig scheinende Gestalt eines Indianers stehen. Ich dachte daran, daß diese Naturkinder, wie man mich versichert hat, heute noch alle Sonnenanbeter sind, trotzdem viele von ihnen, besonders in den Umgebungen der Städte, natürlich getauft sind. Und ich dachte daran, daß ihre Religion vielleicht doch nicht so ganz inferior ist, wie es uns von der Höhe unserer europäischen Weisheit herab, vielleicht scheinen mag. Naiv genug ist er ja, der Sonnenkultus der Indianer. Sie bringen ihrem Gott nicht einmal Opfer. Sie beschränken sich darauf, ihn als Erzeuger und Erhalter der Welt zu bewundern. Der Anschauung der Indianer nach gehören ihrem Gott alle Dinge, die er zuerst bescheint, das heißt, alles was sich auf dem Gipfel der Berge befindet. Dieser Gedanke ist schön und billig zugleich. Vielleicht glaubt der Indianer auch, daß auf den Höhen der Berge, die so wundervoll im Sonnenlicht glänzen, wer weiß was für Herrlichkeiten verborgen sind. Denn in den weiteren Postulaten seiner Weltanschauung ist der Indianer sehr bescheiden. Von den Produkten der Erde beansprucht er für sich nur die gewöhnlichsten, die ihm zur Nahrung, Kleidung und Behausung dienen. Alles was kostbar und schön ist, – das Gold, die Vicunnas, aus deren samtweichem Fell man die schönen Decken macht, die noch zarteren Chinchillas usw., alles das gehört ausschließlich den »Söhnen der Sonne«, den Inkas. Der ordinäre Indianer hat darauf kein Recht.
Was es mit den Inkas eigentlich für eine Bewandtnis hat, darüber habe ich übrigens in Bolivien ebensowenig sicheren Aufschluß finden können, wie in Europa. Die Geschichte des Landes setzt sich aus Legenden zusammen. Ziemlich allgemein nimmt man an, daß der Stamm der Inkas auf die Bemannung eines gestrandeten Normannen-Schiffes zurückzuführen ist, die wegen ihrer hellen Haare und Augen als Sonnenabkömmlinge angesehen wurden. In Peru gibt es noch Indianer, die ihre Herkunft von den Inkas ableiten. Jetzt freilich ist ihre Haut braun, wie die der übrigen Indianer. Doch sind es alles auffallend schöne, hochgewachsene Gestalten mit edlen reinen Gesichtszügen.
Von Tola Pampa begann ernstlich der Abstieg. Eine Stunde noch führte der Weg durch das steinige Felsgeröll, das wir schon zur Genüge kannten. Dann setzte die Vegetation ein, und zwar gleich mit völlig tropischem Charakter: Farrenbäume, Fächerpalmen, zuerst alles noch recht winzig, kaum mannshoch, und vereinzelt. Doch mit jedem Schritt, den wir hinab tun, wächst und verdichtet sich der Wald. Von den Maultieren sind wir abgestiegen und lassen sie hinterher laufen. Beim Abstieg brauchen wir sie nicht. Vor uns liegt ein sonnenüberglühter Grat, ein Weg von fast zwei Stunden. Er führt in leichter Neigung hinab. Nachdem wir ihn überschritten haben, kommen wir in Schatten. Gleichzeitig beginnt der Teil des Weges, der im Volksmunde mit Recht »amargurani« – Bitternis – heißt. Ein geradezu grauenhaft schlechter, vom Regen total ausgewaschener, von breiten Felsspalten durchschnittener Weg. Oft ist man in Verlegenheit, wohin man beim nächsten Schritt den Fuß setzen soll. Wenigstens geht es konstant abwärts. Es wird immer heißer. Man hat bald die Empfindung, daß man in dampfdurchglühter Treibhausluft vorwärts schreitet. Die Kleider kleben am Leibe. Der Schweiß fließt in Strömen.
Und dennoch vergißt man alle körperlichen Beschwerden über der vegetativen Pracht, die einen umgibt. Der Wald wird mit jedem Schritt dichter, endlich ist zu beiden Seiten des Weges richtiger undurchdringlicher Urwald.
Was für ein Wald! Kein Märchen kann ihn schöner schildern. Riesenfarren mit fächerartig ausgebreiteten Ästen, Schlingpflanzen, die wie Girlanden von Baum zu Baum und über den Weg hängen. Üppig wucherndes Buschwerk mit glänzenden, gleichsam lackierten Blättern; überall leuchten gelbe, rote, violette Blüten hervor, einzeln und in schweren Dolden. Tausende von Pflanzen, die bei uns als kostbare Ziergewächse gezüchtet werden, alles in riesengroßen unwahrscheinlichen Dimensionen, mannshohe Schilfblätter, sogenannte Gummibäume (die übrigens mit dem Nutz-Gummibaum nicht das Geringste gemeinsam haben), gigantische Nesseln, deren Blätter von einer Seite samtgrün, von der anderen scharlachrot sind, Palmen von jeder Form und Größe, einzeln und in Gruppen, wie sie kein Kunstgärtner schöner zusammenstellen kann. Ein Wirrwarr von saftigem Grün aller Schattierungen mit leuchtenden Farbenflecken dazwischen. Fast alle größeren Bäume sind mit Moosen bedeckt, Moosen von allen Farben, nilgrün, grau, bläulich, ja dunkel weinrot. Und hier, welch eine Pracht! Aus dem Moose schauen die ersten Orchideen hervor. Man traut seinen Augen nicht. Man greift nach den Blüten, und wenn man sie in der Hand hält, läßt sich ihre Existenz nicht mehr in Abrede stellen. Man kann sich nicht satt sehen an den feinen hellila und dunkelvioletten Blumen. Es sind wahre Wunderwerke der Natur, diese bizarren Kelche mit ihren exzentrischen Formen und herrlichen Farben. Am schönsten sind die großen, goldbraunen Dolden, an denen oft bis dreißig einzelne Blüten sitzen. Man hat bald den ganzen Arm voll von dieser Blütenpracht und weiß nicht, wohin damit.
Es ist Frühstückszeit! An einem kleinen Sumpfe, den sogenannten »Lagunillas« wird Halt gemacht. Hier lernen wir die erste Schattenseite der Tropen kennen – den Mangel an Trinkwasser. Die Thermosflaschen sind alle leer getrunken. Im ganzen Walde ist kein Stückchen trockenes Holz aufzutreiben, um Feuer zu machen und das Sumpfwasser zu kochen. Alle Versuche schlagen fehl. Der Durst wird immer quälender. Schließlich pfeift man auf Fieber und Typhus, schöpft einen Becher voll des trüben Wassers aus dem Sumpf, tut einen »Desinfektionsschuß« Whisky hinein, und nimmt einen herzhaften Schluck. Wie das wohltut, obgleich es scheußlich schmeckt. Nun kann die Reise weiter gehen.
Gleich nach dem Frühstück hatte ich Glück. Ich blieb mit meinem Gewehr eine halbe Stunde zurück, da ich in den Baumkronen mancherlei flattern sah, was mich interessierte. In den Wald zu schießen, hat keinen Zweck, wenn man nicht mit einem Schlagmesser, einer sogenannten »macheta« ausgerüstet ist, wie es hier jeder Indianer bei sich hat. Ohne dieses Instrument ist im Walde keine zwei Schritte vom Wege an ein Durchkommen zu denken. Man muß also geduldig warten, bis die erhoffte Beute über den Weg fliegt.
Da! ich schieße. Und vor mir auf dem Wege liegt ein regelrechter Papagei, prächtig grün und rot gefiedert. In der Freude meiner Seele werfe ich meine Papiros mitsamt meiner schönsten Bernsteinspitze in den Urwald – ich habe sie nie wiedergefunden – und hänge meine bunte Beute an den Sattelknopf. Die schönste Feder kommt an den Hut, der sich übrigens im Laufe der Wochen in einen regelrechten indianischen Federkopfputz verwandelte.
Dieses Mal übernachten wir in einer Indianer-Herberge. Noch um eine Nüance primitiver als in Tola Pampa. Dafür stehen ums Haus herum wilde Zitronen- und Apfelsinenbäume, und unten am Abhänge sehen wir eine Bananenpflanzung. Auch nicht zu verachten.
Wir teilen den einzigen verfügbaren Raum, da er groß genug ist, mit einer Gesellschaft indianischer Packeseltreiber. Sie kochen in einer Ecke stumm – Indianer reden nie, außer dem Allernotwendigsten miteinander – ihren Reis, wir in der anderen geräuschvoll unsere Suppe.
Zu unseren Häupten über den Feldbetten siedelten sich auf einer Stange sämtliche Hühner des Hauses an und machten sich bald unangenehm bemerkbar.
Zu dem durchlöcherten Dach schaut der Sternenhimmel herein, durch den offenen Giebel das Kreuz des Südens, das wir jetzt endlich kennen. Dieses Kreuz ist übrigens ein bluff. Erstens ist es überhaupt nichts Besonderes und zweitens ist es kein Kreuz. Genau ebensogut könnte es einen Triumphwagen oder eine Kaffeekanne vorstellen. Es ist ein unregelmäßiges Parallelogramm von vier Sternen, deren einer ziemlich schwach leuchtet. Warum das ein Kreuz bedeuten soll, ist unerfindlich, jedenfalls weiß das kein Mensch, außer dem Astronomen, der es so getauft hat.
Theoretisch hatten wir von Lorenzo Pata, unserem letzten Nachtlager, bis San Carlos einen Tag. Praktisch wurden zwei daraus. Aber nicht durch unsere Schuld, denn um 5 Uhr war die ganze Gesellschaft auf den Beinen, und um 6 ritten wir aus, wohlgemut, trotz des strömenden Regens. Alles ringsumher trieft. Wir sehr bald ebenfalls. Der naßgeregnete Urwald bietet ein anziehendes Bild. Das Grün scheint noch saftiger. Man glaubt es ordentlich zu spüren, wie die fruchtbaren Kräfte sich darin regen. Die Moose schwellen, die Blumenkelche öffnen sich.
Um 11 Uhr klärte es sich auf. Die Tropensonne tat das ihrige, um uns schnell zu trocknen. Wir dampften richtig. Aus dem Tal – wir sind ja immer noch 1½ Tausend Meter hoch – steigen Nebelfetzen herauf und verfangen sich in den Baumkronen. Der Weg führt bergauf, bergab, bergab, bergauf. Eine gefährliche Stelle ist noch zu überwinden – der sogenannte »tornillo« (die Schraube), – eine korkenzieherartig gewundene Wegstrecke, die an einem Abgrunde entlang führt.
Den ganzen Weg, von Sorata an, war es uns aufgefallen, daß auf dem Gipfel jeder Steigung ein mächtiger Steinhaufen aufgeschichtet war, von besonders riesigen Dimensionen bei den schwierigsten Stellen, am Jachazani-Paß, beim Beginn des Amargurani-Abstiegs, hier am Tornillo. Don Botello gab uns die Erklärung dafür. Wenn der Indianer einen Berg emporsteigt, nimmt er in jede Hand einen Stein, trägt ihn hinauf und legt ihn dann fein säuberlich hin. Er glaubt, daß ihm das Steigen erleichtert wird, wenn er die Steine näher zur Sonne bringt. Psychologisch ist dieser Aberglaube sehr verständlich und berechtigt. Der Indianer denkt die ganze Zeit während des Aufstiegs an seine Steine, und das lenkt die Aufmerksamkeit von der eigenen Erschöpfung ab. Im Laufe der Jahrzehnte bekommt ein jeder Gipfel auf diese Weise ein kunstloses, aber imposantes Denkmal. Bemerkenswert ist, daß die Indianer ihre Steine oft in der Form eines Kreuzes anordnen.
Um 3 Uhr erreichten wir eine »Finca«, San José, des Herrn G., durch dessen Gebiet wir schon seit zwei Tagen ritten. Nun waren noch 3 Stunden bis San Carlos. Nach kurzem Aufenthalt begannen wir den letzten, sehr steilen Abstieg. Allein wir hatten die Rechnung ohne den Regen gemacht, der am Morgen herabgeströmt war. Ein Gebirgsbach – der Rio d'Oro – der unten im Tal den Weg durchschnitt, war derart angeschwollen, daß an ein Passieren gar nicht zu denken war. So mußten wir den ganzen Weg wieder hinauf. Ich blieb unvorsichtiger Weise, vom Jagdeifer beseelt, zurück, schoß auch richtig ein langschwänziges Ungeheuer, halb Papagei, halb Fasan und – beinahe – einen Affen. Doch mußte ich dafür büßen, nämlich den ganzen zweistündigen Aufstieg zu Fuß machen. An diese Stunden denke ich ungern zurück. Ein siebenstündiger Weg, meist zu Fuß, lag schon hinter uns. Halbtot langte ich in San José an. Die Kochkunst unseres vortrefflichen Assessors und eine Flasche wirklich echten Münchener Bieres, das überall in den Tropen, wo es Menschen gibt, verzapft wird, freilich zu Phantasiepreisen, brachte mich nur langsam wieder auf die Beine. Trotz Hunden, Mäusen und einem Hahn, die sich in unserem Zimmer bekriegten, schlief ich wie ein Erschlagener.
Am nächsten Morgen ließen wir uns nicht zurückhalten und nahmen auch glücklich das Hindernis, das uns in Gestalt des Rio d'Oro den Weg versperrte. Dennoch hatten wir auch jetzt, trotz des verhältnismäßig niedrigen Wasserstandes, beim Durchreiten des Stromes das Gefühl, gleich vom Strudel mitgerissen zu werden. Allein das Schicksal meinte es besser mit uns, und nur die Füße wurden naß, ungeachtet der ingeniösen Steigbügel. Gegen Mittag erreichten wir das gelobte Land – San Carlos.




Die Hazienda San Carlos ist entzückend gelegen. Ich würde sagen idyllisch, wäre dieser Ausdruck nicht in den Tropen überhaupt und unter allen Umständen deplaciert. In einem Talkessel, der die Aussicht nach einer Seite freiläßt, sind in regellosem Durcheinander die acht bis zehn Häuser des Gutshofes hingebaut. An einer Seite zieht sich eine üppige Bananenpflanzung hin, deren Früchten wir mehr als einen exquisiten kulinarischen Genuß verdanken.
Von allen Pflanzen der Tropen ist die Bananenstaude, meinem Geschmack nach, die malerischste. Die ganz hell lichtgrünen Blätter von der Form riesiger Palmenwedel falten sich an der Spitze des Baumes zu einem breiten schattenspendenden Dache auseinander. Der Stamm geht von unten nach oben allmählich aus einem bräunlichen Rot in dasselbe Lichtgrün des Laubwerkes über. Zwischen den Blättern lasten schwer die mächtigen Fruchtkolben, an denen sich die Bananen, je nach dem Stadium der Reife und der Sorte, grün, goldgelb oder kupferbraun auseinanderspreizen.
An der anderen Seite der Hazienda ziehen sich die Kaffeeplantagen entlang. Schon von weitem sieht man die feuerroten Kaffeebohnen aus dem Laube hervorleuchten. Ums Wohnhaus herum stehen Orangen und Zitronenbäume, über und über mit reifen Früchten bedeckt.
Nur das Wohnhaus ist ein Bretterbau. Die Wände der übrigen Häuser bestehen, wie überall unten in den Tropen, aus aneinandergereihten Bambusstäben, die einfach in die Erde gesteckt und nur lose mit Bast zusammengeflochten werden. Fenster haben diese Bambuskäfige, von denen ich noch zu erzählen haben werde, nicht. Alle Gebäude sind mit Palmstroh gedeckt. Oberhalb der Plantagen sind die sie umgebenden Hügel mit wundervollem dichten Urwald bestanden.
Obgleich wir unangemeldet in San Carlos eintrafen, wurde uns ein überaus freundlicher Empfang seitens des Verwalters – hier nennt man ihn »gerente« – zuteil. Auf der luftigen Veranda, während unsere Zimmer zurecht gemacht wurden, bekamen wir sofort einen prächtigen rosenroten Cocktail aus Zuckerrohrschnaps vorgesetzt. Ohne das geht es hier nicht. Kein Verbrechen wird strenger gerochen, als wenn man die »cocktail-time« versäumt. Nun, man läßt es sich ja schließlich gefallen. Wenigstens braucht man, wenn man zu Gast ist, nicht um die »Cocktails« zu würfeln, wie wir das in Oruro und La Paz bis zur Besinnungslosigkeit tun mußten.
Vor dem Frühstück noch wurde uns ein langentbehrter Genuß zuteil. Wir konnten baden. Hinter dem Hause hat sich nämlich der umsichtige und reinliche »gerente« mit Bedacht und Fleiß ein Schwimmbad hergerichtet. Es besteht aus einem großen Holzkasten, geräumig genug für eine ganze Familie. Das krystallklare Wasser eines kühlen Gebirgsstromes wird vermittelst zweier Holzröhren herein und wieder hinausgeleitet. Man plätschert also in fließendem Wasser. Daß das Bad von einer gewaltigen Bananenstaude beschattet wird, gibt der ganzen Sache einen, dem Ort entsprechenden, äußerst exotischen Charakter.
Während der fünf Tage in den Kordilleren waren wir alle total verwildert, ganz »en Schwein« wie Heine sagen würde, mit sprossenden Vollbärten. Wir erkannten uns gegenseitig kaum wieder, als wir uns sauber gewaschen und gekämmt an der Frühstückstafel zusammenfanden.
Was die tropischen Menüs anbetrifft, so muß man sich anfangs an mancherlei gewöhnen, was man später nicht mehr entbehren möchte. Dazu gehört allerdings nicht die rote Ahi-Pfefferschote, vor der wir noch von Brasilien her einen Heidenrespekt hatten. Hier wurden die Speisen nur soweit gepfeffert, daß man wenigstens nicht alle seine Tränen zu einer Mahlzeit zu vergießen brauchte. Vor der Suppe werden meist gekochte oder geröstete Bananen aufgetragen, oder eine mehlige kartoffelartige Wurzel »juca«, die mit Butter gegessen wird. Den Bananen haftet in dieser Form ein unangenehm süßlicher Geschmack an. Die größte Tropen-Delikatesse, die man sich gerne gefallen läßt, ist ein Salat aus jungen Trieben der Palmen. Für eine Schüssel müssen vier Stämme gefällt werden. Das ist eigentlich ein Frevel, aber ein außerordentlich wohlschmeckender. Herrlich sind die tropischen Früchte hier, in Brasilien hatten sie mir gar nicht behagt. Da ist vor allen die »chirimoja«, die Königsfrucht, die von außen ungefähr wie eine grüne Zedernuß aussieht, und deren schneeweißes festes Fleisch einen überaus würzigen, fein aromatischen Geschmack hat. Dann die »grenadillos«, Früchte der Passionsblume, die aussehen wie riesige Stachelbeeren und auch ähnlich schmecken. Dann die »palta«, um deren Kern ein grünliches Fleisch von pikantem nußartigem Geschmack sitzt. Man ißt sie meist vor der Mahlzeit mit Salz und Pfeffer. Unangenehm schmeckt das weiße, wollige und faserige Fleisch der »pacais«, die man bei uns in getrocknetem Zustande »Johannisbrot« nennt. Nicht zu verachten dagegen sind die »papaillos«, eine Sorte edler Kürbisse, die ungefähr so behandelt werden, wie bei uns die Kartoffel. Keinen besonderen Geschmack konnte ich den sogenannten »süßen Zitronen« abgewinnen, die überall zu Tausenden wild wachsen. Sie haben überhaupt keinen Geschmack, weder einen süßen, noch einen sauren, noch sonst irgend einen, sind allerdings sehr saftig, was ihnen in wasserarmen Gegenden großen Wert verleiht.
Während der fünf Tage, die wir in San Carlos verweilten, aßen wir langsam aber sicher einen Ochsen auf, bis zu den Gedärmen inklusive, den sogenannten »tripas«, die hier hochgeschätzt, dennoch eine kulinarische Scheußlichkeit sind.
Im übrigen verging die Zeit nur zu schnell in dem angenehmen Bewußtsein, daß man nichts zu tun hatte, als nichts zu tun. In den ersten Tagen strich ich viel mit dem Gewehr umher, brachte auch stets Beute heim, einige von den prächtigen feuerroten »tuncis«, einer ziemlich seltenen Papageisorte, »celestinas«, mit ihrem unwahrscheinlich schönen siebenfarbigen Gefieder, und viel Raubzeug. Die als Braten hochzupreisenden Bergpfauen – »pavo de monte« – habe ich wohl gehört, aber nie zu Gesicht bekommen. Ebenso ging es mit den Affen. Es wird auf die Dauer langweilig, daß man bei solchen Ausflügen nur auf die mehr oder weniger gebahnten Wege angewiesen ist. Im Walde selbst ist auch hier nirgends ein Durchkommen. Wagt man sich einen Schritt seitwärts, so ist man sofort rettungslos von tausend stachligen Schlingpflanzenarmen umgarnt. Der Jäger kann dem Wild nicht nachstellen, sondern muß warten, bis es zu ihm kommt. Dazu gehört mehr Geduld, als mancher besitzt. Läßt man sich aber zu einem verfrühten Schuß verleiten, so muß man es schwer büßen. Auf dem Rückwege aus Mapiri hatte ich die seltene Gelegenheit einen mächtigen Kondor vor die Flinte zu bekommen. In der Aufregung schoß ich zu früh, und er fiel vielleicht dreißig Schritte weit in den Wald hinein. Es dauerte mehr als 1½ Stunden bis wir uns zu zweit diese dreißig Schritte in das Dickicht hineingearbeitet hatten und noch eine weitere halbe Stunde bis es gelang, den Vogel aus der Palme, auf die er gefallen war, herauszuschütteln. Und endlich konnten wir ihn doch nicht mitnehmen, weil er zu schwer war, und es nicht anging, ihn durch das Gewirr von Schlingpflanzen durchzuschleppen.
Die Jagdleidenschaft wurde durch eine harmlosere abgelöst – den Schmetterlingsfang. Zu hunderten gaukeln die bunten Riesenfalter in den Wäldern umher und zwar vorzugsweise an den Wegen, da sie so poesielos sind, eine besondere Vorliebe für Mulamist zu hegen. Es ist nicht so leicht ihrer habhaft zu werden. Erstens sie überhaupt zu fangen, und zweitens wenn man sie glücklich im Netz hat, sie nicht zu beschädigen, denn mit einem kräftigen Flügelschlage kann ein solcher Falter die ganze Pracht seiner Zeichnung stören. Aber Übung macht den Meister. Wenn man sehr geduldig, vorsichtig und leise ist, kann man den sitzenden Schmetterling mit den Fingern an den zusammengelegten Flügeln fassen. Allerdings ist er meist so infam, im allerletzten Augenblick zu entschlüpfen, und es kann einem recht heiß werden bei solch einer Jagd, die oft kilometerweit den Weg entlang führt, zumal Mittags in der Tropensonne. Im Verlaufe der ganzen Reise, vorzugsweise aber in San Carlos, gelang es uns, eine stattliche Sammlung von über 160 Sorten zusammenzubringen. Als wir nachher in La Paz auspackten, hatten wir die Genugtuung, daß selbst Dr. B., der Direktor des allerdings noch jungen bolivianischen Naturhistorischen Museums, eine ganze Reihe von unseren Faltern noch nicht besaß.
Die ersten Tropennächte schläft man schlecht. Sie sind zu schön, diese Nächte. Vor allem sind sie zu unruhig, zu enervierend, zu aufregend. Mit einer unglaublichen Plötzlichkeit brechen sie an. Man hat eben noch im Freien gelesen, da legen sich weiche schwarze Schatten rings auf Wald und Feld, ein kühler Wind streicht durch die Bäume, am dunkelblauen Himmel blitzt ein Stern nach dem anderen auf. Und nun gehts los, als wären alle guten und bösen Luft- und Nachtgeister entfesselt. Ein wahrhaft ohrenbetäubendes Konzert beginnt. Legionen von Grillen, Zykaden, und anderem Nachtgetier zirpen, pfeifen, girren – brüllen, würde ich am liebsten sagen. In den Bäumen schluchzen und klagen die melancholischen Sänger der Nacht. Das Geräusch wird endlich so stark, daß man, wie beim Treswon der Moskauer Kremlglocken keine einzelnen Töne mehr unterscheiden kann. Ein rasender Liebestaumel scheint alles Lebende ergriffen zu haben. Das Locken und Schmeicheln nimmt kein Ende. Riesige Nachtfalter, Fledermäuse, leise Nachtvögel tauchen schattenhaft im Dunkel auf, um gleich wieder zu verschwinden. Und nun beginnt die allabendliche Illumination des Waldes. Unzählige Funken und Flämmchen blitzen überall auf – es sind Millionen von Leuchtkäfern. Alle Bergabhänge sind besät mit ihnen, als wären die Sterne vom Himmel gefallen und könnten im duftenden Laub nicht verlöschen. Doch ein Blick nach oben belehrt einen, daß die Sterne noch an Ort und Stelle stehen. Und auch sie scheinen ihre Leuchtkraft verdoppeln zu wollen, als müßten sie genau hinschauen, was dort unten auf der Erde eigentlich vor sich geht. Sie flimmern und flackern und können ihre Unruhe nicht bemeistern.
Und unter solchen Umständen soll man schlafen. Unmöglich. Man liegt im Liegestuhl, stumm und wunschlos, und trägt mit einer Zigarette sein bescheidenes Scherflein zu der allgemeinen Illumination bei.
Die schönen Tage von San Carlos vergingen nur zu schnell. Immer wieder gab es etwas anderes zu sehen. Wir gingen in die Kaffeeplantagen hinein und halfen die schönen roten Bohnen von den zierlichen Sträuchern pflücken. Dann sahen wir zu, wie die Bohnen von ihrer äußeren Hülle gereinigt werden, was in einer Art Riesenkaffeemühle geschieht, die jedoch von Indianern mit der Hand betrieben wird. Größere Maschinenbetriebe sind hier unten natürlich unmöglich, denn man kann hierher nichts transportieren, was ein größeres Gewicht hat, als eine Mula auf dem Rücken tragen kann.
Vor dem Wohnhaus in San Carlos ist eine große Tenne angelegt, die ich anfangs für einen vernachlässigten Tennisplatz hielt. Das war jedoch ein Irrtum. Auf diese Tenne werden die von ihrer äußeren Hülle befreiten Kaffeebohnen geschüttet und in der prallen Sonne getrocknet. Von Zeit zu Zeit laufen Indios mit nackten Beinen in dem Kaffee umher, um die Bohnen zu wenden und mit der Luft in Kontakt zu bringen. Nirgends in der Welt habe ich besseren Kaffee getrunken, als in San Carlos. Das Geheimnis seiner Zubereitung ist das, daß der Kaffee in gar keine Berührung mit irgend einem Metall kommt. Auf der Lehmfläche des Ofens wird er geröstet, dann nicht gemahlen, sondern zwischen zwei Steinen zerrieben, in einem Tongefäß aufbewahrt und auch gekocht. Nur auf diese Weise erhält sich sein Aroma ganz rein. Gekocht wird ein Extrakt von männermordender Stärke. Er wird kalt serviert und ein Spitzglas davon in der Tasse mit heißem Wasser verdünnt. Das Resultat ist ein Getränk, gegen das Nektar und Ambrosia Spülwasser gewesen sein muß. Ehrgeizige Hausfrauen mögen das Rezept ausprobieren.
Mit Indianern, die vermittelst ihrer säbelartigen »machetos« den Weg durchschlugen, drangen wir in den Urwald ein, um den Chinabaum zu finden, dessen Rinde hier früher ein wichtiger Exportartikel war, bis man sie von anderswo her billiger nach Europa schaffen konnte. Jetzt wird die bittere Rinde nur für den Hausbedarf abgeschält und verarbeitet. Man kämpft damit gegen das Fieber, ohne jedoch radikale Abhilfe schaffen zu können.
Ein weiterer Ausflug führte uns nach den »gomales«, jenem Teil des Urwaldes, in dem der Gummi gewonnen wird, dem die hiesigen Haziendenbesitzer ihren Wohlstand verdanken. In den Wäldern von San Carlos arbeiten mehr als 500 sogenannte »picadores«, Indianer, die täglich zweimal jeder einen Rayon von zirka einem Quadratkilometer abgehen und 100-150 Gummibäume anzapfen. Sie schlagen mit einer spitzen Hacke hinein und befestigen unter der Öffnung ein kleines Blechgefäß, in das der milchige Gummisaft abfließt. Bei der zweiten Runde werden all diese kleinen Becher, von denen an jedem Baum oft zehn bis zwanzig stecken, in einen größeren Eimer entleert. Die weitere Bearbeitung des Gummis besteht darin, daß er über einem schwachen Holzfeuer – im Walde noch – geräuchert wird. Dadurch wird er erstens schwarz und backt sich, zweitens, zusammen. Dann sind die rohen Klumpen zum Export fertig. Die Gummibäume werden hier übrigens nicht gepflanzt, sondern wachsen wild mitten im Urwalde. Die »picadores« müssen sich jeden Tag ihren Weg aufs neue durchschlagen, da die unglaublich schnell wuchernden Schlinggewächse ihn sofort wieder versperren.
Von allen kultivierten Pflanzungen sind, nächst den Bananen, die Kakaoplantagen die schönsten und malerischsten. Der Kakaobaum ist sehr hochstämmig mit einer breiten Blätterkrone, unseren Eichen nicht unähnlich. Im dunkelolivengrünen Laube verstecken sich die Früchte. Eine leuchtend orangegelbe Schale umschließt die bläulichen Bohnen. Das weiße, weichlich-wollige Fleisch, das die Bohnen umhüllt, wird von Liebhabern gegessen, zu denen ich mich jedoch nicht bekennen konnte.
Hin und wieder führte unser Weg durch Reisfelder. Kurzsichtige können ihn für Gerste oder Hafer halten. Er wird auch ebenso abgeerntet. Nur der Drusch bietet ein eigenartiges Bild. Das erste Mal glaubte ich, eine Horde Wahnsinniger, oder Angehörige der Springersekte vor mir zu haben. Doch waren es Indianerweiber, die mit wilden Gesten auf den Reisbüscheln herumtanzten und stampften, und auf diese sehr primitive Weise die Körner aus den Halmen entfernten.
Alle diese Ausflüge wurden nebenbei zum Schmetterlingsfang benutzt. Unser Hauptaugenmerk richtete sich natürlich auf die großen blauschillernden Falter, die in Europa unter Laien unter dem Namen »brasilianischer« bekannt sind. Hier sind sie in drei Sorten vertreten, heller und dunkler gefärbt, mit samtschwarzem beziehungsweise goldbraun gewürfeltem Rande. Im Fluge bilden sie ein bezauberndes Bild, sie schweben so ruhig und aristokratisch daher, als seien sie überzeugt, daß niemand die Dreistigkeit haben könnte, sie zu fangen. Dem Netz, das nach ihnen hascht, weichen sie nicht weiter aus, als unbedingt notwendig ist. Wer beschreibt unsere Freude, als wir eines Tages bei einem Spazierritt unter einem Baum japanischer Paradiesäpfel 40-60 dieser Riesenfalter beisammensitzen sahen. Zum Überfluß schien die ganze Gesellschaft vom Genuß des Fallobstes berauscht zu sein. Sie ließen sich einer nach dem andern ruhig greifen. Wir hatten nicht genug Papiertüten bei uns, um sie alle sorglich zu verpacken.
Die am wenigsten sympathischen Bewohner des Urwaldes sind die Schlangen. Glücklicherweise haben sie vor dem Menschen genau ebensoviel Respekt, wie er vor ihnen, und kneifen beim leisesten Geräusch aus. Ich habe auf meinem Wege keine einzige gesehen. Doch schreckt man unwillkürlich zusammen, wenn man das Laub rascheln hört. Es sind tausende von Eidechsen, die hier eine unwahrscheinliche Größe erreichen. Wie der Blitz huschen sie über den Weg und verschwinden im Moose, man hat kaum Zeit, ihre grünschillernde Schwanzspitze zu sehen. Als wir eines Morgens auf die Veranda traten, prallten wir entsetzt zurück. Im Sande vor dem Hause lag eine enorme Riesenschlange. Erst bei näherem Hinsehen bemerkten wir, daß sie keinen Kopf mehr hatte, obgleich sie sich noch den ganzen Tag ringelte und wand. Ein Indianer hatte das scheußliche Tier nicht weit vom Hause erschlagen. Ihre drei Meter lange, einen halben Meter breite, prächtig blau und grüngolden schimmernde Haut bildet jetzt ein Staatsstück meiner Sammlung.
Von den wilden Tieren des Urwaldes hört man wenig und sieht man gar nichts. Abends tönt ab und zu der Schrei einer Wildkatze aus den Bergen herüber. Alle Jubeljahre einmal stattet ein Leopard seine Visite ab, um dann freilich in einer Nacht eine ganze Schafherde umzubringen, denn er saugt den Tieren nur das Blut aus und läßt die Kadaver liegen.


Allmählich wurde es Zeit für uns, an die Weiterreise zu denken. Wir beschlossen zunächst nach Mapiri zu gehen und von dort aus flußabwärts bis Guanay zu fahren.
Eine Tagereise lag vor uns, als wir uns am Morgen des 17. April auf den Weg machten. Der liebenswürdige »gerente« von San Carlos gab uns das Geleit. Da wir es der Fiebergefahr wegen vermeiden wollten, in Mapiri zu übernachten, kehrten wir unterwegs in San Antonio, der Hazienda eines bolivianischen Senators, ein. Wir wurden aufs freundlichste aufgenommen und beherbergt. Die Annehmlichkeit des Aufenthaltes wurde nur dadurch geschmälert, daß wir veranlaßt wurden, nach hiesiger Sitte, unsere Bekanntschaft mit den Administratoren der Hazienda bis zur Bewußtlosigkeit – nicht im buchstäblichen Sinne des Wortes – mit Cocktails aus Zuckerrohrschnaps zu begießen.
Am nächsten Tage hatten wir nur zwei Stunden bis Mapiri zu reiten, einen wunderschönen Weg, die malerisch bewaldeten Bergabhänge hinunter. Wenn nur die Hitze nicht gewesen wäre, die mit jedem Schritt abwärts unerträglicher wurde. Wir hatten gedacht, in Mapiri ein stattliches Städtchen vorzufinden, da es der Hauptschlüssel zum ganzen Beni-Gebiete ist, von dem aus enorme Gummi- und Kaffeetransporte an die Küste befördert werden. Statt dessen fanden wir ein elendes Nest vor, nicht größer als eine der Haziendas, die wir verlassen hatten. Der ganze Ort hat knapp hundert Einwohner, und auch die werden, so schien es uns, nicht lange mehr leben. Alle bis auf den letzten Mann sind schwer fieberkrank. Sie sehen entsetzlich aus, diese wandelnden Leichen, gelb, vertrocknet, hager mit glanzlosen Augen und erloschenem Blick. Den traurigsten Eindruck machten die Kinder mit ihren schlaffen Körpern, dünnen Armen und Beinen und greisenhaft ernsthaftem Aussehen.
Mapiri besteht aus einer Straße, die mit flachen fensterlosen Häusern – den schon beschriebenen Bambuskäfigen – eingefaßt ist. Auf dieser Straße wuchert Unkraut, Nesseln und haushohe Disteln. Dazwischen spazieren Schweine umher und fressen die überall herumliegenden Bananenschalen. Hin und wieder sieht man ein Maultier oder einen Esel den Kopf unter dem glühenden Sonnenbrande senken. Vor einer Haustür spielt ein Indianerbube mit einem grauen langgeschwänzten Affen. Die Einwohnerschaft ist merkwürdig international. Man muß schon ein ganz verzweifelter Patron sein, um sich in diesem Fieberneste anzusiedeln. Wir trafen einen Dalmatiner dort, Chinesen und zwei Türken, deren einer durchaus seine Flinte und seine Frau verkaufen wollte. Für die Flinte fand er auch bald einen Abnehmer. Die Frau war zu teuer.
Sehr bald erfuhren wir, daß unser Plan, gleich weiter zu fahren, unausführbar sei. Es würde zwei Tage dauern, ein Boot für uns instand zu setzen. Wir wappneten uns also mit Resignation, verdoppelten und verdreifachten die Chininrationen und gingen – Schmetterlinge fangen. Hier wurde ein wunderschöner, samtgrüner, goldgemusterter Falter mit zierlichen Frackschößen das Ziel unserer Sehnsucht. Dieser »Grüne« hat uns nachher noch viel Sorgen und Aufregung gekostet, viel Anlaß zu Spott, Hohn und gegenseitigen Eifersüchteleien gegeben, kurz, unsere schlechten Instinkte entfesselt.
Unser Nachtquartier schlugen wir im Hause eines Holländers auf, eines verbitterten, fieberkranken Krüppels ohne Beine. Er besaß einen Kramladen und fuhr unwirsch auf einem vierrädrigen Holzkarren, den er sein »Automobil« nannte, hinter dem Ladentisch her und hin, wenn er sich nicht mühselig sitzend, durch den Staub schleppte. Das ganze Milieu – ein Cauchemar!
Wenigstens gab es auch hier Münchener Bier. Löwenbräu! Lauwarm freilich, Kostenpunkt zirka 6 Mark die Flasche, aber immerhin ein Labsal bei der Tropenglut. Und da weiter unten im reichen Beni-Gebiet, wie wir wußten, 10-15 Mark für die Flasche bezahlt wird, mußten wir es hier sogar billig finden.
Als wir uns abends auf unsere Feldbetten gelegt hatten und noch darüber nachdachten, wie wir uns am besten gegen die Moskitos, die Hauptträger der Infektion, schützen sollten, drangen plötzlich Laute an mein Ohr. Ich horchte hin, – kein Zweifel, das mußte eine Art Musik sein. Wenn man eine Liebhaberei hat, so läuft man ihr nach, egal, ob das auf dem Nordpol oder in den Tropen ist. Ich sprang natürlich auf und trat vor die Tür. Wundervoller Mondschein überflutet Mapiri. Selbst dieses elende Nest sieht im taghellen Silberschimmer des Tropenmondes ordentlich poetisch aus. Ich lausche, kein Zweifel, es ist irgend eine Musik zu hören, ganz deutlich lassen sich die Schläge einer großen Pauke unterscheiden. Ich werfe die notwendigsten Kleidungsstücke über und gehe den Tönen nach. Sie werden immer deutlicher, Flöten und Pfeifen sind dabei. Die ganze Sache klingt höchst sonderbar. Man wird nicht recht klug daraus, zehn Minuten vor der »Stadt« gelange ich auf eine Wiese.
Dort bietet sich mir folgendes Bild dar: mitten auf der Wiese, vom Mondlicht hell beschienen, stehen zirka fünfzehn Indianer in engem Kreise und blasen auf Tod und Leben in ihre Panspfeifen und langen Flöten hinein. Einer schlägt auf einer riesigen Trommel. Der Kerl hat Rhythmus! Sämtliche Musikanten bewegen die Oberkörper gleichmäßig im Takt. Es stellt sich heraus, daß eine »Probe« abgehalten wird zu einem Feste, das nach zwei Monaten stattfinden sollte. Ja, die Musik ist eine schwere Kunst, zumal das Orchesterspiel. Schon wollte ich fragen, ob sie nicht einen Dirigenten brauchen.
Ich setzte mich ins Gras zu einer kleinen Gruppe anderer Musikliebhaber, und endlich gelang es mir doch, mich einigermaßen in dem Chaos von Tönen zurechtzufinden. Zwei Indianer bliesen eine Melodie, wobei sie sich nach Art der alten russischen Hornmusikanten ablösten, d. h. wenn einem auf seiner Flöte ein Ton fehlte, so blies ihn der andere. Die Schnelligkeit, mit der diese Ablösung geschah, war bewundernswert. Das ist gar nicht einfach. Es kostete meinem Reisekameraden und mir heißes Bemühen, uns nachher in dieser Weise den Donau-Walzer auf zwei indianischen Panspfeifen einzustudieren. Doch das nur nebenbei. Die übrigen zehn oder zwölf Musikanten bliesen zu dieser Melodie die abenteuerlichsten Kontrapunkte, dank denen mitunter ganz merkwürdige Harmonien entstanden. Es gelang mir, im Laufe der Probe, drei Melodien nachzuschreiben. Eine davon gefällt mir mit jedem Tage besser. Ich werde sie in Europa als symphonisches Thema feilbieten.
Als ich tiefbefriedigt von diesem musikalischen Genusse heimkehrte, empfing mich in unserem Bambuskäfig eine höchst aufregende Szene. Auf einer leeren Bierflasche schwankte ein Licht, meine sämtlichen drei Gefährten mit Stöcken und Schmetterlingsnetzen bewaffnet jagten irgend einem Phantome an der Wand nach. Endlich erblickte auch ich es – eine Vogelspinne. Die scheußlichste Kreatur, die ich je in meinem Leben gesehen habe, faustgroß mit zahllosen behaarten Beinen und zwei langen krummen Zähnen am glatten Bauch, in dem wahrscheinlich schon mancher schöne Singvogel verdaut worden war. Ihr Biß ist absolut tödlich. Der tapfere Assessor erlegte sie nach langer Jagd mit einem wohlgezielten Hieb. Das Abenteuer ließ uns lange nicht schlafen, man glaubte immer wieder, die langen haarigen Beine solch eines Scheusals auf der eignen Stirn oder Hand zu spüren. Endlich begannen die Sinne sich doch zu verwirren. Die Moskitos schienen die schöne Indianer-Melodie zu summen ... Außerdem stachen sie leider auch!
Aus meinem Tagebuche. 20. April. Am Morgen um 7 Uhr stiegen wir zum Fluß hinab, um uns einzuschiffen. Unser Boot wartete schon. Es trägt den stolzen Namen »Orion« mit schwarzen Lettern an seinem grauschmutzigen Bug. Wir kommen nicht weg. Es geht hier alles nicht so schnell, obzwar die »Mannschaft« ums Boot herumwimmelt und unendlich geschäftig tut. Es sind sieben indianische Jünglinge in weißen Hemden und Hosen, barhäuptig und barfüßig. Man nennt sie »balzeros«, auch wenn sie nicht auf einer Balza fahren. Es dauert eine Ewigkeit, bis unser Gepäck verstaut ist. Die notwendigsten Sachen sind natürlich ganz nach unten geraten. Nur die überflüssigen sind zur Hand. Auch haben wir Ladung. Kaffeesäcke. Das steht eigentlich nicht im Kontrakt. Erst um 9 Uhr geht die Fahrt los. Uns zu Häupten kreist sehr niedrig ein Aasgeier. Die Flinte ist unter Kaffeesäcken begraben. Ich schieße mit dem Revolver nach ihm. Natürlich vorbei.
Mit langen Stangen wird das Boot bis in die Mitte gestakt. Nun gehts flußabwärts. Heidi! ist das ein Tempo!
Die Balzeros sitzen alle sieben auf dem Bootsrande, baumeln mit den Beinen im Wasser und lenken mit kurzen Rudern. Ein Steuer gibt es nicht.
Das Boot fliegt vorwärts mit dem Strom. Oft scheint es direkt gegen die Felswände des Ufers zu sausen, wendet sich seitwärts, dreht sich ganz um. Man wird schwindlich, macht seine Rechnung mit Gott und der Welt. An dieser Felsenkante müssen wir zerschellen. Nein. Im eleganten Bogen lenken die Balzeros herum. Sie sind doch vertrauenswürdiger als sie aussehen. Sie kennen den Fluß, der nur aus Stromschnellen zu bestehen scheint, wie ihre fünf Finger. Allmählich gewöhnen wir uns an die rasende Geschwindigkeit. Liegen wie Bratheringe auf den Kaffeesäcken in der Sonne.
Das Frühstück besteht aus Konservenwurst und corned-beef. Wir essen aus der Hand. Aus der eigenen natürlich. Die linke Handfläche dient als Teller, die Finger der rechten – als Gabel. Der Frühstückskorb ist mit der Flinte in den tiefsten Gründen des Bootes verloren gegangen.
Die Ufer des Mapiri-Flusses sind malerisch, aber einförmig, sie ziehen sich auf beiden Seiten ziemlich hoch hinauf. Viel Fächerpalmen. Schmetterlinge fliegen ums Boot, setzen sich auf die blendend weißen Hemden der Balzeros, die sie augenscheinlich für duftiger halten als sie sind.
Ein »Grüner« setzt sich W. auf den Rücken, Sch. bemerkt ihn, L. fängt ihn, ich töte ihn, als einziger Besitzer eines Ätherflakons, jeder beansprucht das Eigentumsrecht. Die Geschichte von den zwei Knaben mit der Nuß in komplizierterer Lesart!
Gegen 5 Uhr langten wir auf der Hazienda von Don Carlos S. gegenüber Guanay an. Wir haben 120 Kilometer in 8 Stunden zurückgelegt ohne einen Ruderschlag zu tun. Vorläufig hat die Bootsfahrt ein Ende. Schade darum. Eine kleine vertrocknete Frau mit großen Fieberaugen und einem fieberkranken Kinde auf dem Arme empfängt uns. Ihr Mann – der »gerente« – ist in den Gommales.
Wir bekamen Tee, welch ein Labsal, amüsierten uns mit einem kleinen grünen Papagei, der in Freiheit dressiert auf Tisch und Stühlen herumspringt.
Uns werden zwei Kammern des Bambuskäfigs, ähnlich denen in Mapiri, angewiesen. Gestampfter Lehmboden. Die Wände sehr durchsichtig. Wir sehen uns nach Spinnen um, finden auch einige, aber harmlose.
Als es dunkel wurde, kam der »gerente« heim. Ein Italiener mit langem roten Rübezahlbart. Das Mittagessen sehr bolivianisch. Altes Fleisch – Stiefelsohlen! Auch hier keine frische Milch. Die gräßlichen Blechbüchsen mit »condensed milk«, die wir schon seit La Paz nicht mehr sehen können und dennoch täglich sehen müssen. Konservenbutter.
Von 8 Uhr an göttlicher Mondschein. Es wird fast taghell. Wunderschön sind die Silhouetten der hohen Palmen, die sich am silbernen Himmel scharf und deutlich abzeichnen. Wir sitzen stundenlang auf dem freien Platz vor dem Hause in Liegestühlen. Trinken die unvermeidlichen Cocktails, die hier übrigens besser sind, und hören aus dem Hause ein wirklich vorzügliches – Grammophon. Fast den ganzen »Faust« mit Geraldine Farrar und Caruso, auch die Tettrazini, Melba, Sembrich, Titto Ruffo, Tamagno. Plötzlich tönen russische Laute an unser Ohr, eine Arie aus »Romeo und Juliette«. Wir fahren auf – Sobinow! Erraten! Ein ganz klein wenig patriotischer Stolz regte sich doch in uns.
Drei Tage genossen wir die Gastfreundschaft des im Beni-Gebiet abwesenden Don Carlos S., auf seiner Hazienda. Die Tage vergehen in den Tropen schneller als anderwo, weil um 6 Uhr mit unerbittlicher Regelmäßigkeit die Nacht anbricht. Wir vertrieben uns die Zeit mit Jagd und Schmetterlingsfang.
Täglich fuhren wir nach Guanay hinüber, das sich eigentlich in nichts von Mapiri unterscheidet. Die Flußüberfahrt ist jedesmal wegen der Stromschnellen ein aufregendes Unternehmen. Es wird dazu eine »Balza« benutzt, ein kleines Floß mit aufwärts gebogenem Schnabel, in der Mitte ein Sitz aus gespaltenem Schilfrohr, der sehr wenig dauerhaft aussieht und es wahrscheinlich auch nicht ist. Zwei Balzeros, die jetzt ihren Namen mit Recht tragen, lenken das Fahrzeug vermittels eines langen Bambusstabes und eines kurzen Ruders. Man muß ein tüchtiges Stück aufwärts fahren und läßt sich dann vom Strom auf die andere Seite reißen. Das Anlegen ist ein Kunststück, das nicht jeder fertig bringt. Man kommt fast nie an der Stelle an Land, die man bei der Abfahrt in Aussicht genommen hat.
Unterhalb Guanays mündet der Goldfluß Tipuani in den Mapiri. Wir wanderten täglich dorthin, um ein Bad in dem wunderbar kühlen, krystallklaren Wasser des Tipuani zu nehmen. Die schmutzigen graugelben Fluten des Mapiri sind wenig einladend zum Baden.
In Guanay lernten wir einen Deutschen, einen Mann mit einem merkwürdigen Schicksal kennen, in dessen Hause wir manche Stunde verplauderten. In Europa als angesehener Fabrikdirektor ohne eigenes Verschulden in Bankrott geraten, war er vor einigen Jahren ohne einen Pfennig in der Tasche in Buenos Aires angelangt. Die Anden überschritt er, indem er sich als Maurer, Anstreicher und Eisenbahnarbeiter den Lebensunterhalt verdiente. In Chile gelang es ihm eine kleine kaufmännische Stellung zu finden, von dort wurde er, als man seine frühere Spezialität erfuhr, mit sehr hohem Gehalt als Direktor an eine Fabrik berufen. Dort gab er entgegen den eigenen Interessen, der Administration den Rat, den Betrieb einzustellen, schnürte wieder sein Bündel und ging von Abenteuerlust ergriffen, auf die Wanderschaft – präziser ausgedrückt – Gold suchen. Da er keins fand und seine Ersparnisse aufgebraucht waren, strandete er in Guanay. Ein echt amerikanisches Lebensschicksal. In der Regel hat ja jeder Mensch nichtamerikanischer Nationalität, den man in Amerika trifft, was zu erzählen, und meistens Interessantes. Der Deutsche, dessen Lebenslauf ich eben kurz skizziert habe, war übrigens ein überaus feiner Kopf, hochgebildet, von großer Energie und mit scharfer Beobachtungsgabe ausgerüstet. Ich glaube an die Zukunft solch eines Menschen, trotz seiner Abenteuerlust und Phantasterei.
Wenn wir auf den merkwürdigsten Sitzgelegenheiten in seiner mit allerhand undefinierbarem Kram angefüllten Stube herumsaßen, und eine köstliche Limonade aus selbstgepflückten Zitronen tranken, erfuhren wir mancherlei Interessantes über das tropische Bolivien aus seinem Munde.
Hier ist das Land, wo starke und rücksichtslose Naturen am vollkommensten zum Genuß ihrer persönlichen Freiheit gelangen. Der Kampf ums Dasein wird mit Waffen geführt, die wir im zivilisierten Europa nicht kennen. Das einzige Recht, das Anspruch auf Geltung hat, ist das Faustrecht, moralisch und physisch. Eine andere Gerichtsbarkeit existiert nur dem Namen nach.
Dort nicht weit am Fluß, z. B., sitzt ein Mann auf einer Hazienda, die ihm nicht gehört. In einem langwierigen Prozeß hat man ihm in La Paz schon vor sechs Jahren das Eigentumsrecht abgesprochen. Dennoch geht er nicht hinaus, sondern exploitiert die Reichtümer der Hazienda ruhig weiter. Was soll man mit dem Manne machen? Eines schönen Tages erschienen zwanzig Polizisten, um ihn zu verhaften oder zu vertreiben. Er ließ es darauf ankommen und setzte sich mit seiner treuen Dienerschaft zur Wehr. Die Polizisten spielten die Klügeren und gaben nach, da sie in der Minderzahl waren. Nach einigen Runden Cocktails schieden sie als die besten Freunde. Weiter hat der Vorfall keine Folgen gehabt. Man kann doch nicht wegen eines renitenten Haziendenbesitzers ein Regiment Soldaten über die Kordillere schicken.
Mord und Totschlag sind im allgemeinen an der Tagesordnung. Die Indianer, gutmütig so lange sie nüchtern sind, morden in betrunkenem Zustande aus reiner Freude am Totschlag als solchem. Sie sind übrigens feige und greifen ihre Opfer nie von vorne, sondern immer von hinten an. In Guanay und Umgegend leben zahllose notorische Mörder, sie leben unbehelligt, froh und munter, obgleich jedermann sie kennt, denn der einzige Polizist des Städtchens hat natürlich keine Kourage, sie zu verhaften.
Tatsache ist ferner, daß in Guanay es niemand wagt, abends Licht in seinem Hause anzuzünden, um meuchelmörderischen Flintenschüssen der Indianer nicht als Zielscheibe zu dienen. Und diese Zustände gelten als vollkommen normal. Kein Mensch regt sich mehr darüber auf. Der allgemeine Kriegszustand ist Regel. »Homo homini lupus est«. An unseres freundlichen Wirtes Bettpfosten hingen zwei Karabiner und ebenso viele Revolver.
In Guanay hörten wir so viel Interessantes und Anziehendes über das Beni-Gebiet, besonders über die Jagdgelegenheiten dort, daß wir den Plan faßten, von Guanay aus den ganzen Mapiri-Fluß hinunter bis zum Beni, dann diesen abwärts bis zum Amazonenstrom und quer durch Brasilien nach Para im nordöstlichen Winkel Südamerikas zu fahren. Wir konnten den Plan nicht ausführen. Jetzt sind wir ganz froh darüber, denn in La Paz hörten wir nachher, daß die Krankheitsgefahr im Beni-Gebiet mit jedem Schritt, den man ins Innere tut, wächst. Ein deutscher Militärarzt, der vor nicht langer Zeit eine Militärexpedition nach dem Beni geleitet hatte, erzählte uns, daß er von 380 Mann nur 120 zurückgebracht hatte. Alle übrigen waren an Beri-Beri und verschiedenen Fieberformen, darunter auch dem gelben Fieber, zugrunde gegangen. Unser Vorhaben scheiterte an dem Umstande, daß es sich als unmöglich herausstellte, Geld von La Paz oder Sorata nach Guanay zu bekommen. Eine regelmäßige Postverbindung existiert dort überhaupt nicht. Die Post nach Mapiri und Guanay wird abgesandt, wenn sich genug angesammelt hat, um einen Indio damit zu beladen. Das kann einmal wöchentlich oder auch nur einmal monatlich sein. Wir saßen gerade in Guanay vor dem Hause unseres deutschen Freundes als der Postbote erschien. Er brach buchstäblich vor der Türe zusammen. Sechs Tage war er von Sorata bis Guanay gelaufen und schien schon so wie so nicht sehr kapitelfest zu sein – ein alter knickebeiniger Indianergreis. Geld kann man dem natürlich nicht anvertrauen. Wir hätten das wissen sollen, denn wir selbst wurden in jenen Gegenden als Geldbriefträger benutzt, mußten eine ziemlich große Summe von La Paz nach Sorata und ebensolcheine von Guanay nach Mapiri bringen. Das einzige Geld übrigens, das hier unten, besonders von den Indianern akzeptiert wird, ist Silber und allenfalls Ein-Boliviano-Scheine, größere Banknoten werden nicht gewechselt. Mit einem Fünf-Boliviano-Schein kann man schon ähnliches erleben, wie der Mann mit der Millionenpfund-Note bei Mark Twain.
Kurz, wir mußten uns entschließen, denselben Weg zurückzugehen, den wir gekommen waren, da man einen anderen Weg, durch das Tal des Tipuani-Flusses, als absolut unpassierbar bezeichnete. So wurde denn der »Orion« wieder instand gesetzt, und die nötige Zahl Balzeros – dieses Mal zehn – angeworben.
Am Morgen des 24. April waren wir reisefertig, kamen jedoch nicht zur Zeit weg, denn als wir im Begriff waren, unser Boot zu besteigen, ertönte ein Freudengeschrei am Ufer des Flusses: Don Carlos S. kehrte vom Beni heim. Bei der Biegung des Mapiri unterhalb Guanay zeigte sich sein Boot. Langsam schob es sich längs dem Ufer herauf. Zwanzig Balzeros purzelten übereinander, um es schneller vorwärts zu bekommen.
Diese Heimkehr war ein stolzer Anblick. Auf dem Mast des Bootes wehte die grün-gelb-weiße bolivianische Flagge, hoch auf dem Sonnendach hockte ein mitgebrachter prächtiger, grauschwarzer Affe. Vorne am Bug auf einer Ladung mächtiger Gummiballen stand Don Carlos S., der reine Lohengrin, eine Hünenfigur mit kurzverschnittenem, blonden Bart, der wie ein Heiligenschein das schwarzbraun gebrannte Gesicht umgab. Vier Monate war der Hausherr abwesend gewesen. Seine Frau begrüßte der blonde Riese mit einem Händedruck. Doch beider Augen leuchteten. Das ganze Personal der Hazienda überbot sich in Freudenäußerungen bei der Begrüßung. Da konnten wir nicht zurückstehen. Ein Trunk Löwenbräu besiegelte unsere Bekanntschaft. Dazu hörten wir allerlei interessante Geschichten über das Beni-Gebiet, Tapirjagden, Affenfang und ähnliches.
Die Fahrt des Bootes flußaufwärts, die wir ein Stückchen mit angesehen hatten, gab uns einen Begriff davon, was uns bevorstand. Tatsächlich brauchten wir für die Strecke, die wir in 8 Stunden abwärts gesaust waren, bei der Rückfahrt nicht mehr und nicht weniger, als genau sechs Mal 24 Stunden.
Die Zeit drängte, wir mußten aufbrechen, wenn wir überhaupt noch wegkommen wollten. Gegen Mittag schieden wir mit kräftigem Händedruck von Don Carlos S. und seinen Leuten, die uns so freundliche Gastfreundschaft gewährt hatten.
Aus meinem Tagebuch. 24. April. Da sind wir wieder an Bord des »Orion«. Das ganze Boot ist vollgepackt mit unseren Sachen. Es scheinen immer mehr zu werden. Um 12¼ stoßen wir ab. Aus Guanay winkt man uns Abschiedsgrüße zu. Die Fahrt stromaufwärts scheint wenig erheiternd zu werden. Das Boot ruckt, schwankt, stößt, kratzt auf den Steinen. Wir fahren mit vier Balzeros ab, die übrigen sammeln wir langsam am Ufer aus ihren Häusern auf, reißen sie, beziehungsweise, aus den Armen ihrer liebenden Gattinnen. Jeder bringt eine Bastmatte und ein Bündel Proviant mit. Vier Nächte am Ufer des Flusses ist das Wenigste, was man uns in Aussicht gestellt hat.
Die Technik des Balzeros ist höchst mannigfaltig. Bald werden wir an langen, grauen Bindfäden gezogen, bald gestakt mit langen Bambusstäben, bald gerudert, bald geschoben. Zuweilen dreht sich das Boot um und fährt trotz aller Bemühungen abwärts. Das passiert jedesmal, wenn wir das andere Ufer mit der geringeren Stromschnelligkeit gewinnen wollen. Die Balzeros sind oft bis an die Brust im Wasser. Sie springen wie die Ratten aus dem Boot und wieder hinein. Dabei bekommen wir jedesmal eine Douche. Mit affenartiger Geschwindigkeit wechseln die Burschen ihr Handwerkszeug. Das ist für uns mit Lebensgefahr verbunden. Die Ruder fliegen uns um die Köpfe, die Stricke schlingen sich um unsere Beine, nächstens werden wir an den langen Stecken aufgespießt.
Um 2 Uhr machen wir eine Pause. Holen den Anführer unserer Balzeros ab. Wir müssen in seiner Hütte einkehren. Sie liegt höchst malerisch, von Bananenstauden umgeben, dicht am Wasser. Seine Frau, ein hübsches, aber nicht ganz sauberes Indianerweib kredenzte uns »Chicha«, das nationale Indianergetränk. Wir mußten es trinken, nicht ohne heimliches Grausen. Eine Absage wäre eine tödliche Beleidigung gewesen. Es schmeckt gräßlich, besonders wenn man die Zubereitungsart kennt. Der Hauptbestandteil ist gekauter – jawohl gekauter – Mais! Die Indianer sehen dort im Mapiri-Gebiete alle aus als ob sie die fürchterlichsten Zahngeschwüre hätten. Jeder trägt einen Ballen Mais in der Backentasche, an dem er herumkaut. Abends wird der ganze Vorrat, den die Familie tagsüber gekaut hat, zusammengeschüttet, mit Wasser und etwas Schafsmilch versetzt und zum Gären gebracht. Das ist »Chicha«. Guten Appetit!
Unser Balzero hat auch eine Schnapsdestillation, die er uns voller Stolz zeigte. Sie besteht aus einem Lehmofen und zwei Schweinetrögen. Das ist der ganze Apparat, den ein Weib bedient. Auf welche Weise darin aus Zuckerrohr zwanziggrädiger Spiritus gewonnen wird, bleibt rätselhaft. Wir nehmen einige Flaschen für unsere Jungens mit. Hoffentlich betrinken sie sich nicht gleich von vorneherein.
Kurz vor sechs Uhr legen wir an einer steinigen Uferstelle an. In der Dunkelheit ist man auf dem Fluß vollständig verloren. Die Balzeros bauen aus hohen Palmenschäften zwei Dreiecke auf, die durch eine Stange verbunden werden. Darüber wird ein Segeltuch gehängt – unser Zelt ist fertig. Die vier Betten haben genau Platz darin!
Wir sammeln Holz am Ufer und am Waldesrande. Sch. ist unser vereidigter Feuerwerker. Er bringt ein prächtiges Feuer zustande. Assessor W. kocht. Er hat seinen Beruf verfehlt. Menü: Rumford-Suppe (irgend jemand behauptet, daß sie so heißt, weil man immer mit dem Löffel drin »rumfohrt«), corned-beef mit jungen Erbsen. Dann Tee, Tee in unendlichsten Quantitäten. Zum Tee hatten wir noch einen Kessel reinen Wassers mit. Die Suppe wurde aus dem gelbschmutzigen sandigen Mapiriwasser gekocht. Die schüchternen Versuche, das Wasser durch ein Taschentuch zu filtrieren, verliefen ziemlich ergebnislos. Mit viel List und Tücke wurden die Moskitonetze aufgehängt. Um 9 Uhr steckten wir in den Schlafsäcken.
25. April. Um 5 Uhr heraus. Fast gar nicht geschlafen. Erstens der Mondschein; zweitens – die Ameisen! Scheußliche Bestien! Es gibt hier von allen Größen welche. Sie krabbeln an den Bettpfosten herauf unter das Netz. Keine Hilfe.
Vor dem Frühstück ein herrliches Bad in einem Gebirgsbach, der in den Mapiri mündet.
Das Boot liegt voller Bananen und süßer Zitronen, die uns die Balzeros gebracht haben. Einer behauptet eben, sich ein Bein verstaucht zu haben. Ich glaube, er ist einfach faul und simuliert. Jetzt sitzt er mit einem Gesicht, als wäre seine ganze Verwandtschaft gestorben, auf dem Deck des Bootes.
Es geht kaum vorwärts, jeder Zentimeter des Stromes muß förmlich erobert werden. Die übrigen sieben Jungens arbeiten großartig. Ratsch! Da sind die Näßlinge wieder im Boot.
Abends dasselbe Bild wie gestern. Erbswurstsuppe. Auch der Tee aus schmutzigem Wasser. Er schmeckt aber doch. Nach dem Essen machten wir das Feuer hoch und blieben bei einer Flasche Portwein lange wach. Am gegenüberliegenden Ufer eine Million Leuchtkäfer. Um unser Zelt ein betäubendes Konzert von Grillen und anderem Nachtgetier.
26. April. Dank einer wahrhaft genial erdachten Konstruktion meines Moskitonetzes hatte ich diese Nacht auch vor Ameisen Ruhe. Die anderen sind recht verbeult. Die Balzeros haben uns heute ein tadelloses Sonnendach aus ihren Matten errichtet. Wir liegen uns zuzweit gegenüber. Sch. schnitzt sich einen Bambusstock. W. erzählt Soldatengeschichten, L. repariert ein Schmetterlingsnetz. Sonst das übliche Bild: sechs Balzeros im Wasser, ziehend, schiebend, stoßend, einer mit einem langen Staken vorne am Bug, einer (der mit dem kranken Bein) sauer und böse am Heck. Es ist unglaublich heiß. Wir zerfließen buchstäblich.
Hopp! Da sind Sch. und W. auch schon im Wasser.
Am Nachmittag kamen wir an einer frischen Quelle vorüber und versorgten uns mit Trinkwasser. Während der Frühstückspause machten wir Versuche, vermittelst Dynamitpatronen Fische zu fangen. Die Patronen explodierten zwar, aber meist erst dann, wenn die Fische, denen sie galten, schon 3 Kilometer flußabwärts waren.
An einer Insel versprach mir der Anführer der Balzeros eine Jagd auf Bergpfauen. Wir stiegen eine Stunde lang im Dickicht der Insel umher. Wer nicht da waren, waren die Bergpfauen. Dafür gelbe Papageien, und einige wilde Tauben, – die ganze Beute.
Abends machte Sch. ein wahres Höllenfeuer an. Die Landschaft ist entzückend. Eine stille Bucht. Fächerpalmen und eine Art Trauerweide, deren Zweige weit übers Wasser hinaushängen, das vom Wiederschein des Feuers blutig rot gefärbt ist. Soeben eröffnete uns der Balzero-General, daß wir noch mindestens drei Tage bis Mapiri haben. Nicht alle sind zufrieden damit. Mir ist es recht. Diese herrlichen Abende am Flußufer sind mit gar nichts zu vergleichen, man kann nicht genug davon erleben. Eine höchst romantische Lederstrumpf-Stimmung. W. übt Keulenschwingen mit glühenden Bambusstäben am Waldesrande. Die funkelnden Kreise auf der schwarzen Laubwand sehen großartig phantastisch aus.




In derselben Tonart klingt mein Tagebuch weiter. Besondere Erlebnisse hatten wir keine. Wir genossen das Leben auf, in und an dem Flusse. In Mapiri langten wir am 1. Mai um die Mittagsstunde an. Wir fanden das ganze Bild unverändert, auch unseren holländischen Freund ohne Beine. W. und ich machten uns sofort zu Fuß nach San Carlos auf, da wir unsere Maultiere nicht vorfanden. Unterwegs erlegte ich einen Kondor, was ich schon, nicht ohne Stolz, erzählt habe. Im übrigen war die achtstündige Wanderung eine Qual. Wir hatten die Sonnenglut und die große Steigung, die es zu überwinden galt, nicht in Betracht gezogen, als wir uns nach dem langen Sitzen im Boot, »die Füße ein wenig vertreten« wollten. Außerdem hatten wir die Zeit falsch berechnet und mußten die letzte Wegstrecke von ½7 bis 8 in absoluter Finsternis durch den Urwald tappen.
Erst am Abend des nächsten Tages langten unsere Gefährten mit dem Gepäck an. Wir gönnten uns zwei Ruhetage in San Carlos. Dann mußten wir wohl oder übel daran denken, wieder über die Kordillere nach Hause, d. h. nach La Paz, zu steigen.
Die Zeit drängte insofern, als die Jahreszeit vorrückte. Der erste Wintermonat stand vor der Tür. Von Juni an ist der Yachazani-Paß überhaupt nicht mehr zu überschreiten.
Ungern, sehr ungern schieden wir von San Carlos, seinen liebenswürdigen Bewohnern und – den Schmetterlingen, die nun wieder Ruhe haben sollten.
Unser braver Don Botello war mit dem langen Aufenthalte, den wir in dem tropischen Gebiete gehabt hatten, sehr unzufrieden. Seine Maultiere, gewöhnt an die Höhenluft, vertrugen das Klima nicht und wurden von Tag zu Tag magerer und matter, obgleich sie ein faules Leben, herrlich und in Freuden, auf den saftigen Weideplätzen der Hazienda, führten. Mit einigem Bangen sahen wir die dürren Gestelle an, als sie uns am Morgen des 2. Mai vorgeführt wurden. Als wir uns aufsetzten, fürchteten wir, daß sie in die Knie brechen würden. Doch konnten wir uns keine Tierschutzverein-Sentimentalitäten erlauben. Die Kordillere mußte überschritten werden und zwar sofort und ohne Aufenthalt, das weitere Schicksal der Maultiere durfte uns nicht interessieren.
Die Befürchtung, daß der Weg, den wir ja schon kannten, auf der Rückreise langweilig erscheinen würde, bestätigte sich nicht. Im Gegenteil, die Rückreise wurde kurzweiliger und unterhaltender, als wir voraussetzen konnten, meistenteils freilich in einem Sinne, der uns nicht recht lieb war.
So mußten wir, z. B. am zweiten Tage schon um 5 Uhr morgens aus den Schlafsäcken kriechen: der »Amargurani«-Aufstieg lag vor uns. Hatten wir auf der Hinreise den Weg reichlich schlecht gefunden, so war uns der Name »Amargurani« doch etwas übertrieben erschienen, wenigstens im Vergleich zu anderen Wegstrecken, die reichlich ebenso »bitter« waren. Aber damals waren wir abwärts gestiegen. Außerdem milderten die wunderbaren ersten Eindrücke der einsetzenden tropischen Vegetation die Beschwerlichkeiten sehr erheblich. Man war viel zu beschäftigt mit allen Details des eigenartigen, für uns durchaus neuen landschaftlichen Bildes, um viel auf die Schwierigkeiten des Abstieges zu achten. Jetzt galt es, dieselbe Strecke hinaufzuklettern. Die Tropenpracht der Wälder war durch das im Mapiri-Gebiete Gesehene weit übertroffen worden, reizte das Interesse infolgedessen längst nicht im früheren Maße. Außerdem war der Weg durch die inzwischen niedergegangenen Regengüsse stellenweise buchstäblich grundlos geworden. Von Reiten war keine Rede. Vierzehn Stunden sind wir von Lorenzo Pata bis Tola Pampa hinaufgekeucht. Obgleich wir um 4 Uhr morgens aufbrachen, durfte keine Minute verloren werden, wenn wir nicht vor dem Ziel von der Dunkelheit überrascht werden wollten.
Die Witterungsverhältnisse dabei waren folgende: wir ritten in rabenschwarzer Nacht aus, die Don Botello vergebens mit einem Lichtstümpfchen zu erleuchten bemüht war. Man sah nicht die Ohren des eigenen Maultieres vor sich. Nach einer Viertelstunde ging ein Wolkenbruch auf uns nieder, wie ich ihn selbst in den Tropen noch nicht erlebt hatte. Im Nu war kein trockener Faden mehr an Roß und Reiter. Gleichzeitig brach ein Gewitter von unglaublicher Heftigkeit los. Nach jedem Schlag kniff man sich ins Bein, um sich zu vergewissern, daß man nicht verkohlt war. Für Sekunden erleuchteten die Blitze den Weg, der dann gleich darauf in dreifach verdichtete Finsternis getaucht war. Die zwei Stunden bis zum Sonnenaufgange dauerten eine Ewigkeit. Wir waren gerade am Fuße des Hauptanstieges angelangt. Das Gewitter verzog sich. Dafür begann mit dem Sonnenaufgange die Tropenglut. Als unliebsame Begleiter stiegen mit uns dicke weiße Nebeldämpfe aus dem Tal in die Höhe. Im Gebiete der Vegetationsgrenze verdichteten sie sich zu einer feuchten, undurchdringlich scheinenden Wand. Amagurani! Jetzt konnten wir die »Bitternis« Schritt für Schritt schmecken. Als wir in dem schon geschilderten »Grand Hotel« Tola Pampa anlangten, fielen wir gleich toten Ratten auf unsere Betten und hatten das Gefühl, als müßten wir die sich lockernden Muskeln mit Bindfaden an die Knochen binden.
Der Nebel verließ uns in der Höhe nicht mehr. Der beginnende Winter machte sich geltend. Das wurde uns bald noch überzeugender zum Bewußtsein gebracht. Von Injenio, dem alten Inka-Dorfe, das dieses Mal einen noch rauheren, phantastischeren Eindruck machte, begann der Aufstieg zum Yachazani-Paß. Nach drei Stunden trafen wir die ersten Spuren frisch gefallenen Schnees. Der feine Regen, in dem wir ausgeritten waren, verdichtete sich zu einem regelrechten Schneegestöber.
Der Eindruck, den die Kordillere bei solch einem Wetter macht, ist der einer fast beängstigenden, rauhen und schroffen Wildheit. Es war hundekalt. Weder Sweater noch Poncho, noch Lederjacke boten genügend Schutz gegen Frost, Wind und Schnee. Dabei das erbarmungslos langsame Begräbnistempo, in dem die Mulas den verschneiten Weg hinankrochen! Der schneidende Wind raubte ihnen augenscheinlich den letzten Rest von Atem, den sie noch hatten. Man glaubte jeden Augenblick, daß einem die Füße abfrieren würden. Absteigen war nicht ratsam, denn man hätte bis an die halben Waden im Schnee waten müssen.
Auf dem höchsten Punkte des Passes ließ das Schneegestöber nach. Die Wolken ballten sich zusammen und krönten die Bergspitzen, die uns umgaben. Der Himmel wurde klar. Eine Symphonie von Blau und Weiß ringsumher, wie man sie in solch makelloser Reinheit und Schönheit wohl selten zu sehen bekommt. Schade, daß es zu kalt war, um dieses einzigartige Bild lange zu genießen. Uns fehlten seit einigen Tagen auch die künstlichen Wärmemittel. Ein Gemisch aus Brennspiritus und Wasser war doch nur ein sehr mangelhafter Ersatz für Whisky und Kognak.
Abgestiegen und im Laufschritte hinunter! Die Wärme, nach der wir uns so sehnten, wurde uns bald im Übermaße zuteil. Die fünf Stunden Abstieg vom Yachazani-Paß nach Sorata bringen einen in dieser Jahreszeit aus Eis und Schnee direkt in die Tropentemperatur von 30-35 Grad Celsius – ein Temperaturwechsel, wie man ihn schärfer anderswo kaum erleben kann. Ein Kleidungsstück nach dem anderen wurde den Mulas aufgeladen, bis das Tropen-Déshabillé glücklich wieder erreicht war.
Kurz vor Sorata, beim Passieren eines Indianerdorfes, hatten wir Gelegenheit, das höchst interessante Leben und Treiben bei einer indianischen Festlichkeit mitanzusehen. Es wurde eine Hochzeit gefeiert. Das gibt sämtlichen Bewohnern des Dorfes Anlaß, nicht mehr und nicht weniger als eine volle Woche lang sich unentwegt zu betrinken und ebenso unentwegt zu tanzen. Was die Indianer im Tanzen leisten können, grenzt ans Unwahrscheinliche. Es gibt Burschen, die von Sonnenaufgang bis zur Dunkelheit in unausgesetzter Bewegung sind. Eine Art Extase, ähnlich dem Delirium der indischen Drehderwische, scheint sie zu überkommen. In Gruppen von zehn bis fünfzehn Mann drehen sie sich in langsamen gemessenen Bewegungen, deren Tempo nur selten gesteigert wird, im Kreise und um die eigene Achse herum. Sie sind alle im Festtagskleide, oder irgend einem spezifisch indianischen, phantastischen Maskenanzuge. Hier ist eine Gruppe im herrlichsten Federschmuck, auf dem Kopf ein meterhoher Aufputz von vielfarbigen Papageifedern, der Oberkörper nackt, von der Taille bis zu den Knien wieder eine Art Ballettröckchen von grellgrünen oder roten, in dichten Kränzen aneinandergefügten Federn. Dort eine andere Gruppe hat sich mit Tigerfellen geschmückt. Sie haben eine Art Panzer aus den harten Fellen gebogen, der in Beulen von Rücken, Schultern und Brust absteht, die Beine stecken in Hosen und nur die Rückseite ist mit einer mächtigen grünen Federtournüre ausgestattet. Die Kerls sehen aberwitzig aus, drehen sich stieren Blickes in die Runde, wobei sie sich auf langen Flöten eine grauenhaft mißtönende Musik selber liefern.
Eine andere Gruppe hat abschreckende Tier- und Teufelsmasken vorgebunden, sie schwingen dreigezackte Kriegsspeere und springen mit unmelodischem Geheul regellos durcheinander. Der ganze Dorfplatz scheint sich zu drehen. Dem Zuschauer wird nach zehn Minuten schwindlich zu Mute, man begreift nicht, wie es die Tänzer stundenlang aushalten, ohne Rast und Ruhe in die Runde zu wirbeln.
Hin und wieder verläßt eine Gruppe den Platz, torkelt und taumelt im Gänsemarsch durch ein paar Straßen, um jedoch bald wieder auf den Ausgangspunkt zurückzukommen. In einigen Gruppen machen Knaben von zehn Jahren aufwärts mit. Nur sekundenlang sind die Pausen, in denen ein tiefer Zug aus der kreisenden Flasche mit Patinno-Schnaps getan wird. Die Tänzer scheinen alle total vertiert, in Blick und Ausdruck haben sie nichts Menschliches mehr an sich. Seit vier Tagen erlebt keiner von ihnen eine nüchterne Minute. Doch sind es ausschließlich Männer, die sich an diesem wahnwitzigen Treiben beteiligen. Die Frauen halten sich zaghaft im Hintergrunde. Sie sehen mit glänzenden bewundernden Blicken ihre taumelnden Ehegesponse an und sind glücklich, wenn sie die vor Erschöpfung niedersinkenden Tänzer mit einem Schluck kühler »Chicha« wieder auf die Beine bringen dürfen. Vor Zuschauern haben diese exotischen Tänzer übrigens nicht die geringste Scheu, auch nicht vor photographischen Apparaten. Mir schien, daß kein einziger von ihnen mehr begriff, was überhaupt um ihn herum vorging.
Gegen 5 Uhr nachmittags erreichten wir Sorata und das gastliche Haus seines »Königs« G. Das Städtchen erschien nach den kulturellen Entbehrungen der letzten fünf Wochen wie ein kleines Paris. Ich glaubte, nie einen herrlicheren Konzertflügel unter den Händen gehabt zu haben, als das alte gelbgezähnte Scheusal von Pianino, das dem Salon des G.'schen Hauses als Zimmerzier diente.
Wir waren in Sorata an einem aufregenden Tage angelangt, dem Tage der Präsidentenwahl. An diesem Tage herrschte in Sorata eine ganz fürchterliche Besoffenheit. Soweit die indianischen Bewohner der Stadt nicht in der Gasse lagen, zogen sie mit Pfeifen, Singen und Gebrüll durch die Straßen und trugen den Kaufpreis ihrer Wahlzettel aus einer Kneipe in die andere. Bis in den frühen Morgen hörte man an allen Enden und Ecken der Stadt das unmelodische, sinnlose Geklimper der »Charangos«, einer Art Gitarre, deren Leib aus dem Panzer eines Gürteltieres besteht, dem beliebtesten Instrument der städtischen Indianer.
Im gastfreien Hause des »Königs von Sorata« durften wir uns, dank der überaus liebenswürdigen Einladung des Hausherrn, drei Ruhetage gönnen. Wir konnten sie nach den Strapazen des zweiten Kordilleren-Überganges gut gebrauchen. Es würde zu weit führen, wollte ich noch alle die schönen Ausflüge, die wir zu Fuß und zu Maultier von Sorata aus machten, im einzelnen beschreiben. An den Abenden versammelten wir uns meist auf der luftigen Terrasse des Hauses, die in einen paradiesischen Tropengarten hineinragt, zu einem echt deutschen Skat. Das heißt ganz deutsch war er nicht immer. Wenn der spanische Arzt des Städtchens zu unseren Partnern gehörte, wurde auf spanisch gespielt. Die spezifisch deutschen Skatausdrücke nehmen sich in der Sprache des Cervantes höchst kurios aus: »sastre« (Schneider), »negro« (schwarz), »curazon« (Herzen) usw.
Erst am vierten Tage wurde uns gestattet, von einer langentbehrten Kulturerrungenschaft – dem Telegraphen – Gebrauch zu machen, und eine Kutsche von La Paz nach Achecachi zu bestellen. Bis Achecachi mußten wir noch einen Tag per Maultier reisen. Nicht ohne Bedauern nahm ich – sicherlich für lange, wenn nicht für immer – von dieser Verkehrsmethode Abschied. Hat man sich erst an den Fischgabelsitz in den bolivianischen Gebirgssätteln gewöhnt und sein Temperament dem des Maultieres angepaßt, so ist es ein Hochgenuß, langsam und gemütlich durch die herrliche Gebirgswelt der Kordillere zu reiten. Auf den Weg braucht man nicht aufzupassen. Das besorgen die Tiere. Man genießt die wundervoll reine Luft, die wilde weite Aussicht und läßt seine Gedanken weithin in die Ferne schweifen.
Die Reise bis La Paz verlief ohne bemerkenswerte Erlebnisse. Kurz vor der Stadt, noch im Wagen, überfiel meinen Gefährten ein heftiger Fieberanfall, dasselbe Schicksal ereilte gleich nach der Ankunft in La Paz noch einen Teilnehmer unserer Reise, den kerngesunden und vergnügten Sch. Übrigens sind die unvergeßlichen Eindrücke solch einer Reise im Tropengebiete mit ein paar tüchtigen Schüttelfrösten nicht zu teuer bezahlt.






Der Abschied von La Paz wurde uns schwer. Nicht ohne Wehmut schieden wir von Bolivien. Erstens mußten wir uns nun von unseren beiden Reisegefährten und den zahlreichen lieben Freunden, die wir uns während des ziemlich langen Aufenthaltes in La Paz erworben hatten, trennen. Zweitens scheint uns – hoffentlich zu Unrecht – daß der interessanteste Teil der Reise jetzt hinter uns liegt.
Die Verbindung zwischen La Paz und der peruanischen Küste kann keineswegs bequem genannt werden. Sie besteht aus drei Etappen: Eisenbahnfahrt bis zum Titicaca-See, Dampferfahrt über den See nach Puno, Eisenbahnfahrt vom Peruanischen Ufer des Sees bis zur Küstenstadt Mollendo. Nun scheinen leider die drei Betriebsgesellschaften in Fehde miteinander zu leben. Man kann nie mit Sicherheit darauf rechnen, daß man Anschluß findet. Verspätet man sich auf einer der beiden ersten Etappen, so ist man verloren, denn die Dampfer auf dem Titicaca-See und die peruanischen Schnellzüge verkehren nur zweimal in der Woche. Gewartet wird nicht. Das ist besonders ärgerlich, wenn man in Mollendo einen bestimmten von den auch nicht allzu häufig verkehrenden Küstendampfern erreichen will.
Die bolivianische Hochebene, die wir zweimal im Wagen passiert hatten, durchquerten wir nun im Eisenbahn-Coupé. Kein Mensch wird behaupten, daß der enge Waggon mit seinen schlüpfrigen Wachstuchpolstern bequemer wäre, als der geräumige Phaeton. Aber reizvoll war die Fahrt auch so. Zum letzten Mal verabschiedeten wir uns vom majestätischen Illimani und seinen schneegekrönten Trabanten.
Die interessanteste Station auf dieser Eisenbahnfahrt ist Tiguanaco – eine uralte, von Einwohnern fast verlassene Inka-Stadt. Als der Zug hielt, stürzte eine Horde schmutziger Indianerbuben in den Waggon herein. Mit ohrenbetäubendem Geschrei priesen sie »Reiseandenken« an, zerbrochene Löffel und verrostete Stricknadeln, die sie für Pfeilspitzen und prähistorischen indianischen Hausrat ausgaben. Als Goldplättchen alter Inka-Schätze konnte man zusammengeknetete Kapseln von Subercaseaux- und Santa Rita-Flaschen, chilenischen Weinsorten, erstehen. Ja, an diesen Plätzen eines lebhafteren Fremdenverkehrs muß man beim Einkauf von Antiquitäten vorsichtig sein.
Die Stadt Tiguanaco mit ihren grandiosen Inka-Ruinen, die nun allerdings fraglos echt sind, bietet von weitem einen sehr pittoresken Anblick. In der Nähe konnten wir sie leider nicht besehen.
Den Titicaca-See erreichten wir nach Anbruch der Dunkelheit. Glücklicherweise verspäteten wir uns nicht und fanden im Hafen einen zwar sehr kleinen, aber äußerst appetitlichen Dampfer vor, der natürlich »Inka« hieß. Die Pietät, mit der man dieses durch die brutalen Eroberer ausgerotteten stolzen Volksstammes gedenkt, ist wirklich rührend.
Die Überfahrt über den Titicaca-See dauerte eine ganze Nacht. Es war herrlichster Mondschein, als der »Inka« seine Anker lichtete. Die schwarze Silhouette der Königskordillere hob sich ordentlich gespenstisch vom hellen Nachthimmel ab. Wie ein silberner Strom teilte die glitzernde Mondstraße die unergründlichen schwarzen Fluten des Sees. Allmählich verdüsterte sich jedoch der Himmel. Es wurde empfindlich kalt und windig, die Fahrt des »Inka« immer weniger stolz und immer unruhiger. Plötzlich setzte ein regelrechter Schneesturm ein. Nicht schnell genug konnte man in die winzige Kabine flüchten. Kolossale Schneemassen fegten über das Verdeck. Man muß in dieser Gegend auf die merkwürdigsten Überraschungen gefaßt sein. Am nächsten Morgen noch lag auf Bug und Achterdeck des Dampfers eine dichte Schneedecke, die die Sonne freilich schnell zum Schmelzen brachte.
Die Eisenbahnfahrt vom Ufer des Titicaca-Sees an die peruanische Küste des Stillen Ozeans ist sicherlich eine der schönsten, interessantesten und aufregendsten, die man auf den fünf Erdteilen machen kann. Der Höhenunterschied zwischen beiden Endstationen beträgt mehr als 4000 Meter. Man legt die Strecke in ca. 12 Stunden zurück. Der Zug rast mit atemversetzender, echt amerikanischer Geschwindigkeit vorwärts, obgleich der Winkel des Gefälles oft ein beträchtlicher ist, und kühne Kurven das Geleise nur meterweit an gähnenden Abgründen vorbeiführen. Die Passagiere des Pullman-Wagens fliegen von ihren Sesseln nicht selten unerwarteter und meistens unerwünschter Weise einander in die Arme. Zwischendurch promeniert der Schaffner und erzählt in lässigem Spanisch wenig erheiternde Anekdoten von abgestürzten Eisenbahnzügen.
Die ganze Fahrt über hat man die herrlichste Hochgebirgs-Landschaft vor Augen. Ein Panorama mit den charakteristischen, schon oft geschilderten Farbenspielen der Kordillere. Hier ist die Färbung vorzugsweise hellrosa oder rötlich braun. Weite Strecken des Gerölls sind mit feinem hellgrauen Sande bedeckt. Es sieht aus, als hätte man Decken aus zartestem schwedischen Leder über die Berge gebreitet. In einigen Talkesseln fegt der Wind diesen Sand zusammen, und es bilden sich merkwürdige Hügel, die einander so genau gleichen, als seien sie aus einer Form gegossen. Sie ähneln den Kratern kleiner Vulkane, oder den Brustwehren alter Burgen, denn von einer Seite – woher der Wind weht – sind sie offen. Natürlich wird diese Menge von Flugsand dem Bahnbetriebe oft gefährlich.
Der Zug hält auch bei den wichtigsten Stationen, den Schwefelbädern Jura und der peruanischen »Großstadt« Arequipa nur wenige Minuten.
Arequipa ist im fruchtbarsten Teil des peruanischen Küstengebietes gelegen (immerhin noch 2500 Meter hoch). Hier fließen eine ganze Menge kleiner Gebirgsflüsse zusammen. Man kann ihren Lauf vom Eisenbahnwagen aus weithin verfolgen. Gleich schmalen grünen Bändern ziehen sie sich durch das öde, unwirtliche Gestein. Fast unwahrscheinlich wirkt dank seiner absolut regelmäßigen, geradezu mathematisch genauen Kegelform der schneebedeckte Vulkan Misti, der das Landschaftsbild von Arequipa krönt.
Ein grauenvolles kleines Nest ist die sonnendurchglühte Hafenstadt Mollendo. Hier muß man seine Ansprüche auf Komfort auf ein nicht mehr zu unterbietendes Minimum herunterschrauben.
In der Stadt selbst und in ihrer Umgebung fehlt, ebenso wie in den chilenischen Küstenstädten, jede Spur vegetativen Lebens. Die Sonnenstrahlen prallen überall auf nacktes Gestein und strahlen mit verdoppelter Glut zurück. Ganz wundervoll ist hier allerdings die Ozeanbrandung, die himmelhoch über das weit in die See hineingebaute Hafenbollwerk herüberschäumt.
So schön die Wellen der Brandung aus der Entfernung aussehen, so wenig angenehm sind sie, wenn man sich auf ihnen schaukeln muß. Und das muß man leider.
Die Küstendampfer ankern weit draußen auf der Reede. Kleine Ruderböte, die wie Nußschalen auf den majestätisch dem Ufer zurollenden Wogen herumtanzen, besorgen den Verkehr mit dem Hafen. Nie in meinem Leben habe ich eine ungemütlichere Ruderpartie gemacht. Die Böte haben außer dem Ruderknecht noch eine andere ständige Bemannung: ein bis zwei Knaben, die das immerfort hereinschlagende Wasser ausschöpfen. Eine nicht geringe Geschicklichkeit gehört auch dazu, um zu verhindern, daß das Boot beim Anlegen an die Falltreppe des Dampfers umkippt oder zerschellt. Als ich das gehörig schwankende Deck der »Orissa« betrat, kam es mir nach dieser fürchterlichen Ruderpartie vor, als hätte ich endlich wieder festen Boden unter den Füßen.
Die Küstenfahrt bietet keinerlei neue Eindrücke, sondern immer nur dasselbe Bild, das wir von der Fahrt zwischen Valparaiso und Antofogasta her schon genugsam kannten. In zwei Tagen brachte uns die »Orissa« nach Callao.
Callao ist der Hafen der peruanischen Haupt- und Residenzstadt Lima. Hier zum ersten Male zeigt die pazifische Küste Süd-Amerikas ein etwas freundlicheres Aussehen. Mit Behagen ruht das Auge auf dem saftigen Grün der üppigen tropischen Vegetation, die sich bis dicht an den Ozean hinzieht.
Callao und Lima sind durch eine elektrische Bahn verbunden. Die Fahrt dauert eine knappe halbe Stunde. Von allen Städten der Westküste Süd-Amerikas ist Lima ohne Frage die europäischste. Breite, gutgepflasterte Straßen, konventionelle Regierungsgebäude, anständige Hotels, vorzügliche Läden, Droschken im Stil der Wiener Fiaker, Automobile, gute Restaurants, in denen die Speisenzubereitung nach den bolivianischen Stiefelsohlen geradezu raffiniert, lukullisch erscheint. Alles in allem: recht kulturell, aber – uninteressant.
Nur eine Merkwürdigkeit, eine »Spezialität« von Lima kann ich nicht unerwähnt lassen. In einem fashionablen Laden wurde sie uns als »Reiseandenken« angeboten, jedenfalls war es das sonderbarste Souvenir, dem ich je begegnet bin, denn es war nichts anderes, als – der Kopf, nicht Jochannaans, sondern eines indianischen Mädchens. Keine Nachahmung, kein Papier-maché, kein bluff, sondern echt. Der Kopf eines einst lebendig gewesenen Menschen, oder der Kopf einer Leiche, wie man will. Kein nackter Totenschädel, sondern ein virtuos balsamiertes menschliches Gesicht, mit Glasaugen und langem Haarschopf. Nur die Haut ein wenig verschrumpft. Mir schauderte, als ich mir dieses anmutige Reiseandenken auf meinem Schreibtisch als Briefbeschwerer, oder unter einer Glasglocke in der guten Stube vorstellte.
Die Europäer in Lima treiben mit diesen Scheußlichkeiten einen schwunghaften Handel. Der Absatz ist enorm. Die Indianer, die sehr rasch begriffen, daß ihre Leichenköpfe als Handelsartikel gut bezahlt wurden, fingen an, Freund und Feind hinzumorden, balsamierten ihre Köpfe ein und brachten sie in großen Mengen auf den Markt. Da erst legte sich die Regierung ins Mittel. Jetzt dürfen nur »alte« Köpfe verkauft werden, während »frische« verpönt sind. Aber wer wagt es zu entscheiden, ob solch eine Mumie von gestern oder von anno dazumal stammt? Jedenfalls ist der Artikel rar geworden und infolgedessen im Preise gestiegen. Der Kopf, der uns angeboten wurde, sollte 50 englische Pfund kosten. Ich hätte ebensoviel zugezahlt, um ihn nicht zu besitzen.
Mit diesem unappetitlichen Eindruck schieden wir von Lima. Der peruanische Küstendampfer »Guatemala« nahm uns auf. In acht Tagen soll er uns nach Panama bringen.



Durch drei Dinge ist Panama berühmt. Erstens durch den Panama-Kanal, zweitens durch den Panama-Skandal, drittens durch die Panama-Hüte. Der Panama-Skandal ist nicht mehr aktuell. Der Panama-Kanal wird es bald sein, wenn er nämlich wirklich, wie es heißt, im nächsten Jahre eröffnet wird. Die Panama-Hüte sind es immer und werden es so lange sein, als es für vornehm gilt, was Besseres auf dem Kopfe, als drin zu haben.
Über den Panama-Skandal werde ich mich nicht verbreiten. Wer sich daran erquicken will, lese in den betreffenden Jahrgängen der Pariser Zeitungen nach.
Aber von den Panama-Hüten und dem Panama-Kanal will ich erzählen.
Die Panama-Hüte heißen wahrscheinlich deshalb so, weil sie nicht in Panama gemacht werden. Ihr Entstehungsort ist die Republik Equador, besonders die Gegend um Guayaquil und Payta herum. Dort sitzen die fleißigen Indianerweiber, bleichen und spalten das haarfeine Palmstroh, aus dem ihre geschickten Finger die kostbaren Kopfbedeckungen flechten. In Panama selbst ist man dagegen so unnobel, die Hüte, die den Namen der Stadt tragen, mit einem ziemlich hohen Einfuhrzoll zu belegen. Wer also glaubt, daß man in Panama »billig und gut« Panama-Hüte kaufen kann, wird an Ort und Stelle gar bald eines Besseren, oder vielmehr Schlechteren belehrt. Man zahlt in Panama genau denselben Preis für einen Hut, wie in Europa, nicht unter 10 Dollar für mittelgute Ware. Natürlich gibt es auch hier Hüte, für die 200 Dollar von dreisten Verkäufern verlangt und von verrückten Amerikanern gezahlt werden. Die Zugehörigkeit von Panama-Hüten zu Panama versucht man dadurch kenntlich und glaubhaft zu machen, daß man alberne kleine Reisesouvenirs in Form von Puppen-Panamahüten verkauft.
Was nun den Panama-Kanal anbetrifft, so ist er allerdings sehr großartig in der Anlage, aber doch nicht so imposant, wie man ihn sich in Europa vorstellt, oder wie ich ihn mir wenigstens vorgestellt habe. Es ist kein einheitlicher, schnurgerader Durchstich, der nach dem Prinzip der kürzesten Linie die Küste des Stillen Ozeans mit der des Atlantischen verbindet, sondern vielmehr eine Kombination von vielen einzelnen Kanälen und Schleusen-Systemen, wobei auch die den Isthmus bewässernden Flüsse und einige kleine Binnenseen als Verbindungswege ausgenutzt sind. Wenn man also fragt: »Wie breit ist der Kanal?« so muß die Gegenfrage lauten: »An welcher Stelle?« Die Breite schwankt zwischen 300 und 1000 Fuß, die Länge beträgt genau 50 englische Meilen. Auch die Tiefe ist keine einheitliche. Das Minimum sind 41 Fuß, so daß immerhin ganz gewaltige Passagierdampfer und die größten Kriegsschiffe ihn passieren können. Die flacheren Stellen des Kanals machen, besonders wenn, wie jetzt, kein Wasser drin ist, durchaus keinen imponierenden Eindruck. Wenn man sie betrachtet, so muß man sich die Milliarden ausgebaggerter Kubikmeter Erde vorstellen, um in den vom Führer verlangten Zustand der Andacht und Bewunderung zu geraten. Mit einem »very nice«, womit ihn englische und amerikanische Touristinnen unter ihrem Reiseschleier hervor beglücken, ist er nicht zufrieden. Am sichtbarsten ist die beim Durchstich geleistete enorme Arbeit, mit der übrigens auch heute noch über 40 000 Menschen beschäftigt sind, bei den Schleusen, die frei daliegen und mit ihren gewaltigen Mauern und Riesen-Dampfkränen den Eindruck phantastischer Zyklopen-Festungen machen.
Im Januar 1914 muß der Kanal bekanntlich, laut Kontrakt, dem Verkehr übergeben werden. Danach sieht er jedoch zurzeit nicht aus. Auf allen Strecken wird fieberhaft gearbeitet, auf keiner einzigen noch sind die Arbeiten schon ganz abgeschlossen. An den Schleusen wird gebaut und gemauert, in den Gräben hocken Tausende von Arbeitern mit Spaten und Hacke, auf den Seen knattern und rumoren zahllose Baggermaschinen und fördern Millionen und Abermillionen von Eimern mit Schlamm und Sand ans Tageslicht. Es ist ein betäubender Betrieb. Das ganze Gebiet des Kanales gleicht einem riesigen Ameisenhaufen, und ebensowenig wie bei einem solchen kann man hier bei flüchtiger Betrachtung Plan und Ziel der gemeinsamen Arbeit feststellen.
Ein äußerst buntes Bild bietet die Schar der Arbeiter. Amerikaner, Japaner, Chinesen, Neger, Mulatten – alles wimmelt durcheinander. Betrachtet man die kräftigen halbnackten Gestalten, so denkt man mit Grausen daran, wieviele Menschenopfer diese Kraftprobe technischen Vorwitzes gekostet hat. Zu Hunderttausenden sind die Kanalarbeiter vom Sumpffieber jeder Art weggerafft worden. Eine Zeitlang stockte ja der Betrieb überhaupt, weil es unmöglich war, Arbeiter zu finden, die für hohen Lohn den sicheren Tod in den Kauf nehmen wollten. Dann erst ging man ernstlich daran, die fieberverpesteten Sumpfgebiete des Isthmus zu sanieren. Dieses schwierige Werk ist jetzt gelungen und zwar vermittelst selbsttätiger Petroleum-Pulverisatoren, die in den Wäldern und Sümpfen aufgestellt sind und im Frühjahr alle Wasserflächen mit einer dünnen Schicht Petroleum überziehen, unter der sich die Moskitos nicht entwickeln können. Jetzt gibt es kein Fieber mehr in Panama, denn es gibt keine Moskitos, die die einzigen Träger der Infektion sind. Die Furcht vor ihnen ist aber noch nicht ganz geschwunden. Sämtliche Häuser im Kanalgebiete sind mit einem dichten Schutzgeflecht aus feinstem Draht umgeben. Die Häuser sehen aus wie große viereckige schwarze Käseglocken.
In wirtschaftlicher und politischer Beziehung ist Panama ein Unikum. Der Aufenthalt dort hat für den Fremden manche Schwierigkeit. Vor allen Dingen weiß man nie, ob man sich im gegenwärtigen Augenblick in den Vereinigten Staaten von Nordamerika oder in der spanischen Republik Panama befindet. Seit zehn Jahren ist nämlich Panama – ich wage nicht zu sagen »bekanntlich« – eine selbständige Republik. Nur ein schmaler Streifen Landes, die sogenannte »Kanalzone«, wurde damals den Vereinigten Staaten abgetreten.
In dieser Kanalzone nun ist das beste und einzig komfortable Hotel Panamas gelegen. Dort lebt man natürlich, und befindet sich folglich in den Vereinigten Staaten, spricht englisch, zahlt mit Dollars und wird von amerikanischen Negern bedient. Ums Haus herum promeniert ein »policeman« in dem für die nordamerikanische Polizei charakteristischen Tropenhelm. Macht man jedoch drei Schritte zum Hotelgarten hinaus, so befindet man sich plötzlich und unvermutet in der spanischen Republik Panama. Will man eine Auskunft haben, so muß man sie auf spanisch einholen, an den Straßenecken stehen spanische Polizisten in kühnen Torreadorhüten, macht man einen Einkauf, so heißt es mit spanischen Pesos bezahlen. Da man aber, vom Hotel kommend, nie spanische Pesos in der Tasche hat, wird man beim Wechseln amerikanischer Dollars mit notorischer Sicherheit übers Ohr gehauen. Im Hotel gibt es nur Goldwährung, in der Stadt jedoch Gold-, Silber- und Papierwährung. Kurz, es ist ein unbeschreiblicher Kohl, und schließlich kauft man lieber gar nichts mehr, um nicht eine halbe Stunde lang Rechenexempel mit Pesos und Dollars lösen zu müssen und in der nächsten halben Stunde doch zu merken, daß man Golddollar statt Silberdollar bezahlt hat.
Im übrigen ist Panama ein ganz interessantes kleines Städtchen mit schönen alten spanischen Kirchen, anständigen Droschken und sogar Automobilen, die die engen Straßen verpesten. Man hat im allgemeinen durchaus den Eindruck, daß hier europäische, respektive nordamerikanische Kultur mehr abgefärbt hat, als in allen Städten der westlichen südamerikanischen Republiken zusammengenommen.
Wenige Minuten außerhalb der Stadt Panama und der Kanalzone ist das Land freilich noch ganz wild. Davon konnten wir uns überzeugen, als es uns eines schönen Tages gelang, ein Unternehmen in Szene zu setzen, auf das wir uns schon seit Brasilien gespitzt hatten – eine Alligatorjagd. Alle derartige Unternehmungen sind hier stets mit solchen Schwierigkeiten verbunden, daß man von besonderem Glück reden kann, wenn es gelingt, einen gefaßten Plan auch wirklich auszuführen. Wer hätte, z. B., gedacht, daß man im Lande der Revolver einen offiziellen Erlaubnisschein zum Tragen von – Jagdgewehren braucht. Ich will nicht schildern, was wir zu leiden hatten, bis wir diesen Erlaubnisschein bekamen. Wer einen russischen Utschastok kennt, weiß genau, auch ohne daß ich viele Worte mache, wie es in der Kanzlei des »Alkaden« von Panama hergeht. Doch Beharrlichkeit führte auch hier zum Ziel. Endlich war alles in Ordnung.
Wohlausgerüstet mit Büchsen, Patronen und Proviant machten wir uns auf den Weg. Dieser Weg ist nicht ganz kurz. Er führt quer über die ganze Bucht von Panama, dann vier Stunden stromaufwärts in einem der vielen Flüsse, die den Isthmus bewässern. Wir hatten ein Motorboot gemietet, dessen Besatzung aus zwei Mann bestand, die auf die stolzen Namen »Kapitän« und »Mechaniker« hörten. Leider rechtfertigten sie nachher ihre Titel in keiner Weise. Wir wußten noch nicht, was uns bevorstand, als unser Boot am Morgen fix und geschmeidig über die Bucht von Panama dahinglitt, vorüber an glitzernden kleinen Felseilanden und palmenbestandenen Märcheninseln. Wir freuten uns über die Morgensonne, die das Meer in eine Fläche flüssigen Silbers verwandelte, und über die aberwitzigen langgeschnäbelten Pelikane, die in Scharen unser Boot umschwärmten.
Nach ungefähr fünf Stunden erreichten wir die Mündung des Flusses, dessen Namen, der nichts zur Sache tut, ich vergessen habe. Das Ufer ist zu beiden Seiten mit dichtem Urwalde bestanden. Man erwartet nicht, kaum 60 Kilometer vom kultivierten Panama solch eine Wildnis zu finden. Dieselben dichten Wände von Schlingpflanzen, die wir vom tropischen Bolivien her genügsam kannten, machen den Wald unpassierbar. Allerhand merkwürdiges Wassergetier flatterte von Zeit zu Zeit am Ufer auf. Ich konnte meine Schießgelüste, die schon bei den Pelikanen erwacht waren, nicht bezähmen und machte einem wunderschönen schneeweißen Reiher den Garaus. Allerdings hielt ich ihn (er verzeiht mir diesen Irrtum wohl noch nach dem Tode) für eine wilde Gans. Er hätte seinen stolzen langen Hals nicht einziehen sollen, wenn er für das genommen werden wollte, was er war.
Alligatoren gab es in dem breiten Strome, den wir uns hinaufarbeiteten, keine. Die sollten wir erst an der Mündung eines kleinen Nebenflusses, tiefer im Lande, finden. Mit begreiflicher Spannung sahen wir diesem Ziel entgegen. Endlich stoppte der Motor. Es ist 3 Uhr nachmittags. Der »Kapitän« macht uns auf einige mächtige Baumstämme aufmerksam, die in einem schmalen Seitenflüßchen unter den überhängenden Schlinggewächsen des Ufergebüsches daliegen. Hallo, da setzt sich einer von den Baumstämmen in Bewegung und rudert nach dem anderen Ufer hinüber. Das also sind die Alligatoren. Donnerwetter! Klein sind sie nicht. Ich hatte sie mir ungefähr von der Größe der Nilkrokodile gedacht, aber diese »fellows«, wie sie der Kapitän zärtlich nennt, erreichen eine Länge von mindestens 3-4 Metern. Imposante Kerle. Doch zeigen sie leider nur ihren Rücken. Wenn man genau hinsieht, entdeckt man ein schläfrig blinzelndes Auge von der Größe einer Backpflaume. Und dahinein soll man treffen? Ausgeschlossen, wenigstens bei der Entfernung, in der wir uns vorläufig befanden, d. h. ca. 150 Schritt.
Um unseren Jagdeifer etwas zu dämpfen, gab uns der Kapitän außerdem die tröstliche Versicherung, daß es unter allen und jeden Umständen unmöglich sei, eines Alligators habhaft zu werden, mag man ihn noch so tot schießen. Er geht sofort unter Wasser und bleibt dort, bis ihn sein aufgeblasener Leib an die Oberfläche hebt. Dann gab uns der offenbar sehr bewanderte Mann noch den Rat, zu warten, bis die Ebbe einsetzen würde, d. h. ungefähr drei Stunden. Bei niedrigem Wasserstand sei Hoffnung, daß sich die Alligatoren auf den Sandbänken sonnen würden. Nun versuche man, ausgerüstet mit einer trefflichen Winchester-Büchse, von Alligatoren rings umschwommen, drei Stunden ruhig zu warten. Schon nach zwanzig Minuten pfiffen wir auf Ebbe und Sandbänke und befahlen, unsere kleine Nußschale von Ruderboot ins Wasser zu lassen. Der »Mechaniker« wurde zum Ruderknecht. Die Büchse im Arm fuhren wir das Flüßchen hinauf. Die ersten zehn Schüsse wurden aus einer Entfernung von 20-30 Metern abgegeben. Es erfolgte darauf prompt ein heilloser Skandal im Wasser, mächtige Wellenkreise erfaßten unser kippendes und schwankes Boot, und wer nicht mehr zu sehen war, war der Alligator. Da sahen wir denn selbst ein, daß die Sache auf diese Weise aussichtslos war. Wir wappneten uns also mit Geduld und Schweigen und glitten stumm und regungslos unter den Uferbüschen dahin, jedes Geräusch mit den Rudern wurde vermieden. Ja ein empörter Blick des Ruderers traf mich, als ich mir eine Zigarette anzünden wollte.
Da, plötzlich wird er selbst unruhig. Mit einem mehr als ausdrucksvollen Minenspiel weist er nach einer Stelle des gegenüberliegenden Ufers hin und lenkt den Kahn in der angedeuteten Richtung. Ich sehe gar nichts, mein Freund augenscheinlich auch nicht. Halt, da nicht weiter als drei Schritte vom Steuer ein dicker, grünlicher Balken – der Kopf eines Alligators mit geschlossenen Augen. Ich kann mich nicht umwenden, um zu schießen. Mein Freund sitzt bequemer. Er nähert den Lauf seiner Büchse buchstäblich auf einen halben Meter dem berühmten Auge und drückt los. Donnerschlag, der Radau, der sich erhob! Aus Lederstrumpf und Konsorten wußte ich, daß Alligatoren, wenn angeschossen, die Kähne ihrer Jäger mit Vorliebe vermittelst des Schwanzes umkippen. Ich sah mich im Geiste schon zerfleischt und verdaut im Magen des grünen Ungeheuers. Aber nein, Gott sei Dank, wir leben. Der Alligator leider auch. Mit donnerähnlichem Getöse war er unter Wasser verschwunden.
Also so geht die Sache auch nicht. Was tun? Wie recht hatte unser Kapitän! Wir beschließen, das Flüßchen so weit als möglich hinaufzufahren, die Ebbe abzuwarten und dann mit der Strömung noch lautloser, als vorhin längst einem Ufer hinabzugleiten. Der Ruderknecht legt sich fester in die Riemen. Ich tue mir keinen Zwang an, weder mit Zigarettenrauchen, noch mit Schießen. Mancher exotische Wasservogel muß sein Leben lassen. Das Flußbild ringsherum ist von einer bezaubernden Romantik. Über unseren Köpfen schlagen die Kronen der Palmen und Riesenfarren fast zusammen. Der Fluß fällt rapide. Der Wald am Ufer sieht aus, als sei er auf einem kunstvoll angelegten Damm aus braunen, schlammbedeckten Pfählen erwachsen.
An der nächsten Biegung scheint der Fluß versperrt durch ein weißliches Gebirge. Bei genauerem Hinsehen entdeckten wir, daß dieses Gebirge auf uns zuschwimmt. Es ist der himmelwärts gekehrte Bauch einer Alligatorleiche. Das Tier ist von einer unheimlichen Größe, wir müssen unser Boot dicht ans Ufer drängen, um den Kadaver vorbei zu lassen. Er nimmt die ganze Breite des Flusses ein. Darauf sitzt krächzend ein Schwarm von zwanzig oder dreißig Aasgeiern. Scheußliche, kahlhalsige Tiere. Ich töte mit einem Schrotschusse vier. Die anderen fliegen träge auf, setzen sich aber sofort wieder zum leckeren Mal auf das faulende stinkende Fleisch nieder.
Bei der Abwärtsfahrt sehen wir an den Ufern des inzwischen durch die Ebbe stark verengten Flußbettes eine Unmenge Alligatoren, aber immer nur Kopf und Rücken. Kein einziger wagt sich auf eine Sandbank hinauf, um seinen weichen Bauch als bequemere Zielscheibe darzubieten. Wir verschießen unseren ganzen Patronenvorrat, mehr aus Freude an dem daraufhin entstehenden Wasserbeben, als in Hoffnung auf Beute. Erst bei der Mündung des Flüßchens sehen wir den grünlich-blauen Riesenleib eines prächtigen Alligators, langhingestreckt auf dem sandigen Ufer. Aber ehe wir in Schußweite sind, gleitet auch die letzte Hoffnung stumm und lautlos ins Wasser. Ich glaube, das infame Tier hat uns dabei nicht ohne Sarkasmus angeblinzelt. Die Flintenkugel, die so ein Amphibium ins Gehirn bekommt, regt es wohl nur zu lebhafterem Denken an, ohne seine Lebensgeister ernstlich zu gefährden. Und mit Kanonen hatten wir uns leider nicht bewaffnet.
Es wurde dunkel, und wir rüsteten uns zur Heimfahrt. Dabei hatten jedoch Kapitän und Mechaniker die Rechnung ohne die Ebbe gemacht. Kurz, nach einer halben Stunde saßen wir fest. Regungslos, rettungslos, hoffnungslos. Drei Stunden galt es, zu warten, bis die Flut unser Boot wieder flott machte. Unsere Mannschaft fand das ganz in Ordnung. Wir nicht. Zumal wir für solche Extrastationen durchaus nicht genügend verproviantiert waren und sich Hunger nie fühlbarer macht, als wenn man eine aufregende Jagd hinter sich hat.
Endlich spüren wir einen Ruck. Das Boot, siehe da – es bewegt sich, schwebt. In weniger als zwei Stunden ist die Bucht erreicht. Vertrauensvoll lassen wir uns ins Meer hinaussteuern. Alles geht glatt, in der Ferne sieht man schon die Lichter von Panama aufblitzen. Da, auf einmal ruckt und huppt der Motor so merkwürdig, jetzt setzt er ganz aus, jetzt springt er wieder an, setzt wieder aus, noch einmal, die Pausen werden immer länger, und endlich gibt er mit einem langen Seufzerhauche seinen letzten Lebensodem von sich. Selten ist mir ein Todesfall so nah gegangen.
Was soll ich nun weiter von dieser traurigen Begebenheit erzählen? Um es kurz zu machen: natürlich gelang es weder dem »Mechaniker«, noch dem »Kapitän«, den Motor wieder in Gang zu bringen. Diese würdigen Meister ihres Faches eröffneten uns kaltlächelnd, daß wir die Nacht auf dem Wasser zubringen würden und hoffen könnten, am nächsten Morgen von irgend einem zufällig vorbeifahrenden Dampfer aufgesammelt zu werden. Zwar hatte das Boot einen Mast und auch ein Segel und obgleich niemand zu segeln verstand (auch der »Kapitän« eingestandenermaßen nicht), zogen wir es auf, aber in Ermangelung des leisesten Windhauches hing es schlaff und kraftlos herunter und war nicht dazu zu bewegen, sich zu blähen.
So schaukelten wir denn auf den Wellen als willenloses Spielzeug der Ozeandünung. Das letzte Butterbrot war längst verspeist, der letzte Tropfen Tee getrunken. Es gibt Stimmungen, die man »weißglühende« nennt. Als uns gegen 5 Uhr morgens die Zigaretten ausgingen, glühte ich weiß, schneeweiß, durchsichtig. Begegnungen mit der Mannschaft vermied ich, um nicht zum Mörder zu werden. An Schlaf war vor Wut und Hunger kein Gedanke.
Das wundervolle Schauspiel des Sonnenaufganges konnte unter solchen Umständen natürlich auch nicht gebührend genossen und bewundert werden. Endlich um 10 Uhr morgens erblickten wir am Horizonte ein anderes Motorboot, das direkt auf uns zusteuerte: der Besitzer unseres Bootes, von Sorge um unseren Verbleib erfüllt (wir hatten noch nicht bezahlt), kam uns suchen. Freundlich war der Empfang, den wir ihm bereiteten, trotz aller Freude, nicht. Er nahm uns, schuldbewußt, in Schlepptau, und nach drei langen Stunden kamen wir in Panama an, wo wir uns in die erste beste Hafenkneipe stürzten.
Darüber, daß wir keinen Alligator mithatten, war der Bootsbesitzer keineswegs erstaunt. Er erzählte uns zum Trost, daß er vor einigen Wochen zweiundzwanzig Amerikaner in dieselben Jagdgründe expediert hatte, und daß sie nach einem mörderischen Feuer von Tausend Schuß ebenso beutelos heimgekehrt waren wie wir. Vor unserer Abfahrt hatte er uns diese lehrreiche Geschichte wohlweislich verschwiegen. Und die Moral von der Geschicht'? Fahr auf dem Meer auf Motorbooten nicht.
Da der Kanal noch nicht schiffbar ist, muß der Isthmus im Schnellzuge durchquert werden. Die Fahrt dauert knappe zwei Stunden. Aus dem bequemen Pullman-Car läßt man noch einmal die wechselnden Bilder der Kanalbauten an sich vorüberziehen, denn der Schienenstrang hält ziemlich genau die Richtung des Durchstiches ein. Die weiten Sümpfe, mit dichtem Tropen-Urwalde bestanden, bieten stellenweise ein überaus reizvolles landschaftliches Bild. Beruhigend hinsichtlich der Moskito-Gefahr wirken die mächtigen Petroleum-Behälter, an denen man von Zeit zu Zeit vorüberfährt.
Colon, an der atlantischen Seite der Landenge gelegen, ist der wichtigste Hafen Mittel-Amerikas. Er ist der Knotenpunkt des gesamten Schiffahrt-Verkehrs zwischen Europa, den Westindischen Inseln, Nord- und Mittel-Amerika.
Am Pier erwartete uns ein prächtiger neuer Dampfer der Hamburg-Amerika-Linie »Karl Schurz« – also benannt nach dem Kölner Freiheitskämpfer, der in den Vereinigten Staaten zu der Stellung eines führenden Staatsmannes gelangte und dem kürzlich ein prächtiges Standbild über der Amsterdam-Avenue in New-York enthüllt worden ist.
Die achttägige Seefahrt von Colon bis New York gehört zu den angenehmsten Erinnerungen unsrer Reise. Aus Dankbarkeit möchte ich die Hauptursache unseres Wohlbefindens an Bord des »Karl Schurz« erwähnen. Es war dies die außerordentliche Liebenswürdigkeit und Zuvorkommenheit des gesamten Schiffspersonals, vom Ober-Steward bis zum letzten Schiffsjungen. Alle Angestellten des Dampfers sorgten sich um jeden einzelnen Passagier so, als hinge von dessen Wohl und Wehe ihr eigenes Seelenheil ab. Herrlicher Zustand! Ich glaube, ich bin mein Lebtag nicht besser bedient worden, als im Rauchsalon und im Speisesaale des »Karl Schurz«.
Auf der Route Colon–New York sind zwei Stationen vorgesehen: in Kingston auf Jamaika und in Santiago de Cuba. Auf Jamaica hatten wir einen ganzen Tag Aufenthalt. Diese Insel – wenigstens soviel wir davon zu sehen bekamen – ist ein bezauberndes Fleckchen Erde. Vom ersten Schritt an, den man auf Jamaica tut, spürt man mit Behagen, daß die spanische Lotterwirtschaft, die einem manche Strecken Süd-Amerikas verekelt, aufgehört hat.
Englische Kultur weit und breit. Ihre Vorzüge kann man erst richtig ermessen, wenn man sie sechs Monate lang entbehrt hat.
Eine mehrstündige Automobilfahrt führte uns weite Strecken am Ufer der Insel entlang. Zum ersten Mal konnten wir über die Herrlichkeiten einer gepflegten Tropen-Flora staunen. Es ist bekanntlich eine Spezialität der Engländer, die Natur in Parks zu verwandeln. Das haben sie auch auf Jamaika fertig gekriegt.
Samtene Rasenflächen – echte »greens« – dehnen sich kilometerweit um die Fahrwege, die, nebenbei gesagt, von vorzüglicher Beschaffenheit sind. Die Palmenhaine sind überall vom Unterholz sorglich gereinigt. Blühende Hecken phantastischer Tropenblumen ziehen sich an den Wegen entlang. Man erhält den Eindruck, als sei die ganze Insel ein großer wohlgepflegter Garten. Aus dem Grün blickten überall saubere Villen hervor, deren Bauart vollkommen dem Stil englischer Landhäuser ähnelt.
Das Ziel unserer Fahrt war eine hügelige, mit dichtem Walde bestandene Landzunge, die wir in den Ozean hineinragen sahen. Wer beschreibt unser Erstaunen, als wir erfuhren, daß dies der Aufenthaltsort englischer Zwangssträflinge sei! Wäre nicht die in der Tropenglut doch einigermaßen erhitzende Arbeit im nahen Steinbruch, so möchte man fast einen kleinen Einbruch verüben, um für ein Weilchen hierher deportiert zu werden.
Die Stadt Kingston bietet nichts besonders Bemerkenswertes. Der Eindruck, den man von ihr davonträgt, ist der einer Farbe: Weiß. Weiß sind alle Häuser, weiß die Straßen, weiß ist der Staub, der von Automobilen und verschiedenerlei Fuhrwerken in sehr reichlicher Quantität aufgewirbelt wird, weiß ist die Kleidung aller Passanten männlichen und weiblichen Geschlechts. Nur eines ist nicht weiß: die indigene Einwohnerschaft der Stadt. Die ist nämlich schwarz. Übrigens sind die Jamaika-Neger grauenhaft häßlich, besonders die Frauen, die ja überhaupt bei allen »wilden« Völkern nie und unter keinen Umständen Anspruch darauf erheben können, das schönere Geschlecht zu sein.
Ich ahne, daß man von mir erwartet, ich solle nun etwas vom Jamaika-Rum erzählen. Leider kann ich diesen Wunsch nicht erfüllen. Von diesem Trost aller Grogtrinker habe ich auf Jamaika nicht mehr gesehen als in Europa. Eher weniger. Vielleicht, weil die dampfende Hitze hier jeden »Nasenwärmer« völlig überflüssig macht.
Als wir zum Dampfer zurückkehrten, erwartete uns ein eigenartiger Anblick: eine schier endlose Negerprozession wanderte vom Hafenquai zum Dampfer. Jeder trug einen Bananenkolben auf dem Kopfe. Vor dem Laderaum des Zwischendecks stand ein enormer Neger, mit einem langen Schlachtmesser bewaffnet. Damit hieb er nach dem Kopf jedes vorüberziehenden Prozessionsmitgliedes. Man glaubte, sie müßten alle enthauptet in die Luke purzeln. Das taten sie jedoch nicht. Es stellte sich heraus, daß der grimmige Henker nur die Strünke der Bananenkolben abschlug. Jeder Neger nahm seinen Strunk wieder mit. Er mußte ihn am Ladeplatz abliefern, um einen neuen herübertragen zu dürfen. Eine höchst primitive, aber unfehlbare Ehrlichkeitskontrolle.
An Kuba habe ich nur eine dumpfe Erinnerung, obgleich der Besuch dieser Insel wenige Tage zurückliegt. Mir kommt es immer noch merkwürdig vor, daß ich Santiago wirklich lebend verlassen habe.
So was an Hitze! Dagegen erschien die Treibhaus-Atmosphäre des Mapiri-Tales als Eiskellerluft.
Ein Halbkreis blendendweißer Kalksteinfelsen umgibt die Stadt. In diesem Fokus sammelt die Sonne ihre sengenden Strahlen. Der Boden, den man betritt, scheint weiß zu glühen. Den Druck der heißen Luft auf dem Kopf empfindet man als physischen Schmerz.
Um vom Hafen in die Stadt zu gelangen, muß man einen zirka zweihundert Schritte breiten Platz überschreiten, der den Sonnenstrahlen schutzlos preisgegeben ist. Trotz eines reichlichen Aufgebots von Energie konnte ich den Entschluß nicht fassen, mich auf diesen Platz hinauszuwagen. Ich fühlte, daß ich die andere Seite nicht lebend erreichen würde und umschlich ihn mit großem Bogen im kümmerlichen Schatten der Hauswände.
Kuba ist das Eldorado aller Tabakraucher. Die Kuba-Zigarren hatten auch mich verlockt, den Dampfer zu verlassen. Nachdem ich meinen Einkauf in halb besinnungslosem Zustande besorgt hatte, eilte ich – soweit die Temperatur das zuließ – auf den Dampfer zurück.
Von Santiago habe ich infolgedessen wenig gesehen. Hatte auch keine Sehnsucht, die Tiefen der engen Gassen zu erforschen. Die Stadt macht einen unappetitlichen, unordentlichen Eindruck. Sie scheint ein einziger großer Drogenladen zu sein: überall stehen Fässer, Kisten, Kasten, Warenballen, Tonnen, Flaschenkörbe umher. Die Straßen werden, scheint's, nie gefegt. Spanische Wirtschaft!
Entschädigt wird man dafür durch das reizvolle und malerische Bild, das die Insel darbietet, wenn der Dampfer in langsamer Fahrt die Bucht von Santiago verläßt. Die Ausfahrt ist übrigens so schmal, daß man wetten wollte, unser Kapitän würde sein Schiff nicht durchzwängen. Wider Erwarten gelang es doch. An einer Seite des Felsentores steht eine spanische Festung. Mit einer Batterie kann man hier eine ganze Armada in Schach halten.
Auf der Fahrt von Colon nach New York erlebten wir unseren ersten regelrechten Sturm auf dem Ozean. Die Wellen, die übers Schiff sprangen, verwandelten das Promenadendeck in eine Schlittschuhbahn – ein Umstand, der von allen Pikkolos und Schiffsjungen, soweit sie seefest waren, natürlich eifrigst ausgenutzt wurde. Den ganz Geschickten gelang es, unter dem Druck eines Windstoßes ohne Aufenthalt vom Vorderdeck bis zum Heck zu schliddern. Ein pudelnasser, aber zweifellos sehr vergnüglicher Sport. Er mußte eingestellt werden, als der Dampfer sich gar zu steil zu bäumen anfing. Es war ein wundervolles Schauspiel, wenn sich die Spitze des 6000-Tonnen-Schiffs so tief senkte, daß es regelrecht Wasser schöpfte, und der schäumende Gischt sich wie ein Sturzbach vom Bug zum Steuer ergoß. Das Betreten des Deckes war unter solchen Umständen natürlich verboten. Übrigens gab es unter den Passagieren nur sehr wenige, die dieses Verbot hätten übertreten können.
Erst wenn man den Ozean im Sturm gesehen hat, weiß man, wie großartig schön er sein kann. Nur den ganz Gewaltigen raubt ein Zornesausbruch nichts von ihrer Majestät.




Schon vierundzwanzig Stunden, bevor man die Metropole der Vereinigten Staaten zu Gesicht bekommt, bemächtigt sich des Reisenden eine unerklärliche Unruhe. Selbst wenn man vorher unter den abenteuerlichsten Bedingungen einen ganz fremden, ebenso phantastischen wie interessanten Kontinent – Südamerika – bereist hat. Trotzdem fühlt man es deutlich: das eigentliche Amerika, das Land der unbegrenzten Möglichkeiten beginnt erst mit den Vereinigten Staaten, präziser ausgedrückt mit – New York.
Dieses Vorgefühl trügt in der Tat nicht. Überall in Südamerika, in den Städten und selbst in der Wildnis, gelingt es, wenngleich nicht immer ohne Anstrengung, irgendwelche Anknüpfungspunkte mit dem europäischen Leben zu finden. Die Vergleichsmöglichkeit überhaupt ist gegeben. In New York dagegen muß man von vornherein darauf verzichten, mit den uns gewohnten Lebensbedingungen Vergleiche anzustellen. Mir wenigstens ist es so ergangen.
Ich habe mich nirgendwo, weder in den argentinischen Pampas, noch in den Urwäldern Boliviens, weder auf dem ungastlichen Rücken der Kordilleren noch im buntbewegten Panama so fremd, so wenig heimisch gefühlt, wie in New York. Und dieses Gefühl ist nicht geschwunden, obgleich ich in New York länger geblieben bin und bessere Gelegenheit hatte, mich mit allen Lebensbedingungen vertraut zu machen, als in irgend einer der südamerikanischen Städte.
Die Unruhe, die einen schon vor New York überkommt, verläßt einen dort für keinen Augenblick. Man hat die ganze Zeit das Gefühl, als stünde man unmittelbar vor irgendwelchen Katastrophen des allgemeinen oder persönlichen Lebens, man wird es erst los, wenn man das Schiff besteigt, um nach Europa zurück zu fahren. Dann atmet man ordentlich auf. Der Grund dieser sonderbaren Aufregung ist, glaube ich, nicht in der fabelhaften Großartigkeit des äußeren Stadtbildes, auch nicht im schwindelerregenden Straßenverkehr und im rasenden Tempo des geschäftlichen Lebens zu suchen, obzwar auch dieses alles genügt, um in der ersten Zeit ein Durchschnittstemperament außer Rand und Band zu bringen. Aber schließlich sind London und Paris auch keine Dörfer, und zu Zeiten geht es dort ebenfalls recht lebhaft her. Endlich gibt es keinen Radau, an den man sich nicht gewöhnen könnte. Warum sollte also der New Yorker Straßenverkehr eine Ausnahme machen?
Nein, der Grund, weshalb man in New York innerlich nicht ruhig werden kann, liegt darin, daß man den prinzipiellen Unterschied zwischen den Begriffen »amerikanisch« und »europäisch« fühlt, und sich von Stunde zu Stunde mehr der unüberbrückbaren Kluft bewußt wird, die unseren guten alten Kontinent von der neuen Welt trennt, trotz des täglichen Verkehrs, der zwischen ihnen aufrecht erhalten wird.
Dem Nordamerikaner ist die Psychologie des Europäers ebenso fremd, wie diesem das Innenleben eines Schimpansen. Man versteht sich gegenseitig nicht, denn man ist aus ganz verschiedenem Material geknetet. Und ebensowenig, wie man den einzelnen Menschen versteht, begreift man die Formen, die das Leben dort angenommen hat. D. h. mit dem Verstande wohl, nicht aber mit dem Herzen. Das jedoch ist die Grundbedingung dazu, um sich irgendwo heimisch, oder auch nur gemütlich zu fühlen.
Dieser Umstand braucht einen nicht zu hindern, den Vereinigten Staaten den Zoll aufrichtiger Bewunderung zu entrichten. Es ist ein wundervolles Land, und man bedauert vielleicht schmerzlich, daß es einem innerlich immer verschlossen bleiben muß.
Einen unvergeßlichen Anblick bietet die Bucht von New York, wenn man an einem sonnigen Sommermorgen die Einfahrt passiert. Weithin sichtbar erhebt sich die kolossale Freiheitsstatue auf ihrem breiten Granitsockel. Ihr goldenes Haupt scheint Blitze zu sprühen. Unzählige Dampfer, Segelschoner, Schaluppen schaukeln sich auf den Wellen, dazwischen schießen pfeilschnell in allen Richtungen Motorboote und die kleinen Dampfkutter, die den Verkehr zwischen der Stadt, den vielen Inseln der Bucht und den weiter gelegenen Vororten vermitteln. Es ist ein unwahrscheinlich buntes und belebtes Bild. Im Vergleich dazu scheint Cuxhaven der Vorhof einer Toteninsel.
Bald wird die Aufmerksamkeit von der nächsten Umgebung des Dampfers abgelenkt: vom Morgennebel noch ein wenig verhüllt zeichnet sich die Silhouette der Stadt in immer deutlicher werdenden Umrissen am Horizont ab. Im ersten Augenblick ist es schwer, sich über die Linie dieser Silhouette klar zu werden. Sie hat so merkwürdig viele Ecken und gerade Linien, die hoch in den Himmel hineinragen. Wenn man näher kommt und einzelne Bauwerke unterscheiden kann, begreift man, was man vor sich hat.
Das also sind die berühmten Wolkenkratzer! Vom Meer aus erfaßt man ihre Dimensionen noch ganz und gar nicht. Sie sehen nur so merkwürdig aus, weil sie vereinzelt dazustehen scheinen, denn die Häuserzeile mit Gebäuden unter zehn Stockwerken bleibt unbemerkt.
Es dauert überhaupt eine ganze Weile, zum mindesten einige Tage, bis man das Straßenbild von New York mit vollem Bewußtsein in sich aufzunehmen vermag. Wir sind solche Dimensionen nicht gewöhnt; der Blick gleitet darüber hinweg, ohne daß der Verstand erfaßt, was das Auge sieht. Erst allmählich lernt man begreifen, was man vor sich hat, und erst dann kann man anfangen zu staunen.
Alle Achtung vor den amerikanischen Architekten, deren berühmtester übrigens – eine Frau ist. Sie verstehen es, die kolossalen Steinmassen so zu gliedern, daß man sich von den enormen Gebäuden, die die Straßen umsäumen, keinen Augenblick bedrückt oder eingeengt fühlt. Zählen lassen sich übrigens die Stockwerke der Wolkenkratzer ebensowenig, wie etwa die Waggons eines vorüberfahrenden Güterzugs. Man hat keine Anhaltspunkte. Ist man glücklich in die Gegend von zwanzig gekommen, so muß man sicherlich wieder von vorne anfangen.
Kurz vor unserer Ankunft war das höchste Gebäude New Yorks, auf das sogar die Amerikaner ganz besonders stolz sind, fertig geworden. Es steht in vollster Pracht, von Gerüsten befreit, am Broadway da. Es ist die Kleinigkeit von siebenundsechzig Stockwerken hoch, d. h. es soll so viele Etagen haben. Nachzählen habe ich sie nicht können. Bei einem Zählversuche muß hier auch das sicherste Auge versagen, aus dem einfachen Grunde, weil man in der schwindelnden Höhe der obersten zwanzig Stockwerke keine einzelnen Fenster unterscheiden kann, man mag noch so weitsichtig sein. Man kann sich von den Dimensionen des Gebäudes annähernd eine Vorstellung machen, wenn man erfährt, daß es fast dreihundert Meter, d. h. beinahe ebenso hoch wie der Eifelturm ist. Da es trotzdem durchaus den Eindruck eines Hauses und nicht den eines Turmes macht, kann man sich denken, welch einen enormen Flächenraum es bedeckt. Wie mag es den Leuten zumute sein, die etwa im sechzigsten Stockwerke wohnen und eine Fernsicht fast bis Europa genießen? Unsereines hätte sicherlich nicht die innere Ruhe für solch ein luftiges pied-à-terre, das übrigens in diesem Falle lieber pied-en-air heißen sollte. Schon der Feuersgefahr wegen. Es brennt in New York täglich an allen Ecken und Enden, und zwar vorzugsweise in den Wolkenkratzern. Kein Mensch regt sich mehr darüber auf. Die Zeitungen registrieren ganz geschäftsmäßig die Zahl der Leichen.
Die Wolkenkratzer in New York rangieren nicht als gleichberechtigt unter der großen Masse der übrigen Häuser. Sie sind Aristokraten, und werden individuell behandelt. Bei den Lebenden leugnet die demokratischste aller Nationen den Adel ab, unter toten Gebäuden schafft sie ihn sich. Das äußert sich darin, daß jeder »sky-scraper« seinen Namen hat. Dieser Name bezeichnet entweder den Besitzer des Gebäudes: »Astor-Haus«, oder eine Bestimmung: »Rubber-building«, »Times-building«, oder ist einfach aus freier Phantasie geschöpft: »Atalanta«, »Independencia« usw. Dieser Name genügt natürlich als Adresse, sowohl der Post, als auch den Lenkern der Verkehrs-Vehikel.
Das Wolkenkratzer-Viertel ist die Geschäftsgegend der Stadt, New York-City. Es beschränkt sich auf die Straßen, die den Anfang des Broadway durchqueren. Dieser Broadway ist übrigens eine unfaßliche Straße, nach europäischen Begriffen wenigstens. Er ist – sage und schreibe – 45 Kilometer lang. Wenn man als Kind an einem Ende ausgeht, kommt man als Greis am andern an.
Seine Häuser individualisiert New York, die Straßen dagegen nicht. Es gibt nur wenig Straßen, die einen Namen haben. Die Numerierung der Straßen erleichtert einem zwar das Orientieren in der Stadt, hat aber im übrigen etwas Geisttötendes an sich, ebenso, wie die »Linien« auf dem »Wassili-Ostrow« in Petersburg. Längelang wird die Stadt vom Broadway und zwölf Avenuen durchschnitten, von denen nur eine einen Namen hat: die »Amsterdam Avenue«, quer durch gehen ca. 270 Straßen, deren jede ihre Nummer hat, durch zwei Zahlen und die Hausnummer läßt sich also jede beliebige Stelle der Stadt genau fixieren. Dieses Verfahren ist ebenso bequem wie langweilig, was sich übrigens auch von manchen anderen »amerikanischen« Einrichtungen sagen läßt.
Von den Avenuen ist die großartigste die berühmte »Fünfte«. Die verwegenste Rechenkunst muß an dem Exempel versagen, wieviele Milliarden schwer die Bewohner dieser Straße sind. Im Rayon der ersten siebzig bis achtzig Querstraßen ist die 5. Avenue die vornehmste Kaufstraße New Yorks. Die ganze »Rue de la paix« und »Avenue de l'Opéra« von Paris, die »New-bond-street« aus London haben hier ihre Filialen. Am meisten ins Auge stechen die fabelhaften Juwelierläden und die märchenhaften Blumengeschäfte. Nebenbei bemerkt, trägt jede fashionable New Yorkerin, die die 5. Avenue zu Fuß oder im Auto passiert, einen ziemlich umfangreichen Blumenstrauß im Gürtel, meistens Orchideen oder Rosen.
Beim sogenannten »Central-Park«, einem entzückend gepflegten Stadtgarten, beginnt die vornehmste Wohngegend New-Yorks, der Rayon der »Einfamilienhäuser«. Hier hat sich unter anderem die ganze Dynastie Vanderbilt angesiedelt. Ein Palast steht neben dem anderen. Jeder Chauffeur nennt einem die Bewohner der einzelnen Häuser und erzählt gerne und ausführlich ihre Familiengeschichten. Die Paläste der Dollarkönige zeugen übrigens von einigem Geschmack der – Architekten. Nur dokumentiert sich in fast allen eine gewisse Vorliebe für schwere klobige Steinmassen und wenig Lichtfreudigkeit. Die Häuser sind meistenteils in etwas finster anmutendem romanischem Stil erbaut.
Von den Bewohnern weilt übrigens jetzt kein Mensch in der Stadt. Die ganze 5. Avenue hinauf sind alle Fenster ohne eine einzige Ausnahme verhängt. Ohne sie zu sehen, kennt man diese Bewohner, wenn man einen schwatzhaften Chauffeur hat. Man weiß auch bald, wieviel Geld sie haben, ob sie in glücklicher oder unglücklicher Ehe leben, wieviel ihre Häuser gekostet haben usw. Das teuerste Haus besitzt ein Sohn des berühmten Cornelius Vanderbilt. Es soll die Kleinigkeit von 7 Millionen Dollar gekostet haben, sieht aber nicht danach aus. Einen verhältnismäßig bescheidenen Eindruck macht das Haus des jüngst verstorbenen Pierpont Morgan. Es ist nicht an der 5. Avenue, sondern in einer ihrer Querstraßen gelegen. Der Besitzer hat die wenig geschmackvolle Idee gehabt, mitten zwischen die umgebenden Mietskasernen einen griechischen Tempel für seine weltberühmte Bildergalerie hinbauen zu lassen. Das ganz aus weißem Marmor aufgeführte Gebäude ist an sich wunderschön, ideal in den Proportionen, rein und edel in allen Linien, doch nimmt es sich an dieser Stelle aus, wie eine Edelpalme auf einem Kohlfelde.
Von den öffentlichen Gebäuden New Yorks ist das schönste die »Carnegie-Hall«, ein stilvoller Tempelbau in der vornehmen Umgebung der 5. Avenue. Er beherbergt unter anderem eine wundervolle Bibliothek, in deren Zeitungssaal ich täglich die hauptsächlichen Moskauer Zeitungen lesen konnte.
Schöner noch als die 5. Avenue, wenngleich sie für etwas weniger vornehm gilt, ist die sogenannte »River-side«, das hochgelegene Ufer des imposanten Hudson-River. Unter den herrlichen Villen, die dort stehen, erregt am meisten Bewunderung die Besitzung eines gewissen Mr. Schwab, des getreuen Mitarbeiters Andrew Carnegies. Es ist eine altdeutsche Burg, ungefähr von den Dimensionen des Münchener Nationalmuseums.
Entzückend sieht der Hudson-River mit seinen grünen Ufern an sonnigen Sommertagen aus. Unzählige Segel- und Motor-Jachten beleben seine glänzende Wasserfläche. Einen unbeschreiblich großartigen Eindruck machen die vier Riesenbrücken, die ihn überwölben und die Verbindung zwischen New York und Brooklyn herstellen. Der Anblick dieser zwei Kilometer langen Brücken, die in kühnem Bogen die beiden gegenüberliegenden Ufer verbinden, und mit ihren kolossalen Strebepfeilern fast in die Wolken hineinzuragen scheinen, benimmt einem geradezu den Atem.
Von allen Städten, die mir bis jetzt zu Gesicht gekommen sind, ist New York bei weitem die internationalste. Jedes Volk fast hat dort sein Stadtviertel, in dem es seine Eigenart vollkommen bewahrt. Am interessantesten sind die Stadtviertel der Italiener, Juden, Chinesen und Neger.
Der Hotel-Komfort in Europa wird immer raffinierter und raffinierter. Das verdanken wir den Yankees. Sie sind es »bei sich zu Hause« so gewöhnt und wollen es in Europa, wenn sie uns mit ihrem Besuch beehren, auch nicht schlechter haben. Und da dürfen wir nun mitgenießen, obgleich wir es bei »uns zu Hause« durchaus nicht so gewöhnt sind.
Aber trotz aller unserer Anstrengungen gelingt es uns nicht, die Amerikaner in bezug auf Hotel-Luxus auch nur annähernd zu erreichen, geschweige denn zu übertrumpfen. Weder »Cecil« und »Carlton« in London, noch die glänzendsten Hotels in Paris, noch »Adlon« in Berlin können mit den amerikanischen Hotelpalästen konkurrieren.
In Amerika geht bekanntlich alles ins Grandiose. Neben der Qualität kommt auch die gemeine Quantität zu ungebührlicher Bedeutung. Die Sucht nach großen Zahlen beseelt das Leben und Streben der Amerikaner. Das gilt ganz besonders auch vom Hotel-Betriebe.
Das »Astor-Hotel« in New York genießt den Ruf »vornehm und ruhig« zu sein. Was soll man nun dazu sagen, wenn man hört, daß in diesem »ruhigen« Hotel neun Orchester beschäftigt werden, die zu allen Tages- und Nachtzeiten in den verschiedenen Speisesälen des Hauses konzertieren. Aber selbst damit ist dem unersättlichen Musikbedürfnis der Hotelleitung und ihrer Gäste nicht Genüge getan. Im »Astor-Hotel« steht im großen Bankett-Saal die größte Orgel der Vereinigten Staaten, ein wundervolles Werk amerikanischer Orgelbaukunst, auf der ein eigens angestellter Organist – nebenbei gesagt ein Meister seines Faches, der mit seinen 6000 Dollar Gehalt gewiß nicht zu hoch bezahlt ist – die Tafelfreuden der reichen Yankees würzt.
Während unseres Aufenthaltes im »Astor-Hotel« wurde dort von verschiedenen offiziellen und inoffiziellen deutschen Vereinigungen das 25jährige Regierungsjubiläum Kaiser Wilhelms gefeiert. Der gewöhnliche Betrieb des Hotels erlitt dadurch keine Einbuße. Doch erzählte der Direktor des Hotels nachher nicht ohne Stolz, daß an diesem Abend Diners für insgesamt 2800 Personen serviert worden waren, womit jedoch das Küchenpersonal des Hotels und die 600 Kellner keineswegs überanstrengt wurden.
Eine Sehenswürdigkeit von New York ist der »roof-garden«, des »Astor-Hotels«. Es gibt auch anderswo in der Welt Dachgärten, z. B. in Petersburg auf dem »Hotel d'Europe«. Doch kann er sich mit der vorwitzigen Probe amerikanischer Gartenbaukunst auf dem Dache des »Astor-Hotels« natürlich nicht im entferntesten messen. Schon den Dimensionen nach ist der »Astor-roof-garden« unendlich viel imposanter. Dort gibt es offene und geschlossene Wandelhallen, Squares mit wundervollen Blumenrabatten, ganze Palmenhaine und weiß der Himmel was alles noch. Eine wahrhaft geniale Einrichtung kann man während der mit Recht berüchtigten amerikanischen Hitzwellen nicht genug preisen. Ein großer Teil des Gartens hat nämlich ein Dach aus Glas, und über dieses Dach rieselt ununterbrochen kühles Wasser, wodurch die Temperatur dort immer erträglich ist. Überdies machen diese fließenden Wasser abends beim Lichte unzähliger bunter elektrischer Flammen einen höchst phantastischen Eindruck. Man wähnt sich auf dem Grunde des Ozeans und wartet auf die Fische und Seesterne, die gleich vorbeischwimmen werden. Dekoration zu Rheingold, erster Akt. Und das alles in der Höhe des fünfzehnten Stockwerkes.
Entsprechend diesem Restaurant-Luxus sind natürlich auch die Wohnräume des Hotels aufs raffinierteste eingerichtet und mit allen Bequemlichkeiten der modernen Hoteltechnik versehen. Daß jedes Logis sein eigenes Badezimmer hat und auch im Waschtisch fließendes heißes Wasser, versteht sich in Amerika von selbst. Weniger selbstverständlich, aber ebenso angenehm ist das Telephon in jedem Logis, und zwar ein Telephon, mit dem man nicht nur die Dienstboten anruft, sondern Anschluß nach Chicago, Philadelphia, mit einem Wort überallhin, wo es Telephonleitungen gibt, haben kann. Elektrische Glocken sind übrigens verpönt. Auf einen Anruf der Zentrale des Hotels erscheint prompt der gewünschte dienstbare Geist.
Ein Patent des »Astor-Hotels« ist eine ingeniöse Einrichtung, vermittels derer jeder Hotelgast sofort erfährt, wenn Post für ihn da ist. Jede Nummer hat ihr Postfach. Wenn nun ein Brief oder auch nur eine Visitenkarte in das Postfach hineingeschoben wird, schließt sich eine elektrische Leitung, und in der betreffenden Nummer leuchtet an der Wand ein Menetekel in roter Schrift auf: »mail for you in the office«. Natürlich freut man sich diebisch über diese frohe Botschaft, wenn man abends sein Zimmer betritt. Ein Ruf ins Telephon, und nach fünf Minuten ist man im Besitze seiner Briefe.
Dennoch gab es in New York eine Zeit, in der wir sowohl die Post als auch das Telephon verwünschten. Das war während der ersten vier bis fünf Tage. Und verekelt wurden uns diese beiden nützlichen und angenehmen Institutionen durch meine lieben Kollegen – die New Yorker Journalisten.
Das ist ein Kapitel für sich und sein Inhalt ist tragikomisch. Wenn ich bei seiner Wiedergabe etwas persönlich werde, werden mir das meine verehrten Leser hoffentlich nicht verübeln.
Die Amerikaner bilden sich bekanntlich ein, die demokratischste aller Nationen zu sein. Das hindert sie jedoch keineswegs, einem so dreisten und naiven Snobismus zu huldigen, wie er in Europa glücklicherweise nur noch ausnahmsweise vorkommt. Mein Reisekamerad führt vor seinem Namen einen nach amerikanischen Begriffen außerordentlich hohen Titel. Dieser Umstand genügte, um bei unserer Ankunft in New York an der Landungsbrücke der Hamburg-Amerika-Linie ein ganzes Heer von Reportern und Photographen zu versammeln, denn die Passagierliste des Dampfers war nach New York telegraphiert worden. Da wir auf diesen Ansturm völlig unvorbereitet waren, gaben wir den Herren bereitwilligst Auskunft über alles, was sie wissen wollten, in der Annahme, daß sie sich wirklich für unsere Erlebnisse in den südamerikanischen Tropen interessierten. Stutzig wurden wir, als auch bei unserer Ankunft im Hotel, wo wir ebenfalls telegraphisch angemeldet waren, uns die Visitenkarten einiger Berichterstatter amerikanischer Zeitungen überreicht wurden. Sie folgten uns auf Schritt und Tritt, wo wir gingen und standen, assistierten uns beim Frühstück, notierten sich eifrig das Menü, fragten nach lauter Dingen, die sie ganz und gar nichts angingen und interessierten sich besonders für unsere Meinung über die amerikanischen Frauen. Am nächsten Morgen schon durften wir die Früchte dieser aus angeborener Höflichkeit gewährten Interviews genießen. Alle New Yorker Zeitungen brachten spaltenlange Artikel, die sich aufs ausführlichste mit unserer Wenigkeit beschäftigten. Die Phantasie der Reporter feierte dabei wahre Orgien. Von unseren südamerikanischen Erlebnissen kein Wort, dagegen die Mitteilung von lauter zu sensationellen Ereignissen aufgebauschten Nichtigkeiten.
Wir hatten unseren Koffer, der unsere Gesellschaftsanzüge enthielt, nicht gleich bekommen können und waren infolgedessen gezwungen, in Jackettanzügen zum Mittagessen im Speisesaal des Hotels zu erscheinen: Daraus wurde ein fulminanter Artikel: »Russian Prince dining in the Astor-Hotel in a white flannel suit«. Der phantasiebegabte Journalist schilderte in lebhaften Farben das Entsetzen, das wir beim maitre d'hôtel hervorgerufen hatten, das Aufsehen, das wir bei der Tischgesellschaft erregten, zählte die Gläser »wodki« auf, die wir angeblich getrunken, und die Portionen Kaviar, die wir gegessen hatten, schilderte dann den Inhalt unserer vierzehn (!) Koffer, als wenn er sie selbst eingepackt hätte, und schloß mit der weisen Sentenz, daß wahre Vornehmheit sich auch in einer weißen Flanelljacke nicht verleugnen könne. Von alledem war nur wahr, daß wir statt in Smokings in blauen Anzügen klein und bescheiden in einer Ecke des Speisesaales zu Mittag gespeist hatten.
Ein anderer Reporter ging gleich in medias res. »Russian Prince in New York not for a bride but for study« war sein Artikel mit Riesenlettern überschrieben. Darin standen die wunderbarsten Dinge, die wir angeblich über die Frauen sämtlicher Weltteile und besonders über die amerikanischen Damen geäußert hatten. Sittliche Entrüstung hatten bei uns der »Tango«, der »Turkey-Trot« und wie alle diese geschlichenen, geschaukelten und geschwungenen amerikanischen Schiebetanz-Scheußlichkeiten sonst noch heißen, hervorgerufen. Dem »Mondscheintanz« (??) der bolivianischen Indianerinnen gaben wir entschieden den Vorzug. Diesen ganzen Unsinn hatte sich der kühne Federheld bis auf den letzten i-Punkt aus den Fingern gesogen.
Noch ein anderer schilderte in tragischen Tönen ein völlig belangloses Erlebnis: »Real Russian Prince lost in the L-train«, dem die wahre Begebenheit zugrunde lag, daß wir uns am ersten Abend vergeblich bemüht hatten, mit den Untergrund- und Hochbahnen nach Coney-lsland zu kommen, was mißlang, da wir stets in die falschen Wagen einstiegen und von den bis zur Grobheit unhöflichen Yankees auf keine Weise eine vernünftige Auskunft erhalten konnten. Lange leutselige Gespräche, die mein Kamerad dabei mit den Schaffnern und Mitreisenden geführt hatte, erfuhren wir aus diesem Artikel zum erstenmal.
Da meine Person als solche den amerikanischen Journalisten zu gering war, avancierte ich je nach Bedarf zum »Baron« oder »Professor«. Ein ganz dreister Reporter, den ich nie gesehen habe, leistete sich dabei eine wundervolle Beschreibung meiner äußeren Erscheinung, wobei er sich lange bei der Schilderung meines wallenden weißen Bartes aufhielt und voller Rührung erzählte, welch ein herrliches Verhältnis zwischen dem »genial old gentleman«, dem intimsten Freunde des Grafen Tolstoi (das war ich), und seinem Schutzbefohlenen (mein Reisekamerad) herrsche und mit welch einer Andacht der junge Springinsfeld von Prinz die Weisheit von den Lippen seines »general adviser« lese, der übrigens zuweilen auch als »safety-brake« (Sicherheitsbremse) zu funktionieren habe.
Zuerst amüsierten wir uns über den Unsinn, dann ärgerten wir uns, endlich schnaubten wir Wut, besonders als uns auch aus anderen amerikanischen Städten, Boston, Chicago, Philadelphia Zeitungsausschnitte zugingen, die denselben haarsträubenden Blödsinn, noch verbrämt und ausgeschmückt, enthielten. Den ganzen Tag rasselte das Telephon. Erst waren es nur Reporter, dann Photographen, die uns bei uns, bei sich, vor dem Hotel, im Auto, auf der Straße, immer unentgeltlich photographieren wollten, dann klingelten allerhand Agenten, Wucherer, Damen »der Gesellschaft«, die uns zu Fünfuhr-Tanzkränzchen einluden, verkrachte Russen, darunter ebenfalls einige Fürstinnen und Gräfinnen, die die unglaublichsten Anliegen hatten usw. Denn alle Zeitungsartikel erschienen mit voller Nennung unserer Namen und genauer Angabe der Adresse. Da wir nur wenige gute Freunde in New York hatten, die der Hotel-Administration ausnahmslos bekannt waren, war es glücklicherweise nicht schwer, Gegenmaßregeln zu ergreifen. Wir ordneten kurz entschlossen an, daß kein Mensch, wer es auch sei, empfangen werde und daß keine Telephonverbindung mit unserer Nummer herzustellen sei. Dann hatten wir endlich Ruhe. Aber der »Russian Prince« spukte noch lange in den amerikanischen Blättern.
Für den Snobismus der Amerikaner und ihr Zeitungswesen ist das Erzählte sehr charakteristisch. Es gibt nur zwei Dinge, von denen sich die amerikanischen Journalisten nähren: Klatsch und Sensation. Sonst existiert für sie nichts. Das Niveau aller amerikanischen Zeitungen – auch der deutschen – ist ein geradezu klägliches. Die verpöntesten Pariser Klatschblätter sind trockene wissenschaftliche Revuen dagegen.
Übrigens gibt es noch ein Drittes, wovon die amerikanischen Zeitungen schwellen und ihre Besitzer reich werden: die Reklame. Über das Reklame-Unwesen in Amerika ließen sich Bände schreiben und sind wohl auch schon geschrieben worden. Doch zeigt es sich zuweilen in ganz amüsanten und sogar hübschen Formen. Zu diesen gehört die fabelhafte Lichtreklame, die abends und nachts in den Straßen von New York getrieben wird. Man kann sich denken, welch wunderbare Flächen für Elektrizitäts-Orgien die Brandmauern der Wolkenkratzer abgeben. Diese Gelegenheit nutzen die Amerikaner denn auch gründlich aus. Ganz New York scheint am Abend in Flammen zu stehen. Die Beleuchtungstechnik feiert Triumphe. Die unglaublichsten Dinge spielen sich an den Wänden der Häuser ab, dargestellt durch elektrische Lampen: Boxerkämpfe, Pferderennen, Tänze, weiß der Himmel was alles noch. Diese Illumination bietet ein feenhaftes Bild, an dem man sich anfangs gar nicht satt sehen kann. Außerdem sind diese weithin leuchtenden Reklameschilder vortreffliche Orientierungstafeln für alle Fremde. Zu unserem Leitstern wurde ein zirka dreißig Etagen hoher Frauenkopf, der freundlich mit dem linken Auge blinzelte. Er lud zum Einkauf von »Spearmint« ein. Das ist eine besonders beliebte Sorte des amerikanischen Kaugummis. In Amerika kaut nämlich jedermann von morgens früh bis abends spät Gummi. Hoffentlich ist das ebenso hygienisch, wie es unästhetisch ist. Der Fremde freilich verwünscht den Gummi in der Amerikaner Munde. Zu einer Konversation wird dieser Gummi nämlich nicht etwa herausgenommen oder ausgespuckt, sondern bloß mit der Zunge beiseite geschoben. Nun spricht der Amerikaner sowieso sein Englisch als wenn er Brei im Munde hätte. Dieser Gummiballen in der Backentasche verwandelt seine Aussprache vollends in eine Folge unartikulierter Laute und Geräusche. Wenn man gerade eine halbe Stunde lang mit einem Chauffeur oder Schutzmann geredet hatte, um ihr Kautschuk-Englisch endlich doch gründlich mißzuverstehen und dann zu der freundlich blinzelnden Spearmint-Dame aufblickte, schien ihr Lächeln nur noch Spott und Schadenfreude auszudrücken, und man wußte nicht, was man mehr verwünschen sollte, die Gummi-Industrie oder die elektrische Beleuchtungstechnik, die für sie Reklame macht.
Der Mord-, Spiel- und Skandalprozeß des amerikanischen Polizeileutnants Becker hat die New Yorker Polizei in den Augen Europas diskreditiert. Wir sind ja froh, wenn wir den Nachbarn jenseits des Großen Wassers nachsagen können, daß bei ihnen irgend etwas faul ist. Müssen wir doch in vielen Dingen, wenn auch noch so ungern und widerstrebend, ihre Überlegenheit zugeben. Aber auch in bezug auf die amerikanische Polizei sollte man sich hüten, auf Grund sensationeller Zeitungsnachrichten ein vorschnelles Urteil zu fällen. Eine Eiterbeule beweist noch lange nicht, daß der ganze Organismus krank ist.
Tatsache ist jedenfalls, daß die Einrichtungen der New Yorker Polizei über jedes Lob erhaben sind. Wie diese Einrichtungen funktionieren, ist eine andere Frage, die man erst nach gründlichem Studium der einschlägigen Verhältnisse beantworten könnte.
Bei flüchtigem Einblick wirkt die Organisation der Kriminalpolizei in New York verblüffend. Dank einer einflußreichen Empfehlung durften wir die Einrichtungen des Haupt-Polizeiamts aufs Genaueste in Augenschein nehmen. Es scheint unmöglich, daß jemand, der einmal mit der New Yorker Kriminalpolizei in Berührung gekommen ist, sich jemals wieder vor ihr verbergen könnte.
Ein besonderer Raum enthält die Verbrecher-Albums, d. h. Photographien-Schränke, in denen an beweglichen Rahmen, sorglich geordnet und numeriert, die Porträts sämtlicher Personen zu finden sind, die das Kriminalamt als verdächtig passiert haben. Jede Karte zeigt zwei Aufnahmen, die eine en face, die andere im Profil. Für den Physiognomiker ist diese Porträt-Galerie natürlich eine wahre Fundgrube, aber auch dem Laien fällt es schwer, die Durchsicht der Schränke einzustellen. Leider ist es unmöglich, diese ganze, weit über Hunderttausend Nummern umfassende Sammlung in Augenschein zu nehmen.
Man findet unter den Verbrecher-Physiognomien außerordentlich interessante Gesichter. Man möchte gerne einen oder den anderen Kopf genauer betrachten. Und es reizt einen natürlich, die Geschichte der betreffenden Personen kennen zu lernen. Das ist dem Beschauer übrigens leicht gemacht. Neben der Photographie befindet sich eine zweite Karte, die nicht nur das Signalement des Verbrechers enthält, sondern auch eine kurze Angabe der Art und der Zahl seiner Verbrechen. Neben Raubmördern finden sich dort harmlose Hochstapler, neben Dieben und Wechselfälschern – Heiratsschwindler und Falschmünzer. Eine Nummer auf der Karte verweist einen an einen der Schränke des nebenanliegenden Archivs. Dort findet man in dem betreffenden Schubfache nicht nur das ganze Aktenmaterial, sondern auch alle Zeitungsnotizen über den betreffenden Verbrecher und alle Darstellungen, die seine Schandtaten in der Presse gefunden haben. Oft ist es eine ganze kleine Bibliothek, die zu diesem oder jenem Verbrecherkopf gehört. Wieder eine andere Nummer gibt die Stelle an, wo man das genaue Signalement des Mannes, die Resultate der an ihm vorgenommenen anthropometrischen Messungen und die Photographie seiner Fingerabdrücke finden kann. Überall herrscht eine so musterhafte Ordnung, daß sich jeder Laie sofort zurechtfinden kann, ohne fremder Beihilfe zu bedürfen.
Ein Kapitel für sich bilden die Fingerabdrücke. Der uns begleitende Kriminalbeamte konnte sich nicht genug tun in Lobpreisungen dieses angeblich unfehlbaren Mittels zur Diagnostik von Verbrechern. Das Liniensystem der Fingerspitzen ist jetzt minutiös klassifiziert. Mit kabalistisch anmutenden Zahlen und Buchstaben kann jeder Fingerabdruck aufs genaueste rubrifiziert werden. Das erleichtert nachher seine Auffindung unter dem schon vorhandenen Material sehr erheblich. Unser Führer zeigte uns nachher die Abdrücke eines Zeige- und Mittelfingers, die kürzlich am Tatort eines Verbrechens an einem silbernen Eßlöffel nachgewiesen worden waren und die zur unfehlbaren Identifizierung des Verbrechers – es handelte sich um einen ganz scheußlichen Raubmord – geführt hatte. Wenn man sich das Gewirr der Linien eines Fingerabdrucks unter der Lupe betrachtet, wird allerdings ohne weiteres klar, daß eine genaue Wiederholung dieses komplizierten und bizarren Labyrinths an einem anderen Finger unmöglich ist. Leider sind jetzt nur schon viele amerikanische Verbrecher so schlau, in Handschuhen zu »arbeiten«.
Eine höchst wichtige Rolle im amerikanischen Kriminalwesen spielen die Detektivs. Es wimmelt in New York von Geheimpolizisten. Auf Schritt und Tritt begegnet man allerhand Nick Carters und Nat Pinkertons aus Fleisch und Bein.
In allen Theatern und großen Kaufläden, auf den Bahnhöfen, in den Stadtbahnzügen, an allen öffentlichen Plätzen und in sämtlichen großen Hotels sind sie in Massen zu finden.
In der Halle des »Astor-Hotels« lernten wir sie, durch den Direktor aufmerksam gemacht, bald von anderen Hotelgästen unterscheiden. Mit einem, der ganz besonders vertrauenerweckend aussah, befreundeten wir uns sogar. Der Mann erzählte so viel Interessantes von seiner Tätigkeit, daß in meinem Reisekameraden und in mir der Wunsch erwachte, das Feld seiner früheren Tätigkeit, d. h. die eigentliche Verbrecher-Gegend New Yorks kennen zu lernen. Daraufhin machte uns der Brave den Vorschlag, uns eine Nacht in den verrufensten Stätten des dunkelsten New York herumzuführen. Nachdem uns die Hotel-Administration versichert hatte, daß wir uns dem Mann ruhig anvertrauen könnten, nahmen wir diesen Vorschlag mit Freuden an.
Am nächsten Abend um 12 Uhr fuhr das Auto vor, und los ging es – ins dunkelste New York. Dieser Ausdruck gilt zunächst im buchstäblichen Sinn des Wortes. Durch eine Reihe von miserabel erleuchteten Straßen erreichten wir das Neger-Viertel der Stadt. Das größte Kontingent der Verbrecher in den Vereinigten Staaten ist unter den Schwarzen zu suchen. Wenn man sieht, wie diese Leute behandelt werden, kann man es ihnen eigentlich nicht übel nehmen, daß sie von Haß und Rachedurst gegen die Weißen erfüllt sind. Der weiße Amerikaner sieht den Neger nicht als Menschen an, sondern als inferiores Wesen, vor dessen Berührung ihn ekelt. Ich lernte in New York eine alte Dame kennen, die täglich die unzähligen Treppenstufen zu ihrer im achten Stockwerk gelegenen Wohnung hinauf keuchte, weil sie es für nicht vereinbar mit ihrer menschlichen Würde hielt, den Lift zu benutzen, der von einem Negerboy bedient wurde. Doch das nur nebenbei.
Dieser Horror vor allem, was ein »colored man« ist, zwingt die Neger, in dem für sie reservierten Stadtviertel zu leben und zu sterben. Wir suchten zuerst eine Negerkneipe dritten Ranges auf. Unser Nick Carter schien dort wohlgelitten zu sein. Der Wirt empfing ihn mit ausgesuchter Höflichkeit. Es ging in dem Lokal etwas laut, aber keineswegs anstößig zu. In der Mitte des ziemlich kleinen Raumes drehten sich einige Negermädchen und -burschen im Tanz. Die Musik dazu lieferten ein schwarzer Pianist und zwei ebenso schwarze Gitarristen. Sie eroberten meine Sympathien sofort. Ich habe eine große Schwäche für die originellen Rhythmen der Negermelodien. Sie enthüllen ihren ganzen Reiz aber erst, wenn man sie von Negern selbst spielen hört. Diese Selbstverständlichkeit und Elastizität der stets synkopierten Rhythmen bringt ein Europäer nie und nimmer heraus, er mag noch so musikalisch sein. Furchtbar aber ist es, wenn die Neger anfangen zu singen. Leider tat das eine anwesende Negermaid. Sie hatte, wie alle ihre Stammesgenossen, eine grauenhafte Stimme, ein Mittelding zwischen einem schlecht geschmierten Wagenrad und einem verbeulten Gießkannenrohr. Trotzdem erntete sie beim anwesenden Publikum rauschenden Beifall.
Wir waren die einzigen Weißen, und wurden von den Nebentischen aus scheel angesehen. Die Zuvorkommenheit des Wirtes, der uns selbst bediente, mag die Unzufriedenen im Zaum gehalten haben. Wenn man die Neger en masse beisammen sieht, kann man den animalischen Vorzügen ihrer Rasse seine Bewunderung nicht versagen. Es ist ein Vergnügen, diese tadellos gebauten Gestalten anzusehen, deren Muskelkraft legendarisch ist. Auch die Gesichter der nordamerikanischen Neger sind nicht häßlich. Die Nasen freilich sind nicht gerade von römischem Schnitt, doch fehlen die abstoßenden Lippenwülste der afrikanischen Schwarzen.
Weiße siedeln sich im Neger-Viertel von New York nur ausnahmsweise an. Es gibt nur wenige Weiße, die die Neger gerne unter sich dulden. Dazu gehören alle Personen, die irgend etwas mit der Boxerwelt zu tun haben. Der Box ist das Gebiet, auf dem sich Weiße und Schwarze am besten verstehen, vielleicht weil sie sich dabei von Zeit zu Zeit gegenseitig halb oder ganz totschlagen können. Der »berühmte« Ex-Boxer Tom Charkey, in gewissen Kreisen New Yorks eine der populärsten Persönlichkeiten, der in seinen besten Zeiten sogar »den« Joe Jeffries umgelegt hat, besitzt ein Café im Neger-Viertel New Yorks. Ihm galt unsere zweite Visite.
Im kleinen Lokal wimmelte es von Gestalten, denen man sonst wahrscheinlich mit großem Bogen aus dem Wege gegangen wäre. Der berühmte Mann empfing uns mit huldvoller Herablassung, spie einen langen braunen Strahl – das Resultat eifrigen Tabakkauens – hinter den Ladentisch, unbekümmert darum, wohin er traf und setzte uns dann, ohne sich nach unseren Wünschen erkundigt zu haben, eine Flasche Sekt auf den Tisch. Die trank er dann nachher mit großem Wohlbehagen selbst aus. Der Mann war überhaupt klassisch. Er war so durchdrungen von der Unwiderstehlichkeit seiner Erscheinung, daß er es nicht für nötig befand, irgend etwas zu äußern. Er saß da, stumm und großartig, spuckte von Zeit zu Zeit aus und ließ sich bewundern. Doch bewunderten wir mehr die Tragfähigkeit seines Stuhles, der unter dieser unglaublichen Last nicht zusammenbrach. Unnachahmlich war die Geste, mit der er in gemessenen Zeitabständen stumm und ernst seinen Arm über den Tisch herüberreichte, um uns seinen Bizeps befühlen zu lassen, wobei er wahrscheinlich erwartete, daß wir in Krämpfe des Entzückens und der Bewunderung verfallen würden. Wer beschreibt unser Erstaunen, als zu der leisen Musik eines unsichtbaren Orchesters dieser Mann plötzlich zu singen anfing, und zwar mit einem zittrigen dünnen Fistelstimmchen, das aus dem Mund eines schwachen Kindes zu kommen schien. Ihn selbst rührte sein Gesang so, daß ihm eine Träne über das Gebirge seiner Backe lief. Es war augenscheinlich der letzte Trumpf, den er wohlüberlegt ausspielte, um uns endgiltig aus der Fassung zu bringen. Das gelang ihm auch, aber in einem Sinne, der ihm schwerlich lieb war. Zwei Kouplets konnte ich mit dem nötigen Ernst anhören, doch als ich beim dritten die verzweifelten Muskelspannungen in meines Gefährten Gesicht bemerkte, war meine Fassung tatsächlich dahin. Ich mußte aufspringen und mich auf die Straße retten, sonst wäre ich zweifelsohne in nähere Berührung mit dem soeben befühlten Bizeps geraten.
Nun brachte uns das Auto quer durch New York in noch entlegenere Gegenden. An einer Straßenecke hielt es. Den Rest des Weges mußten wir, um nicht aufzufallen, zu Fuß zurücklegen. Auf den Rat des Detektivs hatten wir uns schon beim Antritt dieser Fahrt bemüht, unserm Aussehen einen etwas rowdyhaften Anstrich zu geben. Nun zogen wir die Mützen noch tiefer herab, schlugen die Rockkragen hoch und schlichen an den Wänden entlang durch die dunklen Gassen. Hin und wieder begegneten uns ähnliche Gestalten, die jedoch den Vorzug der Echtheit hatten.
Vor einem Hoftor blieb unser Führer stehen. Nach langem vorsichtigen Klopfen wurde uns geöffnet. Der sehr wenig einladend aussehende Zerberus ließ uns herein, nachdem sich unser Führer ausgewiesen hatte. Durch eine kleine Hintertür betraten wir ein geräumiges Schenkzimmer. Am liebsten wären wir freilich sofort wieder umgekehrt. Ein lebendig gewordenes Verbrecher-Album aus dem Kriminalamt schien den Raum zu bevölkern. So in Freiheit vorgeführt sind die Verbrecherfratzen doch sehr viel weniger anziehend, als auf dem schönen Glanzpapier der Photographie. Wir drückten uns scheu in eine Ecke mit dem schlechten Gewissen unbefugter Eindringlinge. Man sollte das Hausrecht jeder Gesellschaftsklasse respektieren. Übrigens wurden wir überhaupt nicht beachtet. In dem ganzen Lokal herrschte Totenstille. Die Leute saßen einzeln und in Gruppen um die schmutzigen viereckigen Tische und stierten teilnahmslos vor sich hin. Wir befanden uns dort, wofür Gorki den wunderbar treffenden unübersetzbaren Ausdruck »na dnje« (auf der Neige) gefunden hat. Gewesene Menschen umgaben uns. Ihr erloschener Blick verriet keine Möglichkeit von Initiative mehr, nicht einmal zu einem neuen Verbrechen. Die meisten saßen im Halbschlaf da, nur wenige hatten ein Riesenglas Bier vor sich stehen, das dort wohlfeil und schlecht zu 5 Cents verschenkt wird. Unser Führer bedeutete uns, daß die Besucher dieses Lokals ungefährlich, obgleich der Polizei wohlbekannt seien. Es waren »gewesene« Verbrecher, deren Energie durch lange Zuchthausstrafe endgiltig gelähmt war, oder die einfach zu alt waren, um neue Schandtaten auszuhecken. Der Detektiv holte einige an unseren Tisch heran und für ein Glas Bier erzählten die Leute bereitwillig aus ihrem vielbewegten Leben. Ich müßte ein Buch schreiben, wollte ich ihre zum Teil hochinteressanten Erzählungen wiederholen.
An einem der Nebentische war mir von Anfang an die Gestalt eines älteren Mannes aufgefallen, der mit einem trotzig-verächtlichen Ausdruck vor sich hinstarrte und unserem Erscheinen nicht die geringste Aufmerksamkeit geschenkt hatte. Wäre er nicht so unrasiert gewesen und hätte er einen weniger zerrissenen Rock und einen weniger schäbigen Hut gehabt, so hätte man in ihm ebenfalls einen neugierigen Besucher vermuten können. Ja, mehr als das. Der Mann sah richtig vornehm aus und hatte ein ganz außerordentliches intelligentes Gesicht. Ich fragte unsern Detektiv, ob er ihn nicht kenne. Freilich kannte er ihn. Vor zehn oder fünfzehn Jahren war dieser Bettler eine der geachtetsten Persönlichkeiten der New Yorker haute volée, Bankdirektor und ein schwer reicher Mann. Infolge einiger mißlungener grandioser Spekulationen wurde er Wechselfälscher, kam ins Zuchthaus und jetzt saß er hier. Nur widerwillig folgte er der Einladung an unseren Tisch. Er sprach kaum ein Wort, nahm aber dankend ein Glas Bier an, da er sich selbst keines bezahlen konnte. Es machte einen niederdrückenden, trostlosen Eindruck, in dieser Umgebung einen Menschen zu finden, der in jeder Geste den Gentleman verriet und der sich mit einer gewohnheitsmäßigen Bewegung den schmutzigen Kragen zurechtschob, als er an unseren Tisch trat. Zu helfen war diesem Manne nicht, der jetzt nichts mehr sein konnte, als ein wandelndes Beispiel der Unerbittlichkeit und Grausamkeit amerikanischer Lebensverhältnisse. Dennoch verstand ich nur zu gut die Gefühlsregung meines Gefährten, der gerade diesem Manne, als wir weggingen, seine ganze Barschaft heimlich in die Rocktasche steckte.
Im nächsten Lokal, das wir aufsuchten, ging es vergnügter zu. Von den »gewesenen« kamen wir zu den gegenwärtigen Verbrechern. Auch hier galt es, verschiedene Präliminarien zu erledigen, bevor wir – wieder durch eine Hintertür – in eine Restaurationsstube hineingelassen wurden, in der eine ausgelassene Fröhlichkeit herrschte. Im dichten Tabaksqualm war anfangs nichts zu unterscheiden. Eine wenig liebenswürdige Gestalt – vielleicht ein Meuchelmörder oder Leichenschänder – klimperte auf einer Mandoline, einige junge Burschen stampften dazu einen wilden Niggertanz. Unser Erscheinen wurde mit Halloh begrüßt. Natürlich waren wir sofort als »outsider« erkannt, trotz der aufgeklappten Rockkragen und der Apachenmützen. Vor dem Detektiv, der natürlich auch allen bekannt war, hatte man nicht die geringste Scheu. Hier waren die Verbrecher bei sich zu Hause. Um einen von ihnen herauszuholen, dazu hätte es schon eines beträchtlichen Polizeiaufgebots bedurft, ein einzelner Geheimpolizist flößte ihnen keinen Respekt ein. Da wir in der Minderzahl waren, beschlossen wir, uns mit den Herrschaften gut zu stellen, und ließen eine Runde Bier für die ganze Gesellschaft auffahren. Wir wurden reichlich belohnt. Es wurden uns zu Ehren Tänze aufgeführt und Lieder gesungen, die wir sonst sicherlich nie in unserem Leben zu sehen und zu hören bekommen hätten. Überhaupt kann ich nicht verhehlen, daß die New Yorker Apachen, wenigstens die jüngeren Jahrgänge, unter sich ein höchst unterhaltendes und gar nicht unsympathisches Völkchen sind, d. h. solange sie einem nicht an die Gurgel fahren und die Hände in den eigenen Taschen lassen. Daß sie die gesellschaftliche Ordnung nicht respektieren, ist schließlich ihre Privatangelegenheit.
Nicht ohne Freundschaftsbeteuerungen nahmen wir von den Galgenvögeln, deren Gesellschaft wir bald genugsam genossen hatten, Abschied. Ihre abgefeimten Gaunerphysiognomien bemühten sich dabei, ehrbar und anständig zu blicken, was jedoch nur mangelhaft gelang. Auf den Straßen dieser Gegend war uns entschieden ungemütlicher zumute, als in der verräucherten Kneipe. Das lichtscheue Gesindel, das unseren Weg auf Schritt und Tritt kreuzte, sah sehr wenig vertrauenerweckend aus. Als wir wieder im Auto saßen, fühlten wir uns in Sicherheit.
Die nächste Station war an der Peripherie der Chinesenstadt. Wieder hieß es aussteigen und ein Gewirr von Gassen und Gäßchen zu Fuß durchwandern. Vor einem finsteren alten Hause blieb unser Führer stehen. Wir traten durch das offene Hoftor ein. Durch dunkle Korridore, über schmale Stiegen ging es immer tiefer ins alte Haus hinein. Wir mußten leise auftreten. Endlich wurde Halt gemacht. Wir befanden uns in einem schmutzigen Flur, der durch eine Petroleumlampe – welch ein Anachronismus anno 1913 in New York! – nur spärlich erleuchtet wurde. Der Detektiv klopfte an eine kleine Tür. Nach geraumer Zeit wurden dahinter schlürfende Schritte laut. Ein schmaler Spalt öffnete sich. Als der Detektiv irgend ein geheimnisvolles »Sesam, Sesam, tue dich auf« hineingeflüstert hatte, wurde er breiter. Eine alte Schlampe, auf deren Gesicht alle sieben Totsünden verzeichnet standen, ließ uns eintreten.
Ein merkwürdig penetranter süßlicher Geruch schlug uns entgegen. Die Bestimmung des Raumes, der uns aufnahm, ließ sich nicht feststellen. Es war ein Mittelding zwischen Küche, Vorzimmer und Rumpelkammer. Auf dem Fußboden lagen zerschlagene Flaschen und zerbrochenes Geschirr, an den Wänden hingen allerhand phantastische Kleidungsstücke. Was sich sonst noch darin befand, ließ sich im mystischen Halbdunkel nicht unterscheiden. Das alte Scheusal von Türhüterin führte uns stumm in den nebenanliegenden Raum. Dort bot sich uns ein höchst eigenartiges Bild, wie man es sonst nur in bösen Träumen sieht. Die eine Hälfte des winzig kleinen Zimmers nahm eine mit weichen Kissen belegte Ruhebank ein. Darauf lagen zwei Chinesen und eine Frau mittleren Alters. Zwischen ihnen standen zwei Tabletts mit allerhand geheimnisvollen Gerätschaften, auch zwei trübe brennende Öllampen, die als einzige Beleuchtungskörper dienten. Die Luft war von demselben süßlichen aber nicht unangenehmen Geruch geschwängert.
Opium! Der eine Chinese regte sich nicht mehr. Vielleicht schlief er. Aber auch der andere verriet nicht die geringste Anteilnahme an dem, was um ihn herum vorging. Mit einer ganz mechanischen Bewegung griff er von Zeit zu Zeit nach einem Glasstäbchen, tauchte das in ein Flakon mit der braunen Opium-Salbe, hielt es ohne hinzusehen über die Flamme der Lampe, wo sich das Opium aufblähte, drehte dann ebenso mechanisch und teilnahmslos eine Pille, steckte sie in seine Pfeife, die den Kopf merkwürdigerweise in der Mitte hatte, und sog in fünf bis sechs langen Zügen mit einem ekelhaft schnarchenden Geräusch den giftigen Rauch ein. Dann sank er wieder erschlafft in die Kissen zurück, um nach fünf Minuten dieselbe Prozedur zu wiederholen. Genau dasselbe tat seine Nachbarin, die übrigens ihrer Kleidung nach entschieden den besseren, wenn nicht gar den sehr guten Ständen New Yorks angehören mußte.
Der Chinese reagierte auf keinerlei Fragen. Dagegen zog mich die Dame, die neben ihm lag, selbst in ein Gespräch. Sie pries das Opium als das einzige Ding, das das Leben lebenswert mache. Sie selbst rauchte seit einigen Monaten und behauptete, seither der glücklichste Mensch der Welt zu sein. Jetzt lag sie seit einigen Tagen auf dieser Ruhebank, nahm fast gar keine Nahrung zu sich, schlief wenig, befand sich aber immer in einem Dämmerzustande, der ihr die höchsten Glücksempfindungen vortäuschte. Einen Rausch stellte sie in Abrede. Das sei durchaus nicht die Wirkung des Opiums. Man verliere nicht für einen Augenblick die Besinnung, genieße aber unausgesetzt das höchste körperliche und seelische Wohlbehagen. Man liebt alle Menschen, fühlt sich von allen geliebt, glaubt edel, gut und tugendhaft zu sein und verlangt vom Leben nichts weiter, als – eine Pfeife und ein Flakon von dem süßen braunen Gift.
Je länger man die Opiumdünste einatmet, desto verführerischer erscheint einem der Geruch. Nur mit Mühe konnte ich der Versuchung widerstehen, einige Züge aus der mir angebotenen Pfeife zu entnehmen.
In New York wird das Opiumrauchen bekanntlich mit drakonischer Strenge bestraft. Auf den Vertrieb von Opium stehen als Strafe sieben Jahre Zuchthaus. Dennoch gelingt es nicht, des Lasters Herr zu werden. Wer ihm einmal ergeben ist, kann nicht davon lassen, auch wenn man ihn mit der Todesstrafe bedroht. Woher übrigens unser Detektiv Zutritt zu dieser Opiumwirtschaft hatte, blieb unaufgeklärt.
Als wir uns durch das Gewirr der Stiegen und Korridore wieder auf die Straße gefunden hatten, atmeten wir die frische Morgenluft wie ein langentbehrtes Labsal ein. Das Auto mußte uns mit einem weiten Umwege nach Hause fahren. Aber das Opium ist zudringlich. Als wir uns die erste Papiros ansteckten, hatten wir wieder den süßlichen Geruch in der Nase, und noch zwei volle Tage lang verfolgte uns das penetrante Parfüm als lebendiges Zeichen des Cauchemars, den wir erlebt hatten.
Nirgends tritt der Gegensatz zwischen den beiden Ländern, die dieselbe Sprache reden, England und Nord-Amerika, schärfer hervor, als auf dem Gebiete des Sports. Aus dem Verhalten beider Nationen zum Sport kann man die weitgehendsten Schlußfolgerungen ableiten.
In England wird der Sport um seiner selbst willen getrieben. In Amerika ist er nur und in allen seinen Formen Mittel zum Zweck. Dieser Zweck ist die Wette. Ohne »betting« ist jeglicher Sport in Amerika undenkbar. Seit in den Vereinigten Staaten, laut Parlamentsbeschluß, allenthalben der Totalisator abgeschafft worden ist, ist der Rennsport dort bekanntlich total in Verfall geraten.
Aber bei allen anderen Gattungen des Sports wird das »betting«, wenn auch nicht mit Hilfe des Totalisators, so doch unverfroren genug betrieben.
In England gehört der Sport zu den Betätigungen, und zwar zu den wichtigsten Betätigungen des »gentleman«. In Amerika wird er fast ausschließlich von »professionals« betrieben. Die »gentlemen« beschränken sich aufs Zusehen und aufs – Wetten.
In England steht bekanntlich unter allen Sport-Spielen das Cricket weitaus an erster Stelle. Dem Lawn-Tennis und dem Fußball-Spiel kommt daneben nur eine untergeordnete Bedeutung zu. Es gibt keinen Engländer, der nicht Cricket spielt, oder in seinen jungen Jahren wenigstens gespielt hat. Der Cricket-Match zwischen den Universitäten Cambridge und Oxford gehört zu den wichtigsten nationalen Ereignissen. Das ganze Land nimmt mit dem Herzen daran Teil. Professionelle Cricket-Spieler gibt es aber in England, soviel mir bekannt ist, nur zum Zweck des Trainings.
Amerika hat auch sein nationales Spiel – das »base-ball« –, doch wird dieses höchst interessante und aufregende Spiel fast ausschließlich von professionellen Spielern betrieben. Alle öffentlichen Wettspiele wenigstens vollziehen sich zwischen professionellen Kommandos. Dennoch ist die Rolle, die dieses Spiel im öffentlichen Leben Amerikas inne hat, mindestens der des Cricket in England zu vergleichen.
Ich machte die erste Bekanntschaft mit dem base-ball-Spiel, von dem ich bis dato nichts gehört hatte, ganz zufälliger Weise.
Als ich während eines der ersten Tage meines Aufenthalts in New York den Broadway passierte, kam ich in der Nähe des Brooklyn-Squares buchstäblich nicht vorwärts und nicht rückwärts mehr. Der ganze riesengroße Platz war von einer vieltausendköpfigen Menschenmenge dicht bestanden. Auch in allen Querstraßen stauten sich die Passanten. Alle hatten die Köpfe erhoben und starrten in derselben Richtung auf die Fassade eines Wolkenkratzers. Von Zeit zu Zeit ging ein Gemurmel des Unwillens durch die Menge, oder sie wurde von Ausbrüchen des Entzückens bewegt. Nachdem ich das alles eine Zeitlang verständnislos mitangesehen hatte, entdeckte ich endlich die Zielscheibe aller Blicke. An besagtem Wolkenkratzer, ungefähr in der Höhe der sechsten Etage war eine viereckige grüne Tafel angebracht, die man auf den ersten Blick für einen aufrecht gestellten Billardtisch halten konnte. Auf dieser Tafel bewegten sich mit großer Geschwindigkeit einige weiße und blaue Pflöcke sowie eine kleine weiße Kugel hin und her.
Ein freundlicher Straßenjunge lieferte mir die Erklärung zu diesem Schauspiel, an dem ich vorderhand nichts Bemerkenswertes oder gar Interessantes entdecken konnte. Er erklärte mir, daß die weißen Pflöcke die »Geants« seien und die blauen die »Yankees« und daß die weiße Kugel einen Ball vorstelle, und das Ganze – einen base-ball-Match, der soeben 60 Kilometer außerhalb New Yorks ausgespielt werde. Der Gang des Spieles, jeder Ballwurf und jeder Schlag wird telephonisch übermittelt und auf elektrischem Wege auf der grünen Tafel reproduziert. Echt amerikanisch. Auf diese Weise kann man sich das Wettspiel ansehen und doch die Fahrkarte zum Spielplatz sparen.
Da jeder der Zuschauer natürlich seinen Favoriten hatte, dessen Schicksal mit gewetteten 10 Cents bis 10 und mehr Dollars eng verknüpft war, so wurden auch die das Spiel begleitenden Ausrufe psychologisch verständlich.
In New York und Umgegend sind eine ganze Anzahl wundervoller base-ball-Spielplätze gelegen. Enorme Tribünen in amphitheatralischer Anordnung, auf denen 10-15 000 Zuschauer Platz haben, schließen die Rasenfläche, auf der gespielt wird, ein. Jeden Tag wird irgend ein Match ausgefochten, und die Tribünen sind fast immer spickevoll besetzt. Wo in New York die vielen Tagediebe herkommen, die von 3 bis 6 nichts zu tun haben, als base-ball-Spiele anzusehen, bleibt rätselhaft.
Das Spiel, für das die Amerikaner sich so begeistern, ist eigentlich nichts anderes, als ein qualifiziertes »Ballschlagen«. Nur ist es gefährlicher. Denn der steinharte Ball fliegt aus der Hand der Spieler mit der Geschwindigkeit und Kraft einer Büchsenkugel. Die Zuschauer sind durch ein feinmaschiges Netz, das vor den Tribünen aufgespannt ist, vor ihm geschützt. Es gehört eine unfaßliche Geschicklichkeit dazu, den Ball in seinem rapiden Fluge mit einer kurzen flachen Keule abzuschlagen, und ihn dabei so gut zu treffen, daß man Zeit zu einem »run« in eine der vier Ecken des Grenzgebietes findet, bevor der Ball, mit kolossaler Geschwindigkeit von Hand zu Hand geschleudert, dort eintrifft.
Die Begeisterung, die das amerikanische Publikum dem base-ball-Spiel entgegenbringt, hat es zu einem höchst lukrativen Geschäft gemacht. Der Kapitän des berühmten Kommandos »Yankees« bezieht ein Ministergehalt, nämlich 30 000 Dollar im Jahr. Die Bedeutung, die dieses Spiel in Amerika hat, erkennt man schon daraus, daß alle amerikanischen Zeitungen an erster Stelle d. h. dort wo in vernünftigen Blättern die Leitartikel stehen, die Resultate sämtlicher base-ball-Spiele buchen, die am vorhergehenden Tage in den Vereinigten Staaten abgehalten worden sind.
Die Sport-Spiele, mit denen sich der amerikanische »gentleman« selbst befaßt, sind Polo und Golf. Sie sind schon deswegen in Amerika beliebt, weil es die teuersten aller Arten von Rasensport sind. Am Tage nach meiner Ankunft in New York wurde dort das Match zwischen dem besten amerikanischen und dem besten englischen Polo-Kommando ausgetragen. Das Interesse dafür war, natürlich nur auf Grund der abgeschlossenen Wetten, ein ganz außerordentliches. Die Billett-Aufkäufer, die ihr Unwesen in New York genau ebenso dreist und unverfroren treiben, wie anderswo, verlangten 50 Dollars und mehr für einen annehmbaren Sitzplatz. Am Tage des Matches war auch für diesen Preis keine Eintrittskarte mehr aufzutreiben. Doch konnte man die Aufregungen dieses Wettspiels in der Stadt genießen, ohne nach dem Polo-Ground hinauszufahren, denn der Gang des Spieles wurde alle fünf Minuten auf Riesenplakaten an den Wolkenkratzern der New Yorker »Times« und des »Herald« bekannt gegeben. Von der dichtgedrängten Menschenmenge, die diese Gebäude umstand, wurde jedes »Goal« der Amerikaner mit frenetischem Beifall, jeder Erfolg der Engländer mit ohrenbetäubendem Pfeifen und Johlen begrüßt.
Dem Golf huldigen die New Yorker Millionäre in reiferen Jahren ausnahmslos. Die nähere Umgebung von New York macht den Eindruck, als bestehe sie nur aus »Golf-Greens«. Mehr als hundert Golf-Klubs haben hier ihre ideal gepflegten Spielplätze. Überall sieht man die samtweichen, kurz geschorenen Rasenflächen, sauber beschnittene Hecken, künstliche Hügel, durch Wiesen geleitete Wasserläufe mit künstlich hergerichteten Ufern aus feinem, weißen Seesand. Dort erholen sich die »business«leute von des Tages Last und Mühe. Die wundervolle Besitzung Rockefellers am Ufer des Hudson-River scheint auch ein einziger großer Golfplatz zu sein. Dieses Spiel ist bekanntlich die einzige Leidenschaft des »reichsten Mannes der Welt«, der von seinem Boy begleitet stundenlang den kleinen, weißen Ball aus einem Loch ins andere treibt.
Eine eigentümliche Stellung nimmt in Amerika der Box ein. In dem Staate New York ist er seit einigen Jahren verboten, weil bei den durch Rassenhaß geschürten Boxer-Kämpfen zwischen Negern und Weißen alle Augenblicke ein Totschlag zu registrieren war. Dieses Verbot stört jedoch die findigen Amerikaner keineswegs, mindestens zweimal in der Woche auch in New York die aufregendsten Boxer-Kämpfe zu inszenieren. Man nennt sie offiziell »exhibitions«, und angeblich werden auf diesen »Ausstellungen« nur die Griffe, Stöße und Schläge des regelrechten Box theoretisch und praktisch demonstriert. In Wahrheit jedoch vollziehen sich genau dieselben Kämpfe wie andernorts, es werden genau ebensoviele Physiognomien zerschlagen und kommen die gefährlichsten »knock-out's« vor. Nachher heißt es dann, das sei »aus Versehen« passiert, Staat und Polizei fallen auf diesen Bluff mit der gleichen Grazie hinein.
Die sportlichen Veranstaltungen stehen unter den Vergnügungen, die New York im Sommer bietet, an erster Stelle. Die übrigen Amüsements sind noch minderwertigerer Art. Die Kunst schweigt vollständig. Aber schließlich ist es ja anderswo während der Sommerzeit auch nicht besser. In keinem einzigen ernsthaften Theater wird gespielt. Es gibt im Sommer weder Oper noch Schauspiel in New York.
In den Varieté-Theatern werden »Revuen« aufgeführt, die zum Teil mit fabelhaftem Luxus inszeniert sind und bei denen der mit Recht so beliebte »amerikanische Humor« oft zu unwiderstehlicher Wirkung gelangt. Man verläßt diese Theater meist mit Muskelschmerzen im Gesicht. Übrigens zeigt es sich, daß die Amerikaner bei dem leichten Genre von Musik, die diese Vorstellungen begleitet, höchst Anziehendes zu erfinden und zu gestalten verstehen. »Pikant« ist die Bezeichnung, die auf die Melodik, Rhythmik und Harmonik dieser amerikanischen Musik in gleicher Weise anwendbar ist. Ich habe einige der amerikanischen Revuen aus diesem Grunde zwei und mehr Male mit Vergnügen angehört, zumal die Orchester in allen amerikanischen Varietés nicht wie bei uns aus drei Violinen und einigen mehr oder weniger belanglosen Anhängseln bestehen, sondern den vollen Bestand eines symphonischen Orchesters mit 50-60 gutgeschulten Mitwirkenden darstellen.
Im allgemeinen tut man jedoch besser daran, die sommerlichen Vergnügungen in New York im Freien aufzusuchen. Schon um der Abendkühle wegen, die nach der barbarischen Hitze, die tagsüber in New York herrscht, höchst erquickend wirkt. Wer es irgend ermöglichen kann, flieht abends aus New York an die Küste des Ozeans, der sich z. B. bei »Long-Beach« oder bei »Long-Island« in seiner ganzen majestätischen Pracht vor einem ausbreitet. Wundervolle Automobilstraßen, 50-100 Kilometer außerhalb der Stadt immer noch unter Asphalt, führen dorthin. Exquisite Restaurants sorgen für des Leibes Wohl. Die Eisenbahnzüge, die alle zwei Minuten aus New York in jene Gegenden abgehen, sind allerdings derart überfüllt, daß ihre Benutzung mit Lebensgefahr verbunden ist. Am tollsten geht es natürlich auf den Verkehrswegen zu, die nach »Coney-Island« führen. Dieses Eldorado der New Yorker Kleinbürgerschaft ist mit der Bahn oder per Dampfer in zirka einer halben Stunde zu erreichen.
Auf Coney-lsland befindet sich das Urbild aller »Luna-Parks« der Welt, das von keiner Nachahmung erreicht, geschweige denn übertroffen worden ist. Der Anblick, den diese Amüsier-Insel nachts gewährt, ist tatsächlich überwältigend. Eine Orgie von Elektrizität, gegen die sogar die Straßen-Illumination von New-York verblaßt, wird dort allabendlich gefeiert. Die Konturen sämtlicher Vergnügungspaläste, Aussichtstürme, Restaurations- und Theaterbauten, die Wege der kilometerlangen Berg- und Talbahnen, Fesselballons- und Aeroplan-Karussels, Wasserrutschbahnen und Riesenschaukeln – alles ist mit elektrischen Glühbirnen nachgezeichnet. Der ganze Nachthimmel scheint in Flammen zu stehen, wenn man sich über die Hudson-Brücke Coney-lsland nähert. Der Ort hat die Dimensionen einer mittelgroßen Provinzstadt und besteht ausschließlich aus Vergnügungslokalen. Man würde Wochen brauchen, um sie alle kennen zu lernen. Ein Dutzend Leipziger Messen, ebensoviele Münchener Oktoberwiesen und russische Jahrmärkte würden nur einen kleinen Teil von Coney-lsland bedecken. Ein betäubender Radau herrscht in allen Straßen. Für alle Nationen ist gesorgt.
Der Deutsche findet einige enorme Biergärten mit echtem und unechtem »Münchener« und »Pilsener«, echten und unechten Tiroler Sängern, Käsestullen, Radis, deutschen »Humoristen« und ähnlichen für sein Amüsierbedürfnis unerläßlichen Dingen.
Der Italiener hat seine Osterias mit Mandolinen-Chören und Straßensängern, der Spanier kann sich an spaßhaften Stiergefechten ergötzen, für den Chinesen sind seine heimischen Ball- und Kugelspiele da, den Russen locken Balalaika-Klänge, Chorlieder und übertemperamentvolle Kosakentänze. Daß der Franzose an Chansonetten nicht zu kurz kommt, versteht sich von selbst.
Und der Amerikaner? Der nimmt, wie das ja überhaupt so seine Art ist, von allem ein wenig und zwar das Beste. Besondere Vorliebe bekundet er außerdem für die sogenannten »Wutstillungsbuden«, in denen er für 10 Cents soviel Fayence-Geschirr zerschmettern darf, als er mit fünf Holzbällen zu treffen vermag. Wenn er seinen Rassenhaß auszutoben beabsichtigt, findet er sogar einen lebendigen Neger, nach dessen grinsender Fratze er für 5 Cents mit einem steinharten Kautschukball werfen darf. Nur ist der Neger viel zu geschickt, um sich treffen zu lassen. Das gelang in meinem Beisein nur einem augenscheinlich virtuosen base-ball-Spieler. Der Neger verschwand darauf mit verbundener Nase von der Bildfläche, wurde jedoch sofort durch einen ebenso grinsenden und herausfordernd plattnasigen Stammesgenossen ersetzt.
Eine weitere »nationale« Eigenschaft des Amerikaners ist die Vorliebe für seine Schiebetänze. Denen kann er auf Coney-Island nach Herzenslust fröhnen. Es gibt dort Tanzsäle, in denen sich mehr als 2000 Paare gleichzeitig drehen können, ohne die gegenseitigen Hühneraugen als Tanzboden zu benutzen. Die Pausen werden dort durch Varieté-Darbietungen ausgefüllt, wobei die Bühne auf einer Art elektrischen Bahn um den Riesensaal herumfährt, damit niemand vom Galerie-Publikum zu kurz komme.
Bewundernswert und nicht genug zu loben ist der Anstand, der wie überall in Amerika, so auch auf Coney-Island herrscht. Der New Yorker Proletarier, der in seinem Privatleben vielleicht Stiefelputzer oder Schornsteinfeger ist, beträgt sich auf dem Tanzboden und bei den zum Teil sehr gewagten Vergnügungen des Luna-Parks genau so wie jeder Gentleman in den Salons der sogenannten »guten Gesellschaft«. Wenn man dagegen daran denkt, was man unter Umständen in den Luna-Parks von Paris und Berlin zu sehen bekommt, so kann man dem Anstandsgefühl des amerikanischen Bürgers seine Hochachtung nicht versagen. Ob die innere Moral und Sittlichkeit der Amerikaner diesem äußeren Bilde entspricht, ist natürlich eine andere Frage, deren Beantwortung jedoch ferner Stehende im Grunde genommen ganz und gar nichts angeht.
Zu meinen liebsten Erinnerungen an New York gehören die Stunden, die ich, dank der Vermittlung eines einflußreichen Mannes, in einer der nützlichsten und besten Institutionen der Vereinigten Staaten, dem Jugendgericht, zubringen durfte. Ich wohnte einer Sitzung bei, die von 10 Uhr morgens bis 4 Uhr nachmittags dauerte, doch ist mir die Zeit keinen Augenblick lang geworden, und das Einzige, was ich bedauerte, war, daß ich am nächsten Tage abreisen mußte, wodurch dieser erste Besuch im Jugendgericht leider auch zum einzigen wurde.
Das niederdrückende Gefühl, eine Verantwortung zu übernehmen, die man eigentlich nicht verantworten kann, muß den Jugendrichter in viel stärkerem Maße überkommen, als jeden anderen Rächer der gesellschaftlichen Ordnung. Denn er hat es ausschließlich mit Kindern zu tun, mit werdenden Menschen, die in den wenigsten Fällen selbst für ihre Handlungen einstehen können. Und davon, wie er diesen oder jenen Fall »angreift«, hängt vielleicht das Schicksal eines oder vieler Menschenleben ab.
Wenn man abends in den Straßen von New York umherwandert, fällt es einem sofort auf, daß man nach 10 Uhr keinem Kinde mehr begegnet. Das Gesetz verbietet es Kindern unter 16 Jahren, sich abends in den Straßen herumzutreiben. Und dieses Gesetz wird mit großer Strenge gehandhabt, wie ich mich während der erwähnten Gerichtssitzung überzeugen konnte.
Natürlich wäre das Gesetz allein wahrscheinlich machtlos, wenn ihm nicht die in ganz Amerika weitverzweigte »Kinderschutzgesellschaft« zur Seite stände. Diese Gesellschaft beschäftigt in New York allein Tausende von Agenten und Agentinnen, die zum größten Teil aus reiner Liebe zur Sache ihrem schweren aber lohnenden Beruf nachgehen.
Diese Agenten haben nicht nur das Recht, sondern die Pflicht jedes Kind, das ihnen abends in den Straßen von New York begegnet, aufzugreifen und an die Kinderasyle abzuliefern. Und das schuldige Kind hat sich jedesmal vor dem Jugendgericht zu verantworten.
Man gewinnt manch trostlosen Einblick in die amerikanischen Familienverhältnisse, wenn man den Verhandlungen solch einer Jugendgerichtssitzung folgt. In den allermeisten Fällen sind es die Eltern, die die Kinder dazu anhalten, das Gesetz zu übertreten und sich abends in den Straßen umherzutreiben, sei es zu dem verhältnismäßig unschuldigen Zweck, Zeitungen und Streichhölzer zu verkaufen, oder um sich vorzeitig einem liederlichen Lebenswandel und leichten Gelderwerb zu ergeben.
Man hat dem amerikanischen Kindergericht zum Vorwurf gemacht, daß es die elterliche Autorität untergrabe. Das tut es jedoch in den seltensten Fällen und nur, wenn es absolut notwendig ist. Der Richter wird jeden Augenblick in äußerst schwierige Lagen versetzt. Es gehört ein seltenes Feingefühl, große Menschenkenntnis und ein unfehlbarer Takt dazu, um dieses Amt in wünschenswerter Weise zu versehen.
Ein kleiner sechsjähriger Spatz wird vorgeführt. Als er ins freundliche aber ernste Gesicht des Richters blickt, quellen ihm schon die hellen Tränen aus den Augen.
»Du hast gestern abend um 11 am Herold-Square Zeitungen verkauft?«
Ein kaum hörbares »Ja«.
»Warum tatst du das? Du weißt aus der Schule, daß du abends nicht auf die Straße, sondern früh zu Bett gehen sollst.«
»Die Mutter hat mich doch geschickt.«
Nun wird die Mutter aufgerufen. O diese Mütter! Meistens sind es polnische oder italienische Judenweiber. Die Ausländer und Einwanderer bestreiten, nebenbei gesagt, mehr als 80% aller Fälle, die vor den Jugendgerichten in New York verhandelt werden. In irgend einem fremdsprachigen Idiom ergießt sich ein kaum einzudämmender Redeschwall über den Richter. Ein Dolmetscher, der stets zur Hand ist, übersetzt das Notwendigste. Die Familiengeschichte mehrerer Generationen, die die redelustige Dame zum besten gibt, läßt er natürlich fort. Solchen Müttern gegenüber kann der Richter sehr unangenehm werden. Zum ersten Male bekommt sie eine äußerst scharfe Verwarnung, zum zweiten Male schon nimmt man ihr das Kind fort und bringt es »probeweise« in einem der zahlreichen, großartig organisierten Kinderheime unter. Erfolgt später noch ein Rezidiv, so bekommt sie ihr Kind überhaupt nicht mehr nach Hause, bis es erwachsen ist. Auf diese Weise schützt sich der amerikanische Staat vor heranwachsenden Verbrechern. Freilich sind dazu drei Institutionen nötig, die aufs engste zusammengehören, obgleich sie völlig unabhängig voneinander arbeiten: die Kinderschutzgesellschaft, das Jugendgericht und die Gesellschaft für Kinderheime und Besserungsanstalten für jugendliche Verbrecher.
Selbstverständlich sind nicht alle Fälle, die vors Jugendgericht kommen, so harmloser Art, wie der eben angeführte. Viele der kleinen Delinquenten müssen sich für Diebstahl, Betrug, Tätlichkeiten verantworten. Oder auch für Straßenraub und Mord. Aber Schuleschwänzen gehört ebenfalls zu den Vergehen, die von diesem vielseitigen Gerichtshofe geahndet werden. Die Verhandlungen werden sehr leise geführt, um das Schamgefühl der Kinder zu schonen. Keiner von den jungen Galgenvögeln, die auf der Anklagebank sitzen, braucht zu wissen, was dem anderen zur Last gelegt wird. Auch das Publikum von Tanten und Verwandten kann schwerlich vernehmen, was vor dem Richtertisch verhandelt wird, es mag noch so sehr die Ohren spitzen. Ich hatte meinen Platz neben dem Richter erhalten. Daher entging mir kein Wort der Verhandlungen. Dieser Richter, ein verhältnismäßig junger Mann, hat einen unauslöschlichen Eindruck auf mich gemacht. Fast mit einem Seherblick verstand er es, in die feinsten Geheimnisse der Kinderseele einzudringen. Sein Resumee entbehrte oft nicht eines gewissen Humors.
Ein trotz seiner nicht gerade herkulischen Figur immerhin ganz stämmig aussehender jüdischer Kleinkramhändler behauptete, von einem dreizehnjährigen Jungen »verprügelt« worden zu sein. Als sachlichen Beweis zeigte er eine Beule an der Stirn. Darauf wurde der Angeklagte abgerufen. Es erschien ein schmächtiges, buchstäblich braun und blau geschlagenes Bürschlein. Der Angeklagte behauptete, der Angegriffene gewesen zu sein, stellte im übrigen den Hieb, der die Beule an seines Widersachers Stirn verursacht hatte, nicht in Abrede, und sah so aus, als ob er neben diese erste Beule nicht ungern eine zweite setzen würde. Die Zeugenaussagen neigten zu seinen Gunsten. Der Richter resümierte, daß die Schuld der beiden Widersacher wahrscheinlich im umgekehrten Verhältnis stehe, wie die Größe ihrer Beulen, diktierte dem Jungen eine geringe Freiheitsstrafe zu, und der Jude mußte zahlen, was ihm augenscheinlich sehr viel bitterere Schmerzen verursachte, als seine Beule.
Der ernsteste Fall an diesem Verhandlungstage betraf einen vierzehnjährigen Knaben, der tags zuvor seinen Spielkameraden erschossen hatte. Der Fall lag ziemlich kompliziert. Die beiden Jungen hatten eine alte rostige Pistole gefunden und sich um ihren Besitz heftig gestritten. Der Streit war in Tätlichkeiten ausgeartet und dabei war der unselige Schuß gefallen. Der Angeklagte war sofort ausgerissen, für zwei Tage verschwunden und erfuhr erst, als er sich am dritten Tage zu Hause einstellte, daß er seinen Freund erschossen hatte. Die Mutter des Erschossenen bestand auf der Absichtlichkeit des Verbrechens, auch die Zeugenaussagen einiger Spielgefährten und ihrer respektiven Mütter und Tanten ergaben wenig Günstiges. Demgegenüber stand nur die Aussage des Erschossenen selbst, der im Hospital kurz vor seinem Tode geäußert hatte, »sein Freund« habe »es« ganz sicherlich im Versehen getan.
Der Junge wurde vorgeführt. Trotzig und wild sah er aus, und manchen dummen Streich mochte er auf dem Gewissen haben. Aber seine Augen, die jetzt voller Tränen standen, blickten so offen und ehrlich, daß für mich seine Schuldfrage sofort außer jedem Zweifel stand. Aber der Richter war weniger voreilig.
Mit vorsichtigem Fragen, die mehr den Charakter einer freundschaftlichen Unterredung, als den eines Verhörs hatten, versuchte er dieser Knabenseele auf den Grund zu kommen. Ja, der Junge hatte auf den Freund gezielt, aber nur um ihn zu erschrecken, die Pistole sei losgegangen, er wisse selbst nicht wie. Viel mehr war aus ihm nicht herauszubekommen. Aber die Art und Weise, wie er seine Antworten gab, schnell, unüberlegt, jungenhaft, genügte dem Richter. Er neigte sich zu mir: »He is not a murderer.«
Aber der Fall war damit nicht erledigt. Es wurde noch eine Verhandlung angesetzt, da die Mutter des Erschossenen noch einige Zeugen für die verbrecherischen Instinkte des Angeklagten vorbringen wollte. Und wenn sie ganz New York mobilisiert, – »he is not a murderer« – das war mir ebenso klar, wie dem Richter. Der Junge wurde bis zur zweiten Verhandlung der Obhut eines Kinderheims anvertraut, mehr damit sich seine Nerven etwas beruhigen sollten, als um ihn zu strafen und »unschädlich« zu machen.
Die Agenten und Agentinnen der Kinderschutz-Gesellschaft spielen in den meisten Fällen, wenn es sich um einfache Verwahrlosung der Kinder handelt, die Rolle des Staatsanwaltes. Gegen ihre Anschuldigungen haben sich die Kinder, respektive ihre Eltern zu verteidigen. Sie auch führen die Kinder, wenn sie aus den Besserungsanstalten entlassen werden, wieder dem Richter vor. Oft tun sie das nicht ohne Stolz. Der Richter behauptete, daß die Kinder schon nach einer kurzen Besserungsfrist meist nicht wiederzuerkennen seien. Sie werden in den Anstalten fast ausschließlich durch Freundlichkeit und liebevolle Behandlung »gebessert«. Oft ist es nicht leicht, die Kinder den Eltern zu entreißen. Eine alte triefäugige Italienerin wehrte sich sozusagen mit Händen und Füßen dagegen, schrie und tobte, als man ihre beiden zwölf- und vierzehnjährigen Töchter, die sie zu unsittlichen Lebenswandel anhielt, fortnahm.
Die »gebesserten« Kinder versprechen dem Richter mit Wort und Handschlag, von nun an ein anständiges Leben zu führen. Der pädagogische Wert dieses feierlichen Augenblicks ist ohne Zweifel ein sehr großer. Und die Kinder scheinen sich dessen voll bewußt zu sein. Ich habe nie ernsthaftere Kindergesichter gesehen, als bei diesen kleinen amerikanischen Vagabunden, wenn sie dem Richter ihre Hand entgegenstreckten.
Ich glaube, man kann ohne Sentimentalität behaupten, daß diese Kindergerichte mit den dazu gehörigen Institutionen, der Kinderschutz-Gesellschaft und den Besserungsanstalten für jugendliche Verbrecher, mehr Gutes schaffen und der menschlichen Gesellschaft nützlicher sind, als die raffiniertesten und klügsten Zuchthaussysteme und die strengsten Strafen, die man erwachsenen Verbrechern gegenüber anwendet.
Denn hier, und nur hier, wird das Übel an der Wurzel getroffen.
Und nun soll ich von der letzten Etappe unserer Reise erzählen. Trotz der ersehnten Europanähe ist mir dabei fast trübselig zumute. Man wandelt nicht ungestraft unter Palmen und ...... und muß sogar noch froh sein, wenn man nichts Schlimmeres davonträgt, als einen überlebensgroß proportionierten Katzenjammer.
In der ersten Minute auf nordamerikanischem Boden sollten wir einen Begriff von der dort herrschenden Anti-Gemütlichkeit bekommen. Als wir bei unserer Ankunft den Anlegeplatz der Hamburg-Amerika-Linie betraten, empfing uns ein Kommissionär des Hotels, in dem wir uns angemeldet hatten. Seine erste Frage lautete:
»Wann gedenken Sie abzureisen?«
»In ungefähr zwei Wochen.«
»Dann müssen Sie sich sofort Europa-Tickets besorgen.«
»Kann das nicht vom Hotel aus geschehen?«
»Sie mißverstehen mich. Es muß sofort geschehen. Wir fahren zuerst in die Office der Hamburg-Amerika-Linie, dann ins Hotel.«
Jetzt hatte ich verstanden. Time is money. Und einen eigenen Willen darf man in dieser amerikanischsten aller Fragen in Amerika nicht haben. Also fuhren wir direkt vom Pier zu dem prächtigen Gebäude der Hamburg-Amerika-Linie am Broadway.
»Zwei Kabinen erster Klasse bis Hamburg.«
»Zu wann soll es sein?«
»In ungefähr zwei Wochen.«
»Bedaure. Alles besetzt.«
Doch man hat zuweilen Dusel. Auch wir hatten welchen. Hinter seinem Pult stürzte unvermutet ein übereifriger Clerk hervor.
»Heute morgen ist eine Staatskabine auf dem »Imperator« abgesagt worden. Er geht in drei Wochen. Es ist seine erste Reise.«
Natürlich nahmen wir die Kabine unbesehen. Zumal sich herausstellte, daß sie erheblich billiger war, als die mit entsprechendem Komfort ausgestatteten Luxuskabinen andrer Dampfer. Das kommt daher, weil auf dem »Imperator« 150 Staatskabinen mit eigenem Bad sind, auf den anderen Dampfern aber höchstens 5-10.
Wir waren dem Kommissionär dankbar dafür, daß er uns zur Eile angetrieben hatte. Denn erstens interessierte uns der »Imperator« genau ebenso, wie alle übrigen Bewohner der alten und der neuen Welt, ist er doch »das größte Schiff der Welt«, »der Stolz der deutschen Handelsflotte«, »das größte Wunder der Schiffsbautechnik« und weiß der Himmel, was sonst noch alles. Zweitens aber war der Fall besonders vielverheißend, denn es galt die erste Überfahrt des Kolosses von Amerika nach Europa mitzumachen, jene erste Reise, für die ein erfinderischer deutscher Journalist den entsetzlich geschmacklosen Namen »Jungfernfahrt« geprägt hat, von der man doch mit Fug und Recht ein außergewöhnliches Vergnügen erwarten darf.
Die Ankunft des »Imperator« in New York war die Sensation des Tages und bildete für mindestens eine Woche den alleinigen Gesprächsstoff in allen Salons und in allen Bars. Das war etwas für den »Größen-Fetischismus« der Amerikaner, an dem sie ja alle mehr oder weniger leiden. Zu Hunderttausenden hatten sich Schaulustige in Hoboken versammelt, um die Majestät des Ozeans bei der Ankunft zu begrüßen.
Es ist eine undankbare Aufgabe, den »Imperator« zu beschreiben. Wem sagt es was, daß er 919 Fuß lang ist? Oder macht man sich einen klareren Begriff von seinen Dimensionen, wenn man erfährt, daß er, auf der Steuerschraube aufgestellt, erheblich höher wäre, als der Eifelturm und das 67 Stockwerk hohe »Wolworth-Building« in New York?
Wer hat überhaupt jemals in Gedanken ein Schiff auf der Steuerschraube aufgerichtet, oder ein Haus ins Meer gekippt?
Wenn man anderthalb Mal ums Schiff herumgeht, hat man einen Spaziergang von einem Kilometer gemacht. Vielleicht gibt das eine richtige Vorstellung von der Größe des Ozeanriesen?
Seine Maschine entwickelt 68 000 Pferdekräfte. Wer hat eine Vorstellung davon, was 68 000 Pferdekräfte leisten können?
Nein, mit Größenverhältnissen und Zahlen will ich mich nicht aufhalten. Die kann man außerdem in jedem Prospekt nachlesen.
Der Komfort, mit dem die Reisenden auf dem »Imperator« umgeben sind, grenzt ans Märchenhafte. Die Kabinen sind keine Kabinen, sondern mollig eingerichtete Wohnzimmer. Breite, bequeme Betten, Etablissements weicher Sessel und Divans, Schreibtisch, Kleiderschränke, Wäscheschränke bilden das Ameublement. Nebenan ein mit Kacheln ausgelegtes, geräumiges Badezimmer mit idealen Douche-Vorrichtungen. In den Waschtischen hat man Tag und Nacht fließendes heißes und kaltes Süßwasser. Ein Leben »aus dem Koffer« kennt man auf dem »Imperator« nicht. Zwei Stunden nachdem man den Dampfer betreten und dem Steward seine Schlüssel eingehändigt hat, findet man Kleider, Wäsche und sonstige Bedarfsartikel in den Spinden und Schränken der Kabine sauber aufgeräumt vor. Die Koffer sind im Gepäckraum verschwunden. Ein Bataillon Schneider an Bord sorgt dafür, daß die Garderobe immer in Ordnung ist. Die Herrenwelt feiert zum »dinner« eine wahre Orgie in Bügelfalten.
Wundervoll sind die Gesellschaftsräume des Dampfers: der enorme Tanzsaal mit 14 Fuß hohen Fenstern, die zierlich ausstaffierten Damensalons, das gemütliche, mit viel Geschmack eingerichtete Rauchzimmer, nicht zuletzt der enorme, durch zwei Etagen gebaute, von einer Galerie umgebene Speisesaal, in dem zweimal täglich für 650 Personen gedeckt wird. Das Table d'hôte-Prinzip ist abgeschafft. Es wird ausschließlich an kleinen Tischen à la carte gespeist. Die Verpflegung muß dem verwöhntesten Gaumen genügen. Ein Beispiel zum Beweis: als hors d'oeuvre wird von Zeit zu Zeit für alle 650 Personen Astrachan-Kaviar von ganz exquisiter Qualität serviert.
Für Gourmets und – Snobs existiert außerdem noch ein Ritz-Carlton-Restaurant an Bord, in dem man für Fabelpreise mit dem maître d'hôtel französisch sprechen und von Pariser Köchen zubereitete filets de sol essen kann. Ist man zu faul, seinen Frack zu Tisch anzuziehen, so kann man dasselbe Vergnügen, noch teurer, im Grill-room haben.
Hoch zu preisen ist der Palmengarten des Ritz-Carlton-Restaurants. Dort finden sich nach den Mahlzeiten auch die sparsamen Banausen aus dem allgemeinen Speisesaale ein, um bei einer Tasse Kaffee, einem »fine champagne frappé« und einer guten Import den Klängen eines rotbefrackten Pariser Streichorchesters zu lauschen.
Man schlenkere sich dabei möglichst ungeniert in die breiten Klubsessel, lorgnettiere dreist die unerhörte Toilettenpracht der amerikanischen Schönen und streue die Zigarrenasche auf den knöcheltiefen Smyrnateppich. Wenn man für ganz was Feines gehalten werden will, bemühe man sich überhaupt, die amerikanischen Millionär- oder Milliardär-Jünglinge nachzuahmen, für die die Begriffe »impertinent« und »vornehm« identisch sind.
Der Clou des »Imperator« ist und bleibt doch das Römische Schwimmbad. Ein mit feinstem Kunstsinn ausgestatteter Raum. Italienische Mosaiken schmücken die Wände. Achtzehn pompejanische Säulen tragen eine gewölbte Galerie für Zuschauer. Das Bassin – groß genug, um darin Wasser-Polo zu spielen – ist mit hellgrauem Marmor ausgelegt. Aus Marmor sind auch die Ruhebänke, die das Bassin umgeben. Mit Rauschen und Schäumen stürzt das Ozeanwasser, gleich einem Wasserfall, ins Bassin. Die Temperatur des Wassers wird künstlich auf 22-23 Grad Celsius gehoben. Dieses tägliche Schwimmbad ist ein unvergleichlicher Genuß. In der heißen Jahreszeit muß es geradezu ein Labsal sein.
Daß einem auf dem Promenadendeck behaglich zumute ist, dafür sorgt die »See-Komfort-Gesellschaft« mit Liegestühlen, Decken, Plaids und wundersam geformten Kissen, die sich den tiefsten und flachsten Körperbuchten gleich gut anpassen. Bei ungünstigem Wetter sieht man ganze Regimenter von Kopf bis zu Fuß festeingewickelter Mumien in Reih und Glied auf den endlosen Promenadendecks des Dampfers aufgereiht daliegen.
Kurz, wo immer man sich auf dem »Imperator« befindet, kann man sich in einem Winkel von Abrahams Schoße wähnen.
Und dennoch habe ich mich während der ganzen Amerika-Reise und während der 42 Tage, die ich auf See zugebracht habe, nicht so ungemütlich gefühlt wie auf dem »Imperator«.
In erster Linie war daran natürlich die Ideen-Assoziation schuld, die die Gedanken immer wieder zur »Titanic« hinleitete.
Aber ganz abgesehen davon: dieser unter allen Umständen eigentlich unerlaubte und zum größten Teil sinnlose Luxus kommt einem wie eine Herausforderung der Elemente vor. Man wartet nur darauf, daß sie aufbrausen und diesen ganzen nichtigen menschlichen Tand in Trümmer zerschellen lassen.
Betritt man den von tausend elektrischen Kerzen strahlend hell erleuchteten Speisesaal, in dem die Tische unter der Last der raffinierten Speisen und kostbaren Weine ächzen und ein Meer von Blumen betäubenden Wohlgeruch verbreitet, sieht man das Feuerwerk der blitzenden Juwelen, hört man das Scherzen, Lachen und Knallen der Champagnerpfropfen, so beschleicht einen doch ein ungemütliches Gefühl, wenn man daran denkt, daß nur eine dünne Wand diese ganze Pracht und Herrlichkeit von den grundlosen Tiefen des Ozeans trennt.
Denkt man aber nicht daran, so kann man vollständig vergessen, daß man sich auf einem Dampfer befindet. Von der Bewegung des Schiffes ist nicht das Allergeringste zu spüren. Man merkt nicht einmal, daß es vorwärts geht, von irgend einer Schaukelbewegung des Schiffes ganz zu schweigen. Auch wenn man auf dem Promenadendeck steht, merkt man, besonders abends, nichts vom »Schiff«. Die Gesellschaftsräume des »Imperator« liegen ungefähr elf Etagen über dem Meeresspiegel. Da es auf dem Atlantischen Ozean abends meistens neblig ist, so kann man vom Wasser nichts sehen, weder unter, noch vor, noch hinter sich.
Was nun das Leben an Bord anbetrifft, so spielt es sich im allergewöhnlichsten »vornehmen« Hotelstil ab. Infolgedessen läßt sich wenig mehr davon sagen, als daß es öde, steif, ungesellig, zum Sterben langweilig ist. Von irgend einer »Bordfreiheit« kann hier ebensowenig die Rede sein, wie etwa in der »hall« des Hotels Adlon.
Infolgedessen tat es einem keinen Augenblick leid, Abschied vom Imperator zu nehmen. Luxus kann man auf dem Festlande ebensogut und besser haben, und jenes spezifische etwas abenteuerliche »caché« des Bordlebens auf langen Seereisen war er uns schuldig geblieben. Dieser Umstand bewirkte, daß man am Schluß der Seereise anfing, sich immer mehr auf Europa zu freuen.
Der gute alte Kontinent empfing uns zwar mit einem mürrischen Regenwetter-Gesicht, doch wird er mich so bald nicht wieder in die Flucht schlagen.
Wenn man sich die Sache recht überlegt, scheint was Wahres dran zu sein: das Beste am Reisen ist – die Heimkehr.
Druck von J. J. Augustin in Glückstadt und Hamburg.
Fehlende und falsch gesetzte Anführungszeichen wurden korrigiert. Die Bildtafeln wurde jeweils an das Ende des Kapitels oder Unterkapitels verschoben.
Der Text des Originalbuches wurde grundsätzlich beibehalten, einschließlich uneinheitlicher Schreibweisen wie beispielsweise "Axe" – "Achse", "danach" – "darnach", "Titicaca-See" – "Titicacasee", "unserer" – "unsrer"
mit folgenden Ausnahmen,
Seite 9:
"109" geändert in "104"
(Indianer in Poncho vor einem Bananen-Haine 104)
Seite 11:
"–" eingefügt
(DER STEAMER »ARLANZA«. – VIGO.)
Seite 16:
"Außenrede" geändert in "Außenreede"
(auf der Außenreede von Funchal)
Seite 16:
"Ruderbote" geändert in "Ruderboote"
(einer Unmenge schmaler Ruderboote)
Seite 25:
"Peterburg" geändert in "Petersburg"
(von der Breite des Newski-Prospekt in Petersburg)
Seite 30:
"gans" geändert in "ganz"
(alles ganz europäisch)
Seite 33:
"–" eingefügt
(DIE ARGENTINISCHEN PAMPAS. – DAS WEINLAND VON MENDOZA.)
Seite 49:
"–" eingefügt
(TEMUCO. – EIN AUFZUG DER ARAUKANER-INDIANER.)
Seite 55:
"aurakanisch" geändert in "araukanisch"
(Unterredungen, die auf araukanisch geführt wurden)
Seite 61:
"su" geändert in "zu"
(das Land urbar zu machen)
Seite 66:
"." vor "«" entfernt
(das Mißverstehen europäischer »Kulturerrungenschaften«.)
Seite 67:
"tötlich" geändert in "tödlich"
(Grund ihres absurden, tödlich langweiligen Badelebens)
Seite 70:
"–" eingefügt
(VON VALPARAISO NACH ANTOFOGASTA. – DIE CHILENISCHE SALPETER-INDUSTRIE.)
Seite 72:
"Antafogasta" geändert in "Antofogasta"
(Es bedarf von Antofogasta aus einer sechsstündigen Eisenbahnfahrt)
Seite 72:
"hies" geändert in "hieß"
(Auf einer der nächsten Stationen hieß es »aussteigen!«)
Seite 74:
"ganses" geändert in "ganzes"
(ein ganzes Arsenal voluminöser Reservoirs)
Seite 93:
"Unternehungen" geändert in "Unternehmungen"
(Ausflüge und Unternehmungen zu machen)
Seite 94:
"mitteldeutchen" geändert in "mitteldeutschen"
(von der Größe eines mitteldeutschen Herzogtums)
Seite 94:
"was" geändert in "war"
(Das war ein lustiges Einkaufen!)
Seite 96:
"Halblutindianer" geändert in "Halbblutindianer"
(der Ariero, ein Cholo, d. h. Halbblutindianer)
Seite 104:
"durchschnittenen" geändert in "durchschnittener"
(von breiten Felsspalten durchschnittener Weg)
Seite 109:
"cocktail" geändert in "Cocktail"
(prächtigen rosenroten Cocktail aus Zuckerrohrschnaps)
Seite 110:
"Daz" geändert in "Das"
(Das ist eigentlich ein Frevel)
Seite 110:
"," hinter "aussehen" entfernt und hinter "»grenadillos«" eingefügt
(die »grenadillos«, Früchte der Passionsblume, die aussehen wie riesige)
Seite 114:
"entfernen" geändert in "entfernten"
(die Körner aus den Halmen entfernten)
Seite 115:
"führen" geändert in "fahren"
(von dort aus flußabwärts bis Guanay zu fahren)
Seite 118:
am Ende der Seite wurde ein Gedankenwechsel eingefügt
Seite 126:
"nnd" geändert in "und"
(Mit viel List und Tücke)
Seite 133:
"G.schen" geändert in "G.'schen"
(das dem Salon des G.'schen Hauses als Zimmerzier diente)
Seite 135:
"–" eingefügt
(IM SCHNELLZUG DURCH PERU. – DER TITICACA-SEE.)
Seite 135:
"Phateon" geändert in "Phaeton"
(bequemer wäre, als der geräumige Phaeton)
Seite 136:
"herin" geändert in "herein"
(in den Waggon herein)
Seite 138:
"Antofagasta" geändert in "Antofogasta"
(Fahrt zwischen Valparaiso und Antofogasta)
Seite 143:
"auszufühen" geändert in "auszuführen"
(einen gefaßten Plan auch wirklich auszuführen)
Seite 145:
"," entfernt hinter "schläfrig"
(ein schläfrig blinzelndes Auge von der Größe einer Backpflaume)
Seite 145:
"gegenüberliegengen" geändert in "gegenüberliegenden"
(nach einer Stelle des gegenüberliegenden Ufers hin)
Seite 149:
"–" eingefügt
(VON PANAMA NACH NEW YORK. – JAMAIKA.)
Seite 150:
"Zie" geändert in "Ziel"
(Das Ziel unserer Fahrt war eine hügelige)
Seite 154:
"verversteht" geändert in "versteht"
(Man versteht sich gegenseitig nicht)
Seite 154:
"st" geändert in "ist"
(Es ist ein wundervolles Land)
Seite 158:
"belegen" geändert in "gelegen"
(in einer ihrer Querstraßen gelegen)
Seite 160:
"recht" geändert in "Recht"
(während der mit Recht berüchtigten amerikanischen Hitzwellen)
Seite 168:
"belegenen" geändert in "gelegenen"
(zu ihrer im achten Stockwerk gelegenen Wohnung)
Seite 169:
"wahr" geändert in "war"
(Es war augenscheinlich der letzte Trumpf)
Seite 184:
"angefürte" geändert in "angeführte"
(so harmloser Art, wie der eben angeführte)
Seite 187:
"sie" geändert in "Sie"
(»Wann gedenken Sie abzureisen?«)
Seite 191:
"läß" geändert in "läßt"
(Infolgedessen läßt sich wenig mehr davon sagen)
***END OF THE PROJECT GUTENBERG EBOOK RUND UM SüD-AMERIKA***
******* This file should be named 55419-h.htm or 55419-h.zip *******
This and all associated files of various formats will be found in:
http://www.gutenberg.org/5/5/4/1/55419
Updated editions will replace the previous one--the old editions will be renamed.
Creating the works from print editions not protected by U.S. copyright law means that no one owns a United States copyright in these works, so the Foundation (and you!) can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalties. Special rules, set forth in the General Terms of Use part of this license, apply to copying and distributing Project Gutenberg-tm electronic works to protect the PROJECT GUTENBERG-tm concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for the eBooks, unless you receive specific permission. If you do not charge anything for copies of this eBook, complying with the rules is very easy. You may use this eBook for nearly any purpose such as creation of derivative works, reports, performances and research. They may be modified and printed and given away--you may do practically ANYTHING in the United States with eBooks not protected by U.S. copyright law. Redistribution is subject to the trademark license, especially commercial redistribution.
To protect the Project Gutenberg-tm mission of promoting the free distribution of electronic works, by using or distributing this work (or any other work associated in any way with the phrase "Project Gutenberg"), you agree to comply with all the terms of the Full Project Gutenberg-tm License available with this file or online at www.gutenberg.org/license.
1.A. By reading or using any part of this Project Gutenberg-tm electronic work, you indicate that you have read, understand, agree to and accept all the terms of this license and intellectual property (trademark/copyright) agreement. If you do not agree to abide by all the terms of this agreement, you must cease using and return or destroy all copies of Project Gutenberg-tm electronic works in your possession. If you paid a fee for obtaining a copy of or access to a Project Gutenberg-tm electronic work and you do not agree to be bound by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph 1.E.8.
1.B. "Project Gutenberg" is a registered trademark. It may only be used on or associated in any way with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few things that you can do with most Project Gutenberg-tm electronic works even without complying with the full terms of this agreement. See paragraph 1.C below. There are a lot of things you can do with Project Gutenberg-tm electronic works if you follow the terms of this agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg-tm electronic works. See paragraph 1.E below.
1.C. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation ("the Foundation" or PGLAF), owns a compilation copyright in the collection of Project Gutenberg-tm electronic works. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States. If an individual work is unprotected by copyright law in the United States and you are located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the work as long as all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg-tm mission of promoting free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg-tm works in compliance with the terms of this agreement for keeping the Project Gutenberg-tm name associated with the work. You can easily comply with the terms of this agreement by keeping this work in the same format with its attached full Project Gutenberg-tm License when you share it without charge with others.
1.D. The copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in a constant state of change. If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before downloading, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this work or any other Project Gutenberg-tm work. The Foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country outside the United States.
1.E. Unless you have removed all references to Project Gutenberg:
1.E.1. The following sentence, with active links to, or other immediate access to, the full Project Gutenberg-tm License must appear prominently whenever any copy of a Project Gutenberg-tm work (any work on which the phrase "Project Gutenberg" appears, or with which the phrase "Project Gutenberg" is associated) is accessed, displayed, performed, viewed, copied or distributed:
This eBook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this eBook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you'll have to check the laws of the country where you are located before using this ebook.
1.E.2. If an individual Project Gutenberg-tm electronic work is derived from texts not protected by U.S. copyright law (does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder), the work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charges. If you are redistributing or providing access to a work with the phrase "Project Gutenberg" associated with or appearing on the work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 or obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg-tm trademark as set forth in paragraphs 1.E.8 or 1.E.9.
1.E.3. If an individual Project Gutenberg-tm electronic work is posted with the permission of the copyright holder, your use and distribution must comply with both paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 and any additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked to the Project Gutenberg-tm License for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work.
1.E.4. Do not unlink or detach or remove the full Project Gutenberg-tm License terms from this work, or any files containing a part of this work or any other work associated with Project Gutenberg-tm.
1.E.5. Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic work, or any part of this electronic work, without prominently displaying the sentence set forth in paragraph 1.E.1 with active links or immediate access to the full terms of the Project Gutenberg-tm License.
1.E.6. You may convert to and distribute this work in any binary, compressed, marked up, nonproprietary or proprietary form, including any word processing or hypertext form. However, if you provide access to or distribute copies of a Project Gutenberg-tm work in a format other than "Plain Vanilla ASCII" or other format used in the official version posted on the official Project Gutenberg-tm web site (www.gutenberg.org), you must, at no additional cost, fee or expense to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon request, of the work in its original "Plain Vanilla ASCII" or other form. Any alternate format must include the full Project Gutenberg-tm License as specified in paragraph 1.E.1.
1.E.7. Do not charge a fee for access to, viewing, displaying, performing, copying or distributing any Project Gutenberg-tm works unless you comply with paragraph 1.E.8 or 1.E.9.
1.E.8. You may charge a reasonable fee for copies of or providing access to or distributing Project Gutenberg-tm electronic works provided that
1.E.9. If you wish to charge a fee or distribute a Project Gutenberg-tm electronic work or group of works on different terms than are set forth in this agreement, you must obtain permission in writing from both the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and The Project Gutenberg Trademark LLC, the owner of the Project Gutenberg-tm trademark. Contact the Foundation as set forth in Section 3 below.
1.F.
1.F.1. Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread works not protected by U.S. copyright law in creating the Project Gutenberg-tm collection. Despite these efforts, Project Gutenberg-tm electronic works, and the medium on which they may be stored, may contain "Defects," such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a computer virus, or computer codes that damage or cannot be read by your equipment.
1.F.2. LIMITED WARRANTY, DISCLAIMER OF DAMAGES - Except for the "Right of Replacement or Refund" described in paragraph 1.F.3, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project Gutenberg-tm trademark, and any other party distributing a Project Gutenberg-tm electronic work under this agreement, disclaim all liability to you for damages, costs and expenses, including legal fees. YOU AGREE THAT YOU HAVE NO REMEDIES FOR NEGLIGENCE, STRICT LIABILITY, BREACH OF WARRANTY OR BREACH OF CONTRACT EXCEPT THOSE PROVIDED IN PARAGRAPH 1.F.3. YOU AGREE THAT THE FOUNDATION, THE TRADEMARK OWNER, AND ANY DISTRIBUTOR UNDER THIS AGREEMENT WILL NOT BE LIABLE TO YOU FOR ACTUAL, DIRECT, INDIRECT, CONSEQUENTIAL, PUNITIVE OR INCIDENTAL DAMAGES EVEN IF YOU GIVE NOTICE OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
1.F.3. LIMITED RIGHT OF REPLACEMENT OR REFUND - If you discover a defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can receive a refund of the money (if any) you paid for it by sending a written explanation to the person you received the work from. If you received the work on a physical medium, you must return the medium with your written explanation. The person or entity that provided you with the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a refund. If you received the work electronically, the person or entity providing it to you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy is also defective, you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem.
1.F.4. Except for the limited right of replacement or refund set forth in paragraph 1.F.3, this work is provided to you 'AS-IS', WITH NO OTHER WARRANTIES OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR ANY PURPOSE.
1.F.5. Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain types of damages. If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any provision of this agreement shall not void the remaining provisions.
1.F.6. INDEMNITY - You agree to indemnify and hold the Foundation, the trademark owner, any agent or employee of the Foundation, anyone providing copies of Project Gutenberg-tm electronic works in accordance with this agreement, and any volunteers associated with the production, promotion and distribution of Project Gutenberg-tm electronic works, harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees, that arise directly or indirectly from any of the following which you do or cause to occur: (a) distribution of this or any Project Gutenberg-tm work, (b) alteration, modification, or additions or deletions to any Project Gutenberg-tm work, and (c) any Defect you cause.
Project Gutenberg-tm is synonymous with the free distribution of electronic works in formats readable by the widest variety of computers including obsolete, old, middle-aged and new computers. It exists because of the efforts of hundreds of volunteers and donations from people in all walks of life.
Volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need are critical to reaching Project Gutenberg-tm's goals and ensuring that the Project Gutenberg-tm collection will remain freely available for generations to come. In 2001, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure and permanent future for Project Gutenberg-tm and future generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and how your efforts and donations can help, see Sections 3 and 4 and the Foundation information page at www.gutenberg.org.
The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non profit 501(c)(3) educational corporation organized under the laws of the state of Mississippi and granted tax exempt status by the Internal Revenue Service. The Foundation's EIN or federal tax identification number is 64-6221541. Contributions to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent permitted by U.S. federal laws and your state's laws.
The Foundation's principal office is in Fairbanks, Alaska, with the mailing address: PO Box 750175, Fairbanks, AK 99775, but its volunteers and employees are scattered throughout numerous locations. Its business office is located at 809 North 1500 West, Salt Lake City, UT 84116, (801) 596-1887. Email contact links and up to date contact information can be found at the Foundation's web site and official page at www.gutenberg.org/contact
For additional contact information:
Dr. Gregory B. Newby
Chief Executive and Director
gbnewby@pglaf.org
Project Gutenberg-tm depends upon and cannot survive without wide spread public support and donations to carry out its mission of increasing the number of public domain and licensed works that can be freely distributed in machine readable form accessible by the widest array of equipment including outdated equipment. Many small donations ($1 to $5,000) are particularly important to maintaining tax exempt status with the IRS.
The Foundation is committed to complying with the laws regulating charities and charitable donations in all 50 states of the United States. Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort, much paperwork and many fees to meet and keep up with these requirements. We do not solicit donations in locations where we have not received written confirmation of compliance. To SEND DONATIONS or determine the status of compliance for any particular state visit www.gutenberg.org/donate.
While we cannot and do not solicit contributions from states where we have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition against accepting unsolicited donations from donors in such states who approach us with offers to donate.
International donations are gratefully accepted, but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the United States. U.S. laws alone swamp our small staff.
Please check the Project Gutenberg Web pages for current donation methods and addresses. Donations are accepted in a number of other ways including checks, online payments and credit card donations. To donate, please visit: www.gutenberg.org/donate
Professor Michael S. Hart was the originator of the Project Gutenberg-tm concept of a library of electronic works that could be freely shared with anyone. For forty years, he produced and distributed Project Gutenberg-tm eBooks with only a loose network of volunteer support.
Project Gutenberg-tm eBooks are often created from several printed editions, all of which are confirmed as not protected by copyright in the U.S. unless a copyright notice is included. Thus, we do not necessarily keep eBooks in compliance with any particular paper edition.
Most people start at our Web site which has the main PG search facility: www.gutenberg.org
This Web site includes information about Project Gutenberg-tm, including how to make donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, how to help produce our new eBooks, and how to subscribe to our email newsletter to hear about new eBooks.