
The Project Gutenberg EBook of Schiff vor Anker, by Gorch Fock
This eBook is for the use of anyone anywhere in the United States and most
other parts of the world at no cost and with almost no restrictions
whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of
the Project Gutenberg License included with this eBook or online at
www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you'll have
to check the laws of the country where you are located before using this ebook.
Title: Schiff vor Anker
Erzählungen
Author: Gorch Fock
Editor: Aline Bußmann
Illustrator: Bernhard Klein
Release Date: February 6, 2018 [EBook #56512]
Language: German
Character set encoding: ISO-8859-1
*** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK SCHIFF VOR ANKER ***
Produced by Heike Leichsenring and the Online Distributed
Proofreading Team at http://www.pgdp.net
Schiff vor Anker

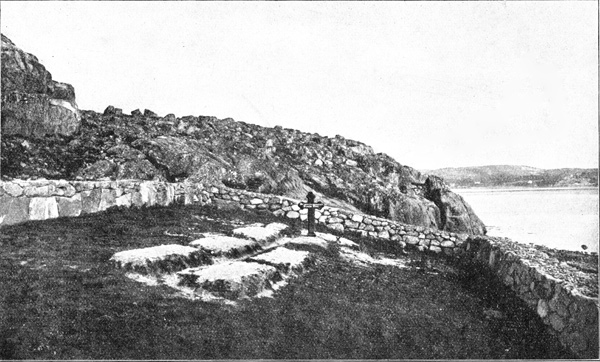
Erzählungen von
Gorch Fock
Aus dem Nachlaß herausgegeben
von Aline Bußmann
Mit Bildern von Gorch Focks Elternhaus
auf Finkenwärder und seinem
Grabe auf Stensholmen in Schweden
Hamburg
Verlag von M. Glogau jr.
1920
1.-10. Tausend.
Mit Umschlagzeichnung von Bernhard Klein.
Zeilenguß-Maschinensatz und Druck
von Oscar Brandstetter in Leipzig.
| Seite | |
| An Gorch Focks Freunde | 7 |
| De solten See | 9 |
| Herbst entgegen | 20 |
| Karen | 29 |
| Vor Ostern | 40 |
| Kassen Witt sin Freeree | 54 |
| Pulli | 68 |
| Sonntagnachmittags | 83 |
| Hans Otto | 89 |
| Ditmer Koels Tochter | 99 |
| Schiffbrüchig | 115 |
| »In Gotts Nomen, Hinnik!« | 123 |
| Auf Helgoland | 131 |
| Die sieben Tannenbäume | 143 |
| Ein Sterben | 154 |
Längst ist Gorch Focks Schiff vor Anker gegangen. Und wir haben seine Schätze davongetragen, die er in der Unendlichkeit des Meeres, in Ferne und Nähe, in Stürmen und Stille in seine Seele gesammelt hatte. Und wir sind mit vollen, schweren Händen davongegangen.
Nacht und dunkle Nebel haben sich nun auf das Land gelegt, für das Gorch Fock sich hingegeben, wenig matte Sterne leuchten am verhüllten Himmel. Wir sind noch einmal den Weg zurückgegangen zu Gorch Fock, an seinem Schiffe glommen noch leise das rote Licht seiner Lebensliebe, das grüne seines hoffenden, unverzagten Herzens, und inmitten der beiden das helle, gelbe, strahlende Licht seines Daseins. Und in dem still gewordenen Schiff haben wir noch einmal nach vergessenen, liegengebliebenen Kostbarkeiten gesucht und fanden Dinge, die nicht untergehen sollen in Vergessenheit.
Bunt ist die Kette, die daraus wurde, Altes und Neues ist nebeneinandergereiht, aber in jedem ist Gorch Focks Geist, der in allen, die ihm nahe sind, lebendig bleiben möchte.
Aline Bußmann.
Hamburg 1919.
Ein Tropfen Tinte sitzt in meiner Feder und will verschrieben sein.
Was ist es, das mich wiegt? Wo bin ich? Was klirrt da? Ist es mein Schwert? Oder habe ich nur geträumt? Sind wir schon auf der Nordsee, haben wir das Skagerrak schon hinter uns, und ist unser Ziel, das Eiland Heiligland, schon in Sicht gekommen? Was da unter und neben mir gluckt und plätschert und gurgelt: ist das schon das grüne Wasser der Nordsee, von dem der Skalde gestern erzählte? Es muß wohl so sein, denn diese Dünung ist nicht mehr so lang wie die des Atlantischen Weltmeeres! Es wird den alten Seekönig von Herzen freuen, daß unser Drachenschiff so schnelle Fahrt gemacht hat, in vier Tagen vom Hardanger bis Heiligland, und er wird morgen lachen, wenn es Tag geworden ist! Vielleicht gießt er wieder einen Becher roten fränkischen Weins in das Meer, wie er tat, als der junge König von Heiligland um seine Enkelin warb! O Gerda, nach der sich die Augen aller Schiffsgenossen immer noch drehen, ob du gleich Braut bist und zu deinem Bräutigam fährst, du bist schön wie die Sonne, die aus der See steigt! Die stillste See kann den blauen Himmel nicht so widerspiegeln, wie dein Auge es tut. Stünde ich mit dir auf dem hohen, roten Felsen, blickte ich mit dir über das weite Meer, wiese ich dir die Segel in der Tiefe und die Wolken, die an der Kimmung aus dem Wasser steigen, du Königskind, ich wollte lachen wie der lichte Balder! Denn ich liebe dich wie die See, und die See liebe ich wie dich – und niemals hat ein Wiking ein größeres und tieferes Wort gesprochen als dieses. Steuern wir nach der Hochzeit nordwärts, der Mitternachtssonne entgegen, so lehnst du nicht mehr mit wehendem Haar am Mast, Gerda. Niemals höre ich dein Lachen wieder – aber mir bleibt die See, die hohe Trösterin, deren Atem alle Wunden heilen kann. Sie wird dem Wiking helfen! Murmelt nur weiter, Wellen am Bug, und erzählt mir vom Meere ...
Abermals sitzt ein Tropfen Tinte in meiner Feder und will verschrieben sein.
Ich habe die Augen geöffnet und erkenne, daß ich geträumt habe! Ich liege nicht im Bauch des nordischen Drachens, sondern auf der Diele eines Fischerfahrzeuges, unseres Ewers, und stecke in einem alten, geflickten Focksegel, in das ich mich der Sommerhitze und der aufrührerischen Wanzen wegen eingewickelt habe. Unter meinem harten Lager strömt das Wasser, das wir im Raum haben, von einer Seite nach der andern. Es gurgelt im Bünn, dem großen Fischkasten, und es klatscht im Wasserfaß. Die Ölröcke und Südwester, die an der Decke hängen, scheuern unruhig hin und her, als baumelten sie im Winde. Gegen den Bug aber springen und hüpfen die Wellen der Nordsee und kluckern wie junge Enten im Graben. Was sie mir erzählen wollen, das haben sie schon Siegfried und Hagen sagen wollen, als sie die Fahrt nach Island unternahmen! Und wenn es auch noch kein Menschenohr begriffen hat: gefreut und erquickt hat es schon abertausend Menschenherzen und wird sie immer erquicken, so lange es eine See auf der Welt gibt. Aber nun singt mich wieder in Schlaf, ihr Wellen, ihr Seen, denn wir sind mitten im Streek, fischen zwischen Helgoland und dem Weserfeuerschiff auf Zungen, und wenn ich nicht geschlafen habe, kann ich keine gute Wache gehen. Noch einmal blicke ich durch die offene Kapp nach dem tiefdunklen, sternenbesäten Nachthimmel hinauf, sehe den dunklen Großtopp durch die Sterne wandern, höre die Gaffel knarren und den Bestmann schnarchen, dann nimmt der schwere, gleichmäßige Schritt des wachhabenden Schiffers an Deck mich mit, und der Schlafbaas mustert mich wieder an.
Abermals sitzt ein Tropfen Tinte in meiner Feder und will verschrieben sein.
Immer noch dieser schwere Schritt auf dem Achterdeck! Oder ist es ein anderer? Ja, der Schritt ist dumpfer ... Schwarz und tot treibt die mächtige Kogge hinter Borkum auf der stillen See. Bis auf den Mann im Krähennest und den leise summenden Posten auf dem hohen Bord scheint das ganze Schiff zu schlafen. Über die Stengen und Wanten kriecht der Mondschein. Wie in schwerem Bann ist die See erstarrt. Zu Stahl scheint sie geronnen zu sein. Ringsum kein Schiff und kein Land, nur die tote See. In der Admiralskajüte aber wacht ein Licht und wachen zwei Menschen. Wie ein Gespenst wandelt der Schatten des langen Klaus Störtebeker an der Wand. Ruhelos geht der junge Seeräuber auf und ab. Mitunter hebt er das geblümte flandrische Tuch und blickt aus dem kleinen Guckloch über die mondbeschienene Wasserfläche, dann nimmt er seine Wanderung wieder auf. Quälen ihn seine wilden Taten, oder hält der Madeirawein ihn wach? Der rotbärtige Godeke Michels, sein Spießgeselle, der auf der halbmondförmigen Bank sitzt und kaum noch die müden Augen offenhalten kann, sagt zuletzt: »Tu es, Klaus, nimm die junge Gesina und bleib an Land, tu dem alten Grafen den Gefallen und gib die Seefahrt auf, überlaß mir die Schiffe, laß Messen lesen und werde ein ehrlicher Kerl an Land. Von Schottland bis Tunis gibt es kein zweites Weib wie Gesina, und sie liebt dich.« »Sie liebt mich,« wiederholt Störtebeker langsam. »Ein geruhiges Leben hinter Deichen, zwischen Menschen und Weibern und Blumen, keinen Sturm und keine Not. Gesina ist schön. Und doch: nein, Godeke! Meine Meerfahrt ist mir lieber als das beste Weib!« »Du bist ein Hansnarr,« murrt Michels, als Störtebeker jetzt an den alten Ostfriesen schreibt. Geräusche und Gespräche unterbrechen jäh die nächtliche Stille an Deck: die Schaluppe muß zu Wasser, damit der Brief sofort bestellt werde. Als das Geknarr der Riemen in der Weite verklingt, wendet der Seeräuber sich von der Reling, blickt noch einmal nach den riesenhaften Fledermausflügeln hinauf und tritt wieder in seine Kajüte. Er hat sich der See verschrieben, das weiß er.
Abermals sitzt ein Tropfen Tinte in meiner Feder und will verschrieben sein.
Ich muß auf einer Segelöse, auf einer Kausch gelegen haben, denn mein Rücken schmerzt. Oder hat die mütterlich-sorgliche Natur mich geweckt, die weiß, daß wir alle drei Stunden unsere Kurre einziehen. Ist es an der Zeit? Ich öffne die Augen: es ist hell, die Sterne sind verblaßt! Da ruft es auch schon singend zum Einziehen. »Intehn! Intehn!« »Jo,« antworte ich und »Jo« echot es in der Steuerbordkoje. Wir schlafen während der Fahrt und Fischerei in voller Kleidung, ich brauche deshalb nur die langen, schweren Seestiefel anzuziehen, die von Tran und Schuppen glänzen; dann stehe ich an Deck und muß mich wundern, denn von der See ist nicht das geringste zu sehen. Segeln wir auf der Milchstraße? Alles Wasser ist mit einer dünnen, aber dichten, undurchdringlichen Schicht weißen Gewölkes bedeckt, daß nicht eine Welle zu erkennen ist. Und die weiße Decke liegt nicht still, sondern fliegt schnell mit dem Morgenwind nach Osten und reißt doch nirgends ab. Die Sonne ist noch nicht aufgegangen. Seltsam ist es. Wären luvwärts nicht die holländische Tjalk und der Fischdampfer in Sicht, die mit Steven und Wanten aus der Morgenmilch ragen, ich könnte glauben, mit einem Luftschiff über den Wolken zu fahren. Mit einem Luftschiff, wie wir es dwars von Spiekeroog sahen, als wir, von einer Windstille heimgesucht, mit schlaffen Segeln und schlagenden Schoten in der stetigen Dünung trieben und nicht fischen konnten. Da stieg es im Nordosten aus der See wie ein helles Segel. Wir wußten erst nicht, was wir aus dem Wölkchen machen sollten, dann aber erkannten wir durch das Glas den Zeppelin, der den Meeresflug wagte, und sahen ihn nun in unsere Einsamkeit hineinwachsen. Immer höher stieg und immer größer wurde die gelbe, kantige Leinwand. Da sickerte schon der Lärm der Motoren herab. Das singende Brausen der neuen Zeit erhob sich. Unglaublich schnell kam das Luftschiff näher: wir hatten schon die Köpfe im Nacken, da, als es über uns stand und seinen Schatten auf die helle See warf, senkte sich der Bug des Riesen, bis der Kiel seiner Stahlgondeln die See berührte. Er fuhr auf dem Wasser entlang, wie um uns recht zu verhöhnen, uns Windjammerer. Ich hätte mich gar nicht gewundert, wenn er eine Kurre zu Wasser gelassen und gefischt hätte. Die Leute schöpften Wasser als Ballast aus der See. Keine dreißig Faden von unserm Ewer brauste die hohe Wand vorbei. Ich winkte nicht mit, aber Tränen stiegen mir ob solcher Menschenkraft und Menschenschönheit in die Augen. Das neue Geschlecht der Meeresherren! Das alte der Meeresknechte trieb regungslos mit alten Segeln in der Windstille und blieb meilenweit zurück. Ein Riesenvogel, der aus der See getrunken hatte, erhob der Zeppelin sich wieder vom Wasser und zog in Leuchtturmhöhen davon. Wie wünschte ich in diesem Augenblick der Hilflosigkeit einen Sturm herbei, um dem fliegenden Schiff zeigen zu können, daß auch wir lebten und webten! Wie seine deutsche Flagge wehte! Immer mittelalterlicher und zurückgebliebener kam ich mir vor. Erst am andern Abend, als wir ein starkes Gewitter bekamen, als der ganze Heben eine Feuersbrunst war und der Donner uns umstürmte und umknallte, als der Regen auf uns niederströmte, als wäre er mit Eimern ausgegossen, als wir auf der hochgehenden Dünung tanzten, erst dann vergaß ich des Luftfahrers. Alles konnte der Zeppelin doch nicht machen: hier brauchte es doch noch der Schiffe und der Seeleute! Und das tröstete mich, so viel Seen auch über den Setzbord stiegen, und so heftige Sprünge der Ewer auch machte, wir hielten stand. Nun stehen wir auf dem weißen Daak, lassen die Fock fallen und hieven, schwer arbeitend, das Schleppnetz, die Kurre, auf. Wie seltsam, ob es gleich alle Tage so ist: eben noch nichts zu erblicken, und nun sind wir schon von hundert äugenden und schreienden Seemöwen umflogen und umkreist! Hiev, hiev! Wer denkt an Möwen, wenn die Kurre eingezogen wird! Hiev! hiev! Endlich haben wir den Steert, das Ende des Netzes, in der Talje, der Knoten wird gelöst, und die See speit ihre Fische aus, ihre Zungen und Schollen, ihre Steinbutten und Rochen, Knurrhähne und Petermännchen. Wie glänzen die Schuppen, die weißen Bäuche in der Morgensonne, die aus der See gestiegen ist und den weißen Nebel von der Diele gefegt hat! Wie schnappt alles nach Wasser, wie springt alles in Angst und Todesnot durcheinander! Sonst habe ich das nicht gesehen, ich sah immer nur ein fröhliches Klappern und Spaddeln, das mir das Herz erfreute, aber seit dem furchtbaren Traum habe ich Augen für die Qualen bekommen. Wir lagen vor Wind in Bremerhaven und hatten einen alten Janmaaten in der Kombüse, der mit unserm Bestmann verwandt war: das gab einen Abend alter deutscher und englischer Matrosenlieder, einen Abend Passatwind, Liniensonne und Kapsturm. Die Nacht darauf träumte mir das Grauenhafte, daß ich an Deck ging, als gerade die Kurre aus der See kam! Heftig erschrak ich, denn die Luft war erfüllt von tausend Schmerzenslauten, von tausend Todesschreien, von tausend Angstrufen! Alle Fische hatten Stimmen bekommen und jammerten ihre Qual in die Luft! Und es schrie nicht nur bei uns, sondern auch auf den andern Schiffen: die ganze Nordsee war erfüllt von diesem Röcheln und Schreien, das so furchtbar anschwoll, daß wir es nicht auszuhalten vermochten! Wir flüchteten zitternd, verkrochen uns in die Kajüte und bebten, als erwarte uns ein Weltgericht! Furchtbares Grauen!
Abermals sitzt ein Tropfen Tinte in meiner Feder und will verschrieben sein.
In Lee steht ein mächtiges Viermastvollschiff in der Sonne und schiebt sich langsam vorwärts! Es ist ein deutsches! Mit hundert weißgrauen Segeln steuert es dem Weltmeer entgegen. Meine Wünsche schwirren wie fliegende Fische um seinen Steven, und meine Sehnsucht hängt sich an seine höchsten Rahen! Da mit können! Große Fahrt tun! Nimm mich doch mit, du großer Laeisz, du Königin des Atlantik! Ich sehne mich nach hundert Tagen ohne Land, ich möchte unter der Linie getauft werden und möchte auch das düstere Kap Horn einmal in mein Leben hineinragen sehen! Ich möchte dich sehen, wenn du die Stürme abschüttelst, du Viermaster!
Schöne Geschöpfe gehören dir, Meer, herrliche Kinder sind dein! Was ist ein Haus gegen ein Schiff, was ist ein Schreiber gegen einen Seemann? Was ist das erstarrte Land gegen dich, atmende, wogende See? Ein Leichnam gegen einen Lebendigen!
O, ihr Schiffe auf der See, und du Dünung du! Ihr Tage und Nächte, ihr Wolken und Winde: was seid ihr an Land? Nichts! Und was seid ihr auf See? Alles, alles, was uns die Seele bewegt!
Ich grüße dich, du kleine Galliote, die du so tapfer deinen Kurs steuerst. Kommst du von Schweden und willst nach England? Du kleiner Mann auf der Back: wiegte dich deine Mutter dort in dem schönen Land der Wälder und Seen auch so gut, wie die See dich jetzt wiegt?
Da – das große »Vaterland«, die schwimmende Stadt, das mächtigste Schiff der Welt! Wie eine Erscheinung! Ich hole die Flagge aus der Achterplicht. Wir brauchen sie sonst nur, wenn ein Kriegsschiff in Sicht kommt, aber das größte und schönste Gebilde der deutschen Hand zu grüßen, hole ich sie dennoch freudig auf! Überschiff du! Wie der englische Kohlenkasten qualmig auf seiner schwarzen Schornsteinpfeife raucht, als ob es ihn verstimmte, dieses Made in Germany!
Noch ein Blick nach dem Schoner und den nachbarlichen Fischerkuttern, und dann laß es genug sein, See. Die Möwen sind weggeflogen, unsere Fische sind auf Eis gebettet, die Kurre pflügt wieder den Meeresgrund, und das Deck ist gedweilt: ich kann wieder drei Stunden schlafen! So wiege mich wieder in Träume hinein, du große, gute See! Und laß mich bei der harten Fischerei niemals vergessen, daß du schön bist wie nichts auf der Welt, wie kein Wald und kein Berg! Noch habe ich es keinen Augenblick vergessen, und allen Witwenkleidern und Tränen zum Trotz soll das Herz daran festhalten! Und sollte mir einmal der Fliegende Holländer begegnen, das todverkündende Geisterschiff, sollte die Sonne ihren Schein verlieren wie auf Golgatha, sollten meine Masten brechen und meine Segel in den Wind fliegen, sollten die Notanker nicht mehr halten, sollten die Luken einschlagen und die große Sturzsee ehern heranwogen und Klar Deck machen, solltest du mich holen, schöne, wilde See, so will ich in aller meiner Not doch erkennen, daß mein letzter Blick deiner größten, höchsten Schönheit gegolten hat.
Ihr aber, ihr Jungen, Lebendigen, setzt weiter Segel auf! Beflaggt eure Schiffe und grüßt die deutsche See, ihr deutschen Jungen! Wiegt euch auf der Dünung und freut euch der Sonne auf den Meeren und Gewässern!
Ich schwimme beim Swiensand, südsüdost von Falkental im tiefen Priel und ringe mit der starken Strömung. Eisigkalt ist das Wasser. Es soll mich heilen von der Herbstmüdigkeit, von den Spinneweben, die meine Sinne umfangen wollen. Schwere, fremde Tropfen sind in meinem Blut. Und wären es die letzten, verzitternden Wellenkreise eines Winterschlafes in grauen Zeiten: ich schüttle sie ab und lache ihrer. Ich brauche den Herbst und seinen Wind, ich rufe ihn: damit meine Wimpel hoch am Mast flattern, damit meine Segel sich blähen, damit meine Mühlen mahlen. Mit weißen Geisterhänden greif ich aus: dreimal noch um das Boot, nein viermal, nein solange, bis die Sonne wieder aus den Wolken kommt. Riesengroß ist mein Fahrzeug: es überragt alle Bäume, alle Deiche, alle Türme, alle Gipfel. Eben komme ich beim Achtersteven aus seinem Schatten und steure auf das kleine, grüne Eiland zu. Die Weidenblätter haben schon helle Farben. Das Reet ist graubraun geworden. Da waten keine Störche mehr, da jagen keine Schwalben, da tanzen keine Mücken mehr umher. Die Kuhblumen, die Butterblumen haben ausgeblüht, die Binsen liegen schwer auf dem Schlick. Still und vereinsamt harrt der Sand der Stürme und Hochfluten. Schwarze Muscheln liegen am Strande, wie Fußtapfen im Schnee. Eine Nebelkrähe schreitet beschaulich am Wasser entlang. Mitunter streckt sie den Kopf vor und gibt sich durch tiefes Krächzen kund. Wilde Enten streben hastig dem Neste zu.
Es wird hell und blank um mich her, es blitzt und schimmert: die Sonne ist da. Ich schwinge mich an Bord und springe von Ducht zu Ducht, derweil die Sonne und der Wind mich abtrocknen. Um Kiel und Steven plätschern die Wogen, sie schlucken und glucken, heimlich und stillvergnügt. Die Augen zu: es ist, als wenn die Glocken gehen, Hochzeitsglocken, Freudenglocken, als wenn die Kinder fern auf der Wiese lachen und spielen, als wenn die Pappeln im Sommerwinde rauschen und erzählen, als wenn die silbernen Quellen über glatte Kiesel und knorrige Tannenwurzeln springen, tief, tief im Walde ... Gluck ... gluck ... gluck ... Eine Henne lockt ihr Küchlein – und das Küchlein legt das Ohr an die Bordwand und horcht und lacht. Das Segel reiß ich mit einer Hand empor, und der Anker kommt schnell genug ans Tageslicht. Dann ziehe ich mich an. Das Boot schwoit, der Lappen fällt voll, und leise gurgelt und zischt es am Steven. Gute Fahrt bei raumem Wind und mit der Tide. Nach Schifferart einen Blick prüfend zu dem braunen Segel hinaufgeschickt – dann halte ich hellen Ausguck.
Der Swiensand schaut mir nach. Blanke, glatte Flächen, dunkle, krause Windstreifen auf der Elbe. Einen langen, breiten Weg hat die Sonne sich gepachtet: da blinkt und gleißt es, da spielen ihre strahlenden Kinder. Hinter Schulau dehnt sich die See, da sind der Himmel und das Wasser allein auf der Welt und halten einander still an den Händen. Rauchwolken bei Rauchwolken, als wär's die Straße zur Hölle. Segel über Segel teilen sich in den mächtigen Strom: graue und braune, hohe und breite, neue und geflickte. Schleppdampfer, Seedampfer, Fischdampfer, Fährdampfer, schwarze und bunte Schornsteine. Weiße, schimmernde Eiderschuner, unförmige holländische Kuffen, breite, protzige, ostfriesische Tjalken, schwere, wetterfeste Finkenwärder Fischerkutter, spitznasige, verwitterte Altenwärder Ewer, braune, runde Lühjollen, alles klüst nach Osten. Weiße, schlanke Leuchttürme verträumen den Tag. Graue Heidehäupter stehn am Wege, wie Nordlandsrecken. Blankenese, Luginsmeer und Luginsland, Utkiek und Kiekut von Hamburg – ein rechtes Sonntagsnest, Tag für Tag in Sonntagskleidern, immer geziert und geschmückt. Die weißen Giebel und die blauen Dächer schauen aus den Baumkronen. Die Fenster sind wie dunkle, kluge Vogelaugen. Helle Streifen leuchten aus dem Grün: das ist der Herbst. An den Brücken liegen Fährdampfer, die grünen, breit und bürgerlich, die schwarzen, schlank und aristokratisch. Ihre weißen Rauchwolken verfliegen an den Abhängen. Die efeuumsponnene Burg der guten Frau äugt still und weltfremd von der waldigen Höhe: sie träumt vom grünen Rhein. Überall spielen die bunten Farben: gelb und rot und braun in hundert Tönen. Der liebe Nienstedter Turm spiegelt sich in der Elbe. Sein grünes Dach und seine goldnen Zeiger glänzen im Sonnenschein. Um seinen Knauf fliegen die Dohlen. Aus allen Schornsteinen qualmt die breite, rote Brauerei. Auf der andern Seite grüßen die grauen und grünen Häuser von Finkenwärder über die Hamburger Dünen hinweg. Auch die trotzige Kirche guckt über den Deich und der Neß mit seinen Eichen. Der helle, zierliche Wasserturm lacht herüber.
Die Mühle mahlt im Winde, und auch im Alten Lande drehen sich die Mühlen. Brotes genug. Mein Segel giekt, mein Fahrzeug schwankt. Die Dünung des glänzenden, hohen Amerikadampfers hat uns erreicht: mein Boot und ich verneigen uns und danken für den Gruß aus der großen, weiten Welt.
Sei mir gegrüßt, du bunte Welt, sei mir gegrüßt, du großes Leben. Du rinnst und jagst durch meine Adern, reißest mich auf und wirfst mich nieder. Nieder? Fortan nicht mehr! Wer so lachen kann, wie ich, der läßt sich nicht mehr niederwerfen. Ich lebe, und hoch will ich leben. Ich lebe mit Wissen und Willen, fühle jeden Atemzug, jeden Windhauch, jeden Wellenschlag. Ich sehe jeden Baum und jede Wolke, deute jeden Schritt und jeden Klang, forsche in allen Mienen und in allen Zügen. Umflutet, umbraust, umkost – und König meines Lebens bin ich! Mittelpunkt der Welt, aller Augen warten auf mich und über meinem Kopfe ist der Himmel am allerhöchsten. Was ich sehe, was ich tue: darauf kommt es an, und für mich scheint die Sonne. Umreißen oder aufbauen, das ist mir gleich, nur wirken, arbeiten, die Arme aufkrempeln können. Und dabei singen mögen! Wenn zwei streiten: hei, dazwischen gesprungen und mitgestritten! Leben, lachen, siegen!
Nicht angekettet sein, wie die rote Leuchtboje hier an Backbord, deren mattes Blinkfeuer mit den Sonnenstrahlen kämpft. Von den Torfewern, die auf die Ebbe lauern, liegt ein ganzes Rudel vor Anker. Sie sind nicht mehr so tief geladen und haben nur noch wenig Decklasten: die unruhige Jahreszeit ist angebrochen. Auf einem Holländer spielen die Kinder Verstecken. Hinter dem Kompaßhäuschen, auf dem Roof, vor der Winde: überall krabbelt es. Ein kleiner Kerl kriecht sogar in das Großsegel hinein. Die Mutter sitzt auf den Luken, schält Kartoffeln und guckt ihnen zu. Ein weißes Landhaus mit riesigen Eulenaugen schmiegt sich bei Flottbek dicht an die hohen Buchen, die es einrahmen. Auf der Chaussee schnauft ein Automobil: ein Augenblick und der Komet ist verschwunden, nur sein Schweif verkündet noch seinen Weg. Helle Kleider, rote Schirme. Mühelos überhole ich ein Segelboot von Neumühlen: weiße Segel allein tun's eben nicht. Vornehm und verbindlich steht das Parkhotel da, und die Schiffe ziehen an ihm vorbei und spiegeln sich in seinen Fenstern. In glänzender Reihe krönen die Landhäuser den waldigen Höhenkamm, weltklug und weltüberlegen, gegenwartkundig und zukunftfroh. Auf dem Sande liegt junges Volk in der Sonne. Ein Mädchen winkt mit der Hand, die beste von allen hebt nur eben das Bein zum Gruße. Spielend rollen die Wellen hinan, kehren zurück und ergießen sich wieder über die Steine. Die Zweige gehen im Winde auf und ab: das ist ein immerwährendes Schmeicheln und Fächeln. Da ziehen sie schon die Boote auf den Strand, schlagen die Segel ab und scheren die Leinen aus. Die Herrlichkeit neigt sich. Heute aber wehen noch die Fahnen, laufen noch die Kellner umher, sitzen noch muntre Gäste an den weißgedeckten Tischen unter den Ulmen, perlt der Wein im Römer, paradiert die dicke Kaffeekanne zwischen Stapeln von Kuchen.
Ree – und mein Boot stößt hart gegen den Brückenkopf. Die Mädchen gucken mir lachend zu, wie ich das Segel herunternehme. Und ich lache mit, denn blühende Rosen und leuchtende Mädchenaugen ... ach was, ich gehe raschen Schrittes dem Lande zu, wie ich immer tue, wenn die Sonne scheint. Bunt wie ein Narrengewand ist das Laub, hier dunkelgrün, da grau, da braun, da rot, da gelb. Rote Vogelbeeren schimmern aus den Büschen. Hinter den Fenstern der altmodischen Lotsenhäuser bunte Blumen. In den Gärten noch Astern und Rosen, etwas welk, zerzaust, aber Rosen, Sommerrosen. Die Elbschlucht hinauf geht es in Sprüngen: Stufen sind für alte Leute und dürfen nicht abgenutzt werden. Graues Laub in allen Ecken und auf allen Wegen, das rauscht und raschelt. Recht in den Sonnenschein setz ich mich und recht angesichts der Elbe. Vorposten! Da unten kreist das Leben, da kräuselt sich das Wasser und wiegt sich auf und ab. Die Schiffe kommen und gehen, und keins läuft vorbei, das ich nicht messe und nach dem Kurs frage und ein Stücklein Wegs begleite. Über mir spielt der West in den Blättern, und an der Erde fegt er das abgefallene Laub auf einen großen Haufen. Dann und wann wirbelt ein Blatt herab. Helle Wolken ziehen in der Luft. Bald scheint die Sonne, bald läuft der Wind mit dem Schatten über die Welt. Auf dem Dach sitzt eine Schar von Spatzen und piept laut durcheinander. Aus den Gärten steigt ein herbstlich feuchter Odem auf. Alle Augenblicke legt ein Dampfer an der Brücke an. Breit und schwarz steigt der Rauch auf. Deutlich ist zu hören, wie die Stege ausgelegt werden, wie das Wasser schäumt, wie die Räder schlagen. Dazwischen Rufe. Tuten und Pfeifen. Hoch und leer kommen die Kohlendampfer herab: die Schraube haut halb in der Luft und wirbelt einen Berg von Gischt auf. Einer von Woermann, einer von Sloman, ein Neptun, ein Kosmos, ein Engländer, ein Normann, so wechselt es ab. Eine schwedische Bark mit der neuen Flagge. Im Südosten das Schuppen- und Masten- und Schornsteingewirr von Kuhwärder, der riesige Laufkran. Die Schlote von Harburg, der Turm von Altenwärder, das helle Band des Köhlbrandes. Dahinter die dunkelgrauen Berge, die tiefblaue Geest, wo die Nebel brauen. Der Schopf des Falkenberges, das kahle Haupt des Opferberges bewachen den Eingang der stillen Heide.
Einzelne Boote rudern noch in der Tiefe. Es muß Hochwasser sein: die braunen Segel erscheinen: die Strohewer, Torfewer, Steinewer, Fruchtewer, Kornewer. Schwerfällig kreuzen sie vorbei und ist doch ein farbenfrohes Bild. Das singt und juchheit nicht und reckt mir doch die Arme, denn es lebt und webt und fährt mit allen Winden.
Marienfäden fliegen umher.
Die Wolken haben den ganzen Himmel überdeckt. Die Dämmerung geht über Strom und Strand. Es dunkelt rasch. Mit Siebenmeilenschritten kommt die Nacht, und riesenhaft ragen Bäume und Giebel in das letzte Abendrot hinein. Die Heide verliert sich. Nur die Elbe schimmert noch grauweiß herauf. Überall sind Lichter entglommen. Eins nach dem andern wird angesteckt. Gelb und grün und rot, matt und hell, groß und klein. Alles wirbelt auf dem bewegten Wasser hin und her. Irgendwo zirpt eine Grille von gelben Ähren, rotem Mohn und blauen Kornblumen. Die Elbchaussee entlang wanken Laternen. Zwei bei zwei halten sich die Kinder an den Händen und blicken mit großen, dunklen Augen auf ihr gelbes Licht. Und singen verträumt von ihrer lieben Laterne. Mählich verklingen die feinen Stimmen in der Ferne.
Leise summe ich die schlichte Kinderweise vor mich hin, als ich langsam den Abhang hinuntergehe. Dann ziehe ich mein Segel wieder auf und kreuze die Elbe hinab.
Hoch und steil steigt das Ufer an und wirft seinen riesigen Schatten. Groß und gespenstisch gehen die Schiffe an mir vorbei. Von allen Seiten umspielen mich die Lichter. Wie Leuchtkäfer schwirren sie durcheinander. Verhaltene Stimmen zittern durch die stille Luft. Am Strand wird es dunkler und einsamer. Auf einem Ewer klagt eine schwermütige Harmonika. Je weiter ich treibe, desto ruhiger, traumvoller wird die Welt. In tiefem Frieden zieht die Elbe dahin. Nur am Steven plätschern die kleinen Wellen.
Droben haben sich die Wolken geteilt und freundliche Sterne schauen herab zur »Guten Nacht«.
In einem Atemzuge schnob der Nordwest von Esbjerg nach Kopenhagen: so klein war Dänemark in dieser Sturmnacht geworden. Nur als die Fackel auf der See erlosch, hart an der jütischen Küste, die zitternde, schwankende Notfackel, als die grauen Segel jäh aufs Wasser schlugen, da ward es urplötzlich stiller, und es schien, als müsse der Wind sich besinnen. Wo eben noch der gewaltige, wilde Nordlandswolf geheult hatte und umhergesprungen war, lag eine riesenhafte, graue Katze auf der Lauer.
Fünf weiße Häuschen, die in der Dünenmulde standen, waren die Mäuse, die sie nicht aus den Augen ließ. Und kaum daß einer zehn zählen konnte, richtete sie sich pfauchend und zischend auf. Der aufgewühlte Dünensand hagelte schwer gegen die Fensterläden. Lange, wehe Klagetöne hallten um Dächer und Giebel. Die See aber schrie noch zorniger gegen die Wolken, hob die weißen Häupter noch höher und rollte noch wilder über den Strand.
Es war Flut geworden.
Das kleine gelbe Nachtlicht wurde unruhig.
Ein großes, starkes Mädchen stand neben dem Tisch und band sich die Flechten auf. Eine Weile guckte sie fragend in den Spiegel und dachte: bist bald alt geworden, Karen! – dann suchte sie Rock und Jacke und zog sich dick und warm an. Sie band ein schwarzes Wolltuch um den Kopf und zog Handschuhe an.
Das Gekeuch des Windes und das Gebrüll der See hatten sie geweckt.
»Karen!«
Niels streckte sein bärtiges Gesicht aus den roten Kissen und richtete sich halb auf. Verschlafen sah er sie an.
»Flut.«
Sie hatte sich eine Tasse Kaffee eingegossen und trank langsam.
Er brummte etwas Undeutliches, dann stieß er den neben ihm schnarchenden Jens an und rüttelte ihn wach.
»Flut, Jens. Steh auf, Jens. Mach dich klar, Jens.«
Aber Jens schalt und knurrte. »Laßt mich schlafen. Morgen – nachher – gleich – ja, ja.«
»Dann haben die andern den Strand rein,« brummte Niels, aber Jens schnarchte und war nicht wieder zu ermuntern.
»Allein geh' ich auch nicht los,« sagte Niels und legte sich die Kissen zurecht. Es war unter der Decke doch wärmer als draußen.
»Leg dich auch wieder hin. Schlaf noch 'ne Stunde oder zwei ... meinetwegen ... zwei ...«
Aber Karen schüttelte den Kopf und ging hinaus.
»Wenn was da ist, holst uns,« rief Niels ihr nach und hörte noch im halben Traum, wie die Tür klappte und der Wind aufheulte. Zugleich fühlte er, wie die Kälte hereinschlug, und er zog ohne Bedenken die Beine etwas höher und steckte den Kopf tiefer unter die Decke. Dann flog die Tür zu und es wurde stiller.
Das Mädchen tastete vornübergebeugt über die Dünen nach dem Strand. Der Wind war so stark und so kalt, daß er ihr fast den Atem benahm und sie sich dann und wann umdrehen mußte. Wie scharfer Schnee schlug der Sand ihr ins Gesicht. Erst als sie den Strand erreicht hatte, wurde es besser.
Es war tiefdunkel. Kein Licht. Und die See war nicht weit zu sehen. Nur fünfzig Faden weit leuchteten die weißen Köpfe. Ein Brausen und Keuchen und Zischen und Brodeln war die Luft, war die See. Das Wasser stieg rasch: der weiße Schaumstreifen wurde von jeder See höher an den Strand gespült.
An diesem Strich entlang ging das Mädchen und bückte sich, wenn sie etwas Dunkles gewahr wurde. Dann stieß sie es mit den Füßen an, zu erfahren, was es sei. Alles Holz las sie auf und steckte es in einen Sack, den sie unter dem Arm trug. Tang und Muscheln lagen viel da – weiter auch fast nichts.
Als es Morgen werden wollte, hatte sie immer noch keine Tracht.
Hinter den Dünen erschien ein grauer Streifen, der höher und höher gekrochen kam.
Der Sturm raste noch mit voller Kraft. Drohender und gewaltiger schüttelte die See ihre Stierhäupter.
Kein Holz, kein Schiff, kein Wrack, kein Notschuß, kein Feuer – nur schwarzes Wasser und weißer Schaum.
Sie blieb stehen ... Da trieb etwas ... etwas Dunkles, Undeutliches, Unförmiges ... es kam näher. Aus Gewohnheit hielt sie die Hand über die Augen, wie sie an hellen Tagen oft getan hatte, wenn Sonnenschein um Dach und Dünen brannte und die Luft flimmerte.
Es konnte ein Schiff sein, ein Kahn wohl oder ein Boot.
Das Seeräuberblut regte sich in ihr, ungeduldig lief sie am Strand auf und ab. Ihre scharfen Augen unterschieden schon, ein Boot war es, voll Wasser geschlagen, eben, daß es trieb und ausguckte. Nur wenn eine große See es auf den breiten Rücken nahm und dann zurücklief, ragte es höher auf. Langsam schoben die Seen es näher heran und endlich saß es am Sand als Strandgut.
Erst wollte Karen zurücklaufen und den Vater Niels, den Bruder Jens rufen. Aber sie besann sich anders und tat es nicht. So ging es nicht: Die Nachbarsleute konnten unterwegs sein, fanden es und hatten es. Sie überlegte, was sie machen sollte, dann zog sie eilig ihre Schuhe aus und streifte die Strümpfe ab. Ihr schauderte vor Kälte. Aber was half das? Sie schürzte den Rock auf und watete mit zusammengebissenen Zähnen in das eiskalte Wasser.
Den Steven hatte sie erfaßt und schwang sich auf den Bordrand. Tastend suchte sie nach der Fangleine, um das Boot aufs Trockene zu ziehen, da stürzte eine riesengroße See heran und schäumte über das Fahrzeug hinweg. Sie war durchnäßt. Fast hätte sie das Gleichgewicht verloren, aber sie hielt sich im letzten Augenblick krampfhaft an der Ducht fest.
Die See hatte es gut gemeint; als sie zurücklief, saß das Boot hoch auf dem Strand.
Wegtreiben konnte es nun fürs erste nicht mehr. Wenn sie noch den Anker aufs Land brachte, war das Strandrecht gewahrt und sie konnte Hilfe holen.
Sie wollte es. Es war so bitterkalt.
So kalte Hände hatte sie.
Sie schauderte vor sich selbst. Wie Totenhände waren sie, wie fremde Hände. Plötzlich fühlte sie eine andere Hand ... ein Fremder war bei ihr im Boot ... ein Toter ... Als gehöre es sich so, fühlte sie die Haare, die Nase, den Mund ... als wenn sie träume ...
Wollte es denn nicht Tag werden?
Über den Dünen wurde es doch schon hell ...
Sie drehte sich wieder um und suchte nach der fremden Hand. Dann zog sie den Toten halb aus dem Wasser und legte ihn mit dem Rücken auf die Ducht.
Der stille Mann war schwer.
Er steckte in Ölzeug. Der Südwester hatte sich in den Nacken geschoben. Die Augen waren weit geöffnet und das Gesicht schneeweiß. Die Lippen waren fest geschlossen.
»Jung,« dachte sie, als sie keinen Bart sah.
Um die Hüften war das Bootstau geknotet – so waren Boot und Mann zusammengeblieben.
»Wer bist du?« murmelte Karen und beugte sich tiefer über ihn, um seine Züge zu erkennen, aber der Tag war noch zu grau.
Wieder schlug eine große See klatschend über den Setzbord.
Da ließ sie die Hände los und löste das Tau. Auf ihren starken Armen trug sie den Toten durch das Wasser und bettete ihn auf das Dünengras. Leise und scheu strich sie ihm das Haar aus dem Gesicht und schaute verwundert in die hellblauen Augen. Verwundert ... einen kurzen Augenblick.
Dann stand sie auf und machte sich wieder mit dem Boot zu schaffen, über das die See fortwährend schäumte. Sie zog es etwas höher, dann entdeckte sie eine Pütz unter den Duchten und machte sich daran, das Wasser auszuschöpfen. Wenn auch die Seen immer wieder hereinschlugen und sie bei dem Winde kaum auf der Ducht stehen konnte, es glückte ihr doch, und als das Boot erst Luft hatte, kam es von selbst höher aus dem Wasser. Bald hatte sie es soweit leer, daß sie auf den Lohnen stehen konnte.
Das Boot war fast neu. Sie beugte sich über den Achtersteven. »Gesine von Hamburg« stand da. Von Hamburg, von Deutschland, dachte sie und sah nach dem Toten hinüber.
Es war Tag geworden – sie gewahrte es und hielt inne. Dann sprang sie heraus und zog das leere Boot so hoch auf den Strand, wie sie konnte, band das Tau um einen herangeschleppten Felsen und lief die Dünen hinan. Der Wind wehte sie hinauf.
Oben auf der Höhe kam es über sie, als habe sie etwas vergessen; sie mußte sich umdrehen und nach dem Toten gucken.
So sonderbar war ihr zumute. Erst hatte sie sich gefreut, Vater und Bruder den Fund zu melden; nun war sie beklommen, war es ihr nicht mehr recht, was sie tat.
Sie sah von oben mit einemmal auf ihr Leben hinab, auf ihr graues, stumpfes Leben. Ein Tag war wie der andere gewesen. Und die Gesichter immer dieselben. Eine Arbeit, ein Schelten und ein Gespräch. Immer das Alte, keinen Tag etwas Neues. Fünf Häuser waren es, und fünf Häuser blieben es. Und auf den Dünen wuchsen ewig keine Blumen. So war es immer gewesen und sie hatte es nicht gewußt: nun aber kam es über sie. Draußen auf der See, ganz weit hinten, daß sie eben noch zu sehen waren, gingen mitunter Schiffe vorbei: Segelschiffe und Dampfer. Die Segel erschienen so weiß und rein, und der Rauch stieg steil in die Luft. Da war die Welt, da fing sie an: da sangen und lachten die Menschen und trugen schöne Kleider. Wie oft hatte sie als Kind barfuß auf dem Sand gestanden und gewartet, daß ein Schiff, ein einziges nur, heransegele und sie abhole. Aber alle zogen vorbei und kamen ihr aus den Augen. Einer mußte kommen, einer, der anders war, als die sie kannte, der lachen und singen konnte, der sich freute und sie bei der Hand nahm, der ihr erzählte und sie fragte. Der hatte immer kommen sollen und war nicht gekommen.
Sie schauderte ... da hinten lag einer mit hellblauen Augen ... ob er es war, der zu ihr gewollt hatte?
Sie wollte nicht – und trat doch ins Haus.
»Vater! Jens!«
Der buschige Schopf wurde zuerst sichtbar.
»Was ist los?«
»Ein Toter, Vater.«
»Weiter nichts?«
Niels wollte sich schon wieder umdrehen.
»Ein Boot auch.«
Das half. Niels richtete sich auf.
»Ein Boot?«
Er stieß Jens heftig an.
»Ein Boot, Jens! Aufstehn!«
Das ließ sich selbst Jens nicht zweimal sagen.
Niels stand schon in der blauen Unterhose da und suchte nach seiner seemännischen Ausrüstung. Zwischendurch fragte er in einem fort:
»Wo ist es? ... Neu? ... Treibt es noch? ... oder sitzt es schon auf Land? ... Was steht dran? ... Und der Tote? ... Was für Zeug? ...«
Jens war auch bald reisefertig, und alle drei wateten durch den Sand. Niels war guter Laune und erzählte von Schiffen und Gütern, die in früheren Jahren angetrieben waren. Daß der Sturm ihm fast den Mund verschloß, störte ihn nicht.
Karen wies mit der Hand.
»Seht! Da!«
Karen war stehen geblieben.
»Vater!«
Niels drehte sich um.
»Was willst du?«
»Dem Toten müßt ihr seine Ruhe lassen. Den dürft ihr nicht anfassen. Versprecht mir das!«
Jens lachte höhnisch.
»Dumme Deern! Wenn das Zeug mir paßt, zieh ich's an. Der braucht nichts mehr.«
Niels hustete.
»Und wenn wir ihn melden, müssen wir ihn beerdigen lassen und vom Boot bleibt nichts nach. Wir begraben ihn in den Dünen und damit gut.«
Jens schüttelte den Kopf.
»Seemannsgrab, Vater, Seemannsgrab. Das wünscht sich jeder Matrose.«
»Das tut ihr nicht! Das nicht! Versprecht mir das!« flehte das Mädchen. »Das dürft ihr nicht. Hört ihr?«
»Mach doch nicht so 'n Lärm um den toten Mann,« knurrte Niels. »Freu dich, daß wir 'n Boot haben.«
»Dann geh ich nicht mehr mit,« drohte Karen.
»Geh meinetwegen nach Haus und koch Kaffee,« sagte Jens gleichmütig. »Wir können's allein.«
Karen begann mit großen Schritten zum Strand zu laufen.
»Willst du hierbleiben!« rief Niels, aber Jens sagte trocken:
»Laß sie laufen!«
»Was hat sie mit einemmal?«
»Mag der Deubel wissen. – Das Boot sieht gut aus.«
»Das können wir brauchen.«
»Nanu? Ist sie verrückt geworden?«
»Lauf, Jens, und halt sie auf.«
»Karen! Karen!«
Die beiden fingen an zu laufen, aber bei dem schweren Wind kamen sie in dem tiefen Sand mit den großen Seestiefeln nur langsam vorwärts.
Als sie am Strand ankamen, war das Boot schon ein gutes Stück vom Lande.
Karen stand auf der Ducht und schob mit dem Haken ab. Schwer haute der Steven in die Seen, und das Fahrzeug dümpelte gewaltig hin und her, aber das starke Mädchen zwang es.
»Karen! Karen!«
»Dumme Deern, komm her.«
Aber der Sturm verschlang jedes Wort, und das Mädchen sah sie gar nicht; ihre Augen waren bei dem Matrosen, der still und friedlich auf den Lohnen lag.
Als sie weit genug war, kniete sie neben ihm nieder und faßte seine kalten Hände.
Und setzte sich so, daß die blauen Augen sie ansahen.
»Ich bring dich heim. Nach Esbjerg und nach Haus,« flüsterte sie und strich mit der Hand weich über seine Stirn.
Sie sah die fürchterliche Flage nicht herankommen und gewahrte die riesige See nicht, die das Boot wie einen Käfer auf den Rücken warf ...
Niels und Jens sahen es mit an.
Es war ein stürmischer Novembertag ...
Hans Banidt las in der Bibel.
Er war grad vom Feld gekommen. Und vom Pflügen. Der dicke Schlick saß noch an seinen Schuhen. Die wollene Mütze hatte er abgesetzt. Mit aufgestützten Armen saß er an dem schweren Eichentisch und war mit allen Gedanken bei Johannes, dem vierten Evangelisten.
Auf dem Hof und um die Wurt wurde es still. Die Knechte ließen das laute Erzählen, und die Mägde gaben das Juchen auf. Das Vieh in den Ställen verhielt sich sinniger. Die Hühner kletterten schlaftrunken auf den Wiemen. Der Hund lag müde an der Kette und rührte sich nicht. Sogar die Sperlinge verlegten ihre Abendschule von den Lindenzweigen nach dem Katendeich.
Die Uhr tickte langsam und leise.
Peter, der alte Knecht, saß am Fenster. Der sah die Sonne größer und roter werden, und tiefer und tiefer sinken. Bis sie mitten auf der Elbe stand. Bis sie unterging. Dann guckte er um die Ecke nach dem jungen Bauern, der so alt und gelehrt aussah und doch nichts von der Welt gesehen hatte, kaum vom Hof hinuntergewesen war. Er sagte aber kein Wort, der alte Peter.
Still war es. Überall.
Nur in der Küche nicht. Da klapperten Pütt und Pann und Teller und Tassen. Da war jemand, der es hild hatte. Da sang jemand. Helle Lieder, neue und alte. Bunt aus der Reihe. Und ließ nicht nach.
Peter freute sich heimlich.
Der Junge hatte es aber doch spitz gekriegt.
»Mok de Kökendör mol to,« sagte er, ohne aufzusehen.
Peter ging und tat es. Aber das half nichts. Der Gesang frischte auf wie der Wind bei der Flut und wurde nur umso lauter.
Es dauerte nicht lange, da ließ Hans sich wieder vernehmen:
»De Diern schall dat Singen nolaten.«
Wieder ging der Knecht die halbe Diele entlang und unterhandelte mit dem Feinde. Aber die Deern ließ das Singen nicht sein.
»Wenn se ne singen schall, kann se ok ne arbein, segg se.«
Damit kam Peter zurück.
Hans las Kapitel sechs noch zu Ende. Dann wurde es ihm über und er stieß die Tür auf.
»De Heidenlarm schall uphürn,« scholl es laut und herrisch über den Flur.
Das half auf dem Stutz. Ein paar Teller klapperten noch nach, dann flog die Tür knallend zu, und es wurde still.
Hans Banidt konnte geruhig weiter lesen. Er tat es auch: aber lag es nun daran, daß das siebente Kapitel ihm nicht recht in den Kram paßte, oder daß die Schummerei schon zu hoch vor dem Fenster stand, oder daß da sonst eine kleine Käulnis über die Schallen gelaufen war: – genug, er kam nicht weiter als bis zum dritten Vers. Eine Weile sah er es noch mit an, wie die Reihen durcheinander liefen, dann stand er auf und ging hinaus.
Er wollte nach der Scheune und nach den Kälbern gucken. Aber als er niemand auf der Diele sah, dünkte ihn das nicht mehr so wichtig. Er blieb bei der Küchentür stehen. Ob die auch innen so braunrot gestrichen war? Das ging ihn wohl was an. Ganz gewiß. Er hatte die Klinke schon in der Hand – aber die Küche war leer. Der Singvogel war ausgeflogen. Die Schüsseln standen noch da, und die Schürze lag groß und breit am Boden. So unklug, die feine Schürze so hinzuwerfen. Er mußte sich doch wohl bücken und sie aufheben. Glatt strich er sie auch mit den großen braunen Händen. Und die Spitzen und Fransen am Hals betrachtete er lange mit besonderer Sachkenntnis. Behutsam hängte er sie an den Nagel, und wieder hallte sein schwerer Schritt über die lange, dämmerdunkle Diele. Niemand war zu erblicken. Die Leute waren wohl alle nach dem Deich gegangen und klönten mit den Fahrensleuten.
Die Fülltür stand noch sperrweit offen. Er machte sie zu und spähte wie zufällig über die Wurt.
Dann ging er langsam auf die Bodentreppe zu. Das war keine Art von der Deern, einfach alles stehen und liegen zu lassen. Mir nichts, dir nichts fortzulaufen. Er wollte es ihr sagen. Morgen. Denn heute kam sie ja doch zu spät. Oben in ihrer Stube konnte sie nicht sein. Das war gewiß. Er brauchte gar nicht zuzusehen oder hinzuhören. Nur, damit er seiner Sache gewiß war, stieg er hinauf.
Im Fenster glomm das Abendrot. Und am Fenster stand die Deern. Zwischen den Truhen. Nicht in ihrer Kammer, im langen, braungetäfelten Saal, wo bei den großen Hochzeiten getanzt worden war. Da stand sie, nur im kurzen, roten Röckchen und im Hemd und kämmte sich ihr Haar, das dunkel und schwer auf den Schultern lag. Der Nacken schimmerte weiß aus den Spitzen, und die runden Arme waren rosig vom Schein des Abends. Sie guckte hinaus.
»Uuch, de Bur,« fuhr sie plötzlich herum und lachte ihn an. Aber sie schrie nicht auf wie die andern Mädchen, und lief nicht weg. Sie kämmte ruhig weiter.
Er zog die Stirn in Falten.
»Schamst di gornix?«
Sie schüttelte übermütig den Kopf.
»Schamen? Weil ick lange Hoor un runne Arms hebb? Nee, Bur!«
Da holte er aber lang aus:
»Weil du jümmer rümjuchs und springs un lachs. Lachen schimpt, Diern. Un mit jedereen geihs los und frees mit em und les di von Hans und Franz no Hus bringen.«
So viel hatte er manche Woche nicht gesprochen.
Sie lachte.
»Ick bün jung, Buer.«
»Dat bün ick ok.«
»Du? Du? Mann, goh af! Du un jung? Du büs jo'n olen Knast, olen Kirl in 'n Löhnstohl. Lachs ne un spricks ne! Gott schall mi bewohrn!«
Sie sah ihn spöttisch an.
Da trat er einen Schritt näher und vergaß viel. Noch mehr aber lernte er hinzu. Sein Atem ging schwer.
Sie fühlte es wohl, und eine wilde Freude kam über sie. Das Weib in ihr stand auf. Wie im Traume drehte sie sich herum.
»Jung bün ick, Hans Banidt. Un den ick mag, den nehm ick.«
Es war etwas Heiseres in ihrer Stimme, denn sie war zu weit gegangen.
Da riß es auch den ernsten Bauern mit.
»Nämst du mi ok?« fragte er schwer.
So spricht kein Herr zu seiner Magd.
Sie sah ihn von der Seite an, so seltsam –
»Wenn du jung würs.«
»Ick bün jung,« brach es da jach bei ihm los, wie im Sommer der erste Donner über das stille Land hallt. Dann riß er sie in seine Arme und drückte sein Gesicht in ihr weiches Haar und fühlte den warmen Leib und wußte nichts mehr als:
»Du ... Du ...«
Am Heben leuchteten die Sterne, und wache Träume woben um die Pferdeköpfe am First.
Den andern Morgen aber schirrwerkte Hans finster und unzufrieden auf dem Hof und knurrte mit den Knechten und schalt, daß es zu hören war. Über die ganze Wurt hallte seine harte Stimme. Nichts war ihm recht. Die Knechte sahen ihn schief von der Seite an.
Geeschen stand am offenen Fenster. Die Sonne schien ihr ins Gesicht. Und die Deern lachte in sich hinein und summte vor sich hin und freute sich über das Geschimpfe des großen Bauern und dachte: »Ji schull'n 't man weeten.«
Als sie zum Melken über die Diele ging, begegneten sie einander.
»Morgen, Hans Banidt,« raunte sie leise.
Er nickte nur und sah in eine Ecke.
»Du denkst der woll aber no, wanehr du no'n Pasturn hinwullt, wat?« neckte sie.
Da ging er batz aus der Tür.
Sie aber blickte ihm sinnend nach und strich sich das Haar zurück.
Als der Heben wieder mit Sternen besät war, gingen wieder junge Träume unter dem riesigen Strohdach um. Und die Nacht hatte flüsternde Stimmen.
Peter brachte das Mehl von der Mühle und die Nachricht, daß Angk, die Katenalte, krank war und sich hingelegt hatte.
Das war Geeschens Großmutter.
Hans schickte die Deern denselben Tag noch zur Pflege hin.
Dann schwieg der greise Pastor.
Der junge Bauer war aufgestanden.
»Die Bibel weiß nichts davon, Herr Pastor. Wenn die alte Frau selbst Hand an sich gelegt hat und nicht in der Reihe liegen kann und keine Rede kriegen kann, Herr Pastor, dann muß ich sie auf meinem eigenen Lande beerdigen und ihr selbst ein Gebet mitgeben.«
Und seine schweren Schritte verklangen auf der Treppe.
Am Staket stand der Schimmel. Er schwang sich hinauf und ritt davon.
Den Abend vor Ostern war es.
Da brannten zwei lange, dünne Kerzen in der verräucherten Kate zu Häupten der alten, toten Frau, deren spitzes, weißes Gesicht aus dem Sarg guckte.
In den Ecken steckte schon die Nacht.
Hans saß neben der Leiche und hatte den Kopf in die Hand gestützt und blickte unverwandt nach der Toten. Ein tiefer, grüblerischer Zug lag um seinen Mund.
Geeschen streifte ihn ab und zu mit scheuen Blicken. Sie war fast bange vor dem starren Bauer, der sich nicht rührte und nicht regte. Sie lehnte am Fenster und sah nach den Lichtern auf dem Wasser. Sie hatte ein feines, schwarzes Kleid an, das Hans ihr aus der Truhe gesucht hatte. Es stand ihr wunderfein. In dicken Flechten lag das Haar um den Kopf. Und die Augen hatten nichts von ihrem Glanz verloren. An ihnen war kein Weinen zu sehen.
Aber Hans sah davon nichts.
Die Kerzen flackerten auf, als die Tür ging und Peter eintrat.
Der Bauer stand müde auf.
»Ward Tied,« sagte er dumpf und sah Geeschen an. Fragend begegnete sie seinem Blick. Dann begriff sie, preßte die Lippen aufeinander und ging an den Schrein. Sie drückte die kalte Hand zum letzten Male und ging wieder nach dem Fenster.
Peter sagte treuherzig: »Adjüst, Angk.«
Dann legte Hans das weiße Kleid zurecht, klappte leise den Deckel zu und verschloß den Sarg.
Die beiden Männer trugen ihn langsam den Deich hinunter und setzten ihn in den grünen Kahn, der am Bollwerk lag.
Es war eben Hochwasser gewesen.
»Du bruks ne mit. Ick kann alleen klor warn,« sagte Hans und nahm die Riemen zur Hand.
»Wenn du 't meens,« gab Peter zur Antwort und steckte die Hände in die Taschen und drehte bei. Unterwegs dachte er an die hundert Pülle grünen Kohls, die er für Angk noch auf dem Felde stehen hatte. Die kriegte sie nun nicht mehr und sie hätte sich so sehr darüber gefreut. Nun konnten sich die Hasen freuen.
Geeschen hatte ein wollenes Tuch um den Kopf gebunden und den Kranz in die Hand genommen. Auf der Achterducht nahm sie Platz und legte den Kranz auf den Sarg.
Sie band das Tuch fester. Es fror sie. Der Nachtwind kam kalt von Osten.
Hans ruderte schweigend ab.
Aus dem Sielgraben waren sie bald hinaus.
Es war tiefe Nacht geworden. Tiefe, stille, feierliche Nacht. Am Heben ging der Mond durch die weißen Wolken wie ein König durch sein Volk. Auf dem Wasser blinkte und leuchtete er. Die Elbe war ruhig. Kaum daß die Lichter von der andern Seite, von Nienstedten und Teufelsbrücke, herüberglitten und -schwankten. Nur das Knarren der Riemen war zu hören, das Surren der wilden Enten, das Tropfen und Lecken der Riemen.
Auf dem Perlenkranz stand der Mondschein starr und kalt, und über das düstere Gesicht des Bauern huschte er fast ängstlich.
Geeschen guckte bald hierhin, bald dorthin.
»Lot dat Kieken no,« sagte er.
Da sah sie den Mond auf dem Wasser und griff mit den Händen danach. Er zerging in Stücke und wurde wieder gelb und rund. Vollmond und Halbmond hatte sie schon gemacht. Nun sollte das erste Viertel an die Reihe kommen.
Da fragte Hans: »Wat heß du dor?«
»Ick griep den Mon.«
»Leß em sitten, hürs?«
Sie hatte die Hand zurückgezogen, aber es dauerte nicht lange, da hatte sie sie wieder heimlich über Bord gestreckt und ließ sich das Wasser durch die Finger strömen.
Er hörte es.
»Nolaten!«
»Warüm?«
Da guckte er ernst auf den Sarg und tauchte die Riemen tiefer ein.
Sie saß da mit ihrem raschen Herzen, mit ihrem warmen Leibe, mit ihrer köstlichen, goldenen Jugend und ihrer neuen, tauigen Freiheit. Wie Blumen und Sonne war es in ihr. Und sie mußte sich ducken, konnte nicht singen. Mußte frieren.
Frieren? Es fror sie nicht. Nicht mehr. Das Tuch fiel ihr von den Schultern. Der Mond spielte mit ihrem Haar und floß um ihr junges Angesicht.
Sie hielt das Schweigen nicht mehr aus.
»Hans Banidt?«
Er sah kaum auf.
»Sitt dor ne so benüßt. Kiek mi an un snack 'n Wurd. Wi levt jo doch, Hans Banidt. Segg doch wat. Mi ward jo rein angs un bangen.«
Er schüttelte den Kopf.
»Wi hebbt Beerdigung.«
»Hans Banidt, di deit dat leid, dat't so kamen is, ne? Du wulls, dat du mi ne sehn hars, wat?«
Er unterbrach sie schroff.
»Wees still, Diern.«
Da gab sie es auf und schwieg.
Auf dem Neß und am Süllberg flammten Feuer auf, große, rote Feuer.
Sie wies mit der Hand hin.
»Kiek, kiek, Hans Banidt! De Ostermonen! Wo grot, wo fein! Dat is Ostern! Ostern, Hans Banidt!«
Er knurrte. Das Gespreche störte ihn. Er wollte nichts wissen.
Sie sah ihn groß und fragend an, bis das kleine Eiland erreicht war. Es war der Swiensand, der verlorne Posten zwischen Blankenese und dem Alten Land, hundert Schritt im Umkreis Sand und Schlick, in der Mitte Weidenbüsche.
Scharrend stieß der Kahn auf den Sand und saß fest. Hans stand auf und zog ihn hoch aufs Trockene.
Da konnte Geeschen ausspringen und lief behend nach den Weiden.
»Kiek, Bur! De feinen, weeken Katten!« Und riß gleich an einem Zweig. Aber der war zäh. Sie mußte ihn zuletzt durchbeißen.
Der Bauer hörte nicht darauf.
Er hatte den Sarg auf den weißen Sand gesetzt und war mit Schaufeln und Äxten dabei, das Grab zu machen. Durch die Wurzeln mußte er sich hauen, mußte graben und graben fast eine Stunde lang.
Geeschen umkreiste das kleine Land und lief in Sprüngen über den Sand. Sie ahmte das Schreien der Möwen nach und machte sich ein Erdbeben in dem feuchten Sand.
Von Zeit zu Zeit wischte Hans sich die Tropfen von der Stirn und schalt:
»Lot dat Speelen no.«
»Ans frier ick.« rief sie.
Dann schlich sie sich behutsam hinter ihn und strich ihm mit den Weidenkätzchen die Backen und war wie ein Iltis davon.
Von den bunten Muscheln suchte sie einen ganzen Berg zusammen. Sie baute aus ihnen ein Haus mit geschickten Händen.
Ordentlich warm wurde ihr dabei.
Hans kam.
»Ick mok 'n Gruft un du?«
»Ick mok 'n Hus,« sagte sie wichtig. »Kiek mol, Hans, wat för 'n Hof.«
»Du bis 'n Kind.«
Dann mußte sie mit ihm gehen.
Der Sarg stand schon in der Tiefe.
Geeschen ließ den Kranz hineinfallen, und es schauderte sie. Hans nahm die Mütze ab und betete laut ein Vaterunser und setzte hinzu:
»Du ligs hier eensom, Angk, bi Meben und Kreien, ober still un geruhig – un mihr wulls du jo ne. Amen.«
Dann rauschte der Sand hinab, und Sarg und Kranz verschwanden. Als der Hügel sich wölbte, steckte er die Schaufel beiseite und sah Geeschen an.
Langsam streckte er ihr die Hand hin.
»De Dode is versorgt. Nu kommt de Lebendigen wedder anne Reh.«
Ein fester Lebenswille stand in seinen Augen. Da legte sie ihre kleine Hand in seine große und sah ihn lange an. Und in beider Augen glomm es auf.
Dann lief sie fort, und als er ihr noch verwundert nachsah, da hatte sie schon einen Haufen Feeks zusammengeworfen und zündete ihn an. Und eine helle, rote Flamme prasselte auf.
»Wat schall dat denn nu?« fragte er.
»Is doch Ostern!« rief sie, »smiet man Feek up!«
Und er tat es. Ihm war wunderlich geworden. Größer und größer wurde das Feuer.
Der Schein wallte auf dem Wasser, als sie heimfuhren. Da sagte er es:
»Wullt du mien Fro warn?«
Sie sah ihn groß und schweigend an, – und schweigend fuhren sie ans Ufer.
Fern auf dem Swiensand leuchtete noch das Osterfeuer durch die Nacht.
Aber die Hähne krähten schon, und Ostern wollte es werden.
Kassen Witt lewt sin Gild.
He hett dat Arbein ne mihr neudig. Söbentwintig Joahr hett he no See foahrn, up allerhand Oart un Wies', as Jung, as Knecht, as Settschipper un as Schipper. Doarbi hett he bi lüttjen so veel up'n Dutt kreen, datt he dat geruhig mit ansehn kann, wenn de annern sich afrieten möt. He hett sin lüttj egen Hus, hett Hof un Diek, hult sich 'n poar Hünner, mokt sich 'n Swien fett – un wat dat doarbi to schirrwarken gift, dat kann he meist in'n wittbunten Buscherump un mit 'n Brösel in 'n Mund af. De Nobers segt: he harr sich dat fein utklamüstert, em kunn keen See un keen Wind wat mihr dohn, un he much woll lachen, wenn de annern schreen müssen.
Letzt wür Kassen Witt ober ne tofreden. He kunn ne recht mihr kloar warn un dacht, he kunn bi sin Joahrn woll noch ganz leiflich freen. As he noch foahrn dä, harr he doar nix van af weeten, do harr he an so'n Krom ne dacht: ober nu kreupen de Heiratsgedanken obends mit em up 'n Bitt un stünn'n morgens mit em up. Wokeen he freen wull, harr he ok all fastsett. Sill schull dat wesen, de swatthoarige Sill, de mit em ut de School kommen wür un de he do woll all 'n ganz lüttig beetjen lien mucht harr. De harr ok keen afkreen, sünder dat he jüst to seggen wüß, worüm se oberbleeben wür. Enkelte sän, se harr ne uppaßt, oder, se harr to veel snootert; welk meenen, se harr ne wullt, welk, se harr all bitieds dat Hexen van ehr Mudder lihrt – un dorüm harr doar keeneen anto wullt. Mucht wesen as't wull: Sill wür 'n glatte Diern wesen, harr danzt un rümjucht as de annern, se wür nu ok noch 'n troße, gohtliche Fro. Kassen harr doar woll Lust to. Datt se beetjen to veel snacken dä, versleu em nix, doar wull he woll mit kloar warn; he kunn ok 'n deftigen Kurrboom snacken. Un wenn se keen hebben wullt harr: 'n gralle Diern brukt doch ne jeden Hans un Franz to nehmen – un kunn Sill ne ganz god up em teuft hebben? – Bloß mit de Hexerei wüß Kassen sich ne recht to stilln: dat wür noch dat Leegste. Wenn Sill hexen kunn, denn harr he den Mot woll batz sacken loten mucht, ober för gewiß wüß dat jo keeneen un de Lüe snacken sich oberlingen eendeel trech.
Dem Deubel ook, wat wür dat noch förn fein Wief, wat güng se noch troß langs 'n Diek! Ehr Ploten weih inne Wind. Folten würn in ehr Gesicht noch ne gewohr to warn, un 'n Gang harr se as 'n junge Diern, de no Musik geiht. Kassen keek ehr 'n ganze Tied noh. Ne, nu kunn he dat ne mihr utholn. Un inne Schummeree pett he sich mol no ehr langs.
Sill seet in ehr Kök un wür bi't Knütten. De griese Koater seet blangn ehr up de Bank.
Kassen füng an to hoffen.
»Nobend, Sill.«
»Nobend! ... Kassen? ... Non? ... Wat heß du denn, dat du mi besöchst? Legt din Hünner keen Eier genog oder fritt din Borch ne good?«
Kassen sett sich up 'n Löhnstohl.
»Ne, Sill, dat wull jüst ne. Dat Veehwark is good up 'n Schick. Ober ik much woll giern mol 'n Wurd mit di alleen snacken, Sill. Kiek mol, Sill, so geiht uns dat: Du sittst hier alleen un ik sitt doar alleen, du kookst för di und ik för mi, dat is eensom un köst duppelte Füerung. Wenn wi nu tohoop kooken däen, Diern, schull dat ne beter gohn? Ik gleuwt meist! Wollt wi uns Plünnen tohoop smieten?«
»Och, Kassen Witt! – Dat harrst man leeber ne seggen schullt. Du harrst den Krom sinnig angohn loten müßt, ne gliek so mit de Klumpfust uppe Nees!« –
Dat güng em schetterig. He kreeg keen Been mihr anne Grund. Sill güng mit Würden up em dol, as de Klimmer up 'n Heenküken oder as de Floot bi vulln Moon un harten Wessenwind up 'n Diek. Wat he woll wüß un wat he woll müß, wat he woll schull un wat he woll wull, so neihte se em. Ehr Doog ne! Freen! Wenn se dat wullt harr, harr se noch 'n ganz annern krien kunnt, un wenn se dat wull, denn kree se vundoog noch 'n ganz annern. Ober nee, se wull mit de Mannslüe nix to dohn hebben, se kunn dat so beter hebben. So güng dat lustig wieder.
Kassen dreew bannig oberstür bi düsse Gelegenheit. He füng noch 'n poarmol wedder an to krüzen un uptoluven, ober he keem gegen Sill ne an. Ehr Koater wür ehr leber as een Mann, sä se. Se harr ehrn Koater, un solang se denn noch harr, wür se ne alleen. De wür trohartiger as 'n Minsch. Doarbi nehm se dat ole griese, täsige Diert up 'n Schoot, un ei dat van 'n Kupp bit no 'n Stiert, as wenn't ehr eegen Kind wür.
»Ne, min seute Koater?«
Dat kunn Kassen ne mit ankieken. Dat wür em all lang to stur wurden up düsse See. He dreih bums bi un seil no Hus.
»Wi snackt doar noch mol ober, Sill,« sä he batz un rabaster den Diek langs as 'n Peerd, dat fillenloopen is.
»Hö! Hö! Kassen, wat büs du denn so inne Foahrt?« reep Ol-Gierd em no, ober Kassen hür doar goarne no hin un leep wieder.
As he in 'n Hus wür un blangen den Oben seet, den Krom noch mol eulich nodacht, güng de Dör open un Ol-Gierd keem inne Dönß rin.
»Hest mi goarne antert, Kassen,« sä he un güng an 'n Disch ran. Doar kreeg he den Tabakskassen her un stopp sich sien Piep vull.
Kassen bier, as harr he nix hürt.
»Lang mi mol 'n Rietsticken her.«
Kassen geef em Füer un Gierd füng an to paffen. Tiedlang duert, to füng Kassen an:
»De Wieber döht all nix.«
»Non? Wat kummt dat denn? Dat lot jüm man ne wies warn, ans kratzt se di woll dien scheune Nees twei.«
»Könnt se all weeten.«
»Kassen, wat hest denn mit jüm hatt? Hest woll freen wullt un hest 'n poar Schoh kreen? Se hebbt doar all van snackt, dat du an't Freen dinkst.«
Kassen wör gnatterig.
»Denn lot jüm man van wat anners snacken,« gnurr he, »ik will ne mihr freen.«
Nu kree Gierd dat Gucheln.
»Härrhärrhärr! Büs woll bi Sill wesen un hest dat Jowurd holn wullt? Dat is nich so leicht.«
Kassen keek sin Makker scharp an, do sä he: »Kanns swiegen, Gierd?«
Gierd nicküpp: »As 'n doode Nebelkreih, dat kann ik di flüstern.«
Kassen snack sinniger.
»Denn will ik di wat seggen, Gierd. De Sill, dat is 'n Hex, 'n Hex up 'n Hauböön, mags dat gleuben oder ne. De is mit 'n Dübel verfreet, un dorüm kann se sich ne verheiraten. Un weeß, keen de Dübel is? Ehr griese Koater: de mok erst 'n poar Oogen as Ewerklüsen.«
»Wat sä Sill denn, as du ehr froogen däst, wat se dien Fro warrn wull?«
»Se sä: ne! Se harr dat so beter un solang se ehrn Koater noch harr, nehm se keen Mann.«
Gierd puß, dat all meist dick van Dook inne Dönß wür. Mit 'n Mol kneep he de Oogen tohoop:
»Mann, Kassen! Nimm ehr den Koater weg! Drull ehr dat Diert! Denn mütt se jo 'n Mann hebben un denn nimmt se di oberlingen.«
»Mi?« Kassen wür noch ungläubig as Thomas. »Denn holt se sich 'n annern Koater.«
»Wat woll! So'n Wief geweuhnt sich ehr an'n Mann, as an'n anner Stück Veehwark. Drull ehr man den Koater.«
»Ik mag't ne dohn, Gierd. Dat Wief kann hexen. Wenn de Katt weg is, kloppt se dreemol up 'n Disch: denn hett se ehr wedder.«
Gierd teuh em an'n Arm.
»Dat ward sich doarbi utwiesen,« sä he plietsch. »Hext Se di den Koater wedder ut't Hus rut, denn is se 'n Hex un du letts ehr loopen. Ans nimmst du ehr to Fro.«
»Ik bün man bang för den Koater, un woneem schall ik doarmit hin?«
»Sett em up din Böön fast, doar grippt he sich woll so veel Müüs, dat he leeben kann. Jeden Dag noch 'n Schöttel Melk – doarmit basta.«
Kassen stöker dat Füer no.
»Wees wat, Gierd? Ik nehm ehr den Koater weg.«
Seit de Tied luer Kassen Witt denn nu Sill ehrn griesen Koater up. Ober so licht as'n Snööf wür de ne to krien, dat harr Kassen bald spitz. Wenn dat düster wür, schul he sich in'n Binnendiek langs un smeet Fisch un Fleesch hin. Swatte und witte Katten keemen bald ankroopen un freeten un gnurrten, ober de griese Koater wür doar ne twüschen. Oder, wenn he mol doartwüschen seet, wür he so wild, dat he sich ne griepen leet. Een Obend ober still Kassen sich achtern groote dicke Esch, un do harr he Glück un kree den Koater in'n Nacken to packen. As he miaun wull, steek he em gau in'n Sack un do in Sprüngen twüschen de Wicheln langs un no Hus hin! De Bööntripp rup, de Dör open gereten, den Sack utschütt, de Dör towarbelt, de Tripp dolsust: dat würn Oogenblick Sook. Kassen frei sich, dat he dat Diert harr, ober bang wür he doch bannig, un as dat boben an to russeln füng un to jauln, puß he bums dat Licht ut, kreup inne Kubutz, scheuf de Bree to un weuhl sich deep inne Küssens rien, dat he nix hürn un sehn kunn. Annern Morgen slirrk he up Strümpfsööcken rup'n Böön, mok de Dör 'n lüttj beetjen open un keek ünner de Pannen langs. Wat verjeuch he sich, de Kater wür narrns to blicken. He kreup wieder inne Dör, to verjeuch he sich wedder; de Koater leeg up 'n ol Goarn un sleep. No dat Verjohn ober frei he sich bannig, hol den Koater 'n Stück Fleesch un 'n Schöttel vull Melk, un as de mit de roote Tung slappen dä, to wüß Kassen, dat dat 'n euliche Katt wür, de nix vanne Hüll afwüß, un dat Sill keen Hexenkrom moken kunn, – un he keem sich bannig kloog vor. As he den Koater wedder bemokt harr, steek he de Hann inne Büxentaschen un slarp gemütlich den Diek lang. Doarbi mok he so'n unschüllig Gesicht, as wenn he keen Swien schreen hürn kunn. Bi Sill ehr Koat bleef he bistohn un keek no't Woater hindool. Un luer up. Richtig duer dat ok ne lang un Sill wör em gewohr.
»Kassen?« ... »Jo!« ... »Kassen?« ... »Jo!« ... »Kassen?« ... »Jo!« ...
Kassen sä jo, ober he keek ne üm.
»Vergeew noch mol to, Kassen! Hür doch mol up! Heß min Koater ne sehn?«
»Soll ich deines Katers Hüter sein?« freug Kassen un keek ehr an, as wenn he ehr dull to wür.
»Ne, eulich! Heß em ne sehn?«
»Kiek ik no Katten? Ik hebb din Koater ne sehn! De sitt woll up 'n Böön!«
»Nee, nee, Kassen. Up 'n Böön is he ne. De is weg.«
Kassen dach: hex em doch wedder her! un meen:
»Dien Koater is di wegloopen?«
»Wegloopen? De löppt ne weg. Drullt is he mi!«
Kassen keek no Hamborg rup:
»Anner Week is de Doom, Sill,« sä he trurig. »Doar ward 'n barg Heiße mokt. Wokeen harr dat dacht!«
Sill leet em ne utsnacken.
»Snack ne so dwatsch,« schüll se, »kumm rin un drink 'n Taß Kaffee mit.«
Dat dä Kassen un höh sich in'n Stillen ober Sill, de noch jümmer söch un reep. Se keek allerwärts to, ober de Koater wür weg un bleef weg. He wull em mit seuken hilpen, sä Kassen toletzt un güng rut – ober de un seuken!
Middogs seh he Sill inne Höf rümstreupen un hür ehr: »Koater! Koater!« roopen.
Annern Dag söch se noch.
»Kassen, wat komm ik ok doch an.«
He nicküpp, ober he sä nix. He leet noch sinnig 'n poar Doog vergohn. To füng he bi lüttjen an mit ehr dorvon to snacken, wie trurig dat för ehr wür, so ganz alleen to husen. Un se kunn doch man 'n anner Katt nehmen.
Sill keek em an, as wenn he 'n Spleen kreen harr. Ober he mok 'n ganz trohartig Gesicht, as wenn he ne bit fief tillen kunn.
Poar Doog loater keem he wedder.
»Sill, wat bün ik ok doch meuh. De ganzen Doog hebb ik nu wedder rümsöcht un rümfroogt. De Koater is un blifft weg. De Lüe lacht een all wat ut. Beduern kinnt dat Hansjochenpack ne.«
Sill schüer sich de Oogen.
»Ik weet, Kassen. Se lacht mi arme Fro all wat ut. Bloß du ne. Du büs 'n vernünftigen Kirl.«
Kassen mark up, ober he sä noch wieder nix. Langsam un wiß, dach he. Morgen för Morgen klau he up 'n Böön rup un geef den Koater wat to freeten, un Morgen för Morgen keek he mol bi Sill rin un beduer ehr.
Up't letzt nehm he 'n Tofoahrt:
»Sill, dat mütt di doch eensom wesen.«
»Kassen, ik bün doar unglücklich ober. Ik mag in min eegen Hus ne mihr wesen.«
»Sill, war ne krank doarbi.«
»Kassen, dat kann kommen.«
Se snack lang so veel ne mihr, so dull nehm se sich de Geschichte to Harten, un wenn se ne noch van ehr Mudder her swatt gohn harr, gleuf ik stiew un fast, harr se nu swatte Kleeder anthon un üm ehrn Koater truert.
Kassen güng Tritt för Tritt un keem jümmer beetjen wieder. Sill leep ne mihr weg, wenn he van Heiraten snack. Toletzt kunn he ehr liekuplos froogen, wat se em staats 'n Koater hebben wull. Se sä ne jo un sä ne nee – den ersten Dag, den tweeten sä se half jo und half nee, denn drütten wör dat »jo« jümmer gröter, dat »nee« jümmer lüttjer – un no'n Week sä se jo, ober se sett doch noch doarbi: »Wenn ik min Koater noch harr, denn harr ik ne mihr freet. Ober nu is't eendohnt.«
Kassen Witt keem sich vör as 'n Keunig. He güng no'n Pastur dol un leet upbeeden un leet sich bi'n Snieder 'n nee Pattje anmeeten.
Doarbi seet de Koater noch jümmer in sin Gefängnis. Kassen dach doar mannichmol ober no. He wüß ne recht, wat he doarmit moken schull. Doodslogen much he em ne. Ganz toletzt säh he sich: wenn de Hochtied wesen is, lot ik em loopen, denn is Sill min Fro un mütt bi mi blieben.
So dach Kassen Witt un wüsch sien Hannen in Elwwoater un meen, sin Streich wür em glückt.
Ober dat keem doch 'n beetjen anners.
Sill kree up'n mol Lust, Kassen sin Gewees, Hus un Hof, to bekieken, mol to sehn, wat se as Fro all ünner de Hannen kree. Kasten dach doar woll an, dat de Koater vullicht jauln kunn un em oahn nix goods, ober nee kunn he doch ne seggen, wenn se ne oahnig warn schull. He wies ehr nu den Diek, den Groaben, den Hof, dat Schuer, den Killer un teuh dat allens gehürig inne Ling. To güng he wieder.
Ober Sill wull dat Hus noch boben sehn. He müß ehr Köök, Dönß, Komer un Krom wiesen, ober he mok dat so gau af, as he kunn.
»So, Sill, dat wür allens,« sä he un mok de Dör open, as wenn he weggohn wull. »Uh, kiek mol den grooten Damper doar in't Foahrwoater!«
»Den Böön hebb ik doch noch ne sehn,« sä do ober Sill un sett den Foot up de erste Tripp.
Kassen still sich an, as wenn he nix hürt harr. He wies wedder no't Foahrtwoater hin.
»Kumm doch mol rut, Sill,« reep he noch harter, »un kiek di bloß mol den grooten Steamkassen an. Wat dat förn Koloß is! Dat is jo woll de Ameriko! Wat förn Diert!«
Ober Sill keem ne.
Se reep wedder:
»Ik will mi erst den Böön besehn. Lot den Damper man susen.«
»Den Böön wies ik di morgen, dat is nu all to düster,« sä he gau un dach: wenn se morgen kummt, sett ik den Koater solang up't Schuer, denn ward se em ne gewoahr.
Se güng ober spöttenup.
De Sook wör mau.
»Doar kanns du ne rup, Sill,« reep Kassen iernst un keem neuger.
»Worüm ne?«
»Diern, dat geiht ne. Jerst mol is dat all to düster, un denn steiht doar allens up 'n Kupp. Doar bricks du Arms un Been.«
»Dat deiht nix. Ik will doar wenigstem mol rupkieken,« sä se.
De Sook wör mau.
»Au ... au ... au ...« jaul Kassen.
Se stünn still.
»Wat heß?« freug se.
»Au ... au ... au ... mi is de Ramm int Been schooten. Ik kann ne mihr stohn. Smeer mi gau 'n beetjen.«
Ober se wür neeschierig worden un wull nu mol den Böön sehn.
»Au ... au ... au ...« jaul Kassen wedder.
Mit 'n Mool füng de Koater up'n Böön an to jaulen.
Sill hür dat gliek un kenn ok de Stimm gliek.
»Dat is min Koater! Verdreihte Kassen Witt! Nu weet ik Bescheed, du heß em drullt! Teuf! Lot mi em erst mol wedder hebben!«
Doarmit se de Bööntripp rup.
Kassen sin Been wür werkwürdig gau wedder heelt, he stünn batz up, as he den Koater miaun hür, neem sin Been inne Hand, leep in Sprüngen den Diek dol, klau gau in'n Kohn un schipper van'n Diek af, bit he in Sicherheit wür.
Mit de Hochtied wör dat nix, dat mark he woll, ober he wull doch wenigstem sien gesunden Oogen un Backen beholen.
Kiek: doar keem Sill ut de Husdör un achter ehr ran de Koater. Kassen kreup meist ünner de Ducht, ober se wör em doch gewoahr. Jüst wull se losleggen, to schufudern, to seh se all de Lüe up'n Diek stohn, de all de Sook markt harrn un lachen. Sill besünn sich: dat harr ok woll noch Tied.
To nehm se ehrn Rocksoom mit de Hand up un teuh den Rock so hoch, dat de bunte Ünnerrock to sehn wür, un güng as 'n Gräfin den Diek langs. Sä keen Goodendag un nix.
Un de Koater mit hoogen Stiert achteran.
Dat heet: twee Doog noher harr Kassen Witt doch een verbunden Gesicht, woneem he 'n poar Weeken mit rümloopen is.
Sien Gild lewt he noch – ober van dat Freen will he nix mihr weeten.
Anhang.
schirrwarken=bewerkstelligen, utklamüstert=ausgetüftelt, leiflich=leicht, troß=stolz, gohtlich=annehmbar, Sill=Cäcilie, Leegste=Schlimmste, oberlingen=vielleicht, eendeel=irgendwas, blangen=neben, Klimmer=Habicht, bannig (unbändig)=sehr, all=schon, oberstür=zurück, rabastern=rasen, bier=tat, Gucheln=Lachen, ans=sonst, drull (v. nord. Troll)=stahl, stiehl, schul=schlich, he vejeuch sich (verjagte sich)=er erschrak, bemookt=eingesperrt, klau=kletterte, Tofoahrt=Anlauf, eendohnt=einerlei, Pattje=Anzug, spöttenup=treppauf, Ramm inne Been=Hexenschuß, schufudern=schelten, enkelte=einzelne, nicküpp=nickte.
Hamburg war Baas.
Es war Baas zu Wasser und zu Lande, weil die Sonne schien und weil Sonntag war; ihm gehörten der grüne Sachsenwald und das rote Helgoland, der weiße Timmendorfer Strand und die blitzenden holsteinischen Seen, ihm eigneten die Deiche von Vierlanden bis zur Lühe, die Elbe von Lauenburg bis zum letzten Feuerschiff, die Berge von Geesthacht bis Schulau, die Heide von Lüneburg bis vor die Tore von Buxtehude. Das alles, mit Wegen und Wogen, Blumen und Häusern, nahm es breit und selbstverständlich in Besitz.
Westlich von den Zeugen der Heiden- und der Seeräuberzeit, dem Opferberg und dem Falkenberg, zog ein hamburgisches Fähnlein tapfer und fröhlich über die neugrünende Heide; oft blieb es stehen und hielt Umschau, es verlängerte und verschönte sich den Weg mit Wald- und Wanderliedern, und tat sich etwas darauf zugute, daß es Lerchen über sich und Grillen unter sich hatte.
Zwei Schwestern waren es, schlanke, blonde Hamburger Deerns, mit hellen Augen und kecken Nasen, ein junger Lehrer mit einem Kopf voller Hochziele und ein kleines Schreiberlein, das aus einem der vielen Schreibstuben ins Freie geflüchtet war. Es schritt an der Spitze der Gruppe, hatte sogar einen Rucksack mit und war wohl guter Dinge. Auf dem Steindamm hatte es sich den Dreien angehängt, weil es das eine Mädchen kannte, und war bei ihnen geblieben, obgleich es schon anfing, seinen Entschluß zu beklagen, denn es war gewohnt, allein zu wohnen und zu wandern, auch wußte es nichts zu erzählen. Es hatte immer große Angst, heimliche Furcht vor dem Leben und vor Menschen, zu denen es nicht gehörte. Die empfand es auch jetzt wieder und um so schwerer, als es sie durch äußerliche Lustigkeit verscheuchen wollte.
Armes Schreiberlein.
Das stille Fischbek mit seinen Eichen und Birken war durchquert, und die kleine Gesellschaft ging auf der großen Landstraße entlang, die von Hamburg nach Stade führt; sie suchten den Moorweg. Dieser fand sich auch bald: aber als sie umbiegen wollten, stand gerade an der Ecke ein Hund, ein schönes, weiß und gelb gezeichnetes, sauberes Tier mit blanken, klugen Augen. Unbeweglich stand es da und sah den Kommenden entgegen, als erwarte es sie. Vor allen wurde das Schreiberlein darauf aufmerksam. Näher gekommen, fing es an, zu locken und zu schmeicheln.
»Non, Pulli! Wat makst du denn dor?«
»O, guckt bloß mal, was für 'n schöner Hund,« rief eins der Mädchen lebhaft.
»Feiner Kerl,« lobte auch der Lehrer.
Der Hund aber sah das Schreiberlein an, dann bellte er freudig und heiß auf und stieß mit den Vorderpfoten heftig in den Heidesand.
»Pulli, sitt dor 'n Rott?« fragte das Schreiberlein, belustigt teilnehmend, aber das andere Mädchen gab ihm einen Rippenstoß.
»Ratte? Er will den Stein wiederholen, Sie. Werfen Sie ihn mal weit weg. Man zu!«
Rasch bückte das Schreiberlein sich. Der Hund wurde toll vor Eifer und wollte zuschnappen, aber die Hand entriß ihm doch den Stein und warf ihn ein Stück den Weg voraus. Bellend stob er nach, daß der Staub aufwirbelte, schoß mit Schnauze und Pfoten tief in den Sand hinein, scharrte heftig den Stein heraus, nahm ihn mit dem Maule auf und sprang eilig und schweifwedelnd mit ihm zurück. Vor dem Schreiberlein blieb er stehen, das ihm den Felsen abnahm und den Kopf streichelte. Es war in Fröhlichkeit gekommen, als es das Tier so fröhlich gehorchen sah: das war ihm noch nicht begegnet und rührte es tief.
Pulli aber wollte von Liebkosungen nichts wissen, er suchte in den Wagenfurchen nach andern Steinen, und als er sie entdeckt hatte, blieb er davor stehen und sprang wie vorher mit den Vorderfüßen darauf los.
»Noch een, Pulli?« fragte das Schreiberlein freundlich, griff schnell zu und warf einen zweiten Stein, der ebenso rasch geholt wurde. Des Hundes Eifer wurde immer größer, je mehr Steine flogen. Die Augen des Schreiberleins strahlten, so große Freude empfand es. Aber auch die andern sahen dem prächtigen Tier gern zu und warfen auch Steine. Alle, wenn sie nicht gar zu groß waren, holte es gehorsamst zurück, aber wenn es sich des Gegenstandes entledigt hatte, sah es doch zuerst nach dem Schreiberlein, stieß mit der Nase an dessen Hand und ermunterte es durch Bellen und Scharren zu neuen Würfen. Diese Bevorzugung behagte dem Schreiberlein über die Maßen, und es wurde nicht müde, mit dem Hunde zu sprechen und ihm das Fell zu glätten, soweit die Ungeduld des Tieres es zuließ, das sich in Kreuz- und Quersprüngen nicht genug tun konnte.
Es trug kein Halsband, so mußte es doch gewiß aus dem Dorfe sein, dachte das Schreiberlein und war betrübt, daß es mit dem Spiel zu Ende ging, denn sie waren mittlerweile schon weit in das Moorgebiet geraten und mußten daran denken, den vierbeinigen Spielvogel nach Haus zu schicken. So flog denn ein Stein weit zurück, begleitet mit dem Rufe: »So, Pulli, den nimm mit, un denn no Hus!«
Wohl sprang der Hund bellend nach, aber er kam getreulich mit dem Stein wieder. Das Schreiberlein klopfte ihm den Hals und nahm ihm den Fund ab, dann wies es mit der Hand zurück: »Goh no Hus, hörst!« Aber Pulli blieb und wedelte.
»Na, denn gah noch 'n Stremel mit,« sagte das Schreiberlein gutmütig und liebevoll, und das alte Spiel fand seine Fortsetzung im Weiterwandern.
»Eigentümlich, was Sie für eine Gewalt über den Hund haben,« sagte der Lehrer.
Das Schreiberlein sagte nichts darauf, aber das Wort erfüllte es doch mit Stolz. Zu dem Hund sagte es: »Lat dat Bellen na, kiek mal hin, wat du di utsehn mokst!« – und wies nach den Beinen und dem Kopf, die arg geschwärzt waren.
»Du mußt doch noch mehr können, als bloß Steine holen,« begann es nach einer Weile wieder und hieß den Hund stehen bleiben. Es prüfte durch, was es von Kunststückchen an andern Hunden gesehen hatte, und bekam heraus, daß Pulli sich totstellen konnte, daß er über den Stock sprang, Pfote gab und auf Geheiß bellte. Nur eins wollte ihm nicht glücken, den wirklichen Namen des Hundes zu erforschen, obgleich es ihm alles Erdenkliche zurief. Weder bei Hektor, Juno, Bruno, noch bei Seemann, Feldmann, Mobbi, Max rührte das Tier sich.
»Denn blift dat bi Pulli!« entschied das Schreiberlein und warf einen Stein. O weh, der plumpste in den sumpfigen Graben. »Hier! Komm hier!« Aber das Rufen half nicht, der Hund stand schon tief in dem moorigen, muddigen Wasser und wühlte es mit dem Maul und den Füßen auf. Naß und beschmutzt, sich schüttelnd, kam er zurück, daß das Schreiberlein traurig wurde, als es das schöne Fell so entstellt sah, aber es vertröstete sich auf den breiten Graben, der kommen mußte. In dem sollte der Hund schwimmen und sich rein spülen, dann mußte er nach Haus geschickt oder gejagt werden.
Der Graben war bald erreicht, und der Zuruf des Schreiberleins ließ den anfangs zögernden Hund in das tiefe Wasser springen. Als er hin und her geschwommen war, rief es ihn zurück.
Er war wirklich reiner geworden, als er sich abgespuddert hatte.
»So, nu sall he no Hus,« sagte das Schreiberlein ernsthaft, trat ihm entgegen, wies mit dem ausgestreckten Arm nach der Geest und befahl: »Pulli, no Hus! No Hus! Hus! Hus!« Aber der Hund ging nicht von der Stelle, er tat, als hätte er nichts gehört: nur daß er von einem Fuß auf den andern trat, mochte kund tun, daß etwas in ihm vorging.
»Kannst du nich hörn?« drohte das Schreiberlein, drängte gegen ihn, schob ihn vorwärts, wies ihm die Fäuste und suchte ihn ernstlich wegzujagen. Auch die andern drei stampften auf und suchten ihn zu scheuchen. »Nach Haus!«
Da schien er zu begreifen, was sie mit ihm vorhatten, und daß es Ernst wurde. Alle Frische und Lebhaftigkeit wich aus seinen Bewegungen, er zwinkerte mit den Augen und schlich unruhig bald vor und bald zurück.
»Man to, man to! No Hus!« Da kam er zu dem Schreiberlein gekrochen und setzte sich vor ihn hin, hob bittend die Vorderpfoten, leckte mit der Zunge und bettelte mit feuchten Augen. Das mochte ein anderer ertragen als das gute Schreiberlein, das tief erschrocken war. »Hast wohl kein Haus?« fragte es bewegt und legte ihm zärtlich die Hand auf den Kopf. »Wenn du bei mir bleiben willst, so tu es. Ich verjage dich nicht.«
Da wedelte der Hund freudig und folgte ihm weiter.
Wieder galt es, Steine zu holen, über den Stock zu springen und hübsch zu machen. Das Schreiberlein schien nur noch für das Tier da zu sein, und das eine Mädchen begann schon, verdrießlich zu werden.
»Wollen Sie ihn mitnehmen?« fragte der Lehrer.
Das Schreiberlein zögerte mit der Antwort. »Ich weiß nicht. Wenn ich wüßte, daß er ausgesetzt wäre und kein Haus hätte, nähme ich ihn mit.« Und es sah nachdenklich aus.
»Wollen Sie ihn denn behalten?« begehrte ein Mädchen zu wissen.
»Ich könnte ihn ja auch nach dem Tierhaus an der Süderstraße bringen,« antwortete das Schreiberlein fast ärgerlich.
»Ach, lassen Sie ihn doch wieder laufen,« sagte das andere Mädchen.
»Geht er denn?« fragte das Schreiberlein. »Er ist ja nicht wegzubringen, nicht mit Gewalt.« Es nahm nochmals einen Anlauf und lief den Hund fast um, aber es hatte wieder keinen Erfolg. Das Tier legte sich erneut aufs Betteln, und das Schreiberlein war nicht der Mann, dem zu widerstehen. Ich kann es nicht, ich bringe es nicht übers Herz, dachte es still und bedrückt, atmete tief auf und streichelte den dankbar winselnden Hund.
Später lief es mit ihm um die Wette und kam den andern dabei ein beträchtliche Stück voraus. Pulli stellte sich an den Grabenrand und schlappte Wasser.
»Büst ok all hungrig?« fragte das Schreiberlein und schnallte den Rucksack ab. Der Hund kam fragend näher und als er Brot und Wurst bekam, fing er es hastig und fraß mit lebhafter Freude. So frühstückten die beiden Wandergenossen am Wegrande, und als die Vorratskammer ausgeräumt war, legte das Schreiberlein sich längelang ins Gras, und der Hund ruhte neben ihm. Die Hand ruhte auf dem Kopf des Tieres. So lagen sie zwischen Löwenzahn und Butterblumen, bis die andern herangekommen waren.
»Ich bin vom Berg der Hirtenknab,« sagte der Lehrer launig.
»Bin ich auch!« gab das Schreiberlein stolz zurück, reckte sich und sprang auf die Füße.
»Soll er denn nun noch weiter mit?« fragte ein Mädchen, als sie wieder eine Strecke gemeinsam zurückgelegt hatten.
Das Schreiberlein guckte wie verloren nach dem dicken, roten Neuenfelder Kirchturm, der inmitten der Dächer stand wie eine Gluckhenne zwischen ihren Küchlein.
»Wir kommen gleich an die Süderelbe,« sagte es, »da soll es sich entscheiden. In das Fährboot kommt er nicht hinein. Schwimmt er uns aber nach, dann soll er mit mir.«
Das war aber nicht seine richtige Meinung. Es war mit dem Hund in Gedanken schon in seiner kleinen Stube angelangt, wie Doktor Faust mit seinem Pudel, und Goethes Worte gingen ihm durch den Sinn.
Wie du draußen auf dem bergigen Wege
durch Rennen und Springen ergötzt uns hast,
so nimm nun auch von mir die Pflege
als ein willkommner, stiller Gast.
Es wußte gewiß, daß der Hund mitlaufen und auch den Weg in das Fährboot finden würde.
Schon blitzte die Süderelbe hell durch das Weidengebüsch. Mit reißender Strömung flutete sie ostwärts. Das Fährboot hielt gerade wartend an dieser Seite, so daß die Gesellschaft nicht zu läuten brauchte.
Zwei Altländer Knechte mit Rädern standen schon im Boot.
Zuerst stiegen der Lehrer und die Mädchen ein, die sorglich ihre Kleider rafften, dann wollte das Schreiberlein folgen, ohne sich nach dem Hund umzusehen, aber dieser sprang behend vor ihm hinein und kroch unter die Duchten.
»Da haben wir es,« bemerkte der Lehrer laut, »was nun?«
»Wollen Sie ihn wirklich mitnehmen?« fragte das ältere Mädchen.
Armes Schreiberlein!
Sechs Menschen guckten es an. Da mußte es wohl fremd und scheu werden. »Ach, laßt es doch, wie es ist,« sagte es ablenkend und setzte sich auf die hinterste Ducht, immerfort nach dem Wasser guckend.
Aber der Fährmann war aufmerksam geworden.
»Hört de Hund ne dorto?« fragte er.
»Nein,« sagte das Mädchen, »er ist uns von der Geest nachgelaufen.«
»Denn schall dat Oos ok ne mit,« entschied der Fährmann. »Rut mit di! Rut!« Er erhob das schwere Ruder und scheuchte den Hund damit ins Wasser, daß das Tier über und über bespritzt wurde und entsetzt zurückwich.
Dann stieß er eilig ab.
Das Schreiberlein schwieg. »Sprich, steh auf, ruf!« schrie es in ihm, aber die alte Lebensangst und Furcht hatte sich riesenhoch in ihm erhoben und preßte ihm die Kehle zu. Wie ein geducktes Vöglein saß es da und sah nach dem Hund.
In dessen Augen lag ein schmerzlicher Ausdruck der Verlassenheit, als er das Boot sich entfernen sah, er winselte und heulte und kroch auf und ab, lief hin und her und guckte verlangend über das Wasser. Ein Altländer rief lockend: »Komm, komm!« Auch in dem Schreiberlein rief es: »Komm, komm!« aber über seine Lippen rang sich kein Laut.
Der Hund watete bis an den Bauch in das Wasser hinein und streckte die Schnauze vor, als wollte er schwimmen.
»De swümmt gliek,« rief ein Knecht.
»Ja, schwimm!« dachte das Schreiberlein und fühlte, daß des Hundes Blick an seinem Gesicht hing, aber es vermochte kein lautes Wort zu finden.
Das Boot kam immer weiter in den Strom hinein.
Der Hund blieb lange Zeit in dem strömenden Wasser stehen, dann watete er langsam nach dem Trockenen zurück. Noch einige Male lief er verlangend auf und ab, stand wieder still und sah dem Boote nach, dann drehte er sich um und lief den Damm hinauf. Oben angekommen, stand er wieder still, sah eine lange Weile zurück, dann lief er fort und verschwand hinter den Weidenbüschen, die den Weg umgaben.
Armes Schreiberlein.
»Tut es Ihnen leid?« fragten die Wandergefährten, als sie am jenseitigen Ufer angekommen waren und nach dem Deiche gingen.
Das Schreiberlein gab keine Antwort, es guckte sich aber immerfort um und sah nach dem anderen Ufer, das still und verlassen dalag, und wartete, daß der Hund wiederkomme. Dann wollte es rufen, so laut es konnte, und er sollte herüberschwimmen. Es konnte nicht begreifen, daß es so gekommen war, und begann den erbärmlichen Verrat zu erkennen, den es sich an seinem treuen Genossen hatte zuschulden kommen lassen.
Der Lehrer gab sich Mühe, ihm einzureden, daß der Hund sein Haus auf der Geest haben müsse, ein ausgesetztes Tier wäre gewiß nicht so reinlich gewesen, daß es sich vermöge seines Geruchssinnes leicht zurückfinden werde, vielleicht schon wieder auf der Geest spiele, aber das Schreiberlein war nicht zu überzeugen. Es guckte nur über das Wasser, schüttelte mit dem Kopf und sagte:
»Das mag Sie rechtfertigen, mich nicht!«
Schwere Dinge warf sein Herz auf. Wie brausendes Wasser gingen ihm die Gedanken durch den Kopf. Es erkannte mit schmerzlicher Gewißheit, daß es einen Schritt getan hatte, der es nach und nach ins Gleiten bringen mußte.
Und der Hund erschien noch immer nicht wieder an der Fähre.
Da, als die Drei schon anfingen, sich heimlich anzustoßen, blieb das Schreiberlein stehen und bot ihnen die Hände zum Abschied.
»Ich kann nicht weitergehen,« sagte es ernst, »ich muß zurückfahren und den Hund suchen. Anders finde ich keine Ruhe.«
»Das ist verrückt!« rief der Lehrer, und sie redeten heftig auf ihn ein, aber sie erreichten nichts, weder vermochten sie ihn mit dem unwegsamen Moor zurückzuhalten, noch mit der nahen Dämmerung zu schrecken.
Er müsse hinüber und sie müßten schon allein nach dem Dampfer gehen. Das war alles, was sie zu hören bekamen.
Kopfschüttelnd mußten sie es schließlich aufgeben und weitergehen.
Über das Schreiberlein aber war mit dem Entschluß eine fiebernde Unruhe gekommen. Es lief mehr, als es ging, nach der Fähre und trieb den Fährmann zur Eile.
»Wedder röber?« fragte dieser.
»Jo, jo!« drängte das Schreiberlein, und wollte schon sagen, daß es seinen Schirm im Altenland vergessen hätte, aber es war etwas in ihm, das gewaltsam hervordrängte. »Ich will den Hund holen,« sagte es festen Tones und empfand dieses Geständnis als etwas Wohltuendes.
Der Fährmann lachte, dann aber sagte er ernst: »De is all lang weg. Ober dor sitt 'n Wulkenbank in 'n Westen, dat kann licht 'n Gewitter geben. Blieft leber hier, ik wohrschoo jo.«
Das hatte das Schreiberlein, das immer nach dem Damm guckte, wohl gar nicht verstanden, denn es gab keine Antwort darauf, sprang aus, noch ehe der Kahn angelegt hatte, und lief in Sprüngen fort, daß der Mann herzlich lachen mußte über den närrischen Kerl.
»Pulli! Pulli!«
Unbekümmert rief das Schreiberlein, einerlei, ob Menschen es hörten oder nicht, spähte nach allen Seiten und schritt erregt weiter, dem Moor entgegen.
Aber kein Hund war zu sehen.
Als es von dem weiten, düstern Moor umfangen war, begann schon die Dämmerung ihre stillen Flügel ausbreiten. Da rief es lauter als zuvor, daß die Regenspatzen in dem Schilf erschrocken das Piepen ließen. Die Dämmerung nahm überhand, da suchte und rief das Schreiberlein noch ängstlicher und strengte seine Augen an, daß es den vorherigen Weg wiederfinde, was bei den vielen Moorwettern, Brücken und Stegen, bei Kreuz- und Querstücken nicht leicht war. Die Weidenbüsche wuchsen wie riesenhafte Tiere aus dem Gras und bekamen drohende Augen.
»Pulli, neem büst du?«
Draußen auf der Elbe war Ebbe eingetreten. Die vermochte aber nicht zu verhindern, daß die Wolkenwand sich höher schob und sich ausbreitete. Einige Sterne waren schon sichtbar: nun schoben sich dunkle Wolkenhände über ihren stillen Schein.
Von den Moorburger Wiesen, den weit entfernten, scholl das ängstliche Brüllen des Viehs. Gespenstisch schnell überzogen die Wolken den Heben. Ferner, grollender Donner quoll langsam auf, als käme er aus dem Wasser. Da fiel auch das erste Licht vom Heben, und ein Windstoß fegte warnend über Baum und Halm.
Armes Schreiberlein – warum stehst du still vor dem breiten Graben; hattest du da einen Steg vermutet? Hast du dich verlaufen, weißt nicht mehr, wo du bist? Und hast den Pulli immer noch nicht gefunden?
Such den Steg, das Gewitter hängt über dir. Die ersten schweren Tropfen fallen wie Blei. Der Wind schwillt an. Den Steg!
Schreiberlein, mit Kriechen kommst du nicht von der Stelle! Da fliegt dein Hut!
Armes Schreiberlein ...
Als der lange Hinnik Quast am andern Morgen seine Moorkartoffeln hacken wollte, hing etwas Braunes unter dem Steg, der über die breite Wettern gelegt ist. Es war ein ertrunkener Mensch, der fehlgetreten sein mußte.
Armes Schreiberlein ...
Unten am Deich beim tiefen Sielgraben stehen kleine Jungen und fischen nach Stichlingen, den Sperlingen im Reiche der Schuppen. Oft müssen sie die runden braunen Netze auswerfen, weit hinaus bis an die Jollen, die da ihren Winterschlaf halten, bis sie einige von den spaddelnden, stacheligen Gesellen fangen. Das ficht sie nicht an. Sie fischen nicht um vergängliche Erdengüter, sondern rein des Vergnügens wegen. Sie werden gar nicht gewahr, daß das Wasser eiskalt ist und daß sie mit den Stiefeln tief im Schlick waten, ebensowenig wie es sie stört, daß es zu Hause für die Kleigräberei und Sabbatschändung vielleicht etwas auf die Jacke, sicherlich aber eine gehörige Tracht Schelte geben wird – sie fischen und fischen und sind gesund und munter dabei.
Jung-Finkenwärder, Fischereigesellschaft mit blauen Hosen.
Dazu weißbunte Hemden. Die runde, graue Fischermütze steht ihnen wie ein Glorienschein um die hellblonden Köpfe. Nur die blaugefrorenen Gesichter und die lauten Reden stellen sich der Heiligkeit entgegen, beim einen mehr, beim andern minder.
Ein grauer, stiller Wintertag will in Dunst und Nebel gehen, wie er gekommen ist. Trübe ist der Himmel, mit farblosen Schatten behangen, und die weite, breite Elbe liegt bleiern und matt da. Auch Blankenese schaut düster und mürrisch drein, als könne es gar nicht blinken und lachen. Einsam kriecht ein Stader Dampfer stromab. Der weiße Rauch verliert sich in dem grauen Einerlei. Ein Tag ohne Sonne. Dem haftet etwas Verlorenes an und etwas Verstimmtes. Wie Schlaf und Tod liegt es auf der Welt, die auf einmal alt geworden zu sein scheint! Und ein Grauen des Vergessens steht in den kahlen Ästen.
An solchen Tagen bringt es mich zu dem alten Harm Holst, der sein kleines Haus am Deich warm und heimlich hält und weder den Ofen, noch die Pfeife ausgehen läßt, auch nicht einmal selbst ausgeht.
Erst macht der struppige Hund wedelnd und niesend seinen Diener, und dann gibt Harm mir nickend und lachend die Hand.
Dann sitzen wir am Fenster.
Nach den Jungen gucken wir, die immer noch fischen und kurren.
Leise nickt er mit dem Kopf: »Da hab ich auch mal gestanden und Stichlinge gefangen.«
»Auch ich,« sage ich langsam, und wie ich so sinne, meine ich, der kleinste aus der Schar zu sein, der am eifrigsten auswirft und am wenigsten fängt.
Dann wird es wieder still.
In der Ecke steht breit und behaglich der hohe Kachelofen, wie eine Bauernfrau, die in ihrer weißen Schürze dasteht und lacht ... leise ... aber doch so, daß es zu hören ist ... Oder sind es die rotbackigen Äpfel, die in der Röhre piepen? Oder ist es der Tee, der in seiner bunten Kanne sein mildes, feines Lied singt? Oben über dem Alkoven aber hängt eine weise, weise Frau aus dem Schwarzwalde, mit rundem, braunem Gesicht und gelben Ketten und Gewichten, und sagt vernehmlich vor sich hin: »Ick weet allns! Ick weet allns!« Plattdeutsch hat sie gut gelernt, aber es langt nur zu den drei Worten: auf eine längere Unterhaltung läßt sie sich nicht ein. Wer alles weiß, der braucht freilich auch nicht mehr viel zu reden.
Harm sagt in die Stille hinein:
»In Hamburg, Gorch, da ist alle Tage Sonntag. Wir haben bloß alle sieben einen.«
Ich nickte bloß. Fast habe ich vergessen, daß es laute Straßen gibt mit grellen Läden und sausenden Bahnen und einem dichten Gewühl elender und glücklicher Menschen.
»Ick weet allns! Ick weet allns!« meinte wieder die Großmutter, und wir hören ihr zu. Sanft und freundlich spricht sie uns die Sekunden ab, und wir lassen sie gewähren.
Bis ich sage: »Nun könnt Ihr den Ofen bald kalt werden lassen.«
»Junge, wo denkst du hin? Wir haben ja noch den Februar vor uns. Und der Februar, der ist ein strenger Mond. Was der einmal zum Januar gesagt hat? Wenn ich soviel Kraft hätte wie du: auf der einen Seite im Topf sollte das Wasser frieren und auf der andern Seite kochen.«
»Ick weet allns! Ick weet allns!« sagte die Stimme aus Baden.
»Da stehen sechs Fische im Kalender, Gorch. Das kann mir nicht gefallen. Die sehen wir bald auf der Elbe.«
»Auf der Elbe?«
»Ja, Gorch. Die Seen kriegen weiße Köpfe. Sturm gibt es ... Der Sommer ist noch weit weg, Junge. Erst muß die Natur sich noch brechen. Und das tut sie nur im Sturm, Gorch. Erst muß sie ein paar Ewer und Kutter kriegen, dann gibt sie uns Schollen und Zungen.«
Ich guckte ihn schweigend an.
»Das ist gewiß so, Gorch. Sieh mal: Bauern kriegt sie nicht. Was tut der Bauer, Gorch? Die Scheune warbelt er zu und die Fenster setzt er mit Luken zu, dann läßt er den Wind suchen und schnauben. Der wird vergrillt und nimmt ein paar Fischerleute beim Flunk. Von denen sind ja genug da!«
»Schwarze Kleider aber noch nicht,« setzte ich düster hinzu.
»Ick weet allns! Ick weet allns!«
»Da war auf dem Kreinhof mal ein großer Bauer, Gorch. Im Frühjahr, wenn es ans Pflügen gehen sollte, fragte er einfach: Wieviel Fischer sind geblieben? Erst wenn es drei waren, holte er den Pflug aus der Scheune. Er wußte, was er tat, Gorch! Waren noch keine Fischer geblieben, so waren auch die Stürme noch nicht dagewesen – und die Stürme gingen mit der Elbe über seinen niedrigen Deich und spülten die Furchen glatt, wenn er vorher gepflügt hatte.«
Die Dämmerung ging säend über das Land und streute tausend dunkle Körner über Weg und Wasser. Die Jungen packten die Netze zusammen, nahmen die Eimer in die Hand und gingen fort, der dampfenden Pfanne und dem rauchenden Stock entgegen.
An der andern Seite, zu Nienstedten und Blankenese, stecken sie die Lichter an, eins nach dem andern. Immer stiller wird es.
Wir bleiben noch in der Schummerei sitzen und haben die Augen auf dem Wasser, über das der Schein der Lampen zittert. Und weil es so geruhig ist und so sinnig und die Formen weicher und unbestimmter werden, weil die Dinge größer und geheimnisvoller erscheinen, erzähle auch ich eine Geschichte, die ich gelesen, von Kai Jans, dem Matrosen, dem Gottsucher, der um die ganze Welt segelte und Hilligenlei suchen wollte und nur von ferne einen großen, guten Menschen stehen sah.
»Hast du dir die Geschichte ausgedacht, Gorch?«
»Nein, ein Dichter, Harm, einer, der früher Pastor gewesen ist, bei Büsum da.«
»Den möcht ich mal sehen, Gorch. Der macht aus Jesus einen Menschen. Das ist gut, Junge. Aber dann mußte er auch aus dem Menschen einen Jesus machen, Gorch. Warum hat er das nicht getan?«
»Ick weet allns! Ick weet allns!« sagte wieder die Muhme von oben.
Und nun die Lampe brennt, wird es noch stiller in dem Stübchen, und wir sagen gar nichts mehr.
Die Kugelbake vor Cuxhaven ist die große Nebelfrau der Elbmündung. Wer sie einmal bei Daak und Dunst über die Watten starren gesehen hat, weiß das. Vor ihr stand bei Nebel und trüber Luft eine Fischersfrau von Döse, ein armes, irres Weib, das ihren verschollenen Mann auf der See suchte; jahrelang hat sie dort gestanden, alle alten Schiffer haben sie gesehen, – bis die riesige Bake sie ablöste.
An dem Balkengestell dieser Bake zog ich die Schuhe aus, streifte die Strümpfe ab, nahm auch meine Mütze in die Hand und watete barhäuptig und barfüßig, von der Sonne erwärmt und von dem salzigen Wasser gekühlt, über das weite Watt dem stillen Duhnen entgegen.
Die auf der Reede von Cuxhaven – twüschen de Baaken, wie die Schiffer sagen – liegenden drei großen, dicken Barken kamen aus Sicht, dafür aber stieg der graue Normannsturm von Neuwerk höher aus den Watten, die beiden binnensten Feuerschiffe der Elbe leuchteten herüber, und vor und hinter ihnen wurde es nicht leer von Schiffen. Krabbenjollen und Fischerewer segelten ein, Tjalken und Gaffelschuner kreuzten seewärts, tiefgehende, schwarze Kohlendampfer zogen zu zweien und dreien ostwärts, Holzdampfer mit gelbleuchtender Decksladung pflügten gen Westen. Sogar hinter der Kimmung, ganz im Norden, hatte der Handel noch schwache Rauchwolken auf der See. Lloydkähne, braunrot, mit großen gelben Nummern an den Seiten, an langen Trossen hinter ihrem zierlichen Schlepper, klüsten von der Weser herüber. In der Weite standen die dunkelbraunen Segel eines Störfischers regungslos auf dem weißen Wasser, und dahinter tauchten wie Maulwurfshügel die Bäume von Büsum-Hilligenlei auf. Seenot und Seeluft erfüllten mein Herz, als ich vor meinen Füßen nach fliehenden, spinneflinken Krabben und auf der See nach Schiffen suchte. Dann dachte ich an die beiden Türme von Altenbruch, die wir vorher passiert hatten, und an das Schifferwort: »Wenn de beiden Turns upenanner stoht, denn hett de Froo dat Seggen an Burd« – also daß die Frau so gut wie gar keine Zeit an Bord zu sagen hat, – an den kleinen, zwergenhaften Mann dachte ich, der mir gegenüber gesessen hatte, mit dünnen Mädchenfingern und einem alten Gesicht, aber mit großen, unschuldigen, neugierigen Kinderaugen, die guckten, als sähen sie zum ersten Male ein Schiff, die von den großen Leuten ängstlich abirrten und sich vertrauend den Kindern zuwandten, – und an das schöne, braune Mädchen dachte ich, mit dem viel zu großen Hut, das von einem Kranze junger Herren und Damen mit heftigen Vorwürfen überschüttet wurde, weil sie sich zu lange im Tanzkreis aufgehalten und mit anderen Herren schön getan haben sollte. Erst verteidigte sie sich klug und gewandt: ein Mädchen dürfe nichts tun, das ihm nicht verdacht werde, hörte ich als heimlicher Lauscher heraus; dann, als die Meute nicht nachgab, schwieg sie, und ihre blaugrauen Augen sahen in die Weite, während ihre Lippen zuckten. Nachher kam sie an die Reihe beim Rundgesang: sie richtete sich auf, warf den Kopf zurück und sang keck, trotzig und übermütig aus dem Rigoletto: »... Ach, wie so trügerisch sind Weiberherzen ...« Je mehr sie sang, desto lauter und bitterer wurden die Worte »... alles ist Lüge ...« da überwältigte sie das Gefühl, und sie barg aufschluchzend ihr Gesicht und ihre Tränen in ihr Tuch ... Die Gesellschaft wurde stumm und verlegen und schämte sich ihrer fast.
Als ich unter solchen Gedanken eine Stunde der Gilde der Wattenläufer angehört hatte, verspürte ich Hunger, und weil ich einiges Eßbares mitgenommen hatte, suchte ich mir am Dünenrande einen sonnigen Fleck aus und legte mich auf den weißen, reinen Sand nieder, kurz vor den ersten Zelten und Körben von Duhnen.
Zum Zeichen meiner Rast aber steckte ich den langen Erlenstock, den ich unterwegs aufgefischt hatte, fest in den Sand und knotete mein Taschentuch daran, das nun flatternd im Winde wehte. Das war gut so, denn wer weiß, ob Hans Otto sich sonst nach mir umgesehen hätte, oder ob er von so viel Zutrauen erfaßt worden wäre.
Ich saß noch nicht recht, da rief es von weitem:
»Ist das deine Fahne? Ist das deine Fahne?«
Und als ich mich umwandte, kam ein sonnenbraunes Kerlchen von vielleicht drei Jahren, nur mit einer Hemdhose bekleidet, in Eile herangestäubt und rief immerfort:
»Ist das deine Fahne? Ja?«
Das war Hans Otto.
Ich mußte seine Frage bejahen. Er winkte, stellte sich neben mich und begutachtete nun die Fahne nach Farbe und Größe, er prüfte, ob der Flaggenstock fest genug stand, ob die Knoten ihrer Bestimmung Genüge leisten konnten, und ob der Wind von der rechten Seite kam. Nach einem Rundgang um den Flaggenhügel wandte er sich wieder mir zu:
»Hast du die Fahne selbst gemacht?«
»Wenn es nicht unbescheiden klingt, mein Junge, ja.«
»Du kannst fix was!« lobte er.
Ich wehrte ab: »Nur mit Einschränkungen, mein Junge, in andern Dingen bin ich ein großer Stümper.«
»Nun weht sie ja nicht mehr,« klagte er dann.
»Man hat es oft am Mittag, daß der Wind mit einem Male einschläft,« sagte ich auskunftgebend. »Die Schiffer draußen auf See wecken ihn dann schnell wieder auf.«
»Wie machen sie das?« begehrte er zu wissen.
»Sehr einfach. Sie kratzen am Mast. Tu du es auch. Ich will dir aber gleich sagen, daß es ein toller Aberglaube ist.«
Und der kleine Kerl bearbeitete den Stock mit den Nägeln so eifrig, daß ich für die Fahne fürchtete, und rief aus Leibeskräften:
»Wind! Wind!«
Zufälligerweise frischte der Wind in diesem Augenblick wesentlich auf, und der Kleine freute sich königlich über die Zauberei.
Seine junge Mutter, die drüben in der Sonne lag, rief ihn: »Hans Otto, komm! Komm hierher!« Aber er verwies ihr solche Störung ernstlich mit der keinen Widerspruch duldenden Antwort: »Du, ich hab' jetzt kein' Zeit!« Diese Sentenz wiederholte er mehrfach, so daß ich darin eins seiner geflügelten Worte anzusprechen geneigt bin.
Als er indessen hinsah, wurde er gewahr, daß seine Mutter ihm auch eine Fahne gemacht hatte: er lief hin und brachte sie schnell in unser Lager, wo wir sie neben meiner aufpflanzten. Wir stellten fest, daß jede ihre besonderen Vorzüge hatte: meine war bunt, seine weiß, meine klein, aber sie wehte hoch, seine groß, aber sie wehte niedrig.
Danach besann Hans Otto sich auf sein Spiel, das er beiseite geworfen hatte, als er meine Flagge flattern sah, und er unterwies mich in seinem ebenso umfangreichen, wie verzwickten Straßenbahnbetrieb, den er ohne Schienen und Drähte nur mittels eines deichsellosen Groschenwagens und mit Hilfe seiner Hände und einer Anzahl Steine und Korkstücke auf dem Strand von Duhnen unterhielt. Ich arbeitete mich allmählich ein und lernte auch die Haltestellen von Hans Ottos Lingelingbahn kennen und – was schon schwieriger war – unterscheiden, die wohl auch die Haltestellen seiner kleinen Lebensreise waren: Sternschanze, Hauptbahnhof, Wilhelmsburg, Altona, Kiel und Blankenese. Die ganze Bahn war eigentlich nur eine Familiengründung, denn Hans Otto beförderte ausschließlich Onkel und Tanten. Und sonderbare Onkel und Tanten waren darunter. Tante Emma zum Beispiel (ein großes Korkstück) war sehr dick und ging nicht gern, weshalb wir sie immer bis zur Endstation mitnehmen mußten. »Onkel Hermann müssen wir stets einen Fensterplatz einräumen, weil er zu gern ausgucken mag.« Tante Wilhelmine war schwerhörig und kurzsichtig – die arme Frau! – und wir mußten ihr deshalb den Namen von jeder Haltestelle ganz laut ins Ohr trompeten. Onkel Fritz war dreist und ging immer mit der brennenden Zigarre in den Wagen, weshalb wir ihn jedesmal auffordern mußten, die Zigarre wegzuwerfen oder nach draußen zu gehen. Weiß Gott, es gab mancherlei zu bedenken und zu beachten!
Als wir unseren Betrieb stillegten, um zu frühstücken, setzte Hans Otto sich neben mich und half mir wacker bei der Mettwurst, mehr noch beim Kuchen und am allermeisten bei den Bananen. Der geneigte Leser mag daraus ersehen, daß Hans Otto ein Leckermaul ist; fragte er aber weiter nach ihm, so bliebe ich stumm, denn ich weiß Hans Ottos Zunamen nicht, auch weiß ich nicht, wo er wohnt. Wir haben einander nicht nach dem Namen gefragt: ich mochte es schon deswegen nicht tun, weil ich als Arbeiter bei der Straßenbahn doch gewissermaßen sein Untergebener war.
Die Einwände seiner kopfschüttelnden Mutter gegen unsere gemeinsame Tafel wehrte ich lachend ab und er mit seiner bekannten und beliebten Redensart: »Du, ich hab' kein' Zeit!«
Nach dem Essen erbot ich mich, dreister geworden, ihm ein Blankenese zu bauen, wenn er mir dabei an die Hand gehen wolle. Er sagte es zu, und wir gingen an den Bau wie die Fronarbeiter an die Pyramiden. Armer, kleiner Hans Otto. Du hattest nicht einmal eine Schaufel und nanntest auch keinen Eimer dein eigen, aber ist es nicht dennoch gut gegangen?
Haben wir nicht unermüdlich mit Händen und Füßen gebaut und gegraben und ausgeschachtet? Haben wir nicht ein breites tiefes Bett für die Elbe zurechtgemacht und auf ihr Nordufer einen hohen, gewaltigen Berg getürmt, das getreue Abbild des Süllbergs, fast so groß wie du, Hans Otto? Hätte da einer kommen und zweifelnd fragen können: Soll das etwa Helgoland sein? Gewiß nicht, was?
Und als der Berg hoch und breit genug war, haben wir die Abhänge platt und glatt geklopft, ich mit meinen großen Händen und du mit deinen kleinen.
Haben wir dann nicht aus roten Steinen einen Turm auf den Gipfel gebaut, hatte der Turm nicht eine richtige Flaggenstange und wehte von ihrem Topp nicht ein Tanghälmchen als Wimpel? Hast du nicht hundert rote, weiße und blaue Häuser herangeschleppt, Steine und Muscheln, und habe ich sie nicht nach einem großartigen Bebauungsplan über den Abhang verteilt? Entdeckten wir nicht in den Dünen eine Art von Immergrün, vortrefflich geeignet für die Bepflanzung unseres Berges mit Baum und Strauch?
Und als alles fertig war und wir etwas zurücktraten, um es besser überschauen zu können, hat es da nicht überaus prächtig und lustig ausgesehen, unser buntes großes Blankenese? Sind nicht die Leute bewundernd stehen geblieben und hat dein kleines Ohr auch nur eine ungünstige Kritik gehört? Von deiner eigenen Freude will ich ja noch gar nicht mal so viel Aufhebens machen, denn du warst als Teilhaber und Miterbauer vielleicht nicht ganz objektiv; aber sind nicht sogar die drei Marineartilleristen, die großen braunen Gestalten, stehen geblieben, die doch gewiß schon an Brockeswalde und an die Mädchen dachten; haben sie nicht Lobesworte gefunden und nicht gleich auf Blankenese geraten?
Wir können auf alle diese Fragen getrost und freudig Ja antworten, Hans Otto, und wir werden der Wahrheit am nächsten sein. – Wie lange wir noch dagestanden und uns unseres Werkes gefreut haben ... ich weiß es nicht, wie ich auch nicht weiß, ob die großen Baggerungen in der Elbe, die wir noch unternahmen, wirklich notwendig waren oder ob sie hätten gespart werden können.
Auch das weiß ich nicht, warum ich dann mit einem Male aufstand und weiterging, Duhnen zu, denn es lag mir im Grunde nichts mehr an Duhnen ...
Du hast mich nicht festgehalten, Hans Otto, als ich dir zum ersten und letzten Male die Hand gab. Nur gesorgt hast du dich, ob ich morgen wiederkäme, und ich habe es bejaht. Ich sehe noch dein betroffenes Gesicht, als ich wegging. Es war, als könntest du nicht glauben, daß ich von dir ginge. Ratlos standest du neben dem großen Süllberg und sahst mir nach. Und wie lange hast du mir nachgesehen!
Als ich im Abenddunkel mit der »Cobra« zurückfuhr und nach den Feuern und Lichtern der dunklen Elbe guckte, da habe ich an dich gedacht, Hans Otto, und es ist mir sogar aufs Herz gefallen, daß ich dich belog, als ich dir sagte, daß ich am anderen Tage wiederkommen wolle. Wie wirst du nach der Kugelbake blicken, daß ich kommen soll, dein Blankenese von neuem aufzubauen, das die übermütigen Mädchen in der Nacht, als die Matrosen sie zu greifen versuchten, zertreten haben ...
... und nun sitze ich in deinem Hamburg, Hans Otto, zwischen scharrenden Federn und klappernden Schreibmaschinen und blicke in Bücher und auf Papiere, rechne mit Dollaren und Peseten und kann es doch nicht verhindern, daß ich geheimerweise auf einen Rechenzettel schreibe: Hans Otto.
Das soll ein Gruß für dich sein!
Der kleine, dicke Bäckergeselle, den die Sonne von 1525 besonders freundlich beschien, als er breitbeinig auf der Kaje saß und mit Steinen nach den Stichlingen warf, die um die Bollwerkspfähle schwärmten, dachte nicht an seine Stutenmacherei, sondern an Venedig und Grönland, an Apfelsinen und Eisbären. Er erschrack sehr, als ihm mit einemmal ein schweres Tau auf den Buckel sauste, und glaubte in die Hände von Seeräubern zu fallen: da erblickte er zu seiner Beruhigung aber nur einen Norderneyer Schellfischangler, der mit seiner grünen Schaluppe heranglitt, und ihm zurief, in jenem selbstverständlichen Ton, den unsre Schiffer noch heute führen: »Hak mal öber!«
Der Gesell tat es, rächte sich aber doch für die Apfelsinen und Eisbären und fuhr den Eilandsmann giftig an: »Wat wullt du Spöcker hier up'n Namiddag? Morgens köpt wi Schellfisch: nu is de Brück leddig!« – »Mien gode Jung, ick heff ok keen Fisch,« sagte der Schiffer gemütlich, »ik heff moi Tiding for den ehrbaren Rat. Moi Tiding! Ik will mi blos'n beeten afdweilen, denn seil ik up't Rathus.«
»O vertell, Schipper! Wat de Borgermester eten kann, dat smeckt ok wol 'n lütten Bäckergesellen,« bat darauf der Gesell und er gab nicht nach, versprach zu schweigen wie eine tote Krähe, und bettelte solange, bis der Fischer sich herbeiließ, ihm zu erzählen, daß er Nachricht von den Schiffen hätte, die seit Pfingsten die Seeräuber jagten. Die See wäre rein gefegt: die Gallion, der flegende Geest, der Bartum und die Jacht seien im Sturm genommen, Klaus Rode sei von den ergrimmten Bootsleuten in Grapenbratenstücke gehauen, dazu zweihundert Mann erschlagen: der Rest von einhundertsechzig Mann aber und der Hauptmann Klaus Kniphof seien von Ditmer Koel gefangen genommen. Diese Seeschlacht sei in der Osterems geschehen und hätte acht Stunden gedauert. Das Geschwader liege windeshalber achter den Greeten: die erste gute Luft könne es aber schon nach der Elbe wehen ...
Hier sprang der Gesell auf, schüttelte sich und rief: »Un wenn de Dübel mi halt, dit kann ik nich verswiegen. Back mi tein Pickplasters up'n Mund, un dat mutt doch rut!« Und ohne auf den fluchenden Norderneyer zu achten, sprang er an Land und rannte stadtein. Die Hände an den Mund gelegt, gröhlte er laut und durchdringend: »Tiding von uns' Schepen, gode Tiding! Ditmer Koel, unse Admiral, hefft Klaus Kniphof mit alle Schepen und alle Mann gefangen genommen!« So schrie er ins Millerntor hinein und ließ nicht nach, und bald hatte er einen Haufen von Kindern und Burschen um sich, die seinen Ruf aufnahmen und ihn gewaltig verstärkten. Nicht lange dauerte es: da hatte man sogar schon eine Weise für die Zeitung erfunden, die also lautete:
»Gode Tiding von uns' Schepen!
Ditmer Koel hefft Kniphof grepen!
Söben Schep un hunnert Mann,
öbermorgen kommt se an.«
Wie eine Windflage, die Staub und Blätter aufwirbelt, so drängte es durch die engen Straßen, und die Rotte vergrößerte sich von Ecke zu Ecke. Hamburg, das schon mondelang auf eine Kunde geharrt hatte, horchte auf, lachte und freute sich des Sieges. Da wurden Fenster aufgestoßen, da wurde gefragt und getan, da traten die Handwerker aus den Türen zu nachbarlichen Gesprächen. Einige steckten die alten Schiffsflaggen heraus, andere ließen einen Krug Braunbiers aus dem Keller holen und machten sich einen lustigen Tag aus der Begebenheit.
Die brausende Woge brandete auch an das Fachwerkhaus, das sich an der Nigentwiete in beschaulicher Stille sonnte und dem Schiffer und Admiral Ditmer Koel gehörte. Die Großmutter des Hauses saß feiernd am halbgeöffneten Fenster und horchte auf die Stille, die hinter all den feinen Geräuschen des Tages ruhte. Neben ihr lehnte Ditmer Koels Tochter, die schöne Gesa, ein blühendes, taufrisches Mädchen von achtzehn Jahren, am Fensterpfosten und spielte nachlässig mit den zwei kleinen grauweißen Katzen, die auf dem Brett übereinander kugelten ...
»... Ditmer Koel hefft Kniphof grepen ...« Das Siegeslied brach um die Ecke und erfüllte die Twiete. – »Grotmoder, hört ji? hört, hört! Se singt von Vader! He kummt wedder!« rief das Mädchen vor Freude erglühend, warf die Kätzchen ritsch – ratsch auf den Fußboden, stieß das Fenster vollends auf und beugte sich hinaus, um zu sehen und zu hören, was da nahte. »O, wat frei ik mi, Grotmoder!«
Grad unter dem Fenster machte der kleine Bäckergesell halt, der schon vor Heiserkeit kaum noch sprechen konnte. »Leewe Gemeende,« krächzte er roten Kopfes, »mal 'n Spier Gehühr!« Und als der Lärm sich etwas verminderte, denn alle warteten, daß nun etwas abfallen sollte: da berichtete er den Frauen weit ausholend und mit umständlichen Gebärden alles, was er wußte und was sich so up'n Stutz schicklicherweise hinzulügen ließ. Zum Schluß nahm er seine Mütze ab und hielt sie treuherzig-verlangend auf. »De Kehl is all bannig drög, aber wat deiht'n Hamborger Jung nich all for unsen Admiral Ditmer Koel.«
Die Greisin schüttelte halb belustigt, halb geärgert den Kopf.
»Wat hett se seggt?« – »Se seggt, Water smeckt söt!« – »O Mann, wat is de Olsch nährig!« »Free Licht bi Dagen un wieder nix!«
Aber Ditmer Koels Tochter sprang leichtfüßig ins Zimmer zurück und durchsuchte Schrank und Schublade, bis sie eine Hand voll Münzen gefunden hatte, die sie dem Gesellen laut klirrend in den Hut warf.
»Ho – nu drinkt Warmbeer un lat Ditmer Koel hoch leben!« rief sie in fröhlicher Unbefangenheit den Weiterdrängenden nach.
Dann fiel sie der Ahne um den Hals: »Grotmoder, lat mi doch nich alleen lachen: Freit jo doch mit! Vader kummt ja doch!« Die Alte strich ihr das blonde Haar aus der Stirn. »Büst so wild, Deern, so wild!« – »As du fröher west büst, nich, Grotmoder?« fragte das Mädchen schalkhaft und erhielt es lächelnd bestätigt. »Ja, Kind, as ick west bün.«
Und dann horchten sie auf den schon halb verschollenen Lärm, dem sich noch die Rufe mühsam entrangen:
»Ditmer Koel schall leben: een, twee, dree ...«
Ditmer Koel sollte leben: er lebte – und es kamen der Tag und die Flut, die ihn mit der hamburgischen Kriegsflotte, den Kraffeln (Caravellen) und Bojers, bei raumem Wind die Elbe heraufbrachte. Mit den erbeuteten Koggen war das Geschwader zehn Schiffe stark und nahm den ganzen Strom ein. Von allen Toppen flatterten die Wimpel. Am Hafen war kein Platz unbestanden: es wimmelte am ganzen Ufer von Menschen, die den Seeräuber und seine Maaten sehen wollten. Der Katarinenglöckner läutete die Glocken.
Der Admiral Ditmer Koel, mit dem bloßen Schwert gegürtet, trug in der Rechten trotzig die zerschossene Flagge des Seeräubers. Er war immer ein hoher, aufrechter Mann gewesen: aber nie ist er größer und gewaltiger erschienen als an diesem Tage, auch dann nicht, als er Ratmann und Bürgermeister geworden war. Sein Gesicht war erregt; nur als er seine Tochter erblickte, die in einem Kränzlein ihrer Altersgenossinnen stand, lief ein freudiges Lächeln über seine Züge. Neben ihm gingen die Schiffer Simon Parseyal, Klaus Hasse und Dietrich von Minden und wechselten hier und da einige Worte mit den ihnen bekannten Bürgern.
Pfeifen- und Trommelklang nahte. Fünf Fähnlein folgten, und hinter ihnen schritt, geleitet von zwei Edelleuten, der Seeräuber Klaus Kniphof, der Hauptmann. Der jugendliche, vierundzwanzigjährige Kopenhagener sah blaß aus, doch war nichts Unmännliches in seinem Gesicht. Er war barhäuptig und trug ein weiches Hemd, dessen Ärmel von Kugeln durchlöchert waren, ein zugeschnittene Wams und blaue Hosen. Hinter ihm gingen die hamburgischen Hauptleute, die Kriegsknechte und das Schiffsvolk, in ihrer Mitte die Menge der einhundertzweiundsechzig Seeräuber, gefesselt und gekettet.
Als Klaus Kniphof die Gruppe der schönen Mädchen gewahrte, sah er mit großen hungrigen Augen hin. Er war von Jugend auf Seemann gewesen und hatte nach den Hoffrauen Karstens von Dänemark und Margaretens von Burgund nur braune, friesische Muschelsucherinnen gesehen: da war ihm der Anblick dieser weißen, glänzenden Jugend wie ein Blick in die Sonne. Ditmer Koels Tochter erschauerte bis ins Herz vor seinen Augen, und ihr verging Lachen und Neugierde zugleich. Die Trommeln wirbelten dumpf: der Zug ging weiter. Die Mädchen wurden von Mitleid ergriffen und erzählten von dem Jüngling, der dem flüchtigen Dänenkönig sein Reich hatte zurückerobern wollen und dabei ein Seeräuber geworden war. Ditmer Koels Tochter stand wie im Traum und sagte kein Wort. Sie sah nur dem Hauptmann mit dunklen Augen nach, und er erwuchs ihr zum treuesten Helden, zum Hagen, der für seinen König in Not und Tod gegangen war. Es war mehr als Mitleid, was sie erfüllte, und in ihrer Mädchenseele regte sich unbewußt ein namenloses Geschöpf, das Weib. Da haßte sie beinahe ihren Vater, dessen gewaltiges Haupt alles Volk überragte. Dann wieder sah sie unverwandt nach dem blonden Scheitel des Dänenhauptmannes.
Ihre Freundinnen hatten genug zu gucken und achteten nicht sonderlich auf sie: aber einem Mannesblick blieb nicht verborgen, was in ihr vorging. In der hintern Reihe, nicht weit von ihr, hatte schon lange ein bleicher, junger Mönch gestanden und sich schier nicht satt sehen können an ihrem lieblichen Gesicht und ihrer schlanken Gestalt. Stefan Kempe war es, der »Ketzermönch« aus dem Magdalenenkloster, einer von den Lutherischen. Seit drei Jahren schon hing seine Feuerseele dem Wittenberger Doktor an, und er predigte laut und unerschrocken das lautere Gotteswort, dem Volk zu freudigem Aufhorchen, den Papisten zu großem Ärgernis. Viel verklagt und verdächtigt, geschmäht und gescholten, blieb er unverzagt bei der neuen Lehre und vertraute seinem Gott. Im Anschauen des reinen Mädchens stieg wie ein Stern am Himmel in seiner Seele der Gedanke an einen lieben Kameraden in ihm auf und bekränzte sein Herz mit roten Rosen: er dachte daran, alle Fesseln zu sprengen, das dunkle Gewand abzulegen und sein Leben zu krönen, wie Luther es getan hatte, als er die Nonne freite.
Da aber sah er, wie Ditmer Koels Tochter nach dem Seeräuber sah, und er fühlte, wie seine Augen schmerzten. Leise wandte er sich ab und ging davon.
Die Arbeitsleute aber spotteten der Seeräuber, und derbe holländische und dänische Flüche schollen hinwider.
Der Admiral wurde seiner Tochter fremder in jenen Tagen, als er sich der Freude über seine Seefahrt überließ und versicherte, daß Klaus Kniphof als ein Seeräuber dem Scharfrichter verfallen sei. Sie kam nicht, um Abenteuer zu erfahren, und sprach weniger als sonst. Er jedoch machte sich wenig Sorge darum, er dachte an nichts als an seine Sache. Kniphofs Fähnlein hänge im Dom unter der Kanzel, verkündigte er eines Tages. Da ging Gesa hinaus, ohne ein Wort zu sagen, und weinte sich auf ihrer Kammer aus. Und als er ein andermal wieder von der Ems erzählte, wie er seinen Leuten zuvor ein kräftig Süpplein zu kosten gegeben hätte, Warmbier mit Büchsenkraut (Schießpulver), das sie teufelswild gemacht hätte, da kam ein Grauen über sein Kind, das es nicht abschütteln konnte. Über ihre Träume aber schaltete der junge, blonde Hauptmann, der auf dem obersten Boden des Winserturmes saß und durch die Eisenstangen auf Fleete und Schuten starrte.
Kniphof hatte um einen rechtskundigen Mann gebeten, dem er seine Sache betrauen wolle: der Rat hielt es aber für geratener, ihm einen Beichtvater zu bestellen. Das war der Ketzer Stefan Kempe, der nun jeden Tag die Hühnerstiege hinankletterte und dem Gefangenen Trost zuzusprechen suchte. Kniphof jedoch hatte noch Segel und Wind. Er berief sich auf den Kaperbrief der Burgunderin und auf seines Königs Bestallung. Als kriegsführende Macht habe er den Gebrechen der Vitalie steuern können, ohne darum ein Seeräuber zu werden. Margarete von Burgund, seines Königs Schwägerin, Karls des Fünften Tochter, werde ihn schützen. Der Rat schickte nach Brüssel und ließ hansisch-stolz fragen: wat se mit den steden to donde hadde? – worauf Margarete den Brief verleugnete und den Seeräuber fallen ließ. Kniphof aber wollte es nicht glauben.
Ditmer Koels Tochter ging hellhörig um ihren Vater herum, bis sie wußte, daß Kniphof noch eine Mutter hatte, die bei Kopenhagen lebte. Da packte sie sich heimlich hinter Schiffer und Kaufleute, die die Ostsee befuhren, schrieb der Greisin, gab ihr von allem Kunde und bat sie dringend, nach Hamburg zu kommen. Die alte Frau kam auch zu Schiff herüber, und Gesa Koel nahm sich ihrer liebevoll und zärtlich an, brachte sie im Kloster unter und stand ihr bei, daß sie vom Rat die Gnade erwirkte, ihren Sohn wiederzusehen.
Es kamen aber zwei Frauen und begehrten Einlaß, und die zweite nannte sich die Schwester von Kniphof. Der Turmhauptmann kratzte sich am Kopf und machte Einwendungen, denn der Ratsbrief ging nur auf die Mutter, aber weil die Schwester ein schönes Weib war, erhoffte er sich einige Gunst und ließ sie mit hinein.
Klaus Kniphof war im Gespräch mit seinem Beichtvater. Als er seine Mutter erblickte, wurde er bleich, er wollte aufstehen und ihr entgegengehen, aber kraftlos brach er zusammen und barg laut schluchzend sein Haupt in ihrem Schoß. Erschüttert stand Gesa Koel dabei.
Nach einer Weile sah Kniphof auf und wurde ruhiger. Stefan Kempe, dessen dunkle Augen um das Mädchen brannten, das er wohl erkannte, schickte sich an hinauszugehen, aber Kniphof bat ihn, zu verweilen. Dann erst sah der Seeräuber das Mädchen und erkannte sie wieder vom Millerntor her und wußte, daß sie aus edlem Geschlecht sein mußte. Er gab ihr die Hand und dankte ihr, daß sie sich seiner guten Mutter angenommen hätte. Gesa aber wies ihn an Stefan Kempe, der der alten Frau das Kloster erschlossen hatte und für sie sorgte. Kniphof schöpfte neue Hoffnung, und er begann zu erzählen. Sein ganzes Leben und seine wilde Meerfahrt breitete er vor den Frauen aus, und Stefan Kempe lehnte düster am Fensterkreuz und kam sich armselig vor. Die Höfe von Kopenhagen, London und Brüssel wurden bedacht: Kniphof redete sich in Jugendlust hinein und berichtete von der holländischen Zeit: wie sie bei Amsterdam die vier großen, schwerbestückten Schiffe ausgerüstet hätten, wie er seine dreihundert Leute angeworben hätte, und wie er dann mit bunten, geschwellten Segeln unter dem Donner der Kanonen in See gestochen sei, Norwegen zu zwingen und Dänemark zurückzuerobern. Dann kamen die Seeschlachten bei Bergen und vor Kopenhagen, der gewaltige Nordsturm bei Skagen. Haushohe Wogen und ein unerschrockenes Herz! Die Lust an der Meerfahrt leuchtete in Kniphofs Zügen auf: Gesa Koel aber sah Stefan Kempe an, als wenn sie vergleichen wollte, und dieser wußte den Blick recht zu deuten.
Kniphof kam auf die Seeräuberzeit. Sein Freibrief müsse ihn schützen, er sei kein Seeräuber. Es könne nicht sein, daß Margarete ihn den Städten überließe: der Bote sei wohl von Oranien abgefertigt worden. Es müsse noch einmal geschickt werden.
Die Glocke erscholl und verkündete, daß die Besuchszeit zu Ende sei. Kniphof verabschiedete gefaßt seine Mutter, die zu weinen begann, und gab dem Mädchen die Hand zum Lebewohl.
Unten am Turm aber standen sich Gesa Koel und Stefan Kempe Aug in Aug gegenüber. Das Mädchen sah ihm offen ins Gesicht, und dann kam es über sie, daß sie ihm vertrauen könne wie einem Bruder, und sie streckte ihm die Hand hin. Da sagte sie ihm, daß sie mit der Frau nach Brüssel reisen und sich der Statthalterin zu Füßen werfen wolle für Kniphof, damit er gerettet werde. Er versuchte nicht sie umzustimmen, denn er fühlte, daß sie diesen Gang tun mußte, aber er bat sie, ein Nonnenkleid anzulegen, das ihre Schönheit der Landstraße verhülle: er werde es ihr bringen. Die Fahrt werde den Seeräuber nicht retten, denn Margarete könne es nicht mit Hamburg verderben: aber um den Frieden ihrer Seele solle sie reisen. Sie schüttelte dazu den Kopf. Dann bat sie ihn, Kniphof noch nichts zu sagen.
Einen Tag danach verließen eine alte Frau und eine verschleierte Nonne in aller Stille die Stadt. Stefan Kempe stand am Klostertor und sah ihnen lange nach. Wunderliche Gedanken wehten über sein Herz, und sein Gewissen schlug, weil er nicht wußte, ob er recht getan hatte. Er lag vor seinem Gott auf den untersten Stufen und sollte Raubmörder und Seeräuber trösten und dem Volk einen neuen, freudigen Glauben predigen! Und sein Kamerad zog für einen anderen davon ...
Den Morgen dann, als die Greisin reise- und lebensmüde vor der hohen Frau Margarete zu Boden sank, daß Graf Egmont sie aufrichten mußte, als Ditmer Koels Tochter kühn und dringend für Klaus Kniphof sprach und die Herzogin an Brief und Wort mahnte, ohne mehr erreichen zu können als ein rasches Wort Egmonts, einen ausweichenden Spruch Margaretens und eine abweisende Entscheidung des düsteren Oranien – da läutete das Armsünderglöcklein von St. Katrinen zu Hamburg und die Winser Wache brachte Klaus Kniphof nach dem Brook. Stefan Kempe ging an seiner Seite: Der Seeräuber war gefaßt. Er hatte das bunte Leben und die weite See fahren lassen und sich in Gott ergeben. In dieser letzten Stunde sagte ihm Stefan Kempe, daß die beiden Frauen nach Brüssel gereist seien. Kniphof schüttelte den Kopf – er glaubte nicht mehr an die Burgunderin, aber es war ihm doch ein Trost, daß seine Mutter ihn nicht diesen Weg gehen sah. Dann fragte er nach seinen Leuten. Und schließlich wollte er den Namen des schönen Mädchens wissen. Da sagte ihm der Mönch, daß sie des Mannes Tochter sei, der in der ersten Reihe säße und am ernstesten drein schaue. Und Kniphof sah auf und erkannte seinen gewaltigen Widersacher Ditmer Koel.
Danach aber mußte er im Angesicht der blauen Elbe den Nacken beugen.
Grauer nordischer Nebel lag auf der Stadt. Stefan Kempe, der Mönch, stand auf offenem Markt und predigte das lautere Wort der Bibel. Schiffer und Handwerker, Bürger und Freunde umdrängten ihn, denn er war des Wortes mächtig und sprach freundlich und gewaltig zugleich. Noch hätte er keine Kirche, sagte er, noch müsse er in Wind und Wetter reden, aber das Licht, das zu Wittenberg angesteckt sei, könne kein Wind und kein Wetter mehr verlöschen, und er werde nicht ruhen, bis es in allen Kirchen Hamburgs brenne. Es geriet aber ein Haufe von Papisten hinzu, die ihn mit Geschrei und Gegenrede zu stören versuchten und ihn überteufeln wollten. Er wurde Ketzer und Volksaufwiegler gescholten. Man werde ihn beim Rat verklagen. Der Mönch wich nicht: immer gewaltiger erhob er seine Stimme, und immer mehr Volk strömte ihm zu.
Da geschah es, daß ein Ratmann zu ihm trat und ihm sagte, er sei ein alter Schiffer und verstünde sich auf Wolken und Wind: es würde gleich regnen, darum wäre es besser, wenn er auf die Katrinenkanzel stiege. Stefan Kempe lächelte und begab sich mutig mit seinem Volk in die Kirche. Die Papisten aber liefen ob des neuen Greuels wutschnaubend nach dem Rathaus und erhoben ein wildes Geschrei über den Ketzer.
Als der Mönch dann in der Dämmerung seinem Kloster zuschritt, folgte ihm eine Nonne, die mit in der Kirche gewesen war. Und als er sich umwandte nach diesem Schatten, da erkannte er Ditmer Koels Tochter. Sie sagte ihm von Burgund, und daß sie Klaus Kniphofs Mutter zu Osnabrück begraben hätte: die Kunde von der Hinrichtung hätte sie getötet. Sie wolle nun in ein Kloster gehen und still leben.
Da aber regte sich in Stefan Kempes Seele ein mächtiger Wind, der nicht vom Himmel kam, sondern von der Erde. Und er sprach zu ihr wie zu einem guten Kameraden: daß er die Kutte ausziehen und ein neuer Mensch werden wolle. Ob sie gewillt, ihr Leben im Kloster zu vertrauern, oder ob sie ihm helfen wolle, wie Katerine von Bora dem Luther.
Ditmer Koels Tochter gab keine Antwort, aber sie hatte doch schon den Mut, den Abend noch an Stefan Kempes Seite zu ihrem Vater zu gehen.
Auf meiner dritten Reise.
Acht Tage waren wir schon mit unserm Ewer draußen, aber wir hatten noch nicht ein einziges Mal die Kurre aussetzen und noch keinen einzigen Streek tun können. Drei Tage hatte es für toll gebriest, nun war es zu still zum Fischen.
Das heißt, nur die Luft lag still, die See war noch in hoher Dünung und warf unser Fahrzeug wie einen kleinen Kahn hin und her. Und das Donnern und Klappern der Segel, das Quieken und Knarren der Gaffeln, das Klirren und Hämmern der Schoten hörte sich unheimlich genug an.
Wir drei Fahrensleute waren just mit dem Abendbrot fertig und standen an Deck. Und wie Kolumbus einst nach Indien suchte, so guckten wir jetzt nach Wind aus.
»Vunobend kummt ok noch keen Käulns,« verkündete der Knecht, und der Schiffer ließ sich vernehmen: »Ick gläuf, dat ward dick van Dook,« und deutete nach Süden, wo eine blaue Wolkenwand auf dem Meere stand. Dann sagte er, daß er die Wache nehmen wollte, – und er hatte es noch nicht ganz gesagt, da war von unserm Knecht auch schon nichts mehr zu hören und zu sehen. Ich blieb oben, fühlte mich noch nicht müde, war bange – um es ehrlich zu sagen – bange vor dem »Dook«. Vor Wind und Regen fürchtete ich mich nicht, aber Nebel hatte ich noch nicht mitgemacht. Der schlich und kroch, tückisch und trugvoll.
»To! Man rup'n Bitt,« mahnte der Schiffer rauh.
»Schall ick ne leber up Deck blieben?« fragte ich und sah an ihm vorbei.
»Worüm?«
»Jä, wenn 't dick van Dook ward,« sagte ich.
Nun lachte er.
»Pannkoken, ick hebb doch ok noch Ogen.«
Der Spott tröstete mich, und ich kletterte langsam hinunter, maß meine Koje aus und stellte wieder einmal fest, daß die Diagonale die längste Linie war. Nur daß das diesmal meine schweren Gedanken nicht verscheuchen konnte. Das dunkle Angstgefühl wollte nicht gehen. Und immer wieder überkam es mich, als stünde mir ein Unglück bevor. Obgleich ich in voller Kleidung war und die Decke bis an den Hals gezogen hatte, fror mich, und ich vermochte lange Zeit nicht einzuschlafen.
Da – – – ich weiß nicht, hatte ich schon geschlafen oder wachte ich noch halb, ertönte ganz nahe der schrille Ton eines Dampfers. Wie ein menschlicher Angstruf klang er. In demselben Augenblicke ein Krachen und Donnern und Brechen, als ginge die Welt unter. Zugleich fühlte ich einen furchtbaren Druck. Meine Beine – saßen sie fest? In jähem Schreck schnellte ich auf ... da neigt sich der Ewer zur Seite ... und ich stürze kopfüber aus der Koje auf die Kajütenbohlen. Stöhnend will ich mich wieder aufrichten, da fliegt der Knecht aus dem gegenüberliegenden Hock und fällt mir auf den Rücken, daß ich abermals zusammenbreche ... Herr Gott, wo waren wir? ... Ich wollte schreien und konnte nicht ... nur ein banges Stöhnen brachte ich heraus. Ich wollte aufstehen und konnte nicht ... wie Blei waren meine Glieder. Endlich sah ich, wie der Knecht sich aufraffte und nach oben hastete. Das gab mir soviel Kraft, daß ich ihm nachkriechen konnte. Da stand ich nun an Deck und erbebte.
Stickendüster war die Nacht, meilenweit schienen unsere Lichter entfernt zu sein, so dunkel glommen sie. Wildes, verworrene Rufen und Schreien. Da – – – eben hinter dem Großmast saß das Ungeheuer, ein schwarzer, steil aufsteigender Dampfersteven. Bis zur Mitte des Ewers war er hereingebrochen und schob ihn immer noch vor sich her, so daß er sich gurgelnd seitwärts senkte.
»Stopp doch! Stopp doch!« hörte ich meinen Schiffer wie wahnsinnig rufen, immer wieder rufen. In schrecklicher Angst versuchte ich, an der glatten Bordwand des Dampfers hinaufzuklettern, aber vergeblich, immer wieder rutschte ich hinunter.
Mit einem Mal ging der Dampfer rückwärts und machte sich langsam von unserm Fahrzeug frei. Ich hatte eben einige Platten erklommen, nun mußte ich zurück und fiel schwer auf den Setzbord nieder.
»Wi sinkt jo! Wi sinkt!« ächzte ich.
»Hol dien Flapp!« gröhlte der Schiffer mich an. »Klau inne Boot, dat wi weg kommt.«
Das half. Hastig kletterte ich zu ihnen in das Boot und eilends machten wir uns daran, alles überflüssige Gerümpel über Bord zu werfen. Immer mehr sank der Ewer weg ... das Wasser spülte über das Deck ... unser Boot wurde flott. Wir griffen nach den Riemen, um aus dem Bereich der drohenden Segel zu kommen, die uns erdrücken wollten. Unser großes, stolzes Schiff gurgelte tiefer und tiefer ...
Kamen wir denn nicht von der Stelle? ... Ein Ruck im Steven ... warum bloß? ... Die Bootsleine! Die ...
Der Schiffer hatte mich am Tage vorher geneckt und gemeint, ich könne noch nicht einmal einen richtigen Fischerknoten machen. Das ihm zu beweisen, hatte ich die Leine an den Mast befestigt, und er war mit meiner Sache zufrieden gewesen. Und nun – saßen wir fest, fest an dem untergehenden Ewer.
»Een Messer, een Biel, een Messer!« so pochten wir gegeneinander auf und wühlten in den Taschen und rissen die Lohnen aus und tasteten unter den Duchten, aber kein Messer, kein Beil gab sich an. Unter uns ein Kochen und Gurgeln und Brodeln, die letzten Lebenszeichen unseres armen Ewers. Und nun kamen wir an die Reihe. Wir drängten wild nach hinten, als unser Steven sich immer weiter duckte. Dann strömte die See schäumend um unsere Füße ... das Boot tauchte unter und mit ihm ging der Knecht zugrunde. Sein Fuß mußte sich irgendwie festgeklemmt haben.
»Greut Finkwarder,« flüsterte er, dann stiegen Luftblasen auf.
»Helpt uns!« rief ich, und »Helpt uns!« antwortete der Schiffer, der dicht bei mir trieb. Wer sollte uns helfen? Allein mit der Nacht und der See und den aufschießenden Blasen.
Schwimmen hatte ich schon von jeher gut können, und so hielt ich mich auch jetzt oben. Ja, ich wurde ruhiger und dachte nach, während ich mich mit der Dünung abmühte. Ich hatte geglaubt, das Leben finge erst an – und nun war es zu Ende. Nun sah ich den grünen Deich und unser kleines, weißes Elternhaus niemals wieder. Und die Sonne schien niemals mehr. Und Mutter guckte sich umsonst die Augen nach mir aus.
Meine Kräfte ließen nach, auch fing mein Bein wieder an zu schmerzen. Lange konnte ich es nicht mehr machen, das fühlte ich. Da kam mir der Gedanke, umzubiegen und zurückzuschwimmen. Vielleicht, daß ich ein Stück vom Ewer antraf. Bald stieß ich mit der Schulter an einen harten Gegenstand. Es war unser Kurrbaum. Ich langte nach ihm. Nun war ich fürs erste geborgen, aber noch lange nicht gerettet, denn wie oft ich auch versuchte, mich quer über ihn zu legen, es gelang mir nicht – jedesmal rollte er herum und ich glitt wieder ab und mußte wieder und wieder Salzwasser schlucken. Todesmatt gab ich endlich das Ringen auf und ließ den Baum los, um weiter zu suchen. Von meinem Schiffer hörte und vernahm ich nichts mehr, auch dann nicht, als ich nach ihm rief: die schweren Seestiefel hatten wohl schon das Nötige getan. Die See wurde nun auch noch gröber. Alle Augenblicke lief mir eine Woge über den Kopf – und doch war ich immer noch bei klarem Bewußtsein. Wieder blinkte die Elbe, wieder grüßte unser Haus, wieder stand Mutter vor der Tür, wieder lachten und schwatzten die Mädchen auf dem Deiche ...
Nun ruderte ich kaum noch mit den Armen. Dann schlug mir die See über dem Kopfe zusammen ... ich sank. Tiefer und tiefer. Und konnte doch noch denken. War erstaunt, daß ich noch nicht ertrunken war, und wunderte mich, daß ich den Grund noch nicht erreicht hatte, sagte mir dann aber auch wieder, daß wir dwars vom Weserfeuerschiff in 22 Faden waren.
Und 22 Faden ... nun war ich unten. Weicher Schlick. Bis über die Enkel sank ich ein, dann blieb ich schräg im Wasser stehen und wurde leise hin- und hergespült. Nun ging es auch mit meinen Gedanken durcheinander, und ich wußte nichts mehr zu denken und zu erkennen.
War ich mit dem Kopfe an einen Stein gestoßen oder war mir etwas Hartes auf den Schädel gefallen, ich wußte es nicht, aber ich fühlte, wie mir ein Tau über das Gesicht scheuerte. War das nicht ein Lot, ein Senkblei? Ja es mußte ein Lot sein! Mit allerletzter Kraft griff ich danach, mit beiden Händen, und hielt es fest.
Im Schweiße gebadet lag ich in meiner Koje und starrte auf das vermeintliche Senkblei in meinen Händen. Es war – einer meiner sonntäglichen Schnürschuhe, der mich dadurch, daß er zur rechten Zeit vom Bord auf meinen Kopf fiel, zwar nicht vom Ertrinken, aber doch von meinem bösen Traum errettete. Denn: ich hatte geträumt. Ich lebte, lebte, so gut, wie nur ein Fischermann leben kann, saß hoch und trocken in meinem Bett, während mein Gegenüber derart schnarchte, daß er das Knarren der Gaffeln übertönte.
Noch nicht eins mit mir kletterte ich an Deck.
Schön und sternenklar war die Nacht.
Der Schiffer ging summend auf und ab. Als er mich erblickte, wunderte er sich und fragte:
»Na, wat is er los?«
»Is dat ne dick van Dook worden?« fragte ich, um etwas zu sagen.
»Ne, mien Jung,« lachte er, »büs woll wedder bang?«
»Ne, bang bün ick ne,« gab ich langsam zurück und verschwand wieder in der Koje.
Langsam ging der Schiffszimmerbaas Jan Siebert an einem Sonntagnachmittag den grünen Elbdeich entlang und guckte mehr nach dem Wasser als nach den Häusern.
Einige von den Booten fielen besonders durch ihre feine Bauart auf. Kein Wunder – Jan Siebert hatte sie gezimmert.
Einige von den Jollen segelten verteufelt fix durch die Binsen. Kein Wunder – Jan Siebert hatte sie gebaut.
Einige von den großen Kuttern leuchteten wie Königsschiffe über das Wasser. Kein Wunder – Jan Siebert hatte sie zusammengeklopft.
So grüßten ihn auf Schritt und Tritt seine Schiffe und machten ihm das Herz warm.
Als er bei Gesine Külpers Strohdach angelangt war, sah er ihren ältesten Sohn im Gras sitzen und einen Aalkorb ausbessern.
»Kumm mol rup, Hinnik,« rief er, und der Junge lief in Sprüngen.
»Gu'n Dag, Jan-Unkel.«
»Segg mol, Junge ... Du kummst nu Ostern ut de Schol ... Wat wullt du denn beschicken?«
Hinrich guckte nach der Elbe.
»Ick will giern up'n groten Kutter.«
»No See, Junge?«
»Jo.«
Der Baas sah ihn lange und prüfend an.
»Dien Vadder is bleben, Hinnik.«
»Großvadder is ok bleben – un Vadder is dorüm doch wedder no See gohn,« antwortete der Junge.
»Is din Mudder dormit inverstohn?«
Der Junge stockte.
»Ick weet 't ne. Ick hebb' er noch ni van seggt,« gab er dann zögernd zu.
Der Baas nickte vor sich hin. – »Is good,« sagte er mehr zu sich als zu dem Jungen und klinkte die Tür auf.
Hinnik aber steckte beide Hände tief in die Hosentaschen und schwankte nach Seefahrerart von einer Seite nach der andern wie ein rollendes Schiff, als er den Deich hinunterstieg, denn er fühlte sich schon als Fischerjunge.
Die schmale, schwarzgekleidete Frau erschrak heftig, und ihr Gesicht wurde noch bleicher.
»Hett he dat seggt?« fragte sie schon zum dritten Mal. »He will no See?«
Jan Siebert nickte ernst.
Sie faltete die mageren Hände.
»He schall ne up 't Woter. Jan Siebert, dat kann gewiß ne gohn. Segg doch sülbst, kann he no See? Sien Vadder is verdrunken, un he will ok no buten? Nee, nee – ick kann keen wedder no See seiln sehn. Ick hol 't ne ut.«
Er schwieg.
»He mütt an Land blieben, Jan Siebert,« fuhr sie erregter fort. »Lot em Buer warn oder Schoster oder Snieder, – ganz egol – ober no See schall he ne. Du büs Vörmund: segg em dat.«
Der Baas war sich einig geworden.
»Denn is 't dat beste, wenn ick em up de Warf nehm un wi em Timmermann warn lot. Denn süht he doch wenigstens Scheep un Woter.«
Sie atmete erleichtert auf.
»Jo, Jan Siebert, nimm em hin.«
»De dree Johr verdeent he ober nix,« sagte der Baas, aber sie schüttelte nur den Kopf.
»Dat deit nix. Min lütj Tügloden smitt woll so veel af, dat wie Brot hebbt.«
Er war aufgestanden.
»Schall ick 't em seggen?«
Sie bot ihm die Hand zum Abschied.
»Jo, segg du 't man. Ick kann 't ne.«
»Hinnik!«
»Wat schall ick?«
»No See kannst du ne kommen. Dat geiht ne. Din Mudder will 't ok ne hebben. Du kummst Ostern no mi un lierst de Timmeree. Dor hest ok jo fix Lust to, ne?«
Der arme Junge stand regungslos da und konnte nicht Ja und nicht Nein sagen. Ihm war, als habe man ihm das Herz in der Brust umgedreht und ihm die Fenster, in die die liebe Sonne schien, mit großen grauen Säcken verhängt.
»Hest du 't hürt, Junge?« fragte der Baas, als er noch immer keine Antwort bekam.
»Jo,« sagte Hinnik da heiser und guckte traurig vor sich hin.
Erst als der Baas fortgegangen war, rührte er sich wieder und sah finster und feindlich nach der Elbe. Die war zwischen ihn und die See getreten. Sie war nun nicht mehr der blaue, blinkende Weg zu der bewegten, unendlichen See: – ein häßlicher, breiter Graben, der ihm alles versperrte. Es war auch ganz gleich, ob er mit dem Aalkorb noch wieder nach dem Priel hinabwatete oder ob er ihn im Gras liegen ließ.
Mit zusammengezogenen Brauen und fest aufeinander gepreßten Lippen kletterte er müde den Binnendeich hinunter, wo er die Elbe nicht sehen konnte, und warf sich ins Gras. Ihm war zum Weinen zumute.
Aus dem Fenster aber folgten ihm zwei todestraurige Augen, und eine bekümmerte Mutter legte die Hände für ihr Kind zusammen.
Seit dem Tage war Hinnik anders. Mit keinem Wort war das Geschehene erwähnt worden – seine Mutter vermied es ängstlich, davon anzufangen – aber es stand etwas zwischen ihnen, das nicht vergehen und nicht verwehen wollte. Hinnik war scheu und zurückhaltend und wich ihren Blicken aus. Strich sie ihm mit der Hand über die Stirn, so trat ein gequälter Ausdruck in sein Gesicht. Sie hatten ihm die große, schöne Lampe weggeholt und dafür ein armseliges Talglicht auf den Tisch gestellt und glaubten, er merke keinen Unterschied: – das konnte er nicht verwinden.
Es war noch nicht viel besser geworden, als er schon auf der Werft stand und mit Hobel und der Axt umzugehen lernte. Wohl begriff er alles leicht und war anstellig und willig, aber in seinem Gesicht war deutlich zu lesen, daß die Arbeit ihn nicht freute, und daß er nicht mit dem Herzen dabei war.
Jan Siebert war aber dennoch guten Mutes und meinte zu Gesine, daß gut Ding seine Weile haben wolle.
Wer weiß – – –
Vielleicht wäre Hinnik doch ein Zimmermann geworden.
Wenn nicht die Elbe so nahe gewesen wäre!
Wenn nicht so viele Ewer und Kutter vorbeigesegelt wären!
Wenn nicht die alten Fahrensleute immer von draußen erzählt hätten!
Und wenn Rudolf Holst an dem Tage in Hamburg einen Koch gekriegt hätte, wäre es vielleicht auch noch anders gekommen. Er kriegte aber keinen und schimpfte im Vorbeigehen, daß er nun liegen bleiben müsse und doch so gern mit der Nachttide hinuntergesegelt wäre.
Da konnte Hinnik nicht anders: er lief ihm nach und ließ sich als Junge annehmen.
Abends erzählte ein aufgekommener Lüttfischer, daß er ihn auf dem Kutter gesehen habe.
»Mi hett dat ahnt,« sagte Jan Siebert zu Gesine, die trostloß dasaß.
»Den leet de See keen Ruh.«
Sie weinte nur noch mehr.
»He will verdrinken als sin Vadder.«
Er schüttelte verweisend den Kopf.
»So nich, min Diern. Nu he mol so wiet is un de See sehn hett, holt wi em ne mihr an Land. Lot em Fischer warn. Von tein bliff doch jümmer bloß een, un he hürt to de negen annern, de wedderkommt.«
Der böse Ostwind hatte den Kutter schon zweimal nach der Weser gejagt, – nun brachte eine gängige Brise aus Westen ihn mit vollem Zeug die Elbe herauf.
Gesine bekam gleich Order von Jan Siebert, daß er aufgekommen sei, – und wartete am andern Tage auf ihren Jungen. Er mußte doch kommen?
Hinnik kam.
Erst zu Jan Siebert.
»Ick hebb di ok 'n poor Fisch mitbröcht,« sagte er und ließ eine Stiege Schollen aus dem Taschentuch springen.
»Weest, wat du verdeent hest,« grollte der Baas und sah ihn schief an. Heimlich freute er sich aber über den wetterbraunen jungen Kerl.
Der sagte keck: »Nee,« sprang aber zur Vorsicht rasch auf den Deich, denn er war nicht sicher, ob nicht doch ein Stück Holz geflogen kam.
»Büs ok seekrank wesen?« scholl es ihm freundlicher nach.
Er lachte.
»Keen Gedanke!«
Seine Mutter saß am Tisch und stützte den Kopf in die Hände.
Er warf zwei Goldstücke hin.
»Mien Verdeenst, Mudder,« sagte er stolz. Dann knüpfte er das Tuch auf und breitete seine Schätze aus: springlebendige Schollen, rote Muscheln, Seeäpfel und Seesterne und eine Handvoll Bernstein.
»Ick kann di seggen, up Bremerhoben is't fein, Mudder. – Den Kaiser hebbt wi ok dropen, Mudder. He güng mit sien witte Jacht no Wilhelmshoben. – Un up Nordernee sünd wi ok an Land wesen. Wi legen dor twee Dog för Wind.«
Er erzählte munter darauf los, ohne sich stören zu lassen. Schließlich guckte er sie aber doch an – und da sah er, daß ihr die Tränen in den Augen standen.
»Wees man still, Mudder. Dat is nu mol so komen. Ick bün Fischer, lot mi man Fischer blieben.«
Sie war aufgestanden.
»In Gotts Nomen, Hinnik!«
Drei Skalden waren mit ihren Drachenschiffen angekommen, hoch aus dem Norden, von Drontheims Fjorden. Ihre Harfen klangen in der Königshalle.
Aber es erging ihnen wunderlich.
Der erste wollte von der blauen See singen und sagen: aber als er Schön-Helgas blaue Augen sah, die so viel blauer waren, vergaß er der See und sang von ihren Augen.
Der zweite wollte von der goldenen Sonne singen und sagen: aber als er Schön-Helgas helles Haar sah, das so viel heller leuchtete, vergaß er der Sonne und sang von ihrem Haar.
Der dritte wollte von den weißen Möwen singen und sagen: aber als er Schön-Helgas weiße Hände sah, die so viel weißer waren, vergaß er der Möwen und sang von ihren Händen.
Als die Töne verklungen waren, ward es still ringsum, wie im tiefen Wald um Mittag.
Da legte die Königin die Hände auf den jungen Scheitel und fragte leise und versonnen:
»Dein Haar ist weich und lockig. Ist es blond und ist dein Auge blau?«
»Ja, Ahne.«
»Blond und blau ... so war auch ich ... als ich die Sonne noch sehen konnte.«
»Du siehst sie wieder und strahlender als je.«
»Das ist mein Glaube.«
Da reichte die blinde, gute Frau den Sängern die Hände und dankte ihnen.
Und vom Strand herauf drang das Lachen der spielenden Wellen.
Blauer Heben und blaue See, so weit das Auge trug. Mitten darin sonnte sich der riesige, hohe Felsen mit dem grünen Scheitel und dem weißen Fuß.
Kein Schiff und kein Segel, kein Mast und keine Ra gaben sich an.
Eine kleine Kühlung aus Osten kräuselte das Wasser und ließ den Sonnenschein in tausend blitzende Sternlein zerrinnen.
Die greise Königin saß gen Westen gewendet, wie sie immer zu tun pflegte.
Schön-Helga stand neben ihr und ließ sich das Haar vom Winde kämmen.
Auf der Bank saß Herr Dietrich von Juist und schlief. Frühmorgens war er mit seinen Schaluppen herübergekreuzt, um Schön-Helga zu freien. Aber ehe er in das rechte Fahrwasser kam, waren das gute Essen und der gute Wein ihm vor den Bug gekommen und hatten ihn über Stag gehen lassen. Nun war er eingeschlafen.
»Ahne, schläfst du?«
Sie schüttelte leis den Kopf.
»Ich träume, Kind. Es tut mir wohl, wenn die Sonnenstrahlen mir das Gesicht wärmen. Ein Gruß von dort ist es, eine milde Mahnung: Komm bald. Sonnenbeschienen: so will ich einst hinüberschlummern in das Sonnenland.«
»Du bist so gut und heilig, daß ich zu dir beten könnte.«
»Du bist mein Auge, Kind. Mein sonnenfreudiges Auge. Was sieht mein Auge?«
»Die helle Sonne auf dem grünen Gras und den Wind, der durch die Halme geht.«
»Das sieht es und die blaue See, die weißen Möwen, die helle Sonne. – Die ganze Welt ist voller Licht und Freude.«
»Das ist sie, Ahne.«
»Blinken und schimmern unsere geschnäbelten Schiffe groß und frei auf dem Wasser?«
»Die sind nicht da. Klaas fischt damit.«
»Mit meinen leuchtenden Königsschiffen? Klaas ist ein jämmerlicher Grundkriecher. Statt zu jagen, zu erobern, zu gewinnen, statt sich mit dem Schwert zu gürten, fiert er die Leine ab und wartet, bis ein magerer Schellfisch oder eine armselige Makreel anbeißt. Wartet geduldig – und ist doch aus altem Wikingstamm. Sein Ohm hat in meinem Kielwasser gesteuert, als wir südwärts segelten. Er fischt ... morgen geht er hin und bettelt.«
»Ahne, der fremde Priester kommt.«
»Wieder, willst du sagen.«
Mit feierlichen Schritten kam er daher.
»Königin, der Herr sendet mich wieder zu dir.«
Sie verwandte das Gesicht nicht von der Sonne.
»Ein Herr? Hast du nicht von Jesus erzählt, einem milden, freundlichen Menschen, der still und verträumt im Morgenlande ging und segnete?«
»Er ist der Herr des Himmels und der Erden. Er nahm alle Sünde auf sich, auch deine, er öffnet dir den Himmel: du sollst an ihn glauben und dich taufen lassen.«
Ganz leise kamen Worte von ihren Lippen.
»Er wäre anders geworden, wenn er das Meer an die Felsen donnern gehört hätte. Aber so ist er nicht für Helgoland. Hier lebt Odin, hier walten die Nornen. Hast du schon all die Länder bekehrt, die im Osten und Süden und Westen aus der See steigen, daß du das heilige Land betrittst?«
»Überall wenden sie sich von den Götzen ab, überall richten sie das Kreuz auf. Kapellen werden gebaut und Glocken geläutet. Wenn du nicht blind wärst, Königin ...«
»Ich bin nicht blind, ich sehe, seit mein Auge sich trübte. Sieh: wenn unsere Skalden singen, springt der reisige Held auf, streicht das Haar aus der Stirn und stürmt nach den Schiffen. Eure Lieder sind süß und lind, sie hören sich gut an, sie schläfern ein. Wer weiß, ob Ihr nicht die ganze Welt in Traum und Schlaf singt. Wie lange aber, Winfried? Dann stehen eherne Sänger auf und wecken sie mit Riesenharfen, daß sie wieder nach Waffen und Feinden verlangt ... Höre, wie die Sperlinge durcheinander schreien. Gewiß schlagen sie eine Schlacht.«
»Wer achtet dessen?«
»Das eben ist es. Du kennst deinen Gott nur aus Büchern. Tu deine Augen auf, und du siehst ihn vor dir und neben dir und über dir. Sogar ein Sperling weiß von ihm zu erzählen. Und die Sonne: ist er's nicht selbst, so licht, daß du ihn nicht anschauen kannst? Nimm dir ein Kind und schau ihm in die Augen. Dann hast du wieder Gott, und was du dem Kinde tust, das tust du ihm.«
Er gab keine Antwort.
»Hast du dich jemals gefreut? Einmal nur gelacht? Ich habe es nie gehört. Seligkeit, Friede, Vergebung der Sünden: einem jungen, sonnenstarken Volk? Ja, wenn du Sonne brächtest, Sonne und Kampf und Freude! Aber auch dann sagt' ich noch: Nein! Wir haben genug Sonne um uns, genug Kampf vor uns, genug Freude in uns ... Damit du nun nicht wieder zu kommen brauchst: auf diesen Felsen kommt kein Christentum. Ich laß es allen sagen. Wer sich taufen lassen will, mag's tun, ich will es keinem wehren, aber den Felsen muß er verlassen. Der bleibt Odin geweiht, und heute Nacht leuchtet ein riesiges, rotes Feuer über das dunkle, schweigende Meer ... Geh, du stehst mir in der Sonne.«
Mittlerweile war auch der Juister munter geworden und rieb sich die Augen. Und als er sah, daß da einer nicht recht wollte, wie er sollte, rasselte er mit dem Schwert und knurrte.
Wohl richtete der Priester sich hoch auf, aber nur, um feierlich zu gehen.
Dietrich lachte aus voller Kehle, weil er wußte, daß die Königin so viel von Lachen und Freuen sprach.
Schön-Helga bekam er aber doch nicht.
»Eine Freude mußt du mir machen können, eine große Freude.«
Das schrieb er sich hinter die Ohren, als er im Korbe saß und sich hinunterfahren ließ. Das Gehen wurde ihm zu sauer.
Frauen und Kinder standen um den Fremden herum, der auf dem Sande stand und von Gott erzählte. Die Fischer und Schiffer hielten sich abseits. Was ging sie der Kram an: sie machten sich aus Göttern verdammt wenig, mochten sie heißen, wie sie wollten. Wie's kam, war's recht: war das Wetter gut, so fischten sie, war es schlecht, so strandete wohl ein Schiff auf den Bänken.
Nur Klaas hörte mit halbem Ohr hin und sah den Priester dunkel fragend an. Er war der Baas der Fischer; er hatte die Drachen von den Schiffen geschlagen und mit dem Fischen angefangen. Er war für das Neue – und da war etwas Neues. Er mußte der erste sein. Aber da rief Kai Rickmers: »Richtig: dein Gott kann aber keinen Wind machen. Der läßt es immer totstill werden. Da hört das Segeln auf: wir können rudern und schwitzen!«
Oben auf dem Felsen stand Schön-Helga und winkte. Klaas gewahrte sie.
Als sie einander begegneten, sagte sie ihm, daß jeder den Felsen verlassen müsse, der Christ werde.
»Habt ihr's gehört, Leute?« sagte Klaas laut.
»Was die Königin sagt, das gilt. Wer Christ wird, muß von Helgoland!« rief Kai.
»Muß von Helgoland!« hieß es ringsum.
Da mit einem Male sagte der Priester:
»Muß den Felsen verlassen. Ich stehe auf dem Unterland, auf dem Sand. Der ist für das Christentum. ‚Der Felsen‘ hat sie gesagt!«
Und er blickte frei um sich.
»Gesagt, aber nicht gemeint!« sagte Kai; aber die andern waren doch still. Daran hatte keiner gedacht.
»Sie will oben allein bleiben. Siedle dich hier an, kleine Gemeinde. Es ist Gottes Finger, der dich leitet,« mahnte der Fremde.
Klaas hatte große Augen gemacht, aber er bezwang sich und sah finster drein.
Solchen Kunststücken fühlte er sich nicht gewachsen.
»Onne Jansen ist krank?« fragte die Königin eines Tages, als sie wieder in der Sonne saß. »Ich höre seinen Schritt nicht mehr.«
Kai Rickmers räusperte sich verlegen.
»Er hat sich taufen lassen.«
»Ja so: ich gebot. Er ist wohl nach Dithmarschen gesegelt?«
Kai hustete noch mehr.
»Er wohnt auf dem Sand.«
»Auf dem Sand?«
»Dem Unterland. Den Felsen mußt' er ja verlassen.«
»Den Felsen? Nur den Felsen? Ist dies nicht Helgoland?«
»Der Priester hat es anders ausgelegt.«
»Ausgelegt.« Sie sann eine Weile. Dann sagte sie ernst: »Es hilft uns nicht, Kai. Er gewinnt. Nun weiß ich es. Wer das kann, kann alles.«
Es kam so.
Von Tag zu Tag mußte sie bekannte Schritte vermissen. Die Holzschuhe, die Filzpantoffeln, die Seestiefel: aller Klang ging nach und nach verloren.
Es wurde oben stiller und stiller.
Die Königin saß immer noch im Sonnenschein, aber sie hörte kaum noch hin und fragte selten.
Eines Morgens aber horchte sie hoch auf. Da stieß einer hart mit dem Schwert auf die Bohlen und lachte. Der von Juist war es.
»Da hab ich gesucht und gegrübelt, Königin, dir eine Freude zu machen, bin gefahren von Amsterdam nach London und von Bremen nach Köln und hab gefragt und getan – und war doch alles nichts Rechtes. Erst eben unten am Strand kam es mir zupaß. Stand er da breitbeinig, der Mann im Weiberrock. Erzählt in einem fort, ich weiß nicht was. Aber als ich hinzukomme, wird er dreist, guckt mich frech an und will mir das Eiland verwehren, sagt, ich solle umkehren, und ich wäre auf falschem Wege gewesen. Grad, als wenn er was von Seefahrt wüßte. Er gibt nicht nach, – umkehren, umkehren; da mußt' ich ihn still machen. Der sagt kein Wort mehr.«
Und er lachte.
Sie verzog keine Miene.
»Nein – es macht mir keine Freude. Er hatte kein Schwert.«
»Ich hab ihn wahrhaftig erschlagen, um dir eine Freude zu machen,« sagte er. »Sonst hätt' er meinetwegen leben bleiben können.«
Aber sie schüttelte den Kopf.
Da knirschte der Sand, und Klaas trat ein.
Dietrich von Juist riß sein Schwert heraus.
»Versuch es mit mir,« rief Klaas. »Einen Unbewaffneten schlachten, ist keine Kunst.«
Schön-Helga schrie laut auf, aber die Königin riß sie hastig an sich.
»Still – hier ist lange nicht gekämpft worden,« sagte sie mit verhaltener Freude und beugte sich weit vor und horchte dem Klirren und Schwirren.
Der Juister mußte dran glauben. Ächzend brach er zusammen und verröchelte auf dem Estrich.
Klaas ließ die Arme sinken und starrte düster zu Boden.
Eine tiefe Stille ging durch die Halle.
Endlich sagte die Königin:
»Du kannst also doch ein Schwert führen, Klaas! Ich hätt' es nicht gedacht.«
Da ging er mit hastigen Schritten hinaus.
Den dritten Tag war er es, der unter den Helgoländern stand und predigte. Es lag kein Friede auf seinem Gesicht, aber sein Mahnen war so dringend und drohend, und er sprach so eindringlich, daß sie sich um ihn drängten und taten, was er wollte. Sie ließen sich taufen.
Und Klaas vergaß des Schwertes, das in einer Felsenspalte rostete. Er fand den Frieden.
Auch die letzten kamen vom Felsen.
Die Königin mußte alles hergeben, zuletzt ihre Augen. Vergeblich rief sie nach Schön-Helga. Die kam nicht wieder. Sie stand Klaas zur Seite und hörte ihm zu.
Da wurde es ganz still um die greise Frau.
Nur Kai Rickmers blieb bei ihr.
Am Abend kam ein Wetter auf, große, graue Wolken schoben sich ineinander, Wind und Meer brausten auf. Die Seen donnerten gegen den Felsen. In Nacht und Sturm stand die Königin auf der Höhe und horchte auf die Rufe. Da erscholl Gesang. Dann wieder laute Rufe. Die Drachenschiffe leuchteten in der Sonne, die Waffen klirrten, die Segel blähten sich auf. Und Schön-Helga war es, die im Königsboot am Mast stand und lachte. Ihr langes Haar wehte im Winde. Und als Klaas sah, wie sie lachte, sprang er vom Steuer auf, nahm sie in die Arme und küßte sie. Und die Fahrgesellen schlugen an die Schilde ...
Als aber die Sonne schien, saß die Königin wieder still in den Strahlen. Die Sperlinge hüpften um sie her, und sie nickte ihnen freundlich zu. Und sie hört, wie am Strand die Möwen lärmen, und wie der Wind durch das Gras geht, und wie die Wellen über die Muscheln und Steine glucksen.
Immer ist ihr Gesicht der Sonne zugewandt. Sie fragt nicht mehr nach den Helgoländern, nicht mehr nach Klaas, auch nicht einmal mehr nach Schön-Helga. Nur von der Sonne und von der Freude spricht sie noch.
Manchmal klingt ein Glockenton zu ihr herauf, aber sie weiß ihn nicht zu deuten.
Im hellen Sonnenschein schläft sie ein.
Trübe, graue Nebel sind gekommen. Sturm und Regen hat es gegeben. Da haben sie es gewagt und sind wieder hinaufgezogen, die Helgoländer, als erste Klaas und Schön-Helga. Und haben alles vergessen, haben gelebt und gelacht.
Aber an stillen, sonnigen Tagen ist es mitunter wie ein wunderliche Grauen über sie gekommen, und sie haben gemeint, die alte, weise Königin säße im Sonnenschein und erzähle leise ihr Märchen von Freude und Licht und Sonne.
Weit ab von den Landstraßen und noch weiter von Dörfern und Höfen steigt ein kleiner Berg aus der weiten, braunen Heide auf. Er liegt in Einsamkeit da, und wenn auch manchmal ein Schäfer mit Hund und Heidschnucken vorbeigeht, so treiben doch gewöhnlich nur Krähen und Hasen auf ihm ihr Wesen.
Einst war's anders. Da war er nicht kahl, sondern trug auf seinem Gipfel sieben Tannenbäume, so daß man meinen mochte, er hätte sich eine dunkelgrüne Mütze über die Ohren gezogen. Und in dem Berge hauste ein Zwerg, den sie das rote Männchen hießen, weil er immer in einem feuerroten Röcklein zutage kam. Ihm gehörten die sieben Tannenbäume, er hatte sie selbst angepflanzt, hatte sie gerichtet und gepflegt, hatte an manchem warmen Sommernachmittag aus der kühlen Tiefe des Berges Wasser getragen – und freute sich nun, daß er sie so weit gebracht hatte, daß sie sich selbst helfen konnten. Und ihm selbst mußten sie auch auf manche Art helfen. Mit ihren feinen Wurzeln hielten sie den Sand fest, daß seiner Höhlenwohnung nicht die Decke niederrieselte, sie sogen den Regen auf bis auf den letzten Tropfen, daß es nicht durchleckte, sie wehrten die Sonnenstrahlen ab, daß es ihm nicht zu heiß wurde. Jedem hatte er einen Namen gegeben: Wegweiser, Regenschirm, Sonnendach, Windbeutel, Gesangsmeister, Stiefelknecht und Spielvogel. Wegweiser war der größte und höchste und wies dem roten Männchen den Weg, wenn es über Geest war. Regenschirm war am dichtesten bezweigt, unter ihm lag der Zwerg, wenn es von den Wolken tröpfelte. Sonnendach war breitgeästet und mußte das Männlein deshalb vor der brennenden Sonne beschützen. Windbeutel war besonders kräftig und stämmig; er stand an der äußersten Ecke und drängte den kalten, scharfen Ostwind beiseite, den der Alte nicht vertragen konnte. Gesangsmeister hatte die beweglichsten Zweige und war der lustigste von allen: bei dem leisesten Windzug strich er mit den Nadeln über das dürre Gras und das Kraut, so daß eine herrliche Musik für Zwergenohren vernehmlich wurde, auch lud er Mücken, Grillen, Brummer, Bienen zu Gast, an hohen Festen sogar eine Meise oder einen Finken: an Gesumme und Gezirpe und Gezwitscher war kein Mangel. Stiefelknecht hatte einen krummen Stamm, den benutzte das Männlein jeden Abend beim Stiefelausziehen; es war aber Geheimnis, ob der Stamm krumm gewesen war und ob der Alte ihn deshalb zum Stiefelknecht gemacht hatte, oder ob der Alte zuerst seine Stiefel an ihm abgezogen hatte und davon die Krümmung herrührte. Spielvogel war noch zu klein und konnte noch nichts tun; er spielte wie ein Kind mit Wind und Sonne.
Es wurde nach und nach Herbst und Winter. Die Bienen flogen nicht mehr, die Grillen starben, die Sonne saß hinter grauem Gewölk, kalt und feucht wurde es auf dem Berg und in den Tälern. Da verkroch sich das rote Männchen tief in seine Höhle, verstopfte den Eingang mit Moos und Steinen und wartete, daß die Sonne und der schöne Sommer wiederkommen sollten. Die sieben Tannenbäume ließ es in Wind und Wetter allein und quälte sich nicht weiter um sie. Das einzige, was es tat, war, daß es morgens bald den einen, bald den andern bei den Wurzeln faßte, als zöge es ein Kind an den Füßen.
»Bäumchen mein:
Sonnenschein?«
fragte es dann, und antwortete das Bäumchen wahrheitsgetreu:
»Zwerglein, nein!«
so legte es sich auf sein Bett von Heidekraut und verschlief den Tag wie ein Murmeltier. So ging es wochenlang, da riß es wieder an den Wurzeln, um zu wissen, was für Wetter sei – und bekam mit einemmal keine Antwort mehr. Es zog stärker, ja es ließ sich an den Wurzeln baumeln, es fragte mit gräßlich lauter Stimme:
»Bäumchen mein:
Sonnenschein?«
aber es antwortete ihm niemand. Sehr erbost, aber auch ein bißchen besorgt, stieß es die Tür auf – o weh, wie erschrak es! – alle sieben Tannenbäume waren verschwunden. Nur Stammstümpfe standen da – der Berg war kahl wie ein Pfannkuchen! Da lief das Männchen umher, als wüßte es nicht, was es tun sollte, guckte herum, schlug die Hände zusammen, rief, fragte, weinte und grämte sich um seine Tannenbäume. Die Hasen kamen angehüpft und erzählten ihm von den großen Menschen, die gekommen wären, am hellen Mittag, und die Bäume abgesägt hätten; auf einen großen Wagen hätten sie sie geworfen, und im Trab seien sie mit ihnen weggefahren. Die Krähen kamen geflogen und wollten trösten. Aber das rote Männchen wollte keinen Trost, es wollte seine Bäume wiederhaben. Es wollte in die Welt hinein und sie suchen. »Du findest sie nicht,« sagten die Krähen, »die Welt ist zu groß.« Das Männlein jammerte wieder. Da nahmen die Krähen all ihren Verstand zusammen und dachten nach, wie sie ihm helfen könnten, und wirklich – sie fanden es.
»Wenn der Mond aufgeht,« sagte sie, »wollen wir ihn bitten, daß er sich zum Spiegel der Welt mache. Dann guckst du hinauf und suchst deine Tannenbäume.« Das war dem Männchen eine willkommene Botschaft, und da es noch nicht dämmerte, lud es die Krähen zu Gast und setzte ihnen Buchweizengrütze, Honig und Brot vor; darüber fielen die hungrigen Brüder mit heißen Schnäbeln her. Als sie noch so saßen und von ihren Reisen erzählten, da guckte der Mond groß und rötlich über die Geest.
»Fangt an!« rief das Männchen; aber die Krähen beschwichtigten es: sie müßten noch warten, damit die Spiegelung besser werde. Endlich, nach langem Warten, war es so weit. Der Mond stand groß und klar über dem Heiderande.
Rauschend flogen die Krähen auf und krächzten oben in der Luft:
»Blanker, gelber Mond am Heben,
spiegle alles Erdenleben!«
Mehrmals und durcheinander schrien sie – das Männlein fürchtete schon, sie möchten es genarrt haben. Plötzlich fielen sie lautlos in das dürre Kraut nieder, und sieh: der Mond wurde größer und größer, leuchtete taghell auf, und wie in einem Spiegel zeigte sich auf ihm die Welt mit allem, was darin war: Wasser und Berge, Städte und Wälder, Häuser und Menschen und Bäume, alles war deutlich zu erkennen. Das rote Männchen machte große Augen und suchte. Dann wies es mit beiden Händen nach einer Gegend.
»Was für eine große Stadt ist das?« rief es zitternd.
»Hamburg,« gaben die Krähen leise zur Antwort.
»Da sind alle sieben, alle meine Tannenbäume!« rief es wieder. »Ich sehe sie alle: Wegweiser in einer großen Kirche, Regenschirm in einem prächtigen Herrenhause, Sonnendach vor einer Dombude, Windbeutel in einer kleinen Stube, Gesangsmeister in einer armseligen Dachkammer, Stiefelknecht an der Straßenecke, Spielvogel oben auf dem Schiffsmast. O – wie müssen sie sich nach mir und dem Berg zurücksehnen, wie mögen sie jammern! Ich will nach Hamburg und sie holen. O – bringt mich nach Hamburg! Hasen und Krähen, liebe Freunde, helft mir!«
Das wollten sie. Das Männchen machte sich reisefertig, zog Handschuhe an, setzte sich auf den Hasen, hielt sich an dessen langen Ohren fest, und – hast du nicht gesehn? – ging's über die Geestberge, daß die Heide wackelte. Als sie aber unter die Lichter von Hamburg gerieten, warf das Hasenroß den Reitersmann ab und trabte angstbeklommen nach Hause zurück. Das Männchen schwang sich kurzgefaßt auf den breiten Rücken der größten Krähe und ließ sich über die Elbe nach dem glänzenden, funkelnden Hamburg tragen. Wohl erschrak es über die Maßen vor den hohen Türmen und den gewaltigen Häusern, wohl entsetzte es sich vor dem vielen Licht und vor den Tausenden von Menschen und hielt sich krampfhaft an den Nackenfedern der Krähe fest, um nicht auf die krabbelnd vollen Straßen zu stürzen – aber die Sorge um seine sieben Tannenbäume hielt ihm den Kopf oben.
Auf dem Kirchendache landete das Rabenschifflein seinen Fahrgast, der sich an dem Blitzableiter hinabgleiten ließ und durch eine Luftröhre in die Kirche stieg. Vor all der Helle und Pracht konnte er kaum die Augen offen halten. Orgelton und Gesang durchbrausten den Raum, in dem kein unbesetzter Platz vorhanden war. Neben dem Altar stand ein großer, hoher Tannenbaum, über und über mit Lichtern bedeckt: es war der Wegweiser. Das Männchen erkannte ihn und schlich sich unter den Bänken entlang zu ihm.
»Armer Wegweiser!« schluchzte es.
Der große Baum aber schüttelte leise die Krone, daß die Lichter flackerten: »Arm?« fragte er, »ich bin nicht arm, ich bin der schönste Baum auf der Erde, ich bin der Weihnachtsbaum. Sieh meine Pracht und mein Leuchten!«
»Ist nur ein Traum, armer Wegweiser, nur ein Traum. Wenn du erwachst, sind deine Lichter erloschen und du liegst vergessen im Winkel. Und stirbst. Komm mit auf den Berg, eh es zu spät ist.«
Der Baum rüttelte wieder seine Krone: »Ich weise andere Wege,« flüsterte er wie im Traum, »Wege zu Gott, Wege zur Freude, Wege zum Kinderland, ich bin beglückt, wenn ich nur zwei Kinderaugen glänzen machen kann. Und hier glänzen tausend. Mußt mir mein Glück schon gönnen, rotes Männchen, und mich stehen lassen.«
Brausend erscholl Orgelton dazwischen.
»Und deine sechs Brüder?« fragte das Männchen.
»Die sind alle Weihnachtsbäume geworden,« sagte der Wegweiser, »tragen Lichter und Nüsse und Äpfel, erfreuen arm und reich, großes und kleines Volk. Um sie klingen Weihnachtslieder und alle Kinder lachen. Keines geht zurück in den Wald. Einen Abend Weihnachtslichter tragen, ist die Sehnsucht aller Tannenbäume. Ist die erfüllt, dann verdorren sie gern. O Weihnacht!«
Als der Baum so gesprochen hatte, sah das Männchen ein, daß es ihn nicht überreden konnte.
»Weihnachten und die Menschen sind dir in die Krone gefahren,« sagte es und stahl sich hinaus. Die Krähe wetzte ihren Schnabel auf dem Dach, das Männchen bestieg den Rücken, und weiter ging es. Zu Regenschirm, der über und über mit Gold und Silber bedeckt war und sich nach der Musik um sich selbst drehte wie ein junges Mädchen im Tanzsaal. Zu Sonnendach, das mit elektrischen Glühlampen besteckt von dem Karussell auf den Schwarm der Dombesucher herableuchtete. Zu Windbeutel, der spärlich behängt eine kleine Arbeiterwohnung erhellte. Zu Gesangsmeister, der in der Dachkammer stand, ein einziges Licht und einen Hering trug; ein grauer Kater saß daneben und wollte sich an den Hering machen, aber jedesmal stach Gesangsmeister ihn mit den Nadeln, daß er miauschreiend zurückspringen mußte.
Alle vier bat das rote Männchen, aber alle antworteten ebenso wie ihr großer Bruder, sie waren glücklich, Weihnachtsbäume geworden zu sein und dachten nicht daran, wieder nach dem kalten, dunkeln Berg zu wandern. Nicht einmal einen Gruß an die braune Heide hatten sie aufzutragen, und mochte das Männlein sie treulos und undankbar schelten, sie spiegelten sich im Schein ihrer Lichter und lachten wie Kinder.
Traurig schwebte der Zwerg wieder durch die Luft, bis er vor Stiefelknecht stand. Der lag auf einem großen, dunkeln Platz in einem Haufen anderer Tannenbäume. Wegen seines alten Fußleidens hatte ihn niemand kaufen wollen.
»Deinen Brüdern will ich es gar nicht mal so sehr verdenken,« sagte der Alte zu ihm, »sie tragen Lichter und sind Weihnachtsbäume – aber du bist keiner.«
»Doch – ich bin ein Weihnachtsbaum, so gut wie die andern,« sagte Stiefelknecht, »der schönste Baum auf Erden. Ich sehe viele glückliche Menschen vorbeigehen: ist das nicht Glück genug? Und vielleicht, nein, gewiß kommt heute abend, ganz spät, noch jemand und nimmt mich mit, steckt mir Lichter an und schmückt mich. Nach der Heide will ich nicht zurück.«
Das Zwerglein bat und bat, aber Stiefelknecht sah nach den Kindern, die jubelnd vorbeistürmten, und hörte nichts.
Da ging es wieder zu seinem schwarzen Rößlein und ließ sich nach dem Hafen fliegen. Der Spielvogel, an dem sein Herz am meisten hing, würde ihm treu bleiben, das hoffte er von seinem Lieblingsbäumchen. Aber am Hafen war kein Spielvogel mehr zu entdecken. Das Schiff wäre schon in See gegangen, erfuhr die Krähe von einigen weitläufigen Verwandten, weißen Möwen, die über dem Wasser schwebten.
»Dann seewärts,« befahl das rote Männchen. Die Krähe flog westwärts über Wasser und Deiche und Schiffsmasten hin, aber als sie bis Cuxhaven gekommen war, setzte sie sich nieder, denn auf die große, endlose See zu fliegen, getraute sie sich nicht. Doch rief sie eine große Seemöwe herbei, die breitete ihre weißen Schwingen und trug das Männchen stolz und schnell über das dunkle, schäumende Meer, bis weit hinter Helgoland. Da tauchte ein einsames Schiff in den Wogen auf und ab und wurde von einer Seite nach der andern geworfen. Der Wind blies gewaltig in die großen, braunen Segel. Auf dem Topp, der höchsten Spitze des Großmastes, tanzte ein kleines Tannenbäumchen im schneidenden Wind auf und ab: das war Spielvogel. Er lachte hellauf und schüttelte die Zweiglein vor Lust, wenn eine Sprühwelle zu ihm heraufspritzte. Und guckte einer der Matrosen zu ihm hinauf, so nickte er ihm freudig zu.
»Armer Spielvogel.«
»He, he, Männlein klein, bist du's?« rief Spielvogel. »Hier ist es lustig, nicht?«
»Komm mit nach der Geest.«
»Nein, nein, nein! Ich bin Weihnachtsbaum, der schönste Baum auf Erden. Und was kann schöner sein, als Weihnachten auf See. Grüß die Heide! Ich muß singen!«
Und Spielvogel sang, so laut er konnte, daß die Matrosen mitsingen mußten und Träume von Land und Licht träumten.
Da sah das rote Männchen ein, daß es seine sieben Tannenbäume verloren hatte, er dachte daran, daß es nun ohne Wegweiser über die Geest irren müsse, daß niemand mehr da sei, der es vor Regen, Sonne und Wind beschützen könne, der ihm vorsinge, der ihm beim Stiefelausziehen helfe, der es durch sein Kinderspiel erfreue – der Berg war so kahl, Regen drang in seine Wohnung – armes Männchen! Mit einemmal breitete es die Arme aus, rutschte von den Möwenflügeln und stürzte sich in das dunkle Wasser hinab.
Seit jener Nacht schwimmt ein seltsamer, leuchtender Fisch in der See. Die Fischer nennen ihn das Petermännchen und halten es für etwas Besonderes, wenn sie ihn fangen.
Es war wieder still in dem kleinen, dämmerdunklen Zimmer mit den dicht verhängten Fenstern und der eben glimmenden Lampe, die dem Erlöschen nahe war. Der Kranke war ruhig geworden. Er hatte die Augen geschlossen und schien zu schlafen, denn sein Atem ging tiefer und gleichmäßiger, und der Mund war nicht mehr so schmerzhaft verzogen. Schwere Schatten lagen unter den Augen, und das Gesicht war fahl und eingefallen: nur das volle, blonde Haar ließ erkennen, daß er jung war.
Heinrich, der Konfirmand, saß am Tische und hielt die Wache bei dem Bruder. Erst hatte er gelesen, nun war er damit fertig und guckte nach dem bunten Schnitzwerk der mächtigen eichenen Truhe und tastete mit den Fingern über den Namen und über den Spruch und die Blumen.
Keine Uhr tickte, die Zeit war stehen geblieben.
Plötzlich rührte Gorch sich.
»Mutter!« sagte er leise.
Heinrich erschrak wie einer, der sich ertappt weiß, und zog die Hand zurück und ließ Truhe Truhe sein.
»Mutter schläft, Gorch. Ich bin bei dir.«
Der Bruder öffnete die Augen und richtete sich mühsam im Bette auf.
»Was ist, Heinrich, Abend oder Morgen?«
»Die Klock muß so bei Zehn herum sein.«
»Ist das Wetter sichtig?«
Heinrich bog die Vorhänge etwas auseinander.
»Es ist heller Mondschein, Gorch.«
»Laß mich sehen!« bat der Kranke, und als der Junge zögerte, verlangte er dringender: »Laß mich sehen!«
Da schob Heinrich die weißen Laken zurück. Und Gorch starrte unverwandt hinaus und sah den dunklen Deich und die weite, graue Elbe und die vielen Lichter, wie sie blinkten, wie sie kamen und gingen, und die hohen, schwarzen Segel der Fischerjollen. Und sah den Mondschein, der den Schatten der kahlen Linden auf die Steine warf, und den gelben Mond, der groß und kalt am Heben stand.
Was in ihm vorging, was er sann und grübelte, was für Gedanken ihn überkamen, ließ sich nicht sagen. Er sprach kein Wort und verzog keine Miene. So blickte er lange in die Nacht, bis ihm die Augen zufielen und er schwer in die Kissen zurücksank.
Da stand Heinrich leise auf und verhängte das Fenster wieder, und wieder blieb die Zeit stehen.
Bis Gorch abermals erwachte.
»Mein Seefahrtsbuch, Heinrich!«
»Was willst du damit?«
»Mein Seefahrtsbuch!«
Er griff erregt in die Decken.
»Ich weiß nicht, wo es ist.«
»Mein Seefahrtsbuch!«
Heinrich zog den Mund schief, es blieb ihm aber doch nichts übrig, als hinzugehen und es aus dem Schrank herauszusuchen. Hastig griff Gorch danach, legte das abgegriffene Buch vor sich hin und blätterte darin und sah nicht mehr, daß er es auf dem Kopfe hielt, und fing an zu erzählen:
»Sieh her, Heinrich!... als Leichtmatrose mit der ‚Pisagua‘ von Hamburg nach Iquique und zurück. Salpeter geladen, Junge. Um Kap Horn. Zweimal. Und zweimal über die Linie. Sieh her, Heinrich!... Als Matrose mit der ‚Lesum‘ von Bremen nach Ostindien. Um Afrika herum. Einhundertfünf Tage. In Kalkutta von Bord. Mit dem englischen Steamer ‚Crawford‘ nach London. Durch den Suezkanal, Heinrich. Mit einer norwegischen Bark... der Deubel mag den Namen behalten haben... in Ballast nach Frederikstad, zurück mit Holz nach Emden. Stille Leute, diese Norweger, haben es aber hinter den Ohren, Heinrich. Mit der Jacht ‚Nebelung‘ in der Levante herumgekreuzt. Feines Essen und nichts zu tun. Bloß putzen und scheuern, rein als 'n Köksch. Mit dem Fischdampfer ‚Poseidon‘ neun Monate bei Spitzbergen im Eise gedonnert. Eisbären gefangen, Heinrich. Waren aber nicht zahm zu kriegen. Mit dem Viermaster ‚Marie‘ sechshundert Polacken nach Honolulu geschafft. Böse Fracht, Junge. Sechshundert Seekranke. Dann von Rangoon mit Reis nach Liverpool. Mit der ‚Columbia‘ von Hamburg nach Neuyork, dreimal hin und her. Eine Notreise mit Harm Focks Ewer. Es war gerade in der Schollenzeit, Heinrich. Ich weiß es noch wie heute...« Er brach ab, seine Gedanken verwirrten sich auf ihrer Weltenwanderung. Mit schwächerer Stimme gab er drein: »Kanton... Singapore... Aden... Gibraltar... Lissabon... Bordeaux... Reval... Stockholm... New Orleans... Kingstown... Maracaibo...« Hier schwieg er ganz: das Fieber war gekommen und hatte einen dicken Strich über sein Seefahrtsbuch gemacht.
Heinrich hatte genau zugehört. Wie sie sich in seinem vierzehnjährigen Kopfe abmalten, so sah er all die fremden Häfen und Küsten vor sich: mit hohen Leuchttürmen, mit runden Kuppeln, mit Palmen und Zedern, mit gelben Mongolen und schwarzen Negern.
Gorch ermunterte sich wieder.
»Das alles habe ich gesehen, Heinrich. Die ganze Erde, die ganze Welt. Im Osten und Westen, im Süden und Norden. Und nun ich krank zurückgekommen bin und keinen Sack voll Geld mitgebracht habe, bedauern sie mich bei Euch am Deich und sagen, mein Leben sei umsonst gewesen, und ich hätte nichts davon gehabt. Sind große Hansnarren, Junge! Große Hansnarren! Mein Leben ist nicht umsonst gewesen, und ich habe was davon gehabt. Mehr, als sie denken können, und mehr, als ich selbst glaubte. Ich habe gelebt und gelacht und gekämpft und bin immer weiter gesteuert, immer weiter... aber, weißt du, Heinrich, immer gerade aus.«
»Hattest du kein Heimweh?« fragte der Junge.
Der Weltumsegler schüttelte den Kopf.
»Nein, Heinrich. Da war der Heimatswimpel schon, er lag nur ganz zu unterst in meiner Teakholzkiste. Einmal hätte ich ihn schon aufgeholt, aber erst wollte ich noch mehr sehen, immer mehr. Die Welt war ja so groß und wurde immer größer. Junge, du weißt ja nicht, wie es auf dem Kai von Singapore wimmelt von Menschen, braun, schwarz, gelb und weiß, wie schön die Sonne auf dem Golf von Neapel blinkt, wie eigen einem das Nordlicht vorkommt, wie viel klarer im Süden die Sterne sind, wie im Atlantik der Sturm rast, wie es tut, wenn man hundert Tage auf dem Wasser gewesen ist und dann einen dunklen Streifen vor sich sieht. Wie Kolumbus begrüßt du dein Indien. Und glücklich habe ich gefahren, immer gute Reisen, kein Schiffbruch, keine Havereien, keine Krankheit ... bis Maracaibo. Ich tausche mit denen nicht, die bis Altona oder Helgoland gekommen sind. Ich habe gelebt.«
Er verpustete sich einen Augenblick und schob sich das Kopfkissen unter den Rücken.
»Nun bin ich krank. Auf den Tod krank. Und kann nicht den kleinen Finger rühren, ohne mir weh zu tun. Und habe keinen Willen mehr, als den: nur erst still zu sein, nur erst unter der Erde zu liegen. Ich kann kaum sitzen und habe bei Sturm und Nacht auf der Ra gestanden. Wäre ich hinuntergeweht. Aber so hinzuschmelzen, wie der Schnee im Frühjahr, der auch wochenlang liegen bleibt. Und so schwach und klein zu werden, das ist bös, Heinrich! So zu liegen und zu jammern.«
Der Fieberfrost schüttelte ihn.
»Lach mich aus, Heinrich! Du bist gesund und die Gesunden tun am besten, wenn sie über die Kranken lachen... Und hör' nicht auf mein Klagen, Heinrich. Wenn es zu weh tut, jammere ich mitunter, daß es schlecht gewesen und verkehrt von mir zu fahren. Es war nicht verkehrt, Junge! Es war recht, war schön, schön und gut. Windstille, Regen, Nebel, Sturm: alles war schön.«
»Sprich nicht so viel, Gorch. Es tut dir weh.«
»Nicht lange mehr, Heinrich... Heinrich! Du kommst nun Ostern aus der Schule und willst zur See. Aber du sollst nicht, weil es mit mir schief gegangen ist, und weil Vater und Jan geblieben sind. Sie raten dir alle ab, ich höre es ja jeden Tag. Und ich soll dir auch abraten. Aber ich rate dir zu, Heinrich! Glaube mir, es ist draußen doch schöner als binnen, und auf See weht die reinste Luft und am besten schläft es sich, wenn die Seen an der Schiffswand plätschern und glucksen. Die Welt ist nicht so fremd, Heinrich, wie sie erzählen, wenn sie um den Ofen sitzen. Sie ist bloß groß. Sie wollen dich Jungen dumm schnacken, dich breitschlagen... hör' nicht darauf ... sie sind jung gewesen und können die Jungen nicht mehr verstehen.«
Heinrich sah ihn fest an.
»Ich tu auch doch, was ich will, Gorch.«
»Tu es, Junge! Begucke dir die Welt und denke an deinen Bruder, wenn du um Kap Horn kreuzest. Und singe mit, wenn die andern Matrosen singen, und bleibe nicht an Bord, wenn sie abends an Land gehen. Geh zur See, Heinrich ... Und nun ... ruf' die Mutter ... ich fühle, daß ich zu Ende bin ... ich möchte ihr gern noch einmal die Hand ...«
Damit fiel der wilde, ruhelose Weltumsegler zurück und verschied, um höheren Ortes Verklarung abzulegen.
End of the Project Gutenberg EBook of Schiff vor Anker, by Gorch Fock
*** END OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK SCHIFF VOR ANKER ***
***** This file should be named 56512-h.htm or 56512-h.zip *****
This and all associated files of various formats will be found in:
http://www.gutenberg.org/5/6/5/1/56512/
Produced by Heike Leichsenring and the Online Distributed
Proofreading Team at http://www.pgdp.net
Updated editions will replace the previous one--the old editions will
be renamed.
Creating the works from print editions not protected by U.S. copyright
law means that no one owns a United States copyright in these works,
so the Foundation (and you!) can copy and distribute it in the United
States without permission and without paying copyright
royalties. Special rules, set forth in the General Terms of Use part
of this license, apply to copying and distributing Project
Gutenberg-tm electronic works to protect the PROJECT GUTENBERG-tm
concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark,
and may not be used if you charge for the eBooks, unless you receive
specific permission. If you do not charge anything for copies of this
eBook, complying with the rules is very easy. You may use this eBook
for nearly any purpose such as creation of derivative works, reports,
performances and research. They may be modified and printed and given
away--you may do practically ANYTHING in the United States with eBooks
not protected by U.S. copyright law. Redistribution is subject to the
trademark license, especially commercial redistribution.
START: FULL LICENSE
THE FULL PROJECT GUTENBERG LICENSE
PLEASE READ THIS BEFORE YOU DISTRIBUTE OR USE THIS WORK
To protect the Project Gutenberg-tm mission of promoting the free
distribution of electronic works, by using or distributing this work
(or any other work associated in any way with the phrase "Project
Gutenberg"), you agree to comply with all the terms of the Full
Project Gutenberg-tm License available with this file or online at
www.gutenberg.org/license.
Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project
Gutenberg-tm electronic works
1.A. By reading or using any part of this Project Gutenberg-tm
electronic work, you indicate that you have read, understand, agree to
and accept all the terms of this license and intellectual property
(trademark/copyright) agreement. If you do not agree to abide by all
the terms of this agreement, you must cease using and return or
destroy all copies of Project Gutenberg-tm electronic works in your
possession. If you paid a fee for obtaining a copy of or access to a
Project Gutenberg-tm electronic work and you do not agree to be bound
by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the
person or entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph
1.E.8.
1.B. "Project Gutenberg" is a registered trademark. It may only be
used on or associated in any way with an electronic work by people who
agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few
things that you can do with most Project Gutenberg-tm electronic works
even without complying with the full terms of this agreement. See
paragraph 1.C below. There are a lot of things you can do with Project
Gutenberg-tm electronic works if you follow the terms of this
agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg-tm
electronic works. See paragraph 1.E below.
1.C. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation ("the
Foundation" or PGLAF), owns a compilation copyright in the collection
of Project Gutenberg-tm electronic works. Nearly all the individual
works in the collection are in the public domain in the United
States. If an individual work is unprotected by copyright law in the
United States and you are located in the United States, we do not
claim a right to prevent you from copying, distributing, performing,
displaying or creating derivative works based on the work as long as
all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope
that you will support the Project Gutenberg-tm mission of promoting
free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg-tm
works in compliance with the terms of this agreement for keeping the
Project Gutenberg-tm name associated with the work. You can easily
comply with the terms of this agreement by keeping this work in the
same format with its attached full Project Gutenberg-tm License when
you share it without charge with others.
1.D. The copyright laws of the place where you are located also govern
what you can do with this work. Copyright laws in most countries are
in a constant state of change. If you are outside the United States,
check the laws of your country in addition to the terms of this
agreement before downloading, copying, displaying, performing,
distributing or creating derivative works based on this work or any
other Project Gutenberg-tm work. The Foundation makes no
representations concerning the copyright status of any work in any
country outside the United States.
1.E. Unless you have removed all references to Project Gutenberg:
1.E.1. The following sentence, with active links to, or other
immediate access to, the full Project Gutenberg-tm License must appear
prominently whenever any copy of a Project Gutenberg-tm work (any work
on which the phrase "Project Gutenberg" appears, or with which the
phrase "Project Gutenberg" is associated) is accessed, displayed,
performed, viewed, copied or distributed:
This eBook is for the use of anyone anywhere in the United States and
most other parts of the world at no cost and with almost no
restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it
under the terms of the Project Gutenberg License included with this
eBook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the
United States, you'll have to check the laws of the country where you
are located before using this ebook.
1.E.2. If an individual Project Gutenberg-tm electronic work is
derived from texts not protected by U.S. copyright law (does not
contain a notice indicating that it is posted with permission of the
copyright holder), the work can be copied and distributed to anyone in
the United States without paying any fees or charges. If you are
redistributing or providing access to a work with the phrase "Project
Gutenberg" associated with or appearing on the work, you must comply
either with the requirements of paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 or
obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg-tm
trademark as set forth in paragraphs 1.E.8 or 1.E.9.
1.E.3. If an individual Project Gutenberg-tm electronic work is posted
with the permission of the copyright holder, your use and distribution
must comply with both paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 and any
additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms
will be linked to the Project Gutenberg-tm License for all works
posted with the permission of the copyright holder found at the
beginning of this work.
1.E.4. Do not unlink or detach or remove the full Project Gutenberg-tm
License terms from this work, or any files containing a part of this
work or any other work associated with Project Gutenberg-tm.
1.E.5. Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this
electronic work, or any part of this electronic work, without
prominently displaying the sentence set forth in paragraph 1.E.1 with
active links or immediate access to the full terms of the Project
Gutenberg-tm License.
1.E.6. You may convert to and distribute this work in any binary,
compressed, marked up, nonproprietary or proprietary form, including
any word processing or hypertext form. However, if you provide access
to or distribute copies of a Project Gutenberg-tm work in a format
other than "Plain Vanilla ASCII" or other format used in the official
version posted on the official Project Gutenberg-tm web site
(www.gutenberg.org), you must, at no additional cost, fee or expense
to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means
of obtaining a copy upon request, of the work in its original "Plain
Vanilla ASCII" or other form. Any alternate format must include the
full Project Gutenberg-tm License as specified in paragraph 1.E.1.
1.E.7. Do not charge a fee for access to, viewing, displaying,
performing, copying or distributing any Project Gutenberg-tm works
unless you comply with paragraph 1.E.8 or 1.E.9.
1.E.8. You may charge a reasonable fee for copies of or providing
access to or distributing Project Gutenberg-tm electronic works
provided that
* You pay a royalty fee of 20% of the gross profits you derive from
the use of Project Gutenberg-tm works calculated using the method
you already use to calculate your applicable taxes. The fee is owed
to the owner of the Project Gutenberg-tm trademark, but he has
agreed to donate royalties under this paragraph to the Project
Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payments must be paid
within 60 days following each date on which you prepare (or are
legally required to prepare) your periodic tax returns. Royalty
payments should be clearly marked as such and sent to the Project
Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in
Section 4, "Information about donations to the Project Gutenberg
Literary Archive Foundation."
* You provide a full refund of any money paid by a user who notifies
you in writing (or by e-mail) within 30 days of receipt that s/he
does not agree to the terms of the full Project Gutenberg-tm
License. You must require such a user to return or destroy all
copies of the works possessed in a physical medium and discontinue
all use of and all access to other copies of Project Gutenberg-tm
works.
* You provide, in accordance with paragraph 1.F.3, a full refund of
any money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the
electronic work is discovered and reported to you within 90 days of
receipt of the work.
* You comply with all other terms of this agreement for free
distribution of Project Gutenberg-tm works.
1.E.9. If you wish to charge a fee or distribute a Project
Gutenberg-tm electronic work or group of works on different terms than
are set forth in this agreement, you must obtain permission in writing
from both the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and The
Project Gutenberg Trademark LLC, the owner of the Project Gutenberg-tm
trademark. Contact the Foundation as set forth in Section 3 below.
1.F.
1.F.1. Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable
effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread
works not protected by U.S. copyright law in creating the Project
Gutenberg-tm collection. Despite these efforts, Project Gutenberg-tm
electronic works, and the medium on which they may be stored, may
contain "Defects," such as, but not limited to, incomplete, inaccurate
or corrupt data, transcription errors, a copyright or other
intellectual property infringement, a defective or damaged disk or
other medium, a computer virus, or computer codes that damage or
cannot be read by your equipment.
1.F.2. LIMITED WARRANTY, DISCLAIMER OF DAMAGES - Except for the "Right
of Replacement or Refund" described in paragraph 1.F.3, the Project
Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project
Gutenberg-tm trademark, and any other party distributing a Project
Gutenberg-tm electronic work under this agreement, disclaim all
liability to you for damages, costs and expenses, including legal
fees. YOU AGREE THAT YOU HAVE NO REMEDIES FOR NEGLIGENCE, STRICT
LIABILITY, BREACH OF WARRANTY OR BREACH OF CONTRACT EXCEPT THOSE
PROVIDED IN PARAGRAPH 1.F.3. YOU AGREE THAT THE FOUNDATION, THE
TRADEMARK OWNER, AND ANY DISTRIBUTOR UNDER THIS AGREEMENT WILL NOT BE
LIABLE TO YOU FOR ACTUAL, DIRECT, INDIRECT, CONSEQUENTIAL, PUNITIVE OR
INCIDENTAL DAMAGES EVEN IF YOU GIVE NOTICE OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
1.F.3. LIMITED RIGHT OF REPLACEMENT OR REFUND - If you discover a
defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can
receive a refund of the money (if any) you paid for it by sending a
written explanation to the person you received the work from. If you
received the work on a physical medium, you must return the medium
with your written explanation. The person or entity that provided you
with the defective work may elect to provide a replacement copy in
lieu of a refund. If you received the work electronically, the person
or entity providing it to you may choose to give you a second
opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If
the second copy is also defective, you may demand a refund in writing
without further opportunities to fix the problem.
1.F.4. Except for the limited right of replacement or refund set forth
in paragraph 1.F.3, this work is provided to you 'AS-IS', WITH NO
OTHER WARRANTIES OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT
LIMITED TO WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR ANY PURPOSE.
1.F.5. Some states do not allow disclaimers of certain implied
warranties or the exclusion or limitation of certain types of
damages. If any disclaimer or limitation set forth in this agreement
violates the law of the state applicable to this agreement, the
agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or
limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or
unenforceability of any provision of this agreement shall not void the
remaining provisions.
1.F.6. INDEMNITY - You agree to indemnify and hold the Foundation, the
trademark owner, any agent or employee of the Foundation, anyone
providing copies of Project Gutenberg-tm electronic works in
accordance with this agreement, and any volunteers associated with the
production, promotion and distribution of Project Gutenberg-tm
electronic works, harmless from all liability, costs and expenses,
including legal fees, that arise directly or indirectly from any of
the following which you do or cause to occur: (a) distribution of this
or any Project Gutenberg-tm work, (b) alteration, modification, or
additions or deletions to any Project Gutenberg-tm work, and (c) any
Defect you cause.
Section 2. Information about the Mission of Project Gutenberg-tm
Project Gutenberg-tm is synonymous with the free distribution of
electronic works in formats readable by the widest variety of
computers including obsolete, old, middle-aged and new computers. It
exists because of the efforts of hundreds of volunteers and donations
from people in all walks of life.
Volunteers and financial support to provide volunteers with the
assistance they need are critical to reaching Project Gutenberg-tm's
goals and ensuring that the Project Gutenberg-tm collection will
remain freely available for generations to come. In 2001, the Project
Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure
and permanent future for Project Gutenberg-tm and future
generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary
Archive Foundation and how your efforts and donations can help, see
Sections 3 and 4 and the Foundation information page at
www.gutenberg.org Section 3. Information about the Project Gutenberg
Literary Archive Foundation
The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non profit
501(c)(3) educational corporation organized under the laws of the
state of Mississippi and granted tax exempt status by the Internal
Revenue Service. The Foundation's EIN or federal tax identification
number is 64-6221541. Contributions to the Project Gutenberg Literary
Archive Foundation are tax deductible to the full extent permitted by
U.S. federal laws and your state's laws.
The Foundation's principal office is in Fairbanks, Alaska, with the
mailing address: PO Box 750175, Fairbanks, AK 99775, but its
volunteers and employees are scattered throughout numerous
locations. Its business office is located at 809 North 1500 West, Salt
Lake City, UT 84116, (801) 596-1887. Email contact links and up to
date contact information can be found at the Foundation's web site and
official page at www.gutenberg.org/contact
For additional contact information:
Dr. Gregory B. Newby
Chief Executive and Director
gbnewby@pglaf.org
Section 4. Information about Donations to the Project Gutenberg
Literary Archive Foundation
Project Gutenberg-tm depends upon and cannot survive without wide
spread public support and donations to carry out its mission of
increasing the number of public domain and licensed works that can be
freely distributed in machine readable form accessible by the widest
array of equipment including outdated equipment. Many small donations
($1 to $5,000) are particularly important to maintaining tax exempt
status with the IRS.
The Foundation is committed to complying with the laws regulating
charities and charitable donations in all 50 states of the United
States. Compliance requirements are not uniform and it takes a
considerable effort, much paperwork and many fees to meet and keep up
with these requirements. We do not solicit donations in locations
where we have not received written confirmation of compliance. To SEND
DONATIONS or determine the status of compliance for any particular
state visit www.gutenberg.org/donate
While we cannot and do not solicit contributions from states where we
have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition
against accepting unsolicited donations from donors in such states who
approach us with offers to donate.
International donations are gratefully accepted, but we cannot make
any statements concerning tax treatment of donations received from
outside the United States. U.S. laws alone swamp our small staff.
Please check the Project Gutenberg Web pages for current donation
methods and addresses. Donations are accepted in a number of other
ways including checks, online payments and credit card donations. To
donate, please visit: www.gutenberg.org/donate
Section 5. General Information About Project Gutenberg-tm electronic works.
Professor Michael S. Hart was the originator of the Project
Gutenberg-tm concept of a library of electronic works that could be
freely shared with anyone. For forty years, he produced and
distributed Project Gutenberg-tm eBooks with only a loose network of
volunteer support.
Project Gutenberg-tm eBooks are often created from several printed
editions, all of which are confirmed as not protected by copyright in
the U.S. unless a copyright notice is included. Thus, we do not
necessarily keep eBooks in compliance with any particular paper
edition.
Most people start at our Web site which has the main PG search
facility: www.gutenberg.org
This Web site includes information about Project Gutenberg-tm,
including how to make donations to the Project Gutenberg Literary
Archive Foundation, how to help produce our new eBooks, and how to
subscribe to our email newsletter to hear about new eBooks.