
The Project Gutenberg EBook of Griechischer Frühling, by Gerhart Hauptmann This eBook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this eBook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you'll have to check the laws of the country where you are located before using this ebook. Title: Griechischer Frühling Author: Gerhart Hauptmann Release Date: September 18, 2018 [EBook #57928] Language: German Character set encoding: ISO-8859-1 *** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK GRIECHISCHER FRÜHLING *** Produced by Peter Becker, Jens Sadowski, and the Online Distributed Proofreading Team at http://www.pgdp.net. This file was produced from images generously made available by The Internet Archive.

ALLE RECHTE, INSBESONDERE DAS DER
ÜBERSETZUNG, VORBEHALTEN.
ERSTE BIS VIERTE AUFLAGE.
100 EXEMPL. SIND AUF HANDGESCHÖPFTEM BÜTTENPAPIER ABGEZOGEN, NUMERIERT UND IN GANZPERGAMENT GEBUNDEN; PREIS 15 M. FÜR DAS EXEMPLAR.

Wagenlenker aus Delphi
(Nach einem Gipsabguss des Bronce-Originals)
GERHART HAUPTMANN
1908
S. FISCHER / VERLAG / BERLIN
HARRY GRAFEN KESSLER GEWIDMET
Ich befinde mich auf einem Lloyddampfer im Hafen von Triest. Zur Not haben wir in Kabinen zweiter Klasse noch Platz gefunden. Es ist ziemlich ungemütlich. Allmählich läßt jedoch das Laufen, Schreien und Rennen der Gepäckträger nach und das Arbeiten der Krane. Man beginnt, sich zu Hause zu fühlen, fängt an sich einzurichten, seine Behaglichkeit zu suchen.
Eine Spießbürgerfamilie hat auf den üblichen Klappstühlen Platz genommen. Mehrmals ertönt aus ihrer Mitte das Wort „Phäakenland“. Erfüllt von einer großen Erwartung, wie ich bin, erzeugt mir Klang und Ausdruck des Wortes in diesem Kreise eine starke Ernüchterung. Wir schreiben den 26. März. Das Wetter ist gut: warme Luft, leichtes Gewölk am Himmel.
Ich nahm heute morgen im Hotel hinter einer sehr großen Fensterscheibe mein Frühstück ein, als, mit einem grünen Zweiglein im Schnabel, draußen eine Taube aus dem Mastenwalde des Hafens heran und nach oben, von links nach rechts, vorbeiflog. Dieses guten Vorzeichens mich erinnernd, fühle ich Zuversicht.
Wir entfernen uns nach einem seltsamen Manöver der „Salzburg“ von Triest. Die Gegenden sind ausgebrannt. Alle Färbungen der Asche treten hervor. Der Karst erscheint wie mit leichtem Schnee bedeckt. Viele gelbe und orangefarbene Segel ziehen über das Meeresblau. Die Maler sind entzückt und beschließen, zu längerem Aufenthalt gelegentlich zurückzukehren.
Es ist jetzt fünf Uhr. Seit etwa zwei Stunden sind wir unterwegs. Beinweiß zieht die nahe Strandlinie an uns vorüber. Wir haben zur linken das flache dalmatinische Land, ausgetrocknet, weit gedehnt, in braunrötlichen Färbungen. Beinweiß, wie von ausgebleichten Knochen errichtet, zeigen sich hie und da Städte und Ortschaften, zuweilen bedecken sie sanftgewölbte, braungrüne Hügel oder liegen auf dem braungrünen Teppich der Ebene. Mit scharfem Auge erkennt man fern weiße Spitzen des Velebitgebirges.
Allmählich werden diese Bergspitzen höher und der ganze Bergzug tritt deutlich hervor. Er ist schneebedeckt. Den Blick hinter mich wendend, bemerke ich: die Sonne steht noch kaum über dem Wasserspiegel, ist im Untergang. Der Mitreisenden bemächtigt sich jene Erregung, in die sie immer geraten, wenn die Stunde herannaht, wo sie die Natur zu bewundern verpflichtet sind. Bemühen wir uns, wahrhaftig zu sein! Der großartige, kosmische Vorgang hat wohl die Seelen der Menschen von je mit Schauern erfüllt, lange bevor das malerische Naturgenießen zur Mode geworden ist, und ich nehme an, daß selbst der naturfremde Durchschnittsmensch unserer Zeit, und besonders auf See, noch immer im Anblick des Sonnenunterganges auf ehrliche Weise wortlos ergriffen ist. Freilich hat sein Gefühl an ursprünglicher, abergläubischer Kraft bis auf schwächliche Reste eingebüßt.
Nach durchaus ruhiger Nacht setzt heut gegen fünf Uhr Vormittag Wind aus nordöstlicher Richtung ein. Ich merke, noch in der Kabine, bereits das leichte Stampfen und Rollen des Schiffes. Als erster von allen Passagieren bin ich an Deck. Ein grauer Dunst überzieht den Morgenhimmel. Das Meer ist nicht mehr lautlos: es rauscht. Schon überschlagen sich einzelne Wogen und bilden Kämme von weißem Gischt. Im Südosten beobachte ich eine düstere Wolkenbank und Wetterleuchten.
Die „Salzburg“ ist ein kleines, nicht gerade sehr komfortables Schiff. Die Matrosen sind eben dabei, das Deck zu reinigen. Sie spritzen aus einer „Schlauchspritze“ Wassermassen darüber hin, so daß ich fortwährend flüchten muß und auch so jeden Augenblick in Gefahr bleibe, durchnäßt zu werden. Es ist kein Tee zu bekommen, trotzdem ich, wärmebedürftig wie ich bin, mehrmals darum ersuche. Die Einrichtungen hier halten einen Vergleich mit dem norddeutschen Lloyd nicht aus.
„O, Tee, in eine Minute fertig“, wiederholt der Steward eben wieder, nachdem etwa anderthalb Stunden Wartens vorüber sind.
Jetzt 7½ Uhr; volle Sonne und Seegang. Unter anderen Wohltaten einer Seereise ist auch die anzumerken, daß man während der Fahrt die ruhige und gesicherte Schönheit der großen Weltinseln wiederum tiefer würdigen lernt. Das Streben des Seefahrers geht auf Land. Statt vieler auseinanderliegender Ziele bemächtigt sich seine Sehnsucht nur dieses einen, wie wenige notwendig. Daher noch im Reiche des Idealen glückselige Inseln auftauchen und als letzte glückselige Ziele genannt werden.
Allerlei Vorgänge der Odyssee, die ich wieder gelesen habe, beschäftigen meine Phantasie. Der schlaue Lügner, der selbst Pallas Athene belügt, gibt manches zu denken. Welche Partien des Werkes sind, außer den eingestandenermaßen erlogenen, wohl noch als erfunden zu betrachten, vom Genius des erfindungsreichen Odysseus? Etwa die ganze Kette von Abenteuern, deren unsterbliche Schönheit unzerstörbar besteht? Es kommen zweifellos Stellen vor, die unerlaubt aufschneiden; so diejenige, wo die Charybdis das Wrack des Odysseus einsaugt, während er sich in das Gezweige eines Feigenbaumes gerettet hat, und wo das selbe Wrack von ihm durch einen Sprung wieder erreicht wird, als es die See an die Oberfläche zurückgibt.
Die Windstärke hat zugenommen. Hie und da kommt ein Sprühregen über Deck. Regenbogenfarbene Schleier lösen sich von den Wellenkämmen. Rechts in der Ferne haben wir italienisches Festland. Ein kleines, scheinbar flaches Inselchen gibt Gelegenheit, das Spiel der Brandung zu beobachten. Zuweilen ist es, als sähen wir den Dampf einer pfeilschnell längs der Klippen hinlaufenden Lokomotive. Weiße Raketen schießen überall auf, mitunter in so gewaltigem Wurf, daß sie, weißen Türmen vergleichbar, einen Augenblick lang stillstehen, bevor sie zusammenstürzen.
Ich lasse mir sagen, daß es sich hier nicht, wie Augenschein glauben macht, um eine Insel, sondern um eine Gruppe handelt: die Tremiti. Der freundliche Schiffsarzt Moser führt mich ins Kartenhaus und weist mir den Punkt auf der Schiffskarte. Auf den Tremiti halten die Italiener gewisse Gefangene, die im Inselbezirk bedingte Freiheit genießen.
Ein Dampfer geht zwischen uns und der Küste gleichen Kurs.
Allmählich sind wir dem Lande näher gekommen, bei schwächerem Wind und stärkerer Dünung. Das Wasser, wie immer in der Nähe von Küsten, zeigt hellgrüne Färbungen. Es gibt schwerlich eine reizvollere Art Landschaft zu genießen, als von der See aus, vom Verdeck eines Schiffes. Die Küsten, so gesehen, versprechen, was sie nie halten können. Die Seele des Schauenden ist so gestimmt, daß sie die Ländereien der Uferstrecken fast alle in einer phantastischen Steigerung, paradiesisch sieht.
Vieste, Stadt und malerisches Kastell, tauchen auf und werden dem Auge deutlich. Die Stadt zieht sich herunter um eine Bucht. Den Hintergrund bilden Höhenzüge, die ins Meer enden: zum Teil bewaldet, zum Teil mit Feldern bedeckt. Durch das Fernglas des Kapitäns erkenne ich vereinzelt gestellte Bäume, die ich für Oliven halte. Eine starke, alte Befestigungsmauer ist vom Kastell aus um die Bucht heruntergeführt. Es ist eigentümlich, wie märchenhaft der Anblick des Ganzen anmutet. Man erinnert sich etwa alter Miniaturen in Bilderhandschriften: Histoire des batailles de Judée, Teseïde oder an Ähnliches, man denkt an Schiffe von phantastischer Form im Hafen der Stadt, an Mauren, Ritter und Kreuzfahrer in ihren Gassen.
Jene, nicht allzuferne, uns Heutigen doch schon völlig fremde Zeit, wo der Orient in die abendländische Welt, wie eine bunte Welle, hineinschlug, jene unwiederbringliche Epoche, vielfältig ausschweifender, abenteuerlicher Phantastik — so ist man versucht zu denken — müsse in einer dem Gegenwartsblick so gespenstischen Stadt noch voll in Blüte stehen. Wetterwolken sammeln sich über dem hochgelegenen Kastell. Die See wogt wie dunkles Silber. Der Wind weht empfindlich kalt.
Homer in der Odyssee läßt den Charakter des Erderschütterers Poseidon durchaus nicht liebenswürdig erscheinen. Er ist es auch nicht. Er ist unzuverlässig; er hat unberechenbare Tücken. Ich empfinde die Seekrankheit, an der viele Damen und einige Herren leiden, als einen hämischen Racheakt. Der Gott übt Rache. In einer Zeit, wo er, verglichen mit ehemals, sich in seiner Macht auf eine ungeahnte Weise beschränkt und zur Duldung verurteilt sieht, rächt er sich auf die niederträchtigste Art. Ich stelle mir vor, er schickt einen aalartig-langen Wurm aus der Tiefe herauf, mit dem Kopf zuerst durch den Mund in den Magen des Seefahrers; aber so, daß der Kopf in den Magen gelangt, dort eingeschlossen, der Schwanz mittlerweile ruhig im Wasser hängen bleibt. Der Seefahrer fühlt diesen Wurm, den niemand sieht. Obgleich er ihn aber nicht sieht, so weiß er doch, daß er grün und schleimig ist, und endlos lang in die See hinunterhängt, und mit dem Kopfe im Magen festsitzt. Die schwierige Aufgabe bleibt nun die: den Wurm, der sich nicht verschlucken und auch nicht ausspucken läßt, aus dem Innern herauszubekommen.
Seltsam ist, daß Homer diesen göttlichen Kniff Poseidons unbeschrieben läßt, zumal er doch sonst im Gräßlichen keine Grenzen kennt und — von den vielerlei Todesarten, die er zur Darstellung bringt, abgesehen — einen verwandten Zustand, der dem Zyklopen Polyphem zustößt, so schildert:
Eine Gesellschaft von Tümmlern zeigt sich hie und da augenblicksschnell überm Wasser in der Nähe des Dampfers. Der Tümmler, vom Seemann als Schweinfisch bezeichnet, ist ein Delphin, der im Mittelmeer wohl fast bei jeder Tagesfahrt gesichtet wird. Er ist ein ausgezeichneter Schwimmer und sehr gefräßig.
Wir verlieren die italienische Küste wieder mehr und mehr aus den Augen. Der Nachmittag schreitet fort durch monotone Stunden, wie sie bei keiner Seereise ganz fehlen. Regenböen gehen zuweilen über Deck. Ich finde einen bequemen Sitzplatz, einigermaßen geschützt vor dem Winde. Ich schließe die Augen. Ich versinke gleichsam in die Geräusche des Meeres. Das Rauschen umgibt mich. Das große, das machtvolle Rauschen, überall her eindringend, unwiderstehlich, erfüllt meine Seele, scheint meine Seele selbst zu sein.
Ich gedenke früherer Seefahrten; darunter sind solche, die ich mit beklommener Seele habe machen müssen. Viele Einzelheiten stehen vor meinem innern Gesicht. Ich vergleiche damit meinen heutigen Zustand. Damals warf der große Ozean unser stattliches Schiff dreizehn Tage lang. Die Seeleute machten ernste Gesichter. Was ich selber für ein Gesicht gemacht habe, weiß ich nicht; denn was mich betrifft: ich erlebte damals stürmische Wochen auf zwei Meeren, und ich wußte genau, daß, wenn wir mit unserem bremensischen Dampfer auch wirklich den Hafen erreichen sollten, dies für mein eigenes, gebrechliches Fahrzeug durchaus nicht der Hafen sei.
Ich erwäge plötzlich mit einem gelinden Entsetzen, daß ich mich nun doch noch auf einer Reise nach jenem Lande befinde, in das es mich schon mit achtzehn Jahren hyperion-sehnsüchtig zog. Zu jener Zeit erzwang ich mir einen Aufbruch dahin, aber die Wunder der italienischen Halbinsel verhinderten mich, mein Ziel zu erreichen. Nun habe ich, das Versäumte nachzuholen: in 26 Jahren zuweilen gehofft, zuweilen nicht mehr gehofft, zuweilen gewünscht, zuweilen auch nicht mehr gewünscht; einmal die Reise geplant, begonnen und liegen gelassen. Und ich gestehe mir ein, daß ich eigentlich niemals an die Möglichkeit ernstlich geglaubt habe, das Land der Griechen mit Augen zu sehen. Noch jetzt, indem ich diese Notizen mache, bin ich mißtrauisch!
Ich kenne übrigens keine Fahrt, die etwas gleich Unwahrscheinliches an sich hätte. Ist doch Griechenland eine Provinz jedes europäischen Geistes geworden; und zwar ist es noch immer die Hauptprovinz. Mit Dampfschiffen oder auf Eisenbahnen hinreisen zu wollen, erscheint fast so unsinnig, als etwa in den Himmel eigener Phantasie mit einer wirklichen Leiter steigen zu wollen.
Es ist sechs Uhr und die Sonne eben im Untergehen. Der Schiffsarzt erzählt mancherlei und kommt auf die Sage vom grünen Strahl. Der grüne Strahl, den gesehen zu haben Schiffsleute mitunter behaupten, erscheint in dem Augenblick, ehe die Abendsonne ganz unter die Wasserlinie tritt. Ich weiß nicht, welche Fülle rätselhaften Naturempfindens diese schöne Vorstellung in mir auslöst. Die Alten, erklärt uns ein kleiner Herr, müßten den grünen Strahl gekannt haben; der Name des ägyptischen Sonnengottes bedeute ursprünglich: grün. Ich weiß nicht, ob es sich so verhält, aber ich fühle in mir eine Sehnsucht, den grünen Strahl zu erblicken. Ich könnte mir einen reinen Toren vorstellen, dessen Leben darin bestünde, über Länder und Meere nach ihm zu suchen, um endlich am Glanz dieses fremden, herrlichen Lichtes unterzugehen. Befinden wir uns vielleicht auf einer ähnlichen Pilgerfahrt? Sind wir nicht etwa Menschen, die das Bereich ihrer Sinne erschöpft haben, nach andersartigen Reizen für Sinne und Übersinne dürsten?
Jedenfalls ist der kleine Herr, durch den wir über den grünen Strahl belehrt wurden, ein seltsamer Pilgersmann. Das putzige Männchen reist in Schlafschuhen. Sein ganzes Betragen und Wesen erregt zugleich Befremden und Sympathie. Wohl über die fünfzig hinaus an Jahren, mit bärtigem Kopf, rundlicher Leibesfülle und kurzen Beinchen, bewegt er sich in seinen Schlafschuhen mit einer bewunderungswürdigen, stillvergnügten Gelenkigkeit. Ich habe ihn auf der Regenplane, von der die verschlossene Öffnung des Schiffsraums überzogen ist, in wahrhaft akrobatischen Stellungen bequem seine Reisebeobachtungen anstellen sehen. Zum Beispiel: er saß wie ein Türke da; indessen die Gleichgültigkeit, mit der er die unwahrscheinlichste Lage seiner Beinchen behandelte, hätte Theodor Amadeus Hoffmann stutzig gemacht. Übrigens trug er Wadenstrümpfe und Kniehosen, Lodenmantel und einen kleinen, verwegenen Tirolerhut. Mitunter machte er mitten am Tage astronomische Studien, wobei er, das Zeißglas gegen den Himmel gerichtet, die Kniee in unbeschreiblicher Weise voneinander entfernt, die Fußsohlen glatt aneinander gelegt, auf dem Rücken lag.
Wir gleiten nun schon geraume Weile unter den Sternen des Nachthimmels. Ein Schlag der Glocke, die vorn auf dem Schiff angebracht ist, bedeutet Feuer rechts. Der Leuchtturm von Brindisi ist gesichtet. Nach und nach treten drei Blinkfeuer von der Küste her abwechselnd in Wirkung. Drei neue Glockenzeichen des vorn wachthaltenden Matrosen ertönen. Sie bedeuten: Schiff in Fahrtrichtung uns entgegen. Ich habe mich so aufgestellt, daß ich die Spitze des großen Vordermasts über mir feierlich schwanken und zwischen den Sternen unaufhaltsam fortrücken sehe. Erst gegen zehn Uhr erreichen wir die enge Hafeneinfahrt von Brindisi, durch die wir, an einem Gespensterkastell vorüber, im vollen Mondlicht langsam gleiten.
Die Bewohner der Stadt scheinen schlafen gegangen zu sein. Die Hafenstraßen sind menschenleer. Treppen und Gäßchen zwischen Häusern, hügelan führend, sind ebenfalls ausgestorben. Kein Laut, nicht einmal Hundegebell, ertönt. Wir erkennen im Mondlicht und im Scheine einiger wenigen Laternen Säulenreste antiker Bauwerke. Brindisi war der südliche Endpunkt der via Appia.
Unglaublich groß wirkt das Schiff in dem kleinen, teichartigen Hafen. Aber, so groß es ist, macht es mit vieler Vorsicht am Kai fest, und erst als es fast ganz ruhig liegt, ist es bemerkt worden. Jetzt werden auf einmal die Straßen belebt. Und schon sind wir nach wenigen Augenblicken vom italienischen Lärm umgeben. Die Polizei erscheint an Bord. Wagen mit Passagieren rasseln von den Hotels heran. Drei Mandoline zupfende, alte Kerle haben sich auf Deck verpflanzt, die den Gesang einer sehr phlegmatischen Mignon begleiten.
Die Nacht liegt hinter mir. Es ist sechs Uhr früh und der 28. März. Wir sind dicht unter Land, und die Sonne tritt eben hinter den ziemlich stark beschneiten Spitzen über die höchste Erhebung des Randgebirges von Epirus voll hervor. Wenig Stratusgewölk liegt über der blauen Silhouette der Küste. Übrigens hat der Himmel Scirocco-Charakter. Streifen und verwaschene Wolkenballen unterbrechen das Himmelsblau. Das Licht der Sonne scheint blaß und kraftlos. Die Luft weht erkältend, ich spüre Müdigkeit.
Ich betrete den Speisesaal der „Salzburg“. An drei Tischen ist das Frühstück vorbereitet. Dazwischen, auf der Erde, liegen Passagiere. Einige erheben sich, noch im Hemd, von ihren Matratzen und beginnen die Kleider anzulegen. Ein großes Glasgefäß mit den verschmierten Resten einer schwarzbraunen Fruchtmarmelade steht in unappetitlicher Nähe. Der Löffel steckt seit Beginn der Reise darin.
Es ist hier alles schon Asien, bedeutet mich ein Mitreisender. Ich kann nicht sagen, daß ich besonders von diesen Übelständen berührt werde, weiß ich doch, daß Korfu, die erste Etappe der Reise, nun bald erreicht ist. Außerdem flüchtet man, nachdem man in Eile etwas Kaffee und Brot genossen hat, wieder an Deck hinaus. Die Berge der Küste, nicht höher als die, von denen etwa Lugano umgeben ist, sind noch mit einigem Schnee bestreut und ähneln ihnen, braunrötlich und kahl, durchaus. Durch diese Gebirge erscheint das Hinterland wie durch einen gigantischen Wall vor dem Meere geschützt.
Man hat jetzt nicht mehr das Gefühl, im offenen Meere zu sein, sondern wir bewegen uns in einer sich mehr und mehr verengenden Wasserstraße. Überall tauchen Küsten und Inseln auf, und nun zur Rechten bereits die Höhen von Korfu. Noch immer schweben mit Gelächter oder Geläut begleitende Möven über uns.
Je länger und näher wir an dem nördlichen Rande von Korfu hingleiten, um so fieberhafter wird das allgemeine Leben an Deck. In schöner Linie langsam ansteigend, gipfelt das Eiland in zwei Spitzen, sanft darnach wieder ins Meer verlaufend. Wieder bemächtigt sich unser jenes Entzücken, das uns eine Küsten-Landschaft bereitet, die man vom Meere aus sieht. Diesmal ist es in mir fast zu einem inneren Jubel gesteigert, im Anblick des schönen Berges, den wir allmählich nach Süden umfahren, und der seine von der Morgensonne beschienenen Abhänge immer deutlicher und verlockender ausbreitet. Ich sage mir, dieses köstliche, fremde Land wird nun auf Wochen hinaus — und Wochen bedeuten auf Reisen viel! — für mich eine Heimat sein.
Was mir bevorsteht, ist eine Art Besitzergreifen. Es ist keine unreale, materielle Eroberung, sondern mehr. Ich bin wieder jung. Ich bin berauscht von schönen Erwartungen, denn ich habe von dieser Insel, solange ich ihren Namen kannte, Träume geträumt.
Es ist zehn Uhr. Wir befinden uns nun in einer wahrhaft phäakischen Bucht. Drepane, Sichel, hieß die Insel im ältesten Altertum, und wir sind in dem Raume der inneren Krümmung. Aber das Jonische Meer ist hier einem weiten, paradiesischen Landsee ähnlich, weil auch der offene Teil der Sichel durch die epirotischen Berge hinter uns scheinbar geschlossen ist.
Ich vermag vor Kopfneuralgien kaum aus den Augen zu sehen. Ich bin insofern ein wenig enttäuscht, als unser Hotel rings von den Häusern der Stadt umgeben ist und es nicht leicht erscheint, zu jenen einsamen Wegen durchzudringen, die mich vom Schiff aus anlockten und die für meine besondere Lebensweise so notwendig sind. Ein kurzer Gang durch einige Straßen von Korfu, der Stadt, zwingt mich, die Bemerkung zu machen, daß hier viele Bettler und Hunde sind. Eine bettelnde Korfiotin, ein robustes Weib in griechischer Tracht, das Kind auf dem Arm, geht mich um eine Gabe an, und ich vermag den feurigen Blicken ihrer beiden flehenden Augen mein hartes Herz nicht erfolgreich entgegenzusetzen.
Ich sehe die ersten griechischen Priester, die im Schmuck ihrer schwarzen Bärte, Talare und hohen, röhrenförmigen Kopfbedeckungen Magiern ähneln, auf Plätzen und Gassen herumstreichen. Die nicht sehr zahlreichen Fremden gehen mit eingezogenen Köpfen umher, es ist ziemlich kalt. Im oberen Stock eines Hauses wird Schule gehalten. Die Kinder, im Innern des Zimmers, singen. Die Lehrer gucken lachend und lebhaft schwatzend zum Fenster heraus. Die Stimmen der Singenden haben mehr einen kühlen, deutschen Charakter und nicht den feurigen, italienischen, an den man im Süden gewöhnt ist. Zuweilen singt einer der Lehrer zum offenen Fenster heraus lustig mit.
Die Stadt Korfu ist in ihrem schöneren Teil durch einen sehr breiten, vergrasten Platz von der Bucht getrennt. Es ist außerordentlich angenehm, hier zu lustwandeln. Ein Capodistria-Denkmal und ein marmornes Rundtempelchen verlieren sich fast auf der weiten Grasfläche. Nach dem Meer hin läuft sie in eine Felszunge aus, die alte Befestigungen aus den Zeiten der Venezianer trägt. Ich begegne kaum einem Menschen. Die Morgensonne liegt auf dem grünen Plan, ein Schäfchen grast nicht weit von mir. Ein Truthahn dreht sich und kollert in der Nähe der langen Hausreihe, deren zahllose Fenster geöffnet sind und den Gesang von — ich weiß nicht wie vielen! — Harzer Rollern in die erquickende Luft schicken.
Wir unternehmen am Nachmittag eine Fahrt über Land; es ist in der Luft eine außerordentlich starke Helligkeit. Figi d’India-Kakteen säumen mauerartig die Straße. Wir sehen violette Anemonen unten am Wegrand, Blumen von neuem und wunderbarem Reiz. Warum will man den Blumen durchaus Eigenschaften von Tieren oder von Menschen andichten und sie nicht lieber zu Göttern machen? Diese kleinen göttlichen Wesen, deren köstlicher Liebreiz uns immer wieder Ausrufe des Entzückens entlockt, zeigen sich in um so größeren Mengen, je mehr wir uns von der Küste entfernen, ins Innere des Eilands hinein.
Der Blick weitet sich bald über Wiesen mit saftig grünen, aber noch kurzen Gräsern, die fleckweise wie beschneit von Margueriten sind. In diesen fast nordischen Rasenflächen stehen Zypressen vereinzelt da und eine südliche Bucht, der Lago di Caliciopolo lacht dahinter auf. In der Straße, die eben diese Bucht mit dem Meere verbindet, erhebt sich ein kleiner, von Mauern und Zypressen gekrönter Fels. Die Mauern bilden ein Mönchskloster. Ponticonisi oder Mausinsel heißt das Ganze, wovon man behauptet, es sei das Phäakenschiff, das, nachdem es Odysseus nach seiner Heimat geleitet hatte, bei seiner Rückkehr, fast schon im Hafen, von Poseidon zu Stein verwandelt worden ist.
Wiesen und umgeworfene Äcker begleiten uns noch. Vollbusige, griechische Frauen, in bunter Landestracht, arbeiten in den Feldern. Kleine, zottelige, unglaublich ruppige Gäule grasen an den Rainen und zwischen Olivenbäumen, an steinigen Abhängen. Auf winzige Eselchen sind große Lasten gelegt, und der Treiber sitzt auf der Last oder hinter der Last noch dazu.
Wir nähern uns mehr und mehr einem Berggebiet. Die Ölwälder geben der Landschaft einen ernsten Charakter. Die tausendfach durchlöcherten Stämme der alten Bäume sind wie aus glanzlosem Silber geflochten. Im Schutze der Kronen wuchert Gestrüpp und ein wildwachsender Himmel fremdartiger Blüten auf.
Das Achilleion der Kaiserin Elisabeth ist auf einer Höhe errichtet, in einer Eiland und Meer beherrschenden Lage. Der obere Teil des Gartens ist ein wenig beengt und kleinlich, besonders angesichts dieser Natur, die sich um ihn her in die Tiefen ausbreitet. Und jener Teil, der zum Meere hinuntersteigt, ist zu steil. Von erhabener Art ist die Achillesverehrung der edlen Frau, obgleich dieser Zug, durch Künstler der Gegenwart, würdigen Ausdruck hier nicht gefunden hat. Das Denkmal Heines, eine halbe Stunde entfernt, unten am Meere, können wir, weil es bereits zu dunkeln beginnt, nicht mehr besuchen.
Die unvergleichlich Edele unter den Frauengestalten jüngster Vergangenheit, die, nach ihresgleichen in unserem Zeitalter vergeblich suchend, einsam geblieben ist, vermochte natürlicherweise den kunstmäßigen Ausdruck ihrer Persönlichkeit nicht selbst zu finden. Und leider schufen Handlangernaturen auch hier nur wieder im ganzen und großen den Ausdruck desselben, dem sie entfliehen wollte. Und nur der Platz, die Welt, der erhabene Glanz und Ernst, in den sie entfloh, legt von diesem Wesen noch gültiges Zeugnis ab.
Wir schreiben den 30. März. Helle, warme Sonne, blendendes Licht überall. Der Morgen ist heiter, erfrischend die Luft. Die Stadt ist erfüllt vom Geschrei der Ausrufer. Viele Menschen liegen jetzt, gegen 9 Uhr früh, am Rande eines kleinen, öffentlichen Platzes umher und sonnen sich. Eine ganze Familie ist zu beobachten, die sich an eine Gartenmauer gelagert hat, in einem sehr notwendigen Wärmebedürfnis wahrscheinlich, da die Nächte kalt und die Keller, in denen die Armen hier wohnen, nicht heizbar sind. Sie genießen die Strahlen der Sonne mit Wohlbehagen, wie Ofenglut. Dabei zeigt sich die Mutter insofern ganz ungeniert durch die Öffentlichkeit, als sie, gleich einer Äffin, in den verfilzten Haaren ihres Jüngsten herumfingert, sehr resolut, obgleich der kleine Gelauste schrecklich weint.
Am Kai der Kaiserin Elisabeth steigert sich der Glanz des Lichtes noch, im Angesichte der schönen Bucht. Das Kai ist eine englische Anlage und die Nachmittagspromenade der korfiotischen Welt. Es wird begleitet von schönen Baumreihen, die, wo sie nicht aus immergrünen Arten gebildet sind, erstes, zartes Grün überzieht. Junge Männer haben Teppiche aus den Häusern geschleppt und auf dem Grase zwischen den Stämmen ausgebreitet. Ein scheußliches, altes, erotomanisches Weib macht unanständige Sprünge in den heiteren Morgen hinein. Sie schreit und schimpft: die Männer lachen, verspotten sie gutmütig. Sie kratzt sich mit obscöner Gebärde, bevor sie davongeht und hebt ihre Lumpen gegen die Spottlustigen.
Ich habe jetzt nicht mehr die tiefblaue, köstlich blinkende Bucht zur Linken, mit den weißen Zelten der albanesischen Berge dahinter, sondern ein großes Gartengebiet, und wandere weiter, meist unter Ölbäumen, bis Ponticonisi dicht unter mir liegt. Von hier gegenüber mündet ein kleines Flüßchen ins Meer und man will dort die Stelle annehmen, wo Odysseus zuerst ans Ufer gelangte und Nausikaa ihm begegnet ist.
Goethes Entwurf zur Nausikaa begleitet mich.
„Was rufen mich für Stimmen aus dem Schlaf?
Wie ein Geschrei, ein laut Gespräch der Frauen
Erklang mir durch die Dämmrung des Erwachens.
Hier seh ich niemand! Scherzen durchs Gebüsch
Die Nymphen? oder ahmt der frische Wind,
Durchs hohe Rohr des Flusses sich bewegend,
Zu meiner Qual die Menschenstimmen nach?
Wo bin ich hingekommen? welchem Lande
Trug mich der Zorn des Wellengottes zu?“
Ich meine, wenn dieses anziehende Fragment die starke Liebe wieder erweckt, oder eine ähnlich starke, wie im Herzen seines Dichters war, so kann dies kein Grund zum Vorwurf sein. Auch dann nicht, wenn diese Liebe das Fehlende, das Ungeborene, zu erkennen vermeint, oder gar zu ergänzen unternimmt. Dieser gelassene Ton, der so warm, stark, richtig und deutsch ist, wird meist durchaus mißverstanden. Man nimmt ihn für kühl und vergißt auch in der Sprache der Iphigenie die „by very much more handsome than fine“ ist, die alles durchdringende Herzlichkeit.
Der Rückweg nach der Stadt führt zwischen wahre Dickichte von Orangen, Granaten und Himbeeren. Eukalyptusbäume mit großgefleckten Stämmen von wunderbarer Schönheit begegnen. Hie und da wandeln Kühe im hohen Gras unter niedrig gehaltenen Orangenpflanzungen. Steinerne Häuschen, Höhlen der Armut, bergen sich inmitten der dichten Gärten. Kinder betteln mit Fröhlichkeit, starrend von Schmutz.
Immer weiter zwischen verwilderten Hecken, mit Blüten bedeckten, schreiten wir. Ich bemerke, außer vielen Brombeeren, dickstämmigen, alten Weißdorn. Marguerits, wie Schnee über Wegrändern und Wiesen, bilden weiße, liebliche Teppiche des Elends. Erbärmliche Höfe sind von Aloepflanzen eingehegt, über deren Stacheln unglaubliche Lumpen zum Trocknen gebreitet sind, und in der Nähe solcher Wohnstätten riecht es nach Müll. Ich sehe nur Männer bei der Feldarbeit. Die Weiber faulenzen, liegen im Dreck und sonnen sich.
Ein griechischer Hirt kommt mir entgegen, ein alter, bärtiger Mann. Die ganze Erscheinung ist wohlgepflegt. Er trägt kretensische Tracht, ein rockartiges, blaues Beinkleid, zwischen den Beinen gerafft, Schnabelschuh’, die Waden gebunden, ein blaues Jäckchen mit Glanzknöpfen, dazu einen strohenen Hut. Fünf Ziegen, nicht mehr, trotten vor ihm hin. Er klappert mit vielen kleinen Blechkannen, die, an einem Riemen hängend, er mit sich führt.
Ein frischer Nordwest hat eingesetzt, jetzt, am Nachmittag. Zwei alte Albanesen, dazu ein Knabe, schreiten langsam über die Lespianata. Einer der würdigen Weißbärte trägt über zwei Mänteln den dritten, dessen Kapuze er über den Kopf gezogen hat. Der unterste Mantel ist von hellerem Tuch, der zweite blau, der dritte über und über bedeckt mit langen, weißlichen Wollzotteln, ähnlich dem Ziegenhaar. Der Sauhirt Eumäus fällt mir ein und die Erzählung des Bettlers Odysseus von seiner List, durch die er nicht nur von Thoas, dem Sohne Andrämons, den Mantel erhielt, sondern auch von Eumäus.
Es scheint, daß die Zahl der Mäntel den Wohlstand ihrer Träger andeutet. Denn auch der zweite dieser imponierenden Berghirten hat drei Mäntel übergeworfen. Dabei tragen sie weiße Wollgamaschen und graulederne Schnabelschuh’. Jeder von ihnen überdies einen ungeschälten, langen Stab. Der Knabe trägt ein rotes Fez. Die Schnäbel seiner roten Schuhe sind länger, als die der Alten und jeder mit einer großen, schwarzen Quaste geziert.
Die Hafenstraßen zeigen das übliche Volksgetriebe. Die Läden öffnen sich auf schmale, hochgelegene Lauben, aus denen man in das Menschengewimmel der engen Gäßchen hinuntersieht. Ein Mann trägt Fische mit silbernen Schuppen auf dem flachen Handteller eilend an mir vorbei. Junge Schafe und Ziegen hängen, ausgeweidet und blutend, vor den Läden der Fleischer. Über der Tür einer Weinstube voll riesiger Fässer sind im Halbkreis Flaschen mit verschieden gefärbtem Inhalt an Schnüren ausgehängt. Man hat schlechte Treppen, übelriechende Winkel zu vermeiden, vertierten Bettlern aus dem Wege zu gehn.
Einer dieser Bettler nähert sich mir. Er überbietet jeden sonstigen, europäischen Eindruck dieser Art. Seine Augen glühen über einem sackartigen Lumpen hervor, mit dem er Mund, Nase und Brust vermummt hat. Er hustet in diese Umhüllung hinein. Er bleibt auf der Straße stehen und hustet, krächzt, pfeift mit Absicht, um aufzufallen, sein fürchterliches Husten minutenlang. Es ist schwer, sich etwas so Abstoßendes vorzustellen, als dieses verlauste, unflätige, barfüßige und halbnackte Gespenst.
Ich verbringe die Stunde um Sonnenuntergang in dem schönen, verwilderten Garten, der dem König von Griechenland gehört. Es ist eine wunderbare Wildnis von alten Zypressen-, Oliven- und Eukalyptusbäumen, ungerechnet alle die blühenden Sträucher, in deren Schatten man sich bewegt. Vielleicht wäre es schade, wenn dieser Garten oft vom König besucht würde, denn bei größerer Pflege müßte er vieles verlieren von dem Reiz des Verwunschenen, der ihm jetzt eigen ist. Die Riesenbäume schwanken gewaltig im Winde und rauschen dazu: ein weiches, aufgestörtes Rauschen, in das sich der eherne Ton des Meeres einmischt.
Wie ich heute morgen das Fenster öffne, ist die Sonne am wolkenlosen Himmel längst aufgegangen. Ich bemerke, daß alles in einem fast weißen Lichte unter mir liegt: die Straßen und Dächer der Stadt, der Himmel, die Landschaft mit ihren Wiesen, Olivenwäldern und fernen Bergen. Als ich aus dem Hotel trete, muß ich die Augen fast schließen, und lange, während ich durch den nördlichen Stadtteil Korfus hinauswandere, suche ich meinen Weg blinzelnd.
Die Vorstadt zeigt das übliche Bild. Auf kleinen Eselchen sitzen Reiter, so groß, daß man meint, sie könnten ihr Reittier mühelos in die Tasche stecken. Ruppige Pferdchen, braunschwarz oder schwarz, mit Schweifen, die bis zur Erde reichen, tragen allerlei tote Lasten und lebende Menschen dazu. Vor ihren zumeist einstöckigen Häusern hocken viele Bewohner und sonnen sich. Eine junge Mutter säugt, auf ihrer Türschwelle sitzend, ihr jüngstes Kind und laust es zugleich, in aller Behaglichkeit und Naivetät. Die weißen Mauerflächen werfen das Licht zurück und erzeugen Augenschmerzen.
Ich komme nun in die Region der Weiden und Ölgärten. Auf einer ebenen Straße, die stellenweise vom Meere bespült, dann wieder durch sumpfige Strecken oder Weideland vom Rande der großen, inneren Bucht getrennt ist. Ich ruhe ein wenig, auf einem Stück Ufermauer am Ausgang der Stadt. Die Sonne brennt heiß. Von den angrenzenden Hügeln steigt ein albanesischer Hirte mit seinen Schafen zur Straße herunter: trotz der Wärme trägt er seine drei Mäntel, oben den fließartigen, über die Schultern gehängt. Ein sehr starkes und hochbeiniges Mutterschwein kommt aus der Stadt und schreitet hinter seinen Ferkeln an mir vorüber. Es folgt ein Eber, der kleiner ist.
Es ist natürlich, wenn ich auch hier wieder an Eumäus denke, den göttlichen Hirten, eine Gestalt, die mir übrigens schon seit längerer Zeit besonders lebendig ist. Eigentümlicherweise umgibt das Tier, dessen Pflege und Zucht ihm besonders oblag, noch heute bei uns auf dem Lande eine Art alter Opferpoesie. Es ist das einzige Tier, das von kleinen Leuten noch heute, nicht ohne große festliche Aufregung, im Hause geschlachtet wird. Das Barbarische liegt nicht in der naiven Freude an Trunk und Schmaus; denn die homerischen Griechen, gleich den alten Germanen, neigten zur Völlerei. Metzgen, essen, trinken, gesundes Ausarbeiten der Glieder im Spiel, im Kampfspiel zumeist, das alles im Einverständnis mit den Himmlischen, ja in ihrer Gegenwart, war für griechische wie für germanische Männer der Inbegriff jeder Festlichkeit.
Es liegt in dem Eumäus-Idyll eine tiefe Naivetät, die entzückend anheimelt. Kaum ist irgendwo im Homer eine gleiche menschliche Wärme zu spüren wie hier. Es wäre vielleicht von dieser Empfindung aus nicht unmöglich, dem ewigen Gegenstande ein neues, lebendiges Dasein für uns zu gewinnen.
Es ist nicht durchaus angenehm, außer zum Zweck der Beobachtung, durch diese weiße, stauberfüllte Vorstadt zurück den Weg zu nehmen. Unglaublich, wieviele Murillosche Kopfreinigungen man hier öffentlich zu sehen bekommt! Es ist glühend heiß. Scharen von Gänsen fliegen vor mir auf und vermehren den Staub, ihn, die weite Straße hinabfliegend, zu Wolken über sich jagend. Hochrädrige Karren kommen mir entgegen. Hunde laufen über den Weg: Bulldoggen, Wolfshunde, Pintscher, Fixköter aller Art! Gelbe, graue und schwarze Katzen liegen umher, laufen, fauchen, retten sich vor Hunden auf Fensterbrüstungen. Eselchen schleppen Ladungen frischgeflochtener Körbe, die den Entgegenkommenden das Ausweichen fast unmöglich machen. Eine breitgebaute, griechische Bäuerin drückt, im bildlichen Sinne, wie sie pompös einherschreitet, ihre Umgebung an die Wand. Bettler, mit zwei alten Getreidesäcken bekleidet, den einen unter den Achseln um den Leib geschlungen, den andern über die Schultern gehängt wie ein Umschlagetuch, sprechen die Inhaber ärmlicher Läden um Gaben an. Ein junger Priesterzögling von sehr gepflegtem Äußeren, mit schwarzem Barett und schwarzer Sutane, ein Jüngling, der schön wie ein Mädchen ist, von einem gemeinen Manne, dem Vater oder Bruder begleitet, geht mir entgegen. Der Arm des Begleiters ist um die Schultern des Priesters gelegt, dessen tiefschwarz glänzendes Haar im Nacken zu einem Knoten geflochten ist. Weiber und Männer blicken ihm nach.
Heute entdecke ich eigentlich erst den Garten des Königs und seine Wunder. Ich nehme mir vor, von morgen ab mehrere Stunden täglich hier zuzubringen. Seit längerer Zeit zum ersten Male genieße ich hier jene köstlichen Augenblicke, die auf Jahre hinaus der Seele Glanz verleihen, und um derentwillen man eigentlich lebt. Es dringt mir mit voller Macht ins Gemüt, wo ich bin, und daß ich das Jonische Meer an den felsigen Rändern des Gartens brausen höre.
Wir haben heute den 1. April. Meine Freunde, die Maler sind, und ich, haben uns am Eingange der Königsvilla von einander getrennt, um, jeder für sich, in dem weiten, verwilderten Gartenbereich auf Entdeckungen auszugehen. Es ist ein Morgen von unvergleichlicher Süßigkeit. Ich schreibe, meiner Gewohnheit nach, im Gehen, mit Bleistift diese Notizen. Mein Auge weidet. Das Paradies wird ein Land voll ungekannter, köstlicher Blumen sein. Die herrlichen Anemonen Korfus tragen mit dazu bei, daß man Ahnungen einer andern Welt empfindet. Man glaubt beinahe, auf einem fremden Planeten zu sein.
In dieser eingebildeten Loslösung liegt eine große Glückseligkeit.
Ich finde nach einigem Wandern die Marmorreste eines antiken Tempelchens. Es sind nur Grundmauern; einige Säulentrommeln liegen umher. Ich lege mich nieder auf die Steine, und eine unsägliche Wollust des Daseins kommt über mich. Ein feines, glückliches Staunen erfüllt mich ganz, zunächst fast noch ungläubig, vor diesem nun Ereignis gewordenen Traum.
Weniger um etwas zu schaffen, als vielmehr um mich ganz einzuschließen in die Homerische Welt, beginne ich ein Gedicht zu schreiben, ein dramatisches, das Telemach, den Sohn des Odysseus, zum Helden hat. Umgeben von Blumen, umtönt von lautem Bienengesumm, fügt sich mir Vers zu Vers, und es ist mir allmählich so, als habe sich um mich her nur mein eigener Traum zu Wahrheit verdichtet.
Die Lage des Tempelchens am Rande der Böschung, hoch überm Meer, ist entzückend; alte, ernste Oliven umgeben in einiger Ferne die Vertiefung, in die es gestellt ist. Welchem Gotte, welchem Heros, welchem Meergreise, welcher Göttin oder Nymphe war das Tempelchen etwa geweiht, das in das grüne Stirnband der Uferhöhe eingeflochten, dem nahenden Schiffer entgegenwinkte? diese kleine, schweigende Wohnung der Seligen, die, Weihe verbreitend, noch heute das Rauschen der Ölbäume, das schwelgerische Summen der Bienen, das Duftgewölke der Wiesen als ewige Opfergaben entgegennimmt. Die kleinen, blinkenden Wellen des Meeres ziehen, vom leisen Ost bewegt, wie in himmlischer Prozession heran, und es ist mir, als wäre ich nie etwas anderes, als ein Diener der unsterblichen Griechengötter gewesen.
Ich weiß nicht, wie ich auf die Vermutung komme, daß unterhalb des Tempelchens eine Grotte und eine Quelle sein müsse. Ich steige verfallene Stufen tief hinab und finde beides. Quellen und Grotten münden auf grüne von Marguerits übersäte Terrassen, in ihrer versteckten Lage von süßestem Reiz. Ich bin hier, um die Götter zu verehren, zu lieben und herrschen zu machen über mich. Deshalb pflücke ich Blumen, werfe sie in das Becken der Quelle, zu den Najaden und Nymphen flehend, den lieblichen Töchtern des Zeus.
Ein brauner, schwermütiger Sonnenuntergang. Wir finden uns an die Schwermut norddeutscher Ebenen irgendwie erinnert. Es ist etwas Kühles in Licht und Landschaft, das vielleicht deutlicher vorstellbar wird, wenn man es unitalienisch nennt. Das Landvolk, obgleich die Bäuerinnen imposant und vollbusig sind und von schöner Rasse, erscheint nach außen hin temperamentlos, im Vergleich mit Italien, und zwar trotz des italienischen Einschlags. Es kommt uns vor, als wäre das Leben hier nicht so kurzweilig, wie auf der italienischen Halbinsel.
Die griechische Bäuerin hat durchaus den graden, treuherzigen Zug, der den Männern hier abgeht, und den man als einen deutschen gern in Anspruch nimmt. Sinnliches Feuer scheint ebenso wenig Ausdruck ihrer besonderen Art zu sein, als bei den homerischen Frauengestalten. Überhaupt erscheinen mir die homerischen Zustände den frühen germanischen nicht allzu fern stehend. Der homerische Grieche ist Krieger durchaus, ein kühner Seefahrer, wie der Normanne verwegener Pirat, von tiefer Frömmigkeit bis zur Bigotterie, trunkliebend, zur Völlerei neigend, dem Rausche großartiger Gastereien zugetan, wo der Gesang des Skalden nicht fehlen durfte.
Ich habe mich auf den Resten des antiken Tempelchens, das ich nun schon zum dritten- oder viertenmal besuche, niedergelassen. Es fällt lauer Frühlingsregen. Ein großer, überhängender, weidenartiger Strauch umgibt mich mit dem Arom seiner Blüten. Die Wellen wallfahrten heut mit starkem Rauschen heran. Immer der gleiche Gottesdienst in der Natur. Wolkendünste bedecken den Himmel.
Immer erst, wenn ich auf den Grundmauern dieses kleinen Gotteshauses gestanden habe, fühle ich mich in den Geist der Alten entrückt und glaube in diesem Geiste alles rings umher zu empfinden. Ich will nie diese Stunden vergessen, die in einem ungeahnten Sinne erneuernd sind. Ich steige ans Meer zu den Najaden hinunter. Auf den Stufen bereits vernehme ich das Geschrei einer Ziege, von der Grotte und Quelle empordringend. Ich bemerke, wie das Tier von einem großen, rotbraunen Segel beunruhigt ist, das sich dem Lande, düster schattend, bis auf wenige Meter nähert, um hier zu wenden. Unwillkürlich muß ich an Seeraub denken und das fortwährende, klägliche Hilferufen des geängstigten Tieres bringt mir, beim Anblick des großen, drohenden Segels, die alte Angst des einsamen Küstenbewohners, vor Überfällen, nah.
Oft ist bei Homer von schwarzen Schiffen die Rede. Ob sie nicht etwa den Nordlandsdrachen ähnlich gewesen sind? Und ob nicht etwa die homerischen Griechen, die ja durchaus Seefahrer und Abenteurernaturen waren, auch das griechische Festland vom Wasser aus zuerst betreten haben?
Eigentümlich ist es, wie sich in einem Gespräch des Plutarch eine Verbindung des hohen Nordens mit diesem Süden andeutet; wo von Völkern griechischen Stammes die Rede ist, die etwa in Kanada angesessen waren, und von einer Insel Ogygia, wo der von Zeus entthronte Kronos gleichsam in Banden eines Winterschlafes gefangen saß. Besonders merkwürdig ist der Zug, daß jener entthronte Gott, Kronos oder Saturn, noch immer alles dasjenige träumte, was der Sohn und Sieger im Süden, Zeus, im Wachen sah. Also etwa, was jener träumte, war diesem Wirklichkeit. Und Herakles begab sich einst in den Norden zurück, und seine Begleiter reinigten Sitte und Sprache der nördlichen Griechen, die inzwischen verwahrlost waren.
Ich strecke mich auf das saftige Grün der Terrasse unter die zahllosen Gänseblümchen aus, als ob ich, ein erster Grieche, soeben nach vieler Mühsal gelandet wäre. Ein starkes Frühlingsempfinden dringt durch mich; und in diesem Gefühle eins mit dem Sprossen, Keimen und Blühen rings um mich her, empfinde ich jeden Naturkult, jede Art Gottesdienst, jedes irgendwie geartete höhere Leben des Menschen durch Eros bedingt.
Ich beobachte eben, vor Sonnenuntergang, in einer Ausbuchtung der Kaimauer, zwei Muselmänner. Sie verrichten ihr Abendgebet. Die Gesichter „nach Mekka“ gewendet, gegen das Meer und die epirotischen Berge, stehen sie ohne Lippenbewegung da. Die Hände sind nicht gefaltet, nur mit den Spitzen der Finger aneinandergelegt. Jetzt, indem sie sich auf ein Knie senken, machen sie gleichzeitig eine tiefe Verneigung. Diese Bewegung wird wiederholt. Sie lassen sich nun auf die Kniee nieder und berühren mit den Stirnen die Erde. Auch diesen Ausdruck andachtsvoller Erniedrigung wiederholen sie. Aufgerichtet, beten sie weiter. Nochmals sinken sie auf die Kniee und berühren mit ihren Stirnen wieder und wieder den Boden. Alsdann fährt sich, noch kniend, der ältere von den beiden Männern mit der Rechten über das Angesicht und über den dunklen, graumelierten Bart, als wollte er einen Traum von der Seele streifen, und nun kehren sie, erwacht, aus dem inneren Heiligtum in das laute Straßenleben, das sie umgibt, zurück. Wer diese Kraft zur Vertiefung sieht, muß die Macht anerkennen und verehren, die hier wirksam ist.
Heut werfen die Wellen ihre Schaumschleier über die Kaimauer der Strada marina. Die Möven halten sich mit Meisterschaft gegen den starken Südwind über den bewegten Wassern des Golfes von Kastrades. Es herrscht Leben und Aufregung. Von gestern zu heut sind die Baumwipfel grün geworden im lauen Regen.
Die Luft ist feucht. Der Garten, in den ich eintrete, braust laut. Der Garten der Kirke, wie ich den Garten des Königs jetzt lieber nenne, braust laut und melodisch und voll. Düfte von zahllosen Blüten dringen durch dunkle, rauschende Laubgänge und strömen um mich mit der bewegten Luft. Es ist herrlich! Der Webstuhl der Kirke braust wie Orgeln: Choräle, endlos und feierlich. Und während die Göttin webt, die Zauberin, bedeckt sich die Erde mit bunten Teppichen. Aus grünen Wipfeln brechen die Blüten: gelb, weiß und rot, wie Blut. Das zarteste der Schönheit entsteht ringsum. Millionen kleiner Blumen trinken den Klang und wachsen in ihm. Himmelhohe Zypressen wiegen die schwarzen Wedel ehrwürdig. Der gewaltige Eukalyptus, an dem ich stehe, scheint zu schaudern vor Wonne, im Ansturm des vollen, erneuten Lebenshauchs. Das sind Boten, die kommen! Verkündigungen!
Wie ich tiefer in das verwunschene Reich eindringe, höre ich über mir in der Luft das beinahe melodische Knarren eines großen Raben. Ich sehe ihn täglich, nun schon das drittemal: den Lieblingsvogel Apollons. Er überquert eine kleine Bucht des Gartens. Der Wind trägt seine Stimme davon, denn ich sehe nur noch, wie er seinen Schnabel öffnet.
Immer noch umgibt mich das Rauschen, das allgemeine, tiefe Getöse. Es scheint aus der Erde zu kommen. Es ist, als ob die Erde selbst tief und gleichmäßig tönte, mitunter bis zu einem unterirdischen Donner gesteigert.
Im Schatten der Ölbäume, im langhalmigen Wiesengras, gibt es viele gemauerte Wasserbrunnen. Über einem, der mir vor Augen liegt, sehe ich Nymphe und Najade gesellt, denn der Gipfel eines Baumes, dessen Stamm im Innern der Zisterne heraufdringt, überquillt ihre Öffnung mit jungem Grün. Die Grazien umtanzen in Gestalt vieler zartester Wiesenblumen den verschwiegenen Ort.
Die Gestalten der Kirke und der Kalypso ähneln einander. Jede von ihnen ist eine „furchtbare Zauberin“, jede von ihnen trägt ein anmutig feines Silbergewand, einen goldenen Gürtel und einen Schleier ums Haupt. Jede von ihnen hat einen Webstuhl, an dem sie ein schönes Gewebe webt. Jede von ihnen wird abwechselnd Nymphe und Göttin genannt. Sie haben beide eine weibliche Neigung zu Odysseus, der mit jeder von ihnen das Lager teilen darf. Beide, an bestimmte Wohnplätze gebunden, sind der mythische Ausdruck sich regender Wachstumskräfte in der Frühlingsnatur, nicht wie die höheren Gottheiten überall, sondern an diesem und jenem Ort. In Kirke scheint das Wesen des Mythus, und besonders in ihrer Kraft zu verwandeln, tiefer und weiter, als in Kalypso ausgebildet zu sein.
Das Rauschen hat in mir nachgerade einen Rausch erzeugt, der Natur und Mythus in eins verbindet, ja ihn zum phantasiegemäßen Ausdruck von jener macht. Auf den Steinen des antiken Tempelchens sitzend, höre ich Gesang um mich her, Laute von vielen Stimmen. Ich bin, wie durch einen leisen, unwiderstehlichen Zwang, in meiner Seele willig gemacht, Zeus und den übrigen Göttern Trankopfer auszugießen, ihre Nähe im Tiefsten empfindend. Es ist etwas Rätselhaftes auch insofern um die Menschenseele, als sie zahllose Formen anzunehmen befähigt ist. Eine große Summe halluzinatorischer Kräfte sehen wir heut als krankhaft an, und der gesunde Mensch hat sie zum Schweigen gebracht, wenn auch nicht ausgestoßen. Und doch hat es Zeiten gegeben, wo der Mensch sie voll Ehrfurcht gelten und menschlich auswirken ließ.
„Und in dem hohen Palaste der schönen Zauberin dienten
Vier holdselige Mägde, die alle Geschäfte besorgten.
Diese waren Töchter der Quellen und schattigen Haine
Und der heiligen Ströme, die in das Meer sich ergießen.“
Die schöne Wäscherin, die ich an einem versteckten Röhrenbrunnen arbeiten sehe, auf meinem Heimwege durch den Park — die erste schöne Griechin überhaupt, die ich zu Gesicht bekomme! — sie scheint mir eine von Kirkes Mägden zu sein. Und wie sie mir in die Augen blickt, befällt mich Furcht, als läge die Kraft der Meisterin auch in ihr, Menschen in Tiere zu verwandeln, und ich sehe mich unwillkürlich nach dem Blümchen Molly um.
Heut, den 5. April, hat ein großes Schiff dreihundert deutsche Männer und Frauen am Strande von Korfu abgesetzt. Ein mit solchen Männern und Frauen beladener Wagen kutscht vor mir her. Auf der Strada marina läßt Gevatter Wurstmacher den Landauer anhalten, steigt heraus und nimmt mit einigen lieben Anverwandten, eilig, in ungezwungener Stellung, photographiergerecht, auf der Kaimauer Platz. Ein schwarzbärtiger Idealist mit langen Beinen und engem Brustkasten erhebt sich auf dem Kutschbock und photographiert. Am Eingange meines Gartens holt die Gesellschaft mich wieder ein, die sich durch das unumgängliche Photographieren verzögert hat. „Palais royal?“ tönt nun die Frage an den Kutscher auf gut Französisch. —
Und wie ich den Garten der Zauberin wieder betrete, von heimlichem Lachen geschüttelt, fällt mir eine Geschichte ein: Mitridates steckte einst in Kleinasien einen Hain der Eumeniden in Brand, und man hörte darob ein ungeheures Gelächter. Die beleidigten Götter forderten nach dem Spruche der Seher Sühnopfer. Die Halswunde jenes Mädchens aber, das man hierauf geschlachtet hatte, lachte noch auf eine furchtbare Weise fort.
Das eine der Fenster unseres Wohnsaales im Hotel Belle Venise gewährt den Blick in eine Sackgasse. Dort ist auch ein Abfallwinkel des Hotels. Der elende Müllhaufen übt eine schreckliche Anziehungskraft auf Tiere und Menschen aus. So oft ich zum Fenster hinausblicke, bemerke ich ein anderes hungriges Individuum, Hund oder Mensch, das ihn durchstöbert. Ohne jeden Sinn für das Ekelhafte greift ein altes Weib in den Unrat, nagt das sitzengebliebene Fleisch aus Apfelsinenresten und schlingt Stücke der Schale ganz hinab. Jeden Morgen erscheinen die gleichen Bettler, abwechselnd mit Hunden, von denen mitunter acht bis zehn auf einmal den Haufen durchstören. Diese scheußliche Nahrungsquelle auszunützen, scheint der einzige Beruf vieler unter den ärmsten Bewohnern Korfus zu sein, die in einem Grade von Armut zu leben gezwungen sind, der, glaube ich, selbst in Italien selten ist. Von Müllhaufen zu Müllhaufen wandern, welch ein unbegreifliches Los der Erbärmlichkeit! Mit Hunden und Katzen um den Wegwurf streiten. Und doch war es vielleicht mitunter das Los Homers, der, wie Pausanias schreibt, auch dieses Schicksal gehabt hat, als blinder Bettler von Ort zu Ort zu ziehn.
Der Garten der Kirke liegt diesen Nachmittag in einer düstern Verzauberung. Die blaßgrünen Schleier der Olivenzweige rieseln leis. Es ist ein ganz zartes und feines Singen. Von unten tönt laut das eherne Rauschen des Jonischen Meeres. Ich muß an das unentschiedene Schlachtengetöse homerischer Kämpfe denken. Der Wolkenversammler verdunkelt den Himmel, und eine bängliche Finsternis verbreitet sich zwischen den Stämmen unter den Ölbaumwipfeln. Vereinzelte große Regentropfen fallen auf mich. Der Efeu erscheint wie ein polypenartig würgendes Tier, er schlägt in unzerbrechliche Bande: Mauern, steinerne Stufen, Bäume! Es ist etwas ewig Totes, ewig Stummes, ewig Verlassenes, ewig Verwandeltes in der Natur und in allem vegetativen Dasein des Gartens. Die Tiere der Kirke schleichen lautlos, tückisch und unsichtbar! der bösen, tückischen Kirke Gefangene! Sie erscheinen für ewig ins Innere dieser Gartenmauer gebannt, wie Sträucher und Bäume an ihre Stelle. Alle diese uralten, rätselhaft verstrickten Olivenbäume gleichen unrettbar verknoteten Schlangen, erstarrt, mitten im Kampf, durch ein schreckliches Zauberwort.
Aber nun geht eine Angst durch den Garten: etwas wie Angst oder nahes Glück. Wir alle, unter der drohenden Macht des beklemmenden Rätsels eines unsagbar traurigen und verwunschenen Daseins, fühlen den nahen Donner des Gottes voraus. Mächtig grollt es fern auf; und Zeus winkt mit der Braue ... Kirke erwartet Zeus.
Ehe man Potamo auf Korfu erreicht, überschreitet man einen kleinen Fluß. Die Ortschaft ist mit grauen Häuschen und einem kleinen Glockenturm auf eine sanft ansteigende Berglehne zwischen Ölbäume und Zypressen hingestreut. Unter den Bewohnern des Ortes, die alle dunkel sind, fällt ein Schmied oder Schlosser auf, der in der Tür seiner Werkstatt mit seinem Schurzfell dasteht, blauäugig, blond und von durchaus kernigem, deutschem Schlag, seiner Haltung und dem Ausdruck seines Gesichtes nach.
Das Tal hinter Potamo entwickelt die ganze Fülle der fruchtbaren Insel. Auf saftigen Wiesenabhängen langhalmiger, üppiger Gräser und Blumen, stehen, Wipfel an Wipfel, Orangenbäume, jeder mit einem Reichtum schwerer und reifer Früchte durchwirkt. Die gleiche, lastende Fülle ist, links vom Wege, in die Talsenkung hinein verbreitet und jenseit die Abhänge hinauf, bis unter die allgegenwärtigen Ölbäume. Fruchtbare Fülle liegt wie ein strenger Ernst über diesem gesegneten Tal. Es ist von Reichtum gleichsam beschwert bis zur Traurigkeit. Es ist etwas fronmäßig Lasttragendes in diesem Überfluß, so daß hier wiederum das Mysterium der Fruchtbarkeit, beinahe zu Gestalten verdichtet, dem inneren Sinne sich aufdrängt. Hier scheint ein dämonischer Reichtum wie dazu bestimmt, verschlagenen Seefahrern sich für eine angstvolle Schwelgerei darzubieten, panischen Schrecknissen nahe.
Gestrüppen, wilden Dickichten gleich, steigen Orangengärten in die Schluchten hinunter, die von uralten Oliven und Zypressen verfinstert sind und locken von dort her, aus der verschwiegenen Tiefe mit ihrer süßen, schweren, fast purpurnen Frucht. Man spürt das Gebärungswunder, das Wunder nymphenhafter Verwandlungen: ein Wirken, das ebenso süß, als qualvoll ist.
Ich sollte hier der Orange von Korfu, als der besten der Welt begeistert huldigen! — Man gehe hin und genieße sie.
Die Straße steigt an und bei einer Wendung tut sich, weithin gedehnt, eine sanfte Tiefe dem Blicke auf: die Ebene zwischen Govino und Pyrgi ungefähr, mit ihren umgrenzenden Höhenzügen. Wälder von Olivenbäumen bedecken sie, ja Gipfel, Abhänge und Ebene überzieht ein einziger Wald. Der majestätische Ernst des Eindrucks ist mit einem unsäglich weichen Reiz verbunden.
Eine Biegung der Straße enthüllt teilweise die blauleuchtende Bucht und die Höhe des San Salvatore dahinter. Zum Ernst, zur Einfalt, zur Großheit, darf man sagen, tritt nun die Süße. — Wir wandeln unter die Wälder hinein. Das Auge wird immer wieder gefesselt von dem unvergleichlichen Linienreiz der zerlöcherten und zerklüfteten Riesenstämme, von denen einige zerrissen und in wilde Windungen zerborsten, doch, mit erzenem, unbeweglichem Griff in die Erde verknotet, aufrecht geblieben sind.
Der Himmel ist grau und bewölkt. Wir entdecken in der Tiefe der fruchttragenden Waldungen Kinder, Hirtinnen mit gelben Kopftüchern. Bis an die Straße zu uns her sind kleine, wollige, unwahrscheinliche Jesusschäfchen verstreut. Ich winke einer der kleinen Hirtinnen: sie kommt nicht leicht. Ihr Dank für unsere Gabe ist ganz Treuherzigkeit.
Schemenhaft flüstern die Ölzweige. Weithin geht und weither kommt ewiges, sanftes, fruchtbares Rauschen.
Wir unternehmen heut eine Fahrt nach Pelleka. Dort, von einem gewissen Punkte aus, überblickt man einen sehr großen Teil der Insel, die Buchten gegen Epirus hin und zugleich das freie Jonische Meer.
Heute, am Sonntag, lehnen etwa hundert Männer über die Mauer der Straße, wo diese eine Kehre macht und gleichsam eine Terrasse oder Rampe der Ortschaft bildet. Unser Wagen wird sogleich von einer großen Menge erbärmlich schmutziger Kinder umringt, die zumeist ein verkommenes Ansehen haben und schlimm husten. Mit uns dem gesuchten Aussichtspunkt zusteigend — wir haben den Wagen verlassen! — verfolgen uns die Kinder in hellen Haufen. Eingeborene Männer versuchen es immer wieder, sie zu verscheuchen, stets vergeblich. Die Kleinen lassen uns vorüber, stehen ein wenig, suchen uns aber gleich darauf wieder auf kürzeren Wegen, rennend, springend, stürzend, einander stoßend, zuvor zu kommen, um mit zäher Unermüdlichkeit uns wiederum anzubetteln.
Sie sind fast durchgängig brünett. Aber es ist auch ein blondes Mädchen da, blauäugig und von zart weißer Haut: ein großer, vollkommen deutscher Kopf, der als solcher auf einem Leiblschen Bilde stehen könnte. Bei diesem Anblick beschleicht mich eine gewissermaßen irrationale Traurigkeit, denn das Mädchen ist eigentlich die vergnügteste unter ihren zahllosen dunklen Zufallsschwestern.
In Gruppen und von den Männern gesondert, stehen am Eingang und Ausgang des kleinen Fleckens die Frauen von Pelleka. Sie machen in der stämmigen Fülle des Körpers und der bunten Schönheit der griechischen Tracht den Eindruck der Wohlhabenheit. Das reiche Haar, das ihre Köpfe in stolzer Frisur umgibt, ist nicht nur ihr eigenes, sondern durch den Haarschatz von Müttern, Großmüttern und Urgroßmüttern vermehrt, der als heilige Erbschaft betrachtet wird.
Heut, soeben, begann ich den letzten Tag, der noch auf Korfu enden wird. Zum Fenster hinausblickend, gewahre ich in der Nähe des Abfallhaufens eine Versammlung von etwa zwanzig Männern: sie umstehen einen vom Regen noch feuchten Platz, auf dem sich, wie kleine zerknüllte Lümpchen, mehrere schmutzige Drachmenscheine befinden. Man schiebt sie mit Stiefelspitzen von Ort zu Ort. Einer der Männer wirft vom Handrücken aus zwei kupferne Münzen in die Luft, und je nachdem sie auf dem Kopfe der Könige liegen, oder diesen nach oben kehren, entscheiden sie über Verlust und Gewinn. Nachdem ein Wurf des Glücksspiels geschehen ist, nimmt einer der Spieler, ein schäbiger Kerl, als Gewinner den ziemlich erheblichen Einsatz vom Erdboden auf und steckt ihn ein.
Die Bevölkerung Korfus krankt an dieser Spielleidenschaft. Es werden dabei von armen Leuten Gewinne und Verluste bestritten, die in keinem Vergleich zu ihrem geringen Besitze stehen. Man sucht dieser Spielwut entgegenzuwirken. Aber, trotzdem man das stumpfsinnige Laster, sofern es in Kneipen oder irgendwie öffentlich auftritt, unter Strafe stellt, ist es dennoch nicht auszurotten. Macht doch die ganze Bevölkerung gemeinsame Sache gegen die Polizei! So sind zum Beispiel die Droschkenkutscher auf der breiten Straße, in die unser Sackgäßchen mündet, freiwillige Wachtposten, die den ziemlich sorglosen Übertretern der Gesetzesbestimmungen soeben die Annäherung eines Polizeimannes durch Winke verkündigen, worauf sich der Schwarm sofort zerstreut.
Ein griechischer Dampfer liegt am Ufer. Ein italienischer kommt eben herein. Ihm folgt die „Tirol“ vom Triester Lloyd. Menschen und Möwen werden aufgeregt.
Die Einschiffung ist nicht angenehm. Wir sind hinter einem Berg von Gepäck ins Boot gequetscht, und jeden Augenblick drohen die hohen Wogen das überladene Fahrzeug umzuwerfen.
Selten ist der Aufenthalt an Deck eines Schiffes im Hafen angenehm. Das Idyll, sofern nicht das Gegenteil eines Idylls im Schicksalsrate beschlossen ist ... das Idyll beginnt immer erst nach der Abfahrt.
Eine schlanke, hohe, jugendschöne Engländerin mit den edlen Zügen klassischer Frauenbildnisse ist an Bord. Seltsam, ich vermag mir das homerische Frauenideal, vermag mir eine Penelope, eine Nausikaa, nur von einer so gearteten Rasse zu denken.
Langsam gleitet Korfu, die Stadt, und Korfu, die Insel, an uns vorüber: die alten Befestigungen, die Esplanade, die Strada marina am Golf von Kastrades, auf der ich so oft nach dem königlichen Garten, nach dem Garten der Kirke, gewandert bin. Der Garten der Kirke selbst gleitet vorüber. Ich nehme mein Fernglas und bin noch einmal an dem lieblichen, jetzt in Schatten gelegten Ort, wo die Trümmer des kleinen antiken Tempelchens einsam zurückbleiben, und wo ich, seltsam genug bei meinen Jahren, fast wunschlos glückliche Augenblicke genoß. Oft sah ich von dort aus Schiffe vorübergleiten und bin nun selbst, der vorübergleitet auf seinem Schiff. Über den dunklen Wipfelgebieten des Gartens steht die Sonne hinter gigantischen Wolken im Niedergang und bricht über alles zu uns und zum Himmel hervor in gewaltigen, limbusartigen Strahlungen, und im Weitergleiten des Schiffes erfüllt mich nur noch der eine Gedanke: du bist auf der Pilgerfahrt zur Stätte des goldelfenbeinernen Zeus.
Die ersten Stunden auf klassischem Boden, nachdem wir in Patras Morgens gelandet sind, bieten lärmende unangenehme Eindrücke. Aber, trotzdem wir nun in einem Bahncoupé, und zwar in einem ziemlich erbärmlichen, sitzen, saugt sich das Auge an Felder und Hügel dieser an uns vorüberflutenden Landschaft fest, als wäre sie nicht von dieser Erde. Vielleicht lieben wir Träume mit stärkerer Liebe, als Wirklichkeit. Aber das innere Auge, das sich selbst im Schlafe oft genug weit öffnet, legt sich mitunter in den Wiesen, Hainen und Hügelländern zur Ruh, die sich einem äußeren Sinne im Lichte des wachen Tages schlicht und gesund darbieten. Und etwas, wie eines inneren Sinnes Entlastung spüre ich nun.
Also: um mich ist Griechenland. Das, was ich bisher so nannte, war alles andere, nur nicht Land. Die Sehnsucht der Seele geht nach Land, der Sehnsucht des Seefahrers darin ähnlich. Immer ist es zunächst nur eingebildet, wonach man sich sehnt, und noch so genaue Nachricht, noch so getreue Schilderung kann aus der schwebenden Insel der Phantasie kein wirklich am Grunde des Meeres verwurzeltes Eiland machen. Das vermag nur der Augenblick, wo man es wirklich betritt.
Was nun so lange durchaus nur ein bloßer Traum der Seele gewesen ist, das will eben diese Seele, vom Staunen der äußeren Sinne berührt, die, von dem Ereignis betroffen, rastlos verzückt, fast überwältigt umherforschen ... das will eben diese Seele nicht gleich für wahr halten. Auch deshalb nicht, weil damit in einem anderen Sinne etwas, zum mindesten der Teil eines Traumbesitzes, in sich versinkt. Dies gilt aber nur für Augenblicke. Es gibt in einem gesund gearteten Geiste keine Todfeindschaft mit der Wirklichkeit: und was sie etwa in einem solchen Geiste zerstört, das hilft sie kräftiger wiederum aufrichten.
Die Landschaft von Elis, durch die wir reisen, berührt mich heimisch. Wir haben zur Rechten das Meer, hinter roter Erde, in unglaublicher Farbenglut. Wie bläulicher Duft liegen Inseln darin: erst wird uns Ithaka, dann Cephalonia, später Zakynthos deutlich. Wir werden an Hügeln vorübergetragen, niedrigen Bergzügen, vor denen Fluren sich ausbreiten, die mit Rebenkulturen bestanden sind. Die Berge zur Linken weichen zurück hinter eine weite Talebene, die sie mit ihren Schneehäuptern begleiten. Einfache, grüne Weideflächen erfreuen den Blick. Und plötzlich erscheinen Bäume, einzelstehend, knorrig, weitverzweigt, die für das zu erklären, was sie wirklich sind, ich kaum getraue. Aber es sind und bleiben doch Eichen, deutsche Eichen, so alt und mächtig entwickelt, wie in der Heimat sie gesehen zu haben ich mich nicht erinnern kann.
Stundenweit dehnen sich nun diese Eichenbestände. Doch sind die jetzt noch fast kahlen Kronen so weit voneinander entfernt, daß ihre Zweige, so breit sie umherreichen, sich nicht berühren. In den einsamen Weideländern darunter zeigen sich hie und da Hirten mit Herden.
Es kommt mir vor, als ob ich unter den vielen, die mit uns reisen, einem großartigen Festtumulte zustrebte. Und durchaus ungewollt drängt sich mir nach und nach die Vision eines olympischen Tages auf: der Kopf und nackte Arm eines jungen Griechen, ein Schrei, eine Bitte, ein Pferdegewieher, Beifallstoben, ein Fluch des Besiegten. Ein Ringer, der sich den Schweiß abwischt. Ein Antlitz, im Kampfe angespannt, fast gequält in übermenschlicher Anstrengung. Donnernder Hufschlag, Rädergekreisch: alles vereinzelt, blitzartig, fragmentarisch.
Auf diesem verlassenen Festplatz ist kaum etwas anderes, als das sanfte und weiche Rauschen der Aleppokiefer vernehmlich, die den niedrigen Kronoshügel bedeckt und hie und da in den Ruinen des alten Tempelbezirks ihre niedrigen Wipfel ausbreitet.
Dieses freundliche Tal des Alpheios ist dermaßen unscheinbar, daß man, den ungeheuren Klang seines Ruhmes im Herzen, bei seinem Anblick in eigentümlicher Weise ergriffen ist. Aber es ist auch von einer bestrickenden Lieblichkeit. Es ist ein Versteck, durch einen niedrigen Höhenzug jenseits des Flusses — und diesseits durch niedrige Berge getrennt von der Welt. Und jemand, der sich von dieser Welt ohne Haß zu verschließen gedächte, könnte nirgend geborgener sein.
Ein kleines, idyllisches Tal für Hirten — eine schlichte, beschränkte Wirklichkeit! — mit einem versandeten Flußlauf, Kiefern und kärglichem Weideland, und doch: es mag hier gewesen sein, es weigert nichts in dem Pilger, für wahr hinzunehmen, daß hier der Kronide, der Ägiserschütterer Zeus, mit Kronos um die Herrschaft der Welt gerungen hat. — Das ist das Wunderbare und Seltsame.
Die Abhänge jenseit des Alpheios färben sich braun. Die Sonne eines warmen und reinen Frühlingstages dringt nicht mehr mit ihren Strahlen bis an die Ruinen, zu mir. Zwei Elstern fliegen von Baum zu Baum, von Säulentrommel zu Säulentrommel. Sie gebärden sich hier wie in einem unbestrittnen Bereich. Ein Kuckuck ruft fortwährend aus den Wipfeln des Kronoshügels herab. — Ich werde diesen olympischen Kuckuck vom zwölften April des Jahres Neunzehnhundertundsieben nicht vergessen.
Die Dunkelheit und die Kühle bricht herein. Noch immer ist das Rauschen des sanften Windes in den Wipfeln die leise und tiefe Musik der Stille. Es ist ein ewiges, flüsterndes Aufatmen, traumhaftes Aufrauschen, gleichsam Aufwachen, von etwas, das zugleich in einem schweren, unerwecklichen Schlaf gebunden ist. Das Leben von einst scheint ins Innere dieses Schlafes gesunken. Wer nie diesen Boden betreten hat, dem ist es schwer begreiflich zu machen, bis zu welchem Grade Rauschen und Rauschen verschieden ist.
Es ist ganz dunkel geworden. Ich unterliege mehr und mehr wieder inneren Eindrücken gespenstischer Wettspiele. Es ist mir, als fielen da und dorther Schreie von Läufern und Ringern aus der nächtlichen Luft. Ich empfinde Getümmel und wilde Bewegungen; und diese hastig fliehenden Dinge begleiten mich wie irgendein Rhythmus, eine Melodie, dergleichen sich manchmal einnistet und nicht zu tilgen ist.
Plötzlich wird, von irgendeinem Hirtenjungen gespielt, der kunstlose Klang einer Rohrflöte laut: er begleitet mich auf dem Heimwege.
Der Morgen duftet nach frischen Saaten und allerlei Feldblumen. Sperlinge lärmen um unsere Herberge. Ich stehe auf dem Vorplatz des hübschen, luftigen Hauses und überblicke von hier aus das enge, freundliche Tal, das die olympischen Trümmer birgt. Hähne krähen in den Höfen verschiedener kleiner Anwesen in der Nähe, von denen jedoch hier nur eines, ein Hüttchen, am Fuße des Kronoshügels, sichtbar ist.
Man müßte ein Tälchen von ähnlichem Reiz, ähnlicher Intimität vielleicht in Thüringen suchen. Wenn man es aber so eng, so niedlich und voller idyllischer Anmut gefunden hätte, so würde man doch nicht, wie hier, so tiefe und göttliche Atemzüge tun.
Mich durchdringt eine staunende Heiterkeit. Der harzige Kiefernadelduft, die heimisch-ländliche Morgenmusik beleben mich. Wie so ganz nah und natürlich berührt nun auf einmal das Griechentum, das durchaus nicht nur im Sinne Homers oder gar im Sinne der Tragiker zu begreifen ist. Viel näher in diesem Augenblick ist mir die Seele des Aristophanes, dessen „Frösche“ ich von den Alpheiossümpfen herüber quaken höre. So laut und energisch quakt der griechische Frosch — ich konnte das während der gestrigen Fahrt wiederholt bemerken! — daß er literarisch durchaus nicht zu übersehen, noch weniger zu überhören war.
Überall schlängeln sich schmale Pfade über die Hügel und zwischen den Hügeln hindurch. Sie sind wie Bänder durch einen Flußlauf gelegt, der zum Alpheios fließt. Kleine Karawanen, Trupps von Eseln und Mauleseln tauchen auf und verschwinden wieder. Man hört ihre Glöckchen, bevor man die Tiere sieht, und nachdem sie den Gesichtskreis verlassen haben. Am Himmel zeigen sich streifige Windwolken. In der braunen Niederung des Alpheios weiden Schafherden.
Man wird an ein großartiges Idyll zu denken haben, das in diesem Tälchen geblüht hat. Es lebte hier eine Priestergemeinschaft nahe den Göttern; aber diese, Götter und Halbgötter, waren die eigentlichen Bewohner des Ortes. Wie wurde doch gerade dieses anspruchslose Stückchen Natur so von ihnen begnadet, daß es gleich einem entfernten Fixstern — einer vor tausend Jahren erloschenen Sonne gleich — noch mit seinem vollen, ruhmstrahlenden Lichte in uns ist?
Diese bescheidenen Wiesen und Anhöhen lockten ein Gedränge von Göttern an, dazu Scharen glanzbegieriger Menschen, die von hier einen Platz unter den Sternen suchten. Nicht alle fanden ihn, aber es lag doch in der Macht des olympischen Zweiges, von einem schlichten Ölbaum dieser Flur gebrochen, Auserwählten Unsterblichkeit zu gewähren.
Ich ersteige den Kronoshügel. Es riecht nach Kiefernharz. Einige Vögel singen in den Zweigen schön und anhaltend. Im Schatten der Nadelwipfel gedeiht eine zarte Ilexart. Die gewundenen Stämme der Kiefern mit tief eingerissener Borke haben etwas Wildkräftiges. Ich pflücke eine blutrote, anemonenartige Blume, überschreite das Band einer Wanderraupe, fünfzehn bis zwanzig Fuß lang. Die Windungen des Alpheios erscheinen: des Gottes, der gen Orthygia hinstrebt, jenseits des Meeres, wo Arethusa, die Nymphe, wohnt, die Geliebte.
Die Fundamente und Trümmer des Tempelbezirks liegen unter mir. Dort, wo der goldelfenbeinerne Zeus gestanden hat, auf den Platten der Cella des Zeustempels, spielt ein Knabe. Es ist mein Sohn. Etwas vollkommen Ahnungsloses, mit leichten, glücklichen Füßen die Stelle umhüpfend, die das Bildnis des Gottes trug, jenes Weltwunder der Kunst, von dem unter den Alten die Rede ging, daß, wer es gesehen habe, ganz unglücklich niemals werden könne.
Die Kiefern rauschen leise und traumhaft über mir. Herdenglocken, wie in den Hochalpen oder auf den Hochflächen des Riesengebirges, klingen von überall her. Dazu kommt das Rauschen des gelben Stroms, der in seinem breiten, versandeten Bette ein Rinnsal bildet, und das Quaken der Frösche in den Tümpeln stehender Wässer seiner Ufer.
Immer noch hüpft der Knabe um den Standort des Götterbildes, das, hervorgegangen aus den Händen des Phidias, den Wolkenversammler, den Vater der Götter und Menschen darstellte; und ich denke daran, wie, der Sage nach, der Gott mit seinem Blitz in die Cella schlug und auf diese Art dem Meister seine Zufriedenheit ausdrückte. Was war das für ein Meister und ein Geschlecht, das Blitzschlag für Zustimmung nahm! Und was war das für eine Kunst, die Götter zu Kritikern hatte!
Die Hügel jenseits des Alpheios bilden eine Art Halbkreis, und ich empfinde sie fast, unwillkürlich forschend hinüberblickend, als einen amphitheatralischen Rundbau für göttliche Zuschauer. Rangen doch auf dem schlichten Festplatz unter mir Götter und Menschen um den Preis.
Meinen Sinn zu den Himmlischen wendend, steige ich langsam wieder in das Vergessenheit und Verlassenheit atmende Wiesental: das Tal des Zeus, das Tal des Dionysos und der Chariten, das Tal des idäischen Herakles, das Tal der sechzehn Frauen der Hera, wo auf dem Altar des Pan Tag und Nacht Opfer brannten, das Tal der Sieger, das Tal des Ehrgeizes, des Ruhmes, der Anbetung und Verherrlichung, das Tal der Wettkämpfe, wo es dem Herakles nicht erspart blieb, mit den Fliegen zu kämpfen, die er aber nur mit Hilfe des Zeus besiegte und dort hinüber, hinter das jenseitige Ufer des Alpheios, trieb.
Und wieder schreite ich zwischen den grauen Trümmern hin, die eine schöne Wiese bedecken. Überall saftiges Grün und gelbe Maiblumen. Das Elsternpaar von gestern fliegt vor mir her. Die Säulen des Zeustempels liegen, wie sie gefallen sind: die riesigen Porostrommeln schräg voneinander gerutscht. Überall duftet es nach Blumen und Thymian um die Steinmassen, die sich im wohltätigen Scheine der Morgensonne warm anfühlen. Von einem jungen Ölbäumchen, nahe dem Zeustempel, breche ich mir, in unüberwindlicher Lüsternheit, seltsamerweise zugleich fast scheu wie ein Dieb, den geheiligten Zweig.
Abschiednehmend trete ich heut das zweitemal vor die Giebelfiguren des Zeustempels, in dem kleinen Museum zu Olympia, und dann vor den Hermes des Praxiteles. Ich lasse dahingestellt, was offenkundig diese Bildwerke unterscheidet, und sehe in Hermes weniger das Werk des Künstlers, als den Gott. Es ist hier möglich, den Gott zu sehen, in der Stille des kleinen Raums, an den die Äcker und Wiesen dicht herantreten. Und so gewiß man in den Museen der großen Städte Kunstwerke sehen kann, vermag man hier in die lebendige Seele des Marmors besser zu dringen und fühlt heraus, was an solchen Gebilden mehr, als Kunstwerk ist. Die griechischen Götter sind nicht von Ewigkeit. Sie sind gezeugt und geboren worden.
Dieser Gott ist besonders bedauernswert in seiner Verstümmelung, da ihm eine überaus zärtliche Schönheit, ein weicher und lieblicher Adel eigen ist. Ambrosische Sohlen sind immer zwischen ihm und der Erde gewesen. Man hat ein Bedauern mit seiner Vereinsamung, weil die unverletzliche, unverletzte, olympisch-weltferne Ruhe und Heiterkeit noch auf seinem Antlitz zu lesen ist, während draußen Altäre und Tempel, fast dem Erdboden gleichgemacht, in Trümmern liegen.
Seltsam ist die hingebende Liebe und Schwärmerei, die dem Bildner den Meißel geführt hat, als er den Rinderdieb, den Schalk, den Täuscher, den schlauen Lügner, den lustigen Meineidigen, den Maultier-Gott und Götterboten darstellte, der allerdings auch die Leier erfand.
Wie schwärmende Bienen am Ast eines Baumes, so hängen die Menschen am Zuge, während wir langsam in Patras einfahren. Lärm, Schmutz, Staub überall. Auch noch in das Hotelzimmer dringt der Lärm ohrenbetäubend. Geräusche, als ob Raketen platzten oder Bomben geworfen würden, unterbrechen das Gebrüll der Ausrufer. Patras ist, nächst dem Piräus, der wichtigste Hafenplatz des modernen Griechenland. Wir sehnen uns in das Unmoderne.
Endlich, nachdem wir eine Nacht hier haben zubringen müssen, sitzen wir, zur Abfahrt fertig, wieder im Bahncoupé. Vor den Türen der Waggons spielt sich ein tumultuarisches Leben mit allerlei bettelhaften Humoren ab. Ein junger, griechischer Bonvivant schenkt einem zerlumpten, lümmelhaft aussehenden Menschen Geld, zeigt flüchtig auf einen der jugendlichen Händler, die allerlei Waren feilbieten, und sofort stürzt sich der bezahlte, tierische Halbidiot auf eben den Händler und walkt ihn durch. Noch niemals habe ich überhaupt binnen kurzer Zeit so viele, wütende Balgereien gesehen. An zwei, drei Stellen des Volksgewimmels klatschen fast gleichzeitig die Maulschellen. Man verfolgt, bringt zu Fall, bearbeitet gegenseitig die Gesichter mit den Fäusten: alles, wie wenn es so sein müßte, in großer Harmlosigkeit.
Zu den schönsten Bahnlinien der Welt gehört diejenige, die von Patras, am Südufer des korinthischen Golfes entlang, über den Isthmus nach Athen führt. Der Golf und seine Umgebung erinnern an die Gegenden des Gardasees. Paradiesische Farbe, Glanz, Reichtum und Fülle in einer beglückten Natur. Der Isthmus zeigt einen anderen Charakter: Weideflächen, vereinzelte Hirten und Niederlassungen. Am Nordrand durch Hügel begrenzt, die, bedeckt von den Wipfeln der Aleppo-Kiefer, zum Wandern anlocken. Alles ist hier von einer erfrischenden, beinahe nordischen Einfachheit.
Die grünen Flächen der Landenge liegen in beträchtlicher Höhe über dem Meere. Nach den großartigen und prunkhaften Wirkungen des peloponnesischen Nordufers überrascht diese schlichte und herbe Landschaft und berührt wohltätig. Eine Empfindung kommt über mich, als sähe ich diese Fluren nicht zum ersten Mal. Das Vertraute daran ist, was überrascht. Ich kann nicht sagen, daß mich etwa je auf der italienischen Halbinsel eine Empfindung des Heimischen, so wie hier, beschlichen hätte. Dort blieb immer der Reiz: das schöne Fremdartige. Ich spüre schon jetzt: ich liebe dies Land. Schon jetzt, im Anfang, erfaßt die Erkenntnis mich, wie ein Rausch, daß eben nur dieser Grund die wahre Heimat der Griechen sein konnte.
Ich spreche den Namen Theseus aus. Und nun hat sich in mir ein psychischer Vorgang vollzogen, der mich, angesichts des isthmischen, ernsten Landgebiets, der griechischen Art, sich Halbgötter vorzustellen, näher bringt. Ich empfinde und sehe in Theseus den Mann von Fleisch und Blut, der wirklich gelebt und dessen Fuß diese Landenge überschritten hat; der, zum Heros gesteigert, noch immer so viel vom Menschen besaß, als vom Gott und auch so noch mit der Stätte seines Wanderns und Wirkens verbunden blieb.
Warum scheuen wir uns und erachten für trivial, unsere heimischen Gegenden, Berge, Flüsse, Täler zu besingen, ja, ihre Namen nur zu erwähnen in Gebilden der Poesie? Weil alle diese Dinge, die als Natur jahrtausendelang für teuflisch erklärt, nie wahrhaft wieder geheiligt worden sind. Hier aber haben Götter und Halbgötter, mit jedem weißen Berggipfel, jedem Tal und Tälchen, jedem Baum und Bäumchen, jedem Fluß und Quell vermählt, alles geheiligt. Geheiligt war das, was über der Erde, auf ihr und in ihr ist. Und rings um sie her, das Meer, war geheiligt. Und so vollkommen war diese Heiligung, daß der Spätgeborene, um Jahrtausende Verspätete, daß der Barbar noch heut — und sogar in einem Bahncoupé — von ihr im tiefsten Wesen durchdrungen wird.
Man muß die Bäume dort suchen, wo sie wachsen, die Götter nicht in einem gottlosen Lande, auf einem gottlosen Boden. Hier aber sind Götter und Helden Landesprodukte. Sie sind dem Landmann gewachsen, wie seine Frucht. Des Landbauers Seele war stark und naiv. Stark und naiv waren seine Götter.
Theseus, um es noch einmal zu sagen, ist also für mich kein riesenmäßiger, leerer Schemen mehr, ich empfinde ihn einerseits nah, schlicht und materialisch, als Kind der Landschaft, die mich umgibt. Andererseits erkenne ich ihn als das, wozu ihn die Seele des Griechen erhoben hat, die aber doch Gott, wie Landeskind, an die Heimat bannte.
Die Landschaft behält, von einer Strecke dicht über dem Meere abgesehen, fortan den ernsten Ausdruck. Der Abend beginnt zu dämmern, ja, verdüstert sich zu einer großartigen Schwermut, von einem Zauber, der eher nordisch, als südlich ist. Es fällt lauer Regen. Das graue Megara, das einen Hügel überzieht, wirkt wie eine geplünderte Stadt. Zwischen Schutthaufen, in ärmlichen Winkeln halb eingestürzter Häuser, scheinen die Menschen zu leben. Man glaubt eine Stadt zu sehen, über die ein Eroberer mit Raub, Brand und Mord seinen Weg genommen hat.
Kurz hinter Eleusis steigt der Zug nochmals bergan, durch die Vorhöhen des Parnes. Bei tieferer Dunkelheit, zunehmendem Regen und kalter Luft kommt mir die steinigte Einöde, in die ich hineinstarre, fast norwegisch vor. Ich bin sehr glücklich über den Wetterumschlag, der mir die ungesunde Vorstellung eines ewiglachenden Himmels nimmt. Die Gegend ist menschenleer. Nur selten begegnet die dunkle Gestalt eines Hirten, aufrecht stehend, dicht in den wolligen Mantel gehüllt. Und während der kalte und feuchte Wind meine Stirne kühlt, Regentropfen mir ins Gesicht wirft, und ich die starke, kalte Regen- und Bergluft in mich einsauge, hat sich ein neues Band geknüpft zwischen meinem Herzen und diesem Lande.
Was Wunder, wenn durch die Erregung der langen Fahrt, in Dunkelheit, in Wind und Wetter, einer höchsten Erfüllung nah, die Seele in einen luziden Zustand gerät, wo es ihr möglich wird, von allem Störenden abzusehen und deutliche Bilder längst vergangenen Lebens in die phantastische, sogenannte Wirklichkeit hineinzutragen. Fast erlebe ich so den tapferen Bergmarsch eines Trupps atheniensischer Jünglinge, etwa zur Zeit des Perikles, und freue mich, wie sie, gesund und wetterhart, der Unbill von Regen und Wind, wie wir selbst es gewohnt sind, wenig achten. Ich lerne die ersten Griechen kennen. Ich freunde mich an mit diesem Schwarm, ich höre die jungen Leute lachen, schwatzen, rufen und atmen. Ich frage mich, ob nicht vielleicht am Ende Alcibiades unter ihnen ist? Es ist mir, als ob ich auch ihn erkannt hätte! Und dies Erleben wird so durchaus eine Realität, daß irgend etwas so Genanntes für mich mehr Realität nicht sein könnte.
Wir rollen hinab in die attische Ebene. Die Lichter einer Stadt, die Lichter Athens, tauchen ferne auf. Das Herz will mir stocken ...
Ein grenzenloses Geschrei, ein Gebrüll, das jeder Beschreibung spottet, empfängt uns am Bahnhof von Athen. Mehrere hundert Kehlen von Kutschern, Gepäckträgern und Hotelbediensteten überbieten sich. Ich habe einen solchen Schlachttumult bis diesen Augenblick, der meinen Fuß auf athenischen Boden stellt, nicht gehört. Die Nacht ist dunkel, es gießt in Strömen.
Eine Stadt, wie das moderne Athen, das sich mit viel Geräusch zwischen Akropolis und Lykabethos einschiebt, muß erst in einem gewissen Sinn überwunden werden, bevor der Geist sich der ersehnten Vergangenheit ungestört hingeben kann. Zum dritten Mal bin ich nun im Theater des Dionysos, dessen sonniger Reiz mich immer aufs neue anlockt. Es hält schwer, sich an dieser Stelle in die furchtbare Welt der Tragödie zu versetzen, hier, wo sie ihre höchste Vollendung gefunden hat. Das, was ihr vor allem zu eignen scheint, das Nachtgeborene, ist von den Sitzen, aus der Orchestra und von der Bühne durch das offene Licht der Sonne verdrängt. Weißer und blendender Dunst bedeckt den Himmel, der Wind weht schwül, und der Lärm einer großen Stadt mit Dampfpfeifen, Wagengerassel, Handwerksgeräuschen und dem Geschrei der Ausrufer überschwemmt und erstickt, von allen Seiten herandringend, jedweden Versuch zur Feierlichkeit.
Was aber auch hier sogleich in meiner Seele sich regt und festnistet, fast jeder andren Empfindung zuvorkommend, ist die Liebe. Sie gründet sich auf den schlichten und phrasenlosen Ausdruck, den hier die Kunst eines Volkes gewonnen hat. Alles berührt hier gesund und natürlich, und nichts in dieser Anlage erweckt den Eindruck zweckwidriger Üppigkeit oder Prahlerei. Irgendwie gewinnt man, lediglich aus diesen architektonischen Resten, die Empfindung von etwas Hellem, Klar-Geistigem, das mit der Göttin im Einklang steht, deren kolossalisches Standbild auf dem hinter mir liegenden Felsen der Akropolis errichtet war, und deren heilig gesprochenen Vogel, die Eule, man aus den Löchern der Felswand, und zwar in den lichten Tag und bis in die Sitzreihen des Theaters hinein, rufen hört.
Ich wüßte nicht, wozu der wahrhaft europäische Geist eine stärkere Liebe fühlen sollte, als zum Attischen. Bei Diodor, den ich leider nur in Übersetzung zu lesen verstehe, wird gesagt: die alten Ägypter hätten der Luft den Namen Athene gegeben, und Glaukopis beziehe sich auf das himmlische Blau der Luft. Der Geist, der hier herrschte, blieb leicht und rein und durchsichtig, wie die attische Luft, auch nachdem das Gewitter der Tragödie sie vorübergehend verfinstert, der Strahl des Zeus sie zerrissen hatte.
Als höchste menschliche Lebensform erscheint mir die Heiterkeit: die Heiterkeit eines Kindes, die im gealterten Mann oder Volk entweder erlischt, oder sich zur Kraft der Komödie steigert. Tragödie und Komödie haben das gleiche Stoffgebiet: eine Behauptung, deren verwegenste Folgerungen zu ziehen, der Dichter noch kommen muß. Der attische Geist erzeugt, wie die Luft eines reinen Herbsttages, in der Brust jenen wonnigen Kitzel, der zu einem beinahe nur innen spürbaren Lachen reizt. Und dieses Lachen, durch den Blick in die Weite der klaren Luft genährt, kann sich wiederum bis zu jenem steigern, das im Tempel des Zeus gehört wurde, zu Olympia, als die Sendboten des Caligula Hand anlegten, um das Bild des Gottes nach Rom zu schleppen.
Man soll nicht vergessen, daß Tragödie und Komödie volkstümlich waren. Es sollen das diejenigen nicht vergessen, die heute in toten Winkeln sitzen. Beide, Tragödie, wie Komödie, haben nichts mit schwachen, überfeinerten Nerven zu tun, und ebensowenig, wie sie, ihre Dichter — am allerwenigsten aber ihr Publikum. Trotzdem aber keiner der Zuschauer jener Zeiten, etwa wie viele der heutigen, beim Hühnerschlachten ohnmächtig wurde, so blieb, nachdem die Gewalt der Tragödie über ihn hingegangen war, die Komödie eines jeden unabweisliche Gegenforderung: und das ist gesund und ist gut.
Die ländlichen Dionysien wurden an der Südseite der Akropolis, im Lenäon, nach beendeter Weinlese abgehalten. Was hindert mich, trotzdem, das sogenannte Schlauchspringen mir unten in der Orchestra meines Theaters vorzustellen? Man sprang auf einen geölten, mit Luft gefüllten Schlauch, und suchte, einbeinig hüpfend, darauf Fuß zu fassen. Das ist der Ausdruck überschäumender Lustigkeit, ein derber überschüssiger Lebensmut. Und nicht aus dem Gegenteil, nicht aus der Schwäche und Lebensflucht entstehen Tragödie und Komödie!
Ein deutscher Kegelklub betritt, von einem schreienden Führer belehrt, den göttlichen Raum. Man sieht es den hilflos tagblinden Augen der Herren an, daß sie vergeblich hier etwas Merkwürdiges suchen. Ich würde ihren gelangweilten Seelen gönnen, sich wenigstens an der Vorstellung aufzuheitern, dem tollen Sprung auf den öligen Schlauch, die mich ergötzt.
Heut betrete ich, ich glaube zum viertenmal, die Akropolis. Es ist länger als fünfundzwanzig Jahre her, daß mein Geist auf dem Götterfelsen heimisch wurde. Damals entwickelte uns ein begeisterter Mann, den inzwischen ein schweres Schicksal ereilt hat, seine Schönheiten. Es ist aber etwas anderes, von jemand belehrt zu werden, der mit eigenen Augen gesehen hat, oder selber die steilen Marmorstufen zu den Propyläen hinaufzusteigen und mit eignen Augen zu sehn.
Ich finde, daß diese Ruinen einen spröden Charakter haben, sich nicht leicht dem Spätgeborenen aufschließen. Ich habe das dunkle Bewußtsein, als ob etwa über die Säulen des Parthenon von da ab, als man sie wieder zu achten anfing, sehr viel Berauschtes verfaßt worden wäre. Und doch glaube ich nicht, daß es viele gibt, die von den Quellen der Berauschung trunken gewesen sind, die wirklich im Parthenon ihren Ursprung haben.
Wie der Parthenon jetzt ist, so heißt seine Formel: Kraft und Ernst! Davon ist die Kraft fast bis zur Drohung, der Ernst fast bis zur Härte gesteigert. Die Sprache der Formen ist so bestimmt, daß ich nicht einmal glauben kann, es sei durch die frühere, bunte Bemalung ihrem Ausdruck etwas genommen worden.
Ich habe das schwächliche Griechisieren, die blutlose Liebe zu einem blutlosen Griechentum niemals leiden mögen. Deshalb schreckt es mich auch nicht ab, mir die dorischen Tempel bunt und in einer für manche Begriffe barbarischen Weise bemalt zu denken. Ja, mit einer gewissen Schadenfreude gönne ich das den Zärtlingen. Ich nehme an, es gab dem architektonischen Eindruck eine wilde Beimischung. Möglicherweise drückte das Grelle des farbigen Überzugs den naiven Stand der Beziehungen zwischen Göttern und Menschen aus, indem er fast marktschreierisch zu festlichen Freuden und damit zu tiefer Verehrung einfing.
Jeder echte Tempel ist volkstümlich. Trotz unserer europäischen Kirchen und Kathedralen glaube ich, gibt es bei uns keine echten Tempel in diesem Betrachte mehr. Vielleicht aus dem Grunde, weil sich bei uns die Lebensfreude von der Kirche geschieden hat, die nur noch gleichsam den Tod und die Gruft verherrlicht. Die Kirchen bei uns sind Mausoleen: wobei ich nur an die katholischen denke. Einen protestantischen Tempel gibt es nicht. Da nun aber das Leben lebt und lebendig ist, so erzeugt sich auch immer unfehlbar wieder der Trieb zur Freude. Und er ist es, der heute das Theater, den gefährlichsten Konkurrenten der Kirche, geschaffen hat. Ich behaupte, was heut die Menschen zur Kirche treibt, ist entweder Todesangst oder Suggestion. Das Theater bedarf solcher Mittel nicht, um Menschen in seine Räume zu bringen. Dorthin drängen sie sich vielmehr, wie Spatzen, von einem fruchtbeladenen Kirschbaume angelockt.
Wenn heut bei uns eine Gauklergesellschaft auf dem Dorfplan Zelte errichtet, herrscht sogleich unter der Mehrzahl der Dörfler, vor allem aber unter den Kindern, festliche Aufregung. Kunstreiter oder Bänkelsänger mit der neuesten Moritat, sie genießen, obgleich in Acht und Bann seit Jahrtausenden, immer die gleiche, natürliche Zuneigung. Der Karren des Thespis war nicht in Acht und Bann getan; ja, Thespis erhielt im Theater, im heiligen Bezirk des Dionysos, seine Statue, und doch scheint er auch nur mit der Moritat von Ikarios umhergezogen zu sein. Kurz, was heute in Theater und Kirche zerfallen ist, war damals ganz und eins; und, weit entfernt ein memento mori zu sein, lockte der Tempel ins höhere, festliche Leben, er lockte dazu, wie ein buntes, göttliches Gauklerzelt.
Während unsre Kirchen eigentlich nur den Unterirdischen geweiht zu sein scheinen, galten die griechischen Tempel als Wohnung der Himmlischen. Deshalb senkten sie lichte Schauder ins Herz, statt der dunklen, und die Pilger ergriff zugleich, in der olympischen Nähe, Furcht, Seligkeit, Sehnsucht und Neid.
Starker Wind. Gesundes, sonniges Wetter. In der Luft wohnt deutscher Frühling. Der Parthenon: stark, machtvoll, ohne südländisches Pathos, rauscht im Winde laut, wie eine Harfe oder das Meer. Ein deutscher Grasgarten ist um ihn herum. Frühlingsblumen beben im Luftzug. Um alle die heiligen Trümmer auf dem grünen Plateau der Akropolis weht Kamillen-Arom. Es ist ein unsäglich entzückender Zustand, zwischen den schwankenden Gräsern auf irgendeinem Stück Marmor zu sitzen, die Augen schweifen zu lassen, über die blendend helle, attische Landschaft hin. Hymettos zur Linken, Penthelikon, als Begrenzung der Ebene. Der Parnes, bei leichter Rückwärtswendung des Kopfes sichtbar. Silbergraue Gebirgswälle, im weiten Kreisbogen um Athen und den Götterfelsen gelagert, der mit dem Parthenon auf dem Scheitel alles beherrscht. Hier stand Athene, aufrecht, mit der vergoldeten Speerspitze. Vom Parnes grüßte der Zeus Parnethios, vom Hymettos grüßte der Zeus Hymethios. Vom Penthele ein zweites Bild der Athene. Attika war von Göttern bewohnt, von Göttern auf allen umliegenden Höhen bewacht, die einander mit göttlichen Brauen zuwinkten. Geradeaus, unter mir, liegt tiefblau, in die herrliche Bucht geschmiegt, das Meer. Aegina und Salamis grüßen herüber ... Ich atme tief! ...
Ich sitze auf einem Priestersessel im Theater des Dionysos. Hähne krähen; es ist, als ob Athen und die Demen nur von Hähnen bewohnt wären. Der städtische Lärm tritt heut ein wenig zurück, und das Geschrei der Ausrufer ist durch das oft wiederholte Geschrei von weidenden Eseln abgelöst. Brütende Sonne erwärmt die gelblichen Marmorsessel und Marmorstufen.
Etwa 30000 Zuschauer wurden auf diesen Stufen untergebracht, von denen nicht allzuviele Reihen erhalten sind; und hinter und über der letzten, obersten Reihe thronten die Götter: denn dort überragt das ganze Theater die rötliche Felswand der Akropolis, gewiß noch heut der seltsamste, rätselvollste und zugleich lehrreichste Fels der Welt.
Noch heute, jenseit von allem Aberglauben jener Art, wie er im Altertum im Volke lebt und dichtet, empfinde ich doch die Kraft, die schaffende Kraft dieses Glaubens tief, und wenn mein Wille allein es meistens ist, der die ausgestorbene Götterwelt zu beleben sucht, hier, angesichts dieses ragenden Felsens, erzeugt sich augenblicksweise, fast unwillkürlich ein Rausch der Göttergegenwart. Zweifellos war es ein Grad der Ekstase, der jene Dreißigtausend hier, auf dem geheiligten Grund des Eleutherischen Dionysos, im Angesichte der heiligen Handlung des Schauspiels befiel, den zu entwickeln dem glaubensarmen Geschlecht von heut das Mittel abhanden gekommen ist. Und ich stehe nicht an, zu behaupten, daß alle Tragiker, bis Euripides, so sehr sie sich von der derb naiven Gläubigkeit der Menge gesondert haben mögen, von Gottesfurcht oder Götterfurcht und vom Glauben an ihre Wirklichkeit, besonders hier, am Fuße und im Bereich des Gespensterfelsens, durchdrungen gewesen sind.
Die Akropolis ist ein Gespensterfelsen. In diesem Theater des Dionysos gingen Gespenster um. In zahllosen Löchern des rotvioletten Gesteins wohnten die Götter, wie Mauerschwalben. Es ist eine enggedrängte, überfüllte, göttliche Ansiedelung: hatten doch, nach Pausanias, die Athener für das Göttliche einen weit größeren Eifer, als die übrigen Griechen. Die Art, wie sie allen möglichen Göttern Asyle und wieder Asyle gründeten, deutet auf Angst. Während ich solchen Gedanken nachhänge, höre ich hinter mir wiederum den Vogel der Pallas, aus einem Felsloch, klägliche Laute in den Tag hineinwimmern und stelle mir vor, wie wohl die atemlos lauschenden Tausende ein Schauer bei diesem Ruf überrieselt hat.
Die Seelenverfassung der großen Tragiker wurde unter anderem auch von dem Umstand bedingt, daß sie Götter als Zuschauer hatten. Daß es so war, ist für mich eine Wirklichkeit. Die Woge des Glaubens, die ihnen aus dreißigtausend Seelen entgegenschlug, verstärkt durch die Nähe göttlicher Troglodyten und Tempelbewohner des Felsens, war allein schon wie eine ungeheure Sturzwelle, und jede Skepsis wurde hinweggespült.
„An der sogenannten südlichen Mauer der Burg, dem Theater zugekehrt, ist ein vergoldetes Haupt, der Gorgone Medusa geweiht, und um dasselbe ist die Ägide angebracht. Am Giebel des Theaters ist im Felsen unter der Burg eine Grotte; auch über dieser steht ein Dreifuß; in ihr sind Apollo und Artemis, wie sie die Kinder der Niobe töten“, schreibt Pausanias. Ein Heiligtum der Artemis Brauronia ist auf der Burg. Der große Tempel der Pallas Athene, ein Heiligtum des Erechtheus, des Poseidon, Altäre des Zeus, zahllose Statuen von Halbgöttern, Göttern und Heroen sind da, Äskulap hat im Felsen sein Heiligtum, Pan seine Grotte, sogar Serapis hat seinen Tempel. Zwei Grotten standen Apollon zu, dem „Apoll unter der Höhe“. Ein tiefer Felsspalt ist der Ort, wo der Gott Creusa, die Tochter Erechtheus’, überraschte und den Stammvater aller Jonier mit ihr zeugte. Hephästos besaß seinen Altar und so fort.
Alle diese Gottheiten lebten nicht nur auf der Burg. Sie durchwanderten bei Nacht und sogar am Tage die Straßen der Stadt. Der Mann aus dem Volke, das Weib aus dem Volke war nicht imstande, die Gebilde des nächtlichen Traums von denen des täglichen Traums zu sondern. Beide waren ihnen so gut, wie das, was sie sonst mit Augen wahrnahmen, Wirklichkeit.
Die Tragiker hatten Götter als Zuschauer, und dadurch wurde nicht nur die Grundverfassung ihrer Seele mit bedingt, sondern die Art des Dramas, das sie hervorbrachten. Auch in diesem Drama traten Götter und Menschen im Verkehr miteinander auf, und es ward damit, in einem gewissen Sinne, das geheiligte Spiegelbild der ins Erhabene gesteigerten Volksseele. Was wäre ein Dichter, dessen Wesen nicht der gesteigerte Ausdruck der Volksseele ist!
Es ist der Vormittag des 20. April. Ich habe den Felsen des Areopag erstiegen. Zwei Soldaten schlafen in einer versteckten Mulde. Esel schreien; Hähne krähen. Der Ort ist verunreinigt. An einem Teile des Felsens werden Vermessungen vorgenommen. Wieder liegt das weiße, blendende Licht über der Landschaft.
Auf diesem Hügel des Ares, heißt es, ist über den Kriegsgott Gericht gehalten worden, in Urzeiten, irgend eines vereinzelten Mordes wegen, den er begangen hatte. Hier, sagt man, wurde Orestes gerichtet und losgesprochen, trotzdem er die Mutter ermordet hatte. In nächster Nähe soll hier ein Heiligtum der Erinnyen gewesen sein, der zürnenden Gottheiten, die von den Athenern die Ehrwürdigen, oder ähnlich, genannt wurden. Ihre Bildnisse sollen nicht schreckenerregend gewesen sein, und erst Äschylos hat ihnen Schlangen ins Haar geflochten.
Es fällt wiederum auf, wie überladen mit Götterasylen der nahe Burgfelsen ist: mit Nestern, Gottesgenisten könnte man sagen! Jeder Spalt, jede Höhle, jeder Fußbreit Stein war für die oberirdischen, unterirdischen oder auch für solche Gottheiten, die im Wasser leben, ausgenützt. Es ist erstaunlich, daß sie hier untereinander Frieden hielten. Vielleicht geschah es, weil Pallas Athene, als Höchstverehrte, über den andern stand.
Man ist hier auf dem Areopag erhaben über der Stadt. Man übersieht einen Teil von ihr und den Theseustempel. Man sieht gegenüber, durch ein Tal getrennt, die Felsplatten der Pnyx. Man hört die zahllosen Schwalben des nahen Burgfelsens zwitschern. Dies Zwitschern wird zu einer sonderbaren Musik, wenn man sich an den ersten Gesang der Odyssee und an die folgenden Verse erinnert:
„Also redete Zeus’ blauäugigte Tochter, und eilend
Flog wie ein Vogel sie durch den Kamin ...“
und an die Neigung der Himmlischen überhaupt, sich in allerlei Tiere, besonders in Vögel, umzuwandeln.
Ich lasse mich nieder, lausche und betrachte den zwitschernden Götterfelsen, die Akropolis. Ich schließe die Augen und finde mich durch das Zwitschern tief und seltsam aufgeregt. Es kommt mir vor, indem ich leise immer wieder vor mich hinspreche: Der zwitschernde Fels! Die zwitschernden Götter! Der zwitschernde Götterfels! als habe ich etwas aus der Seele eines naiven Griechen jener Zeit, da man die Götter noch ehrte, herausempfunden. Vielleicht, sage ich mir, ist, wenn man eine abgestorbene Empfindung wieder beleben kann, damit auch eine kleine, reale Entdeckung gemacht.
Und plötzlich erinnere ich mich der „Vögel“ des Aristophanes, und es überkommt mich zugleich in gesteigertem Maße Entdeckerfreude. Ich bilde mir ein, daß mit dieser Empfindung: „der zwitschernde Fels, die zwitschernden Götter“, im Anblick der Burg, der Keim jenes göttlichen Werkes in der Seele des freiesten unter den Griechen zuerst ins Leben getreten ist. Ich bilde mir ein, vielleicht den reinsten und glücklichsten Augenblick, einen Schöpfungsakt seines wahrhaft dionysischen Daseins, neu zu durchleben, und will es jemand bezweifeln, so raubt er mir doch die heitere, überzeugte Kraft der Stunde nicht.
Frische, nordische Luft. Nordwind. Eine ungeheure Rauch- und Staubwolke wird von Norden nach Süden über das ferne Athen hingejagt. Gegen den Hymettos zieht der bräunliche Dunst, Akropolis und Lykabettos in Schleier hüllend. Ich verfolge, vom Rande der phalerischen Bucht, ein beinahe ausgetrocknetes Flußbett, in der Richtung gegen den Parnes. Schwalben flattern über den spärlichen Wasserpfützen in lebhafter Erwerbstätigkeit. Ich habe zur Linken die letzten Häuser und Gärten der Ansiedelung von Neu-Phaleron, hinter einem Feld grüner Gerste, die in Ähren steht. Zur Rechten, jenseit des Flußlaufs, gegen das ferne Athen hin, sind ebenfalls ausgedehnte Flächen mit Gerste bebaut. Die Finger erstarren mir fast, wie ich diese Bemerkung in mein Buch setze. Die Landschaft ist fast ganz nordisch. Vereinzelte Kaktuspflanzen an den Feldrainen machen den unwahrscheinlichsten Eindruck. Ich beschreite einen Feldweg. Um mich, zu beiden Seiten, wogt tiefgrün die Gerste. Man muß die Alten und das Getreide zusammendenken, um ganz in ihre sinnliche Nähe zu gelangen, mit ihnen vertraut, bei ihnen heimisch zu sein.
Die Akropolis, mit dem Parthenon, erhebt sich unmittelbar aus der weiten Prärie, aus der wogenden See grüner Halme, empor.
Ich kreuze die Landstraße, die von Athen in grader Linie nach dem Piräus hinunter führt, und stoße auf eine niederländische Schänke, unter mächtigen, alten Eschen, die an Ostade oder Breughel erinnert. Ich erblicke, mich gegen Athen wendend, über dem Ausgangspunkt der Straße wiederum die Akropolis mit dem Parthenon. Der Verkehr, mit Mäulern und Pferden an hochrädrigen Karren, bewegt sich in zwei fast ununterbrochenen Reihen von Athen zum Piräus hinunter und umgekehrt. Es wird sehr viel Holz nach Athen geschafft. Unter vielen Mühen, in beinahe undurchdringlichen Staubwolken, arbeite ich mich gegen eisigen Wind. Hunde und Hühner bevölkern die Landstraße. Im Graben, im Grase, das eine dicke Staubschicht überzieht, liegt, grau wie der Staub, ein todmüder Esel und hebt seinen mageren Kopf mir zu. Kantine an Kantine begleitet die Straße rechts und links in arger Verwahrlosung. Ich bin beglückt, als ich einen tüchtigen Landmann, mit zwei guten Pferden, die Hand am Pflug, seinen Acker bestellen sehe, ein Anblick, der in all diesem jämmerlich verstaubten Elend erquickend ist.
Ich weiche dem Staub, verlasse die Straße, und bewege mich weiter, dem Parnes zu, in die Felder hinein. Nun sehe ich die Akropolis wiederum und zwar in einem bleichen, kreidigen Licht, zunächst über blühenden Obstgärten auftauchen. Der Parthenongiebel steht, klein wie ein Spielzeug, kreidig-bleich. In langen Linien schießen die Schwalben dicht über das Gras der Auen und über die Ähren der Gerstenfelder hin. Ich muß an den Flug der Götter denken, an den schemenhaft die ganze Landschaft beherrschenden, zwitschernden Götterfels, und wie von Athene gesagt ist:
„Plötzlich entschwand sie den Blicken und gleich der Schwalbe von Ansehn
Flog sie empor ...“
Wie muß dem frommen Landbewohner mitunter der Flug und der Ruf der Schwalbe erschienen sein! Wie wird er seinen verehrenden Blick zuzeiten bald gegen das Bild des Zeus auf dem nahen Parnes, bald gegen die ferne, überall sichtbare, immer leuchtende Burg der Götter gerichtet haben! Von dorther strichen die Schwalben, dorthin verschwanden sie in geschwindem Flug. Und ähnlich, nicht allzuviel schneller, kamen und gingen die Götter, die keineswegs, wie unser Gott, allgegenwärtig gewesen sind.
Auf dem heiligen Wege, von Athen nach Eleusis hinüber, liegt an der Paßhöhe, zwischen Bergen, das kleine griechische Kloster Daphni. Ich weiß nicht, welches rätselhafte Glück mich auf der Fahrt hierher überkommen hat. Vielleicht war es zunächst die Freude, mit jedem Augenblick tiefer in ein Gebiet des Pan und der Hirten einzudringen.
Überall duftet der Thymian. Er schmückt, strauchartig, die grauen Steinhalden, auch dort, wo die wundervolle Aleppo-Kiefer, der Baum des Pan, nicht zu wurzeln vermag. Aber Kiefer und Thymian vermischen überall ihre Düfte und füllen die reine Luft des schönen Bergtals mit Wohlgeruch.
Der Hof des Klosters, in den wir treten, ist ebenfalls von weihrauchartigen und von grunelnden Düften erfüllt. Am Grunde schmücken ihn zahllose, weiße und gelbe Frühlingsblumen, die ihre Köpfchen den warmen Strahlen des griechischen Frühlingsmorgens darbieten. An einem gestutzten Baum ist die Glocke des Klosters aufgehängt, Sommers und Winters den atmosphärischen Einflüssen preisgegeben und darum bedeckt mit einer schönen, bläulichen Patina. Ein Hündchen, im Winkel des Hofes, vor seiner Hütte, wedelt uns an. Trotzdem es nach Bienen und Fliegen schnappen kann, deren wohlig schwelgerisches Gesumm allenthalben vernehmlich ist, scheint es sich doch in dieser entzückenden, gleichsam verwunschenen Stille zu langweilen.
Antike Säulenreste, Trommeln und Kapitale, liegen umher, auf denen sich Sperlinge, pickend und lärmend, umhertreiben. Sie besuchen den Brunnen, an dem eine alte, hohe Cypresse steht, türkischer Sitte gemäß, als Wahrzeichen.
Das Innere der Klosterkirche bietet ein Bild der Verwahrlosung. Die Mosaiken der Kuppel sind fast vernichtet, die Ziegelwände von Stuck entblößt. Aber der häusliche Laut der immerfort piepsenden Sperlinge und warme Sonne dringt vom Hofe herein, dazu der Ruf des Kuckuck herab aus den Bergen, und der kleine Altar, von gläubigen Händen zärtlich geschmückt, verbreitet mit seinem braunen Holzwerk, mit seinen Bildchen und brennenden Kerzen, einen treuherzig-freundlichen Geist der Einfachheit.
Unsern Weg durch die Hügel abwärts fortsetzend, haben wir eine Stelle zu beachten, wo vor Zeiten ein Tempel der Venus stand. Nicht weit davon bemerken wir, unter einer Kiefer, in statuarischer Ruhe aufgerichtet, die Gestalt eines Hirten, dessen langohrige Schafe, im Schatten des Baumes zusammengedrängt, um ihn her lagern und wie ein einziges Fließ den Boden bedecken.
Was mich auf dieser heiligen Straße besonders erregt, ist das Hallende. Überall zwischen den Bergen schläft der Hall. Die Laute der Stimmen, die Rufe der Vögel, wecken ihn in den schlafenden Gründen. Ich stelle mir vor, daß jemand, den eine unbezwingliche Sehnsucht treibt, sich in die untergegangene Welt der Hellenen, wie in etwas noch Lebendiges einzudrängen, auf ein besseres Mittel schmerzhaft-seliger Täuschung nicht verfallen könnte, als durch das verwaiste Griechenland nur immer geliebte Namen zu rufen, wie Herakles einst den Hylas rief. Gleichwie nun die Stimme des Hylas, des Gestorbenen, im Echo gespenstisch, wie eines Lebenden Stimme, antwortete, so, meine ich, käme dem Rufe des wahren Pilgers jedweder heilige Name, aus dem alten, ewigen Herzen der Berge, fremd, lebendig und mit Gegenwartsschauern zurück.
Wir sind nun an den Rand der Eleusinischen Bucht gelangt, die durch die Höhenzüge der Insel Salamis gegen das Meer hin geschützt, einem friedlichen Landsee ähnlich ist. Ich habe niemals das Galiläische Meer gesehen, und doch finde ich mich an Jesus und jene Fischer gemahnt, die er zu Menschenfischern zu machen unternahm. Das biblische Vorgefühl findet auf der weißen Landstraße längs des Seeufers unerwartet eine Bestätigung, als das klassische Bild der Flucht nach Ägypten lebendig an uns vorüberzieht: eine junge, griechische Bäuerin auf dem Rücken des Maultiers, den Säugling im Arm, von ihrem bärtigen, dunkelhaarigen Joseph begleitet.
Die Bucht liegt in einem weißlichen Perlmuttschimmer still und glatt und die Augen blendend unter den schönkonturierten Spitzen von Salamis. Die Landschaft, im Gegensatz zu dem Tale, aus dem wir kommen, ist offen und weit, und scheint einem anderen Lande anzugehören. Dort wo ein seichter Fluß, aus den Bergen kommend, sein Wasser mit dem der Bucht vermischt, knieen eskimoartig vermummte Wäscherinnen, obgleich weder Haus noch Hütte im weiten Umkreis zu sehen ist.
Wie sich etwa die Sinnesart eines Menschen erschließt, durch die Scholle, die er bebaut, durch die Heimat, die er für sein Wirken erwählt hat, oder durch jene, die ihn hervorbrachte, und festhielt, so erschließt sich zum Teil das Wesen der Demeter im Wesen des eleusinischen Bezirks. Denn dies ist den griechischen Göttern eigen, daß sie mit innigen Banden des Gemüts weniger an den Olymp, als an die griechische Muttererde gebunden sind. Kein Gott, der den Griechen weniger liebte, als der Grieche den Gott — oder weniger die griechische Heimat liebte und in ihr heimisch wäre, als er!
Jesus, der Heiland und Gottessohn, Jesus der Gott, ist uns durch sein irdisch-menschliches Schmerzensschicksal nahegebracht: ebenso den Griechen Demeter. Man stelle sich vor, wie der Grieche etwa auf diesem heiligen Boden empfand, der wirklich Demeters irdischen Wandel gesehen hatte, wo ich, der moderne, skeptische Mensch, sogleich von besonderer Weihe durchdrungen ward, als sich das Bild der Landschaft in mir mit jener anderen Legende vermählt hatte, die mit einer Kraft ohnegleichen heute Zweifler wie Fromme beherrscht.
Der heilige Bezirk, mit dem Weihetempel der Demeter, liegt nur wenig erhaben über die Spiegelhöhe, am Rande der Bucht. Es sei ferne von mir, dieses wärmste und tiefste Mysterium, nämlich das eleusinische, ergründen zu wollen: genug, daß es für mich von Sicheln und schweren Garben rauscht und daß ich darin das Feuer Apolls mit des Aidoneus eisiger Nacht sich vermählen fühle. Übrigens ist ein wahres Mysterium, das durch Mysten gepflegt und lebendig erhalten, nicht in Erstarrung verfallen kann, ein ewiger Quell der Offenbarung, woraus erhellt, daß eben das Unergründliche ganz sein Wesen ist.
Während ich auf den Steinfließen der ehemaligen Vorhalle des Pylon, als wäre ich selbst ein Myste, nachdenklich auf und ab schreite, formt sich mir aus der hellen, heißen, zitternden Luft, in Riesenmaßen, das Bild einer mütterlichen Frau. Ihr Haarschwall, der die Schultern bedeckt und herab bis zur Ferse reicht, ist von der Farbe des reifen Getreides. Sie wandelt, mehr schwebend als schreitend, aus der Tiefe der fruchtbaren eleusinischen Ebene gegen die Bucht heran, und ist von summsenden Schwärmen häuslicher Bienen, ihren Priesterinnen, begleitet.
Die wahren Olympier leiden nicht, Demeter ist eine irdisch-leidende Göttin, deren mütterliches Schmerzensschicksal selbst durch den Richtspruch des Zeus nur gemildert, nicht aufgehoben ist. Auf ihren Zügen liegt, unverwischbar, die Erinnerung ausgestandener Qual und es kann eine größere Qual nicht geben, als die einer Mutter, die ihr verlorenes Kind in grauenhafter Angst und Verzweiflung der Seele sucht. Sie hat Persephoneia wieder gefunden und hier zu Eleusis, der Weihetempel, auf dessen Boden ich stehe, ist der Ort, von dem aus sie die Rückkunft der Tochter und ihre Befreiung aus den Fesseln des Tartarus erzwang, und wo Mutter und Tochter das selige Wiedersehen feierten. Aber sie genießt auch seither, wie gesagt, nicht das reine, ungetrübte, olympische Glück. Nach leidender Menschen Art ist ihr Dasein Genuß und Entbehren, Weh der Trennung und Freude der Wiedervereinigung. Es ist unlöslich, für immer, gleichwie das Dasein der Menschen, aus bitteren Schmerzen und Freuden gemengt.
Das ist es, was sie dem Menschengeschlecht und auch dem Spätgeborenen nahebringt, und was sie mehr, als irgendeinen Olympier, heimisch gemacht hat auf der Erde.
Es kommt hinzu, daß, während eines Teiles des Jahres, Aidoneus die Tochter ins Innere der Erde fordert und dort gefangen hält, wodurch denn die seligen Höhen des Olymps, die dem Kerker der Tochter ferne liegen, den Füßen der Mutter, mit den eleusinischen Ufern verglichen, unseliger Boden sind. Man ist überzeugt, daß Schicksalsschluß die Göttin in das Erkenntnisbereich der Menschen verwiesen hat — in ein beginnendes, neues, höheres, zwischen Menschen und Göttern und zwar mit einem Ereignis, das, unvergeßlich, das Herz ihres Herzens gleichsam an seinen Schauplatz verhaftet hält.
Die „weihrauchduftende“ Stadt Eleusis, die Stadt des Keleus, der Königin Metaneira sowie ihrer leichtgeschürzten Töchter: Kallidike, Kleissidike, Dämo und Kallithoa der „saffranblumengelockten“ ist heut nicht mehr, aber der Thymianstrauch, der überall um die Ruinen wuchert, verbreitet auch heute um die Trümmer warme Gewölke von würzigem Duft. Und die Göttin, die fruchtbare, mütterliche, umwandelt noch heut, in alter, heiliger Schmerzenshoheit die Tempeltrümmer, die Ebene und die Ufer der Bucht. Ich spüre die göttliche Erntemutter, die göttliche Hausfrau, die göttliche Kinderbewahrerin, die Gottesgebärerin überall, die ewige Trägerin des schmerzhaft süßen Verwandlungswunders.
Was mag es gewesen sein, was die offenen Kellergewölbe unter mir an Tagen der großen Feste gesehen haben? Man verehrte hier neben Demeter auch den Dionysos. Nimmt man hinzu, daß der Mohn, als Sinnbild der Fruchtbarkeit, die heilige Blume der Demeter war, so bedeutet das, in zwiefacher Hinsicht, ekstatische Schmerzens- und Glücksraserei. Es bleibt ein seltsamer Umstand, daß Brot, Wein und Blut, dazu das Martyrium eines Gottes, sein Tod und seine Auferstehung, noch heut den Inhalt eines Mysteriums bilden, das einen großen Teil des Erdballs beherrscht.
Ich liege, unweit von Kloster Daphni, unter Kiefern, auf einem Bergabhange hingestreckt. Der Boden ist mit braunen Kiefernadeln bedeckt. Zwischen diesen Nadeln haben sich sehr feine, sehr zarte Gräser ans Licht gedrängt. Aber ich bin hierher gekommen, verlockt von zarten Teppichen weißer Maßliebchen. Sie zogen mich an, wie etwa ein Schwarm lieblicher Kinder anzieht, die man aus nächster Nähe sehen, mit denen man spielen will. Nun liege ich hier und um mich, am Grunde, nicken die zahllosen kleinen, weißen Schwestern mit ihren Köpfchen. Es ist kein Wald. Es sind ganz winzige Hungerblümchen, unter denen ich ein Ungeheuer, ein wahres Gebirge bin. Und doch strömen sie eine Beseligung aus, die ich seit den Tagen meiner Kindheit nicht mehr gefühlt habe.
Und auch damals, in meiner Kindheit, schwebte eine Empfindung, dieser ähnlich, nur feiertäglich durch meine Seele. Ich erinnere mich eines Traumes, den ich zuweilen in meiner Jugend gehabt habe, und der mir jedesmal eine Schwermut in der Seele ließ, da er mir etwas, wie eine unwiederbringliche, arkadische Wonne, schattenhaft vorgaukelte. Ich sah dann stets einen sonnigen, von alten Buchen bestandenen Hang, auf dem ich mit anderen kleinen Kindern bläuliche Leberblümchen abpflückte, die sich durch trockenes, goldbraunes Laub zum Lichte hervorgedrängt hatten. Mehr war es nicht. Ich nehme an, daß dieser Traum nichts weiter, als die Erinnerung eines besonders schönen, wirklich durchlebten Frühlingsmorgens war, aber es scheint, daß ein erstes Genießen der goldenen Lust, zu der sich die Sinne des Kindes erschlossen, das unvergeßliche Glück dieser kurzen Stunde gewesen ist.
Ich liege auf olympischer Erde ausgestreckt. Ich bin, wie ich fühle, zum Ursprung meines Kindestraumes zurückgekehrt. Ja, es ward mir noch Höheres vorbehalten! Mit reifem Geist, mit bewußten, viel umfassenden Sinnen, im vollen Besitz aller schönen Kräfte einer entwickelten Seele, ward ich auf dieses feste Erdreich so vieler ahnungsvoll-grundloser Träume gestellt, in eine Erfüllung ohnegleichen hinein.
Und ich strecke die Arme weit von mir aus und drücke mein Gesicht antäos-zärtlich zwischen die Blumen in diese geliebte Erde hinein. Um mich beben die zarten Grashalme. Über mir atmen die niedrigen Wipfel der Kiefern weich und geheimnisvoll. Ich habe in mancher Wiese bei Sonnenschein auf dem Gesicht oder Rücken gelegen, aber niemals ging von dem Grunde eine ähnliche Kraft, ein ähnlicher Zauber aus, noch drang aus hartem Geröll, das meine Glieder kantig zu spüren hatten, wie hier ein so heißes Glück in mich auf.
Ich bin auf der Rückfahrt von Eleusis nach Athen wieder in diese lieblichen Berge gelangt. Die heilige Straße liegt unter mir, die Athen mit Eleusis verbindet. Herden von Schafen und Ziegen, die in dem grauen Gestein der Talabhänge umhersteigen, grüßen von da und dort mit ihrem Geläut, das, melodisch glucksend, an die Geräusche eines plaudernden Bächleins erinnert.
In der Nähe beginnt ein Kuckuck zu rufen, zunächst allein: und heiter gefragt, schenkt er mir drei Jahrzehnte als Antwort. Es ist mir genug! Nun tönt aus den Kiefernhainen von jenseit des heiligen Weges ein zweiter Prophet: und beide Propheten beginnen und fahren lange Minuten unermüdet fort, sich trotzig und wild, über die ganze Weite des Bergpasses hin, wahrscheinlich widersprechende Prophezeiungen zuzurufen.
Und wieder spüre ich um mich das Hallende. Die Rufe der streitenden Vögel wecken einen gespenstisch verborgenen Schwarm ihresgleichen zu einem Durcheinander von kämpfenden Stimmen auf und mit einer nur geringen Kraft der Einbildung höre ich den Lärm des heiligen Fackelzuges, von Athen gen Eleusis, aus den Bergen zurückschlagen.
Emporgestiegen zu den Gipfeln habe ich rings umher graues Geröll eines Bergrückens, Krüppelkiefern und Thymian, Mittagshitze und Mittagslicht. Unter mir liegen eingeschlossene Steintäler, verlassen und großartig pastoral. Hohe peloponnesische Schneeberge, Hymettos, Likabethos und Pentelikon schließen rings den Gesichtskreis ein. Der saronische Golf und die eleusinische Bucht leuchten herauf mit blauen Gluten. In heißen, zitternden Wolken, zieht überall würzig-bitterer Kräuterduft. Überall summen die Bienen der Demeter.
Wir betreten heute, gegen zehn Uhr abends, im Lichte des Vollmonds die Akropolis. Meine Erwartung, nun gleichsam alle Gespenster der Burg lebendig zu sehen, erfüllt sich nicht: Es müßte denn sein, daß sie alle in dem heiligen Äther aufgelöst seien, der den ganzen Tempelbezirk entmaterialisiert.
Mehr wie am Tage empfinde ich heut, und schon auf den Stufen der Propyläen, das Heiligtum, das Bereich der Götter. Ich zögere, weiter zu schreiten. Ich lasse mich im tiefen Schlagschatten einer Säule nieder und blicke über die Stufen zurück, die ich mir in die magisch-klare Tiefe fortgesetzt denke. Zum erstenmal verbindet sich mir das Ganze mit dem höheren Geistesleben, besonders des Perikleischen Zeitalters, dem der Burgfelsen seine letzte und höchste Weihe verdankt. Das Wirkliche wird im Lichte des Mondes schemenhaft unwirklich, und diesem Unwirklich-Wirklichen können sich historische Träume leichter angleichen.
Als vermöchte der Mond Wärme auszuströmen, so warm ist die Luft und dazu klar und still: das Zwitschern der Fledermäuse kommt aus dem Licht-Äther unter uns. Man fühlt, wie in solchem göttlichen Äther atmend und heimisch in diesem heiligen Bezirk, erlauchte Menschen mit Göttern gelebt haben. Hier, über den magischen Abgrund hinausgehoben, in einen unsäglich zarten, farbigen Glanz, war der Denker, der Staatsmann, der Priester, der Dichter, in Nächten wie diese, mit den Göttern auf gleichen Fuß gestellt und atmete, in naher Vertraulichkeit, mit ihnen die gleiche elysische Luft.
Man müßte von einem nächtlichen Blühen dieses am Tage so schroffen und harten, arg mitgenommenen Olympes reden, von einem Blühen, das unerwartet und außerirdisch die alte vergessene Götterglorie um seine Felskanten wiederherstellt.
Der Parthenon, von der Hymettosseite gesehen, ist in dieser Nacht nicht mehr das Gebilde menschlicher Bauleute. Diese scheinen vielmehr nur einem göttlichen Plane dienstbar gewesen zu sein, das Irdische gewollt, das Himmlische aber vollbracht zu haben. In diesem Tempel ist jetzt nichts Drohendes, nichts Düsteres, nichts Gigantisches mehr, und seine Steinmasse, seine irdische Schwere scheint verflüchtigt. Er ist nur ein Gebilde der Luft, von den Göttern selbst in einen göttlichen Äther hineingedacht und hervorgerufen. Er ist nicht aus totem Marmor zusammengefügt, er lebt! von innen heraus warm und farbig leuchtend, führt er das selige Dasein der Götter. Alles an ihm wird getragen, nichts trägt. Oder aber, es kommt ein Gefühl über dich, daß, wenn du, mit deinem profanen Finger, eine der Säulen zu berühren nicht unterlassen könntest, diese sogleich zu Staub zerspringen würde vor Sprödigkeit.
In dieser Stunde kommt uns die Ahnung von jenem Sein, das die Götter in ihrer Verklärung führen, von irdischen Obliegenheiten befreit. Auch Götter hatten Erdengeschäfte. Wir ahnen, von welchem Boden Platon zu seiner Erkenntnis der reinen Idee sich aufschwang. Welche Bereiche erschlossen sich in solchen schönheitstrunkenen Nächten, die warm und kristallklar zu ein und demselben Element mit den Seelen wurden ... welche Bereiche erschlossen sich den Künstlern und Philosophen hier, als den Gästen und nahen Freunden der Himmlischen!
Und damals, wie heute, drang, wie aus den Zelten eines Lustlagers, Gesang und Geschrei herauf aus der Stadt. Man braucht die Augen nicht zu schließen, um zu vergessen, daß jenes dumpfe Gebrause aus der Tiefe der Lärm des Athens von heute ist: vielmehr hat man Mühe das festzuhalten. In dieser Stunde, im Glanze des unendlichen Zaubers der Gottesburg, pocht und bebt und rauscht für den echten Pilger in allem der alte Puls. Und seltsam eindringlich wird es mir, wie das Griechentum zwar begraben, doch nicht gestorben ist. Es ist sehr tief, aber nur in den Seelen lebendiger Menschen begraben und wenn man erst alle die Schichten von Mergel und Schlacke, unter denen die Griechenseele begraben liegt, kennen wird, wie man die Schichten kennt, über den mykenäischen, trojanischen oder olympischen Fundstellen alter Kulturreste, aus Stein und Erz, so kommt auch vielleicht für das lebendige Griechenerbe die große Stunde der Ausgrabung.
Wir stehen auf dem hohen Achterdeck eines griechischen Dampfers und harren der Abfahrt. Der Lärm des Piräus ist um uns und unter uns. Wir wollen gen Delphi, zum Heiligtum des Apoll und Dionysos.
Mehr gegen den Ausgang des Hafens liegt ein weiß angestrichenes Schiff, ein Amerikafahrer, rings um ihn her auf der Wasserfläche, über die er emporragt, steht, wie auf Dielen, nämlich in kleinen Booten, eng gedrängt, eine Menschenmenge. Es sind griechische Auswanderer, Leute, die das verwunschene Land der Griechenseele nicht ernähren mag.
Dem Hafengebiet entronnen, genießen wir den frischen Luftzug der Fahrt. Unsere Herzen beleben sich. Wir passieren das kahle Inselchen, hinter dem die Schlacht bei Salamis ihren Verlauf genommen hat, den niedrigen Küstenzug, wo Xerxes seinen gemächlichen Thron errichten und vorzeitig abbrechen ließ. Der ganze, bescheidene Schauplatz deutet auf enge maritime Verhältnisse.
Die bergige Salamis öffnet in die fruchtbare Fülle des Innern ein weites Tal. Liebliche Berglehnen, Haine und Wohnstätten werden dem Seefahrer verlockend dargeboten: alles zum Greifen nahe! und es ist wie ein Abschied, wenn er vorüber muß.
Man weist uns Megara. Wir hätten es von der See aus nicht wiedererkannt: Megara, jetzt nur gespenstisch und bleich von seinen Hügeln winkend, die Stadt, die Konstantinopel gegründet hat. Wir werden den Weg der megarensischen Schiffe in einigen Wochen ebenfalls einschlagen.
Wenn wir nicht, wie bisher, über Steuerbord unseres Dampfers hinausblicken, sondern über seine Spitze, so haben wir in der Ferne alpine Schneegipfel des Peloponnes vor uns, darunter, vereinzelt, den drohenden Felsen der Burg von Korinth.
Wir suchen durch den zitternden Luftraum dieser augenblendenden Buchten den Standort des äginetischen Tempels auf, und meine Seele saugt sich fest an die lieblichen Inselfluren von Ägina. Warum sollten wir uns in der vollen Muße der Seefahrt, zwischen diesen geheiligten Küsten, der Träume enthalten und nicht der lieblichen Jägerin Britomartis nachschleichen, einer der vielen Töchter des Zeus, von der die Ägineten behaupteten, daß sie alljährlich von Kreta herüberkäme, sie zu besuchen.
Gibt es wohl etwas, das wundervoller anmutete, als die nüchterne Realität einer Mitteilung des Pausanias, etwa Britomartis angehend, wo niemals die Existenz eines Mitglieds der Götterfamilie, höchstens hie und da ein lokaler Anspruch der Menschen mit Vorsicht in Zweifel gezogen ist.
Nicht nur die Vasenmalereien beweisen es, daß der Grieche sich in allen Formen des niederen Eros auslebte: aber der schaffende Geist, der solche Gestalten, wie Britomartis, entstehen ließ und ihnen ewige Dauer beilegte, mußte das Element der Reinheit, in Betrachtung des Weibes, notwendig in sich bergen, aus dem sie besteht: keusch, frisch, unbewußt-jungfräulich, ist Britomartis im Stande glückseliger Unschuld bewahrt worden. Sie hat mit Amazonen und Nonnen nichts gemein. Es ist in ihr weder Männerhaß noch Entsagung, sondern sie stellt, mit dem freien, behenden Gang, dem lachenden Sperberauge, der Freude an Wald, Feld und Jagd, die gesunde Blüte frischen und herben Magdtums verewigt dar.
Überall auf der Fahrt sind Inseln und Küstenbereiche von lieblicher Intimität, und es ist etwas Ungeheueres, sich vorzustellen, wie hier die Phantasie eines Volkes, in dem die ungebrochene Weltanschauung des Kindes neben exakter und reifer Weisheit des Greisenalters fortbestand, jede Krümmung der Küste, jeden Pfad, jeden nahen Abhang, jeden fernen und ferneren Felsen und Schneegipfel mit einer zweiten Welt göttlich phantastischen Lebens bedeckt und bevölkert hat. Es ist ein Gewirr von Inseln, durch das wir hingleiten, uns jener Stätte mit jeder Minute nähernd, wo, gleichsam aus einem dunklen Quell, diese zweite Welt mit Rätselworten zurück ins reale Leben wirkte und damit zugleich die Atmosphäre des Heimatlandes mit neuem, phantastischem Stoff belud. Es gibt bei uns keine Entwicklung des spezifisch Kindlichen, das stets bewegt, stets gläubig und sprudelnd von Bildern ist, zum Weinen bereit und gleich schnell zum Jauchzen, zum tiefsten Abgrund hinabgestürzt und gleich darauf in den siebenten Himmel hinaufgeschnellt, glückselig im Spiel, wo nichts das vorstellt, was es eigentlich ist, sondern etwas anderes, Erwünschtes, wodurch das Kind es sich, seinem Wesen, seinem Herzen zu eigen macht.
Der große Schöpfungsakt des Homer hat dem kosmischen Nebel der Griechenseele den reichsten Bestand an Gestalten geschenkt, und die Zärtlichkeit, die der spätere Grieche ihnen entgegentrug, zeigt sich besonders in mancher Mythe, die wieder lebendig zu machen unternimmt, was der blinde Homer vor den Schauern des Hades nicht zu retten vermochte. Ich weiß nicht, ob hier herum irgendwo Leuke ist, aber ich wüßte keine Sage zu nennen, die tiefer in das Herz des Griechen hineinleuchtete, als jene, die Helena dem Achill zur Gattin gibt und beide in Wäldern und Tempelhainen der abgeschiedenen kleinen Insel Leuke ein ewig seliges Dasein führen läßt.
Unser Dampfer ist vor dem Eingang zum isthmischen Durchstich angelangt und einige Augenblicke stillgelegt. Mein Wunsch ist, wiederzukehren und besonders auch auf dem herrlichen Isthmus umherzustreifen, dieser gesunden und frischen Hochfläche, die würdig wäre, von starken, heiteren, freien und göttlichen Menschen bewohnt zu sein, die noch nicht sind. Das Auge erquickt sich an weitgedehnten, hainartig lockeren Kieferbeständen, deren tiefes und samtenes Grün, auf grauen, silbererzartigen Klippen, hoch an die blaue Woge des Meeres tritt. Auf diesen bewaldeten Höhen zur Linken hat man den Platz der isthmischen Spiele zu suchen. Man sollte meinen, daß keiner der zahllosen Spielbezirke freier und in Betrachtung des ganzen Griechenlandes günstiger lag, und ferner: daß nirgend so belebt und im frischen Zuge der Seeluft überschäumend die heilige Spiellust des Griechen sich habe auswirken können, wie hier.
Die Einfahrt in den Durchstich erregt uns seltsamerweise feierliche Empfindungen. Die Passagiere werden still, im plötzlichen Schatten der gelben Wände. Wir blicken schweigend zwischen den ungeheuren, braungelben Schnittflächen über uns und suchen den Streifen Himmelsblau, der schmal und farbig in unseren gelben Abgrund herableuchtet.
Kleine, taumelnde, braun-graue Raubvögel scheinen in den Sandlöchern dieser Wände heimisch, ja, der Farbe nach, von ihnen geboren zu sein. Eine Krähe, wahrscheinlich von unserm Dampfer aufgestört, strebt, ängstlich gegen die Wände schlagend, an die Oberfläche der Erde hinauf. Nun bin ich nicht mehr der späte Pilger durch Griechenland, sondern eher Sindbad der Seefahrer, und einige Türken, vorn an der Spitze des rauschenden Schiffes, jeder mit seinem roten Fez längs der gelblichen Ockerschichten gegen den Lichtstreif des Ausganges hingeführt, befestigen diese Illusion.
Der Golf von Korinth tut sich auf. Aber während wir noch zwischen nahen und flachen Ufern hingleiten, denn wir haben die weite Fläche des Golfes noch nicht erreicht, werden wir an einem kleinen Zigeunerlager vorübergeführt und sehen, auf einer Art Landungssteg, zerlumpte Kinder der, wie es scheint, auf ein Fährboot wartenden Bande mit wilden Sprüngen das Schiff begrüßen.
Nach einiger Zeit, während wir immer zur Linken das neue Korinth, die weite, mit Gerstenfeldern bestandene Fläche des einstigen alten, das von dem gewaltigen Felsen Akrokorinth drohend beschattet wurde und die bergigen Küsten des Peloponnes vor Augen hatten, eröffnet sich zur Rechten eine Bucht mit den schneebedeckten Gipfeln des Helikon. Eine Stunde und länger bleibt er nun, immer ein wenig rechts von der Fahrtrichtung, sichtbar, hinter niedrigen, nackten Bergen, die vorgelagert sind. Die Luft war bis hierher schwül und still, nun aber fällt ein kühler Wind von den Höhen des Heiligen Berges herab und in einige Segel, die leicht und hurtig vor ihm her über das blaue Wasser des Golfes vorüberschweben.
Aller Schönheit geht Heiligung voraus. Nur das Geheiligte in der Menschennatur konnte göttlich werden, und die Vergötterung der Natur ging hervor aus der Kraft zu heiligen, die zugleich auch Mutter der Schönheit ist. Wir haben heut eine Wissenschaft von der Natur, die leider nicht von einem heiligen Tempelbezirk umschlossen ist. Immerhin ist sie, und Wissenschaft überhaupt, eine gemeinsame Sache der Nation, ja der Menschheit geworden. Was auf diesem Gebiete geleistet wird, ist schließlich und endlich ein gemeinsames Werk. Dagegen bleiben die reinen Kräfte der Phantasie heute ungenützt und profaniert, statt daß sie am großen sausenden Webstuhl der Zeit gemeinsam der Gottheit lebendiges Kleid wie einstmals wirkten.
Und deshalb, weil die Kräfte der Phantasie heut vereinzelt und zersplittert sind und keine gemäße Umwelt (das heißt: keinen Mythos) vorfinden, außer jenem, wie ihn eben das kurze Einzelleben der Einzelkraft hervorbringen kann, so ist für den Spätgeborenen der Eintritt in diese unendliche, wohlgegründete Mythenwelt zugleich so beflügelnd, befreiend und wahrhaft wohltätig.
Sollte man nicht einer gewissen, nur persönlichen Erkenntnis ohne Verantwortung nachhängen dürfen, die den gleichen Vorgang, der jemals etwas wie eine Tragödie oder Komödie schuf, als Ursprung des ganzen Götterolymps, als Ursprung des gesamten, jenem angenäherten Kreises von Heroen und Helden sieht? Wo sollte man jemals zu dergleichen den Mut gewinnen, wenn nicht auf einem Schiffe im Golf von Korinth, im Angesichte des Helikon? Warum hätte sonst Pan getanzt, als Pindar geboren worden war? und welche Freude muß unter den Göttern des Olymps, von Zeus bis zu Hephaistos und Aidoneus hinunter, ausgebrochen sein, als Homer und mit ihm die Götterwelt aufs neue geboren wurde.
Die ersten Gestalten des ersten Dramas, das je im Haupte des Menschen gespielt wurde, waren „ich“ und „du“. Je differenzierter das Menschenhirn, um so differenzierter wurde das Drama! um so reicher auch an Gestalten wurde es und auch um so mannigfaltiger, besonders deshalb, weil im Drama eine Gestalt nur durch das, was sie von den übrigen unterscheidend absetzt, bestehen kann. Das Drama ist Kampf und ist Harmonie zugleich, und mit der Menge seiner Gestalten wächst auch der Reichtum seiner Bewegungen: und also, in steter Bewegung Gestalten erschaffend, in Tanz und Kampf miteinander treibend, wuchs auch das große Götterdrama im Menschenhirn, zu einer Selbständigkeit, zu einer glänzenden Schönheit und Kraft empor, die jahrtausendelang ihren Ursprung verleugnete.
Polytheismus und Monotheismus schließen einander nicht aus. Wir haben es in der Welt mit zahllosen Formen der Gottheit zu tun, und jenseit der Welt mit der göttlichen Einheit. Diese eine, ungeteilte Gottheit ist nur noch ahnungsweise wahrnehmbar. Sie bleibt ohne jede Vorstellbarkeit. Vorstellbarkeit ist aber das wesentliche Glück menschlicher Erkenntnis, dem darum Polytheismus mehr entspricht. Wir leben in einer Welt der Vorstellungen, oder wir leben nicht mehr in unserer Welt. Kurz: wir können irdische Götter nicht entbehren, wenngleich wir den Einen, Einzigen, Unbekannten, den Alleinen, hinter allem wissen. Wir wollen sehen, fühlen, schmecken und riechen, disharmonisch harmonisch das ganze Drama der Demiurgen, mit seinen olympischen und plutonischen Darstellern. Im „Christentum“ macht der Sohn Gottes einen verunglückten Besuch in dieser Welt, bevor er sie aufgibt und also zertrümmert. Wir aber wollen sie nicht aufgeben, unsere Mutter, der wir verdanken, was wir sind, und wir bleiben im Kampf, verehren die kämpfenden Götter, die menschennahen; freilich vergessen wir auch den menschenfernen, den Gott des ewigen Friedens nicht.
Ein kalter Gebirgswind empfängt uns bei der Einfahrt in die Bucht von Galaxidhi, den alten Krisäischen Meerbusen, und überraschenderweise scheint es mir, als liefe unser Schiff in einen Fjord und wir befänden uns in Norwegen, statt in Griechenland. Beim Anblick der Nadelwälder, von denen die steile Flanke der Kiona bedeckt ist, erfüllt mich das ganze starke und gesunde Bergglück, das mir eingeboren ist. Es zieht mich nach den Gipfeln der waldreichen Kiona hinauf, wohin ich die angestrengten Blicke meiner Augen aussende, als vermöchte ich dort noch heut einen gottselig begeisterten Schwarm rasender Bacchen zwischen den Stämmen aufzustöbern. Es liegt in mir eine Kraft der Zeitlosigkeit, die es mir, besonders in solchen Augenblicken, möglich macht, das Leben als eine große Gegenwart zu empfinden: und deshalb starre ich immer noch forschend hinauf, als ob nicht Tausende von Jahren seit dem letzten Auszug bacchischer Schwärme vergangen wären, und es klingt in mir ununterbrochen:
Dahin leite mich, Bromios, der die bacchischen Chöre führt!
Da sind Chariten, Liebe da,
Da dürfen frei die Bacchen Feste feiern.
Wer hält es sich immer gegenwärtig, daß die Griechen ein Bergvolk gewesen sind? Während wir uns Ithea nähern, tiefer und tiefer in einen ernsten Gebirgskessel eingleitend, erlebe ich diese Tatsache innerlich mit besonderer Deutlichkeit. Die Luft gewinnt an erfrischender Stärke. Die Formen der Gipfel stehen im tiefen und kalten Blau des Himmels kalt und klar, und jetzt erstrahlt uns zur Rechten, hoch erhaben über der in abendlichen Schatten dämmernden Bucht, hinter gewaltig vorgelagerten, dunkel zerklüfteten, kahlen Felsmassen ein schneebedecktes parnassisches Gipfelbereich.
Nun, wo die Sonne hinter der Kiona versunken ist und chthonische Nebel langsam aus den tiefen Flächen der Felsentäler, Terrassen und Risse verdüsternd aufsteigen, steht der Höhenstreif des heiligen Berges Parnaß noch in einem unwandelbar makellosen und göttlichen Licht. Mehr und mehr, indes das Schiff bereits seinen Lauf verlangsamt hat, erdrückt mich eine fast übergewaltige Feierlichkeit.
Man fühlt zugleich, daß man hier nicht mehr im Oberflächenbereich der griechischen Seele ist, sondern den Ursprüngen nahe kommt, nahe kommt in dem Maße, als man sich dem Kern der griechischen Landschaft annähert.
Man findet sich hier einer großen Natur gegenübergestellt, die nordische Rauheit und nordischen Ernst mit der Weichheit und Süße des Südens vereinigt, die hier und dort ringsumher beschneite Berggipfel in den nahen Höhenäther gehoben hat, deren Flanken bis zur Fläche des südlichen Golfes herabreichen, bis an die Krisäische Talsohle, die in gleicher Ebene, einen einzigen, weitgedehnten Ölwald tragend, den Grund des Tales von Krisa erfüllt. Man fühlt, man nähert sich hier den Urmächten, die sich den erschlossenen Sinnen eines Bergvolks, nicht anders wie das Wasser der Felsenquellen, die Frucht des Ölbaums oder des Weinstocks, darboten, so daß der Mensch, gleichwie zwischen Bergen und Bäumen, zwischen Abgründen und Felswänden, zwischen Schafen und Ziegen seiner Herden oder im Kampf, zwischen Raubtieren, auch allüberall unter Göttern, über Göttern und zwischen göttlichen Mächten stand.
Wir steigen, angelangt in Ithea, in einen Wagen, vor den drei Pferde gespannt sind. Die Fahrt beginnt, und wir werden durch Felder grüner Gerste in das Tal von Krisa hineingeführt. Im Getreide tauchen hie und da Ölbäume auf, und mehr und mehr, bis sie zu Hainen zusammentreten und wir zu beiden Seiten der staubigen Straße von Olivenwäldern begleitet sind. Im Halblicht unter den Wipfeln liegen quadratisch begrenzte Wasserflächen. Nicht selten steigt ein gewaltiger Baum daraus empor, scheinbar mit seinem Stamme in einem glattpolierten Spiegel aus dunklem Silber wurzelnd, einem Spiegel, der einen zweiten Olivenbaum, einen rötlichen Abendhimmel und einen anderen, nicht minder strahlenden Parnassischen Gipfel zeigt.
Bauern, die aus den Feldern heimwärts nach den Wohnungen im Gebirge streben, werden von uns im Dämmer der Waldstraße überholt. Es scheint ein in mancher Beziehung veredelter deutscher Schlag zu sein, so überaus vertraut in Haltung, Gang und Humor, in den Proportionen des Körpers, sowie des Angesichts, mit dem blonden Haar und dem blauen Blick, wirken auf mich die Trupps der Landleute. Wir lassen zur Linken ein eilig wanderndes und mit einer dunklen Genossin plauderndes, blondes Mädchen zurück. Sie ist frisch und derb und germanisch kernhaft. Die Art ihres übermütigen Grußes ist zugleich wild, verwegen, ungezogen und treuherzig. Sie würde sich von der jungen und schönen deutschen Bauernmagd, wie ich sie auf den Gütern meiner Heimat gesehen habe, nicht unterscheiden, wenn sie nicht doch ein wenig geschmeidiger und wenn sie nicht eine Tochter aus Hellas wäre.
Und ich gedenke der Pythia.
Religiöses Empfinden hat seine tiefsten Wurzeln in der Natur; und sofern Kultur nicht dazu führt, mit diesem Wurzelsystem stärker, tiefer und weiter verzweigt in die Natur zu dringen, ist sie Feindin der Religion. In diesem großen und zugleich urgesunden Bereich des nahen, großen Mysteriums denkt man nicht an die Götterbilder der Blütezeit, sondern höchstens an primitive Holzbilder, jene Symbole, die, durch Alter geheiligt, der Gottheit menschliche Proportionen nicht aufzwangen. Man gedenkt einer Zeit, wo der Mensch mit allen starken, unverbildeten Sinnen noch gleichsam voll ins Geheimnis hinein geboren war: in das Geheimnis, von dem er sich Zeit seines Lebens durchaus umgeben fand und das zu enthüllen er niemals wünschte.
Nicht der Weltweise war der Ersehnte oder Willkommene unter den Menschen jener Zeit, außer wenn er sich gleich dem Jäger oder dem Hirten — der wahre Hirt ist Jäger zugleich! — zur ach so wenig naiven Verehrung eines Idoles, einer beliebigen Rätselerscheinung, der nur im Rätsel belebten Natur, verstand, sondern ersehnt und willkommen war immer wieder nur das Leben, das tiefere Leben, das den Rausch erzeugende Rätsel.
Immer jedoch ist der Mensch dem Menschen Träger und Verkünder der tiefsten Rätsel zugleich gewesen und so ward das Rätsel stets am höchsten verehrt, wenn es sich durch den Menschen verkündigte, die Gottheit, die durch den Menschen spricht. Und um so höher ward es unter jenen Menschen verehrt, ward die Gottheit verehrt, je mehr sie den schlichten Mann, das gewöhnliche Weib aus dem Hirten- und Jägervolke gewaltsam vor aller Augen umbildete, so daß es von Grund auf verändert, von einem Gott oder Dämon beherrscht, als Rätsel erschien.
Ein so verändertes Wesen war vor urdenklichen Zeiten die erste bäurische Pythia, und sie erschien in den Händen des bogenführenden Jägers und Rinderherden besitzenden Hirten, in den Händen des Jäger- und Hirtengottes Apollon willenlos. Den Willen des Menschen zerbrach der Gott, wie man ein Schloß zerbrechen muß, das die Tür eines fremden Hauses verschließt, will man als Herrscher und Herr in dieses eintreten; und nicht der menschliche Wille, sondern gleichsam die Knechtschaft im göttlichen, nicht Vernunft, sondern Wahnsinn besaß vor den Menschen damals allein die Staunen und Schauder verbreitende Autorität.
Die Pferde beginnen bergan zu klimmen. Mehr und mehr, während wir aus den dunklen Olivenwäldern emportauchen, verdichtet sich um uns die Dämmerung. Die Luft ist warm und bewegungslos. Es ist eine Art tierischer Wärme in der Luft, die aus dem Erdboden, aus den Steinblöcken um uns her, ja überall her zu dunsten scheint. Überall klettern Ziegenherden. Ziegenherden kreuzen den Weg oder trollen ihn mit Geläut zu Tal. Ich fühle auf einmal, wie hier das Hirten- und Jägerleben nicht mehr nur als Idyll zu begreifen ist. In dieser brütenden Atmosphäre, wie sie über den schwarzen Olivenwäldern der Tiefe, in dem weiten, gewaltig zerklüfteten Abgrund zwischen den Wällen schroffer Gebirge steht, wird mein Blut überdies zu einem seltsamen Fieber erregt, und es ist mir, als könne aus dieser buhlerisch warmen, stehenden Luft die Frucht des Lebens unmittelbar hervorgehen. Das Geheimnis ist ringsum nahe um mich. Fast bang empfinde ich seine Berührungen. Es ist, als trennte — sagen wir von den „Müttern“! nur eine dünne Wand oder als läge das ganze Geheimnis, in dem wir schlummern, in einem zurückgehaltenen, göttlichen Atemzug, dessen leisestes Flüstern uns eine Erkenntnis eröffnen könnte, die über die Kraft des Menschen geht.
Ich habe in diesem Augenblick mehr als je zu bedauern, daß mir der musikalische Ausdruck verschlossen ist, denn alles um mich wird mehr und mehr zu einer einzigen, großen, stummen Musik. Das am tiefsten Stumme ist es, was der erhabensten Sprache bedarf, um sich auszudrücken. Allmählich verbreitet sich jenes magische Leuchten in der Natur, das alles vor Eintritt völliger Dunkelheit noch einmal in traumhafter Weise verklärt. Aber Worte besagen nichts, und ich würde, mit der wahrhaft dionysischen Kunst begabt, nach Worten nicht ringen müssen.
Ich empfinde inmitten dieser grenzenlos spielenden Schönheit, die von einem grunderhabenen düsteren Glanze gesättigt ist, immer eine fast schmerzhafte Spannung, als ob ich mich einem redenden Brunnen, einem Urbrunnen aller chthonischen Weisheit gleichsam annäherte, der, wiederum einem Urmunde gleich, unmittelbar aus der Seele der Erde geöffnet sein würde.
Niemals, außer in Träumen, habe ich Farben gesehen, so wie hier auf dem Marktplatze von Chryso, in dessen Nähe das alte Krisa zu denken ist. In diesem Bergstädtchen werden unsere Zugtiere getränkt. In Eimern holt man das Wasser aus dem nahen städtischen Brunnen, der im vollen, magischen Licht des Abends sich, aus dem Felsen rauschend, in sein steinernes Becken stürzt. Hier drängen sich griechische Mädchen, Männer und Maultiere, während im Schatten des Hauses gegenüber würdige Bauern und Hirten beim Weine von den Lasten des Tages ausruhen. Alles dieses wirkt feierlich schattenhaft. Es ist, als bestünde in dem Menschengedränge des kleinen Platzes die geheiligte Übereinkunft, die innere Sammlung der delphischen Pilger nicht durch laute Worte zu stören.
Unter den schweigsam Trinkenden, die uns mit Würde beobachten und ganz ohne Zudringlichkeit, fällt manche edle Erscheinung auf. Von einem Weißbart vermag ich mein Auge lange nicht abzuwenden. Er ist der geborene Edelmann. Die Haltung des schlanken Greises, der seine eigene Schönheit durchaus zu schätzen weiß, ist durchdrungen von einem Anstand, der eingeboren ist. Aus seinem Antlitz sprechen Güte und Menschlichkeit: ich sehe in ihm das Gegenbild aller Barbarei. An diesem Hirten legt jede Wendung des Hauptes, jede gelassene Bewegung des Armes von edler Herkunft Zeugnis ab: von einer Jahrtausende alten, verfeinerten Hirtenwürde! denn wo wäre die Freiheit der Haltung, die stolze Gewohnheit des Selbstgenügens, die Würde des Menschen vor dem Tier, weniger gestört, als im Hirtenberuf.
Es ist, nachdem wir die Stadt verlassen haben und weiter die steilen Kehren aufwärts dringen, als sänke sich von allen Seiten, dichter und dichter, Finsternis über das Geheimnis, dem wir entgegenziehen, schützend herein. Es ist wie eine Art Unschlüssigkeit in der Natur, als deren bevorzugtes Kind sich der gläubige Grieche fühlen muß, die sich mir aber dahin umdeutet, als sollte erst durch die volle Erkenntnis einengender Finsternis der volle Durst zum Orakelbrunnen erzeugt werden.
Noch immer ist die stehende Wärme auch in der fast völligen Dunkelheit verbreitet um mich. Der Himmel hat rötlich zuckende Sterne enthüllt, aber der Blick ist von nun an beengt und eingeschlossen. Die große Empfindung der Götternähe weicht einer gewissen heimlich schleichenden Spukhaftigkeit, und so will ich nun auch eine Vorstellung dieser spukhaften Art aus dem Erlebnis der unvergleichlichen Stunden festhalten.
Mehrmals und immer wieder kam es mir vor, als stiege der Schatten eines einzelnen Mannes mit uns nach dem gleichen Ziele hinan, und zwar auf einem Fußsteige immer die Kehren der großen Straße abschneidend. Kamen wir bis an die Kreuzungsstelle heran, so schien es, als sei er schon vorüber, oder er war zurückgeblieben und stieg weit unten, schattenhaft über die Böschung der tieferen Straßenschlinge herauf. Auch jetzt unterliege ich wieder dem Zwang dieser Vorstellung.
Es ist unumgänglich, daß ein bis ins tiefste religiös erregter, christlich erzogener Mensch, auch wenn er das innere Auge abwendet, gleichsam mittels des peripherischen Sehens doch immer auf die Gestalt des Heilands treffen muß: und dies war mir und ist mir noch jetzt jener Schatten. Etwas wie Unruhe, etwas wie Hast und Besorgnis scheint ihn den gleichen Weg zu treiben, und etwas, wie der gleiche, immer noch ungestillte Durst.
Und ist nicht auch er wiederum ein Hirt? Sah er sich selbst nicht am liebsten unter dem Bilde des Hirten? Sehen ihn nicht die Völker als Hirten? Und verehren ihn nicht die prunkhaften Hohenpriester von heut, mit dem Symbole des Hirtenstabes in der Hand, als göttlichen Hirten, als Hirtengott?
Heut, am frühen Morgen aus meiner Herberge tretend, befinde ich mich auf der sonnigen Dorfstraße eines alpinen Dörfchens. Wenn ich die Straße nach rechts entlang blicke, wo sie, nach mäßiger Steigung, in einiger Ferne abbricht oder in den weißlichen, heißen und wolkenlosen Himmel auszulaufen scheint, so bemerke ich die Spitze eines entfernteren Schneeberges, der sie überragt.
Die Straße läuft meist dicht am Abhang hin. Von ihrem Rande ermesse ich die gewaltige Tiefe eines schluchtartigen Tales, mit steilen Felswänden gegenüber. Die grauen Steinmassen sind durch Thymiansträucher dunkel gefleckt.
Der Grund der Schlucht scheint ein Bachbett zu sein, und wie sich Wasser von seiner hochgelegenen Quelle herniederwindet, bis es am Ende der verbreiterten Schlucht in den weiten See eines größeren Tales tritt, ergießen sich hier, gleichsam wie Wogen aus dunklem Silber, Olivenwaldungen in die Tiefe, wo sie die Fülle des ölreichen Tales von Krisa aufnimmt.
Es ist eine durchaus nur schlichte und ganz gesunde alpine Wonne, die mich erfüllt, jener Zustand des bergluftseligen Müßigganges, in dem man so gern das Morgenidyll dörflichen Lebens beobachtet.
Hähne und Tauben machen das übliche Morgenkonzert. Es wird in der Nähe ein Pferd gestriegelt. Beladene Maultiere trappen vorüber. Alles ist von jener erfrischenden Nüchternheit, die wiederum die gesunde Poesie des Morgens ist.
Kastri heißt das Dorf, in dem wir sind und genächtigt haben. Einige Schritte auf der mit grellstem Lichte blendenden Landstraße um einen Felsenvorsprung herum, und der heilige Tempelbezirk von Delphi soll sich enthüllen.
In diesem Felsenvorsprung, den wir nun erreichen, sind die offenen Höhlen ehemaliger Felsgräber. Nahe dabei haben Wäscherinnen ihren Kessel über ein aromatisches Thymianfeuer gestellt, das uns mit Schwaden erquickenden Weihrauchs umquillt. Schwalben schrillen an uns vorüber, Fliegen summen, irgendwoher dringt das Hungergeschrei junger Nestvögel, und die Sonne scheint, triumphierend gleichsam, bis in die letzten Winkel der leeren Gräber hinein.
Eine zahlreiche Herde schöner Schafe begegnet uns, und minutenlang umgibt uns das freudige Älplergeräusch ihrer Glocken. Ich beobachte eine dicke Glockenform mit tiefem Klang, von der man sagt, daß sie antikem Vorbild entspreche. Inmitten der Herde bewegt sich der dienende Hirt und ein herrenhaft-heiter wandelnder Mann in der knappen, vorwiegend blauen Tracht der Landleute.
Dieser Mann erscheint zugleich jung und alt: insofern jung, als er schlank und elastisch ist, insofern alt, als ein breiter, vollkommen weißer Bart sein Gesicht umrahmt. Doch es ist die Jugend, die in diesem Manne triumphiert: das beweist sein schalkhaft blitzendes Auge, beweist der freie, übermütige Anstand der ganzen Persönlichkeit, eine Art behaglich fröhlichen Stolzes, der weiß, daß er unwiderstehlich fasziniert.
Als Staub und Geläut uns am stärksten umgeben, bemerken wir, wie dieser schöne und glückliche Mann, der übrigens seine Jagdbüchse über der Schulter trägt, den langen Stab aus der Hand seines Hirten nimmt. Gleich darauf tritt er uns entgegen und bietet uns, wirklich aus heiterem Himmel, eben denselben Stab als Gastgeschenk.
Die Wendung des Weges ist erreicht. Die Straße zieht sich in einem weiten Bogen eng unter mächtigen roten Felswänden hin, und der erste Blick in dieses schluchtartige, delphische Tal sucht vergeblich nach einer geeigneten Stätte für menschliche Ansiedelung. Von den roten, senkrecht starrenden Riesenmauern der Phädriaden ist ein Böschungsgebiet abgebröckelt, das steil und scheinbar unzugänglich über uns liegt. Überall in den Alpen trifft man ähnliche Schutt- und Geröllhalden, auf denen man, ebenso wie hier, höchstens weidende Ziegen klettern sieht. Selten bemerkt man dort, etwa in Gestalt einer besonders ärmlichen Hütte, Spuren menschlicher Ansiedelung, während hier der unwahrscheinliche Baugrund für ein Gewirr von Tempeln, tempelartigen Schatzhäusern, von Priesterwohnungen, von Theater und Stadion, sowie von zahllosen Bildern aus Stein und Erz zu denken ist.
Wir schreiten die weiße Straße langsam fort. Wir scheuchen eine anderthalb Fuß lange, grüne Eidechse, die den Weg, ein Wölkchen Staub vor uns aufregend, überquert. Ein Esel, klein, mit einem Berge von Ginster bepackt, begegnet uns: es heißt, daß die Bauern aus Ginster Körbe zur Aufbewahrung für Käse flechten. Ein Maultier schleppt eine Last von bunten Decken gegen Kastri heran, begleitet von einer Handelsfrau, die während des Gehens nicht unterläßt, von dem Wocken aus Ziegenhaar fleißig denselben Faden zu spinnen, aus dem jene Decken gewoben sind.
Immer die steile Böschung des delphischen Tempelbezirks vor Augen, drängt sich mir der Gedanke auf, daß alle die einstigen Priester des Apoll sowohl als die des Dionysos, alle diese Tempel, Theater und Schatzhäuser von ehemals, alle diese zahllosen Säulen und Statuen den Ziegen und einer gewissen Ziegenhirtin gefolgt und nachgeklettert sind.
Das Hirtenleben ist in den meisten Fällen ein Leben der Einsamkeit. Es begünstigt also alle Kräfte visionärer Träumerei. Ruhe der äußeren Sinne und Müßiggang erzeugen die Welt der Einbildung, und es würde auch heut nicht schwer halten, etwa in den Irrenhäusern der Schweiz ländliche Mädchen zu finden, die, befangen in einem religiösen Wahn, von ähnlichen Dingen überzeugt sind, von ähnlichen Dingen „mit rasendem Munde“ sprechen, als die erste Seherin, die Sibylle oder ihre Nachfolgerin zu Delphi, tat. Diese hielten sich etwa für die angetraute Gattin Apolls, oder für seine Schwester, oder erklärten sich für Töchter von ihm.
Wir klettern die steile Straße innerhalb des Tempelbezirkes empor. Überall zwischen den Fundamenten ehemaliger Tempel, Schatzhäuser, Altäre und Statuen blüht die Kamille in großen Büschen, ebenso wie in Eleusis und auf der Akropolis. Die Steine der alten und steilen Straße sind glatt, und mit Mühe nur dringen wir, ohne rückwärts zu gleiten, hinan.
Nicht weit von dem Felsenvorsprung, den man den Stein der Sibylle nennt, ruhe ich aus. In heiß duftenden Büscheln der Kamille, zwischen die ich mich niedergelassen habe, tönt ununterbrochen Bienengesumm. Wer möchte an dieser Stelle mit Fug behaupten wollen, daß ihm die ungeheure Vergangenheit dieser steilen Felslehne in allem Besonderen gegenwärtig sei. Der chthonische Quell, jene, verwirrende Dämpfe ausströmende Felsspalte, die Corethas entdeckte, quillt, wie es heißt, nicht mehr, und schon zur Zeit des großen Periegeten hatten die Dämonen das Orakel verlassen. Werden sie jemals wiederkehren? Und wird, wie es heißt, wenn sie wiederkehren, das Orakel gleich einem lange ungenutzten Instrument göttlichen Ausdrucks aufs neue erschallen?
Die architektonischen Trümmer umher erregen mir einstweilen nur geringe Aufmerksamkeit. Die Kunst inmitten dieser gewaltigen Felsmassen hatte wohl immer, nur im Vergleich mit ihnen, Pygmäencharakter. Durchaus überragend in wilder, unbeirrbarer Majestät bleibt hier die Natur, und wenn sie auch mit Langmut oder auf Göttergebot die Siedelungen der menschlichen Ameise duldet, die sich, nicht ohne Verwegenheit, hier einnistete, so bleibt die Gewalt ihrer Ruhe, die Gewalt ihrer Sprache, die überragende Macht ihres Daseins, das unter allem, hinter allem, über und in allem Gegenwärtige.
Man denkt an Apoll, man denkt an Dionysos, aber an ihre Bilder aus Stein und Erz denkt man in dieser Umgebung nicht: eher wiederum an gewisse Idole, die uralten Holzbilder, deren keines leider auf uns gekommen ist. Man sieht die Götter da und dort, leuchtend, unmaterialisch, visionär, hauptsächlich aber empfindet man sie in der Kraft ihrer Wirkungen. Hier bleiben die Götter das, was unsichtbar gegenwärtig ist: und so bevölkern sie, bevölkern unsichtbare Dämonen die Natur.
Ist wirklich der chthonische Quell versiegt? Haben die Dämonen wirklich die Orakel verlassen? Sind gar die meisten von ihnen tot, wie es heißt, daß der große Pan gestorben ist? Und ist wirklich der große Pan gestorben?
Ich glaube, daß eher jeder andere Quell des vorchristlichen Lebensalters verschüttet ist als der pythische und glaube, daß der große Pan nicht gestorben ist: nicht aus Schwäche des Alters und ebensowenig unter den jahrtausendelangen Verfluchungen einer christlichen Klerisei. Und hier, zwischen diesen sonnebeschienenen Trümmern, ist mir das ganze totgeglaubte Mysterium, sind mir Dämonen und Götter samt dem totgesagten Pan gegenwärtig.
Noch heut sind unter den „vielen Strömen, die unsere Erde nach oben sendet“, viele, die in den Seelen der Menschen eine Verwirrung und Begeisterung hervorrufen, wie in dem Hirten Corethas jener, der in Delphi zutage trat, auch wenn wir dieser Begeisterung wenig achten und die tiefen Weihen nicht mehr allgemein machen wollen, die mit dem heiligen Rausch verbunden sind.
Dieser Parnaß und diese seine roten Schluchten sind Quellgebiet: Quellgebiet natürlicher Wasserströme und Quellgebiet jenes unversiegbaren, silbernen Stromes der Griechenseele, wie er durch die Jahrtausende fließt. Es ist ein anderer Reiz und Geist, der die Quellen, ein anderer, der den Lasten und Wimpel tragenden Strom umgibt. Seltsam, wie der Ursprung des Stromes und seine Wiege dem urewig Alten am nächsten ist: das ewig Alte der ewigen Jugend. Man kann solche Quellgebiete nicht einmal mit Fug allein griechisch nennen, denn sie sind meist, im Gegensatz zu den Strömen, die sie nähren, namenlos.
Gegenüber, jenseit des Taleinschnitts, tönen von der Felswand, dem Ruf des Hornes von Uri nicht unähnlich, gewaltige Laute eines Dudelsacks, hervorgerufen von Hirten, die unerkennbar mit ihren Ziegen in den Felsen umhersteigen. Diese gesegneten Quellgebiete waren und sind noch heute von Hirten umwohnt. Platon nennt die Seele einen Baum, dessen Wurzeln im Haupte des Menschen sind und der von dort aus mit Stamm, Ästen und Blättern sich in das Bereich des Himmels ausdehnt. Ich betrachte die Welt der Sinne als einen Teil der Seele und zugleich ihr Wurzelgebiet, und verlege in das menschliche Hirn einen metaphysischen Keim, aus dem dann der Baum des Himmels mit Stamm, Ästen, Blättern, Blüten und Früchten empordringt.
Nun scheint es mir, daß die Sinne des Jägers, die Sinne des Hirten, die Sinne des Jägerhirten, sagen wir, die feinsten und edelsten Wurzeln sind und daß ein Hirten- und Jägerleben auf Berghöhen der reichste Boden für solche Wurzeln, und also die beste Ernährung für den metaphysischen Keim im Menschen ist.
Zwischen den Trümmern des steilen Tempelbezirks von Delphi umherzusteigen, erfordert einige Mühe und Anstrengung. Am höchsten von allen Baulichkeiten lag wohl das Stadion; ein wenig tiefer, doch mit seinen obersten Sitzen an die unzugängliche Felswand stoßend, ist das Theater dem Felsgrunde abgetrotzt.
Der Eindruck der natürlichen Szenerie, die es umgibt, ist drohend und großartig. Ich empfinde eine Art beengender Bangigkeit in dieser übergewaltigen Nähe der Natur, dieser geharnischten, roten Felsbastionen, die den furchtbarsten Ernst blutiger Schauspiele von den Menschen zu fordern scheinen.
In das Innere dieser Felsmassen scheint übrigens ein dämonisches Leben hineingebannt. Sie wiederholen, in die tiefe Stille über den rötlichen Sitzreihen, die Stimmen unsichtbarer Kinder weit unten im Tal, sie lassen gespenstige Herdenglocken, wie in einem hallenden Saale, durch sich hin läuten und geben die klangvolle Stimme des fernen Hirten aus der Nähe und geläutert zurück. Aus ihrem Inneren dringt Hundegebell, und ein fernes und schwaches Dröhnen, aus dem Tale von Krisa her, erregt in ihr einen klangvoll breiten, feierlich musikalischen Widerhall.
Das ununterbrochene, mitten im heißen Lichte des Mittags gleichsam nächtliche Rauschen der kastalischen Wasser dringt aus der Schlucht der Phädriaden herauf.
Die Götter waren grausame Zuschauer. Unter den Schauspielen, die man zu ihrer Ehre darstellte — man spielte für Götter und vor Göttern, und die griechischen Zuschauer auf den Sitzreihen trieben, mit schaudernder Seele gegenwärtig, Gottesdienst! — unter den Schauspielen, sage ich, waren die, die von Blute trieften, den Göttern vor allen anderen heilig und angenehm. Wenn zu Beginn der großen Opferhandlung, die das Schauspiel der Griechen ist, das schwarze Blut des Bocks in die Opfergefäße schoß, so wurde dadurch das spätere höhere, wenn auch nur scheinbare Menschenopfer nur vorbereitet: das Menschenopfer, das die blutige Wurzel der Tragödie ist.
Blutdunst stieg von der Bühne, von der Orchestra in den brausenden Krater der schaudernden Menge und über sie in die olympischen Reihen blutlüsterner Götterschemen hinauf.
Anders wie im Theater von Athen, tiefer und grausamer und mit größerer Macht, offenbart sich hier, in der felsigten Pytho, unter der Glut des Tagesgestirns, das Tragische, und zwar als die schaudernde Anerkennung unabirrbarer Blutbeschlüsse der Schicksalsmächte: keine wahre Tragödie ohne den Mord, der zugleich wieder jene Schuld des Lebens ist, ohne die sich das Leben nicht fortsetzt, ja, der zugleich immer Schuld und Sühne ist.
Gleich einem zweiten Corethas brechen mir überall in dem großen parnassischen Seelengebiet — und so auch in der Tiefe des roten Steinkraters, darin ich mich eben befinde! — neue chthonische Quellen auf. Es sind jene Urbrunnen, deren Zuflüsse unerschöpflich sind und die noch heute die Seelen der Menschen mit Leben speisen: derjenige aber unter ihnen, der dem inneren Auge der Seele und gleicherweise dem leiblichen Auge vor allen anderen sichtbar und mystisch ist, bleibt immer der springende Brunnen des Bluts.
Ich fühle sehr wohl, welche Gefahren auf den Pilger in solchen parnassischen Brunnengebieten lauern, und vergesse nicht, daß die Dünste aller chthonischen Quellen von einem furchtbaren Wahnsinn schwanger sind. Oft treten sie über dünnen Schichten mürben Grundes ans Tageslicht, unter denen glühende Abgründe lauern. Der Tanz der Musen auf den parnassischen Gipfeln geschah, da sie Göttinnen waren, mit leichten, die Erde nicht belastenden Füßen: das ihnen Verbürgte nimmt uns die Schwere des Körpers, die Schwere des Menschenschicksals nicht.
Auch aus der Tiefe des Blutbrunnens unter mir stieg dumpfer, betäubender Wahnsinn auf. Indem man die grausame Forderung des sonst wohltätigen Gottes im Bocksopfer sinnbildlich darstellte, und im darauffolgenden, höheren Sinnbild gotterfüllter dramatischer Kunst, gaben die Felsen den furchtbaren Schrei des Menschenopfers unter der Hand des Rächers, den dumpfen Fall der rächenden Axt, die Chorklänge der Angst, der Drohung, der schrecklichen Bangigkeit, der wilden Verzweiflung und des jubelnden Bluttriumphes zurück.
Es kann nicht geleugnet werden, Tragödie heißt: Feindschaft, Verfolgung, Haß und Liebe als Lebenswut! Tragödie heißt: Angst, Not, Gefahr, Pein, Qual, Marter, heißt Tücke, Verbrechen, Niedertracht, heißt Mord, Blutgier, Blutschande, Schlächterei — wobei die Blutschande nur gewaltsam in das Bereich des Grausens gesteigert ist. Eine wahre Tragödie sehen hieß, beinahe zu Stein erstarrt, das Angesicht der Medusa erblicken, es hieß das Entsetzen vorwegnehmen, wie es das Leben heimlich immer, selbst für den Günstling des Glücks, in Bereitschaft hat. Der Schrecken herrschte in diesem offenen Theaterraum, und wenn ich bedenke, wie Musik das Wesen einfacher Worte, irgend eines Liedes, erregend erschließt, so fühle ich bei dem Gedanken an die begleitenden Tänze und Klänge der Chöre zu dieser Mordhandlung eisige Schauder im Gebein. Ich stelle mir vor, daß aus dem vieltausendköpfigen Griechengewimmel dieses Halbtrichters zuweilen ein einziger, furchtbarer Hilfeschrei der Furcht, der Angst, des Entsetzens, gräßlich betäubend zum Himmel der Götter aufsteigen mußte, damit der grausamste Druck, die grausamste Spannung sich nicht in unrettbaren Wahnsinn überschlug.
Man muß es sich eingestehen, das ganze Bereich eines Tempelbezirks, und so auch diese delphische Böschung, ist blutgetränkt. An vielen Altären vollzog sich vor dem versammelten Volk die heilige Schlächterei. Die Priester waren vollkommene Schlächter, und das Röcheln sterbender Opfertiere war ihnen die gewöhnlichste und ganz vertraute Musik. Die Jammertöne der Schlachtopfer machten die Luft erzittern und weckten das Echo zwischen den Tempeln und um die Statuen her: sie drangen bis ins Innere der Schatzhäuser und in die Gespräche der Philosophen hinein.
Der Qualm der Altäre, auf denen die Ziege, das Schaf mit der Wolle verbrannt wurde, wirbelte quellend an den roten Felsen hinauf, und ich stelle mir vor, daß dieser Qualm, sich zerteilend, das Tal überdeckte und so die Sonne verfinsterte. Der Opferpriester, mit Blut besudelt, der einem Zyklopen gleich das geschlachtete Tier zerstückte und ihm das Herz aus dem Leibe riß, war dem Volk ein gewöhnlicher Anblick. Er umgoß den ganzen Altar mit Blut. Diese ganze Schlachthausromantik in solchen heiligen Bezirken ist schrecklich und widerlich, und doch ist es immer vor allem der süßliche Dampf des Bluts, der die Fliegen, die Götter des Himmels, die Menge der Menschen, ja sogar die Schatten des Hades anzieht.
In alledem verrät sich mir wiederum der Hirtenursprung der Götter, ihrer Priester und ihres Gottesdienstes, denn das Blutmysterium mußte sich den Jägerhirten zuerst aufschließen und dem Hirten mehr als dem Jäger in ihm, wenn er, friedlich, friedlich von ihm gehütete, zahme Tiere abschlachtete, zuerst das Grausen und hernach den festlichen Schmaus genoß.
Wir sind den steilen Abhang des delphischen Tempelbezirks bis an den obersten Rand emporgeklommen. Ich bin erstaunt, hier, wo aus dem scheinbar Unzugänglichen die rote unzugängliche Felswand sich erhebt, auf eine schöne, eingeschlossene Fläche zu stoßen, hier oben, gleichsam in der Gegend der Adlernester, zwischen Felsenklippen, auf ein Stadion.
Es ist still. Es ist vollkommen still und einsam hier. Das schöne Oblong der Rennbahn, eingeschlossen von den roten Steinen der Sitzreihen, ist mit zarten Gräsern bedeckt. Inmitten dieser verlassenen Wiese hat sich eine Regenlache gebildet, darin man die roten Umfassungsmauern des Felsendomes, mit vielen gelben Blumenbüscheln widergespiegelt sieht.
Ist nicht das Stadion dann am schönsten, wenn der Lärm der Ringer und Renner, wenn die Menge der Zuschauer es verlassen hat? Ich glaube, daß der göttliche Priester Apolls, Plutarch, oft, wie ich jetzt, im leeren Stadion der einzige Zuschauer war und den Gesichten und Stimmen der Stille lauschte.
Es sind Gesichte von Jugend und Glanz, Gesichte der Kraft, Kühnheit und Ehrbegier, es sind Stimmen gottbegeisterter Sänger, die unter sich wetteifernd den Sieger oder den Gott preisen. Es ist der herrlichste Teil der griechischen Phantasmagorie, die hier für den nicht erloschen ist, der gekommen ist, Gesichte zu sehen und Stimmen zu hören.
Die schrecklichen Dünste des Blutbrunnens drangen nicht bis in dieses Bereich, ebensowenig das Todesröcheln der Menschen- und Tieropfer. Hier herrschte das Lachen, hier herrschte die freie, von Erdenschwere befreite, kraftvolle Heiterkeit.
Nur im Stadion, und ganz besonders in dem zu Delphi, das über allen Tempeln und allen Altären des Götterbezirks erhaben ist, atmet man jene leichte, reine und himmlische Luft, die unseren Heroen die Brust mit Begeisterung füllte. Der Schrei und Ruf, der von hier aus über die Welt erscholl, war weder der Ruf des Hirten, der seine Herde lockt, noch war es der wilde Jagdruf des Jägers: es war weder ein Racheschrei noch ein Todesschrei, sondern es war der wild glückselige Schrei und Begeisterungsruf des Lebens.
Mit diesem göttlichen Siegesruf der lebendigen Menschenbrust begrüßte der Grieche den Griechen über die Fjorde und Fjelle seines herrlichen Berglands hinweg, dieses Jauchzen erscholl von Spielplatz zu Spielplatz: von Delphi hinüber nach Korinth, von Korinth nach Argos, von Argos bis Sparta, von Sparta hinüber nach Olympia, von dort gen Athen und umgekehrt.
Ich glaube, nur vom Stadion aus erschließt sich die Griechenseele in alledem, was ihr edelster Ruhm und Reichtum ist; von hier aus gesehen, entwickelt sie ihre reinsten Tugenden. Was wäre die Welt des Griechen ohne friedlichen Wettkampf und Stadion? Was ohne olympischen Ölzweig und Siegerbinde? eben das gleiche erdgebundene Chaos brütender, ringender und quellender Mächte, wie es auch andere Völker darstellen.
Es wird mir nicht leicht, diesen schwebenden und versteckten Spielplatz zwischen parnassischen Klippen zu verlassen, der so wundervoll einsam und wie für Meditationen geschaffen ist. Hier findet sich der sinnende Geist gleichsam in einen nährenden Glanz versenkt, und der Reichtum dessen, was in ihn strömt, kann in seiner Überfülle kaum bewahrt und behalten sein.
Man müßte vom Spiel reden. Man müßte das eigene Denken der Kinder- und Jünglingsjahre heraufrufen und jener Wegeswendung sich erinnern, wo man in eine mißmutige und freudlose Welt einzubiegen gezwungen war, die das Spiel, die höchste Gabe der Götter, verpönt. Man könnte hervorheben, daß bei uns mehr Kinder gemordet werden, als jemals in irgendeinem Bethlehem von irgendeinem Herodes gemordet worden sind: denn man läßt nie das Kind bei uns groß werden, man tötet das Kind im Kinde schon, geschweige, daß man es im Jüngling und Manne leben ließe.
Nackt wurde der Sieger, der Athlet oder Läufer dargestellt, und ehe Praxiteles, ehe Skopas seine Statuen bildete, entstanden ihre Urbilder hier im Stadion. Hier ist für die Schönheit und den Adel der griechischen Seele, für Schönheit und Adel des Körpers der Muttergrund. Hier wurde das schon Geschaffene umgeschaffen, das Umgeschaffene zum ewigen Beispiel und auch als Ansporn für höhere Artung in Erz oder Marmor dargestellt. Hier hatte die Bildung ihre Bildstätte, wenn anders Bildung das Werk eines Bildners ist.
Wer je sein Ohr an die Wände jener Werkstatt gelegt hat, deren Meister den Namen Goethe trug, der wird erkennen, daß nicht nur Wagner, der Famulus, den Menschen mit Göttersinn und Menschenhand zu bilden und hervorzurufen versuchte: alles Sinnen, Grübeln, Wirken, Dichten und Trachten des Meisters war eben demselben Endzweck rastlos untertan. Und wer nicht in jedweder Bildung seines Geistes und seiner Hände das glühende Ringen nach Inkarnation des neuen und höheren Menschen spürt, der hat den Magier nicht verstanden.
Es ist bekannt, wie gewissen griechischen Weisen, und so dem Lykurg! Bildung ein Bilden im lebendigen Fleische, nicht animalisch unbewußt, sondern bewußt „mit Göttersinn und Menschenhand“ bedeutete. Was wäre ein Arzt, der seine Kranken bekleidet sieht, und was ein Erzieher, dem jener Leib samt dem Geiste, dem er höhere Bildung zu geben beabsichtigt, nicht nackt vor der Seele stünde? Aus dem Grunde der Stadien sproßten, nackt, die athletischen Stämme einer göttlichen Saat des Geistes hervor. Und hier, auf dem Boden des delphischen Stadions, gebrauche ich nun zum ersten Male in diesen Aufzeichnungen das Wort Kultur: nämlich als eine fleischliche Bildung zu kraftvoll gefestigter, heiterer, heldenhaft freier Menschlichkeit.
Zwei Vögel, unsern Zeisigen ähnlich, stürzen sich plötzlich aus irgend einem Schlupfloch der Felsen quirlend herab und löschen den Durst aus dem Spiegel der Lache vor mir im Stadion. Ihr piepsendes Spiel weckt Widerhall, und das winzige Leben, der sorglose, dünne Lärm der kleinen Geschöpfe, die niemand stört, offenbaren erst gleichsam das Schicksal dieser Stätte in seiner ganzen Verwunschenheit.
Während ich auf die grüne Erde hinstarre und der Füße jener zahllosen Läufer und Kämpfer gedenke, aller jener göttergleichen, jugendlich kraftvoll schönen Hellenen, die sie erdröhnen machten, vernehme ich wiederum aus den Felsen den gewaltigen Widerhall von Geräuschen, die mir verborgen sind. Aus irgend einem Grunde erhebe ich mich, rufe laut und erhalte ein sechsfaches mächtiges Echo: sechsfach schallt der Name des delphischen Gottes, des Python-Besiegers, aus dem Inneren der Berge zurück.
Ich bin allein. Die dämonische Antwort der alten parnassischen Wände hat bewirkt, daß mich die Kraft der Vergangenheit mit ihren triumphierenden Gegenwarts-Schauern durchdringt und erfaßt und daß ich etwas wie ein Bad von Glanz und Feuer empfinde. Beinahe zitternd horche ich in die neu hereingesunkene, fast noch tiefere Stille hier oben hinein.
Der Morgen ist frisch. Wir schrieben den ersten Mai ins Fremdenbuch. Vor der Türe des Gasthauses warten schäbige Esel und Maultiere, die uns nach Hossios Lucas bringen sollen. Ins Freie tretend, beginne ich mit letzten Blicken Abschied zu nehmen. Ich begrüße die Kiona, den weißen Gipfel des Korax-Gebirges, dort, wo die Dorfstraße, wie es scheint, in den Luftraum verläuft. Ich begrüße drei kleine Mädchen, die, trödelnd, ebenso viele Schäfchen vor sich her treiben, begrüße sie mit einer ihnen unverständlichen Herzlichkeit. Eines der hübschen Kinder küßt mir zum Dank für ein kleines, unerbetenes Geschenk die Hand.
Wir lassen die Mäuler voranklingeln. Wieder schreiten wir an den Felsen vorüber, mit den Höhlungen leerer Gräber darin, und wieder erschließt sich dem Auge die steinigte Böschung des delphischen Tempelbezirks. Wer alles dieses tiefer begreifen wollte, müßte mehr als ein flüchtiger Wanderer sein. Immerhin sind mir auch hier die Steine nicht stumm gewesen.
Wir haben den Grund von Delphi, der Stadt, die unterhalb unseres Weges lag, über allerlei Mauern und Treppchen kletternd, durchstreift, und während wir jetzt unsere Reise fortsetzen, zieht uns das Leuchten der Tempeltrümmer, zwischen tausendjährigen Ölbäumen, zieht uns der weiße Marmor umgestürzter Säulen an. An den kastalischen Wassern nehmen wir wiederum einen kleinen Aufenthalt. Ich habe mich auf einen großen Felsblock niedergelassen, in der wundervoll hallenden und rauschenden Kluft, den Felsenbassins jenes alten Brunnen- und Baderaums gegenüber, wo die delphischen Pilger von einst sich reinigten.
Ein Tempelchen, mit Nischen der Nymphen, war grottenartig in die Felswand gestellt.
Heut sind die Bachläufe arg verunreinigt, die Wasserbecken mit Schlamm gefüllt. Oben durch die feuchte und kalte Klamm fliegen lange Turmschwalben und jagen einander mit raubvogelartigem, zwitscherndem Pfiff.
Wir wiegen uns nun bereits eine gute Weile auf unseren Maultieren. Der Weinstock, das Gewächs des Dionysos, begleitet uns in wohlgepflegten, wohlgeordneten Feldern die parnassischen Höhen hinan. Immer wieder begegnen uns wollige Herden mit ihren Hirten. Ich bemerke plötzlich den mir von gestern bekannten stattlichen Weißbart auf dem Bauche im Grase liegend am Straßenrand und empfinde mit ihm, was sein leise ironisches, überlegen lachendes Antlitz zum Ausdruck bringt. Hinter dem Patriarchen steigen seine Herden zwischen Rainen, Steinen und saftigen Gräsern umher und füllen die Luft mit der Glockenmusik seines reichen Besitzes. Die Sonne strahlt, der Tag wird heiß.
Schon im Altertum wurden solche Wege wie diese auf Mäulern zurückgelegt. So wird auch das Um und An einer Bergreise, an Rufen, Geräuschen und Empfindungen, nicht anders gewesen sein, als es heute ist. Maultiere haben die Eigentümlichkeit, am liebsten nicht in der Mitte des Weges, sondern immer womöglich an steilen Rändern zu schreiten: was dem ungewohnten Reiter zuweilen natürlich Schwindel erregt. Allmählich gewinne ich im Vertrauen auf das sich mehr und mehr entfaltende Klettertalent meines Reittieres eine gewisse, schwindelfreie Sorglosigkeit. Immer wilder und einsamer wird die Berggegend, bis hinter Arachova die Einöde, das heißt die parnassische Höhenzone beginnt. Von der gesamten südlichen Flora ist nichts übrig geblieben. Der letzte Weinstock, der letzte Feigenbaum, die letzte Olive liegt hinter uns. Nun aber tut sich ein weiter und grüner Gebirgssattel vor uns auf, von jener gesunden, alpinen Schönheit, die ebenso heimatlich, als über alles erquickend ist.
Der weite Paß, mit flach geschweifter, beinahe ebener Grundfläche, ist Weideland: das heißt, ein saftiger Wiesenplan, auf dem der Huf des schreitenden Maultiers lautlos wird und der Pfad sich verliert. Das helle, ruhige Grün dieser schönen Alm ist eine tiefe Wohltat für Auge und Herz, und der starke, düster-trotzige Föhrenstand, der die steile Flanke einer nahen Bergwand hinaufklettert, fordert heraus, ihm nachzutun. Ich weiß nicht, was in dieser Landschaft so fremdartig sein sollte, daß man es nicht in den deutschen Alpengebirgen, um diese oder jene Sennhütte her, ebenso antreffen könnte, und doch würde der gesunde Jodler des einsamen Sennen hier einen Zauber vernichten, der unaussprechlich ist.
Das hurtige Glöckchen des Maultieres klingelt am Rand einer teichartig weit verbreiteten Wasserlache dahin, die, in den hellen Smaragd der Bergwiese eingefügt, den blauen Abgrund des griechischen Himmels, die ernste Wand der wetterharten Apolloföhren, und das hastende, kleine Vögelchen in einem ruhigen Spiegel wiedergibt.
Über die Art, wie für den, der sich einmal in das Innere des Mythos hineinbegeben hat, jeder neue sinnliche Eindruck wiederum ganz unlöslich mit diesem Mythos verbunden wird und ihn zu einer fast überzeugenden Wahrheit und Gegenwart steigert, möchte manches zu sagen sein. Es beträfe nicht nur den Prozeß eines gläubigen Wiedererweckens, sondern jenen, durch den die menschliche Schöpfung der Welt überhaupt entstanden ist, es beträfe das Wesen jener zeugenden Kraft, die im dichtenden Genius eines Volkes lebendig ist und darin sich die Seele des Volkes verklärt.
Plötzlich taucht in der panisch beinahe beängstigenden, nordischen Vision von Bergeinsamkeit die wilde Gestalt eines bärtigen Hirten auf, der uns in schneller Gangart, fünf schwarze Böcke vor sich hertreibend, von jenseit, über die grüne Matte entgegenkommt. Die schönen Tiere, die von gleicher Größe und, wie gesagt, schwarz wie Teufel sind, machen den überraschendsten Eindruck. Noch niemals sah ich ein so unwahrscheinliches Fünfgespann. Wer wollte da, wenn eine auserlesene Koppel solcher Böcke, wie zum Opfer geführt, ihm entgegenkommt, und zwar über einen parnassischen Weidegrund, die Nähe des Gottes ableugnen, der einst durch Zeus in die Gestalt eines Bockes verwandelt ward, um ihn vor Heres Rache zu schützen, und dem diese Höhen geheiligt sind.
Wie diese Tiere einhertrotten, unwillig, durch den rauhen Treiber mehr gestört als in Angst versetzt, mit dem böse funkelnden Blick beobachtend, jeder mit seinem zottligen Bart, jeder unter der Last und gewundenen Krönung eines gewaltigen Hörnerpaares, scheinen sie selber inkarnierte Dämonen zu sein, und in wessen Seele nur etwas von dem alten Urväter-Hirten-Drama noch rumort, der fühlt in diesem klassischen Tier einen wahrhaft dämonischen Ausdruck zeugender Kräfte, dem es leider auch seinen Blocksberg-Verruf in der verderbten Weltanschauung der christlichen Zeit zu verdanken hat.
Wir besteigen nach kurzer Rast unsere Maultiere, die wiederum mager, schäbig und scheinbar kraftlos, wie zu Anfang der Reise dastehen. Das unscheinbare Äußere dieser Tiere täuscht uns nicht mehr über den Grad ihrer Zähigkeit.
Zur Linken haben wir nun eine rötlich graue, senkrechte Wand parnassischer Felsmassen, deren Rand einen Gießbach aus großer Höhe herabschüttet. Es ist ein lautloser Wasserfall, der, ehe er noch den Talgrund erreicht, in Schleiern verweht.
Die Maultiere müssen neben dem Lauf eines ausgetrockneten Felsenflußbettes abwärts klettern und erweisen, mehr und mehr erstaunlich für uns, ihre wundervolle Geschicklichkeit. Man würde vielleicht von diesen Felstälern sagen können, daß sie Einöden sind, wenn ihre zitternde, leuchtende und balsamische Luft nicht überall von den wasserartig glucksenden Lauten zahlloser Herdengeläute erfüllt wäre.
Der Paris-artige Knabe, der vorhin, während wir Rast hielten, mit zwitschernden Lauten unsere Aufmerksamkeit beanspruchte, war ein Hirt. Hoch auf der Spitze eines vereinzelten Felskegels, der an der Kreuzungsstelle einiger Hochtäler sich erhebt, steht, gegen den Himmel scharf abgegrenzt, wiederum ein romantisch drapierter Ziegenhirt, mit dem landesüblichen Hirtenstabe. Sofern uns ein Mensch begegnet, ist es ein Hirt, sofern unser Auge in der felsigten Wildnis Menschengestalt zu unterscheiden vermag, unterscheidet es auch ringsum sogleich ein Gewimmel von Schafen oder Thymian rupfenden Ziegen.
In einem Engpaß, durch den wir müssen, hat sich ein Strom von dicker, wandelnder Wolle gestaut, der sich, wohl oder übel, vor den Hufen des langsam schreitenden Maultiers teilen muß. Der Reiter streift mit den Sohlen über die braunen Vliese hin, nachdem die Leitböcke ihre gewaltigen, tiefgetönten Glocken antiker Form, feurig glotzend, ungnädig prustend, vorüber getragen haben.
Diese steinigten Hochtäler, zwischen Parnaß und Helikon, erklingen — nicht von Kirchengeläut! — aber sie sind beständig und überall durchzittert vom Klange der Herdenglocken. Sie sind von einer Musik erfüllt, die das überall glucksende, rinnende, plätschernde Element einer echten parnassischen Quelle ist. Ob nicht vielleicht die Glocke unter dem Halse des weidenden Tieres, die Mutter der Glocke im Turme der Kirche ist, die ja, ins Geistige übertragen, den Parallelismus zum Hirtenleben nirgend verleugnen will? Dann wäre es von besonderem Reiz, den appollinischen Klang zu empfinden, den alten parnassischen Weideklang, der in dem Gedröhne städtischer Sonntagsglocken enthalten sein müßte.
Im Klangelement dieser parnassischen Quelle, dieses Jungbrunnens, bade ich. Es beschleicht mich eine Bezauberung. Ich fühle Appollon unter den Hirten und zwar in schlichter Menschengestalt, als Schäferknecht, wie wir sagen würden, so, wie er die Herden des Laomedon und Admetos hütete. Ich sehe ihn, wie er in dieser Gestalt jede gewöhnliche Arbeit des Hirten verrichten muß, dabei gelegentlich Mäuse vertilgt und den Eidechsen nachstellt. Ich sehe ihn weiter, wie er, ähnlich mir, in der lieblich monotonen Musik dieser Täler gleichsam aufgelöst und versunken ist und wie es ihm endlich, besser als mir, gelingt, die Chariten auf seine Hand zu nehmen. Chariten, musische Instrumente tragend, auf der Hand, war er zu Delphi dargestellt.
Vorsichtig schreitet mein Reittier über eine große Schildkröte, die von den Treibern nicht beachtet wird; ich lasse sie aufheben und die lachenden Aggogiaten reichen mir das, zwischen gewaltigen Schildpattschalen, lebhaft protestierende Tier. Ich sehe an den Mienen der Leute, daß die Schildkröte unter ihnen sich der Popularität eines allbeliebten Komikers zu erfreuen hat, eines lustigen Rats, über den man lacht, sobald er erscheint und bevor er den Mund öffnet. In das Vergnügen der Leute mischt sich dabei eine leise Verlegenheit, wie sie den ernsten Landmann unverkennbar überschleicht, der auf den Holzbänken einer Jahrmarktsbude sein Entzücken über die albernen Späße des Hanswurst nicht zu verbergen vermag. Auch fühlt man heraus, wie das schöne Tier nicht minder geringschätzt, ja verachtet ist, als beliebt: eine Verachtung, eine Geringschätzung, die in seinem friedlichen Wesen und seiner Hilflosigkeit gegenüber den Menschen, trotz seines doppelten Panzers, ihren Ursprung hat.
„Als er sie sah, da lacht er alsbald!“ nämlich Hermes, der Gott, vor Zeiten. Ganz so ergreift unsere kleine Reisegesellschaft beim Anblick des klassischen Tieres unwiderstehliche Heiterkeit.
Wir ziehen weiter, nachdem wir das alte homerische Lachen, das Lachen des Gottes, zu Ende gelacht haben. Aber wir töten nicht, wie Hermes, das Tier, sondern nehmen es lebend unter unseren Gepäckstücken mit. Ich denke darüber nach, wie wohl die Leier ausgesehen und wie wohl geklungen hat, die Hermes aus dem Panzer der Schildkröte und aus Schafsdärmen bildete und die in den Händen Apolls ihren Himmel und Erde durchhallenden Ruhm gewann.
Aber wir sind nun in sengenden Gluten des Mittagslichts zu einem wirklichen, reichlich Wasser spendenden parnassischen Brunnen gelangt, aus dem die Tiere und Treiber gierig trinken. Dicke Strahlen köstlichen Wassers stürzen aus ihrer gemauerten Fassung hervor und rauschend und brausend in das steinerne Becken hinein. Es ist wie ein Reichtum, der sich hier ausschüttet, der nirgends so, als in einem heißen und wasserarmen Lande empfunden wird.
Wir ruhen aus in dem wohligen Lärm und dem kühlen Gestäube des lebenspendenden Elementes.
Das Kloster Hossios Lukas bietet uns Quartier für die Nacht. Vom behäbigen Prior empfangen, geleitet von dienstfertigen Mönchen, treten wir, durch ein kleines Vorgärtchen, ohne Treppen zu steigen, ins Haus. Gleich linker Hand ist ein Zimmer, das uns überwiesen wird. Auf den gebrechlichen Holzaltan des Zimmerchens tretend, blicken wir in den tiefen Klosterhof und zugleich über die Dächer der Mönchskasernen in das vollkommen einsame, wilde Hochtal hinaus.
Eng und nur wenig Hofraum lassend, sind die Klostergebäude in, wie es scheint, geschlossenem Kreis um eine alte byzantinische Kirche gestellt, die sie zugleich beschützen und liebevoll einschließen. Das Hauptportal der Kirche liegt schräg in der Tiefe unter uns. Wir können mit den nahen Wipfeln alter Zypressen Zwiesprache halten, die seit Jahrhunderten Wächter vor diesem Eingang sind.
Der Prior wünscht uns die Kirche zu zeigen, die innen ein trauriges Bild der Verarmung ist. Reste von Mosaiken machen wenig Eindruck auf mich, desto mehr ein Geldschrank, der, an sich befremdlich in diesem geweihten Raum, zugleich ein wunderlicher Kontrast zu seinem kahlen, ausgepoverten Zustand ist.
Dem Prior geht ein jugendlich schöner Mönch mit weiblicher Haartracht an die Hand. Er öffnet Truhen und Krypten mit rostigen Schlüsseln. Das Auge des jungen Mönches verfolgt uns unablässig mit bohrendem Blick. Als wir jetzt wiederum auf dem Balkon unseres Zimmers sind, taucht er auf einem nahen Altane neugierig auf.
Während über den Dächern und in der Wildnis draußen noch Helle des sinkenden Tages verbreitet ist, liegt der Hof unter uns bereits in nächtlicher Dämmerung. Ich horche minutenlang in die wundervolle Stille hinunter, die durch das Geplätscher eines lebendigen Brunnens nur noch tiefer und friedlicher wird. Mit einem Male ist es, als sei die Seele dieser alten winkligen Gottesburg aus tausendjährigem Schlummer erwacht. Arme werden hereingelassen und es wird von den Brüdern unterm Klosterportale ziemlich geräuschvoll Brot verteilt.
Nach einigem Rufen, Treppengehen und Türenschließen tritt wieder die alte verwunschene Stille ein, mit den einsamen Lauten des Röhrenbrunnens. Dann klappert die dicke Bernsteinkette des freundlichen Priors unten im Hof. Man hört genau, wie er sein Spielwerk gewohnheitsgemäß bearbeitet, das heißt die Bernsteinkugeln ununterbrochen durch die Finger gleiten läßt und gegeneinander schiebt.
Ich gehe zur Ruhe, im Ohre feierlich summenden Meßgesang, der schwach aus dem Innern der Kirche dringt.
Der Aufbruch von Hossios Lukas geschieht unter vielen freundlichen Worten und Blicken der Mönche, die um uns versammelt sind. Ich komme eben von einer schönen Terrasse des Klosters zurück, die, inmitten der steinigten Ödenei, von alten, vollbelaubten Platanen beschattet ist. Terrassen für den Gemüsebau setzten sich in die Tiefe fort und hie und da sind dem Felsenschutt des verlassenen Tales Wiesen und Ackerstreifen abgerungen. Ich sah die kleinen „Mädchen für alles“ der älteren Brüder und Patres mit Besen und Wassereimern in lebhafter Tätigkeit, die Patres selber, wie sie rotkarrierte Betten auf ihren morschen Balkonen ausbreiteten. Die kleinen „Mädchen für alles“ sind junge Lehrlinge, deren schönes, langes Haar, wie das von Mädchen, im Nacken zu einem Knoten aufgenommen ist. Es ist ein wolkenlos heiterer Morgen mit einer frühlingshaften Wonne der Luft, die göttlich ist und die in jedem Auge wiederleuchtet. Noch klingt mir der Gruß des Bruders Küper, sein frisches Καλιμερα im Ohr, womit er mich grüßte, als ich unten am Brunnen vorüberging, wo er trällernd ein Weinfaß reinigte. Es war ein Gruß, der ebenfalls von dem frischen Glück dieses Morgens widerklang.
Kaum hat unsere kleinere Karawane sich nur ein wenig, zwischen Gebüschen von Steineichen hintrottend, aus dem Bereich des Klosteridylls entfernt und schon umgibt uns wieder das alte ewige Hirtenidyll. Ich unterscheide mit einem Blick vier einzelne Schafherden, deren Geläute herüberdringt, und plötzlich erscheinen, Wölfen gleich, gewaltige Schäferhunde über uns an der Wegböschung. Man scheucht sie mit großen Steinen zurück.
Wir biegen nach einem längeren Ritt in ein abwärts führendes, enges Tal, das, wie es scheint, recht eigentlich das Dionysische ist. Wir müssen zunächst durch eine gedrängte Herde schwarzer Ziegen förmlich hindurchschwimmen, unter denen sich prächtige Böcke auszeichnen, jenen ähnlich, die ich auf der Höhe des Passes sah. Und wie ich die Blicke über die steinigten Talwände forschend ausschicke, sehe ich sie mit schwarzen Ziegen, wie mit überall hängenden, kletternden, kleinen schwarzen Dämonen bedeckt.
Der Eingang des schwärzlich wimmelnden Tales wird von dem vollen Glanz des Parnasses beherrscht, der aber endlich dem Auge entschwindet, je weiter wir in das Tal hinabdringen: das Tal der Dämonen, das Tal des Dionysos und des Pan, das immer mehr und mehr von gleichmäßig schwarzen Ziegen wimmelt. Wohl eine Viertelstunde lang und länger ziehen wir mitten durch die Herden dahin, die zu beiden Seiten unseres gestrüppreichen Pfades schnauben, Steineichenblätter abrupfen und hie und da leise meckern dazu. Überall raschelt, reißt, stampft und prustet es zwischen den Felsen, in den Gebüschen: da und dort wird ein Glöckchen geschlenkert. Mitunter kommen wir in ein ganzes Glockenkonzert hinein, dessen Lärm das gesprochene Wort verschlingt.
Ich habe, auf meinem Maultier hängend, Augenblicke, wo mir dies alles nicht mehr wirklich ist. Ein alter Knecht und Geschichtenerzähler fällt mir ein, der mir in ländlichen Winterabenden ähnliche Bilder als Visionen geschildert hat. Er war ein Trinker, und als solcher ja auch verknüpft mit Dionysos. In seinen Delirien sah er die Welt, je nachdem, von schwarzen Ziegen oder Katzen erfüllt, wobei er von alpdruckartiger Angst gepeinigt wurde.
Der Schritt des Maultiers, die Glocke des Maultiers, allüberall das Eindringen dieser fremden Welt, dazu die ungewöhnliche Lichtfülle, die Existenz in freier Luft, Ermüdung des Körpers durch ungewöhnliche Reisestrapazen, jagen auch mir einen Anflug von Angst ins Blut. Ich habe vielleicht eine Vision und es ist mir manchmal, als müsse ich diese zahllosen schwarzen Ziegen vor meinen Augen wegwischen, denen mein Blick nicht entgehen kann.
Ein weites Quertal nimmt uns auf und wie ein Spuk liegt nun die Vision der schwarzglänzenden Ziegen hinter mir. Wir überholen einen reisenden Kaufmann, dessen Maultier von einem kleinen Jungen getrieben wird. So schön und vollständig, wie nie zuvor, steht der Parnaß, von dem wir bereits Abschied genommen hatten, vor uns aufgerichtet: ein breiter silberner Wall mit weißen Gipfeln. Ich gewinne den Eindruck, der appollinisch strahlende Glanz strömt in das Tal, das der Berg beherrscht.
Wir reisen nun schon seit einiger Zeit durch die Ebene hin. Neben flacheren Felsgebieten und einem verzweigten Flußbett, das mit Gebüschen bewachsen ist, breiten sich Flächen grüner Saat, über denen klangreich die Lerche zittert.
Es ist faszinierend, zu sehen, wie der Parnaß nun wiederum diese Ebene überragt. Auf breitester Basis ruhend, baut sich der göttliche Berg aus eitel Glanz in majestätischer Schönheit auf. Hier wird es deutlich, wie die bezwingende Gegenwart solcher Höhen göttlichen Ruhm vor den Menschen, die sie umwohnen, durchsetzen und behaupten muß. Ich empfinde nicht anders, als stammte der trillernde Rausch des Lerchengeschmetters, das leuchtende Grün der Saaten, der zitternde Glanz der Luft von diesem geheiligten Berge ab und nähre sich nur von seinem Glanze.
Oftmals wende ich mich auf meinem Maultier nach der verlassenen Felsenwelt der Hirten und Herden zurück, während sich über mir Parnaß und Helikon mit dem Glanz ihrer silbernen Helme über die weite Ebene grüßen. Flössen doch alle Quellen dieser heiligsten Berge wieder reichlich voll und frisch in die abgestorbenen Gebiete der europäischen Seele hinein! Möchte das starre Leuchten dieser olympischen Vision wiederum in sie hineinwachsen und den übelriechenden Dunst verzehren, mit dem sie, wie ein schlecht gelüftetes Zimmer, beladen ist.
Nun sitze ich, von der glühenden Sonne nicht ganz geschützt, unterm Vordach einer Weinschenke. Parnassische Hirten und Hirtenhunde umgeben mich, unter den wettergebräunten Männern sind blonde Köpfe, deren antiker Schnitt unverkennbar ist. Der kühne Blick verrät dionysisches Feuer im Blut. Der Bartwuchs, ohne gepflegt zu sein, ähnelt in Form, Dichte und Kräuselung durchaus gewissen antiken Plastiken, die Helden oder Halbgötter darstellen.
Ich teile die Reste meiner Mahlzeit mit einem weißen, gewaltigen Schäferhund. Und nachdem wir einen Blick auf den schmerzvoll grinsenden Löwen von Cheronea geworfen, ist der parnassische Hirtentraum zu Ende geträumt. Doch nein, an der kleinen Haltestelle der Eisenbahn, die wir erreicht haben, und die von einem Sumpfe voll quakender Frösche umgeben ist, finden wir ein gefesseltes schwarzes Lamm. Es hat, mit dem Rücken nach unten, am Sattel eines Maultieres hängend, eine Reise von zehn Stunden, durch die Hochtäler des Parnaß, von Delphi her, im Sonnenbrande zurückgelegt. Es trägt den Ausdruck hoffnungsloser Fügung im Angesicht. Sein Eigentümer ist jener Kaufmann, den wir überholten, und dessen Maultier ein Knabe trieb. Er wird um sein Osterlamm beneidet und Bahnbeamte treten hinzu, fühlen es ab nach Preis und Gewicht und Fettgehalt. Schließlich legt man das arme, unsäglich leidende, schwarze parnassische Lamm, mit zusammengebundenen Füßen dicht an die Geleise, damit es leicht zu verladen ist. Ich sehe noch, wie es an seinen Fesseln reißt und verzweifelt emporzuspringen versucht, als die Maschine herandonnert und gewaltig an ihm vorüberdröhnt.
Wir haben Athen verlassen, um über Korinth, Mykene, Argos und andere klassische Plätze schließlich nach Sparta zu gelangen. Am Nachmittag ist Korinth erreicht, nach längerer Bahnfahrt, die uns nun schon bekannte Bilder wiederum vor die Augen geführt hat, darunter flüchtige und doch warme Eindrücke von Eleusis, Megara, dem schönen Isthmus und der Eginetischen Bucht.
Ein Wagen führt uns unweit vom Rande des Golfes, dem Fuße von Akrokorinth entgegen, einer drohenden Felsmasse, die von den Resten roher Befestigungen verunziert ist.
Über den Golf herüber weht eine frische, fast nordische Luft, aus der Gegend des Helikon, dessen leuchtender Gipfel schemenhaft sichtbar bleibt. Der Wagen rollt auf schlechten Feldwegen zwischen grünen Saaten dahin.
Der korinthische Knabe hatte für Körper und Geist einen weiten, unsäglich mannigfaltigen Tummelplatz. Den furchtbarsten Burgfelsen über sich, schwamm er im Lärm und Getriebe einer Hafenstadt, die im weiten Kreise von grünen oder nackten Hügeln umgeben war. Überall erlangte sein Blick die geheiligten Höhen der Götter- und Hirtenwelt, die wiederum bis in das Herz der Stadt hineinreichte. Für Wanderungen oder Fahrten taten sich Peloponnes und Isthmus auf und auf diesem herrlichen Erdenfleck genoß er die gleichsam geborgene Schönheit eines südlichen Alpensees und auch die grenzenlose Wonne des freieren Meeres.
Wir besteigen Pferde, und diese erkletterten nun mühsam den Felsen von Akrokorinth, der mehr und mehr, je weiter wir an ihm hinaufkriechen, wie eine verdammte Stätte erscheint: ein düsteres Tor durch einen Ring von Befestigungsmauern, führt in ein ödes Felsenbereich.
Wir sind — die Pferde haben wir vor dem ersten Tore zurückgelassen! — einer zweiten Ringmauer gegenübergestellt, die abermals ein Tor durchbricht. Eilig klimmen wir weiter aufwärts: eine weißliche Sonne hat sich schon nahe bis an den Horizont herabgesenkt. Kalter Bergwind fegt durch ein zweites ungeheures Trümmerbereich, und wir finden uns vor dem engsten jener Mauerringe, die den Gipfel des Festungsberges einschließen. Diesen Gipfel erkletterten wir nun durch ein drittes Tor. Es ist eine Wüstenei, ein Steinchaos. Fremd und schon halb und halb in Schatten gesunken, liegt die gewaltige Bergwelt des Peloponnes unter uns. Wir eilen, aus dieser entsetzlichen Zwingburg durch die Trümmerhöfe wieder hinabzukommen. Wirkliches Grauen, wirkliche Angst tritt uns an.
Nach den geheiligten Hügeln und Bergen, deren Bereich ich in den letzten Wochen betrat oder wenigstens mit dem Blick erreichte, ist dies der erste, der unter einem unabwendbaren Fluch verödet scheint.
Seltsam wie das bange Gefühl, was der nahende Abend einflößt mit dem kleinen Kreis sonderbar banger Phantasiegestalten in Einstimmung ist, die für mich, seitdem ich ein bewußteres Leben führe, mit dem Namen Korinth verbunden sind. Schon vor etwa achtundzwanzig Jahren, während einer kurzen akademischen Studienzeit, drängten sich mir die rätselvollen Gestalten des Periander, seiner Gattin Melissa und des Lykophron, seines Sohnes, auf. Ich darf wohl sagen, daß die Tragödie dieser drei Menschen in ihrer unsäglich bittersüßen Schwermut all die Jahre meine Seele beschäftigt hat.
Periander! Melissa! Lykophron!
Periander, auf dem Burgfelsen hausend, Tyrann von Korinth, allmählich ähnlich wie Saul, ähnlich wie der spartanische König Pausanias, in einen finsteren Wahnsinn versinkend. Leidend an jenem unausbleiblichen Schicksal großer Herrschernaturen, die nach erreichtem Ziel von jenen Dämonen verfolgt werden, die ihnen dahin lockend voranschritten. Er hatte die Einwohnerschaft Korinths von den furchtbaren Felsen herunter terrorisiert und dezimiert. Er hatte Lyside, die Tochter des Tyrannen Prokles, geheiratet, der zu Epidaurus saß. Die Gattin, zärtlich von ihm Melissa genannt, ward später von ihm aus unbekannten Gründen heimlich ermordet: zum wenigsten wurde ihr Tod Periandern zur Last gelegt. Prokles, Lysidens Vater, ließ eines Tages vor den beiden inzwischen herangewachsenen Enkeln, Kypselos und Lykophron, den Söhnen Melissens und Perianders, Worte fallen, die besonders dem Lykophron eine Ahnung von dem Verbrechen des Vaters aufgehen ließen, und diese Ahnung bewirkte nach und nach zwischen Sohn und Vater den tiefsten Zerfall.
Der große Britte hat die Tragödie eines Sohnes geschrieben, dessen Mutter am Morde ihres Gatten, seines Vaters, beteiligt war. Er hat die psychologischen Möglichkeiten, die in dem Vorwurf liegen, nicht bis zu jeder Tiefe erschöpft. Wie denn ein solcher Gegenstand seinem Wesen nach überhaupt unerschöpflich ist, derart zwar, daß er sich selber in immer neuen Formen, aus immer neuen Tiefen manifestieren kann. Vielleicht ist das Problem Periander Lykophron noch rätselvoller und furchtbarer, als es das Rätsel Hamlets und seiner Mutter ist. Dabei hat dieser göttliche Jüngling Lykophron mit dem Dänenprinzen Ähnlichkeit ... man könnte ihn als den korinthischen, ja den griechischen Hamlet bezeichnen.
Gleichwohl war in seiner Natur ein Zug von finstrer Entschlossenheit.
Während Periander in der wesentlichen Vereinsamung der Herrschbegier — denn der Herrschende will allein herrschen und wenn er auch andere Herrscher dulden muß, so erreicht er doch die Trennung von allen, das Alleinsein, immer gewiß. Er gräbt sich meistens jeden gemütischen Zufluß der Seele ab, wodurch sie denn, wie ein Baum bei Dürre, qualvoll langsam zugrunde geht.
Also während Periander, sagte ich, vereinsamt, als Herrscher von Korinth, in seinem Palast auf dem öden Burgfelsen, mit den Dämonen und mit dem Schatten Melissens rang, hatte sich Lykophron nicht nur von ihm abgekehrt, sondern von Grund aus alles und jedes, außer das Leben! was er ihm zu verdanken hatte — alles und jedes, was ihm durch Geburt an Glanz und Prunk mit dem Vater gemeinsam war, dermaßen gründlich von sich getan, daß er, obdachlos und verwahrlost, in den Hallen und Gassen des reichen Korinth umherlungernd, von irgendeinem anderen Bettler nicht mehr zu unterscheiden war.
Hier noch wurde er aber von dem allmächtigen Vater mit rücksichtsloser Strenge verfolgt, dann wieder mit leidenschaftlicher Vaterliebe; doch weder Härte noch Zärtlichkeit vermochten den qualvollen Trotz der vergifteten Liebe abzuschwächen.
Die Tat des Periander wurde mit dem Schicksale dieses Lykophron zum Doppelmord: zum Morde der Gattin und des Sohnes. Und hierin liegt die Eigenart der Tragik, die in der Brust Perianders wütete, daß er einen geliebten und bewunderten Sohn, das köstlichste Gut seines späteren Lebens, plötzlich und unerwartet durch den Fluch seiner häßlichen Tat vernichtet fand. Damit war ihm vielleicht der einzige Zustrom seines Gemütes abgeschnitten und das Herz des alternden Mannes ward von dem Grauen der großen Leere, der großen Öde umschränkt.
Ich bin überzeugt, daß tiefe Zwiste unter nahen Verwandten unter die grauenvollsten Phänomene der menschlichen Psyche zu rechnen sind. In solchen Kämpfen kann es geschehen, daß glühende Zuneigung und glühender Haß parallel laufen — daß Liebe und Haß in jedem der Kämpfenden gleichzeitig und von gleicher Stärke sind: das bedingt die ausgesuchten Qualen und die Endlosigkeit solcher Gegensätze. Liebe verewigt sie, Haß allein würde sie schnell zum Austrag bringen. Was könnte im übrigen furchtbarer sein, als es die Fremdheit derer, die sich kennen, ist?
Periander sendete Boten an das Totenorakel am Acheron, um irgendeine Frage, die ihn quälte, durch den Schatten Melissens beantwortet zu sehen. Melissa dagegen beklagte sich, statt Antwort zu geben und erklärte, sie friere, denn man habe bei der Bestattung ihre Kleider nicht mit verbrannt.
Als die Boten heimkehrten, hierher nach Korinth, konnte Periander nicht daran zweifeln, daß wirklich der Schatten Melissens zu ihnen geredet hatte, denn sie brachten in rätselhaften Worten die Andeutung eines Geheimnisses, dessen einziger Hüter Periander zu sein glaubte.
Durch dieses Geheimnis wurde ein perverses Verbrechen des Gatten verdeckt, der seine Gattin nicht allein getötet, sondern noch im Leichnam mißbraucht hatte: eine finstere Tat, die das schreckliche Wesen des Tyrannen gleichsam mit einem höllischen Strahle der Liebe verklärt.
Er ließ nun in einem Anfall schwerer Gewissensangst die Weiber Korinths, wie zum Fest in den Tempel der Hera berufen. Dort rissen seine Landsknechte ihnen gewaltsam Zierat und Festkleider ab und diese wurden zu Ehren Melissens, und um ihren Schatten zu versöhnen, in später Totenfeier verbrannt.
Periander, Melissa, Lykophron. Es hat immer wieder, während beinahe dreier Jahrzehnte, Tage gegeben, wo ich diese Namen lebendig in mir, ja oft auf der Zunge trug. Sie waren es auch, die, Sehnsucht erweckend, vor mir her schwebten, als ich das erstemal den Anker gehoben hatte, um hierher zu ziehen. Auch während der kleinen Schiffsreise jüngst, durch den Golf von Korinth, hat mein Mund zuweilen diese drei Namen lautlos geformt, nicht minder oft auf der Fahrt nach Akrokorinth. Und hier, im fröstelnden Schauder heftiger Windstöße, auf dem gespenstischen Gipfel des Burgfelsens, habe ich im kraftlosen Licht einer bleichen Sonne, die unterging, die fröstelnden Schatten Perianders, Melissens und Lykophrons dicht um mich gespürt.
Unten, im Dämmer der Rückfahrt, während die Feldgeister über der in Gerstenhalmen wogenden Gräberstätte des alten Korinth sich zu regen beginnen, zuckt im Rädergeroll der nächtlichen Fahrt ein und das andere Bild der lärmenden alten Stadt vor der Seele auf. Mitunter ist alles plötzlich von einer so tosenden Gegenwart, daß ich Geschwätz und Geschrei des Marktes um mich zu hören glaubte, und alles dieses mit dem Anblick weiter abgelegener Felder verquickt, die sich rings um den übermächtig hineingelagerten, finsteren Gewalttäterfelsen wie Leichentücher weit umherbreiten.
Und ohne daß dieser tote Dämmer, dieses ewig teilnahmlose Gegenwartsbild verändert wird, sehe ich die Lohe der Totenfeier Melissens nächtlich hervorbrechen und fühle das Fieber, das die leidenschaftliche Kraft des großen Periander auf die Bewohner der geknechteten Stadt überträgt. Der Heratempel ist vom Geschrei der Weiber erfüllt, denen die Bravi die Kleider vom Leibe reißen, die Gassen vom Geschrei jener anderen, die nackt und beraubt entkommen sind. Nicht weit vom Tempel, den Blick in den rötlichen Schein der Feuersbrunst mit einem starren Lächeln gerichtet, steht Lykophron: durch Schmerz und die Wollust der Selbstkasteiung fast irrsinnig, das Antlitz durch Hunger und innere Wut verzerrt, aber in diesem Augenblick nicht nur vom Wiederscheine des Feuers, sondern von einem bösen Triumphe verklärt. Rings lärmen und brüllen die Leute um ihn: es ist durch Verordnung Perianders aufs strengste verboten, ihn anzureden.
Als aber am folgenden Tage Periander selbst dies zu tun unternimmt, erhält er von seinem Sohne nur diese Antwort: man wird dich in Strafe nehmen, weil du mit Lykophron gesprochen hast.
Gegen zwölf Uhr mittags, nachdem wir am Morgen Korinth verlassen haben, befinde ich mich in einer Herberge, von der aus man die argivische Ebene übersieht. Sie ist begrenzt von gewaltigen peloponnesischen Bergzügen und augenblicklich durchbraust von einem heißen Wind, der in der blendenden Helle des Mittags die Saatfelder wogen macht.
Der Raum, in dem die Kuriere das Frühstück auftragen, hat den gestampften Boden einer Lehmtenne. Er ist zugleich Kaufladen und Weinausschank. Es riecht nach Kattun. Blaue Kattune sind in den Wandregalen aufgestapelt. Dank den Kurieren, die in Athen eine Korporation bilden, herrscht in den Herbergen, die sie bevorzugen, eine gewisse Sauberkeit.
Ich bin vor die Tür des kleinen Wirtshauses getreten. Die von den Bergen Arkadiens eingeschlossene Ebene ist noch immer durchbraust von Sturm und steht noch immer in weißer Glut. In weißlich blendendem Dunst liegt der Himmel über uns. Die Burg von Argos, Larissa, ist in der Talferne sichtbar, der Boden des Tals ist in weite Gewände abgegrenzt, die teils von wogender Gerste bedeckt, teils unbestellt und die trockene rote Scholle zeigend, daliegen.
Diese Landschaft erscheint auf den ersten Blick ein wenig kahl, ein wenig nüchtern in ihrer Weiträumigkeit. Ich bin nicht geneigt, sie als Heimat jener blutigen Schatten anzusprechen, die unter den Namen Agamemnon, Klytämnestra, Tyest und Orestes ruhelos durch die Jahrtausende wandern. Ihre Heimat war im Haupte des Äschylos und des Sophokles.
Die Gestalten der großen Tragödiendichter der Alten sind von einem Element des Grauens getragen und in ihm zu körperlosen Schatten aufgelöst. Es ist in ihnen etwas von den Qualen abgeschiedener Seelen enthalten, die durch die unwiderstehliche Macht einer Totenbeschwörung, zu einer verhaßten Existenz im Lichte gezwungen sind. Auf diese Weise wecken sie die Empfindung in uns, als stünden sie unter einem Fluch, der ihnen aber, so lange sie noch als Menschen unter Menschen ihr Leben lebten, nicht anhaftete. Der schlichte Eindruck einer realen landschaftlichen Natur bei Tageslicht widerlegt jeden Fluch und zwingt der bis zum Zerreißen überspannten Seele den Segen natürlicher Maße auf.
Den Tragikern bleibt in dieser Beziehung Homer vollkommen gesondert gegenübergestellt. Seine Dichtungen sind keine Totenbeschwörungen. Über seinen Gedichten ist nirgend das Haupt der Medusa aufgehängt. Gleicht das Gedicht des Tragikers einem Klagegesang — seines gleicht überall einem Lobgesang, und wenn das Kunstwerk des Tragikers von dem Element der Klage, wie von seinem Lebensblute durchdrungen ist, so ist das Gedicht Homers eine einzige Vibration der Lobpreisung. Die dichtende Klage und heimliche Anklage und das dichtende Lob, wer kann mir sagen, welches von beiden göttlicher ist?
Die Tragödie ist immer eine Art Höllenzwang. Die Schatten werden mit Hilfe von Blut gelockt, gewaltsam eingefangen und brutal, als ob sie nicht Schatten wären, durch Schauspieler ins reale Leben gestellt: da müssen sie nun nichts anderes als ihre Verbrechen, ihre Niederlagen, ihre Schande und ihre Bestrafungen öffentlich darstellen. Hierin verfährt man mit ihnen erbarmungslos.
Seit Beginn meiner Reise liegt mir eine wundervolle Stelle der Odyssee im Sinn. Der Sonnengott, dem man seine geliebte Rinderherde getötet hat, klagt die Frevler, die es getan haben, die Genossen des Odysseus, im Kreise der Götter an und droht, er werde, sofern man ihn nicht an den Tätern räche, fortan nicht mehr den Lebenden, sondern den Toten leuchten:
„Büßen die Frevler mir nicht vollgütige Buße des Raubes;
Steig’ ich hinab in Aïdes Reich, und leuchte den Toten!“
Wer wollte diese erhabenste und zugleich herrlichste Drohung in ihren überwältigenden Aspekten nicht empfinden. Es ist nicht mehr und nicht weniger als der ganze Inhalt eines künftigen Welt-Epos, dessen Dante geboren werden wird. Aber wenn nicht mit der ganzen apollinischen Lichtgewalt, so doch mit einem Strahle davon erscheinen die Gestalten Homers beglückt und sind damit aus dem Abgrund der Toten zu neuem Leben geweckt worden und es ist nicht einzusehen, warum der Gott nicht auch dem dramatischen Dichter einen von seinen Strahlen leihen sollte. Ist doch das Dramatische und das Epische niemals rein getrennt, ebensowenig wie die Tendenzen der Zeit und des Ortes. Und wer wüßte nicht, wie das Epos Homers zugleich auch das gewaltigste Drama und Mutter zahlloser späterer Dramen ist.
Wenn wir einen Durchbruch des apollinischen Glanzes in die Bereiche des Hades als möglich erachteten, so möchte ich die Tragödie, cum grano salis, mit einem Durchbruch der unterirdischen Mächte, oder mit einem Vorstoß dieser Mächte ins Licht vergleichen. Ich meine damit die Tragödie seit Äschylos, von dem es heißt, daß er es gewesen ist, der den Erinnyen Schlangen ins Haar geflochten hat.
Nehmen wir an, die Tragödie habe dem gleichen Instinkt gedient, wie das Menschenopfer. Dann trat allerdings an Stelle der blutigen Handlung der unblutige Schein. Trotzdem in Wahrheit aber Menschenblut nicht vergossen wurde, hatte die bange und schreckliche Wirkung an Macht gewonnen und sich vertieft: derart, daß erst jetzt eine chthonische Wolke gewaltsam lastend und verdüsternd in den olympischen Äther stieg, deren grauenerregende Formen mit den homerischen Lichtgewölken olympischen Ursprungs rangen, und schließlich den ganzen Olymp der Griechen verdüsterten.
Wir brechen auf, um die Trümmer von Mykene und die unterirdischen Bauten zu sehen, die man Schatzhäuser nennt. Ich bin durchaus homerisch gestimmt, wie denn mein ganzes Wesen dem Homerischen huldigt, auch wenn ich nicht des wundervollen Schatzes gedenken müßte, der im Museum zu Athen geborgen liegt und der aus den Gräbern von Mykene gehoben ist. Wo ist das Blutlicht, mit dem Äschylos und Sophokles durch die Jahrhunderte rückwärts diese Stätte beleuchteten? Es ist von der Sonne Homers getilgt. Und ich sehe in diesem Augenblick die Greueltaten der Klytämnestra, des Agist und des Orest höchstens mit den Augen des Menelaos in Sparta an, als er dem jugendlichen Telemach, der gekommen ist, nach Odysseus, seinem Vater, zu forschen, davon erzählt.
„Aber indessen erschlug mir meinen Bruder ein Anderer
Heimlich mit Meuchelmord durch die List des heillosen Weibes ...
Dennoch, wie sehr ich auch trauere, bewein’ ich alle nicht so sehr
Als den einen ...“
womit er Odysseus — nicht einmal Agamemnon! — meint, den lange Vermißten.
Wer, der die kerngesunde Königsidylle jenes Besuches liest, den Telemach in Sparta abstattet, könnte dagegen des Glaubens sein, daß der erprobte Held, Mann und Bruder sich sophokleischen Blutträumen überlassen hätte? Zumal, wenn er sagt:
oder wenn Helena bei ihm ruhte, noch immer „Die Schönste unter den Weibern.“
Das Löwentor, der mykenaische Schutthügel und die Hügel ringsum sind von Sonne durchglüht und von Sturm umbraust. Überall füllt Duft von Thymian und Myrrhen die Luft. Ganz Griechenland duftet jetzt von Thymian und Majoran. In den Kalksteintrümmern der alten Stadt schreien Eulen einander zu, wach und lebhaft, trotz hellblendender Sonne. Weiß wie Schlacke liegt Trümmerstück an Trümmerstück.
Die Burg hat eine raubnestartige Anlage: in Hügeln versteckt und von höheren felsigen Bergen gedeckt, übersah sie das ganze rossenährende Argos. Zur Seite hatte sie eine wilde Kluft, die jeden Zugang verhinderte.
Es ist von eigentümlichem Reiz, sich nach den mykenaischen Gräberfunden in dieser Umgebung ein Leben in Üppigkeit und Luxus vorzustellen: Männer und Frauen, die sich schnürten, und besonders Frauen, deren Toiletten an Glanz und Raffinement der Toilette einer spanischen Tänzerin, die in einem pariser Theater tanzt, gleichgekommen sind. Aber schließlich ist es wieder Homer, der überall den Sinn für Komfort und Luxus entwickelt und nie vergißt, Bäder, duftende Betten, reinliches Linnen, hohe und hallende Säle, Schmuck und Schönheit der Weiber, ja sogar den Wohlgeschmack des Getränks und der Speisen gebührend zu würdigen.
Die unterirdischen Kuppelbauten, die Pausanias Schatzhäuser nennt, sind ihrer eigentlichen Bestimmung nach noch heute ein Rätsel. Sie waren bekannt, wie es scheint, durch das ganze griechische Altertum und wahrscheinlich, so weit sie frei lagen, wie noch heute, erfüllt von Bienengesumm. Das „Schatzhaus des Atreus“, ist vollkommen freigelegt. Die weiche, sausende Chormusik der kleinen honigmachenden Priesterinnen der Demeter, die den unterirdischen Bau erfüllt, verbreitet mystische Feierlichkeit. Sie scheinen im Halblicht der hohen Kuppel umherzutaumeln. Sie fliegen, an den unbestrittenen Besitz dieser Räume gewöhnt, gegen die Köpfe der Eintretenden. Ihr sonorer Flug bewegt sich mit Gehen und Kommen in eine niedrige Nebenkammer, die sehr wohl eine Grabkammer sein könnte. Aber die Menge der Schatzhäuser würde durch eine Bestimmung als unterirdische Tempelgräber, für Totenopfer und Totenkult, nicht erklärt. Ich stelle mir aber gern inmitten dieses sogenannten Artreusschatzhauses einen Altar vor und das Feuer darauf, das den Raum erleuchtet und lärmend belebt und dessen Rauch durch die kleine runde Öffnung der Kuppel abzieht und oben scheinbar aus der Erde selber hervordringt.
Drei Schimmel ziehen unsern Wagen im Galopp durch die Vorstädte von Tripolitza in die arkadische Landschaft hinaus. Der wolkenlose Himmel ist über weite Ackerflächen gespannt, auf denen Reihen bunter, griechischer Landleute arbeiten. Der Tag wird heiß. Die Luft ist erfüllt von Froschgequak.
Nun, nach einer längeren Fahrt durch kleine Ortschaften, verlassen wir die Ebene von Thegea. Die schöne Landstraße steigt bergan, und statt der Felder haben wir rötlich-graue Massen kahlen Gesteins zur Rechten und Linken, die spärlich mit Thymiansträuchern bewachsen sind. Es beginnt damit ein Arkadien, das mehr einer Wüstenei, als dem Paradiese ähnlich sieht. Nach einiger Zeit ist in der Höhe ein Dorf zu sehen, mit einigen langen, dünn belaubten Pappeln, die das Auge hungrig begrüßt. Nur wenig lösen sich die Häuser der Ortschaft von ihrem steinigten Hintergrund, der mit schmalen Gartenstreifen rötlicher Erde durchsetzt ist.
Die Spitzen des Parnon werden zur Linken sichtbar, auf denen der Schnee zu schwinden beginnt. Ein kühler Wind setzt ein und erquickt inmitten dieser arkadischen Wüste.
Ich hatte hier einen womöglich noch größeren Reichtum an Herden zu sehen gehofft, als zwischen Parnaß und Helikon: aber auf weitgedehnten, endlosen Trümmerhalden und auf der Landstraße begegnet nur selten Herde und Hirt. Die Gegend ist arm und ausgestorben, die ehemals das waldreiche Paradies der Jäger und Hirten gewesen ist.
Die Straße wendet sich auf einer freien Paßhöhe rechts und tritt in das Gebiet von Lakonika. Der Taygetos liegt nun breit und mächtig mit weißen Gipfeln vor uns da.
Aus einer ärmlichen Schenke ertönt Gesang. Und zwar ist es eine Musik, die an das Kommersbuchtreiben deutscher Studentenkneipen erinnert. Die Stimmen gehören Gymnasiallehrern aus Sparta an, die, noch im Osterferien-Rausch, fröhlich dorthin zurückreisen.
Es erscheinen jetzt Äcker, Gartenflächen, Wiesen und Bäume oasenartig. Die Erde zwischen Felsen und Bäumen ist rot, und hier und da stehen rötliche Wasserlachen.
Der Parnon verschwindet und taucht wieder auf. Die Gegend gewinnt, nachdem wir die Paßhöhe überschritten haben, an Großartigkeit. Einige der vielen steinigten Hochtäler, die man übersieht, zeigen Baumwuchs inselartig in ihrer Tiefe. Es ist mir, so lange mein Auge durch diese uferlosen, kochenden Wüsteneien schweift, als ob ich das traurig-nackte, ausgetrocknete Griechenland mit einem Mantel grüner Nadelwälder bedecken müßte, und meine Träumereien führen Armeen tätiger Menschen hierher, die, vom sorglich gepflegten Saatkamp aus, in geduldiger Arbeit Arkadien aufforsten. Mit tiefem Respekt gedenke ich der zähen Kraft und Tüchtigkeit jener Männer und Frauen meiner engeren Heimat, auch derer mit krummgezogenem Rücken, die den Forst ernähren, mehr wie sie der Forst ernährt, und mit Staunen vergegenwärtige ich die Schöpferkraft, die in der harten Faust der Arbeit liegt.
Wir halten Rast. Die Herberge ist an eine Krümmung der Bergstraße gestellt. Unter uns liegt ein weites Tal, das der Taygetos mit einer Kette von Schneegipfeln mächtig beherrscht. Der Himmel glüht in einer fast weißen Glut. Hügelige Abhänge in der Nähe, von Olivenhainen bestanden, erscheinen ausgebrannt.
Unsere Herberge hat etwas Japanisches. Das Schilfdach über der schwankenden Veranda, auf der wir stehen, ist durch dünne Stangen gestützt. Unten klingeln die müden Pferde mit ihren Halsglöckchen. Die trinkfrohen Lehrer aus Sparta haben uns eingeholt und sitzen lärmend unten im Gastzimmer. Wir werden in ein oberes Zimmer geführt, dessen Dielen dünn wie Oblaten sind. Durch fingerbreite Fugen zwischen den Brettern können wir zu den Lehrern hinabblicken. Der Kurier trägt ein Frühstück auf. Indessen schwelgen die Augen und ruhen zugleich im jungen Blättergrün eines Pappelbaums, der, vom heißen Winde bewegt, jenseits der Straße schwankt und rauscht.
Nachdem wir gegessen haben, ruhen wir auf der Veranda aus. Bei jedem Schritt, den wir etwa tun, schaukelt die ganze Herberge. Zwei Schwalben sitzen nahe bei mir unter dem Schilfdach auf der Geländerstange. Überall um uns ist lebhaftes Fliegengesumm.
Wir haben vor etwa einer Stunde das Kahni verlassen, wo uns die Lehrer aus Sparta eingeholt hatten. Ihr Einspännerwägelchen stand, als wir abfuhren, vor der Tür und wartete auf die indessen lustig zechenden Gäste. Sonderbar, wie in diesem heißen, stillen und menschenleeren Lande die brave Turnerfidelitas anmutete, die immer wieder in einem gewaltigen Rundgesang gipfelte!
Die Straße beginnt sich stärker zu senken. Wir fahren weite Schlingen und Bogen an tiefen Abstürzen hin, die aber jetzt den Blick in eine immer reicher ausgestaltete Tiefe ziehen. Wir nähern uns der Gegend von Sparta, dem schönen Tal des Eurotas an.
Es ist eine wundervolle Fahrt, durch immer reicher mit Wein, Feigenbäumen und Orangenhainen bestandene Abhänge. Ziegen klettern zur Linken über uns und zur Rechten unter uns. Lieblich gelegene Ansiedelungen mit weißem Gemäuer mehren sich, bis wir endlich das flache Aderngeflecht des Eurotas und zugleich die weite Talsohle überblicken können.
Fast wie Vögel senken wir uns aus gewaltiger Höhe auf das moderne Sparta herab, das, mit weißen Häusern, aus Olivenhainen, Orangengärten und Laubbäumen, weiß heraufleuchtet. Es ist mir dabei, als beginne das strenge und gleichsam erzene Wort Sparta, sich in eine entzückende, ungeahnte südliche Vision aufzulösen. Eine augenblendende Vision von Glanz und Duft.
Ich kann nicht glauben, daß irgendein Land an landschaftlichen Reizen und in der Harmonie solcher Reize mit dem griechischen wetteifern könnte. Es zeigt den überraschendsten Wechsel an Formen und überall eine bestrickende Wohnlichkeit. Man begreift sogleich, daß auch dieses Tal von Sparta eine festgeschlossene Heimat ist, mit der die Bewohner, ähnlich wie mit einem Zimmer, einem Hause verwachsen mußten.
Ich möchte behaupten, daß der Reichtum der griechischen Seele zum Teil eine Folge des eigenartigen Reichtums der griechischen Muttererde ist. Wobei ich von dem landschaftlichen Sinn der Alten den allerhöchsten Begriff habe. Natürlich nicht einem landschaftlichen Sinn in der Weise moderner Malerei, sondern als einer Art Empfindsamkeit, die eine Seele immer wieder zum unbewußten Reflex der Landschaft macht.
Zweifellos war die Phantasie im Geiste des Menschen die erste und lange Zeit alleinige Herrscherin, aber das im Wechsel der Tages- und Jahreszeiten feste Relief des Heimatsbodens blieb in einem gewissen Sinne ihr Tummelplatz. Was an bewegten Gestalten von ihr mit diesem Boden verbunden wurde, das hatte dieser Boden auch miterzeugt.
Das unbewußte Wirken des Geistes, im Kinde so wie im Greise, ist immer wesentlich künstlerisch, und Bildnertrieb ist eine allgemein verbreitete Eigenschaft, auch wo er sich nie dem äußeren Auge sichtbar kundgibt. Auch der Naivste unter den Menschen wohnt in einer Welt, an deren Entstehung er den hauptsächlichsten Anteil hat und die zu ergründen ebenso reizvoll sein würde, als es die Bereisung irgendeines unentdeckten Gebietes von Tibet ist. Unter diesen Naivsten aber ist wiederum keiner, der nicht das Beste, was er geschaffen hat, mit Hilfe des kleinen Stückchens Heimat geschaffen hätte, dahinein er geboren ist.
Ich befinde mich im Garten eines kleinen Privathauses zu Sparta. Vor etwa einer Stunde sind wir hier angelangt. Ich habe mich beeilt, aus dem dürftigen Zimmerchen, das man uns angewiesen hat, wieder ins Freie zu gelangen. Es war eine sogenannte gute Stube, und es fehlte darin nicht einmal das Makartbukett.
Irgendwie, ich weiß zunächst nicht wodurch, bin ich in diesem Grasegarten an längst vergangene Tage erinnert. Eindrücke meines frühen Jünglingsalters steigen auf. Ich vergesse minutenlang, daß die verwilderte Rasenfläche unter meinen Füßen der Boden von Sparta ist. Dann kommt es mir vor, als wandle ich in jenem kleinen Obstgarten, der an das Gutshaus meines Onkels stieß, und etwas vom Tanze der nackten Mädchen Spartas und erster Liebe ginge mir durch den Kopf.
Es ist aber wirklich ein Garten in Sparta und nicht das Gehöft meiner guten Verwandten, wo ich jetzt bin. In der nahen Gartenzisterne quakt ein spartanischer Frosch, ich schreite an einer spartanischen Weißdornhecke hin und spartanische Sperlinge lärmen.
Auf der Konsole des Nußbaumspiegels, dessen sich das Quartier meiner Gastfreunde rühmen kann, fand ich unter anderen Photographien auch ein Bild, — das Bild eines hübschen, ländlichen Mädchens! — das mir sogleich ins Auge fiel. Sie mag wohl längst gestorben sein oder ist etwa vor dreißig Jahren jung gewesen, um jene Zeit, als auch das Mädchen, an das ich mich jetzt erinnern muß, siebzehnjährig durch Garten, Hof und Haus meiner schlesischen Anverwandten schritt.
Die Bergwand des Taygetos ist zum Greifen nahe. Die Sonne versinkt soeben hinter die hohe Kammlinie und beinahe das ganze Tal des Eurotas ist in Schatten gelegt. Die Landschaft ringsum ist zu dieser Stunde zugleich heroisch und anheimelnd.
Plötzlich finde ich mich mit lebhaftem Griechisch angeredet. Ein Mann hat mich zwischen Stachelbeer- und Johannisbeersträuchern entdeckt, ist herzugetreten und setzt voraus, daß ich Griechisch verstehe. Kurze Zeit bin ich hilflos gegen seine neuspartanische Zudringlichkeit, dann aber wird im Giebel unseres Häuschens — das übrigens, windschief, wie es ist, von außen betrachtet unbewohnbar scheint — ein Fenster geöffnet, und das schöne Mädchen, die schöne Spartanerin, noch ganz so jung, wie das Bild sie zeigte, lehnt sich heraus.
Der Mann von der Straße wird nun durch eine tiefe, sonore Frauenstimme zurecht-, das heißt aus dem Garten gewiesen, und ich habe, mit gebundener Zunge, Antlitz und Blick der hübschen Spartanerin über mir.
„Gott grüß euch schönes Jungfräulein
Wo bind ich mein Rößlein hin? —
Nimm du dein Rößlein beim Zügel, beim Zaum,
Binds an den Feigenbaum.“
Der irrationale Wunsch und Zwang, eine Stätte wie die des alten Sparta zu sehen, erklärt sich zwar nicht durch den Namen Lykurg, aber doch ist es vor allem der Genius dieses Namens, der Genius, dessen Wirken eine so unvergleichliche Folge hatte, den man in dieser Landschaft sucht. Man konnte nicht hoffen oder erwarten wollen, hier irgendein Jugendidyll, auch nur in Erinnerung, sich erneuern zu sehen: dennoch nimmt mich, statt jeder historischen Träumerei, eine solche Erinnerung jetzt in Besitz.
Nicht zweimal schwimmst du durch die gleiche Welle, sagt Heraklit, und es ist nicht dieselbe, die um mich und durch mich flutet, als jene Frühlingswoge, durch die ich vor Jahren geschwommen bin: aber es ist doch auch wieder etwas von ewiger Wiederkehr in ihr.
Ich sage mir, daß Lykurg wiederum nichts weiter, als ein großer Hirte, ein großer Schäfer gewesen ist, der den Nachwuchs seines Volkes in „Herde“ teilte. Daß seine Gedanken in der Hauptsache sehr entschlossene Züchtergedanken gewesen sind, wie sie aus den Erfahrungen eines Hirtenlebens sich ergeben und zwar mit Notwendigkeit. Lykurg, der trotzdem mit Delphi Verbindung hatte, war überwiegend ein Mann der kalten Vernunft, gesteh ich mir, und wußte, wie keiner außer ihm, das zeitliche Leben vom ewigen und ihre Zwecke rein zu sondern. Allein durch alle diese Erwägungen vermag ich meine Seele nicht von dem spartanischen Ebenbilde meiner ländlichen Jugendliebe abzuwenden.
Jungens, nicht anders wie Jungens sind, gucken über den Zaun, der hier allerdings von dem krebsscherenartig, stachlig-grünen Gerank der Agave gebildet ist. Sie sind neugierig, werfen Steine in blühende Obstbäume, suchen etwas für ihre Tatkraft, stören mich. Der gleiche Fall veranlaßte mich vor Jahren, an einem denkwürdigen Tage, aus begreiflichen Gründen zu vergeblicher Heftigkeit, dagegen gelang es dem deutschen Urbilde der Spartanerin, das damals neben mir durch den Grasegarten schritt, die Knaben mit wenigen gütigen Worten zu bewegen, von ihren Störungen abzulassen.
Nun ist das schöne Mädchen im Garten erschienen. Ich grüße sie und werde dann magisch in die gleiche Richtung gezogen, die sie eingeschlagen hat, und durch dasselbe Pförtchen im Heckenzaun, durch das sie verschwunden ist.
Ich stehe auf einer kleinen begrasten Halbinsel hinter dem Garten, um die der starke Bergbach eilig sein klares und rauschendes Wasser trägt. Es kommt, eisfrisch, vom Taygetus. Kaum fünf Schritt von mir entfernt haben Zigeuner ihr Zelt aufgeschlagen. Der Vater steht in guterhaltener kretensischer Tracht, mit ruhiger Würde, pfeiferauchend, am Bachesrand. Die Mutter, von zwei Kindern umspielt, hockt an der Erde und schnitzelt Gemüse für die Abendsuppe zurecht, die allbereits über einem bescheidenen Feuerchen brodelt. Zwischen den braunen, halbnackten Kindern springt ein zähnefletschendes Äffchen umher: Dies alles, besonders das kleine Äffchen, wird mit kindlicher Freude bewundert von meiner Dorfschönen.
Ich sehe nun, sie ist kräftig gebaut und jünger, als ich nach dem Bilde, nach der Erscheinung am Fenster und nach den Lauten ihrer Stimme geurteilt hatte, wahrscheinlich nicht über fünfzehn Jahre alt. Sie erinnert mich an den derben Schlag der Deutsch-Schweizerin. Die Zigeunermutter hat, sobald sie meiner ansichtig wurde, ihrem singenden, springenden Lausetöchterchen das Tamburin zugeworfen, womit es sich augenblicklich klirrend vor mir im Tanze zu drehen beginnt. In der Freude darüber trifft sich mein Blick mit dem der jungen Spartanerin.
Inzwischen ist alles um uns her mehr und mehr in abendliche Schatten gesunken. Die Glocke einer nahen Kirche wird angeschlagen. Gebrüll von Rindern dringt von den dämmrigen Weideflächen am Fuß des Taygetus. Das ganze Gebirge ist nur noch eine einzige, ungeheure, blauschwarze Schattenwand, die, scheinbar ganz nahe, den Bach zu meinen Füßen zu speisen scheint, dessen Wasser blauschwarz und rauschend, wie flüssiger Schatten heranwandelt.
Grillen zirpen. Ein märchenhaftes Leuchten ist in der Luft. Kalte und warme Strömungen machen die Blätter der Pappeln und Weiden flüstern, die, zu ernsten, ja feierlichen Gruppen gesellt, die Ränder des breiten Baches begleiten.
Es ist ein Uhr nachts, aber in der Mondeshelle draußen herrscht trotzdem dämonischer Lärm. Hühner und Hähne piepsen und krähen laut, Hunde kläffen und heulen ununterbrochen. Mitunter klingt es wie Stimmen von Kindern, die mit lautem Geschrei lustig und doch auch gespenstisch ihr nächtliches Spiel treiben. In der Gartenzisterne quakt oder trillert immer der gleiche Frosch.
Die alten Spartaner befolgten jahrhundertelang eine Züchtungsmoral. Es hat den Anschein, als wenn die Moral des Lykurg in einem größeren Umfang noch einmal aufleben wollte. Dann würde sein kühnes und vereinzeltes Experiment, mit allen seinen bisherigen Folgen vielleicht nur der bescheidene Anfang einer gewaltigen Umgestaltung des ganzen Menschengeschlechtes sein.
Wenn etwas vorüber ist, so ist es am Ende für unsere Vorstellungskraft gleichgültig, ob es gestern geschah, oder vor mehr als zweitausend Jahren, besonders, wenn es menschlich voll begreifliche Dinge sind. Ob also die spartanischen Mädchen gestern nackt auf der Wiese getanzt haben, damit die Jünglinge ihre Zuchtwahl treffen konnten, oder vor dreitausend Jahren, ist einerlei. Ich nehme an, es sei gestern gewesen. Ich nehme an, daß man noch gestern hier die Willenskraft, den persönlichen Mut, die Disziplin, Gewandtheit, Körperstärke und jedwede Form der Abhärtung vor allem gepflegt und gewürdigt hat. Und daß meinethalben die Epheben noch heute Nacht im Heiligtum des Phöbus, draußen auf den dämmrigen Wiesen, wo ich sie nicht sehe, wie unsre Zigeuner dem Monde, einen Hund opfern.
Ihr Gesetzgeber war Lykurg, ihr Ideal Herakles. Die Standbilder beider Heroen standen auf beiden Brücken, die über den Wassergraben zum Spielplatz bei den Platanen führten. Leider ging es auf eine sinnlose Weise roh, mit Treten, Beißen und Augenausbohren, bei diesen Ephebenkämpfen zu.
Immer noch herrscht im Mondschein draußen derselbe dämonische Höllenlärm. Durch Ort, Stunde, Mondschein und Reiseermüdung aufgeregt, bevölkert sich meine Phantasie mit einer Menge wechselnder Vorstellungen, gleichsam einem altspartanischen Gespenster- und Kirchhofspuk. Bald sehe ich zappelnde Säuglinge im Taygetus ausgesetzt, bald löffle ich selbst bei der gemeinsamen öffentlichen Männermahlzeit die greuliche, schwarze Suppe ein, bald bin ich gleichzeitig dort, wo ein Ephebe zu Ehren der Artemis nackt im Tempel gegeißelt wird und sehe auf dem entfernten Stadion Odysseus mit den ersten Freiern der jungfräulichen Penelope wettlaufen.
Zaudern ist, wie es scheint, schon damals eine Schwäche des edlen Weibes gewesen: ich führe auch die Mißwirtschaft der Freier, im Hause des Gatten, auf sie zurück. Ikarios, der Vater Penelopes, wollte sie aus dem Elternhause in Sparta nicht mit Odysseus ziehen lassen und folgte dem Paare, als es nun doch nicht zurückzuhalten war, im Wagen nach. Dem Odysseus aber, der das Herz seines Weibes noch auf der Reise schwankend sah, ist, nach einem Bericht des Pausanias, die Geduld gerissen, und er hat kurzer Hand seinem Weibe an einer gewissen Stelle des Weges zur Wahl gestellt: entweder nun entschlossen mit ihm nach Ithaka, oder mit ihrem Vater und einem Abschied für immer wieder nach Sparta heimzureisen.
Der Spuk der Nacht ist dem Lichte des Tages gewichen. Unten im Garten grasen Ziegen und eine Kuh. Das Zigeunermädchen sucht nach irgend etwas die Hecken ab. Man hört drei- oder viermal die Pauke der Zigeuner anschlagen. Es ist kein Tropfen Tau gefallen in der Nacht. Ich schreite trockenen Fußes durchs hohe Gras.
Der Zigeuner und seine Frau hocken auf Decken vor ihrem Zelt. Er hat den roten Schal des Kretensers bereits um die Hüften und schmaucht behaglich, indes die zerlumpte Gattin Knöpfe an seiner geöffneten Weste, mit Zwirn und Nadel, sorgsam festmacht. Der Bergfluß rauscht um die Lagerstatt.
Herr Allan I. B. Wace, Pembroke College, Cambridge, hat die Freundlichkeit, uns im kleinen Museum von Sparta mit Erklärungen an die Hand zu gehen. Er geleitet uns durch ausgedehnte Olivenhaine, trotz brennender Sonnenglut, zur Ausgrabungsstätte am Eurotas. Zu hunderten, ja zu tausenden werden hier in den Fundamenten eines Athenatempels Figürchen nach Art unserer Bleisoldaten aufgefunden. Diese Figürchen, von denen viele zutage lagen, so daß die spartanischen Kinder mit ihnen spielten, verrieten das unterirdische Heiligtum.
Gegen Mittag besteigen wir Maultiere, nicht ohne Mühe, weil diese spartanischen Mulis besonders tückisch sind. Die schöne Tochter unseres Gastfreundes, die uns noch gestern abend, mit tremolierender Stimme etwas zur Laute sang, lehnt im Fenster der kleinen Baracke, nicht sehr weit über uns, und beobachtet die Vorbereitungen für unsere Abreise mit kalter Bequemlichkeit. Das hübsche, naive Kind von gestern, dessen Gegenwart mir die Erinnerung eines zarten Jugendidylls erneuern konnte, ist nur noch eine träge, unempfindliche Südländerin.
Ich erinnere mich — und schon ist dieses Gestern wieder Erinnerung! — Wie mir die Kleine nochmals im Garten begegnete, mir ins Gesicht sah und mich anlachte, mit einer offenen Lustigkeit, die keine Schranke mehr übrig läßt. Nun aber blickt sie über mich fort, als ob sie mich nie gesehen hätte, mit vollendeter Gleichgültigkeit.
Wir frühstücken gegen ein Uhr mittags im Hofe eines byzantinischen Klosters — einer Halbruine unter Ruinen! — an den steilen Abhängen der Ruinenstätte Mistra.
Der quadratische Hof ist an drei Seiten von Säulengängen umgeben. Sie tragen eine zweite, offene Galerie. Die vierte Seite des Hofes ist nur durch eine niedrige Mauer vom Abgrund getrennt und eröffnet einen unvergleichlichen Blick in die Ferne und Tiefe des Eurotastales hinab.
Den kurzen Ritt von Sparta herauf haben wir unter brennender Sonne zurückgelegt. Hier ist es kühl. Eine Zypresse, uralt, ragt jenseits der niedrigen Mauer auf. Sie hat ihre Wurzeln hart am Rande der Tiefe eingeschlagen. Ich suche den Lauf des Eurotas und erkenne ihn an seiner Begleitung hoher und frischgrüner Pappeln. Ich verfolge ihn bis zu dem Ort, wo das heutige Sparta liegt: mit seinen weißen Häusern in Olivenwäldern, unter Laubbäumen halb versteckt.
Dieses mächtige, überaus glanzvolle südliche Tal, mit den fruchtreichen Ebenen seiner Grundfläche, widerspricht dem strengen Begriff des Spartanertums. Es ist vielmehr von einer großgearteten Lieblichkeit und scheint zu sorglosem Lebensgenusse einzuladen.
Herr Adamantios Adamantiu, Ephor der Denkmäler des Mittelalters in Mistra, stellt sich uns vor und hat die Freundlichkeit, seine Begleitung durch die Ruinen anzutragen. Seine Mutter und er bewohnen einige kleine Räume eben des selben ausgestorbenen Klosters, in dem wir jetzt sind.
Oben, auf einer der Galerien, hat sich ein lustiger Kreis gebildet. Es sind die gleichen, lebenslustigen Pädagogen, denen wir bereits auf dem Wege nach Sparta mehrmals begegnet sind. Sie befinden sich noch immer im Enthusiasmus des Weins und singen unermüdlich griechische, italienische, ja sogar deutsche Trinklieder.
Ich kann nicht sagen, daß dieser Studentenlärm nach deutschem Muster, mir an dieser Stätte besonders willkommen ist, und doch muß ich lachen, als einer der fröhlichen Zecher, ein älterer Herr, im weinselig-rauhen Sologesang ausführlich darlegt, daß er weder Herzog, Kaiser noch Papst, sondern, lieber als alles, Sultan sein möchte.
Der lebenslustige Sänger, spartanischer Gymnasialprofessor, spricht mich unten im Hofe an. Er macht mir die Freude, zu erklären, ich sei ihm seit lange kein Unbekannter, was mir begreiflicherweise hier, an dem entlegenen Abhange des Taygetus, seltsam zu hören ist.
Die Herren Lehrer haben Abschied genommen und sich entfernt. Herr Adamantios Adamantiu hat mittels eines altertümlichen Schlüssels ein unscheinbares Pförtchen geöffnet und wir sind, durch einen Schritt, aus dem hellen Säulengang in Dunkelheit und zugleich in ein liebliches Märchen versetzt.
Der blumige Dämmer des kleinen geheiligten Raumes, in den wir getreten sind, ist erfüllt von dem Summen vieler Bienen. Es scheint, die kleinen heidnischen Priesterinnen verwalten seit lange in dieser verlassenen Kirche Christi allein den Gottesdienst. Allmählich treten Gold und bunte Farben der Mosaiken mehr und mehr aus der Dunkelheit. Die kleine Kanzel, halbrund und graziös, erscheint, mit einer bemalten Hand verziert, die eine zierliche, bunte Taube, das Symbol des heiligen Geistes, hält.
Dieses enge, byzantinische Gotteshaus ist zugleich im zartesten Sinne bezaubernd und ehrwürdig. Man findet sich nach dem derben Schmollistreiben der Herren Lehrer ganz unvermutet plötzlich in ein unterirdisches Wunder der Schehrazade versetzt, gleichsam in eine liebliche Gruft, eine blumige Kammer des Paradieses, abgeschieden von dem rauhen Treiben irdischer Wirklichkeit.
Herr Adamantios Adamantiu, der Ephor, liebt die ihm anvertrauten Ruinen mit Hingebung, und was mich betrifft, so empfinde ich schmerzlich in diesem Augenblick, daß ich mich schon im nächsten von dem reinen Vergnügen dieses Anblicks trennen muß. Reichtum und Fülle köstlichen Schmucks wird hier vollkommener Ausdruck des Traulichsten, Ausdruck der Einfalt und einer blumigen Religiosität. Das byzantinische Täubchen am Rande der Kanzel verkörpert ebensowohl einen häuslichen, als den heiligen Geist.
Es scheint, daß Herr Adamantios Adamantiu keinen heißeren Wunsch im Herzen trägt, als dauernd diese Ruinen zu hüten: und ich bin überrascht, im Laufe der Unterhaltung wahrzunehmen, wie sehr verwandt der Geist des lauteren Mannes mit jenem ist, der dieses Kirchlein schuf und erfüllt.
Mit leuchtenden Augen erklärt er mir, daß ich, glücklicher als der große Goethe, diese Stätten mit leiblichen Augen sehen kann, wo Faust und Helena sich gefunden haben.
In dieses Heiligtum gehört keine Orgel noch Bachsche Fuge hinein, sondern durchaus nur das Summen der Bienen, die von den zahllosen Blüten der bunten Mosaiken Nektar für ihre Waben zu ernten scheinen.
Sparta und Helena scheinen einander auszuschließen. Was sollte ein Gemeinwesen mit der Schönheit als Selbstzweck beginnen, wo man den Wert eines Suppenkoches höher als den eines Harfenspielers einschätzte? Was hätte Helena mit der spartanischen Strenge, Härte, Roheit, Nüchternheit und Tugendboldigkeit etwa gemein?
Ein junger Spartaner rief, als man beim Gastmahl eine Lyra herbeibrachte: Solche Tändeleien treiben sei nicht lakonisch. Wer möchte nun, da Helena und die Leier Homers nicht zu trennen sind, behaupten wollen, daß Sparta Helenen eine wirkliche Heimat sein konnte?
Herr Adamantios Adamantiu geleitet uns stundenlang auf mühsamen Fußpfaden durch die fränkisch-byzantinisch-türkische Trümmerstadt, die erst im Jahre 1834 durch Ibrahim Pascha zerstört worden ist. Das alte Mistra war an die schwindelerregenden Felswände des Taygetus wie eine Ansiedlung von Paradiesvogelnestern festgeklebt. Einzelne Kirchen werden durch wenige Arbeiter unter Aufsicht des Herrn Ephoren sorgsam, Stein um Stein, wieder hergestellt: Baudenkmäler von größter Zartheit und Lieblichkeit, deren Zerstörung durch die Türken einen unendlich beklagenswerten Verlust bedeutet.
Überall von den Innenwänden der Tempel spricht uns das Zierliche, Köstliche, Höfische an, in dem sich der Farbenreichtum des Orients mit dem zarten Kultus der Freude des deutschen Minnesanges durchdrungen zu haben scheint. Die Reste herrlicher Mosaiken, soweit sie der Brand und die Spieße der Türken übriggelassen haben, scheinen, auch wenn sie heilige Gegenstände behandeln, nur immer die Themen: Ritterdienst, Frauendienst, Gottesdienst durcheinanderzuflechten.
Mittels eines nassen Schwammes bringt der Herr Ephor, auf einer Leiter stehend, eigenhändig die erblindeten Mosaiken zu einem flüchtigen Leuchten im alten Glanz.
„Ein innerer Burghof, umgeben von reichen, phantastischen Gebäuden des Mittelalters“ ist der Schauplatz, in dem Helena sich gefangen fühlt, bevor ihr Faust, im zweiten Teil des gleichgenannten Gedichts, in ritterlicher Hoftracht des Mittelalters entgegentritt. Und mehr als einmal umgibt mich hier das Urbild jener geheiligten Szenerie, darin sich die Vermählung des unruhig suchenden deutschen Genius mit dem weiblichen Idealbild griechischer Schönheit vollzog.
Herr Adamantios Adamantiu, der etwa dreißig Jahre alt und von zarter Gesundheit ist, stellt uns auf einer der Galerien des Klosterhofes seiner würdigen Mutter vor. Diese beiden lieben Menschen und Gastfreunde wollen uns, wie es scheint, nicht mehr fortlassen. Die Mutter bietet meiner Reisegefährtin für die Nacht ihr eigenes Lager an, ihr Sohn dagegen das seine mir.
Von seinem Zimmerchen aus überblickt man die ganze Weite und Tiefe des Eurotastales, bis zu den weißen Gipfeln des Parnon, die hineinleuchten: das Zimmer selber aber ist klein, und enthält nichts weiter als ein kleines Regal für Bücher, Tisch, Stuhl und Feldbettstelle, dazu im Winkel ein ewiges Lämpchen unter einem griechisch-katholischen Gnadenbild. Natürlich, daß in einem verlassenen Kloster die Fenster undicht, die Wände schlecht verputzt — und daß in den rohen Bretterdielen klaffende Fugen sind.
Ganz Sohnesliebe, ganz Vaterlandsliebe und ganz von seinem besonderen Beruf erfüllt: der Pflege jener vaterländischen Altertümer! bringt Herr Adamantios Adamantiu in weltentsagender Tätigkeit seine jungen Jahre zu und beklagt es, daß manche seiner Mitbürger so leicht die mütterliche Scholle aufgeben mögen, die ihrer Kinder so sehr bedarf.
Der hingebungsvolle Geist dieses jungen Griechen erweckt in meiner Seele wärmste Bewunderung und ich rechne die Begegnung mit ihm zu den schönsten Ereignissen meiner bisherigen Reise durch Griechenland. Wie er unverdrossen und mit reinster Geduld Werkstück um Werkstück aus dem Schutt der Verwüstung zu sammeln sucht, um in mühsamen Jahren hier und da etwas Weniges liebevoll wieder herzustellen, von der ganzen, beinahe in einem Augenblicke vernichteten, unersetzlichen Herrlichkeit, das legt von einem Idealismus ohnegleichen Zeugnis ab.
Wir nehmen Abschied von unsern Wirten, um noch vor Einbruch der Nacht den Ritt bis Tripi zu tun: Tripi am Eingang jener mächtigen Schlucht, die sich in die Tiefe des Taygetus fortsetzt, den wir übersteigen wollen.
Unsere Maultiere fangen wie Ziegen oder Gemsen zu klettern an: bald geht es fast lotrecht in die Höhe, bald ebenso lotrecht wieder hinab, so daß ich mitunter die Überzeugung habe, unsere Tiere hätten den eigensinnigen Vorsatz gefaßt, um jeden Preis auf dem Kopfe zu stehen. Wenn man, mit den Blicken vorauseilend, als Unerfahrener die drohenden Schwierigkeiten des Weges im Geiste zu überwinden sucht, so glaubt man mitunter verzagen zu sollen, denn es eröffnet sich scheinbar nur selten für ein Weiterkommen die Möglichkeit.
Aber das Maultier nimmt mit bewunderungswürdiger Leichtigkeit jedes Hindernis: über Böschungen rutschen wir an steinige Bäche hinunter und jenseits des Wassers klettern wir wieder empor. In einem Bachbett steigen wir lange Zeit von einem kantigen Block zum andern bergan und zwar bereits von der Dunkelheit überrascht, bis wir das Wasser am Ausgang der Langada in dem steilen Tale von Tripi rauschen hören. Über eine Geröllhalde geht es alsdann in gefährlicher Eile hinab, bis wir, die Lichter von Tripi vor Augen, auf einer breiten, gesicherten Straße geborgen sind.
Gegen vier Uhr des Morgens wecken mich die Nachtigallen von Tripi. Ich glaube, daß alle Singvögel der ganzen Welt den Aufgang der Sonne mit einem kurzen Konzert begrüßen. Zweifellos ist dies Gottesdienst.
Unser Haus ist in schwindelerregender Höhe über der Talwand erbaut. Wir haben in einem Raume übernachtet, der drei Wände von Glas ohne Vorhänge hat. Büsche reichen bis zu den Fenstern. Mächtige Wipfel alter Laubbäume sind unter uns und bekleiden die steilen Wände der Schlucht.
Während das einsame Licht zunimmt, schlagen die Nachtigallen lauter aus dem Abgrund herauf. Nach einiger Zeit beginnen alle Hähne des Dorfes einen lauten Sturm, der die Nachtigallen sofort verstummen macht.
Auf einem Felsen, scheinbar unzugänglich, inmitten der Schlucht, erscheint die Kirche von Tripi im Morgenlicht. Die Pfade von Tripi, die ganze Anlage dieses Ortes sind ebenso malerisch wie halsbrecherisch.
Die Maultiere klettern schwindelerregende Pfade. Sie halten sich meistens am Rande der Abgründe. Die Langada beginnt großartig, aber kahl und baumlos. Die Gesteinmassen des Bachbettes, auf dem Grunde der gewaltigen Schlucht, liegen bleich, verwaschen und trocken da. Das Tal ist tot. Kein Vogellaut, kein Wasserrauschen!
Indem wir ein wenig höher gelangen, zeigt sich geringe Vegetation. Einige Vögel beginnen zu piepsen. Nach einiger Zeit fällt uns der Ruf eines Kuckucks ins Ohr.
Weiter oben erschließt sich ein Tal, auf dessen Sohle lebendiges Wasser rauscht. Wir steigen in dieses Tal, das eigentlich eine Schlucht ist, hinunter. Die Abhänge sind von Ziegenherden belebt. Eng in die Felswände eingeschlossen, schallen die Herdenglocken laut.
Bis hierher war es, trotz der Frühe, ziemlich heiß. Nun werden wir von erquickenden Winden begrüßt. Erfrischt von der gleichen Strömung der Luft, winken die grünen Wedel der Steineichen von den Felsspitzen. Plötzlich haben wir nickende Büsche überall. Efeuranken klettern wohl hundert Meter und höher die Steinwand hinauf.
Immer wasserreicher erscheinen die Höhen, in die wir aufdringen. Mehrmals werden reißende Bäche überquert. Eine erste, gewaltige Kiefer grüßt vom Abhange. Anemonen, blendend rote, zeigen sich. Kleine Trupps zarter Alpenveilchen. Aus Seitenschachten stürzen klare Wasser über den Weg und ergießen sich in das Sammelbett des größeren Baches.
Wir halten die erste Rast, etwa 2300 Meter hoch im Taygetus, unter einem blühenden Kirschbaum vor der Herberge, genannt zur kleinen Himmelsmutter. Der Bergstrom rauscht. Kirschblüten fallen auf uns herunter. Wir haben herrliche Abhänge gegenüber, die mit starken Aleppokiefern bewaldet sind.
Es ist köstlich hier, entzückend der Blick durch die tiefgesenkten Blütenzweige in die ebenso wilde als wonnige Bergwelt hinein.
Man fühlt hier oben das unbestrittene Reich der göttlichen Jägerin Artemis, die in Lakonien vielfach verehrt wurde. Hier ist für ein freies, seliges Jägerleben noch heut der eigentlich arkadische Tummelplatz. Hier oben fanden auch Opfer statt. Und zwar jene selben Sonnenopfer, die bei den alten Germanen üblich gewesen sind und bei denen die Spartiaten, nicht anders wie unsere Vorfahren, Pferde schlachteten.
Wir haben den Hochpaß überstiegen und nach einem ermüdenden Ritt, meist steil bergab, das Dörfchen Lada erreicht. Ein Bergstrom hat die steinige Straße der Ortschaft mit seinen stürzenden Wellen überschwemmt und niemand denkt daran, ihn in sein Bett zurückzuleiten. Mit Ausnahme eines kleinen Bezirks um die Ansiedelungen Ladas, ist das weite Tal eine einzige Steinwüste.
Träge, fast unwillig, öffnet auf das Klopfen unseres Führers eine derbe, blonde, noch nicht zwanzigjährige Bäuerin die Tür zur Herberge. Ein Ferkel wühlt zwischen Tisch und Bank, in einem finsteren, kellerartigen Raum, dessen Hintergrund ein Lager mit gewaltigen Fässern ausfüllt. In einer hölzernen Schlachtermulde auf dem Tische schläft ein neugeborenes Kind.
Die Jachten der Königin von England und des Königs von Griechenland liegen im Hafen zur Abfahrt bereit. Eben hat sich die „Galata“ des Norddeutschen Lloyd in Bewegung gesetzt, die uns nach Konstantinopel führen soll. Die Häuser des Pyräus stehen im weißen Licht.
Athen ist das Licht, das Auge, das Herz, das Haupt, die atmende Brust, die Blüte von Griechenland: heute des neuen, wie einst des alten! Ich empfand das lebhaft, trotz aller großen Landschaftseindrücke meiner peloponnesischen Fahrt, als ich nach ununterbrochener Reise von Kalamata wieder hier anlangte. Athen ist durch seine Lage geschaffen, und Griechenland ohne Athen wäre niemals geworden, was es war und was es uns ist. Der freie, attische Götterflug hat den freien attischen Geistesflug hervorgerufen.
Indem wir, Abschied nehmend, die Küste zur Linken, hingleiten, vorüber an dem kleinen Hafen Munichia, vorbei an den Siedelungen von Neu-Pharleron, steigt noch einmal das ganze attische Wunder vor uns auf.
Dieser Hymettos, dieser Pentele, dieser Lykabettos, dieser Fels der Akropolis sind keine Zufälligkeit. Alles dieses trägt den Adel seiner Bestimmung im Angesicht.
Wir trinken gierig den Hauch des herrlichen Götterlandes, solange er noch herüberdringt und saugen uns mit den Blicken in seine silberne Anmut fest, bis alles unseren Augen entschwindet.
Ende
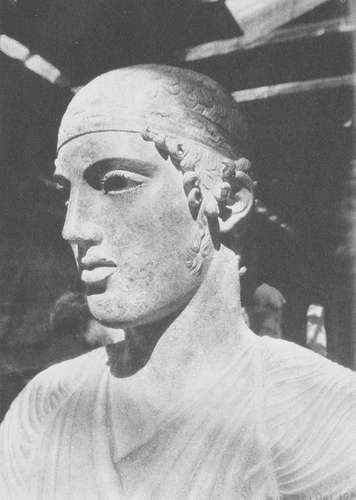
Kopf des Wagenlenkers aus Delphi
(Originalaufnahme)
Druck von W. Drugulin, Leipzig.
Anmerkungen zur Transkription
Die Schreibweise der Buchvorlage wurde weitgehend beibehalten. Offensichtliche Fehler wurden stillscheigend korrigert. Weitere Änderungen, teilweise unter Verwendung anderer Ausgaben sind hier aufgeführt (vorher/nachher):
End of Project Gutenberg's Griechischer Frühling, by Gerhart Hauptmann
*** END OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK GRIECHISCHER FRÜHLING ***
***** This file should be named 57928-h.htm or 57928-h.zip *****
This and all associated files of various formats will be found in:
http://www.gutenberg.org/5/7/9/2/57928/
Produced by Peter Becker, Jens Sadowski, and the Online
Distributed Proofreading Team at http://www.pgdp.net. This
file was produced from images generously made available
by The Internet Archive.
Updated editions will replace the previous one--the old editions will
be renamed.
Creating the works from print editions not protected by U.S. copyright
law means that no one owns a United States copyright in these works,
so the Foundation (and you!) can copy and distribute it in the United
States without permission and without paying copyright
royalties. Special rules, set forth in the General Terms of Use part
of this license, apply to copying and distributing Project
Gutenberg-tm electronic works to protect the PROJECT GUTENBERG-tm
concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark,
and may not be used if you charge for the eBooks, unless you receive
specific permission. If you do not charge anything for copies of this
eBook, complying with the rules is very easy. You may use this eBook
for nearly any purpose such as creation of derivative works, reports,
performances and research. They may be modified and printed and given
away--you may do practically ANYTHING in the United States with eBooks
not protected by U.S. copyright law. Redistribution is subject to the
trademark license, especially commercial redistribution.
START: FULL LICENSE
THE FULL PROJECT GUTENBERG LICENSE
PLEASE READ THIS BEFORE YOU DISTRIBUTE OR USE THIS WORK
To protect the Project Gutenberg-tm mission of promoting the free
distribution of electronic works, by using or distributing this work
(or any other work associated in any way with the phrase "Project
Gutenberg"), you agree to comply with all the terms of the Full
Project Gutenberg-tm License available with this file or online at
www.gutenberg.org/license.
Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project
Gutenberg-tm electronic works
1.A. By reading or using any part of this Project Gutenberg-tm
electronic work, you indicate that you have read, understand, agree to
and accept all the terms of this license and intellectual property
(trademark/copyright) agreement. If you do not agree to abide by all
the terms of this agreement, you must cease using and return or
destroy all copies of Project Gutenberg-tm electronic works in your
possession. If you paid a fee for obtaining a copy of or access to a
Project Gutenberg-tm electronic work and you do not agree to be bound
by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the
person or entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph
1.E.8.
1.B. "Project Gutenberg" is a registered trademark. It may only be
used on or associated in any way with an electronic work by people who
agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few
things that you can do with most Project Gutenberg-tm electronic works
even without complying with the full terms of this agreement. See
paragraph 1.C below. There are a lot of things you can do with Project
Gutenberg-tm electronic works if you follow the terms of this
agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg-tm
electronic works. See paragraph 1.E below.
1.C. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation ("the
Foundation" or PGLAF), owns a compilation copyright in the collection
of Project Gutenberg-tm electronic works. Nearly all the individual
works in the collection are in the public domain in the United
States. If an individual work is unprotected by copyright law in the
United States and you are located in the United States, we do not
claim a right to prevent you from copying, distributing, performing,
displaying or creating derivative works based on the work as long as
all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope
that you will support the Project Gutenberg-tm mission of promoting
free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg-tm
works in compliance with the terms of this agreement for keeping the
Project Gutenberg-tm name associated with the work. You can easily
comply with the terms of this agreement by keeping this work in the
same format with its attached full Project Gutenberg-tm License when
you share it without charge with others.
1.D. The copyright laws of the place where you are located also govern
what you can do with this work. Copyright laws in most countries are
in a constant state of change. If you are outside the United States,
check the laws of your country in addition to the terms of this
agreement before downloading, copying, displaying, performing,
distributing or creating derivative works based on this work or any
other Project Gutenberg-tm work. The Foundation makes no
representations concerning the copyright status of any work in any
country outside the United States.
1.E. Unless you have removed all references to Project Gutenberg:
1.E.1. The following sentence, with active links to, or other
immediate access to, the full Project Gutenberg-tm License must appear
prominently whenever any copy of a Project Gutenberg-tm work (any work
on which the phrase "Project Gutenberg" appears, or with which the
phrase "Project Gutenberg" is associated) is accessed, displayed,
performed, viewed, copied or distributed:
This eBook is for the use of anyone anywhere in the United States and
most other parts of the world at no cost and with almost no
restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it
under the terms of the Project Gutenberg License included with this
eBook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the
United States, you'll have to check the laws of the country where you
are located before using this ebook.
1.E.2. If an individual Project Gutenberg-tm electronic work is
derived from texts not protected by U.S. copyright law (does not
contain a notice indicating that it is posted with permission of the
copyright holder), the work can be copied and distributed to anyone in
the United States without paying any fees or charges. If you are
redistributing or providing access to a work with the phrase "Project
Gutenberg" associated with or appearing on the work, you must comply
either with the requirements of paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 or
obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg-tm
trademark as set forth in paragraphs 1.E.8 or 1.E.9.
1.E.3. If an individual Project Gutenberg-tm electronic work is posted
with the permission of the copyright holder, your use and distribution
must comply with both paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 and any
additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms
will be linked to the Project Gutenberg-tm License for all works
posted with the permission of the copyright holder found at the
beginning of this work.
1.E.4. Do not unlink or detach or remove the full Project Gutenberg-tm
License terms from this work, or any files containing a part of this
work or any other work associated with Project Gutenberg-tm.
1.E.5. Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this
electronic work, or any part of this electronic work, without
prominently displaying the sentence set forth in paragraph 1.E.1 with
active links or immediate access to the full terms of the Project
Gutenberg-tm License.
1.E.6. You may convert to and distribute this work in any binary,
compressed, marked up, nonproprietary or proprietary form, including
any word processing or hypertext form. However, if you provide access
to or distribute copies of a Project Gutenberg-tm work in a format
other than "Plain Vanilla ASCII" or other format used in the official
version posted on the official Project Gutenberg-tm web site
(www.gutenberg.org), you must, at no additional cost, fee or expense
to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means
of obtaining a copy upon request, of the work in its original "Plain
Vanilla ASCII" or other form. Any alternate format must include the
full Project Gutenberg-tm License as specified in paragraph 1.E.1.
1.E.7. Do not charge a fee for access to, viewing, displaying,
performing, copying or distributing any Project Gutenberg-tm works
unless you comply with paragraph 1.E.8 or 1.E.9.
1.E.8. You may charge a reasonable fee for copies of or providing
access to or distributing Project Gutenberg-tm electronic works
provided that
* You pay a royalty fee of 20% of the gross profits you derive from
the use of Project Gutenberg-tm works calculated using the method
you already use to calculate your applicable taxes. The fee is owed
to the owner of the Project Gutenberg-tm trademark, but he has
agreed to donate royalties under this paragraph to the Project
Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payments must be paid
within 60 days following each date on which you prepare (or are
legally required to prepare) your periodic tax returns. Royalty
payments should be clearly marked as such and sent to the Project
Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in
Section 4, "Information about donations to the Project Gutenberg
Literary Archive Foundation."
* You provide a full refund of any money paid by a user who notifies
you in writing (or by e-mail) within 30 days of receipt that s/he
does not agree to the terms of the full Project Gutenberg-tm
License. You must require such a user to return or destroy all
copies of the works possessed in a physical medium and discontinue
all use of and all access to other copies of Project Gutenberg-tm
works.
* You provide, in accordance with paragraph 1.F.3, a full refund of
any money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the
electronic work is discovered and reported to you within 90 days of
receipt of the work.
* You comply with all other terms of this agreement for free
distribution of Project Gutenberg-tm works.
1.E.9. If you wish to charge a fee or distribute a Project
Gutenberg-tm electronic work or group of works on different terms than
are set forth in this agreement, you must obtain permission in writing
from both the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and The
Project Gutenberg Trademark LLC, the owner of the Project Gutenberg-tm
trademark. Contact the Foundation as set forth in Section 3 below.
1.F.
1.F.1. Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable
effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread
works not protected by U.S. copyright law in creating the Project
Gutenberg-tm collection. Despite these efforts, Project Gutenberg-tm
electronic works, and the medium on which they may be stored, may
contain "Defects," such as, but not limited to, incomplete, inaccurate
or corrupt data, transcription errors, a copyright or other
intellectual property infringement, a defective or damaged disk or
other medium, a computer virus, or computer codes that damage or
cannot be read by your equipment.
1.F.2. LIMITED WARRANTY, DISCLAIMER OF DAMAGES - Except for the "Right
of Replacement or Refund" described in paragraph 1.F.3, the Project
Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project
Gutenberg-tm trademark, and any other party distributing a Project
Gutenberg-tm electronic work under this agreement, disclaim all
liability to you for damages, costs and expenses, including legal
fees. YOU AGREE THAT YOU HAVE NO REMEDIES FOR NEGLIGENCE, STRICT
LIABILITY, BREACH OF WARRANTY OR BREACH OF CONTRACT EXCEPT THOSE
PROVIDED IN PARAGRAPH 1.F.3. YOU AGREE THAT THE FOUNDATION, THE
TRADEMARK OWNER, AND ANY DISTRIBUTOR UNDER THIS AGREEMENT WILL NOT BE
LIABLE TO YOU FOR ACTUAL, DIRECT, INDIRECT, CONSEQUENTIAL, PUNITIVE OR
INCIDENTAL DAMAGES EVEN IF YOU GIVE NOTICE OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
1.F.3. LIMITED RIGHT OF REPLACEMENT OR REFUND - If you discover a
defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can
receive a refund of the money (if any) you paid for it by sending a
written explanation to the person you received the work from. If you
received the work on a physical medium, you must return the medium
with your written explanation. The person or entity that provided you
with the defective work may elect to provide a replacement copy in
lieu of a refund. If you received the work electronically, the person
or entity providing it to you may choose to give you a second
opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If
the second copy is also defective, you may demand a refund in writing
without further opportunities to fix the problem.
1.F.4. Except for the limited right of replacement or refund set forth
in paragraph 1.F.3, this work is provided to you 'AS-IS', WITH NO
OTHER WARRANTIES OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT
LIMITED TO WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR ANY PURPOSE.
1.F.5. Some states do not allow disclaimers of certain implied
warranties or the exclusion or limitation of certain types of
damages. If any disclaimer or limitation set forth in this agreement
violates the law of the state applicable to this agreement, the
agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or
limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or
unenforceability of any provision of this agreement shall not void the
remaining provisions.
1.F.6. INDEMNITY - You agree to indemnify and hold the Foundation, the
trademark owner, any agent or employee of the Foundation, anyone
providing copies of Project Gutenberg-tm electronic works in
accordance with this agreement, and any volunteers associated with the
production, promotion and distribution of Project Gutenberg-tm
electronic works, harmless from all liability, costs and expenses,
including legal fees, that arise directly or indirectly from any of
the following which you do or cause to occur: (a) distribution of this
or any Project Gutenberg-tm work, (b) alteration, modification, or
additions or deletions to any Project Gutenberg-tm work, and (c) any
Defect you cause.
Section 2. Information about the Mission of Project Gutenberg-tm
Project Gutenberg-tm is synonymous with the free distribution of
electronic works in formats readable by the widest variety of
computers including obsolete, old, middle-aged and new computers. It
exists because of the efforts of hundreds of volunteers and donations
from people in all walks of life.
Volunteers and financial support to provide volunteers with the
assistance they need are critical to reaching Project Gutenberg-tm's
goals and ensuring that the Project Gutenberg-tm collection will
remain freely available for generations to come. In 2001, the Project
Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure
and permanent future for Project Gutenberg-tm and future
generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary
Archive Foundation and how your efforts and donations can help, see
Sections 3 and 4 and the Foundation information page at
www.gutenberg.org
Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation
The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non profit
501(c)(3) educational corporation organized under the laws of the
state of Mississippi and granted tax exempt status by the Internal
Revenue Service. The Foundation's EIN or federal tax identification
number is 64-6221541. Contributions to the Project Gutenberg Literary
Archive Foundation are tax deductible to the full extent permitted by
U.S. federal laws and your state's laws.
The Foundation's principal office is in Fairbanks, Alaska, with the
mailing address: PO Box 750175, Fairbanks, AK 99775, but its
volunteers and employees are scattered throughout numerous
locations. Its business office is located at 809 North 1500 West, Salt
Lake City, UT 84116, (801) 596-1887. Email contact links and up to
date contact information can be found at the Foundation's web site and
official page at www.gutenberg.org/contact
For additional contact information:
Dr. Gregory B. Newby
Chief Executive and Director
gbnewby@pglaf.org
Section 4. Information about Donations to the Project Gutenberg
Literary Archive Foundation
Project Gutenberg-tm depends upon and cannot survive without wide
spread public support and donations to carry out its mission of
increasing the number of public domain and licensed works that can be
freely distributed in machine readable form accessible by the widest
array of equipment including outdated equipment. Many small donations
($1 to $5,000) are particularly important to maintaining tax exempt
status with the IRS.
The Foundation is committed to complying with the laws regulating
charities and charitable donations in all 50 states of the United
States. Compliance requirements are not uniform and it takes a
considerable effort, much paperwork and many fees to meet and keep up
with these requirements. We do not solicit donations in locations
where we have not received written confirmation of compliance. To SEND
DONATIONS or determine the status of compliance for any particular
state visit www.gutenberg.org/donate
While we cannot and do not solicit contributions from states where we
have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition
against accepting unsolicited donations from donors in such states who
approach us with offers to donate.
International donations are gratefully accepted, but we cannot make
any statements concerning tax treatment of donations received from
outside the United States. U.S. laws alone swamp our small staff.
Please check the Project Gutenberg Web pages for current donation
methods and addresses. Donations are accepted in a number of other
ways including checks, online payments and credit card donations. To
donate, please visit: www.gutenberg.org/donate
Section 5. General Information About Project Gutenberg-tm electronic works.
Professor Michael S. Hart was the originator of the Project
Gutenberg-tm concept of a library of electronic works that could be
freely shared with anyone. For forty years, he produced and
distributed Project Gutenberg-tm eBooks with only a loose network of
volunteer support.
Project Gutenberg-tm eBooks are often created from several printed
editions, all of which are confirmed as not protected by copyright in
the U.S. unless a copyright notice is included. Thus, we do not
necessarily keep eBooks in compliance with any particular paper
edition.
Most people start at our Web site which has the main PG search
facility: www.gutenberg.org
This Web site includes information about Project Gutenberg-tm,
including how to make donations to the Project Gutenberg Literary
Archive Foundation, how to help produce our new eBooks, and how to
subscribe to our email newsletter to hear about new eBooks.