
The Project Gutenberg EBook of Siebeneichen, by Gustav Hildebrand
This eBook is for the use of anyone anywhere in the United States and most
other parts of the world at no cost and with almost no restrictions
whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of
the Project Gutenberg License included with this eBook or online at
www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you'll have
to check the laws of the country where you are located before using this ebook.
Title: Siebeneichen
Roman aus dem Alt-Meißner Land
Author: Gustav Hildebrand
Illustrator: Josef Windisch
Release Date: November 24, 2018 [EBook #58342]
Language: German
Character set encoding: UTF-8
*** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK SIEBENEICHEN ***
Produced by The Online Distributed Proofreading Team at
http://www.pgdp.net
Anmerkungen zur Transkription
Das Original ist in Fraktur gesetzt. Im Original gesperrter bzw. unterstrichener Text ist so ausgezeichnet. Im Original in Antiqua gesetzter Text ist so markiert.
Weitere Anmerkungen zur Transkription befinden sich am Ende des Buches.

Siebeneichen

Roman
aus
dem Alt-Meißner Land
von
Gustav Hildebrand
Mit Federzeichnungen von Josef Windisch

Karl Voegels Verlag G. m. b. H., Berlin
Alle Rechte, insbesondere das der Übersetzung, vorbehalten
Copyright by Karl Voegels Verlag G. m. b. H., Berlin 1912
| Kapitel | Seite | |
| 1. | Vor fünf Jahren | 7 |
| 2. | Das Wiedersehen | 21 |
| 3. | Frau Magdalena erlebt eine Überraschung | 33 |
| 4. | Eine stürmische Ratsversammlung | 39 |
| 5. | Der Amtmann im Urteil der Bürgerschaft | 53 |
| 6. | Unerwarteter Besuch im Rathaus | 63 |
| 7. | Eine große Enttäuschung | 75 |
| 8. | Zwei bewegte Unterredungen | 82 |
| 9. | Im Schatten des alten Markgrafenschlosses | 98 |
| 10. | Der neue Herr | 112 |
| 11. | Der Kurier des Herzogs | 120 |
| 12. | Benedikt Biertimpel | 128 |
| 13. | Drei Fragen | 136 |
| 14. | Nächtlicher Besuch im Dom | 155 |
| 15. | Die Sterne schweigen | 171 |
| 16. | Wider die Brüder des heiligen Franziskus | 178 |
| 17. | Das Geheimnis | 188 |
| 18. | Die beiden roten Rosen | 200 |
| 19. | Im »Gasthof zur Dürren Henne« | 206 |
| 20. | Das Schönste, was ihr der Spielmann gesungen | 221 |
| 21. | Rebbe Liebmann, der alte Jude | 229 |
| 22. | Die drei Getreuen | 234 |
| 23. | Der Ritt nach Dresden | 255 |
| 24. | Unter den sieben Eichen | 259 |

Zu alten Zeiten bedeckte das heutige Sachsen dichter Wald. Näheres über seinen damaligen Zustand wissen wir nicht. Das Land ist viel später als der Westen Germaniens in die Geschichte eingetreten. Tacitus verwechselte die Elbe mit der Saale, indem er diese als Hauptstrom bezeichnete, während er die Elbe für einen Nebenstrom hielt. Der erste römische Feldherr, der vom Rhein her am tiefsten in das unwegsame Land der Germanen eindrang, war Drusus; er erblickte den mittleren Lauf der Elbe. Den Boden Sachsens aber werden die Legionen der Römer wohl niemals betreten haben.
Nach ihm näherte sich erst Germanicus wieder dem Herzen des Landes. Seine Abberufung vereitelte das weitere Vordringen. Die Hand der Geschichte zog sich schon wieder zurück, nachdem sie den Saum des Schleiers kaum berührt hatte, der über diese Gegend gebreitet war.
Jahrhunderte vergingen. Da kam die Völkerwanderung. Ihr Strom riß die an der oberen Elbe sitzenden germanischen Stämme südwestlich mit fort. Das freigewordene Land besetzte ein slawisches Volk, die Daleminzier.[8] Ihrem weiteren Vordringen nach dem Westen trat das Germanentum hartnäckig entgegen und warf die Slawen über die Saale zurück. Zur Befestigung dieser Grenzscheide wurden längs des Stromes deutsche Burgen errichtet.
Unter Karl dem Großen begannen dann die erbitterten Kämpfe zur Wiedergewinnung des verlorenen Landes zwischen Saale und Elbe. Seine Nachfolger setzten den blutigen Streit mit immer geringeren Erfolgen fort. Zuletzt stockten die Kämpfe ganz. Streitigkeiten unter den deutschen Stämmen und Kriege gegen andere Feinde lenkten davon ab. Nur die der slawischen überlegene deutsche Kultur stritt friedlich weiter.
Da kam König Heinrich der Erste zur Regierung. Nach Unterwerfung seiner Feinde und Einigung aller deutschen Stämme trieb nunmehr dieser tatkräftige Fürst seine Reiterscharen siegreich gegen die Slawen vor. Der Entscheidungskampf brach an, als die Daleminzier alle Streitkräfte dicht vor der Elbe zusammenzogen und in ihre feste Burg Gana bei Lommatzsch im heutigen Sachsen warfen. Nach zwanzigtägiger Belagerung wurde die Feste unter großen Opfern erstürmt. Was an wehrfähiger Mannschaft vorhanden war, mußte über die Klinge springen. Der Rest des Slawenheeres wich über den Strom zurück. Das Land bis zur Elbe war wieder deutsch!
Nun befestigte König Heinrich die Stromlinie durch Anlage starker Burgen. So entstand im Jahre 928 die Burg Meißen, benannt nach dem vorbeifließenden Bache Misni. Ihr zu Füßen erblühte der Burgflecken gleichen Namens. An die Spitze der jungen Mark setzte König[9] Heinrich einen Markgrafen. Zudem wurde Meißen Bischofsitz. Der Dom wurde etwa dreihundert Jahre danach errichtet. Arnold von Westfalen baute später das Schloß von Grund neu auf.
Die Albrechtsburg zu Meißen wurde als eine Hochwacht des Deutschtums gegen die andrängenden Slawen gebaut. Sie erzählt die Geschichte des Landes von den entfernten Zeiten an, in denen das Bandum am Wurfspieß des deutschen Häuptlings flog, bis herein in unsere Tage, wo die weißgrüne Flagge des sächsischen Volkes auf ihren Türmen weht.
Die Maiensonne schien warm auf den Marktplatz von Meißen herab.
Am Vormittag hatte hier geschäftiges Treiben geherrscht, denn es war Markttag gewesen. Wie von alters her waren die Landleute von Zehren, Meisa und Cölln hereingekommen, um Fleisch, Geflügel, Kraut und Obst feilzubieten. Neben ihnen hatten Händler ihre Stände errichtet, auf denen allerlei ausgebreitet war: Tuchballen, Schuhe von derbem Leder, wollene Hauben und bunte Tücher. Die Hausfrauen waren von einem zum andern gegangen, um das Gewebe der wollenen Waren sorgfältig zwischen Daumen und Zeigefinger zu prüfen oder nach dem Marktpreis der Lebensmittel zu fragen. Auch die liebe Jugend hatte sich wie immer beizeiten eingestellt, das Gewirr vermehrend und den Lärm, den die Ausrufenden und Feilschenden verursachten, durch ihr Geschrei erheblich steigernd. Denn der junge Nachwuchs hat es zu allen Zeiten verstanden, sich bei mancherlei Gelegenheit unnütz zu machen.
Neue Käufer hatten die mit beladenen Körben nach Hause zurückkehrenden ersetzt, bis die Fülle der Waren allmählich arg zusammengeschmolzen war. So war der Vormittag hingegangen. Und als gegen die Mittagstunde die am Rathaus ausgesteckt gewesene rote Fahne weggenommen wurde, das Zeichen, daß für die Verkäufer das Marktrecht erloschen war, hatten diese die zurückgebliebenen Vorräte eingepackt und die Stadt zu Fuß oder zu Wagen wieder verlassen.
Jetzt war der Marktplatz menschenleer.
An einem Hause zwischen Kirche und Burggasse lehnte ein junger Mann und sah mit versonnenen Blicken den schreienden Spatzen zu, die um die verstreuten Abfälle kämpften. Der Jüngling war schlank gewachsen wie eine Haselrute, und seine feinen Glieder steckten in einem zierlich gearbeiteten Gewand von rotem, lundischem Tuch. Das edel geschnittene Gesicht von blasser Farbe war nur wenig gebräunt. Das weiche, braune Haar, das bis auf den gestickten weißen Schulterkragen sich herabkräuselte, ließ erkennen, daß der Jüngling aus einem vornehmen Geschlecht stammen mußte. Ein schwarzsamtnes Barett, auf der linken Seite mit einem kurzen Reiherstutz verziert, vervollständigte seinen Anzug.
Gegenüber dem ehrwürdigen Rathaus in gotischem Stil, mit seinem mächtigen, spitzen Dach, stand auf der andern Seite des Marktes ein breites Haus mit reichverziertem, hohem Giebel. Es war eines der schönsten und stolzesten Gebäude der Stadt, und sein Besitzer mußte zu den angesehensten Bürgern Meißens gehören.
Auf diesem Hause hafteten wie gebannt die Augen des Jünglings. Er kannte die reiche Portalbekrönung unter[11] der sich das Bogenprofil der kunstvoll geschnitzten Haustür etwas nach vorn neigte, verziert mit Blumen und Früchten, die eines Meisters Hand aus dem Elbsandstein herausgemeißelt hatte. Er kannte auch den Spruch, der um den runden Bogen lief:
Die Erinnerung des Jünglings eilte um ein paar Jahre zurück.
Draußen vor dem Lommatzscher Tor war es gewesen! Und ein strahlender Sommertag, der ihn verlockt hatte, oben auf der Höhe zu lustwandeln. Ach, es war ja sein letzter Tag, bevor er auf Jahre hinauszog! Seine Augen hatten noch einmal in Wehmut an dem schönen Bilde gehangen, das dem Beschauenden von dieser Stelle wird: – den scharfen Umrissen der altersgrauen Markgrafenburg mit ihren kühnen Zinnen, und auf dem ehrwürdigen Dom mit seinen schlanken, himmelragenden Türmen, deren Hintergrund die rebenbedeckten Weinberge des Spaargebirges bilden. Just wie heute war die Luft ein unermeßliches Strahlenmeer gewesen. In der Ferne, wo die Bergesgipfel dichter Wald bedeckte, waren dessen Farben sanft in das helle, sonnendurchflimmerte Himmelsblau geflossen. Und tief unter seinen Füßen hatte der Elbstrom gerauscht. Diese Schönheit hatten seine Blicke durstig eingesogen, damit er Jahre hindurch von der Erinnerung zehren könne.
Da hatte das Ohr des Schauenden plötzlich leises Kichern vernommen. Und als er sich umgesehen, war ihm ein wunderlicher Anblick geworden: unter dicht[12] belaubten alten Buchen und im hohen Grase halb verborgen, hatte ein junges Menschenkind gelegen, das ihn mit den lachenden Blicken eines Koboldes neugierig betrachtete.
Zögernd war er näher getreten. Doch hatte ihn die Erscheinung so überrascht, daß ihm anfänglich die Sprache versagte. Es war ein wahrhaftes Engelsantlitz mit großen, strahlenden Augen, in das er geschaut. Ein schwerer Kranz blonder Flechten, von denen ein sonniges Flimmern ausging, hatte die weiße Stirn umgeben.
Endlich hatte er gesagt:
»Wer bist du? – Bist du ein Mensch oder eine Waldfee?«
Da war das zierliche Wesen auf die Füße gesprungen, hatte vor Ausgelassenheit in die Hände geklatscht und hell aufgelacht, daß es geklungen, als wenn silberne Glöcklein angeschlagen würden.
»Also für eine Fee hältst du mich?« hatte sie endlich ausgerufen. »Du bist ein possierlicher Gesell! Wie heißt denn du?«
»Bernhard,« hatte er geantwortet und schüchtern hinzugefügt: »Und du?«
»Sonnhild!« hatte sie stolz erwidert.
»Sonnhild?« war es ihm leise entfahren. »Wie könntest du auch anders heißen als Sonnhild!«
Da hatte sie wieder gekichert. Und es war ihm noch einmal gewesen, als ob von ihrem goldfarbenen Haar flimmernde Funken aufsprühten.
»Aber ich will heimkehren,« hatte sie gesagt, »geh' mit mir.«
Nach Kinderart sich an den Händen fassend, waren[13] sie unter den Bäumen dahingeschlendert. Das schöne Mädchen an seiner Seite hatte unermüdlich geplaudert. Ihren strahlenden Augen war nichts verborgen geblieben, was am Wege lag. Bald zeigte sie ihm einen Durchblick zwischen den dichten Baumkronen, wo man am andern Ufer die rebenbedeckten Hügel sah, bald wies sie auf schöne Blumen und bunte Gräser, die inmitten des üppigen Mooses standen. Oder sie machte ihn verstohlen auf einen scheuen Vogel aufmerksam, der unhörbar von Zweig zu Zweig hüpfte.
So hatten sie endlich die Stadtmauer erreicht. Als sie durch das Lommatzscher Tor schritten, war hinter dem Fenster das Gesicht des steinalten Torwarts erschienen. Alsdann waren sie durch den tief eingeschnittenen Hohlweg zwischen dem Sankt Afrafelsen und dem mächtigen Burgberg zur Stadt hinabgegangen. Und als endlich die Burggasse hinter ihnen lag und sie über den Markt gingen, hatte das Mädchen gesagt:
»Nun bin ich zu Hause. Willst du mitkommen?«
Eine Weile war er vor dem hohen Haustor mit seinem reichen Holzschnitzwerk und den kunstvollen, schmiedeeisernen Beschlägen in Bewunderung stehengeblieben und hatte andächtig den Spruch gelesen, dessen verschnörkelte Buchstaben tief in den Stein gegraben waren. Dann hatte ihn das Mädchen an der Hand in den Hausflur gezogen.
Der Hausgang stellte eine geräumige, steinerne Halle dar mit hoher Decke, die, wie der Jüngling heute wußte, ein mächtiges Kreuzgewölbe bildete. Die starken Bogen, die dieses gliederten, ruhten seitlich auf herrlich gemeißelten steinernen Konsolen.
Nun hatte sie ihn über die Treppen und durch alle Gemächer des großen Hauses geführt.
Zuerst kamen sie in die Prunkstuben im ersten Stockwerk. Hier waren die Wände bis zur Decke hinauf mit Holzwerk getäfelt oder mit kostbaren Tapeten geschmückt. Mannsgroße venetianische Spiegel standen in den Ecken, feingewebte Vorhänge waren an den Fenstern aufgehängt, und prachtvolle Teppiche schmückten die Fußböden und Wände. Auf dem schweren Hausgerät, mit kunstvollem Schnitzwerk versehen, standen allerlei wunderliche Kuriositäten, wie Waffen und bemalte Geräte fremder Völker, ein ausgeblasenes Straußenei, polierte Muscheln, kunstvoll geschnitzte Kirschkerne, Töpfe mit Bildern versehen und marmorne Gliedmaßen, die in Italien ausgegraben sein sollten.
Des Mädchens flinke Zunge war nicht müde geworden, die Herkunft jedes Gegenstandes zu erklären.
Hier wieder standen Becher aus gemasertem Ahornholz, daneben feine Gläser oder Tongefäße und vielerlei Gerät von Sinn, das schon damals den Stolz der Hausfrau bildete. Dort waren schwere Weinkannen und breite Obstschalen, Teller, worein Figuren gegraben, hohe und vielarmige Tischleuchter, kunstvoll verzierte Trinkgefäße und Salzfäßlein. Und von der Decke der Stuben herab hingen messingne Lichthalter mit sechs oder acht Dillen.
Dies alles war geschickt und sinnig aufgestellt gewesen, nach dem alten Bedürfnis der deutschen Frauen, auch das Leblose gemütlich herzurichten.
Das Mädchen hatte des Jünglings wachsendes Erstaunen beobachtet und sich heimlich daran gefreut.
»Ist es bei dir zu Hause nicht ebenso?« hatte sie gefragt.
»So sieht es wohl nur bei reichen Bürgern aus,« war seine Antwort gewesen.
»Ja, bist du denn kein Bürgerkind?« war es der Erstaunten entfahren.
Da hatte er gefühlt, wie zum erstenmal ein flüchtiges Lächeln auf sein ernstes Gesicht getreten war, als er kurz erwiderte:
»Nein, das bin ich nicht.«
Dann war ihm im nächsten Stockwerk auf dem Treppenabsatz eine Handspritze gezeigt worden, neben einem großen Wasserfaß, und eine Anzahl Feuereimer, die an der niedrigen Decke hingen, ferner eine alte Rüstung, gekrönt mit einem zerhauenen Streithelm. Auch eine mächtige Lade stand dort, über der ein Pirschrohr hing samt der Pulverflasche.
In einer der Schlafstuben war ihm ein übergroß, gelb Himmelbette aufgefallen, zu dem eine Trittleiter hinaufführte, und in der Küche glänzten an der Wand kupferne Kessel und Schüsseln, Bratspieße, Pfannen und Wärmflaschen.
Hier hatte eine alte Frau auf den Knien gelegen und den Fußboden gescheuert. Sie war dürr wie ein Zaunstecken, und in dem strengen Gesicht saß eine spitzige Nase.
»Was für ein fremdes Gesicht ist das?« hatte sie mürrisch gefragt.
Noch bevor er hatte antworten können, war das Mädchen der Frau auf den Rücken gesprungen und hatte ihr die Arme um den Hals geschlungen. Da war die Alte böse geworden und hatte versucht, das Kind abzuschütteln.[16] Aber in der keifenden Stimme war soviel Zärtlichkeit gewesen, daß niemand die Entrüstung hätte ernst nehmen können. Bis endlich der Schelm von der Alten gelassen und ihn wieder aus der Küche gezogen hatte.
»Das ist unsere Hanne,« hatte sie erklärt.
Darauf waren sie durch Kammern gegangen, in denen Wolle hochgestapelt war.
»Dort ist die Werkstatt.« Mit diesen Worten hatte das Mädchen auf eine Tür gezeigt. Und als er sich umgeschaut, war in der offenen Tür die hohe Gestalt eines Mannes erschienen, der das Mädchen geliebkost und seinen Wildfang genannt hatte.
»Wie heißt du?« hatte ihn der Mann gefragt.
»Bernhard.«
»Und wer ist dein Vater?«
»Ernst von Miltitz!«
»Soso,« hatte da der Mann langsam erwidert, »also des Herzogs Hofmarschall ist dein Vater.«
Damit war die Tür zugefallen, und die beiden Kinder waren wieder allein gewesen.
»Wer war dieser Mann?« hatte er gefragt.
Da hatte sie gelächelt.
»Das weißt du nicht? Das war mein Vater, Georg Waltklinger, – der Burgemeister der Stadt!«
An uralten, geschnitzten Truhen vorbei, waren sie alsdann auf die hölzerne Galerie getreten, die in jedem Stockwerk rund um den Hof lief und Lustgänglein hieß. Hier saß eine Magd und schabte Möhren, und die alte Hanne hängte Wäsche auf die Leine.
Nun gingen sie wieder in das Haus zurück, und das[17] Mädchen ergriff wie draußen im Wald seine Hand und lief mit ihm treppauf, treppab und durch vielerlei Gelasse, deren Decken von starken Balken getragen wurden.
Der Jüngling empfand noch heute den unauslöschlichen Eindruck, den das alte Haus mit seinen breiten Treppen, den Kreuzgewölben, den eisenbeschlagenen Türen und den geheimnisvollen, dunklen Winkeln und vergitterten Fenstern auf ihn gemacht.
In einer der Stuben war er plötzlich stehengeblieben und hatte das Kind gefragt:
»Was ist das für ein gemalet Bildnis dort über der Stubentür? Wer ist dieser Mann, der mit so klugen Augen herabschaut?«
Daraufhin hatte das Mädchen mit mitleidigen Blicken geantwortet:
»Die alte Hanne schilt mich oft unwissend. Ich glaube aber, Bernhard, du bist es noch mehr als ich. Dieses Bildnis ist das des Doktors Martin Luther!«
Da war er aufgefahren:
»Derselbe Mann, der von Wittenberg aus die abscheuliche Lehre verbreitet, so gerichtet ist wider die hohen Sakramente der heiligen Kirche?«
Kaum hatte er diese Worte gesprochen, als das Mädchen mit funkelnden Augen dicht vor ihn getreten war.
»Du bist hier in einem gut lutherischen Hauses,« hatte sie schroff gesagt. »Und wenn wir Freunde bleiben wollen, darfst du niemals wieder so garstig sprechen!«
Darauf war er still gewesen, da er nicht wußte, was er hätte entgegnen sollen.
»Es ist Abend geworden, nun muß ich heimkehren,« sagte er endlich.
Da war sie bereit, ihn zu begleiten.
Die Sonne war mittlerweile tief hinabgesunken, und ihre Strahlen vergoldeten nur noch die obersten Simse und Fenster der alten Häuser am Markt. Auf den Gassen war es lebhafter geworden. In den Häusern bereiteten die Hausfrauen das Nachtmahl, und die Männer saßen nach vollbrachtem Tagewerk vor den Türen und plauderten mit den Vorübergehenden oder mit dem Nachbar drüben über der Gasse.
Er war mit dem Burgemeisterskind langsam die Fleischgasse hinabgeschritten, beim Hundewinkel vorbei und durch das Fleischtor ins Freie. Kaum daß ein Erwachsener ihrer sonderlich geachtet.
»Es ist bald Sonnenuntergang,« hatte das Mädchen draußen gesagt. »Daß ich nicht den Torschluß versäume!«
»Wie alt bist du?« hatte er sie gefragt.
»Zwölf Jahre. Und du?«
»Dreizehn.«
Mit einem Male war sie ihm entsprungen, nachdem sie noch den Letzten auf seine Schulter geschlagen. Aber im Nu war er hinterdrein gewesen und hatte sie gefangen und aus Übermut umschlungen. Und da sie sich lebhaft dagegen gewehrt, waren sie zusammen auf die Wiese gefallen, gerade am abschüssigen Uferrand der Triebisch. Zwar hatte er die Umarmung rasch gelöst, doch zu spät. Sie waren den Abhang hinabgekollert. Am Rande des Baches hatten sie sich aufgesetzt und über das kleine Abenteuer lustig gelacht. Bis das Mädchen plötzlich gemeint:
»Nun muß ich aber heimkehren. Wollen wir morgen wieder zusammen spielen?«
Aber er hatte wehmütig den Kopf geschüttelt und gesagt:
»Morgen in aller Frühe muß ich nach Dresden.«
»Kommst du bald wieder?« hatte sie gefragt.
»Nein,« war die Antwort gewesen, »ich bleibe dort auf Jahre.«
Und als sie ihn ungläubig angesehen, hatte er hinzugesetzt:
»Meine Eltern wohnen in Dresden. Ich bin nur für einige Wochen auf unserem Schlosse Siebeneichen gewesen. Ich werde an des Herzogs Hof erzogen.«
»O, du Armer!« hatte das Mädchen ausgerufen und ihn mitleidig angesehen. Aber schon war in ihrem Auge der Schalk wieder aufgeblitzt, und sie war eben im Begriff gewesen, ihn anzuschlagen und davon zu eilen, als er die Hände der neben ihm Sitzenden ergriffen und gefragt hatte:
»Ich habe heute deine Mutter ja nicht gesehen? Wo ist sie gewesen?«
Da hatte sie ihn ernst betrachtet.
»Hättest du sie gern gesehen?«
»Ja,« hatte er geantwortet, »du mußt eine recht gute Mutter haben.«
»Du bist ein lieber Junge, Bernhard,« hatte sie leise erwidert. »Habe Dank für deine freundlichen Worte. Meine Mutter ist seit vielen Jahren tot. Der Vater sagt, sie sei schon auf Erden ein Engel gewesen.«
Und wie sie das sprach, war ein schmerzlicher Zug in ihr liebliches Gesicht getreten. Doch hatte sie die Rührung bald niedergekämpft und ihn gefragt:
»Werden wir uns einmal wiedersehen?«
»Ganz bestimmt!« hatte er versichert.
Dabei war es ihm, als ob seine Augen feucht geworden. Beschämt hatte er sich abgewandt, als das Mädchen plötzlich die Arme um seinen Hals schlang und mit ihren Lippen flüchtig seinen Mund berührte. Alsdann war sie in Verwirrung aufgesprungen. Und als er neben ihr gestanden, hatte er gesehen, daß sie dunkelrot geworden war.
Da hatte er ihre Hand genommen und deutlich empfunden, wie auch ihm die helle Röte in die Schläfen schoß.
Endlich war es von seinen Lippen gekommen:
»Sonnhild – – ich werde dich nie vergessen!«
»Lebe wohl, Bernhard!« hatte sie gesagt.
»Lebe wohl, – Sonnhild!« hatte er erwidert und ihre Hand losgelassen.
Noch einen langen Blick, – dann war das Mädchen gegangen. Vor dem Stadttor war sie stehengeblieben und hatte sich noch einmal umgesehen. Ihre großen Augen waren voll Traurigkeit gewesen. Und die reichen Haarflechten, die das Kindergesicht einrahmten, hatten im Schein der untergehenden Sonne geleuchtet. Eine Sekunde später verschwand ihre lichte Gestalt in dem alten Tor.
Da hatte auch er sich umgewandt und war langsam nach Siebeneichen zurückgekehrt.


Der Jüngling sah noch immer mit träumenden Blicken über den sonnenbeschienenen Marktplatz. Wie oft hatte er nicht an dies alles gedacht! Aber so frisch wie heute waren die Farben des herrlichen Bildes nie gewesen, wenn es in seiner Erinnerung heraufgestiegen. Fünf Jahre waren darüber hingegangen. Heute mußte sie siebzehn zählen, und er war achtzehn. Wie tief dieses Erlebnis doch in seinem Herzen haftete!
Noch immer zankten sich die Sperlinge um die verstreuten Körner. Aus dem Ratskeller trat der behäbige Schenkwirt. In jeder Hand hielt er einen großen Biersterz, gefüllt mit Wasser. Er schwenkte die hölzernen Gefäße sorgfältig aus und verschwand alsdann wieder hinter der Tür.
Zur Rechten des Jünglings, dicht vor der Frauenkirche, befand sich auf dem Markt ein Brunnen. Den Rand des weiten Beckens zierten steinerne Figuren. In der Mitte stand auf einer Säule ein Löwe, aus dessen Rachen das Wasser in einem starken Strahl hervorschoß. Die Augen des Jünglings glitten an dem Brunnen vorbei und blieben wieder auf dem Bürgerhause haften.
Was mochte aus dem lieblichen Burgemeistertöchterlein geworden sein! Wie breit und ruhig das Haus doch dastand. Die vielen blanken Fenster, die vorgekragten Stockwerke, die schwindelnden Simse des hohen Giebels! Trotzig und herausfordernd sah es aus. Und stolz! Freilich, es gehörte doch auch einem der angesehensten Geschlechter der Stadt. Kein Geringerer als Georg Waltklinger, der reiche Tuchmacher und Burgemeister, war sein Besitzer.
Und das deutsche Handwerk – das wußte der Jüngling – mit seinen Innungen und Gilden, der deutsche Bürgerstand, befanden sich ja gerade gegenwärtig in ihrer glanzvollsten Zeit.
Der Jüngling wandte sich ab. Aber bald gingen seine Augen von neuem zu dem Hause zurück. Er betrachtete das breite Tor mit seinen großen, schmiedeeisernen Klopfern, und auf sein bleiches Gesicht stahl sich der alte träumerische Ausdruck.
Da lief plötzlich ein Zittern über des Jünglings Gestalt und mit einem Ruck richtete er sich straff auf. Dazu blickte er angestrengt nach der Tür hinüber. War ihm nicht gewesen, als wenn er durch den offenen Flügel in dem dunklen Hausgang etwas Helles hatte schimmern sehen? Vielleicht ein weißes Gewand? Mit verhaltenem Atem sah er hin. Da erschien eine Frauengestalt auf der Schwelle, die aber sogleich wieder in das Haus zurücktrat, wohl deshalb, um eine noch rechtzeitig entdeckte Unordnung an ihrem Kleide zu beseitigen.
Wie ein Wirbelwind war der Jüngling über den Platz hinweggeeilt und stand nun klopfenden Herzens vor der offenen Tür. Er schaute mit den geblendeten Augen unsicher[23] in den dämmrigen Hausflur hinein. Da gewahrte er in der Mitte des weiten Raumes ein junges Mädchen von hoher Schönheit. Sie trug ein feines, schneeweißes Linnengewand, das ein ärmelloser Überrock von blauem Tuch, mit goldenen und kristallenen Knöpfen verziert, bedeckte. Der Hals war bloß, und unter dem Ausschnitt war ein breiter Rand der köstlichen Leinwand zu sehen.
Wie gebannt sah der Jüngling auf die lichte Gestalt. Da unterschied er die feinen Züge, ein Paar große, blaue Augen und eine überreiche Fülle leuchtenden Haares, das sich unter dem Hute vordrängte. »Sie ist es!« rief in ihm eine Stimme, und er fühlte, wie ihm das Blut zu Kopfe drang. Sein Herz schlug stürmisch. Was er in diesen fünf Jahren geträumt und was er heiß ersehnt, hatte sich in dieser Stunde erfüllt. Er stand wieder vor ihr!
Heimliches Bangen und heller Jubel tönten in seiner Stimme, als er fragte:
»Sonnhild! – – – kennst du mich wieder?«
Darauf blieb es beklemmend still in dem steinernen Gewölbe der Hausflur. Die beiden jungen Menschen standen sich stumm gegenüber. Das Gesicht des Mädchens zeigte große Überraschung, die aber bald durch den Ausdruck lebhaften Unwillens verdrängt wurde. Wie konnte es dieser fremde Mann wagen, sich ihr so gegenüber zu stellen? Tiefe Entrüstung flammte in ihren Augen auf und in dem stolzen Zurückwerfen des feinen Kopfes lag eine strenge Zurechtweisung.
Die Augen des Jünglings hatten während dieser Zeit voll Spannung auf dem schönen Mädchen geruht. Jetzt empfand er, wie seine vertrauliche Begrüßung sie erzürnt[24] hatte. War sie darüber entrüstet, daß er es wagte, sich ihr zu nähern, weil sie als Kinder einmal zusammen gescherzt hatten? Oder hatte sie ihn vergessen? Die Freude über das Wiedersehen hatte ihn fortgerissen, – unter dem zürnenden Blick des in seinem Stolze verletzten Mädchens erhielt er jedoch die verlorene Beherrschung rasch wieder.
Und so nahm er denn nach ritterlichem Brauch das Sammetbarett vom Kopfe, verneigte sich tief und mit feinem Anstand und sprach in ehrfurchtsvollem Tone:
»Mit Gunst, edle Jungfrau! Erinnert Ihr Euch meiner nicht mehr?«
Kaum hatte der Jüngling diese Worte gesprochen, als mit dem Mädchen eine rasche Veränderung vorging. Sie betrachtete sinnend seinen jetzt unbedeckten Kopf, als wenn sie in der Erinnerung ein Erlebnis aus früherer Zeit suche. Auch der Klang der Stimme schien ihr bekannt wie ein alter, lieber Freund. Der Jüngling sah, wie sich die Augen des Mädchens halb schlossen und wie sich ihr Kopf beim Nachdenken ein wenig neigte.
Da sah sie auf, und den Bangenden traf aus ihren großen Augen ein warmer Blick. Und er vermeinte, den süßen Klang der Stimme des jubelnden Kindes von einst wieder zu hören, als sie rief:
»Bernha…!«
Aber schon verstummte sie wieder, und auf ihr Gesicht trat der Ausdruck hoher Verlegenheit. Sie suchte sich zu fassen und sagte endlich, die Silben scharf trennend:
»Junker von Miltitz …«
Der aber trat an sie heran und fragte:
»So erinnert Ihr Euch meiner wirklich noch, Jungfrau?«
Das Mädchen neigte die feine Stirn.
»Daß Ihr so groß geworden, machte Euch mir fremd. Aber wie sollte ich Eurer vergessen, Junker?«
Da traf sein Auge das ihrige warm und innig, daß sich der Blick des Mädchens herabsenkte. Gleichzeitig schlug eine dunkle Röte in das liebliche Gesicht und färbte dieses bis unter die weichen Wellen des blonden Haares purpurn.
»Hier im Hausgang kann unseres Bleibens nicht länger sein,« sagte sie hastig. »Auch auf den Gassen darf man uns nicht beisammen sehen. Ihr wißt, Junker, – unsere Väter! Geht deshalb; ich folge Euch! Droben auf dem Plossenberg mögt Ihr meiner warten!«
Damit wandte sie sich um und ging tiefer in den Hausflur zurück. Der Jüngling aber trat ins Freie und schlug den Weg nach dem Fleischtor ein. Die grell scheinende Sonne blendete ihn anfänglich, daß er die Hand schützend über die Augen legen mußte.
Unwillkürlich sann er darüber nach, welcher Sinn in den letzten Worten des Mädchens gelegen hatte. Man dürfe sie nicht zusammen sehen! Nun ja, Bürger und Adel vertragen sich seit langem nicht. Und er wußte, daß gerade gegenwärtig die Spaltung zwischen ihnen größer war denn je. Besonders die Reichen unter den Bürgern waren voll Erbitterung. Ja, einzelne Geschlechter der Städte waren mit adligen Familien tödlich verfeindet.
Doch bald wurden diese Gedanken von freundlicheren verdrängt. Er hatte sie wiedergesehen! Die Sehnsucht[26] fünf langer Jahre war erfüllt! Das Mädchen war sein schönster Traum gewesen!
Bernhard von Miltitz rief sich noch einmal zurück, wie er ihr vorhin gegenüber gestanden. Dieses leuchtende Auge! Das glänzende Haar! Das liebliche Gesicht! Und dazu der Jubel in der Stimme! – Alles wie einst! Und wie schön sie geworden war! Und mit wieviel Freundlichkeit sie sich seiner erinnerte … »Sonnhild!« flüsterte er.
Bald hatte er das Stadttor und den schmalen Steg über die Triebisch hinter sich. Dann ging er auf der Straße weiter, die durch Wiesen und Felder hinauf auf den Plossenberg führte. Oben angekommen, setzte er sich ins weiche Gras und lehnte den Rücken gegen den breiten Stamm einer mächtigen Birke, deren herabhängende, saftiggrüne Zweige ihn fast berührten. So richtete er den Blick die Straße hinab. Aber bald sah er nichts mehr von seiner Umgebung, sondern überließ sich willig den Träumereien, die ihn erfüllten.
Da wurde er von seinem Nachdenken aufgescheucht, eilende Tritte auf der Straße drangen an sein Ohr. Und wie er aufsah, erkannte er Sonnhild. Sie hatte ihn schon von weitem bemerkt und winkte ihm aus der Ferne zu.
Nach wenigen Minuten war sie bei ihm, und nun gingen sie langsam die Straße weiter. Anfänglich waren sie so beklommen, daß keines von ihnen ein Wort sprechen konnte.
Allmählich aber kamen sie ins Plaudern und sagten sich gegenseitig, wie sich jeder von ihnen doch so verändert habe. Fünf Jahre seien freilich hingegangen;[27] eine lange Zeit, fünf Jahre! Und nun verlor Sonnhild die Befangenheit und erzählte von ihren Erlebnissen während dieser Zeit.
Bernhard von Miltitz ging in Entzücken versunken neben dem schönen Mädchen her. Ihre liebe Stimme hatte er, ach, wie viele Male, in der Erinnerung erklingen lassen. Jetzt hörte er sie wieder! Sie tönte ihm wie die Melodie eines alten Liedes aus den Tagen der Kindheit. Und wenn das Mädchen lachte, drang ihm der Wohllaut ihrer Stimme tief ins Herz.
»Nun, Junker,« rief Sonnhild, »berichtet Ihr einmal, wie es Euch in all den Jahren ergangen ist!«
Und er erzählte dem aufhorchenden Kinde von dem Leben in der herzoglichen Residenzstadt, von den glänzenden Festen bei Hofe und von seinen weiten Reisen, die er gemacht. Denn in Begleitung seines Vaters hatte er bereits Prag, Leipzig und Erfurt gesehen.
Dabei blickte er von Zeit zu Zeit verstohlen zu ihr auf. Das reine Profil ihres Gesichts, der entzückende Ansatz des in einer edlen Linie verlaufenden Halses, die feinen Nasenflügel und die niedlichen rosigen Ohren! Er konnte sich an all diesem Schönen nicht sattsehen. Und wenn er etwas Lustiges sprach, daß sie lachte, dann öffneten sich ihre roten, vollen Lippen, und die beiden Reihen herrlicher Zähne wurden sichtbar.
Plötzlich blieb Bernhard stehen.
»Hier führt ein lauschiger Weg durch den Wald nach Siebeneichen. Laßt uns ihn einschlagen, Jungfrau.«
Langsam und dicht nebeneinander verfolgten sie den schmalen Weg. Die Sonnenstrahlen drangen durch die[28] Baumkronen und fingen sich in Sonnhilds Haar, von dem sie den Hut genommen hatte. Und es schien dem Jüngling, als wenn blitzende Funken daraus hervorsprängen.
Bernhard von Miltitz setzte seinen Bericht fort. Ab und zu warf das Mädchen eine klug gestellte Frage ein, den Jüngling dergestalt zum Weitersprechen ermunternd. Bernhard fand Gefallen an dem Interesse seiner lieblichen Zuhörerin. Er ging aus seiner natürlichen Zurückhaltung unwillkürlich heraus, und sein blasses Gesicht bekam den Anflug einer feinen Röte. Bis mit einem Male Sonnhild fragte:
»Junker, wie alt ist Eure Familie eigentlich?«
»Das Geschlecht der Miltitz,« antwortete der Jüngling, »wird im Jahre 1186 zum ersten Male genannt. Es ist also fast ebenso alt,« fuhr er mit bescheidenem Stolze fort, »wie die Wettiner als erbliche meißnische Fürsten. Die Geschichte meiner Vorfahren ist mit der ihres Landes eng verknüpft. Durch die Jahrhunderte haben sie den Markgrafen treu gedient und allzeit die höchsten Ämter verwaltet. Vor wenigen Jahren kaufte mein Vater unsern heutigen Stammsitz und ließ das Schloß Siebeneichen errichten. Nun steht es hoch auf dem Berge, nahe dem Elbstrom, und seine Mauern und Türme sind weithin sichtbar. Mögen die beiden Namen Miltitz und Siebeneichen fest miteinander verbunden bleiben, – so Gott will, für alle Zeiten!«
Sonnhild hatte diesen Worten mit Aufmerksamkeit gelauscht. Nun fragte sie:
»Sagt mir doch, Junker, woher kommt der Name Siebeneichen?«
»Die Eiche,« antwortete Bernhard, »durfte nach dem Baumkultus der Germanen nicht von jedem Markgenossen geschlagen werden. Sie stand unter den geheiligten Bäumen obenan. Unter ihr wurden Opfer gebracht und Gottesurteile gesprochen. Die sieben Urteiler saßen rund im Kreise unter den Bäumen; in ihrer Mitte thronte der Richter auf einem Stein oder Hügel. Eine solche Gerichtsstätte mag sich zu alten Zeiten auf unserm Berge befunden haben. Die noch heute vor dem Schlosse stehenden sieben Eichen verkünden dies.«
Hier schwieg der Jüngling und blieb stehen. Und als Sonnhild aufsah, bemerkte sie eine hohe Mauer, an der sich Efeu hinaufrankte.
»Wir haben Siebeneichen erreicht,« sagte Bernhard. »Möchtet Ihr in seinem weiten Schloßpark nicht einmal lustwandeln, edles Fräulein?«
Sonnhild sah ihn erfreut an.
»So Ihr es erlaubtet, Junker, tät ich es recht gern!«
Bernhard lächelte befriedigt.
»Dort ist das Tor,« sprach er, »treten wir ein.«
Der ausgedehnte Park prangte in der herrlichsten Frühlingspracht. Unter den hohen Bäumen führte ein Netz von Wegen an herrlichen Blumenbeeten vorüber bis in die entferntesten Teile. Weite Flächen saftiggrünen Rasens wechselten mit dichtbewachsenen Laubengängen, und hinten an der Mauer befanden sich, von fast undurchdringlichem Blattwerk umgeben, lauschige Winkel.
Sonnhild brach wiederholt in Ausrufe des Entzückens aus. Diese Schönheit hatte sie noch nicht gesehen! Und sie bedauerte, daß in der engen Stadt die Anlage selbst eines kleinen Gartens nicht möglich sei.
Jetzt dauerte es auch nicht mehr lange, bis das Mädchen die bisher bewahrte Zurückhaltung vergaß. Flüchtigen Fußes entlief sie ihm, daß der Jüngling Mühe hatte, sie zu fangen. Dann wieder war sie plötzlich verschwunden, und Bernhard von Miltitz sah ihr helles Kleid zwischen den grünen Laubengängen schimmern, bis sie ein gutes Versteck gefunden hatte. Nun ging er ans Suchen.
Obwohl er alle verschwiegenen Winkel des Parkes genau kannte, tat er doch so, als bereite es ihm Mühe, sie zu entdecken. Absichtlich lief er einige Male dicht an ihrem Versteck vorüber, selbst ihr leises Kichern überhörend. Und wenn er das verborgene Plätzchen endlich erreichte und die dicht verschlungenen Ranken auseinanderbog, dann sah er das Mädchen niedergeduckt auf dem Erdboden, und ihre lachenden Augen waren auf ihn gerichtet. Bis sie mit einem Freudenruf aufsprang und jubelte:
»Nein, Junker, wie schön es hier doch ist!«
So wiederholte sich das anmutige Spiel oft, ohne daß eines von ihnen merkte, wie rasch der Nachmittag verging.
Als aber die Schatten der Bäume immer länger wurden, erklärte Sonnhild, heimkehren zu müssen. Und Bernhard von Miltitz erkannte, wie sich die Freude des Mädchens dämpfte und leises Bedauern sie erfüllte.
»Ich bringe Euch bis zum Plossenberg zurück, Jungfrau,« sagte er tröstend. Damit führte er sie zum Park hinaus wieder auf den schmalen Waldweg den sie gekommen. Und da dieser Pfad eben recht eng war und sie doch zu zweien bleiben wollten, mußten sie dicht nebeneinander[31] gehen. So kam es, daß sich ihre Hände wiederholt berührten. Bis mit einem Male Bernhard ihre weiche Hand ergriff und festhielt.
Bei dieser Berührung schreckte das Mädchen zusammen, und ihr sprudelndes Plaudern stockte für einen Augenblick. Doch sie entzog ihm die Hand nicht. Als sie aber nach einer kleinen Weile fühlte, wie sich der Arm des jungen Mannes leise in den ihrigen legte, schwieg sie plötzlich. Eine dunkle Röte flammte in dem lieblichen Gesicht der Jungfrau auf, und ein langer, flehender Blick aus ihren großen Augen traf ihn.
Da bemächtigte sich auch des Jünglings tiefe Verwirrung. Er preßte ihren Arm sanft an sich, und es klang wie eine Bitte, als er den Mund zu ihrem Ohre neigte und so leise flüsterte, als ob selbst die Vögel des Waldes es nicht hören sollten:
»Sonnhild!«
Das Mädchen schwieg. Und da auch Bernhard die Unterhaltung nicht wieder aufnahm, legten sie das letzte Stück Wegs stumm zurück. Die Verwirrung, die sie nicht verlassen wollte, spiegelte sich in den Gesichtszügen der beiden jungen Menschen ab.
Bevor sie aus dem Wald auf die Straße traten, zog Sonnhild ihren Arm sanft aus dem des Jünglings, strich mit den Händen ein paarmal über die schweren, glänzenden Zöpfe und setzte den Hut wieder auf.
»So,« sprach sie und blieb stehen, »nun müssen wir Abschied nehmen! Habt vielen Dank, Junker, für Eure freundliche Begleitung und für die kurzweilige Unterhaltung, die Ihr mir geboten.«
Bernhard von Miltitz wehrte ab.
»Sprecht nicht also, Jungfrau! Ihr gabt mir ebensoviel, wie Ihr meint, empfangen zu haben. Nehmt auch Ihr vielen Dank!«
Hierauf legte Sonnhild ihre weiße Hand für einen Augenblick in die seine und wandte sich zum Gehen.
»Wollen wir uns nicht wiedersehen, Jungfrau?« kam es bestürzt von Bernhards Lippen.
»Doch, Junker, wenn Ihr mögt …«
»Ob ich wollte? Könnt Ihr so fragen? Schon morgen am liebsten …«
»Nein,« entgegnete sie bestimmt, »nicht morgen. Aber nach drei Tagen, von heute an gerechnet, just um dieselbe Stunde.«
»Und wo?«
Sonnhild sann nach.
»Jungfrau, laßt uns wieder dahin gehen, wo ich einst wähnte, eine Waldfee zu erblicken.«
Sonnhild ließ leise ihr wohlklingendes Lachen hören.
»Sei es, Junker. Also, lebt wohl – bis dahin!«
»Auf fröhliches Wiedersehen, Jungfrau!«
Bernhard von Miltitz zog das Barett und verneigte sich. Dann schritt Sonnhild den Berg hinab, während der Jüngling den Waldweg wieder zurückging.


In dem Erker des Turmzimmers im Schlosse Siebeneichen saß Frau Magdalena von Miltitz. In ihrem Schoß lag ein Kleid von grauem Leinen, an dem sie eifrig nähte.
Die Schloßherrin von Siebeneichen war eine große, schöne Frau von noch nicht fünfzig Jahren. Ihre Gesichtsfarbe war ein blühendes Rot, und in das braune Haar hatte sich noch kein einziger Silberfaden gestohlen. Deshalb hielt man sie allgemein für jünger. Sie war eine kluge und entschlossene Frau, die ihre Pflichten im Hause vortrefflich ausübte und die von ihrem Gatten als eine verständige und liebevolle Ehegattin hoch geschätzt wurde.
Frau Magdalena war eine geborene Pflug. Ihr Vater war der angesehene Herr auf Zabeltitz, Heinrich Pflug. Derselbe, der einmal auf die Frage, warum er das Wörtchen »von« doch nie vor seinen Namen setze, geantwortet:
»Warum das? Die Pflugs gehören zu den vier Prinzipalgeschlechtern des meißnischen Heldenadels und[34] wurden immer an erster Stelle genannt. Das weiß jedes Kind!«
Der Stolz des Vaters hatte sich auf die Tochter vererbt. Zwar war sie weit davon entfernt, hochmütig zu sein. Aber tief im Herzen fühlte sie die heimliche Freude, einem uralten, hochgeachteten Adelsgeschlecht zu entstammen.
Frau Magdalena ließ das Kleid sinken. Und während die fleißigen Hände einmal ruhten, schweifte ihr Blick zum Fenster hinaus. Tief unten rauschte die Elbe. Am jenseitigen Ufer stiegen hohe Weinberge empor, hinter denen sich das Land in einer weiten Ebene verlor. Ihre Augen glitten achtlos über das schöne Bild hinweg; sie dachte an ihren Sohn Bernhard. Seine älteren Brüder weilten draußen in der Welt, er, der Jüngste, war ihr verblieben. Dazu hatte er ihrem Mutterherzen heimlich immer am nächsten gestanden. Denn dieselben Eigenschaften, die sein Vater besaß, zeigten sich auch bei ihm recht deutlich.
Schon während seiner Kindheit war der hervorstechendste Zug ihres Jüngsten die Ritterlichkeit gewesen. Mit heimlicher Freude hatte sie immer beobachtet, wie der Knabe sich bemühte, gegen seine Mutter artig und zuvorkommend zu sein. Und als er noch nicht den Kinderschuhen entwachsen war, zeichnete er sich durch selbstbewußte Höflichkeit gegen Frauen vor allen Altersgenossen aus. Auch die vornehme Gesinnung des Vaters hatte er geerbt, und dessen ruhiges Wägen, bevor er handelte.
Freilich wußte Frau Magdalena, daß Bernhard auch die Schwächen seines Vaters besaß: den zuweilen aufflammenden Zorn und die trotzige Beharrlichkeit, die keine Strenge beugen konnte.
Da schreckte sie aus ihrem Nachdenken auf. Draußen hatten hastige Schritte geklungen. Und wie sie den Blick nach der Tür richtete, trat Bernhard ins Zimmer. Frau Magdalena erkannte alsbald, daß ihn etwas bewegte. Seine sonst blassen Wangen waren von einer leichten Röte verfärbt.
Bernhard von Miltitz besaß für seine jungen Jahre ein großes Maß von Beherrschung. Mit dem vollendeten Anstand eines Jünglings aus edlem Geschlecht begrüßte er seine Mutter. Als er sich jedoch zum gewohnten Handkuß vor ihr verneigen wollte, umschlang sie ihn, und er fühlte ihre Lippen auf seiner Stirn. Das machte ihn betroffen, denn er wußte, daß solche Beweise von Zärtlichkeit bei seiner Mutter selten waren.
Frau Magdalena hatte die Hände an des Sohnes Schläfen gelegt und sah ihm liebevoll ins Gesicht. Und bevor sie ihn freiließ, küßte sie ihn noch einmal.
Dieser Ausdruck von mütterlicher Liebe stimmte Bernhard weich, daß er plötzlich den Drang empfand, mit seiner Mutter von dem zu sprechen, was sein Herz erfüllte. Und so begann er denn mit stockenden Worten:
»Mutter, heute nachmittag bin ich mit einem fremden Fräulein in unserm Park gelustwandelt …«
Frau Magdalena horchte auf.
Da fuhr er schon im Sprechen fort. Aber jetzt kam der Redefluß leicht von seinen Lippen:
»Ein vornehmes Fräulein, lieblich, zierlich und anmutig zugleich. Keine, die ich je sah, glich ihr! Ihr Antlitz ist süß, wie das der heiligen Maria, und ihre Gestalt zart, wie die eines jungen Rehs. Und ihr Fuß, ihr kleiner, schmaler Fuß, liebe Mutter, ist so gewölbt,[36] daß sich ein Vöglein darunter verstecken könnte …« Hier brach die Schilderung jäh ab, und eine dunkle Röte bedeckte das Gesicht des Sprechers.
Frau Magdalena war vor Überraschung sprachlos. War das ihr Sohn Bernhard, der jungfräuliche Reize so beredt schildern konnte? Ihr Jüngster von dem sie wußte, daß er es wohl verstand, Frauen ritterlich zu dienen, dessen junges Herz aber, wie sie wähnte, von kühler Gelassenheit beherrscht wurde?
»Du verstehst dich ja meisterlich darauf,« versetzte sie endlich, »die Schönheit junger Fräulein zu rühmen! Aber sag' mir doch vorerst, wer ist denn dieses Mädchen?«
Bernhard war an eines der hohen Erkerfenster getreten und sah, scheinbar gefesselt von dem Fernblick, hinaus. Er kämpfte sichtlich mit einer leichten Verlegenheit. Deshalb wandte er sich auch nicht um, als er antwortete:
»Sie ist ein Meißner Bürgerkind, Mutter.«
»Ich dachte es schon,« versetzte diese. »O ja,« fuhr sie nach kurzem Schweigen fort, »die Bürgersleute von Meißen sind sehr achtbar, und sie werden ihr Kind sicherlich ebenso vortrefflich erzogen haben, wie du es anmutig findest. Der Stolz der Bürger, solange er nicht zur Hoffart wird, ist wohlbegründet in ihrer Tüchtigkeit. Aber sieh, Bernhard, wir gehören nun einmal nicht zu ihnen, und sie mögen uns auch gar nicht zu den ihrigen zählen. Wie heute die Verhältnisse liegen, sollen Adel und Bürgertum hübsch voneinander bleiben. Und, lieber Sohn, der Frieden im Herzen einer Jungfrau ist sehr bald gestört. Hüte dich davor! Was du als ritterliche Aufmerksamkeit betrachtest, wird leicht anders gedeutet.[37] Ein gesittetes Bürgermädchen aber mit schönen Worten zu betören, danach, mein lieber Bernhard, wird es dich nicht verlangen.«
Der Jüngling wandte sich hastig um.
»Nimmermehr!« rief er. »Ich bin ein Miltitz und werde immer nur das tun, was mein Gewissen gutheißt. Dürfte aber die Kluft zwischen Bürger und Adel ein Hindernis für die Vereinigung zweier Herzen sein? Verstieße solches, so man es verlangte, nicht gegen die göttlichen Gebote?«
Diesen mit edler Wärme gesprochenen Worten folgte tiefes Schweigen. Bis Bernhard in ruhigem Tone fortfuhr:
»Die Jungfrau, von der ich sprach, besitzt eine reine, herrliche Seele. Ihr Vater trägt einen hochangesehenen Namen, er ist der Burgemeister …«
»Waltklinger?« Frau Magdalena richtete sich steil auf.
Bernhard sah verwundert auf.
»Ja, liebe Mutter,« antwortete er, »Sonnhild ist die Tochter des Burgemeisters Georg Waltklinger.«
Frau von Miltitz schöpfte tief Atem. Dann sagte sie:
»Nein, Bernhard, der jahrhundertealte Zwist zwischen Adel und Bürgertum darf Herzen, wo sie sich nähern, nicht im Wege stehen. Aber wir können es ruhig denen überlassen, sich hierüber zu verständigen, die es angeht. Für dich mit deinen achtzehn Jahren ist dieses Gespräch zu ernst. Und ich will dir auch sagen, warum ich erschrak, als du vom Burgemeister sprachst. Du bist erst zu kurze Zeit wieder hier, daß du wissen könntest, wie zwischen deinem Vater und dem Rat der Stadt Meißen gegenwärtig eine starke Spannung besteht. Wie dir bekannt, ist vor einigen Jahren drüben im Kurfürstentum[38] Sachsen die Reformation eingeführt worden, während sie bei uns herzoglichen Sachsen vergeblich um Einlaß angeklopft hat. Darüber ist die Bürgerschaft Meißens erbittert, weil sie die lutherische Lehre zur Staatsreligion erhoben sehen möchte. Aber unser Herzog Georg ist ein Feind des Wittenbergers. Deinem Vater fällt es nun als Amtmann von Meißen zu, die widerspenstige Einwohnerschaft in Schach zu halten, wofür er vom Herzog ausreichende Vollmacht erhalten hat. Das Haupt dieser Religionsbewegung ist in Meißen aber der Burgemeister Waltklinger. Dieser stolze und adelsfeindliche Mann betrachtet deinen Vater als einen böswilligen Widersacher und ist ihm bitter gram. Was müßte dein Vater nun empfinden, so er erführe, sein Sohn hofiere dem Burgemeistertöchterlein, und wie müßte das Mädchen leiden, wenn solches dem Waltklinger zugetragen würde. Denn der Jähzorn dieses Mannes soll schlimm sein.«
Frau Magdalena hatte sich bei den letzten Worten erhoben.
»Ich weiß, daß ich mich auf deine Klugheit und auf dein Zartgefühl verlassen kann. Du wirst nie vergessen, welches Maß von Rücksicht du dem Namen, den du trägst, und deinem Vater schuldig bist.«
Hier verließ Frau von Miltitz in mühsam verhehlter Erregung das Zimmer. Bernhard hatte ihre Rede stumm angehört. Jetzt sah er in starrer Haltung noch eine Weile auf die Tür, durch die seine Mutter ihn verlassen. Dann trat er in den Turmerker und schaute lange hinaus über das weite Land.


Der Burgemeister Georg Waltklinger trat aus seinem Haus auf den Marktplatz. Er warf einen kurzen Blick über die Zelte und Stände der Marktfieranten und schlug alsdann den Weg nach der Kirche ein; zwei Stadtknechte mit Spießen auf den Schultern folgten ihm mit respektvollem Abstand.
Georg Waltklinger war ein großer und stattlicher Mann. In seiner Jugend, das war bekannt, hatte er manches Liebesabenteuer gehabt, denn die Herzen der Jungfrauen waren dem schönen Georg, wo immer er erschien, zugeflogen. Dazu war er von bedeutendem Rang. Die Waltklingers zählten zu den ältesten Bürgerfamilien, die ratsfähig waren.
Die Angehörigen dieser Patrizierhäuser besaßen ein starkes Standesbewußtsein. Sie machten darauf Anspruch, als ebenso vornehm zu gelten, wie die angesehensten Familien des meißnischen Uradels. Die geachtesten Geschlechter der Stadt hätten den jungen Mann als Brautwerber mit offenen Armen empfangen. Deshalb war man ihm anfänglich ein wenig ungnädig gesinnt, als das Gerücht umlief, der schöne Georg habe in Dresden gefreit.
Kurz darauf führte er sein junges Weib heim. Sie hieß Maria und war die Tochter eines der reichsten Kaufherren der herzoglichen Residenzstadt. Ihre Schönheit und holdselige Anmut gewann aller Herzen. Dazu besaß sie ein wahrhaft edles Gemüt. Und keiner ging von der Schwelle ihres Hauses, ohne einen tiefen Eindruck von der Frau, die darin waltete, mitzunehmen. Selbst die übelste Zunge wagte sich an Maria Waltklinger nicht heran; so hoch stand der Ruf ihrer Weiblichkeit.
Deshalb verstanden es die Leute, daß Georg Waltklinger, als die Pest sein blühendes Weib nach wenigen Jahren dahinraffte, beinahe den Verstand verlor. Er tobte und schrie und verwünschte Himmel und Erde. Selbst sein liebliches Töchterchen von vier Jahren, das Ebenbild der Mutter, war ihm kein Trost. Ja, man durfte dem Vater das Kind anfangs nicht einmal unter die Augen bringen, da er ihm die Schuld beimaß, es habe der Mutter durch seine Geburt die Kraft genommen, siegreich wider die Krankheit zu streiten.
Maria Waltklinger war verblichen wie ein milder Stern, der in einsamer Nacht dem müden Wanderer freundlich geschimmert, wie eine zarte Blume, deren Schönheit und Duft ihrem Besitzer eine kurze Freude bereitet hat.
Georg Waltklinger aber war von da ab ein anderer Mensch. Er entsagte allen Zerstreuungen und richtete seine ganze Kraft nur auf sein Handwerk, worin er so Außerordentliches vollbrachte, daß nach wenigen Jahren die Erzeugnisse seines Hauses über des Herzogtums Grenzen hinaus gepriesen und begehrt wurden.
Da boten die Ratmannen dem noch in verhältnismäßig jungen Jahren Stehenden den freigewordenen Posten als Burgemeister der Stadt an. Der junge Meister sagte nach anfänglichem Schwanken zu und wurde Stadtoberhaupt. Und damit begann für Meißen eine Reihe segensreicher Jahre, denn Georg Waltklinger verstand es, sein Amt vortrefflich wahrzunehmen. Die gesamte Bürgerschaft gewann ihn lieb und brachte ihre Dankbarkeit dergestalt zum Ausdruck, daß sie sein Amt in jedem Jahre neu bestätigte.
Georg Waltklinger gewahrte mit heimlicher Befriedigung, daß auf seinem Wirken Segen ruhte. Aber diese Erkenntnis machte ihn nicht hoffärtig. Er blieb bei allen Ehrungen der einfache Mann, der jede Anerkennung zurückwies. Mit väterlicher Leutseligkeit sprach er in den schlichtesten Häusern vor, und die Rechtschaffenen unter den fahrenden Gesellen auf der Landstraße durften seiner Achtung ebenso gewiß sein, wie die Häupter der angesehensten Geschlechter der Stadt. Stolz kannte er nicht.
Und doch war Georg Waltklinger gewaltig stolz! Dann nämlich, wenn er mit Mitgliedern des Adels in Berührung trat. Bei solchen Anlässen hatte sein Stolz keine Grenzen! Er kannte genugsam die landläufige Geringschätzung, mit der der Adel auf das arbeitende Bürgertum herabsah. Und da er wußte, wie viel die Städte, besonders während der beiden letzten Jahrhunderte, zum Wohle des Landes beigetragen hatten, weil er von dem hohen Beruf des deutschen Handwerks, ohne sein Verdienst parteiisch zu überschätzen, tief durchdrungen war, setzte er der verächtlichen Haltung der[42] Adligen den ganzen mannhaften Stolz eines freien Bürgers und Handwerkers entgegen. Deshalb war sein Gleichmut bald erschüttert, wenn er von einem Übergriff des Adels hörte. –
Der Burgemeister Georg Waltklinger, begleitet von den beiden Stadtknechten, ging an dem Marktbrunnen und der Kirche vorüber und betrat alsdann durch das neue, prächtige Tor den Kirchhof. Dieser hohe Sandsteinbogen war auf seine Anregung von der Innung der Tuchmacher kürzlich der Stadt gestiftet worden. Der Burgemeister machte heute seinen allwöchentlichen Rundgang durch die Stadt.
Am Frauensteg vorüber ging er den Markt entlang und die Burggasse hinauf. Jeder, der ihn sah, bot ihm den Gruß; und mancher mochte wohl beim Anblick des stattlich dahinschreitenden Stadtoberhauptes heimliche Freude empfinden.
Vor seinem Hause in der Burggasse stand der ehrsame Hans Krebs, der Ratsweinmeister, der sich der Freundschaft Waltklingers rühmen durfte. Beim Herankommen des Burgemeisters zog Krebs die runde, gestrickte Mütze von dem weißen Haar.
»Der Kranz hängt vor deinem Hause,« rief Georg Waltklinger schon in einiger Entfernung. »Du besitzest für diesen Monat die Braugerechtsame. Wie ist dein Bier?«
Hans Krebs verneigte sich ehrerbietig.
»Wein und Bier gleich gut! Heute stoße ich vom frischen Bräu den ersten Zapfen aus. Willst du probieren, Burgemeister?«
Dieser lachte.
»Nicht alsogleich,« versetzte er, »zum Dämmern erwarte mich, Weinmeister.«
Damit ging er weiter und sah auf das Stadtvieh, das heute verspätet durch den Hohlweg vor das Lommatzscher Tor getrieben wurde. Als Geißlbrecht, der Hirt, des Stadtgewaltigen ansichtig wurde, knickte er zusammen und zog demütig die Kappe. Aber der Burgemeister kannte die sonstige Verläßlichkeit des Weißkopfs. Deshalb ging das Ungewitter noch einmal an ihm vorbei.
Den Baderberg hinab, an der Laurentiuskapelle und dem danebenstehenden Hospital vorüberschreitend, betrat Georg Waltklinger nun den Jahrmarkt, auf dessen Mitte das Gewandhaus stand. Hier befanden sich die großen Herbergen der Stadt: die Sonne, der Stern und der Goldene Ring. Und da es just Sonnabend war, herrschte überall geschäftiges Leben.
Auch sah man da und dort einen Neugierigen, welcher vom Lande zum erstenmal in die Stadt gekommen war. Der staunte natürlich gewaltig! Gewiß hatte er schon den großen Eindruck schildern hören, den man beim Betreten Meißens bekomme. Dennoch sah er alles an wie Wunderdinge und fühlte tief den Zauber des Geldes. Dabei entging ihm doch noch das Sehenswerteste, das ja in den dunkeln Stuben und Gewölben der reichen Bürger in eisernen Truhen fest verschlossen gehalten wurde. Schaufenster, in denen die Gewürzzehntner und Handwerker ihre Waren hätten auslegen können, gab es damals freilich noch nicht. Nur der Goldschmied stellte bisweilen kleine Becherlein oder Ketten hinter die grünen Fensterrauten der Werkstatt. Aber mit Vorsicht und unter[44] Bewachung, damit nicht ein fremder Strolch schleunig mit der Beute entlaufe.
Auf der Elbgasse war der Verkehr am stärksten. Vor dem herannahenden Burgemeister und den Stadtknechten wich alles respektvoll zurück, und selbst die Häupter der angesehensten Bürgerfamilien entblößten sich tief. Der freie Bürger wußte, daß er in seiner hohen Achtung vor dem Stadtoberhaupte sich selbst ehrte.
Auf dem ersten Pfeiler der hölzernen Elbbrücke blieb Georg Waltklinger stehen und warf einen kurzen Blick auf die zahlreichen Fischerboote, die großen böhmischen Kähne, die hier ausgeladen wurden, und die arbeitenden Schiffsmühlen. Dann ging er durch das Elbtor den Weg bis zum Naschmarkt zurück. Vor dem Goldenen Löwen stand eine Anzahl Pferde zum Verkauf, um die laut gefeilscht wurde.
Der Burgemeister ließ das alte Franziskanerkloster zur Linken und schaute über den anstoßenden Kirchhof hinweg, auf dem das Beinhaus stand, worin im Mittelalter die vielen menschlichen Gebeine aufgespeichert wurden, die man ausgraben mußte, um den später Heimgegangenen die letzte Ruhestatt in der Erde auf ein paar Jahre zu bereiten. Denn die Friedhöfe waren klein! So behalfen sich die Menschen eine lange Zeit, bis die Not siegte und man sich entschloß, den Gottesacker draußen vor der schirmenden Stadtmauer anzulegen.
Vor der Baderei auf dem Frauenmarkt blieb Georg Waltklinger wiederum stehen. Aus der großen Badestube drang Stimmengewirr. Hier badeten in geräumigen hölzernen Wannen die Menschen friedlich nebeneinander, gleichviel, welchen Geschlechts. Manche Bürger kamen[45] täglich hierher – denn nur die Reichen besaßen ihr Badestüblein zu Hause –, und selbst dem Ärmsten verschaffte die Stadt allwöchentlich und ohne Entgelt die begehrte Gelegenheit zur Reinigung.
Da schlug die Uhr der Stadtkirche zehn. Der Burgemeister durchschritt rasch die Jüdengasse, und als er das Eckhaus erreicht hatte, worin der Apotheker Karl Leuschner seine Tränklein und Mixturen verhandelte, stand er wieder auf dem Markte. Hier war es vonnöten, daß die beiden Stadtknechte ihrem Gebieter voraufgingen, um ihm Raum zu bahnen, – so dicht war das Gewühl in den Gängen.
Jetzt betrat Georg Waltklinger die Tür des Rathauses, zu deren beiden Seiten die Stadtknechte sich aufstellten, die gewaltigen Spieße neben sich auf den Fußboden niederstoßend. Das war das Zeichen, daß der Burgemeister und die Ratmannen sich versammelt hatten.
In dem geräumigen Saal im ersten Stockwerk, dessen Decke von mächtigen Balken getragen wurde, saß die würdige Ratsversammlung an einem langen Tisch. Da erschien der Burgemeister. Er verneigte sich kurz vor den ihn Begrüßenden und nahm den Platz am oberen Ende des Tisches ein.
Die Namen der Männer, die hier vereinigt waren, hatten einen guten Klang. Da war der alte Niclas Anesorge, seines Zeichens gleichfalls Tuchmacher, Heinrich Faust und Hans Mortitz, Gewürzzehntner, der reiche Peter Sorgenfrei, des Burgemeisters Stellvertreter und vorsitzender Meister der Innung der Fleischhauer, Sigmund Badehorn, der Becherer, Christoph Pfluger, Bäcker, und die[46] Meister Claus Haßbecher und Valentin Heide der Leinweberinnung.
Zur Linken des Burgemeisters saß Wolf Behr, der Stadtrichter, neben diesem der Stadtschreiber Valentin Schein.
Georg Waltklinger tat einen lauten Hammerschlag – die Sitzung war eröffnet. Er wandte sich an den Stadtschreiber.
»Sind die Torzölle und Abgaben in der verwichenen Woche befriedigend hoch gewesen?«
»Sie waren es.«
»Stadtrichter, hattet Ihr Frevler wider den Marktfrieden abzustrafen?«
Der Gefragte verneinte.
»Wie stand es um den gemeinen Frieden der Stadt?«
Der Stadtrichter zählte auf: einige Vergehen gegen das Gebot, mit dem Glockenschlage zehn am Abend das Licht zu verlöschen. Der Leinweber und Bortenwirker Heinrich Himmelreich hatte gegen die Zunftregel auf Vorrat gearbeitet, ferner lautes Rufen auf der Straße nächtlicherweile, Bierausschenken ohne die Braugerechtsame zu besitzen, Lärm und lästerliches Fluchen in den Schankstätten, Versuch der Übervorteilung beim Handel um eine Ferkelsau, ein Handwerksgeselle, der im Trunk die Achtung gegen seinen Meister vergaß … und weitere Fälle ähnlicher Art, die Wolf Behr, der Stadtrichter, berichtete.
Aber an der Ungeduld, die auf den ernsten Mienen der Umsitzenden lag, war leicht zu erkennen, daß noch ein weit wichtigerer Punkt zur Verhandlung stand.
»Ein fahrender Gesell hat die löbliche Sitte soweit verletzet, daß er in der Badestube mit einem Frauenzimmer[47] schön tat, wobei beide an Kleidern nicht mehr auf Leib und Gliedmaßen trugen, als ein abgeschälter Stock an Rinde.«
Bei dieser Anklage kam einiges Leben in die bisher schweigsame Versammlung, und zürnende Worte klangen reichlich.
»Die Unsittlichkeit in den Badestuben nimmt überhand,« begann der Burgemeister. »Sorgen wir beizeiten für Abhilfe, auf daß unsere gute Stadt nicht in Verruf komme. Stadtrichter, es liegt Euch ob, eine Kundmachung zu überdenken, nach der Manns- und Weibspersonen die Badereien nur stubenweise getrennt besuchen dürfen!«
Ein beifälliges Murmeln, – die Worte des Burgemeisters waren gutgeheißen.
Wolf Behr fuhr fort:
»Die von der wohlweisen Ratsversammlung bereits ausgesprochene und vom Amtmann gutgeheißene Säckung der Anastasia Quetschlich – wegen der an ihren beiden Kindern verübten Mordtat durch Umdrehung derer Hälse – soll kommenden Dienstag und dergestalt vollzogen werden, daß die Schuldige mit glühendem Zangengriff in den Sack gestecket wird. Alsdann soll dieser Sack vom mittelsten Brückenjoch aus in die Elbe geworfen werden. Als Begleiter auf die letzte Reise möge ihr, wie üblich, bewilligt werden: ein Hund, eine Katze, ein Hahn und eine Schlange, die vor dem Zunähen des Sackes Aufnahme darin zu finden haben.«
»Es geschehe, was rechtens,« befahl der Burgemeister. »Verseht den Stockmeister mit Weisung. Berichtet weiter!«
Der Stadtrichter lehnte sich zurück:
»Mein Bericht ist für heute erschöpft.«
Waltklinger wandte sich wieder an den Stadtschreiber:
»Valentin Schein, was habt Ihr ansonsten!«
Der Stadtschreiber faltete ein Papier auseinander und las seinen Inhalt laut vor:
»Hoch- und Hoch- Wohl- Edle, Veste, Großachtbare, Hoch- und Wohlgelahrte, auch Hoch- und Wohl- Weise, Hochgeehrteste Herren!
Der in tiefster Demut und Niedrigkeit ersterbende Stuhlschreiber der guten Stadt Meißen hat seit mehr denn funfzehn Jahren bis anhero mit hoher Gunst die Stühle in der Kirche Unser lieben Frauen mit Fleiß bemalet und auch manch zierlich Gevatterbrieflein fein säuberlich ausgeführet, wasmaßen ihm Ihro Hoch- und Hoch- Wohl- Edle, Veste, Großachtbare, Hoch- …«
Der Burgemeister wurde ungeduldig.
»Was will der!« schnitt er dem Vorlesenden das Wort ab.
»Der Stuhlschreiber Schabenkese tut dar, daß sein Jahreslohn sich immer mehr verringert habe. So er mit seinem Eheweib und seinen acht Würmlein aber nicht bittere Not leiden soll, bittet er den hohen Rat …«
»In Meißen soll keiner hungern,« warf hier Peter Sorgenfrei, der reiche Fleischhauer, ein.
»So ist es, Sorgenfrei hat recht,« rief es mit mehreren Stimmen.
Der Burgemeister schickte sich zum Sprechen an, – da schwiegen alle.
»Stadtschreiber, weist die Kasse an, daß dem Schabenkese sein Jahreslohn um ein Viertel des Betrages erhöhet[49] werde. Auch sollen ihm aus Mitteln der Stadt allmonatlich zwei Quart Mehl bewilliget werden. – Habt Ihr's?«
»Sehr wohl, Herr Burgemeister!«
Die Ratsversammlung stimmte bereitwillig zu.
Valentin Schein, der Stadtschreiber, klappte die große Mappe zu. Auch er war zu Ende.
Eine Bewegung ging durch die Ratsversammlung. Jeder wußte, daß jetzt der wichtigste Punkt der heutigen Tagesordnung an die Reihe kam. Die Männer setzten sich in den schweren Stühlen zurecht, und jeder blickte erwartungsvoll auf das Stadtoberhaupt.
Georg Waltklinger hatte unterdessen die große Papierrolle ausgebreitet, die er in der Hand gehalten, und von deren unterem Rande an einem goldenen Faden ein schweres Siegel herabhing. Dann ließ er die durchdringenden Augen über die Versammlung schweifen und begann:
»Lieben Freunde! Das Pergament das Ihr hier seht, ist unsere jüngste Bitte an des Herzogs Hoheit, er möge in Gnaden bewilligen, daß denjenigen Einwohnern unserer Stadt das Abendmahl in beiderlei Gestalt gereicht werde, die sich als Anhänger der evangelischen Lehre bekennen. Der unselige Religionshader in unserem Lande will nicht aufhören, während sich drüben im Bruderstaate alles in Lieb' und Eintracht geschlichtet hat. Das sächsische Volk aber ist es nicht, das diesen Unfrieden schürt, es ist, Gott sei's geklagt – ein anderer! Aber die Stimme des Volkes wird nicht schweigen, und Herzog Georg mag es recht bedenken, ob es gut sei, wenn sich der Fürst solchergestalt in scharfen Widerspruch zu seinen[50] Untertanen setzt. Wir werden es keinem zulassen, Zweifel an der Treue des sächsischen Herzogtums zu seinem Herrscher zu hegen. Kann man aber die betrübliche Wahrheit leugnen, daß in allen Teilen des Landes tiefe Erbitterung herrscht?«
Hier wurde Georg Waltklinger von Einwürfen der Zustimmung unterbrochen.
»Nun lieben Freunde,« fuhr der Burgemeister mit steigendem Unwillen fort, »auch in unserer fürstentreuen, alten Markgrafenstadt ist die Erbitterung in der Bürgerschaft hoch angewachsen. Es fehlt nur wenig, daß sie nunmehr verlangt, um was sie bis zum heutigen Tage erfolglos gebeten. Des Volkes Stimme aber ist Gottes Stimme! Und wenn dem Menschen verwehrt wird, so zu seinem Gott zu sprechen, wie sein Gewissen heischt, dann streut man die verhängnisvolle Saat des Unfriedens und der Empörung in sein Herz!«
Der Burgemeister schwieg eine kurze Weile, um alsbald mit erhobener Stimme weiterzusprechen:
»Ihr wißt, lieben Freunde, daß unsere ehrerbietig vorgebrachte Bitte abermals zurückgewiesen wurde. Das ist hart. Sehr hart! Aber unserer geradezu unwürdig ist es, wenn dieser Bescheid nicht von des Herzogs Hoheit, sondern von einem der schlimmsten Papisten gefället ward, die in unserem Lande ihr dunkles Handwerk betreiben. Denn der hochmütige Verfasser der kurzen Zurückweisung unseres Ansuchens auf dem Rande des Pergaments ist kein anderer als unser Amtmann – Ernst von Miltitz!«
Diese Rede erregte einen Sturm der Entrüstung unter den Versammelten. Harte Worte des Unwillens klangen[51] durcheinander, und manch schwielige Faust fiel dröhnend auf den Tisch nieder. Der alte Niclas Anesorge war von seinem Sitze aufgesprungen und schrie seine Empörung über die Männer hin. Einer freien Bürgerschaft tat man dieses an? Soweit war es gekommen, daß nicht einmal der Landesfürst, sondern einer seiner Schranzen engherzig versagte, um was das tief bewegte Volk bat! Bat? Nein! Das war kein Bitten mehr, man flehte ja schon längst! Und die Zurückweisung gerade von dieser Stelle mußte wie ein Fußtritt empfunden werden.
Noch waren keine zwölf Monate verflossen, daß der langjährige Hofmarschall des Herzogs, Ernst von Miltitz, nach Meißen als Amtmann geschickt worden war. Hatte in diesem kurzen Jahr der Hader zwischen ihm und der Bürgerschaft schon einmal aufgehört? Was galt diesem adelsstolzen Mann die freie Bürgerschaft? Sie waren ja keine Schildbürtigen! Am liebsten hätte er der Stadt abgesagt. Aber Bürgerstolz gegen Adelstolz! Hatte nicht das Handwerk das Volk groß gemacht? Waren es nicht die Städte, die verhaßten Bürger, die von den Gutsherren geknechteten Bauern, die Land und Thron stützten? Oder taten dies etwa die verkommenen Edelleute – die Vollsäufer und Gotteslästerer?
Also sprachen die Erzürnten, und manch anderes Schlimme.
»Die herzogliche Verordnung, wonach der Amtmann Bescheide auf Gesuche in Religionssachen erlassen darf, ist schon im verwichenen Jahr an den Rat gelangt,« warf der Stadtschreiber bescheiden ein.
»Was da!« schrie Sigmund Badehorn, der Becherer, »wenn das Volk fragt, muß der Fürst antworten. Der[52] Städter ist alleweil nur zum Geben gut. Aber beim Himmel, sie sollen spüren, was Bürgertrotz ist!«
Der Burgemeister hatte in den Tumult stumm hineingesehen. Auch er war tief erregt. Auf seiner breiten Stirn stand die bläulich geschwollene Zornesader. Aber er beherrschte sich. Er mußte Ruhe bewahren! Zudem wußten alle, daß Georg Waltklinger trotz seines heißen Blutes eiserne Selbstzucht besaß. Und diesen Ruf wollte er nicht zuschanden machen.
Heute konnte freilich nicht mehr verhandelt werden. Deshalb hörte der Burgemeister dem erregten Wortwechsel noch eine Weile zu und schloß endlich die Sitzung.
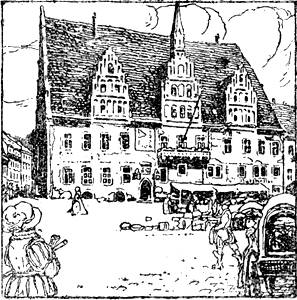

Die Unterredung mit seiner Mutter hatte auf Bernhard von Miltitz einen tiefen Eindruck gemacht. Freilich war die Mutter im Recht! Bürger und Adel mieden sich am besten. Und sein grübelnder Verstand sagte ihm, daß die Abneigung dieser beiden großen Stände voreinander, der mancherorts bestehende Haß, nicht von heute zu morgen durch gütliche Vermittelung beseitigt werden konnten. Diese Zustände waren tief in den Zeitverhältnissen begründet; sie waren mit ihnen groß geworden. Der Adel konnte auf ein ruhmreiches Zeitalter zurückblicken. Aber seine Glanzzeit gehörte doch der Vergangenheit an. Damals zählte der Bürger freilich wenig. Allmählich hatten jedoch Adel und Bürgerschaft ihre Stellung im Staat vertauscht. Die großen Aufgaben des Rittertums waren längst erfüllt. Jetzt besaßen die Adligen zwar noch die vorherrschende Macht, aber ihre Bedeutung war beträchtlich gesunken.
Mit der Entwickelung der Städte und dem Aufblühen des Handwerks war die wirtschaftliche Überlegenheit bald[54] auf die Seite des Bürgertums getreten. Aber auch der innere Wert des Bürgers war erheblich gestiegen. Die gediegenen Erzeugnisse des deutschen Handwerks hatten in kurzer Zeit die Aufmerksamkeit der andern Völker erregt. Allerorts fanden die Waren guten Absatz und taten sich durch ihre Güte vor allen Erzeugnissen hervor.
So war es gekommen, daß in der ganzen Welt das deutsche Handwerk gepriesen wurde und daß der deutsche Handel herrlich aufblühte. Eine große Anzahl von Städten tat sich zusammen und gründete den Hansabund, unter dessen kraftvollem Schutze die erzenen Kiele der mächtigen Segelschiffe die weiten Meere durchschnitten, um die Erzeugnisse deutschen Fleißes nach aller Herren Länder zu bringen.
Dieser glänzende Aufschwung erfüllte Handwerker und Kaufmann mit Befriedigung und Stolz und spornte sie an, emsig weiterzuarbeiten. Aber nicht nur deshalb, um große Vermögen anzusammeln – geschweige daß es dem Reichtum gelungen wäre, seine Erzeuger zu verweichlichen –, der deutsche Bürger setzte vielmehr sein alles daran, den guten Ruf seiner Arbeit stetig zu fördern. Und das gelang ihm.
Wohl kleidete man sich reicher als früher, und in den deutschen Landen fanden allerhand Genußmittel fremder Völker Eingang, die bis dahin unbekannt gewesen waren und Gaumen und Zunge schmeichelten. Der bisher einfache Tisch war reicher besetzt, und Gastmähler wurden gefeiert, bei denen die auserlesensten Speisen aufgetragen wurden und der köstlichste Wein in Strömen floß. Niemand verschmähte es mitzutun, die deutsche Gründlichkeit bewährte sich auch im Genießen.
Aber die Versuchungen, denen im Laufe der Weltgeschichte schon manches Volk erlegen, fanden ein aufrechtes, kraftvolles Geschlecht. Der Fleiß und die Beharrlichkeit des deutschen Handwerks erlitten dadurch keine Einbuße! Die sittlichen Werte des Volkes wuchsen immer mehr, es war sich der hohen Sendung bewußt, die es zu erfüllen hatte. Das Gemeinwesen wurde musterhaft, und die Städte entwickelten sich zu einer Macht, die der Herrlichkeit der Fürsten Glanz und Stütze war. Der Familiensinn vertiefte sich. Man war stolz darauf, von Vorfahren abzustammen, deren Namen seit Jahrhunderten mit Ehrfurcht genannt wurden.
Die Kinder wurden in wahrer Frömmigkeit und strenger Zucht erzogen. Die Achtung vor Gesetz und den Eltern vererbte sich vom Vater auf den Sohn.
So gab es im Handwerker- und Kaufmannsstande zahlreiche Familien, die, gestützt auf große Vermögen, nach außen viel Selbstbewußtsein bewahrten. Das Oberhaupt eines solchen Patriziergeschlechts fühlte sich in seinem Hause als ein Fürst. Hatten seine Vorfahren den Wohlstand und das Ansehen des Volkes nicht begründen und mehren helfen? Und was hatte dagegen seit aber hundert Jahren der Adel getan?
Das waren die Gedanken, die Bernhard von Miltitz jetzt unaufhörlich bestürmten. Er konnte zwar noch nicht in die Tiefen des verworrenen Zeitbildes blicken. Aber er war ein Grübler. Und wo sein Wissen nicht ausreichte, begann er, die Gedankenanfänge zu entwickeln. Bisher hatte er nur mit den Augen eines Abkömmlings aus adligem Geschlecht gesehen, denn die Kenntnis der wirklichen Verhältnisse war ihm nicht gelehrt worden.[56] Seine Mutter war es gewesen, die ihn auf diese Anschauungen gebracht hatte. Und je öfter er nachsann, desto deutlicher enthüllte sich ihm die Wahrheit.
Sein junges Herz schlug laut für das entzückende Kind aus dem Bürgerstand. Ein seliges Gefühl überkam ihn, wenn er daran dachte, Sonnhilds Zuneigung zu besitzen. Zuneigung? Durfte er es so nennen? Nun, darüber mußte er sich Gewißheit verschaffen.
Am verabredeten Tage hatte sich Bernhard von Miltitz pünktlich auf der Höhe vor dem Lommatzscher Tor eingefunden. Es war derselbe Ort, an dem er Sonnhild zum erstenmal gesehen. Er konnte sich genau entsinnen: unter diesem hohen Baum hatte er gestanden, und dicht hinter ihm, wo jetzt ein Bündel Farren mit breiten Wedeln wuchs, hatte sie im Grase gelegen.
Dann trat er so weit vor, daß sein Blick ungehindert in die Weite schweifen konnte. Drüben auf dem andern Elbufer erhoben sich die Hügel, bedeckt von dem leuchtenden Grün der frischen Reben, und zu seiner Rechten, dicht vor der Stadt, ragten der Dom und die alte Markgrafenburg in das lichte Himmelsblau noch hinein. Auch heute lag leuchtender Sonnenschein über dem entzückenden Bild, und die Luft wehte weich und warm und spielte leise mit den Zweigen.
Bernhard war so in Gedanken versunken, daß er Sonnhild erst bemerkte, als das Mädchen neben ihm stand. Jetzt sah er auf, und ihre Blicke trafen sich. Sie trug ein enganliegendes weißes Kleid, das die schlanke Gestalt der aufblühenden Jungfrau deutlich erkennen ließ.
Der Jüngling war von Sonnhilds Schönheit aufs neue betroffen. Er sah eine kurze Weile stumm in das liebliche[57] Gesicht, bis das Mädchen unter seinem Blick errötete und die Augen niederschlug. Da trat er rasch heran, und sie begrüßten sich.
Wie bei ihrem letzten Zusammensein brauchten sie erst eine Zeit lang, um ihre Verlegenheit zu überwinden. Dann aber drängten sich die Worte auf ihre Lippen und sie erinnerten sich beide daran, wie es vor fünf Jahren an dieser Stelle ausgesehen und was sie damals miteinander gesprochen.
So kamen sie ins Plaudern und gingen dabei tiefer in den Wald hinein, der sich neben der Landstraße auf der Anhöhe hinzog. Bernhard legte auch heute wieder seinen Arm behutsam in den der Jungfrau, ohne daß sie durch ein Zeichen peinliche Überraschung verraten hätte. War sie sich dessen im Eifer des Sprechens nicht bewußt geworden, oder erlaubte sie ihm diese Vertraulichkeit? Der Jüngling hoffte das letztere.
Dann pflückten sie die am Wege stehenden Waldblumen und banden sie zum Strauß. Bernhard ließ sich auf das Knie nieder und steckte den seinen in Sonnhilds Gürtel. Darauf trat das Mädchen heran und nestelte ihre Blumen an seinem Kragen fest. Dabei standen sie so eng beisammen, daß ihr Atem sein Gesicht streifte und er die feinen Härchen unterscheiden konnte, die Ohren und Wangen des Mädchens bedeckten. Als Sonnhild aber bei einer unwillkürlichen Bewegung mit der Stirn des Jünglings Wange leicht berührte, trat dieselbe dunkle Röte auf ihr Gesicht, die Bernhard schon wiederholt darin hatte aufsteigen sehen. Und ihre feinen Finger zitterten, bis es ihr gelang, die widerspenstigen Blumen zu befestigen.
Von da an blieb das Mädchen einsilbig, und wenn sie lachte, klang es nicht so natürlich wie sonst. Als Bernhard dies merkte, bemühte er sich, dem Mädchen die Beklemmung überwinden zu helfen, indem er harmlos weiterplauderte. Aber ihr Schweigen raubte ihm endlich die Unbefangenheit, und sein Redefluß versiegte.
Da sagte Sonnhild:
»Junker, ich weiß nicht, ob Euch hinlänglich bekannt ist, welch unseliger Zwist zwischen der Bürgerschaft und Eurem Vater besteht.«
Bernhard erschrak. Doch faßte er sich rasch und entgegnete, wie er wohl wisse, daß eine starke Bewegung zugunsten der Reformation in der Stadt sei. Seinem Vater liege es als Amtmann von Meißen ob, den Befehlen des Herzogs, der von der Einführung der Reformation im meißnischen Sachsen nichts wissen wolle, Geltung zu verschaffen. Und Bernhard fügte hinzu, das Volk würde die Wünsche seines Fürsten gewißlich achten und seine eigenen Wünsche fallen lassen.
Aber Sonnhild schüttelte den Kopf und versetzte mit wehmütigem Lächeln:
»Junker, Eure Harmlosigkeit von früher ist Euch verblieben. Wenn Ihr glaubt, daß die Bürgerschaft Meißens ihre Wünsche aufgäbe, weil der Herzog die Reformation nicht einführen will, dann täuscht Ihr Euch über die Gesinnung der Meißner. Die Gegensätze verschärfen sich mit jedem Tage. Und Euer Vater? Ich glaube bestimmt, daß er nichts anderes tut als seine Pflicht! Aber der ganze Groll der vielen unbefriedigten Menschen richtet sich zuerst doch nur gegen ihn.«
Hier sah Bernhard von Miltitz erstaunt auf.
»Gewiß, Junker, gegen Euern Vater! Der Herzog ist weiter entfernt, und er steht viel zu hoch, daß man es wagte, die gereizten Reden gegen ihn auszustoßen, mit denen die ergrimmte Bürgerschaft ihrem Herzen Luft macht.«
»Aber mein Vater ist doch nur ein Diener des Herzogs, und was er tut, tut er in seinem Namen,« warf Bernhard voll Eifer ein.
»Ich möchte Euch nicht wehtun, Junker,« entgegnete Sonnhild, »deshalb dürft Ihr auch nicht denken, die Worte, die ich jetzt spreche, seien meine eigene Überzeugung: die Bürgerschaft ist Eurem Vater bitter gram, weil sie meint, er schüre den Zwist zwischen ihr und dem Herzog, wo er nur könne, und bestärke diesen in seiner Abneigung gegen die Lutherische Lehre. Denn Euer Vater, Junker, gilt als ein fanatischer Papist.«
Diese Worte, so einfach sie gesprochen waren und obgleich ihnen jeder Ton des Vorwurfs fehlte, machten auf Bernhard einen tiefen Eindruck. Er erwiderte nichts und sah seitwärts in das Gebüsch. Da fühlte er eine weiche Hand, die sich leicht auf seinen Arm legte. Und wie er aufsah, blickte er in Sonnhilds große Augen, die traurig auf ihn gerichtet waren.
»Habe ich Euch doch eine Kränkung bereitet?« sagte sie leise. »Verzeiht, Junker, es war nicht bös gemeint!«
Bernhard war gerührt von dem weichen Ton in Sonnhilds Stimme und dem unaussprechlich lieblichen Ausdruck ihres Gesichts, das dem eines flehenden Kindes glich.
»Liebe Sonnhild,« sagte er herzlich, »was für ein edles Gemüt Ihr doch besitzt.«
Da nahm sie ihre Hand von seinem Arm. Und als sie sich abwandte, schlug ihr die Röte wieder ins Gesicht.
»Was Ihr da sagtet, Jungfrau,« begann Bernhard, »war eine Anklage gegen meinen Vater. Ich bin noch zu unerfahren, um urteilen zu können, ob mein Vater wirklich das tut, wessen man ihn bezichtigt. Wohl weiß ich, daß sein Einfluß auf den Herzog groß ist, und daß ihn dieser vor vielen anderen schätzt. Aber ich weiß auch, Jungfrau, daß mein Vater nicht nur nach Rang und Geburt ein Edelmann ist! Er ist streng, ja, das ist er! Er ist auch zuweilen – heftig. Das habe ich als Kind wiederholt fühlen müssen. Aber er ist auch gerecht! Und hinter seinem strengen Äußeren verbirgt sich ein mildes Herz! Schon als Knabe habe ich meinen Vater innig geliebt und tiefe Ehrfurcht vor ihm besessen. Jetzt aber, nachdem ich sein Inneres geblickt, ist es mein sehnlichster Wunsch, die Eigenschaften des väterlichen Charakters möchten sich auch in mir reich entwickeln.«
Sonnhild warf einen warmen Blick auf Bernhard, ohne daß dieser es bemerkte. Von dem Ernst seiner Rede ganz erfüllt, fuhr er fort:
»Mein Vater ist ein strenggläubiger Christ. Ob er der neuen Lehre feindlich gegenübersteht, weiß ich nicht.«
»Ich glaube Euern Worten, Junker,« versicherte Sonnhild. »Dieser unselige Zwist! Wieviel Tränen und Ärgernisse hat er nicht schon gekostet. Wenn doch nur der Herzog die evangelische Lehre freigeben wollte! Meint Ihr nicht auch, daß es Gott gleich gefällig ist, ob man ihm nun so oder so dient? Nicht die Form ist doch hier das Wertvolle, sondern der Inhalt.«
Bernhard wurde leicht verlegen. Es hätte ihn geschmerzt, dem Mädchen zu widersprechen. Deshalb sagte er nur:
»Ich kenne nichts anderes, als den alten Glauben. Aber wir wissen ja, daß es allein darauf ankommt, dem Höchsten mit ganzer Seele anzugehören.«
Damit war Sonnhild zufrieden.
»Für heute,« sprach sie, »ist es aber genug, Junker! So Ihr jedoch kommenden Samstag für ein Stündchen Zeit hättet …«
»Aber Jungfrau, wie mögt Ihr nur so fragen,« erwiderte Bernhard, indem er bemüht war, seiner Stimme einen Anflug von Vorwurf zu geben.
Sonnhild lächelte.
»Und wieder hier?« fragte sie neckend.
»Wieder hier,« antwortete er und drückte voll Wärme die Hand, die sie ihm reichte.
Dann sah er ihr lange nach, bis die jungfräuliche Gestalt seinen Blicken entschwand.
Langsam ging er darauf quer durch den Wald, bis zur Landstraße, die er stadtwärts verfolgte. Da holte ihn ein junges Mädchen ein, das ihn aufmerksam betrachtete und alsdann dicht in seiner Nähe blieb.
Bernhard fühlte, wie ihn die Unbekannte dreist ansah. Auch als er seinen Blick verweisend auf sie richtete, fuhr sie fort, ihn anzustarren.
Sie mochte zwanzig Jahre zählen. Ihr Körper war gut gewachsen und von leichter Fülle. Beim Gehen wiegten die Schultern ein wenig, und der wohlgerundete Busen schwebte auf und nieder. Ihr Gesicht war sehr bleich, fast durchsichtig. Unter den starken, schwarzen Brauen glänzten zwei herrliche Augen. Die schmale Nase besaß eine scharfe Krümmung. Das Mädchen war eine Jüdin.
Bernhard sah von ihr weg. Aber er empfand, daß sie kein Auge von ihm ließ. Ihrem abgenutzten Kleide nach stammte sie aus dem niederen Volke.
Nachdem beide ein Stück fast nebeneinander gegangen waren, sah er wieder zu ihr hin und blickte eine kurze Weile in ihre großen, blauen Augen.
Ein seltsames Gefühl überkam den Jüngling. Erinnerten ihn diese Augen nicht an Sonnhild? Er verwarf den Gedanken. Doch mußte er bald eingestehen, daß die Augen des Judenmädchens denen Sonnhilds glichen. Aber sie sahen ihn ganz anders an. Die Augen Sonnhilds leuchteten wie zwei Sterne am nächtlichen Himmel, die der Jüdin blickten starr und frech. Und verhaltene Glut blitzte in ihnen.
Da sah er zum drittenmal hinüber, und ihre Blicke trafen sich wieder. Eine magnetische Kraft schien von diesen Augen auszugehen.
Bernhard wurde ärgerlich, schwieg aber. So gingen sie bis zum Stadttor. Hier angekommen, blieb das Mädchen stehen, während er durch das Tor weiterging. Als er sich aber in geraumer Entfernung noch einmal umsah, bemerkte er die Jüdin unbeweglich neben dem Torhaus an die Stadtmauer gelehnt, ihm nachschauend.
Unwillig wandte er sich um. Aber lange hatte er das Gefühl, als ob die starren Augen noch immer auf ihn gerichtet seien.


Der Unfrieden der Bürgerschaft bereitete Georg Waltklinger nicht wenig Sorge. Zudem hatte er in seinem Gewerbe fleißig zu schaffen. Vom frühen Morgen bis zum Abend war er mit den Gesellen bei der Arbeit. Das Tuch, das er anfertigte, stand bei den Kaufleuten in besonderem Ruf, und sie bestürmten ihn mit Wünschen und großen Aufträgen.
Nur wenn ihn die Pflicht als Stadtoberhaupt rief, war er nicht in der Werkstatt anzutreffen. Dann legte er die große Schürze ab, vertauschte das Arbeitsgewand mit dem Kleide des Burgemeisters und begab sich auf das Rathaus.
Zuweilen traf es sich, daß ein Bittender, um seinen Rat zu heischen, ihn bei der Arbeit aufsuchte. Dieser mußte sich neben ihn setzen und so sein Anliegen vortragen. Währenddem arbeitete Waltklinger schweigend weiter und warf nur ab und zu eine Frage ein.
Besonders der Tuchmacher und Ratmann Niclas Anesorge saß wiederholt bei ihm. Der alte Mann war ein Feuerkopf und ein eifriger Protestant. In der Werkstatt daheim schaffte sein Sohn, er selbst überwachte die Erfolge der evangelischen Lehre im ganzen Lande. Da er des[64] jüngeren Waltklingers Verstand und Mäßigung hoch schätzte, ordnete er sich ihm willig unter.
Anesorge redete viel und heftig. Wenn er auf sein Lieblingsgespräch kam, konnte er ganz wild werden. Dann schrie er nicht selten seine Zuhörer an, daß es manchem bänglich zumute ward. In der Innungsstube und in den Schenken wurde es rasch lebhaft, wenn Anesorge eintrat. Natürlich bildete der Religionszwist seit langem den Mittelpunkt aller Unterhaltung. Deshalb war der Stoff schon abgebraucht. Fuhr aber Meister Anesorge irgendwo dazwischen, dann kam die Masse schnell in Fluß.
Seine drei größten Feinde waren der Bischof, der ihm, wie er sagte, den ganzen schönen Dom oben auf der Schloßfreiheit verleidete, ferner Ernst von Miltitz und Herzog Georg. Von diesen dreien sprach er am liebsten. Für jeden hatte er sich eine erkleckliche Anzahl liebevoller Kraftausdrücke zurechtgelegt, die er scharf voneinander unterschied. Wenn er lebhaft wurde, und dieses pflegte bald einzutreten, ließ er die Kernworte als Würze in seine Rede einfließen.
Dazu schlug er mit der Faust öfters auf den Tisch und begleitete seine Worte mit unvorsichtigen Handbewegungen. Dies rächte sich bisweilen, denn er warf damit seinen eigenen Wein und den anderer unterschiedslos um. Das machte ihn hitziger, als wenn er ihn getrunken hätte. Er verstieg sich zu gewagten Ausfällen und entkräftete Behauptungen, die niemand aufgestellt hatte. Ab und zu blickte er sich im Kreise um, als wenn er Widerspruch erwarte. Aber die Umsitzenden hüteten sich. Denn es war hinlänglich bekannt, daß der alte Anesorge mit[65] demselben Nachdruck, mit dem er die evangelische Bewegung verteidigte, den leisesten Widerspruch gegen seine Ansichten ablehnte.
Wenn er endlich lange genug gewettert hatte, war die Last von seiner Brust für diesen Tag herunter. Die hellen Augen leuchteten jugendlich in dem vom Wein geröteten Gesicht, und mit sich selbst zufrieden, strich er über das kurze, weiße Haar. Traf er alsdann auf dem Nachhauseweg einen Handwerksburschen oder einen vagierenden Bettler, so gab er diesem reichlich.
Daheim erwartete ihn sein Weib, das jedesmal sagte:
»Ich seh' dir's schon wieder an. Geh ins Bett, Mann! Dich muß der Tod noch einmal besonders aufs Maul schlagen.«
Er aber kniff seine greise Ehehälfte zärtlich in die volle Backe und entgegnete:
»Laß es nur gut sein, Alte! Wir erleben es noch beide, daß die ganze schwarze Klerisei mit Sack und Pack – heidi – zum Stadttor hinauszieht!«
Eines Tages wurde dem Burgemeister und den Ratmannen eine große Überraschung. Sie waren wieder im Rathaus versammelt, als plötzlich einer der beiden Stadtknechte mit dem Spieß in der, Hand die Treppe heraufgestampft kam, die Tür zum großen Saal aufriß und hineinschrie:
»Seine Gnaden, der Herr Amtmann!«
Gleich darauf war zu aller höchlichstem Erstaunen Herr Ernst von Miltitz eingetreten. Der Burgemeister selbst war es gewesen, der sich als Erster erhoben, um den Vertreter des Herzogs zu begrüßen. Er tat dies mit eisiger Miene.[66] Und wie er sich verbeugte, sah es aus, als wenn er des Stadtknechts Spieß verschluckt hätte.
Die Ratmannen, die ohne Ausnahme auf ihren Burgemeister guckten, taten ebenso steif wie er.
Dann lud Waltklinger Herrn Ernst von Miltitz ein, zu seiner Rechten am Tische Platz zu nehmen. Denn Gesetz und Recht forderten es, daß der Amtmann den Beratungen der Ratsversammlung anwohnen durfte.
Die lange Tagesordnung wurde weiter besprochen. Als sie zu Ende war, richtete sich Herr Ernst von Miltitz aus seiner zurückgelehnten Haltung auf und sprach:
»Es fügt sich heute zum erstenmal, daß ich bei einer Gemeindeversammlung gegenwärtig bin. Den Wunsch, dies einmal zu tun, habe ich schon seit langer Zeit gehegt. Doch haben mich meine zahlreichen Berufspflichten bisher daran gehindert. Ich habe mich nunmehr davon überzeugt, mit welcher Ordnung und strengen Sachlichkeit die Verhandlungen geführt werden. Darüber bin ich erfreut, aber nicht verwundert. Denn nur so konnte ich es vorfinden. Welch ersprießliche Tätigkeit der Burgemeister und die Ratmannen von Meißen entfalten, das lehrt auf den ersten Blick der Zustand der blühenden Gemeinde. Es ist weithin bekannt, wie die Stadt Meißen hierin unter den sächsischen Städten obenan steht. Dieser Rang gebührt ihr mit Recht! Auch Herzog Georg, unser allergnädigster Herr, weiß solches, und er freut sich seiner guten und treuen Stadt. Ich wünsche, daß die Bürgerschaft Meißens jederzeit genug solcher Männer findet, mit denen sie ihren Rat beschickt!«
Ernst von Miltitz hatte diese Worte ruhig und hier und da mit Nachdruck gesprochen. Der warme Ton ehrlicher[67] Überzeugung hatte durchgeklungen. Selbst der leiseste Verdacht, daß er schmeicheln wolle, hätte in keinem der Zuhörer aufsteigen können.
Jetzt sah er sich im Kreise um, gleichsam als wollten die Augen bestätigen, was sein Mund gesprochen. Aber die Männer saßen stumm am Tische und hielten ihre Blicke gesenkt.
Über die ernsten Züge des Amtmanns lief ein Schatten. Er wartete noch eine kurze Weile, dann fuhr er fort:
»Wo man soviel ehrliches Wollen und gutes Vollbringen antrifft, soll freundliche Nachsicht Richter sein, wenn die Erreichung von Zielen angestrebt wird, die man sich besser nicht gesteckt hätte. Die Bürger kennen sattsam des Herzogs Entschlüsse in Sachen der Religion. Sie haben als treue Untertanen die Pflicht, sie zu achten und sich ihnen unterzuordnen. Wer seinen Fürsten liebt, beugt sich vor ihm! Ein braver Untertan tut nicht gut daran, über die Grenzen des Landes hinauszuschauen, damit er erblicke, was seine Unzufriedenheit erregt.
Die kurfürstlichen Sachsen beten im neuen Glauben, wie sie es nennen; wir herzoglichen feiern unsere Andachten im alten. Die Evangelischen beteuern, daß der Weg, den sie gingen, ebenso zur ewigen Seligkeit führe. Es ist nicht mein Beruf, diesem zu widersprechen. Aber damit erkennen sie an, daß auch die bisherige Straße dieses Ziel erreicht. Glauben ist Herzenssache! Wer aber zwei Möglichkeiten des Vollbringens sieht, kann die Ausführung wählen, die sich mit den Pflichten eines treuen Untertanen verträgt. Doch soll, was ich jetzt gesagt, nicht die lobende Anerkennung abschwächen, die ich vorhin ausgesprochen.«
Ernst und eindringlich, fast väterlich hatte diese Rede geklungen. Doch hatte sie keinen Eindruck hinterlassen, sie war wirkungslos verhallt. Die Männer hatten mit eisigem Schweigen zugehört, das auch jetzt noch anhielt.
Endlich räusperte sich der Burgemeister und erwiderte in achtungsvollem Ton:
»Es erfüllt uns mit Genugtuung, Herr Amtmann, aus Euerm Munde zu vernehmen, daß das Land und selbst des Herzogs Hoheit anerkennt, wie der Rat der Stadt Meißen seine Pflicht tut. Diese Anerkennung soll uns darin bestärken, wie bisher weiter zu wirken. Die Zustimmung zu unserem Tun aber als Lob zu betrachten, weist der Rat zu Meißen ab! Denn er tut eben nichts anderes als seine Pflicht!«
Zu diesen Worten erklang zum ersten Male ein beifälliges Murmeln.
»Was das andere betrifft, Herr Amtmann,« setzte Georg Waltklinger mit weiser Mäßigung hinzu, »so haben uns Eure Worte die erhoffte Befriedigung nicht gebracht. Glauben ist Herzenssache, sagtet Ihr. Nun, Herr Amtmann, unsere Herzen verlangt es eben nach jener hohen Befriedigung, die ihnen die Lehre des Doktors Luther gibt. Der alte Glaube aber kann dem keine Erbauung mehr spenden, der die köstliche Weihe empfunden, die das große Werk des Wittenbergers ausgießt. So Ihr der Bürgerschaft von Meißen einen Dienst tun möchtet, den sie Euch nie vergessen würde, dann geht hin zu unserm erlauchten Herrn und öffnet ihm die Augen darüber, wie hoch die Not gestiegen ist, die sein Volk im Innern leidet!«
Der Burgemeister hatte mit fließender Beredsamkeit[69] und allen aus der Seele gesprochen. Die Männer fühlten die tiefe Wirkung der Worte ihres Oberhaupts. Kein Beifallszeichen ertönte, aber auf ihren Mienen stand das Einverständnis zu dem Gehörten. Doch Ernst von Miltitz machte eine abweisende Gebärde.
»Männer, die fest und wahr zu dem Herzog stehen, sprechen anders!«
Waltklinger richtete sich groß auf.
»Die zum Herzog stehen?« entgegnete er mit niedergehaltener Erregung. »Nicht weniger treu und fest, als Ihr, Herr Amtmann, bekennt sich der Rat und die Einwohnerschaft zu unserm gnädigen Herrn! Aber warum setzt sich der Herzog so scharf in Widerspruch mit seinen Untertanen? Warum gibt er die Kirchen für den lutherischen Glauben nicht frei? Warum erlaubt er nicht, daß uns das Abendmahl in beiderlei Gestalt gereicht werde? Denkt er vielleicht, durch sein Sträuben für alle Zeiten das zu verhindern, was mit zwingender Notwendigkeit doch einmal eintreten muß? Treue und Anhänglichkeit zu der Person des Herzogs sind hohe Tugenden, Herr Amtmann. Und wir üben sie. Aber über Fürstendienst steht Gottesdienst!«
Da war es heraus! Nun wußte der Vertraute des Herzogs alles. Und er konnte es seinem Herrn berichten. Das waren unerschrockene Worte gewesen, die der Burgemeister gesagt hatte. Alle empfanden es! Die freimütige Haltung Waltklingers hatte sie begeistert.
Ernst von Miltitz war vom Stuhl aufgestanden, und mit ihm erhob sich die Versammlung.
»Herr Burgemeister,« sagte der Amtmann tief verstimmt, »ich habe das Äußerste versucht, Euch von Euern[70] unausführbaren Plänen abzubringen. Es ist mir mißlungen. Ich bedaure es! Seid Ihr Euch aber auch bewußt, was Eure abweisende Haltung bedeutet?«
Wie zwei Gegner standen die beiden Männer einander gegenüber. Georg Waltklinger, der den Amtmann um eines Hauptes Länge überragte, stand hoch aufgerichtet mit zurückgeworfenem Kopf. Noch nie hatte er die Würde als Burgemeister so gefühlt, wie in dieser Minute, und noch nie war er so stolz gewesen, ein freier Handwerksmeister zu sein, wie gerade jetzt.
»Ja, Herr Amtmann,« kam es mit männlicher Festigkeit von seinen Lippen. »Ich weiß es, was diese Stunde bedeutet. Sie eröffnet den Kampf. Die Bürgerschaft von Meißen steht hinter mir, – ich werde ihn ausfechten!«
Ernst von Miltitz fühlte, wie er in den Augen der Männer als der Unterlegene erschien. Schon war er im Begriff, die Kühnheit des Burgemeisters scharf zurückzuweisen, um dergestalt die starke Wirkung seiner Rede abzuschwächen. Aber er verschmähte es. In vornehmer Haltung und mit einem stummen Gruß verließ er den Saal.
Jetzt brach das Schweigen. Die Mitglieder der Ratsversammlung priesen mit lauten Worten die Klugheit und den Freimut ihres Oberhaupts. Einer nach dem andern drängte sich an Waltklinger heran, damit er ihm die Hand drücke, als Zeichen des Einverständnisses zu seiner mannhaften Rede. Niclas Anesorges Gesicht strahlte. Er hatte immer eine hohe Meinung von der Tüchtigkeit Waltklingers gehabt. Heute war dieser aber über sich hinausgewachsen. Wie kraftvoll die Worte geklungen hatten – und wie stolz!
So gingen die Ratmannen auseinander und trugen die Kunde von dem bedeutsamen Vorfall hinaus. Sie flog von Gasse zu Gasse und huschte in jedes Haus. Die Einwohnerschaft der Stadt Meißen aber empfand große Befriedigung und war wieder einmal stolz auf ihren Burgemeister.
Nur einer legte seiner Freude kurze Zügel an – Georg Waltklinger. Nicht daß er die Gefahr scheute, die der heraufbeschworene Kampf ihm bringen mußte. Er kannte keine Furcht! Wer so wie er im innersten Herzen von der Rechtlichkeit seines Wollens überzeugt war, wer so gerade Wege ging, der konnte allem, was auch kam, ruhig entgegensehen.
Als er aber zu später Abendstunde beim Kerzenschein in seinem Zimmer saß, kamen ihm allerhand Gedanken und Zweifel, ob er recht gehandelt. Ernst von Miltitz, das fühlte er jetzt, war sicherlich als heimlicher Abgesandter seines Herrn erschienen. Herzog Georg liebte seine alte Markgrafenstadt und es war ihm daran gelegen, mit ihrer Bürgerschaft in Frieden zu leben. Wohl war es die Mehrzahl der sächsischen Städte, die unaufhörlich um die Reformation baten, aber von Meißen schallte dieser Ruf doch am stärksten. Deshalb hatte der Herzog seinem Vertrauten wohl auch die Weisung gegeben, den Rat unverfänglich und in Güte zu überreden, damit er seinen Einfluß auf die Bürger geltend mache. Und der Amtmann, das war nicht zu leugnen, hatte sich seines Auftrags mit Geschick entledigt.
Die hohen Herren waren jedoch, als sie den Plan schmiedeten, von der wirklichen Stimmung im Volke nicht unterrichtet gewesen. Der Bürger wollte nicht[72] nachgeben, ja, er konnte es nicht mehr. Der Geist des Wittenbergers war schon zu tief in aller Seelen eingedrungen. Und wenn der Herzog selbst käme und es versuchte, und wenn er bäte! – man könnte ihm doch nur eine Antwort geben! Soweit also war Waltklinger beruhigt.
War es aber notwendig gewesen, dem Amtmann so scharf zu erwidern, wie er es getan? O, – persönlich empfand Georg Waltklinger lebhafte Befriedigung darüber. Denn den Amtseifer des neuen Herrn hatte die Stadt schon wiederholt wie Nadelstiche empfunden. Und dann! War nicht gerade Ernst von Miltitz einer von jenen Adligen, die auf die verhaßten Städter von oben herabsahen? Dem konnte es nicht schaden, daß ihm einmal ein freier Bürger und der erste Vertreter einer Stadt so unbeugsam entgegen getreten war!
Aber die Bürgerschaft! Konnten für sie nicht schwere Nachteile erwachsen? Der Amtmann würde sicherlich Gelegenheiten suchen, wo der Stadt etwas am Zeuge zu flicken war. Und finden würde er dabei etwas! Er konnte ihr überall Schwierigkeiten bereiten, wenigstens solche, die wirtschaftliche Einbußen bedeuteten. Doch man hatte ein ruhiges Gewissen; der Haushalt der Stadt war geordnet. Aber doch freute sich der Burgemeister im stillen, daß seine starke innere Erregung ihn nicht fortgerissen hatte, als er dem Amtmann gegenübergestanden.
Sorgen und Aufregung hatten ihm also die letzten Wochen zur Genüge gebracht.
Georg Waltklinger hielt den Kopf auf den Tisch gestützt, als eine Hand leise über sein Haar strich. Er wandte sich um.
»Ach, Sonnhild,« sagte er zerstreut, »bist du noch wach?«
»Ich habe darauf warten wollen, bis du mit deinem Grübeln zu Ende gekommen wärest. Aber du findest kein Ende.«
»Laß deinen Vater, Kind, du kannst seine Sorgen ja doch nicht teilen,« versetzte Waltklinger.
»Lieber Vater, du vergißt über deinen Geschäften alles, das ganze Haus und – auch mich!«
Der wehmütige Klang dieser Worte drang Waltklinger zum Herzen. Und er wurde sich bewußt, daß er seine Tochter wenig an den Zerstreuungen ihrer Altersgenossinnen teilnehmen ließ, sondern geflissentlich an das Haus bannte, damit die Zeit noch lange hinausgeschoben würde, zu der er ihre Liebe mit jemand anderem teilen mußte. Hatte er dann aber nicht auch die Pflicht, Sonnhild durch vieles Beisammensein mit ihr zu entschädigen? Tat er dies?
Georg Waltklinger fühlte, daß er darin gefehlt. Zärtlich schlang er den Arm um Sonnhild und zog sie auf seinen Schoß nieder.
»Mein Töchterchen,« sagte er tröstend, »die Zeiten werden auch wieder besser. Ich will mich fortan immer rechtzeitig daran erinnern, daß daheim mein Sonnenschein auf mich wartet.«
Dazu hob er ihren Kopf auf und sah in ihre bekümmerten Augen.
»Lieber Vater,« sprach Sonnhild, sich erhebend, »weißt du es nicht, welchen Tag wir heute schreiben?«
Georg Waltklinger horchte auf und sann nach. Da lief plötzlich eine dunkle Röte über sein Gesicht, daß er wie ein Schuldbewußter vor seinem Kinde saß.
»Verzeihe deinem Vater, Sonnhild!« sagte er in tiefer Rührung. »Es ist heute das erstemal, daß ich ihren Todestag ohne Feier habe vorübergehen lassen. Komm, laß uns das Versäumte nachholen.«
Und er nahm den doppelarmigen Leuchter von schwerem Silber und ging mit ihm voran in das erste Stockwerk. Als sie durch die Reihe der Prunkstuben hindurchschritten, schallten ihre Schritte dumpf von den Wänden zurück.
In dem hintersten Gemach angekommen, stellte Waltklinger den Leuchter nieder. Dann neigte er sich über einen kleinen Betstuhl, der noch von Urgroßvaters Zeiten stammte, und zog an einer niederhängenden Schnur, worauf sich ein grünseidener Vorhang teilte und eine in Öl gemalte Leinwand sichtbar wurde. Der dunkle Rahmen umschloß ein herrliches Frauenbildnis. Der Kopf war bedeckt mit einer schweren Last golden glänzenden Haares. Und das schmale Gesicht trug einen unaussprechlich lieblichen Ausdruck.
»Laß uns beten,« sagte Georg Waltklinger.
Da knieten Vater und Tochter nieder und beteten leise miteinander. In dem Gemach herrschte tiefe Stille. Nur der Wurm nagte leise in dem Getäfel der hohen Wände, und die seltsam geformten Schatten des flackernden Kerzenlichts huschten gespenstisch darüber hin.
Hierauf erhoben sie sich und sahen lange stumm in das engelschöne Gesicht an der Wand. Endlich wandte sich Waltklinger zu Sonnhild, legte ihr die Hände auf das Haupt und sprach mit Inbrunst:
»Bleibe ebenso gut und edel und rein, mein Kind, wie du bisher warst und wie deine Mutter es gewesen ist!«


Bernhard von Miltitz sehnte voll Ungeduld die nächste Zusammenkunft mit Sonnhild herbei. Die Tage bis dahin vertrieb er sich damit, einsam durch Wald und Flur zu streifen. Sein einziger Gedanke war sie! Und sein Herz schlug vor Freude rascher, wenn er sich mit aller Lebendigkeit die Erinnerung daran zurückrief, wieviel freundliche Worte und Blicke Sonnhild für ihn besessen. Zuweilen fuhr er nachts aus dem Schlafe auf. Dann meinte er, das Mädchen müsse vor ihm stehen. So lebhaft hatte er von ihr geträumt.
Als endlich der Tag des Wiedersehens gekommen, machte sich der Jüngling schon lange vor der festgesetzten Zeit auf den Weg. Er hatte sich heute mit besonderer Sorgfalt gekleidet und das braune Haar fleißig gebürstet, daß es in zierlichen Wellen herabhing. Auch einen prächtigen Stickereikragen hatte er auf die Schultern gelegt und nagelneue, braune Knöchelschuhe angezogen.
So ging er leichten Schrittes durch die Gassen der Stadt. Manche Jungfrau, die dem vornehmen Junker begegnete, hätte ihn gar zu gern genauer betrachtet. Aber die gute Sitte verlangte, daß sie mit niedergeschlagenen Augen an ihm vorbeiging. Nur die jungen Bürgerstöchter,[76] die an den Fenstern hinter den blütenweißen Vorhängen standen und sich die Zeit damit vertrieben, auf die Vorübergehenden hinabzuschauen, verfolgten den Jüngling mit den Augen, so weit sie konnten. Sein feines, bleiches Gesicht – das nur ein wenig zu ernst war –, fesselte ihre Aufmerksamkeit in hohem Maße und seine Haltung entzückte sie.
Als Bernhard zum Lommatzscher Tor hinausschritt, mußte er unwillkürlich des Mädchens gedenken, dem er jüngst begegnet war. Aber ebenso rasch, wie dieser Gedanke gekommen, verschwand er wieder. Sonnhild stieg vor seinem Geiste herauf und hielt all seine Sinne im Bann.
Der Jüngling setzte sich neben der Straße auf einen Stein, um hier das Mädchen zu erwarten. Da schlug es vom Dom mit dumpfen Schlägen die vierte Stunde. Bernhard sprang auf. Sollte er Sonnhild verfehlt haben? Sie hatte heute gewiß einen andern Weg gewählt. Vielleicht war sie in großer Ungeduld noch früher hinausgegangen als er und erwartete ihn an der bekannten Stelle.
Mit eiligen Schritten lief Bernhard durch den Wald. Schon während des Nahens suchten seine Augen die weiße Gestalt unter den grünen Bäumen. Aber er konnte sie nicht entdecken. Endlich hatte er das Ziel erreicht, – Sonnhild war nicht zu sehen. Er eilte zu einigen anderen Punkten, wo er mit ihr schon einmal verweilt, suchte alles mit den Augen ab, rief »huhu!« und darauf wiederholt ihren Namen – umsonst. Seine Stimme verhallte im Walde.
Da kam das Gefühl einer großen Enttäuschung über ihn. Er warf sich auf das schwellende Moos, verschränkte[77] die Arme unter dem Kopf und sah starr auf das leise Spiel des Windes in den Blättern. Bald setzte er sich jedoch hastig wieder auf und sprang endlich in die Höhe. Das heimliche Angstgefühl hatte ihn gepackt, Sonnhild könne krank geworden oder ein Unglücksfall möchte ihr zugestoßen sein.
Unschlüssig, wie er sich hierüber Gewißheit verschaffe, trieb es ihn rastlos in die Kreuz und die Quere, bis er endlich wieder auf dem alten Fleck stand. Jetzt zwang sich Bernhard zum ruhigen Nachdenken. Es mußte doch nicht gerade Krankheit sein, was Sonnhild am Kommen verhindert hatte. Konnte nicht das Gespräch, welches sie gepflogen, die Ursache sein, daß Sonnhild ein nochmaliges Zusammentreffen mit ihm vermied? Der Zwist ihrer Väter und sein Bekennen zur katholischen Kirche – –.
»Dieser unselige Religionshader,« seufzte der Jüngling, »nun empfinde auch ich ihn.«
Traurig strich er ziellos durch den Wald, von Zeit zu Zeit nach dem Aussichtspunkt zurückkehrend mit der leisen Hoffnung, das Mädchen könne sich noch verspätet eingefunden haben. Er zermarterte seinen Kopf mit Plänen, wie es ihm wohl möglich sei, Sonnhild heimlich zu sprechen. Aber er gab einen Entschluß nach dem andern wieder auf. Mit ihrer Ausführung hätte er Sonnhild sicher nur geschadet.
Nun ging der Tag zur Rüste, und jede Hoffnung, das Mädchen noch zu sehen, entschwand. Bernhard schaute noch einmal hoch über den Strom hinweg, nach den Weinbergen, die im Widerschein des aufleuchtenden Abendrots in einen Schimmer von Purpur getaucht waren. Dann richtete er den Blick auf das herrliche Meisterwerk[78] Konrads von Westfalen, das Markgrafenschloß, dessen zahlreiche Fenster rot glühten, als stehe hinter ihnen alles in Flammen, und auf den altehrwürdigen Dom. Die Strahlen der scheidenden Sonne umschmeichelten das goldene Kreuz in schwindelnder Höhe, als wenn das Himmelslicht die letzte Dulderstätte seines Herrn und Meisters, dieses irdische Symbol des höchsten Heils noch einmal küssen wolle.
Aber der Jüngling hatte heute für die überwältigende Schönheit dieses Anblicks kein Auge. Seine Sonne strahlte nicht! Und vor seinem bangen Blick zogen drohende Schatten herauf.
Müde begab er sich auf den Heimweg. Als er die Straße erreicht hatte, bemerkte er eine weibliche Gestalt, die seitwärts an einem Baum lehnte, als wenn sie ihn schon seit langem erwartet habe. Es war das Judenmädchen.
Sie stand in steifer Haltung und hielt die Augen unverrückt auf ihn gerichtet. Bernhard sah kurz hinüber. Und auch heute hatte er wieder das Empfinden, als wenn er Sonnhilds Augen sähe.
Ihrer nicht achtend, ging er vorüber. Da hörte er, wie sie ihren Platz verließ und ihm in kurzer Entfernung folgte. Bernhard verdroß dies. Er blieb stehen, um sie vorbeizulassen. Sobald sie jedoch seine Absicht erkannte, blieb sie ebenfalls stehen. Da warf er ihr einen strafenden Blick zu. Sie fing ihn gleichmütig auf, und Bernhard sah, wie ihre Augen verzehrend auf ihn gerichtet waren.
Er wandte sich wieder zum Gehen; sie folgte ihm.[79] Er blieb stehen – sie auch. Nach einer Weile tat er es noch einmal, – das Spiel wiederholte sich.
Da ward der Jüngling zornig. Er trat auf das Mädchen zu und fuhr sie hart an. Aber es schien, als wenn sie seine barschen Worte nicht verstünde. In ihr marmorweißes Gesicht schoß ein schwaches Lächeln, und in den glutvollen Augen loderte es auf. Das Schweigen des Mädchens erbitterte Bernhard, daß er sie wütend schalt. Da wurde das Lächeln auf ihrem Gesicht stärker; es drückte die Befriedigung aus, die sie an seiner Gegenwart empfand.
Bernhard stand ratlos da. War sie erfreut, wenn er sie schalt? Er mußte es annehmen! Was für ein rätselvolles Mädchen war dies! Was wollte sie von ihm! Da schoß ihm ein Gedanke durch den Kopf. Sie war sicherlich kein Kind des Landes, und seine Sprache war nicht die ihrige.
»Verstehst du, was ich zu dir spreche?« fragte er.
»Ich verstehe Euch,« klang es zurück.
Da sah Bernhard dem Mädchen verständnislos ins Gesicht. Dann wandte er sich ab und verfolgte den Weg weiter, sich nicht mehr daran kehrend, daß sie ihm wie sein Schatten folgte.
Als sie das Stadttor erreicht hatten, drängte sie sich an ihn heran und blickte ihm noch einmal ins Gesicht Dann blieb sie stehen. Da trat aus der Wohnung des Torhüters eine Frau von unverkennbar jüdischem Aussehen, deren Gesicht noch die Spuren einstiger hoher Schönheit trug. Die sagte zärtlich zu dem Mädchen:
»Mirjam, mein Seelchen, wo bist du so lange gewesen?«
Das Mädchen achtete aber nicht auf diese Frage, sondern fuhr die Frau an:
»Mutter, gib mir Geld auf ein Paar neue Schuhe!«
Während der hierauf folgenden Woche ging Bernhard täglich vor das Lommatzscher Tor hinaus, ohne jedoch Sonnhild wiederzusehen. Sein Gemüt umdüsterte sich, und er wurde tieftraurig. Jeden Morgen hoffte er von neuem, daß sie sich heute einstellen würde, und jeden Abend ging er mißmutig und enttäuscht nach Siebeneichen zurück.
Das Judenmädchen stand Tag für Tag wie eine Bildsäule unter dem Baum, seiner wartend. Wenn er vorbeigeschritten war, heftete sie sich lautlos an seine Fersen. Bernhard hatte noch einen letzten Versuch gemacht, sie davon zu jagen. Aber sie hatte seinen Zornausbruch teilnahmlos über sich ergehen lassen. Und als er die Hand erhoben, um sie zu schlagen, hatte sie gelächelt. Seitdem kümmerte er sich nicht mehr um sie und vergaß zuweilen völlig, daß sie in seiner Nähe war.
Nun waren sieben Tage vergangen, ohne daß Bernhard Sonnhild wiedergesehen hätte. Es war wieder Samstag. Bernhard lag an derselben Stelle, wo sie sich getroffen, im Grase und träumte mit offenen Augen von ihr. Das Herz war ihm schwer. Er wußte nicht, ob das Mädchen krank war, oder ob sie nichts mehr von ihm wissen wollte.
Endlich erhob er sich von dem weichen Moosteppich, mit dem Entschlusse, einen gewaltsamen Versuch zu wagen, Sonnhild wiederzusehen. Da fielen seine Augen auf die Jüdin. Sie stand unweit von ihm und blickte ihn an –[81] flehentlich und verlangend. Bernhard fühlte sich gefesselt von diesen ausdrucksvollen Augen, und er empfand eine unerklärliche Unruhe. Das Blut drang ihm heiß in die Schläfen, und seine Pulse flogen.
Mit feinem Instinkt merkte das Mädchen blitzschnell diese Veränderung. Sie tat einen geschmeidigen Katzenschritt und stand nun dicht vor ihm. Bernhard sah ein frohlockendes Lächeln auf ihren halbgeöffneten Lippen und unterschied das heftige Wogen ihres Busens. Die Einsamkeit des Waldes und das verschwommene Licht steigerten die Wirkung, die das Mädchen auf den Jüngling ausübte. Sein ganzer Körper zitterte, und eine starke Macht, die er noch nie empfunden, drängte ihn zu der Jüdin hin. Schon fühlte er seinen Widerstand schwinden, – da raffte er noch einmal allen Willen zusammen.
Zurücktretend wandte er sich ab und ging langsam dahin. Wohl merkte er, wie der Sturm in seinem Innern noch tobte, aber er zwang sich zur Ruhe. Da erschien vor seiner Seele das leuchtende Bild Sonnhilds, und er sah ihre unschuldvollen Augen. In demselben Augenblick fiel alle Schwäche von ihm ab, und die kühle Besonnenheit stellte sich wieder ein.
Hinter sich hörte er die schleichenden Tritte des enttäuschten Mädchens, das zu früh frohlockt hatte. Schnell trat er den Heimweg an, damit die Versuchung weit hinter ihm bleibe.


Der Abend dieses Tages war hereingebrochen. Mit dem Dunkelwerden waren die Gassen Meißens verödet. Jetzt lagen sie in tiefer Ruhe. Im Sommer pflegten viele Einwohner sich zu dieser Stunde zur Ruhe zu begeben. Überdies war ja morgen Sonntag, an dem sich bei schönem Wetter das Leben auf den Gassen schon frühzeitig entfaltete. Nur hier und da brannte hinter den Fenstern noch Licht zu der letzten Verrichtung der emsig schaffenden Hausfrau.
Dieser geringe Lichtschimmer bildete die einzige Beleuchtung der Gassen. Wenn auch diese schwachen Flämmlein erstarben, war es dunkel in der Stadt. Wer also zu später Stunde noch außer dem Hause war und nicht das Glück hatte, daß ihm der Mond freundlich sein bleiches Licht spendete, der mußte aufs Geratewohl seinen Weg zurücklegen. War aber die Finsternis dem Auge undurchdringlich, dann trug wohl der nächtlich Wandelnde eine Laterne in der Hand. Nur die reichen Bürger ließen sich von einer Magd heimleuchten, und die Vornehmsten[83] in den großen Städten wurden von Dienern begleitet, die Pechfackeln vorauftrugen.
Tiefe Ruhe herrschte in der Stadt. Nur in den Schenkstuben war es noch lebendig. An Gesprächstoff mangelte es in dieser bewegten Zeit natürlich nicht. Aber selbst in stillen Zeiten hat Frau Politik, diese liebenswürdige Dame, für jeden Stammtisch auf dem Erdenrund, an dem wackre deutsche Männer sitzen, wenigstens ein Quentchen interessanter Neuigkeit freundlicherweise immer übrig gehabt.
Es war ein milder Frühlingsabend. Sonnhild saß auf dem Lustgänglein, um die herrliche Luft zu genießen. Vor ihr stand auf dem kleinen Tisch eine zinnerne Lampe, in deren mit Erdöl gefülltem Becken der brennende Docht lag. Das Mädchen hielt eine angefangene Stickereiarbeit in den Händen, die zu dem nahen Geburtstag des Vaters fertig sein sollte.
Sonnhild stichelte tapfer beim trüben Schein der Lampe. Da entsank die Arbeit den fleißigen Händen, und ihr Blick verlor sich. Sie dachte angestrengt nach. Ein wehmütiger Zug trat auf ihr Gesicht, und endlich lief eine feine Röte darüber hin. Das Mädchen erschrak und nahm die unterbrochene Arbeit wieder auf. Bald kamen aber die Träumereien von neuem, und sie vergaß gänzlich die Außenwelt.
Da fuhr sie auf. Hatte sie nicht auf dem Hof leises Geräusch vernommen? Sie horchte. Es war alles still. Der milde Abendwind spielte leise mit dem leinenen Vorhang, der ihren Platz von dem hinteren Teil der Galerie abschloß. Sie beruhigte sich und gab sich von neuem willig den Gedanken hin, die sie erfüllten.
Aber schon wieder war es ihr, als ob sie etwas Ungewöhnliches gehört habe. Doch schalt sie auf ihren törichten Argwohn, denn was sollte sie hier stören? Und abermals vergaß sie die Arbeit. Sie legte sich zurück und schloß die Augen. Es mußte eine freundliche Erinnerung sein, die in ihrer Seele heraufstieg! Denn ein glückliches Lächeln trat auf ihr Gesicht, und ihr Mund flüsterte leise einen Namen – einmal, zweimal.
Im nächsten Augenblick aber richtete sie sich auf und horchte angestrengt. Jetzt bestand kein Zweifel mehr, daß sie einen fremden Laut vernommen hatte. Sollte etwa ein Fremder ins Haus gedrungen sein? Das Tor stand noch offen, der Vater verschloß es erst, wenn er aus der Innungsstube nach dem Nachttrunk heimkehrte.
Das Mädchen saß unbeweglich und strengte alle Sinne an. Da bemerkte sie, wie sich der Vorhang leise bewegte. Geängstigt sprang Sonnhild auf und trat bis an die Mauer zurück, die Augen starr auf die Falten der Leinwand gerichtet. Sie fühlte, daß dahinter ein Mensch stand. Ihre Glieder waren wie gelähmt, und von ihren Lippen kam ein unterdrückter Laut des Entsetzens.
Da teilte sich der Vorhang, und ein Mann trat in den Lichtkreis. Sonnhild stand mit vorgeneigtem Oberkörper und starrte auf den Eindringling Im nächsten Augenblick stieß sie geängstigt aus:
»Bernhard! …« und
»Sonnhild!« klang es fast gleichzeitig, und Bernhard flog ihr zu Füßen und haschte nach ihrer Hand und preßte sie lange an seine Lippen.
Sonnhild lehnte sich erschöpft an die Wand zurück; ihr Körper zitterte vor Aufregung.
»Verzeiht,« flüsterte der Jüngling zerknirscht, »daß ich Euch Angst bereitete. Ich bitte Euch tausendmal, mir zu verzeihen, edle Jungfrau …«
»Es ist nichts,« stammelte das Mädchen, sich sammelnd, »der Schrecken ist schon vorüber. Wie tollkühn Ihr doch seid! Wenn nun mein Vater zu Hause wäre!«
Bernhard erhob sich und betrachtete Sonnhilds verängstigtes Gesicht.
»Jungfrau,« sprach er, »wenn Ihr wüßtet, wie unsäglich ich in den letzten Tagen gelitten habe! Mir war ja so sehr bange um Euch!« Und der tiefe Ernst, der im Ton dieser Worte lag, bestätigte ihre Wahrheit.
»Auch mich, Junker, hat es nach dem Zusammensein mit Euch sehnlichst verlangt,« sagte das Mädchen blutrot und mit niedergeschlagenen Augen. »Und wie schwer ich es getragen habe, daß ich mein Versprechen nicht halten konnte! Ich durfte es nicht wagen, Euch zu begegnen. Mein Vater hat Verdacht geschöpft, oder ein mißgünstiger Aufpasser hat ihm etwas hinterbracht. Er bat mich, den Fuß so lange nicht vor die Stadtmauer zu setzen, bis er mir solches wieder erlaube. Und mein Vater ist ja so gut zu mir, Junker! Man sagt, er sei ein Eisenkopf. Aber wenn er mit mir spricht, ist er weich und liebevoll, wie eine Mutter zu ihrem kranken Kind. Junker, – ich durfte meinen Vater nicht betrügen!«
Bernhard sah Sonnhild voll Wärme an.
»Ihr tatet recht, Jungfrau,« sagte er leise, »Ihr dürft Eurem guten Vater nicht weh tun. Aber ich flehe Euch an, mir Eure Gegenwart noch einmal zu schenken. Von der Erinnerung an diese Stunde will ich dann so lange zehren, bis das Glück uns holder sein wird. Denn in[86] meinem Herzen brennt eine Flamme, Jungfrau, die mich noch verzehrt!«
Sonnhild senkte den Kopf.
»Ihr sagtet Eurem Vater zu,« sprach der Jüngling weiter, »nicht vor die Tore der Stadt zu gehen. Dieses Versprechen sollt Ihr ihm halten! Deshalb sei der Ort unserer Begegnung der Schloßberg. Die dichten Bäume am Fuße der Burg werden neidische Blicke von uns fernhalten. O – edle Jungfrau, sagt nicht nein, ich flehe darum!«
Der Klang dieser Worte schlug dem Mädchen ans Herz. Und als sie in Bernhards bittende Augen sah, war ihr letzter Widerstand besiegt.
»Sei es darum,« flüsterte sie mit schmerzlichem Lächeln, »wie könnte ich Euch etwas abschlagen, wenn Ihr so bittet. Am Dienstag zur gewohnten Stunde wartet meiner oben im Schloßhof, ganz hinten an der Mauer auf der Elbseite.«
»O – wie gütig Ihr seid,« erwiderte der Jüngling, »ich danke es Euch viele Male!«
»Doch wie konntet Ihr nur hierherkommen?« fragte Sonnhild ängstlich, sich erst jetzt der großen Gefahr bewußt werdend, in der sie schwebten.
»Den Wächter am Jüdentor bestach ich mit einem reichlichen Weingeld. Er wird mir auch zum Austritt wieder öffnen. Euer Haus fand ich offen, und als ich den Lichtschein im Hofe sah, legte ich rasch die Leiter an und gewann so das Lustgänglein. Noch konnte ich Euch ja nicht sehen und zögerte deshalb. Da verriet mir der Schlag meines Herzens Eure Gegenwart. Und so fand ich Euch,« schloß der Jüngling treuherzig.
Das Mädchen antwortete nicht, ließ es aber geschehen, daß Bernhard ihr tief in die Augen sah. Plötzlich sagte sie hastig:
»Jetzt aber geht schnell! Die Uhr steht kurz vor zehn, – der Vater möchte uns andernfalls überraschen!«
Sie führte Bernhard die Treppe hinab und setzte die Lampe auf deren unterste Stufe, daß ihr Licht den großen Hausflur spärlich erhellte.
Ein letzter Blick und Händedruck – dann wandte sich Bernhard zum Gehen. Im nächsten Augenblick prallte er zurück: er sah im Rahmen der offenen Tür die hohe Gestalt eines Mannes stehen.
Der Jüngling war heftig erschrocken. Zudem bemerkte er noch, daß Sonnhild taumelte und die Augen schloß. Dann trat der Mann näher und richtete die Blicke durchbohrend zuerst auf Sonnhild, dann auf ihn selbst. Bernhard sah in das gerötete Gesicht des Mannes, das dessen hohe Erregung verriet. Eine Weile kämpfte dieser mit sich, bis er in rauhem Tone fragte:
»Wer seid Ihr?«
»Bernhard von Miltitz,« antwortete der Jüngling, sich blitzschnell des Tages erinnernd, an dem derselbe Mund die nämliche Frage an ihn gerichtet hatte.
Der Mann zuckte zusammen, und mit großer Anstrengung fragte er wieder:
»Und was führt Euch zu dieser Stunde, was überhaupt kann Euch in mein Haus führen?«
Der Jüngling schwieg.
Eine todesbange Minute verstrich. In dem dämmrig erhellten großen Hausflur klang kein Laut. Die drei Menschen standen regungslos, als ob sie von Stein wären.
Da schrie der Mann auf:
»Ein Miltitz! – in meinem Hause! – – – zur Nacht! –«
Hier schlug seine Stimme um. Und sich gegen Sonnhild wendend, kam es nur noch mit furchtbarer Anstrengung aus seinem keuchenden Munde:
»Du …! Du …!«
In diesem Augenblick stellte sich Bernhard vor dem Wutschäumenden und sagte mit fester Stimme:
»Herr Burgemeister, alle Schuld gebührt mir. Ich drang in Euer Haus ein; niemand rief mich!«
»Bube!« keuchte Waltklinger, und es schien, als wenn er sich auf den Jüngling stürzen wolle. »Mein Kind, mein reines Kind fordere ich von dir …!«
Da flammte es in Bernhards bleichem Gesicht auf. Die Seelenqual des verzweifelten Vaters erschütterte ihn. Von tiefster Bewegung erfüllt, erwiderte er:
»Auf Euerm Kind, Herr Burgemeister, haftet nicht der leiseste Makel!«
Aber der, dem diese Worte galten, war taub dafür. Seine sinnlose Wut gewährte der ruhigen Überlegung keinen Raum. Lange nach Worten ringend, stieß er endlich aus:
»Hinaus aus diesem reinen Hause – Gewürm! Miltitze – – wir rechnen noch miteinander ab!«
Eine Sekunde lang schwankte Bernhard, ob er nicht auf die schwere Beleidigung antworten sollte. Dann gewann das Bedauern mit dem Wütenden die Oberhand. Er warf einen raschen Blick auf Sonnhild. Bleich bis in die Lippen hinein, lehnte sie an der Mauer, und in ihren[89] Augen lag ein herzzerreißendes Flehen. Das tilgte in des Jünglings Brust den letzten Zweifel. Er schritt langsam zur Tür und verließ das Haus.
Jetzt wandte sich Waltklinger zu Sonnhild. Aber noch bevor sein furchtbarer Zorn zum Ausbruch kam, trat aus dem Dunkel der Treppe eine Frau hervor, die sich mit ihrer hohen Gestalt schützend vor das Mädchen stellte. Es war Hanne, die alte Haushälterin des Burgemeisters.
»Nun ist es genug!« rief sie. »Eure Absage an den Junker durfte ich nicht stören. Dem Kinde aber werdet Ihr kein Haar krümmen! Ich habe die ganze Unterhaltung der beiden heimlich mit angehört. Es war nichts darin, was Euerm Namen, was Georg Waltklingers Tochter zur Unehre gereicht hätte. Gefehlt haben beide; die Schuld trägt der Jüngling. Euer maßloser Zorn hat sie gestraft, schwerer als sie es verdienen. – Und nun geh in deine Kammer, Sonnhild!«
Das Mädchen raffte sich zusammen und ging wie eine Nachtwandlerin die Treppe hinauf, indessen die alte Hanne die Haustür verschloß.
Aber die Wut Waltklingers hatten diese Worte nicht beschwichtigen können.
»Infame Buhlerin!« rief er.
Da richtete die Greisin ihren langen, dürren Leib hoch auf und trat vor ihren Beleidiger.
»Ihr glaubt mir nicht, Burgemeister?« sagte sie kalt. »Die Hanne dient dem Hause Waltklinger nun fünfundsechzig Jahre, und keiner hat sie je für unehrlich befunden. Aber ich gebe zu, leichtsinnig bin ich gewesen, – Jahre hindurch. Seht her, auf diesen alten Armen habe ich Euch[90] einst getragen, denn es war seit Eurer Geburt keine Mutter mehr in diesem Hause. Ihr fandet an meinem Herzen das erste Lächeln, und Euer erstes Lallen galt mir. Dann lehrte ich Euch das Beten, und Euer Kummer und Euer Weinen erstarb, wenn Ihr die Arme um meinen Hals legtet. Mit meiner schwachen Kraft behütete ich Eure Seele, und ich wachte an Eurem Bett, wenn Ihr krank wart. So wuchst Ihr heran.
Dann kam die Zeit, wo ich fehlte, – aus Liebe zu Euch!«
Georg Waltklingers Zorn hatte sich bei den Worten der Greisin gedämpft. Jetzt machte er eine Gebärde.
»Nein,« fuhr die Alte mit schwächer werdender Stimme fort, »nein, Jörg, heute müssen wir zusammen Rechnung machen! Weißt du es nicht mehr, wie du zur Hanne betteltest und ihr schmeicheltest, daß sie deine Jünglingsstreiche vor dem gestrengen Vater verbergen sollte? Wie oft habe ich nicht die halbe Nacht aufgesessen und gelauscht, damit ich das leise Klopfen an der Haustür nicht überhörte, um dich auf den Strümpfen einzulassen! Und wie ich heucheln mußte deinem Vater gegenüber! Damals schlichst du auch in Bürgerhäuser hinein, mein Jörg! Aber ob du den Haustöchtern nur solche lauteren Worte gesagt hast, wie der Junker heute abend deiner Tochter, – das, Jörg, magst du dir selber beantworten! Also rase nicht gegen dein eigen Blut. Du weißt doch, mein Junge, – die Sünden der Väter …! Aber der gute Gott hat deinem Kinde den Geist seiner Mutter vererbt. Sonnhild gleicht mit jedem Tage immer mehr deiner Maria …«
Hier kehrte Georg Waltklinger der Greisin stumm den Rücken und stampfte die Treppe hinauf.
Und wie vor fünfzig Jahren der Kopf ihres Jörg, lag heute Nacht an der treuen Brust der alten Hanne das Haupt seines schluchzenden Kindes.
Am darauffolgenden Tage saßen Ernst von Miltitz und Frau Magdalena im Familienzimmer des Schlosses Siebeneichen in ernstem Gespräch. Da klopfte es an der Tür, und gleich darauf trat Bernhard ein.
»Du ließest mich rufen, Vater,« sagte er und kam ein paar Schritte näher.
Ernst von Miltitz betrachtete den Sohn streng, während Frau Magdalena vor sich niedersah.
»Heute vormittag ist ein Schreiben an mich gekommen, dessen Inhalt eine Anklage gegen dich bildet. Nun hat sich freilich der Absender, wie ich ihn kenne, großer Zurückhaltung beflissen. Aber daß gerade der Burgemeister Waltklinger es ist, der berechtigten Grund hat, sich über dich zu beklagen, ist mir überaus peinlich.
Erst vor kurzem habe ich dir geschildert, wie schwierig mir es zuweilen wird, meine Pflichten als Amtmann zu tun, und du weißt, daß Waltklinger mein schlimmster Gegner ist. Dennoch stellst du der Tochter dieses Mannes nach. Das ist eine Unklugheit und ein Mangel an Rücksicht gegen deinen Vater. Beides hätte ich nicht von dir erwartet.«
Bernhard nagte an der Unterlippe. Der Vater hatte recht, – von seinem Standpunkt aus. Aber er ahnte ja nicht, wie es in dem Herzen seines Sohnes aussah! Er betrachtete das als Spielerei, was ihm heiliges Empfinden war.
Da sollte es schon kommen. Ernst von Miltitz fuhr fort:
»Ich halte dich mit deinen achtzehn Jahren noch für zu jung, um schon eine Liebschaft anzuknüpfen. Gewiß könntest du sagen, daß du in Dresden bereits mancherlei gesehen hast, und daß junge Männer in deinem Alter es als Zeitvertreib betrachten, Jungfrauen heimlich den Hof zu machen. Aber das ist eine Unsitte! Sie verdirbt den Charakter, hält vom Studium der ernsten Pflichten ab, die uns auferlegt sind, und verdreht einem unschuldigen Mädchen den Kopf. Deine Erziehung, Bernhard, hat dich gelehrt, solches als ein freventliches Spiel zu unterlassen. Die Abkommen alter Familien müssen sich jederzeit der hohen Verpflichtung bewußt sein, die ihnen ihr Name auferlegt. Die hervorragende Stellung des Adels wird vom Bürgerstande genug angefeindet. Wenn wir noch dazu unsern Ruf der Makellosigkeit hingeben, dann haben unsere Widersacher recht, und wir verdienen es nicht, daß sich unsere Vorfahren durch die Jahrhunderte heiß bemühten, unserm Namen den hohen Klang zu bewahren. Nicht Stellung und Besitz – der Ruf, Bernhard, ist das höchste Gut des Mannes!«
Dem Jüngling waren die Worte aus der Seele gesprochen. Aber seine Empfindungen für Sonnhild waren ja ganz anderer Art, als der Vater glaubte. Und in diesem Augenblicke wurde sich Bernhard bewußt, daß seine Neigung zu dem Mädchen tiefe Liebe war. Der Lebensernst war frühzeitig in ihm wach geworden, er hatte ihn vom Vater geerbt. Und so jung er auch war, erkannte er doch unzweifelhaft die Echtheit seiner Leidenschaft.
»Vater,« erwiderte er jetzt, »es tut mir leid, wenn ich dich betrübt habe! Verzeihe mir. Du kennst mich als[93] besonnen und weißt, daß mir gute Sitte und hohe Gesinnung unveräußerliche Güter sind. Während du zu mir sprachst, habe ich einen tiefen Blick in mein Inneres getan. Und ich weiß mich noch so rein, wie du mich immer befunden hast.«
Bernhard schöpfte tief Atem. Dann fügte er hinzu:
»Das Geschick ist gegen mich. Denn nicht nur, daß es mir seine Gunst zu dem, was ich begann, versagte, es zwingt mich auch, mit dem Bekennen meines Tuns, dich, lieber Vater, zu betrüben.«
Ernst von Miltitz hatte der Rede seines Sohnes beifällig zugehört. Bei den letzten Worten sah er gespannt auf.
»Die Tochter des Burgemeisters Waltklinger ist aufs sorgfältigste erzogen und eine Jungfrau von reinem und edlem Herzen. Ich liebe sie!«
Tiefe Stille herrschte in dem großen Zimmer. Ernst von Miltitz war von dem Geständnis seines Sohnes so überrascht worden, daß er eine Weile brauchte, ihm zu erwidern. Seine Stimme klang spöttisch, als er begann:
»Diese Rolle spielst du nicht gut, Bernhard! Gib sie auf! Denn was du da sprachst, waren die unbesonnenen Worte eines bis über die Ohren verschossenen Knaben. Aber man verliebt sich nicht in die Erstbeste.«
»Mein Vater,« erwiderte Bernhard bestimmt, »ich bin mir meines Handels völlig bewußt. Ich wiederhole, daß ich Sonnhild liebe!«
Aber Ernst von Miltitz lächelte frostig und schüttelte den Kopf.
»Zugegeben, daß es wahr wäre – im Grunde ist es aber nichts anderes als das Eintagsspiel unreifer Kinder –,[94] und wenn es so wäre, sage ich, dann wüßtest du, was deine Pflicht ist.«
»Meine Pflicht kenne ich! Ich werde sie nie vergessen! Aber ihr Bereich endet hier vor meinem Herzen. Untugend zu begehren und Sittenlosem zu frönen, wäre meiner nicht würdig. Sonnhild aber ist eine Jungfrau von makellosem Ruf und reinem Gemüt, die als Gattin heimzuführen, sich kein Edelmann zu schämen brauchte!«
»Und vergißt du ganz, wer sie ist?« fragte Ernst von Miltitz mit niedergehaltenem Zorn.
»Nein,« versetzte Bernhard, »das vergaß ich nicht. Sie entstammt einer rechtschaffenen und sehr geachteten bürgerlichen Familie. Aber sollte mich dies hindern, dem Mädchen meine Liebe zu schenken? Nimmermehr! Denn welche Mutter aus adligem Geschlecht könnte feineren Adel in die Seele ihres Kindes pflanzen, als ihn Sonnhild besitzt! Wer sie kennt, wird mein Handeln verstehen; nur die herrschenden Anschauungen unserer Kreise sind gegen mich!«
Ernst von Miltitz stand vom Stuhl auf.
»Du bist noch zu jung, mein Sohn, um dich schon zu verlieben. Auch fehlt es dir noch am richtigen Empfinden, was man mit Rücksicht auf seinen Stand unterlassen muß. Meine väterliche Obrigkeit braucht aber mit dir hierüber nicht zu verhandeln. Ich habe mich umsonst an deinen Verstand gewandt, der ist dir verliebten Toren abhanden gekommen. Bernhard, ich untersage dir den Verkehr mit dem Mädchen! Du wirst sie vergessen!«
Der Jüngling blieb hierauf stumm. Dieses Schweigen reizte den erzürnten Vater.
»Du Tropf,« sagte er, »dein Herz wird nicht in Stücke gehen. Schon morgen betrachtest du, was du heute aufgibst, als eine Laune von gestern.«
Da klang es fest und ruhig von Bernhards Mund:
»Ich liebe Sonnhild aus tiefster Seele und werde nie anders können!«
Jetzt brauste Ernst von Miltitz auf:
»Widerspruch gegen mein Gebot? Weißt du jetzt selbst nicht mehr, daß die vornehmste Pflicht eines Kindes gegen die Eltern der Gehorsam ist? Wage es nicht, meinem Willen zu trotzen!«
Diese scharfe Zurechtweisung verletzte Bernhard tief. Aber die Hochachtung vor der väterlichen Macht verhinderte ihn, dies auszusprechen.
»Versprich mir,« versetzte Ernst von Miltitz, »daß du dich dem Mädchen nie wieder nähern wirst!«
Bernhard richtete den Blick fest auf den Zürnenden und antwortete:
»Vater, – das vermag ich nicht zu versprechen.«
Bis jetzt hatte Frau Magdalena an sich gehalten. Nun rang sie die Hände ineinander, und ihre Blicke suchten die Augen des Sohnes. Bernhard sah es, aber er zuckte nur stumm mit den Achseln.
Ernst von Miltitz' Zorn wuchs durch den Widerstand. Der Jüngling hatte seinen Vater noch nie so erregt gesehen, und er ahnte einen heftigen Ausbruch, den er mit großer Beherrschung über sich ergehen lassen wollte.
»Du kannst mir dein Wort nicht geben?« rief Ernst von Miltitz mit zornbebender Stimme. »Einfältiger Knabe! Begreifst du nicht, daß es dich nach etwas ganz anderem verlangt, als nach dem Herzen des Mädchens?«
Bernhard schwieg. Er empfand heimliche Befriedigung darüber, daß er seine Beherrschung behielt. Der ihn so verletzte, war sein Vater! Von ihm durfte er keine Rechenschaft fordern!
»Und das Mädchen,« klang des Zürnenden Stimme wieder, »es wird nicht so töricht sein wie du. Darf sie nicht die Braut eines Miltitz werden, so kann sie doch seine Geliebte sein …«
»Vater!« schrie Bernhard in diesem Augenblick schneidend auf und flog auf den Sprecher zu. Ernst von Miltitz stand unbeweglich. Aber sein Blick ging nach den Degen, die ihm zur Seite an der waffengeschmückten Wand hingen.
So standen sich Vater und Sohn gegenüber. Ernst von Miltitz mit gekünstelter Ruhe, Bernhard in leidenschaftlicher Erregung, mit totenbleichem Gesicht und funkelnden Augen. Doch währte es kaum eine Sekunde, dann war die Leidenschaft verflogen.
Bernhard fühlte tiefe Beschämung und ging mit gesenktem Kopf bis zur Tür zurück. Doch auch Ernst von Miltitz hatte angesichts der drohenden Haltung seines Sohnes die verlorene Beherrschung rasch wiedergefunden. Er wußte sich schuld an dem häßlichen Auftritt. Deshalb sprach er auch kein Wort mehr darüber, sondern trat an das Fenster und sah eine Weile schweigend hinaus.
Endlich wandte er sich um und sagte in scheinbar gleichgültigem Tone:
»Kaiser Karl weilt wieder einmal in Worms. Der Herzog beabsichtigt, Caspar von Carlowitz an das kaiserliche Hoflager zu senden, um der Majestät seine gleichbleibende Ergebenheit und seine Standhaftigkeit im alten[97] Glauben von neuem zu versichern. Du wirst den herzoglichen Abgesandten als Junker dahin begleiten. Ich habe mit Vetter Carlowitz bereits alles verabredet. In drei Tagen gehst du nach Dresden und meldest dich in der Hofkanzlei, woselbst die Pässe und Vollmachten für Euch geschrieben werden. Vor deiner Abreise spreche ich dich noch!«
Bernhard vernahm dies alles wie im Traum. Das gestrige Erlebnis hatte ihn schon erschüttert, und nun der heutige Tag! – Er verneigte sich stumm und begab sich auf sein Zimmer.


Auf der Ostseite des Markgrafenschlosses fällt der hohe Syenitfelsen in einer steilen Lehne ab. Diese mit Bäumen bewachsene Fläche hieß der Tiergarten. An dieser Stelle stand hinter einem Vorsprung der Grundmauer des Schlosses Sonnhild und schaute hinab.
Zwischen den Rebenstöcken drüben auf dem Ratsweinberg liefen Winzerinnen geschäftig hin und her, und die weißen Tücher, die sie um den Kopf geschlungen, tauchten in dem saftigen Grün abwechselnd auf, um nach einer Weile wieder zu verschwinden.
Auf der hölzernen Elbbrücke mit den beiden Torhäusern über den Brückenköpfen gingen und standen Menschlein, die von der Höhe aus so klein erschienen wie Finger. Den Strom zogen langsam schwerbeladene, mächtige Holzkähne hinunter. Sie kamen zum Teil aus Böhmen, zum andern Teil bargen sie Erzeugnisse der meißnischen Handwerkskunst und trugen diese nach den Seehäfen. Am Rande des Stroms klapperten lustig Getreide mahlende Schiffmühlen, die bei einer Belagerung der Stadt von der Mauer aus sorgfältig beschützt wurden, da man ihrer nicht entbehren konnte.
Am Fuße des Abhangs, gleichlaufend mit dem Strom, stand die Stadtmauer. Sie war aus schweren Granitblöcken gebaut und wurde von steinhartem Mörtel zusammengehalten. Ihre Höhe betrug an die zehn Ellen und zwei Ellen ihre Stärke. Stromabwärts, wo die Mauer nach der Nordseite zurücksprang, war das Wassertor, das wie alle andern Stadttore starke Flügel besaß, mit schweren Eisenbeschlägen, Schlössern und Ketten. Darüber erhob sich der mit Ziegeln abgedeckte, die Wohnung des Torwächters enthaltende Stadtturm.
Sonnhild sah dies alles, aber es machte keinen Eindruck auf sie. Nur stromaufwärts richtete sich zuweilen ihr Blick, dahin, wo sie hinter Bäumen verborgen Siebeneichen wußte.
Da hörte sie leichte Tritte, und gleich darauf trat Bernhard hinter der Mauerecke hervor. Bei Sonnhilds Anblick blieb er stehen, und sie sahen sich eine lange Weile stumm in die Augen. Dann trat er heran und reichte ihr die Hand.
»Bernhard,« sagte das Mädchen in schmerzlichem Ton.
Der Jüngling preßte die Lippen aufeinander und erwiderte nichts.
»Wie jubelte es doch noch vor kurzem in meinem Herzen«, klagte Sonnhild, »heute ist es still darin. Das Schicksal ist uns mißgünstig …«
»Wir werden ihm trotzen!« fiel Bernhard ein und warf den Kopf in den Nacken.
»Jungfrau,« fuhr er fort, »ich danke Euch für Eure Worte, die Ihr soeben gesprochen. Bestätigen sie mir doch, daß auch Euer Herz von dem bewegt ist, was ich fühle.«
Sonnhild fuhr bestürzt auf. Denn ihr ward bewußt, daß sie ihr zartes Geheimnis verraten hatte.
»Junker,« stammelte sie, »um Gottes willen, was sprechen wir. Nein, es darf nicht sein. Die tiefe Abneigung der beiden Stände voreinander, denen wir angehören – der Haß – – –«
»Sonnhild,« versetzte der Jüngling mit Ernst, »sprecht nicht also, ich bitte Euch! Was uns trennend im Wege steht, ist nichts anderes, als ein schlimmes Vorurteil. Wie lange noch, und die sich heute so bitter bekämpfen, werden nicht mehr verstehen, warum sie dies einst getan. Adel und Bürgertum werden noch einmal die Schranke zwischen sich niederreißen und sich versöhnen. Dann erst können sie die großen Aufgaben lösen, die ihnen gemeinsam gesteckt sind.«
»Wie edel Ihr seid,« antwortete Sonnhild. »Aber wann wird dies eintreten? Die Abneigung ist ja so tief eingewurzelt. Und dazu der grimme Glaubenshader!«
»Wir beten alle zu einem Gott,« sagte Bernhard, »und wer ihn aus tiefem Herzen verehrt, der allein dient ihm wahrhaftig.«
Das Mädchen vermochte nicht, zu erwidern. Aber ein innig dankbarer Blick lohnte die Worte des Jünglings.
»Man hält uns für Kinder, Sonnhild, und was wir tun, für kindisches Spiel. Aber sie wissen nicht, wie sie irren. Zeigen wir es ihnen, daß wir stark sind im Beharren und daß wir dulden können. Heute ist unser Himmel trübe, aber wir werden auch wieder die Sonne an ihm heraufziehen sehen!«
Des Mädchens Brust arbeitete heftig.
»Junker!« rief sie plötzlich, »nein, nicht diese Worte! Mein Vater ist unversöhnlich. Er würde nie erlauben – – –«
»Euer Vater? Wohl ist er heftig gewesen, und ich habe seinen Zorn schwer empfinden müssen. Aber ich habe ihm das verziehen. Denn das Heil seines Kindes steht ihm über allem. Und er ist ja Euer Vater!«
Da ergriff Sonnhild beide Hände des Jünglings und drückte sie warm.
»Mein Vater gleicht dem Euern,« fuhr Bernhard fort. »Er hat mich streng gescholten, als er es erfuhr, und es ist zu einem Auftritt gekommen, so schlimm, daß ich zeit meines Lebens erröten werde, wenn ich daran denke. Aber auch bei ihm ist väterliche Liebe der Grund zu seinem Zorn gewesen. – Ach, wenn nur die Anschauungen nicht so verblendet wären!«
Von Traurigkeit erfüllt, schwiegen sie und sahen hinab auf den Strom, auf dessen Rücken die breiten Schiffe schwammen, und auf die Brücke, über die gerade eine Herde Vieh getrieben wurde, denn es war heute wieder Markttag, und auf die sanften Hügel elbaufwärts, die vom hellsten Grün bis zum dunkelsten Braun in reichster Farbenpracht prangten. Glanz und Flimmern erfüllte die Luft, und auf dem schmalen Streifen Wiese zu ihren Füßen gaukelten schillernde Schmetterlinge von Blume zu Blume. Die Sonne schien von hinten her auf das Schloß, dessen kolossalen Schatten mit seinen scharf abgegrenzten Rändern weithin werfend.
»Sonnhild,« sagte Bernhard, »wißt Ihr, was mein Vater für mich bestimmt hat? Ich soll einen Abgesandten des Herzogs nach Worms an den kaiserlichen Hof begleiten. Übermorgen schon reise ich.«
Das Mädchen krampfte die Hände zusammen, antwortete aber nicht.
»Jeder meiner Altersgenossen wird mich darum beneiden. Und wenn dieser Auftrag mir geworden wäre, bevor ich Euch wiedergesehen, hätte er mich mit Stolz erfüllt. Heute macht er mich traurig. Denn die Wahl ist nur auf mich gefallen, damit ich für längere Zeit von der Heimat entfernt werde. Ich soll Euch vergessen. Aber Sonnhild,« versicherte der Jüngling mit überquellender Wärme, »ich werde Euch nie vergessen!«
Da raffte sich das Mädchen auf.
»Nein, Bernhard,« sprach sie mit Festigkeit, »Ihr dürft nicht also sprechen! Preist diese Sendung als ein Glück und heißt sie willkommen. Die lange Trennung wird uns über die schwerste Zeit hinweghelfen. Weiltet Ihr hier, so würden sich unsere Herzen nicht beruhigen, weil eines die Nähe des andern immer fühlen müßte.«
Hier schwieg das Mädchen und wurde blutrot, daß sie so geplaudert.
»Liebe Sonnhild,« erwiderte Bernhard mit Bestimmtheit, »mein Herz wird sich immer nach dem Euern sehnen, und wäre ich noch so weit von Euch entfernt.«
Die Verwirrung des Mädchens wuchs bei diesen Worten, und sie wandte ihr glühendes Gesicht ab. Da konnte der Jüngling nicht mehr an sich halten. Er ergriff Sonnhilds Hand und bat:
»Scheltet mich nicht, wenn ich so spreche. Ach, wenn Ihr wüßtet, Jungfrau, wie es um mich steht! Alles, was gut ist in mir, gehört Euch. All meine Gedanken weilen am liebsten in Eurer Nähe, und wenn ich bei Euch sein darf, und wenn ich in Eure lieben Augen schaue – – –«
»Haltet ein, Bernhard!« rief das Mädchen mit fliegendem Atem, »was sprecht Ihr! Schonet meiner!«
»Nein,« fuhr der Jüngling mit gesteigerter Erregung fort, »laßt es mich einmal sagen, was ich für Euch empfinde. Die Riesenlast möchte mich sonst noch erdrücken. Sonnhild, ich liebe Euch mit meinem ganzen Herzen, mehr, als ich Vater und Mutter liebe, und Euch zu besitzen, wäre mir das höchste Glück auf Erden!«
»Aber es darf doch nicht sein!« schrie Sonnhild gequält auf.
»Vergeßt einmal alles,« bat Bernhard in weichem Tone, »was uns scheidet, und sprecht das aus, wozu das Herz Euch drängt. Ach, sagt es mir doch nur ein einziges Mal, wonach meine Seele bangt.«
»Bernhard, lieber Bernhard,« flehte Sonnhild mit rührender Stimme, »seid stark!«
Und er sah, wie ihre Lippen zuckten, und wie ihre Augen umflort waren. Sie war ein tapferes Mädchen und bezwang sich besser als er!
Sonnhild mußte alle Kraft zusammennehmen, um ihre Rührung zu bekämpfen.
Da bemerkte sie die tiefe Niedergeschlagenheit Bernhards. Und als sie ihn heimlich noch einmal ansah, liefen ihm zwei dicke Tränen über die Wangen. Aber sie wollte standhaft bleiben. Dann handelte sie, wie es ja auch für ihn das beste war.
Sonnhild wandte sich ab und tat, als ob sie die Tränen des Jünglings nicht bemerke. Sie fühlte in ihrer Brust einen nagenden Schmerz, und sie mußte an sich halten, daß sie nicht verzweifelt schrie: »Bernhard, ich kann ja nicht leben ohne dich!«
Minuten vergingen in lautlosem Schweigen. Endlich hob Bernhard an:
»Sonnhild, wollen wir nicht du zueinander sagen, wenn wir uns wieder begegnen?«
»Ja, Bernhard,« antwortete das Mädchen freudig, »seien wir fortab Freunde. Nimm mein schwesterliches Du!«
»Ich danke dir, Sonnhild,« sprach der Jüngling bewegt. »Aber nun bitte ich noch um eins: übermorgen reise ich. Sonnhild, ich gehe weit fort. Auf wie lange, weiß ich nicht. Möchtest du mir nicht morgen noch ein einziges Viertelstündchen schenken, daß wir uns Lebewohl sagen?«
Das Mädchen schrak zusammen. Heute hatte sie ihr Herz bezwungen, ob ihr dies noch einmal gelingen würde …?
»Ach, Bernhard« stammelte sie bestürzt, »steh davon ab. Ich bitte dich darum. Es ist des Schweren nun genug für uns!«
»Sonnhild,« antwortete er leise, und sein ganzes Herz lag in der Stimme, »gewähre mir diese letzte Bitte! Laß uns morgen Abschied nehmen.«
Das Mädchen schlug die Hand auf die Augen und wandte sich ab. Da ergriff er ihre Rechte, und sie fühlte sein flehendes Verlangen noch einmal im Druck seiner Hand.
»Wenn du es wünschest, Bernhard, so sei es,« sprach sie leise.
Darauf gingen sie stumm auseinander.
Am nächsten Tag schritt Bernhard mit schwerem Herzen den Hohlweg hinauf. Sein Gesicht zeigte die Spuren[105] starker seelischer Erregung, sein Gang war müde. Er hatte die letzte Nacht wachend auf seinem Lager zugebracht. Liebte ihn Sonnhild nicht? Doch, er fühlte es. Aber sie konnte ihr Herz bezwingen.
Bernhard empfand leise Scham, wenn er daran dachte, was für ein starker Charakter das Mädchen war. Und er war fest entschlossen, heute keine Schwachheit zu zeigen.
Als er den Ausgang des Hohlwegs erreicht hatte, stand geradeaus am Stadttor das Judenmädchen, ihm den Rücken zuwendend. Ob sie in den jüngst vergangenen Tagen, wo er nicht vor das Tor gegangen, seiner geharrt?
Aber ebenso rasch, wie dieser Gedanke Bernhard gekommen, entschwand er ihm wieder. Er bog links ab zur Schloßfreiheit und kam zum Afrakloster. Als er dieses erreicht hatte, trat ein Priester aus der Tür, angetan mit dem Meßgewand und in den Händen das Kruzifix und den Kelch mit der Hostie. Er befand sich auf einem Versehgang, daß er einem Sterbenden sein letztes Stündlein erleichtere. Die beiden Ministranten gingen voran. Und da gerade ein paar Leute des Wegs kamen, ließen sie die Klingeln ertönen. Aber die Männer beugten das Knie nicht, sondern schritten mit abgewendeten Blicken vorüber. Es waren Lutherische. Bernhard kniete jedoch nieder. Und als ihm der Priester das schwarze Kreuz entgegenhielt, küßte er entblößten Hauptes die silberne Gestalt des Erlösers. Alsdann faltete er die Hände, neigte das Haupt darüber und flüsterte: »Hilf uns, heilige Maria, Gottesmutter, in unserem schweren Herzeleid!«
Darauf schritt der Mönch die Stufen des Steigs hinunter, während Bernhard am Schleinitzer Hof vorbei über[106] die hohe Brücke ging, deren gewaltiger steinerner Bogen, den Hohlweg überspannend, den Schloßberg mit dem Afrafelsen verbindet. So kam er zum Burgtor, durchmaß den kleinen Schloßhof und ging dann am Kornhaus vorbei quer über den Domplatz.
Vor dem Domkeller zu seiner Rechten standen ein paar Handelsjuden, die mit lauten Worten und unter lebhaften Gebärden ein Geschäft abschlossen. Die Domherrenhäuser, die Dechanei und das bischöfliche Wohnhaus lagen in tiefster Ruhe.
Im Vorbeischreiten warf der Jüngling träumend den Blick auf das Schloß und auf die hohen Fenster des alten Doms. Dann gelangte er auf den hinteren Schloßhof. Da blieb er stehen und schaute zurück, ob kein neugieriges Auge ihm folge. Aber er sah keinen Menschen. Oder täuschte er sich? War dort hinter der Ecke des Doms nicht blitzschnell eine flüchtige Gestalt verschwunden? Bernhard schalt seine Phantasie. Nun sah er schon am hellichten Tage Gespenster!
Mit raschen Schritten gewann er den lauschigen Platz. Da stand wie gestern Sonnhild und wartete.
Das Mädchen kam ihm ein paar Schritte entgegen, und sie begrüßten sich. Sonnhild sah bleich aus, und tiefer Ernst lag auf ihrem Gesicht. Sie betrachtete den Jüngling forschend und fragte endlich:
»Bist du krank, Bernhard?«
»Nein, Sonnhild,« erwiderte er, »nur der Schlaf und die Lust am Essen fliehen mich. Nun ich bei dir bin, ist ja alles gut.«
Das Mädchen antwortete nicht.
»Wie der Tag doch wieder herrlich ist,« sagte Bernhard und schaute versonnen in den goldenen Glanz, der auf den Weinbergen und über den Fluren lag. »Das eine bleibt mir, und wenn ich auch noch so weit von dir sein werde: die Sonnenstrahlen, die dich wärmen, kommen auch zu mir. Und wenn ich in wachen Nächten an meinem Fenster sitze und zu den Sternen aufsehe, dann werde ich Trost in dem Gedanken finden, daß auch deine Augen diese Sterne erblicken.«
»Bernhard,« sagte Sonnhild leise, »es ist besser, wenn du die schönen Stunden, die wir zusammen verlebt haben, bald vergißt. Zerquäle deine Brust nicht. Laß das Neue auf dich wirken. Du wirst andere Länder und Menschen sehen und viel Herrlichkeit und Pracht. Auch an andern Mädchen wird es nicht fehlen, die viel schöner sein werden, als ich. Und du wirst nicht mehr begreifen, wie du mich einst begehren konntest.«
Der Jüngling schüttelte mit abgewandtem Gesicht den Kopf.
»Wohl bin ich noch jung,« versetzte er langsam, »aber ich fühle eine Lebensreife in mir, die höher ist als meine Jahre. Darum ist das, was ich empfinde, die Überzeugung eines Mannes, der sich geprüft hat. Gefühle, so heilig und stark, wie sie mich jetzt erfüllen, können für eine andere nicht noch einmal erwachen. Mein Herz wird sich verhärten, und die frühlingsjungen Pflänzlein, die in ihm sprießen, werden verdorren bis zur Wurzel.«
»Sieh, Bernhard,« sagte Sonnhild mit tiefem Weh in der Stimme, »es muß aber doch sein!«
»Ich bin nicht davon überzeugt. Starke Liebe, die treu und wahr ist, überdauert alle Stürme des Lebens!«
Sonnhild wollten die Sinne schwinden, und jeder Blutstropfen wich aus ihrem Gesicht. Aber sie blieb stumm.
»Morgen zu dieser Stunde sind wir schon weit von Dresden entfernt,« sagte Bernhard in Gedanken verloren. »Und in acht Tagen? Wer mag es wissen. – Aber ich bin heute nicht gekommen, um noch einmal zu klagen,« fuhr er mit Festigkeit fort. »Jetzt heißt es kämpfen. Täglich und stündlich mit der Macht ringen, die dem beschwichtigenden Verstand und dem wohltätigen Vergessen trotzt. Doch – schweig' ich still davon …«
Ein düstrer Zug umspielte die Lippen des Jünglings und gab seinem bleichen Gesicht etwas Herbes. Während der letztverwichenen fünf Jahre hatte ihn die Erinnerung an Sonnhild nie verlassen. Wie eine überirdisch schöne Erscheinung war ihr Bild in seiner Seele heraufgestiegen, wenn sich der ernste Jüngling inmitten seiner anders gearteten Altersgenossen einsam gefühlt hatte. Und dann war nach all dem langen Hoffen und Harren das heiße Sehnen erfüllt, der herrliche Traum war zur Wirklichkeit geworden.
Diese Erfüllung war auf seinen Lebensweg wie strahlender Sonnenschein gefallen, dessen milde Wärme er bis ins Innerste gespürt. Dem Mädchen hatte sein ganzes Denken, hatten seine edelsten Empfindungen gegolten!
Nun war alles aus! Rasch war das Glück gekommen, wie ein glänzendes Himmelslicht in dunkler Nacht, – und ebenso rasch war es wieder verschwunden. Er sollte Sonnhild vergessen …
Bernhard empfand unsägliche Bitterkeit bei diesem Gedanken.
Da sah er auf: in Sonnhilds Augen standen Tränen. Das tapfre Mädchen! Auch sie bewegte der Abschied tiefinnerlich.
Er nahm ihre Hand in die seine und sagte gerührt:
»Sonnhild, ich sehe, wie du leidest. Ich will dir den Schmerz der Abschiedsstunde verkürzen. Laß uns Lebewohl sagen.«
Sie versuchte sich zu fassen und drängte die Tränen zurück. Da schloß sie plötzlich die Augen, und ihr jungfräulicher Körper bebte so stark, daß Bernhard sie umfing. Und als ihr Kopf mit dem kummerbleichen Gesicht und dem goldglänzenden Haar willenlos an seiner Brust lehnte, flüsterte sie:
»Bernhard, – mein Bernhard, – ich liebe dich ja über alles!«
Da schoß es heiß nach dem Herzen des Jünglings, und in seine Augen trat ein seltsamer Glanz.
»Sonnhild,« fragte Bernhard eindringlich, »vergißt du auch nicht das schier Unüberwindliche, das zwischen uns steht?«
»Nein, ich vergaß es nicht,« flüsterte sie, »aber zwischen unserer Liebe soll nichts stehen!«
Da drückte er das zitternde Mädchen an seine Brust, und ihre Lippen fanden sich zum ersten Kuß.
»Bernhard,« sagte Sonnhild, sich aufrichtend, »ich konnte dich nicht so ziehen lassen. Nun werde ich stark genug sein, die Trennung zu ertragen. Meine treue Liebe wird dich begleiten und mein Gebet dich beschützen.«
In seligem Empfinden zog Bernhard das Mädchen von neuem an sich.
»Mein Geliebter,« sprach Sonnhild innig, »wir wollen Geduld üben. Welch wunderbare Fügungen sendet zuweilen der Himmel! Mag es noch so schwer erscheinen. Wahrhafte Liebe – du sagtest es bereits – überwindet alles!«
Da vernahmen sie ein leises Brechen von Zweigen. Und wie sie rasch die Umarmung lösten und sich umwandten, blickten sie eine Sekunde lang in ein Frauenantlitz, das so blaß und verzehrt war, wie das Gesicht eines schwer leidenden Menschen. Aber die großen, blauen Augen unter dem pechschwarzen Haar glühten vor innerm Feuer. Dann schlug das Gebüsch wieder zusammen, und die Erscheinung war verschwunden.
»Wer war das?« fragte Sonnhild in banger Besorgnis.
»Ängstige dich nicht, mein Lieb,« antwortete Bernhard begütigend. »Ein junges Judenmädchen war es, dem ich wiederholt begegnet bin, als ich vergebens vor das Stadttor ging.«
Sonnhild atmete erleichtert auf.
»Hast du die drohenden Augen gesehen?« fragte sie, sich das Haar aus der Stirne streichend.
»Du bist erregt, liebste Sonnhild,« antwortete Bernhard beklommen. »Das Mädchen starrt immer so.«
Und wieder fiel ihm die Ähnlichkeit dieser Augen mit denen Sonnhilds auf.
»Geh mit Gott, mein Geliebter,« sagte Sonnhild und schmiegte sich an Bernhards Brust. »Was nun auch kommen mag, – unsere Liebe soll sich als stark und wahr erweisen.«
»Du inniggeliebtes Mädchen! Nicht Raum noch Zeit[111] können unsere Liebe vermindern. Und so stark die Stürme auch brausen mögen, wir werden allem trotzen!«
Sonnhild zog einen schmalen Reif ab und steckte ihn an seinen Finger. Hierauf legte sie noch einmal ihre Hand in die seine. Ein letzter, langer Blick – dann stand Bernhard allein. Wohl fühlte er, wie ihn der Abschied tief betrübte. Aber die Traurigkeit, mit der er gekommen, war verschwunden, und die Hoffnung auf einen glücklichen Ausgang aus diesem Wirrsal erfüllte ihn.
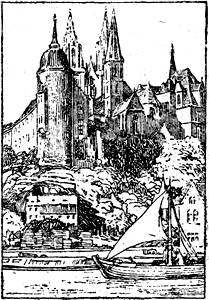

Das deutsche Volk hat bange Zeiten durchleben müssen, bevor es sich seine Einheit und Machtstellung und damit den langjährigen, segensreichen Frieden erkämpft hat. Einen der denkwürdigsten Abschnitte seiner Entwickelung bildet die Zeit dieser Erzählung.
Wohl hatte draußen der deutsche Namen einen guten Klang. Aber im Innern des Landes nahm der Kampf kein Ende. Starke Mächte wüteten gegeneinander, und das Eisen und die Seuchen hatten furchtbar aufgeräumt. Der Landadel mißbrauchte vielenorts seine Gewalt, daß die bäuerliche Bevölkerung unter dem schweren Druck seufzte. Dazu trat der nicht endenwollende Streit der Fürsten untereinander, die sich mit Haß und Krieg verfolgten. Die glänzenden Erfolge der gewerbfleißigen Städte wurden von den Adligen mit Mißgunst betrachtet. Der Wohlstand des Bürgers war ihnen ein Dorn im Auge, und sein Selbstbewußtsein und seinen Stolz erwiderten sie mit Verachtung.
Neben diesem erbitterten weltlichen Hader lastete schwere Kümmernis auf den Seelen der Menschen. Schon lange war von vieler Mund der Ruf erklungen, die Kirche an Haupt und Gliedern zu verbessern und den Mißbrauch zu[113] beseitigen, den sie trieb. Aber diese Stimmen blieben von den Päpsten ungehört. Die Abgaben an die Kirche wuchsen von Jahr zu Jahr und bildeten eine drückende Bürde für das Volk. Der höhere Klerus strebte nach weltlicher Macht. Die fürstliche Prachtentfaltung, die er übte, und sein Schwelgen in sinnlichem Genuß brachten es mit sich, daß er das Wirken für die Lehre des Evangeliums vernachlässigte.
Die niedere Geistlichkeit fühlte kaum noch die schwachen Zügel dieses Regiments. Viele wurden träge, vernachlässigten ihre Pflichten als Seelsorger und warfen sich der Sittenlosigkeit in die Arme. In den Klöstern machte sich das Laster breit, daß die schamlosesten Vorgänge dem Volke bekannt wurden.
So war es um die verordneten Diener der Kirche bestellt!
Ein großer Teil der Bevölkerung war tief verstimmt. Bangigkeit lastete auf dem geistigen Leben, und die Herzen der Menschen litten schwer unter der ungestillten Sehnsucht nach der ewigen Liebe und zerquälten sich in bangem nach Gott Suchen.
Die Not war auf das höchste gestiegen, als von Wittenberg her eine Stimme erklang, der das ganze Volk mit verhaltenem Atem lauschte. Der Kapuzinermönch Doktor Martin Luther erhob laut Einspruch gegen die unhaltbaren Zustände, unter denen er die wahre Religiosität der Menschen gefährdet sah. Und Hunderttausende jubelten dem Unerschrockenen zu, als er sich den Schmeicheleien verschloß, mit denen der Papst ihn von weiteren Schritten gegen die Kirche abhalten wollte.
Des kühnen Mönchleins kernhafte Schriften und Reden[114] zündeten in Millionen deutschen Herzen. Wonach man seit Jahrzehnten gebangt, was man unklar empfunden, hier wurde es deutlich ausgesprochen. Eine große Partei entstand, die sich für Luther erklärte und die dessen weiteres Wirken mit Spannung verfolgte. Die Studentenschaften scharten sich zuerst um das neuentrollte Banner, auf dem der Kampf für die Freiheit des Geistes in goldenen Lettern geschrieben stand. Dann folgten die Städte und endlich das breite Land.
Wie auf Sturmesflügeln eilte die Botschaft durch die deutschen Lande, daß der beherzte Reformator Papst und Kaiser getrotzt, indem er auf dem glänzenden Reichstage zu Worms vor einer großen Anzahl von Fürsten und hohen Würdenträgern der Kirche in gewaltiger Rede seine neue Lehre verteidigt hatte.
Begeisterung riß das Volk hin, und endloser Jubel brach allerorts aus. Man fühlte: es waren Ketten abgefallen. Und vom Knäblein bis zum Greis sprachen die Menschen wie ein Gebet das herrliche Wort: »Hier stehe ich, ich kann nicht anders, Gott helfe mir. Amen!«
Wohl begann noch einmal ein großes Streiten, bevor die erhitzten Geister zur Ruhe kamen: der Bauernkrieg loderte auf, und auch die Fürsten zogen aufs neue vom Leder. Aber bei diesen Kämpfen und allen feindseligen Anfechtungen erstarkte die neue Kirche immer mehr und entwickelte sich zu einem unüberwindlichen Bollwerk gegen ihre Widersacher. Zahlreich waren die Übertritte. Kurfürst Friedrich der Weise von Sachsen war der erste deutsche Fürst, der mit seinem ganzen Volke die neue Lehre annahm. Andere folgten. Besonders groß war der Eifer im Bürgerstand.
Die herzoglichen Sachsen sahen mit scheelen Augen nach Dresden, wo ihr Landesherr, Herzog Georg, den die Nachwelt den Bärtigen nennt, seinen Hof hatte. Dieser Fürst wollte nichts von dem neuen Evangelium wissen.
Die beiden Söhne des Herzogs waren gestorben. Damit nun das Land nicht an seinen eifrig protestantischen Bruder Heinrich falle, hatte Herzog Georg ein Testament errichtet, wonach Sachsen nur unter der Bedingung Heinrich vererbt werde, daß dieser den alten Glauben unangerührt lasse. Andernfalls sollten der Kaiser und König Ferdinand das Herzogtum erhalten.
So lagen die Verhältnisse um die Zeit, da Bernhard von Sonnhild Abschied genommen hatte. Wie alle andern Städte des Herzogtums, grollten auch die Bewohner Meißens ihrem Landesfürsten. Denn mit Ausnahme weniger war das ganze Land für die neue Lehre. Aber es wollte kein Hoffnungsschimmer heraufdämmern, daß das heiße Sehnen des Volkes gestillt würde.
Da eilte die überraschende Kunde von dem schnellen Tode des Herzogs Georg durch Sachsen. Darauf hörte man, daß Herzog Heinrich sich von seinem Aufenthaltsort Freiberg nach Dresden begeben habe, wo er das allgemein bekannte Testament vorfinden mußte.
Würde er die Regierung antreten oder das Land fremden Machthabern überlassen? Für die durch des Verstorbenen letzten Willen gesicherte Beibehaltung des alten Glaubens war es gleich, wie er sich entschied. Aber allenthalben ward der Wunsch laut, daß das angestammte Fürstenhaus dem Herzogtum erhalten bleiben möchte. Denn im[116] Grunde war das sächsische Volk den Wettinern ehrlich zugetan.
Noch waren erst wenige Tage seit der Todeskunde verstrichen, als eine neue Nachricht von Dresden kam, die das Land geradezu alarmierte. Herzog Georg, so hieß es, habe zwar das Testament ausfertigen lassen, aber die Vollziehung sei von ihm hinausgeschoben worden. Nun habe ihn sein plötzlicher Tod daran verhindert, die Urkunde zu unterschreiben und sie damit rechtskräftig zu machen. Herzog Heinrich sei der gesetzmäßig Erbe, und keine Beschränkung hindere seinen Willen.
Da brach unter der Bevölkerung großer Jubel aus, der sich erneute, als die Bestätigung dieser Nachricht eintraf. Denn niemand zweifelte daran, daß der zum neuen Glauben treu stehende Herzog Heinrich die Wünsche des Volkes erfüllen würde.
An den Rat der Stadt Meißen aber kam in diesen Tagen eine Verordnung des neuen Regierenden, wonach der Verstorbene an der Seite seiner Vorgänger im Dom beigesetzt werden sollte.
Burgemeister Waltklinger berief sogleich die Ratmannen zur Versammlung, und man beriet die Feierlichkeiten, mit denen die Stadt dem verstorbenen Landesfürsten die letzte Ehre erweisen wollte. Aller Hader war verstummt. Der Tod hatte die Zwietracht ausgelöscht.
Die Gassen, die der Zug berühren mußte, wurden gründlich vom Schmutz gereinigt. Denn zu Zeiten des Mittelalters war in den Städten die Gasse der natürliche Abladeplatz für allen Abfall, der im Hause entstand, und der Tummelplatz des lieben Stadtviehs. An diese Unreinlichkeit hatten sich die Bewohner so gewöhnt, daß nur bei hohem Fürstenbesuch[117] gründlich aufgeräumt wurde, – doch durfte solcher nicht öfter als einmal im Jahre kommen. Erschien hingegen der Landesherr in kürzeren Zeiträumen, so mußte er sich's gefallen lassen, wenn sein Wagen, wie der jedes andern Sterblichen, bis zu den Achsen der Räder in dem Morast versank.
Als der Tag herangekommen, hatte sich die ganze Einwohnerschaft in Festkleidern vor den Häusern versammelt. Die Gilden und Innungen waren mit umflorten Fahnen aufmarschiert und bildeten eine Ehrengasse für den toten Herzog. Der Burgemeister und die Ratmannen, angetan mit ihrer feierlichen Amtstracht und goldenen Ketten, empfingen die Leiche am Stadttor und schritten ihr vorauf bis zum Dom. Langsam bewegte sich unter großem Gepränge der Zug durch die Gassen, während die Stadtpfeifer Trauermelodien aufspielten.
Vor dem Dom angekommen, war der Stadtrat unschlüssig, ob er das Gotteshaus zur Teilnahme an der Totenfeier betreten sollte. Da aber der Burgemeister und die Ratmannen ihren Herzog, den sie als guten Lutherischen kannten, der Leiche hinterdrein schreiten sahen, folgten auch sie ins Innere.
Da ward plötzlich allen Teilnehmern eine große Überraschung. Kaum war der Sarg auf dem schwarzumkleideten Katafalk vor dem Hochaltar niedergesetzt worden, als Herzog Heinrich noch vor Beginn des Gottesdienstes den Dom wieder verließ. Der Stadtrat und ein großer Teil der Versammlung schloß sich ihm an.
Das war eine deutliche Kundgebung des Herzogs für seine Stellung als regierender Landesfürst zum neuen Glauben. Die Bürgerschaft Meißens frohlockte, wenn sie[118] an die Zukunft dachte, und die Nachricht von dem Geschehnis flog pfeilschnell durch das Land.
Jeder fühlte, daß eine neue Zeit anbrach. Ein weiterer Vorbote ließ nicht lange auf sich warten.
Die katholische Partei mit der Geistlichkeit an der Spitze beabsichtigte, zu Ehren des verstorbenen Fürsten den Dreißigsten besonders glanzvoll zu begehen. Da erhielt der Amtmann Ernst von Miltitz eine Verordnung des Herzogs, daß die beabsichtigte Zeremonie zu unterlassen sei.
Dieses Verbot bildete eine empfindliche Niederlage für die Anhänger des alten Glaubens, besonders aber für den Klerus. Bisher hatten seine Mühlen lustig geklappert, – der Wind von Dresden her war immer günstig gewesen. Herzog Georg hatte sich als verläßlicher Anhänger und Beschützer der Kirche erwiesen, und durch das Testament wußte die Geistlichkeit das Land für den alten Glauben erhalten.
Da starb ihr Schirmherr, und die Zuversicht, die man auf das Testament gesetzt, ging in Trümmer. Alsbald hatte sich im katholischen Lager eine Gegnerschaft wider den protestantischen Herzog Heinrich gebildet. Nun war freilich, wie befürchtet, die Erhebung der lutherischen Lehre zur Staatsreligion bisher ausgeblieben. Aber das Verhalten des Herzogs bei der Beisetzung kennzeichnete klar seine Gesinnung.
Die Feier des dreißigsten Tages nach dem Hinscheiden des Herzogs Georg sollte als eine große Prozession stattfinden. Da kam das Verbot. Der Bischof geriet in hellen Zorn, und Ernst von Miltitz hatte es als Anhänger der alten Kirche nicht leicht, der Weisung des Herzogs Nachdruck[119] zu geben. Die Feier würde dem Verstorbenen nichts nützen, hatte der neue Herr gesagt, denn sie sei nur ein Mißbrauch Gottes.
Zuletzt blieb der Geistlichkeit aber doch nichts anderes übrig, als sich zu fügen. Sie tat es widerwillig und nur mit Rücksicht auf die heimliche Befürchtung, man möchte im Weigerungsfalle den Herzog zu schärferem Vorgehen gegen die Kirche reizen.
Das sächsische Volk aber pries seinen Fürsten und stellte all seine Hoffnung auf ihn.


Nun waren schon Wochen seit dem Tage vergangen, an dem die beiden Liebenden Abschied genommen hatten. Sonnhild fühlte sich vereinsamt. Das Verhältnis zum Vater war anfänglich gespannt gewesen. Sie hatte gemerkt, wie schwer es ihm gefallen war, die seinem Zorn folgende Betrübnis zu überwinden. Gleichwohl war er immer freundlich zu ihr und hatte den schlimmen Vorfall mit keinem Worte berührt. Auch schien ihm seine Heftigkeit nachträglich leid zu tun. Er wiederholte seine Liebkosungen wie früher und versuchte, Sonnhilds Schwermut durch kostbare Geschenke zu vertreiben.
Mit müdem Lächeln dankte das Mädchen dem Vater. Doch empfand sie, wie er überzeugt war, daß er ihr mit all diesem doch nicht helfen konnte. Und so kam es, daß wohl die äußeren Liebesbeweise zwischen Vater und Kind ebensooft wie früher ausgetauscht wurden, daß sie aber nicht mehr so herzlich waren, und daß beide von Gefühlen bewegt wurden, die sie voreinander verbargen. Statt der bisherigen Offenheit, herrschte jetzt heimlicher Zwang zwischen ihnen.
Sonnhild litt sehr unter diesem Zustand. Zum Glück war der Vater in dieser bewegten Zeit oft auf dem Rathaus und ließ sie viel allein.
Heute war Sonntag. Man schrieb den 15. Juli 1539.
Sonnhild saß schon zur zeitigen Vormittagsstunde am Fenster, um auf das gewohnte bunte Treiben hinabzusehen, das sich Sonntags auf dem Markt entwickelte. Zudem war heute Schützenfest. Hierzu waren die Landleute aus der Umgegend schon am frühen Morgen als Zuschauer in die Stadt eingezogen. Denn das Schützenfest war das größte Volksfest des ganzen Jahres.
Eine Zeitlang schaute Sonnhild auf die geputzten Menschen. Dann lehnte sie sich in den Stuhl zurück und sann. Das letzte Fest, bei dem sie von Herzen fröhlich sein konnte, war das Maienfest gewesen. Da hatte ihr die gute Hanne den Festschmuck aus der Lade geholt und sie damit schmücken helfen und ihr den Maienkranz ins Haar gewunden. Der Vater hatte beim Beutler eine neue zierliche Tasche für sie erstanden, die köstlich nach Ambra gerochen, und einen silbergefaßten Handspiegel, der an einer Kette als Zierat an der Seite getragen wurde.
So war sie hinaus auf den grünen Anger neben dem Kuttelhof gegangen. Dort hatten sich die jungen Mädchen getroffen. Alle geschmückt mit Schappel und Dupfing und in prächtigen Frühlingskleidern.
Zwar ging dem Maienfest alljährlich noch ein anderer Tag voran, an dem man draußen mitsammen fröhlich war. Denn schon Wochen vorher, als die ersten Kätzchen aus Weide und Hasel ausgebrochen, waren alle jungen Mädchen und Jünglinge hinausgezogen. Und wer das[122] erste Veilchen fand, der verkündete dies laut. Dann eilten alle dahin und tanzten im Kreise um diesen frühen Abgesandten des lieblichen Lenzes.
Doch beim Maienfest ging es noch lustiger her. Da wurden die großen Reihen getanzt. Der Vorsänger stimmte an, worauf der Chor der Umstehenden laut den Text des Reihens sang, und leise sangen die tanzenden Mädchen die Weise mit. Dann wurde der bunte Federball geworfen und noch einmal um die Linde getanzt.
Die jungen Bürgersöhne waren gleichfalls im Festschmuck erschienen, die sammetnen Wämser an Kragen und Ärmeln mit köstlichen Spitzen besetzt. Auch waren immer einige Junker dabei in wallendem Haar, den Gürtel wohl beschlagen mit glänzendem Metall, und die Spitze des Schwertes beim Gehen an der Ferse klingen lassend.
Die Bürgersöhne sahen deren Kommen aber nicht gern und betrachteten sie mit stolzen Blicken, wofür die jungen Edelleute hochmütig um sich schauten. Zuletzt wurde die schönste Jungfrau mit einem Kranz von frühen Feldblumen als Maienkönigin gekrönt und im Triumphzug und unter lautem Singen nach Hause geführt. In diesem Jahre war Sonnhild Maienkönigin gewesen.
All diese freundlichen Bilder stiegen in Sonnhilds Erinnerung herauf. Und bald nach dem lieblichen Fest war ja die schönste Zeit ihres Lebens angebrochen: sie hatte den Jugendfreund wiedergesehen!
»Bernhard, – mein Bernhard,« flüsterte Sonnhild. Und sie merkte, wie es ihr warm in die Augen stieg. –
Mittlerweile hatte die Menge auf dem Markt zugenommen. Da sah man die Bürgerfrauen, die keine[123] Frau eines Dienenden in ihren Kreis ließen. Abseits von ihnen standen die Frauen der reichen Familien. Aber den unterwürfigsten Gruß erwiesen die Gesellen und Dienenden den Frauen und Töchtern aus den Patriziergeschlechtern. Die gleiche Auszeichnung erfuhren die Männer. Doch von diesen waren nur wenige auf dem Markt; sie weilten zum Frühtrunk in den Schenken.
Die Frauen wachten streng darüber, daß die feinen Abstufungen in der Rangstellung, die von der Größe des Reichtums abhängig waren, äußerlich aufs peinlichste gewahrt wurden. Wer unter dem eigenen Kreis stand, mußte sich's gefallen lassen, kühl behandelt zu werden. Nach oben aber wurde viel Freundlichkeit aufgewendet.
Die eleganten Frauen unter den Reichen trugen ein langes Gewand von kostbarem Stoff und reich besetzt. Der Schleppenschwanz war sechs Fuß lang und nahm auf der Straße allerlei Unrat auf. Wenn sie zum Tanz gingen, befestigten sie die lästige Schleppe mit einem großen, eisernen Haken hinten am Rücken, wo sie wie ein schweres Gewicht niederhing. Dafür hatten aber die Kleider oben fast gar keinen Stoff. Sie waren so weit offen, daß man den ganzen Busen und den größten Teil des Rückens sah. Die jungen Herren waren mit dieser Schaustellung recht zufrieden. Aber die Prediger wetterten von den Kanzeln grimmig dagegen – natürlich erfolglos.
Die einfacheren Bürgerfrauen gingen zwar weniger kostbar, aber immer noch recht anspruchsvoll gekleidet. Denn es bestand in den Städten unter den Frauen ein wahrer Wetteifer in der Entfaltung von Luxus.
Ferner sah man unter der Menge langlockige Bauern[124] in altfränkischer Kleidung: kurzen, tuchenen Jacken, Kniehosen und hochschäftigen Lederstiefeln, dazu ihre Weiber mit hellen Kleidern in schreienden Farben. Auch herzogliche Landsknechte vom Schlosse waren da, mit martialischen Bärten, einheimische und fremde Schützenbrüder und endlich Bürger, bewaffnet mit Ober- und Untergewehr.
Denn jeder Bürger, soweit waffenfähig, war wehrhaft. Zu ruhigen Zeiten gingen sie ihrem Handwerk nach. Sobald aber die Waffenübungen riefen, dann stand die Werkstatt leer. Hoch aufgereckt stolzierte der Angehörige der Bürgerwehr durch die Menge. Auf dem Kopfe den großen Schlapphut, geschmückt mit Birkenreis oder Hopfenblüte, Sporen an den Füßen, die Flinte auf dem Rücken und den Degen vorm Herzen. Die Bürger eines Viertels hatten ihr eigenes Fähnlein, und an ihrer Spitze stand der Viertelsmeister.
Auch Franziskanermönche aus dem Kloster am Heinrichsplatz drängten sich durch das Gewimmel, den Apostolischen Friedensgruß bietend. Sie gingen ohne Schuhe und unbedeckten Hauptes. Die lange Kutte mit der Kapuze auf dem Rücken war von grauer Wolle und mit einem knotigen Strick umgürtet. Sie waren Bettelmönche und standen in engem Verkehr mit den Bürgern, da viele von ihnen Meißner Stadtkinder waren.
Vom Turm der Frauenkirche wurden fromme Lieder mit Posaunen geblasen, und dann begann von allen Türmen das Läuten der Glocken.
Ein Teil der Fremden staute vor der Rathaustür, neben der an einer Kette ein Halseisen hing, als Zeichen, daß der Markt die Richtstätte war. In dem hohen Gewölbe[125] des Eingangs stand die Ratswage. Wer freilich in den großen Saal im Oberstock hätte einen Blick werfen können, der würde die Ratsherren an einer reichgeschmückten Tafel haben sitzen sehen. An jedem Sonntag hatten sie freien Tischtrunk, heute aber bot ihnen die Stadt einen Festschmaus.
Vom Dom schlug gerade die zwölfte Stunde, und schon schickten sich die ersten an, zum Mittagessen nach Hause zu gehen, als mit einemmal in der Menge eine Bewegung entstand. Vom Heinrichsplatz her drang dumpfer Lärm und pflanzte sich bis zum Marktplatz fort. Gleichzeitig wichen die Menschen zurück, und durch die so geschaffene Gasse sprengte auf schweißbedecktem Pferde ein Postreiter der herzoglichen Hofpost.
Als er den Markt erreicht hatte, hielt er inmitten der vielen Neugierigen an, riß die auf seinem Rücken hängende, bestaubte Ledertasche auf den Bauch und entnahm ihr einen dicken Brief, der mit großen roten Siegeln verschlossen war.
»Wo treffe ich den Burgemeister?« rief er in die Menge. Worauf es durcheinander schrie:
»Auf dem Rathause!«
Der Reiter sprang vom Pferde, warf einem der Nächststehenden die Zügel zu und stampfte zur Rathaustür hinein.
Die Ankunft eines Eilboten vom herzoglichen Hof in Dresden war etwas Außergewöhnliches und rief eine starke Spannung unter der Menge hervor. Niemand entfernte sich. Dafür drängten alle nach dem Rathaus hin, und einer gab dem andern seine Ansicht über den Inhalt des Schreibens kund.
Die Erwartung stieg immer höher. Und da eine geraume Zeit darüber hinging, bis die Neugierde gestillt wurde, schwoll das Stimmengewirr zum Lärm an.
Da erschallten plötzlich laute Rufe nach Ruhe. Aller Blicke richteten sich auf das Rathaus, wo der Burgemeister eben ein Fenster aufriß. Hinter ihm und an den andern Saalfenstern erschienen die Ratsherren.
Georg Waltklingers Gesicht war bleich vor innerer Bewegung; nur die Stirn zeigte sich von dem genossenen Wein leicht getötet. In der Hand hielt er ein großes Pergament mit herabhängendem Siegel.
Der Lärm auf dem Marktplatz verstummte augenblicklich. Aller Herzen klopften vor Spannung; man ahnte eine bedeutsame Kundmachung.
Waltklinger beugte sich weit aus dem Fenster und rief mit gewaltiger Stimme in das Schweigen hinein:
»Mitbürger, vernehmt die hohe Botschaft des Herzogs an seine treuen Landeskinder: Alle Kirchen der Stadt, den Dom dazu gerechnet, werden dem neuen Evangelium geöffnet! Von den Kanzeln und in den Schulen darf fortan nur die protestantische Lehre verkündet und das Abendmahl soll in beiderlei Gestalt gereicht werden!«
Der Burgemeister ließ das Blatt sinken. Kein Beifallsruf erscholl. Die Überraschung hatte die Zungen aller gelähmt.
Da rief er noch einmal:
»Bürgerschaft Meißens! Euer tiefes Sehnen während langer Jahre ist erfüllt. Die Botschaft bedeutet die Einführung der Reformation im meißnischen Sachsen! – Lang lebe Herzog Heinrich!«
Jetzt brach ein beispielloser Tumult aus. Alles schrie und jubelte durcheinander. Des Herzogs Name wurde immer von neuem gerufen. In manchem Auge standen Tränen. Die einen blieben stumm vor Rührung, andere umarmten sich oder warfen die Hüte in die Luft und stießen laute Freudenrufe aus. Ja man mußte sich's wiederholen, daß das Unglaubliche Geschehnis war: der Herzog hatte dem Lande die Reformation geschenkt!
Lange noch hielt der betäubende Lärm an, bis sich die Menge allmählich verlaufen hatte. Es gab aber kein Haus in der Stadt, in dem man während des Mittagessens nicht über das große Ereignis gesprochen hätte. Der heutige Tag war ohnehin ein Festtag. Durch die frohe Botschaft hatte er aber eine hohe Weihe erhalten!


Bald wurde die Einwohnerschaft wieder auf die Gasse gelockt. Der große Festzug der Bürgerschützen zog mit Trompeten- und Paukenschall vor das Jüdentor, allwo der Schießanger lag. Und die Menge hastete dem Zug hinterdrein.
Den kleinen Platz inmitten der Fleischgasse, der Hundewinkel genannt, schlossen lauter niedrige Häuser von gewinnendem Aussehen ein, bestehend aus Unter- und Oberstock. Eines von ihnen machte einen besonders freundlichen Eindruck. Es war frisch weiß gestrichen und mit einem hölzernen Spalier versehen, an dem sich edle Reben hinaufrankten, daß die grünen Weinblätter die ganze Vorderseite des Hauses bis zu dem moosbewachsenen Ziegeldach bedeckten. Das steinerne Türgewände stellte einen verzierten Rundbogen dar, in den hüben und drüben ein Sitzstein eingelassen war. Die Haustür war in der Mitte teilbar, die obere Hälfte stand tagsüber immer offen. Vor dem Haus befand sich ein schmales Gärtchen, das ein niedriger Lattenzaun einfriedigte.
Auf den Sitzsteinen saßen ein Mann und eine Frau. Sie waren beide alt und daher wohl dem Festtrubel abhold.[129] Aber ihre Augen, mit denen sie die Vorübergehenden musterten, glänzten noch frisch.
»Ach, Gevatterin,« sagte der alte Mann, »mein Weib kann noch immer nicht vom Treiben der Jugend lassen. Natürlich mußte sie mit zum Festplatz ziehen.«
Dazu seufzte er so komisch, daß die Zuhörerin leise lächelte. Sie war seit langen Jahren die Nachbarin des Ehepaares und dessen Vertraute.
»Euer Weib ist eben noch lebenslustig, daran müßt Ihr denken, Gevatter. Eine so rüstige Sechzigerin wie sie …«
»Ja, ja, – wenn sie erst an die Siebzig kommt, wird sie's wohl auch lassen,« unterbrach sie der Alte kopfnickend.
Benedikt Biertimpel war seines Zeichens Löffelmacher, betrieb aber sein Handwerk schon seit Jahren nicht mehr. In der Jugend war er lange auf der Wanderschaft gewesen und hatte viel gesehen, so Prag und Wien. Auch nach Ungarn hinein war er ein Stück gekommen. Da war er wieder auf Schusters Rappen gestiegen, und der Wind hatte ihn quer über das liebe deutsche Vaterland hinweg bis nach Flandern getrieben. Von dort war er eines Tages heimgekehrt, aber nicht allein, wie er ausgezogen. An seiner Seite hatte sich ein blutjunges Frauenzimmer befunden, ein immer lustiges Ding, das sein vom Vater ererbtes Häuschen täglich fast auf den Kopf stellte.
Der gute Biertimpel war ein sinnierender Geselle und von langsamem, bequemem Wesen. Da brachte ihn sein junges Weib zuweilen höllisch in Trab. Sie fuhr wie ein[130] Irrwisch umher, und zu keiner Minute war er sicher vor ihr. Als temperamentvolle Rheinländerin mochte sie es nicht leiden, wenn ein Mensch gemächlich war. So führte sie ein straffes Pantoffelregiment über ihren Biertimpel, worein er sich nach kurzem Widerstand ergeben hatte, und das er still seufzend erduldete.
»Ach, Gevatterin,« hob der allwege philosophierende Biertimpel redselig an, »nein, Gevatterin, Ihr könnt daher reden, was Ihr mögt, aber wir leben in einer verderbten Zeit! Denkt einmal nach, als wir jung waren, wie friedlich da alles zuging.«
»Aber Gevatter, Ihr dürft nicht denken …«
»Die Menschen sind es,« schnitt Biertimpel der Matrone gewandt das Wort ab, »die Menschen selbst, sage ich, verschlechtern die Zeiten. Wo sind die guten Tage der Einfachheit geblieben! Heute? Glanz, Pracht und Hoffärtigkeit!«
Die Zuhörerin fügte sich lachend in das aufgezwungene Stillschweigen. Wenn Meister Biertimpel also sprach – und dies pflegte er nie in Gegenwart seiner Frau zu tun –, dann war gegen ihn nicht aufzukommen. Also schwieg sie. So konnte Biertimpel sein Lieblingsthema gemächlich ausspinnen.
»In den Weibsbildern sitzt der Teufel! Das habe ich immer behauptet, und noch keiner hat mir's widerlegt. O, diese Töchter und Mütter, die nicht wissen, wie sie prangen sollen! Sie treten einher und schwänzeln und haben köstliche Schuhe an den Füßen und tragen güldene Hauben, und auf den Kleidern Perlborten und hohe Krausen und sonstiges Gefetz. Auch in durchsichtigen Gewändern laufen sie und strecken die bleckenden Hälslein[131] aus wie Hirsche. Dazu werfen sie die Äuglein um sich und wissen ihre Gebärden danach zu richten, daß alles lieblich und lustig anzusehen ist.
Die jungen Weibsbilder wollen alle gern schön sein, klar Gesichte und weiße Händlein behalten. Und da manche diese von Natur nicht hat, untersteht sie sich, solches durch Kunst und andere Mittel zuwege zu bringen. Und es will traun allenthalben gemein werden, daß die jungen Frauen beginnen ins Töpflein zu blasen und das Angesicht zu färben nach ihrem Gefallen, damit sie desto schöner mögen anzusehen sein. Wo bleibt da Zucht und Sitte?«
Hier sah der wackere Biertimpel die Matrone entsetzt an. Aber an einer Antwort war ihm nichts gelegen, deshalb fuhr er rasch fort:
»Vorzeiten ließen sich's die Menschen genügen an dem Zeuge, das sie selbst gemacht. Sie kleideten sich in wollene Tuche und in Barchent und wußten nichts von Sammet und Seiden. Purpur und köstliche Leinwand waren der Könige und großer Potentaten Tracht!
Itzund lassen sich's Adlige und Bürgertöchter daran nicht genügen. Sie wollen es hohen Personen nachtun und das Beste von Damast und Atlas haben und weiche Kleider an ihrem Halse und auf ihrem Leibe tragen. Ist fast keine Dienstmagd zu finden, sonderlich in fürnehmen Städten, sie will seidene Ärmel, einen Rock von bruggischem Atlas oder von Zindeldort mit zwei, drei Schweifen und sammetnen Borten tragen. Und in den Röcken muß ein Stahlreifen sein, damit sie wie eine Glocke aussehen und weit um sich sperren. Darin walzen sie daher wie Bierfasse und können nicht aus den Gestühlen der Kirche[132] kommen. Wenn sie aber eine Hausmutter werden soll, kann sie nicht wohl ein Windeltüchlein bezahlen oder zuwege bringen.«
Benedikt Biertimpel hatte sich in Eifer geredet. Jetzt nahm er sein Käppchen ab und wischte die Schweißperlen von der Stirn. Diese Gelegenheit benutzte die Nachbarin klug und versetzte:
»Gevatter, erzürnt Euch nicht! Auch in unserer Jugend …«
»War alles viel besser!« eiferte der Entrüstete von neuem. »Was bei den Alten vor dreißig und vierzig Jahren ehrbar gewesen, taugt jetzt nicht mehr. Ist alles nur aufs Prangen gerichtet. Man will immer was Neues, was Seltsames haben. Was fremd – ausländisch, hat man am liebsten! Alle Völker haben ihre sonderliche Tracht und Manier, allein wir Deutschen wollen bei nichts Gewissem bleiben. Was man einmal gesehen, will man nachtun! Muß alles verschnürt, verbrämt, gekräuselt und wunderlich und seltsam gestickt sein. Möchte doch bald eine jede Frau von Adel oder bei fürnehmen Bürgern eine eigene Nähterin und Bortenwirkerin haben, die übers Jahr ausnähet. Da muß man mehr auf Kleidung und Schmuck wenden, als sonsten in der Haushaltung. Ei, behüte Gott!«
Der Sprecher wischte flugs wieder einmal über die Stirn.
»Es sind ihrer viele, die schändliche und greuliche Hoffart treiben mit den Haaren ihres Hauptes. Die natürlichen Haare taugen nichts mehr, sie müssen blond gebleichet sein und über einen Draht gezogen. Das soll sonderlich hübsch sein! Und manche trägt auf ihrem[133] Haupte Haare, die aus dem Beinhaus von einem toten Kopfe sind.
Um den Hals muß man ein großes, dickes Gekröse haben aus teurer Leinwand. Das muß gestärkt und mit heißem Eisen ausgezogen werden. Da steht das Haupt in der Mitte, wie Sankt Johannes' Haupt in der Schüssel. Ja, die Kleider müssen auch nicht mehr vorn, sondern hinten im Nacken zugemacht sein, als stünde das Gesichte auf dem Rücken. Und gar die Ärmel! Die müssen unter dem Arm durchsichtig sein, daß man die weiße Haut sehen und erkennen mag. Geht doch manche Dienstmagd dermaßen daher, daß sie es wohl einer reichen Bürgerstochter zuvortut. Danach, wenn sie zur Ehe greifen soll, da ist weder Bett, Decke, noch Strecke. Die jungen Frauen lernen sich fein in die Hoffart schicken. Weiß manche nicht, wie sie treten soll. Weiß die Füße so zierlich zu setzen, daß sie nicht ein rohes Ei entzwei trete. Das ist jetzund der Welt Lauf!«
Die gutmütige Greisin war bei dieser langen Rede wirklich ein wenig ungeduldig geworden und begann jetzt, ihr vielgeschmähtes Geschlecht zu verteidigen. Da sah Meister Biertimpel auf und maß die Sprecherin mit erstaunten Blicken. Nicht lange vermochte er an sich zu halten. Dann fuhr er ihr hitzig ins Wort:
»Gevatterin, was Ihr daherredet! Die Zeit ist verderbt, sage ich. Hat nicht unlängst selbst der Burgemeister laut gescholten, daß die Frauen ungesellig seien und steif wie Ölgötzen bei der Tafel säßen und Prunk über alles liebten und adelsüchtig wären? Das war der Waltklinger, Gevatterin, der das sprach, kein Geringerer! Und ist es nicht wahr, daß die jungen Weibsbilder[134] mit den Äuglein nach den jungen Gesellen werfen? Und wie sie sich verantworten können! Sollte sie einer zur Rede setzen, dem würde es wohl gehen, wie jenem alten Vater. Der sagt zu einer jungen Frau, so ihm auf der Gasse begegnete: ›Junge Frauen sollen nicht nach Mannspersonen sehen, sondern ihre Augen zur Erden niederschlagen.‹
›Nein‹, antwortete sie darauf, ›nicht also! Ihr selbst sollt die Erde ansehen, denn der Mann ist aus der Erden. Das Weib aber ist aus einer Mannesrippen erbaut. Drum sehe ich mich nach dem um, von dem ich genommen und gemacht bin.‹«
Meister Biertimpel betrachtete die Gevatterin triumphierend. Diese zuckte die Achseln und schwieg. Sie bekannte sich geschlagen. Da zeterte er weiter:
»Jeder will freien, wann und wo er will. Junge Rotzlöffel, die kaum achtzehn Jahre alt sind, wollen Weiber haben, die man noch billig in der Schulen schicken möchte.
Will jetzund schweigen des losen Gesindels, fürnehmlich unter den Frauen, das die Ehe hält, wie der Hund die Fasten …«
Hier brach der Zürnende plötzlich ab und wurde sichtlich unruhig. Die Gevatterin sah verwundert auf – da kam des guten Biertimpels wackeres Eheweib über den Platz geschritten. Sie kehrte erhitzt vom Schießanger heim. Jetzt lächelte die Gevatterin, sie verstand den raschen Schluß der eifernden Rede.
Nun nahm die Angekommene ihres Ehegatten Sitz ein, und ihre Lippen flossen über von der Lust und Freude, die sie heute wieder erlebt hatte. Meister Biertimpel[135] schwieg dazu und machte sich in dem kleinen Vorgarten zu schaffen.
So bestand zwischen den beiden Ehegatten eine Harmonie, bei der sie alt geworden waren. Ab und zu freilich protestierte Biertimpel einmal gegen die leise Flöte, nach der er gezwungenermaßen tanzte. Bei solchen Gelegenheiten hörte die Nachbarin immer einen kurzen Streit, dessen Ende ein wiederholtes, kräftiges Klatschen bildete. Darauf wurde die brummende Stimme des Hausherrn still.
Jedenfalls wußten die Umwohnenden, daß in dem weißgetünchten und mit grünen Reben umrankten, freundlichen Häuschen die ehelichen Verhältnisse aufs beste geregelt waren.


Auf dem Festplatz ging es hoch her. Das Gewühl war stark und die Luft an einigen Stellen schier unerträglich, denn es wurde viel Staub aufgewirbelt, und der Tag war heiß.
Da die Bürger die Verteidigung der Stadt in Kriegszeiten übernehmen mußten, hatte der Rat ein großes Interesse an der Erhaltung ihrer Schießfertigkeit. Deshalb begünstigte er die bürgerlichen Waffenübungen mit Freibier und Prämien. Bei den alljährlichen Schützenfesten – so pflegte er es seit langem – bestand sein Preis in einem Stück Tuch von zwanzig Ellen zu Hosen oder in dreißig Stück zinnernen Tellern.
Zu diesem Freischießen kamen die Schützen von weit her. Es galt als Ehrensache, den einmal gewonnenen Ruf der Treffsicherheit zu verteidigen. Die Schützenfeste mancher Städte standen hoch im Ansehen, so die von Leipzig, Chemnitz, Dresden und Meißen.
Das Schützenzelt stand am Jüdentor. Die Schießbahn lief elbwärts längs der Stadtmauer bis zu einem dicken Turm, der Fronfeste.
Geschossen wurde auf zweierlei Art: mit der Armbrust nach einem aufgerichteten Vogel und mit der Büchse oder dem Haken nach einer Scheibe von dritthalb Schuh um den Nagel. Die Schützen saßen beim Schießen und mußten ohne Anlehnen mit freischwebenden Armen zielen. Wer einen Fehler schoß, wurde geneckt. Er bekam unter großem Hallo auf einem hölzernen Teller inmitten eines Nesselkranzes einen Quarkkäse und ein Glas Bier. Dazu wurde ein Tusch geblasen.
Das Hauptvergnügen für jung und alt bildeten die Lustbarkeiten. Auch bei dem diesmaligen Schützenfest gab es deren im Überfluß. Unmittelbar vor dem Fleischtor stand ein weithin sichtbares Gerüst, des Pritschmeisters Predigtstuhl. Das Amt des Pritschmeisters war ein uralter Brauch bei Volksfesten. Wer es ausübte, zog von Stadt zu Stadt, und es gab etliche, die eine Berühmtheit erlangten. Der Pritschmeister war als Hanswurst gekleidet und mußte Späße machen und komische Reden halten. Dann wieder befand er sich unter der Menge, wo er mit seiner langen Pritsche die erkorenen Opfer bearbeitete. Das mußte sich jeder gefallen lassen.
Seine Gehilfen waren Knaben in Narrentracht. Sie überfielen den Erstbesten und schleppten ihn zum Predigtstuhl. Hier eröffnete der Pritschmeister ein hochnotpeinliches Gericht, von dessen verhängten Strafen sich der Verurteilte nach Rang und Ansehen mit einem Biergeld loskaufen konnte. Dieses unaufhörliche Spiel bildete die Hauptbelustigung für jedermann.
An einer andern Stelle wurden die Kräfte im Steinstoßen versucht. Ein fünfundvierzig Pfund schwerer[138] Stein mußte nach Stoßensrecht fortgeschleudert werden.
Dort wieder stand ein wilder Mann, dem man neun Kugeln um einen Kreuzer in den Mund warf. Unweit von ihm war ein Degenschlucker. Daneben kauerte in einem Topf ein Hahn, der bei verbundenen Augen mit Dreschflegeln getroffen werden mußte. Dudelsackpfeifer spielten dazu auf. Auch ein glatter Kletterbaum war da und mehrere Kegelbahnen. Wer sein Glück versuchen wollte, griff in den Glückstopf, gefüllt mit Anweisungen auf Gewinne und mit noch mehr Nieten.
Hier galoppierten Bauernburschen an einer Puppe vorbei und warfen Bälle danach. Am Abhang zur Triebisch stand eine junge, ungezähmte Kuh, die den Hügel hinabgepeitscht wurde und mit fettigen Handschuhen zurückgehalten werden mußte.
Auch ein alter Landsknecht wartete mit seinen Darbietungen auf. Er mochte sich viele Jahre seines Lebens und für manchen deutschen Potentaten herumgeschlagen haben. Zuletzt war er Fähnrich gewesen und verstand sich meisterlich aufs Fahnenspiel. Mit dem weiß-grünen Tuch am langen Stock führte er Ober- und Unterhiebe, Paraden und Stockaden und zeigte das Rosenbrechen. Dann drehte er die Fahne im Zirkelschwung um das Haupt und warf sie in die Höhe, um bis zum Auffangen ein Pistol abzuschießen. Endlich schlang er das Fahnentuch malerisch um sich und machte seine Reverenz, indem er beide Knie beugte. Dazu spielte sein zahnloses Weib auf einer Mundharmonika den Burgundermarsch.
Zwischen zwei Bäumen hatte ein verwegener Seilfahrer[139] sein Seil aufgespannt, auf dem er vom Jüdentor bis zum Fleischtor lief.
Ferner wurde ein kluger Hund gezeigt, der einen Luftsprung machte, wenn einer sein Liebchen nannte, der aber heulte, wenn man den türkischen Kaiser nannte. Zuletzt hing ihm sein Herr ein Hütlein an die Pfote und schickte ihn auf den Hinterbeinen zu den Zuschauern um einen Zehrpfennig, dieweilen er noch eine große Reise vorhabe.
Hier gab es einen Vater mit sechs Kindern, die alle musizierten, dort ein Weib, das mit Händen und Füßen essen und nähen konnte, und wieder anderswo ein einjähriges Kind, ganz voll Haare und mit einem Barte.
Schließlich waren noch zwei Affen zu sehen, ein Meerschwein und eine Löffelgans. Auch Bänkelsänger und verblüffende Taschenspieler warteten mit ihren Künsten auf.
So fehlte es nicht an allerhand Ergötzlichem. Und doch war mit diesem allen der Reichtum an Sehenswertem noch keineswegs erschöpft.
Da handelte einer mit Wurmsamen, der andere mit Bilsensamen gegen das Zahnweh. Hier stand einer, der fraß Werg, stopfte es bis in den Hals hinein und spie Feuer heraus. Einer verkaufte Läusesalbe, das Gedächtnis damit zu stärken, einer wusch die Hände und das Gesicht mit geschmolzenem Blei, ein anderer zog Schnüre aus dem Mund. Wieder einer hielt ein Büchslein hin. Ein einfältiger Tropf blies neugierig hinein, worauf ihm eine Rußwolke das ganze Gesicht bestäubte. Wer von den Umstehenden darob lachte, zahlte einen Kreuzer.
Das waren die Griffe der Landfahrer und Gaukler, womit sie sich durch die Welt brachten.
Recht Erkleckliches wurde im Essen und Trinken geleistet. Dazu saßen die Gäste auf Bänken um lange Tische herum, deren Pfähle in den Boden gerammt waren. Da gab es Bratferkel, Reis in griechischer Weise, Hähne, französisches Blancmanger und orientalisches Konfekt. Auch Sauerkraut mit Riesenbratwürsten und gekochte Elbfische in saurer Milch. Alles mußte kräftig gewürzt sein.
Dazu wurde einheimisches Bier und Meißner Landwein geschenkt.
Alten Landsknechten mit ausgepichten Kehlen, die gewohnt waren, jeden Batzen durch die Gurgel zu jagen, war der dargebotene Stoff zu wenig herzhaft. Sie hätten am liebsten gehackte Glassplitter drein getan. Daher bestellten sie sich ein Gemisch von verdorbenem Wein, scharfem Pfeffer und Honig. Das hieß der Lautertrank. Dieser war so sauer, daß er die eisernen Schnauzen der Gefäße abfraß.
Die Frauen knabberten unablässig Süßigkeiten. Marzipan galt nicht mehr für fein. Dafür war Zitronat aufgekommen.
Die Ratsherren saßen an einer Ehrentafel im Schützenzelt. Auf der Wiese drängte sich die Menge, lachend, schreiend, schwitzend.
Alle Stände waren vertreten. Natürlich kam auch der alte Unfriede zwischen Adel und Bürgertum wieder zum Vorschein. Als Vertreter dieser beiden Klassen fühlten sich Handwerksgesellen mit losem Mundwerk und Landsknechte berufen. Das waren sonnverbrannte, starkknochige Männer mit kühnem Antlitz und scharfer Wehr. Zwar waren sie gerade keine Tugendspiegel, aber treu und verläßlich. Jeder einzelne hätte sich bei rittermäßiger[141] Veranlassung für seinen Herrn ohne Bedenken totschlagen lassen.
Da flogen die Sticheleien herüber und hinüber; Handwerksgesellen und Bauern bildeten eine Partei.
»Eisenbeißer,« höhnten sie die Landsknechte, »Hahnenreißer, Bärenstecher, stolze Federhansen!«
Und »Heringsnasen«, gaben die zurück, »Krippenreiter, Wurstreiter, Pfeffersäcke, Misthammel!«
»Haha, haha,« lachte ein junger Gesell. »Als unlängst der Teufel ein paar Krippenreiter fortschaffen wollte, riß ihm in der Luft der Sack. Da hat er den ganzen Plunder an der nächsten Ecke ausgeschüttet.«
Hier verlor einer der Gefoppten die Geduld und stürzte dem Lachenden seinen frisch gefüllten Becher Lautertrank ins Gesicht. Aber der Begossene lachte nur noch ärger. Da guckte der alte Landsknecht betrübt in den leeren Becher, doch war es nun einmal geschehen.
Dicht daneben spielte der Stadtpfeifer mit seinen Gesellen auf. Der grüne Wiesenplan war der Tanzplatz. Mit sicherem Griff packte der Bursche sein Mädchen um die Hüfte und riß die vor Lust Kreischende im Wirbel herum. Wange war an Wange gepreßt, und die Schweißperlen auf ihren Stirnen flossen ineinander. So drehte man sich, so lange der Atem reichte.
Heiahei und hei! Wie flog da Mantel, Rock und Gugelhut!
Unter den Festteilnehmern befand sich auch Sonnhild. Zwar wäre sie am liebsten zu Hause geblieben, sich ihren Träumereien überlassend. Aber die alte Hanne hatte zum Gehen gemahnt, da das Mädchen andernfalls den Vater betrüben würde.
Einsilbig stand sie unter ihren Freundinnen und betrachtete mit gezwungenem Lächeln die Lustbarkeiten. Das golden leuchtende Haar war mit einem Schappel von kostbaren Bändern geschmückt, und das enganschließende, weiße Kleid mit roter Schärpe und ebensolchen Schleifen hob den jugendfrischen Eindruck ihrer zarten Gestalt. Aber die rosigen Wangen waren bleich geworden, und die großen, traurigen Augen gaben dem lieblichen Gesicht einen rührenden Ausdruck.
Ein Spielmann fesselte für kurze Zeit ihre Aufmerksamkeit. Er trug die Fiedel samt Bogen an einem Bande auf dem Rücken und übte die Kunst des Wahrsagens aus den Linien der Hand.
Seine Prophezeiungen wurden viel begehrt, besonders von den jungen Mädchen. Mit heißen Wangen stellten sie die um einen Kreuzer erlaubten drei Fragen, die fast immer den noch unbekannten Zukünftigen betrafen. Wie alt er sei, wollten sie wissen, ob schön, blond oder braun, wie gewachsen, welchen Zeichens sein Handwerk wäre, ob er ein guter Junge sei, oder ob er gar tränke und später sein Weib prügele. Alles dies interessierte.
Der Prophet war mundgewandt und verstand es, nicht zu viel des Guten, aber auch nicht zu wenig zu sagen, fast immer aber die Wißbegierde der jungen Dinger zu befriedigen.
Sonnhild war aufmerksam geworden und hörte eine Weile den Fragen und Antworten zu. Sie verspürte den brennenden Wunsch, sich ebenfalls die Zukunft entschleiern zu lassen. Schon hielt sie ihre Hand hin, als die Scham das Begehren überwand und sie sich abkehrte.
Teilnahmlos ging sie durch die Menge, vor dieser und jener Darbietung kurze Zeit stehen bleibend. So hatte sie allmählich das Ende des Festplatzes erreicht, wo sich nur wenig Menschen befanden.
Hier blieb sie stehen und sah gedankenschwer einem Trupp weißer Federwolken nach, die in dem blauen Luftmeer pfeilschnell hoch über ihrem Haupte dahinzogen, nach Westen zu. Wenn sie mit ihnen ziehen könnte! Nur einen Gruß möchte sie diesen flüchtigen Reisenden mitgeben können, die des Raumes sieghaft spotteten.
Da vernahm sie, wie von hinterher jemand zu ihr sprach. Und als sie sich umwandte, stand der Bursche vor ihr, der den Mädchen wahrgesagt hatte.
»Mit Gunst, Herrin,« versetzte dieser, »möchtet nicht auch Ihr einem armen Spielmann einen Zehrpfennig verdienen lassen?«
»Ich habe keine Fragen an Euch,« antwortete Sonnhild abweisend.
»Nun, so erlaubt, daß ich drei Fragen an Euch richte,« versetzte er keck.
Sonnhild horchte auf. Der Ton seiner Worte machte sie stutzig. Verbarg sich hinter ihnen etwas?
Sie betrachtete den Spielmann genauer. Er war ein hübscher, junger Bursche mit freiem Blick und glänzendweißen Zähnen.
»Fragt immerhin,« erklärte sie, auf den Scherz eingehend; »ob ich Euch aber antworten werde …«
»Hoffentlich vermögt Ihr's,« fiel er ihr in die Rede. »Die erste Frage also. Sie soll entscheiden, ob ich die zweite und dritte tue. Herrin, wo träumt sich's besser, unter dreizehn Linden oder unter sieben Eichen?«
Sonnhild war betroffen. Sie heftete den Blick durchdringend auf den Spielmann, um in seinem Gesicht zu lesen. Der aber stand gleichgültig vor ihr, und seine Züge offenbarten keinen seiner Gedanken.
»Unter sieben Eichen,« antwortete Sonnhild zögernd.
»Die zweite Frage: so der Ausgezogene seiner Herzallerliebsten ein Gegenangebinde sendet, von derselben Art, wie er beim Abschied empfangen, was müßte dieses dann sein?«
Sonnhild wurde dunkelrot. War es Zufall, was der Fremde sprach? Durfte sie sich ihm anvertrauen? Sollte wirklich …? Das Herz klopfte ihr zum Zerspringen.
»Ein Ringlein,« sagte das Mädchen endlich mit gepreßter Stimme.
»Die dritte Frage! Und wie nennt Ihr jenen, von dem Ihr solches empfangen möchtet?«
Sonnhild kämpfte mit einer großen Verwirrung. Sie schlug die Augen nieder, und es währte eine Weile, bevor sie sich gesammelt hatte. Nach einem tiefen Atemzug sah sie wieder auf; alles Blut war aus ihren Wangen gewichen.
»Bernhard,« sagte sie kaum hörbar.
In des jungen Spielmanns Augen trat ein Leuchten.
»Dann seid Ihr die ehr- und tugendsame Jungfrau Sonnhild Waltklinger!« rief der Landfremde freudig, »und ich habe recht geraten. Zweierlei präge dir wohl ein, sagte der edle Junker zu mir: die Reinheit und Bläue der Luft – das sind ihre Augen, sowie das goldene Glänzen der Sonne – das ist ihr Haar. Und das Ganze ist mein Himmel, setzte er für sich hinzu.«
Zugleich tastete der Bursche nach der dunkelroten Wollschärpe, die er um den Leib gewunden trug, und deren goldgefranste Enden von der linken Hüfte herabhingen. Aus ihren Falten zog er einen niedlichen Gegenstand, sorgsam in weiches Papier eingeschlagen. Und als er die Hülle entfernt, hielt er einen Ring zwischen zwei Fingern, den er Sonnhild verstohlen reichte.
»Empfangt ihn, o Herrin; nun bin ich meines Auftrags ledig.«
Bebend griff das Mädchen nach dem teuern Liebeszeichen und barg es rasch in dem Täschchen, das ihr an der Seite herabhing.
»Ja Nürnberg war es,« erklärte der Spielmann, »wo Junker von Miltitz mich mit dieser Sendung betraute. Dort sollte sein Begleiter ein kostbares Geschenk für den Kaiser einhandeln. Ihr wißt, o Herrin, daß in dieser Stadt die weltberühmten Meister der deutschen Goldschmiedekunst ihr edles Handwerk betreiben. Bei einem derselben erstand er das Ringlein. Er war auf der Reise nach Worms; ich trug meine Fiedel gegen Wien. Da ward mir der Auftrag. Sein Vertrauen ehrte mich, und so wandte ich die Spitzen meiner Schuhe nach Sachsen.«
»Viel herzlichen Dank, wackerer Fremdling,« stammelte Sonnhild, »und als äußeres Zeichen meiner Erkenntlichkeit für Euern guten Dienst nehmt das.«
Während dieser Worte hatte das Mädchen von einem feingliedrigen, goldenen Kettlein einen Florentiner Dukaten genestelt, den sie auf der Brust trug.
»Nein, edle Jungfrau,« sagte er, mit der Hand wehrend und leise den Kopf schüttelnd, »nicht also.[146] Schon dem Junker habe ich die Annahme einer Entlohnung verweigert. Denn er steht nicht in meiner Schuld, wohl ich aber tief in der seinigen. Hört meinen raschen Bericht, wie das gekommen.«
Und mit fliegenden Worten erzählte der Jüngling:
»Also zu Nürnberg war's, auf dem Marktplatz, just vor dem Schönen Brunnen, wo ich gerade im Begriff bin, mit dem ersten Bogenstrich, den ich in der Stadt tue, Zuhörer anzulocken. Ich war todmüde von der Wanderung. Magen und Beutel waren leer. Da entsteht ein wüster Tumult. Gedränge um mich herum und laute Rufe nach dem Dieb, der einer vornehmen Frau, wie mich die ausgestoßenen Worte belehren, ein zierliches Agnus Dei von Gold und blitzenden Steinen im Gewühl von der Brust gerissen. Das Getümmel wächst lawinengleich. Da schreit eine Stimme: Der Spielmann! Hundert Augen haschen nach mir, und im nächsten Augenblick dringt die erregte Menge auf mich Ahnungslosen ein. Rohe Fäuste fallen nieder und zerren mich nach allen Seiten. Der Landfahrer war's, kein anderer! Schlagt ihn tot, zerreißt ihn, den Hund! Ich fühle Grabesodem auf meinem Gesicht, und: Maria, du Gebenedeite! durchblitzt es mein Hirn. Da haften meine Augen verzweiflungsvoll auf zwei anderen, hoch über der Menge, die träumerisch blicken. Ich sehe, wie diese Augen erwachen und meine Todesnöte erkennen. Viel schneller, als ich's erzähle, drängt ein Reiter sein steigend Roß in das Getümmel, – ein schöner Jüngling, mit feinem und bleichem Antlitz.
›Vernunft, Leute!‹ ruft er, den Lärm übertönend. ›Die Bürger Nürnbergs, meine ich, werden keinen ohne Urteil[147] richten!‹ Aber die Wut der Menge läßt den Einspruch abprallen. Schon dringt ein riesenhafter, wild aussehender Gesell auf mich ein und greift mit beiden Fäusten nach meinem Halse – da saust ein blankes Schwert flach auf seinen breiten Rücken nieder. Der Getroffene brüllt wie ein Hengst und wendet sich gegen seinen Angreifer. Der aber hat den Degen schon wieder emporgerissen und mit flammendem Antlitz und zornfunkelnden Augen beugt er sich weit über den Hals des Pferdes.
Elender! ruft er, wagt es, diesem ein Leid zu tun!
Der Geschlagene fühlte seine Wut verrauchen; der herrische Zorn seines Angreifers entwaffnete ihn. Auch die Menge war im Nu ernüchtert, ebenso rasch, wie sie mich andernfalls zerrissen hätte. Und als nun noch der Begleiter des Jünglings, ein älterer Edelmann, wie ich sogleich erkannte, beruhigend einsprach, ließen sie von mir ab. Eine Sekunde später war es um mich herum leer: die Wütenden waren zur Kirche unserer lieben Frauen hinüber geeilt, wo man den Dieb im Besitze des Kleinods erwischt hatte.
Daß ich's vollende,« schloß der Erzähler. »Der mutige Jüngling wehrte meinen Dank, warf mir einen Goldgulden zu und sprengte seinem voraufreitenden, arg bestaubten Begleiter nach. Aber ich lief bis zur Nacht die Gassen ab, bis meine wegwunden Sohlen in den Schuhen in Blut standen. Gerade vor der Herberge der beiden Herren sank ich nieder.
Am nächsten Tag trat ich vor meinen Retter und flehte um einen Dienst. Da ward er mir; ich kam ihm gelegen. Und so bin ich hier.«
In Sonnhilds Brust war beim Zuhören mehr als einmal heller Jubel erklungen. Ihr Busen wogte stürmisch auf und nieder. Das war der edle Charakter und die Unerschrockenheit Bernhards! Sich zur Ruhe zwingend, sprach sie:
»Möchtet Ihr, Fremdling, diese Gabe nicht doch als Andenken an mich mit Euch nehmen?«
Die Augen des Jünglings ruhten versunken auf dem schönen Mädchen.
»Das Gold, das Ihr mir bietet,« sagte er traurig, »würde bei mir keine bleibende Statt haben. Der Hunger ist der grimmigste Feind der Fahrenden. Ich weiß, daß ich mich von Euerm Dukaten einstmals doch trennen müßte, und das täte mir im Herzen weh! So Ihr meinen schlechten Dienst aber reich lohnen möchtet, schenkt mir das blutrote Schleiflein von Euerm Kleid, das Euch just am Herzen sitzet.«
Errötend lächelte Sonnhild und willfahrte der Bitte. Der Jüngling empfing mit zitternder Hand das Geschenk und führte es andächtig an seine Lippen. Dann sprach er leise:
»Er nannte Euch seinen Himmel! Ich begriff nicht, wie ein Liebender so sprechen könne. Jetzt aber, wo ich Euch gesehen, das jähe Erröten und Erbleichen Eurer Wangen beobachtet und Euern lauten Herzschlag vernommen, als Ihr ihn nanntet, jetzt verstehe ich seine Worte. Ihr zeigtet Euch gütig gegen mich und huldvoll und gewährtet mir dieses Geschenk. Jungfrau – das ist der beglückendste Lohn, der dem Spielmann werden konnte!«
Mit diesen Worten wandte er sich rasch ab und verschwand in der Menge.
Sonnhild sah dem Davonschreitenden mit warmen Blicken nach. Und selbst dann, als sie seine Gestalt in dem Gewühl nicht mehr unterscheiden konnte, stand sie noch eine Weile traumverloren. Endlich erinnerte sie sich des Ringleins und verließ mit schnellen Schritten den Festplatz.
Zu Hause angekommen begab sich Sonnhild heimlich in ihre Kammer und verriegelte die Tür hinter sich. Dann lauschte sie atemlos. Ob die alte Hanne ihr Kommen gehört hatte? Nichts regte sich. Alles blieb still, als wäre das große Haus mit den vielen Stuben und dunkeln Winkeln ausgestorben. Die Hanne saß gewiß strickend auf dem Lustgänglein in ihrem bequemen Stuhl. Und die Mägde weilten noch auf dem Festplatze.
Jetzt trat Sonnhild zum Fenster und zog den Ring hervor, ein eben nicht breiter goldener Reif und ein kleines Kunstwerk. Er stellte eine Schlange dar, die sich in den Schwanz biß – das Symbol der ewigen Liebe. Der immer schwächer verlaufende Leib war mit kunstvoll geschliffenen, überaus zierlichen Edelsteinen besetzt, die den Schuppenpanzer der Schlange darstellen sollten. Der Kopf des Tieres war abgeplattet, und die Augen bildeten zwei köstliche Rubinchen, von denen purpurleuchtende Strahlen ausgingen.
Das Mädchen stand wie geblendet. Dieser wunderschöne Ring! Keiner der ihrigen, soviel sie als vornehme Bürgerstochter deren auch besaß, glich ihm an Schönheit. Und dazu kam er von dem Geliebten! Sein Auge hatte auf ihm geruht und seine Hand ihn berührt. Im Überschwang ihrer Gefühle preßte Sonnhild einen Kuß auf[150] das köstliche Liebeszeichen, und in ihren großen Augen schimmerten Freudentränen.
Dann entnahm sie einem aus Zedernholz gefertigten und mit Perlmuttereinlagen kunstvoll verzierten Schmuckkasten, der bis zum Rande mit Kostbarkeiten angefüllt war, eine dünne, goldene Kette und zog sie durch den Ring. Hierauf betrachtete sie ihn noch lange mit zärtlichen Augen, und es war dem Mädchen, als ob sie Zwiesprache mit dem Ringe halten könne.
Er erzählte ihr, wie oft der ferne Geliebte ihrer gedenke, und daß er zuweilen leise ihren Namen flüsterte. Und Bernhards feines, blasses Antlitz stieg vor Sonnhilds Geist herauf. Sie sah es in edlem Zorn wie mit Blut übergossen, als er hoch zu Roß, alle Gefahr verachtend, in die wütendes Menge hineinsprengte, sein Leben für einen arg Bedrängten aufs Spiel setzend. Denn wie leicht hätte sich die Leidenschaft des Volkshaufens gegen ihn kehren können! Das Mädchen erschauerte.
Die Dämmerung stahl sich herein, und Sonnhild hörte, wie die Besucher des Festplatzes in die Stadt zurückkehrten. Da hing sie das Kettlein um den entblößten Hals und barg den Ring an ihrem Herzen. Denn sie mußte ihn vor dem Auge des argwöhnenden Vaters verborgen halten.
Darauf kühlte sie die brennenden Augen und begab sich in das Familienzimmer.
Nach beendeter Abendmahlzeit stand Georg Waltklinger auf, streichelte Sonnhild liebevoll das Haar und drückte ihr den gewohnten Gutenachtkuß auf die Stirn. Dann ging er nach dem Ratskeller. Denn der heutige Tag war hoch bedeutsam, der denkwürdigste vielleicht,[151] den das lebende Geschlecht feiern durfte. Herzog Heinrich hatte ja dem Lande die Reformation geschenkt!
Draußen war es dunkel und still geworden. Da überkam Sonnhild mit einem Male eine tiefe Sehnsucht, den Platz aufzusuchen, wo sie von dem Geliebten Abschied genommen.
Mit fliegender Hast eilte sie in ihre Kammer, schlang ein Tuch um die Schultern und stahl sich aus dem Hause. Die köstliche Luft des Sommerabends mit tiefen Zügen einatmend, schritt sie quer über den Markt und die Burggasse hinauf.
Der Mond war in einer schmalen Sichel aufgegangen und beleuchtete die Gassen hinreichend. Nur die im Schatten liegenden Häuserreihen waren in tiefes Dunkel getaucht. Aus den Schenken schallte Lärm, und durch die Fenster drang das Licht auf die Gasse. Sonnhild begegnete nur ein paar verspätet Heimkehrenden. Wenn sie an ihnen vorüberging, zog sie das Tuch sorgsam über das Gesicht.
So erreichte sie den Hohlweg. Als sie seine Steigung mit verlangsamten Schritten zurücklegte, hallte ihr Tritt leise von den hohen Mauern zurück. In diese schmale Schlucht fiel kein Lichtstrahl. Kaum konnte das Auge in der pechschwarzen Finsternis das Nächstliegende unterscheiden. Nichts regte sich; Kirchhofsstille. Sonnhild fühlte eine leise Beklemmung. Aber der Gedanke an den Geliebten verlieh ihr Mut.
Da hatte sie den Ausgang des Hohlwegs erreicht, und nun schimmerte in kurzer Entfernung vor ihr das matte Licht der Lampe des Torwarts vom Lommatzscher Tor.
Schon wollte sich Sonnhild linksab wenden, um dem Wege zu folgen, der am Afrakloster vorbei über den Domplatz zum Schlosse führte, als sie plötzlich jäh stehen blieb. Zu ihrer Linken hatte sich von der hohen Mauer ein Schatten gelöst, der durch die tiefe Dunkelheit unhörbar auf sie zukam. Ein furchtbares Angstgefühl überfiel das Mädchen. Sie wollte fliehen, aber ihre Glieder waren wie gelähmt.
Jetzt stand die Gestalt dicht vor ihr. Das Mondlicht fiel ihr voll ins Gesicht. Sonnhild fühlte, wie ihr Herzschlag aussetzte: sie sah in ein erschreckend bleiches Antlitz, aus dem ein Paar tiefliegender Augen sie starr betrachteten. Blitzschnell erinnerte sie sich des Abschiedes von Bernhard, bei dem diese Augen aus dem nahen Gebüsch heraus drohend auf sie gerichtet waren.
Das unbekannte Mädchen zuckte zusammen. Es hatte seine Todfeindin erkannt. Eine dämonische Freude schoß in das ausgezehrte Gesicht, und in den großen Augen flackerte es auf. Da stieß Sonnhild einen durchdringenden Schrei aus und lief davon, so schnell ihre Füße sie trugen. Das Judenmädchen aber eilte ihr in wilder Jagd hinterdrein.
Das Gattertor zum Friedhof vor dem Sankt Afrakloster stand offen. Sonnhild fuhr hinein und eilte zwischen den Gräbern hin, den Weg verfehlend. Die herabhängenden Zweige der Trauerweiden peitschten ihr Gesicht, und die Dornen der Rosenbüsche zerrissen ihre Kleider und Hände. Aber nur vorwärts! Dicht hinter ihr keuchte die Verfolgerin. Da hatte diese die Fliehende erreicht. Sonnhild fühlte, wie eine abgemagerte, heiße Hand ihre Schulter umklammerte … Noch einmal[153] verlieh ihr die Verzweiflung Riesenkräfte. Mit ein paar wilden Sätzen gewann sie wieder einen kleinen Vorsprung, wobei ihr die umklammernde Hand das Tuch von der Schulter riß.
Eine weit geöffnete Pforte gähnte der Geängstigten tiefschwarz entgegen; – hinein! Wie Schatten huschten die beiden Frauen durch den langgestreckten Kreuzgang und zum hinteren Tor hinaus wieder ins Freie. Von neuem ging die rasende Flucht die Gänge des Friedhofs entlang und im Sprung über Grabhügel hinweg, durch das Gattertor auf die Straße zum Hohlweg zurück. Mit unverminderter Geschwindigkeit flogen sie den abschüssigen Weg hinab, in der pechschwarzen Finsternis nur durch die tiefen Atemstöße die Gegenwart des andern erkennend.
Am Ende des Hohlwegs befand sich das Terminhaus der Freiberger Dominikaner, das Stationshaus für den Bettelbezirk. Ein trübbrennendes Lämpchen hing jetzt über der Tür.
Pfeilschnell schoß Sonnhild darauf zu. Aber ihre Kraft war erschöpft, sie fühlte, daß sie nach wenigen Schritten zusammenbrechen mußte. Doch das Schnaufen der Verfolgerin trieb sie weiter.
Da sah Sonnhild im Näherkommen, wie von der Burggasse her ein Weib auf den schwachen Lichtkreis zuschritt. In der nächsten Sekunde war sie bei ihr.
»Helft, Frau! Um Gottes willen, erbarmt Euch!« stieß die Todesmatte aus und sank auf dem kleinen Platz nieder.
Verwundert blickte die Fremde auf das zusammengebrochene Mädchen. Da flog eine zweite Gestalt atemlos[154] heran und war im Begriff, sich auf die Liegende zu stürzen, als das Weib dazwischentrat.
»Mirjam!«
Die Rasende prallte zurück.
»Mutter, hinweg!« zischte sie.
»Mirjam,« bat die Stimme.
»Hinweg, sage ich – sie darf nicht mehr leben …«
Gleichzeitig stieß sie die Frau beiseite, und Sonnhild sah ihr wutverzerrtes Gesicht und ihre glühenden Augen über sich gebeugt. Da wurde das Mädchen weggezogen und die beiden Frauen rangen miteinander, bis die Mutter die Schwachwerdende festhielt, ihren Mund zu deren Ohr neigte und ihr leise ein paar Worte zuflüsterte.
Die Wirkung dieser Mitteilung war entsetzlich. Eine Sekunde lang stand die Rasende unbeweglich. Dann warf sie die Hände über den Kopf und fiel mit einem erschütternden Schmerzensschrei hintenüber.
Eine kurze Weile betrachtete die Mutter in bitterer Wehmut ihr Kind. Dann hob sie die Ohnmächtige auf und verschwand mit ihr in der Dunkelheit des Hohlwegs.
Halb betäubt raffte sich Sonnhild empor. Das von Wut entstellte Gesicht wollte nicht vor ihren Augen verschwinden, und der durchdringende Aufschrei gellte ihr noch in den Ohren gräßlich wider.
Endlich wandte sie sich um und kehrte erschöpft nach Hause zurück.


Den Burgemeister Waltklinger nahmen in diesen Tagen seine Amtsgeschäfte stark in Anspruch. Der Ruf seiner Tüchtigkeit als Stadtoberhaupt war auch zum Herzog Heinrich gedrungen. Und obwohl dieser ihn nicht kannte, schätzte er ihn. Denn es war wertvoll, gerade in Meißen, der Residenz des Bischofs, jetzt einen energischen und zuverlässigen Burgemeister zu wissen.
Zwar war der rechtmäßige Vertreter der Landesregierung der Amtmann. Und an Ernst von Miltitz' treuer Pflichterfüllung und Anhänglichkeit an das Herrscherhaus wurde nicht gezweifelt.
Ob nun aber die Regierung in Dresden es vorzog, sich an den Burgemeister Waltklinger wegen seines großen Einflusses auf die Bürgerschaft Meißens und wegen seines Eifers für die neue Lehre unmittelbar zu wenden, oder ob sie das religiöse Empfinden des katholischen Amtmanns schonen wollte – genug, jedenfalls wurde in diesen Tagen der Rat der Stadt mit der Ausführung von Herzoglichen Verordnungen betraut, deren Vollziehung zu andern Zeiten dem Amtmann zufiel.
Darüber herrschte unter den Ratmannen lebhafte Befriedigung, denn der Vorzug, der ihrem Burgemeister[156] solchergestalt wurde, schmeichelte ihrem Stolz. Unter der Einwohnerschaft lief sogar das Gerücht herum, Ernst von Miltitz sei beim Herzog in Ungnade gefallen, worüber manch einer leise Schadenfreude empfand.
Obzwar die Stadt der Tüchtigkeit des Amtmanns manche Verbesserung verdankte, wurde doch andrerseits sein straffes Regiment als lästig empfunden. Zudem war er Katholik! Und gerade in diesen kriegerischen Tagen, nachdem man so lange für das neue Evangelium gestritten und so viele Demütigungen durch den fanatischen Klerus erlitten hatte, genügte schon die Zugehörigkeit zur katholischen Kirche, um einem Mann die Volksgunst zu entziehen.
Eines Vormittags erschienen im Hause des Burgemeisters zwei Ratmannen, Peter Sorgenfrei, der reiche Fleischhauer, und der alte Niclas Anesorge. Sie trafen ihn natürlich bei der Arbeit. Georg Waltklinger legte die Arbeitsschürze ab und geleitete seinen Besuch nach einer der Prunkstuben im ersten Stockwerk. Hier setzten sie sich an den runden Tisch.
Das Temperament dieser beiden Ratmannen war grundverschieden. Niclas Anesorge war der bekannte Brausekopf, der sich trotz seiner hohen Jahre leicht zu Unüberlegtheiten hinreißen ließ. Der am Ausgang der Fünfziger stehende Peter Sorgenfrei hingegen war bedächtig in Wort und Tat, aber von einer zähen Ausdauer. Er besaß einen hünenhaften Körper, und seine Bewegungen waren schwerfällig. Seine Familie galt als eine der ältesten der Stadt.
Niclas Anesorge war in fröhlicher Stimmung. Schmunzelnd rieb er sich die Hände, während er versetzte:
»Wer hätte noch vor wenigen Wochen gedacht, daß sich alles so glücklich schickte! Herzog Heinrich, du bist mir der Liebste!«
»Ja, es hat sich wunderbar gefügt,« sagte Waltklinger.
»Am Tage, wo die Schwarzröcke zum Tor hinausziehen, soll aus dem Löwenmaul des Marktbrunnens auf mein Geheiß Wein fließen,« erwiderte Anesorge.
»Wie ihr wißt,« begann Waltklinger, »haben wir alljährlich gegen Bezahlung aus der Herzoglichen Hofkasse an das Kloster zum heiligen Kreuz meißnisches Tuch und schwäbische Schleier geliefert. Nun hat in diesem Jahr die Äbtissin Christina von Lüttichau für jede Nonne einen Leidener Rock und einen lundischen Mantel bei der Hofhaltung in Dresden angefordert.
Was tut da der Herzog? Heute früh erhalte ich ein Schreiben, wonach die alljährliche Lieferung an das Kloster unterbleiben soll. Die frommen Schwestern aber hat er streng angewiesen, das Ordensgewand abzulegen und weltliche Kleider zu tragen.«
Niclas Anesorge lachte ins Fäustchen.
»Ein verständiger und energischer Herr ist Herzog Heinrich,« klang Peter Sorgenfreis tiefer Baß. »Der packt fest zu. Wie weit ist denn die Streitigkeit mit der Domgeistlichkeit, Burgemeister?«
»Dieselbe Verordnung des Herzogs, die uns die Einführung der Lutherischen Lehre anbefiehlt, hat natürlich auch der Bischof erhalten.«
Anesorge krümmte sich vor Freude.
»Mein halbes Vermögen,« rief er, »hätte ich darangegeben, die giftgrünen Pfaffengesichter zu sehen, als sie es erfuhren. Die kugelrunden Domherren werden[158] fauchend umeinander gesprungen sein wie geprügelte Katzen.«
Lächelnd fuhr Waltklinger fort:
»Wenige Tage darauf bietet der Bischof dem Herzog an, er wolle Kirchen und Schulen reformieren. Aber damit war Heinrich nicht einverstanden. Vielmehr läßt er den geistlichen Herrn bescheiden, daß er die Reformation selbst durchführen wolle, und zwar streng nach dem Sinn der Augsburgischen Konfession.«
»Alles, was man vom Tun des Herzogs vernimmt, zeugt für seine Klugheit und Tatkraft,« unterbrach Sorgenfrei.
»Und um das begonnene Werk zu fördern, erklärt Herzog Heinrich dem Bischof gleichzeitig, daß er in den nächsten Tagen den Wittenberger Theologen Jonas zu ihm schicken werde, nach dessen Anordnung zu handeln sei.«
Niclas Anesorge sprang vom Stuhl auf und durchmaß stürmischen Schritts die Stube.
»Ein Segen ist dieser Herzog für das Land!« rief er wiederholt, »sein Andenken wird nie untergehen im sächsischen Volk!«
»Diese Haltung Herzog Heinrichs hat den Bischof natürlich aufs höchste erbittert, und es hat an heftigen Vorstellungen in Dresden nicht gefehlt. Dem Landesfürsten stehe es nicht zu, hat der Krummstab geäußert, sich in die innern Angelegenheiten der katholischen Kirche zu mischen. Der Fürsten Machtbereich erstrecke sich allein auf weltliche Dinge.
Darauf hat der Herzog in kühlem Ton erwidert, die Angelegenheiten der katholischen Kirche interessierten ihn gar wenig. Dafür bekümmere er sich eifrig um die[159] protestantische Lehre, zu der er sich bekenne, und die nun auch fast alle seiner Untertanen angenommen hätten. Den Bischof werde sein geistliches Hirtenamt nicht mehr drücken, da er fortan nur noch verschwindend wenig Schäflein besitzen würde.«
Die beiden Ratsherren horchten mit Spannung auf des Burgemeisters Erzählung. Dieser fuhr fort:
»Nun ist unlängst der angekündigte Prediger Jonas in aller Stille angekommen und Rudolf von Rechenberg als weltlicher Rat ihm zur Seite. Diese beiden sind vor den Bischof getreten und haben unter Berufung auf die Verordnung des Landesfürsten von ihm die Abtretung des Doms verlangt. Darüber ist der geistliche Herr etwas aus dem Häuschen geraten, und er soll die herzoglichen Abgesandten wenig manierlich angehaucht haben. Mit um so größerer Ruhe haben diese die Forderung wiederholt und Gewaltmaßregeln in Aussicht gestellt. Der entrüstete Bischof ist daraufhin so lebhaft geworden, daß alle Domherren nacheinander herbeigelaufen sind. Und nun war das Gezeter natürlich groß.
Der Dom ist kirchliches Eigentum, hat der Bischof einmal über das andere gerufen. Nein, hat Rudolf von Rechenberg ruhig geantwortet, er ist von den Spenden und Abgaben des Volkes erbauet worden und Eigentum des Landes. Den kirchlichen Vertretern wurde er alsdann zur Benutzung übergeben.
Wir werden das Gotteshaus nicht herausgeben, hat der zornige Priester gewettert, auf daß es nicht entweihet werde.
In dem ehrwürdigen Bau, hat darauf Rechenberg erwidert, werde auch in Zukunft dem allmächtigen Gott[160] ebenso ergeben und inbrünstig gedient werden, wie bisher. Und die göttliche Liebe und Gnade werde sich auch über die neue Gemeinde ausgießen. Die Diener der katholischen Kirche möchten nur ruhig das Gotteshaus verlassen und die felsenfeste Überzeugung mitnehmen, daß der Dom für alle Zeiten eine geweihte Stätte bleiben werde. Nicht Stein und Eisen stempelten den Bau zur Kirche, sondern der lebendige Geist, den das göttliche Wort in den Seelen der in ihm Versammelten erzeuget.«
Georg Waltklinger machte eine Pause.
»Ihr werdet nun wissen wollen,« begann er wieder, »woher ich dies alles so gut kenne. Hört den Schluß meiner Erzählung, woraus hervorgehen wird, daß bei der Ausführung der Herzoglichen Verordnung ich selbst mitgewirkt habe.«
Die Zuhörer fuhren überrascht auf, versuchten aber nicht, den Fluß der Rede mit unnützen Fragen aufzuhalten.
»Die beiden Abgesandten des Herzogs hatten dem Bischof die Frist von dreimal vierundzwanzig Stunden gestellt. Nach Ablauf dieser Zeit sollten alle Merkmale des katholischen Glaubens aus dem Dom entfernt sein. Dies geschah nicht. Vernehmt nun, wie Herzog Heinrich seinem landesherrlichen Ansehen Nachdruck verschafft.
Verwichene Nacht, es mochte gegen ein Uhr in der Frühe sein, tönt der eiserne Klopfer an meinem Haustor sehr vernehmlich dreimal. Ich verlasse das Bett, kleide mich rasch an und öffne. Ein Mann tritt in den Flur. Beim Schein der flackernden Kerze erkenne ich Herrn Rudolf von Rechenberg.
›Herr Burgemeister,‹ spricht dieser, ›ich ersuche Euch,[161] mit mir zu gehen. Auf herzogliche Weisung bedarf ich Eurer Zeugenschaft als bestallter Vertreter der Stadt Meißen.‹
Ich werfe meinen Nachtmantel über, und wenige Minuten darauf schreiten wir durch die Burggasse und die Stiegen hinauf nach dem Schloß. Kein lebendes Wesen war zu sehen. Auf dem Domplatz begegnet uns ein Mann. – ›Herr Jonas, es kann beginnen‹, sagt Rudolf von Rechenberg.
Da sehe ich vor der offenen Dompforte eine Schar Leute, zehn oder zwölf, und sechs bewaffnete Burgknechte, die den Eingang bewachen.
Nun treten wir in das Innere des Doms. Zunder flammt auf, und beim Schein von Pechfackeln geht es vorwärts. Unsere Tritte hallen durch das nächtliche Schweigen von den hohen Mauern zurück.
Wir stehen vor dem Altar. Herr Rudolf von Rechenberg läßt alles von ihm entfernen, was an Sonderheiten der katholischen Lehre vorhanden. Schweigend packen die Männer die Geräte in bereitgehaltene Körbe, – Altardecke, Paramente, Monstranz, Glocken, Weihrauchkessel, Patenen, Peristerium und das Aquamanile. Auch der Reliquienschrein wird entfernt und noch mancherlei dazu.
Herr Jonas bezeichnet die Gegenstände, und Rechenberg befiehlt, sie wegzuräumen.
Endlich ist scheinbar alles getan. Da ruft Herr Rudolf von Rechenberg einige Männer zu sich, ihres Zeichens Steinmetzen, wie ich alsbald erkennen sollte. Mit diesen begibt er sich zum Grabe des heiligen Benno und weist die Leute an, es zu entfernen. Sie werfen ihre Kittel ab,[162] und nun hallen die Schläge von Hammer und Meißel durch die Stille, bis der tote Bischof den Platz geräumt hat und sein Grabmal dem Erdboden gleich gemacht ist. Die entfernten Steinbilder werden gleichfalls sorgsam in Körbe verpackt.
Nun, Herr Jonas, hebt Rechenberg an, ist das Werk vollendet? Der Wittenberger Theolog schaut sich lange um. Es ist getan, sagt er endlich.
Da läßt Herr von Rechenberg die Körbe schließen. Tragt sie nach dem Heinrichskloster hinab, befiehlt er den Männern. Diese heben ihre Last auf und entfernen sich.
Darauf wendet er sich an mich. Herr Burgemeister, sagt er mit jener Gelassenheit, die ihn auszeichnet, solchermaßen bewältigt man rebellische Priester. Der Fürst muß immer Herr bleiben in seinem Lande. Er dient allein dem Höchsten, nicht der Kirche. Diese ist ihm untertan. Lasset alle wissen, was Ihr hier gesehen, und tut der Einwohnerschaft kund, daß morgen abend neun Uhr der erste lutherische Gottesdienst im Dom von unserem wackern Herrn Jonas abgehalten wird. Sobald heute die Stunde schicklich, teilen wir diesen herzoglichen Willen dem Amtmann mit.
Als ich das herrliche Gotteshaus verließ,« schloß Georg Waltklinger seinen Bericht, »dämmerte im Osten fahles Frühlicht herauf, und auf dem Schloßfirst jubelten die Schwarzdrosseln dem jungen Tag entgegen. Ich aber sah und hörte nicht viel von alledem, so hatte mich das Erlebnis ergriffen!«
Aber auch die beiden Ratmannen standen unter dem Bann des Erzählten.
»Wann willst du den Rat zusammenberufen, Burgemeister?« fragte Peter Sorgenfrei.
»Für heute nachmittag vier Uhr. Der Ratsbote ist darum schon auf den Beinen. Der Bürgerschaft soll es durch den Ausrufer verkündet werden.«
Niclas Anesorge frohlockte.
»Wie wird dem Siebeneichener die Galle schwellen, wenn er hört, daß wieder einmal ohne seine Mitwirkung alles besorgt worden ist.«
»Und daß nicht er, sondern der Burgemeister zugezogen wurde,« setzte Waltklinger lächelnd hinzu.
Peter Sorgenfrei blieb ernst.
»Burgemeister,« sagte er in seiner ganzen Bedächtigkeit, »meinst du nicht, daß es an der Zeit wäre, den Amtmann durch ein paar freundliche Worte wissen zu lassen, wie der Rat der Stadt Wert darauf legt, in guten Beziehungen zu ihm zu stehen?«
Da fuhr der alte Anesorge auf:
»Freundliche Worte diesem Amtmann? Warum nicht gar!« rief er patzig.
Georg Waltklingers Stirn hatte sich gerunzelt.
»Wir sind Ernst von Miltitz keine Erklärung schuldig,« sagte er mit verhaltenem Grimm. »Er hat das gute Einvernehmen zwischen uns gestört, nicht wir. Von seiner Seite kamen die Angriffe.«
»Er befolgte Willen und Weisung seines Fürsten!«
»Mit Quälereien hat er uns zugesetzt, als er wußte, in welch tiefer Sehnsucht sich die Bürgerschaft nach dem neuen Evangelium verzehrte.«
»Er schuldete seinem Herrn Gehorsam!«
Waltklinger lachte bitter auf. Wohl war er innerlich überzeugt, daß Ernst von Miltitz als Beauftragter des Herzogs nicht anders hatte handeln können. Aber sein Widerwillen gegen diesen Mann war so stark, daß er ihm wissentlich unrecht tun konnte.
»Du meinst also, wie er zu uns kam und uns zu überreden versuchte, tat er nur – – –«
»Seine Pflicht!« unterbrach Peter Sorgenfrei eisig. »Du selbst, Burgemeister, und gerade du hättest nicht anders gehandelt. Ein ungetreuer Knecht, der nicht den Willen seines Herrn erfüllte!«
Georg Waltklingers Erregung wuchs.
»Sorgenfrei,« sagte er kopfschüttelnd, »du befindest dich in einem großen Irrtum. Wohl ist ein Amtmann seinem Fürsten zum Gehorsam verpflichtet. Aber hinter allem, was Miltitz sprach und uns in kirchlichen Dingen auferlegte, lauerte ein gut Teil persönlichen Übelwollens. Weißt du nicht, daß der hochmütige Herr auf Siebeneichen einer der schlimmsten Römlinge ist, die wir im Lande haben?«
»Recht hast du, Burgemeister,« eiferte Niclas Anesorge. »Dieser Amtmann ist uns doppelt mißgünstig gesinnt. Einmal gehört er zu jenen Vertretern des Adels, die die Bauern am liebsten vor den Pflug spannen und uns Städtern einen strengen Zehnten auferlegen möchten, damit sie im Nichtstun prassen können. Und das andere Mal ist er ein finsterer, herzloser Hasser von allem, was lutherisch ist.«
Der reiche Fleischhauer warf dem Sprecher einen mißbilligenden Blick zu.
»Dein weißes Haar, Anesorge, sollte dich endlich davon zurückhalten, Abwesende zu verunglimpfen. Aus deinen Worten spricht persönlicher Haß und kleinliche Gesinnung.«
»Hörst du's, Waltklinger?« fuhr der Gescholtene auf, »so spricht ein Ratmanne der Stadt Meißen!«
Peter Sorgenfrei ließ sich nicht irremachen.
»Du zeigst dich gegen den Amtmann gereizt, Burgemeister,« fuhr er fort. »Wir wollen unsere gute Zeit jetzt nicht daran verschwenden, zu untersuchen, wie weit du dazu im Rechte bist. Aber das eine nimm mir nicht krumm, Waltklinger: ich bin verwundert ob deiner Rede, der Miltitz sei ein Römling. Solches plappert der Volksmund. Lassen wir den Nachbetern ihr Geschwätz. Wir sind ernste Männer und sprechen nur das, was wir wissen! Oder solltest du Beweise für deine Behauptung besitzen? Dann will ich gern bekennen, daß ich im Unrecht bin.«
Der Burgemeister kämpfte mit einer leichten Verlegenheit. Hatte er Beweise? Nein! Sorgenfrei war kein geübter Sprecher, und es machte ihm sichtlich Mühe, längere Zeit zu reden. Aber was er sagte, war durchdacht. Alles war kernig an ihm! Ein Mensch, auf dessen Wort man wie auf einen Felsen bauen konnte.
Schnell gefaßt, versetzte Waltklinger:
»Hast du's ganz vergessen – 's ist noch nicht lange her –, wie der Amtmann unsere Ratsversammlung besuchte und uns überreden wollte, den alten Glauben zu behalten? Da verriet sich sein schwarzes Herz doch recht offenkundig!«
»Ich habe den Sinn seiner Worte getreu im Gedächtnis behalten,« erwiderte Sorgenfrei. »Miltitz verglich den[166] alten und den neuen Glauben mit zwei Wegen, die zum ewigen Heil führten. Das ist eine Rede, wie sie ein eingefleischter Papist nicht im Munde führt. Denn ein solcher läßt das lutherische Wort nimmermehr gelten. Seien wir also gerecht.«
Waltklinger fühlte sich in die Enge getrieben. Sorgenfreis ungeschminkte Rede war nicht zu widerlegen. Da enthob ihn ein eintretender Bote, der einen Brief brachte, der Verlegenheit, zu antworten. Der Burgemeister öffnete und las die Schrift.
»Vom Amtmann,« sagte er. »Er fordert den Rat auf, übermorgen zehn Uhr vormittag vor dem Heinrichskloster einzutreffen, um die alte Streitigkeit zwischen dem Kloster und der Stadt wegen der Kirchhofsgrenze zu schlichten.«
Niclas Anesorge spitzte die Lippen und pfiff laut.
»Nichts als ein Vorwand,« rief er. »Der alte Fuchs will uns wieder einmal die Leviten lesen!«
»Glaub's schon, daß dem so ist,« stimmte Waltklinger zu. »In der letzten Zeit ist es zu oft geschehen, daß sich die Landesregierung unmittelbar an die Stadt gewendet hat, statt durch den Amtmann zu uns zu sprechen. Darob ist er ergrimmt. Und weil er nach oben hin still sein muß, hat er sich vorgenommen, dem Rat einmal seine ganze Macht zu zeigen.«
Anesorge stimmte zu. Peter Sorgenfrei schwieg. Waltklinger empfand dies als einen erneuten Widerspruch, der ihn stark verdroß, so sehr er seinen Vertreter auch schätzte.
»Gevatter,« wandte er sich mit schlecht verhehltem Spott an Sorgenfrei, »mir scheint, wir bemühen uns[167] heute umsonst, deine Beistimmung zu erhalten. Und doch verfechten wir nur die Sache der Bürgerschaft. Der Herr Amtmann hat dir's angetan! Hm … Vertreter einer der ältesten Adelsfamilien des Landes, hohes Amt, sehr angesehen bei Hofe – – – Rückgrat! Rückgrat!«
Peter Sorgenfrei richtete seinen gewaltigen Körper etwas höher auf, wie ein gereizter Löwe tut, der es aber verschmäht, sich auf seinen Angreifer zu stürzen. Doch das Zittern seiner tiefen Stimme verriet den Zorn, der in ihm aufgestiegen war. Die Gutmütigkeit des reichen Fleischhauers war in der Stadt sprichwörtlich. Um so mehr wirkte es deshalb, wenn er zornig wurde.
»Ich kann es keinem erlauben,« sagte er endlich, »an meiner Gesinnung als Vertreter der Bürger zu zweifeln. Alles, was ich für die Stadt tue, habe ich daraufhin geprüft, ob es ihrem Wohle dient. So hab' ich es gehalten von dem Tage ab, an dem ich mein Amt übernommen. Wenn die Bürgerschaft mit Peter Sorgenfrei nicht mehr zufrieden ist, möge sie sein Amt von ihm zurückfordern. Bis dahin aber übe ich es so aus, wie in all den Tagen, wo ich mit gutem Gewissen Gott und den Menschen Rechenschaft ablegen konnte.«
Der Hüne zwang sich bei dieser Rede zur Ruhe. Nur die mächtige Hand, die auf dem Tische lag, zitterte. Jetzt verrauchte sein Zorn schon wieder. Und in gemäßigterem Tone fuhr er fort:
»Dies alles ist dir genugsam bekannt, Waltklinger, wenn selbst du so verletzende Worte gebrauchst, wie eben. Denn gerade du bist es, der mich vor allen andern wohl am besten kennt. Aber ebensogut kenne ich dich, dein Herz und deine Klugheit. Aber auch deine Schwächen! Und[168] da wir einmal bei dieser Aussprache sind, will ich auf halbem Wege nicht stehenbleiben. Männer, die eine vierzigjährige Freundschaft verbindet, dürfen ganz offen zueinander sprechen.
Bürger und Adel sind die Kinder einer Mutter. Ihre Aufgaben sind in vielen Dingen gemeinsame. Was läge näher als ihr Zusammenarbeiten zum Wohle des Landes! Anstatt dieses zu tun, liegen sie seit Jahrhunderten in erbittertem Streit und vergeuden damit gute Kräfte. Wir kennen die Ursachen des Haders, der sich täglich erneuert. Gefehlt wird hüben und drüben! Wem aber das Gedeihen der Heimaterde am Herzen liegt, der sollte vom Streit ablassen und sich zum Frieden geneigt zeigen. Das gilt für die Einsichtigen in beiden Lagern. Schon hört man unter den Adligen Stimmen, die den Hochmut ihresgleichen uns Bürgern gegenüber verurteilen. Wenn sich aber solche Freunde des Friedens uns nähern, werden sie kalt zurückgewiesen. Das frommt dem Frieden nicht!«
Peter Sorgenfrei beugte sich weit vornüber.
»Georg,« sagte er eindringlich, »so mich nicht alle guten Geister verlassen, dann werde ich recht behalten, wenn ich ausspreche: der Siebeneichener ist einer von denen, die vermitteln möchten. Prüfen wir uns einmal recht sorgfältig, ob in manchem Streit, den wir mit ihm hatten, nicht die Ursache bei uns gelegen hat. Sein Regiment ist straff, aber nicht hart, und seine Gerechtigkeit wird gerühmt. Zudem sind die Widerwärtigkeiten des religiösen Zwistes beseitigt, die auf dem Wege lagen, wie spitze Stiefel. Aber mehr als einmal habe ich empfunden, daß er unser Vertrauen suchte. Und könnten[169] wir uns entschließen, ihm solches zu schenken, so wäre das der erste Schritt zur Freundschaft!
Also: starker Bürgersinn und Bürgerstolz in Ehren! Aber trotzig wollen wir nicht sein und einem guten Wort eine gute Statt einräumen. Wer uns einen Schritt entgegenkommt, dem wollen wir's mit zweien danken. Das dient dem Frieden, Georg, und fördert das Wohl der Bürgerschaft!«
Der reiche Fleischhauer erhob sich.
»Genug, Freunde,« sagte er, »zwischen uns besteht Klarheit. Laßt meine Rede auf Euch wirken, sie ist gut gemeint.«
Und ohne eine Antwort abzuwarten, drückte er beiden Männern die Hand und ließ sie allein.
Die ruhigen Worte hatten auf die Zuhörer Eindruck gemacht. Als Sorgenfrei sie verlassen, schwiegen sie eine Weile. Dann fragte Niclas Anesorge etwas kleinlaut:
»Nun, Burgemeister, wie stellst du dich dazu?«
Waltklinger warf einen raschen Blick durch das Fenster, hinab auf den Markt, wo der Ausrufer mit der Klingel gerade verkündete, was sich in der verflossenen Nacht im Dom zugetragen hatte. Endlich versetzte er:
»Sorgenfrei ist ein Schönseher. Schon immer war er's. Nun er den Glaubenshader glücklich beseitigt weiß, meint er, Bürger und Adel brauchten sich nur in die Arme zu fallen. Ich wäre nicht abgeneigt, Frieden zu schließen. Aber der Bürger möchte Kratzfüße machen und mit krummem Rücken demütig bitten. So will es der Adel. Und so wird es nicht! Um Freundschaft bitten, haben wir nicht nötig. Ist es den Herren ehrlich daran gelegen, so mögen[170] sie kommen. Hochmütig anschauen werden wir sie nicht. Bis dahin aber Gott befohlen!«
Anesorge lächelte.
»Du redest gut, Burgemeister. Auf dich ist immer Verlaß. Bis jetzt war das Pfaffengesindel der grimmigste Feind, nun ist es der Adel. – Und wie denkst du über den Amtmann?«
Waltklinger zog die Brauen zusammen.
»Dem trau' ich nicht! Er sollte bestrebt sein, unser Freund zu werden? Nimmermehr! Ich halte ihn keiner warmen Regung fähig. Vielleicht erleben wir es noch, daß sich mein Urteil als richtig erweist. Er ist ein herzloser Mann, der nur auf seinen Vorteil denkt. Ich werde seinen Hochmut mit Verächtlichkeit abtun.«
»Vortrefflich! Ganz ausgezeichnet!« frohlockte der alte Anesorge und klopfte den Burgemeister auf die Schulter. »Bleib' so, Waltklinger, wir alle werden dir beistehen!«
Danach trennten sich die Männer.
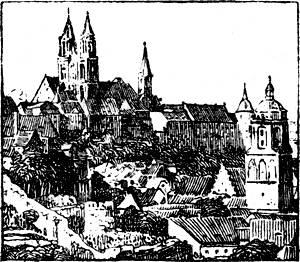

Am Abend des nächsten Tages strömte das Volk zum Dom. Und es waren ihrer weit mehr, die Eintritt begehrten, als der geräumige Bau fassen konnte. Zur gleichen Stunde hatte die katholische Geistlichkeit für die Anhänger des alten Glaubens einen Trutzgottesdienst in der Kirche des Franziskanerklosters verkünden lassen.
Hier wurde der ganze kirchliche Glanz des Mittelalters, das höchste Schaugepränge des katholischen Kultus entfaltet. Eine große Anzahl Kerzen verbreitete in der Kirche strahlendes Licht, und starker Weihrauchduft schlug den Eintretenden entgegen.
Der Hochaltar war rot bekleidet und mit schwersilbernen Leuchtern, die dicke Wachskerzen trugen, aufs prächtigste geschmückt. Zu diesem Hochamt hatten sich alle Priester Meißens und seiner Umgebung versammelt. Selbst aus dem nahen Dresden waren sie herbeigekommen.
Der Propst war mit dem vollzähligen Domkapitel erschienen. Die Domherren trugen Gewänder von kostbaren Stoffen mit Pelzwerk verbrämt und mit reichgoldenen Stickereien.
Das Chor war angefüllt mit Vikaren und Großvikaren, Offizialen, Diakonen und Subdiakonen, die hinter den Kanonikern standen. Den noch freien Raum nahmen die Choralisten ein, die sich beim Betreten des Chors nach Osten und Westen verneigten und die den beiden Prälaten, Propst und Dekan, die schuldige Achtung durch Verbeugen erwiesen.
Zuletzt erschien unter einem Baldachin der Bischof in vollem Ornat, geschmückt mit Mitra und Brustkreuz und den Krummstab in den Händen. Zahlreiche Ministranten begleiteten ihn. Das Pontifikalamt begann, bei dem der Bischof die Messe zelebrierte.
Unter den am Eingang stehenden Andächtigen befand sich ein Mann, der mit sichtlicher Unrast seine Augen schweifen ließ und nicht viel von der Weihung vernehmen mochte, die sich gerade vollzog. – – In nomine Patris et Filii et Spiritus sancti. Amen – – – – Seine Sinne arbeiteten angestrengt, ein Gedanke von höchster Bedeutung mußte ihn erfüllen.
Wie im Traum vernahm er noch das Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, Oremus. Dann versank er in tiefes Grübeln, aus dem ihn erst wieder das Kyrie eleison merkte. Als aber das Gloria in excelsis ertönte, hörte er nichts mehr. Nur beim Verklingen des Gesangs murmelten seine Lippen: Amen.
Die Opferung wurde vollzogen, die Händewaschung – Orate, fratres, ut meum – – – – Per omnia saecula saeculorum – – –.
Das Sursum corda zitterte durch den Raum, die heilige Wandlung stand bevor. Hier erwachte der Grübler für einen Augenblick, dann wurde sein Geist wieder hinweggezogen.[173] Da traf ein von Jugend auf wohlbekannter Klang sein Ohr, der den Versunkenen in die Gegenwart hereinriß, – das Tönen der Schelle der Ministranten. Ein Rauschen, und die ganze Gemeinde fiel auf die Knie. Der heiligste Augenblick der Messe war gekommen. Der Bischof erhob sich und zeigte die geweihte Hostie und den Kelch dem Volke.
Während der nun folgenden Kommunion sah der Mann wieder teilnahmlos auf die Schar der Andächtigen, bis der Priester das Te Deum laudamus anstimmte und die Gemeinde mit Inbrunst einfiel: Großer Gott, wir loben dich!
Da verließ der Mann die Kirche und trat hinaus auf den Heinrichsplatz. Seine Augen, von dem hellen Kerzenlicht geblendet, konnten die Finsternis nicht durchdringen. Die Stadt war wie ausgestorben, kein Mensch begegnete ihm.
In dem hohen Erker des Eckhauses an der Elbgasse brannte ein einsames Licht. Vom Heinrichskloster her tönten die Klänge des Lobgesanges ihm noch schwach hinterdrein. Sonst herrschte lautlose Stille.
In der Mitte des Marktes blieb der nächtliche Wanderer erschöpft stehen, nahm den Hut vom Kopf und trocknete die feuchte Stirn. Die Umrisse der hohen Giebel und Erker der Gebäude traten aus der Dunkelheit schwach hervor. Rechts stand das ehrwürdige Rathaus, zu seiner Linken ragte die wuchtige Fassade vom Wohnhause des Burgemeisters hoch in die Luft.
Der einsame Mann sah zum bewölkten Himmel auf; ein einziger Stern glänzte hell herab. Mit einer stummen Frage hingen seine Augen lange an dem blinkenden Licht.[174] Wenn ihm von oben herab Rat kommen möchte! – Aber keine Stimme drang hernieder. Der leuchtende Stern zog seine ferne Bahn still weiter.
Jetzt ruhten die Blicke des Mannes versonnen auf dem Brunnen. Die steinernen Figuren standen steif auf ihren Sockeln. Ab und zu schien es, als ob sie die Gesichter einander zuwendeten und leise flüsterten. Der Löwe über ihren Häuptern betrachtete aufmerksam den runden Strahl, der ihm aus dem Maule floß, und es sah aus, als wenn er die Ohren spitzte und aufmerksam den murmelnden Klängen des alten Brunnenliedes lauschte, das seine Wasser sangen.
Noch einmal schlug der Einsame die Augen aufwärts. Sein Atem ging schwer. Da teilte sich plötzlich eine Nebelwolke, und zwei weitere Sterne wurden sichtbar. Die Blicke des Schauenden hingen wie gebannt an dieser Erscheinung, und sein Herz schlug laut. Sollte das Hervortreten der flimmernden Himmelslichter für ihn bedeutungsvoll sein? Wies das glänzende Dreigestirn nicht nach dem Dom? Der Mann erschauerte.
Noch eine kurze Weile hingen seine Augen an den Sternen. Dann riß er sich von dem Anblick los und ging mit schnellen Schritten die Burggasse hinauf.
Am Fuße der Domstufen brannte am Terminhause der Dominikaner wie allnächtlich das Lämpchen und leuchtete ihm ein Stück. Endlich stand er vor dem Dom, durch dessen bunte Fenster das Licht fiel und auf das Steinpflaster scharf geschnittene Rechtecke zeichnete.
Die Besucher des Gotteshauses standen eng aneinander gedrängt bis zu der offenen Tür. Jeder hatte an dem ersten protestantischen Gottesdienst im Dom teilnehmen[175] wollen. Der Unbekannte stellte sich auf die steinerne Schwelle und sah hinein. Auch hier strahlte heller Lichterglanz bis in die fernsten Winkel des Kirchenschiffs.
Auf der Kanzel stand in schwarzem Talar mit weißen Beffchen die ehrfurchtgebietende Gestalt des greisen Predigers Jonas, der mit markigen Worten zu der Gemeinde sprach. Seine Augen leuchteten in heller Begeisterung, und das faltenreiche Gesicht war von einer jugendlichen Röte überzogen.
Die Rede des trefflichen Greises drang den Zuhörern zum Herzen. Wie gebannt hingen ihre Blicke an seinem Munde. Auch der Unbekannte lauschte den zündenden Worten.
Der weise Religionsdiener hatte als Stoff seiner Predigt das Herz der christlichen Lehre gewählt, jenes Kapitel, das wie kein anderes geeignet ist, das menschliche Empfinden wachzurufen. Er sang das unvergängliche Hohe Lied der Liebe! Jetzt sprach er von der Liebe zum Nächsten. Mit eindringlichen Worten ermahnte er seine protestantischen Zuhörer, es den katholischen Mitbrüdern nicht zu entgelten, wenn sie an ihrem alten Glauben festhielten, und keiner solle meinen, daß sein Glaube der wahre und nur allein gottgefällige sei. Hier müsse das Herz entscheiden. Das Irren sei der menschlichen Natur als Stempel aufgedrückt. Man dürfe nicht hoffärtig auf seiner Überzeugung beharren, – Demut und felsenfester Glaube an die Barmherzigkeit und Ewigkeit der Himmel seien der köstlichste Schmuck eines wahren Christen.
Mit diesen Worten schloß Herr Jonas die erste protestantische Predigt im Dom zu Meißen.
Jetzt erklang die Orgel. Zuerst spielte sie ein leises[176] Präludium. Durch die Fülle der Töne zog sich eine gedämpfte Melodie, die nur leise anklang und gerade dann wieder entschwand, wenn die Zuhörer sie zu erkennen meinten. Ihr Wohllaut entzückte jedes Ohr.
Da riß das Vorspiel plötzlich ab. Eine Sekunde lang herrschte tiefe Stille. Dann setzte die Orgel mit voller Kraft ein. Die machtvollen Töne brausten durch den Dom bis in den entferntesten Winkel, schlugen hinauf zu dem großen Erlöserkreuz an der Decke und brachen sich an den hohen Säulen, daß diese erzitterten. Nun stimmte die Gemeinde mit vielhundert Kehlen in hoher Begeisterung den Gesang an. Es war jenes Lied, das in den damaligen Tagen in aller Mund war, und das die Mutter ihrem Kindlein als Wiegenlied sang – das Lied, das der mannhafte Doktor Martin Luther seinen Anhängern als Trutzlied beschert:
Der Unbekannte war der Predigt mit großer Aufmerksamkeit gefolgt. Jetzt aber, als er den brausenden Gesang vernahm und die hohe Begeisterung der Andächtigen von ihren Gesichtern las, fühlte er sich tief ergriffen.
Er verließ seinen Platz und ging sinnend vor dem Gotteshaus auf und ab.
Was vorhin im Heinrichskloster und jetzt hier im Dom die Seelen der Menschen im Bann gehalten, waren der Geist und die weihevollen Ausdrucksformen der beiden Hauptzweige der christlichen Kirche, die sich wie zwei Weltanschauungen schroff gegenüberstanden. Beiden wohnte die Kraft inne, das menschliche Herz vom Irdischen loszulösen und in unstillbarer Sehnsucht nach dem[177] unerforschlichen Ewigen lauter schlagen zu lassen; – und doch gähnte zwischen ihnen ein tiefer Abgrund!
Dem Sinnenden ward offenbar, daß er einen schwankenden Steg von Fels zu Fels geschlagen hatte, auf dessen Mitte er jetzt unschlüssig stand.
Da hörte er Schritte. Und um sich neugierigen Blicken zu entziehen, ging er hinüber nach der Schotterei und verbarg sich im Dunkel.
Der Gesang war zu Ende, und die Besucher verließen den Dom. Noch durchdrungen von der Weihe, gingen sie in Gruppen schweigsam der Stadt zu. Nach kurzer Zeit war das Gotteshaus leer, und die Lichter verlöschten. Da verließ der Unbekannte seinen Platz und näherte sich der offengebliebenen Tür.
In der Kirche waren nur noch zwei Personen, der Domdiener, der bei dem matten Schein der auf dem Altar brennenden zwei Kerzen die Abendmahlgefäße ordnete, und der Prediger Jonas, der mit der Bibel unter dem Arm eben auf den Ausgang zuschritt. Da bemerkte der Greis an der Türschwelle einen Menschen. Er näherte sich ihm und betrachtete ihn bei dem herrschenden Halbdunkel forschend. Das Gesicht war Herrn Jonas bekannt; erst gestern hatte er diesem Mann gegenübergestanden.
»Ihr hier, – Herr Amtmann?« fragte er höchlichst erstaunt.
Ernst von Miltitz trat dicht an den Prediger heran und antwortete:
»Ehrwürdiger, ich bitte Euch, kehrt noch einmal um und … reicht mir das Abendmahl in beiderlei Gestalt!«


Am nächsten Morgen hatten sich der Burgemeister und die Ratmannen zu der vom Amtmann anberaumten Stunde auf dem Heinrichsplatz eingefunden. Die Ursache des Zusammenkommens war eine langjährige Streitigkeit. Während der Abt der Franziskaner behauptete, nach alten Abmachungen dürfe die niedrige Mauer des Friedhofs um zwei Ellen in den Frauenmarkt hineingerückt werden, machte die Stadt geltend, die Verbreiterung des Kirchhofes wäre früher wohl einmal erwogen worden, doch seien die Verhandlungen hierüber auf halbem Wege steckengeblieben. Die Klosterverwaltung hätte ihre Gegenentschädigung so verklausuliert, daß der Rat die Sache habe fallen lassen. Jetzt vorgebrachte Zeichnungen seien Entwürfe, wie es damals geplant war. Zum Abschluß der Unterhandlungen wäre es jedoch nicht gekommen.
Unter den Versammelten herrschte das Vorgefühl von Siegesbewußtsein. Zwar hatte das Kloster erhebliche Anstrengungen gemacht, die Rechtmäßigkeit seiner Forderung zu beweisen. Aber die Urkunde über den Abschluß[179] beizubringen, war den Kuttenträgern nicht gelungen. Und der bestimmte Ton ihres Begehrens hatte die Stadtväter arg verschnupft. Freundlichen Bitten hätte man wohl das Ohr geliehen. So aber blieb der Rat kühl und bestand auf Vorweisung des Dokuments.
»Gebt wohl acht, Freunde, wie sich der Amtmann gebärden wird,« rief Niclas Anesorge den Ratmannen zu. »Der ist bekanntlich gut Freund mit dem Kloster. Freilich, – die Schwarzen halten zusammen.«
»Meinst du, daß Miltitz seinen Freunden zuliebe Recht bräche?« warf Siegmund Badehorn, der Becherer, ein.
Der in diesen Worten klingende leise Spott ernüchterte den alten Anesorge ein wenig. Er lachte verlegen auf und erwiderte:
»Na, Gevatter, du weißt ja, Wachs ist biegsam. Es kommt darauf an, wie man's knetet.«
»Und wer es in Händen hat,« brummte Peter Sorgenfrei.
Der verbissene Streitkopf ward ärgerlich.
»Eine Krähe hackt der andern kein Auge aus!« rief er.
»So ist es, Anesorge hat recht,« bestärkten Claus Haßbecher und Christoph Pfluger wie aus einem Munde.
»Als ob wir nicht schon Beweise genug dafür hätten, wie's gemacht wird, damit uns die Bäume nicht in den Himmel wachsen,« bestätigte Heinrich Faust.
»Wenn die katholische Kirche sich mit der Stadt um etwas streitet, hat diese von Rechts wegen unrecht,« erklärte Valentin Heide lachend.
Hans Mortitz, der Gewürzzehntner, nickte beifällig.
»An den Fingern könnte man die Fälle herzählen, wo es so eintrat,« meinte er.
Der Burgemeister vernahm diese Stimmen nicht ungern.
»Daß das Kloster sich der hohen Protektion des Siebeneichener Herrn erfreut, wissen wir,« sagte er trocken. »Wie sie es aber hier drehen und wenden werden, darauf bin ich neugierig. Stadtschreiber, habt Ihr die alten Verhandlungen vollzählig bei Euch?«
»Hier sind sie,« versicherte Valentin Schein.
Da wurde die Unterhaltung gestört. Der Prior, angetan mit grauer Kutte, trat aus dem Kloster und kam mit bedächtigen Schritten heran. Ihm folgte der Lektor mit einer großen Papierrolle in der Hand. Die Parteien begrüßten sich frostig, wurden aber jeder weiteren Verhandlung enthoben, denn über den Frauenmarkt kam soeben ein kleiner Trupp Berittener, mit dem Amtmann an der Spitze. Seine Begleiter waren Hans von Minkwitz, der stellvertretende Schloßhauptmann, und Anton von Schönberg. Vier Burgknechte mit Hellebarden auf den Schultern gingen hinterher.
Ernst von Miltitz war anscheinend gut aufgelegt. Er erwiderte den Gruß nach allen Seiten und ritt mitten unter die Versammelten, während sich seine Begleiter als Unbeteiligte ein Stück seitwärts hielten.
»Ein dringliches Geschäft ruft mich auf die Burg,« versetzte er, »unsere Sache wird ja nicht viel Zeit in Anspruch nehmen. Herr Prior, Ihr seid der Fordernde, bringt vor, was Ihr zu sagen habt.«
Der Angesprochene, ein alter Mönch mit gebeugtem Kopf und rundem Rücken, versetzte:
»Der Streit währet nun schon viele Jahre, und es wäre wohlgetan, ihn zu beendigen. Das Kloster verlangt die Hinausschiebung der Friedhofsmauer um zwei Ellen.[181] Zur Abtretung des Streifens Land hat sich die Stadtverwaltung bereits verpflichtet …«
»Verpflichtet?« fiel hier der Burgemeister erregt ein.
»Laßt der Rede ohne Unterbrechung Lauf,« begütigte der Amtmann und sah von neuem auf den greisen Prior.
»Verpflichtet, sage ich,« sprach dieser weiter. »Wie anders würden wir das als Forderung bezeichnen, um was wir sonst nachsuchen müßten.«
»Nun, Herr Burgemeister,« versetzte Ernst von Miltitz, »was habt Ihr hiergegen vorzubringen?«
Georg Waltklinger war heute morgen ziemlich unwirsch erwacht. Das Bewußtsein, mit dem Amtmann verhandeln zu müssen, hatte seinen Nachtschlaf beeinträchtigt. Dazu reizte ihn der Streit mit dem Kloster. Und was bedeutete die befremdende Freundlichkeit des Amtmanns? Dahinter mußte etwas stecken! Der sonst besonnene Mann empfand Argwohn und Unruhe, und sein heißes Temperament rang heimlich mit der kühlen Beherrschung.
»Schon unter meinem Amtsvorgänger,« erwiderte er, sich zur Ruhe zwingend, »hat das Kloster sein Ersuchen an die Stadt gerichtet. Die Erfüllung scheiterte trotz aller Geneigtheit des Rats an der fehlenden Bereitwilligkeit zu Gegenleistungen. Zu einem Abschluß ist es nicht gekommen.«
Der Amtmann wandte sich wieder an den Prior.
»Ich selbst bin es gewesen,« versetzte dieser, »der damals, es mögen an die zwanzig Jahre verstrichen sein, die Unterhandlungen des Klosters als Lektor führte.«
»Unterhandlungen!« rief der Burgemeister, »aber kein Abschluß. Es ist nichts verbrieft und nichts besiegelt.«
»Vielleicht sind die Parteien geneigt, sich zu vergleichen,« riet der Amtmann.
»Wir wären gern einverstanden,« versetzte der Prior, »dem Schaden muß doch abgeholfen werden, bevor er unheilbar ist. Der Friedhof ist des Klosters und dient den frommen Brüdern als letzte Ruhestätte. So die Stadt unsere Forderung bewilligte – auch ihr mangelt es an Begräbnisplätzen –, wären wir erbötig, den Bürgern einen Teil des Gewonnenen einzuräumen. Das ist mein Vorschlag.«
Ernst von Miltitz wandte sich an Waltklinger.
»Wie denkt Ihr darüber? Mir will das Anerbieten günstig erscheinen.«
Die Ratmannen verhielten sich still und sahen auf ihren Burgemeister. Nur vereinzelt tönten aus ihrer Mitte Zeichen des Beifalls.
In Waltklinger begehrte der Eigensinn auf. Amtmann und Prior waren ihm beide verhaßt. Warum auch sich vergleichen! Lieber diesen ohnehin geringen Gewinn der Stadt entgehen lassen. Sie würden hinterher ja doch nur triumphieren, dem Rat einen Vorteil abgelistet zu haben. Für diesen Spott von Kirche und Adel war der Bürger zu gut!
»Herr Amtmann,« erklärte er schroff, »die Stadt beabsichtigt nicht, auf einen Vergleich einzugehen. Der angebotene Raum hülfe unserm Bedürfnis nicht ab, da er viel zu klein wäre. Der Rat erwägt überdies die Anlage eines größeren Friedhofes vor dem Jüdentor.«
Diese wenig verbindliche Rede verdroß den Amtmann etwas.
Aber Ernst von Miltitz war heute in gehobener[183] Stimmung, so daß er dem Sprecher die Unfreundlichkeit nicht nachtrug.
»Das Angebot ist abgewiesen, Herr Prior,« sagte er bedauernd.
Der Greis schüttelte den Kopf, als wenn er diese Hartnäckigkeit nicht verstünde.
»Wohllöblicher Rat,« hob er in väterlichem Ton an, »glaubt es mir altem Mann, wenn ich versichere, daß die Stadt die Verpflichtung hat, die Forderung zu erfüllen.«
»Euer graues Haar in Ehren,« antwortete Georg Waltklinger frostig, »aber es ist nicht üblich, mit mündlichen Versicherungen zweifelhafte Abmachungen als geschehen darzustellen. Beweist es!« –
Ernst von Miltitz machte eine Handbewegung, die die Richtigkeit dieser Worte bestärkte.
»Herr Prior, wie Ihr wißt, – ohne Beweis kein Urteil.«
Da wandte sich der ehrwürdige Greis um und griff nach dem Pergament, das der Lektor ihm reichte. Die vergilbte Urkunde ausrollend, sprach er:
»Vor wenigen Wochen haben wir diesen Zeugen für die Rechtmäßigkeit unserer Forderung im Archiv des Klosters ganz zufällig entdeckt. Wir hofften, ohne dieses Beweisstück gütlich auszukommen; es mißlang. Nun mag der Zeuge sprechen. Dies ist eine Zeichnung über die vereinbarte Änderung. Sie unterscheidet sich von den bereits beigebrachten aber dadurch, daß sie am Rande die Worte trägt: Hiemit einverstanden. Gottlieb Kühne, Burgemeister. So es Euch beliebt, Herr Amtmann, mögt Ihr Euch leicht von der Wahrheit überzeugen.«
Mit diesen Worten trat der Prior an Ernst von Miltitz heran, der sich vom Pferde herabbeugte und mit lauter Stimme die Randschrift noch einmal las.
Diese plötzliche Wandlung hatte die Ratmannen so überrascht, daß jeder von ihnen die Sache verloren gab. Nur Georg Waltklinger beharrte bei seinem Sträuben.
»Mit dem Anerkenntnis des verstorbenen Stadtoberhaupts ist der Streit entschieden,« versetzte Ernst von Miltitz. »Dem Kloster steht die Veränderung der Fluchtgrenze mit Recht zu.«
»Wo ist der Beweis dafür, Herr Amtmann?« sagte der Burgemeister mit schlecht verhehlter Erbitterung.
»Hier ist er,« antwortete Ernst von Miltitz und wies auf das Dokument.
»Das ist keine Urkunde nach dem Gesetz,« brauste Waltklinger auf. »Wo ist der Schriftsatz, frage ich, der bestehen muß, wenn eine Sache als rechtsverbindlich gelten soll?«
Den Ratmannen wurde ungemütlich. Sie erkannten, daß ihr Burgemeister im Begriff war, eine Torheit zu begehen. Und manch einer, der wußte, wie es um Waltklingers Jähzorn stand, bangte für ihn. Seine herausfordernde Haltung und das Beben seiner Stimme weissagten nichts Gutes.
Aber Georg Waltklinger bezwang sich noch einmal.
»Eine Schrift über die Gültigkeit der Abtretung muß doch vorgelegt werden,« wiederholte er in ruhigerem Tone.
Ernst von Miltitz war ein feiner Menschenkenner. Er ahnte, was in dem Erregten vorging. Eine kurze Weile war er unentschlossen, ob er die ungehörige Form[185] des Einspruchs rügen solle. Da bestimmte ihn der gemäßigtere Ton Waltklingers es zu unterlassen.
»Herr Burgemeister,« versetzte er ruhig, »Ihr befindet Euch in einem Irrtum. Nicht einen ausführlichen Schriftsatz verlangt das Gesetz über Abmachungen dieser Art, sondern eine schriftliche Anerkennung. Als solche muß ich den Vermerk Eures Amtsvorgängers ansehen.«
Georg Waltklingers Auge glühte. Er reckte sich hoch auf, und die Umstehenden sahen, daß er zitterte. Wie er so stand, mit wogender Brust, den schönen Kopf mit dem kurzgeschnittenen Vollbart zurückgeworfen, bot er ein Bild wahrhafter Männlichkeit – hingerissen von der Leidenschaft.
»Herr Amtmann,« rief er mit bebender Stimme, »das bedeutet eine Vergewaltigung der Stadt …«
»Bist du unsinnig?« rannte ihm Peter Sorgenfrei von hinten zu.
Waltklinger empfand den Warner wie einen neuen Feind. Seine Wut wurde durch die Beschwichtigung nur noch größer. Er wandte den Kopf nach ihm zurück …
In demselben Augenblick machte das Pferd des Amtmanns eine rasche Bewegung. Das lange Stehen hatte es ohnehin unruhig gemacht, und sein Schweif hatte rastlos die Mücken abgewehrt. Jetzt mußte das Tier den Stich eines dieser Blutsauger empfinden. Es tat einen plötzlichen Schritt vorwärts und bäumte auf. Waltklinger hatte sich gereizt zu Sorgenfrei gewendet, da fuhr er herum. Des Pferdes Kopf war dicht über dem seinen. – Der Amtmann fühlt sich verletzt, durchblitzte es ihn, er will dich überreiten. Und seine erregte Phantasie ließ eine erhobene Reitpeitsche über ihm schweben, die[186] in der nächsten Sekunde niederfallen mußte. Sollte der Bürger warten, bis ihn der Adlige …
Da griff er schon in die Zügel, um das Pferd zu halten. Aber sein maßloser Zorn hatte ihm alle Überlegung geraubt. Gerade wie das Tier wieder im Niedergehen war, riß er es mit gewaltigem Arm herab, daß es fast auf die Knie niederbrach. Der Reiter, durch das plötzliche Aufbäumen zurückgeworfen, wurde jetzt auf den Pferdehals geschleudert und stürzte kopfüber herab, noch ehe die Umstehenden zur Hilfe herbeispringen konnten.
Nun hoben sie den Besinnungslosen auf; sein Gesicht war vor Schmutz fast unkenntlich.
Noch hielt die Bestürzung alle im Bann, als Hans von Minkwitz, der stellvertretende Schloßhauptmann, vom Pferde sprang und rief:
»Burgemeister Waltklinger, ich verhafte Euch im Namen des Gesetzes! Ihr habt Euch in seinem Vertreter an der unverletzlichen Person des Herzogs vergriffen!«
Auf diese Worte hin drangen die vier Burgknechte durch die Versammelten und nahmen den Verhafteten in ihre Mitte.
Georg Waltklingers Gesicht war weiß wie ein Tuch. Seine Augen ruhten starr auf dem Gestürzten, der gleich einem Toten in den Armen zweier Ratmannen lag.
»Auf das Schloß mit ihm!« rief Hans von Minkwitz den Burgknechten zu, während Siegmund Badehorn und Valentin Heide den Ohnmächtigen vorsichtig nach der nahen Baderei trugen.
Da trat Peter Sorgenfrei vor.
»Herr Schloßhauptmann,« sagte er in tiefer Bewegung, »ein entsetzliches Unglück ist über uns gekommen. Noch[187] vermögen wir nicht, es zu fassen. Waltklinger wird sich der rechtlichen Untersuchung nicht entziehen. Nur erlaubt gütigst, daß Eure Knechte ihn hinüber nach der Fronfeste bringen, anstatt auf das Schloß.«
Hans von Minkwitz, obgleich wie alle Umstehenden aufs höchste erregt, verstand. Der Burgemeister der Stadt – – – in Haft auf dem Schloß? Die Bürger wollten zeigen, daß der städtische Gewahrsam ebenso sicher sei und daß sie es als Ehrensache betrachteten …
»Peter Sorgenfrei, verbürgt Ihr Euch als jetzt amtierender Burgemeister für die Sicherheit des Gefangenen?« fragte der Schloßhauptmann.
»Ich verbürge mich,« antwortete dieser.
»Dann nach der Fronfeste,« befahl Minkwitz.
Georg Waltklinger blickte teilnahmlos auf die Sprechenden. Da gab ihm einer der Burgknechte ein Zeichen, worauf er in ihrer Mitte nach dem nahen Turm schritt. Und alle Anwesenden gaben ihm das Geleit.


Die Kunde von der Gefangennahme Waltklingers war wie ein Lauffeuer durch die Stadt geeilt. Jeder, der das Unglück vernahm, blieb stumm vor schmerzlicher Überraschung. Meißens Burgemeister in strenger Haft! Und angeklagt eines Majestätsverbrechens! Das war eine niederschmetternde Nachricht. Georg Waltklinger, der stolze Bürger und hochgeschätzte Burgemeister der Stadt Meißen, in der Fronfeste! … Mancher schüttelte den Kopf und wollte nimmer daran glauben.
Nachdem der erste Schrecken vorüber war, besprach man den Vorfall mit seinen Ursachen und Folgen. Es gab deren, die dem Amtmann die ganze Schuld beimaßen. Wie könne es denn auch für Recht gelten, alte Unterhandlungen als gültig anzusehen, ohne daß eine ordentliche Schrift sie beglaubige. Ein solches Geschäft wäre erst dann richtig, wenn man etwas Geschriebenes in Händen habe.
Die Zeichnung mit den wenigen zustimmenden Worten des früheren Burgemeisters genüge nicht. Der verstorbene Gottlieb Kühne, – du lieber Gott, er war ja ein ganz tüchtiges Stadtoberhaupt gewesen. Aber schließlich, zu der Zeit, aus der die Unterschrift stammte, war[189] er schon ein alter Mann und sein Geist nicht mehr frisch. Deshalb mochte er auch vergessen haben, nachträglich für eine richtige Urkunde zu sorgen. Was er da geschrieben, sei seine Meinung gewesen. Ob aber der gesamte Rat damit einverstanden war, wo stand denn das?
So sprachen welche und versuchten, sich gegenseitig von der Richtigkeit ihrer Ansicht zu überzeugen. Innerlich glaubten sie diese Rede aber nicht. Der alte Anesorge lief von einem zum andern, hielt seine Opfer eine halbe Stunde auf der Gasse am Rockknopf fest oder brachte sie daheim in der Werkstatt um unziemlich lange Zeit. Er wetterte und schimpfte gegen die Pfaffen, die die ganze Zeichnung gefälscht hätten, und gegen den Amtmann, der daran zweifle, wenn Waltklinger sage, die Abtretung sei nicht gültig.
Dabei sprudelte er seinem Zuhörer ins Gesicht und ließ ihn nicht zu Worte kommen und redete so lange auf ihn ein, bis seine umherspähenden Augen einen andern entdeckt hatten, der arglos seines Weges kam. Dann ließ er den völlig Zerredeten stehen und schoß auf den Kommenden los.
So brachte ihm jeder neue Tag neue Aufregung.
Der größte Teil der Bürgerschaft war aber von der Schuld Waltklingers überzeugt. Und da unterdessen auch des Amtmanns Übertritt zum Protestantismus bekannt wurde, dämpfte sich bei manchem die feindselige Stimmung gegen ihn. So sehr man den Burgemeister schätzte und obgleich jedermann sich sagte, daß er an das Wohl der Stadt gedacht, als er die Gültigkeit der Urkunde anzweifelte, hier konnte man ihm doch nicht recht geben. Sein Jähzorn, den er sonst immer bezwungen, hatte ihm[190] einen bösen Streich gespielt. Die Abtretung bestand sicherlich zu Recht.
Nur die Vertrauten wußten, daß die tiefe Abneigung Waltklingers gegen den adligen Amtmann der wirkliche Antrieb zu seinem Widerspruch gewesen war.
Wie würde die Strafe sein? Man wagte kaum, davon zu sprechen. Es war eine vom Amtmann anberaumte Versammlung zweier strittigen Parteien gewesen, zu der dieser als Vertreter des Herzogs gekommen war, um Recht zu sprechen. Und während der gesetzlichen Verhandlung hatte der Burgemeister den Amtmann persönlich angegriffen! Sicherlich würde bei Betrachtung der Schuldfrage der verhängnisvolle Umstand mildernd in die Wagschale fallen, daß das Pferd stieg und Waltklinger argwöhnen konnte, der von ihm Gekränkte wolle ihn züchtigen.
Aber viel sprach das nicht für ihn. Denn ein im Namen des Landesfürsten Recht sprechender Amtmann, so würde man erwidern, läßt sich zu Tätlichkeiten nicht hinreißen. Er besitzt genug Mittel, Verletzungen seines Ansehens zu ahnden. Solches ist selbst dem gemeinen Volke bekannt. Wie erst muß ein Burgemeister dies wissen!
Zur Verschärfung der Schuld mußte aber der betrübende Umstand beitragen, daß Ernst von Miltitz aus seiner Ohnmacht noch nicht erwacht war! Die aus Dresden herbeigerufenen Ärzte hatten die Köpfe geschüttelt und sehr ernste Gesichter gemacht. Ob die Schädelwandung zerbrochen sei, wußten sie noch nicht.
Jedenfalls lastete auf der Bürgerschaft Meißens schwere Kümmernis, denn es gab niemand, der für den[191] Burgemeister Waltklinger keine warme Empfindung besaß. Er war der Stolz der Stadt und ihr Liebling.
Von allen Menschen hatte das Unglück Sonnhild natürlich am schwersten getroffen. Als sie die entsetzliche Kunde vernommen, war sie nach der Fronfeste geeilt, um dem geliebten Vater Trost zuzusprechen. Hier hatten die Burgknechte am Fuße der Treppe sie zurückgewiesen.
Darauf war Sonnhild in die zu ebener Erde gelegene Wohnung des alten städtischen Hüters des Gefängnisses getreten, von dem sie wußte, daß er dem Vater aus früherer Zeit Dank schuldete. Aber der alte Mann hatte bedauernd den Kopf geschüttelt. Der Gefangene stand nicht unter seiner Obhut. Und wie er wußte, hatten die Knechte strenge Weisung, keinen Menschen, wer es auch sei, zu ihm zu lassen. Dieser Befehl stamme vom Schloßhauptmann, bei ihm möge sie ihre Bitte vorbringen.
Da war Sonnhild zum Schloß hinaufgegangen und hatte gebeten, vor den Schloßhauptmann gelassen zu werden. Aber ihre Bitte war abgeschlagen worden. Sonnhild hatte sich jedoch im Hause versteckt und ohne Speise und Trank an ihrem geschützten Platze bis zum Abend ausgehalten. Als dann der Schloßhauptmann die Treppe herabgeschritten kam, hatte sie sich vor ihm auf die Knie geworfen und seine Füße umklammert und in den Tönen der Verzweiflung gefleht, sie zu ihrem Vater zu lassen.
Herr Hans von Minkwitz war ein edler Charakter. Und als er in das wunderschöne Mädchenantlitz gesehen, das leichenfahl und von Schmerz entstellt war und aus dem ihn zwei große Augen flehentlich anstrahlten, mochte es ihm unsagbar schwer geworden sein, seine Pflicht zu tun.
Aber er mußte das Mädchen abweisen. Bevor der untersuchende Staatsrat aus Dresden nicht gekommen sei und ihren Vater verhört habe, dürfe er niemandem Zutritt zu dem Gefangenen gewähren.
Da hatte sich Sonnhild aufgerafft und war müden Schrittes gegangen.
Am nächsten Tage hatte sie den Versuch erneuert. Hans von Minkwitz ließ die Unglückliche bescheiden, die Untersuchung sei zwar beendet, der herzogliche Abgesandte habe aber die strenge Haft verfügt, wonach der Burgemeister keinen Besuch erhalten dürfe. Daß diese scharfe Maßregel nur in solchen Fällen angewendet wurde, wenn der Beschuldigte eine schwere Strafe gewärtigen mußte, hatte Hans von Minkwitz wohlweislich verschwiegen.
Der Urteilspruch pflegte in allen Fällen, in denen die Hoheitswürde empfindlich geschädigt war, rasch verkündet zu werden. Zudem lag hier der Fall klar zutage. Der Verhaftete bestritt seine Schuld nicht. Als ihm aber der Staatsrat nahegelegt, die Gnade des Herzogs anzurufen, hatte er stumm den Kopf geschüttelt.
Was die alsbaldige Festsetzung der Strafe jedoch verhinderte, war der Zustand des Amtmanns, der noch immer zwischen Leben und Tod schwebte. Je nachdem, wofür das Geschick sich entschied, würde das Herzogliche Hofgericht ein schärferes oder milderes Urteil fällen.
Die Einwohnerschaft horchte daher gespannt auf jede Nachricht, die aus Siebeneichen über das Befinden des Schloßherrn in die Stadt drang. Allstündlich ließ Peter Sorgenfrei, als Vertreter des in Haft gesetzten Burgemeisters,[193] auf dem Marktplatz den Bescheid ausrufen, der dem Boten des Rats in Siebeneichen geworden.
Die Verkündung blieb tagelang dieselbe: Ernst von Miltitz habe die Besinnung noch nicht wieder bekommen. Seine Ernährung erfolge künstlich.
Sobald des Ausrufers Klingel ertönte, öffnete sich eines der Fenster des stattlichen Bürgerhauses auf dem Marktplatz und eine in tiefe Trauer gekleidete Mädchengestalt beugte sich weit heraus. Wenn die Mitteilung über das unveränderte Befinden des Kranken verklungen war, verschwand das blasse Antlitz mit dem Ausdruck schmerzlicher Enttäuschung, und das Fenster schloß sich wieder.
So wurde die Bürgerschaft Meißens Tage hindurch in atemloser Spannung gehalten.
Die alte Hanne, selbst tief erschüttert, hatte in dieser Zeit schwer zu kämpfen. Sonnhild saß vom Morgen bis zum Abend am Fenster, starrte hinab auf den Marktplatz und weigerte sich, etwas zu genießen. Nur mit Mühe konnte die Greisin ihren Liebling dazu bewegen.
Es war um die Mittagstunde, und das Klingelzeichen tönte wieder einmal herauf. Sonnhild erwachte aus ihrer Erstarrung und öffnete mechanisch das Fenster. Da klangen auch schon die Worte des Ausrufers an ihr Ohr:
»… zwar noch nicht völlig zum Bewußtsein gekommen, aber die Ärzte haben erklärt, daß keine Lebensgefahr mehr bestünde!«
Sonnhild sank in den Stuhl zurück. Mit geschlossenen Augen saß sie eine Weile regungslos.
Endlich erhob sie sich mühsam und ging durch die Flucht der Zimmer, bis sie vor der Tür des letzten stehenblieb.[194] Feierlich, als wenn sie ein Heiligtum beträte, öffnete sie und schritt über die Schwelle.
Unterdessen hatte eine fremde Frau das Waltklingersche Haus betreten. Die alte Hanne, die ihr auf der Treppe begegnete, war erschrocken stehengeblieben und hatte kein Wort vom Munde gebracht.
Mürrisch und ohne Gruß trat die Fremde zu der Greisin und sprach ein paar Worte zu ihr. Darauf zeigte die Hanne stumm auf eine Tür, durch die die Fremde verschwand. Die Greisin aber lief in die Küche und setzte sich erschöpft auf einen Stuhl.
Das Zimmer, worin sich die Fremde nun befand, war das nämliche, das Sonnhild soeben verlassen hatte. Sie betrachtete die schweren Möbel und die Eichentäfelung der Wände. Bald wandte sie die Augen aber unwillig ab und ging durch die weitgeöffneten Türen von einem Zimmer ins andere. Zuletzt stand sie vor einem Raum, aus dem durch die Türspalte Kerzenlicht schimmerte.
Zögernd blickte sie hinein und unterschied in dem Halbdunkel eine kniende Mädchengestalt, die ihr den Rücken zuwandte. Da fiel ihr Blick auf ein Frauenbildnis an der Wand. Die Fremde zuckte zusammen und trat zurück.
Sonnhild hatte das Geräusch gehört, das die rasche Bewegung gemacht, und trat aus dem Zimmer. Fragend betrachtete sie die Fremde. Hatte sie diese harten Züge nicht schon einmal gesehen? Aber so kummervoll wie heute waren sie nicht gewesen. Sonnhild sann nach. Der Schmerz und die Angst hatten ihr Gedächtnis geschwächt
Da wachte die Erinnerung an ein grausiges Erlebnis auf. Sie sah im Geiste die wutverzerrten Züge und die[195] funkelnden Augen des Mädchens, von dem sie in jener Nacht verfolgt worden war.
Unwillkürlich wich Sonnhild einen Schritt zurück, und ihr Blick ging besorgt zur Tür, ob nicht das Mädchen dahinter laure.
Mit spröder Stimme sagte jetzt die Frau:
»Meine Tochter läßt Euch bitten, sie noch heute zu besuchen. Sie ist krank und liegt zu Bett.«
Sonnhild sah erstaunt auf.
»Ich soll Eure Tochter besuchen? Sie, die Böses wider mich im Schilde geführt? Das kann doch unmöglich Euer Ernst sein.«
»Doch,« antwortete die Frau kurz, »es ist so. Sie läßt Euch dringlich bitten.«
Sonnhilds Stolz regte sich.
»Dann sagt ihr, daß ich nicht käme.«
»Ihr tätet etwas Gutes, so Ihr sie besuchtet.«
»Wer so gehandelt, wie sie, hat das Anrecht auf die Freundlichkeit des von ihm Bedrohten verwirkt.«
»Sie hat gefleht, ich solle nicht eher von Euch gehen, bis Ihr mir die Zusage gegeben.«
»Dann tut es mir um Euretwillen leid, daß Ihr Euch vergeblich bemühtet.«
»Aber wenn sie Euch um Verzeihung bitten möchte?«
»Verzeihen? Warum, frage ich, tat sie mir dies Schlimme?«
»Das fragt sie selbst.«
Da überdachte Sonnhild ihr eigenes Weh, und Mitleid kam sie an.
»Sagt, Frau, durchlebt Eure Tochter Stunden, in denen sie ohne Verstand ist?«
»Nein,« erwiderte die Frau, der die weiche Regung Sonnhilds nicht entgangen war, »ihr Verstand ist gesund. Oder doch, – Ihr habt recht, sie hatte in jener unseligen Stunde den Verstand verloren.«
Die Frau tat einen tiefen Atemzug. Dann sprach sie weiter.
»Hört, was ich Euch sage. Mein armes Kind besitzt das Blut seiner Mutter. Sie liebt mit grenzenloser Leidenschaft. Auch ich tat es einst. Heute hasse ich ihn, den ich liebte.«
Sonnhild empfand Unbehagen beim Klang dieser Worte.
»Aber was habe ich mit der Liebe Eurer Tochter zu schaffen?« fragte sie.
»Sie hat Euern Junker wiederholt von der Ferne gesehen. Seine männliche Schönheit hat ihr's angetan. Leidenschaft hat ihre Vernunft erdrückt, sonst wäre es nicht dahin gekommen. Die Eifersucht eines Weibes ist um so maßloser, je größer ihre Liebe ist …«
Sonnhild erzitterte. Darum also! Einer warmen Empfindung nachgebend, sagte sie:
»Seht, Frau, und versichert Eurer Tochter, daß ich ihr verzeihe.«
»Möchtet Ihr das meinem Kinde nicht selbst sagen?«
»Nicht jetzt. Die Erinnerung an die häßliche Stunde ist noch zu frisch. Ich bin besorgt, der Ton meiner Stimme möchte die Herzlichkeit meiner Worte mindern.«
Da wurde die Frau weich.
»Ihr verdient Dank! Aber welcher edle Mensch tut das Gute nur halb, wenn er es ganz verrichten kann?«
»Später einmal, verlaßt Euch darauf!«
»Jungfrau,« erwiderte die Bittende ernst, »sagt nicht: später. Es würde sicher zu spät sein! Denn das Leben meiner Tochter währt nur noch Stunden …«
Der wehmutsvolle Zug in Sonnhilds bleichem Gesicht trat schärfer hervor, als sie mit unsäglicher Ergebung antwortete:
»Gute Frau, auch ich stehe an der Schwelle zur Ewigkeit. Ihr kennt sicherlich das furchtbare Schicksal, das uns betroffen, und dessen zermalmende Ungewißheit vielleicht schon tötet, bevor der Richtspruch fällt. Der Trostlose vermag nicht, Trost zu spenden. Kehrt deshalb rasch heim zu Eurer Tochter, damit sie keine Minute ihrer letzten Stunden der mütterlichen Liebe entbehre.«
Und als Sonnhild wahrnahm, wie es in dem strengen Gesicht der Frau arbeitete, fügte sie, um ihr Tröstung zuzusprechen, hinzu:
»Euer Kind ist reich gegen mich Arme, denn sie hat noch eine Mutter. Vielleicht auch den Vater …«
»Den hat mein Kind nie besessen!« stieß die Frau aus. »Kommt mit mir!« flehte sie gleich darauf wieder.
»Ich habe alles verziehen, sagt ihr das …«
»Möchtet Ihr einem Todkranken nicht das Sterben erleichtern?« stammelte die Frau schluchzend und die Hände ringend. »Es ist ja mein Kind, mein einziges Kind, zu dem Ihr kommen sollt!«
Da schrie Sonnhild gequält auf:
»Ich, die ich vor Kummer vergehe, soll trösten? Frau! Wer hat denn für mich Trost in meinem entsetzlichen Weh?«
»Meine Tochter wird Euer tröstender Engel sein …«
»Eure sterbende Tochter? Welchen Anteil sollte sie an meinem Schicksal nehmen und an dem meines Vaters?«
Die Frau hatte die Augen niedergeschlagen; ihr Gesicht war wie von Stein. Plötzlich sah Sonnhild, wie die Fremde dicht an sie herantrat, und vernahm ihre leise, tonlose Stimme. Ein Schwindel überfiel das Mädchen. Sie taumelte gegen die Wand und griff mit den Händen in die Luft, um Halt zu finden. Die Frau aber wich ein paar Schritte zurück, dann war auch ihre Kraft zu Ende. Vom Schmerz überwältigt, lehnte sie die Wange an die Tür und blieb in zusammengesunkener Haltung stehen.
Endlich raffte sie sich wieder auf und strich die rabenschwarzen Haare von den Schläfen zurück. Schon war sie im Begriff, das Zimmer zu verlassen, als sie, ohne sich umzusehen, noch einmal fragte:
»Was darf ich Mirjam ausrichten, Jungfrau?«
Eine bange Sekunde verstrich, dann klang es leise von Sonnhilds zuckenden Lippen:
»Ich komme …«
Erst geraume Zeit darauf, als die Frau das Zimmer verlassen hatte, richtete sich Sonnhild auf und ging in ihr Zimmer zurück. Hier setzte sie sich wieder in den Armstuhl und stützte den Kopf in die Hand. –
Wollte der Boden, auf dem das väterliche Haus stand, denn nicht wanken?
Sonnhild überdachte ihr junges Leben. Die zartesten Erinnerungen an die verstorbene Mutter stiegen herauf, und sie entsann sich, ach, wie vieler Gelegenheiten, wo sie die Liebe und unerschöpfliche Güte ihres Vaters warm empfunden hatte. Ihr Leben war heiter und sonnig gewesen, wie ein köstlicher Frühlingstag. Kein Wunsch war ihr versagt geblieben. Und sie hatte ihren Vater von ganzer Seele[199] wiedergeliebt. Als sie aus den Kinderjahren getreten, war sie stolz auf ihn gewesen, weil er so hohe Verehrung genoß und weil alle stolz auf ihn waren.
Sie kannte sein weiches Herz und wußte, daß fremde Not ihm näher ging, als eigene. Wieviel Gutes tat er nicht heimlich! Was für ein wahrhaft gläubiger Christ er war, und mit welch tiefer Liebe er an seiner unersetzlichen Heimgegangenen hing! Seine Rechtschaffenheit in Handel und Wandel, seine hohen Ehrbegriffe, sein Streben nach Erfüllung edler Menschlichkeit …
Sonnhild verfiel in tiefes Sinnen. Noch nie hatten ähnliche Gedanken sie bestürmt wie in dieser Stunde. Ein lichter Funke war in ihre Seele gefallen, und sie prüfte und urteilte mit dem Verständnis eines gereiften Menschen. Das schwere Geschick hatte ihr geistiges Auge sehend gemacht. Sollte sie verweilen? Sicherlich war viel Schmerz und Weh bereitet worden! Aber das leuchtende Bild des Vaters ließ sich nicht aus ihrer Seele verdrängen. Wie oft mochte auch an seinem Herzen bittrer Schmerz genagt haben!
Das Mädchen sprang auf, eilte zu dem Wandbrett, riß das Bild des Vaters herunter und küßte es mit Inbrunst.
Dann begab sie sich auf den schweren Weg.
Auf dem Markt verkündete der Ausrufer eine weitere Besserung des Schwerkranken in Siebeneichen. Sonnhild vernahm es, und ihre Lippen sprachen ein stummes Dankgebet. Wer der Schmerzgeprüften begegnete, sah voll Mitleid auf sie. Und sie fühlte, wie alle ihren Vater lieb hatten.


Der Torhüter des Lommatzscher Tores war ein hochbetagter Jude und hieß Rebbe Liebmann. Obgleich die Juden nicht geachtet waren, erfreute sich der alte Liebmann eines guten Rufs. In ernster Zeit, als die Pest, die grausige Würgerin, wieder einmal durch die deutschen Lande fegte, hatte er sein schweres Amt übernommen. Mit sprichwörtlicher Zuverlässigkeit hütete er das Stadttor, und die ehrwürdige Erscheinung des Alten wurde im Laufe der vielen Jahre zu einem Wahrzeichen der alten Markgrafenstadt. Nicht nur das herangewachsene Geschlecht Meißens kannte und schätzte ihn, sondern auch alle Fuhrleute weit und breit. Vielen hohen und niederen Reisenden war er bekannt und einer großen Anzahl der Vaganten und Handwerksburschen, die das liebe deutsche Vaterland unausgesetzt nach allen Richtungen hin durchzogen.
Denn unter diesen Herumstreichern wurde der nicht als zunftmäßig angesehen, der nicht wenigstens einmal die spitzen Domtürme und die verwitterten Mauern des hochragenden Schlosses von Alt-Meißen gesehen hatte. Gerade[201] diese Stadt galt vor vielen andern deutschen Städten als ein beliebtes Ziel der Wanderfahrten.
Am Bodensee und am Niederrhein, in den Marschen und im Bereiche des flatternden schwarz-goldenen Kreuzbanners vom Deutschen Ritterorden sprach man daher von dem eisgrauen Torhüter Meißens. Und alle fahrenden Burschen, die wieder einmal, von Leipzig kommend, durch das Lommatzscher Tor in die Stadt einzogen, begrüßten ihn mit freudigem Zuruf. So vieles sich im Laufe der Jahre auch veränderte – die Burg, der Dom und der alte Rebbe in Meißen blieben.
Sein Weib war ihm gestorben. Dafür besorgte die Tochter den Haushalt der Familie, die ein Enkelkind vermehrt hatte. Und als Liebmann – fast hundertjährig und noch immer rüstig – erblindet war, gab man ihm einen Gesellen zur Hand. Der Alte durfte seine Wohnung im Torwärterhaus behalten, und die Stadt gewährte ihm den Unterhalt bis ans Lebensende.
Mit beklommenem Herzen trat Sonnhild in das Haus des alten Torhüters, wo ihr Mirjams Mutter entgegenkam.
»Ihre Kammer ist die erste im Oberstock,« sagte sie und führte Sonnhild zu der dunkeln Holzstiege. Die ausgetretenen Stufen knarrten, als des Mädchens leiser Tritt sie berührte.
Sonnhild öffnete die nächste Tür und trat ein. In der kleinen Kammer stand am Fenster ein Bett, in dem die Kranke lag. Erschreckt blieb Sonnhild stehen und betrachtete die Züge des Mädchens, die sich so verändert hatten, daß sie fast nicht mehr zu erkennen waren. Das Gesicht war wachsbleich, und die roten Flecken auf den eingefallenen[202] Wangen zeugten für die Fieberhitze, die in diesem welken Leib raste.
Sonnhild bemerkte, wie die in ihre Höhlen zurückgesunkenen Augen des Mädchens mit einem todesbangen Ausdruck sie ansahen. Da senkte sich auf das Bürgerkind tiefes Mitleid herab. Die Unglückliche! Wie hart hatte sie das Schicksal von Geburt an behandelt! Hier mußte sie versuchen, eine große Schuld zu mildern!
Sonnhild trat heran und legte ihre Hand auf die abgezehrte, fieberheiße der Kranken, deren Blicke noch immer mit herzzerreißendem Flehen auf ihr ruhten.
»Schwester, – liebe Schwester,« sagte Sonnhild leise.
Da erbebte der Körper des Mädchens unter heftigen Zuckungen. Überwältigt schloß sie die Augen, und Tränen rannen über ihre Wangen. Sonnhild setzte sich auf den Bettrand, zog aus dem an ihrer Seite hängenden Täschchen ein Spitzentuch und trocknete Mirjams Tränen. Bei dieser Berührung öffnete diese die Augen wieder, und ein unbeschreiblicher Dankesblick strahlte zu der Wohltäterin auf.
Dann verharrten die Mädchen lange Zeit ganz still. Nur die großen, blauen Augen beider hielten stumme Zwiesprache.
»Kann ich etwas für dich tun?« fragte Sonnhild, sich tief zu Mirjam hinabbeugend.
Die aber lächelte nur und schüttelte leise den Kopf.
»Ich bin ja so unsäglich glücklich!« flüsterte sie.
Darauf sahen sie sich wieder stumm in die Augen, und keines von ihnen empfand, wie die Zeit verrann. Die Gegenwart war ihren Sinnen entrückt, nur ihre Seelen sprachen zueinander. Auch daß sich einmal die Tür leise[203] öffnete und Mirjams Mutter in dem Spalt flüchtig sichtbar wurde, bemerkten sie nicht.
Endlich erhob sich Sonnhild; die Kranke kämpfte mit einem Schwächeanfall.
»Nun will ich dich für heute allein lassen,« sagte sie, »morgen besuche ich dich wieder.«
Ein neuer Dankesblick lohnte das Versprechen, und die Kranke machte Anstrengung, zu reden. Sonnhild neigte sich über sie und vernahm die Worte:
»Darf ich's sagen?«
»Sprich es aus, Mirjam,« antwortete sie weich.
»Nenne mich noch einmal, wie du mich nanntest.«
Da küßte Sonnhild die marmorweiße Stirn und sprach:
»Liebe Schwester!«
»Du Gute,« flüsterte die Kranke und schloß die müden Augen.
Sonnhild wartete noch so lange, bis die gleichmäßigen Atemzüge verkündeten, daß Mirjam schlief. Dann verließ sie leise die Kammer.
Wie die letztvergangenen Nächte, verbrachte Sonnhild auch diese Nacht ohne Schlaf. Mechanisch kleidete sie sich am andern Morgen an und nahm auf das dringende Bitten der bekümmerten Haushälterin einige Bissen Nahrung zu sich. Dann setzte sie sich ans Fenster und wartete geduldig, bis auf dem Markt das Klingelzeichen ertönte. Sie lehnte sich hinaus und hörte wie im Traum die weiterschreitende Besserung des kranken Amtmanns verkünden.
Auf dem Lustgänglein befand sich Sonnhilds kleiner Blumengarten. Hier schnitt sie von einem hohen Stock zwei dunkelrote Rosen ab, die über Nacht aufgebrochen waren, sie der Kranken zu bringen.
Als sie in Mirjams Kammer trat, schlief diese. Sonnhild näherte sich leise und ließ sich wie gestern auf dem Bett nieder. Der Gesichtsausdruck Mirjams erschien ihr heute weniger leidend. Aber die verfallenen Züge führten eine eindringliche Sprache und riefen Sonnhilds ganzes Erbarmen wach.
Da zuckte es einige Male in dem Gesicht der Schlafenden, und dann schlug sie die Augen auf.
»Guten Morgen, liebe Mirjam,« sagte Sonnhild und legte die Rosen auf die Bettdecke.
Über das Gesicht Mirjams lief ein glückliches Lächeln, und eine schwache Röte verfärbte ihr Stirn und Schläfen. Das Gefühl der höchsten Freude erstickte ihre Worte. Endlich stammelte sie:
»Sonnhild – habe Dank!«
Nun erblickte sie auch die Rosen und sog deren starken Duft mit tiefen Zügen ein. Sonnhilds Brust schnürte die Wehmut zusammen, als sie die dunkelroten Blumen neben dem bleichen Gesicht sah.
Auch heute fiel der Kranken das Sprechen schwer. Aber Sonnhild bemerkte, wie glücklich ihre Gegenwart sie machte. Die beiden Mädchen sahen sich wie gestern wortlos in die Augen. Alles, was ihre Lippen hätten sagen mögen, sprachen ihre Blicke, die in unendlicher Liebe ineinander ruhten.
»Kannst du mir wirklich verzeihen?« flüsterte die Kranke.
»Liebe Schwester,« tröstete sie Sonnhild. »Sprich nicht also! Alles, was hinter uns liegt, wollen wir vergessen. Wir haben uns gefunden, um uns zu lieben.«
Der Schauer eines unfaßbaren Glücks überlief Mirjam. Die ganze Lebenskraft der Heimgehenden schien sich in[205] ihren Augen zu vereinigen, die in unnatürlichem Glanze strahlten.
Da beugte sich Sonnhild herab und fragte mit tiefem Ernst:
»Mirjam, ein schweres Verhängnis hat es gefügt, daß du des Vaters entbehren mußtest. Zürnst du ihm dafür?«
Wieder lief eine feine Röte über das bleiche Gesicht der Kranken, und sie flüsterte:
»Ich bete allstündlich für meinen unglücklichen Vater.«
»Mirjam!« schrie Sonnhild gepreßt auf, dann sank ihr Kopf auf die Bettdecke nieder. In dem Gesicht der Kranken leuchtete es auf, und ihre abgemagerten Hände streichelten Sonnhilds goldglänzendes Haar. Feierliches Schweigen herrschte in dem kleinen Raum. Die Mädchen gedachten wohl des einen, der ihnen teuer war, und in dem Flehen für sein Heil vereinigten sich beider Seelen.
Dann nahm Sonnhild Abschied. Schmeichelnd berührte sie Mirjams Wangen, deren Blick für alles Liebe dankte, das sie empfing.
»Zum Abend komm' ich noch einmal,« sprach Sonnhild.
»Liebe, liebe Schwester,« stammelte die Kranke. Aber die Stimme versagte für mehr Worte, und Tränen füllten ihre Augen.
Noch einmal nickte die Gehende von der Tür aus zurück; dann war Mirjam allein. Sie nahm die beiden Rosen und betrachtete sie lange und mit liebevollem Blick. Und als sie die Blumen küßte, fielen ein paar Tränen darauf, die wie glänzende Tautropfen auf den dunkelroten Blättern lagen.


Die Kunde von den Vorgängen in Meißen hatte im Lande großes Aufsehen erregt. Der Urteilsspruch war nunmehr stündlich zu erwarten, da sich der Verletzte außer Lebensgefahr befand. Eine große Menge Neugieriger strömte deshalb in die Stadt, da alle Zeugen des Ausgangs der Tragödie sein wollten.
Eine Viertelmeile vor dem Lommatzscher Tor lag an der Landstraße der »Gasthof zur Dürren Henne«. Hier fand zu allen Zeiten mancher Fahrende Unterschlupf, der sich tagsüber müde weitergeschleppt und die Stadt nicht mehr erreichen konnte, oder dem sich das Stadttor mit Sonnenuntergang geschlossen hatte.
Mittag war längst vorüber. Die Schenke war gefüllt. Da sah man alles Volk vereinigt, das die Landstraße befuhr: Handwerksburschen, einen reisenden protestantischen Geistlichen, dem am Tische gegenüber ein Kapuzinermönch saß, Landsknechte, die vor der Schenke ihre Lanze in den Boden gestoßen hatten, Bauern, rittermäßige Leute und ihre Knechte und wildes Volk.
Die erregten Stimmen der Trinkenden verursachten[207] dumpfen Lärm, aus dem bisweilen ein kerniger Fluch oder ein dröhnendes Lachen herausschallte. Der Wirt lief in weißen Hemdärmeln und großer, blauer Schürze umher und trug auf. Ein paar unersättliche Hartsäufer lehnten am Schenktisch.
Den Mittelpunkt der zusammengewürfelten Gesellschaft bildeten zwei Männer, deren Tisch die andern respektvoll freigelassen hatten. Beide waren abenteuerliche Erscheinungen und im Herzogtum allerorts bekannt.
Der erste gehörte zu jenen uralten, wilden Edelleuten ohne Halm und Bügel, wie sie nach dem Verfall des Rittertums so lange durch die Lande liefen, bis das namenlose Geschlecht ausstarb oder bis sein letzter Vertreter am Hochgericht als eines jener formlosen Bündel schaukelte, um die die schwarzen Vögel flatterten.
Nun war Ritter Burkhard ein alter Mann, der mit der abgeklärten Ruhe eines Philosophen auf den Augenblick wartete, der der letzte seines bewegten Erdenlebens sein sollte. Denn bewegt war dieses wahrhaftig gewesen. Schon als Fünfzehnjähriger hatte er sich als Landsknecht verdungen und im Laufe der Jahrzehnte allen europäischen Herrschern gedient. Warf eine wohlgelaunte Lebenswoge sein Schifflein hoch empor, daß ihn ein Reichsgraf als Edelmann duzte oder ein leibhaftiger Herzog ihn zu Tisch bat, so ertrug er dies mit der nämlichen vornehmen Gelassenheit, mit der er andern Tags zusammen mit einem Bettelmann die Suppe auslöffelte, oder es erlitt, wenn ein erzürnter Wirt ihn als zahlungsunfähigen Zecher vor die Tür warf.
Der andere von beiden war eine ebenso interessante Erscheinung. Nicht allzu groß, aber herkulisch gebaut.[208] Todesverwegen und mit einer wahren Löwennatur begnadet, war er der Schrecken der Schenken. Dem Wirt, der ihm nichts auf Pump geben wollte, schlug er alles kurz und klein. Zwar war es das Gesetz der Schenke, das Geld vorher auf den Tisch zu legen. Bruder Antonius jedoch machte die alleinige Ausnahme.
So hieß er, weil er früher einmal Dominikanerpater gewesen war. Als er die sieben Weihen auf sein Haupt bekommen, fühlte er, daß es an der Zeit war, den in nebelhafte Ferne hinausgeschobenen himmlischen Belohnungen die reellen irdischen Freuden vorzuziehen. Eines Morgens, als in dem Kloster der gewohnte Ton des Mettenglöckleins durch den Schlafsaal zitterte, worauf sich beim Ampelschein lautlose Gestalten vom Lager erhoben, die alsdann kerzentragend paarweise durch den Kreuzgang schritten und geistliche Lieder dazu sangen, – als dieses Erhebende sich wieder einmal zutrag, fehlte einer der frommen Mönche. Das war Bruder Antonius, der nächtlicherweile die weiße Kutte voll Ordnungssinn an den ragenden Nagel in seiner Zellentür gehangen und danach in wenig anderer als paradiesischer Kleidung von der Klostermauer hinabgesprungen war, – irrtümlich auf die weltliche Seite.
Da kam in aller Herrgottsfrühe ein Bauersmann die Straße daher, der auf seinem Hundekarren Butter und Eier zur Stadt fuhr. Bruder Antonius hielt den Verdutzten an und bat ihn höflich um seine Gewandung. Er hätte gewiß noch ein zweites Kleid daheim im Kasten, deshalb müsse er mit ihm teilen. Solches fordere auch die Bibel, wie der Bauer, wenn er Protestant sei, sich ja daheim sattsam überzeugen könne.
Der solchermaßen Überfallene gab sein Mißbehagen zu erkennen, worauf Bruder Antonius ihm die Hand vorsichtig auf die Schulter legte. Ein weniger behutsamer Griff hätte dem Landmann unnütz den Arm zerbrochen. Da hüpfte der riesige Hund aus seinem Geschirr und machte Anstalt, sich auf den Unbekleideten zu stürzen. Der fromme Antonius ergriff gelassen einen mäßigen Feldstein und warf ihn dem Vierbeinigen vor den Bauch, worauf sich dieser vor Bestürzung und aus andern Ursachen einige Male sorgfältig überschlug.
Nun war der Bauer überzeugt, daß er der höflichen Bitte zu willfahren hatte. Der ungewandte Mönch schlüpfte in die sündenvolle weltliche Kleidung, dankte herzlich und empfahl sich für ein andermal. Als darauf das Bäuerlein, beinahe barfuß bis zum Kinn, vor seinem Hunde stand, wunderte sich dieser nicht wenig über das schnurrige Aussehen seines Herrn.
Mit diesem Begebnis trat Bruder Antonius in die lasterhafte Welt ein, die er bis jetzt von Berufs wegen viel geschmäht und deren Sündenlast er fortan um ein Erkleckliches vermehren sollte.
»Vor kurzem trank ich das ölige, schwarze Bier der Erfurter, brr,« sagte Ritter Burkhard. »Hierzulande braut man besser.«
»Weiß nicht, ob Ihr recht habt, Konfrater,« versetzte Bruder Antonius; »mir ist's einerlei, wessen Bier ich trinke. – Rülpse nicht so anhaltend, Schwein!« rief er einem alten Landsknecht zu, der die Gewohnheit hatte, jedem Gegenübersitzenden einmal über das andere mit unfehlbarer Sicherheit dicht am rechten und linken Ohre vorbeizuspucken.
Jedem andern wäre der Gescholtene, ein bärbeißiger Gesell, an die Gurgel gefahren. Mit Bruder Antonius aber wollte er seit jenem Tage im Bösen nichts zu tun haben, wo er gesehen, daß dieser einen baumlangen Fuhrmann im Bogen durch das splitternde Fenster der Schenke hinaus zu seinen Pferden warf.
»Heda, Wirt,« rief Bruder Antonius, »bring' mir heut Wein!«
Der Gerufene stellte sich schwerhörig und setzte einen Topf Bier auf den Tisch.
»Daß dich der Donner und Hagel miteinander erschlage, alter Fuchs!« schrie der ehemalige Mönch. »Was soll mir der Quark? Wein! Hörst du?«
»Rösselwein?«
»Der bangt um sein Geld,« rief Bruder Antonius belustigt und schlug auf die klimpernde Tasche. »Hier ist genug. Bring' mir einen Krug roten Traminer!«
»Hast wohl Geld, Bruderherz?« fragte der Ritter Burkhard, sehnsüchtig mit dem funkelnden Wein liebäugelnd. Zugleich sann er darüber nach, welchem Gaunerstreich der Mönch seinen Reichtum wohl verdanke.
Bruder Antonius lächelte. Der alte Ritter pflegte mit der Miene eines vollendeten Grandseigneurs jedem das für Höherstehende bestimmte Ihr zu gönnen. Konnte er aber damit etwas herausschlagen, so gebrauchte er leutselig das Du. Und wenn ein zerlumpter Herumtreiber ihm einen Kornschnaps zahlte, ertrug es seine Würde, wenn auch dieser ihn duzte.
»Bist gewiß wieder einmal abgebrannt, Gevattersmann,« versetzte gutmütig der Mönch. »Wirt, gib dem Ritter Traminer!«
Die Augen des Alten funkelten, und er sog den Wein begierig über die Zunge.
»Fällt mir gerade eine Geschichte ein,« warf er gut gelaunt hin, »an die ich gestern dachte, als ich in der Stadt die hochgeladenen Mistwagen sah. Denn die Meißner, das muß man ihnen lassen, halten ihre Stadt sauber.
Kam ich da kürzlich von Speyer in Frankfurt an. Wie ich über den Marktplatz schlendere, sehe ich auf der Erde eine Mütze liegen, eine Mütze, wie sie der gemeine Mann nicht zu tragen pflegt. Ich bücke mich und hebe sie auf. Da – o Wunder! – erkenne ich unter der Mütze einen Schopf blonder Haare. Ich sehe näher hin – und richtig! Wie ich vermutete, gehörte zu dem Haarbüschel ein Kopf, der im Morast steckte. Ich grabe rundherum auf, und mit meiner Hilfe gelingt es dem Blondgeschopften auch glücklich, sich vollends herauszuarbeiten.
Der Maria sei Dank und gleichfalls Euch, sagt der gerettete Edelmann. Ein Lumpenpack, das Stadtvolk! Seine Gassen so versäuen zu lassen. Doch nun helft mir, wackerer Speergesell, mein Pferd ausgraben, das noch darin steckt. Es ist mit mir zu gleicher Zeit versunken.«
Das war eine von den kleinen Geschichten, wie sie der alte Ritter bei guter Laune zu erzählen pflegte. Denn sein adliges Herkommen – wofür er einen vollgültigen Beweis zwar nicht beibringen konnte – legte ihm, wie er behauptete, die Pflicht auf, die Städter gelegentlich ein wenig zu hänseln.
Einige Zuhörer rümpften die Nase, die meisten lachten aber. Am ärgsten Bruder Antonius, der als ehemaliger Kleriker von keiner Partei war. Er wieherte, daß er sich krümmte.
»Beim heiligen Dominikus,« rief er, »der Spaß ist köstlich!«
Einen Tuchmachergesellen, der an diesem Morgen in Oschatz aufgebrochen war, machte die Geschichte aber ärgerlich. Und da er nach Meißen gewandert, um bei einem angesehenen Meister – der vornehmsten Innung der Stadt! – in Lohn und Brot zu treten, fühlte er sich berufen, die Sache der Städter wahrzunehmen.
Er wandte sich zu einem nebensitzenden Handwerksburschen und sagte laut:
»Du, wie heißt doch das gute, alte Bauernsprichwort? Ach, ich hab's: Jungen Sperlingen und jungen Edelleuten soll man beizeiten die Köpfe eindrücken.«
Im Nu fuhren die Landsknechte auf. Die Handwerksgesellen aber scharten sich um den jungen Sprecher. Wilde Rufe wurden ausgestoßen, geballte Fäuste flogen in die Luft, und es sah aus, als ob die Parteien in der nächsten Sekunde im Handgemenge sein würden.
Da stieß Bruder Antonius wohlgelaunt und ohne jeglichen Kraftaufwand mit dem Fuße nach dem nächststehenden Handwerksburschen, dessen elastischen Körperteil unterhalb des Rückens leicht berührend. Der Getroffene flog wie eine Kanonenkugel in das Gemenge, im Fallen die drei Ergrimmtesten unter den Streitenden mit zu Boden reißend. Das wirkte. Ebenso schnell, wie sich die Gemüter erhitzt, waren sie wieder abgekühlt. Man setzte sich nieder, vergaß den Groll und sah vergnügt und erstaunt einander an.
»Jugend ist stürmisch,« entschuldigte Bruder Antonius, zum Ritter gewendet, mit komischem Ernst den Vorfall. »Man müßte jedem Zornigen, bevor er den Weg zur Sünde beschreitet, eindringlich ins Gewissen reden.«
Der Alte schmunzelte:
»Das würde bei ihm so viel wirken, als wenn man einem Krebs droht, man wolle ihn ersäufen. Solches sagte schon meine alte Magd, die meinen Sohn erzogen und beflohet hat.«
Da trat ein Spielmann in die Schenkstube, ein junger, hübscher Bursche mit verhärmtem Gesicht und einer Fiedel auf dem Rücken.
»Wollt Ihr mein Bündel für eine Nacht beherbergen?« fragte er den Wirt.
»Jeder, der zahlt, bekommt bei mir sein Losament,« antwortete dieser.
Der Spielmann nickte.
»Heda, du junges Blut,« rief Bruder Antonius, »setze dich da her.«
Der Gerufene wagte nicht zu widersprechen und nahm am Tisch der beiden Platz.
»Warst du nicht kürzlich in Nürnberg?« fragte der Mönch.
»Da habt Ihr recht! Ach, nun erkenn' ich Euch. Ihr habt mich nachts von der Gasse aufgelesen, nachdem ich auf der Suche nach meinem Lebensretter vor Erschöpfung zusammengebrochen war. Auf Euern Armen trugt Ihr mich in eine Herberge und reichtet mir Speis' und Trank …«
»Larifari,« unterbrach Bruder Antonius den sich mit Worten Überstürzenden unwillig, »das war sicher ein anderer. Aber erzähle mir, Bursch, wie es kam, daß du mit deiner Brotwinsel so schnell von dort verschwandest?«
»Ohne Euch Lebewohl zu sagen. Gelt, das war schlecht von mir! Aber hört, wie sich das zutrug. Der mutige Junker vertraute mir ein Ringlein an, damit ich es nach[214] Meißen zu seiner Herzallerliebsten brächte. Und so kam es, daß ich über den einen den andern vergaß.«
»Und da kommst du erst heute mit dem Reif an?«
»Ach nein,« versetzte der Spielmann, »die Jungfrau hat längst ihren Schmuck. Ich war unterdessen schon wieder in Leipzig und habe auf der Messe zum Tanz aufgespielt. Aber ich weiß selbst nicht, warum ich wieder hierher zurückgekehrt bin …«
Der Bursche wurde rot und fing an zu stottern.
»Ich will dir's sagen, Knabe,« wandte sich Ritter Burkhard an ihn. »Du bist verliebt! Das holde Kind mit dem Ringlein hat dir's angetan. Deine blassen Wangen schreien es einem ja in die Ohren.«
Der Spielmann bekam einen puterroten Kopf und blinzelte mit den Augen wie eine Zieselmaus.
»Jaja, – der Schnaps und die verfluchte Liebe,« versetzte Bruder Antonius trocken. »Wirtschaft, Traminer!«
Der Wirt flog.
»Hast du Hunger?« fragte der Mönch den Burschen, worauf dieser den Kopf schüttelte.
»Dann trink',« versetzte er mit gekünsteltem Unwillen. »Ein schmachtender Spielmann! Ich mag kein sauertöpfisches Gesicht sehen!«
»Ich auch nicht,« stimmte der Bursche bei und goß das erste Glas hinab.
»Gevattersmann,« rief Bruder Antonius dem Ritter Burkhard zu, »was habt Ihr denn da für einen absonderlichen Ring am Finger?«
Der Alte hielt den Arm in die Höhe, daß es alle sehen konnten. Am kleinen Finger der linken Hand steckte ein ganz schmaler, goldener Reif.
»Wie oft habt Ihr den schon vertrunken und wieder eingelöst?« erkundigte sich der Mönch.
»Noch nie,« versetzte der Ritter Burkhard stolz. »Er stammt von meiner Schwester, die nun aber schon seit hundertdreißig Jahren tot ist.«
Der Alte hatte dies so ernsthaft gesagt, daß es eine Weile dauerte, bis die Umsitzenden fühlten, wie er sie wieder foppen wollte. Der Mönch lachte zuerst, er war natürlich der Schlaueste. Allmählich begriffen auch die andern den Scherz.
»Der Ritter ist mit allen Salben geschmiert,« schrie Bruder Antonius und lachte, daß die Wände zitterten.
»Meine Schwester,« so fuhr Ritter Burkhard mit unverwüstlicher Ruhe fort, »erhielt von der Gemahlin Friedrichs des Streitbaren am Tage der Gründung der Leipziger Universität ein Paar Ohrringe. Diese wurden nach ihrem Tode zu Fingerringen erweitert. Der eine von ihnen ist dieser Ring.«
Da lachte Bruder Antonius so ausgelassen, daß die Umsitzenden besorgt waren, er möchte einen Schaden erleiden. Als alter Leipziger kannte er das Gründungsjahr der Universität recht gut. Nachdem er sich endlich beruhigt hatte, versetzte er:
»Nein, Gevattersmann, so verwegen wie Ihr schneidet keiner auf.«
»Es verhält sich aber doch so, wie ich sagte,« versicherte der Alte.
Jetzt wurde der Mönch unwillig. Der Ritter mußte doch wissen, daß er wenigstens ihm solche Bären nicht aufbinden konnte.
»Es tut mir leid, Euch blamieren zu müssen,« sagte er ärgerlich, »aber nun kann ich doch nicht anders. Die Gründung der Universität zu Leipzig erfolgte nämlich im Jahre …«
»1409,« fiel ihm der Alte ins Wort.
Der Mönch saß mit offenem Munde da.
»Da wißt Ihr's ja selbst, alter Ketzer!« schrie er. »Aber gesteht doch nun die Unmöglichkeit zu, daß Eure Schwester an der Feier hat teilnehmen können. Wir schreiben heute doch Anno 1539!«
»Ich schlage vor,« warf der junge Spielmann schüchtern ein, »wer unrecht hat, zahlt einen Traminer.«
»Vortrefflich!« frohlockte der Mönch. »Den meinen auf den Tisch! Dem Weißkopf soll das Wasser kannenweis aus den Mundwinkeln laufen, wenn ich ihn allein trinke.«
Ritter Burkhard nahm die Wette an und legte – mangels barer Münze – als Pfand den strittigen Ring auf den Tisch.
»Merkt auf,« begann er. »Meine Schwester war Anno 1409 gerade sieben Jahr alt, als sie der Markgräfin Blumen auf den Weg streuen durfte. Zur Belohnung dafür empfing sie die Ringe. Unser gemeinsamer Vater zählte damals siebenundzwanzig. Noch in demselben Jahre starb meine Schwester, also vor 130 Jahren. Später starb auch die Gemahlin meines Vaters. Lange blieb er unbeweibt. Da heiratete er mit 78 Jahren ein zweites Mal und bekam trotz seines hohen Alters – Anno 1460 – noch einen Sohn. Der bin ich. Heute zähle ich neunundsiebzig.«
Der Alte hatte langsam und überzeugend gesprochen. Jeder war verblüfft, Bruder Antonius am meisten. Die Rechnung war richtig! Warum sollte ein Greis von achtundsiebzig Jahren nicht noch einmal Vater werden? Derlei hat es schon gegeben.
Noch war die Erstarrung von den Zuhörern nicht gewichen, als Ritter Burkhard den Ring wieder sorgfältig an den Finger steckte. Dann griff er mit Seelenruhe nach dem Krug, der vor dem Mönch stand, und goß den blutroten Traminer schmunzelnd in sein Glas. Angesichts dieser Bewegung wachte Bruder Antonius auf.
»Bei dem gütigen Augenstrahl des heiligen Benno, der Malefiz hat recht,« seufzte er, um sodann mit Löwenstimme zu schreien:
»Sauf, daß dir das höllische Feuer in die Gurgel fahre!« Dazu lachte er grimmig über sich selbst, denn er fühlte sich am meisten gefoppt.
»Wie war das doch damals, Bruder Antonius,« rief einer über alle Köpfe hinweg, »als Ihr die große Trinkschlacht gewannt?«
Diese Aufforderung war nicht ohne Absicht geschehen. Der Rufende kannte den Mönch seit langem und wußte, wie gern dieser von dem hitzigen Zechgelage erzählte. Antonius kam die Frage gelegen.
»Ich war noch nicht einmal Laienbruder,« erzählte er, »und kasteite mich wohl gerade auf das Ordensgelübde, als das Kloster den Besuch eines hohen Prälaten erhielt. Diesen frommen Diener der Kirche begleitete, wohin er auch ging, der Ruf, ein ganz gewaltiger Zecher zu sein. Am Abend wurde mir als Novizen der Zutritt zum[218] Refektorium nicht erlaubt. Da kommt nach dem Nachtschmaus der Bruder Kellermeister, der meinen Durst am besten kannte, atemlos zu mir in die Zelle. Hochwürden sei in rosigster Laune und wünsche einen sattelfesten Bruder als Zutrinker. Keiner der Brüder wage den Strauß; ich möchte den Ruf des Klosters retten.
Von langem Besinnen bin ich nie gewesen, willige also bald ein, für die frommen Mitbrüder Kämpe zu sein. Daß ich's kurz mache: einer nach dem andern um mich herum sank langsam vom Stuhl. Unser gestrenger Abt nickte mir als Letzter des Klosters noch einmal freundlich zu, dann sah ich ihn an diesem Abend nicht mehr. Auch die Konventsherren schliefen ein, und als allerletzter empfahl sich der hohe Herr, nachdem er noch einen wahren Basiliskenblick auf mich Grünen geschossen hatte. – Der Bruder Kellermeister, der als Unparteiischer nicht mittrinken durfte, sprach mir hierauf seine Hochachtung aus. Bei solchen hervorstechenden Fähigkeiten, versicherte er, sei mir eine glänzende Laufbahn gewiß. Dieser Tag,« so schloß Bruder Antonius, »ist der erhabenste meines Lebens geblieben!«
Anhaltendes Gelächter, vermischt mit fröhlichen Zurufen, lohnte dem Erzähler seine lustige Geschichte. Keiner unterließ, ihm seine Anerkennung auszusprechen. Nur der junge Spielmann blieb stumm. Der feurige Wein hatte seine Wangen getötet. Den Kopf in die Hand gestützt, saß er am Tisch und sah sinnend zu Boden.
Da schnellte er plötzlich in die Höhe, sprang auf den Tisch und griff nach der Geige.
»Ruhe,« rief es durcheinander, »der Fahrende will uns eins singen!«
Stillschweigen trat ein. Der Bursche stützte die Fiedel wie eine Laute auf die Hüfte und zupfte die Saiten zu einem kleinen Vorspiel. Alsdann sang er mit schäumendem Übermut:
Die Wirkung dieses Liedes war unbeschreiblich, denn der gutmütige Mönch, so gewalttätig er zuweilen auch sein mochte, war allgemein mehr beliebt als gefürchtet. Schon manch einer war Zeuge gewesen, wie er in einer schwachen Stunde geheult hatte, wie ein Schloßhund. Ein ehrlicher Jubel brach aus, daß die Schenkstubenwände erzitterten. Nur die überlaute Stimme des Mönchs war herauszuhören. Wie unsinnig trommelte er mit den Fäusten auf den Tisch und schrie in einem fort: »Traminer! Traminer!« Und als er den Wirt zaudern sah, warf er einen vollen Dukaten auf den Tisch und schrie dann noch ärger: »Tra – mi – ner!«
Im Nu standen sechs Krüge auf dem Tisch, und von allen Seiten griffen Hände nach den Gläsern.
»Das Lied muß mit Fledermausblut auf Menschenhaut geschrieben und im Gasthof zur Dürren Henne zum ewigen Andenken aufbewahrt werden,« schrie einer zum Klang der Gläser.
»Hol mich dieser und jener!« rief Bruder Antonius, »das war das Beste, was ich mein Lebtag gehört habe. Doch, wo ist der Bursch? Er soll einen guten Rekompens haben!«
Alle sahen sich nach dem Spielmann um, aber keiner entdeckte ihn. Er hatte den Tumult benutzt und sich hinausgestohlen.
»Laßt ihn laufen, er entgeht seiner Belohnung nicht,« versetzte der Mönch. »Der verliebte Schäfer wird allein sein wollen. Die Holzweibchen und der höllische Nachtjäger rüsten sich schon, durch den Wald zu fahren; dazu will er ihnen aufspielen.«


Nachdem Sonnhild die schwerleidende Mirjam verlassen, hatte diese lange Zeit still gelegen, die weitgeöffneten Augen nach der Decke gerichtet. Ihr Atem ging immer schwächer. Aber der sonnige Glanz, der über das ergebungsvolle Gesicht gebreitet war, hatte sich nicht vermindert.
Da schlugen mit einem Male schmeichelnde Töne an ihr Ohr. Mit Anstrengung richtete sie sich auf und sah zwischen den Blumentöpfen auf dem Fensterstock hinab. Drunten lehnte am Zaun ein junger Spielmann und strich die Geige. Und als er sie bemerkte, sang er mit weicher Stimme:
Mirjam lehnte sich gegen das Fenster, dessen einer Flügel geöffnet war, und preßte die Stirn an die Scheibe,[222] damit ihr kein Wort entgehe. Als der Sänger geendet, wurde sie traurig, denn sein Lied war ihr zu Herzen gegangen.
Freilich paßte der Schluß dieser schwermütigen Weise nicht auf sie; in ihrer Brust frohlockte es.
Da hob der Spielmann von neuem den Bogen. Seine Augen schwammen in Wehmutstränen. Und als wenn es gelte, sich allen Kummer vom Herzen zu singen, stimmte er voll Inbrunst an:
In den Augen der Kranken perlten Tränen des Mitleids. Auch dieses Lied war nicht für sie. Aber aus seiner Seele heraus hatte es gesprochen. So jung und schon so viel Weh! Vielleicht ward auch ihm heilsame Tröstung.
Der Bursche wollte schon wieder wandern, als er noch einmal zum Fenster hinaufsah. Da begegnete sein Blick dem mitleidvollen des Mädchens. Ihre großen, strahlenden Augen erinnerten ihn unwillkürlich an ein anderes Augenpaar, das unvergeßlich in seiner Erinnerung stand.[223] Auf die weiße Stirn der Schauenden und auf ihr schwarzes Haar hingen leuchtende Fuchsienblüten herab.
Da griff der Spielmann noch einmal zur Geige, und der süßeste Wohllaut, der in ihren Saiten schlummerte, klang zu dem Mädchen hinauf, als er sang:
Als das Lied geendet, lehnte Mirjam regungslos am Fenster. Ihr lebensmüdes Herz schlug noch einmal zum Zerspringen. Das war das Schönste, was ihr der Spielmann gesungen!
Sie nahm eine der rotglühenden Rosen und warf sie dem Sänger hinab. Der griff danach, um der großen, blauen Augen willen, und steckte die Rose vorn in das Wams.
Jetzt sank Mirjam erschöpft auf das Bett zurück. Sie fühlte ihr Herz beklemmt, schob die Bettdecke zurück und riß das Hemd auf. Die abgezehrte, marmorweiße Brust, mit feinen, blauen Adern durchzogen, ward sichtbar. Da nahm sie die dunkelrote Rose und legte sie an ihr Herz. Draußen klang der Tritt der Mutter, und gleich darauf trat diese in die Kammer.
Sonnhild hatte vergebens gehofft, von dem Ausrufer eine weitere Besserung des Kranken aus Siebeneichen zu hören. Da auch während des Nachmittags die Nachricht sich nicht veränderte, verließ das Mädchen den Platz am Fenster und machte sich zu Mirjam auf.
Wie sie in das Torhaus trat, schien es Sonnhild, als ob ihr ein kalter Hauch entgegenwehe. Vor der kleinen Tür blieb sie stehen und holte tief Atem. Dann trat sie ein.
Mirjam lag mit gefalteten Händen unbeweglich auf dem Rücken. Ihre Brust war bloß; an ihrem Herzen lag eine rote Rose. Die Augen waren geschlossen und die bleichen Lippen leicht geöffnet, als ob sie flüstere. Himmlischer Frieden verschönte die Züge. Ihr reines Herz hatte aufgehört zu schlagen.
Vor dem Bett kniete Mirjams Mutter. Sonnhild ließ sich neben ihr nieder, legte die Stirn auf die Bettkante und betete. Der letzte der drei Menschen, der sie liebte, war von ihr gegangen. Nun war sie allein – – –
Als Sonnhild wieder aufstand, fühlte sie sich gestärkt. Noch einmal betrachtete sie das friedliche Gesicht der Dulderin und berührte zum letztenmal die durchsichtigen Hände. Mirjam hatte ausgekämpft! Wann würde ihr geängstigtes Herz Ruhe finden?
Alsdann ging sie. Mirjams Mutter folgte dem Mädchen.
Im Hausflur reichten sich beide Frauen wortlos die Hände. Keine von ihnen vermochte die andere zu trösten.
Als Sonnhild nach Hause zurückkehrte, erschien sie den Vorübergehenden noch bleicher als in den letzten Tagen. In ihrem Zimmer angekommen, setzte sie sich müde ans Fenster und wartete geduldig. Da drang der Ton der Klingel heraus. Sie öffnete, beugte sich hinaus, und – das Herz wollte ihr stillstehen.
Noch lange, nachdem die Worte auf dem Markt verklungen waren, stand sie am Fenster. Dann sank sie in den Stuhl zurück. Die furchtbare Verkündung schallte unaufhörlich in ihren Ohren: »– – morgen früh auf dem Marktplatz gestäupt und auf zehn Jahre aus dem Lande verwiesen – – –«
Das Mädchen war vernichtet. Die Schwester tot, der Vater entehrt und schimpflich verjagt und der Geliebte weit entfernt, – jetzt konnte nur noch das Himmelsgewölbe auf sie niederbrechen. Als die Bäume sich in diesem Jahre belaubten, vermochte sie das große Glück kaum zu fassen, das ihr die Vorsehung beschieden. Nun, wo die Blätter bald abfielen, war sie der ärmste Mensch auf Erden! O du furchtbares Schicksal! – Und keine Träne wollte ihr die Brust erleichtern!
Da schlug sie die Augen auf und fuhr voll Entsetzen im Stuhl zurück. Spottete nun auch noch die Phantasie ihrer?
»Sonnhild,« hörte sie eine Stimme sprechen. Dann schritt jemand auf sie zu, kniete vor ihr nieder und legte die Arme um sie. Ihre umflorten Augen konnten kaum[226] die Umrisse des Knienden erkennen. Sie tastete nach ihm und fragte leise:
»Bernhard, bist du es?«
»Ja, Geliebte, dein Bernhard!«
Da beugte sich das Mädchen herab und sagte:
»Bernhard, du darfst mich nicht länger lieben! Ich bin deiner nicht mehr wert.«
»Sonnhild,« rief der Jüngling schluchzend, »du Reine!«
»Morgen wird mein Vater ehrlos sein – – –«
»Tausende werden sein unbeflecktes Bild nicht aus ihrer Seele verdrängen lassen – – –«
»Die Tochter eines Entehrten weist jeder von seiner Schwelle.«
»Dein furchtbares Geschick wird dich vor Gott und den Menschen nur erhöhen!«
»Aber dein schwerkranker Vater!« stammelte das Mädchen.
»Geliebte, ich bringe dir gute Nachricht,« rief der Jüngling aufspringend. »Mein Vater ist vor wenigen Stunden zum Bewußtsein gekommen, und die Ärzte haben erklärt, daß schlimme Folgen des Sturzes sich nicht einstellen würden.«
Da erhob sich das Mädchen, legte ihren Kopf an die Brust des Geliebten und wehrte ihm nicht, als er ihre Stirn küßte.
»Sonnhild,« raunte ihr Bernhard ins Ohr, »deinem Vater darf kein Leid geschehen, ich befreie ihn aus dem Gefängnis.«
Das Mädchen schreckte zusammen.
»Heute zur Mittagstunde bin ich mit Caspar von Carlowitz heimgekehrt,« sprach er weiter. »Er begab sich auf[227] die Burg, um sein Amt als Schloßhauptmann wieder anzutreten, und ich eilte nach Siebeneichen, wo ich den Vater schon bei Bewußtsein fand. Ich habe nicht gewagt, mit ihm über die Ursache seines Sturzes zu sprechen. Aber er war sehr gütig. Gegen Abend habe ich große Müdigkeit infolge der weiten Reise vorgeschützt und bin zu dir geeilt, während sie mich in meiner Kammer wähnen. Der Plan zur Befreiung deines Vaters steht in mir fest, er muß gelingen!«
Bei diesen Worten schlug in Sonnhild die Flamme der Begeisterung für das Befreiungswerk hoch auf. Dunkle Röte schoß in die bleichen Wangen, und ihre Augen glänzten.
»Der Turm ist in die Stadtmauer eingebaut,« sprach sie mit fliegenden Worten. »Wir nähern uns außerhalb der Stadt der Fronfeste und rufen meinen Vater ans Fenster. Dann werfen wir ihm einen Stein zu, an den ein Faden gebunden ist, und lassen ihn eine Strickleiter emporziehen und Werkzeuge, mit denen er die eisernen Stäbe vor dem Fenster durchfeilen kann – – –«
Bernhard sah der Geliebten in das glühende Gesicht. Bewunderung und Wehmut erfüllten ihn. Der Plan war unausführbar. Denn am Fuße des Turms, außerhalb der Mauer, stand ein Pikett Burgknechte, wie er gesehen, als er die Umgebung der Fronfeste betrachtet hatte. Aber in seinen Augen flackerte es, und auf seinem ernsten Gesicht stand die Entschlossenheit, mit der er seinen Plan ausführen würde. So gefahrlos, wie Sonnhild wähnte, war das Werk freilich nicht zu verrichten.
»Geliebte,« antwortete der Jüngling zärtlich, »sorge dich nicht! Du hast in den vergangenen Tagen viel Schweres[228] durchkämpfen müssen. Nun laß mich an deine Stelle treten. Mein Plan ist ein anderer, – will's Gott, daß er gelingt! Auf ihn wollen wir bauen. Wirf deinen großen Kummer von dir. Wenn mich nicht alle Gunst des Himmels verläßt, befindet sich dein Vater morgen früh in Sicherheit. Jetzt aber entlaß mich, damit ich noch die letzten Vorbereitungen für das Werk treffen kann.«
Sonnhild schmiegte sich an den Geliebten. An seiner Brust fühlte sie sich geborgen. Und ihr Vertrauen auf seine Umsicht und Entschlossenheit war felsenfest.
»Was du auch tust, du stehst unter dem Schutze des Höchsten, mein Geliebter,« sprach sie mit Innigkeit, »ich werde für dich und für meinen schwergeprüften Vater beten!«
Aufs tiefste bewegt, drückte Bernhard das Mädchen an sich, als wenn es gälte, Abschied für immer zu nehmen – – –


Es war Abend geworden. In der zu ebener Erde gelegenen Stube im Torwarthause am Lommatzscher Tor saßen einsam zwei Menschen. Auf dem Tisch stand eine tönerne Schale, gefüllt mit Mohnöl, worin ein Docht brannte. Der Schein der Lampe erhellte das Zimmer nur spärlich. Dem Tisch gegenüber stand ein großes Bett, worüber ein weißes Laken gebreitet war.
Vornübergesunken hockte zu Füßen des Bettes auf dem Boden eine Frau. Im Hintergrunde der Stube saß in einem schweren Armstuhl ein würdiger Greis von dem Aussehen eines altbiblischen Propheten. Sein Kopf war mit einer wahren Löwenmähne langen Haares bedeckt, und der schlohweiße Bart, der von dem runzeligen Gesicht nur die scharfe Hakennase und die mächtige Stirn freiließ, hing tief auf die Brust herab. Über den blinden Augen wölbten sich buschige Brauen. Die Arme des Greises lagen auf den Seitenlehnen des Stuhles.
Drückende Stille herrschte in dem Raum.
Da fuhr das Weib auf:
»Zwanzig Jahre der Qual und Verzweiflung – Jehova rast wider uns!«
Dann sank sie von neuem vornüber.
»Der furchtbare Schlag hat dein Gemüt umdüstert, Lea,« antwortete Rebbe Liebmann mit tiefer Stimme. »Der Herr hat uns schwer geprüft. Aber selbst aus dem tiefsten Leid sollen seine Kinder die köstliche Zuversicht schöpfen, daß sie dereinst reich belohnt werden.«
»Unser Geschlecht ist verflucht!« murmelte das Weib in dumpfer Verzweiflung.
»Die Ratschlüsse des Ewigen sind unerschöpflich; was er tut, ist wohlgetan.«
»Warum knechtet er gerade sein Volk mit blindwütiger Grausamkeit! Zuerst zerstreute er es in alle Welt. Dann ließ er zu, daß die Völker der Erde die Flüchtlinge wieder vertrieben oder aus ihrer Gemeinschaft ausstießen. Tief verhaßt und unentbehrlich, begehrt und verflucht sein war unser Los. Waren nicht unsere Väter von allem entrechtet? Haben nicht – auch in den deutschen Landen! – die grausamsten Judenverfolgungen jahrhundertelang angehalten und unzählige Leben vernichtet und mühsam erworbenes Gut geraubt? Man beschuldigte uns, das Vieh krank gemacht, die Brunnen vergiftet und Mißwachs herbeigeführt zu haben, um die unmenschlichsten Missetaten an uns zu verüben. Wie kurz ist erst die Zeit, die vergangen, seitdem unser Volk nicht mehr die gelbe Kokarde an den Rücken trägt – das schimpfliche Abzeichen der Unreinen – – –«
Das Weib hielt keuchend inne. Ihr Gesicht trug den Ausdruck maßloser Erbitterung.
»Und wie die Gemeinschaft,« fuhr sie fort, »verfolgt er erbarmungslos auch den einzelnen.«
»Lea,« fiel der Blinde beschwörend ein, »deine Rede ist lästerlich. Laß den reinen Spiegel deiner Seele nicht[231] trüben von den dunkeln Wolken des Zorns, die darüber hinziehen, und wende dein Herz nicht von dem Herrn aller Himmel! Zwei Jahrzehnte hast du die teuflischen Geister des Grolles und Hasses bezwungen – – –«
»Jetzt reißen sie die schwachen Schranken nieder,« schrie das Weib, sprang auf und stampfte den Boden mit den Füßen, »die die versagende Kraft jeden Morgen von neuem aufrichten mußte. Fallt ab von mir, schwachherzige Geduld und schimpfliche Geneigtheit zur Vergebung! Es ist ein Kampf wider die Natur. Der Gott, der mich erschaffen, muß es an seinem Werke büßen, daß es mißraten. Einst war ich groß im Lieben, heute bin ich's im Hassen! Haha!«
»Wer so frevelt wie du, mein Kind, dem wird es dereinst schwer werden, vor dem Richterstuhle des Ewigen Worte zu finden.«
»Soll ich den lieben, der mich betrog und mein Kind zum Bankert machte?«
»Und doch kenne ich eine,« klang des Greises eindringliche Stimme, »die zu Gott dankte, als er ihren Schoß segnete.«
Da verstummte das Weib. Der Greis aber fuhr fort:
»Hast du ihm nicht alles abgeschlagen, was er in leidenschaftlicher Liebe für dich und das Kind tun wollte? Und wie er vor der Wiege des Neugeborenen kniete und mit gerungenen Händen dich anflehte, du möchtest ihm verzeihen, was sprachst du da? Ich verzeihe um den Preis der völligen Entsagung auf das Kind! Er umklammerte deine Füße, – du stießest ihn. Da versprach er's und ging. Aber in wieviel ungezählten Nächten haben wir nicht die wohlbekannten Schritte vor dem Hause und das[232] leise Klopfen an der Tür vernommen, bis nach stundenlangem Harren der Tritt in der Ferne verhallte. So ging es, bis sich die Wunde in seinem Herzen geschlossen haben mochte.«
Am Stadttor tönte der eiserne Klopfer, draußen stand jemand, der Einlaß begehrte. Aus einer Nebenkammer ging der Geselle hinaus. Die schweren Ketten rasselten und fielen herab, und das Tor kreischte in den Angeln. Eine kurze Weile, dann entfernten sich stadtwärts Schritte. Das Tor schlug zu, und der Geselle kehrte wieder in seine Kammer zurück. Die zwei Menschen hörten es kaum, so gefesselt waren all ihre Sinne.
»Mein armes Kind,« klang des Greises Stimme wieder, »laß das herzzerreißende Weh, das sich in deine Seele hineingebohrt, nicht Herr über dich werden. Nach unsern Werken der Liebe werden wir einst belohnet oder gerichtet werden. Der Gute vergißt über dem eigenen Schmerz nicht den Schmerz des Nächsten. Du weißt, daß er ein Unglücklicher ist und wie schwer er jetzt leidet.«
»Heute sind alle Wunden wieder aufgerissen,« klagte das Weib tonlos, »die er meinem Herzen geschlagen. Und ich fühle, daß ich gelogen, als ich ihm verziehen.«
»Dann verzeihe ihm nun aus vollem Herzen.«
»Wer meinen Gram und meine Verzweiflung ermessen kann, die schlimmer peinigen als Höllenqualen, der wird nicht verlangen, daß ich ihm ein zweites Mal vergebe.«
»Nicht zweimal sollen wir vergeben, fordert der Allmächtige des Himmels und der Erden, sondern siebenmal siebzigmal.«
»Aber ich vermag es nicht!« schrie das Weib grell auf.
Da erhob sich der Blinde, ging mit sicheren Schritten zu dem Bett und schlug das weiße Laken zurück. Seine großen lichtlosen Augen auf die Tochter gerichtet, sprach er:
»So lerne das Verzeihen von deinem Kinde, das mit einem Gebet für den Vater von uns gegangen ist.«
Die Frau erschrak und stützte sich schwer auf das Fußende des Bettes. Ihr Atem flog und ihre weitgeöffneten Augen waren starr auf die abgezehrte Gestalt im weißen Sterbehemd. Das blasse Gesicht der Toten war verklärt von dem Ausdruck tiefen Friedens, den Mirjam beim Verscheiden empfunden. Zwischen den gefalteten Händen hielt sie die dunkelrote, welke Rose.
Sekunden verstrichen. Als wenn sie einem zermalmenden Druck trotzen wollte, verharrte die Frau hartnäckig in gebeugter Haltung. Dann brach sie vor dem Bett lautlos nieder.


Die ältesten Bewohner Meißens erinnerten sich nicht, die Stadt jemals in so großer Aufregung gesehen zu haben, wie an diesem Abend. Die Häuser standen leer, jedermann war auf die Gasse geeilt. Wie zu Kriegszeiten herrschte fieberhaftes Leben unter der Einwohnerschaft. Hinter vielen Fenstern brannte Licht, so daß die Gassen hell waren.
Auf dem Markt standen vier hohe Böcke, die mit Pech gefüllte, eiserne Schalen trugen, aus denen rote, rußige Flammen emporloderten. Vor dem Rathaus bauten Zimmerer ein hölzernes Gerüst. Eine unabsehbare Menge drängte sich unaufhörlich daran vorbei. Die hellen Hammerschläge drangen scharf durch den Lärm. Jeder verstand, was sie verkündeten: morgen früh sollte auf diesen Brettern dem Burgemeister Georg Waltklinger durch den aus Dresden zu erwartenden Henker der entblößte Rücken mit Ruten gepeitscht werden.
Zwar war eine Abordnung der Bürgerschaft unter Vorantritt Peter Sorgenfreis nach Dresden geeilt, um[235] die Gnade des Herzogs anzurufen. Aber sie waren abgewiesen worden!
Der Herzog hatte die Männer wohl empfangen und sein Bedauern ausgesprochen, daß er ihre Bitte abschlagen müsse. Den ausgezeichneten Ruf ihres Burgemeisters kenne er. Gleichwohl dürfe er dem Spruch des Gerichts nicht entgegentreten. Die unbesonnene Handlung sei ein schwerer Angriff gegen Gesetz und Obrigkeit, und das Leben eines hohen Beamten des Landes, den der Herzog als einen seiner besten bezeichnete, wäre ihr um Haaresbreite zum Opfer gefallen. Nur insoweit könnte das Urteil gemildert werden, als der Besitz des Schuldigen nicht um den dem Staat bei der Ausweisung zufallenden Teil geschmälert würde.
Traurig kehrten die Männer heim. Wie der Herzog bei Einführung der Reformation seine Tatkraft bewiesen, ebenso unbeugsam war er, wenn es galt, eine Verletzung der Würde des Gesetzes zu sühnen.
Das Gewühl in den Gassen wurde immer ärger, und dasselbe Bild, das große Zusammenläufe einer erregten Menge überall bieten, zeigte sich auch hier. Anfänglich schoben sich die Menschen stumm durcheinander. Der Geist der Ordnung leitete sie noch. Allmählich gewann aber die Erregung Oberhand, die die Masse berauschte. Die Unbesonnenen begannen damit, drohende Rufe auszustoßen, und die friedlich Gesinnten wurden davon angesteckt. Dazu tat der genossene Wein seine Wirkung. Nichtsnutziges Gesindel beging Ausschreitungen und riß durch sein Beispiel nüchterne Zuschauer, die aus Neugierde auf die Gasse gegangen waren, mit fort.
Man fragt sich, wo diese lichtscheuen Elemente in ruhigen[236] Zeiten ihre Schlupfwinkel haben, – inmitten eines erregten Volkshaufens blüht ihr Weizen, und sie sind wie aus der Erde gestampft da. Sie laufen Sturm wider Gesetz und Ordnung, wiegeln die Friedfertigen auf und sitzen mit dem Aufruhr zu Tische. Ihr Handwerk ist um so gefährlicher, als sie es am liebsten heimlich betreiben. Droht ihnen Gefahr, so ducken sie sich. Und greift der eiserne Arm des Gesetzes ein, dann sind sie wie weggeblasen und überlassen den bürgerlichen Mitschreier seinem Schicksal. – Parasiten!
Vor der Fronfeste, wo gleichfalls Pechpfannen brannten, gab es wüste Auftritte. Stimmen wurden laut, die die gewaltsame Befreiung des Gefangenen forderten. Und gegen die am Eingang stehenden bewaffneten Burgknechte fielen wilde Drohungen. Ein Haufe von Schreienden und Betrunkenen zog durch die Gassen, den Tumult steigernd.
Als auf dem Marktplatz der Bau des Gerüstes beendet war, hatte sich ein Mann darauf geschwungen, der mit einer zündenden Rede das Volk aufforderte, den durch den Herzog abgeschlagenen Gnadenakt selbst zu vollziehen. Es war der Bruder Antonius. Seine Beredsamkeit stachelte das Volk auf, daß es seinen Worten Beifall schrie. Aber die Besonnenen unter der Menge schritten ein, verwiesen dem Mönch seine Rede und beschwichtigten die Aufgeregten.
Die Bürger, die die Nachtwache hatten, gingen umher, ermahnten das Volk zur Ruhe und versuchten, es zum Heimkehren zu bewegen. Aber diese Zirkler sahen bald ein, daß sie heute machtlos waren. Die Aufregung war zu groß, und es waren ihrer zu viel, die in den Gassen tobten.
Dazu gab es selbst Bürger, die die wachsende Leidenschaft insgeheim anstachelten. Der alte Anesorge lief durch die Menge und reizte sie auf. Die ungeheure Spannung und das vergebliche Harren auf die noch immer erwartete Begnadigung hatten ihm fast den Verstand geraubt.
Während nun auf den Gassen der drohende Aufruhr sein schauerliches Lied sang, war es in der Zelle des Gefangenen der Fronfeste still. Der Lärm drang nicht durch die dicken Mauern und starken, eichenen Fensterladen. Der Raum war schmal. Ein Tisch, ein Stuhl und ein eisernes Bett bildeten seine dürftige Ausstattung.
Georg Waltklinger lehnte mit dem Rücken gegen den Tisch. Sein Haar war in Unordnung, das Gesicht bleich. Vor ihm stand der weißhaarige Edelbeck, der Hüter der Fronfeste. Er war soeben eingetreten, hatte die Tür sorgsam hinter sich geschlossen, die brennende Laterne niedergestellt und den großen Schlüsselring dazugelegt.
»Nein, Herr Burgemeister,« versetzte der Alte, »nun kann ich's nimmer mit ansehen. Euer Unglück zerbricht mir das Herz.«
Waltklinger seufzte und machte eine Handbewegung, die sagen wollte: mir ist nicht zu helfen.
»Wie geht's deinem Sohn, dem Heinrich?« fragte er mit müder Stimme, um den Alten abzulenken.
»Von ihm wollte ich eben sprechen,« antwortete Edelbeck. »Wieviel Gutes habt Ihr an dem getan! Herr Burgemeister, wenn Ihr wüßtet, wie der Junge an Euch hängt, wohl ebenso, wie an seinem leiblichen Vater.«
»Laß es gut sein,« versetzte Waltklinger, »'s war nicht der Mühe wert.«
»Wie, ich sollte das gering anschlagen? Es war ein schlimmer Abend,« nickte der Alte. »Der wilde Junge, der aber doch zu lenken war wie ein Kind, hatte im Jähzorn einen Mitspieler mit dem Messer gestochen. Ihr kanntet meinen Heinrich, war er doch Euer Lehrbursche und Geselle, und Ihr hattet ihn wahrhaft lieb. Ein braves Kind, dein Heinrich, sagtet Ihr manchmal zu mir. Da kam das Unglück. – Ich rang vor Euch die Hände: helft, helft, daß mein Heinrich vor Schande bewahrt bleibe! Meine Verzweiflung rührte Euch. Ihr versaht den Jungen mit einem guten Stück Geld und ließt ihn bei Nacht und Nebel heimlich entweichen. Den Schwergetroffenen, der sich nur langsam erholte, suchtet Ihr auf, gabt ihm Schweige- und Schmerzensgeld und nahmt Euch seiner Familie an. Noch heute empfängt sie ja Eure Wohltaten.«
Waltklinger sah nachdenkend nieder.
»Nun ist der Junge im Hessischen,« erzählte der alte Edelbeck weiter, »und es geht ihm gut. Und seine Frau, die sich fast zu Tode ängstigte, als ihm der Prozeß gemacht werden sollte, ist mit den Kindern wohlbehalten bei ihm angekommen. Er schreibt, daß sein neuer Meister mit ihm recht zufrieden sei. Als dieser hörte, daß er das Handwerk bei Euch gelernt habe, hat er den Jungen eingestellt. Denn Euer Name war ihm bekannt. Wenn Ihr den Heinrich damals nicht vor dem Schlimmen bewahrt hättet, wie anders wär' es gekommen! Seine brave Frau und die lieben Kinder hätte der furchtbare Schlag schwer getroffen.«
Den Alten übermannte die Rührung, daß ihm die Sprache versagte. Er schwieg eine Weile und fuhr mit[239] der Hand über die feuchten Augen. Dann begann er wieder:
»Und wie meinem Heinrich das Unglück damals zugestoßen, ebenso seid auch Ihr hineingeraten: das heiße Blut hat Euch hingerissen. Wie manchem prächtigen Menschen hat der Jähzorn nicht schon schwere Stunden gebracht!«
Der alte Wärter brach hier kurz ab, wandte den Kopf nach der Tür und lauschte angestrengt. Von dem lärmenden Volkshaufen war nichts zu hören. Nur der verworrene Klang einzelner Worte drang in die Zelle, die von den wachehabenden Burgknechten kamen.
Da trat Edelbeck nahe an den Sitzenden heran und sagte mit gedämpfter Stimme:
»Herr Burgemeister, seitdem Ihr in der Fronfeste sitzt, ist der Schlaf meinen alten Augen ferngeblieben, und ich habe meinen Kopf zerquält um Euretwillen. Nun weiß ich, was ich tun muß. Euch ist bekannt, daß der Turm zwei Ausgänge hat: den gewöhnlichen, den die Knechte bewachen, und den nie benutzten, der aus meiner Wärterstube unmittelbar ins Freie führt. Die drei größten Schlüssel an diesem Bund öffnen die eiserne Tür.«
Georg Waltklinger horchte auf.
»Es wäre jammerschade, wenn ein so geachteter und verdienter Mann, wie Ihr seid, dieselbe erniedrigende Strafe erleiden sollte, wie der gemeine Verbrecher. Und ich müßte mich noch in der Sterbestunde einen schlechten Kerl nennen, wenn ich Euch heute den Dienst nicht vergelten wollte, den Ihr meinem Heinrich getan habt. Also geht auf und davon, Burgemeister! Freilich – – – na, wie soll ich's[240] sagen, – Ihr wißt ja, ich hab's zugeschworen, meine Gefangenen treu zu bewachen. Auf meinem weißen Haar haftet kein Stäubchen Unehre, und ich darf vor den Menschen nicht meineidig werden. Wie ich freilich mit dem droben fertig werden soll, – na, kümmert Euch nicht viel darum, das wird mir schon gelingen! Ich tu's ja für meinen Heinrich und die herzigen Kinderchen – – – Ihr könnt noch unendlich viel Gutes tun, um mich alten Mann ist es nicht schade! – Die Tür ist unverschlossen, die Treppe bis zu meiner Stube frei – – nehmt den spitzen Stahl, der mir an der Seite hängt, Burgemeister – und – – stoßt zu – – –«
Waltklinger war den hastigen Worten des Alten mit höchster Spannung gefolgt. Jetzt stand er erschüttert auf, umarmte den Wärter und sagte:
»Edelbeck, was du da sprichst, verrät dein gutes Herz. Wie soll ich dir's danken! Du bist ein Held! Deshalb ist der Preis zu hoch, mit dem ich mir die Freiheit erkaufen sollte. Ich will in den Augen unseres lieben Herrgotts zwar gern weniger gelten als du, aber ich möchte vor ihm nicht als Wicht dastehen. Und das wäre ich, wenn ich dein Angebot annähme. Du hältst viel auf mich, Alter, – das freut mich! Aber gerade darum, weil ein solcher Ehrenmann, wie du mich schätzt, muß ich über meinen Ruf streng wachen. Sonst sagen die Leute: an dem Waltklinger ist doch nichts gewesen!«
Dem Alten war bei diesen Worten der Kopf auf die Brust gesunken. Nun wandte er sich langsam um, nahm das klirrende Schlüsselbund auf und verließ, ohne noch[241] ein Wort zu sprechen, die Zelle. Georg Waltklinger sah eine Weile in das matte Licht der auf dem Boden stehenden Laterne. Dann setzte er sich, stützte den Kopf auf und versank in tiefes Nachdenken.
Da hörte er, wie der alte Edelbeck wieder eintrat.
»Herr Burgemeister,« sagte dieser, »ein Weib hat an meine Tür geklopft und so dringend gebeten, zu Euch gelassen zu werden, daß ich ihr's nicht abschlagen mochte.«
Waltklinger sah sich um.
»Wen soll es jetzt so dringlich nach einer Unterredung mit mir verlangen? Es ist doch nicht meine Tochter? Ich möchte ihr den Schmerz meines Anblicks ersparen …«
»Das Weib ist verhüllt, aber Eure Tochter ist es nicht.«
Waltklinger schwankte einen Augenblick.
»Laß sie kommen,« sagte er alsdann.
Der Alte ging. Eine kurze Weile verstrich. Da hörte Waltklinger ein leises Geräusch, und wie er sich umwandte, sah er auf der Schwelle eine Frau stehen. Ihr Kopftuch war herabgeglitten. Aber das Licht der Laterne brannte so trübe, daß er die Züge der Eintretenden nicht erkennen konnte. Waltklinger erhob sich und tat ein paar Schritte nach der Tür. Plötzlich blieb er überrascht stehen. Die Frau ging zu dem Bett und setzte sich erschöpft darauf.
»Ja, Georg, ich bin es,« sagte sie unter raschen Atemzügen. »Unser Kind ist gestorben.«
»Lea,« schrie der Mann auf, »Mirjam ist tot – – –?«
Die Frau nickte mit dem Kopf.
»Sie ist tot,« wiederholte sie.
Georg Waltklinger sank auf den Stuhl nieder, stützte die Ellenbogen auf den Tisch und barg das Gesicht in[242] beiden Händen. So saß er unbeweglich. Nur das fast unmerkliche Jucken seiner breiten Schultern verriet den großen Schmerz, der in ihm arbeitete.
Die Frau betrachtete den Erschütterten lange. Dann ging sie zu ihm hin. Zögernd legte sie ihre Hand auf seine Schulter.
»Georg,« sagte sie in weichem Tone, »ich glaubte immer, du hättest sie aus deinem Herzen gestoßen. Jetzt weiß ich's, wie lieb du sie behalten hast.«
Waltklinger wandte sich zu ihr.
»Deine Botschaft ist tieftraurig, Lea, hab' aber Dank, daß du gekommen bist. Willst du mir nicht etwas von unserm Kind erzählen?«
Die Frau setzte sich wieder auf das Bett und beschrieb Mirjams Krankheit und Hinscheiden. Waltklinger war es feierlich zumute. Zwar hatte er das Mädchen, wie es die engen Verhältnisse der kleinen Stadt mit sich brachten, im Laufe der Jahre oft gesehen. Aber er hatte sie nie angesprochen und durch nichts verraten, daß er ihr Vater war. Die Scheu vor der Öffentlichkeit, mehr aber noch das Gelöbnis, das er der Mutter einst gegeben, hatten ihn abgehalten, den Schleier zu lüften, der auf Mirjams Geburt lag. Innerlich war er ihr jedoch nahe geblieben, und es hatte ihn geschmerzt, sie als Fremde ansehen zu müssen. Nun aber, wo er ihren Tod vernahm, fühlte er, wie nahe sie seinem Herzen immer gestanden hatte.
»Du bist hart zu mir gewesen, Lea,« sagte Waltklinger schmerzlich. »Aber ich darf mit dir nicht rechten, denn ich hatte deinen Frieden schwer gestört. Wie viele Jahre seitdem auch dahingegangen sind, der Kummer darüber ist nicht von mir gewichen. Durch aufopferndes Wirken[243] für andere habe ich versucht, mein Gewissen zu beschwichtigen. Aber seine Stimme hat nie stillgeschwiegen.«
»Wenn ich deine Seelenpein mildern kann, Georg, will ich's gern tun. In so bitteres Leid der Tod den Menschen auch stößt, wenn er ihm sein Alles raubt, so ist er doch ein Bote des Himmels. Und sein gewaltiger Schmerz erweicht das Gemüt. Ich durfte dir wohl zürnen, aber ich war grausam. Das tut mir heute weh! Der große Schmerz trifft uns beide, er soll uns aussöhnen. Auch Mirjam hat dir nicht gezürnt. Sie ging mit einem Gebet für ihren Vater auf den Lippen.«
Waltklinger blickte schmerzlich auf.
»Deine Worte geben mir viel Tröstung, Lea; ich danke dir!«
»Georg,« sagte die Frau und trat zu dem Sitzenden, »ich kann dich nicht so leiden sehen. Dein Schicksal rührt mich tief.« Sie zog aus der Tasche ihres Kleides ein Fläschchen. »Hier nimm,« flüsterte sie, »es ist ein sicher wirkender Trank, der dich friedlich einschlafen läßt. Unsere Familie behütet sein Geheimnis seit Jahrhunderten. Du bist ein ehrenhafter, stolzer Mann, Jörg, und wirst den Tod der erniedrigenden Strafe vorziehen. Das Herz würde mir vollends brechen, wenn – –«
Sie schwieg und sah zur Seite.
Der Gefangene griff überwältigt nach ihren beiden Händen und antwortete:
»Liebe Lea, so weit also geht deine Güte für den, der dich betrog? Du beschämst mich. Dein Vorschlag will mein Bestes, aber ich kann ihn nicht annehmen! Ich habe gefehlt! Deshalb darf ich mich meinen irdischen Richtern nicht entziehen, so unerträglich mir ihre Strafe[244] auch scheint. Dem himmlischen Richter kann ich doch nicht entgehen. Und er würde viel schwerer geneigt sein, mir zu vergeben, wenn ich handelte, wie du mir rätst. Ein aufrechter Mann darf nicht zurückschrecken, wenn getane Schuld an ihm gesühnt werden soll.«
Die Frau weinte leise.
»Ich habe es geahnt, daß du so sprechen würdest,« stammelte sie.
Enttäuscht barg sie das Fläschchen wieder in ihrer Tasche und wischte die Tränen aus den Augen. Dann reichte sie ihm die Hand zum Abschied und sagte:
»So tröste dich der Allmächtige, Jörg. Mit seiner Kraft wirst du das Schwere überwinden.«
»Mag er auch dein Weh mildern und in bangen Stunden an deiner Seite stehen. Lebe wohl, Lea!«
Eine Sekunde darauf war Waltklinger allein. Er lauschte noch aufmerksam den sich entfernenden Tritten, bis sie ganz verklungen waren. Dann streckte er sich ermattet auf das Bett. Wieder war ein lieber Mensch von ihm gegangen! Und eine innere Stimme sagte ihm, daß auch unter der Bürgerschaft viele innigen Anteil an seinem Geschick nähmen. Da fühlte er, wie sich langsam seine Augen füllten. Es waren Freudentränen, und er schämte sich ihrer nicht.
Bald öffnete sich die Tür wieder; der alte Edelbeck erschien noch einmal.
»Herr,« versetzte er, »unten wartet ein Kapuziner, um Euch geistliche Stärkung zu bringen.«
»Ein Mönch?« fragte Waltklinger. »Er muß doch wissen, welchen Glaubens ich bin. Teile ihm mit, daß[245] ich heute von einem Diener meiner Kirche bereits Tröstung empfangen hätte.«
»Das sagte ich dem Kuttenträger schon, aber er ließ sich nicht fortschicken.«
Waltklinger lächelte trübe.
»Er will mir eine vermeintliche Wohltat erweisen; dafür gebührt ihm Dank. Schick' ihn herauf.«
Mit diesen Worten erhob er sich vom Bett und ging mit großen Schritten auf und ab. Da trat der Mönch in die Zelle, die Kapuze auf dem Kopf. Er horchte noch einmal in den Gang hinaus. Aber es war nichts Verdächtiges zu hören, nur ein dumpfer, verworrener Lärm, der vom Frauenmarkt heraufdrang. Nun schloß er die Tür und wandte sich zu dem Gefangenen.
Rasch löste er den Knoten des hanfenen Strickes, der um seinen Leib geschlungen war, riß die Kutte herab und warf sie von sich. Ein hochgewachsener Jüngling von schlankem Körper, an dessen Seite ein gerader Degen hing, stand jetzt vor dem Erstaunten.
»Bernhard von Miltitz!« rief Waltklinger, »Ihr hier? Und was soll diese Verkleidung?«
»Es ist das drittemal, Herr Burgemeister, daß ich Euch unter die Augen trete. Heute werdet Ihr mich nicht von Euch weisen.«
Und des Jünglings Atem flog, als er hinzusetzte:
»Ich bringe Euch Befreiung! Schlüpft in diese Kutte und begebt Euch von hinnen. Keiner der Burgknechte wird argwöhnen, daß dieses Ordenskleid seinen Träger gewechselt hat. In den Gassen tobt eine aufgeregte Menge; es kann Euch nicht schwer werden, im Gewühl unerkannt zu entkommen. Der Wächter des Jüdentores[246] ist bestochen, er wird öffnen. Am Einfluß der Triebisch in den Strom liegt ein Boot; der vertraute Fährmann rudert Euch über die Elbe. Drüben wartet Georg von Komerstadt Eurer. Von da mögt Ihr auf windschnellem Rosse über Königsbrück in das böhmische Land entkommen. Eilt, daß keine kostbare Minute verrinne!«
Georg Waltklinger war starr vor Überraschung. Endlich fragte er:
»Was bewegt Euch dazu, Junker, mich aus meinem Gefängnis zu befreien?«
»Die Liebe zu Eurer Tochter,« rief dieser. »Unsere Herzen sind unlösbar verbunden. Ich habe heute mit Sonnhild von Eurer Rettung gesprochen, ohne ihr meinen Plan zu verraten. Aber sputet Euch!«
»Und wenn ich Euer Anerbieten annähme, was würde dann aus Euch?«
»Ich bleibe an Eurer Stelle im Turm!«
»Ist es Euch bekannt, daß Gefangenenbefreiung mit schwerer Freiheitsstrafe gesühnt wird, die auch Euer Vater von Euch nicht abwenden könnte?«
»Ich weiß es. Doch unterlaßt alle Worte und nehmt das Kleid,« drängte der Jüngling in fiebernder Hast.
»Bernhard von Miltitz, Ihr seid ein edelmütiger Jüngling, und ich schulde Euch großen Dank. Euer Plan ist verlockend, und seine Ausführung würde wohl glücken. Aber ich muß Eure Hilfe ausschlagen.«
»Ausschlagen? Was ficht Euch an, Herr Burgemeister?«
»Meine Freiheit wäre zu teuer erkauft – –«
»Sorgt Euch nicht um andere, denkt an Euer Kind.[247] Klopft Euer Vaterherz nicht rascher bei dem Gedanken, das Werk für Sonnhild zu tun?«
»Tut Ihr es für sie?« fragte Waltklinger.
Da schoß dem Jüngling die Röte in das Gesicht.
»Ich sagte es Euch ja schon, – – – aber, – auf denn! Wozu die Worte! Die Gunst möchte sich von der Ausführung des Plans bei weiterem Zögern wenden.«
»Ich bleibe!«
Der Jüngling fuhr auf. Draußen wurden eilende Schritte hörbar.
»Geht doch,« rief Bernhard, »das ganze Lebensglück Eures Kindes steht auf dem – –« Da flog krachend die Tür auf, und drei Bewaffnete stürzten herein.
»Im Namen des Herzogs, Junker von Miltitz, Ihr seid mein Gefangener!« rief der vorderste Knecht, indem er auf Bernhard eindrang.
Dieser riß seinen Degen aus der Scheide und hieb den schlanken Holzschaft des ihm entgegengehaltenen Spießes mittendurch. Ein anderer Knecht sprang mit großem Ungestüm an die Stelle des Wehrlosen. Bernhard sah den Stoß der Pike kommen und wich blitzschnell zur Seite. Ein scharfes Knirschen – und die stählerne Spitze zersplitterte an den Steinquadern der Mauer. »Ergebt Euch!« rief der dritte Knecht und kam mit wagrechtem Spieß heran. Da sprang Bernhard hinzu, griff mit nerviger Hand nach der Waffe und ruckte so heftig daran, daß der Knecht jählings auf den Fußboden der Zelle geschleudert ward und besinnungslos liegenblieb.
Jetzt riß der Jüngling in schäumendem Zorn den Degen in die Höhe, als Caspar von Carlowitz, der Schloßhauptmann, der mit Bernhard erst heute von der Reise[248] zurückgekehrt war, mit dem blanken Schwert in der Faust atemlos in die Zelle trat.
»Kein Blut fließe!« befahl er. »Bernhard, den Degen weg!«
Aber die maßlose Erregung des Junkers war damit nicht zu beschwichtigen. Er sah in dem plötzlich Erschienenen nur einen neuen Feind. Und er drang auf die beiden Knechte ein, die das Untergewehr gegen ihn gezogen hatten. Da stieß Caspar von Carlowitz sein Schwert in die Scheide, kreuzte die Arme über der Brust und rief:
»Sinnloser Knabe! Wenn du Blut vergießen mußt, so wähl' das meinige!«
Diese Worte schlugen in die Seele des Ergrimmten. Der zum Streich ausgeholte Arm sank schlaff herab. Ein Zittern überlief die schlanke Gestalt, und der Degen entglitt der Faust und fiel klirrend zu Boden. Und dann sank der Jüngling mit lautem Aufschluchzen an die Brust des väterlichen Freundes.
Unterdessen war der Lärm und die Bewegung in den Gassen zu solcher Höhe angewachsen, daß Peter Sorgenfrei, um einen etwa ausbrechenden Aufruhr niederzuhalten, drei Fähnlein der Bürgerwehr aufgeboten hatte.
Das erste war unter seinem Viertelsmeister, den die schwarz-gelbe Binde kenntlich machte, in Reih und Glied vor dem Rathaus aufmarschiert. Das Fähnlein des zweiten Bezirks war vom Jahrmarkt her im Sturmschritt auf den Frauenmarkt gerückt, und der dritte Haufe zog unter Trommelschlag durch die Jüdengasse ebenfalls vor die Fronfeste.
Hier hatte sich die Verwirrung aufs höchste gesteigert. Der Schloßhauptmann war mit einer Wachtverstärkung angekommen, was einen Unsinnigen veranlaßt hatte, das Gerücht auszusprengen, dem Burgemeister solle ein Leids zugefügt werden. Dem alten Anesorge wiederum war der Gedanke aufgestiegen, die Menge trunken zu machen, daß sie geneigt werde, eine Gewalttat zu begehen. Zu diesem Zweck hatte er neben der Frauenkirche einige Oxhoft Wein aufstellen lassen, der in tönernen Krügen herumgereicht wurde. Er selbst fuhr durch das Gewühl und feuerte die ärgsten Schreier an, die Fronfeste zu stürmen und den Burgemeister zu befreien.
Das Heulen in den Gassen wuchs, und der Ruf »Feuerjo!« ertönte von allen Seiten. Ein Eiferer war auf den Kirchturm geeilt, und schon gellte die Feuerglocke über die Stadt hin. Die Bürger des Feuerschutzdienstes liefen nach der Spritze. Bald darauf rasselte diese durch die Elbgasse nach dem Marktplatz.
Am schlimmsten ging es am Turm zu, von dessen Eingang die Bürgerwehr die Menge zurückgedrängt hatte. Hier war das Gerücht von einer Befreiung des Burgemeisters durch List laut geworden. Der Wächter vom Jüdentor habe den Plan verraten, und das Dazwischentreten des Schloßhauptmanns hätte das Werk vereitelt.
Ein ohrenzerreißender Lärm hallte über den Frauenmarkt. Peter Sorgenfrei stand auf dem von Menschen freigemachten, kleinen Raum vor dem Tor der Fronfeste, den zu betreten bewaffnete Bürger die Menge zurückhielten. Da wandte sich Sorgenfrei gegen den ärgsten Lärmmacher in der vordersten Reihe – Bruder Antonius –, der jäh verstummte, als der riesige Fleischhauer[250] auf ihn zutrat. Der Mönch stand wie versteinert, nicht das Weiße im Auge zuckte. Nur der Blick hing starr an der erhobenen, gewaltigen Faust. Wenn diese niederfiel – das wußte er –, zerschlug sie seinen Schädel wie einen irdenen Topf. Doch ging das Verhängnis noch einmal an dem alten Landstreicher vorbei.
Da machte die Menge eine Bewegung und drängte, allen Anstrengungen der Bürgerwehr zum Trotz, bis nahe zum Eingang des Turmes vor.
Zur gleichen Zeit öffnete sich das Tor der Fronfeste und Caspar von Carlowitz trat heraus. Acht bewaffnete Burgknechte folgten ihm, in deren Mitte mit leichenblassem Gesicht Bernhard von Miltitz ging.
»Eine Gasse im Namen des Herzogs!« rief der Schloßhauptmann der dichtgedrängten Menge zu.
Keiner rührte sich, der Aufforderung nachzukommen; nur ein verstärktes Geheul erbrauste als Antwort.
Jetzt klang Peter Sorgenfreis gewaltige Stimme in den Lärm hinein:
»Will die allzeit gesetzestreue Bürgerschaft Meißens dem Herzog Heinrich die Reformation mit Aufruhr und Empörung danken?«
Das wirkte. Stille trat ein, und die Menge teilte sich.
Caspar von Carlowitz ging voran und winkte den Knechten, ihm zu folgen.
Da geschah etwas Unerwartetes. Ein Weib drängte sich durch die vordersten Reihen und flog mit dem schrillen Ruf »Bernhard!« auf den Gefangenen zu. Einer der Knechte, den die drohende Haltung der Menge und ihr Geschrei kopflos gemacht, glaubte, daß eine gewaltsame Befreiung des Gefangenen versucht würde. Er hob[251] den Spieß, stach zu und – traf einen Jüngling, der blitzschnell vor das Mädchen gesprungen war. Der Gestochene brach lautlos zusammen. Das Mädchen aber schlüpfte zwischen den Knechten hindurch und schlang die Arme um den Gefangenen.
Der rasche Vorgang war von tiefer Wirkung auf die Umstehenden. Jeder kannte das Mädchen, es war die Tochter des Burgemeisters. Und wer war der unglückliche Gefangene, der Waltklingers Befreiung heldenmütig versucht hatte?
Da rief eine Stimme:
»Ist das nicht der Junker von Miltitz?«
Der Ruf schlug ein. Die Menge ahnte, was sich hier abspielte, und war ergriffen. Die Liebenden waren die Kinder der feindlichen Väter! So dichtgedrängt das Volk den Frauenmarkt auch bedeckte, herrschte doch jetzt tiefes Stillschweigen.
Inzwischen waren Caspar von Carlowitz und Peter Sorgenfrei zu den Umschlungenen getreten und hatten gütlich auf sie eingesprochen. Darauf flüsterte Bernhard der Geliebten noch ein paar Worte zu und löste alsdann ihre Hände schonend von seinem Hals. Während Sorgenfrei nun die Gebrochene beiseite führte, setzten sich die Burgknechte mit dem Gefangenen in ihrer Mitte in Bewegung.
Dieser Auftritt hatte die Menge plötzlich ernüchtert. Keiner besaß noch Verlangen, den Lärm fortzusetzen. Alle fühlten, daß sich etwas Großes zugetragen hatte. Das allgewaltige Schicksal war mit leisem Flügelrauschen über ihren Häuptern hingezogen.
Rascher, als er entstanden, zerstreute sich der Auflauf, und die Gassen wurden leer. Nur die letzten der Heimkehrenden sahen noch, wie der Schloßhauptmann auf schäumendem Pferde die Burggasse herabgesprengt kam und über den Markt und durch die Fleischgasse galoppierte. Schon in geraumer Entfernung vom Fleischtor klang seine befehlende Stimme:
»Torwart, hallo, – Tor auf!«
Der Torwart sprang hinzu, riß die schweren Torflügel auseinander, und Caspar von Carlowitz ritt hindurch. Donnernd schlugen die Pferdehufe den Triebischsteg. Und dann sprengte er den Plossenberg hinan, – die Straße nach Siebeneichen.
Nachdem Peter Sorgenfrei das zitternde Mädchen aus der Menge geführt, ließ er sie allein und eilte zum Turm zurück. Da bemerkte Sonnhild an der Kirchhofsmauer einige Männer, die einen auf der Erde Liegenden umstanden.
Das Mädchen ging zu der Gruppe; sie wußte, daß dort ihr heldenmütiger Retter lag. Als sie sich zu ihm hinabbeugte, erkannte sie ihn. Es war der junge Spielmann. Der Stoß des Knechts auf seine Brust war so stark gewesen, daß er den Körper durchbohrt hatte. Die Fiedel, die der Bursche auf dem Rücken getragen, lag neben ihm. Des Spießes Spitze hatte sie zertrümmert.
Sonnhild kniete mit zusammengepreßten Lippen zur Seite des Spielmanns nieder. Die glanzlosen Augen des Verscheidenden leuchteten auf, als er das Mädchen erkannte.
»Jungfrau,« flüsterte er in hohem Glücksgefühl, »welch schöner Tod!«
Sonnhild drängte das furchtbare Weh zurück, das ihr die Brust zerriß.
»Edler Jüngling,« sprach sie erschüttert, »wie soll ich's Euch danken, was Ihr für mich getan!«
Aber der Spielmann wehrte ihren Worten.
»Sprecht nicht also. Das Bewußtsein, Euch gedient zu haben, ist mir Danks genug.«
»Ihr habt mein armseliges Leben um eine kurze Spanne verlängert, indem Ihr Euer junges Leben als Einsatz gabt. Unerträglicher Gram hat mein Herz gebrochen; wie lange noch, und es steht still. Ihr hättet Euch nicht aufopfern sollen.«
Da lächelte der Spielmann beglückt.
»Ihr werdet noch ungezählte Tage erleben, und die Sonne wird freundlich auf Euern Weg fallen. Was liegt an mir?«
Ein hellroter Blutstrahl brach aus seinem Munde und machte ihn verstummen. Große Schwäche kam über ihn. Er fühlte, es war sein Letztes. Mit äußerster Kraft widerstand er noch einmal dem Ruf aus dem Jenseits und stammelte:
»Jungfrau, ich mußte von hinnen, weil ich Euch liebte – er mag mir's verzeihen. Das Leben hätte mich bedrückt, aber der Tod für Euch beseligt mich! Grüßt mir den edlen Junker; – ihm – und – Euch – meine – – Segens – wün – sche – – –«
Mit diesen Worten starb der Spielmann. Sonnhild sah sein Auge brechen, nachdem es ihr noch einmal gelächelt.[254] Da deckten die Männer einen Mantel auf ihn und trugen ihn fort. Nun war Sonnhild allein. Der Mond schien hell und ließ alle Gegenstände deutlich erkennen.
Ohne zu wissen wohin, lief Sonnhild fort von dieser Stelle, bis sie vor einer Mauer stand. Jetzt sah sie sich um. Sie befand sich auf dem Friedhof der Franziskaner, und dicht vor ihr war das Beinhaus.
Eine Weile lang versuchte das Mädchen, alle Kraft zusammenzunehmen, daß sie der übermächtigen Schwächeanwandlung, die sie fühlte, nicht erliege. Dann brach sie in die Knie, lehnte die Wange an die Mauer des Beinhauses und schrie auf vor Schmerz.


Frau Magdalena von Miltitz saß beim Schein der Lampe im Familienzimmer des Schlosses Siebeneichen. Sie war unbeschäftigt, und ihr Blick hing nachdenklich an dem offenen Fenster. Leise Unruhe quälte sie.
Sie ging zum Fenster und lehnte sich hinaus. Es war ein prächtiger Herbstabend. Die Mondscheibe hing scharf umzeichnet am Himmel, und das silberne Licht umwob schmeichelnd die Zweige und Blätter der Bäume. In der Tiefe glitzerte das breite Band des Elbstroms. Fledermäuse huschten vorbei, und von Zeit zu Zeit erklang der Ruf eines Kauzes.
Jetzt vernahm Frau Magdalena Pferdegetrappel. Eilends verließ sie das Zimmer und begab sich auf die nach dem Schloßhof gelegene Veranda. Da trabte auch schon ein Reiter durch das Tor. Sie erkannte Caspar von Carlowitz und rief ihn an.
»Base,« hörte sie seine Stimme im Näherkommen, »wie ist das Befinden deines Mannes? Kann ich ihn sogleich sprechen?«
Damit hielt er vor der Veranda. Frau Magdalena sah in sein mondbeschienenes Gesicht; es war tiefernst, wie sie es noch nie gesehen.
»Du triffst Ernst nicht zu Hause,« antwortete sie. »Kaum war er heute zum Bewußtsein zurückgekehrt, so erkundigte er sich nach dem Schicksal Waltklingers. Als er die Strafe erfuhr, war er aufs tiefste betroffen. Während des ganzen Nachmittags stand er unter dem Eindruck dieser Nachricht. Mit einem Male erklärte er, daß er zum Herzog fahren und um Milderung der Strafe bitten wolle. Die Tat sei in der heftigsten Gemütserregung geschehen, Waltklinger wäre als Mensch und Burgemeister hochachtbar, und was er ähnliches mehr sprach. Und da Bernhard die Nachricht aus Dresden mitbrachte, Herzog Heinrich werde noch heute nach Prag reisen und als Liebhaber nächtlicher Fahrten gegen Mitternacht aufbrechen, ließ Ernst alsbald anspannen und fuhr davon. Sein Zustand war recht gut; dennoch bange ich um ihn. Doch mochte ich ihn nicht von der Fürbitte zurückhalten.«
Frau Magdalena schwieg. Während ihrer Rede war der Vogt aus dem Pferdestall auf den Hof getreten.
»Ich muß gleichfalls zum Herzog,« stieß der Schloßhauptmann aus. »Welche Stunde ist es, Vogt?«
»Fast elf,« antwortete dieser.
»Vetter Carlowitz,« sagte Frau Magdalena, »dein Gebaren ist ein wenig seltsam. Du ängstigst mich. Was bewegt dich zu dem nächtlichen Ritt? Sag' es mir.«
»Nichts, nichts, Base,« beschwichtigte dieser erregt. »Vogt, ziehe sofort das schnellste Pferd aus deinem Stalle! In zwei Minuten muß ich reiten.«
Der Vogt verschwand in großer Eile.
»Soll dich nicht wenigstens Bernhard begleiten?« drang Frau Magdalena in den Schloßhauptmann.
»Bernhard?« entfuhr es diesem.
Beim Klange dieses einen Wortes stutzte Frau Magdalena.
»Nun ja,« sagte sie gepreßt. »Er begab sich heute schon früh zu Bett – – Doch, nein, – wie ist mir, – sein feines Ohr hätte unser Gespräch längst schon vernommen und er wäre ans Fenster getreten – –«
Frau Magdalena warf einen geängstigten Blick zu den Fenstern hinauf.
»Vetter!« rief sie. »Du verbirgst mir etwas! Laß es mich wissen, was es auch sei!«
Caspar von Carlowitz erwiderte:
»Nun du es ahnst, kann ich das Schlimme nicht mehr verschweigen.« Und er erzählte mit hastigen Worten, was sich zugetragen.
Frau Magdalena erbleichte bis in die Lippen hinein.
Jetzt führte der Vogt das rasch gezäumte Pferd vor. Der Schloßhauptmann sprang von dem seinen und bestieg das junge, mutige Tier.
»Wie lange rechnest du mit ihm bis zum Dresdner Schloß?« fragte er.
»Wenn Ihr ihm die Zügel laßt, Herr, dann trägt Euch der Hengst in weniger als einer Stunde dahin. Habt Ihr erst Wilsdruff hinter Euch, so wird er davonschießen wie ein Pfeil.«
»Es ist gut.«
Carlowitz nahm die Zügel fest in die Faust und ritt dicht an die Veranda heran.
»Mut, Base,« raunte er, »du kennst den Edelsinn unseres Herzogs.« Und als er ihren starren Blick sah, fügte er[258] hinzu: »Wir stehen alle in Gottes Hand. Kein Haar fällt ohne seinen Willen von unserm Haupt!«
Da beugte sich Frau Magdalena über die Brüstung, reichte dem Schloßhauptmann die Hand und sprach gefaßt, aber mit zuckenden Lippen:
»Reite unter seiner Hut, Vetter!«
Carlowitz drängte sein Pferd zurück und trabte zum Hoftor hinaus. Bald hatte er die Landstraße erreicht, die hell beschienen wie eine gerade Linie durch die Landschaft lief.
Da schnalzte er mit der Zunge; der Hengst prustete und spitzte die Ohren. Jetzt drückte ihm der Reiter die Sporen in die Weichen. Das junge Tier gewahrte die Zügelfreiheit und galoppierte an. Eine Sekunde darauf flog Carlowitz wie eine spukhafte Erscheinung durch die stille Nacht.


Ein schöner Herbstmorgen brach an. Schon zu früher Stunde wurde es in den Gassen lebendig. Von der Erregung vom Abend vorher war nichts mehr zu spüren. Die Menschen trugen ernste, sorgenvolle Mienen, und unwillkürlich dämpfte jeder die Stimme im Gespräch mit dem andern.
Die Menge wuchs. Heute dachte niemand daran, sein Tagewerk zu beginnen. Unaufhörlich strömten die Neugierigen nach dem Markt, und das Gerüst war von einem undurchdringlichen Menschenring eingeschlossen.
Da flog plötzlich von der Fronfeste her ein Gerücht durch die Menge. Wer es vernahm, schreckte zusammen und glaubte ihm nicht, obwohl es jedes Herz in neuer Hoffnung schlagen machte.
Ernst von Miltitz wäre gestern unter schwerer Gefahr für seine Gesundheit nach Dresden zum Herzog geeilt. Im Schloß angekommen, sei er infolge der Wagenfahrt sehr schwach gewesen. Endlich habe er sich wieder erholt und den Herzog vor der Abreise noch am Wagenschlag um Gnade für den Burgemeister gebeten. Herzog Heinrich hätte die überraschende Bitte freundlich aufgenommen. Im Begriff, seinem Geheimschreiber eine Milderung der Strafe[260] zu diktieren, sei Caspar von Carlowitz auf fast zusammenbrechendem Rosse herangesprengt. Auch dieser habe um Gnade gefleht, und zwar für den Sohn des vor dem Herzog stehenden Vaters, der für seinen Feind bat. Als Herzog Heinrich die unüberlegte Tat des edelmütigen Jünglings vernommen, sei er ergriffen gewesen. Und wie er seinen geschätzten Amtmann, ob des Ungeheuerlichen, das sein Sohn gewagt, habe erbleichen sehen, da sei es rasch von seinem Lippen gekommen: ›Volle Gnade für beide!‹
Vor wenigen Minuten hätte Caspar von Carlowitz dem Burgemeister die Begnadigung verkündet.
Aus dem dichtgedrängten Haufen erscholl nicht ein einziger Ruf der Freude. Man mußte erst Gewißheit haben, bevor man das gepreßte Herz frei machte. Wie grausam wäre ein Irrtum gewesen.
»Auf, zur Fronfeste!« rief laut eine Stimme, und die Menge drängte ungestüm durch die Jüdengasse nach dem Frauenmarkt.
Das Gerücht beruhte auf Wahrheit! Noch in der Nacht waren Ernst von Miltitz und Caspar von Carlowitz von Dresden zurückgekommen. Und als der Morgen dämmerte, hatte beim Wächter des zu Füßen des Burgfelsens gelegenen Wassertors ein Jüngling um Auslaß gebeten. Außerhalb der Stadtmauer war er sodann elbaufwärts geeilt, bis er Siebeneichen erreicht hatte.
Zu derselben Zeit, als in Meißen die Kunde des herzoglichen Gnadenaktes laut wurde, saßen Ernst von Miltitz, Frau Magdalena und Bernhard beim Morgenimbiß. Eine schwere Stunde lag hinter ihnen. Bernhard hatte seinen Vater um Verzeihung für seine Tat gebeten. Die[261] Liebe zu der Tochter des Burgemeister habe ihn zu diesem Beginnen bewegt. Auch habe er geglaubt, die schwere Strafe von dem Mann abwenden zu sollen, um deren Milderung der Vater sicherlich würde gebeten haben, wenn er das verhängnisvolle Geschick Waltklingers gekannt hätte. Der väterliche Bittgang, nachdem er das Urteil erfahren, bestätige dem Sohn, daß er die Großmut des Vaters seinem Feinde gegenüber richtig eingeschätzt.
Wohl verurteilte Ernst von Miltitz die rasche und gegen das Gesetz gerichtete Tat des Jünglings. Aber mit geheimem Stolz erkannte er auch den Edelmut, der den Sohn zu dieser Handlung getrieben. Deshalb verzieh er ihm aus vollem Herzen, und ihre Aussöhnung vertrieb selbst den Schatten, der seit jenem bösen Auftritt zwischen ihnen gestanden.
Frau Magdalena hatte ihren Sohn stumm in die Arme geschlossen. Sie kannte ihn nur zu gut. Er war das treue Abbild seines Vaters. Eine übereilte Handlung konnte der Jüngling, bis das Leben seinen Charakter gereift, wohl begehen, aber nie eine Tat, die einen Makel auf ihn geworfen hätte. Und die warme Regung, die ihn getrieben, war doch ebenfalls das Erbe seines Vaters.
So saßen die drei mit übervollem Herzen beieinander.
Da hörten sie die Tür gehen. Und wie sie sich umschauten, gewährten sie auf der Schwelle zwei Menschen: ein junges, blasses Mädchen und einen gebeugten Mann. Die schönen Augen des Mädchens waren mit Tränen gefüllt; ihre Hand lag in der des völlig fassungslosen Begleiters. Keines von beiden sprach ein Wort. Da tat der Mann an der Tür ein paar unsichere Schritte ins[262] Zimmer. Dann versagte ihm die Kraft. Langsam breitete er die Arme aus, sank auf die Knie nieder und stammelte:
»Ernst von Miltitz, – Ihr habt – – –«
Hier brach seine Stimme.
Der Amtmann sprang vom Stuhl auf und ging zu dem Knienden.
»Georg Waltklinger,« sagte er gütig, »steht auf. Nicht mir, unserm gütigen Herzog gebührt Euer Dank!«
Der Kniende haschte nach den ihm entgegengestreckten Händen und hielt sie fest.
»Herr Amtmann,« stammelte er, »meine schwere Schuld drückt mich bei Eurem Anblick nieder, – und so will ich mit Euch sprechen. Eure Großmut mag meinem Dank wehren, für den mir alle Worte zu schwach sind, aber mein Geständnis müßt Ihr anhören. Ich bin Euch übel gesinnt gewesen, und was ich über Euch gesprochen, mag mir Gott verzeihen. Als einen rechthaberischen Mann ohne menschliches Mitgefühl habe ich Euch betrachtet. Und wäre das Schlimme nicht über mich gekommen, so hätte ich Euch wohl für immer bitter unrecht getan. Darum preise ich die Prüfung! Meine Hoffart habt Ihr mit Edelsinn erwidert. Ernst von Miltitz, Ihr habt mich besiegt! – Könnt Ihr verzeihen?«
Während dieser Rede waren die Ratsherren und noch einige andere angesehene Bürger Meißens in das Zimmer getreten. Alle waren sichtlich ergriffen.
»Ich verzeihe Euch gern, wenn Ihr eine Schuld gegen mich fühlt,« antwortete der Amtmann bewegt. »Die Überlieferung aus vergangenen Zeiten ist es gewesen, was Euch verhinderte, mich gerechter zu beurteilen. Und was Ihr erlitten, mußtet Ihr für die Feindschaft büßen, die Adel[263] und Städte so lange schon trennt. Vielenorts wird der Wunsch laut, das alte Zerwürfnis zu beseitigen. Beginnen wir damit! Wollt Ihr das Versprechen besiegeln, allen Hader zu vergessen und mir Euer Vertrauen für die Zukunft zu schenken, so reicht mir die Hand.«
»Das will ich, Herr Amtmann!« versetzte Waltklinger freudig und schlug ein.
»Ich danke Euch, Herr Burgemeister! Und Ihr sollt es erfahren, wie ich Euch schätze. Nun aber steht auf.«
Peter Sorgenfrei dankte jetzt im Namen des Rats für die hochherzige Fürbitte. Aber Ernst von Miltitz wehrte ab.
Da trat ein Greis vor den Schloßherrn. Es war der alte Niclas Anesorge. Seine Züge waren verfallen, und es schien, als wenn die Aufregungen der letzten Tage den verbissenen Weißkopf an den Rand des Grabes gebracht hätten.
»Herr Amtmann,« murmelte der Alte, »mir müßt Ihr noch erlauben, zu Euch zu sprechen. Ich hab' Euch am schlimmsten mitgespielt! Und wenn man's gewahr wird, daß es ein guter Mensch gewesen, den man verunglimpft hat, so tut das bitter weh! Ich werde mir's nimmer verzeihen können – –«
Der Alte senkte den Kopf und weinte. Als Ernst von Miltitz ihn getröstet, ging er kopfschüttelnd hinaus.
»Was Ihr unserm Burgemeister erwiesen, Herr Amtmann,« hob Peter Sorgenfrei noch einmal an, »das empfindet jeder einzelne der Bürgerschaft, als wenn Ihr's ihm getan hättet.«
Bei diesen Worten hatte Sorgenfrei das Fenster geöffnet.
»Möchtet Ihr nicht einmal herantreten?« fragte er.
Ernst von Miltitz stellte sich neben ihn und sah hinaus. Den ganzen weiten Park füllte, Kopf an Kopf, eine dichtgedrängte Menge, die mit entblößten Häuptern in feierlichem Schweigen harrte. Ergriffen sah der Amtmann hinab. Da brausten plötzlich vielhundertstimmig die Rufe durch die Luft:
»Ernst von Miltitz! – – – Herzog Heinrich! – –«
Und zu dem lauten Jubel schwenkten die Meißner die Hüte und Mützen, und aus ihren Augen las Ernst von Miltitz Dankbarkeit und ehrliche Beschämung.
Sich zu den im Zimmer Versammelten zurückwendend, fielen des Amtmanns Blicke auf seinen Sohn, dessen Augen vor innerer Bewegung mit Tränen gefüllt waren.
Da wandte sich Ernst von Miltitz nach allen Seiten um, als wenn er jemand suche. Plötzlich schritt er durch den Kreis der Ratsherren nach der Tür, wo Sonnhild lehnte. Er sprach leise ein paar väterliche Worte zu ihr, faßte sie alsdann bei der Hand und führte sie vor ihren Vater.
Mit niedergeschlagenen Augen stand das Mädchen mitten unter den Versammelten. In ihren Zügen war von dem großen Glück, das ihr Herz erfüllte, nichts zu lesen. Die Freude war zu jäh gekommen, und die Leiden waren zu schwer gewesen. Das feine Gesicht Sonnhilds war bleich, und die edelgeformten Schläfen, die das leuchtende Haar halb bedeckte, zitterten noch ob der furchtbaren Aufregung der letzten Tage.
»Burgemeister Waltklinger,« hob Ernst von Miltitz an, »hier Eure Tochter, die mit ihren schwachen Kräften von allen wohl am meisten gelitten hat!«
Bei diesen Worten schossen Tränen in Waltklingers Augen.
Ernst von Miltitz ergriff mit der freien Linken die Hand Bernhards.
»Was erwidert Ihr, Georg Waltklinger, wenn ich jetzt als Brautwerber meines Sohnes vor Euch trete und bitte: gebt ihm die Hand Eurer Tochter!«
Da überlief die hohe Gestalt Waltklingers ein so starkes Zittern, daß Peter Sorgenfrei an seine Seite trat und ihn stützte. Über die Wangen des Tiefergriffenen rannen die Tränen, und seine Augen gingen in unaussprechlicher Dankbarkeit zu dem edelmütigen Jüngling, der das Leben furchtlos an seine Befreiung gesetzt hatte. Die Bewegung, die den starken Mann erzittern machte, war so tief, daß er kaum ein paar Worte sprechen konnte.
Nun legte Ernst von Miltitz die Hände der Liebenden ineinander. Bernhard sah, wie eine feine Röte in Sonnhilds bleiches Gesicht stieg. Und als das Mädchen die wunderbaren Augen zu ihm aufschlug und ihre Blicke sich trafen, da erwachte in ihren beiden jungen Herzen die Zuversicht, daß die bangen Tage nun zu Ende waren und eine glücklichere Zukunft verheißungsvoll für sie anbrach.
Frau Magdalenas feines weibliches Empfinden ermaß von allen am besten, was Sonnhild gelitten. Und da sie bemerkte, daß die Rührung das tapfere Mädchen zu überwältigen drohte, führte sie es aus dem Kreis und zog im jähen Aufwallen ihrer mütterlichen Liebe die junge Tochter an ihre Brust.
Meißen ist die älteste Stadt der Mark; von ihr ging einst die deutsche Kultur über das ganze Land. Seine[266] geheimnisvolle Anziehungskraft, die schon im Mittelalter die Fahrenden verspürten, übt ihre Wirkung auch auf die Menschen unserer Tage aus. Ein großer Strom von Reisenden flutet alljährlich dahin. Aufmerksam betrachten sie das alte Rathaus und die noch erhaltenen alten Häuser in den engen Gassen.
Sie bestaunen den prächtigen Dom, diese vornehme Pflegstätte des protestantischen Gottesdienstes, mit seiner tief auf das menschliche Herz wirkenden Schönheit, – die Albrechtsburg, das herrliche Baudenkmal aus mittelalterlicher Zeit, deren Anfänge auf ein Jahrtausend zurückschauen, – die Fürstenschule, eine der ersten Bildungsstätten Deutschlands, die bald nach Einführung der Reformation gegründet wurde, – und die berühmte Porzellanmanufaktur, deren Erzeugnisse, kenntlich durch die gekreuzten Kurschwerter, in der ganzen Welt hochgeschätzt werden.
So finden Kunst, Wissenschaft und Gewerbefleiß in Meißen vorzügliche Pflege; – die Enkel verstehen es, den Ruf, den ihre Väter der Stadt erwarben, hochzuhalten!
Umgrenzt von Bergen und Rebenhügeln, von Feld und Wald, liegt die Stadt malerisch zu beiden Seiten des Elbstroms. Wie der Drang und Wechsel der Zeiten sich auch gestalten möge, die herrliche Gottesnatur, die sie umgibt, wird der alten Markgrafenstadt für alle Zeiten einen guten Platz unter den schönsten deutschen Städten sichern.
Der Tag, mit dessen Anbruch unsere Erzählung schließt, neigte sich seinem Ende zu. Im Schlosse Siebeneichen[267] war alles still. Die Dämmerung ließ das gegenüberliegende Ufer mit seinen lieblichen Weinbergen nur noch schwach erkennen. In der Tiefe rauschten die Wasser des Stroms ihre dumpfen, jahrtausendealten Gesänge.
An den Stamm eines der alten Bäume gelehnt, die dem Schloß seinen Namen gegeben, standen schweigsam zwei junge Menschen eng umschlungen und blickten in die zunehmende Dunkelheit. Zuweilen erschauerte das Mädchen. Dann drückte sie der Jüngling an sich, und sie beruhigte sich dabei.
Tiefer Frieden erfüllte die Seelen beider, und in der weiten Natur herrschte feierliches Schweigen, in das nichts anderes hineinklang als eine wundersame, geheimnisvolle Melodie: das leise Rauschen der sieben Eichen.


Schaffet gute Bücher ins Haus!
Ein Roman aus der guten alten Zeit!
Rund um den Kreuzturm
Roman aus den Dresdner Maitagen von 1849
von
Gustav Hildebrand
Mit Federzeichnungen von Josef Windisch
Vornehm gebunden 6 M.
Gustav Hildebrand, der sich mit seinem Roman »Siebeneichen« sofort einen ehrenvollen Platz in der Literatur unserer Tage gesichert hat, legt in seinem Roman »Rund um den Kreuzturm« den blutigen Dresdner Mai-Aufstand vom Jahre 1849 zu Grunde, und die Schilderungen der Häuser- und Straßenkämpfe mit all ihrem Drum und Dran, besonders die Barrikadenstürme bilden den Mittel- und Höhepunkt des Buches, das mit feinem historischen Gefühl die ganze Bewegung aus ihren Ursachen heraus sich entfaltend vorführt bis zu ihrem traurigen Abschluß. Scharf treten die Führer hervor, klar erfaßt ist die Stimmung in Volk und Heer, und das alles auf dem Grunde eines ebenso plastischen, wie liebevollen Gemäldes der Stadt Dresden und der Gesellschaft der damaligen Zeit dargestellt. Anheimelnde Wärme und Frische und ein gesunder, gemütvoller Idealismus sprechen aus jeder Zeile.
Karl Voegels Verlag G. m. b. H. • Berlin O 27.
Ein Buch, das jeder besitzen sollte!
Leonardo da Vinci
Historischer Roman aus der Wende des 15. Jahrhunderts
von
Dmitry Sergejewitsch Mereschkowski.
Zweiter Band der Trilogie: Christ und Antichrist.
(Erster Band: Julian Apostata;
Dritter Band: Peter der Große.)
Erste vollst. Ausgabe!
90. Tausend!
Ein stattlicher Band von 487 Seiten mit 16 Kunstbeilagen, gebunden in elegantem, modernem Geschenkband.
Preis nur 9 M.
Einige Kritiken: Das Buch gehört zu den seltenen Schriften, deren Wirkung auf nachdenkliche Leser bleibend ist, ja deren Lektüre wie ein Schicksal in das Leben vieler einzugreifen imstande ist. Es kann nicht dringend genug empfohlen werden. Um ihm gerecht zu werden, müßte man allerdings mehr als ein paar Ankündigungszeilen zur Verfügung haben. Hier müssen einige wenige Worte warmer Bewunderung genügen.
(»Blätter für Volksbibliothek und Lesehallen.«)
Nur ein absoluter Beherrscher schriftstellerischer Darstellungskunst konnte dieses Buch ins Leben rufen, das seinem Autor eine den bedeutendsten Erzählern ebenbürtige Stellung anweist …
(›Monatsb. üb. Kunstw.‹, Münch.)
Mereschkowski, der jüngste der russischen Schriftsteller, ist ein würdiger Nachfolger Tolstois und Dostojewskis.
(»Daily Telegraph«, London.)
Ein packendes Buch, das höher steht als die besten Romane der Neuzeit, höher, als es sich sagen läßt …
(»Spectator«, London.)
… Gewöhnliche Romane hat Mereschkowski nicht geschrieben, es sind gewaltige Seelen- und Kulturbilder.
(»Liter. Echo«, Berlin.)
… so steht dieses machtvolle Werk als das bedeutendste, das Riesenfleiß und geniale Phantasie bisher einen modernen Dichter aus der Lebens- und Gestaltenfülle der italienischen Renaissancezeit hat erschaffen lassen.
(»Westermanns illustr. Monatshefte.«)
Karl Voegels Verlag G. m. b. H. • Berlin O 27.
Bücher, die man kennen muß!
Julian Apostata
Der letzte Hellene auf dem Throne der Cäsaren
Historischer Roman von
Dmitry Sergejewitsch Mereschkowski.
Elegant gebunden 7 M.
Erster Band der Trilogie: Christ und Antichrist.
(Zweiter Band: Leonardo da Vinci;
Dritter Band: Peter der Große.)
Ein hochinteressanter Roman, der immer wieder bedeutendes Aufsehen in der Leserwelt erregt.
Peter der Große und Alexei
Historischer Roman aus Rußlands großer Zeit von
Dmitry Sergejewitsch Mereschkowski
Vornehm gebunden 8 M.
Dritter Band der Trilogie: Christ und Antichrist.
(Erster Band: Julian Apostata;
Zweiter Band: Leonardo da Vinci.)
Der Roman ist sowohl in historischer als auch in kulturgeschichtlicher Beziehung von größtem Reiz.
Karl Voegels Verlag G. m. b. H. • Berlin O 27.
Für Freunde vornehm. Belletristik!
Tolstoi und Dostojewski
Leben / Schaffen / Religion
von
Dmitry Sergejewitsch Mereschkowski.
Deutsch von Carl von Gütschow.
Vornehm geb. 7 M.
Über die Bedeutung eines Werkes, welches diese größten Vertreter des russischen Geisteslebens einer eingehenden u. grundlegenden kritischen Untersuchung unterwirft und sie in ihrer Gesamterscheinung als Menschen und Künstler betrachtet, brauchen wir hier wohl nicht viel zu sagen. Reicht doch der geistige Einfluß, den diese machtvollen dichterischen Persönlichkeiten auf ihre Zeitgenossen ausgeübt haben, weit über die Grenzen ihres großen Vaterlandes hinaus, und dieses Buch darf daher von vornherein nicht nur bei Literaturforschern und allen Gelehrten, die den Erscheinungen und treibenden Kräften unseres bewegten Zeitalters nachspüren, sondern überhaupt bei der Gesamtheit der Gebildeten auf das lebhafteste Interesse rechnen. – Wenn Mereschkowski in seiner Kritik zu ganz neuen Ergebnissen kommt und z. B. Tolstoi, den er als Künstler hochschätzt und in gewisser Hinsicht sogar als den bedeutendsten unserer Zeit hinstellt, einen gewaltigen Zwiespalt und Inkonsequenz in seiner Welt- und Lebensanschauung nachweist, so mag das manchem als Ketzerei erscheinen, wird aber nicht verfehlen, gerade auch die zahlreichen Mitglieder der großen Tolstoi-Gemeinde in Deutschland zu zwingen, zu diesem Buche Stellung zu nehmen. – Daß Mereschkowski, selbst ein schaffender Dichter von so bedeutender Darstellungskraft, auch in diesem Werke weit mehr gibt als eine bloße Kritik dieser beiden Geistesheroen, daß er vielmehr die menschliche u. dichterische Persönlichkeit seiner großen Landsleute in genialer Weise vor dem Leser aufbaut, war von ihm nicht anders zu erwarten.
Karl Voegels Verlag G. m. b. H. • Berlin O 27.
Druck: Oskar Bonde, Altenburg.
Weitere Anmerkungen zur Transkription
Offensichtliche Fehler wurden stillschweigend korrigiert. Die Darstellung der Ellipsen wurde vereinheitlicht.
Korrekturen:
S. 235: die → die die
Oberhand, die die Masse berauschte
End of the Project Gutenberg EBook of Siebeneichen, by Gustav Hildebrand
*** END OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK SIEBENEICHEN ***
***** This file should be named 58342-h.htm or 58342-h.zip *****
This and all associated files of various formats will be found in:
http://www.gutenberg.org/5/8/3/4/58342/
Produced by The Online Distributed Proofreading Team at
http://www.pgdp.net
Updated editions will replace the previous one--the old editions will
be renamed.
Creating the works from print editions not protected by U.S. copyright
law means that no one owns a United States copyright in these works,
so the Foundation (and you!) can copy and distribute it in the United
States without permission and without paying copyright
royalties. Special rules, set forth in the General Terms of Use part
of this license, apply to copying and distributing Project
Gutenberg-tm electronic works to protect the PROJECT GUTENBERG-tm
concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark,
and may not be used if you charge for the eBooks, unless you receive
specific permission. If you do not charge anything for copies of this
eBook, complying with the rules is very easy. You may use this eBook
for nearly any purpose such as creation of derivative works, reports,
performances and research. They may be modified and printed and given
away--you may do practically ANYTHING in the United States with eBooks
not protected by U.S. copyright law. Redistribution is subject to the
trademark license, especially commercial redistribution.
START: FULL LICENSE
THE FULL PROJECT GUTENBERG LICENSE
PLEASE READ THIS BEFORE YOU DISTRIBUTE OR USE THIS WORK
To protect the Project Gutenberg-tm mission of promoting the free
distribution of electronic works, by using or distributing this work
(or any other work associated in any way with the phrase "Project
Gutenberg"), you agree to comply with all the terms of the Full
Project Gutenberg-tm License available with this file or online at
www.gutenberg.org/license.
Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project
Gutenberg-tm electronic works
1.A. By reading or using any part of this Project Gutenberg-tm
electronic work, you indicate that you have read, understand, agree to
and accept all the terms of this license and intellectual property
(trademark/copyright) agreement. If you do not agree to abide by all
the terms of this agreement, you must cease using and return or
destroy all copies of Project Gutenberg-tm electronic works in your
possession. If you paid a fee for obtaining a copy of or access to a
Project Gutenberg-tm electronic work and you do not agree to be bound
by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the
person or entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph
1.E.8.
1.B. "Project Gutenberg" is a registered trademark. It may only be
used on or associated in any way with an electronic work by people who
agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few
things that you can do with most Project Gutenberg-tm electronic works
even without complying with the full terms of this agreement. See
paragraph 1.C below. There are a lot of things you can do with Project
Gutenberg-tm electronic works if you follow the terms of this
agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg-tm
electronic works. See paragraph 1.E below.
1.C. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation ("the
Foundation" or PGLAF), owns a compilation copyright in the collection
of Project Gutenberg-tm electronic works. Nearly all the individual
works in the collection are in the public domain in the United
States. If an individual work is unprotected by copyright law in the
United States and you are located in the United States, we do not
claim a right to prevent you from copying, distributing, performing,
displaying or creating derivative works based on the work as long as
all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope
that you will support the Project Gutenberg-tm mission of promoting
free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg-tm
works in compliance with the terms of this agreement for keeping the
Project Gutenberg-tm name associated with the work. You can easily
comply with the terms of this agreement by keeping this work in the
same format with its attached full Project Gutenberg-tm License when
you share it without charge with others.
1.D. The copyright laws of the place where you are located also govern
what you can do with this work. Copyright laws in most countries are
in a constant state of change. If you are outside the United States,
check the laws of your country in addition to the terms of this
agreement before downloading, copying, displaying, performing,
distributing or creating derivative works based on this work or any
other Project Gutenberg-tm work. The Foundation makes no
representations concerning the copyright status of any work in any
country outside the United States.
1.E. Unless you have removed all references to Project Gutenberg:
1.E.1. The following sentence, with active links to, or other
immediate access to, the full Project Gutenberg-tm License must appear
prominently whenever any copy of a Project Gutenberg-tm work (any work
on which the phrase "Project Gutenberg" appears, or with which the
phrase "Project Gutenberg" is associated) is accessed, displayed,
performed, viewed, copied or distributed:
This eBook is for the use of anyone anywhere in the United States and
most other parts of the world at no cost and with almost no
restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it
under the terms of the Project Gutenberg License included with this
eBook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the
United States, you'll have to check the laws of the country where you
are located before using this ebook.
1.E.2. If an individual Project Gutenberg-tm electronic work is
derived from texts not protected by U.S. copyright law (does not
contain a notice indicating that it is posted with permission of the
copyright holder), the work can be copied and distributed to anyone in
the United States without paying any fees or charges. If you are
redistributing or providing access to a work with the phrase "Project
Gutenberg" associated with or appearing on the work, you must comply
either with the requirements of paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 or
obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg-tm
trademark as set forth in paragraphs 1.E.8 or 1.E.9.
1.E.3. If an individual Project Gutenberg-tm electronic work is posted
with the permission of the copyright holder, your use and distribution
must comply with both paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 and any
additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms
will be linked to the Project Gutenberg-tm License for all works
posted with the permission of the copyright holder found at the
beginning of this work.
1.E.4. Do not unlink or detach or remove the full Project Gutenberg-tm
License terms from this work, or any files containing a part of this
work or any other work associated with Project Gutenberg-tm.
1.E.5. Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this
electronic work, or any part of this electronic work, without
prominently displaying the sentence set forth in paragraph 1.E.1 with
active links or immediate access to the full terms of the Project
Gutenberg-tm License.
1.E.6. You may convert to and distribute this work in any binary,
compressed, marked up, nonproprietary or proprietary form, including
any word processing or hypertext form. However, if you provide access
to or distribute copies of a Project Gutenberg-tm work in a format
other than "Plain Vanilla ASCII" or other format used in the official
version posted on the official Project Gutenberg-tm web site
(www.gutenberg.org), you must, at no additional cost, fee or expense
to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means
of obtaining a copy upon request, of the work in its original "Plain
Vanilla ASCII" or other form. Any alternate format must include the
full Project Gutenberg-tm License as specified in paragraph 1.E.1.
1.E.7. Do not charge a fee for access to, viewing, displaying,
performing, copying or distributing any Project Gutenberg-tm works
unless you comply with paragraph 1.E.8 or 1.E.9.
1.E.8. You may charge a reasonable fee for copies of or providing
access to or distributing Project Gutenberg-tm electronic works
provided that
* You pay a royalty fee of 20% of the gross profits you derive from
the use of Project Gutenberg-tm works calculated using the method
you already use to calculate your applicable taxes. The fee is owed
to the owner of the Project Gutenberg-tm trademark, but he has
agreed to donate royalties under this paragraph to the Project
Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payments must be paid
within 60 days following each date on which you prepare (or are
legally required to prepare) your periodic tax returns. Royalty
payments should be clearly marked as such and sent to the Project
Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in
Section 4, "Information about donations to the Project Gutenberg
Literary Archive Foundation."
* You provide a full refund of any money paid by a user who notifies
you in writing (or by e-mail) within 30 days of receipt that s/he
does not agree to the terms of the full Project Gutenberg-tm
License. You must require such a user to return or destroy all
copies of the works possessed in a physical medium and discontinue
all use of and all access to other copies of Project Gutenberg-tm
works.
* You provide, in accordance with paragraph 1.F.3, a full refund of
any money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the
electronic work is discovered and reported to you within 90 days of
receipt of the work.
* You comply with all other terms of this agreement for free
distribution of Project Gutenberg-tm works.
1.E.9. If you wish to charge a fee or distribute a Project
Gutenberg-tm electronic work or group of works on different terms than
are set forth in this agreement, you must obtain permission in writing
from both the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and The
Project Gutenberg Trademark LLC, the owner of the Project Gutenberg-tm
trademark. Contact the Foundation as set forth in Section 3 below.
1.F.
1.F.1. Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable
effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread
works not protected by U.S. copyright law in creating the Project
Gutenberg-tm collection. Despite these efforts, Project Gutenberg-tm
electronic works, and the medium on which they may be stored, may
contain "Defects," such as, but not limited to, incomplete, inaccurate
or corrupt data, transcription errors, a copyright or other
intellectual property infringement, a defective or damaged disk or
other medium, a computer virus, or computer codes that damage or
cannot be read by your equipment.
1.F.2. LIMITED WARRANTY, DISCLAIMER OF DAMAGES - Except for the "Right
of Replacement or Refund" described in paragraph 1.F.3, the Project
Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project
Gutenberg-tm trademark, and any other party distributing a Project
Gutenberg-tm electronic work under this agreement, disclaim all
liability to you for damages, costs and expenses, including legal
fees. YOU AGREE THAT YOU HAVE NO REMEDIES FOR NEGLIGENCE, STRICT
LIABILITY, BREACH OF WARRANTY OR BREACH OF CONTRACT EXCEPT THOSE
PROVIDED IN PARAGRAPH 1.F.3. YOU AGREE THAT THE FOUNDATION, THE
TRADEMARK OWNER, AND ANY DISTRIBUTOR UNDER THIS AGREEMENT WILL NOT BE
LIABLE TO YOU FOR ACTUAL, DIRECT, INDIRECT, CONSEQUENTIAL, PUNITIVE OR
INCIDENTAL DAMAGES EVEN IF YOU GIVE NOTICE OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
1.F.3. LIMITED RIGHT OF REPLACEMENT OR REFUND - If you discover a
defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can
receive a refund of the money (if any) you paid for it by sending a
written explanation to the person you received the work from. If you
received the work on a physical medium, you must return the medium
with your written explanation. The person or entity that provided you
with the defective work may elect to provide a replacement copy in
lieu of a refund. If you received the work electronically, the person
or entity providing it to you may choose to give you a second
opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If
the second copy is also defective, you may demand a refund in writing
without further opportunities to fix the problem.
1.F.4. Except for the limited right of replacement or refund set forth
in paragraph 1.F.3, this work is provided to you 'AS-IS', WITH NO
OTHER WARRANTIES OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT
LIMITED TO WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR ANY PURPOSE.
1.F.5. Some states do not allow disclaimers of certain implied
warranties or the exclusion or limitation of certain types of
damages. If any disclaimer or limitation set forth in this agreement
violates the law of the state applicable to this agreement, the
agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or
limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or
unenforceability of any provision of this agreement shall not void the
remaining provisions.
1.F.6. INDEMNITY - You agree to indemnify and hold the Foundation, the
trademark owner, any agent or employee of the Foundation, anyone
providing copies of Project Gutenberg-tm electronic works in
accordance with this agreement, and any volunteers associated with the
production, promotion and distribution of Project Gutenberg-tm
electronic works, harmless from all liability, costs and expenses,
including legal fees, that arise directly or indirectly from any of
the following which you do or cause to occur: (a) distribution of this
or any Project Gutenberg-tm work, (b) alteration, modification, or
additions or deletions to any Project Gutenberg-tm work, and (c) any
Defect you cause.
Section 2. Information about the Mission of Project Gutenberg-tm
Project Gutenberg-tm is synonymous with the free distribution of
electronic works in formats readable by the widest variety of
computers including obsolete, old, middle-aged and new computers. It
exists because of the efforts of hundreds of volunteers and donations
from people in all walks of life.
Volunteers and financial support to provide volunteers with the
assistance they need are critical to reaching Project Gutenberg-tm's
goals and ensuring that the Project Gutenberg-tm collection will
remain freely available for generations to come. In 2001, the Project
Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure
and permanent future for Project Gutenberg-tm and future
generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary
Archive Foundation and how your efforts and donations can help, see
Sections 3 and 4 and the Foundation information page at
www.gutenberg.org
Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation
The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non profit
501(c)(3) educational corporation organized under the laws of the
state of Mississippi and granted tax exempt status by the Internal
Revenue Service. The Foundation's EIN or federal tax identification
number is 64-6221541. Contributions to the Project Gutenberg Literary
Archive Foundation are tax deductible to the full extent permitted by
U.S. federal laws and your state's laws.
The Foundation's principal office is in Fairbanks, Alaska, with the
mailing address: PO Box 750175, Fairbanks, AK 99775, but its
volunteers and employees are scattered throughout numerous
locations. Its business office is located at 809 North 1500 West, Salt
Lake City, UT 84116, (801) 596-1887. Email contact links and up to
date contact information can be found at the Foundation's web site and
official page at www.gutenberg.org/contact
For additional contact information:
Dr. Gregory B. Newby
Chief Executive and Director
gbnewby@pglaf.org
Section 4. Information about Donations to the Project Gutenberg
Literary Archive Foundation
Project Gutenberg-tm depends upon and cannot survive without wide
spread public support and donations to carry out its mission of
increasing the number of public domain and licensed works that can be
freely distributed in machine readable form accessible by the widest
array of equipment including outdated equipment. Many small donations
($1 to $5,000) are particularly important to maintaining tax exempt
status with the IRS.
The Foundation is committed to complying with the laws regulating
charities and charitable donations in all 50 states of the United
States. Compliance requirements are not uniform and it takes a
considerable effort, much paperwork and many fees to meet and keep up
with these requirements. We do not solicit donations in locations
where we have not received written confirmation of compliance. To SEND
DONATIONS or determine the status of compliance for any particular
state visit www.gutenberg.org/donate
While we cannot and do not solicit contributions from states where we
have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition
against accepting unsolicited donations from donors in such states who
approach us with offers to donate.
International donations are gratefully accepted, but we cannot make
any statements concerning tax treatment of donations received from
outside the United States. U.S. laws alone swamp our small staff.
Please check the Project Gutenberg Web pages for current donation
methods and addresses. Donations are accepted in a number of other
ways including checks, online payments and credit card donations. To
donate, please visit: www.gutenberg.org/donate
Section 5. General Information About Project Gutenberg-tm electronic works.
Professor Michael S. Hart was the originator of the Project
Gutenberg-tm concept of a library of electronic works that could be
freely shared with anyone. For forty years, he produced and
distributed Project Gutenberg-tm eBooks with only a loose network of
volunteer support.
Project Gutenberg-tm eBooks are often created from several printed
editions, all of which are confirmed as not protected by copyright in
the U.S. unless a copyright notice is included. Thus, we do not
necessarily keep eBooks in compliance with any particular paper
edition.
Most people start at our Web site which has the main PG search
facility: www.gutenberg.org
This Web site includes information about Project Gutenberg-tm,
including how to make donations to the Project Gutenberg Literary
Archive Foundation, how to help produce our new eBooks, and how to
subscribe to our email newsletter to hear about new eBooks.