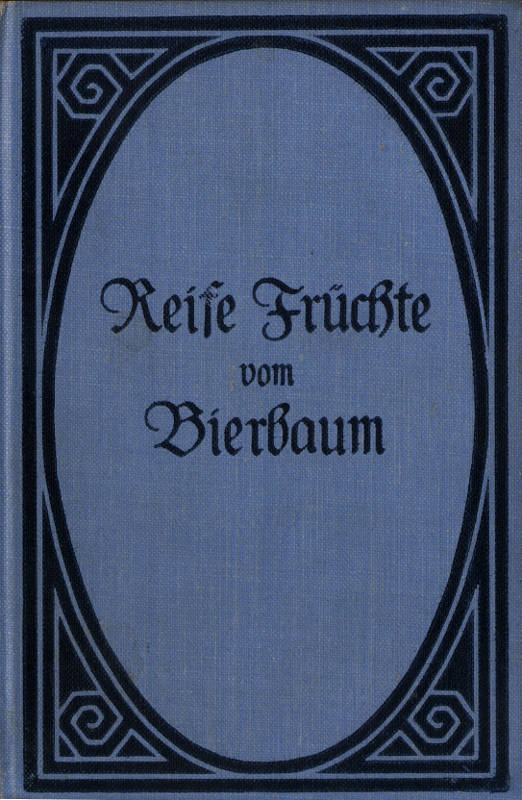
Project Gutenberg's Reife Früchte vom Bierbaum, by Otto Julius Bierbaum This eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this eBook or online at www.gutenberg.org/license Title: Reife Früchte vom Bierbaum Author: Otto Julius Bierbaum Editor: Fritz Droop Release Date: June 20, 2020 [EBook #62438] Language: German Character set encoding: UTF-8 *** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK REIFE FRÜCHTE VOM BIERBAUM *** Produced by The Online Distributed Proofreading Team at https://www.pgdp.net
Anmerkungen zur Transkription
Das Original ist in Fraktur gesetzt. Im Original gesperrter Text ist so ausgezeichnet. Im Original in Antiqua gesetzter Text ist so markiert.
Weitere Anmerkungen zur Transkription befinden sich am Ende des Buches.
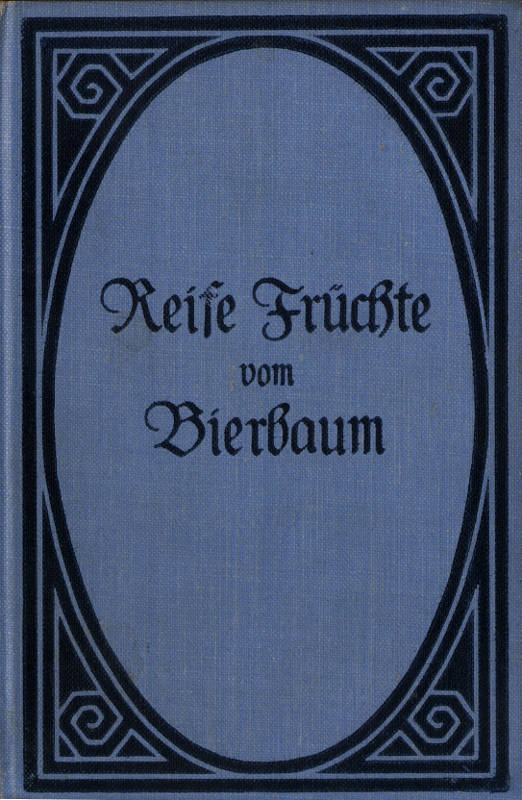

Phot. Hugo Erfurth, Dresden.
Aus den letzten Ernten ausgewählt und mit einem Vorspruch dargebracht
von
Fritz Droop.
Mit einem Bildnis Otto Julius Bierbaums.
Leipzig
Druck und Verlag von Philipp Reclam jun.
Von Zeit zu Zeit tut uns das Lachen not, das Lachen, das über den Alltag erhebt, die Freude, die uns stärkt und befreit; es gibt keinen besseren Arzt auf der Welt als den Humor, keinen besseren Führer durchs Leben als die Lebensfreude!
In der Erkenntnis dieses Grundsatzes ruht die Bedeutung Otto Julius Bierbaums, und wenn irgend etwas die Hoffnung stärken kann, daß wir wieder einer gesunderen künstlerischen Zeit entgegengehen, so ist es der Umschwung der öffentlichen Meinung zugunsten eines Liliencron, Bierbaum und Hartleben. Denn nicht immer war man so »tolerant«, und noch trennen uns keine zwei Jahrzehnte von der Zeit, da man weder von dem einen noch dem andern etwas wußte oder wissen wollte. Aber ein ungebärdiger Überschwang und eine brausende Zuversicht zu sich selbst gab diesen Dichtern die Kraft, sich durchzusetzen. Sie schlugen, wie Bierbaum in einem Aufsatz über Liliencron sich einmal ausdrückt, wie die Fohlen auf der Weide aus und vermieden es, artiger zu scheinen, als ihnen zumute war. Auf bürgerliche Reputation kam es ihnen durchaus nicht an, und sie empfanden es als eine große Genugtuung, wenn man mit dem Finger der Entrüstung auf sie hinwies als auf zügellose Frevler gegen alle Ordnung und Sitte. »Der allerorten gegen uns erhobene Schulmeisterbakel machte uns nur noch verwegener und vergnügter, und der Umstand, daß alle Argumente gegen uns schließlich darauf hinausliefen, uns unsere grüne Jugend vorzuwerfen, ließ uns eben diese, die wir als unseren Vorzug[4] empfanden, erst recht auftrumpfen.« Sie nannten sich Realisten, waren aber weltfremde Feinde der Realität, Idealisten vom reinsten Wasser, mit so großer Vorliebe sie auch die Kunstmittel des Naturalismus anwandten, um als Gegensatz zum Bilde ihrer Sehnsucht, das rechtschaffen verschwommen war, ein Bild der »Wirklichkeit« zu machen, von der sie in Wirklichkeit noch bitter wenig Ahnung hatten. Es waren jene übermütig lebensfrohen Gesellen, wie Bierbaum sie in dem jüngst erschienenen Versbuch »Maultrommel und Flöte« so trefflich zeichnet, indem er sie als »junge Götter in Hemdsärmeln« singen läßt:
Heute wissen wir, daß Bierbaum kein geringerer Lebenskünstler ist als Liliencron und erkennen es deshalb als einen Zug wohltuender Dankbarkeit, daß er zum Lobe des Dichters der »Adjutantenritte« die ehernen Worte fand: »Da kam Liliencron, und wir vernahmen aus seinem Munde in Versen von ganz der Art, um die wir rangen, Worte der Bejahung des Lebens ohne Sehnsucht nach Utopien, wohl aber verklärt durch Gesichte einer zweiten tieferen Realität: der des seherischen Künstlers. Zum ersten Male, und das entzückte uns[5] besonders, sahen wir unter uns einen Dichter von ganz ursprünglicher und unverbildeter dichterischer Veranlagung, der kein Literat war, ja das Gegenteil eines Literaten, und der in seinen Gedichten, so voll sie der reinsten, echtesten, kräftigsten Poesie waren, auch nicht den Dichter hervorkehrte, dieses abstrakte X., das alles individuell Menschliche verbirgt, sondern eine ganz deutliche Persönlichkeit bekannte. Auch wir taten uns ja etwas darauf zugute, daß wir, nicht selten mit mehr Selbstbewußtsein als Geschmack unserem dichterischen Ich deutliche Persönlichkeitszüge mitgaben, wenn wir es zum Mittelpunkte einer lyrischen Konfession machten, aber es sah dennoch fast immer recht sehr allgemein aus, denn, so heftig wir nach dem höchsten Gute: der Persönlichkeit trachteten, so wenig konnten wir es im allgemeinen erreicht haben, da wir zu jung dazu waren und zu wenig wirklich erlebt hatten. Auch waren wir zu ausschließlich Dichter und betonten diesen Umstand sogar als etwas, das uns auszeichnete, – eigentlich ganz wie die von uns so sehr geschmähten ›Alten‹, die es nur in anderer Manier und aus anderen Gründen taten.«
Bereits vor zwanzig Jahren durfte er seine ersten Lorbeeren pflücken, als er mit seinen warmherzigen und geistvollen Abhandlungen über Arnold Böcklin, Detlev von Liliencron, Fritz von Uhde und Franz Stuck die Kreise der Künstler und Literaten entzückte. Außerhalb dieser Kreise war sein Name zunächst noch wenig bekannt, und erst die »Studentenbeichten« trugen seinen Ruhm hinaus auf den Markt, bis ihn der »Irrgarten der Liebe« und die vornehme Auswahl des »Seidenen Buches« geradezu volkstümlich machten. Jedenfalls gehört Bierbaum heute zu den meist- und bestkomponierten unter den lebenden Lyrikern; es sei nur an die Kompositionen von Richard Strauß und Max Reger oder an das vielgesungene Lied »Sommernacht« in der genialen Vertonung des Königsberger Kapellmeisters Paul Scheinpflug erinnert:
Bierbaums Gedichte, Lieder und Sprüche haben fast durchweg etwas Schlichtes, Natürliches, etwas Einschmeichelndes und Herzgewinnendes, wie es unser Volk liebt; und wenn seine Versbücher auch eine Menge leichter Tändeleien mit sich führen, so enthalten sie doch alle eine stattliche Anzahl Gedichte, über denen ein wirklich echter, zarter Duft von Grazie und Anmut liegt.
Mit dem Schauspiel »Stella und Antonie« betrat der Dichter zum ersten Male den dornenreichen Pfad des Dramatikers. Das Stück, das an den vornehmsten deutschen Bühnen wiederholt mit glänzendem Erfolge aufgeführt worden ist, behandelt die Tragödie eines Mannes, der zwischen zwei leidenschaftliche Weiber gerät, von denen sich das eine an seine Sinne, das andere an sein Herz und seine Seele wendet; es ist der Konflikt zwischen der wildbegehrenden Natur und der edlen Sitte, ein heißer Kampf, in dem die Sitte siegt. Im Elberfelder Stadttheater erzielten außerdem vor einigen Jahren zwei mit allerlei Spitzen und Bosheiten gegen Pastor und Staatsanwalt gespickte »Stilpe-Komödien« einen allgemeinen Heiterkeitserfolg. Weiter schrieb er das graziös-tiefsinnige Märchenspiel »Lobetanz«, zu der Ludwig Thuille zarte lyrische Weisen fand. Er gab Kortums »Jobsiade« mit einer launigen Vorrede in Knittelversen neu heraus, schrieb eine willkommene Studie und Verteidigungsschrift[7] über Meister Hans Thoma, dichtete als alter Korpsstudent aus Anlaß des Leipziger Universitätsjubiläums die Studentenkomödie »Der Musenkrieg« und ist Herausgeber des seit einigen Jahren im Verlage von Theodor Weicher (der auch die mit handschriftlichen Selbstbiographien der Dichter und ihren Porträts ausgestattete Sammlung »Deutsche Lyrik der Neuzeit« herausgebracht hat) in Leipzig erscheinenden Goethe-Kalenders. Er gründete die Monatsschrift »Insel«, gab den »Modernen Musenalmanach« heraus und rief mit Meier-Gräfe zusammen die kostbar ausgestattete Kunstzeitschrift »Pan« ins Leben. Was er aber auch begann, geschah in einer glücklichen Stunde, unter einem glücklichen Stern.
Daß seine Muse auch dem Zuge der Zeit zu folgen wußte, bewies er durch die »Empfindsame Reise im Automobil«. Mit offenen, wachen, allen Erscheinungen des Lebens und der Natur zugewandten Sinnen reisen, nennt er empfindsam reisen, und dieses Reisen allein erscheint ihm als das wirkliche Reisen, wert und dazu angetan, zur Kunst erhoben zu werden. In unserer Zeit hat man das Reisen ja verlernt; man läßt sich transportieren. Bierbaums Ziel war, mit dem modernsten aller Fahrzeuge auf recht altmodische Weise zu reisen; sein Leitspruch hieß: »Lerne reisen ohne zu rasen«, und die achtzehn Briefe, in denen der Dichter seinen Freunden Detlev von Liliencron, Hans Thoma, Franz Stuck, Max Schillings, Fritz von Uhde, Oskar von Chelius, Ludwig Thuille und anderen berichtet, beweisen, daß er seinen Spruch zu beherzigen verstand. Bierbaum hat sehen und genießen gelernt; das ist's, was ihn ebensosehr zum geistvollen Plauderer und Humoristen wie zum Sittenschilderer und Kunstkritiker stempelt. In der soeben bei Georg Müller in München erschienenen »Yankeedoodle-Fahrt« hat er diese Fähigkeit von neuem im schönsten Lichte entwickelt.
Eine besondere Betrachtung gebührt Otto Julius Bierbaum als Romancier. Was Schönheit und Weiberklugheit vermag,[8] das erzählt Bibaomo, Baccalaureus der schönen Künste, in seinem Roman »Das schöne Mädchen von Pao«, in der »Schlangendame« geschieht nichts weniger, als daß die Serpentincancanöse Fräulein Paula Hollunder einen verbummelten Studenten, Herrn Ewald Brock, erzieht, bemuttert und nicht eher ruht, bis sie aus ihm einen wirklichen Doktor und ein braves und nützliches Mitglied der menschlichen Gesellschaft gemacht hat. Die landläufige Moral bekommt hier also einen argen Stoß; für die Überzarten, Zimperlichen, Prüden ist die »Schlangendame« nichts, ebensowenig wie der »Pankratius Graunzer«.
Dasselbe gilt von »Stilpe«, dem Roman des verkommenen Genies, sowie von der dreibändigen Geschichte »Prinz Kuckuck, Leben, Taten, Meinungen und Höllenfahrt eines Wollüstlings«; beides Werke von ebenso groteskem Farbenspiel wie bitterem Ernst, aus denen nicht zuletzt der Berufserzieher eine Fülle von Anregungen und heilsamen Lehren ziehen kann. Was Bierbaum selbst über das Wesen des Romans denkt, hat er in seinem Widmungsbriefe an Holger Drachmann ausgedrückt, über seine besonderen Absichten mit dem Zeitroman »Prinz Kuckuck« sagt er in den von Professor Litzmann herausgegebenen Mitteilungen der Literarhistorischen Gesellschaft in Bonn:
»Die Grundabsicht meiner Arbeit ist satirischer Natur, aber die Satire wendet sich nicht gegen bestimmte Personen, sondern gegen allgemeinere Zeiterscheinungen. Es lassen sich herausheben: Erziehungswesen, Übermenschentümlichkeit, Macht des Geldes (über den Besitzer wie über seine Umgebung), Rassenphrasen, künstlerische Galoppentwickelung, Erotomanieen aller Art, Snobismen auf verschiedenen Gebieten (selbst der Religion), Neigung zur Allüre und allem Äußerlichen. Dies alles wie in einem kochenden Nudeltopfe: ein ewiges Auf- und Nieder- und Durcheinanderwallen: eine Zeit ohne Helden und ohne Stil, aber mit heftig bewegter Tendenz danach.
Insofern erscheint eine Hauptfigur mit Zügen ausgestattet,[9] die nicht bloß individuell gedacht sind: Der Erbe, der nicht zu erwerben weiß, um zu besitzen. Indessen ist er doch nicht wesentlich als Typus angelegt, wenngleich gewisse Besonderheiten an ihm (so sein ›antisemitisches‹ Halbjudentum, das Zufallhafte seines Reichtums und damit sein Mangel an Tradition) nicht ohne eine Art symbolisch allgemeiner Bedeutung sind. Denn neben der satirischen Absicht leitete mich das Interesse an gewissen psychologischen Problemen und, natürlich, die Lust am fabulierenden Gestalten.
Darüber aber ist nun wohl vom Verfasser nichts zu sagen. Erscheint das psychologische Problem, erscheinen die einzelnen Gestalten nicht mit aller Deutlichkeit, und entbehrt die (übrigens erfundene, nur in einzelnen Voraussetzungen der Anlage modifiziert dem Leben entnommene) Fabel der Geschichte des Reizes überzeugender Anziehungskraft, so hilft kein Kommentar und Wegweiser des Autors über den Umstand weg, daß sein Werk verfehlt ist. –
Im ersten Hefte des dritten Bandes ›Aus Kunst und Altertum‹ finden sich hintereinander zwei Axiome Goethes, die auf meinen Roman im allgemeinen wie im besonderen passen:
›Der Roman ist eine subjektive Epopöe, in welcher der Verfasser sich die Erlaubnis ausbittet, die Welt nach seiner Weise zu behandeln. Es fragt sich also nur, ob er eine Weise habe; das andere wird sich schon finden.‹ Und:
›Es gibt problematische Naturen, die keiner Lage gewachsen sind, in der sie sich befinden, und denen keine genug tut. Daraus entsteht der ungeheure Widerstreit, der das Leben ohne Genuß verzehrt.‹
Auf die Frage, ob ich eine Weise habe, kann nur der Roman selbst antworten; auf die, ob sie den anderen gefällt, nur die anderen; und schließlich auf die, ob sie künstlerisch wertvoll zum Ausdruck gebracht worden ist, mag die Kritik ihre Antwort geben. Ich glaube, daß Aufbau und Gliederung meiner subjektiven Epopöe für den ästhetischen Beurteiler literarischer[10] Kunstwerke einiges Interesse haben werden. Bei aller Freiheit im einzelnen bin ich konstruktiv sehr streng zu Werke gegangen, – auch in Fällen, wo man mir am Ende nachsagen wird, daß ich mich aus reiner Lust am Fabulieren habe gehen lassen (z. B. in dem Zwischenstück aus dem XVIII. Jahrhundert im dritten Bande, das eine Art Rück- und Wiederspiegelung des Problems sein will). Die Vielfältigkeit des Stiles läßt sich, denk ich, durch die Anlage des Ganzen rechtfertigen, das ich mit einem weitläufigen Gebäudekomplex nach Art des bayrischen Nationalmuseums vergleichen möchte, das, als Ganzes eine ästhetische Einheit, im einzelnen die verschiedensten Stile aufweist (in der Architektur wie in der Inneneinrichtung). Wenn es mir wie Meister Gabriel von Seidl gelungen ist, mit verschiedenartigen Mitteln ein Gebäude aufzurichten, das dennoch als organisches Gebilde wirkt gleich alten Bauwerken, denen die Entwickelung der Zeit eine Vielfältigkeit des Stiles gegeben hat, ohne ihre konstruktive Einart zu verwischen, so glaube ich, daß der Wechsel des Duktus kein Fehler meines Romanes ist. Es geschah nicht aus Lust an stilistischer Spielerei, sondern stellte sich wie von selbst mit dem Wechsel der Szenerie, der Handlung, der Zeit innerhalb meiner Geschichte ein. Wäre sie (vergleichsweise) ein Dom, ein Palast, ein idyllisches Landhaus, so möchte das Nebeneinander von Stilen schwerer zu verteidigen sein. Sie ist aber eine Art Museum von allerhand, höflich ausgedrückt, Kuriositäten der Generation, zu der ich gehöre, und so durfte ich meiner Empfindung nach, die Geschichte der schönen Sara im Stile der Krinolinenzeit, die Erlebnisse des ›Helden‹ in der Ulrikusstraße zu Hamburg aber im Stile des Naturalismus vom Anfang der achtziger Jahre erzählen usw.
Das zweite Zitat aus Goethe, das, wenn ich nicht irre, bei dem bekannten Spielhagenschen Romane Pate gestanden hat, umschreibt das dominierende Problem im Leben meines sehr problematischen Wollüstlings aufs treffendste. Wie es mir nach[11] Beendigung der ersten beiden Bände vor Augen kam, erschrak ich beinahe, als hätte ich mich selbst auf einem Plagiat ertappt. Bei dieser Gelegenheit ist zu bemerken, daß das ›Wollüstling‹ im Titel eine ironische Nuance hat …
Nur wer des Sinnes für Nuance und Ironie entbehrt, dürfte überhaupt gut tun, sich eine weniger problematische Lektüre zu wählen, als den ›Prinzen Kuckuck‹. Damit ist gesagt, daß das Buch sich insbesondere nicht für junge Mädchen eignet, als welche fast ausnahmslos so glücklich sind, diesen gefährlichen Sinn nicht zu besitzen.
Es soll ja überdies auch unmoralisch sein und ist bereits als pornographisch denunziert worden. Demnach gibt es Leute, die Bücher mit der ausgesprochenen Absicht lesen, Anstoß zu nehmen. Es muß dies eine Art Perversität sein; geistiger Masochismus etwa. Denn, wenn ein Buch auf seinem Titel ausdrücklich bekennt, daß es vom Leben, den Taten, den Meinungen und der Höllenfahrt eines Wollüstlings handelt, so sollte ein (sozusagen) normal prüder Mensch sich hinlänglich gewarnt und abgestoßen fühlen, und er sollte sich den Stein des Anstoßes nicht geradezu ins Haus tragen. Tut er's dennoch, so wird man annehmen dürfen, daß ihm entweder das Ärgernisnehmen oder das Denunzieren vergnüglich ist. Jeder Staatsanwalt aber sollte mit Entschiedenheit erklären, daß die Organe des Staates nicht dazu da sind, derlei perversen Trieben zu dienen. Ich für mein Teil darf sagen, daß mir ebenso unerwünscht wie diese Art Leser die sind, denen das Wort Wollüstling etwa als Einladung erschienen ist. – Im übrigen glaube ich, daß mein Roman eine sehr schöne Moral hat. Sie steht bei Immanuel Kant mit diesen schönen Worten zu lesen: ›Durch die Einschränkung der Selbstliebe und Niederschlagung des Eigendünkels entsteht in uns jenes Gefühl, welches das Moralgesetz in uns bewirkt.‹«
Es kam Bierbaum bei der Niederschrift des »Prinzen Kuckuck« nicht allein darauf an, das Leben eines Menschen zu schildern;[12] sein ungleich größeres Thema war die Zeit, in der sich der Held bewegt. Seltsame Gestalten tauchen vor uns auf, seltsam und doch so lebenswahr und psychologisch echt, und alles das ergänzt sich zu einem treuen Spiegelbild des unruhigen Getriebes unserer gegenwärtigen Epoche, deren Pulsschlag hastig und unsicher, voll Leidenschaft und Erregung ist. Wer die wahren Schäden unserer Zeit kennt und sich nicht fürchtet, dieses zu bekennen, der wird den »Prinzen Kuckuck« mit noch größerer Freude begrüßen, wie einst den »Stilpe«. Denn es geht, wie Felix Salten in der »Zeit« so treffend ausgeführt hat, von der Erzählung ein solcher Sturm des Geschehens, des Erfindens aus, daß es ist, als hätte man die Begebenheiten, die Menschen und die Schicksale eines ganzen Zeitalters zusammengeschüttelt, die Stoffe von zwanzig Romanen, von dreißig Komödien und von hundertfünfzig Novellen. Der Sohn der schönen Sara schreitet durch diesen Tumult von Gestalten und Ereignissen, durch dieses Zeitalter, welches das unserige ist. Er wächst auf, wandelt sich, genießt die Welt, taumelt durch die Brandung der Epoche, überall dort, wo sie am wildesten schäumt, ist der Liebling und der Narr des Glücks, und stirbt wie eine Flamme oder wie ein Gleichnis. Im »Prinzen Kuckuck« ist so ziemlich alles aufgefangen, was heute die germanisch-slawisch-gallisch-jüdische Menschheit des modernen Europa erlebt; ginge diese Welt jetzt durch eine Sintflut spurlos unter, sie fände sich mit all ihrem sonderbaren Getier in diesem Buch aufbewahrt, wie in Noahs Arche.
Dem Roman ließ Bierbaum sehr schnell das Essaybuch »Liliencron«, die »Sonderbaren Geschichten« und die »Yankeedoodle-Fahrt« folgen. In seinem Liliencron-Buch hat Bierbaum – neben Michael Georg Conrad ohne Frage der Berufenste unter allen »Biographen« Liliencrons – die bedeutendsten seiner zahlreichen Bekenntnisschriften über den Unvergeßlichen vereinigt. Nur wenigen hat sich der Dichter des »Poggfred« und der »Adjutantenritte« so unverhohlen mitgeteilt wie ihm; zudem war[13] Bierbaum nächst dem großen Anreger und Vorkämpfer Michael Georg Conrad der erste, der die Bedeutung Liliencrons erkannte und mit glühender Begeisterung und offenem Freimut für ihn in die Schranken trat. Man versteht es und freut sich dessen, daß die Dankbarkeit den Verfasser veranlaßte, das Buch dem älteren Kameraden zuzueignen, und man braucht nur den Widmungsbrief an Michael Georg Conrad zu lesen, um den Grundakkord zu vernehmen, auf dem die Sinfonie des herrlichen Buches sich aufbaut: die Sinfonie der Schönheit und der Kraft.
Die »Sonderbaren Geschichten« erinnern uns in der Kunst der Prosa an den großen Roman, ja sie übertreffen ihn darin vielleicht insofern, als der Reichtum der Ausdrucksmittel hier in schärferer Zucht gehalten, klarer disponiert ist. Ein Stück wie »Samalio Pardulus« darf als Wortkunstwerk einen Rang beanspruchen, der oberhalb des meisten steht, was die künstlerische deutsche Belletristik hervorgebracht hat. Diese Sprache hat nicht bloß Anschaulichkeit und Wärme, sie hat auch Rhythmus und zwar, daß ich nicht mißverstanden werde: ohne sogenannte poetische Prosa zu sein. In ihr waltet die Ökonomie der Novelle, wie im »Prinzen Kuckuck« der mächtige Atem des künstlerischen Romans der Sprache das Gesetz: die künstlerische Struktur gibt. Man muß in Deutschland immer wieder auf derlei hinweisen, denn der Genuß von Kunstwerken des Wortes hängt nicht bloß vom Verständnis des Inhaltes, sondern fast noch mehr davon ab, daß der Leser seinen Sinn für die Form bilde und des Wohlgefühls teilhaftig werde, das in der Erkenntnis von Schönheiten liegt, die sich nur dem offenbaren, der das innere Ohr hat. Wir haben das erst durch Nietzsche wieder erlangt, von dem Bierbaum als Künstler viel mehr beeinflußt worden ist, als von irgendeinem Lebenden; wie denn überhaupt seine künstlerischen Nährväter hauptsächlich in der Vergangenheit zu suchen sind. So steht seine Lyrik keineswegs wesentlich unter[14] Liliencronschem Einflusse, sondern unter dem von Goethe, Claudius, Bürger. Von den Modernen hat nur der große Nietzsche stark auf ihn eingewirkt.
Das Hauptmerkmal der »Sonderbaren Geschichten« ist ihr grotesker Zug. Wenn »Die Stimme des Blutes« wie »Samalio Pardulus« eine tragische, »Der mutige Revierförster« eine satirische Groteske ist, so findet sich für jedes andere Stück – die vorliegende Auswahl bringt außer den beiden letzten Geschichten noch aus der Sammlung das launige Epos »Der heilige Mine« und die von echter Raubritterromantik getragene Erzählung »Annemargret und die drei Junggesellen« – gleichfalls als Hauptzug der der Groteske im Sinne der Alten und der Renaissance. Es sind eigentlich alles Maskenspiele; aber unter der Maske, durch die Maske leuchtet das Leben. Alle diese »Sonderbaren Geschichten«, die sich so leicht lesen, sind im Grunde gar keine so leichte Ware; nur nachdenkliche Lektüre wird ihr gerecht. Und das ist überhaupt das unterscheidende Merkmal des Bierbaum der letzten Zeit, daß er zwar seine Leichtigkeit nicht verloren hat, auf seinen Flügeln aber mehr zur Höhe trägt, als früher. Auch die Gedichte von »Maultrommel und Flöte« zeigen das. Der Wein dieser Lyrik ist schwerer geworden, ohne an Bouquet verloren zu haben. Und wenn Bierbaum auch hier noch gerne tändelt, so ist es der frohmütige Spaß eines reifen Mannes, nicht mehr jugendliches Amüsement. So stehen auch die Stücke der »Yankeedoodle-Fahrt« über der »Empfindsamen Reise im Automobil«, weil diesmal das Gepäck reicher an den Reiseeffekten ist, die zur großen Lebensreise gehören, soll sie zu der höchsten Station: Weltanschauung führen. Trotzdem, nein: eben deswegen überglänzt alle drei Bücher echter Bierbaumscher Humor. Nur muß man das Wort wohl etwas tiefer zu nehmen beginnen, als man es bisher tat oder tun dürfte. So ist der Humor der »Yankeedoodle-Fahrt« wenn auch nicht bitter, so doch bittersüß.[15] Aber sauer sind die Früchte von diesem Baume nie; Sonne und Leben hat sie gereift, es sind Sonnenfrüchte.
Im Frühjahr 1910 sollte außer dem Romanfresko »Die Päpstin« eine Novellensammlung »Die Schatulle des Grafen Trümmel« erscheinen, für den Herbst hatte Bierbaum die Veröffentlichung einer großen Selbstbiographie geplant. Er hat die Drucklegung dieser Werke ebensowenig erleben sollen wie das Erscheinen seiner »Reifen Früchte«, auf die er sich so gefreut hatte. Sein letztes abgeschlossenes Werk ist eine Dichtung für die Bühne; das mit Königsbrun-Schaup zusammen gearbeitete Stück führt den Titel »Fortuna. Abenteuer in 5 Akten« und wird noch in diesem Jahre zur Aufführung gelangen.
»Aus den letzten Ernten …«, so sollte es im Titel der »Reifen Früchte« heißen, dessen originelle Fassung des Dichters eigene Idee war; so war es – schon im Herbst 1909! – überlegt. Wer hätte gedacht, daß es wirklich letzte Früchte sein würden? Im Dezember vorigen Jahres warf ein chronisches Nierenleiden den Dichter auf das Krankenlager, von dem er sich, allem Sträuben zum Trotz, nicht wieder erheben sollte, obgleich sein Zustand sich vorübergehend gebessert hatte. Ein Brief, den ich am 2. Februar frühmorgens von seinen Angehörigen aus Dresden erhielt, klang sehr besorgt. Doch fielen mir allerlei Sätze aus seinen eigenen letzten Briefen ein, kraftstrotzende, von reifem Lebenssinn und unverwüstlicher Daseinsfreude getragene Gedanken. Und wie ich alle Bedenken und alle Sorge um den kranken Freund mit dem gleichen Optimismus zu verscheuchen suche, bringt der Telegraph die Trauerkunde: Otto Julius Bierbaum ist gestern abend im Alter von 44 Jahren an Herzlähmung gestorben …
Nun ist der Mund, der so lustig plaudern und so herzhaft lachen konnte, für immer verstummt, wir werden seine Stimme[16] nie mehr hören. Und wir hadern mit dem Geschick und können es nicht fassen, daß es gerade diesem Manne die Feder aus der Hand winden mußte, dem unermüdlichen Apostel der Schönheit, Freiheit und Freude. So steht sein Bild kraftvoll und edel neben dem seines Freundes Detlev, für den er immer so tapfer in die Bresche gesprungen war, getreu dem schönen Spruche, mit dem er mir, drei Tage vor seiner Erkrankung, sein herrliches Liliencron-Buch sandte:
Ja, lichterloh brannte sein Herz, wenn es galt, für etwas Hohes, Edles einzutreten, und seine Waffen waren blank und scharf. Das ist Bierbaums – wie auch Liliencrons – bleibendes Verdienst: daß er die Freude an gesunder Sinnlichkeit und Schönheit in unser graues Alltagsleben trägt, ohne Sinnlichkeit mit Plumpheit, Schönheit mit Ästheterei zu verwechseln. Die Freude, die er verkündet, macht stark und befreit und erhebt. Wie sagt doch der Seher in der »Vernarrten Prinzeß«?
Danzig, im Februar 1910.
Fritz Droop.
erblickte das Licht dieser Welt am 28. Juni 1865 zu Grüneberg in Niederschlesien als der Sohn eines eingeborenen Konditors und einer sächsischen Bergmannstochter. In der väterlichen Familie waren zwei Berufszweige erblich: Ein süßer: die Zuckerbäckerei, und ein saurer: die protestantische Theologie. Otto Julius hatte aber wohl einen besonders starken Gemütseinschlag von der mütterlichen Familie her (in der einmal, zur Zeit Napoleons ein französischer Tambour eine Gastrolle gegeben haben soll), und so fand in ihm weder die süße noch die saure Familientradition ihre Fortsetzung. Doch blieb ihm Zeit seines Lebens von Abstammung wegen ein ausgesprochener Sinn für bessere Kuchen und Edelmetalle im Blute, ohne daß er ihn indessen immer befriedigen könnte. Dieses Unvermögen kommt aber eben daher, weil er, statt das Süße oder das Saure oder sonst was Ordentliches zu lernen, sich von Jugend auf dem Laster des Versemachens und Fabulierens hingegeben hat. Was hat er davon? –: Ein immer zweifelhaftes Budget und die Ungnade des Literaturaufsehers Bartels in Sulza bei Weimar. Dieses hindert ihn aber nicht daran, mit trotziger Hartnäckigkeit weiter zu schreiben und zwar ohne alle weise Beschränkung auf ein bestimmtes[20] Fach der Dichtkunst. Nicht allein, daß er Gedichte jeder Art und Unart sowie Novellen, Romane, Operntexte, Dramen, Balletts, Reisebeschreibungen, Märchen von sich gibt; er schreibt auch noch allerhand Aufsätze über allerhand Menschen, Dinge und Ideen. Dies ist ein so grober Verstoß gegen das moderne Gesetz von der Teilung der Arbeit, daß man nicht energisch genug dagegen Front machen kann. Warum, so fragen wir mit Nachdruck, hat sich O. J. B. nicht damit begnügt, den »Lustigen Ehemann« zu verfassen? Wie klar und hold umrissen stünde dann sein Bild im Herzen der dankbaren Mitwelt. Daß er auch noch Zeitschriften gründete, mag ihm verziehen werden, weil sie (Pan und Insel) eingegangen sind, und weil es sich schließlich, Gott sei Lob und Dank, doch herausgestellt hat, daß die aufregenden Nachrichten über seine schmachvoll hohen Redaktionsgehälter nur die Phantasiegebilde einiger erfindungsreichen Köpfe waren. Auch seine längere Reise im Automobil hat ihren Stachel verloren, seitdem man weiß, daß sie nicht auf eigene Kosten unternommen worden ist. Über seine Mitschuld am Überbrettl gehen die Meinungen auseinander. Einige Passagen im »Stilpe« belasten ihn zwar schwer, aber das Programm seines Trianon-Theaters wird immer als besinnungslos rein lyrisches Entlastungsdokument angeführt werden können. Ob O. J. B. harmlos ist, muß dahin gestellt bleiben; da er es sich nicht abgewöhnen zu können scheint, über gewisse Charaktereigentümlichkeiten erbost zu werden, als da sind: Neid, Lügenhaftigkeit, Undankbarkeit, Tratsch- und Verleumdungssucht und aufgeblasener Dummstolz, so muß er doch wohl einige Bosheit im Leibe haben, und die christliche Demut, die, nicht zufrieden,[21] links geohrfeigt zu werden, auch die rechte Wange hinhält, fehlt ihm ganz und gar. Da er lieben kann, kann er auch hassen, und wie die platonische Liebe, so ist auch der platonische Haß nicht seiner Art gemäß. Es scheint, daß er einige Laster hat. Der Trunk gehört nicht dazu. Auch nicht der Geiz und die Faulheit. Aber es könnte sein, daß man Momente von Stolz, Wollüstigkeit, Rachsucht in seinem Leben fände. Item: vom Heiligen ist er entfernt. Hunde, Katzen, Blumen; Horaz, Shakespeare, Goethe; Glück, das »wohltemperierte Klavier«, Mozart, archaische Skulpturen, alte italienische Maler, moderne Impressionisten; Büttenpapier, Seide und Ceylontee liebt er sehr. Für die größten unter den modernen Dichtern gelten ihm Dostojewski und Nietzsche. – Th. Th. Heine ist ihm lieber als Max Klinger. – Alte Stile sind ihm erfreulicher als moderne. Und er ist überhaupt revidiert unmodern. Daher ist er ein Renegat des »Buchschmucks« und bereut seine Sünden auf diesem Gebiete herzlich. Was die moderne Musik angeht, so scheint es, daß sein Nervensystem ihr nicht gewachsen ist. Seine Unfähigkeit, »Farben« zu hören, ist schlechthin pathologisch und man muß es wohl pervers nennen, daß er die schönsten musikalischen Kapitel aus der psychopathia sexualis einfach nicht kapiert. Kurz: er ist unmusikalisch. Aber er besitzt eine Phonola und er freut sich dieses Automusikels täglich. Moderne Bücher liest er nicht gar viele, aber es gibt ein paar Autoren, von denen er keines ausläßt. Darunter steht in erster Linie Wedekind. Wenn er das Glück hat, einen Neuen für sich zu entdecken, so ist sein Vergnügen groß. Mit dem gleichen Vergnügen hat er entdeckt, daß er sich früher in seiner[22] Begeisterung einmal bös geirrt hat. Es ist ihm, als wäre seitdem die Luft in seinem Leben besser geworden. In alten Briefwechseln, Tagebüchern und Memoiren zu lesen ist ihm die spannendste Lektüre. Den größten Genuß auf diesem Gebiete bereiten ihm die Tagebücher Friedrichs von Gentz, den er überdies für einen der besten Prosaisten in deutscher Sprache hält. Dieses Interesse für einen Mann, der als charakterloser Sybarit bei allen deutschen Männern von Überzeugungstreue und Tugend hinlänglich verrufen, sicherlich jedoch so gut wie unbekannt ist, beweist natürlich, daß O. J. B. gleichfalls ein charakterloser Sybarit ist. Und er hat in der Tat einiges mit Friedrich v. Gentz gemeinsam. So die Passion für gutes Deutsch, die gleichzeitig auch als eine Art Sybaritismus bezeichnet werden kann. Ferner die Neigung, über seine Verhältnisse hinaus zu leben (was in mancherlei Sinne zu verstehen ist). Dann den Tic fürs Vornehme (gleichfalls in mehr als einem Betracht). Dann das Bedürfnis nach lebendiger Schönheit und lebendigem Geist, aber doch auch nach Bequemlichkeit. Weiter aber auch die Fähigkeit, stark zu arbeiten und in der Anerkennung weniger sich dafür belohnt zu fühlen.
Was ihn jedoch von Gentz unterscheidet, ist dies: Er ist durchaus kein Mensch und zieht die Einsamkeit der besten Gesellschaft bei weitem vor. Übrigens verehrt er Napoleon in demselben Grade, wie Gentz ihn verabscheut hat.
Sollte sich hier die Frage nach seinen politischen Meinungen aufrichten, so wäre die Antwort: Er würde vielleicht welche haben, wenn für ihn die Möglichkeit bestünde, sie zu betätigen. Eine Stimmzettelabgabe alle fünf Jahre hält er für keine Betätigung, und zum[23] politischen Schriftsteller fehlt ihm der Glaube an ein in Deutschland realisierbares Programm. Die Mächte, die im deutschen Reiche Politik machen, sind, oben und unten, für freie Geister unzugänglich. Nur politische Temperamente von der Vehemenz und Aufopferungsfähigkeit Maximilian Hardens können, wenn sie wie dieser sehr klug und im höchsten Sinne diplomatisch begabt sind, bei uns wirklich wirken, ohne ein Amt oder Massen für sich zu haben.
Religiös ist O. J. B. Eklektiker. Vom Judentum hat er die Psalmen, vom Protestantismus eine ziemliche Anzahl Gesangbuchslieder, vom Katholizismus die Instrumentalmusik und verschiedene Bestandteile der sakralen Garderobe, vom Buddhismus die schöne Pose des Sitzens auf einer Lotosblüte, vom Konfuzianismus das Prinzip der großen Wurstigkeit, vom Taoismus die höchstangesehene Mystik ahnungsvoller Wortverknüpfungen in seine Privatkirche übernommen, deren Hauptlehre übrigens lautet: »Halte Dir alles Gesindel vom Leibe, denn es hindert Dich, in Deinen Himmel zu kommen!«
Da ein moderner Mensch einen Sport treiben muß, so hat O. J. B. das Radfahren und Bilderknipsen erlernt. Da er aber ein unmodern moderner Mensch ist, radelt er in einem Tempo, das jeden Kinderwagen zum Vorfahren herausfordert, und er geht beim Photographieren allen poetischen Stimmungseffekten entschlossen aus dem Wege. Übrigens hat es bisher nur seine Frau zu bestreiten gewagt, daß er ein brillanter Radfahrer und absolut sicherer Photograph ist. Natürlich sammelt O. J. B. auch. Aber es ist nicht weit her mit seinen Sammlungen, denn es machen ihm nur die Dinge wirklich Spaß, die er billig erworben zu[24] haben glaubt, und dabei hat er sich fast ausschließlich auf Sammelgebiete kapriziert, wo billig schon etwas zu haben ist. Weder alte Bücher, noch alte Buntpapiere, noch alte Bilder, Kupferstiche, Möbel, Gläser, Fayencen, Porzellane sind in diesen abscheulichen Zeiten, wo jeder Antiquar ein Gelehrter ist, billig zu erstehen, – von alten China- und Japansachen, sowie alten Stoffen ganz zu schweigen. Nur mit alten Büttenpapieren ist ihm hier und da ein Coup gelungen. Aber da er roh genug ist, die edelsten alten Erzeugnisse längst vermachter Bütten zu Manuskripten zu benutzen, kann auch von einer ordentlichen Büttenpapiersammlung nicht die Rede sein.
O. J. B. war merkwürdig lange jung. Ein Kindskopf ist er bis in die Mitte seiner dreißiger Jahre geblieben. Da kam der Ernst, – und er wurde frech, obwohl er erst noch eine etwas düstere, dumpfe Zeit durchzumachen hatte. Augenblicklich ist er damit beschäftigt, den letzten Rest von Widerspruch, der ihm aus jener Zeit in der Seele geblieben ist, auszutreiben. Da er einen Menschen zur Seite hat, der sorglich gewillt und stark ist, ihm dabei zu helfen, wird es wohl gelingen. Schon jetzt fühlt er sich stärker denn je.
In einer Anwandlung von literarhistorischer Systematik hat er seine bisherige Entwickelung einmal schematisiert und drei Perioden festgestellt. Die erste nannte er »Stilpe im Irrgarten der Liebe« und datierte sie von 1885–1900. Er hätte sie auch »Kindskopf« nennen können. Sie ist im Grunde rein lyrisch, aber neben ein paar Gedichten ragt aus ihr der »Stilpe« auf. Die zweite nannte er »Stella und Antonie« und setzte sie von 1900–1905 an. Es ist seine dumpfe Zeit. Mit dem »Prinzen Kuckuck« ließ[25] er eine dritte beginnen und er nannte sie »Grotesken«; sie nimmt sich bis jetzt etwas bunt aus. Aber es scheint, daß er ihr keine lange Dauer zutraut. »Wo wollen Sie denn eigentlich hin?« sagte der Storch zum Schmetterling, der von Blume zu Blume flog. »Fragen Sie die Blumen, Herr Professor!« antwortete der Falter; »aber eines kann ich Ihnen schon sagen: nicht in Ihren Schnabel, gefährlicher Philister, der Sie sind.«

1 Kapitel 1 und 2 des gleichnamigen Abschnittes aus »Yankeedoodle-Fahrt und andere Reisegeschichten«.
Vom Nervenseiltanzen und Tunnelfahren, vom schwimmenden Hotel und dem Geflügelhofe, von Lyrik, Meer und Himmel.
Als ich so außer mir geraten war, daß ich mich selbst mit fatalster Deutlichkeit betrachten konnte, fühlte ich das Bedürfnis, wieder zu mir selber zu kommen. Aber es ist schwer, in sein Ich zurückzukriechen, wenn man es einmal verlassen und dann allzuscharf von außen angesehen hat. Ich fuhr um mich herum wie eine vergiftete Maus, die ihr Loch nicht findet und dennoch immerzu dies Loch umkreist. Ein schauderhaftes Heimweh und ein Grauen vor der Rückkehr zugleich. Selbst meinen verehrtesten Feinden wünsche ich diese Sensation nicht, obwohl es mir nicht zweifelhaft ist, daß sie, deren Oberflächlichkeit mir in der Tat manchmal Übelkeit verursacht hat, ein bißchen Seelenqual zu ihrer Vertiefung wohl brauchen könnten.
Da sprach ein weiser Arzt und Seelenkenner also auf mich ein: Sie gehören zu jenen Akrobaten, die auf ihren eigenen Nerven seiltanzen und dadurch gezwungen sind, immerfort einen Punkt im Auge zu behalten, der in ihnen selber liegt: nämlich im eigenen[28] Gehirne. Das tut weder den Nerven noch dem Gehirne gut und ist überdies eine brotlose und lebensgefährliche Kunst. Wenn Sie nicht binnen kurzem augenscheinlich verrückt werden wollen (denn eine heimliche Verrücktheit ist Ihr Zustand bereits), so ist es nötig, daß Sie unverzüglich eine breitere Basis zu gewinnen suchen, um von ihr aus Ihre Blicke in einem möglichst weiten Gesichtskreis umherschweifen zu lassen. Sie sind außer sich, weil Sie so sehr in sich sind. Das vertragen nur Heilige und Sie würden sich einem verhängnisvollen Irrtum hingeben, wenn Sie meinen wollten, daß Sie zur Heiligkeit angelegt wären. Dazu sind Sie zu korpulent und libidinos, – wohl auch nicht unbescheiden genug. Leute Ihrer Konstitution sind darauf angewiesen, die Welt auf sich wirken zu lassen. Ihre Empfindlichkeit sträubt sich dagegen, und es ist gewiß, daß Sie unter den nicht immer zarten Fingern der Welt leiden, aber dieses Leiden ist immer noch heilsamer für Sie, als die selbst bereiteten Schmerzen der Heautontimorumenie. Ich rate Ihnen: Kaufen Sie sich einen Schiffskoffer und stellen Sie Amphitriten auf die Probe. Ihre Zukunft liegt auf dem Wasser, das Salzgehalt und im Salze Brom hat. Speien Sie sich einmal kräftig aus und trinken Sie so viel Sonnenlicht als möglich. Aber, ich beschwöre Sie, lassen Sie alles Schreibgeräte zu Hause, denn, unter uns gesagt, der Federhalter ist die gefährliche Balancierstange, mit der Sie sich bisher auf dem Nervenseile im Gleichgewicht erhalten haben.
Ich honorierte diese Invektionen mit zwanzig Franken und einem müden Lächeln, nahm den breitbeinigen Gang eines alten Seekapitäns an und versetzte[29] meine ahnungslose Frau in das äußerste Erstaunen durch Intonierung des Liedes:
Ihre Bemerkung, daß der Kompaß keine Flinte sei, die man spannen könnte, wies ich mit der Entgegnung zurück, daß nautische Details uns bald mehr als genug beschäftigen würden, einstweilen aber Wichtigeres zu erledigen sei: nämlich die Frage, ob man auf eine moderne Seereise einen Frack oder bloß einen Smoking mitnehmen müsse.
Klug und vorsorglich, wie sie ist, entschied sie sich für beides, ja sie wollte sogar, daß ich auch einen Zylinderhut mitnähme. »Wahnwitzige Idee!« grollte ich; »dir fehlt jedes Stilgefühl. Eine schottische Mütze oder ein Dreimaster, – ja; niemals eine Tube!«
Am entsprechenden Orte wird es sich zeigen, wer von uns beiden auf der Höhe der Situation gewesen ist.
Da es uns vollkommen gleichgültig war, wohin wir reisen würden (denn ich hatte ja lediglich das Gebot erhalten, eine Seereise »an sich« zu machen), überließen wir es einem Freunde, Schiff und Ziel zu bestimmen. Er sandte uns eine Kabinenkarte für den Doppelschraubendampfer Yankeedoodle, den die berühmte Onkel Sam-Michel-Linie eben zu einer Orientreise in Genua bereithielt. Ein beigeschlossenes Druckheft schilderte die ganze Reise in äußerst lebendigen Farben, so daß mir sofort ganz orientalisch zumute wurde, als ich las, was alles uns bevorstand.
»Kein Zweifel,« sagte ich zu meiner Frau, »es wird äußerst lehrreich werden. Schade nur, daß wir uns nicht länger auf die Reise freuen dürfen, denn[30] das ist doch das Schönste am Reisen: sich vorher darauf zu freuen.«
Aber es half nun nichts: kaum, daß die Koffer gepackt waren, mußten wir uns in den Dampfwagen setzen, der uns nach Genua transportierte. Meine Idiosynkrasie gegen das Eisenbahnreisen gestaltete diese Fahrt zu einer via crucis, an die ich nur mit Grauen denken kann. Kein Zweifel: ich bin ein arger Sünder, aber so viele Todsünden habe ich denn doch nicht begangen, daß ich die Höllenqualen verdient hätte, die mir in den endlosen Tunnels an der Riviera zuteil wurden, wo rechts und links des Gleises offenbar teuflische Dämonen aufgestellt waren, die, während ich in stinkendem Qualm fast erstickte, mit eisernen Hämmern gegen eiserne Wände zu schlagen schienen. Nun: wir sind nicht zum Vergnügen auf der Welt, und es ist gewiß in der Ordnung, daß Nerven, die für angenehme Sensationen besonders empfindlich sind, dafür um so heftiger unter unangenehmen leiden. Sela.
Das Gedröhne einer Kesselschmiede in den Ohren, die Lungen voller Ruß und im Schädel ein Gefühl, als seien sämtliche Gehirnwindungen mit flüssigem Blei angefüllt, begab ich mich mit meiner Frau in das berühmte Theater Carlo Felice, aber beileibe nicht, um uns Tristano e Isotta italienisch vorspielen zu lassen, sondern von wegen der exzellenten Küche seines Restaurants. Doch wurde uns auch hier ein außerordentliches Schauspiel zuteil: wir sahen einen jener italienischen Eßkünstler, die den illustren Fressern der Antike nichts nachgeben. Was dieser überlebensgroße Bauch sich alles servieren ließ, und mit welch andächtigem Kennerentzücken er seine Füllung zu einer Art gottesdienstlichen Handlung erhob, läßt sich in Kürze[31] und auf Deutsch nicht schildern. Es muß genügen, zu sagen, daß es ein klassisches Schauspiel war, würdig, von einem Petronius der Nachwelt überantwortet zu werden. Denn es läßt sich von derart großen Gegenständen wohl nur in monumentaler Latinität handeln.
Als ich am nächsten Morgen den Yankeedoodle vor mir liegen sah, wie er unabsehbare Massen von Koffern und Menschen in sich aufnahm, mußte ich an den gewaltigen Speisevertilger denken, und so erübrigt es sich, zu bemerken, daß Yankeedoodle ein imposantes Schiff ist.
Wir wurden tief unten in seinem Innern verstaut und fühlten uns sehr winzig. Dafür erfüllte uns aber sogleich eine sehr gewisse Zuversicht zu dem massigen Zweischlöter. »Ich glaube kaum, daß wir mit dem Yankeedoodle untergehen werden,« sagte ich zu meiner Frau; »ja selbst meine Hoffnung auf ausgiebige Seekrankheit ist bereits ins Wanken geraten.«
»Und mir ist schon übel,« entgegnete sie.
Dabei stand das Schiff fest wie ein Turm.
Weshalb ich sagte: »Autosuggestion gilt nicht, und wenn du mit Gewalt seekrank wirst, um später damit zu renommieren, so kannst du sicher sein, daß ich deine Finten aufdecken werde.«
In diesem Augenblicke brüllte Yankeedoodle auf eine Weise, daß mir Hören und Sehen verging. Dreimal. Wie nie ein Mastodont gebrüllt hat. Homer hätte das hören sollen, und er hätte kein solches Wesen vom Gebrüll seiner verwundeten Helden gemacht.
»Was hat er denn?« fragte ich entsetzt.
»Er sagt Adieu,« erklärte meine Frau ruhig, die von nun an überhaupt gerne so tat, als wüßte sie alles.
Und es war wirklich so. Immer, wenn Yankeedoodle sich anschickte, in See zu stechen (ein Ausdruck, der aber für solche Kolosse gar nicht paßt; ebensogut könnte man sagen, ein Dampfhammer sticht ins Erz), brüllte er so unmanierlich. Es gehört das zum guten Ton bei diesen Dampfgiganten. Ob es einen Zweck hat, weiß ich nicht. Vielleicht heißt es nicht bloß: adieu, sondern auch: Platz da! Hühneraugen weg!
Und richtig: wir fuhren. Doch muß ich wohl besser sagen: wir glitten dahin. So leise, sanft, unmerklich, daß ich fürs erste jede Hoffnung auf das große Speien aufgab, während meine Frau mit weiblicher Beharrlichkeit beteuerte, nun werde ihr aber schon sehr übel.
Da sie offenbar nur höchst ungern von diesem Wahne lassen wollte, bestärkte ich sie in der Überzeugung, seekrank zu sein, indem ich ihr erklärte, sie sähe grasgrün aus und tue mir furchtbar leid.
Worauf es ihr sehr bald besser wurde.
Eine kleine Weile noch, und sie teilte meine Empfindung, daß Yankeedoodle, weit davon entfernt, ein Schiff zu sein, wie wir es uns gedacht hatten, einfach ein Hotel war, das sich auf Salzwasser bewegte. Statt Matrosen zu sehen, die an Tauen herumklettern, und Kommandorufe zu vernehmen von Offizieren, die Sprachrohre am Munde und Fernrohre vor den Augen hatten, erblickten wir Kellner, die da höflich leise säuselten: Bouillon gefällig? Doch lernten wir bald, sie Stewards zu nennen, was immerhin eine gewisse Seestimmung erzeugte.
Dennoch blieb eine deutliche Enttäuschung in uns zurück. Unser romantisches Bedürfnis wollte nicht auf seine Rechnung kommen. Wir hatten uns das[33] alles viel abenteuerlicher vorgestellt. Wenn wenigstens ein Mastkorb dagewesen wäre, in dem sich ein Matrose befunden hätte, der Ahoi! rief …
Statt dessen sagte ein Herr, der zwar eine Art Seemannsmütze aufhatte, aber den Gymnasialprofessor durchaus nicht verleugnen konnte, laut und vernehmlich: Thalatta! Thalatta!
Mein Magen drehte sich um und ich mich mit ihm.
O Ägir, Herr der Fluten, stöhnte ich in meinem lieben Herzen, sorge dafür, daß ich diesem Humanisten nirgendwo benachbart werde in diesem schwimmenden Hotel!
Und ich fühlte, daß es jetzt vor allem nötig war, einen Platz auf dem Yankeedoodle ausfindig zu machen, wohin wir uns vor den übrigen Hotelgästen flüchten könnten, falls diese irgendwie nicht nach unserem Geschmack sein sollten.
Alle diese Herrschaften, sagten wir uns, sind gewiß durch Qualitäten ausgezeichnet, die uns fehlen, und wir wollen ohne weiteres annehmen, daß sie nicht bloß einer höheren Steuerklasse angehören als wir, sondern auch in jeder anderen bürgerlichen Hinsicht den Vorzug vor uns verdienen. Aber wir sind nun mal Uhunaturen, die in den Geflügelhof nicht passen. Zärtlich girrende Tauben, gluckende Hennen, majestätische Hähne sind kein Umgang für uns, geschweige denn diese stolzen Pfauen und Perlhühner aus Amerika, die sich, das merkten wir bald, als die Elite des Yankeedoodle betrachteten und von den Funktionären der O. S.-M.-L. auch als solche ästimiert wurden, da sie die besten Käfige innehatten. Alles das, gaben wir gerne zu, ist ganz in der Ordnung, aber diese Ordnung ist nicht die unsere. Suchen wir also einen[34] Winkel aus, wo wir das prächtige Gesamtbild am wenigsten stören.
Wir fanden es auf dem Hinterdeck, das von allen besseren Passagieren streng gemieden wurde, weil es bei den gewöhnlichen Fahrten des Yankeedoodle, die nicht dem Vergnügen, sondern der Überfahrt nach Amerika dienen, als das Deck der zweiten Kajüte gilt. Für uns besaß es außer dem Vorzug, wenig besucht zu sein, auch noch den, zwei Etagen zu haben. Die obere war die schönste, denn auf ihr befand man sich wirklich en plein air. Hier verbarg uns kein vorgespanntes Segeltuch Meer und Himmel, wie sonst überall auf diesem Schiffe, dessen Einrichtungen mehr darauf berechnet zu sein schienen, das Meer vergessen, als sehen zu lassen. Die begehrtesten Plätze des Hauptdecks (zumeist von Amerikanern besetzt), nämlich die an den Innenseiten, gewährten den dort in ihren Klappstühlen Ausgestreckten die Aussicht auf den Streifen Himmel, der zwischen dem Dach und der Segeltuchwand des Decks sichtbar bleibt. Weder Meer noch Küste war von dort aus zu sehen. Die Außenseiten des Hauptdecks sahen aber nicht einmal diesen Streifen Himmel, sondern nur die Kajütenwand, garniert mit horizontal gelagerten Amerikanern.
Es wollte uns anfangs nicht in den Sinn, wie gerade diese Plätze so sehr begehrt sein konnten, die eigentlich nichts anderes waren als Einzelglieder im Spalier einer Promenade; denn zwischen ihnen war der allgemeine Wandelgang. Wir mußten erst begreifen lernen, was wir Uhus nicht ohne weiteres wissen: daß das Publikum auch auf Reisen sich vor allem anderen für das Publikum interessiert. Die Menschen lieben einander zwar nur in einem sehr[35] gemäßigten Grade, aber sie sind sich gegenseitig äußerst interessant, und so leben sie gerne in Gesellschaft, sei es auch nur, um sich innerhalb deren wieder in Extragesellschaften abzuspalten. Je länger wir das Wesen auf unserem Schiffe betrachteten, um so mehr spürten wir, daß viele geradezu deshalb den Yankeedoodle bestiegen hatten, um nach der vielleicht monoton gewordenen Gesellschaft zu Hause hier eine neue zu finden. Und wir merkten schließlich, obwohl wir immer nur aus der Ferne in dieses lebendige Netz von Gesellschaftsfäden blickten, daß nicht bloß die Spinne Sympathie dabei am Werke war, sondern auch mancherlei Berechnung, – nicht zu vergessen die mehr oder weniger schönen Damen Eitelkeit und Medisance.
Ich kann nicht leugnen, daß, von der Ferne angesehen, dieses große Gesellschaftsspiel einen gewissen Reiz für mich hatte, da ich nur selten dazu komme, derlei zu beobachten. Einen reineren Genuß bereitete mir aber doch der Anblick des hohen Himmels und der weiten Wasserfläche, obgleich ich gestehen muß, daß eigentlich poetische Stimmungen ausblieben. Der Anblick war schön, – aber nur Genuß, nicht Erregung. Mein Auge ließ sich's wohl sein, und mein »Herz« quittierte mit Dank darüber, – aber kühl, eigentlich unbeteiligt. Ich habe es ein paarmal gescholten deswegen und bin mir selber sehr gram gewesen darum. Bist du das noch, habe ich mir gesagt, der vor Zeiten sich bis zur wonnigsten Verrücktheit entzücken konnte vor einem Tümpel, auf dem ein paar Spritzer Sonnenuntergang kringelten? Dem ein schüchternes, dummes kleines Ding wie eine junge Birke Seligkeiten ins Herz schüttete, der vor einem Quellchen in die Knie[36] sinken konnte, Verse zu stammeln, dessen Blicke verzückt an Wolken hingen und mit ihnen hinüberschwammen zu den goldberänderten Himmelsküsten einer nicht bloß äußerlich gesehenen, sondern innig umfaßten Schönheit, – das ist derselbe, der sich hier, in einem Stuhle der Ocean-Comfort-Company liegend, Lichteffekte servieren läßt, wie kurz vorher Tee mit Streuselkuchen? Ei du satter, fauler, leerer Halunke du, mach daß du hinunterkommst auf das Promenadendeck und sieh, wenn die Sonne untergeht, nach der Uhr, ob es auch pünktlich geschehen ist! Laß dich von dem Gymnasiallehrer auf Ägypten, Kleinasien, Griechenland vorbereiten; du hast es nötig, denn wer nicht mehr fühlen kann, soll wenigstens wissen. Und wenn du auch dazu zu faul bist, so zeige den jungen Töchtern Germanias, die, halb Misses, halb Gretchen, die moderne Weiblichkeit des zahlungsfähigen Deutschland mit mehr Selbstbewußtsein als Geschmack vertreten, daß auch du tennis-englisch und über »Frühlings Erwachen« reden kannst. Da du nüchtern geworden bist, ist dein Platz bei den Nüchternen. Vielleicht sagen sie dir etwas, da die großen Dinge dir stumm geworden sind. So schimpfte ich mich. Aber mit Unrecht. Denn es war nicht so, wie ich mir sagte. Meer und Himmel waren mir nicht stumm. Ich verstand ihre Sprache nicht so schnell, wie früher die von Busch, Baum, Quelle, Wolken. Und dies ist nicht verwunderlich. Jene Dinge, die den jungen lyrischen Menschen so schnell ins Gespräch zogen, sprachen seine Sprache, die Sprache der schnellen Gefühle, naiver Lust, einfältiger Triebe. Er hörte und sah in allem nur sich. Wenn er niederkniete und ins Plappern der Quelle Verse rief, so kniete er vor[37] sich selber und überschrie das murmelnde Element. Er war (Heil ihm, daß er's gewesen) frech beim Frohsinn, und so hatte er's wohl leicht, zu schwärmen. (Lyrik! Eine selbstverständliche Sache für junge Menschen, denn es ist ihr Aus- und Einatmen. – In dieser Parenthese wäre noch allerhand zu bemerken. So dies, daß die große Seltenheit wirklicher Lyriker damit nicht im Widerspruche steht. Es gibt nämlich nur sehr wenige junge Menschen in dem Alter, wo zum Gefühle künstlerisches Vermögen tritt. Was Goethe das Närrische am Lyrischen nennt, ist das Kindliche. Die beiden reinsten Lyriker unter den heutigen Deutschen: Martin Greif und Max Dauthendey, sind Kindsköpfe. Auch Ludwig Finckh hat Anlage dazu. Rilke dagegen, dieses unheimliche Genietalent, ist ein Wunderkind. Übrigens liegt beim reinen Lyriker die Gefahr nahe, aus dem Kindlichen ins Kindische zu verfallen, sich auszuleiern. Aber wo komme ich hin!) Das schlechthin Große dagegen, Meer und Himmel, monoton erhaben (mit Worten aus der Terminologie menschlicher Kunst zu reden: Monumentalnatur) – das duckt die Frechheit. Seine Sprache ist Gedröhn und Brausen: Vokabeln fehlen in dieser Musik voll rhythmischer Symbole. Das Herz, das hier nur stummen Dank hat, verdient keine Schmähung, und der Mann, der vor diesem Schauspiel Auge wird, ganz Auge: und klares, nicht trunkenes, mag sich der Zuversicht getrösten, daß dieser ruhige Genuß ruhig des Reichsten, das dem Menschen an äußeren Eindrücken zuteil werden kann, nicht bloß der Netzhaut zugute kommt, sondern zu einem inneren Schatze wird, auch wenn er sich nicht gerade kleinweis in lyrische Silberstücke ausmünzen läßt.
Von meinem schlechten Charakter und der Absicht, ihn zu bewähren; von meinem Lordshut und Madames Patriotismus; vom Mauldeutschtum und dem deklassierten Ölbaum; von der Tugend und ihrer mangelhaften Belohnung; vom Genie der Pariser Putzmamsells und der bedauerlichen Unfähigkeit deutscher Dichter sie zu fördern; von grünen Tischen, Théodore und der Rache auf Ansichtspostkarten.
Wer auch nur oberflächlich mit der modernen deutschen Literaturgeschichte bekannt ist, weiß, daß ich von schmutzigster Geldgier besessen bin. Im übrigen schwankt mein Charakterbild ja bedenklich: denn, während die einen sagen, daß ich zwar ein ganz passabler Lyriker sei, aber leider auch Romane schreibe, so finden andere, daß ich zwar im Romane gewisse Qualitäten an den Tag gelegt, bedauerlicherweise aber den üblen Ehrgeiz hätte, auch Verse machen zu wollen; und so durch alle übrigen Gattungen der belles lettres durch, mit denen ich mich, immer einigen zum Vergnügen, anderen aber zur Mißlust, abgegeben habe und immerzu weiter noch abgebe. Das einzige, was feststeht, ist, wie ich mich nun hinlänglich überzeugt habe, die felsenfeste Gewißheit, daß ich ein hervorragendes Talent besitze, Schätze zu sammeln. So werde ich als ein zweiter Midas in die holzpapierene Unsterblichkeit eingehen und bin schon jetzt, wie mein phrygisches Urbild, durch Eselsohren entstellt – wobei es dahingestellt bleibt, ob es lauter Apollos sind, die mir zu diesem Schmucke verholfen haben.
Kein Wunder, daß ich manchmal Lust habe, diesem Zustande ein Ende zu machen, der immerhin etwas[39] Peinliches hat. Nichts trägt sich so lästig, wie der Ruf von Talenten und Reichtümern, die man nicht besitzt. Und dann: man kommt sich, auch wenn man ihn nicht verbreitet hat, wie ein Schwindler vor.
Also möchte ich ihn furchtbar gerne wahrmachen.
Und so beschloß ich, in Monte Carlo hundert Franken zu setzen, um zehntausend zu gewinnen.
»Nimm deinen großen Pompadour mit,« sagte ich zu meiner Frau, als der Yankeedoodle sich Villafranca näherte; »wir werden ihn nötig haben.«
»Du willst also wirklich spielen!?« rief sie voller Entsetzen aus.
»Ja!!« sagte ich mit zwei Ausrufezeichen.
Und ich tat mein schönes Gewand an und setzte den großen grauen Lordshut auf, den ich in Deutschland nicht zu tragen wage, weil er eine Art Nabel hat, nämlich einen Filzknopf zur Kaschierung der Ventilöffnung. Denn es ist ein Hut, den die englischen Lords in Indien tragen, wo es sehr heiß ist.
Auch meine Frau putzte sich so stattlich heraus, wie es dem Umstande angemessen erscheinen mußte, daß wir uns in den wabernden Dunstkreis rollenden Reichtums begeben wollten.
Da hier das »Reisebureau« noch keine Macht über uns hatte (denn den Weg zum Spieltische würden wir, so meinte es nicht ohne psychologischen Scharfsinn, schon selber finden), durften wir, o Glück und Wonne, o Seligkeit, allein gehen. Die Prozedur der Ausbootung, vor der meine Frau auf recht anmutige Art Angst an den Tag legte, während ich nicht ganz so graziös den erfahrenen Gangwaykletterer spielte, vollzog sich ohne jede Fährlichkeit, obwohl ich, zu meinem nur mühsam verhehlten Mißvergnügen, gezwungen[40] war, mit der Linken den zwar schönen, aber nicht ganz festsitzenden Lordshut zu halten, da ich doch die entschiedene Tendenz hatte, mit ihr Halt am Treppengeländer zu suchen. Aber es ging auch so, und ehe wir's uns versahen, befanden wir uns alle drei: die Frau, der Hut und ich, im Boot. Nervige Arme ruderten uns an die französische Küste. (Das muß ich einmal in einem Romane gelesen haben.) Da diese von Rechts wegen eine italienische Küste sein sollte, regte sich in meiner Frau die Patriotin, und sie hätte gar zu gerne gehört, daß sich der Mann mit den nervigen Armen zur Italia irredenta bekannt und Verwünschungen gegen die Franzmänner ausgestoßen hätte. Aber es fiel ihm gar nicht ein, Gefühle dieser Art grün-weiß-rot aufleuchten zu lassen, vielmehr sagte er, und noch dazu in einem stark französisch unterwachsenen Italienisch, sie in Villefranche (!) seien allzumal höchlich zufrieden mit der Pariser Republik, denn der gallische Hahn füttere die Seinen besser als der savoyische Adler.
»Vergogna!« meinte die Toskanerin, gab ihm aber doch eine gute Mancia, wenn auch demonstrativerweise in italienischer Münze. Worauf der Nervige dann endlich Evviva Italia! rief.
Nach den mächtigen Befestigungen zu urteilen, mit denen die Franzosen den Hafen von Villafranca (das aber nur die Bücher so nennen; die Leute sagen alle Villefranche) umgürtet haben, gedenken sie, dieses schöne Stück Land gewiß nicht freiwillig wieder herzugeben. Auch liegt eine Menge Kriegsvolk dort in Garnison; Alpenjäger, sehr gut aussehende und malerisch uniformierte Leute. Indessen fand die etwas kordial demokratische Art, mit der sie ihre Vorgesetzten grüßen,[41] durchaus nicht den Beifall zweier unserer Reisegenossen, die, wohl in der Meinung, daß kein Mensch in Frankreich deutsch versteht, recht laut und ungeniert Kritik daran übten, wobei der Ausdruck »schlappe Bande« noch der mildeste war. Mir kam das weder sehr klug vor, noch fand ich es hübsch, habe aber auch im weiteren Verlaufe unserer Reise noch recht oft die Beobachtung machen müssen, daß unsere Landsleute sich gerne darin gefallen, fremde Sitten, Gewohnheiten, Einrichtungen unter dem Gesichtswinkel des in Deutschland Üblichen zu beurteilen, zuweilen direkt mit dem Schlußtrumpf: hier sollten wir Ordnung schaffen dürfen! Ob Geibel das gemeint hat, als er ausrief »Und es mag am deutschen Wesen einmal noch die Welt genesen«, scheint mir fraglich, während ich der sehr bestimmten Überzeugung bin, daß dieses Wesensmachen vom deutschen Wesen sehr dazu angetan ist, das deutsche Wesen in Mißkredit zu bringen.
Schade nur, daß der schöne Weltverstand, der bisher die Deutschen auszeichnete, verloren gehen muß, wenn dieses Mauldeutschtum, das nachgerade zum Großmauldeutschtum zu werden droht, um sich greift. Ich habe auf dieser Reise nicht viele Deutsche getroffen, auf die das Wort Goethes hätte angewendet werden dürfen, das sonst vom deutschen Geiste gelten durfte: »Der ist nicht fremd, der teilzunehmen weiß.« Und so habe ich mich manchmal gefragt: Warum reisen diese Leute eigentlich? Nur um sich einzuprägen, daß es eigentlich ein Unsinn, zu reisen, da es ja doch in Deutschland am schönsten ist? Insofern, als der Deutsche sich auf die Dauer am wohlsten in Deutschland befinden mag, wie jeder andere Mensch in seinem Vaterlande, ist das gewiß richtig. Aber, zu reisen,[42] bloß um das bestätigt zu sehen: welch eine sonderbare Sinnesverkehrung ist das doch! Man geht freilich nicht in die Fremde, um sich der Heimat zu entfremden, aber einen vernünftigen Sinn hat das Reisen doch nur insofern, als es von der Sehnsucht eingegeben ist, zu dem heimisch Schönen sich etwas fremd Schönes einzuverleiben, innerlich reicher zu werden aus den Schäden der Fremde, indem man an ihnen teilnimmt. Dies scheint aber vielen direkt unmöglich zu sein. Sie sehen z. B. (ich konstruiere hier nicht, sondern gebe wieder, was ich mit eigenen Ohren gehört habe) einen Ölbaum. »Gott, was für ein häßliches Ding ist das!« sagen sie, »da ist doch eine richtige deutsche Eiche was anderes!« Man müßte närrisch sein, wenn man das bestreiten oder sich durch einen Ölbaum den Geschmack an einer Eiche verderben lassen wollte, aber nicht weniger närrisch ist es auch (von dem damit bewiesenen Mangel an Schönheitsempfinden gar nicht zu reden), im fernen Syrierlande die deutsche Eiche heraufzubeschwören, um den Eindruck eines Ölbaumes zu deklassieren. Es wäre davon, als von etwas schlechthin Törichtem gar nicht der Rede wert, wenn sich nicht eben eine Art von perversem Nationalismus darin äußerte, ein häßlicher Geist der Selbstzufriedenheit und Ablehnung alles Fremden, das nur noch als kurios, nicht aber als schön anerkannt wird. Diese Art Negation hat etwas Freches, das ganz unleidlich gerade für den ist, der sein deutsches Wesen als Bejahung jeder Schönheit empfindet. Auch ist es gottsträflich dumm, mit also verkleisterten Sinnen auf Reisen zu gehen.
Ein Rosselenker rief uns an, fragend, ob er uns für zwanzig Franken zweispännig nach Monaco[43] befördern dürfte. Mein Lordshut und Madames Spitzenmantel hatten es ihm angetan. Aber es lag uns wahrhaftig ferne, unserm Spielfonds zwanzig Franken zu entziehen. Wir blieben, wie hold er auch lächelte, fest und warteten auf die elektrische Trambahn.
Diese Charakterstärke hätte einen besseren Lohn verdient als den, der uns zuteil wurde. Wir mußten fast eine Stunde harren, bis ein Wagen kam, in dem es noch zwei freie Plätze gab, und zwar Stehplätze. Ich erwähne dies als Beitrag zur Morallehre. Nein, o ihr gutgläubigen Schwärmer, es ist nicht wahr, daß Tugend belohnt wird. Das lüsterne Fleisch fährt zweispännig, und der stoische Wille muß sich von knoblauchduftigen Nizzarden auf den Hühneraugen herumtreten lassen. Aber das ist richtig: hinterher ist die Genugtuung der Tugend groß, die achtzehn Franken für den Spieltisch gespart hat.
Von der Pracht und Herrlichkeit des Kasinoplatzes auf Monte Carlo möge ein anderer handeln. Ich für meinen Teil finde ihn allzu prächtig und allzu herrlich. Mir fehlt der Sinn für Pompositäten ohne lebendigen Geschmack. Dagegen habe ich mit Signora recht andächtig und entzückt die Auslagen einiger Pariser Putzmachergeschäfte bewundert. Beim Andenken der verliebten kleinen Müsette! – meine Frau hat recht: diese Pariser »Schurkerinnen« (so heißt in toscano-tedesco das Femininum von Schurke) haben mehr als Talent, haben Genie. Aus ein bißchen Sammet oder Seide, Spitzen oder Tüll, Stroh oder Pelz, mit ein paar Blumen, Schleifen, Rüschen, Federn wirken sie ästhetische Wunder. Diese Hüte haben den Reiz von Improvisationen geistreich geschmackvoller Menschen. Es haftet ihnen nichts vom Geiste der[44] Schwere an, keine Steifheit, keine Absichtlichkeit. Es ist Grazie mit Witz; Esprit, der Phantasie hat; Geschmack, der es bis zur Poesie bringt. Ein fabelhaft sicherer Sinn für Form und Farbe unternimmt die frechsten Wagnisse bis hart an die Grenze des Möglichen, ohne jedoch etwas hervorzubringen, das nicht als Kunstwerk von Distinktion wirkte. Selbst das Höchste in der Kunst bringt er zuwege: reine Einfalt ohne Banalität. Wir sahen einen Hut, der eigentlich nichts war als ein umgestülpter Topf aus rotem, weißem und schwarzem Sammet. Es ist ganz unmöglich, zu sagen, warum dieses Ding nicht etwa plump oder komisch, sondern schlechterdings hinreißend schön aussah. Das Geheimnis seiner Schönheit lag wohl darin, daß die Linien seines Umrisses sowohl wie jede Falte des Stoffes von Fingern gebildet waren, die genialer Eingebung des Momentes folgten, nachdem das Ganze zuvor innerlich von der Künstlerin gesehen worden war.
Es begreift sich leicht, daß meine Frau den lebhaften Wunsch hegte, einen solchen Hut zu besitzen, und ich noch den lebhafteren, sie in einem solchen Hute zu sehen. Daß aber ein deutscher Dichter, und er sei gleich, wie ich, noch mehr Geschäftsmann als Dichter, nicht in der Lage ist, seiner Frau ein derartiges Kunstwerk, die Verkörperung des ästhetischen Genies einer traditionell ästhetischen Rasse, zu kaufen, leuchtet ohne weiteres ein.
Unsere Begierde, die Bank von Monte Carlo zu sprengen, wurde zur wilden Leidenschaft. Kaum, daß ich noch Blicke für die eleganten Ambassadricen der Venus von Paris hatte; kaum, daß meine Frau noch Andachtskraft für die Auslagen der großen Schneider[45] aufzubringen vermochte: das Gold läutete uns in seinen Tempel; wir folgten der großen Glocke. (Ich rühre die Pauke des Pathos. Wenn sie ledern klingt – ist es meine Schuld?)
Das Leben in den Spielsälen der Monaco-Aktien-Gesellschaft, deren Dividenden so gewaltig sind, wie es unsere Hoffnung war, sie durch einen phänomenalen Gewinn zu schmälern, ist zum Glück schon so oft und mit so glühenden Farben geschildert worden, daß ich mir die Mühe ersparen kann, ein Gemälde davon zu entwerfen. Ich lasse es um so lieber bleiben, als ich weder die flackernden Augen der verzweiflungsvoll ihr Letztes auf eine Karte setzenden Spieler, noch das müde Lächeln der Verspieler von Riesenvermögen, noch die grausame Verkniffenheit in den erbarmungslosen Augen des Croupiers bemerkt habe. Ich sah nicht, weil ich lediglich auf die dicken Fünffrankenstücke guckte, die ich, gänzlich unbekannt mit den Regeln des Spieles, irgendwohin setzte, wo gerade Platz war. Ich hörte »Faites votre jeu, messieurs« und »rien ne va plus«; und die Kugeln tanzten; und es roch wie in einem Parfümerieladen. Und das ging eine Weile so hin, bis ich fünfzig Franken verloren hatte und die Stimme meiner Frau vernahm, die da lautete: »Du hast gar keine Ahnung von der Sache. Laß mich machen!«
Sie hatte nämlich, während ich im Interesse unserer Finanzen rastlos tätig gewesen war, versucht, den Sinn der Figuren und Nummern zu ergründen, die auf dem grünen Tuche zu sehen waren. Und nun fing sie an, mit Überlegung zu tun, was ich unüberlegt getan hatte. Mit anderen Worten: ich hatte gespielt – sie: berechnete.
Wenn Fortuna nicht ein ganz albernes Frauenzimmer wäre, das keine Idee davon hat, worin ihr Wesen eigentlich beruht: nämlich im Unberechenbaren, das ich mit dem Instinkte des Schicksalskundigen kühn und groß herausgefordert hatte, so hätte sie meine Frau sofort durch andauerndes Einziehen ihrer Fünffrankenstücke bestrafen müssen. Statt dessen bereitete sie ihr den Triumph, sie die fünfzig Franken wiedergewinnen zu lassen, die ich verloren hatte.
Ich wußte nicht, ob ich mich darüber freuen oder ärgern sollte. Denn, wenn es zwar erfreulich war, den Spielfonds wieder beisammen zu haben, so war es doch auch ärgerlich, dies mit einer Einbuße an Autorität zu bezahlen.
Indessen: würdelos, wie man nun einmal wird, wenn man, wie ich, den Sinn auf das Materielle zu richten gewöhnt ist, freute ich mich schließlich doch, indem ich im geheimen hoffte, die verlorene Autorität auf anderem Wege wieder zu gewinnen.
Meine Frau aber setzte mit Überlegung weiter. Einmal sogar zehn Franken. Und gewann immerzu. Es kam der Augenblick, wo unser Spielfonds verdoppelt war.
»Siehst du?« sagte sie und lächelte so infam, wie ich es ihr niemals zugetraut hätte.
»Was denn?« entgegnete ich kühl.
»Duecento lire!« erwiderte sie, – der Moment war zu erhaben, als daß sie ihn nicht toskanisch hätte verklären müssen.
»Wenn's weiter nichts ist!?« warf ich verächtlich hin.
Da setzte sie, gereizt und kühn, fünfzig Franken auf einmal.
Ich dachte nicht anders, als sie sei im Glückstaumel übergeschnappt, und ergriff eines der unheimlichen Schiebestäbchen, den Wahnwitz aufzuhalten, die fünfzig Franken zurückzuscharren. Da krähte der glatzköpfige Croupier aber auch schon los: Rien ne va plus, und die schicksalträchtige Kugel hopste wie besessen in der Roulette.
»Du bist verrückt,« stöhnte ich, von dem Rechte des Ehemanns, grob zu sein, skrupellos Gebrauch machend.
Die Kugel stand still.
Mein Herz auch.
Der Croupier scharrte geschickt und gelassen die Unglückshäufchen von Fünf- und Zehnfrankenstücken zu sich heran, denen die Kugel Pech gehopst hatte.
Gleich wird ihr Häufchen auch beim Teufel sein, dachte ich mir und verfluchte den weiblichen Leichtsinn.
Da: ping, ping, ping, ping ließ er Goldstücke auf das Häufchen regnen; lauter Napoleondors; eine unglaubliche Menge.
In diesem Momente bewies meine Frau wahre Seelengröße.
Sie machte, ruhig, als sei es ihr ein gemeiner Anblick, Goldstücke dutzendweise um sich zu versammeln, ihren Pompadour auf, kramte darin herum, als suchte sie etwas, entnahm ihm ihr Taschentuch, wischte sich am Näschen, legte das Tuch hinein, placierte den geöffneten Silberbügel des Pompadours am Rande der Tafel und ließ mit unglaublich gut gespielter Gleichgültigkeit den Goldstrom hineinplätschern.
Dies getan, stand sie nicht ohne Majestät auf und sagte zu mir: »Ich glaube, unsere letzte Trambahn muß gleich abgehn.«
Es ist unglaublich, aber nichts als die reine Wahrheit: sie wollte sich mit ihrem Raube auf den Yankeedoodle zurückziehen.
»Wir haben genug,« erklärte sie. »Ich weiß nicht wieviel ich gewonnen habe, aber: es ist genug. Wenn ich jetzt weiter spiele, verliere ich.«
Ich hatte die dunkle Empfindung, daß sie recht hatte; daß sie wirklich die Stimme des Schicksals in sich vernahm: daß es also vernünftig war, was sie sagte. Und ich wollte sie schon am Ärmel nehmen und mit ihr fortgehen – direkt zu dem himmlischen Hute drüben.
Da ging ein Rauschen durch den Saal, ein Flüstern, das zu einem Surren von Stimmen wurde, und ein Rascheln von vielen, vielen seidenen Frauenkleidern.
»C'est Théodore!« hörten wir rufen. »Théodore! Théodore; Cinquanto mille! Soixante! Théodore!«
Wir sahen uns um und genossen den Anblick von gut drei Dutzend aufgeregter Damen verschiedenen Alters, aber gleichen Metiers, die, Eisenfeilspänen gleich, wenn der Magnet sie in seine Sphäre gezogen hat, allesamt auf einen Punkt zuschossen: in den Nebensaal zu einem anderen grünen Tische, wo ein unangenehm schöner junger Herr stand, durchaus und ausschließlich damit beschäftigt, Tausendfrankennoten in ein enormes Portefeuille zu stopfen.
»Redner wird beglückwünscht,« sagte ich zu meiner Frau.
»Glaubst du wirklich, daß er fünfzig-, sechzigtausend Lire gewonnen hat?« sagte sie.
»Nach der Ovation zu urteilen, die ihm Fortunas Cousine, die eifersüchtige Venus, bringt, gewiß. Du[49] kannst dich darauf verlassen, daß er diesen Tag nicht als Einsiedler beschließen wird,« sagte ich.
»Diese Unanständigkeiten interessieren mich gar nicht,« sagte sie.
»Ich finde es gar nicht unanständig, sechzigtausend Franken zu gewinnen, und bin jeden Augenblick zu der gleichen Unanständigkeit bereit,« sagte ich.
»Ich auch,« sagte sie, und ging in den Nebensaal zu dem anderen grünen Tische.
Sie hatte es sehr bald heraus, daß es dort in Einsatz, Gewinn und Verlust erheblich anders kleckte, als bei unserer zahmen Roulette.
»Ich glaube,« sagte sie, »wir versuchen es einmal hier.«
»Aber,« sagte ich, »ich denke, du hast kein Glück mehr?«
»Dort!« sagte sie; »hier ist es etwas anderes. Wie du siehst, muß man hier mindestens zwanzig Lire setzen.«
Ich sah ein, daß das in der Tat etwas ganz anderes war, und erhob keinen eheherrlichen Einspruch. Nur machte ich zur Bedingung, daß auch ich in Théodores Spuren wandeln durfte.
»Doppelt genäht hält besser, weißt du …«
»Ja, wenn du nur eine Ahnung vom Nähen hättest.«
»Ich? Bitte: Im Trente et quarante habe ich vor zehn Jahren einmal zweihundert Franken gewonnen.«
»Und sie wieder verloren, weil du nicht zur rechten Zeit aufhörtest.«
»Aber heute habe ich zwei große Beispiele vor mir: dich und Théodore.«
»Wenn du mir versprichst, aufzuhören, sobald du fünftausend, – nein: viertausend, – nein: wenn du dreitausend Franken gewonnen hast …«
»Selbstredend.«
Sie ließ mich einen Griff in den Pompadour tun, und ich begab mich mit einer Faust voller Goldstücke zur anderen Seite des Tisches.
Ich war wirklich vom Glück begünstigt: eben, als ich erschien, stand eine dicke Dame auf und fluchte etwas Polnisches.
Hast du verloren, mein Täubchen, dacht' ich mir, so ist die Wahrscheinlichkeit um so größer, daß ich auf diesem Platz gewinnen werde.
Ach, – ich bin immer ein schlechter Mathematiker gewesen: auch diese Wahrscheinlichkeitsrechnung stimmte nicht.
Andere Leute gewinnen wenigstens anfangs und verlieren das Gewonnene nur infolge ihrer Willensschwäche, weil sie nicht aufzuhören wissen und blind und blöde die Schwelle überschreiten, die aus dem Gewinnen ins Verlieren führt: ich aber verlor von Anfang an, unaufhörlich, immerzu, ohne Unterlaß und Unterbrechung.
Da ich von Mal zu Mal die Einsätze verdoppelte, ging es sehr schnell; ich darf wohl sagen: rapid. Die Sache hatte nicht den mindesten psychologischen Witz. Es war eine ganz blödsinnige Wiederholung von Niederträchtigkeiten.
Angeekelt von einem Schicksal, das keine Nuancen kennt, schob ich den Stuhl zurück, aufzustehen. Es blieb mir auch nichts anderes übrig, denn nicht der Schatten eines Napoleondors war mehr in meinem Besitze.
Ich hörte im zermarterten Geiste bereits die Reprimanden von Madame und trug Bedenken, mich der großen Gewinnerin zu nähern, als ich, aufstehend und mich umwendend, sie mir gegenübersah.
Ich senkte den Blick.
Als ich ihn erhob, sah ich, daß der ihrige noch nicht den Mut aufgebracht hatte, sich zu erheben.
Ich wußte genug.
»Hast du noch Geld zur Trambahn?« fragte ich.
»Wir können sogar noch Abendbrot essen,« sagte sie, »und ein paar Ansichtspostkarten wegschicken.«
»Es gibt welche mit Schmähungen auf Albert I., Honoré Charles, Fürsten von Monaco,« sagte ich.
»Die nehmen wir,« sagte sie.
2 Anfangskapitel des »Prinzen Kuckuck«, unter diesem Titel als Erzählung für sich zuerst in der »Neuen Rundschau« erschienen.
F. D.
Es war um die Zeit der unumschränkten Herrschaft der Kaiserin Eugenie über die Modemagazine der alten und der neuen Welt, als Madame Sara Asher, die junge Witwe des alten Mister Leon Asher (Felle und Pelzwarenkonfektion, Neuyork) zum ersten Male seit ihrer Kindheit ihre kleinen Füße wieder auf europäischen Boden setzte.
Europa war damals kleine, auf hohen Stöckeln balancierende Füße gewöhnt, und auch die hohen bis zur Mitte der Waden reichenden Juchtenstiefelchen mit goldenen Schnürenquasten, die Madame Sara trug und geschickt in ihrer ganzen Pracht zu zeigen keineswegs ermangelte, waren keine Sensation für den alten Erdteil, der damals auf üppige Eleganz gestimmt war und noch nicht den kategorischen Imperativ der bismarckschen Kürassierstiefel erfahren hatte. Selbst Madame Ashers lilafarbenes Krinolinkleid, diese prachtvolle Glocke mit dem prachtvolleren Schwengelpaar der beiden in weißseidenen Strümpfen steckenden Beine war nicht imstande, besonderen Eindruck auf[53] einen Kontinent zu machen, der mit jedem neuerscheinenden Pariser Modejournale neue Glockenwunder erlebte und neben einer Kaiserin der Mode ein paar hundert Modeköniginnen besaß, deren jede den raffinierten Sinn dieser Verheimlichung der weiblichen Beine wohl begriffen hatte. Trotzdem drehte sich schon auf dem Jungfernstieg zu Hamburg mancher elegante Kommerz interessiert nach der schönen Jüdin um, und wer sich des damals noch seltenen Vorzugs rühmen durfte, mit einem Monokel begabt zu sein (dessen rand- und bandlose Vollkommenheit freilich noch nicht erreicht war), ließ hinter dessen Fensterglase Blicke blitzen, die rückhaltlose Anerkennung sowohl wie den Wunsch verrieten, dieser nach jeder Richtung hin wohlgebauten Dame einmal an einem Orte zu begegnen, wo sich Beziehungen leicht und mühelos anknüpfen lassen.
Noch größer aber war ihr Erfolg in Leipzig, wohin sie sich auf mehrere Wochen begeben mußte, weil mit der Verwandtschaft des seligen Leon noch einige Erbschaftsangelegenheiten zu ordnen waren. Der Brühl, wo diese Verwandtschaft in einer zwar nicht wohlriechenden, dafür aber um so lukrativeren Sphäre von »Rauchwaren« hauste, geriet in beträchtliche Aufregung, und es gab wahrhaftig mehr als einen unbeweibten Rauchwarenhändler, der stürmisch bereit war, der schönen und reichen Sara nicht bloß seine kostbarsten Eisbärenfelle, sondern auch sein liebefühlendes Herz nebst allen Geschäftsbüchern zu Füßen zu legen.
Indessen, Madame Sara hatte offenbar wenig Sinn für die hingebungsvollen Gefühle verwandter und befreundeter Firmen. Sie war keineswegs in[54] der Absicht nach Leipzig gereist, weiterhin auf ehelicher Grundlage in Pelz und Pelzkonfektion zu machen. Sie hatte an ihrem einen Rauch- und Pelzwarenhändler schon völlig genug gehabt und war im Grunde froh, daß ihre Ehefirma durch den Tod gelöscht worden war. Denn der alte dürre Leon, diese zweibeinige Rechenmaschine, der man sie in sehr jungen Jahren beigegeben hatte, war ganz und gar nicht ihr Geschmack gewesen. Für seine löblichen Qualitäten als Kaufmann und Familienvater hatte sie kein Organ besessen, aber ein um so schärferes Auge für das, was ihm als Menschen im allgemeinen und als Mann im besonderen an den Eigenschaften fehlte, für die es ihr an Organ keineswegs gebrach.
Mochte er ein Charakter gewesen sein: sie war vor allem ein Temperament. Er war einer der aus dem Osten Europas gekommenen Juden gewesen, von denen sie zu sagen pflegte, selbst ihr Schatten färbe noch ab, und der Geist des Ghettos stöhne in ihren schönsten Reden (und das und nichts anderes sei das Mauscheln), während sie die Tochter eines sehr westlichen, nämlich spanischen Juden war (eines jüdischen Granden, wie sie sagte) und einer Kreolin. Freilich war auch der Vater dieser Kreolin bestimmt ein Jude gewesen, und das indianische Blut in ihrer Herkunft mütterlicherseits begegnete in der Verwandtschaft auf dem Brühl unverhohlenem Zweifel, aber es lag ihr auch ganz fern, ihre Zugehörigkeit zum jüdischen Stamme zu leugnen. Sie war vielmehr stolz darauf und sprach es bei jeder Gelegenheit recht hochmütig aus, daß sie sich als Aristokratin fühle, eben weil sie Jüdin sei, und noch dazu spanische Jüdin. Es war das, wie ihre Schönheit, ihr Geist und ihr Temperament,[55] ein Erbteil ihres Vaters, der zwei Haupteigenschaften besessen hatte: Stolz und Phantasie. Aus einem reichen Hause stammend, hatte er sich, von der Lust nach Unabhängigkeit und Abenteuern getrieben, von seiner orthodoxen und streng in sich abgeschlossenen Familie gelöst und war in die Welt hinausgezogen. Lange hatte er in Italien gelebt, mit der inbrünstigen Andacht eines Psalmoden die früheste, halb byzantinische Kunst verehrend und immer den stolzen Plan hegend, der Verkündiger dieser Kunst zu sein. Dann hatte ihn die deutsche Kunstgelehrsamkeit, wenn nicht abgekühlt, so ernüchtert, und er war in das Getriebe der revolutionären Bewegung, gleichzeitig aber in den Aufruhr der Liebe zu seiner »Kreolin« geraten, die er als Tänzerin in Dresden kennen gelernt hatte. So kam es, daß die »spanische Sara« (wie man sie nicht ohne Respekt auf dem Brühl nannte) zu ihrem Leidwesen in Deutschland geboren worden war. Indessen konnte sie keine Erinnerung daran haben, da ihr Vater schon vor dem tollen Jahre Deutschland verlassen und mit Frankreich vertauscht hatte. Aber auch dieses Land genügte seinem revolutionären Sinne nicht, und er wanderte mit Weib und Kind nach Amerika aus, wo es ihm indessen erst recht nicht gelang, zur Harmonie zu kommen. Immer die größten Pläne, bald wissenschaftlicher, bald poetischer, bald politischer Natur wälzend und sich aus einem Lager der Meinungen immer wieder in ein anderes begebend, immer wieder abgestoßen durch das, was er Philistertum nannte, und überall abstoßend durch seinen Stolz und sein Weiterhinausbegehren, endete er als vollkommener Einsiedler der Gedanken, als geborener précurseur, wie er sich selbst nannte. Seine Frau war[56] ihm weggestorben, als Sara noch nicht zehn Jahre alt war. Diese war nun sein einziger Umgang, und in ihrer Erziehung ging er völlig auf. Er brachte ihr, einem höchst aufgeweckten Kinde, früher, als ihr gut sein konnte, nicht nur seine reichen Kenntnisse in Sprachen, Kunst und Literaturgeschichte, sondern auch seine ganze Weltauffassung bei, die schließlich immer mehr Nihilismus geworden war. Eine rasche Krankheit raffte ihn weg, kurz bevor sie das fünfzehnte Jahr erreicht hatte. Da er ihr fast nichts hinterließ, mußte sie es als ein großes Glück betrachten, daß der alte reiche Leon Asher sich ihrer annahm. Das Wohlleben in seinem Hause gefiel ihr, und so sagte sie nicht nein, als der Fünfzigjährige die Sechzehnjährige zur Frau begehrte. Sie gebar ihm in drei Ehejahren zwei Söhne. Als er starb, hatte sie das Gefühl: jetzt beginne ich zu leben. Kaum, daß das Trauerjahr vorüber war, übergab sie ihre zwei Kinder, zu denen sie auch nicht die geringste mütterliche Zuneigung empfand, einer Schwester des Verstorbenen und unternahm die Reise nach Europa, zwar unter dem Vorwande, nur Erbschaftsangelegenheiten betreiben zu wollen, aber mit der bestimmten Absicht, in Europa zu bleiben und dort ihr Leben in aller Freiheit einer reichen jungen Witwe zu genießen. Die aufs Geistige gewandten revolutionären Lehren ihres Vaters hatten bei ihr eine sehr deutliche Wendung aufs Sinnliche genommen, doch besaß sie einen gewissen sehr günstigen Dämpfer in ihrer wohlfundierten ästhetischen Bildung.
Aber der Brühl zu Leipzig konnte freilich keine Landschaft nach ihrem Sinne sein. Sie nahm nur schnell ein kleines Verhältnis mit einem hübschen,[57] aber allzuwenig interessanten Korpsstudenten mit; dann reiste sie nach Dresden. Der Galerie wegen, meinte sie, doch dachte sie wohl auch an anderes.
Ihr Vater, kein Freund des deutschen Wesens, hatte ihr von Dresden berichtet als der einzigen deutschen Stadt mit galanter Kultur. Er hatte dies freilich nicht ganz in dem Sinne gemeint, in dem es sich bei ihr festgesetzt hatte. Aber es war in diesem Falle gewesen, wie auch sonst: sie hatte, indem sie eine allgemein gefaßte Meinung ihres Vaters in ihre Auffassungssphäre übernahm, sie zwar allzu wörtlich aus dem Allgemeinen einer männlichen Erfahrung in das Besondere ihrer weiblichen Gefühls- und Anschauungswelt übersetzt, aber im wesentlichen deckten sich Original und Übersetzung doch.
Der Vater Saras hatte Dresden mit den Augen des Kunstgelehrten und Kunsthistorikers angesehen. Er war italienischen und französischen Einflüssen in der Kunst und Kultur der sächsischen Residenzstadt nachgegangen und dabei auch italienischem und französischem Blute begegnet. Dies mußte ihn, den unter Romanen geborenen, wie etwas Heimatliches berühren. Und seine Phantasie half nach. In jedem schwarzen oder braunen Auge einer Dresdnerin erblickte er ein lebendiges Denkmal längst verwehter Schäferstunden französischer Soldaten und italienischer Künstler, wenn es auch vielleicht in Wahrheit slawisches Braun und Schwarz war. Und dann kam hinzu, daß er seine eigene Liebe in dieser Stadt erlebt hatte. Hier hatte das Wochenbett seiner Frau, hier die Wiege Saras gestanden; und beide Betten, das große und das kleine, hatte er mit alten Meißner Figürchen umgeben, kleinen Kunstwerken, auf die das Wort einer galanten Kultur[58] wirklich zutraf. Alles dies lebte in Sara nach, unbewußt, halb bewußt, ganz bewußt.
Als sie der hübsche, aber leider von Korpsinteressen völlig absorbierte Kurt von Kantern, die stahlblaue Lausitzer-Mütze tief, wie es damals Mode war, in die Stirn gezogen, einmal gefragt hatte: »Aber warum denn gerade nach Dresden, Madame? Auf Ehre – Dresden ist ein langstieliges Kaffeedorf!« hatte sie geantwortet: »Für Korpsstudenten – mag sein. Korpsstudenten interessieren sich nicht für Meißner Porzellan. Korpsstudenten sind tapfere Ritter, aber keine Kavaliere im Sinne der galanten Zeit. Sie müssen zu viel Bier trinken und zu oft pauken. Das ist gewiß reizend – für Korpsstudenten. Ich aber habe schon genug von steilen Terzen und Hakenquarten. Ich möchte nicht gerne Anlaß zur Eifersucht haben, und am wenigsten Anlaß zur Eifersucht auf die Kneipe. Ich möchte mich in Jünglinge verlieben, die auf der ganzen Welt nichts kennen und wollen als mich, oder in Männer, die sich in meiner Gesellschaft von großen Dingen ausruhen.«
Davon begriff der hübsche Lausitzer-Senior nicht gar viel; die schöne Sara aber hatte damit immerhin etwas von der Oberfläche ihrer Instinkte verraten.
In Dresden logierte sie sich nahe dem Zwinger in einem höchst soliden und von der besten Gesellschaft frequentierten Hotel ein, wo sie schon bei der Ankunft nicht geringen Eindruck machte; einmal durch die große Anzahl der von ihr mitgeführten sehr umfangreichen und schweren Lederkoffer und dann durch ihre Jungfer, eine äußerst häßliche und, wie es schien, taube Negerin,[59] die von ihr Lala genannt wurde und ihrer Herrin sklavisch anhänglich war.
Dieses Verhältnis führte sich in erster Linie darauf zurück, daß Lala mit ihrer Herrin zusammen aufgewachsen war, am Äußeren der Erziehung mit anteilnehmend, so daß sie gleich dieser Deutsch, Englisch, Französisch und Italienisch verstand, aber vom Vater Saras doch immer auf dem Stand einer durchaus willenlosen und sklavisch abhängigen Dienerin niedergehalten. Sie hatte nie einen Pfennig Lohn erhalten und nie daran gedacht, dergleichen als etwas ihr Zukommendes zu betrachten. »Du bist Saras dunkle Schwester,« hatte ihr der Alte gesagt, »und gehörst zu ihr, wie ihr Schatten. Und wie ihr Schatten sollst du sein: stumm, taub – für die anderen. Aber Sara wird keine Geheimnisse vor ihrer dunklen Schwester haben, und Saras Schatten wird Saras Schicksal teilen. Sara wird für ihn denken und Sara wird für ihn sorgen. So ist es die Bestimmung und so das Glück der dunklen Schwester.« Der Alte hatte wohl gewußt, warum er in Bildern zu der kleinen, verprügelt und halb verhungert in sein Haus gekommenen Negerin gesprochen hatte. Ihre wie aus einer Schicht braunen Öls stumpf leuchtenden schwarzen Augen hatten ihm die unklar träumende Seele dieses Wesens offenbart, das treu wie ein Hund und zu allem Guten und Bösen abzurichten war. Der Alte sorgte dafür, daß nichts in ihr helle wurde, als das Gefühl für die Erhabenheit Saras über ihr. Und dieses Gefühl wurde immer mehr zu einer demütigen Anbetung, je reifer die Schönheit Saras wurde. Wie Sara selbst, ohne Religion aufgewachsen, hatte sie, aus einem mystischen Bedürfnisse ihres dunklen Wesens[60] heraus, Sara zu einem Idol nach der Art derer gemacht, die ihre schwarzen Vorfahren angebetet haben mochten. Das war keine gute Göttin, kein lieber Gott, das war nur eben das höhere Wesen, die Macht, die Lenkung. Und es war die Schönheit, die Helle.
Lala wurde zur Dichterin, wenn sie ihre Gefühle für Sara aussprach.
Wie Sara zum Führen eines Tagebuches angehalten worden war, so auch sie, aber sie schrieb nur Dinge hinein, die Sara betrafen, und jede Seite begann mit der Überschrift: »Heute sprach die helle Schwester dies.« Dann folgte etwa: »Hole das grüne Kleid, Lala. Tat es die dunkle Schwester. Sprach später die helle Schwester: Ich liebe noch immer den jungen Mann. Bring ihm den Brief. Tat es die dunkle Schwester. Und der junge Mann lächelte, denn die helle Schwester liebt ihn. Und kam zur Nacht nicht heim. Sanft sei ihr Glück wie der Mond, und heiß wie die Sonne. Die dunkle Schwester kennt die Liebe nicht, aber sie hat alles mit von der hellen Schwester. Und es ist gut für sie. Alles ist gut, so dunkel und gut.«
In diesem seltsamen Tagebuche bediente sich Lala derselben Geheimschrift, die sie mit Sara von Saras Vater erlernt hatte. Doch hatte sie sich noch einige Sigel dazu erfunden. So für die Worte: »Heute sprach die helle Schwester« einen Kreis, durch den ein Pfeil wagrecht ging und für die Worte: »Tat es die dunkle Schwester« einen Halbmond, durch den ein Pfeil senkrecht ging.
Ihre Taubheit war Verstellung zu dem Zwecke, die Äußerungen fremder Leute über ihre Herrin vernehmen[61] zu können, ohne daß diese sich dessen versahen. So hatte sie schon während der Ehe Saras der hellen Schwester wertvolle Spionendienste unter der Verwandtschaft des ahnungslosen Mister Leon Asher geleistet. Sara selbst pflegte ihre Dienerin auch ihren nächsten Bekannten und Vertrauten gegenüber als harmlose Idiotin hinzustellen, was um so weniger auf Mißtrauen stieß, als die primitiven Umgangsformen zwischen Herrin und Dienerin, wie das gegenseitig angewandte Du, ohnehin den Eindruck machten, als seien sie auf kindliche Zurückgebliebenheit des Verstandes der seltsamen braunen »Jungfer« zurückzuführen.
Nachdem Madame Sara in den besten Geschäften der Pragerstraße nach den besten Pariser Modellen ihre zwar ohnehin reiche, aber doch noch nicht ganz auf der Höhe des europäischen Geschmackes befindliche Garderobe ergänzt hatte und es nun an türkischen Schals, spanischen Mantillen, kleinen koketten Federhütchen, knisternden Reifröcken und durchbrochenen Halbhandschuhen mit den elegantesten Dresdener Madams mehr als aufnehmen konnte, fand sie es für angezeigt, ihre Antrittsvisite bei der berühmtesten, ob auch ganz altmodisch gekleideten Dresdnerin zu machen, deren erlauchte italienische Herkunft zweifellos ist: bei der Sixtinischen Madonna.
Gleich den meisten anderen Fremden durchschritt auch sie (doch war es mehr ein Durchwogen) alle übrigen Säle der Galerie, ohne den an ihren Wänden prangenden Kostbarkeiten mehr als einen vorüberstreifenden Blick zu gönnen, mit dem Ausdruck der von Sehnsucht beflügelten Wisserin der höchsten Gnade,[62] bis sie zu dem gebenedeiten Raume gelangte, wo die himmlischen Augen der Mutter und des Kindes leuchten, vor denen Papst und Heilige knien.
Die schöne Jüdin, froh, dort niemand zu treffen, ließ sich mit einem knisternden Aufbauschen ihres dunkelgrün seidenen Reifrockes in einem Fauteuil dem Bilde gegenüber nieder, erhob ihren schönen, mit vollgerundeten, schwermütig schwankenden Schmachtlocken frisierten Kopf zu dem Gemälde und führte das goldene Lorgnon an die dunklen und durch unterlegtes Beinschwarz noch mehr gehobenen Augen.
Ein wunderlicher Gegensatz, wie von Gavarni mit verruchter Raffiniertheit erfunden, diese beiden Frauenbilder einander vis-à-vis: das lebendige, als ob es ein zwar amüsantes, aber freches Gespenst des Lebens wäre, und das aus der Kunst geborene, das fast noch mehr wie Leben strahlte: als Lebensleuchten selber aus tiefster, innigster Einfalt.
Madame Sara empfand selbst so etwas und zog ein Spiegelchen aus ihrem perlengestickten Ridikül, sich darin zu betrachten.
Warum schminken wir uns eigentlich so absurd, dachte sie für sich. Warum diese Masse Rot auf so viel Creme-Weiß. – Nun ja, wir sind keine Göttinnen … Und doch … es wird einem wunderlich zumute.
Und sie sah wieder die Madonna an.
Und dachte weiter: – Wer hat mehr Ursache, stolz zu sein, als wir Jüdinnen? – Die schönste Römerin war dem größten Künstler Italiens gerade gut genug, eine Jüdin darzustellen … – Religion?
Sie lächelte.
Wer hier die Liebe nicht sieht, hat keine Augen. – Freilich: der Papst, die Heiligen, die Engel … Enfin![63] Künstler können sich was herausnehmen … Künstler! Ah! … Zweierlei gibt's: Künstler und Helden – oder, ohne Romantik gesprochen, Soldaten – d. h. Offiziere.
In diesem Augenblicke wurden ihre Gedanken durch das bestimmte Gefühl unterbrochen, daß hinter ihr ein Mann stehen müsse. Eine kleine Wendung ihres Kopfes, ein Blick nach hinten, colla coda dell' occhio, genügte, ihr zu zeigen, daß ihr Gefühl sich nicht getäuscht hatte.
Eine Weile später würde sie ihn auch mit der Nase haben wahrnehmen können, denn der Herr, der jetzt schräg hinter Madame stand und keinen Blick von ihr wandte, wie wenn er nicht der Sixtinerin wegen gekommen wäre, sondern wegen der Amerikanerin, dieser Herr, ein straff aufrechter Vierziger mit blonden Koteletten in der Mode der Zeit, einem rosigen Teint, sehr hellbraunen Augen und einem Anzuge, dessen sich der Empereur in Paris nicht hätte zu schämen brauchen, liebte offenbar die starken Gerüche. Damals war unter den vornehmen Mitgliedern der Herrenwelt ein Parfüm bevorzugt, das heute zu den Lehrlingen im Kellnergewerbe herabgesunken ist: Jockey-Klub. Doch war dieses Odeur damals noch nicht so degeneriert wie heute, wo es aus den zusammengegossenen Neigen anderer Extrakte hergestellt zu werden scheint. Es war vielmehr in der Blüte seiner Kraft und duftete restlos die große Seele dessen aus, der seine Erfindung inspiriert hatte: des Prinzen von Wales, dem bei seiner Inspiration nichts Geringeres vorgeschwebt hatte, als eine Erhebung des Stallgeruchs zum Odeur, – Rennpferd-Stallgeruchs, versteht sich. Frisches Heu und Juchtenleder als Dominante. Ein wirkliches Odeur de chevalier, viel sagend und viel[64] versprechend für geistreiche Nasen von Damen mit Temperamentsphantasie.
Der schönen Sara, die allzulange Ledergerüche hatte erdulden müssen, die nicht raffiniert und nicht nobilisiert waren, fehlte es an dieser Phantasie keineswegs, und so kam es, daß ihre Geruchsnerven in der bestimmten Ahnung vibrierten, der Herr hinter ihr könne eine Bedeutung für sie haben. Und so ließ sie mit scheinbarer Nachlässigkeit ihr winziges Spitzentaschentuch fallen, dessen Parfüm etwa als Komplementär-Geruch zu jenem Odeur de chevalier hätte bezeichnet werden dürfen. Sofort machte der Herr mit den Koteletten ein paar schnelle federnde Schritte nach vorn, bückte sich zu dem winzigen weißen Häufchen aus Seide, Spitzen und Duft nieder, ergriff das zarte Gewebe und überreichte es Madame mit einer Verbeugung, die zugleich ritterlich und galant, die beste Welt verriet.
Ah, machte Sara mit vollendet gespielter Überraschung, das heißt mit einem Tone der Überraschung, dem man es anhören konnte, daß die Überraschung gespielt war. Der Herr mit den hellbraunen Augen verstand sich auf Tonnuancen aus Frauenmunde und wußte auch die richtigen Folgerungen daraus zu ziehen und sich den Folgerungen entsprechend mit Delikatesse zu benehmen. Aber hier hätte es der Erfahrung und Sicherheit eines Meisters in der Kunst der Anknüpfung mit Damen nicht einmal bedurft, denn angesichts ganz großer Gegenstände der Kunst oder Natur ist es selbst für Anfänger leicht, den Faden zu einem Gespräch anzuspinnen und fest zu drehen. Was so hoch über der gemeinen Konvenienz steht, wie die Sixtinische Madonna, verleiht mit der Macht[65] von Souveränen auch das Recht, sich in seiner Gegenwart zeitweilig über konventionelle Schranken wegzusetzen.
So waren Weltdame und Weltmann bald in einem angenehm bewegten Gespräch, das bei Raffael begonnen hatte, über die Kunst im allgemeinen anmutig weggeschaukelt war und sich schließlich behaglich über Fragen des gesellschaftlichen Lebens in Dresden ausbreitete.
Der Umstand, daß auch der Herr als Fremder in Dresden weilte, ergab eine willkommene Erleichterung der gegenseitigen Aussprache. Eine Reisebekanntschaft, sogleich als Reisebekanntschaft determiniert, wird von Leuten von Welt, die sonst zumeist gezwungen sind, sich in festen Zirkeln zu bewegen, immer als eine angenehme Bescherung des Zufalls gerne begrüßt. Man lernt sich schnell kennen, kommt einander, wenn Sympathie im Spiele ist, sehr schnell nahe, bleibt aber doch immer Passagier, und es genügt, eines Tages zu sagen: Morgen mit dem Frühzuge reise ich weg. Nicht einmal das Stammbuchblatt früherer Zeiten ist auszufüllen:
Fürst Wladimir Golkow, russischer Kavallerie-General außer Dienst, Kommandeur des Sankt-Georgsordens für besondere Bravour im Krimkriege, besaß viel Neigung zu derlei Bekanntschaften, zumal wenn es sich um schöne Partnerinnen handelte, und er lebte recht eigentlich solcher Reisebekanntschaften wegen immer auf Reisen. Doch war Dresden, das zu jener Zeit von Russen überhaupt bevorzugt wurde, der Ort,[66] zu dem er von Zeit zu Zeit immer wieder zurückkehrte. Daher er hier eine feste Wohnung unterhielt, eine kleine Villa in einem großen Garten der Neustadt.
Heute knattert auch durch dieses damals noch ganz ländlich stille Viertel der elektrische Trambahnwagen; die großen Gärten sind parzelliert, und in jedem der neuen kleinen Gärten steht, die dumm-moderne Front zur Straße gewendet, ein kleiner Steinkäfig mit Stuckornamenten, in dem ein Dresdner Partikulier wohnt, dem es gerade recht ist, daß er seinem Nachbar in die Fenster gucken und riechen kann, was der Herr Rechnungsrat nebenan heute zu Mittage hat. Damals aber war das eine vornehme Gegend. Wenige, aber große, mit alten Bäumen bestandene Gärten, und tief im Grün des Gartens, von der Straße kaum sichtbar, ein altes Herrenhaus mit französischem Doppeldach, ohne viel Schmuck, und ganz gewiß ohne angeklebten Schmuck, aber von guten architektonischen Verhältnissen, behaglich geschmackvoll.
Ein solches Haus in solchem Garten hatte sich »der Russe«, wie er in der Gegend kurz genannt wurde, erworben und ganz nach seinem Sinne mit Möbeln aus der Zeit des ersten Kaiserreichs ausgestattet, die damals bloß als altmodisch, aber noch nicht für »antik« galten. Sie sagten ihm in ihrer strengen und etwas steifen Pracht viel mehr zu, als die mit Rokoko-Verzierungen recht oberflächlich spielenden Möbel des zweiten Kaiserreichs, die ihm den Eindruck von Unsolidität und Weichlichkeit machten. Er aber liebte die gerade Linie, sparsamen, zurückhaltenden Schmuck aus echtem Material und eine gewisse Massigkeit. Das grazilere »Damen-Empire«, die feinbeinigen Tischchen und wie aus Gitterwerk zierlich[67] konstruierten Sofachen fand man bei ihm nicht, wohl aber gewaltige, wenn auch durch die Kunst der Verhältnisse nicht plump erscheinenden Tische und wahrhaft überlebensgroße Prachtkanapees. Die östliche Herkunft und den früheren Beruf des Besitzers verrieten kostbare persische Teppiche, turkestanische Vorhangstoffe und wertvolle Waffen der verschiedensten Art: Säbel, Degen, Pistolen, Gewehre, die, weit zahlreicher als Bilder, an den Wänden hingen. Doch fehlte es auch an Bildern nicht völlig, und diese ließen gleichfalls gewisse Schlüsse auf die Neigungen ihres Besitzers zu. Da waren bunte, edelsteinbeladene russische Heiligenbilder, byzantinische Madonnen neben tibetanischen Malereien auf Seide, die schauderhafte Götzen, überladen mit Attributen der Grausamkeit und Wollust, darstellten, aber es gebrach auch nicht an allerhand nackten Damen antikmythologischer und ganz und gar moderner Herkunft. Diese letzteren aber waren nicht so sehr durch klassische Schönheit wie durch Fülle ausgezeichnet. Auch plastische Kunstwerke waren vorhanden, doch gewahrte man weniger echte Bronzen, als Erzeugnisse des berühmten russischen Phosphor-Eisenwerkes bei Jekaterinburg, die nichts so gerne darstellen, wie reitende Kosaken.
Auch von diesen Dingen war bereits in Gegenwart der Sixtinischen Madonna die Rede, und es war nicht bloß höfliche Vorheuchelung, wenn Madame Sara erklärte, daß alles Russische sie besonders interessiere.
»Rußland, verzeihen Sie, Fürst, hat für uns Amerikaner den Reiz kostbarer Barbarei. Gilt uns Europa als die alte, schon etwas lahmgewordene Kultur, so Rußland als der große Rachen, der diese Kultur einmal verschlingen und, wenn er imstande ist,[68] sie zu verdauen, aus ihr ein neues Gebilde von halb asiatischem Charakter erstehen lassen wird.«
»Ich verstehe, Madame. Wir Russen sind für Sie die Europäer à la tartare. Ein bißchen Politur über dicker Roheit. Nun ja, gottlob, es ist etwas Wahres daran. Unsere Kraft liegt in Asien, im Urgebiet des Menschen, das schon mehr Kulturen sterben sah, als je in Europa entstanden sind. Dort ist viel verfault und daher, dank der Düngung durch Jahrtausende der beste Humus für eine neue, für unsere Kultur. – Was Sie in Amerika verflucht schnell und, entschuldigen Sie, etwas oberflächlich gemacht haben, machen wir verflucht langsam, daher aber um so gründlicher. Sie haben auf ein neues Land den äußerst schnell alt gewordenen europäischen Liberalismus gepfropft, aber dieses Wunderkind wird wie alle Wunderkinder früher sterben, als es Nachkommen hervorbringen konnte. Wir aber gehen auf das echte Urwesen des Menschen zurück, das sich, wenn Sie wollen, barbarisch geworden, im Osten erhalten hat und zu alt ist, als daß es die Kinderei des Liberalismus hätte mitmachen können. Panslavismus heißt Asiatismus, heißt Mystizismus. Revanche für Marathon und Salamis ist das letzte Ziel der russischen Politik.«
»Oh! Oh! Sie springen weit und überspringen viel, Fürst!«
»Das kommt, weil wir Russen an große Ausdehnungen gewöhnt sind.«
»Wie wir Amerikaner.«
»Aber Sie springen an der Longe Europas in der Manege des Liberalismus. Zirkuskünste! Bei uns aber ist Freiheit und Größe! Nur bei uns!«
»Freiheit? Existiert das Wort im Russischen?«
»Nicht im Sinne der kümmerlichen Liberté, aus der die ruchlos idiotische Égalité hervorgegangen ist, aber im großen Ursinne der Brüderlichkeit eines ganzen Volkes, das sich als Familie fühlt und mit tiefem Instinkte den fürchterlichen Unsinn des Individualismus erkannt hat, den wir den griechischen Windbeuteln und den einzigen entarteten Orientalen verdanken: den Juden.«
Bei diesem Worte fühlte die kluge Sara, der dieses Gespräch ein seltsam aus Ärger und Respekt gemischtes Vergnügen bereitet hatte, daß jetzt der Moment gekommen war, wo es sich entscheiden mußte, ob sich mehr und Besseres aus ihm entwickeln sollte, als Gespräche.
Und sie sagte mit einem Lächeln, das schlechterdings bezaubernd war in seiner Mischung aus ein bißchen Demut mit viel Stolz: »Sehen Sie mir es nicht an, daß ich Jüdin bin, Fürst?«
Auch der Kommandeur des Sankt-Georgsordens empfand sehr schnell die Bedeutung dieses Momentes. Er, der in der Tat längst und keineswegs mit Mißfallen die jüdische Herkunft seiner schönen Partnerin bemerkt hatte, ergriff ihre linke Hand und zog sie an die Lippen, indem er sprach: »Ich verstehe mich auf Frauenschönheit, Madame, und ich müßte nicht tatarisches Blut in mir haben, wenn ich sie nicht zu schätzen und – abzuschätzen wüßte. Meine Liebe für den Orient ist nicht bloß platonisch-politischer Natur. Mag ich auch die Juden für entartete Orientalen mit dem denkbar schlechtesten Einfluß auf die menschliche Kultur halten – die Jüdinnen sind mir immer besonders verehrungswürdig erschienen, und ich möchte mich ihrem Einflusse keineswegs[70] entziehen, – zumal, wenn er über ein Lächeln verfügt, wie Sie.«
Madame Sara hörte den Unterton von paschahafter Überlegenheit aus diesen Worten wohl heraus, aber er mißfiel ihr durchaus nicht. Im Gegenteil: Sie ahnte aus ihm etwas, das sie innerlich höchst angenehm aufschauern ließ.
Und sie wiederholte ihr Lächeln, indem sie die Demut darin zur Balance mit dem Stolze steigerte. Und sagte: »Auch die Ironie in Ihren Worten entzückt mich, Fürst, – nicht bloß die Schmeichelei. Sie haben eine mir sehr zusagende Manier der galanten Huldigung, und ich würde es vielleicht auf einen Versuch ankommen lassen wollen, zu erfahren, ob Sie jetzt bloß – höflich gewesen sind.«
Der Versuch wurde gemacht, wurde wiederholt, und es war bald kein Zweifel mehr daran erlaubt, daß Fürst Golkow eine mehr als platonische Neigung für schöne Jüdinnen hatte.
Schon nach wenigen Wochen war Madame Sara im buen retiro des Fürsten wie zu Hause, und sie lernte den Zusammenhang begreifen, der zwischen den byzantinischen Madonnen, den tibetanischen Verzückungsgreueln und den Kosaken aus russischem Weicheisen bestand. – –
Wie ihr das neu war nach ihren Erfahrungen mit dem seligen Asher und dem Intermezzo mit dem hübschen Leipziger Korpsburschen!
Sie lernte mit großem Interesse das erotische Gruseln kennen und entbrannte in heftigster Leidenschaft zu ihrem Tataren, wie sie nun den Fürsten gerne nannte. Indessen: den Kopf verlor sie dabei doch nicht. Wie gerne sie auch ihrem erotischen[71] Mystagogen auf den dämmerigen Wegen in das mystische Paradies folgte, und wie gelehrig sie sich auch aus angeborenem Talente benahm, – sie verfiel ihm nicht so ganz, wie es den Anschein hatte, und wie er es nach dem Anschein gerne glaubte. Sie exaltierte sich nicht aus Berechnung; das hatte ihr Temperament nicht nötig. Sie spielte auch nicht aus Berechnung die Liebessklavin; diese Rolle war ihr im gegebenen Momente Natur. Aber beides, die Exaltation und die demütige Unterwerfung unter den Herrn der Liebe, nahm sie nicht dauernd ein; – sie blieb über der Sache, die für sie nicht Liebe, sondern Sensation war, aber sie wußte sich klüglich den Anschein zu geben, als sei sie nicht bloß in seinen Armen sein.
Auch beim Fürsten war es nicht Liebe im wahren mystischen Sinne des Wortes, nicht die ganze innere Verknüpfung seines Wesens mit dem ihren. Er entzückte sich an ihr zu Schwelgereien seiner wunderlich verstiegenen und alle Abgründe aufsuchenden Erotik. Er genoß in ihr – Asien und meinte in ihr – das Judentum zu unterwerfen. Aber es ging ihm wie manchen großen Herrn, die, gerade wenn sie am unumschränktesten zu herrschen glauben, um ihr eigentliches Herrschertum betrogen werden. Die schöne Jüdin wurde ihm zum Bedürfnis, und sie zwang ihm leise eine Monogamie auf, die ganz und gar nicht in seinem Wesen lag.
Ein solcher Zustand aus wirklicher Liebe ist Glück. Beim Fürsten war es eine Folge von Rauschzuständen, denen es am Intermezzo des Katzenjammers nicht fehlte. Trotzdem dachten beide nicht daran, die so intim gewordene Reisebekanntschaft durch eine Abreise zu lösen.
Madame Sara fühlte sich in Dresden durchaus und in jeder Richtung wohl. Sie war durch den Fürsten, soweit er selbst gesellschaftliche Beziehungen pflegte, in die Gesellschaft gekommen, – nicht so sehr in die der ansässigen Kreise, als in die der Fremden von Distinktion. Und, wo sie erschien, machte sie Aufsehen, gefiel sie. Das tat ihr wohl und machte ihr Vergnügen, zumal, da sie an Schönheit, Geist und Eleganz keine Rivalin fand.
Es dauerte nicht lange, und sie war umworben. Ein Attaché der französischen Gesandtschaft gefiel ihr, aber seine Gespräche waren zu pariserisch glatt. Sie war tiefere Paradoxe gewöhnt als die, die Monsieur le Comte de Brottignolles aus dem Figaro schöpfte, den sie selber las. Auch ein junger sehr reicher Engländer, der immer vorgab, sich zum Studium der deutschen Sprache in Dresden aufzuhalten, aber nie ein deutsches Wort über seine wunderbar rasierten britischen Lippen brachte, machte in seiner blonden Gesundheit einen gewissen Eindruck auf sie. Er war nicht parfümiert und roch doch gut. Alles war gut ausgearbeitet und doch strotzend an ihm. Kurz: ein Triumph der Hygiene. Aber er war gar zu englisch, zu insular, und man konnte mit ihm schlechterdings nur über Dinge reden, die augenscheinlich vernünftig waren. Und, um Leitartikel miteinander auszutauschen, dazu, meinte Madame Sara, unterhält sich eine junge Frau nicht mit einem jungen Manne. Überdies hatte sie die Empfindung, daß er grausam tugendhaft sei und sich darauf noch etwas einbilde.
Der Fürst, dem es nicht entgehen konnte, daß seine Sulamitin auch anderen gefiel, beobachtete mit großem Vergnügen das Vergebliche aller Versuche der anderen,[73] ihr nahe zu kommen, und legte das wohlgefällig als Beweis seiner festen Alleinherrschaft aus. Irgendwie erstaunlich fand er es nicht, denn es gehörte zu seiner Überzeugung von den Vorzügen der östlichen Menschen, daß dort die Männer zwar polygam, die Weiber aber monogam veranlagt seien. »Sogar die Jüdinnen,« hatte er einmal zu Sara gesagt, »die überhaupt noch echte Orientalinnen sind, weshalb sie sich in ihren schönen Exemplaren auch überall gleichen, während der amerikanische Jude ganz wie ein Amerikaner aussieht, der französische Jude ganz wie ein Franzose.« Auch gegenüber solchen Reden hatte Sara das unterwürfige Lächeln der Favoritin, aber in ihrem Innern sah es dabei gar nicht unterwürfig aus, und im Tagebuche Lalas gab es eine Stelle, die lautete so: »Sprach die helle Schwester: Je gescheiter ein Mann ist, um so leichter kann ihn eine Frau betrügen.«
Eines Morgens wurde Madame Sara, die erst sehr spät von einem Besuche bei ihrem Tataren nach Hause gekommen war und unerquicklich geträumt hatte, durch rasendes Klavierspielen und eine fürchterliche Art von Gesang geweckt. Beides wurde offenbar direkt über ihr verübt. Sie schellte Lala herbei und rief ihr entgegen: »Was ist denn das! Wer wohnt denn über uns?«
»Oh!« antwortete Lala mit großem Ernste, »du wirst ihn lieben. Er ist so häßlich wie ich, aber du wirst ihn lieben. Er ist anders. Er ist gut und verrückt. Er hat zu mir gesagt: ›Ei du Scheusälchen‹!«
Madame Sara, eben noch recht ärgerlich, mußte lachen, und sie sagte: »Mir scheint, Lala: du liebst ihn. Dann muß ich zurücktreten.«
Aber Lala verstand solche Scherze nicht. Sie sagte: »Oh, es ist wahr. Er ist ganz für dich. Er ist ganz anders und ganz für dich, und er wird dich lieben.«
»Dann soll er vor allem mit diesem schrecklichen Klavierpauken aufhören und mit dem noch schrecklicheren Gesingse!«
»Lala geht zu ihm.«
Und Lala ging hinauf, und augenblicklich wurde es ruhig.
Nach einer Weile kam die dunkle Schwester mit einem Billett zurück, auf dem folgende Worte standen:
Aber Orpheus hat auch nicht das Glück gehabt, Madame Sara Asher Neuyork (siehe Fremdenbuch) zu sehen, wie der ganz ergebenst endesunterfertigte Musikante und Poet, der zwar nicht leben kann, wenn er nicht den Flügel bearbeitet und seine unsterblichen Melodien den Morgenwinden mitteilen darf, aber lieber aufs Leben zu verzichten gewillt ist, als daß er der schönsten aller Damen ärgerlich sein möchte. – Es liegt also bei Madame, zu entscheiden, ob ich leben oder sterben soll. – Ich werde mir erlauben, selbst um die Entscheidung anzufragen, wenn Madame die Gnade haben will, mir dafür eine Stunde zu bestimmen.
Der ich bin der schönsten Dame alleruntertänigster Diener und Knecht Sturmius de Musis.«
»Du scheinst recht zu haben, Lala, er ist entschieden verrückt,« sagte Sara, als sie unter Lächeln das Billett gelesen hatte. »Aber er ist ein amüsanter[75] Narr. Du kannst ihm also sagen, daß ich um ein Uhr für ihn zu sprechen bin.«
Punkt ein Uhr überbrachte Lala ihrer Herrin eine Visitenkarte, die den wirklichen Namen des Maestro Sturmius de Musis aufwies, einen alten deutschen Adelsnamen, der eben an allen Plakattafeln der Stadt über einer Konzertanzeige zu lesen war. »Ich lasse bitten!« sagte sehr freundlich Madame Sara, musterte schnell noch einmal ihre raffiniert halb auf Empfang, halb auf Negligé gestimmte Toilette und ließ sich, gelb auf rosa, in einen üppig gepolsterten Armstuhl sinken.
Kaum, daß sie noch einen Wurf alter Brabanter Spitzen über türkischen Pantöffelchen zur Geltung hatte kommen lassen können, stand der Flügelgewaltige auch schon in der Türe.
Er sah, oberflächlich angesehen, recht unscheinbar aus. Klein und mager, wie er war, verschwand er fast in dem überlangen, schwarzen, noch etwas biedermeierisch geschnittenen Bratenrocke, den er zu breit karierten hellen Nankinghosen trug. Ein nicht recht eleganter Umlegekragen gestattete einem hellroten seidenen Schlips, weiter hervorzuzipfeln, als es die Mode erlaubte, und ließ einen keineswegs schönen, allzulangen und sehr sehnigen Hals frei, der zu allem Überfluß noch von einem überlebensgroßen Adamsapfel belebt wurde. Dieser fleißig auf- und niedersteigende Knollen hätte bei jedem anderen die Aufmerksamkeit des Betrachters konkurrenzlos in Anspruch genommen. Bei Madame Saras Besucher vergaß man ihn bald, wenn man einmal den Kopf angesehen hatte. Vor allem: er war zu groß. Er paßte nicht zum Körper. Er wirkte als Kopf an sich. Und dann: er war grausam häßlich, weil er auch in sich keine[76] anständigen Verhältnisse hatte. Ein Hohn auf das Gesetz vom goldenen Schnitt. Die Stirn, über zwei dicken blonden Raupen, den Augenbrauen, ansetzend, hörte scheinbar überhaupt nicht auf. Dafür war die Nase zu kurz geraten, und sie erschien außerdem noch kürzer, als sie schon war, weil sie sich in optischer Verkürzung präsentierte, nämlich mehr nach aufwärts als nach abwärts tendierend. Dafür war wieder der Raum zwischen Nase und Mund viel zu ausgedehnt. Zwar war er mit einem hellblonden, in Spitzen gedrehten starken Schnurrbart bestanden, aber es wäre für zwei solcher Schnurrbärte Platz gewesen. Der Mund, obwohl zu breit und schmallippig, war geistreich. Nur entblößte er leider wahre Nagetierzähne, breite, gelbliche Schaber. Und dann war kein Kinn da, sondern nur ein Zwickelbart, ein gesteifter pharaonischer Zwickelbart, der im Verein mit dem breiten Mund und der gewaltigen Malmfläche sofort die Idee wachrief: Nußknacker. Die stark hervortretenden oberen Backenknochen unterstützten die Idee wirksam, während die ungeheuren Ohren die Gedanken mehr ins Gebiet der Zoologie riefen. Zornig trompetende Elefanten, wenn sie die Ohren abstehen lassen, erfreuen sich ähnlicher Seitenornamente. Sein Haupthaar litt unter dem Größenwahn seiner Stirn. Man konnte eigentlich nur vom Hinterhaupthaar reden. Doch ersetzte es an Länge, was ihm an Terrain versagt war. Es fiel beträchtlich über den Rand des Rockkragens herab, war aber säuberlich gerade geschnitten.
Ein solcher Kopf hätte wohl Entsetzen erregen müssen, wenn in ihm nicht zwei Augen gewesen wären, so voll Geist, Güte, Glut und Leben, daß man in ihrem Anblicke alles übrige vergaß und sofort die[77] Empfindung gewann: dieser Mann hat es nicht nötig, äußerlich schön zu sein; er hat alle Schönheit innerlich, das heißt: er ist ein wunderbar guter und wunderbar geistvoller Mensch, ein geniales Herz und ein genialer Kopf. Seine Häßlichkeit, statt zu verstimmen oder gar Mitleid hervorzurufen, machte heiter, steckte mit Heiterkeit an, von den Augen her, um die herum ein lebhaftes und doch nicht zuckendes Muskelspiel fröhlicher Laune war, witzig und dionysisch zugleich, kindlich und faunisch, gemütlich und enthusiastisch.
Wenn er aber gar den Mund auftat und in seiner, Konsonanten und Vokale wunderlich zusammenquetschenden Sprache zu reden begann, war es, als ob alle guten Geister des Lebens mobil gemacht worden wären gegen Langeweile, Dumpfheit und Verdrossenheit. Er brauchte gar nichts Besonderes zu sagen: alles klang originell, denn ein jeder fühlte unbedingt: dieser Mensch spricht sich unverstellt aus, jedes Wort ist getragen von einem Impuls, keines schielt nach verborgenen Absichten, und wäre es auch nur die Absicht, originell zu wirken. Anderseits mochte manches anfangs närrisch klingen, aber bald merkte man, daß es nur närrisch geklungen hatte, weil es gar tief natürlich gewesen war, kindliche Weisheit, die sich nicht gut in konventionellen Schablonen ausdrücken kann, und die sich ganz naiv primitiver Mittel bedient. Dabei war Meister Sturmius alles andere eher als ein rohes Naturprodukt. Er war nicht nur sehr gebildet, äußerst belesen, ja im Umkreise seiner künstlerischen Interessen beinahe gelehrt; er hatte auch als Erbgabe seines alten Geschlechtes einen sehr sicheren Fond überkommener Kultur. Wenn er sich zuweilen recht ungeniert betrug, die Mode nach seinem Geschmacke[78] modelte, die Konvention nach seinem Sinne bog, so war es kein wüstes Durchbrechen von Schranken, sondern immer ein elegantes Drüberwegsetzen mit dem leisesten Takte für das Wo, Wie, Wann und Wieweit. Nur in seiner Kunst war er ein rücksichtsloser Draufgänger, und er pflegte das so zu entschuldigen: Alles, was in meiner Familie früher Ritterliches, Räuberisches, Mörderisches passiert ist mit Schild und Schwert und Spieß, üb' ich aufs neue aus im Kampfe für die Kunst gegen die Philister. Alle meine raubritterlichen Vorfahren haben nicht so viel Eisen zerhauen, wie ich Flügel, und ich will doch sehen, ob ich nicht mehr Kunstphilister zur Strecke bringe, als sie Krämer. Sturmius, mein erlauchter Ahne, hat seinen Bruder Arbogast mit einem alten Streitkolben erschlagen, weil er nicht Martin Luthern anhangen wollte; – so würde auch ich meinen Bruder umbringen, wenn er nicht an Richard Wagner und die Musik der Zukunft glaubte. Es ist ein großes Glück für meinen Bruder, daß ich keinen habe.
Madame Sara, die keinen schlechten Blick für Menschen hatte, erkannte schon an der Art des Eintretens, daß ihr Gast trotz seines allzu subjektiven Bratenrockes ein Mann von Welt war, denn er kam ohne jede Spur von Befangenheit auf sie zu und küßte ihr die Hand wie einer, der gewöhnt ist, mit Schönheiten des Salons umzugehen. Dabei überstrahlte sie sein Blick ebenso verehrungsvoll wie munter, und sie fand, daß dieser Musikus, ästhetisch genommen, zwar ein Scheusal sei, aber ein höchst interessantes, ja – reizendes Scheusal. Naiv treulos, wie sie war, dachte sie sofort vergleichend an ihren Tataren, und diesmal schien es ihr, als sei der »andere«, das heißt[79] der neuauftauchende, vielleicht … nun: weiter dachte sie nicht. Und sie sprach: »Sie haben wirklich meine Entscheidung über Leben und Tod, Herr von …«
Aber Meister Sturmius fiel ihr ins Wort, ehe sie seinen Namen hatte aussprechen können: »Haben Sie die Gnade, mich nicht bei meinem in die Register des Staates eingetragenen Namen zu nennen, Madame! Auf die Gefahr hin, daß Sie mich sogleich ersuchen werden, Ihr Zimmer zu verlassen, bitte ich Sie, mich mit dem Vornamen anzureden, den in den Zeiten, da meine Familie noch katholisch war, die Erstgeborenen unseres Hauses trugen, und den ich mir selbst für den Verkehr mit Göttinnen beigelegt habe: Sturmius!«
Madame Sara lachte belustigt auf: »Sturmius? Steht der Name wirklich im Kalender? Ist er nicht von Ernst Theodor Amadeus Hoffmann erfunden worden?«
»Es hat so viel Sturmiusse meines Namens gegeben, daß wir sie numeriert haben, Madame. Der letzte war der vierzehnte und trug den Namen Judenschreck, nicht, weil er das Volk Gottes haßte, sondern weil er sehr kreditbedürftig war.«
»Das Volk Gottes? Wie meinen Sie das?«
»Wie es in der Bibel steht. Denn die Juden sind wirklich die Auserwählten ihres Gottes, den sie bei uns importiert haben. Es war ihr erster großer Importartikel und ist ihr bestes Geschäft geblieben bis auf den heutigen Tag. Wir haben ihn teuer bezahlt.«
»Sie sprechen nicht sehr respektvoll vom lieben Gott.«
»Der Gott der Juden heißt Jehova.«
Madame Sara war ärgerlich. Was sollte das alles? Wußte er nicht, daß ihr Name jüdisch war? Sah er nicht, daß er eine Jüdin vor sich hatte?
Sie sprach: »Es ist nicht gescheit, daß Sie Ihre Richterin über Tod und Leben beleidigen, Herr von …«
»Bitte: Sturmius!« – »Wenn ich nun eine fromme Jüdin wäre …?« – »Sie sind überhaupt keine Jüdin.« – »Doch, und ich bin stolz darauf.« – »Sie sind ebensowenig eine Jüdin, wie Christus ein Jude war.« – »Was war Christus denn?« – »Christus.« – »Das verstehe ich nicht.«
»Christus war die Liebe, war nichts als Liebe, war ganz und gar Liebe. Daher war er weder Jude noch sonst etwas, und darum gehört er allen, nicht bloß uns Christen, sondern auch den Juden und Heiden. Und so ist es mit jedem Menschen, der etwas ganz Seltenes ist. So ist mein Freund Richard Wagner ganz Genie, und darum ist er kein Deutscher, sondern Richard Wagner, darum gehört er nicht bloß uns, die wir seine Jünger sind, sondern auch den Juden und Heiden der Musik.«
»Und ich?«
»Madame! Dinge, die ich nur auf fünfzeiligem Papier oder nur aus dem Flügel ausdrücken kann, erdreiste ich mich nicht, in Worte zu fassen. – Haben Sie die Gnade und erlauben Sie mir, weiterzuleben, weiterzumusizieren, – und ich will Ihnen Gelegenheit geben, zu hören, was Sie sind.«
»Sie sind ein wunderlicher Heiliger.«
»Weder heilig noch wunderlich. Nur Musikant und ein Stück Poet. Doch bin ich leider nicht groß genug, um nicht nebenbei ein deutscher Querkopf und als solcher zum Beispiel ein hitziger Judenfresser zu sein.«
»Das ist amüsant.« – »Für mich sehr.« – »Also ist es Ihnen nicht ernst damit?« – »Ich brauche meinen Ernst für meine Kunst. Juden fresse ich zur Erholung.« – »Haben Sie Mendelssohn schon gefressen?« – »Der ist mir zu musikalisch.« – »Und Meyerbeer?« – »Den habe ich gefressen.«
Und Meister Sturmius lachte über den Doppelsinn seiner Antwort selber so herzlich auf, daß sein Gelächter ansteckend wirkte und auch Madame Sara schallend lachen mußte.
»Aber Sie stehen ja noch immer, Sturmius,« nahm, durch das gemeinsame Gelächter in eine übermütige Laune geraten, Madame Sara das Wort, »setzen Sie sich, Meister!«
»Nicht ›Meister‹,« erwiderte der, indem er sich setzte. »Es gibt nur einen Meister, und der sitzt jetzt in der Schweiz über Partituren zu Werken, die die Pforten der Ewigkeit aufreißen werden. Ich bin nur Sturmius der Jünger: Ihr Sturmius, Madame, wie seiner, denn die Schönheit ist der Nachfolge so würdig, wie das Genie. – Gestatten Sie mir, daß ich Ihnen die Schleppe trage, als Ihr musikalischer Page.«
»Das würde wohl unschicklich sein bei der Krinolinenmode,« meinte Madame Sara, und Sturmius schüttelte sich aufs neue vor Lachen, und wiederum mußte Madame Sara einfallen, und es dauerte eine ganze Weile, bis sie sich beruhigt hatte, um sagen zu können: »Mein Gott, was für Kinder wir sind, wir schreien miteinander vor Lachen, als kennten wir uns von Jugend auf. Das ganze Hotel werden wir skandalisieren.«
»Wenn es auf mich ankäme,« antwortete Sturmius, »ich hätte nichts dagegen, wenn es die ganze Stadt wäre.«
Da dachte Madame Sara zum zweitenmal an ihren Tataren und sagte: »Das wollen wir bleiben lassen, Sturmius. Ich bin mehr für Ausschluß der Öffentlichkeit bei Privatvergnügen.«
Und sie lachte wieder, – aber schon etwas leiser.
Der von Sara beliebte Modus wurde beibehalten. Selbst im Hotel wurde, dank des virtuosen Aufpassens von Lala, die entente intime zwischen erstem und zweitem Stock nicht bemerkt, die sich aus der entente cordiale sehr bald entwickelte und den asiatischen Beziehungen Madame Saras an Intensität nichts nachgab.
Die schöne Jüdin war sehr glücklich mit ihren beiden verliebten Antisemiten, deren Rassenhaß sie auf so angenehme Weise ad absurdum führte, und die ihr dafür so viel Glut und Verehrung entgegenbrachten, daß in der Tat für die ganze übrige Judenheit nur recht wenig Liebe mehr übrig bleiben konnte. Der kleine Gott hatte wirklich gut für ihr großes Herz gesorgt. Es waren nicht bloß zwei Männer, die sie umfingen, – es waren zwei Rassen, zwei Weltanschauungen, die ihr huldigten. Und das ergab auch in puncto puncti zwei angenehm verschiedene Gebarungen. Alles Mystische, Auto- und Theokratische lag dem Jünger der Zukunftsmusik aus altem germanischen Adelsstamme gänzlich fern. Er zündete keine Lampe in Rubingläsern an vor byzantinischen Madonnen, um Dämmerstimmungen auf dem Grenzgebiete zwischen Religion und Erotik zu Explosionen heftigster Liebesherrschsucht und wollüstigster Liebesuntertänigkeit zu steigern. Den Tribut, den er der schönen Frau mit allen Sinnen leidenschaftlich darbrachte, war[83] völlig frei von asiatischen Ingredienzien. Seine Leidenschaft war klarer, frischer, heiterer. Er liebte nicht zum ersten Male, aber er liebte wie beim ersten Male: jungenhaft mit der bald drolligen, bald rührenden Überschwenglichkeit eines jungen Studenten, – nur kam, wenn es ans Sprechen ging, ein reicher erfahrener Geist hinzu und, wenn er seine Entzückung musikalisch äußerte, eine meisterhafte Kunst.
Für eine Virtuosin der Liebe, als welche sich Madame Sara bald fühlen durfte, war diese Nuance ein wunderbarer Genuß, der durch die äußere Häßlichkeit nur noch erhöht wurde.
»Welches Glück,« sagte sie einmal zu ihm, als er in seinem gelbseidenen, blau und grün geblümten Schlafrock vor ihr herumsprang und aus allen Winkeln der Welt- und Naturgeschichte Epitheta zum Preise ihrer Schönheit zusammensuchte, – »welches Glück, mein Sturmius, daß du kein schöner Tenor bist, sondern ein häßlicher, der häßlichste aller Musikanten. Wie schrecklich, wenn du eine Adlernase hättest.«
»Schweig! Es ist nicht zum Ausdenken!« rief Sturmius und schüttelte die Fäuste.
»Stell dir das groteske Elend vor, wenn du Locken hättest, Sturmius!«
»Absurditäten stelle ich mir nicht vor, Madonna! Es wäre aber mehr als absurd, es wäre in der Tat verhängnisvoll. Denn, hätte ich Locken und eine Adlernase, was wäre die Folge? Ich würde Lala lieben und nicht dich, denn Künstler lieben immer den Gegensatz. Was deine Schönheit liebt, o Perle von Juda, ist meine Scheusäligkeit. Ich bin ein verhuzelter, verkrumpelter Germane, ein stark Shakespearescher Witz des einäugigen Wotan, der übrigens auch kein Apollo[84] ist. – Darum liebe ich dich, die strahlende, gliederherrliche Jüdin, Jehovas seliges Meisterstück.«
»Denke dir: Wenn ich ein Kind von dir bekäme,« sagte nach einer nachdenklichen Pause Madame Sara.
»Dann lerne ich,« antwortete Sturmius, »auf meine alten Tage beten, daß es ein Sohn sei und keine Tochter. Denn er wird trotz deiner Schönheit ein häßliches Kind sein.«
Madame Sara dachte wieder eine Weile nach, dann sprach sie: »Auch ich will, daß es ein Sohn sei. Es ist nicht gut, wenn zwei so verliebte Gegensätze ein Mädchen in die Welt setzen.«
»Du redest so mütterlich, meine Halskette, – hast du einen Grund, so mütterlich zu reden?«
»Ich fürchte: Ja.«
»Du – fürchtest?«
»Ja ich fürchte. Ich will kein Kind. Schon der Gedanke irritiert mich. Ich käme mir degradiert vor. Eine Liebe, die – Folgen … das ist doch – gemein.«
»Ja gnädige Frau, es ist gemein.«
»Laß mich mit Schillerschen Doppelsinnigkeiten zufrieden, Sturmius; du weißt, für Schiller habe ich kein Organ.«
»Ich weiß, er ist für dich der Dichter der deutschen Turnvereine und Liedertafeln, und meine braune Venus von Jerusalem ahnt mit gutem Instinkte, daß vor dem Erze seiner Jamben einmal das Reich der Krinoline in den Staub sinken wird.«
»Wenn du von Bismarck reden willst, Sturmius, geh' ich.«
»So will ich von Bismarck spielen.«
Und Sturmius setzte sich an den Flügel und phantasierte über Beethovens Eroica.
Die Gleichgültigkeit, mit der Sturmius die Andeutung Saras aufgenommen hatte, beleidigte diese gar nicht. Sie fühlte dabei nur, daß der Maestro sie ebensowenig »liebte«, wie sie ihn, das heißt, daß ihr Verhältnis beiderseitig frei von aller Sentimentalität war – dies Wort ohne jede Abschätzigkeit gebraucht. Und das war ihr im höchsten Grade sympathisch.
Sie empfand es ganz deutlich: der häßliche Komponist huldigte ihrer Schönheit mit höchster Leidenschaft, ohne auch nur im geringsten im Gemüte beteiligt zu sein. Und nicht anders stand es um ihre Neigung zu ihm, nur daß sie seiner genialen Männlichkeit huldigte. Sein künstlerisches Temperament und sein scharfer Geist flößten ihr tiefsten Respekt ein, und sie empfand es als wollüstige Auszeichnung, daß er sie einer in glühende Erotik verdichteten Verehrung für würdig erachtete, die seiner Hingabe an die Kunst kaum etwas nachgab. Daß dieser Zustand nicht andauern würde, wußte sie wohl, und auch das war ihr recht. Sie hatte durch den gleichzeitigen Umgang mit den beiden Männern die feste Überzeugung gewonnen, daß sie sich nur in der Abwechslung ganz wohl fühlte.
Wie sehr sie sich dadurch von der ungeheuren Mehrzahl der Frauen unterschied, war ihr keineswegs unklar, und sie hatte auch Verstand genug, einzusehen, wie weit sie damit von der herrschenden Moral abrückte. Mit Sturmius konnte sie darüber von der Leber wegreden, und das erschien ihr als großer Vorzug des deutschen Künstlers vor dem russischen General, dessen Qualitäten auf einem ganz entgegengesetzten Gebiete lagen. Sie waren ihr nicht weniger gemäß, ja sie lagen ihrem eigenen Wesen als Frau näher. Aber sie war doch nicht so ganz Orientalin, wie der[86] Verehrer Asiens glaubte, sie war viel differenzierter, westlicher, als er ahnte, dem gegenüber sie sich von vornherein viel weniger enthüllt hatte, als dem Deutschen. Er kannte in ihr nur die Sulamitin, wie er sie sich ins alte Testament hineinkonstruiert hatte, aber sie war, ihm unbewußt, gleichzeitig gar sehr modern, im Sinne der Emanzipation des Fleisches durch das Gehirn, wie sie Heinrich Heine gepredigt hatte, den Fürst Golkow nicht anders zu nennen pflegte, als das »Genie der jüdischen Entartung.«
»Dieser Auswurf des Orients, dieser Teufel in Judengestalt, ist von der Vorsehung dazu bestimmt gewesen, das ganze Talent seiner Rasse zu keinem anderen Zwecke zu verkörpern als zu dem: Die Deutschen zu demoralisieren und dadurch reif zum Untergange durch das Slaventum zu machen. Goethe, auch ein gefallener Engel, ist ihm darin vorangegangen, aber längst nicht mit so diabolischem Erfolg, denn Goethe war ein ästhetischer Hellene. Heine, indessen, war Juden-Grieche. Goethe konnte, bei allem Hellenentum, noch ein Gretchen fabulieren. Heine hat dieses Gretchen vergiftet, indem er es emanzipierte. – Und dieses Volk, diese Deutschen, erst durch Rom verdorben, dann durch Luther um jedes Gefühl der Religion gebracht, dann durch Kant bis zur Gasflüssigkeit in reine Vernunft aufgelöst, dann durch Goethe in griechische Formen vereist, durch Schiller aber wieder durch heiße Phrasen aufgetaut, daß sie wie Brei auseinander flossen, und schließlich von Heine mit allen Gärungsstoffen aus dem Sumpfe jüdischer Entartung durchsetzt, – dieses Volk von lauter Individuen will – einig, will ein ganzes werden. Es hat niemals ein lächerlicheres politisches Phänomen gegeben, und auch[87] Herr von Bismarck wird beim besten Willen nicht imstande sein, aus dieser Fata Morgana ein Gebilde von Realität zu machen.«
Auf solchen Umwegen pflegte der Verehrer Asiens auf die heilige Allianz zu kommen, die für ihn der letzte Gipfel europäischer, – nämlich asiatischer Politik war.
Zuweilen machte sich Madame Sara das Vergnügen, diese Gedankengänge, die sie nur mäßig interessierten, vor Sturmius auszubreiten, der sich darüber schief lachen wollte.
»O du güldne Posaune von Jericho,« rief er dann wohl aus, »o du lustig schmetternde! Nie bist du reizender, als wenn dein schöner Mund so greulichen Unsinn tönt!«
Dagegen nahm er ihre eigenen Ergüsse über ihre Ansichten von Liebe ohne Sentimentalität ernst.
»Solche Ansichten stehen dir zu Gesicht, und bei schönen Frauen kommt alles darauf an, wie es ihnen steht. Es wäre schlimm, wenn unsere deutschen Hausmütter so dächten; es wäre entsetzlich. Aber diese Gefahr ist nicht vorhanden. Fest steht und treu die Wacht am Ehebett. Du aber darfst und sollst verruchte Maximen haben. Eine Schönheit wie die deine würde gegen den Stil sündigen, wollte sie moralisch sein. Auch die große Dame von Babylon hat ihre Existenzberechtigung, und wir Künstler verdanken ihr unsere besten Informationen. Ach, es sind in eurem herrlichen alten Buche wundervolle Stellen darüber! Heute darf man so etwas nur in Musik sagen, – und das wird jetzt in Triebschen von dem größten aller Propheten besorgt.«
Und nun sollte Madame Sara ein Kind bekommen, von dem sie nicht wußte: ist es von dem, dessen Seele in Asien wohnt, oder von dem, der das Heil der Zukunft von Bismarck und Richard Wagner erwartet.
Im Brennpunkte der Leidenschaft zweier Gegenpole stehend und sich jedem, dem einen wie dem anderen, mit gleicher Leidenschaft zuwendend, hatte sie zuweilen das Gefühl eines Verhängnisses über sich, das ihr manchmal grell, manchmal düster, kaum je einmal in einem ruhigen Lichte erschien.
Doch kam das nicht häufig über sie.
Klar war ihr das eine: das Kind durfte ihr nicht unbequem werden, und von ihrer Mutterschaft durfte niemand erfahren, schon wegen der Gesetze ihres Staates nicht, das für eine Witwe, welche außerehelich gebiert, sehr fatale vermögensrechtliche Folgen festsetzte.
In Lalas Tagebuch stand, als der Dresdner Aufenthalt zu sieben Monaten gediehen war, dieses: »Sprach die helle Schwester: Laß uns das Kind in einen Binsenkorb tun, wie Mose, und den Wellen eines Flusses übergeben. Und Geld dazu und von den Vätern Geschenke. Hat es Glück, so wird die Tochter Pharaos es finden und zu Ehren aufziehen. Wir aber wollen es nur von weitem verfolgen und ihm beistehen, wenn es nottut.«
So alttestamentlich ging es indessen nicht zu.
Als die Zeit herangekommen war, daß es für Sara nötig schien, sich zurückzuziehen, nahm sie freundlich und gelassen von ihren beiden Dresdner Freunden Abschied.
Rührendes ereignete sich dabei nicht.
»Da du nicht wünschst, daß ich für unser Kind sorge, so darf ich dich nur bitten, ihm ein kleines Andenken stiften zu dürfen,« sagte Fürst Golkow, – »diese Bronze eines mit vorgelegter Lanze dahinstürmenden Kosaken. Es möge ein Symbol für sein Leben sein – zumal wenn es ein Junge ist.«
Maestro Sturmius aber bat sie, dem Kinde zum Andenken an seinen »ausgezeichneten aber leider mehr musikalischen als moralischen Papa« seinen schönsten seidenen Schlafrock mit auf den Lebensweg zu geben. »Denn,« so fügte er hinzu, »es gibt in jedem Menschenleben Augenblicke, wo ein seidener Schlafrock einem härenen Gewande vorzuziehen ist.
Sollte man finden, daß diese Erzählung eigentlich keinen rechten Schluß hat, so würde man mir damit nicht zu nahe treten, denn ich habe diese Empfindung selber gehabt. So sehr, daß ich einen ganzen Roman dazu als Schluß geschrieben habe: den Roman des Sohnes der schönen Sara, der zwar einen seidenen Schlafrock und einen reitenden Kosaken, aber keinen genau bestimmbaren Vater hatte, und der »Prinz Kuckuck« genannt wurde, weil er zeitlebens in fremden Nestern hauste.
Johannes Pauli, der ein Jude war, ehe er ein Barfüßermönch wurde, erzählt in seinem Buche »Schimpf und Ernst« die sonderbar düstre Geschichte eines Malers, der ein Monstrum war: halb Mensch, halb Roß, hausend im wilden Walde, aber mit hoher Kunst gar wunderbar begabt. Doch, wie seine Farben auch leuchteten, und wie meisterlich immer seine Zeichnung ging: was er gestaltete, hatte die scheusälige Grimasse seines Urhebers. Nicht einmal den Heiland vermochte er anders als mißgestalt zu schaffen, dermaßen, daß man ihn eher für einen Teufel als den Sohn Gottes habe ansehen müssen. Daher denn Christus selber ergrimmte und dem malenden Ungetüm erschien, ihm seine Schönheit zu zeigen und ihm ins Gemüt zu reden.
Daß er dabei gesprochen hat, wie es der Barfüßer berichtet: nämlich nicht anders als wie ein junger Herr, der, von seiner Schönheit eingenommen, die Leistungen seines Photographen nicht vorteilhaft genug findet, ist schwer zu glauben. Eher hat noch die Antwort des schlimmen Malers glaubliche Haltung: daß er nichts als Vergeltung übe an dem, der zuerst ihn als Scheusal geschaffen habe. »Wahrlich, wäre ich es mächtig, dir Härteres anzutun, als böse Bilder – ich tät's mit Lust.«
Da ergrimmte der Herr, nach des Mönchs Bericht, in großem Zorne und stieß mit seinen Händen das Malgerüst um, auf dem Samalio Pardulus stand, daß es ihn unter sich erschlug, und sprach: Talem perpetrat verdictam, qui per ipsam perdit vitam.
Hat dieser Johannes seinen Jesus recht gekannt? Hat er um den Maler Bescheid gewußt? Nein: er wußte weder von Gott noch von der Kunst.
Die Geschichte von Samalio Pardulus nach den Quellen und nach dem Geiste ist so:
Ja: Er war ein wildhäßlicher Mensch: über die Maßen lang und dürr, dazu schiefschulterig und lahm; und hatte einen lächerlich spitzen Kopf voll krausborstiger schwarzer Haare, die bis tief in die faltige Stirn hineingewachsen waren; aber keinen Bart um die schmalen, gleichsam verwelkten Lippen, und auch die gelben, schlotterigen Wangen waren ganz bloß, wie bei einem Kinde. Dafür lagen wie zwei dicke Raupen, die sich ineinander verbissen haben, dichte, stachelige Brauen über den kugelig hervorstehenden braungrünen Augen, und seine knochigen, langen Hände waren dicht behaart. Auch aus den viel zu großen und abstehenden, dabei pergamentfarbenen Ohren wuchsen Haarbüschel heraus, und nicht minder aus den abscheulich weiten Öffnungen der Nase, die im übrigen übermäßig lang und an der Spitze schnabelartig überhangend war. Ein Roßmensch war er aber nun doch nicht und lebte auch nicht eigentlich im Walde, sondern in einer der Burg an Burg, Turm an Turm wie aus Zyklopenquadern zusammengehäuften Städte des Albanergebirgs: zu jener Zeit, da es niemals Frieden gab, sondern[92] immer der Krieg den Rachen offen hatte, sei es, daß unter den Geschlechtern Streit war, oder zwischen diesen und den Bürgerlichen.
Indessen lebte man darum keineswegs traurig, sondern, ob auch in steter Unsicherheit, mutig, ja lustig dahin, immer darauf gefaßt, dem Leben schnell Lebewohl sagen zu müssen, aber entschlossen, bis zum Ende des großen Abenteuers frisch und derb zuzulangen nach allem, was Gott oder Teufel auftafelte. Zwischen Laster und Tugend, Tod und Wollust, Kampf und Schmaus aber gingen in Kapuzen und Sutanen Mönche und Priester dunkel umher und hatten für alles ihre lauten und leisen Worte, und in den Kirchen knieten Freund und Feind nebeneinander, mit den Nüstern schwülen süßen Weihrauch atmend, mit den Ohren Geheimnisse vernehmend aus herrischen, aber wie auf Wolken göttlicher Verheißung schwebenden Tönen, und mit den Augen umfangend die königlich strenge, jedoch auch mütterliche, jedoch auch bräutliche Schönheit der goldumloderten Madonna.
Samalio Pardulus, seinem eigentlichen Namen nach der Sproß des ältesten und mächtigsten Geschlechtes der Stadt, das sich auf altrömischen Ursprung zurückführte, war weder bei den Rittern noch bei den Geistlichen, weder bei den Kämpfen noch bei den Schmäusen: war auch in der Kirche nicht zu sehen. Er nahm nicht teil am Leben seiner Tage, war im Gefühle tot für alles, was jenen Menschen Glück oder Unglück hieß. Und hatte auch nicht Freude an sich selbst.
Kannte nur eine Lust: allein zu sein und um sich herum eine neue Welt zu bilden aus Gestalten seiner Einbildung, der eine starke Kraft zu Gebote stand, sich in Bildern darzustellen.
Das Handwerk hatte er von einem Manne aus Florenz gelernt, der, aus der Heimat um Parteifeindschaft willen vertrieben, der Geheimschreiber seines Vaters geworden war: ein schweigsamer Mensch, dessen Augen voller Klage und Heimsucht waren. Was dieser mit Pinsel und Farbe vermochte, hatte er auch bald vermocht. Aber er wollte mehr. Denn jener, der das Malen nur erlernt hatte, um sich, da er noch reich und ein großer Herr gewesen war, müßige Stunden zu vertreiben, malte nur, was die Meister seiner Vaterstadt schon einmal gemalt hatten, und er gedachte gar nicht, es ihnen gleich zu tun, oder gar mehr als sie. Indem er malte, dachte er an Florenz und schuf sich ein blasses Abbild des Schönen, daraus er vertrieben worden war. Samalio Pardulus aber (wir wissen nicht, welche Bewandtnis es mit diesem Namen hat) hatte keine Kunst fremder Meister gesehen (denn die schlechten Bilder in den Kirchen und Häusern seiner Stadt waren nicht meisterlich), und so gedachte er an nichts Fremdes: nur an das, was in ihm selber war und das er innerlich sah als etwas ganz ihm Eigenes, nicht zugespiegelt aus fremder Kunst, am wenigsten der seines Lehrers. Seine innerlichen Gesichte aus sich herauszustellen, die schwankenden fest, die verwehenden dauerhaft zu machen, war sein Begehren.
»Daß ich Genossen hätte, male ich,« sagte er einmal zu seinem Lehrer, »ich male, daß ich nicht ganz allein sei. Könnte ich nicht malen, so würde ich mit Huren Kinder machen: aber mit den schamlosesten und wüstesten. Ja mit Tieren, wenn es die Natur zuließe. Nur, daß ein anderes Volk um mich herum wäre als dieses, das mir greulich fremd ist.«
Messer Giacomo, der weder solche Worte vernommen, noch Bilder gesehen hatte, wie die seines wüsten Schülers, und dem es eine Art schreckhaften Ergötzens war, in der Langenweile seiner Verbannung sich mit dem »mostro« zu beschäftigen, schrieb in seinem (übrigens langweiligen, weil gar zu eintönigen) diario, das man später im Archive des Schlosses Certaldo alto aufgefunden hat, als das alte Gemäuer in den Besitz des Staates überging, getreulich alles auf, was er »nella selva«: im Walde draußen beim »centauro«, wie er seinen Schüler nannte, sah und hörte. Es scheint, daß er später in seine Heimat zurückgekehrt ist und in jenem Schlosse zwischen Florenz und Siena seine Tage beschlossen hat. Unter den über dem Schloßportale heute noch sichtbaren Wappen der verschiedenen Geschlechter, die einander im Besitze von Certaldo alto folgten, befindet sich auch das seine. Weiter wissen wir nichts von ihm. Wenn aus dem übrigen seines Tagebuches nicht hervorginge, daß er ein grundnüchterner Mann gewesen ist, der sich nicht mit Phantasiebeschäftigungen abgab, sondern, seine kleine Pinselliebhaberei abgerechnet, ganz in den realen Interessen aufging, die ihn zum tätigen Parteimann machten, so könnte man glauben, er habe sich diesen Samalio Pardulus erfunden, gewissermaßen, um sich auch als Poeten zu versuchen. Aber die Art, wie er den Äußerungen des seltsamen Menschen (gemalten wie gesprochenen) immer den Kommentar eines unerschütterlich mittelmäßigen Besserwissertums und biederer Philistrosität anhängt, läßt diesen Verdacht nicht aufkommen. Wir dürfen, wie wunderlich auch das meiste erscheinen mag, was er berichtet, mit Sicherheit annehmen, daß der Herr von Certaldo alto den »Zentauren« wirklich und leibhaftig gekannt, jene wilden Bilder gesessen[95] und alle die Worte vernommen hat, die er, stets mit Äußerungen des Entsetzens, mitteilte.
Wir folgen seinen Aufzeichnungen in allem wesentlich getreu und nehmen nur da das Recht in Anspruch, aus seinen tadelnden Kommentaren das Bild des »Scheusals« in einem Sinne zu ergänzen, der mit Messer Giacomos Meinungen nichts gemein hat.
Einiges sei in wörtlicher Übertragung hergestellt. So, was der Toskaner über Samalios Kunst und Wesen im allgemeinen sagt: »Es ist ein sonderbares Ding um die Kunst dieses ungebärdigen Menschen. Sie ist voller Lästerung des Lebens, das in ihr nicht von Gott zu sein scheint, sondern vom Teufel. Malt er den Wald (wie er insonders gerne und nicht ohne Geschick tut), so ist es, als ob die Bäume ein jeder dämonisch besessen wären; kein Pflanzenwesen, sondern ein Tier, und alle zusammen sind wie eine Versammlung von Gespenstern, daß man sich fürchtet, in das Dunkel hineinzusehen, das wie aus ihnen innerst herauskommt: aber nicht schwarz, sondern bräunlich. Er hat, genau wie sie um sein Kastell im Felsgebirg stehen, Pinien gemalt, als welche doch freundliche Bäume sind, von edler Liniatur und eigentlich wohltätig, da sie von oben Schatten geben, aber, des fehlenden Unterästichts halber, der Luft den Weg nicht sperren. Bei ihm aber sind sie Ungetüme, die mit borstigen Schädeln widereinander rennen. Nicht so, als ob er ihnen Gesichter malte. Das wäre am Ende lustig. Sondern es sind Schädel von Riesen, die noch niemand sah, von Riesenwesen aus Baumart und doch tierisch. Sie sind bös und alle untereinander feind. Es ist, als ob sie sich gegeneinander stemmten mit diesen wilden Köpfen, daß[96] sie so, ihre Kräfte vereinigend, mächtig würden, ihre Stämme aus dem Erdreich zu reißen. – Nicht anders macht er es mit Tieren und Menschen. Gott schuf sie, wie wir alle sie sehen. Dieser Ungestalte bildet sie ungestalt. Seine Pferde sind langhaarig wie Ziegen, und man möchte zugleich glauben, daß sie auch von Ebern stammten. Nie malt er sie anders als rot und schwarz gefleckt. Doch eine Schimmelstute hat er gemalt, das schamloseste, das je erdacht worden ist: ein Pferd mit Menschenhaut, ganz ohne Haar, bis auf eine Stelle, die er zum Mittelpunkte des Bildes gemacht hat. Das Tier, das Menschentier, biegt den Hals in einer schmerzhaft-unmöglichen Linie um und wendet so dem erschreckten Betrachter seinen Kopf zu, der zwar der Kopf eines Pferdes ist, aber so mit den Zügen eines Weibes vergattet, daß man die Augen niederschlagen muß. Denn es lacht auf eine schändliche, buhlerische und doch höchst klägliche Art. Es hat entzündete blaue Augen. Dafür hat er ein Weib gemalt mit dem Fell einer blau und schwarz gestreiften Katze. Dieses Weib reitet auf einem Manne, der das Zottelhaar eines weißen Schäferhundes hat und vorstehende Raffzähne gleich dieser Hundeart. Es reitet verkehrt auf ihm, sich mit beiden Händen an die buschige Rute ankrallend. Und der Hund-Mann hebt den Kopf nach Art eines heulenden Rüden, der die Matz wittert.
Fragte ich ihn, was alles dies bedeute.
Antwortete er: »Nicht weniger und nicht mehr als das, was eure Welt ist: meine.«
Sagte ich ihm: »Das heißt Gott höhnen.«
Antwortete er: »Niemand höhnt Gott mehr, als Gott sich selber verhöhnte, wie er den Menschen nach[97] seinem Ebenbilde erschuf. Schaut mich an und sprecht: Sieht so Gott aus?«
Schwieg ich aus höflicher Rücksicht.
Lachte er (was nun bei ihm Lachen heißt: ein Zucken um die Mundwinkel) und sprach: »Oder, wenn ihr ins Glas seht: seht ihr Gott gespiegelt?«
Entgegnete ich (mit gerechtem Fuge streng): »Nicht also ist jenes Wort der Schrift gemeint. Gott ist das vollkommen Schöne: wir nur unvollkommene Abbilder, verzerrt obendrein durch die Erbsünde und den Fluch darauf.«
Lachte er nochmals (und ganz abscheulich), also sprechend: »So wäre Gott ein Stümper oder hätte getan, was ich tue.«
Ging im Gemach herum und rieb sich die Hände, daß es knackte, wie Holzscheite. Blieb plötzlich stehen und sah mich mit verkniffenen Augen an. Und schrie: »Der Fluch! Die Sünde! Was heißen diese Worte? Daß er Fratzen braucht, sich zu vergnügen: Euer schöner Gott! Denn (und das sprach er leise, gar ernsthaft) als Stümper ist er nicht zu denken.«
Warf sich ins Gestühl und starrte ins Deckengebälk, dorthin, wo der greuliche Leuchter hängt, den er in der Grabhöhle der Heiden gefunden hat: ist als eine große Sonnenblume gebildet, aber jedes Blatt hat die Form der weiblichen Scham, daß jede Kerze, darein gesteckt, zum Phallus wird.
Saß lange schweigend, bis er sprach: »Nein, kein Stümper. Sondern wahrlich Gott: wahrlich Künstler. Und wir bloß Affen seiner Kunst. Aber (und dies rief er wieder laut, hell, wütig, indem er aufsprang): Alles dürfen wir, was er darf: alles. Und sind ihm um so ähnlicher, je mehr wir die göttliche Freude an[98] der Fratze haben: diese Freude des großen Zorns, aus dem allein die Lust des Schaffens kommt. Denn die Liebe ist das Ekelhafte, ist das Sichbegnügen mit dem, was da: was langweilig, immer das gleiche, verflucht und noch einmal und in alle Ewigkeit verflucht das gleiche ist. Vulva und Phallus. Das ist für die Herde: im Schweinekoben und im Fürstenbette dasselbe. Aber einigen ist es gegeben, sich wie Gott selber zu vergnügen, weil sich Gott in ihnen am meisten vergnügt, da sie die vollkommensten Fratzen seiner selbst sind. Das sind die Künstler. Sie wissen, daß Gott die Welt nicht aus Liebe erschaffen hat, sondern aus Not … Gott! Was ist Gott? Was … wäre Gott? Gott wäre die Einsamkeit.«
Trat ganz nahe an mich heran, und seine Augen waren fürchterlich, als er sprach: »Vernehmet, Mann aus Toskana, und bewahrt es wohl, denn es ist die Wahrheit: Gott war tot, als er die Welt schuf. Als er lebte, war nichts um ihn: Er war das All, die unbewegte Leere, das vollkommene Nichts, das ist: das einzig mögliche vollkommene. Doch wäre er nicht Gott: nicht Geist gewesen, wenn ihm diese Ewigkeit, diese scheußlich vollkommene Ewigkeit genügt hätte. Es kam die Not des Wollens über ihn, und er beschloß, zu sterben, daß aus seinem Tode die Welt, aus seiner Einsamkeit die Vielheit des Lebens würde: nicht anders, als wie aus einem Leichnam Würmer werden.«
Ich entsetzte mich über diesen Unflat schändlicher Einbildung, schlug dreimal das Kreuz und erhob mich, zu gehen. Er aber legte seine beiden harten Hände auf meine Schultern, daß mir nicht anders war, als wenn Satanas mich verderben wollte, und drückte mich ins Gestühl.
Und sprach: »Höret nur weiter! Es ist nicht gut, die Wahrheit halbet zu vernehmen. Auch ist nicht gottlos, was ich Euch sage. Denn seht: ob Gott auch tot ist: die Welt ist dennoch göttlich, da sie von ihm ist. Zwar sind die Kreaturen nur Würmer, die von seinem Tode leben, aber es ist doch göttliche Nahrung, die sie erhält.«
Ich raffte mich auf und verwies ihm sein Gerede, indem ich ihn einen heidnischen Sophisten hieß.
Er schüttelte den Kopf: »Was mich von Eurer Art Christen unterscheidet ist nur, daß ich von Gott einen zu göttlichen Begriff habe, um vermeinen zu können, daß diese langweilige Welt des ewig Gleichen sein Leben umfassen oder ausdrücken könnte. Ich denke von Gott so hoch, daß mir sein Totes noch göttlich genug deucht für unsereins, ja als das einzig Göttliche, das wir vertragen können. Gott und Welt: Einsamkeit und Leben verträgt sich unmöglich. Und seht doch: Ist das nicht christlich gedacht, daß er für uns starb? Und was sage ich mit den Würmern anders als dies: daß er uns die Erbsünde vermacht hat?«
»Ihr spottet,« rief ich laut, »und spottet Euch um die ewige Seligkeit!«
»Damit ist es freilich nichts,« sagte er ernsthaft, »denn Gott hat sie selber aufgegeben: auch er vermochte es nicht, sie zu ertragen. Das war ja seine Not, die ihn zu sterben, als Gott zu sterben und im Gewürme weiterzuleben zwang. Die große Not der Langenweile war es. Jetzt ist er ihrer ledig. Der tote Gott vergnügt sich in der Vielheit von Fratzen, in denen er lebt: und wenn es auch gewiß ein zorniges Vergnügen ist, so ist es ebendarum göttlich. – Hier, bei mir (er wies um sich), hier in mir (er schlug sich auf die[100] Brust) ist ihm am wohlsten. Denn meine Welt ist nach seinem Rezept gemacht, und ich sterbe gleich ihm einen Tod der zornigsten Not.«
Indem er dieses sagte, war mir, als ob in seinen Augen etwas glömme: ich weiß nicht, war es Wahnsinn oder Begeisterung.
Die Madonna sei ihm gnädig! Er spricht nie von ihr, und, ob er sich mit seinem Malgeräte auch an allem vergreift, was uns heilig, ihm aber nur ein Anlaß zu schändlicher Fratzerei ist: sie malt er nie.«
Das Kastell, in dem Samalio die meisten seiner Tage und Nächte verbrachte, lag abseits der Stadt auf gewachsenem Fels, in den Terrassen eingehauen waren. Aber bis nahe dorthin, wo der Stein sich nackt emporhob aus dem Erdreich, stand starker Wald: Steineichen, Pinien; auch Zypressen und Kastanien. Es waren mächtige, herrische Bäume, die es nicht duldeten, daß Kleines neben ihnen aufkam. Nur der Blitz durfte die Riesen fällen oder das Alter. Dann wuchs aus ihrer Fäulnis das Neue. Es gab allerlei wildes Getier dort: vornehmlich Wildkatzen und Luchse, am allermeisten aber Geier und Eulen. Nachts, so berichtet der Toskaner, war es lauter um das Schloß, als bei Tage. Denn, so sagt er: »Da es dunkelte, wachten die Räuber auf, denen tagsüber selbst der finstere Wald zu helle war, und riefen einander oder kreischten auf beim Mord: der Luchs, heulend wie ein Wolf, der rote Wildkilling, tückisch jaulend; aber am fürchterlichsten die große Ohreule mit ihrem tiefen u-hu, das wie Klage tut, aber Blutgier ist.«
Doch behagte gerade dieses Nachtkonzert der Unholde dem Mißgestalteten, der von sich behauptete, gleich Luchsen, Katzen, Eulen nachts besser zu sehen als bei Tage, weshalb er sich erst bei Tagesgrauen zur Ruhe begab und bis zum hohen Mittag schlief.
»Die braune Nacht,« so sagte er, »hat tiefere Farben, als der milchige Tag. Sie schillert nicht, sie glüht. Ihr Braun ist eigentlich altes Gold, gemischt mit dem Rot geronnenen Blutes. Auch ist ein tiefes Veilchenblau dabei. Zuweilen haben alle Konturen tief purpurne, zuweilen tief orangenfarbene Lichtabgrenzungen. Auch Schatten gibt es noch in der dunkelsten Nacht: sie sind das Wunderbarste an Farbe; aber auf der Palette gibt es dieses Braun der tiefsten: ganz schon geistigen Tiefe nicht. Es ist, als ob die Nacht dieses Braun träumte.«
Er malte nur in diesen, nur von ihm gesehenen Nachtfarben, und so darf man es dem Toskaner glauben, daß Samalios Bilder waren »wie aus einer anderen Welt, die das Licht nicht von unserer Sonne hat: man mußte glauben, sie hatten es aus den Augen dieses Nachtmenschen, der, obzwar bei Tage (doch nur in der Dämmerung) malend, immer nur nächtige Bilder schuf, als ob es keinen Tag gäbe. Indessen waren unter seinen Tafeln solche, in denen eine unbeschreibliche dunkle Glut bebte, vergleichbar dem Lichte, das in manche Edelsteine eingeschlossen zu sein scheint, die noch im Finstern leuchten.«
Danach könnte man meinen, daß Messer Giacomo die Bilder Samalios in den Farben schön gefunden habe. Doch weit gefehlt. Er nennt ihre Farben bald »höllisch«, bald »grausam«, dann einmal »blutrünstig«, wieder einmal »schändlich geil«, einmal sogar »himmelschreiend[102] bäuerisch und barbarisch, ohne jedes Gefühl für Feinheit und Würde«. Sie »tun dem gebildeten Auge weh und rufen Angst und Schrecken hervor, anstatt daß sie erheitern«.
Der Toskaner hatte von sich aus zweifellos recht, aber ebenso zweifellos ist, daß Samalio nicht gemalt hat, um Messer Giacomo zu erheitern. Es lag ihm nicht einmal daran, daß der Herr von Certaldo alto sie ansah. Wir wissen es von diesem selbst, daß er stets ungeladen das Kastell besuchte. »Ritt wieder einmal zur Zentaurenburg, um mir die Grillen zu vertreiben. Wurde übel empfangen, sah aber doch Neues. Wie immer: Greuel über Greuel. Die große Tafel aber will er noch immer nicht zeigen.«
Von dieser wird noch zu handeln sein.
Vorerst möge aus des Toskaners Aufzeichnungen zusammengestellt werden, was etwa weiter dazu dienen kann, uns einen Begriff vom Wesen und Leben dieses wunderbaren Menschen zu vermitteln.
Aus diesen Notizen fügt sich das Bild eines Précurseurs des Rinascimento, jedoch ohne die bewußte Tendenz zur Antike.
Alle geistigen Strömungen bereiten sich vor: versuchen sich gewissermaßen in unzeitgemäßen einzelnen. Ehe sie zum Schicksale einer Zeit: ehe sie Epoche werden, treten sie gewissermassen als Ferment in den Schicksalen einzelner auf, die damit zur Einsamkeit verurteilt sind und, meist ohne jede sichtliche positive Wirkung, eine Bestimmung erfüllen, deren Sinn wir nicht begreifen.
Er hat dies selbst gefühlt. Eines Abends sagte er zu seinem Lehrer, der ihm berichtet hatte, daß das Volk ihn für einen Zauberer hielte: »Bin ich etwa[103] keiner? Lebe ich nicht das Kommende voraus? Ist es nicht Zauberei, daß ich bin, als wäre ich mein Urenkel?«
»Wie das?« fragte der Toskaner.
Und Samalio antwortet: »Jeder von Euch hat den Glauben des anderen; jeder von Euch ist Nachbar: Stütze und gestützt; keiner von Euch ist frei: eine Kraft für sich. Ihr seid alle durcheinander bestimmt und findet das füglich. Selbst die gewalttätigen, die sich Herren heißen, handeln mit Rücksicht auf andere, sei es auch nur, daß sie über andere herrschen wollen. Für mich gibt es keine anderen. Ich kenne Euch nicht. Ich kenne nur mich. Ich bin so weit von Euch entfernt, wie von den Menschen, die den Turm von Babel bauten. Ich habe einmal davon gehört (als ich ein Kind war), daß es Menschen gibt außer mir, aber ich habe einsehen gelernt, daß das ein Irrtum ist. Dieses Märchen ist nur wahr für die, die keine Wirklichkeit in sich haben. Wer sich begriffen hat, weiß, daß er allein ist.«
»Als ich dies hörte,« fügt hier der Toskaner bei, »war mir einen Augenblick wahrlich zumute, als sei dieser Wahnsinn Wahrheit. Daran waren die (Gott verzeih' mir die Sünde) verfluchten Augen des Scheusals schuld, deren Blicke mich wie glitzernde Fäden umspannen. Ganz sicherlich: er ist mit dem Bösen im Bunde. – Aber ich machte mich frei und rief: Wie? Denkt doch an Euren Vater, an Eure Mutter!«
Darauf hat Samalio erwidert: »Vater und Mutter sind nicht außer mir, sondern in mir, und nicht nur sie, sondern alle, von denen sie gekommen sind. Und nicht nur die, sondern alle Menschen, die je waren.[104] Dies eben ist es, Mann: wer wirklich Einer ist, ist Alle, – und braucht darum Keinen.«
Trotzdem berichtet Messer Giacomo, daß Samalio »von einer entsetzlichen Liebe« geplagt worden sei.
»Alle wissen es,« schreibt er, »und alle verabscheuen ihn darum noch mehr als um seiner Scheußlichkeit willen: daß er in unziemlicher Liebe entbrannt ist gegen seine leibliche Schwester Bianca Maria, die so schön, wie er häßlich ist. Sie wäre wert, daß man nach ihrem Antlitz die Madonna malte, denn auf ihm ist alle Holdseligkeit und Schöne vereinigt. Zweierlei nimmt mich wunder: daß diese beiden Geschwister sind, und daß er, das Ungetüm, es wagt, seine Blicke zu ihr zu erheben, deren Schönheit ihn, meine ich, doch eher mit Haß und Neid erfüllen müßte. Gepriesen sei Gott, daß das engelhafte Mädchen ihn verabscheut. Man sagt (und ich erachte es nicht für unmöglich, obwohl es nur ein Gerede ohne sichern Anhalt ist), daß er sie nachts in ihrer Kammer überfallen habe: doch ohne seinen nichtswürdigen Zweck zu erreichen, denn sie habe ihm mit dem großen Kruzifix, das über ihrem Bette hängt, einen Streich quer über die Stirne versetzt, wovon er (was ich selber wohl gesehen habe) eine tiefe Wunde davontrug. Und folgenden Tages (was wiederum zutrifft) sei er aus der Stadt gewichen, und seither rührt sein dauernder Aufenthalt draußen im Walde. Sie aber ist seitdem verzagt und seltsam schüchtern, derart, daß sie aller Männer Antlitz flieht; und hat sich ohne Widerrede auf Geheiß ihres Vaters einem Edelherrn aus der Nachbarschaft verlobt, dessen Antrag sie vorher zurückgewiesen.«
Es findet sich (begreiflicherweise; denn darüber hat Samalio sicherlich nie gesprochen) in dem Tagebuche[105] des Toskaners keine Äußerung des Malers über seine Schwester. Doch ergeben sich bei genauerem Zusehen Zusammenhänge, die dem Berichterstatter offenbar nicht zum Bewußtsein gekommen sind.
Wir finden folgendes: »Fragte ich den Zentauren, warum er nicht die Madonna malte.«
Antwort: »Weil es unmöglich ist.«
Wiederfrage: »Haben es doch schon Tausende getan?«
Antwort: »Weil sie sie nie gesehen haben.«
Ich: »So hättet am Ende Ihr sie gesehen?«
Er: »Wohl.«
Tat ich erstaunt und fragte: »Ei: im Traume?«
Antwortete er: »Es ist kein Unterschied zwischen dem, was ihr in Traum und Wirklichkeit spaltet.«
Sagte ich: »Nun: man träumt im Schlafe und sieht wach.«
Betrachtete er mich erstaunt: »Und der Unterschied?«
Ich konnte es ihm nicht erklären, oder, wie ich besser sage: er stellte sich an, als begriffe er nicht, was doch auf der Hand liegt (wie es denn immer seine Art ist, Selbstverständliches unverständlich zu nennen). Also blieb mir verhohlen, wie das mit der Madonna gemeint.«
Ein andermal: »Fand ihn vor einem gar schändlichen Bilde. War der Christ am Kreuze zwischen den beiden Schächern. Es graute mir, als ich sah, daß er sich selbst als den Gekreuzigten gemalt hat, aber, so dies möglich, noch scheusäliger, als er wahrlich ist. Und war über und über voll Blutrunst. Hing ihm aus der Wunde vom Spieße des Lanzknechts geronnenes Blut traubendick und von der[106] Schulterwunde wie rote Maiskolben. Saß im Brusthaar wie Grind. Hatte sich im Schamtuch ekel gesackt. War wie der geschundene Marsyas.«
»Dies ist nicht Jesus,« schrie ich auf, »dies ist der Teufel Oberster, den Ihr vor dem Spiegel gemalt!«
Denn ich war sehr zornig. Er aber schien keineswegs beleidigt, sondern lächelte und sprach: »Wisset Ihr nicht, da Ihr ja doch auch mit Farb und Pinsel hantiert: daß jeglicher nichts malen kann, als sich selbst? Wenn ich spreche, so bin ich der Ton; wenn ich sehe, ist's mein Gesicht; mal ich, so kommt nichts auf die Tafel als immer ich. Da ich nur ich sein kann, was könnte anderes von mir kommen als ich? – Christus! Wer ist das? Immer der, der ihn fühlt, von ihm redet, ihn malt. Was schüttelt Ihr Euch und tut entsetzt? Kennt Ihr die Schrift nicht? Wisset Ihr nicht, daß er sich allen gegeben hat? Nun: so auch mir. Und dieser da (er wies zur Tafel) ist wahrlich der meine, so ganz und gar, daß wir beide ein und derselbe sind.«
Daß ich es gestehe: ich bebte vor großem Zorn, und ich rief: »Von Sinnen seid Ihr, und ich müßte Euch vors geistliche Gericht bringen, wüßte ich nicht, daß Wahnsinn aus Euch phantasiert.« Er fuhr sich durch sein stachelig Haar und murmelte etwas, wovon ich nichts verstand als: Noch nicht, noch nicht!
Dann sagte er, ganz ruhig: »Mensch! Mensch! Weißt du nicht, daß alles Große Wahnsinn ist? Als die Liebe Wahnsinn wurde, schlug man sie ans Kreuz. Holla! Seitdem ist sie tot. Nun ist Raum für den Zorn … Doch das versteht Ihr nicht. Sonst würdet Ihr's aus meinem Bilde lesen, darauf es deutlicher steht als auf allen anderen Tafeln des crucifixus. Doch[107] steht es auf allen: selbst den ganz lästerlichen: die da lächeln.«
Mit einem Male schien es, als wollte er mir zu Leibe. Er schritt auf mich zu, die kleinen Augen so verkniffen, daß die Blicke aus einem Schlitze schossen, stieß mir die Faust auf die Brust und schrie: »Tolle Hunde haben mehr Gefühl für das Opfer auf Golgatha als Ihr, die Ihr aus einem Löwen ein Lamm gemacht habt. Es tut Euch wohl, sein blutiges Vließ zu krauen. Es tut Euch wohl, Wasser aus den Augen zu lassen über den, der Blut aus seinem Leibe ließ für Euch. Es tut Euch wohl, aus dem Größten eine Puppe gemacht zu haben, damit Ihr spielen könnt!«
Ich wollte gehen. Aber er hielt mich fest. Und schleppte mich zu dem großen verhangenen Bilde. Dort ließ er mich los und stieß mich in einen Stuhl.
Und sprach: »Hast du vernommen, daß nachts Geister kommen, mich zu besuchen?«
Ich hatte es vernommen und antwortete so, fügte aber hinzu, daß ich es nicht glaubte.
»Es ist!« rief er.
Ich schlug das Kreuz.
»Laßt den Gestus!« sagte er ruhig. »Der Geist, der zu mir kommt, ist nicht höllisch. Christus selber ist hier jede Nacht und mit ihm die Madonna.«
Gott verzeihe es mir und alle seine Heiligen, daß ich dem Scheusal nicht in seine Lästerfratze spie, sondern bloß, aber unerschrocken, sagte: Das lügt Ihr!
Da sah er mich groß an und ergriff den Zipfel des Vorhanges und sprach: »Knie nieder!«
Ich glaubte nicht anders, als er wollte mich heißen, den Teufel anbeten und weigerte mich des.
»Knie!« knurrte er und griff nach dem Dolche.
»Die Sünde kommt auf Euch,« stöhnte ich und ließ mich auf die Knie nieder, Gottes Hilfe herbeirufend durch fleißiges Kreuzschlagen.
Als ich die Ringe des Vorhanges kreischen hörte, senkte ich den Kopf und schloß die Augen feste, ja nichts zu sehen. Und war des Bestimmtesten entschlossen, nicht freiwillig Kopf und Blick zu erheben.
Mir ist, als hätte ich lange so auf den Knien gelegen, die Augen also feste zugedrückt, daß vor den geschlossenen goldene Sterne und Scheiben tanzten. Auch rann mir Schweiß von der Stirne über die Lider, und es war, als wollte er mir die aufbeizen, da er in die Augen drang mit seiner Schärfe.
Dies weiß ich jetzt. Da ich aber voller Ängste lag, glaubte ich, es fräße höllisches Feuer an ihnen. Und ich wimmerte sehr.
Erst als ich seine Schritte von mir gehen hörte, wurde mir etwas mutiger. Ich hob den Kopf, jedoch nach rückwärts gewandt, dorthin, wo der Schreckliche nun in einem Stuhle saß und über mich weg zu dem Bilde blickte: die rechte Hand über die Augen schirmend, wie Maler ihre Tafeln aus der Ferne anzusehen pflegen.
Und er murmelte, als sei ich gar nicht da:
»Es will nicht glühen, wie in der Nacht. Die Purpurspitzen ihrer Brüste sind noch tot. Das Fleisch ist viel zu hell. Im Haar zu wenig Brand noch. Als meine Hand darüber fuhr, hat es geknistert. Das dort ist Werg, nicht Leben. Sonst … ist … sie … schön.«
Er atmete schwer und laut und ließ die Hand sinken. Und merkte nun mich, stand auf und schritt schnell her, griff über mich weg und riß den Vorhang wieder vor das Bild.
»Steh auf!« herrschte er mich an. »Danke deinem Gotte, daß er dich davor bewahrt hat, das zu sehen, was meine schamlose Raserei dir enthüllt hat. Denn wisse: auf dieser Tafel ist die Madonna in Wahrheit, vom nackten Leben leibhaft, geisthaft hergerissen mit der Brunst meines Auges. Würdest du sie gesehen haben, hätten dich diese meine Hände erwürgt. Und nun geh und schrei es auf den Gassen aus, daß Samalio Pardulus die Madonna nackt gemalt hat, reitend auf einem Zentauren mit den Zügen ihres Sohnes, der ihr Bruder ist. Und daß er mit ihr wegsetzt vom steinigen Felsen Golgatha über einen Abgrund voller Blut, aus dem die Spitzen von Domen ragen zu einem Schlosse von veilchenfarbenem Amethystquarz, bewacht von den Tieren der Apokalypse, und daß dieses Schloß der Sarg Gottes ist, in dem Samalius wohnt und wacht, daß keine Würmer zu ihm kommen.«
Man darf es dem Florentiner glauben, daß er nach diesen »Worten das Weite gesucht hat, wie einer, dem der Böse auf den Fersen ist.« Trotzdem hat er nicht den Angeber gespielt und seine Erlebnisse niemandem vertraut, als den Blättern seines Buches.
Aber auch ohne seine Mithilfe wurde es ruchbar, daß nächtlicherweile Unheimliches sich begab auf dem Schlosse im Walde.
Da Samalio nachts niemand bei sich hatte als einen alten halbblinden und ganz stummen Diener, so konnten die Gerüchte nicht aus dem Schlosse kommen. Sie entstanden in der Stadt selbst, im Hause der Eltern des Malers.
Seit diese wegen der bevorstehenden Hochzeit der Tochter zu mächtigen Verwandten des Bräutigams nach Rom gereist waren, ging es im Palazzo Nacht[110] für Nacht um. Unnötig, all das zu erzählen, was die erschrockene Dienerschaft allnächtlich gesehen und gehört haben wollte. Übereinstimmend wurde dies berichtet:
Allabendlich, sobald es ganz finster geworden war (man befand sich im Dezember, und es war ein nebliges Wetter ohne Mondschein), kam den steilsten Steg zur Stadt heran, den sonst nur die Ziegenhirten nahmen, ein riesiges schwarzes Pferd, auf dem ein hagerer Mann saß, gehüllt in einen schwarzen Mantel, auf dem schwarzbärtigen Kopfe einen breitkrempigen Kegelhut. Man hätte, wäre nicht der Bart gewesen (und das andere, das nur Gespenstern eigen ist), meinen können, es sei Samalio. Doch war es sicherlich ein Gespenst, denn aus dem Mantel, daher, dorther, und von seinen Schultern leuchteten gelbe Lichter, und grüne Lichter liefen neben dem Pferde. Der Wachtturm des Hauses, das wie alle Häuser der adeligen Geschlechter mehr eine Burg als ein Palast war, stand auf der Stadtmauer, und auf seinem Umgang befand sich, wie auf den eigentlichen Mauertürmen, die ganze Nacht hindurch ein Wächter. Nur er konnte die Erscheinung verfolgen, sobald sie der Mauer nahe gekommen war. Denn die übrigen Fenster des Palastes, der von der Mauer etwas abstand, gewährten keinen Blick dorthin. Auch hätten wohl weder Männer noch Frauen den Fürwitz gewagt, das Gespenst nahe zu betrachten, da es schon entsetzlich genug anzusehen war, wie sich, sobald Pferd und Mann in das Schattenbereich der Mauer gekommen waren, die gelben Lichter aus dem Mantel und von den Schultern des Mannes in die Lüfte erhoben und das Haus zu umschwirren begannen, während die grünen Lichter in weiten Bogen den[111] Raum vor dem Turm umkreisten. Aus dem Wächter war nichts herauszubringen als das eine: Der Mann im schwarzen Mantel schritt durch das geschlossene Turmtor, ohne daß sich dessen Angeln drehten. Als er aber das erste Mal gekommen sei, habe er ihm folgendes gesagt: Mein Anblick tötet dich. Ich schone dich, solange du allein wachst. Erblicke ich dich mit Kameraden, so bist du wie sie des Todes. Daher sich niemand herbeidrängte, dem Wächter Gesellschaft zu leisten. Auch hütete sich im Hause ein jeder wohl, die Augen aufzutun, solange »der Schwarze« darin war. Der Wachthund, ein riesiges Tier, war am Morgen nach dem ersten Erscheinen mit durchbissener Kehle gefunden worden. Das Gespenst blieb stets nur ganz kurze Zeit im Palast. Seine Anwesenheit machte sich lediglich durch ein sonderbar tappendes Geräusch von vielen Schritten, wie von Kindern, die ein Mann begleitet, merkbar. Kaum, daß dieses Geräusch vorüber war, konnten die Mutigeren von ihren Fenstern aus Pferd, Reiter und Lichter im Walde verschwinden sehen: in der Richtung zum Waldschlosse Samalios.
Messer Giacomo, der nicht im Palast wohnte, sondern ein kleineres Haus in der Mitte der Stadt angewiesen erhalten hatte, berichtet alles dies vom Hörensagen nach Erzählungen der Dienerschaft. Da er es für angebracht hielt, einen reitenden Boten nach Rom zu senden, um die Herrschaft von dem unheimlichen Wesen zu unterrichten, aber nicht ohne die Meinung der Tochter des Hauses handeln wollte, der er überdies Schutz und Beistand bei so schreckhaften Umständen anzutragen sich verpflichtet glaubte (denn alle oberen Hausbediensteten waren mit auf der Reise), so begab er sich zu Maria Bianca:
»Ich fand das edle Fräulein,« so schreibt er, »gegen alle Erwartung heitern Sinnes, obgleich sehr blaß und trotz des Lächelns in den schönen Augen, gleichsam wie eine Kranke, welche die Tröster trösten will. Sie scherzte über das Gerede des Gesindes und sprach: Ich habe wahrlich keine Furcht vor dem Gespenste: so wenig, daß ich meine Kammerfrau, die früher bei mir schlief, aus meinem Schlafzimmer getan habe. Das alles sind nur Torheiten, und es ist nicht wert, darüber zu sprechen, geschweige denn einen Boten aufs Pferd zu setzen. – Auf so bestimmte Meinung des gnädigen Fräuleins hin unterließ ich die Botschaft.«
Nach seinem letzten, schreckhaften Besuche bei Samalio indessen überkam ihn doch aufs neue Angst, zumal von Bauern aus der Umgebung des Waldschlosses schon früher aufgetauchte Gerüchte bestätigt worden waren, es ginge auch dort Absonderliches vor: mit seltsam singenden Stimmen und einer sonst nie wahrgenommenen bunten Helligkeit hinter den Fenstern. Und er ging nochmals zu Maria Bianca. Er schreibt (mit zitternden Händen, wie er vorausschickt): »Was habe ich sehen müssen! Schlimmeres als eine Kranke. Ihre Augen leuchteten wie im Fieber und sie entsetzten mich, da ich sah, daß sie jetzt denen des Ungeheuers gleichen. Sie ist ganz verändert und dennoch so schön wie je. Aber anders. Gott verzeihe mir den Frevel, daß ich so denke und es hinschreibe: Ihre Schönheit ist schamlos worden. Wie das? Wie darf ich so Unmögliches denken? Jedoch: ich sah es. Mit diesen Augen sah ich den gleißenden Wurm in ihren Augen. Und wenn alle Heiligen um mich her stünden, und alle ihre Martern mich bedrohten, und alle ihre Seligkeiten mich zurückschreckten vor jedem unbedachten[113] Wort, – ich muß es sagen (und schrecke doch zusammen, wie ich es nun schreibe), sie hat den verruchten Stolz der großen Huren im Blick. So brennen die Lippen keiner Keuschen. Keine reine Jungfrau liegt so im Gestühl. Selbst in ihrer Stimme ist nicht Unschuld mehr. Es ist eine bebende, wollustnachzitternde Reife in ihr, die wie eine schamlose Offenbarung des Geheimsten ist. Da ist Sättigung und Begierde, aber etwas Drohendes und doch Verzweifeltes ist dabei. Ich suche vergeblich, es in Worte zu fassen. Die toskanische Sprache, reich genug wie wir wissen, Himmel und Hölle zu malen, scheint unvermögend, diesen Triumph voller Qual, dieses Beben aus erfülltem Stolz auszunennen. – O, ich konnte wohl alle meine Fragen und Berichte, derentwegen ich gekommen war, für mich behalten, denn ich wußte auf einmal alles: Nicht törichtes Geschwätz der Gesindestuben ist dieser Spuk, der sich hier begibt und dort erzeugt wird: ist Wahrheit, furchtbare, schändliche, höllische Wahrheit. Das Ungeheuer drüben, unvermögend, diesen Engel blutschänderisch selbst zu gewinnen, hat sich mit der Hölle verbündet, ihr den Inkubus zu senden, und dem ganzen Teufel gelang, was dem halben mißlingen mußte. Der Engel ist gefallen: eine Teufelshure richtet sich auf im verfluchten Stolze der Wollust. In diesem Hause wohnt die geile Pest der Hölle, gesandt von jenem Scheusal, das durch den Anblick einer reinen Schönheit zum Wahnsinn und vom Wahnsinn zum Frevel aller Frevel getrieben wurde: zur Zauberei. – Wie groß ist doch die Macht des Bösen! Als sie mich anlächelte und mit einem seltsam vollen Tone von scheinbarer Sorglosigkeit sagte: »Nicht doch, Messer Giacomo, bei meinem Bruder sind[114] so wenig höllische Geister wie hier, und es tut wahrlich nicht not, die Eltern zu erschrecken,« da war ich einen Augenblick selber im Netze des Teufels und gedachte wiederum, die Botschaft sein zu lassen. Aber siehe, der Böse verrät sich schließlich doch: Denn es kamen noch die Worte (gewiß aus widerwilligem Mund, denn ich sah, daß er bebte): Das Schicksal ist weder aufzuhalten noch zu beschleunigen. Es erfüllt sich, wenn es zeitig ist. – Ich verbeugte mich, nahm Urlaub und ging. – Der Bote ist auf dem Wege. Wär' ich bei besseren Kräften, ritte ich selbst. Denn es ist wahrlich besser, im Sattel zu sitzen und auf unsicheren Straßen Tag und Nacht zu reiten, als hier zu sein, wo sich so Schreckliches begibt und noch Entsetzlicheres vorbereitet.«
Folgt ein Gebet zu allen Heiligen und ein Spruch zur Abwehr der Dämonen.
Aus den weiteren Aufzeichnungen des Florentiners ergibt sich dies:
Die Eltern schickten den reitenden Boten sofort mit der Anzeige zurück, daß sie sich unverweilt auf die Rückreise begeben würden. Diese Botschaft, mündlich gefaßt, erging an die Tochter und kam zu später Abendstunde an. Das Gesinde, sehr erfreut darüber, benachrichtigte sogleich Messer Giacomo, der sich auf der Stelle in den Palast begab, am Morgen des folgenden Tages gleich zur Stelle zu sein. Maria Bianca, statt ihn vorzulassen, ließ ihm sagen, er habe sich übel um ihre Eltern verdient gemacht. Wenn ihm sein Leben lieb sei, möge er sich stille halten und seinen Fürwitz nicht weiter treiben. Er schloß sich erschreckt in sein Zimmer ein. Kaum eine Stunde später begab sich das Übliche. Nur, wie die Dienerschaft erklärte, heftiger, lauter als sonst. Man hörte das[115] Fräulein stöhnen und eine heisere Mannesstimme. Türen fielen ins Schloß, ein gräßlicher tierischer Laut fauchte heulend auf und ging in ein wütendes Wimmern über, das lange anhielt. Es schien aus dem Schlafzimmer des Fräuleins zu kommen.
Der ›Inkubus!‹ dachte sich Giacomo und schlug, solange es erklang, das Kreuz. Endlich ward es still, aber niemand wagte sich aus seinem Zimmer.
Am frühen Morgen schon kam die Herrschaft an. Die Nebel hatten sich noch nicht gehoben. In den Korridoren des Palastes lag dämmeriger Halbschein. Der Vater befahl eine Laterne und begab sich, wie er ging und stand, im Reisepelze zum Zimmer Maria Biancas, denn er hatte der ungewiß enthaltenen Botschaft entnommen, daß sie krank sei von dem Spuke. Messer Giacomo, in dessen Ohren noch immer das gräßliche Wimmern klang, führte die ganz erschöpfte und geängstigte alte Dame. Die Dienerschaft drängte hinterdrein.
Ein paar Schritte vor der Tür machte der Graf halt und wandte sich an Giacomo: »Ihr habt mir nicht alles gemeldet. Es steht schlimmer. Warum kommt sie uns nicht entgegen?«
»O mein Gott,« seufzte die Gräfin und schritt am Grafen vorbei zur Tür.
»Nicht doch, nicht doch!« bat Messer Giacomo. »Nicht hinein!«
»Sagt alles,« befahl der Graf.
Der Florentiner trat nahe an ihn heran und flüsterte: »Es ist unmöglich zu sagen. Ich kann nur bitten, schlagt das Kreuz und laßt mich vorangehen.«
Der Graf sah ihn groß an. »Ins Schlafzimmer meiner Tochter? Seid Ihr von Sinnen?«
Messer Giacomo rang die Hände und flüsterte noch leiser: »Sie … schämt sich nicht mehr.«
Der Graf hob die rechte Faust – und ließ sie schlaff sinken. Dann winkte er der Dienerschaft zurückzubleiben und stöhnte: »Wenn Ihr die Wahrheit gesagt habt, töte ich sie, habt Ihr gelogen, töte ich Euch.«
Er griff nach seinem Dolche und tat einen Schritt voran.
Die Gräfin hatte indessen ihr Ohr an die Türe gelegt und gebot mit der Hand Schweigen. »Mir ist, ich höre sie röcheln.«
Sie klopfte leise an die Türe.
Ein sonderbares Knurren wurde vernehmbar.
»Der Inkubus,« schrie Messer Giacomo auf und wandte sich wie zur Flucht um. Der Graf packte ihn beim Handgelenk und zwang ihn zur Tür. »Öffnet! Und sei's mit Gewalt!« Giacomo drückte auf die Klinke. Die Türe tat sich auf.
Das Zimmer war ganz dunkel. Nur am Fenster glomm etwas Leuchtendes, wie wenn das Licht des Morgens aus zwei Löchern durch die vorgezogene schwere Samtgardine bräche.
»Da … da … dort sitzt er!« stöhnte Giacomo und bekreuzte sich.
In diesem Augenblicke flogen die zwei hellen Punkte in einem großen Bogen durch das Zimmer über die Köpfe der Eingetretenen hinweg – hinaus. Gleich darauf erhob sich, während die drei, von Entsetzen gepackt, am Türpfosten Halt suchten, im Korridor Geschrei und Gekreisch der Dienerschaft, überschrillt von einem langgezogenen wütenden Geheul, das dann in Fauchen überging und schließlich knurrend zu[117] verröcheln schien. Dann hörte man das Gesinde die Treppe hinabpoltern und die Treppentüre zuschlagen.
Der Graf kam zuerst zu sich. Er ging zum Fenster und riß die Gardinen auseinander. Das Zimmer war leer. Das Bett hinter den geschlossenen Vorhängen unberührt.
»Wo ist sie?« stöhnte die Gräfin auf und sank vor dem Bett zusammen.
Der Graf sah Messer Giacomo fragend an.
Der flüsterte, mit dem Kopf zur Türe: »Das war sie … die Hexe.«
»Licht!« schrie der Graf den Korridor hinaus.
Niemand kam.
»Sie fürchten sich. Wer fürchtete sich hier nicht?« murmelte der Florentiner.
»Was könnte ich noch zu fürchten haben,« murmelte tonlos der Graf und schritt zur Türe.
Links neben der Tür stand am Boden die Laterne. Er hob sie hoch. Ihre Verrahmung und die ausgeschnittene Ornamentierung der Haube warfen ein Rankennetz von Schatten an Decke und Wand. Da die Hand des Grafen zitterte und die Laterne sich in der Handhabe drehte, war es ein huschender Tanz von Schatten und Licht. Da fiel aus der größten Scheibe ein gelber Schein auf etwas Geducktes, Schwarzes in einer Ecke.
Der Graf ging unsicheren Schrittes darauf los, machte das Zeichen des Kreuzes und murmelte: »Bist du es?«
Das Wesen, nun wieder verschattet, duckte sich noch mehr zusammen und knurrte tückisch.
Da ergriff den Greis eine wahnsinnige Wut. Er riß den Dolch aus der Scheide und warf sich mit dem ganzen Gewichte seines Körpers vornüber auf das[118] Dunkle, den Dolch voran. Er fühlte einen heißen Hauch in seinem Gesicht und heißes Blut über der Faust. Wild packte er mit beiden Händen zu, und zwischen seinen eingekrallten Fingern verreckte eine riesige Wildkatze. Er trug sie, die Hände weit vor sich gestreckt, keuchend zum Zimmer und warf den noch zuckenden Leib auf das Bett Maria Biancas. Dann kniete er nieder, schlug die blutigen Hände vors Gesicht und betete – für die Seele seiner Tochter.
Die Gräfin lag ohnmächtig vor dem Bett. Auf ihre Stirn tropfte das Blut des Tieres.
Messer Giacomo schreibt: »Auch ich hatte schier die Besinnung verloren. Das Herz saß mir im Halse. Ich fühlte sein Pulsen im Hirn. Vor meinen Augen war ein roter Dampf. Ich weiß nicht: war das das Blut, das mir so heftig zusetzte, oder höllische Vortäuschung. Durch das rote Dunkel hindurch sah ich die Augen des Teufeltieres verlöschen: und es waren genau die Augen Maria Biancas. Ihr letzter Blick, voller Wut, galt mir. Ich wehrte dem Bösen mit dem Kreuze und kniete gleichfalls nieder, für die arme Seele zu beten. Dann trugen wir, der Graf und ich, die edle Dame in ihr Gemach, beide im Herzen dankbar, daß sie nicht zu sich kam. Darauf erzählte ich dem unglücklichen Vater alles, was ich wußte. Wer etwa Zweifel daran gehegt hätte, daß der aus altrömischem Heldenblute stammte, der würde sich jeglichen Zweifels daran wohl begeben haben angesichts der Größe und Festigkeit, mit der der Graf nach Anhörung meines Berichtes nichts weiter sagte als: »So bleibt mir nur noch übrig, auch ihn auszutilgen.«
Er ließ für sich, Giacomo und zehn Knechte satteln, setzte, für den Fall, daß er im Kampfe mit dem Zauberer[119] zu Tode kommen sollte, sein Testament auf, sein ganzes Vermögen der Kirche vermachend, tauchte Schwert und Dolch in geweihtes Wasser und ritt langsam mit seinen Begleitern zum Walde. Rechts von ihm ritt Messer Giacomo, links der Turmwächter. Dieser, sonst der Mutigste unter allen Dienern des Grafen, wankte schier im Sattel und war entstellt von Angst und Grauen. Sein Gebieter sprach ihm Mut zu, aber je näher sie dem Schlosse kamen, um so unsteter wurde sein Blick, um so blasser sein Gesicht.
Wie sie des Schlosses ansichtig wurden, das im fahlen Lichte eines sonnenlosen Tages dastand, wie aus glanzlosem Blei, graubläulich, gleichsam tückisch, hieß der Graf alle von den Pferden steigen und niederknien zu beten. Dann, als sie wieder im Sattel saßen, mußten sie die Schwerter ziehen, sie steil gerade vor sich halten als Kreuzeszeichen und die Hymne singen:
»Es war uns allen,« schreibt der Toskaner, »ausgenommen den alten Herrn, wie ich anbetrachtlich des Funkelns in seinem Aug', glaube, nicht gar mutig zu Sinne. Aber das Lied, wie es aus uns drang, umgab uns gleichsam mit dem Atem tapferer Erzengel. Als wir vor dem Tore hielten, sah ich, daß alle Knechte wacker rote Wangen hatten, bis auf den Wächter.«
Da das Tor verschlossen war (wie auch alle Fenster, die Läden vorhatten), schlug der Graf mit dem Knaufe[120] seines Schwertes daran und rief: Im Namen des Dreieinigen, öffne!
Statt der Antwort erfolgte ein harsches, gaumiges Röcheln. Dann klirrten Schlüssel, die Türflügel kreischten in den Angeln, und aus der Öffnung trat der alte Diener, sogleich in die Knie sinkend und beide Arme ausbreitend. In seinem qualvoll aufgerissenen Munde sah man die schwere Zunge wie im Krampfe zucken, während im Gaumen wieder die entsetzlichen nach Ausdruck ringenden Laute röchelten. In den blinden Augen lag leer, grau der Widerschein des dunstigen Himmels.
Der Florentiner berichtet: »Obgleich der Erbarmungswürdige weder mit dem Munde noch mit den Augen zu sprechen vermochte, verstanden wir ihn doch alle gleich und wußten, daß das Scheusal tot war.«
Der Graf winkte den Knechten, zurückzubleiben und gebot dem Stummen, ihn und Giacomo zur Leiche zu führen. Der aber warf sich lang auf die Erde bin, als ob er sich mit den Händen in sie einkrallen wollte.
»Da wußten wir,« schreibt Giacomo, »daß uns noch Schlimmeres bevorstand, etwas, das selbst den entsetzte, den Blindheit davor bewahrt hatte, es sehen zu müssen.«
»Ich möchte es Euch, Messer Giacomo,« sagte der Graf, »gerne ersparen, mich zu begleiten. Aber, seht, mich wandelt jetzt Furcht an, da ich mich doch nicht davor gefürchtet habe, den zu töten, der das Leben von mir hatte. O mein Gott, warum begnadigst du mich nicht mit Blindheit! Furchtbares zu tun, hat für den Edlen keinen Schrecken, wenn Not und Pflicht gebietet. Aber es gibt Dinge von einem Antlitz, dessen Ahnung schon auch den Tapfersten zur Flucht scheucht.[121] Doch es muß geschehen. Ich muß mit diesen Augen sehen, was mein Herz schon weiß. Messer Giacomo, die Sünde braucht den Teufel nicht. Wenn Ihr Euch jetzt noch vor höllischen Geistern fürchtet, so sage ich Euch: Ihr könnt ruhig mit mir gehen. Wenn Ihr aber dem Grauen nicht gewachsen seid, das von der verfluchten Natur ausgeht, aus der wir alle sind, so sage ich Euch: Laßt es mich allein ertragen, der ich es muß, weil ich mit meinem Blute daran schuldig bin.«
Der Florentiner, der diese Worte so berichtet, fügt hinzu: »Auch jetzt, da ich dies mit Besonnenheit aufzeichne, verstehe ich es nicht, geschweige denn, daß ich es verstand, als ich es vernahm. Der Böse, dessen augenscheinliches Werk mein armer edler Herr von jenem Augenblick an leugnete, hat ihn verwirrt. Gelobt sei Gott dafür, daß er wenigstens meinen Geist vor Verdunklung schützte.«
Die beiden gingen durch dunkle Korridore, dunkle Treppen hinauf zu dem großen Turmgemache, das Giacomo als Werkstatt des Malers kannte, und wo er mit Recht vermutete, daß sie seine Leiche finden würden.
Lassen wir ihn berichten: »Ich schritt voraus und hob den ledernen Vorhang auseinander, daß der Graf eintreten konnte. Er ging aber nicht mit mir ins Zimmer, sondern hielt sich rechts und links mit der Hand am Türvorhang fest. Ich hörte, wie sein Atem ging, und war froh, dies Leben zu hören, denn es kam nun das schwerste Grauen von allem über mich, so, daß ich nicht mit Schritten zu gehen wagte, sondern, keinen Fuß hebend, mich gleichsam füßlings über den Teppich vorwärts tastete. Da stieß ich mit den Knien gegen etwas Weiches an und bog mich behutsam[122] darüber, die suchenden Hände vorstreckend. Nie vordem habe ich gewußt, daß das furchtbarste Grauen, das der Mensch empfinden kann, in den Fingerspitzen wohnt. Alle Qual der Furcht, des Entsetzens, das sich gleichsam zurücksträubt und doch wie eine willenlose Last langsam, fürchterlich langsam und dennoch unabwendbar, vorwärts wuchtet, saß knäuelhaft, wie geduckt zusammengerollt unter meinen Fingernägeln, die mir (doch war das sicherlich Blendwerk) zu leuchten schienen. Dies alles währte kaum die Dauer eines Atemzuges und war dem Gefühle nach eine Ewigkeit – bis der Augenblick kam, da die Qual gleichsam in die Wut umschlug, sich selber ein Ende machen zu wollen, und sei es durch noch Schlimmeres. Ich warf mich vornüber und flog mit einem grauenhaften Schrei zurück. Meine Hände hatten zwei nackte, schauerlich kalte Frauenbrüste gefühlt, mein warmer Mund einen kalten berührt.
Ich taumelte bis zum Vorhang zurück und keuchte: »Die Hexe! Dort!«
Der Graf drängte mich beiseite und murmelte: »Ich wußte es.« Dann, ein paar Schritte vorwärts tuend, lauter: »Ich bitte Euch, laßt Licht herein. Ich fühle die beiden, und es verlangt mich nun sie zu sehen.« Er schien ganz ruhig. Ich hörte seinen Atem nicht mehr. Ein Knarren verriet mir, daß er auf einen Stuhl getroffen war, in den er sich niedergelassen hatte.
Ich tastete mich die Wand entlang zum Fenster, um ja nicht beim Durchschreiten des Zimmers nochmals in Berührung mit einem der beiden verfluchten Leiber zu kommen. Denn noch immer rann ein schaudervolles, eisiges Entsetzen durch meine Adern. So voller Grausen war ich und gleichsam angstbeflissen,[123] daß, als des Grafen Hand an der Seite der Stuhlwange herabglitt, ich beim Hören des leisen, schürfenden Tones zusammenknickte, für einen Augenblick nicht anders vermeinend, als es sei ein Seufzer aus toten Lippen.
Endlich war ich beim Fenster angelangt und fühlte die Quaste der Vorhangschnur in meiner Hand. Ich brauchte meine ganze Kraft zu der geringen Arbeit, die Gardine sich teilen zu lassen: so völlig erschöpft war ich. Um aber das Fenster und den einen Laden zu öffnen, bedurfte ich der Hilfe des Gebets. Ich rief laut die Madonna an, mir beizustehen.
Da hörte ich einen greulichen Fluch. War da mein alter, edler, frommer Herr, der über die Reinste der Reinen das schmutzigste Wort spie?
Wollte Gott, ich dürfte noch glauben, daß er der Satan selber war, wie ich es damals glaubte. –
Ich riß Fenster und Läden auf, indem ich, ohne mich umzuwenden, schrie: »Fleuch hinaus, Geist der Finsternis! Weiche, weiche, weiche von uns, Fürst der Hölle!« Und legte meine Stirn aufs Fensterbrett, nochmals zu beten. Der feuchte, kalte Wind aus dem Walde strich mir übers Haar und weckte mich gleichsam aus dem wohltätigen Schlummer der Andacht, die mich aber doch so weit gestärkt hatte, daß ich spürte, es sei geraten, mich diesem Luftstrome nicht länger auszusetzen. Ich wandte mich um, vermied es aber wohl, dorthin zu blicken, wo ich die beiden Leichen vermutete. Doch sah ich den Grafen. Er saß in dem flammrot seidenen hochlehnigen Stuhle des Malers, den ich wohl kannte mit seinen goldeingewirkten Zeichen einer fremden heidnischen Schrift. Steif angelehnt saß er, ganz regungslos; auch die Arme und Hände, gerade[124] hingelegt auf die Armlehnen, rührten sich nicht im mindesten. Man hätte meinen können, er sei tot.
Nur die Augen lebten. Lebten gierig.
Und es waren die Augen des Scheusals.
Mir war, als starrten diese selben Augen überall her: kalt glühend durch das kalt graue Morgenlicht. Sie glotzten kugelig von den Buckeln der kupfernen Wandleuchter, blinzelten verkniffen aus allen Facetten der Gläser und Flaschen auf dem Kredenzbord, schossen blitzende Blicke von den Spitzen der Degen, Dolche, Hellebarden an der Wand, lauerten tückisch in allen Falten der Vorhänge.
Ich sah wohl, daß der Böse sich nicht hatte bannen lassen durch meine Gebete, und bald mußte ich es auch hören.
Denn er sprach aus dem Grafen wie folgt: »Ihr mußtet sterben, um mich fühlen zu lassen, wie verwandt ich euch bin. Mit meinem Blute habt ihr: mein Blut hat in euch gesündigt. Wie dürfte ich verdammen, da ich, ob auch mit Grauen, verstehe? Der Tod ist ein mächtiger Lehrer. Ich habe die Hölle verlernt vor seinem Grauen. Sie ist nicht hinter dem Tode, ist vor ihm: in diesem Leben, das kraft heiliger Gesetze verbietet, wozu der unheilige Geist treibt, der in unseren Adern glüht. Ich habe ihn stets gebändigt. Und durfte wohl stolz darauf sein: denn mein ganzes Leben hat sich dem Gesetze geopfert. Aber siehe, mein Blut hat sich gerächt: mein Opfer war unnütz und ein frommer Frevel. Ich durfte rein bleiben, weil diese da alle meine Unreine in sich nahmen. Wo ist da Gott? Wo ist da Teufel? Ich sehe, daß ihr sehr elend und von aller Heiligkeit ausgeschlossen wart: Verworfene vor allen Menschen; und doch überkommt mich der[125] Glaube, daß euer Leben völliger war als das meine, und euer Tod freier und stolzer als der der Frommen, doch noch im letzten Augenblicke um Vorteil handeln. Ihr seid in einer großen Gewißheit dahingegangen nach großen Sünden; ich aber, der Fromme, bleibe voller Zweifel hier und fürchte, daß ich weder selig noch unselig sterben kann.«
Selbst die Stimme, in der dies sprach, war nicht des Grafen Stimme. Sie hatte einen vollen, zuversichtlichen, tapferen Ton gehabt. Was hier klang, war wie der Ton einer gesprungenen Glocke. Es war, als schwebte er nicht durch die Luft, sondern er glitte von den Lippen, rönne über Kinn und Brust, tropfte den Stuhl hinab zum Teppich, kröche über diesen weg zu den beiden.
Mir aber gruben sich die Worte, wie matt sie auch klangen, mit einer magischen Gewalt ein, so daß ich sie zu jeder Stunde wiederholen könnte, wie ich sie jetzt gleichsam unter dem Diktate des Satans niedergeschrieben habe. (Ich wage es, die Wahrheit zu sagen, in diesem Augenblick nicht, hinter mich zu blicken, denn ich weiß: in dem Bilde des heidnischen Ahnherrn dieser nun erloschenen Familie, das ich selber nach einer alten Tafel im Palaste hier auf die Wand übertragen habe, stehen jene beiden Augen. Ich weiß es, denn ich fühle ihren Blick als einen dumpfen Druck am Nacken.)
Immer noch starr geradeaus schauend, wandte sich der Graf nun in seinem alten, nur etwas müderen Tone mit diesen Worten an mich: »Seht Ihr, wie schön sie ist, Messer Giacomo?«
Antwortete ich: »Nein, Herr. Gott verhüte, daß ich meine Blicke zu diesem Greuel wende. Die Hexe ist nackt.«
Sprach er, nicht zornig, aber gestrenge: »Laßt dieses Torenwort und sprecht mit Achtung von meiner Tochter. Nackt ist sie, aber so schön, daß nichts Schamloses an ihrer Nacktheit ist. Auch ist sie tot, und nur im Lebendigen ist Sünde und der Schatten der Sünde: Scham oder Unscham. Ich sehe sie an wie ein Werk des Meißels, den der Tod geführt hat, und ich denke zurück an meine jungen Tage, da ich mich nächtens mit einer Fackel in den Keller schlich, wo in einer Ecke die Madonna der Heiden stand, zu der meine Ahnen einst gebetet haben: Frau Venus. Doch diese hier ist schöner. Ich denke mir: Sie wurde so schön, weil meine Jugend unter jenem Venusstern stand. Die Göttin, deren Bild ich mit eigener Hand zerschlug, als der Geist des Gesetzes von mir Besitz ergriffen hatte, hat sich gerächt, indem sie aus meinem Blute ihr schöneres Bild gestaltete. Glaubt nur, Messer Giacomo, die Götter der Heiden sind nicht tot. Sie leben in unserem Blute, und aus unserem Blute leben sie immer aufs neue auf in sichtbarlicher Nachgestalt. Der Schatten des Kreuzes ist doch nur ein Schatten, der sich nach der alten Sonne drehen muß. Ihr blickt noch immer nicht hin?«
»Da sei Gott vor!« antwortete ich bestimmt.
Er aber sprach: »Ihr tut mir leid. Dieser Anblick, vor dem auch ich mich gefürchtet habe vor wenigen Minuten noch, und es ist seitdem doch eine Fülle von Zeit verstrichen, reicher als mein ganzes armes Leben in heiliger Finsternis – dieser Anblick ist kein Schrecken: ist klare, ruhige, wohl feierliche, aber nicht gestrenge Offenbarung. Mein schönes Kind liegt auf dem Ruhebette, wie es von Venus erschaffen ward. Der rechte Arm ruht unter dem Haupte, die linke Hand im Haar des Bruders, meines häßlichen Kindes, das, vor dem[127] schönen niederkniend, den selbstgerufenen Tod erwartet hat. Er trägt einen Mantel aus dunkel veilchenblauem Sammet und auf dem Haupte einen Dornenkranz. Ihr wendet Euch ab und seid empört. Mir selber tat der Anblick weh, denn es dünkte mich unwürdig, gleich einem Schauspieler in den Tod zu gehen, Großes nachäffend. Doch weiß ich es besser, seitdem mich das Bild, vor dem sie gestorben sind, belehrt hat, daß er nicht als Mime starb, sondern als Maler. Auf diesem Bilde sind die Farben noch feucht an dem Kopfe mit der Dornenkrone, und es ist, als ob die Blutstropfen lebendig herunterrönnen aus dem krausen Haar über die gelben Wangen. Er hat sich die Dornen ins Haupt gestoßen, dieses Blut fließen zu sehen, aber mehr noch zur Aufgeißelung der Kraft, die auch äußerlich fühlen wollte, was sie innerlich ergriffen hatte. – Ihr wißt, daß es mir immer zuwider war, ihn die Kunst des Malens wie etwas treiben zu sehen, das mehr ist als vornehmer Zeitvertreib. Daß ich es Euch gestehe: Ich verachtete ihn darum, und er war mir seiner Kunst wegen noch abscheulicher als wegen seiner Häßlichkeit und düsteren Art. Nun lehrt mich dieser Morgen, mit dem eine helle Nacht für mich anbricht, auch dies: daß Kunst, mit diesem Stolze heroischer Hingabe ausgeübt, zu den größten Menschendingen gehört, zu denen, die über alle Tiefen und Nebel hinwegtragen, wie dieser zentaurische Christus die nackte Madonna hinwegträgt vom Felsen des Todes über qualmige Städte zur Festung Einsamkeit. – Ich will, hört mich wohl: Ich will in diesem Hause meine Tage beschließen und auf diesem Lager sterben vor diesem Bild, das dann wie alles andere von der Hand meines Sohnes mit meinem Leichnam zu den Leibern meiner[128] Kinder eingegraben werden soll in den Fels dieses Berges. Immer und immer will ich es sehen, wie ihre linke Hand in das blutige Haar des Christus-Zentauren greift, dessen blutrünstiges Antlitz sich ihr in schmerzlichster: seligster Liebe zuwendet. Ihre holden, gütigen, mutigen, aller Liebe vollen Augen sollen auch mir hinüberleuchten zu jener Ruhe, die Gott selber bewacht.«
Kaum daß der Graf geendet hatte, drang Gemurmel und Schrittgestampf vom Gange her in den Saal, und die Stimme eines Knechtes bat um Einlaß.
Der alte Herr erhob sich ruhig, löste seinen Pelzmantel von den Schultern und legte ihn über die Toten. Dann zog er den Vorhang vor das Bild und rief mit seiner alten Stimme des Befehlensgewohnten gebietend: »Tretet still herein!«
Sogleich verstummte Gemurmel und Gestampf. Die Knechte traten gebückt ins Gemach, vor sich her den Wächter schiebend, der gefesselt war und vor dem Grafen in die Knie sank.
»Geht,« befahl der Herr den übrigen, und dem Knienden: »Steh auf und sprich!«
Der erhob sich und murmelte: »Ich wollte fliehen, Herr, weil ich mitschuldig war an dem Schrecklichen, und will nun alles eingestehen.«
Der Graf legte ihm eine Hand auf die Schulter und ergriff mit der anderen die gefesselten Hände des Wächters. Und sprach: »Ich weiß. Doch niemand außer dir und mir soll wissen, denn dieser (und er wies auf mich) sieht nicht mit sehenden Augen und wird auch die anderen heilsam blind machen. Du aber sollst zu keinem Menschen mehr reden, sondern mit mir eingeschlossen bleiben in diesem Hause. Die Leichen[129] meiner Kinder im Felsen zu begraben, soll deine erste Arbeit sein; deine letzte: mit meinem Leichnam dasselbe zu tun. Dann sollst du dieses Schloß besitzen mit allem, was darin ist.«
Der Wächter, diesen Spruch so wenig begreifend wie ich, der ich aber längst die Besessenheit des Grafen erkannt hatte, beugte sich stumm über die Hand seines Gebieters und küßte sie.
Mir blieb nichts mehr zu tun übrig, als um Urlaub zu bitten für immer und zu fragen, welche Botschaft ich der Gräfin bringen solle.
Die Antwort war: »Sag meiner Gattin, daß sie mir willkommen ist, wenn sie sich stark genug fühlt, mit mir bei den Dämonen zu hausen. Niemand weiß ja über diese so gut Bescheid, wie Ihr. Wie ich sie kenne, wird sie es vorziehen, sich in den Schutz der anderen Madonna zu begeben. Und sagt ihr, wenn sie Euch dies kundgibt, von mir, daß sie recht daran tut und daß es mich beruhigen wird, sie in dem besten Schutze zu wissen, darin sich ein Mutterherz ausruhen kann. Ich weiß, sie wird für mich beten. Sagt Ihr auch das. Und fügt von mir noch dies hinzu: daß ich ihr ehrerbietig und mit dem ganzen Reste von Liebe dafür danke, den ich für Lebendiges noch fühlen kann.« Obwohl ich dank der Klarheit, die sich immer mehr in mir ausbreitete, sehr wohl begriff, daß das Gütige und Wahre in diesen Worten keineswegs ein Zeichen etwa aufdämmernder Vernunft, sondern nichts als spöttische Verstellung des Teufels war, der diesen Geist völlig verwirrt hatte, mußte ich mich doch, mehr unbewußt als mit Fleiße, gleichfalls auf die Hand des Unglückseligen beugen. Meine Lippen fühlten, daß sie ganz kalt war.
Ich ritt mit den Knechten im schnellsten Galopp zur Stadt. Der Nebel hatte sich gehoben. Als ich mich, wir mochten etwa zwei Bogenschüsse weit geritten sein, umwandte, sah ich das Schloß im hellsten Sonnenlichte über dem schwarzen Walde gleichsam höhnisch leuchten.
Morgen geleite ich die Gräfin nach Rom ins Kloster. Dort will ich auf bessere Zeiten warten, daß ich nach Toskana zurückkehren kann.
Zum Danke für meine Rettung aus der grausamen Gefahr, gleich meinem edlen alten Herrn in die Verstrickung des Teufels zu fallen, habe ich heute gelobt, nie wieder einen Pinsel zur Hand nehmen. Die Kunst ist die schlimmste Schlinge des Bösen.«
Nebst einem Vorwort von den Raubrittern und dem Segen der Aufklärung.
Eine äußerst dunkle Zeit das Mittelalter!
Eine äußerst unmoralische Gesellschaft die Raubritter!
Es ist ja wahr: unsere Gardekavallerieoffiziere stammen meistens von ihnen ab. Aber auch sie müssen heutzutage so viele Examina machen, daß wir mit Genugtuung konstatieren können: die Wurzelbürste der allgemeinen Bildung hat sie bürgerlich moralisiert, und kein ehrsamer Zivilist braucht sich mehr vor ihnen zu fürchten. Ja: sie selber weinen nun viel Druckerschwärze über die schlechten Sitten ihrer Vorfahren und sind gar sehr betrübt darüber, daß in ihren Familien solche Sachen passiert sind.
Was für Sachen! Ah: was für Sachen! Man möchte wirklich manchmal daran zweifeln, daß unsere heutigen lieben glatten Herren von, auf und zu die richtigen Nachkommen dieser unmoralischen Rauhbeine sind, die solche Sachen gemacht haben.
Denn, um das gelindeste Wort zu brauchen: saftige Kumpane sind sie gewesen, diese Herren von[132] Eisenbeiß auf Eisensteiß, und rund um sie herum war nicht der Exerzierplatz, nicht das Bureau, sondern der dicke, dunkle Wald.
Der gehörte ihnen; den hatten sie lieb. Aber die Städte und die Städter konnten sie nicht leiden.
Was da in engen Gassen herumkroch, war ihnen ein übel tugendhaft Gesindel: einzeln feig, in Masse frech; geschäftig und geschwätzig; krummbucklig und scheelsüchtig; krittlich und profitlich; in allen Dingen nach der Elle gerichtet und abgemessen; eingepackt in Sippschaften und Zünfte; klettentreu zusammengefilzt und miteinander verbacken in Schmutz und Schweiß und schmieriger Biederkeit.
Sie dagegen, die edlen Herren vom spitzen Sporn und Stegreif, die Junker Schlagdrauf, Greifzu, Haltfest, fühlten sich als Einzelne, Eigene, Freie, und es schien ihnen ihr gutes Recht zu sein, die Säcke der Krämer in ihre Kammern zu leeren, obwohl es die Obrigkeit nicht guthieß.
Denn die Obrigkeit konnten sie auch nicht leiden, außer wenn sie selber Obrigkeit waren.
Man ersieht aus alledem, wie ungebildet die Raubritter gewesen sind.
Hätten sie Schulbildung genossen gehabt, so würden sie sich ohne weiteres haben sagen müssen, daß das so auf die Dauer nicht fortgehen konnte, und daß sie sich mit einem solchen Betragen für alle Zeit in der Weltgeschichte ein miserables Renommee schaffen mußten. So ist es auch gekommen. Die Tugend hat gesiegt; überall herrscht Ordnung und Gesetz; jede Körperverletzung wird unnachsichtig bestraft; wer seinen Mitbürger an seinem Eigentum schädigt, kommt, mit oder ohne Wappen, hinter Schloß und Riegel: und[133] die ganze gebildete Menschheit hat alle Ursache, jene abscheulichen Zeiten höchst verächtlich zu finden, mit sich aber sehr zufrieden zu sein.
Nur Degenerierte und Dichter (was auf eins hinausläuft) sind imstande, an diesem Chorus der Freude nicht mit teilzunehmen. Sie allein vermögen es auch, dem Raubrittertume noch einigen Geschmack abzugewinnen.
Es muß da irgendeine Verwandtschaft bestehen. Vielleicht war das Raubrittertum eine Art angewandter Lyrik? Vielleicht ist Lyrik eine Art verhindertes Raubrittertum? Wie es auch sei: dem tüchtigen Bürger sind beide gleich unsympathisch, und dieser Umstand beweist allein schon, daß sie irgendwie zusammengehören.
Da mir an meiner Reputation gelegen ist, und da ich nicht wünsche, daß die Geheimrätin X. und der Schuhmachermeister Y. sich darauf einigen, mich für einen verspäteten Raubritter zu halten, darf ich nicht unterlassen, hier zu erklären, daß ich nicht zu jenen Raubritterpoeten gehöre, daß ich, wie sehr auch der Anschein gegen mich sprechen mag, im Besitze der bürgerlichen Ehrenrechte bin, und daß ich mit der kleinen Geschichte von Annemargret und den drei Junggesellen keineswegs das abscheuliche Ziel verfolge, zum Mädchenraub aufzufordern.
Diese Geschichte ist vielmehr durchaus moralischer Natur und beweist aufs klarste, daß das Mittelalter wirklich finster war.
Stellen Sie sich vor, sie spielte nicht damals, sondern heute. Würde sie mit Mord und Totschlag endigen? O nein! Es gäbe ein niedliches kleines viereckiges Verhältnis; nichts weiter: wie es sich für anständige junge Leute aus guter Familie ziemt, schickt und paßt.
In Wahrheit hat sie sich auch so begeben, und Annemargret fährt heute auf Gummirädern. Ich habe sie erst gestern Unter den Linden gesehn.
Seien wir stolz! Seien wir heiter! Es lebe die Aufklärung.
Es waren einmal drei junge Junggesellen, recht adelige Burschen: nämlich Söhne eines alten Raubritters.
Der war aber tot und lag mit seiner Frau, der weiland Raubritterin, in seinem Erbbegräbnisse tief im Walde. Sein Wappen, ein behelmter Wolf, der eine dreigespaltene Zunge sehr rot und im zierlichsten heraldischen Schnörkelschwunge aus dem raffzähnigen Rachen bleckte, lag in Stein gehauen über ihm; und das war gut, denn damit war die Sicherheit gegeben, daß der alte Raubritter den Landfrieden, den er dem Tode hatte schwören müssen, auch wirklich hielt. Es wäre ihm schon zuzutrauen gewesen, daß er auch noch als Gerippe auf Krämer ausgeritten wäre.
Seine drei Söhne: Welf, Ralph und Rolf, besorgten das ja auch, aber doch nicht mit der ganzen väterlichen Leidenschaft. Sie taten es nur berufshalber und wenn die Münze ausging, nicht aus Sport und innerlichem Bedürfnis. Die Jagd war ihnen vergnüglicher, und sie hetzten den Bären lieber als den Juden.
So lebten sie recht angenehm bewegt in ihrem alten Schlosse am Walde, tranken sowohl roten als auch weißen Wein in beträchtlichen Mengen und aßen vielen[135] saftigen Braten dazu, den ihnen ihre alte Haushälterin, die ehr- und tugendgeachtete Jungfrau Barbara, genannt das Reibeisen, gar vorzüglich am Spieße zu braten verstand.
Aber eines Tages, gerade, als sie einen Rehrücken am Spieße hatte und emsig drehte, sagte sie plötzlich ohne ersichtliche Ursache: Mein Jesus, Barmherzigkeit! fiel hin und war tot. Der Rehrücken verbrannte, der Brandgeruch, erst ganz angenehm, dann schon mehr unlieblich, stieg bis ins Turmgemach, wo Welf, Ralph und Rolf sich eben die Würfelknochen unter erklecklichen Flüchen ins Gesicht schmissen, und lockte die Brüder zur Küche.
Da wurden sie sehr traurig, als sie das Reibeisen tot auf dem Steinboden liegen sahen, schlugen hastige Kreuze und fluchten mörderlich.
»Wer soll uns nun kochen und braten!« rief Welf.
»Sie konnte es so schön knusperich!« klagte Ralph.
»Und dennoch blieb er innen saftig!« bemerkte Rolf.
»Du mußt jetzt den Spieß drehen!« entschieden Welf und Ralph, die beiden ältesten, indem sie sich zu Rolf, dem jüngsten, wandten.
»Ich werde euch den Spieß in den Bauch rennen!« bemerkte dieser gelassen.
Darauf prügelten sie sich eine Weile mit Hingebung.
Aber damit war die Dienstbotenfrage nicht erledigt.
Da kam Welf'n ein guter Gedanke: »Laßt uns eine Köchin aufheben!«
»Ha!« riefen die anderen und umarmten ihn, »das ist eine Idee!«
»Legen wir uns an den Kreuzweg am Unkenteich, wenn die Dorfdirnen zur heiligen Urschel paternostern[136] gehen!« schrie Welf, der entschieden der Taktiker unter den dreien war.
»Ha!« riefen die anderen, »das ist wieder eine Idee!«
»Machen wir aber schnell, denn ich bin hungrig!« brüllte Welf mit ritterlichem Ungestüm.
»Los!« brüllten die anderen.
Und sie stiegen in die Rüstkammer, schnallten sich die Harnische um, ergriffen die gewaltigen Schlachtschwerter, vergaßen auch nicht die dicken Streitkolben, setzten sich die Helme mit den Wolfsrachen aufs lockige Haupt und schwangen sich auf die ebenso mutigen wie dicken Rosse.
Hei, wie wieherten die, als es im Donnersaus über die Zugbrücke ging und dann am Walde entlang zum Unkenteiche!
Der alte Christoph, der einzige Knecht, der den dreien nicht davongelaufen war (weil er Rheumatismus hatte und nicht laufen konnte) und der nun alle männlichen Ämter bekleidete, die es auf einer rechtschaffenen Ritterburg gibt, zog die Zugbrücke wieder hoch und knurrte in seinen grauen Bart: Wenn sich wenigstens einer von den dreien den Hals brechen wollte!
Dann ging er hin und wunderte sich, daß das alte Reibeisen tot war.
Unterdessen lagen die drei Junker hinter den Kreuzwegbuchen am Unkenteiche und ließen die Weiblichkeit des Dorfes Sankt Ursula Revue passieren, die in die Kapelle zum Rosenkranz ging.
Es waren aber meistens alte Weiblein, die da mit dem Rosenkranz vorbeihumpelten, und die drei hatten auf dem Hinritt beschlossen, keine Alte zu fangen. Denn,[137] wie Rolf sehr richtig bemerkt hatte: Eine Alte stirbt bald, und dann haben wir gleich wieder Wechsel. Und sich ewig an neue Köchinnen gewöhnen müssen, ist lästig.
Eine Junge also! Den Spieß drehen und Betten machen kann schließlich jede, und die richtige Reibeisentradition wollen wir ihr schon beibringen.
Aber, wie nun auch Junge vorüberkamen, setzten sie doch ihren Gäulen nicht sogleich die Zinken ein und fuhren drauflos, sondern es gab über jede ein kritisches Gewispere und mancherlei Aussetzungen hinter den Buchen;
Zu dick!
Zu dürr!
Läuft über die große Zeh!
Zu braun!
Zu blaß!
Hat scheelen Blick!
Hat keine Brust!
Watschelt!
Zu lang!
Zu kurz!
Krummbein!
Schiefmaul!
Knollnase!
Satthals!
Pinkel im Gesicht!
Leberfleckig!
Warzenacker!
Und so, streng kritisch, immerfort, daß man hätte meinen sollen, es handele sich hier gar nicht darum, eine Köchin zu rauben, sondern eine künftige Burgherrin für Wolfsturm.
Da kam aber eine, in einem kurzen, roten Rock mit schwarzem Mieder, aus dem, um einen vollen, weißen Arm, die weißen Hemdärmel sauber blitzten: und die gefiel allen dreien offenbar ganz über die Maßen wohl. Sie hatte ein frisches, rundes Gesicht, mit ein Paar allerliebsten, lachenden Augen darin, die schwarz und funkelnd waren wie reife Brombeeren. Schwarz und glänzend war auch das volle Haar, das in einem dichten Kranze doppelt ums Hinterhaupt ging. Dazu wohlbeschlagen im Mieder, kräftig im Gehwerk, kurz: nett ganz und gar und etwa achtzehn Jahre alt.
»Die!« stieß Welf hastig hervor.
»Ha!« stieß Ralph nach.
»Los!« kommandierte Rolf.
Und, heissa, heidi, klapp, klapp, klapp! brachen die Gäule aus dem Unterholz und sperrten den Weg.
»Jesusmariaundjos…!« schrie die Kleine auf und guckte erstaunt die Geharnischten an.
»Halt!« donnerten die drei Junker.
»I steh ja schon!« antwortete das Mädchen und zog trotzig die Lippen hoch. »Was soll i denn noch?!«
Viel Furcht hatte der Balg nicht.
»Aufs Pferd zu mir!« schrien die grimmigen Brüder.
»Auf alle drei Pferd?« antwortete das Mädchen und lächelte dazu.
»Auf mein Pferd!« brüllte jeder einzelne und preschte vor.
Das Mädchen ließ den Rosenkranz fallen und flüchtete hinter einen Baum. So, einstweilen sicher, drehte sie den drei Gaulgebietern himmlisch vergnügt eine Nase.
»Kommst vor!?« drohte Welf.
»Kommst her!?« drohte Ralph.
»Wart Balg!« rief Rolf, sprang vom Pferde, packte das Ding, hob's in den Sattel, sprang nach und sauste davon, gerade wie die beiden anderen abgesprungen waren.
Die kletterten, unsäglich fluchend, wieder aufs Schlachtroß und galoppierten, Pferdenase an Pferdenase, hinter dem Flüchtigen drein, der in einer Weise lachte, daß sich die ältesten Eichen nicht erinnerten, je ein solches Lachen gehört zu haben.
An der Zugbrücke, die der alte Christoph natürlich wieder nicht rechtzeitig hochgezogen hatte, trafen sich die drei.
Das mindeste, was Welf und Ralph vorhatten, war, den schnöden Rolf ans Brückentor zu nageln. Die Schwerter hatten sie schon heraus und fluchen taten sie auch, wie es der Situation angemessen war. Aber Rolf war nicht geneigt, sich annageln zu lassen. Er zog gleichfalls blank, warf den Gaul herum und legte aus. Dazu brüllte er gewaltig, und, da die beiden anderen nicht weniger brüllten, so gab es einen richtigen Raubritterspektakel.
Das paßte der Kleinen aber gar nicht. Sie hielt sich beide Ohren zu und schrie in das Getöse: »Ob ihr gleich stille seid?! Wenn ihr euch erstechen wollt, so laßt mich wenigstens vorher in die Burg!«
Da sanken den dreien die Schwerter.
Richtig! Darauf kam's ja am Ende bloß an: daß die Kleine in die Burg kam.
Schlump! fuhren die Klingen in die Scheiden, und Hahaha! und Hohoho! lachten die Reisigen, daß den[140] Rossen ganz übel im Bauch wurde von der Erschütterung.
Die Kleine aber sprang vom Pferde, schüttelte die zerknillten Röcke, rieb sich ein bißchen in der Gegend, die den Sattel gefühlt hatte, und rief: »Also gut, ihr unverschämten Junker, jetzt geh' ich in eure Burg. Da mag's nett aussehen! Na, ich bin bloß gespannt, was ich da drinnen soll, in dem alten Wolfszwinger.«
»Braten, Jungfer, hahaha!«
»Betten machen, hohoho!«
»Strümpfe stopfen! Wämser flicken!«
»Weiter nichts? Das kann ich gut und noch viel mehr.«
Mit diesen Worten schritt die kecke, kleine Bestie über die Zugbrücke, als hätte sie zeitlebens keine andere Schwelle gekannt, zupfte den alten Christoph, der völlig Glasaugen gekriegt hatte vor blödem Staunen, am Bart, ging, während die zwölf Hufe über die Brücke donnerten, geradeswegs zum inneren Burghofe, guckte sich gelassen um und rief: »Ja so! Wieviel Lohn krieg ich denn?«
»Einen Dukaten für den Braten!« lachte Welf.
»Zwölf Batzen fürs Schüsselauskratzen!« lachte Ralph.
»Zehn Groschen für die süße Goschen!« lachte Rolf.
Mit der zufriedenen Heiterkeit, die sich nach wohlgetanen Werken bei allen Menschen von frisch zugreifender Sinnesart einzustellen pflegt, sprangen die drei jungen Junggesellen von ihren Pferden, griffen, hübsch einer nach dem andern, dem Mädchen unters Kinn und fragten: »Jetzt aber: wie heißt die Jungfer!«
»Annemargret, wie sie geht und steht, die die Betten macht und den Bratspieß dreht.«
»Ich weiß noch einen Reim drauf!« erklärte Rolf.
»Na?«
»Die mit dem Junker ins Be…«
Aber da hatte er auch schon einen derartigen Klapps auf dem Munde, daß er einstweilen das Reimen sein ließ.
Klappse, die der eine kriegt, stimmen die andern heiter. Das war auch schon in den alten Raubritterzeiten so. Und deshalb ist es kein Wunder, daß Welf und Ralph sich jenes Mal vor Lachen so weit bogen, als ihre Harnische zuließen, während sich Rolf unterm Schnurrbarte rieb und etwas unwirsch bemerkte: »Racker verdammter!«
Indessen war Annemargret aber schon in der Küche verschwunden, und aus allerlei Geräuschen konnten die drei Brüder entnehmen, daß das resolute kleine Mädchen bereits dabei war, die so jäh unterbrochene Tätigkeit der seligen Barbara aufzunehmen.
Die drei Junker auf, zu und von Wolfsturm waren im allgemeinen selten einer Meinung, aber darin stimmten sie bald völlig überein, daß es im Grunde eine Gnade des Himmels gewesen sei, das ehr- und tugendgeachtete Reibeisen zu sich und in die Schar seiner Seligen aufzunehmen. Denn Annemargret war der verblichenen Barbara wirklich in jeder Hinsicht überlegen. Vielleicht machte sie den Braten nicht gerade besser als die am Bratspieß selig Entschlafene, aber, daß er besser schmeckte, daran war kein Zweifel erlaubt. Selbst ein Bärenschinken bekommt ein Ansehen von Fröhlichkeit, wenn die Zinnplatte, auf der er in Burgundersauce zwischen gerösteten Kastanien[142] dampft, von zwei netten, kleinen Händen auf den Tisch gesetzt wird. Und dann schon das Geträller von der Küche her, während der Bratenwender den Grundton schnurrt. Man sieht dem Kommenden mit größerer Heiterkeit entgegen, und selbst ein versalzenes Mus hat von vornherein mildernde Umstände in sich, wenn es von so gerne gesehenen Fingern versalzen worden ist.
Vielleicht war Barbara das bessere Gemüt, die frommere Seele gewesen: aber so aufbetten wie Annemargret hatte sie nicht gekonnt. Viel Wert hatten die drei rauhen Junggesellen ja auch nicht darauf gelegt, daß der Strohsack immer aufgeschüttelt, das Kissen frisch überzogen, das Leintuch glattgebreitet wurde – wenn nur immer der Schlaftrunk handbereit stand. Aber nun war es doch angenehm, sich auch in diesen Dingen wohlbesorgt zu fühlen. Die kleine Unbequemlichkeit, daß man auch selber, schandenhalber, sich etwas ordentlicher zu führen hatte und nicht, nach längeren Schlaftrünken oder so, mit den Stiefeln ins Bett steigen durfte, ließ sich mitnehmen. Man ließ sich überhaupt ganz gerne ein bißchen glatt lecken, da es ja nicht bis auf die ritterliche Seele und den rauhen Kern des deutschen Mannes ging, wenn man es sich gefallen ließ, daß die Lederwämse Nähte in den Wolfsturmschen Farben, blaurot, kriegten, die Stiefel auch an Wochentagen geputzt, die geknickten Helmfedern durch neue ersetzt und überhaupt allerlei Dinge getrieben wurden, die eigentlich gegen die Tradition der Wolfsturms waren. Annemargret hatte sogar ein Heer von alten Weibern aufgeboten und die Dielen scheuern, die Vertäfelung putzen und die Küche weißen lassen – lauter Dinge, die seit dem Tod der ehedem gebietenden Frau Mutter nicht geschehen waren und den Brüdern[143] als krämerhafte Albernheiten gegolten hatten. Es war sogar Geld dafür ausgegeben worden, und Welf hatte sich bei Erwerbung dieses Geldes einen kleinen Leibesschaden zugezogen, da er die schwere Kassette dem renitenten früheren Inhaber eigenhändig entrissen hatte.
Doch das wurde alles gerne ertragen, da man sich unter dem neuen Regime wirklich behaglich fühlte.
Ja, die drei Brüder brachten noch weitere Opfer für das kleine, aber unentbehrliche Mädchen.
Da Annemargret die Tochter des Bürgermeisters von St. Ursula war, eines gewichtigen Mannes unter den Bauern, und da dieser Mann und Bürgermeister die Hartnäckigkeit besaß, Herausgabe der Tochter zu fordern, andernfalls er mit Klagen bei irgendeinem Herzoge drohte, der sich Landesfürst nannte, und da überdies Annemargret selber recht schön bat, man möge alles in Frieden ordnen, so ließen sich die drei Brüder, die eigentlich prinzipiell gegen jede friedliche Ordnung einen angeborenen Widerwillen hatten und es schlechterdings würdelos fanden, sich mit jemandem zu »vertragen«, herbei, dem in St. Ursula hausenden Volke für ewige Zeiten Freiheit von jeder Brandschatzung durch das Wolfssturmsche Haus schriftlich mit beigesiegeltem Wolfsrachen zu versprechen, zu verheißen und zuzusagen.
Welf und Ralph hatten sich gegen dieses Ansinnen als echte Wölfe von Wolfsturm lange und mannhaft gewehrt, aber Rolf war schließlich damit durchgedrungen, daß er nicht weniger als zwanzig Möglichkeiten nachwies, den Vertrag beiseitezuschieben; schlimmsten Falles dadurch, daß man sich mit den Vettern auf Zinkenberg, Festenburg, Geyerstein, Rabenhorst verbände und das Nest unten überhaupt beseitige –[144] womit denn der Kontrakt auch beseitigt wäre, da eben der eine Kontrahent nicht mehr existierte.
Schließlich wirkte aber doch am gründlichsten das Mädchen selber.
Den Welf brauchte sie nur im Nacken zu krauen, so ward er milde wie Mandelöl.
Beim Ralph genügte schon ein kleiner Patscher auf die Backen.
Und den Rolf hatte sie überhaupt schon und ohne jede besondere Hantierung.
Das ging nun also alles vorzüglich, und auf Wolfsturm herrschte ein vorzüglicher Humor. Ralph blies sogar die Klappentrompete, und Welf, der weniger musikalisch war, rührte zuweilen vor lauter Wohlgefühl die große Kesselpauke, die in der Waffenkammer stand. Rolf aber – sang.
Zu den eigentlichen Minnesängern, die nun in der Literaturgeschichte stehen und von den höheren Töchtern auswendig gelernt werden müssen, gehörte er ja nicht. Er dichtete und sang etwas kunstlos, aber Reime auf et fand er immerhin eine erkleckliche Menge, obwohl es des Peregrinus Syntax Reimlexikon damals noch nicht gab.
Oft, während die beiden Älteren draußen im wilden Walde den Jagdspieß sausen ließen, saß er, gleich Herrn Walter von der Vogelweide, auf einem Steine und deckte Bein mit Bein. Doch gehörte das eine Beinpaar der Annemargret. Auch dichtete und sang er in dieser Stellung keineswegs unablässig, trieb vielmehr andere zum poetischen Hausgebrauch notwendige Dinge. Als da sind: Ausmessung des Parallelismus der Glieder beim Strophenbau, Rhythmenabklopfung auf rundlichen, rhythmisch wohlgebauten und daher[145] als Maßeinheit dienlichen Stellen, Gleichklangsstudien unter Zugrundelegung des Geräusches, das zwei Lippen hervorbringen, die, soeben noch fest aufeinandergepreßt, sich plötzlich voneinander lösen.
Die weniger dichterisch veranlagten Brüder bemerkten diese Übungen in praktischer Poetik mit Unbehagen und ermangelten nicht, dem Benjamin von Wolfsturm klarzumachen, daß sie ihm die Knochen im Leibe zerbrechen würden, wenn er fürderhin zu Hause wilderte, während sie draußen mit Wölfen und Bären Stelldicheins hatten.
Aber Rolf rümpfte nur die Nase dazu und zog die Lippen hoch, schlug auch wohl aufs Schwert, daß es nur so klirrte, und meinte: der Busch, in dem er jetzt jagte, dünkte ihm lieblicher als der wilde Wald, und wenn ihm da einer ins Gehege käme, so wäre es wohl möglich, daß er mit ihm verführe, wie mit einem frechen Bauern, den's nach Edelmanns Hirschen lüstete.
Derlei Reden, hin und her geschleudert wie Jagdspieße, trübten den Humor auf Wolfsturm zuweilen etwas, und wenn nicht Jungfer Annemargret so unbändig klug gewesen wäre, wie sie wirklich war, so hätte der Humor wohl bald ein Ende gehabt und es wäre nicht bei geredeten Jagdspießen geblieben.
Aber, ei, wie war Margretlein klug! Hatte sie's mit Junker Rolf, wenn die anderen draußen mit Bruder Petz tanzten, so hatte sie's doch auch mit diesen, wenn die Gelegenheit gut war.
Der grimme Welf war sicher, sie nicht gar selten oben im Treppenwinkel zu treffen, wenn er, Ausguck zu halten, zum Turme stieg. Und da schwand sein Unmut schleunig, hatte er im Dunkel das runde, gefüge Ding im Arm, das er noch lieber an sich preßte,[146] als den Urhumpen der Wölfe von Wolfsturm. Wie wundersüß ging's ihm ins Ohr, wie sie so an ihm hing und flüsterte: »Lieb's Welfle du, was bist du stark!«
Ralph aber kriegte sein Teil wohl zugemessen unten im Weinkeller. Dort, wo's so kühl und heimlich war, zwischen den großen, werten Tonnen, saßen sie eng beieinander auf dem Tonnenschragen, rechts den braven Malvasier und links den lieblichen Traminer, und hielten einander so nahe und enge, daß es ihnen bei aller Kellerkühle gar freundlich warm wurde. Ach, wie wunderhold's ihm im rundwölbigen Keller widerklang, wenn sie lispelte: »Lieb's Ralphle lieb's, was bist du g'schmeidi!«
So glaubte sich denn im Grunde jeder Hahn im Margretenkorbe und lachte heimlich die anderen aus, die nach demselben Bissen leckten, und keiner wußte, daß ein Korb drei Hähne beherbergen kann, wenn die Körblerin es nur einzuteilen weiß.
Ein bißchen dumm waren die drei jungen Junggesellen schon, wie man sieht. Aber was will man bei so ungenügenden Volksschulverhältnissen, wie sie in den Raubritterzeiten herrschten, anders verlangen? Es war halt das finstre Mittelalter.
Also: gut ging's im allgemeinen. Es kriegte jeder sein Annemargretisch Teil, und, ein paar Verdachtswolken abgerechnet, die sich hier und da über dem Haupte Rolfs gleich schwarzen Kutteln himmlischer Riesenkühe zusammenzogen, trübte nichts die verliebte Selbstsicherheit jedes einzelnen.
Ralph blies bereits schelmische Triller auf der Klappentrompete, Welf verübte ganz virtuos leidenschaftliche Donnerwetter der Liebe auf der Kesselpauke, und Rolf hatte ungefähr sämtliche Reime beisammen,[147] die die deutsche Sprache auf et hergibt. Es wurde fast idyllisch auf Wolfsturm und sämtliche Bewohner dieses adeligen Sitzes, Christoph und die gewaltigen Streitrosse nicht ausgenommen, setzten einigermaßen Fett an.
Da kam das Schicksal in Ritterstiefeln und trat alles entzwei.
Es war ein schöner, klarer Herbsttag und die Weinlese eben vorüber.
Welf saß oben auf dem Geländer des Turmumgangs und guckte aus. Plötzlich rief er in den Hof hinab, wo Margaret eben die drei Paar Ritterstiefel im Brunnentrog spülte: »Ralph und Rolf: wo stecken die Junker!?«
»Im Keller und klopfen die Tonnen ab, wieviel noch Wein drinnen.«
»Ha, das ist gut, bei meiner Seel'! Ruf sie herauf!«
Annemargret schickte ein gutes Blickchen empor, das mit eisengepanzerter Kußfaust sehr ritterlich erwidert ward, beugte sich zu einer allerliebsten Rundung zusammen, daß Welf beim Anblick der kühn ausgebogenen Hinterfülle vor Entzücken stöhnte und rief mit süßer Stimme ins dunkle Kellerloch: »Junkerchen, herauf! Der Welf hat was!«
Ralph und Rolf traten gebückt aus der niederen Kellertür und schrien zum Turm: »Hallo, was ist?«
»Gewimmt3 ist! Die Bauern fahren das Praschlett4 zur Stadt.«
»Alle Teufel und Satansbrut!« rief Ralph – »schon?«
»Ei freilich! Es ist die Zeit! Ihr ließt wohl alles den Krämern in die Löcher fahren, säß ich nicht hier und guckte aus. Wie steht's in den Tonnen?«
»Nieder!« antwortete Rolf. »Die Traminerin klingt hohl wie deine Pauke.«
»Und den Malvasier kann eine junge Katze auslecken,« fügte Ralph hinzu.
»So denn mit Eilen in Stiefel und Sattel und hurtig Ersatz geschafft!«
Welf schwang sich vom Gelände und polterte die Treppe herab.
sang anmutigen Eifers voll der nie um Reime verlegene Rolf.
»Sind alle noch naß!« gab die zurück.
»Was schiert mich das!?« reimte Rolf entgegen und fuhr in die patschnassen Lederhöhlen.
Indessen brüllte Ralph nach den Pferden, rumorte Welf im Waffengelasse, klirrte Christoph mit den Zaumketten, klapperten die Gäule aus dem Stalle, lachte und kicherte Margret. Kurz: Wolfsturm machte mobil.
Wie die drei glücklich im Sattel saßen und den Schlußtrunk genommen hatten, den Annemargret jedem erst annippen mußte, ehe sie ihn dem vom Gaul Gebeugten in die Eisenpfote gab, wurde der Kriegsplan gemacht.
»Ich reit auf die Traminer!« erklärte Welf.
»Ich hol' den süßen von Margreid!« entschied sich Ralph.
»Ich will mich hinter Urschel nach Schilcher5 umtun!« gab Rolf kund.
5 Schillerwein, halb weiß, halb rot.
Aber Annemargret protestierte: »Nix hinter Urschl! Urschl hat's schriftlich! Ihr seid mir die Nettern!«
»Ho, die Urschl-Margret, hohohoho!« lachten die drei.
»Also reit ich anderswohin auf den Schilcher, daß uns Annemargretlein nit sauer wird, die Urschlerin!« erklärte Rolf. »Bleibt sie uns dann süß?«
»Süß allen dreien!« lachte das Mädchen und stemmte die Arme in die Seiten, fest und keck wie eine flinke Bäuerin.
»Fallt's mir fei' mit ins Praschletschaff«6, fügte sie hinzu, wie die Junker abritten.
6 Maischbottich.
Dann stand sie noch lange und blickte den nach drei Richtungen auseinandersprengenden von der Mauer aus nach und ließ jedem ihr Tüchlein zuwehen, wenn er sich umwandte und ihr mit der gepanzerten Faust winkte.
Sind doch alle drei recht liebe Junker, dachte sie sich. Jeder hat was besonders Liebes. Der Welf ist wie ein Bär so kräftig und grimmig. Huh, wie er zupackt! Schier blaue Flecke gibt's und ist doch gar lieb. Der Ralph ist nicht so ganz stark, aber hitzig. Küßt er, ist's wie ein Biß, und der Atem geht einem aus vor lauter Schönsein. Aber der Rolf hat was gar Zart's und Fein's und kann reden, daß man die Augen zumachen muß, – so lieblich schwatzt er. Wenn er so leise um die Hüften greift, geht's kitzlich überallhin, als wenn jed's Blutströpfel im Leibe lachen sollt'.[150] Lacht auch jed's. – So ist's mit allen dreien, wundergut in Heimlichkeit. Möcht' keinen missen. Muß aber immer fein schlau und achtsam sein. Hu, wenn der eine mich mit dem anderen säh. Das gäb böses Getu.
So sinnierte sie aufs angenehmste vor sich hin. Dann ging sie aufbetten.
Wie sie mit den Junkerbetten fertig war, dachte sie sich: Will doch heut die dreie mit dem Wein im Putz überraschen! Und ging in ihre Kammer, den Sonntagsstaat anzulegen.
Schon damals, in den wilden Raubritterzeiten, zogen sich hübsche Mädchen gerne aus und an, und, wenn die Spiegel auch gar klein und trübe waren, sie sahen sich doch gern darin. Es war also das Anziehen eine liebliche Beschäftigung für die Kleine, und als sie ihre Röcke von sich hatte und im kurzärmeligen Leinenhemdchen dastand, da drehte sie sich wohl viele Male vor dem Spiegel hin und her und betrachtete sich selber mit viel Aufmerksamkeit, Ernst und Genugtuung.
Da, plötzlich ging die Kammertür auf, und Junker Rolf stand auf der Schwelle.
Aber nicht lange. Denn kaum hatte er das Mädchen in dieser auch für Junker besonders lieblichen Verfassung gesehen, da war er mit einem Satze bei ihr und umfing sie mit den geharnischten Armen.
»Hu, bist du kalt!« rief sie erschrocken aus, die über der Kälte dieser eisernen Umarmung ganz vergessen hatte, daß sie sich erst schämen mußte.
Aber auch ihm war das Eisen jetzt unbequem. Hastig entschiente er sich, und krach, bumm, knirr flogen die Harnischteile von ihm, und er stand im Lederwamse. Es ging viel schneller als sonst mit dem alten Christoph.
Nun war es gar nicht mehr kalt, wie er sie umfing.
Eine Weile hatten die Lippen mehr zu tun, als zu reden.
Dann aber fragte Margret: »Ja, aber, daß ich das Pferd nicht auf der Brücke gehört hab'! Und wo ist denn das Praschlet?«
»Draußen angebunden das Pferd! Praschlet mögen die anderen bringen! Du bist mir lieber, als aller Wein! Du, mein rotweißer Schilcher und süßer Malvasier! Lieb's Ding im Rock, viel lieber noch im Hemd! Du! Du! Du! Oh, was du weiß und weich bist! Dräng dich, drück dich, leg dich mir nah! O du mein Wein von Ursula! Du heiße, weiße, voll und rund! Gib deinen Mund! Gib deinen Mund! Und wieder, wieder! Gretlein, mein Mädlein!«
Sie aber sagte nichts und küßte bloß.
Da: Treppengepolter. Da: Rasseln vor der Tür. Da: krach eine Faust wider das Türgetäfel.
Rolf sprang auf und sprang zur Tür, – g'rad vor die Brust Welfs, der sie eben aufgerissen hatte.
Ein Heulen wie aus Wolfsrachen, ein Stoß mit der geschienten Faust vor Rolfs Brust. Der taumelt zurück, bückt sich, sucht sein Schwert.
Aber schon wirft sich, mit beiden Fäusten sein Schwert nach unten stoßend, Welf über ihn und rennt dem Gebückten den Stahl durch den Rücken.
Starr saß Annemargret im Hemd auf dem Bett und hielt kindängstlich die Finger an den Mund.
Jetzt … kommt … das Schwert … zu mir …
Welf zog das Schwert aus dem verröchelnden Leibe, warf es nieder und stellte sich vor der Starrenden schnaufend auf.
»Dich … drossl' ich … so …«
Er streckte die auseinandergekrallten Eisenfinger nach ihrem Hals.
Sie sank vom Bett und kniete vor ihm bettelnd nieder.
»Lieb's Welfle, stark's, sei gut …!«
Und nimmt die beiden eisernen Hände und legt sie sich auf die hochgehende Brust und lächelt.
»Du! … Du! …«
Er hebt sie hoch auf und wirft sie aufs Bett, und nimmt sie wieder hoch und preßt sie wütend, klammernd an sich, und nimmt sie wie ein Kind auf den Arm und trägt sie in der Kammer herum und schluchzt und brummt und küßt sie und erdrosselt sie halb vor Grimm und Liebe.
»Heioh! Heioh! Der Süße von Margreid! Zehn Yrn7 und gutgemessen! Heioh Margret, für dich der Süße von Margreid!«
7 Altes Tiroler Weinmaß.
Ralph hielt im Burghofe neben einem Parschletfuder, das zwei geknebelte Knechte eben eingeführt hatten.
»Für dich der Süße von Margreid! Da, schau Margret!« schrie Welf und trat mit dem Mädchen auf dem Arm ans Fenster.
»Was tust du da!« brüllte Ralph, bebend vor Zorn, als er das sah.
»Meine Margret! Meine Margret!« brüllte Welf. »Willst du sie auch noch? So komm und hol sie.«
Mit einem Satze sprang Ralph vom Pferde und die Treppe hinauf.
Welf setzte Margret aufs Bett, hob sein Schwert auf und stürzte hinaus.
Draußen auf der Treppe rasselten sie aneinander. Brüllen. Fluchen. Schnaufen. Gepolter. Ein Schrei.
Ralph rollte, erschlagen, die Treppe hinunter.
»Hahahaha! Hahahaha; Annemargret, jetzt sind wir allein! Geh in den Keller und hol, was noch im Fasse ist! Ei, geh immer im Hemd! Sollst mir fürder im Hemde gehn! Denn so hab ich dich doppelt lieb, du mollig Ding!«
Annemargretlein – lächelte und ging. Mit beiden Händen den Humpen tragend kam sie wieder.
»Trink an, mein Schätzel!«
Sie nippte und bot ihm den Humpen. Er nahm einen langen Zug.
»Nun lös mir die Riemen und nimm mir die Schienen ab … So, mein liebs Ding … Und küsse mich auch! … So, mein liebs Ding! … Und setz dich mir auf den Schoß! … So, mein liebs Ding! … Ei, ist es nicht besser zu zweit? … Sag's, mein liebs Ding!«
»Ja …«
Nun lagen Ralph und Rolf draußen im wilden Walde bei ihrem Vater, dem alten Raubritter, im Erbbegräbnis, und die ehrsame Steinmetzzunft der Nachbarschaft hatte Arbeit, ihnen das Wappen auf ihren Grabplatten auszuhauen. Das Blut auf der Treppe und in Margrets Kammer war zwar nicht so leicht abzuscheuern, aber man sah es bei der Dunkelheit, wie sie in Raubritterburgen gewöhnlich herrschte, auch nicht eben sehr, und überdies war Margret ausquartiert.
Somit wäre also alles gut gewesen, und es blieb eigentlich nur noch die Fahrt zum Heiligen Grabe übrig, die Welf, um nicht unliebsames Aufsehen zu[154] erregen, doch wohl unternehmen mußte. Denn, wenn auch die Polizei damals zu wünschen übrigließ, wenn es sich um ritterliche Familienangelegenheiten handelte, so hatte der Beichtstuhl doch seine Prinzipien, und alles ließ sich am Ende nicht mit ein paar Messen oder auch Stiftungen abmachen. Aber es hatte ja Zeit.
Indessen kam es böser.
Zuerst kam Welf bloß unter den Pantoffel.
Das war nicht angenehm, ließ sich aber doch ertragen, denn Welf war sehr verliebt, und Annemargret ließ es an nichts fehlen, diese Verliebtheit immer warm zu erhalten.
Aber eine Weile hin, und sie kriegte Launen.
Und das war schlimmer. Denn Unfriede in der Liebe geht auf die Nerven – sogar bei raubritterlichen Junkern, denen selbst ein paar eilige Brudermorde noch lange keine Nervenzustände zuziehen. Das Schmollen bald und bald Zanken, das Kammertürverriegeln und Beichtevorschützen und dann wieder das Gebettel: »Geh, ein Ringlein ins Ohr, ein Kettlein um'n Hals, ein seiden Fürtüchel, ein Paar rote Schuh! …« Hol's der Teufel und sein schwänzig Gesinde!
Indessen: man ritt halt öfter auf die Krämer; man wetterte mal und brüllte sich aus; tat dann auch wieder recht fein und lieblich um den Balg, und schließlich war der am guten Ende auch wieder fein, und es schmeckte die Liebe um so süßer, wenn vorher der Zank recht sauer geschmeckt hatte.
Aber eines Tages, just, als es anfing kalt zu werden und Welf die Fenster mit Moos ausfütterte, kam Annemargret, ein Bündel in der Hand, auf ihn zu und sagte ganz kurz: »Junker, i geh!«
»Was tust du!! …?«
»Aufkünden tu i. Heim mag i.«
»Wa … as?? …!«
»Ja, sell.8 Is mir zu öd hierheroben jetzt.«
8 Das.
»Wa … as??? …!«
»Früher, wo ihr dreie ward, is ja gangen. Hättst halt nit den Ralph derschlagen und den Rolf. Die Langweil hab i.«
Dem Junker schwollen die Schläfenadern.
»Also, ich allein bin dir nicht genug. – Du … du … ha!« –
»So is.«
»Also die andern fehlen dir!!?«
»Freili!«
Sie ließ die Schürzenbänder wirbeln und legte den Kopf auf die Seite. Das war ihre Trotzpose.
Da ging dem Junker Welf der Ritterzorn durch, und er gab ihr eine Ohrfeige, daß die Trotzpose auf die andere Seite verlegt wurde. Ein Glück, daß er die Eisenhandschuhe nicht anhatte. Es langte auch so.
»Jetzt geh i erscht recht!« sagte sie, heulte gar nicht mal erst lange, nahm ihr Bündel auf, drehte sich um, daß die Röcke flogen, und ging.
Welf war ganz starr. Dann überlegte er sich, ob es nicht das beste wäre, sie auch totzuschlagen. Aber da er zum Überlegen immer sehr viel Zeit brauchte, war sie schon zum Tore hinaus, als er damit fertig war. Übrigens hatte er sich auch anders entschieden. Er war keines heroischen Entschlusses fähig. Wie vor den Kopf geschlagen saß er da und riß das Moos in Flocken. Dann sprang er plötzlich auf, stieß ein Fenster ein und brüllte hinaus: »Luder! Luder!«
Einen eisernen Topf, der gerade neben ihm stand, schmiß er in gewaltigem Bogen hinter ihr drein.
Sie aber stand jenseits der Zugbrücke und drehte ihm eine lange Nase.
»Bhütigod, grimms Welfle, verkühl di nit!«
Welf tat einen grausamen Fluch, reckte die Arme, haute aufs Fensterbrett, brüllte, daß die Scheiben klirrten, riß sich am Bart und rannte in die Waffenkammer. Rasend rührte er dort das Instrument seiner Leidenschaft und paukte in Donnerwirbeln seinen Ingrimm aus.
Wie er nicht mehr konnte, sank er auf die Rüstbank nieder und fühlte sich leichter.
Und siehe: es ward ihm weich zu Sinne, und in seinem Gemüt war eine welke Empfänglichkeit für christliche Gedanken.
»Christoph!« rief er, und in seiner Stimme klang seltsame Milde.
»Ja, Herr!« antwortete der.
»Haben wir noch einen Pilgermantel mit Muscheln?«
»Ja, aber recht schäbig sieht er aus, sind die Motten drin, und ein paar Muscheln gehen ab.«
»Macht nichts! Bürste ihn aus und nähe die Muscheln fest. Ich walle nach Jerusalem!«
»Wo … hin!?«
»Frage nicht – bürste!«
Christoph sperrte den Mund auf und wunderte sich. Dann bürstete er den Pilgermantel derer von Wolfsturm und freute sich, daß er nun auf eine Weile keine Stiefeln mehr zu putzen haben würde.
Erst drei Paar, dann ein Paar, dann kein Paar!
So steht Gott seinen treuen Knechten bei und verhilft ihnen zu einem ruhigen Alter.
König Leberecht, der schon in vorgerückten Jahren befindliche, aber immer noch recht rüstige Beherrscher eines angenehm im Gebiete der mittleren Zone gelegenen Landes, liebte es, die Büchse im Arm, auf hohe Berge zu steigen und dort all das Wild zu erlegen, das man mit viel Mühe und Kunst in die unmittelbare Nähe seines Feuerrohres brachte.
Auf diesen Jagdzügen begleitete ihn, der gerne Menschen um sich hatte, weil er wohl wußte, daß es für Fürsten nicht gut ist, allein zu sein, nicht nur eine Schar bevorzugter Männer des Hof- und Staatsdienstes, sondern auch eine wohlausgewählte Mustergarnitur solcher Leute, die sich durch sachgemäße Überdeckung größerer Leinwandflächen mit Farbe oder durch andere Hantierungen von gewissermaßen künstlerischem Charakter in der Leute Mund gebracht und überdies durch die Annahme des Titels von Professoren bewiesen hatten, daß sie, obwohl keiner ernsthaften Beschäftigung obliegend, doch Sinn für das bürgerlich Reputierliche besaßen.
Es war, und dessen war sich ein jeder in des Königs Jagdgefolge wohl bewußt, eine große Ehre, mit Seiner Majestät durch die Felder und die Auen zu streifen, sowie auf schmalen Pfaden die erhabenen Gipfel der[158] Bergwelt zu erklimmen, die wie wenig anderes dazu angetan erscheint, dem Menschen einen Begriff davon zu geben, wie großartig die Welt ist. Indessen, wie die meisten Ehren, so war auch diese mit Anstrengungen und Unbequemlichkeiten verbunden. Schon das Klettern allein erschien den älteren Ministern, vortragenden Räten, Kammerherren und Kunstprofessoren als eine im Grunde nicht ganz erfreuliche Muskelübung.
Denn, abgesehen davon, daß der königliche Bergsteiger schon an und für sich in seiner Eigenschaft als Fürst jenen elastischen und lebhaften Gang hatte, von dem wir immer in den Zeitungen lesen, wenn von einem in Bewegung befindlichen Landesvater die Rede ist, war König Leberecht auch noch besonders auf diesen Sport trainiert, da er Zeit seines Lebens die meisten freien Stunden, die ihm die Regierungsgeschäfte ließen, hauptsächlich dazu verwandt hatte, sich in der ebenso gesunden wie vornehmen Kunst des Kletterns auszubilden. Er wäre, wenn ihm die Schicksalsgöttinnen statt einer Krone einen Gamsbarthut und statt des Zepters einen Bergstock in die Wiege gelegt hätten, zweifellos ein ebenso vortrefflicher Bergführer geworden, wie er nun in Wirklichkeit ein scharmanter König geworden war.
Aber die böse Notwendigkeit, mit den untrainierten Beinen des Untertanen den trainierten Beinen des Souveräns in gleichem Schritt und Tritt zu folgen, war noch nicht einmal die fatalste Begleiterscheinung jener ehrenvollen Jagdpartien. Das Unangenehmste waren die kalten Bäder, die die höchst badelustige Majestät auf luftigster Höhe im schneekühlen Gewässer munterer Gebirgsbäche zu nehmen liebte, und von[159] denen sich keiner ihrer Begleiter ausschließen konnte, da sich der Wasserscheue sonst dem Verdachte ausgesetzt hätte, daß er nicht unter allen Umständen gesonnen sei, seinem höchsten Herrn überallhin zu folgen.
Wie viele ministerielle, geheimrätliche, kammerherrliche, kunstprofessorale Schnupfen die Erfüllung dieser harten Untertanenpflicht im Laufe der Jahre zur Folge hatte, darüber besteht keine Statistik, doch darf ruhig angenommen werden, daß ihrer viele und die meisten davon hartnäckiger Natur waren. Denn nicht jeder verträgt zehn Grad Reaumur im Wasser. Die Loyalität ist willig, aber das Fleisch ist schwach.
Nach einem solchen Bade in der Höhe von 1500 Metern bei entsprechender Wassertemperatur begab es sich nun einmal, daß der König, dem von der genossenen Wasserkühle selber die Finger etwas klamm geworden waren, seine Toilette (mit gebotener Delikatesse zu sprechen) nicht ganz zu Ende führte. Anfangs bemerkte niemand diesen Umstand, da ein jeder nur von dem einen Wunsche beseelt war, die eigene gesunkene Blutwärme durch allseitig luftdichten Verschluß der Kleider wieder in die Höhe zu bringen. Als sich aber später die königliche Jagdgesellschaft auf einem angenehmen Wiesenplane zur Rast niedergelassen hatte, nahm man den kleinen, aber durch seine Örtlichkeit fatal auffälligen Mangel wahr.
Nun ist eine solche Wahrnehmung selbst unter gewöhnlichen Menschen, wenn der eine nicht gerade die Frau des anderen ist, mit einer gewissen Peinlichkeit verbunden. Denn es handelt sich hier, wenn man der Sache auf den Grund geht, um einen Umstand, der geeignet ist, das sittliche Gefühl zu verletzen, um einen dolus eventualis auf dem besonders[160] heiklen Gebiete der Erbsünde sozusagen. Indessen, schließlich gibt sich doch immer einer den gewissen Ruck, nimmt den betreffenden (in den meisten Fällen ist es ein alter Professor oder Dichter) beiseite und flüstert (wenn er das Wort »geradezu« im Wappen führt): »Sie, Ihr Hosentürl ist offen,« oder (wenn er delikater ist) mit einem schnellen orientierenden Blicke: »Es ist etwas bei Ihnen nicht in Ordnung.« Ja, es gibt sogar Leute, die selbst bei so peinlichen Gelegenheiten zu frivolen Scherzen aufgelegt sind und etwa die Bemerkung machen: »Sie, verlier'n S' fei' nix!«
Kann man aber so etwas einem Fürsten, einem Könige sagen? Nein: Man kann nicht! Der höfische Stil versagt hier vollkommen. Es gibt durchaus keine Redewendung in der Phraseologie des Umganges mit Majestäten, die es ermöglichte, derlei vor ein allerhöchstes Ohr zu bringen, als über welchem bei feierlichen Anlässen nur durch ein paar Zentimeter getrennt eine Krone zu sitzen kommt. Nicht einmal der mit allen Essenzen höfischer Eleganz und Wortbiegungskunst gewaschene Zeremonienmeister Baron von Bemsl, der doch eine anerkannte Autorität auf dem Gebiet höfischer Linguistik ist, und von dem man hoffte, er werde die schwierige Mission übernehmen und so seinem dichten Lorbeerkranze als königlicher Hausdiplomat ein neues leuchtendes Blatt einverleiben, erklärte, dies überschreite seine Fähigkeiten: dieser Fall sei von einer Heikligkeit, daß man seine Lösung nicht einer Menschenzunge, sondern der Vorsehung selber überlassen müsse, die übrigens, so fügte er mit anmutiger Zuversicht hinzu, noch immer bewiesen habe, daß sie über das königliche Haus mit besonderer Aufmerksamkeit wache. Sohin (er liebte dieses kuriale[161] Wort) werde ihr auch dieser Umstand nicht entgehen, und sie werde zweifellos Mittel und Wege finden, ihn zu beheben, ohne daß sich ein schwacher Mensch den Mund zu verbrennen brauche.
»Das ist alles sehr schön und sehr gut, und ich bin schon von Ressorts wegen der letzte, der an der Vorsehung zu zweifeln wagt,« bemerkte der Kultusminister, dem es trotz eines kaum überstandenen Schüttelfrostes jetzt sehr heiß zumute wurde, »aber sie müßte äußerst schnell eingreifen. Bedenken Sie, lieber Baron, daß uns am Fuße dieses Berges eine Deputation der ländlichen Bevölkerung erwartet, darunter vier weißgekleidete Jungfrauen, von denen die jüngste ein Huldigungsgedicht auswendig gelernt hat. Ich wette meinen Kopf, daß die Jungfrau aus dem Konzept kommt, wenn ihr Blick zufällig auf die derangierte Gegend fällt, und diese infamen Bauernlackel werden dem höchsten Herrn sämtlich, ich sage Ihnen: sämtlich nicht ins Gesicht sehen, sondern – ebendorthin. Mein Gott, mein Gott: Die Situation ist von einer märchenhaften Scheußlichkeit. Wir können uns, so gern wir sonst dazu bereit sind, hier nicht auf höhere Mächte verlassen; wir müssen selber handeln. Wozu sind Sie denn Zeremonienmeister, wenn Sie sofort versagen, wo es einmal gilt, die durch einen tückischen Zufall bedrohte Würde des Königstums zu retten! Hic Rhodus! Hic salta! Walten Sie Ihres Amtes!«
Der Zeremonienmeister, der es bisher immer zu vermeiden gewußt hatte, in Anwesenheit des Königs Schweiß abzusondern, war nicht imstande, die plebejische Feuchtigkeit zurückzudrängen, die ihm angesichts dieser grauenerregenden Perspektive auf die Stirne[162] trat. Er fühlte die ganze furchtbare Verantwortung, die ihm diese entsetzliche Situation aufbürdete. Er sah das Ansehen des Hofes in Gefahr, die Regierung wanken, den Staat konvulsivischen Zuckungen preisgegeben. Vor seinem inneren Auge jagten sich Feuer, Pulverdampf und blutigrote Wogen der Rebellion. Vor allem aber bebte sein ganzes Gemüt und schoß molkig zusammen wie Milch, wenn's wittert, bei dem Gedanken, daß seine Stellung auf dem Spiele stand. Denn in der Tat, dieser Toilettenmangel gehörte in sein Ressort, da kein Kammerdiener zugegen war.
Sollte er vielleicht doch? … Sollte er nicht doch vielleicht mit dem Anstand, den er hatte, diskret sich in den Hüften wiegend, an den König herantreten und mit delikatem Augenniederschlag lispeln: »Majestät haben allerhöchst geruht, zu vergessen, sich die …«
Aber bei allen Heiligen und Nothelfern, das geht ja doch nicht! Niemals noch, solange es Zeremonienmeister gibt, haben Zeremonienmeisterlippen derartiges zu einem König zu sagen sich erkühnt.
In seiner fassungslosen Verwirrung überfiel ihn die phantastische Idee, zu den Mitteln der Mimik zu greifen und, sich dicht vor seiner Majestät postierend, an sich selbst, gewissermaßen wie an einem Lehrphantom, scheinbar die Handlung vorzunehmen, die der König an seiner Kleidung tatsächlich unterlassen hatte.
Aber das war ja grotesk, skurril, Wahnsinn! Ebenso hätte er direkt hingehen und, an das respektive Kleidungsstück der allerhöchsten Person Hand anlegend, den Mangel brevi manu reparieren können – eine Vorstellung, bei der er fast in Tränen der Verzweiflung ausgebrochen wäre.
Aber Verzweiflung ist ein zu gelindes Wort, um auszudrücken, in welchem Zustande sich das zeremonienmeisterliche Gemüt befand. Er war der Auflösung nahe. Schon konnte er kaum mehr seine Augen regieren, die immer nur den einen, sich zu einem ungeheuren Schlund und Abgrund klaffend erweiternden Punkt suchten, der die schauderhafte Quelle dieser unsäglich grausamen Prüfung für ihn war. Gewaltsam mußte er seine Blicke von dort wegwenden, um sie ziellos im Kreise herumirren zu lassen. –
Ob denn nicht doch irgendeiner der Anwesenden es wagen würde?
An die Staats- und Hoffunktionäre sich zu wenden, war ganz aussichtslos; das fühlte er mit der Gewißheit des Erfahrenen. Aber vielleicht einer dieser Kunstprofessoren?! Unter ihnen, die ja auch sonst zu seinem Entsetzen oft genug gegen den höfischen Ton verstießen, mußte doch einer zu finden sein, der, wenn man ihm einen Orden oder einen Auftrag oder schließlich den persönlichen Adel versprach, das unerhörte, kaum auszudenkende Wagstück unternahm.
Er zog jeden einzelnen beiseite, bat, flehte, rang die Hände, versprach schließlich den gebührenfreien Freiherrntitel und die Erblichkeit der Professur in der Familie, eingeschlossen die weibliche Nachkommenschaft – nichts half. Alle erklärten, lieber täglich eine Literflasche Mastixfirnis auf das Wohl des erhabenen Landesherrn leeren zu wollen.
Der Zeremonienmeister hatte das absolut sichere Gefühl, daß der jüngste Tag herangebrochen sei; in seinen Ohren dröhnten deutlich die Posaunen. Da fiel sein Blick auf den Revierförster Meier, der hinter[164] einem Baum saß und mit Mißmut konstatierte, daß sein Enzianschnaps zu Ende war.
Ein letzter Hoffnungsstrahl flackerte, aber nur ganz schwach, im Ingenium des halbtoten Hofmanns auf. Der Meister des höfischen Parketts trat zum Meister des gebirgigen Forstes und entwickelte ihm, indem er sich bemühte, durch leise Dialektfärbung seiner Sprechweise etwas Volkstümliches zu verleihen, den ganzen Komplex der verhängnisvollen Verlegenheit, hinzufügend, daß er, der biedere Mann aus dem Volke, allein befähigt und berufen sei, den Hof, die Regierung, den Staat zu retten, indem er den König auf jenen Punkt aufmerksam machte, auf jenen Punkt …
»Das Hosentürl? Wenn's weiter nix is?!« meinte Meier.
»Aber Sie dürfen natürlich nicht so geradezu, lieber Meier,« flüsterte der Zeremonienmeister, dem doch etwas bange wurde bei dieser schnellen Entschlossenheit des offenbar ganz ungeleckten Bären … »Sie müssen durch die Blume gewissermaßen … von hinten herum sozusagen … abstrakt …« Er fand durchaus nicht die populären Akzente. Das lag zu weit weg von seinem Ressort.
»Versteh' schon! Natürlich! Ich kenn' mich aus. Von der Schleichseitn zuweripürschen muß ich mich. Nicht gleich mit dem Hosentürl ins Haus fallen. Beileib! Beileib! Fein andrehn muß man so was. So, in der Art, daß der König meinen könnt', es wär' einem andern sein Hosentürl! … Schwer is schon. Aber ich hab' schon andere Füchse gefangen.«
Nach diesen Worten überzeugte sich der Revierförster nochmals, daß seine Flasche vollkommen leer war, schob sie resigniert in seinen Rucksack und stand[165] mit der Miene eines Mannes auf, der heftig nachdenkt und zu allem entschlossen ist.
Der Zeremonienmeister sah ein, daß dieser Mann, wenn nicht vorher der Himmel einfiel, binnen zwei Minuten das Unglaubliche zum Ereignis machen werde. Ihm ward zumute, als ob plötzlich der feste Boden unter ihm zu wanken begänne; eine grauslich hohe Woge hob ihn, senkte ihn und führte ihn aufs hohe Meer hinaus, einem ungewissen Schicksal entgegen, das irgendwo den Rachen aufsperrte, ihn zu verschlingen. Wie er bemerkte, daß der Revierförster sich in Bewegung setzte, fühlte er alle Schrecken der Seekrankheit in seinen Eingeweiden. Nur wie durch einen Schleier, einen gelbgrauen Nebel sah und hörte er, was sich nun begab.
Der Revierförster Meier ging gerade auf den König zu, sah ihn aus seinen katzengrauen Augen zutraulich von unten an, nahm seinen bis ins Zeiserlfarbene verschossenen, vor sehr langer Zeit einmal dunkelgrün gewesenen Hut ab und – machte eine Verbeugung. Sodann aber setzte er seinen Hut wieder auf und stand stramm.
Mit dem scharfen Blicke, der ihn stets auszeichnete, bemerkte König Leberecht, daß dieses durchaus reglementswidrige Gebaren seinen Grund in etwas besonderem haben müsse, und fragte mit dem huldvollen Tone, der das erste ist, was ein jeder richtige König sich anzueignen keine Mühe und Übung scheut: »Na, Meier, was gibt's?«
(In diesem Augenblicke gab es dem Zeremonienmeister einen schmerzlichen Ruck, und er sah sich direkt vis-à-vis dem Rachen des Ungeheuers, das ihn verschlingen wollte. Sein Herzschlag setzte aus. Ein[166] überlebensgroßer Knödel kroch in seiner Speiseröhre mit einer unangenehm schlickernden Abart des Rollens empor und versetzte ihm auch den Atem. Sein letzter Gedanke war der Orden vom heiligen Kajetan, von dem er schon lange träumte. Dann: Nacht und Vernichtung.)
Meier aber trat einen Schritt vor und sprach mit der markig festen Stimme des deutschen Mannes, der keine Menschenfurcht kennt:« »Ich möchte bloß die hohen Herrschaften was fragen.«
Alles war starr. Keiner begriff. Auch König Leberecht nicht. Aber sein Ton war doch noch immer huldvollst, als er sagte: »Fragen Sie nur zu, Meier.«
Und Meier ließ seine Stimme fröhlich erschallen und sprach: »Wie wär's denn, meine Herrschaften, wenn wir alle miteinander unsere Hosentürln zumachten?«
Eine Reflexbewegung seiner Hände belehrte den König über den Sinn dieser rhetorischen Frage. Er richtete, was zu richten war, und lachte dann so herzlich laut auf, daß seine Umgebung überzeugt sein konnte, es sei durchaus im Sinne der Etikette gehandelt, wenn sie mitlachte. Und da es zugleich ein Lachen der Befreiung war, war es ein brausendes, dröhnendes, herzerfreuendes Lachen.
Selbst die Spechte, die die hohen Stämme der Fichten bepochten, hielten mit Hämmern inne und lachten mit.
Der Zeremonienmeister aber erwachte unter diesem Ensemblesatz des Vergnügens zu neuem Leben und fand sogleich, daß es unschicklich sei, in der allerhöchsten Nähe zu wiehern, wie unerzogene Rösser. Wäre ihm nicht gleichzeitig jener fatale Knödel gottlob zergangen[167] und verschwunden, so daß er wieder frei atmen und sich im Vollbesitze seiner Kontenanz fühlen konnte, hätte er noch einen schlimmeren Vergleich gewählt.
König Leberecht aber sprach, indem er dem Revierförster eine Zigarre anbot (die dieser jetzt noch und mit der ausgesprochenen Absicht, daß sie bis ans Ende der Tage dort bleiben soll, in seinem Glaskasten aufbewahrt): »Meier, Sie sind ein ganzer Kerl. Schade, daß ich Sie nicht in der Regierung verwenden kann. – Ja, meine Herren,« und damit wandte er sich zu den übrigen: »das Volk, das Volk! … Es ist eine schöne Sache um das Volk! …«
Dann stieg er, langsamer, als es sonst seine Art war, in tiefes Sinnen versunken, den Berg hinab, an dessen Fuße ihn ein junges Mädchen in weißen, gestärkten Kleidern mit den Worten begrüßte:
Bei diesen Worten stellte sich bei Seiner Majestät eine Ideenassoziation ein, die ein Lächeln des königlichen Mundes zur Folge hatte, woraus alle anwesenden Gemeindevorstände aufs neue die Überzeugung gewannen, daß der hohe Herr nach wie vor den Interessen des Nährstandes seine besondere Huld zuwendete.
9 Man muß es dem Dichter zugute halten, daß er falsch betont. Er stammte nicht aus Rom, sondern aus Jerusalem.
Ende.
| Seite | |
| Einleitung | 3 |
| Skizze zum Porträt eines guten Bekannten von mir | 19 |
| Yankeedoodle-Fahrt | 27 |
| Die Liaisons der schönen Sara | 52 |
| Samalio Pardulus | 90 |
| Annemargret und die drei Junggesellen | 131 |
| Der mutige Revierförster | 157 |
| Der heilige Mime | 169 |
| Gedichte: | |
| Flußfahrt im Frühling | 191 |
| Der stille alte Goethe | 192 |
| Des Helden Not | 192 |
| Erde, liebe Erde | 193 |
| Südtiroler Herbst | 193 |
| Erzählung | 194 |
| Der Verliebte | 195 |
| Seele! | 196 |
| Grabschrift für meinen Vater | 196 |
| Lyrikerasten | 196 |
| Schwein und Pfau (Eine fatale Fabel) | 197 |
| Wegweiser | 199 |
| Gott sei Dank! | 199 |
| Unser Schloß | 203 |
| Die Reise ohne Fahrplan | 204 |
Von Otto Julius Bierbaum erschienen folgende Werke:
Lyrik:
Erlebte Gedichte. Gustav Schuhr Verlag, Berlin, 1892. Jetzt im Inselverlag Leipzig.
Nehmt, Frouwe, diesen Kranz. Gustav Schuhr, Berlin, 1894. Jetzt Inselverlag.
Irrgarten der Liebe (34. Tausend). Inselverlag, 1901.
Dann als »Neubestellter Irrgarten der Liebe«. (Neu angeordnet und vermehrt). Ders. Verlag, 1906. (35. bis 40. Tausend.)
Das seidene Buch. Deutsche Verlagsanstalt, Stuttgart, 1903.
Maultrommel und Flöte. Georg Müller, München 1907.
Erzählendes:
Studentenbeichten. Novellen. Schuster u. Loeffler, Berlin, 1. Reihe 1891, 2. Reihe 1897. (1. Reihe 8. Aufl., 2. Reihe 6. Aufl.)
Die Schlangendame. Novelle. Derselbe Verlag, 1893. (6. Aufl.)
Die Freiersfahrten und Freiersmeinungen des weiberfeindlichen Herrn Pankrazius Graunzer. Ders. Verlag, 1895. (6. Aufl.)
Stilpe. Roman aus der Froschperspektive. Derselbe Verlag, 1897. (8. Aufl.)
Das schöne Mädchen von Pao. Chinesischer Roman. Derselbe Verlag, 1899. (3. Aufl.) (Große Künstlerausgabe mit Illustrationen von B. Lyers, 1909, im Verlage von Georg Müller.)
Kaktus. Künstlergeschichten. (3. Aufl.) Derselbe Verlag, 1899.
Annemargret und die drei Junggesellen. Novellen. Inselverlag, Leipzig, 1902. (Vergriffen; zum Teil übernommen in die »Sonderbaren Geschichten«.)
Die Haare der heiligen Fringilla und andere Geschichten. Albert Langen, München, 1903. (Verschiedentlich neu aufgelegt.)
Das höllische Automobil. Novellen. Wiener Verlag, Wien, 1904. (Vergriffen; zum Teil übernommen in die »Sonderbaren Geschichten«.)
Zäpfel Kerns Abenteuer. Kinderbuch. Georg Müller, München, 1906. Jetzt bei Schaffstein & Co., Köln. (Neue Aufl. 1910.)
Prinz Kuckuck. Zeitroman in 3 Bdn. Georg Müller, München, 1906/07. 12. Aufl.
Sonderbare Geschichten. 3 Bde. Derselbe Verlag, 1908.
Dramatisches:
Lobetanz. Bühnenspiel für Musik (komp. von L. Thuille). Genossenschaft »Pan«, Berlin, dann Schuster & Loeffler, Berlin, 1895, jetzt Georg Müller, München.
Gugeline. Bühnenspiel für Musik (komp. von L. Thuille). Inselverlag, Leipzig, 1899.
Pan im Busch. Tanzspiel (komp. v. Felix Mottl). Inselverlag, 1899.
Stella und Antonie. Schauspiel. Albert Langen München, 1903.
Die vernarrte Prinzeß (komp. von O. von Chelius). Derselbe Verlag, 1904.
Zwei Stilpekomödien. (Das Cénacle der Maulesel und die Schlangendame.) Georg Müller, München, 1905.
Zwei Münchener Faschingsspiele (Fastnachts-Festspiele.) Albert Langen, München, 1905.
Der Bräutigam wider Willen. (Komödie nach Dostojewski.) Wiener Verlag, Wien, 1906.
Der Musenkrieg. Studentenkomödie für Musik. Karl Curtius, Berlin, 1907.
Kritisches:
Die zweite Münchener Jahresausstellung Arnold Böcklin. Dr. E. Albert & Co., München, 1890/91, vergriffen.
Detlev von Liliencron. Wilh. Friedrich, Leipzig, 1892, vergriffen.
Fritz von Uhde. Dr. E. Albert & Co., München, 1893, vergriffen.
Franz Stuck (Prachtwerk). Derselbe Verlag, 1893, vergriffen.
Aus beiden Lagern. Über das erste Ausstellungsjahr in München. Karl Schüler, München, 1893, vergriffen.
Franz Stuck. In der Monographienreihe von Velhagen & Klasing, Bielefeld, 1899. (Neue Auflage 1909.)
Hans Thoma. In der »Kunst« von Marquardt & Co., Berlin, 1903. (3. Aufl. 1909.)
Fritz v. Uhde. In der »Kunst unserer Zeit«. Hanfstängl, München, 1905, als Buch gänzlich umgearbeitet bei Georg Müller, 1908.
Liliencron. Ein Essaybuch. Verlag von Georg Müller, München.
Verschiedenes:
Der bunte Vogel von 1897. Kalenderbuch, Gedichte und allerhand Prosa. Schuster & Loeffler, Berlin, 1896, jetzt Georg Müller, München.
Der bunte Vogel von 1899. Derselbe Verlag, 1898, jetzt Georg Müller, München.
Eine empfindsame Reise im Automobil. Reiseberichte. Marquardt & Co., Berlin, 1903.
Dasselbe, erweitert unter dem Titel »Mit der Kraft«. Derselbe Verlag, 1906.
Die Yankeedoodle-Fahrt und andere Reisegeschichten. Georg Müller, München, 1910.
Demnächst erscheint:
Fortuna. Ein Abenteuer in 5 Akten (mit Königsbrun-Schaup). Verlag von Georg Müller, München.
Weitere Anmerkungen zur Transkription
Offensichtliche Fehler wurden stillschweigend korrigiert. Die Darstellung der Ellipsen wurde vereinheitlicht.
Korrekturen:
S. 21: achaische → archaische
Mozart, archaische Skulpturen
S. 101: Mißgestalten → Mißgestalteten
dieses Nachtkonzert der Unholde dem Mißgestalteten
S. 185: sehrende → zehrende
Wie zehrende Liebeskunde
End of Project Gutenberg's Reife Früchte vom Bierbaum, by Otto Julius Bierbaum
*** END OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK REIFE FRÜCHTE VOM BIERBAUM ***
***** This file should be named 62438-h.htm or 62438-h.zip *****
This and all associated files of various formats will be found in:
http://www.gutenberg.org/6/2/4/3/62438/
Produced by The Online Distributed Proofreading Team at
https://www.pgdp.net
Updated editions will replace the previous one--the old editions
will be renamed.
Creating the works from public domain print editions means that no
one owns a United States copyright in these works, so the Foundation
(and you!) can copy and distribute it in the United States without
permission and without paying copyright royalties. Special rules,
set forth in the General Terms of Use part of this license, apply to
copying and distributing Project Gutenberg-tm electronic works to
protect the PROJECT GUTENBERG-tm concept and trademark. Project
Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you
charge for the eBooks, unless you receive specific permission. If you
do not charge anything for copies of this eBook, complying with the
rules is very easy. You may use this eBook for nearly any purpose
such as creation of derivative works, reports, performances and
research. They may be modified and printed and given away--you may do
practically ANYTHING with public domain eBooks. Redistribution is
subject to the trademark license, especially commercial
redistribution.
*** START: FULL LICENSE ***
THE FULL PROJECT GUTENBERG LICENSE
PLEASE READ THIS BEFORE YOU DISTRIBUTE OR USE THIS WORK
To protect the Project Gutenberg-tm mission of promoting the free
distribution of electronic works, by using or distributing this work
(or any other work associated in any way with the phrase "Project
Gutenberg"), you agree to comply with all the terms of the Full Project
Gutenberg-tm License (available with this file or online at
http://gutenberg.org/license).
Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg-tm
electronic works
1.A. By reading or using any part of this Project Gutenberg-tm
electronic work, you indicate that you have read, understand, agree to
and accept all the terms of this license and intellectual property
(trademark/copyright) agreement. If you do not agree to abide by all
the terms of this agreement, you must cease using and return or destroy
all copies of Project Gutenberg-tm electronic works in your possession.
If you paid a fee for obtaining a copy of or access to a Project
Gutenberg-tm electronic work and you do not agree to be bound by the
terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or
entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph 1.E.8.
1.B. "Project Gutenberg" is a registered trademark. It may only be
used on or associated in any way with an electronic work by people who
agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few
things that you can do with most Project Gutenberg-tm electronic works
even without complying with the full terms of this agreement. See
paragraph 1.C below. There are a lot of things you can do with Project
Gutenberg-tm electronic works if you follow the terms of this agreement
and help preserve free future access to Project Gutenberg-tm electronic
works. See paragraph 1.E below.
1.C. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation ("the Foundation"
or PGLAF), owns a compilation copyright in the collection of Project
Gutenberg-tm electronic works. Nearly all the individual works in the
collection are in the public domain in the United States. If an
individual work is in the public domain in the United States and you are
located in the United States, we do not claim a right to prevent you from
copying, distributing, performing, displaying or creating derivative
works based on the work as long as all references to Project Gutenberg
are removed. Of course, we hope that you will support the Project
Gutenberg-tm mission of promoting free access to electronic works by
freely sharing Project Gutenberg-tm works in compliance with the terms of
this agreement for keeping the Project Gutenberg-tm name associated with
the work. You can easily comply with the terms of this agreement by
keeping this work in the same format with its attached full Project
Gutenberg-tm License when you share it without charge with others.
1.D. The copyright laws of the place where you are located also govern
what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in
a constant state of change. If you are outside the United States, check
the laws of your country in addition to the terms of this agreement
before downloading, copying, displaying, performing, distributing or
creating derivative works based on this work or any other Project
Gutenberg-tm work. The Foundation makes no representations concerning
the copyright status of any work in any country outside the United
States.
1.E. Unless you have removed all references to Project Gutenberg:
1.E.1. The following sentence, with active links to, or other immediate
access to, the full Project Gutenberg-tm License must appear prominently
whenever any copy of a Project Gutenberg-tm work (any work on which the
phrase "Project Gutenberg" appears, or with which the phrase "Project
Gutenberg" is associated) is accessed, displayed, performed, viewed,
copied or distributed:
This eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with
almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or
re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included
with this eBook or online at www.gutenberg.org/license
1.E.2. If an individual Project Gutenberg-tm electronic work is derived
from the public domain (does not contain a notice indicating that it is
posted with permission of the copyright holder), the work can be copied
and distributed to anyone in the United States without paying any fees
or charges. If you are redistributing or providing access to a work
with the phrase "Project Gutenberg" associated with or appearing on the
work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.E.1
through 1.E.7 or obtain permission for the use of the work and the
Project Gutenberg-tm trademark as set forth in paragraphs 1.E.8 or
1.E.9.
1.E.3. If an individual Project Gutenberg-tm electronic work is posted
with the permission of the copyright holder, your use and distribution
must comply with both paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 and any additional
terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked
to the Project Gutenberg-tm License for all works posted with the
permission of the copyright holder found at the beginning of this work.
1.E.4. Do not unlink or detach or remove the full Project Gutenberg-tm
License terms from this work, or any files containing a part of this
work or any other work associated with Project Gutenberg-tm.
1.E.5. Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this
electronic work, or any part of this electronic work, without
prominently displaying the sentence set forth in paragraph 1.E.1 with
active links or immediate access to the full terms of the Project
Gutenberg-tm License.
1.E.6. You may convert to and distribute this work in any binary,
compressed, marked up, nonproprietary or proprietary form, including any
word processing or hypertext form. However, if you provide access to or
distribute copies of a Project Gutenberg-tm work in a format other than
"Plain Vanilla ASCII" or other format used in the official version
posted on the official Project Gutenberg-tm web site (www.gutenberg.org),
you must, at no additional cost, fee or expense to the user, provide a
copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon
request, of the work in its original "Plain Vanilla ASCII" or other
form. Any alternate format must include the full Project Gutenberg-tm
License as specified in paragraph 1.E.1.
1.E.7. Do not charge a fee for access to, viewing, displaying,
performing, copying or distributing any Project Gutenberg-tm works
unless you comply with paragraph 1.E.8 or 1.E.9.
1.E.8. You may charge a reasonable fee for copies of or providing
access to or distributing Project Gutenberg-tm electronic works provided
that
- You pay a royalty fee of 20% of the gross profits you derive from
the use of Project Gutenberg-tm works calculated using the method
you already use to calculate your applicable taxes. The fee is
owed to the owner of the Project Gutenberg-tm trademark, but he
has agreed to donate royalties under this paragraph to the
Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payments
must be paid within 60 days following each date on which you
prepare (or are legally required to prepare) your periodic tax
returns. Royalty payments should be clearly marked as such and
sent to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation at the
address specified in Section 4, "Information about donations to
the Project Gutenberg Literary Archive Foundation."
- You provide a full refund of any money paid by a user who notifies
you in writing (or by e-mail) within 30 days of receipt that s/he
does not agree to the terms of the full Project Gutenberg-tm
License. You must require such a user to return or
destroy all copies of the works possessed in a physical medium
and discontinue all use of and all access to other copies of
Project Gutenberg-tm works.
- You provide, in accordance with paragraph 1.F.3, a full refund of any
money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the
electronic work is discovered and reported to you within 90 days
of receipt of the work.
- You comply with all other terms of this agreement for free
distribution of Project Gutenberg-tm works.
1.E.9. If you wish to charge a fee or distribute a Project Gutenberg-tm
electronic work or group of works on different terms than are set
forth in this agreement, you must obtain permission in writing from
both the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and Michael
Hart, the owner of the Project Gutenberg-tm trademark. Contact the
Foundation as set forth in Section 3 below.
1.F.
1.F.1. Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable
effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread
public domain works in creating the Project Gutenberg-tm
collection. Despite these efforts, Project Gutenberg-tm electronic
works, and the medium on which they may be stored, may contain
"Defects," such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or
corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual
property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a
computer virus, or computer codes that damage or cannot be read by
your equipment.
1.F.2. LIMITED WARRANTY, DISCLAIMER OF DAMAGES - Except for the "Right
of Replacement or Refund" described in paragraph 1.F.3, the Project
Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project
Gutenberg-tm trademark, and any other party distributing a Project
Gutenberg-tm electronic work under this agreement, disclaim all
liability to you for damages, costs and expenses, including legal
fees. YOU AGREE THAT YOU HAVE NO REMEDIES FOR NEGLIGENCE, STRICT
LIABILITY, BREACH OF WARRANTY OR BREACH OF CONTRACT EXCEPT THOSE
PROVIDED IN PARAGRAPH 1.F.3. YOU AGREE THAT THE FOUNDATION, THE
TRADEMARK OWNER, AND ANY DISTRIBUTOR UNDER THIS AGREEMENT WILL NOT BE
LIABLE TO YOU FOR ACTUAL, DIRECT, INDIRECT, CONSEQUENTIAL, PUNITIVE OR
INCIDENTAL DAMAGES EVEN IF YOU GIVE NOTICE OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
1.F.3. LIMITED RIGHT OF REPLACEMENT OR REFUND - If you discover a
defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can
receive a refund of the money (if any) you paid for it by sending a
written explanation to the person you received the work from. If you
received the work on a physical medium, you must return the medium with
your written explanation. The person or entity that provided you with
the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a
refund. If you received the work electronically, the person or entity
providing it to you may choose to give you a second opportunity to
receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy
is also defective, you may demand a refund in writing without further
opportunities to fix the problem.
1.F.4. Except for the limited right of replacement or refund set forth
in paragraph 1.F.3, this work is provided to you 'AS-IS' WITH NO OTHER
WARRANTIES OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR ANY PURPOSE.
1.F.5. Some states do not allow disclaimers of certain implied
warranties or the exclusion or limitation of certain types of damages.
If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the
law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be
interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by
the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any
provision of this agreement shall not void the remaining provisions.
1.F.6. INDEMNITY - You agree to indemnify and hold the Foundation, the
trademark owner, any agent or employee of the Foundation, anyone
providing copies of Project Gutenberg-tm electronic works in accordance
with this agreement, and any volunteers associated with the production,
promotion and distribution of Project Gutenberg-tm electronic works,
harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees,
that arise directly or indirectly from any of the following which you do
or cause to occur: (a) distribution of this or any Project Gutenberg-tm
work, (b) alteration, modification, or additions or deletions to any
Project Gutenberg-tm work, and (c) any Defect you cause.
Section 2. Information about the Mission of Project Gutenberg-tm
Project Gutenberg-tm is synonymous with the free distribution of
electronic works in formats readable by the widest variety of computers
including obsolete, old, middle-aged and new computers. It exists
because of the efforts of hundreds of volunteers and donations from
people in all walks of life.
Volunteers and financial support to provide volunteers with the
assistance they need, are critical to reaching Project Gutenberg-tm's
goals and ensuring that the Project Gutenberg-tm collection will
remain freely available for generations to come. In 2001, the Project
Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure
and permanent future for Project Gutenberg-tm and future generations.
To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation
and how your efforts and donations can help, see Sections 3 and 4
and the Foundation web page at http://www.pglaf.org.
Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive
Foundation
The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non profit
501(c)(3) educational corporation organized under the laws of the
state of Mississippi and granted tax exempt status by the Internal
Revenue Service. The Foundation's EIN or federal tax identification
number is 64-6221541. Its 501(c)(3) letter is posted at
http://pglaf.org/fundraising. Contributions to the Project Gutenberg
Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent
permitted by U.S. federal laws and your state's laws.
The Foundation's principal office is located at 4557 Melan Dr. S.
Fairbanks, AK, 99712., but its volunteers and employees are scattered
throughout numerous locations. Its business office is located at
809 North 1500 West, Salt Lake City, UT 84116, (801) 596-1887, email
business@pglaf.org. Email contact links and up to date contact
information can be found at the Foundation's web site and official
page at http://pglaf.org
For additional contact information:
Dr. Gregory B. Newby
Chief Executive and Director
gbnewby@pglaf.org
Section 4. Information about Donations to the Project Gutenberg
Literary Archive Foundation
Project Gutenberg-tm depends upon and cannot survive without wide
spread public support and donations to carry out its mission of
increasing the number of public domain and licensed works that can be
freely distributed in machine readable form accessible by the widest
array of equipment including outdated equipment. Many small donations
($1 to $5,000) are particularly important to maintaining tax exempt
status with the IRS.
The Foundation is committed to complying with the laws regulating
charities and charitable donations in all 50 states of the United
States. Compliance requirements are not uniform and it takes a
considerable effort, much paperwork and many fees to meet and keep up
with these requirements. We do not solicit donations in locations
where we have not received written confirmation of compliance. To
SEND DONATIONS or determine the status of compliance for any
particular state visit http://pglaf.org
While we cannot and do not solicit contributions from states where we
have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition
against accepting unsolicited donations from donors in such states who
approach us with offers to donate.
International donations are gratefully accepted, but we cannot make
any statements concerning tax treatment of donations received from
outside the United States. U.S. laws alone swamp our small staff.
Please check the Project Gutenberg Web pages for current donation
methods and addresses. Donations are accepted in a number of other
ways including checks, online payments and credit card donations.
To donate, please visit: http://pglaf.org/donate
Section 5. General Information About Project Gutenberg-tm electronic
works.
Professor Michael S. Hart is the originator of the Project Gutenberg-tm
concept of a library of electronic works that could be freely shared
with anyone. For thirty years, he produced and distributed Project
Gutenberg-tm eBooks with only a loose network of volunteer support.
Project Gutenberg-tm eBooks are often created from several printed
editions, all of which are confirmed as Public Domain in the U.S.
unless a copyright notice is included. Thus, we do not necessarily
keep eBooks in compliance with any particular paper edition.
Most people start at our Web site which has the main PG search facility:
http://www.gutenberg.org
This Web site includes information about Project Gutenberg-tm,
including how to make donations to the Project Gutenberg Literary
Archive Foundation, how to help produce our new eBooks, and how to
subscribe to our email newsletter to hear about new eBooks.