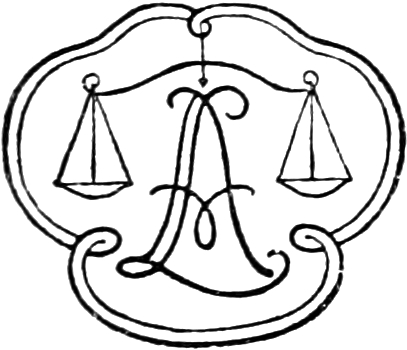The Project Gutenberg EBook of Kultur-Kuriosa, Zweiter Band, by Max Kemmerich
This eBook is for the use of anyone anywhere in the United States and most
other parts of the world at no cost and with almost no restrictions
whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of
the Project Gutenberg License included with this eBook or online at
www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you'll have
to check the laws of the country where you are located before using this ebook.
Title: Kultur-Kuriosa, Zweiter Band
Author: Max Kemmerich
Release Date: November 18, 2020 [EBook #63801]
Language: German
Character set encoding: UTF-8
*** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK KULTUR-KURIOSA, ZWEITER BAND ***
Produced by Peter Becker, Reiner Ruf, and the Online
Distributed Proofreading Team at https://www.pgdp.net (This
file was produced from images generously made available
by The Internet Archive)
Anmerkungen zur Transkription
Der vorliegende Text wurde anhand der 1910 erschienenen
Buchausgabe so weit wie möglich originalgetreu wiedergegeben.
Typographische Fehler wurden stillschweigend korrigiert. Ungewöhnliche
und heute nicht mehr gebräuchliche Schreibweisen sowie Schreibvarianten
bleiben gegenüber dem Original unverändert, sofern der Sinn des Texts
dadurch nicht beeinträchtigt wird.
Abhängig von der im jeweiligen Lesegerät installierten
Schriftart können die im Original gesperrt
gedruckten Passagen gesperrt, in serifenloser Schrift, oder aber sowohl
serifenlos als auch gesperrt erscheinen.
Kultur-Kuriosa
Zweiter Band
von
Dr. Max Kemmerich
Erstes bis viertes Tausend
Albert Langen, München
Von Dr.
Max Kemmerich erschienen bei Albert
Langen:
Kultur-Kuriosa Erster Band 7.
Tausend
Dinge, die man nicht sagt 5. Tausend
Copyright 1910 by Albert Langen, Munich
Der Erfolg des ersten Bandes der Kultur-Kuriosa hat mich veranlaßt,
diesen zweiten, der nach den gleichen Gesichtspunkten geschrieben wurde
und nach mancher Richtung hin Ergänzungen enthält, folgen zu lassen.
Für die Berichtigung eventueller Irrtümer bin ich dankbar.
Leute, denen ein sittlicher Klerus, ein vorurteilsfreier Gelehrter
oder ein gerechter Richter kurios erscheinen, werden sich hoffentlich
über dieses Buch geradeso alterieren, wie über seinen Vorgänger. Ich
schreibe aber ausschließlich für Gebildete und kann daher auf sie
leider keine Rücksicht nehmen.
München, den 5. August 1910
Der Verfasser
[S. iv]
Inhaltsverzeichnis
|
|
|
Seite
|
|
1.
|
Abschnitt: Modernes und Merkwürdiges im Altertum
|
|
|
2.
|
Abschnitt: Wissenschaft
|
|
|
3.
|
Abschnitt: Autoritäten, gelehrte Zunft und Fortschritt
|
|
|
4.
|
Abschnitt: Die »Dilettanten« und Outsider
|
|
|
5.
|
Abschnitt: Von Universität und Schule
|
|
|
6.
|
Abschnitt: Zensur und Prüderie
|
|
|
7.
|
Abschnitt: Frömmigkeit
|
|
|
8.
|
Abschnitt: Mein Reich ist nicht von dieser Welt
|
|
|
9.
|
Abschnitt: Klerus und Sittlichkeit
|
|
|
10.
|
Abschnitt: Ehe
|
|
|
11.
|
Abschnitt: Rechtspflege
|
|
|
12.
|
Abschnitt: Von allerlei Sitten und Zeremoniell
|
|
|
Anmerkungen
|
|
[S. 1]
Erster Abschnitt
Modernes und Merkwürdiges im Altertum
Das Interesse, das gerade diesem Kapitel der Kultur-Kuriosa
entgegengebracht wurde, rechtfertigt eine Fortsetzung. So seien auch
hier zwanglos Tatsachen aneinandergereiht.
Die italienische archäologische Kommission hat bei Ausgrabungen im
Königspalast zu Phaistos (Kreta) einen Fund gemacht, der Gutenbergs
geniale Erfindung in graueste Vorzeit – etwa Mitte des zweiten
vorchristlichen Jahrtausends – zurückverfolgen läßt. Man fand eine
große Terrakottascheibe, die auf beiden Seiten eine Inschrift in
Hieroglyphen enthält. Und zwar wurde diese zweihundertundvierzig Zeilen
lange Inschrift auf die noch ungebrannte Scheibe mit beweglichen
Lettern gedruckt.[1]
Die Römer waren der Erfindung der Buchdruckerkunst
außerordentlich nahe. Nicht nur, daß wir aus Quintilian wissen (I,
1. 25), daß Kinder mit beweglichen Lettern spielten, um so leicht
buchstabieren zu lernen, Cicero (de natura deorum II, 37) macht die
Bemerkung, daß es gerade so undenkbar sei,[S. 2] die Welt sei aus einer
zufälligen Verbindung der Atome entstanden, wie die Annahme, aus einem
Haufen auf die Erde geschütteter Metallbuchstaben könnten die Annalen
des Ennius werden. Also kannte man sogar Metallbuchstaben! Es
ist daher viel verwunderlicher, daß die Römer keinen Buchdruck hatten,
als es das Gegenteil sein würde.
*
Die technischen und chemischen Kenntnisse der ältesten Griechen und
deren Vorgänger waren ebenfalls weit bedeutender, als man bisher geahnt
hat. Man fand bei den Ausgrabungen des deutschen archäologischen
Instituts in Pylos Gegenstände aus Pate vitreuse, schönes blaues
Kaliglas und Fayence. Also war die Glasfabrikation den Trägern
der mykenischen Kultur bereits um die Mitte des zweiten vorchristlichen
Jahrtausends bekannt. Ferner besaß man bewundernswerte Kenntnisse in
der Farbenbereitung, konnte farbiges Kali- und Natronglas herstellen,
wußte Kupfer mit Zinn und Blei in ganz bestimmtem Verhältnis zu
legieren, wie man das Kupfer chemisch rein darzustellen vermochte.
Ferner konnte man versilbern. In einem Grabe um 2500 v. Chr.
fand man eine mit Silberfolie teilweise bedeckte Tonvase.
Am erstaunlichsten sind aber die theoretischen Anschauungen: Man
hatte den Begriff der Atome, der Einheit der Materie,
deren Unzerstörbarkeit und Unerschaffbarkeit und
kannte die Identität von Materie und Energie. D. h. man hatte
eine physikalische Weltanschauung, wie wir sie erst seit relativ sehr
kurzer Zeit besitzen.[2]
*
[S. 3]
Daß bereits um 400 v. Chr. mit Gas geheizt wurde, dürfte nicht
vielen bekannt sein. Ktesias berichtet, daß in Karamanien das dort
entweichende Erdgas als Heizmaterial für den Hausgebrauch Verwendung
fand.[3]
Vor achtzig Jahren erhielt der Ingenieur Neilson ein Patent auf ein
Heißluftgebläse für Hochöfen. Bei den Ausgrabungen in Tel
el Hesey in Südpalästina sind Funde gemacht worden, die es so gut
wie sicher erscheinen lassen, daß schon um 1400 v. Chr. die alten
Orientalen dieses Verfahren kannten. Man fand einen Hochofen für
Eisenbereitung, der eine Vorrichtung besaß, welche bezweckte, die
Außenluft vor ihrer Einführung in den Ofen zu erwärmen.[4]
*
Daß der Gedanke des Seeweges nach Ostindien und der
Entdeckung Amerikas der Antike keineswegs fremd war, ist eine
gewiß erstaunliche Tatsache. Krates verlegte – im Gegensatz zu
Aristarch – die Wanderfahrten des Odysseus in den Atlantischen Ozean
(Gellius 14, 6. 3). Und zwar ließ er den Menelaos von Gadeira (Cadix)
aus, Afrika umschiffend, Indien erreichen und nach siebenjähriger Fahrt
zurückkehren (Strabo I, 31). Bekanntlich war Vasko de Gama der erste,
der im Jahre 1498 auf diesem Wege das Wunderland erreichte. Einen noch
kühneren Gedanken sprach fünfzig Jahre später der große Poseidonius
mit der Behauptung aus, daß Indien von Spanien aus bei günstigen
Ostwinden in kurzer Zeit zu erreichen sei (Strabo II, 6 und Seneca
nat. I, prol. 13). Strabo aber wurde bereits im Jahre 1470 von Guarino
ins[S. 4] Lateinische übersetzt und war nachweislich dem Kolumbus durch
Toscanelli bekannt geworden. Es ist also höchst wahrscheinlich,
daß Kolumbus, als er auf dem angegebenen Wege 1492 Amerika entdeckte,
nur einen Gedanken zur Ausführung brachte, der ihm aus dem Altertum
übermittelt worden war.[5]
*
Beim Wort »Amerika« denken wir gern an »unbegrenzte Möglichkeiten«, an
Wolkenkratzer und gigantische Projekte. Auch sie sind keineswegs neuen
Datums, selbst wenn wir nicht auf die Pyramiden oder die gewaltigen
altägyptischen Tempelanlagen blicken. Der berühmten Neu-Yorker
Freiheitsstatue ist wohl vergleichbar der Koloß von Rhodos.
Dieser war 70 Ellen oder 105 römische Fuß (32 m) hoch und stand in
der Nähe des Hafeneinganges. Nur wenige konnten den Daumen der Figur
umfassen und jeder seiner Finger war größer wie die meisten Statuen.
Nachdem er nur 66 Jahre gestanden hatte, zerbrach er infolge eines
Erdbebens 227 v. Chr. Fast 900 Jahre lag er auf der Erde, bis ein
arabischer General die Reste im Jahre 672 an einen Juden verkaufte, der
900 Kamele mit dem Erz belud (Plinius 34, 41).
*
Noch amerikanischer als der Sonnenkoloß mutet uns der Plan des
Stasikrates, eines Schülers des Lysippos an. Er wollte – wie
Plinius, Plutarch und Strabo übereinstimmend bezeugen – den felsigen
Athosberg in eine Kolossalbildsäule Alexan[S. 5]ders des Großen
verwandeln. Diese größte aller existierenden Statuen sollte in der
linken Hand eine Stadt halten, groß genug, 10000 Einwohner zu fassen,
und in der Rechten eine Urne, aus der sich ein Strom ins Meer ergösse.
*
Streiks sind uns auch aus der Antike überliefert. Im Jahre 311
v. Chr. fühlte sich die ehrenwerte Zunft der Musikanten (tibicines)
schwer beleidigt, weil der ihnen von alters her zustehende festliche
Freischmaus, den sie jährlich einmal auf dem Kapitol in aede Jovis auf
Staatskosten abhalten durften, gestrichen worden war. Sie verließen
alle Rom und begaben sich nach Tibur. Das war aber für die Behörden
höchst peinlich, denn ohne Musik konnten die Opfer nicht abgehalten
werden. Man holte sie durch eine List zurück, indem man sie einzeln
betrunken machte und voll des süßen Weines auf Leiterwagen nach
Rom schaffte. Übrigens gaben die Zensoren nach und billigten den
feuchtfröhlichen Musikern ihre alte Gerechtsame wieder zu (Livius IX,
30, Ovid. fast. VI, 665 ff.).
*
Nichts wäre irriger als die Anschauung, in prähistorischen Zeiten
sei man aller ärztlichen Kenntnisse bar gewesen. Im Gegenteil haben
wir es hier mit hervorragenden Chirurgen zu tun. In dem
altbajuwarischen Reihengräberfeld bei Allach in Oberbayern fand
man z. B. einen Schädel, an dem einst ein taubeneigroßes Stück
abgeschlagen, später aber[S. 6] vorzüglich und fast genau an derselben
Stelle zum Anwachsen gebracht worden war. Dieser Schädel befindet
sich in der prähistorischen Sammlung zu München. Ferner verstand
man es, Arm- und Beinbrüche vortrefflich zu heilen. So lieferte
das alemannische Reihengräberfeld bei Memmingen ein Beispiel eines
Flötenschnabelbruches. In diesem auch für heutige Begriffe sehr
schwierigen Falle kann nur ein ausgebildeter Arzt tätig gewesen sein.
Ebenso fand man im merowingischen Reihengräberfeld von Wies-Oppenheim
einen befriedigend verheilten Schulterknochen. Die Trepanation der
Schädeldecke war bereits in der älteren Bronzezeit geübt, wie ein
Fund aus Giebichenstein bei Halle lehrt. Das Loch besaß die Größe
eines Markstückes und ist in der späteren Lebenszeit der Person durch
reichliche Knochenneubildung wieder ganz gefüllt worden.[6]
Daß schon im Altertum eine Ärztin ihre Kunst zu allgemeiner
Anerkennung ausübte, lehrt ein Fund, den die österreichische Expedition
des Jahres 1892 auf dem Trümmerfeld der alten lykischen Stadt Tlos
im südlichen Kleinasien machte. Man fand eine Statuenbasis mit der
griechischen Inschrift: »Antiochis, die Tochter des Diodotes aus
Tlos, deren ärztliche Empirie von Rat und Gemeinde der Stadt Tlos
beglaubigt ist, hat sich das ihr zuerkannte Standbild auf eigene Kosten
errichten lassen.« Also auch die weibliche Eitelkeit läßt sich so weit
zurückverfolgen!
Mag der amerikanische Zahnarzt auch ein Produkt der Neuzeit sein, seine
Leistungen sind es nicht so sehr. So wurde ein antikes künstliches
Gebiß in der uralten Etruskerstadt Tarquinii gefunden. Es wird[S. 7]
jetzt im Museo Municipale in Corneto, drittes Zimmer, gezeigt.
*
Auch Nahrungsmittelfälscher gab es im Altertum, und zwar wurde
Brot mit Gips versetzt. Besonders häufig waren Weinpantschereien,
wie nach zahlreichen Klagen alter Autoren feststeht. Man setzte dem
Gepansch eine Art von Fuchsin zu.
Wer meinen sollte, die berühmte Worcestershire-Sauce sei
ohne Vorläufer, wird sich wundern, daß die Römer im Garum (Garon),
einer sehr kostbaren, aus Fischen bereiteten Sauce, etwas Ähnliches
besaßen. Sogar koschere (garum castimoniale), aus schuppenlosen
Fischen bereitete gab es. In Pompeji wurde ein irdenes Gefäß damit
gefunden. Plinius (nat. his. XXXI, 93–95) beschreibt die Verfertigung
dieser Würze.[7] Apicius (de re coquinaria I, 32) kennt eine Reihe von
Speisen, denen er Garum zugesetzt wissen will, z. B. ein Oenogarum,
eine Weinbrühe mit Trüffel.
Auch Bowlen kannten die Alten. Der berühmte Feinschmecker
Apicius beschreibt nicht nur Rosenbowle (I, 4), Honigwein, der mit
verschiedenen Gewürzen gekocht wird (I, 1) und anderes, sondern sogar
einen Rosenwein ohne Rosen (I, 4), wie wir ja auch Maibowlen haben, die
aus Surrogaten hergestellt sind.
Übersetze ich das Rezept richtig – ich interessierte mich einst sehr
für Apicius, den ich in Übersetzung herausgeben wollte, was inzwischen
von anderer Seite geschehen sein soll – dann lautet es: »Rosenwein
ohne Rosen bereite folgendermaßen: Grüne Zitronen[S. 8]blätter in einem
Palmenkörbchen gib in ein Faß Most, bevor er gärt, und nimm sie nach
vierzig Tagen heraus. Falls es nötig sein sollte, setze Honig hinzu
und bediene dich (dieses Getränkes) statt des Rosenweins«. Genau im
Stile der modernen Kochbücher! Vielleicht probiert einmal eine geneigte
Leserin dieses oder jenes Rezept, doch empfiehlt es sich, dazu Johann
Heinrich Diernbachs »Flora Apiciana« (Heidelberg und Leipzig 1831) zu
konsultieren, da hier die Gewürze usw. genau bestimmt sind.
*
Die künstliche Bebrütung von Eiern der Gänse, Enten und Hühner,
die noch 1829 dem Franzosen Copineau trotz vieler Versuche nicht
glücken wollte, war bereits den alten Ägyptern geläufig. Und zwar
legten sie die Eier in Kammern aus Lehm, die mittels großer, aus
Ziegelsteinen zusammengesetzter und in die Erde hineingebauter Öfen
täglich drei bis vier Stunden geheizt wurden. Die Eier lagen auf Stroh
und wurden alle sechs Stunden umgewendet, nach zehn Tagen untersucht
und die gut befundenen in eine höhere wärmere Abteilung desselben
Gemachs gelegt. Die Temperatur wurde natürlich nur nach dem Gefühl
abgeschätzt und nach Bedarf durch Öffnen von Luftzügen vermindert
(Aristoteles hist. anim. VI, 2, 3 und Diodor I, 74).
*
Auch Schneckenzuchtgärten besaß man, wie heute in Frankreich und
bei uns besonders in Württemberg. Man war so raffiniert, daß man die
verschiedenen Rassen gesondert zog, und verwendete zur Ver[S. 9]feinerung
des Geschmacks bei der Fütterung Zucker und gekochten Wein (Plinius
nat. hist. IX, 173 und XXX, 45).
*
Daß diese Züchtungsmethoden nur auf Grund eingehender Kenntnis der
Lebensweise der Tiere möglich waren, ergibt sich von selbst. Die Alten
waren keineswegs die schlechten Beobachter, für die wir sie, uns an
manche Märchen und Irrtümer klammernd, gerne ausgeben. Daß der Löwe
am Ende seines Schwanzes einen in der Haarquaste verschwindenden
Knochenstachel besitzt, behauptet Aelian (Peri zoon VI,
1). Niemand wollte das glauben, bis Blumenbach zu Anfang des 19.
Jahrhunderts die Beobachtung bestätigte.
Vom Gorilla wissen wir erst seit etwa 60 Jahren. Vor mehr als
2000 Jahren aber war er schon den Karthagern bekannt, als sie mit
einer Flotte von 60 Schiffen der Westküste Afrikas entlang fuhren.
Hanno hielt diesen Anthropoiden für einen Menschen (Periplus 17 =
Geogr. Graeci min. I, 13, Plinius nat. hist. VI, 200), die Wissenschaft
verwies aber seine Entdeckung ins Fabelreich, bis 1847 der erste nach
Europa kommende Gorillaschädel die Existenz dieses Menschenaffen bewies.
Aristoteles wußte über die Haifische mehr, als die neueren
Naturforscher vor Johannes Müller.
Er kannte auch schon das Prinzip der Korrelation der Organe,
die Schutzfärbung der Tiere, sowie den Farbwechsel des
Chamäleons als Anpassungserscheinung an die Umgebung. Ferner[S. 10]
kannte er den Einfluß, den Klima und Nahrung auf die
Größe der Tiere ausüben, ja den des Landschaftscharakters auf ihre
Gemütsart. Weder die Tier- noch die Pflanzengeographie
war den alten Autoren unbekannt. Die des Theophrast ist geradezu von
imponierender Größe.
Im letzten Jahre ging durch die Zeitungen eine Notiz, daß ein
Naturforscher die Entdeckung gemacht habe, die Lungen seien
Kühlapparate mit dem Zweck, die Bluttemperatur herabzumindern.
Wer ahnte, daß Aristoteles bereits diese Tatsache vor dritthalb
Jahrtausenden konstatiert hatte?[8]
Der Unterschied der männlichen und weiblichen Pflanzen war schon
zu Herodots Zeit bekannt.
Den Spiritismus, und zweifellos auch Hypnotismus
und verwandte Phänomene gab es auch schon in der Antike. Auch das
Tischrücken, bei uns erst seit wenig mehr als einem halben
Jahrhundert bekannt, war den Griechen und Römern nicht neu. Man
setze zur Erforschung der Zukunft geweihte Dreifüße in Bewegung. Ein
derartiges Verfahren gab unter Valens († 378) Veranlassung zu einem
ungeheuern Zaubereiprozeß.
Der hl. Augustinus kannte auch schon das Gedankenlesen (Contra
Acad. II, 17).
*
Die Frauenrechtlerinnen werden nicht ohne Neid hören, daß Kaiser
Heliogabal einen Weiberrat eingerichtet hatte, wie Aelius
Lampridius im Leben dieses Monarchen erzählt. Die ihm unterstehenden
Fälle waren allerdings nicht welterschütternd. Der auf dem[S. 11] Quirinal
tagende Weibersenat hatte nämlich über Kleiderfragen zu entscheiden,
ferner darüber, wer auf Wagen, Pferd, Esel oder Tragstuhl befördert
werden solle usw., ob dieser Tragstuhl aus Fell oder Knochen gemacht
sein sollte, wer Gold oder Edelsteine an den Stiefeln tragen dürfe und
Ähnliches.
*
Daß im alten Rom griechische Erzieher gehalten wurden und das
Griechische überhaupt die Stelle des Französischen bei uns einnahm
– besonders instruktiv ist hierfür Suetons Leben des Augustus –
ist hinlänglich bekannt. Nicht allzuviele aber dürften wissen, daß
unsere halbbarbarischen Vorfahren schon im 12. Jahrhundert Franzosen
engagierten, damit die Kinder in der Jugend schon die damals bereits
hochgeschätzte Sprache erlernten. So kann z. B. Wolfram von Eschenbach
zwar weder lesen noch schreiben, wohl aber französisch reden.[9]
*
Bemerkenswert ist der Konservativismus der Kinderspiele.
Das Altertum hatte nicht nur Puppen, es kannte auch
Steckenpferde, auf denen die jungen Griechen und Römer ganz wie
unsere Kinder ritten (Horaz Sat. II, 3. 248, Plutarch, Agesilaos 25
etc.). Ferner spielten sie mit Kreiseln, die wie heute durch
Peitschenhiebe in Bewegung gesetzt wurden (Persius, Sat. III, 51).
Auch Brummkreisel waren bekannt. Ferner schaukelte sich damals
das junge Volk wie heute, spielte auch Blindekuh (Poll. IX,
123), König und Soldaten (Herodot I, 114), Plumpsack oder[S. 12]
Der Fuchs geht ’rum (Poll. IX, 115), ferner mit Reifen
und Ball. Auch das Anschlagspiel war bekannt (Poll. IX,
117), das Raten auf Grad oder Ungrad und ein Spiel, bei dem einer sich
in Gegenwart mehrerer Mitspieler die Augen zuhalten mußte und sich
schlagen ließ. Erriet er den Richtigen, dann kam der, der geschlagen
hatte, an die Reihe, erriet er ihn nicht, dann mußte er sich solange
von den Anwesenden schlagen lassen, bis er den richtigen Namen nannte.
Alle diese Spiele haben natürlich im Griechischen und Lateinischen
ihre eigenen Namen. Das letztgenannte heißt in gewissen Gegenden
Schinkenklopfen.
Wie unsere Kinder törichterweise mit dem Schwarzen Mann, dem
Daumenschneider und andern Schreckfiguren geängstigt werden, so
die der Alten mit Gespenstern namens Mormo, Lamia, Gello usw.
Bezeichnenderweise hieß es noch lange nach 212 v. Chr. bei unartigen
Kindern: »Warte, Hannibal kommt!«
*
Wer heute über die Baupolizei schimpft – und welcher
Hausbesitzer täte das nicht mit dem größten Recht! – mag sich
trösten. Auch in Athen gab es diese Behörde schon. Sie hatte dafür zu
sorgen, daß altersschwache Bauten nicht einstürzten, daß Neubauten den
erlassenen Vorschriften gemäß errichtet wurden usw. (Plato, Legg. VI,
p. 763; Aristoteles Polit. VI, 5).
[S. 13]
*
Wettersäulen, wie wir sie da und dort an Plätzen finden, gab
es auch schon vor mehr als 2000 Jahren. Schon der alte Astronom und
Hydrauliker Meton stellte kurz vor dem Peloponnesischen Kriege in
Athen eine astronomische Säule auf, an der eine von ihm erfundene Art
Sonnenuhr angebracht war nebst Registern für Sonnen- und Sternen-Auf-
und Niedergang. Diese Wettersäule, die auch die Windrichtung angab, und
zwar durch Windfahnen ähnlich wie heute, stand ursprünglich auf der
Pnyx, später am Kolonos Agoraios (Aelian, var. hist. X, 7; Diodor XII,
36 etc.).
*
Im alten Konstantinopel gab es auch bereits öffentliche
Bedürfnisanstalten. Der Häretiker Arius starb in einer solchen
im Jahre 336. (Athanasius, de morte Arii c. 2 sq. Sokrates h. e. I.
38.)[10]
*
Das Altertum kannte auch den im Deutschen Lift genannten
Personen- und Güter-Aufzug. Professor Boni, Direktor der
Ausgrabungen am Forum Romanum, hat den Nachweis erbracht, daß man
bereits im alten Rom zur Zeit Julius Cäsars den Aufzug benutzte. Man
fand am Forum eine Reihe von Nischen, die zweifellos dazu dienten,
richtige Lifts unterzubringen, in denen schwere Lasten, wie Gladiatoren
und wilde Tiere, aus den unterirdischen Gängen zur Oberfläche
befördert wurden. An einen großen unterirdischen Gang sind vier
kleinere Quergänge angegliedert, ein jeder dieser[S. 14] Quergänge enthält
drei Kammern für das Hebewerk und drei Schächte für die Lifts. In
den zwölf Kammern – so wird in La Casa berichtet – sieht man heute
noch die großen schweren Würfelblöcke aus Tuffstein, die zum Hebewerk
gehörten, und aus der Abnutzung kann man genau erkennen, wie hoch
die Lifts liefen und wie stark sie benutzt wurden. Da jeder Aufzug
imstande war, fünf bis sechs Menschen zu heben, so konnten gleichzeitig
mehr als sechzig Menschen zur Oberfläche des Forums gehoben werden.
Übrigens ging der Gebrauch der Aufzüge, wie es scheint, bereits in
der Kaiserzeit wieder verloren. Mehr als anderthalb Jahrtausende
mußten vergehen, bis der erste Aufzug – und zwar in Jena – wieder
eingerichtet wurde. Aber erst seit wenigen Dezennien hat er allgemeine
Verbreitung gefunden.
*
Zünfte sind ja gewiß nicht mehr modern, aber daß sie ins
alte Rom zurückreichen, hat doch erst Mommsen in seiner Schrift »De
collegiis et sodaliciis Romanorum« nachgewiesen.
Wer aber hält nicht die Mitteilung, das Altertum habe geraucht,
für einen schlechten Witz? Und doch unterliegt es nicht dem
allergeringsten Zweifel. Bereits in vorgeschichtlichen Gallo-römischen
Gräbern, in Neufville-le-Pollet und in Seine-inférieure in Frankreich,
ferner in Schottland, Irland und anderwärts fand man Pfeifenköpfe aus
gebranntem Ton, Eisen und Bronce. Ferner in Massen am Hadrianswall, in
holländischen Grabhügeln, römische aber noch in der Schweiz, im Berner
Jura und natürlich[S. 15] in Rom selbst. Plinius berichtet uns darüber von
den Barbaren. Daß die Skythen Hanf rauchten, steht fest, während wir
das Material, das sonst verwandt wurde, nicht kennen.[11]
*
Daß die Römer in den »tironischen Noten« eine Art Stenographie
hatten, ist hinlänglich bekannt. Cicero benutzte diese Kurzschrift
nicht nur zur Aufzeichnung seiner Reden, sondern auch für seine
Korrespondenz. Aber die Erfindung reicht weit höher in die
Vergangenheit hinauf. Ennius kannte bereits 1100 Zeichen, Seneca aber
vermehrte den überkommenen Schatz auf etwa 5000 Zeichen und Siegel, so
ein ungeheures Material liefernd, das sich zum Teil das Mittelalter
hindurch erhielt. Wie nun Louis Prosper und Eugène Guénin in einem
»Geschichte der Stenographie im Altertum und im Mittelalter« genannten
Werke (Paris 1909) feststellen konnten, ist die Stenographie sogar
vorrömischer Herkunft. Sie weist eine so große Ähnlichkeit mit der
altägyptischen Kursivschrift, dem sogenannten Demotischen, auf, daß
sie unzweifelhaft von diesen vereinfachten Hieroglyphen herstammt. Das
Prinzip ist auch das gleiche: ein beschränktes Alphabet, verbunden mit
einer Silbenschrift, die durch Ideogramme ergänzt wird. Das Demotische
kam auf dem Umweg über Griechenland nach Rom, um dort zur Stenographie
zu werden.
Daß die Stenographie erst 1786 von Samuel Taylor wieder erfunden,
von Gabelsberger 1817 vervollkommnet, dürfte allgemein bekannt sein.
Jedenfalls genügten auch schon die alten Stenographen den[S. 16] an sie
gestellten Anforderungen, denn Martial singt (XIV, 208):
»Mögen die Worte auch eilen, die Hand ist schneller als jene Ehe
die Zunge ihr Werk, hat es die Rechte vollbracht.«
*
Mancher wird geneigt sein, wenigstens Börsenkrachs für eine
neuere Erscheinung zu halten. Das ist aber durchaus nicht richtig.
Schon das ptolemäische Ägypten hat einen regelrechten Kupferkrach
aufzuweisen. Während das Verhältnis des Silberwertes zu dem des Goldes
von 1: 15½ vor vier Jahrtausenden und länger schon annähernd bestand
und erst bei der großen Silberentwertung der letzten Jahrzehnte
wesentlich gestört wurde, ist das beim Kupfer ganz anders. Im Anfang
der Ptolemäerzeit war das Wertverhältnis von Silber und Kupfer wie 120:
1. Wenige Jahrzehnte später war der Wert des Kupfers auf ein Drittel
bzw. ein Viertel des früheren gesunken, nachdem schon vorher sich im
Großverkehr ein Agio für Silber gezeigt hatte.[12]
Die Naturalwirtschaft hat in Deutschland erst zur Zeit der Kreuzzüge
der Geldwirtschaft weichen müssen, daß sie völlig verschwand,
ist aber erst wenige Jahrhunderte her. Da kann uns nun mit
Bewunderung vor der uralten Kultur des Zweistromlandes die Tatsache
erfüllen, daß bereits die dem vierten vorchristlichen Jahrtausend
angehörigen altbabylonischen Texte der Nippur-Sammlung im K. O.
Museum in Konstantinopel den Beweis liefern, daß man längst zur
Geldwirtschaft übergegangen war.[S. 17] Allerdings war das Geld sehr
teuer. Man zahlte gewöhnlich 33⅓% Zins.[13]
Eine Klage, die man zu Beginn unseres Jahrhunderts, als unsere jungen
Männer mit Weltschmerz und runden Rücken herumliefen und Dekadenz
tot-chik war, häufig hören konnte, findet sich schon beim Kirchenvater
Cyprian. Nachdem er darüber gejammert hat, daß die Welt immer
schlechter wird, fährt er fort: »Grauköpfe sehen wir unter den Knaben;
die Haare fallen aus, bevor sie wachsen und das Leben hört nicht auf
mit dem Greisenalter, sondern fängt mit ihm an.« (An Demetrianus c.
4.)[14]
[S. 18]
Zweiter Abschnitt
Wissenschaft
Die Wissenschaft ist bekanntlich um ihrer selbst willen da. Das
rechtfertigt es, wenn Dinge, deren Wert der Laie mit dem besten Willen
nicht verstehen kann, mit heiligem Eifer untersucht werden. Es macht es
geradezu zur Pflicht. Nicht nur heute, sondern seit je. Dem Gelehrten
aber, der sich am meisten plagt, als wolle er ein Thema zu einer
Dissertation oder Habilitationsschrift aufstöbern, dem gebührt die
Palme der Unsterblichkeit, die wir ihm hiermit überreichen. Daneben
mögen in diesem Kapitel einige Meinungen Platz finden, die wir nicht
für klug oder richtig halten.
Doch beginnen wir mit einer Ehrenrettung!
Wer wird es wagen, der Kirche noch fernerhin den Vorwurf zu machen, sie
sei eine Feindin der Wissenschaft, wenn man tief gerührt liest, was für
köstliche Blüten ihrem Schoße entsproßten?
Was will das Forschen unserer Physiker und Chemiker bedeuten gegenüber
Fragen, wie sie der große Scholastiker Petrus Lombardus († 1164)
aufwirft? Ob ein Vorhersehen und Vorherbestimmen Gottes möglich gewesen
wäre, wenn es keine Ge[S. 19]schöpfe gegeben hätte? So lautet eine dieser
Fragen, aus seinen vier Libri sententiarum, dem Hauptlehrbuch, nach dem
die Theologie in den gelehrten Schulen vorgetragen wurde.
Zweifellos ist das Interesse daran brennend. Aber was bedeutet sie
gegenüber der andern: Wo war Gott vor der Schöpfung?
Daß Seelenheil und kultureller Fortschritt unlöslich von der
Beantwortung abhängig sind, fühlen wir, auch ohne daß es uns jemand
sagte.
Doch der Wissensdrang, nicht etwa der nach nichtigen Dingen,
sondern nach solchen von ewiger Bedeutung, war bei Petrus Lombardus
unersättlich. So fragte er denn weiter:
Ob Gott mehr wissen kann, als er weiß?
Ob ein Prädestinierter verdammt oder ein Verworfener selig werden könne?
Ob Gott etwas Besseres oder etwas auf bessere Weise machen könne, als
er es macht?
Ob Gott allezeit alles könne, was er gekonnt hat?
Doch nicht auf Gott beschränkt sich die Fragefreudigkeit des großen
Kirchenlehrers. Beschäftigt er sich auch natürlich am liebsten mit ihm,
so ist er doch viel zu leutselig, um sein Interesse nicht bisweilen
minder Vornehmen zuzuwenden. So wirft er die Frage auf: Wo die Engel
nach ihrer Schöpfung gewesen sind?
Ob die guten Engel sündigen, die bösen rechtschaffen leben können?
Ob alle Engel körperlich sind? (kleiner Schäker!)
Ob die Rangordnung der Engel seit dem Anfang der Schöpfung bestimmt
worden sei?
[S. 20]
Sogar auf den Menschen dehnt sich der scholastische Frageeifer aus.
Probleme von größter Bedeutung beschäftigen die Denker und zeigen uns
aufs neue, wie unrecht wir der Kirche tun mit dem Vorwurf, sie habe
auf Kosten einer brauchbaren irdischen eine verschrobene überirdische
Afterwissenschaft kultiviert.
Wen interessiert es nicht zu wissen, in welchem Alter der Mensch
geschaffen worden ist? Warum wurde Eva nun gerade aus der Rippe und
nicht aus einem andern Teil des Mannes geschaffen? Und warum schlief
Adam dabei? Die Wichtigkeit der Sache hätte schon gerechtfertigt, daß
er wach gewesen wäre. Das findet wenigstens Petrus Lombardus.
Interessanter noch ist die Frage, ob der Mensch ewig hätte leben
können, wenn er auch nicht vom Baume der Erkenntnis genossen hätte?
Etwas indiskreter lautet: Warum sich die Menschen im Paradies nicht
begattet hätten? Jetzt verstehen wir auch des Petrus Lombardus Neugier
nach dem Alter, in dem sie geschaffen wurden!
Wie hätten die ersten Menschen sich fortgepflanzt, wenn sie nicht
gesündigt hätten? Eine Frage von hochaktuellem Interesse. Gibt es
doch heute noch genug Frömmler, die im Geschlechtsverkehr eine Sünde
erblicken und damit tatsächlich der Sünde das größte aller Wunder und
aller Güter zuschreiben: das Leben.
Petrus muß auch so etwas ahnen, wenn er fragt, ob – ohne den
Sündenfall – die Kinder mit vollkommen ausgewachsenen Gliedern und mit
dem vollen Gebrauch der Sinne würden geboren worden sein?
Von höchster Neugier zeugt die Frage, warum[S. 21] der Sohn und nicht der
Hl. Geist oder der Vater Mensch geworden seien? Mit großem Ernst
wurde natürlich alles behandelt, was mit der sogenannten Erlösung
zusammenhing. So die Frage, ob Gott das durch Christus dargebrachte
Opfer auch hätte annehmen können, wenn dieser ein Weib gewesen wäre.
Mit Rücksicht auf die außerordentliche Wichtigkeit und Vordringlichkeit
gerade dieser Frage wurde in der Schule des Petrus Lombardus nicht
minder, wie in der seines Schülers Petrus von Poitiers das Thema emsig
diskutiert. Man war sich einig, daß nur ein ganz verruchtes Scheusal,
dem das schamlose Maul (os impudicum) in gehöriger Weise gestopft
werden muß, in dem Sinne hätte antworten können, daß Christus auch als
Weib den an einen Erlöser zu stellenden Anforderungen hätte genügen
können.[15]
Occam hat in seinem Centilogium folgende Thesen: C. 8–11: »Zulässig
sind die Sätze: Gott der Vater ist der Sohn der hl. Jungfrau; der Hl.
Geist ist der Mensch, welcher der Sohn der hl. Jungfrau ist; der Vater,
der niemals starb, kann gestorben sein, der Sohn, der starb, kann auch
niemals gestorben sein.«... C. 29: »Der Leib Christi kann sich zu
gleicher Zeit in entgegengesetzter Richtung bewegen und wird faktisch
so bewegt, wenn z. B. ein Priester ihn emporhebt und der andere ihn in
demselben Moment niederlegt.«[16]
*
Unter dem Titel: »Disputatio nova contra mulieres qua probatur eas
homines non esse«[S. 22] erschien 1595 ein Büchlein ohne Verfassernamen
und Druckort.
Der gelehrte Autor rühmt sich in diesem Elaborat durch 50
unwiderlegliche Stellen der Heiligen Schrift den Beweis geführt zu
haben, daß Weiber weder Menschen seien, noch von Christus erlöst
wurden.
Er beginnt mit der These, Christus habe nicht für die Frauen gelitten
und sie deshalb auch nicht erlöst. Sehr merkwürdig und bezeichnend für
den scholastischen Geist und die ganze Rabulistik des Mittelalters
ist seine Beweisführung. So heißt es im vierten Absatz: Da die Hl.
Schrift alle verflucht, die etwas Gottes Wort hinzufügen, so sind auch
alle jene verflucht, die hinzufügen, die Weiber seien Menschen und es
glauben. Denn weder im Alten noch im Neuen Testament werde ein Weib
Mensch genannt. Wären sie Menschen, dann hätte aber der Hl. Geist sie
auch zweifellos so genannt. Wer trotzdem behauptet, sie seien Menschen,
der maßt sich an, mehr zu wissen als Gott.
Im achten Absatz heißt es: Eva war kein Mensch, denn sie wurde nicht
etwa geschaffen, damit Adam nicht allein sei, sondern damit Adam
durch sie Menschen zeugen sollte, deren Dasein ihn von der Einsamkeit
befreite.
Im zwölften Absatz sagt der Autor: Da Gott allwissend ist, so wußte
er auch bei der Schöpfung Adams, daß er Eva erschaffen würde. Hätte
er gewollt, daß sie auch ein Mensch sei wie Adam, dann hätte er nicht
im Singularis gesprochen: »ich will einen Menschen schaffen«,
sondern er hätte gesagt:[S. 23] »ich will Menschen schaffen«. Weil er aber so
sprach, besitzen wir den sichersten Beweis aus Gottes eigenem Munde,
daß Gott nicht gewollt habe, daß das Weib ein Mensch sei, und daß er
nur einen Menschen geschaffen hat und nicht etwa zwei.
Auch aus dem Sündenfall folgt im 14. Absatz die weibliche
Unebenbürtigkeit: Wäre das Weib dem Adam gleich gewesen, dann hätten im
Paradiese zwei Menschen gesündigt. Denn Eva beging denselben Fehltritt
wie Adam. Der Apostel sagt aber ausdrücklich: durch einen
Menschen sei die Sünde in die Welt gekommen. In diesem Stile wird der
»Beweis« weiter geführt, um mit der gewiß vielen Damen schmerzlichen
Konstatierung zu schließen, daß das Alte Testament so gut wie das Neue
den Weibern nicht nur ihr Menschentum abspreche, sondern daß Christus
auch nicht für sie gestorben sei.
Doch der Anonymus hatte die Rechnung ohne den Wirt gemacht.
Diese Einmischung in ihre Domäne konnten sich die Erbpächter der
Unsterblichkeit nicht bieten lassen. Noch im gleichen Jahre 1595
erschien die Schrift: »Admonitio Theologicae Facultatis in
Academia VVittebergensi ad scholasticam Juventutem, de libello
famoso & blasphemo recens sparso, cuius titulus est: Disputatio Nova
contra mulieres, qua ostenditur, eas homines non esse«. Wiewohl die
theologische Fakultät in der Einleitung ausdrücklich sagt, daß es
möglich sei, daß impurus iste canis (»jener unreine Hund«), wie die
milden Streiter Gottes sich so geschmackvoll ausdrücken, nur im Spaß
seinen Angriff gemeint habe, sieht sie sich doch genötigt, nicht nur
durch Worte der heiligen[S. 24] Schrift zu beweisen, daß das Weib doch ein
Mensch sei, sondern sich hochoffiziell zu unterschreiben: »12. Januar
1595 Decanus, Senior et Professores Theologicae Facultatis in Academia
VVittebergensi.« Man hielt es also offenbar für sehr notwendig, mit
schwerem Geschütz den Angreifer der Weiber niederzukämpfen. Sei es, daß
man ein schlechtes Gewissen hatte, sei es, daß er begeisterten Beifall
gefunden hatte.
Trotz dieser Kathedralentscheidung scheinen die Verächter der holden
Weiblichkeit noch lange nicht Ruhe gegeben zu haben. Wenigstens liegt
mir noch aus dem Jahre 1690, also nach einem vollen Jahrhundert, unter
dem Titel »Mulier homo« ohne Erscheinungsort und Verfassernamen ein
Neudruck vor. Hier ist auch der feierliche Schluß fortgelassen. Sollten
etwa trostbedürftige Ehemänner die Abnehmer gewesen sein?
Noch im Jahre 1767 erschien unter dem Titel »Beantwortung der Frage, ob
das Frauenzimmer ein notwendiges Uebel sey« zu Frankfurt und Leipzig
ein Büchlein, das allerdings das Thema mehr humoristisch behandelt,
auch keinen Verfassernamen trägt.
Ja, noch aus dem Jahre 1791 liegt mit eine Broschüre über das Thema
vor. Sie trägt den Titel »Apologie des schönen Geschlechts oder Beweis,
daß die Frauenzimmer Menschen sind«, wurde von Heinrich Nudow aus dem
Lateinischen übersetzt und erschien in Königsberg.
Interessant ist die Bemerkung der Vorrede, »daß einige neuere
spekulative Naturforscher des schönen Geschlechts« zu der »sehr
wahrscheinlichen« Annahme gelangt seien, daß »der Sitz der Seele
bei den[S. 25] Frauenzimmern nicht wie bei den Männern im Gehirn, sondern in
der Gebärmutter seyn soll; – daß da sich alles Leben und Seyn,
– alles Dichten und Trachten beim andern Geschlecht von einem gewissen
inneren Triebe ableiten, und wieder darauf zurückführen läßt, dem die
Natur jenes Eingeweide zu einem Hauptwerkzeug bestimmte, auch wohl
das andere Geschlecht großenteils (und vielleicht gänzlich) nur durch
die Gebärmutter denken dürfe.« Der Verfasser konstatiert und beweist
übrigens die Menschheit des schönen Geschlechts.
Lassen wir dahingestellt, was in diesen Schriften, die wir
keineswegs vollzählig aufführten, Ernst, was Witz ist, so viel steht
unwiderleglich fest, daß eine ganze theologische Fakultät es für
notwendig hielt, feierlich dagegen Stellung zu nehmen, daß das Weib
kein Mensch sei. Wäre es ihnen nicht möglich gewesen, durch Bibelworte
den Gegenbeweis zu führen, so hätte selbstverständlich die fromme Herde
noch etliche Jahrhunderte lang das Weib für ein Tier gehalten.
*
Ein gewisser Georgius Fridericus Gublingius schrieb im Jahre
1725 eine Dissertation in Wittenberg mit dem Titel: De barba
Deorum ex priscarum Graeciae et Latii maxime Religionum monumentis.
Behandelte er in dieser gelehrten Schrift die Frage, ob die Götter
bärtig waren, so in einer andern im gleichen Jahre ebenfalls in
Wittenberg erschienenen unter dem Titel: »De causis barbae Deorum«,
die[S. 26] ebenso wichtige nach den Gründen dieser Bärtigkeit.
*
Eine außerordentliche gelehrte Arbeit erschien 1705 zu Leipzig mit
folgendem Titel: »Cogitationes admodum probabiles de vestimentis
Israelitarum in deserto an per miraculum duraverint aut creverint in
dissertatione academica indultu Philosophici Ordinis Lipsiae ad II.
Aprilis A. MDCCV habenda eruditorum examini exhibitae a Gottfrido
Zeibigio & Johann Andrea Beckero.« Die philosophische Fakultät
promovierte also zwei Doktoranden, die Herren Zeibig und
Becker, weil sie Betrachtungen darüber anstellten, ob die
Kleider der Juden in der Wüste durch ein Wunder alle Strapazen
ausgehalten haben oder gar nachwuchsen!
*
Ein gewisser Paul Christian Hilscher prüft in Dresden 1703 in
einer seinem Schwiegervater, dem Dr. der Theologie und Superintendenten
zu Freiberg, Christian Lehmann gewidmeten Gratulationsschrift zum
60. Geburtstage die hochwichtige Frage nach der Bibliothek
Adams. (De bibliotheca Adami.) Das Heftchen ist mit wundervollen
Schriftzeichen geschmückt und natürlich grundgelehrt. So eine Art
Seitenstück also zu Beringers Würzburger Petrefaktenbuch, das wir bald
kennen lernen werden.
*
Christian Tobias Ephraim Reinhard, ein sonst ganz ernster
Schriftsteller, der auch über die in der[S. 27] Bibel vorkommenden
Krankheiten geschrieben hat, veröffentlichte im Jahre 1752 zu
Hamburg eine Schrift: »Untersuchung der Frage, ob unsere ersten
Urältern Adam und Eva einen Nabel gehabt.« Er kommt im § 17
dieser Abhandlung, die wohl ernst gemeint sein dürfte, zu folgendem
Resultat: »Genug, Adam und Eva sind nicht gebohren, sondern gemacht,
nicht gezeuget, sondern geschaffen worden, und wer hieran zweifelt,
der ist kein würdiges Glied der Kirche, sondern wird kraft meines
Amts dem Teufel übergeben. Von dieser Wahrheit gibt der heilige
Geschichtschreiber Moses in seinem Buche von der Erzeugung das
allerbewährteste Zeugnis. Da es nun eine unumstößliche Wahrheit
bleibet: daß unsere ersten Stammväter nicht gebohren worden sind, so
muß es auch wahr sein, daß sie keinen Nabel nöthig gehabt haben. Denn
da dieselben niemals im Mutterleibe verborgen gewesen sind, so hat
ihnen fraglich keine Nabelschnur zu statten kommen dürfen. Haben sie
nun keine Nabelschnur nöthig gehabt, so haben sie auch keinen Nabel,
als dessen Überrest derselbe ist, besitzen können.«
Reinhard war »Der Arzneygelahrtheit Doktor und Heilarzt zu Camenz«, wie
er auf dem Titelblatt des Schriftchen vermerkt.
*
Das erleichtert uns den Übergang zu den Naturwissenschaften.
*
Jahrhunderte nahm man an, die Meergänse sollten aus einer Muschel, der
Entenmuschel, hervorgehen.[S. 28] Diese Theorie ist weniger verwunderlich,
als die Tatsache, daß bedeutende Gelehrte sich durch Augenschein
davon überzeugt haben wollten. So schrieb der Leibarzt Rudolfs
II., Michael Mayer, er habe in den Muschelschalen den wie in seinem Ei
liegenden Fötus des Vogels selbst gesehen und sich überzeugt,
daß er Schnabel, Augen, Füße, Flügel und selbst angehende Federn besaß.
Der gleichfalls im 17. Jahrhundert lebende Sir Robert Moray, dessen
Bericht in den Schriften der Londoner königlichen Gesellschaft 1677–78
veröffentlicht ist, behauptete, in jeder Entenmuschel, die er öffnete,
ein vollkommen ausgebildetes Vögelchen gefunden zu haben.[17]
*
Daß auch die Universitäten ähnliche Fabeln verbreiteten, zumal dort, wo
die Jesuiten für das Fortbestehen des Autoritätsglaubens wirkten, kann
nicht verwundern.
Unter dem Titel: »Positiones ex universa philosophia Aristotelis tum
contemplativa tum politica, quas in Alma ac Celeberrima Herbipolensium
Universitate pro suprema Doctoratus philosophici laurea praeside R.
P. Ignatio Zinck e Soc. Jesu AA. LL. & Philos. Magistro e jusdemque
in praedicta Universitate Professore publice defendendas suscepit D.
Joannes Bernardus Dill Herbipolensis etc. etc.« erschien im Jahre 1700
eine philosophisch-naturwissenschaftliche Dissertation zu Würzburg. Das
hochgelahrte Werk, das den Joh. Bernh. Dill zum Verteidiger,
den Jesuiten Prof. P. Ignaz Zinck zum Verfasser hatte, läßt
schon[S. 29] ahnen, welch außerordentlichen Ruhm diese christ-katholische
Universität noch erringen sollte.
Da wird erzählt, wie der Blick eines Vogels heile, verschiedene Steine
auf den Menschen wirkten, z. B. Jaspis die Lebensgeister wecke, der
Amethyst, auf den Nabel des Berauschten gelegt, die Dünste aus dem Kopf
zieht und die Trunkenheit verscheucht oder der im Magen des Haushahns
sich bildende lapis alectorius denjenigen, der ihn im Munde trägt,
mutig und tapfer macht. Als Belege für die Möglichkeit ewigen Feuers
wird erzählt, daß im Jahre 1041 im Grabe des von Turnus getöteten
Pallas eine Lampe gefunden wurde, die bereits 1611 Jahre brannte und
vielleicht noch brennen würde, wenn sie damals nicht zerbrochen und
das künstlich präparierte Öl verschüttet worden wäre. Ferner brannte
die unter Paul III. gefundene Grablampe von Ciceros Tochter Tulliola
ebenfalls noch.
Mit dem gleichen Ernst gibt diese Dissertation den Bericht des
Jesuiten Schott wieder, daß in Schottland, auf den Hebriden und in
einigen Gegenden Indiens an den Bäumen Enten und andere Vogelarten
wachsen, die wie Blätter hervorsprossen, dann wie Obst sich runden,
endlich Vogelgestalt bekommen und an dem Schnabel gleich dem Stiele
herabhängen, bis sie ganz ausgereift abfallen und davonfliegen.
Auf die Autorität des »Apostels« hin wird endlich gelehrt: im
künftigen Leben werden »wir Auserwählten alle« eine Größe von 4 Ellen
= 6 Fuß haben, nicht mehr und nicht weniger, denn dies sei, wie die
Geschichtschreiber und Väter allenthalben berichten, die Größe Christi
gewesen. Den[S. 30] Größeren werden – so fügt der englische Lehrer bei –
der Überschuß über die Normalgröße genommen und damit die Kleinen
aufgebessert werden.[18]
*
Im Jahre 1726 erschien zu Würzburg ein Buch, das für uns unschätzbaren
Wert besitzt. Es trug nach dem Gebrauche der Zeit folgenden etwas
langatmigen Titel: LITHOGRAPHIAE WIRCEBURGENSIS, DUCENTIS LAPIDUM
FIGURATORUM, A POTIORI INSECTIFORMIUM, PRODIGIOSIS IMAGINIBUS EXORNATAE
SPECIMEN PRIMUM, Quod IN DISSERTATIONE INAUGURALI PHYSICO-HISTORICA,
CUM ANNEXIS COROLLARIIS MEDICIS, AUTHORITATE ET CONSENSU INCLYTAE
FACULTATIS MEDICAE, IN ALMA EOO-FRANCICA WIRCEBURGENSIUM UNIVERSITATE,
PRAESIDE Praenobili, Clarissimo Expertissimo Viro ac Domino, D.
JOANNE BARTHOLOMAEO ADAMO BERINGER, Philosophiae & Medicinae Doctore,
Ejusdémque Professore Publ:Ordin:Facult:Medicae h. t. Decano &
Seniore, Reverendissimi & Celsissimi PINCIPIS (sic!) Wirceburgensis
Consiliario, & Archiatro, Aulae, nec non Principalis Seminarii DD.
Nobilium & Clericorum, ac Magni Hospitalis Julianaei Primo loco Medico,
Exantlatis de more rigidis Examinibus, PRO SUPREMA DOCTORATUS MEDICI
LAUREA, annexisque Privilegiis ritè consequendis, PUBLICAE LITTERATORUM
DISQUISITIONI SUBMITTIT GEORGIUS LUDOVICUS HUEBER Herbipolensis, AA.
LL. &[S. 31] Philosophiae Baccalaureus, Medicinae Candidatus. IN CONSUETO
AUDITORIO MEDICO.
Dieser schöne Titel, auch typographisch bedeutend reicher, als es hier
zum Ausdruck kommt, dazu ein schöner Titelkupferstich stehen zu Beginn
eines Buches, das auf Erden nicht viele Rivalen haben dürfte.
Georg Ludwig Hueber heißt also der Verfasser, dessen
medicinische Habilitationsschrift vor uns liegt, sein Lehrer aber
Johann Bartholomäus Adam Beringer, ein Mann schwer an Weisheit,
Würden und Titeln, Professor, Leibarzt des Fürstbischofs und anderes
mehr. Da es damals Sitte war, daß die Promotionsschrift vom Professor
abgefaßt wurde, so war Beringer der eigentliche Autor.[19]
Es handelt sich um eine großartige Entdeckung, die er gemacht
hatte oder doch gemacht haben wollte. In der Nähe von Würzburg
waren Petrefakte gefunden worden, die er auf schönen Kupfertafeln
gewissenhaft abbildete. Da gab es Blumen und Frösche, Fische und
anderes Getier. Auch eine Spinne mit Netz war versteinert (Taf. X),
ferner eine Spinne im Begriff eine Fliege zu fangen, zusammen mit
ihrem Opfer, ein reizendes Tierstückchen! Aber auch Stilleben fehlten
unter den Versteinerungen nicht, so ein Schmetterling, der an einer
Blume saugt (Taf. VI). Noch viel abenteuerlichere Dinge waren vom
hochgelahrten Herren zutage gefördert worden: ein versteinerter Stern,
ein Halbmond, ein Stern mit Halbmond, ja Figuren so ähnlich aussehend,
wie die primitive Kunst Kometen zeichnet (Taf. III). Das und noch
vieles andere war auf den schönen Kupfertafeln zu sehen. Besonderes
Interesse verdienten Versteine[S. 32]rungen, auf denen in hebräischen Lettern
Jehova und ähnliches stand (Taf. VII).
Natürlich war auch für begleitenden Text gesorgt. War doch die
Entdeckung so verblüffend, so über alle Maßen großartig, daß ein
ausgiebiger Kommentar sich von selbst verstand. So bewies Beringer vor
allem, daß es sich hier nicht etwa um Überreste aus heidnischer Zeit
handle, auch nicht um Kunstgegenstände jüdischer Herkunft. O nein,
es war alles Natur. Es waren Versteinerungen von Tieren und
Pflanzen, die vor unvordenklichen Zeiten das Meer ausgespült hatte
(vgl. Kap. 4 und 13). Daran ließen sich natürlich die weitgehendsten
Schlüsse knüpfen sowie Ausfälle auf Zweifler. Und das tat auch der
gelehrte Verfasser.
Aber leider blieb seine große wissenschaftliche Tat nicht vom Neide der
Götter verschont. Es stellte sich heraus, daß Schüler und Gegner des
Professors aus Ulk Pseudopetrefakte künstlich hergestellt hatten und in
dem Steinbruch finden ließen, den der Professor häufig besuchte.
Es dürfte sich hier um eine der größten akademischen Dummheiten
handeln, von der die Geschichte der Wissenschaften weiß. Das fühlte
auch Beringer, denn er ließ alle erreichbaren Exemplare des Werkes
vernichten, so daß es zur großen Seltenheit wurde. Die kgl. Hof- und
Staatsbibliothek in München ist im Besitze eines tadellos erhaltenen
Exemplars.[20]
*
Auf moralischem Gebiete hat aber Beringer einen Konkurrenten in der
Person des nicht unbedeutenden[S. 33] Kulturhistorikers Friedrich von
Hellwald. Wenn er die Ursache unserer heutigen Milde und unseres
Entsetzens über die früheren Gräuel der Hexenprozesse nicht darin
findet, daß wir so viel bessere Menschen als unsere Vorfahren sind,
sondern einfach, weil wir wissen, daß es keine schädlichen Hexen gibt,
so hat er recht. Wahrscheinlich würden wir uns nicht viel anders als
das Mittelalter benehmen, wenn wir noch heute unter dem verdummenden
Einfluß der Kirche ständen. Grotesk aber ist die Art, wie Hellwald zu
beweisen versucht, daß die Inquisition gar nicht so schlimm war. Er
ähnelt darin einem gewissen Hoeniger, dessen Methode die Harmlosigkeit
des Dreißigjährigen Krieges zu beweisen, wir im I. Bande (S. 126)
kennen lernten.
Hellwald schreibt (mit Kürzungen): »Nach Llorente, Histoire critique
de L’Inquisition d’Espagne, 1815–1817, sollen von 1481–1808 in Spanien
31912 Menschen verbrannt worden sein. Nach glaubwürdigen Quellen betrug
die Bevölkerung Spaniens um 1500 n. Chr. 9320691, welche Ziffer 2½
Jahrhunderte, bis 1768 (Jahr der ersten verläßlicheren Volkszählung)
stationär blieb.
Gesetzt nun, die Ketzerverbrennungen wären über diese Periode
gleichmäßig verteilt gewesen, so hätten dieselben alljährlich 97,6
oder rund 100 Menschen, d. h. 1 : 90000, das Leben gekostet. Nun soll
aber Torquemada in den 15 Jahren von 1483–1498 allein 8300, d. h.
durchschnittlich 586 Menschen jährlich, nach den glaubwürdigen
Angaben Marianas, dem Maurenbrecher folgt, 1481–1498 nur 2000 Opfer
zum Scheiterhaufen gesandt haben; diese Ziffern wären also von den[S. 34]
obigen abzuziehen, d. h. auf 312 Jahre entfallen 23112 Opfer = 74 im
Jahre = 1 : 121756. Diese Zahlen sind nicht so furchtbar groß, wie
nachstehendes, der Gegenwart entnommenes Beispiel illustriert. Nach dem
»American Railroad Journal« fanden im Jahre 1873 im ganzen 576 Menschen
den Tod durch Unglücksfälle auf Eisenbahnen im Gebiete der Vereinigten
Staaten, 1112 wurden verletzt. Diese Ziffern findet das genannte Blatt
ziemlich unbedeutend und in der Tat fällt es niemandem bei, über
dieselben ein Klagegeschrei zu erheben. Wenn nun diese Ziffern immer
so ›unbedeutend‹ blieben, so würden in dem gleichen Zeitraume von 327
Jahren nicht weniger als 188352 Tote und 363624 Verwundete diesem
Fortschritte der Zivilisation zum Opfer fallen.«
Daß der relative Menschenverlust nicht allzu groß war, wenn auch die
Opfer der Inquisition bedeutend unterschätzt sind und tatsächlich
einzelne Ortschaften und Landstriche entvölkert wurden, sei zugegeben.
Aber ist deshalb der Wahn weniger gräßlich?
Köstlich ist auch folgende Meditation: »Endlich, so banal es klingt,
so wahr ist doch, daß alle die beklagenswerten Opfer menschlicher
Torheit eines anderen Todes einmal hätten sterben müssen. Ihr Leben
ist wohl verkürzt worden, doch käme es noch sehr darauf an zu wissen,
wie groß der durch diese Verkürzung verursachte Schaden war. Dazu
müßte man genau kennen: Lebensalter und Lebensverhältnisse, leibliche
Konstitution und geistige Gaben dieser vorzeitig Gestorbenen; wie viele
dem Greisenalter gehörten und schon zeugungsunfähig waren, wie vielen
eine kränkliche Organisation nur mehr eine kurze[S. 35] Lebensfrist gegönnt
hätte; man müßte veranschlagen, wie viele durch anderweitige Zufälle
oder in Ausübung ihres Berufes ohnedies ein vorzeitiges Ende gefunden
hätten, wie viele von akuten Krankheiten dahingerafft worden wären
u. dgl. Erst die Eliminierung aller dieser komplexen Faktoren würden
gestatten, den erlittenen Verlust auf ein annähernd richtiges Maß
zurückzuführen.«[21]
*
Bekanntlich behaupten die bayerischen Lyzeen, den Universitäten im
Range gleichstehende Hochschulen zu sein, und die schwarze Gesellschaft
wird zu betonen nicht müde, daß die wissenschaftlichen Leistungen
diesem Range auch völlig entsprechen.
Wir können ohne Zaudern weiter gehen: sie übertreffen ihn! Sie lassen
alle weltlichen Bildungsstätten weit hinter sich.
Ihr fordert Beweise? Nichts einfacher als das. Wo hätte uns je eine
Universität eine Topographie der Hölle geschenkt, wenn nicht
Münster, das glorreiche Wirkungsfeld des großen Bautz? (Vgl. 1. Bd. S.
225 ff.)
Wären wir etwa über Satan informiert, wenn nicht David Leiste,
Professor der Moraltheologie, Patrologie und Pädagogik am k. Lyzeum in
Dillingen unter dem Titel »Die Besessenheit« ein Programm im
Jahre 1886/87 darüber veröffentlicht hätte. Ein grundgelehrtes Werk
noch dazu. Wir schlagen auf gut Glück S. 24 ff. auf.
»Die Wirklichkeit dämonischer Erscheinungen in einem objektiv
wirklichen, materiellen Körper, nicht[S. 36] etwa in einem bloß eingebildeten
imaginären, bezeugt die Heil. Schrift. Nach ihrem Bericht hat Satan die
Eva in sichtbarer Schlangengestalt versucht; daß auch die Versuchung
Christi eine rein äußerliche war, ist zweifellos; es ist gewöhnliche,
wenn auch nicht ausdrücklich durch die Heil. Schrift verbürgte Annahme,
daß Satan hiebei sich mit einem materiellen Leibe umkleidet habe, der
ihn als Geist der Hölle verbergen solle. Wieder wird Satan in die
Erscheinung treten am Ende der Menschengeschichte in den großen Kämpfen
des Reiches Gottes mit dem Antichrist.
Es bestätigen uns dann auch die hl. Väter und Theologen die Tatsache,
daß Satan zum Zwecke der Menschenverführung und Menschenplage auf
Erden sich zeige in der angenommenen Gestalt von Verstorbenen, von
wilden Tieren, von Vögeln. Unter den verschiedensten Tiergestalten
ist Satan schon erschienen, nur die der Taube und des Lammes, sagt
Majolus, glaubt man, sei ihm verboten. Die Form der Ziege und des
Bockes kommt gar häufig in den Versuchungen vor. »Weil im großen Drama
des Weltgerichts dem Bock als Symbol des Sklaven der Sünde seine Rolle
zugewiesen ist, so steht der Annahme, der Dämon habe je bisweilen unter
dieser oder einer entsprechenden Gestalt seine Besuche gemacht, nichts
im Wege.« (Rütjes, Der Teufel, Essen 1878, S. 60.) Majolus sagt, diese
Erscheinungsgestalt komme ihm zu, weil dies geile und hochmütige Tiere
seien. Satan ist ferner schon erschienen als Löwe, Wolf, Bär, Stier,
Schwein, Fuchs, als schwarzer Kater oder Hund. So z. B. erblickten
der hl. Stanislaus und der ehrwürdige Pfarrer von Ars den Teufel in[S. 37]
Hundegestalt, mit feurigen Augen, also in der Gestalt eines Tieres, das
als Sinnbild der Schamlosigkeit bekannt ist; letzterer sah ihn auch
in der Gestalt eines Kopfkissens, oder die bösen Geister belästigten
ihn auch in der Gestalt von Fledermäusen. Ferner zeigte sich Satan
als Hahn, Eule, Geier, Drache, Schlange, Kröte, Eidechse, Skorpion,
Spinne, Fliege, Mücke, Wespe. Auch die Menschengestalt gebraucht er als
Hülle und erscheint als Bauer, Schiffer, Geistlicher, als geputztes,
verführerisches Weib, als Mädchen. Der ehrwürdigen Maria Crescentia von
Kaufbeuren zeigte sich der Teufel in Gestalt einer Nonne, eines Negers,
eines Jägers oder auch in verschiedenen Tiergestalten« etc.
Trotzdem brauchen wir keine allzu große Furcht zu haben. Denn – und
daß er das zu unserer Beruhigung sagt, spricht für das gute Herz
des Herrn Verfassers – »Seinem Erscheinungsleibe das Bild eines
vollkommenen Leibes aufzudrücken, ist Satan nicht allweg
gestattet; er ist genötigt, ihm teilweise eine tierische Bildung oder
eine andere verzerrte und fratzenhafte Form zu geben. Und während der
gute Engel seinen Leib aus edlen, ätherischen Stoffen bildet, ist der
Teufel für diesen Zweck auf unreine, schmutzige Materien angewiesen.«
(S. 28.)
Die historische Tatsächlichkeit wenn auch nicht aller, so doch vieler
Teufelserscheinungen steht fest. »... sicherlich (ist) ein bedeutender
Teil der von der Geschichte aufbewahrten Vorgänge dieser Art als
historisch glaubwürdig anzunehmen und haben wir es nicht mit lauter
›Teufeleien der Mönchsphantasie‹ zu tun.« (S. 30.)
[S. 38]
Das ist ja entschieden unheimlich. Und doch braucht es uns nicht
ins Bockshorn zu jagen. Denn wie der gelehrte Autor auf S. 139 ff.
ausführt, hat der Satan gegenwärtig die Taktik geändert und die
offenkundige leibliche Besessenheit hat – hurra! – abgenommen.
Und doch ist die Sache nicht ganz geheuer. »Sollte es vielleicht eine
furchtbare Strafe der so weit verbreiteten Apostasie sein, daß Gott
dem Teufel die Taktik erlaubt hat, inkognito sein Geschäft zu
treiben und so die blinden Seelen um so sicherer in den Abgrund zu
jagen?« (S. 145 f., zitiert nach dem Kirchenlexikon, 2. Aufl., II, S.
517 ff., Art. Besessene.) Daß die spiritistischen, somnambulistischen
und verwandten Phänomene auf den Teufel zurückgehen, steht fest.
Verlassen wir dies unheimliche Thema, um uns heiterern Gesichtern
zuzuwenden.
*
Papst Alexander VI. schenkte durch die Bulle Inter cetera vom 4. Mai
1493 den Spaniern alle entdeckten und noch zu entdeckenden Länder
nicht nur westlich, sondern auch südlich eines bestimmten
Längengrades! Und zwar tat das der damals noch fehlbare Nachfolger
Petri »ex certa scientia«. Er wußte es also ganz genau![22]
*
Da lobe ich mir doch die deutsche Gründlichkeit. Bekanntlich entdeckte
ein Gelehrter bereits die Wichtigkeit von Goethes Wäschezettel
für die deutsche Literatur. Er wird aber noch übertroffen vom
»Altmeister der chemischen Geschichtsforschung H. Kopp«,[S. 39] der die Worte
Encheiresin naturae aus der Schülerszene des Faust zum Gegenstand
jahrzehntelanger Nachforschungen machte.[23]
Zu diesem Kapitel gehört auch folgendes: In der Berliner Wochenschrift
»Die Standarte« schreibt ein Germanist, er habe in einem Goetheseminar
der Berliner Universität tagelang an der Frage gearbeitet,
ob in einem Heft Goethes die Ausstreichungen mit schwarzer oder
roter Tinte oder mit Bleistift gemacht worden sind. Das tiefe
Problem, ob der vorgoethische Faust mit Vornamen Heinrich oder Johann
geheißen habe, läßt die Forscher nicht zur Ruhe kommen. Und von
höchster Bedeutung ist, ob Goethe Lieschen oder Liesgen
geschrieben hat, wie der Wasserstempel im Konzept zu den
»Wahlverwandtschaften« aussieht, ob eine Notiz am 21. oder 22. oder
gar – wie Pniower behauptet – am 24. Oktober eingetragen ist. Das
ist Goetheforschung! Wer aber etwa gar denkt, es sei gleichgültig,
ob das »Kophtische Lied« 1789 oder 1791 geschrieben sei, wird
erbarmungslos aus diesem geweihten Kreise verbannt.[24]
*
Auf diesen Ton ist auch die Gründlichkeit wissenschaftlicher Kritiken
und Kontroversen gestimmt. In der Historischen Vierteljahrsschrift,
einem angesehenen Fachorgane, finde ich – um ein Beispiel für
unzählige zu nennen – folgende schöne Stelle: »Eine ›mißverständliche‹
Äußerung ist nach meinem Sprachgebrauch keine solche, die von
Mißverständnis zeugt, sondern die Mißverständnis erzeugen könnte.
›Miß[S. 40]verständlich› in diesem Sinne erschienen mir die Worte: ›B.
setzt die Urkunde nach 1162‹. Setzen ist ein örtlicher Ausdruck; man
kann also richtig sagen: ›B. setzt die Urkunde vor 1162‹, weil wir
die Präposition vor ebensowohl örtlich als zeitlich gebrauchen. Der
richtige Gegensatz zu dem örtlichen vor ist aber nicht nach, sondern
hinter (hinter 1162), während nach in örtlichem Gebrauche uns zunächst
die Richtung bedeutet, aber damit zugleich häufig die Vorstellung des
›hinein in‹ verbindet; man vergleiche: ›er ist nach Frankfurt gesetzt‹
und ›das Regiment ist nach Krefeld verlegt‹. Ein Leser von korrektem
Sprachgefühl, der B.s eigene Darstellung noch nicht kennt, muß hier
also geradezu verstehen: ›B. setzt die Urkunde in das Jahr 1162‹,
wiewohl die S.sche Ausdrucksweise häufiger vorkommen mag. Müßig war
meine Bemerkung also nicht.«[25]
Im engen Kreis verengert sich der Sinn.
Mir selbst ist eine ähnliche Geschichte, die mich königlich
amüsierte, mit einem Geheimrat Harry Breßlau passiert. In meiner
»Frühmittelalterlichen Porträtplastik in Deutschland« hatte ich
auch die Siegelkunde gestreift und zum Belege dafür, daß mir der
Beweis, bereits die frühmittelalterliche Kunst habe eine gewisse
Porträtfähigkeit besessen – was bisher unbekannt war und von einem
großen Teil der gelehrten Zunft heute noch bestritten wird – u. a. auf
folgendes hingewiesen: Im Allgemeinen Reichsarchiv in München befindet
sich – auch unter der Abgußsammlung echter Kaisersiegel – ein Siegel,
das bisher den Namen Heinrichs II. trug. Ich sah sofort, daß hier ein
Irrtum vorliege und es eine[S. 41] Porträtdarstellung Heinrichs III. sei.
Daraufhin wurde dann der Irrtum richtiggestellt.
Das muß nun den Herrn Geheimrat tief empört haben, denn er schreibt
im 35. Bde. des Neuen Archivs der Gesellschaft für ältere deutsche
Geschichtskunde S. 297: »Wenn die Kenntnisse und die Sorgfalt des Herrn
ebenso groß wären, wie sein Selbstbewußtsein, würde er vielleicht einen
Blick in den dritten Band unserer Diplomata-Ausgabe geworfen und sich
überzeugt haben, daß die Tatsache bereits in der Note p. zu DH. H.
332 b auf S. 421 festgestellt war.«
Tant de bruit!!!
[S. 42]
Dritter Abschnitt
Autoritäten, gelehrte Zunft und Fortschritt
Schon an anderer Stelle habe ich meine Ansichten über das Versagen
der sogenannten Autoritäten nicht minder als der ganzen gelehrten
Zunft dem Genialen und Neuen gegenüber ausgesprochen. Der letzte
Abschnitt des ersten Bandes dieses Buches enthält genügend Material
zum Beweise dafür, daß der Fortschritt sich nicht durch, sondern
trotz Autoritäten vollzieht und daß keineswegs nur im Mittelalter,
sondern auch heute noch vorgefaßte Meinungen, Theorien und Hypothesen
höher bewertet werden, als gut beglaubigte Beobachtungen, falls sie
ihnen widersprechen. Dazu kommt das Gesetz der Trägheit, das gerade
in Gelehrtenkreisen unverbrüchlich befolgt wird. Weiteres Material in
dieser Richtung zu sammeln, war mir eine besondere Freude.
Beginnen wir mit den Naturwissenschaften.
Bekanntlich war Aristoteles das ganze Mittelalter hindurch eine
unbestrittene Autorität in allen weltlichen Fragen. Wie wir noch später
bei Betrachtung[S. 43] der Universitäten sehen werden, durfte niemand von
seiner Lehre abweichen, es sei denn, sie widersprach einem Dogma.
Galens Autorität als Arzt war nicht geringer, die der Bibel in allen
Fragen ist hinlänglich bekannt. So werden wir denn sehen, daß es vor
allem die genannten Autoritäten sind, denen der Fortschritt im harten
Kampfe fußweise den Boden abgewinnen muß, um – andere Autoritäten
dafür einzutauschen.
Galilei, 25jährig im Jahre 1589 zum Professor an der Universität
Pisa ernannt, trat öffentlich gegen Aristoteles auf, indem er durch
Vernunftschlüsse bewies, daß alle Körper gleich schnell fallen.
Gleichzeitig trat er den experimentellen Beweis an, indem er vom
schiefen Turm der Stadt unter anderem eine 100pfündige Bombe und
eine halbpfündige Kanonenkugel fallen ließ, die bei der ungefähren
Fallhöhe von 70 m kaum eine Handbreit abwichen. Trotzdem vertrauten
die peripatetischen Kollegen ihrem Aristoteles mehr, als der direkten
Naturbeobachtung, ja, sie empfingen den unbequemen Gegner mit Pfeifen.
Dadurch wurde der große Forscher gezwungen, die Universität zu
verlassen, um einer Kündigung seines Kontraktes zuvorzukommen.
Als er die Jupitermonde entdeckt hatte, scheuten sich die
peripatetischen Professoren, in ein Fernrohr zu sehen, aus Furcht, sie
könnten diese Beobachtung bestätigt finden! Daß sie später die
kirchliche Hilfe in Anspruch nahmen, um den Mann zu vernichten, der
es gewagt hatte, das Aristotelische Himmelsgebäude zu stürzen, ist
hinlänglich bekannt. Aber auch die wissenschaftlichen »Autoritäten«
traten[S. 44] gegen seine Verteidigung des Kopernikus und der Drehung
der Erde auf. Der Professor der Philosophie in Pisa, Scipione
Chiaramonti (1565–1652), schrieb heftig gegen seine epochemachende
Vergleichung des Ptolemäischen und Kopernikanischen Weltsystems und der
Peripatetiker Claude Berigard (1578–1663) behauptete, Galilei
habe dem Simplicius nicht die stärksten Gründe gegen die Bewegung der
Erde in den Mund gelegt.[26]
*
Da J. Baptista Benedettis mechanische Entdeckungen wiederholt
Aristoteles widersprachen, fanden sie nicht die verdiente Beachtung. Im
16. Jahrhundert mußte die Physik nach Aristoteles oder zur Not, wenn
es sich um statische Verhältnisse handelte, nach Archimedes gelehrt
werden. Sonst konnte das Werk nicht den Beifall der zünftigen Gelehrten
finden und wurde, soweit irgend möglich, totgeschwiegen.[27]
*
Tycho de Brahe lehnte das Kopernikanische System ab, unter
anderem, weil die Bibel (Josua 10, 12) direkt der Bewegung
der Erde widerspräche. Allerdings stürzte er das bisher herrschende
Ptolemäische System.[28]
*
Peter Ramus (Ramée geb. 1515), ein verdienstvoller französischer
Mathematiker, der auch als Lehrer der Beredsamkeit und Philosophie
tätig war, griff Aris[S. 45]toteles, dessen Logik er noch nicht einmal gelten
lassen wollte, kühn an. Dadurch entfesselte er einen förmlichen Sturm
der Entrüstung an allen Universitäten, der für ihn die schlimme Folge
hatte, daß er seiner Lehrerstelle in Paris entsetzt wurde und
aus der Stadt fliehen mußte. Als er später zurückzukehren wagte und
seine Lehrtätigkeit wieder aufnahm, wurde er in der Bartholomäusnacht
1572 ermordet, wie man sagt auf Anstiften des Carpentarius,
seines scholastischen Gegners.[29]
*
Newton, der erst im 12. Lebensjahre auf die Schule kam und
dort anfänglich als schlechter Schüler galt, veröffentlichte 1687 in
seinem berühmten Werke Philosophia naturalis principia mathematica
das bereits früher von ihm entdeckte Gravitationsgesetz. Statt nun
anzuerkennen, was Newton unwiderleglich bewiesen hatte, daß alle
Himmelserscheinungen wenigstens so vor sich gehen, als strebten alle
Körper nach dem direkten Verhältnis ihrer Massen und dem indirekt
quadratischen Verhältnis ihrer Entfernungen zueinander, negierten
seine Cartesianischen Gegner einfach Newtons große Entdeckung.[30]
Später erklärte er kategorisch, »Hypothesen bilde ich nicht«. Durch
die Autorität, die dieser Mann, dessen Schüler nach und nach mehr oder
weniger alle Physiker wurden, im Laufe der Zeit erlangt hatte, bekamen
die Hypothesen lange Zeit einen verächtlichen Beigeschmack und
verschwanden mehr als nötig und dienlich aus der Physik.
[S. 46]
Cotes, der Schüler Newtons, erklärte, allerdings nicht ohne
seines Meisters Verschulden, die Schwere für eine einfachste, vom
Schöpfer der Materie direkt eingepflanzte Ursache. Er hält es für
irreligiös, nach weiteren Erklärungen derselben zu suchen
und so den Schöpfer ganz eliminieren, oder doch ganz begreifen zu
wollen. In der von ihm zu Newtons Lebzeiten veranstalteten 2. Auflage
der »Principien« erklärte er schon das Suchen nach der Ursache
der Schwere oder Vermittlung der Fernwirkung als ein Zeichen des
Atheismus![31]
*
Huygens veröffentlichte 1690 seine bereits 1678 vor der
Pariser Akademie verlesene Abhandlung über das Licht, in der er eine
vollständige Undulationstheorie des Lichtes entwickelte, die bis auf
einen Hauptpunkt ganz mit unserer jetzigen Lichttheorie übereinstimmt.
Huygens setzt nämlich einen höchst feinen und beweglichen, durch das
ganze Weltall verbreiteten Stoff, den Äther, voraus. Wird an einer
Stelle ein Ätherteilchen in Schwingung versetzt, so teilen sich die
Schwingungen allen benachbarten Teilchen mit und durch den Raum
pflanzt sich eine Ätherwelle fort, die jenes Teilchen zum Mittelpunkt
hat. Trifft eine solche Welle unser Auge, so haben wir die Empfindung
von Licht. Dank dieser Theorie gelang es für jede Richtung des in
einen Doppelspat einfallenden Lichtstrahles die Richtung auch des
außerordentlich gebrochenen Strahles durch Rechnung oder Konstruktion
ohne jede weitere Beobachtung zu finden. Dieser Traité de la lumière,
bzw. diese Undulations[S. 47]theorie fand nicht die Anerkennung Newtons.
Die Abhandlung wurde von den Physikern einfach totgeschwiegen
und blieb in der Folgezeit ohne jede Wirkung. Sie war für ein
ganzes folgendes Jahrhundert so gut wie nicht geschrieben. Noch die
bedeutenden Geschichtschreiber zu Ende des 18. Jahrhunderts erwähnen
das Werk fast nur als Kuriosität![32]
*
Jean Richer († 1696) wurde von der Pariser Akademie im Jahre
1671 nach Cayenne geschickt, und kehrte zwei Jahre später von
dieser Reise heim. Anfänglich wurde er wegen der Genauigkeit seiner
Arbeiten sehr belobt, doch brachte er auch eine Entdeckung mit, die
den Akademikern bald sehr unangenehm wurde. Er hatte von Paris nach
Cayenne eine gute Pendeluhr mitgenommen, fand aber, daß sie in Cayenne
täglich um zwei Minuten zu langsam ging und daß er das Pendel um 1,25
Linien verkürzen mußte. Er glaubte zuerst an einen Irrtum seinerseits,
als er aber bei seiner Rückkehr nach Paris das Pendel wieder auf
die frühere Länge stellen mußte, behauptete er mit Sicherheit
die Veränderlichkeit der Länge des Sekundenpendels mit der
geographischen Breite. Richer erklärte diese daraus, daß durch die
Umdrehung der Erde die Schwere am Äquator verringert werde und daß auch
vielleicht die Erde an den Polen abgeplattet sei und darum die Schwere
nach den Polen hin zunehme. Die Akademie aber wollte durchaus nicht
an eine Abplattung der Erde glauben. Übrigens widersetzte sich die
Pariser Akademie auch dieser Tatsache, als Newton sie[S. 48] 1687 bewies. Man
führte die Verlängerung des Pendels auf das heiße Klima zurück, wiewohl
Newton nachwies, daß die Ausdehnung durch die Wärme viel zu gering sei.
Für Richer war seine Entdeckung sehr verhängnisvoll. Die eine
unbequeme, weil in den Augen der Akademiker der geltenden Theorie
widersprechende Beobachtung verringerte den Wert aller übrigen, so
daß er schwer darunter leiden mußte und kränkelnd von der Reise
zurückgekehrt, hinfort nur mehr geringen Anteil an den Arbeiten der
Akademie nahm.[33]
*
Thomas Youngs Arbeiten, durch die er zu einem Reformator der
Theorie der Optik wurde, hatten zu seinen Lebzeiten gar keinen Erfolg.
Henry Brougham (1778–1868) schrieb in der angesehenen Edinburgh
Review vom Jahre 1803 sehr ungünstig über seine Arbeiten. Er vermochte
in denselben absolut nichts, was den Namen einer Entdeckung, ja nur
eines wissenschaftlichen Experiments verdiente, zu finden und konnte
seinen Bericht überhaupt nicht schließen, »ohne die Aufmerksamkeit
der Royal Society darauf zu lenken, daß sie in den letzten Zeiten
so viele flüchtige und inhaltsleere Aufsätze in ihre Schriften
aufgenommen habe«. Als William Hyde Wollaston sich für
Youngs Interferenztheorie günstig ausgesprochen hatte, äußerte
Brougham auch darüber seine Unzufriedenheit, »daß ein so genauer
und scharfsinniger Experimentator die seltsame Undulationstheorie
angenommen hat«. Die englischen Gelehrten gingen über Youngs Arbeiten
ohne weitere[S. 49] Diskussion zur Tagesordnung über, die Deutschen
übersetzen sie, ohne Gebrauch davon zu machen und die Franzosen lernten
sie gar nicht oder doch nur ganz unvollkommen kennen. Schließlich wurde
Young selbst wankend und bereit sein System aufzugeben![34]
*
Als Fresnel durch seine Arbeiten die feste Begründung der
Undulationstheorie des Lichtes gab, die Theorie der Interferenz und
Beugung des Lichtes durch seine meisterhaften Messungen bestätigte,
die Gesetze der Reflexion und Brechung des polarisierten Lichtes
entwickelte, desgleichen die der Doppelbrechung des Lichtes in
Kristallen u. a. m. konnte er doch den vollen Sieg seiner Ansichten
nicht mehr erleben. Der gefeierte Physiker Biot vertrat nach
wie vor die Emanationstheorie. Ganz ungeheuerlich aber erschien den
Physikern die Annahme der Transversalschwingungen des Äthers. Weder
Arago noch Laplace noch Poisson konnten sich zu
ihr bekehren. Noch bis 1830 blieb die Allgemeinheit der Physiker dabei,
daß Emissionstheorie und Undulationstheorie die optischen Erscheinungen
ungefähr gleich gut erklären. Brewster lehnte die letztere sogar
noch 1833 erbittert ab.[35]
*
Als Fraunhofer im Sonnenspektrum die bekannten Linien fand und
feststellte, daß sie immer unter denselben Umständen vorhanden waren
und unter allen Umständen in denselben Farbentönen liegen blieben,
was er im I. Band der Denkschriften für die Münchener Akademie der
Wissenschaften[S. 50] 1814/15 veröffentlichte, legten die Physiker den Linien
wenig theoretische Wichtigkeit bei. Biot erwähnte sie selbst in
der 3. Auflage seines Lehrbuches noch nicht und die ersten Bände
von Gehlers physikalischem Lexikon machten auch nur wenig Aufhebens von
ihnen.[36]
*
Die Theorien der Elektrodynamik und des Elektromagnetismus, die
Ampère aufstellte, wurden anfänglich von den Physikern
abgelehnt. Biot war des Unterganges dieser Lehren ganz
sicher und erhoffte von den Physikern, daß sie ihm seinerzeit die
Ehre zollen würden, daß er von Anfang an diese Hypothesen abgelehnt
habe.[37]
*
Als Sadi Carnot 1824, 28jährig, sein Werk »Réflexions sur la
puissance motrice du feu et les machines propres à développer cette
puissance« veröffentlicht hatte, durch das er der Vater der neueren
Wärmetheorie wurde und in dem er zum ersten Male klar und deutlich
die Erschaffung mechanischer nicht bloß, sondern auch physischer
Kräfte leugnete und das perpetuum mobile mechanicum so gut wie das
perpetuum mobile physicum, wenigstens soweit es thermodynamische
Maschinen betraf, für unmöglich erklärte, erfuhr sein Werk völlige
Nichtbeachtung. Weder Berzelius noch Gehlers
Wörterbuch der Physik erwähnen Carnot. Erst nach der Entdeckung des
mechanischen Äquivalents der Wärme fanden seine Arbeiten die verdiente
Aufmerksamkeit.[38]
[S. 51]
*
Die von George Green 1828 gefundene Potentialfunktion wurde
überhaupt nicht beachtet, ebenso die Arbeiten Hamiltons
über dasselbe Thema nur wenig. Erst als Gauß 1840 die von
ihm kurz Potential genannte Funktion bearbeitete, fand sie allgemeine
Verbreitung und Anerkennung.[39]
*
Faradays Bemerkungen über die Influenz fanden keine ungeteilt
günstige Aufnahme und die meisten Physiker, zumal die deutschen, waren
mit seiner Gegnerschaft gegen die actio in distans durchaus nicht
einverstanden. Man hielt seine Ideen von einer vermittelten Fernwirkung
für Gebilde einer ausschweifenden Phantasie oder verkehrt
geleiteter Philosophie.[40]
*
Euler führte 1762 Licht, Wärme und Elektrizität auf eine
allgemeine Ursache, den Äther, zurück. Damit kam er, trotz mancher
Mängel der Hypothese, dem Gesetz der Umwandlung der Kräfte sehr
nahe und verdient unsere höchste Bewunderung dafür, daß er vor mehr
als einem Jahrhundert nicht nur auf eine gemeinsame Wurzel aller
Kräfte hinwies, sondern daß es ihm auch gelang, wenigstens teilweise
die Erscheinungen aus ihr abzuleiten. Da er jedoch mit Newtons
Autorität kollidierte, wußten seine Zeitgenossen sein Verdienst
nicht zu schätzen. Bezeichnend ist, daß Priestley in seiner zu
London 1772 erschienenen Geschichte der Optik in bezug auf den großen
Mathematiker es ablehnt, »den Leser mit bloßen Hypothesen
aufzuhalten«.[41]
[S. 52]
Graf Rumford (1753–1814) hatte durch Beobachtungen beim
Kanonenbohren in den Werkstätten des Militärzeughauses zu München und
daran anschließende Versuche festgestellt, daß durch Reiben zweier
Körper aneinander unbestimmte, vielleicht unbegrenzte Mengen von Wärme
erzeugt werden könnten. Daraus folgerte er, daß man unmöglich diese
Wärme selbst als einen Stoff annehmen könne – dies nach
der gültigen Phlogistontheorie geschah –, sondern was durch
Bewegung immer unerschöpflich erzeugt werden könne, selbst nur Bewegung
sei. Daher müsse man alle Wärmeerscheinungen als Bewegungserscheinungen
auffassen.
Humphry Davy (1778–1829) prüfte Rumfords Versuche nach
und erzeugte Wärme sogar durch Reibung von Eisstücken, wobei
sich herausstellte, daß das sich bildende Wasser eine höhere
Temperatur erhielt, als die Lufttemperatur gerade betrug. Das war
eine glänzende Bestätigung von Rumfords Versuchen. Er stellte eine
Vibrationstheorie auf und erklärte alle Erscheinungen der Wärme
durch die Annahme, daß in einem festen Körper die Teilchen in
beständig schwingender Bewegung sind. Auch Thomas Young, der
Wiedererwecker der Undulationstheorie des Lichtes, bekannte sich zur
Vibrationstheorie und gelangte zur Überzeugung, daß Licht und
Wärme aus ganz gleichartigen Schwingungen bestehen, die sich nur
dadurch unterscheiden, daß die Wärmeschwingungen langsamer sind,
als die des Lichtes. Trotzdem fühlten sich die Physiker nicht
veranlaßt, diesen Behauptungen Youngs eine größere Beachtung
zu schenken, als seinen Bemühungen um die Reform[S. 53] der Optik. Die
meisten Physiker kehrten, wiewohl sie merkten, daß sich die genannten
Versuche mit der Annahme eines Wärmestoffes schwer vereinigen ließen,
doch zu ihm zurück. Man betrachtete die Erzeugung der Wärme durch
Reibung nur als einen nicht geklärten dunklen Punkt an dem sonst reinen
Himmel der herrschenden Theorie, und bemühte sich mit gutem Erfolg,
diesen dunklen Punkt ganz zu übersehen.[42]
*
Giovanni Battista Guglielmini († 1817) stellte Berechnungen
an über die Abweichung fallender Körper von der Lotlinie und fand,
daß die östliche Abweichung eines von der St. Peterskirche in Rom 240
Fuß hoch fallenden Körpers durch die Rotation der Erde ½ Zoll von
der Vertikalen betragen müsse. In den Jahren 1790 und 1791 machte er
diesbezügliche Versuche, die mit den Resultaten seiner Berechnung
ziemlich gut übereinstimmten. Wunderbarerweise fand er aber auch
gleichzeitig eine, allerdings geringe, südliche Abweichung. Laplace
schloß aus dieser Abweichung, die ihm theoretisch unmöglich
erschien, nur, daß die ganzen Versuche gänzlich ungenau und
ihr Zeugnis für die Achsendrehung der Erde ganz unkräftig sei.
Auch als Benzenberg im Jahre 1802 vom Michelsturm in Hamburg und
im nächsten Jahre in einem Kohlenschacht zu Schlehbusch in der Mark die
Versuche mit gleichem Resultat wieder aufnahm, gelang es ihm nicht, die
meisten Physiker davon zu[S. 54] überzeugen, daß die südliche Abweichung in
Zusammenhang mit der Schwere und Rotation der Erde stünde.[43]
*
Als es Davy, der übrigens als Lehrling bei einem Chirurgen
und Apotheker seine glänzende Laufbahn begonnen hatte, gelungen
war, noch vor dem Jahre 1812 das elektrische Bogenlicht zu
erzeugen, mit dem er Platina, Quarz, Kalk etc. schmolz, erregten diese
Entdeckungen nicht das Aufsehen, das man hätte erwarten dürfen.
Ja, theoretisch erschien die kolossale Wärme- und Lichtproduktion bei
der geltenden materiellen Theorie der Wärme sogar beunruhigend
und unbequem! Man beobachtete hinfort unter den Physikern über
dieses Thema Schweigen![44]
Dufay (1698–1733) war es ein Jahrhundert früher nicht besser
ergangen. Er hatte u. a. die Verschiedenheit der positiven von der
negativen Elektrizität entdeckt. »Das entscheidende Kennzeichen
besteht darin, daß sie sich selbst abstoßen und im Gegenteil eine die
andere anzieht.« Dieses äußerst wichtige Prinzip fand nicht gleich die
verdiente Anerkennung und ist später erst zur Geltung gebracht worden,
ohne daß man dabei die Verdienste Dufays anerkannt hätte.[45]
*
Der geniale Erfinder Papin, der bereits den Gedanken hatte,
Wagen durch Dampfkraft zu bewegen, der Versuche mit einem Taucherschiff
anstellte, eine Zentrifugalpumpe erfand, die ohne Ventile und Klappen[S. 55]
kontinuierlich das Wasser heben und auch als Blasebalg gut verwendbar
sein sollte, der ferner den nach ihm benannten Dampfkochtopf erfand,
der aber auch erst der Neuzeit die Dienste leistete, die Papin sich
von ihm versprach, hatte den Plan, ein Schiff durch Dampfkraft zu
bewegen. Es gelang ihm jedoch nicht, die Royal Society, die überhaupt
die Entwicklung der Dampfmaschine wenig beachtete, für seine Idee zu
gewinnen. Er starb in Dürftigkeit.[46]
*
Im Jahre 1663 erschien aus der Feder des Edward Somerset, Marquis of
Worcester, in London ein Schriftchen unter dem Titel: A century of
the names and scantlings of such inventions as at present I can coll to
mind to have tried and perfected. Hier erwähnt unter No. 68 Worcester
eine Maschine, die, mit Dampf betrieben, Wasser in beliebiger Menge
auf beliebige Höhe fortdauernd zu heben vermag. Obwohl er auf diesen
Vorläufer der Dampfmaschine im gleichen Jahre für sich und seine
Erben ein Patent auf 90 Jahre erhielt, geriet die Erfindung mit
seinem 1667 erfolgten Tode bereits in Vergessenheit.[47]
*
Als Poggendorf im XLVIII. Bande seiner Annalen 1839 (S. 193) einen
Aufsatz über Daguerres Erfindung der Photographie
brachte, rechtfertigte er die Veröffentlichung folgendermaßen: »Bei dem
allgemeinen und, man kann wohl sagen, über[S. 56]triebenen Interesse,
welches die Anzeige von Herrn Daguerres Entdeckung im Publikum gefunden
hat...« Das Publikum, d. h. die Nichtzünftler, hat allerdings häufig
genug mehr Verständnis für das Neue bewiesen, als die Hochgelahrten.
*
Das Telephon, die Erfindung des Autodidakten Philipp
Reis, wurde zwar in wissenschaftlichen Werken, ja sogar in
populären Schriften erwähnt. Das hinderte aber nicht, daß es allmählich
in Vergessenheit geriet. Und zwar so gründlich, daß die mit
Unterstützung der historischen Kommission der bayerischen Akademie der
Wissenschaften herausgegebene »Geschichte der Technologie« von Karl
Kramarsch (München 1872) weder den Namen des Erfinders Reis, noch die
von ihm geprägte Bezeichnung Telephon aufführt. Erst als Graham
Bell, der den Apparat verbesserte, auch die Idee für sich in
Anspruch nahm, erinnerte man sich in Deutschland des ursprünglichen
Erfinders, dessen Tage gezählt waren.[48]
*
Die »Edinburgh Review« forderte das Publikum auf, Thomas Gray
in eine Zwangsjacke zu stecken, weil er den Plan von Eisenbahnen
entwarf.
*
Ein so großer Gelehrter wie Sir Humphry Davy lachte über die
Vorstellung, daß London einmal mit Gas beleuchtet werden solle.
[S. 57]
*
Die französische Akademie der Wissenschaften verspottete den großen
Astronomen Arago, als er nur das Verlangen stellte, über das
Projekt eines elektrischen Telegraphen eine Diskussion zu
eröffnen.
*
Als Stephenson vorschlug, Lokomotiven auf der Liverpool-
und Manchestereisenbahn zu benutzen, führten gelehrte Männer den
Beweis, daß es unmöglich sei, zwölf englische Meilen in einer
Stunde zurückzulegen. Eine andere hohe wissenschaftliche Autorität
erklärte es für gleich unmöglich, daß Meeresdampfer jemals den
Atlantischen Ozean durchkreuzen könnten.[49]
*
Als die Gasbeleuchtung der Straßen eingeführt werden sollte,
eiferte die Kölnische Zeitung in der Nummer vom 23. April 1828
aus theologischen Gründen dagegen. Es sei unzulässig, die von Gott
dunkel geschaffene Nacht zu erhellen.
*
Helmholtz erklärte im Jahre 1872 als Mitglied einer vom
preußischen Staate eingesetzte Kommission zur Prüfung äronautischer
Fragen für nicht wahrscheinlich, daß der Mensch, auch durch den
allergeschicktesten flügelähnlichen Mechanismus, den er durch seine
eigene Muskelkraft zu bewegen hätte, jemals sein eigenes Gewicht
in die Höhe heben und dort erhalten könne. Mag der große Gelehrte
mit[S. 58] der menschlichen Muskelkraft auch recht behalten haben, so
lähmte doch anderseits seine Autorität die aviatischen Bestrebungen
überhaupt.[50]
*
Der Professor am Polytechnikum in Hannover und dessen nachmaliger
Rektor Wilhelm Launhardt (geb. 1832), ein hochangesehener
Ingenieur und Fachschriftsteller, warnte seine Zuhörer davor, sich
mit den stets vergeblich gewesenen Versuchen zur Erfindung eines
Automobils abzuplagen.[51]
*
Wenden wir uns nun der Medizin zu, in der es den großen Männern um kein
Haar besser erging als in den Naturwissenschaften oder der Technik.
Leopold Auenbrugger (1722–1809), Arzt in Wien, erfand
die Perkussionsmethode, über deren Unentbehrlichkeit zur
physikalischen Untersuchung des Körpers niemand im Zweifel ist.
Und zwar fand er nicht durch Zufall diese großartige Erleichterung
der Diagnose, sondern durch Nachdenken und Experiment, dabei ganz
unvorbereitet und ohne jegliche Andeutung früherer Beobachter. Er
veröffentlichte seine hochbedeutende Erfindung im Jahre 1761 in Wien
nach siebenjähriger Vorarbeit unter dem Titel Inventum novum ex
percussione thoracis humani ut signo abstrusos interni pectoris morbos
detegendi.
Es handelt sich hier um einen der ersten und glänzendsten Triumphe der
anatomischen Forschung, und der Gedanke liegt nahe, daß das auch die
Zeit[S. 59]genossen erkannt hätten. Wer aber das Verhalten der Zunft und
Autoritäten dem Neuen gegenüber kennt, wird es weniger erstaunlich
finden, daß nur ein einziger Arzt namens Stoll den Wert der
Untersuchungsmethode durch Perkussion, wenn auch nicht ihrem vollen
Umfange nach, erkannt und dieselbe geübt hat. Van Swieten
und de Haën schenkten Auenbruggers großer Leistung keine
Aufmerksamkeit. Von einigen Seiten wurde die Entdeckung lächerlich
gemacht, von andern mißverstanden. So schrieb unter andern Vogel
in einer Kritik der Auenbruggerschen Schrift (Neue med. Bibliothek
1766, VI, S. 89), daß dieses Inventum mit besserem Recht novum
antiquum, als novum hätte benannt werden können, da es nichts
anderes als die von Hippokrates geübte Sukkussion sei.
Es ist ja eine beliebte Methode, das Neue zunächst als schlecht
abzulehnen. Dann den Nachweis zu erbringen, daß es überhaupt nicht
neu ist. Leute, deren Sitzorgane in umgekehrtem Verhältnis zu den
Denkorganen entwickelt sind, werden auch stets Anklänge in irgendeinem
alten Schmöker finden. Vogel war jedenfalls vorsichtig, als er das
hohe Alter einer Erfindung festzustellen versuchte, bevor deren
Wert anerkannt worden war. Bezeichnend ist das Urteil des berühmten
Haller (Göttingische gelehrte Anzeigen 1762, S. 1013). »Alle
dergleichen Vorschläge verdienen zwar nicht auf der Stelle angenommen,
aber mit Achtung gehört zu werden.« Nur keine Eile!
Da die wenigen günstigen Urteile keine Beachtung fanden, geriet
Auenbruggers Erfindung und Schrift in völlige Vergessenheit,
bis der große[S. 60] Pariser Arzt Corvisart ihr den ihr gebührenden
Platz in der praktischen Heilkunde sicherte. Im Jahre 1808, also ein
Jahr vor des genialen Erfinders Tode, aber 47 Jahre nach ihrer
Veröffentlichung, gab er unter dem Titel »Nouvelle methode pour
reconnaître les maladies internes de la poitrine par la percussion de
cette cavité« eine Übersetzung des Werkes heraus, deren Vorwort bewies,
daß er als erster die Bedeutung dieser Erfindung für das Heil der
Kranken in ihrem ganzen Umfange vollkommen gewürdigt hatte.[52]
*
Ganz ähnlich wie der Perkussion erging es der zur Diagnose nicht minder
wichtigen Auskultation. Der selbständige Erfinder der klinischen
Auskultation war der bekannte französische Arzt Laënnec (1781
bis 1826). Zwar hatten bereits die alten griechischen Ärzte diese
Methode angewandt, sie war aber völlig in Vergessenheit geraten, so
daß Laënnecs Erfinderruhm nicht gemindert wird, um so weniger, als er
auch das Stethoskop anwandte und sich als Meister in der Determination
akustischer Zeichen erwies. Der von ihm in die Auskultation
eingeführten Nomenklatur bedienen sich noch die heutigen Ärzte. Sein
Werk ist ein vollständiges Handbuch der Diagnostik, zumal in seiner
zweiten 1826 erschienenen Auflage. Übrigens gedenkt Laënnec auch der
Perkussion, nur daß er die Leistungen dieser Methode für sich allein
für eng begrenzt und zweifelhaft hält.
Zunächst fand Laënnec auch bei seinen Landsleuten keine
allgemeine Anerkennung. Man[S. 61] eiferte von mancher Seite gegen die
»Cylindromanes«. Besonders Broussais (Examen des doctrines
médicales ... T. II, Paris 1821) hatte vielfache oft recht kleinliche
Bemängelungen und Ausstellungen. Am ersten wurde die neue Methode in
England, zuletzt in Deutschland angenommen.[53]
*
Franz Anton Mesmer (1733–1815) suchte nachzuweisen, daß die
Himmelskörper durch ihre gegenseitigen Anziehungskräfte einen Einfluß
auf unser Nervensystem ausüben (de Planetarum influxu 1766). Ferner
beschäftigte er sich viel mit Magnetismus, den er für heilkräftig
hielt und mit dem er auch Heilungen vollführte. Als er bemerkte, daß
auch ohne Anwendung des Magnetes durch bloßes Streichen mit den Händen
eigentümliche Wirkungen hervorgebracht wurden, schloß er daraus auf
eine von ihm ausströmende, dem Magnetismus verwandte Kraft, die er
»tierischen Magnetismus« nannte und in sein Heilsystem aufnahm.
(Sendschreiben an einen auswärtigen Arzt über die Magnetkunde, Wien
1775.) Tatsächlich gelang es ihm, Schlaf zu erzeugen, er beobachtete
den Somnambulismus und das Hellsehen, ließ mit den Fingerspitzen
verschlossene Briefe lesen u. a. m. Andere identifizierten die
zugrundeliegende geheimnisvolle Kraft nicht mit dem Magnetismus,
sondern, wie Reichenbach mit dem von ihm angenommenen Od, oder wie
Kieser, Gmelin, Passavant mit Tellurismus, Siderismus oder Nervenäther.
Doch die Erklärungsversuche der Phänomene haben für uns weniger
Interesse, als die Stellung der[S. 62] wissenschaftlichen Welt zu Mesmer.
In Wien hatte er wenig Glück. Eine Partei tat das, was dem unbequemen
Neuen gegenüber immer das Naheliegendste ist und was deshalb unsere
offizielle Wissenschaft auch heute noch den okkulten Phänomenen
gegenüber tut: sie leugnete kurzweg alles. Selbst Wiener
Augenzeugen (Störck, Barth, Ingenhouß) sprachen sich nicht für die
Glaubwürdigkeit seiner magnetischen Kuren aus. Nur wenige Ärzte, die
die Vorgänge an Magnetisierten beobachtet hatten, gaben ein, wenn
auch nicht absolut günstiges, so doch reserviertes Urteil über die
Vorgänge ab. Zwar begründete Mesmer in Wien ein Spital zur Ausübung
seiner Heilmethode, mußte die Kaiserstadt aber 1778 verlassen, um
sich nach Paris zu begeben. Hier wurde der Magnetismus zur Modesache.
Das hinderte aber – und mit Recht – die Gelehrten natürlich nicht,
nach wie vor ihm kritisch gegenüberzustehen. Daß die Pariser Akademie
der Wissenschaften und die medizinische Fakultät, Instanzen, denen
1784 die Untersuchung übertragen war, und in denen Männer wie Leroy,
Bailly, Lavoisier u. a. saßen, die Heilerfolge einfach auf die Macht
der Einbildung zurückführten und damit alle Mesmerschen Experimente
leugneten, zeugt allerdings nicht von übergroßem Scharfblick. Mesmer
sah sich daraufhin gezwungen, nach Deutschland zurückzukehren.
Daß sich Mystik und Schwärmerei der wunderbaren Entdeckung
bemächtigten, liegt nahe, ebenso daß dadurch ernste Männer zu erhöhter
Skepsis veranlaßt wurden. Tatsächlich fiel bereits in den dreißiger
Jahren des 19. Jahrhunderts der tierische Magnetismus bei den Ärzten
in Mißachtung, nachdem er eine[S. 63] Zeitlang Anhänger gehabt hatte. Mesmer
aber galt hinfort als Schwindler.
Wir wollen hier natürlich keine Lanze für den tierischen Magnetismus
brechen, noch für Reichenbachs Od oder andere Erklärungsversuche.
Wohl aber legen wir Gewicht auf die sich auch hier wiederholende
Erscheinung, daß Tatsachen geleugnet werden, weil sie in das gerade
herrschende System nicht passen, oder weil Phantasten aus ihnen zu weit
gehende Schlüsse ziehen.
Doch Mesmer sollte eine, allerdings sehr späte, Rechtfertigung
erfahren. Im Jahre 1841 machte der Arzt James Baid (1795–1860)
in Manchester die Entdeckung, daß bei einzelnen Individuen durch
jedes beliebige Verfahren, das die Aufmerksamkeit auf einen
Punkt lenkt, ein eigentümlicher Schlaf hervorgerufen werden kann
und daß dieses Verfahren sich unter Umständen auch als Heilmittel
empfehle. In seiner 1843 erschienenen Schrift nannte er diese
Erscheinung Neurypnologie (so der Titel des Buches) oder Hypnotismus.
Er beobachtete dieselben Erscheinungen wie beim Mesmerismus,
verwahrte sich aber – vielleicht durch das Beispiel jenes gewarnt
– mit aller Entschiedenheit gegen die Annahme einer besonderen,
vom Arzt ausgeübten, Kraft und betonte, daß sie lediglich auf einer
eigentümlichen subjektiven Stimmung beruhe, in der das Individuum
durch nervöse Erregung, herbeigeführt durch Konzentration des Geistes
auf einen Gedanken, versetzt werde oder sich selbst versetze. Erst
im Todesjahre Braids 1860 wurde durch Broca und Azam der Braidismus
als ein wichtiger Fortschritt erkannt und der Pariser[S. 64] Akademie der
Wissenschaften davon Mitteilung gemacht. Trotzdem blieben diese
Erscheinungen bis zum Ende der siebziger Jahre ziemlich unbekannt.
Erst durch das Auftreten des gewerbsmäßigen Hypnotiseurs Hansen
1879 angeregt, haben seit 1880 die exakten Untersuchungen von seiten
kompetenter Naturforscher die Realität der mit dem Namen Hypnotismus
bezeichneten Erscheinungen und die Identität derselben mit den
von fremden Zutaten entkleideten Beobachtungen Mesmers außer aller
Frage gestellt.[54]
Virchow blieb bekanntlich zeitlebens ein Leugner und Hauptgegner
des Hypnotismus.
Bedenkt man nun, daß Suggestion, Hypnotismus, Somnambulismus,
Hellseherei und wie diese Erscheinungen alle heißen mögen, seit vielen
Jahrtausenden bekannt und geübt sind, daß Mesmer zuerst die Augen des
gebildeten Europa mit negativem Erfolg auf seine Experimente richtete
und daß nach seinem Tode 70, nach der ersten Veröffentlichung seiner
Beobachtungen mehr als 100 Jahre vergingen, dann wird man gegen
Negationen von Autoritäten und Akademien nicht minder mißtrauisch
werden, als man vorurteilslos an irgendwelche noch so phantastisch
erscheinende Behauptungen herantreten wird. Was aber Hypnotismus und
Suggestion ihrem Wesen nach sind, weiß man heute ebensowenig, wie in
Mesmers Tagen. Man begnügt sich mit Beschreibung der Beobachtungen
und Anwendung der gemachten Erfahrungen. Ob das aber prinzipiell den
Hypothesen eines Mesmer und Reichenbach gegenüber ein Fortschritt ist,
sei dahingestellt. Auch auf diesem Felde wird die Zukunft[S. 65] uns nicht
durch, sondern trotz der Autoritäten die Wahrheit entschleiern.
*
Die Dialectical Society in London hielt im Jahre 1869 eine große Anzahl
von Sitzungen zur Erforschung der sogenannten okkulten Phänomene ab,
an denen unter anderen bedeutenden Männern auch Alfred Russel
Wallace teilnahm. Die Resultate über Tischrücken, Klopfen,
Bewegung von Gegenständen ohne Kontakt etc. waren so erstaunlich,
daß mehrere Mitglieder der Gesellschaft sich weigerten, die Schlüsse
anzuerkennen, es sei denn, der Chemiker Crookes hätte sie
nachgeprüft. Der berühmte Gelehrte unterzog sich dieser Aufgabe mit
dem Erfolge, daß er die erstaunlichsten Beobachtungen der Dialectical
Society nicht nur bestätigen, sondern sogar ergänzen konnte. Z. B.
gelang es, eine Ziehharmonika ohne Berührung zum Spielen zu bringen,
Gewichtsveränderungen von Körpern zu erzielen, Tische und Stühle, ja
menschliche Körper ohne Berührung in die Höhe zu heben etc. Hatte
früher Crookes Bereiterklärung, sich der Nachprüfung zu unterziehen,
das Entzücken aller Kritiker geweckt, schlug die Stimmung ins konträre
Gegenteil um, als die Hoffnungen, der Gelehrte werde ein neues Zeugnis
zugunsten ihrer Ansichten bringen, sich nicht erfüllten. Die
Königliche Gesellschaft in London aber, deren Mitglied Crookes
ist, und die seine Beteiligung an den okkulten Forschungen gebilligt
hatte, solange sie annehmen konnte, es handle sich um Schwindel,
nahm seine Schrift nicht an, als er den Bekennermut bewies, das
zu bestätigen,[S. 66] was er gesehen hatte. Professor Stokes, der
Sekretär der Gesellschaft, weigerte sich, sich mit diesem Gegenstande
zu befassen und auch nur den Titel unter den akademischen
Publikationen einzutragen. Es war die genaue Wiederholung
dessen, was an der Akademie in Paris im Jahre 1853 den Versuchen des
Grafen Gasparin gegenüber geschehen war und was die Londoner
Gesellschaft einst Franklins Blitzableiter gegenüber getan hatte.[55]
*
Als Lombroso den Nachweis erbracht hatte, daß das
Pelagra, eine in Italien furchtbare Opfer fordernde Krankheit,
durch Vergiftung mit verdorbenem Mais entstehe, wurde diese Theorie
jahrelang mit wahrer Wut bekämpft, bis sie sich allgemein
durchsetzte. Heute zweifelt niemand mehr daran, daß Lombroso die
Ursache des Pelagra richtig erkannte.
Ähnlich ging es ihm mit der Theorie des geborenen Verbrechers,
die auch heute noch von vielen abgelehnt wird. Immerhin ist sie ins
Strafrecht eingedrungen, z. B. in Ungarn, aber auch in Deutschland, wo
man versucht, der Person des Verbrechers Rechnung zu tragen.
Diese einem Aufsatz von Lombrosos langjährigem Freunde A.
Pfungst entnommenen Angaben sind auch deshalb interessant, weil
der Autor das Eintreten des italienischen Gelehrten für Okkultismus
und Spiritismus damit entschuldigt, »daß das Alter seine eminente
Beobachtungsgabe, auf die er sich bei den spiritistischen Experimenten
blindlings verließ, schon[S. 67] sehr geschwächt hatte« (S. 641). Also auch
hier Theorie gegen Beobachtung und Experiment.[56]
*
Karl Schleich, der Erfinder der subkutanen Einspritzung zur
Erreichung der Anästhesie wurde von den Kollegen heftig bekämpft.
*
Lord Lister (geb. 1827), der Vater der modernen
Wundbehandlung, der zuerst Desinfektion der Wunde, dann aller
mit der Wunde in Berührung kommenden Gegenstände anwandte und empfahl,
hatte zwar in Deutschland größeren Erfolg als in seinem Vaterlande,
aber auch bei uns wurde seine großartige Entdeckung von einigen
bedeutenden Chirurgen skeptisch aufgenommen. Und doch wüteten
damals Pyämie (Eiterfieber), Septichämie (Blutvergiftung), Wundrose,
Hospitalbrand, Lymphgefäß- und Venenentzündung in entsetzlicher
Weise. In Nußbaums Krankenhaus verfielen diesen Infektionskrankheiten
alle komplizierten Brüche, fast alle Amputationen. 1872 kam dazu
der Hospitalbrand, der sich bis 1874 so vermehrte, daß 80% aller
Wunden und Geschwüre von ihm ergriffen, vielfach Knochen
abgestoßen, Gefäße angefressen wurden, und zwar in Fällen, die
vielleicht wegen eines entzündeten Fingers, einer Schrunde am Kopf oder
einer anderen Kleinigkeit ins Spital kamen. »Eine wirklich glatte
Heilung hat man vor dem Jahre 1875 auf dieser Klinik nie gesehen.«
Wie durch einen Zauber[S. 68] verschwand das alles durch Listers große, von
Nußbaum in ihrer Tragweite erkannte Erfindung.[57]
*
Der Pfarrer I. F. Esper (1742–1810) hatte in den Gailenreuther
Höhlen der Fränkischen Schweiz zwischen den Resten vorweltlicher
Tiere auch Menschenknochen entdeckt, und die Fundgeschichte 1774
veröffentlicht. In seinem Werke »Ausführliche Nachricht von
neuentdeckten Zoolithen«, das sich durch heute noch vollkommen
brauchbare Abbildungen der von ihm entdeckten diluvialen Höhlentiere
auszeichnet, hatte er ganz im Sinne der modernen Wissenschaft
argumentiert: Der Mensch, dessen Reste mit denen der diluvialen
Säugetiere im Höhlenschlamme begraben wurden, muß auch mit diesen
Tieren gelebt haben, er war sonach Zeuge der »großen Flut«.
Daß sein Fund falsch gedeutet wurde, war des großen Cuvier
(1769–1832) Schuld. Er erkannte zwar die wissenschaftliche Richtigkeit
des Esperschen Fundes an, aber für den diluvialen Menschen war in
seinem Weltsystem kein Raum. Seine bis vor wenigen Jahrzehnten in
der Wissenschaft herrschende Katastrophentheorie nahm gewaltige
Erdrevolutionen an, die die organischen Schöpfungen der vorausgehenden
geologischen Periode vollkommen vernichteten, so daß durch Neuschöpfung
sich nach jeder solchen Revolution die Erde neu bevölkern mußte. Da sei
es undenkbar, daß der Mensch, der Periode des Alluviums angehörig, die
Katastrophe, die vor 5–10000 Jahren das Diluvium mit Mammut, Elefant,
Nashorn etc. vernichtete, überdauert hätte.
[S. 69]
Cuviers Autorität wurde noch gestützt durch die der Bibel, deren
Sintflutsage er eine gewisse wissenschaftliche Stütze gewährte. Deshalb
wurde dieser Katastrophentheorie besonders in England, »wo theologische
Vorurteile von jeher die geologischen Anschauungen beeinflußten«,
gehuldigt. Sie erschwerte Darwin und Lyell den Sieg der
Evolutionstheorie, die uns heute beherrscht.
Ohne Cuvier würde man ohne Zweifel den Homo diluvii testis, den
Diluvialmenschen, weiter gesucht haben, wie Scheuchzer
(1672–1733) ihn ja bereits gefunden zu haben glaubte. Allerdings
erkannte Cuvier in der Versteinerung, die Scheuchzer in einem
vortrefflichen Kupfer publizierte und mit dem schönen Vers:
»Betrübtes Bein-Gerüst von einem alten Sünder,
Erweiche Stein und Hertz der neuen Boßheits-Kinder«
zierte, statt eines Kindes, einen 1 m langen Wassermolch.[58]
*
Im Jahre 1856 wurde im Devonkalk des Neandertales bei Düsseldorf
ein Skelett gefunden, das nach den geologischen Umständen des Ortes
zweifellos in außerordentlich hohe Vorzeit hinauf reicht. Heute
weiß man, zumal inzwischen in Spy, Krapina, Brünn, La Naulette und
anderwärts ähnliche Reste gefunden wurden, daß es sich hier um
Überbleibsel einer tiefstehenden fossilen Menschenrasse handelt. Das
hatte bereits Dr. Fuhlrott, dem die betreffenden Skelettteile
zuerst übermittelt wurden, festgestellt. Daß er[S. 70] damals mit seiner
Ansicht vom europäischen Urmenschen nicht durchdrang, lag an den
Autoritäten. Professor Mayer in Bonn meinte, die Gebeine
rührten von einem 1814 gestorbenen Kosaken her, Professor Rudolf
Wagner in Göttingen erkannte in ihnen einen alten Holländer wieder,
Dr. Pruner-Bey in Paris aber einen Kelten. Maßgebend blieb
die Ansicht Virchows, der größten damaligen Autorität, der
die Reste mit einem gichtbrüchigen Greis identifizierte. Ihm war
es zuzuschreiben, daß lange Zeit die Anthropologen von der richtigen
Deutung abgehalten wurden.[59]
*
Abraham Gottlob Werner (1750–1817), hervorragender Mineraloge
und Vater der Geognosie, stellte die »neptunische Lehre« auf, d. h. die
Hypothese, daß der Ozean der Quell aller Bildungen der Erde sei und
jede neue Gestaltung im Mineralreich sich aus dem Wasser bilde. Sein
Schüler Voigt bestritt das, besonders mit Rücksicht auf den Basalt,
erlitt aber durch Werners Autorität eine Niederlage. Erst nach
seinem Tode konnte Buchs und Humboldts Vulkantheorie
Boden fassen.[60]
*
Über den großen 1751 bei Agram gefallenen Meteorstein schrieb der
gelehrte Wiener Professor Stütz 1790: »daß das Eisen vom Himmel
gefallen sein soll, mögen wohl 1751 selbst Deutschlands aufgeklärte
Köpfe bei der damals unter uns herrschenden[S. 71] Ungewißheit in der
Naturgeschichte und Physik geglaubt haben, aber in unseren Zeiten
wäre es unverzeihlich, solche Märchen auch nur wahrscheinlich zu
finden.«
An mehreren Museen wurden solche Meteorsteine sogar weggeworfen,
»um sich nicht durch das Behalten derselben lächerlich zu
machen«.
Im gleichen Jahre 1790 fiel ein Stein bei Juillac in Frankreich nieder,
und der Maire dieser Stadt sandte einen mit der Unterschrift von 300
Zeugen versehenen Bericht an die Akademie der Wissenschaften.
Aber die Herren Akademiker waren ihrer Sache zu sicher.
Der Referent Bertholon sagte, man müsse eine Gemeinde
bemitleiden, welche einen so törichten Maire habe, daß er solche
Märchen glaube. Und er fügte hinzu: »Wie traurig ist es nicht,
eine ganze Munizipalität durch ein Protokoll in aller Form Volkssagen
bescheinigen zu sehen, die nur zu bemitleiden sind. Was soll
ich einem solchen Protokoll weiter beifügen? Alle Bemerkungen ergeben
sich einem philosophisch gebildeten Leser von selbst, wenn er dieses
authentische Zeugnis eines offenbar falschen Faktums, eines physisch
unmöglichen Phänomens liest.«
Alle, die den herrschenden Ansichten dieser Gelehrten nicht beistimmen
wollten, wurden verlacht.
Der sonst sehr ruhig denkende Gelehrte A. Deluc sagte sogar:
Wenn ihm ein solcher Stein vor die Füße fallen würde, müßte er zwar
sagen, er habe es gesehen, könne es aber doch nicht glauben.
Auch Vaudin sagte, man müsse so unglaubliche[S. 72] Dinge lieber
wegleugnen, als sich auf Erklärungen derselben einlassen.
Das war die Ansicht der französischen Akademie, die damals unter
dem Vorsitz des berühmten Laplace in der Wissenschaft unbedingt
dominierte.[61]
*
Als Piazzi im Jahre 1801 die Entdeckung des ersten Planetoiden
Ceres machte, wies sie Hegel (De orbitis planetarum, Jena 1801)
aus philosophischen Gründen zurück.[62]
*
Bekanntlich ist heute noch nicht der Kampf zwischen Lamarckismus und
Darwinismus völlig entschieden und wird es wohl auch nur im Sinne
einer Verschmelzung beider Lehren werden können. Da ist es nicht nur
erstaunlich, daß Lamarcks »Philosophie zoologique«, wiewohl sie in
einem naturphilosophischen Zeitalter erschien, fast unbeachtet blieb,
mehr noch ist es des großen Darwin Urteil über dieses hervorragende
Werk. Er nennt die Philosophie zoologique ein wertloses Buch,
aus dem er nicht eine Tatsache und nicht eine Idee
entnommen habe. Mit diesem widersinnigen Buche habe Lamarck der
Abstammungslehre mehr geschadet als genützt.[63]
*
Herbert Spencer (1821–1903), der größte englische Philosoph des
ausgehenden 19. Jahrhunderts, wurde in solchem Maße als Autodidakt
behandelt,[S. 73] daß sein bedeutendes Buch »Social Statics«, das im
ganzen nur in erster Auflage in 157 Exemplaren erschien, erst in
14 Jahren abgesetzt wurde. Als nach 24jähriger Tätigkeit sein
Erfolg gesichert war, lehnte er die dem unstudierten Manne von den
Universitäten von St. Andrews, Bologna, Cambridge, Edinburgh und
Budapest zugedachte Würde eines Ehrendoktors ab, wie er auch den Antrag
der Akademien von Rom, Turin, Neapel, Paris, Philadelphia, Kopenhagen,
Brüssel, Wien und Mailand, ihn zum korrespondierenden Mitglied zu
ernennen, zurückwies.[64]
*
Wie Robert Mayers erste Arbeiten überall totgeschwiegen wurden,
und zwar so gründlich, daß weder in akademischen Zeitschriften darüber
referiert noch in anderen Werken von ihnen Notiz genommen wurde,
so erging es auch ähnlich Helmholtz’ Abhandlung »Über die
Erhaltung der Kraft«. Er sagt selbst darüber: »Die Aufnahme meiner
Arbeit in Poggendorffs Annalen wurde mir verweigert, und unter den
Mitgliedern der Berliner Akademie war es nur C. G. Jacobi, der
Mathematiker, der sich meiner annahm. Ruhm und äußere Förderung war in
jenen Zeiten mit der neuen Überzeugung noch nicht zu gewinnen, eher das
Gegenteil!«[65]
*
Auch die prophetischen Worte E. H. Webers, die er im Jahre 1835
über die zukünftigen Funktionen des elektromagnetischen Telegraphen
sprach, blieben vom Spott nicht verschont.[66]
[S. 74]
Übrigens hat der gleiche große Physiologe Ernst Heinrich Weber zu
wiederholten Malen Zöllner gegenüber geäußert, daß von allen
wissenschaftlichen Theorien Virchows auch nicht eine einzige das
Ende seines irdischen Daseins überdauern würde.
*
Als William Jones und Henry Thomas Colebrooke (1765–1857)
das Sanskrit erstmalig gründlich studiert, teilweise übersetzt
und gefunden hatten, daß es eine reiche Literatur und nicht geringe
Verwandtschaft mit den klassischen Sprachen aufwies, stießen sie
auf nicht geringen Widerstand. Da sich mit dieser innigen Beziehung
des Sanskrits zu den geographisch so weit entlegenen europäischen
Sprachen die alten Anschauungen, welche entweder alle Sprachen aus
dem Hebräischen ableiteten oder größtenteils von einander isolierten,
nicht in Einklang bringen lassen, so ergriff der berühmte Philologe
Dugald Steward (1753–1828) den einfachsten Ausweg, indem er die
ganze Geschichte mit der Sanskritsprache für eine Lüge erklärte.
Er schrieb einen Essay, in dem er zu beweisen suchte, daß sie von
den spitzbübischen Brahmanen nach dem Muster des Griechischen und
Lateinischen zusammengeschmiedet sei und die Sprache sowohl als auch
die Literatur eine Fälschung seien. Diese Ansicht entwickelte noch
im Jahre 1840 der Professor in Dublin, Charles William Wall,
weitläufig (Göttingische gelehrte Anzeigen 1842 S. 1888).[67]
[S. 75]
*
Endlich wollen wir die Niederlage nicht vergessen, die sich
Autoritäten und Fachleute noch in allerletzter Zeit in der Frage der
Wünschelrute holten. Bekanntlich versteht man darunter eine
Rute oder auch einen Draht, der in der Hand gewisser besonders dazu
disponierter Leute durch heftiges Ausschlagen das Vorhandensein von
unterirdischen Wasserläufen anzeigt. Auch Erzlager sollen auf diese
Weise auffindbar sein. Das Gerücht von der wunderbaren Kraft der
Wünschelrute, die zumeist aus Hasel oder Weide gemacht wird, geht seit
Urzeiten im Volke. Statt nun nachzuprüfen und dabei zu finden, daß
die Beobachtungsgabe des Volkes, wie sich schon oft zeigte, der der
Gelehrten kaum nachsteht, wenn auch die kritische Sichtung mangelhaft
ist, wurde das Phänomen von den Gelehrten rundweg als Humbug
abgelehnt.
Das geschah auch, nachdem Landrat von Uslar unbestreitbare
Erfolge in Südwestafrika aufzuweisen hatte. Im »Prometheus« wurde
in den neunziger Jahren ein heftiger Kampf über die Möglichkeit
des Phänomens bzw. dessen Wirklichkeit zwischen Theoretikern, die
negierten, und Praktikern, die auf die unleugbaren Erfolge hinwiesen,
geführt. Besonders ein Ingenieur H. Ehlert konnte sich in
gehässigen Angriffen nicht genug tun.
Da griff in den Jahren 1908 und 1909 der Münchner Arzt Dr.
Aigner, also natürlich wieder ein Laie, die Frage auf und
es gelang ihm durch eine große Zahl praktischer Beweise, die er in
Gegenwart von Vertretern des Magistrates erbrachte, festzustellen, daß
die Wünschelrute tatsächlich in den Händen[S. 76] von gewissen Leuten die ihr
zugeschriebene Wirkung ausübt.
Über die Erklärung des Phänomens mögen sich die Fachleute in die Haare
geraten. Das Wichtigste ist die Konstatierung der Tatsächlichkeit.
Der dem Mittelalter gemachte Vorwurf, statt die eigenen Augen zu
gebrauchen, nach »Beweisen« bei Aristoteles, Galen und anderen
Autoritäten zu fahnden, kann auch der gelehrten Zunft von heute nicht
erspart werden. Auch sie lehnt schlankweg alles ab, was nicht in ihre
Theorien und Hypothesen paßt, statt die Phänomene zu prüfen und von
der festen Basis des Experimentes aus die Richtigkeit der Theorien zu
untersuchen.[68]
*
Nicht nur auf dem weiten Felde der Wissenschaft, nicht minder im Reiche
der Kunst deckt sich eine Geschichte der Kritik mit einer solchen der
Blamage der Autoritäten und Sachverständigen. Es sei zugegeben, daß
gerade in der Musik sehr viel auf den Geschmack ankommt, da es einen
objektiven Maßstab entsprechend der wissenschaftlichen Wahrheit nicht
gibt. Immerhin ist es amüsant und lehrreich zu sehen, wie auf allen
Gebieten der Fortschritt sich nur im harten Kampfe mit dem Bestehenden
durchsetzen konnte.
*
Im »Musikalischen Wochenblatt« sprach ein zeitgenössischer Leser seine
»freimütigen Gedanken« über Mozart aus und zwar nach
dessen Don Giovanni:
»Niemand wird in Mozart den Mann von Talenten und den erfahrenen,
reichhaltigen und angenehmen[S. 77] Komponisten verkennen. Noch habe
ich ihn aber von keinem gründlichen Kenner der Kunst für einen
korrekten, viel weniger vollendeten Künstler halten
sehen, noch weniger wird ihn der geschmackvolle Kritiker für einen
in Beziehung auf Poesie richtigen und feinen Komponisten
halten.«[69]
Übrigens beschuldigte man Mozart auch des Plagiats in der
Ouvertüre zu Don Giovanni.[70]
Mozart war, wie Brendel in seiner Geschichte der Musik schreibt, den
Zeitgenossen ein Buch mit sieben Siegeln. »Man traut seinen Augen
nicht, wenn man die damaligen Zeitungen nachliest und kaum hie und da
eine dürftige Notiz über ihn findet. Erst die Zauberflöte machte ihn
populär.«
Doch selbst das trifft nicht ganz zu. In Schauls Briefen über Geschmack
wird gefragt, ob sich der Anfang des zweiten Finales, dem er eine
schöne Melodie zugesteht, mit der gesunden Vernunft vertrüge,
da drei kleine Knaben in so schweren Halbtönen singen müßten, daß es
einem geübten Sänger schwer werde, sie rein zu treffen. Man warf ihm
auch vor, für die Instrumente Unmögliches zu schreiben. Einer der drei
Posaunisten in der Friedhofsszene erklärte: »Das kann man so nicht
blasen und von Ihnen werde ich es auch nicht lernen!«
Beethoven erging es von seiten der Kritik nicht besser. Er hatte
das gemein mit allen genialen Menschen, die neue Wege einschlugen. Die
Allgemeine Musikalische Zeitung in Leipzig, damals das einzige deutsche
kritische Organ von allgemein anerkannter Autorität, schreibt in einer
Besprechung der drei Violinsonaten op. 12: »Herr van Beethoven geht[S. 78]
einen eigenen Gang; aber was ist das für ein bizarrer, mühseliger
Gang! Gelehrt, gelehrt und immerfort gelehrt und keine Natur, kein
Gesang!«[71]
*
Im gleichen Organ erschien 1805 über die Eroika folgende
verständnisvolle Kritik: »Diese lange, äußerst schwierige Komposition
ist eigentlich eine sehr weit ausgeführte kühne und wilde
Phantasie. Es fehlt ihr gar nicht an frappanten und schönen
Stellen, in denen man den energischen, talentvollen Geist ihres
Schöpfers erkennen muß: sehr oft scheint sie sich ins Regellose
zu verlieren.«
C. M. von Weber, der Komponist des »Freischütz«, schrieb
23jährig über Beethoven folgendes erstaunliche Urteil: »Die feurige,
ja beinahe unglaubliche Erfindungsgabe, die ihn beseelt, ist von
einer solchen Verwirrung in Anordnung seiner Ideen begleitet,
daß nur seine früheren Kompositionen mich ansprechen, die letzteren
hingegen mir nur ein verworrenes Chaos, ein unverständliches
Ringen nach Neuem sind, aus denen einzelne himmlische Genieblitze
hervorleuchten, die zeigen, wie groß er sein könnte, wenn er seine
üppige Phantasie zügeln wollte.«
Die Kreutzersonate (op. 47) wurde zu Beethovens Zeit als
unaufführbar erklärt. (Nach Schindler.)
*
Als Franz Schubert der Gesellschaft der Musikfreunde in Wien
seine große C-dur-Symphonie aus Dankbarkeit für eine ihm dargebrachte
Huldigung übergab, wurde sie von den Künstlern der Gesellschaft als
unaufführbar abgelehnt.[72]
[S. 79]
Tieck nennt den »Freischütz« das »unmusikalischste
Getöse, das je über die Bühne getobt ist«. Ludwig Spohr
urteilte über die Oper auch ungünstig.
Über die Euryanthe schreibt die »Zeitung für Literatur, Kunst, Theater
und Mode«, nachdem sie dem Komponisten Bizarrerie und Mangel an Einheit
und Klarheit vorgeworfen hat. »Mangel an Melodie zeige sich da
gerade am meisten, wo sie am ehesten zu erwarten gewesen wäre....«
Franz Schubert sagt vom gleichen Werk, daß es »keine Musik, keine
legitime Form und Durchführung enthalte, sondern lediglich auf
Effekt berechnet sei und weit hinter dem Freischütz zurückstehe.« (Nach
La Mara.)
Dem melodienreichen Oberon ging es nicht besser.
*
Daß Wagners Tristan für unaufführbar gehalten wurde, ist
allgemein bekannt. Merkwürdig ist, daß Mozarts Biograph Otto
Jahn in seinen Gesammelten Aufsätzen über Musik nicht nur
Tannhäuser ablehnt, sondern Wagner schöpferisches Genie
abspricht!!
Der bekannte Tadel gegen Wagner, er übertöne mit seinen Instrumenten
die Sänger, findet sich auch schon Mozart gegenüber. Kaiser Josef II.
äußerte es gegen Dr. Hersdorf.
*
Endlich noch einige Urteile über Goethe.
Im Oktoberheft des Jahres 1832, ein halbes Jahr nach seinem Tode,
schreibt im »Sachsenfreund«, einer damals viel gelesenen Monatsschrift,
ein Anonymus aus Weimar:
[S. 80]
»Unser Goethe ist vergessen, wie zu erwarten war, zu erwarten
nicht der Unempfänglichkeit halber, welche die Weimaraner für achtbare
Erscheinungen hätten, sondern seiner eigenen Individualität wegen. Der
Mensch fühlt sich nur vom Menschlichen angezogen, solange er es hat,
und sieht ihm trauernd nach, wenn’s ihm entrissen wird. Menschliches
aber hatte Goethe nicht, wie alle wissen, die ihn näher kannten,
und nicht, wie eine Handvoll hiesiger Goethemanen, mit Blindheit
über ihn geschlagen sind. Er fühlte und litt mit keinem menschlichen
Wesen außer ihm, und die großen Interessen der Menschheit waren
ihm völlig fremd, insofern nicht etwa im Gefolge derselben die
aristokratischen Gesellschaftsverhältnisse bedroht waren, an denen sein
Herz hing. Er war eine in sich abgeschlossene Marmorstatue, in welcher
nur das große Talent wohnte, die Welterscheinungen, die sich an und in
ihr abspiegelten, mit der objektivischen Anschaulichkeit und Vollendung
wiederzugeben. Einen Eindruck brachten sie aber nicht auf ihn hervor.
Denn dazu gehört das Medium des Gemütes, und das hatte Goethe
nicht. Darum kamen seine Ansichten und Maximen, wenn sie ihm einmal
über die weniger bewachte Lippe fuhren, dem gemütvollen Menschen fast
schauerlich vor, und man hatte Mühe, sich von der ihm innewohnenden
Selbstsucht und Härte einen angemessenen Begriff zu machen. Nie tat er
einem wohl, der ihm nicht persönlich dienstfertig dafür wurde, und für
Wohltaten wußte er seinen größten Gönnern nicht Dank. Das Testament,
das er hinterließ, zeugt für jenes, und der Mann, der fast ohne
alle unmittelbar[S. 81] geleisteten Dienste Weimar in mehr als 50 Jahren
Hunderttausende kostete, vermachte den Armen oder irgendeinem milden
Institut bei seinem Tode – nicht einen Heller. Seine Werke, nun ja,
sie werden ihn überleben, nämlich die sechs bis acht Bände, in die eine
kritische Hand einmal die Weizenkörner sammelt, welche in vierzig und
mehr Bänden voll Spreu enthalten sind. Diese Spreu wird aber vergessen
werden. Die Nemesis wird auch hier ihr Amt verwalten, wie sie es in
Hinsicht seiner häuslichen Verhältnisse tat.«[73]
Des Witzes halber seien diesem klassischen Urteile eines Anonymus noch
einige neuere von katholischen Autoritäten angereiht.
Baumgarten S. J. schreibt in »Goethes Lehr- und Wanderjahre« (Freiburg
1882, S. 99) über die Sturm- und Drangperiode:
»Da sitzen nun die Götterjünglinge, Goethe, Lenz, Klinger, Kaufmann,
gelegentlich auch Herder und Wieland; von ferne hört man ein
Waldhorn, und der Mond hat nichts zu tun, als das phantasiebedürftige
Conciliabulum anzuscheinen. Sehen Sie, meine Herren! Hier haben wir
die Anfänge unserer unsterblichen deutschen Nationalliteratur, welche
alle bisherigen Literaturen und Kulturen eminent in sich begreift, wie
der erwachsene Mann alle früheren Stadien des Lebens. Da die Poesie
der beiden Sturm- und Drangpoeten Lenz und Klinger sich hauptsächlich
in der Analyse der gemeinsten und wütendsten Leidenschaften, toller
Liebe, Eifersucht, Unzucht, Kindsmord und anderer schauerlicher Greuel
bewegte, und da sie in Sprache und Ausdruck keine Grenzen kannte, so
läßt sich denken, was sie in halben und[S. 82] ganzen Nächten in Goethes
Gartenhaus verhandelt haben mögen. Gevatter Wieland hatte an solchen
Kapiteln auch seinen Spaß.«
Über »Hermann und Dorothea« urteilt Norrenberg in seiner Allgemeinen
Geschichte der Literatur (Münster 1884, III. Bd., S. 181):
»Nirgendwo offenbart sich Goethes Gesinnung abstoßender als in ›Hermann
und Dorothea‹. Das glaubens- und inhaltsleere, trotz aller Noblesse
spießbürgerliche Gesellschaftsleben des ausgehenden achtzehnten
Jahrhunderts ist nie mit einer so abschreckend photographischen
Treue geschildert worden, als in diesem Epos. Man muß den blasierten
Quietismus des Weimarer Lebens kennen, das versumpft in dem deistischen
Humanismus, auch in der so nahen Perspektive der tragischen Ereignisse
der französischen Revolution nicht im mindesten religiösen oder
patriotischen Aufschwungs fähig war, um diese Dichtung zu verstehen.
Ich kann mir keine entnervendere Lektüre für die Jugend denken, als
›Hermann und Dorothea‹.«
Der verstorbene Bischof Paul Haffner (Frankfurter zeitgemäße Broschüren
II, 9 [1880]) stellt fest:
»Es ist bezeichnend für unsere heutige Bildung, daß von Goethes
Schriften diejenigen am meisten gelesen werden, welche an obszönen
Stellen am reichsten sind.«[74]
*
Heinrich Heine hatte im Jahre 1910, außer dem in den Herzen
des Volkes errichteten, noch kein Denkmal in Deutschland. Oder wollen
wir das lite[S. 83]rarische, das der Heinetöter Adolf Bartels Heine und
sich errichtet, dafür gelten lassen?[75] Das einzige ihm von der
Kaiserin Elisabeth in Korfu geweihte wurde entfernt, nachdem das
Achilleion in den Besitz Kaiser Wilhelms II. übergegangen war.
[S. 84]
Vierter Abschnitt
Die „Dilettanten“ und Outsider
Die immer fortschreitende Spezialisierung der Wissenschaften, deren
Umfang in gleicher Proportion zunimmt, wie der Gesichtskreis ihrer
Vertreter sich verengert, hat nicht nur zu einer kaum je dagewesenen
Unterschätzung des gesunden Menschenverstandes, ja des Genialen
geführt, sie geht auch mit einer übermäßigen Hochschätzung der
technischen, handwerksmäßigen Routine einher. Nur was der Spezialist
leistet, vermag sich heute durchzusetzen. Unter diesen Umständen
scheint es nicht zwecklos, den Beweis zu erbringen, daß auf allen
Gebieten nicht dem Fachmann, sondern dem »Dilettanten«, dem Outsider
die größten Entdeckungen und Erfindungen zu danken sind. Daß eine Reihe
der Größten Autodidakten waren, ist nicht ohne Interesse.
Während sich um den Fachmann, der immer mehr zum Handwerker wird, die
hohen Mauern seiner Spezialdisziplin im immer enger werdenden Kreise
schließen, ist es das verächtlich »Dilettant« genannte Genie oder doch
Talent mit weitem Horizont, das allein die Flugkraft besitzt, sie zu
überwinden. Gleicht letzteres dem Entdecker neuer Länder, so ist es der
[S. 85]
Zünftler, der dort Käfern und Läusen nachjagt, um sie in dicken
Folianten zu edieren.
Diesem schon wiederholt von mir ausgesprochenen Gedanken mögen die
Beweise nun folgen.
*
Otto von Guericke (1602–1686), der größte deutsche Physiker des
17. Jahrhunderts, war von Beruf Jurist, wenn er sich auch kurze Zeit
in Leyden neben neueren Sprachen mit Physik, angewandter Mathematik,
Mechanik und Fortifikationslehre beschäftigt hatte. Im Jahre 1626 trat
er in das Ratskollegium seiner Vaterstadt Magdeburg ein, wurde dann
Schutz- oder Kriegsherr der Stadt, in welcher Stellung er während der
Belagerung durch Tilly (1631) vollauf seine Pflicht tat, wurde später
Generalquartiermeister und Ingenieur Gustav Adolfs, beteiligte sich am
Wiederaufbau der Stadt Magdeburg, wo er eine Schiffbrücke über die Elbe
legte und trieb daneben Ackerwirtschaft und Bierbrauerei. Im Jahre 1646
wurde er zum Bürgermeister erwählt und vorzugsweise zu diplomatischen
Geschäften verwandt. So nahm er auch an den Friedensverhandlungen in
Osnabrück teil. Erst seit 1660 konnte er nach vielen Missionen in Ruhe
zu Hause leben. Seine physikalischen Versuche konnte er also nur
neben seinem Berufe ausführen!
Guericke kam zu seiner Erfindung der Luftpumpe im Bestreben,
den alten philosophischen Streit über die Existenz eines leeren Raumes
zu entscheiden, und zwar als erster auf experimentellem Wege. Er wies
durch seine Versuche sowohl die bedeutende Größe des Luftdrucks,
wie die [S. 86]Elastizität der Luft nach, und zwar erbrachte er den
öffentlichen Beweis 1654 auf dem Magdeburger Reichstage, also mitten
in seiner anderweitigen Berufstätigkeit. Vielleicht machte er alle
seine Entdeckungen bereits in den Jahren 1632–1638, jedenfalls sind
alle vor 1663 abgeschlossen. Dieser Dilettant erfand ferner 1657 oder
58 ein Wasserbarometer, 1661 das Manometer, bestimmte
die Schwere der Luft, bewies, daß zum Brennen Luft gehöre
und die Flamme die Luft verzehre, konstruierte eine primitive
Elektrisiermaschine, die hinreichte, um die Tatsache des
elektrischen Abstoßens und Leuchtens zu finden und vervollständigte
die magnetischen Kenntnisse seiner Zeit. Ferner stellte er zuerst
im Mittelalter die Meinung auf, daß die Wiederkehr der Kometen sich
bestimmen lassen müsse.[76]
Wie Herr Professor A. Gudemann mir mitzuteilen die Liebenswürdigkeit
hatte, war auf letzteren Gedanken bereits Seneca (nat. Quaest. 7, 25,
7) gekommen. »Es wird einmal jemand kommen, der beweist, in welchen
Teilen die Kometen umlaufen, warum sie so getrennt von den anderen
umlaufen, wie viele und in welcher Beschaffenheit sie sind.«
*
Simon Stevin (1548–1620) war ursprünglich Kaufmann, dann
Steueraufseher in seiner Vaterstadt Brügge, endlich Oberaufseher der
Land- und Wasserwerke in Holland, dann Generalquartiermeister. Er
erwarb sich große Verdienste um das Artillerie- und Befestigungswesen,
erfand den Segelwagen und den Segelschlitten, stellte
1586 die erste richtige Theorie[S. 87] über die schiefe Ebene auf,
deutete den Satz vom Parallelogramm der Kräfte an, erklärte
das Gleichgewicht in kommunizierenden Röhren, führte die
Dezimalbruchrechnung 1596 ein und sprach schon aus, daß dadurch
die Dezimalteilung von Maßen, Gewichten und Münzen nötig würde. Endlich
erwarb er sich als Geograph und durch die unter dem Namen Hylokinese
veröffentlichten Prinzipien der tellurischen Morphologie Verdienste.[77]
*
J. Baptista Benedetti (1530–1590) hatte nie eine Schule besucht
und nur unter Tartaglia die vier ersten Bücher des Euklid gelesen,
wonach er sich dann allein weiterbildete. Trotzdem ließ er schon mit
23 Jahren das bedeutende Werk »resolutio omnium Euclidis problematum«
erscheinen, in welchem er alle Probleme des großen Griechen mit
einer Zirkelöffnung lösen lehrte. In einem späteren Werke
bewies er Kenntnis der Beharrung eines Körpers auch in der Bewegung,
behauptete, daß alle Körper ohne Rücksicht auf ihr Gewicht von gleicher
Höhe in gleicher Zeit zur Erde fallen und daß im Kreise geschwungene
Körper, sich selbst überlassen, in der Tangente des Kreises fortgehen.
Endlich löste er die Aufgabe vom schiefen Hebel.[78]
*
Giambattista della Porta (1538–1615), ein reicher
neapolitanischer Edelmann, betrieb die Physik als Liebhaberei. Trotzdem
haben wir in ihm den Erfinder der camera obskura und einer Art
laterna magica zu erblicken. Er erkannte auch zuerst, daß[S. 88] man
in einem Hohlspiegel die Brennpunkte aller Strahlen, die in der Nähe
der Achse einfallen, ohne merklichen Fehler in den Mittelpunkt des
Halbkreises setzen könne. Porta wurde später von der Inquisition der
Zauberei und übernatürlicher Kräfte angeklagt.[79]
*
Der Begründer der Pflanzenphysiologie war Stephan Hales
(1677–1761), ein sehr tüchtiger Theologe und Pfarrer in
verschiedenen Grafschaften. Noch einmal zeigte sich in ihm der
originelle Erfindergeist und die gesunde, urwüchsige Logik der großen
Naturforscher aus Newtons Zeitalter. Sein »Statical essays« (1727)
war das erste umfangreiche, ganz der Ernährung und Selbstbewegung der
Pflanzen gewidmete Werk. Es berücksichtigte zwar die ältere Literatur,
teilte aber doch im wesentlichen neue Untersuchungen des Verfassers
mit. Eine Fülle neuer Experimente und Beobachtungen, Messungen und
Berechnungen vereinigen sich hier zu einem lebensvollen Bild.[80]
*
Halley (1656–1742), übrigens der Sohn eines Seifensieders, hatte
bekanntlich die Wiederkehr des nach ihm benannten Kometen,
der auch in diesem Jahre erschien, im Jahre 1703 berechnet und auf
den Anfang des Jahres 1759 vorherbestimmt. Alle Astronomen Europas
suchten daher, als das Jahr 1758 seinem Ende sich näherte, den Himmel
mit Fernrohren ab, jedoch vergeblich. Anders der Bauer[S. 89] Johann
Palitzsch (1723–1788). Schon als Hüterjunge hatte er sich für
die Sternenwelt interessiert, dann sich durch Selbststudium ansehnliche
astronomische Kenntnisse erworben. Als nun der Siebenjährige Krieg
sein Vaterland Sachsen heimsuchte, versteckte er seine primitiven
astronomischen Instrumente, aus Furcht, sie könnten ihm gestohlen
werden. Um die Weihnachtszeit 1758 trat in der Kriegsführung eine Pause
ein. Diese benutzte er dazu, um sein Fernrohr auszugraben und die
Stelle des Himmels abzusuchen, wo er den Komet erwartete. Tatsächlich
entdeckte er ihn als erster als nebeligen Stern im Sternbild der
Fische. Damit hatte der Bauernastronom einen Vorsprung vor der
ganzen Welt gewonnen und sein Name wurde überall genannt. In
Paris sah man ihn erst vier Wochen später. Palitzsch blieb hinfort
mit der Londoner Akademie in ständiger Korrespondenz. Übrigens war er
nichts weniger als einseitig, besaß vielmehr bedeutende botanische und
physikalische Kenntnisse, die ihn dazu befähigten, im Großen Garten zu
Dresden einen Süßwasserpolypen zu entdecken. Er errichtete auch als
erster in Sachsen 1775 einen Blitzableiter und zwar auf dem
Schloßturm in Dresden. Er blieb bis zu seinem Tode, durch zahlreiche
Ehrungen ausgezeichnet, ein schlichter Landmann.[81]
*
Thomas Young (1773–1829) studierte Medizin und betrieb nur
nebenbei mathematische, physikalische, botanische und philologische
Studien. Von 1801 bis 1804 war er Professor an der Royal Institution,
von[S. 90] 1811 bis zu seinem Tode war er Arzt am St. Georges-Hospital in
London. Seine wissenschaftlichen, überall wertvollen Arbeiten
betreffen Mechanik, Optik, Wärmetheorie,
Akustik, theoretische Chemie, die Bewegung des
Blutes, den Schiffbau, die mittlere Lebensdauer
des Menschen, die Dichte der Erde, das wahrscheinlich
richtigste Resultat aus mehreren Beobachtungen, die Ursache
der Schwere, Ebbe und Flut, die Figur der
Erde, die Mondatmosphäre. Er leistete auch wichtige
Dienste für die Entzifferung der Hieroglyphen. Außerdem war
er schriftstellerisch tätig, ein gründlicher Kenner der Musik,
ausgezeichneter Maler und geübter Reiter, der gegen Kunstreiter
Wetten gewann. Er war ein Vorkämpfer gegen die Emissionstheorie,
von der er sich bereits 1801 in einer der Royal Society vorgelegten
Abhandlung zugunsten der Undulationstheorie lossagte. Schon in seiner
1800 erschienenen akustischen Abhandlung hatte er eine epochemachende
Entdeckung gemacht, die ihn zum Reformator der Theorie der Optik werden
ließ: die Interferenz von Wellenbewegungen.[82]
*
Humphrey Potter war, wie berichtet wird, an der Konstruktion der
ersten praktisch tätigen Dampfmaschine, die 1711 zu Wolverhamton
für einen Herrn Back zum Heben von Wasser aufgestellt wurde, beteiligt.
Und zwar sei er als Knabe mit dem Auf- und Zudrehen der Hähne,
welche den Dampf oder das kalte Wasser vom Dampfzylinder abschlossen,
beauftragt gewesen. Weil ihm diese Manipulationen[S. 91] zu langweilig
wurden, habe er die Hähne durch Bindfäden so mit dem Balancierer der
Maschine verbunden, daß dieser statt seiner das Umstellen derselben
zur richtigen Zeit besorgte. Daß diese geniale Erfindung der
Vervollkommnung der Dampfmaschine vorausgehen mußte, ist hinlänglich
bekannt.[83]
*
Der geniale Erfinder Denys Papin (1647–1710, vgl.
S. 54) war
studierter Mediziner.
*
Maupertuis (1698–1759) war ursprünglich Soldat und zwar von
1718–1723. Er entdeckte das Prinzip der kleinsten Wirkung, nach dem
alle mechanischen Probleme analytisch zu lösen waren.[84]
*
Benjamin Franklin (1706–1790) war der Sohn eines unbemittelten
Seifensieders, besuchte, da er früh seinem Vater im Geschäft helfen
mußte, eine mittelmäßige Schule mit nur geringem Erfolg und erwarb
sich später seine Kenntnisse ohne Lehrer. Ohne jegliche Gymnasial-
oder gar Universitätsbildung, allein durch Selbststudium, brachte
er es nicht nur zu einem hervorragenden Staatsmann, sondern auch zu
einem epochemachenden Gelehrten. Seine Erfindung des Blitzableiters und
andere große Taten sind zu bekannt, um hier näher dargelegt zu werden.
Sicher ist, daß die Welt es nur dem Fehlen der ge[S. 92]lehrten Zunft und des
Befähigungsnachweises in Amerika zu danken hat, wenn dieser seltene
Mann seinen Fähigkeiten gemäß Großes leisten durfte.[85]
*
Doch wie so oft zwei Personen gleichzeitig ein Problem lösen, so auch
beim Blitzableiter. Gleichzeitig und unabhängig von Franklin wurde er
auch in Europa erfunden, und zwar von Prokop Divisch zu Prenditz
bei Znaim im Jahre 1750. Der Erfinder war wieder kein Fachmann, sondern
ein Pfarrer.[86]
*
Luigi Galvani (1737–1798) war Professor der Medizin und
beschäftigte sich besonders mit vergleichender Anatomie und
Physiologie. Ist die Tatsache, daß hier wieder kein Fachmann, sondern
ein Outsider eine der großartigsten Entdeckungen machte, schon
bemerkenswert genug, so sind es die Nebenumstände nicht minder. Wie
er in seiner 1791 erschienenen Schrift »De viribus electricitatis
in motu musculari commentarius« erzählt, trug sich die Geschichte
seiner Entdeckung folgendermaßen zu: »Ich zerschnitt einen Frosch...,
legte ihn, ohne etwas zu vermuten, auf die Tafel, worauf die
Elektrisiermaschine stand, die gänzlich vom Konduktor getrennt und
ziemlich weit davon entfernt war. Als aber einer meiner Zuhörer die
Spitze des Messers von ungefähr ein wenig an die inneren Schenkelnerven
brachte, wurden die Muskeln aller Glieder sogleich zusammengezogen, als
ob sie von heftigen Konvulsionen ergriffen würden. Ein anderer von
den Anwesenden glaubte zu bemerken, es geschähe nur zur Zeit, wenn
der[S. 93] Konduktor einen Funken gäbe. Er bewunderte die Neuheit der Sache
und machte mich, der ich eben etwas ganz anderes vorhatte, aufmerksam
darauf.«
Wer der »andere von den Anwesenden« war, ist niemals mit Sicherheit
festgestellt worden. In Bologna ging das Gerücht, es sei die eigene
Gattin Galvanis gewesen. Danach gebührte ihr ein nicht geringes
Verdienst an dieser unsterblichen Entdeckung.[87]
Wie Wilhelm Ostwald in seiner »Entwicklung der Elektrochemie« erzählt,
verdankte Galvani gerade der Lückenhaftigkeit seiner Kenntnisse
diese Entdeckung, da die damaligen Theorien, wenn er sie gekannt hätte,
eine Erklärung des Phänomens geboten hätten.
*
Etienne Louis Malus (1775–1812) war auf der polytechnischen
Schule gebildet, wurde 1796 Kapitän im Geniekorps, erkrankte als
Teilnehmer an der ägyptischen Expedition an der Pest, wurde,
nach Frankreich zurückgekehrt, von 1806–1808 Unterdirektor der
Fortifikationen in Straßburg und im folgenden Jahre Examinator an
der polytechnischen Schule in Paris. Dieser Offizier entdeckte die
Polarisation des Lichtes, was er schon 1808 dem Institute von
Frankreich mitteilte. Er gab auch alle Methoden an, die zu einer
richtigen Beschreibung und Messung der Polarisationserscheinungen
dienlich sind.[88]
*
Augustin Jean Fresnel (1788–1827), der in höchst genialer
Weise die Anwendung der Undulationstheorie auf die Polarisation und
Doppelbrechung[S. 94] des Lichtes bewerkstelligte, war Ingenieur, also
ebenfalls kein Fachmann.[89]
*
Johann Fraunhofer (1787–1826) war der Sohn eines armen Glasers,
in dessen Geschäft er so viel helfen mußte, daß er bis zum 14. Jahre
des Lesens und Schreibens unkundig blieb. Nachdem er schon vorher
bei einem Spiegelmacher und Glasschleifer in der Lehre gewesen war,
kam er 1806 in das mechanisch-optische Institut von Utzschneider in
Benediktbeuern, in das er 1809 als Teilhaber eintrat. Als die Anstalt
1819 nach München verlegt worden war, wurde er dort Professor. Die
genialen Arbeiten dieses Selfmademan über das Spektrum, sowie
seine Fernrohre sind hinlänglich bekannt. Zu beachten aber ist,
daß viele dieser großen Entdecker nicht nur Dilettanten im Sinne der
Zunft waren, sondern auch im jugendlichsten Alter in bahnbrechender
Weise die Wissenschaft förderten.[90]
*
Besonders das mathematische Talent zeigt sich häufig sehr früh. So
bezog William Thomson, der von nahezu beispielloser Frühreife
war, im Alter von 10 Jahren die Universität. Gauß schrieb
seine 1804 erschienenen »Disquisitiones Arithmeticae«, die höchste
seiner Leistungen, als Primaner. Evariste Galois, dem
manche die größte mathematische Begabung aller Zeiten zuerkennen
wollen, schrieb eine Reihe von Arbeiten als 20jähriger Jüngling
innerhalb von drei Wochen, einer ihm bis zu einem Duell, in dem
er fiel, verbleibenden Frist. Die Pariser Akademie, die diese Arbeiten
gegenwärtig herausgibt, ist bereits bis zu ihrem achten Bande
gekommen!
[S. 95]
Niels Henrik Abel schrieb seine ersten Abhandlungen mit 18
Jahren und starb mit 27 Jahren, nachdem er seinen Namen gegen den des
großen Gauß gestellt hatte. William Thomson aber löste noch als
Knabe an der Universität Glasgow eine Preisaufgabe über die Gestalt der
Erde und behandelte in Cambridge mit 18 Jahren in einer grundlegenden
Abhandlung die Analogie der Theorie der Wärmeleitung in festen Körpern
mit der der elektromagnetischen Anziehung streng mathematisch.[91]
*
Hier mag auch an die bekannte Tatsache erinnert werden, daß Pierre
Fermat (1601–1665), ein so hervorragender Mathematiker, daß bis
heute noch trotz eines Preises von 100000 M. es nicht gelingen wollte,
seine berühmte Gleichung elementar zu lösen, Jurist war.
André Marie Ampère (1775–1836) wuchs auf einer kleinen Besitzung
seiner Eltern bei Lyon auf. Hier war der Knabe viel auf sich selbst
angewiesen und versuchte seinen Wissensdurst durch das Studium des
großen Dictionnaire von D’Alembert und Diderot zu stillen, dessen 20
Bände er gründlich und ohne Auslassung durcharbeitete. Später – nach
der Hinrichtung seines Vaters war er ein Jahr in geistige Apathie
verfallen – regte ihn die Botanik und das Studium der lateinischen
Dichter vor allem an. Um sich eine Lebensstellung zu schaffen, wurde
Ampère 1796 Privatlehrer der Mathematik in Lyon und studierte in den
Mußestunden die Chemie von Lavoisier.[S. 96] Dieser geniale Autodidakt
wurde Lehrer der Physik an der Zentralschule zu Bourg im Jahre 1807,
später Professor an der polytechnischen Schule zu Paris. Von 1800–1820,
wo seine elektrischen Untersuchungen begannen, beschäftigte er sich
viel mit mathematischen Arbeiten. Über ihn urteilt Maxwell (Lehrbuch
der Elektrizität, Berlin 1883, II, S. 216): »Ampères Untersuchungen,
durch die er die Gesetze der mechanischen Wirkungen elektrischer
Ströme aufeinander begründete, gehören zu den glänzendsten Taten,
die je in der Wissenschaft vollbracht worden sind. Theorie und
Experiment scheinen in voller Macht und Ausbildung dem Hirn des
›Newton der Elektrizität‹ entsprungen zu sein. Seine Schrift (Théorie
des Phénomènes etc.) ist in der Form vollendet, in der Präzision
des Ausdrucks unerreichbar, und ihre Bilanze besteht in einer
Formel, aus der man alle Phänomene, welche die Elektrizität bietet,
abzuleiten vermag, und die in allen Zeiten als Kardinalformel der
Elektrodynamik bestehen bleiben wird.«[92]
*
Die Voltasche Säule wurde von Cruikshank (1745–1800),
Arzt und Chemiker seines Zeichens, verbessert durch einen Trog,
in den 60 aufeinandergelötete Plattenpaare von Zink und Silber
eingelassen wurden. Die Zwischenräume zwischen den Plattenpaaren
füllte er mit salzsaurem Ammoniak. Eine bedeutende Verbesserung
brachte Wilkinson, ein Londoner Wundarzt, an, indem er diese
Trogapparate in ihrer äußeren Einrichtung den heutigen Tauchbatterien
annäherte. Weiter auf diese Details einzugehen ist[S. 97] zwecklos. Desto
interessanter aber die Feststellung, daß zwei so wichtige Fortschritte
elektrotechnischer Art von Nichtfachleuten herrühren.[93]
*
Chladni (1756–1827), der Vater der Akustik, der unter anderem
die nach ihm genannten berühmten Klangfiguren entdeckte, studierte
auf den Wunsch seines Vaters Jura und erst nach dessen Tode
Naturwissenschaften. Erst im Alter von 19 Jahren fing er an, Klavier
zu spielen und erfand 1790 im Euphon ein neues Toninstrument, mit
dem er als Virtuose Kunstreisen machte, von deren Ertrag er sich ein
beträchtliches Vermögen ersparen konnte.[94]
*
Thomas Johann Seebeck (1770–1831), der Entdecker des heute
Thermoelektrizität genannten »Thermomagnetismus«, hatte Medizin
studiert, lebte dann als Privatmann in Jena, Bayreuth und
Nürnberg und wurde 1818 Mitglied der Berliner Akademie. Also auch er
war kein Fachmann; so wenig wie Carnot, der Vater der neuen
Wärmetheorie, insofern dieselbe mathematisch ist und man die
Größenverhältnisse der Wirkungen betrachtet. Er war nach Absolvierung
der polytechnischen Schule 1814 französischer Genieoffizier, trat
1819 als Leutnant in den Generalstab ein und wandte sich, da er nicht
befördert wurde, dem Studium der Wärmeerscheinungen zu. Nachdem er 1828
seinen Abschied genommen hatte, starb er 1832 im Alter von 36 Jahren.
Aus hinterlassenen Papieren geht hervor, daß er bereits den Satz von
der Erhaltung der Kraft allgemein[S. 98] ausgesprochen hat, in der Form,
»daß die bewegende Kraft in der Natur eine unveränderliche Größe ist,
daß sie im eigentlichen Sinne des Wortes weder geschaffen noch zerstört
wird«.[95]
*
Michael Faraday wurde 1791 als Sohn eines Hufschmiedes
geboren. Im Alter von 13 Jahren trat er bei einem Buchhändler
und Buchbinder ein, um dort acht Jahre zu bleiben. In seinen
Mußestunden las er Mrs. Marcets Gespräche über Chemie und aus der
Encyklopädia Britannica die Abhandlungen über Elektrizität und
bemühte sich auch, die dort angegebenen Versuche zu wiederholen.
1810 und 1811 erlaubte ihm sein Meister, an einigen Abenden populäre
Vorlesungen eines Herrn Tatum über Physik zu besuchen. 1812 hörte
er die vier letzten Vorlesungen Humphrey Davys. Auf Grund seiner
Ausarbeitung der gehörten Vorlesungen, die er an Davy sandte, erhielt
dieser Autodidakt 1813 die Stelle eines Assistenten am Laboratorium
der Royal Institution, trat dann mit Davy eine größere Reise an und
hielt 1816 seine erste Vorlesung. 1824 wurde er, nicht ohne vorheriges
Widerstreben Davys, zum Mitglied der Royal Society gewählt, und nun
folgten die Ehren schnell.
Faraday war einer der bedeutendsten Naturforscher aller Zeiten, dessen
Entdeckungen zahllos sind. Er hatte auch schon die klare Einsicht in
die Einheit aller Naturkräfte, welche die moderne Physik erst
nach längerer Zeit und nach vielen[S. 99] Kämpfen sich erworben hat. Die Idee
der gegenseitigen Umwandlungsfähigkeit der Naturkräfte war bei seinen
bedeutendsten Entdeckungen der leitende Gedanke.[96]
*
George Green (1793–1841), der 1828 die Potentialfunktion zur
Bestimmung physikalischer Kräfte zuerst einführte, war Sohn eines
Bäckers und Müllers und setzte anfangs das Gewerbe seines Vaters
fort, um später in Cambridge zu studieren.[97]
*
Siméon Denis Poisson (1781–1840) wurde in der Jugend zu
einem verwandten Chirurgen in die Lehre geschickt, da der
Familienrat ihn der geistigen Anstrengungen eines Notariates nicht
für gewachsen hielt. Hier war er gänzlich unbrauchbar. Als
er 1798 in die polytechnische Schule eintrat, behauptete er immer den
ersten Platz, wurde bereits 1800 Repetent und 1806 Professor. Er hat
sich um die mathematische Mechanik große Verdienste erworben.[98]
*
Julius Robert Mayer (1814–1878), der Entdecker des Gesetzes
von der Erhaltung der Energie, aus dem er die Äquivalenz von
Arbeit und Wärme folgerte und das mechanische Äquivalent der Wärme
berechnete, war Arzt. Als Schiffsarzt machte ihn 1840 in Java
die veränderte Farbe des Venenblutes darauf aufmerksam, daß zwischen
dem Stoffverbrauch und der produzierten Wärme im menschlichen Körper[S. 100]
ein direkter Zusammenhang bestehen müsse. Seiner Arbeit »Bemerkungen
über die Kräfte der unbelebten Natur« versagte Poggendorff die
Aufnahme in seine Annalen der Physik und Chemie, wie er auch
keine der späteren Arbeiten Mayers abdruckte.
Also auch der Entdecker eines der größten physikalischen Gesetze war
kein Fachmann, sondern ein junger Arzt.[99]
*
Das andere Genie, das sich mit diesem Thema befaßte, das uns in
ungeahnter Weise einen Einblick in die Ökonomie des Weltalls eröffnet,
und der auch das Glück hatte, Anerkennung zu finden, war ebenfalls
kein Physiker, sondern der Besitzer einer Bierbrauerei:
James Prescott Joule (1818–1889). Er begründete die mechanische
Wärmetheorie auf experimentellem Wege und zwar in völliger
Unabhängigkeit von Mayer.
Die Hauptabhandlung des 32jährigen erschien 1850, nachdem er bereits
1843 Gedanken geäußert hatte, die an Kühnheit den Mayerschen von 1845
fast gleichkamen. Übrigens war Joule auch der Begründer der Kinetischen
Theorie der Gase.[100]
*
Auch H. Helmholtz, der dritte Große auf diesem Felde, war, als
er im Jahre 1847 seine Abhandlung »Über die Erhaltung der Kraft«
veröffentlichte, in der er mathematisch das Gesetz bewies, nicht
Physiker oder Mathematiker, sondern ein junger Arzt. Helmholtz,
1821 geboren, studierte Medizin, wurde 1843 Militärarzt in Potsdam,
1848 Lehrer der Anatomie an[S. 101] der Kunstakademie in Berlin und erst 1871
– nach verschiedenen anderen Stellen als Professor der Physiologie –
Professor der Physik in Berlin.[101]
*
Leclerc de Buffon (1707–1788) studierte Mathematik und Physik
und war Intendant des Jardin royal des plantes in Paris. Wiewohl
er also nicht Geologe von Fach war, ja auf geologischem
Gebiete nur in beschränktem Maße als Beobachter und Forscher tätig
war, bekämpfte er bereits die Annahme einer universellen
Sintflut und erkannte u. a., daß ein Teil der in der Erde
begrabenen Fossilien zu erloschenen Arten gehört. Auch lehrte
er die Abplattung der Erde an den Polen und Erhöhung am Äquator.
Zittel sagte von Buffon: »Ein Vergleich der Epoques de la nature
(1778) mit den zum Teil kindischen Hypothesen seiner Vorgänger und
Zeitgenossen zeigt am deutlichsten die geistige Überlegenheit des
großen Naturforschers.« Die Grundgedanken dieses Outsiders haben sich
als richtig bis heute bewährt.[102]
*
Leopold von Buch (1774–1852) galt mit vollem Recht für
den größten Geologen seiner Zeit. Weder er noch Alexander von
Humboldt (1769–1859), dessen Auftreten durch die Anregung, die er
auf weite Kreise ausübte und der in Deutschland der jungen Wissenschaft
viele Freunde und Anhänger zuführte, wie das Buffon und Cuvier in
Frankreich getan hatten, nicht hoch genug zu veranschlagen ist, haben
je ein öffentliches Lehramt bekleidet. In völlig unab[S. 102]hängiger
Lebensstellung widmeten sie sich ganz der Wissenschaft, darin ihrem
großen englischen Kollegen Lyell (1797–1875) gleichend.
Die größten Geologen waren also entweder überhaupt nicht Fachleute im
strengen Sinne oder doch nicht zünftige Gelehrte.[103]
*
Der französische Ingenieur Claude Chappe hatte einen
optischen Telegraphen im Jahre 1792 konstruiert, der schon
zwei Jahre später zwischen Paris und Lille fertiggestellt wurde,
um bald in der Länge von etwa 5000 km sich durch ganz Frankreich
zu ziehen. Die 300 km von Paris nach Toulouse wurden in 20 Minuten
durch die Zeichensprache zurückgelegt. Da aber nur an hellen Tagen,
wenn es weder regnete noch schneite, telegraphiert werden konnte,
war die Benutzung der Linien vom Zufall abhängig. Darüber sprach im
Jahre 1809 der bayerische Minister Graf Montgelas in Gegenwart des
Professors der Anatomie Thomas Sömmering. Da dieser sich in
seinen Mußestunden mit allen möglichen Dingen beschäftigte, kam er auch
auf den Gedanken, die Elektrizität zu verwenden und konnte schon acht
Wochen später der bayerischen Akademie der Wissenschaften einen von ihm
erfundenen elektromagnetischen Telegraphen vorführen, den ersten
elektrischen Telegraphen, den es je gegeben hat. Wenn auch das System
unpraktisch oder doch sehr kostspielig war, so hatte er zweifellos das
Verdienst, gezeigt zu haben, daß man die Elektrizität überhaupt zum
Zwecke der Telegraphie benutzen könne.
[S. 103]
Merkwürdig ist aber, daß ein so genialer und weitblickender Mann wie
Napoleon sich allein abfällig über die Erfindung äußerte und sie
wegwerfend als »une idée germanique« bezeichnete. Oder sollte ihn die
Unvollkommenheit im praktischen Sinne dazu bewogen haben?[104]
*
George Stephenson (1781–1848), der Hauptbegründer des
Eisenbahnwesens, der auch die erste Eisenbahn zur Beförderung von
Personen zwischen Stockton und Darlington baute, fing seine glänzende
Laufbahn als einfacher Dampfmaschinenwärter an.[105]
*
Samuel Morse (1791–1872) war Maler. Auf der Heimreise
von Europa, wo er die Mal- und Zeichenschulen studiert hatte, nach
Amerika, entwarf er 1832 einen Drucktelegraphen und das nach
ihm benannte, aus Punkten und Linien bestehende Zeichensystem.
1837 erhielt er auf seine Erfindung ein amerikanisches Patent und baute
1843 die erste Versuchslinie zwischen Washington und Baltimore ein. Die
Erfindung dieses Autodidakten und Outsiders wurde bekanntlich allgemein
eingeführt.[106]
*
Der Erfinder des Kehlkopfspiegels war nicht etwa ein Arzt,
sondern der berühmte Gesanglehrer Manuel Garcia (1805–1906).
Diese Erfindung ermöglichte erst die Laryngoskopie.[107]
[S. 104]
*
Wie die Erfinder des Luftballons, Joseph Michel Mongolfier
(1740–1810) und Jacques Etienne Mongolfier (1745–1799)
Papierfabrikanten waren, so die der drei lenkbaren Luftschiffe,
des starren, halbstarren und unstarren Systems, sämtlich nicht
Fachmänner, sondern, wie jedermann weiß, die Offiziere Graf
Zeppelin, Major Groß und Major von Parseval.
*
Übrigens war der erste, der einen noch dazu erfolgreichen Versuch zur
Konstruktion eines lenkbaren Luftschiffes machte, ein armer römischer
Schuster, der im Palazzo Aldobrandini wohnte. Dort besuchte ihn
Le Bar, der Erzieher Napoleons III., mit seinem Zögling am 18. November
1823. Die Flugmaschine bestand aus zwei Teilen, von denen der eine
den Ballon in horizontaler Richtung halten, während der andere die
Sicherheit der Fahrt verbürgen sollte.[108]
*
Daguerre (1783–1851), der im Jahre 1838 die Erfindung der
Photographie machte, d. h. das Licht zur Bildererzeugung
zwang, war nicht nur kein Fachmann, sondern sogar »eigentlicher
Fachkenntnisse bar« und seines Zeichens Maler. Ursprünglich war
er Steuerbeamter gewesen. Übrigens hatten sich schon vorher Physiker
(Davy und Wedgewood) erfolglos damit beschäftigt.[109]
*
Foucault (1819–1868) veröffentlichte seine berühmten
Pendelversuche »Démonstration physique[S. 105] du mouvement de rotation
de la terre au moyen du pendule« im Jahre 1850, also 31jährig.
Er bekleidete damals die Stellung eines Redakteurs des
wissenschaftlichen Teiles des Journal des Débats.
*
Die ersten Versuche zur Umwandlung der Elektrizität in Töne machte 1837
Page (1812–1868). Er war seines Zeichens Agent und Patentanwalt
in Washington. Ph. Reis (1834–1874) trat 1850 als Lehrling in
ein Farbwarengeschäft zu Frankfurt a. M. ein und studierte privatim
seit 1853 Mathematik und Naturwissenschaften. Um das Jahr 1860
konstruierte der erst 24jährige Autodidakt das erste Telephon,
an dem er seit 1857 gearbeitet hatte. Das erste praktisch verwendbare
Telephon aber konstruierte der Taubstummenlehrer Graham Bell,
geb. 1847 in Boston, im Jahre 1876. Also kein einziger Physiker,
sondern ausschließlich »Dilettanten«, von denen noch dazu kein
einziger das 30. Lebensjahr erreicht hatte, waren die Erfinder dieses
außerordentlichen Verkehrsmittels.[110]
*
Die beiden Weltfirmen Siemens & Halske in Berlin und Karl Zeiß in
Jena sind aus bescheidenen mechanischen Werkstätten hervorgegangen
und verdanken ihre Blüte dem Eintritt von Männern, die außerhalb der
Zunft standen. Dort des Artillerieoffiziers Werner Siemens
(1816–1892), dessen Erfindungen und Verbesserungen, besonders auf
dem Gebiet des Telegraphenwesens, außerordentlich zahl[S. 106]reich sind;
hier des Universitätsdozenten Ernst Abbe. Karl Zeiß
(1816–1888) selbst besaß keine Universitätsbildung, sondern
hatte vor der Prima das Gymnasium verlassen, um dann in mechanischen
und Maschinenwerkstätten zu lernen.[111]
*
Der Erfinder des Zweirades, Karl von Drais (1784–1851),
war von Beruf nicht etwa Mechaniker, sondern badischer Forstmeister.
Er war auch der erste, der eine Schreibmaschine, und zwar auf
stenographischer Grundlage, konstruierte.[112]
*
Charles Darwin (1809–1892), über dessen Leistungen sich
wohl jedes Wort erübrigt, war in der Schule des Dr. Buttler in
Shrewsbury ein so schlechter Schüler, daß sein Vater ihn mit
16 Jahren herausnahm und Medizin studieren ließ. Da er auch da
nichts leistete, widmete er sich nach zwei Jahren in Cambridge der
Theologie, in der er nach drei Jahren das Baccalaureusexamen
bestand. Nebenher interessierte er sich für Mineralien, Pflanzen,
Muscheln, Insekten, aber auch für Münzen und Siegel, die er sammelte.
Auch Geologie, Botanik und besonders Zoologie zog er in den Bereich
seines Interesses, ohne aber den Vorsatz, Geistlicher zu werden, um
dieser Liebhabereien willen, zu denen noch leidenschaftliche Liebe
zur Jagd kam, aufzugeben. Nach seinem eigenen Geständnis »würde er
sich damals für verrückt gehalten haben, wenn er in den ersten Tagen[S. 107]
nach Eröffnung der Rebhuhnjagd zugunsten von Geologie oder einer
anderen Wissenschaft auf die Jagd hätte verzichten wollen«. Als für
die fünfjährige Weltumseglung des englischen Kriegsschiffes »Beagle«
ein Naturforscher gesucht wurde, empfahl Professor Henslow Darwin.
Da aber dessen Vater kein rechtes Vertrauen zur Ernsthaftigkeit des
Jünglings hatte, schrieb er ab, und nur dem Zufall ist es zu danken,
daß aus der Reise doch etwas wurde. Tatsächlich trat er sie (1831) an,
ohne in irgendeiner der vier Wissenschaften, auf welche er während
der Reise hauptsächlich sein Augenmerk zu richten hatte: Zoologie,
Botanik, Geologie und Paläontologie, ein abgerundetes Schulwissen
zu besitzen. Dafür besaß er allerdings den freien, durch keine
Lehrmeinungen beeinträchtigten Blick für die Erscheinungen der
Umgebung, ein Gewinn, der fürstlichen Lohn trug. So hat der in der
ersten Hälfte der Zwanziger stehende Forscher, der schon vor der Reise
die Flimmerlarven der Moostierchen und das Keimen der Pollenschläuche
entdeckt hatte, auf ihr die Theorie der Entstehung der Korallenriffe,
ja, seine Deszendenztheorie aufgestellt. Der große Forscher und
edle Mensch hat niemals ein öffentliches Lehramt bekleidet.[113]
*
Darwin mag uns daran erinnern, daß außer den bereits oben genannten
noch eine Reihe von schlechten Schülern mit ihren Erfolgen im
späteren Leben ganz zufrieden sein konnten. Bekanntlich war J.
J. Rousseau ein solcher Ausreißer, der nach einer[S. 108] jämmerlichen
Schulbildung seinem Meister, einem Kupferstecher in Genf, 16jährig
durchging, später Bedienter wurde, sich auch eine Zeitlang einem
Hochstapler anschloß und sich als schon berühmter Mann vom
Notenabschreiben nährte.
*
Liebig erzählt von sich selbst, daß er als Schüler keine
Erfolge hatte. Bürger wurde als zwölfjähriges Bürschchen
von der Stadtschule zu Aschersleben geschwenkt, der große Dichter
Shelley erlebte auf der Schule zu Eton ein gleiches Schicksal
und nochmals auf der Universität zu Oxford. Auch Edgar Poe wurde
relegiert. Schiller ging bekanntlich von der Karlsschule durch,
der Turnvater Jahn aber entfloh dem Gymnasium zum Grauen Kloster
in Berlin.
*
Van Erpecum, ein Schüler an der Höheren Schule in Batavia,
machte die Beobachtung – es dürfte 1902 gewesen sein –, daß in einem
bis zum Rande mit Wasser und darin herumschwimmenden Eisstückchen
gefülltem Gefäß das Wasser nicht überfloß, als das Eis schmolz. Daraus
folgerte er das »Gesetz der permanenten Oberfläche«, das er mit
Hilfe seines Lehrers in den Sitzungsberichten der Kgl. Niederländischen
Akademie der Wissenschaften veröffentlichte.[114]
*
Wie die genialsten Gedanken und Beobachtungen in den
Naturwissenschaften und der Technik von Dilettanten bzw. Outsiders
stammen, also von Männern, die nicht der gelehrten Zunft angehörten
und häufig[S. 109] das Gebiet nur im Nebenfach bestellten, sahen wir
eben. Ja, wir trafen auch in späteren Jahrhunderten eine Reihe von
Männern, die auf vielen Gebieten geniale Bahnbrecher wurden, wie das
in der Renaissance so häufig war. Ebenso verhält es sich auch in
den Geisteswissenschaften. Auch hier ist der Beweis nicht schwer zu
erbringen.
*
William Jones (1746–1794) war es, der sich zuerst eine
eindringende Kenntnis des Sanskrit erwarb und in wesentlich richtigen
und geschmackvollen Übersetzungen erprobte. Er führte Cakuntala so
gut wie die Gesetze des Manu und Teile der Rigveda in die europäische
Literatur ein. Natürlich war er nicht Philologe oder Orientalist von
Fach, sondern Oberrichter in Fort William in Bengalen.[115]
*
Der erste, der Sanskrit und seine Literatur in wahrhaft
philologischem Sinne behandelte – schreibt Benfey – und dadurch einen
sicheren Grund für eine Sanskritphilologie legte, war Henry Thomas
Colebrooke (1765–1837). Auch er war Jurist, nämlich
Richter in Mirzapoor in Indien, dann politischer Resident am Hofe von
Berar.[116]
*
Der erste Entzifferer der Keilinschrift war der klassische
Philologe Georg Friedrich Grotefend (1775–1853). Die größten
Kenner der Keilinschriften räumen ihm nicht nur die Priorität
der Entzifferung, sondern auch die Größe der Entdeckung an sich
ein, wie sie auch die Bedeutung seiner Methode für die weiteren
Entzifferungsversuche anerkennen. Schon im[S. 110] Jahre 1802, also 27jährig,
legte Grotefend seine ersten Entzifferungsresultate der Göttinger
Akademie der Wissenschaften vor. Das erstaunlichste war nun, daß dieser
Mann, der die Genialität besaß, die seit Jahrtausenden schweigenden
Steine zum Reden zu bringen, gar nicht Sanskrit konnte![117]
*
Der Ruhm, den rechten Weg zur Entzifferung der Hieroglyphen
gefunden und weiter gegangen zu sein, gebührt dem englischen
Arzt Thomas Young, von dessen Genialität im Reiche der
Naturwissenschaften wir schon früher Zeugen waren. Er veröffentlichte
1815 in dem Cambridger »Museum criticum« eine mutmaßliche Übersetzung
des ganzen demotischen Teils der Inschrift von Rosette, die
Entzifferung sämtlicher darin vorkommender Eigennamen und außerdem
die Erklärung von 80 andern Wörtern und ein aus diesen Erklärungen
sich ergebendes demotisches Alphabet. Er entdeckte sogar, daß viele
Wörter nicht alphabetisch, sondern symbolisch geschrieben seien. Eine
außerordentliche Förderung ließ Jean François Champollion le
jeune (1790 bis 1832) der Entzifferung der Hieroglyphen angedeihen, ja,
er ist der eigentliche Vater der neuen Wissenschaft geworden. Er war
seit 1809 Professor der Geschichte in Grenoble. Ihm glückte die
Entzifferung 1822, also in seinem 32. Lebensjahre.[118]
*
Enden wir hier das Kapitel. Wohl niemand wird mehr bestreiten wollen,
daß uns der Beweis ge[S. 111]lang. Und doch können wir mit einem Trostwort
schließen.
Die Universitäten sind im allgemeinen nicht schlechter geworden. Sie
verbannen heute die Genialität nicht weiter von sich als in früheren
Jahrhunderten. Sie waren immer eine Organisation der Mittelmäßigkeit.
*
Das sei zum Schluß durch Beispiele und Worte eines berufenen Kenners
belegt.
Georg von Peurbach, dem bereits Padua und Bologna einen
Lehrstuhl für Astronomie angeboten hatten, las in Wien als Magister der
Artistenfakultät 1434–1460 vorzugsweise über römische Dichter.
Nur 1458 hielt er eine mathematische Vorlesung. Sein großer Schüler
Regiomontanus war an keiner Universität, sondern in Nürnberg
tätig, da er an den damaligen Universitäten wenig Förderung seiner
Studien zu finden meinte. Georg Kaufmann konstatiert, daß »die
Wirksamkeit der beiden großen Astronomen und Mathematiker, die den
Ruhm der Wiener Universität zu bilden pflegen, der Wiener
Universität nur lose verwandt waren, daß ihre Studien außerhalb des
Rahmens ihrer akademischen Tätigkeit lagen, und daß sie die Ordnung des
mathematischen Unterrichts in Wien nicht umgestaltet haben.«[119]
*
Es ist immer dieselbe Sache: Von der Universität und der gelehrten
Zunft gering geschätzt oder bekämpft, wird der »Dilettant« nach
seinem Tode mit Gewalt zum Professor und Kollegen gestempelt. Denn,[S. 112]
wollte die gelehrte Zunft auf die Outsider verzichten, dann wäre
das gleichbedeutend mit einem Verzicht auf die größten Förderer der
Wissenschaft.
Anm. Hierzu ist in meinem Buch: »Dinge, die man nicht sagt«,
das Kapitel: »Kunst und Dilettantismus« zu vergleichen, das noch
eine Reihe Ergänzungen liefert.
[S. 113]
Fünfter Abschnitt
Von Universität und Schule
Die mittelalterlichen Scholaren der Artistenfakultät, also die große
Masse, lebte in den Bursen in größtem Zwang. Sie standen den ganzen Tag
unter Aufsicht, ihr Aufstehen, Essen und Trinken, Studium, Ausgehen,
alles war vorgeschrieben, das Verbot der Wirtshäuser und Tanzräume, des
Kartenspiels bestand bei ihnen wie bei unsern Mittelschülern, kurz, sie
waren durchaus unfrei im Gegensatz zum modernen Studenten, hinter dem
sie an Lebensalter allerdings bedeutend zurückstanden.
Nichts aber wäre falscher, als die Annahme, sie hätten deshalb einen
halbwegs anständigen Lebenswandel geführt. So muß ein Heidelberger
Statut von 1466 verbieten, daß die Scholaren den Magister während
der Vorlesungen durch Geschrei und Schimpfreden störten,
oder dadurch, daß sie einen Fuchs zwängen, das Salve anzustimmen
oder mit Dreck würfen. Schon früher mußte in Heidelberg verboten
werden, in den Vorlesungen mit Steinen zu werfen oder ähnlichen
Unfug zu verüben. Wer während der Vorlesung mit Steinen wirft – heißt
es[S. 114] dort 1444 – oder andere Unverschämtheiten sich zuschulden kommen
läßt, dem soll – man meint das Sitzorgan gegerbt werden. O nein – dem
soll eine Vorlesung als versäumt angerechnet werden!
Die groben Späße der Scholaren arteten bisweilen geradezu in Verbrechen
aus. Sie plünderten die Gärten der Bürger, drangen nachts in die
Häuser, beleidigten die Braut auf dem Zuge zur Kirche, drängten sich in
Hochzeitsgesellschaften und wollten hier die Herren spielen, erregten
nachts Waffenlärm, indem sie auf die Steine der Straßen schlugen, und
griffen die Wächter an und wer sonst über die Straße kam. An allen
Universitäten ereignete sich dergleichen Unfug. In Köln, Heidelberg und
anderwärts kam es wiederholt zu förmlichen Tumulten, bei denen Sturm
geläutet und das Banner entfaltet wurde.
Nur einen Unfug kannte man damals noch nicht, den der späteren
Duelle. Von ihnen findet sich keine Spur. Beleidigungen wurden von
Magistern und Scholaren auf dem Rechtswege ausgetragen, ohne Schaden
an ihrer Ehre. Sonst setzte es tüchtige Prügel ab, was jedenfalls
weit verständiger ist, als die Säbelschlägerei und Pistolenschießerei
zwischen den dümmsten Grünlingen, die sich in ihrer funkelnagelneuen
Ehre jeden Augenblick beleidigt fühlen. Wer den haarsträubenden Unfug
und den frivolen Leichtsinn vieler studentischer »Ehrengerichte« kennt,
wird das nur bestätigen können.[120]
*
Einst frug der Kurfürst Christian von Sachsen Friedrich Taubmann
(1565–1613), »was die Studenten[S. 115] in Wittenberg machten? Taubmann stehet
von der Taffel auff, gehet mit dem Degen in den Hoff hinunter, hauet
in die Steine, grabet etliche auss und wirfft zu dem Churfürsten in
die Fenster und schreyet: ›Herunter, du Penal, du Spulwurm‹ etc. Der
Churfürst läßt ihm sagen: Er sol nur auffhören, er hätte Bescheids
genug.«[121]
*
Prinz Wilhelm von Nassau-Dillenburg erzählt in seiner 1694 abgefaßten
Reisebeschreibung über die Studenten in Padua: »Padua ist eine
weitläufige, aber menschenleere Stadt, in deren Straßen man auch im
größten Regen trocken einhergehen kann, unter den Gängen, die vor den
Häusern sind. Es ist aber wunderlich, daß dort die Studenten Macht
haben, Arme und Beine nicht nur sich selbst, sondern auch Fremden zu
zerschießen.
Sobald es Nacht wird, gehen sie gewaffnet in Scharen aus, auf
verschiedenen Parteien, und verstecken sich hin und wieder hinter die
steinernen Pfeiler. Kömmt einer, so rufen sie ihn an: Qui va li? Da
trägt es sich bisweilen zu, daß man zwischen zwei Qui va li? kömmt,
und also in der größten Gefahr ist. – Auch dieses läßt die Republik
(Venedig) aus Politik zu.«[122]
*
Das wilde Leben der Scholaren wurde durch das ihrer Lehrer höchstens
noch übertroffen. Da ist verboten, daß ein Magister mit einem
Stein, einem Becher oder etwas ähnlichem werfe. Wer nur[S. 116] den
Arm zum Werfen erhob, aber nicht warf, hatte zehn neue Groschen
Strafe zu zahlen, wer warf, aber nicht traf, hatte acht Gulden zu
erlegen, wer aber traf, wurde nach der Größe des Schadens bestraft.
Auch Faustschläge und Reißen an den Haaren hatten ihre
Tarife! Man stelle sich vor: Professoren! Niemand sollte auch
durch das Fenster einsteigen. Tief blicken läßt die Bestimmung,
daß kein Lehrer ad commodum suum meretricem (zu seinem Nutzen eine
Prostituierte) ins Kollegium mitbringen dürfe. Das war sehr teuer
und kostete eine ganze Jahresrente als Strafe, ebenso wie das andere
Verbot, das man zu erlassen für nötig befunden hatte: vel actum
venereum inibi exercere (den Beischlaf dort auszuüben). Bei den
Disputationen aber war das Verbot von Schimpfworten wie ketzerisch,
der Ketzerei verdächtig, Eselei oder Dummheit verboten.[123] Leider
besitzen wir keine Instanz, die aus den Polemiken unserer Gelehrten die
Schimpfereien und Lackelhaftigkeiten entfernte, die immer noch an den
sozialen Tiefstand früherer Jahrhunderte unliebsam erinnern.
*
Von der kläglichen Finanzlage, in der sich in der Regel die
mittelalterlichen Universitäten, Fakultäten und Professoren befanden,
gibt eine Vorstellung die Motivierung der Wiener Fakultät für das
Unterlassen einer Beschickung der Nürnberger Tagung, auf der der Kaiser
über die Berufung eines andern Konzils verhandeln wollte. Sie schreibt
am 30. Dezember 1442: »weil die Universitätskasse vollkommen leer sei
und die Universität selbst in großen Schulden stecke.«
[S. 117]
Mag auch der Wunsch, sich überhaupt zu drücken, bei der Schwarzfärbung
mitbestimmend gewesen sein, so beweisen doch die Schwierigkeiten, die
die gleiche Universität hatte, um ihren Gesandten 1433 in Basel mit
Geld auszustatten, daß Schmalhans Küchenmeister war. Jeder Professor
hätte im Durchschnitt jährlich drei Gulden beisteuern müssen. Das
ist allerdings sehr viel, wenn man bedenkt, daß der Mindestbesoldete
nur 30 Gulden im Jahre an Gehalt erhielt und daß nur die Professoren
der oberen Fakultäten – in Wien etwa 30 Gelehrte – Einnahmen von
80–100 Gulden buchen konnten. Ganz wenige unter ihnen zogen bedeutende
Revenuen aus Prüfungen, sowie ihrer Praxis als Anwälte oder Ärzte.[124]
Jede Nebeneinnahme war natürlich hochwillkommen. Am meisten warfen
die Promotionen in den oberen Fakultäten ab. Der Doktorand war
verpflichtet, an die bei der Promotion anwesenden Magister und
Doktoren Geschenke zu verteilen, und zwar zumeist ein Paar Handschuhe,
wobei auch wohl unterschieden wurde, wer solche aus Hirschleder
bekommen solle oder aus einer geringeren Qualität. Auch ein Barett,
ein Geldstück oder einige Ellen Tuch waren übliche Geschenke. In
Frankfurt wurden zwischen den Doktoren der oberen Fakultäten förmliche
Verträge geschlossen, welche z. B. den Doktoren der Medizin das Recht
verbürgten, bei der Promotion von Juristen und Theologen mit solchen
Geschenken bedacht zu werden und umgekehrt. Dazu mußte der Doktorand
Wein und Konfekt den Examinatoren und dem Kanzler liefern und den
Doktorschmaus, dem sich bisweilen auch ein Ball anreihte, bezahlen. Da
ist es[S. 118] dann kein Wunder, wenn die Kosten einer Promotion enorm waren.
So mußte in Leipzig zu Beginn des 16. Jahrhunderts ein Doktor der
Rechte bei seiner Promotion für Gelage, Umzüge, Musik und Geschenke die
Summe von 250 Dukaten aufwenden.[125]
*
Wie kläglich die finanzielle Lage der Professoren war, geht aus
einer Klageschrift der Universität Heidelberg von 1462 an den Papst
hervor. Sie seien großenteils alte Männer, die von ihrer akademischen
Tätigkeit leben müßten und gezwungen wären, zu betteln, wenn der
Papst ihnen die mit ihren Professuren verbundenen Pfründen entzöge.
Deshalb möchte der Papst ihre unentschiedene Stellung in den wegen der
Konzilien entstandenen Parteikämpfen nicht verübeln, da sie auch von
ihrem Landesherren abhängig seien. »Wenn wir ihm nur im geringsten
entgegentreten, dann verlieren wir unsere Einkünfte.«[126]
*
Nach einer Urkunde vom Jahre 1804 erhielt Immanuel Kant
folgendes Gehalt: »I. Als Professor der Logik und Metaphysik 1)
Salarium 166 Thaler 60 Grsch. 2) Zulage 86 Thlr. 73 Grsch. 16⅕ Pf.
3) Accise 26 Thlr. 50 Grsch. (quartaliter zahlbar). 4) Mühlen-Gefälle
(als annuum fällig den 1. April) 4 Thlr. 5) Thalheimsche Gefälle (als
annuum fällig den 19. Juni) 17 Thlr. 53 Grsch. 3 Pf. 6) An Getreyde
44 Schffl. Roggen, quartaliter zu berechnen, aber gewöhnlich erst
im letzten Quartal zu empfangen. Diese sind im Etat à 40 Grsch. p.
Schffl. angeschlagen[S. 119] auf 19 Thlr. 50 Grsch. 7) Aus dem Stipendio
Gerhard Janseniano (als annuum fällig den 31. Dezbr.) 75 Grsch. 8)
An Zinsen aus der philosophischen Fakultät (halbjährig in Ostern und
Michael fällig) 10 Thlr. 88 Grsch. 1⅛ Pf. 9) Ex Signis Initiationis
(halbjährlich in Ostern und Michael fällig) nach der Fraktion 27 Thlr.
17 Grsch. 15 Pf. 10) An Censur-Gebühren nach der Fraktion 6 Grsch.
11) An Holz 5 Achtel, welche von der Königl. Holz-Cämmerey im ersten
Quartal des Etats-Jahres pränumerando geliefert werden. Diese sind im
Etat à 5 Thlr. p. Achtel angeschlagen auf 25 Thlr. Summa als Professor
385 Thlr. 43 Grsch. 17 (1713⁄40) Pf.« Dazu kommt sein Gehalt II.
als Senator, der sich in ähnlicher Weise zusammensetzt, in Höhe von
43 Thlr. 59 Grsch. 17 Pf., ferner der als Senior der philosophischen
Fakultät in der Höhe von 100 Thalern und endlich eine außerordentliche
Zulage aus der kgl. Ober-Schul-Kasse im Betrage von 220 Thalern. Mithin
stand sich der größte Denker, den Deutschland, vielleicht die Erde am
Ende des 18. Jahrhunderts besaß, auf 749 Thaler, 23 Groschen und 10
Pf. im Jahre![127]
*
An der Leipziger Universität gab es im Mittelalter ein großes und ein
kleines Kolleg, in denen die Studenten, wie ja damals allgemein üblich,
auf Grund besonderer Statuten gemeinsam lebten. Diese Statuten nun
bestimmten nicht nur die Reihenfolge, in der bei Tisch die Speisen
anzubieten waren, sie enthielten auch die Vorschrift, daß kein
Kollegiat in den Vorlesungen oder Disputationen Sätze auf[S. 120]stellen
dürfe, die der Mehrheit der Kollegiaten mißfielen. Wer es doch tat
und auf die Mahnung nicht hörte, verlor Tisch und Einkünfte,
bis er vom Kollegium wieder zu Gnaden aufgenommen war. Es war also
möglich, daß im Kleinen – acht Stellen aufweisenden – Kolleg eine
Meinung zulässig war, die im Großen Kolleg mit 22 Stellen verboten war
und man fand nichts Entehrendes darin, eine wissenschaftliche Ansicht
durch einen Majoritätsbeschluß einer derartigen Genossenschaft zu
unterdrücken und offen durch solche Mittel auf die Gesinnung zu wirken.
Mag es sich auch entsprechend der ganzen mittelalterlichen Methode um
die einfältigsten Spitzfindigkeiten gehandelt haben, so war darum die
Vergewaltigung der Lehrmeinung nicht geringer.[128]
*
Das ist weniger verwunderlich, wenn man weiß, daß jedem
mittelalterlichen Universitätslehrer nicht nur die Kleidung, in der er
allein Vorlesungen halten durfte, sondern auch Inhalt und Form des
Unterrichts genau vorgeschrieben waren. Und zwar nicht etwa bloß
das Buch, sondern auch der Kommentar, die Glosse und
damit der ganze Gang und Hauptinhalt der Erklärung. Ferner ob
und wieviel er diktieren, ob er aus dem Heft vortragen oder wenigstens
einen Gedächtniszettel benutzen dürfe. Es war auch verboten, in einer
Stunde mehr oder weniger als die von der Fakultät vorgeschriebenen
Abschnitte durchzunehmen. War auch meist freier Vortrag gefordert, so
tadelt ein Ingolstädter Gut[S. 121]achten von 1507 es doch als verwerfliches
Virtuosentum, daß der Doktor Theoderich, ein Jurist, Text und Glossen
aus dem Gedächtnis anführe, statt sie aus dem Buch vorzulesen. Der
Lehrer war in solcher Weise nach allen Seiten hin gebunden und
wurde so sehr nur als Werkzeug betrachtet, daß er nicht nur sich – wie
unsere heutigen Volksschullehrer, sofern sie Religionsunterricht zu
erteilen haben – den in den vorgeschriebenen Büchern und Kommentaren
vertretenen Ansichten anzuschließen hatte, sondern auch Methode und
Meinung wechseln mußte, wenn die Fakultät die Bücher wechselte.
So konnte der Streit von zwei Schulen der Kommentatoren über die
logischen Lehrbücher zu einem Kampf an den Universitäten und unter den
Universitäten werden, wie der berühmte zwischen den Realisten,
die sich bei der Erklärung der Aristotelischen Logik und des allgemein
gebrauchten Kompendiums des Petrus Hispanus den älteren Kommentatoren,
Albertus Magnus, Duns Scotus, Thomas von Aquino u. a. anschlossen, und
den Nominalisten, die an Occam anknüpften. Letztere, die auf
Wortformen der Begriffe und Verhältnisse des Satzbaues das Hauptgewicht
legten, wurden die größten Meister spitzfindiger und sophistischer
Dialektik. Es handelte sich lediglich um einen literarischen, keinen
spekulativen Parteigegensatz.
Nun ist nichts bezeichnender für das Wesen der mittelalterlichen
Universität und den Lehrzwang, den sie ausübte, als die Tatsache, daß
die eine Richtung die andere nicht neben sich duldete, vielmehr an
der einen Universität nur nach der alten,[S. 122] an der andern nur nach der
neuen Methode gelehrt werden durfte.
Als sich Hieronymus von Prag, der sich am 7. April 1406 in Heidelberg
hatte immatrikulieren lassen, mit Leidenschaft in einer Disputation
zum Realismus bekannte, die Fakultät die Aufstellungen des Hieronymus
widerlegen ließ und Hieronymus hierauf wieder antworten wollte,
wurde den Studierenden bei ihrem Eide untersagt, dem Akte
anzuwohnen! Weiter beschloß die Fakultät, daß fortan kein auf einer
andern Universität ausgebildeter Bakkalar oder Magister in die Fakultät
aufgenommen werden solle, bevor er sich eidlich verpflichtet
habe, keine Frage zu determinieren, ohne vorher dem Dekan seine
Aufstellung vorzulegen und zu schwören, sie auf dem Katheder
wörtlich und ohne jede Änderung vorzutragen.
Noch im Jahre 1452 mußte sich jeder Magister in Heidelberg bei
der Aufnahme in die Fakultät eidlich verpflichten, nur auf
Grund der neuen, vor allem durch Marsilius von Padua eingeführten,
nominalistischen Methode zu lehren. Einige Lehrer, die den alten Weg
für richtiger hielten, mußten ausscheiden. Erst ein Machtwort des
Kurfürsten Friedrich beseitigte dieses Monopol.
In Tübingen, das schon 1477 beiden Richtungen gleiche Geltung
einräumte, konnte ein Scholar oder Bakkalar nicht, wie seit 1452 in
Heidelberg, beliebig bei Lehrern der einen oder andern Partei hören,
vielmehr hatte er sich für einen von beiden zu entscheiden und in dem
gewählten Wege die Grade zu erwerben.
[S. 123]
*
Die unbestrittene Autorität des Aristoteles in den weltlichen
Wissenschaften wurde sowohl von den Nominalisten, als von den
Realisten anerkannt. Beide Parteien stimmten darin überein, daß
sich niemand von seiner Lehre entfernen dürfe, es sei denn,
einer seiner Sätze widerstreite der Kirchenlehre. In diesem Falle solle
man darauf hinweisen, daß Aristoteles nach der bloßen Vernunft urteile,
ohne durch den Glauben erleuchtet zu sein. So zu den Scholaren zu
sprechen war in Heidelberg ausdrücklich vorgeschrieben. Zugleich wurde
jeder neue Magister eidlich verpflichtet, die Worte des Aristoteles
und seines Kommentators als feste und gewissermaßen unzweifelhafte
Wahrheit zu verkünden.[129]
*
Als Petrus Ramus um die Erlaubnis gebeten hatte, in Genf
lehren zu dürfen, erhielt er von Beza (1519–1606), dem Nachfolger
Calvins, die für die nicht eben freie Stellung der neuen Kirche zu
Aristoteles charakteristische Antwort: »Die Genfer haben ein für
allemal beschlossen, weder in der Logik, noch in irgendeinem andern
Wissenszweige von den Ansichten des Aristoteles abzuweichen.«[130]
*
Georg Kaufmann, der hervorragende Kenner unseres mittelalterlichen
Universitätswesen, urteilt über die Bedeutung der Hochschulen für die
Entwicklung der Wissenschaften wie folgt: »Alle Fakultäten hielten[S. 124] bis
ans Ende der Periode (also bis zur Reformationszeit) die Lehrziele und
die Lehrmethode fest, die ihre Statuten aus dem 14. Jahrhundert zeigen,
und soweit sie neuen Ansprüchen und Regungen Raum ließen, geschah es
fast immer auf Drängen von Personen und Behörden, die außerhalb
der Universitäten standen, oder ihnen doch nur lose und äußerlich
verbunden waren.
Der Scholar, Bakkalaureus, Lizentiat oder Doktor der Medizin des Jahres
1490 war noch ganz mit denselben Büchern, Kenntnissen und selbst Sitten
ausgestattet, wie wir ihn im Jahre 1390 verlassen haben.
Genau so verhielt es sich in der Artistenfakultät. Um 1500 verfolgte
man ungefähr die gleichen Ziele, wie um 1400 und hatte auch noch
dieselben Lehrbücher.«[131]
*
Im Jahre 1471 trug sich nach derselben Quelle ein Ereignis zu, das
selbst im Mittelalter, das an Sonderbarkeiten gewiß nicht Mangel
litt, selten war. Sechs Schustergesellen sandten nämlich der
Universität Leipzig einen Fehdebrief! Sie sagten darin, daß ihnen
von vier Scholaren Gewalt geschehen sei, ohne daß ihnen dafür Recht
geworden wäre. So wollten sie sich denn erholen an allen denen,
»dye do Studenten synt, junck adir alt«. Die Landesherren erließen
allerdings einen Befehl auf Ergreifung der sechs Schustergesellen, aber
merkwürdigerweise unter gleichzeitiger indirekter Anerkennung des
Fehderechtes. Nur weil sie nicht zuerst vor den Gerichten über das
ihnen angetane Unrecht Klage[S. 125] geführt, sondern gleich Fehde angesagt
hätten, wurde gegen sie eingeschritten. Außerdem rief die Universität
die geistliche Gerichtsbarkeit gegen die Feinde auf.
*
Ernster lief eine Affäre ab, die hier mitgeteilt werden möge, wiewohl
es sich nicht um einen Studenten handelt. Sie ist aber überaus
bezeichnend für das, was in unserem Mittelalter möglich war.
Ein Müllerknecht namens Klee hatte Forderungen an die Stadt
Mühlhausen wegen rückständigen Lohnes. Eigentlich schuldeten zwar
Meister ihm das Geld, da er aber ein frecher Bursche war, mit dem
die Stadt nichts zu tun haben wollte, kam sie für die Schuld auf
und deponierte die fragliche Summe auf seine Klage hin. Er erhob
das Geld aber nicht, vielmehr steckte er am 11. April 1466 einen
Fehdebrief an das Gatter des Baseler Tores zu Mühlhausen! Also
ein einzelner Müllerknecht, der einer ganzen Stadt die Fehde ansagt!
Bald nahm sich seiner der Ritter Peter von Regisheim an, der einige
Bürger gefangen setzte und der Stadt seinen Fehdebrief übersandte.
Andere Ritter folgten nach, so daß schließlich der Adel des ganzen
Sundgaues gegen Mühlhausen in Fehde lag. Die Geschichte zog immer
weitere Kreise und wurde Anlaß zum wenige Jahre später erfolgten
Zusammenbruch des mächtigen Reiches Karls des Kühnen von Burgund.
Kleine Ursache, große Wirkung.[132]
[S. 126]
*
Auch Differenzen zwischen Gelehrten konnten die unangenehmsten Folgen
haben.
Der Professor Flacius in Jena geriet mit seinem Kollegen Victorinus
Striegel, einem Anhänger Melanchthons, in Jena über das liberum
arbitrium und die sogenannten guten Werke in einen erbitterten Streit,
in dem Striegel, der Jenaische Professor Schnepf und der dortige
Superintendent Andreas Hugel zum höchsten Zorne ihres Gegners und
seiner Partei das »Confutationsbuch« verfaßten. Flacius brachte
die Fürsten von Weimar auf seine Seite, und da Striegel nicht zur
Zurücknahme seiner Ansichten zu bewegen war, griffen die Fürsten zu
einem eigenartigen Mittel, über das uns der Bericht des bekannten
Wittenberger Professors Justus Jonas an den Herzog Albrecht von Preußen
belehrt.
»Die jungen Fürsten zu Sachsen (Weimar) haben Victorinum bei der
Nacht in der Stadt Jena überfallen und samt dem Superintendenten
des Orts, Magister Andreas Hugel, einem frommen, gottesfürchtigen,
gelehrten, alten Mann, gefänglich, wie man Dieben und Mördern
tut, wegführen lassen.... Am heiligen Ostertag nämlich hat man
an die hundert Hakenschützen, desgleichen an fünfzig oder sechzig
Pferde, unter welchen jedoch keiner von Adel gewesen, in Weimar auf
den Abend sich rüsten lassen, ihnen aber nicht angezeigt, wem oder
wohin es gelte; denn man hat diese Dinge sehr heimlich gehalten, auch
derenthalben zwei Tage zuvor auf der Straße zwischen Weimar und Jena
gestreift, den Boten alle Briefe genommen und erbrochen, auch etliche
Wandersleute, unter welchen der junge Doktor Cornarius,[S. 127] untersucht
und wieder zurück in die Stadt Weimar geführt, auf daß Victorinus ja
nicht etwa gewarnt würde und sich (dessen er doch nie willens gewesen)
davonmachte. Folgends am Ostermontage, zwischen zwei und drei in
der Nacht, sind die Tore der Stadt Jena auf vorangehende fleißige
Bestellung geöffnet worden, Reiter und Hakenschützen hineingelassen,
welche alsbald in die zwei Gassen, darin Dr. Victorinus und der
Superintendent ihre Wohnung haben, gerückt, dem Victorinus mit großem
Ungestüm die Türe mit Äxten und Zimmerbeilen aufgehauen, und als der
fromme, ehrliche Mann aus Schrecken samt seiner tugendreichen, lieben
Hausfrau im Hemde herabgelaufen und gefragt: was da wäre? ob Feuer da
wäre? haben die Ölberger geantwortet: Was sollte da sein? Wir sind da
und wollen dich losen Bösewicht dahin führen, wohin du gehörst.
Als sein frommes Weib diese Worte gehört, hat sie Zeter und Mordio
angefangen zu schreien, durch welches Geschrei sie die Judasrotte
also erzürnt, daß einer unter den Ölbergern, sonder Zweifel ein
ehrevergessener Schelm, dem armen, erschrockenen, ehrlichen, frommen
Weibe eine Zündbüchse vor den Leib gehalten und gesagt: Schweig, du
Pfaffenhure, oder ich will eine Kugel durch dich schießen! Welche
Schmähung Dr. Victorinus verantwortet; darauf sie ihn einen Schelm
gescholten, wodurch er denn nicht unbillig bewegt und wieder gesagt:
Ei! bist du ein Schelm, so bleib einer; ich bin kein Schelm!
Dieser Lärm hat nicht lange gewährt, denn die Ölberger haben sich vor
den Studenten und der[S. 128] Bürgerschaft, wo sie des Spiels inne und wach
würden, sehr besorgt und derwegen so heftig geeilt, daß sie auch dem
frommen Manne Victorinus nicht haben Weile gelassen, daß er seine
Kleider hätte anziehen können, sondern man hat ihn im Hemde auf den
Weg gestoßen und mit Not so lange gewartet, daß man ihm die Kleider
hintennach geworfen.
Mit dem Superintendenten hat man etwas gelinder verfahren, und wie
der gemeine Laut gehet, so werden sie sehr hart gehalten und nicht so
traktiert, wie billig solche Leute, ob sie gleich ein Größeres verwirkt
hätten, gehalten und traktiert werden sollten. Gott tröste die frommen,
heiligen Leute, wehre und steuere den Teufelskindern, welche die jungen
Fürsten auf solche Umwege führen.«
In einem späteren Briefe berichtet Justus Jonas dem Herzog, daß man
noch viel brutaler, als er zuerst mitgeteilt habe, gegen die Herren
verfuhr: »Man ist nicht allein bei Nebel und Nacht in sein Haus
gefallen, Tür und Angel in Stücke zerhauen, sondern die Judasrotte ist
dem frommen, ehrlichen Manne Victorinus in seine Schlafkammer gefallen,
haben ihn auf einer Seite des Bettes gefunden, ganz bloß und gleich in
dem, daß er sein Hemd über dem Haupt und an seinen Leib gezogen. Sein
frommes, ehrliches Weib, des seligen Mannes Doktor Schneppii Tochter,
haben sie auf der andern Seite des Bettes mutterleibesnackt gefunden,
da das fromm tugendreich Weib stumm und bestürzt gestanden wie ein
Stock, sich vor Schrecken nicht regen noch besinnen können... Des alles
ungeacht haben sie ihr Büchsen und Spieß vor das Herz gehalten und sie
mit Schmähworten greulich angegriffen...«
[S. 129]
Grund zu diesem Betragen, das selbst dem Redakteur eines
regierungsfeindlichen Blatte gegenüber vielleicht sogar in Preußen
befremden würde, war die treue Anhängerschaft Victorin Striegels an
Melanchthon und die kursächsischen Theologen zu Wittenberg, die Flacius
haßte, wiewohl ihn Melanchthon früher mit Wohltaten überschüttet
hatte.[133]
*
Das Bild, das Küchelbecker von der Wiener Universität noch um 1730
entwirft, spricht Bände über die segensreiche Wirkung der Kirche in
wissenschaftlichen Fragen. Galt dort die alleinige Meinung der Kirche,
so ist das bei einem orthodoxen Hofe weniger verwunderlich. Aber das
war nicht alles. »Wir wollen nur anführen, daß die Auctorität des Heil.
Aristotelis in Philosophicis hieselbst ebenfalls infalible
ist; Dahero die hiesigen Magistri artium, als unmündige Kinder ihre
Vernunfft unter dem »Autos epha« gefangen nehmen und dessen Dogmata
beschwehren müssen. Auch in der Jurisprudenz muß man nach der alten
einfältigen Leyer derer Canonisten und Civilisten forttantzen und
beyleibe keine neuen Meinungen, auch nicht einmal exercitii gratia,
statuieren, wo man sich nicht einen Schwarm Jesuiten auf den Halß
laden will... In der Medicin hat es fast gleiche Bewandniß, die Moral
und Jus Naturae werden allhier schlecht tractiret, und fast nichts
als Fabeln und absurde Principia, deren sich ein jeder vernünfftiger
Mensch schämen muß, tradiret. Das Jus publicum und die Historie,
so wohl die Profan- als Kirchen-Geschichte, können ebenfalls nicht
aufrichtig gelehret[S. 130] werden, weil sonst die römische Kirche ziemlich
würde censiret werden müssen. Dieses alles ist auch die Ursache, warum
so viele österreichische Cavaliers, wenn sie auf Reise gehen, zu Leyden
noch eine Zeit lang studieren, und diese Studia daselbst tractiren.
Und mit kurtzen: wie ist es möglich, hinter die Wahrheit zu kommen, wo
man nicht libertatem sentiendi, ratiocinandi hat. Denn Latein und die
Metaphysique alleine machen keinen Gelehrten.«[134]
*
Am 23. Juli 1798 erschien eine »Verordnung wegen Verhütung und
Bestrafung der die öffentliche Ruhe stöhrenden Excesse der Studirenden
auf sämmtlichen Akademien in den Königlichen Staaten«. Friedrich
Wilhelm III. von Preußen erteilt darin der Polizei das früher
versagte Recht, Studenten zu verhaften, wobei sie sich nötigenfalls
militärischen Beistandes bedienen durfte. In keinem Falle sollte gegen
Studenten, die sich »Ungezogenheiten und Ausschweifungen« erlauben und
»ihren Frevel so weit treiben, daß solcher der öffentlichen Sicherheit
gefährlich geworden« auf Geldstrafen oder Relegation erkannt werden,
sondern auf Gefängnis oder körperliche Züchtigung. Unter keinerlei
Vorwand wird jemand der Zugang zu dem Gefangenen gestattet, selbst der
Gefangenenwärter darf sich mit ihm in keine Unterredung einlassen,
auch nicht einmal in das Gefängnis kommen, sondern muß mittelst einer
Drehmaschine für die Nahrung und Reinlichkeit des Gefangenen sorgen.
Bücher und Schreibmaterialien waren nicht gestattet; die Nahrung ist
»unveränderlich« gleichförmig. »Die[S. 131] Züchtigung mit Peitschenhieben«
muß als »ein väterliches Besserungsmittel angesehen, sie muß im
Gefängnisse in Gegenwart des Vorgesetzten vollstreckt, und von diesem
mit den nötigen Ermahnungen begleitet werden.«
Diese Strafe wäre unverständlich, wenn man nicht wüßte, wie die
Studenten in und außerhalb Preußens damals und früher, aber auch noch
später gehaust haben. Bonner Korpsstudenten haben uns noch im Jahre
1910 daran erinnert, daß der alte Geist des Vandalismus in unsern
Musensöhnen die Stürme der Jahrhunderte überdauert hat.[135]
*
An die großen Disputationen, eine der wichtigsten Institutionen der
mittelalterlichen Universität, die bisweilen vierzehn Tage dauerten
und in denen Berge leeren Strohs gedroschen wurden, schlossen sich
häufig Disputationen über mehr scherzhafte Probleme an. Entsprechend
der Liederlichkeit des Klerus und dem wüsten Treiben der Scholaren war
auch die Wahl des Themas. So wurde 1494 in Erfurt über das Monopol
der Schweinezunft, 1515 ebenda über Säufer und Suff (de
generibus ebriosorum et ebrietate) disputiert. In Heidelberg aber
verzapfte Joh. Grieb unter Wimpflings Präsidium 1478 oder 1479 seine
Weisheit über die Schelmenzunft (monopolium et societas des
Lichtschiffs). Im Jahre 1499 aber disputierte man über die Treue der
Kokotten (de fide meretricum) und die Treue der Beischläferinnen
der Priester (de fide concubinarum in sacerdotes). Daß bei diesen
Festakten der Fakultät,[S. 132] die vom Katheder herab gehaltenen Reden
von Zoten und unanständigen Schwänken strotzten, versteht sich von
selbst.[136]
*
Wohin es führt, wenn die Kirche die Universitäten beherrscht, lernten
wir im Mittelalter zur Genüge kennen. Jeder Gelehrte brachte seine
Studien in irgend welche Beziehungen zu ihr. So glaubte Erasmus
Rheinhold in Wittenberg, einer der bedeutendsten Mathematiker
der Reformationszeit, die Mathematik nicht höher loben zu
können, als wenn er sie als »eine Zier der christlichen Lehre
und Kirche« empfahl. Die Astronomie ward zu einer
Wissenschaft, deren letzter Zweck die Anbetung Gottes war,
wie die Geschichte das ganze Mittelalter hindurch in keinem
andern Sinne geschrieben wurde, als dem, Gott und sein Wirken zu
verherrlichen.[137]
*
A. Weishaupt erzählt, der religiöse Unterricht habe zum Teil darin
bestanden, daß die Schüler das Vaterunser rückwärts ohne Anstoß
hersagen sollten, oder angeben, wie oft et, in oder cum in dem ersten
Hauptstück des Canisius stehen usw.[138]
*
Der Exbenediktiner H. Braun, der Schulreformator Bayerns, verfaßte
einen Katechismus, der 1769 von der Universität Ingolstadt, 1771 von
fünf Ordinariaten und der Universität Salzburg begutachtet war. Ein
Kritiker rügte es, daß Braun die lateinische Wendung[S. 133] »ich glaube
in Gott Vater« im Glaubensbekenntnis abänderte in »ich glaube
an Gott Vater«. Das wird als »lutherisch-deutsch« gescholten.
»Warum sollen wir den Glauben der Lutheraner beten?« Der glaubensstarke
Mann schließt: »Wann in unser katholisches Land dererlei Katechismus
sollen eingeführet werden, wollen wir selbige zusammen sammeln und in
das Feuer werfen, damit die liebe Jugend hierdurch nicht verführet
werde und sohin fälschlich beten lerne«. Denn die genannte Übersetzung
sei eine Verfälschung der wahren Lehre, die »von niemand ohne schwäre
Sünde verteidiget und angenommen werden darf«.
*
Joh. Adam Freiherr v. Ickstatt, Professor der Rechte in Ingolstadt,
wurde als Förderer des Luthertums in öffentlicher Predigt ausgeschrien
– und der Pöbel gegen ihn gehetzt (1752), weil er – seinen
juristischen Vorlesungen Leitfäden von protestantischen
Autoren zugrunde gelegt hatte.
*
Uns allen ist noch erinnerlich, wie Ludwig Wahrmund wegen seines
Vortrages »Katholische Weltanschauung und freie Wissenschaft« im Jahre
1908, also anderthalb Jahrhunderte später, behandelt wurde. Wie die
tiroler Bauern mit Knütteln nach Innsbruck zogen, um, aufgehetzt von
ihren Seelenhirten, den Mann zu erschlagen, der es gewagt hatte, Dinge
zu sagen, die schließlich jedes Kind mit der Mutterbrust einsaugt, die
aber einem unter jahrhundertelang fortgesetzter Verdummung leidenden
Volke als Revolution und Anarchismus erscheinen. Wir erinnern uns auch,
wie große Parteien den Mann am[S. 134] liebsten totgeschlagen hätten, weil er
anders denkt als sie. Die anschließenden Fälle Schnitzer, Tremel, die
Modernistenhetze beweisen, daß die Sache blieb, nur die Form hat sich
geändert.
Daß es aber sogar eine mächtige Partei gibt, die, wenn auch nicht diese
Form, so doch die Opferung des Intellekts der Autorität billigt, ja
bewundert, und zwar im 20. Jahrhundert, ist nicht ohne Interesse.
Der Jesuit Donat legt u. a. die Gefahren dar, die aus der
Berechtigung jedermanns, sich ein selbständiges Urteil zu bilden,
folgten. Die »krankhafte Zweifelsucht« unserer Zeit, sei eine giftige
Atmosphäre, die den empfänglichen Geist, der sich lange in ihr
aufhalte, anstecke, ohne daß er es merkt.
Man könnte das ja auch so ausdrücken: die Summe der Erfahrungen, die
mit den kirchlichen Dogmen kollidieren, ist so groß, daß auch der
Blinde es langsam merkt und sich weigert, das Sacrificium intellectus
zu bringen.
Köstlich ist die instinktive Angst vor der Wahrheit und dem
unaufhaltsamen Vordringen der weltlichen Freiheit im Gegensatz zur
kirchlichen Unfreiheit, wie sie sich in Aussprüchen großer Katholiken
oder gar Heiliger dokumentiert. »Kardinal Mai« war ein Mann der
Wissenschaft. Er sagte – und dafür können wir einstehen –: »Ich habe
auch die Erlaubnis, verbotene Bücher zu lesen; ich benutze dieselbe
aber nie und habe auch nicht vor, sie zu gebrauchen.«
Als der gelehrte Muratori eine Schrift zur Widerlegung eines
häretischen Buches schrieb, entschuldigte er sich in der Einleitung:
»Spät gelangte dieses Buch in meine Hände... und ich konnte es nicht
über[S. 135] mich bringen, es zu lesen. Denn zu welchem Zwecke anders, als um
selbst der Torheit zu verfallen sollte ich die Schriften der Neuerer
lesen? Ich suche und liebe solche, die mich in der Religion bestärken,
nicht solche, die mich von ihr abwendig machen.«
Der Hl. Franz von Sales dankt in seinen Schriften mit rührender
Einfallt Gott dem Herrn, daß er ihn bei der Lesung derartiger Bücher
vor dem Verlust seines Glaubens bewahrt habe.
Der gelehrte spanische Philosoph Balmes sagte einst seinen Freunden:
»Ihr wißt, daß der Glaube tief in meinem Herzen wurzelt. Und dennoch
kann ich kein verbotenes Buch lesen, ohne das Bedürfnis zu fühlen, mich
wieder durch das Lesen der Hl. Schrift, der Nachfolge Christi und des
gottseligen Ludwig von Granada in die rechte Stimmung zu versetzen.«
Während es überall für verdienstvoll um nicht zu sagen anständig gilt,
sich durch Gründe überzeugen zu lassen, während der vorwärtsstrebende
Mensch begierig alles in sich aufnimmt, was ihm hilft, alte Irrtümer
gegen neue Wahrheiten einzutauschen, wird also heute noch in der Kirche
der am höchsten angesehen, der sich gewaltsam Scheuklappen vorbindet
und der Wahrheit aus dem Wege geht.[139]
*
Bekanntlich herrscht an unseren Universitäten nicht nur Lern-,
sondern auch Lehrfreiheit. Autoritäten, ein jurare in verba magistri
existiert de jure nicht mehr. Wohl aber de facto. Oder wie läßt sich
die Tatsache, daß weder Atheisten, noch Sozialdemokraten, noch an
protestantischen Universitäten, z. B. Halle,[S. 136] Katholiken – und zwar
auch für Lehrfächer, die mit der Kirche weder direkt noch indirekt
etwas zu tun haben – zugelassen werden? Es ist dieselbe Sache in
anderer Form: Aufrechterhaltung des Status quo um jeden Preis und
Bekämpfung des Geistes mit materiellen statt mit geistigen Waffen.
*
Werfen wir noch einen flüchtigen Blick auf den Unterricht des Volkes.
In der Zirkularverordnung über die Garnisonschulen vom 31.
August 1799 entwickelt Friedrich Wilhelm von Preußen u. a. folgende
Gedanken: »... Ein mit diesen Eigenschaften ausgerüsteter Soldat
wird auf seinem Platze gewiß ein brauchbarer Diener des Staates, und
zugleich ein glücklicher Mensch sein, wenn niemand das Bestreben nach
höheren Dingen in ihm zu erwecken sucht. Der Keim zur Unzufriedenheit
mit seinem Stande wird sich aber in eben dem Grade entwickeln, in
welchem man seinen wissenschaftlichen Unterricht weiter ausdehnt. Nur
wenige Menschen der unteren Volksklasse sind von der Natur so sehr
verwahrloset, daß sie nicht die Fähigkeit haben sollten, etwas mehr
zu leisten, als ihr Stand von ihnen erfordert, und sich dadurch auf
irgendeinem Wege über denselben zu erheben. Ein zu weit gedehnter
Unterricht wird das Gefühl solcher Fähigkeiten in ihnen rege machen,
durch deren Anwendungen sie sich leicht ein günstigeres Schicksal, als
das eines gemeinen Soldaten ist, würden verschaffen können...«[140]
Die Antwort war – Jena!
[S. 137]
*
Im selben Geiste war der Volksschulunterricht gehalten. Der Hofprediger
Sack, der einer Verbesserung des Volksschulwesens das Wort redete,
erörterte noch die Frage, ob Lesen und Schreiben Lehrgegenstand sein
sollen, da doch der Nutzen dieser beiden Kenntnisse für den Landmann
sehr gering sei, während hingegen die Anpreisung der Taten der
Landesfürsten unbedingt von der Schule besorgt werden müsse.[140]
Das ist ja auch noch in unserm Geschichtsunterricht nicht gerade
nebensächlich.
*
Übrigens, war nach dem Lehrermaterial zu urteilen, die von Friedrich
Wilhelm gefürchtete Gefahr einer Überladung des Volkes mit gelehrter
Bildung nicht sehr groß. Invalide Soldaten versahen vielfach
den Unterricht und ihre Vorbereitung bestand darin, daß man sie fürs
Einpauken von Gesangbuchversen eine Zeitlang abrichtete. Nebenbei
hatten die Landlehrer noch allerlei andere Erziehungspflichten, z. B.
die erst 1802 ihnen abgenommene, den Hebammen einen Katechismus für
Geburtshilfe zu erklären!
Das Diensteinkommen der Landlehrer in der Mark Brandenburg betrug zu
Beginn des 19. Jahrhunderts: in zwei Fällen zwischen 220 und
250 Taler jährlich, dagegen in 155 Fällen unter 10 Talern; 182 bezogen
zwischen 10 und 20 Talern, 263 zwischen 20 und 40 Taler, 167 zwischen
40 und 60 Taler, 131 zwischen 60 und 80 Taler. 92 zwischen 80 und
100 Taler und 151 über 100 Taler. Das war allerdings ein gewaltiger
Fortschritt gegenüber den Zuständen von 1774, denn[S. 138] damals besass
die Kurmark nur 49 Landlehrer mit mehr als 100 Talern Jahresgehalt,
184 aber bezogen 10 Taler und weniger, 111 weniger als 5 Taler und
163 gar kein Gehalt. Deshalb betrachteten die Lehrer den Unterricht
als Nebensache und übten dabei ihren Beruf aus. In der Kurmark
besassen 1806 2026 Dörfer weder Schule noch Lehrer. Friedrich Wilhelms
Bestrebungen hatten somit durchschlagenden Erfolg. Übrigens war auch
in väterlicher Weise dafür gesorgt, daß die Kinder nicht durch Studium
des Lesens und Rechnens dem geistigen Hochmut überliefert würden. Die
Teilnahme an diesen Stunden war nämlich wahlfrei und kostete erhöhtes
Schulgeld, das viele Eltern zu zahlen nicht in der Lage waren.[141]
*
Auch auf den Gymnasien war zu Anfang des 19. Jahrhunderts der
Unterricht selbst für uns, so wenig wir darin verwöhnt sind,
hinlänglich befremdlich. Franz Neumann (1798–1895) erzählt z. B.
in seiner bekannten, von seiner Tochter Luise veröffentlichten
Lebensgeschichte (Tübingen 1904), daß er auf dem Berliner Gymnasium
lateinische Pflanzennamen hätte lernen müssen, ohne auch nur
zu wissen, daß er nun botanischen Unterricht habe.
*
Zum Schluß noch eine Tatsache, die zu denken gibt. Bekanntlich besitzt
München in der Person des Schulrats Kerschensteiner eine Koryphä
allerersten[S. 139] Ranges. Wie sehr trotzdem der Geist des Hl. Bureaukratius
in unserem Schulwesen steckt, erhellt daraus, daß einige Schulen
den Unterricht ruhig weiter erteilten und die Kinder im
Klassenzimmer beliessen, als Graf Zeppelin am 1. und 2. April 1909
sein Luftschiff über München lenkte![142]
[S. 140]
Sechster Abschnitt
Zensur und Prüderie
Am 26. April 1794 erließ König Friedrich Wilhelm II. von Preußen
folgendes »Reskript an das Kammergericht wegen der Mißbräuche, die
bei der Zensur zu deren Verteilung überhand genommen«: »daß dem
Unwesen, welches seit einiger Zeit mit Schriften getrieben wird,
die entweder den Grund aller Religion überhaupt angreifen, und
die wichtigsten Wahrheiten derselben verdächtig, verächtlich oder
lächerlich machen wollen, oder aber die christliche Religion, die
biblischen Schriften, und die darin vorgetragenen Geschichts- und
positiven Glaubenswahrheiten, für das Volk zu Gegenständen des
Zweifels oder gar des Spottes zu machen, sich unterfangen, und dadurch
zugleich die praktische Religion, ohne welche keine bürgerliche
Ruhe und Ordnung bestehen kann, in ihren Grundfesten erschüttern;
im gleichen solchen Schriften, worin die Grundsätze der Staats- und
bürgerlichen Verfassung angetastet, Maßregeln der Regierung aus
unrichtigen und gehässigen Gesichtspunkten dargestellt, Ungehorsam
und Wider[S. 141]spänstigkeit gegen Gesetze und Obrigkeiten verteidigt, oder
doch die Gemüter zu unnützen Grübeleien über Gegenstände,
welche die Fassung- und Beurteilungskraft des großen Haufens der
Leser übersteigen, aufgefordert, und zu unrichtigen Anwendungen
mißverstandener theoretischer Sätze verleitet werden, mit dem größten
Ernst und Nachdrucke entgegengearbeitet, gegen diejenigen aber, welche
den ergangenen Zensur-Gesetzen auf irgend eine Art zuwiderhandeln,
nach aller Strenge dieser Gesetze, ohne die geringste Nachsicht oder
Schonung verfahren werden soll.«[143]
In dem »General-Privilegium und Gülde-Brief für die Schwarz- und
Weiß-Nagel-Schmiede zu Alt-Stettin, auch für sämtliche Schwarz- und
Weiß-Nagel-Schmiede in Vor- und Hinter-Pommern. De Dato Charlottenburg,
den 29. July 1802« heißt es im Artikel XXI:
»Alles Korrespondieren mit anderen ein- oder ausländischen
Gewerken, soll sich das Gewerk bei schwerer Strafe enthalten,
wenn aber besondere Umstände etwa dergleichen erforderten, soll es mit
Zuziehung des Beisitzers, auch wohl nach Befinden mit Vorwissen des
Magistrats, selbst geschehen, wie denn auch, wenn von den anderen ein-
oder ausländischen Gewerken Schreiben einliefen, solche unerbrochen an
den Beisitzer gebracht, in dessen Gegenwart eröffnet, und die Antwort
mit demselben verabredet werden soll.«
Aber die preußische Regierung hatte nicht nur Angst vor eventuellen
Verschwörungen der Zünfte und hielt sie deshalb unter ständiger
polizeilicher[S. 142] Kontrolle, sie fürchtet auch die Gesellen und
verbietet ihnen deshalb das Briefeschreiben.
Der Artikel XXXIV des genannten Privilegs lautet:
»Alles Briefwechselns mit andern Gesellschaften oder sogenannten
Brüderschaften haben sich die Gesellen bei empfindlicher Strafe zu
enthalten, weshalb ihnen auch kein Siegel gestattet wird. Die etwa
von anderen ein- und ausländischen Brüderschaften eingehenden Schreiben
sollen aber nach der Verordnung vom 23. März 1799 sofort dem Magistrat
in Vorschlag genommen, und von demselben nach Befinden des Inhalts die
Aushändigung an die Gesellen oder deren Kassierung verfügt werden.«[144]
*
Im Jahre 1794 las in Zelle eine Gesellschaft mit Vergnügen den
Moniteur, den sie aus Bremen erhielt. Seit Mitte Mai des Jahres blieb
das Blatt aber aus. Die Zellische Gesellschaft wandte sich daher an
ihren Lieferanten und erhielt die Antwort, daß der Moniteur, sowie alle
französischen Zeitungen den kaiserlichen Postbeamten »bey nahmhafter
Strafe und nach Befinden der Kassation« zu debitieren verboten wären.
»Von dem Verbote sind blos Fürstlichkeiten, wirkliche Minister und
Gesandte an fremden Höfen ausgenommen, an deren offene Adressen die
Zeitungen gehen müssen.« Schon in anderen deutschen Provinzen war ein
ähnliches Verbot vorhergegangen. Mit diesen Mittelchen hoffte man
die Wirkungen der grossen Revolution fern zu halten. Allerdings[S. 143]
nimmt Archenholz »eine Abwesenheit der Weisheit« bei Erlaß dieser
Maßnahme an.[145]
*
Zur Zeit des Vatikanischen Konzils kam der Verlagsbuchhändler
Josef Bachem zum hochbetagten Präses des Priesterseminars in Köln,
Dr. Westhoff, um ihm sein Bedenken gegen das Unfehlbarkeitsdogma
vorzutragen. Der Greis zeigte ihm darauf in der Bibliothek des Seminars
nicht weniger als sechzehn Katechismen, die im 18. Jahrhundert in der
Erzdiözese Köln in Gebrauch gewesen waren und die sämtlich und ohne
Ausnahme die Lehre von der päpstlichen Unfehlbarkeit in Sachen der
Glaubens- und der Sittenlehre klar und deutlich vortrugen. Erst die
preußische Zensur, wie sie vor 1848 bestand, hat diese Lehre aus dem
kirchlichen Katechismus gestrichen![146]
Die historisch-politischen Blätter begannen im Jahre 1840 (S. 586)
einen Artikel folgendermaßen: »In Preußen sind nun fast alle
katholischen Journale und Zeitungen verboten und, um die Sache
ab ovo zu beginnen, hat man, willkommene Gelegenheit ergreifend,
buchhändlerische Interdikte gegen künftig erscheinende noch ungeborene
Werke in Maße geschleudert oder ihre Verbreitung in einer Weise
erschwert, daß es einem Verbote gleichzuachten ist.«
Unter der Maske des Liberalismus hat bekanntlich Bismarck im
sogenannten Kulturkampf aufs rücksichtsloseste die katholische
Presse verfolgt, wie er ja un[S. 144]beschadet seiner sonstigen kaum zu
überschätzenden Größe skrupellos und gewalttätig gegen alles vorging,
was sich ihm nicht beugte. Deshalb zieht Bismarck als endlosen
Kometenschweif, in dem wir heute noch leben, jene Atmosphäre des
Servilismus und der Duckmäuserei nach, die nicht weniger Sklavennaturen
züchtete, als der Absolutismus. Doch war die kleinstaatliche
Vergangenheit uns in einem voraus: wer wegen seiner Meinungen in Reuß
jüngere Linie verfolgt wurde, siedelte in die ältere Linie über und
konnte seiner Überzeugung treu bleiben. Im geeinten Deutschland reichte
Bismarcks Arm überall hin.
Damals veranstaltete die Frankfurter Zeitung eine Zählung der
Verurteilungen wegen Preßvergehen. Wiewohl sie auf Vollständigkeit
nicht im entferntesten Anspruch macht, stellt sie im Januar 1875 21,
im Februar 35, im März 39, im April 42 verurteilte Zeitungsherausgeber
fest. Es wurden also in vier Monaten 137 Pressdelinquenten mit
Geldbußen oder Gefängnis bestraft. Außerdem fanden in derselben Zeit 30
Konfiskationen von Zeitungen statt. Gegen vier Redakteure der Germania
waren einmal zu gleicher Zeit Prozesse und Bestrafungen im Gange. Aber
mehr als das: In mindestens drei katholischen Blättern haben sich
nachweislich Bedienstete der Berliner Geheimpolizei in Stellungen von
Mitredakteuren eingeschmuggelt, bisweilen sogar über Jahr und Tag
hinaus. Sie hatten nicht nur Spionendienste, sondern auch solche als
agents provocateurs, die die Leiter der katholischen Blätter zu
extremen Äußerungen anzutreiben versuchten, zu verrichten.[147]
[S. 145]
Im Jahre 1845 erschien folgender Katalog: »Index librorum prohibitorum.
Katalog über die in den Jahren 1844 und 1845 in Deutschland verbotenen
Bücher. Erste Hälfte.« Die zweite Hälfte erschien 1846. Wiewohl
der Index nicht vollständig ist, da die Verbote von Zeitungen und
Zeitschriften nicht aufgenommen wurden, enthält er 437 durch 570
Verbote untersagte Schriften. Man sieht, die weltliche Regierung kann
es auch.
*
Nicht viel besser als gegen die katholische Kirche verfuhr man gegen
die Sozialisten. Nachdem gegen sie ein Ausnahmegesetz geschaffen
war, erschien 1886 ein förmlicher Index librorum prohibitorum. Er
lautet: »Sozialdemokratische Druckschriften und Vereine verboten auf
Grund des Reichsgesetzes gegen die gemeingefährlichen Bestrebungen
der Sozialdemokratie vom 21. Oktober 1878« (1886). Zwei Jahre
später erschien ein Nachtrag. Nach den amtlichen Angaben kommen im
Durchschnitt 130 verbotene Schriften je auf ein Jahr, also wurden
in den zwölf Jahren des Bestehens des Gesetzes rund 1500–1600
Drucksachen verboten.[148]
*
Doch nun zum römischen Index!
Auf ihm stehen neben Rankes »Römischen Päpsten« Kants »Kritik der
reinen Vernunft« gegen die schon Friedrich Wilhelm II. von Preußen in
einer Kabinettsorder unter Minister Möller eingeschritten war, und[S. 146]
Baruch Spinoza. Für letzteren ist das nichts Außerordentliches, da
zwischen 1656 und 1680 über 500 scharfe Verbote gegen die Schriften
dieses großen und edlen Juden erlassen worden waren.[149]
Man kann ohne Übertreibung sagen, daß in den letzten Jahrhunderten
nicht ein einziger großer Denker oder Dichter lebte, dessen Name nicht
auf einem der katholischen Indices zu finden war oder ist. Wer bei
Reusch das Namenverzeichnis durchblättert, glaubt sich in eine geistige
Ruhmeshalle versetzt.
*
Im Jahre 1890 sollte im Lessingtheater in Berlin Sudermanns »Sodoms
Ende« aufgeführt werden. Wiewohl nun Preßfreiheit auch in Preußen
besteht und der Artikel 27 der preußischen Verfassung jedem Preußen das
Recht der freien Meinungsäußerung verbürgt und ausdrücklich verfügt,
daß eine Zensur nicht eingeführt werden dürfe, existiert sie doch. Und
zwar nach einer Polizeiverordnung vom 10. Juli 1851 – also anderthalb
Jahre nach der Verfassung erlassen – in der festgesetzt wird, daß die
Erlaubnis zur Veranstaltung einer öffentlichen Theatervorstellung beim
kgl. Polizeipräsidium schriftlich nachgesucht werden müsse.
Das hatte Oskar Blumenthal, der Direktor des Lessingtheaters, auch
mit »Sodoms Ende« getan. Als kein Bescheid von der Polizei einlief,
aber alles für die erste Aufführung, mit Kainz und in Gegenwart des
Dichters, vorbereitet war, wurde Blumenthal stutzig. Drei Tage vor dem
Aufführungstermin fuhr er nach dem Polizeipräsidium, wo ihm mitgeteilt
wurde, daß[S. 147] der Theaterzensor die Erlaubnis bereits unbedenklich
erteilt hatte, als der Präsident, Freiherr von Richthofen, sich das
Werk hatte kommen lassen und die öffentliche Aufführung verbot. –
Blumenthal ging darauf zum Polizeigewaltigen persönlich, um die Gründe
für das Verbot zu erfahren. Es entwickelte sich folgendes Gespräch, das
er selbst veröffentlicht:
»Ich höre soeben, Herr Präsident, daß mir drei Tage vor der ersten
Aufführung Hermann Sudermanns Drama »Sodoms Ende« verboten werden soll?«
»Das stimmt!«
»Und daß Sie persönlich das Verbot verfügt haben?«
»Stimmt auch!«
»Ja, aber bedenken Sie die Situation eines Bühnenleiters, Herr
Präsident! Vierzehn Tage angestrengter Bühnenproben... ein Gastspiel
mit Joseph Kainz für diese Novität abgeschlossen... der ganze
Spielplan der nächsten Wochen darauf aufgebaut... selbstverständlich
kein Ersatzstück vorbereitet... die Erfolge des früheren Repertoires
ausgeschöpft... das Haus für die ersten drei Vorstellungen schon
vollständig ausverkauft... und nun diese Ratlosigkeit auf der Höhe der
Saison, in der besten Zeit des Theaterjahres.«
»Alles sehr traurig, aber die Behörde kann auf Privatinteressen keine
Rücksicht nehmen.«
»Aber warum das Verbot, warum?«
»Weil es uns so paßt.«
»Ich verstehe vollkommen, Herr Präsident... Sie wollen mir durch diesen
Lakonismus ins Gedächtnis rufen, daß nach der polizeilichen Verordnung[S. 148]
vom 10. Juli 1851 die Behörde nicht verpflichtet ist, für das Verbot
eines Stückes Gründe anzugeben...«
»Na, da wissen Sie ja also Bescheid!«
»Ich meine aber nur, Herr Präsident, daß doch immerhin die Möglichkeit
vorliegt, durch behutsame Änderungen die Bedenken, die zu diesem Verbot
geführt haben, aus der Welt zu schaffen. Vielleicht sind es nur einige
gewagte Stellen, um die es sich handelt?«
»O nein!«
»Oder einzelne Szenen?«
»Auch nicht!«
»Ja, aber was sonst?«
»Die janze Richtung paßt uns nicht.«[150]
So geschehen in Deutschland am Ende des 19. Jahrhunderts. Wie glücklich
eine Kunst, die unter polizeilicher Obhut stehen darf!
Blumenthal war hierauf beim Minister des Innern, Herrfuth. Er las das
Stück, veranlaßte einige kleine Milderungen und riet Blumenthal, es
wieder dem Polizeipräsidenten zu unterbreiten.
Die Antwort des Polizeipräsidenten vom 27. Oktober 1890 – die
Unterredung hatte am 23. stattgefunden – lautete:
»Ew. Wohlgeboren!
erwidere ich auf das gefällige Schreiben vom 24. d. M. bei Rückgabe
der Anlage desselben, ergebenst, daß ich auch nach nochmaliger
Erwägung mich nicht veranlaßt sehen kann, die Genehmigung zur
Aufführung des Dramas »Sodoms Ende« zu erteilen, da dasselbe in
seiner ganzen Anlage und Durchführung geeignet erscheint, das
sittliche Gefühl zu verletzen, dieses[S. 149] sittenpolizeiliche Bedenken
daher durch die von Ihnen angebotene Streichung einzelner besonders
anstößiger Stellen nicht behoben werden kann.«
Am 31. Oktober hob der Minister des Innern diese Verfügung auf, nachdem
eine Generalprobe nur in Gegenwart dreier Ministerialräte über die
Existenzberechtigung der »neuen Richtung« entschieden hatte, ein
Eingreifen, das nicht ohne Tadel von allerhöchster Stelle geblieben
ist. »Sie hätten sich fragen sollen,« sagte der Kaiser dem Minister,
»ob Sie auch in Begleitung Ihrer Tochter jede Szene anhören
könnten.«
*
In Blumenthals und Kadelburgs Schwank »Die Großstadtluft« wurde durch
Reskript vom 26. November 1891 angeordnet, die Verse zu streichen:
»Nun bin ich ledig aller Erdenplag’. Mich kann kein Glück, kein Hoffen
mehr betrügen. Und wenn einst naht der Auferstehungstag, ich bleibe
liegen.« Die Polizei fürchtete, sie könnten durch Verspottung des
Auferstehungsglaubens ärgerlich wirken![151]
*
Da wird es sich hinfort empfehlen, es so zu machen wie die
Venezianischen Autoren des 18. Jahrhunderts.
Unter ihnen herrschte ein sonderbarer Brauch, von dem Keyßler
berichtet: »Bey den italienischen Opern ist noch zu bemerken, daß
die Verfertiger ihrer Texte gemeiniglich auf den ersten Blättern der
gedruckten Exemplare sich mit einer ausdrücklichen Protestation
verwahren, wie sie im Herzen rein[S. 150] katholisch wären, und man die im
Texte vorkommenden Worte von Idolo, Numi, Deità, Fato, Fortuna, Adorare
und dergleichen nicht anders als poetische Scherze anzusehen habe.«[152]
*
In dem Schauspiel »Falsche Heilige« verläßt eine junge Frau ihren
Gatten, weil sie erfahren hat, daß er vor seiner Verheiratung eine
Gouvernante verführt hat. Ihr Onkel, ein Pariser Lebemann, faßt seine
Meinung in folgende Worte zusammen: »Ich bitte Sie! Da will sich meine
Nichte von ihrem Mann scheiden lassen, weil er früher einmal, vor der
Ehe, eine Gouvernante... Ja, das ist doch einfach lächerlich! Wann soll
man denn mit einer Gouvernante eine Liebschaft haben? Vor der Ehe darf
man nicht. In der Ehe kann man nicht. Nach der Ehe will man nicht....
Oder sollen die Gouvernanten vielleicht überhaupt abgeschafft werden?«
Gottlob rettete der Stift des Zensors Deutschlands Sittlichkeit durch
Tilgung dieser furchtbaren Stelle. Von diesem Tage an wurden bisweilen
die Aufführungen des Lessingtheaters von dem Revierwachtmeister mit dem
Textbuch in der Hand überwacht, und jede Abweichung vom polizeilich
gestatteten Text zur Kenntnis des Zensors gebracht. Man hatte diese
schrecklichen Worte nämlich von der Bühne aus nochmals zur großen
Heiterkeit des Publikums gesprochen, was Blumenthal eine sehr scharfe
Vermahnung eingetragen hatte.[153]
[S. 151]
*
Mit Recht wird unsere Jugend vor allem Unsittlichen behütet. Hier hat
der Zensor eine besonders dankbare Aufgabe, der er sich mit größter
Gewissenhaftigkeit unterzieht.
In den »Liedern für die deutsche Volksschule«, herausgegeben vom
Bezirkslehrerverein München, Heft 1, 2, 3 (München 1894 ff.), besitzen
wir ein Werk, dessen segensreiche Wirkung auf die Seelen unserer Kinder
nicht hoch genug zu bewerten ist. Zwar heißt es auf S. 4 im II. Heft
ausdrücklich: »Stets wurde darauf gesehen, die Volkslieder nach Melodie
und Text in ihrer ursprünglichen Form wiederzugeben«, aber darum nur
keine Angst! Selbst die keusche Seele eines Lizentiatus Bohn kann das
Buch ohne Gefahr für ihren Frieden lesen. Das werden wir beweisen.
Hölty, augenscheinlich ein recht frivoler Geselle, singt in seinem
»Mailied« (I, 27):
»Haltet Tanz
Auf grünen Auen,
Ihr schönen Frauen!«
So ein Skandal! Nun, Ballhorn – pardon! der Bezirkslehrerverein war
sich der drohenden Gefahr für die Knaben der 1. und 2. Schulklasse
bewußt und griff mit anerkennenswerter Energie selbst zur Leier und die
Muse küßte ihn mit hörbarem Schmatzen. Er singt:
»Pflückt einen Kranz
Und haltet Tanz
In grünen Hainen,
Ihr lieben Kleinen.«
[S. 152]
Für diesmal wären also die Kinder noch vor den Fallstricken der Erotik
bewahrt geblieben.
Daß in Goethes »Frühzeitiger Frühling« (III, 79) die obszöne letzte
Strophe:
»Saget, seit gestern,
Wie mir geschah,
Liebliche Schwestern,
Liebchen ist da!«
gestrichen wurde, versteht sich von selbst. Nun hat aber derselbe
greuliche Heide auch ein »Sommerlied« gedichtet, in dem die gefühlsrohe
Strophe:
»Ach, aber da,
Wo Liebchen ich sah,
Im Kämmerlein,
So nieder und klein –!«
vorkommt. Das schreit ja geradezu nach Umdichtung. Gottlob verhallte
der Ruf nicht ungehört. Todesmutig bestieg der Herausgeber den Pegasus
und machte seinem gequälten Herzen in folgenden Perlen Luft:
»Als ich im Hei-
Mattale dich sah,
O Hüttelein,
So nieder und klein.«
Wie schön!!
Eichendorff in seiner ganzen Leichtfertigkeit offenbart sich im »Frohen
Wandersmann« (II, 10). Er wagt da zu singen:
»Die Trägen, die zu Hause liegen,
Erquicket nicht das Morgenrot,
Sie wissen nur von Kinderwiegen,
Von Sorgen, Last und Not ums Brot.«
[S. 153]
»Kinderwiegen«, man denke! Natürlich waltete der Zensor seines Amtes.
Wie hätte er auch die Phantasie der ihm anvertrauten Jugend durch solch
schlüpferige Bilder vergiften lassen dürfen?
Starken Toback setzt Arndt in seiner »Frühlingslust« (III, 36) seinen
Lesern vor. Die 6. Strophe lautet:
»Juchei! alle Welt!
Juchei in Liebe!
Liebeslust und Wonneschall,
Erd’ und Himmel halten Ball.«
Liebeslust – Wonneschall und dann noch einen Ball! Das ist entschieden
zu viel. In der richtigen Erwägung, die sträflichen Orgien dieser Welt
dürfen nicht in die Schule verpflanzt werden, strich der Herausgeber.
Schade, daß wir so um eine Bereicherung unserer Poesie gekommen sind.
Wie schön hätte er das umdichten können! Aber vielleicht war es doch
besser so, wenn auch nicht für unsere Literatur, so doch für die
Unverdorbenheit der Kinder.[154]
*
Der preußische Kultusminister hat das »Lesebuch für höhere
Mädchenschulen« von Karl Hessel, das bereits in 6. Auflage vorliegt,
für die paritätische höhere Mädchenschule in Kreuznach verboten wegen
konfessioneller und moralischer Bedenken. Ausdrücklich sind zwei
Bedenken ersterer Art angeführt: erstens heißt es in Peter Roseggers
humoristischer Erzählung »Der Gansräuber«, daß die Staudenbäuerin bei
der Nachricht von der Ermordung ihrer Martins[S. 154]gans entrüstet ausgerufen
habe: »Das ist ja eine Todsünde gegen den heiligen Martinus!« Es ist
ohne weiteres klar, daß eine solche mangelhafte Beschlagenheit der
Staudenbäuerin in der Dogmatik mit Rücksicht auf die verhängnisvollen
Wirkungen auf die Seelen der höheren Töchter nicht geduldet werden kann.
Dann hat auch Freiligrath in seinem berühmten Gedicht »Am Baum der
Menschheit drängt sich Blüt’ an Blüte«, in dem er die Völker und
Länder mit Blüten vergleicht, in höchst sträflicher Weise auf den
paritätischen Charakter der Schule nicht Rücksicht genommen.
Er spricht nämlich den Gedanken, mit Luthers Auftreten sei eine
Blütezeit angebrochen, als Zukunftsaussicht des Reformators aus. Vor
katholischen Ohren! Man denke! Wie könnten da die Seelen der armen
Schäflein in Anfechtungen fallen!
Die schrecklichen Verse lauten:
»Der Knospe Deutschland auch, Gott sei gepriesen!
Regt sich’s im Schoß! Dem Bersten scheint sie nah,
Frisch, wie sie Hermann auf den Weserwiesen,
Frisch, wie sie Luther vor der Wartburg sah!«
Nicht minder gefahrdrohend wie für das Glaubensleben der Kinder ist das
genannte Buch für ihre Moral. In dem Märchen vom Schlaraffenland heißt
es nach Bechsteins Erzählung, dort flögen gebratene Tauben den Leuten
ins Maul, auch müsse man sich durch einen Reisbrei durchfressen,
um ins Land zu kommen. Solche Ausdrücke, sagt der Minister –
übrigens mit Recht –, dürften Mädchen nicht in den Mund nehmen. Aber
einen solch gesegneten Appetit,[S. 155] daß man sich durch einen Reisberg
durch»essen« kann, hat doch nicht jeder!
In Hebels Gedicht »Der Schneider in Pensa« wird erzählt, wie ein
wohlhabender deutscher Schneider 1812 badische Soldaten zu Pensa in
Rußland bewirtet habe. Es heißt da, der Schneider habe sich schon
vorher auf solche Einquartierung gefreut; er liebte sie, sagt Hebel,
schon zum voraus ungesehenerweise, wie eine Frau ihr Kindlein schon
liebt und ihm Brei geben kann, ehe sie es hat.
Diesen Satz bezeichnet der Minister als anstößig![155]
*
Die Tugendhaftigkeit unserer Zeit macht keineswegs vor der Kastration
von Gedichten und Volksliedern halt. Sie hat auch rückwirkende Kraft.
Jeder wahre Tugendheld muß sein Herz höher schlagen hören, wenn er
wahrnimmt, daß nichts so klein oder kleinlich ist, daß die Sittlichkeit
sich nicht seiner bemächtigt.
Ein Beispiel für viele: Ungezählte Jahre stand in den
Schülerverzeichnissen, die den Jahresberichten der bayerischen
Gymnasien angehängt sind, unter der Rubrik »Stand des Vaters« Privatier
etc. Das ist nunmehr insofern geändert, als bei unehelichen Kindern in
diesem Falle Privatiere stehen würde, also der Stand der Mutter! Die
Folge dieser sittenstrengen Maßnahme ist klar. Die Kinder werden mit
der ihnen eigenen Grausamkeit sich die Schande der Eltern, oder das,
was die Spießbürger so zu nennen pflegen, vorwerfen und damit einen
Wermuttropfen in die Seele des schuldlosen Opfers träufeln. Aber[S. 156] was
schadet das weiter? Wenn nur die Moral gerettet wurde![156]
*
Mit der Prüderie der Behörden und Geistlichkeit kontrastiert
ganz merkwürdig das Verhalten in der Beichte. Der Redakteur der
Aschaffenburger Zeitung Pepi Matthes hat vor einigen Jahren unter
dem Titel »Wenn Kinder beichten. Eine Anklage« ein Schriftchen
herausgegeben, das inzwischen recht selten geworden ist und in dem er
seine Erfahrungen mit dem Beichtstuhl voller Entrüstung veröffentlicht.
Seine Zentrumsgegner denunzierten ihn darauf, er wurde in eine sehr
unangenehme Untersuchung verwickelt und die Schrift konfisziert. Aber
da es ihm gelang, den Wahrheitsbeweis zu erbringen, mußte das Verfahren
nach § 184 Abs. 1 RStrGB. eingestellt und die Broschüre frei gegeben
werden.
Statt nun, daß die Frommen voller Entrüstung sich vom System der
Beichte oder mindestens dessen Handhabung abgewandt hätten, verfolgen
sie Matthes heute noch mit Feuereifer nach dem altbewährten deutschen
Prinzip, nicht den Brandleger zu bekämpfen, sondern den Passanten, der
»Es brennt« ruft.
Bezeichnend für die Kampfesweise ist u. a. der in Nr. 410 der
Münchener Neuesten Nachrichten vom Jahre 1909 abgedruckte Brief des
Gymnasialrektors Dr. J. Straub. Darin heißt es: »... Wohl aber begab
ich mich vor einiger Zeit... zu sämtlichen hiesigen Buchhandlungen
und erklärte dort, ich müßte den Schülern das Betreten ihrer
Geschäftsräume unter Androhung der schwersten Strafen verbieten, wenn[S. 157]
sie das angedeutete Preßerzeugnis auf Lager hielten. Damit tat ich
lediglich meine Pflicht und erfüllte einen ausdrücklichen Auftrag des
k. Staatsministeriums. Auch an Herrn Bürgermeister Dr. Matt wandte
ich mich mit der Anfrage, ob von Polizei wegen gegen die Verbreitung
solcher Produkte nicht vorgegangen werden könnte.«
In diesem Schriftchen, dessen Wahrheit also gerichtlich festgestellt
wurde, finden sich folgende Proben aus der Beichte:
Ich war 14 Jahre alt und legte meine Osterbeichte ab.
»Hast du Unzüchtiges getan?«
»Nein.«
»Hast du dich niemals angerührt?«
»Nein, nur wenn ich’s mußte.«
»Hast du niemals mit der Hand dich an schamhafter Stelle angefaßt,
jenen Teil in die Hand genommen und hast so gesündigt?«
»Aber nein.«
»Hast du nie etwas Besonderes aus deinem schamhaftesten Teil kommen
sehen oder das gefühlt, wenn du im Bett lagst?«
»Nein, Hochwürden.« – – –
Schon oft hatte ich so etwas von Kameraden gehört, die der Beichtvater
auch so ausgefragt hatte. Aber ich verstand all das nicht. Am Abend
nach jener Beichte lag ich unruhig im Bett. Es war mir so heiß, so
schwül.
Meine Beichte fiel mir ein.
Ich warf Bett und Decke zurück, damit ich nicht so heiß bliebe.
[S. 158]
Ich mußte am nächsten Morgen kommunizieren. Ach, wie ist das, wenn man
so ist, wie der Beichtvater heute gesagt hat? Ich preßte die Schenkel
aufeinander. Es half nichts. So war ich noch niemals.
»Hast du...?« »Hast du...?« »Tatest du...?«
Die Fragen gingen mir immer schneller durch den Kopf. »Vater unser...«
Meine Sinne waren nicht beim Beten, sondern bei der Beichte.
Die Hand... »Hast du noch nie...?« »Hast du niemals...?«
Gott, Gott, wie reizten mich diese Fragen, so oft ich daran
dachte. – – –
Am nächsten Morgen konnte ich nicht kommunizieren. »Ich habe aus
Versehen nach 12 Uhr noch ein bißchen Brot gegessen,« belog ich meinen
Religionslehrer.
Bei der nächsten Beichte aber mußte ich antworten: »Ich habe es getan.«
*
Wie Matthes bei einem Augustiner einige Zeit später beichtet, der ihn
gleich fragt, wo er wohnt und sich nach den Töchtern der Wirtsleute
erkundigt, erzählt er folgendermaßen:
»Die eine heißt Emmy und die andere Anna?«
»Ja.«
»Hast du mit diesen noch nicht unschamhaft verkehrt?«
»Nein.«
»Hast du sie nicht mit lüsternen Blicken angesehen? Auch das ist eine
Sünde.«
[S. 159]
»Nein.«
»Hast du sie nicht, auch nicht wie zum Scherz, an der Brust gefaßt?
Oder am Schenkel, oder gar dazwischen, über oder unter dem Kleid, oder
dorthin lüstern gesehen?«
»Nein.«
Matthes bekam drei »Vaterunser« und »Gegrüßet seist du, Maria«, nebst
einem Rosenkranz als Buße auf.
Hinfort konnte er die Töchter seiner Wirtsleute nicht mehr so ruhig
ansehen.
*
Wir wollen den Fall des Pater Sanktes, eines Religionslehrers an
unteren Klassen, der sich an seinen Schülern sittlich verfehlt,
übergehen, da einzelne Entgleisungen überall vorkommen können. Ob
Sanktes wirklich, wie er klagte, in der Beichte von der Versuchung
besiegt wurde, bleibe dahingestellt. Wichtiger ist die Feststellung
des Matthes, daß er von sämtlichen Beichtvätern mit alleiniger
Ausnahme von zweien, mit ähnlichen Fragen gequält wurde. Sogar ob
sie mit ihrer Schwester zusammen geschlafen hätten, wurden die Buben
gefragt.!!
Ein Schüler erhängte sich aus Furcht vor den Folgen des Lasters, das er
in der Beichte gelernt hatte.
Ein Beichtvater fragt: »Hast du dich nie, vielleicht unter einem
harmlosen Vorwand, an den Beinen gefaßt?«
»Nein, nein.«
»Hast du niemals ein Mädchen geküßt?«
»Ja.«
»Hast du dabei sinnliche Gefühle erweckt, indem[S. 160] du vielleicht deine
Knie oder deinen Körper an sie gepreßt hast, oder deine Brust? Oder
hast du mit deiner Zunge zwischen ihren Lippen geleckt?«
»Aber nein.«
»Hast du auf einem Schoße einer weiblichen Person gesessen und dabei
Böses gedacht?«
»Nein.«
»Auch bei deiner Mutter nicht?«
*
Von der Art eines Ordensgeistlichen, die Beichte bei Mädchen anzuhören,
berichtet Matthes:
Die kleine Bertha war Erstkommunikantin und wird, nachdem der Pater
jedes Gebot einzeln durchgegangen ist, auch nach dem sechsten gefragt.
»Hast du niemals mit Buben gespielt?«
»Ja, oft.«
»Hast du sie auch berührt?«
»Ja.«
»Sie dich auch?«
»Ja.«
»Natürlich, um Schlechtes zu tun!«
»Aber nein, nein, so nicht! Gespielt, so gespielt halt, Nachlaufen,
Verstecken, Fangen und so, und so anderes.«
»Lüge nicht! Ich habe es gesehen, wie dich Buben angegriffen
haben.«
»Aber nein, nein!«
»Hast du dich selbst angegriffen?«
»Ja; nein, so nicht, wie Sie wieder denken!«
»Gewiß, du hast es getan! Ich weiß es. Du hast dich angerührt.«
[S. 161]
»Aber nein doch, nein!«
»Sagst du gleich ja? Willst du gleich ja sagen? Nun, wird es bald,
willst du ja sagen?«
Dabei polterte der Beichtvater wider das Gitter, das ihn von seinem
Beichtkind trennte. Und bebend kam es da von den Lippen:
»Ja.«
»Nun, mit der Hand oder mit dem Stöcken.«
Keine Antwort.
»Mit der Hand oder mit dem Stöcken?«
Wieder schwieg die Kleine.
Da polterte Hochwürden wieder und leise sagte das Kind:
»Mit der Hand.« Nur, damit Hochwürden zufrieden war.
»Sag, hast du auch mit einem Hund dich abgegeben?« usw. usw.
*
Man kann sehr freie Ansichten haben und wird doch voller Empörung sich
von dieser systematischen Jugendverderbnis abwenden. Gesellt sich dazu
aber die Scheinheiligkeit und Prüderie der schwarzen Rotte, dann kann
der ehrliche Mann nur bedauern, sich voll Ekel abwenden zu müssen,
statt mit einem kräftigen Fußtritt die ganze Gesellschaft an die Luft
zu setzen.
Aber was nützt die Keuschheit in Worten, wenn die in Werken
fehlt! Wenn es auch sehr zu beklagen ist, daß in dieser Hinsicht
nicht so viel geschieht, wie zur Reinhaltung der Literatur, so ist doch
schon der Anfang zu begrüßen. Die Keuschheits[S. 162]gürtel werden nämlich
wieder modern! Das beweist nachstehende Geschichte. Heil allen
Tugendhaften! Halleluja!
Der Apotheker Parat wurde im Februar 1910 in Paris zum Gegenstand
des Interesses der ganzen Welt, weil sich herausstellte, daß er aus
Eifersucht seine Frau in Ketten legte und durch Keuschheitsgürtel ihre
Treue sich sicherte. Würde es sich hier um die wahnsinnige Handlung
eines einzelnen handeln, dann könnten wir sie so wenig unter die
Kultur-Kuriosa aufnehmen, wie die Prozesse in Madrid im Jahre 1892 und
in Paris 1899 aus dem gleichen Grunde. In beiden wurden die Männer
bestraft, weil ein gewaltsamer Zwang vorlag. Es handelt sich hier aber
keineswegs um Unica, vielmehr sind noch heute Keuschheitsgürtel bei
uns in Gebrauch. Es existiert sogar eine Industrie, die solche
»Edozone« erzeugt. Dem Pariser Korrespondenten des Berliner Tageblattes
fielen zwei solcher Geschäftsanzeigen in die Hände, aus den Jahren 1879
und 1885, die eine aus Paris, die andere aus einem Orte im Departement
Aveyron. In ihnen werden Keuschheitsgürtel je nach der Ausführung im
Preise von 120–380 Frs. angeboten. Die Verfasser der Prospekte waren
zweifellos geschichtlich unterrichtete Persönlichkeiten. Der eine
rechtfertigt sein Angebot wie folgt: »Man wird sagen, ein verrücktes
Unternehmen: aber wer ist verrückter, der Mann, der die Zwangsjacke
erfunden hat, oder der Wahnsinnige, dem sie angelegt werden muß?«
Dr. Cabanès, der bekannte Sammler von geschichtlichen Kuriositäten,
erzählt, daß es in Paris Fabrikanten gibt, die diese merkwürdigen
Instrumente auf Be[S. 163]stellung anfertigen und Ehemänner und Liebhaber, die
sie für teures Geld kaufen und natürlich ihren Freundinnen anlegen.
Das schönste Exemplar, das Cabanès gesehen hat, war ein Gürtel mit
kostbarem Goldbeschlag und ziseliertem Schloß und wurde zum Preise von
500 Frs. von einer Demimondaine der Rue de Penthicore einem Sammler zum
Kaufe angeboten.[157]
[S. 164]
Siebenter Abschnitt
Frömmigkeit
Alle frühmittelalterlichen Heiligen zeichneten sich schon in früher
Jugend durch hohe Begabung aus, so daß sie an Sitten und Erfahrung
Greisen glichen. Juvenis senex, greisenhafter Jüngling, war, anders wie
heute, höchstes Lob und daher stehende Redensart. Dieser Abgeklärtheit
entsprach auch der Tatendrang, der dem hl. Bernward von Hildesheim
wiederholt den Ehrentitel einer »mater ecclesiae«, dem Sankt Johann
sogar den einer »virgo egregius«, einer ausgezeichneten Jungfrau
einträgt. Auf einem Gebiet aber kannten Erfindungsreichtum und
Energie der frommen Männer keine Grenzen: auf dem der Sonderbarkeiten.
Quaeque extrema semper appetiit (Was es nun Sonderbares gab, erstrebte
er immer), heißt es von Angilram[158], und das trifft den Nagel auf den
Kopf. Es waren wirklich auch für ihre Zeitgenossen sonderbare Heilige,
und doch ist die Art ihres Wirkens, da es in fast gleicher Weise stets
wiederkehrt, so charakteristisch, ja sogar typisch, daß es wohl mit
in erster Linie dazu führte, ihnen Heiligenqualitäten zu verleihen,
lag ihm doch das tiefernste Bestreben[S. 165] zugrunde, durch Überwindung der
Welt den Himmel zu erobern. Diese Eroberung, im strategischen Plane bei
allen gleich, wird taktisch verschieden in Angriff genommen.
Am harmlosesten erscheint uns das Streben, ein »Bild« der Demut und
Milde abzugeben. Kein Abschied ohne Tränenfluten, keine Verzeihung,
ohne daß die Umstehenden mit dem am Boden sich Windenden nicht
mitgeweint hätten. Die Kunst, nach Belieben zu weinen – wir reden
despektierlich in solchen Fällen von Krokodilstränen –, die gratia
lacrimarum galt als eine jener Himmelsgaben, die nur dem Erwählten
zuteil werden. Kaiser Otto III. und der hl. Bernward weinten beim
Abschied so heftig, daß sie sich schämten, unter die Leute zu gehen,
Alfkerus weinte, wenn er die hl. Messe las, so ausgiebig, daß der
größte Teil seines Körpers naß wurde; Eid von Meißen hatte vom
vielen Weinen immer entzündete Augen. Eine Gelegenheit, in Tränen
zu zerfließen, durfte, wer nur einigermaßen auf Heiligkeit oder
Heiligmäßigkeit Anspruch erheben wollte, niemals ungenutzt vorübergehen
lassen. Ob es sich um Reue, Erbitten einer Gnade, Beichte, Messe oder
Gebet handelte, wer nur irgend konnte, weinte. Die Tränenfröhlichkeit
besonders des 10. Jahrhunderts kann kühn mit der der Wertherzeit in
Konkurrenz treten. So tadelt Adam von Bremen an den Dänen, daß
sie Tränen und Wehklagen aus Reue oder sogar für Tote verabscheuten.
(Mon. germ. SS. VII, p. 336.)
Ernster schon waren die Kasteiungen durch Geißelung, Entzug des
Schlafes, Hunger und Durst, besonders wirksam aber die Handlungen,
die dem[S. 166] Bestreben, der Niedrigste von allen zu sein, ihr Dasein
verdankten. Adalbert von Bremen bittet seinen Feind, der ihn
mißhandelt, um Verzeihung.[159] Johann von Gorze hat über jeden
heiteren Augenblick nachträglich die schwersten Gewissensbisse. Er
putzt (wie auch der hl. Adalbert) seinen Mitbrüdern oder gar dem
Gesinde die Stiefel, sogar gegen deren Willen, buttert, bis ihm der
Schweiß kommt und flickt in den nächtlichen Mußestunden Netze, ja,
er reinigt oft die Latrinen! Ganz ähnlich handelt Angilram.[160] Die
Königin Mathilde begibt sich nur scheinbar zur Ruhe, verläßt vielmehr
ihr Lager, sobald alles schläft und tut die Nacht durch Gutes, um dann
morgens, von niemand bemerkt, wieder ihr Lager aufzusuchen. Sie dringt
auch heimlich in die Zellen, um beim Baden der Armen behilflich zu
sein, während sie sich selbst Bäder versagt.[161] Der stolze Adalbert
von Bremen wusch vor dem Schlafengehen 30 und mehr Bettlern die Füße.
Ähnliches hatte schon die Tochter König Chilperichs von Burgund,
Chrotechilde, getan, wie Fredegar erzählt. Brun von Köln, der Bruder
Ottos des Großen, sitzt im Schafpelz unter Königen.[162] Fast keiner
aber gönnt sich den damals so beliebten Genuß eines Bades, und doch
berichten die Biographen von der Schönheit ihrer Helden!
Diese Kasteiungen müssen für sehr harmlos gelten im Vergleich zur Sitte
der ersten Christen, sich zu entmannen. Justinus erzählt von dem
Gesuche eines Christen in Alexandrien an den Präfekten Felix: er möchte
einem Arzt gestatten, ihn zu entmannen. Denn ohne diese Genehmigung
durften die Ärzte die Operation nicht vornehmen. Origenes entmannte[S. 167]
sich selbst und das Konzil zu Nicäa von 325 sah sich genötigt,
Stellung zu nehmen zu der Frage dieser Verstümmelung.[163]
Rühmend erzählt der Biograph vom hl. Ulrich, daß er sich zwar das
Gesicht wusch, aber nicht badete, außer an drei Festtagen im Jahre.
Dafür wusch er aber eigenhändig 12 Armen die Füße. Der Königssohn
Brun war nicht weniger wasserscheu wie Johann von Gorze, der auch
Medikamente verschmähte. Angilram badete auch nicht.[164] Waren die
frommen Männer so auch zu Lebzeiten keine Nasenweide der frommen
Gemeinde, so holten sie das doch im Tode nach. Denn dann entströmten –
das müssen wir wohl oder übel den Chronisten glauben – den Särgen der
frommen Männer liebliche Düfte. Von Eid, Ansfrid, Evergerius von Köln
und Udalrich wird es wenigstens ausdrücklich erzählt.[165]
*
Das Weinen gehörte auch noch zur Zeit der Kreuzzüge selbst beim Militär
zur Frömmigkeit. Der Chronist erzählt: »Es war Sitte im Heere, daß
in jeder Nacht, ehe sie sich zum Schlafen niederlegten, ein dazu
bestimmter Mann mit lauter Stimme inmitten des Heeres den gewöhnlichen
Spruch rief: ›Hilf, heiliges Grab!‹ In diesen Ruf stimmten alle ein,
wiederholten ihn, streckten mit reichlichen Tränen die Hände zum Himmel
empor und erflehten Gottes Barmherzigkeit und Hilfe. Dann hub der
Herold selbst wieder an, indem er wie vorher ausrief: ›Hilf, heiliges
Grab!‹ Und alle wiederholten es; und als er gleichfalls zum dritten
Male rief, so taten es ihm alle[S. 168] nach mit großer Herzenszerknirschung
und unter Tränen. Wer würde dies in solcher Lage nicht tun? da doch
schon diese Tatsache zu berichten Tränen den Hörern entlocken kann.
Durch diese Anrufung schien das Heer sich gar sehr gestärkt zu
fühlen.[166]«
*
Die durch Schönheit, Klugheit, Sittenstrenge und Frömmigkeit
ausgezeichnete Athenerin Irene wurde durch den Tod ihres
Gemahles, des Kaisers Leo IV., im Jahre 780 für ihren zehnjährigen
Sohn Regentin des byzantinischen Reiches. Als der Sohn regierungsfähig
geworden war, ließ sie die Truppen auf die noch nie dagewesene Formel
»Solange du lebst, werden wir uns deinen Sohn als Kaiser nicht gefallen
lassen« schwören. Doch der Staatsstreich mißlang, Irene wurde von der
Regierung entfernt, und Konstantin VI., der zuerst sieben Jahre mit
Karls des Großen Tochter Rothrude verlobt gewesen war, kam endlich
zur Herrschaft. Aus Gutmütigkeit verzieh er schon nach einem Jahre
seiner Mutter und setzte sie wieder in ihre bevorzugte Stellung ein.
Nach fünfjähriger Wühlarbeit gegen den tapferen Sohn machte sie ihn
unpopulär. Dann riet sie ihm, seine Gemahlin zu verstoßen und die
schöne Hofdame Theodote zu heiraten (795). Jetzt war der Kaiser
verloren. Die Kirche trat wegen des ungesetzlichen Schrittes gegen ihn
auf, Irene nahm ihn gefangen und ließ ihm in demselben Purpurgemache
des Kaiserpalastes, in dem sie ihm das Leben gegeben hatte, durch
den Henker die Augen ausstechen! Wiewohl die Verstümmelung mit
besonderer Grausamkeit aus[S. 169]geführt war und in der Absicht, seinen Tod
zu veranlassen, ohne der Mutter das Odium der Mörderin aufzuladen,
lebte der Kaiser noch einige Jahre. Irene aber nahm mit Ignorierung
ihres Geschlechtscharakters den Titel »Kaiser« an. Doch schon 802
fiel sie, deren Ehrgeiz eine Ehe mit Karl dem Großen im Bereiche der
Möglichkeit gehalten hatte, als Opfer einer Revolution. Sie starb
einsam und verlassen 803 auf Lesbos.
Die byzantinischen Schriftsteller finden für diese Kaiserin kaum
ein Wort des Tadels. War sie doch die Wiederherstellerin der
Bilderverehrung. Als Heilige gehört sie dem Himmel der
griechisch-katholischen Kirche an.[167]
*
Robert von Arbrissel (Albresec in der Bretagne), der Stifter des Ordens
von Fontaevraud hatte eine sonderbare Probe seiner Keuschheit ersonnen.
Er ging nicht nur in Bordelle und bewog durch seine Predigt die
Prostituierten, fromm zu werden – und zwar so viele, daß er
für sie drei Klöster errichten mußte, von denen deshalb das eine de la
Magdelaine benannt wurde, er schlief auch öfter zwischen zwei Nonnen
– nackt natürlich, gemäß der damaligen Sitte –, bloß um die Kraft des
Willens über das Fleisch zu erproben.
Der Abt Gottfried von Vendome tadelte ihn wegen der unklugen Erfindung
dieses neuen Martyriums; Marbod, Bischof von Rennes, aber ermahnte
ihn, sich solchen Verführungen nicht auszusetzen, die[S. 170] den guten Ruf,
wenn auch nicht die Seele verwundeten. Er tadelte ihn auch, daß er in
haarigem Fell und zerrissenen Kleidern, mit halbnackten Hüften, langem
Bart, abgeschnittenem Haupthaar und bloßen Füßen gehe.[168]
*
Das Mittelalter in seinem Kinderglauben suchte Befreiung von Sünden,
weniger durch innere Einkehr, als dadurch, daß es durch weite Reisen,
nach Rom, Jerusalem oder an andere geheiligte Orte, räumlich der
Gnadenquelle nahte. Jeglicher Schmerz, jede Form irdischer Qual, selbst
jedes Verbrechen konnte sich hoffend nach Rom wenden, um zu den Füßen
des Papstes Erlösung zu empfangen. Aber neben wahrhaft Reuigen, die
in hellen Haufen jahrhundertelang den Weg über die Alpen einschlugen,
befand sich auch manch räudiges Schaf. Ja, die damaligen Anschauungen
trieben entsittlichte Menschen, fluchwürdige Verbrecher, die heute
in Gefängnissen sorgfältig vom Kontakt mit der Mitwelt ferngehalten
werden, zu solchen Pilgerfahrten, trugen sie ihnen doch neben der
Hochachtung vor freiwilliger Buße auch noch sicheren Unterhalt
ein.
Der Schuldige ward in die Welt geschickt, versehen mit einem Schein
seines Bischofs, welcher ihn als Mörder oder Blutschänder offen
bezeichnete, ihm seine Reise, ihre Art und Dauer vorschrieb, und ihn
zugleich mit einer Legitimation, entsprechend unseren Pässen,
versah. Er zeigte seine Legitimation allen Äbten und Bischöfen der
Orte vor, durch welche er[S. 171] kam. Diesem Verdammungs- und gleichzeitigen
Empfehlungsbrief verdankte er überall gastliche Aufnahme.
Deshalb hüllten sich nicht selten Gauner, die gar kein schweres
Verbrechen begangen hatten, in die Maske der scheußlichsten Untat.
So hatten sie Gelegenheit zu sorgenfreier Reise und Aussicht auf
betrügerischen Gewinn. In Ketten, mit schweren Eisenringen um Hals
und Arme, halbnackt zogen sie mit ihren falschen Pässen durch die
Länder, stellten sich auch vielfach besessen, warfen sich vor den
Heiligenbildern der Kirchen und Klöster nieder und erlangten, indem
sie durch deren Anblick plötzlich zur Besinnung gekommen zu sein
vortäuschten, von den beglückten Mönchen Geschenke.
Bezeichnend für die Sitten, die in solchen Pilgergesellschaften
herrschten, ist, daß schon 744 der Erzbischof Bonifazius von Mailand an
Cutbert von Canterbury schrieb, die Synode möge den Frauen und Nonnen
solche Reisen untersagen, »weil viele von ihnen zugrunde gehen,
wenige aber unberührt heimkehren. Denn es gibt in der Lombardei nur
sehr wenige Städte, desgleichen in Franzien oder Gallien, in denen
sich nicht eine Ehebrecherin oder Prostituierte aus englischem Stamme
befindet.«
Viele erlagen also den Versuchungen der Pilgerfahrten. Deshalb
verbot auch die Synode von Friaul 791 bereits den Nonnen, nach Rom
zu pilgern.[169]
[S. 172]
*
Wahre Frömmigkeit römischer Observanz, überall zu finden, wo die
kasuistische Pseudomoral der Kirche herrscht, lehrt uns ein niedliches
Geschichtchen kennen, das ebensogut heute passiert sein könnte, wie
im Jahre 1580 und überaus bezeichnend ist für die Denkweise weitester
Kreise unter dem segenspendenden Krummstab.
Montaigne erzählt: »Un quidam etant avecques une courtisane, et couché
sur un lit et parmi la liberté de cete pratique-là, voila sur les
24 heures l’Ave Maria soner: elle se jeta tout soudein, du lit à
terre, et se mit à genous pour faire sa priere. Etant avecques un
autre, voila la bone mere (car notammant les jeunes ont des vielles
gouvernantes, de quoi elles font des meres ou des tantes), qui vient
hurter à la porte, et avecques cholere et furie arrache du col de cette
jeune un lasset qu’elle avoit, où il pandoit une petite Notre-Dame,
pour ne la contaminer de l’ordure de son peché; la jeune santit
un’extreme contrition d’avoir oblié à se l’oster du col, come ell’avoit
acostumé.«[170]
*
Als Montaigne in der Karwoche 1581 in Rom weilte, sah er eine ungeheure
Prozession mit Fackeln – er schätzt deren Anzahl auf 12000 –, die
sich, in Büßerkompanien geteilt, gegen St. Peter bewegte. Musikkapellen
waren im Zuge verteilt und Lieder wurden unausgesetzt während des
Marsches gesungen. Inmitten jeder Gruppe, deren es wenigstens 500 gab,
schritt eine Reihe von Büßern, die sich mit einem[S. 173] Tau (corde)
den Rücken in bemitleidenswerter Weise blutig schlugen.
»Das ist ein Rätsel, das ich noch nicht recht verstehe, aber alle
sind braun und blau geschlagen (meurtris) und grausam verwundet und
martern und schlagen sich unaufhörlich. Sehenswert ist ihre Fassung,
die Sicherheit ihrer Schritte, die Festigkeit ihrer Worte (denn ich
hörte mehrere sprechen) und ihr Gesicht (denn mehrere waren in der
Straße barhäuptig). Es erweckte keineswegs den Anschein, als seien sie
in einer schmerzvollen Tätigkeit, noch in einer ernsten begriffen, und
junge Leute von zwölf oder dreizehn Jahren waren darunter. Dicht bei
mir war ein sehr Junger mit angenehmem Gesicht; eine junge Frau sprach
ihr Bedauern aus, ihn sich so verwunden zu sehen. Er wandte sich zu
uns und sagte ihr lachend: ›Genug, sage dir, daß ich das für deine
Sünden tue und nicht für meine eignen.‹ Sie zeigen bei dieser Tätigkeit
nicht nur keine Angst oder Zwang, sondern sie tun es mit Freude oder
mindestens mit solcher Gleichgültigkeit, daß du sie sehen kannst, wie
sie sich mit anderen Dingen beschäftigen, lachen, sich auf der Straße
zanken, laufen, springen, wie es in einem so großen Gedränge, wo die
Reihen in Unordnung geraten, passiert. Unter ihnen gibt es Leute, die
Wein tragen, um ihnen zum Trinken anzubieten: niemand nimmt einen
Schluck. Man gibt ihnen auch Zuckerwerk, und die, welche Wein tragen,
nehmen häufig davon in den Mund und dann spucken sie ihn wieder aus und
benetzen damit das Ende ihrer Geißel, das aus einem Strick besteht und
sie sind derart mit Blut beklebt, daß man sie begießen muß,[S. 174] um sie
auseinander zu bringen; einige blasen den Wein auf ihre Wunden. Nach
ihrem Schuhwerk und Strümpfen zu urteilen sind es Leute sehr niederen
Standes, die sich für diesen Dienst vermieten, wenigstens die Mehrzahl.
Man sagte mir wohl, daß man ihre Schultern mit etwas polstert, aber
ich habe die Wundmale zu frisch gesehen und die Attacken so lange
fortgesetzt, daß es kein Heilmittel zur Beseitigung der Empfindung
gibt. Und wozu würde man sie mindern, wenn alles Spiegelfechterei
wäre?«[171]
*
Keyßler, der 1730 in Rom war, erzählt: »Am grünen Donnerstag kamen
etliche geistliche Brüderschaften und eine volkreiche Prozession von
andern Leuten nach der St. Peterskirche. Unter dieser Gesellschaft
fanden sich zehn bis zwölf maskierte Personen, welche ihre entblößten
Rücken mit vielen Riemen, an deren Enden eiserne Stifte waren, also
zerschlugen, daß man es nicht ohne Ekel ansehen konnte, und die
Stellen, wo sie sich etwas aufgehalten hatten, an dem Blute auf dem
Fußboden der Kirche zu erkennen war. Hinter einem jeden solchen
eigenmächtigen Märtyrer oder im Beichtstuhle dazu verurteilten
Missetäter, wurde eine brennende Fackel getragen und oftmals an den
zerfleischten Rücken gehalten, damit das Blut nicht gerinnen sollte.«
In einer unterirdischen Kapelle der Jesuiten bekam jeder Eintretende,
hinter dem die Türe gleich verschlossen wurde, tüchtige Geißeln, »die
sich in sieben bis acht Ende oft geknüpfter Reifschnüre verteilten«.
Ein Jesuit erinnerte – es war Karfreitag –[S. 175] an die Leiden Christi
und forderte zur Nachahmung auf. Die Lichter wurden ausgelöscht, die
Litanei gesungen und jedermann geißelte sich. Und zwar geschahen die
Ermahnungen und die darauf folgenden Geißelungen dreimal.[172]
Welche Ähnlichkeit mit dem alljährlich im Orient stattfindenden Umzug
der Perser zur Erinnerung an Alis Tod!
*
Übrigens ließen sich auch Herrscher geißeln. Kaiser Heinrich III.
legte nie seinen königlichen Ornat an, bevor er sich dieser Züchtigung
unterworfen hatte. König Otto IV. ließ sich auf dem Totenbette bis aufs
Blut schlagen und noch der große Kurfürst Maximilian I. von Bayern
(1598–1650) ließ mit eigener Hand Schläge auf seinen entblößten Rücken
fallen.[173]
*
Keyßler erzählt von einer sonderbaren Sitte, die in Loretto herrschte.
»Die Kastraten, so in der Musik der Santa Capella gebraucht
werden, lesen hier gleichfalls Messe, und tragen währen
der selbigen ihre abgeschnittenen Testiculos und andere dergleichen
Pertinentien in einer Schachtel in der Tasche bey sich, vermuthlich
weil sie nach der Mathematik werden behaupten wollen, daß 99⁄100 und
1⁄100 allezeit ein Ganzes ausmachen. In Rom höret man von dergleichen
Gewohnheit nicht, in dem oberen Theile von Italien aber ist die Sache
nicht ungewöhnlich.«
[S. 176]
*
Die Maranen, d. h. zwangsweise getaufte Juden der Pyrennäenhalbinsel,
die im geheimen noch dem Glauben ihrer Väter anhingen, heirateten auch
in der Regel untereinander und mußten deshalb häufig die päpstliche
Ehedispens einholen. Zu Beginn des 18. Jahrhunderts erlebten diese
Maranen eine religiöse Renaissance. Sie ließen sich einen gewissen
Rabbi Falcon aus Jerusalem kommen, um die vollkommene Wahrung der
orthodoxen Riten und Gebräuche zu gewährleisten. Damals traten viele
noch im Alter zum Judentum öffentlich über und ließen sich beschneiden.
Sehr sonderbar aber ist der Brauch, daß manche, die wegen vorgerückten
Alters vor den Schmerzen einer Beschneidung zurückscheuten, wenn
sie sich auch offen zum Judentum bekannten, diese Operation
nach dem Tode an sich vornehmen ließen. Jakob de Mezas hat in
seinem »Mohelbuche« seit dem Jahre 1706 zahlreiche solche Fälle
registriert.[173]
*
Der Professor der Dogmatik P. Lépicier, angestellt an der Propaganda
fidei in Rom, schrieb 1909 unter dem Titel »De stabilitate et progressu
dogmatis« ein Buch. Er vertritt darin die Ansicht, daß ein Ketzer
nicht nur exkommuniziert, sondern von Rechts wegen auch getötet werden
dürfe. Denn er sei, wie Aristoteles sagt, schlimmer als ein wildes
Tier, das zu töten ja auch keine Sünde sei. Daß die Kirche das Recht
habe, einen Ketzer zum Tode zu verurteilen, unterliegt dem milden
Apostel der christlichen Liebe nicht dem geringsten Zweifel (S. 174
f.). »Diejenigen katholischen Apologeten irren von der[S. 177] Wahrheit ab,
die da sagen, die Schuld an solchen Sentenzen (Hinrichtung von Ketzern)
sei der weltlichen Inquisition zuzuschreiben, oder die feigerweise
zugestehen, die Kirche habe, dem Zeitgeist folgend, in dieser Sache
in etwas ihr Recht überschritten« (S. 183 f.). Auch vertritt er die
Ansicht, man solle Ketzer und Abtrünnige mit Gewalt in den Schoß der
alleinseligmachenden Kirche zurückführen (S. 190 f.).
Die Propaganda hat die Aufgabe, Missionare auszubilden und ihre
Zöglinge genießen besondere Auszeichnungen. Die von Kardinal
Hergenröther herausgegebene Enzyklopädie der katholischen Theologie
sagt zum Ruhme der Propaganda: »Noch mehr muß das Institut eine Zierde
in den Augen derjenigen sein, welche zu ermessen wissen, was seine
Zöglinge seit der Gründung des Hauses Großartiges geleistet haben zur
Erfüllung des Wortes: Eunte docete omnes gentes – Gehet und lehret
alle Völker –, nicht bloß unter schweißvoller apostolischer Arbeit,
sondern auch mit dem Opfer des Blutes.«
Daß letzteres gebracht wird, wenn auch wohl weniger von den Bekehrern,
als von den Bekehrten, darüber können wir uns nach Lépiciers
Ausführungen beruhigen.
*
Doch wir wollen unsere Blicke abwenden von mittelalterlicher
Beschränktheit, wie sie in diesen Anschauungen sich äußert und wie
sie auch die klugen Jesuiten[174] heute nicht mehr vertreten. Erbauen
wir uns lieber am Beispiel eines ebenso frommen, wie[S. 178] aufgeklärten
Mannes, dessen Name in Deutschland genannt wird, wenn es gilt, einen
Zeugen für die Wohlvereinbarkeit strenger Kirchlichkeit mit wahrhaft
modernem Empfinden aufzurufen. Wir meinen natürlich den Kardinal
Fischer in Köln. Durchdrungen von wahrhaft sittlichem Geiste, Catos
Vorbild nachahmend, doch, was sage ich, überflügelnd, verbot er den
Klosterschwestern zu – baden! Diese hochmoralische Bestimmung
ist heute noch in Kraft. Richten wir unsere Herzen auf an diesem
Beispiel wahrer Frömmigkeit und Keuschheit![175]
*
Ja, wir sind wahrhaft fromm. In der Schule beginnt der innere Drang,
später sorgen Staat und Kirche dafür, daß das Feuer weiterglimmt, ja
lodert. Oder geht das nicht zwingend daraus hervor, daß es uns nicht
genügt, wenn ein Mathematiklehrer Mathematik versteht, sondern
daß er auch in der Religion beschlagen sein muß? Kann man
sich überhaupt etwas Gräßlicheres denken als ketzerische Mathematik
oder – fast gerade so schlimm – Mathematik, vorgetragen von einem
Ketzer? So denken auch manche deutsche Staaten, vor allem Preußen,
und fordern deshalb vom Lehramtskandidaten der Mathematik und der
Naturwissenschaften ein Examen in der Religionslehre zum
Beweise dafür, daß er auch gut – heucheln kann.
[S. 179]
*
Doch nix genaues weiß man nicht – auch nicht darüber, ob die Kinder
zeitlebens der Mutter Kirche mit der von einem herrschsüchtigen Klerus
so sehr erwünschten Treue anhängen werden. Deshalb ist es gut, sich
rechtzeitig vorzusehen. So dachte auch Bischof Benzler von Metz
und erließ im Frühjahr 1909 einen Hirtenbrief gegen die Mischehen.
Priester sind nun einmal – das bringt das Amt so mit sich –
friedfertige Leute, und besonders die Männer, die Christi Namen täglich
hundertmal im Munde führen, zeichnen sich durch Sanftmut vor andern
Sterblichen aus. Sie suchen Trennendes zu überbrücken, Gegensätze zu
mildern. Gesellt sich nun zur christlichen Liebe auch noch die fürs
Vaterland, die Einsicht, daß die Blutbäder und brennenden Städte in
Deutschlands Vergangenheit uns für alle Zeiten ein Memento zurufen,
wohin konfessioneller Hader führt, dann werden wir des glaubensstarken
Bischofs Hirtenbrief doppelt zu schätzen wissen.
Er empfiehlt darin wärmstens eine »Eine verbotene Frucht« betitelte
Schrift. Hier wird den Pfarrern geraten, sie möchten am Kommunionstage
den Kindern die schriftliche Erklärung abfordern: »Ich
verspreche an diesem schönsten Tage meines Lebens, daß ich niemals eine
gemischte Ehe eingehen werde«!!!
Die so vergewaltigten Kinder sind elf bis dreizehn Jahre alt!
Um aber auch im späteren Alter den Gefahren der Verseuchung oder
Ansteckung durch Andersgläubige – hu! – möglichst wenig ausgesetzt
zu sein,[S. 180] gründet man konfessionelle Klubs. So etablierte sich
vor etlichen Jahren in Kissingen ein Kränzchen katholischer
Kurgäste, und neuerdings tat sich auch in Juist eine
Vereinigung katholischer Kurgäste, ein katholischer
Strandklub auf.[176]
*
An den bayerischen Gymnasien herrscht Kirchenzwang. Er gründet sich auf
den letzten Passus des § 1 der »Disziplinarsatzungen für die Schüler
der Studienanstalten im Königreich Bayern«, mit dem harmlosen Wortlaut:
»Religiosität betätige der Schüler in seinem ganzen Lebenswandel,
insbesondere auch in der Ausübung der religiösen Pflichten seines
Bekenntnisses.
Alle Sonn- und Feiertage haben die Schüler dem Gottesdienst ihrer
Konfession mit Andacht beizuwohnen.«
Die Forderung der erzwungenen »Andacht« bringt wenigstens eine
humoristische Note in die Tragik der Anwendung des Paragraphen unter
ultramontaner Herrschaft. Denn sie ist barbarisch. Tagesausflüge
ohne vorhergehende Genehmigung des Religionslehrers oder
Konrektors sind unzulässig! Eine nachherige Erlaubnis wird nicht
erteilt. Also ist der Familienvater, der wegen des schlechten Wetters
am Samstag den projektierten Sonntagsausflug fallen ließ, nicht in der
Lage, seinen Kindern doch die Erholung zu gönnen, wenn das Wetter sich
aufheitert!
[S. 181]
Ein Schüler wurde sogar bestraft, weil er einen anderen
als den vorgeschriebenen Gottesdienst mitgemacht hatte!
Einem anderen wurde verboten, am Samstag zu seinem in der Nähe
Münchens wohnenden Vater zu reisen, um wenigstens einen Tag
wöchentlich im Elternhause zuzubringen. Und das, wiewohl sich der Vater
für den Besuch der dortigen Messe verbürgte! So blieb dem armen Jungen
nichts anderes übrig, als erst nach dem sonntäglichen Gottesdienst zu
fahren.
Im Jahre 1906 mußten die Schüler eines Realgymnasiums auf den
zweitägigen Besuch der Landesausstellung in Nürnberg verzichten,
weil der Professor keine Bürgschaft dafür übernehmen konnte, daß seine
Zöglinge an beiden Feiertagen die Messe besuchen würden!
Wie in der bayerischen Abgeordnetenkammer festgestellt wurde, gibt es
in der Pfalz ein Gymnasium, das eine höchst sinnreiche Kontrolle der
Schüler eingeführt hat. Jeder erhält eine Karte, ähnlich den
Abonnements bei den Friseuren. Verläßt der Schüler die Kirche nach
absolviertem Gottesdienst, dann wird die Karte geknipst!
Und doch bestreitet der bekannte Staatsrechtslehrer Max von Seydel,
daß hier ein Verstoß gegen die verfassungsmäßig garantierte
Gewissensfreiheit vorliege. Das alles sei kein Zwang, denn niemand sei
verpflichtet, sich der Staatsanstalten zu bedienen!
Der Gelehrte vergaß, daß nicht jeder als Vanderbild geboren ist.
Und doch ist das alles herzlichst zu begrüßen.[S. 182] Wird doch so eine
Generation erzogen, die voller Begeisterung für die Trennung von Staat
und Kirche eintreten wird.[177]
*
Doch nicht nur die Seelen müssen vor ketzerischem Gift bewahrt
werden. Wem es ernst mit seiner Religion ist, wer weiß, was er
ihr schuldet, der macht hier nicht halt. Er breitet die liebenden
Arme der Mutter Kirche auch über – Würste aus. So lesen
wir in einer im März des Jahres 1910 im Tauber- und Frankenboten,
einem in Tauberbischofsheim in Baden erscheinenden ultramontanen
Intelligenzblatt: »... auch das kaufende Publikum soll darauf
sehen, daß es seine Ware bei Bäckern, Metzgern und Kaufleuten in
Zentrumsblättern eingepackt bekommt.«
Zum Verpacken der Würste mögen sich diese Geistesprodukte allenfalls
noch eignen.
*
Im Jahre 1908 (das Jahrhundert ist zu beachten!) erschien im Verlage
von Ludwig Auer in Donauwörth unter dem Titel »Die Ehe; eine
Unterweisung über die sittlichen, religiösen und hygienischen Pflichten
für Erwachsene, besonders für Braut- und Eheleute« ein Buch, das mit
dem bischöflichen Imprimatur der Augusta Vindelicorum vom 13. Februar
1908 (Generalvikar Dr. Göbl) versehen ist, in elfter Auflage.
In diesem frommen Werke wird natürlich auch[S. 183] auf die Wichtigkeit der
Nottaufe hingewiesen (S. 218 ff.), sowie auf die Maßregeln, die zu
ergreifen sind, wenn ein Kind bei der Geburt zu sterben droht. Seine
Seele muß doch davor bewahrt werden, ins Fegefeuer zu kommen!
Jeder sogenannte Abgang, mag er noch so unförmlich sein und vielleicht
auch gar keine Gestalt haben, ist nur ein verbildetes Menschenwesen und
seine Seele ist für den Himmel bestimmt. Ist der Abgang der Fehlgeburt
auch klein und weiß man auch nicht, ob das Wesen noch lebt, so öffne
man die dasselbe umgebende Hauthülle und tauche es in das Wasser,
wobei man die Taufworte spricht und die Bedingung beifügt: »Wenn du
lebst.« Diese Nottaufe bewirkt geistliche Verwandtschaft, die ein
Ehehindernis bildet!
Wegen der Wichtigkeit des Gegenstandes wird die Schrift von J. Neth
»Die Verwaltung des Priesteramtes« wörtlich zitiert. Sie lautet:
»Wenn bei schweren Geburten zu besorgen steht, es möchte das Kind
sterben, ehe es vollkommen geboren wird, und wenn es möglich wird,
demselben mit Wasser beizukommen, so taufet es im Mutterleibe mittels
einer Röhre oder Spritze, wie sie jede Hebamme haben soll, oder durch
einen Schwamm, den ihr über das Kind im Mutterleibe auspreßt, und
sprechet dabei die Worte: ›Wenn du der Taufe fähig bist, usw....‹
Sollte es sich ereignen, daß nach gespendeter Taufe im Mutterleibe zwei
oder mehrere Kinder zur Welt kommen, so daß man nicht weiß, welches
von ihnen die Taufe im Mutterleibe empfangen habe, so müßt ihr jedes
derselben bedingungs[S. 184]weise »Wenn du nicht schon getauft bist«...
wiedertaufen«.
Diese Anweisungen sind dem gewissenhaften Verfasser des Ehebüchleins
anscheinend nicht ausführlich genug. Sein Geist (sit venia verbo!)
treibt ihn daher, zu der bezeichneten Stelle des Textes folgende
Anmerkung zu setzen, deren Wert nur der nicht zu würdigen versteht, der
allen Christentumes bar ist.
Sie lautet: »Das ist übrigens von Unkundigen kaum durchführbar. Es
müssen ja die das Kind umgebenden Eihäute zuerst zerrissen sein, damit
das Taufwasser das Kind treffe und nicht die Eihäute. Da könnte
man leicht eine Verletzung hervorrufen. Die Taufe im Mutterleibe,
von nicht genau unterrichteten Personen vorgenommen, hat einen sehr
zweifelhaften Wert, und ist wohl nie Gewißheit gegeben, ob das Kind
wirklich getauft ist. Erst wenn der Kopf teilweise geboren ist,
resp. sichtbar ist, kann er vom Schleim gesäubert werden und weiß man,
daß das Taufwasser auch wirklich das Kind trifft.«
*
Aber nicht nur fürs Seelenheil des präsumptiven Täuflings, auch für das
Wohl der Mutter ist der gewissenhafte Autor besorgt, denn er gibt die
hygienische Vorschrift: »Um die Gefahr einer Infektion zu vermeiden,
muß das Wasser abgekocht und ganz rein sein; desgleichen das zur
Verwendung kommende Instrument.«
Welche Fülle von Frömmigkeit, gepaart mit weltlicher Weisheit, lebt
doch unter uns! Aber in dieser[S. 185] gottlosen Zeit muß der wahre Christ
das Tageslicht scheuen, damit dort glaubensloses Gesindel (†††)
Unfug treibt und der christkatholischen Menschheit ein Dorn im Auge
ist. Darum wählte der Verfasser die Anonymität. Schade, wir hätten
ihn so gerne mit dem Höllentopographen Professor Bautz künftiger
Heiligsprechung empfohlen.
[S. 186]
Achter Abschnitt
Mein Reich ist nicht von dieser Welt
So sagte Christus. Das Papsttum sagte es auch, war aber klug genug,
anders zu handeln. Mochte es auch die sicherste Anwartschaft auf das
Himmelreich in der Tasche haben, darum auf Erden leer auszugehen, fiel
ihm nicht ein. Und man muß es vor allen den Päpsten in Avignon lassen:
das Scheren der Lämmer hatten sie los.
Da gab es zunächst das Servitium commune. Jeder Bischof oder
Abt war zu dessen Zahlung bei Androhung schwerster Kirchenstrafen
verpflichtet, ehe seine Bestätigungsurkunde ausgehändigt wurde. Diese
Abgabe betrug den dritten Teil des Jahreseinkommens der Pfründe.
Während die eine Hälfte in die päpstliche Kasse floß, gehörte die
andere denjenigen Kardinälen, welche an dem Promotionskonsistorium
teilgenommen hatten.
Außerdem hatte jeder promovierte Bischof oder Abt noch fünf servitia
communia zu zahlen, von denen jedes von derselben Höhe war, wie der
Betrag, welcher den einzelnen Kardinälen von der zweiten Hälfte des
Servitium commune gebührte. Dieses belief sich im 14. Jahrhundert für
Köln auf 10000, für Trier[S. 187] auf 7000 Kammergoldgulden. Die Gesamtsumme
der für Köln zu zahlenden Servitia betrug etwa 11000, für Trier 7700
Kammergoldgulden.
Diese Servitia betrugen aber noch nicht einmal den größten Teil der
für die Einholung der päpstlichen Bestätigung aufzuwendenden Gelder.
Dazu kam das Geld für das Pallium in der Höhe von mehreren
hundert Dukaten, ferner für die Hin- und Rückreise des zu Bestätigenden
oder seines Bevollmächtigten, für den Aufenthalt an der Kurie bis
zur Bestätigung, für die Ausfertigung der Ernennungsbullen in den
verschiedenen Ämtern der Kurie und für die Schenkung von Geldsummen
oder Wertsachen an niedere und höhere Kurialbeamte bis hinauf zu den
Kardinälen. So konnte die Erwirkung der päpstlichen Ernennung des
jungen Walram zum Erzbischof von Köln 40000 Goldgulden, über eine
Million Mark, kosten. Die Folge dieses Ausbeutungssystems der Kurie
war natürlich, daß die deutschen Bischöfe des 13. und 14. Jahrhunderts
mit seltenen Ausnahmen in ständiger Geldnot sich befanden. Denn meist
starb der Bischof, bevor die Schulden für seine Bestätigung abgetragen
waren, so daß die Diözese neben der Tilgung der alten Schulden neue für
den neuen Herrn aufnehmen mußte.
*
Was für Bischöfe und reguläre Äbte die Servizien waren, das waren für
den übrigen Klerus die Annaten. Sie bestanden darin, daß die
Hälfte des Einkommens des ersten Jahres der Kurie abgeführt
wurde. Am 8. Dezember 1316 wurde diese Steuer zum ersten Male auf
drei Jahre der Trierer und Kölner[S. 188] Diözese auferlegt, ohne dort viel
Gegenliebe zu finden. Man drückte sich um sie wo man nur konnte und
so war der Ertrag recht minimal. Deshalb wurden am 13. August 1327
noch durch neue Verfügung die sogenannten Interkalalfrüchte von der
Kurie beansprucht. D. h. die während einer Vakanz fälligen Einkünfte
aller an der Kurie vakant werdenden kirchlichen Benefizien werden der
päpstlichen Kammer vorbehalten.
Das genügte aber alles noch nicht der Geldgier des angeblichen
Nachfolgers des armen Fischers Petri. So erklärte Klemens VI. auch
die Spolien, d. h. den beweglichen Nachlaß der Bischöfe und
Äbte in einzelnen Fällen, wenn er nämlich vermutlich sehr groß war,
für eine gute Beute der päpstlichen Kammer.
Dazu kam noch der Zehnte, stellenweise durch den Zwanzigsten
ersetzt oder das sogenannte Subsidium, d. i. eine bestimmte abgerundete
Geldsumme, die der Bischof auf den Klerus innerhalb seiner Diözese zu
verteilen, zu erheben und dann an die päpstliche Kammer oder an den
betreffenden Kollektor der päpstlichen Kammer abzuführen hatte.
Am 1. Dezember 1343 schrieb Klemens VI. einen dreijährigen und dann
nochmals einen zweijährigen Zehnten aus, um das Geld angeblich zu
einem Kriege gegen die Türken zu verwenden. Zur Ausführung kam dieser
zwar nicht, aber das von Klemens aus dem Klerus erpreßte Geld setzte
ihn in die angenehme Lage, dem französischen König über 700000 und
seinen Verwandten über 100000 Kammergoldgulden, also zusammen über
zwanzig Millionen Mark, leihen[S. 189] zu können. Allerdings kam es auch
vor, daß der Klerus sich weigerte, sich diesem Ausbeutungssystem zu
fügen. Schon 1265 hatte Klemens IV. die Verleihung aller am Sitze
der Kurie erledigten kirchlichen Benefizien dem päpstlichen Stuhle
vorbehalten. Diese Zahl schwillt während des zehnjährigen Pontifikats
Klemens VI. zu tausenden an. Außerdem gab es noch Exspektanzen,
entstanden aus Bitten und Empfehlungen von Päpsten des 12. Jahrhunderts
für einzelne Personen zum Zwecke ihrer Versorgung mit einer Pfründe
an die ordentlichen Kirchenoberen als deren Verleiher. Schließlich
wurden aus den Bitten Befehle mit Strafandrohungen. Häufig ernannte
der Papst einen Nachfolger zugleich mit den betreffenden Kollegien, so
daß die Gegenkandidaten jahrelang prozessieren mußten. Die Sporteln
beider vereinnahmte natürlich die Kurie, ohne sich weiter viel darum zu
kümmern, wer in den Besitz der Pfründe kam.[178]
*
In welcher Weise das Avignonische Papsttum, der »strenge« und
»ausgezeichnete« Innozenz VI., der »heiligmäßige« Urban V. und der
»durch Klugheit ausgezeichnete« Gregor IX., Nachfolger des Mannes,
der morgens nicht wußte, wo er abends sein müdes Haupt niederlegen
sollte, mit dem Gelde schalteten, werden wir gleich sehen. Die Dummheit
der Völker, die sich von einer prasserischen Geistlichkeit aussaugen
ließen, war aber gewiß nicht geringer, als die Habsucht der Kurie.
Am 3. Mai 1372 verlieh Gregor XI. dem von[S. 190] ihm ein Jahr vorher zum
Kardinal ernannten Jakob Orsini eine Massenexspektanz für künftig
erledigte Pfründen in den Patriarchaten Aquileja und Grado und in der
Mainzer Kirchenprovinz bis zu einem taxmäßigen Jahresertrage von 4000
Kammergoldgulden, deren Kaufkraft nach heutigem Gelde über 100000
M. entsprechen.
Welche Pfründenmassen vier Kardinäle beim Ausbruch des Schismas 1378
lediglich in England besessen haben, erfahren wir von einem von
ihnen, Wilhelm d’Aigrefeuille. Sie bezogen jährlich nämlich 12000
Kammergoldgulden, denen eine heutige Summe von rund 350000 M.
an Kaufkraft gleichkommt. Allerdings war England ein besonders
beliebtes Ausbeutungsobjekt, da hier, wie in Frankreich, die
Geldwirtschaft völlig die Naturalwirtschaft verdrängt hatte, während
in Deutschland im 14. Jahrhundert noch vorwiegend die Steuern etc. in
Natura gezahlt wurden.[179]
Außer dem Ertrage ihrer in verschiedenen Ländern der abendländischen
Christenheit gelegenen Pfründen hatten die Kardinäle noch die Einkünfte
ihrer römischen Titelkirchen, ferner die Hälfte der aus verschiedenen
Ländern an den päpstlichen Stuhl zu zahlenden Zensusabgaben, die Hälfte
der servitia communia und Einnahmen aus dem Ertrage der visitationes
reales mancher Prälaten, sowie Anteile an mehreren anderen Einkünften
des päpstlichen Stuhles.
Diese Zensusabgaben, die allerdings gerade zur Avignonischen Zeit
oftmals nicht eingeliefert wurden, waren sehr bedeutend. Die
Beherrscher Neapels schuldeten einen Jahreszensus von 8000 Unzen Gold
= 40000 Kammergoldgulden (ca. 1200000 M.) jähr[S. 191]lich dem päpstlichen
Stuhle, die Beherrscher der Insel Sizilien jährlich 3000 Unzen Gold.
Was die servitia communia betrifft, zu deren Zahlung die neuernannten
oder neu bestätigten Bischöfe und Äbte verpflichtet waren, so betrug
1336 die von der päpstlichen Kammer vereinnahmte Hälfte – die andere
fiel ja an die Kardinäle – über 30792 Kammergoldgulden. Im zweiten
Pontifikatsjahre Klemens VI. waren es gar 59904 Kammergoldgulden, also
ca. 1700000 M.! Das Durchschnittseinkommen der päpstlichen Kammer in
den neun Jahren von 1336–1345 belief sich auf 48000 Kammergoldgulden
jährlich und das war, wie gesagt, nur die Hälfte der servitia communia.
Diese Summe verringert sich unter Innocenz VI. im Durchschnitt seines
neunjährigen Pontifikates auf rund 33450 Kammergoldgulden jährlich. Da
nun das Kardinalkollegium, wie gesagt, auf die gleiche Summe Anspruch
hatte, die Zahl der am Sitze der Kurie weilenden Kardinäle unter diesem
Papste aber im Durchschnitt 22 betrug, so kam im Jahresdurchschnitt
auf jeden Kardinal allein an Servitiengeldern die Summe von etwa 1500
Kammergoldgulden oder 45000 M. nach heutigem Gelde.
*
Das Gesamteinkommen eines Kardinals betrug während der Regierung
Klemens VI. und Innozenz VI. nach der aktenmäßig fundierten Berechnung
Sauerlands mindestens 4000–5000 Kammergoldgulden jährlich.
Das Hirtenamt war also recht einträglich, denn nach unserem Gelde
entspricht diese[S. 192] Summe einer Kaufkraft von 120000–150000 M. Mancher
von ihnen wird aber jährlich eine doppelt oder dreifach so große
Summe vereinnahmt haben. Das läßt sich beispielsweise aus dem
Nachlaßinventar Hugo Rogers, des Bruders Klemens VI. erweisen. Am 20.
September 1342 zum Kardinal ernannt, starb er am 21. Oktober 1363.
Er war also 21 Jahre Kardinal. In seinem Nachlaß fand man 179186
Goldmünzen und über 8000 Silbermünzen, also eine Geldmasse, deren
damalige Kaufkraft einer heutigen Summe von etwa 6000000 M. gleichkommt.
Diesem Oheim Hugo hatte dessen Neffe Peter, der mit 17 Jahren Kardinal
und mit 39 Jahren Papst war (Gregor XI.) erfolgreich nachgeeifert. Sein
Nachlaß enthielt außer dem Gold- und Silbergerät in barem Gelde 140503
Goldgulden, die aber natürlich nicht der Christenheit oder den Armen,
sondern seinem nahen Verwandten Reymond von Turenne als Haupterben
zufielen.[180]
*
Sauerland hat festgestellt, daß im 14. Jahrhundert im Rheinland nicht
weniger als 94 Nichtpriester im Besitz von Pfarreien waren. Das
schlug natürlich auch damals dem Kirchenrecht ins Gesicht. Während es
häufig in den Urkunden heißt, daß dieser Zustand »viele Jahre« gedauert
hat, gelang es dem Gelehrten, 38 Fälle genau festzustellen. Unter
diesen findet sich in fünf Fällen die Dauer von 10 Jahren, in einem
Fall 11 Jahre, in zwei Fällen 12 Jahre, in drei Fällen 13 Jahre, in
einem Fall 14 Jahre, in zwei Fällen 16 Jahre, in einem Fall 19 Jahre,
in einem Falle aber[S. 193] sogar 26 Jahre!! Es kam vor, daß ein
Nichtpriester einem ebensolchen folgte!
Unter den 38 Pfarrinhabern finden sich ein Knabe von 6 Jahren,
einer von 10 Jahren, vier von 11 Jahren und ein Knabe von 14
Jahren.[181]
*
Nicht nur die Söhne von Geistlichen erhielten durch
päpstlichen Dispens mit der Priesterwürde die Pfründe, sondern auch
ein Nonnensohn wird genannt. An sich ist Vorurteilslosigkeit
gegenüber der Herkunft gewiß kein Kulturkuriosum, aber merkwürdig
ist, daß die angeblich so sittenstrenge Kirche daran keinen Anstoß
nimmt.[182]
*
Ein schönes Beispiel für die Dimensionen, die zur Zeit des
Avignonischen Papsttumes die Pfründenjagd einnehmen konnte, bietet
der Dr. Regum Heinrich Sudermann, Angehöriger einer adeligen
Dortmunder Patrizierfamilie. Er war Sekretär des in ständiger Geldnot
befindlichen Kölner Erzbischofs Walram und erhielt von ihm für eine
Anleihe von 500 Goldgulden die bedeutenden Höfe der Kölnischen Kirche
zu Hagen und Schwelm samt der dortigen erzbischöflichen Gerichtsgewalt
verpfändet.
Während der Regierung Benedikts XII., zwischen 1337 und 1340, erschien
Sudermann viermal als erzbischöflicher Gesandter an der Kurie. Dafür
erhielt er nur die Exspektanz für eine Kanonikatspfründe der Kölner
Severinskirche, die im nächsten Jahre zu[S. 194] einer Exspektanz für eine
höhere Pfründe derselben Kirche erweitert wurde. Das war gewiß nicht zu
viel. Aber es sollte nicht alles bleiben.
Unter der sechsjährigen Regierung Klemens VI. erhielt er eine
Kanonikatswohnung, eine Kanonikatspfründe und die Scholastrie der
Kölner Andreaskirche. Außerdem erwirkte er seinem Bruder Bertram
Exspektanzen auf zwei Pfründen und ferner eine priesterliche
Kanonikatspfründe der Kölner Domkirche. Für einen außerehelich
geborenen Neffen Hermann erwirkte er päpstliche Dispens zum Empfang
der Weihen und eine Pfründe oder eine Exspektanz, einem andern Neffen
eine Exspektanz für eine Kanonikatspfründe der Soester Patroklikirche.
Ferner erwirkte er zwei Angestellten bzw. Bekannten Pfründen.
Später trat Suderman als Notar in päpstliche Dienste und wurde in
wichtigen Geschäften viermal nach Deutschland geschickt. Dafür erhielt
er für seine eigene Person noch drei Pfründen vom Papste, so daß er am
Ende des Pontifikats Innozenz VI. im Besitze der Pfründen von Lüttich,
Haslach, Maastricht, Xanten und St. Andreas in Köln sich befand. Sie
warfen etwa 120 Mark Silber jährlich ab, die Mark Silber galt etwa
fünf Kammergoldgulden, dessen Wert etwa zehn Mark, deren Kaufkraft
damals aber zwei bis dreimal so hoch war wie heute, so ergibt sich eine
Jahresrente von 12–18000 Mark. Das ist durchaus nicht übertrieben. Aber
Suderman wirkte weniger für sich, als für seine Verwandten, Freunde
und Diener.
Das eine Mal erbittet er Pfründen bzw. Pfründenexspektanzen für
sechs Neffen und zwei Diener,[S. 195] das andere Mal für drei
unehelich geborene Neffen je eine Exspektanz für eine höhere
Pfründe, ein drittes Mal Pfründen und Exspektanzen für fünf Verwandte,
ein viertes Mal fünf Pfründen und zwei Pfründenexspektanzen für sieben
Neffen, ein fünftes Mal Pfründen und Pfründenexspektanzen für sechs
Verwandte, Gehilfen und Diener und ein sechstes und letztes Mal elf
Pfründenexspektanzen für elf Neffen. Onkels von heute, nehmt euch ein
Beispiel an diesem edlen Manne, der während der Regierung Innozenz’
VI. nicht weniger als 56 päpstliche Verleihungen von Pfründen und
Exspektanzen für andere erwirkte!
Hier lernten wir ein Musterbild eines vornehmen Kurialen der Avignoner
Papstzeit kennen, der für sich wenige, aber fette Pfründen erwirbt,
aber möglichst viel für seine Verwandten und Diener zu erwerben
trachtet und versteht. Was Nepotismus ist, dürfte nunmehr jeder
wissen.[183]
*
Doch was will der Nepotismus eines Kurialbeamten des 14. Jahrhunderts
bedeuten gegenüber dem des Papstes Sixtus IV. und seiner Nachfolger! Er
wurde nie, weder vorher noch nachher, so rücksichtslos betrieben. Er
war das Prinzip aller Handlungen dieses Statthalters Christi.
Im Jahre seiner Papstwahl noch, 1471, machte er zwei Neffen, Pietro
Riario, den man für seinen Sohn hielt, und Julian Rovere, nachmals
Julius II., junge Menschen niederer Abkunft, weder durch Ver[S. 196]dienst
noch Talent ausgezeichnet, zu Kardinälen. Dessen ungeachtet erhielt
Pietro die Würden eines Patriarchen von Konstantinopel, eines
Erzbischofs von Sevilla, Florenz und Mende und so viele Benefizien, daß
sich sein Einkommen auf 60000 Goldgulden belief. In den zwei Jahren,
die dieser Parasit noch zu leben hatte, bis Reichtümer und Leben
vergeudet waren, stürzte sich Riario in die sinnloseste Schwelgerei.
Seine Feste übertrafen an Verschwendung alles je Dagewesene. Seine
Nachttöpfe waren aus vergoldetem Silber! Der erbärmliche Mensch
starb, erst 28 Jahre alt, nachdem er 200000 Goldgulden (ca. acht
Millionen Mark!) verpraßt hatte, mit Hinterlassung großer Schulden. Er
war mächtiger gewesen als der Papst![184]
*
Die kirchlichen Zustände im 14. Jahrhundert werden am Beispiel
des Erzbischofs Walram von Köln deutlich. Um das Jahr 1315,
als zwölfjähriger Knabe, hatte er bereits eine Kölner
Domkanonikatspfründe erhalten, noch bevor ihm die Tonsur erteilt
worden war. In seinem 23. Lebensjahre erhielt er dazu die Propstei
der Maastrichter Stiftskirche S. Servatii, eine Sinekure, sowie die
Thesaurarie der Kölner Domkirche, obschon er damals für beide Würden
noch nicht das kanonische Alter hatte. Nachdem er dieses erreicht,
verlieh der Papst ihm noch die Propstei der Lütticher Domkirche, eine
Kuratdignität, samt einer dortigen Domkanonikatspfründe und gestattete
ihm den Fortbesitz der Maastrichter Propstei. Weil er aber unterlassen
hatte, wegen der beiden erst[S. 197]genannten Dignitäten den vorgeschriebenen
kanonischen Dispens wegen mangelnden Alters einzuholen, war er der
kirchlichen Strafe der Infamie und der Unfähigkeit zum Erwerb und
Besitz kirchlicher Pfründen verfallen. Doch die päpstliche Lossprechung
von diesen Kirchenstrafen und kanonische Wiedereinsetzung in die
Kirchenpfründen wurde ihm unterm 30. September 1330 zuteil.
Zugleich schrieb ihm der Papst vor, bis zum nächsten Osterfest
(1331) die für die Lütticher Dompropstei kanonisch erforderliche
Subdiakonatsweihe und dann binnen dreier Jahre die dafür ebenfalls
erforderliche Diakonats- und Priesterweihen sich erteilen zu
lassen. Walram versäumte die erste Pflicht und erfüllte auch die
Residenzpflicht nicht. Deshalb verfiel er neuerdings den vorgenannten
Kirchenstrafen. Doch erhielt er am Ostermontag 1331 die päpstliche
Lossprechung und zugleich die Erlaubnis, den Empfang der Diakonats- und
Priesterweihe noch drei Jahre lang aufzuschieben. In der Zwischenzeit
hatte Walram am 21. Oktober 1328 Titel und Vorrechte eines päpstlichen
Kaplans erhalten.
Diese, wenigstens nach heutigen Begriffen, nicht ganz normale
Lebensgeschichte war aber noch lange nicht zu Ende. Am 27. Januar
1332 wurde nämlich Walram zum Erzbischof von Köln ernannt. Da er aber
das vom kanonischen Recht für einen Bischof erforderliche Alter noch
nicht erreicht hatte, was dem Papste verschwiegen worden war, so war
die Ernennungsurkunde ungültig und mußte durch eine neue gültige
Ausfertigung, die das Datum des folgenden Tages trägt, ersetzt werden.
[S. 198]
Der noch nicht dreißigjährige Erzbischof hatte erst die sogenannten
niederen Weihen erhalten. Deshalb bekam er vom Papste die Erlaubnis,
binnen dreier Jahre sich die drei höheren Weihen von einem beliebigen
Bischof erteilen zu lassen.
Diese ganze abenteuerlich klingende, aber durchaus nicht vereinzelte
Geschichte findet ihre Erklärung darin, daß Walram von seinem Bruder,
dem Grafen Wilhelm von Jülich, dem Neffen des französischen Königs,
protegiert worden war. Dieser hatte dem Papst als Entgeld für
seine Bereitwilligkeit in der Ernennungsangelegenheit das eidliche
Versprechen gegeben, dem päpstlichen Stuhle zeitlebens treu und ergeben
zu bleiben und ein Widersacher Ludwigs des Bayern und anderer Gegner
des Papsttums zu sein.
Außerdem war die Sache für Wilhelm auch nicht billig. Sie hatte nämlich
40000 Goldgulden gekostet, also etwa 1200000 Mark nach heutigem
Geldwert!
Daß das Erzbistum diese Summe wieder aufbringen mußte, ist
selbstverständlich. Aber das ging nicht glatt. Vielmehr sah sich
Walram gezwungen, aus Gründen der Sparsamkeit das hochverschuldete
Erzstift, dessen wichtigste Besitzungen verpfändet waren, zu verlassen
und seine Verwaltung fremden Personen anzuvertrauen. Er wanderte mit
wenigen Begleitern nach Frankreich, wo er nach 17jähriger nicht eben
glorreicher Verwaltung der hohen Würde am 14. August 1349 in Paris
starb.[185]
*
Wie wenig Rücksicht die Avignonischen Päpste auf die materielle
Wohlfahrt der Kirchenprovinzen[S. 199] legten, geht schon aus der einzigen
Tatsache schlagend hervor, daß der Nachfolger Walrams, Wilhelm von
Genepe, sich verpflichten mußte, Klemens VI. 30000 Goldgulden zu
zahlen.[186]
*
Auch heute noch scheint der geistliche Beruf recht einträglich zu
sein, wie aus der in »Reynolds Newspaper« (6. Januar 1907) enthaltenen
Zusammenstellung von Hinterlassenschaften von Klerikern im Jahre 1906
aus England hervorgeht.
233 testamentarische Hinterlassenschaften mit in Summa 5638073 £, im
Durchschnitt pro Person 23933 £ werden hier notiert.
10 überstiegen 2 Millionen Mark: Rev. Sir Richard Fitzherbert,
Rektor von Warshop = 530548 £. Rev. J. H. Godber, Kanonikus von
Southwell = 218506 £. Jeder dieser 10 hinterließ im Durchschnitt 179121
£.
Die 9 Bischöfe, deren Testament im Jahre 1901 veröffentlicht wurde,
hinterließen im Durchschnitt je 24332 £, also etwa eine halbe Million
Mark.
[S. 200]
Neunter Abschnitt
Klerus und Sittlichkeit
Gegen den ersten Band dieses Buches ist von ultramontanen Blättern der
Vorwurf erhoben worden – natürlich ohne auch nur den Gegenbeweis,
der völlig aussichtslos gewesen wäre, zu versuchen –, daß ich die im
mittelalterlichen Klerus herrschende Unsittlichkeit stark übertrieben
hätte. Nun liegt mir nichts ferner, als zu bestreiten, daß es zu allen
Zeiten und überall sittenstrenge und edle Menschen gegeben habe und daß
auch die katholische Geistlichkeit solche stets in ihren Reihen zählte.
Wohl aber ist es grundfalsch, ihnen eine höhere Moral zu imputieren. Im
Gegenteil waren im Mittelalter und besonders vor der Reformation dort
häufig Zustände zu finden, die man kaum irgendwo in einer Gesellschaft,
die nur einigermaßen auf gute Sitten Anspruch erheben möchte, antreffen
dürfte.
*
Der ultramontane Historiker Janssen hielt die Unsittlichkeit des
Klerus vor der Reformation für kaum der Erwähnung wert und führt die
Verwilderung in tendenziöser und die Tatsachen auf den Kopf[S. 201] stellender
Weise auf die Reformation zurück. Mag diese große Geistesbewegung auch
viele Schattenseiten im Gefolge gehabt haben, so wird die Gerechtigkeit
ihr doch zum mindesten eine Besserung der öffentlichen Sittlichkeit
zubilligen müssen.
*
Ein anderer Gesinnungsgenosse Janssens, H. Finke, im übrigen ein
vortrefflicher Historiker, hat zum mindesten Schleswig-Holstein und
Westfalen für die Länder erklärt, die von der sittlichen Verwilderung
der Zeit verschont geblieben seien[187], eine Behauptung, die Pastor
nicht nur übernimmt, sondern in seiner Bearbeitung des Janssenschen
Werkes noch erweitert.[188] Unter diesen Umständen ist es besonders
amüsant, die Zustände Westfalens, also des vorgeblichen
sittlichen Musterlandes, kennen zu lernen.
Es handelt sich um einen offiziellen Bericht des Fiskalprokurators
Friedrich Turken, also eines Geistlichen, am Kölnischen Offizialgericht
in Werl an den Siegler des Offizialgerichts in Köln vom Jahre 1458.[189]
Das Dokument ist mithin völlig einwandfrei und nicht, wie man glauben
möchte, die gehässige Streitschrift eines Satirikers.
Zunächst werden Verstöße gegen die äußere kirchliche Ordnung
festgestellt, widerrechtliche Abhaltung des Gottesdienstes, Ausfall
der Messe bis zu 14 Tagen, Simonie, gehässige Verweigerung des
Beichtstuhls, Spendung des Abendmahls an Exkommunizierte, und zwar
bewußt und aus Dreistigkeit. In Rüthen werden zwei Vikariate gegründet,
nur damit der Pfarrer als Vagabund leben kann.
Ferner wird konstatiert, daß die Geistlichkeit sich[S. 202] nicht nur an
Wein- und Getreidehandel beteiligt – und zwar trotz Wohlstandes
aus purer Gewinnsucht –, sondern daß der Klerus allgemein Zins-
und Wuchergeschäfte macht. Der Pfarrer in Rüthen erhält von einem
Sterbenden um der Absolution und der Exsequien willen alle Güter
vermacht, hat ihn dann aber weder absolviert, noch kirchlich
bestattet. Die fünfjährige Tochter des Verstorbenen ist dadurch
gezwungen, sich von Almosen zu nähren.
Der Gewinnsucht ebenbürtig ist die Schimpfwut und
Gewalttätigkeit. Das Dokument führt die Schimpfworte genau an.
Uns interessiert mehr die Tatsache, daß ein Pfarrer den Schulmeister
vor dem Altar »im Angesicht des ewigen Gottes« verprügelt, oder daß
der von Flierich seine eigene Mutter mißhandelt, oder daß ein
anderer in Schwerte mit Bürgern ein Messerstechen veranstaltet.
Bei demselben wird für die Fastnacht die Teilnahme an einem Turnier
getadelt.
Harmloser ist das wilde Jagen der Geistlichkeit bis zu reinem
Vagabundenleben, nicht schön der Wirtshausbesuch mit Betrunkenheit,
Erbrechen und Übernachten auf der Straße. Am wenigsten erfreulich
die geschlechtliche Unsittlichkeit. Das Protokoll enthält fünf
Fälle von Konkubinaten der Pfarrer mit verheirateten Frauen, deren
Männer noch leben. Einmal wird die Frau gegen die ausdrückliche
Reklamation des Mannes vom Pfarrer zurückbehalten, ein Mandat
des Erzbischofs bleibt gänzlich wirkungslos. Daneben erscheinen
Prostituierte im Umgang mit Pfarrern, so scheint das Leben
des Kaplans Heinrich Jummen in Werl sich – und[S. 203] zwar ganz
öffentlich – überhaupt vornehmlich in diesen Kreisen zu bewegen.
Das Benehmen dieses Seelenhirten wird im Dokument bis herab zu den
Wechselreden im Frauenhause mit einer Laszivität geschildert, die
nur mit der Faszetienliteratur verglichen werden kann. Der Pfarrer
in Altenrüthen hat eine Ehefrau und zwei Ledige mißbraucht,
im Nachbardorfe Rüthen aber gar drei Ehefrauen und eine Ledige,
in Elsey zwei Ledige. Förmliche Schlägereien zwischen Konkubinen
um einen Pfarrer kommen vor. Der Aplerbecker veranstaltet eine große
Gasterei zur Hochzeit seiner Tochter. Dieselbe Konkubine
dient gleichzeitig und auch nacheinander verschiedenen Geistlichen.
Übrigens muß sich auch die Breslauer Diözesansynode von 1440 gegen
das Konkubinat mit Ehefrauen wenden. Die Eichstädter Diözesansynode
von 1453 aber sieht sich ausdrücklich zur Festsetzung veranlaßt, daß
auch simplex fornicatio eine Sünde sei. Man war also bisher
zumeist anderer Ansicht.
*
Papst Gregor XII. erließ im Jahre 1308 eine Bulle, in welcher die
Zustände in einer großen Anzahl von Benediktinerinnenklöstern der
nordwestdeutschen Diözesen Bremen, Münster und Utrecht dargestellt
werden.
Nachdem der Papst festgestellt hat, daß fast jegliche Religion
und Beachtung der Ordensregel abhanden gekommen sind, dafür aber
Fleischeslust und Laster regierten, fährt er fort:
»Sie selbst, aus weltlichem Stande und Leben[S. 204] hervorgegangen,
nehmen bisweilen ihre Konkubinen oder Kebsweiber, die sie, wie
vorausgeschickt, im weltlichen Stande gehalten hatten, sogar mitsamt
den Kindern, die sie mit den Kebsweibern gezeugt hatten, mit sich in
die vorgenannten Klöster, in die sie aufgenommen wurden, und halten
und begünstigen sie in ihnen ganz öffentlich, wie sie es früher getan
hatten, als sie noch selbst in weltlichem Stande gelebt hatten, und
scheuen sich nicht, die Messe und andere heilige Ämter zu feiern,
ohne von solchen Verbrechen absolviert zu sein. Es huren auch viele
Nonnen mit ihren Prälaten, Mönchen und Geistlichen herum und gebären in
denselben Klöstern viele Söhne und Töchter, die sie von den gleichen
Prälaten, Mönchen und Geistlichen durch Hurerei oder blutschänderischen
Beischlaf empfangen haben.
Die Söhne aber machen sie zu Mönchen, die auf dieselbe Weise
empfangenen Töchter aber häufig zu Nonnen in den genannten Klöstern.
Und was bemitleidenswert ist: viele dieser Nonnen vergessen
ihre mütterliche Liebe und treiben, indem sie Böses durch Böses
noch vermehren, ihre Frucht ab und töten die zutage geförderten
Kinder....«[190]
*
Im Jahre 1423 berief Erzbischof Otto von Ziegenhain eine
Provinzialsynode, auf der die Sittenzustände im Klerus der Trierer
Kirchenprovinz folgendermaßen geschildert werden:
»Wiewohl aber gegen jene bereits geweihten Kleriker, die notorisch
Konkubinen bei sich halten oder andere verdächtige Weiber viele neue
und alte[S. 205] Gesetze erlassen sind und mehrere bestraft wurden, haben doch
viele heutige Kleriker keine Achtung vor den genannten Strafen, sondern
sie entehren sich, indem sie diese verruchte Sünde begehen. Daraus
entsteht viel Ärgernis, und aller Wahrscheinlichkeit nach würde es noch
mehr sein, wenn nicht Vorkehrungen getroffen würden.«
Daraufhin erließ die Provinzialsynode den Befehl, daß kein Presbyter
oder Kleriker eine Konkubine oder eine verdächtige Weibsperson in
seinem Hause habe. Habe er aber eine solche bei sich, so müsse er
sie binnen zwölf Tagen »tatsächlich und mit Erfolg entfernen und
entlassen«.
*
An solchen Schilderungen von authentischer Seite ist kein Mangel.
Bemerkenswert ist noch das 17. Kapitel der Kölner Diözesansynode vom
Jahre 1307, das über Vorfälle in Nonnenklöstern berichtet:
»... viele Nonnen unserer Stadt und geheiligten Diözese werden
geschändet, und wenn sie so geschändet sind, von diesen (Verführern)
aus ihren Klöstern entführt und zur großen Gefahr ihrer Seelen und
vielem Ärgernis öffentlich abspenstig gemacht. Die so Ferngehaltenen
werden durch die nämlichen bisweilen durch Listen, häufig durch
Drohungen und Gewalt, ihren Klöstern wieder zurückerstattet.
Die Nonnen selbst aber, die so gehalten sind, werden, um nicht durch
ihre Straflosigkeit zu Ähnlichem zu verführen, durch die Äbtissinnen,
Lehrerinnen oder Priorinnen und die Konvente ihrer Klöster nicht anders
wieder aufgenommen, als auf Grund[S. 206] einer Karzerstrafe,... bis sie durch
uns... der Wiederaufnahme.. würdig erachtet werden.«
Im Jahre 1371 mußte in Köln ein gleicher Befehl erlassen werden.[191]
*
Die gleiche Kölner Synode sah sich auch veranlaßt, in ihrem 15.
Kapitel ausdrücklich den Klerikern zu verbieten, in ihren Testamenten
über die Einkünfte des sogenannten Gnadenjahres, das ist des
ersten Jahres nach ihrem Tode, dessen Einkünfte ihnen noch zukamen,
zugunsten ihrer Konkubinen und ihrer unehelichen Kinder zu
verfügen.
Zu Beginn des 14. Jahrhunderts kam es soundso oft vor, daß Mönche
und Nonnen aus ihren Klöstern aussprangen und dann nach Aufgabe der
Ordenskleidung und Ordenszucht als Weltleute lebten. Daß relativ nicht
viel urkundliches Material uns erhalten ist, hat seinen Grund darin,
daß nur solche Fälle zu unserer Kenntnis gelangen, in denen diese
Ordenspersonen später ihre Flucht aus dem Kloster bereuten und
die Wiederaufnahme begehrten. Nur wenn sie die Hilfe des Papstes
dazu in Anspruch nahmen, besitzen wir die einschlägigen Dokumente. Wie
häufig jedoch tatsächlich diese Fahnenflucht war, erhellte daraus, daß
Papst Benedikt XII. sich veranlaßt sah, eine besondere Konstitution zu
erlassen.[192]
*
Die sogenannten Strafakten des Marienburger Ordenshauses enthalten
mehrere Fälle, wo die Deutschen Herren unter dem Deckmantel der Beichte
und[S. 207] Buße systematisch Verführung von Frauen und Jungfrauen, ja sogar
gewaltsame Schändung von neun- und zwölfjährigen Mädchen verübt hatten.
Der Ordensmeister Jungingen sah sich veranlaßt, Verbote zu erlassen,
daß kein weibliches Tier, weder Stute, noch Eselin, noch Hündin, im
Ordenshause gehalten werden dürfe. Ähnliche Verbote bestanden auch
für die Klöster auf dem Berge Athos. In Rom mußten sie gar noch in den
dreißiger Jahren des 19. Jahrhunderts erneuert werden!!!
Wiewohl nun die Ordensritter in Marienburg ein wohleingerichtetes
Frauenhaus unterhielten, liefen doch häufig Beschwerden von Bürgern
ein, daß ihre Frauen und Töchter mit Gewalt aufs Schloß geschleppt und
dort bis zur Mißhandlung gemißbraucht wurden.[193]
*
Klemens VI. hat im ersten Jahre seines Pontifikats 1342 sieben Trierer
und dreizehn Kölner, die unehelich von Priestern erzeugt worden
waren, dispensiert, so daß sie Priester werden konnten. In den Jahren
1335–1342 war dieser Dispens 9 Priestersöhnen der Diözese Metz, 17
ebensolchen der Diözese Trier, 20 der Diözese Köln und 36 der Diözese
Lüttich erteilt worden. Im ganzen absolvierte Klemens im gleichen
Jahre 484 Priestersöhne nach Ablegung eines Examens. Bedenkt
man nun, daß selbstverständlich nicht jede Bitte um Dispens erfüllt
wurde, daß doch nicht jedes Kind eines Priesters ein Sohn ist, nur
ein Bruchteil das entsprechende Alter erreicht und doch gewiß nicht
die Mehrheit gerade den Priester[S. 208]beruf wählte, der eines besonderen
päpstlichen Dispenses bedarf, also der einzige ist, den zu ergreifen
diese Herkunft de jure ausschließt, so wirft das alles auf die Art, in
welcher das Zölibat gehalten wurde, ein grelleres Licht, als die noch
so drastischen Exklamationen der Sittenprediger und Chronisten.
*
Von unbedingt kompetenten Beurteilern liegt für die nordischen Länder
ein Bericht des päpstlichen Notars und Abbreviators Dietrich von
Nieheim (»Nemus Unionis«) vom Jahre 1408 (abgedruckt bei Sauerland S.
298 f.) und für Spanien und Süditalien des päpstlichen Pönitentiars
Alvar Pelajo vom Jahre 1332 in seiner Schrift »De planctu ecclesiae«
(abgedruckt eb. S. 297 f.) vor. Das von beiden unverdächtigen
Zeugen gefällte Urteil entspricht völlig den aus der Statistik
gezogenen Schlüssen. Nieheim stellt z. B. ausdrücklich fest, daß es
den norwegischen Presbytern und Bischöfen nach heimischer Sitte
freistand, öffentliche Konkubinen zu halten. Dabei waren diese
weiblichen Personen ganz und gar nicht gering geschätzt, sondern
nahmen geradezu am Range ihres Freundes teil. Daß Priester niederen
Ranges, die das Zölibat hielten, ja, die ohne Konkubine lebten, nicht
die Regel, sondern die Ausnahme bildeten, verstände sich von selbst,
auch wenn es nicht ausdrücklich berichtet würde.[194]
[S. 209]
*
Als der päpstliche Vikar unter Sixtus IV. den Geistlichen und Kurialen
verbot, sich Konkubinen zu halten, tadelte der Papst ihn deshalb
heftig und hob das Verbot wieder auf. Er motivierte es damit,
daß man kaum einen Priester ohne Konkubine fände. »Und aus diesem
Grunde wurden die Prostituierten gezählt, die damals in Rom öffentlich
waren, um ein wahrheitsgetreues Bild zu gewinnen und die Zahl der
Prostituierten auf 6800 festgestellt, abgesehen von jenen, die im
Konkubinat leben und die nicht öffentlich, sondern im geheimen zu fünft
oder sechst ihre Künste ausüben, desgleichen jener, die einen einzigen
oder mehrere Kuppler haben. Daran kann man erkennen – schreibt
Infessura –, wie in Rom gelebt wird, wo das Haupt des Glaubens wohnt,
und wie der heilige Staat regiert wird.«[195]
Berücksichtigt man, daß Rom damals kaum 70000 Einwohner hatte, so läßt
sich der Prozentsatz der Prostituierten etwa folgendermaßen berechnen:
Ziehen wir ein Drittel der Einwohner – sehr mäßig gerechnet – als
Kinder und Greise ab, so bleiben etwa 45000, nehmen wir an, die
Hälfte davon sei weiblich gewesen, dann war jede vierte weibliche
Person eine Prostituierte, ohne Rücksicht auf die im Konkubinat
lebenden![196]
*
Wir besitzen aus den Jahren 1519–1521 für ein kleines Gebiet der
Mainzer Erzdiözese Taxlisten, in denen die Höhe der Strafe für die
einzelnen Delikte von Priestern festgesetzt ist.
[S. 210]
Der Bordellbesuch von Priestern wird von allen Vergehen am niedrigsten
eingeschätzt, nämlich im Durchschnitt auf 16 sol. Ehebruch kostet
schon 30, Inzest 88 sol. Gegenüber dieser niedrigen Bestrafung von
Fleischessünden, die ein vernichtendes Urteil über die kirchliche
Moral nicht nur gestattet, sondern fordert, werden Verstöße gegen die
kirchliche Ordnung überaus hoch bestraft.
Unkanonische Amtsführung kostet 29 sol., Nichtbeachtung der
Residenzpflicht 44, Begräbnis eines Exkommunizierten aber 240 sol.
Also war in den Augen der mittelalterlichen Kirche die Sünde, einen
Exkommunizierten ehrlich zu bestatten und damit praktisches Christentum
zu üben, fast dreimal so schwer wie die der Blutschande, während man um
dasselbe Geld sich als Priester acht Ehebrüche leisten konnte.
*
Diese kulturhistorisch außerordentlich wertvolle Strafliste erstreckt
sich auch auf Laien. So kostet eine Übertretung des Fastenverbotes
gerade doppelt so viel als ein Ehebruch.
Die Jahresrechnungen des Kölner Offizialatgerichtes in Werl aus den
Jahren 1495–1515 ergeben ein ähnliches Bild. Denn die höchste der
hier vorkommenden Strafen, nämlich 31 fl. 2 ß ist auf Celebratio
in suspensio gelegt, während zwei schwere Inzestfälle nur mit 19
fl. 5 ß oder 20 fl. 8 ß geahndet werden, ein anderer gar nur mit 14
fl. Ein doppelter Unzuchtfall erhält die Strafe von 3 fl. 5 ß. Sehr
billige,[S. 211] geradezu Tietzpreise, erzielten einfache Unzuchtfälle. Sie
bleiben massenhaft überhaupt unter dem Satze von 1 fl. Ehebruch war
kostspieliger, denn die Strafe von 3 fl. 9 ß wird mit der Armut des
Inkulpaten motiviert.
*
Teuer waren dagegen Verstöße gegen die Kirchenordnung: der Laie,
der seinen Priester hintergeht und trotz seiner Exkommunikation das
Abendmahl nimmt, erhält eine Strafe von 2 fl. 6 ß, der Priester aber,
der ihm ahnungslos das Abendmahl reicht, 6 fl. 5 ß.
Während ein Laie, der, ohne es zu wissen, eine Verwandte vierten Grades
geheiratet hat, einer Buße von 3 fl. 9 ß unterworfen wird, kommt ein
Priester, der mit einem Schulmädchen in seinem Hause Unzucht treibt,
schon mit 1 fl. durch.
Auch in dem 1517 in Rom gedruckten Taxenbuch wird Zulassung eines
Exkommunizierten zum Gottesdienst schwerer bestraft, wie Inzest. Ganz
ähnlich übrigens schon die berühmten Dekretalien des Bischofs Burchhard
von Worms († 1025). Man vergleiche das 19. Buch dieses Werkes (Pariser
Ausgabe von 1549, S. 262 ff.).
Zweifelt noch jemand, daß es der Kirche vor der mit so viel Fanatismus
und Borniertheit bekämpften Reformation keineswegs so sehr um Hebung
der Sittlichkeit, als um Erzwingung äußerlicher disziplinärer
Unterordnung zu tun war? Denn diese Taxen, die jeder Moral ins Gesicht
schlagen, sind nicht etwa[S. 212] von irgendwelchen lokalen Gewalten, sondern
von der offiziellen Kirche festgesetzt worden.
Dazu gibt es noch eine ganze Reihe von Beispielen, daß diese milden
Strafen gegen Geistliche nicht verhängt wurden. Daher existierte ein
Sprichwort: Wer ohne Strafe leben will, der werde Kleriker.
*
Als die Camminer Synode von 1454 die Vertreibung der Konkubinen binnen
zwölf Tagen bei einer Strafe von 10 Mark Silbers gebietet, vergißt
sie nicht den Zusatz: »es sei denn, sie würden aus gerechten und
vernünftigen Gründen von uns geduldet«!!!
*
Nach Aussagen Kölner Pfarrer von 1484 über die Behandlung homosexueller
Vergehen ergibt sich, daß die Geistlichen es bisweilen überhaupt
unterließen, kirchliche Strafmittel anzuwenden. Die kirchlichen
Behörden hatten es eben vielfach aufgegeben, sich dem Sittenverfall
entgegenzustemmen. Das war eine natürliche Folge der aszetischen
Grundtendenz der Kirche, die im unüberbrückbaren Widerspruch zum
Leben stand. Die Kirche war einfach ratlos gegenüber der allgemeinen
sittlichen Auflösung, die eintreten muß, wenn Unmögliches gefordert
wird.
*
Da die Kirche trotz zahlloser, im 15. Jahrhundert zur Schärfung
des Gewissens der Geistlichkeit abgehaltener Provinzial- und
Diözesansynoden, trotz[S. 213] Klostervisitationen und glühenden
Volkspredigern kein nennenswertes Resultat erzielte, sahen sich
vielfach die weltlichen Fürsten genötigt, die Reinigung des geistlichen
Standes vorzunehmen. So ordnet Herzog Wilhelm von Jülich am 2. August
1478 die Vertreibung der »pfaffenmede« an.[197]
*
Die Freunde Zwinglis verfaßten 1522 einen »Kommentar«, in dem sie gegen
den Bischof Hugo von Hohenladenberg, der von 1496–1529 den Krummstab
über Konstanz führte, die schwersten Vorwürfe erhoben. So, daß er
früher 4, jetzt 5 Gulden Strafe für jedes illegitime Priesterkind
erhebe. Das war auch der Grund, weshalb er gegen die Eheforderung der
Priester war, denn er wollte auf eine so reiche Einnahmequelle nicht
verzichten. Sollen doch in einem einzigen Jahre in seiner Diözese nicht
weniger als 1500 Priesterkinder geboren worden sein, von denen er also
nach dem alten Satz 6000, nach dem erhöhten aber 7500 Gulden Strafgeld
bezog! Habe einer eine Konkubine oder nicht, so sage man ihm: »Was geht
dies meinem gnädigen Herren an, daß du keine hast? Warum nimmst du
nicht eine?« Das Geld mußte auf alle Fälle erlegt werden.
Selbst wenn in dieser Schrift eine Übertreibung untergelaufen sein
sollte, so ist es doch bezeichnend, daß die Zeitgenossen das von ihrem
Seelenhirten für glaubhaft hielten, und der Rat der Stadt Zürich
amtlich in einem Aktenstück festgestellt, »daß die Bischöfe Geld nehmen
und den Pfarrkindern ihre Metzen lassen«.[198]
[S. 214]
*
Der Erfolg der landesherrlichen Eingriffe, die besonders seit dem
Trientiner Konzil sich mehrten, war aber sogar noch im 17. Jahrhundert
keineswegs groß, selbst nicht in Bayern, das sich heute mit gerechtem
Stolz rühmen darf, Deutschlands größte Dunkelkammer zu besitzen.
Das Konkubinat der Priester war noch keineswegs ausgerottet und die
Zahl der Priesterkinder groß. Der durchaus klerikale Schriftsteller
Albertinus schreibt sehr vielsagend über die Sittlichkeit unter
Maximilian I. von Bayern (gest. 1650), daß durch die Menge
der Sünder die Sünde nicht geringer werde. Damals wurde im Rendamt
Landshut, das aber sittlich höher stand als Burghausen, eine ganze
Reihe von Geistlichen aufgeführt, denen Verführung von Dienstboten,
Mißbrauch des Beichtstuhls, Notzuchtsversuche, Körperverletzungen etc.
zur Last fielen. Von den Konventualen zu Osterhofen heißt es, daß sie
nächtlicherweile viel auslaufen und sich an leichtfertige Weibspersonen
hängen.[199]
*
Die »Newe Zeitunge von der Römischen Kayserlichen Mayestet Legation gen
Rom zum new erwehlten Papst, im jetzigen Jar, nach weihnachten 1560. in
4o« bringt folgenden erbaulichen Stimmungsbericht aus der Hauptstadt
der Christenheit.
»Ich glaube nicht, daß unter der Sonne ein ärger Leben verbracht werde,
als in Rom. Das geht umher den ganzen Tag auf Gassen und Straßen,
alles durcheinander, und der feilen Mädchen und Weiber gar viele, so
daß deren daselbst leben 30000, wie ein[S. 215] Register sagt, deren die
geringste jede dem Papste jährlich 2 Kronen zahlt, die stattlichste
aber 20 Kronen. Sie sind fast hoch privilegiert, daß man keine darf
krumm ansehen; denn wenn sie einen verklagen, der wird ohne alle Gnade
gestraft.
Und da haben sich Männer und Weiber verlarvt, wie die Narren in
Teutschland, in der Fastnacht. Unter solchen Mummereien reiten auch die
Pfaffen einher. Und haben wir gesehen, daß der Kardinal Farnese
alle Gassen durchrannte, mit und um ihn dreizehn Curtisaninnen.
So findet man auch viele Weiber ins Mannskleidern einher gehen, mit
zerhackten und zerschnittenen Hosen, und haben ihre Rapiere an den
Seiten, als wären sie Landsknechte. Dieselbe müssen Briefe (d. h.
Erlaubnisscheine) haben, welche sie aber theuer kaufen von päpstlicher
Heiligkeit. Also nimmt man hier Geld von Rom und läßt alles gottlose
Wesen zu. Es schadet alles garnichts. Hilf, lieber Gott! wie ist das
Volk so verkehrt.
Ich habe mit des Papstes Kämmerlingen einem oft und vielmals geredet,
und des bösen Lebens gedacht, das in Rom geführt wird. Darauf er mir
geantwortet: Auf das Leben dürfe ich nicht sehen, darauf käme nichts
an, sondern ich sollte tun, als sähe ich nicht, was ich nicht sehen
möchte. Aber ich danke Gott, daß meine Zeit kömmt, hinweg zu ziehen aus
Rom, und gedenke, so Gott will, nimmermehr wieder dahin zu kommen.«[200]
Dieser Bericht eines augenscheinlich ehrlichen Mannes aus dem Jahre
1560 lehrt im Verein mit zahllosen andern, daß der Klerus es immer
vortrefflich[S. 216] verstanden hat, Wasser zu predigen und Wein zu trinken
und daß, wie in jeder anderen, so auch in sittlicher Beziehung
Priesterherrschaft von allen möglichen die schlechteste ist.
*
Begreiflicherweise war es sogar noch in späterer Zeit jenseits der
Alpen nicht besser.
Die Sittlichkeit im schwarzen, urreaktionären Neapel stand um 1730
nach Keyßlers Beschreibung nicht sehr leuchtend da: »Was die itzigen
Zeiten anlangt, so muß man gestehen, daß die Freyheit und freche
Lebensart der lüderlichen Weibspersonen in dieser Hauptstadt auf den
höchsten Grad gestiegen, und die Stadt hierinn alle andere übertreffe.
Es wohnen in einer einzigen Gegend über zweytausend Curtisanen
beysammen, und schämen sich geistliche Personen nicht, in diesen Gassen
sich gleichfalls einzuquartieren. In allen rechnet man hier über
achtzehntausend solcher Donne libere. Die Jugend wird dadurch gänzlich
verdorben, und die Geistlichkeit selbst kann wenig im Zaume gehalten
werden, weil die weltliche Obrigkeit nichts über sie zu befehlen hat,
und die Clerisey, aus Respect vor das Amt und den heiligen Stand,
einander durch die Finger sieht, ja es wohl übel nimmt, wenn man ihnen
ihren freyen Willen nicht lassen will.«
Wie der gelehrte Reisende weiter berichtet, wurde der Auditor des
päpstlichen Nuntius in flagranti erwischt, aber nicht bestraft, da
sich selbst der Vizekönig nicht getraute. Der Geistliche aber hatte
die Dreistigkeit, die Bestrafung der Anzeiger zu[S. 217] fordern, womit
er durchdrang. »Um aber doch einigermaßen allen diesen Herren
wiederum einen Possen zu spielen, so ließ er zwar die Häscher mit einer
Beschimpfung durch die Stadt führen, es war aber auf der Tafel, welche
sie gewöhnlicher Weise auf der Brust tragen mußten, um die Verbrechen
der Missethäter anzudeuten, geschrieben, daß solche Strafe ihnen
angetan würde, weil sie sich unterstanden, den Auditor des päpstlichen
Nuntius in seinen Plaisirs zu verunruhigen.«[201]
*
Was sich selbst noch am Ende des 18. Jahrhunderts, und zwar in Bayern
ein anmaßender und sittenloser Klerus herausnehmen durfte, möge aus
folgender mehr tragischen als komischen Geschichte erhellen, die sich
im Jahre 1786 zu Neuberg im Gericht Pfädter zutrug.
Ein junger Bauer heiratete und wohnte weiter mit der bald
neunzigjährigen Großmutter zusammen. Nach einiger Zeit gab die Kuh
des jungen Paares keine Milch mehr, während der Quell bei der der
Alten weiter sprudelte. Eine Magd, die wegen einer Untreue getadelt
worden war, haßte die Greisin und sprengte deshalb das Gerücht aus,
sie sei eine Hexe und habe die Kuh verzaubert. Zugleich wußte sie die
junge Bäuerin gegen sie mißtrauisch zu machen, so daß ihr schließlich
verboten wurde, die eigene Kuh zu melken. Die Folge waren auch
Streitigkeiten in der jungen Ehe.
Daß das Vieh krank sein könne – es gab Blut – und die ungeeignete
Fütterung das Ausbleiben der[S. 218] Milch, das sich auch sofort bei der
Kuh der Greisin einstellte, als sie mit der andern von der Magd auf
die Weide getrieben wurde, verursacht habe, kam niemand in den Sinn.
Zauberei stand fest, und die Franziskaner mußten helfen.
Nach vergeblichen Experimenten ging die junge Frau wieder ins Kloster,
wo sie nach dem »Hexenpater«, den es damals noch in jedem Kloster
gab, verlangte. In ein Separatzimmer geführt und mit Bier bewirtet,
schüttete die junge Frau ihr Herz aus und es entspann sich folgendes
Gespräch:
»Pater: Bäuerin! Bäuerin! Da muß was anders als die Alte schuld sein –
wie meint Ihr?
Bäuerin: Ich? Ja mein Gott! wo soll’s dann fehlen?
P.: Habt Ihr Euern Mann treulieb?
B.: O ja, von Herzen gern.
P.: Seid Ihr mit ihm zufrieden?
B.: Ja.
P.: Versteht mich wohl! Ich mein’s so, ob er bei der Nacht im Bette
tut, wie Ihr es verlanget, so lang und so viel?
B.: Aber ei! – (voll Scham) Ihr Hochw–
P.: Nur heraus mit der Sprache, denn da kommt viel darauf an – also?
B.: Ja! Ihr Hochwürden.
P.: Hm. Hm. (Ergreift ihre Hand.) Weib! Weib! Beinahe komme ich auf
andere Gedanken!
B.: Aber, Ihr Hochwürden, ich bitt’ enk um Gottes willen – werds ja
mich für kai Hex halten?
P.: Das nicht, Weible, aber – wie! Macht ’nmal Euer Mieder auf!
[S. 219]
B.: Ihr Hochwürden! Was denken S’? Ist ja ä Schand’!
P.: Ich kann Euch nicht helfen. – Ich komm’ sonst nicht auf die Spur.
– Nun.
B.: In Gottes Namen! Aber Herr!
P.: So! – Schon wieder nähere Spuren (indem er die volle Brust
streicht – drückt – und zuletzt saugt).
B.: Aber, Ihr Hochwürden! Was ist denn das? O jeges! wenn’ ai Mensch
sehe –
P.: Halt’ dich, Närrin! (Saugt immer fort.)
B.: Nun, was zeigt sich denn?
P. (voll Feuer): Ja, Mütterchen! ich spüre zwar, daß eine Hexerei in
Eurem Leibe ist – aber noch weiß ich nit, kömmt’s von Eurer Alten oder
gar von Eurem Manne her – und um das zu finden, müßt Ihr Euch schon da
niederlegen.
B.: Ja, was woll’es dän thai mit mir?
P.: Das werdet Ihr schon sehen. – Gelt, Ihr seid schwanger?
B.: Ja, Ihr Hochwürden!
P.: Nun schaut! Das Kind ist verhext, und da wird Euch ein schöner
Bankert Freud’ machen und einmal auf dem Scheiterhaufen brinnen
(brennen), wenn ich Euch nicht helfe – und es geben Euch die Kühe
keine Milch, bis da geholfen ist – gebt Euch also willig und legt Euch
nieder.
B.: Nu, wann’s Ihr Hochwürden befehlen.« etc.
Der Schluß war nicht nur, daß der Pater sich viehisch an der Frau
verging, er gab ihr auch noch den Rat, mit einem Prügel versehen in
den Stall zu gehen, wo sie die Hexe treffen werde. So lange[S. 220] bis
Blut fließe, solle sie auf sie einschlagen und mit dem Blut die
Euter der Kühe bestreichen.
Die Bäuerin handelte nach Befehl, ging in den Stall, traf dort
die Großmutter und schlug sie tot. Nur durch die
Gerichtsverhandlung kam auch der schändliche Streich des Geistlichen
auf.
Aber niemand dachte daran, den schurkischen Pater Benno zu verfolgen.
Endlich gelang es dem energischen Eingreifen eines einzigen Richters,
gegen den Geistlichen Strafverfolgung zu erwirken. Er wurde auf zehn
Jahre vom Messelesen suspendiert und ebensolange in klösterlichem
Arrest auf Wasser und Brot gesetzt, d. h. begnadigt, denn daß die
Mönche ihrem Kollegen nichts Böses taten, ist klar. Die Regierung
fürchtete aber ein energisches Eingreifen. Statt mit dem Schwert
hingerichtet zu werden – was das Los der Bäuerin gewesen wäre, wenn
der Schurkenstreich nicht aufgekommen wäre – wurde sie auf freien Fuß
gesetzt.
*
Solche Zustände scheinen heute unmöglich zu sein. Scheinen! Das Zölibat
ist eine der Natur zu sehr ins Gesicht schlagende Vergewaltigung,
als daß auch beim besten Willen seine Durchführung streng gehandhabt
werden könnte. Man mag vorsichtiger sein, Delikte mögen auch seltener
werden, aufhören werden sie nie. Aber ein Unterschied ist zwischen
der zwar kirchlich verdammten, aber moralisch einwandfreien normalen
Befriedigung der Sinnlichkeit und viehischen Vergewaltigung und
Versuchung anvertrauter Seelen.
[S. 221]
Am 8. April 1910 wurde vor der Strafkammer I des kgl. Landgerichts
in Stuttgart gegen den Simplizissimus bzw. dessen verantwortlichen
Redakteur Gulbransson in einer Beleidigungsklage des Bischofs Keppler
von Rottenburg verhandelt und Gulbransson zu zwei Monaten Gefängnis
verurteilt. Dieser Vorgang wäre für uns ohne jedes Interesse, wenn
nicht während der Verhandlung Dinge zur Sprache gekommen wären, die
eigentümliche Blitzlichter auf die sittliche Führung der katholischen
Geistlichkeit wenigstens der Diözese Rottenburg geworfen hätten.
Der Stadtpfarrer Bauer von Schramberg war wegen Sittlichkeitsverbrechen
zu mehrjähriger Zuchthausstrafe verurteilt worden. Da Bischof Keppler
am Vorabend des Schuldspruches eine zu Mißverständnissen Anlaß gebende
Rede über die Möglichkeit eines gerichtlichen Falschspruches gehalten
hatte, glaubte der Simplizissimus – und mit ihm noch viele andere
Organe – daß Bischof Keppler gegen sittliche Verfehlungen seiner
Geistlichen, wofern sie nur politisch brauchbar wären, zu milde
vorgehe. Deshalb erschien in dem satirischen Blatt eine Zeichnung, den
Bischof als Hirten einer Schweineherde darstellend. Die Schweine aber
trugen priesterliche Gewandung. Die Überschrift des Bildes lautete:
»Alles fürs Zentrum«, die Unterschrift aber: »Durch sein Eintreten für
den Pfarrer Bauer hat der Bischof Keppler von Rottenburg gezeigt, daß
er nicht nur über Schafe, sondern auch über Schweine ein guter Hirte
ist.«
In der Gerichtsverhandlung, in der festgestellt wurde, daß Pfarrer
Bauer sich in schamlosester Weise an Kindern usw. vergangen hatte,
stellte der Verteidiger[S. 222] Rechtsanwalt Heusel den Antrag, den
Wahrheitsbeweis für folgende in der Diözese vorgekommene Fälle zu
erbringen. Wir zitieren seine Ausführungen wörtlich:
»1. Der Fall des Pfarrers Gehr von Zuffenhausen.
Ich beantrage hier die Akten der Kgl. Staatsanwaltschaft Stuttgart
betreffend die Anzeige gegen den katholischen Pfarrer Gehr von
Zuffenhausen vom Jahre 1908 beizuziehen. Pfarrer Gehr hat von
zahlreichen Schulmädchen, welche in die 6. und 7. Klasse der
Volksschule gingen, also vermutlich im 13. oder 14. Lebensjahr und
vor der Kommunion stehenden Mädchen verlangt, sie sollen
ihre Röcke in die Höhe heben; er hat einzelnen dieser Mädchen
selbst den Rock in die Höhe gehoben, hat Mädchen auch rücklings
auf seine Knie gesetzt, sie wie etwa kleine Kinder auf seinen
Knien reiten lassen und sie dann rücklings mit dem Kopf zum Boden
hinunterschnappen lassen, daß die Mädchen selbst auf den Gedanken
kamen, er wolle ihnen unter die Röcke sehen.
Pfarrer Gehr hat weiter, was das Schwerwiegendere ist, um die
Entdeckung seiner Verfehlungen zu verhindern, die Mädchen so
bearbeitet, daß es schwer, wenn nicht unmöglich war, von ihnen
den wahren Sachverhalt erfahren zu können. Es ist durch mehrfache
Landjägermeldungen bestätigt, daß Pfarrer Gehr sich direkt
bemüht hat, die Mädchen zu falschen Aussagen zu verleiten, und
daß den mißbrauchten Kindern mit der Hölle und mit[S. 223] Gotteszell
gedroht worden ist, falls sie etwas gegen den Pfarrer aussagen.
Es ist nicht meine Aufgabe als Verteidiger, ein derartiges
Verhalten entsprechend zu charakterisieren. Tatsache ist, daß
hochstehende Richter ihrem Erstaunen darüber Ausdruck verliehen
haben, daß gegen Pfarrer Gehr gerichtlich nicht vorgegangen
worden ist. Tatsache ist weiter, daß die einzige Maßregel,
welche seitens des bischöflichen Ordinariats gegen ihn verfügt
worden ist, die war, daß er auf die beliebte, in schönster
Lage am Bodensee gelegene Pfarrei Eriskirch versetzt worden ist.
2. Der Fall des Pfarrers und Schulinspektors Adis von
Dotternhausen, O.-A. Rottweil.
Hier wird die beantragte Beiziehung der Akten des bischöflichen
Ordinariats das Nähere ergeben. Für den Fall, daß die Vorlage
dieser Akten verweigert werden sollte, werde ich eingehenden Beweis
erbringen. Pfarrer Adis hat Verbrechen im Sinne des § 176
Z. 3 StGB. begangen und in der Gemeinde Dotternhausen hiedurch und
durch sonstige sittliche Verfehlungen das größte Ärgernis erregt.
Die einzige Strafe, die gegen ihn verfügt worden ist, bestand in
einer nur auf die Dauer eines halben Jahres verfügten Suspension
vom Amt, welche Zeit Pfarrer Adis nicht im Disziplinarhaus der
Diözese Rottenburg für katholische Geistliche, sondern vermutlich
in einem Kloster verbrachte.
3. Der Fall des katholischen Pfarrers Kolb von Ennabeuren, O.-A.
Münsingen.
Pfarrer Kolb hat durch fortgesetzten Verkehr mit[S. 224] übel
beleumundeten Frauenzimmern in der Gemeinde Ennabeuren derartiges
sittliches Ärgernis erregt, daß sich ein Bürger von Ennabeuren,
namens Johannes Reyhinger, Frohnmeister daselbst, den ich
für sämtliches hier Vorgetragene als Zeugen benenne und zur
Hauptverhandlung vorzuladen beantrage, persönlich nach
Rottenburg an das bischöfliche Ordinariat wandte. Fronmeister
Johannes Reyhinger schilderte dort einem Domkapitular das
sittlich verwerfliche Verhalten Kolbs, insbesondere auch die
Tatsache, daß, wie ortsbekannt geworden war, ein Frauenzimmer von
Ennabeuren häufig bei Kolb in seiner Wohnung genächtigt und dort im
Pfarrhof eine besondere Bettstelle zur Verfügung gehabt habe,
ohne daß seitens des Ordinariats gegen Kolb eingeschritten worden
wäre.
4. Der Fall betreffend Kaplan Hag in Scheer, O.-A. Saulgau.
Kaplan Hag hatte zwei Knaben, welche bei kirchlichen Anlässen als
Ministranten fungierten und von denen einer jetzt Schutzmann ist,
in der Kirche zur Päderastie angeleitet und mißbraucht. Er ist
jetzt in Argentinien Pfarrer.
5. Der Fall des Pfarrers und Kammerers Höflinger von Altheim,
O.-A. Riedlingen.
Der genannte Pfarrer war außerehelicher Vater von fünf
Kindern, deren Mütter zwei ledige Frauenspersonen seiner
Gemeinde waren. Diese Tatsache ist in der Gemeinde bekannt geworden
und hat dort berechtigtes Aufsehen erregt. Er verpflichtete
sich, den jüngsten zwei seiner Kinder das Geld zur
Übersiedelung nach Amerika zu geben, worüber[S. 225] ein Vertrag
gefertigt worden ist. Kirchlich wurde nicht weiter gegen ihn
eingeschritten; er hat jedenfalls auch in Zukunft seines Amtes
als Pfarrer gewaltet.
6. Der Fall betreffend den Kaplan Azger in Heufelden, O.-A.
Ehningen.
Dieser Kaplan hatte in den Jahren 1906 und 1907 ein im ganzen Dorfe
bekanntes Verhältnis mit einer Industrielehrerin, ohne daß gegen
ihn seitens des Ordinariats eingeschritten worden wäre.
7. Ich beantrage weiter die Beiziehung der Akten der Kgl.
Staatsanwaltschaft und des Kgl. Landgerichts Rottweil, betreffend
den Fall des Pfarrers Knittel von Wachendorf, O.-A. Horb.
Dieser Fall hat seinerzeit auch im Württembergischen Landtag eine
eingehende Besprechung gefunden.
8. Ebenso beantrage ich die Beiziehung der Gerichtsakten,
betreffend den Pfarrer Nuber in Buchau am Federsee, O.-A.
Riedlingen, welcher seinerzeit wegen Schändung von Knaben
in der Kirche angeklagt war und der sich in der Folge im
Amtsgerichtsgefängnisse zu Riedlingen erhängte.«
Ob der sittliche Tiefstand in der Rottenburger Diözese besonders groß
ist, wagen wir nicht anzunehmen, noch viel weniger können wir es
feststellen. Ist das aber nicht der Fall, dann bleibt nur ein eben
nicht rühmlicher Schluß auf die übrigen Diözesen zu ziehen übrig.
[S. 226]
*
Wie der Corriere de la sera mitteilte, hatte das Erdbeben vom 28.
Dezember 1908, das Messina und mehrere Küstenorte zerstörte, wobei nach
der offiziellen Verlustliste über 98000 Menschen ums Leben kamen, eine
ungeahnte Nebenwirkung. Die Mönche von San Procopio (Kalabrien)
verlangten nämlich in Messina Unterstützung für sich und ihre
Familien. In Palmi lebten mehrere Mönche in wilder Ehe. Einer davon
hatte sechs Kinder, für die er um Brot bat.
*
Mag sich also auch das sittliche Niveau der Geistlichkeit seit dem
Mittelalter nicht wesentlich gehoben haben, wenn auch keineswegs
geleugnet werden soll, daß die Konkurrenz der Kirchen und das gute
Beispiel der bürgerlichen Welt veredelnd wirkte, so ist dafür die
Nuditätenschnüffelei desto mehr gewachsen. Unter diesen Umständen
bietet es erhöhtes Interesse, zu sehen, was die Kirche zuließ, als
sie unumschränkt herrschte. Der Schluß, daß auch die äußerliche
Versittlichung nicht ihr, sondern andern Mächten ihren Ursprung dankt,
sie aber, wie überall, so auch hier ein kultur- und kunsthemmendes
Extrem aufstellte, liegt nicht fern.
*
An den Gesimsen des Straßburger Münsters im Innern der Kirche waren
satirische Bildwerke auf die Mönche angebracht, so Affen, Esel,
Schweine im Mönchshabit Messe lesend. Und zwar, wie feststeht, nicht
etwa unter protestantischem Einfluß, da schon im Jahre 1449 der Bau
vollendet war. Die pièce de[S. 227] résistance bildete an der Treppe, die auf
die große Kanzel führte, ein am Boden liegender Mönch, der »sich bei
einer liegenden Nonne gar ungeziemender Freyheiten gebrauchet«.
Wenige Jahre vor 1729 erst wurden diese nicht gerade für prüde Augen
bestimmten Plastiken entfernt, nach Fiorillo erst nach 1764. Geiler von
Kaysersberg hatte augenscheinlich an dieser Darstellung keinen Anstoß
genommen. Nach Fiorillo wurde sie sogar erst unter seinen Augen 1486
angebracht.[202]
*
Nach demselben Gewährsmann befand sich noch damals im Erfurter Dom
»an der Ecke rechter Hand ... unter den Zierathen eines Gesimses ein
Concubitus Monachi cum Monacha gar deutlich in Stein gehauen,
daß man also nicht nur aus dem straßburgischen, sondern auch hiesigen
Domgebäude zeigen kann, wie die Clerisey vor der Reformation es so
grob und plump in ihrem Leben und Wandel getrieben, daß auch die
Handwerksleute nicht unterlassen können, in öffentlichen Gebäuden
ihren Spott darüber zu treiben, wo nicht gar die jalousie zwischen den
Mönchen und der übrigen Clerisey zu solchen ärgerlichen Vorstellungen
Anlaß gegeben und den Layen dergleichen Arbeit anbefohlen hat«.[203]
*
An einem Kapitell der Kirche des Egerer Schlosses in Böhmen ist
Adam und Eva dargestellt, beide natürlich völlig nackt. Adam
manipuliert dabei in höchst[S. 228] merkwürdiger Weise an seinem intimsten
Körperteile.[204]
*
In der Hauptkirche von Nördlingen befindet sich ein angeblich von Jesse
Herlin 1503 gemaltes, 1601 restauriertes jüngstes Gericht, das einen
Papst mit Kardinälen und Mönchen in der Hölle zeigt und ein Weib,
das von einem Teufel vergewaltigt wird.
*
Die Kirche zu Weilheim in Württemberg besitzt ein ähnliches Fresko-Bild
aus dem 15. Jahrhundert. Es stellt ein Jüngstes Gericht dar und scheint
allerdings mehr satirisch als unsittlich zu sein.[205]
*
Am Dom zu Freiburg i. Br. befindet sich ein Wasserspeier in
menschlicher Gestalt, der die Abflußröhre aus dem Gesäß herausragen
hat. Die Person macht das vergnügteste Gesicht von der Welt. Nicht
ohne Grund, denn nicht jedem ist es vergönnt, seinen Gefühlen der
Hochschätzung für die lieben Zeitgenossen in so deutlicher Weise
Ausdruck zu verleihen.[206]
*
Die Unsittlichkeit der genannten Darstellungen war nicht etwa, wie man
annehmen könnte, ein deutsches Privilegium, sondern in der ganzen
Christenheit nahm man daran keinen Anstoß.[S. 229] Fiorillo schreibt
z. B.: »Unter dem Chorgestühl in der Capelle Heinrichs VII. in der
Westminster Abtei wird man einiger Basreliefs gewahr, die äußerst
schlüpfrige und unzüchtige Bilder enthalten, so daß es unbegreiflich
ist, wie die frommen Benediktinermönche dieselben haben dulden können.
Jedoch findet man auch ähnliche obscöne Dinge zu Canterbury, an Chalk
Church in Kent...« Da Fiorillo zu Beginn des 19. Jahrhunderts schrieb,
hatte bis dahin die Kirche keinen Anstoß genommen. Auch hier also, auf
so kleinem Gebiet selbst, zeigt es sich, daß Besserungen nicht durch,
sondern ohne, oft trotz und gegen die Kirche sich durchsetzen.[207]
[S. 230]
Zehnter Abschnitt
Ehe
Noch gegen Ende des 18. Jahrhunderts herrschte bei den Bauern in fast
allen Teilen Deutschlands die Sitte, dem Bräutigam alle ehelichen
Rechte gradatim zu gestatten.
»Sehr oft verweigern die Mädchen ihrem Liebhaber die Gewährung seiner
letzten Wünsche solang, bis er Gewalt braucht. Das geschiht
allezeit, wenn ihnen wegen seiner Leibesstärke einige Zweifel zurück
sind, welche sie sich freilich auf keine so heikle Weise, als die
Witwe Wadmann, aufzulösen wissen. Es kömmt daher ein solcher Kampf
dem Kerl oft sehr teuer zu stehen, weil es nicht wenig Mühe kostet,
ein Baurenmensch zu bezwingen, das jene wollüstige Reizbarkeit nicht
besitzt, die Frauenzimmer von Stande so plötzlich entwafnet.«[208]
*
Während man die Nächte, in denen alles gewährt wurde, Probenächte
nannte, hießen die andern, bei denen der Bauernbursch auf möglichst
halsbrecherischem Wege ins Schlafzimmer des Bauernmädchens eindrang,
um zu plaudern, wobei natürlich auch In[S. 231]timitäten nicht unterblieben,
Kommnächte. »Die Landleute finden ihre Gewohnheit so unschuldig, daß
es nicht selten geschiht, wenn der Geistliche im Orte einen Bauren
nach dem Wohlsein seiner Töchter frägt, diser ihm zum Beweise, daß sie
gut heranwüchsen, mit aller Offenherzigkeit und mit einem väterlichen
Wohlgefallen erzehlt, wie sie schon anfiengen, ihre Kommnächte zu
halten.«[209]
*
Keyßler erzählt im Jahre 1729 folgendes: »In den Dörfern des
benachbarten Bregenzerwaldes hat bisher die wunderliche Gewohnheit
regieret, daß die unverheiratheten Baurensöhne und Knechte ohne Scheu
so lange bei einem ledigen Mädchen haben schlafen können, bis
dieselbe ein Kind von ihnen bekommen, da dann jene erst, und zwar
bei den höchsten Strafen, verbunden waren, sie zu heirathen. Diese
Art von Galanterie heißen sie fuegen, und finden sie daran so wenig
auszusetzen, daß, da man seit etlichen Jahren, kraft obrigkeitlichen
Amtes, diese schändliche Weise abschaffen wollen, es zu einer Art
von Aufruhr gediehen, und die Sache noch in einem Proceß, zu dessen
Führung sie einen Advocaten aus Lindau angenommen haben, verwickelt
ist.«[210]
*
Nicht viel früher herrschte auch in den Bürgerhäusern noch
die schöne Sitte des »Beischlafens auf Glauben«, die wir im vorigen
Bande kennen gelernt haben. Der Prädikant Wilhelm Ambach (Quellen
zur[S. 232] Frankfurter Gesch. II, 34) erzählt von Frankfurt a. M. darüber
(zitiert nach Schultz): »Das weibliche geschlecht ist ja fast blöd und
schwach, aber man sahe hie bei vielen, daß in hurei, ehebruch und aller
leichtfertigkeit stark und frech waren, dann auch 50jährige witfrauen,
die jetzt Kindeskinder haben, aller ehren und freundschaft vergessen;
jungfrauen sind ihren herrn und eltern entlaufen, sich in schändliche
hurei begeben; jedoch haben etliche aus ihnen öffentlich geehlichet,
viel blieben ungeehlichet, schlufen bei uf Gelderischen glauben,
gewöhnlich aber lebten sie frech und gut kriegerisch...«
Daß der biedere Prädikant, wie bei einem Geistlichen
selbstverständlich, furchtbar übertreibt und nach den zu hoch
hängenden Trauben schielt, ist eine Sache für sich. An der Sitte des
»Gelderischen Glaubens« auch in Bürgerkreisen wird sich kaum zweifeln
lassen.[211]
*
Ja, die gastliche Prostitution, bei barbarischen und
halbbarbarischen Völkern sehr häufig und darin bestehend, daß der Wirt
seinem Gast das Eheweib oder die Tochter für die Nacht leiht, läßt sich
in Deutschland noch sehr spät nachweisen. Ältere Zeugnisse, an denen
in Skandinavien und für Island kein Mangel herrscht, fehlen bei uns,
dafür berichtet aber Thomas Murner in der Gäuchmatt (Geschwor. Art. 9):
»es ist in dem Niderlande auch der Brauch, so der Wirt ein lieben
gast hat, daß er im sin frouw zulegt auf guten glouben.« Ja, in
einem Briefe an J. G. Forster vom 20. Juni 1788[S. 233] erzählt der in Bern
wohnende, aus Biel gebürtige Höpfner, daß es im Berner Oberlande
verbürgter Brauch sei, daß ein Vater seine Tochter, ein Bruder seine
Schwester, ein Mann seine Frau dem fremden Gast in aller Höflichkeit
zur Nacht anbiete und sich eine große Ehre daraus mache, wenn
man es annehme.[212]
*
Im alten Skandinavien scheint es Sitte gewesen zu sein, daß der
Beischlaf vor der Hochzeit ausgeübt wurde. Sehr sonderbar ist, daß
Fritjof die Prinzessin Ingeborg gleich nach der Verlobung im Tempel zu
Baldershagen genießt, und nicht minder erstaunlich, daß König Harald
in Norwegen, der die schöne Asa mit Gewalt gewinnen will, dem für ihn
eintretenden Ritter gestatten muß, mit ihr die Probenacht zu
halten, bevor er zu den Waffen greift![213]
*
Ein sonderbarer Brauch, der sich sonst nur bei barbarischen oder
halbbarbarischen Völkern findet, herrschte noch vor zwei Jahrhunderten
in Island. In der Relation d’Islande dans le Recueil des Voyages au
Nord. Amsterdam 1715. T. I, p. 35 heißt es: »Les filles, qui sont fort
belles dans cette Isle, mais fort mal vetues vont voir ces Allemans et
ofrent à ceux, qui n’ont pas des femmes de coucher avec eux pour du
pain, pour du biscuit et pour quelqu’autre chose de peu de valeur.
Les pères mêmes, dit-on, présentent leurs filles aux Etrangers.
Et si[S. 234] leurs filles déviennent grosses, ce leur est un grand
honneur. Car elles sont plus considerées et plus recherchées par les
Islandois, que les autres. Il y a même de la presse de les avoir.«
Übrigens sollen, wie ich von glaubwürdiger Seite erfahre, noch heute
im Schwarzwald und auch in Mecklenburg, vielleicht auch anderwärts,
ähnliche Sitten herrschen. Und zwar nicht nur »Probenächte«, sondern
auch die Anschauung, daß das schwangere Bauernmädchen höher geschätzt
wird, als eines, das seine Fruchtbarkeit erst noch beweisen muß.
Allerdings heiratet fast ausnahmslos der Bauernbursch das von ihm
geschwängerte Mädchen.
*
Noch im späteren Mittelalter war unter dem hohen Adel, also nicht etwa
nur im Volke, der Brauch verbreitet, daß die Braut vor der Hochzeit
sich ihrem Bräutigam ganz hingab. So hielt im Jahre 1378 nach einer
Urkunde Graf Johann IV. von Habsburg ein ganzes halbes Jahr lang
mit der Herzland von Rappoltstein Probenächte ab, um dann wegen
seiner Untüchtigkeit einen Korb zu erhalten. Allerdings hatte die Dame
nicht so ganz unrecht. Köstlich aber ist die Kur, die ein Straßburger
»Meister Heinrich von Sachsen, der der beste Meister ist, den man
finden kan« anwandte: »undt hiengent ime an in eine Bad an sin
Ding ettwie viel Bliges (Blei) wol fünfzig Pfunf schwer undt
pflasterten ine, als menlich seitt, undt verfieng alles nüt, daß sü
imme ut gemachen konnten, daß er verfengklich were[S. 235] zu Frowen.« Wiewohl
diese Kur lange fortgesetzt wurde, hatte sie so wenig Erfolg, wie die
entschieden angenehmere, ihm hundert Frauen vorzustellen, um diejenige
auszusuchen, die voraussichtlich die gewünschte Wirkung erzielen
würde.[214]
*
Höchst bezeichnend für Sitte und Schamgefühl unserer Ahnen ist folgende
Geschichte, die Vitus Arnpek erzählt: Herzog Ludwig I. von Bayern hielt
eine Probenacht mit der schönen verwitweten Gräfin Ludmilla von Bogen,
einer geborenen böhmischen Prinzessin. Da die Gräfin wohl nicht ohne
Grund fürchtete, der Herzog wolle zwar die Freuden der Liebe bei ihr
genießen, sie dann aber sitzen lassen, ersann sie eine List. Als der
Herzog wieder einmal sie besuchte, fand er auf dem vor ihrem Bette
hängenden Vorhang vor ihr drei schön gemalte Ritter. Sie legten sich zu
Bett und huldigten der Liebe Freuden. Die Gräfin aber bewog den Herzog,
ihr zu schwören, daß er sie zu seiner Gemahlin machen wolle, was er
auch angesichts der gemalten Ritter tat. Kaum war es geschehen, als die
Gräfin den Vorhang zurückzog, so daß drei Ritter, die sie vorher
dahinter versteckt hatte, und die also Zeugen des nicht alltäglichen
Schauspiels gewesen waren, sichtbar wurden. Sie bestätigten
sofort, daß sie des Herzogs Schwur gehört hatten. Ludwig aber war sehr
überrascht, da er wohl gehofft hatte, ohne Zeugen den Schwur ableugnen
zu können. Er führte nach einem Jahr mit großen Festlichkeiten die
Gräfin[S. 236] heim. Übrigens hat diese Geschichte im Volksliede ihre
Verewigung gefunden.[215]
*
Noch im 16. Jahrhundert war es Sitte, daß die Jungvermählte sich in
der Brautnacht nackt zu Bett begab, woher das französische Sprichwort
stammt: »Ses promesses ressemblent à celle d’une mariée qui antreroit
au lit en chemise.« Im weiteren Verlaufe des Jahrhunderts erst bürgerte
sich der heutige Brauch, im Hemd zu schlafen, wenigstens im Winter,
allgemein ein. Aber das 1618 erschienene Buch »La Bienséance de la
conversation entre les hommes« hielt es noch für nötig, vom Schlafen
ohne Hemd abzuraten. Ja in »La civilté nouvelle« vom Jahre 1667
erscheint noch die gleiche Mahnung. Allerdings handelt es sich jetzt
nicht mehr um die erste Gesellschaft.[216]
*
Das kanonische Recht scheidet die Ehe bekanntlich nur dann, wenn
durch männliches oder weibliches Unvermögen der Zweck, Kinder zu
erzeugen, nicht erfüllt werden kann. Der berühmte französische Jurist
François Hotman (1524–1590) prüft nun sehr eingehend die Frage, wie
die männliche Impotenz festgestellt werden könne und liefert in
seiner langen und grundgelehrten Abhandlung auch folgenden Passus:
»An Stelle der beiden Feststellungsmethoden hat man, ich weiß nicht
durch welches Unglück unseres Jahrhunderts, eine weitere eingeführt,
die die brutalste ist,[S. 237] die man sich ausdenken kann und von der wir
hoffen, daß sie von ebenso kurzer Dauer ist, wie sie wenig Vernunft und
juristisches Aussehen (apparence) besitzt: Es ist dies der sogenannte
Kongreß. Abgesehen davon, daß er gegen die öffentliche
Ehrbarkeit verstößt, ist er überdies unzweifelhaft auch unnütz....
Erst seit kurzer Zeit ist dieses Verfahren in Übung: sein Ursprung
mag darin zu suchen sein, daß ein scham- und ehrloser Mann, der von
seiner Frau der Impotenz geziehen war, sich rühmte, den Beweis
seiner Tüchtigkeit zu erbringen in Gegenwart von Leuten, die sich
darauf verstünden. Und wenn die Richter diesen Beweis zuließen, so
geschah es sowohl aus Überraschung und weil sie darüber nicht reiflich
nachgedacht hatten, als auch weil einige Weise im Anfange dieses
Verfahren nicht für schlecht hielten, in der Erwägung, die Frauen durch
diese Schande und Schamlosigkeit von der allzu großen und häufigen
Klage, die sie gegen ihre Ehemänner erhoben, abzuschrecken. Denn das
Gesetz gestattet bisweilen ein Übel, um ein größeres zu heilen. Ein
Beispiel dafür bietet die Geschichte, die Aulus Gelius lib. 15, kap.
10 von einigen jungen Mädchen aus Milet erzählt, die aus Verrücktheit
freiwillig aus dem Leben schieden. Und man konnte dieser Krankheit, die
sich stark vermehrte, keinen Einhalt tun, außer durch eine entehrende
Strafe, die man über sie verhängte: die Männer bestimmten, daß alle
diejenigen, die sich auf diese Weise umgebracht hatten, splitternackt
überall herumgetragen und dem Volk gezeigt würden. Die übrigen
jungen Mädchen wurden durch die Schande eines so wenig ehrenvollen[S. 238]
Leichenbegängnisses derart ins Herz getroffen, daß sie ihren Verstand
wiedergewannen und nicht mehr in diese Krankheit verfielen.
So dachte man wohl auch, daß ein so unehrenvoller Kongreß die
Klagen der Frauen mäßigen würde. Aber im Gegenteil (wie das
Jahrhundert ja unglücklich ist), sie fühlten sich durch dieses
Mittel gestärkt, und von Beginn ihres Scheidungsprozesses an
fordern sie selbst den Kongreß, da sie alle wissen, daß sie
damit ein unzweifelhaftes Mittel besitzen, den Prozeß zu gewinnen.
Denn welche Sicherheit jeder Mann sich auch zutrauen mag (wenn er
nicht ebenso brutal und schamlos ist wie ein Hund), er wird einräumen,
wenn er für sich und ohne Leidenschaft es gut betrachtet, daß es nicht
in seiner Gewalt liegt, den Beweis für seine Fähigkeit, die Ehe zu
vollziehen, zu erbringen in Gegenwart des Gerichtshofes, den
man verehrt, angesichts der Ärzte, Chirurgen und Matronen, die
man fürchtet und mit einer Frau, die man für seine Feindin hält, da
eingestandenermaßen solche Akte Selbstsicherheit, Heimlichkeit und
Freundschaft erfordern.«[217]
*
Nach einem handschriftlichen Amtsbericht vom 8. März 1666 ging es den
Pantoffelhelden in der Gegend von Mainz recht schlecht. »Es
ist ein alter Gebrauch hierumb in der Nachbarschaft, falß etwan ein
Frauw ihren Mann schlagen sollte, daß alle des Fleckens oder Dorffs,
worin das Factum geschehen, angrenzende Gemärker sichs annehmen; doch
würdt die sach vff den letzten Faßnachttag oder Eschermitt[S. 239]woch als
ein recht Faßnachtspiehl versparet, da denn alle Gemärker, nachdem
sie sich 8 oder 14 Tag zuvor angemeldet, Jung und Alt, so Lust dazu
haben, sich versammeln, mit Trommen, Pfeiff und fliegenten Fahnen zu
Pferd und zu Fuß dem Orth zuziehen, wo das Factum geschehen, vor dem
Flecken sich anmelden, und etliche aus ihren mittlen zu dem schulthesen
schicken, welche ihre Anklag wieder den geschlagenen Mann thun, auch
zugleich ihre Zeugen, so sie deswegen haben, vorstellen, nachdem nuhn
selbige abgehöret, und ausfündig gemacht worden, daß die Frau den
Mann geschlagen, würdt ihnen der Einzug in den Flecken gegönnt, da
sie dann also baldt sich alle sambdt vor des geschlagenen mans Hauß
versammeln, das Hauß umbringen, undt fallß der Mann sich mit ihnen
nicht vergleichet undt abfindet, schlagen sie Leitern ahn, steigen
auf das Dach, hauwen ihme die Fürst ein undt reißen das Dach bis vff
die vierte Latt von oben ahn ab, vergleicht er sich aber, so ziehen
sie wieder ohne Verletzung des Hauses ab, falß aber der Beweiß nicht
kann geführt werden, müssen sie unverrichteter sach wieder abziehen.«
Im ehemaligen Fürstentum Fulda war es ebenso. Wenn ein Mann überwiesen
wird, von seiner Frau Schläge bekommen zu haben, so hat das
Hofmarschallamt das Recht, die Sache zu untersuchen. Ist die Anklage
begründet, dann wird dem Geschlagenen durch Diener in fürstlicher
Livree das Dach seines Wohnhauses abgedeckt. Noch im Jahre 1768
oder 1769 ist eine solche Exekution vollzogen worden (Journal von und
für Teutschland. 1784. 1. Th.,[S. 240] S. 136), ja, noch 1795 soll dieser
Brauch geübt worden sein.[218]
*
Höchst sonderbar war die Gerechtsame der Familie von Frankenstein bei
Darmstadt, die von dieser Stadt jährlich 12 Malter Korn erhielt, um
dafür, wenn die Darmstädter es verlangten, durch einen besonderen Boten
einen Esel zu schicken, auf dem die schlagfertige Frau durch die Stadt
reiten mußte. Der letzte derartige Fall wird vom Jahre 1536 erwähnt.
Eine ähnliche Sitte bestand in Frankreich. Dort mußte der Mann, der
sich von seiner besseren Hälfte schlagen ließ, zur Schande auf einem
Esel reiten, und zwar rittlings, den Schwanz in den Händen haltend.
Wenn der Pantoffelheld sich durch die Flucht dieser Strafe entzog, dann
mußte der nächste Nachbar für ihn herhalten.
*
In den Statuten des schwarzburgischen Städtchens Blankenburg vom Jahre
1594 heißt es § 14: »Welch Weib ihren Ehemann rauft oder schlägt, die
soll nach Befinden und Umständen der Sachen mit Geld oder Gefängnis
bestraft werden, oder da sie des Vermögens, soll sie der Rathsdiener
zum Kleide wüllen Gewandt geben.« § 15 lautet: »Da aber ein Exempel
vorgefunden werden sollte, daß ein Mann so weibisch, daß er sich
von seinem Weibe raufen, schlagen und schelten ließe, und solches
gebührlicher Weise nicht eifert oder klagt, der soll des Raths beide
Stadtknechte[S. 241] mit Wüllengewandt kleiden, oder da ers nicht vermag, mit
Gefängnis oder sonst willkürlich gestraft, und ihme hierüber das
Dach auf seinem Hauße aufgehoben werden.«
Eine ähnliche, später außer Kraft gesetzte Verordnung stand auch in den
rudolstädtischen Statuten.
*
Eine sehr verständige, nur etwas gewalttätige Sitte herrschte im
Fürstentum Hechingen, um die eheliche Harmonie zu sichern. Die
gesetztesten Bauern einiger zu Balingen gehöriger Ortschaften wählten
einen ehrlichen, untadelhaften Mann in aller Stille. Dieser wurde Datte
genannt, im Schwäbischen soviel wie Vater. Der Datte wählte sich zwei
Assistenten. Erfuhr er nun, daß ein Ehepaar im Zwist lebe und sich
gegeneinander unanständig betrage, dann erkundigte er sich genau, ob
das Gerücht auch begründet sei. War es der Fall, dann ging er nachts
mit seinen beiden Assistenten vor das Haus des Ehepaares, klopfte an
und antwortete auf die Frage: Wer da? weiter nichts als: »Der Datte
kommt.«
Hat diese wohlmeinende Mahnung zum Frieden keinen Erfolg, dann kommt
er ein zweites Mal in finsterer Nacht, klopft stärker an und sagt
nochmals: »Der Datte kommt.« Blieb auch diese Warnung fruchtlos,
dann kam er ein drittes Mal nachts, jetzt aber mit seinen vermummten
Assistenten. Mit Knütteln machen sie sich über den schuldigen Teil,
der gewissenhaft ermittelt ist, her und verprügeln ihn exemplarisch.
Die Wirkung dieser Sitte war glänzend,[S. 242] denn lange Zeit kamen
keine Ehehändel in den betreffenden Orten vor. Als aber der Datte
seines Amtes einmal zu energisch gewaltet hatte, untersagte die
Landesregierung den Brauch.
*
Eine befremdende, aber der da und dort in unserem Recht auftretenden
Romantik ein ehrendes Zeugnis ausstellende Sitte bestand darin,
Verbrecher dann frei zu lassen, wenn Jungfrauen sie zur Ehe
begehrten.
Im Jahre 1505 erschien zu Lyon ein Buch mit dem Titel: »Le Masuer
en françois selon la coutume du hault et du bas pays d’Auvergne«.
Hier heißt es Blatt 119: »In mehreren Orten und Ländern herrscht die
Gewohnheit, wenn eine heiratsfähige Frau, namentlich, sofern sie noch
Jungfrau ist, einen zum Tode verurteilten und zum Galgen abgeführten
Mann zum Gatten verlangt, man ihn der genannten Frau überliefert; sie
wird ihm das Leben retten. Aber, setzt der Autor hinzu, es geschieht
dies entgegen dem gemeinen Recht.«
*
Im Kirchenstaat scheint dieser Brauch noch zu Beginn des 19.
Jahrhunderts bestanden zu haben. Der 1812 hingerichtete Räuber Stefano
Spadolino wurde nämlich von der Galeerenstrafe befreit durch eine
Türkin, die das Christentum annahm und ihn zur Ehe begehrte.
[S. 243]
*
Uns braucht es nicht zu kümmern, ob es kodifiziertes oder
Gewohnheitsrecht war, ob der König um seine Einwilligung zur
Begnadigung angegangen werden mußte und er sie dann verweigern durfte
oder nicht. Uns genügt die Tatsache, daß so und so oft der gewiß
schöne Brauch gehandhabt wurde. Im Jahre 1579 wurde Martin Hugert
vom Kurfürsten August von Sachsen begnadigt, weil »auff demütiges
Suppliciren Ursulen, Mich. Langen Tochter, gnädigst bewilligt, dem
heiligen Ehestand zu ehren, ime Gnade wiederfahren lassen..., doch daß
ime gemeldete Supplicantin ehelich getrauet werde, ehe sie das Land
verlassen.« In einem andern Falle unter Kurfürst Johann Georg I. (1606)
gaben die Richter, nicht der Landesfürst, das Urteil ab, daß der zum
Tode verurteilte Peter Mebuß des Gefängnisses ledig sei, da sich eine
Magd erbot, ihn zu heiraten.
Noch im Jahre 1725 ereignete sich ein solcher Fall, und zwar umgekehrt,
indem der Mann die Frau durch Ehe befreite. Ein Gerbergeselle Weber von
Mölig in Schwaben trat vor das Gericht mit der Erklärung, wenn der zum
Tode verurteilten Anna Maria Inderbitzi (Schwyz) das Leben geschenkt
und sie von Henkershand verschont werde, wolle er sie ehelichen. Er
habe sie zwar weder gesehen noch gesprochen, sein Entschluß rühre
lediglich aus christlichem Mitleid her, auch habe sein Großvater eine
solche Weibsperson durch Heirat am Leben erhalten und Glück und Segen
gehabt. Das Gericht erkannte nach reiflicher Überlegung: »Es sollen
beide Personen vorgeführt werden und für den Fall der Einwilligung soll
der Anna Maria die Strafe erlassen werden.« Die[S. 244] Verlobung fand statt
in Gegenwart des Pfarrers und zweier Kapuziner, nach vierzehn Tagen
die Hochzeit. (E. Osenbrüggen, »Neue kulturhistorische Bilder aus der
Schweiz«, 1864, S. 51.)
*
Der leitende Gedanke war natürlich der, daß ein Mensch nicht völlig
verdorben sein könne, wenn er noch jemanden findet, der mit ihm die Ehe
wagt. Und schließlich war das Risiko des Heiratenden ja viel größer als
das des begnadigenden Staates.
Das Andenken an dieses Jungfrauenrecht ist heute noch im Volke nicht
ganz erloschen. Als im Jahre 1834 zu Schönfeld bei Dresden zwei
Raubmörder hingerichtet werden sollten, fragte eine Frauensperson
beim Pfarrer an, ob wohl ein Unverheirateter unter diesen Verbrechern
dadurch zu befreien sei, daß sie ihn zur Ehe begehre.[219]
*
Eine sehr merkwürdige Sitte wird uns aus dem 18. Jahrhundert aus
Litauen berichtet: »Die Litthauer sind überaus ängstlich und
vorsichtig, daß ihr Ehestand nicht unfruchtbar und ohne Segen seyn
möge; daher sie lieber eine Hure mit zwei und mehr unehrlichen Kindern
heyraten, als eine Jungfer.« Das ist ja nicht so sonderbar, da ja
unsere Bauern, für die Kinder Lebensbedingung sind und die unfehlbar
auf die Gant kommen, wenn sie statt der Söhne bezahlte Arbeiter haben
müssen, genau so verfahren. Allerdings meist so, daß sie diejenige Dirn
heiraten, mit der sie selbst Kinder haben. Um so befremdender ist die
Fortsetzung des Berichtes: »Die Weiber[S. 245] sollen mit gutem Willen der
Männer Coadjutores Connubii oder Neben-Beyschläffer halten; denen
Männern aber wird es für eine Unehre gehalten, wenn sie Concubinen
haben.« Vielleicht trat nur dann die Freiheit, einen Liebhaber zu
nehmen, in Kraft, wenn Verdacht bestand, daß die Kinderlosigkeit auf
Verschulden des Mannes zurückzuführen sei.[220]
[S. 246]
Elfter Abschnitt
Rechtspflege
Nicht nur daß Tiere von weltlichen und kirchlichen Behörden bestraft
wurden, kam im Mittelalter vor – die beiden letzten derartigen
französischen Fälle ereigneten sich noch 1793, ja 1845! – man
verhandelte auch mit ihnen. Um 1500 wurde in der Diözese
Lausanne ein außerordentlicher Tierprozeß in Gestalt eines bedingten
Mandatsprozesses eingeführt. Der bischöfliche Official erläßt auf die
Supplik der geschädigten Grundbesitzer den Ausweisungsbefehl an die
verklagten Tiere unter Exorcismen und Androhung der Malediktion
sowie unter dem Angebot, den Verklagten einen Kurator oder Defensor
stellen zu wollen, falls jemand den Befehl anzufechten gedenke. Damit
verbindet er unter Androhung der Exkommunikation den Befehl, daß
die Tiere während der späteren Verhandlungen sich jeder weiteren
Ausbreitung zu enthalten haben.
Das erste Verfahren schließt mit einem Urteil ab, das die verklagten
Tiere ausweist. Es handelt sich hier ausschließlich um sogenanntes
Ungeziefer,[S. 247] wenigstens niemals um Haustiere oder bestimmte einzelne
Tiere. Also um Mäuse, Ratten, Maulwürfe, Insekten, Raupen, Engerlinge,
Schnecken, Blutegel, Schlangen, Kröten. Allerdings wurde es in Canada
auch gegen wilde Tauben, in Südfrankreich schon viel früher gegen
Störche, in Deutschland gegen Sperlinge, am Genfer See gegen Aale
angewandt, wenn sie in ungezählten Mengen auftraten und gemeinschädlich
geworden waren. Im Ausweisungsbefehl wurde in der Regel eine Frist
bestimmt, innerhalb der die Tiere ihren Abzug bewerkstelligen sollen.
Gelegentlich hat man dies so ins einzelne durchgebildet, daß man
den ausgewiesenen Tieren bis zum Ablauf der Frist freies Geleit
zusicherte. Ziemlich weitverbreitet war auch – wenigstens
seit dem Spätmittelalter – der Brauch, mit der Ausweisung eine
Verweisung zu verbinden, sei es, daß man den Tieren aufgab, sich an
einen nicht näher bezeichneten Ort zurückzuziehen, wo sie niemandem
mehr würden schaden können, sei es, daß man zu diesem Behuf einen
Ort benannte. Bald verurteilte man sie »ins Meer«, bald verbannte
man sie auf eine entlegene Insel, oder man räumte ihnen gar einen
freien Bezirk in der Gemeinde ein mit der Auflage, die außerhalb
desselben gelegenen Grundstücke zu verschonen. So noch 1713 im Urteil
von Piedade-no-Maranhao. Dies hat mitunter zu einem förmlichen
Vergleichsangebot der Klagspartei an den Offizialvertreter der
verklagten Tiere geführt, wonach diesen vertragsmäßig ein solches
Grundstück überlassen werden sollte. Die mancherlei Vorbehalte
und Klauseln, womit man einen solchen Vergleich[S. 248] ausstattete,
zeigen, wie ernsthaft der Vertrag der Menschen mit den Tieren gemeint
war.[221]
*
Prozesse gegen Tiere sind erst seit dem 15. Jahrhundert deutlich
nachweisbar, während Malediktionen und Exkommunikationen viel älter
sind. Der letzte Tierprozeß in der vollen Form hat sich vor einem
weltlichen Gericht abgespielt, und zwar 1733 vor dem von Bouranton.
Aber noch ein Jahrhundert lang haben im Norden die Erinnerungen an die
Tierprozesse fortgedauert. Noch um 1805 oder 1806 haben die Bauern
auf Lyö in der Herrschaft Holstenshus einen solchen Prozeß wenigstens
angefangen.
*
Lautete in einem Tierprozeß (gegen Haustiere) das Urteil auf Tötung,
dann war auch die Todesart bestimmt. Das Tier wurde demnach als
Verbrecher angesehen, dem ein verbrecherischer Wille zugeschrieben
wurde. Pour la cruauté et férocité commise (1567) verurteilt das
Gericht, d. h. graduierte oder doch geschulte Juristen, den Übeltäter.
Am meisten üblich war es, das Tier durch Hängen zu töten oder es zu
erdrosseln, und nachher aufzuhängen oder doch zu schleifen. In gewissen
Gegenden scheint man aber das Lebendigbegraben oder das Steinigen,
das Verbrennen oder das Enthaupten vorgezogen zu haben. Erst seit dem
17. Jahrhundert kommt es ab, die Todesart im Urteil zu bestimmen. Das
Gericht überläßt ihre Auswahl hinfort dem Gerichtsherrn oder dessen
Vollzugsbeamten.
[S. 249]
Der Vollzug des Urteils geschah öffentlich unter dem Geläute
der Glocken. Stets obliegt dem Diener der öffentlichen Gewalt,
dem Nach- oder Scharfrichter, der Vollzug. Die Richtstatt ist der
gesetzliche Hinrichtungsort. Hatte das Urteil auf Hängen gelautet,
so geschah das am Baum oder am Galgen. Ein Wandbild in der Kirche
Sainte-Trinité zu Falaise zeigt das Tier sogar in Menschenkleidern.
Man hatte auch sorgsam darauf zu achten, daß durch den Strafvollzug
der Inhaber der hohen Gerichtsbarkeit nicht in seinen Rechten
gekränkt wird. In dieser Hinsicht hat das Verfahren mehrmals zu
Beschwerden und Streitigkeiten Anlaß gegeben. Noch 1572 liefern,
um dergleichen zu vermeiden, die von Moyen-Moutier ein dort zum
Strang verurteiltes Schwein an den Probst von Saint-Dizenz als den
vollzugsberechtigten Herrn unter altherkömmlichen Formen aus, indem sie
das Tier bis zum Steinkreuz le Tembroix führen, wo der Probst, dreimal
angerufen, alle »Verbrecher« (criminaly) in Empfang zu nehmen hat.
*
Die Glocke von S. Marco in Florenz, La Piagnola genannt, läutete am 8.
April 1498 Sturm, als die Gegner Savonarolas das Kloster in der Nacht
belagerten und erstürmten und den Propheten ins Gefängnis führten.
Dieses Rufen verzieh man der Glocke nicht. Am 29. Juni 1498
beschloß der Große Rat von Florenz, daß die Glocke von S. Marco zu
bestrafen sei. Am folgenden Tage riß das Volk sie vom Turm
herunter, ließ sie von Eseln durch die Straßen der[S. 250] Stadt schleifen,
und der Henker folgte ihr und peitschte sie. Dann wurde sie
aus der Stadt verbannt. Auf dem Campanile von S. Salvatore al
Monte blieb sie elf Jahre im Exil, bis sie am 9. Juni 1509 wieder auf
den Glockenturm von S. Marco heraufgezogen wurde.
Die Glocke, ein Werk Donatellos und Michelozzos, befindet sich seit
1908 im Museo di S. Marco, wo man sich von den damals erlittenen
Mißhandlungen überzeugen kann.[222]
*
Dafür, daß die Frauenemanzipation nicht zu Übergriffen führte, war im
Gesetz in weniger ritterlicher als wirksamer Weise gesorgt: »Wenn ein
böses schnödes Weib auf freier Straße einen Bürger oder Bürgerkinder
mit ehrenrührigen Worten anfährt, so darf er das Weib dreimal
vermahnen, solche Worte heel zu halten, und wenn es auch das drittemal
fruchtlos, seine Faust nehmen, dem Weibe an den Hals schlagen, sie in
die Gosse werfen, mit Füßen vor den Hintern stoßen und dann gehen ohne
Strafe.«[223]
*
Daneben findet sich eine Ritterlichkeit, die unsere Gesetzgebung
vermissen läßt: Die Schwangere genießt das Vorrecht, ihre Gelüste zu
befriedigen, ebenso darf ohne weiteres für eine Kindbetterin Wein und
Brot entwendet werden. Ja, mehr als das. Im Weistum von Galgenscheid
(Untermosel) von 1460 heißt es, nachdem das Jagen verboten: »is
enwere dan, das eyne frawe swanger ginge mit eyme kinde und des[S. 251]
wiltz gelustet, die mag eynen man oder knechte usschicken, des wiltz
so viel griffen und sahen, das sie iren gelosten gebussen moge
ungeverlichen.«[224]
*
Bekannt ist das Verbrennen und Hängen in Effigie. Aber daß man auch
in Effigie gerädert werden konnte – für den Delinquenten
entschieden wesentlich dem Verfahren in natura vorzuziehen –,
berichtet Felix Platter im Jahre 1554.[225]
*
Die Gespenster mischten sich früher in so mancherlei Angelegenheiten
des Lebens, daß die Juristen nicht umhin zu können glaubten, ihre
Rechte zu bestimmen. Der berühmte Rechtslehrer Johann Samuel
Stryck verfaßte darüber eine 1700 zu Halle erschienene
umfangreiche Dissertation (De jure spectrorum. Halle 1700. recusa
ib. 1738), in der er sich so eingehend mit der Materie befaßte, daß
das Gespensterrecht es sicher zum Range einer selbständigen
Wissenschaft, wie Handels- oder Wechselrecht, gebracht hätte, wenn
die Aufklärung nicht schnöderweise das schöne System über den Haufen
geworfen hätte.
Nach einer Einleitung, in der die verschiedenen Sorten von Gespenstern,
als da sind Kobolde, Nixen, Feldgeister, Bergmännchen etc. dem Leser
vorgestellt werden, kommen in schönster systematischer Ordnung die
durch dieselben entstehenden Rechtsfälle an die Reihe. Der Hexenhammer
hatte ja auch mehr als zwei Jahrhunderte früher diese Materie
behandelt. Man[S. 252] sieht daraus wieder einmal, wie sehr die weltlichen
Wissenschaften den geistlichen nachhinken.
*
Doch ad rem! Es gibt bekanntlich Personen, die von Gespenstern sehr
geplagt werden. Was ist nun zu tun, wenn ein Ehegatte die Beobachtung
macht, daß sein Gespons zu dieser Sorte gehört? Stryck gestattet aus
diesem Grunde zwar die Auflösung eines Verlöbnisses, nicht aber die
Ehescheidung. Der Mann muß dann eben den Spuk als Hauskreuz ansehen und
es zusammen mit seinem angetrauten mit Würde tragen.
Da ein Haus, in dem die Geister spukten, nahezu wertlos war, findet
es Stryck nur gerecht, wenn gegen den Verkäufer, der damit den
Käufer betrog, Klage erhoben wird. Natürlich wird dadurch auch ein
Mietkontrakt hinfällig. Wenn der Spuk aber so harmlos ist, daß die
Geister nur in den abgelegensten Teilen des Hauses an die Türen
klopfen oder ein wenig heulen, dann darf man deshalb nicht gleich die
Flinte ins Korn werfen und ausziehen. Auch ist der Vermieter nicht
zum Nachgeben verpflichtet, wenn er beweisen kann, daß bisher sein
Haus von Geistern rein war und erst seit der Vermietung, weil die neue
Partei mit Hexen und Zauberern in Feindschaft lebe, von ihnen zum
Tummelplatz auserkoren wurde. Natürlich hat der Hausherr das Recht
auf Injurienklage, wenn ein Verleumder sein Haus für nicht geheuer
bezeichnet.
Wenn der Teufel jemand zu Verbrechen bewegt, so ist der Delinquent
darum nicht jeder Strafe ledig, aber unter gewissen Umständen ist es
doch billig, sie[S. 253] zu mildern, z. B. wenn der Delinquent anführen kann,
der Teufel habe gedroht, ihn zu ersticken oder den Hals umzudrehen.
Augenscheinlich hatte Stryck die Materie nicht gründlich genug
behandelt, denn der Rechtsgelehrte Karl Friedrich Romanus in
Leipzig sah sich 1703 gezwungen, die Frage, ob wegen Gespenstern
der Mietkontrakt aufgehoben werden könne, mit großem Aufwand von
Gelehrsamkeit und Spitzfindigkeit nochmals zu behandeln. (Schediasma
polemicum expendens quaestionem an dentur spectra, magi et sagae.
Lips. 1703.) Da er die Gespensterfurcht durch hundert Zitate beweist,
so steht für ihn fest, daß selbst die manierlichsten Geister den
Mieter zur Auflösung des Kontraktes berechtigen. Thomasius war
allerdings anderer Ansicht (De non rescindendo contractu conductionis
ob metum spectrorum. Halle 1711 recusa ib. 1721. Deutsche Halle 1711),
doch der bedeutende Mann stand dem Geisterglauben überhaupt recht
skeptisch gegenüber. Dieser Stryck nun ging den Theologen in der
»Gläubigkeit« nicht weit genug und mußte sich deshalb mit einer Menge
Gegner herumschlagen.[226]
*
Friedrich der Große hob bekanntlich durch die Kabinettsorder
vom 3. Juni 1740 die Tortur in seinen Ländern auf, außer bei
Majestätsverbrechen, Landesverrat und Massenmord. Natürlich gegen den
Willen der Juristen. Ein teilweises, allerdings sehr verklausuliertes
Zurückgreifen auf sie enthält das Zirkular Friedrich Wilhelms
III. von Preußen vom 21. Juli[S. 254] 1802. Es ordnet zwar an, daß »bei
Criminal-Untersuchungen die Angeschuldigten durch thätliche Behandlung
nicht zum Bekenntniß der Wahrheit zu nöthigen« sind, führt aus, »wie
unzulässig der Gebrauch der Schärfe in einer Criminal-Untersuchung
sei, und wie leicht die Inquirenten von der ihnen eingeräumten
Befugniß, einen verstockten Verbrecher für offenbare Lügen zu
züchtigen, Mißbrauch machen können«. Deshalb sei »die Anwendung
körperlicher Züchtigungen als Mittel zur Erforschung der Wahrheit bei
Criminal-Untersuchungen gänzlich zu untersagen.« Das klingt sehr schön.
Dann aber heißt es weiter:
»Damit aber der halsstarrige und verschlagene Verbrecher durch
freche Lügen und Erdichtungen, oder durch verstocktes Leugnen, oder
gänzliches Schweigen sich nicht der verdienten Strafe entziehen möge,
soll... das Collegium befugt sein..., eine Züchtigung gegen einen
solchen Angeschuldigten zu verfügen. Vorzüglich findet eine solche
Züchtigung alsdann statt, wenn der Verbrecher bei einem gegen ihn
ausgemittelten Verbrechen, welches er nicht allein ausgeübt haben kann,
die Angabe der Mitschuldigen verweigert, oder wenn der Dieb nicht
anzeigen will, wo sich die gestohlenen Sachen befinden, oder wenn
dieser hierin durch falsche Angaben den Richter täuscht. Die Züchtigung
muß nach Beschaffenheit des körperlichen Zustandes in einer bestimmten
Anzahl von Peitschen- oder Rutenhieben bestehen, auch kann an
deren Stelle Entziehung der besseren Kost, einsames Gefängnis oder eine
ähnliche, der Gesundheit des Angeschuldigten unschädliche Maßregel
gewählt werden.«[227]
[S. 255]
Das heißt auf deutsch, daß es in Preußen noch zu Beginn des 19.
Jahrhunderts rechtens war, Geständnisse in gewissen Fällen durch
Peitschenhiebe zu erzwingen.
Das scheint uns haarsträubend und doch haben wir heute noch eine viel
schlimmere Tortur, als sie früher bestand. Wirft Müller dem Meyer
ein Schimpfwort an den Kopf, dann hat er obendrein noch das Recht,
durch Zeugen alles an schmutziger Wäsche in die Öffentlichkeit zu
zerren, was sich nur über seinen Gegner auftreiben läßt. Die Zeugen
selbst aber sind verpflichtet, bis in die intimsten Intimitäten ihres
eigenen Lebens hinein alles nur irgend einer sensationslüsternen Menge
interessant erscheinende vor aller Welt aufzudecken. Eine Reihe von
Prozessen aus letzter Zeit beweisen, daß ungezählte Existenzen durch
diese moderne Tortur vernichtet werden können. Es ist nur Glückssache,
ob nicht jeder von uns einmal gezwungen wird, seinen eigenen
moralischen Henker vielleicht um einer Bagatelle willen zu machen.
Manchem dürften da die Stockschläge von ehedem humaner erscheinen.
*
Friedrich Wilhelm III. erließ am 7. Juli 1802 das »Publicandum
wegen Deportation incorrigibler Verbrecher in die Sibirischen
Bergwerke«. Unter der Motivierung, daß der beabsichtigte Zweck, die
getreuen Untertanen vor Verbrechern zu schützen, nicht erreicht wurde,
da von Zeit zu Zeit solche Verbrecher aus den Strafanstalten entwichen
und andrer[S. 256]seits die Hoffnung auf Flucht selbst lebenslängliche
Verurteilung diesen Bösewichtern nicht hinlänglich schrecklich
erscheinen läßt, heißt es:
»Aus diesen Gründen haben Allerhöchst dieselben beschlossen, die
in den Strafanstalten befindlichen incorrigible Diebe, Räuber,
Brandstifter und ähnliche grobe Verbrecher, in einen entfernten
Weltteil transportieren zu lassen, um dort zu den härtesten
Arbeiten gebraucht zu werden, ohne daß ihnen einige Hoffnung übrig
bliebe, jemals wieder in Freiheit zu kommen. Diesem gemäß ist mit
dem Russisch-Kaiserlichen Hof die Vereinbarung getroffen, daß
dergleichen Bösewichter in dem im äußersten Sibirien, über tausend
Meilen von der Grenze der Königlichen Staaten belegenen Bergwerken
zum Bergbau gebraucht werden sollen, und es sind hierauf vorerst Acht
und Funfzig der verdorbensten solcher Verbrecher am 17. Junius d. J. an
den Kaiserlich Russischen Kommandanten zu Narva würklich abgeliefert,
um von dort in diese Sibirischen Bergwerke transportiert zu werden.
Seine Königliche Majestät werden durch fernere, von Zeit zu Zeit zu
bewürkende Absendungen solcher Verbrecher die Eigenthumsrechte der
sämmtlichen Bewohner Ihrer Staaten gegen die Unternehmungen solcher
Bösewichter schüzzen, und lasse daher dieses zur Beruhigung Ihrer
gutgesinnten Unterthanen und zur Warnung für jedermann hierdurch
öffentlich bekannt machen.«
Daß der Staat zur Sicherung seiner Untertanen zur Deportation oder
zu sonstigen Gewaltmitteln greift,[S. 257] ist gewiß kein Kultur-Kuriosum,
wohl aber, daß eine Großmacht sich der Hilfe einer anderen bedient, um
seiner verbrecherischen Untertanen, noch dazu in friedlichen Zeiten,
Herr zu werden.
*
Übrigens waren die herrschenden preußischen Gesetze nicht durch Milde
ausgezeichnet. Das Vermögen der politischen Verbrecher wurde
eingezogen, auch ihre Kinder durften »zur Abwendung künftiger Gefahren«
in beständiger Gefangenschaft gehalten oder verbannt werden.
Selbst Eltern, Kinder und Ehegatten waren bei zehnjähriger bis
lebenslänglicher Festungsstrafe zur Denunziation und Verhütung dieses
Verbrechens verpflichtet. Landesverräter sollten »zum Richtplatz
geschleift, mit dem Rade von unten herauf getötet, und der Körper
auf das Rad geflochten werden«. Zum Landesverrat gehörte auch
die Verleitung zur Auswanderung und Verrat von Fabrik- und
Handlungsgeheimnissen, doch hatte es in diesem Falle mit vier- bis
achtjähriger Festungs- oder Zuchthausstrafe sein Bewenden.[228]
*
Im Palais, das Friedrich Wilhelm III. bewohnte, wurden Gegenstände im
Werte von 50 Talern gestohlen. Bei einem Mädchen, das für die Königin
strickte, fand man einige Sachen. Sie wurde verhaftet, der Fall dem
König angezeigt und er befahl: »daß man[S. 258] die eingezogene und arretirte
Inquisitin Louise M. so lange peitschen sollte, bis sie ihre
Mitschuldigen bekenne, und anzeigen würde, und wenn sie unter
den Streichen tot bleiben sollte.«
Darauf zählte man dem Mädchen den ersten Tag 79, den andern Tag 86
und nachmittags 50 Peitschenhiebe »theils auf den bloßen Hintern, und
theils auf den Rücken ohne Barmherzigkeit auf, überließ die Direktion
des Verfahrens den niedrigsten Beamten, das heißt Schreibern und Boten.
– Das Urtheil erfolgte und sie wurde zu Zuchthausstrafe auf des Königs
Gnade (d. h. so lange der König wollte!!) condemnirt. Durch diese
von dem jetzt regierenden König eingeführten Peitschenhiebe bei den
Inquisitionen ist die Tortur der Alten optima forma eingeführt.«
*
Das noch zu Beginn des 19. Jahrhunderts gültige Preußische Kriegsrecht
hatte folgende Todesstrafen: »1. Arquebusieren (erschießen), 2.
Hinrichtung durch das Schwert, 3. durch den Strang, 4. durch das
Feuer, 5. durch das Rad von oben hinab oder von unten herauf, 6. durch
Viertheilung.
Bei der Hinrichtung durch das Schwert ist die Verscharrung des
Leichnams auf der Exekutionsstätte, oder das Flechten des enthaupteten
Körpers auf das Rad eine gesetzliche Folge der mindern oder größern
Wichtigkeit des Verbrechens.
Die Hinrichtung durch den Strang kann theils in der Garnison... theils
außerhalb der Garnison an dem gewöhnlichen Galgen geschehen... Im[S. 259]
zweiten Fall bleibt der Körper bis zur Verwesung am Galgen hängen.
Die Exekution durch Feuer, durch das Rad oder durch Viertheilen wird
jedesmal außerhalb der Garnison auf der gewöhnlichen Gerichtsstätte
vollzogen, und erfolgt sodann die Verscharrung des Leichnams oder
dessen Heftung auf das Rad, oder Anschlagen der Theile an den Galgen
oder an besonders dazu errichtete Pfähle nach der Größe und Wichtigkeit
des Verbrechens.
In wie weit bei Militär-Personen die Todesstrafe verschärft werden
kann, wobei... die... bestimmte Gattung der Strafe... für den
Verbrecher empfindlicher und für den Zuschauer abschreckender zu machen
ist, wohin das Schleifen zur Richtstätte, das Abhauen einer oder beider
Hände und so weiter gehören mag, muß in jedem einzelnen Falle entweder
nach den besonderen Militärgesetzen, oder bei gemeinen Verbrechen
der Militär-Personen, nach dem allgemeinen Landrechte beurtheilt und
festgesetzt werden.«
Wer sich selbst entleibte, wurde unter dem Galgen durch den Schinder
verscharrt.
Die Ehefrau eines Deserteurs, welche mit ihrem Ehemann zugleich
entwichen oder zwar zurückgeblieben, aber der Durchhelfung desselben
schuldig befunden, wurde mit dem Verlust ihres eingebrachten oder sonst
eigentümlichen Vermögens, welches der Generalinvalidenkasse zufiel,
bestraft.[229]
[S. 260]
*
Die letzte Tortur in Deutschland fand im Jahre 1826 im Amte Meinersen
in Hannover statt. Ein Häusler Wiegmann war im Anfang des Jahres
verhaftet worden, weil er zwei Pferde gestohlen haben sollte, die
auf 80 Taler gewertet wurden. Da er leugnete, ging man nach den
Regeln des Inquisitionsprozesses mit »Verbal- und Realterrition«
gegen ihn vor. Man bedrohte ihn erst mit der Folter, zeigte ihm dann
die Instrumente und erklärte sie und folterte ihn endlich wirklich.
Die Justizkanzlei in Celle erließ am 4. März eine ausführliche
Instruktion über das hierbei zu beobachtende Verfahren. So sollte der
Nachrichter bei Vorzeigung der Folterwerkzeuge den Inquirierten zu
einem »ungezwungenen« (sic!) Bekenntnisse ermahnen, ihn aber, wenn er
kein Geständnis ablegte, auf die Folterbank setzen, ihm Daumenschrauben
anlegen und mit deren Zuschraubung einen »gelinden« Anfang machen.
In der Nacht vom 12. zum 13. März führte man Wiegmann in den Keller
unter dem Amtshause, wo der Scharfrichter mit zehn Henkersknechten
schon versammelt war. Zehn Minuten vor ein Uhr wurde der Inquirent
seiner Ketten entledigt, noch einmal befragt, beteuerte aber seine
Unschuld.
Der Scharfrichter erklärte ihm nun die furchtbaren Werkzeuge, die
in der absichtlich matten Beleuchtung immer noch entsetzlich genug
aussahen, und man drängte ihn wieder um ein Geständnis. Da er standhaft
blieb – er war aller Wahrscheinlichkeit nach unschuldig –, trat nun
der Scharfrichter mit seinen Gesellen in ernstere Funktion.
Lärmend fielen die rohen Burschen über Wieg[S. 261]mann her, rissen ihm die
Kleider vom Leibe und setzten ihn auf den mit Stacheln gespickten
Marterstuhl. Die Augen hatte man ihm verbunden, die Hände an die
Stuhllehne gefesselt und den Stuhl selbst zurückgelehnt, damit er die
Stacheln mehr fühle. Trotzdem beteuerte er seine Unschuld.
Nun nahm man den Unglücklichen auf eine Minute herunter und ermahnte
ihn abermals zur Wahrheit. Da er nicht gestand, legte man ihn
sofort wieder zurück und setzte ihm obendrein die schrecklichen
Daumenschrauben an. Er hielt geduldig die Hände hin und zuckte nur
einige Male zusammen, als man ihm noch unvermutet Peitschenhiebe
versetzte. Er jammerte: »Wie kann ich etwas bekennen was ich nicht
getan.«
Nun wurden ihm, während man seine Wunden mit Salben bestrich, wieder
neue Folterinstrumente gezeigt und angedroht, aber seine Kraft war
erschöpft. Er sagte: »Ich friere und kann nichts mehr sehen.« Man
führte ihn nun ins Gefängnis zurück.
Seine Angst vor neuer Folterung, die gesetzlich nicht zulässig
gewesen wäre, beutete man in diabolischer Weise aus. Man erweckte
durch raffinierte Vorkehrungen aller Art in ihm den Glauben, daß er
abends wieder gefoltert werden würde und erzählte ihm allerlei von den
furchtbaren Vorbereitungen, die getroffen würden.
Nun gestand er in seiner Zelle aus Todesangst. Der Richter hatte sich
eilig zu ihm begeben, und um einem Wiederruf vorzubeugen, ließ man in
der Amtsstube Licht machen, trieb Leute, die Geräusch machen mußten,
auf dem Amtshofe zusammen und ließ[S. 262] Männer mit brennenden Kerzen
zwischen Amtsstube und Folterkeller hin- und herlaufen. So erweckte man
in ihm den Glauben, daß noch mehr Henkersknechte angekommen seien, ihre
Zurüstungen träfen, und daß Neugierige etwas davon zu erhaschen suchten.
Die Justizkanzlei tadelte allerdings scharf die unnötige Strenge der
»Realterrition«, dann die einen Tag dauernde Verbalterrition. »Für
künftige Fälle« hatte die Kanzlei dem Amt ein solches Vorgehen, wie
dieses, verboten. Gottlob sollten sie sich aber nicht mehr ereignen.
Am 17. April 1822 (nach Krieg erst 1840) wurde die Folter in Hannover
abgeschafft.
Wiegmann hatte vier Jahr Zuchthaus auf sein »freies Geständnis« hin
erhalten, und im Zuchthaus starb er auch.[230]
*
Bis zum Jahre 1648 erhielt sich zu Oudewater in Holland der Brauch,
daß sich Leute, die der Hexerei beschuldigt wurden, auf der großen
Stadtwage wiegen ließen. Bis aufs Hemd entkleidet geschah dies in
Gegenwart des Stadtschreibers und der Gerichtsschöppen. Bei Weibern war
auch die Wehmutter gegenwärtig. Dafür zahlte man 6 Gulden und 10 Sols,
erhielt aber ein gerichtliches Zertifikat, worin bestätigt wurde, »daß
ihr Gewicht ihrem Wuchse gemäß und nichts Teuflisches an ihrem Körper
befindlich sey«. Durch dieses Attest entging man der Inquisition.
Deshalb zog man es natürlich vor, das Geld zu erlegen, statt den
Scheiterhaufen zu riskieren.[231]
[S. 263]
*
Aus dem Jahre 1752 hat sich ein Kabinettsbefehl des Markgrafen Karl
Friedrich von Baden-Durlach erhalten, der an die Einwohner des am Fuße
der Hardt nördlich von Landau gelegenen Fleckens Rodt gerichtet ist
und Verfälschung des Weines mit Spießglas, Silberglött und anderen
Mineralien mit dem Tode durch den Strang bedroht, in milderen
Fällen, d. h. bei Anwendung von Zucker, Rosinen etc. mit dreijähriger
Zuchthausstrafe.[232]
*
Der letzte Fall von krimineller Behandlung der Häresie liegt auch noch
keineswegs so weit zurück, als man annehmen sollte. Er ereignete sich
nämlich im Jahre 1751 und betraf einen Advokaten und Notar in Tirol.
Lief die Sache auch nicht allzu grausam ab, so wurde der Angeklagte
doch recht wenig glimpflich behandelt.[233]
*
Das erinnert einigermaßen an die – allerdings in Abrede gestellte
– Äußerung eines bayerischen Ministerialbeamten dem Professor
Sickenberger gegenüber, daß Personen, die mit ihrer Kirche
zerfallen wären, suspekt seien und daher wenig Aussicht haben, eine
Staatsanstellung zu erhalten!!! Wurde die Äußerung auch bestritten, die
Tatsache, daß bis heute keine Anstellung erfolgte, bleibt bestehen.
*
In einem Pommerschen Städtchen ist die Benutzung von Leitern ohne
Spitzen untersagt. Eines Nachts[S. 264] im Jahre 1909 besuchte ein Dieb ein
Gehöft und benutzte eine auf dem Hofe stehende Leiter, um in das Haus
einzusteigen. Er wird gestört, die Leiter fällt um und er bricht den
Oberschenkel. Nun haben wir aber die sogenannte Haftpflicht, und das
war für den Dieb ein großes Glück. Der Besitzer des Gehöftes muß dem
Herrn Einbrecher die durch den Schenkelbruch entstandenen Kurkosten und
eine Entschädigungssumme zahlen, weil die spitzenlose Leiter gegen das
Gesetz verstieß!![234]
*
Zu dieser erbaulichen Geschichte bietet die folgende ein allerliebstes
Gegenstück. In einem Dorfe in der Provinz Schleswig-Holstein bricht
Feuer aus. Fünf Menschenleben sind in Gefahr. Ein Arbeiter wagt sein
eigenes und rettet die fünf, wird dabei aber so schwer verletzt, daß
er längere Zeit keine Arbeit verrichten kann. Sein Antrag bei der
Gemeinde um Unterstützung wird rundweg abgelehnt, weil er – die
Rettung »ohne Order« vorgenommen hatte. Difficile est satyram non
scribere.[235]
*
Der Ruhm des schleswig-holsteinschen Abdera ließ die edlen Bewohner
Altonas anscheinend nicht schlafen. Sie bemühten sich also auch
ihrerseits, eine denkwürdige Tat zu begehen, und das gelang ihnen
über Erwarten glänzend. Der früher in Altona angestellte Schutzmann
Riese hatte vor einiger Zeit ein Kind aus dem Treibeis der Elbe vor
dem Tode des[S. 265] Ertrinkens gerettet. Durch das kalte Bad, das der Beamte
dabei unfreiwillig nahm, stellte sich bei ihm ein rheumatisches
Leiden ein, das Dienstunfähigkeit im Gefolge hatte. Darauf kündigte
die Stadt Altona dem wackeren Beamten den Dienst und entließ ihn
ohne Pension, weil er – der heilige Bureaukratius fordert es
so – noch nicht zehn Jahre sein Amt verwaltet hatte. Riese verklagte
nun die Stadt auf Zahlung einer Pension, die Stadt aber, jedenfalls
aus Furcht, ihre Munifizens könnte nicht weit genug bekannt werden,
führte den Prozeß sowohl vor dem Landesgericht, als auch vor dem
Oberlandesgericht. Sie verlor aber schändlicherweise und wurde zur
Zahlung der Pension verurteilt.[236]
Es gibt eben keine Gerechtigkeit mehr auf der Welt.
[S. 266]
Zwölfter Abschnitt
Von allerlei Sitten und Zeremoniell
In den Göttinger Statuten des Jahres 1342 mußte besonders verboten
werden, nicht im Ratskeller, wo man beisammen aß und trank,
seine gröbste Notdurft zu verrichten.
Übrigens erzählt Schweinichen, daß sich 1571 unter den schlesischen
Adeligen ein Verein der Unflätigen gebildet hatte, mit dem
Statut, sich nicht zu waschen, nicht zu beten und unflätig zu
sein, wohin sie kämen.[237]
*
Was man dem Adel alles zutraute, geht u. a. aus der preußischen
Hofordnung aus der Zeit Herzog Albrechts hervor. Es handelt sich
um Vorschriften für den Besuch der Junker im Gemach der Hofdamen:
»desgleichen sollen die vom Adell auch zuchtig neben ihnen (den
Hofdamen) nidersitzen und alldo alle unzuchtige geberden und wort
vermeiden, wie dann solchs die Adeliche zucht und gebrauch ehrlicher
furstlicher frauenzimmer erfordert.[S. 267] Und das dem also, und nicht
anderst, gemes gelept, soll der Hoffmeister und Hoffmeisterin darauff
fleißig sehen und daruber halten und in Summa keynem Edelman den
eingang gestatten, dan der sich zuchtig, ehrlich, erbarlich und, wie
sich geburt, beweysen thue.«[238]
Zu denken gibt auch folgender Passus in der Hofordnung des Markgrafen
Philipp II. von Baden-Baden (1571–1588): »Khein Unzucht, so die Natur
in Niechterkeit nothalber erfordert, solle anderer Enden dann an
denen orthen, da es sich gebürt und die darzu verordnet, verricht und
dargegen die schandtliche und ergerliche unhöflichkeiten und schanden,
so anderwerts biß anhero bößlich und schädlich in vil weg fürgangen,
gewißlich vermiden bleiben, bey gefengkhnus und unserer ungnad
unnachläßlicher gefahr.«
Die württembergische Hofordnung Herzog Johann Friedrichs enthält sogar
noch 1614 einen ganz ähnlichen Passus.[239]
*
In der Hofordnung Karls II. von Baden-Durlach heißt es: »Und nachdem
von dem hofgesindt bißher mermaln clag furkhomen, das sie nachts
uff der gassen allerhandt unzucht treiben und etwa den Burgern mit
einschlagung und einwerffung der fenster und in ander weg schaden
beschicht, so wollen Ire f. Gn. – edel und unedel hiemit, sich eins
solchen gentzlich zu enthalten, gebotten haben und, da solches nit
helffen (wurde), mit der straaff niemandts schonen.«
[S. 268]
*
Eine Bestimmung, die sich häufig findet und tief blicken läßt, ist die
Karls II. von Baden-Durlach: »Disgleichen soll niemandts kein büchsen
in der Statt abschießen, sonder solchs vor der Statt an unschadlichen
ortten tun.« Es war damals augenscheinlich gang und gebe, daß die
Hofleute in der Stadt herumschossen.[240]
*
Jede Hofordnung fast ohne Ausnahme enthält Bestimmungen über den
Burgfrieden, der unter dieser rauhbeinigen Gesellschaft gar nicht
energisch genug aufrecht erhalten werden konnte. So bestimmen die
württembergischen Hofordnungen noch das ganze 17. Jahrhundert hindurch,
daß, wer vom Gesinde sich an seinem Vorgesetzten vergreift, die rechte
Hand verlieren soll. Ebenda wird als Burgfriedensverletzung auch
bezeichnet, wenn jemand sich weigert, mit einem andern am selben Tisch
zu sitzen.[241]
*
Zur Illustrierung des höfischen Tones dient auch folgender Passus
in der Hof- und Feldordnung der Herzöge Adolf Friedrich und Johann
Albrecht II. von Mecklenburg vom Jahre 1609: »Es sol auch bei und uber
den Malzeiten ohne uberlauts schreyen, auch zerprech- und werfung der
Trinckgeschier sich ein jeder zuchtig und eingezogen verhalten...«[242]
Dazu passen aus der Hofordnung des Markgrafen Johann von Küstrin
die Bestimmungen: »§ 2. Eß soll auch der Hoffmeister bei seinen Unß
gethanen[S. 269] pflichten kein unordnunge in unsern furstlichen frauenzimmer
gestadten und darauf mit gut achtung geben, das keine Unfleterei weder
im Frauenzimmer noch davor getrieben werde, und do es von jungen oder
alten geschehe...
§ 3. Do auch der Hoffmeister einig Winkellsitzen, es were von Magden
oder Andern vormerckte, oder daß sonsten unrichtigkeitt befunden, soll
ehr uns und unsere(m) Gemahll solches jederzeitt zu vermelden schuldigk
sein, auch kein unordentlich gereiß oder dergleichen scherz, so mit
Jungfern oder Megden vorgenommen wurden, nicht gestatten, sondern
straffen.
§ 4. Es soll auch keine Saufferey in dem frauenzimmer verstattet noch
nachgeben werden.
Es folgen dann noch ähnliche Bestimmungen, so daß die Edelleute nur bis
8 Uhr abends sich mit den Jungfrauen, unter denen selbstverständlich
Hofdamen gemeint sind, unterhalten dürfen etc. Man denke sich eine
moderne Hofordnung! Und dazu muß ausdrücklich bemerkt werden, daß sehr
viele es für nötig hielten, in dieser Weise für den Anstand zu sorgen.
So z. B. Herzog Bogislaw XIV. von Pommern-Stettin, der den Hofmeister
dafür sorgen läßt, daß ›auch darin (im Gemach der Hofdamen) keine
unzulessige vollsaufferey oder sonsten wüstes, wildes wesen getrieben,
besonders (sondern) ein jeder zu rechter Zeit wiederumb wegk an seinen
ort gehen und das Frauenzimmer zu rechter Zeit geschlossen werden
möge.‹«[243]
[S. 270]
*
Der Ton bei Hofe wird deutlich aus der Hofordnung Herzog Johann
Albrechts von Mecklenburg vom Jahre 1574. »Und weill S. f. G. in
erfahrung kommen, das die Diener, wan S. f. G. auf der Jagd oder
sonsten auff den höfen seindt, den Leutten die huener todtschlagen,
daß Obst auß den Gertten nehmen und sich sonsten dergleichen Dingen
erzeigen, alß wan eß in offenem feldtzug wehre, auch dißfalls S. f. G.
eigen Höfe und Gartten nicht verschonen. Also wollen S. f. G. solches
hiemitt ernstlich verbotten ...«
*
Montaigne, der im Jahre 1580 seine Reise antrat, ist von der
Sauberkeit, die er überall in Deutschland findet, entzückt. Besonders
lobt er die Reinlichkeit in den Augsburger Häusern, wo er sogar
nirgends Spinnweben antrifft. Köstlich ist, wie er die Einrichtung der
Schlafzimmer beschreibt: »ils metent souvent contre la paroy a coté
des licts, du linge et des rideaus, pour qu’on ne salisse leur muraille
ein crachant«.[244]
Nun muß man ja berücksichtigen, daß Montaigne gemäß seiner sozialen
Stellung und Vermögen nur mit wohlhabenden Kreisen in Berührung kam und
wohl auch von Frankreich her durch Reinlichkeit nicht allzu verwöhnt
war. Denn beim niedern Volk sah es anders aus. Ein Jahrhundert früher
schreibt Platter über die Läuseplage im Spital: »Ich hette schier offt
man gwelt hette, dry leuß mit einandren uß dem busen zogen.« Das
heißt: so oft er gewollte hätte,[S. 271] würde er drei Läuse mit einem Griff
aus dem Busen gezogen haben![245]
*
Der Furcht vor Insekten, die ja nicht unbegründet gewesen zu sein
scheint, dienten auch die Baldachine oder Betthimmel. Man war besonders
besorgt, den Kopf der Schlafenden vor Ungeziefer zu schützen, das von
der Decke herabfallen konnte. Deshalb waren – was nicht für unsere
Sauberkeit sprechen will – im 15. und 16. Jahrhundert die Betten zum
Teil der ganzen Länge nach, zum Teil auch nur am Kopfende mit einem
Holzhimmel überdeckt. In den Niederlanden genügte Stoff, wohl leichte
Seide, diesem Zweck. Aber man machte die bittere Erfahrung, daß das
gerade geschah, was man vermeiden wollte: die ungebetenen Gäste ließen
sich in den Baldachinen häuslich nieder. Deshalb verschwand im Laufe
des 17. Jahrhunderts das Himmelbett langsam, wenigstens das schwere mit
Holzdach.[246]
Wie es im 16. Jahrhunderte etc. von Flöhen und Läusen wimmelte, geht
aus der Rolle hervor, die diese Tierchen im öffentlichen Interesse
einnahmen. So prophezeit Fischart in seiner Praktik (S. 27), daß
diese Wandleuß in Frankreich gedeihen werden – ähnlich auch Rabelais
wiederholt in Gargantua und Pantagruel – und in der Flohatz 2082, daß
»kein Wandlauß nach kein Floh nicht bleibt.«
Ho. Coler (Oeconomia Bd. XVIII, c. 19) setzt im Ernste auseinander: »Es
sind aber von diesen edlen Creaturen dreyerley: Kopfleuse, Kleiderleuse
und Filtzleuse. Die erste befehle ich den Kindern und[S. 272] Weibern, die
andere den Landsknechten, Botten und Bettlern, die dritten den Bulern
und Hurenhengsten.«
Montaigne war also nicht nur naiv, sondern auch recht anspruchslos!
*
Im 14. Jahrhundert und früher hatten die Betten eine riesige Größe.
Solche von vier Meter Breite waren die Regel. Allerdings schlief
nicht nur das Ehepaar im gleichen Bett, wie ja mancherorts heute noch
üblich, sondern die Adeligen luden auch regelmäßig ihre Waffengefährten
ein, in ihrem Bett zu schlafen, zum Zeichen der Waffenbrüderschaft.
Und zwar lud man den Freund auch ins Ehebett ein, so daß häufig
die Gattin neben dem Gast lag. Aber auch Hunde genossen die
Gastfreundschaft.[247]
*
Noch im 17. Jahrhundert besaßen die Damen keinen Salon, vielmehr
empfingen sie Besuche im Schlafzimmer, und zwar auf dem Bett
liegend. Das Bett spielte überhaupt eine große Rolle im Leben
der Damen. Als am 2. Oktober 1686 die Gesandtschaft von Siam dem
Sonnenkönig ihre Aufwartung machte, empfing die Gemahlin des Dauphin
sie im Bett, desgleichen lagen alle Prinzessinnen von Geblüt auf
dem Bett, als sie den exotischen Gästen Audienz erteilten.
Der Dichter Gombault hatte freien Zutritt bei der Königin Maria von
Medici. Eines Tages traf er[S. 273] sie auf ihrem Bett liegend, die Kleider in
Unordnung. In Verse goß er seine Erlebnisse:
Souvent je doute encore, et de sens dépourveû,
Dans la difficulté de me croire moy mesme,
Je pense avoir songé ce que mes yeux ont veû.
Die Sitte gab um so mehr zu pikanten Situationen und entsprechenden
Erlebnissen Gelegenheit, als die Intimen des Hauses und Ehrengäste
sich auf das Bett setzen oder gar legen durften.
Ein Handbuch des guten Tones vom Jahre 1675 muß deshalb ausdrücklich
feststellen, daß es unschicklich ist, sich auf das Bett einer Dame zu
setzen, und daß es sehr ungehörig sei, sich zur Konversation auf ein
Bett zu werfen.
*
Noch merkwürdiger war die Sitte, daß die Neuvermählte sich vom
Tage nach der Hochzeit an drei Tage lang auf ihrem Bett liegend allen
Bekannten zeigen mußte. Und zwar hatten auch ganz Fernstehende
zu diesem Schauspiel Zutritt. Man unterzog dabei die junge Frau
einem Kreuzverhör, um ihre Haltung zu prüfen. Selbst die höchsten
Damen konnten sich dem Brauch nicht entziehen. Der Herzog von Lauzun
renommierte bei dieser Gelegenheit mit seinen Heldentaten...!
Im Jahre 1698 heiratete der Graf d’Ayen ein Fräulein d’Aubigné, Nichte
der Mme. de Maintenon. Nach dem Souper legte man das Paar zu Bett.
»Der König reichte, wie Saint-Simon (II, p. 59) erzählt, das[S. 274] Hemd dem
Grafen, die Herzogin von Bourgogne der Braut das ihre. Der König sah
beide im Bett mit der ganzen Hochzeitsgesellschaft; er selbst zog ihnen
den Bettvorhang zu...« Am andern Morgen empfingen Mme. de Maintenon und
in einem anstoßenden Zimmer die Gräfin d’Ayen auf ihren Betten liegend
den ganzen Hof.
Aber noch in der Mitte des folgenden Jahrhunderts gehörte das Bett zum
höfischen Zeremoniell. Im Februar 1747 heiratete der Dauphin, Sohn
Ludwigs XV., in zweiter Ehe Maria Josepha von Sachsen, nachmals Mutter
dreier Könige. Der Herzog von Croy erzählt darüber in seinen Memoiren
(Ed. Grouchy, p. 49):
»Wir waren bei der Toilette der Dauphine anwesend, die sich
öffentlich abspielte, bis zu dem Augenblick, wo die Königin
ihr das Hemd gab. In diesem Augenblick ließ der König alle Männer
zur Toilette des Dauphin gehen, dem Seine Majestät das Hemd reichte.
Als beide Zeremonien beendet waren, kehrte jedermann wieder ins
Schlafzimmer der Frau Kronprinzessin zurück. Sie war in der Nachthaube
und in ziemlicher Verlegenheit, aber weniger wie der Dauphin. Als sie
im Bett lagen, zog man die Vorhänge zurück und jedermann betrachtete
die beiden einige Zeit lang.«
*
Im 17. Jahrhundert stand das Bett ziemlich in der Mitte des Zimmers und
hatte infolgedessen rechts und links je einen freien Raum, eine Gasse,
von ungefähr gleicher Breite. Aber während die eine, etwas[S. 275] schmälere,
für intim galt, war die etwas breitere die offizielle. Einst
spielte König Heinrich IV., durch Gicht ans Bett gefesselt, mit
Bassompierre, der uns die Geschichte erzählt (Mémoires ed. Chantérac
T. I, p. 218), Würfel, und zwar saß er in der kleinen Gasse, während
die große für eventuelle Besuche frei blieb. Da kam Mme. d’Angoulême.
Der König drehte sich sofort herum und empfing die Herzogin »auf der
andern Seite des Bettes«.
Selbst die königlichen Prinzessinnen mußten, wenn sie am Bett Ludwigs
XIV. vorbeigingen, es durch eine tiefe Verbeugung grüßen. Auch
bei der Königin grüßten die Damen das Bett.[248]
*
Im ausgehenden 15. Jahrhundert war der Gebrauch des
Taschentuches nicht allgemein verbreitet. Man konnte sich mit
der Hand schneuzen – das erlaubten sogar die Sittenlehrer – nur mußte
es die linke Hand sein, da man mit der rechten bei Tisch das
Fleisch aß! Bediente man sich aber der Linken, dann konnte man ruhig
seine Finger zur Reinigung benutzen.
Daher mußte es als geradezu verwegene Neuerung gelten, wenn Jean
Sulpice in seinem Libellus de moribus in mensa servandis vom Jahre 1545
das Taschentuch empfiehlt und schreibt: »Wenn du dich schneuzen mußt,
dann darfst du eine solche Ausscheidung nicht mit den Fingern nehmen,
vielmehr in einem Taschentuch bergen.«
Erhebend ist auch die Vorschrift, die Erasmus von Rotterdam in
seiner unter dem Titel: Civilité[S. 276] moral des enfants im Jahre 1613 im
Französischen erschienenen, aus dem Lateinischen übersetzten Schrift
gibt. Daß der Nasenschleim entfernt werden müsse, steht bei ihm
fest: »Aber sich in seine Mütze oder an seinem Ärmel zu schneuzen
ist bäuerisch; sich am Arm oder am Ellenbogen zu schneuzen, mag den
Zuckerbäckern anstehen; sich mit der Hand zu schneuzen, wenn du sie
zufällig im gleichen Augenblick an deinen Anzug hinbringst, ist nicht
viel gesitteter. Aber die Ausscheidungen der Nase mit einem Taschentuch
aufzunehmen, indem man sich etwas von Standespersonen abwendet, ist
eine hochanständige Sache. Und wenn durch Zufall etwas davon zu
Boden fallen sollte, wenn man sich nämlich mit zwei Fingern schneuzt,
dann muß man sofort darauf treten.«[249]
*
Montaigne erzählt im 22. Kapitel des 1. Buches seiner Essais von einem
Edelmann, der sich noch mit seiner Hand schneuzte. Und zwar tat er das,
weil er dem Nasenschleim nicht das Privileg einräumen wollte, in feiner
Wäsche aufgenommen und sorgfältig eingesteckt zu werden. Er hielt es
für viel verständiger, sich dieser Unreinlichkeit zu entledigen, wo es
gerade sei. Und Montaigne pflichtete ihm bei!
*
Noch im 17. Jahrhundert war der Gebrauch des Taschentuches so wenig
absolutes Erfordernis des wohlerzogenen Mannes, daß selbst ein großer
Herr[S. 277] sich der Finger bedienen durfte. Eines Tages sah Hauterive de
l’Aubespine, ein Edelmann von hohem Range, die Blüte Frankreichs bei
sich, darunter den berühmten Turenne. Als während des Mahles Hauterive
sich schneuzen mußte, drückte er mit dem Finger ein Nasenloch zu und
schleuderte den Inhalt des andern wie einen Pfeil gegen den Kamin.
Dabei machte er ein Geräusch wie ein Pistolenschuß. Ruvigny rief bei
dieser Detonation zum großen Gaudium der andern aus: »Mein Herr, Sie
sind doch hoffentlich nicht verwundet?«
De la Mésangère schrieb im Jahre 1797 über dieses nicht sehr
appetitliche Thema: »Vor einigen Jahren machte man eine Kunst daraus,
sich zu schneuzen. Der eine ahmte den Trompetenton nach, der andere das
Schnurren der Katze. Der Gipfel der Vollendung bestand darin, weder zu
viel noch zu wenig Geräusch zu verursachen.«[250]
*
Einen Einblick in das höfische Zeremoniell gewährt uns die
Kammerordnung Herzog Wilhelms V. (dankt 1595 ab, † 1626) von Bayern
vom Jahre 1589. Dieser fromme, ja asketische Monarch bestimmt: »Alß
wir unß dann anzuclaiden wellen anfangen und die Camerpersohnen
darzue verordent werden, sollen die Camerer die Rekh und Mentl in der
Vorcamer von sich legen und also eingenestlet in den Goldern (Kollern)
oder Rekhlen mit anhangenden Iren Rapieren und seittenwähren zu uns
hineingehen und nach vorgehender reverentz on alle Dif(f)erenz und
forgang, wie bißhero geschehen, sondern vertraulich[S. 278] under einander
zu dienen anfachen. Wir verordnen es dann in dieser Instruction oder
ordnung in nachvolgendem anderst, hat es seinen Weg; Nemblich es soll
unser Oberst Camerer oder in seinem abwesen der von uns verordnet
verwalter und, so der kheiner vorhanden, allzeit dem Dienst nach der
öltist oder auch ain anderer Camerer das Schlafhemet von uns empfahen
und alßbaldt unser Leibbarbierer oder in seinem abwesen ainer aus den
Camerdienern unsern Leib mit Tüechern reiben und abstreichen, dieweil
uns der Oberst Camerer den Camb raichen, damit wir uns selbs daß Haar
und Parth khemen, alß dann unser Obrist Camerer das hemet von dem
Camerdiener nemmen und unß solchcs sowol als hernach den Prustfleckh
und gestrickht hemetgeben. Volgents solle uns ainer aus den Camerern
die Leinen sockhen und dariber die Hosen, schuech und Pantofel, deren
Ime die Camerdiener indifferenter ains nach dem andern raichen sollen,
anlegen. Auf dasselb soll uns das Tuech, so wir zu dem hendwaschen fir
unß zu braitten pflegen, gegeben werden und daruf aus unsern Camerern
ainer daß Peckhen und khandlen und der ander daß Mundtwasser nemmen und
mit vorgehender Credentz daß Wasser, der Obrist oder anderer Camerer
aber das Tuech zum Trinckhen raichen, welche alßdan nach verrichtem
handwaschen daß handt- und Mundtwasser auszeschitten und das Peckhe(n)
wiederumben zu seubern wie auch bemelte Tüecher dem Camerdiener
zuestellen sollen. Also solle uns hernach unser oberster Camerer daß
Wames raichen, uns anlegen und aus den Camerern ainer den Nachtrockh
von uns nemmen, aus unsern Camerdienern ainem[S. 279] zuestellen und je zween
von den Camerern uns einnesteln und alsoforth ganz und gar ankhlaiden
und, so offt es auch von nothen, die seitenwehr, Pareth oder Gurt und
gulden flüß (Goldenes Vließ) geben.
Der Leibbarbierer sollr, da wir es begern, dem obristen Camerer, mit
ainem Haubttuech verdeckht, daß Zanpulfer und Handsaiffen langen,
derselb uns solches auf vorgehende Credenzung zu gebrauchen raichen und
Ime, Barbierer, hernach wider zuestellen.
Wenn wir dann auß unser Camer in die Vorcamer gleich alßbalden gehen,
so sollen uns unsere Camerer alle vor(–), die Oberst Camerer aber
strackhs volgen und nachgehen, uns zue und von der khurchen biß zu der
Tafel belaitten. Da wir auch die Wöhr im Zimer nit wurden anhengen,
solle sy der Obrist Camerer uns und sonst niemandts nachtragen.«[251]
*
In dieser umständlichen Art sind auch die andern Dienste, der bei der
Tafel, beim Auskleiden etc. festgesetzt. Interessant ist aber diese
Stelle nicht nur wegen ihrer zeremoniösen Umständlichkeit, die den
spanischen Einfluß deutlich verrät und sich wesentlich vom Brauch der
andern damaligen deutschen Höfe unterscheidet, auch nicht allein,
weil sie uns Gelegenheit bietet, die Toilette des Fürsten genau zu
verfolgen, sondern besonders deshalb, weil sie lehrt, daß man sich
damals nicht wusch! Nur Hände und Zähne kommen mit dem Wasser
in Berührung. Das andere wird schlecht und recht durch Abreiben mit
Tüchern ersetzt.
[S. 280]
*
Madame Campan erzählt in ihren berühmten Memoiren folgende Geschichte,
die die unglückliche Marie Antoinette zum Gegenstand hat:
Das Ankleiden der Prinzessin war ein Meisterwerk der Etikette. Hier
war alles vorgeschrieben... Wenn eine Prinzessin der königlichen
Familie beim Ankleiden der Königin zugegen war, mußte die Ehrendame
ihr ihre Funktionen abtreten. Aber sie zedierte sie nicht direkt
den Prinzessinnen von Geblüt; in diesem Falle gab die Ehrendame das
Hemd der ersten Kammerfrau zurück, die es der Prinzessin von Geblüt
überreichte. Jede dieser Damen beobachtete skrupulös diese Gebräuche
als Bestandteile ihrer Rechte bildend.
An einem Wintertage ereignete es sich, daß die Königin, bereits ganz
entkleidet, im Begriffe war, ihr Hemd anzuziehen. Ich hielt es ganz
entfaltet. Die Ehrendame tritt ein, beeilt sich, ihre Handschuhe
auszuziehen und nimmt das Hemd. Es klopft leise an die Tür, man öffnet:
es ist die Frau Herzogin von Orléans; ihre Handschuhe sind ausgezogen,
sie tritt vor, um das Hemd zu nehmen, aber die Ehrendame darf es ihr
nicht reichen; sie gibt es mir zurück, ich gebe es der Prinzessin. Es
klopft neuerdings: es ist Madame, Gräfin von der Provence; die Herzogin
von Orléans überreicht ihr das Hemd. Die Königin hielt ihre Arme über
der Brust gekreuzt und schien zu frieren. Madame sieht ihre peinliche
Haltung, wirft nur ihr Taschentuch fort, behält die Handschuhe an und
bringt, indem sie ihr das Hemd überstreift, die Haare der Königin in
Unordnung. Diese lächelt, um ihre Ungeduld zu bemänteln, aber erst,
nachdem[S. 281] sie mehrmals zwischen den Zähnen gemurmelt hatte: »Das ist
scheußlich. Welche Belästigung.«[252]
*
In der Vergangenheit trauerte das ganze Land um den Tod des
Landesfürsten, und zwar in Frankreich ein volles Jahr lang.
Die ganze Nation ging schwarz. Kein Bürger, mag er in noch so
beschränkten Verhältnissen gelebt haben, der nicht Trauerkleidung
getragen, auf Schmuck verzichtet und seine Familie und Dienstboten zum
mindesten in dunkle Gewandung gesteckt hätte. Allerdings erhielten die
Angestellten des Hofes – ein Begriff, der außerordentlich weit gefaßt
wurde – von diesem die Trauerkleidung geliefert. Es genügte aber
nicht, für die eigenen Fürsten Trauer anzulegen, man trug in Paris
Trauer um jeden europäischen Fürsten.
Da die lange Hoftrauer so drückend, besonders von der Luxusindustrie,
empfunden wurde, reduzierte eine königliche Ordonnanze vom 23. Juni
1716 ihre Dauer auf ein halbes Jahr. Natürlich gab es über die Art
ihrer Ausführung die genauesten Vorschriften.
Übrigens war auch die Privattrauer – die ersten Zeugnisse, daß
die Trauer überhaupt äußerlich kenntlich gemacht wurde, gehen in
Frankreich nicht weiter, als zum Beginn des 14. Jahrhunderts zurück
– außerordentlich riguros. Aliénor de Poitiers, eine große Dame, die
zwischen 1484 und 1491 »Les honneurs de la Cour« schrieb, ein Buch,
in dem die genauesten Details über Fragen der Etikette sich finden,
erzählt, daß ihre Standesgenossinnen beim Tode der Eltern neun Tage
lang auf ihrem Bett sitzen[S. 282] mußten, zugedeckt mit blauem Tuche. Das
Zimmer aber mußten sie sechs Wochen hüten. Bei dieser großen Trauer um
Gatten oder Eltern durfte man auch weder Ringe noch Handschuhe tragen.
*
Nach dem Tode des Herzogs von Bourbon im Jahre 1456 blieb seine
Tochter, Frau von Charolais, nicht weniger als sechs Wochen in ihrem
Zimmer, und zwar auf einem mit weißem Tuche überzogenen Bett liegend.
Das Zimmer aber war ganz mit schwarzem Tuch ausgeschlagen, und schwarze
Tücher vertraten auch die Stelle von Teppichen. Davor aber war ein
großes Gemach ebenso hergerichtet. Übrigens lag sie, wenn sie allein
war, weder immer, noch blieb sie stets im gleichen Zimmer. 40 Tage
Stubenarrest nach dem Tode des Gatten war so gebräuchlich, daß ein
Jahrhundert später Katharina von Medici fast getadelt wird, als sie
sich nicht fügte.
Die Witwe mußte ihre Trauerkleidung immer tragen, es sei denn, sie
verheiratete sich wieder, was selten genug vorkam, schon weil die
Kirche es nicht gern sah. Übrigens war diese Witwentracht schwarz oder
grau, zu Beginn des 16. Jahrhunderts und im 17. weiß, ebenso weiß bei
Königinnen noch im 18. Jahrhundert. Im 16. Jahrhundert mußten die
Witwen ihre Haare zwei Jahre lang verbergen und nur mit einem bis zu
den Füßen reichenden Schleier ausgehen.
Heinrich III. von Frankreich trug nach dem Tode der Marie von Kleve an
seiner ausnahmsweise schwarzen[S. 283] Kleidung silberne Tränen, Totenköpfe
und ähnliche Embleme. Nach dem frühen Tode Karls VIII. 1498 trug Anna
von Bretagne um ihn, abweichend vom königlichen Brauch, schwarze
Trauer. Neun Monate nach seinem Tode hatte sie sich aber durch die Ehe
mit Ludwig XII. getröstet. Als sie starb, trauerte ihr zweiter Gatte
auch schwarz um sie und ließ keinen Gesandten vor, der nicht schwarz
gekleidet war. Auch er heiratete neun Monate später wieder. Regel war,
daß die Könige in Violett trauerten, sogar noch im 18. Jahrhundert,
noch Napoleon hielt den Brauch aufrecht. Brantôme sagte ausdrücklich,
daß Maria Stuart weiß trauerte, also sich dem Brauch fügte. Noch heute
heißt ein Zimmer im Hotel Cluny »Zimmer der weißen Königin«, weil Marie
von England, die junge Witwe Ludwigs XII., sich dorthin zurückgezogen
hatte.[253]
*
Über die Volkssitten, die im Jahre der Entdeckung Amerikas im
bischöflichen Brixen herrschten, unterrichtet uns ein gleichzeitiger
venetianischer Reisebericht. »Hier verbrachten wir den Rest des
Feiertages (Fronleichnam) und nahmen wahr, daß die Einwohner sich in
ihren Häusern sehr vergnügten, indem sie, das Haupt mit Eichen- oder
Efeuguirlanden geschmückt, mit den Frauen zum Klange der Querpfeife
tanzten. Danach führte jeder seine Dame zu einem Sitz, wobei er sie
mit sehr großer Ausgelassenheit umarmte und herzte. Auch einige
junge Venezianer Edelleute aus der Begleitung der Gesandten versuchten
mit den hübschesten Damen[S. 284] zum Zeichen ihres Wohlgefallens auf dem
Balle zu tanzen. In Brixen herrscht überhaupt ein ausgelassener
Ton, denn auf den Straßen ist es – und zwar nicht bloß
den Einheimischen, sondern auch den Fremden – erlaubt, junge
Damen anzufassen und zu berühren und ihnen Liebenswürdigkeiten zu
sagen.«[254]
Also ein Seitenstück zu dem aus dem 1. Bande bekannten Bericht des
Bracciolini aus den Bädern in der Schweiz! Nur daß es hier wenigstens
äußerlich trockener war.
*
Von den Sitten in Venedig, das Keyßler 1730 besuchte, erzählt er:
»Eine Maitresse zu halten, wird einigermaßen für ein unabsonderliches
Recht eines Edelmannes gehalten: und wenn einer durch seine Armuth
verhindert ist, für sich allein eine Beyschläferin zu unterhalten;
so tritt er mit drey oder vier Mannspersonen in eine Gesellschaft,
um einander die gemeinschaftlichen Unkosten ertragen zu helfen.
Jeder begnüget sich alsdann mit denen vierundzwanzig Stunden, welche
der Reihe nach an ihn kommen: und wenn des Morgens der eine seinen
Schlafrock, Schlafmütze und Pantoffeln aus dem Hause der Curtisane
abholen läßt, so nimmt um eben solche Zeit das in der Ordnung folgende
Mitglied der loblichen Gesellschaft, durch Uebersendung von dergleichen
Equipage Besitz von seiner Statthalterschaft. Die Wollüste gehen in
Venedig so weit, und die daraus[S. 285] entstehende garstigen Krankheiten sind
so gemein, daß man kaum der Mühe werth achtet, sich von etlichen Arten
curiren zu lassen.«[255]
*
Am Cirknizer See hatten im 18. Jahrhundert die Bauern das Recht zu
fischen. »es läuft aber alsdann bey der Fischerey alles ohne Scham
unter einander, Manns- und Weibspersonen, wie sie auf die Welt
kommen. Die Obrigkeit und Clerisey hat etliche mal gesucht, solche
Gewohnheit abzubringen, vornehmlich wegen der jungen Mönche in den
zur Fischerey berechtigten Klöstern, welche sich allsdann nicht gern
in ihren vier Mauern eingeschlossen wollen halten lassen, sondern
desto mehr begierig sind, einer Augenweide zu genießen, je seltener
und verbothener ihnen solche ist; allein man hat es noch nicht dazu
bringen können, daß beydes Geschlecht auch nur in leichter Kleidung
dabei erschienen wäre. Wahr ist es, daß dieses gemeine Volk kein
Arges daraus machet, und keine Versuchung von einer Sache empfindet,
die ihnen ganz gewöhnlich ist; man höret auch nicht, daß bei solcher
Gelegenheit mehr Böses vorgehe, als bey andern, wo man noch so wohl
mit Kleydungen bedeckt ist; allein die fremden Anwesende bekommen
Gelegenheit zu manchem üppigen Gelächter und vielerlei Anmerkungen; den
Mönchen gereichet in solcher Materie ein geringer Anblick zur starken
Versuchung, und obgleich das hiesige weibliche Geschlecht von gemeinem
Stande ihrer Schönheit nach nicht so beschaffen ist, daß es in manchen
andern Ländern[S. 286] große Liebesgluten entzünden könnte, so ist doch
bisweilen das häßliche nicht unangenehm, wo man von nichts schönerem
weis.«[256]
Bezeichnend ist hierbei, daß die biederen Landbewohner so wenig wie die
Eingeborenen der Tropen erotischen Wallungen ausgesetzt sind, wohl aber
die Erbpächter der Sittlichkeit, der Klerus.
*
In den Bädern in Ofen war man damals auch nicht prüde: »In dem
mittelsten großen Raume dieser Bäder befindet sich beyderley Geschlecht
untereinander, und ist das Mannsvolk nur mit einer Schürze, und
die Weibspersonen mit einem Vorhemde einigermaßen bedeckt. In dem
Raizenbade hält das gemeine Volk sogar dieses wenige für überflüssige
Ceremonien.«
Erster Abschnitt.
(S. 1 ff.)
Kultur-Kuriosa
Erster Band
7. Tausend
Schrifttitel von Walter Tiemann
Geheftet 3 Mark 50 Pf., gebunden 5 Mark
Münchner Neueste Nachrichten: Wenn ich den Verfasser
recht verstanden habe, so hat er mit dieser Veröffentlichung von
Kulturdokumenten aller Zeiten und Völker das ethische Ziel verfolgt, im
Spiegel der Vergangenheit das Bild der Gegenwart zu zeigen und dadurch
auch seinerseits dazu beizutragen, daß Leben, Ehre, Freiheit und fremde
Überzeugung jene Achtung genieße, die er mit vollem Recht als das
wichtigste Kulturkriterium betrachtet, wichtiger als alle technischen
und wissenschaftlichen Fortschritte und alle künstlerischen Großtaten.
Der Tag, Berlin: Ein ganz verflixtes Buch. Vom Standpunkt der
Orthodoxie aus – hüben wie drüben – höchst verwerflich nach Tendenz
und Inhalt. Und nun gar: wenn man sich »Töchterschülerinnen« als seine
ungebetenen Leserinnen vorstellen wollte – einfach Pfui Deibel! Und
dennoch: recht zum Nachdenken bewegend, zur Einkehr stimmend, zur
Umschau anregend. Notabene: Für solche, die ihr bißchen Spiritus
gewöhnt sind nicht nach einem irgendwie vorgeschriebenen Schema F
einzustellen. Bei allem Pessimismus, der daraus spricht, eine sinnige
Gabe für geborene Optimisten.... Der wahre Satiriker will nicht nur
bloßstellen, sondern auch bessern; so will auch dies Buch bei aller
Boshaftigkeit oder doch Ungeschminktheit den unserer »Bildung« durchaus
nicht überall adäquaten Stand unserer sogenannten Kultur heben.
Möchte es vor allen Dingen unter die Augen der Männer geraten, die es
namentlich angeht!
Generalanzeiger Mannheim: Solche Bücher sind selten. Denn zu
gern verschließt sich der Mensch solch grassem Bekenntnis der Wahrheit.
Aber sie haben eben dadurch doppelten Wert. Kemmerichs »Kultur-Kuriosa«
sollte jeder besitzen, der Anteil nimmt an menschlicher Kultur, und es
ist jedem von uns heilsam, mitunter in dem Buche zu blättern.
Neue Züricher Zeitung: Eine Sammlung drastischer Anekdoten aus
dem weiten Reiche der Kulturgeschichte, mit viel Geschick ausgewählt
zum Behufe des Nachweises, »daß unsere Kultur, soweit sie auf Befreiung
von Grausamkeit, Intoleranz und Borniertheit beruht, noch sehr jungen
Datums ist.« In der Tat ist es unglaublich, von welcher Barberei wir
herkommen, und in welcher Barberei wir vielfach heute noch stecken, auf
dem Gebiete des Rechts, der Ehe, der Sittlichkeit, des Glaubenslebens
usw. Manchmal traut man seinen Augen nicht; aber der Verfasser beruft
sich in einem überaus reichen Literaturnachweis durchgängig auf die
besten Quellen.
Verlag von Albert Langen in München
Dinge, die man nicht sagt
5. Tausend
Preis geheftet 5 Mark 50 Pf., gebunden 5 Mark
Der Tag: Dies neue Buch stellt eine gediegene, gut durchdachte,
durchaus zusammenhängende, fein gegliederte Beweisführung dar.
Freilich ganz ohne Anmerkungen, Belege, Kommentare, sogar ohne
Register: es ist erlebt. Ein heißes Streben und Sehnen nach Besserung,
Veredelung, Modernisierung durchzieht das Ganze. Und wo die Satire
scharf zu schneiden gezwungen ist, weil der baumelnde Zopf gar zu fest
sitzt, da wird ihr versöhnlich geholfen durch einen den schlimmsten
Griesgram entwaffnenden Humor. Zur Habilitation würde Kemmerich wohl
nirgends zugelassen werden – schad’t nix: der Stand der wahrhaft
freien Schriftsteller, der streitbaren Ritter vom Geiste, hat auch
Daseinsberechtigung, Verdienste und Adel.
Gerichtszeitung, Wien: Es ist ein Vorzug des Kemmerichschen
Buches, durch drastische Beispiele größere Wirkungen zu erzielen, als
durch tiefsinnige, wissenschaftliche Betrachtungen.
Neue Weltanschauung: Der Verfasser sieht den Dingen überall
mutig ins Auge und hat die lobenswerte, wenn auch an vielen Stellen
ungern gesehene Gewohnheit, sie beim richtigen Namen zu nennen. Kurzum
wir haben ein tapferes Buch vor uns, an dem jeder Freund der Wahrheit
und des Fortschrittes seine helle Freude haben muß.
Öst.-Ungar. Buchhändler-Zeitung: Das ist eine kleine, harmlose
Blumenlese der »Dinge, die man nicht sagt«, die aber Dr. Kemmerich,
der Verfasser der »Kultur-Kuriosa«, ausführlich niederschreibt. Vieles
in dem vorbildlich vornehm ausgestatteten Buche ist wahr, manches
übertrieben, alles interessant.
Verlag von Albert Langen in München
Druck von Hesse & Becker in Leipzig
Papier von Bohnenberger & Cie., Papierfabrik, Niefern bei Pforzheim
Einbände von E. A. Enders, Großbuchbinderei, Leipzig
End of Project Gutenberg's Kultur-Kuriosa, Zweiter Band, by Max Kemmerich
*** END OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK KULTUR-KURIOSA, ZWEITER BAND ***
***** This file should be named 63801-h.htm or 63801-h.zip *****
This and all associated files of various formats will be found in:
http://www.gutenberg.org/6/3/8/0/63801/
Produced by Peter Becker, Reiner Ruf, and the Online
Distributed Proofreading Team at https://www.pgdp.net (This
file was produced from images generously made available
by The Internet Archive)
Updated editions will replace the previous one--the old editions will
be renamed.
Creating the works from print editions not protected by U.S. copyright
law means that no one owns a United States copyright in these works,
so the Foundation (and you!) can copy and distribute it in the United
States without permission and without paying copyright
royalties. Special rules, set forth in the General Terms of Use part
of this license, apply to copying and distributing Project
Gutenberg-tm electronic works to protect the PROJECT GUTENBERG-tm
concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark,
and may not be used if you charge for the eBooks, unless you receive
specific permission. If you do not charge anything for copies of this
eBook, complying with the rules is very easy. You may use this eBook
for nearly any purpose such as creation of derivative works, reports,
performances and research. They may be modified and printed and given
away--you may do practically ANYTHING in the United States with eBooks
not protected by U.S. copyright law. Redistribution is subject to the
trademark license, especially commercial redistribution.
START: FULL LICENSE
THE FULL PROJECT GUTENBERG LICENSE
PLEASE READ THIS BEFORE YOU DISTRIBUTE OR USE THIS WORK
To protect the Project Gutenberg-tm mission of promoting the free
distribution of electronic works, by using or distributing this work
(or any other work associated in any way with the phrase "Project
Gutenberg"), you agree to comply with all the terms of the Full
Project Gutenberg-tm License available with this file or online at
www.gutenberg.org/license.
Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project
Gutenberg-tm electronic works
1.A. By reading or using any part of this Project Gutenberg-tm
electronic work, you indicate that you have read, understand, agree to
and accept all the terms of this license and intellectual property
(trademark/copyright) agreement. If you do not agree to abide by all
the terms of this agreement, you must cease using and return or
destroy all copies of Project Gutenberg-tm electronic works in your
possession. If you paid a fee for obtaining a copy of or access to a
Project Gutenberg-tm electronic work and you do not agree to be bound
by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the
person or entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph
1.E.8.
1.B. "Project Gutenberg" is a registered trademark. It may only be
used on or associated in any way with an electronic work by people who
agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few
things that you can do with most Project Gutenberg-tm electronic works
even without complying with the full terms of this agreement. See
paragraph 1.C below. There are a lot of things you can do with Project
Gutenberg-tm electronic works if you follow the terms of this
agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg-tm
electronic works. See paragraph 1.E below.
1.C. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation ("the
Foundation" or PGLAF), owns a compilation copyright in the collection
of Project Gutenberg-tm electronic works. Nearly all the individual
works in the collection are in the public domain in the United
States. If an individual work is unprotected by copyright law in the
United States and you are located in the United States, we do not
claim a right to prevent you from copying, distributing, performing,
displaying or creating derivative works based on the work as long as
all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope
that you will support the Project Gutenberg-tm mission of promoting
free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg-tm
works in compliance with the terms of this agreement for keeping the
Project Gutenberg-tm name associated with the work. You can easily
comply with the terms of this agreement by keeping this work in the
same format with its attached full Project Gutenberg-tm License when
you share it without charge with others.
1.D. The copyright laws of the place where you are located also govern
what you can do with this work. Copyright laws in most countries are
in a constant state of change. If you are outside the United States,
check the laws of your country in addition to the terms of this
agreement before downloading, copying, displaying, performing,
distributing or creating derivative works based on this work or any
other Project Gutenberg-tm work. The Foundation makes no
representations concerning the copyright status of any work in any
country outside the United States.
1.E. Unless you have removed all references to Project Gutenberg:
1.E.1. The following sentence, with active links to, or other
immediate access to, the full Project Gutenberg-tm License must appear
prominently whenever any copy of a Project Gutenberg-tm work (any work
on which the phrase "Project Gutenberg" appears, or with which the
phrase "Project Gutenberg" is associated) is accessed, displayed,
performed, viewed, copied or distributed:
This eBook is for the use of anyone anywhere in the United States and
most other parts of the world at no cost and with almost no
restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it
under the terms of the Project Gutenberg License included with this
eBook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the
United States, you'll have to check the laws of the country where you
are located before using this ebook.
1.E.2. If an individual Project Gutenberg-tm electronic work is
derived from texts not protected by U.S. copyright law (does not
contain a notice indicating that it is posted with permission of the
copyright holder), the work can be copied and distributed to anyone in
the United States without paying any fees or charges. If you are
redistributing or providing access to a work with the phrase "Project
Gutenberg" associated with or appearing on the work, you must comply
either with the requirements of paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 or
obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg-tm
trademark as set forth in paragraphs 1.E.8 or 1.E.9.
1.E.3. If an individual Project Gutenberg-tm electronic work is posted
with the permission of the copyright holder, your use and distribution
must comply with both paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 and any
additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms
will be linked to the Project Gutenberg-tm License for all works
posted with the permission of the copyright holder found at the
beginning of this work.
1.E.4. Do not unlink or detach or remove the full Project Gutenberg-tm
License terms from this work, or any files containing a part of this
work or any other work associated with Project Gutenberg-tm.
1.E.5. Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this
electronic work, or any part of this electronic work, without
prominently displaying the sentence set forth in paragraph 1.E.1 with
active links or immediate access to the full terms of the Project
Gutenberg-tm License.
1.E.6. You may convert to and distribute this work in any binary,
compressed, marked up, nonproprietary or proprietary form, including
any word processing or hypertext form. However, if you provide access
to or distribute copies of a Project Gutenberg-tm work in a format
other than "Plain Vanilla ASCII" or other format used in the official
version posted on the official Project Gutenberg-tm web site
(www.gutenberg.org), you must, at no additional cost, fee or expense
to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means
of obtaining a copy upon request, of the work in its original "Plain
Vanilla ASCII" or other form. Any alternate format must include the
full Project Gutenberg-tm License as specified in paragraph 1.E.1.
1.E.7. Do not charge a fee for access to, viewing, displaying,
performing, copying or distributing any Project Gutenberg-tm works
unless you comply with paragraph 1.E.8 or 1.E.9.
1.E.8. You may charge a reasonable fee for copies of or providing
access to or distributing Project Gutenberg-tm electronic works
provided that
* You pay a royalty fee of 20% of the gross profits you derive from
the use of Project Gutenberg-tm works calculated using the method
you already use to calculate your applicable taxes. The fee is owed
to the owner of the Project Gutenberg-tm trademark, but he has
agreed to donate royalties under this paragraph to the Project
Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payments must be paid
within 60 days following each date on which you prepare (or are
legally required to prepare) your periodic tax returns. Royalty
payments should be clearly marked as such and sent to the Project
Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in
Section 4, "Information about donations to the Project Gutenberg
Literary Archive Foundation."
* You provide a full refund of any money paid by a user who notifies
you in writing (or by e-mail) within 30 days of receipt that s/he
does not agree to the terms of the full Project Gutenberg-tm
License. You must require such a user to return or destroy all
copies of the works possessed in a physical medium and discontinue
all use of and all access to other copies of Project Gutenberg-tm
works.
* You provide, in accordance with paragraph 1.F.3, a full refund of
any money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the
electronic work is discovered and reported to you within 90 days of
receipt of the work.
* You comply with all other terms of this agreement for free
distribution of Project Gutenberg-tm works.
1.E.9. If you wish to charge a fee or distribute a Project
Gutenberg-tm electronic work or group of works on different terms than
are set forth in this agreement, you must obtain permission in writing
from both the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and The
Project Gutenberg Trademark LLC, the owner of the Project Gutenberg-tm
trademark. Contact the Foundation as set forth in Section 3 below.
1.F.
1.F.1. Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable
effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread
works not protected by U.S. copyright law in creating the Project
Gutenberg-tm collection. Despite these efforts, Project Gutenberg-tm
electronic works, and the medium on which they may be stored, may
contain "Defects," such as, but not limited to, incomplete, inaccurate
or corrupt data, transcription errors, a copyright or other
intellectual property infringement, a defective or damaged disk or
other medium, a computer virus, or computer codes that damage or
cannot be read by your equipment.
1.F.2. LIMITED WARRANTY, DISCLAIMER OF DAMAGES - Except for the "Right
of Replacement or Refund" described in paragraph 1.F.3, the Project
Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project
Gutenberg-tm trademark, and any other party distributing a Project
Gutenberg-tm electronic work under this agreement, disclaim all
liability to you for damages, costs and expenses, including legal
fees. YOU AGREE THAT YOU HAVE NO REMEDIES FOR NEGLIGENCE, STRICT
LIABILITY, BREACH OF WARRANTY OR BREACH OF CONTRACT EXCEPT THOSE
PROVIDED IN PARAGRAPH 1.F.3. YOU AGREE THAT THE FOUNDATION, THE
TRADEMARK OWNER, AND ANY DISTRIBUTOR UNDER THIS AGREEMENT WILL NOT BE
LIABLE TO YOU FOR ACTUAL, DIRECT, INDIRECT, CONSEQUENTIAL, PUNITIVE OR
INCIDENTAL DAMAGES EVEN IF YOU GIVE NOTICE OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
1.F.3. LIMITED RIGHT OF REPLACEMENT OR REFUND - If you discover a
defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can
receive a refund of the money (if any) you paid for it by sending a
written explanation to the person you received the work from. If you
received the work on a physical medium, you must return the medium
with your written explanation. The person or entity that provided you
with the defective work may elect to provide a replacement copy in
lieu of a refund. If you received the work electronically, the person
or entity providing it to you may choose to give you a second
opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If
the second copy is also defective, you may demand a refund in writing
without further opportunities to fix the problem.
1.F.4. Except for the limited right of replacement or refund set forth
in paragraph 1.F.3, this work is provided to you 'AS-IS', WITH NO
OTHER WARRANTIES OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT
LIMITED TO WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR ANY PURPOSE.
1.F.5. Some states do not allow disclaimers of certain implied
warranties or the exclusion or limitation of certain types of
damages. If any disclaimer or limitation set forth in this agreement
violates the law of the state applicable to this agreement, the
agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or
limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or
unenforceability of any provision of this agreement shall not void the
remaining provisions.
1.F.6. INDEMNITY - You agree to indemnify and hold the Foundation, the
trademark owner, any agent or employee of the Foundation, anyone
providing copies of Project Gutenberg-tm electronic works in
accordance with this agreement, and any volunteers associated with the
production, promotion and distribution of Project Gutenberg-tm
electronic works, harmless from all liability, costs and expenses,
including legal fees, that arise directly or indirectly from any of
the following which you do or cause to occur: (a) distribution of this
or any Project Gutenberg-tm work, (b) alteration, modification, or
additions or deletions to any Project Gutenberg-tm work, and (c) any
Defect you cause.
Section 2. Information about the Mission of Project Gutenberg-tm
Project Gutenberg-tm is synonymous with the free distribution of
electronic works in formats readable by the widest variety of
computers including obsolete, old, middle-aged and new computers. It
exists because of the efforts of hundreds of volunteers and donations
from people in all walks of life.
Volunteers and financial support to provide volunteers with the
assistance they need are critical to reaching Project Gutenberg-tm's
goals and ensuring that the Project Gutenberg-tm collection will
remain freely available for generations to come. In 2001, the Project
Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure
and permanent future for Project Gutenberg-tm and future
generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary
Archive Foundation and how your efforts and donations can help, see
Sections 3 and 4 and the Foundation information page at
www.gutenberg.org
Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation
The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non profit
501(c)(3) educational corporation organized under the laws of the
state of Mississippi and granted tax exempt status by the Internal
Revenue Service. The Foundation's EIN or federal tax identification
number is 64-6221541. Contributions to the Project Gutenberg Literary
Archive Foundation are tax deductible to the full extent permitted by
U.S. federal laws and your state's laws.
The Foundation's principal office is in Fairbanks, Alaska, with the
mailing address: PO Box 750175, Fairbanks, AK 99775, but its
volunteers and employees are scattered throughout numerous
locations. Its business office is located at 809 North 1500 West, Salt
Lake City, UT 84116, (801) 596-1887. Email contact links and up to
date contact information can be found at the Foundation's web site and
official page at www.gutenberg.org/contact
For additional contact information:
Dr. Gregory B. Newby
Chief Executive and Director
gbnewby@pglaf.org
Section 4. Information about Donations to the Project Gutenberg
Literary Archive Foundation
Project Gutenberg-tm depends upon and cannot survive without wide
spread public support and donations to carry out its mission of
increasing the number of public domain and licensed works that can be
freely distributed in machine readable form accessible by the widest
array of equipment including outdated equipment. Many small donations
($1 to $5,000) are particularly important to maintaining tax exempt
status with the IRS.
The Foundation is committed to complying with the laws regulating
charities and charitable donations in all 50 states of the United
States. Compliance requirements are not uniform and it takes a
considerable effort, much paperwork and many fees to meet and keep up
with these requirements. We do not solicit donations in locations
where we have not received written confirmation of compliance. To SEND
DONATIONS or determine the status of compliance for any particular
state visit www.gutenberg.org/donate
While we cannot and do not solicit contributions from states where we
have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition
against accepting unsolicited donations from donors in such states who
approach us with offers to donate.
International donations are gratefully accepted, but we cannot make
any statements concerning tax treatment of donations received from
outside the United States. U.S. laws alone swamp our small staff.
Please check the Project Gutenberg Web pages for current donation
methods and addresses. Donations are accepted in a number of other
ways including checks, online payments and credit card donations. To
donate, please visit: www.gutenberg.org/donate
Section 5. General Information About Project Gutenberg-tm electronic works.
Professor Michael S. Hart was the originator of the Project
Gutenberg-tm concept of a library of electronic works that could be
freely shared with anyone. For forty years, he produced and
distributed Project Gutenberg-tm eBooks with only a loose network of
volunteer support.
Project Gutenberg-tm eBooks are often created from several printed
editions, all of which are confirmed as not protected by copyright in
the U.S. unless a copyright notice is included. Thus, we do not
necessarily keep eBooks in compliance with any particular paper
edition.
Most people start at our Web site which has the main PG search
facility: www.gutenberg.org
This Web site includes information about Project Gutenberg-tm,
including how to make donations to the Project Gutenberg Literary
Archive Foundation, how to help produce our new eBooks, and how to
subscribe to our email newsletter to hear about new eBooks.