
The Project Gutenberg EBook of Unter den Hohen Tauern, by Arthur Achleitner
This eBook is for the use of anyone anywhere in the United States and most
other parts of the world at no cost and with almost no restrictions
whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of
the Project Gutenberg License included with this eBook or online at
www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you'll have
to check the laws of the country where you are located before using this ebook.
Title: Unter den Hohen Tauern
Ein Roman aus der Steiermark
Author: Arthur Achleitner
Release Date: November 18, 2020 [EBook #63802]
Language: German
Character set encoding: UTF-8
*** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK UNTER DEN HOHEN TAUERN ***
Produced by the Online Distributed Proofreading Team at
https://www.pgdp.net
Anmerkungen zur Transkription
Der vorliegende Text wurde anhand der 1911 erschienenen Buchausgabe so weit wie möglich originalgetreu wiedergegeben. Typographische Fehler wurden stillschweigend korrigiert. Ungewöhnliche und heute nicht mehr gebräuchliche Schreibweisen sowie Schreibvarianten bleiben gegenüber dem Original unverändert, sofern der Sinn des Texts dadurch nicht beeinträchtigt wird. Fremdsprachige Ausdrücke sowie Passagen in Dialekt wurden ohne Korrektur übernommen.
Das Inhaltsverzeichnis wurde der Übersichtlichkeit halber vom Bearbeiter eingefügt.
Das Original wurde in Frakturschrift gesetzt. Passagen in Antiquaschrift werden im vorliegenden Text kursiv dargestellt. Abhängig von der im jeweiligen Lesegerät installierten Schriftart können die im Original gesperrt gedruckten Passagen gesperrt, in serifenloser Schrift, oder aber sowohl serifenlos als auch gesperrt erscheinen.

Achleitner / Unter den Hohen Tauern
Arthur Achleitner
Ein Roman
aus der Steiermark
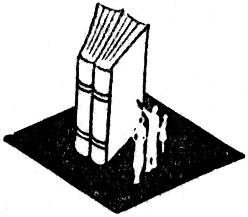
Frau und Mutter-Verlag
Wien und Leipzig
Printed in Germany
Neue Ausgabe des Romanes „Admont“
Copyright 1911 by Gebrüder Paetel Verlag, Berlin
Druck von Hallberg & Büchting in Leipzig
|
Seite
|
|
|
Erstes Kapitel
|
|
|
Zweites Kapitel
|
|
|
Drittes Kapitel
|
|
|
Viertes Kapitel
|
|
|
Fünftes Kapitel
|
|
|
Sechstes Kapitel
|
|
|
Siebentes Kapitel
|
|
|
Achtes Kapitel
|
|
|
Neuntes Kapitel
|
|
|
Zehntes Kapitel
|
|
|
Elftes Kapitel
|
|
|
Zwölftes Kapitel
|
|
|
Dreizehntes Kapitel
|
|
|
Vierzehntes Kapitel
|
An einem Augustnachmittage schoß die Sonne noch rasch etliche stechende Strahlenpfeile in das von der munteren Enns durchzogene Talbecken von Admont, dann verschwand das Weltlicht hinter einer dunklen Wolkenbank, die dräuend Sturm und Grobwetter ankündigte. Dumpfe Schwüle brütete in der Niederung; um die grauen hochragenden Kämme der wuchtigen Bergkolosse, der sogenannten „Haller Mauern“ im Norden von Admont, wehte ein starker Nordwestwind, der alsbald dem breiten Felsenhaupte des Großen Pyrgas eine Nebelhaube aufsetzte und auch dem Scheiblingstein, der gigantischen zweitgrößten Erhebung dieses starren Steinmeeres, Wolken und Schwaden zujagte, so daß die Zinnen und Grate, die Schneemulden und wildzerrissenen Rippen und Runsen von einem weißgrauen Chaos verhüllt wurden.
Bleischwer und glühendheiß war die Luft selbst im Fichtenwalde des Mittelgebirges, sie trieb den auf einem Jagdsteige bergan schreitenden Förstern den Schweiß aus allen Poren. Voran stieg elastisch, stetig und stumm der Oberförster Ambros Hartlieb, ein schlanker, geschmeidiger Mann von etwa fünfunddreißig Jahren in verwitterter Steierertracht; dunkel das Auge, energisch und streng der Blick, schwarz das Haar und der kurzgehaltene Vollbart. Eine sympathische Erscheinung, doch[S. 6] umweht von einer Strenge, die eine vertrauliche Annäherung verhindern zu wollen schien. Das Gegenteil solcher Härte im Gesichtsausdruck offenbarte die Gestalt des Begleiters, des Forstwartes mit dem drolligen Namen Benjamin Gnugesser; mittelgroß der gleichalterige Mann mit einem berufswidrigen Bäuchlein, blauäugig, gutmütig, rötlichblond das lockige Haupthaar und ganz fuchsfarbig der überlange, wallende Patriarchenbart. Wie ein Gnom, ein Bergmanndl aus der Sagenwelt, sah der Forstwart Gnugesser aus, die Mensch gewordene Herzensgüte, Friedensliebe und Einfalt.
In dieser Gewitterschwüle beim Aufstieg schwitzte Gnugesser infolge seiner Korpulenz für drei, und mancher Seufzer entfloh dem Gehege seiner etwas schadhaften Zähne. Hartlieb achtete dieser Seufzer nicht, zu sehr war er in Gedanken vertieft, die sich mit den durch Besitzwechsel geschaffenen neuen Verhältnissen beschäftigten.
An die Zukunft im Dienst, im Jagdbetrieb und in den Revieren dachte auch Gnugesser, und viel Gutes glaubte er nicht erhoffen zu dürfen. Gerne hätte er darüber mit dem Vorgesetzten gesprochen, Hartliebs Meinung erholt. Da der Oberförster sich bisher ausgeschwiegen hatte, wagte der Forstwart es nicht, das ihn überstark beschäftigende Thema anzuschneiden.
Auf einer kleinen Hochfläche in Nähe eines steilwandigen Grabens blieb Hartlieb stehen, betrachtete hochgegangenes Kleinvieh, die alte verfallene Heuhütte, modernde Baumriesen und die Hirschfährten, die zu einer nahen Suhle führten. Dann aber richtete der Oberförster einen forschenden Blick zum grau überzogenen Firmament und mahnte den Begleiter zur Eile.
„Wohl, wohl! Wird bald losgehen! Macht aber nix,[S. 7] naß bin ich bereits!“ erwiderte Gnugesser, lächelnd wie immer und nach Atem ringend.
Als die beiden weiterschritten, rollte der Donner aus der Wolkenbank, die sich auf dem wuchtigen Pyrgas-Kolosse festgesetzt hatte. In beschleunigtem Tempo strebte Hartlieb zwischen den Randklippen der Gstattmaier-Hochalpe zu, auf deren Plateau die Pyrgas-Jagdhütte inmitten der besten Gamsreviere lag. Gnugesser keuchte schweißtriefend hinterdrein.
Im Felsgewirre staubte es auf, der Bergwind trieb sein Spiel und bemühte sich, den Förstern die Hüte vom Kopf zu reißen. Die Jagdhütte kam in Sicht, ein verwittertes Holzhaus, mit einem gelbweiß blinkenden neuen Anbau, windumtost. Ein Jagdgehilfe in Hemdsärmeln stand vor der Türe und hielt Ausschau. Und wie er die beiden Förster erblickte, verschwand er, um rasch darauf in Joppe und mit Hut wieder zu erscheinen und den Vorgesetzten entgegenzugehen. Ein bildhübscher blonder Bursch, schlank, ein Kerl zum Verlieben, zart und fein die Gesichtszüge, etwas melancholische Augen, ein nettes Schnurrbärtchen, kirschrot die feinen Lippen. Ein schmucker Bursch, den die Steierertracht sehr gut kleidete. Die Sommersonne hatte Wangen, Hände und Knie nur wenig zu bräunen vermocht. Höflich, fast demütig begrüßte er die Vorgesetzten und wollte ihnen Rucksack und Gewehr abnehmen.
Hartlieb nickte zum Gruße und wehrte mit einer Handbewegung die Bemühungen des hübschen Jagdgehilfen Eichkitz ab. Der Forstwart schnappte nach Luft und lief Galopp, als der erste Regenschauer über den Hochalpboden rauschend prasselte. In großen Sprüngen erreichten die drei die schützende Hütte. Und nun ging es los: knatternd schlugen Graupeln auf das Schindel[S. 8]dach, dann vollführten erbsgroße Schloßen einen betäubenden Lärm, den ein Wolkenbruch mit eigroßen Hagelstücken ins Maßlose steigerte.
Viel Schaden konnte der Sturm der Jagdhütte nicht zufügen, denn Eichkitz hatte die hölzernen Fensterläden auf der Wetterseite fürsorglich bereits vor dem Losbruch des Gewitters fest geschlossen. An den Holzläden prallten die Hagelkörner machtlos ab.
Im Spektakel des Orkans war ein Sprechen unmöglich; man hätte brüllen müssen, um sich einigermaßen verständlich machen zu können.
Angenehm empfand Oberförster Hartlieb, während er Rucksack und Gewehr ablegte, die warme Temperatur im Kochraume der Diensthütte; der Jäger Eichkitz als Praktikus hatte im eisernen Herd ein tüchtiges Feuer entfacht und zum Empfang der schwitzenden Herren stetig unterhalten. Die Wärme tat wohl nach mühevollem Aufstieg. Befriedigt nickte Hartlieb, als Eichkitz geschäftig noch weiter Holz in den Herd schob.
Benjamin Gnugesser machte es sich bequem, nahm Platz auf der Bank an der einen Hüttenseite, aber er lächelte jetzt nicht und hatte auch kein Verlangen nach der Tabakspfeife. Das schwere Unwetter schien ihn, wenn auch nicht zu ängstigen, so doch mit einigem Unbehagen zu erfüllen. Oft genug hatte er den Admonter Fachmann gemahnt, endlich auf der Pyrgas-Jagdhütte den Blitzableiter anzubringen, doch dem Manne war bisher der Weg hinauf zur einsamen Höhe zu weit gewesen. So wetterhart Gnugesser war, vor Blitzschlägen hatte er einen gewaltigen Respekt.
Unbekümmert um den schweren Sturm, der sich vergeblich bemühte, die Hütte umzureißen, zündete sich Hartlieb eine Zigarre an, und zum Dank für das woh[S. 9]lige Herdfeuer spendete er dem Jagdgehilfen einen Glimmstengel, den Eichkitz katzbuckelnd, dankend entgegennahm und sofort in Brand steckte.
Eine Weile herrschte nächtliche Finsternis um die sturmumtoste Hütte. Im Herdraume waren nur die roten Punkte der glimmenden Zigarren und zuweilen aufzuckende Flämmchen im Ofen zu sehen.
Dann ließen Hagel und Regen nach, es wurde lichter. Dafür umwallten schwere Nebelschwaden die Hütte.
Eichkitz öffnete nun die Fensterläden auf der Wetterseite. Eisigkalte Luft drang herein, so daß der Jäger die Fenster schleunigst wieder schloß.
Auf dem Alpboden wogte ein Nebelmeer, weiß wie um Weihnachten war der Grund, vom Hagel bedeckt. Kalt pfiff der Höhenwind. Doch der Sturm hatte ausgetobt; ihm folgte ein feiner Regen.
Hartlieb nahm jetzt die Besichtigung des neuen Anbaues vor, gefolgt vom Forstwart und Jäger. Und auf den ersten Blick gewahrte der Oberförster den Mangel eines Ofens im Wohnraume des Zuhäusels. Hartlieb wandte sich an Gnugesser mit der Frage, ob der Ofen rechtzeitig bestellt worden sei. Mit einem Lächeln des ruhigen Gewissens antwortete der Forstwart: „Wohl, wohl, Herr Oberförster! Rechtzeitig bestellt, selbstverständlich sofort, wie ich den Auftrag erhalten habe! Aber die Handwerksleut sind halt so langsam! Und von selber kommt der Ofen halt nicht herauf zur Pyrgas-Hütt’n!“
„Der Teufel soll die Kerle holen! Demnach sind vermutlich auch in den anderen Anbauten die Öfen noch nicht aufgestellt? So eine verdammte Schlamperei! Und jeden Tag kann die Fürstin ankommen! Wird ein Aufenthalt auf einer der Jagdhütten befohlen, so haben wir[S. 10] das höllische G’frett gleich zum Beginn der neuen Herrschaft! Der Hausmarschall wird zetern, daß uns die Ohren sausen!“
Auf Gnugessers bartumwucherten Lippen erstarb das Lächeln, da er stotterte: „Wohl, wohl! Sein tuets ein Öllend mit die Handwerksleut! Und die neue Ära fangt schief an!“
„Veranlassen Sie morgen früh in Admont alles Nötige wegen der Ofenlieferung! Treten Sie die Kerle, bis sie quietschen! Es muß alles zusammen helfen, auf daß der Befehl vollzogen ist, bevor die neue Gebieterin erstmals heraufkommt! Sie sind mir verantwortlich, Herr Forstwart! Verstanden?“
„Wohl, wohl!“ stammelte Gnugesser in sichtlichem Unbehagen.
Hartlieb wandte sich zum Jagdgehilfen und rügte mit scharfen Worten die ungenügende Revierkontrolle wegen des hochgegangenen Kleinviehes. „Dieser Unfug darf nicht geduldet werden! Sie müssen doch als Jäger wissen, daß die Gams die Witterung von Ziegen und Schafen absolut nicht vertragen! Ausgebrochenes und hochgegangenes Kleinvieh muß entweder gepfändet oder erschossen werden, auf daß die Eigentümer für bessere Beaufsichtigung sorgen! Erstmals pfänden gegen Auslösung im Jagdamt zu Hall! Nützt das nichts, so machen Sie von der Waffe Gebrauch und schießen das hochgegangene Kleinvieh kurzerhand ab! Die Jagdgehilfen sind für die Reinhaltung der Reviere verantwortlich!“
„Zu Befehl!“ erwiderte Eichkitz.
„Sie sind jetzt ein für allemal gewarnt! Ich dulde keine Schlamperei im Dienst und Revier!“
„Zu Befehl! An mir wird’s nicht fehlen! Je schärfer[S. 11] wir aber vorgehen, desto rabiater und aufsässiger werden die Almbauern werden! Wo uns Jaagern von den Leuten eh bereits nichts mehr an Milch und Butter abgegeben wird! Ich bitt g’horsamst: Dürfen wir es zunächst nicht im Guten, mit Verwarnungen versuchen?“
Scharf klang Hartliebs Antwort: „Wie Sie es machen, das ist mir egal! Ordnung muß herrschen! Denken Sie gefälligst mehr an Ihren Dienst! Sehe ich noch mal hochgegangenes Kleinzeug im Revier, so haben Sie die Kündigung zu gewärtigen!“
Von dieser Androhung erschreckt, bat der schmucke Jäger um Verzeihung, und eifrig gelobte er schneidiges Vorgehen.
„Wird gut sein in Ihrem eigenen Interesse! – Wie haben sich die Zimmerleute beim Bau des Zuhäusels verhalten?“
„Zu dienen, Herr Oberförster! Ich bin fleißig um die Weg g’wesen, ist niemand weiter als höchstens zur Schneemulde am Großen Pyrgas gekommen! Ich glaub nicht, daß die Gams besonders beunruhigt worden sind! Touristen hab ich nach Möglichkeit abgewiesen!“
„Bis auf weiteres bleibt jeder Durchgang in den Hochrevieren gesperrt! Will die Fürstin den Jochbummlern das – Gamsversprengen erlauben, so ist das Sache der Gebieterin! Die Jägerei wird hierüber verständigt werden! Einstweilen ist jeder Tourist ausnahmslos aus den Revieren auszuweisen! Bei Aufstellung des Ofens in der Pyrgas-Hütte haben Sie die Aufsicht zu führen, jede Revierbeunruhigung nach Möglichkeit zu verhindern! – So, nun begleiten Sie uns in die Steinschütt!“
Die Herren kehrten in die alte Hütte zurück, indes Eichkitz das Zuhäusel sorgfältig versperrte.
Säuerlich lächelnd meinte Gnugesser: „Mit Verlaub, Herr Oberförster! Ich hab g’meint, wir bleiben über Nacht in der Pyrgas-Hütte...! Wo es doch regnet!“
„Das wäre sinnlose Zeitvergeudung! Wir gehen noch am Abend über Schottenboden und Assangeralp zur Million-Hütte, wo wir den Hausmarschall treffen werden. Der Regen kann uns nicht abhalten! Und Ihnen kann fleißige Bewegung nur nützlich sein; je eher Sie tannenschlank werden, desto besser für Sie! Ich fürchte sehr, daß die neue Gebieterin wegen Ihres Bäuchleins Schlüsse auf – Bequemlichkeit und üppiges Leben ziehen wird!“
„Ach, du lieber Himmel! Bei dem mageren Gehalt und strengen Dienst ein – üppiges Leben! Und wo meine Frau zudem keine – Kochkünstlerin ist!“
Ein sarkastisches Lächeln huschte über Hartliebs Gesicht, und ein ironischer Blick streifte Gnugessers Wanst.
Rucksäcke und Gewehre wurden umgehangen. Auch Eichkitz hatte sich marschfertig gemacht; er löschte das Herdfeuer und schloß die Hütte ab, nachdem die Herren ins Freie getreten waren.
Kalt pfiff der Wind, trostlos in Fäden träufelte der Regen hernieder. Unter den schweren Bergschuhen knirschten die Hagelkörner auf dem Alpboden.
Der vorausstapfende Jäger Eichkitz nahm die Richtung zur nebelerfüllten Felswildnis der Steinschütt, elastisch schreitend, doch arg verdrossen.
Hartlieb erkannte sofort, daß bei dem schlechten Wetter auf einen „guten Anblick“ nicht zu rechnen, der Marsch in die Schütt ganz zwecklos war. Deshalb schickte er den Jäger zurück und wanderte mit dem Forstwart auf steinigen, teils mit Schloßen bedeckten, teils vermurten oder ausgewaschenen Pfaden durch Regen, Wind und[S. 13] Nebel den Weg zurück zur Plechauer-Alp und dann hinüber zum Schottenboden. Das Ziel war die sogenannte Million-Hütte im Bereiche des Stadlgrabens, wo die besten Hirsche stehen.
Spätabends erreichten die durchnäßten Förster die einsame Hütte, die gleichfalls einen neuen Anbau für Damen aufwies. Wider Erwarten war die Million-Hütte verschlossen, der Hausmarschall der Fürstin Sophie von Schwarzenstein, Graf Thurn-Valsassina von Villalta und Spessa, mit dem Jäger Xandl noch nicht angekommen.
Dienstwillig suchte Gnugesser den Hüttenschlüssel in der Holzschicht an der Seitenwand der alten Hütte und schloß auf. Kalte Luft wehte entgegen. „Wird gleich warm werden!“ rief der Forstwart, der schnell Gewehr und Rucksack ablegte und im Sparherd Feuer anzündete. Dann holte er vom nahen Brünnlein Wasser herbei und stellte es in einem Topf darauf. Hartlieb entnahm seinem Rucksack zwei kleine Konservenbüchsen mit Gulasch, eine Flasche Bier und Brot.
Als das Wasser zischte und brodelte, wurden die Konservenbüchsen in den Topf gelegt. Wenige Minuten später war die Kocharbeit beendet. Mit einer Blechschere öffnete Hartlieb die Büchsen, denen ein würziger Duft entstieg.
Gnugesser schnupperte wohl wie ein windender Jagdhund, lehnte aber die Einladung zum Mitessen dankend ab und begnügte sich mit dem mitgeführten Stück Speck und Schwarzbrot.
„Wie Sie wollen! Mögen Sie Gulasch nicht?“ fragte Hartlieb.
„Schon, aber nur in der Nähe von einem Wirtshaus!“
„Ach so! Von wegen dem Durst, den der Paprika erzeugt? Na, in Konserven ist nur sehr schwacher Paprika enthalten, und zum Durstlöschen gibt es ja Wasser genug! Ich werde die zweite Portion für den Grafen aufbewahren, falls er keinen Proviant bei sich haben sollte!“
An seinem Speck kauend, richtete Gnugesser im Heuboden oberhalb des Herdraumes ein Lager zur Nachtruhe her. Dann kehrte er in das Wohn- und Kochstübchen zurück und fragte, ob er, da der Graf wahrscheinlich nicht kommen werde, heimgehen dürfe.
Ironisch fragte Hartlieb: „Treibt Sie denn sehnsüchtige Liebe nach Hause?“
„Ich bitt, Herr Oberförster! Wo ich doch schon zwei Jahr verheiratet bin! Ich hab nur gemeint, Sie benötigen mich nicht für Abend und Nacht!“
„Ich allerdings nicht! Kommt der Graf doch noch, so könnte es sein, daß er Sie morgen um die Führung bitten will! Kommt er heute nimmer, so hätte Ihre Anwesenheit allerdings keinen Zweck!“
„Will denn der Graf pirschen auf Hirsche? Bei diesem Wetter wird er keinen Wedel äugen können! Was will er sonst heroben?“
„Weiß ich nicht! Vielleicht nur ein Inspektionsgang, Kontrolle, ob alle Jagdhütten den Damen-Anbau vorschriftsmäßig erhalten haben!“
„Ist g’spaßig, daß unser Jagdbetrieb nun – verweiblicht werden soll! Ein Frauenzimmer als – Jagdherr! Ich kann mir nicht denken, wie das geht! Die Jaager stecken auch die Köpf zusammen und tuscheln darüber!“
Hartlieb trat vor die Hütte, lauschte, kehrte zurück und stellte es Gnugesser frei, nach Hause zu gehen.
Die Gelegenheit, über die neuen Verhältnisse mit dem[S. 15] Vorgesetzten zu sprechen, wollte der Forstwart nun doch nützen. Er steckte die kleine Petroleumlampe an, schloß die Fensterläden und bat, Gesellschaft leisten zu dürfen.
„Aber die teure Gattin?“
„Wird nicht sterben, wenn ich über Nacht ausbleibe! Dergleichen kommt ja öfter vor in unserem Beruf! Mit Verlaub, glauben Sie, Herr Oberförster, daß wir mit gleichem Gehalt übernommen werden? Hat der Hausmarschall darüber nichts gesagt?“
„Bis jetzt keine Silbe! Ich denke, die Käuferin des Jagdgutes wird froh sein, tüchtiges und geschultes Personal übernehmen zu können!“
„Wohl, wohl! Was aber, wenn das Gehalt etwas reduziert würde? Das wär für uns doch recht bitter! Für die verheirateten Beamten nämlich! Sie, Herr Oberförster, brauchen als lediger Mann sich da weniger zu sorgen...“
„Verbürgen kann ich nichts! Beruhigen Sie sich nur! Wegen der Löhne und Gehälter muß ich ja gefragt werden, und ich werde selbstverständlich dafür eintreten, daß in dieser Beziehung alles beim alten bleibt!“
Gnugesser lächelte und glättete seinen fuchsigen Patriarchenbart, nun ihm der größte Stein der Sorge von der Brust fiel. Und zutraulich meinte er: „Noch schöner tät es sein, wenn Sie, Herr Oberförster, eine Gehaltsaufbesserung durchsetzen könnten! Für mich gleich nur zweihundert Kroneln, eine Wohltat wäre das für meine Verhältnisse!“
„Mit einer Aufbesserung darf man der Fürstin bei der Übernahme des Besitzes nicht kommen! Um so weniger, als sie teuer, zu teuer gekauft hat!“
„So? Hätt sie doch die Finger davon gelassen! Wenn man denkt: Auf den Jagdherrn Grafen Lichtenberg, der[S. 16] freilich nur Pächter war, ein Frauenzimmer als Gebieterin in Jagdangelegenheiten – – der Magen könnt sich umdrehen! Jagdlicher Damenbetrieb! Unmöglich, nicht auszudenken!“
Hartlieb streifte die Asche von seiner Zigarre und wollte dem Forstwart eben raten, das Zünglein zu hüten, da wurden Schritte laut, die sich der Hütte näherten.
Gnugesser stand auf und eilte hinaus.
Auch der Oberförster erhob sich und öffnete die Türe, damit die Angekommenen etwas Licht zur Orientierung haben sollten.
„Guten Abend!“ grüßte eine hohe schlanke Gestalt in dunklem Lodengewande. Graf Thurn-Valsassina, der weißhaarige Hausmarschall und Hofchef, reichte den Beamten die Hand und entschuldigte das arg verspätete Erscheinen mit dem Hinweise auf das Unwetter, das zu unfreiwilligem Aufenthalt in der Griesweber-Hochalm gezwungen hatte.
Hartlieb bat den Grafen, in die warme Stube einzutreten und vorliebzunehmen mit dem Wenigen, was geboten werden könne.
Der Hausmarschall trat in die schwacherleuchtete Stube und rief: „Oh, wie wohlig warm! Das ist wirklich sehr behaglich! Ich bitte Sie, meinetwegen keine Umstände zu machen! Proviant habe ich mit im Rucksack, den mein wackerer Begleiter, der brave Xandl, trägt! Wir wollen in der Bergeinsamkeit brüderlich teilen! He, Xandl, antreten und auspacken!“
Mit seinem schönsten Lächeln auf den bebuschten Lippen griff Gnugesser, der fuchsige Gnom, ein, indem er dem großen Jagdgehilfen Xandl den Rucksack abnahm und zuflüsterte: „Gschwind den Herrn bedienen! Stiefel ausziehen!“
Hartlieb legte inzwischen Holz im Herde nach, so daß es alsbald knisterte.
Flink kniete Xandl, ein Koloß von einem sonnverbrannten Menschen, vor dem Hausmarschall nieder und bat: „Haben S’ die Gnad, Herr Graf, und lassen S’ Ihnen die schweren Schuach ausziehen! Einen Haxen nach dem andern, wenn’s g’fällig ist!“ Und flink löste er die Schuhriemen auf.
„Ei ei, wie geschult doch der Xandl im Kammerdienst ist!“ meinte schmunzelnd Graf Thurn.
Gnugesser fischte aus dem Inhalt des Rucksackes die Hausschuhe heraus und überreichte sie dem Hofchef.
Zu dritt nahmen die Herren am kleinen Tische Platz, indes Xandl sich bescheiden auf die Bank an der Wand setzte und an einem Stück Schwarzbrot kaute.
„So ist’s nicht gemeint, Xandl! Auch der brave Führer und Jägersmann gehört an den Tisch! Vorerst aber bringen Sie uns den Wein und den kalten Aufschnitt!“
Brüderlich wurde alles geteilt. Der Höflichkeit halber nahmen die Beamten die Happen Schinken zur Brotschnitte dankend an, ebenso den Schluck Ungarweines. Hartlieb schenkte die Gulaschportion dem Xandl, dem das Gesicht vor Freude leuchtete. „Werd ich gleich Kuchelmadel machen und aufkochen! Vergelt’s Gott, Herr Oberförster!“
Graf Thurn erzählte, daß er nach der Inspektion einiger Hütten zur Gamsquöhn aufgestiegen sei, vom Gewitter überrascht wurde, in der Hochalm lange wartete, dann in den Falkennotgraben gestiegen sei, um dann nach zeitraubender Kraxelei den Stadlgraben zu erreichen. „Es ist ein wundervolles Gebiet, aber scharf und strapaziös! Der Dienst und wohl auch die Jagd[S. 18]ausübung wird in den Revieren der ‚Haller Mauern‘ nicht leicht sein! – He, Xandl, die Zigarren!“
Gnugesser blinzelte dem Oberförster zu, als Graf Thurn die Bemerkung über Dienst und Jagdausübung in den Revieren gemacht hatte. Doch Hartliebs Antlitz blieb unverändert. Auch enthielt er sich jeder Äußerung. Die Zigarrenspende Thurns nahm er mit einer leichten Verbeugung an, während Gnugesser und Xandl laut dankten.
Graf Thurn fragte, ob in allen für die Fürstin bestimmten Anbauten, so wie in den Kochzimmern gleichfalls eiserne Öfen aufgestellt seien.
„Sie sind längst bestellt, werden nächster Tage zur Aufstellung gelangen!“ erwiderte Hartlieb.
„Schön! Machen Sie die Sache eilig, denn Durchlaucht werden in allernächster Zeit ankommen! Und einmal in Hall, ist man keine Stunde sicher, daß ein Hüttenbesuch befohlen wird! Bei Eintritt groben Wetters wäre es sehr fatal, wenn Durchlaucht in einer Hütte frieren müßte!“
Gnugesser hatte den Mund angelweit offen, sosehr interessierte ihn jedes Wort. Und plötzlich rutschte ihm die Frage heraus, ob die Fürstin von der Jagd etwas verstehe.
„Herr Forstwart, ich bitte Sie, jede indirekte Frage zu unterlassen!“ bemerkte rügend Hartlieb, und ein scharfer Blick flog zu Gnugesser hinüber.
Begütigend meinte Graf Thurn: „Nicht doch! Das Interesse der Forstbeamten für die neue Herrin ist ja begreiflich! Und hier unter uns Männern hat es nichts auf sich, wenn Fragen gestellt werden! Die Fürstin hat zu Lebzeiten ihres Gemahls den gnädigsten Herrn oft auf Pirschgängen begleitet und, soviel ich weiß, manchen Hirsch mit gutem Blattschuß umgelegt!“
Nun wagte auch der hünenhaft gebaute Jagdgehilfe Xandl eine Bemerkung dahin, daß ein gelegentlicher Pirschgang und ein weidgerechter Jagdbetrieb zweierlei sei. „Mit Vergunst, Herr Graf, wenn es erlaubt ist: wird die Duhrlauch selber die Jagdleitung führen, selbständig dirigieren, oder bleibt unser Herr Oberförster der Chef?“
„Das weiß ich nicht! Ich für meine Person, als Hofchef und Hausmarschall, werde mich in die Jagdangelegenheiten ganz gewiß nicht einmischen! Und falls ich gefragt werden sollte, werde ich befürworten, daß Herr Oberförster Hartlieb der Jagdleiter bleibe! Den Entschließungen der Fürstin kann natürlich nicht vorgegriffen werden! Durchlaucht ist die Gebieterin, wir haben ihre Befehle zu vollziehen!“
„Oh, Jessas!“ rief Gnugesser, und sein Bäuchlein zitterte.
„Nur keine Angst! Durchlaucht ist die Güte selbst! – Nun aber Schluß, meine Herren! Ich bin müde!“
Zu dritt kletterten die Herren auf der Leiter in den Dachboden, wo das Nachtlager im Heu bezogen wurde. Wollene Decken schützten vor der Zugluft, die durch die Balkenritzen trotz der Moosverstopfung kalt und scharf eindrang.
Xandl räumte unten auf, löschte das Lämplein und legte sich angekleidet auf die Holzbank zur Nachtruhe nieder.
Nach Mitternacht entlud sich ein Gewitter über den Stadlgraben, heftig wütete der Sturm unter schweren Regengüssen, rüttelte an der Hütte, riß grob die Türe wiederholt auf, die der aus dem Schlafe aufgeschreckte Jäger Xandl wieder schloß. Doch gegen Tagesanbruch verstummte das Sturmgeheul, das Wehen erstarb, der Regen hörte auf.
Xandl erwachte, rieb sich den Schlaf aus den Augen, und sachte öffnete er die Fensterbalken. Helles Morgenlicht und würzige Alpenluft strömten herein. Reingefegt war das Firmament, das lichtblau sich über den angeschneiten Haller Mauern wölbte. Ein prachtvoller Pirschmorgen nach düsterer Sturmesnacht. Des Jägers erster Gedanke war der seiner Führung anvertraute Graf und die günstige Chance für eine Pirsch. Aber in Erinnerung der Tatsache, daß Graf Thurn keine Büchse mitführte, wurde Xandl unschlüssig. Den herrlichen Pirschmorgen ungenützt verstreichen zu lassen, deuchte ihn eine schwere Unterlassungssünde zu sein. Als Hofchef und Hausmarschall müßte der Graf ja doch Abschußerlaubnis haben... Und die Kugelbüchse kann ihm ja der Oberförster oder der Forstwart leihen. So weckte denn Xandl die Herren mit der Meldung, daß ein prachtvoller Pirschmorgen angebrochen sei. Und hurtig machte der Jäger Feuer im Herd, um ein karges Frühstück, eine Brennsuppe zu bereiten.
Verfroren und steif in den alten Knochen kam Graf Thurn die Leiter herab, hinter ihm die Förster. Vor der Hütte wurde die Pracht des alpinen Sommermorgens, das Funkeln und Glitzern der Millionen Wasserperlen an Blattwerk und Koniferennadeln im Glanz der ersten, in den Graben blinzelnden Sonnenstrahlen bewundert.
Hartlieb bot sein Dienstgewehr für einen Pirschgang an und stellte sich als Führer zur Verfügung. Gnugesser sprach von einem guten Zwölfender, der auf dem Waschenberge stehe.
Da rief Graf Thurn: „Aber, meine Herren! Wo denken Sie hin! Ohne spezielle Erlaubnis werde ich mich hüten, eine Büchse auch nur in die Hand zu nehmen,[S. 21] geschweige denn auf irgendwelches Wild Dampf zu machen! Erst muß die Gebieterin ihren Besitz angetreten, das Jagdgut übernommen haben! Dann werden wir schon hören, ob uns die Bejagung eines Revierteiles gestattet wird oder versagt bleibt! Zur Hütteninspektion bin ich heroben, nicht zum weidwerken! Drum: hands off!“
Diesmal wechselte Hartlieb mit Gnugesser einen vielsagenden Blick.
Xandl aber platzte heraus: „Also wird die Duhrlauch – schußneidisch sein! Sell geht grad noch ab!“
Graf Thurn ignorierte diese Bemerkung und fragte, ob ein warmer Schluck, egal was, zum Frühstück zu haben sei.
Ganz Kuchelmadel, Kammerdiener, Küchenchef in einer Person, offerierte Xandl: „Haben S’ die Ehr, gnädig Herr Graf, die Brennsupp’n ist serviert! Aber noch heiß, verbrennen Sie Ihnen nicht die Lefzen! Wär schad drum! Wo Sie einen so schönen weißen Schnauzer haben!“
Mit Behagen wurde die Brennsuppe, der nur das Salz fehlte, geschlürft.
Da Graf Thurn auf die Fortsetzung der Hüttenbesichtigung verzichtete, traf Hartlieb seine Dispositionen: Gnugesser erhielt Auftrag, wegen schleunigster Ofenlieferung nach Admont zu gehen, Xandl solle in der Hütte aufräumen und hiernach Dienst machen in den oberen Revieren und im Gebiete des Natterriegel vorwitzige Gamsversprenger wegstampern, für absolute Ruhe im Gamsrevier sorgen. Wenn nötig, unter Anwendung von Gewalt.
„Na, schön! Wie disponieren Sie, Herr Oberförster, über sich und mich?“ fragte Graf Thurn.
Lächelnd meinte Hartlieb: „Über den Herrn Hofchef hat wohl der Jagdleiter am allerwenigsten zu verfügen! Wenn Sie aber, Herr Graf, erlauben, möchte ich Sie durch unsere schönsten und besten Reviere geleiten, Ihnen zeigen, daß wir einen gutgehegten Wildstand haben! Weidmännisch gesprochen: Einen ausgiebigen ‚guten Anblick‘ mit viel ‚roten Fleckerln‘ möchte ich Ihnen verschaffen!“
„Topp, einverstanden! Freilich wird es schmerzlich sein, bei ‚gutem Anblick‘ den Finger nicht krumm machen zu dürfen! Also gehen wir!“
Vor Gnugessers Abgang fragte Hartlieb noch, wie weit die Schlägerungsarbeit auf dem Raschanger gediehen sei.
„Wird heute beendet werden! Ich werd nachmittag kontrollieren! Mit Vergunst, Herr Oberförster, darf ich dem drängelnden Simerlbauern den erbetenen Schindelstamm anweisen! Ist ein zudringlicher Mensch!“
„Wenn wirtschaftlich kein Hindernis besteht, daß der betreffende gewünschte Stamm wegkommt und der Stamm zur Taxe bezahlt wird, kann angewiesen werden! Entspricht der Baum nicht, so geben Sie ihn als Prügelstamm weg, aber nicht unter der üblichen Taxe!“
„Ist recht! Darf ich mir bei dieser Gelegenheit auch den Zangerlbauern durch Befriedigung seines Wunsches – er möchte drei Schnitthölzer zu einem Schlafzimmerboden erhalten – vom Halse schaffen? Tanne oder Fichte?“
„Ist egal, je nachdem Stämme passend stehen! Halten Sie sich aber knapp und die Bauern kurz! Gott befohlen!“
„Empfehl mich, Herr Oberförster!“ Und zum Hofchef gewendet, verabschiedete sich der Bäuchleinträger[S. 23] mit österreichisch-höflichem „Küß d’ Hand, Herr Graf!“
Eine erquickende, zuweilen freilich nasse Wanderung durch triefende Gräser, durch kühle Wälder war es. Diana zeigte sich gnädig und gönnte den Herren manchen „guten Anblick“ von eleganten Rehböcken, von einem guten Zehnender mit hohem, weit ausgelegtem Geweih. Mehr als ein Dutzend Stück Hochwild ließ die Göttin vorüberwechseln.
Für Berghirsche waren die Geweihträger wirklich gut zu nennen.
Graf Thurn hielt mit anerkennenden Worten für den Heger nicht zurück, doch bat er den „Anblicks“-Gang abzubrechen. „Es berührt auf die Dauer doch schmerzlich, wenn – die Jagderlaubnis fehlt!“
Hartlieb nickte zustimmend. Aber gute Gams wollte er dem Hofchef noch zeigen. Und dabei erproben, ob Graf Thurn – steigen könne. Weit war im Gebiet der Haller Mauern nicht zu wandern, aber steil ist dieses hochragende Kalkgebirg. Leicht und geräuschlos, für sein Alter erstaunlich gut und sicher, stieg Graf Thurn, und die Freude an der großartigen Alpennatur, das Interesse für das Krickelwild leuchtete aus seinen Augen.
Nach kaum zweistündigem Aufstieg wurde ein prächtiges Plätzchen erreicht; ein verhältnismäßig breites Latschenfeld, durchzogen von einzelnen grünen Grasflecken, breitete sich aus und zog zu grauweiß leuchtenden Wandeln hinauf.
Hartlieb trat vorsichtig hinter einen Fichtenboschen und lud durch eine leise Kopfbewegung den Begleiter ein, sich an seine Seite zu stellen. Graf Thurn folgte dem Oberförster und stand wie angemauert, als sich vorne ein gelbgrauer Fleck aus dem Krummholz empor[S. 24]schob, ein starker Gams, der ein Weilchen äste, dann aber den Grind hob und mißtrauisch zu äugen begann. Um den Kapitalen wurde es lebendig, sieben, acht Gams kamen aus den Latschen, schüttelten sich die Regentropfen aus der fahlen Sommerdecke, sonnten sich behaglich im warmen Licht und guckten den sichernden Bock verwundert an. Die Kitze hatten Hunger und ästen alsbald, zupften eifrig an den Spitzen der saftigen Gräser, treulich behütet von den Mamas, die immer wieder aufwarfen und auf den kapitalen Bock äugten.
Der herrliche „gute Anblick“ machte den Grafen zittern vor Jagdlust. Hartlieb, an derlei gewöhnt, stand starr wie eine Bildsäule. Thurn verlor die Herrschaft über sich. Eine winzige Bewegung von Kopf und Hand genügte: der Kapitale empfahl sich und verschwand plötzlich in den Latschen, deren Äste über ihm zusammenschlugen und einen Sprühstaub von glitzernden Tropfen in das Sonnenlicht warfen. Eiligst ahmten Geißen und Kitze das Beispiel nach...
Seufzend verließ Thurn diese Stätte und folgte dem Jagdleiter auf der Wanderung zu Tale. Stumm, hochbefriedigt, dankbar. Und mit der Hoffnung in der Brust, daß die Gebieterin vielleicht doch ein Teilchen dieser Idealreviere zur Bejagung freigeben werde...
Dem Befehl entsprechend war der hünenhafte Jäger Xandl wohl in die obersten Reviere gestiegen, aber mit dem Marsche zum Felsgewirr des „Natterriegel“ eilte es ihm nicht. Viel wichtiger hielt er eine Aussprache mit dem Kollegen Eichkitz, dem er erzählen wollte, was in der Million-Hütte an Neuigkeiten zu hören gewesen war. Deshalb stapfte Xandl pfadlos durch das steinige Gebiet des „Scheibling“ und suchte mit dem Fernrohr das Gstattmaier-Revier ab, hoffend, den Kollegen irgendwo sehen zu können. Diese Erwartung erfüllte sich nicht. Einen Besuch der Pyrgas-Hütte mußte sich Xandl versagen, der Dienst erlaubte eine solche Zeitvergeudung nicht. Und mit dem unerbittlich strengen Jagdleiter Hartlieb war nicht zu spaßen. Aber ein Mittel zur Verständigung des Kollegen wußte Xandl doch: Deponierung einer schriftlichen Nachricht in der tiefer gelegenen Plechauer-Alm, wo Eichkitz sicher in den nächsten Tagen einkehren wird. Der Höhenverlust hatte für einen Jäger nicht viel zu bedeuten. Also stieg Xandl zur Plechauer-Alm herab. In der Hütte traf er den schönen Eichkitz in eifriger Unterhaltung mit der schmächtigen Sennerin Burgl, die einen Schreckensschrei ausstieß, als Xandl plötzlich auftauchte und spottlustig rief: „Tue mir nix, ich tue dir auch nix!“
Eichkitz ließ sich nicht in Verlegenheit bringen, vom[S. 26] Kollegen hatte er keine Unannehmlichkeiten zu befürchten; gelassen meinte er: „Je, der Xandl! Bist natürlich – dienstlich da, wie ich!“
Die Sennerin benutzte die Gelegenheit, das Kämmerlein zu verlassen, und machte sich vor der Hütte zu schaffen.
„Dienstlich grad nicht! Hab dir einen Zettel bei der Burgl hinterlegen wollen, die große Neuigkeit, wo der Graf Thurn, der wo der Hofchef von der Duhrlauch ist, in der Million-Hütt’n verzählt hat!“
„Schieß los!“ meinte Eichkitz und zupfte an seinem Bärtchen.
„Ja! G’sagt hat er, der Graf, er hätt bis jetzt keine Abschußerlaubnis! Ausschauen tuets akrat so, als tät die Fürstin – schußneidisch sein! Spannst was, Eichkitz?“
Gelassen erwiderte der hübsche Bursch: „Ich wüßt nicht, warum ich darüber heiß werden sollt! Wir kriegen ja doch keine Abschußerlaubnis! Und ob der Graf jaagern darf oder nicht, das kann uns wurscht sein!“
„Ich bin der Meinung, daß es schief geht, wenn die Duhrlauch schußneidisch ist! Das gang grad noch ab!“
„Bist irrig, Xandl! Ist die Fürstin wirklich schußneidisch, so haltet sie was auf ihre Jagd! Das kann uns nur freuen!“
Xandl schüttelte den Kopf. „Ist überhaupt zwider, daß wir keinen Herrn nimmer haben! Weiberwirtschaft im Jagdbetrieb, der Teufel soll s’ holen!“
„Bist irrig, Xandl! Justament das Weiberregiment g’fallt mir!“
„Ah na! Wird nicht sein! Weiber haben verdammt viel Mucken und Launen!“
„Das schon! Kann auch zuweilen höllisch zwider sein und werden! Aber weil die neue Besitzerin ein Weib ist,[S. 27] kann derjenige nur profitieren, der es versteht, das Weib zu behandeln!“
„Jessas, na! Wie du daherredest so leicht und ausg’schamt! Du bist nur ein Jaager, und sie eine wirkliche Fürstin! Die wird sich in Ewigkeit nicht von dir behandeln lassen! Gstampert wirst katschaus in der ersten Minut, wo du anfangst, frech z’ werden!“
„Bist wieder irrig, Xandl! Von Frech-werden ist keine Red! Im Gegenteil! Demütig sein, katzbuckeln, einschmeicheln, vorsichtig anpirschen, und grad nur das reden, was sie gern hört, die Duhrlauch! Z’viel von der Jagd wird sie eh nicht verstehen! Versteht sie aber gar nix, ist es noch besser! Um so leichter laßt sie sich anbleameln...!“
„Wo der Oberförster so streng und scharf ist!“
„Bist wieder irrig! Ich glaub, die strenge harte Zeit für uns ist bereits vorbei! Und beim Weiberregiment wird der hantige Hartlieb mit sich und seiner Stellung Arbeit g’nug haben! Sauer wird ihm sein Dienst werden! Für uns aber wird es besser und leichter! Wenigstens ich spekulier darauf!“
„Wenn du dich nur nicht verspekulierst!“
„Keine Sorg, Xandl! Auf die Weiberbehandlung versteh ich mich! Der Fürstin wird die b’sonders schwache Seit’n wohl auch und bald abzugucken sein! Da ist mir nicht bang!“
„Tue, was du willst! Ich verbrenn mir die Finger nicht! Und jetzt muß ich springen, muß Dienst machen auf ’m Natterriegel!“
„Dank schön für die Botschaft! Sag nichts, daß wir uns ’troffen haben! Der Hartlieb wird eh immer fuchtig, wenn er merkt, daß Jaager bei Sennerinnen einkehren! Eh schon wissen! Aufs Wiederschauen gelegentlich! B’hüt dich, Xandl!“
„Auch soviel!“ Xandl verließ, die Sennerin kurz grüßend, die Alm in unbehaglicher Stimmung. Für die Art, wie Eichkitz die Lage auffaßte, fehlte es dem Hünen an dem nötigen Verständnisse. Xandl fürchtete sich geradezu vor dem Weiberregimente im Jagddienst.
Eichkitz griff nach Büchse und Bergstock, um den Reviergang fortzusetzen.
Die Sennerin Burgl hantierte am Brunnen und rief spöttisch: „Pressiert es jetzt auf einmal mit dem Dienstmachen? Was haben denn die Jaager so Wichtiges zu verhandeln g’habt?“
„Der Xandl fürchtet sich so vor der Fürstin!“ antwortete ironisch der hübsche Jäger.
Burgl ließ das Wasserschaffl fallen und trippelte auf Eichkitz zu. „Was sagst?“
„Fürchten tuet er sich vor der Duhrlauch!“
„Warum denn? Ist die Fürstin etwa ein harbes Weib?“
„Derweilen wissen wir noch gar nix!“
„Schaden könnt es nix, wenn sie einen gewissen Jaager z’sammenstauchen tät! Von wegen Hoffart und Eitelkeit! Ist ja ganz aus der Art, wie du mit die Weiberleut umspringst! Kein bisserl Achtung vor dem weiblichen Geschlecht! So ein Sausewind! Gleich immer aufs Verführen aus! Schamst dich nicht?!“
„Wüßt nicht warum! Küß d’Hand, gnä Fräuln!“ spottete Eichkitz.
Nun erzürnt, sprang Burgl in die Hütte.
Der hübsche Jäger wanderte über den grünen sonnigen Almboden und lachte in sich hinein: „Wirst schon noch zahm werden, Wildkatzl!“
*
Als der Forstwart Gnugesser sein Falstaff-Bäuchlein zum Wiedschlag auf dem Raschanger hinaufschleppte, seufzend und nach Luft schnappend, warteten bereits zwei spindeldürre Bergbauern auf ihn, der Simerl und der Zangerl, rauchend, mit Tabak ordinärster Sorte die Waldluft verpestend. Und sogleich lamentierten sie, mit dem Warten soviel Zeit verloren zu haben.
In seiner Herzensgüte entschuldigte sich Gnugesser, daß er beim besten Willen nicht früher habe kommen können; der Weg nach Admont und über Hall zurück und zum Raschanger sei weit und beanspruche Zeit. „Dafür soll nun jeder geschwind sein Holz angewiesen bekommen!“
„Nur nix übereilen! Ich bitt, geben S’ mir den Schindelstamm mehr herunten, wo die Bringung leichter ist und nicht soviel Zeit, Müh und Geld kostet! Wo ich den Stamm auch noch zahlen muß!“ meinte der Simerl und begann nun, der Bergsohle zustapfend, einen schönen Baum zu suchen. An jeder Fichte hatte der Bauer etwas auszusetzen, kein Stamm war ihm schön und astfrei genug. Und immer maulte der Simerl: „Wo ich den Stamm zahlen muß!“
Lächelnd mahnte Gnugesser zur Eile und Zeitersparnis. „Such dir die Fichte aus, aber bald! Der Zangerl möchte ja auch heute noch seine Schnitthölzer! Und ich möcht dann meine Ruh bekommen!“
Endlich hatte Simerl einen Stamm gefunden, von dem er glaubte, daß die Fichte zu Schindeln gehe. Simerl nahm die Untersuchung vor, langsam und umständlich, bis festgestellt war, daß der Baum „gut kliebe“. Und nun wollte Simerl den Stamm sofort gefällt haben.
„Mußt schon warten, bis die Holzer von oben kommen! Morgen wird der Stamm gefällt werden! Aber[S. 30] vorher mußt die Tax in der Kanzlei des Oberförsters zahlen!“
Davon wollte Simerl aber nichts wissen. Aus dem Gejammer merkte Gnugesser, daß es dem Bauern darum zu tun war, den Stamm zu erhalten, das Geld dafür aber schuldig zu bleiben. Infolge dieser Wahrnehmung unterließ es der pflichttreue Forstwart, die ausgesuchte Fichte anzuplätzen.
Simerl sah sich durchschaut und ging fluchend heim.
Der gleichfalls zaundürre Zangerl holte die forstamtliche Quittung hervor zum Beweise, daß er den Betrag für drei Schnitthölzer bereits erlegt habe.
„Gut! Dann hat die Auszeigung einer schönen astfreien Tanne keine Schwierigkeit!“ versicherte Gnugesser und machte sich auf die Suche eines besonders kräftigen Baumes.
Da begann aber der Zangerl zu zetern und zu protestieren mit einem ungeheuerlichen Wortaufwand. Mit aller Entschiedenheit wehrte er sich gegen die Zuweisung einer – Tanne. „Wo ich Holz brauch für den Boden der Schlafkammer. Einen tänneren Boden will ich nicht und nehm ich nicht! In Ewigkeit nicht! Wo ich die Tax bereits bezahlt hab!“
Verwundert fragte Gnugesser, warum denn der Bauer Tannenholz nicht nehmen wolle.
Ein Blick unsäglichen Bedauerns, einer Geringschätzung ob solchen Mangels an Wissen streifte den Forstwart. Im belehrenden Tone erklärte Zangerl: „Will der Herr ein Forstwart sein und weiß nicht, daß im tännernen Holz die Flöh wachsen!“
Gnugesser lachte aus vollem Halse. Und schluckend versicherte er, davon bis jetzt nichts gewußt zu haben.
„Solche Leut sein Förster! Tannenholz erzeugt Flöh,[S. 31] das weiß jeder Bergbauer, nur der Forstwart weiß es nicht! Also die Tann nehm ich nicht! Ich will einen fichtenen Stubenboden!“
Benjamin Gnugesser lachte, daß sein Bäuchlein hüpfte. „Kannst eine astreine Fichte haben! Wir vom Forstamt wollen es nicht verantworten, daß der Zangerlbauer samt Familie von den Flöhen aufgefressen wird!“
Fast eine Stunde verfloß, bis Zangerl eine Fichte gefunden hatte, die seinen Ansprüchen genügte. Dieser Stamm wurde dann vom Forstwart mit dem Plätzhammer gemerkt und zur Fällung angewiesen.
Damit hatte das Tagwerk Gnugessers ein Ende. Müde trollte er hinunter zum Forsthause beim Dörflein Hall.
Ein alter Quadernbau mit neuem Ziegeldache am Sträßlein, beschattet von Fichten; „Steinkasten“ pflegte der Forstwart dieses Dienst- und Wohngebäude zu nennen, in dem er mit seiner ihm vor zwei Jahren angetrauten Gattin Amanda hauste. Forstwarts im Parterre, der Oberförster Hartlieb im oberen Stockwerke, wo sich auch die Forstkanzlei und das Jagdamt befinden. Hier wohnte auch zur Zeit Graf Thurn, dem Hartlieb zwei Zimmerchen hatte abtreten müssen. Straßenseitig befand sich ein Nutzgärtchen, das den Bewohnern des Forsthauses in beschränktem Maße Salat und Gemüse lieferte. Besonders gepflegt sah das Gärtchen aber nicht aus; es entbehrte wohl der sorgsamen Hand.
„Grüß Gott, Weiberl! Da bin ich endlich und nicht wenig müd und hungrig!“ rief Benjamin beim Eintritt in die Stube und hing Hut und Gewehr auf den Kleiderständer neben der Türe.
Frau Amanda zuckte überrascht zusammen und schob hastig eine Zeitung in das Nähkörbchen. „Du bist schon[S. 32] da?“ stieß die junge, blasse Frau aus und erhob sich, um dem Gatten einige Schritte entgegenzutrippeln. Über mittelgroß, sehr schlank, scharf geschnitten das Gesicht und die Nase, eckig die Gestalt – machte Amanda Gnugesser auf den ersten Moment einen ungünstigen Eindruck; bei näherer Betrachtung offenbarte sich jedoch die überraschende Schönheit des Auges. Große braune Rätselaugen, unergründlich, seltsam leuchtend. Wundervoll auch das rehfarbige Haar in reichster Fülle, nur mangelhaft frisiert, leichthin aufgesteckt, in Unordnung geraten. Im einfachen Kattunkleide sah Frau Amanda einem Dienstmädchen gleich, das durch Vernachlässigung der Toilette gleichgültig jeden Zauber der Weiblichkeit zerstört, weil niemand da ist, für den man sich putzen und schmücken konnte. Aus Kleidung und Körperhaltung offenbarte sich eine Gleichgültigkeit, die geradezu aufreizte, nach der Ursache zu forschen. Nur Benjamin Gnugesser fragte nie danach, er sah die Vernachlässigung, die, wenn nicht zerstörte, so doch geminderte Anmut des Weibes nicht. Er war von Anbeginn durch die Braut nicht verwöhnt worden. Entgegen dem allgemeinen Brauche, daß Mädchen sich vor Männern nur im Zustande einer gewissen Vollkommenheit in der Toilette, Frisur und sehr guter Laune sehen lassen, hatte Fräulein Amanda, damals Lehrerin, sich nie bemüht, ihr Wesen und ihre Erscheinung zu idealisieren oder Illusionen zu erwecken. Sie wollte nicht täuschen. Und als Ehefrau negierte sie rundweg die Behauptung, wonach das Eheglück um so besser gefördert werde, je vollkommener es die Gattin verstehe, den Mann in der Illusion, ein Ideal zu besitzen, ständig zu erhalten. Die Gleichgültigkeit der zum Zölibat verurteilten Lehrerin gegen Kleider, Schmuck, Tand und unzählige Kleinig[S. 33]keiten hatte Amanda in den Ehestand mitgebracht. Und die Fortdauer dieser Gleichgültigkeit hatte eine bestimmte Ursache.
Scherzend erwiderte Benjamin: „Es ist nur mein Geist, der bei dir erschienen ist. Er hat aber Hunger und Durst!“
„Mußt dich schon gedulden! Die Stunde deiner Heimkehr war mir nicht bekannt, ich muß also erst kochen! Den Durst wirst wohl selber löschen können! Flaschenbier ist im Keller!“
„Dank schön für die Auskunft! Werde gleich in den Keller hinabspazieren! Vorher möcht ich aber wissen, was es zu schnabulieren gibt!“
Mit leichtem Spott sprach Amanda: „Etwas ganz Feines, Kalbsfüße!“
Benjamin schnalzte mit der Zunge, rief: „Nobel, grad nobel!“ und stapfte in den Keller.
Frau Amanda kehrte schnell an den Nähtisch zurück und verschloß die vorhin weggelegte Zeitung gleich einer Kostbarkeit in der Schublade einer Kommode, deren Schlüssel sie einsteckte. Dann begab sie sich in die kleine Küche, wo die Dunkelheit sie zwang, Licht zu machen.
Im dämmerigen Wohnstübchen leerte der Forstwart das Fläschchen Bier, entledigte sich der schweren Bergstiefel, schlüpfte in bequeme Hausschuhe und stellte sich an das offene Fenster, um zu beobachten, wie die Dämmerung mählich in die Nacht überging. Für den Forstmann und Jäger war dieses oft gesehene Schauspiel aber doch etwas langweilig. Auch knurrte der Magen, der Hunger zerstörte die Poesie des Sommerabends. Benjamin wollte sich die Wartezeit verkürzen und irgend etwas lesen. Er steckte die kleine Hängelampe an und nahm von der Kommode den dort liegenden Pack Zei[S. 34]tungen. Und groß wunderte er sich, wie wohl diese Zeitungen, dem Titel nach in Köln erscheinend, in die steierische Bergeinsamkeit und just in das Forsthaus Hall bei Admont gekommen sein mochten.
Eine Weile blätterte er diese Zeitungen durch, sah dann das Datum an und legte die „ollen Kamellen“ geringschätzig weg. Lektüre war sein Fall überhaupt nicht, für alte Zeitungen hatte er aber ganz und gar kein Interesse.
„Dauert das lang, bis die Kalbsfüße kommen!“ brummte der hungrige Förster. In Gedanken entschuldigte er gutmütig die Gattin, die als frühere Lehrerin ungern kochte. Daß Amanda sich so spät am Abend abmühte, Kalbsfüße zu backen, fand Gnugesser sehr nett und dankenswert.
Endlich erschien die Gattin mit der Speise. Krebsrot waren Amandas Wangen, dunkelbraun, fast schwarz gebrannt die Kalbsfüße.
Auf den ersten Blick erkannte Benjamin, daß die Kalbsfüße überhitzt gebacken und wahrscheinlich ungenießbar sein würden. Dennoch lobte er den Eifer und dankte für die Aufopferung. Und zur Belohnung wollte er das zweite Fläschchen Bier der Gattin abtreten.
Amanda lehnte ab mit dem Hinweise, daß sie grundsätzlich den Alkohol meide.
Mit Todesverachtung würgte der Gatte die außen verbrannten, innen fast noch rohen Kalbsfüße hinab und goß mit allerdings verdächtigem Eifer Bier darauf.
Gottlob merkte Amanda nichts, sie saß am Tische, seltsam in Gedanken vertieft.
Den fuchsigen Patriarchenbart glättend, fragte Benjamin, wie denn die Zeitungen aus Köln sich in das Haller Forsthaus verirren konnten.
Amanda griff nach einem widerspenstigen Strähnchen ihres herrlichen Haares und erwiderte in gekünstelt ruhigem Tone: „Die hat mir unser Pfarrer, der Pater Wilfrid, gebracht!“
„So? Na, was soll denn Interessantes drinstehen?“
„Der Roman ist sehr schön!“
„Nix für ungut, Weiberl! Aber ich meine doch, dem Pfarrer hätt was Gscheiteres einfallen können, als einer Hausfrau einen Roman zum Lesen zu geben!“
Beleidigt warf Amanda den Kopf auf und scharf erwiderte sie: „Schinden und rackern darf sich die Frau, eine geistige Erholung wird ihr aber nicht gegönnt! Von Fortbildung gar nicht zu sprechen! Als frühere Lehrerin habe ich andere geistige Bedürfnisse als Bauernweiber!“
Gutmütig beteuerte Benjamin, daß seine Bemerkung nicht schlimm gemeint sei. „Kannst ja tun und lesen, was du willst! Ich red dir gewiß nix drein! Bin ja ein genügsamer, bescheidener Mensch!“
„Den Mangel an Verkehr mit Leuten von Bildung empfinde ich bitter! Wir leben in einer geradezu trostlosen Abgeschiedenheit! Meine einzige Hoffnung ist, daß durch die Fürstin vielleicht ein Verkehr mit den Kammerfrauen sich wird ermöglichen lassen...!“
„Nix für ungut, Weiberl! Ich bin nur ein Forstwart, ein Waldmensch, aber um den Verkehr mit Domestiken reiß ich mich nicht! Diese Sorte aufgeblasener hochnäsiger Menschen ist mir zu minder und nicht nach meinem Geschmack!“
Amanda hob die eckigen Schultern und spottete: „Mußt halt schauen, daß die Fürstin sich mit dem Herrn Forstwart huldvollst abgibt!“
„Fehlgeschossen, Weiberl! Die Duhrlauch ist mir zu hoch! Art zu Art!“
„Stimmt! Ich hätte das bedenken sollen, als es noch Zeit war!“
„Ich glaub gar, du willst sticheln? Bist heute schon sehr merkwürdig spitz und stachlig! Hast denn Verdruß gehabt? Bist etwa krank? Blaß schaust aus, Weiberl!“
Amanda ging unvermittelt auf ein anderes Thema über und fragte, ob unter der neuen Herrschaft eine Gehaltsaufbesserung möglich sein könnte.
„Nicht daran zu denken! Wir dürfen froh sein, wenn das gesamte Personal unvermindert und mit unveränderten Löhnen übernommen wird!“
„Wieviel festes Gehalt hast du denn zur Zeit?“
„Seltsame Frage! Du weißt doch, daß ich tausendachthundert Kronen Fixum habe!“
„Ja doch! Aber ich weiß nicht, ob das Schußgeld eingerechnet ist!“
„Warum willst du denn das wissen?“
„Ich möchte nicht vom Finanzamt unangenehm überrascht werden, wenn beispielsweise das Einkommen höher ist und demgemäß ein größerer Steuerbetrag zu zahlen sein würde! Muß das Schußgeld auch versteuert werden?“
„Keine Idee! Wir haben nur wenig Raubzeug, also ist das Schußgeld minimal! Jedes Sechserl braucht man denn doch nicht dem Finanzamt auf die Nase zu binden!“
„Glaubst du, daß es unter der neuen Herrschaft größere Trinkgelder geben wird?“
„Nix für ungut, Weiberl! Aber was du eben gesagt hast, das ist höheres Blech! Ich bin als Forstwart Beamter, der selbstverständlich kein Trinkgeld annimmt! Jagdgehilfen halten die Hand hin, so Jagdgäste Weidmannsheil gehabt haben! Niemals aber die Beamten!“
„Na, na! Mit dem ‚fürstlichen‘ Einkommen von tau[S. 37]sendachthundert Silberlingen brauchst die Nase nicht gar so hoch zu tragen! Eine Aufbesserung, egal von welcher Seite sie kommt, wäre hocherwünscht als Zuschuß zu dem viel zu knappen Wirtschaftsgeld!“
„Ah, so lauft der Has! Tut mir leid, aber das Haushaltsgeld kann ich beim besten Willen nicht erhöhen! Mußt schon schauen und trachten, daß du damit auskommst! So, müd, krachmüd bin ich, freu mich auf das Bett! Gehst auch schlafen?“
„Ich werd noch ein bisserl lesen! Gute Nacht, Beni!“
„Gute Nacht, Weiberl!“ Benjamin trat zur Gattin und gab ihr den Gutenachtkuß, den Amanda kaum erwiderte. „Nix für ungut, wenn ich schon schlafe, wenn du kommst!“
„Orgle nur zu! Gute Nacht!“
Horchend blieb Amanda am Tische sitzen. Sie holte geräuschlos das sie so mächtig interessierende Zeitungsblatt aus der Kommode hervor, als kräftige Gutturaltöne die Gewißheit gaben, daß der Gatte schlief. Wieder las die Frau den kurzen Artikel, dessen Inhalt ihre ganze Denkkraft, ihr Sinnen und Streben in Anspruch nahm, ihre Zukunft gründlich umgestalten wird und muß.
Wie Amandas schöne Augen aufleuchteten bei dem Gedanken, die in dem Artikel angedeutete Reform durchzuführen! Zunächst in ihrer Ehe! Dann aber soll dafür gesorgt werden, daß die Wohltat der Reform auch anderen Hausfrauen zuteil werde! Nötigenfalls wird die Neuerung im ehelichen Haushalt erkämpft werden... Amanda wird einen Frauenbund gründen. Der früheren Lehrerin, ihrer Intelligenz und Geistesschulung gebührt selbstverständlich der Vorsitz. Eine große Mission harrt ihrer, und ihr Leben wird einen neuen Inhalt erhalten und lebenswert werden.
Die Gedanken der einsamen Frau sprangen um zwei Jahre zurück und beschäftigten sich mit der Frage, warum Amanda ihren Beruf aufgegeben hatte und die Ehe mit Benjamin Gnugesser eingegangen war. Eine Ehe, die nicht befriedigte. Freilich hatte sie der Beruf auch nicht befriedigt. Nur einen einzigen Vorteil hatte die Stellung in den Augen Amandas: die feste Besoldung. Die Arbeit in der Schule wurde gelohnt. Um der Selbständigkeit und des Gehaltes willen war Amanda Lehrerin geworden. Nicht aus Freude und Liebe zu diesem Berufe. Ihr Brot mußte sie sich verdienen, die mittellose Tochter eines inzwischen verstorbenen Subalternbeamten wollte nach Möglichkeit unabhängig sein, finanziell gesichert in der Welt stehen, an jedem Monatsersten Bargeld in die Hand bekommen. Dieses Ziel war erreicht worden. Aber eine gute Lehrerin war Amanda nicht; diese Tatsache erkannte sie selbst wie auch die Ursache: den Mangel an Berufsliebe. Aus diesem Mangel mußte eine Abneigung gegen diesen Beruf erwachsen, die sich in dem Maße steigerte, als sich die Widerwärtigkeiten in Schule und dörflichem Leben vermehrten. Die Schule und der Lehrberuf verlangen Begeisterung und liebevolle Hingebung, so Ersprießliches geleistet werden soll. Fräulein Amanda hatte die Schule aber lediglich als Versorgungsanstalt betrachtet. Konflikte, Reibereien, Rügen konnten nicht ausbleiben, verleideten die Stellung. Prüfungen der Kinder ergaben Mißerfolge, die der Lehrerin angekreidet wurden und zu Strafversetzungen führten. Sogar von Entlassung aus dem Schuldienst war gesprochen worden. Und diese Drohung hatte Amanda auf den Gedanken gebracht, die Versorgung im Ehestande zu suchen und anzustreben. Benjamin war im gleichen Orte angestellt und gleich der[S. 39] Lehrerin aß er im Gasthause; sie trafen sich täglich und wurden Freunde. Und als Beni zum Forstwart ernannt worden war, warb er um Amandas Hand, denn Beni war in Amanda ehrlich verliebt und blind gegen den Mangel jeglicher Körperreize. Der Lehrerin hingegen war es nur um eine anderweitige Versorgung zu tun. Liebe empfand sie nicht, weder zum Gatten noch zum Hauswesen. Von der Führung eines Haushaltes konnte die Ex-Lehrerin keine Ahnung haben. Er war auch danach. Es ging zur Not, denn einiges lernte Frau Amanda ja doch, freilich unter Geldopfern für verpfuschte Speisen. Und es wird mit „Ach und Krach“ weitergehen dank der Herzensgüte Benis. Der Verstand sagte Amanda, daß sie nie eine richtige und tüchtige Hausfrau werden könne.
Amanda begann zu später Stunde zu rechnen, nachdem sie den ihr Inneres aufwühlenden Zeitungsartikel abermals gelesen hatte. Achtzehnhundert Kronen festes Einkommen bezieht der Gatte. Würde ein Drittel abgezogen als Entlohnung für die Arbeit der Hausfrau, so würde Beni kaum imstande sein, mit der verbleibenden Summe alle Bedürfnisse des Lebens und Haushalts zu bestreiten. Demnach muß eine Gehaltserhöhung angestrebt werden.
Frau Amanda horchte plötzlich auf, beruhigte sich aber sofort, als sie die Stimme des heimgekehrten Oberförsters erkannte. Hartlieb schloß die Haustür auf und ließ dem Grafen Thurn den Vortritt.
Schnell nahm Amanda die Lampe vom Tisch, trat in den Flur, um den Herren die Treppe zu erleuchten.
Graf Thurn dankte freundlichst für diese liebenswürdige Aufmerksamkeit und fügte bei, daß die Fürstin übermorgen nachmittag ankommen werde. „Frau Forst[S. 40]wart haben wohl die Güte, für die Schmückung des Forsthauses zu sorgen, ja? Und dankbar werde ich sein, wenn Sie mir behilflich sein wollten, die Front des Jagdschlössels zu zieren! Das Personal kommt nämlich erst übermorgen früh hierher, also zu spät für die Ausschmückung!“
„Mit größtem Vergnügen, Herr Graf!“
„Schön! Verbindlichsten Dank! Nun aber gute Nacht, Frau Forstwart!“
Amanda begleitete mit der Lampe die Herren bis in das obere Stockwerk. Dann kehrte sie in ihre Wohnung zurück und begab sich zur Ruhe. Fand aber lange nicht den Schlaf, da sich schwere Gedanken an Reform, Gehaltsaufbesserung, auch an die Zukunft unter der neuen Herrschaft durch ihren Kopf wälzten. Eine große Rolle spielte auch die Fürstin Sophie von Schwarzenstein, die neue Gebieterin des Haller Jagdgutes...
Vom Sonnengolde verklärt, sah das winzige Dörfchen Hall mit seinem netten Pfarrhause und dem hübschen, auf einem grünen Hügel thronenden Kirchlein wie ein Kinderspielzeug aus. Verstreut im Tal standen die Häuschen, meist unter Obstbäumen versteckt, die Siedlungen von Bauern und Arbeitern; ehemals vor acht Jahrhunderten bildete das Dorf die Stätten von Sudleuten, da das Benediktinerstift hier eine vielumstrittene Salzpfanne besaß. Im Norden dieses Alpendörfleins türmen sich die grauen Kalkkolosse der „Haller Mauern“ auf, deren Mittelgebirge bewaldet ist.
Im Wohngemach, zugleich Speisezimmer des schlichten, sauberen Pfarrhauses, saß Oberförster Hartlieb als Gast bei seinem Freunde Pater Wilfrid Ritter von Springenfels, der die Funktion des Pfarrers ausübte, zugleich aber Konventual des Admonter Benediktinerklosters und Gastmeister dieses Stiftes war. Wohnhaft im Stifte, kommt Pater Wilfrid zweimal in der Woche nach Hall, nimmt im Pfarrhause, das Eigentum des Stiftes ist, kurzen Aufenthalt, um sich als Seelsorger der Gemeinde zu widmen. Wird der Pfarrer weiterhin benötigt, so muß er im Stifte verständigt werden. Mit der Pünktlichkeit der Könige pflegte Pater Wilfrid an den bestimmten Tagen zur üblichen Stunde nach Hall zu kommen. Und wie ein Vater stand er jedem der Dorfbewohner mit Rat und Tat zur Verfügung. Ein großer[S. 42] hagerer Aristokrat im schwarzen Benediktinerhabit, dem obersteierischen sogenannten Eisenadel entsprossen, adeligen Hochofen- und Hammerwerksbesitzern, reichen Leuten zur Blütezeit der Eisenindustrie. Aus vermögender Familie stammend, hätte es der junge Ritter von Springenfels nicht nötig gehabt, eine Versorgung anzustreben; er erwählte freiwillig den Priesterberuf aus Begeisterung und trat in den Admonter Benediktinerorden ein, um in der heißgeliebten obersteierischen Heimat lebenslang bleiben zu können. Diese Heimatsliebe schloß indes große Reisen zur Urlaubszeit behufs Ausbildung und Weitung des Blickes nicht aus; wie denn auch Pater Wilfrid stetig bemüht war, die Studien aus mannigfachen Gebieten unter Ausnützung der kostbare Schätze bergenden Stiftsbibliothek fortzusetzen. Die adelige Abstammung führte dazu, daß in jenen Fällen, da von fürstlichen Gutsbesitzern in der Umgebung von Admont ein priesterlicher Stiftsherr zum Messelesen in Schloßkapellen erbeten wurde, stets Pater Wilfrid Ritter von Springenfels delegiert ward. Diese Tätigkeit trug dem Benediktiner von den Mitbrüdern den Scherznamen „Hofkaplan“ ein, wobei Pater Wilfrid um die Tafeleinladungen beneidet wurde. Intelligenz, Bildung und Noblesse kündeten Kopf und Augen dieses Benediktiners. Ein Priester wie eigens geschaffen für den Verkehr mit dem Hochadel, mit Fürsten und Königen; aber sein Umgang mit den Haller Dörflern bewies immer wieder, daß Pater Wilfrid auch ein vortrefflicher Bauernpfarrer, der opferwillige Freund der Armen und Ärmsten war. Durch den Verkehr mit dem feinen Pfarrer von Hall nahmen selbst rauhbeinige Burschen einen gewissen Schliff an. Und immer gedrückt voll war die Kirche an Sonn- und Feiertagen, da die Dörfler eine[S. 43] gehaltvolle Predigt ihres Pfarrers zu erwarten hatten. Kein Donnerwetter im Dialekt von der Kanzel; formvollendete, dem Auffassungsvermögen der Zuhörer angepaßte Vorträge, liebevolle Ermahnungen zu Eintracht und gottgefälligem, christlichem Leben gab Pater Wilfrid. Mußte der Haller Pfarrer, durch dörfliche Ereignisse oder Verfehlungen der Pfarrangehörigen gezwungen, scharf vorgehen, so blieben Rüge und Tadel stets vornehm in Form und Ton, die Kanzelrede vermied jede Nennung von Namen. Diese vornehme Objektivität und Schonung weckte das Ehrgefühl und erzeugte Dankempfindungen derer, die recht gut wußten, daß sie die Rüge anging.
Stolz waren die Haller auf ihren Pfarrer im Benediktinerhabit. Und neben diesem Stolz saß die Sorge, daß Hall den verehrten und allbeliebten Pater Wilfrid verlieren könnte.
„Also, womit kann ich Ihnen, Herr Oberförster, dienen?“ fragte Pater Wilfrid zum zweiten Male, da Hartlieb mit seinem Anliegen nicht herausrücken wollte. „Über die bevorstehende Ankunft der Fürstin bin ich vom Hausmarschall bereits verständigt!“
„Eben diese Ankunft macht mir Sorge! Ich bin bekanntlich alles, nur kein Hofmann! Vor dem Hofdienst graut mir, ich sehe sehr schwarz in die Zukunft! Eine Bitte hätte ich, sie hängt mit der Ankunft der Fürstin zusammen; eine Ansprache soll gehalten werden, aber ich bin kein Redner, würde jämmerlich verunglücken! Also bitte ich herzlich, daß Sie mir diese drückende Last abnehmen!“
„Gerne werde ich Ihnen, dem Freunde, dienen! Aber der Benediktiner kann doch nicht im Namen der Jägerei und des Forstpersonals die Fürstin begrüßen!“
„Der Pfarrer ist Amtsperson, hält eine offizielle Ansprache im Namen der Pfarrgemeinde! Ich hänge dann ein kräftig ‚Weidmannsheil‘ daran, die Jägerei wird schon donnernd einstimmen!“
„Das ist ein Ausweg! Gut, machen wir es nach Ihrem Vorschlag! Was nun Ihre Befürchtungen wegen des sogenannten Hofdienstes betrifft, möchte ich aufmerksam machen, daß Fürstlichkeiten von Forst- und Jagdbeamten den Hofton und das Katzbuckeln weder erwarten noch wünschen! Unangenehm sind zuweilen die Hofschranzen, liebedienerische und eingebildete Gschaftelhuber, hochnäsige Leute, die den Beamten Dienst und Leben bei Hofe sauer machen! Da indes Graf Thurn ein sehr liebenswürdiger und einsichtsvoller Herr und frei von jeglicher Kompetenzeifersucht ist, haben Sie, lieber Freund, so gut wie gar keinen Grund zu Befürchtungen!“
„Hm! Aber das Gefolge!“ meinte Hartlieb unsicheren Tones.
„Na, eine Hofdame kann doch den Jagdleiter nicht genieren und wird wohl nie Ihren Weg kreuzen! Und was sonst noch um die Fürstin wimmelt, Zofen, Kammerdiener usw., das sind Angestellte, die der Chef des Wald- und Jagdamtes gar nicht zu sehen braucht und am besten völlig ignoriert! Also Kopf hoch, lieber Freund Oberförster, schneidig in die Welt gucken, wie es der grünen Gilde ziemt! Sie erfüllen nach wie vor Ihre Dienstpflicht mit aller Berufstreue und gehen Ihren Weg ohne Seitenblicke! Um die Hofleute kümmern Sie sich keinen Pfifferling! Probatum est!“
Hartlieb dankte für den freundlichen Zuspruch. Doch der sorgenvolle Ausdruck in seinem Antlitz wollte sich nicht aufhellen.
Pater Wilfrid verstand sich darauf, in den Mienen zu lesen; der tiefe Ernst Hartliebs veranlaßte den Pfarrer, zu fragen, was denn noch das Weidmannsherz bedrücke.
Der Oberförster stieß die Worte hervor: „Der frühere Jagdherr war ein weidgerechter Mann...!“
„Ahem! Und die neue Besitzerin ist eine Frau! Da liegt wohl der Hase im Pfeffer? Und da kann nur eines empfohlen werden: Pflicht erfüllen und abwarten, wie sich die Dinge gestalten werden!“
„Gewiß! Fatal bleibt es immer, wenn eine Frau die Zügel führt! Ich als Jagdbeamter muß der Wahrheit entsprechend sagen, daß eine Gebieterin, die sich wie ein richtiger Jagdherr um alles die Jagd Betreffende eingehend kümmert, geradezu zu fürchten ist!“
„Wieso?“
„Weil sicher die Grundsätze und Anordnungen im Jagdbetriebe von einem Tag zum andern wechseln werden, je nach den mannigfachen Einflüssen, die auf das weibliche Gemüt physisch oder seelisch zu jeglicher Stunde wirken durch schlimme Berater, Günstlinge, Schmeichler und womöglich auch durch Freundinnen! Dem ehrlichen, geraden Jagdleiter wird es unendlich schwer werden müssen, auf seinem Posten auszuharren, ohne seiner Überzeugung übergroße Opfer zu bringen! Ich habe viel über die Situation nachgedacht, konnte aber selbstverständlich darüber mit meinem Personal aus triftigen Gründen nicht sprechen! Ihnen, dem Freunde, muß ich gestehen: wir bekommen eine wetterwendische Wirtschaft in das Jagdgebiet, heillose Zustände, denen selbst Sankt Hubertus machtlos gegenüberstehen wird! So gerne ich in diesen Revieren diene, die schönen Haller Berge liebe, es wird doch besser sein, wenn Ausschau nach einem[S. 46] anderen Posten gehalten wird! Mir schwant hier Unheil!“
„Freund Hartlieb, Sie sehen hier vielleicht doch zu schwarz! Ich als Priester kann nicht mitreden, der Benediktiner versteht vom Jagdwesen nichts! Daß Frauenherrschaft je nach Laune dem Wechsel unterworfen ist, kann freilich nicht bestritten werden! Aber es ist doch nicht anzunehmen, daß Launenhaftigkeit sich in einem Jagdbetrieb breitmachen werde! Ich kann mir dergleichen nicht vorstellen!“
„Frauensinn ist unberechenbar! Auch einer Fürstin kann ein schmucker Jagdgehilfe gefallen, Frauengunst kann einen Liebling zum tatsächlichen Jagddirigenten machen... Der verantwortliche Jagdleiter aber wird entweder fliegen oder zum willenlosen Werkzeug und Spielball herabsinken! Einem solchen Schicksal möchte ich rechtzeitig ausweichen!“
„Das sind düstere Gedanken zu Beginn einer neuen Ära! Ihre Befürchtungen erschweren die Ausarbeitung einer Begrüßungsansprache! Als Optimist hoffe ich aber dennoch, daß sich die Verhältnisse besser gestalten werden, als wir zur Stunde glauben! Und darauf wollen wir ein Gläschen Stiftswein leeren, ja?“
Die Pfortenglocke gellte durch das stille Pfarrhaus. Und kurz darauf meldete die weißhaarige, verhutzelte Dienerin Frau Erna, daß die Loidlbäuerin im Sterben liege...
„Schnell den Mesner verständigen! In zehn Minuten werde ich zum Provisurgang bereit sein!“
Die Dienerin verschwand.
Zum Oberförster gewandt, sprach Pater Wilfrid: „Verzeihen Sie! Mich ruft der heilige Dienst! Sterbende darf man nicht warten lassen!“
Hartlieb dankte herzlich für die Gewährung einer vertraulichen Aussprache und verabschiedete sich. Auf dem Wege zum Gasthause, wo der Oberförster zu speisen pflegte, traf er den Grafen Thurn, der das gleiche Ziel hatte und zu Mittag essen wollte. Sehr befriedigt sprach sich der Hofchef über die Frau Forstwart aus, die für eine hübsche Außendekoration des Jagdschlössels gesorgt und dabei viel künstlerischen Geschmack entwickelt habe. Durchlaucht werde gewiß entzückt sein.
Bei Tisch in dem bescheidenen Gasthause des Dörfleins richtete Graf Thurn an den wortkargen Oberförster die Frage, ob der Jagdfachmann es für möglich halte, daß die Jagdausübung in den wirklich herrlichen Haller Revieren einen apathischen, blasierten jungen Mann psychisch zum Vorteil verändern, aufrütteln, die Weidmannslust erwecken könnte.
In seiner ernsten Weise äußerte sich Hartlieb dahin, daß vielleicht Treibjagden auf Gams, wenn diese Jagdart noch unbekannt sei, ein gewisses Interesse bei dem Betreffenden wachrufen könne. Fehle das Jägerblut, so wird ein blasierter junger Mann nie ein weidgerechter Jäger werden. Bei Treibjagden stehe indes zu befürchten, daß im jungen Manne nicht die echte Jagdfreude, sondern die Schießwut erweckt werde. Ein „Schießer“ sei nun und nimmer ein wünschenswerter Gast in gehegten Revieren, eher zu fürchten, nach Möglichkeit hinauszuexpedieren.
„Sie werden wohl recht haben, Herr Oberförster! Aber unbegreiflich ist mir, daß sich das Jägerblut nicht immer vererbt! Der Vater des schläfrigen, apathischen jungen Mannes war passionierter Weidmann!“
„Von Beruf?“
„Nein! Nur zum Vergnügen!“
„Sportinteressen vererben sich nicht! Wer die Jagd nur als Sport betreibt, der ist noch kein echter Jäger! – Ein interessantes Gegenstück zu dem erwähnten jungen blasierten Manne können Sie, Herr Graf, im Stifte der Benediktiner zu Admont sehen und gewissermaßen bemitleiden wegen der schweren Seelenkämpfe, die der Novize Nonnosus durchkämpfen muß, um das echte, in seinen Adern tobende Jägerblut zu bezwingen!“
„Wie? Ein Novize und leidenschaftlicher Weidmann?“
„Der Leidenschaft muß der Novize Herr werden! Von Herzen gern hätte ich dem jungen Manne Jagdgelegenheit verschafft, konnte es aber nicht, da unser früherer Jagdherr unauffindbar verreist war, meine Kompetenz nicht ausreichte, um eine Abschußbewilligung zu erteilen! Ich bin sehr gespannt, zu vernehmen, ob Nonnosus die Leidenschaft überwinden wird! Er ist der Sohn eines Jägers und besitzt echtes Jägerblut! Dem Nonnosus dürfte das Ziel des höheren Jagddienstes vorgeschwebt haben, die Armut vereitelte es; der Noblesse des Abtes war es zu danken, daß der Jaagersbub auf Klosterkosten studieren durfte. Diese Wohltat will der Student durch Eintritt in den Benediktinerorden vergelten; die Dankbarkeit verhinderte ein ‚Ausspringen‘! Bis zur feierlichen Profeß muß der Novize sich bemühen, die Jagdleidenschaft zu überwinden! Leicht wird das nicht sein, zumal der arme Kerl kränkelt!“
„Ich werde mir den interessanten Mann ansehen! Glaube auch, daß sich die Fürstin dafür speziell interessieren wird!“
*
Die Begrüßungsfeierlichkeit am festlich geschmückten Forsthause war beendet, die Fürstin und das Gefolge[S. 49] zum Jagdschlößl gefahren, das drei Kilometer tiefer im einsamen waldreichen Halltale stand. Die Jagdgehilfen hatten sich entfernt, um noch Dienst in den Revieren zu tun; Forstwart Gnugesser hockte verstimmt in seiner Wohnung.
Froh dessen, daß die Feierlichkeit gut verlaufen war und die neue Gebieterin in Erwiderung auf die Ansprache des Pfarrers und auf das „Weidmannsheil“ der Jägerei erklärt hatte, daß die Jagdherrin einen richtigen Jagdbetrieb wünsche und mit allen im Frieden leben möchte, lud der Oberförster den „Festredner“ Pater Wilfrid ein, in der Jagdamtskanzlei einer Flasche den Hals zu brechen, ein Rauchopfer darzubringen und die Zeit mit Geplauder bis zum Dinerbeginn auszufüllen.
Pater Wilfrid willigte unter der Bedingung ein, daß er eine Stunde auf den Besuch des Priesters bei der kranken Siebenbrunner Bäuerin verwenden dürfe.
Während Pater Wilfrid die Treppe hinanstieg, bat Hartlieb Frau Amanda um Besorgung von Gläsern, Brot und etwas Schinken. Der Oberförster holte den Wein aus dem Keller.
Sichtlich verdrossen servierte Frau Amanda den Herren in der Kanzlei. Das ihr von Hartlieb angebotene Glas Wein lehnte sie ab mit dem Hinweise, daß sie erstens Abstinenzlerin und zweitens nicht in der Stimmung sei, ein Fest zu feiern, nachdem die Fürstin den Forstwart ignoriert und ihn nicht zum Diner eingeladen habe.
Begütigend griff Pater Wilfrid ein: „Liebe Frau Forstwart! Nur nicht brummen, wird schon kummen! Das Speisezimmer in dem Schlößl ist ein beschränkter Raum, es können nicht viele Gäste zu Tische sein! Der Herr Forstwart wird sicher ein andermal zur Tafel be[S. 50]fohlen werden! Wenn ich Ihnen einen Rat erteilen darf, lautet er wohlmeinend und freundlich dahin: den Ärger unterdrücken, ein freundliches Gesicht auch dann zeigen, wenn der Mensch Essig und Galle auf der Zunge hat! Fürstlichkeiten muß man jeden Verdruß ersparen! Jedenfalls wird die Fürstin die Frau Forstwart gelegentlich besuchen; es wäre unklug, wenn Frau Gnugesser solchen auszeichnenden und vielleicht auch wichtigen und bedeutungsvollen Besuch unmöglich machen würde! Übrigens irren Sie, liebe Frau Forstwart, wenn Sie glauben, daß ein sogenanntes Festdiner ein Vergnügen ist! Genau genommen ist es eine Dienstessache, steife Etikette, es heißt schrecklich aufpassen und schweigen; antworten darf man nur, wenn man gefragt wurde; das Essen ist Nebensache, es wird mit wahnsinniger Eile serviert, weil die Hoheiten wie die Dienerschaft die Gäste möglichst schnell verschwinden zu sehen wünschen!“ Pater Wilfrid beschattete mit der rechten Hand seine lachenden Augen.
„Also nix für uns!“ rief Frau Amanda, die jedes Wort des hofkundigen Geistlichen glaubte, und zog sich zurück.
Aber auch Hartlieb in seiner Furcht vor dem Hofdienst hielt die Äußerung des Pfarrers für ernst gemeint und sprach davon, daß er die Einladung fürchte.
Nun schmunzelte Pater Wilfrid und witzelte: „Auch du, Brutus? Man sollte es nicht für möglich halten, daß handgreiflicher Scherz für blutigen Ernst genommen werde!“ Und nun gestand der joviale Benediktiner, daß er die Schilderung des Hofdiners absichtlich übertrieben habe, um der verärgerten Forstwartsfrau den Stachel aus der Seele zu nehmen. Das Frauenzimmer solle nur glauben, daß die Teilnahme an einer Festtafel für die[S. 51] Eingeladenen eine Qual sei; die Frau Gnugesser werde sich dann nach einer solchen Einladung nicht sehnen. „Das war der Zweck meiner Äußerung! Nun und nimmer hätte ich geglaubt, daß mein Freund Hartlieb darauf reinfallen könnte! Also nur keine Angst vor dem Festdiner! Eines wird aber gut sein: vorher essen, egal was, damit der Eingeladene nicht hungrig zur Festtafel komme! Also: Prost! Und ein Happen Schinken ist nicht ohne! Rauchen ist erlaubt, nur muß man vor Dinerbeginn den Mund ausspülen oder Pfefferminz nehmen, damit namentlich empfindliche Damen und ihre Geruchsorgane nicht beleidigt werden!“
Hartlieb taute etwas auf, lächelte und drohte mit dem Zeigefinger: „Pater Wilfrid von Springenfels, gerissener Diplomat, ein mit allen Salben geschmierter Höfling! Im Nebenamte Pfarrer! Wo bleibt die Wahrheitsliebe?“
Pater Wilfrid streckte die Finger, daß sie knackten, und meinte lachend: „Na ja, es ist ein alter Schnee, daß ein Hofmann nicht immer mit der absoluten Wahrheit durch das Leben gehen kann! Es gibt zahlreiche Situationen, die Notlügen geradezu erzwingen! Für den Fall, daß eine harmlose Notlüge Gutes beabsichtigt und erreicht, wird die Sünde nicht besonders groß oder schwer und gewissermaßen berechtigt sein! In solcher Erwägung habe ich als Hofmann die Frau Gnugesser ‚angeblümelt‘! Hoffentlich wird der Zweck erreicht! So, nun aber möchte ich als Pfarrer die kranke Bäuerin besuchen! Wir treffen uns zehn Minuten vor sieben Uhr vor dem Jagdschlößl! Auf Wiedersehen!“
Hartlieb begleitete den geistlichen Freund zur Treppe, und zur Verabschiedung fragte der Förster noch schnell, in welchem Anzug man zur Festtafel zu erscheinen habe.
„Dienstuniform besserer Art oder Steierertracht! Wird in der Bergeinsamkeit nicht so genau genommen von den hohen Herrschaften! Ich erscheine ja auch, wie Figura zeigt, mit schwarzem Strohhut, nicht mit der Angströhre! Couleur freilich schwarz, wegen unverbesserlich klerikaler Gesinnung!“ Lachend ging der liebenswürdige Schalk...
In die Kanzlei zurückkehrend, beneidete Hartlieb den Benediktiner um seinen Humor und um die Weltgewandtheit...
Graf Thurn, der die Fürstin zum Jagdschlößl geleitet hatte, verließ es eben, um sich eiligst zum Forsthause zu begeben und Toilette für das Diner zu machen.
Als es Zeit wurde, zum Diner zu gehen, lud Graf Thurn den Oberförster zur Begleitung ein. Und unterwegs brachte der Hofchef das Gespräch auf Wildschaden und deren Behandlung seitens des Jagdamtes.
Aus den präzisen Äußerungen Hartliebs klang die Versicherung, daß ohne Strenge und Ernst nicht durchzukommen sei. Die Ansprüche der Bauern gingen nicht nur ins Maßlose, der Wildschaden werde zuweilen sogar künstlich auf sogenannten Wildschadenackerln erzeugt, um den Jagdbesitzer schamlos schröpfen zu können. Der dümmste Bauer entwickle auf diesem Gebiete der Täuschung und Schädigung der Jagdkasse eine erstaunliche Raffiniertheit, die zu strengstem Vorgehen zwinge. Wo es sich um wirklichen, vom Hochwild hervorgerufenen Schaden handle, sei bisher stets nach Recht vergütet worden. Schwindel und Betrug hingegen wurde mit rücksichtsloser und unerbittlicher Strenge bekämpft und geahndet.
„Nun ja! Der Fachmann muß die Verhältnisse kennen! Ich will mich nicht einmischen, diese Angelegen[S. 53]heiten liegen außerhalb meiner Kompetenz! Sollte je die Sprache darauf kommen, möchte ich den Jagdleiter im voraus dahin informiert haben, daß unsere hohe Gebieterin den Frieden wünscht! Durchlaucht wird Ihnen Milde nahelegen!“
„Milde ist in unseren Revieren deplaziert und kostet schwer Geld! Und Milde erreicht niemals Zufriedenheit, macht die Querulanten und Schwindler nur übermütig und in ihren Forderungen unersättlich!“
„Sagen Sie das nicht der Fürstin! Es klingt zu scharf und hart für Damenohren! Würde den Jagdleiter im Lichte der Grausamkeit erscheinen lassen! Bedenken Sie, daß unser Jagdherr eine Dame ist!“
Schatten huschten über Hartliebs Gesicht. „Zu Befehl, Herr Graf! Ich danke Ihnen für die gütige Information!“
„Nehmen Sie meine gutgemeinten Worte nicht übel! Ich wollte Ihnen nützen!“
„Besten Dank, Herr Graf, für Ihr Wohlwollen! Darf ich fragen, ob für morgen oder die nächsten Tage Befehle zu Jagden zu gewärtigen sind? Wenn ja, müßten noch heute Dispositionen getroffen werden, je nachdem die Fürstin pirschen, drücken, riegeln oder treiben lassen will!“
„Bis zur Stunde ist irgendeine Andeutung nicht erfolgt! Vielleicht hören wir beim Diner Näheres darüber! Ich möchte übrigens darauf aufmerksam machen, daß Änderungen von Absichten, plötzliche Zurücknahme von erteilten Befehlen nichts Seltenes sind! Derlei darf und soll den Jagdleiter niemals verdrießen; er muß sich stets vor Augen halten, daß eine Dame gebietet! Und immer Rücksicht nehmen auf die Fürstin, die ja auch Kummer und Sorgen hat!“
In Nähe des Jagdschlößls wartete Pater Wilfrid, der sich den angekommenen Herren sogleich anschloß. Graf Thurn führte die Gäste hinauf in den Empfangssalon und blieb bei ihnen.
Ein kleiner lichter Raum, mit Zirbenholz getäfelt, an den Wänden etliche, nicht üble Jagdgemälde älterer Meister, Rohrstühle mit hohen Lehnen um einen ovalen Tisch, dessen Zirbenplatte eine hübsch entwickelte Blaufichte trug.
Hartlieb stand auf dem gelben Parkett wie auf glühenden Kohlen, unsicher, unbehaglich, in der Stimmung, die sich im steierischen Dialekt mit knappen drei Worten ausdrücken läßt: „Außi möcht i!“ Vieltausendmal lieber im Bergwalde bei schlechtestem Wetter, denn hier im Salon, des Erscheinens der Fürstin gewärtig. Derlei Situationen gewohnt, plauderten Pater Wilfrid und Graf Thurn gedämpften Tones, und der elegante Benediktiner erzählte köstliche Audienzwitze, lustige Mißverständnisse, die er geheimnisvoll flüsterte und dazu eine wahre Leichenbittermiene machte.
Die Türe wurde geöffnet, Fürstin Sophie von Schwarzenstein trat lächelnd und elastisch ein. „‚Grüß Gott‘ dem Priester, ‚Weidmannsheil‘ unserem Jagdleiter!“ sprach sie frisch und munter und reichte den Herren die schmale weiße Hand. Eine Fünfzigerin von schlanker Gestalt, noch immer eine schöne Frau, volle Büste, die Anmut der Wienerin. Leicht ergraut das Haar, Sorgenfalten um die Augen und Lippen. Einfache, dennoch elegante Dinertoilette, grauer Rock, schwarze Seidenbluse, am Halse eine Brosche von Gold mit gefaßten Hirschgrandeln.
Pater Wilfrid hauchte einen Kuß auf die Hand der Fürstin. Hartlieb begnügte sich mit einem scheuen Hände[S. 55]druck und stand dann bolzengerade, stumm, den Blick auf die Türe zum Speisezimmer gerichtet, durch die im leisen Katzenschritt die Hofdame kam. Ein einziger Blick und Hartliebs Wangen flammten, ein Prickeln in den Händen, ein Hämmern in den Schläfen, ein Flimmern und Gleißen vor den Weidmannsaugen. Im Nu des ersten Blickes auf diese in duftiges Weiß gekleidete Frauengestalt entstand der Gedanke an Mustela martes, an den Edelmarder. Geschmeidig und biegsam der Körper, scharf der Blick aus den braunen, sprühenden Augen, deren dunkle Brauen glänzten genau wie die dunklen Langhaare um die braunen Marderseher. Tiefbraun und schimmernd das Haupthaar, blaß wie Elfenbein das Gesicht. Und wie beim jungen Mustela die Kehle hochgelb leuchtet, trug die Dame ein goldfarbenes Seidenband um den Hals; daran hing ein Medaillon. Zwischen den leicht geöffneten Lippen schimmerten wahrhaftige Marderzähnchen.
Die eigenartige Schönheit wirkte betäubend auf den stillen, ernsten Weidmann.
Fürstin Sophie sprach: „Meine Hofdame, Fräulein von Gussitsch! Die vorzustellenden Herren sind Pater Wilfrid, der Pfarrer von Hall und Admonter Stiftsherr, und unser Oberförster, Jagdleiter Hartlieb!“
Die Herren verneigten sich.
Der Kammerdiener, ein hoch und breit gebauter, ältlicher Mann in verfeinerter Steierertracht, meldete diskreten Tones, daß serviert sei.
Freundlich nickend, befahl die Fürstin: „Gut, Norbert! Weisen Sie die Plätze an! Graf Thurn, Ihren Arm, bitte! Und Herr Hartlieb führt Fräulein von Gussitsch zu Tische!“
Wieder flammten Hartliebs Wangen, und schier hör[S. 56]bar klopfte das Jägerherz da „Mustela“ die Hand in den Arm des Oberförsters legte. Zu Tische geleiten konnte er die interessante schöne Dame, aber nicht einen einzigen Ton brachte er über die zuckenden Lippen. Und vergebens fragte er sich in Gedanken, wo er die Augen bei der Begrüßungsfeier gehabt haben mußte, da er die Hofdame gar nicht gesehen hatte. Allerdings war beim Empfang sein Interesse ausschließlich auf die neue Gebieterin konzentriert gewesen.
„Mustela“ war Hartliebs Tischnachbarin. Sehr angenehm und dennoch fatal, prickelnder Nervenkitzel und lähmende, hilflose Verlegenheit des an derlei Situationen nicht gewöhnten Waldbeamten: offen die Augen und doch blind.
Gut das Diner, diskret und rasch serviert, wenig Wein.
Fürstin Sophie plauderte mit Pater Wilfrid, fragte bunt durcheinander wegen der Plätze im Oratorium der Haller Kirche, nach Ortsnamen, Kirchenbedürfnissen. Und im Handumdrehen, mit graziösen Scherzesworten war Pater Wilfrid zum „Hofkaplan“ ernannt.
Kühl bis ans Herz hinan, legte Pater Wilfrid ein Stück Poularde auf seinen Teller.
„Sie sind doch jedenfalls hochbeglückt von dieser Ernennung, wie?“
„Untertänigst aufzuwarten: nicht ganz hochbeglückt, Durchlaucht! Hatte die Ernennung mindestens zum Hofburgpfarrer erhofft! Ohne Gehalt eines solchen natürlich! Weil ich nämlich ‚Hofkaplan‘ längst bin!“ Dazu schmunzelte der Schalk und verdrehte die Augen wie der balzende Urhahn.
„So ein Schwerenöter! Ich habe keine Burg, kann Sie also höchstens zum ‚Hofpfarrer‘ ernennen, für die Dauer des Haller Aufenthaltes!“
„Untertänigsten Dank!“ Pater Wilfrid ließ den Blick über die Tischgeräte in seiner Nähe suchend gleiten.
„Was suchen denn Hochwürden?“ fragte neugierig und belustigt die Fürstin.
„Senf, Durchlaucht!“
„Was? Senf zum Geflügel?“
„Zu dienen! Mit Rücksicht auf den Einfluß der Nahrungsmittel auf den Charakter...“
„Was Sie sagen! Welchen Einfluß soll denn der Senf haben, speziell auf Ihren Charakter?“
„Senf stärkt das Gedächtnis! Ich muß morgen eine Rede schwingen, habe nicht viel Zeit zum Memorieren, also nehme ich gedächtnisstärkenden Senf zur Poularde!“
Höchlich amüsiert lachte die Fürstin hellauf. Auch Graf Thurn schmunzelte vergnügt. Und Fräulein von Gussitsch zeigte die blendend weißen Marderzähnchen.
Nur Hartlieb blieb ernst und steif.
„Hat der Herr Hofpfarrer noch mehr von charakterbeeinflussenden Nahrungsmitteln auf Lager?“
„Nicht viel, Durchlaucht! Ochsenfleisch gibt Mut und Energie, Schweinefleisch führt zu pessimistischen Anschauungen...“
„Nicht übel! Was ist’s mit Kalbfleisch?“
„Böse Eigenschaft, Durchlaucht! Bewirkt Verlust der geistigen Widerstandskraft!“
„Huhu! Schrecklich! Und Hammelfleisch?“
„Die Wirkung tritt in Montenegro deutlich zutage!“
„Wieso denn?“
„Alle Bewohner der schwarzen Berge sind der Melancholie verfallen!“
Sophie kicherte: „Gräßlich! Was bevorzugen denn die Admonter Stiftsherren?“
„Wir legen Wert auf Grazie und Geist, daher trinken[S. 58] wir Milch und essen hauptsächlich Eier!“ Wilfrid blinzelte und senkte mit köstlich markierter Demut das Haupt.
Die hohe Frau kämpfte mit einem Lachkrampf. Und Fräulein von Gussitsch stopfte den Serviettenzipfel in ihr Mündchen. Hartlieb blickte Wilfrid vorwurfsvoll an, dann aber betroffen den Kammerdiener, der ihm den Teller wegnahm, obwohl der Oberförster vom Geflügel noch keinen Bissen gegessen hatte.
Endlich hatte die Fürstin den Lachkitzel überwunden. Sie wandte sich zu Hartlieb und fragte nach dem letzten Abschuß unter Graf Lichtenberg.
Sachlich und trocken gab der Oberförster Aufschluß: zwanzig gute Hirsche, dreißig Gamsböcke, vier Geltgeißen.
„Wie ist der Stand an Rehwild?“
„Zur Zeit haben wir etwa hundert Böcke und Geißen! Vom Auerwild sicher vierzig Hahnen! Hasen nur wenig!“
„Hegen, Herr Oberförster! Ich will viel Hasen haben! Überhaupt viel Wild! Es soll wimmeln in meinen Revieren!“
„Zu Befehl! Das Wimmeln wird aber die Ziffern der Wildschadenvergütung bedeutend erhöhen!“
Inzwischen war der Pudding serviert worden, von dem Hartlieb auch nichts erwischt hatte.
„Gesegnete Mahlzeit!“ Die Tafel war aufgehoben.
„Kaffee und Zigarren in der Veranda, Norbert!“
Eine Importe hielt Hartlieb in Händen, doch zum Rauchen kam er nicht; er mußte eine Menge Fragen der Gebieterin beantworten. Und was für Fragen! Eine Gänsehaut lief dem Förster über den Rücken, als beispielsweise die Fürstin wissen wollte, ob unter den Jagdgehilfen sich auch hübsche Burschen befänden, fesche Steierer, schneidige Kerle. Und ob die Jäger verlobt seien?
Nach solchen Fragen fand es Hartlieb begreiflich, daß die insgeheim erhoffte Abschußbewilligung, die Zuweisung einer kleinen Jagdparzelle, jämmerlich ins Wasser fiel.
Als die Fürstin ihre Zigarette ausdrückte, fragte Hartlieb, ob für morgen und die nächsten Tage Pirschen befohlen werden.
Der Bescheid lautete ausweichend. Erst mal eingewöhnen, sicheres Wetter abwarten, die Herren können anfragen, Norbert werde Bescheid geben...
Zum Abschied richtete die Fürstin an Pater Wilfrid die Bitte, für übermorgen nachmittag den Besuch im Stifte Admont anzusagen und den Cicerone zu machen.
Schluß. Die Gäste hatten sich zu empfehlen. In Gnaden huldvoll entlassen. Graf Thurn wurde zu einem kleinen Vortrage zurückbehalten.
Stumm wanderten die Freunde Hartlieb und Pater Wilfrid durch die Dämmerung auf dem Sträßlein zum Forsthause zurück. Des Försters Stimmung verriet das Köpfen von Disteln. Wo Hartlieb am Wegrande ragende Disteln sah, schlug er ihnen mit dem Stock die Köpfe ab...
Beim Hause angelangt, mahnte Pater Wilfrid zu Geduld und Ruhe.
„Danke! Der Beginn läßt sich übel an, schlimmer noch, als ich befürchtet hatte!“
„Kopf hoch, lieber Freund! Denken Sie stets an das Sprüchlein: Nicht alles Ungemach, das droht, wird dir begegnen; es muß ja nicht aus jeder Wolke regnen! – Gute Nacht!“
„Gute Nacht, Hochwürden!“
Pater Wilfrid setzte seinen Weg hinaus zum Dörflein Hall fort. Und er wunderte sich, als ihm zu ver[S. 60]hältnismäßig später Abendstunde Frau Gnugesser mit rotem Kopf in sichtlicher Erregung begegnete, spitz grüßte und maliziös lächelte.
Grüßend schritt der Pfarrer weiter. Und in Hall bestieg er den seiner harrenden Stiftswagen, um nach Admont zu fahren.
Erst neun Uhr abends war es, doch alles Leben im Jagdschlößl schien bereits erloschen, klösterliche Stille, da die Fürstin sich zurückgezogen hatte.
In einem nordseitig gelegenen Stübchen mit Blick auf den zum Greifen nahen Tannenwald saß Martina von Gussitsch, jetzt im bequemen Hauskleide, am kleinen Tische bei Lampenschein und kritzelte etliche Notizen, die nicht vergessen werden durften und sich zu einer Art Tagebuch gestalteten. So schrieb Martina: „Zweimal täglich im Admonter Postamt nach eingelaufenen Briefen für die Fürstin fragen lassen; das Postfräulein bitten, daß eventuell mit Abendzügen eingetroffene Briefe mit Eilbote herausgeschickt werden! – Seltsam ist die Zappeligkeit der Fürstin, diese Ungeduld wegen anscheinend mit außerordentlicher Sehnsucht erwarteten Briefe vom Filius. – Einstweilen geheimnisvolle Verhältnisse! Möchte wissen, was dem Filius, Muttersöhnchen vermutlich, eigentlich fehlt; kann aber die Kammerfrau Hildegard unmöglich fragen. Nette Leute diese zwei Diener mit so drolligen Steierernamen: Norbert Saurugger, Hildegard Schoiswohl! Prachtvoll! Aber Leute, die vollstes Vertrauen genießen, sich auffallend viel aus dem – Wurschtkessel nehmen dürfen, ohne daß Durchlaucht es verübelt. – Mitwisser? – Schade, daß Prinz Emil mit seinem Adjutanten Baron Wolffsegg schon nach Dresden abgereist war, als die neue ‚Hofdame‘ den Dienst antrat. Seit neun Tagen[S. 61] ‚Hofdienst‘! Wenn ein kleinadeliges Mädel kein Geld hat, nur ein bisserl Protektion, macht man sie zur Lady at court, auch Maid of honour oder gar Lady of the bedchamber genannt! ‚Bettzimmerfräulein‘ auf Deutsch. – Was ich wohl in dieser ‚Hofstellung‘ erleben werde? Rosige Hoffnungen habe ich nicht! Und vor dem ‚Dienst‘ als Begleiterin der Fürstin auf Bergtouren und gar auf Jagden graut mir jetzt schon! Unsereins darf sich doch nicht echauffieren, nie derangiert aussehen, soll immer propre sein... Wie das erreichen, wenn gekraxelt werden muß?! Überhaupt will es mir unsinnig erscheinen, daß Damen jaagern! Ob wirkliche Jagdpassion die Fürstin erfüllt? Oder handelt es sich nur um eine Laune? Oder wurde dieses Jagdgut für den Filius gekauft? Warum ist Prinz Emil aber dann nicht hier, warum kutschiert er im Lande herum? Sonderbar, höchst sonderbar! Es muß irgend etwas dahinter stecken. – Vielleicht kann man vom Grafen Thurn etwas erfahren? – Was wohl der Oberförster für ’ne Seele ist? Schmucker Mann, echter Jägertyp, Waldmensch, aus Eiche geschnitzt oder aus Granit gemeißelt. Einstweilen unbeholfen, rührend naiv, ein großes Kind. Doch nicht, der tiefe Ernst, die Strenge widersprechen solcher Auffassung. Vielleicht fürchtet er die neue Herrschaft? Jagdherr eine – Frau! Komisch muß das für den Jagdoberbeamten sein, wenn nicht unangenehm von wegen der Rücksichtnahme. – Großer Gott, das Jagdkleid! Was nur soll ich anziehen? Besitze ja nur ein Lodenkostüm! Werde nun doch gezwungen sein, in dieser Kleiderfrage die Frau Schoiswohl zu fragen; denn die Maid of honour muß doch genau so gekleidet sein wie die Gebieterin auf der Jagd!... Werde mich nie, nie mit der Jagd befreunden können! Niemals!“
Mit unsicherem trüben Wetter, doch ohne Regen, begann der erste Tag des „Hofdienstes“ in der Bergeinsamkeit für Fräulein von Gussitsch. Wohlige Stille, göttliche Ruhe. Erquickend die würzige Waldluft. Des unsicheren Wetters glaubte Martina sich freuen zu sollen, denn ein Jagdgang dürfte unter diesen Umständen nicht befohlen werden. Wahrscheinlich nach dem mittäglichen Lunch ein mehrstündiges Vorlesen oder sonstiges Unterhaltungsmachen. Darauf war Martina gefaßt.
Gegen zehn Uhr überbrachte die rundliche hübsche Frau Hildegard Schoiswohl die Mitteilung, daß Durchlaucht soeben den Forstwart holen ließ und die Begleitung der Hofdame wünschen.
„Wird denn gejagt?“ fragte überrascht Martina.
Die Kammerfrau erklärte: „Anscheinend nicht, denn Durchlaucht tragen Straßentoilette! Baronesse wollen in einer halben Stunde bereit sein!“
Notgedrungen mußte Fräulein von Gussitsch nun doch die Frage wegen der Jagdkleidung mit der Kammerfrau besprechen und Hildegards Hilfe erbitten.
Der Triumph leuchtete aus den Augen der hochbefriedigten Kammerfrau, nun doch von der Hofdame um Rat und Hilfe gebeten zu werden. Frau Schoiswohl fühlte sich, und ziemlich selbstbewußt erklärte sie,[S. 63] daß die Angelegenheit rasch erledigt sein werde, wenn die Baronesse einen Lodenrock fußfrei kürzen und den dazugehörenden Pantalon fort large anfertigen lasse. „Das in kürzester Zeit zu machen, bin ich gern bereit! Ich bitte nur um den nötigen Stoff!“
„Sie sind sehr freundlich! Aber Stoff zu einem Jagdkostüm führe ich nicht mit! An die Beschaffung hätte ich in Wien denken sollen! Was machen wir nun? So eine Verlegenheit!“
Im Tone der Bemutterung sprach die Kammerfrau: „So wie ich Durchlaucht kenne, wird es mit der Jagdausübung keine Eile haben, das Hauptinteresse ist auf den Posteinlauf konzentriert! Sollte wider Erwarten eine Jagd befohlen werden, so gibt es schon Mittel und Wege zur Verhinderung! Baronesse lassen inzwischen von Wien oder Graz Lodenstoff kommen, und ich werde dann schneidern! Wenn Sie wünschen, schreibe ich und beauftrage eine Verwandte mit der raschen Besorgung!“
„Ja, bitte, besorgen Sie alles Nötige, selbstverständlich komme ich für alle Kosten auf!“
„Wird gemacht!“ Es klang etwas arrogant, als die Kammerfrau noch darauf aufmerksam machte, daß die Baronesse zur Begleitung keine helle Bluse tragen dürfe.
„Frau Schoiswohl! Ich muß bitten...“
„Verzeihung, Baronesse! Es ist nicht Anmaßung, nur gut gemeint, wenn ich rate, dunkle Kleider zu tragen; Durchlaucht werden einen Reviergang machen! Helle Kleider würden das Wild beunruhigen! Durchlaucht kleiden sich stets dunkel auf derlei Waldwanderungen, demnach...“
„Ich verstehe! Danke!“
Devot und doch arrogant grüßend, entfernte sich die Kammerfrau, die sich freute, die junge Hofdame in[S. 64] Verlegenheit und Abhängigkeit gebracht zu haben. Und etliche Silberlinge werden bei der Stoffbesorgung zu verdienen sein.
Ärgerlich grub Martina ihre Marderzähnchen in die Unterlippe, während sie die Bluse wechselte und sich zum Ausgang rüstete.
Es kam aber gar nicht zu dem Waldbummel. Da die Forstbeamten nicht zu Hause waren, änderte Fürstin Sophie ihre Absicht und befahl eine Spazierfahrt nach Hall und Weng zur Besichtigung dieser Dörfer und ihrer Kirchen. Fräulein von Gussitsch und der unvermeidliche Kammerdiener Norbert sollten mitfahren. Norbert, der immer Steierertracht trug und trotz seiner fünfzig Jahre und des grauen Schnauzbartes in diesem Kostüm wie ein Junger aussah, schien die Ausfahrt nicht zu passen. Prüfend hielt er die Hände flach in die Luft, guckte zum grauen Firmament empor und schüttelte den Kopf so bedenklich, daß der grüne Ausseer Hut wackelte.
Dieses Manöver wiederholte der fesche Kammerdiener so lange, bis richtig wie erhofft die Fürstin vom Fenster aus sein Gebaren wahrnahm und herunterrief: „Was ist’s, Norbert? Glaubst du, daß wir schlechtes Wetter bekommen?“
„Zu dienen, Durchlaucht! Grobwetter, fürchte ich! Mir tun nur die armen Pferde leid, wenn sie in einen Wolkenbruch geraten!“
„Nein, nein! Die Pferde müssen geschont werden! Abbestellen, Norbert! Wir bleiben zu Hause!“
„Zu Befehl, Durchlaucht!“ Vergnügt ob des Gelingens seines listigen Manövers, bestellte Norbert die Ausfahrt ab. Und bis zum Lunch oblag er dem behaglichen dolce far niente in seiner Kammer. Dann frei[S. 65]lich mußte er die Tafel decken für drei Personen, denn Graf Thurn war zum Lunch geladen. Nachmittags gedachte der bequeme Kammerdiener einen länglichen „Schlaf zu tun“ und bis zum abendlichen Diner gründlich zu faulenzen, sich von der Reise zu „erholen“. Doch zwischen Kaviar und Sardinen ereilte Norbert der gemessene Befehl, nach dem Lunch nach Admont zu gehen und die Post zu holen.
Diskret flüsterte der geschulte Diener sein „Zu Befehl!“ Und als er der Fürstin die Silberplatte mit den gebräunten Kalbskoteletten reichte, fragte er mit hingehauchten Worten, ob er den Brief aus Dresden der Eile wegen zu Wagen bringen dürfe.
Was höhere Faulheit war, hielt die Fürstin für rührenden Diensteifer, für den guten Willen, den heiß ersehnten Brief mit großmöglichster Geschwindigkeit in die Bergeinsamkeit zu bringen. Hochbefriedigt von diesem Diensteifer, erteilte die Fürstin durch Kopfnicken ihre Zustimmung.
Noch weilten die Herrschaften bei Tische, da kam Forstwart Gnugesser in Wehr und Waffen schwitzend und mit hüpfendem Bäuchlein angesprungen. Amanda hatte dem von einem Reviergange heimgekehrten Gatten mitgeteilt, daß die Fürstin ihn zum Führer gewünscht habe. Nun war er da und wollte sich melden. Auf sein karges Mittagessen hatte Benjamin verzichtet, um die Fürstin nur ja nicht warten zu lassen. Nun hieß es aber für ihn geduldig warten und hungern.
Nach dem Lunch sprach Fürstin Sophie im Flur des Schlößls mit ihm, hörte seinen Bericht an, wonach in der „Gschwend“ ein schußbarer Hirsch mit einem Ovalgeweih stehe, der noch vor der Brunft abgeschossen werden müsse. Sie gab wegen dieses Hirsches keinen Be[S. 66]scheid und erklärte, daß auf die Führung Gnugessers wegen der unbeständigen Witterung verzichtet werde.
Die grenzenlose Gutmütigkeit veranlaßte Benjamin zu sagen: „Wohl wohl! Ganz wie Duhrlauch wünschen! Halt ein andermal! Wünsche wohl gespeist z’ haben! Empfehl mich g’horsamst!“ Zog sein Hütel und trug Bäuchlein, Rucksack, Hirschfänger, Büchsflinte, Bergstock und sein goldenes Herzelein zurück zum „Steinkasten“. Den fuchsigen Patriarchenbart teilten die leicht zitternden Finger in zwei große Wülste. Dies war das einzige Anzeichen dafür, daß Beni sich über die „Fopperei“ ein bisserl geärgert hatte. Als Gnugesser hungrig wie ein Wolf am „Steinkasten“ ankam, war der Patriarchenbart wieder geglättet und in Ordnung, der kleine Ärger verraucht.
Der von Norbert angekündigte Wolkenbruch kam nicht, nur etliche Regentropfen wagten die Fahrt zur Erde. Und dann guckte Frau Sonne für kurze Zeit in die Haller Bergeinsamkeit. Stolz wie ein Spanier fuhr Norbert nach Admont, selbstverständlich im Fond des Wagens sitzend.
Die Fürstin aber unternahm einen Talbummel, zum reizend gelegenen Sensenwerk am Fuße der „Haller Mauern“. Dann zurück. Um fünf Uhr Tee auf der Terrasse, Versuch einer Handarbeit seitens der Fürstin mit oftmaligem Blick auf das Sträßlein. Fräulein von Gussitsch häkelte gehorsamst und schwieg untertänigst. Graf Thurn war beurlaubt und weilte im „Steinkasten“, beschäftigt mit den Vorbereitungen zur befohlenen Fahrt nach Wien, um vergessene Sachen für die Fürstin zu holen.
Nach sechs Uhr kam Norbert zurück und überbrachte Zeitungen. Der erwartete Brief aus Dresden war nicht eingelaufen.
Seufzend, mit einer Kummerfalte auf der Stirne, machte sich Fürstin Sophie an die Lektüre. Verzichtete aber bald.
„Darf ich vielleicht vorlesen?“ fragte dienstbereit Martina.
„Danke! Ich werde bis zum Diner etwas ruhen! Sorgen Sie bitte dafür, daß nur zwei Gänge serviert werden, alles übrige streichen! Danke, werde allein hinaufgehen!“ Freundlich nickend zog sich die Fürstin zurück.
Mitleidsvoll blickte Martina der Frau nach. Und dann begab sich auch das Hoffräulein auf das Zimmer.
Kaum zwanzig Minuten währte das Diner, zu dem Graf Thurn nicht geladen war. Dann hatte der Dienst für Martina ein Ende für diesen Tag in der Haller Bergeinsamkeit. Huldvolle Entlassung mit Handkuß, tiefer Knicks. „Geruhsame Nacht, Durchlaucht!“
Ein wehmütiges Lächeln, ein gütiges Kopfnicken. Sophie von Schwarzenstein zog sich mit ihrem Kummer zurück. Im Schlafzimmer harrte ihrer die unentbehrliche Hildegard.
*
Der Wind blies durch das Admonter Ennstal und zwang in den etwas sumpfenden Niederungen Schilf und Riedgräser zu respektvollsten Verbeugungen. Reingefegt war das Firmament, kahl und klar starrten die vielen Felsriesen in den lichten Himmelsdom: weißbestreut die Spitzen der „Haller Mauern“, rechts der Enns die wuchtigen Türme des „Sparafeld“, der „Reichenstein“, das „Hochtor“ und die vielen Bergkolosse, die sich zusammendrängen, um das berühmte „Gesäuse“, eine gigantische, von der tosenden Enns[S. 68] durchflossene Felsenwildnis, zu bilden. Inmitten des lieblich grünen, bergumrahmten Admonter Talbeckens erhebt sich zur Höhe von siebenzig Metern das schlanke, doppeltürmige St.-Blasius-Münster, die elegante Domkirche im gotischen Stile, umgeben von den quaderngefügten Gebäuden des uralten, von vielen Schicksalsschlägen heimgesuchten Benediktinerstiftes Admont.
Wie liebkosend umspielten die Sonnenstrahlen diese Stätte emsigen Fleißes, der Gelehrsamkeit, der Wohltätigkeit und klösterlichen Arbeit.
Der im Jahre 1074 gegründeten, im Laufe der Jahrhunderte durch wissenschaftliche Tätigkeit hochberühmt gewordenen Benediktinerabtei, an die sich die Häuser des Marktfleckens Admont schmiegen wie Küchlein um die Mutterhenne, galt der Besuch der Fürstin Sophie von Schwarzenstein.
Im munteren Trabe eilte der fürstliche Wagen dem einzig schön gelegenen, imposanten, vornehme Ruhe kündenden Stifte zu. Im Fond saßen die Fürstin Sophie und das Hoffräulein von Gussitsch, beide in schwarze Seide gehüllt, auf dem Rücksitze Graf Thurn. Auf dem Bock neben dem Kutscher der unvermeidliche Norbert in der schmucken Steierertracht. Die Diener ganz Würde, schier spanische Grandezza.
Im Anblick der im Süden aufgetürmten Bergkolosse und des herrlichen Münsters vergaß die Fürstin der nagenden Sorgen, auftauend pries sie die Schönheit des Gotteshauses inmitten des entzückenden Geländes. Und Graf Thurn mußte rasch über die Geschichte des Stiftes einige Informationen geben. Marschallsaufgaben, auf die der gewandte Beamte sich ahnungsvoll vorbereitet hatte und deren er sich aalglatt entledigte. Und mit Eleganz verstand Graf Thurn das Interesse der Frau[S. 69] für einen Novizen des Stiftes zu erwecken, indem er erzählte, daß ein junger Kleriker mit Jägerblut in den Adern schwer ringe und kämpfe, um die Jagdleidenschaft zu bezwingen bis zum Tage der für das ganze Leben entscheidenden Profeßablegung.
Für einen Moment wich die Farbe aus dem Antlitz der Fürstin, die Wangen wurden kalkig, das Haupt sank um etliche Zoll tiefer wie in jäher Betroffenheit und weher Erinnerung. Doch sogleich richtete sie sich auf, eine leichte Röte schoß in die Wangen, und voll Interesse rief sie: „Was Sie sagen! Ein Novize, also ein eingekleideter Kleriker, von Jagdpassion erfüllt, Sohn eines Berufsjägers! Und für immer entsagen müssen! Den jungen Mann möchte ich kennenlernen, mit ihm sprechen! Bitte, veranlassen Sie, lieber Graf, das Weitere!“
Der Wagen rollte schnell die Hauptgasse des saubergehaltenen Marktfleckens entlang, die Bewohner grüßten respektvoll den – Kammerdiener.
Am Portal der Prälatur harrte Pater Wilfrid in seiner offiziellen Eigenschaft als Gastmeister des Stifts, neben ihm ein Klosterfrater, des hohen Gastes.
Bei der Anfahrt winkte Fürstin Sophie dem Pater huldvoll grüßend zu, ersichtlich in bester Stimmung. Und Wilfrid erwies Reverenz durch eine tadellose Verbeugung.
Ein Ruck, die Pferde standen mit schlagenden Flanken. Norbert flog vom Bock wie ein Blitz und riß den Schlag auf.
Die breite Steintreppe auf weichem Teppich hinansteigend, sprach die Fürstin von dem vorzüglichen Eindruck, den zunächst äußerlich das Münster wie die Stiftsgebäude hervorrufen.
Pater Wilfrid bat, es wolle Durchlaucht sich noch eine Treppe höher bemühen, an der Prälatur erwarten Seine Gnaden der Herr Abt den hohen Besuch.
„So feierlich? Wohl vorschriftsmäßige Empfangsetikette? Aber unnötig! Privater Besuch, diktiert von regstem Interesse, wobei eine gewisse Sympathie mitspielt, denn mein ‚Hofpfarrer‘ ist ja Admonter Stiftsherr!“
„Untertänigsten Dank, Durchlaucht, für so viel Huld und Gnade! Ganz nach Vorschrift kann sich der Empfang des hohen Gastes leider nicht vollziehen, da unser Prior verreist ist, also nicht zur Reverenzerweisung erscheinen kann! Alles übrige im Programm wird hoffentlich klappen!“
„Was? Ein ganzes Programm? Mea culpa, ich hätte besser getan, den Besuch nicht anzukündigen, die Stiftsherren zu überrumpeln, um das Vergnügen einer ‚sweet disorder‘ genießen zu können!“
„Es ist keineswegs ausgeschlossen, daß Durchlaucht trotz der Besuchsansage dieses ‚Vergnügen‘ dennoch teilhaft werden können, denn unsere Camerieri sind nicht höfisch geschult, ils travaillent pour le bon Dieu und – entbehren der Grazie!“ Wilfrid spitzte den Mund, als wollte er Honig schlürfen, und blinzelte dazu.
Kichernd ging Sophie auf den Scherz ein und rief: „Milch geben, viel Milch den Leuten!“
Der Fürstin folgten Graf Thurn und Fräulein von Gussitsch. Der Hausmarschall flüsterte: „Gottlob, die Stimmung ist vortrefflich!“
An der zur Prälatur führenden Flügeltüre stand die hohe Gestalt des Abtes Beda. Ein Vierziger im Galahabit, auf der Brust die goldene Kette des Summus Abbas. Schlanke Eleganz der Erscheinung, Würde[S. 71] und Noblesse, durchgeistigt die Gesichtszüge, Ruhe und Milde im Blick. Die feine, hohe Gestalt gleichsam umweht von Höflichkeit und Toleranz. Ein Idealpriester, von Liebe, Vertrauen und Hochachtung der Mitbrüder im Konvent erkoren und erwählt zur höchsten Würde, die das Kapitel zu vergeben hat. Primus inter pares. Mit weltmännischer Ehrerbietung begrüßte Abt Beda die Fürstin und hieß sie unter Dankesversicherungen für den auszeichnenden Besuch willkommen.
Den Begleitern wurde eine höfische Verbeugung gewidmet, indessen Sophie den Grafen Thurn und ihre Hofdame vorstellte.
Die erste Besichtigung galt der berühmten Bibliothek, einer Sammlung von 80000 Bänden, von über 1100 Handschriftenbänden und fast 1000 Inkunabeln.
Die Führung übernahm hier der Archivar und Bibliothekar Pater Leo, ein großer, breitschulteriger Mönch in strammer Haltung, dem der Offizier aus den Augen leuchtete. Und ein Schmiß im freundlichen Gesicht verriet den früheren Studenten.
Mit ersichtlichem Wohlgefallen und vielem Interesse wandte sich Sophie diesem Benediktiner zu, der es ausgezeichnet verstand, alles für Damen Überflüssige und Uninteressante auszuscheiden und knapp nur auf das Wichtigste aufmerksam zu machen.
Die üppigen Formen der italienischen Spätrenaissance des prachtvollen, durch zwei Stockwerke reichenden Saales, die herrlichen Fresken und Deckenbilder, welsche Kunst und deutsche Skulpturen nahmen die Fürstin sofort gefangen und lösten Rufe der Bewunderung aus. Zur Erklärung der Bildhauerarbeiten des Meisters Stammel, für die Hinweise auf die drolligsten Burlesken, auf weihevolle Stimmung und beißenden Witz,[S. 72] auf olympische Schönheit und bäuerliche Derbheit in den Schnitzereien war Pater Leo der richtige Mann, dessen trocken witzige Bemerkungen die hohe Frau höchlichst belustigten und auch Fräulein von Gussitsch zum Kichern brachten.
Für die Manuskriptfragmente aus dem achten und neunten Jahrhundert setzte der Bibliothekar kein Interesse voraus, aber auf das kostbare prachtvolle Missale aus dem zwölften Jahrhundert machte er aufmerksam, ebenso auf die handschriftliche Reisebeschreibung des Marco Polo.
Vor diesem interessanten Manuskript im Glaskasten blieb die Fürstin stehen und sprach: „Wie ist es nur? Von dem uralten Zeug versteh’ ich nichts, dennoch klingt der Name so bekannt, ja modern! Haben Hochwürden dafür eine Erklärung?“
Pater Leo, ein Schalk wie sein Kollegissimus Wilfrid, verzog keine Miene, verbeugte sich leicht und erwiderte: „Durchlaucht wollen in Gnaden an die höchstmoderne – Teesorte Marco Polo denken!“
„Ach ja! Das ist es! Danke bestens!“ Zufällig blickte Sophie dem in ihrer Nähe stehenden Pater Wilfrid ins Gesicht, der abermals die Lippen gespitzt hatte. Auflachend drohte sie dem Gastmeister mit dem Zeigefinger: „Sano compatrioti, ein Schalk ärger wie der andere! Aber liebenswürdige Herren, die Gott sei Dank gar nichts – Spanisch-Inquisitorisches an sich haben! Was meint mein ‚Hofpfarrer‘?“
Wilfrid erwiderte respektvollst und strohtrocken: „Durchlaucht haben immer recht! Im Stift spricht nur einer Spanisch, nämlich ich, und zwar kann ich nur die wenigen Worte: beso la mano! Mehr ist vom Übel!“
Der Reihe nach wurden die herrliche Kirche, der Stiftsgarten und Keller besichtigt, und zwar unter Führung des Abtes. Als Sophie dann den Wunsch aussprach, die Klosterküche anschauen zu dürfen, tauchte als Cicerone wieder Pater Leo auf und sprach verbindlichst: „Darf ich bitten, sich abermals meiner Führung anzuvertrauen?“
Die Fürstin rief verdutzt: „Nanu?! Was hat denn den Archivar und Bibliothekar die Klosterküche zu kümmern?“
„Zu dienen, Durchlaucht! Ich bin nämlich auch noch der Pater Kuchlmeister, der im Schweiße seines Angesichts für die Mägen der Stiftsherren zu sorgen hat! Und hoffentlich verschmähen die hohen Herrschaften die von mir bereitgestellte Jause in der Prälatur nicht!“
„Archivar, Bibliothekar und Kuchlmeister, köstliche Zusammenstellung!“
„Köstlich finde ich diese cumulatio gerade nicht!“
„Was sind Sie denn noch alles?“
„Die Bauern von Weng muß ich zum Himmel führen, so wie der Pater Wilfrid in Hall!“
„Ein vielbeschäftigter Mann!“
Pater Leo versicherte, man habe die Förderung des geistigen und leiblichen Wohles der Stiftsangehörigen absichtlich in eine Hand gelegt, auf daß – nicht zuviel des Guten auf beiden Seiten geschehe...
Die Damen lachten vor Vergnügen über diesen Scherz.
Graf Thurn verabschiedete sich; für ihn war die Stunde der Abreise nach Wien gekommen.
In der Prälatur, den Wohnräumen des Abtes, angekommen, sprach die Fürstin die Bitte aus, es möge ihr der „Novize mit dem Jägerblut“ vorgestellt werden.[S. 74] Zugleich bat sie den Abt um Mitteilung der Verhältnisse. „Kann ich etwas zugunsten und zum Nutzen des jungen Mannes tun, so bitte ich, es mir zu sagen!“
Abt Beda geleitete die Fürstin in das Empfangszimmer, während Fräulein von Gussitsch und die Stiftsherren Wilfrid und Leo in das für hohe Gäste bestimmte Speisezimmer der Prälatur traten.
Abt Beda teilte der Fürstin mit, daß der Novize Nonnosus ein übereifriger Student und beflissen sei, durch strenge Aszese der Jagdleidenschaft Herr zu werden. Dadurch schädigte der Novize seine Gesundheit in nicht unbedenklichem Maße. Väterliche Ermahnungen zur Einschränkung der selbstgewählten Aszese und des übereifrigen Studiums hatten keinen Erfolg. „Ich bin nun gerne geneigt, dem braven Novizen Erholung und Zerstreuung zu gönnen und sogar eine Ausnahme zu gestatten! Nur will es mir fraglich erscheinen, ob beispielsweise eine Beteiligung am Jagdvergnügen bei dem Novizen den seelischen Zustand bessern wird oder kann! Die Möglichkeit soll ja nicht bestritten werden! Anderseits kann die Ausübung der Jagd die Leidenschaft erst recht steigern!“
Fürstin Sophie fragte sehr interessiert: „Ist denn einem Kleriker die Jagdausübung überhaupt gestattet?“
„Um das Decorum clericale und namentlich die spezifisch klerikalen Tugenden zu wahren, sollen sich, gemäß den kirchlichen Bestimmungen, Geistliche gewissen Vergnügungen entschlagen! Direkt und streng verboten ist die Jagd mit Hunden und Falken, die Venatio clamorosa, das ist die lärmende Jagd! Die Kanonisten folgerten aus diesem strikten Verbot, daß die Jagd mit Netzen oder die Pirsche, die Venatio quieta, den Geistlichen erlaubt sei! Für diese Unterscheidung der[S. 75] Jagdarten scheint sogar das Konzil von Trient zu sprechen! Selbstverständlich können die Bischöfe jegliche Jagdart verbieten!“
„Was ist daraus zu folgern?“
„Wenn ich wüßte, daß ein kurzes, auf einige Tage beschränktes Jagdvergnügen dem Novizen gesundheitlich nützen und psychisch nicht schaden würde, wäre ich geneigt, ausnahmsweise die Erlaubnis zu erteilen! Der Aufenthalt in der Höhenluft dürfte dem armen jungen Manne sicher gut tun!“
„Unter diesen Umständen bitte ich, mir den Novizen in Zivilkleidung nach Hall zu senden! Ich werde ihn mit hinaufnehmen, etwa zur Pyrgashütte, und dort pirschen lassen! Dort oben hat er Höhenluft! Und vielleicht gewährt die nun doch ermöglichte Jagdgelegenheit eine Beruhigung der aufgewühlten Nerven! Der Mensch wünscht am heißesten das, was er nicht bekommen kann! Die Jägerei wird für den Novizen sofort an Wert und Lust verlieren, wenn er sie ausgiebig betreiben kann! Er soll nach Herzenslust Gemsen schießen, ich gönne ihm diese Freude! Ja, ich bin nun überzeugt, daß die Jagdleidenschaft durch reichliche Abschußerlaubnis sich vermindert und ganz verschwindet! Also, mit Ihrer Zustimmung, machen wir das interessante Experiment! Senden Sie mir demnächst den jungen Kleriker nach Hall, ich werde das Weitere veranlassen! Auf die Vorstellung jetzt verzichte ich!“
Mit aller Ehrerbietung und doch herzlich dankte der Abt für diesen Huldbeweis. Und dann geleitete er die Fürstin in das Speisezimmer, wo die Hofdame und die beiden Stiftsherren warteten.
„Nun rasch eine kleine Jause zur Stärkung! Ich möchte nicht länger stören!“ Kaum hatte die Fürstin[S. 76] Platz genommen, beeilte sich der Gastmeister Pater Wilfrid Flaschenwein zu kredenzen.
„Wie? Wein?“ rief die Fürstin überrascht, „Pater Wilfrid behauptet doch, daß die Stiftsherren auf Grazie und Geist halten, also – Milch trinken und sich von Eiern nähren!“
„Ganz richtig! Tun wir auch – zuweilen! Den hohen Gästen reichen wir aber Wein trinkbarer Sorte aus unseren Weingärten!“
Ein Frater servierte kalten Aufschnitt und Schinken in einer auffallenden Befangenheit, und zwar nur den Damen.
Die Stiftsherren saßen zwar am Tische, nahmen aber nichts zu sich, da just an diesem Tage das Gebot: jejunium, Enthaltsamkeit, nur einmalige Sättigung, zu befolgen war, ein Gebot, das sich selbstverständlich nicht auf die Klostergäste erstreckt. Pater Wilfrid, als Mann von Takt, bemühte sich, durch ein Gespräch zu verhüten, daß die Fürstin auf diese pflichtgemäße Enthaltsamkeit der Klosterangehörigen aufmerksam werde. Er sprach von jener ‚sweet disorder‘, jener „süßen Unordnung“, die stets dann eintrete, wenn hoher Besuch im Hause weile, da die Domestiken sich mit Vorliebe zu – drücken pflegen. „Auch heute ist es der Fall! Ich muß daher inständig um Entschuldigung bitten, daß ein im Servierdienst ungeschulter Frater die hohen Gäste in wenig genügender Weise bedient!“
„Aber nein! Der Frater macht seine Sache ganz vortrefflich!“ Und nun gewahrte die Fürstin die Enthaltsamkeit der Herren. „Warum greifen denn die hochwürdigen Herren nicht zu? Frater, servieren Sie, bitte, den Stiftsherren!“
Nun war doch eingetreten, was Pater Wilfrid hatte[S. 77] verhüten wollen. Und die Verlegenheit machte der Frater vollständig, als er der Fürstin wichtigtuend zuflüsterte: „Wir haben jejunium!“
„Was haben Sie?“
„Fasttag haben wir!“ platzte der Klosterbruder heraus. Ein Wink des Abtes veranlaßte den Pechvogel, schleunigst zu verschwinden.
Die Fürstin erhob sich, dankte für die liebenswürdige Bewirtung und bat um den Wagen.
Unter Beachtung des üblichen Zeremoniells vollzog sich die Verabschiedung.
Schon zogen die Pferde an, da ließ die Fürstin anhalten und bat den Gastmeister, dafür zu sorgen, daß jener Frater nicht – bestraft werde. „Milde üben, ja!“
„Zu Befehl, Durchlaucht! Ich werde es dem Herrn Abte melden!“
„Vielen Dank! Auf baldiges Wiedersehen!“
Nun rollte der Wagen über den Hof und bog in die Hauptstraße ein. Norbert auf dem Bock drehte sich um und meldete der Gebieterin, daß er die Post bereits geholt habe. Wissend, wie sehnsüchtig Durchlaucht einen Brief aus Dresden erwartete, griff Norbert in die Tasche, um den Brief zu überreichen.
Mit einer leichten Handbewegung wehrte die Fürstin ab. Wunderbar wußte diese Frau sich zu beherrschen. Aber auch Norbert wußte, was er zu tun hatte. Zum Kutscher sagte er: „Schnell fahren!“
Hinter der Ennsbrücke wurde ein rasendes Tempo genommen, eine wilde Jagd begann, die ein Sprechen der Wageninsassen unmöglich machte.
Sophie hatte aber gar nicht die Absicht, zu sprechen. Mit geschlossenen Augen, bleich vor Erwartung, saß sie im Wagen und ließ sich rütteln und stoßen.
Fräulein von Gussitsch klammerte sich mit beiden Händen an den Rand des Wagenschlages, um nicht an die Fürstin geschleudert zu werden. Den Zweck dieser tollen, rasenden Fahrt: die Zeitverkürzung, begriff sie. Aber lebensgefährlich war diese Ersparnis weniger Minuten doch.
Martina atmete auf, als der Wagen vor der Villa hielt.
„Ich sehe Sie bei Tische, bis zum Diner sind Sie frei, liebe Gussitsch!“ sprach die Fürstin und schritt, von Norbert gefolgt, ins Haus. Nun doch fast zappelig, nervös, aufgeregt. Zwei Stunden hatte Martina Zeit, um sich Gedanken zu machen und Fragen zu stellen, was denn eigentlich dieser Sorgen bereite und weshalb die Fürstin einsam in dieser Weltabgeschiedenheit weile, der Sohn aber auf Reisen sei. Warum die Trennung?
Aus dem Verhalten der Fürstin bei Tische konnte Martina nicht klug werden. Sie war einsilbig, wachsbleich, gedrückt. Manchmal öffnete sie die Lippen, als wollte sie sprechen, sich durch eine Mitteilung von seelischem Druck befreien. Aber es kam kein Wort. Ein Ringen nach einem Entschlusse. Beängstigende Stille. Dann ein Wink; Norbert verschwand aus dem Speisezimmer.
Und nun richtete Fürstin Sophie an Fräulein von Gussitsch die Bitte, dem Baron Wolffsegg, dem Begleiter des Prinzen Emil, zu schreiben, es möge der Adjutant sorgsamst kontrollieren, mit wem der Prinz verkehre...
Martina traute ihren Ohren nicht und wagte es auch nicht, einen forschenden Blick auf die Gebieterin zu richten.
Leise sprach die Fürstin im Tone der besorgten Mut[S. 79]ter: „Es ist mein Wunsch, daß Wolffsegg Leute fernhalte, die meinen Sohn übel beeinflussen könnten!“
„Zu Befehl, Durchlaucht!“
„Verstehen Sie mich, bitte, recht! Schonend schreiben! Es soll dem Baron kein Vorwurf gemacht werden, um Himmels willen nicht! Wolffsegg ist ja ein tadelloser Kavalier, eine treue Seele, seit Jahren bewährt! Also nicht die Spur einer Rüge! Höchste Vorsicht, die ja auch wegen der Eigenart meines Sohnes geübt werden muß!“
Martina richtete nun einen verschüchterten Blick auf die bleich gewordene Fürstin. Und bebenden Tones sprach die ängstlich und unsicher gewordene Hofdame davon, daß sie den Brief mit denkbar größter Vorsicht entwerfen, das Konzept zur höchsten Genehmigung unterbreiten werde.
„Die Unterbreitung ist nicht nötig! Sie besitzen ja Taktgefühl, liebe Martina! Ich bin überzeugt, daß Sie den Brief ganz nach Wunsch konzipieren werden. Leicht wird es freilich nicht sein! Größte Vorsicht, denn es besteht die Gefahr, daß Wolffsegg die Bitte verübelt, in mißverständlicher Auffassung mit dem Prinzen darüber spricht und daß dadurch mein Sohn sich verletzt fühlt!“ Ein tiefer Seufzer der Sorge folgte diesen Worten.
Wieder trat eine Pause ein. Die Fürstin schien zu überlegen oder sich in wehmütige Erinnerungen zu vertiefen.
Angesichts dieser Situation wünschte Martina sich auf eine einsame Insel im Indischen Ozean, möglichst weit weg von dem fürstlichen Jagdschlößl...
Sophie richtete sich etwas auf und sprach leise, unsicheren Tones: „Sie kennen meinen Sohn noch nicht![S. 80] Sie sind ja erst nach seiner Abreise in meine Dienste getreten! Ich muß Sie deshalb einigermaßen informieren, daß mein Sohn – leider Gottes – apathischer Natur ist! Blasiertheit kann man seinen Seelenzustand nicht nennen, vielleicht liegt ein ungewöhnlicher Mangel an jeglichem Lebensinteresse vor! Zum Zwecke einer sozusagen geistigen Aufrüttelung ist die Reise zunächst nach Dresden angetreten worden! Mein armer Sohn sollte aus dem Bereich der Wiener Luft gebracht werden...! Neue Menschen und vielleicht auch – Frauen soll er kennenlernen! – Können Sie die Sorgen einer angsterfüllten Mutter verstehen, liebe Martina? Sie sind allerdings noch sehr jung, immerhin ein weibliches Wesen! Frauen können sich verstehen oder doch in derlei Situationen hineindenken!“
„Zu dienen, Durchlaucht!“ Mehr konnte Martina beim besten Willen nicht sagen. Und unmöglich fragen, welche Bewandtnis es mit dem Dresdner Briefe habe, der anscheinend so große Sorgen wachrief.
Sophie strich sich mit der schmalen Rechten über die Stirne. „Wenn ich vorhin davon sprach, daß wir ein geistiges Erwachen erstreben, so muß diese vertrauliche Bemerkung ergänzt werden, und zwar dahin, daß mein Sohn in Dresden etwas aufgewacht ist! Mehr als mir lieb ist, zu meinem Schrecken! Was Emils Brief an mich beweist! An sich ist dieses Aufwachen gewiß erfreulich als Zeichen dafür, daß Emil sich für Menschen zu interessieren beginnt, die Apathie abgestreift hat!“
Wieder trat eine Pause ein. Sophie sann und überlegte.
Im Speisezimmer war es dunkel geworden. Den Wald umwoben die Schatten der aufziehenden Sommernacht.
Nach einer Weile zog die Fürstin den ihr so kostbaren Brief aus der Tasche und sprach: „Für eine Nacht werde ich mich von diesem Dokument doch trennen müssen, denn es erscheint mir zwingend nötig, daß Sie, liebe Martina, den Brief lesen, sich ein eigenes Urteil bilden! Genau informiert und orientiert, werden Sie dann auch imstande sein, den Brief an Baron Wolffsegg meinen Intentionen entsprechend zu verfassen! Ein Beweis besonderen Vertrauens, hören Sie, Martina, ganz besondere Vertrauenssache! Lesen Sie in heutiger Nacht Emils Brief, bilden Sie sich ein objektives Urteil! Morgen früh zehn Uhr bringen Sie mir den Brief unauffällig und unsichtbar! Hildegard wird verständigt sein und Sie, nur Sie, vorlassen! Hier, liebe Martina! Sie bürgen mir für die prompte Rückgabe des Dokumentes, ja?“
„Zu Befehl, Durchlaucht!“ Martina nahm die Oktavbogen entgegen und versenkte das knisternde Papier in ihre Tasche.
„So, nun gute Nacht, liebe Gussitsch! Strengste Diskretion! Gute Nacht!“
„Geruhsame Nacht, Durchlaucht!“ Martina waltete ihres Amtes und klingelte.
Hildegard erschien mit Licht und begleitete die Gebieterin in ihre Zimmer.
Martina durfte allein ihr Kämmerlein aufsuchen.
Nie in ihrem jungen Leben hatte Fräulein von Gussitsch so flink Licht gemacht als jetzt, um schnell zur Lektüre des Briefes zu kommen.
Etwas enttäuscht, aber doch von dieser Lektüre belustigt, kicherte Martina. Unbegreiflich fand sie die Auffassung der Mutter über diesen Brief. Soviel wie gar keinen Anlaß zu Sorgen. Ungewöhnlich war allenfalls[S. 82] die Ausdrucksweise. Martina fand die Epistel weit mehr witzig, denn derb. Sicher ein vollgültiger Beweis dafür, daß das bisher apathische, blasierte Prinzlein in der Dresdener Luft wach geworden ist und recht gut zu beobachten versteht. Und eine gewisse Federgewandtheit ist ihm nicht abzusprechen. An sittengefährdenden Umgang mit bösen Menschen war gar nicht zu denken! Außerdem sollte er sich doch eine Frau suchen!
Der Auftrag, dem „Zwetschgenbaron“ Wolffsegg im Sinne der Fürstin zu schreiben, hatte nach der Lektüre des Emilschen Briefes viel von seinen Schrecken verloren. Martina erwog nur noch, ob es möglich sein werde, die Fürstin zu überreden, gar nicht schreiben zu lassen.
Vergnügt kichernd, begab sich das zierliche Hoffräulein zu Bett.
*
Es half am anderen Morgen alles nichts, Martina erhielt den Befehl, dem Baron Wolffsegg zu schreiben. Was alles die Fürstin noch beifügte, ließ Fräulein von Gussitsch erkennen, daß der Hofdame die Verantwortung aufgehalst werden sollte für den Fall, daß Wolffsegg die Warnungs- und Rügeepistel krumm nimmt. Martina soll das – Prügelmädchen sein in Ermangelung eines Prügelknaben.
Ein mehrstündiger Eiertanz mit der Feder, bis das Brieflein glatt und säuberlich geschrieben war. Höchst vorsichtig und fein, klug und gewandt; und mit einem salvierenden Hinweis auf – „höchsten“ Wunsch... Diesen Hinweis konnte sich die Hofdame leisten, da ja[S. 83] die Fürstin jegliche Kenntnisnahme des Konzeptes und Briefinhaltes abgelehnt hatte.
Also lief die Epistel nach Dresden...
Obwohl nicht befohlen, meldete sich gegen Mittag der Forstwartpatriarch zum Rapport und erbat Gehör bei der Gebieterin. Gnugesser wollte endgültigen Bescheid wegen des „Oval“hirsches haben.
Weder Norbert noch Hildegard, die Vertrauenspersonen, zeigten Lust, den Beamten anzumelden, obwohl der gutmütige Forstwart sehr nett und höflich um „Wohlwollen und Gnade“ bat und die Kammerfrau Hildegard Witwe Schoiswohl sogar mit „gnä Frau“ titulierte. Half alles nichts, denn Hildegard wollte die heute übelgelaunte Gebieterin durch Anmeldung des Forstbeamten nicht belästigen, sich keinem Verweise aussetzen.
Der Zufall war wohlwollender. Fürstin Sophie unternahm vor dem Lunch einen Spaziergang, sah am Hause den wartenden Beamten und fragte nach seinen Wünschen.
Gnugesser erklärte in aller pflichtschuldigen Ehrerbietung, doch mit Bestimmtheit: „Halten zu Gnaden, Duhrlauch, der Hirsch mit dem häßlichen Ovalgeweih muß weg, und zwar noch vor Brunftbeginn, auf daß eine Vererbung verhindert wird! Wenn gnädig Duhrlauch den Kerl nicht selber – wegputzen wollen, erlauben S’s vielleicht, daß ich ihn abschieße?!“
„Aber keine Idee! Ich finde diese Ovalform sehr interessant! Dieser Hirsch muß unbedingt erhalten bleiben!“
In Gnugessers Äugelein lag mehr als Staunen, völlige Verblüffung und Ratlosigkeit! Und nicht wenig Verdruß über die Weiberwirtschaft im Jagdbetriebe.[S. 84] Die Abschußverweigerung konnte Benjamin leicht verwinden; den Wald- und Jagdbeamten berührte es aber schmerzlich, daß auf ausdrücklichen Befehl ein Revierverschandler, ein die Geweihbildung verhunzender Hirsch gar geschont werden sollte.
Benis Mund weitete sich bis zu den beiden Ohrläppchen, als die Fürstin mitteilte, daß ein Admonter Theologe im Revier Gstattmaier-Hochalp und in der „Sauwiel“ pirschen und Gams in unbeschränkter Anzahl schießen dürfe. „Melden Sie das dem Oberförster! Adieu!“
Soviel das Bäuchlein es gestattete, verbeugte sich Gnugesser. Dann aber stülpte er mit einer besonderen Energie das zerzauste Hütel auf sein Haupt und trottete heim. Mit heiliger Entrüstung in der Weidmannsbrust, mit Zorn in der Kinderseele.
Knirschend stieß Beni hervor, – hübsch weit entfernt vom Jagdschlößl –: „Toll wird’s, ganz narrisch! Weiber im Revier, o Graus! Und jetzt gar auch – Theologen! Höher geht’s nimmer! Kutten und Gams! Mir gangst!“ Und der herzensgute, kindlichfromme Forstwart fluchte...
Die Abwesenheit der Gattin zur Mittagszeit war auch nicht geeignet, die üble Laune Benis zu bessern. Blieb ihm nichts anderes übrig, als selbst zu kochen: Spiegeleier und Salat dazu. Mehr von der Kochkunst war nicht sein eigen.
Vergeblich fragte er sich, was denn zur Mittagszeit um Himmels willen Amanda auswärts zu tun haben könne. Mehrmals war die Gattin schon abwesend. Eine auffallende Pflichtvernachlässigung und Rücksichtslosigkeit!
Lange konnte sich Gnugesser derlei Fragen nicht hingeben; er mußte nach Tisch wieder in den nimmerruhenden Dienst.
Zum Abend war Amanda allerdings zu Hause, das schlecht gekochte Essen bereit; die Gattin war aber nicht geneigt, Aufschlüsse über ihre Abwesenheit zu geben. Da sie indes versicherte, sich unlieb verspätet zu haben und just heimgekommen zu sein, wie Beni nach Tisch in das Revier ging, ließ sich der herzensgute Mann leicht beschwichtigen.
Leicht gelang der Gattin der Themawechsel durch die Frage, was es Neues in den Revieren gäbe.
Bei Gnugesser war indes der Ärger schon verraucht; vor Amanda wollte er nicht über die Fürstin reden, schimpfen erst recht nicht. Ein einzig und winzig Würmchen nagte allerdings noch gar emsig in der Brust: der Neid! Den Beamten bleibt ein Abschuß versagt, der Theologe hingegen darf Gams nach Herzenslust niederknallen. Beni war gar nicht leidenschaftlicher Jäger, ganz frei von Schießwut; wegen der Abschußerlaubnis beneidete er den Theologen aber doch, den er, der fromme, kirchenfreundliche Beamte, in allergeheimsten Gedanken einen „Schleicher“ und „Kittelpfaffen“ genannt hatte. Denn es war doch gar nicht zu bezweifeln, daß der Theologe die Abschußerlaubnis „erschlichen“ haben mußte. Kittelprotektion! Weiberwirtschaft im Revier!
„Friert dich in der Zung, weil ich keine Antwort auf meine Frage bekomm?“ klang es spitz von den Lippen Amandas.
Gutmütig lachte Beni: „Nein, nein! Ist ja Sommer! Nur Gedanken hab’ ich mir gemacht, weil – na, ist Dienstsache, also Amtsgeheimnis! Neues gibt es nichts! Nicht einmal Bescheid haben wir wegen der definitiven Übernahme beim alten Gehalt!“
Schnippisch warf Amanda das Wort „Amtsgeheimnis“ hin. „Lächerlich das Verschanzen hinter das Dienst[S. 86]geheimnis, wo doch eine Frau regiert und dirigiert! Da werden die Amtsgeheimnisse strengstens gewahrt bleiben! Übrigens: was das Gehalt anbelangt, muß unbedingt eine Aufbesserung eintreten!“
„Die Aussichten sind dazu nicht gut! Kein Darandenken!“
„Im Gegenteil: davon reden, und das bei nächster Gelegenheit!“
„Um Gottes willen nicht, Weiberl! Es könnt die Fürstin verschnupfen! Wo sie eh nicht in rosiger Laune ist und auch noch gspaßige Ansichten vom Jagdbetrieb hat!“
„Ich bin keine Klosterfrau, also laß ich mir das Reden nicht verbieten! Ich werde mir die Fürstin schon fürifangen! Frau zu Frau redet sich viel leichter, als wenn ein Mannsbild dabei ist!“
„Warum bist du denn so erpicht auf eine Gehaltsaufbesserung? Du profitierst ja davon doch nichts, direkt wenigstens nicht!“
„Der Herr Forstwart irrt sich da aber ganz gewaltig! Ist übrigens egal, ob Aufbesserung oder nicht: die Frauenarbeit im Ehestande muß von nun an bezahlt und gelohnt werden! Mit Bargeld!“
Beni lachte, daß sein Bäuchlein hüpfte und Lachtränen aus den Augen sprangen. Und übermütig zitierte er den Wiener Gassenhauer: „Maderln, hebt’s d’ Füß in die Höh, heut geigt der Strauß!“
„Laß doch das hölzerne dumme Gelächter! Dir wird das Spotten schon vergehen, wenn es blechen heißt!“
„Vom Zahlen bin ich allerdings kein Freund, weil ich allweil z’ wenig Geld hab trotz aller Sparsamkeit! Aber der Witz von Bezahlung der Ehefrau für ihre[S. 87] Arbeit im Hausstand ist so gut, daß ich mir ein Flaschel Bier jetzt kaufe! Der Witz muß begossen werden!“
„Laß die Faxen, Beni! Es ist Ernst, nicht Scherz!“
„Die Leichenbittermiene steht dir ausgezeichnet, nur mußt ein schwarzes Seidenkleid dazu anziehen!“ spottete der belustigte Ehemann.
„Hör zu und paß auf, Beni! Es ist heiliger Ernst! Das neue Gesetz bestimmt, daß den Ehefrauen für ihre Arbeit im Hausstand ein Drittel des Gehalts oder Jahreseinkommens des Ehemannes ausgezahlt werden muß! Von Rechts wegen! Gesetz ist Gesetz, es muß befolgt werden von jedem Staatsangehörigen!“
„Ganz ausgezeichnet! Den Witz schick an die ‚Fliegenden Blätter‘, er wird sicher angenommen und honoriert! Weißt was, Weiberl, für das Honorar kaufen wir uns dann im Admonter Stiftskeller ein Flascherl ‚Eisentürer‘!“
„Wer nicht hören will, muß fühlen! Der Ernst des neuen Gesetzes wird dich schon zwicken! Ohne Gehaltsaufbesserung, also nach deinem jetzigen Einkommen, gebührt mir ein Jahreslohn von sechshundert Kronen für meine Hausfrauenarbeit! Diese Summe verlange ich! Und kraft des neuen Gesetzes bestehe ich auf Bezahlung dieser Summe! Und im Weigerungsfalle werde ich dich, wozu ich gesetzlich berechtigt bin, vor Gericht belangen!“
Beni schrie vor Vergnügen, trommelte mit den Fäusten auf der Tischplatte, und im Übermaß der Freude an dem köstlichen Witz begann er in Schlappschuhen zu schuhplatteln, ahmte die Bewegungen des balzenden Urhahnes nach und wollte die Gattin animieren, sich am „Platteln“ zu beteiligen.
Amanda in höchster Entrüstung versetzte dem seelenvergnügten, lachenden Gatten einen Stoß, der Beni ins[S. 88] Torkeln brachte, dann aber rauschte Amanda aus der Stube. Krachend flog die Tür ins Schloß.
In herrlichster Laune pfiff Benjamin die lustige Melodie des „Schuhplattlers“ zu Ende. Und dann holte er sich wirklich ein Fläschle Bier aus dem Keller, um den Witz und das famose neue Gesetz zu begießen. Allein allerdings, denn Amanda ließ sich für diesen Abend nicht mehr sehen.
Merkwürdig – mit einem Male wollte dem einsamen Zecher das Bier nicht mehr schmecken. Wenn Amanda keinen Witz gemacht haben sollte, wenn wirklich ein neues Gesetz bestünde?
„Unmöglich!“ knurrte Beni, dem das Lachen vergangen war. „Es sind die unglaublichsten Gesetze schon gemacht und sanktioniert worden, aber noch nie ein Gesetz, wonach die Ehefrau wie eine Dienstmagd einen Lohn für ihre Arbeit im Hausstande bekommen solle. Ein solches Gesetz kann doch gar nicht gemacht werden! Undenkbar! Durch eine derartige Lohnzahlung würde die Hausfrau ja zur Dienstmagd herabgedrückt, jeder Würde beraubt werden! Ein verrücktes Gesetz wäre das! Und gleich ein Drittel des Jahresgehaltes oder Einkommens! Wer kann denn das leisten und erschwingen? Die Subalternbeamten mit ihrem winzigen Gehalt! Die Gewerbetreibenden! Die Bauern!“
Je länger Benjamin über das neue Gesetz nachdachte, desto schwüler wurde ihm trotz der Abendkühle, die durch die offenstehenden Fenster in die Stube drang. Ganze zwölfhundert Kronen vom Gehalt würden nach Abzug des „gesetzlichen“ Lohndrittels verbleiben für den Haushalt, für alle Bedürfnisse des Lebens, für Kleider, Schuhe usw. Unmöglich ein Auskommen mit einer so winzigen Summe! So unsinnig und grausam kann doch[S. 89] eine Regierung nicht sein, die schlechtbesoldeten Ehemänner zu zwingen, der Gattin ein Drittel des Jahresgehaltes auszuzahlen.
Im bitteren Sinnieren fand Gnugesser ein Körnchen Trost: ein klein bißchen „überspannt“ ist Amanda als frühere Lehrerin, sie wird vielleicht irgend etwas dem angeblichen Gesetze Ähnliches aufgeschnappt und nicht recht verstanden haben. Das vermeintliche, unmögliche Drittel würde just der Gattin in den Kram passen, denn auf Geld ist sie erpicht wie Meister Petz auf Zeidelhonig!
Beni beschloß, sich wegen des „neuen“ Gesetzes zu erkundigen, am besten beim Pfarrer Pater Wilfrid, der doch davon auch etwas wissen muß. Ist, wie zu erwarten steht, nichts Wahres an dieser ohnehin unglaublichen Sache, so werden der überspannten Gattin die Lohndrittelmucken bald ausgetrieben sein. In aller Güte und Gemütlichkeit selbstverständlich. Denn wehe tun möchte Beni der Gattin nicht...
Im Schlafzimmer fand er Amanda schlummernd. Ihre geschlossenen Augen täuschten und beruhigten ihn. Kaum hatte Beni das Licht ausgelöscht, flammten Amandas Rätselaugen auf...
Mit hochalpinen Kleidern durch Hildegards Schneiderkunst ausgerüstet, konnte das Hoffräulein von Gussitsch einem Befehle zur Begleitung mit einiger Ruhe entgegensehen. Stoff für ein richtiges Lodenkleid war unterwegs. Die Fürstin Sophie schien jedoch nicht die geringste Jagdpassion zu verspüren; der vom Jagdpersonal sehnlichst erwartete Befehl zur Wildausmachung für Pirsch oder Drücken erfloß nicht. Dagegen äußerte die Fürstin den Wunsch, das Forsthaus zu inspizieren, der Forstwartfrau Gnugesser einen Besuch abzustatten. Für Fräulein von Gussitsch war dieser Wunsch natürlich Befehl, weshalb die Hofdame fragte, wann sie zur Disposition sein müsse.
Der Bescheid lautete: eine halbe Stunde vor dem Lunch, keine Ansage im Forsthause.
Ein einleuchtender Befehl hinsichtlich der Nichtansage, damit Frau Amanda keine Veranstaltungen zu feierlich-steifem Empfang oder gar zu einer unerwünschten Bewirtung treffen kann.
Weniger einleuchtend fanden die allmächtigen Angestellten Norbert und Hildegard den Besuch, sie befürchteten eine Verspätung des Lunchbeginnes durch Verschwatzen. Wie überall in Hofhaltungen, sahen die „Vertrauenspersonen“ sehr darauf, daß pünktlich gegessen werde am Tische der – Angestellten. Die höchsten Herrschaften können leichter warten.
Im Forsthause herrschte eine Totenstille; die Forstbeamten weilten dienstlich auswärts, Graf Thurn in Wien; Frau Amanda beschäftigte sich mit dem Entwurf einer Ansprache, die demnächst in einer Versammlung von Ehefrauen in der Angelegenheit der Entlohnung weiblicher Arbeit im Ehestande gehalten werden solle.
In diese ziemlich schwierige Geistesarbeit vertieft, achtete Amanda gar nicht des Geräusches leichter Schritte im Flur. Sehr überrascht fuhr sie in die Höhe, als eine Frauenstimme rief: „Ist jemand da?“
Amanda trippelte in den Flur und stieß einen Schrei des Schreckens und zugleich freudigster Überraschung aus, als sie die Fürstin erblickte, die ob dieser Wirkung ihres unvermuteten Erscheinens vergnügt schmunzelte und die Frau Gnugesser bat, ja keine „Geschichten“ zu machen. Fürstin Sophie vereitelte auch sofort jede Möglichkeit hierzu, indem sie bat, ihr die Wohnung des Forstwarts zu zeigen und zu sagen, was allenfalls einer Änderung oder Verbesserung bedürfe.
Diese gutgemeinte, aber auch unvorsichtige Äußerung gab Amanda nicht nur die Ruhe wieder, sondern auch hocherwünschten Anlaß, Bitten um bauliche Verbesserungen vorzubringen.
Die Fürstin bereute denn auch ihre Äußerung und ging auf ein anderes Thema über, indem sie fragte, ob sich die Frau Forstwart wohl fühle in dieser Einsamkeit.
Sofort hing sich Amanda, indem sie den Damen Stühle anbot, in dieses Thema ein und sprach gewandt und flüssig über den bitter empfundenen Mangel an Verkehr mit gebildeten Leuten und an Mitteln geistiger Weiterbildung. Nützliche Bücher seien ebenso schwer zu beschaffen wie die enorm teuren Lebensmittel.
Auf die letztere Anspielung ging die Fürstin nicht ein,[S. 92] doch versprach sie, die „einsame“ Försterin mit nützlichen Büchern versehen zu wollen.
„Untertänigsten Dank, Durchlaucht! Besonders beglückt werde ich sein, wenn Durchlaucht die Gnade haben wollten, mir ein Exemplar des neuen, für Hausfrauen so sehr wichtigen Gesetzes und wenn möglich eines Kommentars dazu schenken würden!“
„Welches Gesetz meinen Sie denn, liebe Frau?“
„Es gibt ein völlig neues Gesetz, das der Frau einen Anteil am Gewinn der Ehe in Höhe eines Drittels gewährt! Ist der Ehemann ein Beamter, so muß er gesetzlich ein Drittel seines Jahresgehalts der Ehefrau zahlen als Entlohnung der von der Frau im Haushalt geleisteten Arbeit! Von Rechts wegen!“
Erstaunt und interessiert rief die Fürstin: „Was Sie sagen! Von einem solchen Gesetz habe ich bisher keine Ahnung gehabt!“ Und zu Fräulein von Gussitsch gewendet, fragte Fürstin Sophie: „Wissen Sie, liebe Gussitsch, etwas von diesem sehr interessanten und wichtigen Gesetze?“
Martina mußte gestehen, daß sie bisher nicht das geringste davon gelesen und auch nichts gehört habe.
Amanda sprach hastig: „Doch! Die Zeitungen beschäftigen sich angelegentlich mit dieser Frage der Entlohnung der Frau im Hausstand! Ich habe derlei Artikel ja selbst und so oft gelesen, daß ich hierüber sehr gut informiert bin und auch darüber sprechen kann! Durch das neue Gesetz, durch positive Rechtsnorm, ist ein Ziel erreicht, das angesehene Frauen längst erstrebt hatten und das doch wohl als durchaus berechtigt und den modernen Verhältnissen entsprechend anerkannt werden muß!“
„Gewiß! Sagen Sie, liebe Frau, welche Stellung[S. 93] haben Sie vor Ihrer Verheiratung innegehabt? Sie verfügen augenscheinlich über eine Vorbildung, die sonst in Kreisen kleiner Beamter nicht zu finden ist!“
„Ich war früher Lehrerin!“
„Ach so! Das macht Ihre Stellungnahme zu dieser interessanten Frage begreiflich! Was ich aber nicht verstehe, ist die Entstehung eines in seinen Wirkungen so einschneidenden Gesetzes. Es wird doch über Kleinigkeiten oft ganz schrecklich debattiert und Lärm geschlagen!“
„Höchste Herrschaften werden von diesem Gesetze nicht betroffen, also ist es leicht möglich, daß Durchlaucht sich um dasselbe nicht gekümmert, das Gesetz sozusagen übersehen haben! Die Interessen- und Gedankensphäre einer Fürstin ist doch eine ganz andere, als die einer Forstwartfrau oder Bäuerin oder Ehefrau eines Gewerbetreibenden!“
„Allerdings!“ Zur Hofdame sprach die Fürstin: „Bitte, liebe Gussitsch, behalten Sie diese Angelegenheit im Auge und beschaffen Sie baldmöglichst das betreffende Gesetz!“
Martina verbeugte sich.
Dann wandte sich die Fürstin wieder zu Amanda mit der Frage: „Wie gedenken Sie auf Grund dieses interessanten Gesetzes in Ihrem Hauswesen vorzugehen?“
Leuchtenden Auges und lebhaften Tones erwiderte Frau Gnugesser: „Die Stellungnahme ist leicht und doch auch sehr schwer! Leicht insofern, als das Gesetz klar und deutlich der Ehefrau das Gehaltsdrittel zuspricht! Schwer hingegen wird es dem Ehemanne sein, dieses Drittel in bar der Gattin auszuzahlen, wenn das Gehalt keine entsprechende Aufbesserung findet! Mein Mann bezieht achtzehnhundert Kronen Gehalt...“
„Verstehe! Also bekommen Sie als Ehefrau sechshundert Kronen, das ist eine respektable Entlohnung Ihrer Arbeit, nicht? Ich hätte wahrlich nicht geglaubt, daß ein so vernünftiges und wichtiges Gesetz gemacht werden kann! Ein bedeutender Fortschritt auf dem Wege der Gesetzgebung, eine soziale Großtat! Jeder Arbeiter ist seines Lohnes wert! Zweifellos ist durch das Gesetz die große Bedeutung der Frau als guter Haushälterin und Verwalterin für die Sicherung der Früchte des Eheerwerbes nun allgemein anerkannt! Und auf der Frauentätigkeit beruht der Segen der Familie! Sehr schön also diese Sache! Nur merkwürdig, daß ich davon bisher keinen Ton gehört habe! Apropos: wie stellen sich denn die anderen Hausfrauen dieser Gegend zu dieser grandiosen Neuerung?“
Umständlich berichtete Amanda, die sich nun in ihrem Fahrwasser befand, über die durchgeführte Agitation, über die Belehrung der Frauen in Hall, über den bereits errungenen Erfolg, der darin bestehe, daß sogar auch Bauernweiber die Drittelszahlung fordern. Demnächst werde eine öffentliche Frauenversammlung stattfinden.
„Sehr schön! Großartige Sache! Muß unterstützt werden! Aber nun sind wir lange genug hier gewesen! Wir sprechen gelegentlich darüber! Adieu, liebe Frau! Auf Wiedersehen!“
Mit einem Wortschwall des Dankes für die hohe Ehre des auszeichnenden Besuches geleitete Amanda die Damen vor das Haus. Ein letzter Versuch der Anspielung auf die Notwendigkeit einer Gehaltsaufbesserung als Folge der Drittelszahlung mißlang kläglich, da die Fürstin die Uhr zog und sich jäh verabschiedete. War es doch bereits ein Uhr geworden, die Stunde des Lunch erheblich überschritten.
Eilig zum Schlößl stapfend, meinte die Fürstin: „Wie man sich nur so verschwatzen kann! War aber ganz interessant, nur kann ich trotz alledem nicht recht glauben, daß bei uns ein so einschneidendes Gesetz in Geltung ist! Vergessen Sie nicht, ein Exemplar zu besorgen! Was ist denn Ihre Meinung über dieses rätselhafte Gesetz, liebe Martina?“
„Verzeihen, Durchlaucht, in Gnaden! Erst möchte ich die einzelnen Gesetzesbestimmungen lesen...!“
„Ja doch! Die Sache muß ihre Richtigkeit haben, denn die Försterin ist vorzüglich informiert und orientiert! Ich bin neugierig zu erfahren, wie sich unser ‚Hofpfarre‘ zu dieser Angelegenheit stellt!“
„Dem Pfarrer dürfte weniger das Gesetz, viel mehr die Revolutionierung der Ehefrauen eine böse Bescherung verursachen!“ meinte Martina, um doch auch etwas zu sagen und ein gewisses Interesse zu markieren.
„Apropos: Pfarrer! Teilen Sie dem Pater Wilfrid mit, daß er am 30. August, dem Todestage meines hochseligen Gemahls, ein feierliches Requiem zelebrieren soll! – So, da sind wir! Die armen Leute! Haben so lange auf das Essen warten müssen!“
Norbert kam gesprungen und nahm den Damen die Schirme ab.
„Nicht böse sein, Alter! Wir haben uns verplaudert!“ sprach liebenswürdig die Fürstin. „Gleich servieren! Hast du argen Hunger, Norbert?“
„Untertänigst zu dienen, Durchlaucht, dem alten Diener fällt das Fasten schwer! Ich bitte um Verzeihung...“
„Was hast du denn angestellt?“
„Ich habe mir eine Kleinigkeit in der Küche geben lassen!“
„Ganz recht! Sehr vernünftig! Hoffentlich war auch Hildegard so klug!“
„Gewiß, Durchlaucht! Mit gnädigster nachträglicher Genehmigung!“
„Aber gern! Natürlich!“
Die Damen begaben sich ins Speisezimmer und durften einige Zeit warten, bis serviert wurde.
Die Angestellten hatten nicht eine Kleinigkeit, sondern das komplette Menü verspeist, und zwar reichlich. Daher die Köchin nun rasch Schnitzel als Ersatz zubereiten mußte.
*
Jeder Sonntag bringt dem Pfarrer, der keinen Kaplan hat, in den Dörfern Arbeit in reichlichem Maße. Besonders mit Arbeit gesegnet war Pater Wilfrid, der Pfarrer von Hall. Früh des Morgens begann die Arbeit im Beichtstuhl, der sich um acht Uhr das Hochamt mit Predigt anschloß. Unverdrossen, ja freudig tat der liebenswürdige Pfarrer und Vater seiner Gemeinde seinen Dienst, angenehm davon berührt, wenn das Gotteshaus dicht von Andächtigen gefüllt war. Insbesondere freute ihn die Anwesenheit der Fürstin mit Hofdame im kleinen Oratorium. Während der Predigt gewahrte er zu seiner Befriedigung auch die Forstbeamten und etliche Jäger in den Reihen der Dörfler.
Nach dem Gottesdienste drängten zahlreiche Bauern zum Pfarrhause, wo sie sich aufstellten wie die Orgelpfeifen.
Grüßend kam Pater Wilfrid vom Kirchlein herab, freundlich bat er die Leute, ihm ein Viertelstündchen zum Frühstück zu gönnen, dann stehe er zur Verfügung. Und lächelnd meinte er: „Aber einer nach dem andern![S. 97] Nicht alle zugleich einidrucken! Das vertragen die Mauern vom Häuserl nicht!“
„Wohl, wohl!“ riefen die Bauern und lachten.
Die weißhaarige Dienerin im Pfarrhause trug den Kaffee mit Semmel auf, und bemutternd mahnte sie den Pfarrer, er solle sich nur Zeit lassen zum Frühstücken; die Bauern könnten schon warten, die kommen allweil noch früh genug ins Wirtshaus.
Im Flur gellte die Hausglocke scharf und ungestüm.
„Jesses na, so eine Pressiererei! Der Hansdampf läutet mir gut! Lassen S’ Ihnen nur Zeit, Hochwürden Herr Pfarrer! Ich mach nicht früher auf, als bis Sie gefrühstückt haben!“
Pater Wilfrid trat ans Fenster und guckte, wer denn Einlaß forderte. Erschrocken fuhr er zurück und hastig rief er: „Erna, g’schwind aufmachen! Die Fürstin will mich besuchen!“
„Wär nicht zwider! Jesses na, so was! Wo ich gar nicht darnach an’zogen bin und keinen Hut nicht aufhab!“
Der Kammerdiener Norbert riß abermals am Glockenstrange.
Die Dienerin sprang zur Haustüre und öffnete unter unzähligen Verbeugungen. „Na, so eine Ehr! Frau Duhrlauch kommen selber, um mich zu besuchen!“
Fräulein von Gussitsch sprach: „Durchlaucht geruhen den Herrn Pfarrer zu besuchen! Bitte, melden Sie sofort!“
Gedehnten Tones, ob der leisen Zurechtweisung gekränkt, erwiderte die Dienerin: „Selles Melden ist neammer nötig, wo der Pfarrer Ihnen eh schon vom Fenster aus gesehen hat! Da springt er ja schon, der Herr Hochwürden! Haben S’ die Ehr, und gehen S’ halt auffi!“
Pater Wilfrid bat die Damen, sich gütigst in das obere Stockwerk bemühen zu wollen. Höflichst geleitete er die Fürstin hinauf.
Die Dienerin wollte die Haustüre abschließen und sah den Kammerdiener Norbert wartend stehen. Ihn sprach sie schnippisch an: „San Sö vielleicht der Brettelhupfer von der Fürstin? Dann können S’ herinnen bleiben!“
Würdevoll erklärte Norbert, daß er der „Herr Kammerdiener“ sei.
Pater Wilfrid erschien oben an der Treppe und rief: „Geschwind, Erna, Tee machen! Durchlaucht wünschen Tee zu nehmen!“
Schrill antwortete Frau Erna: „Was Ihnen nicht einfallt! Wo wir im ganzen Haus kein Stäuberl Tee nicht haben! Und sicher im ganzen Dorf auch nicht! Ein Schalerl Kaffee kann sie haben, die Frau Duhrlauch, sonst nichts!“
So mußte denn Pater Wilfrid diesen Bescheid überbringen. Über seine komisch klägliche Miene lachte die Fürstin hellauf. „Tut nichts, ist kein Unglück! Herr Pfarrer wollen erlauben, daß ich Ihr Haus mit Tee und was dazu gehört, versorge! Aus Selbstsucht, denn wir werden künftig nach dem Gottesdienst bei Ihnen den Tee nehmen! Das heißt, wenn Sie erlauben! So, nun wollen wir um so weniger stören, als zahlreiche Bauern auf Audienzerteilung warten! Auf Wiedersehen, Herr Pfarrer!“
Norbert mußte den beim Wirte eingestellten Wagen holen. Am Pfarrhause wartend, sah die Fürstin den Oberförster Hartlieb, den sie einlud, im Wagen mit nach Hause zu fahren.
Mit höflichen, ernsten Dankesworten nahm Hart[S. 99]lieb diese Einladung an, wiewohl sie seine Absicht, im Grabnerhofe dienstlich vorzusprechen, durchkreuzte. Unwillkommen war sie ihm aber dennoch nicht, da er doch wieder einmal Fräulein von Gussitsch in die schönen Mustela-Lichter gucken konnte. Fand er doch Fräulein Edelmarderchen zum Anbeißen nett und hübsch. Insgeheim natürlich, mit Ausschluß aller Öffentlichkeit.
Da es eine ziemliche Zeit währte, bis die Pferde angeschirrt waren, bat die Fürstin, es wolle sich der Pfarrer nicht aufhalten lassen und die Leute vornehmen. „Ich habe ohnedies mit dem Herrn Oberförster zu sprechen!“
Pater Wilfrid verabschiedete sich und nahm den ersten wartenden Bauern mit in die Pfarrkanzlei.
Ehrerbietig harrte Hartlieb der Mitteilungen, und er war im voraus überzeugt, daß sie höchst wahrscheinlich eine Überraschung wenig angenehmer Art für den Jagddienst sein werden. Aber auf die Frage, wie sich das Jagdgut verzinse, war er doch nicht gefaßt. Die Käuferin mußte doch über die Verzinsung informiert sein...
Kaum konnte Hartlieb seine Verblüffung verbergen.
Fräulein von Gussitsch hatte sich diskret einige Schritte entfernt und hielt auf dem Sträßlein Ausguck nach dem Wagen.
Trocken und ernst wie immer gab Hartlieb die Auskunft: „Da für den Haller Besitz nur das Jagdinteresse ausschlaggebend war und ist, beträgt die Verzinsung nur zwei vom Hundert! Soll die Rente gehoben werden, so muß eine geregelte Forstnutzung eintreten; wir haben hiebreife Bestände, und für Nutzholz sind dieser Tage günstige Offerten von größeren Firmen eingelaufen! Ich wollte nur noch kurze Zeit warten, ob nicht noch einige Angebote erfolgen, und hatte vor, demnächst hierüber[S. 100] Vortrag zu erstatten und die Genehmigung zur Durchforstung und Schlägerung einzuholen!“
Das Antlitz der Fürstin bekam einen Zug von Geringschätzung, die Lippen umspielte ein ironisches Lächeln, etwas wie Hochmütigkeit, da Sophie sarkastisch sprach: „Holzhandel ist nicht mein Geschmack! Das Gut habe ich in ganz anderer Absicht gekauft; freilich steht dahin, ob sich diese Absicht verwirklichen läßt! Jedenfalls bleibt einzig und allein das Jagdinteresse ausschlaggebend, ich werde mich mit der kleinen Verzinsung begnügen! Also beachten Sie, lieber Hartlieb: nur das Jagdinteresse im Auge behalten!“
„Zu dienen, Durchlaucht! Eben das Jagdinteresse veranlaßt mich auf Grund eigener Wahrnehmungen in letzter Zeit und in Berücksichtigung der Jägerrapporte den Abschuß überzähliger Gelttiere, und zwar bald, noch vor Beginn der Hirschbrunft zu beantragen...“
„Aber warum denn?“
„Es hat sich das Geschlechtsmischungsverhältnis verschoben, wir haben zu viel Kahlwild, der Abschuß von Gelttieren ist nötig! Ich möchte bitten, daß das Personal, das ja sehr fachkundig ist, diesen Abschuß vornehmen darf, und zwar auf der Pirsch, weil dadurch die Revierbeunruhigung möglichst vermieden wird!“
Die Lippen hochziehend, meinte die Fürstin: „Ich weiß nicht! Der Abschuß will mir nicht gefallen, noch weniger das – Kanonieren durch das Personal! Und ganz und gar nicht will mir gefallen, daß just das weibliche Wild zum Opfer fallen soll! Das ist grausam! Nach Möglichkeit hegen, Herr Oberförster, hegen!“
„Im Jagdinteresse bin ich genötigt, dringendst den Abschuß der überzähligen Gelttiere zu verlangen!“ erwiderte Hartlieb höflichen, doch dienstlich festen[S. 101] Tones. Und ehrlich ernst blickte er der Gebieterin ins Auge.
„Ja doch! Sie als Fachmann müssen es ja besser wissen und verstehen, Sie sind ja auch verantwortlich! Aber Wünsche wird die Besitzerin, sozusagen der ‚Jagdherr‘, denn doch noch aussprechen dürfen! Machen Sie mal einen Überschlag, so eine Art Aufstellung, damit ich erfahre, wieviel weibliches Wild der Kugel verfallen soll! Eines steht fest: ich für meine Person werde mich an dem erzwungenen Abschuß nicht beteiligen! Und ohne Kontrolle darf auch das Personal nicht abschießen! – Der Wagen kommt! Wir fahren heim! Herr Oberförster, Sie können bis zum Forsthause mitfahren!“
Unterwegs litt Hartlieb alle Qualen der Unterordnung des eigenen Intellekts, des seelischen Kampfes in der Frage, ob der Fachmann sich ducken, dem Willen eines Laien, noch dazu dem einer Frau, sich unterwerfen oder auf die Dienstesstellung verzichten, sich um einen anderen Posten bewerben solle. Unmännlich und feig erschien ihm das Ducken, die Unterwerfung ein Verrat an den Idealen des grünen Berufes! Lieber aus diesem Dienst scheiden mit reiner, ehrlicher Weidmannsseele! Gehen, bevor der Waldmann – fliegt...
Ein Weilchen hatte Fürstin Sophie mit Martina geplaudert, Fragen gestellt und sie selbst beantwortet, bevor das Hoffräulein die Lippen öffnete. Dann wandte sich die Fürstin mit einem liebenswürdigen Lächeln an den Oberförster und fragte ihn im Tone köstlicher Naivität: „Sagen Sie mal, lieber Hartlieb, was wird denn bei der jetzigen Art des Jagdbetriebes eigentlich aus den – Rehwitwen und aus den alten Rehjungfern? Es werden ja doch immer nur Rehböcke geschossen! Wer sorgt für die – Reh-Relikten?“
Hartliebs Blick kündete Verblüffung; der Oberförster war paff. Und auf der Zunge lag sehr locker ein Ausruf gelinden Entsetzens, ein Hilferuf des konsternierten Weidmannes zum St. Hubertus.
Zum rettenden Engel aus dieser Verlegenheit Hartliebs wurde Martina, die in diesem Moment lachte und ihre schimmernden Marderzähnchen zeigte.
Dieses erquickend frische Lachen ermöglichte es dem Jagdbeamten, den Ausruf ungesprochen hinabzuschlucken, die verblüffende naive Frage der Fürstin im Scherztone dahin zu beantworten, daß der Schöpfer dem Leben der „Rehwitwen“ und alten „Rehjungfern“ mit dem fünfzehnten Jahre ein natürliches Ziel und Ende gesetzt habe, so nicht durch Krankheiten diese „Relikten“ früher verenden. Eine Verschiebung des Geschlechtsmischungsverhältnisses zwinge übrigens auch beim Rehwild zum Abschuß überzähliger Geißen und Gelttiere.
„Ach Gott! Nun kommt der schreckliche Mensch schon wieder mit den ‚Geschlechtsmischungsverhältnissen‘! An sich schon eine gräßliche Worthäufung, gleich drei Hauptwörter aneinander gehängt und grausam verquickt! Hat die Weidmannsprache, die ich wohl nie werde erlernen können, noch mehr solcher Wortungetüme und Ungeheuer?“
Ehe Hartlieb antworten konnte, wandte sich die Fürstin aber schon wieder an das Hoffräulein mit der Bemerkung, daß vergessen worden sei, den Pfarrer wegen des Requiems zu interpellieren, zu fragen, ob diese Angelegenheit in Ordnung sei.
Martina versicherte, daß sie befehlsgemäß dem Pater Wilfrid geschrieben habe und somit wohl auf prompte Erledigung gerechnet werden dürfe.
„Schicken Sie den Norbert zum Pfarrer! Ich will[S. 103] bestimmten Bescheid erhalten! – Na, da sind wir ja schon am Forsthause! Apropos: Schicken Sie mir morgen den Jäger Eichkitz zum Rapport! Auf Wiedersehen, Herr Oberförster!“
Hartlieb verabschiedete sich. Ein warmer Blick inniger Sympathie flog zum Mustela-Fräulein...
„Bei St. Huberto! Immer muß ich das Fräulein mit dem geschmeidigen, zierlichen Edelmarder vergleichen!“ murmelte Hartlieb, als er nach Abfahrt der Damen in das stille Forsthaus trat.
*
Der Reihe nach nahm Pater Wilfrid in der Haller Pfarrkanzlei die Bauern und sonstigen Besucher vor.
Ein stämmiger Mann, der Schmied von Hall, ältlicher Junggeselle, erbat Auskunft, welche Papiere zu beschaffen seien, da er aus Barmherzigkeit eine arme Witwe mit zwei Kindern heiraten wolle, um die bittere Not zu beseitigen.
Mit der beruhigenden Auskunft, daß die gewöhnlichen Legitimationspapiere genügen und daß nach Empfang derselben das Pfarramt das Weitere besorgen werde, konnte der Schmied sich entfernen. Ziemlich enttäuscht darüber, daß die Sache so glatt gehen werde, und daß der Pfarrer auf die „Barmherzigkeit“ soviel wie gar nicht geachtet hatte.
Der zweite Besucher, seines Zeichens Spengler und Glasermeister in einer Person, wünschte Aufschluß bezüglich des neuen Gesetzes, wonach die Gattin für ihre Arbeit im Hauswesen künftig bezahlt werden müsse.
Pater Wilfrid ließ die Frage wiederholen, so sehr mißtraute er seinen Ohren. Und dann erklärte er, sich wegen des ihm ganz unbekannten „Gesetzes“ erkundigen[S. 104] zu wollen. „Kommen Sie am nächsten Sonntag, dann werden Sie Bescheid erhalten!“
Mit einem ähnlichen, schärfer präzisierten Anliegen kam der dritte Besucher, ein Taglöhner und Besitzer eines Kleinanwesens bei Hall. Der abgerackerte Mann wollte wissen, ob er wirklich verpflichtet sei, von seinem ohnehin geringen Einkommen aus seinem Tagwerk dem Eheweibe die Hälfte als Lohn für die Hausarbeit zahlen zu müssen. „Springgiftig“ fordere die Gattin jetzt schon eine Anzahlung, könne aber nicht sagen, welches Gesetz diese Zahlungspflicht des Mannes vorschreibt.
Pater Wilfrid gab dem Manne den gleichen Bescheid wie bei Nummer zwei.
Der vierte Besucher war ein mittlerer Bauer, der erbost klagte, daß seine Bäuerin die Hühner verkauft, den Erlös für sich behalten habe als Entschädigung für ihre Arbeit in Haus, Stall, Garten und Feld.
Nun wurde Pater Wilfrid ob dieser Übereinstimmung der Anliegen doch stutzig. Er fragte, ob Anzeichen vorliegen, daß die Bäuerin vielleicht aufgehetzt worden sei. Ingrimmig berichtete der Bauer, daß vor einiger Zeit die Frau des Forstwarts öfter im Gehöft erschienen sei, eifrig mit der Bäuerin getuschelt und verhandelt habe, worauf das Eheweib sehr scharf geworden sei. „Sagen S’ nur gleich, Herr Pfarrer, was ich machen soll! Därf ich das hantige Weib verhauen? Und was ist das für ein ‚Gesetz‘, von dem die Bäuerin behauptet, daß ich fürder blechen muß, was Zeug haltet?“
„Gedulde dich bis zum nächsten Sonntag! Ich werde mich inzwischen erkundigen! Von einem Gesetz, das die Hausarbeit der Ehefrau entlohnt, weiß ich einstweilen nichts! Glaub auch nicht, daß es bei uns ein solches Gesetz gibt!“
„So? Nicht? Na, freu dich, Alte! Ihr werd ich das Hühnerverkaufen hinter meinem Rücken schon austreiben mit’m Haslinger!“
„Warte mit dem – Haslinger bis zum nächsten Sonntag! Aufs Wiederschauen!“
Insofern die übrigen Besucher verheiratet waren, hatten sie alle das gleiche Anliegen und den Wunsch, bezüglich des neuen Gesetzes informiert zu werden. Auch der Dorfkrämer, der davon sprach, daß er die Hölle auf Erden habe, seit die Frau Gnugesser in seinem Hause verkehre und sein Weib zur Freundin und Vertrauten erkürt habe. Auch andere Weiber kommen häufig und halten Sitzungen ab, als wenn der Kramerladen ein Weiberparlament wäre.
„Ausstampern!“ meinte anzüglich Pater Wilfrid und schmunzelte dazu.
„Hat sich was mit dem Ausstampern! Hasen und Katzelen kann man stampern, nicht aber Weiberleut, wenn die Weibets – bleiben wollen! Einmal hab ich das Stampern probiert, ein zweites Mal tue ich es nicht wieder! Eine Watschen hab ich erwischt, die ist nicht von schwacher Hand gewesen! Und was mich wurmt: ich weiß nicht von wem! Kann sein, daß es die Kramerin gewesen ist, es kann aber auch sein, daß ein Bauernweib mir die Watschen runtergewischt hat! Jedenfalls ist keine christliche Demut im Spiel gewesen! Drum bin ich der Meinung, daß Hochwürden Herr Pfarrer auf der Kanzel loswettern sollten gegen die Malefizweiber, die rebellisch worden sind! Aber, bitt schön, ausgiebig loswettern, gesalzen und gepfeffert, ganz sakrisch, auf daß den Revoluzzerinnen Hören und Sehen vergeht und die Augen tropfen!“
„Wird schon zur rechten Zeit geschehen!“ Einer[S. 106] Regung folgend, riß Pater Wilfrid rasch die Türe auf. Richtig kniete die Dienerin vor dem Schlüsselloch. Heillose Bestürzung. Wie ein begossener Pudel sprang die Witwe Erna auf, und krebsrot im verhutzelten Gesicht hastete sie davon.
Der Krämer rieb sich schadenfroh die Hände und freute sich mächtig. Und lachend verließ er das Pfarrhaus.
Pater Wilfrid eilte nun in das Schulgebäude, um den Sonntagsschülern Unterricht in der Christenlehre zu erteilen.
Dann ein Halbstündchen Pause für einen kleinen Imbiß und für eine Rüge der Dienerin wegen Belauschungsversuchen von Dienstgesprächen. Die weißhaarige Frau Erna verhalf dem jovialen Pfarrer zu einer nicht geringen Überraschung, indem die alte Dienerin statt mit einer Entschuldigung mit dem Vorwurf anrückte, daß Pater Wilfrid zu den – nichtsnutzigen, hartherzigen und grausamen Mannsbildern halte! Deshalb sei es eine heilige Pflicht der Weiber, sich zusammenzuschließen und alles aufzubieten, daß die segensreichen Bestimmungen des neuen Gesetzes voll und ganz zur Durchführung gelangen...
Pater Wilfrid griff sich an den Kopf und rief: „Ja, wie wird mir denn?“ Die alte Witwe richtete sich gravitätisch auf, stemmte die Hände auf die schmalen Hüften und erwiderte triumphierend: „Jawohl! Gucken Sie nur verwundert, Hochwürden! Ihr Staunen ändert nicht das geringste an der Tatsache, daß das neue Gesetz die Stellung der Frauen im Haushalt und Ehestand bedeutend heben und bessern wird! Ich für meine Person werde allerdings von dem neuen Gesetz nichts profitieren! Dennoch erachte ich es als meine Pflicht, mich[S. 107] den Frauen anzuschließen und tapfer mitzukämpfen, bis der Sieg errungen ist!“
Kühl gab Pater Wilfrid zur Antwort: „Gewiß, Frau Erna! Sie können mitkämpfen, meinetwegen heldenhaft mit Schwert und Spieß, nur nicht als Pfarrhäuserin! Bevor Sie die Waffen zum Heldenkampf ergreifen, müssen Sie das Pfarrhaus und Ihre bisherige Stellung verlassen! Und das heute noch! Im Hause eines friedfertigen Priesters wird eine Revolution, die Unterstützung verrückter Frauen nicht geduldet! Eine Stunde Zeit zum Überlegen sei Ihnen gegönnt! Ich muß jetzt wieder in die Schule zur Christenlehre für die Mädchen gehen! Hernach ist Segen und Rosenkranzgebet in der Kirche! Sodann geben Sie Ihre Erklärung ab! Guten Tag, Frau Erna!“
Verblüfft guckte die Matrone; ihr Kopf wackelte, die knöcherigen Finger bebten. Und weinerlich klangen die Worte: „Mit Vergunst, Herr Pfarrer! Wenn Sie die Sach so scharf anfassen, wird es für mich wohl gescheiter sein, wenn ich meine Finger nicht hineinstecke! Wo soll ich altes Weibel denn ein anderes Heimatl finden, so ich aus dem stillen Pfarrhaus außig’schmissen werd! Ich bitt um Verzeihung! Die Frauen sollen ohne die alte Erna kämpfen und sich die Finger verbrennen! Ich tue nimmer mit!“
„Gut! Dann bleibt alles beim alten! Adieu!“
Im Dienste vollzog sich für Pater Wilfrid die an Sonntagen übliche Hetzjagd: Schulunterricht, nachmittägiger Gottesdienst, Beteiligung an einer Versammlung christlicher Arbeiter. Während dieser Verhandlung wurde der Pfarrer abberufen, er mußte dem todkranken Zirnitzbauern die Sterbesakramente bringen. Hernach noch die Vorkehrungen für den Todesfall treffen, Kranke[S. 108] besuchen und trösten. Darüber wurde es Abend. Im Einspännerwägelchen fuhr dann der Haller Himmelsführer zurück ins Admonter Kloster. Das Tagewerk war aber immer noch nicht beendet; als Gastmeister des Stiftes hatte Pater Wilfrid die Pflicht, sich um die Gäste des Klosters zu kümmern, für ihr leibliches Wohl, für gute Unterkunft und nach Möglichkeit auch für gesellschaftliche Unterhaltung zu sorgen. Verpflichtungen von nicht gerade angenehmer Natur, wenn der Gastmeister so viele Sorgen im Kopfe hat. Die größte Rolle spielte das neue „Gesetz“ und die Haller „Weiberrevolution“. Beiläufig und sehr dunkel glaubte Pater Wilfrid sich erinnern zu können, in einer Zeitung vor Wochen einen Artikel gelesen zu haben, der sich mit der Frage: Entlohnung der Hausfrauenarbeit im Ehestande, irgendwie beschäftigte. Flüchtig gelesen und schnell vergessen. Emsig suchte Pater Wilfrid in einer hofseitig gelegenen Zelle nach jener Zeitung. Einer der weltlichen Klosterdiener kam und meldete pflichtgemäß, daß einige Gäste gekommen seien, die sich jetzt in der Hofmeisterei befänden. Provisorisch hätte der Diener des Gästetraktes die Zimmer angewiesen und das Nötige für Beherbergung besorgt.
Rasch kontrollierte der Pater Gastmeister, ob der Rang der Gäste mit den angewiesenen Zimmern und ihrer Ausstattung einigermaßen übereinstimmte. Eine Umlogierung mit Verbringung des Reisegepäckes mußte vorgenommen, Rücksicht auf Rang und Etikette, auf die altberühmte Gastfreundschaft des Stiftes geübt werden. Nun eilte der vielbeschäftigte Gastmeister hinauf in die im obersten Stockwerke gelegene sogenannte Hofmeisterei. Ein großer, vielfenstriger Saal, klösterlich einfach ausgestattet; ein Billard, von dem der Klosterwitz erzählt,[S. 109] daß schon Kolumbus vor Antritt seiner Reise nach Amerika auf diesem Vergnügungsmöbel gespielt hätte, etliche runde Tische für Kartenspieler, an der einen Wand ein langer Tisch für Gäste und Stiftsherren mit etlichen seltsam geformten Flaschen, die zwei Sorten Klosterwein enthielten. Eine Kredenz mit Gläsern, ein Kleiderrechen und ein Ständer für Zeitungen bildeten die Ausstattung des von einer großen Hängelampe dürftig erleuchteten Saales. Klösterlich einfach und bescheiden. Dennoch hatte dieser Raum eine Kostbarkeit aufzuweisen: die herrliche, überwältigende Aussicht auf die „Haller Mauern“, auf das wuchtig ragende Felsengebirge im Norden von Admont. Freilich waren von diesen Zyklopenmauern am späten Abend nur noch die düsteren Schatten zu sehen.
Etliche Stiftsherren mit dem Abte, den die goldene Prälatenkette kenntlich machte, und drei Laiengäste saßen an dem langen Tische, rauchten und plauderten. Nippten zeitweilig vom Weine, der an Sonntagen auf Klosterrechnung den Stiftsherren gereicht wird. Gästen natürlich auch an Wochentagen für die Dauer ihrer Anwesenheit.
Pater Wilfrid stellte sich den fremden Gästen als Gastmeister vor, bat wegen verspäteten Erscheinens um Entschuldigung und verständigte den einen Herrn wegen der Umlogierung. Und nun waltete er mit allem Eifer seines Amtes, auf daß die Gäste rechtzeitig die Gläser gefüllt erhielten und Unterhaltung fanden. Seine Weltgeläufigkeit wie die höfisch geschulten Umgangsformen kamen dem Gastmeister gut zu statten und machten den denkbar besten Eindruck. Benediktinerhöflichkeit und -gastlichkeit.
Der vornehme Abt richtete später diskret an den Gast[S. 110]meister und Haller Pfarrer im halblauten Tone die Frage, ob dafür gesorgt sei, daß die Fürstin von Schwarzenstein einen standesgemäßen Platz in der Haller Kirche habe.
Flüsternd antwortete Pater Wilfrid: „Zu dienen, Euer Gnaden! Alles in Ordnung und prompt besorgt!“
Ein freundlicher Blick des Abtes glitt zum Gastmeister, ein Nicken kündete Befriedigung und Wohlwollen. Um zehn Uhr erhoben sich die Gäste.
Geräuschlos und flink besorgte Pater Wilfrid Licht. Und nachdem sich die Gäste vom Abt und von den Stiftsherren verabschiedet hatten, geleitete der Gastmeister, witzig sich als „Zimmermadel im Habit“ vorstellend, die Gäste in ihre Zimmer, sah noch geschwind nach, ob auch Wasser vorhanden war, und zog sich dann mit besten Wünschen für eine „geruhsame Nacht“ zurück.
In seiner Zelle bei traulichem Lampenschein beschäftigte sich Pater Wilfrid noch einmal mit dem heillos unangenehmen „neuen Gesetze“. Die Erinnerung an jenen Zeitungsartikel kehrte zurück und wurde lichter. Und mit einem Male wußte der einsame Denker, daß der Entwurf zum neuen Zivilgesetzbuche die Bestimmung enthält, wonach die Ehefrau ein Drittel des Einkommens des Mannes als Entschädigung für ihre Arbeit im Hauswesen erhalten solle.
Noch lichter wurde die Erinnerung: Es handelt sich um den Entwurf zum neuen Zivilgesetzbuche der Schweiz.
„Gott sei Dank!“ murmelte Pater Wilfrid. Und wie von einer schweren Last befreit, atmete er tief auf.
Und dann schlug er sich mit der Hand an die Stirne in Erinnerung, daß jener Zeitungsartikel in einem Kölner Blatte enthalten war. Und einen Pack dieser[S. 111] Zeitungen hat er selbst der Frau Forstwart Gnugesser, die um Lektüre gebeten hatte, zum Lesen gegeben.
„Oh! Was hab ich getan?!“ stöhnte Pater Wilfrid. „Wie kann man so unvorsichtig sein? Den Hecht in den Karpfenteich setzen!“
Freilich gab es eine Entschuldigung: niemand konnte ahnen, daß die Forstwartsfrau just diesen Zeitungsartikel aufschnappen, den Entwurf als gültiges Gesetz betrachten, die Länder verwechseln, den Entwurf als Agitationsmittel benützen, die Weiber von Hall „revolutionieren“ werde...
Die mißverständliche Auffassung, die Verwechslung der Schweiz, ermöglicht aber eine Gegenagitation, die wirksame Bekämpfung der „Revolution“! Die Aufklärung des Irrtums durch eine Predigt von der Kanzel aus wird und muß die Flammen der Weiberrevolution ersticken, in der Haller Gemeinde die Ordnung und den Frieden wiederherstellen.
Um den Frieden bei seinen Pfarrangehörigen war es Wilfrid zu tun; dem Frieden zuliebe hat er unzählige Opfer gebracht und wird sie bringen, solange er Himmelsführer in der Gemeinde Hall sein wird.
So schrieb denn Wilfrid etliche Gedanken für die Predigt nieder.
Gegen Mitternacht machte sich die Ermüdung geltend. War der Pfarrer und Gastmeister doch seit vier Uhr früh im Dienste, ununterbrochen tätig.
Die Feder entsank der fleißigen Hand.
Wilfrid löschte die Lampe aus und begab sich zur wohlverdienten Ruhe.
Vor dem Jagdschlößl im einsamen Halltale stand eines klaren Morgens ein schmächtiger, junger Mann in alter, verwetzter Steierertracht. Kalkigweiß die Wangen, seltsam tief, scharfblickend und flackernd die Augen. Bartlos, frisch rasiert die Wangen. Ein Mensch, weltfremd und dennoch welthungrig. Mit dem aszetischen Gesichtsausdruck schien der magere junge Mann gar nicht in die Tracht zu passen, die auf einen Bergstock gestützte Gestalt mit einem Kugelstutzen älteren Systems auf der linken Schulter sah wie Maskerade aus.
An scherzhafte Verkleidung, an Salontirolerei glaubte denn auch der Kammerdiener Norbert, als er diesen „Steierer“ erblickte und wegweisen wollte. Unmöglich konnte der junge, bleiche Mann ein Jagdgehilfe sein: die auffallend weißen Hände, die kalkige Gesichtsfarbe sprachen dagegen. „Sie, junger Mann, entfernen S’ Ihnen! Hier haben Sie nichts zu suchen!“ rief er patzig.
Gelassen erwiderte der junge Mann: „Ave! Guten Morgen!“ Und unverändert blieb er in der Stellung.
Norbert riß es fast um. „Was haben Sie gesagt? Ave? Wer sind wir denn?“
„Zu dienen! Ich heiße Nonnosus, bin Admonter Novize und von Durchlaucht hierher befohlen!“
„Nicht übel das! Ich weiß kein Wort! Unmöglich können Sie in dieser Maskerade vorgelassen werden![S. 113] Und was ein angehender ‚Mönch‘ im Jagdschlößl zu tun hat, kann ich mir auch nicht denken!“
In hellstem Entzücken, in fanatischer Freude flammten die Augen des Novizen auf, leise röteten sich seine bleichen Wangen, da Nonnosus davon sprach, daß er von der Fürstin zur Jagd eingeladen sei, mit besonderer Erlaubnis des Abtes pirschen, etliche Tage auf einer Jagdhütte oben verbringen dürfe. „Seien Sie so gütig, Herr, und melden Sie der Fürstin, daß der ‚Novize mit dem Jägerblut‘ gekommen ist! Die Fürstin wird sich dann schon erinnern, daß sie mich eingeladen hat und daß sie mich mit hinaufnehmen will! Haben Sie die Güte!“
Norbert schüttelte den Kopf.
Elastisch und flink kam der fesche Jäger Eichkitz heran. Den sonderbaren „Steierer“ erblickend, spöttelte der schmucke Jägersmann: „Je! Was ist denn dös für ein Spatzenschrecker! Wo haben s’ denn diesen Popanz aus’lassen? Wohl eine Vogelscheuch’n für ein Erbsenfeld?“
Norbert schüttelte sich vor Lachen. Und Eichkitz lachte mit.
Ruhig sprach Nonnosus: „Ave! Der Spott sei verziehen!“
Eichkitz grinste, hob verächtlich die Schultern und bat den Kammerdiener um Anmeldung. „Zum Bericht auf neun Uhr von der Duhrlauch befohlen, Herr Kammerdiener!“
„Das ist eine andere Wurscht! Befohlen, na gut! Wundert mich aber, weil so früh die Fürstin sonst niemand empfängt!“
Pfauenstolz meinte der schmucke Jäger: „Mich schon! Ausdrücklich auf Neuni befohlen, aufzuwarten!“
Norbert verschwand. Und alsbald kam er wieder, um zu melden, daß der Herr aus dem Stift warten möge, bis der Jäger Eichkitz Bericht erstattet habe.
„Danke, Herr! Ich werde geduldig warten!“ erwiderte Nonnosus in unveränderter Haltung, auf seinen Bergstock gestützt.
Eichkitz legte im Flur Büchsflinte und Bergstock ab; mit dem Hirschfänger an der Linken und mit dem Hütl in der Rechten stapfte er hinauf. Und im Zirbensalon wartete er. Ziemlich lange währte es, bis die Fürstin erschien.
Der unvermutete Anblick überraschte ihn; denn noch nie im Leben hatte er eine Dame im – Jagdkleid gesehen.
Sophie trug eine dunkelgraue Bluse aus Rohseide, darüber eine kokette Lodenjacke, fußfrei kurz der grüne Lodenrock, Hosen von gleichem Stoff, zierliche, bis zu den Knöcheln reichende Lederschuhe, die notdürftig genagelt waren. Auf dem Kopfe saß ein dunkelgrüner Ausseer Hut, geschmückt mit hellgrünem Seidenband und einem Gamsbart. Für einige Sekunden verblüffte den Jäger Eichkitz diese Erscheinung, besonders die Plastik der üppigen Büste und die ungewohnte Kleidung. Doch rasch fand der junge Jäger und Weiberkenner heraus, daß dieses schneidige Kostüm und die grüne Farbe wohl für ein hübsches junges Mädel passe, keineswegs aber für eine Fünfzigerin. Mit vortrefflicher Selbstbeherrschung unterdrückte er den Lachkitzel, den diese Kleidung in ihm geweckt hatte. Eichkitz verbeugte sich und stammelte: „Gnädig Duhrlauch haben befohlen! Ich melde mich gehorsamst zur Stelle!“
Lächelnd musterte die Fürstin den bildhübschen Burschen und lobte sein pünktliches Erscheinen. „Ich möchte[S. 115] von Ihnen hören, ob wir wirklich zuviel Gelttiere in den Hirschrevieren haben! Viel zuviel Kahlwild angeblich!“
Die besondere Betonung des Wörtchens „angeblich“ fing der schlaue Bursche sofort auf, er war willens, sich ganz nach der Gebieterin zu richten und ihr zu Gefallen zu reden. Deshalb meinte er: „Ist nicht so gefährlich!“
„Wieso?“
„Wenn gnädig Duhrlauch Kahlwild und Geltstück nicht abschießen wollen, muß es auch nicht sein!“
„Also besteht kein gebieterischer Zwang?“
„Zu befehlen hat doch nur gnädig Duhrlauch! Das Verhältnis jagdbarer Hirsche zum Kahlwild soll sein wie 1 zu 5! Das langt, weil ja unsere Geweihten an Geweih und Leib eh stetig zurückgehen!“
„Weshalb denn?“
„In den Hochrevieren haben die Hirsche nicht die beste Äsung und für Blutauffrischung ist nichts geschehen! Im letzten Winter ist die Fütterung nicht überreichlich gewesen, weil ja die Pachtzeit ablief und ein Käufer nicht vorhanden gewesen ist! Wenn gnädig Duhrlauch jedem Hirsch mehr als fünf Stück gönnen wollen, hat es nicht viel auf sich! Ganz wie Sie wollen!“
„Der Gedanke, Kahlwild abschießen zu lassen, ist mir unangenehm!“
„Muß ja nicht sein! Schießen dafür gnädig Duhrlauch die jungen Spritzer und Schneiderhirscheln weg!“
„Sie meinen wohl auch, Eichkitz, daß man den Wald möglichst unberührt lassen soll, was?“
„Mit Vergunst! Ich bin nur Jaager, vom Forstwesen versteh ich nichts! Unsereiner heult um jeden Baum, der g’schlägert wird! Wie und wo soll denn unser Hirschwild gedeihen, wenn der Wald immer weniger wird?“
„Danke! Ihre Liebe zu Wild und Wald gefällt mir sehr gut! Ich hatte die Absicht, daß wir heute nachmittag zur Pyrgas-Hütte hinaufsteigen und im dortigen Revier auf Gemsen pirschen werden! Nun aber bestimme ich, da ja auch der Admonter Theologe bereits da ist, daß wir in einer Stunde aufbrechen! Die Förster sollen nachkommen! Apropos: Behandeln Sie den Admonter Theologen gut, er ist Sohn eines Jägers, hat Jägerblut in den Adern! Er darf pirschen, er soll mal die Wonnen des Weidmannslebens durchkosten, ich habe ihn eingeladen, er ist für einige Tage mein Jagdgast!“
„Zu Befehl! Hab ihn schon gesehen! So ein – lieber, netter, armer Herr! Schad, daß er als Jaagerssohn Geistlicher werden muß! Wird ihn hart genug ankommen, die Bezwingung des Jaagerblutes! Befehlen Duhrlauch noch was?“
„Danke! Sie können gehen! Verständigen Sie rasch den Herrn Oberförster und kommen Sie alsbald zurück! Wir marschieren um zehn Uhr ab!“
„Zu Befehl! Küß d’Hand, gnädig Duhrlauch!“ Ein huldvoller Wink und ein Blick des Wohlgefallens. Eichkitz machte einen Kratzfuß und stelzte vorsichtig über das glatte Parkett.
Den erheblich gestiegenen Wert seiner Person ließ Eichkitz dem Kammerdiener in der patzig gesprochenen Mitteilung fühlen, daß in einer Stunde zur Pyrgas-Hütte aufgebrochen werde. „Unter meiner Führung! Veranlassen Sie wegen Proviant und Bagasch das Weitere! Wir marschieren Punkt zehn Uhr ab! Servus, Herr Norbert!“
Seinen Ohren nicht trauend, rief Norbert: „Wie? Was? Er ist wohl nicht bei Trost?! Und den arroganten[S. 117] Ton verbitt ich mir! Für Ihn, den Jagdgehilfen, bin ich der Herr Haushofmeister! Verstanden!“
„‚Giften‘ S’ Ihnen, wie Sie mögen, vorher aber vollziehen Sie den Befehl der Duhrlauch! Alles herrichten und auffitragen!“ Eichkitz ließ den Kammerdiener in heller Entrüstung stehen und begab sich hurtig zum Theologen vor dem Jagdschlößl, dem er mitteilte, daß die Fürstin ihn erwarte.
„Ich danke Ihnen herzlichst, Herr Oberjäger, für Ihre Güte!“
Die Titelerhöhung schmeichelte Eichkitz nicht wenig, gönnerhaft und herablassend meinte er: „Ist gern g’schehen! Springen S’ hinauf! Hohe Herrschaften darf man nicht warten lassen!“ Dann eilte der Jäger zum Forsthause, um den Befehl zu überbringen. Und im voraus freute er sich, wie die Förster Hartlieb und Gnugesser bei ihrer Rückkehr aus dem Dienst zum Mittag überrascht und verblüfft sein werden, daß die Fürstin unter Führung des Jägers Eichkitz bereits am Vormittag ins Revier gegangen ist. Den Befehl mußte Eichkitz schriftlich hinterlegen und in das Schlüsselloch der Haustüre stecken, denn das Forsthaus war wie ausgestorben, die Männer und auch Frau Forstwart Amanda waren abwesend.
Dann wanderte Eichkitz gemächlich zum Jagdschlößl, wo unter der Dienerschaft eine ameisenhafte Regsamkeit herrschte infolge des überraschenden Befehles zu verfrühtem Aufbruche.
Im Zirbensalon unterhielt sich Fürstin Sophie mit dem bleichen Theologen im schlotternden Steierergewand. Der junge Mann mit seinen tiefen, leidenschaftlich flammenden Augen, sein demütiges Wesen, sein Seelenkampf wie seine Zukunft, all das interessierte die Frau[S. 118] in besonderem Maße. Etwas ganz Neues im Einerlei der Bergeinsamkeit! Dazu der prickelnde Nervenreiz für das bevorstehende Experiment auf psychischem Gebiete: Wird des Novizen glühende Jagdleidenschaft durch die Jagdleidenschaft erst recht auflohen zu versengender Flamme oder infolge gesättigter Gier erlöschen?
Zunächst fesselte die Fürstin die Art, wie Nonnosus in Dankbarkeit des Abtes gedachte, der ihm das Studium ermöglichte und in vollendeter Vornehmheit seines hohen Amtes so ganz anders walte, denn sonst anderswo die Seminarvorsteher.
„Wieso denn?“ fragte die Fürstin.
„Durch Grundsätze und Anleitungen für die jungen Theologen! So dringt unser Summus Abbas auf Selbstbildung und Selbstzucht! Wir müssen erst selber Pädagogen werden, meint der Abt, dann können wir auch andere bilden! Duckmäuser, Frömmler wünscht man im Stifte nicht!“
„Wie denkt man im Stifte wohl über die Beziehungen der Theologen zur Frauenwelt?“ Ein forschender Blick flog zum Novizen.
Ruhig erwiderte Nonnosus: „Wir haben Anstandskurse im Kloster behufs Beseitigung von Schüchternheit und Unbeholfenheit, Erzielung eines gesetzten und sicheren Auftretens! Noblesse im Verkehr mit Frauen wird gefordert! Entgegen dem anderswo üblichen Gebote, daß Kleriker Frauen kaum die Hand reichen dürfen, lehrt man uns im Stifte, daß Frauen auch Menschen seien, und daß Leute mit übertriebener Prüderie leicht und häufig in das Gegenteil umschlagen! Unser Abt verurteilt die totale Abschließung der Theologen von der Welt...!“
„Stimmt! Was denken Sie über den Hochmut?“
„Im Stifte lehrt man uns, daß der Priesterberuf ein hehres Amt, die Priesterwürde hochzuhalten sei; aber die jungen Priester sollen und dürfen sich nicht einbilden, infolge der Würde Menschen höherer Art oder gar unfehlbar zu sein! Aus solchen üblen Auffassungen erwachsen Hochmut und Unverträglichkeit!“
„Freuen Sie sich schon auf die Tage frohen Weidwerkes?“ Die Frage warf den Theologen im Nu aus dem seelischen Gleichgewichte; Nonnosus verlor die Herrschaft über sich, die Augen flackerten, das Blut schoß in die Wangen, tobte in den Schläfen und machte fast schwindelig. Begeisterung und Leidenschaft leuchtete aus den tiefen Augen, verklärte das bleiche, scharfgeschnittene Gesicht. Wie weggeweht war in diesem Moment der asketische Ausdruck.
„Sie dürfen, so Sie guten Anlauf haben, Gamsböcke schießen und von Hirschen, was Sie mit sicherem Schuß bekommen können! Weibliches Wild muß geschont bleiben!“
Wie verhaltenes Jauchzen klangen die Worte: „Vergelt’s Gott vieltausendmal für die große, große Freud!“
„Schon gut, junger Freund! Schnappen Sie nur nicht über!“ Und in jäher Erinnerung an ihren Sohn, der so gar kein Jagdinteresse besitzt, verstummte die Fürstin, und ihre Gesichtszüge verfinsterten sich. Schatten des Schmerzes lagen auf den leise zuckenden Lippen. Doch rasch überwand sie sich und rief nach der Kammerfrau, die beauftragt wurde, für ein Gabelfrühstück für den Theologen zu sorgen.
Hildegard nahm den schier taumelnden Nonnosus mit.
Eine Stunde später wurde der Marsch zur hochgelegenen Pyrgas-Hütte angetreten. Als Führer an der Spitze pfauenstolz, wie ein Triumphator der Jäger[S. 120] Eichkitz. In einem Abstand von etwa acht Schritten folgten die Fürstin und Martina von Gussitsch, die gleich der Gebieterin auch ein Jagdkleid trug. Mit dem Unterschiede, daß dem jungen zierlichen Fräulein diese einfache Kleidung entzückend stand. Hinterdrein stapfte Nonnosus etwas unsicher, des Steigens nicht mehr gewöhnt, vom Jagdfieber durchrüttelt, mit heißen, lodernden Augen.
Mürrisch folgte Herr Norbert mit dem leichten Kugelstutzen der Gebieterin und dem Wettermäntelchen.
Frau Hildegard trug ein kleines Köfferchen und war auffallend guter Laune. Die dralle Kammerfrau freute sich mächtig, auf der Pyrgas-Hütte den Oberförster Hartlieb zu treffen, den sie – ohne sein Wissen – in ihr Witibherz eingeschlossen hatte. Nicht mehr und nicht weniger als Frau Oberförster wollte Hildegard werden, den Namen Schoiswohl mit Hartlieb vertauschen, an der Seite des Jagdoberbeamten so glücklich als möglich werden. Einstweilen hieß es freilich vorsichtig und zu Hartlieb liebenswürdig sein... Drei Diener schleppten Decken, dickgefüllte Rucksäcke mit Konserven usw.
Den Beschluß der Karawane bildete ein von einem Pferde gezogenes Schlapfenwägelchen, geleitet vom höchst verdrossenen Leibkutscher, der ob dieser Dienstesdegradierung empört war. Wenn etwas sein umdüstertes Gemüt trösten und aufhellen konnte, war es der Umstand, daß die Kiste auf dem Wägelchen viele gute eßbare Sachen, Bier und Wein in vielen Flaschen enthielt. Auf Anordnung Norberts, der nie das leibliche Wohl bei derlei Expeditionen vergaß und mit längerem Aufenthalte zu rechnen pflegte nach dem bewährten Grundsatz: lieber zuviel mitnehmen als zuwenig. Demgemäß konnte die fürstliche Freßkiste gar nicht groß genug sein.
Ehrgeiz und allerlei Hoffnungen hatten den Führer Eichkitz veranlaßt, ein Eiltempo anzuschlagen, das auf Dauer wohl der geübte Hochgebirgsjäger einhalten konnte, selbst im steilen Aufstiege, nun und nimmer aber Damen. Absicht des Triumphators war es, die Fürstin möglichst schnell zur Pyrgas-Hütte zu bringen, früher, als die Förster erscheinen konnten, auf daß der Jäger als der einzige anwesende Fachmann vielleicht den Auftrag erhalten würde, die Gebieterin auf einer Gamspirsch zu begleiten. Jagdleiter sein für den ersten Gang, danach lechzte der ehrgeizige Bursche.
Wie Eichkitz aber den sehr groß gewordenen Abstand, die weit zurückgebliebenen Damen gewahrte, gab er das Eiltempo sofort auf und blieb wartend auf dem Steige stehen. Nicht eben entzückt von der nach seiner Meinung miserablen Steigerei der bereits puterrot im Gesichte gewordenen Fürstin, die sich der Jacke entledigt hatte und nur mühsam kraxelte. Flink und sicher stieg Fräulein von Gussitsch. Wie ein Gamserl! dachte Eichkitz, dem die hübsche Hofdame arg in die Augen stach. Ein Hoffräulein! Eine feine Abwechslung wäre das! Aber so hoch darf man die Augen nicht heben! Soviel Vernunft besaß der Jäger denn doch...
Von nun an hielt Eichkitz den kurzen Abstand ein und stieg langsam, drehte sich oft um, gleichsam in Erwartung, von der Gebieterin befragt und sonstwie angesprochen zu werden.
Doch Fürstin Sophie hatte mit Atemnot zu kämpfen und nicht die geringste Lust, sich in ein Gespräch einzulassen.
Ein Blick auf die Taschenuhr überzeugte Eichkitz, daß bei diesem Schneckentempo alle Pirsch- und Jagdleitungshoffnungen aufgegeben werden müßten.
Und als auf der Plechauer Alp eine längere Rast befohlen wurde, konnte Eichkitz leicht ausrechnen, daß in spätestens einer Stunde die Förster im Eilmarsch ankommen werden. Groß staunte die Sennerin ob der Tatsache, daß der Jäger Eichkitz die hohe Ehre genoß, Führer sein zu dürfen. Das war wenigstens ein Wonnetropfen: der Jäger imponierte jetzt der Sennerin, dem Wildkatzl!
Geraume Zeit benötigte die ermüdete Fürstin zur Erholung. Und vom Aufstieg zur hoch und steil gelegenen Pyrgas-Hütte wollte sie im Sonnenbrande vorerst gar nichts wissen. Norbert erhielt Auftrag, einen Imbiß und kalten Tee zu reichen.
Nicht einen Bissen konnte indes Fürstin Sophie genießen. Nur vom kalten Tee schluckte sie fleißig.
Nonnosus befand sich in einer Beziehung in ähnlicher Lage wie die Fürstin: er konnte den dankend angenommenen Happen Schinken nicht essen. Hatte überhaupt kein Bedürfnis, nur das übermächtige, brennende Verlangen, an Wild zu kommen. So nahe dem Gamsreviere, den wuchtigen „Haller Mauern“, von Höhenluft umweht, deuchte ihm jede vertrödelte Viertelstunde ein schrecklicher Zeitverlust.
Und nun ließ sich die wieder zu Atem gekommene Fürstin gar in ein leutseliges Gespräch mit der Sennerin ein, fragte um nahezu alles im Alpbetriebe und im Leben einer „Alpenjungfrau“, und zeigte für die nichtigsten Dinge reges Interesse.
Wie von Eichkitz berechnet und befürchtet, kam es: plötzlich tauchte die hagere Gestalt Hartliebs am Rande des Almbodens auf. Und wie er sich der Plechauer Hütte näherte, in deren Schatten die Karawane lagerte, schleppte schier zerfließend der Forstwart Gnugesser sein[S. 123] Bäuchlein über den grünen Rasen. In Strähnen flatternd der fuchsige Patriarchenbart. Bergmännlein schwitzend, wie Neuschnee in der Julisonne... Das große rote Taschentuch konnte das viele „Schmelzwasser“, so von Stirne, Wangen und Nacken rieselte, nicht mehr aufsaugen.
Trotz alledem: pünktlich war Benjamin doch heroben!
Die Förster meldeten sich bei der Fürstin und wurden belobt, so herzlich belobt, daß der in der Nähe stehende Jäger Eichkitz Essig im Munde zu haben glaubte. Und dieser Essig verwandelte sich in bitterste Galle, als der Befehl erteilt wurde: Alles voraus zur Pyrgas-Hütte! Hartlieb sollte den Theologen an die Gams bringen! Fräulein von Gussitsch und Norbert haben zu bleiben als Schutz für die Gebieterin! „Ich werde erst in der Abendkühle hinaufkommen!“ sprach die Fürstin.
Wieder einmal anders disponiert! Aber schließlich begreiflich. In der Nachmittagssonne steil im Gewänd aufsteigen, ist nicht jedermanns Sache. Und Damen sind keine berggewohnten Jagdgehilfen...
Auf dem abendlichen Pirschgange hatte Oberförster Hartlieb an dem ihm anvertrauten Theologen nur zwei Ermahnungen gerichtet: Auf den Wind achten und nicht übereilt und nicht zu weit schießen.
Nonnosus, vom Jagdfieber erfaßt, hatte nur nicken können, das Sprechen war ihm unmöglich geworden; wie zugeschnürt war ihm der Hals.
Beim Betreten einer Mulde gab Hartlieb das Zeichen zur Wahrung größter Vorsicht, indem er den Zeigefinger auf den Mund legte.
An der Buchtung der von Latschen bestandenen und von Grasbändern durchzogenen Mulde, etwa drei Büch[S. 124]senschuß entfernt, ästen am Fuße einer Felswand vier Gams ohne Kitze. Ein kapitaler Bock war darunter, ein „alter Herr“ vermutlich, mißtrauisch, denn oft warf er auf und sicherte.
Ein Näherkommen war unmöglich, die Entfernung für einen sicheren Schuß viel zu weit. Unmöglich auch eine Erörterung des Jagdplanes und der durch Sonne und Wind kompliziert gewordenen Situation. Hartlieb hatte nicht geglaubt, daß an der Buchtung um diese Stunde gute Gams stehen werden, die Böcke weiter oben vermutet. Noch beschien die Sonne einen Teil der Hänge, die obere Felsmauer stand hell im scheidenden Licht, demgemäß mußte mit Sicherheit angenommen werden, daß der Wind aufwärts streichen wird. Aber der Zeit nach müssen bald die Abendschatten zu ziehen beginnen, der Wind muß umschlagen und von oben wieder herabstreichen. In diesem sehr bald zu gewärtigenden Umschlag lag die Komplikation, das Übersteigen der Gams war sehr erschwert, zwecklos im Moment, da der Wind wechselt und von oben herabzieht, dem Wilde die Menschenwitterung zuträgt.
Einen Moment stand Hartlieb wie angemauert; plötzlich ließ er sich geräuschlos nieder. Und wie vom Blitz getroffen sank hinter ihm der Novize lautlos zu Boden. Nonnosus hatte den sichernden Bock rechtzeitig eräugt, die schwere Gefahr einer Vergrämung augenblicklich erfaßt.
Ein Überlegen nun ohne jedes Verständigungsmittel. Und zuwenig Deckung. Die Schußdistanz zu weit. Und die Zeit drängte, für ein Übersteigen des kleinen Rudels war es nun schon zu spät.
Langsam und lautlos schob Hartlieb sich über das Geröll etwas vorwärts. Nonnosus kroch vorsichtig nach,[S. 125] die scharfen Augen auf den mißtrauischen Bock gerichtet, der sich mählich beruhigte und wieder zu äsen begann.
Auf etliche Manneslängen konnten die beiden sich vorwärtsschieben, bis zu einem Latschenschopf, der die letzte kleine Deckung bot. Darüber hinaus war das Gelände völlig offen.
Hartlieb lag still wie ein Holzklotz. Unbeweglich auch Nonnosus, obwohl die spitzen Steine sich in die Hände und Knie bohrten. Doch in heißer Erwartung, in glühender Jagdleidenschaft achtete der Theologe dieses körperlichen Schmerzes nicht, fühlte ihn kaum. Viel wichtiger war die Abschätzung der Distanz, die Selbstbezwingung, das Niederkämpfen des lockenden Gedankens, auf so große Entfernung zu schießen. Eine Seelenmarter wurde es, der psychische Kampf viel schwerer denn die Entsagung des Klerikers auf die Freuden der Welt. Unmöglich ein Wink, ein Wort des Rates vom erfahrenen Jagdleiter, der wie tot am Boden lag.
Sachte begannen die Abendschatten ihr wundersames Spiel im leisen Ziehen. Das Schußlicht minderte sich.
Der Bock verließ das Rudel, zog weg, verschwand zuweilen zwischen Felsen und Latschen. Aber er kam immer wieder an den Standort, um den Schützen zu peinigen. Und mehrmals stellte der Bock sich wannenbreit, lockend zum Schusse.
Nonnosus war am Ende seiner Willenskraft. Mit äußerster Mühe unterdrückte er ein Stöhnen, das der Seelenkampf, die aufs höchste gesteigerte Leidenschaft und die nun drängende Schießwut dem Gemarterten erpressen wollten.
Der regungslos liegende Jagdleiter staunte in Gedanken über das korrekte Verhalten seines Begleiters, über die Seelenstärke, die den mehr als gewagten, un[S. 126]weidmännischen Schuß nicht zuließ. Manchmal, für Augenblicke, erwartete Hartlieb aber doch, daß es knapp hinter ihm krachen werde, denn Nonnosus war ja nicht Fachmann, nicht gewöhnt an solchen „Anblick“.
Noch ein Moment größter Spannung: Nonnosus nahm den Stutzen an den Kopf und versuchte zu zielen.
Also doch! Sicher ein Fehlschuß bei schwindendem Licht! dachte Hartlieb und wünschte von Herzen, daß die Kugel am Kapitalen vorbeifliegen möge.
Aber der tapfere Theologe bezwang sich und schob den Stutzen von sich.
Der Kapitalbock verschwand hinter einem Felsen. Und das Rudel empfahl sich und zog gelassen weiter.
Die Dämmerung wob dunkle Schleier um die Stätte eines harten Seelenkampfes.
Der letzte Schimmer auf der Pyrgas-Spitze erlosch, als sich die Herren erhoben.
Hartlieb reichte dem heldenhaften Theologen die Hand und sprach im Tone aufrichtiger Bewunderung: „Brav gemacht! Meinen vollsten Respekt! So kann nur der echte Weidmann handeln! Meine Hochachtung für Ihre erstaunliche Willenskraft!“
„Fast wäre ich doch im letzten Augenblick der überstarken Versuchung erlegen! Ich darf also Ihr Lob nicht annehmen! Doch lieber geschneidert heimgehen, als belastet sein mit einer Jagdsünde!“
„Morgen ist auch Jagdtag! St. Hubertus wird Sie schon belohnen und Diana gnädig sein!“
Geschäftig frohes Leben herrschte auf der Pyrgas-Hütte, als Hartlieb und Nonnosus ankamen. Das Diner wurde eben serviert. Norbert hatte es wichtig mit dem Bedienen der Damen, die vor dem Anbau auf einer Bank saßen und vergnügt über die primitive Art dieser[S. 127] Hofjagdtafel kicherten. Der ins Freie gebrachte Tisch wackelte bedrohlich, wenn die Damen Fleisch schneiden wollten, die Gläser wollten nicht stehenbleiben.
Flink kniete Eichkitz nieder, um Abhilfe zu schaffen, indem er den Tischfüßen an der abschüssigen Stelle zusammengebogene Briefe unterlegte.
Dies bemerkend, meinte Fürstin Sophie gutgelaunt: „Wohl Liebesbriefe, Eichkitz, was?“
„Nicht ganz erraten, Duhrlauch! Nur unbezahlte Rechnungen! Hat also nichts zu bedeuten, wenn die Briefeln etwa gelesen werden!“
„Sie schreiben wohl keine Liebesbriefe, was?“
„Nein, Duhrlauch! Ich mach so was immer mündlich ab! Ist sicherer!“
Ein großes Stück Roastbeef belohnte Eichkitz für seine Bemühung.
Hartlieb, Nonnosus und Gnugesser wurden eingeladen, am Tische der Damen zu speisen. Da es an Stühlen mangelte, wurde die Bank aus der Jägerstube herausgebracht.
Nonnosus sollte Bericht erstatten. Demütig bat er um Dispens. Für ihn ergriff Hartlieb das Wort und lobte die Selbstbezwingung des Theologen mit Wärme.
Die Fürstin dankte für diese Enthaltsamkeit und versprach dafür zu sorgen, daß Nonnosus morgen sicher zu Schuß kommen werde.
In einen Wettermantel gehüllt, von Hartlieb begleitet, unternahm Fürstin Sophie noch eine kleine Promenade. Es wurde ein Gamstrieb für den Vormittag angeordnet. Hartlieb machte zwar aufmerksam, daß in den Pyrgas-Revieren nie „getrieben“ worden sei, selten „gedrückt“; aber die Gebieterin bestand auf ihrem Willen. Sie schränkte den Befehl aber dann doch ein, indem[S. 128] sie dem Wunsche Ausdruck gab, es möge für Nonnosus „geriegelt“ werden. Eichkitz und der Forstwart sollen in die „Sauwiel“ steigen und von oben die Gams herabdrücken zu den von der Fürstin und von Nonnosus bezogenen Ständen. Je ein Gams genüge für die Schützen.
„Zu Befehl, Durchlaucht! Ich werde am frühesten Morgen die Stände herrichten! Gute Nacht, Durchlaucht, angenehme Ruhe!“
Nur flüchtig konnte Hartlieb noch einen Blick von Mustela, vom zierlich-hübschen Hoffräulein erhaschen. Ein funkelnder Blick wie von Marderlichtern im Dunkel der Nacht.
Die Damen zogen sich in den Anbau zurück. Die Kammerfrau flüsterte dem Oberförster die Frage zu, ob er wohl mit allem Nötigen versorgt sei oder besondere Wünsche hege. Kühlhöflich lehnte Hartlieb alles dankend ab. Und merkte gar nicht, wieviel Zärtlichkeit Hildegard in den Flüsterton gelegt hatte und wie heiß ihre Augen flammten.
Schwer enttäuscht huschte die Kammerfrau dann in den Damenanbau.
Alles „Männervolk“ nächtigte in der alten Hütte. Der Theologe durfte auf einer Holzbank liegen, eine Rücksichtnahme auf seinen Stand.
Der Morgen ließ sich trüb und nebelig an. Und sehr spät wurde es, bis die Fürstin erschien. Für das „Riegeln“ war alles vorbereitet. Eichkitz und Gnugesser saßen wohl schon oben in der „Sauwiel“ und froren im Nebel und warteten auf den Hebschuß, der als Zeichen des Jagdbeginnes vereinbart worden war. Aber dieser Schuß fiel nicht, da die Fürstin immer wieder Befehle zu erteilen hatte und von der Hütte nicht wegzubringen war. Hartlieb wartete geduldig zwar, doch auch ziemlich[S. 129] verdrossen. Und Nonnosus bebte vor Freude und Jagdlust.
Endlich war es so weit, daß zu den Ständen gegangen wurde. Nonnosus erhielt seinen Stand angewiesen und erkannte nun sofort, daß es sich um eine kleine Treibjagd handeln wird. Ängstlich flüsterte er dem Jagdleiter zu: „Verzeihung! Ich darf nur pirschen!“
Hartlieb konnte keine Antwort geben, es rief ihn die Fürstin zu sich.
Sehr einfach, doch recht praktisch war für den Theologen ein Sitz errichtet in der Weise, daß der Schütze den Anlauf in der Flanke bekommen muß. Unbehindert der Anschuß. Der Theologe mit dem Jägerblut kämpfte hart und schwer um einen Entschluß, denn mit aller Klarheit erinnerte er sich der Vorschriften, die dem Kleriker die venatio clamorosa, die lärmende Jagd, verbieten. Zur Pirsche war er eingeladen, heute aber eine Treibjagd befohlen. Was soll der Theologe nun tun? Sitzenbleiben und zuschauen, wie die Gams vorüberspringen werden? Oder schlankweg den Stand verlassen, gehorsam den Vorschriften? Und was wird die Fürstin sagen, die doch mit besonderer Rücksicht auf ihn diese Treibjagd angeordnet hat, auf daß er sicher zu Schuß komme?
In dieser Gewissensklemme stellte sich ein Beschwichtigungsgedanke ein: bezüglich der venatio clamorosa ist ausdrücklich die Jagd mit Hunden verboten; auf Gams wird aber nie mit Hunden „geriegelt“; also kann der Kleriker sich an dieser Jagdart beteiligen.
Recht wohl befand sich Nonnosus bei dieser Beschwichtigung des Gewissens nicht. Er blieb auf dem Stand und rang sich zu dem Entschlusse durch, das Wild unbeschossen zu lassen und später auf eventuellen[S. 130] Vorhalt zu erklären, daß er wegen ungenügender Sicherheit im Ansprechen des Geschlechtes auf das Dampfmachen verzichtet habe. Eine Notlüge wird das sein, um den Vorschriften zu gehorchen und Rücksicht auf die Fürstin zu üben.
Der Hebschuß fiel, vom Oberförster abgefeuert, als die Fürstin endlich schußbereit war.
Eine Viertelstunde später machten Eichkitz und Gnugesser durch Einsteigen in die Wände das Krickelwild hoch. Das etwas schmale Terrain gestattete den flüchtenden und herunterstürmenden Gemsen nicht die hübsche Entfaltung der breiten Front in schnellster Vorwärtsbewegung.
Ein Schuß vom Stande der Fürstin löste sie in hastende Rudel auf.
Schon der Hebschuß hatte im Nu den so mühsam errungenen Entschluß des Theologen zum Verzicht umgestoßen. Die bebenden Finger schoben die Patronen in die Kugelläufe und zogen die Hähne auf. Und wie dann Diana sich gnädig zeigte und dem Schützen einen guten Anlauf gewährte, da siegte die Jagdleidenschaft über sämtliche kanonischen Vorschriften. Die Büchse flog an die Wange, das scharfe Jägerauge suchte unter dem anlaufenden Krickelwilde einen guten Bock aus, die „Fliege“ faßte Haar, zog mit, fuhr entsprechend vor, und alsbald schlug die Kugel. Stürzend quittierte der Gams den Schuß, der Bock rutschte, versuchte hochzukommen, doch rasch entwich die Lebenskraft.
Eine zweite Kugel warf eine auffallend starke Geltgeiß um. Schnell lud Nonnosus wieder. Das Gros im Trieb war vorüber. Doch ein Nachzügler kam gehumpelt, ein Bock mit seltsam verkrüppeltem linken Hinterlauf. Sichtlich sehr pressiert wegen der Annäherung der Trei[S. 131]ber, aber infolge von Schmerzen im kranken Hinterlauf gehindert, das rettende Fluchttempo anzuschlagen. Aus Mitleid und Barmherzigkeit feuerte Nonnosus und fehlte. Die zweite Kugel warf den Bock um, doch stand er wieder auf und blieb dann mit gekrümmtem Rücken stehen.
Wieder schob Nonnosus Patronen ins Lager. Der Fangschuß ging zu hoch, erst die vierte Kugel beendete die Leiden des Kranken.
Der Trieb war zu Ende. Für Nonnosus begann jedoch die seelische Bedrängnis, da der Blick auf seine Strecke fiel. Zwei Böcke und eine starke Geltgeiß! Erlegt in einer Treibjagd. Venatio clamorosa! Trotz aller Vorschriften! Schier schwarz ward es dem Theologen vor den Augen, da er an die Folgen dieses Vergehens dachte. Unselige Jagdleidenschaft...
Entblößten Hauptes, mit gesenktem Blick, erwartete Nonnosus die Fürstin, fest entschlossen, um sofortige Entlassung behufs Rückkehr in das Stift zu bitten.
Aber es kam anders. Schon auf eine Distanz von einem Dutzend Schritten rief die übelgelaunte Fürstin: „Was war denn das für eine Kanonade bei Ihnen? Wer wird denn so gamshungrig sein! Sie wissen doch, daß ich hegen will! Sie dezimieren mir ja mein Wild! Übermitteln Sie dem Herrn Abte beste Grüße!“
So viel verstand Nonnosus nun, daß er entlassen war, in vollster Ungnade entlassen, und daß er sich schleunigst zu verflüchtigen habe. Er stammelte etliche Dankesworte und trollte dann eiligst ab...
Verärgert klagte die Fürstin zu Hartlieb über Schießwut und Undankbarkeit.
„Halten zu Gnaden, Durchlaucht! Es ist mit echter Jagdpassion ein eigen Ding, die Selbstbezwingung ist[S. 132] sehr schwer, zuweilen ganz unmöglich! Es ist meine Schuld, daß der Theologe den guten Anlauf ausgenützt hat, denn ich hatte vergessen, dem Theologen mitzuteilen, daß Durchlaucht nur ein Gams bewilligt hatten! Der Abschuß des kranken Bockes mit dem verkrüppelten Hinterlauf ist unter allen Umständen weidmännisch korrekt zu nennen, dieser Abschuß war geboten und hätte auch gegen den Befehl erfolgen müssen!“
„Was? Nicht übel! Meine Befehle müssen stets beachtet werden!“
„Gewiß, Durchlaucht, beachtet! In jagdlichen Angelegenheiten ist der Vollzug hingegen auf die Möglichkeit beschränkt! Oberstes Gesetz ist stets die weidmännische Handlungsweise!“
„Ich bin sehr erstaunt, solche Äußerungen zu hören!“
„Halten zu Gnaden, Durchlaucht! Krankes Wild muß vom Personal oder von geladenen Gästen unbedingt abgeschossen werden; es ist heilige Pflicht, die Leiden zu beenden!“
Spitz erwiderte die Gebieterin: „Ja doch, selbstverständlich! – Sie haben kürzlich wegen Schlägerung angefragt! Ich wünsche, daß die Schlägerung unterbleibt!“ Und nun fügte Fürstin Sophie genau die vom Jäger Eichkitz geäußerten Worte hinzu: „Wo sollen denn unsere Hirsche leben und gedeihen, wenn der Wald immer weniger wird!“
Trocken murmelte Hartlieb: „Zu Befehl, Durchlaucht!“
Am Abend dieses getrübten Jagdtages saß Martina von Gussitsch wieder in ihrer Stube der Villa im einsamen Halltale und kritzelte etliche Bemerkungen in das „Tagebuch“.
„Was die Diener bei Hof mit dem Ausdruck ‚Her[S. 133]hängen‘ meinen, weiß ich jetzt aus eigener Erfahrung. Wenig zu tun haben und doch wie ein Kettenhund angehängt sein! Für mich lautet es natürlich feiner: ‚zur Disposition stehen‘! War das ein ‚Vergnügen‘ auf der Pyrgas-Jagdhütte!! Nichts zu tun, nichts zu lesen, keine Gelegenheit zu irgendeiner Selbstbeschäftigung! Beschränkt die Räumlichkeiten aufs äußerste! Absonderung unmöglich! Dazu noch die untertänige und doch freche Zudringlichkeit der Kammerfrau Hildegard, die, wie mir scheint, es wagt, die Augen zu Hartlieb zu erheben! So eine Frechheit! Aber Hartlieb ignoriert sie! Auf der Hütte war es ein höheres Mopsen. Gegend ja allerdings imponierend, bei Nebel freilich weniger großartig! Und wie der Wind in der Felsenwelt gern und häufig umspringt, so auch die Meinungen, Ansichten usw. Launen der gnädigsten Gebieterin. – – Hui, wie schnell verflog doch das Jagdinteresse! – Und wie schnell vollzog sich die Übersiedlung von der Pyrgas-Hütte herunter in die Villa! Mit nahezu nüchternem Magen, denn das Gabelfrühstück wurde abgesagt! Der ‚Strecke‘, den erlegten Gemsen, nicht ein Blick gegönnt! Ich verstehe – leider – vom Jagdbetrieb, vom Jagdwesen usw. nichts, aber so etwas wie eine Ahnung habe ich doch, daß ‚unser‘ Jagdbetrieb in seiner Unbeständigkeit nicht der richtige sein kann. Wetterwendisch, ohne Rücksicht auf weidmännische Sitte und Brauch! Mit dem Oberförster Jagdleiter Hartlieb und der Gebieterin muß es ‚etwas‘ gegeben haben, irgendeinen Verdruß; kein Wunder übrigens, wenn der Jagdleiter ob dieses Kuddelmuddels verdrossen ist. Auch über die Bevorzugung eines Jagdgehilfen über den Kopf des Oberbeamten hinweg. Der Eichkitz muß bei solcher Verhätschelung bald frech werden, wenn er es nicht schon ist. Ob sich Hartlieb diese[S. 134] Eingriffe in seine Kompetenz, die Ignorierung des Instanzenzuges auf Dauer gefallen lassen wird? Hartlieb in seinem Ernst sieht nicht darnach aus! Zu ernst, sehr verschlossen; aber männlich, korrekt, zweifellos ehrlich: ein richtiger Mann in des Wortes bester Bedeutung. Vielleicht durch den rauhen harten Dienst ein bisserl ‚eckig‘ geworden; sicher alles, nur kein Hofmann! Aber wie er ist, mir gefällt er sehr gut; die ‚Ecken‘ könnten abgeschliffen werden von sanfter Frauenhand... Ach du lieber Himmel! Wohin verirren sich die Gedanken?!! So ‚heiß‘ kann Liebe ja gar nicht sein, um lebenslang und besonders im Winter hier auszuhalten; ein solches Opfer kann es nicht geben! Das Diktum von der ‚alles besiegenden Liebe‘ gilt nicht für das Halltal, weil unmöglich! Übrigens bin ich nicht in Hartlieb verliebt! Nein! Er gefällt mir sehr gut; das ist alles und sicher nicht viel! Ecco la verità!“
Pater Wilfrid, der „Hofpfarrer“ von Hall, hatte einen schlimmen Tag hinter sich, als er nach Admont zurückkehrte in nichts weniger denn rosiger Laune. Was für einen Krach hatte es beim Spielbüchlerbauern wegen der Verlegung des Requiem gegeben! Für den 30. August hatte dieser Bauer einen Trauergottesdienst zum Gedächtnisse eines Verwandten bestellt, und der Pfarrer hatte diesen Jahrtag notiert. Somit wäre diese Angelegenheit in Ordnung gewesen, wenn nicht auch die Fürstin von Schwarzenstein auf den gleichen Tag ein Requiem zum Gedächtnisse des seligen Gemahls bestellt hätte. Dieser Frau mußte doch, obwohl die Anmeldung verspätet einlief, der Vortritt eingeräumt werden. Von dem Grundsatze: „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ wollte der Spielbüchler aber nicht abgehen, mit erschrecklicher Deutlichkeit hatte er sich dahin geäußert, daß er auf die Fürstin von Schwarzenstein – huste, soweit die deutsche Zunge klinge. Eine niedliche Bescherung für den Haller Pfarrer! Aber als Diplomat wußte sich Pater Wilfrid doch zu helfen, indem er die heikle Angelegenheit auf ein Gebiet hinüberschob, wo der Spielbüchler empfindlich und zu treffen war: Wildschadenvergütung! Auf die Anspielung, daß der Mangel an Rücksicht die Fürstin veranlassen werde, künftig dem Spielbüchlerbauern gegenüber die Wildschadenvergütung nicht mehr mit Noblesse in gewünschter Höhe zu bewilligen,[S. 136] reagierte der Bauer doch und er erklärte, einen Tag warten zu wollen, wenn der Pfarrer garantiere, daß die Verschiebung des Requiems dem Verstorbenen nicht wehe tun werde. Diese Garantie konnte der Pfarrer geben mit gutem Gewissen. Nach dem Krach war also der Zweck doch erreicht worden.
Hingegen blitzte der gewandte, erfahrene und weltkundige Pater Wilfrid bei Amanda Gnugesser jämmerlich ab. Die Försterin gab ihm zwar die Zeitung zurück, aber sie weigerte sich mit erstaunlicher Entschiedenheit, die Agitation für die Vergütung der Arbeit der Ehefrau im Haushalte aufzugeben. Auf Grund des neuen Gesetzes müsse das hohe Ziel in jeder Familie erreicht werden. Und die Agitation sei auch bereits im besten Zuge, werde alsbald zu vollem Erfolge führen.
Vergebens hatte Pater Wilfrid aufmerksam gemacht, daß der Gesetzentwurf in der – Schweiz, nicht hier im Lande geplant sei, also von einer gültigen Gesetzesbestimmung gar nicht gesprochen werden könne. Hartnäckig hielt Frau Amanda am segensreichen Prinzip dieser Frauenfrage fest, die Verbesserung der Rechtslage müsse errungen werden, und es sei ganz gleichgültig, von wem die Anregung zur Entlohnung der Frau im Ehestande ausgegangen sei. Tue der Staat nicht mit, wolle man diese hochwichtige Frauenfrage nicht im Wege eines Staatsgesetzes erledigen, so werde eben der Privatweg beschritten, der Kampf mit den Ehemännern in Hall von den Weibern ausgefochten werden. Die Männer müssen zahlen, egal, ob ihnen die Augen tropfen.
Pater Wilfrid verbot dann jedwede Agitation in seinem Pfarrsprengel.
Frau Amanda aber lachte ihn aus, verwies auf die Tatsache, daß die Haller Weiber bereits revolutioniert[S. 137] seien, und daß die Fürstin von Schwarzenstein auf Seite der Frauen stehe, mit der Entlohnungsbestrebung wärmstens sympathisiere.
Unter solchen Umständen konnte ein weiterer Disput mit dieser hitzigen Frau keinen Zweck mehr haben. Einstweilen mußte der Pfarrer den Rückzug antreten. Demnächst aber wird der Kampf aufgenommen werden, und zwar von der Kanzel aus.
Im Stifte suchte Wilfrid den Archivar Pater Leo auf, der gleich ihm Pfarrer des Nachbardorfes Weng ist, also ein spezielles Interesse für die Haller Frauenrevolution haben mußte. Pater Leo sprach denn auch offen die Befürchtung aus, daß die Funken und Flammen dieser Weiberrevolution nach Weng überspringen und überschlagen werden, und daß es kaum möglich sein werde, mit einer Predigt die rabiat gewordenen Frauen zu besänftigen.
„Ein anderes Mittel zur Bekämpfung der Revolution steht uns aber nicht zu Gebote!“ meinte Pater Wilfrid.
„Zunächst freilich nicht, uns wenigstens nicht! Du wirst gut tun, deine Fürstin zum Abrücken von der Haller Frauenrevolution zu veranlassen! Tut die Fürstin nimmer mit, so schwindet der Nimbus, die damischen Weiber werden stutzig, wahrscheinlich durch den Rückzug der Fürstin doch etwas eingeschüchtert werden! Wenn die Flammen nach Weng überschlagen, werde ich als Wenger Pfarrer alles aufbieten, um den Männern das Rückgrat zu steifen! Und das wird gelingen, denn wo die Bauern zahlen sollen, werden sie sehr rasch bockbeinig und schwerhörig. Gehe hin und tue desgleichen, viellieber Bruder im Herrn!“
„Ganz gut! Und wie soll ich meine Fürstin zum Abrücken veranlassen?“
„Ja, das weiß ich nicht, ich bin ja kein Hofmann! Bring ihr bei, daß die Beteiligung an der Frauenrevolution Kosten verursacht, daß die Fürstin blechen, die Löhne ihrer verheirateten Diener und Beamten aufbessern muß, wenn die von ihren Frauen geschröpften Diener und Beamten die Weiberarbeit im Haushalt entlohnen sollen! Vom Gehalt können die Ehemänner das ja nicht leisten! Hört die Fürstin, daß die Liebäugelei mit der Frauenbewegung sie schwer Geld kostet, dann, meine ich unmaßgeblich, wird die Frau mit aller Beschleunigung krebsen!“
„Der Rat ist gut und beachtenswert! Ein gerissenes Herrchen, der vielliebe Amtsbruder!“
„Ach wo! Minimale Lebensweisheit, daß Geld überall eine gewichtige Rolle spielt! Von Gerissenheit keine Spur! Und tausend Meilen entfernt vom klugen und gewandten – Eisenbaron!“
Wilfrid lachte zu dieser harmlos gemeinten Stichelei auf seine adelige Abstammung. Und dann fragte er, ob Gäste im Stift angekommen seien, und was es sonst Neues intra muros monasterii gebe.
„Nicht viel, das Wenige aber schön und erquickend!“ Und nun berichtete Pater Leo über den Stand der Jagdangelegenheit des Novizen Nonnosus, der dem Abte Vergehen, Beteiligung an einer Treibjagd, der dem Kleriker verbotenen venatio clamorosa, rückhaltlos eingestanden und demütig um Bestrafung gebeten habe.
„Na, was hat der Summus Abbas verfügt?“ fragte in offensichtlicher Spannung Pater Wilfrid.
„Wie mir der Abt mitteilte, will er den Nonnosus der Heilsamkeit wegen einige Tage zappeln lassen, dann aber verzeihen und von jeder Bestrafung absehen. Wie der Abbas den ‚Fall Nonnosus‘ auffaßt, liege ein direkt[S. 139] straffälliges Vergehen gegen die kanonische Vorschrift nicht vor; verboten sei die venatio clamorosa, den Ausdruck ‚Riegeljagd‘ wende der betreffende Paragraph nicht an, also habe der Grundsatz zu gelten: ‚Strafgesetze sind streng zu interpretieren, Analogien sind nicht zulässig, in dubio pro reo!‘ Der Abbas erklärt, daß demnach die Erledigung der Sache in eigener Kompetenz zulässig, die Meldung an den Bischof nicht nötig sei! Die milde tolerante Behandlung werde eine viel bessere Wirkung bei Nonnosus erzielen denn eine harte Bestrafung! Und so glaubt der Abbas, daß der Novize im Laufe der Zeit seine Jagdleidenschaft überwinden werde! Wohlwollen und Liebe seien gute Heilmittel, sagte der Abbas, und mit feinem Lächeln fügte er bei: ‚studeat plus amari quam timeri‘!“
Freudig berührt, begeistert sprach Pater Wilfrid: „Ja, unser Abbas! Eine Perle! Gott erhalte ihn uns ungezählte Jahre!“
„Ganz meine Meinung! Und noch eine Neuigkeit haben wir im Hause! Die erquickende Milde des Abbas hat dem anderen Novizen, Modestus, den Mut gegeben, sich dem Abte anzuvertrauen. Geständnis: Kein Beruf zum Priester und erst recht nicht für das Klosterleben! Will Medizin studieren!“
„Alle Wetter, so’ne Bescherung! Auf Stiftskosten studiert und jetzt ausspringen! Was hat denn der Abt gesagt?“
„Wunderschönes Diktum! Summus Abbas sprach: ‚Wir können auch tüchtige, christlich denkende Ärzte brauchen, die das Ordenswesen aus eigener Erfahrung kennen!‘ Und der Abbas will auch uns, id est conventus, angehen, nach Maßgabe der Stiftsverhältnisse eine Unterstützung zu bewilligen! Erquickende Toleranz, was?“
„Wahrhaftig erquickend! – Nun aber Schluß! Ich bin rechtschaffen müde! Muß aber noch die Kampfpredigt endgültig zu Papier bringen!“
„Wünsche viel Vergnügen und gute Verrichtung ad hoc! Salve!“
Die Patres-Pfarrer trennten sich, und Wilfrid suchte seine Zelle auf und schrieb fleißig in die Nacht hinein mit gutem Erfolge...
*
Mit dichtem, langsam ziehendem Allerheiligen Nebel begann der Morgen des Augustsonntages. Kühl war es im einsamen Halltale, frostig in den Gemächern der Villa. Die Bewohner fröstelten wohl alle, bis auf die Köchin in der Küche, wo es wohlig warm war. Und auch Fürstin Sophie empfand die Morgenkühle in dem Moment nicht, da die Kammerfrau Hildegard auf silberner Platte einen soeben eingelaufenen Brief überreichte. Vor der Vertrauten gab sich die Fürstin nicht die Mühe, ihre Erregung zu verbergen; sie griff hastig nach dem Briefe und sprach: „Ich werde klingeln!“
Hildegard verschwand.
Gierig begann Sophie die zweite Epistel des Sohnes, aufgegeben in Dessau, zu lesen. Mit Überfliegen der Schilderung, die Emil von der hübschen, prächtig entwickelten Muldestadt gab.
„Denk Dir nur, liebste Mama: der Herzog führt Allerhöchst persönlich in seinem Theater die Regie, er ist der erste und letzte auf den Theaterproben, kümmert sich um Kostüme, Szenerie, Dekorationen, macht Dienst als Beleuchtungskontrolleur, prüft die Leistungen des Orchesters und Kapellmeisters, kontrolliert die Tempi,[S. 141] kurz er leitet alles selbst. Glaube aber ja nicht, liebste Mama, daß der Herzog bei dieser verblüffenden Tätigkeit etwa ein G’schaftlhuber ist. Er ist Fachmann durch und durch, seit vielen Jahren. Übrigens weiß ja die heutzutage sich für Kunst interessierende Welt, daß dieser Sproß des Hauses Askanien ein genialer Regisseur für Richard Wagner und die musikdramatische Kunst ist, ein Bahnbrecher, der die Edeltraditionen eines gesunden Originalstiles der deutschen Bühne mit produktivem Geiste lebendig in seiner Person verkörpert! Alle Welt weiß das seit vielen Jahren, nur ich habe es nicht gewußt! Zu Dessau an der Mulde, wo die Leute halb sächsisch und halb berlinisch sprechen, habe ich erkannt, daß ich von Wagnerscher Musik und Kunst jetzt halb soviel verstehe wie der Leibjäger Seiner Hoheit. Nu nadierlich, es muß doch der dienende Mensch in allernächster Umgebung des hohen Fachmannes von Kunst mehr verstehen als unsereiner, der doch nur wegen des Balletts ins Theater zu gehen pflegt!
Von wo der Herzog den vielen Spiritus bezogen hat, weiß ich nun auch, nämlich von München, wo er fleißig mit Verstand und ohne Bier Kunstgeschichte studiert und dem dortigen Theater das Beste der Wagner-Inszenierungen abgeguckt hat. Muß der Mann gute und geschulte Augen haben! Und ein enormes Gedächtnis, das ihm ermöglichte, alles auf sein Dessauer Theater zu übertragen! Münchens Errungenschaften im verkleinerten Maße in Dessau! Und hier ein sehr dankbares, vom Herzog gut für Kunst erzogenes Publikum!“
Fürstin Sophie hielt in der Lektüre inne und stöhnte: „Gott! Was er für Nichtigkeiten schreibt!“
Dann las sie weiter: „Bevorzugt wird hier die Oper, das Schauspiel, gut gepflegt, läuft nebenher! Für[S. 142] modernes Liebesleben in neuen Stücken interessiert sich der Herzog anscheinend nicht, ick ooch nich! Wenn es wahr ist, was ich hier gehört habe, übertrumpft Dessau das Münchner Theater insofern, als es an der Mulde kein Defizit gibt! Mit so an vierhundert braunen Lappen subventioniert der Herzog seine Bühne und tut dabei noch Dienst als Oberregisseur und Hofkapellmeister! Allen Respekt! – In Gesprächen über Kunst habe ich mich aus triftigen Gründen auf das andächtige Zuhören beschränkt und vorsichtshalber keinen Ton von mir gegeben! Somit steht zu hoffen, daß der fürstliche Oberspiritual nicht gemerkt hat, was für ein – Flußpferd in puncto theatralische Kunst Prinz Emil von Schwarzenstein ist! Diese Ignoranz, auf deutsch: Dummheit, kann ich der lieben Mama schon eingestehen, weil Du meine Geistesbeschränktheit ja nicht auf den Stephansturm hängen wirst!“
Die Kammerfrau trat ein und meldete, daß der Wagen zur Kirchfahrt bereitstehe.
„Gleich, Hildegard! Nur noch fünf Minuten!“
Hastig las Fürstin Sophie den Bericht des Sohnes zu Ende: „Tags darauf fuhren wir, der Herzog und ich, in die Dessauer Gehege, begleitet vom Leibjäger, der nicht bloß Kammerdiener, sondern gelernter Jäger ist und die Pirschfahrt zu dirigieren hatte. Ein interessanter Mummelgreis als sachkundiger Jagdkutscher auf dem Bock neben dem Leibjäger. Um die Wahrheit zu sagen: die genaue Kenntnis der Fahrwege und ihrer Beschaffenheit, der Bodenverhältnisse (zuweilen sumpfig), der Standorte des Rot- und Damwildes, der Sauen, das fast wortlose Zusammenarbeiten des Leibjägers und des Jagdkutschers, das brillante Umfahren und Einkreisen des Wildes hat mir imponiert! Für Jagd und[S. 143] Wild habe ich bekanntlich und bis jetzt kein besonderes Interesse!“
Seufzend unterbrach die Fürstin für einen Moment die Lektüre. Um Emils Interesse für Jagd und Wild zu wecken, hat die Fürstin das Jagdgut Hall gekauft. Und nun bestätigt der Sohn schwarz auf weiß den Mangel an Jagdinteresse... Zwecklos ausgegeben das viele Geld! – Dann las die Fürstin den Schluß: „Was hat denn Dein neues Hoffräulein dem Wolffsegg im Höchsten Auftrage geschrieben? Wolffsegg macht einen Kopf wie ein Schaf beim Donnerwetter! Ist die neue Brettelhupferin wenigstens jung? Hübsch kann sie nicht sein, weil Hofdamen nie schön sind! Mir ist’s natürlich egal, ich frage nur, weil die Brettelhupferin ja doch Deine Hofdame, also ständig bei Dir ist! Für die allernächste Umgebung wählt man doch lieber nette, sozusagen patschierliche, wenn möglich jüngere Leute aus!
Kuß und Gruß der lieben Mama!
Ew. Durchlaucht ehrerbietigst
Emil von Schwarzenstein.
P.S. Auch hier sind die adeligen Töchter des Landes nicht nach meinem Geschmack.“
Sophie verschloß den Brief. Und fuhr mit Fräulein von Gussitsch zur Kirche im Dörflein Hall.
Unterwegs fragte die Fürstin: „Was haben Sie denn, liebe Martina, dem Baron Wolffsegg geschrieben? Mein Sohn meldet, daß Wolffsegg gekränkt sei!“
Die Hofdame versicherte, taktvoll und zart im Sinne der erteilten Weisung geschrieben zu haben. Anlaß zu einem Gekränktsein sei ganz gewiß nicht gegeben.
Die Fürstin schwieg und hing ihren Gedanken nach, die sich mit dem Sohne beschäftigten. Unverkennbar[S. 144] ein gewisses Aufwachen als wohltätige Folge dieser Reise.
Die Nebel wichen, die Sonne lachte. Köstlich war die Fahrt zur Kirche. In guter Stimmung kam Sophie in Hall an, ehrerbietig von den Männern, mit auffallender Wärme, fast mit Begeisterung von den Weibern begrüßt.
Pater Wilfrid hatte schon mit der Predigt begonnen, als die Fürstin mit dem Hoffräulein sich im kleinen Oratorium niederließ. Die Ankunft der Fürstin gewahrend, zauderte der Pfarrer einen Moment. Fatal war seine Lage, da er sich blitzschnell erinnerte, daß die Fürstin in der Haller „Frauenfrage“ auf Seite der Frau Forstwart Gnugesser stehe. Der Pfarrer aber soll und muß heute von der Kanzel aus den Kampf gegen die Weiberrevolution aufnehmen. Sein Thema kann er nicht fallen lassen, es ist unmöglich, auf die Fürstin Rücksicht zu nehmen. Das Interesse und Wohl der Pfarrgemeinde geht vor und steht höher. Entschlossen und mutig sprach Pater Wilfrid auf der kleinen Kanzel von der Einheit der Kirche und des Glaubens. „Christus wollte auch jene Gemeinschaft, welche die Wurzel des gesellschaftlichen Lebens bildet, die Ehe, auf den Boden der unzertrennlichen Einheit stellen. Und hier wollte er nicht nur eine äußere Einheit, er wollte die vollkommene Einheit der Familie, besonders der Ehegatten wiederherstellen. Diese von Christus gewollte Einheit verlangt aber die Gemeinsamkeit der beiderseitigen Interessen der Ehegatten. Nach der Lehre Christi soll der Mann das Haupt der Familie sein, die Frau aber soll in allen rechtlichen und billigen Dingen dem Manne untergeordnet bleiben, wie es die Kirche den Brautleuten ausdrücklich und entschieden an das Herz legt. Trennung[S. 145] und Spaltung der Interessen beider Eheleute kann darum unmöglich der Wille des göttlichen Stifters des Ehesakramentes sein.“
Pater Wilfrid hielt einen Moment inne, dann sprach er mit scharfer Betonung: „Wenn in der gegenwärtigen Zeit Strömungen kommen, die das Ideal der gottgewollten Einheit der Ehe zerstören wollen, so ist das nichts anderes als ein Angriff auf die Grundfesten der Ehe selbst! Es ist traurig und betrübend, daß in unsere Pfarrgemeinde solche Ideen durch Zeitungsnachrichten den Weg gefunden haben. Diese irrigen Nachrichten sind unverständigerweise mündlich weitergetragen worden von Personen, die keine Ahnung davon haben, daß durch derlei Ideen die Einheit der Ehe schwer geschädigt, erschüttert, ja vernichtet wird. Darum ist es notwendig, daß bei der menschlichen Schwäche beide Eheleute diesen Gedanken der von Christus grundgelegten und in seiner irdischen Familie vorbildlich durchgeführten Einheit der Ehe nie aus den Augen lassen und sich weder durch schriftliche, dem unchristlichen Weltsinne entsprungene Neuerungsideen, noch durch mündlich fortgepflanzte einseitige Interessenpropaganda in ihrer gegenseitigen heiligen Aufgabe irremachen lassen! Es ist notwendig, daß in erster Linie der Mann, der Ernährer und Brotverdiener, die Früchte seiner Arbeit zum Wohle seiner Familie verwendet und nicht in einseitigem Interesse nur für sein Wohlbehagen sorgt! Ihm muß als treue Lebensgefährtin die Frau zur Seite stehen, die Gattin, die nicht durch einen rein weltlichen Arbeitsvertrag, sondern durch ein Sakrament mit ihm verbunden ist.
Eine schwere Gefahr für den Familienfrieden und für die Erziehung der Kinder ist es, wenn Mann und Frau ihre eigenen Wege gehen wollen und sogar eine Tren[S. 146]nung der zeitlichen Güter und irdischen Interessen vornehmen wollen. Wenn Ehegatten dem Zuge der Zeit folgen, der darauf hinausgeht, daß jeder nur sich selbst der Nächste sein soll und sich nur um sein eigenes Wohl zu kümmern habe, so zerreißen solche Ehegatten dadurch das Band des ehelichen Glückes, sie vernichten die göttliche Gnade im verantwortungsvollen Ehestande. Gütertrennung vernichtet das Ideal der Ehe, die innigste Verbindung von Mann und Weib. Die Ehe hat zum Grunde die Opferliebe; jeder Gatte muß für den Ehepartner Opfer bringen können, muß sie auch bringen im gemeinsamen Interesse. Ohne gegenseitiges Vertrauen gibt es keine Liebe.
In unserer Gemeinde streben einige Ehefrauen die Entlohnung ihrer Arbeit im Haushalte an. Diese Frauen sollen bedenken, daß das Eheweib, das für die Hausarbeit Bezahlung fordert, sich selbst erniedrigt! Ein solches Weib ist nicht mehr die dem Manne ebenbürtige Ehegattin, sondern eine Dienstmagd gegen Lohn!“
Wieder machte der Pfarrer eine kleine Pause. Und dabei gewahrte er, wie die Fürstin Sophie sich weit vorgebeugt hatte und den Prediger mißbilligend anblickte. Aber weder Zustimmung noch Tadel durfte ihn abhalten, seine Pflicht zu erfüllen. So sprach er scharf im Tone weiter: „Die Frauen, die in unserer Gemeinde den Frieden in den Familien stören, von den Ehemännern gleich gar ein Drittel des Jahresverdienstes als Arbeitsvergütung fordern, diese Frauen berufen sich auf ein neues Gesetz, das eine solche Bestimmung enthalte. Laßt euch, Ehemänner, nicht irremachen, nicht einschüchtern! Bei uns gibt es ein solches Gesetz nicht, weder ein altes noch ein neues! In der Schweiz ist geplant, eine ähnliche Bestimmung in den Entwurf zum neuen Zivil[S. 147]gesetzbuche aufzunehmen! Was die Schweizer tun, geht uns nichts an! Die Agitation der Frauen entbehrt also jeglicher Berechtigung! Und strafbar ist die Aufreizung! Wahret den Frieden im Hause! Amen!“
Bevor Pater Wilfrid die Kanzel verließ, warf er einen Blick auf die Menge der Andächtigen. Unverkennbar war die Überraschung der Frauen, ein gewisses Frohlocken in den Mienen der Männer, ein Aufatmen der drangsalierten, nun durch den Pfarrer befreiten Ehemänner.
Überrascht, unangenehm berührt schien auch Fürstin Sophie zu sein, die den Prediger starr vor Staunen angeguckt hatte und sich nun in das Dunkel des Oratoriums zurückzog. Und während des anschließenden Gottesdienstes beschäftigten sich die Gedanken der Frau mit der Frage, wie es die Gattin des Forstwarts wagen konnte, das Protektorat zu erbitten, wenn die ganze soziale Angelegenheit keine gesetzliche Basis hat. Eine Unverfrorenheit war es von der Forstwartsfrau, die Unterstützung zu erschleichen, die Fürstin in eine unberechtigte Agitation hineinzuzerren. Unschön und rücksichtslos fand es Sophie aber vom Pfarrer, daß er ihr nicht beizeiten die nötigen Informationen gegeben, einen Rückzug in aller Stille ermöglicht hatte. In dieser üblen Stimmung flüsterte die Fürstin dem Hoffräulein gegen Ende des Gottesdienstes die Bitte zu, dafür zu sorgen, daß der Wagen zur sofortigen Rückfahrt bereitgehalten werde. Gehorsam entfernte sich Martina aus dem Oratorium.
Im Pfarrhause hatte die Dienerin Witwe Erna alles schön für den zu erwartenden Besuch der Fürstin, für das Teefrühstück vorbereitet.
Als Pater Wilfrid hungrig von der Kirche kam und[S. 148] den festlich geschmückten Frühstückstisch sah, lobte er die Wirtschafterin, die darob zwar geschmeichelt lächelte, dennoch aber dem Pfarrer die Bemerkung nicht schenken konnte, daß der hochwürdige Herr sich mit der heutigen Predigt bei den Frauen eine böse Suppe eingebrockt habe.
„Ach was! Bringen Sie den Tee! Die Fürstin wird gleich kommen!“
Wagengerassel auf dem Sträßlein veranlaßte Erna zum Fenster zu springen. Und erregt rief sie: „Da haben S’ den Salat, Herr Pfarrer! Den Tee können S’ alleinig trinken, die Fürstin fahrt heim! Mit dem Besuch ist also nichts, und ich hab mich umensunst geplagt! Wahrscheinlich wird sich auch die Duhrlauch wegen der Predigt geärgert haben! Wie man sich nur eine solche Supp’n einbrocken kann...!“
„Bringen Sie mir das Frühstück! Auf Ihre Bemerkungen verzichte ich!“
Alsbald servierte Erna mit allen Anzeichen der Enttäuschung und Verdrossenheit.
Und Pater Wilfrid löffelte noch, als die Hausglocke Besuch anmeldete. Der übliche Sonntagsaudienzdienst für den vielgeplagten Pfarrer begann. Als erster Besucher kam der Forstwart Gnugesser mit seinem strahlendsten Lächeln höchster Befriedigung, beweglich und vergnügt, so daß das Bäuchlein hüpfte. Mit beiden Händen liebkoste der Forstwart den fuchsigen Patriarchenbart und zog die Schnauzerenden in die Länge, wodurch das Männlein ein geradezu kriegerisches Aussehen bekam. „Danken möcht ich, Herr Pfarrer, für die prachtvolle Predigt! Gut, sehr gut haben Sie den Weibern, die wo Geld möchten für die Arbeit im Haushalt, die Meinung gesagt! Uns Ehemännern haben Sie die[S. 149] heißersehnte Erlösung gebracht! Ich dank von ganzem Herzen! Und meine Amanda werd ich mir heut noch fürifangen und die Krämerin auch, die, wo das Haupt der Weiberrevolution ist!“
Scharf gellte die Hausglocke. Seine Rede unterbrechend, guckte Gnugesser zum Fenster hinaus, zog aber sofort den krebsrot gewordenen Kopf zurück und stotterte: „Au weh! Herr Pfarrer bekommen gefährlichen Besuch: die Krämerin will herein! Kann ich derweil nicht in Ihrem Schlafzimmer oder Salon warten, bis die Krämerin das Haus verlaßt?“
Lächelnd meinte Pater Wilfrid: „Eben sagten Sie doch, daß Sie Ihre Frau und die Krämerin fürifangen wollten! Die Gelegenheit dazu ist geboten, Sie können der Krämerin hier die Meinung sagen!“
„Nein, nein! Nicht hier, das Pfarrhaus soll doch ein Haus des Friedens sein! Empfehl mich gehorsamst, Herr Pfarrer!“ Und der tapfere Held mit dem Bäuchlein und Patriarchenbart drückte sich zur Türe hinaus. Und prasselte die Treppe hinab so schnell, daß sich die hagere Krämerin erschreckt in eine Ecke flüchtete.
Als dann diese Frau vor dem Pfarrer stand, mußte Wilfrid unwillkürlich an jene Hundespezies denken, die sich durch besondere Magerkeit und minimale Menge an Gehirn auszeichnet. Dürr und mager wie ein Windhund war die Krämerin, aus den Augen leuchtete keineswegs Intelligenz, dafür Streitlust und Eigensinn. Unter dem schwarzen Kopftüchel quirlten etliche dünne Haarsträhne heraus wie Schlänglein. Das scharfgeschnittene Gesicht gemahnte an einen Raubvogel und kündete alles, nur nicht Sanftmut und Frieden. Und Krieg die eckigen Ellenbogen, Kampf die knochigen, auf die schmalen Hüften gestemmten Hände. Ein böser Blick züngelte am[S. 150] Pfarrer hinauf, der aber diese Musterung ruhig aushielt und mit leichter Ironie im Tone fragte, womit er dienen könne.
Fester stemmte die Krämerin die Hände auf die Hüften, scharf klang die Stimme: „Die Predigt, Herr Pfarrer, die unglaubliche Predigt! Es ist wirklich nicht zu glauben, was Sie heut von der Kanzel verkündet haben!“ Die rechte Hand löste sich von der Hüfte, gebieterisch streckte sich der Zeigefinger. „Diese Verkündigung wird der Herr Pfarrer zurücknehmen!“
„Warum denn, liebe Frau?“
„Weil das neue G’setz schwarz auf weiß zu lesen ist! Die ganze Welt weiß davon, nur der Pfarrer von Hall weiß nichts! Ich sag Ihnen: wir führen die gesetzliche Bestimmung durch, ob es Ihnen recht ist oder nicht! Wo ich die Fürsteherin vom Haller Frauenbund bin und zu befehlen hab!“
„Die Absicht, ein gar nicht existierendes Gesetz zur Geltung zu bringen, müssen Sie nicht dem Pfarramt, sondern der Behörde und der Gendarmerie anzeigen, die Ihnen das Nötige und Weitere dann schon mitteilen wird!“
„Mit den verdruckten Herren von der Bezirkshauptmannschaft will ich nichts zu tun haben, die Herren sind zu politisch! Von der Kanzel hat der Pfarrer gesprochen, durchaus Behauptungen, die dem Frauenbund nicht passen, also halt ich mich an den Pfarrer, der die heutige Predigt z’rücknehmen muß am nächsten Sonntag!“
„Zurücknehmen kann ich nichts, aber ich werde in der nächsten Predigt schildern, was für eine grundgescheite Fürsteherin der Haller Frauenbund hat...“
„Das ist grad nicht nötig! Ich weiß schon selbst, daß ich eine g’scheite Frau bin!“
„Schön! Da Sie soviel Intelligenz besitzen, werden Sie gewiß auch wissen, wie man die Tür von – außen zumacht!“
„Was? Ausschaffen! Mich, die Fürsteherin, wo im kleinen Finger mehr Gesetzeskenntnis hat als der ganze Herr Pfarrer! Das Ausschaffen werden S’ büßen, wahrlich nicht wenig!“ Wie beschwörend streckte das hagere Weib die dünnen Arme in die Höhe. „Sie wollen den Kampf, gut, wir werden um unser heiliges Recht kämpfen! Empfehl mich, Hochwürden!“ Schrill lachend, entrüstet verließ die Krämerin mit zappeligen Schritten das Zimmer.
Pater Wilfrid konnte der Komik dieses Auftrittes nicht widerstehen und schmunzelte. In das Treppenhaus tretend, wollte er eben hinunter zu Erna rufen, daß der nächste Besuch vorgelassen werden solle; das Gekeife der Krämerin veranlaßte ihn jedoch, mit dem Rufe zu warten.
Wütend zeterte die Krämerin zur Dienerin: „Außi g’schmissen hat er mich! Wo ich die Fürsteherin bin! Ich aber steh gut dafür: die längste Zeit ist er in Hall Pfarrer g’wesen! Außi muß er! Und dem Abt in Admont werd ich meine Meinung sagen, bis ihm die Augen tropfen und die Ohren stauben!“
Wilfrid lachte hellauf.
In höchster Wut warf die Krämerin die Haustüre so wuchtig ins Schloß, daß das Pfarrhaus erzitterte.
Der Reihe nach kamen Bauern mit ihren Anliegen; diesmal aber auch etliche Weiber, die aber wider Erwarten Wilfrids nicht auf die Predigt reagierten, dafür erstaunliche Bitten vorbrachten. Eine Bäuerin wünschte eine Bevorzugung durch Anweisung eines Kirchenstuhles in der vordersten Bank. Die Bauersfrau Troger bat[S. 152] um Benediktion des Stalles, und zwar heute noch, weil der Pfarrer an Wochentagen selten oder nie in Hall sei, und eine Kuh Schlingbeschwerden habe. Eine andere Bäuerin klagte über den Lehrer, der ihren Kindern zuwenig beibringe und zuviel mit dem Stock arbeite. Mit einer kostbaren Beschwerde kam eine alte Jungfer namens Hupfauf: „Herr Hochwürden!“ lispelte sie anfangs, „ich bin es bekanntlich, die seit Jahren den Marienaltar mit Blumen schmückt; Sie aber sind es, der diesen Schmuck immer wegnehmen ließ!“
Pater Wilfrid erwiderte trocken: „Ganz richtig! Jede Zierde muß Maß und Geschmack haben! Auch ziert man den Marienaltar nur an Marientagen und im Monat Mai!“
Bedeutend schärfer im Ton rief die Jungfer Hupfauf: „Was? Sie wollen mir vorschreiben, wann ich die Gottesmutter verehren und schmücken darf? Und zuwenig G’schmack soll ich haben! So eine Beleidigung! Danken sollen Sie, daß man sich überhaupts um die Kirch’n kümmert! Wo die Welt eh schier nichts mehr von Kirch’n und Pfarrer wissen will in dieser schrecklichen Zeit!“
Wilfrid suchte die aufgeregte alte Maid zu beruhigen.
Aber die Jungfer wurde völlig rabiat und zeterte: „Sein tun die Mannsbilder alle gleich, lauter Spitzbuben, die z’sammenhelfen, wo es gegen die Jungfern geht! Schamen sollen Sie Ihnen, daß Sie zu den Mannsbildern halten und gegen die Weiber predigen! Mich geht die Sach mit dem Frauenbund nichts an, weil ich Gott sei Dank eine Jungfer bin und in Ewigkeit von Mann und Heirat nichts wissen will! Aber weil der Herr Pfarrer so – herb auf die armen Frauen ist und mir das Schmücken des Altars nicht erlauben[S. 153] will, werd ich von nun an zum Frauenbund halten! Jawohl! Und Sie werden dann schon sehen, daß Sie den kürzeren ziehen! Denn siegen tut immer und überall das edle weibliche Geschlecht und die Tugend! Empfehl mich, Hochwürden!“
Während die alte Maid hinausrauschte, krümmte sich Wilfrid vor Lachen.
*
Dem Requiem zum Gedächtnisse des hochseligen Fürsten wohnten die Witwe, der zurückgekehrte Hausmarschall Graf Thurn, Fräulein von Gussitsch, die Beamten, etliche Jäger und das gesamte Personal bei. Hernach stattete die Fürstin mit Martina dem Pfarrer einen Dankbesuch ab. In milder Stimmung, die der Trauerfeier entsprach, dankerfüllt ob der rührendschönen Gedächtnisrede Wilfrids.
Die Dienerin konnte diesmal Triumphe feiern und Anerkennung einheimsen, denn Fürstin Sophie nahm den Tee ein und lobte die weißhaarige Wirtschafterin nach allen Seiten hin.
Im Verlaufe des Frühstücks kam die Fürstin auf Wilfrids „soziale“ Predigt insofern zu sprechen, daß die hohe Frau fragte, ob es wirklich kein Gesetz ähnlich dem Schweizer Entwurf gebe.
Schlicht erwiderte Wilfrid: „Nein, Durchlaucht!“
„Was wird denn nun die Folge Ihrer Kontrastellung sein?“
Die Schultern hochziehend, meinte Pater Wilfrid: „Abwarten und Tee trinken! Wenn die Männer mit dem Geld nicht herausrücken, wird die Frauenrevolution im Sande verlaufen müssen! Je eher, desto besser! Auch im Interesse Euer Durchlaucht!“
Überrascht fragte die Fürstin: „Wieso? Meine Privatinteressen haben doch mit der Haller Frauenbewegung nichts zu tun!“
„Doch! Nämlich im Falle, daß ein Gesetz à la Schweiz den Ehefrauen das Gehaltsdrittel des Brotverdieners bewilligen würde!“
„Ich verstehe Sie wirklich nicht!“
„Müßten die im Dienste Euer Durchlaucht stehenden verheirateten Beamten und Diener das Gehaltsdrittel den tugendsamen Ehefrauen zahlen, so würden die Beamten und Diener genötigt sein, die gnädigste Gebieterin um – Gehalts- und Lohnaufbesserung zu bitten!“
„Ach so! Danke für diese wichtige Aufklärung! Sehen Sie zu, Herr Pfarrer, daß die Frauenbewegung bald ein wohltätig Ende findet!“
Nach der Abfahrt der Frau rieb sich Peter Wilfrid die Hände, denn das schnell erfolgte „Umsatteln“ der Fürstin bereitete ihm Spaß. Und dann beschloß er, das energische Abrücken der Fürstin zu verwerten im Kampfe gegen die Haller Weiberrevolution.
Das direkte Eingreifen der Fürstin in jagdliche Angelegenheiten, der Befehl, daß die Jagdgehilfen ihr direkt Berichte zu erstatten haben, all das mußte zur Ignorierung des Instanzenzuges führen, die Dienstesverhältnisse nachteilig beeinflussen, die Charaktere ungünstig verändern. Die Jagdgehilfen merkten sehr rasch, daß sie williges Gehör fanden, sie kamen wegen jedes Pfifferlings, machten sich wichtig, betonten die Mühen ihres Dienstes, ihre Aufopferung, und versuchten Geldgeschenke herauszuschinden. Um den Jagdleiter Hartlieb kümmerten sich die Jagdgehilfen kaum noch. Erteilte er Befehle, so wurde mit der Befolgung gewartet, weil nach entsprechend gefärbtem Bericht von der Fürstin ja doch Gegenorder gegeben wurde. Offene Auflehnung gegen den Oberbeamten wagten die Jäger natürlich nicht; aber sie freuten sich diebisch, daß so vieles über den Kopf Hartliebs hinweg angeordnet, dem Jagdleiter die Hände gebunden, ihm Stellung und Dienst sehr sauer gemacht wurden.
Am frechsten gebärdete sich der schmucke, von Durchlaucht ganz besonders bevorzugte Jäger Eichkitz. War er doch eine Art „vortragender Rat“ in Jagddienstangelegenheiten geworden, täglich zum Bericht befohlen. Und fast immer geschah, was er befürwortete. Die täglichen Gänge zur Villa gaben einen willkommenen,[S. 156] leicht zu begründenden Anlaß zur Dienstschwänzung, zu Erleichterungen. Die Rennerei in die hochgelegenen Pyrgas-Reviere hatte ein Ende. Klug deckte sich Eichkitz den Rücken gegen das Eingreifen des Oberbeamten, indem der fesche Bursch die Gebieterin aufmerksam machte, daß er nicht gleichzeitig an zwei Orten sein könne; nicht in der Villa bei der gnädigsten Fürstin und nicht zur selben Zeit auf dem Pyrgas. Das begriff die Gebieterin, und sie befahl, daß den Dienst in den Pyrgas-Revieren ein anderer Jagdgehilfe zu machen habe; Eichkitz solle nur zeitweilig behufs Kontrolle nachschauen.
Eichkitz trug die Nase hoch; aber so klug war er doch, um sich durch Brüskierungen nicht unnötigerweise Feinde zu schaffen. Groß war freilich die Verlockung, den Kammerdiener Norbert hochnäsig zu behandeln oder doch zu verulken; Eichkitz sagte sich aber, daß er vielleicht den wegen seines Einflusses nicht zu unterschätzenden Mann gelegentlich brauchen könnte, und stellte sich in dieser Erwägung auf guten Fuß mit dem Haushofmeister. Der Kammerfrau Hildegard, der noch immer stattlichen Witib, gegenüber spielte er den aufmerksamen, demütigen Jüngling, huldigte ihr und verdrehte die Augen, seufzte wohl auch, wenn just kein Beobachter vorhanden war, und bettelte um Protektion. Nicht vergebens, denn die geschmeichelte Kammerfrau steckte ihm manchen Bissen zu. Da Eichkitz zur Schonung seines Geldbeutels freie Verköstigung zu Lasten, doch ohne Wissen der Fürstin anstrebte, mußte logischerweise mit der fürstlichen Hofköchin anbandeln. Dies gestaltete sich aber schwerer, als der hübsche Frechdachs es sich vorgestellt hatte. Die üppige Köchin mit dem ungewöhnlichen Taufnamen Restituta war keineswegs blind, sah ganz gut, daß der Jäger ein bildhübscher Kerl war, aber sie hatte[S. 157] unerschütterliche Grundsätze. Restituta machte auch Eichkitz gegenüber, als er sie erstmals anschmachtete, kein Hehl daraus, daß sie gelobt und geschworen habe, genau den gleichen Lebenswandel zu führen wie ihre Namenspatronin, nämlich „jungfräulich“ zu bleiben und „mutig“ durch das irdische Leben zu gehen, auf daß die Köchin wie die heilige Restituta genau an einem 17. Mai sterbe und von einem Spezialengel in das himmlische Paradies geführt werde. Im tiefsten, heiligsten Ernste hatte Fräulein Restituta dies gesagt und dabei einen Blick verfrühter Verzückung zum Küchenplafond gerichtet. Eichkitz aber kämpfte mit übermenschlicher Kraft, um das Lachen zu verbeißen und den Anschein zu erwecken, als glaube er jedes Wort und er sei ein Verehrer der Restituta von wegen ihres „Mutes“. Nur sprechen konnte er in jener Stunde nicht, der Lachkitzel war zu stark.
Bei einem zweiten Versuch der Anbandelung war der Frechdachs aber schon imstande, zu fragen, ob die Restituta auch – wohltätig gewesen sei.
Davon war der Köchin nichts bekannt; sie wußte sich aber zu helfen, indem sie dem andächtig zuhörenden Jäger mitteilte, daß laut der Heiligenlegende die selige Jungfrau Restituta aus einer – adeligen Familie stammte. Weil sie dann Christin wurde und hinterdrein ob ihres Märtyrertodes heilig, muß sie auch wohltätig gewesen sein.
Eichkitz beschattete mit der Hand die listig funkelnden und lachenden Augen, und süßlichen Tones sprach er die Überzeugung aus, daß sicherlich auch die Köchin Restituta willens sei, sich durch ausgiebige Wohltätigkeit den freien Eintritt in das Himmelreich zu verdienen.
Wie erhofft, biß die dicke Köchin auf diesen Köder,[S. 158] indem sie herausplatze: „Aha jo! Gärn aa no! Wos möcht er denn, der Jaaga?“
„Der Hunger tut weh, Fräuln Restituta! Besonders tut der Hunger weh, wenn der Mensch kein Geld nicht hat! Sind Sie vielleicht auch aus einer adeligen Familie, Fräuln Restituta? So etwa vom Landadel?“
Hochgeschmeichelt meinte die Köchin mit wonnekündendem Lächeln: „Därweil no net!“
Der Lohn für die kecke Schmeichelei bestand darin, daß Eichkitz ein großes Stück Paprikaspeck bekam. Und als der enttäuschte Schelm jammerte, daß der Paprika viel Durst erzeuge, gab ihm Restituta auch noch Geld zur Durstlöschung. Und dazu den Rat, zu jener Stunde in die Küche zu kommen, wenn für das Hauspersonal das Essen verabreicht werde. Wo für so viele Leute Speise und Trank vorhanden sei, könne ein armer, frommer Jäger auch mitessen.
Und so erreichte der Frechdachs sein Ziel doch. Aber schon nach etlichen Tagen juckte ihn der Übermut, er verulkte die heilige Restituta so drollig und witzig, daß die Hausangestellten vor Vergnügen brüllten, die entrüstete Köchin aber den Spötter mit dem Besen fortjagte.
*
Oberförster Hartlieb war sich darüber völlig klargeworden, daß er unter den so gründlich und ungünstig veränderten Dienstesverhältnissen nicht auf die Dauer in seiner Stellung bleiben könne. Mannesehre, Stolz und Berufsliebe zwingen dazu, den Posten aufzugeben, sich um eine andere Stellung zu bewerben, anderswo unter einem Jagdherrn und Sachverständigen zu dienen. Der Weiberwirtschaft im Jagdbetriebe war Ambros[S. 159] Hartlieb bis zum Ekel überdrüssig geworden. Von einem richtigen normalen Jagdbetrieb konnte überhaupt nicht mehr gesprochen werden. Überflüssig war der Jagdleiter, er wurde nicht gerufen, erhielt auch keine Befehle. Kam er in die Reviere, traf er den einen oder anderen Jagdgehilfen im Dienst, so war ziemlich deutlich eine gewisse passive Resistenz zu beobachten. Nicht offene Weigerung, die Befehle Hartliebs zu befolgen, nur verhaltener Widerstand, Verzögerung. Lauernde Blicke, spöttisches Lächeln, widerliche, mit Hohn gemischte Unterwürfigkeit; Mienen, die zu künden schienen: Jagdleiter bist du nicht, hast nichts mehr zu befehlen, kannst mir auf den Buckel steigen!
Keine Abschußerlaubnis. Keine Einladung mehr. Diese Ignorierung tat Ambros allerdings nicht wehe, im Gegenteil, der Forstmann und Jäger freute sich, daß ihn die Gebieterin in dieser Beziehung vergessen zu haben schien. Für den Hofdienst schwärmte Hartlieb nicht, hatte von der ersten Stunde an nichts Gutes erhofft. Aber doch nicht geglaubt, daß alles so schlimm für den Waldoberbeamten und Jagdleiter unter der Damenherrschaft kommen würde. Unerträglich und empörend war die Lage für den ernsten, einsamen Ambros geworden. Entwürdigend! Dirigent ist der Jagdgehilfe Eichkitz, Frechdachs und Schmeichler in einer Person. Ein falscher Tropf, aber ein fescher Bursch. Verlogen, faul, Egoist, eine Null als Jäger und als Mensch.
In einsamen Stunden fragte sich Hartlieb oft, warum er sich nicht aufraffen kann, den Dienst aufzukündigen und den früheren Jagdpächter Grafen Lichtenberg brieflich zu fragen, ob er eine Stellung für ihn habe.
Etliche Gründe hatte Ambros für seine Unentschlossenheit, für das Hinausschieben des entscheidenden Schrittes.
Die Hirschbrunft wird demnächst beginnen. Will die Gebieterin Brunfthirsche schießen, so muß sie sich ja doch an ihren Jagdleiter wenden. Unmöglich kann die Hirschbrunft ganz ignoriert bleiben; sie ist doch die Hohe Zeit, das Herrlichste im Jagdbetriebe und für den Jagdherrn!
Wenn Hartlieb die Weiberwirtschaft verfluchte, so galt die Verdammung genau genommen nur der Mißwirtschaft auf der Seite der launenhaften und in ihren Entschlüssen unberechenbaren Gebieterin. Keineswegs der Hofdame, die ja nichts zu sagen, nichts anzuordnen hat.
Dachte Ambros an das ihm sympathische Fräulein von Gussitsch, so hüpfte das Herzelein vor Wonne. Und dem einsamen ernsten Beamten war zumute, als müßte er himmelhoch jauchzen. Wie zierlich, nett, hübsch das Hoffräulein doch ist! Wie ein Edelmarder geschmeidig und elegant! Ob Mustela in diesem Leben Frau Hartlieb werden könnte?
Können und wollen ist zweierlei!
So hoffte Ambros Hartlieb und wartete; erlitt alle Qualen trostloser Verliebtheit...
Über seine triste Lage hätte er gerne mit dem Grafen Thurn gesprochen, sich dem alten liebenswürdigen Hausmarschall anvertraut. Aber der Graf hatte infolge der miserablen Witterung das Reißen bekommen und sich mit längerem Urlaub zum Gebrauch der berühmten heißen Quellen nach Römerbad in der südlichen Steiermark geflüchtet.
Am Mittag eines naßkalten Herbsttages war es. Hartlieb hatte sich von Frau Amanda Gnugesser eine Fleischkonserve warm machen lassen, deren Inhalt er in der Kanzlei verspeiste. Der Gang zum Wirt in Hall war erspart. Eine Zigarre am Fenster schmauchend,[S. 161] hielt Ambros stehend kurze Siesta und blickte auf das zum Jagdschlößl führende Sträßlein im nebelerfüllten Halltale.
Plötzlich zuckte Hartlieb zusammen. Jähe Röte schoß ihm in die Wangen, ein Zittern lief durch den Körper, das Blut hämmerte und klopfte.
Das Sträßlein kam Mustela-Martina herangestapft. In neckisch-praktischem Lodenkleid, fußfrei der kurze Rock, so daß die Stiefelchen sichtbar waren. Schneidig auf dem hübschen Köpfchen thronend das grüne Ausseer Hütel. Die geschmeidige Mustelagestalt freilich neidisch verhüllt von einem wasserdichten Regenmäntelchen. Ohne Regenschirm. Der zaghaft fallenden Schnürltropfen lachend, so daß die Marderzähnchen blinkten. Offenbar mußte das bildhübsche Hoffräulein sehr vergnügt sein.
„Ob Mustela zu mir in die Kanzlei kommt?“ fragte sich flüsternd Ambros. Und des Zigarrenqualmes wegen, zur Lüftung der Kanzlei, riß er die Fenster auf. Und grüßte respektvollst.
Und das Hoffräulein dankte mit einem allerliebsten Kopfnicken und munterem Lächeln. Und steuerte trippelnd dem Forsthause zu.
Martina kam nicht herauf. Sie besuchte die Forstwartsfrau. Wie Ambros die überspannte Amanda Gnugesser um diesen Besuch beneidete!
Der Uhr nach war es Zeit, den Dienstgang anzutreten. Hartlieb schloß die Fenster, machte sich marschfertig, und – blieb in der Kanzlei. Wartete und horchte auf das seltsame Klingen im Herzen.
Frau Amanda begrüßte die hübsche Hofdame strahlenden Auges und mit einer gewissen stolzen Feierlichkeit. Sie hatte brieflich um Audienz gebeten in der Absicht, die Fürstin gewissermaßen scharfzumachen, als[S. 162] Vorspann zu benützen und wegen der heillos unangenehmen Kanzelrede gegen den Pfarrer auszuspielen. Der Eitelkeit schmeichelte es nicht wenig, daß die Fürstin eigens die Hofdame schickt, um den erhofften, sehnlichst gewünschten Bescheid zu bringen, der nach Amandas Auffassung nur die Gewährung der Audienz sein konnte. Frau Amanda stutzte, als Martina von Gussitsch es dankend ablehnte, Platz zu nehmen und höflich mitteilte, daß auf Wunsch der Fürstin künftighin Zuschriften nicht an sie selbst, sondern an das Marschallamt oder an die Hofdame vom Dienst gerichtet werden sollen.
Der Glanz in Amandas Augen erlosch, der Blick ward hart, die Lippen bleich. Und eine tiefe Falte zeigte sich auf der Stirne. Schwer enttäuscht sprach Frau Gnugesser: „Um mir das zu sagen, haben sich gnädiges Fräulein selbst herbemüht?“
„Eine willkommene Bewegung in frischer Waldluft vor dem Lunch! Mündlich Bescheid zu geben, ist mir lieber als das Schreiben von Briefen! Allerdings überbringe ich einen Bescheid, der Ihren Wünschen nicht entsprechen wird!“
Amanda rief erbittert schrillen Tones: „Meine Bitte um Audienz ist abgelehnt? Der Empfang verweigert? In einer so wichtigen Angelegenheit? Nicht zu glauben! Erst volles Interesse, jetzt Ablehnung! Ein erstaunlicher Wankelmut! Da wird wohl die Predigt eine Rolle gespielt haben!“
„Bitte, beruhigen Sie sich! Ich bin über die Gründe, die Durchlaucht zur Ablehnung Ihrer Bitte veranlaßt haben, nicht informiert, kann also keine Auskunft geben! Die Fürstin wünscht, daß die Agitation eingestellt werde!“
Heftig und gereizt wies Amanda darauf hin, daß die Agitation reine Privatsache sei und man demnach die[S. 163] Fürstin weder um ihre Meinung zu fragen noch um Erlaubnis zu bitten habe.
Kühl und höflich erwiderte Fräulein von Gussitsch: „Die Wünsche der Fürstin werden von jenen Frauen respektiert werden müssen, deren Ehemänner im fürstlichen Dienst stehen!“
„Soll das eine Drohung sein?“
„Nein, nur eine gutgemeinte Mahnung zur Vorsicht!“
Spitz und giftig rief Amanda: „Ach was, Papperlapapp! Der Mann im fürstlichen Dienst erfüllt seine Pflicht, die Frau steht nicht im fürstlichen Dienst, sie ist Privatperson, und was die Frau tut, das geht die Fürstin keinen Pfifferling an! Will sich die Fürstin um uns kümmern, so soll sie die Hungerlöhne aufbessern! Auf diesem Gebiete kann sie sich nützlich machen!“
„Meine Mission ist beendet! Guten Tag, Frau Forstwart!“
Amanda begleitete das Hoffräulein bis in den Flur, und zum Abschied höhnte sie gründlich verbittert: „Empfehl mich! Meinen Handkuß, wenn ich bitten darf! Und wegen einer Einladung zum Essen soll man sich nicht mehr strapazieren, wir gehen grundsätzlich nicht zu Hof!“ Und wütend kehrte Amanda in ihre Wohnung zurück und warf die Tür krachend ins Schloß.
Dieser Spektakel war für Hartlieb ein hochwillkommenes Signal, daß der Besuch beendet sein mußte. In Wehr und Waffen sprang der Oberförster die Treppe herab, und glücklich erwischte er Martina in nächster Nähe des Forsthauses. Weniger glücklich war er in der Wahl einer Anrede. Ansprechen wollte er Mustela, er mußte einige Worte an Martina richten, um die Wonne ihrer Nähe für einige Augenblicke zu genießen. Und so stammelte er denn: „Verzeihung! Keinen Befehl für mich?“
Martina machte kehrt, und lachend zeigte sie die blitzenden Marderzähnchen: „Hofdamen haben bekanntlich nichts zu befehlen! Das könnte der Herr Oberförster und Hofjagdleiter wissen!“
„Darf ich Sie begleiten?“
„Aber ja, es wird mir ein Vergnügen sein! Vorausgesetzt, daß der Dienst Sie auf den gleichen Weg führt!“
Der brave Waldmensch konnte nicht lügen, Ambros platzte mit der Wahrheit heraus: „Dienstlich sollte ich in entgegengesetzter Richtung wandern! Aber ich möchte Sie begleiten und ein ganz klein bisserl mit – Mustela plaudern!“
Martinas zarte Wangen färbten sich. Der Verlegenheit wurde das Hoffräulein rasch Herr. „Also schwänzt der Oberbeamte den Dienst! Ein leuchtendes Beispiel für die Untergebenen! Apropos: mit wem wollen Sie ein ganz klein bisserl plaudern?“
Jetzt war die Reihe zum Rotwerden an Hartlieb. Und in hilfloser Verlegenheit stammelte er das Geständnis, daß Fräulein von Gussitsch ihn besonders dann lebhaft an die Geschmeidigkeit und Zierlichkeit des graziösen Edelmarders, der lateinisch „Mustela martes“ heiße, erinnere, wenn das Fräulein ein hochgelbes Halsband trage.
Die Bäcklein Martinas flammten glutrot. „Ei der Tausend! Soll ich mich durch diesen Vergleich geschmeichelt oder beleidigt fühlen? Der Marder ist doch ein Raubtier, nicht?“
„Allerdings! Scheu, listig, beherzt, der denkbar kühnste Räuber, aber schön von Gestalt, vornehm besonders der Edelmarder in jungen Jahren mit dem hochgelben Hals! Ein schneidiges Kerlchen!“
Martina kicherte im langsamen Weiterschreiten:[S. 165] „Außerordentlich dankbar bin ich für diesen schmeichelhaften Vergleich! Entzückend nett, daß der Herr Oberförster das harmlose Hoffräulein mit dem ‚denkbar kühnsten Räuber‘ vergleicht! Können Sie mir vielleicht sagen, was ich bereits – geraubt habe?“
So locker zwei Worte auf Hartliebs Zunge saßen, so leicht die Antwort wäre, er wagte nicht, sie zu geben. Die Blutwelle in Martinas Wangen kündete, daß Fräulein von Gussitsch die zwei ungesprochenen Worte erraten hatte. Und nun zappelte Martina mit beschleunigten Schritten heim.
Um doch etwas noch zu sagen, stammelte Ambros: „Die Schneid Mustelas ist so groß, daß der schöne Edelmarder Tiere angreift, die ihm an Kraft und Körpergröße weit überlegen sind!“
„So? Greift ‚Mustela‘ auch – Menschen an?“
„In seltenen Ausnahmefällen auch Forstbeamte!“
„Huhu! Höchst gefährlich! Sehen Sie sich vor, Herr Oberförster, daß Ihnen ‚Mustela‘ nicht mal plötzlich ins Gesicht springt und die Äugelein auskratzt!“
Hartlieb lachte vergnügt: „Soll nur springen!“
„Lieber nicht! Addio!“ lispelte Martina und flatterte hastig wie ein aufgescheuchtes Vögelchen dem nahen Schlößl zu. Wie ein Lohgerber den fortschwimmenden Fellen, guckte Ambros dem Hoffräulein betrübt nach. Dann kehrte er um und wanderte in den Wald auf der entgegengesetzten Seite...
Im Speisesaale des Schlößls stand Norbert vor der Suppenterrine am Büfett und wartete auf das Erscheinen der Fürstin. Martina hatte in aller Eile Dinerkleider angelegt, kam genau auf die Sekunde in den Speisesaal und guckte verwundert.
Norbert flüsterte ihr zu: „Kann eine Weile dauern,[S. 166] Durchlaucht lesen einen soeben aus Berlin eingelaufenen Brief!“
Stehend wartete Martina auf das Erscheinen der Fürstin.
Fürstin Sophie las den Brief ihres Sohnes.
„Liebste Mama! Über Berlin zu schreiben, werde ick mir hüten; diese großartige Weltstadt möge ein Schriftsteller von Gottes Gnaden und Beruf schildern. Nach so kurzer Zeit ein Urteil über eine total fremde und imponierende Millionenstadt abzugeben, wäre dumm und frech. Eines spüre ich schon beim Kaffee jeglichen Morgen: Wien ist Wien, und Berlin ist janz anders! In allem und jedem! Abstoßend und anziehend wie – Tiroler Rotwein besserer Sorte... An Damen habe ich hier vielerlei Exemplare kennengelernt. Adelige und nichtadelige. Hübsche und alte. Was meinst Du zu einer bürgerlichen Gattin?...“
Als Fürstin Sophie den Brief zu Ende gelesen hatte, lag ein schwaches Lächeln auf den Lippen.
Einen Blick warf sie auf die Uhr. Dann eilte die Fürstin in den Speisesaal, wo sie sich wegen der Verspätung bei Fräulein von Gussitsch entschuldigte.
Wortlos verbeugte sich Martina.
„Rasch servieren, Norbert! Und nur zwei Gänge! Nach Tisch bitte ich Sie, liebe Gussitsch, zu mir zu kommen!“
„Zu Befehl, Durchlaucht!“
Kein Wort wurde während des abgekürzten Lunches weiter gesprochen.
Für Martina war es leicht zu erraten, daß der neue Brief des Prinzen den Befehl veranlaßt haben werde. Einen drolligen Bericht vermutend, der wahrscheinlich abermals die hyperempfindlichen Nerven der Gebieterin[S. 167] irritiert, sah das Hoffräulein der Aussprache im Wohngemache mit voller Ruhe entgegen.
„Bitte schreiben Sie das Telegramm, das ich Ihnen diktieren werde!“
Gehorsam holte Martina das Schreibzeug und ein Telegrammformular und harrte alsdann des Diktates.
Sophie sann und überlegte. Und plötzlich diktierte sie die Adresse und den Text: „Brief erhalten, erbitte Heimkehr! Drahtantwort wegen Ankunft und Wagen zum Bahnhof Admont. Mama.“
Fräulein von Gussitsch schrieb die Worte.
Dann sagte die Fürstin: „Lassen Sie anspannen, fahren Sie mit dem Telegramm zum Bahnhof, damit Zeit gewonnen wird! Und studieren Sie die Fahrpläne der Schnellzüge, die mein Sohn benutzen kann!“
Martina gehorchte...
Als alles nach Auftrag besorgt war, der Wettergott ein Einsehen hatte und etliche Sonnenstrahlen in das Ennstal sandte zur Erquickung eingeregneter Menschen, da schickte Martina den Wagen zurück; sie wollte laufen, dem Dienst ein Schnippchen schlagen... Frei sein für ganze zwei Stunden! Auf die Gefahr hin, bei Rückkehr von Durchlaucht einen Wischer in zugespitzten Worten zu bekommen.
In Gedanken nannte Martina sich eine „nette“ Hofdame, die auf das „Dienstschwänzen“ erpicht ist. Doch dicht neben der Erkenntnis dieser schweren Sünde saß auch schon die Entschuldigung: ein Hoffräulein hat ja noch weniger vom Leben als die hohen Herrschaften, nicht einmal die Ausgangsfreuden der Dienstmädchen an Sonntagen! Ein mittelloses Hoffräulein, auf die Stellung angewiesen, besseres Zimmermädel, weiter nichts!
Merkwürdig, wie schnell die Gedanken des „besseren[S. 168] Zimmermädels“ plötzlich sich mit der Frage beschäftigten, ob „man“ denn lebenslang in dieser Abhängigkeit ausharren könne?
Jedes Dienstmädel hofft und ersehnt Befreiung, möchte, bevor die Haare grau werden, heiraten und Frau sein.
Martinas Gedanken flatterten in das stille Forsthaus zu Hall und umspielten den ernsten lieben Oberförster Hartlieb und erbauten in rasender Eile ein Luftschloß, das zwei sich liebende Menschen bewohnen...
Wie sich Martina aber vergegenwärtigte, daß sie als Frau Hartlieb ständig im einsamen Forsthause würde leben, viele Monate im Jahre mit der Fürstin in Berührung kommen müssen, da fiel das kühnragende Luftschloß jäh zusammen...
Traurig promenierte Martina durch die stiftische Eichelau zur Ennsbrücke und pilgerte auf dem Sträßlein gen Norden zum Dorfe Hall. Fest entschlossen, niemals wieder Luftschlösser zu bauen. Aber dieser Vorsatz zerschellte an einem neuen Gedanken, an der plötzlich aufgetauchten Frage, ob denn Hartlieb genötigt sei, lebenslang im Haller Dienste zu bleiben?
Eine Wegstunde hindurch beschäftigte sich Martina mit der Frage, was die Hofdame wohl tun würde, wenn Hartlieb einen anderen Posten annehmen und um Fräulein von Gussitsch anhalten würde? Soll die Antwort ein „Ja“ oder ein „Nein“ sein? Zur Bejahung gehört doch die große, alles überwindende Liebe!
Martina schüttelte das hübsche Köpfchen, in dem so viele Fragen durcheinanderwirbelten. Und sie flüsterte dem Tann zu: „Soweit sind wir ja noch gar nicht! Ich weiß ja gar nicht, ob Hartlieb mich liebt!“
Im grünen Tann seufzte der abendliche Bergwind.
Der erwartete Wischer erfolgte nicht. Die Kammer[S. 169]frau Hildegard meldete der heimgekehrten Hofdame in flötendem Tone, daß die Fürstin das Diner abgesagt, sich zurückgezogen und auf jede Dienstleistung seitens des Fräuleins von Gussitsch verzichtet habe.
Somit war Martina ein freier Abend beschieden. Dienstfrei, aber selbstverständlich an das Haus gebunden.
Im stillen Kämmerlein einsam und alleine lesen, schreiben. Und denken... „Viel denken macht Kopfweh!“ Schmerzliche Gefühle stellten sich ein, da Martina nach langem Sinnen erkannte, daß ihr so ziemlich alle Eigenschaften einer Hausfrau fehlen. Eine „schlechte Partie“ würde Hartlieb mit dem Hoffräulein machen. Ganz abgesehen von der betrüblichen Tatsache, daß auch noch die Mitgift fehlte...
Also an der Kette bleiben, besseres Dienstmädel...
Salzige Kügelchen rannen über die Wangen...
Ein klarer kühler Morgen brach an, einen Prachttag kündend.
Des lachenden Sonnenscheins vermochte sich Martina nicht zu freuen, da sie der Folgen des gestern nach Berlin abgegangenen Telegrammes gedachte. Von Stunde zu Stunde bangte Martina einer unangenehmen Antwort und der Berufung der Fürstin entgegen.
Dienstbereit harrte das Hoffräulein auf dem Zimmer.
Gegen elf Uhr brachte Norbert ein Telegramm. Unwillkürlich fragte Martina, ob auch Durchlaucht eine Depesche erhalten habe.
„Bis jetzt noch nicht, gnädiges Fräulein! Ist denn etwas Besonderes los?“
„Danke, nein! Sie können gehen, lieber Norbert!“
Der Kammerdiener entfernte sich schwer enttäuscht und geärgert.
Martina bereute, Norbert gefragt zu haben; aber eine[S. 170] Gewißheit wollte sie doch darüber haben, ob auch die Gebieterin eine Depesche erhielt. Da dies nicht der Fall ist, kann das an die Hofdame gerichtete Telegramm nur von Baron Wolffsegg stammen, und der Inhalt muß unangenehm sein.
Ein Blick – und Martina stieß einen Schrei des Schreckens aus.
Die befürchteten Folgen des Befehles waren da: der Prinz will Berlin nicht verlassen, Wolffsegg ersucht die Hofdame, der Fürstin die Bitte um sofortige Entlassung zu unterbreiten.
Eine heillose Bescherung. Wie nur mit pflichtschuldiger Rücksicht und Zartheit der Fürstin diese Hiobspost beibringen?
Martina biß die Marderzähnchen aufeinander, nahm die Depesche zur Hand und ging in das Vorzimmer, wo sie Hildegard dienstbereit wartend traf: „Bitte, melden sie mich! Dringliche Dienstangelegenheit!“
Hildegard zögerte und fragte flüsternd, neugierig und zudringlich: „Doch nichts Unangenehmes? So früh am Tage Unangenehmes! Durchlaucht müssen geschont werden, haben eine schlechte Nacht gehabt!“
So leise gesprochen wurde, die Fürstin mußte doch etwas gehört haben. Sie öffnete die Türe. Bleich, übernächtig sah sie aus, brennend die Augen, tiefe Sorgenfalten im Gesicht.
Die Hofdame erblickend, zwang sich die Fürstin zu einem freundlichen Lächeln. „Schon dienstbereit? Bitte, kommen Sie zu mir herein! Hildegard soll warten!“
Im Zimmer seufzte Sophie schmerzhaft. „Was bringen Sie, liebe Martina?“
„Zu dienen, Durchlaucht! Soeben erhielt ich aus Berlin eine Depesche des Barons Wolffsegg...“
„Geben Sie!“
Die Fürstin las das Telegramm langsam. Und mit einer das Hoffräulein überraschenden Ruhe sprach sie: „Ähnliches habe ich befürchtet, nämlich die Weigerung Emils! Nicht aber die Demission Wolffseggs, von der keine Rede sein kann; wenigstens jetzt nicht und bis Emil an meiner Seite ist! – Wir hätten anders depeschieren sollen...!“
Den im Nachsatze steckenden Vorwurf schluckte Martina gehorsam hinunter, wiewohl er schmerzte. Ein ganz ungerechtfertigter Vorwurf, denn der Text war doch diktiert, stammte nicht vom Hoffräulein...
Sophie sprach weiter: „Es kann auch sein, daß Wolffsegg von früher her verärgert ist, ob des Briefes, den Sie ihm gesendet haben! – Depeschieren Sie, daß die Demission nicht angenommen wird!“
Der zweite Vorwurf tat Martina bitter wehe. „Befehlen Durchlaucht noch etwas?“
„Danke, nein! Ich will abwarten, was Emil antworten wird! Die Depesche an Wolffsegg hat übrigens keine Eile! Sie bleiben zur Disposition! Danke! Auf Wiedersehen!“
Nun weinte Martina wirklich. Wimmerte eine geschlagene Stunde. Wischte aber hastig die Tränen weg, als es klopfte. „Herein!“
Ein Blick, ein Aufspringen und Entgegeneilen. „Durchlaucht geruhen selbst...!“
Güte, Herzlichkeit und warme Freude kündete das Antlitz der hohen Frau. Weichen Tones sprach die Fürstin: „Ja, selbst! Muß ja Abbitte leisten dafür, daß ich Ihnen Vorwürfe gemacht habe! Also: Verzeihung, liebe Martina! Will mich bessern! Und Sie, liebe Martina, sollen die erste sein, die einzige, der ich die[S. 172] Freudenbotschaft mitteile: Emil fügt sich doch! Er wird morgen nach Admont kommen! Das Schmerzlichste: Ungehorsam und Auflehnung bleibt mir also erspart! Gott sei Dank dafür! – Aber nun sagen Sie mir, liebe Martina, was meinen Sie: wie könnte ich dem Sohne zum Dank für seine Fügsamkeit eine besondere Freude machen?“
Martina machte aufmerksam, daß sie in keiner Weise informiert sei, nicht die hohe Ehre hätte, den Prinzen zu kennen; demnach außerstande, irgendwelche Meinung zu haben und zu äußern.
„Das Haller Jagdgut kann ich Emil nicht schenken, weil er sich – einstweilen – noch nicht besonders für die Jagd interessiert! Gekauft habe ich das Jagdgut ja nur für ihn!“
So ratlos Martina war, ein Gedanke blitzte auf. „Wie wäre es, wenn Durchlaucht dem Prinzen die – Oberleitung übertragen würden? Als Beweis der Dankbarkeit und zugleich des Vertrauens! Und der Prinz würde dadurch Beschäftigung haben, sich im Verkehr mit dem Oberförster mählich doch für Wild, Forst und Jagd interessieren!“
„Hm! Zwar glaube ich nicht recht daran, aber man kann es ja versuchen! – Und nun eine private Bitte, sprechen Sie mit Hartlieb, auf daß der Oberförster für einen schönen Empfang meines Sohnes sorgt, ja?“
Martina erglühte wie eine Pfingstrose.
Das jähe Erröten gewahrend, meinte die Fürstin: „Nanu! Was ist Ihnen denn? Doch nicht Fieber?“
„Verzeihung! Mir ist arg heiß geworden –, die Freudenbotschaft plötzlich, die wider Erwarten doch günstige Wendung nach dem vorausgegangenen Ärger...“
„Nu, nu! Hofdamen dürfen sich nicht ärgern! Nun[S. 173] bitte ich Sie, den Oberförster vertraulich zu verständigen! Und laden Sie ihn zum Lunch ein! Auf Wiedersehen, liebe Martina!“
Fräulein von Gussitsch küßte der Fürstin die Hand und geleitete die Gebieterin bis in den Korridor.
Da saß nun Martina in der düsteren, ärmlich und streng dienstlich ausgestatteten Forstkanzlei vor dem Oberförster Hartlieb, beide stumm. So freundlich, ja freudig die Begrüßung war, ein gedämpftes Aufjauchzen sehnsüchtiger Seelen, die fröhliche Situation wurde durch zwei Worte verändert: „Zu spät!“
Mit munterer Wichtigkeit hatte Fräulein von Gussitsch berichtet, daß künftig Prinz Emil sozusagen „Jagdherr“ sein werde, der Oberleiter, und Hartlieb seine rechte Hand und oberster Berater, der sich wohl bald in einen Vertrauensmann und Freund verwandeln werde. Daß Martina der Fürstin diesen Gedanken eingeblasen hatte im Interesse Hartliebs, verschwieg das Hoffräulein, um nicht zuviel zu verraten. Nur ganz wenig hatte Martina durchblicken lassen, daß nach Rückkehr des jungen Prinzen das „Weiberregiment“ ein wohltätiges Ende finden werde. Einen Freudenschrei aus Hartliebs frohbewegter, von Druck und Sorgen befreiter Brust hatte Martina erwartet. Ambros Hartlieb aber hatte tiefernst mit tonloser Stimme geantwortet: „Zu spät!“
So bestürzt war Martina, daß sie gar nicht fragen konnte, was geschehen sei.
Wie erloschen schien Lebensfreude und Zukunftshoffnung in Hartlieb, da er nach einer Pause sprach: „Zu spät kommt diese Botschaft, denn ich habe Schritte getan, um eine – andere Stellung zu erhalten! Hier sind die dienstlichen und sonstigen Verhältnisse unerträglich geworden!“
In Martina quoll nach dem ersten lähmenden Schrecken jetzt doch eine kleine Hoffnung auf, auch der Mut zu fragen, ob denn ein Stellungswechsel sich so rasend schnell vollziehe, daß es für hier „zu spät“ sein müsse.
Ein leises Lächeln huschte über Hartliebs ernstes Antlitz: „Das wohl nicht! Ich habe an den früheren Jagdpächter von Hall, Grafen Lichtenberg, geschrieben, ihn um gnädige Vermittlung und Empfehlung gebeten...“
„Ach so!“ rief Martina im Tone der Befreiung von schwerer Sorge. „Demnach ist noch nichts abgemacht, Sie können also abwarten und zusehen, wie sich die Dienstesverhältnisse – bessern werden! Und sind sie ‚erträglich‘ oder gar – was ich hoffe und wünsche – gut geworden, so wird der Herr Oberförster doch wohl hierbleiben! Landschaftlich ist es ja doch wundervoll im Halltale, nicht?“
„Gewiß! Nur schweren Herzens würde ich von hier scheiden! An eine günstige Gestaltung der Verhältnisse vermag ich aber nicht zu glauben!“
„Warum nicht?“
„Weil es heißt, daß der junge Prinz wenig oder gar kein Interesse für das Weidwerk habe!“
Rasch warf Martina die Frage ein: „Woher wissen Sie denn das?“
„Vor einiger Zeit, vor Ankunft der Frau Fürstin, hatte Graf Thurn die Frage an mich gerichtet, ob die Jagdausübung in den herrlichen Haller Revieren einen jungen apathischen Mann aufrütteln, die Weidmannslust erwecken könne. Namen wurden nicht genannt! Ich werde mich wohl kaum irren, wenn ich in dem ‚apathischen jungen Manne‘ den Prinzen Emil vermute! Wenn die Weidmannslust in einem Menschen erst – geweckt[S. 175] werden soll, dann ist doch sicher ein Jagdinteresse nicht vorhanden!“
„Das ist allerdings richtig gefolgert! Wer weiß aber, ob sich nicht doch ein gewisses Interesse einstellt! Der Jagdleiter selbst kann da einen großen Einfluß ausüben, je nachdem er den jungen Herrn behandelt, ihm Weidmannsfreuden verschafft! Nach meiner Auffassung ist das Wichtigste, daß der Herr Oberförster in engsten Konnex mit dem Prinzen kommt, den jungen Herrn führt und leitet! Das Weitere ergibt sich von selbst! Und die Günstlingswirtschaft wird wohl bald ein Ende finden!“
„Das wäre freilich ein Segen!“
„Hoffen wir das Beste! Und einstweilen bleiben Sie, ja?“
„Versprechen kann ich nichts! Hat Graf Lichtenberg ein Jagdgut gekauft und wünscht er mich, so werde ich seinem Rufe Folge leisten müssen!“
Martina sann und murmelte: „Lichtenberg, Lichtenberg?“
„Zu dienen: Graf Udo von Lichtenberg!“
Munter rief Martina: „Hab ihn schon! Vor kurzem las ich in der Zeitung, daß Graf Udo Lichtenberg nach Afrika abgereist sei, um im Sudan zu jagen! Demnach werden Sie von ihm in den nächsten Tagen kaum Nachricht erhalten!“
„Was? Nach Afrika? Das kann nicht stimmen, nach Afrika zu Jagdzwecken reist man gewöhnlich um die Jahreswende! Und dem Grafen Lichtenberg sieht es nicht gleich, daß er die Hirschbrunft in heimatlichen Bergen ignoriere!“
„Ist alles egal, Sie bleiben bis auf weiteres, ja?“
„Bis auf weiteres, ja!“
„Sagen wir: auf ein Jahr, ja? Hand darauf!“
Ambros zögerte; es schien ihm bedenklich, sich zu binden.
„Auf Manneswort, mir zuliebe, Herr Hartlieb!“
Bewegt rief Ambros: „Ach Gott, was tät’ ich nicht alles – Mustela zuliebe?“
„Hand darauf!“
Hartlieb legte seine sonnengebräunte Hand in das ihm von Martina gereichte schmale Händchen.
Und nun kicherte das vergnügt gewordene Hoffräulein: „Den mir aufgebrachten ‚Spitznamen‘ ‚Mustela‘ muß ich mir also gefallen lassen! Ist übrigens nicht ohne, die neue Situation: Mustela fängt den Jäger! Ansonsten ist es doch umgekehrt, nicht?“
Ambros gab Martinas Händchen frei. „Darf ich erfahren, warum gnädiges Fräulein mein Verbleiben wünschen? Sind Sie denn gern im fürstlichen Dienst?“
„Beide Fragen kann ich nicht beantworten, ganz unmöglich! Und nun zum Schlusse – die Zeit drängt und der Dienst ruft: Besorgen Sie gütigst alles für den festlichen Empfang, auf daß der Prinz recht angenehm überrascht wird und Sie liebgewinnt! Addio! Herr Oberförster!“
Martina hatte es merkwürdig eilig, aus dem Forsthause zu kommen. Hartlieb aber hatte ein Gefühl, als sei seinerseits etwas sehr Liebes und Großes gründlich versäumt und verpatzt worden...
Spät am Abend kritzelte Martina in das Tagebuch: „So ein Zottelbär, dieser Ambros Hartlieb! Führt seinen Namen zu Recht, denn es geht ‚hart‘ mit seiner ‚Liebe‘! Aber ich hab’ ihn gern, schrecklich gern und hoffe auf einen guten Ausgang in späterer Zeit! – Gute Nacht, lieber Hartlieb!“
Überraschend und mit Überraschungen für die Mama war Prinz Emil gekommen. Ein schlanker, hochgewachsener junger Mann, blond das nicht üppige Haupthaar, flachsartig das Schnurrbärtchen, lichtblaue Augen mit dem Ausdruck von Gutmütigkeit. Muttersöhnchen, mager wie ein Zahnstocher, verzärtelt, verhätschelt, unsicher; bis vor wenigen Wochen wohl auch eitel, unfähig, einen selbständigen Entschluß zu fassen. Ehrerbietig hatte Prinz Emil die Mama begrüßt und geküßt, nichts von Verstimmung merken lassen, die ihm wegen der Abberufung von Berlin im Herzen saß.
Tadellos höflich, nur etwas neugierig, hatte er das Hoffräulein begrüßt. Und Martina hatte mit dem schönsten Hofknicks Reverenz erwiesen; in Gedanken aber das Muttersöhnchen „Steccadente mit Schafblick“ genannt.
Schon die Schnurrbärtchenfasson bildete eine Überraschung für Mama. Dann die Tatsache, daß Baron Wolffsegg nicht mitgekommen war, also Emil allein, nur von seinem Diener begleitet, hatte reisen müssen. Daß der Sohn bereits vierundzwanzig Lenze zählte, vergaß die Mama gänzlich. Und verärgert war die Fürstin über den Anlaß der Pflichtvernachlässigung seitens des Adjutanten. Verstimmt über die leichtfertige Art, wie Emil den Baron Wolffsegg kordial entschuldigte: Erbtante freundlichst prompt gestorben, selbstverständlich, daß Wolffsegg anstandshalber bei Beerdigung mithalf[S. 178] und nun in Prag den vielen Draht einsackt; so ein Schwein kann eben nur ein böhmischer Baron haben.
Diese Sprachweise, diese Ausdrücke gingen der Fürstin schwer auf die Nerven. Aber sie rügte nicht, um nicht schon am Tage des Wiedersehens Verstimmung und Verdruß heraufzubeschwören.
Nicht völlig nach Wunsch der Mama hatte Emil sich bei der feierlichen Begrüßung an der festlich geschmückten Villa benommen: zu kordial und burschikos den Oberförster behandelt, begrüßt mit den Worten: „Nette Chose, sehr hübsch, freut mir jletscherhaft, lieber Oberförster; ich danke Ihnen heftig! Hoffe, daß wir Freunde werden im grünen Revier! Servus!“
Einfach gräßlich für einen Prinzen, dachte Mama.
Und dann die an den Forstwart gerichteten Worte: „Ah, notleidender Agrarier, wie Figura zeigt, essen wohl viel Notstandsgockel, daher der große Hendlfriedhof? Wie heißen Sie denn? Was, Gnugesser! Alle Wetter! Da versteht sich der Plenus venter von selbst! Muß bezüglich Ihrer Nase Witz von König Ludwig dem Ollen kopieren: ‚He, Landrichter, große Nase, doch nicht von der Regierung bekommen?‘ Na, bei Ihnen gar nicht möglich, denn Sie sind ja nicht von der Regierung, sondern unser Beamter! Auf Wiedersehen!“
Für die Mama war es unverkennbar, daß Emil „aufgewacht“, von lähmender Apathie, von Geistesträgheit befreit ist. Die Reise hat gute Früchte gebracht. In dieser Hinsicht. Aber sonst: gräßliche Manieren, schrecklich der Ton. Eine beklagenswerte Veränderung im Wesen des bisher so gefügig gewesenen Muttersöhnchens.
So sehr ging all dieses Neue auf die Nerven, daß die Fürstin alsbald, ohne Begleitung, nach Admont fuhr, um mit Pater Wilfrid darüber zu sprechen.
Ein Privatissimum in der Klosterzelle, die der Öffentlichkeit zugänglich sein muß und sich außerhalb der Klausur befindet, weil Wilfrid Pfarrer ist, also Amtsperson.
Fürstin und Mönch in bescheidener Zelle; sorgenerfüllt die Frau, diensteifrig der Pfarrer und Edelmann von Erfahrung und Weltkenntnis.
Bitter klagte Fürstin Sophie, daß der Sohn „in Preußen“ revolutioniert, zu seinem Schaden in Kopf und Seele beeinflußt und verändert worden sei; spottlustig, sarkastisch der lammfromm gewesene Jüngling, standeswidrige Leutseligkeit. Seufzend, mit zitternder Stimme sprach die Fürstin: „Denken Sie nur, Hochwürden, mein Sohn fragte mich, wie ich über eine bürgerliche Braut dächte. Unerhört! Aber ich habe das Schreckliche verhindert durch einen gemessenen Befehl! Mit aller Strenge werde ich künftig vorgehen, um Entgleisungen zu verhüten, den Jungen vor Unglück bewahren! Helfen Sie mir, Herr Pfarrer, mit Ihrem Rat, mit Ihrer Erfahrung als Priester und Seelenhirte!“
Pater Wilfrid verbeugte sich und sprach: „Euer Durchlaucht werden sich mit dem Faktum vertraut machen müssen, daß die Zeit vorüber ist, in der sich ein Sohn gängeln läßt; Prinz Emil ist der mütterlichen Aufsicht entwachsen, mit vierundzwanzig Jahren allerdings noch kein ausgereifter Mann, aber auch kein Jüngling mehr, der sich lenken, am Händchen führen läßt! Das Befehlenwollen der Eltern, nachdem der Sohn mündig geworden ist, seine eigenen Anschauungen hat und sich über das Lebensziel klar geworden ist, führt zu nichts Gutem! Mit solcher Befehlerei – ich bitte zu verzeihen – erzielt man nur Verschlossenheit, Gereiztheit, Eigensinn und Widerstand! Letzterer wird sich je nach Tem[S. 180]perament und Erziehung aktiv oder passiv zeigen! Jeder Priester von Erfahrung muß zu den Eltern sagen: Ne feceris! Tue es nicht!“
Die Fürstin jammerte: „Ach Gott! Nun halten gar auch Sie, der Geistliche, dem Sohne die Stange! Die Mutter wird doch berechtigt sein, Gehorsam zu fordern?“
„Zu dienen, Durchlaucht! Achtung muß der Sohn erweisen, auch Gehorsam in dem, was den Eltern zukommt! Aber nicht darüber hinaus! Die Eltern können mahnend und warnend einzuwirken versuchen, erzwingen können sie aber nichts mehr! Gute Erziehung wird den Mann gewordenen Sohn davon abhalten, daß er Mahnungen und Warnungen etwa brüsk zurückweist!“
Gedrückt klang die Klage: „So habe ich denn nichts mehr zu sagen und den Sohn soviel wie verloren – –!“
Soviel Pater Wilfrid sich bemühte, die hohe Frau zu trösten, es blieb vergeblich; die Fürstin erwies sich Trostworten nicht zugänglich in ihrem Seelenschmerze und verabschiedete sich mit Dank für die freilich sehr bittere Aufklärung.
Der Seelenkenner im Benediktinerhabit behielt recht mit seiner Voraussage. Emil verhielt sich seiner Erziehung entsprechend selbstverständlich einwandfrei im Verkehr mit der Mama bei Tisch und sonstigem Zusammentreffen, aber von der früheren Offenherzigkeit, vom bedingungslosen Gehorsam war keine Spur mehr vorhanden.
Der scharf beobachtenden Mutter konnte die schmerzliche Tatsache nicht entgehen, daß der Sohn grollte, der Mama nach Möglichkeit auswich. Um so mehr mühte sich die Fürstin ab, eine Annäherung und Versöhnung herbeizuführen, zumal sie befürchtete, daß die Verschlossenheit und das untätige Leben den Sohn auf[S. 181] schlimme Gedanken und gefährliche Streiche bringen könnte. Um eine Flucht zu verhindern, hielt die Fürstin Emil sehr knapp mit Geldmitteln. Dachte gar nicht daran, daß dieses Vorgehen den mündigen Sohn völlig erbittern mußte. Und ganz verfehlt war der Tadel der Untätigkeit, die mit liebeflehenden Worten verzuckerte Mahnung zu irgendeiner Beschäftigung, z. B. Übernahme der Oberleitung im Forst- und Jagdamt, Kontrolle der Beamten und Jäger.
Emil lehnte ab mit dem Hinweise auf Mangel an Sachverständnis.
Eines tat er aber doch, ohne Wissen der Mama, er staubte den Freikost und sonstige Benefizien schindenden Jäger Eichkitz aus dem Schlößl raus, so gründlich und scharf, daß dem hübschen Frechdachs Hören und Sehen verging. Jäh hatte das Schlemmerleben und auch die Beeinflussung der Gebieterin ein Ende. Daniel Eichkitz mußte im Hochreviere Dienst tun wie die anderen Jagdgehilfen.
Zeuge dieser Ausstaubung des Parasiten war vom Fenster ihrer Stube aus Fräulein Gussitsch, ohne daß Emil davon eine Ahnung hatte.
Bald darauf wurde Martina zur Fürstin befohlen. Zu einer Aussprache. Das tiefbekümmerte Mutterherz verlangte nach Hilfe und Befreiung von quälenden Sorgen. Einen Weg sollte die Hofdame finden, der zum Herzen des Sohnes führt. Und Martina soll intervenieren, auf daß sich der Prinz beschäftige, um die Bewirtschaftung des Jagdgutes kümmere.
Ob dieser Bitten war Martina anfangs erschreckt. Aber in Erinnerung an die von ihr beobachtete Ausschaffung des Jägers Eichkitz konnte Martina mit gutem Gewissen der hohen Gebieterin sagen, daß Prinz Emil[S. 182] bereits sich der Interessen der fürstlichen Familie annehme, für Ordnung wenigstens teilweise gesorgt habe.
Über die Details dieses Vorganges informiert, gab die Fürstin den seither bevorzugten Lieblingsjäger und Berater in Jagddienstangelegenheiten sofort preis, billigte die Ausschaffung nicht nur, sondern lobte der Hofdame gegenüber den Sohn himmelhoch, als hätte Emil die Welt aus den Angeln gehoben. Und im selben Atemzuge schier bat die Fürstin, es solle Martina den Prinzen dahin zu bestimmen suchen, daß er seine Tätigkeit zur Schaffung von Ordnung und Disziplin ausdehne und den Bediensteten scharf auf die Finger sehe. Wehen Tones klagte sie: „Auf mich hört Emil ja leider Gottes nicht mehr, vielleicht zeigt er sich Ihren Worten zugänglich! Seien Sie aber vorsichtig, liebe Martina, auf daß nicht Erbitterung und Trotz geweckt wird! Diplomatisch klug und vorsichtig vorgehen, um Emil willfährig zu machen! Mein Sohn soll glauben, daß sein Wille respektiert wird, daß er ganz nach seinem Gutdünken lebt und handelt; dabei aber wird er doch gelenkt durch Sie nach meinem Willen! Leicht wird das freilich nicht durchzuführen sein! Aber wir wollen den Versuch wagen!“
Martina erklärte pflichtschuldigst ihre Bereitwilligkeit, machte aber auf die Gefahren der gewünschten Intervention aufmerksam.
„Gefahren? Ich wüßte nicht, welche Gefahr aus Ihrer Intervention erstehen könnte!“
„Ich werde mich zunächst der Gefahr aussetzen, in den Augen des Prinzen zudringlich zu erscheinen und zurückgewiesen zu werden!“
„Undenkbar, wenn Sie klug und diplomatisch, mit Frauentakt intervenieren!“
„Sodann befürchte ich üble Nachrede, wenn man mich häufig in Gesellschaft des jungen Herrn sieht...!“
„Wo es sich um meine Wünsche handelt, hat Domestikengeschwätz nichts, aber rein gar nichts zu bedeuten! Sie handeln ja in meinem Auftrage und helfen einer bekümmerten Mutter! Sie dürfen jedoch mit keinem Ton verraten, daß die Intervention mit meinem Wissen erfolgt! Und nun gehen Sie ans Werk! Die Mutter dankt Ihnen von ganzem Herzen für diesen Lieblingsdienst, den ich nie vergessen werde!“ Liebreich und huldvoll reichte die Fürstin dem Hoffräulein die Hand zum Kusse.
Auf ihrem Zimmer konnte Martina den Kriegsplan entwerfen. Ein geradezu lästiger Auftrag, unangenehm und gefährlich; dennoch nicht ganz unerwünscht nach der Richtung hin, daß Martina im Interesse Hartliebs wirken kann, wenn ihr Einfluß den Prinzen bestimmt, sich um die Jagd zu kümmern, mit Hartlieb zu verkehren und der Mißwirtschaft ein Ende zu machen. Werden die Dienstesverhältnisse gebessert, so wird Hartlieb froh werden und Martina dankbar sein.
Ein beseligender Gedanke und Ausblick in die Zukunft. Vertrauensperson der Fürstin! Wie aber schnell und ausgiebig Einfluß auf den Prinzen gewinnen, ohne daß das hübsche Hoffräulein sich etwas vergibt und den Ruf schädigt...?
Ein langes Sinnen und Planen. Dann ein Lächeln der Befriedigung, wobei die feinen Marderzähnchen blinkten.
Martina hielt fleißig Ausschau nach dem „Zahnstocher mit dem Schafblick“. Vorerst vergebens.
Aber gegen Abend vor der Dinerstunde sah sie den Prinzen zigarettenrauchend am Waldesrande unter[S. 184] einer Fichte liegen, vermutlich vor Langeweile zum Sterben bereit.
Mustela auf der Jagd... Martina schlich aus dem Schlößl, promenierte gegen den Talschluß zu, bog vom Sträßlein ab und stieg ein Weilchen bergan. Dann kam wie von ungefähr und rein zufällig das Hoffräulein, leise ein Liedchen summend, von oben genau in der Richtung auf den lungernden Prinzen herab.
Schon das Knacken dürrer Zweige, das Kollern losgetretener Steine hatte Emil aufmerksam gemacht. Neugierig guckte er aufwärts. Und wie er das hübsche Hoffräulein im neckischen Lodenkleide erblickte, grüßte er vergnügt lächelnd und fragte, ob Fräulein von Gussitsch „dienstlich“ Steine loslöse und ein Prinzenleben dadurch schwer gefährde.
Im grünen Tann ein köstlich karikierter Hofknicks, wobei Martina kichernd mit den Fingerspitzen das fußfreie Lodenkittelchen um einen Zoll hochhob. „Untertänigst zu dienen! Die Steinchen haben nicht meine Füße losgelöst, sondern das schlechte Gewissen, die schwer bedrückte Hofdamenseele...!“
Mit einem wahrhaftigen Schafblick guckte Emil das Fräulein an. „Was? Schlechtes Gewissen, bedrückte Seele? Ich bin perplex! Non capisco niente!“
„Glaub es gerne, daß der gnädigste Prinz mich nicht verstehen!“
„Nein, wirklich nicht! Habe keine Ahnung!“
„So muß ich denn beichten, mitten im Grünen!“
„Ich bin furchtbar neugierig! Schießen Sie los! Aber wollen wir uns nicht setzen auf schwellende Moospolster?“
„Danke, nein! Es beichtet sich leichter im Stehen! Dabei wird auch vermieden, daß etwaige Beobachter auf[S. 185] den Gedanken kommen, es handle sich um ein – Rendezvous zum Maikäfern!“
„Ach, das wär aber wirklich nett, maikäfern mit einem etikettwidrig hübschen Hoffräulein, derweilen die gestrenge Fürstin von – Zahnschmerzen gepeinigt wird!“
„Es maikäfert sich gar nichts, gnädiger Prinz!“ Und nun beichtete Martina planmäßig, daß sie Zeugin der Ausschaffung des profithungrigen Jägers Eichkitz gewesen sei. Diese rettende und befreiende Tat des Prinzen habe sie als Wohltat empfunden. Und den ordnungschaffenden jungen Herrn lobte sie über den Klee und sprach die Hoffnung aus, daß Prinz Emil noch mehr von den Parasiten „fürifangen“ und dreinfahren werde „wie ein geölter Blitz“.
Höchlich geschmeichelt und interessiert rief Emil: „Aber das ist ja furchtbar nett! Hab’ ich mir da die Anerkennung des hübschen Hoffräuleins errungen und hatte davon keine Ahnung! Wenn Sie es wünschen, werde ich mit Vergnügen noch mehr der Kerls ‚fürifangen‘! Nur müssen Sie mir die Gauner näher bezeichnen! Überhaupt sagen, wo es Schlampereien gibt! Ordnung will ich gern und schleunigst schaffen!“
Mit einem strahlenden Lächeln des Triumphes blickte Martina den so prächtig auf den gewünschten Pfad erwachenden Interesses gelockten Prinzen an. Und auf den Scherzton eingehend, sagte sie: „Bei mangelnder Kontrolle gibt es überall Schlampereien, besonders in Hofhaltungen ohne – männliche Oberaufsicht! Genaue Auskunft kann ich nicht geben, denn ich bin dienstlich stets in der Nähe der hohen Gebieterin! Direkt unter den Augen der Durchlaucht wagt auch der frechste der Frechdachse nicht zu stehlen! Hinterm Rücken schon![S. 186] Wenn aber der gnädigste Herr den Oberförster und Jagdleiter ins Vertrauen ziehen, kann Ihnen Hartlieb Dinge erzählen, daß die prinzlichen Augen tropfen!“
„So? Nicht übel! Na, Feuerle anzünden ist von jeher meine Passion gewesen! Gleich morgen werde ich mit dem Oberförster reden, mich informieren lassen!“
„Das wäre furchtbar nett von Ihnen! Vorausgesetzt, daß Sie den wohltätigen Sport des ‚Fürifangens‘ und ‚Feuerle-Anzündens‘ für längere Zeit betreiben wollen, nicht nur vorübergehend auf einige Tage!“
„Aber gern! Sind denn die Verhältnisse durchweg so schlimm?“
„So unerträglich, daß der Oberförster die Stellung verlassen wollte! Ich habe schwere Mühe gehabt, ihn zu bewegen, daß er versprach, auszuharren, bis der gnädigste Prinz kommt und mit eiserner Hand eingreift! Gottlob, Durchlaucht sind da und haben bereits mit Mannesmut und Mannesfaust eingegriffen! Allen Respekt, untertänigst natürlich!“
„Sind Sie aber ein netter Käfer! Und so tapfer in Wahrung unserer Interessen! Weil wir aber so nett allein sind, möchte ich Sie bitten, mit mir einen Tauschhandel einzugehen, gewissermaßen ein Geschäft auf Gegenseitigkeit! Ich werde alles tun, was Sie wünschen, zur Schaffung von Ordnung und Purifizierung der Verhältnisse! Das Hoffräulein muß mir aber versprechen, schön fein die Mama zu bearbeiten, daß sie in einiger Zeit doch einwilligt und mir erlaubt, daß ich wieder nach Berlin kann. Wollen Sie mir diesen Gefallen tun?“
Aalglatt wich Martina einem bindenden Versprechen aus und verwies auf den Mangel an Einfluß. Was getan werden kann, soll aber gerne geschehen. Übrigens[S. 187] gäbe es ein sicheres Mittel, um das gewünschte Ziel zu erreichen: abschmeicheln!
„Nee, Fräuleinken, dazu bin ick bereits zu alt!“ meinte gedehnt der Prinz Emil.
„Huhu! Ein Greis von zwei Dutzend Lenzen! Einfach schauderhaft! Krücken gefällig zum Abstieg? Daheim Fleckerlschuhe anziehen, die gichtkranken Knie umwickeln mit Fellen von Rheumatismus-Katzen! Mummelgreis, der sich nicht zu helfen weiß! Tun Sie mir aber leid! Hab’ geglaubt, Prinz Emil sei ein junger fescher Mann! Derweil ist er ein ‚alter Mummelgreis‘!“
Belustigt lachte Emil auf. „Na, wir werden ja sehen, wie der Hase läuft! Und inzwischen wollen wir zwei fest zusammenhalten, ja?“
„Gerne, Durchlaucht!“
„Ach was! Für Sie bin ich einfach der ‚Herr Emil‘! Das heißt, wenn wir allein und unter uns sind! Die Hofschranzen und Popanzen brauchen nichts zu merken von unserer Verschwörung! Also, auf Handschlag!“
Zögernd sprach Martina: „Zur ‚Verschwörung‘ bin ich wohl bereit! Aber die Degradierung...?“
„Gut! Dann befehle ich Ihnen, mich mit ‚Herr Emil‘ zu titulieren.“
„Zu Befehl! Hier meine Hand, ‚Herr Emil‘! Und nun, damit die Schranzen und Popanzen nichts merken, geht der ‚Herr Emil‘ schön alleine voraus und hinunter zur Villa! Ich aber schlängle mich auf einem Umweg nach Hause! Empfehl mich gehorsamst!“
„Servus, Käferl!“ Gehorsam und vergnügt stapfte der sehr munter gewordene, aus der „Tramhapigkeit“ völlig erwachte Prinz hinunter.
Bis Martina auf Umwegen zum Schlößl kam, war eine heillose Verspätung eingetreten, die Dinerstunde[S. 188] überschritten. Fürstin Sophie sagte nichts, blickte nur das Hoffräulein fragend an. Und wie sie das „optische Signal“ in Martinas strahlenden Augen gewahrte, daß der erste Schritt zur Intervention getan, mit Erfolg getan sei, da huschte ein Lächeln der Befriedigung über die Lippen der Mama.
Prinz Emil aber setzte eine Miene auf, als könne er nicht bis fünfe zählen. Heuchelte absolute Gleichgültigkeit, schielte aber gelegentlich nach Martina, die er jetzt zum Anbeißen nett fand.
Wenn es möglich wäre, einen gesunden Forstmann des Morgens im Bette zu überraschen, Emil von Schwarzenstein hätte dies Kunststück fast fertiggebracht, denn er kam am nächsten Tage zu sehr früher Stunde in das Forsthaus. Zum größten Erstaunen Hartliebs, der seinen Ohren nicht trauen wollte, als Prinz Emil, der Träumer, von Reorganisation, verschärfter Kontrolle, ja von Beseitigung jeglicher Günstlingswirtschaft sprach und den Oberförster um Unterstützung bat. Die Kontrolle der Jagdgehilfen in den Revieren sollte nach wie vor Aufgabe des Jagdleiters sein und bleiben, die Regulierung des nötigen Abschusses vom Vorstand des Jagdamtes persönlich vorgenommen werden.
Auf den Einwand Hartliebs, daß die Fürstin gegenteilige Befehle erteilt habe, äußerte sich Prinz Emil dahin, daß er nun die Oberleitung führen werde und demgemäß seine Anordnungen zu befolgen seien, die selbstverständlich erst nach Zustimmung des Jagdleiters gegeben werden sollen.
Freudig überrascht fragte Hartlieb, ob denn Prinz Emil nicht selbst den Abschuß vornehmen, das Weidwerk ausüben wolle.
Emil verneinte diese Frage ohne Angabe der Gründe[S. 189] und bat, es möge ihn Hartlieb sofort in die Reviere führen behufs Kontrolle.
Dazu war Ambros Hartlieb natürlich mit Vergnügen bereit. Nur fragte er, während er nach Büchse und Bergstock griff, ob denn der Prinz mit Proviant versehen sei.
„Ist nicht nötig! Werde nicht verhungern!“
So marschierten beide denn ab. Und Hartlieb schlug einen Jägersteig ein, der zwar arg steil war, dafür schnell in die Höhe führte... Wie sich der Oberförster über den Wandel der Dinge freute! Manches am jungen Herrn gefiel Hartlieb in hohem Maße: der Eifer, die Einfachheit, der gute Wille für eine Reorganisation und Abschaffung der Günstlingswirtschaft. Nicht weniger erfreulich war für den Jagdleiter die Abschußbewilligung. Sonderbar fand Hartlieb allerdings den Verzicht auf jegliches Weidwerken; sonderbar bei einem jungen Manne, dem so herrliche, reichbestandene Reviere zur Verfügung stehen. Sollte der Mangel an Jagdinteresse wirklich bis zur Gleichgültigkeit für jegliches Wild gesteigert sein? Im langsamen Steigen erinnerte sich Hartlieb wieder der Worte des Grafen Thurn, der Frage, ob ein junger apathischer Mann beim Anblick von Wild auftauen, gewissermaßen von Jagdfieber ergriffen werden könne. Eine Probe darauf wollte Hartlieb vornehmen, den Prinzen an einen kapitalen Hirsch bringen, Emil das schußfertige Gewehr geben, und das Weitere beobachten. Nach Hartliebs Meinung kann ein schußberechtigter Mann beim Anblick eines Kapitalen unmöglich eiszapfig bleiben, das Hirschfieber muß wirken...
Steigen konnte Emil vorzüglich, trittsicher und geräuschlos. Immer hielt er Abstand ein, blieb nie zurück und schwätzte nicht.
Durch einen finsteren, engen Steilgraben ging es aufwärts, dann hinein in düsteren Hochwald, der zu den „Haller Mauern“ sich dehnte.
Hartlieb strebte im lautlosen Pirschschritt einer Lichtung zu, wo seit einiger Zeit ein kapitaler Zwölfender stand.
Emil folgte dem Führer stumm und unhörbar.
Zwischen den alten hochstämmigen Mantelfichten schimmerte es grau, die Lichtung war nahe.
Hartlieb blieb stehen, um zu horchen. Wie angemauert stand fünf Schritte von ihm der Prinz.
Von der Lichtungswiese her kam ein rauher Ruf, ein kurzer Trenzer, dann ein dröhnend Rollen, der Schrei des Brunfthirsches zornig, begehrlich, ungeduldig, herausfordernd: „ä–o–ah!“
Ein forschender Blick Hartliebs musterte den Prinzen, der ruhig stand und nur etwas verwundert horchte. Keine Spur von Leidenschaft oder Ergriffenheit.
So nahe als möglich pirschte Hartlieb den röhrenden Hirsch an. Gehorsam wie ein guter Jagdhund folgte ihm der Prinz auf Schritt und Tritt.
Fast in der Mitte der felsumrandeten Lichtung stand der Kapitale breit, vorgestreckt den zottigen Hals, werbend und kampfbegierig schreiend. Ein König, der zum Kampfe ruft...
Bis auf Kugelschußdistanz brachte Hartlieb den Prinzen, der staunend den kapitalen Zwölfender anguckte. Flink und lautlos machte Hartlieb seine Büchsflinte schußfertig und gab sie wortlos dem Prinzen in der sicheren Erwartung, daß Emil nun zielen, die berühmte Sekunde lang die höchste Weidmannswonne genießen werde, indem das Büchsenkorn im Hirschblatt Haar faßt und der Finger den Stecher zum Schuß berührt...
Prinz Emil sprach laut: „Aber was wollen S’ denn?“ Und er gab die Büchse zurück.
In hoher Flucht ging der vergrämte Hirsch ab...
Jetzt wußte Hartlieb bestimmt, daß dieser junge Mann kein Jäger war und niemals einer werden wird.
Fast schmerzlich wirkte diese Erkenntnis auf den Jagdleiter. Und nichts weniger denn ermunternd für den Dienst unter einem Jagdherrn, der kein Weidmann ist...
Viel mehr als der Zwölfender, der sich so rasch empfohlen hatte, interessierte Emil ein überraschender Kontrollbesuch des Jagdgehilfen Eichkitz. Deshalb fragte er, in welchem Distrikt Eichkitz zu finden sein werde. Zugleich erzählte er die Episode der „Ausstaubung“. Wobei Emil den Ton bis zum Flüstern dämpfte, da Hartlieb den Zeigefinger an den Mund gelegt hatte.
Leise gab der Oberförster die kurze Antwort dahin, daß er den gnädigen Herrn zu Eichkitz führen werde.
Eine mehrstündige scharfe Wanderung tief in Gräben hinunter, wieder hinauf, durch Wald, Steinwildnis, bis das grasige Plateau der Plechauer Alpe erreicht wurde.
Wie Emil den wuchtigen Steinkoloß des imposanten Großen Pyrgas erblickte, rief er in heller Bewunderung: „Gott! Wie prachtvoll! Welch herrlich schöne Natur!“
Trockenen und leisen Tones sprach Hartlieb: „Bitt schön! Nicht laut werden! Wenn Sie den Eichkitz überraschen wollen, müssen wir mit aller Vorsicht zur Almhütte pirschen! Wahrscheinlich hockt der Loder bei der Sennerin Burgl und raspelt Süßholz!“
„Ja, gut! Machen wir! Bitte führen Sie mich so, daß wir nicht gesehen werden und daß ich den Kerl ‚fürifangen‘ kann!“
Für diesen Überfall eines pflichtvergessenen Jagdgehilfen meinte es die Sonne gut, sie versteckte sich hinter dunklen Wolken, so daß der Almboden stark beschattet war. In diesem Schatten schlichen Hartlieb und Emil der Hütte zu, deren Türe halb offenstand.
Die scharf klingende Stimme der schmächtigen Sennerin Burgl war deutlich zu hören: „Aus ist’s und gar ist’s! Wie du meinst, mag ich nicht! Auf dein Rezept: ‚vorm Heiraten taufen‘ laß ich mich nicht ein! Probier dein Rezept bei den Hofmentschern! Ich will nichts wissen! Und jetzt pack dich durch! Ein Jaager gehört ins Refür, nicht in die Almhütt’n!“
„Sehr richtig!“ rief Prinz Emil und trat plötzlich in den Herdraum der Hütte.
„Jeß Maria!“ schrie entsetzt die tugendhafte Burgl und rang die Hände.
Verblüfft rutschte Daniel Eichkitz vom Herdrand herunter und stellte sich in Positur behufs Erweisung einer Art militärischer Reverenz vor dem Prinzen.
Scharf sprach Emil: „Das nennen Sie Dienst machen? Für die Schürzenjagd, für das Karessieren bezahlen wir die Jagdgehilfen nicht! Ich warne Sie: Werden Sie noch einmal auf einer Dienstvernachlässigung ertappt, so erfolgt die sofortige Entlassung, verstanden!“
Eichkitz erwiderte schnippisch: „Mit Verlaub! Der gnädig Herr hat mich aus dem Jagdschlößl ausg’schafft, das langt! Vom Dienst ausschaffen kann mich, so meine ich, doch wohl nur die Frau Fürstin, die wo Gebieterin ist und die Herrschaft ’kauft hat! I glaub nicht, daß...“
„Herr Oberförster, darf ich bitten!“ rief Prinz Emil mit zornbebender Stimme.
Hartlieb trat ein und fragte: „Durchlaucht befehlen?“
„Der Jagdgehilfe Eichkitz ist sofort seines Dienstes zu entheben! Über Kündigungsfrist, Lohnauszahlung usw. wollen Sie das Weitere veranlassen! Ebenso ist für Ersatz zu sorgen! Einstweilen kann wohl ein anderer Jagdgehilfe das Revier am Pyrgas beaufsichtigen!“
„Sehr wohl, Durchlaucht!“ Zu Eichkitz gewendet sprach Hartlieb: „Sie verlassen sofort das Revier! Den Hüttenschlüssel bringen Sie in die Jagdamtskanzlei, wo morgen früh acht Uhr mit Ihnen abgerechnet wird!“
Emil hatte die Almhütte bereits verlassen. Ihm folgte Hartlieb.
Völlig verdattert hatte die schmächtige Burgl zugehört. Jetzt, da die Herren sich entfernt hatten, meinte sie zu Eichkitz, dessen Zähne an der Unterlippe nagten: „Siehgst es, da hast es! Ich hab es allweil g’sagt, daß die Dienstschwänzerei nichts taugt und bald ein böses End nimmt! Und dein Leichtsinn auch! Kannst lang suchen, bis du wieder einen so schönen Jaagerposten findest, du Sausewind!“
Grob schnauzte Daniel Eichkitz die herbe Sennerin ab: „Dumme Gans! G’heiratet hätt ich dich nie nicht! Und nun kannst mir auf den Buckel steigen!“ Mit weiten Schritten zog er ab. Hinauf zur Pyrgas-Jagdhütte, um seine wenigen Habseligkeiten zu packen.
Die Herren wanderten durch den Plechauergraben zu Tale. Und in der Ebene des Halltales angekommen, sprach Prinz Emil seinen Dank für die Führung aus. „Um meine Dankbarkeit aber auch zu beweisen, bitte ich Sie, den bewußten Zwölferhirsch zu schießen! Und auch nach Bedarf überzähliges Kahlwild, ganz wie Sie[S. 194] es für nötig erachten! Auf meine Beteiligung am Abschuß und überhaupt am Weidwerk müssen Sie aber verzichten! Mir fehlt das Interesse, das Jägerblut! Ich bin nur ein begeisterter Naturfreund und Alpinist, habe nicht das geringste Verständnis für Wild und Jagd! Hingegen habe ich den ehrlichen Willen, Ihnen zu helfen, auf daß Ordnung wird! Bitte, sagen Sie dem Dickwanst Gnugesser – drolliger Name –, er soll mich morgen acht Uhr abholen; wir wollen einen forstlichen Kontrollgang machen! Weidmannsheil, lieber Oberförster! Auf Wiedersehen!“
„Weidmannsdank! Und gehorsamsten herzlichsten Dank für die erquickende Abschußerlaubnis!“
Der Forstwart Gnugesser stand Punkt acht Uhr früh am Portal des Schlößls, diesmal in Forstuniform und statt mit dem Hirschfänger mit dem Plätzhammer ausgerüstet. Mit seinem strahlendsten Lächeln im bärtigen Gesicht, hocherfreut von den guten Neuigkeiten, die ihm gestern abend Oberförster Hartlieb mitgeteilt hatte. Bereitwilligst hatte Beni auf Ersuchen Hartliebs die Mission übernommen, den jungen Prinzen über forsttechnische Angelegenheiten zu informieren, ihm die Notwendigkeit einer Forstnutzung auseinanderzusetzen, auf daß Prinz Emil den Widerstand der Mama bezüglich jeder Schlägerung überwinde und auch auf diesem Gebiete Reformen einführe.
Länger als vermutet mußte Beni warten, denn Prinz Emil kanzelte im Flur des Hauses den Kammerdiener Norbert ab, und zwar so kräftig und gut verständlich, daß sich Gnugesser bei all seiner Gutmütigkeit und Friedensliebe hochvergnügt die Hände rieb. Offenbar versteht der junge Herr das „Aufmischen“ gründlich; und wenn Prinz Emil jetzt sogar die „allmächtigen[S. 195]“ Vertrauenspersonen und einflußreichen Diener „fürifangt“, so müssen – nach Benis Meinung – die Verhältnisse bald anders und sehr gut werden.
Endlich kam Prinz Emil in schlichter Lodenkleidung heraus, dem Gesichtsausdruck nach etwas verstimmt, grüßte kurz und bat, es wolle der Forstwart auf einem Inspektionsgange über den Stand der Forstangelegenheiten Vortrag erstatten.
Der Marsch durch das nebelerfüllte Halltal wurde sofort angetreten. Für Benis dickes Bäuchlein und kurze Beine in einem zu schnellen Tempo. Eine Weile hielt Gnugesser zappelnd Schritt zur Linken des weitausgreifenden Prinzen, der sich anscheinend durch das Renntempo den Ärger weglaufen wollte. Dann aber wurde Benis Atem immer kürzer. So mußte er denn bitten, es möge der gnädige Herr etwas weniger schnell gehen. „Ich derpack das Gerenn nicht, die Haxeln sind z’ kurz!“
Schmunzelnd mäßigte Emil das Tempo. Und mit sarkastischem Blick musterte er den „Hendlfriedhof“, das hüpfende Bäuchlein Gnugessers.
Beni fing den Blick auf und sprach: „Glauben S’ nur ja nicht, gnädiger Herr, daß mein Wanst vom zu guten Essen so dick worden ist!“
„Also vom Hungern und Fasten?“ meinte lächelnd Emil und ging gemächlichen Schrittes weiter.
Eifrig beteuerte Beni, daß bei ihm Naturanlage vorhanden sei, eine mehr als dreimal verfluchte Veranlagung, die stetigen Verdruß verursache.
„Warum denn Verdruß?“
„No ja, halten zu Gnaden, weil mich jeder Hansdampf – Jeß Maria! Ich nehm das dumme Wort z’ruck – weil mich die Leut immer frozzeln wegen des[S. 196] dicken Bäucherls! Ist aber nicht zum Lachen! Magere Kost...“
„Vielleicht futtert der Forstwart zu feucht?“
„Ist nicht möglich, Duhrlauch! Wo das Gehalt so klein ist!“
„Was? Unzufriedenheit mit dem Gehalt?“
„Nicht! Keine Spur nicht von Unzufriedenheit! Wenn ich sag, daß mein Gehalt so klein ist, so hängt das mit meinem Hauskreuz und mit der vermaledeiten Haller Weiberrevolution zusammen!“
Emil fragte, neugierig geworden, nach Details dieser ihm fremden Verhältnisse und blieb stehen, damit Beni ruhigen Atems berichten konnte.
Der häusliche Krieg wegen der Entschädigung der Hausfrauenarbeit im Ehestande, der Kampf um das Gehaltsdrittel des Brotverdieners hatte Beni die Hauptwaffe, die Zunge, so geschärft, daß er sehr präzis und geläufig über die Entwicklung dieser Frage referieren konnte. Und besonders scharf betonte er die ethische Seite, das Herabdrücken der Würde der Ehefrau durch Annahme eines Lohnes auf das Niveau der bezahlten Dienstmagd. Für die ihn selbst betreffende finanzielle Seite hatte er nur den winzigen Spott, den die Gutmütigkeit gestattete. „Merkwürdig ist nur, daß die Weiber nicht nachgeben wollen, wiewohl es gar kein solches Gesetz gibt und selbst in der Schweiz nur ein Entwurf besteht! Der Pfarrer hat bereits scharf geschossen, die Bezirkshauptmannschaft hat jedwede Agitation verboten und Bestrafung wegen Störung der öffentlichen Ruhe angedroht! Hilft alles nichts, meine heißgeliebte Amanda will das Gehaltsdrittel und hetzt weiter, bis sie hoffentlich bald eingekastelt wird!“
„Aber das ist ja köstlich!“
„Mit Vergunst: was soll köstlich sein?“
„Die Situation, wenn Amanda – das ist wohl Ihre Gattin? – ‚eingekastelt‘ wird!“
„Köstlich oder nicht, jedenfalls krieg ich für einige Zeit Ruhe, so meine süße Amanda hinter schwedischen Gardinen sitzt als Revoluzzerin und Volksaufwieglerin!“
„Ist denn meine Mama über diese interessante Affäre informiert worden?“
„Wohl, wohl! Eine Zeitlang ist die Frau Fürstin für die Frauen gewesen, Duhrlauch hat es sogar dem Pfarrer von Hall verübelt, daß er die Revolution bekämpfte! Wie aber die Frau Fürstin vom Pfarrer genauer informiert worden ist, hat die Frau Fürstin nichts mehr wissen wollen! Natürlich schimpfen die Haller Weiber jetzt wie die Rohrspatzen über die Frau Fürstin!“
„Na, sehr nette Chose! Was soll denn daraus werden?“
„Ich hab keine Ahnung! Das begehrte Drittel kann ich nicht zahlen, soviel steht fest! Dazu ist die Gage wirklich zu klein; nichts für ungut, gnädiger Herr!“
Im Weiterschreiten ließ sich Prinz Emil über die Höhe der Beamtengehälter und über die Löhne der Waldarbeiter und Jagdgehilfen informieren. Selbst von Mama mit Geld sehr knapp gehalten, hatte Emil eine Ahnung davon, was es heißt, mit wenig Geld leben zu müssen. Kein besonderes Verständnis für soziale Verhältnisse, noch weniger Verständnis dafür, wieviel Geld der Haushalt eines schlecht bezahlten Beamten oder Forstarbeiters jährlich verschlingt. Aber eine hübsche Idee hatte Emil, einen niedlichen Revanchegedanken: für seine eigene Knapphaltung ist Revanche möglich und sehr nett, indem der knickrigen Mama etlicher Mammon[S. 198] dadurch abgeknöpft wird, daß man die Löhne des Forstwarts und der verheirateten Waldarbeiter aufbessert. Diebisch freute sich Emil über diese niedliche Revancheidee.
Gnugesser erhielt Auftrag, ein Verzeichnis der verheirateten Angestellten im fürstlichen Dienste anzufertigen und auszurechnen, wieviel gezahlt werden müsse bei einer Aufbesserung um zwanzig Prozent.
Einen Luftsprung vollführte Beni. Das Bäuchlein hüpfte. Und vor Freude schrie Gnugesser: „Vergelt’s Gott diese Wohltat!“
„Nur gemach! Erst die Berechnung! Dann muß ich die Angelegenheit prüfen, studieren, wie Gelder aus dem Ertrag des Herrschaftsgutes flüssig gemacht werden können! Denn aus der Privatschatulle wird Mama die zur Aufbesserung der Löhne nicht bewilligen!“
„Oh, gnädiger Herr! Geld soviel wie Heu können Sie herauszwicken, wenn überständiges Holz verkauft wird! Angebote haben wir genug, hiebreifen Bestand auch, nur die Erlaubnis zum Schlägern haben wir nicht – einstweilen!“
„Gut! Machen wir! Ich werde Mama schon umstimmen! Aber nun noch etwas: den geldhungrigen Eheweibern muß der Mund gestopft, die Lust zum Revolutionieren gründlich ausgetrieben werden!“
„Wie wollen denn gnädiger Herr dieses Kunststück fertigbringen?“
„Sehr einfach das: zehn Prozent der Aufbesserung liefert der Ehemann der Gattin als Nadelgeld ab! Wer damit nicht zufrieden ist, wer weiter hetzt und agitiert, wird entlassen!“
„Oha! Aber die Ehefrauen können doch nicht entlassen werden!“
„Die Weiber nicht, aber die in unserem Dienst stehenden verheirateten Beamten und Arbeiter!“
„Ah so wohl! Jetzt versteh ich, was Sie meinen! Wir Ehekrüppel bekommen durch die Aufbesserung eine Waffe, mit der wir die Revolution im Haushalt bekämpfen und niederringen können! Feine Idee das! Hätt gar nicht geglaubt, daß unser junger Prinz soviel Spiritus im Kopf hat! Jeß Maria, nichts für ungut; es ist mir gleich nur so dumm herausgerutscht!“ Und wütend auf sich selbst, schlug sich Beni auf den vorlauten Mund.
Belustigt sprach Prinz Emil: „Ist schon recht, Dickwanst! Ich bin wirklich nicht so dumm, wie ich aussehe! Die Idee zur Lösung der ‚Revolutionsfrage‘ gefällt mir selber, und ich glaube, daß den Weibern der Mund gründlich gestopft wird!“
„Wohl, wohl! Bis auf die gefährliche Krämerin in Hall! Diese Oberhetzerin steht nicht im fürstlichen Dienst, sie kann also auf die Herrschaften husten und pfeifen, wie sie mag! Und das wird sie auch tun! Und solang dieses Malefizweib hetzt, wird auch keine endgültige Ruhe eintreten!“
„So? Da bin ich anderer Meinung! Die Krämerin wird einfach boykottiert!“
„Wie denn das?“
„Zur Strafe für die Verhetzung wird der Boykott über die Krämerin verhängt! Wir kaufen nichts mehr bei ihr! Und wer von unseren Beamten und Dienern fürder den Bedarf bei der Krämerin deckt, wird entlassen! Merkt das die Krämerin, so wird sie, um nicht geschäftlich ruiniert zu werden, ganz gewiß zu Kreuz kriechen und jede Agitation einstellen!“
„Gott! Sie sind ein heller Kopf!“ Und wieder schlug sich Beni auf den Mund.
„Na schön! Nun gehen Sie heim und besorgen Sie mir so rasch als möglich die Aufstellung und Berechnung! Bis Mittag will ich alles in Händen haben!“
„Sehr wohl, gnädiger Herr! Aber was ist’s mit dem Inspektionsgang?“
„Machen wir ein andermal! Mich interessiert jetzt die Revolutionsangelegenheit und ihre Lösung!“
Des guten Herbstwetters halber hatte Fürstin Sophie eine Wagenfahrt nach dem idyllisch gelegenen Wallfahrtsorte Frauenberg bei Admont befohlen, und zwar nach dem Lunch. Als aber bei Aufhebung der Tafel Prinz Emil um Audienz in einer dienstlichen Angelegenheit bat mit dem Hinweise, daß die Besprechung wahrscheinlich längere Zeit beanspruchen werde, bestellte die erstaunte Mama den Wagen wieder ab.
Daß der Sohn der Mutter sich wieder nähert, eine Aussprache wünscht, sich um Herrschaftsangelegenheiten kümmert, erfüllte die Fürstin mit größter Freude. Und im voraus war sie gewillt, allen Vorschlägen des geliebten Sohnes zuzustimmen.
Als aber Emil mit dem von Gnugesser gelieferten Aktenmaterial im Zimmer der Mama erschien und von Schlägerung und Lohnaufbesserung sprach, ward die Miene der Fürstin etwas säuerlich. Und Mama verschanzte sich hinter dem Ausspruch des Jagdgehilfen Eichkitz, wonach die Jäger um jeden gefällten Baum heulen und „die Hirsche auch“.
Trocken und kurz erzählte Emil, weshalb der Eichkitz wegen grober Dienstesvernachlässigung entlassen worden sei.
Nun gab Mama jeden Widerstand auf, hütete sich auch, wegen der Entlassung des früheren Günstlings Eichkitz ein Wort zu äußern. „Tu was du willst, lieber[S. 202] Sohn! Wenn ich um eines bitten darf, tu nichts ohne Hartlieb gefragt zu haben, der ja Fachmann ist!“
„Gewiß! Selbstverständlich! Du wirst ja zweifellos während meiner Abwesenheit auch stets den Oberförster gefragt haben!“
Fürstin Sophie biß sich auf die Unterlippe und schwieg.
„So! Es ist alles erledigt! Wenn Mama gestattet, werde ich euch begleiten und mit nach Frauenberg fahren!“
„Da du mitfahren willst, kann Martina zu Hause bleiben!“
„Aber nein! Die Gussitsch soll nur mitfahren! Das arme Wurm versauert ja ohnehin auf ihrem Kammerl! Das bissel Vergnügen einer Wagenfahrt ist ihr schon zu gönnen! Vorausgesetzt, daß es in dem Nest etwas zu schnabulieren gibt! Ich habe heute einen merkwürdigen Appetit auf Backhühner und Steiererwein! Da der – mündige Prinz von Schwarzenstein naturellement die Zeche zu berappen haben wird, dermalen aber – horribile dictu – nur über lumpige zehn Kroneln verfügt, muß ich die durchlauchtigste Fürstin-Mama um Ausfolgung von Moneten allergehorsamst bitten!“
„Ja freilich! Wieviel wird denn das Backhendl-Vergnügen kosten?“
„Hundert Kroneln werden vielleicht genügen! Nichts Gewisses weiß man nicht!“
„Was? Hundert Kronen?! Das ist ja ein ganzes Vermögen! Hundert Kronen für ein Backhendl? Entsetzlich! Unerhört teuer!“
Schmunzelnd meinte Emil, den das Gejammer Mamas belustigte: „Ach wo! Ein Hunderter ist ungefähr soviel, wie wenn ein Ochs ein Veigerl frißt!“
„Ach Gott! Diese Ausdrücke! Schrecklich! Sie gehen mir auf die Nerven!“
Die Audienz endete damit, daß die Mama, die vom Geldwert und merkantilen Dingen nicht viel verstand, dem Sohne ganze zwanzig Kronen gab, die Emil gelassen in die Westentasche steckte. „Danke! Jetzt aber muß auch Norbert mitfahren!“
„Aber warum denn?“
„Das bleibt einstweilen mein Geheimnis! Untertänigsten Dank, liebe Mama!“ Emil küßte der Mutter die Hand und empfahl sich.
Unten, und zwar in Nähe der Fenster von Martinas Zimmer, befahl Emil dem verdutzten Kammerdiener Norbert die Bestellung des viersitzigen Wagens absichtlich so lauten Tones, daß Fräulein von Gussitsch jedes Wort hören mußte. Richtig erschien auch Martina an einem der offenen Fenster.
Hinauf grüßend und mit den Augen zwinkernd rief Emil: „Bitte, sich rasch fertigzumachen! Dienstfahrt nach Frauenberg zu Backhendl und Steiererwein! Ich fahre ooch mit!“
„Nicht möglich! Che grandissimo onore!“ kicherte Martina und verschwand vom Fenster.
In Gedanken nannte Emil das Hoffräulein einen „sehr netten Käfer“. Und auch die Wahrheit gestand er sich ein, daß er nur deshalb mitfährt, um die zum Anbeißen hübsche Martina etliche Stunden als Gegenüber betrachten zu können.
Als der Wagen vorfuhr, erteilte Emil dem Kammerdiener den Befehl: „Sie fahren als Reisefourier mit, verstanden?“
„Zu Befehl! Ich werde mich sofort mit dem Nötigen[S. 204] versehen!“ Und hurtig verschwand Norbert, um ebenso rasch wieder zu erscheinen.
Noch vor der Abfahrt wurde eine Depesche gebracht, welche für den Abend die Rückkehr des Grafen Thurn ankündigte und einen Wagen zum Bahnhofe Admont erbat.
Fürstin Sophie meinte, daß man auf dem Rückwege von Frauenberg den Grafen in Admont abholen könne.
Davon wollte aber Prinz Emil, dessen Augen die schöne Martina anblitzten, nichts wissen; er heuchelte Sehnsucht nach familiärem Zusammensein, das gestört würde durch ein minutiöses Erscheinen am Bahnhofe.
Hocherfreut nahm die Mama diese spitzbübische Heuchelei für Ernst und gab Befehl, daß ein eigener Wagen für den Grafen Thurn gesendet werde.
Während der Fahrt durch das in den Farben des Herbstes prangende Ennstal verhielt sich Emil schweigsam. Gleichgültig gegen die Pracht der himmelragenden Felskolosse, die das Tal besäumen. Um so größeres Interesse verriet der Blick für das bildhübsche Hoffräulein. Zu Martinas Unbehagen, denn fängt die Fürstin nur einen einzigen dieser brennendes Interesse kündenden Blicke auf, so wird eine bitterböse Situation heraufbeschworen sein. Unangenehm war sie jetzt schon während dieser dem „Vergnügen“ gewidmeten Fahrt durch die angespannte Aufmerksamkeit für die Gebieterin für den in jedem Moment möglichen Fall einer Ansprache, durch die Dienstesbereitschaft, durch den Zwang der Zurückdrängung von Gedanken, die sich mit Hartlieb beschäftigen wollten. Und wegen der brennenden Blicke Emils mußte Martina doch darüber nachdenken, wie sie der drohenden Gefahr entgegentreten solle, wie beizeiten[S. 205] die züngelnde Flamme gelöscht werden könne. Der erwachte Prinz muß toll geworden sein, von einem Sinnestaumel erfaßt; ein verzehrendes Feuer glüht in seinen flackernden Augen. Und der Tollgewordene wagte es sogar zu fußeln.
Martina mahnte mit einem tiefernsten Blick zur Vernunft, und scheu schielte sie nach der Fürstin, die gottlob von dem Gebaren des Sohnes nichts wahrgenommen zu haben schien und ihren Gedanken nachhing.
Emil gab auf die optische Mahnung hin Ruhe, aber am nervösen Zucken der Finger war zu erkennen, daß der junge Mann seine drängenden Sinne kaum länger wird beherrschen können.
Auf dem hochgelegenen Frauenberg angekommen, besuchte Fürstin Sophie, von Martina begleitet, sofort die doppeltürmige Wallfahrtskirche. Auch Emil ging mit, zur sichtlichen Freude der Mutter.
Als dann die Sehenswürdigkeiten besichtigt waren und der von Norbert gedeckte Tisch im schattigen Garten des behäbigen Gasthofes bezogen wurde, waren etliche Stunden verflossen. Immer noch zu früh für das von Emil geplante ländliche Diner. Und bei dem bestellten dünnen Kaffee mit trockenem Kuchen konnte die gewünschte Stimmung nicht eintreten. Das eisige Verhalten Martinas, die nur für die Gebieterin zu leben schien, machte Emil verdrossen.
Die Fürstin sprach von der überraschenden Stilverschiedenheit der Kirchen im Ennstale, besonders von dem Kontraste zwischen Admont und Frauenberg. Im Blasius-Münster edelste Gotik mit romanischen Portalen aus der Zeit des ersten Kirchenbaues, in Frauenberg hingegen ein italienischer Barockbau, prunkvolle Stuckarbeiten und prächtige farbenglühende Fresken. Zu Emil[S. 206] gewendet, sprach die Mama: „Du hattest doch Kunstgeschichte studiert, mußt also mehr verstehen als ich! Kannst du angeben, wie man dazu kam, just hier einen so reichen italienischen Barockbau aufzuführen?“
Emil hatte keine blasse Ahnung von Kunstgeschichte, aber die Inschrift der Grabplatte vor dem Hochaltare hatte er gelesen, und darauf sich stützend, von plötzlichem Übermut erfaßt, schwatzte er davon, daß der Erbauer von Frauenberg, der hier zu Ende des 17. Jahrhunderts beigesetzte Admonter Abt Adalbert aus dem Geschlecht der Heufler zu Rasen und Hohenbüchel ein Italiener gewesen sei.
„Mit dem Namen Heufler zu Rasen ein Italiener? Wie ist denn das möglich?“
„Oh, der Name bedeutet nicht viel für die Nationalität! Es kann ein Stockböhmak und Urtscheche einen völlig deutschen Namen haben oder umgekehrt!“
„Ja doch! Wenn aber jener Heufler zu Rasen ein Italiener war, wie kam er in das Stift Admont?“
„Wahrscheinlich mit der Eisenbahn!“
Ob dieser handgreiflichen Aufschneiderei mußte Martina auflachen, sie konnte sich nicht bemeistern. Der Anachronismus war zu drollig, ebenso das spitzbübische Gesicht des Schelms, der es darauf angelegt hatte, die Mama reinfallen zu lassen.
Wie nun Emil sah, daß das von ihm vergötterte Hoffräulein vergnügt lachte, war er augenblicklich in rosigster Stimmung und bemüht, Martina in guter Laune zu erhalten.
Leise rügend sprach die Mama: „Du beliebst zu spaßen!“
„Verzeihung! Harmloser Ulk im Familienkreise! Ko[S. 207]pie der alten Geschichte vom Kaiser Josef und der Bahnwärterstochter!“
Wieder ging die ahnungslose Mama dem Schalk ins Netz, indem sie sagte: „Davon ist mir nicht das geringste bekannt! Es wird sich doch der hohe Herr nicht so weit vergessen haben...?“
„Oh, Mesalliancen sind auch in früherer Zeit vorgekommen! Und in neuester Zeit gibt es deren massenhaft! Ich würde auch nicht locker lassen! Um keinen Preis der Welt!“ Ein heißer Blick flog auf Martina.
Fürstin Sophie erwiderte ernsten Tones: „Die Vernunft muß immer über der Neigung stehen!“
„Verzeihung, Mama! Du meinst die Staatsräson! Für sie gilt allerdings dein Diktum immer und völlig! Bei mir wird es aber eine andere – Wurscht sein, da kommt die Staatsräson gar nicht in Betracht!“
„Gott! Diese Ausdrücke! Und dann dieses sonderbare Thema! Ich will nicht hoffen, daß du noch derlei gefährliche Absichten hegst! Du bist doch auch noch zu jung!“
„Oho! Bin schon vierundzwanzig Jahre alt!“
„Entschieden verfrüht!“
„Verzeihung, daß ich widerspreche.“ Wieder flog ein heißer Blick auf die vor Schrecken erbleichende Hofdame.
In italienischer Sprache mahnte Mama: „Laß doch dieses Thema fallen! Bezahle die Rechnung! Ich wünsche heimzufahren, möchte vor Ankunft Thurns zu Hause sein!“
„Nana! Welche ‚Pressiererei‘! Und die Backhendl, auf die ich mich so mächtig gefreut habe?“
„Bitte, rufe Norbert und erteile Auftrag, daß angespannt wird!“
Der Kammerdiener stand in einiger Entfernung dienstbereit und kam auf Emils Wink sofort herbei.
Gedehnten Tones sprach der Prinz: „Der Reisefourier soll seines Amtes walten! Abendessen abbestellen, aber bezahlen! Sogleich anspannen!“
Erstaunt fragte die Fürstin leise: „Was soll das mit dem ‚Reisefourier‘? Warum zahlst du nicht die Zeche?“
Emil lachte nun vergnügt: „Werde mir hüten! Die zwanzig Silberlinge befinden sich unsäglich wohl in meiner Tasche! Der bezüglich der nicht bewilligten Backhendl verunglückte Ausflug soll nur aus der hochfürstlichen Kasse bezahlt werden! Norbert als Fourier wird schon verrechnen! Ich habe Rübchen: ätsch – ätsch! Mamale ist reingefallen! Diesmal bin ich der Schlauere gewesen!“ Und lachend imitierte Emil das Rübchenschaben und verbeugte sich drollig.
Das geschah so nett und witzig, daß Mama nun doch lächelte und das Prinzlein einen ausgewachsenen Spitzbuben nannte.
Während der Rückfahrt attackierte Emil das Hoffräulein abermals mit heißen Blicken, rutschte quecksilbrig auf seinem Sitze hin und her und suchte Martinas Händchen zu erhaschen.
Dies bemerkte die Fürstin. Mit eisigen Worten bat sie den Sohn um ein anständiges Verhalten. „Später wird mehr zu sprechen sein!“
Martina erschauerte und war dem Weinen nahe.
Emil schien toll geworden zu sein. Er meinte: „Ach Gott! Wenn nötig, können wir sofort das Thema erörtern! Einmal muß es ja doch zum Klappen kommen!“
Scharf mahnte die Fürstin: „Still jetzt! Die Leute auf dem Bock haben Ohren! Bedenke, daß du Prinz Schwarzenstein bist!“
Emil verzog die Lippen und schwieg.
Als der Wagen an der Jagdvilla vorfuhr, bat Mar[S. 209]tina bebenden Tones um Gewährung einer außerordentlichen Audienz.
„Ich werde Sie rufen lassen! Vorerst habe ich mit meinem Sohne zu sprechen!“ erwiderte sehr frostig die Fürstin.
Hildegard kam gesprungen, um die Fürstin in ihr Zimmer zu geleiten und beim Kleiderwechsel behilflich zu sein. Das mußte auf ausdrücklichen Befehl sehr rasch geschehen. Dann erfolgte der Auftrag, den Prinzen zu rufen und dafür zu sorgen, daß keine Störung erfolge.
Die Kammerfrau beteuerte, strengsten Türdienst leisten zu wollen. War doch ihre Neugierde übergroß.
Hochaufgerichtet, wie eine strafende Göttin, flammenden Blickes, empört und entrüstet, stand die Mama vor dem Sohne, der sich trotzig verhielt, zum Losplatzen bereit schien, aber doch gehorsam die gepfefferte Strafpredigt ruhig anhörte.
Aneinandergereihte Rügen für ein unartig gewesenes Kind, Tadelsworte, die mit der Frage endeten, was denn das Spiel heißen solle.
„Nicht Spiel, Mama! Ich liebe Fräulein von Gussitsch!“
„Ach was! Wo hast du nicht geliebt? In Dresden? In Dessau? Und in Berlin das bürgerliche Fräulein? Jünglingslaunen, Strohfeuer! Etliche kalte Umschläge, und der Fall ist erledigt! Bedauerlich, ja schmerzlich ist es für mich, daß ich die nette, mir sympathische Person nun entlassen, das arme Mädel in die grausame Welt hinausstoßen muß! Und das ist deine Schuld!“
Festen Tones erwiderte Emil: „Nein, Mama! Nicht Jünglingslaunen, denn ich bin volljährig! Und nicht Strohfeuer, denn es ist heftige Leidenschaft, brennende Liebe!“
„Kinderei, nichts anderes!“
„Bitte, nicht dieses Wort, nicht diesen Ton! Ich bin kein Bub mehr und auch nicht gewillt, mich gängeln zu lassen! Und ich will dir ganz ernsthaft einen Vorschlag machen, Mama! Du weißt, daß ich sehr gerne in Berlin weiterleben möchte! Dir zuliebe habe ich mich deinen Wünschen gefügt und bin zurückgekehrt! Nun bin ich bereit, auf ‚Berlin‘ zu verzichten, wenn du mir erlaubst, daß ich Fräulein von Gussitsch heiraten darf! Martina oder keine!“
„Keine!“ Es klang metallisch hart und schneidend, erbittert und eisig.
„Du lehnst meinen Vorschlag ab?“
„Ja, rundweg!“
„Gut! Für die Folgen hat die Mama aufzukommen!“
„Ich verbitte mir derlei Ausdrücke! Nun geh und sage Hildegard, daß sie die Gussitsch rufen soll!“
So zornig und erbittert verließ Emil das Boudoir, daß er die Verlegenheit der beim Horchen überraschten Kammerfrau nicht gewahrte. Grollend entledigte der Prinz sich des Auftrages, und dann schloß er sich in seinem Zimmer ein.
Martina sah elend aus, verweint und bleich, gerötet die Augen; schluchzend bat sie um Entlassung.
Die Fürstin fühlte nun doch Mitleid mit dem armen Mädchen, und weichen Tones sprach sie: „Zu meinem Schmerze werde ich Sie leider wegschicken müssen! Doch will ich mich bemühen, eine ähnliche und passende Stellung für Sie zu beschaffen! Deshalb bleiben Sie vorerst noch hier! Ich bin dessen sicher, daß Sie verstehen werden, sich das – Kind vom Leibe zu halten! Kalte Umschläge werden den Jungen hoffentlich sehr bald zur Vernunft bringen!“
Martina wimmerte: „Ich bitte inständigst, mir zu glauben, daß mich nicht die geringste Schuld trifft! Das Aufflackern des Strohfeuers ist mir unbegreiflich! Ich habe nichts, aber wirklich nichts getan, um eine Entzündung herbeizuführen!“
„Das will ich gern glauben! Es kann ja dieses ‚Feuerfangen‘ mit dem rasch erfolgten ‚Aufwachen‘ meines Sohnes in gewisser Verbindung stehen! Ein psychologisch nicht genügend aufgeklärter Vorgang in der Jünglingsseele! Für Emil sicher bedeutungslos, weil vorübergehend! Eine Kinderei! Mißlich ist freilich, daß die Kinderei Ihnen die Stellung kostet! Vielleicht gelingt es, Sie durch eine Heirat in gute Obhut zu bringen! Hofdame für Lebenszeit werden Sie ja doch nicht bleiben wollen! Was ich zu Ihrer Versorgung tun kann, soll gerne geschehen, auch finanziell! Wollen Sie sich gegebenenfalls vertrauensvoll und offen an mich wenden!“
Todtraurig wiederholte Martina die Beteuerung, daß sie frei von jeder Schuld sei.
Und darob empfand die Fürstin ein starkes Befremden. Sie ärgerte sich, daß das vermögenslose Fräulein das finanzielle Anerbieten ignorierte, alle Schuld dem Prinzen zuschieben will. In übler Laune sprach die Gebieterin davon, daß die Hofdame nicht ganz frei von Schuld sein könne, die „Intervention“ vermutlich zu wenig diplomatisch durchgeführt und dem Jungen eine Annäherung erlaubt habe, die zu üblen Folgen führen mußte.
Schluchzend wehrte sich Martina gegen diese Vorwürfe und verwies darauf, daß sie bei Entgegennahme des Auftrages zur Intervention auf die Gefahren derselben rechtzeitig aufmerksam gemacht habe.
Spitz klang die Antwort: „Sie werden doch nicht etwa[S. 212] mir Vorwürfe machen wollen? Erinnern Sie sich gefälligst, daß ich die Gefährlichkeit negierte in der selbstverständlichen Voraussetzung, daß das Hoffräulein klug und diplomatisch, mit Frauentakt interveniere! Genug davon! Was geschehen ist, soll totgeschwiegen werden! Damit Sie mit Emil möglichst wenig zusammentreffen, werden Sie für einige Zeit an der Tafel nicht teilnehmen, auf Ihrem Zimmer speisen! Auch sollen Sie einstweilen dienstfrei bleiben! Beschränken Sie Ihre Ausgänge auf das zur Bewegung unerläßliche Minimum, meiden Sie aber dabei jedes Zusammentreffen mit dem – Kinde! Und wenn nötig, weisen Sie den Jungen schroff zurück! Es tut mir leid, so sprechen und anordnen zu müssen, aber es muß eben sein! Ich hoffe, daß in einigen Wochen eine alle Teile befriedigende Lösung gefunden sein wird!“ Eine Handbewegung und Martina war entlassen.
Unmöglich war es Fräulein von Gussitsch, diesmal die strafende Hand der gnädigen Fürstin zu küssen. Zu sehr schmerzte jedes Wort, ganz besonders wurmten jedoch die Vorwürfe. Leise schluchzend verbeugte sich Martina und verließ das Zimmer.
Einer bösen, schlaflosen Nacht folgte ein kühler Morgen. Eingedenk des Befehles, Spaziergänge auf das Minimum zu beschränken und nach Möglichkeit ein Zusammentreffen mit dem „Kinde“ Emil von Schwarzenstein zu vermeiden, entschloß sich Martina zu Ausgängen jeweils am frühen Morgen und späten Abend. Und so verließ sie an diesem Morgen die Villa zu einer frühen Stunde, da das Küchenpersonal noch nicht sichtbar war. Hinaus ins Freie, hinein in den nebelumflorten Bergwald, wo die Tannen geheimnisvoll flüstern und die Hirsche orgeln...
Spät des Morgens erwachte Prinz Emil. Mit einigem Haarweh als Folgen eines ausgiebig genommenen Schlaftrunkes am verflossenen Abend. Zwei Flaschen schweren Ungarweines, die sich Emil als Schlummerpunsch geleistet hatte, waren von guter Wirkung gewesen und hatten allen Ärger verscheucht und einen prächtigen Schlaf erzeugt. Jetzt am Morgen hieß es, Kater vertreiben, zunächst mit Kaltwasser den Schädel behandeln. Viel quellfrisches Wasser benötigte Emil. Und in diesem vielen Naß ertrank ganz jämmerlich eine gewisse Liebe zu einer gewissen Dame. Und nach Beseitigung des Haarwehs sagte sich Emil, daß er eigentlich doch sehr dämlich vorgegangen sei und sich überflüssigerweise eine böse Suppe eingebrockt habe. In der Gewissenserforschung kam er zu einem lebhaften Bedauern, die doch so nette Hofdame in eine sehr schlimme Situation gebracht zu haben. Unrecht hatte die Mama ja nicht, daß sie die Liebäugelei, den Flirt mit der Gussitsch nicht dulden wollte. Und völlig gerechtfertigt und einleuchtend ist der Protest gegen eine Heirat. Ordentlich froh war Emil, daß sich die Mama mit dem strikten Verbot als die Gescheitere erwies; denn jetzt am Morgen empfand er nicht die Spur einer heißen Liebe, nicht die geringste Lust, die Gussitsch zu heiraten. Dafür etwas wie Reue, sich in die Nesseln gesetzt zu haben. Das war erklecklich dumm. Dieser Selbsterkenntnis gesellte sich die Frage bei, wie auf gute und nicht schmerzhafte Weise die Folgen dieser Dummheit beseitigt werden könnten. Unvermeidlich wird ein Kanossagang zur Mama, eine ehrliche Beichte sein; muß aber gemacht werden, schon wegen der schlechten Finanzen. Und Fräulein von Gussitsch wird man um Entschuldigung bitten müssen.
Mit diesem guten Vorsatze fand Emil denn auch das seelische Gleichgewicht wieder, den leichten Frohsinn der Jugend. Er frühstückte mit Behagen. Und als er sich die Zigarette anzündete, wurde der Oberförster Hartlieb gemeldet.
„Ich lasse bitten, im Empfangssalon!“ sprach Prinz Emil und fügte bei: „Seit wann versieht denn die Kammerfrau den Meldedienst? Wo steckt denn Norbert?“
Hildegard gab Auskunft, daß Norbert nach Admont gefahren sei, um die Post zu holen. Deshalb habe sie den Meldedienst übernommen.
„Danke! Führen Sie den Oberförster in den Salon!“
Die Kammerfrau verschwand.
Als gutmütiger Mensch wollte Emil den Beamten nicht unnötig warten lassen; es tat dem Prinzen zwar leid, die Zigarette wegzuwerfen, aber es geschah doch.
Beim Eintritt in das Zirbenzimmer fiel Emil der verstörte Gesichtsausdruck, die verzerrte Miene Hartliebs auf. Kalkweiß waren die Wangen, der Blick kündete bittersten Schmerz.
„Was ist Ihnen? Sind Sie krank?“ fragte teilnahmsvoll der Prinz.
„Danke ergebenst! Mir ist nicht wohl!“
„Da wollen wir auf die dienstliche Besprechung verzichten! Gehen Sie sofort heim, schonen und pflegen Sie sich! Der Forstwart kann Ihre Vertretung übernehmen! Lassen Sie auch den Arzt kommen! Ich werde später Nachschau halten!“
„Vielen Dank! Es wird nichts von Bedeutung sein! Und den Holzverkauf zu guten Preisen dürfen wir nicht versäumen!“
„Machen Sie das alles nach Ermessen und Gewissen! Aber schonen und pflegen Sie sich! Nehmen Sie die Akten nur wieder mit! Apropos: Mama ist mit allen Vorschlägen einverstanden! Kann Ihnen im Vertrauen auch mitteilen, daß Mama viel auf den Fachmann Hartlieb hält!“
Erstaunt blickte Ambros auf. „Darf ich erfahren, wem ich das zu verdanken habe?“
„Das weiß ich nicht! Über die eingerissenen Übelstände hat mir Fräulein von Gussitsch gesagt, daß Sie der richtige Mann zur Sanierung seien und alles Vertrauen verdienen! Demgemäß habe ich bei Mama Vollmacht für Sie erwirkt! Nun aber Schluß! Sie zittern ja am ganzen Leibe! Wünschen Sie stärkende Tropfen oder Kognak? Donnerwetter, Mann, fallen Sie mir nicht um!“
Hartlieb mußte sich stützen, mit den Händen an einem Stuhle festhalten. Zuviel stürmte in dieser kurzen Spanne Zeit auf ihn ein.
Emil sprang in das anstoßende Speisezimmer, entnahm der Kredenz die Kognakflasche und brachte den stärkenden Schluck.
Dankend leerte Hartlieb ein Gläschen davon. Und dann verabschiedete er sich.
„Auf Wiedersehen! Gegen Mittag besuche ich Sie!“ rief Emil dem Oberförster nach, der sich schwankenden Ganges entfernte.
Im Freien erholte sich Hartlieb rasch, und die Schwäche schwand. Er ging taleinwärts, um beim Rottmeister eine Schlägerung anzuordnen.
Wie er sich auf dem sonnenverklärten Sträßlein dem Sensenwerk näherte, kam ihm zu seiner freudigen und zugleich erschreckenden Überraschung Fräulein von Gus[S. 216]sitsch entgegen. Verweint und eiligen Schrittes. Und beim Anblick des Oberförsters zuckte Martina zusammen, die Wangen erbleichten, die zierliche Gestalt erbebte. Als sie sich gegenüberstanden, rangen beide nach Worten. Am schwersten Hartlieb, der die bittersten Seelenqualen litt, nachdem ihm die Kammerfrau Hildegard die alle Hoffnungen vernichtende Neuigkeit zugeflüstert hatte, daß Prinz Emil die Hofdame von Gussitsch heiraten werde. Was soll jetzt der im Innersten so schwer getroffene, schlichte ehrliche Waldmann sagen? Wie danken, daß Martina sich zu seinem Gunsten verwendet hatte? Wie die Braut des Prinzen behandeln? Darf er gratulieren? Kann er es, der jede Hoffnung und sein Lebensglück verloren hat...?
Vergeblich mühte sich Martina ab, die Herrschaft über sich mit der nötigen Raschheit wiederzugewinnen. Wie gelähmt war die Gehirntätigkeit. Unmöglich war es, dem geliebten Manne zu sagen, daß sie tiefunglücklich sei und demnächst die Entlassung zu gewärtigen habe. Unmöglich, von Hartlieb jetzt Abschied zu nehmen... Und ganz unmöglich, in dieser Minute ein harmloses, nichtssagendes Gespräch zu führen. Alle Fähigkeiten der gutgeschulten, weltgewandten Hofdame versagten. Dagegen füllten sich die Augen mit verräterischen Zähren.
Hartlieb stützte sich auf den Stock, um nicht zu taumeln, und stammelte in abgehackten Worten seinen tiefgefühlten Dank für die wohlwollende Empfehlung bei den Herrschaften. „Ich, ich hab jetzt Vollmacht für, für alles! Aber, aber es freut mich nimmer –!“
Nun fand Martina doch so viel Kraft, um wehmütig zu lächeln und zu sagen: „Das wenige, was ich für Sie tun konnte, ist gern, von Herzen gern geschehen![S. 217] Was mich wundert, ist, daß Sie von meiner geringfügigen Bemühung Kenntnis erlangt haben!“
„Vorhin hat der Prinz davon gesprochen!“
„Sie waren eben beim jungen Herrn?“ rief überrascht Martina.
Hartlieb nickte. Das Übermaß schmerzlichster Empfindungen überwältigte ihn.
In der Sorge, dem Prinzen auf der Rückkehr zur Villa in den Weg zu laufen, erkundigte sich Martina nach der Richtung, die Prinz Emil eingeschlagen habe.
Ächzend stieß Hartlieb hervor: „Er ist noch daheim!“
„Danke! Dann muß ich mich beeilen, heimzukommen! Leben Sie wohl, Herr Hartlieb!“ Ein Blick voll Liebe und Trauer. Dann huschte Martina hinweg und lief im Trab davon.
Ambros drehte sich um und guckte dem Fräulein nach. Und dachte: Wie sie es doch eilig hat, zum Bräutigam zu kommen. Alles verloren...
Gebrochen schleppte sich Hartlieb weiter, um den Rottmeister aufzusuchen.
Martina huschte in das Schlößl. Von den Dienerinnen begegnete ihr nur die Kammerfrau Hildegard, die höflich grüßte und dem in Ungnade gefallenen Hoffräulein einen spöttischen Blick zuwarf und grinsend fragte, ob jetzt der Kaffee auf das Zimmer gebracht werden dürfe.
„Ich bitte darum!“ Dann verschwand Martina in ihrer Stube, die ein Gefängnis für sie geworden ist.
Leichter als erwartet vollzog sich Emils Kanossagang: die Bitte um Mamas Verzeihung wurde freudigst aufgenommen und sofort erfüllt. Aber wegen der Aufbesserung seiner Finanzen erlebte Emil eine grausame Enttäuschung. Nicht ein Wort wurde davon gesprochen. Antippen wollte aber Emil nicht. Und groß staunte er,[S. 218] als nach der Mitteilung, daß nun auch Fräulein von Gussitsch um Entschuldigung werde gebeten werden, Mama dem Sohne diesen Besuch verbot und befahl, es solle Emil schriftlich um Verzeihung bitten.
Enttäuscht verließ Emil die gestrenge Mama. Mit dem Entschluß, nun behufs Aufbesserung seiner trostlos schlechten Finanzen Schulden zu machen, egal wo und bei wem. Hauptsächlich in Admont, weil der Ort doch größer als das Dörflein Hall ist. Und der Satan flüsterte ihm den Rat ein: „Geh pumpen ins Kloster zu den Benediktinern!“
Im Forsthause besuchte Prinz Emil den vom Kuraufenthalte in Römerbad zurückgekehrten Hausmarschall Grafen Thurn. Diese Höflichkeitsvisite fiel sehr kurz aus, da Graf Thurn von der Reise ermüdet heimgekommen war und nicht danach aussah, als würde er geneigt sein, dem Prinzlein die Taschen mit Dukaten zu füllen. Liebenswürdig wie immer, ganz Hofmann und aalglatt, sehr dankbar für die ihm erwiesene Aufmerksamkeit. Wie der Weißbart sich nach den Ergebnissen der Reise erkundigen, gewissermaßen sondieren wollte, verabschiedete sich Emil mit dem Versprechen, darüber ein andermal referieren zu wollen.
Nun schlenderte Prinz Emil gemächlich nach Admont. Das von Sonnenstrahlen goldumwobene Münster mit den schlanken Doppeltürmen grüßte verheißungsvoll entgegen. Und die stolzen Gebäude des Stiftes erinnerten den Wanderer an das Hauptziel des Ausfluges. Aber besonders groß war Emils Zuversicht nicht, denn für ihn konnte doch nur ein einziger Stiftsherr in Betracht kommen: der Pfarrer von Hall, Pater Wilfrid. Andere Stiftsherren kannte Emil nicht. Den Abt zu behelligen, durfte überhaupt nicht gewagt werden. Bei Wilfrid[S. 219] stand zu hoffen, daß er nicht nur helfen, sondern auch schweigen werde. Mama darf unter keinen Umständen von dieser heiklen Angelegenheit Kenntnis erlangen. Über den Rückzahlungstermin zerbrach sich Emil einstweilen den Kopf noch nicht.
Die lange Hauptgasse des Marktes Admont hinaufschreitend, erblickte Emil am Hotel „Zur Post“ zu seiner freudigsten Überraschung seinen Adjutanten Baron Wolffsegg, der soeben wegfahren wollte. Sofort rief Emil den sehr länglichen, elegant gekleideten Zwetschgenbaron an. Und Wolffsegg verließ sofort den Wagen, als er den Prinzen erkannte, nahm eine stramme Haltung an und zwirbelte den rotblonden Bart auf. Im Schatten des ziemlich großen Strohhutes waren die unzähligen Sommersprossen auf Nase und Wangen nicht zu sehen, die vor der Erbschaftsübernahme den Reichtum Wolffseggs gebildet hatten.
Auf den ersten Blick gewahrte Emil, daß der zu Geld gekommene Adjutant sich jetzt fühlte, sich auch elegante Kleider zugelegt hat.
Wolffsegg erwies Reverenz mit erlesener Höflichkeit wie stets, aber doch mit einer Nuance, die merken ließ, daß man jetzt auch wer sei, nicht mehr der in Ehrfurcht ersterbende Habenichts und Bärenführer. Er lud den Prinzen ein, sich auf das Hotelzimmer zu bemühen. „Wollte soeben nach Hall fahren, mich melden bei den durchlauchtigsten Herrschaften!“
Emil lachte: „Bei mir ist die Meldung nicht mehr nötig! Mama wird sich freuen, den getreuen Wolffsegg, jetzigen Dukatenhamster, wiederzusehen! Gondeln Sie so bald wie möglich hinaus!“
„Zu dienen, Durchlaucht!“
Im Hotelzimmer angelangt, klopfte Emil auf den[S. 220] Busch mit der Frage, ob sich die Trauerfeier ausgiebig gelohnt habe.
„Untertänigsten Dank! Ausgiebig ist ein dehnbarer Begriff! So viel ist es, daß ich, falls dazu die Lust kommt, eigenen Kohl bauen und mir den Luxus einer Liebesheirat leisten kann!“
„Ah, was Sie sagen?! Also mächtig viel Moneten! Gratuliere heftig! Wissen Sie denn was anfangen mit dem vielen Zeug?“
„Einstweilen alles in sicheren Papierchen in einer soliden Bank deponiert!“
„Alles?“
„Wieviel wünschen Durchlaucht momentan?“
„Hm! Momentan genügt ein brauner Lappen! Wenn Sie so lieb, verbunden mit Diskretion, sein wollen!“
„Aus meiner Reisekasse kann ich momentan leider nicht mehr als hundert Kronen entbehren!“
„Her damit! Ist zwar verflucht wenig, aber in der Not frißt der arme Teufel auch Fliegen! Aber, bitte, absolute Diskretion!“
„Selbstverständlich!“
Emil dankte und schob die Scheine in die Westentasche.
„Wann soll ich den Dienst antreten?“
„Gar nicht! Hier wenigstens nicht! Es wäre denn, daß Sie mir helfen wollen, die Zeit totzuschlagen! Verdammt langweiliges Nest hier!“
„Aber, Durchlaucht haben doch prachtvolle Reviere...!“
„Die Jagd interessiert mich nicht!“
„Hm! Demnach bin ich eigentlich überflüssig geworden! Ich werde also demissionieren, mir ein Gut kaufen! Dürfte ich vielleicht vorher in Ihren Revieren jagen?“
„Soviel Sie wollen! Wenden Sie sich nur an den Oberförster Hartlieb, den ich verständigen werde! Und nun nochmals Dank! Auf Wiedersehen!“
Die Herren trennten sich. Wolffsegg fuhr nach Hall, Emil aber stapfte in das weitgedehnte Stift und suchte den Pater Wilfrid. Aber der Gastmeister des Klosters und Pfarrer von Hall war nicht anwesend. Wie es hieß, dienstlich unterwegs. Drei Tage hindurch pendelte Emil zwischen Hall und Admont hin und her, immer vergeblich; es glückte nicht, den auswärts im Pfarrdienst vielbeschäftigten Priester zu treffen. Bis zu später Abendstunde konnte der Prinz nicht warten, zum Diner mußte er im Jagdschlößl sein.
Warum er so erpicht war, sich eine größere Summe zu beschaffen, wußte Emil sich selbst nicht zu sagen. Unabhängig für einige Zeit durch Geldbesitz wollte er sein. Geld aber nur vom Hofpfarrer entlehnen, weil der Mann schweigen kann.
Wegen der Jagdwünsche Wolffseggs hatte Emil mit Hartlieb gesprochen. Etliche Tage später hörte er gelegentlich einer Begegnung vom Oberförster, daß der Baron von der Jagderlaubnis keinen Gebrauch gemacht habe und plötzlich abgereist sei.
Darob erstaunt, fragte Emil die Mama nach der Veranlassung des Verschwindens Wolffseggs. Die Verstimmung der Fürstin bemerkend, bereute Emil sogleich, die Mama mit einer ihr unangenehmen Frage belästigt zu haben.
Die Antwort enthielt zunächst die Klage, daß alles zusammenkäme, um der Gebieterin Verdruß zu bereiten. Nicht zum wenigsten der Sohn, der sich im Faulenzen übe...
Emil schluckte diese Rüge wortlos hinunter.
Sodann erzählte die Fürstin bitteren Tones von dem Riesenverdruß, den Fräulein von Gussitsch heraufbeschworen hatte, indem Martina sich rundweg weigerte, von einer prachtvollen Gelegenheit zur Rangierung Gebrauch zu machen.
Verblüfft fragte Emil: „Rangierung! Wieso denn?“
„Wolffsegg hatte geradezu edel gehandelt, der Gussitsch jenen anscheinend unglücklich konzipierten Brief völlig verziehen! Mich fragte er, ob ich zustimmen würde, wenn er um Martina werbe, wozu er durch die Erbschaft jetzt in der Lage sei! Im Interesse der Gussitsch habe ich natürlich zugestimmt! Martina aber hat den Heiratsantrag rundweg abgelehnt! Unbegreiflich! Und albern!“
„Geschmacksache, liebe Mama! Viel Sommersprossen, eine Glatze hat er auch! Und er ist so etwas wie ein Geldprotz, dem der Mammon in den Kopf gestiegen ist! Er trägt jetzt die Nase ziemlich hoch!“
„Ach was! Ein Mädel wie Martina, nach allem, was vorgefallen ist, soll froh sein, in eine glänzende Ehe kommen zu können!“
„Vielleicht war sie sich darüber klar, daß sie volles Eheglück an Wolffseggs Seite nicht finden werde! Wenn ich ein Mädel wär, ich würde eher ein Mondkalb heiraten, als den Wolffsegg!“
„Gott, diese Ausdrücke! Und dabei redest du wie ein Kind!“
„Verzeihung! Ich versteh es halt nicht besser! Reine Gefühlssache! Was geschieht denn nun mit der Gussitsch?“
„Ich weiß noch nicht! Ihre Anwesenheit ist lästig, aber es geht nicht an, das arme Mädel in die Welt hinauszustoßen! Es wäre dies grausam und unchristlich! Also soll sie in Gottes Namen bis auf weiteres blei[S. 223]ben! Ich werde mich schriftlich bemühen, für Martina einen anderen annehmbaren Posten als Hofdame zu beschaffen! Genug davon! – Was aber dich betrifft, wünsche ich, daß du dich endlich beschäftigst, um die Oberleitung kümmerst, Ordnung schaffst!“
„Hab ich ja bereits getan, wenigstens das Nötigste! Viel war ja nicht zu tun, da doch meine liebe, umsichtige Mama seither dirigierte und für Ordnung sorgte! Zur Zeit möchte ich ausschnaufen und ein bissel bummeln! Es ist ja so schön in Admont! Und sehr gerne besuche ich die Benediktiner, die doch gewiß ein guter Umgang für mich sind! Gentlemen, nobel und gastfreundlich!“
Daß der Schalk ulkte und stichelte, merkte die Mama nicht; sie hörte mit Freude, daß sich der Sohn die Admonter Stiftsherren zum Verkehr erwählt habe. Und so gab sie gerne die Zustimmung zu weiteren Besuchen im Stifte. Nur den erbetenen Hunderter gab sie nicht und motivierte die Ablehnung durch Wiederholung der Worte Emils, wonach die Admonter Benediktiner Gentlemen nobel und gastfreundlich sind, der Sohn also kein Geld für Speise und Trank benötige.
„Aber, Mama! Manica, bonamano, zu deutsch: Trinkgeld muß man den servierenden Dienern doch geben! Ein Prinz mindestens zehnmal mehr als ein bürgerlicher Gast des Stiftes! Und so die Paters rauchen, darf ich mich durch Zigarrenspenden doch auch nicht lumpen lassen!“
„Ja doch! Es ist schrecklich, was junge Männer Geld verpulvern!“ Seufzend gab die Fürstin etliche Scheine aus ihrer Schatulle.
„Untertänigsten Dank, liebe Mama!“ rief Emil freudestrahlend und ließ die Scheine in der Westentasche verschwinden. Und dann hatte er es eilig, ins Freie zu kommen und sich satt zu lachen...
Im Frohlocken über die genehmigte Gehaltsaufbesserung, die eine wertvolle Waffe sein sollte, hatte sich Forstwart Gnugesser die Bekämpfung der Revolution im Haushalte als kinderleicht vorgestellt, indem der kleine herzensgute Mann erwartete, daß nach Verkündigung der Freudenbotschaft seine Amanda ihm jauchzend um den Hals fallen und die ihr zustehenden zehn Prozent, in Summe hundertachtzig Kronen, mit Dank einsacken und auf jede weitere Agitation bereitwillig verzichten werde. Um so größer war die Verblüffung Benis, als nach Verkündigung der Freudenbotschaft Frau Amanda kühl blieb, verächtlich und geringschätzig den Mund verzog und in wegwerfendem Tone erklärte, daß die genannte Summe ein Bettel sei, den sie nicht annehmen werde.
„Wird nicht sein, liebes Weiberl! Hundertachtzig Kroneln jährlich sind doch kein Bettel! Schön, wunderschön und nobel ist’s von der Herrschaft, daß sie uns wirklich im Gehalt aufgebessert hat! Insofern hat die Agitation der Revoluzzerinnen von Hall gute Früchte getragen! Jetzt aber muß Ruhe werden, die Hetzerei ein Ende haben, ansonsten wird der junge Herr rabiat! Am nächsten Monatsersten bekommen wir das Geld, ich werde dann dir die hundertachtzig Kroneln gewissenhaft einhändigen!“
„Ist nicht nötig! Die Annahme des Pfifferlings wird verweigert! Ich bestehe auf Auszahlung des Drittels vom Gehalt und selbstverständlich auch von der Aufbesserung!“ erwiderte spitz Frau Amanda und fuchtelte mit einer langen Kleiderschere kampflustig in der Luft.
Auf Benis bartumwucherten Lippen erstarb das gutmütige Lächeln, die Miene wurde sehr ernst, da der kleine Bäuchlemann sich breit vor die am Fenster sitzende Gattin stellte und energischen Tones sprach: „Genug jetzt mit den Faxen! An der Agitation wird die Forstwartsfrau sich von dieser Stunde an nicht mehr beteiligen, verstanden! Als Haushaltsvorstand befehle ich das!“
Ein spöttischer Blick züngelte am Männle empor. Und jäh lachte Amanda. Der Kontrast zwischen der kleinen Gestalt des Vorstandes und der Befehlhabersmiene wirkte auf die Gattin komisch. Beleidigend klang dieses Lachen der Geringschätzung.
Beni richtete sich auf, hob den Kopf, teilte den Patriarchenbart in zwei Hälften, stampfte mit dem Fuße, um seinen Worten dröhnende Resonanz zu geben: „Ich befehle es!“
Nun schrie Amanda vor Lachen, warf die Schere weg und trommelte mit den geballten Händen auf ihre Knie.
Nie im Leben hatte Beni je die Hand gegen ein Weib erhoben, jetzt fühlte er sich stark versucht, die Beleidigung mit einem Fausthieb zu vergelten. Er hob wohl die Hand, aber er bezwang sich und ließ sie wieder sinken. In seinen Augen flammte Energie, etwas Stahlhartes, eine Unbeugsamkeit, die Amanda zwar nicht einschüchterte, aber doch veranlaßte, das beleidigende Gelächter zu unterdrücken.
„Der von der Herrschaft erlassene Befehl lautet dahin, daß jede Agitation im Haushalte der verheirateten Beamten und Diener eingestellt werden müsse! Weigern sich die Ehefrauen, beteiligen sie sich noch weiter an der Hetze, so werden die betreffenden Männer aus dem Dienste entlassen! Ich hoffe, daß meine Gattin soviel Vernunft besitzt, um den Ernst der Situation zu erfassen!“
Wieder verzog Amanda den Mund, und sie höhnte: „Lächerlich! Derlei Eingriffe in das Familienleben müssen mit aller Energie zurückgewiesen werden! Der junge Hansdampf soll es nur versuchen, ich werde ihm das Nötige schon sagen! Das Prinzerl soll erst etwas lernen und sich selbst bei der Nase nehmen! Nicht aber die Nase in Dinge stecken, von denen er nichts versteht! Wenn der Forstwart nicht den Mut hat, das dem Mutterbubi zu sagen, so besorg ich das!“
„Genug nun, Amanda! Die Situation ist durchaus nicht spaßhaft! Ich habe nicht Lust, mir Stellung und Existenz zu verscherzen oder durch meine Frau gefährden zu lassen! Ein für allemal laß es dir gesagt sein und zur Warnung dienen: ich respektiere den Befehl, ich verbiete dir jedwede Beteiligung an der Agitation! Fügst du dich meiner Anordnung nicht, so wirst du die Folgen zu fühlen bekommen!“
Amanda stand auf und fragte ironisch: „Darf ich wissen, welcherart die Folgen sein werden?“
„Die Trennung!“ erwiderte Beni kurz, sehr ernst und inhaltsschwer. Und nun schickte er sich an, die Wohnstube zu verlassen.
Die Drohung verfehlte eine gewisse Wirkung nicht, nur wollte Amanda das letzte Wort haben. Deshalb rupfte sie dem Gatten vor, daß es nicht eben schön sei,[S. 227] wenn ein Ehemann die Stellung höher bewerte als das angetraute Eheweib. Das Anklammern an die Berufsstellung im Dienst sei geradezu lächerlich, ein tüchtiger Forstwart werde überall leicht ein gleiches, wenn nicht besseres Unterkommen finden.
Beni blieb an der Türe stehen und sprach in seiner alten Herzensgüte: „Möglich schon, aber nicht leicht, weil es zuviel Bewerber gibt! Du vergissest aber eins: das Halltal ist meine Heimat! Mit jeder Faser des Herzens hängt der Steierer an seiner engeren Heimat, in ihr zu dienen und zu wirken ist höchste Seligkeit auf Erden! Ich liebe meine Heimat über alles! Die Heimatsliebe läßt manches weniger Erfreuliche hinnehmen und ertragen! Verstehst du das, Amanda?“
„Ja, Beni! Aber ich kann mich nicht dreinfinden, daß sich die Herrschaft in Familienangelegenheiten mischen darf!“
„Mit gutem Willen geht es schon! Darfst dir nur vor Augen halten, daß die Absicht eine gute ist! Die Herrschaft will Ruhe und Frieden haben, sie hat kein anderes Mittel, um Frieden zu stiften in den Familien ihrer verheirateten Beamten und Diener. Sei gescheit, Amanda! Ich glaube ja auch nicht, daß man zum Äußersten greifen, mich entlassen würde; aber als vernünftiger Mensch will ich es nicht zum Äußersten kommen lassen, nicht unsere Existenz gefährden, weil ich ja doch verheiratet bin und für mein Weib zu sorgen habe! Ich füge mich aus Liebe zu dir und zur Heimat! Also finde auch du dich drein!“
„Na ja, meinetwegen!“
„Brav gesprochen, Weiberl! Und anjetzo gelobe ich, daß ich die bewußte Summe freiwillig aufrunden werde! Damit ist das Ziel deiner Bestrebungen erreicht, die[S. 228] Bezahlung der Hausfrauenarbeit! Und noch etwas, wonach auch du dich zu richten hast: die Herrschaft befiehlt, daß bei weiterer Verhetzung seitens der Krämerin von Hall ihr Geschäft boykottiert werden muß!“
„Wieso?“
„Wenn die Krämerin nicht Ruhe gibt und die Agitation einstellt, wird die Herrschaft von ihr nichts mehr beziehen! Und die Beamten und Diener dürfen bei der Krämerin nicht mehr einkaufen!“
„Eine noblichte Herrschaft, die einem Landkrämer das bisserl Existenz ruiniert!“
„Gutgemeinte Drohung, die hoffentlich wirken wird! Sei gescheit, Weiberl!“
„Nein, diesem Zwang füge ich mich nicht! Wir wohnen so entlegen, daß ich nicht jeden Tag zum Einkaufen nach Admont laufen kann; ist Hall schon weit genug entfernt!“
„Wart es ab, Weiberl! Merkt die Krämerin, daß ihr geschäftlicher Schaden droht, wird sie schleunigst umsatteln, es auf den Boykott gar nicht ankommen lassen! Sie wird sich fügen!“
Interessiert fragte Amanda, wer denn der Krämerin die Drohung zu übermitteln habe.
„Leider bin ich damit beauftragt! Ich hab aber noch keine Zeit gehabt, zur Krämerin zu gehen!“
„Weißt was, Beni, diese Mission übernehme ich! Es interessiert mich zu beobachten, was für ein Gesicht die Krämerin bei der Boykottankündigung macht!“
„Merkwürdig! Erst bist du hantig und oppositionslustig, und jetzt willst du sozusagen im Auftrag der Herrschaft handeln und gegen die Krämerin, deine intimste Freundin, vorgehen! Das begreif ich nicht recht!“
„Die Mannerleut verstehen gar oft nichts von der weiblichen Psyche! Mein Gedankengang ist doch leicht zu begreifen: Weil ich zum Nachgeben genötigt bin, macht es mir ein besonderes Vergnügen, gewährt es einen aparten Nervenreiz, zu sehen, wie die Drohung und der Zwang auf die Freundin wirkt, wie sich die Krämerin winden und krümmen, seelisch leiden wird! Der Kampf der Stolzen gegen den Geschäftssinn und die Profitgier wird sehr interessant sein! Und wo was Nervenspannendes los ist, da bin ich für mein Leben gern dabei! Aus diesen Gründen übernehme ich die Mission! Und der Krämerin werd ich zusetzen, daß ihr die Augen tropfen!“
„Ja ja, die Weiber! Na, die Hauptsach ist, daß wir zwei einig sind, und daß du dich nun den Anordnungen fügst! Das freut mich!“
„Abgemacht! Und jetzt geh ich nach Hall zur Krämerin!“
Eine Stunde später spielte Amanda Gnugesser mit der sehr zungengewandten Krämerin wie die Katze mit der Maus. Zunächst spannte Amanda die Freundin auf die Folter durch die tropfenweise Mitteilung der von der Herrschaft erlassenen Drohung hinsichtlich der Entlassung der verheirateten Beamten und Diener für den Fall, daß ihre Ehefrauen weiteragitieren.
Die Krämerin schrie vor Überraschung und Entrüstung. Und sogleich wollte sie wissen, welche Stellung Amanda dieser Vergewaltigung gegenüber einnehme.
Amanda wich aus mit dem Hinweise auf das Diktum: Gewalt geht vor Recht.
„Himmelschreiend und empörend ist diese Vergewaltigung! Gefährdung, ja Raub der persönlichen Freiheit! Unerhörter Eingriff in das Familienleben!“ Dann zeterte[S. 230] die rabiate Krämerin davon, daß der Frauenbund den Kampf gegen die Herrschaft mit aller Energie, mit Rücksichtslosigkeit aufnehmen und durchführen müsse. Mit Anzeigen bei der Staatsanwaltschaft, mit Denunziationen bei Gericht und bei der Gendarmerie, mit Protestnoten an die Fürstin, der man das Leben sauer machen müsse. „Überhaupt die Fürstin! So ein wankelmütiges Weib, wetterwendisch wie ein Kirchenhahn! Erst nennt sie unsere Bestrebungen gut, sichert Unterstützung zu; dann krebst sie, weil der Pfarrer gegen uns gepredigt hat!“
Um die Freundin noch mehr in die Hitze zu bringen, lobte Amanda die Herrschaft wegen der bewilligten Gehalts- und Lohnaufbesserung.
„Wird nicht von Bedeutung sein! Wo es zahlen heißt, sind die hohen Herrschaften immer taub, sie drücken sich nach Möglichkeit! Pfennigfuchser, Skontoschinder sind sie alle, ohne Ausnahme! Jeder Geschäftsmann hustet auf solche Leut! Man profitiert eh schier nichts!“
„Also liegt Ihnen nichts an der geschäftlichen Verbindung mit der Fürstin?“
„Nicht soviel als ich Schwarz unterm Nagel hab!“ rief prahlerisch die Krämerin und schnipste mit den Fingern.
„Na, dann ist der Verlust nicht von Bedeutung und für Sie nicht schmerzhaft!“ meinte Amanda gedehnten und lauernden Tones.
„Wieso? Was für ein Verlust soll mir da bevorstehen?“
„Ihr Geschäft soll boykottiert werden, falls Sie sich weiter an der Agitation beteiligen! Die Herrschaft wird nichts mehr von Ihnen beziehen! Und sämtlichen Beam[S. 231]ten, Dienern und Arbeitern im fürstlichen Dienst wird verboten, bei Ihnen einzukaufen – – –!“
„Allmächtiger Gott! Das tät ja mein Ruin sein! Völliger Krach! Zusperren kann ich das Gewölb in der Stund, wo das wahr werden tät! Sie machen wohl Spaßetteln, liebe Frau Forstwart! Jessas – Mariand – Josef! Da tät ja alles verloren sein! Sagen S’ um Himmels willen, ist der Befehl schon erteilt worden wegen der Boykottierung?“
„Soviel ich weiß, erwartet die Herrschaft eine bindende Erklärung Ihrerseits! Da Sie sagten, daß der Frauenbund den Kampf gegen die ‚unmoralische‘ Herrschaft mit aller Energie und Rücksichtslosigkeit aufnehmen und durchführen werde, ist doch wohl anzunehmen, daß die Herrschaft Ihre Antwort als Kriegserklärung betrachtet und den Boykott über Ihr Geschäft verhängt! Das dürfte morgen geschehen!“
„Jess – Maria! Fallt mir ja gar nicht ein, den Krieg zu erklären! Wo die Fürstin eine so gute fromme Frau ist! Eine Wohltäterin ohnegleichen! Und wo mich die Frauen eigentlich gar nichts angehen, von denen ich nie profitieren kann, weil ja ich das Geschäft führ und den Simandl von einem Mann ernähren muß! Für mich kann es ja gar kein Drittel aus Gehalt oder Verdienst der Männer geben; ich bin ja als Geschäftsfrau die Erwerberin und Brotverdienerin! Auf den Frauenbund hust ich, der wo mich in solche Schlamassel bringt und zum Geschäftsruin!“
„Ihre Ausführungen wirken überraschend! Sie sind inkonsequent! Die Fürstin nennen Sie wetterwendisch, dabei satteln Sie aber selbst um – –!“
„Aber natürlich! Wo es sich um Geschäft, Existenz und Profit handelt! So dumm bin ich nicht, daß ich[S. 232] mich für andere Leute opfere, gegen den Strom schwimm, wo ich gar nicht schwimmen kann! Nein, so dumm bin ich wirklich nicht! Ich glaub auch nicht, daß Sie so dumm sein werden! Aber wissen möcht ich, warum die Herrschaft grad und justament die Forstwartsfrau ausgesucht hat, mir die Schreckensnachricht zu überbringen! Sie sind doch meine Freundin, zugleich die ärgste Hetzerin von wegen der Entlohnung der Frauenarbeit im Hausstand!“
„Vielleicht eine Ironie des Schicksals!“
„Teuflische Bosheit! Ist aber jetzt alles egal! Ich tue nimmer mit! Sagen Sie das der Herrschaft und daß ich aus dem Frauenbund austrete! Ist mir schon z’ dumm der Boykott!“
„Soll ich auch sagen, daß Sie die Fürstin eine charakterlose Frau genannt haben?“ fragte maliziös Amanda, die sich gottvoll amüsierte.
„Ich weiß von gar nichts! Nicht ein Wörtel hab ich gesagt!“
„Also werd ich melden, daß die Krämerin von Hall sich allen Anordnungen der Herrschaft fügt, aus dem Frauenbund austritt und jede Agitation nunmehr meidet!“
„Äa! Sein Sie so gut und melden Sie das der Fürstin. Mit g’horsamsten Respekt und Handkuß! Ich laß mich empfehlen und um Aufträge bitten!“ Nun wollte die aus dem seelischen Gleichgewicht geworfene, schwer erregte Krämerin die Freundin mit Rosogliolikör bewirten, doch Amanda lehnte dankend ab. Befürchtete doch Frau Gnugesser, daß sie bei längerem Aufenthalt das Lachen nicht würde verbeißen können.
Hochbefriedigt und belustigt ging Amanda heim. Und[S. 233] im Bergwalde lachte sie sich satt und sang vergnügt ein Duliäh nach dem andern. Der Spaß mit der Krämerin war erquickend gewesen...
*
Für den Novizen Nonnosus war der schönste, aber auch schwerste Tag der feierliche Profeß, der Gelübdeablegung, des endgültigen Abschiedes vom Weltleben, des Verzichtes für immer, gekommen. Ein strahlender Spätherbsttag mit lachendem Sonnenglanze im schönen Admonter Becken des Ennstales. Der frühe Morgen war freilich frostig, herb und neblig; aber die Sonne siegte alsbald und vergoldete die wuchtigen Felskolosse, küßte die Zinnen und Zacken, die hehr und ernst in den lichtblauen Äther ragten. Feierliches Glockengeläute vom Blasiusmünster kündete den Beginn dieses bedeutungsvollen Tages für den jungen Mönch, der in seiner Zelle kniend betete um die Kraft zum Verzicht auf das Weltleben. Den besten und ehrlichsten Willen besaß der Kleriker, um nach der heute erfolgenden Aufnahme in das Kapitel dem Stifte Ehre zu machen durch treueste Pflichterfüllung, die oberste Tugend der Dankbarkeit zu üben immerdar bis zum letzten Atemzuge. Rein und abgeklärt war die Seele, wunschlos des irdischen Lebens, erfüllt von Begeisterung für den Beruf. Von der kleinen Verwandtschaft war Abschied genommen worden, tapfer und mutig der Trennungsschmerz überwunden. Rein und frei fühlte sich Nonnosus; ein ehrlicher Diener des Herrn wird heute die Vota solemnia ablegen... Ohne Mißton in der Seele!
Entscheidend wird die nächste Stunde für das ganze Leben sein, und darum ist sie die schwerste des Lebens.[S. 234] Mit der Welt hatte Nonnosus abgerechnet, er fühlte nichts mehr, was ihn zurückhalten könnte; dennoch befand er sich in einer starken seelischen Erregung, verbunden mit Angst und Beklemmung, über deren Grund und Inhalt er sich keine Rechenschaft geben konnte. Ihm war zumute, als stände er vor einem großen Unglücke, dem er rasch ausweichen soll... Eine tiefe Traurigkeit kam über ihn, für die er keinen Anlaß fand. Und er erinnerte sich der Warnung des Spirituals vor einem Rücktritt ohne bestimmte, klar erkannte Gründe; Nonnosus klangen die Worte des Spirituals im Ohre: „Jeder Theologe wird in letzter Stunde von einer tiefen Traurigkeit befallen, die überwunden werden muß! Der gewissenhafte Theologe soll zum Altare gehen wie in ein brennendes Haus, entschlossen, mutig! Dieser Mut bringt dann tiefe Freude, selige Ruhe, im Berufe die Festigkeit! Theologen, die schwer überwinden, stehen später in ihrem Seelsorgeramte viel fester als jene, die mit verklärtem Gesichte und in Sehnsucht zum Altare treten...!“
Die Erinnerung an diese goldenen Worte des alten erfahrenen Spirituals gab Kraft und Mut.
Wie die Glocken zum zweitenmal ertönten, erhob sich Nonnosus vom Betstuhl. Ein letzter Blick auf das Kruzifix an der weißgetünchten Wand... Nonnosus hatte Angst und Zweifel überwunden. Fest wie Granit ist der Entschluß zur Pflichterfüllung!
Gefaßt griff der Profitent Nonnosus nach dem Pergamentblatte, das die von ihm geschriebene Profeßformel enthielt. Bleich waren die Wangen, die Zähne aufeinandergepreßt; doch ruhig die Seele, der Kampf beendet. Ein Sonnenstrahl huschte in die kahle Zelle.
Der Spiritualdirektor Pater Lullus erschien in der[S. 235] Zelle, um den Profitenten Nonnosus abzuholen. Ein schmächtiges altes Männlein mit viel Runzeln im Gesicht, unansehnlich, aber mit geistkündenden blitzenden Augen; ein Gelehrter im Benediktinerhabit, der Spiritual der Kleriker und zugleich ihr Freund, Führer und Berater. In lateinischer Sprache fragte Pater Lullus, ob der Profitent zum Gange in die Kirche, zur Ablegung der Vota solemnia bereit sei. Ein forschender Blick auf den Novizen, dann nickte Lullus befriedigt; er hatte in den Augen des Profitenten den festen Entschluß, Verzicht und Überwindung gelesen.
Beide Mönche verließen die Klausur, schritten durch den langen Korridor gen Norden, dessen Fenster eine wundervolle Aussicht auf die Bergkolosse der „Haller Mauern“ boten.
Ein letzter Blick des Novizen flog zum Großen Pyrgas, hinauf ins Gamsrevier... Nonnosus zuckte für einen Moment zusammen, der glühende Kopf neigte vornüber. Heftig pochte das Blut in Herz und Schläfen.
„Mut!“ flüsterte der alte Spiritual, „Mut und Gottvertrauen!“
Nonnosus nickte zum Dank und senkte die Lider. Nicht einen einzigen Blick warf er mehr durch die vielen Fenster des Flankenkorridors. Sein Schritt verlangsamte sich, als die Mönche die breiten Steintreppen hinabstiegen, um die Sakristei des großen Domes zu erreichen.
Wieder mahnte der Spiritual: „Mut und Gottvertrauen!“
Noch ein Schritt über die Schwelle der Sakristei... Ein ehrerbietiger stummer Gruß für den Pater Prior, der bereits den Ornat zur Zelebrierung des Hochamtes[S. 236] angelegt hatte. Ein mittelgroßer, von der Last der sechsundsiebzig Jahre gebeugter Mönch im Silberhaar, der den Gruß mit aufmunternd wohlwollendem Blick erwiderte. Die Diakone als Assistenten des Priors nickten freundlich. Vom Spiritual geleitet, begab sich Nonnosus zu seinem Platze im Chorstuhl des Presbyteriums, wo der Profitent niederkniete. Pater Lullus blieb in seiner Nähe, gleichsam zum Schutz.
Feierliche Orgelklänge empfingen den von den Diakonen begleiteten Prior auf dem Gange zum prächtig geschmückten, von einer überlebensgroßen Statue des St. Blasius aus weißem Marmor überragten Hochaltar.
Das Hochamt begann und wurde wie an Sonntagen zelebriert bis zum Evangelium. Wie dieses aber gesungen wurde, ertönte die schrille, im ganzen Kloster vernehmbare Konventglocke, die alle Patres des Stiftes zusammenrief.
Wohl fünf Minuten gellte diese Glocke, dann verstummte sie.
Der Prior am Hochaltare stimmte das „Kredo“ an, das dann der Musikchor zu Ende sang.
Nun trat Schweigen im Dome ein. Tiefes, feierliches Schweigen.
Aus der Sakristei kam der Zug der Stiftsherren, paarweise, voran die jüngsten Patres, dann die älteren, die alten mit dem Schnee auf dem Haupte oder kahlköpfig; alle bekleidet mit dem weiten, faltigen, schwarzen Ordenskleide mit Kapuze, zuletzt schritt der Abt mit goldenem Brustkreuz an schwerer Kette, auf dem Haupte die Mitra, in der Hand den silbernen Stab.
Im Presbyterium bildeten die Patres Spalier, durch das der Abt mit seinem Zeremoniar schritt. Dann betrat[S. 237] der Abt die Stufen des Hochaltars und nahm Platz auf dem für ihn bereitgestellten Stuhle.
Der Prior mit seiner Assistenz stand auf der Epistelseite vor den Sitzen.
Nun waltete der Spiritual seines Amtes, indem er Nonnosus, der die Pergamentrolle in der zitternden Rechten trug, zum Abte geleitete. Hier kniete Nonnosus nieder und reichte die Urkunde entfaltet dem Abte, der sie entgegennahm und dem Profitenten zum Ablesen vorhielt.
Nonnosus bekreuzte sich und las den lateinischen Text der Profeßformel mit dem Schlusse: „In huius rei testimonium praesentem schedulam manu propria scripsi.“ (Zum Zeugnis dessen hab ich gegenwärtige Urkunde mit eigener Hand geschrieben.)
Langsam und würdevoll sprach der Abt: „Haec tibi servanti vitam aeternam promitto!“ (Wenn du dies beobachtest, verspreche ich dir das ewige Leben.)
Nonnosus stand auf, trug die Urkunde zur Epistelseite des Hochaltars. Dann kehrte er zum Stuhle des Abtes zurück und kniete wieder nieder.
Abt Beda sprach ein Gebet über den Profitenten, erhob sich von seinem Sitze und blieb stehen, bis der vom Spiritual geleitete Nonnosus das Ende des Presbyteriums erreichte. Hier knieten beide nieder und sangen den Psalmvers: „Suscipe me, Domine, secundum eloquium tuum et vivam, et non confundas me ab expectatione mea.“
Der ganze Konvent, alle Patres sangen diesen Vers im gleichen Tone nach.
Nun standen Nonnosus und der Spiritual auf, gingen bis in die Mitte des Presbyteriums, knieten hier nieder und sangen den Vers um einen Ton höher.
Der Konvent wiederholte den Vers gleichfalls in erhöhtem Tone. Der Spiritual führte den Profitenten nun bis zur untersten Stufe des Hochaltars, wo zum drittenmal und wieder um einen Ton höher der Vers gesungen, vom Konvent dann wiederholt wurde. Und ergreifend klang der vom ganzen Kapitel gesungene Schluß: „Gloria Patri et Filio et Spiritui sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.“
Nochmal segnete der Abt den vor dem Hochaltare knienden Profitenten und sprach über ihn Gebete. Dann schritt Abt Beda zur Epistelseite und weihte die dort niedergelegten neuen Ordenskleider für den Profitenten. Hierauf kniete der Abt auf der obersten Stufe des Altares nieder und stimmte den Hymnus an: „Veni creator spiritus“. Der Musikchor sang den Hymnus weiter.
Feierlich gestaltete sich die Abnahme des bisherigen Skapuliers und Bekleidung des Profitenten mit einem neuen, ad hoc geweihten Skapulier seitens des Abtes, der dann Nonnosus die Hand reichte und ihm auf beide Wangen den Bruderkuß gab. Während der Abt mit Mitra und Stab in der Mitte des Altares stehenblieb, vollzog sich die Zeremonie des Bruderkusses, indem Nonnosus mit dem Pater Prior und allen Kapitularen den Kuß tauschte.
Laienbrüder trugen ein schwarzes Bahrtuch in das Presbyterium und breiteten es in der Mitte des Presbyteriums aus, just an der Stelle, unter der sich die Totengruft des Konventes befindet. Auf das Bahrtuch gegen den Altar zu wurde ein schwarzes Kissen gelegt.
Nonnosus küßte den jüngsten Pater und schritt dann[S. 239] langsam zum Bahrtuch, zog die Kapuze über den Kopf und legte sich der Länge nach auf das schwarze Tuch, drückte das blasse Gesicht auf das Kissen und blieb regungslos liegen.
Im selben Augenblick ertönte die große Sterbeglocke dumpf in schweren Schlägen, ernst und feierlich, mahnend, daß der auf dem Bahrtuche und so nahe der Totengruft liegende Profitent nun der Welt abgestorben sein soll und muß...
Ein schwaches Zucken lief durch den Körper des Pater Nonnosus, der die zum Gebet gefalteten Hände fester aneinanderpreßte. Kam ihm doch in diesem erschütternden Moment so recht zum Bewußtsein, daß jetzt der Abschied von der Welt sich für immer vollzogen hat...
Helle Klingeltöne verkündeten das Sanktus. Der eine Diakon verließ den Hochaltar und schritt zum Bahrtuche. Und er berührte mit dem Fuße leicht den Profitenten und sprach: „Surge qui dormis et exurge a mortuis, et illuminabit te Christus!“ (Erhebe dich, der du ruhest, und steh auf von den Toten, erleuchten wird dich Christus.)
Nonnosus erhob sich langsam und zog die Kapuze vom Haupte. Kalkig waren seine Wangen. In den Augen glühte das Feuer der Begeisterung für den Beruf.
Nonnosus begab sich in den Chorstuhl, wo er niederkniete. Der Diakon kehrte an den Altar zurück.
Nach der Kommunion des zelebrierenden Priors schritt Nonnosus zum Altar, aus der Hand des Priors empfing er das hl. Abendmahl, worauf er zu seinem Stuhle zurückkehrte.
Zum Schlusse des Hochamtes ging Nonnosus zum[S. 240] letztenmal an den Altar, auf der untersten Stufe kniend empfing er den besonderen Segen des Priors. Und hier blieb er dann allein, versunken in Gebete, nachdem der Prior samt Assistenz die Kirche verlassen hatte.
Aufgenommen als gleichberechtigter Konventual, aber allein, um Gelegenheit zu haben, Gott zu danken...
Einer Herzensregung folgend, besuchte die Fürstin das vom Tisch verbannte Fräulein von Gussitsch. Wider Absicht und Willen klagte die Fürstin leisen Tones darüber, daß der Sohn so gar kein Faserchen Mut besitze, wohl auch nie lernen werde, sich selbst zu überwinden. Ob Emil je die Mannesfestigkeit erringen werde? Jenen stahlharten Willen, der allein es ermöglicht, aufrecht durch das Erdenleben zu gehen?
Die Fürstin hielt im Sprechen inne, erwartete von Martina Antwort, vielleicht auch ein Trosteswort. Das arme Hoffräulein rang nach Worten und fand keines.
„Irre werde ich an meinem Sohne! Lange Jahre ein träumerisches Wesen, Apathie, Schläfrigkeit, Stumpfsinn! Dann das Aufwachen mit nichts weniger denn erfreulichen Folgen! Unausgeglichenheit, ein Schwanken wie das Rohr im Winde! Ich fürchte, es fehlt am Charakter!“
Leise und schüchtern erwiderte Martina: „Verzeihung, Durchlaucht! Prinz Emil ist ja noch jung! Der beste Most braucht Zeit zur Klärung, dann wird guter Wein daraus!“
„Wenn Sie recht hätten, Martina, wie glücklich würde die Mutter sein! Es ist ja richtig, mit vierundzwanzig Jahren ist Emil noch sehr jung! In hohem Range kommt es fast nie vor, daß ein junger Mann mit[S. 242] diesen Jahren schon abgeklärt und willensstark, ernst und gefestet ist! Wenn er nur arbeiten, sich ernsthaft beschäftigen würde! Immer nur ein Anlauf, ein Stehenbleiben auf halbem Wege! – Doch nun wollen wir von Ihnen sprechen, liebe Martina! Sie bleiben bei mir, ja –? Und es bleibt, wie es war! Die dumme Geschichte mit Emil ist vorüber und soll begraben sein! Wenn sich aber noch einmal Gelegenheit bietet, soll Fräulein von Gussitsch aber doch...! Nein, davon wollen wir heute nicht sprechen!“
Hildegard meldete, daß Graf Thurn um Audienz bitte, und verschwand.
Die Fürstin verabschiedete sich von Martina und empfing im Salon den Hausmarschall, der um Gewährung eines zweitägigen Urlaubes zum Besuche des Prinzen Coburg in Schladming bat.
„Selbstverständlich genehmigt! Vermutlich eine Jagdeinladung?“
„Zu dienen!“
„Eben fällt mir ein, daß unserseits völlig vergessen wurde, Ihnen Abschußerlaubnis zu erteilen! Ich bitte, diese Vergeßlichkeit zu entschuldigen! Da mein Sohn soviel wie gar kein Jagdinteresse hegt, ist das Haller Jagdgut eigentlich zwecklos erworben worden! Ihnen, lieber Graf, stehen alle Reviere frei! Und wegen der Bejagung wollen Sie sich nur mit dem Jagdleiter Hartlieb ins Benehmen setzen! Hartlieb kann auch nach Gutdünken abschießen! Gute Reise, lieber Graf!“
„Untertänigsten Dank für so viel Huld und Gnade!“ Sophie nickte freundlich und fragte, ob der Graf sich am Lunch beteiligen werde.
„Mit gnädigster Erlaubnis möchte ich den Mittagszug benutzen!“
„Viel Vergnügen! Und Weidmannsheil!“
Mit Handkuß verabschiedete sich der alte Hausmarschall.
Das Versehen verspätet gutgemacht zu haben, gewährte der Fürstin eine gewisse Befriedigung. Aber einen Stachel hatte sie doch in der Brust, so sie an Emil, an seine Gleichgültigkeit gegen Wild und Jagd dachte. Und sie flüsterte: „Bin aber nicht auch ich gleichgültig geworden? Ist in mir nicht auch jegliches Jagdinteresse erstorben? Eben weil Emil sich nicht dafür interessiert!“ Und Sophie wünschte sich, es möge der Sohn sich einen stahlharten Willen erwerben.
*
Einen Tag später lauerte Prinz Emil im kleinen Bahnhofe zu Admont wie die Spinne auf eine Fliege im Netz auf den Pfarrer Pater Wilfrid, der mit einem Zuge von Selztal zurückkommen sollte. So hatte der Klosterpförtner berichtet, aber nicht zu sagen gewußt, wann der Pater Gastmeister heimkommen werde.
Da nun Emil den Hofpfarrer in finanzieller Angelegenheit unter allen Umständen sprechen wollte, wartete der geldhungrige Prinz von vormittag neun Uhr ab auf jeden Zug aus der Richtung von Selztal. Die Zwischenzeit vertrieb er sich mit Bummeln, leistete sich im Stiftskeller, der für Laiengäste offenstand, auch ein Fläschchen Edelweines aus der Luttenberger Gegend; doch prompt fand Emil sich wieder im Bahnhofe ein, wenn ein Zug fällig war. Gegen Mittag kreuzten zwei Züge aus Süd und Nord in Admont. Der Erwartete kam nicht. Aber dem Zuge aus dem Süden entstieg eine junge Dame, deren wundersame Erscheinung Emil Herz[S. 244]klopfen verursachte. Tannenschlank die Gestalt, fein geschnitten das Gesicht, gebräunt die Wangen von südlicher Sonne. Dunkle, feurige und große Augen. Welscher Typus aus Norditalien wohl, gemildert etwas durch germanischen Einschlag. Elegante Toilette, sicheres Auftreten der befehlgewohnten Aristokratin, deren Stimme wie ein Silberglöckchen klang, als die junge Dame nach einem Gepäckträger rief. Und zwar vergeblich, da es in dem Miniaturbahnhofe trotz des starken Verkehrs keine Diener und Träger gab.
Das Köfferchen und die Lederhandtasche verrieten wie die Gestalt höchste Eleganz.
Betroffen stand die junge Dame am Zuge und guckte nach einem dienstbaren Geist, indes die Passagiere hastig den Zug verließen, andere Fahrgäste aber einstiegen.
Emil ging auf die Dame zu und bot seine Dienste mit ritterlicher Galanterie und mit einem Humor an, der das Fräulein lachen machte. Emil sagte nämlich: „Dem Beruf nach bin ich zwar kein Packträger, aber recht viel mehr Intelligenz besitze ich auch nicht! Schönes Fräulein, darf ich’s wagen, Ihnen meine Dienste anzutragen? Auf Trinkgeld verzichte ich!“
„Ah, Herr Faust! Con piacere, ecco!“ Ohne weiteres deutete die junge Dame auf die Gepäckstücke, und lächelnd rief sie Emil zu: „Rasch zu einem Wagen!“
Prinz Schwarzenstein mußte mitteilen, daß es keine Wagen gab im kleinen Admont und nur der Omnibus des Posthotels am Bahnhofe stehe.
Im Befehlstone, doch liebenswürdig lächelnd, sprach die junge Dame: „Dann besorgen Sie einen Wagen, aber rasch! Ich habe Eile!“
„Zu dienen! Aber Gnädigste können doch inzwischen nicht allein und schutzlos hier warten, bis ich mit dem[S. 245] requirierten Wagen komme! Gnädigste wollen mich ins Städtle begleiten!“
„Ob Herr Doktor Faust der richtige ‚Schutz‘ und Führer sein wird, steht denn doch zu bezweifeln! Besonders vertrauenerweckend sieht er nicht aus, der Herr Doktor Faust!“ Die junge Dame musterte mit drollig forschendem Blicke den Prinzen, der inzwischen das Handgepäck aufgenommen hatte.
„Oh, oh! Gnädigste können mir ruhig volles Vertrauen schenken, denn ich bin nicht Doktor Faust! Und Gnädigste sehen nicht – gretchenhaft aus, werden also auch nicht à la Gretchen einitappen!“
Das Fräulein kicherte belustigt und folgte dem seltsamen „Gepäckträger“, der nun vorschlug, den Hotelomnibus zu benutzen und im Hotel „Post“ einen Privatwagen zu mieten.
Es befremdete die junge Dame, daß Emil gleich ihr in den Hotelomnibus stieg. „Ich danke für Ihre Gefälligkeit, bedarf aber Ihrer Dienste nicht weiter!“
„Doch! Ich muß ja behilflich sein, damit Gnädigste rasch den gewünschten Wagen im Hotel bekommen! Deshalb fahre ich mit! Furierdienst ist meine Spezialität! Besserer Brettlhupfer!“
„So! Vermutlich im Dienst der Fürstin von Schwarzenstein, was?“
Für einen Moment stutzte Emil; es überraschte ihn, daß das fremde Fräulein Kenntnis von der Existenz der Schwarzensteins hatte. Die Lust an Abenteuern war aber so groß, daß er keck und verwegen log und schwindelte, frischweg behauptete, der Privatsekretär der Fürstin zu sein.
„Ah! Da sind Sie ja des Vertrauens würdig! Und falls Sie gleich mir nach Hall fahren wollen, lade ich Sie ein, mich zu begleiten!“
„Mit größtem Vergnügen! Also Gnädigste wünschen, nach Hall zu fahren! Darf ich fragen: Hall Dorf, Forsthaus oder Jagdschlößl?“
„Für einen Geheimsekretär sind Sie ein bissel – neugierig!“ stichelte das elegante und bildhübsche Fräulein.
„Stimmt! Böse Beispiele verderben gute Sitten! Man lernt das Neugierigsein von den Dienern und Vertrauenspersonen! Ich will nicht fragen, wer Gnädigste sind!“
„Sehr löblich von Ihnen! Ich will aber freiwillig den Schleier des Geheimnisses lüften: ich bin die – Schwester des Oberförsters!“
Emil machte ein wahrhaftiges Schafsgesicht. Und verblüfft stotterte er: „Nicht möglich! Hartlieb hat ja gar keine Schwester!“
Der Omnibus hielt vor dem Gasthofe „Post“. Hotelgäste vermutend stürzten der Eigentümer, der „Herr Ober“, ein Kellner und der langohrige Pikkolo dienstbereit herbei.
Prinz Schwarzenstein half der Dame aussteigen und bestellte sofort einen Wagen zur Fahrt nach Hall-Forsthaus. Dann bot er dem Fräulein ein Frühstück an, das jedoch dankend abgelehnt wurde. Ziemlich abgekühlt, überlegte Emil, ob er nicht guttun würde, sich zu drücken. Ist das verdammt hübsche Fräulein wirklich die Schwester Hartliebs, dann heißt es für den Prinzen: Hands off!
Das schelmische, spitzbübische Lachen im Auge der Dame brachte ihn auf den Gedanken, daß das Fräulein genau so wie er ulkt, daß die Dame sowenig Hartliebs Schwester ist, wie Emil der Geheimsekretär der Fürstin. Und dieser Gedanke veranlaßte ihn, den Scherz nach[S. 247] Möglichkeit bis zur Aufklärung der drolligen Situation fortzusetzen. Ulkig fragte er, ob Papa oder Mama Hartlieb welscher Abkunft gewesen sei.
„Warum denn?“
„Weil Sie unverkennbar romanisches Blut haben müssen! Halb deutsch, halb italienisch! Welsche Schönheit!“ sprach Emil in italienischem Idiom der horchenden Leute wegen.
In reinem Toskanisch scherzte die junge Dame, daß die Großmutter eine gebürtige Olona gewesen sei, verwandt mit den Familien Masnago-Laveno; daher habe der Oberförster den welschen Typ.
„Donnerwetter! Die Namen Olona, Masnago-Laveno kommen mir aber bekannt vor, sehr bekannt! Es muß die Fürstin davon gesprochen haben...!“
„Hat die Fürstin längere Zeit in Mailand verbracht?“
„Ja, vor einigen Jahren! – Aber da ist der Wagen! Darf ich bitten! Apropos: ist Herr Hartlieb von Ihrer Ankunft verständigt?“
„Nein, ich komme überraschend!“ lachte glockenhell das Fräulein.
„Stimmt! Denn ich bin sehr überrascht! Che bellezza!“
„Für einen fürstlichen Geheimsekretär sind Sie ein besonderer Frechdachs! Fast möchte ich bezweifeln, daß Sie sich in dieser Stellung befinden!“
Während der raschen Fahrt nach Hall schwätzte Emil der jungen Dame schier die zierlichen Ohren weg und guckte ihr möglichst oft und tief in die schönen Augen. Doch hielt er unwillkürlich eine gewisse Grenze ein im Empfinden, daß das Fräulein nicht die Schwester Hartliebs sei, von erheblich höherer Abkunft sein müsse. Aber[S. 248] nett und lieb, zum Anbeißen nett. Distinguiert und doch nicht prüde.
„Als Hofbeamter müssen Sie den Grafen Thurn kennen! Ist der Hausmarschall zu Hause?“
Diese Frage brachte Emil auf die richtige Spur. Frohlockend rief er: „Gnädigste haben sich jetzt verraten! Mit dem Inkognito ist es aus! Gnädigster Komtesse lege ich verehrungsvollsten Respekt zu Füßen!“
„Wie dumm von mir! Aber Sie sind auch nicht der Hofsekretär! Darauf getraue ich mir meinen Kopf zu wetten!“
„Was soll ich zum Einsatz geben? Wer soll ich denn sein?“
Komtesse Isotta Thurn wandte den hübschen Kopf zu Emil und blickte ihn voll und prüfend an. „Nach Papas Schilderungen sind Sie der Prinz Schwarzenstein! Ich bitte um Verzeihung, daß ich Durchlaucht so respektwidrig behandelt habe! Zugleich danke ich aber auch für die ritterliche und liebenswürdige Hilfeleistung!“
„Keine Ursache, Komtesse! Aber Sie irren sich in meiner Person...“
„Unmöglich! Es stimmt die Beschreibung, die mir Papa gegeben hat, als er mich das letztemal in der Pension zu Lausanne besuchte!“ Und schalkhaft lachend, fügte Isotta bei: „Es stimmt aber auch bezüglich Ihres Auftretens!“
„Wieso denn?“
„Hofsekretäre sind niemals – Frechdachse! Oh, bitte untertänigst um Verzeihung!“
„Warum soll denn ein junger Sekretär, den keine Sorgen drücken, einer bildhübschen jungen – ‚Oberförstersschwester‘ gegenüber nicht als – Frechdachs auf[S. 249]treten? Hätte ich gewußt, daß Gnädigste die Komtesse Thurn sind, würde ich allerdings bescheidener mich verhalten haben! Um Verzeihung muß also ich bitten, untertänigst und gehorsamst! Und ganz besonders herzlichst bitte ich um Diskretion! Denn wenn Graf Thurn erfährt, wie frech ich mit seiner Tochter angebandelt habe, fangt er mich füri!“
„Diskretion wird sicher gewahrt! Aber das Versteckenspielen müssen Sie nun aufgeben! Mit einem simplen Sekretär kann und darf die Komtesse Thurn sich nicht weiter beschäftigen...! Das werden Sie doch begreifen!“
„Will sich die Komtesse mit dem Prinzen Schwarzenstein ‚beschäftigen‘?“
Isotta erglühte und schwieg.
Emil ergriff ihre Hand und drückte einen Kuß darauf. Dann bat er, es wolle die Komtesse, da Papa Thurn auf zwei Tage verreist sei, Quartier im Jagdschlößl nehmen.
„Danke vielmals! Aber wo Papa wohnt, wird das Quartier auch der Tochter genügen! Und jede Belästigung der Fürstin muß vermieden werden!“
„Ach wo! Im Forsthause können Sie, Komtesse, nicht bleiben, in Abwesenheit Ihres Papas schon gar nicht; es fehlt ja auch an jeder Bedienung!“ Emil richtete sich auf, markierte Energie und sprach gebieterisch: „Ich befehle, daß Sie Quartier im Jagdschlößl nehmen!“
„Huhu! Durchlaucht befehlen!“ lachte Isotta spitzbübisch.
„Gel, das imponiert Ihnen, was?“
„Und wie? Zwingt zu ersterbender Ehrfurcht! Hihi! Regieren Durchlaucht immer so energisch und scharf?“
„Spotten Sie nur zu! Die Hauptsache ist der Gehor[S. 250]sam! Bitte, teuerste Komtesse, nehmen Sie Quartier bei uns! Es wäre nett, entzückend, himmlisch, wenn wir ein Dach über uns hätten!“
Wieder erglühte Isotta. Und sie wehrte ab: „Aber, Prinz! Was wird die Fürstin denken?“
„Mama wird sicher auch finden, daß die Komtesse Thurn ein entzückendes Frauenzimmerl ist!“
„Nun ist’s aber genug der Schmeichelei! Ein Mischmasch-Komtessel bin ich, halb deutsch, halb welsch!“
„Oh, ich bin sehr für den Mischmasch! Besonders, wenn das Mischmasch-Komtessel so himmlisch nett und lieb ist! – Holla! Dort wimmelt Mama spazoren, und zwar ausnahmsweise allein! Der Fall ist günstig! He, Kutscher, halten!“
Isotta wehrte sich vergeblich. Sie mußte raus und mit Emil der Fürstin entgegengehen, die nicht wenig staunte, den Sohn mit einer eleganten jungen Dame anmarschieren zu sehen.
Auf Distanz von zwölf Schritt rief Emil lebhaft: „Mama, Mama! Denk dir, ich habe Komtesse Thurn unterwegs aufgegabelt! Sie wollte den Papa überraschen, das ist ihr aber mißglückt, denn Graf Thurn ist abwesend!“
Durch diesen Zuruf schwand das Befremden sofort; jetzt angenehm berührt, kam Fürstin Sophie mit raschen Schritten heran, und freudig begrüßte sie die Tochter des alten Hausmarschalls. Mama genehmigte auch alle Vorschläge Emils wegen des Quartiers im Jagdschlößl, vorbehaltlich der Zustimmung Thurns.
Emil strahlte vor Freude. Und übermütig erzählte er, daß Komtesse sich weigerte, daß er aber befohlen habe, Quartier im Schlößl zu nehmen.
Mit feiner Ironie sprach die Mama: „Der Prinz[S. 251] Schwarzenstein kann gegebenenfalls dem Hausmarschall Befehle erteilen, niemals aber dessen Tochter. Ich bitte Komtesse, bei uns zu bleiben als lieber Gast! Und nun wollen wir heimkehren!“
Emil schickte den Wagen mit dem Gepäck voraus. Auf dem Wege zur Villa mußte er den stummen Begleiter spielen, denn Mama sprach ausschließlich mit Komtesse Isotta.
In böse Verlegenheit brachte ihn die Frage der Fürstin, wo er die Komtesse aufgegabelt habe. „Meines Wissens hast du doch die Komtesse bisher nie gesehen!“
Rasch gefaßt, antwortete Isotta an Emils Stelle, daß sie im Bahnhofe Admont den ihr unbekannten Prinzen um Auskunft über eine Fahrgelegenheit zum Forsthause Hall gebeten und sich hernach als Tochter des Hausmarschalls vorgestellt habe. Worauf Prinz Emil mitgefahren sei.
„Ach so!“ Mit einigem Mißtrauen fragte die Fürstin den Sohn: „Was hattest denn du auf dem Bahnhof zu tun? Noch dazu zur Zeit, da wir speisen?“
„Verzeihung, Mama! Ich konnte nicht rechtzeitig um Dispens vom Lunch bitten! Auf dem Bahnhof wollte ich Pater Wilfrid erwarten, der aber nicht kam! Ein Glück, daß ich anwesend war, der Komtesse behilflich sein konnte!“
Zwei Blicke des Einverständnisses der jungen Leute kreuzten sich. Optische Warnungen vor Verplapperung. Besonders Isottas Blick mahnte zur Vorsicht.
Wonne und Glückseligkeit empfand Emil, daß die Komtesse sich so tapfer auf seine Seite stellte und so brillant lügen konnte, um das Geheimnis der Bekanntschaft zu wahren. Ein schneidiges Mädel, höchst sympathisch, nett zum Anbeißen! Dazu Gräfin, also...
Als Quartier bekam Komtesse Thurn ein Zimmer ähnlich dem Hoffräuleingemache, klein, doch zweckentsprechend eingerichtet. Die Räumlichkeiten waren im Jagdschlößl beschränkt, nur für Jagdgäste zu kurzem Aufenthalt bemessen.
Die Fürstin machte Isotta mit der Hausordnung bekannt, stellte Fräulein von Gussitsch vor und beauftragte die Dienerschaft, dem Gaste alle Aufmerksamkeit zu widmen. Alle Liebenswürdigkeit konnte jedoch die Komtesse darüber nicht täuschen, daß die Fürstin irgendein Mißtrauen hegte. Auch fiel es Isotta auf, wie scharf die Mama den Sohn bei Tisch überwachte.
Davon merkte Emil anscheinend nichts, er gab sich keine Mühe, die Freude über die Anwesenheit der ihm höchst sympathischen Komtesse zu verbergen, und widmete ihr seine Aufmerksamkeit. Ohne Übertreibung, ohne Draufgängerei. Freilich glänzten seine Augen seltsam.
Die Hofdame war bei Tisch nur Staffage, es hatte Martina reichlich Gelegenheit zu stillen Beobachtungen, und sie war sich sehr rasch darüber klar, daß Prinz Emil jetzt ernstlich Feuer gefangen habe, und daß die Fürstin die Situation erfaßte und keineswegs einverstanden war. Das Abschwenken Emils konnte Martina nur willkommen sein, die Ignorierung ihrer Person verbürgte Ruhe. Aber neugierig war Martina doch auf die Entwicklung der fühlbar gespannten Situation.
Auffällig war, daß die Fürstin sich nach dem abendlichen Diner nicht wie üblich zurückzog, sondern im Speisezimmer blieb und Martina um etwas Musik bat. Fräulein von Gussitsch mußte das im Empfangssalon stehende Pianino bearbeiten, vermutlich nur zum Zwecke, daß Prinz Emil der Komtesse nicht die Cour schneiden konnte und zur Schweigsamkeit gezwungen war. Eine[S. 253] lange Stunde hindurch mußte Martina Musik machen. Dann wurde kurz dafür gedankt und Schluß befohlen. Kurzer Abschied, rascher Rückzug.
Auf seiner Bude konnte Emil sich mopsen nach Belieben. Auch das schöne Liedchen summen: „Du bist mir nah und doch so fern.“ Wie sehr er sich für Isotta interessierte, bewies die Tatsache, daß für diesen Abend kein Schlummerpunsch in sein Kämmerlein kam, das verliebte Prinzlein völlig nüchtern in die Federn kroch und langmächtig und wahrhaftig maikäferte.
Mehrere Enttäuschungen brachte der nächste Tag für Emil. Nicht für ein Viertelstündchen war es möglich, mit Komtesse Isotta ohne Zeugen zu sprechen; Mama belegte sie ständig, ging mit ihr spazieren, beschäftigte sie fortwährend, bis es Zeit wurde, für den Grafen Thurn den Wagen zum Admonter Bahnhof zu senden. Isotta wurde es freigestellt, den Papa abzuholen, und für diesen Fall war Fräulein von Gussitsch zur Begleitung befohlen. Wie dies Emil hörte, verzichtete er sofort auf die Mitfahrt.
Die Komtesse hingegen wollte um die Erlaubnis bitten, Papa im Forsthause erwarten zu dürfen, fügte sich aber der Anordnung und fuhr mit Martina weg.
Zwei Stunden später kam Fräulein von Gussitsch allein zurück und meldete der Fürstin dienstlich, daß Graf Thurn vorerst mit seiner Tochter im Forsthause eine Aussprache pflegen wolle und sodann ins Jagdschlößl kommen werde, um wegen der unangenehmen Überraschung Durchlaucht untertänigst um Entschuldigung zu bitten.
Fürstin Sophie nickte nur. Und das Lächeln einer gewissen Befriedigung huschte über ihre Lippen. Sie schien die Handlungsweise des allzeit streng korrekten Hofchefs erwartet zu haben.
In der Wohnung Thurns entlud sich ein böses Ungewitter über das schöne Töchterlein. Graf Thurn rüffelte Isotta wegen der leichtsinnig unternommenen Soloreise, ganz besonders aber ob der schweren Belästigung der Fürstin durch die geradezu unverschämte Einquartierung in das Schlößl.
Isotta wehrte sich mit dem Hinweise, daß man sie ja genötigt habe, Quartier im Jagdschlößl zu nehmen.
„Ach was! Wenn man überraschend kommt und einem ins Haus plumpst, bleibt den hohen Herrschaften nichts anderes übrig, als gute Miene zum bösen Spiel zu machen und den Eindringling willkommen zu heißen! Traurig genug, daß die Tochter des Hofchefs nicht soviel Lebensart hat, um einen skandalösen Überfall zu vermeiden!“
„Aber, Papa! Ich versichere dir, daß ich gezwungen worden bin!“
„Wer hat dich gezwungen?“
„Prinz Emil!“
Die Stirne runzelnd rief Graf Thurn: „Unmöglich! Den Prinzen kennst du ja gar nicht! Wie kann Prinz Emil dazu kommen, dich einzuladen!“
Der Ärger über den Rüffel verleitete Isotta zu einer unvorsichtigen Beichte, wie sie den netten und liebenswürdigen Prinzen kennengelernt hatte, ganz zufällig, und dann selbstverständlich mit ihm zum Forsthause gefahren sei. Und hierauf habe der Prinz sie der zufällig auf einem Spaziergange herbeigekommenen Fürstin vorgestellt.
Jetzt rügte Thurn das Gebaren der Tochter erst recht scharf und als skandalöse Aufdringlichkeit. Nicht weniger die empörenden Mängel der Schulerziehung. Wenn schon nicht Verstand und Vernunft, so doch das weibliche Gefühl hätte derlei Taktlosigkeiten verhindern[S. 255] müssen. Unerhört, wie sich eine Komtesse Thurn dem Prinzen geradezu an den Hals werfen konnte. Blamiert bis auf die Knochen sei der Hofchef und Vater. Und was die Fürstin sich denken werde! „Dein Verhalten zwingt mich, die Konsequenzen zu ziehen! Die erste Folge ist, daß ich um sofortigen Urlaub bitten werde, um dich morgen zu Verwandten nach Mailand zu bringen! Zum zweiten bin ich genötigt, meine Entlassung zu erbitten! Das Schlößl betrittst du nicht mehr! Du nächtigst bei mir! Dein Gepäck werde ich holen lassen! So, und nun hast du Zimmerarrest! Ich gehe indessen zur Fürstin!“ Kurz entschlossen sperrte Graf Thurn die Tochter im Zimmer ein und steckte den Schlüssel zu sich. Und eilig ging er zum Jagdschlößl.
In außerordentlicher Audienz stimmte Fürstin Sophie zu, daß Graf Thurn Urlaub nach Italien nehme, die Bitte um Entlassung hingegen lehnte sie ab, weil kein Grund dazu vorhanden sei. Und leisen Tones fügte sie hinzu: „Es liegt auch nicht alle Schuld auf der anderen Seite! Mein Sohn dürfte ebenfalls – hm – inkorrekt vorgegangen sein, er wird seine Strafe schon noch bekommen! Jedenfalls ist Ihre und der Komtesse Abreise wünschenswert! Der Wagen für morgen früh steht zur Verfügung, wollen Sie selbst den Kutscher verständigen! Norbert soll das Gepäck der Komtesse nach dem Forsthause bringen! Gute Reise, lieber Graf!“
„Untertänigsten Dank, Durchlaucht!“
„Nehmen Sie die Sache nicht zu schwer! Trübe Stunden bleiben den Eltern nie erspart, weder in der Hütte noch in einem Palast! Und die sorgsamste Erziehung schützt nicht vor dummen Streichen der mündig, aber nicht reif gewordenen Kinder! Adieu, lieber Graf! Wir bleiben in Freundschaft die alten!“
Ein Handkuß, dann verließ Thurn mit zusammengepreßten Lippen das Wohngemach.
Ahnungslos von alledem stand Emil, mit Martina plaudernd, im Speisesaale, auf Mama und Komtesse Isotta wartend. Und angelegentlich hatte sich Prinz Emil erkundigt, wo denn eigentlich die gräfliche Familie Thurn ihren Hauptsitz habe.
Des Umstandes froh, daß der Prinz ein verhältnismäßig harmloses Thema berührte, gab Martina Auskunft, soviel sie konnte, dahin, daß die Thurn-Valsassina de Villalta und Spessa von einem Napoleone della Torre, Signore di Milano abstammen und um die Mitte des 16. Jahrhunderts Reichsgrafen wurden.
„Also wird Mailand der Wohnort der Familie sein?“ meinte Emil.
„Das kann stimmen!“
Der Eintritt der Fürstin beendigte das Gespräch.
Die Mitteilung Mamas, daß die Thurns am Diner nicht teilnehmen, da der Graf sehr ermüdet sei, überraschte Emil. Aber er wagte keine Bemerkung.
Schon zum Frühstück erfuhr Emil von Norbert die Neuigkeit, daß die Komtesse gar nicht im Jagdschlößl genächtigt habe und mit Papa in aller Frühe abgereist sei. „Überraschend gekommen, überraschend gegangen! Schade, so hübsch die Komtesse und so lustig! Was es da nur gegeben haben mag? Diesmal weiß ich weniger wie nichts!“
Mit einem wahrhaftigen Schafblick guckte Emil den alten Kammerdiener an, bestürzt, fassungslos.
Norbert war längst gegangen, doch konnte Emil noch immer nicht begreifen, was diese verblüffende Abreise veranlaßt haben konnte. Wie auf den Kopf geschlagen fühlte sich der Prinz, denkunfähig, betäubt, niedergeschmettert. Körperliche und seelische Schmerzen, das bittere Gefühl eines furchtbaren Verlustes, eine gähnende Leere. Gewichen ein großes Glück, erstorben jegliche Lebensfreude. Mählich aber reifte der Entschluß, alles zu wagen, um nach Möglichkeit das mit Isotta verknüpfte Lebensglück doch noch zu erringen. Wenn nötig, mit Kampf und Gewalt.
Emil fühlte mit dem Erstarken der Energie, im Zittern um sein Lebensglück, daß es nun mit jeder Gängelei des verhätschelten Muttersöhnchens vorbei sein müsse, daß es zugreifen heißt und Krieg geführt werden muß.[S. 258] Krieg gegen Mama, die zweifellos mitgeholfen, den Grafen Thurn bestimmt hat, seine Tochter wegzubringen. Krieg aber auch gegen Papa Thurn, dem Emil von Schwarzenstein die Tochter Isotta abringen muß. Wo aber die Thurns finden? Die Antwort auf diese selbstgestellte Frage gab die Erinnerung an die Auskunft des Hoffräuleins, daß die Thurns aus Mailand stammen, also dort irgendwo begütert sein werden. Demnach wird man in der Gegend von Mailand nach Thurns Verwandtschaft und Besitzungen zu suchen haben.
Einmal soweit entschlossen, richtete Emil sein Augenmerk auf die Hauptsache: Geld zum Kriegführen.
Der Versuch des Prinzen, vom Oberförster Hartlieb aus der Jagdamtskasse eine Summe zu erhalten, hatte ein klägliches Resultat: gegen Quittung erhielt Emil den für seine Zwecke lumpigen Betrag von hundert Kronen.
In dieser Not stellte sich der Gedanke an Pater Wilfrid ein. Den liebenswürdigen Benediktiner als Pumpquelle hatte Emil ja schon einmal ins Auge genommen, die Ankunft und kurze Anwesenheit Isottas aber die Ausführung des Pumpversuches vereitelt.
Um jedes Aufsehen zu vermeiden, verzichtete der Prinz auf den Wagen, wie ein Dieb schlich er davon und eilte nach Admont. Und glücklich traf er den Pater, Gastmeister und Pfarrer in der Zelle des Stiftes an.
Emil platzte heraus: „Gott sei Dank, daß ich Sie noch rechtzeitig erwischt habe! Ich muß nämlich in dringendster Angelegenheit verreisen, – Ehrensache – habe aber zuwenig Moneten! Darf Mama nicht behelligen, ansonsten kommt sie mir zu früh auf gewisse Schliche! In dieser Verlegenheit muß mir unser lieber Hofpfarrer[S. 259] aushelfen! Ich rufe also in Not und Verlegenheit: hilf, heiliger Wilfrid!“
Freundlich bot er Emil fünfhundert Kronen an. „Wenn Durchlaucht damit gedient ist!“
„Oh, sehr angenehm! Hochwürden verpflichten mich zu besonderem Danke! Meine Situation ist derart mißlich, daß sie mich zwingt, Ihr liebenswürdiges Angebot anzunehmen wider bessere Einsicht, gegen Anstand und Sitte! Heillos unangenehme Situation! Verzeihen Sie meine Ungezogenheit, entschuldigen Sie in Gnaden meine Frechheit! Sie wissen ja: in der Not frißt der Teufel Fliegen! Der Prinz von Schwarzenstein auch! Also helfen Sie mir mit den fünfhundert Kronen aus der Not! Ich muß sie haben! Wegen Zinsen und Rückzahlung...“
„Bitte, jedes weitere Wort ist überflüssig! Ecco!“ Damit gab Wilfrid dem Prinzen die Scheine, die Emil sofort in der Westentasche verschwinden ließ.
„Vergelt’s Gott vieltausendmal für diese Hilfe in der Not!“ Mit einem kräftigen Händedruck verabschiedete sich der Prinz vom gefälligen Priester.
Ohne das geringste Gepäck fuhr Emil mit dem Mittagszuge von Admont nach Selztal, wo er den Schnellzug nach dem Süden benutzte. Und in Udine gab er ein Telegramm an Mama auf des Inhaltes, daß er genötigt sei, in dringender Angelegenheit für einige Zeit zu verreisen.
Die Bestürzung und Angst über Emils Verschwinden wurde durch diese Depesche beseitigt, nicht aber die Sorge vor bösen Komplikationen. Aus dem Aufgabeorte Udine konnte die Fürstin unschwer erraten, welcher Art die dringende Angelegenheit sein werde. Wenngleich nun nicht zu befürchten stand, daß Graf Thurn, falls ihn[S. 260] Emil findet, je die Hand zu Dummheiten bieten wird, die Fürstin fühlte sich beunruhigt, sie bangte um den Sohn, der ohne jede Begleitung, ohne Schutz, ohne größeres Gepäck und gänzlich mittellos in Italien weilte. Mama sah in Emil immer noch und nur das Mutterbubi, jetzt hilflos allen Fährlichkeiten der Welt preisgegeben; daher die Angst, das Entsetzen, daß dem verhätschelten Liebling, dem so lange gegängelten Herzensbubi Unheil zustoßen könnte und werde. Daß Emil längst „erwacht“ war, vergaß die Mutter, sie dachte auch nicht daran, wie sehr sie gewünscht und ersehnt hatte, es möge der Sohn eine – stahlharte Energie sich erringen. Auf Tatkraft und Schneid deutete dieser Sprung in die Welt, doch dies vermochte die Fürstin nicht zu erkennen. Der Liebling hilflos im Welschland! Diese entsetzliche Tatsache peinigte die Mutter um so mehr, als sie außerstande war, dem Sohne Geld zu senden, da seine Adresse unbekannt war. In diesen Stunden der Angst und Sorge war die Fürstin bereit, Tausende zu opfern, um nur den Liebling schleunigst wieder zu erhalten. Sie dachte auch daran, dem Grafen Thurn nach Mailand Geld für Emil zu senden. Aber der Gedanke wurde verworfen, aus triftigen Gründen. Reiche Geldmittel würden dem Sohne sicher den Nacken steifen, „Bubi“ veranlassen, erst recht in Italien zu bleiben und dumme Streiche zu machen. Viel besser wird es sein, den Jungen zappeln und mürbe werden zu lassen. Die Not wird ihm die Liebes- und Heiratsmucken schon austreiben.
Aber der Gedanke, daß Emil Not leiden müsse, vielleicht obdachlos sei, als Landstreicher aufgegriffen, als Schwindler an die Grenze abgeschoben und der Polizei übergeben werde, verursachte eine Aufregung und Angst,[S. 261] die die Fürstin nahezu krank machte. Dazu die Unmöglichkeit, mit Fräulein von Gussitsch über diesen Streich des Sohnes zu sprechen. Unmöglich! Trotz des Bedürfnisses, sich die Angst von der schwer bedrückten Seele zu sprechen. Die Sorgen hinunterwürgen, totschweigen den neuen Skandal.
In ihrem Jammer ließ die Fürstin tags darauf den Pater Wilfrid zu sich bitten. Dem Priester vertraute sie ihr Leid an: das Verschwinden des Sohnes, die Befürchtung, daß Emil versuchen werde, dem Grafen Thurn die Erlaubnis zur Verlobung mit Komtesse Isotta abzutrotzen oder abzuschmeicheln. Dabei ließ die Fürstin durchleuchten, daß für einen Prinzen die Heirat einer Grafentochter als wenig standesgemäß nicht in Betracht kommen könne. Trotz aller Herzensnot doch Hochmut...
Pater Wilfrid war nicht wenig überrascht von diesen Mitteilungen. Nun wußte er doch, wozu der Prinz das gepumpte Geld benötigte. Von einer Ehrensache hatte der Schlingel geflunkert! Von der Tatsache, daß der Hofpfarrer selbst mit seinem Gelde Emil den Sprung in die Welt ermöglichte, darf die Fürstin natürlich kein Sterbenswörtchen erfahren. Dieses Geheimnis muß Wilfrid peinlichst bewahren.
„Helfen Sie mir doch, Hochwürden! Raten Sie mir, was soll ich tun! Die Situation ist ja gräßlich!“
Wilfrid suchte sich aus der Verlegenheit zu ziehen, indem er vorschlug, es möge Durchlaucht an den Grafen Thurn nach Mailand oder wo er sonst Aufenthalt nehmen könnte, die telegraphische Bitte richten, mit der Tochter rasch eine große Reise, vielleicht über See, anzutreten. „Ist das Schiff mit Thurn an Bord abgegangen, bevor Prinz Emil die betreffende Hafenstadt er[S. 262]reichte, so wird er die zwecklose Suche wohl bald aufgeben und mangels Reisegeld reumütig heimkehren! Meine ich unmaßgeblichst!“
Sofort ging die Fürstin darauf ein. Sie schrieb drei Depeschen und bat Pater Wilfrid, diese mitzunehmen und in Admont aufzugeben. „Col tempo presto! Subito!“ Die Fürstin ließ anspannen, den geistlichen Vertrauensmann zu Wagen nach Admont bringen, um Zeit zu gewinnen. Und so sehr drängte sie zur Eile, daß Pater Wilfrid selber zappelig wurde. Unterwegs erst fiel ihm ein, daß die Fürstin völlig vergessen hatte, ihm Geld zur Zahlung der Telegrammgebühren zu behändigen. Wilfrid pfiff leise durch die Zähne und dachte sich allerlei über die Mucken des Hofdienstes...
*
Mit einiger Verspätung war die Kunde vom Verschwinden des Prinzen Emil auch in das stille Forsthaus, in die Kanzlei Hartliebs, gedrungen, und zwar durch Frau Gnugesser, die den Oberförster mit der Frage überraschte, ob er schon wisse, daß der Prinz plötzlich „durchgegangen“ sei. Das jähe Entsetzen ob dieser Schreckensnachricht hatte Ambros ein einziges Wort abgepreßt: „Allein?“
Auf diese kurze Frage hatte Frau Amanda lachend mit einer Gegenfrage geantwortet: „Mit wem hätte denn der Prinz durchbrennen sollen?“
Worauf Hartlieb mit flammendem Antlitz fluchtähnlich die Treppe hinaufgestürmt war, um von seinem Seelenzustande nicht noch mehr zu verraten. Allein mußte er sein mit seinen Gedanken und Gefühlen, mit der überquellenden Freude... Fort der Prinz, ohne[S. 263] Begleitung. Demnach mußte sich Martina hier befinden, also kann es nicht wahr sein, daß Prinz Emil sich mit dem Hoffräulein verlobt habe. Was die Kammerfrau Hildegard mitteilte, war nichts als Tratsch.
Und ist Martina frei, dann kann Ambros es wagen, um ihre Hand zu bitten...! Darf er aber auf die Zustimmung hoffen? Und kann ein Ehebund geschlossen werden im jetzigen Dienstverhältnisse? Ist die Stellung des Oberförsters so fest gegründet, daß der Oberbeamte heiraten kann? Freie Hand in Dienstangelegenheiten hat man ihm wieder gegeben, den Oberbeamten in seine Rechte eingesetzt. Wie wird sich jedoch die Zukunft gestalten, wenn infolge der Flucht des Prinzen die Fürstin das Haller Jagdgut verkauft? Ihr wird der Besitz verleidet sein! Ein besonderes Interesse an Jagd und Wild ist ohnehin nicht vorhanden! Überdruß und schlechte Laune können sie sehr leicht und rasch veranlassen, die Besitzung abzustoßen, wegzugeben selbst mit bedeutendem Verlust!
Wird ein neuer Eigentümer die Beamten im Dienst übernehmen, dem Oberförster die Heirat gestatten?
Diese schwer auf die Seele drückenden Fragen machten Ambros kleinlaut, die Sorge vor der Zukunft nagte, biß die Hoffnungen tot. Nur eines konnte die Sorge nicht vernichten: das Bewußtsein der Tüchtigkeit des Beamten im Berufe. Dieses Bewußtsein hielt aufrecht, gab Mut und neue Hoffnung. Wie eine Erleuchtung kam es über Hartlieb, ein heller und kluger Gedanke: Tu, wozu das Herz dich antreibt! Übernommen wird der Oberbeamte sicher, und ist er bereits verheiratet, so braucht er nicht erst um den Ehekonsens zu bitten!
Optimist, ein Hellseher, ein sonniger Mensch wurde Ambros in dieser Stunde, zum mindesten hatte er die[S. 264] Sonne froher Hoffnung jetzt in der Brust. Und dieses Leuchten in der Seele konnten die Nebelschwaden in Berg und Wald nicht verschleiern, nicht verlöschen.
So entschloß sich denn Hartlieb zum Gang in das Schlößl. Mit Mustela-Martina wollte er sprechen, um ihre Hand bitten.
Da klopfte es, und der Forstwart Gnugesser schob sein Bäuchlein in die Kanzlei. Dienstliche Runzeln statt des üblichen Lächelns der Gutmütigkeit auf der Stirne. Kläglich klangen seine Worte, der Bericht, daß der Holzhändler mehr als vereinbart geschlägert und die Plätzzeichen der Grenzbäume herausgehauen habe. Gnugesser wollte wissen, was er in diesem Falle tun und wie er dienstlich gegen diesen Betrug vorgehen solle.
Der ernste, pflichttreue Oberförster zeigte sich wohl zum ersten Male im Dienstesleben ungeduldig, fast ungehalten über die Störung; zappelig und rasch rief er: „Sofort Anzeige bei der Gendarmerie erstatten! Beseitigung der Plätzzeichen an Grenzbäumen ist Urkundenfälschung! Veranlassen Sie das Weitere in eigener Kompetenz! Ich habe keine Zeit! Adieu!“ Und er stürmte aus der Kanzlei, ehe der überraschte Forstwart auch nur ein weiteres Wort über die bebuschten Lippen bringen konnte. Langsam stapfte Beni die Treppe hinunter. Und schwer wälzte er die Gedanken durch den Kopf, daß Waldbäume Urkunden sein können. Doch mählich begriff er, was Hartlieb mit dem fremd klingenden Ausspruch sagen wollte.
Im Jagdschlößl wimmelte alles durcheinander wie in einem Ameisenhaufen; ein emsiges Packen von Koffern, Handtaschen, Hutschachteln. Weder Hildegard noch Norbert hatten für den Oberförster Zeit, sosehr beschäftigt waren sie mit den Vorbereitungen zur Abreise. Nur[S. 265] sehr flüchtig in wenigen Worten gab der alte Kammerdiener Auskunft, daß plötzlich der Befehl zur Reise nach Italien erteilt worden sei. Ein jäher Schreck fiel Hartlieb in das klopfende Herz. Wird Martina die Gebieterin begleiten? Werden die Damen zurückkehren?
Während Ambros überdachte, wie er sich verhalten solle, wollte die Hofköchin an ihm vorbeihuschen. Rasch fing er die üppige Restituta ab, hielt die aufschreiende tugendsame Maid mit eisernem Griffe fest und bat sie, ihn zum Hoffräulein zu führen, das er dienstlich sprechen müsse. Zwar blickte Restituta ihn sehr mißtrauisch an, doch der Hinweis auf den Dienst veranlaßte sie doch, den Förster in das obere Stockwerk zu führen und ihn bei Fräulein von Gussitsch anzumelden.
Auch Martina war mit dem Kofferpacken beschäftigt; sie guckte sehr überrascht, als Hartlieb mit fast ängstlicher Miene an der Türe stand und flehentliche Blicke auf sie richtete.
Vom großen Reisekoffer wegtretend, ging Martina dem Oberförster entgegen, reichte ihm die Hand und bat Platz zu nehmen. „Womit kann ich dienen? Wie Sie sehen, sind wir eifrig mit den Vorbereitungen zur Abreise beschäftigt!“
„Verzeihung, daß ich störe! Aber es muß sein! Ich kann gnädiges Fräulein nicht abreisen lassen...“ Hartlieb hielt inne und blickte Martina bittend an.
Erglühend erwiderte sie: „Sie können mich nicht abreisen lassen? Weshalb? Ich muß aber laut Befehl die Fürstin begleiten!“
„Ja! Sie müssen laut Befehl!“ Wie ein schwaches Echo klangen Hartliebs Worte, heiser, wehmütig, angsterfüllt. Fahl war sein Gesicht, eine rührende Bitte lag in seinen Augen.
„Sie haben vermutlich vernommen, daß wir abreisen, und Sie wollen wohl Abschied nehmen?“
„Ja und nein! Verzeihung, es fällt mir so schwer, zu sprechen! Aber es muß sein! Die jähe Abreise...! Werden Sie denn hierher zurückkehren? Und wann? Und was hat denn diese plötzliche Abreise zu bedeuten?“
„Viel Fragen, Herr Oberförster! Und nicht eine einzige kann ich beantworten!“
„Vielleicht doch die Frage – nein, ich will nicht fragen, ich weiß ja, daß es nur ein leeres Gerücht war! Aber unglücklich hat es mich doch gemacht und schweres Leid gebracht! Bitte, bitte inständig, fahren Sie nicht nach Italien, wenn – etwa der Prinz dort unten sein sollte...!“ Ambros brach ab und würgte die anderen Worte hinunter.
Martina erriet, was Hartlieb sagen wollte und nicht aussprechen konnte. Und für sie bestand nun kein Zweifel mehr, daß Ambros, der liebe, ernste, eckige Waldmensch, ihr in ehrlicher Liebe zugetan ist. Ihn darf sie nicht länger leiden lassen, ihm muß sie durch ein kleines Entgegenkommen die Aussprache erleichtern, sozusagen die Zunge lösen. Und das rasch, denn die Zeit drängt... Wie aber entgegenkommen, ohne sich etwas zu vergeben?
Ambros stöhnte: „Der Prinz...!“
„Beruhigen Sie sich, lieber Herr Hartlieb! Es ist nur Strohfeuer gewesen, ein kleiner Brand, der rasch verlöschte; freilich hatte er auch mir viel Leid gebracht! Jetzt brennt es gefährlicher, doch dieser Brand hat uns nichts zu kümmern!“
„Uns?“ Jubelnd wiederholte Ambros dieses Wörtchen. Und nun fand er Mut und Worte, um zu sagen, daß er Fräulein von Gussitsch längst liebe und verehre. „Nur die Werbung konnte ich nicht wagen! Die Ver[S. 267]hältnisse sind auch jetzt nicht günstig, aber die bevorstehende Abreise, die Ungewißheit, ob Sie wieder zurückkommen werden, die Möglichkeit, daß die Besitzung verkauft wird, die Angst, Sie zu verlieren, all das zusammen zwingt mich zur innigen Bitte: Erhöre mich, Martina, und werde in Gnaden meine Frau! Viel kann ich freilich nicht bieten, nur ein Leben in der Bergeinsamkeit, aber ehrliche Liebe und Treue und Dankbarkeit! Nimm vorlieb mit dem Wenigen und mit dem verwilderten Waldmenschen...!“
„Still!“ lispelte hold erglühend Martina und schloß mit dem Patschhändchen den Mund Hartliebs.
Ambros küßte das Händchen, zog Martina an sich und bettelte wie ein schüchterner Junge um das Jawort.
Martina aber bot dem geliebten Manne die Lippen zum Verlobungskusse.
Heftiges Klopfen an der Tür schreckte das Paar auseinander. Hildegard trat ein und meldete, daß Fräulein von Gussitsch sofort zur Fürstin kommen solle. Grünlich schillerten die Augen der Kammerfrau, Schlangenblicke trafen Martina und Ambros, ein böses Lächeln umspielte Hildegards Lippen. Eine böse Bemerkung wagte sie aber doch nicht auszusprechen.
Um jedoch gehässigen Verdächtigungen schlankweg ein Ende zu machen, erklärte Martina tapfer, daß sie sich soeben mit Herrn Oberförster Hartlieb verlobt habe.
„Untertänigsten Glückwunsch!“ lispelte Hildegard mit anzüglichem Hüsteln. Und in schlecht verhehlter Wut huschte sie aus dem Zimmer.
„Nun aber fort, Geliebter! Hier darf ich dich nicht länger behalten! Bleib in Nähe des Schlößls, etwa gedeckt am Waldesrand, vielleicht können wir uns noch sprechen!“
Gehorsam entfernte sich Ambros. Glück und Seligkeit verklärten sein Antlitz.
Martina trat in das Zimmer der Fürstin. „Durchlaucht haben befohlen...!“
In großer Erregung schritt Sophie auf und ab und hielt zwei Depeschen in der rechten Hand. Bei jeder Bewegung knisterte das Papier. Schwer atmend sprach die Fürstin, mühsam nach einem Entschlusse ringend: „Die Reise werden wir absagen müssen, wir würden ja doch zu spät kommen...! Sorgen Sie dafür, daß Pater Wilfrid unverzüglich hierherkommt, ich muß ihn sprechen in dringender Angelegenheit! Fahren Sie, bitte, nach Admont und bringen Sie mir den Pfarrer, unverzüglich, so rasch als möglich!“
„Zu Befehl, Durchlaucht!“ sprach Martina und wandte sich zum Gehen. Und wies den Gedanken zurück, der schmerzerfüllten Gebieterin jetzt Mitteilungen persönlicher Art zu machen.
Die Fürstin holte tief Atem. „Noch einen Augenblick, liebe Gussitsch! Sie müssen ja doch wissen, um was es sich handelt! Der Kummer will nicht enden in meinem Hause! Ein Sorgenkind ist mein Sohn! Erst die unglückselige Affäre Emils mit – meiner Hofdame, dann die Flucht, und jetzt teilt mir mein Sohn mit, daß er sich mit Komtesse Isotta Thurn gegen den Willen des Vaters verlobt habe! Emil erbittet meine Zustimmung, Graf Thurn hingegen bittet um sofortige Entlassung! Herr des Himmels, was soll ich tun in dieser Situation! Es ist mir peinlich, den Pater Wilfrid belästigen zu müssen, aber ich benötige seinen Rat! Was denken Sie, liebe Martina, über den schmerzlichen Fall, über Emils unbegreifliches Verhalten und Vorgehen? Bitte, sagen Sie offen Ihre ehrliche Meinung!“
Martina zögerte.
Doch die Fürstin bat flehentlich in ihrer Bedrängnis. „Vielleicht, nein: gewiß findet der Frauensinn, das weibliche Empfinden den richtigen Weg besser als jeder Mann! Ich bitte Sie, liebe Martina, herzlich um Bekanntgabe Ihrer Auffassung!“
Nun mußte das Hoffräulein wohl oder übel der Bitte, die einem Befehl glich, nachkommen. Martina machte aufmerksam, daß es sich nun um eine ernste Angelegenheit handle, daß eine Verweigerung der erbetenen Zustimmung den energisch gewordenen Prinzen auf einen Weg drängen werde, der zu einer gewalttätigen Durchsetzung seines Willens führt. „Nach meiner allerdings unmaßgeblichen Meinung scheint Prinz Emil fest entschlossen zu sein, die Komtesse Thurn zu ehelichen, auch gegen den Willen der Fürstinmutter und des Grafen Thurn! In diesem Entschlusse liegt die Gefahr einer kompromittierenden Gewalttat! Es zeugt von Liebe, daß Prinz Emil die Mama um Zustimmung bittet...!“
Ächzend rief die Fürstin: „Die telegraphische Bitte kann aber ebensogut als eine Nötigung, als ein Ultimatum aufgefaßt werden!“
„Allerdings! Unzweifelhaft ist Prinz Emil zum Äußersten entschlossen! Er wird seinen Willen unter allen Umständen durchsetzen! Wird die erbetene Zustimmung verweigert, so gestaltet sich die Situation erst recht mißlich, der Protest bleibt wirkungslos, ebenso eine etwaige Androhung der Enterbung!“
„Emil besitzt ja keine Mittel, er kann doch gar nicht heiraten! Und die Komtesse muß doch so vernünftig sein, zu erkennen, daß diese unglückselige Heirat einem Sprung ins Dunkle, ins Elend gleichkommt!“
„Verzeihung, Durchlaucht! Ein liebend Weib scheut diesen Sprung nicht, geht mit dem Geliebten vereint, so es sein muß, auch in den Tod! Prinz Emil und Komtesse Thurn lieben sich ehrlich und heiß, daher diese eiserne Entschlossenheit, dieser Mut, gegen alle Hindernisse anzukämpfen! – Was die erwähnte momentane Mittellosigkeit anbelangt, so hat sie nicht viel zu bedeuten; ein Prinz Schwarzenstein wird rasch Geldgeber finden, Name und Rang verschaffen Kredit! Allerdings wird Prinz Emil auf diese Weise in Wuchererhände geraten, und die fürstliche Privatschatulle wird schwere Opfer bringen müssen, um den Prinzen aus den Wuchererhänden zu befreien! Was aber in der Brust des Prinzen verbleiben und wie ein Stachel wirken wird, das wird die Verbitterung, der Trotz, wenn nicht Haß sein! In dieser Erwägung dürfte es sich empfehlen, allen Komplikationen und Konsequenzen ein Ende zu machen durch Gewährung der Bitte...!“
„Ich soll also zustimmend antworten?“ Fast tonlos und schwer seufzend sprach die Fürstin diese Worte.
„Ja, Durchlaucht! Die Liebe der Mutter zum Sohne kann auch dieses Opfer bringen!“ sprach offen, in erquickender Ehrlichkeit Martina. Und hellen Tones fügte sie bei: „Was den Entschluß zur Opferdarbringung erschwert, ist lediglich der Gedanke, daß ein Ultimatum gestellt wurde! Jedes Ultimatum reizt zum Widerstande, weckt Entrüstung; besonders aufreizend wird ein Ultimatum dann sein, wenn es vom Kinde gegen die eigene Mutter gerichtet wird! In diesem Falle muß aber die Mutterliebe größer sein als die an sich berechtigte Entrüstung! Die Liebe kann alles, sie überwindet alles! Das Größte, das Heiligste ist die Mutterliebe, größer, heißer und opferwilliger als die Liebe des Wei[S. 271]bes zum Manne, denn die Mutter liebte den Sohn ja schon von der Stunde an, da sie ihm das Leben gegeben! Können sich Durchlaucht zu dem großen Opfer aufraffen, der Lohn wird groß, schön und beseligend sein, denn die Mutter gewinnt die Liebe des Sohnes wieder, weckt die Dankbarkeit in der Kinderbrust, gewinnt eine dankbare Tochter dazu!“ Martina hatte sich warm gesprochen, Tränen liefen ihr über die Wangen.
Die Fürstin schluchzte. In tiefer Bewegung reichte sie dem Hoffräulein die Hand, und weinend dankte sie für die Anteilnahme, für das Mitempfinden in schwerer Stunde. Martina küßte die Hand der seelisch erschütterten Frau.
Und die Fürstin zog das tapfere Mädchen gleich einer Schwester an sich, legte den Arm um Martinas Nacken und lehnte das tränenfeuchte Antlitz an die Schulter der in dieser Viertelstunde zur Freundin gewordenen Hofdame. Und leise sprach die hohe Frau: „Ich habe den Sohn verloren, durch Sie kann ich ihn wiedererhalten! Drum will ich tun, was Sie mir raten!“ Langsam, zart und weich löste Sophie die Umarmung. Dann diktierte sie Martina zwei Depeschen, die Zustimmung zu Emils Verlobung mit Isotta und die Ablehnung der Bitte Thurns wegen der Demission.
Während des Schreibens war Martina dem Heulen nahe, so mächtig wirkte das von der Mutterliebe gebrachte Opfer auf die eigene Seele. Dicke Zähren tropften auf das Papier. Und auch die Fürstin hatte viel an den Augen zu wischen. Doch ziemlich gefaßt bat sie dann, es möge Martina nach Admont fahren und die Depeschen als dringend aufgeben.
Martina erhob sich, steckte die Telegramme ein und öffnete den kleinen Mund, so daß die Marderzähnchen blinkten. Wollte reden und wagte es nicht...
Gütig und weich fragte Sophie: „Wollen Sie mir noch etwas sagen?“
Jetzt war der wichtige Moment da, es muß gesprochen werden. Tapfer richtete sich das zierliche hübsche Fräulein auf, trippelte auf die Fürstin zu, küßte ihr demütig die Hand und bettelte innigen, zu Herzen gehenden Tones: „Verzeihung, Durchlaucht! Darf mich Herr Hartlieb im Wagen begleiten?“
Verwundert blickte Sophie auf und sprach: „Wenn Sie es wünschen, warum denn nicht? Hat denn der Oberförster zu tun in Admont?“
„Einiges zu besprechen hätten wir! Ich muß beichten, Euer Durchlaucht gestehen, daß wir uns – verlobt haben! Und so bitte ich denn in schuldiger Demut und Ehrerbietung um die Erlaubnis...“
Wohl verriet der Blick der Fürstin großes Staunen, eine schmerzliche Überraschung und Enttäuschung, doch gütig und mild sprach die hohe Frau: „Möge Ihnen alles irdische Glück beschieden sein, das wünsche ich Ihnen von Herzen! Wir sprechen noch darüber! Doch jetzt schon bitte ich Sie, schieben Sie die Trauung noch etwas hinaus, lassen Sie mich nicht allein! Eine Verschiebung, bis die Kinder hier und getraut sind! Ja, bitte? Und nun eilen Sie nach Admont der Depeschen wegen! Emil wird sehnsüchtig auf meine Einwilligung warten!“
„Untertänigsten Dank!“ jubelte Martina, küßte der Gebieterin die Hand und wirbelte gegen jede Hofetikette davon.
Sophie setzte sich an das Fenster und blickte hinüber zum nebeldurchzogenen schweigenden Bergwald. Jetzt wußte die einsame Frau, wer dem Hoffräulein die ergreifenden und hinreißenden Worte in den Mund gelegt[S. 273] hatte: die Liebe! Wer selbst liebt, kann beredt von Liebe sprechen! Und viel besser, wärmer und überzeugender als der sonst so redegewandte Hofpfarrer Pater Wilfrid...
Auf leisen Sohlen kam die Kammerfrau Hildegard, um nach Wünschen zu fragen. Und Gift spritzen wollte die um eine Lebenshoffnung gebrachte Witib, hetzen, die Heirat, wenn irgend möglich, hintertreiben.
Kaum merkte die Fürstin, worauf Hildegard zielte, da winkte die Gebieterin ab und sprach: „Ich weiß davon und wünsche der braven Gussitsch alles Glück! Du kannst gehen!“
Seit Tagen schneite es mit geringen Unterbrechungen. Die Fichten rings um die Villa im Halltal trugen weiße Zipfelmützen und waren in helle Mäntel gehüllt. Trotz des grau verhängten düsteren Himmels war es licht ringsum geworden, der Schnee leuchtete in die Zimmer.
Wieder saß Fürstin Sophie am Fenster ihres behaglich erwärmten Boudoirs und blickte sinnend hinüber zum Bergwald, der still und geduldig die ins dunkelgrüne Geäst fallende weiße Last entgegennahm und ergebungsvoll trug. Still und geduldig! Auch die jungen Fichten und Tannen, die der schwere Schnee drückte, niederbeugte, sie trugen die Last so gut sie konnten...
Im Anblick der winterlichen Natur kam der einsamen Fürstin das schöne Gedicht Halms in den Sinn:
Vor dem geistigen Auge zogen die Ereignisse der jüngstverflossenen Zeit vorüber: die Rückkehr des glückstrahlenden Sohnes, an seiner Seite die Braut in ge[S. 275]drückter Stimmung, scheu und verschüchtert, sich vor der Mama des Bräutigams fürchtend. Gedrückt auch Graf Thurn, dem vom alten ehrlichen Gesicht abzulesen war, wie sehr er litt unter dem Druck der Schicksalsfügung.
Sophie fühlte noch immer die bangen Minuten, da die Augen von Vater und Tochter auf sie gerichtet waren, flehend um Gnade und Verzeihung. Und wie damals klopfte auch jetzt noch das Herz in Erinnerung. Wie schwer war es doch, das rechte Wort zu finden, die Autorität zu wahren, zu rügen, ohne weh zu tun, fühlen zu lassen, welch großer Schmerz der Mutter zugefügt worden war. Ein schwerer Kampf um das rechte Wort war es, aber das Wort hatte die Mutter nicht gefunden, überhaupt nichts gesprochen. Den Sohn umarmt und geküßt, nach ihm die Komtesse verzeihend an die klopfende Brust gezogen. Wodurch ein Tränenwildbach aus Isottas Augen entfesselt wurde.
Richtig gehandelt mußte die Mama doch haben, denn nie im Leben war sie so innig geküßt worden...
Dem alten treuen Hausmarschall hatte die Fürstin die Hand gereicht, auf die Thurn einen Kuß drückte, viel zu lang, vielsagend, in unaussprechlicher Dankbarkeit.
Damit war das Schwerste, der Empfang der Heimgekehrten, überwunden.
Leben ins Haus brachte der quecksilbrig gewordene Sohn. Welchen Wandel hatte doch Emil durchgemacht! Erst ein Träumer, schläfrig, geistig zurückgeblieben zum Jammer der Mutter. Und dann das Erwachen zu einem impulsiven Menschen. Und was die Mutter ersehnte: stahlharte Energie, Emil erwarb sie sich; allerdings zu früh und nicht eben auf einem erwünschten Wege.
Sophie gedachte der Trauung im Haller Kirchlein. Eine sehr schlichte Feier unter Ausschluß aller Öffent[S. 276]lichkeit. Sehr ergreifend und für die Fürstin schmerzlich, weil sie den Gedanken an eine Mesalliance nicht loswerden konnte. Eine Enttäuschung blieb diese Heirat doch. Eine Bedrückung der Seele. Die Last mußte getragen werden. Und sie wird weiter getragen in der Hoffnung, daß die Ehe eine glückliche werde.
Viel Enttäuschungen, zuviel! Für Emil war das Haller Jagdgut gekauft worden... Auf die Schwarzensteinsche Herrschaft in Böhmen will er sich nach der Hochzeitsreise zurückziehen und seinen Kohl selber bauen. Ein reines Ökonomiegut, ohne Jagd.
Sophie fragte sich, ob denn sie selbst ein nennenswertes Interesse für die Jagd entwickelt hatte. Und sie mußte diese Frage rundweg verneinen. Allerdings gab es auch viele Ablenkung und Hindernisse. Ein Jagdgut, auf dem das Weidwerk nicht ausgeübt wird, gehört wohl in andere Hände...
Martina kam und meldete sich zum Dienst. Mit roten Backen vom Spaziergange in frischer Schneeluft, munter und seelenvergnügt bei allem höfischen Respekt.
Wie welk und alt fühlte sich Sophie beim Anblick Martinas, die seit der Verlobung vor Glück strahlte... Die Trennung von dem Hoffräulein wird schwerfallen.
„Was bringen Sie mir?“ fragte die Fürstin müden Tones.
„Gute Nachricht, Durchlaucht! Hartlieb verbürgt für morgen herrliches, frostklares Wetter und läßt durch mich Durchlaucht inständig bitten, mit ihm zum Scheiblingstein hinaufzusteigen! Die Gamsbrunft ist im besten Gange, die Böcke treiben hitzig, es wird eine gute, erfolgreiche Pirsch geben!“
Lächelnd erwiderte Sophie, indem sie auf Martina zuschritt: „Ei, ei! Welche Wandlung bei Ihnen! Wenn[S. 277] mich nicht alles täuscht, hatten Sie früher nicht das geringste Interesse für Hochgebirg und Jagd! Und jetzt bedienen sie sich sogar der Weidmannssprache!“
Martina senkte das purpurn erglühende Köpfchen und sprach leise: „Es ist richtig, daß ich geglaubt habe, mich nie mit dem Jagdwesen befreunden zu können...! Aber die Zeiten ändern sich...“
„Und wir mit ihnen! Bei Fräulein von Gussitsch ist der Wandel sehr begreiflich; die Braut eines Jagdleiters muß ja dem Berufe des Bräutigams und Gatten warmes Interesse entgegenbringen!“
„Werden Durchlaucht morgen ins Revier Scheiblingstein hinaufsteigen? Ich bitte untertänigst um Bescheid, um Hartlieb verständigen zu können!“
„Besondere Lust verspüre ich nicht, glaube auch nicht an den Eintritt frostklaren Wetters bis morgen!“
In begeisterten Worten empfahl Martina den Aufstieg ins Gamsrevier, einen wenn auch nur kurzen Aufenthalt in der Höhenwelt mit ihrer Winterpracht, um die Sorgen zu bannen und frischen Lebensmut wiederzugewinnen.
„Ei ei! Sie wünschen wohl, mich begleiten zu können? Genauer gesagt: Martina ersehnt diesen winterlichen Jagdausflug natürlich aus rein ‚jagdlichen‘ Motiven! Gott, wie sie lügen kann und heucheln, die brave Martina!“ Die Fürstin drohte mit erhobenem Zeigefinger und lächelte.
„Nein, Durchlaucht! Ich will und kann nicht lügen! Also gestehe ich ehrlich ein: Gams schauen möchte ich, Durchlaucht begleiten, und freuen würde ich mich von Herzen, wenn die Pirsch und der Aufenthalt hoch oben Euer Durchlaucht so froh machen könnte, wie – mir ums Herz so fröhlich ist!“
„Danke! So froh und lebensfreudig wie die junge Martina kann die alte Frau nicht werden! Aber die Freude will ich Ihnen machen, will also Ihren und Hartliebs Wunsch erfüllen! Veranlassen Sie alles Weitere!“
„Untertänigsten Dank! So darf ich also Hartlieb gleich verständigen?“
„Natürlich! Springen Sie hinüber zum Forsthause!“
„Das ist gar nicht nötig, denn Hartlieb erwartet unten den Bescheid!“
Sophie lachte belustigt. „Ist das eine verliebte Bande! Aber zu den ganz Schlauen gehört meine Martina doch nicht! Würden Sie den Bescheid ins Forsthaus tragen, so hätten Sie doch Zeit und reichlichen Anlaß zu einer ‚Aussprache‘ in der Jagdkanzlei!“
„Ich komme ja vom Forsthause, und Hartlieb hat mich zum Schlößl begleitet! Es ist alles von uns besprochen und abgekartet! Verzeihen Durchlaucht diese Heimlichkeit und Verschlagenheit!“
„Ei, wie schlau! Und daher die roten Bäcklein! Na, springen Sie hinunter! Adieu!“
*
Zum Abend kam Graf Thurn von einer kleinen Dienstreise zurück, und vor dem Diner hatte er eine längere Besprechung mit der Gebieterin.
Die Audienz endete mit einer Einladung zur Gamspirsch, die den Hausmarschall sehr erfreute, aber auch ernst stimmte.
Einer gewissen Wehmut konnte sich auch die Fürstin nicht erwehren, doch die hohe Frau überwand sie und sich. „Ein letztes Mal, Graf! Es muß sein! Und für[S. 279] die Reviere sowie auch für die Beamten wird es besser sein, wenn...! Genug davon! Sie speisen mit uns, lieber Graf! Wir wollen uns gegenseitig trösten in unserer Vereinsamung! Und noch eins: Am Tage der Hochzeit Martinas reisen wir ab und nehmen Winterquartier in Wien!“
„Zu Befehl, Durchlaucht!“
*
War das eine Pracht oben zwischen Pyrgas und Scheiblingstein, als die Sonne aufging und ihre rotgoldigen Strahlen die verschneiten Bergkolosse umwoben und in feurige Lichtbündel hüllten! Die Kämme mit dem flimmernden Hermelin verwandelten sich in flüssiges Gold, und darüber wölbte sich der Himmelsdom, prangend im schönsten Azurblau!
Dank des sehr frühen Aufbruches noch vor Morgendämmerung hatte die Jagdgesellschaft unter Führung Hartliebs die Pyrgas-Hütte, in der ein Jagdgehilfe die Öfen speiste, erreicht, ehe der Schnee von der Sonne weich gemacht worden war.
In der Hütte wurde ein Frühstück eingenommen und dabei der Jagdplan bekanntgegeben. Die Damen führt Hartlieb, den Grafen Thurn der Jäger.
Alsbald wurde aufgebrochen, und zwar in nahezu entgegengesetzter Richtung. Hartlieb bat um größtmögliche Ruhe und völlige Schweigsamkeit. Ein liebevoller Blick flatterte zu Martina, die im Jagddreß allerliebst aussah. Dann war Hartlieb nur noch Führer und Fachmann. Etwas schwerfällig stapfte die Fürstin hinterdrein in elegischer Stimmung.
Eine Stunde später standen die Damen mit Hartlieb vor einer ziemlich breiten Mulde, wo es von Gams wimmelte. Und was für gute Gams! Und viel Leben!
Trieb hier ein starker Bock einen Rivalen in sausender Fahrt aus dem Machtbereiche, unweit davon suchte ein anderer Bock ein Rudel anzupirschen, das ein Kapitaler beherrschte und bewachte. Am Muldenrande stand ein sehr guter Bock, prüfte den Wind, der aufwärts strich im Sonnenlichte, und zog die Oberlippe hinauf, wie es alle Brunftböcke tun, wenn sie sich von der Witterung überzeugen wollen. Und davon mußte er nicht genügend in den Windfang bekommen haben, denn er blieb stehen und äugte forschend nach den benachbarten Rudeln. Dann schüttelte er die dicke schwarze Winterdecke, so daß der stattliche gereimelte Bart auf dem Rücken hin und her wackelte.
Köstlich war dieser gute Anblick. Martina saß auf einem Felsblock in größerer Entfernung und schwelgte im Genuß, der sich steigerte, als sie zwischen den Gemsen etliche Steinhühner gewahrte, die sich ihr Gefieder putzten und dann so geschäftig zwischen den Gemsen hin und her liefen, als hätten sie wunder was und enorm viel zu tun. Hoch über der Mulde kreisten Kolkraben und ließen ihren Ruf ertönen: Krook, krook!
Noch immer stand der Kapitale wannenbreit in einer Distanz von etwa fünfzig Metern. Hartlieb deutete durch einen Blick an, daß die Fürstin schießen solle.
Während sich Sophie fertigmachte, scharrte der Bock den Schnee weg.
Der Schuß fiel. Der Kapitale verhoffte, äugte und schien sich über die Schußrichtung nicht klar zu sein. Aber mit der Ruhe in der Mulde war es nun vorbei, Geißen und Kitze wurden erregt und begannen zu pfei[S. 281]fen, und mit einem Male waren nur die Spiegel zu sehen, die ganze Gesellschaft suchte in gewaltigen Fluchten Schutz in den verschiedenen Latschendickungen, von denen das Schmelzwasser tropfte. Auch der Kapitale war mitgegangen in eleganter Flucht; doch der Schwarze kehrte bald um, zog der Fürstin entgegen und blieb in Nähe eines Krummholzgestrüppes stehen.
Wieder gab die Fürstin Feuer, die Kugel warf den Kapitalen um, doch kam er rasch wieder auf die Läufe, blieb aber schwerkrank mit gekrümmtem Rücken stehen. Aus dem Latschengestrüpp fuhr ein schwarzer Teufel heraus, und sehr interessiert untersuchte er die Schweißfährte des Schwerkranken und stieg dann um den Kameraden in Haltung der Brunftböcke herum, bis der Kranke sich wegschleppte und dann niedertat.
Was sich nun ereignete, empörte die Fürstin und versetzte sie in Wut.
Der gesunde Schwarze stürzte auf den schwerkranken Kameraden und suchte ihn aufzutreiben. Vergebens, denn es fehlte bereits an Kraft. Blitzesschnell schlug nun der Gesunde die Krickeln in die Drossel des Kranken, zerrte und riß ihn nach vorne etwas in die Höhe. Der Gepeinigte klagte laut, worauf der Gesunde von seinem Opfer abließ. Doch nur für wenige Augenblicke war Ruhe. Erneut fuhr der Teufel auf den im Verenden liegenden Kameraden los.
Jetzt feuerte die Fürstin mit ihrem Repetierstutzen mehrmals, Schuß auf Schuß, zu hoch, zu tief und daneben. Eine Kugel faßte den Teufel aber doch, links vom Blatt. Ein Sprung in die Höhe, ein rasend schnelles dreimaliges Drehen im Kreise, dann stürzte der schwarze Bursch und schlegelte mit den Läufen. Er hatte genug. Die Fürstin aber schrie wie toll...
Damit endete diese Pirsch. Mit einem gewaltigen Verdrusse, denn die Fürstin war außer sich wegen der Roheit des Gamsbockes. Und dieser Verdruß erleichterte später in der Pyrgas-Hütte die Mitteilung an Hartlieb, daß das Jagdgut unter ziemlichem Verlust, jedoch mit der Bedingung: Übernahme aller Beamten und Bediensteten in jetziger Gehalts- und Lohnhöhe seit gestern verkauft sei. Ein Erschrecken, wenn nicht Entsetzen des Brautpaares hatte Fürstin Sophie erwartet. Das Verhalten Hartliebs wie Martinas enttäuschte in dieser Beziehung, das Brautpaar blieb gelassen und nahm die inhaltsschwere Mitteilung ruhig entgegen.
Hartlieb bat nur, ihm in Gnaden zu sagen, wer der Käufer sei.
„Der frühere Pächter Graf Lichtenberg, zur Zeit Pächter der stiftischen Jagdgründe im Triebental!“
„Untertänigsten Dank!“ Kein Wort mehr darüber äußerte Hartlieb. Aber sein an die sehr überraschte Braut gerichteter Blick kündete eine unaussprechliche Freude.
Martina senkte die Lider, um das Frohlocken über diese Freudenbotschaft zu verbergen.
Graf Thurn kehrte von der Pirsch zur Hütte zurück, der Jagdgehilfe trug zwei gute Böcke. Innig dankte der Hausmarschall der Gebieterin für die Abschußerlaubnis. Und mit wehmütiger Freude nahm er aus den Händen Hartliebs den grünen Latschenbruch entgegen. War es doch für Thurn der letzte Jagdgang im Haller Revier gewesen...
Am Abend im Jagdschlößl äußerte die Fürstin dem Grafen Thurn gegenüber ihr Befremden darüber, daß der Jagdleiter Hartlieb die Mitteilung vom Verkauf der Herrschaft Hall so überraschend gelassen hingenom[S. 283]men habe. Keine Spur von Trauer oder Schmerz über diesen doch sehr einschneidenden Wechsel. Und sie fragte den Hausmarschall, wie diese befremdende Gleichgültigkeit, der Mangel an jeglicher Anhänglichkeit, zu erklären sei.
Diese Frage versetzte den alten Hofbeamten in eine nicht geringe Verlegenheit. Unmöglich war es, die Wahrheit zu sagen, unmöglich darauf hinzuweisen, daß es für den Jagdbeamten geradezu eine Wonne sei, einem sachkundigen weidgerechten Jagdherrn zu dienen, noch dazu dem Grafen Lichtenberg, dem Kenner der Reviere, dem bereits als grundtüchtigen Jäger wohlbekannten und hochgeschätzten früheren Pächter. Unmöglich konnte Thurn sagen, daß Hartlieb nach all dem seither im Dienste Erlebten den Verkauf geradezu als Befreiung aus unerquicklichen Verhältnissen empfinden und bejubeln muß. Aus der Verlegenheit zog sich Graf Thurn aalglatt mit der Versicherung, daß der Brautstand des Paares den Schmerz über den Wechsel, den Kummer über den Verlust der so gnädigen Gebieterin paralysieren werde. Das Brautpaar habe wohl nur das bevorstehende Eheglück vor Augen...
Mit dieser diplomatischen Antwort gab sich die Fürstin zufrieden. Eine leise Verstimmung mochte aber doch zurückgeblieben sein, denn Sophie gab Befehl zur Übersiedlung nach Wien noch vor der Trauung des Paares.
Als die Fürstin die Bestürzung Martinas gewahrte, siegte die Herzensgüte aber doch über die Verstimmung und ließ die hohe Frau sprechen: „Sie sollen nicht obdachlos werden, liebe Martina, ehe Sie den Schutz des Gatten erhalten! Ich nehme Sie mit nach Wien, denn ich benötige die Hofdame dringend zur Auswahl der[S. 284] Hochzeitsgeschenke! Zur Trauung fahren Sie dann nach Hall! Ist’s recht so?“
In aufquellender Dankbarkeit küßte Martina der herzensguten Fürstin die Hand.
Als Hartlieb diese Neuigkeit erfuhr, machte er zwar einen langen Hals und guckte verdutzt, aber er fügte sich sogleich der Anordnung und in die kurze Trennung von der Braut.
In aller Stille verließ die Fürstin mit Gefolge das Jagdgut...
An einem frostklaren Wintermorgen mit glitzernder Pracht vereinigte in der kleinen Haller Kirche Pater Wilfrid das schöne, glückstrahlende Paar. Und der Trauung wohnte als Brautführer der neue alte Jagdherr Graf Lichtenberg bei, der in seinem Äußern und in der Steierertracht eher einem Jagdgehilfen gleich sah. Aber verflucht jaagerisch sah er aus, auf den ersten Blick erkennbar als echter Weidmann. Und was der Jagdherr nach beendigtem Gottesdienste zur kleinen Festgesellschaft sprach, klang kurz, schneidig und jaagerisch und kündete den Beginn einer neuen Ära: „Die Hauptsache in einem geordneten Jagdbetrieb ist die Pünktlichkeit! Auch zur Schonzeit und für eine Jagdleitersfrau! Jetzt ist es zehni, Punkt zwölf Uhr erscheinen das Brautpaar und alle Festgäste inklusive Pfarrer und Jaagerei in der Villa zum Essen! Alle sind meine Gäste! Daß mir keiner wegbleibt! Inzwischen kann jeder tun, was er mag, nur nicht ins Wirtshaus gehen und vorher essen und trinken; ich hab Sach genug im Haus! Und jetzt schauts, daß aussi kummts beim Loch! Auf Wiedersehen!“ Graf Lichtenberg nickte freundlich, ging aus der Sakristei, bestieg den Schlitten und fuhr in das verschneite, sonnenverklärte Halltal.
Die Hochrufe der freudig überraschten Jägerei klangen ihm nach. Als das Brautpaar am Forsthause vorfuhr, gab es ein großes Geguck, denn zwölf stämmige Treiberburschen und mehrere Leiterwagen harrten der Neuvermählten und begrüßten das Paar jauchzend und jodelnd.
Hartlieb fragte erstaunt, was denn das bedeuten solle.
Und die Antwort lautete: die Leute hätten Befehl, den Umzug des Oberförsters in die neue Wohnung durchzuführen, die Möbel in das Jagdschlößl zu bringen, wo das Paar von nun an wohnen werde.
Ein Jubelruf Martinas ertönte.
Ambros hielt alles für einen Scherz des neuen Gebieters. Aber es war ernst gemeint, eine Hochzeitsüberraschung, allerdings sehr drolliger Art, denn nun hieß es in aller Eile packen, um den Termin zum Diner einzuhalten. „Gottlob hab ich nicht viel im Eigentum!“ meinte lachend Hartlieb, als er seine Habseligkeiten in die paar Kisten stopfte. Die Kanzlei hatt je im Forsthause zu verbleiben. Kurz vor zwölf Uhr fuhren Hartliebs an dem Schlößl vor, empfangen von Exzellenz, die sich vor Lachen krümmte über das Gelingen der aparten Überraschung. Galant half Graf Lichtenberg der jungen Frau aus dem Schlitten. Und Martinas Arm nehmend, geleitete er die Braut in die Wohnräume Hartliebs im Parterre. Beim Anblick des neuen behaglichen Mobiliars, alles niegelnagelneu und ebenso komfortabel wie praktisch, schrie Martina vor Wonne.
Und Hartlieb in seiner Überraschung stotterte: „Aber, Exzellenz! Soviel Gnade verdiene ich ja nicht!“
„Still! Was Sie verdienen oder nicht, das zu beurteilen ist meine Sache! Während wir hochzeitlich speisen, bringen die Treibervölker die sieben Zwetschgen[S. 286] des verflossenen Junggesellen! Später kann sich das Brautpaar mit Auspacken und Einräumen die Zeit vertreiben; das zu viele Balzen taugt nix! Frau Hartlieb kann sich überzeugen, daß alles da ist: Wäsche aller Art in den Kästen, Geschirr in der Küche, auch die Betten sind nicht vergessen worden, zwei Betten natürlich! Gehen wir essen!“
„Einen Augenblick, Exzellenz!“ rief glückstrahlend Martina, trippelte in die neue Wohnung und öffnete die Türe des Wäscheschrankes und jubelte, als sie die reiche Ausstattung sah.
Vergnügt zwirbelte Graf Lichtenberg den grauen Bart. Und nun flatterte Martina auf ihn zu und rief lachend und vor Freude weinend zugleich: „Dank, tausend Dank von ganzem Herzen! Ich muß Exzellenz ein Dankesbusserl geben, ich kann nicht anders! Der Ambros erlaubt es schon!“ Und schwupp hing Martina am Halse des Jagdherrn und küßte ihn.
„Danke! Ist nicht ohne, so ’ne Balz! Fühle mich reich belohnt für die kleine Überraschung! Nun aber – Pünktlichkeit! Marsch fort, hinauf zu Tisch!“
Hartlieb wollte danken.
„Still! Hinauf! Immer Pünktlichkeit, auch beim Essen!“
Als die Sonne schied, fuhr Graf Lichtenberg nach Admont. Sehr vergnügt darüber, sein Teil beigetragen zu haben, zwei Menschen sehr überrascht und glückselig gemacht zu haben.
Das Hoffräulein verwandelte sich in eine richtige Jägersfrau und liebte den tüchtigen Gatten und hing mit ganzer Seele an der herrlichen Bergwelt von Admont.
Ende
Paetels Roman-Reihe
Zum gleichen Preise und in gleicher Ausstattung sind erschienen:
|
1.
|
Arthur Achleitner
|
Das Schloß im Moor. Roman
|
|
2.
|
Arthur Achleitner
|
Der Stier von Salzburg. Roman
|
|
3.
|
Arthur Achleitner
|
Unter den Hohen Tauern. Roman
|
|
24.
|
Arthur Achleitner
|
Die Rose vom Chiemsee. Roman
|
|
25.
|
Arthur Achleitner
|
In den Bergen da lauert der Wildschütz. Roman
|
|
26.
|
Arthur Achleitner
|
Spiel mit der Liebe. Roman
|
|
42.
|
A. E. Brachvogel
|
Friedemann Bach. Roman
|
|
23.
|
E. Brontë
|
Der Sturmheidehof. Roman
|
|
4.
|
Paul Burg
|
Freudvoll und leidvoll. Roman
|
|
5.
|
Paul Burg
|
Meine Christel. Roman
|
|
6.
|
Paul Burg
|
Christels Ehe. Roman
|
|
7.
|
Paul Burg
|
Der schöne alte Herr. Roman
|
|
9.
|
Paul Burg
|
Der Mollwitzer Schimmel. Roman
|
|
31.
|
A. Dumas-Sohn
|
Die Dame mit den Kamelien. Roman
|
|
32.
|
A. Dumas-Sohn
|
Die Dame mit den Perlen. Roman
|
|
10.
|
Otto E. Ehlers
|
Indische Reisebilder
|
|
11.
|
Paul Oskar Höcker
|
Die Sonne von St. Moritz. Roman
|
|
12.
|
Paul Oskar Höcker
|
Dodi. Roman
|
|
13.
|
Paul Oskar Höcker
|
Verbotene Frucht. Roman
|
|
14.
|
Paul Oskar Höcker
|
Das flammende Kätchen. Roman
|
|
15.
|
Paul Oskar Höcker
|
Fasching. Roman
|
|
35.
|
Victor Hugo
|
„1793“. Roman
|
|
17.
|
Hermann Löns
|
Was da kreucht und fleugt. 20 Tier- und Jagdgeschichten
|
|
22.
|
Henriette von Meerheimb
|
Die verlorene Krone. Roman
|
|
19.
|
Rudolph Stratz
|
Die Hand der Fatme. Roman
|
|
20.
|
Rudolph Stratz
|
Zum weißen Lamm. Roman
|
|
21.
|
Rudolph Stratz
|
Liebe um Barbara. Roman
|
|
18.
|
Adolf Streckfuß
|
Der Oberförster von Margrabowo. Roman
|
|
45.
|
Luise Westkirch
|
Der Todfeind. Kriminalroman
|
|
39.
|
Fedor von Zobeltitz
|
Das Glück der Eva Sporrschild. Roman
|
In jeder guten Buchhandlung vorrätig!
Gebrüder Paetel Verlag / Berlin
Von
Hans Hoffmann
erschienen in unserem Verlage:
Landsturm
Roman
Der eiserne Rittmeister
Roman
Wider den Kurfürsten
Roman
Geschichten aus Hinterpommern
Vier Novellen
Der Hexenprediger und andere Novellen
Tante Fritzchen
Skizzen
Von Frühling zu Frühling
Bilder und Skizzen
Das Gymnasium zu Stolpenburg
Novelle
Verlag von Gebrüder Paetel / Berlin
End of Project Gutenberg's Unter den Hohen Tauern, by Arthur Achleitner
*** END OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK UNTER DEN HOHEN TAUERN ***
***** This file should be named 63802-h.htm or 63802-h.zip *****
This and all associated files of various formats will be found in:
http://www.gutenberg.org/6/3/8/0/63802/
Produced by the Online Distributed Proofreading Team at
https://www.pgdp.net
Updated editions will replace the previous one--the old editions will
be renamed.
Creating the works from print editions not protected by U.S. copyright
law means that no one owns a United States copyright in these works,
so the Foundation (and you!) can copy and distribute it in the United
States without permission and without paying copyright
royalties. Special rules, set forth in the General Terms of Use part
of this license, apply to copying and distributing Project
Gutenberg-tm electronic works to protect the PROJECT GUTENBERG-tm
concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark,
and may not be used if you charge for the eBooks, unless you receive
specific permission. If you do not charge anything for copies of this
eBook, complying with the rules is very easy. You may use this eBook
for nearly any purpose such as creation of derivative works, reports,
performances and research. They may be modified and printed and given
away--you may do practically ANYTHING in the United States with eBooks
not protected by U.S. copyright law. Redistribution is subject to the
trademark license, especially commercial redistribution.
START: FULL LICENSE
THE FULL PROJECT GUTENBERG LICENSE
PLEASE READ THIS BEFORE YOU DISTRIBUTE OR USE THIS WORK
To protect the Project Gutenberg-tm mission of promoting the free
distribution of electronic works, by using or distributing this work
(or any other work associated in any way with the phrase "Project
Gutenberg"), you agree to comply with all the terms of the Full
Project Gutenberg-tm License available with this file or online at
www.gutenberg.org/license.
Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project
Gutenberg-tm electronic works
1.A. By reading or using any part of this Project Gutenberg-tm
electronic work, you indicate that you have read, understand, agree to
and accept all the terms of this license and intellectual property
(trademark/copyright) agreement. If you do not agree to abide by all
the terms of this agreement, you must cease using and return or
destroy all copies of Project Gutenberg-tm electronic works in your
possession. If you paid a fee for obtaining a copy of or access to a
Project Gutenberg-tm electronic work and you do not agree to be bound
by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the
person or entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph
1.E.8.
1.B. "Project Gutenberg" is a registered trademark. It may only be
used on or associated in any way with an electronic work by people who
agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few
things that you can do with most Project Gutenberg-tm electronic works
even without complying with the full terms of this agreement. See
paragraph 1.C below. There are a lot of things you can do with Project
Gutenberg-tm electronic works if you follow the terms of this
agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg-tm
electronic works. See paragraph 1.E below.
1.C. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation ("the
Foundation" or PGLAF), owns a compilation copyright in the collection
of Project Gutenberg-tm electronic works. Nearly all the individual
works in the collection are in the public domain in the United
States. If an individual work is unprotected by copyright law in the
United States and you are located in the United States, we do not
claim a right to prevent you from copying, distributing, performing,
displaying or creating derivative works based on the work as long as
all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope
that you will support the Project Gutenberg-tm mission of promoting
free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg-tm
works in compliance with the terms of this agreement for keeping the
Project Gutenberg-tm name associated with the work. You can easily
comply with the terms of this agreement by keeping this work in the
same format with its attached full Project Gutenberg-tm License when
you share it without charge with others.
1.D. The copyright laws of the place where you are located also govern
what you can do with this work. Copyright laws in most countries are
in a constant state of change. If you are outside the United States,
check the laws of your country in addition to the terms of this
agreement before downloading, copying, displaying, performing,
distributing or creating derivative works based on this work or any
other Project Gutenberg-tm work. The Foundation makes no
representations concerning the copyright status of any work in any
country outside the United States.
1.E. Unless you have removed all references to Project Gutenberg:
1.E.1. The following sentence, with active links to, or other
immediate access to, the full Project Gutenberg-tm License must appear
prominently whenever any copy of a Project Gutenberg-tm work (any work
on which the phrase "Project Gutenberg" appears, or with which the
phrase "Project Gutenberg" is associated) is accessed, displayed,
performed, viewed, copied or distributed:
This eBook is for the use of anyone anywhere in the United States and
most other parts of the world at no cost and with almost no
restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it
under the terms of the Project Gutenberg License included with this
eBook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the
United States, you'll have to check the laws of the country where you
are located before using this ebook.
1.E.2. If an individual Project Gutenberg-tm electronic work is
derived from texts not protected by U.S. copyright law (does not
contain a notice indicating that it is posted with permission of the
copyright holder), the work can be copied and distributed to anyone in
the United States without paying any fees or charges. If you are
redistributing or providing access to a work with the phrase "Project
Gutenberg" associated with or appearing on the work, you must comply
either with the requirements of paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 or
obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg-tm
trademark as set forth in paragraphs 1.E.8 or 1.E.9.
1.E.3. If an individual Project Gutenberg-tm electronic work is posted
with the permission of the copyright holder, your use and distribution
must comply with both paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 and any
additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms
will be linked to the Project Gutenberg-tm License for all works
posted with the permission of the copyright holder found at the
beginning of this work.
1.E.4. Do not unlink or detach or remove the full Project Gutenberg-tm
License terms from this work, or any files containing a part of this
work or any other work associated with Project Gutenberg-tm.
1.E.5. Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this
electronic work, or any part of this electronic work, without
prominently displaying the sentence set forth in paragraph 1.E.1 with
active links or immediate access to the full terms of the Project
Gutenberg-tm License.
1.E.6. You may convert to and distribute this work in any binary,
compressed, marked up, nonproprietary or proprietary form, including
any word processing or hypertext form. However, if you provide access
to or distribute copies of a Project Gutenberg-tm work in a format
other than "Plain Vanilla ASCII" or other format used in the official
version posted on the official Project Gutenberg-tm web site
(www.gutenberg.org), you must, at no additional cost, fee or expense
to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means
of obtaining a copy upon request, of the work in its original "Plain
Vanilla ASCII" or other form. Any alternate format must include the
full Project Gutenberg-tm License as specified in paragraph 1.E.1.
1.E.7. Do not charge a fee for access to, viewing, displaying,
performing, copying or distributing any Project Gutenberg-tm works
unless you comply with paragraph 1.E.8 or 1.E.9.
1.E.8. You may charge a reasonable fee for copies of or providing
access to or distributing Project Gutenberg-tm electronic works
provided that
* You pay a royalty fee of 20% of the gross profits you derive from
the use of Project Gutenberg-tm works calculated using the method
you already use to calculate your applicable taxes. The fee is owed
to the owner of the Project Gutenberg-tm trademark, but he has
agreed to donate royalties under this paragraph to the Project
Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payments must be paid
within 60 days following each date on which you prepare (or are
legally required to prepare) your periodic tax returns. Royalty
payments should be clearly marked as such and sent to the Project
Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in
Section 4, "Information about donations to the Project Gutenberg
Literary Archive Foundation."
* You provide a full refund of any money paid by a user who notifies
you in writing (or by e-mail) within 30 days of receipt that s/he
does not agree to the terms of the full Project Gutenberg-tm
License. You must require such a user to return or destroy all
copies of the works possessed in a physical medium and discontinue
all use of and all access to other copies of Project Gutenberg-tm
works.
* You provide, in accordance with paragraph 1.F.3, a full refund of
any money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the
electronic work is discovered and reported to you within 90 days of
receipt of the work.
* You comply with all other terms of this agreement for free
distribution of Project Gutenberg-tm works.
1.E.9. If you wish to charge a fee or distribute a Project
Gutenberg-tm electronic work or group of works on different terms than
are set forth in this agreement, you must obtain permission in writing
from both the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and The
Project Gutenberg Trademark LLC, the owner of the Project Gutenberg-tm
trademark. Contact the Foundation as set forth in Section 3 below.
1.F.
1.F.1. Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable
effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread
works not protected by U.S. copyright law in creating the Project
Gutenberg-tm collection. Despite these efforts, Project Gutenberg-tm
electronic works, and the medium on which they may be stored, may
contain "Defects," such as, but not limited to, incomplete, inaccurate
or corrupt data, transcription errors, a copyright or other
intellectual property infringement, a defective or damaged disk or
other medium, a computer virus, or computer codes that damage or
cannot be read by your equipment.
1.F.2. LIMITED WARRANTY, DISCLAIMER OF DAMAGES - Except for the "Right
of Replacement or Refund" described in paragraph 1.F.3, the Project
Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project
Gutenberg-tm trademark, and any other party distributing a Project
Gutenberg-tm electronic work under this agreement, disclaim all
liability to you for damages, costs and expenses, including legal
fees. YOU AGREE THAT YOU HAVE NO REMEDIES FOR NEGLIGENCE, STRICT
LIABILITY, BREACH OF WARRANTY OR BREACH OF CONTRACT EXCEPT THOSE
PROVIDED IN PARAGRAPH 1.F.3. YOU AGREE THAT THE FOUNDATION, THE
TRADEMARK OWNER, AND ANY DISTRIBUTOR UNDER THIS AGREEMENT WILL NOT BE
LIABLE TO YOU FOR ACTUAL, DIRECT, INDIRECT, CONSEQUENTIAL, PUNITIVE OR
INCIDENTAL DAMAGES EVEN IF YOU GIVE NOTICE OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
1.F.3. LIMITED RIGHT OF REPLACEMENT OR REFUND - If you discover a
defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can
receive a refund of the money (if any) you paid for it by sending a
written explanation to the person you received the work from. If you
received the work on a physical medium, you must return the medium
with your written explanation. The person or entity that provided you
with the defective work may elect to provide a replacement copy in
lieu of a refund. If you received the work electronically, the person
or entity providing it to you may choose to give you a second
opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If
the second copy is also defective, you may demand a refund in writing
without further opportunities to fix the problem.
1.F.4. Except for the limited right of replacement or refund set forth
in paragraph 1.F.3, this work is provided to you 'AS-IS', WITH NO
OTHER WARRANTIES OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT
LIMITED TO WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR ANY PURPOSE.
1.F.5. Some states do not allow disclaimers of certain implied
warranties or the exclusion or limitation of certain types of
damages. If any disclaimer or limitation set forth in this agreement
violates the law of the state applicable to this agreement, the
agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or
limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or
unenforceability of any provision of this agreement shall not void the
remaining provisions.
1.F.6. INDEMNITY - You agree to indemnify and hold the Foundation, the
trademark owner, any agent or employee of the Foundation, anyone
providing copies of Project Gutenberg-tm electronic works in
accordance with this agreement, and any volunteers associated with the
production, promotion and distribution of Project Gutenberg-tm
electronic works, harmless from all liability, costs and expenses,
including legal fees, that arise directly or indirectly from any of
the following which you do or cause to occur: (a) distribution of this
or any Project Gutenberg-tm work, (b) alteration, modification, or
additions or deletions to any Project Gutenberg-tm work, and (c) any
Defect you cause.
Section 2. Information about the Mission of Project Gutenberg-tm
Project Gutenberg-tm is synonymous with the free distribution of
electronic works in formats readable by the widest variety of
computers including obsolete, old, middle-aged and new computers. It
exists because of the efforts of hundreds of volunteers and donations
from people in all walks of life.
Volunteers and financial support to provide volunteers with the
assistance they need are critical to reaching Project Gutenberg-tm's
goals and ensuring that the Project Gutenberg-tm collection will
remain freely available for generations to come. In 2001, the Project
Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure
and permanent future for Project Gutenberg-tm and future
generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary
Archive Foundation and how your efforts and donations can help, see
Sections 3 and 4 and the Foundation information page at
www.gutenberg.org
Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation
The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non profit
501(c)(3) educational corporation organized under the laws of the
state of Mississippi and granted tax exempt status by the Internal
Revenue Service. The Foundation's EIN or federal tax identification
number is 64-6221541. Contributions to the Project Gutenberg Literary
Archive Foundation are tax deductible to the full extent permitted by
U.S. federal laws and your state's laws.
The Foundation's principal office is in Fairbanks, Alaska, with the
mailing address: PO Box 750175, Fairbanks, AK 99775, but its
volunteers and employees are scattered throughout numerous
locations. Its business office is located at 809 North 1500 West, Salt
Lake City, UT 84116, (801) 596-1887. Email contact links and up to
date contact information can be found at the Foundation's web site and
official page at www.gutenberg.org/contact
For additional contact information:
Dr. Gregory B. Newby
Chief Executive and Director
gbnewby@pglaf.org
Section 4. Information about Donations to the Project Gutenberg
Literary Archive Foundation
Project Gutenberg-tm depends upon and cannot survive without wide
spread public support and donations to carry out its mission of
increasing the number of public domain and licensed works that can be
freely distributed in machine readable form accessible by the widest
array of equipment including outdated equipment. Many small donations
($1 to $5,000) are particularly important to maintaining tax exempt
status with the IRS.
The Foundation is committed to complying with the laws regulating
charities and charitable donations in all 50 states of the United
States. Compliance requirements are not uniform and it takes a
considerable effort, much paperwork and many fees to meet and keep up
with these requirements. We do not solicit donations in locations
where we have not received written confirmation of compliance. To SEND
DONATIONS or determine the status of compliance for any particular
state visit www.gutenberg.org/donate
While we cannot and do not solicit contributions from states where we
have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition
against accepting unsolicited donations from donors in such states who
approach us with offers to donate.
International donations are gratefully accepted, but we cannot make
any statements concerning tax treatment of donations received from
outside the United States. U.S. laws alone swamp our small staff.
Please check the Project Gutenberg Web pages for current donation
methods and addresses. Donations are accepted in a number of other
ways including checks, online payments and credit card donations. To
donate, please visit: www.gutenberg.org/donate
Section 5. General Information About Project Gutenberg-tm electronic works.
Professor Michael S. Hart was the originator of the Project
Gutenberg-tm concept of a library of electronic works that could be
freely shared with anyone. For forty years, he produced and
distributed Project Gutenberg-tm eBooks with only a loose network of
volunteer support.
Project Gutenberg-tm eBooks are often created from several printed
editions, all of which are confirmed as not protected by copyright in
the U.S. unless a copyright notice is included. Thus, we do not
necessarily keep eBooks in compliance with any particular paper
edition.
Most people start at our Web site which has the main PG search
facility: www.gutenberg.org
This Web site includes information about Project Gutenberg-tm,
including how to make donations to the Project Gutenberg Literary
Archive Foundation, how to help produce our new eBooks, and how to
subscribe to our email newsletter to hear about new eBooks.