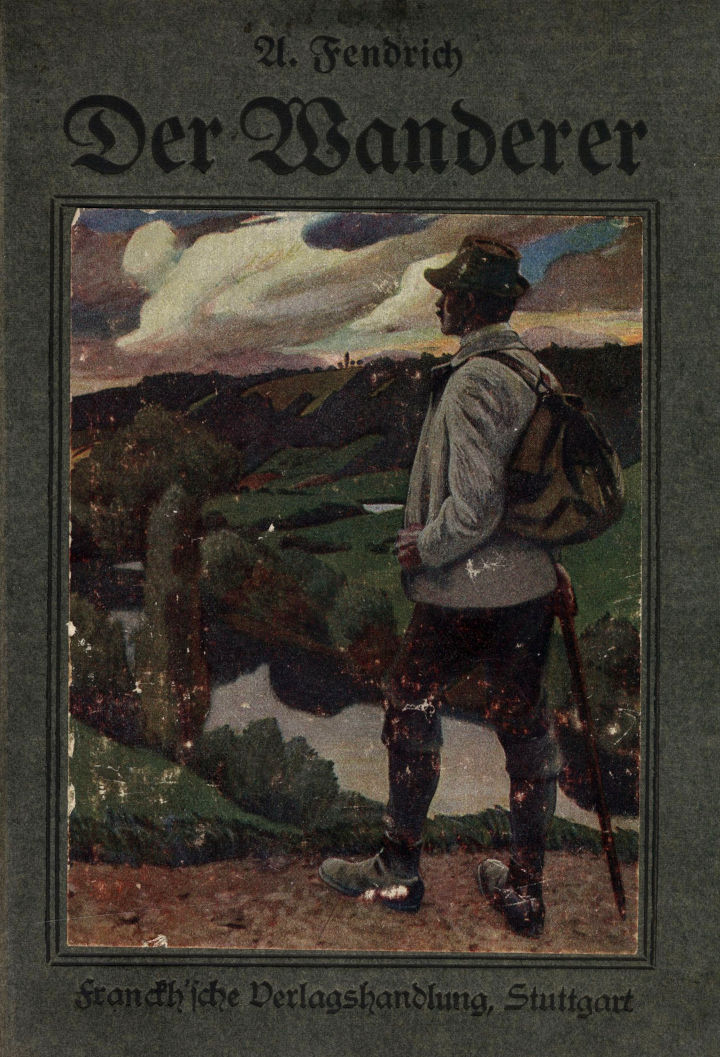
Anmerkungen zur Transkription
Das Original ist in Fraktur gesetzt. Im Original gesperrter Text ist so ausgezeichnet. Im Original in Antiqua gesetzter Text ist so markiert. Ein im Original unleserlicher Name wurde durch *** ersetzt.
Offensichtliche Fehler wurden stillschweigend korrigiert.
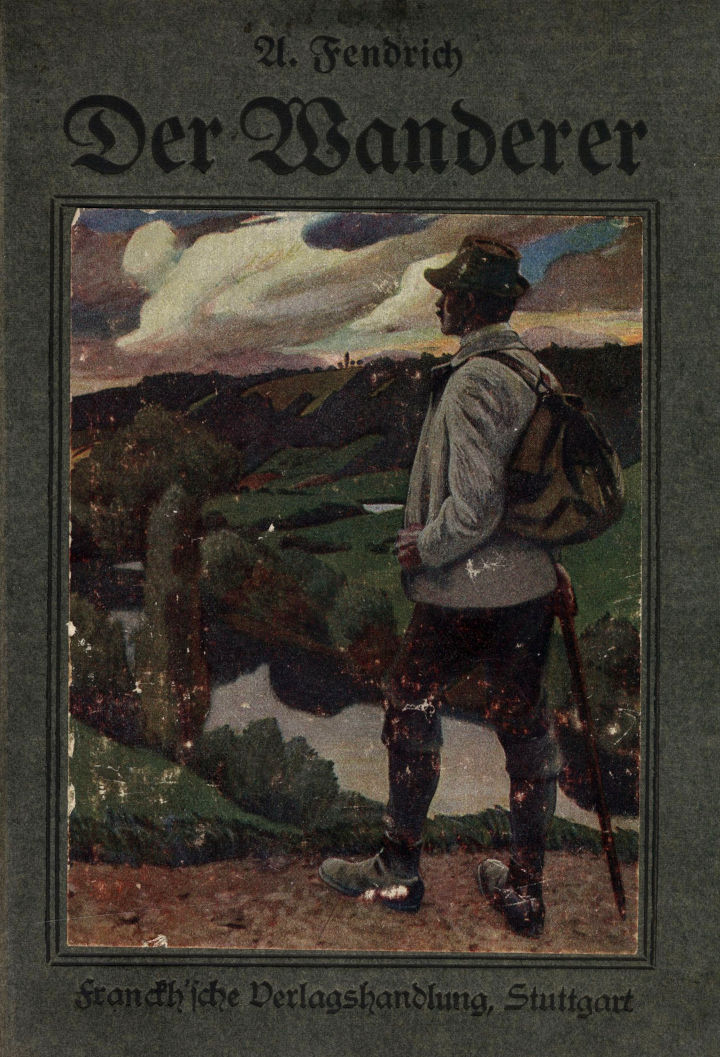
Von
A. Fendrich
Mit 8 Tafeln und zahlreichen Textabbildungen nach Originalaufnahmen
Sechste Auflage

Franckh'sche Verlagshandlung, Stuttgart
Copyright 1920 by
Franckh'sche Verlagshandlung
Stuttgart
Druck der Stuttgarter Vereins-Buchdruckerei.
Meinem guten Kameraden
in Treue
Weihnachten 1912
Der Verfasser
| Seite | |
| Allgemeines und Historisches. | |
| Das Wandern, ja das Wandern | 5 |
| Aus alten Scharteken | 12 |
| Von der Heimat | 16 |
| Zur Psychologie des Wanderns. | |
| Vom Rhythmus der Jahreszeiten | 19 |
| Allerlei Heimatschutz | 24 |
| Schauen, nicht schwärmen | 28 |
| Wenn wir uns selbst im Lichte stehen | 30 |
| Vom Horchen in der Stille | 33 |
| Vom Überhopsen | 37 |
| Wie man wandern soll. | |
| Mit Kindern | 41 |
| Vom Kränzewinden | 43 |
| Einsam, zweisam, dreisam oder in Scharen? | 45 |
| Der Wanderschuh als Erzieher | 47 |
| Was man braucht. | |
| Des Wanderers Kleid | 51 |
| Der Rucksack | 53 |
| Von den Schuhen und den Füßen | 55 |
| Vom Essen und vom Trinken | 58 |
| Vom Knipsen | 63 |
| Menschlich-Allzumenschliches. | |
| Aphorismen | 70 |
| Menschen | 73 |
| Hinaus! | 76 |
| An die jungen Männer | 80 |
| An die jungen Mädchen | 81 |
| Vom neuen Wandern. | |
| Von Wiesen und Bäumen | 83 |
| Vom Wald | 86 |
| Von der Heide, der Marsch und der Geest | 89 |
| Wie man Städte ansehen soll | 94 |
| Die deutschen Lande | 99 |
| An die Alten und die Jungen | 106 |
| Die Natur. (Ein Schlußwort) | 109 |
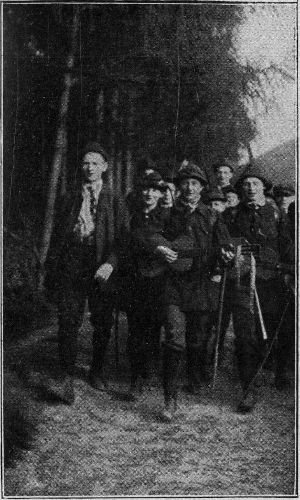
Phot. Ad. Saal.
Wandervögel.
Schlicht, fast dürftig kommen sie dahergezogen, die fünf Wörtlein im alten Liede »vom Wandern«, ja »vom Wandern« – und bergen unter ihrem unscheinbaren Gewande ganze Welten. Stürmisch und laut jubelnd, dann wieder mit gedankenschwerer Bedächtigkeit oder vor sich hinschlendernd mit leichten Sinnen, dann aber auch einmal ausschreitend in festem Schritt stämmiger Männlichkeit und schließlich leise auf den Zehenspitzen gehend und geheimnisvoll nickend und mahnend, so kommen sie immer anders wieder im Kehrreim des Liedes, die tiefen, schlichten, kleinen Worte.
Was ist's, das aus ihnen singt wie helle, hohe Knabenstimmen an einem keuschen, kühlen Taumorgen? Was ist's, das aus der Zeile schwingt wie dumpfes Geläut von versunkenen Glocken? Was klingt aus ihnen wie klarer, harter Männergesang von rauhem Felsenweg herab? Und was ringt sich aus ihnen los und nickt und winkt wie verborgene Weisheit?
Es ist das Leben, das brausende und sausende, das liebe und trübe; das Leben, in dem nicht weit von den Wiegen die Särge stehen; das Leben, das Glück und Leid nebeneinander auf die gleiche Bank gesetzt hat; das Leben, wo der Männerklarheit sentimentale Schwäche ins Handwerk pfuscht und wo die Weisheit nicht[6] so weit von der Narrheit wohnt, daß sich die beiden nicht die Hände reichen könnten.
Mensch sein, das heißt nicht nur Kämpfer, sondern auch Wanderer sein. In allen Dingen. Wer nicht gelernt hat, alles als Wanderer anzusehen, mit hellen, unbestechlichen Augen, aber auch mit dem warmen Glanz der Güte; wer nicht weiß, stets vor sich hinzusehen auf den Pfad und dessen Hindernisse, anstatt die Nase in der Luft zu tragen; wer nicht ohne Wehmut und ohne Haß alles hinter sich lassen kann, Schönes und Häßliches, an dem er einmal vorbeigeschritten ist, der kennt nicht das Geheimnis des Wanderns.

Phot. R. Hilbert, Rathenow.
Gewitterstimmung an der Havel.
Leicht und hell sollen wir wandern: über Berg und Tal, im Ringen um die Anhöhe einer befreienden Weltanschauung, im Kampf um Brot und Heim, wie auch im dunkeln, dumpfen Gedränge der feindlichen Gewalten in unserer Brust; immer sollen wir Wanderer sein, vom Frühling bis in den Winter unseres Lebens. Immer müssen wir bereit stehen mit gegürteten Lenden und dem Stab in der Hand, weiter zu gehen, vorwärts zu dringen und aufwärts.
So ist das Leben oder soll es sein. Leben sollen wir und streben, nicht kleben.
Das müßte aber ein schlechter Wanderer sein, der immer nur Sonnenschein und linde Lüfte erwartete für seine Fahrten und es nicht erfahren hätte, daß Regen und Sturm und Nebel und Kälte nichts sind als gütige Gaben, die wir mit ebenso dankbaren Händen nehmen sollten wie die Himmelsbläue und die Balsamdüfte[7] der guten Tage. Denn wir werden der ganzen Herrlichkeit des strahlenden Himmelslichts nur inne, weil es nicht immer scheint. Alles Immerwährende wird Zustand. Und »Zustand« – hat Goethe einmal gesagt – »ist ein grauenhaftes Wort«. Leider ist in der Zeit des Goethedienstes das Wort fast unbekannt. Jeder Zustand, auch der schönste, wird auf die Dauer gähnende Langeweile. Wer einmal eine lange Prozession wolkenloser Sonnentage im weiten Süden über sich ergehen lassen mußte, der weiß erst recht den wirren Wechsel unseres Klimas zu schätzen. Nur ständiger Wechsel ist beglückendes Leben, und das Wandern beglückt und entzückt uns nur aus dem gleichen Grunde.
Das Wandern von allem zu allem im Weltall, das allein erhält das Leben und läßt es nicht versinken. Das Eisenmolekül wandert durch die Adern unserer Schläfen; der elektrische Funke wandert in seinem rasenden Tempo durch die Meere von Erdteil zu Erdteil; die Berge wandern, langsam abbröckelnd, in Jahrmillionen durch die Flüsse in die Ebene und ins Meer; und unsere Mutter Erde wandert seit Jahrmilliarden dankbar und treu um ihre Lebenspenderin – die Sonne.
Das monotone Motto der ständigen Bewegung, wie es der griechische Weise in den zwei Worten: »Alles fließt« geprägt hat, müßte farbiger und richtiger heißen: »Alles wiegt, alles wogt, alles wandert.«
»Das Wandern, ja das Wandern!«
Da kommen sie schon wieder, die fünf klugen, kleinen Worte, wohlgemut und froh. Und es ist auf einmal, als ob ein Tor aufgeschlagen würde, durch das wir aus dumpfer Enge weit hinaussehen in die sonnige Welt; es ist, als ob wir einen einsam über Hügelhöhen schreitend erblickten, einen Wandergesellen, der, aller Abenteuer gewärtig, frohgemut den Stecken schwingt und in die reinen Lüfte singt, was seine Brust erfüllt. Das Wehen und das Rauschen des Walddoms, das übermütige Geglucker der kleinen Wiesenquellen, das Bimmeln und Läuten ziehender Herden – alles das lebt in den fünf kleinen Worten. Sie singen vom Frohlocken eines heimlichen Königskindes, das sich verlaufen hatte und in Gefangenschaft geraten war und nun jubelt über die wiedergewonnene Freiheit – des heimlichen Königskindes, das sich nun wieder tragen lassen darf von den Wogen eines größeren Lebens, auf denen es neue Fahrten wagt nach neuen Ufern.
Denn zu den Wogen gehört das Wagen. Etwas einsetzen können, das ist der wirklichen Menschen Lust. Das Leben ist umsonst, der Tod ist umsonst, und da ist es doch verständlich, daß wir uns nicht[8] lumpen lassen wollen und auch mit etwas herausrücken. Und was haben wir zu geben. Nichts als das Leben.
Das macht die Wanderfahrten kühner Menschen so wunderbar, daß sie aus der stumpfen Behaglichkeit ausziehen auf gefahrvolle Entdeckungsreisen, deren Ertrag erst durch den ständigen Einsatz ihres Lebens seinen ganzen, großen Wert erhält.

Phot. R. Hilbert, Rathenow.
Heimkehr.
Die Klage über die Leerheit und Öde des Daseins in so vielen Berufen, besonders in Beamtenkreisen, rührt nicht zum mindesten daher, daß das Leben dieser Unzufriedenen geregelt ist wie ein langweilig pendelndes Uhrwerk. Wenn sie einmal aufgezogen sind, dann wissen sie genau, wie der Tag verläuft, wie ihre Karriere sein wird, wann sie befördert und wann sie pensioniert werden, um »in Ruhe« ihre letzten Tage genießen zu können. Das Unerwartete, das Unerhörte, kurz das Abenteuer spielt in ihrem wohlregistrierten Leben keine Rolle mehr. Ihre Existenz ist ein unveränderliches Programm mit festliegenden Nummern. Ihr Dasein ist so sicher eingeschachtelt, daß es nicht wundernehmen kann, wenn die Sehnsucht nach nervenpeitschenden Sensationen und nach einem schrillen Gegenklang zu ihrem inhaltlosen Normaldasein gerade in diesen Kreisen nichts Ungewöhnliches ist. Das Leben unendlich vieler tüchtiger Menschen ist so »ordentlich«, so grauenhaft ordentlich geworden, daß Unordentlichkeiten bis zu starken Exzessen in aller Heimlichkeit als Ausgleich dienen müssen.
Was wäre für diese Armen das Wandern, ja das Wandern?
Die Lust nach Unvorhergesehenem und der Drang nach zeitweiliger Verrückung des normalen Ablaufs der Dinge nimmt in unserer Zeit deshalb so beängstigend ab, weil wir nichts mehr wissen von dem leichten Sinn und dem sonnigen Humor derer, denen das Wandern eine Kunst war und die auch durch des Lebens Gefilde lieber tanzend schritten als keuchend. Da muß ich an meinen alten[9] Onkel Schang denken, der sein Leben lang ein Wagnergesell war und bis über die Siebzig hinaus wandernd Europa durchzog, von Schweden bis nach Italien und von Paris bis in die Türkei. Er rührte, was nicht unwichtig ist, bis zum fünfzigsten Jahr keine geistigen Getränke an und arbeitete überall nur so lange, bis er wieder einige Monate lang ein freies Leben führen konnte. Alle paar Jahre kam er einmal ins Heimatdorf, aber lange hielt er es nicht aus. Seine alten Kameraden fragten ihn zu viel, und er war sein Lebtag nie fürs viele Reden. Als sie ihn aber einmal gar zu zäh ausforschten, warum er wieder in der Welt umherfahren wolle, er, ein so geschickter Krummholz, der zu Hause doch ein schönes Geld verdienen könnte, da hob er den Zeigefinger in die Höhe und hielt einen seiner ganz seltenen kleinen Vorträge: »Schaut,« sagte er, »es gibt halt zweierlei Menschen auf der Erde: wir, die wandern, und ihr, die andern! Ihr seid einfach ein wenig zu kurz gekommen. Euch fehlt halt etwas, wißt ihr was?« Natürlich brachten's die Zuhörer nicht heraus, was er meinte, und der Onkel Schang fuhr fort: »Euch fehlt das große W! Alles Große fängt mit einem W an. Das große W ist das erste, was wir schon von der Geburt an kennen lernen: Das Weh!« Die Bauern lachten, er aber fuhr ganz ernst weiter: »Die Welt fängt mit einem großen W an und der Wald und das Wandern und die Weibervölker und die Wunder, von denen ihr nichts versteht; und die Weisheit, die ihr noch lange nicht mit Löffeln gefressen habt, wenn ihr's auch meint; und die Wahrheit, die ich euch jetzt um die Ohren schlage!« Er machte eine Pause und sagte zuletzt ganz leise: »Und der Wein!« Denn er hatte bei dieser Rede die Fünfzig schon überschritten.
So wird's mit dem Onkel Schang schon gewesen sein wie mit dem Taglöhner, von dem die Ebner-Eschenbach erzählt. Er war ein lustiger Geselle, spielte gern die Laute und wurde im Dorf für einen Taugenichts gehalten. Er starb zu gleicher Zeit wie ein anderer Sohn des Dorfes, der in die Welt gegangen und ein berühmter Schriftsteller und Dichter geworden war. Beide wurden zu gleicher Stunde begraben. Kein Mensch gab dem »Dorflumpen« die letzte Ehre. Da trat eine große, schöne Frau in wallendem Gewand an sein Grab, legte einen Lorbeerzweig auf den Tannensarg und sagte mit einer Stimme, wie sie nur den Göttinnen eigen ist: »Das war ein Dichter!« Dann ging sie hinüber an das Grab des berühmten Mannes, das von einer großen Menschenmenge umstanden war, schritt auf den reichgeschmückten Sarg zu, blickte die Menschenmenge ruhig an und sprach: »Das war ein Taglöhner!«
Ja, die Dichter, die haben's mit dem Wandern. Wenn sie durch Wald und Felder ziehen, dann offenbart sich ihnen das Leben. Aber ein anderes. Es wird schon so sein, daß es mehr als eines gibt; nicht im Jenseits, von dem wir nichts wissen, sondern im Diesseits.

Phot. R. Hilbert, Rathenow.
Letzte Sonnenstrahlen im Heidewald.
Ich weiß einen Arzt, der nie eine Rose in seinem Garten schneidet, ohne das Messer vorher so gut geschliffen zu haben, als ob er es bei der Operation eines seiner Patienten brauchte. Und ich weiß einen großen deutschen Maler, der von der wehmutvollen Gebärde einer alten Silberpappel am Bodensee so ergriffen wurde, daß ihm ein paar Tränen über die Wangen rollten. Und ich weiß einen Dichter, den einmal nach einem fröhlichen Gelage in einer kühlen Weinlaube am Schwäbischen Meer einige zu Gast geladene Bekannte fragten, was er eigentlich über Gott und die Natur denke. »Blödsinnige Frage!« Das war zunächst seine Antwort. Als sie aber nicht abließen, gab er nach und sagte: »Na ja, wenn ich eben einmal draußen herumlaufe und nicht an blühenden Büschen und Hecken vorbeikomme, ohne ihnen mit der Hand über die Schöpfe zu fahren und ihnen ein gutes Wort zu sagen, dann, na ja, dann spür' ich eben[11] etwas.« Die anderen sahen ihn, was nicht allein von den zu vielen Schoppen kam, starr und verständnislos an; der Dichter aber ärgerte sich darüber, daß er doch nachgegeben und Perlen verschleudert hatte, und fügte seiner Antwort noch vier kraftvolle Worte hinzu, an denen wir jedoch lieber in raschem Schritt und Tritt vorüberwandern wollen.
Und zu guter Letzt, da die fünf kleinen, wissenden Wörtchen hören, daß von Dichtern die Rede ist, kommen sie noch einmal auf leisen Zehen herbeigeschlichen und sagen still und feierlich:
»Das Wandern, ja das Wandern!«

Phot. W. Groothoff.
Fahrende Scholaren.
Und wieder geht ein Tor auf, und ich sehe, wie ein anderer Dichter, der erst vor kurzem heimgegangen ist und von dessen Existenz die Welt jetzt erst durch seine posthumen Werke erfahren hat, zusammen mit mir in einer warmen Sommernacht ausruht auf einer weiten Bergwiese. Wir sahen in das Zucken und Lodern der Welten am Himmelszelt und schwiegen miteinander. Da kam ihn auf einmal die übermütige Laune derer an, die mit lebendiger Seele sterben, und er sagte: »Eigentlich sind wir doch hier nirgends als in einer Weltallsherberge – Allerweltsherberge«, korrigierte er sich lachend. »Diejenigen, welche zu tief in der Kreide stehen oder sich der Hausordnung nicht fügen wollen, werden nach mehrmaliger Verwarnung hinausgeworfen vom Hausknecht – dem Herrn Mors. Ich meine immer, sie lassen mich nicht mehr lange sitzen.« So sprach er mit tragischem Humor! Er wußte, wie es um ihn stand. Dann spürte ich seine Hand an der meinigen und hörte seine immer noch metallen klingende Stimme einen Reim sagen wie eine Strophe, die aus einem neuen Wanderlied in die warme Sternennacht hinausklang:
Bald darauf ging er, ein kosmischer Wanderer. Wir aber, die anderen, die noch nicht so weit sind, wollen zuerst einmal das Wandern auf unserem Stern und auf gutgesohlten, irdischen Stiefeln erlernen.
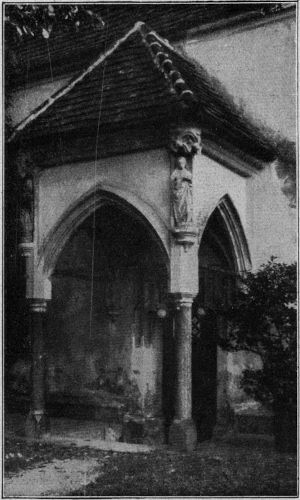
Phot. Fidelis Mayer, Altötting.
Portal einer Schloßkapelle in Burghausen.
Der Sinn zum Wandern kann nicht erworben werden, auch nicht durch die Mitgliedschaft zu einem der vielen Wandervereine, wie sie jetzt unter dem warmen Regen der »Naturbewegung« aus dem Boden schießen. Es ist mit dem Wandern wie mit dem Glauben. Es muß etwas Angeborenes sein, ein Geschenk – wenn man will, eine Gnade. Daß die moderne Naturschwärmerei ein Erzeugnis unserer Großstadtkultur ist und daß dabei oft nur das Abenteuer, wie zum Beispiel eine im Heuschober zugebrachte Nacht, den Hauptreiz bildet, das wissen alle Nüchternen. Im Grunde ist das modische Wandern eigentlich nur die Reflexbewegung der in öden Straßen, steinernen Mietkasernen und im Gewirr eines mit Licht- und Schallreklame arbeitenden Großhandels ermüdeten Menschen. Wer wollte das leugnen? Der Mensch der Großstadt streckt eben wie ein Kind die sehnsüchtigen Hände hinaus nach den Blumen und Bächen und Vögeln und Schmetterlingen eines verlorenen Paradieses.
Aber erklärt das alles?
Haben denn vor anderthalb Jahrhunderten die tobenden Universalgenies und die schmachtenden Werthers der »Sturm- und Drangperiode« nicht auch versucht, ihren Weltschmerz und ihre stürmischen Leidenschaften zu vergessen und zu ertränken im wonnigen Meer der blühenden Feldeinsamkeiten und im beredten Schweigen des Waldgeflüsters? Und all das, obwohl die lächerliche Ländlichkeit des Verkehrs in den Kleinstädten jener Zeit nicht so nervenzerrüttend war, daß der Durst nach dem »Busen der Natur« daraus hätte entstehen können. Das war die Zeit, wo man nach Einbruch der Nacht sich ohne Laterne im Schmutz auch der hochansehnlichsten Straßen von Residenzstädten nicht zurechtfinden konnte, und wo die damaligen Stadtpläne mit ihrem heimeligen Durcheinander von lauschig duftenden Gärten und kühl verschwiegenen Häusern geradezu ein Ideal für die heute so bescheiden gewordene Gartenbewegung darstellten.
Das Wandern steckt dem Menschen eben von Anbeginn an in den Gliedern. Als Adam seine erste, überraschend schnell nötig gewordene Reise antrat – wer weiß, ob ihm trotz des Abschiedsschmerzes schließlich nicht das Herz aufgegangen ist ob all des Neuen, was er zu sehen bekam?! Um so mehr, als er seine Freude teilen und sie dergestalt doppelt genießen konnte. Wenn man es innewerden will, daß das Wandern eine alte Sucht, vielleicht auch eine alte Tugend eines Teils der Menschen ist, so braucht man nur die ersten Bücher aufzuschlagen, darinnen von der Menschheit Glück und Schmerz die Rede ist, den Pentateuch, die alten Propheten und – ja nicht zu vergessen – das Hohelied des Königs Salomo und die Weisheit des Jesus Sirach. Wenn es da irgendwo einmal ans Wandern geht, sei es bei dem Auszug aus Ägypten, was immerhin schon eine ganz ansehnliche Leistung gewesen sein muß, oder wenn der junge Tobias mit seinem kleinen Schnauzer und dem inkognito ihm als Führer dienenden Erzengel auf die Brautschau geht, jedesmal weiß der Chronist mit den einfachen Mitteln jener wuchtigen, schlichten Sprache eine Reisestimmung zwischen die Zeilen hinzuzaubern, wie sie eben nur der geborene Wanderer kennt und wie sie mit ihrem vorausleuchtenden Schein alles noch viel schöner vorauserleben läßt, als es in der Wirklichkeit wird. Und – wohlgemerkt, die alten Mannen des Volkes Israel, die ja später das Wandern wie kein anderes Volk sozusagen als Schicksal lernen mußten, verstanden sich auf das genußfreudige, anspruchslose Wandern, ohne großes Getöse zu machen, und hatten dabei die Augen immer weit offen. Ich habe für diejenigen, die[14] es nicht für Wert halten oder nicht die Zeit haben, die Originale selber nachzulesen, an anderer Stelle (im Kapitel vom Rhythmus der Jahreszeiten) Proben von Naturschilderungen im Alten Testament gegeben. Denn – darüber sollten wir uns klar sein – Wandern ohne eine innige Aufnahme der Natureindrücke durch ein »unbescholtenes, freies Auge«, wie es Gottfried Keller so wundervoll einfach nennt, das ist kein Wandern.
In unserer germanischen Literatur sind die Beweise eines hochentwickelten Wandersinns zahlreich genug für jene Lust am Wandern, die nur eine andere Art von Frömmigkeit ist. Diese Frömmigkeit hat sich bei unseren Altvordern besonders in der Vergeistigung und in der plastischen Gestaltung der Naturgewalten und Naturschönheiten in Zwergen und Kobolden, Halbgöttern und Riesen, Waldfeen und Göttern gezeigt und ist nichts anderes als die Empfindung der eigenen Kleinheit und das Streben über sich hinaus. Der »Wanderer« – wie oft tritt Wodan unter diesem Namen auf! – was will er anderes, als das All liebend in sich aufnehmen und in das dunkle Haus des eigenen, trotz seiner Göttlichkeit der Zeit und dem Raum unterworfenen Wesens die Lichtfluten und Farbenwellen der ganzen Schöpfung einströmen lassen?!
Wir besitzen in irischen Heldengedichten, die erst vor kurzer Zeit entdeckt wurden, Naturschilderungen von einer überraschenden Innigkeit. Dagegen sind alle historischen Urkunden, die über Wanderungen ganzer Völker oder auch einzelner Persönlichkeiten, besonders von Dichternaturen aus der Zeit von der Völkerwanderung bis zum 12. Jahrhundert, vorliegen, fast ohne jede Andeutung dafür, daß das Anschauen der Natur als Genuß empfunden wurde. Das Naturgefühl, d. h. der bewußte sehnsüchtige Drang, über das eigene Dasein hinaus nun am Leben der ganzen Schöpfung teilzunehmen, flammt erst mit Franz von Assisi und dann allerdings mit einer Gewalt auf, wie sie nur zu erklären ist aus der jahrhundertelangen Unterdrückung eines menschlich seelischen Bedürfnisses.
Die Technik des Wanderns und ihre Beschreibung in alten Scharteken, deren die meisten aus dem 17. und 18. Jahrhundert stammen, lassen in ihrer spießbürgerlichen Umständlichkeit und in der altjüngferlichen Schreckhaftigkeit vermuten, daß die vorangehende Zeit der Renaissance mit ihrer ausgeprägten Wirklichkeitsphilosophie für Natur nicht viel übrig hatte. Daß dieser Sinn bei den Menschen der Renaissance stark zurückgegangen ist, darauf läßt u. a. auch die dürftige Behandlung der Landschaft in den[15] großen Erzeugnissen der bildenden Kunst jener Zeit schließen, die eigentlich nur »den Menschen« kannte. Der Dreißigjährige Krieg und die darauffolgende Zeit des deutschen Barocks haben ihr übriges getan zur Vernichtung des erwachten Naturempfindens. Was wir dann später aus den Denkwürdigkeiten berühmter Leute aus dem 18. Jahrhundert kennen – ich denke gerade an die Ängste der Markgräfin von Bayreuth, der Schwester des alten Fritz, als sie »durch die fürchterlich beengenden Schluchten« des uns heute so sanft erscheinenden Thüringer Ländchens fuhr – und was wir aus ähnlichen zeitgenössischen Schilderungen wissen, das ist für uns Menschen des Wanderns und Reisens, der Hochtouristik und der großen geographischen Entdeckungen einfach von erfrischendem Humor.
Nicht weniger bekömmlich, besonders beim Eingeregnetsein in Gasthäusern oder Hütten oder als mittelbar wirkende Anregung vor Touren, ist das Lesen von alten Schmökern, wie z. B. »Die Kunst des Reysens im Schweyzergebirge« (1794) oder die Beschreibung der Fahrt, welche die Abgeordneten zum ersten badischen Landtag im Jahre 1806 vom Bodensee nach Karlsruhe zu unternehmen hatten, bei welcher Gelegenheit »außer vier höchlichst ermattenden Reysetagen in der Extrapost so an die sechzig Reichsgulden benebst Trinkgeldern« draufgingen.
Alles das und vieles andre soll dem Leser nur zum Bewußtsein bringen, daß wir am Anfang einer ganz neuen Periode der Naturbetrachtung stehen und daß für uns bei aller Hochachtung vor dem hohen Stand vieler Naturbeschreibungen von Dichtern vergangener Zeiten das meiste doch zu den alten »Scharteken« gehört. Wir befinden uns eben auf der Schwelle einer Zeit, in deren Tempeln nicht nur einzelnen Bevorzugten, sondern einem großen Teil des Volkes die Tore geöffnet werden zu zergliedernd-populärwissenschaftlichem Erkennen der Natur als einheitlicher Schöpfung (was hat in dieser Richtung nicht allein schon die Kosmosgesellschaft getan!) wie auch zu seelischer Aufnahme der Naturschönheiten als Mittel der Daseinsbereicherung. Jedes soziale Streben, das dem industriellen Proletariat mit der Verkürzung der Arbeitszeit auch den Ersatz für grobsinnliches Genießen gibt, wirkt von selbst in dieser Richtung. Uns muß die analytisch erkannte Natur wieder erlebte Offenbarung werden, so wie es Byron in einem für unsere rasche Zeit nun auch schon zur »Scharteke« gewordenen Buche aussprach:
Was seit Jahrhunderten und Jahrtausenden von Menschen, die Augen hatten, zu sehen, in alten Scharteken gesagt wurde, das muß endlich einmal für uns Kulturmenschen eroberte und festgehaltene Wirklichkeit werden. Sonst sind wir auch auf diesem Gebiet nicht Erfüller, sondern Vergeuder dessen, was die Vorzeit uns vorgearbeitet hat. Denn wir sollen nicht mehr als blinde Bettler, sondern als sehende Herren einer reichen Schöpfung dankbar über die Erde schreiten.
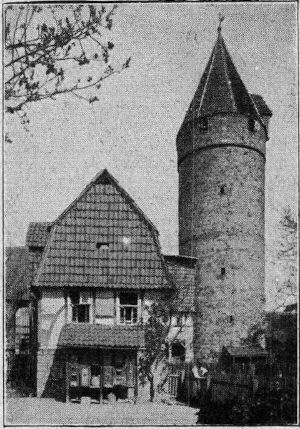
Hofphot. C. Eberth, Cassel.
Es ist eine eigene Sache mit der Heimat. So viele, die alles im Vaterlande über die Maßen gut eingerichtet fanden, solange ihr großes Bedürfnis nach Ellenbogenraum nicht beeinträchtigt wurde durch lieblose Mitmenschen von ähnlicher Gemütsveranlagung, wandten in späteren Jahren der Heimat den Rücken, klagten über »die hohen Steuern« und ähnliche »Mißstände« und kamen schließlich in dem Gedanken an ihre zunehmende Arterienverkalkung nicht mehr aus ausländischen Kurorten heraus. Sie lebten im Winter in Ägypten und im Sommer in der Nähe des Nordpols, und ihre Sonne ging ihnen manchmal unter hinter trübem Gewölke irgendwo in der Fremde.
Tafel I

Rud. Lichtenberg phot.
Pappelallee in Norddeutschland

W. Bandelow phot.
Abend auf der Elbe
Andere sind in der Jugend voll von gerechter Empörung gegen die Heimat, suchen die Wahrheit und die Liebe und womöglich[17] auch ihr Auskommen jenseits der deutschen Grenzpfähle, aber eines schönen Tages empfinden sie das unwiderstehliche Bedürfnis, sich vom Schneider ihres Vaterstädtchens – ja gerade von dem – einen neuen Anzug anmessen zu lassen, oder wieder einmal Knackwürste mit Kartoffelsalat zu essen, so wie früher bei der Mutter. Wenn sie dann nach tage- oder wochenlanger Reise zu Hause angekommen sind, finden sie die scharfsinnigsten Gründe zu immer neuen Verschiebungen der Abreise. Die Nachbarn nicken wissend mit dem Kopfe und blinzeln einander zu: »Aha, das Heimweh!« Der Heimgefundene nimmt aber am zunehmenden Goldglanz, der sich über die Wiesen und Wälder und Dörfer seiner Jugendstreifereien legt, wahr, daß er erst am Entdecken der Heimat ist. Und dann kommt eine selige Zeit. Dann wird alles Alte – die kleinen tosenden Bergbäche, aus deren Granitblöcken man als Sekundaner und als neuer Prometheus uneinnehmbare Burgen bauen wollte; die alten, langweiligen Flußdämme, auf denen man im Sturm und Regen hinraste, weil man sich für den unglücklichsten Menschen in der Welt hielt; die wenigen der von den »Anforderungen der Neuzeit« verschont gebliebenen alten Winkel und Gassen der Vaterstadt, die einem damals so trostlos langweilig und uninteressant vorkamen – all dies Alte wird neu und schöner. Eine ebenso unverstandene wie grenzenlose Dankbarkeit zieht einem durch das Herz, nur dafür, daß man gerade hier, in dieser Heimat, in diesem Winkel, im Wirbel des brausenden Lebens ins Dasein geschoben wurde.

Zur Verfügung gestellt vom Verein Naturschutzpark.
Schnuckenhirte in der Lüneburger Heide.
Dieses Stück vom Hängen am Engen ist eine der starken Wurzeln, ohne die der Mensch nicht werden kann. Die Bodenständigkeit ist aber kein Hindernis dafür, daß die Krone des Baums sich ausbreite, weit über den Wurzelgrund hinaus. Das Weltbürgertum ist für lange noch nur eine Sache der Seele, und auch die echte Demokratie ist vorerst nur im Reich des Geistes möglich. In dieser Welt der Erscheinungen hat alles Internationale seine Grenzen schon in der einfachen Tatsache der Stammes- und Rassenverschiedenheit der Menschen. Deshalb sind wir außer Alemannen, Schwaben, Märkern, Friesen usw. zunächst Deutsche. Und die Entdeckung Deutschlands ist – obwohl sogar die beiden Pole keine »weißen Stellen« auf der Weltkarte mehr sind – für die weitaus meisten Wanderer noch eine Tat der Zukunft. Wir kennen es nicht, unser Vaterland. So viele Dichter auch schon gesungen haben von der Schönheit der deutschen Lande, man hat im besten Falle gefühlvoll mitgesungen, alle die Lieder: »Von Frankreich bis zum Böhmerwald« und »Von dem Nordmeer bis zur Etsch«, aber gesehen, sehen wollen haben es wenige, auch die nicht, die es vermocht hätten. »Dann lieber schon was Richtiges!« hieß es. Die Schweiz, Italien oder neuerdings auch Indien und Japan.
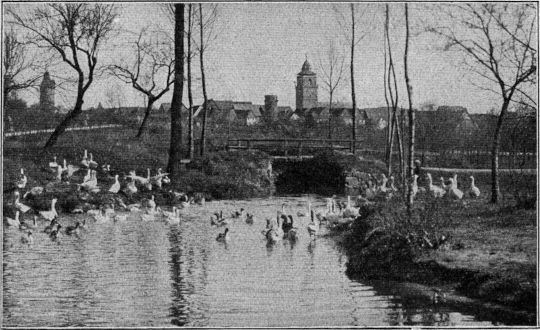
Hofphot. C. Eberth, Cassel.
Vorfrühling am Bach.
Vor wenigen Tagen erst habe ich gelesen, was einer unserer feinsten Wanderer und besten Erzähler, Hermann Hesse, über seine[19] indische Fahrt berichtet hat. Es war so viel Kühlheit, so viel vom Sichfremdfühlen in der Schilderung all der östlich-südlichen Pracht; sein Herz ging erst auf, als er auf dem höchsten Berg Ceylons in herber, großer Felsenlandschaft, umzogen von gewaltigen Wolkengebilden, die wer weiß was alles an Sturm und Donner, an Blitz und Licht gebären wollten, wieder an die Größe unserer nordischen Heimat erinnert wurde, »darin wir uns das verlorene Paradies selber bauen müssen, weil wir dort im alten Eden fremd geworden sind«. – Gott sei Dank, hätte ich fast gesagt zu dieser ergebenen Entschlossenheit des wehmütigen, wenn auch klaren Heimatsuchers und Dichters.
Wir fangen wieder an, etwas vom ewigen und beglückenden Wechsel der Dinge zu verstehen, obwohl uns die farbenschreiende Eintönigkeit des Stadtlebens die Sinne zur Wahrnehmung des Gewöhnlichsten in der Erscheinungswelt langsam geraubt hat. Wir ahnen es wieder, daß Leben nichts als Bewegung und Bewegung nichts als Wechsel ist. In der modernen Tanzkunst wird der Rhythmus, der nichts ist als bewußt geleiteter und organisch geordneter Wechsel, als Erlöser von Gedankenflucht und ähnlichen allgemein verbreiteten Nervenübeln, d. h. unrhythmisch ablaufenden unbeherrschten Körperfunktionen, mit Erfolg verwendet. Die Statistik entdeckt auf allen Lebensgebieten den Rhythmus als wichtiges Gesetz.
Aber vom großen Rhythmus der Jahreszeiten, der besonders in unserer gemäßigten Zone die unterschiedlichsten Bewegungskurven aufweist, kennt die Menschheit, als Ganzes genommen, vorerst nur das grob Sinnfällige, die gegenseitige Erhöhung aller Schönheitsunterschiede. In den vier Jahreszeiten wird zwar auch schon vom harmlosen Gemüte genossen, aber die leisen Übergänge und die zahllosen verstohlenen Kostümwechsel, an denen sich die Natur in jeder Jahreszeit ergötzt, die sind auch Wanderern von langjähriger Vereinsvergangenheit immer noch mit mehr als sieben Siegeln verschlossen. Da gibt's nur eine Hilfe: »Schauen lernen!«
In meiner Heimat fängt's schon an im Vorfrühling, wenn der müde Winter mit dem jungen Lenz seinen Strauß ausficht, und man, wie einmal Goethe seiner Frau v. Stein schrieb, »im streichenden Februarwind den kommenden Frühling riechen kann«.[20] Da blühen bei uns neben schmutzigen Schneezungen ganz schüchtern die ersten blaßgelben Primeln, und in den vom Schneewasser der Berge dunkeln Bächen lassen sich die goldenen Sumpfdotterblumen rütteln, daß man nicht weiß, ob's ihnen dabei eigentlich angst oder wohl ist. Am Rande dunkler Wälder, die in ahnungsvollem Schweigen darauf warten, was denn da wieder kommen will, schluchzen sehnsüchtige Drosseln, die sich nichts mehr weismachen lassen von dem immer schwächer werdenden Tyrannen, obwohl er noch jeden Morgen mit Schneeschauern, seinen letzten Rückzugskanonaden, dem leisen Knospen in allen Tälern bange machen will. Vorsichtig nimmt der große Himmelsmaler von seiner Palette vorerst einmal nur die ganz lichten, dünnen Farben: blasses Smaragdgrün für die sprießenden Wiesen, schüchternes Indischrot für die treibenden Buchenwälder und ein milchiges Blau für das Firmament. Damit lasiert er mehr, als daß er forsch darauflospinselt, denn: man kann nicht wissen!
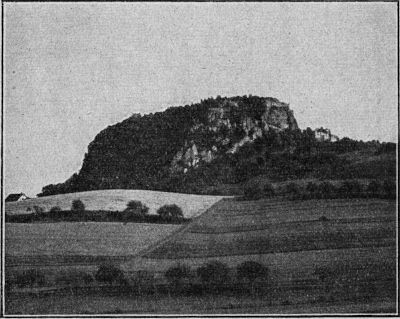
Hohentwiel. Von Norden gesehen.
Aber in irgendeiner lauen, von Feuchtigkeit schwangeren Nacht[21] und gerade dann, wenn natürlich kein Mensch es ahnt, wird heimlich alles neu; zuerst, wie es das Jungfräuliche an sich hat, voll beglückter Verschämtheit, dann aber mit der rasenden Inbrunst und mit der vollen Gewalt der Natur, wenn sie auf nichts mehr aus ist als auf das »Glück des heißen Diebstahls«. Mit satten Farben dringt die Schöpfung ans Licht, und der Himmel feiert wieder Hochzeit mit der alten Mutter Erde, die sich so gut auf die kosmetischen Künste, vielleicht sind es auch kosmische Künste, ewiger Verjüngung versteht.

Zur Verfügung gestellt von der Dampfschiffgesellschaft Oberweser, Hameln.
An der Oberweser.
Und während die Ebene sich schmückt, reicher denn eine Braut, haben die Berge alle Arbeit, mitzukommen. Aber wenn sie einmal in Feststimmung sind, dann geht es da droben in flottem Zeitmaß, und kaum ist die letzte Schneegrube versickert, da verwandelt schon die violette Pracht des mannshohen Wolfsmilchlattichs auch die greulichsten Schluchten in zauberhafte Hochzeitssäle für das leichtsinnige Volk der Mücken und Schmetterlinge. Die schwarzen Tannen regnen aus den Wipfeln Wolken von schwefelgelbem Blütenstaub über ihre eigenen Zweige. Kaum hat man sich's versehen, da bräunt sich schon nach einem kurzen heißen Sommer der spärliche Hafer auf den steinigen Feldern. Und noch einmal so lange, dann glühen die roten Beerenbüschel in dem Gezweig der Ebereschen, die überall im Schwarzwald längs der breiten, sauberen Straßen stehen wie Spaliere für heimliche Fürsten der Wanderkunst, unter denen manch einer oft nichts als eine erheblich flickbedürftige[22] Kluft sein eigen nennt. Drunten in der Ebene vollzieht sich die Zeit des Werbens und der Erfüllung in viel majestätischeren Formen. Da wogen zuerst grün, dann blaßgelb und schließlich braungolden die Fruchtfelder, und überall erklingt das Lied vom Reichtum der Natur und der Armut der Menschen, die das Glück überall da suchen, wo es nicht ist, und es fast nicht mehr für menschenwürdig halten, wenn sie sich nicht in allerhand Sommerfrischen mindestens ebenso gelangweilt haben wie innerhalb ihrer eigenen Pfähle, anstatt in ihrer so nahen und für sie doch so unnahbaren Herrlichkeit. Denn sie haben fast alle Augen, die nicht sehen; Augen, vor allem, die nichts davon wissen, daß alles, was man über Bäume, Wolken, Wälder, Bäche sagen kann, nichts ist als dürftiges Wortgestammel. Sie wissen nichts davon, daß auch der ärmlichste Baum keine Viertelstunde lang am gleichen Tage der gleiche ist, und daß der Wind und die Sonne und die Luft und das in ihr verborgen schwebende Wasser und tausend andere Dinge diesen einfachen Baum fast jede Minute verändern und aus ihm ein wechselndes Schauspiel für jede empfängliche Iris machen.
Auch was wir vom Winter wissen, ist nur erst der Anfang und nicht viel mehr, als was der feine Feuilletonist der Bibel, Jesus Sirach, mindestens auch schon wußte: »Durch des Herrn Wort fällt ein großer Schnee, und er läßt es wunderlich durcheinander blitzen, daß sich der Himmel auftut und die Wolken schweben, wie die Vögel fliegen. Er macht durch seine Kraft die Wolken dicht, daß Hagelsteine herausfallen. Durch seinen Willen wehet der Südwind und der Nordwind, und wie die Vögel fliegen, so wenden sich die Winde und wehen den Schnee durcheinander, daß er sich zu Haufen wirft, als wenn sich die Heuschrecken niedertun. Er ist so weiß, daß er die Augen blendet, und das Herz muß sich wundern solches seltsamen Regens. Er schüttet den Reif auf die Erde wie Salz, und wenn es gefriert, so werden Eiszacken wie die Spitzen an den Stecken. Und wenn der kalte Nordwind geht, dann wird das Wasser zu Eis. Wo das Wasser ist, da wehet er überher und zeucht dem Wasser einen Harnisch an.«
So kannte Jesus Sirach in dem Libanonwinter, der um Damaskus herum sich sogar zum Skilaufen eignen soll, die Winterherrlichkeit, die wir jetzt erst entdeckt zu haben glauben, schon vor zweitausend Jahren.
So ist der Wellengang der Jahreszeiten, von dem ich nur ein dürftiges Bild aus der Heimat selbst geben kann, in allen Gauen Deutschlands ein anderer, je nach der Bodengestaltung, dem Wasser- oder Waldreichtum und der Beschaffenheit der Ackererde.[23] Aber in der gleichen Gegend fällt es keinem Frühling ein, genau so Einzug zu halten wie sein Vorfahre des vergangenen Jahres. Und so wie jeder Sommer und Herbst läßt es sich auch kein Winter nehmen, durch angenehme und unangenehme Überraschungen die Menschen immer wieder das alte »πάντα ῥεῖ« (alles fließt) zu lehren. »Mehr Freude!« heißt heute die Parole. Einverstanden. Aber wenn nur jeder Mensch versuchte, anstatt immer in sein Sorgenherz täglich aus dem Fenster heraus die tausend kalendermäßigen und ordnungswidrigen Szenenwechsel seiner allernächsten Umgebung zu beobachten.
Aber jeder Mensch hat sein Steckenpferd, und so ist denn, wo auch das Wandern im Winter zu den trivialsten Alltäglichkeiten gehört, wird das Bekenntnis nicht mißverstanden werden, daß unter den Jahreszeiten meine heimliche Liebe der Winter ist.
Meine eigen heimliche Liebe ist doch die Zeit, wo in heimlichen Nächten die stille weiße Himmelsware des ersten Schnees auf die Welt herabsinkt, alle Ecken und Kanten in der Welt polstert und wattiert, den Wagen das Knarren und den Öfen das Faulenzen vertreibt, den Gäulen vor den Schlitten das Schellenzeug anhängt, und wo in der weißen Einsamkeit über heimliche Waldwiesen sich der erste Jauchzer eines beglückten Schneeschuhmenschen in die helle, kalte Winterluft schwingt. Das ist Tod und Leben zugleich, der weiße Tod um uns und das blutrote Leben in uns. Der schönste Gegentakt im Rhythmus zwischen Mensch und Natur.
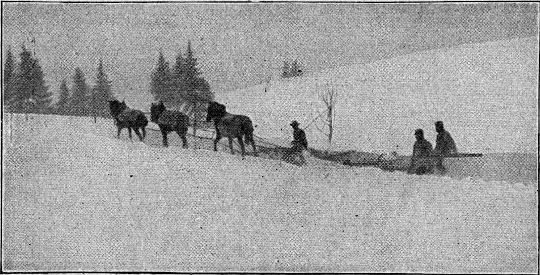
Phot. Dr. Biehler.

Phot. Hans Müller-Brauel.
Eine Braut aus der Lüneburger Heide.
Daß die Heimatschutzbewegung eine Kulturangelegenheit von tiefer Bedeutung geworden ist, wird kein ernsthafter Wanderer mehr bestreiten wollen. Der »Heimatschutz« macht so viel im guten von sich reden, daß es nicht von Schaden sein kann, wenn einmal der Empfindung so vieler Stillen im Lande Ausdruck verliehen wird, daß alles Wirken für Heimatschutz vor allem eine Sache persönlicher Begabung in dieser Richtung ist.
Zwei Typen von Heimatschützlern, deren Wirken nach Kräften zu unterbinden die Sache eines jeden Freundes seiner Heimat sein muß, treten in den letzten Jahren besonders stark in den Vordergrund.
Tafel II

Hofphotograph C. Eberth, Cassel, phot.
Erntezeit in Mitteldeutschland
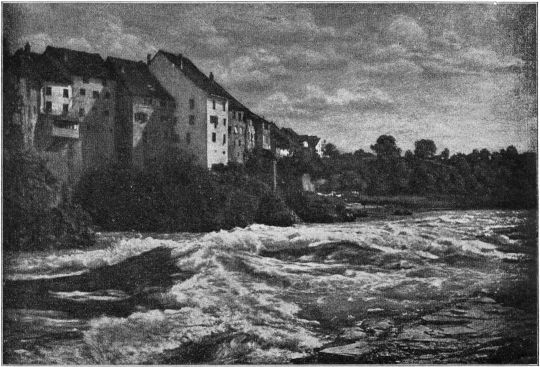
H. von Seggern phot.
Der Rhein bei Laufenburg
Das sind die Herren mit irgendeinem Titel und dann die Herren Privatiers, die sich aus reiner Langweile der »edlen Sache« opfern. Daß es viele hohe Beamte und Professoren ebenso wie im Ruhestand befindliche Geschäftsleute gibt, die geschickt und energisch ihre selbstgewählte Aufgabe als Schützer der Heimat auffassen, das schafft die Tatsache noch nicht aus der Welt, daß gerade Männer dieser beiden Sphären, die einen durch Überschätzung des Vereinswesens beim Heimatschutz und die andern, weil sie nur auf Erwerbung neuer »Freunde der Sache« aus sind, mancherlei Unheil anrichten und wenn auch nicht gerade hemmend, so doch auch nicht fördernd wirken. Die flammende Hingabe eines Rentiers, welcher der Erhaltung irgendeiner alten zerschlagenen wertlosen Sandsteinstatue viel Schweiß und Zeit opfert, in allen Ehren. Aber[25] beides hat mit dem Geist des echten Heimatschutzes ebensowenig zu tun wie der verbindliche Tadel, den ein für alles »Völkische« interessierter Professor in wohlgesetzten und wissenschaftlich einwandfreien Briefen für jede Scheuerntür übrig hat, deren Besitzer oder Verfertiger nach seiner Ansicht nicht genügend stilrein vorgegangen ist. Daß es sich hier um keine Übertreibungen handelt, kann man fast aus jeder Nummer der trefflichen Zeitschrift für Heimatschutz lesen, deren Schriftführer mit achtunggebietender Geduld und Zartheit immer wieder seine beweglichen Klagen in dieser Richtung ausspricht.

Mühle im Schwarzwald.
Was für den Heimatschutz nötig ist, das sind vor allem Männer, die mit ihrem ganzen Wesen in demjenigen Teil der deutschen Heimat wurzeln, dessen landschaftliche Eigenart sie erhalten wollen. Es sind Männer, welche die Sprache des Volkes verstehen und seine Art lieben und zu achten wissen. Wenn ein solcher die tiefe Bedeutung und die Notwendigkeit der Naturschutzbewegung erkennt und den »Naturschutz« nicht als Konservatorium für einzelne Raritäten, seien es Bäume, Denkmäler oder alte Häuser, anschaut, sondern im Sinne der Erhaltung des gesamten Landschaftsbildes als einer der Grundlagen unsrer Volkskraft und Volksgesundheit betrachtet, dann wird er in einem Jahr mehr leisten als ein aus irgendeinem fernen Teil Deutschlands in fremde Verhältnisse versetzter Gelehrter mit all seinen unbestrittenen Kenntnissen und seinem anerkennenswerten sachlichen Eifer für die Sache in einem Jahrzehnt.

Phot. Rud. Lichtenberg.
Am Rand des Kiefernwaldes.
Eine praktische Möglichkeit, ganz unauffällig für Heimatschutz zu wirken, wird von unseren »Fahrenden« viel zu wenig benutzt. Wenn sie mit einem nicht offensichtlich zur Schau getragenen, aber mit wenigen Worten harmlos ausgesprochenen Beifall oder Tadel beim Vorüberwandern an einem kleinen alten Bauernhaus,[26] dessen Fenster mit einem Flor blühender Geranien herausgeputzt sind, ihrer Empfindung Ausdruck geben, aber auch am Hof eines sogenannten Herrenbauern, der die Anfangsbuchstaben seines Namens mit Ziegeln meterhoch auf seinem Dach anbringen läßt, ihrem Mißfallen freien Lauf lassen, dann nutzt dies, wenn es häufig in einem Sommer geschieht, besser als Reden für Heimatschutz. Die Bauern sind in dieser Richtung viel feinfühliger, als junge Leute in der Stadt es sich träumen lassen, und alles auffällige Gebaren, besonders aber wohlwollend herablassende Vorträge haben die entgegengesetzte Wirkung. Die Bauern besitzen eine starke Empfindung für alles Gemachte. Ein Heimatschutz im positivsten Sinn des Wortes ist aber der stille Respekt, den die Wanderer vor dem einzelnen Menschen und vor dem ganzen Leben des Bauern auf ihren Fahrten an den Tag legen; der Respekt, der eigentlich nichts andres ist als das stetig wache Bewußtsein, hier zwischen den Äckern und Wäldern einer nicht standes- und vielleicht auch nicht stammesverwandten Bevölkerung Gastrecht zu genießen. Rechtlich liegt natürlich die Situation so, daß kein Wanderer den Bauern seiner Gegend, die er durchstreift, irgendwie zu Dank verpflichtet ist, selbst nicht, wenn es sich um Straßen handelt, die aus[27] Gemeinmitteln gebaut sind. Aber die wirkliche Bedeutung des Bauernstandes als der Wurzel der Volkskraft (wohlverstanden nur als Wurzel, die ohne die Krone einer hochentwickelten Kultur in sich selbst nicht überschätzt werden darf!) liegt jenseits aller Sentimentalität, wie denn überhaupt alle Bauernschwärmerei das sichere Zeichen von geistiger Mittelmäßigkeit und von Dilettantismus des nur nach »Kraft« sehnsüchtigen Dekadenten ist. Das schließt aber die sachliche Ehrung der Landbevölkerung und den ökonomischen Sinn für die Bedeutung des oft mit viel Schweiß und Gefahr eroberten Kulturbodens nicht aus. Man denke nur an den erbitterten Krieg, den die Bewohner der Vierlande mit der Schilf- und Rohrwildnis der Unterelbe zu führen hatten, bis jener Boden ihnen das tägliche Brot gab.

Phot. R. Hilbert, Rathenow.
Heimkehr vom Felde.
Jeder Wandersmann kann auf dem Lande bei den Bauern, die weder die »braven Menschen« noch die »hinterlistigen Brüder« sind, als die sie Oberflächlichkeit und Gescheittuerei gewöhnlich bezeichnen, unsagbar viel lernen, sowohl für den praktischen Sinn als auch für sein innerstes Leben. Denn die Helden des Alltags, die oft einem überschweren Schicksal eine harte Stirn bieten und mit hellen Augen in die unsichere Weite sehen, die sind am ehesten bei den »dummen Bauern« zu finden.
Wer also nicht nur für schöne alte Bäume und malerische Felsstücke sich ins Zeug wirft, sondern für die Härte und Tragik eines rechten Bauernlebens auch Sinn und Achtung hat, erst der ist ein eifriger Schützer der Heimat. Es gibt seit uralten Zeiten einen Sport, und der heißt »das Volk lieben«. Man ist »leutselig«, geht unter die »niederen Klassen«, und wie das alles heißt. Besonders aber den Bauern treten Städter als vorübergehende Sommerfrischlinge mit taktloser Zuneigung nahe oder sie biedern sich, oft auch mit dialektischen Sprachversuchen, in Bauernstuben[28] an, ohne zu ahnen, wieviel Weltgift sie hinaustragen aufs Land und wie sie bei allem guten Willen Heimatverderber sind.
Mögen sie's lassen! Unsre Liebe zur Heimat sei Liebe! Aber das persönliche Verhältnis zur Heimat der andern Menschen, besonders der Bauern, sei achtungsvoller Abstand und unaufdringliche Freundlichkeit.
Das Naturschwärmen ist vom Übel. Es ist unmännlich, krankhaft und verschließt uns die Natur, anstatt sie uns zu erschließen. Das Schwärmen ist die letzte Betätigungsmöglichkeit entarteter Menschen. Sie machen aus dem Leiden eine Wollust und nennen sich gefühlvoll, ob es nun wehmütig verzückt auf Werthersche Art oder schmerzlich-frech nach Heine geschieht. Sie sehen die Natur mit sentimentalen Augen und erwählen sie zu ihrer Freundin, weil sie es unter den Menschen und im Kampfgewühl nicht mehr aushalten. Aber über das gewaltige, unbeugsame Leben in der Natur sehen sie hinweg. Sie ahnen nichts von dem heroischen Kampf zartester Keimkräfte gegen die brutalen Gewalten von Kälte und Sturm. Sie sehen nichts von dem ständigen Sieg des nie erschlaffenden Werdenwollens und vernehmen nichts von den ewigen Wehen der unerschöpflich fruchtbaren Gebärerin. Das aber ist heroische Naturbetrachtung. Aus dieser Art des Schauens der Natur kann am ersten der Menschen Zusammenhang mit der großen Macht des Weltalls durchgespürt werden. Sie allein, die heroische Naturbetrachtung, ist des jungen Riesen Antäus würdig, der immer wieder lernen kann aus der unbeugsamen Zähigkeit alles Niedergetretenen. Und jeder junge Mann, jeder noch nicht in unveränderlicher Satzung verkalkte Mensch ist ein Antäus, der darauf zu achten hat, daß er auf der Erde bleibe – der festen.
Aber auch an einem anderen Kraftquell sollte er öfters trinken, der Mensch des zwanzigsten Jahrhunderts.
»Die Welt ist innerlich ruhig und still, und so muß auch der Mensch sein, der sie betrachten will« – hat einmal einer der tiefsten Erlauscher der Stille der Natur und einer der kraftvollsten Dichter und Kämpfer gesagt, Gottfried Keller. Die Welt der Großstadt, des Tramwaygeklingels, der Schaufenster und der Plakatsäulen hat uns die Zugänge zu der Stille der Welt verschlossen, in der die unterirdischen Quellen alles Seins rauschen. Wir müssen wieder danach auf die Suche gehen. Wir alle, die wir im Zeitalter[29] der Erkenntnis und der kritischen Naturforschung glauben, das Leben zu haben.
Erkenntnis als Resultat spekulativer Dialektik ist etwas Großes. Aber diese Erkenntnis allein tut es nicht. Das Wissen ist eine Macht; aber wenn es meint, alles zu wissen, so wird ein Wähnen daraus, eine blasierte Aufgeblasenheit, von der es zum geistigen Stillstand nicht weit ist.
Es gibt noch andere Organe, um die Natur zu erfassen, als den kritischen Verstand: das unmittelbare Schauen, die tief ursprüngliche Empfindung, das intuitive Erlebnis. Diese bewahren uns vor der geistigen Verknöcherung, die sich auf dem Wahn gründet, alles kritisch erlernen zu können.
Wir dürfen das Staunen nicht verlernen. Die Großstadt hat es fast so weit gebracht, daß die Menschen glauben, sie könnten alle Rätsel der Natur in kinematographischen Theatern und wissenschaftlichen Vorträgen gegen bescheidenes Eintrittsgeld gelöst bekommen. Wer aber nur einmal auf Bergeshöhen dem schweigenden Atmen der Natur gelauscht, wer je die fragenden Augen geschaut, die uns aus aller großen Einsamkeit ansehen, der legt vor dieser Stille bescheiden seinen Dünkel nieder.
Das nimmt uns nicht die Lust, Kämpfer und Eroberer zu sein. Alles ist unser. Die Welt ist unser. Aber wir müssen in ihr bleiben, wie sie in uns – bleiben möchte. Und wenn wir ihr das verwehren, dann werden wir mit der Zeit mürbe, wurmstichig und innerlich zerfallen, trotz aller hohen Ziele.
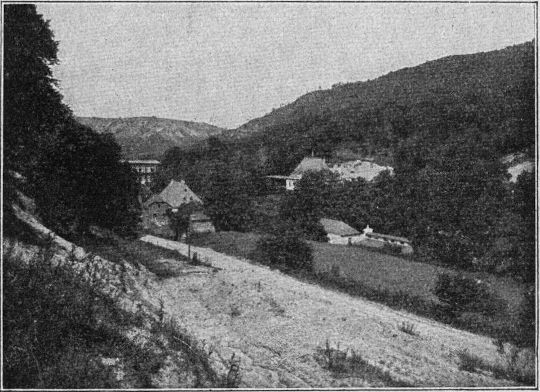
Bad Tönnisstein in der Eifel.
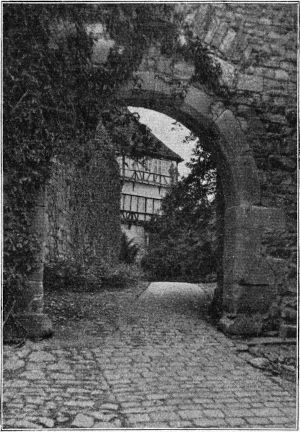
Phot. Ad. Saal.
Schloß Bebenhausen im Schönbuch.
Das tun wir leider fast alle, ohne es zu wissen. Wir ahnen es nicht, weshalb der »andere in uns«, der ewige Grübler oder – wie er nicht übel in einem neuen Roman genannt wird – der »ewige Deutsche«, unserem wirklichen helleren »Ich« so oft beim Schauen das Auge trübt. Wir hören es ja oft genug, daß wir beim Schauen die Sorgen und die Gedanken und die ungelösten Probleme zu Hause lassen sollen! Aber sie haben so lange Beine, unsere Grillen und Sorgen, und haben uns so lieb – und wandern mit.
Wie wird man sie denn los und dazu den »anderen in uns«, der immer etwas zu befürchten, etwas auszuklügeln hat und sich noch Gott weiß was darauf einbildet, daß er ein so sorgender Mensch ist, der »an alles denkt«? Und dabei stiefelt er mit den Augen am Boden durch die Herrlichkeiten der Welt und über die Freiheit der Berge und wagt es nicht auch einmal, ordentlich zu niesen, anstatt auch einmal in den Tag hineinzuleben wie ein halber Herrgott. – Wie ein halber, bitte!
Wer ist eigentlich dieser fatale Weggenosse, der uns beim Alleinwandern anhängt wie eine Klette und uns immer zuflüstert: »Ach, laß das alles da draußen, die Berge, Wolken, Felder! Was ist das? Du bist das Wichtigste, der Wichtigste (oder die Wichtigste) bei alledem! Du, deine Gedanken, deine Pläne, deine Sorgen!«
Wenn man sich einmal klar darüber geworden ist, daß es sich[31] hier nur um eine der tausend Masken der lieben Eitelkeit handelt, dann ist man der Befreiung von diesem störenden Gesellen schon um ein gutes Stück näher. Und es ist nichts anderes als lächerliche Eitelkeit, wenn wir z. B. beim Beschauen eines herrlich gewachsenen alten Baumriesen oder bei der Entdeckung feiner, für die meisten Wald- und Wiesenbummler verborgener Farbenübergänge auf einmal ganz im stillen bemerken, wie sich in diesen gedankenlosen Vorgang (und solche Gedankenlosigkeit kann nicht genug empfohlen werden!) ein seltsames Sehnen hineinschleicht, ein Etwas, das uns ganz verbindlich mitteilt, es sei doch eigentlich sehr nett, daß wir all diese Herrlichkeiten mit solcher Intensivität des Erlebens erfassen – als einer der wenigen unter den vielen!
Das ist der Vorgang bei der so ziemlich gröbsten Form der Störung des reinen Schauens durch das reflektierende Treiben der Gedanken, die sich zwischen uns und das Geschaute wie eine Nebelwand stellen. Anstatt uns zu helfen und uns die vor Augen liegenden Herrlichkeiten zu offenbaren, strahlen unsere »Gedanken« und »Gefühle« nur ihre eigene Dürftigkeit auf uns zurück. Daher das Wort »Reflexion«! was nichts anderes als wie Zurückstrahlen bedeutet. Der Mensch fühlt sich durch diese Reflexion beleuchtet als Einzahl, als »derjenige, welcher!«
So werden wir vom »anderen in uns« ahnungslos um die tiefsten Eindrücke betrogen. Statt objektiv die Natur zu erleben, genießen wir subjektiv uns selbst. Das geschieht bei den meisten Menschen automatisch, ganz ohne ihr Zutun. Aber jedesmal, wenn die Reflexion mit biederer Ehrlichkeit uns auf die Achsel klopft und uns z. B. in der Phantasie ausmalt, wie wir uns ausnehmen würden, wenn dieser oder jener Bekannte uns, in ein solches Landschaftsbild versunken, so in dieser hingerissenen Stellung sehen könnte, dann empfinden wir doch als Warnung ein fatales Gefühl im Hals!
Das ist dann die unwillkürliche Reflexbewegung einer gesunden Psyche. Folge ihr! So viele Wanderer, die über steigende Nervosität auf ihren Fahrten klagen, mögen sich einmal auf diesen Punkt hin selber ausforschen. Wenn nicht anhaltende Überanstrengung die Ursache ihrer verminderten Genußfähigkeit ist, dann treffen sie ganz sicher hier ihre wunde Stelle.
Die Heilung liegt, wie die Heilung der allermeisten seelischen Störungen, in der Befolgung des Losungswortes: Los von dir selbst! Die neueste Psychologie hat ja die Ursache der meisten seelischen Erkrankungen im Bewußtsein entdeckt!
Möglich ist die Heilung aber nur dadurch, daß man diesen verneinenden Imperativ in einen bejahenden verwandelt.[32] Der kann aber immer nur lauten: Bewußte und innige Hingabe an das Ganze!
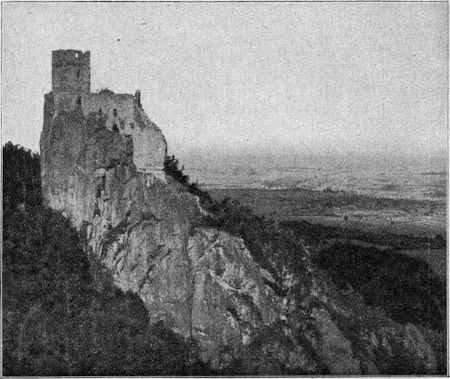
Zur Verfügung gestellt vom Vogesenklub.
Ruine Giersberg in den Vogesen.
Immer nur an das andere oder an die anderen denken! Nicht an »den anderen in uns«! In unserem Falle heißt das: Mit ganzer Seele und mit allen Kräften die Landschaftsreize auf sich wirken zu lassen und jeden Gedanken (sei es auch nur die bei Malern und Schriftstellern so leicht sich einstellende Überlegung, mit welchen technischen Mitteln der Eindruck des geschauten Naturbildes wiederzugeben wäre) kühl und gelassen übergehen und desto heller aus sich selbst heraussehen!
Das ist gar keine kleine Arbeit.
Tafel III.
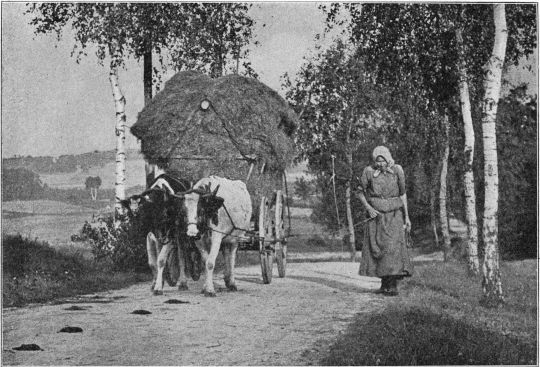
E. Stöbe phot.
Sommerzeit in Posen

H. von Seggern phot.
Holländische Tjalk auf der Unterelbe
Aber sie verlohnt sich, und eines schönen Tages wird man ganz unvermutet des Glückes innewerden, das die alten deutschen Mystiker »seiner selber ledig sein« nannten. Da werden Nebelhüllen fallen, und man wird das Schauen lernen. Das Schauen[33] der Natur oder, wie Spinoza sagt, »naturae sive dei« (der Natur oder Gottes).
Dann lebt man im All als eines seiner Teile, und keines der geringsten; als ein lebendiges, bewußtes Glied der Schöpfung, aber in ihr, mit ihr und sie in uns, in uns und mit uns. Weiter aber, als in der Natur das wiederzufinden, was man in sich selbst zum eigenen beglückenden Staunen entdeckte, weiter bringt es kein Sterblicher. Das heißt man reif sein! Dann steht man sich nicht mehr im Wege, und der »andere in uns« hat das Schweigen gelernt, das wir allerdings unter den anderen zuvor geübt haben müssen. Wenn er aber nicht mehr in Gedanken mit uns reden kann, ist er tot. Aber oft tut er nur so. Denn er ist zählebig wie alles Niedere.

Phot. Rud. Lichtenberg.
»Dort drunten in der Mühle.«
Der Kampf gegen die Klaviere ist in den Städten auf der ganzen Linie entbrannt, wenn auch noch nicht mit dem ganzen wünschenswerten Erfolg. Mit der Zeit wird es an einem ernsten Krieg gegen die Grammophone auf den Dörfern nicht fehlen dürfen. Aber es scheint, daß sich eine neue musikalische Influenza vorbereitet, und[34] zwar besonders unter den Wanderern. Sie ist lange nicht so schlimm. Aber die Gefahr ist da. Die Laute, womöglich mit verschiedenfarbigen Bändern geziert, soll das Instrument der Zukunft werden. Wie aus allem, was aus der Hand künstlerisch interessierter und für das Volkswohl begeisterter Geschäftsleute kommt, so wird auch hier aus einer Wohltat eine Plage. Die Welt der »Fahrenden« wird überschwemmt mit Preislisten von fabelhaft billigen und klingenden Lauten.
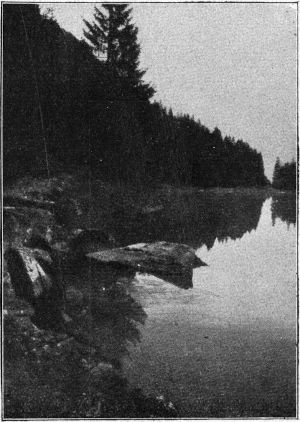
Phot. O. Mayer.
Feldsee im Schwarzwald.
Mein Sohn, ich warne dich vor dem Mann mit der Zupfgeige. Er wird sich dir harmlos lächelnd und verbindlich grüßend nahen, und zwar gerade dann, wenn du allein sein möchtest; und er wird dir sein allerneuestes »Liedel vorsingen«. Denn dieses so gern gebrauchte und verballhornte süddeutsche Verkleinerungswort ist ebenso oft Maskerade wie die blaue bayrische Zwilchjacke.
Ich will dem Lautenschlagen und dem Zupfgeigenspielen und dem Klampfenzirpen gewiß nichts Übles nachsagen. Ich schlage sie selbst, die sechs Saiten. Aber ihm irgendwie das Wort reden braucht man nicht. Es wird auf diesen Tonwerkzeugen von lauten Dilettanten viel mehr als von stillen Künstlerseelen gewirkt. Womit der Dank für die vielen hellen Stunden, die ich einzelnen frohen Gesellen bei der Rast unter schattigem Laubdach und Künstlern wie Robert Kothe, Sven Scholander oder auch anderen nur in kleineren Räumen als dem Konzertsaal wirkenden Talenten schulde, nicht unterschlagen werden soll. Den Wanderer, den ich meine und der Ohren hat zu hören, soll in diesen[35] Zeilen nur auf eine herrlichere Laute aufmerksam gemacht werden als die um 10 bis 60 Mark beim Musikalienhändler zu erstehende.
In allen deutschen Volksliedern, in den ältesten am meisten, kommt ein Reichtum von Gefühlen zum Ausdruck, die einem feineren Gehörsinn entstammen, als wir ihn noch besitzen. Mit so vielem anderen haben wir Kulturmenschen auch das Hören verlernt. Die zierlichen Sinneswerkzeuge im Gehörgang des Naturmenschen, Steigbügel, Hammer, Amboß, waren noch nicht durch wüstes Straßenbahngeklingel, Dampfsirenengeheul, Automobilhuppengetute und ähnliche Errungenschaften aus der Kunst des Sichvernehmlichmachens abgestumpft. Wir alle sind harthörig geworden. Nur so konnten Richard Strauß und andere Erfolge haben! Aber es gibt verborgene Wege, um uns aus diesen Orgien der Dissonanz zurückzufinden zu den Harmonien des verlorenen Paradieses, zu den heiteren und beruhigenden Schöpfungen unsichtbarer Schuberts, Mozarte und ähnlichen hellen Tongewaltigen.
Jeder Wanderer, der allein seine Straße dahinzieht und vielleicht geistig und auch körperlich unter einem Übermaß von Eindrücken leidet, die wie eine Flut von Farben und Formen durch das enge Tor der Pupille in die Seele stürmen, versuche einmal in aller Ruhe während des Wanderns die Augen zu schließen und zeitweise blind weiterzumarschieren. Auf einem nicht zu schmalen Weg ist das viel leichter, als man sich's denkt, und außerdem eine ganz gute Übung für den Gleichgewichtssinn. Dann wird er durch die Hilfe des noch frischen, weil bisher fast gar nicht in Anspruch genommenen Gehörsinns eine neue Welt entdecken. Eine Welt, wo es mehr oder weniger tief, je nach dem Grade der Veranlagung des Wanderers, tönt und dröhnt, singt und schwingt von bisher unbemerkten Lebensäußerungen der Natur. Er wird mit der ganzen Frische unermüdeter Empfänglichkeit im Rauschen des Baches den Singsang und den rhythmischen Tanz der Melodien heraushören können, ohne die ein großer Tonsetzer wie Schubert niemals seine wundervollen Lieder wie »Ein Bächlein hört ich rauschen« u. a. hätte komponieren können. Er wird es verstehen, wenn Richard Wagner einmal erzählte, er habe seine Melodien »oft aus der Luft aufgefangen«. Die Achteltöne im leisen Sang der Grasrispen, die zitternden Terzen im Rauschen der Tannenwipfel und tausend kleine und große Lieder, die der Wind auf den unzähligen Harfen der Natur spielt, werden ihn Zeichen und Wunder vernehmen lassen.
Um nur beim Gröbsten zu bleiben: Wie viele Fahrende kennen die Stimmen aller Waldvögel? Und wie wenige erst hören die zitternden Fugen auf der großen Orgel in der verlorenen Kirche des[36] Waldes? Und die Gesänge der Geister über den Wassern? Und so viele andere ganz natürliche und gar nicht überirdische Klänge, die im Wald und auf der Heide, in den Tälern und auf den Bergen ertönen?
Nicht von den Stimmungen ist hier die Rede, die liebende Jünglinge und Jungfrauen aus dem Wald heraushören, so wie sie sie hineinschmachten, denn da schreit's wirklich so heraus, wie man hineinschreit, sondern von dem objektiven Erleben der Lautwelt, die in der Natur ihr Dasein hat, und die wie alles in Farbe und Form Gestaltete uns vertraut werden kann. Es erhöht die Genußfähigkeit beim Wandern, wenn man das schwirrende, säuselnde, klingende und brausende Leben in Feld und Wald vernimmt. Die Indianer legen das Ohr an die Erde und vernehmen einen nahenden Reiter auf eine Stunde Entfernung. Wir müssen wieder Hörer werden, wenn uns Vieles und Großes, Treues und Wahres in der Verworrenheit unseres Daseins nicht verloren gehen soll. Und so wie bei Blind-, Stumm- und Taubgeborenen das Tastgefühl einspringt für die kranken Sinne, bis auch diese Stiefkinder der Natur auf ihre Art sagen können, was ihr Innerstes bewegt (man denke hier nur an Helen Keller), so können wir mit gesunden Sinnen Beglückten durch gelegentliche freiwillige Ausschaltung, sozusagen Außerdienstsetzung des einen Sinnes den andern stärken und kräftigen.
Also lernt hören, ihr Fahrenden! Es gibt viele Sprachen, aber die Muttersprache der Natur wird am seltensten gelernt, und es ist doch das schönste und leichteste Esperanto.
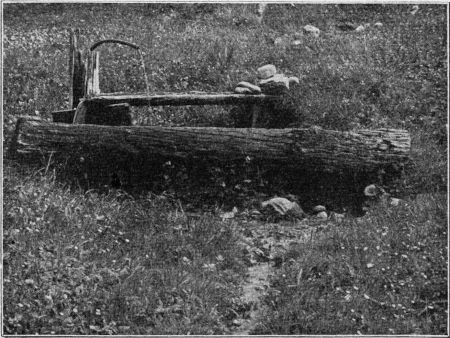
Phot. Chr. Meißer.
Brunnen auf der Bergwiese.

Nach einer Kupferdruckkarte der Kunstverlagsanstalt Joh. Elchlepp, Freiburg.
Schwarzwaldhaus.
Der alte römische Schriftsteller und Staatsmann Plinius, der als Neffe seines berühmten Onkels sich stark für Naturwissenschaften interessierte, erzählt in einer seiner vielen feinen Briefe, was die Menschen doch für merkwürdige Käuze seien, wenn sie lange Reise zu Land und zu Meer machten, um Neues zu sehen. Er selber sei ein so merkwürdiger und unglaublicher Geselle. Denn auch er unternehme jedes Jahr große Fahrten in die weite Welt und habe dabei noch nicht einmal den Waldsee auf dem Gute seiner Schwiegermutter gesehen, auf dem die Naturerscheinung einer schwimmenden Insel studiert werden könne.
Es wird wohl nicht viele Wanderer geben, die bei dieser Erzählung nicht das Gefühl überschliche: »Auch du gehörst zu dieser Sorte.« Nirgends mehr als auf den in unserer allernächsten Umgebung gelegenen Feldern und in den Wäldern unseres Bannkreises harrt unserer noch manche Offenbarung; und jeder Glaube, daß man im Umkreise von höchstens 20 Kilometern keine neuen Entdeckungen mehr machen könne, erweist sich bei genauem Suchen als eine Oberflächlichkeit. Das Gute liegt auch hier so nah; wir sehen es nur nicht. Es geht uns fast allen wie dem Menschen, der in den Himmel kam und dort, von einem Engel im Paradies[38] herumgeführt, sich an den herrlichen Blumen und Bäumen nicht satt genug sehen konnte, und dann sehr erstaunt war, als ihm der Engel sagte: »Genau dieselben Blumen und Bäume habt ihr drunten auf der Erde. Ihr seht sie nur nicht, ihr armen Menschen!«
Also entdeckt zunächst einmal in euren eigenen Wäldern und auf euren eigenen Fluren die Wunder, bevor ihr so weit hinaus und hinauf wollt. Jeder Wald und jedes Feld hat sein Geheimnis. Aber nur demjenigen wird es enthüllt, der die große tiefe Liebe zu seiner Heimat im Herzen trägt. Der rasche Wegefahrer und der neugierige Rundreisetourist stolpert, mit der Nase in der Luft, immer am schönsten vorbei. Die Nase in der Luft zu haben, ist nicht vom Übel. Im Gegenteil. Aber dann auch die Luft in der Nase haben! Weniger umständlich ausgedrückt: Mund zu und Nase auf! Durch die Nase atmen! Nicht durch den in blödem Erstaunen geöffneten Mund. Die Nase hat viel mit den Geheimnissen der heimatlichen Fluren und Wälder zu tun. Kein Sinn ist, wie die Kundschafter der Seele entdeckten, so eng mit dem Erinnerungsvermögen verknüpft wie der Geruchsinn. Wenn ich z. B. die Schwarzwaldbahn hinauffahre und atme so in der Gegend von Gutach die erste Nase voll echter würziger Schwarzwaldluft, dann taucht eine Welt voll Erinnerungen in den Bergen glücklich verlebter Tage auf; ich vergesse den Dunst, der sich aus den Düften von Zeitungspapier, Tinte und Zigarrenrauch zusammensetzt, und werde wieder ein Mensch – sozusagen wenigstens. Napoleon I. hat einmal gesagt, er würde blind seine Heimat Korsika wiedererkennen an dem Duft, den das felsige Eiland über das Mittelmeer hin ausströmt. Mit Napoleon I. habe ich sonst – wie mir meine besten Freunde glaubhaft versichern – nichts gemein; aber am Geruche würde ich auch meinen Schwarzwald wiedererkennen, wenn ich ihn nicht mehr sehen könnte.

Phot. H. Hoek.
Herbst im Dreisamtal (Schwarzwald).
Dem richtigen Wanderer geht es immer, wie Hans Thoma, dem großen Schwarzwälder Sinnierer und Maler, es ging, als er nach seiner ersten italienischen Reise zum erstenmal wieder in Sachsenhausen beim Apfelwein saß und die Zwetschgenbäume im Garten der Wirtschaft aber auch gar nicht mehr schön finden konnte. Dieser Mißmut über den Verlust des Paradieses hielt an, bis die untergehende Sonne ein Goldnetz in die Bäume hing. Da erst entdeckte er wieder von neuem die Schönheit der Sachsenhäuser Zwetschgenbäume. Im Heimatwald ist es jedesmal ebenso wie mit den Zwetschgenbäumen in Sachsenhausen – unbeschadet deren unbestrittener Vorzüge! In der Heimat sind wir selber und können es sein. Draußen in der kalten Welt sind wir Hotelnummern oder[39] mißtrauisch betrachtete Fremde. Ich will versuchen, deutlicher zu werden. Nicht nur die Sonne spinnt Goldnetze in die Sachsenhäuser Zwetschgenbäume, in die Feldbergtannen oder die schlesischen Birkenalleen oder was sonst noch sein mag. Wir selber tun es auch. Die Schönheit der Natur ist nicht nur etwas Objektives, allen Menschen gleich Sichtbares und Zugängliches; sie ist stark subjektiver Färbung unterworfen. Aber noch mehr. Wir verlegen in unsre Umgebung und in die Natur auch eigne Gemütswerte und empfangen sie wieder zurück von ihr. Ein altes Möbel, das von den Zweckmäßigkeitslinien des modernen Kunstgewerbes nichts an sich hat, kann uns lieber und teurer sein als das schönste von einem modernen Raumkünstler[40] geschaffene Stück. Wir haben mit ersterem etwas zusammen erlebt, und besonders, wenn dies etwas Schönes war, so ruht unser Auge mit Wohlgefallen auf ihm. So beseelen wir auch die Natur, die uns vertraut ist, und verweben ihr Äußeres mit unseren inneren Erlebnissen und Stimmungen. Das, was man Heimatgefühl nennt, beruht ganz auf diesem Beseelen der Natur durch den Menschen. Hier sind wir daheim, und selbst wenn wir Fremdlinge sind, können wir uns doch daheim fühlen. Es sind keine das Nervenleben stark in Bewegung setzenden Eindrücke, denen wir hier begegnen, keine geräuschvolle Fremdenindustrie, keine die Seele erschütternde Landschaft. Kraftvolle Ruhe und stille Sicherheit ist's, was der Wald und das Feld der Heimat uns bieten.
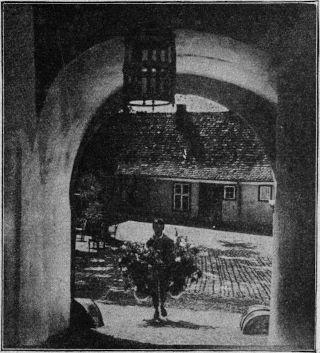
Phot. J. Magirus, Ulm.
Sommerblumen.
Wir waren (das ist jetzt auch schon ein Vierteljahrhundert her) drei Schulkameraden und Freunde, hatten den Übergang aus der Obersekunda an die Unterprima nicht gerade glänzend, aber doch auch ohne Makel bewerkstelligt und standen vor unserer ersten Großtat, einer Reise in die Schweiz, zu der die Mittel durch Aufführungen von Tragödien, bearbeitet für Kinder unter 10 Jahren, das heißt durch Kasperletheaterspielen vor der Jugend der Nachbarschaft verdient worden waren. Der Reiseplan entbehrte nicht der Großzügigkeit, und unser eigentliches Ziel wurde verschwiegen, so weit war's bis dahin. Die Nachbarn und Nachbarinnen bewunderten diese unsere nicht zu bestreitende, offenkundige Begabung zu Weltreisenden. Nur der gute alte Vater der beiden Freunde, der in allen Dingen eine gemächliche Sicherheit an den Tag legte, warnte uns. Wenn man noch nicht einmal das eigene Ländli kenne, wie wolle man da schon in die Schweiz oder gar noch nach Italien reisen. Er hatte für[41] solche Lebensanschauungen einen eigenen Ausdruck: »Überhopst ist so gut wie gelogen,« meinte er.
Natürlich setzten wir's doch durch. Aber wir haben ihm alle drei seither recht gegeben, dem alten, guten Vater. Auch beim Wandern ist das Überspringen ein Stück Unehrlichkeit. Und es ist immer ein Glück, wenn man's später noch gutmachen kann und alles »Überhopsen« ehrlich und redlich nachholen.

Hofphot. C. Eberth, Cassel.
Brief einer Mutter an eine »Reform«mutter.
Verehrte Frau, ich werde mich nicht täuschen in der Annahme, daß Ihre unerschütterliche Güte mir für manches von dem, was da kommen soll, pränumerando Verzeihung gewährt. Also:
Sie befinden sich in einer großen Gefahr, und ich möchte Sie allen Ernstes warnen vor den – Schriftgelehrten! Sie gehören zu den Ahnungslosen, die es haben, ohne es zu wissen, und nun sind Sie auf dem besten Wege, Ihre natürliche Gabe für Kindererziehung hinzugeben gegen ein unnatürliches, wichtigtuerisches Nachdenken und Diskutieren über Kindererziehung und modernes Wandern, wie es sich jetzt in der Gestalt von allerhand klugen Leuten an Sie herandrängt. Werfen Sie sie hinaus, verehrte Frau, die Leute, die immer vom Himmelreich der Kinder reden und selbst den Schlüssel dazu nicht haben, und lassen Sie mich, gewissermaßen stellvertretend, Ihnen sagen, was Sie vor der Zeit Ihrer Infektion mit dem Bazillus der Kindswissenschaft geantwortet hätten, wenn Sie gefragt worden wären, was Sie jetzt hinter den spanischen Wänden einer Ihnen gar nicht liegenden, modernen Bestrebung hervor mich fragen. Sie hätten zum Beispiel der Dame mit den vielen Kindermädchen, die Sie ja kennen und die Ihnen jetzt das[42] Leben schwer macht mit langen überzeitgemäßen Erziehungsreformen, geantwortet:
»Nehmen Sie mir es nicht übel, meine Liebe, aber wie kann man nur so dumm fragen? Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute so nah liegt? Da reden die Leute den ganzen Tag von der Natur und suchen sie, wie mein Mann oft seine Brille sucht, die er auf der Nase hat. Das geht mir einfach auf die Nerven, diese gelehrten Gespräche über Sport und Regeneration, und wie das dumme Zeug alles heißt. Das ist doch alles so furchtbar einfach, wenn man's nur richtig anfaßt. Vor acht Tagen, da wurde es mir einmal zu eng in der Küche und in der Haushaltung; kurz, ich wollte was anderes haben als das ewige Wäscheaufschreiben, das tägliche Denken, was nun wohl zu Mittag oder zu Abend gekocht werden soll, und ähnliche tiefsinnige Betrachtungen, die aber nun doch einmal sein müssen, so lang als die Welt steht. Nun, da sagte ich meinen Jungen beim Zubettgehen: »Kinder, morgen wird's fein! Vater geht fort, und da werden wir wohl nicht so dumm sein, zu Hause zu bleiben! Gewandert wird, den ganzen lieben Tag.« Und als die Jungen laut aufschrien vor Freude und fragten, wohin, da wußte ich es, offen gestanden, selbst noch nicht. Und am andern Morgen wußte ich es auch noch nicht, und wir liefen einmal drauflos, weil's uns selber wunderte, wohin wir eigentlich kämen. Natürlich in die Berge, die uns am nächsten sind und auf deren grünenden Kuppen mit dem unendlichen Himmel darüber aller Haushaltungskram von mir abfällt wie von selber. Und die Jungen? Ja, wissen Sie, die brachten doch überhaupt erst Stimmung in die Geschichte. Überhaupt, meine Liebe, das Wandern, wenn man's nicht gerade auf dreißig Kilometer im Tag abgesehen hat, ist am wunderbarsten mit Kindern. Nicht unter fünf Jahren, das will ich zugeben. Aber schließlich, wenn ich so denke, wie war das etwas Herrliches, wenn wir zu Hause, als ich noch klein war, mit Vater und Mutter und noch einer anderen Familie zusammen, die ebenso leichtsinnig veranlagt war wie wir, kurz, einer ganzen Bande, mit einem Dutzend Jungen und Mädels und zwei – erschrecken Sie nicht – Kinderwagen hinauszogen in den grünen Wald, stundenweit, und an einem Waldbach lagerten, futterten, spielten, lachten und schliefen. Nie hab' ich gesehen, daß die Eltern und die Älteren den Humor verloren hätten. Im Gegenteil. Vater war noch toller als wir alle zusammen,[43] zeigte uns die Vogelnester oder schlug Tannenzapfenschlachten mit uns, einer gegen zwölfe.
Aber schließlich will ich Ihnen doch von uns erzählen. Sie sagten mir dieser Tage einmal, wir müßten die Kinder schauen lernen. Unsinn! Nehmen Sie es nicht übel. Die sehen meist mehr als wir, und ich habe von jeher gefunden, daß es eine Aufdringlichkeit ist, wenn wir uns in die Seelen unserer Kinder hineinschleichen, um sie mit unseren Augen sehen zu lassen. Wir sollten's mit den ihrigen lernen, denn sie sehen sicher klarer, einfacher und reiner.«
Sehen Sie, so würden Sie unbefangen und frisch heraus Ihrer gelehrten Freundin, bei der es kein Kindermädchen drei Monate lang aushält, antworten, wenn Sie sich nicht hätten imponieren lassen und an ihren eigenen gesunden Menschenverstand fest geglaubt hätten.
Mit guten Grüßen Ihre
R. M.

Phot. Hans Müller-Brauel.
Alte Frau aus dem Alten Land (Unterelbe).
Wir haben das Kränzewinden verlernt. Allerhöchstens winden und werfen wir sie noch in den Theatern. Aber ist hier nicht mehr als Theater? Auf der bunten Schaubühne der Natur mit ihrer[44] ständigen Wechselszenerie? Nur die Kinder verstehen sich noch aufs Kränzewinden. Oder sie haben wenigstens den dankbaren Sinn dafür, wenn man sie's lehrt. Und neuerdings auch junge Mädchen, wenn sie keine dionysische oder sonstige Mode daraus machen. Denn zu einem Getue, zu dem bei uns so gerne alles wird, sind die Blumen doch zu gut. Wirklich zart können nur unverdorbene Kinder mit Blumen umgehen.
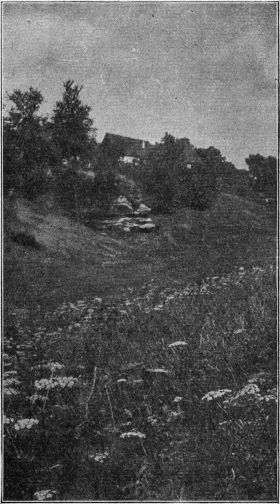
Phot. F. Clauß, Landau.
Wiesen und Hänge.
Am rauschenden Bach, der zwischen hellen Matten und dunklem Wald dahinschoß, sah ich gestern ein Mädchen, das reihte an einer dünnen Gerte weiße Gänseblümchen und violettes Knabenkraut auf. Ein zwei- und ein dreijähriges Kind, Mädel und Bub, sahen ihm mit beglückten großen Augen bei der Arbeit zu. Der junge Adam bekam einen Reif aus blühendem Sauerampfer und rotem Klee, und die kleine Eva einen aus Orchideen und Hahnenfuß. Ihr solltet einmal gesehen haben, mit welch würdiger Bescheidenheit so ein kleines Mädchen oder mit wieviel schämiger Andacht der wilde Bube seinen Kranz trägt. Sie wissen noch, daß sie dazu gehören. Zu alledem: zu den blühenden Wiesen und den grünen Hainen, zu den Vögeln, die durch die Lüfte schwirren, und zu den Käfern, die, grüngolden, sich nach allen Seiten hin retten, wenn so ein Niedeckkind aus seiner Burg stampfend und trampelnd in ihre winzige Insektenwelt geraten ist. Das sind noch Königskinder gewesen,[45] verlaufene! Und als das Mädeli mit der dunkeln Krone auf den goldblonden Locken und das Bübli mit dem herberen Schmuck eines Ringes aus rötlichen Kleeblüten über dem kurzen Haar anfingen zu singen:
da tauchte vor mir die versunkene Stadt Vineta wie ein sonniges Nebelbild wieder auf, oder, um es modern auszudrücken, ich erlebte wieder ein Stückchen Himmelreich.
Packet also eure Rucksäcke, ergreift eure Stäbe, gehet hin und tuet desgleichen! Wir wollen nicht werden wie die Kinder. Bewahre! Dies Bemühen hat seine bedenklichen Gefahren; denn vom Kindlichen zum Kindischen ist es nicht weit. Aber »das Himmelreich annehmen als ein Kind« – das ist es. Das ist die gute Übersetzung des alten Textes vom alten Dr. Martinus Luther, der zwar keineswegs meine ganze schwärmerische Verehrung besitzt, der aber ein – Lautherr war und sich auf Deutsch verstand, noch besser sogar als mancher deutsche Oberlehrer oder Gymnasialprofessor.
Vom einsamen Wandern will ich nicht reden. Das muß man entweder oder man ist gar nicht dafür geschaffen. Eine Bücherfrage ist das nicht – sondern Privatsache.
Zu zweit? »Two is no society,« sagen die Engländer, und die verstehen sich auf Lebens- und Wanderkunst. Aber es gibt Ausnahmen von dieser Regel. Wenn ein junger Mann mit seiner Braut, ein Mann mit seinem Weib die graue Alltäglichkeit des Lebens vertauschen mit dem freien Wandern über Berg und Tal, dann sind die beiden »society«. Sie erfassen die Welt mit einer verstärkten Anziehungskraft der Seelen, und in ihrem doppelten Augenpaar spiegelt sich alles Sichtbare doppelt schön. Die im psychischen Wechselstrom ihrer Empfindungen erzeugte hohe Voltspannung ihrer geeinigten Seelen leuchtet tiefer in die halb milde, halb herbe Verworrenheit der deutschen Landschaft, und ihre Sinne erfüllen sich weit mehr mit den vollen Lauten des rauschenden Daseins, als wenn sie allein wären. So leben sie im Widerspiel gegenseitiger Erhöhung des Innern wie des Äußern. Und darum ist solches Gehen zu zweit die höchste Form des Wanderns.
Solche Zweisamen wandern gar nicht zu zweit. Sie sind eins. Sie brauchen nicht unter allen Umständen Mann und Frau zu sein. Es gibt auch Jünglingsfreundschaften, die das Wandern zu einem hochsinnigen Leben machen. Aber sie sind selten. Solche Wandererkameraden sind, wie der Koran sagt, »von Gott gelehrt«. Und der helle Blick des einen läßt aus des anderen Mund wortarme, aber reine Weisheit über die Schönheit der Welt hervorbrechen. Kennt ihr sie nicht, die zwei, die man da und dort einmal sieht und die leichten Schritts und mit leuchtenden Augen die Wonne des Daseins fest und frei, froh und stark ergreifen und genießen? Der Eine und die Eine?
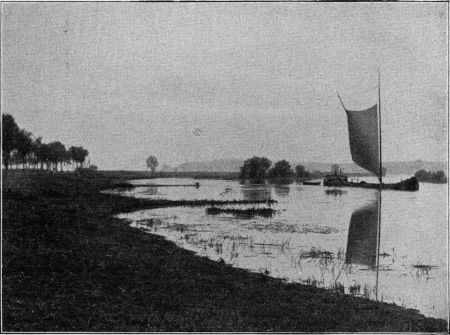
Phot. R. Hilbert, Rathenow.
Flußlandschaft aus Brandenburg.
Wenn das Verhältnis nicht ähnlich ist, dann wird das Wandern zu zweit gar leicht gestört durch Reibungen und Meinungsverschiedenheiten, zu deren Schlichtung der dritte Mann fehlt, oder man wird sich bei dem großen Bedürfnis des Menschen nach Wechsel allzurasch überdrüssig, ohne es sich – was das Schlimmste ist – zuzugestehen.
Zu dritt oder zu viert geht es sich nur gut, wenn langjährige nahe Beziehungen schon die Linien des Drei- oder Vierecks gezogen[47] haben. Eine gewisse Sicherheit des guten Auskommens fängt erst beim halben Dutzend an, und daß beim Hordenwandern die Mindestzahl zwölf und die Höchstzahl zwanzig beträgt, das hat seine guten Erfahrungsgründe.
In der wandernden Horde läßt sich das Bedürfnis, besonders der jüngeren Menschen, sich einem anderen Gleichgesinnten anzuschließen oder, objektiver und richtiger ausgedrückt, die Lücken seiner besonderen Veranlagung auszugleichen durch den inneren Bestand des entgegengesetzt veranlagten Freundes, viel leichter befriedigen. Dazu kommt noch die Notwendigkeit, sich schon aus reiner Selbstsucht willig ins Ganze einzuordnen und dem Führer unterzuordnen. Aber damit kommen wir schon zu dem Kapitel:
Ohne das Wort »Erziehung« geht es heute nun einmal nicht mehr. Es muß erzogen werden. Die Welt ist voller tatenlustiger Schulmeister, die umhergehen, zu suchen, wen sie erziehen könnten.
Warum läßt man denn die jungen Menschen – und die alten dazu – nicht unmittelbarer, nämlich durch das Leben selbst, erziehen? Es hat es ja noch kein Schulmeister in der Welt weiter gebracht als dazu, daß seine Schüler nach ein oder zwei Jahrzehnten merkten: »Er hat wahrhaftig recht gehabt!« Der Mensch läßt sich schon von Jugend an eines seiner größten Vorrechte nicht beschneiden, das Recht, nur durch höchsteigenen Schaden klug zu werden.
Wenn man aber von diesen Anzüglichkeiten absieht, dann allerdings muß man sagen, daß es kaum eine bessere Schule fürs Leben gibt als die gemeinsamen Wanderungen, die nun alljährlich in immer steigendem Maße von der erwachsenen Jugend aller Bevölkerungsklassen im Sommer wie im Winter unternommen werden. Ich will dabei ganz von den Vereinigungen absehen, die, wie die Pfadfinder und die Freischaren, neben ethisch hochstehenden hauptsächlich militärische Ziele im Auge haben und die – wohl ganz wider Willen – in der Richtung der Entwicklung des Heerwesens zur Miliz wirken.
Das Wandern junger (und älterer) Männer zusammen wirkt schon ohne alle aufdringliche Erziehung in hohem Maße erzieherisch, weil es täglich jeden Teilnehmer vor die Lösung des großen Problems der Gegenwart: »Menschen untereinander« bringt. Und dies in Lagen, die an das Gemeinschaftsempfinden des einzelnen viel höhere Anforderungen stellen, als es bei der gewöhnlichen[48] Art, wie junge Menschen bisher gewöhnlich untereinander waren, der Fall sein konnte, nämlich auf der Bierbank, wo reichlich Alkohol und Tabak das ursprünglich im Menschen lebende Gefühl des Widereinander lähmten, um allerdings später desto unverhüllter zur Geltung zu kommen. Draußen aber in den Bergen oder auf der Heide wird es jedem unter dem Dutzend angehender Staatsbürger täglich mehrere Male zum Bewußtsein gebracht, daß sein Wohlbefinden und seine gute Stimmung in hohem Maße abhängig sind von der Haltung der Wanderkameraden, die ihrerseits wieder bestimmt wird durch die Art, wie er, der einzelne, seine Pflichten erfüllt, und wie er sich auch sonst, rein von der Gemütsseite aus, zum Ganzen stellt. Das Gliedhafte seines Daseins wird dem Wandervogel, dem Gesellen oder wie er heißen mag, zum erstenmal ganz deutlich klar, und zwar weit mehr als in der Schule, wo er leicht ohne große Nachteile ein egoistisch beschränktes Einzeldasein führen konnte. In jedem Augenblick kann an den Wanderer die Entscheidung herantreten, ob er, unter Aufgabe seiner eigenen augenblicklichen Bequemlichkeit, eines Kameraden kleine oder große Not zu der seinen machen will, mag es sich um die Übernahme eines Teils der schweren Traglast des anderen handeln, um ein gutes Wort, wenn des Kameraden Herz ihm etwas Schweres anvertraut, oder um einen Taler, den jener nicht hat.
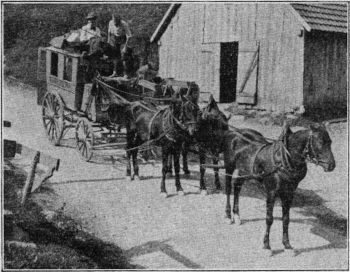
Phot. W. Riegger.
Gebirgspost.
Aber es ist noch ein anderes. Häufiger als sonst kann es der in Horden ziehende Wanderbursche erfahren, daß das übliche gute Verhältnis auf Gegenseitigkeit: »Wie du mir, so ich dir,« im tiefsten Grunde eine niedrige Stufe des Lebens der Menschen[49] untereinander darstellt. Bereits die häufige örtliche Trennung der Wanderer einer und derselben Schar ist schon Anlaß dazu, daß die Wärme einer empfangenen Freundlichkeit (und wie viele kleine Dienste gibt es da) nicht an den eigentlichen Geber zurückerstattet wird, sondern an einen anderen zufällig anwesenden Kameraden, der ihrer gerade bedürftig ist. So wird beim Wandern das »Revanchieren« (das Wort ist sehr bezeichnend!) einem schwerer gemacht als im Stadtleben. Ein freiwillig und gern hingegebenes Stückchen Herz geht weiter im Kreise herum und wirkt tiefer beim Wandern, als wenn in der Stadt der Herr: »Sehr liebenswürdig!« dem Herrn: »Darf ich Ihnen vielleicht behilflich sein?« die Freundlichkeit postwendend zurückgibt, um ja sofort quitt, d. h. ihm nicht mehr verpflichtet zu sein.
Denn: Man kann nicht wissen!
Tafel IV

Ferd. Clauß phot.
Bergdorf in der Pfalz

Hofphotograph C. Eberth, Cassel, phot.
Hessisches Dorf
Draußen in den hellen Buchenhallen, unter den dunkeln Spitzbogen des Tannenwaldes, am Ufer des leichtbewegten blauen Sees oder inmitten des Felsens eines rauschenden Wildbachs fällt so viel von selber ab an Dünkel und Torheit, an Abneigung und Pharisäertum zwischen den Menschen, weil sie dem Leben des ewigen All so viel näher sind als sonst. Beim Einatmen der gleichen reinen Gottesluft würden sie – wenn ihnen der Vorgang zum Bewußtsein käme – nicht aus dem Staunen darüber herauskommen, was ein Mensch zwischen Mauern und Dächern doch oft ein fataler Herr und draußen unter grünen Zweigen und freiem Himmel ein lieber Kerl sein kann.
Daß die Protektion und die Beonkelung der Wanderbewegung in der Richtung der Organisation ganz bedeutende Verdienste hat, das wird gern und freudig anerkannt.
Ich will hier nicht die Gelegenheit ergreifen, um zu untersuchen, inwieweit »Wandern« und »Organisation« eigentlich eine Contradictio in adjecto (ein Widerspruch im Beiwort) sind. Auf die Theorie kommt es hier gar nicht an, sondern nur darauf, inwieweit die organisatorische Zusammenfassung den inneren Kern, die Wanderlust und vor allem den Wert des Wanderns erhöht oder vermindert. Und da hat nun die Entwicklung der letzten Jahre eines unzweifelhaft erwiesen: Die Wanderbewegung hat zu einem großen Teil nicht mehr ihren Zweck in sich selbst, sondern sie ist Mittel zu Zwecken geworden, welche viele der jungen, frohen Gesellen nicht ahnen. Ein großer Teil der in großen Verbänden organisierten jungen Wanderer befinden sich, ohne es zu wissen, unter einem Einfluß, dessen Tendenzen die schon unter den Erwachsenen vorhandenen Klassengegensätze noch verschärfen. Welche[50] Klasse, ob die »besitzende« oder »nichtbesitzende«, damit angefangen hat, die wandernde Jugend zu bearbeiten, soll hier nicht untersucht werden, ebensowenig, als hier überhaupt Anklagen erhoben werden sollen. Es sollen nur Dinge gesagt werden, die bisher kaum einmal gesagt wurden. Und da muß das eine ausgesprochen werden:
Wir leben denn doch in einem Zeitalter, wo »Persönlichkeit« und »Gewissensfreiheit« doch schon mehr als Worte und Begriffe sind. Für alle Staatsbürger Deutschlands ist die Zeit, wo der Mensch vom Menschen noch nicht getrennt zu werden brauchte, die Jugendzeit. Die einzige Möglichkeit, wo die erbitternden Gegensätze, die durch die verschiedene Klassenzugehörigkeit und – was fast gleichbedeutend ist – verschiedene politische Gesinnung der Menschen hervorgerufen werden, nicht zum Ausdruck zu kommen brauchen, weil der Mensch im All der Schöpfung seine Wesensgemeinschaft leichter verspürt als in den Straßen der Stadt, wo Herkommen und Sitte und Agitation die Verschiedenheit zu offener Feindschaft ausarten lassen – diese einzige Möglichkeit ist das Wandern draußen in der freien Natur.
Und diese letzte Zuflucht des modernen, über die Dinge nicht mehr herrschenden, sondern von »Bewegungen«, »Konstellationen«, »Konjunkturen« usw. regierten Menschen des zwanzigsten Jahrhunderts wird ihm genommen, geraubt in der einzigen Zeit, wo politische Überzeugungen das Gehirn noch nicht erstarren ließen.
Es bedarf nicht vieler Worte mehr, damit man wisse, was ich sagen will.
Es ist das: Man drille nicht die jugendliche Seele auf ein politisches und soziales Dogma ein, auf das sie nicht aus freien Stücken schwört, sondern lasse solchen Knospenfrevel! Auf beiden Seiten! Man lasse den Frieden – dessen auf die Dauer kein Menschenherz entbehren kann – wenigstens unter den Laubdächern der Obstbäume, auf den grünen Matten, unter den hellen Buchenhallen und den dunklen Spitzbogendächern des Tannenwaldes – Frieden sein mit dem ganzen stillen Segen seiner Kraft!
Sonst ist alle Begönnerung des Jugendwanderns – auf beiden Seiten! – nichts anderes als jene von aller Welt so grimmig verachtete Schändung der Mittel durch die Heiligung der Zwecke und ein fluchwürdiger Mißbrauch jenes Teils der Schöpfung, nämlich der Natur, den der Mensch noch nicht entehrt hat durch seine Qual und seinen Haß. Es ist der Anfang von der völligen Austreibung des Menschen aus dem Paradies und der Entweihung der letzten Stätten des Friedens, wenn die Wanderbewegung unter[51] der deutschen Jugend nicht sauber gehalten wird von jeder politischen oder sozialen Tendenz.
Ich habe zum Schluß nur noch die eine Bitte an alle, die er angeht: Man überlege sich diese Sache in der Richtung alles Folgerichtigkeiten, bevor man – lächelt. Denn es ist so leicht und bequem und – für den Augenblick so erfolgreich, das Lächeln.
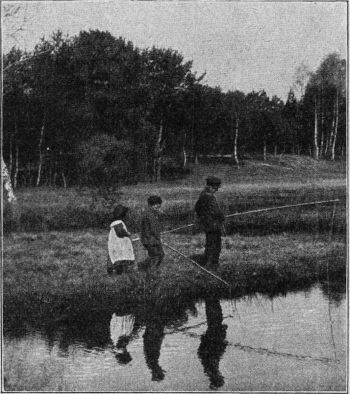
Phot. R. Hilbert, Rathenow.
Sonntagmorgen.
Gib acht! Das Kleid ist ein Steckbrief, und ahnungslos schreibst du ihn dir selber. Die Hotelportiers und Kellner, die mit einem unbestechlich kalten Blick das Äußere der ankommenden Gäste und besonders den Zustand und die Preislage der Stiefel überfliegen und danach ihren Mann in irgendeinem Schubfach einrangieren, haben so unrecht nicht. Die Methode ist zwar grob, aber fürs Gröbste genügt sie. Damit wollte ich nur auf die Gefahr jedes »Kostüms« hinweisen.
Anderseits geht es nicht gut an, vor einer Wanderung nur deshalb die Wandlung zu einem frischen, schlichten, frohen Menschen[52] durchzumachen, damit nach der einzig richtigen Methode das äußere Gewand uns sozusagen von innen heraus anwachse, die Kleidung sozusagen das Symbol des Herzens werde und ja niemandem der edle Kern unter der angenehm bescheidenen Hülle entgehe.
Und drittens hinwiederum läßt sich das alles eben überhaupt nicht machen, sondern es geschieht mit der unerbittlichen Folgerichtigkeit, nach der alles von innen nach außen wird. Da helfen alle Faxen nicht.
Ich kenne einen Mann, der trägt manchmal, obwohl er nicht in Oberbayern wohnt, bei fröhlich festlichen Gelegenheiten »Gamslederne« mit gestickten Hosenträgern, aber niemand käme auf den Gedanken, er habe sich kostümiert. Denn er ist darin der gleiche Mensch wie im Gehrock. Und ein anderer lebt schon jahrelang in den Bergen. Als er aber einmal mit seinem gemildert prätentiösen Asphaltschritt in »Gamsledernen« und im grünem »Hüterl« einem alten Oberbayern begegnete, da blieb dieser mit grinsendem Erstaunen stehen und fragte mit der unzarten Herzenseinfalt solcher Gebirgler: »Ja, sag mei Liaba, wie bist au du nur in des G'wandl eini kimme?«
Das ist's. Das G'wandl!
Man erwarte also von mir keine Vorschläge in der Richtung der einzig richtigen Wander»kluft«. Schon deshalb nicht, weil sich ein jeder ja doch so anzieht, wie er es für am wirkungsvollsten hält.
Es gehört ja nicht zu den erfreulichsten Seiten der modernen Wanderbewegung, daß wir im Wald und auf der Heide, in Bahnhöfen und in Großstadtstraßen immer mehr fragwürdige Gestalten von tragikomischer Ausrüstung sehen. Ihre gefärbten Hahnenfedern auf dem grünen Jägerhütchen, ihre mit Bändern von allen Regenbogenfarben geschmückten Zupfgeigen und ihre ausgesucht auffallend gemusterten Strümpfe über den erbarmungswürdigen Waden reizen nur um so mehr zu Spott, als sie die blasierte Fadheit der dazugehörigen Gesichter nur desto mehr hervorheben. Diese Beckmesser der deutschen wandernden Jugend sind zum Glück nicht in der Überzahl. Denn den meisten unter der Jungmannschaft, auf deren Schultern ein großer Teil unserer Zukunftshoffnungen liegt, ist es doch schon aufgegangen, daß nur der beseligt aufgehen kann in der Herrlichkeit und Größe der Allschöpfung, der mit keiner Faser mehr danach strebt, die Aufmerksamkeit auf seinen sonderbar ausstaffierten Leichnam zu lenken.
Also: jeder suche sich sein Wanderkleid! Denn die Einförmigkeit des graugrünen »Sportanzuges« mit Gürtel und Quetschfalten, der für den deutschen »Vergnügungsreisenden« schon so witzblätterhaft typisch geworden ist wie früher der großkarierte Nanking für den Engländer, ist auch nichts Erhebendes. Das erste sei Haltbarkeit! Denn wer sich aus Angst für seinen Hosenboden nicht auf jeden Felsen oder Baumstamm setzen kann, der ist ein armer Mann und ein Spott von Wind und Wetter und der eigenen Kameraden. Alles junge Wandervolk, das oft noch am Nachmittag nicht weiß, wo am Abend das Haupt hinlegen, braucht außer einer widerstandsfähigen »Kluft« einen nicht zu schweren Wettermantel, einen Lodenumhang, und womöglich ein Stück von wasserdichtem Mosettigbatist (etwa 1,50 auf 1,50 m groß), der, auf Handbreite zusammengelegt, sich bequem in die Tasche stecken läßt und bei unvorhergesehenen Freilagern gute Dienste gegen Feuchtigkeit leistet.
Wer so empfindet, der bleibe lieber zu Hause, bis »syn« Herz wieder ganz frei geworden ist. Frei muß der Bursch sein, wenn er wandern will, vorausgesetzt, daß er nicht lieber allein mit seinem übervollen Herzen loszieht. Denn in solchem Falle gibt es nichts Besseres als seine Gefühle, die wirklichen wie die vermeintlichen, zu verlaufen und – zu verschwitzen. Das sind gemütlose Bemerkungen – ich weiß es – aber sie sind probat!
Beim Rucksackpacken muß Feiertagsstimmung sein, und man muß, wie der alte deutsche Mystiker Ekkehardus so schön sagt, »sich aller Dinge ledig wissen«. Der Deutsche unserer Tage ist gewöhnt, daß ihm in Büchern alles klein vorgekaut wird, und der Ratschläge, was ein richtig gepackter Rucksack alles enthalten müsse, gibt es zahllose. »Je weniger, desto besser,« ist ein schlechter Rat. Noch schlechter aber ist der andere: »Ja nichts vergessen!« Es gibt treffliche Menschen, wahre Ritter der Peinlichkeit, die können vor der Ausfahrt ein ganzes Haus unglücklich machen, weil sie drei Tage lang vorher mit langen Zetteln, worauf »alles verzeichnet ist«, herumgeistern. Wegen einer in ihrem tiefsinnig ausgeklügelten Nähzeug fehlenden Sicherheitsnadel können sie es bei Mutter und Schwester zu geradezu erschütternden Auftritten kommen lassen, die des Hauswesens ruhigen Bestand ernstlich gefährden.[54] Andre wieder sehen selig lächelnd der Stunde des Abmarsches entgegen, und wenn ihnen nicht irgendein guter Geist den Rucksack packt, so nehmen sie ihn eben »so« mit.
Die Wahrheit liegt in der Mitte.
Lerne zu Hause schon entbehren, mache dich unabhängig von dem Beefsteak, ohne das du angeblich nicht leben kannst! Vermeide das »Glas Bier«, ohne das du angeblich nicht schlafen kannst, und lasse die vielen Zigarren und Zigaretten, ohne die du allerdings meist nicht nur angeblich, sondern wirklich den Humor verlierst! Habe den Mut, ihn zu verlieren! Die Bäume draußen im Wald und die grünen Matten werden ihn nicht entbehren, wenn du schnaubend hindurchrasest, um wieder dein eigener Herr zu werden. In alledem aber werde kein Fanatiker und kein Prahlhans deiner Enthaltsamkeit. Hast du dann noch wieder gelernt, was des alten Adam erste Beschäftigung war, als der Herr ihm »einen lebendigen Odem« in die Nase blies, nämlich atmen, richtig atmen, menschenwürdig atmen, das heißt von der Luft zu einem guten Teil leben, dann kannst du's wagen, wagen mit einem Rucksack, der nicht mehr enthält als zwei Woll- oder Lahmannhemden (ich kenne keine alleinseligmachende Unterwäsche!), mit zwei leichten Unterbeinkleidern (es gibt jetzt sehr bequeme nur bis an die Knie, die zugleich als Badehose benutzt werden können), einigen Taschentüchern, zwei Halsbinden, Seife, Nähzeug usw., und was außerdem deine persönlichen Bedürfnisse, Skizzenblock, Farbenschachtel usw. sind. Von Strümpfen und Socken ist im nächsten Kapitel besonders die Rede. Hast du noch alle Schul- und Erwerbssorgen so gründlich zu Hause gelassen, daß sie nicht die Lust ankommt, dir nachzureisen, dann bist du ein freierer, fröhlicherer Wanderer als alle, die in jeder Stadt auf ein noch nicht angekommenes oder schon wieder an die besorgte Mutter zurückgegangenes Paket warten und nie ohne Befürchtung und Wünsche sind. Allerdings muß man bei solch leichtem Gepäck manchmal an einem Waldbach einen halben Wäschetag veranstalten, was aber auch seine Reize hat.
Leicht' Gepäck, mein Jung', das ist das halbe Glück auf Erden überhaupt – und beim Wandern insbesondere.
Es wäre nun auch noch vom Kochzeug zu reden. Ich will gar nicht behaupten, daß es nicht noch besseres Kochgeschirr und praktischere Apparate gebe als die, welche ich im Gebrauch habe. Aber ich persönlich habe nur die besten Erfahrungen mit den Aluminiumausrüstungen von Ecklöh in Lüdenscheid gemacht!
Die Zupfgeige ist kein so unentbehrliches Geräte beim Wandern, daß man da besondere Ratschläge geben müßte. Es wird auch[55] schon so genug gezupft, und bei all dem Guten, was die wiederauflebende einfache Kunst unserer Urgroßeltern mit sich gebracht hat, an dem Stück spielerischer Unwahrheit, dem »Holdrio«-Ton und so manchem anderen Gespielten ist die Zupfgeige zum Teil schuld. Es gibt Wanderer, deren innerer Mensch an ihrer guten Stimme und an ihrer schönen Zupfgeige langsam, aber sicher zugrunde geht.
Also hüte dich! Das Wandern ist mehr als das Zupfgeigen. Und nun noch ein Wort zum Preis des Rucksacks. Das Schönste am Rucksack ist das Glück des Bündelschnallens, jene selige Unrast – nicht die unselige Hast! –, die uns beschleicht, wenn es endlich nicht mehr zu bezweifeln ist, daß wir gehen können. Denn was kommt nicht immer noch alles dazwischen, besonders bei uns älteren Semestern!
Wenn nun der »Bündelestag«, wie sie im Wald droben sagen, da ist, dann wird der Rucksack lebendig, der alte, treue, höchst unfein dreinschauende Rucksack! Alles, was er mit uns erlebt, schwebt aus seinem wettergebleichten, einmal grasgrün gewesenen Segeltuch heraus und sagt viele, viele Male: »Weißt du noch?«
Ach, wenn ich an den Lederranzen, an die ungefügige Reisetasche denke, die auch noch Scheffel, der Bruder Josephus vom dürren Ast als Juniperus durch die Täler da oben trug, und an den damals vorgeschriebenen »achteckigen« Reiseschal, wie groß wird dann die Bewunderung vor dem genialen Erfinder dieser einfachsten aller Wandertaschen, des Rucksacks, dieses Gehäuses für alles, was eines Wanderers Herz begehrt und braucht. Tintenkleckse, Harzflecken, die Spuren zerbrochener Toilettenwasserfläschchen (denn auch ich war einst in Arkadien geboren!) und so vieles andere zeugt vom bewegten Leben seines richtigen Wandererherzens, und an allen Lasten des Erdendaseins hab' ich schwerer getragen als an meinem jetzt graugrünbraunen Rucksack, der – nach dieser schönen Rede! – alle Brüder von ähnlich bewegter Vergangenheit hiermit grüßen läßt. Er ist ein Wissender geworden in all den Jahren, aber er liebt das Schweigen – Gott sei Dank – mehr wie sein Herr, der über all das »schreiben« muß.
Beide sind des Wanderers eigentlichster Lebensuntergrund. Es ist niemals ganz gleichgültig, auf welchem Fuße wir leben, aber für den Wanderer wird die Fußfrage zur Alternative: Sein oder Nichtsein! In unserem Falle heißt das: Wandern oder Nichtwandern.
Es ist etwas Erhebendes, wenn der Mensch nach dem schönen Wort des Dichters das Haupt in den Wolken trägt; wenn er aber hinter einer morgenfrischen, trittfesten Schar junger Wanderer, bei allem Heroismus der Schmerzüberwindung, doch so vorsichtig einhergeht, als ob die Straße voll frischer Eier läge, so ist solches nicht sehr erhebend. Die Grenzen unserer Bedürfnisse, soweit sie der Rucksack enthält, sind dehnbar und von unserer Persönlichkeit und unserem Vorleben abhängig; aber unerbittlich sind die Satzungen für unsere Füße, die zwar des Wanderers treueste Diener, aber auch seine Despoten sind. Sie entscheiden über sein Wohl und Wehe. Jedem Rekruten wird es unter Mithilfe von ernstlichen Suggestionen in der Richtung von drei Tagen Mittelarrest beigebracht, daß der Schutz des Vaterlandes im innigsten Zusammenhang stehe mit dem Zustande seiner »Untertanen«. Und doch, wie mancher Jüngling und wie manche Jungfrau zogen schon aus, um bereits am ersten Tag der Wanderschaft ihr Damaskus zu erleben, d. h. ihre Bekehrung zum einzigen Götzendienst, den der Wanderer mit den Gliedmaßen seines Körpers treiben darf. Die Fußpflege ist das Abc der Wanderkunst, so peinlich das poetisch veranlagte Gemüter auch berühren mag. Vor allem ist die Ferse jedes Wanderers seine – man vergebe diesen sachlich einwandfreien Kalauer! – Achillesferse. Schon manchmal ist einer wegen einer einfachen Wasserblase auf der Strecke geblieben, und andere, härtere Naturen, die sich nicht ergaben, wissen, wie eine solche Lappalie uns völlig genußunfähig machen kann. Keinem passiert es zum zweitenmal.
Der Fuß des Wanderers soll vor dem Antritt jeder größeren Tour eine zweckentsprechende Behandlung erfahren; zunächst durch kleine und stufenweise in Dauer und Schwierigkeit wachsende Märsche, sodann durch Abhärtung und schließlich durch Gewöhnung an den Wanderschuh.
Die heute so beliebte Abhärtung durch Barfußgehen oder durch das Tragen von Sandalen macht die Fußhaut zwar unempfindlicher gegen Wind und Wetter, aber desto empfindlicher gegen die während einer langen Zeit nicht mehr in Betracht gekommene Reibung der oberen Fußhaut an den Schäften geschlossener Schuhe. Andere als geschlossene Schuhbekleidung kann aber beim Wandern nicht in Betracht kommen. Das lästige Eindringen von Sand und Steinen in die Sandalen und Halbschuhe ist auf die Dauer nicht auszuhalten.
Tafel V

Chr. Meisser phot.
Märzensonne im Bergwald
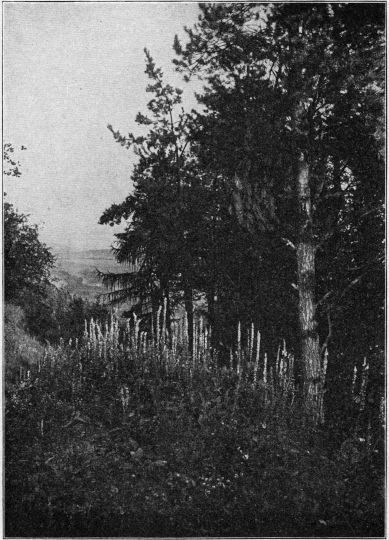
G. Urff phot.
Waldlichtung im Hochsommer
Wer sodann glaubt, mit Stiefeln, die er am Abend vor dem Abmarsch in der Hast gekauft hat, zum Ziele zu kommen, der kennt noch nichts von der guten Behandlung, auf welche die Füße beim[57] Wandern grundsätzlich Anspruch machen. Sie wollen gut ausgetretene, aber doch noch gut anliegende Schuhe haben, mit denen sie schon vor der Wanderung ein ungestörtes und angenehmes Verhältnis eingehen konnten, und sind auch in bezug auf Socken und Strümpfe gar nicht bescheiden. Fünf Paar wollene Socken von verschiedener Dicke, deren Fersen und Zehenstück mit Salizyltalg eher zu reichlich als zu dürftig einzufetten ist, sind das mindeste für den eisernen Bestand eines ehrlichen Wanderrucksacks. Gelegentliches Waschen der Füße mit Ameisenspiritus oder ähnlichen Hausmitteln ist ebenso zu empfehlen wie Massage. Für einen Unfug halte ich das täglich häufige kalte Baden der Füße in jedem Waldbach wie auch die täglichen heißen Fußbäder (wenn man nicht gerade herzleidend ist). Schweißfüße sind nicht zu heilen. Für den Nebenmenschen und sich selbst sind ihre unangenehmen Kennzeichen nur durch häufigen Wäsche- und Schuhwechsel zu mildern. Das ist eine Forderung der einfachsten Höflichkeit. Darin sind uns andere Völker, z. B. die Japaner, weit überlegen. So störend die Nachsendungen durch die Post für einen Wanderer, der auch dem Zufall sein Recht lassen will, sein mögen, gelegentlicher Ganzersatz von Schuhen und Socken ist auf einer mehr als zwei Wochen dauernden Wanderung kein Luxus, sondern hygienische Selbstverständlichkeit. Denn die Schweißmengen, die ein Paar 14 Tage lang ohne Wechsel getragene Schuhe aufnehmen und die daraus entstehenden Düfte sind ebenso ungesund als lästig.
Es ist seit einigen Jahren Mode geworden, auch einfache Wanderungen im Mittelgebirge immer in den schwergenagelten, dicksohligen Schuhen zu machen, die für den Alpinisten unentbehrlich, ja eine Conditio sine qua non sind. Aber wenn man nur die ganz unnötig erhöhte Arbeitsleistung infolge des großen Gewichts der Schwergenagelten in Betracht zieht und ganz absieht von der größeren Bequemlichkeit eines halbleichten Tourenstiefels, dann springt das Unsinnige dieser Mode in die Augen.
»Aber es sieht eben schneidiger aus!« – Ich kenne den Einwand und weiß, was auch junge Männer opfermutig an Unbequemlichkeit ertragen können um des »Eindrucks« willen. Aber diese ja so verständliche und bei jedem wohl einmal auftretende Periode, wo man sich für den Mittelpunkt der allgemeinen Aufmerksamkeit hält, leidet an der genügsamen Einsichtslosigkeit aller Eitelkeit. Die Wanderer der günstigsten Pose vergessen das eine, daß die »Kenner« ja lächeln über solche Späße; um aber nur die Bewunderung der ahnungslosen Gelegenheitsausflügler zu erregen, müßte doch der Stolz ein wenig größer sein;[58] ich meine den richtigen Stolz, das saubere Selbstbewußtsein, dem alle Mätzchen verächtlich sind.
Für »Damen« ist die erste richtige Wanderschaft fast immer der erste harte Kursus, in welchem der Fuß sich für alte Sünden rächt und der jungen Wandersmaid den richtigen Respekt vor den ihr nun einmal durch Geburt oder Schicksal verliehenen Fußmaßen beibringt. Denn so viel man wandernden Frauen und Jungfrauen sonst nachsagen mag, den Vorwurf, als lebten sie auf einem großen Fuß, kann man ihnen nie machen.
Gamaschen sind Geschmacks- und Modesache. Wer nicht anders zu können glaubt, als in Gamaschen loszuziehen, der nehme dann wenigstens das Beste, was auf diesem Gebiet existiert, die leichte, saubere, poröse und verblüffend einfach zu bindende Wickelgamasche »Mars«.

Phot. Ad. Saal.
Wanderer beim Abkochen.
Ich fühle nicht den Beruf in mir, meine Mitmenschen und Mitwanderer auf diesem herrlichen Planeten zu meiner Speisekarte zu bekehren. Wir sonderbaren Kostgänger des Gastgebers[59] unserer Weltenherberge sollen auch hierin ein jeder nach seiner »Fasson selig werden«, und alle Geschmäcke sind zu »tolerieren«. Aber eine kleine Predigt kann ich bei dieser Gelegenheit doch nicht unterdrücken.
Der Antialkoholismus unserer Tage kann nach meiner Ansicht eine ebenso große Besessenheit sein wie sein Gegenteil und verleitet fast noch mehr als dieser zu allerhand Hochmut, der bekanntlich immer vor dem Fall kommt. Während des Wanderns jedoch ist der Alkohol in jeder Form und Menge durchaus vom Übel. Es ist bis jetzt noch nicht erlebt worden, daß einer, der sich aufs Wandern verstanden hat, auch nur dem bekannten »Glas Wein« das Wort geredet hätte. Natürlich nur für so lange, als der Wandersmann noch irgendeine Leistung vor sich hat. Was dieser dann abends tut, das ist wieder ganz und gar seine Privatangelegenheit, und wenn er klug ist, dann hält er sich in diesem Punkt besser nicht unbedingt an den sonst auch fürs Streifen durch Wald und Welt sehr empfehlenswerten Spruch, nicht an den morgigen Tag zu denken.
Wer so steht, der mag im übrigen seinem Feuchtigkeitsbedürfnis auf dem Marsche oder bei den Mahlzeiten mit Sauermilch oder Quellwasser, mit künstlichen Limonaden in Wirtshäusern am Wege oder – was weit billiger und nützlicher – mit dünnem Tee und Kaffee aus der Feldflasche nachhelfen. Der natürliche Instinkt bewahrt ihn hier vor vielen Torheiten. Wem aber noch gesagt werden muß, daß er sich nicht mit eiskaltem Quellwasser schädigen soll, und wer nicht weiß, daß er mit einem Minimum von Flüssigkeit am besten fährt, weil er es ja doch wieder herausschwitzen muß, der möge lieber mit seinen Sorgen zu Hause bleiben. Der ist kein geborener Wanderer und wird es auch nie lernen.
Etwas anderes ist es mit dem Essen. Denn das ist wirklich eine noch ganz unbekannte Kunst im Zeitalter der angeblich so hochentwickelten Kultur. Sehr viele und nicht immer anmutige Predigten gegen den Alkoholismus wären überflüssig, wenn die Propheten sich einmal mehr mit den Gefahren des Essens als mit denen des Trinkens beschäftigen wollten. Mit dem zuvielen Essen fängt es an, nicht umgekehrt. Bei den meisten wenigstens. Nur keine Illusionen über diesen Punkt! Denn schon sehe ich in Gedanken einige Leser entrüstet auffahren mit dem zornigen Vorwurf im Herzen, nun wolle man ihnen auch noch – dieses Wort wird immer im Tone einer edlen Biederkeit ausgesprochen – ihr tägliches Brot beschneiden! »Heute, in der Ära der sozialen Frage!«
Gemach! Es gibt noch so etwas wie eine Wissenschaft, wenn auch mein Glaube an deren alleinseligmachende Wirkung nicht übermäßig groß ist. Ich halte diesen ernsthaften Predigtschwank durchaus nicht in der Wüste der Not, sondern in jenen Gefilden, wo die Fleischtöpfe Ägyptens gar heftig brodeln. Und da beißt nun keine Maus einen Faden daran ab, daß der »gebildete« Mensch aus dem Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts, der ja doch ein Übermensch werden will, sich vor allem einmal vom Überessen zurückentwickeln muß zum Essen. Vielleicht hat nichts zu dieser Erkenntnis so sehr beigetragen als die nun zum Glück auch in der Versenkung verschwundenen Rekordmärsche. Plenus venter studiert nicht nur, sondern marschiert auch nicht gern. Überall kamen die zähen, anscheinend ausgemergelten Läufer immer vor den Herkulesgestalten an. Ein richtiger David ist noch immer einem Goliath über gewesen. Beim Steinschleudern und sonst. Das zeigt sich auch beim einfachen, allem Sportgetriebe abholden Wandern.
Aber wir wollen doch ganz absehen von den äußeren Leistungen und nur von innerem Gewinn reden. Frau Aja erzählte, ihr Wolfgang habe mehr gesehen und erlebt, wenn er von Frankfurt nach Mainz reiste, als andere Leute auf großen Fahrten durch die Welt. Darum handelt es sich aber! Nämlich um die Aufnahmefähigkeit und das persönliche Glücksempfinden beim Wandern. Schon aus reinem Egoismus müßte da jeder, der das Wandern ernst nehmen, als eine Lebensschule betrachten und als einen Quell des Glücks genießen will, einmal in einem guten, von einem verständigen Fachmann geschriebenen Buche die neue Lehre vom Essen studieren. Ob das in einem Werk des Engländers Fletscher, des Dänen Hindhede oder des Amerikaners Dew geschieht, ist gleichgültig. Dann würde er nach einigen praktischen Übungen und Erfahrungen innewerden, daß alle Nahrungsaufnahme zu einem Fest werden kann, wenn man, was bisher für eine Schande und für ein Zeichen von Unbildung gehalten wurde, ganz und gar bei der Sache ist. Etwa so, wie es kraftgenialisch und exzentrisch Goethe, der große Lebenskünstler, schildert in seinem Gedicht von den zwei Propheten und dem Weltkind in der Mitten. Dann braucht es sich aber gar nicht um gebackene Hahnen zu handeln wie damals. Beim ebenso bedächtigen wie hingebungsvollen Genießen der einfachsten Nahrung kann man dahinterkommen, daß Reichtümer von Wohlgeschmack in jedem Stück Butterbrot liegen, wenn man sie nur zu heben versteht.
Wir Städter rümpfen in manchen Dingen die Nase über das Landvolk, das von den Dilettanten des Wanderns mit gleichem Unrecht[61] ungebührlich über- wie unterschätzt wird. So beruht zum Beispiel der Vergleich zwischen dem hochentwickelten Appetit eines an einer Table d'hote mit fünf Gängen arbeitenden Essers mit demjenigen eines Scheuerndreschers auf irrigen Voraussetzungen. Wer's nicht glaubt, der möge einmal Bauernknechte oder -mägde beobachten, wie sie am Tisch um eine große Schüssel Milch sitzen, bedächtig löffeln und langsam dazu ihre Kartoffeln kauen und das Mahl höchstens mit einem kraftvollen und nicht für zarte Ohren geeigneten Spaße würzen. Es könnte sich manche Tafel, an der man vor Messerklirren, tollem Durcheinanderreden und Schmatzen fast selbst nichts mehr hört, ein Beispiel daran nehmen. Wer nach einem scharfen Marsch im kühlen Schatten einer alten Eiche oder einer mächtigen Tanne schon einmal allein seinen kargen Imbiß eingenommen hat, umfächelt vom streichenden Wind und unterhalten durch die Tafelmusik der summenden Hummeln, der lispelnden Blätter und der gluckernden Quellen, der weiß, was ich meine. Er weiß, daß man beim Essen nicht beten soll! Das Gebet soll im Essen selber liegen. Alles andere ist vom Übel. Man soll sich freuen. Das ist alles.
Einen anderen Grundsatz aber als denjenigen der größtmöglichen Mäßigkeit gibt es nicht, wenn man dieser einfachen Freuden teilhaftig werden will. Auch hier wirkt in ganz ungeahnter Weise das Naturgesetz von der denkbar stärksten Wirkung bei denkbar geringstem Kraftaufwand. Man muß nur immer die richtige Grenze zu finden wissen, und zwar immer nur für seine Person allein. Denn auch das ist ein unanfechtbarer Grundsatz, der sehr trivial klingt, aber ganz tiefe Geheimnisse enthält, daß, was für den einen gilt, nicht auch zugleich für den anderen richtig zu sein braucht: die eben erwähnte Grenze muß man langsam herausklauben lernen.

Phot. Ad. Saal.
»Nun leb wohl, du kleine Gasse.«
Es bleibt nur noch übrig, einige kleine Winke zu geben in der Richtung des besten Nahrungsmaterials. In dieser Beziehung werden mit der besten Absicht unendlich viel Torheiten begangen, genau so wie in der Richtung des Zuwenig oder Zuviel. Vor allem gilt eines, was zu wenig beachtet wird! Der Magen ist in Angelegenheiten des Essens und Trinkens immer viel klüger als das Gehirn, und alles unmittelbare Empfinden, das sich leise und in nachdrücklicher Stille geltend macht, trifft immer viel besser das Rechte als alle aus Büchern gelernten Theorien. Diese verwirren nur im gegebenen Fall, wo der Wanderer sich nicht klar ist, was und wieviel er jetzt gerade essen oder trinken soll. Da fängt die Hypochondrie an, die man sich doch wegwandern will. Die Selbsterziehung beim Wandern kommt also gar nicht auf dem üblichen[62] Wege durchs Gehirn und durch Vielwisserei, sondern sie muß sich darauf erstrecken, daß wir wieder Ohren bekommen – innerliche natürlich und nicht zu lange – Ohren für das feine Mahnen und Klopfen unseres Organismus und seiner einzelnen wichtigen Zentralen. Diese Art des Gehorsams hat nichts zu tun mit äußeren Vorschriften. Denn jeder Organismus ist etwas ganz Besonderes. Erst durch diesen freiwilligen Gehorsam – nicht unseren groben Instinkten, sondern unseren feinsten Empfindungen gegenüber – kommen wir zu einer unvermutet großen Freiheit des Körpers. Denn so wie alles Überschätzen des Körperlichen vom Übel ist, ebenso rächt sich alles Unterschätzen des von uns noch lange nicht mit allen seinen Wundern genügend erkannten Zellenbaus unseres Körpers. Zu einer allgemeiner verbreiteten und höheren Art von Kultur und Leben können wir aber in unserer Zeitenwende nur dadurch kommen, daß die den Zellenbau ihres Organismus bewußt beherrschenden Menschen zu gesunden Bauzellen eines höherstehenden gesellschaftlichen Organismus werden. Womit, nebenbei gesagt, die Zusammenhänge zwischen dem Wandern[63] und den großen Kulturproblemen unserer Zeit genügend aufgedeckt sein dürfte.
Wer besondere Versuche mit vollwertigem Ernährungsmaterial machen will, der sei in erster Reihe auf frische Nüsse, Früchte, sodann Brot allererster Qualität (worüber im Anhang ein Rezept) und schließlich, wo frisches Obst und Früchte oder Nüsse nicht zu haben sind, auf die hervorragenden Nuß-, Honig- und ähnliche Präparate der Hamburger Nuxowerke verwiesen. Zu beachten wäre dabei immer, daß die leichteren und weniger nahrhaften dieser Präparate den kräftigeren und nicht immer kräftigenderen beim Wandern vorzuziehen sind. Den kaum ausbleibenden Vorwurf geschäftlicher Reklame für diesen Artikel auf dem Gebiet der Ernährungshygiene für den Wanderer werde ich mit gänzlicher Gelassenheit ertragen. Mit alledem soll aber nicht im geringsten einer einseitigen vegetarischen Ernährung mit ihren außerordentlichen Gefahren das Wort geredet werden. Wer daher dem natürlich empfundenen und nicht mehr zurückzudrängenden Bedürfnis nach einem soliden Filet aux Champignons am Abend eines festen Marsches nachgibt und sich dabei eine halbe (für starke Männer eine ganze) Flasche Rebenbluts zu Gemüte führt, der kann eines herzlichen »Prosit!« und »Wohl bekomm's!« meinerseits sicher sein.
Die Sprache ist eine Verräterin. Durch alle möglichen Klangfarben; in den Worten deutet sie an, um was es sich in Wirklichkeit handelt. Wer nicht das Diebische, das Leichtfertige, Elsternhafte aus dem Wörtchen »Knipsen« heraushört, der weiß noch nichts von der verborgenen Musik der Worte, die hier doch ganz klar im Ton an »Stibitzen« erinnert. Die kleinen Detektivapparate, die seit einem Jahrzehnt etwa den roten Baedeker aus der Hand der »Vergnügungsreisenden« verdrängt haben, sind nichts anderes als kluge Behälter für die kleinen raschen Diebstähle draußen in der Natur. Die moderne Technik macht uns alles so bequem. Wer hat es nicht schon erlebt, das Bild: Auf dem Dampferverdeck eines der herrlichsten Seen Deutschlands stehen allerhand Reisende, Damen und Herren. Auf einmal taucht ein altes Schloß aus den Fluten auf. Ein allgemeines »Ah!« So drückt sich die rasche Begeisterung aus. Dann wird's auf einmal still. Wie auf Kommando werden Kodaks und andere Kameras hochgehoben und ein lautloses Pelotonfeuer auf das arme Schloß gerichtet. Ein paar[64] knipsende Geräusche, wie wenn man einen Fingernagel am anderen wetzt, zucken durch die feierliche Stille. Dann beginnt wieder die Unterhaltung in allen Weltsprachen, und der nächste Film wird aufgedreht.
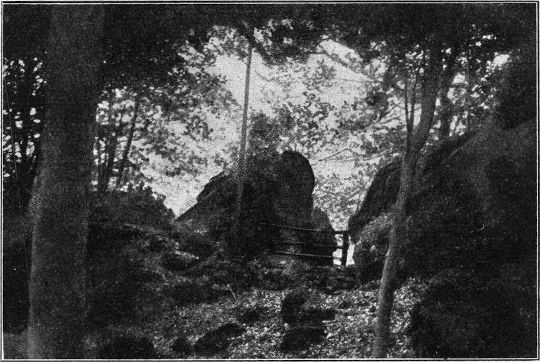
Der Seggenstein im Hessenlande.
Ich will die Kunst des Photographierens gewiß nicht herabsetzen und den ungeheuren Fortschritt auf diesem Gebiet bestreiten. Die Illustrationen dieses Buches würden mich teilweise selber Lügen strafen. Aber das Photographieren als Massenbetrieb ist eine grauenhafte Sache geworden. Denn nicht nur kann man nichts getrost nach Hause tragen, wenn man's nur schwarz auf weiß besitzt, sondern was das Licht auf die photographische Platte im Bruchteil einer Sekunde zaubert, ist lange nicht das, was wir in der Kamera unserer Augen, der das photographische Spielzeug ja nur nachgebildet ist, sammeln könnten.
Tafel VI

Wimpfen a. B.: Hohenstaufentor

Neckartal bei Neckargerach
Es liegt in allem rein Technischen eine merkwürdige Ironie. So etwas wie eine Strafe dafür, daß man sich mit untergeordneten Hilfsmitteln begnügt, wo wir doch alle über viel Größeres verfügen, wenn wir's nur erkennen und pflegen wollten. Ich meine die psychische Fähigkeit, alle äußeren Dinge, vor allem Landschaften und Stimmungen in der Natur, durch unser Auge unmittelbar aufzunehmen und wie durch eine konservierende Lösung den künstlerischen Gehalt des Geschauten durch unsere Seele ins Unterbewußtsein[65] versinken zu lassen. Daß das möglich ist, das zeigt – um ein möglichst prägnantes Schulbeispiel anzuführen – der Fall aller jener Maler und Zeichner, die nach dem Gedächtnis reproduzieren. Ich kenne selber einen alten Akademieprofessor, der tagsüber im Café oder abends im Theater interessante Köpfe durch intensives Schauen sich derart tief einverleibt, daß er in der Nacht vor dem Schlafengehen die Gesichter aus dem Gedächtnis zeichnen kann. Sie sind fast immer porträtähnlich. Aus dieser alten bekannten Tatsache ziehen nur leider die allerwenigsten Wanderer den richtigen Schluß: Jeder Mensch ist bis zu einem gewissen Grade Zeichner, Maler, Dichter, Musiker. Denn: es gibt wirklich gar keine menschliche Fähigkeit, die der einzelne nicht in irgendeinem Grade selber besäße. Die Zeichnungen in den Wohnhöhlen unserer Vorfahren aus der Steinzeit lehren uns, wie stark damals schon der Mensch künstlerisch produktiv war. Das bildnerische Talent im Menschen und seine Anlagen zum Zeichnen und Malen werden nun aber durch die handwerksmäßige Liebhaberphotographie am meisten unterdrückt. Daß manche Menschen erst durch das Photographieren zu den ersten Sehübungen gelangen, wird damit gar nicht bestritten, wie denn ein jedes Ding bekanntlich seine zwei Seiten hat.
Da und dort dämmert ja die Ahnung vom Schaden des Knipsens schon auf, und manche Feinfühlige empfinden die Vorspiegelung falscher Tatsachen beim Photographieren recht lebhaft. Die Täuschung seiner selbst und des anderen liegt nämlich darin, daß – künstlerisch ausgedrückt – der schöpferische Vorgang zwischen dem Eindruck einerseits, den der Photograph von einer Landschaft hat, die ihn zur Wiedergabe reizt, und zwischen dem Resultat der Wiedergabe andererseits eine ganze Anzahl von Trübungen und Fälschungen durchmachen muß. Wer »nur so zum Spaß« photographiert, wird das natürlich nicht verstehen und es für überspannt halten. Wer aber sich ständig über sein eigenes Photographieren ärgert, auch wenn er künstlerisch schon recht ansehnliche Bilder zustande bringt, und dabei nicht darauf kommt, woran es eigentlich liegt, daß das fatale Gefühl einer ständigen Unbefriedigung nicht weichen will, dem möchte ich auf die Sprünge helfen.
Jeder Amateur weiß, daß die allerbesten Stimmungsbilder sehr häufig Zufallssache sind, wenn nicht die Stimmung bewußt durch kluge Mittel der Technik hineingetont wurde. Daß viele der schönsten Dämmerstimmungen bei ganz grellem Sonnenscheinlicht gemacht sind, dürfte auch weniger Unterrichteten bekannt sein. Jedenfalls gelingt es nicht sehr oft, gerade denjenigen[66] Stimmungswert photographisch aus einer Landschaft herauszuholen, der einen zur Wiederholung des Geschauten durch Negativ und Kopie gereizt hat. So ist es eben keine Ausnahme beim Photographieren, daß man, wie ein französisches Sprichwort sagt, auch Amseln ißt, wenn man keine Wachteln hat. Andererseits ist mancher Kamerajäger sehr erstaunt, wenn er nach scheinbar harmlosen photographischen Streifereien in der Dunkelkammer große Entdeckungen konstatiert. Vielen Liebhaberphotographen kommt es gar nicht zum Bewußtsein, daß eben hier eine im höheren Sinne nicht anders als Unwahrhaftigkeit zu nennende Trübung des künstlerischen Schaffens vorliegt. Aber die bei feineren Gemütern unausbleibliche Wirkung dieses inneren Vorgangs wird eben doch empfunden, genau so, wie der Aquarellist sich schämt, wenn er in Wasserfarben eine duftige Morgenstimmung aufs Papier hauchen wollte, die ihm vorbeigerät, die von einem Ahnungslosen aber als ein sehr hübscher Abendeffekt empfunden und gelobt wird.

Phot. Gottheit & Sohn, Königsberg.
Aus Gilge, dem ostpreußischen Venedig.
Aus diesen und manchen anderen Gründen greift mancher Wanderer wieder zu Bleistift und zum Skizzenbuch oder trägt anstatt der Kamera eine Blechschachtel mit Wasserfarben und einen guten Papierblock im Rucksack. Goethe hat sich in seinen späteren Jahren manchmal unmutig darüber geäußert, daß zu seiner Zeit »alles gezeichnet« habe. Aber abgesehen davon, daß der alte Herr eben auch manchmal, wohl vom Vater her, schulmeisterliche, engherzige Anwandlungen hatte, ist es doch jedenfalls noch hundertmal besser, alles zeichnet, denn alles knipst! Denn Zeichnen und Malen ist, mag es noch so unbeholfen ausfallen, kein mit dem leichten Schatten künstlerischer Unehrlichkeit behaftetes Knipsen, sondern – man erschrecke nicht über das neue Wort – ein Ipsen!
»Ego ipse!« Ich selber hab's gemacht! Das kann jeder sagen, der, an einem Rain oder auf einem Baumstamm sitzend, mit der Tücke des Objekts gerungen hat, das sich nur widerwillig den Absichten des Naturfreundes fügt. Aber dieses Bewußtsein ist das geringste. Der Wert des Zeichnens und des Malens liegt vielmehr darin, daß der Wanderer gezwungen wird, einmal das Bild, das er gern mit nach Hause nehmen möchte, intensiv auf sich wirken zu lassen, und zwar nach seinen Helligkeitswerten wie nach den allgemeinen Linien, nach seinen Farbentönen wie nach dem perspektivischen Aufbau. Kurz, er muß den Eindruck in seine Einzelbestandteile zerlegen und dann das erschaute Bild in seinem wesentlichsten Inhalt auf die denkbar einfachste Form in seinem Innern zusammenbringen. Dann erst kann der Vorgang der Wiedergabe beginnen.
So aber lernt man das Schauen und das Schaffen. Selbst wenn das, was er auf das Papier mit Blei oder Farben zaubert, auch ein fauler Zauber ist, so hat er doch ein Stückchen der großen Arbeit geleistet, die jedes wirklichen Menschen Aufgabe bildet: die Wunder der Außenwelt in sich aufzusaugen, sich damit das Herz zu erfüllen, so groß oder klein es ist, und das Aufgenommene als eine neue Schöpfung herauszugestalten, sich selber zur Freude, manchmal auch anderen zur Lehre: nämlich zur Lehre, wie man dahinterkommt hinter die verborgenen Herrlichkeiten und Wunder der Welt.
Und das ist schon etwas.
Hans Thoma, der große Zauberer, der es mehr als fast alle anderen deutschen Maler verstanden hat, aus der Landschaft die Seele zu lösen und auf Leinwand zu bannen, hat vor nicht gar zu langer Zeit aus einem ähnlichen Gesichtspunkt heraus gegen die sonst sicher sehr schönen Künstlerdrucke geredet, die jetzt in den Schulen[68] zum Schmuck und zur Belehrung die Wände zieren. Er haßt das Mechanische darin, das Unlebendige; und er meinte, auch das schlechteste Ölbild eines sehr bescheidenen Malers gäbe den Kindern mehr als ein Druck, weil sie da eine Idee davon bekommen können, wie solch ein Gemälde entsteht. Die Kinder sehen die Pinselstriche, mit denen die Farbe und damit das Bild auf die Leinwand getragen wurde. So kommen sie dahinter. Diejenigen, welche genügend begabt sind, werden auf diese Weise zum Nachmachen angeregt. Bei einem noch so vorzüglichen Steindruck aber ist der technische Werdevorgang viel schwerer zu erkennen.
Das ist ganz zweifellos so. Die Massenreproduktion zerstört den lebendigen Zusammenhang zwischen künstlerischem Erzeugnis und dem Beschauer. Das lehrt uns aber noch etwas anderes, für unseren Fall Wichtigeres. Kleine Skizzen, sei es mit Bleistift oder in Aquarell, enthalten etwas so Persönliches und haben so viel von dem innersten Ringen um Gestaltung in sich aufgesogen, daß sie, mögen sie auch noch so dürftig sein, für den Dilettanten selber viel bessere Schlüssel zur Erweckung vergessener Eindrücke sind als Photographien. Die Engländer, von denen wir noch manches lernen könnten, haben das Aquarellieren und Zeichnen auf Wanderungen schon lange geübt. Und ich war einmal Zeuge davon, wie ein früherer Zögling einer Ruskinschule einigen Bekannten seine nicht übermäßig gut geratenen Aquarellskizzen zeigte. Bei einer jeden von ihnen brach er, obwohl die Bildchen schon alt waren, in eine lebendige und humorvolle Schilderung der ganzen Situation aus, in der das Aquarell entstanden war. Das künstlerisch Unvollkommene rief seinen Erinnerungsschatz wach; und was er nun in Worten hinzufügte, gab uns allen ein noch viel lebendigeres Bild, als es die beste Skizze vermocht hätte. Ist nun aber einer gar so klug, seine unvollkommenen Bemühungen mit Bleistift und Papier für sich zu behalten und nie zu zeigen, so werden sie ihm in stillen einsamen Stunden die schönsten Geschichten aus seinen Wanderfahrten erzählen, noch besser, als alle Tagebücher dies vermöchten.
Ich habe hier nur gegen die Knipser geredet; gegen jene fatalen Wanderkameraden, die nichts ungeknipst lassen können. Dieser Tage fand ich in der Zeitschrift »Der Wanderer« einen ausgezeichneten Ausdruck für Photographenapparat, einen wahren Kernschuß der Sprachreinigung: »Die Strahlenfalle« nennen die Gesellen eines hannöverschen Wanderbundes den Kodak ebenso bezeichnend als witzig! – Wie wär's, wenn man auch von den »Strahlengefallenen« reden würde, womit die Leute gemeint[69] wären, die nicht mehr wissen, daß der Mensch bei der Geburt zwei wundervoll arbeitende »Strahlenfallen« mitbekommen hat, die in der Regel kein Licht mehr ausstrahlen, sobald sie das Einstrahlenlassen verlernt haben.

Hofphot. C. Eberth, Cassel.
Kirchbauna bei Cassel.
Ich sage nichts gegen das Photographieren einzelner begabter Amateure. Ich besitze selbst eine Sammlung von geschenkten Lichtbildern, deren Durchsicht mir schon mehr als einmal nicht nur immer wieder neue Erinnerungswerte zum so und so vielten Male verschaffte, sondern auch jenen fast an die Grenze des Kunstgenusses grenzenden Genuß bereitete, der von untheatralischen, mit keuschen Sinnen und mit zarten Fingern aufgenommenen und liebevoll »entwickelten« Photos ausgeht. Ich rede also nur gegen die neue Naturkleptomanie der wandernden Nurknipser, gegen jene Filmpest, die nur ein weiterer Schritt zu der Entpersönlichung des Menschen und seiner Entwürdigung zum Maschinisten einer Unzahl von wunderbar[70] feinen technischen Apparaten ist, die ihm aber nach und nach die Hände, die Füße, die Augen und schließlich auch – das Herz ersetzen. Und der Deus ex machina taugt auch auf diesem Gebiete nichts. Er gibt scheinbar und raubt dafür um so mehr! Und du sollst dich nicht berauben lassen, du Wanderer, der du einer neuen Zeit der Fülle und der Helle entgegengehst!
Aphorismen.
Bleib in deiner Haut, wo auch deines Schusters Rappen traben mögen, und sage nicht: »Grüß enk Gott«, wenn du zu Hause den Nächsten mit einem »Juten Tach« begrüßest. Es ist keine Schande, der und nur der sein zu wollen, der man ist, und die Herzlichkeit des Grußes muß der andere aus deinen Augen verspüren. Alles das liegt jenseits von Geographie und Dialekt.
Machen Kleider wirklich Leute? Leute schon – aber keine Wanderer und keine – Menschen. Und der Weg zum Menschen geht über das Wandern.
»Andere Städtchen, andere Mädchen!« Das ist ganz in der Ordnung. Wenn du im Übermut eines schönen Sommerabends in einen Garten einfällst und von dem Blütenreichtum einige Rosen plünderst und im goldenen Schein deiner Jünglingssehnsucht in jedes Mägdleins Augen, das aus einem altmodischen Giebelfenster schaut, den Himmel siehst, dann ist's, wie wenn ein Blitz nur leuchtet aber nicht trifft, wie wenn eine Sternschnuppe nur vor dir niedergleitet, dir aber nicht auf den Kopf fällt. So, aber nicht anders soll dir ein jedes andere Städtchen ein anderes Mädchen bescheren. Aber – rühre nicht daran! Dann ist es Glück! Und die Zeit ist nicht so sehr lang, wo man die Baßgeigen am Himmel und diesen selbst in jedes Jungfräuleins Augen sieht.
Auch die Unbefangenheit hat ihre ewigen Grenzen, wenn nicht aus ihren drei mittleren Silben ganz verschämt etwas anderes werden soll.
Es ist nichts unmöglich. Ich sah einmal zwei junge Touristen einem Bäuerlein über die Kleeäcker laufen und gleich darauf den Versuch machen, dem alten Mann unter Anbietung von Broschüren über »Ländliche Wohlfahrtspflege« einen kleinen Vortrag zu halten. Ob das Bäuerlein diesen Genuß nicht allein haben wollte – ich weiß es nicht. Jedenfalls rief er seinen zwei Knechten und sah sich unterdessen in der Scheuer nach dem Nagel um, wo der Geißelstecken hing. Worauf die beiden jungen Herren es vorzogen, ihren Vortrag ohne weitere Begründung abzubrechen und die ungastliche Stätte zu fliehen. Was sie nur hatten?
Mein Sohn, wenn du gern singst und eine schöne Stimme hast, dann vergiß das eine nicht: Immer hören es auch die anderen!
Botanik ist eine schöne Sache. Aber wenn dich einer bei jeder Blume, deren er habhaft werden kann, mit ihrem lateinischen Namen und der Zahl der Staubfäden beglücken will, dann laß den Mann allein mit seinem Latein und schüttle seinen Staub von deinen Füßen.
Wenn dein Rucksack leer ist und auch dein Magen, so bitte deinen Gefährten um nichts. Wenn er es nicht von selber merkt, dann gibt er nur ungern. Und so lange muß dein Stolz über deinem Magen sein.
Die Teilnahme am Wohl und Wehe seines Wanderkameraden ist ein schöner Zug. Wenn du aber doch durch ein unerbetenes Herumsausen für die anderen, und weil du »so gerne Dienste leistest«, schließlich selber dein Eigenes vergißt und der ganzen Horde zur Last fällst, dann gehört das zum Altruismus, das ein Laster ist.
Nur nicht immer erziehen wollen beim Wandern in Horden. Es ist schon manchem guten, aber schwerfälligen Burschen das Wandern verleidet worden, weil jeder ihn »erziehen« wollte.
Aber es gibt Muttersöhnchen, Jüngelchen und Brüder voller süßlicher Tücke, die eine ganze Schar von fröhlichen fahrenden Gesellen untereinandermachen und mit den auserlesensten Tricks alle hintereinanderhetzen können.
Ich bin grundsätzlich gegen alle Gewalttätigkeiten, aber da bedarf es nachträglicher Kinderstube: wenn die zwei Gesellen mit[72] den treuesten Herzen, aber auch mit den kräftigsten Armen solch einen Knaben hinter einem großen Busch einmal nach alter guter Sitte – »erziehen«, dann geschehen oft Zeichen und Wunder! Vornehmer aber ist es auf jeden Fall, einen solchen »Unmöglichen« mit dem nötigen Reisegeld versehen postwendend nach Hause zu schicken.
Wenn du die Berge liebst, so rede nie über ihre Höhe; wenn du die Wolken liebst, so klage nicht über die Regentage; wenn du die Blumen liebst, so reiße sie nicht bei jeder Gelegenheit ab, um sie nachher wieder wegzuwerfen; und wenn du deine Wanderkameraden liebst, dann sehe nicht auf ihre Torheiten und Schwächen. Sie werden es dir danken und sie desto eher ablegen.
Gott sei Dank, sagte einer vom »A. W. V.«, daß ich nicht bei der Blase »F. K. B.« bin. Die Kerle verkaufen unter der Woche Heringe und mimen am Sonntag Wandersport. – Da schlug ihn der Vater aller Wanderer mit noch größerer Blindheit als denjenigen, woran er schon litt. Und je weniger er auf seinen Touren sah, desto »pyramidaler« und »phänomenaler« kam ihm alles vor, besonders er aber sich selbst.
Hab nicht den Ehrgeiz, beliebt zu sein. Die Beliebtheit ist immer die Treppe, auf der einer von seinen ersten Bewunderern heruntergeworfen wird; auch wenn er der Diensteifrigste der ganzen Schar war. Denn alle merken bald, daß er nur aus Eitelkeit uneigennützig und aus Eigennutz liebenswürdig war.
Du bist ein Witzbold?! Dann vergesse nie das Rezept: morgens und abends einen Eßlöffel voll. Mehr bekömmt dir schlecht und den andern.
Wenn du eine Scheune beim Nachtlager oder untertags ein Lokal überfüllt findest, dann ist es ein Zeichen von Einsicht, wenn du nicht vergissest, daß du auch selber zu dieser Überfüllung nicht weniger beiträgst wie jeder andere.
Die Knallprotzen der Nacktkultur! Eher versetzen sie eine alte harmlos im Walde wandernde Jungfer durch ihren entblößten[73] Oberkörper in Aufregung, als daß sie deren Zimperlichkeit zu Hilfe kommen, rasch die Jacke anziehen und auf die Bewunderung ihrer schönen Schultern und Arme verzichten. Das wäre ritterlicher, wenn denn durchaus der Held markiert werden muß.
Im Paradies wird es sicher einmal keine Polizeivorschriften geben, aber auch nur Menschen, die das Vernünftige von selbst tun. Das mögen sich die jungen Wanderer merken, welche glauben, die sehr wichtigen amtlichen Vorschriften jedes Landes über das Anzünden von offenen Feuern nicht kennen zu brauchen.
Man kann in aller Gutherzigkeit Dinge tun, die andern sehr schlecht bekommen. Wir haben einmal zu dritt einen Fischernachen benutzt, um an das andre nahe Ufer eines Sees zu fahren, und machten das Schiff ohne Erlaubnis los, weil wir sicher waren, es in kurzer Zeit wieder zurückzubringen. Aber es verging ohne unsere Schuld ein ganzer Tag, und wir kamen gerade dazu, wie ein anderer Junge als vermeintlicher Täter von dem Fischer die Prügel bekam. Es half uns nichts, daß wir uns gleich als Täter bekannten; und wir haben auf jener Wanderung wie im ganzen Leben kaum einen so trüben Abend voller Beschämung gehabt wie damals.
Wenn dein Deutschtum in dir nicht mit einigen guten Tropfen von Menschheitsgefühl und Weltbürgerempfinden gesalbt ist, dann lasse lieber das Reisen im Ausland.
Es ist etwas Herrliches um unsere deutsche Wanderbewegung. Aber die Zeit ist nicht fern, wo eine große Anzahl von denen, die heute mit Rucksack und Hakenstock der Natur und den Mitmenschen näher kommen, es für – unfein halten und mit der gelassenen Empörung der »Vornehmen« wieder in ihren vier Wänden sitzen bleiben werden, weil ja heutzutage »einfach alles, alles mögliche wandert«.
Drei Arten gibt's von Menschen, sagt der Koran: den Freund, den Sanften und den Tapferen. Den einen erkennt man in der Not, den anderen im Zorn, den dritten in der Gefahr.
Beim Wandern kann man sie alle drei finden. Häufig sind sie nicht.
Es war am Titlis. Kaum eine halbe Stunde vom Trübsee aufwärts, wo der Weg steiler und steiniger ist als sonst, da übertrat sich einer den linken Fuß. Der Führer der Schar – es waren Wandervögel –, ein junger Mediziner, kurz vor dem Examen, stellte Sehnenzerreißung mit starkem Bluterguß fest. Es war ein Tag voll von Glanz und Leuchten. Der blanke Schild des Titlisgletschers winkte verlockend. Da kamen zufällig Berufsführer von oben, die wollten den Verunglückten schon hinunterbringen. Aber einer von der Schar, ein stiller Junge, ließ sich nicht abhalten, den Maroden zu begleiten. Im Trübseehaus massierte er ihn, las ihm vor und wartete, bis der Kranke auf einem Maultier nach Engelberg gebracht werden konnte. Auch da ging er mit. Als die anderen ihn am Tag darauf allein in Engelberg wieder trafen, meinten die meisten: »Na, Franz, so was! Der hätte doch allein seine kaputten Knochen hüten können – 's war einfach ganz wundervoll da oben! So 'ne Dämlichkeit!«
Der Franz sah ganz verlegen drein und antwortete nichts. Was hätte er auch sagen können? Das waren halt – zwei Welten.
In der Hohen Rhön, als es noch zwei Stunden bis zum Rastplatz war, wo abgekocht werden sollte, mußte der »Olympier« – so hieß er im »Pennal« – unbedingt Zigaretten rauchen, um »in Stimmung zu kommen«. Der Koch pumpte ihm die letzten Streichhölzer mit der Warnung, ja nicht alle zu verbrauchen. Denn die ganze Bande war zufälligerweise ohne Feuer. Der »Olympier« kannte solche irdischen Lappalien nicht. Nach einer Stunde (seine Zigaretten gingen ihm alle Augenblicke aus) war kein Streichholz mehr in der Schachtel. Der Küchenmeister mag so eine Ahnung gehabt haben, fragte nach den Streichhölzern und konnte nur noch die betrübende Tatsache feststellen. Was tun? Wolken bedeckten den ganzen Himmel. Mit einem Brennglas war also nichts zu machen, Zunder und Feuerstein waren nicht da. Das ganze Dutzend der Kameraden gähnte nur so vor Hunger. Nach einigen Minuten sah man nichts mehr vom Koch. »Der hat sich wohl dünne gemacht!« meinten manche, die von der Geschichte erfuhren. Aber gegen den »Olympier« wurde die Stimmung geradezu drohend. Aber als man am bekannten Rastplatz ankam, prasselte schon ein großes Feuer, der Koch wartete nur auf das Kochgeschirr und die Erbswürste. Er war in aller Stille im Laufschritt in ein nahegelegenes Dorf gerannt, hatte dort Streichhölzer gekauft und war auf einem geliehenen Rad zurückgefahren. Als der »Kohldampf« sich unter[75] der Gegenwirkung des leckeren Mahles verzogen hatte, bot der Koch dem Olympier freundlich Feuer an zu einer für ihn nun natürlich nötig gewordenen Zigarette.
Ein junger Freund, der mir den Vorfall erzählte, wußte nichts über die augenblickliche Wirkung dieser grenzenlos sanften Zurechtweisung des sehr begabten, aber verwöhnten und etwas sehr leicht angelegten Sünders zu sagen. Er schien das damals nur in der Ordnung zu finden. – Aber von diesem Tage an rauchte er nicht mehr und wurde ein wenigstens so tüchtiger und zuverlässiger Mensch, als es bei seiner Veranlagung möglich war.
Vom Koch aber sagte beim Essen jeder, als er von seinem tollen Trab nach Zündhölzern hörte: »Na, der Bruder, der »Olympier«, hätte mich mal kennen lernen sollen!« Dabei machten sie eine nicht mißzuverstehende Handbewegung, löffelten aber ihre Suppe weiter und fanden das auch ganz in der Ordnung.
Es waren eben – zwei Welten.
Beim dritten Erlebnis, am Untersee, war eine Schar von Primanern einer deutschen Stadt bei einem der dort wohnenden Dichter und Fürsprecher der Wanderbewegung zu Besuch gewesen. Auf der Rückfahrt bei vollbesetztem Boote gingen die Wellen während eines der dort ganz unerwartet rasch einsetzenden Föhnstürme ziemlich hoch. Der Schiffmann mahnte zur Ruhe. Als aber eine Welle den Boden des Bootes bis über die Bretter füllte, womit der Kielraum überdeckt war, legte sich über sein altes Landsknechtgesicht ein seltsamer Zug. Ernst, Angst und ein wenig verhaltene Wut über die »Schwadronöre« stand auf den braunen, harten Zügen geschrieben. Er ruderte grimmig drauflos und sagte zu den Gehilfen am zweiten Ruderpaar ganz leise: »Schuh usziehe!«
Dies verstanden nur wenige. Sie erkannten nicht den Ernst der Lage, weil die beiden Ufer dort nicht mehr als einen Kilometer voneinander entfernt liegen. Eine zweite Sturzwelle kam. Das Boot sank bis an den Rand ein. Da sprang einer der wenigen, die verstanden hatten, warum der Schiffsknecht die Schuhe ausziehen sollte, der »lange Mann«, wie sein Übername bei den Kameraden war, ein junger Hüne, dessen Mut geradeso groß war wie seine Geschicklichkeit in allen Arten von Sport, nur mit der Hose bekleidet in den See und schwamm die hundert Meter bis zum Ufer fast so schnell wie das Boot, das nun, um mehr als hundertfünfzig Pfund erleichtert, aus der größten Gefahr war.
Als alle wohlbehalten auf der Ufermauer des alten Hafens mit dem malerischen Stadttor standen, meinte einer: »Aber so 'n Luxus, langer Mann! Sich in solche Unkosten stürzen! Wir wären ja die paar Meter auch so 'rüber gekommen!« Der alte Schiffer sah zuerst den Sprecher verächtlich und dann den Schwimmer mit einem Blick an, der weder seine Bewunderung noch seine Dankbarkeit verbergen konnte. Er hatte eine Frau und sechs Kinder.
Das waren eben auch – zwei Welten.

Zur Verfügung gestellt vom Verschönerungsverein Altenburg i. S.
Bäuerin aus Sachsen-Altenburg.
Ich kenne einen Mann, der sonst als leidlich friedvoller Mensch gilt. Von Zeit zu Zeit aber wird er von etwas heimgesucht, das seine Leute den »Zustand« nennen. Dieses Wort ist für die Kleinen wie für die Großen im Hause so etwas ungefähr wie ein Sturmsignal. Alles rettet sich, wenn auf den Stiegen die Kunde geht, der Vater habe seinen »Zustand«. Selbst die Katze und der Hund ziehen sich dann in sichere Winkel zurück, von denen niemand nichts weiß.
Diesen Mann hatte es vor einigen Tagen wieder einmal gepackt. Weshalb, das wußte kein Mensch. Schon um neun Uhr morgens[77] hatte die Kleinste das Unheil geahnt. Sehr besorgt hatte sie zum kleinen Bruder gesagt: »Papa danz bös, Muckel dudu betommt!« Richtig brach auch bald nach dieser Prophezeiung das Unwetter los. Drei Türen fielen kurz nacheinander irgendwo im Haus so kräftig ins Schloß, wie das eigentlich nur angesichts eines bevorstehenden Weltunterganges gerechtfertigt wäre. Wie grollender Donner rollten einige unverständliche, verschiedensprachige Bemerkungen, die wohl als Verwünschungen aufgefaßt sein wollten, hintennach und verhallten hinter der zugehauenen Haustür ungefährlich in der freien Luft. Im Hof stoben die Hühner wild auseinander, und mit fliegenden Rockzipfeln verschwand der Zornige durch die Hoftür. Mit gütigen und nachsichtigen Armen aber nahm die Freiheit der Felder und Wälder den Rasenden auf wie einen Leidenden. Und das war er wohl auch.
Seltsam wurde ihm da draußen zumut, als er immer noch in der fliegenden Hast des »Zustandes« langen Schritts die Landstraße hinab dem Wald zuging. Es war ihm gerade, als ob er zum erstenmal nach Jahrzehnten die Welt wieder erblickte. Das neue Brot des Jahres stand noch auf den grünen, hohen Halmen, links und rechts vom Weg. Ein leiser Wind strich über das grausilberne Ährenmeer hin, und die Kornfelder schlugen leise Wellen, und alle Halme verneigten sich vor dem zornigen Manne.
Drüben am Berg floß das glühende Gold der Ginstersträucher wie ein Strom von Reichtum die Hänge herab. Am Himmel, ringsherum am unendlichen Horizont, ruhten seltsame Wolkengebilde, feierliche, spaßige, gewaltige, und dazwischen kleines Flutterzeug. Was war da nur los? Fast wie eine Wolkenausstellung sah's aus. Wie wilde Anemonen blühte draußen über der Ebene am Himmel ein Feld von weißen Wölkchen, daneben ruhten majestätisch, wie die Staatsschimmel irgendeiner hohen Gottheit, silberglänzende Wolkenballen, und andere noch heller leuchtende und hoch aufgetürmte stiegen, schnaubenden Kriegsrossen gleich, drohend am Himmel in die Höhe. Über den dunkeln Bergwäldern schwenkten ganz langsam Wolken wie Luftschiffe, die gerade landen wollten. Schlanke Zeppeline schwebten da, die immer noch wuchsen und wer weiß was allerhand noch werden wollten, und dicke Parsevale. Leuchtend blau wölbte sich die Himmelskuppel über der Erde. Die vollen Saaten, zwischenhinein mit üppigen Bäumen durchstanden, taten gar selbstbewußt in ihrer reifenden Schönheit unter der strahlenden Sonne. Licht lag über der ganzen Welt, über den Bergen, über den stillen Fluren und den raschen Bächen. Und während des Flüchtigen Schritt immer ruhiger ward, klang durch[78] die Stille eine stumme Verheißung von Hoffnung und Leben und Glück.
Das galt ihm; das wußte er.
Er raste nicht mehr, sondern schaute verwundert um sich über die langvergessene Herrlichkeit. Ein scharfer Beobachter drüben in den Bauernhäusern hätte sogar entdecken können, wie er sich manchmal verlegen hinter den Ohren kratzte. Und vor den braunen Hütten mit den bemoosten Strohdächern hockten wie in der Hitze eingenickte Wächter viele alte über und über in Blust stehende Holunderbüsche.
»Wie schön, wie ganz wunderbar schön,« entfuhr es dem Manne mit dem »Zustand« fast demütig. Er begann sich regelrecht zu schämen. Mit jedem Schritt wurde er es immer mehr inne, daß er krank war. Nicht gefährlich! Nur bücherkrank und stubenkrank! Die blaßvioletten Skabiosen in den Wiesen mit ihren hübschen Blumenkörben verstanden auch, wie's um ihn stand, und die herrlichen goldgelben Sterne des Ziegenbarts wußten es so gut wie die weißen Dolden und roten Rispen und die blauen Glocken und die braunen Wiesenknöpfe, was mit ihm los war. Sie hatten schon alle lachen wollen über den sonderbaren Menschen, denn sie waren übermütig, weil alle Wiesen so herrlich im Pfingstglanz leuchteten, und der da aussah, als hätte er die ganze Zeit auf dem Mond gelebt, wo es erwiesenermaßen nichts mehr gibt, als griesgrämige Berge, die keine Feuer mehr spucken und auch keine Blumen auf ihren ausgemergelten Felsrippen mehr wachsen lassen konnten. Aber als die Butterblumen und die Ziegenbärte eben verächtlich lachen wollten, da kam auf einmal der Wind vor dem stubenkranken Wanderer her und fuhr all den Gräsern und Kräutern über die übermütigen Köpfe, daß sie sich ganz bescheiden vor ihm neigten, und sagte:
»Wie könnt ihr nur? Das ist doch einer von denen, die über uns Bücher schreiben müssen!«
Da schämten sich die Wiesenblumen; denn so viel wußten sie wenigstens, daß man beim Bücherschreiben, auch über die Blumen und über die Wolken und die Bäche und die Bäume und den Wind, in der Stube sitzen muß, wo es das alles nicht gibt.
Der Mann aber, der zuletzt nur noch ganz langsam gegangen und oft stehen geblieben war, um mit durstigen Augen all den bunten Glanz und all das ruhige Glück sonniger Farbenstille in seine verstaubte Seele hineinzutrinken, fing auf einmal von neuem an zu laufen. Nicht mehr aus Zorn. O nein! Er spürte nun, daß er wieder lebte, lebte in der Welt und mit der Welt, und[79] die Welt in ihm. Er fing an zu singen und zu springen. Wie lange, das wußte er selber nicht. Aber plötzlich stand er wieder vor der Tür seines Hauses mit einem mächtigen Strauß aus Feld- und Waldblumen in der Hand, und er wunderte sich sehr, daß ihm sein Weib lächelnd entgegentrat, den Strauß mit wenigen, guten Worten bewunderte und sonst tat, als ob gar nichts gewesen wäre.
Was war denn überhaupt geschehen?
Er hatte nur noch ein dumpfes Gefühl einer wüsten, langen Gefangenschaft in dunkeln Räumen, einer barbarischen Trennung von Licht und Welt und Sonne und Schönheit. Und als er wieder in seinem Bücherkerker angekommen war, da wußte er, was ihm gefehlt hatte.
Von da an ging alles wieder gut im Haus, denn jeden Tag besuchte man mit dem Vater die Holunderbüsche und den Wald und den Bach und die Wolken und überhaupt alles da draußen vor dem Gartenhag, was so schön ist.
Und daß dieser Mann, der ein guter Bekannter von mir war, je einmal den »Zustand« hatte, das ist nun wie ein Märchen aus alten Zeiten. Und wenn es wieder kommen will und er fragt bei uns um unsere Meinung, dann wird die Parole gegen den Erzfeind aller Stubenhocker, den Sorgengeist, ausgegeben. Die Großen und die Kleinen und die Kleinsten werden in die gute Stube gerufen, ich setze mich ans Klavier, und der böse Geist fährt aus unter den Klängen des Liedes:
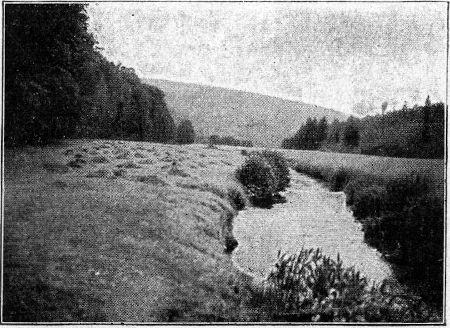
Phot. ***
Das Schondratal, ein Seitental der Fränkischen Saale.
Es braust in den Lüften von Pfingststürmen. Welcher junge Mann hätte es noch nicht verspürt, sei er Student, Arbeiter, Kaufmann oder Kanzlist, der es ernst nimmt mit dem Leben, das tiefe Erbeben, unter dem unser ganzes Leben, das des einzelnen wie das der Familie, das des Staates wie das der Völkerbünde erzittert? Die Zukunft des deutschen Volkes – und das geht uns zunächst an! – hat im Hochofen des 20. Jahrhunderts schon fast die Weißglut erreicht, und es braucht Männer, um das Schmelzgut ohne Gefahren und Verluste in Formen zu fassen. Ganze, reine, tapfere und treue Männer braucht es! Unter ihrem Brusttuch muß das Herz der neuen Zeit schlagen, das dem hohen Blutdruck eines intensiveren Lebens gewachsen ist und zugleich über die für unzeitgemäß tiefe Empfindungen unentbehrlichen Nerven verfügt. Es braucht überall, in jedem Feldlager der neuen Geisteskämpfe, Männer mit kühnen Stirnen, hellen Augen und nüchternen Gehirnen.
Aber erst die nächste Generation, wenn nicht erst die unserer Enkel, wird die Entscheidungsschlachten zu schlagen haben. Zu dem zähen Körper und dem hellen Geist, deren es dazu bedarf, kann das Wandern helfen! Es kann, wenn es in keine neue »Meierei« ausartet. Aber es muß es nicht. Die Befreiungskriege im Anfang des letzten Jahrhunderts haben eine gestählte Jugend vorgefunden, ohne daß man vom »Wandersport« eine Ahnung hatte. Denn auch das Wandern ist kein Allerweltsheilmittel gegen jene inneren Schwären, die zur Bewältigung großer Aufgaben unfähig machen, kein unfehlbares Mittel gegen Verweichlichung, Unwahrhaftigkeit und – in höherem Sinne genommen – Unsauberkeit. Und doch wird gerade das Wandern eines der ersten Mittel sein zur Erringung jener Eigenschaften, die das Wesen eines jungen Mannes, wie er sein soll, ausmachen. An deren Eroberung muß jeder, der sich selbst nicht gut genug ist, das ganze Feuer seiner Seele und die ungeschwächte Zähigkeit seines Willens setzen. Gut sein, wahrhaftig sein, rein sein, stark sein! Das ist's! Wer das hat, der wird nicht unterliegen! Und zwar kommt es gerade auf eben diese Reihenfolge der genannten Eigenschaften an; denn eine ist dabei die natürliche Ursache der anderen.
Tafel VII

H. Dopfer phot.
Frühjahr im Dachstein

Wehrli, A.-G., phot.
Am Untersee
Ich weiß es wohl, daß viele lächeln werden über dieses unmoderne und »lebensverneinende« Programm. Aber – abgesehen davon, daß es lebensbejahend im höchsten Sinne ist! – weiß[81] ich auch ein anderes: Manche haben das schon fertiggebracht! Junge Männer bis in die Mitte der zwanziger Jahre! Und viele andere werden nicht anders können, als entschlossen zu nicken zu diesem stillen Aufruf: Freiwillige vor! Und diese werden ohne Anmeldung und ohne Uniform der Welt dem All, oder wie sie das in ihrer Sprache nennen mögen, ihr junges Leben zur Verfügung stellen.
Den Geist und die Kraft aber zu solchem Vorhaben werden sie am ehesten finden in den Bergen, im rauschenden Wald, wenn das erste Morgenlicht durch die Bäume in den zerzausten Rasen des Waldes fliegt oder beim Wandern im roten Mittagszauber der Heide oder wenn ein herber Wind am Abend über sonnenumspielte purpurne Kuppen streicht – oder überall wo »der Mensch noch nicht ist mit seiner Qual«. Das heißt in der Natur, die Spinoza gleichsetzt mit dem Maß des All: »Natura sive deus«.
Auf diesem Kampffeld wird der neue Krieg, der heilige Krieg um innere Größe, Reinheit und Stärke beginnen:
(Eichendorff.)
Siehe zunächst unter: »An die jungen Männer«. Sodann noch mit der gebührenden Höflichkeit einiges Besondere:
Über das Wandern der jungen Leute mit Mädchen in Horden oder auch in kleinerer Anzahl läßt sich Allgemeingültiges nur schwer sagen. Das ist immer eine reine Personenfrage. Auch[82] haben, seitdem die Welt steht, alle jungen Menschenkinder verschiedenen Geschlechtes, welche der Mai des Lebens zusammenführte, auch ohne die Ratschläge von Wanderbüchern und sogar ohne das Einverständnis besorgter Mütter und Tanten es verstanden, ihre Wanderungen durch Wald und Feld zu machen, allein in der verständnisinnigen und verschwiegenen Gegenwart von Bäumen und Wiesen, die sich durch den Glanz ihrer jungen reinen Liebe beglückt fühlten. Aber die Frage des Zusammenwanderns als Normalzustand läßt, nachdem wir noch nicht einmal die Koedukation haben, doch auch bei unbefangenen älteren Leuten einige Bedenken aufkommen.
Vor allem haben mir junge Freunde oft gesagt, mit Mädchen sei (abgesehen von den »technischen Schwierigkeiten beim Übernachten«, wie sie das diskret nannten) hordenweise nicht gut wandern. Die Gründe dafür lassen sich auf einen besonders gelungenen Satz eines der jungen Kameraden, der mir frisch und unbefangen seine Meinung sagte, zusammenbringen: »Nämlich, man befindet sich fortwährend auf einem schmalen Grat mit den Mädels. Auf der einen Seite gähnt die Gefahr, daß sie sich durch gänzliche Gleichstellung in ihren Rechten, aber auch in ihren Pflichten mit den Jungens vernachlässigt fühlen, und im Abgrund auf der anderen Seite lauert die größte Wahrscheinlichkeit, daß die Mädels durch das sogenannte ritterliche Benehmen der Jungens verwöhnt werden, und damit die Möglichkeit von Mißhelligkeiten im Quadrat, sei es der Gleichstellung, sei es der Ritterlichkeit, wächst. Und an Krach fehlt's wahrhaftig, wenn wir ganz unter uns sind, auch nicht, so daß es absolut noch mehr sein müßte!«
So der junge Weltweise und Wandervogel, seines Zeichens dazumal Oberprimaner, Sohn einer kinderreichen Familie und überall geliebt als ein »famoser Kerl«. Er war ein »Kenner«, trotz seiner jungen Jahre. Mir persönlich mangeln eigene Erfahrungen in dieser Richtung. Aber ich halte mich immer daran, daß noch jeder tüchtige junge Kerl, dem es später wahrhaftig an Eroberungen nicht fehlte, sich immer gegen das Zusammenwandern von »Mädels und Jungens« aussprach. Nur die verdächtig Frühreifen und die »Schmachter«, die später, wie damals schon, von der Weiblichkeit nicht recht ernst genommen wurden, nur die waren für »moderne Auffassung« und fürs Zusammenwandern.
Zum Schluß nur noch eine kurze Erzählung einer wirklichen Begebenheit für diejenigen Frauen und Jungfrauen, die immer noch das parlanische »Mulier taceat in ecclesia«, das nur in der konzentrierten lateinischen Fassung grob klingt, als eine Kürzung der[83] Frauenrechte auffassen. Ich selber bin für Zulassung der Frau zu allen dem Mann zugänglichen Ständen. Man muß alles probieren. Aber die Entwicklung in den Wandervereinen, wo manchmal auch junge Mädchen offizielle Mitglieder sind, spricht sehr für den Apostel Paulus.
Hatten da in einer süddeutschen Universitätsstadt die Mitglieder eines akademischen Wanderklubs das Empfinden, es sei »zeitgemäß«, den weiblichen Mitgliedern auch Stimmrecht und Redefreiheit zu gewähren. Die Diskussionen über die einfachsten Vereinsangelegenheiten hatten nämlich unter den männlichen Mitgliedern bis weit über die Mitternachtsstunde gedauert. Da hoffte man von der Neuerung eine Besserung. Es wurde statt dessen aber »furchtbar«. Da griff eine kluge alte Frau ein und riet den jungen Leuten, sie sollten die »Mädels« an den Sitzungen teilnehmen lassen, aber ohne Stimm- und Rederecht. Der Erfolg war ein solcher Wetteifer der jungen Männer um kurzes, sachliches und treffendes Sprechen angesichts der Damen, daß alles Geschäftliche in längstens einer Stunde erledigt und besser erledigt war als früher.
Ich will keine zu weitgehenden Schlüsse hieraus ziehen, aber die Tatsache spricht – wie man wohl etwas übertrieben sagt – Bände.
Der umbrische Wandersmann, der vor acht Jahrhunderten mit einigen Gefährten die oberitalienischen Ebenen und Hügelländer durchstreifte, kommt wieder in Mode. Ich habe das gute Zutrauen zu meinen Lesern, daß sie durch die Tagesmode hindurch zu diesem großen liebenswürdigen Manne von Assisi selbst vordringen, zu diesem sonderbaren Heiligen, der nicht nur mit den Fischen im Wasser, den Vögeln in der Luft wie mit Kameraden sprach und die Sonne und den Mond als Schwester und Bruder anredete, wenn es ihm gerade darum war, sondern auch in einem innigen Verkehr mit Bäumen und Wiesenblumen stand. Das wird manchem verrückt vorkommen. Es ist es auch, wenn man daraus eine schwüle Gefühlsschwärmerei macht, die häufiger nur ein Surrogat für gesunde, aber unterdrückte Triebe ist. Aber in der Wirklichkeit gibt es dieses Verhältnis zwischen Natur und Mensch, und wenn es nicht der holländische Brillenschleifer und Mathematiker Spinoza gehabt hätte, dann wäre es ihm nicht möglich gewesen, in der Natur Gott zu sehen. Ohne dieses Hindurchblicken durch äußere Hüllen hätte aber auch Hermann Hesse seinen Peter Camenzind in dem[84] gleichnamigen Roman nicht alle Abend nach der großen Kiefer auf dem Hügel sehen lassen können, deren Wohl dem Schwärmer noch mehr als das anderer Bäume am Herzen lag. Zu den gleichen heimlichen Jüngern des Franz von Umbrien gehört auch der junge deutsch-amerikanische Mediziner, der einmal in einer Gesellschaft sagen sollte, wie er über die Religion denke, und darauf die allgemein für dumm gehaltene Antwort gab: »Well, wenn ich spazierengehe und ich möchte eine Blume pflücken, tue es aber nicht, weil ich gut zu ihr fühle und spüre, daß sie auch möchte geliebt sein und Samen bringen, well, das ist my religion!«

Phot. B. Haldy.
Margareten.
Deutsch schwach, aber Religion zweifellos gut.
Und ich kenne noch so einen. In dessen Tagebuch vom vorigen Frühjahr ist zu lesen: Es will wieder Frühling werden, und ich gehe jeden Morgen von meinem Dorf den Weg zu den nächsten Hügeln hinauf. Links und rechts vom Weg auf den Äckern und Wiesen steht alles voll von Obstbäumen, keiner ist wie der andere. Die Kirschbäume gleichen sich noch am meisten. Aber die Birnbäume, das ist ein Baumvolk von Riesen und Zwergen, Krummen und Buckligen, Übermütigen und Melancholikern. Die zwischendrin versteckten kleinen Apfelbäume sind seltsame Käuze. Sie fahren mit ihren eckigen und in allen Richtungen gekrümmten Zweigen in der Luft herum, daß man meint, sie wüßten nicht, wo hinaus vor Leichtsinn und Übermut. Die bescheidensten sind noch die Kirschbäume. Aber auch unter ihnen gibt es manche, die die Kraft ihres Stammes zu früh in dicken Ästen vergeuden, so daß dann nichts Rechtes mehr für die Höhe übrigbleibt, wie das so gern die Art der Birnbäume ist. Überhaupt sieht man den Bäumen im Frühjahr, kurz vor dem[85] Ausschlagen, am besten an, was sie wirklich sind. In den Formen und Linien des kahlen Gezweigs, in dem der Saft schon quillt, kommt ihr ganzes Temperament zum Ausdruck. Viele stehen da in strotzender Kraft, während andere ihr verfehltes Leben im ganzen Aussehen verraten. Manchen sieht man es an, wie sie sich trotz ärmlicher Verhältnisse gewalttätig durchgesetzt haben, und manche stehen auf gutem Boden und im vollen Licht recht ängstlich da und bekümmert, wie Geizhälse, die mitten im Reichtum verhungern wollen. Über die Baumvölker ragt aber ein Kirschbaum empor wie eine junge Königin. Er steht auf einem ganz kleinen Hügel und gefiel mir auf einem Spaziergang durch die selbstbewußte, frohe Art, wie er von dem glatten runden Stamm seine Zweige mit einer gewissen Feierlichkeit nach allen Seiten in die Luft streckte. Kein bißchen Moos war auf seiner Rinde zu sehen, und seine Zweige verästelten sich zu Tausenden dunkler Fingerchen. Etwas wie frohe Erwartung lag über der gesunden Gestalt dieses Baumes, und das grüngestrichene Bänkchen neben seinem Stamm schien ganz stolz darauf zu sein, gerade hier stehen zu dürfen. Als alle anderen Bäume noch kahl wie im Winter waren, war eines schönen Tags der Kirschbaum über und über mit grünen Spitzchen besetzt, und rund um ihn herum waren Hunderte von Maßliebchen aufgegangen. Es war kein Zweifel, er würde der erste sein, der im Lande blühte. Am gleichen Abend zeigte er schon seine ersten weißgrünen Knospen. Eines Morgens stand er im Brautstaat da.
Ich weiß, man wird nun über mich lachen, weil ich glaube, daß der Kirschbaum genau wußte, wie schön er an diesem Morgen war. Aber ich will zu meiner Entschuldigung doch anführen, daß ein großer deutscher Maler vor einer mächtigen Trauerweide, die gar nicht weit von dem Kirschbaum stand, weinen mußte, so ergriff ihn die hoheitsvolle, tragische Gebärde des Baumes. Und wenn man meint, nur Dichter und Maler und derlei überspannte Leute glaubten an solche Dinge, so weiß ich einen berühmten Musiker, der beim unvorsichtigen Abbrechen von Zweigen ein direktes Schmerzgefühl empfand und in solchen Fällen tat, als ob es sich um eine Verwundung eines lebenden Wesens handelte … Nur wenige unter den Tausenden von Sommerfrischlern, die jetzt die Bergheiden und Waldwiesen überschwemmen, haben Respekt vor dem Besitz des Bauern und hausen in dieser Richtung oft wie die Tiere. Aber noch weniger Menschen gibt es, die nicht nur aus Furcht vor dem Gesetz, sondern aus einer heiligen Achtung vor einer jeden Art von Leben heraus, auch wenn es nur Pflanzenleben[86] ist, weder unnötig Blumen am Weg abreißen, noch den Rasen der Wiesen zertreten; einfach, weil sie nicht können.
Es wird heute so viel vom Erleben geredet, ohne daß man sich eine Vorstellung davon macht, was nun wirklich ein Erlebnis ist. Daß man auch eine Wiese erleben kann, das scheint vielleicht nicht ohne weiteres wahrscheinlich. Und doch ist es so. Es ist gleichbedeutend mit dem, was Goethe immer wieder das Schauen nannte.
Ein Wanderer tritt aus einem dunklen Tannenwald in eine breite Lichtung. Da blühen zwischen feinem Berggras die goldenen Sterne der Arnika und recken sich hoch über das niedere Volk der Skabiosen, die, fast demütig vor den Majestäten unter den wilden Bergblumen, ihre hellvioletten Blütenkörbe gerade nur über die Grasspitzen in die Höhe halten. Noch weiter unten im grünen Teppich, fast am Boden, bietet der rote Klee den summenden Bienen und Hummeln verborgene Liebeslager dar. Aber alles das sieht der Wanderer nicht nacheinander, sondern zugleich. Daß die Sonne hinter seinem Rücken steht und die eigentliche Veranlassung dazu ist, daß der rote Klee aus den heimlichen Grasgemächern hervor und die bescheidenen violetten Skabiosen und die stolzen Arnikasterne sich wie grüßend zu ihm wenden, das ist ihm gleichgültig. Das Leben verspürt Leben. Des Wanderers Seele tritt in Fühlung mit dem eigentlichen Sein der Pflanzen und Blumen, und ihm ist auf einmal, als ob er entschwand in eine Region des Daseins, wo es keine Trennung mehr gibt zwischen allem Erschaffenen. Das mag ungefähr der Marschendichter Allmers empfunden haben, als er das wunderbare Lied wie von unsichtbaren Elfen ins Ohr gesagt bekam:
Was das eigentlich ist, der Wald, das vermag ich beim besten Willen nicht zu sagen. Nicht als ob es nicht Forstassessoren und Botaniker genug gäbe, die einem sehr sauber und leichtfaßlich[87] erklären könnten, daß der Wald immer eine Ansammlung von dicht beieinander stehenden Bäumen aller möglichen Arten sei; einige gelehrte Männer sind sogar dahintergekommen, daß der Wald eine Art sozialer Gemeinschaft mit bestimmten Gesetzen ist, daß er einen grimmigen Kampf mit der feindlichen Heide führt, die mit ihrem niederen Fußvolk, den Tausenden von bedürfnislosen Erikasträuchern, in jede Bresche eindringt und den mächtigsten Baumriesen mit den rauschenden Kronen das Leben sauer und schließlich unmöglich macht, so daß die Majestäten fallen unter dem unvermeidlichen Vordringen des Zwergvolkes, das ihren Wurzeln auf eine listige Art – durch Bodenverfilzung – Wasser, Licht und Luft entzieht.
Alles das ist sehr interessant, und es gibt z. B. von Francé im Kosmosverlage gute Büchlein, die ein jeder gelesen haben sollte, der den Wald liebt. Aber deshalb liebt man nicht den Wald, und all dies erklärt nicht das, was hinter dem Wald steckt, das eigentliche – Walden.
Ich möchte also nur alle ehrlichen Kameraden vom Wanderstab warnen vor der Einbildung, als wüßten sie, was der Wald ist.
Das haben zu allen Zeiten nur immer wenige Begnadete unter Millionen geahnt, und die sagten es dann, ein jeder in seiner besonderen Art, nicht so klar, daß man es ohne weiteres verstehen konnte. Aber wirklich gewußt, was es mit dem Wald auf sich hat, das hat z. B. Richard Wagner, und gesagt hat er es in den paar hundert Takten im Siegfried, im »Waldweben«, wo der junge Siegfried auf einmal die Stimmen der Waldvögel versteht und das ganze geheime Raunen zwischen Sonnenlichtern und Blätterrauschen. Gemalt hat den Wald eigentlich nur Moritz v. Schwind, dann und wann einmal auch Arnold Böcklin und Hans Thoma. Es gibt ja viele Bilder sehr berühmter Kunstmaler, auf denen die Baumstämme und das Moos und das Blattwerk »viel natürlicher« gemalt sind; aber man sucht in ihnen vergebens nach jenem ruhevollen, auch in der dunklen Schattenkühle allgegenwärtigen Leuchten, das zu uns reden kann wie die tröstenden Worte einer Mutter; vor dem einem aber auch manchmal etwas wie Angst in die Kehle steigt, weil man es gerade in diesem Augenblick unaussprechlich klar empfindet, daß man noch lange nicht ein ordentlicher Mensch geworden ist. Ich meine, der wirklich ordentliche Mensch, den zu werden man sich heimlich vornahm, als man so zwischen vierzehn und zwanzig war und einmal so »ungeheuer edel« werden wollte.
Von den vielen Dichtern, die vom Wald gesungen, war im Grunde nur Eichendorff ein Eingeweihter. Was an Heimlichkeit und[88] stiller Größe, an schlichter Reinheit und unaufdringlicher Stärke im deutschen Wald lebt, das hat er, der so viele der Lieder weckte, die in allen Dingen schlafen, fast als einziger Sänger des deutschen Waldes zu sagen vermocht.
Ich bin kein Teutschtümler und glaube nicht an alleinseligmachendes Ariertum, aber daß die Teutonen in den Wald gehen mußten, wenn sie ihrem Wodan näher sein wollten, das begreife ich ganz ohne Nachdenken. Das Gescheiteste war es schon nicht, als Fridolin vom Oberrhein und andere Bekehrer zum Umhauen der alten Eichen und Taxusbäume ihre Zuflucht nehmen mußten, um sich in Ansehen zu setzen.
Einmal – vor bald zehn Jahren – da sind wir zu fünft durch den Bergwald gewandert. Zwei Stunden lang ging's unter den lichtgrünen Dächern des frühsommerlichen Laubwaldes dahin. Die Sonnenstrahlen, die durch das nicht ganz geschlossene Blätterwerk der Baumkronen heimliche Wege fanden, trieben allerhand fröhlichen Unsinn mit dem wenigen Schmuck, den die zwei mitwandernden Frauen am Hals oder an den Fingern trugen. Nahgerückte Berggipfel sahen in das ganz stille, rauschende, lichte Glück des sprossenden Frühsommerwaldes, und zwischen Stämmen hindurch schlang sich ein verhaltenes Singen von einem nie gekannten, in den tiefsten Tiefen des Menschenherzens wohnenden Frieden, den die Welt doch einmal beschert bekommen würde. Einmal sicher! Ein wenig warnungsvoll und mit feierlicher Stille wanderte das Glück zwischen den Schatten der alten Buchen und Eichen mit uns, ohne uns einmal aus den Augen zu lassen, und keines von uns fünf wagte während der seltsamen zwei Stunden mit einem einzigen Wort die duftende Kühle des jungen Waldes zu stören. Wir sahen dem Spiel der Eichhörnchen zu, hörten das siegreiche Jubeln der Waldvögel, vernahmen in der Ferne das behagliche Grunzen eines Wildebers, all das sahen und vernahmen wir mit frohen, wissenden, segnenden Augen – aber wir wollten nichts für uns selbst.
Ich weiß, in jenen zwei Stunden haben wir alle fünf etwas gewußt vom Wald und seinem Geheimnis, das gewebt ist aus den kreisenden Aureolen des Sonnenlichts und aus der Finsternis, die mit tausend Augen in der Nacht zwischen den Stämmen in der Wildnis hinausschaut ins sternenhelle Land, gewebt aus dem beseligenden Rieseln jungfräulicher Birken und der stummen, unbeweglichen Wucht, mit der die Fürsten des Waldes den Sturm und sein Höllengesindel ganz außer Rand und Band bringen; denn an ihrer gelassenen Kraft erschöpft sich ihr zügelloses Rasen.
Was das damals war, das weiß ich nicht gewiß. Aber da es in den Märchen von »Tausendundeiner Nacht« Galoschen des Glücks gibt, in denen ein richtiger »Ali« nur »Mutabor« zu sagen brauchte, um in einer Sekunde von Kopenhagen nach Konstantinopel zu kommen, warum soll es heute, nach tausend weiteren Jahren, nicht auch so eine Art Galoschen – des Herzens geben, mit denen man durch die ungeahnten Geheimnisse und Wunder des deutschen Waldes schreiten kann, natürlich ganz unverdienterweise!

Phot. Prof. Dr. Hausrath.
Mittagsstille im Wald.
Wer den Drang in sich fühlt, einmal ohne Überschreitung der deutschen Grenze etwas Grundanderes zu sehen als ruhevolles Mittelgebirge, schöne deutsche Laubwälder, stille, grünende Matten mit dem eintönigen Leben von Bauern, die gerade ihr Leben noch fristen können; wer einmal die Antithese zu den Wiesen und Bäumen und süddeutschen Binnenseen des vorhergehenden Abschnittes erleben will, der wandere von einer der schönen mitteldeutschen Städte wie Braunschweig oder Lüneburg durch die[90] Heide hinab an die Geest und hinab an die Marsch. Dieses Hinab mißt bloß einige Meter Unterschied in der Meereshöhe, und doch sind diese wenigen Meter entscheidend für den ganzen von Grund aus anderen Charakter der Landschaft, wie sie an der Waterkant, immer noch unentdeckt von den Landratten, mit allen ihren großen, herben Wundern liegt. Besonders die Deichlandschaft der Niederelbe, die sich wie ein Kranz künstlicher Seen um Hamburg herumschließt, ist ein noch unentdecktes Reich. Dort ist das große Meertor von Deutschland, durch das man hindurchsieht auf die Welt außerhalb unseres kleinen Europa, auf Amerika, Asien, Afrika, Australien, von denen die richtigen Jungens der berühmten Fischerdörfer an der Niederelbe reden, so wie wir in der südwestdeutschen Ecke von Frankfurt oder Berlin.

Phot. Hans Müller-Brauel.
Frau aus der südl. Lüneburger Heide.
Die paar Monate, die ich da oben zugebracht habe, hätten nicht genügt, um mich in diese wesensverschiedene Welt einzuweihen, wenn nicht mancher Schleier gelüftet und manches Rätsel gelöst worden wäre durch ein Werk, das ich jedem nach wirklichem, tiefem Erfassen jenes herrlichen Landstreifens Verlangendem an der Nordsee nicht dringend genug empfehlen kann, nämlich Professor Dr. Lindes »Niederelbe«. Dort schaffen elementar einfache Linien der Natur, ein wirklich noch urwüchsiges und scheu auf sich selbst zurückgezogenes Volkstum, das in ständig wogenden Wasserschleiern webende Sonnenlicht und nicht zuletzt einen architektonisch hoch entwickelten bäuerlichen Kunstsinn, eine Welt ganz für sich – eine Welt, zu der die Entdeckungen der Worpsweder Maler in der Bremer Heide für die große Öffentlichkeit nur ein winziges Schrittchen bedeutet.
Unter den deutschen Heiden ist die lüneburgische die größte. Die stille Schönheit dieser unfruchtbaren Wüste ist bis jetzt weder von einem Maler noch von einem Dichter auch nur annähernd dem Bewußtsein der Bewohner Süd- und Mitteldeutschlands nahegebracht worden. Die in rosaroter Abendglut brennende Heidewildnis mit dem braunen Uferrand der Torfmoore, die unsagbar große Einsamkeit, die von Horizont zu Horizont geht und höchstens[91] einmal durchschauert wird vom verlorenen Echo der Dampfsirenen großer Weser- oder Elbeschiffe; die einsamen »Ahlen«, die sich aus dem Moor oder aus der Heide wie flache Schildbuckel erheben und mit einem rauchgeschwärzten, strohbedachten Heidehaus gekrönt sind, und die Menschen der Heide, die von dem dürftigen Kornwuchs leben, den die Stückchen urbar gemachtes Land widerwillig hergeben; von alledem haben wir Wanderer des Südens keinen Begriff.

Phot. W. Noelle.
Fahrstraße in der östlichen Lüneburger Heide.
Unser Staunen wächst aber, wenn diese ärmliche Welt, deren machtvolle Schönheit eigentlich nur durch die gekrümmten und gebückten Gestalten der mißtrauisch blinzelnden Heidebauern das Stigma der Armut erhält, versinkt und sich auf einmal auf dem üppigen, feuchten Wiesenboden der Marsch große Herden von schwarzen Rindern weidend langsam vorwärts bewegen; wo überall Zäune und Tore, die oft wahre ländliche Prunkpforten sind, den Grundbesitz der Marschbauern abgrenzen. Die in großzügigen Formen gebundene Marschlandschaft mit ihren gelbbraunen Tönen ist oft in ihren meerabgelegenen Teilen von Enklaven von Mooren und kleinen Bezirken mattschimmernder Heide oder glühenden Feldern von Strandnelken durchsetzt. Und wenn man auf einmal zwischen graugelber Sandwildnis, eiszeitlichem Schottergeröll, buschigen Erikafeldern und aufdringlich fetten Huflattichvegetationen unvermutet den heimeligen Zauber eines mit köstlichem Holzwerk gezierten und von Schutzbäumen gegen den Sturm umstandenen[92] Altländerhauses sieht, dann beginnt das Paradies der Elblande. – Die Fußwanderungen an der Niederelbe sind stählend für den Körper durch die nahe Salzluft des Meeres, sie bereichern die Seele durch den dem großen Schöpfersinn nach genialer Abwechslung entsprechenden Wechsel von endlosen funkelnd gelben Rapsfeldern, braun wuchernden Schilfwirrnissen, die man fast Dschungel nennen kann, und hinter denen der silberblaue, oft von schaumköpfigen Wogen übersäte Elbestrom an den üppig grünen Wolken großer Obstbaumanlagen ruhig und stolz vorbeizieht. Und alle diese Herrlichkeit genießt der Marschbauer oder der Fischer an der Unterelbe weit mehr als unser badischer Bauer den Reiz der Rheinebene. Sonst könnte er nicht von dem dunkeln, vom Sturm mit rollenden Wogen übersäten Strom, der dort schon breit ist wie ein Meerarm, das wunderbare Wort prägen: »Dee Els (Elbe) geiht in Hemdsärmeln.«
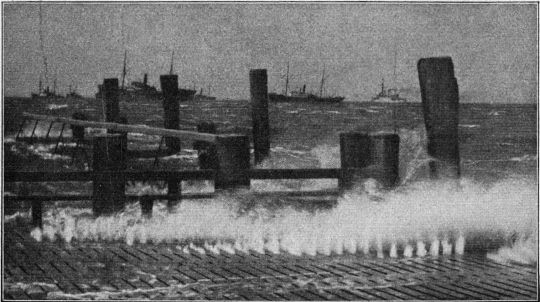
Phot. Albert Angelbeck.
Sturm an der »Wasserkante«.
Das sind nur die allergröbsten Geheimnisse. Wenn man aber einmal dahintergerät, wie der durch Schilfwildnis ziehende Strom eigentlich aus zwei sich ständig bekämpfenden Flüssen besteht, nämlich dem aus dem Lande kommenden Süßwasserfluß und dem durch den Pulsschlag des Meeres bis hinauf nach Hamburg getriebenen Salzstrom, und daß z. B. das harmlos erscheinende Süßwasser leicht obenauf schwimmt, aus Ufer Fluß macht, während das Salzwasser das verschlungene Gut wieder an anderen Stellen[93] anschwemmt, dann bekommt dieser Strom etwas von bewußt wirkendem und schaffendem Leben. Die unzähligen dunkeln Ewer mit ihren tiefroten und braunen Segeln, die herrlichen Fünfmaster, die noch wirkliche Schiffe sind im Gegensatz zu den gigantischen und uneleganten Kästen, den aus drei und vier Schornsteinen rauchenden Ozeandampfern, die dicken, plumpen Schlepper, die Bernhardiner der Elbe, wie sie genannt werden, die die auf Sandbänken festgefahrenen Ozeandampfer von der Gefahr des Strandens zu retten haben, und schließlich die kleinen, in der Schilfwildnis liegenden Krabbenboote, auf denen die Fischer an offenen Feuern ihr Mittagsmahl kochen, alles das sieht sich dann an wie eine leicht gefällige Last, die der breite Strom gutmütig und willig flußab oder flußauf trägt, je nachdem die Ebbe oder die Flut eingesetzt hat. Und dann noch die zahllosen, uns Landratten unbekannten Idylle von weidenden Schafen, Ziegen und Rindern zwischen hängenden Fischernetzen; das hell lachende, herbfrohe Leben der Dorfjugend auf den weißgestrichenen Bänken vor den Marschhöfen, in denen innen und außen alles von einer geradezu holländischen Sauberkeit ist; die ungeheuern Unterschiede zwischen den Erwerbszweigen ganz nahe beieinander liegender Landstrecken, z. B. der hochentwickelte Gemüse- und Obstbau des alten Landes und die berühmte Viehzucht der Vierlande; dann das glitzernde Leben im Winter, wo jung und alt auf den gefrorenen Fleten Schlittschuh läuft und die Elbe mit Grundeis geht, als ob lange Ketten aus großen Silberperlen mit der Ebbe oder der Flut stromab und stromauf getrieben würden! Alles das ist eine Welt voll so frischer Urwüchsigkeit, daß man es begreifen kann, wenn die Hamburger die Mark und Berlin ihr Hinterland nennen und die Hoffnung haben, daß aus dieser fast ungeschmälerten Kraft einmal das größte Gemeinwesen des Deutschen Reiches emporwachsen werde.
Es ist einerlei, ob das so sein wird oder nicht (denn der Hamburger und der Marschbauer neigen von Natur zum Größengefühl). Aber wenn man mich fragen würde, was es außer dem Schwarzwald mit seinen verborgenen Bergwundern landschaftlich noch Unerhörtes und nicht zu Übersehendes in Deutschland gäbe, dann würde ich in der ganzen Ehrlichkeit meines beschränkten Schwarzwaldpartikularismus sagen, nach dem Schwarzwald komme zu allererst die Waterkant in Betracht, d. h. das Land der Marsch, der Geest und der Heide.

Phot. Fidelis Mayer, Altötting.
Altes Portal in Rothenburg o. d. T.
Im Schlendern! Ohne Baedeker oder sonstige Führer, die einen mit und ohne Stern zu den berühmten Kirchen, sehenswerten Profanbauten und nicht zu übersehenden Denkmälern geleiten. Das größte Übel beim Besehen der Städte ist der Zeitgeiz. Die meisten Wanderer leiden an der Zwangsvorstellung, »alles« gesehen haben zu müssen. Sie empfinden es fast wie eine Gewissenlosigkeit, wenn sie etwas auslassen. Das sind die Sklaven der Kataloge. Wenn sie sich Nürnberg besehen, dann sind sie vorschriftsmäßig von elf bis zwölf im Bratwurstglöckle, bis zwei auf der Burg und bis vier Uhr im Germanischen Museum. An Leib und Seele gerädert, suchen sie dann ihrer Aufnahmefähigkeit durch einige Schoppen in den historisch geheiligten Winkeln des »Posthorns« oder »so wo« aufzuhelfen, was aber zumeist programmwidrig ist.
Wer aber auf gut Glück die Straßen der alten Städte durchwandert, der empfindet auch das Glück aller ersten Entdecker! Es kann ihm nicht viel entgehen, wenn er mit hellen Augen zwei Tage lang den großen und einen Tag den kleinen Städten widmet. Aber wenn er so ganz zufällig, sagen wir, in Bremen sich auf einmal dem steinernen Roland gegenüber sieht und ganz ohne vorhergehendes Studium historischer oder künstlerischer Randglossen zu diesem ebenso merkwürdigen wie wundersamen Denkmal das kindlich freundliche Lächeln des unerschrockenen Helden der deutschen Sage auf sich wirken läßt, dann vergißt er diesen Eindruck nicht mehr so leicht. Ob er dabei den Stil des Kunstwerks für spätromanisch[95] oder frühgotisch hielt, das tut nichts zur Sache. Er hat den Roland von Bremen einfach erlebt und hat tausendmal mehr von ihm als ein anderer, der sich zuerst kunsthistorisch unterrichtete, um sich vor den Kameraden beim Besuch der Statue »nicht zu blamieren«. Der Bock, den jener mit der falschen Stilzuteilung geschossen, ist lange nicht so schlimm als das anempfundene und fremdem Wissen entwendete richtige Stilgefühl des klugen Alleswissers.
Also lieber eine kraftvolle Dummheit als ein schwächliches Prunken mit unredlichen Kenntnissen. Denn es gibt nur eine Art von redlichen Kenntnissen, die erlebten, oder um mich chemisch-biologisch auszudrücken, die assimilierten Kenntnisse.

Phot. H. Jost.
Rathaus in Michelstadt im Odenwald.
Kein Wanderer wird es als Abfall und als Untreue von seinen eigentlichen Zielen empfinden, wenn er sich einmal aus ganzem Herzen freut, in der Ferne die grünleuchtenden Kupfertürme einer großen, mit altem und doch noch lebendigem Bauwerk gesegneten Stadt zu erblicken und das Heulager in Bauernscheunen mit dem sauberen Bett eines einfachen Gasthauses zu vertauschen. Wer das bestreitet, der prahlt. Man muß nur einmal die komisch feierliche Eßlust gesehen haben, mit der eine Schar von Wandervögeln, die ein freigebiger Gönner zu einem regelrechten Gasthofmahl eingeladen hat, sich ihrer Aufgabe entledigen. Wer das einmal neidlos zu sehen bekam, der begreift, daß auch beim Wandern allein der Wechsel erfreut, und daß ständiges Traben in der Ebene ebenso langweilig wird wie die immer sich gleichbleibenden Lagergerichte aus irgendeinem Wandererkochbuche.

Phot. R. Hilbert, Rathenow.
Aus Tangermünde.
Wenn du also, Wandersmann, nach einem guten Imbiß und einer köstlichen Nacht in einem kühlen, frischen Bett deinen Rucksack in irgendeinem sicheren Verlies aufgehoben weißt, dann schlendere unbeschwert durch die Straßen, schließe immer nur wenige, aber tiefe Freundschaften mit dem Schönsten, was dir von schönen[96] Häusern und feinen Bildnissen, himmelhohen Domen und trotzigen Burgen dein Herz gefangennimmt. Es ist dabei einerlei, ob deine Liebe der geistvoll und fast frivol lächelnden »Fraue Welt« gilt, die am Münster von Basel hoch über dem Rhein ihr Busentuch lüftet, oder dem treuherzig dummen Ritter Georg am Dom von Bamberg, der, steif im hölzernen Sattel sitzend, mit der Unerschütterlichkeit eines Parsivals den Drachen absticht, wie wenn es sich um ein Ferkel handelte; oder ob dir die Madonna von Nürnberg in der wellenhaft aufsteigenden Andacht ihres Gewandes und der beglückt dankenden Reinheit ihrer gefalteten Hände dein Herz erbeben ließ, oder ob du die Augen nicht wenden konntest von dem zierlichen Gitterwerk des Meisters, der aus roten Quadern in der kühnen Pyramide des Freiburger Münsters einen wunderbar lichten Dank für alle Herrlichkeit der Erde dem Himmel entgegenbaute.
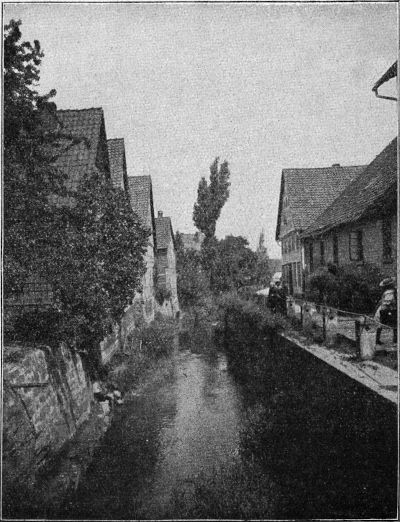
Zur Verfügung gestellt vom Touristenverein Hannover.
Hannöversches Dorfbild.
Sei also immer Herr deiner Zeit und nicht ihr Sklave! Du darfst sie auch dann und wann souverän verschwenden! Denn wenn du z. B. in Verona nichts vom Grab der Julia und nichts von den Reiterstandbildern der Skaligerfürsten und nicht einmal etwas von den Bildern des Paolo von Verona gesehen hast, weil es dich immer wieder nach dem alten Festungshügel jenseits der Etsch zog, wo der Zypressenwald steht und wo du den schönsten Blick auf den farbigen und zugleich kriegerisch drohenden Zauber der Stadt[97] Dietrichs von Berne genießest, so hast du doch mehr von Verona gehabt als alle die Atemlosen, die alles gesehen haben und doch nichts.

Phot. Heinrich Jost.
Deutsches Städtchen.
Der deutsche Wanderer von Durchschnittsbildung besitzt leider noch zu geringes Verständnis für Architektur und kann deshalb die Schönheit der deutschen Stadt nicht bis auf den Grund auskosten und ihr eigentliches Wesen nicht erfassen. Aber das schließt nicht aus, daß er unbefangen und unabsichtlich den Geist, der in dem Gefüge des Ganzen wie in einzelnen Gebäuden unbewußt sinnliche Form[98] angenommen hat, auf sich wirken läßt. Sowohl in der eigenartigen Gesamtheit des Städteaufbaues und in seinem Grundriß wie auch in den alten Köstlichkeiten verschwiegener Gassen, in der einladenden Wohnlichkeit der von einem Garten umschlossenen behaglichen Bürgerhäuser, aus malerischen Winkeln, murmelnden Brunnen, wuchtigen Plätzen und rhythmisch von Bogen zu Bogen sich schwingenden Brücken gewinnt er ein Bild von der inneren Art der Bewohner einer Stadt. Er erlebt die Stadt. Er wird sich im Innersten bewußt, daß Natur allein es nicht tut, sondern daß der schöpferisch gestaltende Menschengeist, aus den Muttertiefen der Natur heraus schaffend und vom Geist aus den Höhen befruchtet, sich über die Natur hinausheben und die Anfänge einer Welt gestalten kann, zu der ja die vollendenden Kulturwirklichkeiten noch fehlen, aber nicht immer zu fehlen brauchen. Und so viel auf diesen Seiten von den Wunden die Rede war, welche die Halbkultur unserer Gegenwart uns schlägt: aus dem Geist der großen deutschen Künstler, die vor Jahrhunderten ihre Sermons in stone gehalten haben und ihre kraftvoll schöne Gedankenwelt Fleisch und Blut in Steingestalt gewinnen ließen, wird der mit den Sinnen einer sublimeren Weltanschauung ausgestattete Wanderer bei gelegentlichem Schlendern durch schöne alte Städte den Glauben an die Zukunft des Volkes sich wiedererringen. Und dieses Heilmittels, des großen Zukunftsglaubens,[99] können wir als Heilung gegen die vielen Bisse und Stiche, deren wir uns von der Amphibienwelt unserer Halbkultur nicht erwehren können, am wenigsten entbehren.
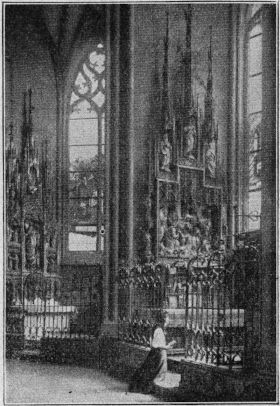
Phot. Ferrars, Freiburg i. Br.
Im Freiburger Münster.
Wir müssen uns das Paradies selber bauen in der nordischen Heimat – schreibt Hermann Hesse von seiner Ceylonreise. Diese Heimat ist das Deutschland, wo – um unbescheiden bei der eigenen Heimat anzufangen – der Rhein einen zärtlichen Ellenbogen um ein herbes Bergland macht, um ein Land einfacher Linien, aber auch voll grüner Waldverworrenheit und gesegnet mit einer Ruhe, die nicht erschlafft, sondern ermuntert zu tätigem Leben. Daneben lebt auf einer Hochebene das Volk der Sueven, die gerade nicht darauf erpicht sind, ihrem Namen (die Sanften) unter allen Umständen Ehre zu machen, die aber zwischen eintönigen, von schmalen Flüssen durchwundenen Rebbergen und in alten feinen Städten, angefüllt von dem eigensinnigen Formen- und Farbengeschmack der Schwaben, ein Leben voll rüstiger Ehrlichkeit und geschmeidiger Klugheit führen. Das deutliche Selbstbewußtsein,[100] dem deutschen Vaterland eine nicht geringe Zahl von Männern geschenkt zu haben, deren Name lange nicht mit ihrem Todestag verschwand, fehlt ihnen dabei nicht.
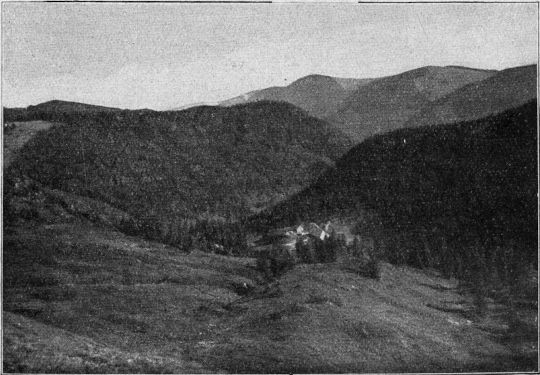
Phot. E. Braun.
Hochtal im Schwarzwald.
Weiter dem Osten zu, auf einer noch rauheren Hochebene, haben die markomannischen Fäuste und die glaubensstarken Köpfe der Oberbayern nicht verhindern können, daß dort ein sonderbares Großstadtgebilde aufblühte, in dem neben einem angeborenen Sinn für Darstellung eine große Zahl von Männern und Frauen in zähem Lebenskampf hochwertige Kulturarbeit leistet, und zwar von solcher Bedeutung, daß die »Kunstmetropole des Südens« den Namen eines modernen »Capua« leicht auf die Achsel nehmen kann. Durch den blauen Alpenkranz, der sich um die Stadt schlingt, kommt Deutschland auch noch in die Reihe jener Staaten, die nicht ohne den Diademschmuck ewigen Schnees geblieben sind.

Hofphot. C. Eberth, Cassel.
Schwälmer Mädchen.
Das ganze Frankenland von der französischen bis zur österreichischen Grenze ist für den deutschen Wanderer noch immer zu sehr Terra incognita, besonders die Gegend der Main- und der pfälzischen Franken. Doch auch bei den blinden Hessen sind noch die verschwiegenen Malerwinkel und die verzauberten Welten altväterlichen Lebens zu finden, die ihre schlichte Schönheit nicht[101] jedem kecken Wegfahrer offenbaren, sondern gesucht, mit frommem Gemüt durchwandert und in aller Stille geliebt werden wollen. Dort liegen hinter den dichten Wällen schwerbeladener Obstbäume versteckte Dörfer mit launig dicken Kirchtürmen oder vorlaut über das grüne Gewoge schauenden Rokokozwiebeln von Gemeinden mit guten Pfründen; und wer es versteht, sich da hineinzuschleichen, der bekommt zum Lohn den ganzen unberührten Reiz ländlichen Friedens und Segens beschert.
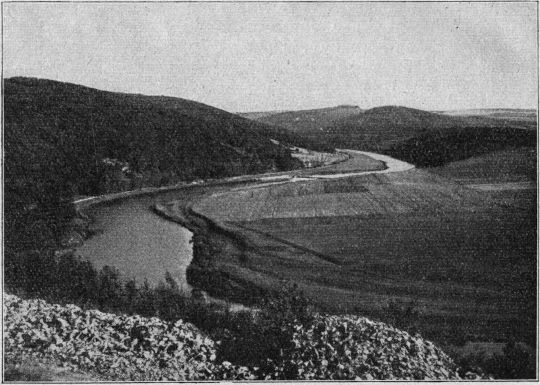
Phot. E. Braun.
Fuldaschleife bei Kragendorf.
Herbere Töne und tiefere Noten schlägt schon das Land um den Teutoburger Wald herum an, so sehr manche Striche noch an die Milde des Taunus oder der Rhön gemahnen. Wie eine Insel von fremder Eigenart steigen an der Mosel die vulkanischen Eifelberge mit ihren ossianisch-schwermütigen Maarlandschaften hervor. Erst in den hannöverschen Landen, wo die deutsche Tiefebene ernstlich ihre guten Rechte geltend macht und wo auch die rauhen Paradiese der niederdeutschen Heide beginnen, nimmt die Landschaft wieder Formen und Färbungen an, die den Wanderer zunächst überraschen und dann, wenn er seine Augen eingestellt hat, beglücken.

Phot. W. Noelle.
Alter Bauernhof in der Lüneburger Heide.
Nach den romantischen Rheinfahrten (aber nicht auf einem Dampfer in der Hochsaison!) wird einem das Rheindelta fast immer eintönig erscheinen. Und beim Wandern durch die nicht restlos befriedigende Synthese des Teutoburger Waldes, dessen viele trotzige Einsiedlereichen mit ihrem unwiderstehlichen Baumzauber sich in dem für unsere Schwarzwaldbegriffe dürftigen Tannenforst doch in nicht ganz ebenbürtiger Gesellschaft fühlen, da müssen schon die Trümmer des geschichtlichen Wissens aus dem Gymnasium das Maß der Wanderfreuden vollmachen. Aber dann kommt Westfalen und besonders die eigentümliche rote Erde, und das ist etwas ganz eigenartig Neues. Wer die rote Erde mit der von düsteren Rauchflaggen durchwehten Luft, mit der höllischen Pracht ihrer drohenden Stimmungen, wo am Horizont die Kaminwälder[102] und die Feuerscheine der Hochöfen des Menschen unverzagten Willen zur Herrschaft über die Erde verkünden, nicht genießen kann, der geht noch in den Kinderschuhen des Wanderers, dessen Herz ist nur empfänglich für die sentimentale Verschwommenheit süßlicher Landschaftsbilder, wie sie für den »Naturliebhaber« (auch so ein bezeichnendes Wort) und für den Kunstkenner der Biedermeierzeit einzig in Betracht kamen, als rascher Genuß des Auges wie als dauernder Schmuck des Hauses. Daran aber erkennt man den objektiv gereiften Wanderer, ob er, einerlei von welcher politischen Gesinnung, empfänglich ist für den fast brutal heroischen Klang und für die erdhaft riesenhafte Tönung von allem, was in jener so unparadiesisch trotzigen Gegend Form und Farbe angenommen hat. Und was soll ich erst sagen zum Preise des Vaterlandes dort, wo die großen und kleinen, wegen ihrer fast holländischen Sauberkeit auffallenden Viehherden an den letzten Hügeln und Bergen weiden, die für den Süddeutschen die letzte Erinnerung an die Heimat sind, bevor wir ein neues Staunen lernen. Das Entzücken nämlich über die schlichte Geradlinigkeit der Landschaft an der Wasserkante, besonders der Niederweser und der Niederelbe, wo[103] ein im Kampf mit dem »blanken Hans« der Nordsee hart und still gewordenes Bauernvolk einer endlosen Rohr- und Schilfwildnis weite Strecken des gesegnetsten Kulturlandes abgerungen hat und dort ein uns Landratten so ganz fremdes Leben voller Trotz und Stolz führt. Und das alte Strandpiratenblut (darüber ist jetzt die Wissenschaft ganz einig!) verschafft sich in diesen Sprossen noch jetzt manchmal nach wochenlanger Stille Ausdruck durch Ausbrüche, die als Widerspiel der Elementargewalten des Meeres nur den von der Kultur nicht geschwächten Naturmenschen verständlich sind. Dort in Friesland, an der holsteinischen Niederelbe, wirkt für den Binnenländer ein ganz neuer Zauber, der dem nüchternen, oft fast empörend geordneten Landschaftsbild einen Reiz von ungeahnter Vielfältigkeit verleiht: das Wasser, das Meer. Mögen die Fahrrinnen zur Elbe schnurgerade, die Linden beschnitten sein wie Weidenstrünke und diese selbst, oft Baumstämme von ansehnlicher »Postur« mit struppigen, kurzgeschorenen Köpfen, alles tun, um das Landschaftsbild »uninteressant« zu machen, schon das »Altländer« Haus mit seiner bis ins künstlerische Raffinement[104] gehenden Holzarchitektur und dem sauberen Dach aus kurzem gutgebundenen und fast pedantisch gerade beschnittenen Stroh, zärtlich umhegt von Bäumen und Büschen, ist ein kleines Wunder eines »Heims«. Und doch wie bitter und hart ist dort noch das Verhältnis vom Mensch zum Menschen, besonders vom Herrn zum Knecht! Aber gerade, als wollte die Natur hier das Unerbittliche, Schweigsame im Menschen mildern, hängt der sonnendurchglänzte Wasserdunst des Meeres oder der stundenbreiten Flußläufe über die Erde dort unten Gold- und Silbernetze, deren Wirkung die Landratte sich nicht vorstellen kann. Breit verschwimmend im Lichtglanz, der vom frühen Morgen bis zum späten Abend mit einem verschwenderischen Farbenreichtum prunkt, so erscheint alles Geradlinig-Eckige im Land der Marschen. Und wer nicht die alten Fleten am Hamburger Hafen, die engen, kanaldurchzogenen Gassen der alten Lagerhäuser hansischer Großkaufleute der Vergangenheit gesehen hat, wie sie im lichtdurchglühten Wasserdunst und im sonnengeröteten Qualm der Dampfer zu Märchengassen aus goldigem Purpur und echtem Ultramarin[105] werden, der weiß nicht, was des Meeres ungezählte Zauberer aus übelriechenden Winkeln und morschen, himmelhohen Warenspeichern machen können.

Phot. Wilh. Bandelow.
Hamburger Flet bei Ebbe.
Wir haben oben von einem der eigentümlichsten Städtegebilde in der südöstlichen Ecke des Reiches gesprochen, von München. Es hat seinen fast künstlerisch kontrastartig wirkenden Gegensatz im Nordwesten Deutschlands. Den Abschluß der dem Süddeutschen in der grandiosen Einfachheit ihrer Linien und in dem fast holländischen Zauber der wassergesättigten Atmosphäre nicht ohne weiteres verständlichen Landschaft der roten Heide, der samtgrünen Marsch, der schwarzen Moorwildnisse, der verträumten Schilfufer und der waldigen Hügelhänge an dem meergleichen Strom, der schimmernden Obstwälder und der gelben Sanddünen, der stillen Deiche und der rollenden Wogen – diesen Abschluß bildet die bedeutungsvollste und lebendigste aller deutschen Städte: Hamburg. Während der Rhein, dem granitenen Leibe der Alpen entsprungen, doch immer im engen Felsenbett dahinrollt und wenigstens bis zu seiner holländischen Deltaversandung an alten Burgen, hohen Domen, Rebenhügeln und fruchtbaren Gefilden dahinrauscht, und er eigentlich doch immer nur das große, sagenumwobene Idyll eines Flusses ist, entwickelt sich die dem Busen des Riesengebirges entquellende Elbe auf verhältnismäßig kürzerem Lauf durch sozusagen nüchternes Land zur monumentalen Größe, die zu unserem technisch merkantilen Zeitalter eher passen will als die Poesie des romantischen Rhein! Berlin ist ja zweifellos politische Reichshauptstadt. Aber das Tor, das uns mit allen Erdteilen verbindet und bei aller merkantilen Einseitigkeit doch das Sigillum der zukünftigen Groß-Großstadt Deutschlands schon jetzt an der Stirn trägt, ist Hamburg. Wer's nicht glaubt, mag selbst hingehn. Das kann durch keine Statistik, durch keine politischen Reden, sondern nur durch die Augen erschaut und erfaßt werden.
Tafel VIII

Gottheil & Sohn, Königsberg, phot.
Ostpreußische Küstenlandschaft

R. Hilbert phot.
In der Norddeutschen Tiefebene
Wenn ich nun nicht auch auf der Ostseite Deutschlands den Weg durch Pommern, Sachsen, Schlesien usw. zurück mache, so nur deshalb, weil mir im Laufe der Betrachtungen klar geworden ist, daß das eigentlich ein Buch für sich gäbe. Nur so viel zum Schluß: Aller Chauvinismus ist mir in der Seele zuwider, und das Lied: »Deutschland, Deutschland über alles« ist zwar als politisches Lied verständlich, und ich kenne kein schöneres Ziel, als daß das Lied wahrgemacht würde: daß Deutschland Europas und der Welt Musterstaat würde. Aber die Liebe zur Heimat schließt die Erkenntnis nicht aus, daß die ganze Erde und alle Länder voller Wunder sondersgleichen sind. Nur sollen wir beim A[106] anfangen, und unser A ist Deutschland, das Land, das bei aller Festgründigkeit doch das wandelbarste, das entwicklungsfähigste der europäischen Kulturländer ist. Schon darum ist es des Wanderers Sache, einmal zunächst seine eigenen Gaue zu schauen. Um so klarer wird er die Schönheiten anderer Länder zu würdigen wissen.
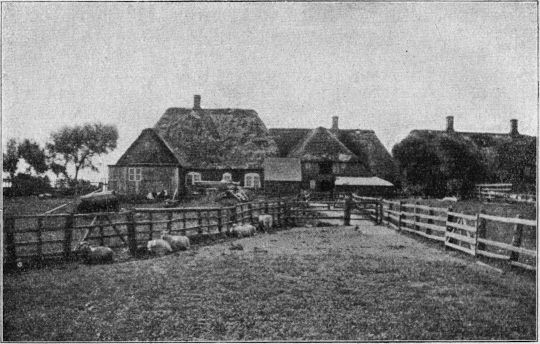
Phot. U. Rheinboldt.
Halligwerft.
In den großen Zeiten des Weltenadvents, in denen wir leben, und in den brausenden Wehen der Pfingsten eines neuen Jahrtausends müssen am Schlusse eines Wanderbuches noch zwei Dinge gesagt werden. Denn es ist nicht gleichgültig, wie der Sauser des nahenden Herbstes ins Stadium kommt – wie sie drüben über dem Rhein sagen – und wie der neue Most sich bis zur Klärung gebärdet. Da kommt es erheblich auf die Schläuche an.
Das eine ist also das: Mag es mit der neuen Religion, von der wir so viel reden hören, kommen wie es wolle, sie wird mit den Kenntnissen der biologischen Wissenschaft und mit unserem bisher entweder allzu verachteten oder zu sehr verhätschelten Körper rechnen müssen. Denn dieses größte aller Wunder der Natur hat da auch sein Wort mitzureden. Wir wissen heute, daß eine sündhafte[107] Verschwendung von Kraft in der Richtung moralischer Anstrengungen gemacht wird und daß der heilige Antonius und viele ähnliche nach größerer sittlicher Reinheit ringende Menschen viel weniger Versuchungen zu erdulden gehabt hätten und daß das Maß vieler Heiligengeschichten auf ein Geringes zurückgedrängt worden wäre, wenn diese Stoiker, Heiligen oder wie sie sich heißen, mehr von dem Zusammenhängen des Seelenlebens mit dem Essen und der Verdauung gekannt hätten. So wie für den wirklichen Kulturmenschen Eile etwas Niedriges bedeutet, so muß Sauberkeit in jedem Sinne eine Nationaltugend werden. Vor allem beim Wandern, wo die Verführung zum Gegenteil so groß ist.
Das ist das eine und gilt für die Alten wie für die Jungen. Das andere ist nur für die Alten.
Seitdem die Welt steht, haben die Menschen jenseits der Fünfziger noch nie den Heroismus gehabt, auf die alte selbstgefällige Einbildung zu verzichten, die Jugend sei schlimmer als zur Zeit, wo sie jung waren. Mit diesem Greisengedanken prahlt schon Salomo, man findet ihn bei Plinius; kurz, es handelt sich hier um eine Gedankenverkalkung, die niemand aufgeben will. Und doch spricht schon allein der Gang der Weltgeschichte dagegen. Aber es braucht noch mehr. Wir älteren Semester sollten es wieder anstreben, die Jungen nicht nur zu schulmeistern, sondern auch von ihnen zu lernen. Schon deswegen, weil wir so selber jünger bleiben, als wenn wir uns in die würdigen Ecken unserer Philisterweisheit zurückziehen. Es ist so töricht, wenn wir keinen Gebrauch machen von der weisen Einrichtung der Natur, die uns die Jungen als Schrittmacher gibt, wenn wir ihnen – denn sie sind mit Recht anspruchsvoll in den vielen Fällen ihrer rührenden Hilflosigkeit – unsere Erfahrungen nicht aufschulmeistern, sondern mit väterlicher Kameradschaftlichkeit mitteilen.
Wenn ich mich bisher fast nur an die Jugend wandte, um sie zum Kampf gegen sportliche Herzverkalkung beim Wandern und exklusive Tendenzen aufzurufen, so gelten diese Worte den vielen älteren Stillen im Lande, die sich von irgendeiner guten Tante weismachen ließen, sie seien zu alt zum Wandern.
Es ist nicht wahr! Ihr seid nicht zu alt! Lernet wieder das Wandern! So würde ganz ohne Lärm und Organisation und Agitation ein Geheimbund der alten Herren, eine Brüderschaft vom geruhigen Wanderschuh entstehen, deren Mitglieder schon durch ihr Dasein beschämend und anfeuernd auf die Jugend wirken könnte. Das gäbe eine Brüderschaft der Unentwegten, ein Fähnlein der Aufrechten, ohne Vereinsbeiträge und ohne Vereinszeichen.[108] Höchstens das eine Zeichen wäre erlaubt, ein gut pochendes Herz, das jung geblieben ist, nicht an Arteriosklerose und ähnliche überflüssige Segnungen unserer Zeit glaubt, sondern an die Jugend, besonders an die eigene. Das sind die Herzen, die ihre Flammen, wenn auch gedämpft durch den gesunden Menschenverstand des Schwabenalters, noch lodern lassen, wenn die anderen von der alten Garde zwar noch nicht gestorben sind, aber sich schon lange ergeben und die Flinte ins Korn geworfen haben.
Und warum?
Weil sie auf den die Lebenskraft gar zu leicht untergrabenden Trick der modernsten aller Zauberinnen, der Technik, hereingefallen sind, den wichtigsten Teil des körperlichen Lebens, die Bewegung, nach und nach an sich zu ziehen und aus den Menschen immer mehr Stückgüter zu machen, die zur Beförderung übernommen werden, sei's auf dem Motorrad und Auto, oder auf der Eisenbahn und im Lenkballon, oder auf dem Ozeandampfer und im Unterseeboot. Besonders die »Elektrische« wirkt im Alltagsleben verheerend und entzieht uns mit einer infernalischen Subtilität Bewegungsbedürfnis und Muskelkraft. Es wird den älteren Semestern lebensgefährlich bequem gemacht. Mit beängstigender Zuvorkommenheit wird alles an uns herangebracht. Das Kino erspart uns bald das Reisen, und wer weiß, bald können wir vielleicht in unseren vier Wänden prima Schwarzwaldluft atmen, die uns Fernluftleitungen zu mäßigen Preisen zuführen wie Wasser, Gas und Elektrizität. Wir werden uns eines schönen Tags überhaupt nicht mehr von der Stelle zu bewegen brauchen, und unser Leben wird sich auf dem Sofa ganz wirkungsvoll und schöpferisch abspielen können, ohne daß wir mit der Wimper zucken.
Das ist groteske Übertreibung, werden viele sagen. Zugegeben! Und doch kann ich es nicht verwehren, daß angesichts solcher Möglichkeitsperspektiven zwei Gestalten vor mein Auge treten: Mein alter Großvater, der noch mit 80 Jahren uns jede Woche einmal in der Stadt besuchte und die vier Stunden her und die vier Stunden heim ins Dorf zu Fuß zurücklegte. Und dann der jetzt auch schon 80jährige leichtfüßige Vater Weißbart, in dessen Familie das allsonntägliche Wandern eine Art Gottesdienst war und dessen Frau und Kindern ich es heute noch danke, daß ich mit meinem erheblichen Talent zum Stubenhocker und Bücherwurm schon in jungen Jahren den Segen kennen lernte
vom Wandern, ja vom Wandern.
Natur! Wir sind von ihr umgeben und umschlungen – unvermögend, aus ihr herauszutreten, und unvermögend, tiefer in sie hinein zu kommen. Ungebeten und ungewarnt nimmt sie uns in den Kreislauf ihres Tanzes auf und treibt sich mit uns fort, bis wir ermüdet sind und ihrem Arme entfallen …
Sie schafft ewig neue Gestalten, was da ist, war noch nie; was war, kommt nicht wieder: alles ist neu und doch wieder das Alte.
Sie scheint alles auf Individualität angelegt zu haben und macht sich nichts aus den Individuen. Sie baut immer und zerstört immer, und ihre Werkstätte ist unzugänglich …
Sie lebt in lauter Kindern; und die Mutter, wo ist sie? Sie ist die einzige Künstlerin: aus dem simpelsten Stoffe zu den größten Kontrasten: ohne Schein der Anstrengung zu der größten Vollendung; zur genauesten Bestimmtheit, immer mit etwas Weichem überzogen. Jedes ihrer Werke hat ein eignes Wesen, jede ihrer Erscheinungen den isoliertesten Begriff, und doch macht alles eins aus.
Es ist ein ewiges Leben, Werden und Bewegen in ihr, und doch rückt sie nicht weiter. Sie verwandelt sich ewig und ist kein Moment Stillstehen in ihr. Fürs Bleiben hat sie keinen Begriff, und ihren Fluch hat sie ans Stillstehen gehängt. Sie ist fest: ihr Tritt ist gemessen, ihre Ausnahmen selten, ihre Gesetze unwandelbar.
Sie läßt jedes Kind an ihr künsteln, jeden Toren über sie richten, Tausende stumpf über sie hingehen und nichts sehen, und hat an allen ihre Freude und findet bei allen ihre Rechnung …
Man gehorcht ihren Gesetzen, auch wenn man ihnen widerstrebt; man wirkt mit ihr, auch wenn man gegen sie wirken will. Sie macht alles, was sie gibt, zur Wohltat; denn sie macht es erst unentbehrlich. Sie säumt, daß man sie verlange; sie eilt, daß man sie nicht satt werde …
Sie hat keine Sprache noch Rede, aber sie schafft Zungen und Herzen, durch die sie fühlt und spricht. Ihre Krone ist die Liebe; nur durch sie kommt man ihr nahe. Sie macht Klüfte zwischen allen Wesen, und alles will sie verschlingen. Sie hat alles isoliert, um alles zusammen zu ziehen. Durch ein paar Züge aus dem Becher der Liebe hält sie für ein Leben voll Mühe schadlos …
Sie ist alles. Sie belohnt sich selbst und bestraft sich selbst, erfreut und quält sich selbst. Sie ist rauh und gelinde, lieblich und[110] schrecklich, kraftlos und allgewaltig. Alles ist immer da in ihr. Vergangenheit und Zukunft kennt sie nicht. Gegenwart ist ihr Ewigkeit. Sie ist gütig. Ich preise sie mit allen ihren Werken. Sie ist weise und still. Man reißt ihr keine Erklärung vom Leibe, trutzt ihr kein Geschenk ab, das sie nicht freiwillig gibt. Sie ist listig, aber zu gutem Ziele, und am besten ist's, ihre List nicht zu merken …
Sie hat mich hereingestellt. Sie wird mich auch herausführen. Ich vertraue mich ihr. Sie wird ihr Werk nicht hassen. Alles ist ihre Schuld, alles ist ihr Verdienst.
Das sind Worte des jungen Goethe. Wenn man mit unserer Unfähigkeit, die ja auch die seine war, rechnet, Unaussprechliches auszusprechen, so wird man die theoretische Gleichsetzung von natura mit deus bei dem jungen Spinozisten verstehen. Aber in unserer Zeit hat sich neben einer tiefen Erfassung des von Goethe gelebten Lebens eine Goethelithurgie entwickelt, die sich nur durch einen unfreiwillig zugegebenen Mangel an weiteren und höheren Zielen bei den Anhängern dieses neuesten heidnischen Kirchleins erklären läßt. Da ist es in den Tagen, wo jeder zweite gebildete Deutsche die wie allzuguter Wein etwas ölig gewordene Weisheit des alten Olympiers schlürft wie ein Lebenselixier, vielleicht am Platz, an der bescheidenen Zauntüre, die aus den auch nur gedachten und erträumten Weiden des vorliegenden Wanderbuches herausführt, einen Trank aus dem tosenden, klaren Quell zu kredenzen, aus dem Goethe in den Jahren geschöpft hat, wo ihn die abgeklärte, aber doch schon durch den Abendstaub des müden Wanderers behaftete Weisheit noch nicht zierte; jene Altersreife, durch deren Genuß man zwar schön kristallinisch, aber doch eben als Goethephilister versteinert. Auch gar nicht philiströs veranlagte Männer unserer Zeit sind bis zu einem Grade erkrankt an diesem modernen Goethekultus, daß sie – faute de mieux – Goethe zum alleinseligmachenden Propheten des neuen Deutschland erhoben.
Goethe war 31 Jahre alt, als er obige, einem Aphorismenkranz entnommenen Sätze schrieb, die sich in ihrer abgrundtiefen Klarheit und in der Fülle ihrer Antithesen ganz mit dem aufreizenden Reichtum der Natur an Widersprüchen decken. Vielleicht ist das vorliegende kleine Buch für manchen, der auch mit dem Herzen wandert, eine Hilfe, um sich aus der Zerklüftung der Welt, wie wir sie sehen, in die Einheit dessen, was dahinter liegt, zu retten.[111] Nicht allein mit dem Verstand, der zwar ein gutes Handwerkszeug, aber kein guter Führer ist; nicht nur mit dem aufmerksamen Ohr des fleißigen Schülers, dem bekanntlich im Faust so dumm wurde, als ginge ihm ein Mühlrad im Kopfe herum; sondern mit den schauenden Augen, die des Leibes Licht sind. Und dazu mit jener sanften Unerschrockenheit der Seele, die nichts zu fürchten hat, weil sie nach des jungen Goethe prophetischen Worten die einzige Möglichkeit ist, uns der Natur zu nähern: Die bewegte Stille der Liebe.

Phot. J. Hartmann.
Im Riesengebirge.
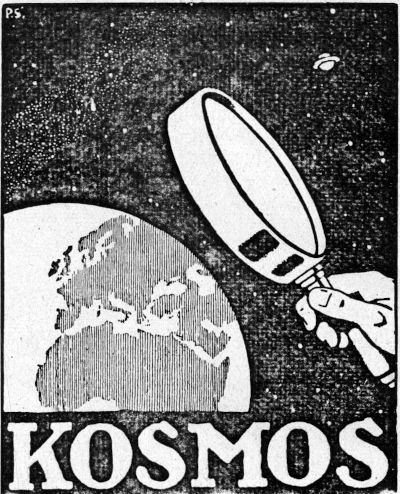
KOSMOS
Gesellschaft der Naturfreunde
bietet für jedermann einen
billigen und guten
Lesestoff
Belehrend – Unterhaltend
Jedes Mitglied erhält
für den Preis von vierteljährlich
nur 7.50
jährlich 12 reich bebilderte Monatshefte und
4 packende Bücher erster Schriftsteller kostenlos.
Treten sie sofort bei oder verlangen sie Prospekt
bei Ihrer Buchhandlung oder der Geschäftsstelle
des Kosmos, Stuttgart