Die Heimat
Roman aus den schlesischen Bergen
von
Paul Keller
Mit Buchschmuck von Felix Schumacher
122. bis 136. Auflage.

Bergstadtverlag Wilh. Gottl. Korn
Breslau und Leipzig
Anmerkungen zur Transkription
Das Original ist in Fraktur gesetzt. Im Original gesperrter Text ist so ausgezeichnet. Im Original in Antiqua gesetzter Text ist so markiert.
Weitere Anmerkungen zur Transkription befinden sich am Ende des Buches.
Roman aus den schlesischen Bergen
von
Paul Keller
Mit Buchschmuck von Felix Schumacher
122. bis 136. Auflage.

Bergstadtverlag Wilh. Gottl. Korn
Breslau und Leipzig
Alle Rechte,
insbesondere das der Übersetzung, vorbehalten.
Copyright 1915 by
Bergstadtverlag Wilh. Gottl. Korn, Breslau.
Druck von Wilh. Gottl. Korn in Breslau.
Im Buchenhofe war ein Hühnchen ermordet worden. Der Verdacht lenkte sich auf Waldmann, den Dachshund, der nach der Tat flüchtig geworden war. Es war auch dem Schaffersohne Hannes, der sich sofort aufgemacht hatte, die Spuren des Mörders zu verfolgen, nicht gelungen, des Attentäters habhaft zu werden.
»Der Gauner is ausgerückt,« meldete er niedergeschlagen dem Sohne seines Herrn, dem vierzehnjährigen Heinrich Raschdorf, der zu den Ferien daheim war. »Ich sag' Dir, a muß in a Fuchsloch gekrochen sein, sonst hätt' ich 'n erwischt. Ich hab' gesucht wie verrückt!«
»Wenn er Hunger haben wird, kommt er von selber nach Hause,« sagte voll Überlegung Heinrich, der Quartaner.
»Ja, und weißte was? Dann machen wir 'n Heidenulk! Wir machen Gericht! Du bist der Richter, und ich bin der Poliziste, und Du verurteilst a Dackel, daß ihm der Poliziste fünfe aufs Leder haut, und daß a ihn mit der Schnauze a paarmal aufs tote Hühndel stampt, und daß a ihn 'ne Stunde in a Kohlschuppen sperrt. Gelt, Heinrich, das machste?«
»Ich werd' mir's überlegen,« antwortete in vornehmer Ruhe der Quartaner.
Diese Zurückhaltung schien dem lebhaften Bauernburschen nicht zu gefallen. Er sann über etwas anderes nach. Nicht lange, so hatte er's.
»Ja, und weißte was, Heinrich? Das Hühndel werden wir begraben. So 'n Begräbnis macht auch 'n riesigen Spaß! Du machst a Pfarrer –«
»Das ist mir schon zu kindisch, das hab' ich früher gemacht,« erwiderte Heinrich.
»Na, hör' mal, wenn Du auch Quartaner bist, kannste doch noch 'n Pfarrer machen. Siehste, ich bin der Totengräber. Wir machen 'n Leichenzug, und ich setz' mir Vaters Zylinder auf und geh' so wackelig vorm Zug her, gerade wie der alte Lempert. Was Ulkigeres wie 'n Totengräber gibt's nich. Na, und die Mädel sind doch och dabei, die Lene und die Lotte und die Liese. Die müssen flennen. Und wenn Du die Rede hältst, müssen sie immer mehr flennen, und nachher lassen wir das Hühndel ins Grab und die Mädel singen: »In der Blüte deiner Jahre«. Na, wenn das nischt is! –«
Der Quartaner überlegte. Die Beredsamkeit seines ländlichen Freundes beeinflußte ihn. Skrupel hatte er ja freilich. Seine »Kollegen« in der Quarta würden so etwas »einfach dämlich« gefunden haben. Also sagte er langsam und bedächtig:
»Eigentlich ist es kindisch! Aber Dir zu Gefallen können wir's ja noch einmal machen. Doch es ist das letzte Mal, Hannes, das sag' ich Dir. Und Vater und Mutter dürfen nichts wissen.«
»Die wissen so wie so nischt,« sagte Hannes. »Der »Herr« sitzt drüben beim Schräger, und die »Frau« hat 'n Kopfkrampf und liegt im Bette. Besser kann sich's nich treffen.«
»Na, denn meinetwegen, Hannes!«
Hannes war von diesem Zugeständnis freudig berührt. Er hob einen dürren Stecken aus dem Garten auf, rannte ans Fenster des stattlichen Bauernhauses und klopfte dreimal feierlich an.
Der Kopf eines dunkeläugigen, bildhübschen Mädchens von etwa zwölf Jahren wurde sichtbar.
»Was is 'n los?«
Hannes senkte geheimnisvoll das Haupt und sagte mit der düsteren Stimme eines »Grabebitters«:
»Der Herr Raschdorf läßt schön grüßen, und a läßt bitten, daß die Jungfer Magdalene so freundlich sein täte und 'm toten Hühndel 's letzte Ehrengeleite geben. Der Pfarr' und die Schule gehn mit!«
»Macht Ihr wirklich Begräbnis?« fragte sie, nicht ohne Begeisterung.
»Natürlich, Lene,« antwortete der Leichenbitter und fiel aus der Rolle. »Es wird riesig ulkig. Heinrich is Pfarrer und ich Totengräber, und du mußt das Hühndel in a Sarg legen. Auf 'm Kleiderschranke sind ja die Zigarrenkisten; da nimmste eine, und da haste die Leiche!«
Damit warf er dem Mädchen das tote Hühnchen, das er bisher in der Hand getragen hatte, aufs Fensterbrett, schlug sich selber mit dem »Grabebitterstöckel« ein paarmal auf die Waden und rannte davon.
Der »Buchenkretscham« war vom »Buchenhofe«, auf dem Heinrich und Magdalene die Kinder der Herrschaft waren, Hannes aber als Sohn des »Schaffers« lebte, nur durch die Straße getrennt, die von der Stadt her nach dem schlesischen Gebirgsdorfe führte. Früher waren beide Höfe zu einer großen »Herrschaft« vereinigt gewesen. Der letzte Besitzer war bankerott geworden, das Gut wurde dismembriert, einzelne Teile des Ackers wurden an Bauern des Dorfes verkauft; aus dem Rest der Felder und den Gebäuden aber entstanden zwei neue Besitztümer, immer noch sehr stattlichen Umfanges: der Buchenhof Hermann Raschdorfs und der Buchenkretscham des Julius Schräger.
Vor dem Kretscham machte Hannes vorsichtig Halt. Er schlich an ein Fenster der Gaststube und lugte vorsichtig durch die Scheiben. Die Ausschau befriedigte ihn. Sein »Herr« und Schräger, der Gastwirt, saßen beisammen und sprachen eifrig miteinander. Diese beiden würden voraussichtlich die Trauerfeierlichkeit nicht stören. Also begab sich Hannes Reichel nach dem Hausflur. Er hatte Glück und traf die Schräger-Lotte, die er suchte.
Das etwas blasse Kind erschrak ein wenig, als es Hannes dreimal mit seinem Stecken auf den Arm klopfte und sagte:
»Der Herr Raschdorf läßt schön grüßen, und ob die Jungfer Lotte vielleichte so freundlich sein täte und 'm toten Hühndel 's letzte Ehrengeleite geben. Der Pfarr' und die Schule gehn mit!«
»Was? Der Herr Raschdorf sitzt ja drin in unserer Stube. Und warum hauste mich denn so auf den Arm?«
Der Grabebitter fiel abermals aus der Rolle.
»Tumme Gans, der Herr Raschdorf is der Heinrich, und wenn Du nich in 'ner halben Stunde drüben bist und mitmachst, da – da sollst Du mal sehen!«
Das Mädchen wollte noch etwas fragen, aber Hannes »schmitzte« bereits seine Waden und »sockte« ab.
»Mit der Lotte is nischt los,« sagte er zu sich selbst. »Sie is 'ne Tunte! Aber die Lene, die Lene!«
Und das Bürschlein blieb einen Moment stehen und verdrehte verliebt die Augen. Dann setzte es sich schnell wieder in Bewegung.
Im grellhellen Licht des Julitags lag das Dorf langgestreckt drunten im Tal. Die Nordseite war durch einen waldigen Hügelzug abgeschlossen, an dessen Abhang, etwas abgesondert vom Dorfe, die Buchenhöfe lagen. Drüben die südliche Einrandung der Talmulde war viel niedriger, ganz mit gelben Saaten bestanden, über denen schwer und schwül die Sommersonne lag. Und all die vollen Ähren standen wie im heißen Fieber, in einem Fieber, welches das Leben zur Gluthitze bringt und doch die besten Säfte und Kräfte verkalkt, verzuckert und vermehlt, so daß nach dem heißen Rausch das Sterben kommt.
Hannes rannte hinab ins Dorf. An ein paar Bauernhöfen lief er vorbei, dann kam eine grüne Aue, auf der ein kleines, nettes Haus stand.
Hannes reckte sich und klopfte mit seinem Stecken ans Fenster. Ein schmächtiges, blasses Mädel erschien.
»Der Herr Heinrich Raschdorf läßt schön grüßen, und ob die Jungfer Liese nicht so freundlich sein wollen mögen[6] täte, 'm toten Hühndel 's letzte Ehrengeleite zu geben. Der Pfarr' und die Schule gehn mit!«
»Wenn is es denn? Wenn is es denn?« fragte das Kind mit vielem Interesse. »Macht der Heinrich a Pfarrer?«
»Natürlich, Liese, macht a 'n Pfarrer.«
»Gelt, Du, Hannes, der is aber gar nich 'n bissel stolz geworden, und a is doch schon Quartaner, hat doch jetzt immer Gamaschen an,« sagte das Mädchen bewundernd.
»Nu eben,« pflichtete Hannes bei. »Komm och balde nach, Liese; 's geht gleich los! Ich muß bloß schnell 's Grab graben und 'n Zylinder suchen. Wenn kommt 'n Dein Vater heim?«
»Nu, a kommt balde! Ich müßte eigentlich –«
»Gar nischt mußte! Bloß kommen! Kannste »In der Blüte deiner Jahre« auswendig, Liese?«
»Bloß drei Verse.«
»Das langt! Bloß balde kommen! In einer reichlichen halben Stunde geht der Rummel los. – Nanu, wer is 'n das?«
Zehn Meter von Hannes entfernt lag auf der Aue Waldmann, der Dackel. Er lag mit der Schnauze auf der Erde, so daß seine langen Ohren den Boden berührten, und schielte mit höchst durchtriebenem Gesicht den Hannes an.
»A is schon a paar Stunden hier,« berichtete Liese. »Ich hab' ihm Milchsuppe gegeben.«
»Machste recht, Liese! So ein'm Lump, der 's Hühndel totgebissen hat, Milchsuppe!«
»Ja, das wußt' ich doch nicht, Hannes. Und ich denke, Du bist froh, daß wir Begräbnis machen können.«
»Natürlich, Liese, bin ich froh. Wenn der Dackel 's Hühndel nicht erbissen hätte, wär's sehr schade; aber weil a 's erbissen hat, kriegt a Hiebe. Das is nich mehr wie recht und billig. – – Dackel, nu Dackerle, nu Waldmänndel, nu komm doch; siehste nich, daß ich Zucker hab'? Zucker, Waldmänndel! Na, da komm her, Dackel!«
Der Junge näherte sich Schritt für Schritt dem Hunde. Der lag lauernd auf der Erde und schnitt ein über die Maßen schlaues Gesicht. Er lachte geradezu. Und als der Hannes auf drei Schritte herangekommen war, sprang der Dackel auf und lief davon, daß der Boden hinter ihm aufflog. In dreißig Meter Entfernung legte et sich wieder nieder und grinste seinen Verfolger mit überlegener Schadenfreude an. Der verbiß seinen Ärger und beschloß zunächst, seinen Stecken wegzuwerfen und beide Hände in die Taschen zu stecken, damit ersichtlich sei, daß er gar nichts Übles im Sinne führe. Dabei verdoppelte er die Kosenamen und führte alle Schätze der heimischen Speisekammer namentlich auf. Doch als er sich dem Verfolgten wieder auf drei Schritte genähert hatte, brachte dieser sein Leibliches abermals durch eine fabelhaft beschleunigte Flucht in Sicherheit.
Ein paar Knaben schlenderten müßig die Dorfstraße herab. Als Hannes sie gewahrte, gab er die Verfolgung des Hundes auf und wandte sich den Jungen zu in der Absicht, neue Teilnehmer an dem Begräbnis zu werben. Seine ganze blühende Redekunst wandte er zu diesem Zweck auf. Ohne Erfolg!
»Mit 'm Heinrich Raschdorf spiel' ich nich,« sagte Ernst Riedel, »der is a stolzer Affe!«
»Ich geb' mich auch nich mit 'm ab,« sagte ein zweiter.
»Und ich tät' überhaupt von mein'm Vater Wichse kriegen, wenn ich uff a Buchenhof ging,« sagte der dritte.
Hannes war wütend.
»Das werd' ich 'm Herrn Lehrer sagen, der is Heinrichs Großvater,« sagte er, nachdem er sich kurz die Unmöglichkeit zu Gemüte geführt hatte, selbst die drei starken Bengel durchzuprügeln.
»Wenn a mir was tut,« sagte Ernst Riedel, »geht mein Vater zum Schulinspektor.«
»Und meiner och!«
Sie gingen. Hannes schaute ihnen eine Weile nach. Dann spuckte er aus und schrie ihnen nach: »Ochsen, Ochsen, Dorfochsen!«
In der Gaststube des Buchenkretschams war es ganz still. Nur zwei Männer saßen drin: Hermann Raschdorf, der Buchenbauer, und Julius Schräger, der Wirt. Man hörte, wie am Leimstengel auf dem Fensterbrett die gefangenen Fliegen zitterten. Die Sonne aber, die bei aller vielen Arbeit immer noch Zeit findet, ein wenig Spaß zu treiben, wie alle großen Leute, gestattete sich ein wunderliches Spiel. Sie beleuchtete die großen Schnapsflaschen, die im Schanksims standen, und entlockte ihnen wunderbare Lichter; und wer da genau hinsah auf die flimmernden Flaschenleiber, konnte denken, er sähe lauter große Edelsteine. Da war der Benediktiner, dunkel wie ein Orthoklas, und daneben glänzte die Kirschflasche wie ein riesiger Rubin; der grüne Magenbitter kam sich sicherlich selber vor wie ein märchenhafter[9] Smaragd, und der Eierkognak war so milchig hell und hatte so sanfte Mondscheinreflexe wie ein echter Opal. Der Branntwein aber, von echtem »Wasser und Feuer«, hielt sich ohne übermäßige Bescheidenheit für einen Diamanten. Schade, daß so viele Menschen nicht darauf achten, wenn die Sonne einmal witzig ist. Auch die beiden Männer nicht.
»Die Hauptsache is, Hermann, daß Du mir keine Schuld gibst,« sagte der Wirt.
»Aber Du hast mir doch am meisten zugeredet, daß ich die verfluchten Aktien gekauft hab'!« entgegnete der Buchenbauer.
»Zugeredet, was heißt zugeredet? Hätt' ich Dir zugeredet, wenn ich nich gedacht hätte, die Sache wär' gut, was? Hätt' ich das? Was? Selber hätt' ich welche gekauft, wenn ich damals Geld liegen gehabt hätte.«
»Und ich? Hatt' ich welches liegen? Hatt' ich's? Hab' ich nich 'ne neue Hypothek aufgenommen? Fünftausend Taler, Mensch! Fünftausend Taler! Was das heißen will bei mir!«
Der Gastwirt sprang ärgerlich auf, steckte die Hände in die Hosentaschen und trat ans Fenster.
»So is 's! Wenn die Leute Pech haben, schieben sie's immer auf andere.«
Er drehte sich rasch wieder um.
»Nu, Mensch, siehste das nich ein, daß ich's bloß gut gemeint hab'? Daß ich bloß Dein Bestes wollte? Was?! Wenn die Sache richtig gegangen wär' –«
»Wenn! Man soll sich mit solchen Lausekerlen nicht einlassen. Herrgott, wenn wirklich, Schräger – – es is ja – es is ja gar nich zum Ausdenken –«
Der kleine, dicke Gastwirt legte dem großen, stattlichen Bauern beschwichtigend die Hand auf die Schulter.
»Hermann! Was nutz't n das alles! Abwarten! ruhig abwarten!«
»Abwarten! Du hast gut reden. Abwarten! Ich – ich – mir wird die Zeit zur Ewigkeit; drüben liegt mein Weib krank, sie weiß nichts von all dem, die Zinsen bin ich noch schuldig von Johanni, – ich – ich –«
»Weißte, Hermann, trink'n wir 'n Kirsch!«
»Ich mag nich, ich will nich, ich hab' schon genug!«
»Trink'n wir halt 'n Kirsch! Das wirste mir doch nich abschlagen, Hermann!«
Der Wirt ging nach dem Schanksims, und der Rubin tauchte unter.
»Na also!« sagte Schräger, indem er langsam mit den gefüllten Gläsern zurückkam. »Nur nich 'n Kopp verlieren! Wird ja noch alles werden. So, da! Na, trink mal, Hermann! Auf Dein Wohl!«
Da tönten Schritte draußen im Hausflur.
»Der Briefträger,« keuchte Raschdorf und stieß das gefüllte Glas um. Er stand auf und stützte sich schwer auf den Tisch. Ein Landbriefträger trat über die Schwelle, erhitzt und bestaubt.
»Guten Tag!« sagte er; »'n Korn und a Glas Einfach –«
»Is was an mich?« fragte Raschdorf schwer beklommen. Auch der Wirt blickte aufs höchste gespannt nach der schwarzen Ledertasche. »Jawohl, Herr Raschdorf, da ist ein Brief!«
»Vom Rechtsanwalt,« sagte Raschdorf leise und langte über den Tisch.
»Komm mit ins Stübel, Hermann!« riet der Wirt.
Die beiden Männer gingen ins Wohnzimmer des Wirtes. Mit zitternden Fingern löste Hermann Raschdorf den Umschlag des Briefes.
»Setz' Dich, Hermann, setz' Dich!« Der Wirt zwang ihn aufs Sofa.
Und Raschdorf las. Da wurde das Gesicht blaß, die Mundwinkel verzogen sich, der Unterkiefer zitterte, und auf der Stirn brannte ein roter Fleck wie eine Wunde.
»Verflucht! Oh – oh – verflucht!«
Das Papier entsank dem starken Mann, und er selbst fiel mit dem Gesicht auf das Sofa und krallte seine Finger in die Polster.
»Was is denn, Hermann, um Gottes willen, was is denn?«
Keine Antwort. Der hünenhafte Körper nur zuckte krampfhaft auf und nieder, die Hände fuhren wie irre hin und her, und der Kopf bohrte sich in den Sofasitz.
Der Wirt bückte sich, hob den Brief auf und las.
Eine lange Pause entstand.
»Fünfzehn Prozent, nur fünfzehn Prozent!«
Schräger setzte sich auf einen Stuhl. Schweigend betrachtete er den Unglücklichen, der in dumpfes Schluchzen ausbrach. In den grauen Augen des Wirtes zuckte es sonderbar. Ein Weilchen blieb er so ganz still, dann schlich er auf den Zehen hinaus und verkaufte drüben dem wartenden Briefträger um zehn Pfennig Schnaps und Bier.
»Sagen Sie einstweilen von dem Briefe nichts im Dorfe,« sagte er zu dem Briefträger und kassierte die zehn[12] Pfennig Zeche ein. Dann ging er zurück nach der Wohnstube. Behutsam öffnete er die Tür. Raschdorf lehnte auf dem Sofa, die Füße weit von sich gestreckt.
»Hermann!«
»Na, was sagste? Haste gelesen? Fünfzehn Prozent! Was? Das macht sich! Diese Schweinebande!«
»Aber 's muß doch 'n Gesetz geben, Hermann!«
»Gesetz geben! Schafkopp! Gesetz! Wenn Du 'n Hund ohne Maulkorb rumlaufen läßt, oder wenn Du die Wagentafel zu Hause vergessen hast, da gibt's 'n Gesetz, da werden sie Dich schon fassen; aber wenn kleine Leute von Spekulanten um ihr Geld begaunert werden, um Tausende, um viele Tausende, um alles – da gibt's kein Gesetz, da kräht kein Hahn darüber, da kümmert sich kein Teufel drum – Schweinebande!«
Schräger trat nahe an den Sofatisch.
»Es ist schrecklich, Hermann! Und das Schlimmste: nu werd' ich die Schuld kriegen.«
Raschdorf blickte auf.
»Die Schuld kriegen! Du? Hä! Natürlich bist Du schuld!«
»Hermann, das verbitt' ich –«
»Ach, halt's Maul! Was hat's denn für 'n Zweck, wenn ich Dir die Schuld geb'? Krieg' ich mein Geld wieder? Was? Nee! Hin is hin! Aber daß Du mir zugeraten hast, daß Du mir in a Ohren gelegen hast Tag und Nacht, das steht auf ein'm andern Brette, Schräger!«
»Na, is gut, Hermann! Gut is! Ich werd' Dir ja nich mehr raten! Ich sag' ja kein Sterbenswort mehr, und wenn Du –«
»Und wenn ich gleich pleite geh'! Weiß ich, Schräger, weiß ich! Is auch ganz gut so.«
»Na, das is ja richtig! Das habe ich mir ja gerade um Dich verdient!«
Schräger trat ans Fenster und blickte hinaus auf die staubige Straße. Raschdorf erhob sich und dehnte die Arme.
»So! Nu werd' ich's meinem kranken Weibe sagen, und nachher könn'n wir ja die Klappe zumachen und fechten gehn.«
Schräger drehte sich langsam um.
»Hermann,« sagte er, und seine Stimme klang warm, »Hermann, wenn Du 'n Freund brauchst!«
Raschdorf sah ihn mit herbem Lächeln an.
»Wenn ich 'n Freund brauch', komm ich zu Dir. Verlaß Dich darauf, Schräger!«
Sie sahen sich einige Sekunden in die Augen.
»Adieu, Schräger!« – –
Über die Straße ging Raschdorf und über seinen Hof. Er sah und hörte nicht. Als er in den Hausflur kam, blieb er stehen, als ob er Mut fassen müsse. Von oben herab klang ein hohles Husten. Da raffte sich der Mann auf. Langsam stieg er die Treppe hinauf und öffnete eine Tür. »Wie geht Dir's, Anna?«
Die sanfte, zarte Frau, die im Bette lag, sah ihn erstaunt an und fragte furchtsam:
»Was ist Dir, Hermann?«
»Mir? – Was soll mir sein?«
Die Kranke richtete sich auf.
»Hermann, es ist was passiert! Dir ist was; Hermann, was ist Dir?«
Er sank auf den Stuhl neben ihrem Bette und lehnte den Kopf an das kühle Kissen. Und wie sich ein Schuldbekenntnis von Männerlippen immer schwer und schmerzhaft losringt, so auch jetzt.
»Anna, ich – hab' spekuliert, – und ich hab' verloren.«
Eine heiße Röte zog über das weiße Frauengesicht. Sie sagte nicht gleich etwas, aber dann fragte sie:
»Ist es viel, Hermann?«
»Viel, Anna! Sehr viel! Über – über viertausend Taler.«
Die Kranke sank in die Kissen zurück und legte den rechten Arm über die Stirn und die Augen. Und der Mann saß in finsterem Schweigen an ihrem Bette. Kein Laut. Nur die Frau hustete ein paarmal. Und die Sonne schien schwül in die Stube.
Da klang ein seltsam Tönen in diese Todestraurigkeit. Vom Garten unten drang schwaches Kindersingen: »In der Blüte deiner Jahre«.
Müde erhob sich Raschdorf. Er hatte nicht den Mut, seiner blassen Frau in die Augen zu sehen. So trat er sachte ans Fenster und lehnte sich gegen die Mauer.
Ein wunderliches Bild bot sich ihm unten im Garten. Er sah nicht alles, nicht den Hannes, der possenhaft aufgeputzt da unten stand, nicht die fremden Kinder; er sah ein totes Hühnchen, das mit Myrtenzweigen und blauen Bändern geschmückt über einer Grube stand, er sah sein[15] schönes Kind, die Magdalene, und er sah seinen einzigen Sohn, der wie ein Geistlicher angezogen unten stand und vernehmlich sagte: »Vita brevis! Vita difficilis!«
»Das Leben ist kurz! Das Leben ist schwer!«
Das Wort traf den Mann ins Herz. Er ging zurück zum Bette der kranken Frau und bedeckte sein Gesicht mit beiden Händen. –
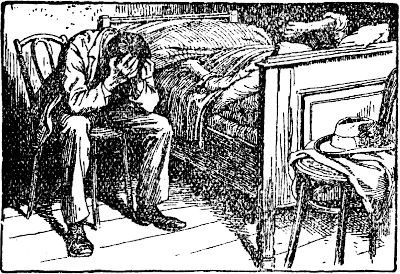
Drüben im Buchenkretscham durchmaß der Wirt die einsame Gaststube. Er war wohl in schwerer Erregung. An allen Tischen blieb er stehen und trommelte mit den dicken, kurzen Fingern darauf. Immer lockte es ihn ans Fenster, und er hatte doch nicht den Mut, ganz nahe hinzutreten. Die Augen aber richteten sich immer aufs neue nach dem Buchenhofe. So vertieft war er in seine Gedanken und in das Anschauen des stattlichen Gehöftes, daß er nicht einmal bemerkte, wie sich die Tür öffnete und ein Mann erschien, der ihn sekundenlang beobachtete.
»Eine wunderschöne Besitzung, der Buchenhof, was, Schräger?«
»Ah – ah – ja – ja – natürlich – natürlich; ach, Du bist's, Berger, Du hast mich ja –«
»So erschreckt, gelt ja? Hähä! Is kaum zu glauben, daß 'n Gastwirt erschrickt, wenn a Gast kommt.«
»Ich – ich dachte gerade nur –«
»Du dachtest gerade nur darüber nach, was doch der Buchenhof für 'ne riesig hübsche Wirtschaft wär', und da kam ich dummerweise und störte Dich in Deiner Andacht.«
»Bist doch halt a gespaßiger Mensch, Berger. Immer weißte 'n Witz. Was kann ich Dir denn einschenken?«
»Gar nischt! Ich will Dich bloß was fragen, Schräger. – – Weiß er's schon?« Und er zeigte mit dem Daumen nach dem Buchenhofe.
»Was – was soll er denn wissen?«
»Von der Pleite und den 15 Prozent!«
»Berger, woher weißt denn Du das schon wieder? Das is ja gar nicht möglich!«
Der andere lachte.
»Ja, weißte, wenn man Lumpenmann is wie ich und so mit einer Kurier-Hunde-Post im ganzen Lande rumfuhrwerkt, da hört man vieles. Was a richtiger Lumpenmann is, der weiß alles.«
Der Wirt sah Berger mit unruhig flackernden Augen an.
»Na, meinetwegen! A weiß schon. A hat halt Pech! Mich geht's ja nischt an, Berger. Was?«
»Nu je! O ja! Doch, doch!«
Der Lumpenmann lachte bei dieser Rede. Schräger fuhr auf.
»Mich soll's angehen? Mich? Was denn? Was denn zum Beispiel? Möcht' ich wissen. Was denn, Berger?«
Der lehnte sich gegen das Schenksims, kniff seine Äuglein ein wenig zusammen und sagte ganz ruhig: »Ich werd' Dir mal was sagen, Schräger. Siehste, es könnte einer auf den Gedanken kommen, es wär' eigentlich ganz hübsch, wenn die beiden Buchenhöfe wieder zusammenkämen. – Laß mich reden, Schräger, reg' Dich nich uff! Also, wenn alles wieder eine Herrschaft wär'! Das könnte schon einer denken.[18] Nich? Na, aber 's wär' 'n sehr dummer Gedanke, Schräger, denn die Raschdorfs gehen da drüben nich raus!«
»Ich weiß nich, was Du hast, Berger. Ich denk' doch im Traume nich an so was. Der Raschdorf is mein Freund.«
»Is Dein Freund, Schräger. Das ist hübsch von Dir! Und weil Du nu Deinen Freund mit den Aktien so in die Tinte geritten hast –«
»Berger, das laß ich mir nich gefallen!«
»Weil Du ihn so in die Tinte reingeritten hast, sag' ich, wirste ihn wohl jetzt wieder rausreiten müssen.«
»Das is 'ne Frechheit von Dir, Berger! Wie kommste denn dazu? Das geht Dich doch gar nischt an!«
»Geht mich gar nischt an, Schräger, da haste recht! Aber gerade das, was mich nischt angeht, um das kümmer' ich mich. Schräger, ich will Dir mal in aller Gemütlichkeit was sagen: Wenn Du etwa am Raschdorf schuftig handelst, da mach' ich Dich schlecht im ganzen Vaterlande und im ganzen Waldenburger Kreise. Verstehste? Ich verkauf' Dich als Lumpen in jedem Hause.«
»Nu is aber genug, Berger! Das sagste mir in meinem Hause? Ich verklag' Dich, und wenn Du noch 'n einziges Wort sagst, da –«
»Da schmeißte mich raus. Machste recht, Schräger, tät' ich auch machen! Aber ich geh' schon alleine. Meine Meinung weißte! Leb' gesund, Schräger!«
Berger hörte noch, daß ihm der Wirt etwas nachzischelte, aber er kümmerte sich nicht darum. Aus der sauersüß riechenden Wirtsstube trat er wieder hinaus auf die sonnenbeglänzte, freie Straße. Ein kleiner Planwagen stand[19] da, vor den ein großer, schwarz- und weißhaariger Hund gespannt war. Der schielte seinen Herrn mit einem verliebten Seitenblick an und klopfte in drei gleichmäßigen Zwischenräumen mit seinem mächtigen Schweife an die Wagendeichsel. Der Lumpenmann stutzte und betrachtete aufmerksam sein Gefährt, in dem sich leise etwas regte.
»Haste etwa a Raschdorf Heinrich gesehen, Pluto?«
Der Hund bellte freudig.
»Oder vielleichte gar a Schaffer-Hannes?«
Der Hund bellte noch lauter.
»Haste sie wirklich gesehen, Pluto? Möcht' ich wissen, wo sie stecken.«
Der Hund bellte wie toll und zerrte und riß an seinem Geschirr. Der Lumpenmann bückte sich und machte ihn frei.
»Na, da such', Pluto, da such'!«
Ein Satz, und der mächtige Hund war unter der Plane verschwunden. Ein Zeter- und Mordgeschrei erhob sich in dem kleinen Wagen, dazwischen tönte ein ganz rasendes Hundegebell. Der Lumpenmann stand da und lachte, und die Tränen liefen ihm über das runzelige, bestaubte Gesicht.
Ein paar Gamaschen wurden auf der Deichsel sichtbar, in denen steckten zwei Quartanerfüße, und nach und nach kam der ganze junge Akademiker zum Vorschein. Unterdessen war ein wüstes Gebrülle und Gebelle im Wagen.
»Du bist verrückt, Pluto! Mein Gesicht, au, mein Gesicht!«
Der kleine Wagen wankte und bebte von dem gewaltigen Kampfe, der sich in ihm abspielte, und dann wurde in[20] seiner dunklen Öffnung ein animalischer Knäuel sichtbar, und rechts von der Deichsel fiel ein Hund auf die Straße, und links von der Deichsel ein Junge.
Hannes erhob sich mit zerkratztem Gesicht.
»Wir kommen vom Begräbnis,« sagte er kläglich und betrachtete zerknirscht den demolierten Paradehut seines Vaters. »Da macht man sich 'n kleinen Spaß und kriecht mal in den Lumpenwagen, und gleich hetzt a mit Hunden. Was bloß mein Vater zu seinem Zylinder sagen wird! Pfui, Mathias, das werd' ich mir merken! Das is ruppig von Ihn'n.«
Der Lumpenmann lachte, daß er sich schüttelte.
»Ihr Halunken! Gelt, das wär' a Spaß gewesen, wenn Euch der Mathias Berger ins Dorf gezogen hätte! Na, heul' nich etwa, Hannes! Sagen wird Dein Vater zum kaputen Zylinder nischt; a sagt ja nie was; höchstens durchhauen wird a Dich.«
In diesen Worten vermochte Hannes einen erheblichen Trost nicht zu erblicken, und so versprach ihm Mathias Berger einen neuen Zylinderhut. Er habe zwei Stück. Einer rühre von seiner Hochzeit her, den anderen habe er geerbt. Der Hannes solle sich den schönsten gleich abholen, ehe der Vater vom Felde heimkehre und gewahr werde, was mit seiner »Trauertonne« passiert sei.
Da war die Not des Buben behoben. Und nachdem Hannes durch einige kritische Fragen, die das Erbstück betrafen, die tröstliche Zusicherung erhalten hatte, daß die beiden Hüte Bergers wirklich Prachtexemplare ihrer Art seien, spannte er sich selbst neben den von ihm sonst heißgeliebten[21] Pluto und zog mit ihm das Wägelchen die Straße hinab dem Dorfe zu.
Mathias Berger und Heinrich Raschdorf folgten in einiger Entfernung. Es war Abend geworden. Einzelne Schnitter kamen heim vom Felde. Irgendwo draußen waren die ersten Halme gefallen. Wie die Leute am Anfang der Ernte so stolz daherschreiten! In ihren Muskeln ist aufgespeicherte Kraft, und die frohe Gewißheit wohnt in ihren Herzen, daß ihr Körper kräftig und tüchtig ist. Diese gesunden Menschen sind vielleicht die glücklichsten Leute der Erde. Sicher aber die leidlosesten, die ruhigsten, die ungeängstigtsten. Was ihnen fehlt, wissen sie nicht, und was sie haben, steht über aller Wertung nach Geld. Die anderen haben viel, was Plunder ist, und das Schlimmere ist: sie wissen, was ihnen fehlt, und grübeln darüber nach und sehnen sich müde. Es ist kein Wunder, daß ein verschlossener, wortkarger Stolz in den Bauern wohnt. Lächelt der Städter über den Landmann, wenn er ihn unbeholfen über seine Straßen troddeln sieht, der Bauer lacht unendlich verächtlicher über den Städter, wenn der neben seinen Erdfurchen und strotzenden Saaten so vorsichtig und blaß und müde daherwandelt.
Mathias Berger sah seinen jungen Begleiter an, der einen grauen Anzug mit kurzen Hosen, einen weißen Strohhut und Gamaschen trug. »Eigentlich siehst Du Dich komisch an hier auf der Dorfstraße,« sagte er.
»Ja, Mathias, wissen Sie, und ich wär' auch viel lieber wieder zu Hause.«
»Gefällt Dir's nicht auf der Schule in Breslau?«
»O ja, wenn man der Siebente ist von achtunddreißig,[22] das ist schon ganz anständig. Im Französischen hab' ich bloß »genügend«, sonst steh' ich ganz gut. Aber wissen Sie Mathias, das Schlimme ist, daß mir immer so bange ist.«
»Du hast wohl manchmal das Heimweh, Heinrich?«
Der Knabe mäßigte seine Stimme.
»Ja, aber das sag' ich bloß Ihnen, Mathias! Sonst müßt' ich mich ja zu sehr schämen. Und meine Kollegen würden sagen, ich sei eine Memme, und ich kriegte Klassenkeile. Aber mir ist halt immer so bange. Ich kann nicht dafür. Überhaupt nach den Ferien! Einmal hab' ich nach den Ferien meine Wochentagsschuhe vier Wochen lang nicht angehabt. Ich mochte sie nicht abbürsten, weil – weil Boden von zu Hause dran war.«
Der Lumpenmann wandte sich ab und sagte mit verstellter, etwas heiserer Stimme:
»Das wirste schon noch überwinden lernen, Heinrich! Oder willste nicht gern Doktor werden oder Pfarrer oder sowas?«
»Nein, Mathias, ich will nicht! Ich will wieder zu Hause sein, wo Ihr alle seid.«
»Willste denn Bauer werden, Heinrich?«
»Ja. Sehn Sie mal, Mathias, es wär' doch schade um unser schönes Gut. Sehn Sie, hier gerade an dem wilden Kirschbaum kann man unsere ganzen Felder übersehen. Das sind doch viel! Nicht, Mathias? Eigentlich sind wir doch reich. Aber das sag' ich gar nicht in Breslau. Ich denk' bloß immer dran, daß wir so ein schönes Gut haben.«
Der Lumpenmann bückte sich hastig nach dem Wegrande,[23] riß einen Stengel Sauerampfer ab, biß darauf herum und spuckte dann alles weit von sich.
»Was macht denn Deine Mutter?« fragte er.
»Die ist wieder ganz krank. Am Mittwoch, wie Wochenmarkt in Waldenburg war, war sie mit beim Doktor.«
»Und was hat der gesagt?«
»Das weiß ich nicht. Sie hat geweint, als sie heimkam. Das ist es auch, was mir immer so bange macht, daß die Mutter nicht gesund ist.«
Sie gingen eine Weile schweigend weiter.
»Sieh nur, daß Du weiter auf der Schule fortkommst, Heinrich! Gelt, bis in die Prima mußt Du, eh' Du den Einjährigen hast?«
»Bloß bis Ober-Sekunda.«
»Das wär'n also reichlich noch drei Jahre. Sieh och, Heinrich, 's is schon gutt, wenn Du was lernst. Auf alle Fälle is gutt. 's is ja ganz erbärmlich, wenn einer so tumm is wie zum Beispiel ich. Kannste denn eine Stellung kriegen, wenn Du einjährig bist, Heinrich?«
»O ja, es war einer mit auf unserer Bude, der ist nach 'm Einjährigen abgegangen, und jetzt ist er Schreiber auf einem Landratsamte, und dann wird er Kreissekretär oder so ähnlich. Aber ich mag nicht Kreissekretär werden. Ich will Bauer werden.«
»Schon, schon, Heinrich! Aber sieh mal, am Ende könnt'st Du Dich doch später anders besinnen.«
»Nie, Mathias, nie! Ich übernehm' das Gut. Das ist tausendmal besser, als wenn ich so in einer Schreibstube sitzen muß.«
Ein Blick des Lumpenmannes glitt über die goldenen Fluren, die sich rechts und links von ihm ausdehnten und die alle jetzt noch den Raschdorfs gehörten.
»Wir werden schon sehen, daß Du ein Bauer werden kannst. Wir werden schon sehen!« sagte er. – –
Hannes hielt mit der Hundefuhre mitten auf dem Wege an. Aus einem Feldraine bog ein Trupp Schnitter ein, und an ihrer Spitze schritt schwer und gewichtig August Reichel, der Vater des Hannes.
»Na, da komm mal schnell, Heinrich, sonst passiert da unten ein Unglück!« sagte der Lumpenmann und schritt mit seinem Begleiter rüstig aus.
Sie kamen ziemlich gleichzeitig mit den Schnittern an dem Wagen an. August Reichel, ein Riese von Gestalt, blieb stehen und betrachtete höchst beängstigenden Blickes seinen Sprößling, der da beklommen vor ihm stand und mit der einen Hand krampfhaft hinter dem Rücken etwas versteckte.
Der Riese reckte ein wenig den Hals und konnte so ganz bequem auch aus einiger Entfernung die Rückseite seines Nachkommens einer genauen Musterung unterziehen. Ein Zucken ging über das Gesicht des Goliath.
»Her!« sagte er lakonisch und streckte die Hand aus.
Hannes reichte ihm die ruinierte »Trauertonne« und schielte halb ängstlich, halb abwartend durch die Haare, die ihm in die Stirn hingen, zu seinem muskulösen Vater hinauf.
Der betrachtete den Zylinder, nahm den Strohhut vom Kopfe, probierte den Zylinder auf, fand, daß er ihm passe, prüfte dann das Schweißleder und hieb plötzlich dem Knirps[25] vor ihm den Hut mit solcher Wucht auf den Kopf, daß dieser bis übers Kinn darin versank und mit beiden Beinen zugleich auf der Straße kniete.
»August, halb und halb bin ich schuld,« sagte der Lumpenmann beschwichtigend, »ich hab' zwei Zylinderhüte zu Hause; ich schick' Dir einen.«
Über das breite Gesicht des Riesen ging ein Lächeln.
»Ich brauch' keinen!« sagte er und nickte dem Lumpenmann freundlich zu. Daran setzte er sich wieder an die Spitze seiner Schnitterschar und schritt in breitbeiniger Majestät die Anhöhe hinauf dem Buchenhofe zu.
Hannes arbeitete sich ans Tageslicht. Er sah seinem Vater halb ärgerlich, halb schadenfroh nach und sagte, indem er sich die Stirn rieb und dem Vater mit dem Finger nachdrohte:
»Na wart' nur! Wenn ich heute abend Koppschmerzen hab', da wirste mir ja Tee kochen müssen!«
Mathias Berger lachte, Pluto bellte einen kleinen Jubelhymnus, Hannes faßte ihn um den Hals, und die kleine Karawane zog weiter.
So kamen sie bei dem kleinen Hause des Lumpenmannes an. Die Liese kam ihnen entgegen. Eine ganze Woche lang hatte sie den Vater wieder nicht gesehen. Nun schmiegte sie sich zärtlich an ihn. Er aber schlang den Arm um sie und fuhr mit der Hand über ihren flachsblonden Kopf.
»Liese! Nu, Liese! Nu, mei Madel du!«
Ein ganzer Strom von Liebe ging durch diese paar Worte. Dann kam auch die Schwester Bergers, die ihm seit[26] dem frühen Tode seiner Frau die Hauswirtschaft besorgte. Unterdessen spannten die Knaben den Hund aus und schoben den Wagen in einen kleinen Schuppen. Mathias Berger folgte ihnen. Er hob einen riesigen Sack aus dem Wagen, der prall mit Lumpen gefüllt war, und schüttelte ihn aus.
»Na, da seht mal! Wenn ich die sortieren werd', das ist ganz int'ressant. Da ist alles dabei. Wollflecke von Großmutterkleidern und Kattun von Kinderschürzen, Übrigbleibsel vom Brautstaate und Leinwand von einem Totenhemde. A Lumpenmann kann alles sehen. Es kommt von allem was in seinen Sack.«
Heinrich folgte gedankenvoll diesen Worten; aber Hannes hörte nicht darauf und machte sich mit einem kleinen Holzkasten zu schaffen.
In der Stube wurde dieses Schatzkästlein geöffnet. Ein Kinderherz konnte bei solchem Anblick selig sein. Es gab ja auch einige langweilige Dinge in dem Kasten, wie: Fingerhüte, Nähnadeln, Zwirn, Jerusalemer Balsam und Federhalter. Aber sonst! Soldatenbilder, allerhand andere Bilder mit schönen Versen von Gustav Kühn aus Neu Ruppin, Peitschenschnüre, Pfeifen, Kreisel, Spielmarken, Papierorden, kleine Pistolen, Vogelpfeifen, »goldene und silberne« Uhren und Fingerringe die schwere Masse mit den prachtvollsten Steinen.
»Ich möchte gerne a Fingerringel für die Raschdorf-Lene« sagte Hannes, »weil die mir ofte manchmal a Stückel Wurstschnitte gibt.«
»Such' Dir einen aus, Hannes,« sagte der Lumpenmann.
Der Knabe wühlte mit zitternden Fingern in den Schätzen. So mag den Märchenprinzen zu Mute gewesen sein, die nach dem Wunderring suchten.
Heinrich stand etwas abseits. Er hielt es wohl mit seiner Gymnasiastenwürde unvereinbar, sich noch für solche Dinge zu interessieren, aber er wandte doch kein Auge von dem Kasten. Schließlich trat er mit gewaltsam erzwungener Gleichgültigkeit näher.
»Was ist denn da eigentlich alles?« fragte er mit ungeheurem Gleichmut.
»Wenn Dir was gefällt, Heinrich, such' Dir nur aus,« sagte Berger freundlich.
Heinrich tat so, als ob er das durchaus nicht beabsichtige, aber schließlich prüfte er doch eine kleine Zündblattpistole und ließ sich durch einiges Zureden Bergers bewegen, sie nebst einer Schachtel Munition zu behalten. Auch einen silbernen Ordensstern nahm er noch an sich. Dann aber fühlte er das Bedürfnis, wieder ernsthafter aufzutreten.
»Wissen Sie, Mathias, wer die Lumpenmänner eigentlich in Schlesien eingeführt hat?«
»Nein,« sagte Mathias, »das weiß ich nicht.«
»Das hat der Alte Fritz getan,« belehrte ihn Heinrich. »Vor der Zeit des Alten Fritz gab's keine Lumpenmänner in Schlesien.«
»Da hat der Alte Fritz was sehr Kluges gemacht,« entgegnete Berger.
»Is überhaupt sehr tüchtig gewesen,« sagte Hannes wohlwollend, um damit zu zeigen, daß er auch in der Geschichte bewandert sei. Dabei stellte er drei Ringe in die[28] engere Wahl: einen Diamantring, einen Rubinring und einen einfachen Silberreif, auf dem das Wort »Liebe« eingeprägt war.
»Ja,« nahm Heinrich wieder das Wort, »der Alte Fritz war sehr sparsam, und er wollte nicht, daß die Leute was wegwarfen: Lumpen, Knochen, altes Eisen und so ähnlich. Da setzte er die Lumpenmänner im Lande ein. Und die mußten solche Dinge im Kasten haben wie Sie, Mathias. Und das nennt man Tauschhandel. Wobei es auch auf die neuen Papierfabriken ankam.«
Bergers Augen leuchteten. »Sieh mal, Heinrich, das is doch hübsch, wenn einer das alles weiß. Ich bin nu schon so lange Lumpenmann, und ich bin es auch gerne; aber ich hab' noch nie gewußt, wer uns eigentlich erfunden hat. Es wär' doch hübsch, wenn Du weiter studiertest und ein Gelehrter würdest. Nich, Heinrich? Sieh mal, Bauern gibt's doch massenhaft auf der Welt.«
Der Knabe fühlte sich geschmeichelt, aber er schüttelte doch den Kopf.
»Nein, ich will Bauer sein. Ich will den Hof übernehmen. Ich will immer hier sein.«
»Das is richtig,« stimmte Hannes bei; »wenn Du nich da bist, is nischt los zu Hause. Sieh mal, Heinrich, welchen nehm' ich nu: den mit dem weißen oder den mit dem roten Stein? Den silbernen mit »Liebe« mag ich nich; da gäb' mir die Lene am Ende 'ne Backpfeife. Ich denke, ich nehm' den roten.«
»Nimm sie beide, Hannes,« sagte der Lumpenmann. »Wer die Wahl hat, hat die Qual.«
»Aber der silberne ist auch niedlich – sehr hübsch ist er,« sagte Heinrich.
»So behalt' ihn,« sagte Berger.
»Den mit »Liebe«?« fragte Hannes erstaunt. »Wem willste denn den mit »Liebe« schenken, Heinrich?«
Der Quartaner wurde blutrot.
»Ach, niemand,« stotterte er, »niemand, vielleicht der Liese.«
Und er gab das unechte, kleine Ringlein der Liese, der Tochter Bergers, die schon lange mit roten Wangen hinter ihm gestanden hatte.
Am Abend noch, als die Sonne im Verlöschen war, ging Mathias Berger die Dorfstraße hinab nach der Schule. Die beiden Knaben waren längst zu Hause; die kleine Liese lag im Bett und schlief und hatte das silberne Ringlein am Finger.
Der alte Dorfkantor Johannes Henschel saß an einem Harmonium und spielte aus einer Orgelpartitur.
»Es ist eine schwere Sache, eine sehr schwere Sache, Herr Kontor, wegen der ich komme,« sagte Berger.
»Was ist denn?«
»Herr Kantor, eh' 's Ihnen die anderen sagen: Ihr Schwiegersohn, der Herr Raschdorf, verliert bei der Fabrik sein Geld.«
Das blasse Gesicht des alten Lehrers wurde noch um einen Schein fahler, und die welke Rechte fuhr nach der Brust.
»Bei den Aktien?! Ist das möglich, Berger? Ist das möglich?«
Mathias Berger sah den Alten mitleidig an.
»Es ist so, Herr Kantor. In Altwasser drüben der Teichmann verliert auch dreitausend. Von dem weiß ich's. Fünfzehn Prozent kriegen die Aktionäre raus. Das ist alles.«
Ein Zittern ging über das Antlitz des alten Mannes. Dann stützte er den Kopf schwer auf die Hand.
»O mein Gott!«
Es war ganz still in der Stube, nur die Uhr tickte leise. Draußen erhob sich ein matter Nachtwind und fuhr müde durch die alten Bäume des Schulgartens.
Mathias Berger nahm wieder das Wort.
»Sehn Sie, Herr Kantor, das ist ja eigentlich nicht meine Sache. Es geht mich gar nischt an. Aber Sie wissen ja, ich bin Ihn'n viel Dank schuldig. Wie ich a blutarmer Junge war, ohne Vater und Mutter, da haben Sie mich aufgenommen und mich großgefüttert. Das vergess' ich nich, und wenn ich hundert Jahr' werd'. Was mir das jetzt leid tut, kann ich gar nich sagen. Aber, Herr Kantor, der Herr Raschdorf sollte sich nich mit 'm Schräger einlassen. Das is a grundschlechter Kerl!«
»Der Gastwirt? Ach nein, Berger! Der hat ja meinem Schwiegersohn immer noch ausgeholfen, wenn's einmal fehlte.«
»Ausgeholfen, Herr Kantor! Warum denn? Warum denn? Weil a ihn nach und nach ganz in seine Gewalt kriegen will. Bloß darum! Ich sag' Ihnen, dem dicken Kerle wird erst ganz wohl sein, wenn a beide Höfe hat. Darauf spekuliert a, darauf hat a's abgesehn! Schräger is Raschdorfs größter Feind!«
Der alte Kantor schüttelte unwillig den Kopf.
»Das müssen Sie nicht sagen, Berger, das ist unrecht! Schräger hat sein Geld auf die letzte Hypothek gegeben. Der ist ein Freund von meinem Schwiegersohn.«
Mathias Berger erhob sich.
»Na, da – da tut mir's leid, daß ich was gesagt hab'.«
»Setzen Sie sich, Berger, setzen Sie sich doch wieder! Sie sehen zu schwarz. Der Schräger und mein Schwiegersohn sind Freunde. Sie sind zusammen in die Schule gegangen, sie sind zusammen aufgewachsen. Schräger ist nicht schuld. Das ist halt Unglück, Berger, schreckliches Unglück! O Gott, ich weiß ja nicht, was werden soll! Fünftausend Taler! Und mir hat er immer nichts gesagt, wie's steht, nichts!«
Eine Pause entstand. Beide Männer starrten vor sich hin.
»Um Ihre Tochter tut mir's leid,« sagte Berger endlich leise.
Der alte Lehrer wandte sich ab.
»Und um den Jungen, um den Heinrich! Heute sagt a mir, a will nich studieren; a will Bauer werden – übernehmen die Wirtschaft –, das is ja a Jammer.«
Ernst und groß wandte der Alte die Augen dem schlichten Manne gegenüber zu.
»Ich hab' ein Unrecht begangen, Mathias – ich, nicht der Schräger. Ich mußte dem Raschdorf die Anna nicht geben. In so einem Gut muß Geld sein! Was waren da die paar Pfennige, die ich ihr mitgeben konnte? Gar nichts! Gar nichts! – Und nun ist das Elend da. Ich bin schuld daran, Mathias – ich!«
Berger richtete sich auf.
»Herr Kantor, nehmen Sie's nich übel, aber das is – das is Unsinn, was Sie da sagen. Sie sind nich schuld! Der Raschdorf stand sehr gut da. Der brauchte keine reiche Frau. Bei dem ging's ohne Mitgift. Aber wie hat a gelebt? Wie a gnädiger Herr! Immer oben raus! Und das Schlimmste: a hat sich mit dem Schräger eingelassen, und das is und bleibt ein Malefiz-Lump, und wenn a noch so scheinheilig tut, und wenn Sie noch so für ihn reden.«
Der Kantor schüttelte den Kopf.
»Es wäre schlecht, Mathias, einem zweiten die Schuld zu geben, wenn uns ein Unglück trifft. Und selbst, wenn er ihm zugeredet hat, wer konnte das ahnen? Den Ausgang konnte niemand wissen. Es ist eine bittere Sache, Mathias, wenn man alt ist und ein einziges Kind hat, und dem geht's so!«
Als der Lumpenmann heimging, lag die Sommernacht über dem schlummernden Dorfe. Ernte! In schweren, schwülen Zügen atmete draußen das todgeweihte Feld.
Mathias Berger blieb stehen und sah noch einmal nach dem Schulhause zurück, das ihm in seiner Kindheit ein zweites, besseres Vaterhaus gewesen war und wohin ihn auch jetzt noch eine leise Sehnsucht immer wieder führte. Er liebte den alten Mann dort, der so gutmütig und kurzsichtig war, daß er die Bosheit der Menschen nicht erkannte, nicht die Bosheit, aber auch nicht die geheimen, tiefen Leiden, die dicht neben ihm bluteten.
Als bettelarmes Kind hatte ihn der Kantor aufgenommen in sein Haus, ihn erzogen, ihn auch außer der Schulzeit unterrichtet. Da war der Mathias mit der Schul-Anna zusammen aufgewachsen, und sie hatten gelebt wie Bruder und Schwester. Später ging Mathias als Bergmann in die Grube. Aber wenn er einen freien Sonntag hatte, war er im Schulhause. Da war leise, während er heranwuchs, die Liebe in sein Herz gekommen. Es hatte niemand was gewußt, nicht der Kantor und auch nicht die Anna. Es wäre ja so schrecklich frech und undankbar gewesen, wenn er etwas davon gezeigt hätte, er, der arme Kohlenschlepper.
Bis sie sich verlobte. Da war es zu Ende gewesen mit seiner Fassung. Er brachte es nicht mehr über sich, ins Schulhaus zu gehen. Und damals hat es dann die Anna gewußt. Der Kantor hat sich bloß gewundert und über den Abtrünnigen geärgert.
Ach, die furchtbare Arbeit in der Kohlengrube! So allein sein in den düsteren Stollen unter der Erde und gar keine Hoffnung haben für alle Zukunft. Das hielt Berger nicht aus.
Ein Verwandter von ihm starb und hinterließ ihm ein Häuslein und das Lumpenhandelgeschäft. Der Kantor wollte von dem Berufswechsel nichts wissen; aber Mathias war froh, daß er nun immer im Freien sein konnte, herumwandern in der Welt bei vielen Leuten und nicht mehr allein sein mußte mit seinem Herzenskummer. Da wurde er allgemach wieder ruhiger und heiterer. Nach einigen Jahren heiratete er ein braves Mädchen. Er hatte ihr keine trübe[34] Stunde bereitet, sie ihm auch nicht. Aber sie starb schon nach einem Jahr, als die Liese geboren wurde.
Da war er wieder einsam. Und über Ehe und Grab kam manchmal in stillen Stunden aus der Jugendzeit die alte Liebe wieder, ganz wunschlos, aber doch schmerzhaft tief – so wie heute, da sie krank und schwach nun doch der Armut entgegengehen sollte, der Armut, die allein ihm einstmals verbot, sie zu begehren.
Von fernher kam ein Gewitter, und Mathias ging heim.

Anfang des nächsten Oktober kam Heinrich wieder nach Hause. Es waren Herbstferien. Ein Dienstjunge holte ihn mit einem kleinen Korbwagen vom Bahnhof ab. Die großen, schwarzen Augen des Knaben hingen unverwandt an den heimischen Bergen. Immer, wenn er von der flachen Oderebene da unten kam und zum ersten Male wieder die Hügel des prächtigen, reichgegliederten Waldenburger Berglandes aufsteigen sah, schlug sein Herz schneller, gerade als ob auf den einsamsten jener Berge ein heiliger Friede wohne, wo allein alle Bangigkeit gestillt und alle Sehnsucht vergessen würde.
Und doch war die Landschaft trübe. Die bunten Blätter zitterten an den Bäumen, und weiße Nebelschleier zogen über die leeren Wiesen. Die Weiden standen wie gebückte, krumme Greise an den Bächen und Teichen, als wollten sie sich hinunterstürzen und sterben. Und der Wind sang in den hohen Pappeln am Wege ein Lied vom fernen Sommer und von toter Freude.
Aber es war die Heimat, die Heimat, die dieser Knabe schmerzhaft liebte, an die er alle Tage dachte, da er ihr fern sein mußte.
Langsam fuhr der Wagen die sandige Straße entlang. Der Kirchturm des Dorfes ragte auf; da lief ein Zittern über die Gestalt des Kindes, und die feine Gestalt reckte und dehnte sich, mehr zu sehen, mehr von der Heimat. Dann kam ein Grenzweg, und nun war Heinrich Raschdorf auf väterlichem Boden. Ein glückseliges Leuchten brach aus seinen Augen. Jetzt war es aus mit Sehnsucht, Heimweh und Herzeleid, jetzt fühlte er sich sicher und geborgen.
Hier auf heimischer Erde wäre er dem gefürchtetsten Lehrer sicher und lächelnd entgegengetreten; hier hätte er sie nur einmal haben mögen, alle seine Mitschüler; beide Hände würde er ausstrecken und sagen:
»Seht Ihr, hier bin ich zu Hause! Hier wohnen mein Vater und meine Mutter und mein Großvater und alle, die ich kenne. Und alle die Felder sind unser, und dort drüben das ist unser Hof.«
Ein Mann mit einem Jagdgewehr ging über die Felder, kaum zwei- oder dreihundert Meter vom Wege entfernt. Der Dienstjunge hielt das Pferd an. Heinrich aber sprang auf, riß den Hut vom Kopfe, winkte und schrie: »Vater, Vater, Vater!«
Der Mann unten blieb stehen, blinzelte durch das Herbstlicht herauf und winkte ein wenig mit der Hand. Dann gab er ein Zeichen weiterzufahren und setzte seinen Pirschgang fort.
Knarrend fuhr der Wagen die Straße weiter. Der Knabe saß ganz still. Ein Kartoffelfeld tauchte auf. Eine[37] Anzahl arbeitender Menschen waren da beschäftigt und wühlten geschäftig in der schwarzen Erde nach den weißen, duftenden Knollen. August Reichel, der Schaffer, überwachte das Ganze wie ein schweigender König. Aber allen nahm er die schweren, gefüllten Körbe ab und schüttete deren Inhalt auf einen riesigen Wagen.
Da trennte sich ein junger Bursche vom Arbeitstroß, rannte ein Stückchen, fiel über einen Kartoffelsack, stand wieder auf, stolperte noch einmal über eine Furche, riß dann die Mütze vom Kopfe, schlug in einem ganz närrischen Tempo Räder damit in die Luft, sprang über den Straßengraben, trat an den Wagen und sagte keuchend:
»Na, Heinrich, das is aber fein, daß De kommst!«
»Guten Tag, Hannes! Du hast ja so kalte Hände.«
»Na, klaub' mal Kartoffeln, wenn der Boden so kalt is! Du kannst froh sein, daß De immer Quartaner sein und in der Stube sitzen kannst.«
»Hannes, Du mußt mitkommen!«
Heinrich rief hinüber nach dem Felde: »He! – Reichel! – Schaffer! – Darf der Hannes mit mir fahren?«
Der Riese verfiel in Nachdenken, schüttelte erst heftig den Kopf, dachte aber weiter nach, zuckte dann unschlüssig die Achseln, machte noch eine bedenkliche Pause, nickte darauf kurz und wandte sich ab.
»Das wußt' ich schon,« sagte Hannes und kletterte auf den Wagen. »Ich sag' Dir, a hätte sich geärgert, wenn ich nich mitgefahren wär', und ich och. Los, Friedrich! Nu komm'n wir vom Gymnasium! Haste vielleicht Zigaretten, Heinrich? Hier sieht's keen Mensch!«
Auch der einsame Jäger ging heim. Er hatte kein Glück. Seine Jagdtasche blieb leer.
Glück! Raschdorf lachte. Er und Glück haben! Das gab's lange nicht mehr für ihn.
Müde lehnte er sich auf sein Gewehr und sah düsteren Blickes über die kahlen, toten Felder und nach den Wolken, die schwer über die bunten Berge herabsanken. So trübselig hüllten sie die schimmernde Herrlichkeit ein, wie man dunkle Decken und Schleier zieht über goldene Wände zur Zeit der Trauer. Nach Minuten erst merkte der Einsame, daß er in Gefahr sei, denn die Hähne des Gewehrs, gegen dessen Lauf er sich lehnte, waren gespannt.
Ein herbes Zucken ging über das Gesicht des Mannes, dann riß er das Gewehr herauf und feuerte beide Schüsse in die Luft. Er schloß die Augen bei dem dumpfen Knall, dann ging er weiter.
Und wie so häufig in letzter Zeit, ging er zum Schräger. Er traf den Wirt allein, denn es war noch am zeitigen Nachmittag.
»Nu, kommste mit a Zinsen, Hermann?« fragte Schräger freundlich.
»Haste es so eilig mit a Zinsen? Ich dächte, Du brauchst 's nich so nötig.«
»Nu je, sein Geld braucht jeder; jeder, Hermann! Ich och!«
Raschdorf setzte sich schwerfällig hinter einen Tisch.
»Schneid' mir's aus der Haut! Ich hab's nich! Hexen kann's keiner!«
Der Wirt wandte ihm verdrießlich den Rücken und sah mürrisch zum Fenster hinaus. Draußen rumpelte eine Rübenfuhre[39] langsam vorbei. Dann wurde es still. Keiner der Männer sprach.
Da öffnete sich die Tür, und ein etwa siebzehnjähriger Junge trat herein, ein starker Bursche von auffallend idiotischem Gesichtsausdruck. Das war der einzige Sohn Schrägers.
»Hu, hu,« sagte er und rieb sich die Hände. »Is aber kalt heute! Mag ich nich auf dem Felde sein – mag ich nich – mag ich gar nich a bissel. – Schön tumm! – Schön tumm! – Schön tumm!«
»Du sollst machen, daß Du wieder rauskommst, Du Faulpelz!« sagte Schräger.
Aber der Sohn lachte ihn aus.
»Selber Faulpelz! Och, es is kalt draußen. Und hier is warm! Hier is viel schöner! Schön tumm! – Schön tumm!«
Er fing an zu pfeifen und hüpfte auf einem Bein die Stube entlang, wobei er sich immer abwechselnd Ohren und Nase rieb. Dann setzte er sich hinter einen Tisch und dröselte stumpf vor sich hin. Schräger beachtete ihn nicht mehr. Er wandte sich wieder an Raschdorf.
»Sieh mal, Hermann, Ordnung muß nu mal sein. In Geldsachen hört die Gemütlichkeit auf. Das is nu mal so! Zum Wegschenken hat ja keiner was.«
Raschdorf fuhr auf und schlug mit der Faust auf den Tisch.
»Wegschenken? Wer spricht denn vom Wegschenken? Mir braucht keiner was zu schenken, und Du zu allerletzt. Das hab' ich noch nicht nötig!«
Schräger zuckte die Achseln.
»Immer gleich beleidigt! Immer der große Herr, der sich nischt sagen läßt. Siehste, Hermann, das is Dein Fehler. Du hast Dir's nach und nach mit allen Bauern verdorben. Wenn Du mehr Freunde hättest –«
»Ach, halt's Maul, laß mich in Frieden mit den Schafköppen!«
»Ihihihi – Schafköppen, Schafköppen, Schafköppen!« lachte der Idiot.
»Du sollst machen, daß Du rauskommst, Gustav!«
Der Junge rührte sich nicht vom Platze.
»Ne,« grinste er. »Es is kalt! Schön tumm!«
Raschdorf nahm wieder das Wort.
»Würde mir einer von den'n helfen? Was? Keiner! Sie würden sich hüten. Sie borgen mir nicht einen Taler.«
»Das macht bloß der Schräger,« sagte der Wirt bitter. »Der is der Schafkopp.«
Da wurde das Gesicht des Buchenbauern dunkelrot, und er fuhr jähzornig auf:
»Du – Schräger – ich – ich – geb' Dir 'ne Backpfeife!«
»Gib ihm eine, gib ihm eine!« schrie der Idiot mit Begeisterung.
Der dicke Leib des Wirtes zappelte vor Erregung. »So? – Soso? Backpfeifen – Backpfeifen bietet mir der gnädige Herr an? So? Backpfeifen für alles, was ich ihm schon zu Gefallen getan hab'? Is gutt, Herr Raschdorf! Wenn ich bis morgen meine Zinsen hab' und zum nächsten Quartal meine 20 000 Mark, da – da kann der gnädige Herr backpfeifen, wen a will.«
Es wurde still. Nur eine Zeitung knisterte, die der Idiot mit den Händen bearbeitete. Schräger trat wieder ans Fenster und sah hinaus. Langsam erhob sich Raschdorf und griff nach seinem Gewehr. Und so trat er neben den Wirt.
»Julius,« sagte er langsam und schwer, »ich werd' versuchen, daß Du zu Deinem Gelde kommst. Was ich heute rede, weiß ich nich. Mir summt alles im Koppe, und manchmal – da – da wird mir ganz trübe. Siehst Du, vorhin, draußen auf 'm Felde, da hab' ich so auf der Büchse gelehnt – so –«
»Sie is doch nich geladen?« kreischte der Wirt und trat ein paar Schritte zurück.
Raschdorf lächelte. »Vorhin war sie geladen – jetzt nich!«
Schräger betrachtete ihn mit unruhigen Augen.
»Du mußt doch nich – Du mußt doch nich, Hermann, hier in der Stube – leg' mal die Flinte weg und setz' Dich wieder! Wir wollen miteinander reden.«
Der andere folgte mechanisch.
»Wieviel haste denn übrig, Hermann?« fragte der Wirt.
»Übrig?« Raschdorf lachte. »Übrig is sehr gut! Ich häng' noch von Johanni her, und dann in fünf Tagen is 'n Wechsel fällig über 500 Mark. Ich – ich weiß mir keinen Rat mehr. Es gelingt mir nischt mehr, es geht nich mehr, alles geht krachen, Geld kommt nich ein – es is zum Verrücktwerden!«
»Aber Du hast doch noch das ganze Getreide in den Scheunen. Warum läßte denn nich ausdreschen?«
»Eins – zwei, links – rechts, eins – zwei, links – rechts!« Der Idiot hatte sich einen Helm aus Papier gemacht und marschierte durch die Stube.
»Mach' doch, daß Du rauskommst, Gustav,« fuhr ihn nun Raschdorf an. »Man kann ja kein vernünftiges Wort reden, Du alberner Bengel!«
Gustav schnitt ihm eine Grimasse. »Schön tumm! Gar nischt zu sagen! Es is kalt draußen. Eins – zwei, rechts – links!« Dann hielt er plötzlich inne, drohte dem Bauern mit der Faust und schrie:
»Gar nischt zu sagen! Gar nischt rauszuschmeißen! Hu je, es is so kalt, es is so sehr kalt!«
Er heulte laut auf. Sein Vater sagte freundlich zu ihm: »Setz' Dich still in den Winkel, Gustav! Du kannst hierbleiben!«
Er war tief verstimmt. Er selbst schrie seine Kinder manchmal an, aber von fremden Leuten ließ er ihnen nicht zu nahe treten. Der Idiot setzte sich hinter einen Tisch und heulte stumpf eine Weile vor sich hin. Von Zeit zu Zeit warf er einen grimmen Blick nach den Männern und drohte mit der Faust. Dann nahm er den Papierhelm vom Kopfe und entfaltete das Zeitungsblatt. Er fand ein Bild darin, das ihn offenbar sehr interessierte, denn er stierte es unausgesetzt an, lachte, grunzte zuweilen vergnügt und schnitt Gesichter dazu.
Ein Bauer aus dem Dorfe trat in die Stube.
»Guten Tag, Schräger! 'n Korn! Tag, Raschdorf!«
»Guten Tag, Riedel!«
»Na, wie geht's?«
Raschdorf lachte.
»Gutt geht's! Famos geht's! Wie soll's gehen?«
Der Bauer nickte.
»Na ja, wie soll's dem reichen Raschdorf gehn? Dem muß 's gutt gehn! Habt Ihr's schon gehört? Beim Huhndorf sein'm Schwager hat's letzte Nacht gebrannt. Die Scheune und die Stallung is abgebrannt.«
»Ach, da is das dort gewesen?« sagte der Wirt. »Die Röte haben wir ja gesehen; 's muß a riesiges Feuer gewesen sein. Nu, wie is denn das zugegangen?«
Riedel zuckte die Achseln und lächelte vielsagend.
»Ja, wer weiß! Wenn einer gut versichert is, und die Gebäude taugen nich mehr viel, da is ja das Abbrennen gar keen so großes Unglück nich.«
Raschdorf lachte grimmig.
»Da haste recht! Man möchte selber wünschen, daß's amal brennte!«
»Versündigt Euch nur nicht!« sagte Schräger.
Riedel blickte Raschdorf aufmerksam an.
»Nu, bei Dir sind doch die Gebäude noch ganz gutt!«
Raschdorf zuckte die Achseln.
»Gutt? Was heißt gutt? Flickereien gibt's immerfort. Die Scheunen möcht' ich neu decken lassen, und der Kuhstall is ganz erbärmlich eingerichtet. Die alten Kerle haben keine Idee gehabt, wie a vernünftiger Stall zu bau'n is. Na, und wie das beim Huhndorf sein'm Schwager is – a kriegt a schönes Stück Geld von der Versicherung, und dann – ein'm Abgebrannten hilft jeder. Das is gar nich so schlimm.«
»Na, immerhin, jetzt vor'm Winter – 'ne Zuckerlecke is das nich.«
»Nu, ja, man red't halt so,« sagte Raschdorf achselzuckend; »ich für mein Teil red' ihm ja auch nichts Böses nach.«
Damit sprang die Unterhaltung auf etwas anderes über. Ein paar andere Gäste kamen noch, und der dicke Wirt ging immer hin und her mit den gefüllten Schnapsgläsern. Am meisten trank Hermann Raschdorf.
Drüben seine kranke Frau war allein. Am Nachmittag, als ihr Junge heimgekommen war, hatte sie seit Wochen wieder einmal eine glückliche Stunde gehabt. Den Hannes, der mitkam, hatte sie mit einem Auftrag ins Nachbardorf geschickt. Es war ihr zu unruhig, und sie wollte auch ihren Heinrich allein für sich haben.
Sie war so einsam. Höchstens daß ihr Vater aus dem Dorfe kam und sie besuchte. Den Mann sah sie selten, und wenn er da war, hatte er schlechte Laune. Und das Kind, die Magdalene, war nicht fürs Stillsitzen. Ihr gesunder Körper wollte hinaus zu Arbeit oder Spiel.
So war sie eine stille Frau, immer sich selbst überlassen. Da kamen so trübe Gedanken. Krank sein, immer krank, keine Hoffnung haben auf völlige Heilung, machtlos zusehen, wie dem Manne sein Hab und Gut langsam aus den Händen glitt und den Kindern die Heimat versank, das war ihr Los.
Aber die Märtyrerinnen murren nicht, und wenn sie jemand um ihr Schicksal fragt, lächeln sie. Und es ist auch im ärmsten Leben etwas Liebes und Lichtes.
Der Heinrich! Er hing so zärtlich an ihr, er schrieb ihr alle drei Tage einen Brief. Und wenn sie in stiller Nacht[45] leidend und wachend in ihrer tiefen Verlassenheit im Bette lag, dann suchte auch ihre geängstigte Seele eine Heimat. Durch die Nacht flog ihre Sehnsucht, hinab über Berge, hin über rauschende Wälder und schlummernde Dörfer, bis zu einer großen, glänzenden Stadt an einem breiten, tiefen Strom, dorthin, wo die hellen Lichter nicht erlöschten die ganze Nacht, wo das Leben flutete auf den Straßen und Plätzen, und wo doch in einem einsamen Stüblein ein müder Knabe schlief, dessen letzter Gedanke seine Mutter gewesen. Am warmklopfenden, reinen Herzen dieses Kindes machten Frau Annas Leid und Sehnsucht Halt und wurden stille – denn dort war ihre Heimat.
Und heute war diese Heimat ihr wieder nähergerückt, heute war eigentlich auch sie nach Hause gekommen.
Es war so schön gewesen die zwei Stunden, so, als ob draußen goldener Sonnenschein wäre und die blassen Astern im Garten strahlende Rosen seien. Von ihrem Kummer und ihren Leiden hat sie ihm wenig erzählt, fast gar nichts. Sie wollte sich diese Glücksstunde, auf die sie lange gewartet hatte, nicht trüben. Sie fühlte ja auch nichts Schmerzliches, sie war ganz gesund und glücklich.
Aber dann war der Hannes zurückgekommen. Er hatte sich heute sehr beeilt. Da hatte sie selbst dem Heinrich zugeredet, er solle ein bißchen mit dem Hannes hinausgehen; sie wolle nun ruhen.
So war sie wieder allein. Aber das stille Lächeln auf ihrem Gesichte blieb. Die Lene kam und brachte die Lampe. Sie küßte die Mutter in großer Eile und ging bald wieder hinaus.
Es war so stille. Man hörte, wie die Lampe knisterte. Der Dackel war verfroren vom Felde gekommen und vertrug sich heute sogar mit der Katze, nur um ein Plätzchen am Ofen neben ihr in ungestörter Ruhe zu genießen.
Die Uhr schlug sieben. Da ging draußen knarrend das Hoftürchen, und ein schwerer, unsicherer Schritt schlurrte über den Hof. Das war wohl ihr Mann. Sie lauschte. Die Schritte verloren sich, er kam noch nicht ins Haus.
Erst nach einer knappen Viertelstunde trat er bei ihr ein. Er hing die Mütze an einen Nagel und sah sich unsicher um.
»Wo is der Heinrich?«
»Er is ein bißchen drüben beim Schaffer.«
»So. Beim Schaffer? Ge – hört a da hin? Was? Hierher gehört a! Der Schaffer is wohl wichtiger – wie – wie ich – was?«
Die Frau wandte sich ab.
»Er kommt gleich wieder!«
»So? Kommt gleich! – Will ich auch – will ich auch wünschen.«
Da ging schon die Haustür, und Heinrich kam. Hannes war in seiner Begleitung Aber wie er sah, daß der »Herr« in der Stube war, zog er es vor, draußen zu bleiben.
»Guten Abend, Vater!«
»Nu, kommste endlich?«
»Ja, ich war ein bißchen beim Schaffer, weil Du noch nicht da warst.«
»Weil ich – weil ich nicht da war? Werd' wohl noch amal fortgehen können – was?«
»Ich bitte Dich, Hermann.«
Der Junge setzte sich niedergeschlagen und verschüchtert an den Tisch.
Sein Vater trat vor ihn, legte die Hand auf seine Schulter und schüttelte ihn ein bißchen. Dann sagte er mit rauher Stimme: »Na, haste schon die große Neuigkeit gehört, daß wir – daß wir – so gut wie bankerott sind?«
»Vater!«
»Hermann, ich bitte Dich –«
»Was is da zu schreien? In a paar Monaten da wissen's alle alten Weiber – da pfeifen's die Sperlinge –«
Der Knabe richtete die Augen auf den Vater – entsetzt, fassungslos.
»Vater! Was sagst Du? Das ist doch nicht wahr!«
Er sprang auf, klammerte die Hände um den einen Arm des Vaters, und der Mund verzog sich zu zuckendem Weinen.
Raschdorf ließ schwer das Haupt sinken.
»Es ist wahr – ich sag's ja eben – es ist nichts mehr zu machen –«
»Vater, müssen wir da fort von unserem Hofe? Müssen wir da fort von zu Hause?«
Der Mann war plötzlich nüchterner geworden.
»Ja,« sagte er, und seine Stimme ging schwer, »es geht hier mit uns zu Ende.«
Da ließ ihn der Knabe los und brach in bitterliches Weinen aus. Die kranke Frau im Lehnstuhl sah ihn mit unbewegtem Gesichte an. Langsam aus der tiefsten Quelle des Herzens stiegen zwei Tränen in ihre großen Augen. Die galten ihrem Kinde, das einen Schicksalsspruch vernahm, der es aus seiner Heimat verbannte, und das es nun nicht[48] glauben wollte und mit unschuldigen Tränen und Bitten sich dagegen vergebens wehrte. –
Draußen war Nacht. Ringsum am Himmel hing ein Kranz aus lichteren Wolken. Aber über dem Buchenhofe drohte ein schwarzes Gewölk – finster, zerrissen. Regentropfen rieselten aus der Unheilswolke und trafen den Buchenhof, als ob ein finsterer Geist mit seinem Weihwedel dort oben stände und einen schrecklichen Segen spräche: das Weihewort des Verderbens.
Eine dunkle Gestalt jagte flatternd über den Hof. Ein Keuchen ging von ihrem Munde. Sie fiel. Sie sprang auf. Die Haustür riß sie auf, die Stubentür:
»Jeses, es brennt – es brennt in der Scheune!«
»Es – es brennt!«
Ein schriller Laut aus dem Munde der Frau, die sich erhob und leblos zurücksank.
»Es brennt?! Es brennt?!« Ein lallendes Kinderwimmern.
»Es brennt!« Ein lautes, gellendes Männerlachen! –

Im Garten unter einem Apfelbaume, abseits von der Menge stand Mathias Berger, der Lumpenmann, und hielt mit seinen Armen Heinrich Raschdorf umschlungen. Ringsum standen Tische, Schränke, Stühle, lagen Betten, Kleider, Wirtschaftsgeräte verstreut im Garten.
Der Markt der Unglücklichen!
Die Fackeln des Unheils beleuchteten ihn. Das friedliche Laub der Bäume zitterte vor der Höllenglut, färbte sich rot und sank zur Erde. Und die kahlen Äste starrten dem Feuer entgegen, wie zitternde Tiere vor ringelnden Schlangen beben.
»Heinrich! Du mußt ins Haus! Sieh mal, das Wohnhaus brennt nich ab – das is nu vorbei! Du mußt ins Warme, Heinrich!«
»Ich will nicht, Mathias – ich – ich muß Wasser tragen!«
»Du kannst ja nicht mehr! Du bist ja durchnäßt, Du zitterst ja am ganzen Leibe.«
»Es ist ja unser Hof – ich – ich – oh – oh – Mathias – –«
Der Knabe war ohnmächtig.
Berger rief über den Garten:
»Ehrenfried, he – Ehrenfried!«
Ein Bauer kam heran.
»Ehrenfried, paß a bissel auf hier, daß niemand was stiehlt! Ich muß den Jungen ins Warme bringen; er holt sich sonst den Tod.«
Der Bauer war zu dem Dienst gern bereit.
»Schaff' ihn doch zum Schräger rüber ins Wirtshaus,« riet er.
Berger schüttelte den Kopf und trug den ohnmächtigen Knaben ins Wohnhaus. Die Leute machten ihm scheu Platz.
Ein donnerndes Krachen dröhnte durch den Hof. Eine hohe Mauer war zusammengestürzt. Funken sprühten um das ohnmächtige Kind und seinen Retter.
Drinnen in der Wohnstube war der große Ofen noch warm, und Hund und Katze lagen friedlich unter der Ofenbank. Sonst war alles ausgeräumt. Nur die Petroleumlampe brannte noch. Aber ihr trautes Licht wurde schrecklich überstrahlt von der roten Lohe, die von draußen hereinleuchtete.
Berger legte den Knaben auf den Fußboden und ging nach dem Garten zurück. Dort raffte er eine Menge Betten auf und trug sie nach der Stube.
Fürsorglich bettete er das kranke Kind, nachdem er es der triefenden Kleider entledigt. Dann kniete er neben dem Lager nieder und drückte einen Kuß auf die kalte Stirn des Knaben.
Da ging die Tür auf. Eine Frau trat langsam in die Stube. Ihre Stirn war marmorweiß, aber auf den Wangen[51] brannte das Fieber, und das Feuer von draußen beleuchtete sie.
»Berger! Was ist denn? O Gott, was ist?«
Der Lumpenmann erhob sich und erschrak.
»Frau Raschdorf, Sie! – Sie sollen doch im Gasthause bleiben! Es ist nicht gut für Sie –«
»Was ist mit Heinrich? Berger, was ist mit Heinrich?«
»Er ist ohnmächtig, gerade erst ohnmächtig geworden. Er hat sich so sehr angestrengt, und dann die Aufregung –«
»Heinrich, mein lieber Heinrich!« Und die Frau kniete aufweinend neben dem Lager nieder.
Berger schlich hinaus. Aus dem großen Durcheinander im Garten suchte er den Lehnstuhl und eine Decke heraus und trug beides nach der Stube.
»Ich bringe Ihnen Ihren Lehnstuhl, Frau Raschdorf.«
Sie erhob sich. »Mathias, er kommt nicht zu sich. Was wird werden? Was wird mit ihm werden?«
Der Lumpenmann beugte sich über das Kind.
»Er wird schon wärmer. Ich denke, er wird bald aufwachen, gut zugedeckt ist er ja, da wird er schwitzen, und es wird ihm weiter nichts passieren.«
Zitternd stand ihm die Frau gegenüber. Ihre Augen leuchteten heiß auf, als sie ihn ansah; ein Zittern flog über ihren Körper, und mit erregter Stimme sagte sie:
»Mathias – Du – Du hast das einzige gerettet – was ich noch habe.«
Sie streckte die Hände aus und schlug sie über seine Schultern, und ihr Gesicht sank matt an seine Brust in halber Ohnmacht.
Mathias Berger stand wie einer, der plötzlich stirbt und dem nur eine heiße, letzte Lebenswoge noch schmerzhaft und warm durchs Herz schlägt.
Doch er raffte sich rasch zusammen. »Setzen Sie sich, Frau – Frau Raschdorf und wachen Sie bei ihm!«
Langsam ging er aus der Stube. –
Und immer noch stand die Unheilswolke über dem Buchenhofe. Die Feuerflammen schlugen hinauf zu ihr und malten grellrote Lichter auf ihren schwarzen Untergrund. Wie Blutstropfen fiel der leise Regen.
Feuer von vollen Garben und duftendem Heu! In wahnsinniger, trunkener, taumelnder Freude erhoben sich die Feuerflammen. Draußen lagen die stillen, abgeernteten Felder, und nun war es, als ob jeder Halm in der Scheuer, jede vertrocknete Blume im Heu sterbend noch einmal das stille Plätzchen im Feldgrund grüßen wollte, da es gegrünt und geblüht und mit Faltern und zarten Winden gekost hatte. Jetzt zuckten über die beraubten Fluren stolze, jubelnde Flammensignale:
»Triumph! Wir sterben einen roten, herrlichen Tod! Erspart bleiben uns Tenne und Mühle. Die Natur ist groß, und der Mensch ist nichts!«
Die Menschen, die mit der Natur gerungen hatten im langen, mühsamen Kampfe, die ihr die Beute abjagten mit Schlauheit und Fleiß: sie standen bleich als die Besiegten, die Geschlagenen, und die Beute war ihnen entrissen, und ihr Bollwerk war zerstört.
Frau Mutter Erde sah schweigend zu, aber die Witwenschleier, die noch am Tage weiß und grau um ihre feuchte[53] Stirn hingen, färbten sich rot. Die Halme und Blumen sind ihre Lieblingskinder, und der Mensch ist der Stiefsohn. – –
Der Bauer Raschdorf saß auf einem umgestülpten Karren. Finsteren Auges sah er der Verheerung zu. Nicht einen Finger rührte er zur Hilfe. Von Zeit zu Zeit nur verzog sich sein Gesicht; seine Hände klammerten sich an die Beine und gruben sich oft schmerzhaft ins Fleisch. Und neben ihm kauerte, Entsetzen in den schönen Kinderaugen, die Magdalene, sein Ebenbild, sein Liebling.
Die beiden Scheuern lagen verwüstet; nun brannte der große Stall. Die Rinder zogen hinab ins Dorf. Ihr Brüllen klang dumpf durch die Nacht.
Vier oder fünf Spritzen aus dem Dorfe und aus den Nachbarorten waren da. Sie hatten sich bemüht, als die Scheuern brannten, das Wohnhaus und das Gesindehaus zu retten. Das war ihnen auch gelungen, denn der Wind war günstig. Aber die Giebel waren geschwärzt, die Fensterscheiben zerplatzt.
Und abseits von denen, die das Unglück traf, stand die Menge mit ihren Gefühlen. Ein lähmender Schreck hatte sie aus den Stuben gerissen, als die Glocke vom Turme wimmerte und der Feuerruf durch die Gassen heulte. Aber als sie sich überzeugten, daß sie selbst nicht in Gefahr seien, legte sich die Angst sehr rasch. Mitleid kam, Lust zu helfen, Lust zu schauen, Lust was zu erleben. Niemand von diesen Leuten war müde, alle belebte die Sensation, und so kam es auch hier wie immer, daß dicht neben das Grauen und die Vernichtung der Humor sich unter die Gaffer stellte und sich sein Sprüchlein leistete. Jetzt war nichts mehr zu[54] retten; aber immer, wenn eine neue Spritze ankam, trat sie mit in Tätigkeit, und so fuhren die Wasserstrahlen in den rettungslos weiter brennenden Stall lustig hinein und erzeugten viel Zischen und Dampf.
Zu ganz später Zeit, als das Feuer schon nachließ, kam die Spritze eines Nachbarortes, der nur eine Viertelstunde weit entfernt lag.
»Die sind auch schon munter!« sagte einer laut.
»Um die is 's nich schade,« bemerkte sein Nachbar ebenso vernehmlich. »Der ihre Spritze is a Unikum. Bei der vertrocknen im Sommer immer die Messingventile.«
Die verspäteten Rettungsmannschaften machten ob solch vorlauter und sehr applaudierter Rede grimmige Gesichter. Aber da die Spötter recht behielten, mühten sie sich ein wenig um ihre Spritze ab, pumpten, schraubten, rüttelten, besahen sie mit verständigen Mienen von allen Seiten, überzeugten sich aber, daß nichts zu machen sei, und fuhren deshalb kopfschüttelnd wieder heim. Und das schöne Bewußtsein, das Gute wenigstens gewollt zu haben, begleitete sie.
Dort, wo die Weiber standen, war viel Lärm. Jede hohe, stolze Flamme wurde mit viel Geschrei begleitet; über alles, was geschah, wurde laut verhandelt, gezetert, gejammert oder gelacht.
Als Mathias Berger den Heinrich ins Haus trug, wurden Rufe des Mitleids laut, auch als Frau Anna müde und krank über die Straße geschritten kam. Aber als Berger den Stuhl und die Decke holte, zwinkerten sich ein paar Weiber wortlos zu.
Und dann schritt der Bauer Raschdorf schweigend an ihnen vorbei, ohne sie anzusehen.
Die Weiber sahen ihm nach und atmeten schwerer; aber sie schwiegen, bis er weit genug war. Dann wollten sie alle gern über ihn reden, aber keine hatte den Mut, anzufangen. Nur zögernd, tropfenweise beginnend, aber immer anwachsend, entstand ihre Rede, wie ein kunstgerecht gezogener Wasserfall.
»O je,« seufzte die Mutigste und Ungeduldigste.
»Den trifft's auch ordentlich,« sagte eine zweite.
»Nu, da!« sagte eine dritte. »Und wenn man bedenkt, wie er doch – wie er doch eigentlich –«
Pause. Sie mochte nicht vollenden – die dritte. Aber alle waren gespannt, geladen, übervoll von innerem Rededrange.
Inzwischen stürzte abermals eine Mauer dröhnend zusammen. Eine Schuttwolke, durch die Millionen Funken blitzten, fuhr wirbelnd in die Höhe. Die Weiber waren bei dem Knall zusammengefahren, aber sie vergaßen deshalb nicht, was sie bewegte. Ein paar Sekunden sahen sie nach dem rauchenden Trümmerhaufen, dann kehrte ihr Interesse zu Hermann Raschdorf zurück.
»Na, Gott verzeih' mir die Sünde!« sagte wieder die Erste, Mutigste, Ungeduldigste. »Man soll ja keinem was Schlechtes nachsagen, überhaupt bei so was, aber stolz war der Raschdorf –«
Sie konnte nicht vollenden, der Bann war gebrochen, die Schleuse gezogen, die Fluten dröhnten. Es war ein Chaos. Da kam über den Garten eine häßliche, dürre Frau daher. Sie stellte sich zu ihren Mitschwestern, hörte ihr Lärmen und lächelte fein. Das waren ja alles dumme Gänse gegen das, was sie wußte.
Allmählich brauste der Wasserfall schwächer – verlief sich. Die Weiber sahen die Neue an. Sie ahnten mit feinem Instinkt, daß sie etwas Besonderes wisse.
»Was haste denn, Glasen?« fragte eine. »Haste was gesehen oder gehört?«
»Sie weiß was!« »Natürlich weiß sie was!« »Na, seht och, wie sie tut!« »Warum will sie's denn nich sagen?« »Wir sagen doch nischt weiter!«
So sprudelte es durcheinander.
Frau Glase blähte sich vor Stolz und Überlegenheit.
»Was ich weiß, weiß niemand,« sagte sie kühl.
Nun brach das Chaos wieder los.
Das wäre doch unrecht, so was nicht zu sagen. Man hätte doch keine Geheimnisse. Es wär' doch nichts dabei. Überhaupt sei das gar nicht recht, erst so zu tun. Weitergesagt würde doch nichts. Es seien doch alle immer sehr freundlich zur Glasen gewesen. Eine habe gar bei ihr Pate gestanden. Und sie seien doch so unter sich. Oder vielleicht wisse sie überhaupt nichts.
Das letzte Argument allein zündete; Frau Glase richtete sich auf. Sie sah die Zweiflerin verächtlich an und wandte sich darauf an die Allgemeinheit.
»Aber daß Ihr nischt weitersagt!«
Über ein Schock Finger fuhren beteuernd nach der Gegend des Schürzenlatzes.
»Ich hab' durchs Fenster gesehen, bloß wegen des Jungen, es tut einem doch leid um so ein Kind, es war ganz durchnäßt –«
»Natürlich tut's einem schrecklich leid. Weiter!«
»Na, also da war erst der Berger allein und dann –«
»Dann? Weiter, Glasen!«
»Dann kam die Frau.«
»Wir haben sie gesehen! Wir haben ja gesehen! Weiter, Glasen! Dann kam die Frau. Und, und was war da?«
Frau Glase machte eine Kunstpause und weidete sich an der Spannung ihrer Mitschwestern. So ein großes und stolzes Gefühl hatte sie noch nie empfunden in ihrem Leben.
»Weiter, Glasen! Erzähl' doch weiter!«
»Um den Hals genommen hat a sie.«
»Um den Hals genommen!« Das wieherten sie.
»Um den Hals genommen und geküßt!«
»Geküßt!«
Das Wort kam von allen zu gleicher Zeit. Dann war es still. Es arbeitete zu sehr in diesen Weibern; sie konnten nicht reden. Schreck, Freude, Sensationslust fuhren wie ein jäher Sturm über ihre flachen Seelen, und der eigene Schlamm rührte sich und warf Blasen.
Allmählich nur beruhigten sie sich. Aber jetzt waren sie stiller. Sie traten dichter zusammen und tuschelten und raunten und taten entrüstet und verbargen ein Lachen und waren alle sehr vergnügt.
Ein Riese nahte der Gruppe; er trug zwei schwere Eimer mit Wasser in den Händen. Schweigend, ohne auch nur hinzusehen, wollte er vorübergehen.
Da drang ein Laut an sein Ohr, der ihn verwirrte. Er machte ein unbeholfenes Gesicht und glaubte, er habe sich getäuscht; aber ein zweites und drittes Wort fing er wider Willen auf. Da wurden ihm die Eimer schwer, und[58] er stellte sie auf die Erde. Noch so ein böses Wort, noch eins. Da reckte sich der Riese.
»Dreckschleudern, sauelendige! Wollt Ihr die Fresse halten! Wollt Ihr wohl gleich die Fresse halten?!«
Und ein Eimer eiskalten Wassers ergoß sich über die Köpfe der Weiber, ihm folgte blitzschnell der zweite.
Kreischen, Gellen, eilige Flucht, Lachen oder auch zornige Zurufe der Männer, und August Reichel, der Schaffer, stand allein und zitterte zum erstenmal in seinem Leben.
Eine Weile stand er ganz stumm und dumm da. Hilflos blickte er in die leeren Eimer. Es war richtig, er hatte sie ausgegossen und eine laute, lange Rede dazu gehalten. Es wunderte ihn, daß er etwas gesagt hatte. Das Ausgießen fand er ohne weiteres in Ordnung. Einem Manne, der lachend herankam und fragte, was denn der Schaffer mit den Weibern habe, gab er keine Antwort. Er ergriff nur seine Eimer und ging verdrossen nach dem Bache zurück, von wo er gekommen war.
Es soll wenig so peinliche Dinge auf der Welt geben, als wenn jemand, der gerade mit Lust und Begeisterung schimpft, unvermutet mit Wasser begossen wird. Bei irgendeinem Heidenvolke hatte einmal der Gott der Gerechtigkeit den Einfall, das unverhoffte Wasserbad vom Himmel aus für alle schimpfenden und verleumdenden Menschen einzuführen; aber der Gott der Weisheit widerriet ihm und sagte, da käme die Welt aus der Sündflut nicht mehr heraus.
Ein Teil der Weiber schlich still nach Hause. Das waren jene, die nicht bloß froren, sondern sich auch schämten, denn es waren auch viele gutmütige dabei. Die anderen liefen zu[59] ihren Männern und schimpften mehr als zuvor, und die Männer nahmen sich der durchnäßten Ehefrauen an und schimpften mit.
So hatte August Reichel, der dumme, gute Riese, mit seinen zwei Eimern Wasser nichts gelöscht, er hatte nur Öl in ein böses Feuer geschüttet.
Die Aufgeregten zogen sich ein wenig zurück und standen beratend beieinander.
Und es kam einer heran, der bisher mit offenem Munde und blöden, glänzenden Augen ganz dicht am Feuer gestanden hatte – Gustav Schräger, der idiotische Sohn des Gastwirts. Immer nach drei Schritten blieb er stehen und starrte in die lodernde Glut. Und dann reckte er die Hände in die Luft, als wolle er die Flammen aneifern, immer höher empor zu schlagen.
»O je, es wird kleiner! Es ist nicht groß! Uff! Uff! Hu! Brr! Aah!«
Die Weiber deuteten auf den Idioten und lachten. Dann riefen sie ihn an. Er kam langsam näher, grinste und sagte ganz unvermittelt:
»Der Herr Raschdorf hat's angezündet!«
Die Gesellschaft schrak bei diesem Wort zusammen.
»Gustav, wirste still sein! Das sagt man doch nich! Aber Gustav!«
Der Idiot schnitt eine Grimasse.
»Ich weiß es! Er hat's angezündet! O! Ah! Dort, das is fein! Hoch! Hoch! Brr!«
Er wollte wieder zum Feuer zurück, aber ein Weib hielt ihn am Arm fest.
»Wie kannste denn so was sagen, Gustav? Das darfste doch nich.«
Er sah sie grinsend an.
»Es is schön! Und es wird noch ein Mann verbrennen! Paß auf! Und sie werden ihn tragen! Siehst Du! Siehst Du! Dort! Ooh – oooh!«
Er wollte sich losreißen, aber das Weib hielt ihn fest.
»Gustav, Du mußt's uns sagen. Wie kannste denn sagen: der Herr Raschdorf hat's angezündet? Du wirst ja eingesperrt, wenn das rauskommt.«
Der Idiot sah sie an und zog ein weinerliches Gesicht.
»Ich laß mich nich einsperren! Ich will nich! Ich will zum Feuer! Ich sag's meinem Vater! Laß mich doch los! Du zwickst mich in meinen Arm!«
»Aber woher weißte denn das vom Herrn Raschdorf, Gustav?«
»Er will mich rausschmeißen! Gar nischt zu sagen! Es war kalt! Es war so kalt!«
»Aber a hat doch nich angezündet?«
»A hat's gesagt. A hat gesagt, a zünd't an. Laß mich los! A hat's gesagt! Und ich soll raus – raus – Du zwickst mich so – alte Gans!«
Der Idiot brach in Heulen aus. Vergebens versuchten die Weiber ihn zu beruhigen. Er riß sich los und lief nach Hause.
Der Gastwirt Julius Schräger kam keuchend heran.
»Was habt Ihr mit dem Jungen? Was habt Ihr mit dem unglücklichen Kinde?«
Er war in riesiger Erregung. Ein Mann trat vor.
»Herr Schräger, wir haben ihm bloß gutt zugered't, weil a – weil a was gesagt hat –«
»Was hat a gesagt? Was hat a gesagt?«
Sie schwiegen.
»Was a gesagt hat, will ich wissen! Was Ihr mit mein'm Jungen habt, will ich wissen!«
Ein Mann faßte Mut. »Nu, ich sag's halt! Ich sag's ja bloß nach. Mir kann keiner was anhaben.«
»Was a gesagt hat, will ich wissen!«
Schräger wurde feuerrot. Da trat der Mann an ihn heran und flüsterte ihm etwas ins Ohr. Die anderen waren totenstill.
»Das is Unsinn! Das sagt halt der dumme Junge so. Das hat a vielleicht nich richtig verstanden. Gesagt hat der Raschdorf was; aber das war gewiß nich so gemeint.«
Schräger ging seinem Sohne nach, und die Menge blieb erregt in flüsternder Unterhaltung zurück. Das Feuer ließ langsam nach, aber die Unglückswolke stand über dem Buchenhof schwärzer als zuvor.
Ein grauer Herbstmorgen kam. Die Spritzen und alle die neugierigen Zuschauer waren fort. Mathias Berger und August Reichel trugen aus dem Garten die letzte Truhe ins Wohnhaus. Als sie den schweren Kasten aufheben, sah Berger, daß ein umgebrochenes, hölzernes Kreuzlein darunter lag; darauf stand zu lesen: »Hier ruht unser liebes Hühnchen.«
Von der Herrschaft war nichts zu sehen. Die Frau lag schwerkrank zu Bett, und der Herr hatte sich in eine Stube[62] eingeschlossen. Auf einem Sofa in feuchten Kleidern lag Magdalene Raschdorf und schlief. Sie hatte rote Wangen und lachte im Traum. Zwei Schritte davon entfernt hatte sich Hannes auf die bloße Diele gebettet und lag regungslos wie ein Toter.
Heinrich stand draußen mitten im Schutt. Ein Mädchen näherte sich ihm und sah ihn mit großen Träumeraugen lange an.
»Heinrich!«
»Du – ach Du bist's, Schräger-Lotte!«
Sie kam näher und sah ihm mit tiefer Teilnahme ins Gesicht. Er schlug die Augen nieder und preßte die Lippen fest aneinander. Er wollte sich beherrschen. Da faßte sie ihn am Arm und lehnte den blonden Mädchenkopf an seine Schulter.
»Es tut mir leid um Euch, Heinrich! Ich hab' die ganze Nacht geweint. Deine Mutter war bei uns und hat auch so geweint.« Sie schluchzte.
Da hielt er sich nicht länger, ein krampfhafter, dumpfer Schrei kam ihm vom Munde.
»Lotte! Jetzt – jetzt wissen wir nicht mehr, wohin.«
Und er weinte bitterlich.
»Heinrich – lieber Heinrich!«
Es lag ein guter, tröstender Klang in dieser Stimme.
Nach einer Weile beruhigte er sich. Er nahm Lotte an der Hand und zog sie mit sich bis zu dem umgestürzten Karren, auf dem in der Nacht sein Vater gesessen hatte. Dort setzten sich die beiden Kinder nieder und schmiegten sich dicht aneinander.
Mit seltsamer Stimme sagte Heinrich: »Gestern, als ich dort oben fuhr, dort oben auf der Straße, und unseren Hof sah, da war ich so stolz und wollte ihn gern allen Bekannten in Breslau zeigen und sagen: »Seht Ihr, das ist unser.« Und nachher sagte mein Vater, wir seien bankerott, und in der Nacht brannten wir ab.«
Er fröstelte in sich zusammen, und das Mädchen rückte ihm noch näher. Mit flüsternder Stimme sagte sie: »Sei nur still, Heinrich! Der Vater sagt, ich erb' einmal unser Haus und unsere Felder. Nachher schenk' ich Dir alles.«
Der Knabe rührte sich nicht. Aber es ging warm durch den jungen Körper. Langsam wandte er den Kopf und sah Lotte an, die mit großen, schönen Augen tröstend zu ihm aufschaute. Und da beugte er sich zu ihr und küßte sie feierlich auf den Mund.
»Wenn ich groß bin, werd' ich Dich heiraten, Lotte.«
Das sagte er fest und bestimmt.
Das Mädchen lächelte glücklich. »Aber den schönen Fingerring hast Du der Liese geschenkt.«
»Das war nur, weil ich mich vor dem Hannes und dem Mathias schämte. Ich wollte ihn eigentlich für Dich.«
Dann saßen sie schweigend. Ringsum war trüber Herbst, und der Wind fuhr über die Ruinen und spielte mit Schutt und Staub.
Da sah das Mädchen nach dem Dorfwege.
»Du, Heinrich, da kommt Dein Großvater!«
»Ja, er ist's,« sagte der Knabe. »Der hat Feuer läuten müssen in der Nacht. Denk' mal, Lotte, was das ist, in der Nacht über den Kirchhof gehen und auf den finstern Turm[64] klettern. Und dann hat er mit seinen alten Augen vom Turme auf das Feuer gesehen und gewiß an meine Mutter gedacht.«
Das Mädchen legte die Hand prüfend über die Augen. Auch der Knabe sah wieder scharf nach dem Wege.
»Sieh mal, Lotte, der Großvater kommt so schnell, und sonst kriegt er doch so schwer Atem – und da hinten, wer kommt da?«
»Das ist der Wachtmeister, Heinrich!«
»Der Wachtmeister? Was will der?«
»Was will der?« wiederholte das Mädchen unschlüssig.
Heinrich erhob sich erregt. »Ich will hinein, ich muß wissen, was das bedeutet. Geh' auch heim, Lotte, es steht so eine finstere Wolke über uns, und es fängt an zu regnen!«

Das Verhör des Angeklagten war beendet. Hermann Raschdorf hatte die Schuld, die ihm zugemessen wurde, nicht eingestanden. Der Zuhörerraum war überfüllt. Wer aus dem Dorfe hatte abkommen können, war zur Verhandlung gefahren.
»A sieht riesig schlecht aus,« flüsterte der Schmied dem Krämer zu.
»Na, das is aber och,« sagte der. »Das nimmt einen schon mit. Überhaupt so eenen wie den! Na, seh och, was a für graue Haare gekriegt hat.«
»Nich a eenzigesmal sieht a sich um,« sagte die Glasen. »A schamt sich halt zu sehr!«
»Da soll sich eener och nich –«
»Ruhe im Zuhörerraum!«
Der Gastwirt Julius Schräger wurde aufgerufen. Mit glühend rotem Gesicht trat er vor den grünen Tisch. Nicht einen Blick sandte er nach dem Angeklagten, der seinen Nachbar mit verängstigten Augen betrachtete.
»Ich mache Sie auf die Heiligkeit und Wichtigkeit des Eides aufmerksam! Sprechen Sie mir nach!«
»Ich schwöre, daß ich die reine Wahrheit sagen, nichts verschweigen und nichts hinzusetzen werde! So wahr mir Gott helfe!«
Die Personalien des Zeugen wurden festgestellt, und dann wurde Schräger aufgefordert, alles zu sagen, was er etwa über die Entstehung des Brandes wisse.
In unbeholfener Rede begann er. Er erzählte, daß Raschdorf am Nachmittag des Brandtages bei ihm gewesen sei, daß sie zuerst über die mißliche Vermögenslage des Angeklagten gesprochen hätten; dann sei der Riedel-Bauer gekommen und hätte von einem Feuer in der Nachbarschaft erzählt. Und da hätte der Raschdorf gesagt, so schlimm sei das Abbrennen gar nicht, weil doch die Versicherung zahle und weil alle Leute einem Abgebrannten helfen.
»Was haben Sie zu solchen Redensarten gesagt?«
»Ich hab' gesagt, er solle sich nich versündigen!«
»Jawohl, das war auch das einzig Richtige, was Sie sagen konnten. Erzählen Sie weiter!«
Ja, weiter wisse er nicht viel. Der Riedel hätte gesagt, die Gebäude des Raschdorf seien doch sehr gut; aber da hätte der Raschdorf entgegnet, der Stall tauge nichts und die Dächer seien schadhaft; es gäb' überhaupt immer Flickereien. Der Raschdorf sei etwas betrunken gewesen. Um sieben Uhr sei er fortgegangen, und um halb acht Uhr sei eine Magd vom Buchenhof gekommen und habe das Feuer gemeldet.
»Sie haben mit dem Angeklagten in Geldgeschäften gestanden?«
»Ja, ich hab' ihm manchmal borgen müssen.«
»Zuletzt hat der Angeklagte einen großen Verlust durch Aktienkauf gehabt. Es heißt, Sie hätten ihm zu diesem Geschäft dringend geraten. Wie steht das?«
Schräger wurde verlegen. Er erzählte, vor Jahren sei ein Fabrikunternehmen als Aktiengesellschaft gegründet worden. Da hätte er dem Raschdorf geraten, sich zu beteiligen. Der Raschdorf hätte das auch getan.
»Aber er hat damals eine Hypothek aufnehmen müssen, um die Aktien zeichnen zu können?«
»Ja, aber damals hat der Raschdorf noch sehr gut dagestanden.«
»Es war ein gewagter Rat von Ihnen! Aber Sie meinten wohl, die Sache sei sicher und werde rentabel werden?«
»Ja – ja, das meint' ich!«
»Das is nich wahr! Das is a Schwindel!«
»Ruhe im Zuhörerraum! Wenn das noch einmal vorkommt, laß ich den Störenfried sofort hier vorführen!«
Die Dorfleute duckten sich zusammen und rückten ein wenig von Mathias weg, der zitternd an der Barriere stand und die Worte gerufen hatte.
»Wissen Sie, Herr Schräger, wer der Brandstifter gewesen ist?«
»Nein!«
Der Verteidiger erhob sich.
»Eine Frage! Herr Schräger, Sie sind ein Freund und Nachbar des Angeklagten gewesen. Sie kennen ihn genau von Jugend auf. Halten Sie ihn der Brandstiftung für fähig?«
Schräger wurde sehr unruhig. »Ich – ich weiß es nich genau. Aber ich denke – a wird's wohl gewest sein!«
»Das is nich wahr! Das is 'ne Gemeinheit! Der Raschdorf war's nich! Eher war's der Schräger schon selber!«
Der Präsident fuhr empört in die Höhe.
»Gerichtsdiener! Der Mann dort an der Barriere, der das gerufen hat, ist sofort hier vorzuführen!«
Ein Gerichtsdiener kam in den Zuhörerraum, und Mathias Berger wurde dem Richter vorgeführt. Die Dorfleute wagten kaum noch zu atmen.
Die Personalien Bergers wurden festgestellt.
»Wie können Sie sich erdreisten, hier wiederholt die Verhandlung zu stören?«
»Ich – ich halt' mich nicht, wenn ich seh', wie der – der – der Lump da falsch aussagt!«
»Ich werd' ihn verklagen!« sagte Schräger krebsrot vor Wut.
»Das ist Ihr Recht, Zeuge!«
Der Staatsanwalt erhob sich.
»Ich beantrage gegen Mathias Berger wegen groben Unfugs vor Gericht drei Tage sogleich zu vollstreckender Haft!«
So wurde erkannt und Berger abgeführt.
Draußen auf dem langen Gerichtskorridor lehnte in einer Fensternische Heinrich Raschdorf. Mathias Berger, den der Gerichtsdiener sacht am Arme hatte, ging an ihm vorüber und sah ihn mit einem wehen Blicke an.
»Mathias – Mathias, was ist –?«
»Heinrich, Dein Vater ist verloren!«
»Mathias, ich will – ich – ich –«
Er klammerte sich verzweifelnd an den Lumpenmann.
»Geh weg, mein Junge, laß los!«
Er ließ nicht los, da schob ihn der Gerichtsdiener energisch zur Seite.
Der Knabe sah den beiden nach, die in dem langen Korridor verschwanden. Dann trat er ans Fenster und starrte hinab in den kahlen Gerichtshof.
Drinnen im Gerichtssaal wurde eine Magd verhört.
Sie habe im Kuhstall zu tun gehabt, aber dann habe sie einen Futterkorb aus der Scheune holen wollen, und da habe sie gesehen, daß es brenne. Da sei sie nach der Wohnstube gelaufen.
»Was hat der Angeklagte gesagt, als Sie ihm die Meldung machten?«
Die Magd schwieg.
»Was Ihr Herr gesagt hat, als Sie ihm sagten, daß es brenne, frage ich.«
»A – – a hat gesagt: »Es – es brennt!« Und dann hat a – hat a – gelacht!«
Eine Bewegung ging durch den ganzen Gerichtssaal, und der Angeklagte zuckte zusammen.
Dann ein Knecht. Er sagte aus, der Herr sei in den Pferdestall zu ihm gekommen und sehr lange dagewesen. Er hätte über alles mögliche geschimpft, und dann sei er gegangen. Wohin, das wisse der Zeuge nicht.
»Heinrich Raschdorf!«
Kein Atemzug war hörbar im weiten Gerichtssaal. Der Angeklagte nur fuhr herum und wandte sein erdfahles Gesicht der Tür zu.
Gesenkten Kopfes, mit blutleerem Angesicht trat Heinrich Raschdorf in den Gerichtssaal. Ein einziges Mal irrten[70] seine dunklen Augen im Kreise. Als er den Vater sah, öffnete sich ihm der Mund, das Gesicht verzog sich, und er blieb stehen. Aber dann senkte er die Augen und trat vor den Richter.
Der betrachtete den bildschönen Knaben, und durch die kalten, forschenden Juristenaugen zuckte ein warmer Strahl.
»Mein Kind! Du bist als Zeuge vorgeladen. Der Angeklagte ist Dein Vater. Du darfst das Zeugnis verweigern. Dann kannst Du bald wieder gehen!«
Der Knabe hob die Augen und sah den Richter ängstlich an.
»Ich – ich will alles – alles sagen. Ich – ich habe – habe selber angezündet!«
Ein paar Schreie tönten aus dem Zuhörerraum, und der Präsident vergaß den Ordnungsruf.
»Du hast angezündet?«
»Ja! – Ich – ich hab' Zigaretten – Zigaretten rauchen wollen – in der Scheune – und da – da –«
Der Angeklagte erhob die Hand.
»Heinrich! Heinrich, ist das wahr?«
Heinrich Raschdorf sah ihn nicht an und sagte:
»Es ist wahr!«
»Junge, wie kannst Du das so sagen? Du wirst ja sofort eingesperrt, wenn das wahr ist. Bedenke doch das!« mahnte der Richter.
»Es ist wahr!« wiederholte Heinrich.
Daran wurde er blaß und fing an so heftig zu zittern, daß ihm der Richter gebot, sich einstweilen zu setzen, bis er sich erholt habe.
Die Verhandlung nahm ihren Fortgang.
»August Reichel!«
Der Riese tappte schwer in den Saal. Die Eidesformel murmelte er so leise, daß ihn der Präsident ermahnen mußte, vernehmbar zu sprechen.
Mit unbeholfenem, ängstlichem Gesicht stand er vor dem Gericht. Er sollte erzählen, aber er knurrte nur, brummte unverständliches Zeug und brachte keinen Satz heraus. Da verlegte sich der Richter aufs Abfragen.
»Waren Sie zur Zeit der Tat im Hofe oder in den Wirtschaftsgebäuden?«
Reichel starrte den Richter an und schwieg.
»Ich frage, ob Sie an dem betreffenden Tage abends in der Zeit von 7 bis ½8 Uhr sich im Hofe, im Stalle oder in der Scheune aufgehalten haben?«
Der Schaffer schüttelte den Kopf.
»Nee!«
»Wo waren Sie in dieser Zeit?«
Reichel besann sich und sagte dann langsam:
»Derheeme!«
»Was heißt »derheeme?« Sie meinen, Sie waren zu Hause in Ihrer Stube?«
Reichel nickte.
»Wer war bei Ihnen?«
»Der Hannes und der Heinrich!«
»Was haben die Knaben bei Ihnen gemacht?«
»Sechsundsechzig!«
»Was?«
»Sechsundsechzig! Ich bring's ihn' bei!«
Ein paar Geschworene grinsten.
»Also die Knaben haben Karten gespielt? Wie lange?«
»Bis um halb achte!«
»Wieso gerade bis ½8 Uhr?«
»Wie's halb schlug, nahm ich die Karten weg.«
»So! Und dann ist Heinrich Raschdorf fortgegangen? Allein?«
»Nee, mit Hannes!«
»Wissen Sie etwas über die Entstehung des Brandes?«
Reichel schüttelte den Kopf.
»Aber der Herr is 's nich gewesen!« sagte er.
»Wieso ist er's nicht gewesen?«
Reichel zuckte die Schultern.
»Wissen Sie etwas, was dafür spricht, daß Ihr Herr unschuldig ist?«
Reichel nickte bedeutsam.
»Ich sprech's!«
Der Richter fuhr sich mit der Hand übers Gesicht.
»Ich meine, Reichel, das ist doch nur Ihre Ansicht! Haben Sie irgendeinen Beweis dafür?«
»A tutt's nich! A tutt's nich!«
»Setzen Sie sich!«
Der Schaffer setzte sich auf die schmale Zeugenbank und streckte die mächtigen Beine weit in den Saal. Er machte ein finsteres Gesicht, denn das viele Reden hatte ihn verdrossen. –
»Johannes Reichel!«
Hannes wurde halb zwangsweise in ganz jämmerlicher Verfassung herbeitransportiert. Er zappelte an Händen[73] und Beinen und heulte zum Steinerweichen. Der Richter redete ihm gut zu, aber davon wurde das Geheul ärger. Da brüllte ihn der Beamte riesig an, und das half.
Der Richter stellte zunächst fest, daß Hannes mit seinem Vater und Heinrich zusammen gewesen sei.
»Was habt Ihr gemacht?« fragte der Richter in seiner wohlwollenden, aber etwas kurzen Weise.
Über diese Frage erschrak der gute Hannes mächtig. Er fing an zu heulen, hob die Hände bittend auf und schluchzte: »Sechsundsechzig gespielt – aber ich werd's ja nich mehr machen – ich werd's ja nich mehr machen – bloß nich einsperr'n – och – och je – och je –«
»Sei mal ruhig, Junge! Ob Ihr Karten gespielt habt, ist mir egal. Da passiert Dir nichts. Erzähl' mal, wie der Heinrich Raschdorf nach Hause gegangen ist. Aber nun sag' die Wahrheit! Wehe Dir, wenn Du lügst. Also wie war das?«
Hannes erzählte, er sei mit Heinrich sofort hinüber nach der Wohnstube gegangen.
»Sag' mal, mein Junge, Karten gespielt habt Ihr also; habt Ihr nicht auch geraucht?«
»Nee, geraucht haben wir nich – gar nich geraucht – gar nich a kleenes bissel –«
»Johannes, lüge nicht! Ihr habt geraucht?«
»A eenziges Mal haben wir Zigaretten geraucht, aber das war im Sommer auf'm Felde – der Heinrich zwei und ich eine – aber da wurd' uns so schlecht –«
»Ob Ihr an dem Tage geraucht habt, wie's bei Euch brannte?«
»Nee, da nich, da hatten wir ja gar keene Zigaretten. Wahrhaftig nich!«
»Seid Ihr nicht, ehe Ihr zu Raschdorf in die Wohnstube ginget, in der Scheune gewesen?«
»Nee, wir sind bald rübergegangen.«
»Heinrich Raschdorf!« Der Knabe trat wieder vor.
»Du hast gehört, was Dein Freund aussagt. Das ist gerade das Gegenteil von dem, was Du sagst. Wer lügt nun von Euch beiden?«
»Ich – ich hab' geraucht – allein geraucht – in der Scheune –«
»Du hast allein geraucht? Wann hast Du geraucht? Wann bist Du allein gewesen?«
Der Knabe kam in tödliche Verlegenheit und wußte keine Antwort. Hannes faßte Courage und meldete sich mit dem Zeigefinger wie in der Schule.
»Herr Lehrer, a schwindelt! A war ja immerfort bei uns, und dann, wie wir rübergegangen sind, da is noch der Robert mit uns gegangen, der Knecht.«
»Robert Kirschner!«
Der Knecht sagte aus, er sei aus dem Wagenschuppen gekommen, da habe er die beiden Knaben aus dem Gesindehause kommen sehen, und weil er den Heinrich, der gerade erst zu den Ferien gekommen sei, noch nicht gesprochen habe, sei er mit den Knaben gegangen und habe sie bis zur Tür begleitet. Den Heinrich habe er in die Stube gehen sehen, und mit dem Hannes habe er noch geplaudert. Und da sei schon die Karoline gekommen und habe gesagt, daß es brenne.
»Heinrich Raschdorf! Warum lügst Du vor Gericht? Warum beschuldigst Du Dich selbst?«
»Mein Vater! Mein Vater!«
»Du hast Deinen Vater retten wollen?«
Der Knabe nickte unter heftigem Schluchzen. Es war aus mit seiner Fassung.
»Hat Dir jemand zugeredet zu einer solchen Aussage? Sag' jetzt die Wahrheit, mein Junge! Du weißt, Gott sieht Dir ins Herz. Und Du darfst Dein Herz nicht beflecken. Hat Dir jemand zugeredet, Dich selbst falsch anzuklagen?«
»Es hat mir niemand zugeredet!«
»Wirklich nicht? Wie kamst Du darauf?«
»Ich hab' so Angst – so schrecklich Angst!«
»Setz' Dich, Heinrich Raschdorf!«
»Frau Anna Raschdorf!«
Die schwindsüchtige Frau wankt in den Saal. Auf ihren Wangen blühten die Kirchhofsrosen.
»Wollen Sie von Ihrem Recht der Zeugnisverweigerung Gebrauch machen, Frau Raschdorf?«
»Nein!«
Sie sagte aus, was sie wußte. Sie leugnete nicht, daß Ihr Mann nicht nüchtern gewesen sei; aber als er dem Knaben mitgeteilt, der Ruin stehe vor der Tür, habe er gebebt. Und durch den Brand sei es nur schlimmer geworden. Maschinen seien verbrannt, die nicht versichert seien, die ganze, reiche Ernte sei verbrannt, das Vieh müsse auswärts sein. Das Elend sei erst durch den Brand voll geworden.
Eine Reihe anderer Zeugen wurde noch vernommen, ohne daß etwas Erhebliches zutage gefördert wurde.
Die Plaidoyers begannen.
Der Staatsanwalt führte aus:
Der Angeklagte sei in einer verzweifelten Vermögenslage gewesen. Er habe am Johannitermin die Zinsen nicht zahlen können und am Michaelitermin auch nicht. Dazu sei eine Wechselschuld gekommen, die er nicht habe tilgen können. Am Nachmittag des Brandtages nun sei durch die Erzählung des Bauern Riedel die Phantasie Raschdorfs angeregt worden; er habe in einem Brande einen günstigen Ausweg erkannt und diesem Gedanken auch durch außerordentlich belastende Worte Ausdruck verliehen. Sein Hirn sei durch reichlich genossenen Alkohol weiter erhitzt worden, und so sei der Vertreter der Anklage der vollen Überzeugung, der Angeklagte habe das Feuer in der Scheune angelegt, sei darauf in den Pferdestall gegangen, wo er durch ganz unmotiviertes Herumschimpfen sich habe gleichgültig und unverdächtig stellen wollen, und habe sich dann nach der Wohnstube begeben. Im Rausch hätte er es dann nicht verhindern können, zu lachen, als die Magd das Feuer meldete. Welcher Bauer lache wohl, wenn ihm Feuer in seinem Gehöft gemeldet würde? Die Tatsache, daß sich die Vermögenslage des Angeklagten durch den Brand verschlechtert habe, könne entlastend nicht ins Gewicht fallen. Raschdorf habe einen vorläufigen Aufschub, eine Wendung der Dinge gewünscht; die Aussicht, viel bares Geld in die Hand zu bekommen, habe ihn verlockt. Verdächtig erscheine dem Staatsanwalt auch die Aussage des Heinrich Raschdorf. Welches Kind klage sich selbst eines so furchtbaren Verbrechens an, wenn es nicht dazu angeregt, geradezu verführt worden sei? Ein Kind habe[77] Angst vor dem Gericht; es suche sich eher reinzuwaschen als sich zu belasten. Dieser Knabe Heinrich Raschdorf habe entlastend wirken wollen, aber das Gegenteil sei eingetreten. Es sei eine verunglückte Komödie gewesen. Auch den anderen Zwischenfall wolle der Staatsanwalt nicht unerwähnt lassen. Vom Zuhörerraum sei Partei genommen worden für den Angeklagten, und der Hauptbelastungszeuge Schräger sei beleidigt und geradezu selbst beschuldigt worden. Gerade dieser Zeuge sei aber durchaus glaubwürdig. Durch den Brand sei sein eigenes Gehöft, das ganz in der Nachbarschaft liege, höchst gefährdet gewesen; dazu komme, daß Schräger den ganzen Nachmittag in Gesellschaft seiner Gäste in der Wirtsstube gewesen sei bis zum Ausbruch des Brandes. Und dieser Mann, der den Angeklagten von Jugend auf kenne, der sein Freund sei und ihm dutzendmal aus finanziellen Notlagen geholfen habe, der nun bei Verurteilung des Angeklagten und dem daraus resultierenden finanziellen Zusammenbruch wahrscheinlich sein Geld verliere, sei unter dem Druck des Eides doch nicht fähig gewesen, auszusagen, daß er seinem Freund, Nachbar und Schuldner die Tat nicht zutraue. Er, der Staatsanwalt, bitte die Herren Geschworenen, das Schuldig auszusprechen, damit die Bestrafung des Verbrechers erfolge.
Ein Schrei. Heinrich Raschdorf lag mit weit ausgestreckten Armen im Gerichtssaal, mit dem Gesicht auf der Erde.
Der Schaffer hob ihn auf und trug ihn behutsam aus dem Saale. Ihm folgte Frau Anna.
So war Hermann Raschdorf allein. Weder Frau noch Kind hörten die Rede des Verteidigers. Die Ausführungen[78] dieses Mannes bestanden in der Hauptsache darin, daß Hermann Raschdorf, der ein gewisses Maß von Bildung besitze, nie und nimmer ein so plump angelegtes Verbrechen begangen haben könne. Er würde sich, selbst im Rausche, gehütet haben, kurz nachdem er die unvorsichtigen Worte gesprochen, eine Tat zu begehen, deren er mit großer Wahrscheinlichkeit verdächtigt werden mußte. Dazu komme, daß Raschdorf durch den Brand seine Vermögenslage verschlechtert sehe. Er, Verteidiger, sei der Ansicht, daß das Feuer schon angelegt gewesen sei, als Raschdorf noch in der Schenke saß. Um seinen psychologischen Tiefblick könne der Verteidiger den Herrn Staatsanwalt nicht beneiden. Es komme sehr wohl vor, daß ein Mensch, dem ein furchtbares Unglück gemeldet würde, jäh auflache, das sei ein viel intensiverer Ausdruck des Jammers als Tränen; denn so, wie es Freudentränen gibt, so gibt es ein Lachen der Verzweiflung, und das sei bei Hermann Raschdorf wohl vorauszusetzen gewesen, der kurz vor der Meldung des Feuers seinem Sohne Mitteilung von dem drohenden Bankrott gemacht und sich in schwerer Gemütsbewegung befunden habe. Noch mehr tue es aber dem Verteidiger leid, daß der Herr Staatsanwalt die Kindesliebe des kleinen Heinrich Raschdorf, die hier so echt und ergreifend in Erscheinung getreten sei, eine verunglückte Komödie genannt habe. So geschickt spiele auch der befähigtste Knabe nicht Komödie, daß er ohnmächtig zusammenbricht, wenn er von schwerer Strafe hört, zu der er den geliebten Vater schon verurteilt glaubte. Sehr wohl komme es aber vor, daß ein Kind in der Angst seines Herzens sich fälschlich selber anklage, um ein geliebtes Wesen zu retten. Der Idealismus[79] liege eben einer Kindesnatur näher als einem Staatsanwalt. »Meine Herren Geschworenen! Ich erwarte von Ihrem Gerechtigkeitsgefühl aufs bestimmteste, daß Sie diesen Mann nicht ins Zuchthaus schicken werden auf einen bloßen Verdacht hin, dessen Beweis in keiner Weise gelungen ist; daß Sie einem so heldenmütigen Knaben nicht den Vater, einer so kranken Frau nicht den Mann, einem so verwüsteten Besitztum nicht den Retter nehmen werden. Im ganzen aber appelliere ich nicht an Ihr Mitleid, sondern an Ihre Gerechtigkeit und erwarte den Freispruch.«
Die Geschworenen zogen sich zurück. Die Wintersonne schien strahlend in den kahlen Gerichtsraum, Schellengeläute ertönte von draußen, und das Lachen lustiger Menschen schallte von der Straße.
Und hier saß ein Mann, dessen Schicksal in den Händen schwacher Menschen lag.
In der Ferne schlug eine dumpfe Glocke dreimal.
»Drei! Paß auf, a kriegt drei Jahre,« flüsterte erregt die abergläubische Glasen im Zuhörerraum.
»Mir wird schlecht,« sagte die Krämerin und ging hinaus.
Und nun wieder diese schwere Stille. Hin und wieder hörte man leise die Feder des zurückgebliebenen Staatsanwalts kratzen, der gleichmütig Akten las und unterschrieb.
Die Geschworenen kamen zurück. Kein Laut ging durch den weiten Saal. Auch draußen war's still.
»Die Geschworenen haben die Schuldfragen verneint. Hermann Raschdorf ist freigesprochen und alsbald aus der Haft zu entlassen.«
Da begrub der Mann auf der Anklagebank sein Gesicht in beide Hände und weinte wie ein Kind. Eine Qual taute auf, eine furchtbare, lange Qual.
Die große Gaststube des »Gelben Rosses« war überfüllt. Es war nachmittags gegen 4 Uhr. Nur Bauern waren da, die von der Schwurgerichts-Verhandlung kamen und im »Gelben Roß« ihre Pferde und Fuhren untergebracht hatten.
Da herrschte wüstes Stimmengewirr. Die Leute hatten alle rote Gesichter, und auch die Langsamen und Schläfrigen unter ihnen waren aufgeregt und redeten viel oder grunzten wenigstens viel öfter und intensiver als sonst. Die viele innere Hitze brachte reichlichen Alkoholgenuß und der Alkohol wiederum viel innere Hitze zuwege, und die Bestellungszurufe an die Bedienung wie die Prostschreie waren das einzige, was abseits der Affäre Raschdorf gesprochen wurde.
Irgendein Verein zog draußen mit klingender Musik vorbei. Aber nur wenige Weiber traten ans Fenster. Den Männern war das Schauspiel, das sie sonst sicher über die Maßen interessiert hätte, heute gleichgültig.
Ein Bauernbursche kam in die Stube und meldete seinem Herrn, das »Handpferd tue so komisch, es kriege vielleicht die Kolik«. Zu jeder anderen Zeit wäre eine solche Meldung ein Alarmsignal zu allgemeinem Aufbruch nach dem Pferdestall gewesen, wo jeder seine Weisheit und Erfahrung zeigen konnte; heute hatte der Besitzer Mühe, seinen Schwager zu bereden, mit ihm »zum Rechten« zu sehen.
Wie wenn eine Dreschmaschine in einem großen Hofe summt, zischt, poltert, klappert, rasselt, qualmt, – so war's.
Aber eine Stimme im Bauernhofe gibt's, die selbst den Lärm der Dreschmaschine übertönt, das ist, wenn ein rechter Hahn kräht, und eine Stimme gab's auch in dieser Versammlung, die über all den wüsten Skandal sich erhob, das war die des Barbiers.
»Der Staatsanwalt, der – der is mei Mann! Der Verteidiger – äh, das is 'n Jude. Der macht's fürs Geld! Aber der Staatsanwalt, der hat's ihm gegeben! Donnerschlag, der Mann hat was weg!«
Es wurde ein bißchen ruhiger, und der Barbier konnte fortfahren: »Wer soll's denn eigentlich gewesen sein? Is 'n eenziger Bummler an dem Tage im Dorfe gewesen? Was? Habt Ihr einen gesehen? Ich nich! Und einer aus'm Dorfe? In unserm Dorfe gibt's kein'n Anzünder, es wär' denn grade –«
»Du, sag' bloß nischt vom Gastwirt Schräger,« warnte einer.
»Wer spricht 'n vom Schräger? Höchstens der Berger! Und der wird ja wissen, warum a zu Raschdorfen hält!«
Da wurde es noch stiller. Nur einige lachten vor sich hin, und die Glasen versuchte, verschämt auszusehen.
Der Barbier nahm wieder das Wort:
»Ich gönn' keinem was Schlechtes, aber dem Berger, dem is recht. Da hat a doch amal was uff sei großes Maul. Damals, wie a das Schandgedichte uff mich gemacht hat: »Versichert's Leben, der Bader kommt!« – Ja, da lacht Ihr schon wieder – wie damals – wie damals lacht Ihr, aber wen läßt denn der Berger in Ruh'? Keenen! Keen' eenzigen! A bild't sich ein, a is klüger wie a Bauer. So a[82] Lumpenmann, so a Stromer! Jetzt hat a Zeit, Gedichte zu machen, drei Tage lang! Der Staatsanwalt läßt sich nischt vormachen. Jetzt kann a die Gefängnismauer abschmatzen!«
»Der Barbier is a Hauptkerl!« sagte einer voll Anerkennung.
»Na, ich sag' Euch,« fiel dieser geschmeichelt ein, »ich hätt' nich Zeuge sein dürfen, da wär's anders gekommen, ganz anders; ich hätte schon gered't, ich hätt' den Herren schon a Lichtel uffgesteckt. Aber wenn solche Mohhörner dastehn wie der Reichel-Schaffer –«
Alle lachten.
»Vom Sechsundsechzigspiel'n quatscht das Rindvieh, als wenn das dazu gehörte – 's ganze Gericht hat ja gelacht, wie der sich blamierte. Aber solche Zeugen brauchte der Raschdorf!«
»Na, aber gutt sah der Raschdorf nich aus, wie a so uff der Anklagebanke saß.«
»I ja, da vergeht ein'm 's Dicketun! Früher da konnt' a nischt fein genug haben. Ich durft' ihm die Haare und a Bart nich verschneiden. »Sie schneiden mir Treppen in a Kopp,« sagt a, und da fuhr er in die Stadt und gab 20 Pfennig fürs Haarschneiden. Na, wer's so häufig zum Wegschmeißen hat!«
»'n riesigen Stolz hatt' a, das is wahr,« sagte wieder ein anderer; »wenn nich einer gerade auf der Schulbanke mit ihm gesessen hatte, mit dem machte der nich Brüderschaft.«
»Nee, nee, nee!«
Es entstand wieder allgemeines Gespräch.
Da kam Schräger. Wenn der Pfarrer in die Stube getreten wäre, es wäre nicht halb so still geworden wie jetzt.
Der Gastwirt sah sich verdrossen um und ging an einen Tisch. »'ne Tasse Kaffee und a Paar Wiener!« bestellte er.
»Prosit, Herr Schräger!« schrie der Barbier und näherte sich dem Tisch.
Die andern sahen gespannt zu.
»Prosit! Prosit!« antwortete Schräger kurz. In diesem Augenblick öffnete sich die Tür, und hinter einer Dienstmagd, die flüchtig hereinkam, trat Heinrich Raschdorf in die Stube. Niemand sah auf die Magd und den Knaben; alle blickten nach dem Tisch Schrägers. Heinrich blieb erst unschlüssig stehen, dann setzte er sich auf einen Stuhl, der in einem Winkel am Schanksims stand. Die Mutter hatte ihn, als ihm unwohl geworden war, nach dem Gasthause gebracht; aber er hatte sich rasch wieder erholt. Dann war jemand gekommen, der gesagt hatte, der Vater sei freigesprochen, und da war die Mutter gegangen, den Vater zu holen. Er selbst mußte zurückbleiben und wartete hier auf die Eltern.
»Nu, Herr Schräger, Sie sind ja so stille,« sagte der Barbier, »Sie ärgern sich doch nich etwa?«
»Da soll sich einer nich ärgern! Aber ich verklag' den Berger, ich verklag' den Kerl! Das laß' ich mir nich gefall'n!«
»Nu, das könn'n Sie sich ja gar nich gefall'n lassen. Wir haben gerade davon gesprochen. Der Berger hat halt Ursache, daß a zu Raschdorfs hält – na, Sie wissen ja – und Sie haben ja glänzend dagestanden, Herr Schräger.[84] Wie Sie der Staatsanwalt rausgestrichen hat, und a hat doch gesagt, Sie sind ganz unverdächtig.«
»Das will ich meinen, daß der's nich gewesen is, der a ganzen Tag in der Stube steckt und sein Geld zusetzt. Oder traut mir das überhaupt jemand zu?«
Schräger stand auf und musterte herausfordernd den Kreis. Ein lebhaftes Protestieren ging los, und ein paar Bauern schüttelten dem Wirt die Hände.
»Wir wissen 's schon, wer 's gewesen ist,« krähte der Barbier; »und wenn ihn 's Gericht zehnmal freispricht, der Raschdorf war's doch. Die stolze Bande –«
»Jeses, der Junge!«
Ein Weib schrie es, und nun sahen alle nach dem dunklen Winkel, aus dem Heinrich Raschdorf hervortrat. Mit glühenden Augen, wie ein gereiztes Raubtier, so stand er da; die weißen Zähne blitzten und bissen knirschend aufeinander; die Fäuste ballten sich – er bückte sich ein bißchen, sprang an, kletterte an dem langen Bader empor und hieb ihm die Faust ein paarmal derart auf Mund und Nase, daß dem Manne das Blut übers Gesicht rann.
»Ich schlag' Dich tot, Bader, ich schlag' Dich tot!«
Der Bader fluchte, schrie, wehrte sich und machte sich mühsam frei. Er wollte sich auf das Kind stürzen, aber das Blut rann ihm so reichlich und die Augen tränten ihm so stark, daß er hinaus nach dem Hofe mußte.
Die anderen waren starr.
Heinrich Raschdorf stand mitten in der Stube.
»Wer das noch einmal sagt – das von meinem Vater, den hau' ich gerade so!«
Ein paar Leute brummten oder lachten leise.
»Mein Vater ist freigesprochen – er ist unschuldig – das Gericht hat's gesagt, und das müßt Ihr glauben!«
Niemand rührte sich. Heinrich schoß das Wasser in die Augen.
»Ist jemand, der das nicht glaubt, daß mein Vater unschuldig ist?« fragte er hilflos.
Kein Laut in der Stube.
»Aber er gehört doch zu Euch, Ihr müßt es doch glauben!« Das sagte er in bettelndem Tone.
Ein gegnerisches Gemurmel erhob sich. Kein freundlicher Zuruf erfolgte. Da brach Heinrich Raschdorf in bittere, zornige Tränen aus:
»Dann – dann – seid Ihr alle – alle miteinander Schufte!«
Und ehe noch die Männer sich schwerfällig und schimpfend erhoben, den Knaben zu strafen, war Heinrich Raschdorf verschwunden.
Eine stille Straße entlang kam müde ein Mann gegangen, und neben ihm ging eine hustende Frau.
Ihnen trat Heinrich entgegen.
Er blieb vor dem Vater stehen, aber er gab ihm nicht die Hand. Scheu sah er mit seinen Kinderaugen den Vater an.
»Vater, sag' mir, ob Du's gewesen bist?«
Hermann Raschdorf fühlte die Wucht des Augenblicks.
»Nein, Heinrich, ich war's nicht!«
Er sagte es ruhig und fest.
Da atmete der Knabe tief auf, erfaßte die Hand des Vaters und küßte sie.
Bis vor die Stadt gingen die drei und warteten, bis der Schaffer kam und sie in sein Gefährt aufnahm.
Nicht ein Wort wurde gesprochen auf der langen Fahrt. Der frühe Abend war schon angebrochen, als sie zu Hause ankamen. Einen langen, scheuen Blick warf der Buchenbauer hinüber nach den verwüsteten Gebäuden. Da fuhr ein kalter Windstoß über die Trümmer und traf den Buchenbauer ins Gesicht, wie ein eisiges Urteil.
»Der Raschdorf is freigesprochen,« sagte auf dem Heimweg der Barbier. »Aber ich räch' mich an ihm, und der Kanaille, dem Jungen, streich ich's an. Wenn mir bloß nicht immer so leichte die Nase blut'te! Ich hätt'n ermurkst! Aber den Alten bring' ich rein, und wenn a zehn Juden bezahlt. Ich ruh' nich, bis alles raus is und bis a drinne sitzt!«
Und ob der böse Schaumschläger seine lächerliche Drohung auch nicht erfüllen konnte, er tat etwas Schlimmeres. Von Haus zu Haus führte sein Geschäft, und in jedem Hause stahl er den Raschdorfs etwas von der heiligen Erde, auf der wir allein unsere Heimat gründen können – von dem Herzenslande der Liebe und Sympathie der Gemeindegenossen.
Wer keinen Hof und keinen Fuß breit eigenen Bodens besitzt, kann doch eine Heimat haben, aber wem die Mitbürger ein Plätzchen idealen Baugrundes in ihren Herzen verweigern, der ist heimatlos.

Es war Neujahrstag. Jahre gibt es, in denen die Zeit müde und schläfrig an unserem Herde sitzt und ihre grauen Alltagsfäden spinnt, daß wir nicht merken, wie Frühling und Sommer rinnen und wie wir in der Gleichförmigkeit der Tage älter werden. Aber Jahre gibt es auch, wo die Zeit wirtschaftet und schaltet wie ein veränderungswütiges Weib: zerstört und aufbaut, rückt, schiebt, ändert, neue Blumen an unsere Fenster pflanzt, Leute hinausdrängt und andere hereinruft und uns am Ende ein Heim zeigt, das wir nicht wiedererkennen.
So ein Jahr kam für den Buchenhof.
Am Neujahrstage fing's an. Schräger war in die Stube getreten und hatte von Raschdorf erfahren müssen, daß sich dieser weder die vertrauliche Anrede »Hermann« noch das »Du« weiter von seinem Nachbar gefallen lassen wolle.
»So will ich mich auch nich erst setzen,« sagte Schräger gekränkt; »so will ich bloß kurz und bündig sagen, daß ich die[88] 20 000 Mark kündige. Ich werd' dann noch einen Brief schicken, daß es gesetzmäßig ist. Adieu!«
Raschdorf rührte sich nicht und sagte auch kein Wort. Schräger ging langsam zur Tür. Er drehte sich noch einmal um und sah Raschdorf fragend an. Aber der blieb völlig regungslos. Da ging Schräger aus der Stube.
Eine Stunde später brachte ein Knecht die schriftliche Kündigung und gab sie dem Buchenbauer persönlich ab. Unter dem Schreiben standen außer Schrägers Unterschrift noch die Worte: »Ernst Riedel, Gutsbesitzer, als Zeuge.«
Der Buchenbauer war ein anderer geworden, seit er aus dem Gefängnis zurück war. Er sprach selten noch ein Wort, er ging nie in ein Gasthaus, er schimpfte nicht mehr, er klagte auch nicht. Scheu und gedrückt brachte er die Tage dahin. Das Vieh, das bei den Bauern im Dorfe einquartiert gewesen war, hatte er verkauft. Er mochte keine Gefälligkeiten. So war er ein Bauer, der kein Stück Rind und kein Pferd mehr besaß und dessen Scheuern und Ställe in Schutt lagen.
Und am Nachmittag dieses Neujahrstages kam noch ein Bote und brachte einen Kündigungsbrief aus dem Dorfe über 5000 Mark, und außer dem Namen des Gläubigers stand unter dem Schreiben noch ein anderer unterschrieben »als Zeuge«.
Da sah der Buchenbauer mit einem langen Blick hinüber nach dem Kretscham und wußte, wer diesen zweiten Brief veranlaßt hatte.
Am Abend war die Familie zusammen. Sonst waren am Neujahrsabend noch einmal die Christbaumlichter angezündet[89] worden. Dieses Jahr war es vergessen worden, eine Tanne zu schmücken.
So schwermütig tickte die Uhr diese ersten Stunden des neuen Jahres herunter. Ein Brief lag auf dem Tische. Aus einer fernen Stadt wünschte ein Zigarrenkaufmann dem Buchenbauer Glück zum neuen Jahr. Sonst hatte niemand eine Karte geschickt.
Ein paarmal versuchte die kranke Frau, ein Gespräch anzufangen. Raschdorf gab ihr zerstreute, widersinnige Antworten. Er starrte immer blinzelnd in das Lampenlicht, und dann las er die Glückwunschkarte des Kaufmanns – dutzendmal.
Von den Kündigungen sagte er nichts.
Auch drüben im Gesindehause war es traurig. Hannes lag auf einer Bank und schlief; sein Vater rauchte Tabak und sah zuweilen schweigend auf den Jungen.
Am Ofen saßen zwei junge Mägde und weinten und wisperten leise. Morgen war Ziehtag; sie kamen nach entfernten Orten und hatten hier im Dorfe ihre Schätze. Da lag das neue Jahr und alle Zukunft trübe vor ihren jungen Augen.
Drüben im Buchenkretscham aber war viel Leben, und der Barbier, der sich betrunken hatte, lärmte von Gericht und Staatsanwalt und sagte, der Raschdorf müsse fort aus der Gemeinde.
Am 2. Januar war Ziehtag. Viele große Wagen rumpelten durchs Dorf, die neuen Knechte und Mägde abzuholen. An diesem »Sterztag« ist es Brauch, daß sich die Dienstleute betrinken. Abschied wird getrunken und neue Freundschaft[90] geschlossen; so mancher, der aus dem Dorfe scheidet, will sich Mut holen im Branntwein und fügt zu dem Heimweh, das ihn am anderen Tage packen wird, noch den physischen Jammer.
Der Gastwirt Schräger machte gute Geschäfte. Er verstand es auch, er war ein »gemeenschaftlicher« Mann, klopfte die Mägde vertraulich auf den Rücken und sprach mit jedem Pferdejungen; dabei horchte er und fragte viel, wußte alles und war stolz, so populär zu sein.
Noch einer zog seine Straße – Mathias Berger, der Lumpenmann. Sein Wägelchen hatte er in einen Schlitten umgewandelt, denn die Wege lagen voll Schnee, und es schneite auch heute sacht.
Bei den beiden Buchenhöfen war er rasch vorbeigefahren. Rechts drüben, wo die Ruinen gähnten, war zu viel, was er liebte, und links drüben, wo das Geschäft blühte, zu viel, was er haßte.
Am 28. Dezember sollte er vor dem Schiedsrichter erscheinen. Er hatte sich schön gehütet. Mochte ihn der Schräger auf dem ordentlichen Gericht verklagen, wenn er die Courage hatte. Und wenn er wieder eingesperrt würde –?
Ah, wegen einer Beleidigung wird man nicht eingesperrt, da zahlt man Strafe. Und Geld hatte Mathias Berger viel – viel mehr, als die Leute ahnten.
Daß er die drei Tage Haft bekommen hatte, zehrte an ihm. Über das ganze Weihnachtsfest war er zu keinem Menschen gegangen; er war auch jetzt froh, daß er fortziehen konnte.
Er hatte gesessen! Das war ein böses Wort. Er war der einzige gewesen, den infolge des Brandes da unten eine gerichtliche Strafe getroffen hatte.
Daran dachte der Mathias jetzt, als er am Waldrande mit seinem Hundeschlitten dahinfuhr. Und er blieb halten und zog ein Zeitungsblatt aus der Tasche, worin zu lesen stand, daß ein Redakteur sechs Monate lang eingesperrt worden sei, weil er seine Meinung gesagt habe. Nun habe es sich herausgestellt, daß diese Meinung die richtige und der Gefangene ein Märtyrer gewesen sei. Dieses Blatt war Bergers Trost.
Er las es auch jetzt wieder und sagte sich, es sei doch eine schöne Sache, für die Wahrheit zu leiden. Auch dann, wenn einen die Leute für einen Lumpen halten. Dann erst recht! Nur muß man sich nicht selber verlieren und hübsch stark und mutig –
Da – ein Schuß.
Gleichzeitig ein dumpfer Schrei nahe aus dem Walde.
Berger ist zusammengefahren, als habe der Schuß ihn getroffen. Der Hund bricht in ein heulendes Gebell aus. Was war das? Wem galt dieser Schuß? Was war das für eine Stimme?
Berger rafft sich auf und schirrt den Hund los.
»Such', Pluto, such'!«
Beide springen über den Grabenrand und verschwinden im Walde.
Ein kurzes Suchen – da finden sie ihn – nicht weit vom Waldrande.
Gegen eine Fichte liegt er mit blutender Brust, und neben ihm liegt das Jagdgewehr im Schnee.
»Raschdorf! Herr Raschdorf! O du großer Gott!«
Der Lumpenmann beugt sich tief zu dem Verwundeten. Der rührt keine Wimper.
»Raschdorf! Hermann! Komm zu Dir! Komm zu Dir!«
Der liegt mit verglasten Augen und röchelt schwer und schaurig.
Berger reißt dem Verletzten Rock, Weste und Hemd auf und sieht das Blut strömen aus vielen winzigen Wunden. Da nimmt er ein reines Taschentuch und bindet es mit einer Schnur fest auf die Wunden.
Nun rafft er ihn auf und trägt ihn mit furchtbarer Anstrengung nach der Straße. Dort legt er ihn auf den Schnee und holt den kleinen Schlitten herbei. Dahinein bettet er den Verwundeten und fährt behutsam zurück nach dem Buchenhofe. Und der Hund geht gesenkten Hauptes nebenher, denn er fühlt, daß sein Herr weint, fühlt, daß das eine traurige Fahrt ohnegleichen ist.
Der stolze Buchenbauer fährt heim auf Lumpenmanns kleinem Schlitten, und nebenher geht der Tod, ein düsterer Wegegenoß, ein schauriger Kamerad, den der dumpfe Feuerton des Gewehrs zur Stelle rief. Jetzt noch schreitet er neben dem Buchenbauer über den weißen Schnee; aber bald wird er die Führung übernehmen und auf seinen Wegen wandeln mit dem anderen.
Unten im Dorfe singen ein paar Knechte:
Mathias Berger horcht hinunter und sagt erschüttert zu sich selbst: »Es ist Ziehtag!« –
Am Nachmittag kam Raschdorf noch einmal auf Sekunden zu sich.
»Raschdorf, um Christi willen bereuen Sie Ihre Sünden!«
Und der Geistliche, der am Bette stand, hielt ihm ein Kreuz hin.
Raschdorf starrte ihn gläsernen Auges an, dann verzog sich sein Gesicht wie zum Weinen, und er versuchte, das Kreuz zu küssen. Aber dabei verlor er schon wieder das Bewußtsein.
»Durch diese heilige Salbung und durch seine mildreiche Barmherzigkeit verzeihe Dir der Herr alles.« –
Gegen 4 Uhr war Hermann Raschdorf tot.
Am Fenster lehnten Frau Anna und Heinrich. Sie hielten sich fest umklammert. Der Winterabend lag auf der Flur, und über dem verschneiten Walde ging fahl die Sonne unter, die ferne Sonne, die uns doch unendlich näher ist als die Seelen der lieben Toten, die heimgegangen. Mit weißem, unbewegtem Gesichte schaute Frau Anna nach dem gelben Schimmer. Bald ging nun auch sie auf die weite Reise, und der Knabe, den sie liebte, blieb einsam zurück, ohne Eltern und ohne Heimat. In vielen Jahren aber, wenn auch er vollendet, würden sie sich wiedersehen. Das sind die Stunden, in denen Gott mit den Menschen spricht, er, der Trost und[94] Frieden für die Trauernden hat, wenn die Welt und all ihre Weisheit und all ihre Tröstung versagt.
Durchs Dorf flog die Kunde: »Raschdorf hat sich erschossen! Das Gewissen hat ihm keine Ruhe gelassen!«
Berger hatte es übernommen, die Träger der Leiche für das Begräbnis zu besorgen. Bauern werden sonst von Bauern zu Grabe getragen. Aber der erste Bauer, den Berger um den Liebesdienst ansprach, sagte, er habe nicht Zeit, und der zweite meinte, er habe die Influenza. Da spuckte Mathias Berger draußen vor dem Tore aus, fuhr nach der Stadt und bestellte einen Leichenwagen nebst den Leichendienern. Die kosteten viel Geld, aber sie kamen pünktlich.
»Geld ist etwas Gutes,« sprach der schlichte Philosoph bei sich selbst, »es ist oft viel zuverlässiger als die Nächstenliebe.«
Am 5. Januar war das Begräbnis. Hunderte und Aberhunderte von Zuschauern füllten den Friedhof. Der Geistliche sprach die üblichen Gebete. Dann mußte die Rede kommen. Aller Augen hingen an dem Munde des Priesters. Klar und deutlich sprach er:
»Wir beten für den Verstorbenen und alle, die mit ihm hier schlummern, jetzt noch ein Vaterunser.«
Und sonst kein Wort. Bald nach dem Vaterunser ging der Geistliche fort. Nicht einmal die übliche Danksagung für das »christliche Trauergeleite« sprach er. Mathias Berger hatte sich außer der Einsegnung des Grabes alles andere namens der Hinterbliebenen verbeten, auch die Danksagung.[95] Die Leute, die da hinkämen, meinte Berger, kämen aus Neugierde und nicht aus Teilnahme, für die Neugier aber brauche sich niemand zu bedanken.
Eine große Enttäuschung bemächtigte sich der Teilnehmer am Begräbnis, und die Männer suchten sich in etwas zu entschädigen und gingen ins Wirtshaus.
Dort wurden dann dem toten Hermann Raschdorf viele Leichenreden gehalten.
Drüben im Buchenhof saß ein kleiner Kreis von Menschen und beriet über die Zukunft: Frau Anna, Heinrich, der alte Kantor, der Schaffer und Mathias Berger.
Und auch der Lumpenmann hielt eine kleine Leichenrede. »Heinrich, wenn Dir amal jemand sagt: Dein Vater hat sich erschossen, da sag': Ja, a hat sich erschossen, aber ob a 's freiwillig gemacht hat oder ob a verunglückt is, das weiß der liebe Herrgott alleine. Aber wenn Dir jemand sagt: Dein Vater hat sich selber angezünd't, da spuck' ihm ins Gesichte, denn das is die höllischste Lüge von der Welt. Wer angezünd't hat, das wird noch amal lichterloh rauskommen. Und nu will ich noch was sagen: der Buchenhof bleibt 'm Heinrich. A wird nich verkauft!«
Frau Anna sah Berger wehmütig an.
»Der Hof muß verkauft werden – bald! Schräger hat seine 20 000 Mark gekündigt und der Müller seine 5000 Mark. Jetzt borgt uns niemand zur letzten Hypothek hundert Taler.«
Berger machte eine abwehrende Handbewegung. »Lassen Sie mich reden, Frau Raschdorf. Wieviel sind Schulden?«
»110 000 Mark.«
»So? Und der Hof is wert 150 000! Wenigstens!«
»Jetzt nicht! Jetzt gelten die Wirtschaften nichts! Und 's is kein Vieh da, kein Ackerzeug, die Gebäude sind abgebrannt. Wer weiß, ob wir mit den Schulden rauskommen, wenn wir verkaufen und noch das Versicherungsgeld dazu rechnen.«
Die Frau streckte beide Hände trostlos über den Tisch. Mathias Berger nahm eine entschlossene Miene an.
»Die Wirtschaften gelten jetzt nischt! Gutt! Also wird sie nich verkloppt. Das wär' ja traurig. Und nu raus mit der Sprache! Erschreckt nich! Ich borg' das nötige Geld selber!«
»Von wem?«
»Von wem? Von mir! Ich borg's selber! 10 000 Taler borg' ich, das sind 30 000 Mark.«
Die anderen sahen ihn verständnislos an.
»Ja, von wem wollen Sie's denn borgen?«
»Nu, von niemand! Von mir selber! Ich hab' selber so viel Geld übrig!«
»Machen Sie heute keine Scherze, Mathias,« mahnte der Kontor. Frau Anna und Heinrich sahen betroffen vor sich nieder, und nur der Schaffer grunzte ein wenig amüsiert. Da nahm Berger das Wort:
»Da muß ich zuerst 'ne kleine Geschichte erzählen. Es geht oft recht wunderbar zu im Leben. Also eines schönen Tages – es sind jetzt sechs Jahre her – sitz' ich in Waldenburg in eener Kneipe. Kommt der Schräger rein. Na, damals vertrugen wir uns noch besser, und a plauderte immer[97] gerne mit mir, denn a Lumpenmann weiß manches, was a anderer nich weiß. Na, wie gesagt, der Schräger setzt sich zu mir. 'n kleenen Stiefel hatt' a sitzen. Auf 'm Tisch stand a Würfelbecher. »Sind wir amal um 'n Böhm!« sagte er und warf siebzehn. Ich wollt' mich nich blamieren, warf sechzehn und zahlte zehn Pfennige. »Revanche,« sagte der Schräger und warf dreizehn; und ich revanchierte mich, schmiß sieben und gab wieder zehn Pfennige. Das gefiel 'm Schräger; a würfelte immer von neuem und ich immer mit, und ich bezahlte immer 'n Böhm, bis 'ne Mark voll war. »Weißte, Berger, riskier'n wir amal 'ne Zicke, setz'n wir jeder amal fünf Böhm. Wenn schon, denn schon!« »Wenn schon, denn schon,« sagte ich und setzte fünfzig Pfennige, denn ich hatte och 'n kleenen Stiefel sitzen. Nu schmeißt a sechzehn und ich achtzehn, und das ging so fort, bis ich ihm fünf Mark und fünfzig Pfennige abgeknöppt hatte. Da war a wütend, nahm seine Mütze und ging. Ich freut' mich natürlich nich schlecht, ließ mir gleich 'n telikaten Kalbsbraten für 40 Pfennige bringen und schickte mein'm Hunde für 10 Pfennige Knochen aus der Küche. Dann fuhr ich los. Wie ich nu so durch die Stadt fuhr, les' ich a großes Plakat: Marienburger Geldlotterie. Große Geldgewinne. Los 3 Mark. Ich lehnte an meiner Hundekutsche und lernte so sachte das Plakat auswendig. Und weil ich, wie gesagt, nicht ganz klar war, geh' ich rein und kauf' a Los, von Schrägers Gelde. Wie ich' wieder rauskam, sah mich mein Hund an, als wenn a sagen wollte: Du tummer Kerl, was hätt'n wir für das Geld für 'ne Menge Kalbsbraten und Knochen haben können. Aber na, 's Geschäft war gemacht. Damit nu wenigstens von dem[98] Gewinn was Reelles raushängen tät, kaufte ich von den zwee Mark, die ich noch hatte, der Liese 'ne Puppe. Na und? – Nach vier Wochen hatt' ich mit mein'm Los 30 000 Mark gewonnen, a dritten Hauptgewinn.«
»Berger! Es is nich möglich!«
»Ist denn das wahr, Mathias?«
Die ganze Gesellschaft war aufs höchste erregt.
Berger lächelte. »Es ist wahr. Und ich hab' das Geld Heller für Pfennig ausgezahlt gekriegt. Aber ich hab' mir's nich in Waldenburg geholt; ich bin nach Breslau gefahr'n. Denn ich mochte kein'n Lärm machen.«
»Das is ja nicht zu glauben!«
»Was is nich zu glauben? Daß jemand 'n Haupttreffer macht? Das kommt bei jeder Lotterie vor. Und daß es mal 'n kleenen Mann trifft, das kommt ooch vor. Ich hab' für das Geld Papiere gekauft. Vierprozentige! Das macht zwölfhundert Mark Zinsen aufs Jahr. Die hab' ich fast alle gespart. Das sind nun wieder gegen 7000 Mark. Gesagt hab' ich keinem Menschen was. Nich amal meine Schwester weiß was und die Liese ooch nischt.«
»Aber warum – warum haben Sie denn das verschwiegen?«
Berger sah vor sich nieder.
»Ja, warum? Na, das habt Ihr wohl schon oft gehört und gelesen, daß mancher, den die Leute für 'nen blutarmen Kerl hielten, in Wirklichkeet a kleener Krösus war. Bei manchem, der a Fechtbruder war, fand man am Ende viel Gold und Silber unter seinen Lumpen. 's gibt solche schnurrige Kerle. 's is a ganz besonderer Spaß, die Welt[99] zum Narr'n zu halten. Bei mir war's auch so. Aber 's war nich das alleene. Das Geld kam zu spät. Zehn Jahre früher hätt's kommen müssen, wie ich noch jünger war. Da hätt' ich's gebraucht.«
Die andern sahen ihn verständnislos an; nur Frau Anna blickte vor sich nieder.
Berger zwang sich wieder zu einem launigeren Tone.
»Ja, und für een'n Lumpenmann paßt sich's doch nich, wenn a reich is. Ich schämte mich. Und Lumpenmann wollt' ich bleiben. So in der Welt rumfahren und zu Leuten kommen, das paßt mir. Das is nich so langweilig. Da gibt's alle Tage was Neues. Na, und das Geschäft ernährt mich. Deswegen braucht' ich auch das Geld nich. Ich hab' mir immer gedacht, so 'ne Lotterie is was Tummes. Immer gewinnt's einer, der's nich braucht. Aber wiederum war 's nich so was Tummes. Immer, wenn mich so eener scheel ansah, und dachte: »Ach, der arme Schlucker!« lacht' ich mir eens im stillen. Und ich dachte an allerhand!«
Die andern schwiegen. Bergers Augen begannen zu leuchten.
»Und jetzt dank' ich Gott, daß ich das Geld hab'. Jetzt kann ich's gebrauchen.«
»Berger, Sie können ja nicht – Sie dürfen nicht Ihr Geld auf eine so unsichere Sache –«
»Ich mach', was ich will! Ich borg's – basta! Die Sache steht ganz gut. Der Schräger und der Müller werden ausgezahlt, bleiben 85 000 Mark Schulden. Das is bloß reichlich die Hälfte von dem, was das Gut wert is. Dann bleiben immer noch 5000 Mark zu dem Versicherungsgelde, daß die[100] Gebäude wieder ordentlich aufgebaut werden können. Und wenn ich sterbe, haben die Liese und die Schwester noch 7000 Mark. Das ist viel Geld. Und außerdem haben sie die Hypothek.«
»Berger, es ist mir, als ob Sie ein Märchen erzählten,« sagte der alte Kantor. »Sie müssen aber an Ihr Kind denken.«
»An die Liese denk' ich schon. Der bleibt alles, jeder Pfennig. Wenn's nich sicher wär', borgt' ich's nich. Denn ich bin geizig geworden, seit ich das Geld hab'. Aber es is sicher!«
»Das werden wir nicht annehmen, Berger.«
»So? Und damals – wie ich ins Gemeindehaus kommen sollte – als Dorfarmer? – Sie denken wohl, a Lumpenmann hat keen Ehrgefühl? Das merkt a sich, wenn ihn jemand nich hat verlumpen und verhungern lassen. Und offen gesagt, ich weeß mir keen Rat mit 'm Gelde. Ich hab' mir ofte gesagt, eigentlich könntest du was anfangen, die Liese aufputzen und so – oder selbst 'n feinen Kerl rausbeißen. Ich hab' immer lachen müssen, wenn mir so was einfiel. 's kam mir so riesig tumm vor. Na, und da hab' ich's immer aufgeschoben. Kommt alles noch zurechte, dacht' ich immer. Laß das Mädel! Besser is, sie denkt, sie is arm. Da wird sie a recht braves Mädel werden. Kommt alles zurechte!«
»Ich besauf' mich auch amal, und nachher tu ich würfeln,« nahm sich Reichel, der Schaffer, vor. Es war das erste Mal, daß er begeistert war.
Die anderen aber sahen ernst vor sich nieder. Sie waren alle in tiefer Verlegenheit. Es entstand eine Pause. Frau Anna ergriff Bergers Hand.
»Mathias, Sie wollen mir das Sterben leichter machen.«
»Mutter!«
»Kind! Anna, sprich nicht so! Ich kann's nicht hören!«
Die Frau schüttelte leise den Kopf und bedeckte das Gesicht mit den Händen.
Mathias Berger sagte nichts. Ein Weilchen saß er ganz still da mit rotem Gesicht. Dann stand er plötzlich auf und ging hinaus.
Im öden Hofe stand er regungslos.
Einmal, als er ein junger Bursche war, hatte er ein Mädchen geliebt. Es wurde nicht sein. Ein reicher Nebenbuhler kam und riß sie in seine Arme.
Jetzt ist sie arm geworden und er reich, und der andere ist begraben. Aber wiederum wird sie nicht sein. Ein stärkerer Freier kommt – der Tod. Er steht wohl schon drüben auf den kahlen Wiesen. Bald schreitet er über die Trümmer und den Hof und führt die Anna heim in sein stilles Haus. Und die Menschen werden bei der Hochzeitsfeier läuten und singen und hinterher lachen und zechen, wie jetzt die lauten Gäste drüben in der Schenke. Der Mathias aber wird wieder mit seinem Handwagen in der Welt herumziehen und das Vergessen suchen.
»Mathias! Mathias, wo sind Sie denn?«
»Heinrich! Komm mal her, Heinrich!«
»Mathias, sind Sie krank?«
»Es ist nichts, Heinrich! Ich hab' mir bloß so mancherlei überlegt. Heinrich, wir zwei werden zusammenhalten!«
»Ja, Mathias! Ich bin so froh, daß Sie mein Vormund werden sollen.«
»Vormund nennen sie's auf 'm Gericht; wir heißen's Freund. Du sollst jetzt »Du« zu mir sagen, Heinrich, und ich sag' auch »Du«, für immer. Und uns zwei soll niemand auseinander bringen!«
So reichten sie sich die Hände.

Es war nahe an Mitternacht. Der Buchenhof lag längst ganz still; auch in der Wirtsstube des Kretschams waren die Lichter erloschen. Nur aus der Giebelstube drang noch ein matter Schein. Julius Schräger war noch wach.
Das Bett war aufgedeckt; es war totenstill im Hause, und Schräger war den ganzen Tag von früh an auf den Beinen gewesen. Aber er legte sich nicht nieder.
Langsam trat er ans Fenster. Der Mond war aufgegangen, und in seinem halbhellen Licht lag drunten das Dorf. Der Kirchturm ragte deutlich in die Luft.
Dort unten, ganz nahe am Turme, lag Hermann Raschdorf die erste Nacht! Er lag unter gefrorenen, harten Schollen in einem dünnen Totenhemd, und seine[104] Nachbarn zur Rechten und zur Linken waren Tote, Leute, die schon lange dort unten schliefen. Wie still das dort sein mußte! Nur die Würmer bohrten an Holz und Knochen, und zuweilen brach ein Sargdeckel. Dann senkten sich die Schollen und – drückten schwer.
Schräger fröstelte und trat vom Fenster zurück.
Er war ein Narr, sich so schwere Gedanken zu machen. Zu ändern war nichts. So setzte er sich auf den Bettrand und legte sich auf die Kissen nieder. Aber kein Schlaf kam über seine Augen. Er sah immer in das rote, leise singende Licht. Als wenn das Licht blutete und wimmerte, so war's.
Schräger schloß die Augen. Warum dachte er immer an Raschdorf? Er war fort. Er konnte ihm nichts anhaben. Kein Haar konnte er ihm krümmen. Und bis dahin, daß er auch hinunter müßte, war's lange hin. Dann war der andere längst zu Staub zerfallen.
Da schlich draußen etwas heran. Schräger lauschte. Es kam näher – stockte – war still. Aber jetzt kam's wieder – es stieß an einen Stuhl und war wieder still. Dann ächzte es deutlich vor der Tür.
Schräger richtete sich halb auf. Kalter Schweiß trat auf seine Stirn. Steif und lahm stützten sich die Hände auf die Kissen.
Da ächzte es wieder draußen.
Und jetzt tastete es an die Tür und klinkte langsam auf.
»Was? Wa–as? – – – Ah – Du – Gustav! – Was willst Du?«
Der Idiot, der ganz dürftig angezogen war, legte den Finger auf den Mund.
»Pst! Still! Ich komm Dir was sagen.«
Er schlich mit unheimlich glitzernden Augen zu seinem Vater und sagte ihm leise ins Ohr:
»A kommt wieder!«
Schräger erblaßte.
»Gustav, wie kannst Du Dich erdreisten, jetzt in der Nacht –«
»Pst! Ich fürcht' mich! A kommt – a rennt über die Felder – mit der Flinte – ich hab' 'n gesehn – a will mich schießen – und da komm ich zu Dir – Du mußt mich verstecken – und Du mußt ihm Geld geben, daß a nich schießt.«
Schräger wurde es brühheiß.
»Gustav, augenblicklich gehst Du in Deine Kammer und legst Dich schlafen. Das is Unsinn!«
Der Idiot brach in Heulen aus, und Schräger mußte ihm den Mund zuhalten.
»Still, Gustav, sei doch still! Es hört Dich sonst jemand. Du kannst ja hierbleiben. Schrei nich – schrei nich, Gustav! – Komm, leg' Dich ins Bette, ich zieh' Dir die Hosen runter – so – und nu leg' Dich um; ich deck' Dich fest zu.«
Der Idiot klapperte mit den Zähnen, als er im Bette lag.
»Fürchte Dich nich, Gustav, fürchte Dich nich, es kommt kein Mensch. Schlaf' ruhig ein! Es kommt niemand!«
»Du, ich hab'n gesehn! A weiß jetzt, daß ich angezünd't hab'!«
»Bist Du ruhig, Gustav, bist Du ruhig! Du hast ja gar nich angezünd't.«
»O ja, ich hab'! Mit zwei Streichhölzeln! A wollte mich rausschmeißen – uh, und es war doch so kalt.«
»Wenn Du nich ruhig bist, Gustav, kommt der Gendarm. Das darfst Du keinem sagen, sonst wirst Du fortgeholt. Niemand darfst Du das sagen, hörst Du? Keinem Menschen!«
Schräger zitterte vor Erregung.
»Ich sag's nich. Sonst schießt a mich tot!«
»Schlaf' ein, Gustav, schlaf' ein!«
»Oh, es hat so gebrannt, so hoch und so heiß, und jetzt wird a kommen. – Hörst Du? – A kommt auf der Treppe – Vater, versteck' mich!«
Schräger setzte sich auf den Bettrand und ergriff die Hände des Burschen. Leise redete er auf ihn ein und gebot ihm, die Augen zu schließen.
Der Idiot verbarg sich tief in den Betten und hielt krampfhaft des Vaters Hand. Von Zeit zu Zeit schrie er auf, dann hielt ihm Schräger den Mund zu. So verging eine qualvolle halbe Stunde, dann fing der Bursche leise an zu weinen und schlief allmählich ein.
Schräger erhob sich. Sein Gesicht war fahl. Ein leiser, schwerer Fluch kam über seine Lippen. Dieser Mann erkannte, daß sich ein Wurm in sein Lebensmark eingebohrt hatte, der nie mehr weichen werde.
Langsam ging er an den Schreibtisch, der an der Wand stand, und nahm ein Zeitungspapier heraus. Es war dasselbe Blatt, das Gustav am Brandtage zuerst zu einem Heim geformt, dann entfaltet und so gierig betrachtet hatte.
Das Blatt enthielt ein Bild, das ein brennendes Haus darstellte, aus dem ohnmächtige Menschen getragen wurden. Dieses Bild hatte die Phantasie des Idioten erregt und ihn zu seiner Tat angestachelt, wozu noch gekommen war, daß die Bauern von einem Brande gesprochen und Raschdorf den Burschen gekränkt hatte.
So war alles gekommen, und Schräger hatte noch am selben Abend die furchtbare Wahrheit erfahren. Als Gustav vom Brande nach Hause lief, war er ihm gefolgt. Da hatte der Knabe unter der Treppe im Hausflur gekauert und gewimmert. Er hatte ihn mit sich in die Stube genommen und ihn ausgefragt. Und da war ihm der unglückliche Bursche schreiend zu Füßen gefallen und hatte ihm gestanden, er habe die Scheuer angezündet.
Anfangs hatte es Schräger nicht geglaubt. Aber dann hatte er dem Jungen die Taschen durchsucht und das Bild und ein ganzes Päckchen Schwefelhölzer gefunden. Entsetzt hatte er noch einige Fragen gestellt und mit Gewißheit die furchtbare Wahrheit erkannt, daß sein Sohn der Brandstifter sei.
Und doch hatte ihn damals nichts bewegt als die peinigende Sorge, die Sache möchte offenbar werden. Der Verschleierung der Tatsache galt von da an all sein Bemühen, hinter das sogar sein altes Bestreben, den Buchenhof zu erwerben, weit zurücktrat.
Nun trat er an das Bett des schlafenden Burschen. Auch im Schlafe war dieses Gesicht häßlich und öde. Der Junge atmete schwer, und seine struppigen Haare waren feucht von Schweiß. Er sah wohl auch im Traume den schrecklichen Jäger, vor dem er sich fürchtete.
Schrägers Kopf sank auf die Brust. Das war eine der schweren Nachtstunden, da der Mensch Rechnung hält in seinem Herzen und vor Schuld und Urteil erschrickt.
Wenn Gustav plauderte!
Sie konnten dem Jungen gerichtlich nichts tun, er konnte nicht verantwortlich gemacht werden. Aber sie würden ihn in eine Anstalt bringen, ihn unschädlich machen für immer.
Und das fürchtete Schräger; dagegen sträubte er sich mit ganzer Seele. Er liebte seine beiden Kinder abgöttisch, wie so oft Geizhälse, die in ihrer Seele sonst nie einen Funken Idealismus haben, an ihren Kindern mit einer unordentlichen Glut hängen, die anständigen Leuten fremd ist. Das ist auch ein Zug, den die Geizhälse mit den Bestien gemeinsam haben. Und noch eines kam hier dazu, die Gefahr, daß der Junge des Vaters Mitwissenschaft verriet.
Sein Eid! Sein Eid! Wie stand er da!
Gewiß, er konnte im schlimmsten Falle alles abstreiten. Das Zeugnis des Jungen galt vor Gericht nichts. Er konnte sagen, er habe nichts gewußt. Aber die Dorfleute! Wenn ihr Vertrauen verschwunden war, war sein Geschäft verloren – alles verloren. Das durfte unter keinen Umständen geschehen.
Und sein alter Plan: den Buchenhof zu gewinnen! Es war ja gut, wenn der Raschdorf unterging. Was ging ihn der Raschdorf an? Schließlich hatte er sich doch selber ruiniert!
Die Lampe ging aus. Schräger erschrak. Jetzt im Dunkeln würde auch er sich fürchten. Er sann nach, wo er Licht[109] hernehmen könnte. Es war, ohne Geräusch zu verursachen, keines zu erlangen. So setzte sich der Einsame in einen Lehnstuhl.
Nur das eine nicht, nur nicht nach dem Fenster sehen! Das Mondlicht fiel so gespenstisch herein, und dort unten ragte der Turm auf, als wenn mitten aus dem Kirchhof sich ein geisterhaft drohender Riesenfinger emporstrecke.
Nur nicht nach dem Fenster sehen!
Eine Weile saß Schräger grübelnd still. Dann begannen seine Lippen zu zucken, Worte zu sprechen, ohne daß er's hindern konnte: »Ich schwöre vor Gott dem Allmächtigen und Allwissenden, daß ich die reine Wahrheit sagen, nichts verschweigen –«
Ein Stöhnen; Schräger sprang auf. Was fiel ihm ein? Wie kam er dazu, das zu sagen – das?
Er schloß die Augen und drückte den Kopf gegen die Kacheln des Ofens; sie waren kalt.
Kalt! Wenn das Feuer erlischt und wenn das Leben erlischt, kommt die Kälte.
»– nichts verschweigen und nichts hinzusetzen –«
Schräger raffte sich auf, und wie alle, die das Elend trifft, versuchte er den Kampf mit der furchtbaren Furie, die das böse Gewissen heißt, den nutzlosen, törichten Kampf, den auf die Dauer kein Sterblicher besteht, wenn nicht die starke, heilige Gnadenhand Gottes die eisernen Krallenfinger mächtig und linde aus den blutenden Schultern löst.
»Was hab' ich denn getan? Was hab' ich denn gesagt? Ich hab' nur erzählt, was ich wußte. Nur das!«
»– nichts verschweigen –«
Schräger blickte scheu nach dem Bette.
Eines hatte er verschwiegen: das, was alles gelöst hätte.
»Wissen Sie, wer der Brandstifter ist?«
»Nein!«
Und die schwarze, hohläugige Gegnerin warf den Einsamen in den Lehnstuhl zurück. Dort preßte er das Gesicht gegen die Lehne.
Da, wie er sich sammelte, aufraffte, kam ihm eine neue Waffe.
»Es ist niemand verpflichtet, gegen sein eigen Fleisch und Blut zu zeugen. So sagt wenigstens das Gericht, wenn auch nicht die Religion.«
Er atmete auf. Das würde die Erlösung sein, der Sieg! Der Dämon stand an der Tür, als wolle er gehen. Aber er wandte sich noch einmal um.
»Trauen Sie dem Angeklagten das Verbrechen zu?«
Wie ein Lavastrom flutete die Frage durch die Seele des Einsamen, die Frage und die meineidige Antwort, die er gegeben: »Ich weiß es nicht genau. Er wird es wohl gewesen sein!«
Leise kam der Dämon näher und beugte sich an Schrägers Ohr. Das Fenster knackte und knisterte ein wenig. Das klang wie leises, böses Lachen. Und es war, als ob die furchtbare Stimme zischelte:
»Und weißt Du, was Du weiter getan hast? Das Geld hast Du ihm gekündigt, ihn bankerott zu machen; zum Müller bist Du gegangen, ihn aufzuhetzen, und da hat Dein Freund die Flinte genommen und ist hinübergegangen. Und Gott hat gefragt: »Woher kommst Du? Ich habe Dich nicht gerufen!«[111] Mit Donnerstimme hat Gott es gefragt. Dein Freund aber hat mit bleicher Hand hinabgezeigt auf Dich und gesagt: »Der hat mich auf den Weg gezwungen zu Dir, der! …««
»Gustav, wach' auf! Wach' auf, Gustav! Ich kann nicht allein sein!«
Der Bursche fuhr erschrocken auf.
Und Julius Schräger suchte bei ihm Hilfe, bei dem Idioten, der verschlafen wimmerte und bald wieder einschlief.
Ein wenig später rasselte draußen ein Fuhrwerk vorbei. Schräger sprang ans Fenster. Wie eine Erlösung betrachtete er die brennenden Wagenlichter. Da waren doch Menschen – Menschen.
Aber bald darauf kam noch ein Licht langsam über die Felder herauf, ein einsames Licht, vor dem es dem erregten Manne schauerte. Wie gebannt sah er hin; er konnte sich nicht wegrühren vom Fenster, als wenn jenes Licht ihn zwinge. Er rieb sich die Augen, er wollte das Blendwerk bannen. Es gelang nicht. Näher kam das Licht, immer näher, gerade auf das Haus zu. Und nicht auf der Straße kam's, nein, über die Felder, ein weißes, blasses, taumelndes Licht.
Der Wind wimmerte draußen, und der Mond war untergegangen hinter schwarzem Gewölk. Es war fast ganz dunkel.
Jetzt war das Licht da. Wie eine Laterne war's und hatte doch nicht die Form gewöhnlicher Laternen.
Jetzt – jetzt konnte er's sehen! Eine schwarze Gestalt trug die Laterne, und ihr folgte eine weiße. Schräger sah es deutlich im Lichtschein.
Und jetzt verschwanden die Gestalten mit dem Lichte huschend drüben im Buchenhofe.
Mit verzerrtem Gesicht drehte sich Schräger um.
Der Tod, der den Raschdorf heimführt, fiel ihm ein.
Er war sonst nie furchtsam gewesen. Aber seit er einen unter dem Rasen hatte, dem er den Atem genommen, kam die grauenhafte Angst – die wahnwitzige, abergläubische Furcht.
Finster war's, schauerlich finster, und der Junge röchelte so schwer.
Ein Mittel! Ein Mittel, um der Qual zu entgehen!
An den Wänden tastete sich Schräger hin, zur Tür hinaus und dann leise wie ein Dieb die Treppe hinunter nach der Gaststube.
Dort atmete er auf. Es wurde ihm ein bißchen wohler. Vorsichtig schloß er die Fensterläden, dann zündete er die Lampe an. Licht! Licht ist allein schon eine Wohltat.
Aber doch war's auch hier einsam und furchtsam.
Da suchte er das Mittel.
Zum ersten Male trank er viel Schnaps. Dadurch wurde er mutiger. Schließlich füllte er eine Flasche, löschte das Licht aus, tappte nach seiner Schlafstube zurück, um den Jungen nicht allein zu lassen, setzte sich in den Lehnstuhl und trank – trank aus der Flasche.
Am andern Morgen lag ein lichter Dreikönigstag über der winterlichen Erde.
Schräger erhob sich müde und zerschlagen aus dem Lehnstuhl, in dem er ein paar Stunden im dumpfen Schlummer[113] des Rausches gelegen hatte. Es war acht Uhr vorbei. Er weckte seinen Sohn und gebot ihm noch einmal eindringlich Schweigen. Dann versprach er ihm, er würde ein zweites Bett in diese Stube schaffen lassen, und Gustav könne jetzt immer bei ihm schlafen. Nur dürfe er nichts sagen.
Drunten im Hause polterten die Dienstleute. Das tat Schräger wohl. Auch das Licht beruhigte ihn. Mehr aber half ihm ein guter Gedanke, den er in der Nacht gefaßt hatte: er wollte hinüber zur Frau Raschdorf gehen und die Kündigung zurücknehmen.
Schlafen mußte er wieder können, ruhig mußte er wieder sein, selbst auf die Gefahr hin, daß er den Buchenhof nicht bekam. Sonst, meinte er, würde er verrückt werden vor Furcht.
So ging er gleich vor dem Frühstück nach dem Buchenhofe. Unter der Tür traf er die Magdalene Raschdorf.
Das schöne Kind sah ihn herb an.
»Lene, ist Deine Mutter schon aufgestanden?«
Das Mädchen schüttelte finster den Kopf.
»Ich möchte mit Deiner Mutter gern sprechen.«
»Sie ist krank!« sagte Lene und wandte ihm den Rücken.
»Ganz wie der Vater,« dachte Schräger, »so stolz und abweisend.« Aber er zwang sich, freundlich zu sein.
»Lene, ist es schlimmer geworden mit der Mutter?«
Das Kind nickte und schlug die Hände vors Gesicht; dann lief es ins Haus.
Eine Magd erschien und klärte Schräger auf. Die Frau hatte in der Nacht Blutsturz bekommen. Ein Gespann hatte den Doktor geholt und eine barmherzige Schwester aus der[114] Stadt mitgebracht, und der Pfarrer und der alte Kantor waren auch in der Nacht gekommen.
»Mit einer Laterne?« fragte Schräger stockend.
»Ja, mit einer Kirchenlaterne!«
»Aah!« seufzte Schräger auf und nickte.
Der Arzt kam die Treppe herab.
»Was wünschen Sie?« fragte er Schräger.
»Ich – ich habe der Frau Raschdorf Geld gekündigt, und ich will die Kündigung zurücknehmen.«
»Lieber Freund, da kommen Sie leider zu spät. Frau Raschdorf ist eben gestorben.«
Ein schriller Schrei ertönte von oben. Das war die Lene, die es auch jetzt eben erfuhr. – Schräger ging mit schweren Schritten heim. – – – –
Wieder flog die Todeskunde durchs Dorf, und die Leute wurden still. Ein Schrecken kam über die Menschen.
So viel Trauer in einem Hause weckte überall Furcht. Ein leises Grauen mischte sich drein, als sei hier eine Strafe des Himmels sichtbar und offenkundig in Erscheinung getreten für Sünden, die die Menge nicht genau kannte. Aber ein Mitleid regte sich in den weicheren Herzen für die zwei verwaisten Kinder. Dieses Mitleid hätte zum Siege verhelfen können im Kampfe um die Heimat. Durch Mitleid hätte Heinrich Raschdorf sich jenen Herzboden bei den Mitgliedern der Gemeinde erkaufen können, um den er lange Jahre hindurch so bitter kämpfen mußte. Es kam ein günstiger Augenblick, wie er nicht mehr wiederkam. – Ein paar Sympathiekundgebungen kamen aus dem Dorfe. Gespanne wurden angeboten, auch sonstige Unterstützung, und zwölf Männer meldeten[115] sich freiwillig als Träger der Leiche. Der Bauer, der sich vor Tagen wegen Influenza entschuldigt hatte, hatte die zwölf Männer gesammelt. Er schickte eine Magd und ließ fragen, ob die Träger gebraucht würden.
Mathias Berger brachte seinem Mündel Heinrich die Nachricht aus der Küche in die Wohnstube.
»Die Leute werden vernünftig, Heinrich! Siehst Du, schlecht sind sie gar nich. Sie haben sich bloß mit Deinem Vater nich verstehen können. Es is schon gut, Heinrich, wenn Du mit den Leuten auskommst, denn sonst bleibst Du in der Fremde, auch wenn Du zu Hause bist. Das kannst Du mir glauben.«
»Den Vater haben sie nich tragen mögen,« sagte der Junge finster. »Warum nicht?«
Mathias Berger wußte nicht gleich eine richtige Antwort. Eine leidenschaftliche Röte flammte über das Knabengesicht.
»Weil sie dumm sind, weil sie schlecht sind! Mathias, ich hab's gehört, ich hab' gehört, wie sie auf meinen Vater schimpften, damals in der Stadt. Alle haben sie gelacht über den schuftigen Barbier, und wie ich ihm die Nase blutig gehau'n hab', da haben sie über mich herfallen wollen – zwanzig Männer über einen Jungen! Mathias, sie dürfen meine Mutter nicht tragen. Ich leid's nicht!«
Die stolze, herrische Art der Raschdorfs brach bei dem Knaben durch. Mathias blieb ruhig und milde.
»Heinrich, sie lassen sich selber anbieten. Es ist nun einmal so Sitte auf dem Dorfe. Wenn wir das abschlagen, das is eine riesige Beleidigung.«
»Und die? Haben die meinen Vater nicht beleidigt? Gebettelt hab' ich, gebettelt, Mathias, daß sie's glauben sollen, sie haben nicht gemuckst. Ich leid's nicht, Mathias, ich leid's nicht, daß sie die Mutter tragen.«
»Hör' mich mal an, Heinrich! Siehst Du, die Scheune werden wir wieder aufbauen, den Stall auch. Das is nich schwer. Auch die Wirtschaft kriegen wir wieder rauf. Das is auch nich schwer. Das läßt sich alles machen, wenn man a bissel Geld hat und fleißig is. Aber Heinrich – die Leute, die Leute! Die müssen auch wieder lernen, freundlich mit uns zu sein. Das is die Hauptsache, Heinrich! Das is wichtiger, als daß wir die Wirtschaft wieder aufbauen. Sieh mal, ich war früher so a armer Kerl. Ich hatte kaum a paar Sonntaghosen. Aber zu Hause war ich, 'ne Heimat hatt' ich. Das war, weil mir die Leute gut waren. Dein Vater, Heinrich, der hat keine solche Heimat gehabt.«
»Willst Du auch auf den Vater schimpfen, Mathias?«
»Wein' doch nich, Heinrich! Ich will ja bloß mit Dir reden, weil Du doch schon ein großer, kluger Mensch bist. Sieh mal, ich sage, das war eben das Unglück von Deinem Vater, daß a sich nich mit a Leuten im Dorfe vertrug. Ich sag' ja nich, daß a schuld war. Ich sag' bloß, es war sein Unglück. Denn siehst Du, immer alleine konnt' a nich sein, immer in die Stadt fahren konnt' a auch nich, na, und da wurd' a verdrossen und ging zum Schräger, und das war sein Verderben.«
Der Knabe weinte leise vor sich hin. Berger schlang den Arm um seine Schulter.
»Heinrich, Du hängst so an zu Hause. Es ist notwendig, Heinrich, daß wir gute Freunde im Dorfe haben. Ich bin zu a ungeschickter Kerl, ich kann Dir's nich so beschreiben, wie ich mir's denke. Aber das weiß ich: Wir brauchen die Leute, auch wenn wir sie nich brauchen. Wir müssen's annehmen, Heinrich!«
»Da – da sag' ihnen, sie sollen die Mutter tragen; Du bist ja klüger, Du mußt's ja wissen.«
In demselben Augenblick öffnete sich die Tür, und Magdalene Raschdorf trat hastig ein.
Ihre braunen Augen standen voll Tränen. Die Stimme bebte ihr, als sie sprach: »Mathias, sie hat gesagt – sie hat zu unserer Martha gesagt – Sie – Sie haben – Sie haben unsere Mutter geküßt!«
»Lene! Was fällt Dir ein! Wer sagt das?« rief Berger.
»Wer sagt das, Lene?« stammelte Heinrich.
»Die – die Magd vom Perschke-Bauer, die da is – die hat's zur Martha gesagt – und ich – ich hab's gehört!«
Mathias sprang aus der Stube hinüber nach der Küche. Eine junge Magd stand schwatzend bei einer andern.
»Frauenzimmer, erbärmliches, was hast Du gesagt? Zu dem Kinde? Zu dem Kinde?«
Die Magd wurde blaß und floh in einen Winkel.
»Was ist denn? Was ist denn? Jeses! A will mich hau'n!«
»Was hast Du gesagt von mir und der toten Frau Raschdorf – Mädel?«
Berger, der ihr gefolgt war, trat drohend und keuchend vor sie.
»Ich hab' nichts gesagt – ich hab' – Jeses –!«
Ein Schlag klatschte ihr auf die Wange.
»Gesteh's, Frauenzimmer, oder –«
»O Gott, o Gott, lassen Sie mich!«
»Was Du gesagt hast, will ich wissen!«
Wieder erhob er drohend die Faust.
»Ich hab's bloß nachgesagt, der Herr sagt's, die Frau, 's ganze Dorf. Ich kann nicht dafür –!«
»Das ganze Dorf? Raus! Und sag' Deinem Herrn, wenn sich noch eins auf dem Buchenhof sehen läßt, da hetz' ich die Hunde!«
»Ich bring' sie um! Ich schlag' sie tot!« schrie Heinrich in rasender Wut und klammerte sich an das Mädchen. Berger riß ihn los.
»Laß sie! Laß sie laufen, Heinrich!«
»Loslassen, Mathias, los! Ich schlag' sie tot!«
Heinrich schlug mit den Füßen gegen Mathias, der ihn festhielt, während das Mädchen heulend davonlief.
Nach langer Zeit, als sie sich etwas beruhigt hatten, sagte Berger:
»Es war unrecht, Heinrich! Das dumme Ding quatscht bloß nach, was ihr die Leute vorreden. Aber, Heinrich, ich war ein großer Esel. Du hast recht, die dürfen Deine Mutter nicht tragen. Sie sind zu schlecht!«
Der Knabe wandte ihm den Rücken und stand in finsterem Groll und in furchtbarem Nachgrübeln zitternd da. Berger betrachtete ihn und ahnte, was in dieser Seele vorging. Da sagte er mild:
»Heinrich, komm einmal mit zur Mutter!«
In der kleinen Stube stand der Sarg. So friedlich lag die verklärte Frau auf den weißen Kissen. Laut aufschluchzend kniete Heinrich am Sarge nieder. Mathias Berger stand da mit gefalteten Händen, lange – in stummer Betrachtung. Das war ein tiefes Glück, daß er so ruhig hier stehen konnte.
»Heinrich,« sagte er leise, »ich hab' Deine Mutter sehr lieb gehabt, aber küssen tu ich sie jetzt das erste Mal.«
Und er beugte sich über den Sarg und küßte die lächelnde Tote.
Dann faßte er den Knaben an der Hand und führte ihn hinaus. Und Heinrich schmiegte sich fest an ihn an.

Neues Leben war auf den Buchenhof gezogen. Unten im Dorfe im kleinen Schuppen stand unbenutzt der Lumpenwagen, und Pluto, der »Bernhardiner«, lag faul im Buchenhofe und duldete mit lässiger, gelangweilter Vornehmheit die Neckereien Waldmanns, des Dachses.
Mathias Berger war nicht mehr auf den Lumpenhandel gezogen, er war der Verweser des Buchenhofes geworden.
Die Bauern im Dorfe lachten. Ein Lumpenmann Großbauer, das war auch zum Lachen. Zum Bauer sein gehört Verstand und noch mehr Geld. Und das hatte Mathias Berger beides nicht. Wenigstens nicht den richtigen Verstand. Von Geld war sowieso nicht die Rede.
Der Barbier hatte ein »Gedicht« gemacht; das hieß:
Dieses Gedicht fand starken Beifall im Dorfe, und selbst die kleinen Kinder lernten es auswendig. Auch erfand ein[121] Tonkünstler eine sinnige Melodie dazu, so daß das Lied gesungen und gepfiffen werden konnte. Den Dichter machte es populär, und alle hielten ihn für einen witzigen Menschen, der einen helleren Kopf habe als die anderen Leute.
Mathias Berger hörte von dem Spottverse und beschloß, in einem wirklichen Gedichte, das der Redakteur des kleinen, landläufigen Blättchens gewiß drucken würde, dem Barbier und den Dorfleuten eine derbe öffentliche Antwort zu geben.
Mathias war in seinen Feierstunden ein Dichter. Er verfaßte zwar meist nur Gelegenheitsgedichte, wie Nachrufe, Festtagswünsche u. dergl.; aber einige Gedichte hatten auch in der Zeitung gestanden, und so hoffte Mathias, auch diesmal mit einem geharnischten Poem anzukommen.
Da fand er am Tor des Buchenhofes mit Kreide die Worte angeschrieben: »Der Barbiehr ist ein Esel!« Hannes, der Schaffersohn, bekannte sich mit vergnügtem Schmunzeln als Urheber dieses Sinnspruches und versicherte mit Wichtigkeit, daß er denselben Satz fast auf allen Zäunen und Toren des Dorfes verewigt habe. Dafür erhielt er von Mathias Berger eine unvermutete, aber sehr ausdrucksvolle Ohrfeige, und dieser andererseits zog aus dem Vorfall die weise Lehre, daß es nicht gut sei, sich mit Schubiacks in einen literarischen Kampf einzulassen. –
Auf Betreiben des alten Kantors war Mathias Berger zum gesetzlichen Vormund über die beiden Kinder Heinrich und Magdalena Raschdorf bestimmt worden.
Einen Tumult gab es im Dorfe, als bekannt wurde, daß Berger für Heinrich Raschdorf das Gut kaufe und der[122] Knabe sich mit seiner Schwester »auseinandersetze«. Das Gut war abgeschätzt worden, nicht viel über die Gesamtschulden hinaus, die Heinrich Raschdorf übernahm. Das Mädchen erhielt eine geringe Summe ausgezahlt, die fest angelegt wurde.
»Wenn es uns besser geht, Lene,« sagte Mathias, »dann bekommst Du freiwillig, so viel wir Dir geben können. Jetzt dürfen wir den Hof nich noch mehr belasten, sonst können wir ihn nich halten.«
Das Mädchen verstand nichts davon; es war zufrieden, daß es auf dem väterlichen Gute bleiben durfte. –
Und um diese Zeit geschah es, daß Hannes abermals Prügel kriegen mußte. Das kam so:
Er hatte einem Rudel Jungen, das ihm den Spottvers von den »sechs Dreiern« in die Ohren sang, wütend und doch triumphierend zugeschrien, der Mathias Berger habe mehr Geld als die ganze »Lumpenpakasche« der Dorfleute, er hab' das ganze Dorf »gefünffingert«, denn er besitze 40- oder gar 100 000 Taler, und das habe kein Mensch gewußt. Und als die Jungen lachten, fragte er sie schnippisch, woher denn etwa mit solcher »Fixigkeit und Leichtigkeit« dem Schräger und dem Müller die Schulden bezahlt würden, wenn nicht der Mathias das Geld gäb'. Denn sonst borgte doch kein Mensch.
Diese Straßendebatte hatte drei Folgeereignisse:
1. Mathias Berger wurde zur Einkommen- und Kommunalsteuer herangezogen; 2. im Dorfe entstand eine neue, vielleicht überhaupt die stärkste Sensation, und 3. Hannes bekam Hiebe.
Das letzte Ereignis vollzog sich an einem trüben schwermütigen Märzabend in des Schaffers Stube. Der Vater war[123] sehr schweigsam dabei, der Sohn nicht. Nach der Katastrophe ging Hannes hinaus, starrte in das trübe Abendlicht und lehnte seinen verlängerten Rücken gegen eine kühle Mauer. Da kam die Lene über den Hof, sah ihn verächtlich an und sprach nur das eine Wort: »Quatschkopp«.
Damit warf sie ihm etwas vor die Füße. Es war der Ring, den er ihr ehemals verehrt hatte.
Hannes rührte sich nicht. Für seinen Kampfesmut so schmählich behandelt zu werden, hatte er nicht verdient. Er nahm sich fest vor, weder mit seinem Vater noch mit Mathias noch mit der Lene jemals im Leben wieder ein Wort zu reden, und dann kroch er in sein Bett und schlief mit wehem Herzen und ebensolchem Rücken ein.
Im Dorfe unten aber wurde nach drei Tagen eine romantische Mär erzählt. Irgendwo – den Ort wußte niemand genau – habe eine alte, sehr geizige Frau gelebt, die all ihr Lebtag gespart und sich eine große Menge Papiergeld in einen alten, wollenen Unterrock eingenäht habe. Niemand hätte von dem kostbaren Unterfutter des alten Rockes, den die Frau beständig auf dem Leibe getragen habe, etwas gewußt, selbst die eigenen Kinder nicht. Eines Tages sei die Frau plötzlich am Herzschlag gestorben. Der Rock sei nebst anderem wertlosen Zeug einem gewissen Lumpenmann verkauft worden, und das weitere könne sich jeder denken.
Von dieser Geschichte erfuhr Mathias Berger vorläufig nichts. Er wußte, daß die Sympathie, die er früher im Dorfe genossen, geschwunden war seit dem Tage, da er sich der Raschdorfschen Sache annahm. Er hatte sich in Widerspruch[124] gesetzt mit der öffentlichen Meinung, und das mußte er fühlen. Daß er einer ungeheuren Unehrlichkeit bezichtigt wurde, ahnte er nicht, freute sich vielmehr, daß sich die Leute schmerzlich den Kopf darüber zerbrechen würden, wie er zu so vielem Gelde gekommen sei.
Unterdes hatte er auch nicht Zeit, sich um das Gerede im Dorfe zu kümmern. Die riesige Arbeitslast, dem zerrütteten Buchenhofe wieder aufzuhelfen, lag auf seinen Schultern. Und da wuchs mit der Aufgabe seine Kraft. Zum erstenmal im Leben stand er so schweren Forderungen gegenüber, und sie stählten ihn.
Im zeitigen Frühjahr schon begann der Aufbau der Gebäude. Mathias Berger hatte einen tüchtigen, gewissenhaften Maurermeister gefunden, der sein Werk solid, rasch und billig herstellte.
Berger war von früh bis in die späte Nacht tätig. Jetzt war er in der Stadt zu Verhandlungen, jetzt stand er draußen auf dem Felde, jetzt saß er grübelnd und rechnend in der Stube, und dann stand er wieder unter den Handlangern und rührte Kalk ein oder trug Ziegel.
Ein Notstall wurde errichtet, die nötigen Ackerpferde gekauft, das Ackerzeug ergänzt, und die Feldarbeit konnte neu beginnen. Reichel, der Riese, arbeitete für drei. Aber er tat noch mehr. Er bot Mathias Berger seine Ersparnisse an, die sich auf ein paar hundert Mark beliefen.
»Reichel,« sagte Berger, »Dein Geld brauch' ich jetzt noch nich. Vielleicht später! Dann pump' ich Dich an, das versprech' ich Dir feierlich! Jetzt brauch' ich bloß Dich selber. Aber ganz notwendig, Reichel!«
Der Riese errötete über das Lob, das in diesen Worten lag, und arbeitete wieder, als ob er die Welt zusammenreißen wolle. Es war, als ob er seinen Charakter geändert habe, denn er tat alles mit einer großen Hast, wenn er ging und arbeitete, und ließ die majestätische Ruhe ganz außer acht, die sonst seinem Wesen eigen war.
Auch die Kinder halfen emsig nach ihren Kräften, und Hannes benahm sich in diesen Tagen tadellos, denn am Tage blieb ihm nicht eine Minute Zeit, Allotria zu treiben, und am Abend war er todmüde.
In all diesem emsigen Treiben fehlte nur Heinrich. Er war wieder auf der Schule. Ein paarmal schrieb er dringende Briefe, er wolle nach Hause, wolle helfen. Aber Berger, sein Vormund, ging darauf nicht ein. Er antwortete ihm kaum. Einmal nur schrieb er auf eine Postkarte: »Lieber Heinrich, sei Du nur so fleißig auf der Schule, wie wir hier alle sind, dann wird alles gut werden.«
So kam es, daß Heinrich trotz der heftigen Seelenerschütterungen, die seine Schülerarbeit gehemmt hatten, zu Ostern das Versetzungszeugnis als »Dritter der Klasse« nach Hause tragen konnte.
Auf dem Bahnhof holte den Knaben niemand ab. Es war kein Pferd übriggeblieben für die Fuhre. Aber da drüben hielt ein Wagen aus Heinrichs Heimatsdorfe. Ein Bauer holte irgend jemand von der Bahn. Heinrich stand mit seinem schweren Handkoffer da und wartete immer, ob ihn der Bauer nicht auffordern würde, mitzufahren. Aber der sagte kein Wort, und zu bitten schämte sich der Knabe. So fuhr der Bauer mit seinem halbleeren Wagen heim, und Heinrich[126] nahm den Koffer und machte sich schwerbeladen auf den Weg nach Hause.
Der Koffer zerrte an seinen Armen und Schultern. Aber dem Knaben war doch, als ob er an dem Herzen in der Brust noch schwerer zu tragen habe. Er kam das erstemal nach Hause seit dem Tode beider Eltern.
Wie schwer sich das ging! Schwer und ohne alle Freude. Er hatte auch jetzt keine Begierde, die Veränderungen zu sehen, die seitdem gemacht worden waren. Es waren schon zu viel Veränderungen für eine Heimat.
Als er den Buchenhof sehen konnte, blieb er tiefatmend stehen. Dann begann er heftig zu weinen. War er dort unten zu Hause? War das wirklich der Ort, nach dem er sich in seinen Heimwehstunden gesehnt hatte? Oder war er nicht in die Irre gegangen, war das nicht die Fremde?
Wenn sein Vater jetzt dort unten ginge und nur einmal hinaufnickte, das wäre schön.
Aber dort war der Kirchhof. Dort lagen Vater und Mutter. Dorthin mußte der Heinrich gehen, wenn er nach Hause kommen wollte.
Und die Tränen des Kindes flossen reichlicher.
Da erhob sich etwas vom Straßenrande, ein Stückchen den Weg hinunter, und kam rasch auf Heinrich zugelaufen. Es war Lotte Schräger.
»Guten Tag, Heinrich! Guten Tag! Ach, ist das schön, daß Du kommst! Siehst Du, ich hab' einen Strauß gemacht. Da – nimm ihn! Warum sagst Du denn nichts? Gefällt er Dir nicht? Es gibt jetzt noch keine hübscheren Blumen.«
»O ja, Lotte, er ist sehr schön. Wo kommst Du denn her?«
»Ich hab' gewußt, daß Du kommst. Und es hat Dich doch niemand abgeholt, da wollt' ich Dir ein bißchen entgegengehen.«
Er wurde verlegen.
»Na ja, Lotte, da seh' ich doch jemand, den ich kenne.«
»Komm, ich werd' Dir den Koffer tragen. Oh, is der schwer!«
»Laß, Lotte, den Koffer kannst Du nicht tragen, den trag' ich selber!«
»Na nu, mal weg mit der Hand! Ich trag' den Koffer! Du mußt ja schon schrecklich müde sein!«
»Lotte, es geht nicht! Laß mich wenigstens am Henkel mit anfassen, da wird's besser gehen!«
So einigten sie sich und trugen den Koffer miteinander den Weg entlang.
Der Frühling lachte aus dem Walde heraus, und Heinrich Raschdorf ward auf einmal wohl ums Herz. Die Bangigkeit war verschwunden, und wie durch ein Wunder war die Ferienfreude in sein Herz eingekehrt.
»Lotte, ich freu' mich so, daß ich Dich getroffen habe.«
Das Mädchen sah ihm unschuldig ins Gesicht und lachte.
»Ja, sieh mal, Heinrich, das ist halt, weil ich doch eigentlich Deine Braut bin. Weißt Du noch damals vom Feuer?«
»Ich weiß es noch!«
Der Knabe war rot geworden. Er war schon reifer als das Kind, und es ging ihm jetzt wie eine langsame Lähmung durch die Glieder. Er hatte immer jene Mitschüler für schlechte Subjekte gehalten, die davon redeten, daß sie eine »Flamme«[128] hätten. Es waren so fünf bis zehn Stück davon in der Klasse. Und ein paar machten sogar Gedichte. Herauskommen durfte so etwas nicht, da wäre einer einfach »abgesägt« worden. Eine schlechte Nummer wäre das mindeste gewesen.
Eine Angst packte Heinrich, ohne daß er doch ein heimliches Glücksgefühl los wurde. Und der junge Herkules wußte gar nicht, daß er da mit seinem Koffer auf einem Scheideweg herumlief.
Lotte begann wieder zu reden.
»Jetzt nach Ostern komm ich auch auf die Schule. In eine Höhere Töchterschule. Weißt Du, Stunden hab' ich ja schon viel gehabt, auch im Französischen, aber jetzt soll ich nu die richtige Bildung lernen. Vielleicht auf vier Jahre komm ich fort.«
»So, so, Lotte. Da wirst Du ja eine feine Dame werden.«
»Ja, der Vater will's. Viel Spaß macht mir's nicht. Aber ich denke, wenn Du doch so viel lernst, da muß ich auch nicht so dumm sein, wenn wir uns schon einmal heiraten.«
Das Mädchen ging von seinem Eheprojekt nicht ab.
»Du hast doch niemand was erzählt, Lotte?« fragte Heinrich ängstlich.
»Soll ich nicht?«
»Nein, Lotte, Du darfst nichts erzählen – niemand! Hörst Du – niemand: Das paßt sich nicht!«
»Das paßt sich nicht?«
Das Mädchen wurde nachdenklich. Zum ersten Male kam ihr ein dumpfes Bewußtsein, daß es sich hier um etwas handele, was niemand wissen dürfe. Und das tat ihr leid.
»Aber – aber so einen niedlichen Ring könntest Du mir auch schenken.«
Dem Knaben wurde schwül, und er sah sich ängstlich um, ob auch niemand in der Nähe sei.
»Ich möchte schon, aber ich hab' keinen, und wenn's geht, schenk' ich Dir einen.«
»Ach, da würd' ich mich aber freuen, Du! Schrecklich tät ich mich freuen!«
Heinrich begann ein alltägliches Gespräch, und das setzten sie fort, bis sie sich eine Strecke vom Buchenhofe entfernt verabschiedeten.
Unterm Hoftor blieb Heinrich stehen. Er kannte das väterliche Gehöft kaum wieder. Vieles war verändert. Eine Menge Baumaterialien war im Hofe aufgeschichtet und eine Schar Arbeitsleute war geschäftig tätig.
Abseits an einer Mauer saßen Hannes und Lene. Sie hatten ein jedes einen Hammer in der Hand, und damit schlugen sie Kalk los von alten Ziegeln.
Als sie Heinrich sahen, kamen sie rasch auf ihn zu. Mit herzlicher Freude begrüßten sie den Heimkehrenden.
»Jesses,« schrie Hannes, »nu hat niemand an den Koffer gedacht. Na, da haste gut schleppen können. Gib mal her! Schwerleck, der zieht! Na, siehste, Heinrich, Du mußt nich immer so viel Bücher reintun, denn sie sind schwer, und pauken tuste in den Ferien doch nich!«
»Von wem haste denn den Strauß?« fragte Lene.
Heinrich wurde rot und suchte nach einer Ausrede. Aber dann sagte er mit möglichstem Gleichmut:
»Ach, ich hab' die Schräger Lotte getroffen, und die hat ihn mir geschenkt!«
»Die Schräger Lotte?« fragte Lene streng.
»Die Schräger Lotte?« wiederholte Hannes entrüstet. »Na, ich danke, mit der gibst Du Dich noch ab und läßt Dir Sträuße schenken? Das hätt' ich nich von Dir gedacht!«
»Aber was – was ist denn?«
Hannes und Lene sahen sich an.
»Er weiß noch nich. Na, ich werd' Dir's sagen, Heinrich. Rat' mal, wo unser Mathias is!«
»Unser Mathias? Zu Hause! Wo sonst?«
Die Lene trat ganz dicht an ihn heran und flüsterte ihm ins Ohr:
»Im Gefängnis is a!«
»Im Gefängnis – das ist nicht wahr!«
»Ja! Der Schräger hat'n verklagt, und da hat a zehn Tage gekriegt. Wegen der Beleidigung!«
Der Knabe stand wie erstarrt.
»Na, und Du läßt Dir von der Lotte 'n Strauß schenken?«
Heinrich konnte kein Wort sagen, kein armseliges Wort. Ein Stückchen Heimat hatte sich vor ihm aufgetan, als er mit dem Nachbarskinde vorhin wanderte. Und das wurde ihm so grausam wieder genommen.
»Seit wann ist er fort?« brachte er endlich heraus.
»Heute is der vierte Tag. A hat sich gerade über die Feiertage einsperr'n lassen, daß a dann wieder mit arbeiten kann. Na siehste, die Schrägerleute, das sind eben alles Lumpe.«
Jenseits des Hoftors schallte eine krächzende Stimme:
»Eingesperrt – eingesperrt! – Sechs Dreier und einen Hund, einen großen Hund!«
»Das ist der Gustav, das blödsinnige Heft! – Da! Hier habt Ihr Euren Mist wieder!«
Und Hannes riß Heinrich den Strauß aus der Hand und schleuderte ihn über das Tor.
»Was machst Du, Hannes, was –«
Aber draußen schrie der Idiot schon wieder: »Blumen! Blumen! O, schöne Blumen! A Pukettel! A Pukettel! Ich putz mich! Ich mach mich fein! Sechs Dreier und einen Hund – einen gro–o–o–ßen Hund!«
Damit verschwand er singend im Kretscham.
Heinrich stand mit gesenktem Kopfe da.
»Unser Mathias! Aber das war doch nicht recht, Hannes! Die Lotte kann doch nichts dafür.«
Die Antwort gab seine Schwester Lene.
»Das is ganz egal! Von den Schrägerleuten darfst Du keinen Strauß nehmen. Das paßt sich nicht!«
»Du wirst doch nich etwa zu den'n halten! Das hätt' sich der Mathias gerade verdient. Na komm, Lene, wir müssen wieder Ziegeln abkratzen. Geh nur in die Stube, Heinrich.«
Die Kinder gingen fort, und Heinrich nahm den Koffer und trat ins Haus.
Niemand war in der großen Wohnstube. Leer und einsam lag das Zimmer. Da fühlte Heinrich Raschdorf, daß hier die Heimat nicht mehr war.
Müde sank der Gast auf einen Stuhl und stützte sich auf den Tisch. Und so saß er ohne klare Empfindungen. Nur eine große Bangigkeit war in ihm.
Er hatte wohl auch Hunger. Aber es kam niemand, ihn zu fragen, ob ihm etwas fehle.
Der Lehnstuhl der Mutter stand am Fenster – leer. Zuguterletzt ging Heinrich mit zagen, scheuen Schritten näher und setzte sich in den Stuhl. Das Gesicht preßte er gegen die Lehne.
Und auch in dem Stuhle war nicht die Heimat. Nur eine wilde, quälende Sehnsucht kam, indes es draußen langsam dunkelte.
Drüben über der Straße ging indes eine Kindheit unter.
Die Kindheit Lottes.
Wer von allen weiß, wie lange Kindheit dauert? Bei manchen Wesen ist sie früh verloren; bei manchen dauert sie das ganze Leben.
Wer ein Wissender wurde, ist kein Kind mehr. Nur die sind Kinder, die vor den verschleierten Bildern des Lebens wunschlos stehen und nicht fragen.
Wer mit zweifelnder Hand den Schleier hob, oder wem ein Sturm die großen, öden Bilder enthüllte, der ist weit von der Kindheit.
Und wer weit von der Kindheit ist, ist nahe dem Tode.
Die Scham war diesem Mädchen gekommen wie ein dunkelrotes Licht, das ein trübes Erkennen brachte, das Erkennen, daß Lieb' und Treue gemißhandelt werden können.

Drei Jahre später. Die Osterglocken läuteten genau so wie damals, als der Buchenhof wieder aufgebaut wurde. Ganz derselbe Akkord! Ganz dasselbe Osterlied. Nur ein neuer Kantor ging vor der singenden Menge; der andere war bei der stillen, großen Zuhörerschar, die ungesehen hinter der frühlingsgrünen Rasengardine nach Auferstehungsliedern lauscht.
Vorweg im kirchlichen Zuge gingen die Musizierenden, dann kam der Priester mit seiner Begleitung und dann die Gläubigen in Reihen zu fünf oder sechs Leuten.
Eine solche Reihe bestand aus Heinrich und Lene Raschdorf, Mathias Berger, Liese, dem Schaffer und seinem Sohne Hannes.
Die Buchenhofleute gingen immer für sich. Sie vermischten sich mit den anderen nicht.
Früher waren sie mit bei der Musikkapelle gewesen, jetzt schon lange nicht mehr. Sie waren einmal beleidigt worden.
»Das ist kein Schade,« hatte der Mathias damals gesagt, als er mit seiner Trompete nach Hause kam, die sonst auf dem Chor neben der Orgel hing, »gar kein Schade, denn die Sänger und Musikanten sind die unandächtigsten Leute in der ganzen Kirche. Wenn sie musizieren, da haben sie bloß immer aufzupassen, daß sie nich aus 'm Takt kommen, und könn'n an a Herrgott nicht denken, und wenn Pause is, da schnaupen sie sich die Nasen aus oder quatschen miteinander. Na, ich sage: Wenn der Herr Jesus mal auf so 'n Chor käm', der schlüg' manchem die Baßgeige um die Ohren.«
»Is richtig,« hatte der Schaffer gesagt und sonst nichts, hatte aber auch damit seine künstlerische Stellung als Paukenschläger begraben.
Am nächsten Sonntag aber, als Reichel mit Mathias in der Kirche unten im Schiff saß, schlief er ein. Da sagte Mathias auf dem Heimwege, für den Schaffer wäre das Paukenschlagen immer noch der allerbeste Gottesdienst.
Nach der kirchlichen Feier an jenem Ostermorgen gingen die Buchenhofleute miteinander heim.
Sie waren sehr fröhlich, denn es ging ihnen gut. Heinrich war nun endgültig von der Schule zurück. Er hatte die Berechtigung zum Einjährigen-Dienst erworben, und Mathias Berger war zufrieden mit ihm. Heinrich war ein hochgewachsener, etwas blasser, aber hübscher Bursche geworden.
»Nun kann's gehen, wie's will, Heinrich, nu find'st Du immer 'ne Stelle.«
Übrigens ging es gut. Der Hof war völlig neu eingerichtet, und ein paar günstige Jahre sowie Fleiß und Anspruchslosigkeit,[136] die keiner Steigerung mehr fähig waren, hatten zuwege gebracht, daß Mathias Berger nicht nur die Zinsen pünktlich bezahlen konnte, sondern immer neue Verbesserungen im wirtschaftlichen Betrieb anlegte, wenn er auch vorläufig noch kein Geld sparte.
Wenn ihn aber Heinrich fragte, ob er sich auch gewissenhaft die Zinsen für sein eigenes Kapital nähme, wurde er immer verstimmt und sagte:
»Möchtest mir wohl auch gern Lohn geben wie einem Großknecht? Sei nur still! Ich komm schon zu meiner Sache, wenn's erst besser geht. Später rechnen wir ab. Ich schreib' alles auf. Und weißt Du, was ich brauche, nehm' ich mir, und meiner Schwester und der Liese schick' ich Milch und Butter, Kartoffeln und Speck. Das sind genug Zinsen.«
Nun trug sich Mathias Berger mit großen Plänen. In einem Hügel, der zum Buchenhof gehörte, hatte er ein Lehmlager entdeckt. Also wollte er eine Ziegelei anlegen und erhoffte von dieser reichliche Erträge. Nur klug und vorsichtig müsse man es anfangen. Jedenfalls sei die Sache bei der regen Bautätigkeit, die im Kreise entfaltet werde, durchaus aussichtsvoll. Als Anlagekapital wollte Mathias Berger seine letzten 7000 Mark zu Hilfe nehmen.
»Und wenn das Geld verloren geht, wenn wir pleite werden, wenn Du stirbst, was wird dann aus der Liese?«
Bergers Gesicht verfinsterte sich etwas.
»Aus der Liese?! Na ja! Aber sieh mal, da muß sie halt arbeiten – wie wär's, wenn ich das Geld nicht gewonnen hätte? Und dann is vom Pleitewerden gar keine[137] Rede. Geht der Krempel nicht, hör'n wir zur rechten Zeit auf!«
Heinrich dachte nach.
»Jawohl, und ich würde ja auch die Liese nicht verlassen, ich würde alles tun für sie – alles!«
Da leuchteten Mathias Bergers Augen. Es lag ein eigener Osterglanz darin. Und er drückte Heinrich stumm die Hand.
Der aber sah den Weg hinauf.
Dort ging im jungen Morgenlicht eine schlanke, feine Mädchengestalt. Sie trug ein lichtes Kleid und einen ganz modischen Hut.
Neben ihr ging ein junger Bursche, und vornweg trollte der Idiot. –
»Du,« sagte Hannes zu Lene, die auch miteinander gingen, »eigentlich ist doch die Schräger Lotte a sehr hübsches Mädel geworden.«
Lene antwortete nicht.
»Na, ich sag' ja, Lene, Du bist ja auch ganz hübsch, wenn Du och nich so fein und klug bist. Und was die Hauptsache is, Du bist doch viel kräftiger als wie die Lotte.«
Das hielt Hannes für eine Schmeichelei. Die Lene aber fuhr ihn zornig an, daß er es für ratsamer hielt, sich Heinrich anzuschließen, der indes langsam herankam.
»Was ist denn los? Ihr habt Euch wohl wieder gezankt? Könnt Ihr Euch denn nicht vertragen?«
»Nee, dazu is die Lene zu grob. Sie hat keene Bildung! Am besten is, ich red' überhaupt nich mehr mit ihr.«
»Was habt Ihr denn wieder mitsammen?«
»Ach, ich hab' bloß gesagt, daß mir die Lotte gefällt, und da is se wahrscheinlich eifersüchtig oder so was.«
Heinrich sah vor sich nieder auf den Weg.
»Damals hattest Du Lottes Strauß auf die Straße geworfen, alter Freund. Weißt Du, daß sie seit der Zeit nie mehr mit mir gesprochen hat?«
»Ja. Aber im Grunde genommen is 's ja besser so. Freundschaft könn'n wir doch mit a Schräger-Leuten nich halten. – Sieh mal a jungen Riedel! Ich globe, der will se poussier'n. A lauft alle Tage zum Schräger. Na, das wär' auch, als wenn sich der Ochse mit 'm Kanarienvogel verheiratete!«
In diesem Augenblick wandte sich Gustav Schräger um und brüllte aus vollen Lungen den Bergweg herunter:
Man hörte den jungen Riedelbauer lachen, während Lotte den Idioten offenbar scharf zur Ruhe wies. Da blieb er hinter ihr und ihrem Begleiter zurück, drehte sich von Zeit zu Zeit um, drohte mit der Faust nach den Buchenhofleuten oder warf Steine den Weg herab.
»A wird immer blödsinniger,« sagte Hannes. »Aber das Versel vom Barbier kann a immer noch. 's is das einzige, was a auswendig kann. Na, und sein Vater is bald nich mehr klüger wie er.«
»Du mußt nicht so reden, Hannes.«
»Na, Du hast eben keine Ahnung, Heinrich, wie der Schräger sauft. Alle Tage is a besoffen, manchmal schon[139] frühmorgens. Und weißte, das is komisch: a sauft gerade seit dem Tage, wo Deine Mutter gestorben is.«
»Wieso?«
»Früher hat doch der Schräger kaum amal genippt, und an dem Tage, wo Deine Mutter frühmorgens starb, da war a mittags schon so besoffen und hat so gelärmt im Kretscham, daß man's bis bei uns gehört hat. Weißte, was Mathias sagt? Das is das böse Gewissen! Das will a totsaufen!«
»Das kann kein Mensch behaupten.«
»Behaupten wird's der Mathias nich mehr, dafür hat a ja zehn Tage gekriegt. Weißte noch, jetzt sind's grade drei Jahre. Das war a schlechtes Osterfest. Der Mathias kann alles vergessen, aber daß a hat sitzen müssen, das frißt an 'm. Deswegen is a auch bloß mit a Leuten im Dorfe nich mehr gutt. Die geh'n nu amal doch zum Schräger, und den Schräger kann a nich leiden.«
»Eigentlich ist es schlimm, daß wir uns mit den Leuten nicht vertragen, aber ich hoffe, daß es doch mal besser werden wird!«
»Da kannste lange hoffen! Wenn wir jetzt erst noch Ziegeleibesitzer sind, da fressen sich die Leute selber uff vor Neid. Denn im Grunde genommen nehmen sie's uns doch bloß übel, daß wir damals nich pleite geworden sind. Wenn Dein Vater eingesperrt worden wär', und die Wirtschaft hätte der Schräger, und Du wärst Knecht, da wär'n Dir die Leute ganz gutt. So aber nich!«
Heinrich seufzte. Hannes fuhr fort zu reden.
»Und was haben sie alles gesagt: Dein Vater hat angezünd't oder Du! Ja, ja, guck nur! Das sagen sie immer[140] noch. Zwar nich laut, denn da setzt's ja zehn Tage, aber sie sagen's. Du oder Dein Vater, oder beide! Und dann, daß a sich erschossen hat. Und von Deiner Mutter und vom Mathias –«
»Hör' auf, Hannes, hör' auf! Ich mag nichts mehr hören davon!« – – – –
Ein Stückchen weiter den Weg hinauf sagte Lotte Schräger zum jungen Riedel: »Es ist doch unrecht von den Dorfleuten, daß sie so garstig zu den Raschdorfs sind.«
»Unrecht, hä! Zu solchen Feuermachern und Selbstmördern?!«
»Wer kann das beweisen? Kein Mensch!«
»Beweisen! Hä! Das Gericht freilich nich. Aber wir wissen's alle. Und der Berger. Wo hat a denn das Geld her? 40 000 Mark a Lumpenmann! Was?«
»Das weiß ich nicht.«
»Nee, das weeß keen Mensch, das weeß a bloß selber. Da müßt' sich's Gericht drum bekümmern; aber darum schert sich keen Teufel. Zu knapper Not, daß a damals was aufs Maul kriegte, wie a 's Deinem Vater in die Schuhe schieben wollte, ein'm Manne, der überhaupt nich aus der Stube gekommen is. Das sind feine Leute, was?«
Lotte schwieg.
»Na, und dann – a hat die Raschdorfen geküßt. Die Glasen hat's gesehen. Und das, während der Hof brennt in der Nacht. Feine Leute!«
»Riedel, bitte, nicht – nicht so was –«
»Und warum interessiert a sich denn gar so sehr für den Heinrich? Warum nimmt a weder Lohn noch Zinsen?«
»Das kann ich nich sagen.«
»Na, und der alte Raschdorf hat mit kein'm Menschen Freundschaft gehalten, und die jetzt scheinen auch drauf zu warten, daß sie's ganze Dorf um Verzeihung bitten kommt. Hol' der Teufel die hochnäsige Bande!«
»Riedel, ich leid' solche Redensarten nicht.«
»Leid'st sie nich? Na, da – da kann ich wohl gehen, da kann's ja die Schräger-Lotte mit a Buchenhofleuten halten. Aber der studierte Heinrich, der gefällt vielleicht der Lotte, da hält sie's lieber gegen a Vater –«
»Riedel, das leid' ich nicht! Solches Gerede paßt sich nicht, überhaupt auf dem Kirchwege! Da geh lieber!«
Der Bursche sah mit finsterem Gesicht auf den Boden. Zwanzig Schritte weit ging er noch mit, dann bog er in einen Feldrain ein. Lotte ließ ihn gehen und schritt ernst weiter. Der Idiot aber schlich dem jungen Riedel nach.
»Du,« sagte er tückisch, »wir werden sie schmeißen!«
Riedel antwortete ihm nicht, aber er blieb stehen. Indessen kamen Heinrich und Hannes näher, ein Stück dahinter Mathias und Lene. Der junge Riedel sah Heinrich herausfordernd an. Dann lachte er roh und rief laut herüber:
»Die Schräger Lotte möchte lieber mit a Buchenhofleuten gehn!«
»Die Schräger Lotte läßt a Herrn Raschdorf schön grüßen, und sie möchte gern seine Liebste sein!«
Heinrich blieb erschrocken stehen und wurde feuerrot.
»Ja,« fing der junge Riedel wieder an, »und sie nimmt ihm gar nischt übel, nich a Brand und rein gar nischt!«
»Riedel! Ich – ich –« Heinrich ging ein paar Schritte auf den rohen Burschen zu und blieb dann stehen. Er schämte sich, tätlich zu werden. Riedel hielt das für Feigheit.
»Oho, komm nur her, fang' nur an; Du bist mir gerade recht!«
Da kam der Schaffer. Er ging schweigend auf Riedel zu. Der stand verlegen still, denn den Schaffer fürchtete er.
»Mit Ihnen hab' ich nischt,« sagte er halb trotzig und halb beklommen. Darauf bekam er keine Antwort.
Der Schaffer faßte ihn an beiden Schultern und kommandierte: »Kehrt!« Damit drehte er den jungen Mann mit einem gewaltigen Ruck um, gab ihm einen freundlichen Stoß in den Rücken und sagte: »Marsch!«
Der junge, starke Bauer kochte vor Wut. Aber es nützte nichts; diesem Riesen war er bei weitem nicht gewachsen, und so mußte er einen Schritt vor ihm hermarschieren den Berg hinab, wenn er nicht das Schlimmste gewärtigen wollte.
Jedesmal, wenn er sich widersetzen oder stehen bleiben wollte, bot ihm der Schaffer in gutmütigem Tonfall eine riesige Tracht Prügel an.
Und so mußte er gehen und konnte nur schimpfen, denn wenn er geprügelt worden wäre, das wäre eine zu große Schande gewesen.
Als sie ein großes Stück gegangen waren, sagte Reichel:
»'s is heiliger Tag heute! Da soll man nich brüll'n, nich schimpfen und überhaupt keene Stänkerei machen!« Mit dieser Ermahnung verließ der tapfere Christ den wütenden jungen Riedel und ging schweigend zurück.
Hannes hatte sich indessen aus hellem Vergnügen über das Bravourstück seines Vaters lang auf den Wiesenrain geworfen und mit Füßen die Erde getrommelt. Diese Beifallskundgebung trug ihm einen häßlichen Fleck auf seinem neuen Sommeranzug und außerdem das bedrückende Bewußtsein ein, daß er für seine Leute nicht Partei ergreifen dürfe, ohne Schaden zu nehmen. Und es blieb ihm nichts übrig, als vorläufig auf das Benzin und auf die Zukunft zu hoffen.
Fünf Tage nach diesem Ostermorgen begann Heinrichs Tätigkeit als Bauer.
O du liebe, schwere Zeit!
Eine Mahnung sollte jeder verständige Mensch beherzigen: Wenn du geeignet bist, lateinische Schriften mit Geschick zu übersetzen und algebraische Aufgaben mit Richtigkeit zu lösen, so unternimm es nicht, Pferde anzuschirren, sonst kannst du an all deinen Talenten irre werden und andere auch.
Hannes stand als Lehrmeister neben Heinrich, der sich bemühte, einen Ackergaul anzuschirren. Der junge Magister war schlechter Laune.
»Heinrich, Du bist einfach 'n tapriger Hering. Hierum kommt der Riemen! Hier mußte festschnallen! Nu, Mensch, siehste denn die Schnalle nich? Nich zu locker! So, in das Loch! Herrjeh, Kerl, wenn Du als Primus schon so tumm bist, wie mögen erst die andren sein!«
»Bitte, Hannes, red' nicht so viel!«
»Da soll einer nich reden! Sieh ock, wie sich der Schimmel umguckt! Der lacht sich eens über Dich! Nanu a Zaum[144] einmachen! Fürcht' Dich ock nich! Der Schimmel beißt nich; höchstens Haber! Geh weg, ich mach' a Zaum selber ein, das wär' mir a Gegratsche! Mach derweile a Mist aus a Hufen raus.«
»Was soll ich?«
»A Mist aus a Hufen rausmachen!«
»Womit denn – womit soll ich denn, Hannes?«
»Womit? Schafkopp! Mit a Händen! Mit was denn sonst?«
»Pfui, das ist schrecklich unappetitlich!«
Hannes schüttelte über seinen talentlosen Schüler melancholisch den Kopf.
»Unappetitlich! Mensch! Als wenn da was zum Essen wär'! Na, da sieh mal her, so macht man a Mist aus a Hufen raus, schmeißt 'n natürlich weg und wischt sich an a Hosen die Hände ab. Möcht' ich wissen, was dabei unappetitlich is!«
Heinrich sagte gar nichts; er seufzte nur schwer. Dann bestieg er mit Hannes den Ackerwagen, und sie fuhren hinaus aufs Feld. Er selbst behielt die Zügel.
Wie sie ein Stückchen draußen waren, bückte sich der Schimmel nach dem Wegrain und fing an zu grasen, während er den Wagen langsam, sehr langsam hinter sich herzog. Heinrich ließ ihn gewähren, denn er meinte, solch ein Gebahren sei bei den Ackerpferden allgemein üblich.
Hannes aber saß stumm neben ihm mit verhaltenem Zorn und schwerer Verachtung. Nach einer Weile hielt er's aber nicht länger aus und er seufzte zynisch:
»Na, da werden wir ja hoffentlich zu Mittage draußen sein.«
Heinrich schrak aus seinen Träumen empor und wackelte energisch mit der Leine. Der Schimmel ließ sich dadurch nicht stören, sondern streckte gerade seine lüsterne Zunge nach einer frisch aufgeschossenen Maiblumenstaude aus – da hieb ihm unvermutet der Hannes die Peitsche über den Rücken, daß er aufzuckte und sich in eine für sein Temperament verblüffend schnelle Gangart setzte.
Leider geschah es, daß Heinrich über den Hieb noch heftiger erschrak als der Schimmel, und daß ihm deshalb die Leine entglitt, die nun unten auf der Erde einherschleifte. Und in dieser für einen Kutscher sehr trostlosen Verfassung begegnete das dahinsausende Gefährt dem Barbier.
Der schlug ein Gelächter an und ging dann schnell dem Buchenkretscham zu. –
Auf dem Felde draußen sagte Hannes finster:
»Du plamierst ein'n kolussal!«
Heinrich wußte nichts zu erwidern. Da war er nun der Herr und Besitzer des Buchenhofes, hatte mehr gelernt als alle anderen Bauern und wußte nicht einmal einen fetten Gaul zu regieren.
Und nun kam die schwierigere Aufgabe. Heinrich sollte pflügen lernen. Hannes spannte den Schimmel an den Pflug und sagte:
»Den Rand mach' ich! Das is zu schwer für Dich. Geh mal nebenher und paß auf! So – also so wird der Pflug gehalten. Fest muß man ihn halten, sonst springt a raus. Und 's Pferd muß immer'n Fuß breit weg von der Furche gehn. Jüh!«
Aufmerksam schritt Heinrich neben dem Pfluge einher. Er gab genau acht, und die Sache erschien ihm kinderleicht.[146] Hannes machte allerlei Kunststückchen; er überbot sich in technischen Ausdrücken, namentlich in den direkten Anreden, die er an das Pferd richtete, und ließ bald die rechte, bald die linke Hand von den Holmen los, wie ein eitler Radler auf der Straße, wenn er den Passanten zeigen will, wie sicher er seiner Sache sei.
Indessen kam Heinrich in eine schwermütige Stimmung. Seine Gedanken flogen hinab nach Breslau. Heute begann das neue Schuljahr. Die Ober-Sekunda! Jetzt mußte eigentlich alles erst recht interessant werden. Der Ordinarius in Ober-Sekunda war bekannt als tüchtiger Lehrer. Ach, er durfte seinem Unterricht nicht lauschen; er mußte pflügen lernen, mußte stumpfsinnig die Furchen entlang gehen, immer hin und her ohne alle Abwechslung, ohne jedes bißchen Geist.
Aber er hatte es ja doch so gewollt; er hatte um jeden Preis in der Heimat sein wollen.
Und wieder dachte er nach, was für eine Bewandtnis es um die Heimat habe.
»Na, nu kommst Du dran, Heinrich; nu nimm Dich aber zusammen!«
Heinrich trat an den Pflug, und sein Gesicht war so rot, als ob ihm eine schwierige Examenaufgabe gestellt worden sei, von deren guter Lösung alles abhing. Krampfhaft fest faßte er die Holmen des Pfluges.
»Los!« sagte er mit erregter Stimme.
»Los versteht der Schimmel nich,« korrigierte Hannes; »jüh mußte sagen.«
»Jüh!«
Das Pferd zog an. Ein paar Schritte ging es. Heinrich taumelte hinter dem Pfluge hinüber und herüber wie ein Betrunkener; schließlich flog die Pflugschar aus der Erde heraus, der Pflug fiel um, und Heinrich sprang beiseite, um nicht geschlagen zu werden.
Der Schimmel blieb verdutzt stehen und schaute sich mitleidig um. Hannes aber zuckte empört die Schultern.
»Schweinisch, sag' ich, einfach schweinisch!«
Das war seine Kritik, dann zog er den Pflug zurück, verbesserte die »verhunzte Furche«, fuhr bis auf die Mitte des Ackers und bot Heinrich abermals den Pflug an.
Ach, der Erfolg war nicht besser als vorher. Hannes schimpfte, und über Heinrich kam tiefe Verzagtheit.
»Es geht nicht, Hannes, es geht absolut nicht.«
Hannes steckte sinnend die Hände in die Hosentaschen.
»Heinrich, ich glaube, Du wirst a ganz miserabler Pauer werden.«
Das fürchtete Heinrich auch, und die Frage, ob es nicht besser für ihn gewesen wäre, bei den Büchern zu bleiben, tauchte ihm schon an diesem ersten Tage seiner Bauerntätigkeit auf.
Trotzdem nahm er mit großer Energie immer wieder das Geschäft des Pflügens auf, und einmal gelang es ihm, eine ganze Furche entlang zu fahren. Da rötete sich sein Gesicht vor Freude. Als er aber den Pflug umwenden wollte, um zurückzufahren, geschah ein Unglück. Er setzte sich das schwere Ackergerät heftig auf den Fuß. Laut auf schrie er, warf den Pflug hin und setzte sich an den Feldrand.
Wieder wandte sich der Schimmel um und machte eine so undeutliche Miene, daß niemand wissen konnte, ob sie Mitleid oder Ironie bedeute.
Hannes kam mit langen Schritten heran und besah sich den blutenden Fuß, von dem Heinrich indessen den Stiefel gezogen hatte. Zorn und Mitleid kämpften in ihm.
»Das allerbeste is, Du gehst nach Hause. Das is ja lebensgefährlich für Dich!« –
»Du – dem Großbauern blutet der Fuß. A hat sich gewiß a Pflug drauf gesetzt. Na und die Furche, sieh mal, die hat a gemacht.«
Darauf ein schallendes Gelächter.
Drüben am Wege standen der Barbier und der junge Riedel.
Heinrich wandte sich ab vor Scham. Hannes aber, der die beiden Männer auch nicht hatte kommen sehen, da das Ackerfeld hinter einem kleinen Erlengebüsch lag, knirschte vor Zorn.
»So 'ne lausige Plamage! Nu haben die Kerle zugesehn!«
Aber dann wandte er sich nach dem Wege hinüber:
»Macht, daß Ihr fortkommt! Das hier geht Euch gar nischt an. Der Raschdorf Heinrich hat mehr Verstand in einer großen Zehe als Ihr in der ganzen Figur, die Mütze noch mitgerechnet.«
»Nu, so ein Lausejunge!«
Der Barbier und Riedel kamen übers Feld.
Hannes ergriff die Peitsche.
»Heinrich, Du nimmst a Barbier, ich nehm' a Riedel!«
Heinrich sprang auf. Mit dem blutenden, nackten Fuße stand er auf dem schwarzen Boden. Aber er stand stolz und herrisch da.
»Zurück! Das ist mein Grund und Boden! Ich verbiete Euch, daß Ihr ihn betretet.«
Die beiden Störenfriede blieben stehen.
»Das is Hausfriedensbruch!« schrie Hannes. »Dafür setzt's Kittchen!«[1]
[1] Gefängnis.
Sie stutzten. Sie glaubten das von »Hausfriedensbruch« und kehrten um mit der Drohung, der Hannes laufe ihnen schon noch in die Hände.
Dann machten sie noch ein paar hämische Bemerkungen und gingen nach dem Dorfe.
Dort entstanden dem landwirtschaftlichen Erstlingswerk des jungen Buchenbauern zwei üble Kritiker. –
»Nu werd' ich den Schimmel einspannen und Dich nach Hause fahr'n. Laufen wirste wohl nich können.«
So geschah es. Als Hannes wieder aufs Feld zurückkam und nun den Acker in prächtigen, geraden Furchen pflügte, dachte er jedesmal, wenn er voll Freude sein Werk betrachtete:
»Bloß gut, daß ich nie aufs Gymnasium gegangen bin.«
Der junge Buchenbauer aber saß trostlos daheim in seiner Stube. Die Liese verband ihm den Fuß.
Mit zärtlicher Sorgfalt wusch sie die Wunde, und als sie den heilsamen Arnikasaft darauf goß, sah sie ängstlich[150] nach Heinrich, ob es ihm auch nicht zu große Schmerzen verursachte.
Mit geschickten Fingern legte sie den Verband an.
Heinrich betrachtete das zarte, hübsche Mädchen. Sie war jetzt siebzehn Jahre alt. Lichtblondes Haar fiel gescheitelt um die reine, weiße Stirn. Das Gesicht war etwas blaß.
Heinrich dachte daran, wie zärtlich Mathias dieses Mädchen liebte, und er nahm sich vor, all sein Leben lang freundlich zur Liese zu sein. Das, meinte er, erfordere schon die Dankbarkeit gegen Mathias, seinen großen Wohltäter.
Und dieser Gedanke, daß Mathias sich freuen würde, wenn er gut und lieb zur Liese wäre, faßte ihn stark zu dieser Stunde. Bisher hatte er kaum daran gedacht. Jetzt ward ihm die hohe Pflicht inne.
Er strich dem knienden Mädchen sanft mit der Hand über den Scheitel.
»Du bist so gut zu mir, Liese. Ich danke Dir!«
Da sah sie ihn an mit strahlenden Augen, und ihre blassen Wangen färbten sich ein wenig rot.
»Ich tue es gern,« sagte sie schlicht.
In diesem Augenblick sah Mathias zum Gartenfenster herein. Einen Augenblick betrachtete er die beiden, dann trat er lautlos zurück.
Im Garten lehnte er sich an einen Baum. Die ersten Knospen waren aufgesprungen und schauten ihn an wie eben aufgegangene Sterne. –
Die folgenden Tage war Heinrich an die Stube gefesselt. Der Fuß war ihm stark geschwollen.
Da bat er die Liese, sie möchte ihm einige von seinen Büchern bringen.
Wie die Bücher vor ihm lagen, strahlten die Augen des jungen Buchenbauern. Es war, als ob er alte Freunde wiedersehe.
Dann brachte der Postbote einen Brief. Er war von einem guten Freunde Heinrichs aus Breslau, einem Schulkameraden, der in der Klasse neben ihm gesessen und auch in derselben Pension mit ihm gewohnt hatte.
Mit einem Jubelrufe empfing Heinrich das Schreiben und las mit leuchtenden Augen. Lauter interessante Neuigkeiten von Leuten, die er gut kannte. Und am Schluß kam die Schilderung des Lebens und Treibens in der neuen Klasse.
Über diesen Brief bekam Heinrich das Heimweh, und zwar so bitter und stark, wie er es früher kaum gekannt hatte. Er schaute sich um. War er denn nicht zu Hause? War das nicht seine Stube? War das nicht die heimatliche Straße draußen? Wie konnte er Heimweh bekommen? Was war es doch um die Heimat?
Der Jüngling wußte es nicht; er glaubte immer noch, die Heimat sei ein sichtbarer, bestimmter Raum.
Als ein Weilchen später Mathias in die Stube trat, sagte Heinrich: »Mathias, ich hab' ein Anliegen. Ich hab' hier einen Brief von einem Freunde bekommen, der jetzt in Ober-Sekunda ist. Ich möchte mir gern die Bücher von der neuen Klasse schicken lassen. Es interessiert mich doch, was jetzt kommt, und dann, manchmal werd' ich ja doch Zeit haben, ein wenig zu lernen.«
»Ja, Heinrich, das machst Du recht, wenn Du weiter lernen willst.«
So kam es, daß der junge Buchenbauer ein Studierender blieb. An all den langen Abenden saß er bei den Büchern, auch an den Regentagen. Und sein reger Geist faßte das meiste richtig. Dabei versäumte er nicht, sich in den landwirtschaftlichen Arbeiten auszubilden; und es ging auch ganz gut, seit er den schweigsamen, geduldigen Schaffer zu seinem Lehrmeister gemacht hatte. Hannes hatte keine Unterrichtserfolge bei ihm erzielen können, weil er ein zu heißsporniger, bissiger Pädagoge war. Also ward ihm sein landwirtschaftliches Mentoramt auf Grund eines Familienbeschlusses entzogen, und er fügte sich in diese Absetzung mit Würde.

Und wieder waren Jahre vergangen, fünf Jahre, in denen sich wenig geändert hatte. – Dieselbe Heimat, dieselben Menschen! Nur die Kinder waren vollends herangewachsen. Der Buchenhof war völlig wieder ausgebaut und in tadellosem Zustande. Er war stattlicher und schöner als je. So war die Prophezeiung des Mathias wahr geworden: daß es nicht schwer sein würde, die Wirtschaft wieder emporzubringen.
Auch die Ziegelei hatte sich gut bewährt. Das Lehmlager in dem Hügel hatte sich als viel ergiebiger und besser herausgestellt, als anfänglich erwartet worden war. Der Betrieb war geordnet, der Absatz ausgezeichnet. So brachte das Unternehmen Überschüsse, und etliche Leute rechneten aus, daß der Buchenbauer allein durch die Ziegelei ein steinreicher Mann werden müsse.
Da wurde es möglich, nach und nach Schulden zu tilgen. Heinrich bestand darauf, daß Mathias Berger seine Zinsen und seinen Gewinnanteil von der Ziegelei einkassierte und für Liese anlegte. Er selber sparte für seine Schwester Lene.
Also stand alles wohl. Geld ist am Ende von geschickten Leuten immer leicht zu verdienen.
Dagegen waren die Buchenhofleute in der Sympathie ihrer Mitbürger kaum vorwärts gekommen. Die räumliche Heimat hatten sie gerettet, die andere, wirkliche, ideelle war ihnen noch versagt.
Es ist sehr schwer, bei schlichten Landleuten alte Vorurteile auszurotten. Dazu kam, daß sich in all den Jahren im Dorfe nichts Aufregendes ereignet hatte. Die Buchenhofaffäre war aktuell geblieben. Das Unaufgeklärte, Ungewisse behielt den Reiz. Immer blieb die Hoffnung, es werde noch einmal Licht kommen in die dunklen Geschehnisse.
Es soll nicht gesagt sein, daß die Schuld ganz auf der Seite der Dorfleute lag. Die Schlesier sind im allgemeinen gute, gemütliche Menschen, nicht hart, finster und abgeschlossen, wie sonst die Leute in der großen, nordischen Ebene vielfach sind, sondern leicht zugänglich, lustig und eher den fröhlichen Süddeutschen vergleichbar. Das Gebirgsvölklein namentlich ist von leichterem Schlage und hat viel Sonne in der Seele.
So war's auch hier im Dorfe. Aber die Buchenhofleute hielten sich selbst abseits. Sie mochten nicht hingehen und um die Heimatsgemeinschaft werben, und eine freundliche Einladung wurde ihnen nicht zuteil.
Mathias Berger wußte, daß noch jetzt in vielen Behausungen die alten Zeitungsnummern aufbewahrt wurden, in denen die Verhandlung des Brandprozesses geschildert war und seine zwangsweise Abbitte an Schräger stand. Er hatte endlich auch gehört, daß er wegen seines Geldes verdächtigt[155] wurde. Da hatte er sich nicht enthalten können, an Schräger einen Brief zu schreiben, in dem er ihm »spät, aber doch« dafür dankte, daß er ihn ehemals habe fünf Mark gewinnen lassen, für die er ein Glückslos gekauft habe. Das Geld habe gerade dazu gereicht, den Buchenhof zu halten, der wohl sonst das Besitztum des Wirtes unnütz vergrößert hätte. Der Brief war an einer neuen Injurie gerade noch knapp vorbeigegangen. Schräger hatte gewettert und geflucht, und die Dorfleute hatten die Lotteriegeschichte nicht geglaubt, sondern desto eifriger nach einer recht abenteuerlichen Lösung der Bergerschen Vermögensfrage gesucht.
Am wenigsten fand Heinrich den Weg, obwohl seine weiche Seele ihn suchte. Oftmals zwar redete er sich ein, er brauche die Gemeinschaft nicht, er habe ja Gesellschaft auf dem Hofe, lauter liebe Leute, die's treu zu ihm meinten. Aber er kam nicht um die alte Wahrheit herum, daß der Mensch nicht immer mit denselben Menschen verkehren kann. Die Schiffsleute, die lange auf demselben Fahrzeug eng zusammenlebten, gehen auseinander, wenn sie ans Land kommen. Sie haben einmal das Bedürfnis, die alltäglichen Gesichter auf eine Weile nicht zu sehen. Und es gibt viele Leute, die in Bureaus, Geschäften, Schulen friedlich und freundlich zusammenarbeiten und sich doch in ihren Freistunden nicht sehen und treffen mögen, sondern lieber Fremde aufsuchen oder allein sind.
Die Buchenhofleute lebten zusammen wie auf einem großen, einsamen Schiff. Im Winter vergingen Wochen, ohne daß sie ein Wort mit jemand von auswärts wechselten. Und so kam es, daß ein Händler, wenn er sich in das Gehöft[156] verirrte, wie ein lieber Gast festgehalten und nach allem möglichen befragt wurde.
Am schwersten litt an solch trüben Wintertagen der Hannes. Es kam vor, daß er sich auf die Ofenbank legte und vor lauter Einsamkeit heulte. Dann schwor er hoch und teuer, wenn erst der Frühling käme, zöge er in die Fremde. Wenn die Lene das hörte, sagte sie, er solle nur geschwind machen, daß er fortkäme. Und das nahm er dann immer übel.
Auch Mathias litt an der Einsamkeit. Manchmal, wenn er den alten Pluto streichelte, der immer noch das Gnadenbrot bekam, dachte er an seine Lumpenmannszeit, und da kam es ihm vor, als sei er damals ein junger, glückseliger Vagant gewesen, der frei und unverdrossen auf grünen Straßen fuhr, heute hier, morgen dort, immer wieder bei anderen Leuten, immer lustig und überall gern gesehen.
Heinrich saß zu solchen Zeiten hinter seinen Büchern und studierte. Nur eine war glücklich und ganz zufrieden: das war die Liese. Diese einsamen Stunden waren ihre seligste Zeit. Dann saß sie mit ihrem Nähzeug still und freundlich da und hob nur manchmal die Augen, um nach Heinrich zu schauen.
Aber drüben im Buchenkretscham wohnte noch ein einsameres Menschenkind, ein Kind, das gar keine Heimat hatte: das war Lotte Schräger.
Sie hatte niemand. Der Vater war fast täglich betrunken, der Bruder ein Idiot. Und ihr verhältnismäßig hohes Maß von Bildung vermehrte nur das Unglück, erhöhte das Grauen, das ihre »Heimat« ihr einflößte.
Von den Buchenhofleuten sah sie selten jemand. Sie wurde auch von ihnen gar nicht beachtet. Die stolze Lene Raschdorf hatte ihr sogar zweimal einen Gruß nicht erwidert. Aber die Lene blieb manchmal stehen und sah sie mit ihren kohlschwarzen Augen herausfordernd und feindselig an. Sie war ganz wie ihr Vater, der alte Raschdorf, vor dem sich die Lotte auch immer ein wenig gefürchtet hatte. Und sie trug neuerdings am Sonntag modische Kleider. Sie trug sie wie eine Dame, ohne Fehler. Aber Lotte wußte, daß sie es ihr nachmache.
Den Heinrich Raschdorf sah Lotte sehr selten. Gesprochen hatte sie nicht mehr mit ihm nach jenem Tage, da sie ihm den Strauß geschenkt und den Koffer getragen hatte. Damals war sie ja ein dummes Kind gewesen, aber sie wurde jetzt noch rot, wenn sie an die alten Tage dachte. Daß er sie geküßt hatte, daß sie ihm zugeredet hatte, er möchte sie heiraten, daß er dann ihren Strauß auf die Straße geworfen hatte, daran dachte sie oft.
Wenn er sie jetzt traf, zog er mit städtischer Höflichkeit den Hut, und sie neigte ebenso kalt-höflich den Kopf. Sie wußte kaum, wie er aussah; nur daß er einen Schnurrbart trug, hatte sie einmal gesehen.
So war es wieder einmal Frühling geworden. Draußen war ein wunderbarer, weicher Abend, aber der Kretscham war voll von Leuten. Die saßen alle in üblem Tabaksqualm und sehnten sich nicht nach der herrlichen Luft draußen, durch die die Nachtigallen sangen, durch die der Flieder duftete, durch die die Sterne leuchteten.
Bauern haben gern schlechte Stubenluft, viel lieber noch als die Städter. Das ist merkwürdig genug, da doch die Luft im Freien, die sie meist atmen, die Bauern wählerisch und verwöhnt machen müßte. Es ist anzunehmen, der Tod habe das so eingerichtet, denn wenn die Bauern auch noch gesund wohnten und schliefen, so wie sie gesund arbeiten, würden wohl alle über hundert Jahre alt werden. Und das gäbe zu viele Auszügler. – – – –
Es war Steuertag. »Gemeindegebot, Rente, Schulgeld, Schornsteinfegergeld und Nachtwächtergeld« wurden eingenommen. Da waren die meisten Hausväter persönlich erschienen, um ihre Steuer zu bezahlen. Kam aber irgendeine Frau, so neckten sich alle mit ihr, und Schräger mußte ihr einen Ingwer einschenken, den irgendeiner zum Besten gab. Das ist bäuerliche Ritterlichkeit.
Vom Buchenhofe brachte stets eine Magd die Steuer. Sie allein bekam keinen Ingwer.
An diesem Tage war im Buchenhofe große Aufregung gewesen, denn Hannes hatte plötzlich und ohne alle äußere Veranlassung erklärt, er werde selber gehen, um die Steuer abzuliefern. Er fügte noch die kühne Behauptung hinzu, daß er sich auch vor dem Teufel nicht fürchte, und daß er den Leuten beweisen wolle, daß der Buchenhof ebenso das heilige Recht habe, seine Steuer persönlich zu zahlen wie alle anderen. Zudem läge die Sache günstig, denn Mathias sei nicht zu Hause, der sonst dagegen reden würde.
Was Hannes zu seinem kühnen Plane begeistert hatte, ist, wie gesagt, schwer zu bestimmen. Es war zum Teil[159] Laune, zum Teil die Lust, endlich einmal etwas Neues zu erleben und der Einsamkeit entrissen zu werden.
Wie nun aber immer bei der Entscheidung »prinzipieller Fragen« viel und klug geredet wird, so auch hier. Sogar der Schaffer beteiligte sich an der Debatte, scheinbar gegen Hannes, im Grunde aber doch wie immer für ihn. Heinrich war unschlüssig, und nur Lene widersprach aufs heftigste. Aber schließlich siegte Hannes. Er bekam das Steuerbuch ausgehändigt, und Lene zählte ihm aus der »Schwinge« den Steuerbetrag auf und noch eine Mark darüber, wie Hannes wünschte. Sie mußte ihm sogar das große Paradeportemonnaie des alten Raschdorf borgen, das dieser immer nur bei besonders feierlichen Anlässen gebraucht hatte.
Also ausgerüstet schritt Hannes in seinem Sonntagsanzug über die Straße, stolz wie ein Held, der in den Kampf zieht, einer gegen alle.
Die Buchenhofleute sahen ihm vom Fenster aus nach. Das Herz klopfte allen, am meisten dem besorgten Vater des Helden. Am besten sei es, meinte der Schaffer, er bewaffne sich mit einem tüchtigen Stecken und stelle sich hinters Hoftor, damit er gleich hinüber könne, wenn er etwa den Hannes schreien höre.
Aber Hannes schrie nicht. Mit einem Ruck riß er drüben die Tür des Kretschams auf und trat hocherhobenen Hauptes in die Stube. Sein urplötzliches Erscheinen hatte wirklich den gewünschten Erfolg. Die Bauern waren über die Maßen verblüfft, und es entstand eine große Stille.
Diese Wirkung gedachte Hannes noch zu steigern. Er schnitt also ein Gesicht, das hoheitsvoll sein sollte, in Wirklichkeit[160] aber verunglückte, trat an den Gerichtstisch und grüßte mit nachlässiger Stimme:
»Mahlzeit!«
In dem städtischen Gruße »Mahlzeit«, meinte Hannes, liege die ganze Summe von Hoheit und Vornehmheit, über die ein Mensch verfügen könne, klar ausgedrückt.
»Mahlzeit!« wiederholte er, da niemand antwortete. »Ich bringe persönlich die Steuer vom Buchenhofe, denn der Buchenhof hat das Recht dazu!«
Das bestritt niemand. Es antwortete überhaupt keiner der Anwesenden.
»Wieviel macht es?« fragte Hannes und zog das riesige Paradeportemonnaie des alten Raschdorf mit viel Umständlichkeit aus der Tasche. Er wußte zwar die Summe ganz genau, aber er hatte durch seine Frage Gelegenheit, das Portemonnaie herausfordernd in der Hand zu halten, während der Gerichtsschreiber die Summe ausrechnete.
»Also so?« sagte er, als er den Steuerbetrag erfahren hatte, und fing an, das Geld langsam aufzuzählen, wobei er jedes Stück einzeln aus dem Portemonnaie nahm. Gegen Ende hin aber wurde er plötzlich unruhig, überflog den aufgezählten Betrag, guckte betroffen ins Portemonnaie, zählte nochmals, verfärbte sich ein wenig und fragte beklommen:
»Wieviel macht es?«
Der Gemeindeschreiber wiederholte den Betrag.
O, ihr lieben Heiligen! Hannes hatte eine Mark zu wenig, statt einer Mark zu viel. Wie ein greller Blitz fuhr ihm die Erkenntnis durch den Kopf, die Lene habe einen Taler für ein Fünfmarkstück angesehen.
»Es langt nicht!« flüsterte irgendwo eine Stimme unter den gespannt zuschauenden Bauern, und ein heimliches Kichern brach an. Hannes richtete sich wütend empor.
»Was? Es langt nich? Bei wem langt's nich?«
Und er wandte sich wieder an die Ortsbehörde.
»Das Kleingeld langt allerdings nich,« sagte er und strich den aufgezählten Betrag wieder ein. »Können Sie auf einen Hundertmarkschein herausgeben?«
»O ja,« sagte der Schulze, »das können wir schon. Wo ist der Hundertmarkschein?«
Das hatte Hannes nicht erwartet. Er wurde fürchterlich verlegen. Als aber nun die Bauern und die Steuerbeamten in eine unbändige Heiterkeit ausbrachen, raffte er sich auf und schrie:
»Hundertmarkschein? Wir haben massig Hundertmarkscheine! Aber ich muß meinen unterwegs verloren haben. Wer ihn find't, kann ihn behalten. Versteht Ihr? Kann ihn behalten! Und ich geh einen neuen holen.«
Er gab sich Mühe, mit möglichster Würde wieder hinauszuschreiten, was die Bauern nicht hinderte, in ein dröhnendes Gelächter auszubrechen.
Wütend schritt Hannes über die Straße, nicht, ohne sich ein paarmal umzusehen, als ob er etwas suche. Hinter dem Tor traf er seinen Vater, der einen dicken Knüppel in der Hand hatte.
»Haben sie Dir etwas getan?« fragte der Schaffer.
»Laß mich!« knurrte Hannes und stampfte nach der Stube. Dort wurde er mit erwartungsvollen Gesichtern empfangen.
»Plamiert sind wir!« schrie der heimgekehrte Gesandte und sank auf einen Stuhl. »Bis auf die Knochen plamiert! Ich hab' 'ne Mark zu wenig gehabt; die Lene hat mir 'n Taler für 'n Fünfmarkstück gegeben.«
Der Schaffer hieb mit seinem Knüppel auf den Tisch, daß die Stube dröhnte. Heinrich knurrte verdrießlich etwas von Albernheiten, und nur die Lene lachte.
Da fuhr Hannes zornig auf:
»Lene,« keuchte er, »hast Du das etwa gar absichtlich gemacht?«
Das Mädchen schaute ihn blitzend an.
»Meinste etwa, ich kann nich zählen? Meinste, ich kenne das Geld nich?«
»Lene, das is frech; das is – ich – ich – o, da habt Ihr den Quark; ich – ich – das is 'ne Gemeenheet – das laß ich mir nich gefallen – zum Vierteljahr zieh ich fort – werden schon sehen –«
»Werden schon sehen!« stimmte der Schaffer bei und stampfte hinter Hannes aus der Stube.
Auf dem Boden lag das Paradeportemonnaie des alten Raschdorf.
Die beiden Geschwister waren allein. Auch Heinrich war aufgebracht.
»Warum machst Du das, Lene? Warum blamierst Du ihn und uns?«
Das Mädchen sah ihn zornig an.
»Von uns hat niemand was bei den Leuten dort drüben zu suchen. Wenn's keiner versteht, ich versteh's! So ein Esel – es ist ihm recht!«
Sie schob das Portemonnaie mit dem Fuße beiseite und ging hinaus.
Der junge Buchenbauer sah ihr nach. Zum erstenmal fiel ihm auf, wie wenig er im Grunde genommen auf seinem Hofe zu sagen habe. Er war nicht der Herr. Kein Mensch kümmerte sich um seine Meinung, höchstens Mathias. Sie waren alle Herren: Hannes, der Schaffer, am meisten Lene. Er hatte immer geschwiegen in dem Gefühl, daß die anderen es ja besser verstünden, und daß er ihnen doch zur Dankbarkeit verpflichtet sei.
Aber jetzt regte sich in seiner weichen Seele der Trotz. Er hob das Portemonnaie seines Vaters auf und schüttelte den Inhalt in seinen eigenen Geldbeutel.
Nun würde er selber zur Steuer gehen! Jawohl!
Die Berger-Liese kam herein.
»Heinrich, es muß jemand zur Steuer; es is die höchste Zeit. Ich werd geh'n. Mir werden sie ja nischt tun.«
»Nein, Liese, Du gehst nicht! Du am allerwenigsten! Aber Du bist ein vernünftiges Mädel!«
Er reichte ihr die Hand. Liese errötete, denn Heinrich sprach selten mit ihr.
»Wer soll denn aber gehn? Hannes mag nicht; ich hab' ihm schon zugeredet, aber er will nicht, und der Schaffer ist furchtbar böse.«
»Ich gehe selber!«
In diesem Augenblick kam Lene wieder in die Stube.
»Ich gehe selber zur Steuer!« wiederholte Heinrich.
Da wurde das Mädel blaß.
»Du gehst nicht!« sagte sie bestimmt und heftig.
»Jawohl, ich gehe! Ich gehe bald!«
»Du gehst nicht, sage ich!«
Er sah sie an.
»Lene, der Herr bin ich! Merk' Dir das!«
Sie ging auf ihn zu und faßte ihn ins Auge.
»Heinrich, wenn Du zur Steuer gehst, lauf' ich fort!«
»Dann laufe fort!« sagte er gleichgültig.
Und er ging aus der Stube mit festem Schritt.
Dennoch zitterte ihm die Hand, als er die Türklinke zum Buchenkretscham berührte. Seit seiner Kindheit Tagen war er in diesem Raume, der doch bloß auf der anderen Seite der Straße lag, nicht gewesen.
Die Tür ging auf.
Einige Sekunden sah Heinrich nichts als Rauch.
»Guten Abend!«
Niemand antwortete. Alle sahen verblüfft auf den jungen Herrn vom Buchenhof, und Schräger, der schon wieder betrunken war, torkelte gegen das Schanksims und stierte den Eintretenden an, der einige Sekunden an der Tür stehen blieb.
Da sprach endlich einer: »Der Hundertmarkschein kommt!«
Das war der Bader. Aber nur der junge Riedel lachte; die anderen schwiegen.
Heinrich ging durch die Stube zum Gemeindetisch.
»Ich bringe die Steuer,« sagte er leise und zählte den Betrag auf.
Der Gemeindeschreiber quittierte.
»Sechs Dreier und einen Hund!« sang in einer Ecke der Idiot. Es lachten zwei. Aber Heinrich beachtete es nicht.
»Guten Abend!« sagte er, nahm das Steuerbuch und wandte sich zum Gehen.
Da trat ihm einer entgegen. Es war der alte, grauhaarige Hirsel-Bauer. Er streckte ihm die Hand hin.
»Herr Raschdorf,« sagte er freundlich, »mögen Sie einen Schnaps mit mir trinken?«
Heinrich war ganz erschrocken. Unschlüssig blickte er nach links und rechts auf die vielen Leute und sagte dann stockend: »Nein, ich – ich muß Ihnen danken, Herr Hirsel! Gute Nacht!«
Und er drückte ihm flüchtig die Hand und ging schnell hinaus.
Kopfschüttelnd setzte sich der alte, freundliche Mann. Der Bader aber sprang auf den Stuhl.
»Habt Ihr's gesehen? Das hat nu der Hirsel davon! Der Raschdorf und ein'n Schnaps mit jemand trinken! Da müßt' a keen Raschdorf sein! Das is un bleibt 'ne hochnäsige Bande!«
Und nun hatte der Bader wieder alle für sich. –
Draußen vor der Haustür traf Heinrich Lotte Schräger.
Er blieb betroffen stehen.
Auch sie sagte kein Wort.
Aber dann sahen sie sich scheu an wie zwei Menschen, die sich gekannt haben vor langer Zeit und sich wiedertreffen und nun nicht wissen, ob sie Freunde sind oder Feinde.
»Guten Abend!« sagte Heinrich und zog den Hut. Damit wollte er gehen. Aber er besann sich.
»Fräulein Lotte,« sagte er leise und hastig, »ich – ich hab' Ihnen immer noch was zu sagen.«
Er brach ab. Er wartete wohl auf ein Wort von ihr, aber sie sagte nichts. Da begann er wieder:
»Sie sind einmal sehr freundlich zu mir gewesen – Sie wissen wohl – damals, als wir noch Kinder waren – es ist ja jetzt an die acht Jahre her – aber ich wollte Ihnen bloß sagen, den Strauß hab' ich nicht auf die Straße geworfen – ich nicht! Sie sind mir gewiß recht böse gewesen die lange Zeit.«
Sie sah ihn errötend an, schüttelte den Kopf und ging rasch ins Haus.
Langsam schritt Heinrich über die Straße. Beim Hoftor blieb er stehen und holte tief Atem. Nach dem Buchenkretscham schaute er, hinter dessen erhellten Fenstern ein wüster Lärm war. Es war ihm doch sehr wohl.
Daß er ihr das hatte sagen können, das machte ihn froh. Es hatte ihn bedrückt all die Jahre.
Sie war ein herrlich schönes Mädchen geworden. Das hatte er erst heute so recht gesehen. So reif und so schön!
Warum klopfte ihm das Herz so laut?
Er sah immer hinüber nach der Stelle, wo er mit ihr gestanden hatte. Sie hatte kein Wort gesagt, sie hatte ihn nur angesehen.
In einer Giebelstube des Buchenkretschams wurde es hell. Heinrich schaute hinauf.
Jetzt kam eine Gestalt ans Fenster.
Das war Lotte!
Sie lehnte sich an die Scheiben und schaute hinüber nach dem Buchenhofe.
O, wie ihm das Herz schlug! Er betrachtete ihr dunkles Schattenbild und vermochte sich nicht zu rühren.
Da sah sie ihn unten im Mondlicht stehen.
Erschreckt legte sie eine Hand auf die Stirn. Bald darauf ging sie vom Fenster hinweg, und das Licht erlosch.
Eine Minute lang stand Heinrich noch still, dann ging er.
Im Hausflur auf der Treppe saß seine Schwester Lene. Sie hatte den Kopf auf beide Hände gestützt. Neben ihr stand Mathias, der in der Stadt gewesen und eben heimgekommen war.
»Du warst im Kretscham, Heinrich?«
»Ja, ich habe die Steuer hinübergetragen!«
Mathias sah ihn milde an.
»Es ist schon recht, Heinrich, Du kannst ja tun, was Du willst.«
»Aber ich – ich lauf' fort!« rief Lene.
Sie sprang auf.
»Geh in die Stube, Heinrich! Die Lene laß mir! Fortlaufen darf sie ja nich. Sie gehört ja ebensogut hierher wie Du!«
Heinrich ging nach der Stube. Liese Berger brachte ihm das Abendessen. Freundlich sah sie ihn an.
»Ist es gut gegangen?« fragte sie.
»Ja, Liese, ganz gut.«
Das blasse Mädchen nickte freudig.
»Und die Lene wird schon dableiben, wir reden ihr ja alle gut zu.«
Sie bediente ihn mit ihrer großen Freundlichkeit und ihrem stillen Eifer. Sie reichte ihm alles zu und fragte, ob es ihm auch schmecke.
Er mußte sich zwingen zum Essen. Und er wünschte fast, die freundliche Liese sei nicht bei ihm. Ihre Freundlichkeit tat ihm heute weh!
Sie sah ihn besorgt an.
»Du mußt Dich nicht so ärgern, Heinrich. Es wird ja alles wieder gut. Du mußt essen, Heinrich!«
Bald darauf ging er nach seinem Zimmer. Er mußte allein sein. Um alles in der Welt wollte er jetzt mit niemand sprechen, auch mit der Lene nicht. Er dachte kaum an sie.
Er wollte nachdenken, aber er vermochte nicht auf seinem Stuhle stillzusitzen. Angekleidet warf er sich aufs Bett und blinzelte in das Lampenlicht.
Ja, es war so. Er war froh, daß er in den Kretscham gegangen war. Er war froh, auch wenn es allen anderen nicht paßte.
Er war mutig gewesen. Und dieses schöne Bewußtsein trieb ihm, wie allen weichherzigen Leuten, die es nicht gewöhnt sind, das Blut in den Kopf. Wie ein Rausch war's. Denn das ist ja wahr, daß Mut trunken macht, einen früher, einen später, je nachdem, wieviel er verträgt.
Sie hatten geschwiegen; nur zwei hatten über ihn gelacht, die zwei kläglichsten. Die anderen nicht. Und einer hatte ihn sogar zu einem Trunke eingeladen. Der gute alte[169] Mann! Es war schade, daß er es ausschlagen mußte, aber sich da hinsetzen, unter diese Leute, das wär' ja unmöglich gewesen.
Ob's der Hirsel übel genommen hatte? Vielleicht! Wahrscheinlich sogar!
Heinrich sprang auf, setzte sich an den Tisch und schrieb an Hirsel einen langen Entschuldigungsbrief.
Ein Gefühl der Liebe für den alten Mann flutete durch das Herz des Jünglings. Wenn er jetzt einmal ins Dorf hinabsah, wußte er doch, daß dort unten jemand war, der's gut mit ihm meinte.
Ach, er war so glücklich, daß er ein ganz kleines Stückchen Heimat gewonnen hatte.
Als die Mitternacht vorbei war, hatte der junge Buchenbauer noch immer keinen Schlaf gefunden. Er mußte jetzt doch an seine Leute denken. Zum ersten Male hatte er sich in Widerspruch zu ihnen gestellt, zum ersten Male war er aufgeregt und glücklich, während sie gewiß alle mit bedrückten Herzen zur Ruhe gegangen waren.
Eine leise Reue kam, oder doch der Wunsch, sie recht bald alle wieder zu versöhnen, auch die Lene.
Freilich hatten sie ja nichts verloren.
Nichts?
Die Lotte fiel ihm ein.
Was sie wohl sagen würden, wenn sie wüßten, daß er mit Lotte Schräger gesprochen hatte? Eigentlich mußte er es ihnen erzählen. Das wäre aufrichtig.
Aber er schämte sich und beschloß, die Begegnung für sich zu behalten.
Was war auch geschehen? Entschuldigt hatte er sich wegen einer Ungezogenheit, wahrlich spät genug entschuldigt. Sonst nichts.
Und nun war er quitt mit Lotte Schräger.

So ist ein neuer Kampf in Heinrich Raschdorfs junges Leben getreten. Und im alten Kampf um die Heimat rückten die Bundesgenossen einen Schritt von ihm ab. Seine Schwester Lene weit! Sie sprach nicht mehr mit Heinrich; sie ging immer mit finsterem, verschlossenem Gesichte herum. Es kränkte ihren Stolz, daß sie gedroht und dann die Drohung nicht ausgeführt hatte.
Sie war schwach gewesen und unterlegen.
Und es war nicht bloß der beleidigte Trotz, daß ihr Wille nicht durchgegangen war; es lebte in diesem Mädchen auch das feine Empfinden, daß in die starke Position der Buchenhofleute eine Bresche geschlagen worden sei durch eigene Schuld.
Das wußte auch Mathias.
Einmal war er selbst es gewesen, der den Frieden gepredigt hatte, damals, als die tote Frau noch auf der Bahre lag, als er die Kinder übernahm und einen Weg für sie nach der Heimat suchte. Da erkannte sein kluger Sinn allein im Frieden mit den Leuten das Heil.
Wie eine stolze, halbzerstörte Festung kam ihm der Buchenhof damals vor, ein gar schwacher Platz, der nicht zu halten war, wenn ihn die Gegner unten im Tal mit zäher Feindseligkeit belagerten und ihn qualvoll aushungerten an Liebe und Freude.
Ein Tag mußte kommen, an dem sich die Burgleute ergaben auf Gnade und Ungnade, um in die Verbannung zu ziehen.
Deshalb wollte sich Mathias vergleichen. Aber als er einen Weg hinüber suchte, mit der weißen Fahne in der Hand, wurde er heimtückisch angefallen, er und Heinrich, und auch nach der lieben Toten warfen sie ihre schmutzigen Geschosse.
Da wußte Mathias nichts mehr von Frieden, da kam der Groll, der Trotz, und er baute den Buchenhof neu, stark, unantastbar, wie er meinte.
So war es gut gegangen all die Jahre. Gut?
Hatten sie nicht alle quälenden Hunger gelitten nach Liebe, nach Freundlichkeit, nach menschlicher Gemeinschaft?
Eine Festung ist keine Heimat. Heimat braucht offene Tore, breite, freie Straßen, an denen keine Fangeisen liegen und an denen keine Warnungstafeln stehen, sondern freundliche Wegweiser.
Jetzt also ging der junge Herr ins feindliche Lager. Er ging nicht, Verrat zu üben, er ging nur, Vertrauen zu zeigen und nach und nach Vertrauen zu gewinnen.
War er nicht zu loben?
Aber eine quälende Unruhe war in Mathias, der junge Herr vom Buchenhofe werde da drüben verunglücken.
Der Unfriede war auf den Buchenhof gekommen aus winzigem Anlaß. Auch der Schaffer war finster und sprach kein Wort. Er zürnte schwer mit Lene, und es war anzunehmen, daß er den schlimmen Streich, den sie seinem Sohne gespielt, nie mehr im Leben vergessen würde.
Hannes betrug sich ganz ungebärdig. Zunächst beschloß er, einen Tag »blau« zu machen. Ferner nahm er sich vor, am anderen Tage in den Buchenkretscham zu gehen und ein Säuferleben anzufangen, der Lene zum Trotz. Da er sich aber schließlich schämte, das Lokal wieder zu betreten, in dem er eine so wenig rühmliche Rolle gespielt hatte, ging er nach dem Nachbarort, trank in einem Gasthause drei Glas Bier und kam auch wirklich schwer betrunken nach Hause.
In der Nacht war er sehr krank, und sein stämmiger Vater betrachtete mit besorgten Blicken den Sohn, von dem er annahm, daß er nun dicht am Abgrunde des körperlichen und seelischen Verderbens stehe.
Am anderen Morgen glaubte Hannes selbst, seine allmähliche Auflösung sei nahe. Die Krankheit in ihren wilden Erscheinungen war zwar vorüber, dafür hatte sich aber ein Zustand eingestellt, der ihn befürchten ließ, daß seine Kräfte sich langsam vollends abschwächen würden.
Um so freudiger überrascht war er, als er gegen Mittag Hunger bekam und sich nach der Mahlzeit wieder recht leidlich fühlte. Also beschloß er, sich langsam wieder ans Leben zu gewöhnen und auch das Arbeiten wieder aufzunehmen.
Eine Woche lang schmollte er mit Lene, dann hielt er es nicht länger aus und sagte zu dem Mädchen: »Lene, das is auf die Dauer zu tumm. Reden wir lieber wieder!«
Die Lene lachte und sprach auch wieder mit dem Hannes, aber sie dachte bei sich selbst: »Er ist kein rechter Mann. Das durfte er sich nicht gefallen lassen. Er hätte mich müssen laufen lassen; so ist er ein Trottel.«
Und der gute Hannes pfiff derweil vergnügt und hatte gar keine Ahnung, daß er ein Trottel war. Er kannte das Leben nicht, er kannte das Bier nicht, er kannte das Weib nicht. Er war ein harmloser, lustiger Bursche, dem es sicher noch einmal sehr schlecht gehen mußte, ehe er dieses gutmütige, dumme Pfeifen sein lassen würde.
Es war an einem sommerheißen Maitag, kaum eine Woche später. Heinrich war nach der Stadt gefahren, um etliches zu besorgen. Nun war er auf dem Heimwege. Ganz allein saß er auf der kleinen Droschke und ließ das Pferd gemächlich seines Weges ziehen. Dabei konnte er ungestört seinen Gedanken nachhängen.
Daran dachte er, daß der junge Riedel sich um die Lotte bewarb. Und obwohl sich der Buchenbauer alle zwei Minuten sagte, daß ihn die Sache nichts angehe, gab er sich doch immer wieder Mühe, mit hundert Gründen und Einwendungen das Unsinnige einer solchen Verbindung zu beweisen. Und er redete sich selber in großen Zorn.
So kam es, daß er heftig erschrak, als er plötzlich die Lotte kaum dreihundert Schritte weit vor sich auf der Straße gehen sah. Sie war offenbar auch in der Stadt gewesen. In der Hand trug sie ein kleines Paket.
Dem Buchenbauer wackelten die Zügel in der Hand, und er wußte nicht, ob dieses Zusammentreffen ein Glück oder ein großes Unglück sei.
Was sollte er tun? Was sollte er nur tun?
Sie auffordern, mitzufahren, sie und er ganz allein – sie, die Schräger Lotte, und er, ein Raschdorf? Seine Leute, was würden die sagen? Das kam doch heraus, das ging doch nicht zu verheimlichen. Der Mathias, die Lene – alle – was würden sie sagen?
Heinrich zupfte an der Leine, und das Pferd schlich langsam im Tritt. Es war ein bequemes Rößlein, das seinerseits sich gegen ein vorsichtiges, abwartendes Tempo nicht sträubte.
Aber trotzdem – in wenigen Minuten mußte er sie eingeholt haben! Was dann? Sollte er an ihr vorüberfahren? Sie laufen lassen in diesem Staub und in dieser Hitze? Sie, die ihm einstmals den schweren Koffer getragen hatte? Und ganz abgesehen davon – vorüberfahren, unhöflich sein, grob – das ging nicht, das ging nicht!
Kurz entschlossen rückte sich Heinrich stramm auf und hieb auf das Pferd ein. Und in kaum zwei Minuten war er an Lottes Seite.
»Guten Tag, Fräulein! Darf ich Sie auffordern, mit mir zu fahren?«
Sie schaute zu ihm auf. Ihr Gesicht glühte von der Anstrengung des Laufens, und sie zitterte ein wenig, als sie sagte:
»Ich – ich danke, Herr Raschdorf – ich werde jetzt gleich den Feldweg gehen. Es ist ja nur eine halbe Stunde nach Hause. Ich danke!«
»So schlagen Sie mir's ab?«
»Ich – ich möchte Ihnen keine Ungelegenheiten bereiten, Herr Raschdorf!«
»Ungelegenheiten? Wieso?«
»Ja! Sie wissen ja – es ist um die Ihrigen – es war mir so furchtbar peinlich, als ich sah, daß Sie hinter mir –«
Da sprang er auf die Straße.
»Lotte, Sie müssen mit mir fahren, jawohl, Sie müssen! Sie kränken mich, wenn Sie mir's abschlagen. Wir haben doch nichts gegeneinander – nichts – nichts – rein gar nichts!«
Sie schaute ihn mit ihren großen, dunkelgrauen Augen eine Sekunde an.
»Nein, wir haben wohl nichts, aber es ist besser, ich danke, Herr Raschdorf, ich bin ja in einer halben Stunde zu Hause.«
»Lotte!«
Er ergriff sie an der Hand.
»Lotte – Fräulein Lotte, wissen Sie noch – damals vor acht Jahren, als ich heimkam, auf diesem selben Wege, als wir den Koffer miteinander trugen, wissen Sie noch?«
»Ja, aber da waren wir Kinder – jetzt – es ist schon besser, wenn ich zu Fuß gehe.«
Er ließ ihre Hand los. Tonlos sagte er:
»Ja, vielleicht ist's besser; vielleicht wär's eine Schande für Sie, wenn Sie mit mir führen.«
»Heinrich Raschdorf!«
»Was sehen Sie mich so an? Es ist doch so! Von dem Raschdorf Heinrich mag kein Mensch im Dorfe was, keine[177] Gefälligkeit, keinen kleinen Dienst, keine Freundlichkeit; der ist ja ausgestoßen.«
»Herr Raschdorf! Sagen Sie nicht so was! Ich fahre mit!«
»Lotte, das will ich Ihnen danken!«
Er half ihr auf den Wagen und stieg nach. Zitternd ergriff er die Zügel wieder. Es war nur ein Sitz da. So saßen Sie dicht nebeneinander. Minutenlang fuhren sie die Straße entlang, ohne daß eines ein Wort gefunden hätte. Und die Maisonne lachte, und das Rößlein ging so wonnig sachte.
So war dem jungen Buchenbauer noch niemals im Leben zu mute gewesen. Das Herz war ihm übervoll, und doch fand er kein armseliges Wörtlein. Endlich raffte er sich auf:
»Sie müssen mir noch sagen, Fräulein Lotte, ob Sie mir wegen des Straußes böse gewesen sind!«
»Ach, ich habe mich damals wohl sehr geärgert. Aber ich weiß ja jetzt, daß Sie ihn nicht weggeworfen haben!«
»Nein, wirklich nicht, ich wollte, ich besäße ihn noch jetzt.«
»Den armseligen Kinderstrauß?«
»Ja, denn damals war doch noch eine bessere Zeit. Da war ich noch nicht gar so einsam.«
»Fühlen Sie sich einsam?« fragte sie leise.
»O, Lotte, Sie wissen gar nicht, Sie können gar nicht glauben, was das heißt: so leben wie ich.«
»Sie haben eine Schwester und gute Freunde.«
»Ja, das weiß ich, das schätze ich auch, aber das langt nicht, das langt nicht auf so viele lange Jahre. Ein bißchen[178] Vertrauen, ein bißchen Freundlichkeit von den Leuten, sehen Sie, das fehlt mir.«
Sie schwieg.
Er sah sie schmerzlich an. Dann sprach er leidenschaftlich:
»Und doch schwör' ich Ihnen, Lotte: Ich war unschuldig an dem Unglück, und mein toter Vater auch!«
Sie war tief erschüttert. Leise sprach sie:
»Das weiß ich, das hab' ich auch immer geglaubt.«
»Lotte, das ist gut von Ihnen!«
Er preßte ihre Hand. Ein Weilchen hielt er sie so fest, dann erschrak er und gab sie frei.
Einige Minuten fuhren sie wieder schweigend dahin, dann sagte Lotte leise:
»Und wie denken Sie, daß mir's geht?«
Er suchte nach einer Antwort. Der trunksüchtige Vater fiel ihm ein, der idiotische Bruder, und ihre ganze trostlose Verlassenheit kam ihm zum Bewußtsein.
»Ja, ich weiß wohl, ich ahne es, es tut mir leid, Lotte, aber die Leute im Dorfe, die achten und ehren Sie doch.«
»Die Leute im Dorfe! Wenn ich eine rechte Heimat hätte, brauchte ich keine Leute aus dem Dorfe. Ich will sie nicht.«
Der Widerspruch zwischen ihr und ihm selbst fiel ihm auf.
»Lotte, ich glaube, wir sind beide nicht glücklich. Wir haben beide ein Haus, in dem wir wohnen, und haben doch beide keine Heimat.«
Sie sah zu ihm auf. Ähnliche Gedanken hatte sie schon oft gehabt; nur diese klare Form hatte sie ihnen nicht geben können.
»Ja,« sagte sie, »Sie haben recht!«
Dann sprachen sie von der Kinderzeit, von jenen goldenen Tagen, als sie noch glücklich waren, als sie beide noch eine Heimat hatten.
Darüber vergaßen sie ihren Kummer, und manchmal schauten sie sich heimlich und schnell in die Augen – so, wie man ein altes, heimgekehrtes Glück herzklopfend betrachtet. Und sie waren beide rot im Gesicht, und tief in den Augen strahlte es wie eine ganz leise Erlösungshoffnung.
Die Straße führte durch den Wald. Da schwiegen sie wieder.
Über den Schattenweg huschten einzelne goldene Lichter, und fern sang ein Brünnlein durch die Mittagsstille.
Ganz langsam fuhr das Gefährt die weiche Straße entlang, und die beiden jungen Menschenkinder schauten hinab nach dem blühenden Wegrande. Dort, wo die Maiglöckchen blühten, hielt er an, sprang hinab, pflückte drei Stengel und reichte sie ihr.
»Wir haben keine Feindschaft, Lotte!« sagte er bewegt.
»Nein – nein, Heinrich!«
Und dann wieder weiter, den grünen Frühlingswald entlang, der still in blühender Freundlichkeit die beiden anschaute aus märchentiefen Augen. Zwei bunte, seltsame Schmetterlinge gaukelten vor ihnen her; denen schauten sie nach mit träumenden Augen, und ihre Hände lagen dicht beieinander und berührten sich leise.
Da war ihnen wohl. Sie waren zu Hause. Auf diesem kleinen Wagen war die Heimat.
Als sie aber hinaus ins Lichte kamen und die Buchenhöfe sahen, fröstelten sie vor dem grellen, heißen Sonnenlicht. Da wußten sie, daß sie dort beide wieder in der Fremde sein würden.
Er faßte wieder ihre Hand.
»Lotte, wenn wir uns manchmal – nur manchmal sprechen könnten, das wär' ein Glück!«
»Es ist ja nicht möglich!«
»Es muß möglich sein, Lotte! Wir wollen Freunde sein!«
»Hallo! Hallo! Hallo!«
Der Idiot sprang aus dem Walde. Er hatte eine riesige Tüte in der Hand, ganz gefüllt mit Maikäfern.
Die beiden erschraken, und auch der Idiot blieb erstaunt stehen. Er sperrte den Mund auf.
»Und – und – und einen Hund,« grunzte er überrascht, das einzige, was ihm immer einfiel, wenn er jemanden vom Buchenhofe sah.
»Mein Bruder! O Gott, mein Bruder!«
Auch Heinrich war peinlich überrascht.
»Die Lotte und der – und der – und einen Hund, einen großen Hund!« krähte der Idiot.
»Lassen Sie mich absteigen, Herr Raschdorf – ich muß mit ihm reden.«
Heinrich Raschdorf hielt an. »Bleiben Sie, Lotte! – Gustav, Gustav, komm einmal her!«
»Schön tumm! Du schmeißt mich ins Feuer. Du sperrst mich ein. Und einen gro–o–ßen Hund!«
»Ich will hinab, Herr Raschdorf – ich muß zu ihm, adieu – Sie wissen nicht –«
»Wann sehen wir uns, Lotte?«
»Ich weiß nicht! Lassen Sie meine Hand los, ich will absteigen.«
Der Idiot war inzwischen tückisch herangeschlichen und schleuderte urplötzlich dem Pferde die Tüte mit den Maikäfern an den Kopf. Das Pferd fuhr auf, rückte an und raste davon, während Lotte, die im Absteigen begriffen war, mit einem Aufschrei auf die Straße stürzte.
Mit verzweifelter Kraft brachte Heinrich das zitternde Tier zum Stehen und lief den Weg zurück.
Da lag Lotte Schräger auf der Straße. Das Hinterrad war ihr über den linken Fuß gegangen.
»Lotte, um Gottes willen, was ist geschehen?«
»Mein Fuß – mein Fuß – überfahren – ach, mir wird schwindelig –«
»Lotte, geliebte Lotte!«
Er tastete nach ihrem Fuße; aus dem niederen Schuh quoll das Blut. Da raffte er das Mädchen auf und trug es nach dem Wagen.
Der Idiot stand mit entsetztem Gesichte da und schrie:
»Es blutet! Es blutet!«
Und er verkroch sich im Walde.
Vorsichtig hob Heinrich die Verwundete auf den Wagen. Ein Frösteln ging durch seine Seele.
An derselben Stelle hatte vor Jahren Mathias Berger seinen sterbenden Vater auf seinen kleinen Schlitten geladen. Und nun ging es wie damals behutsam die Anhöhe hinab den Buchenhöfen zu.
»Heinrich!«
Sie klammerte sich fest an ihn.
»Lotte, Lotte! Geliebte Lotte!«
Sie war ohnmächtig.
Er bettete sie an seine Brust und schlang den rechten Arm um sie. Mit der linken Hand hielt er die Zügel.
So bleich und so schön war sie, und sie atmete schwer, aber doch nicht schwerer als der junge Buchenbauer. Er betrachtete immer ihr süßes, bleiches Gesicht. Und einmal bückte er sich hastig scheu über sie und küßte sie auf den Mund. Ein Seligkeitsschauer glühte ihm durch den Körper. –
Als sie in die Nähe des Buchenhofes kamen, gingen zwei durch den Garten – Mathias und Liese.
Sie hielten Ausschau. Und nun gewahrten sie ihn. Die Hände legten sie über die Augen, um besser sehen zu können. So standen sie regungslos wie Bildsäulen.
Aber plötzlich kam Leben in die beiden Leute. Sie sprachen erregt miteinander, zeigten nach ihm, und auf einmal wandte sich die Liese um und lief ins Haus.
Mathias Berger aber ging langsam nach dem nächsten Baume und lehnte sich an.
Heinrich hatte das alles wohl gesehen, aber es war ihm so, als ob es ihn nichts anginge. Er nickte nur grüßend und fuhr vorbei, hinüber zum Kretscham.
Zwei Mägde und die alte Wirtschafterin sahen durchs Küchenfenster und kamen schreiend herausgelaufen. Heinrich unterrichtete sie kurz und übergab ihnen Lotte. Dann fragte er nach Schräger.
Der saß in der Gaststube und schlief. Er hatte sich am Vormittag schon wieder betrunken.
Heinrich rüttelte den Schlafenden. Der öffnete die Augen, sah den jungen Raschdorf und grunzte auf.
»Erschrecken Sie nicht, Herr Schräger, es ist ein Unglück passiert. Fräulein Lotte ist ein Stück mit mir gefahren, und als sie absteigen wollte, hat der Gustav das Pferd scheu gemacht. Da ist sie gefallen, und der Fuß ist ihr überfahren worden.«
Schräger starrte ihn verständnislos an.
»Herr Schräger, es muß augenblicklich jemand nach dem Arzt fahren!«
»Nach – nach dem – dem Arzte fahren?«
Heinrich sah, daß der Mann betrunken war.
»Ja, es ist keine Zeit zu verlieren! Hören Sie, Herr Schräger, ich werde selbst den Arzt holen. Hören Sie?«
»Ja – ja – den – Doktor –«
Heinrich war schon draußen. Der Wirtschafterin schärfte er ein, den Schuh und den Strumpf vorsichtig abzuziehen und den Fuß immerfort mit kaltem Wasser zu kühlen. Er fahre nach dem Arzt.
Dann sprang er auf die Droschke und fuhr nach dem Buchenhof. Auf den Stufen vor der Haustür standen Hannes und Lene. Mathias und Liese waren nicht zu sehen.
»Hannes, schnell die beiden Rappen einspannen! Ich fahr' nach dem Arzt. Fräulein Schräger ist verunglückt.«
Hannes und Lene sahen ihn wortlos an.
»So steht doch nicht so blöde da! Sie ist ein Stück mit mir gefahren, und als sie absteigen wollte, ist sie gefallen, und der Fuß ist ihr überfahren.«
»Sie haben ja selber Fuhrwerk drüben,« sagte Hannes.
»Ja, aber das dauert alles zu lange; ich fahre, das ist doch Christenpflicht.«
Lene lachte laut und spöttisch auf.
»Christenpflicht!«
»Hannes, willst Du helfen oder nicht?«
»Wehe Dir, Hannes, wenn Du eine Hand rührst!«
»Hannes, bin ich der Herr oder die? Und läßt Du Dich von einem Weibe kommandieren?«
Hannes war in schwerer Verlegenheit. Aber schließlich sagte er: »Es ist ja Mumpitz, aber helfen tu ich!«
Lene warf ihm einen verächtlichen Blick zu und ging ins Haus. Wenige Minuten später sauste das Gefährt Heinrichs nach der Stadt.
In ganz verhältnismäßig kurzer Zeit brachte er den Arzt.
Unten im Hausflur stand er und wartete auf Nachricht. Die Wirtschafterin kam.
Der Fuß wäre gebrochen, aber es sei keine Gefahr. Bei guter Pflege würde alles recht schön heilen.
»Werden Sie das Fräulein auch gut pflegen, Stenzeln?«
Die Alte sah den jungen Mann freundlich an und versprach ihr Bestes. Er gab ihr ein Geldstück.
»Hier, nehmen Sie das! Sagen Sie aber keinem Menschen davon! Und grüßen Sie das Fräulein! Sie soll nicht böse sein auf mich. Mir tut das Unglück sehr leid. Und, Stenzeln, alle Abende um neun Uhr kommen Sie mal an die Haustür. Ich will Sie fragen, wie's geht!«

Durch die Mainacht ging der Mond.
Drunten im Dorfe schlug es Mitternacht. Da hatten die Buchenhofleute den Frieden des Schlafes noch nicht gefunden. Und doch war ein jeder in seiner Kammer seit langen Stunden.
Droben im ersten Stock lehnte der junge Buchenbauer am Fenster und schaute hinüber nach der Giebelstube des Kretschams.
Ein Licht schimmerte durch die Nacht herüber.
Dort war sie!
Der junge Träumer schloß die Augen.
Da sah er ein Meer und in dem Meer ein fernes Eiland. Von diesem Eiland schien das Licht wie ein winkendes Leuchtturmfeuer, das den Weg zeigt zu einem heimatlichen Hafen.
Aber wenn Heinrich Raschdorf die Augen öffnete, sah er die Dorfstraße. Die lag zwischen ihm und ihr wie ein unüberbrückbarer Abgrund. Er riß das Fenster auf. Schwerer Duft traf ihn, das Silberlicht gaukelte vor seinen Augen, und ein Vogel in der Nähe sang ein wonniges Lied.
Da schlug die Liebe in das junge Blut, und all ihr taumelndes, berauschendes Glück kam über den Einsamen. Eine heiße Röte flammte über Heinrichs Gesicht, und ein Vorsatz formte sich in seinem Herzen, sein Glück zu suchen. Und immer wieder ging er die wenigen Minuten im Geiste durch, die er mit ihr verlebt hatte, brachte sich alles in Erinnerung, was sie gesprochen, und war ganz außer sich vor lauter Aufregung, Liebe und Mitleid.
Da klopfte es an die Tür.
Heinrich lauschte, aber er rührte sich nicht.
Abermaliges Klopfen.
Nun ging er und öffnete.
Seine Schwester Lene stand draußen, völlig angekleidet. Das Erstaunen Heinrichs war groß; die Schwester hatte mit ihm seit dem Tage, da er im Buchenkretscham zur Steuer war, nicht mehr gesprochen.
»Du bist es, Lene? Was willst Du?«
»Mit Dir reden! Ich sah, daß Du noch wachst.«
»Komm herein!«
Er schloß die Tür hinter ihr. Sie schaute sich um und bemerkte alsbald das offenstehende Fenster und das Licht drüben über der Straße.
Sie sah ihn scharf an, und er konnte nicht hindern, daß er errötete. Er mußte an den Vater denken, wie sie so stolz und kalt vor ihm stand.
»Willst Du sie heiraten?« fragte sie unvermittelt. Ihre Stimme klang heiser.
»Heiraten? Wen?«
»Wen?«
Sie lachte scharf und kurz, trat ans Fenster und schloß es. Da überkam ihn der Trotz wieder.
»Lene, ich will Dir was sagen: so lasse ich mich nicht behandeln. Verstehst Du? Was ich tue oder lasse, ist schließlich meine Sache.«
»Nein!« Das sagte sie laut und heftig. »Es ist nicht Deine Sache, es geht uns alle an! Wir haben alle für Dich gearbeitet. Was Du hast, hast Du von uns!«
»Von Euch! Das weiß ich. Du kommst also, um mir zu sagen, was ich Euch alles schuldig bin, kommst, um mir das vorzurechnen?«
Ihr war jede Sentimentalität fremd.
»Ja, deswegen komm ich! Du bist uns genug schuldig, das Meiste! Beinah alles! Und ich red' nicht von mir, aber vom Mathias red' ich.«
»Vom Mathias? Was schadet es denn, wenn ich – wenn ich –«
»Wenn Du zum Schräger laufst? Hinter der Lotte her bist? Es ist wahr! Es wird sich hübsch machen, wenn Du mit der Lotte zur Trauung gehn wirst.«
»Sei still, Lene! Das geht Dich nichts an, solches Gerede leid' ich nicht!«
Sie ließ sich nicht stören.
»Ja, und der besoffene Schräger wird als Schwiegervater hinterher geh'n.«
»Lene, ich werf' Dich raus!«
»Erst red' ich! Es wird hübsch sein, wenn Ihr bei Vaters Grab vorbeigehn werdet, den die Bande auf 'm Gewissen hat, und – und der Mathias wird auch zusehn müssen,[189] den sie ins Gefängnis gebracht haben. Sehr hübsch wird's sein! Du bist ein Staatskerl, Heinrich!«
»Hör' auf, Lene! Du machst mich verrückt!«
Er setzte sich auf einen Stuhl. Sie sagte nichts, lehnte sich an die Wand und sah ihn streng, ja haßerfüllt an. Ihn aber hatte sie mit dem einzigen Hinweis auf den Vater geschlagen. Da begann er endlich: »Es ist nichts erwiesen!«
»Daß der Vater tot is, das is erwiesen!«
Darauf wußte er nichts zu entgegnen. Endlich sagte er: »Der Vater ist verunglückt.«
»Nein!«
Dieses »Nein« klang furchtbar in der Stille der Nacht. Heinrich traf es wie ein Schlag, und er fröstelte in sich zusammen. Er hatte nie dieser schrecklichen Frage gegenüberstehen können, ohne eine versöhnliche Antwort mit aller Macht zu erzwingen. Dieses herbe Mädchen gab die Antwort. Er sah sie scheu an.
»Wie kannst Du – wie kannst Du das nur sagen, Lene? Vom Vater?«
Auf einen Augenblick kämpfte sie mit Tränen. Dann kam der Groll wieder über sie.
»Vaters Tod ist ganz klar. Und der Schräger hat's gewollt. Der hat unseren Vater ums Geld gebracht, dann hat er falsch geschworen, und zuletzt hat er das Geld gekündigt. Da wußt' sich der Vater keinen Rat mehr. Und jetzt – jetzt laufst Du hin – der einzige Sohn –«
Es war aus mit ihrer Fassung. Sie sank auf einen Stuhl, bedeckte das Gesicht mit beiden Händen und fing leidenschaftlich an zu weinen.
Er saß ihr in zusammengesunkener Stellung und mit unbewegtem Gesicht gegenüber. Endlich sagte er tonlos: »Hör' auf zu weinen, Lene. Es ist ja nichts geschehen. Ich will nicht leugnen, daß ich der Lotte gut bin – lange schon, länger, als ich's selber weiß, aber das – das wird sich ja überwinden lassen – weil es muß – weil es muß –«
Er stand auf und wandte sich ab. Da war sie plötzlich hinter ihm, umschlang seinen Hals und küßte heiß seine Wange.
»Heinrich, weißte denn gar nichts – gar nichts von der Liese?«
»Wie? Was? Was soll ich von der Liese wissen?«
»Daß sie Dir – daß sie Dir so unendlich gut is, Heinrich!«
Er fuhr herum. »Mir? Die Liese? Mir gut? Lene!«
»Und der Mathias hat immer drauf gehofft.«
Er sah sie erstaunt an. Eine grelle, wehe Erkenntnis kam ihm. »O Lene, das – das hätt' ich nicht gedacht!«
Schwer setzte er sich wieder auf den Stuhl.
Sie legte den Arm auf seine Schulter.
»Du mußt nicht denken, Heinrich, daß der Mathias alles bloß deswegen gemacht hat. Das wär' schlecht, so was von ihm zu denken. Aber ich weiß, daß a drauf gehofft hat. Und nu – Heinrich, es hat mir das Herz umgedreht, wie a heute rumgegangen is, so weiß im Gesichte, und a wollt' nichts zeigen, und a wollt' immer mit der Liese lustig sein – das war zum Erbarmen –«
Er starrte sie an, schüttelte sich und schloß die Augen.
»Lene, das – das könnt Ihr nicht von mir verlangen.«
Sie sah wehmütig vor sich hin.
»Das verlangen wir ja nicht, aber das andere, Heinrich, das darfste uns nich antun.«
Es entstand eine lange Pause.
Draußen sang immer noch der kleine Vogel sein süßes Lied. Und über der Straße schimmerte das warme Licht.
Das Mädchen war verändert. Mit scheuer Zärtlichkeit ergriff sie die Hand des Bruders.
»Heinrich, fällt Dir's so schwer?«
Er antwortete heiser:
»Ich weiß es erst jetzt – jetzt, da ich sie nicht haben darf, wie lieb ich sie hab', wie unsinnig lieb!«
Und nach einer Weile schluchzte er auf:
»Lene, wir haben ein schreckliches Leben!«
Ihr Gesicht verzog sich.
»Ich weiß ja, ich bin häßlich zu Dir und zu allen Leuten, ich ärgere Euch alle – alle, aber ich kann nicht dafür.«
Er antwortete nicht.
»Aber ich mein's auch gut, bloß ich kann's nicht so zeigen, ich bin ein so schrecklich grobes, dummes Ding. Und mich kann niemand leiden!«
Sie fing wieder leidenschaftlich an zu weinen. Trotz seines eigenen Leides fühlte er, daß auch die Schwester einsam und glücklos sei.
»Lene,« sagte er, »wir wollen versuchen, daß wir uns jetzt besser vertragen. Ich weiß schon, was ich Euch schuldig bin. Ich werd' mir Mühe geben, Lene, in jeder Weise Mühe geben!«
Und drüben über der Straße?
Die alte Stenzeln war eingeschlafen bei der Krankenwache. Jetzt schreckte sie empor.
»Ach Gott, ich bin wohl – ich bin wohl eingeschlafen? Fehlt was, Lotte?«
Das schöne Mädchen schüttelte den Kopf.
»Ich bin ganz zufrieden.«
Auch sie hörte den kleinen Vogel, der draußen sang. Und auch sie dachte daran, wie sie mit Heinrich durch den Wald gefahren war. Wie sie da beide so still und glückselig waren. Die Maiglöckchen, die er ihr gepflückt, standen in einer kleinen Vase am Bette. Sie waren ihr teuer. Und sie freute sich, daß sie bei dem Sturze vom Wagen nur ihre goldene Brosche verloren hatte, nicht diese drei Blumenstengel.
»Wie kam es denn, Stenzeln, daß Herr Raschdorf nach dem Arzte gefahren ist und nicht jemand von uns?«
»I du meine Güte, das hätt' lange gedauert! Na, Du weißt ja, Lotte! Aber der junge Herr drüben is gefahren wie a Toller.«
Lotte lächelte.
»Weiß er schon, daß ich den Fuß gebrochen habe?«
»Freilich, freilich! A hat ja unten im Hause gewartet, bis ich ihm alles gesagt hab'. Na, und a läßt Dich schön grüßen, und es tät ihm schrecklich leid!«
Lotte lächelte wieder.
»Ja, Stenzeln, das glaub' ich, daß es ihm leid tut; er ist ein sehr guter Mensch.«
Die Stenzeln nickte und dröselte ein Weilchen für sich hin. Dann hustete sie und sagte: »Na, eigentlich soll ich's ja[193] nich sagen, aber Du wirst ja nischt verraten – da sieh mal!«
Sie zeigte ein Fünfmarkstück und mäßigte ihre Stimme zu einem Flüstern: »Das hat a mir geschenkt, der junge Raschdorf, und ich soll Dich nur gut pflegen, hat a gesagt –«
Eine tiefe Röte zog über das Gesicht der Kranken, und ein glückliches Leuchten brach aus ihren Augen.
»Ja, und jeden Abend um neune will a mich unten an der Haustür fragen kommen, wie's Dir geht.«
»Hat er das gesagt?«
»Freilich hat a! A hat 'ne schreckliche Bangigkeet um Dich.«
Die Stenzeln seufzte.
»Schade is! Schade, daß a nu grade der Raschdorf is. Sonst is a wirklich a sehr schmucker Mensch.«
Lotte antwortete nicht; nur die Hand irrte auf dem Deckbett hin und her, und auf ihren Wangen brannte die Röte.
»Ja, und gewundert hab' ich mich, daß Dein Vater weiter nischt gesagt hat. Na, aber bei dem kommt's vielleichte noch. O, das wird a Aufsehen sein im Dorfe! Da werden sie ja wieder was zusammenquatschen. Is doch aber nischt dabei. Denn an was anderes is ja hier gar nich zu denken.«
Lotte lag ganz still. Ihre Augen wurden ernst und traurig.
»An etwas anderes ist ja hier gar nicht zu denken!«
Eine heiße, qualvolle Unruhe kam, die mehr weh tat als die Schmerzen des kranken Fußes.
Das junge Mädchen starrte vor sich hin. Da – mitten durch ihr Herzeleid schimmerte es immer wieder duftig und silbern –
Ein paar Blumen! Ein glänzendes Geldstück!

Droben im Walde stand ein uraltes, verwittertes Heiligenbild. Es wußte niemand, wer es da hingestellt, wußte niemand mehr, ob es aus Freud' oder Leid geschehen, ob es ein Dank sein sollte oder eine Bitte, ob eine fromme Seele es errichtet habe oder einer, dem eine Schuld im Herzen schrie.
Es stand da die Jahrhunderte hindurch. Und der Frühling stellte seine Blüten rund umher; die Sommersonne vergoldete den grauen Stein; an seinem Fuße legten sich die Käfer schlafen zur Herbsteszeit ins grüne Moos, und wenn die Weihnachtsglocken aus dem Tale klangen, flimmerten Eis und Schnee um das alte Bild, wie auf dem Altar in der Kirche weiße Decken und[196] glänzende Steine. Manchmal zog ein einsamer Wanderer die Mütze ab vor dem alten Bilde. Das ist kein Götzendienst, wenn ein Mensch das Haupt entblößt an so ehrwürdigem Orte, wo so viel Leid und Lust ausgerungen wurden, so viel Friede und Andacht, aber auch so viel Kampf und Reue zu Hause waren seit langen Jahren.
An diesem Heiligenbilde kniete Liese Berger. Der Abend war nicht weit. Da lag ein roter, verklärender Schein über ihr und dem grauen Stein. Von fern sangen ein paar Vögel. Sonst war alles still. Und der Wald blühte über ihr.
Ein langes, stummes Gebet lag in den Augen des Mädchens, ein Gebet voll Qualen. Aber wie sie auf das Bild hinschaute, wurden ihre Augen stiller.
»Wenn es eine Sünde war, verzeih' es mir, heilige Mutter Gottes!«
Das Bild gab keine Antwort; aber in die Augen der Betenden kam Friede. –
Es stand einer von fern. Er war der Liese heimlich nachgegangen. Mathias, ihr Vater.
Er störte sie nicht – o nein! Er wußte, was sie betete. Er wußte, daß es ein Totengebet war für seine und ihre liebste Lebenshoffnung.
Jetzt erhob sie sich und sah ihn. Ein wenig erschrak sie, aber er ging auf sie zu und nahm sie in seine Arme.
»Liese!«
Kein Wort redeten sie. Sie standen ganz still. Ein Vogel, der auf dem Aste saß, hielt inne in seinem Liede, neigte das Köpflein zur Seite und schaute die beiden verwundert an. Und als sie endlich fortgingen, flog er hinüber[197] zum Heiligenbild, wo sein Weiblein im Neste saß, und erzählte ihr, daß es Menschen gäbe, die ganz still stehen und nicht reden. Das Weiblein zwinkerte ihn verständnisvoll an und wies mit dem Schnabel hinab auf das zerdrückte Gras vor dem Bilde.
Und dann sprachen sie von ihren eigenen Sorgen. –
Die beiden Menschen aber gingen schweigend den Bergpfad hinab. Nach einer Weile blieb die Liese stehen.
»Vater, ich will ins Kloster gehen!«
Er erschrak wie vor einem Blitz.
»Mädel!«
Sie klammerte sich an seinen Arm.
»Es ist nicht – es ist ja nicht erst seit gestern – es ist viel länger, ich hab's schon immer gedacht, schon als Schulkind – aber jetzt – Vater, ich will gern ins Kloster!«
»Nein, Liese! Auf keinen Fall! Das geb' ich nicht zu!«
Sie senkte den Kopf. Er aber schlang erschüttert den Arm um ihre Schulter.
»Deswegen nich, Liese! Meine Einzige! Nein, eher will ich –« Die Sprache versagte ihm.
»Es ist ja nicht bloß deswegen, Vater!«
»Ja! Ich weiß schon! Ich weiß genau! Nein, Liese, das geb' ich nich zu. Eher ziehn wir weit fort! Du bist mir die Nächste. Das kann nich sein! Deswegen nich!«
Stumm ging die Liese neben dem Vater her.
»Meinst Du, daß ich's nicht mehr wert bin?«
»Nich wert? Du, mei' frommes, goldenes Kind, Du! Aber mei' Tochter, 's kann ja alles noch gut werden. 's is ja doch nischt weiter passiert, es kann ja alles noch werden.«
Sie sah ihm hell in die Augen und schüttelte den Kopf. Dabei sagte sie ruhig: »Nein, es ist vorbei!«
»Es is nich vorbei! Wieso denn?«
»Wenn a mich auch noch wollte – jetzt wollt' ich nich mehr!«
Er sah sie erschüttert an.
»Wir sind nich füreinander! Ich weiß jetzt. Es war unrecht von mir, daran zu denken, und ich will schon lange ins Kloster.«
»Liese, ich geb's nich zu!«
»Warum nicht, Vater? Ich hab's da ganz gut. Ich geh Kranke pflegen, das tue ich gern. Da kann ich was nützen. Und ich bin vielleicht ganz glücklich. Und so – wenn ich in der Welt bleib'?«
Er sagte nichts mehr. Die stillen Frauen tauchten vor seiner Seele auf, die Siegerinnen, die in sich die Welt überwunden haben. Es liegt alles hinter ihnen, was die Menschenkinder erregt: sie wollen kein Geld, keinen Ruhm, kein Vergnügen, keine Bequemlichkeit, keine irdische Liebe. Sie wollen nur das Gute. Vielleicht, daß eine hie und da mit sich kämpft; die meisten haben Frieden. Und gegen den Frieden ist doch alles andere armer Tand.
Und wenn die Liese in der Welt blieb ohne Beruf, ohne Liebe, ohne Frieden?
Vielleicht, daß es ihr gut wäre im Kloster, vielleicht!
Aber er? – Aber er! –
»Liese, wir wollen weder »ja« noch »nein« sagen; wir wollen abwarten, noch lange abwarten.«
Vom Dorfe herauf nach dem Buchenkretscham zu kamen der junge Riedel und der Barbier.
»Wenn wir's ins Reine bringen, fünfzig Taler sind Deine,« sagte Riedel.
»So leicht wird's gar nich sein,« meinte der Barbier, »Du hast a alten Schräger schon zu ofte geärgert. Und dann der Raschdorf!«
»Quatsch' nich, Mensch! Mehr wie fünfzig Taler gibt's nich! Das mit'm Raschdorf is Mumpitz. Die Schräger Lotte und der Raschdorf! So was gibt's nich. Da red' mir nischt vor.« – – –
Schräger war allein. Er war bereits wieder nicht mehr nüchtern. Die beiden eintretenden Männer grüßten und bestellten sich etwas.
»Na, man hört ja schöne Dinge,« fing der Barbier an.
»Was, schöne Dinge?« fragte Schräger stupid.
»Nu, von der Lotte. Seit wann fährt'n die mit'm Raschdorf Heinrich spazieren?«
»Ja, seit wann fährt'n die mit'm Raschdorf Heinrich spazieren?« wiederholte Riedel spitzig.
»Weeß ich nich,« sagte Schräger pomadig und trank einen Schnaps.
»Weeß a nich,« sagten die anderen beiden gleichzeitig und sehr betroffen.
»Ja, kümmerst Du Dich denn nich drum, Schräger, wenn Dei' Mädel zum Spektakel mit 'm Raschdorf in der Welt rumfährt?«
»Nee,« sagte Schräger, »mir is alles ganz piepe. Ganz egal is mir alles! Hol' alles der Teifel! Prost!«
»Der Kerl is besoffen,« sagte der Freiersmann leise.
»Sag' mal, Schräger, das kann Dir doch nich egal sein. Die Leute im Dorfe reden ja riesig. Sie sagen, die Lotte hat mit 'm Heinrich a Verhältnis.«
»Verhältnis? Weeß ich nich! Kann sein! Kann schon sein! Is mir alles Wurst!«
Riedel und der Barbier sahen sich ratlos an.
»Nu, Schräger, Du bist wohl nich gescheit? Du wirst doch nich zugeben, daß der Raschdorf mit der Lotte a Verhältnis hat? Du bist wohl verrückt?«
»Nee, ich bin gar nich verrückt! 's is ganz gutt so. Kommt alles zusammen, alles zusammen. Is alles gutt! Freut mich! Freut mich wirklich!«
Er rieb sich die Hände.
»A is wirklich verrückt geworden,« sagte Riedel.
»Ich werd' Dir was sagen, Schräger,« fing der Barbier in scharfem Tonfall an. »Du bist a Schafskopp! Der Raschdorf denkt gar nich an die Lotte, der hat 'ne ganz andere. Und Du kannst Dir mit solchem blödsinnigen Getue bloß Läuse n a Pelz setzen. Wenn das rauskommt, daß Du uff a Raschdorf spekulierst, da –«
»Was da?«
»Na so und so –«
»Was so und so?«
Der Wirt wurde etwas nüchterner.
»Na, ich will ja nich zuviel sagen; aber das weißte vielleicht, daß der Mathias gesagt hat, Du spekulierst drauf, daß die Güter zusammenkommen, und hättest deswegen a alten Raschdorf so reingebracht.«
Schräger fuhr wütend auf.
»Der Teifel hol' a Mathias; ich spekulier' nich! Hab' ich nie gemacht! Das is Schwindel!«
»Ja, aber die Leute werden's sagen; sie werden jetzt 'm Mathias recht geben –«
»Wer? Wer? Ich verklag' 'n!«
»Kannste nich! Und dann, wenn wirklich was draus würde, da tränk' keen Mensch mehr bei Dir für fünf Pfennige Schnaps. Mit a Buchenhofleuten will niemand was zu tun haben.«
Der Wirt glotzte die beiden an. Er wollte etwas sagen, schimpfen, abstreiten, aber schließlich wandte er sich ab und trat ans Fenster.
Heute früh, als er ausgeschlafen hatte und sich der Vorkommnisse vom vorhergehenden Tage bei nüchternem Geiste erinnerte, war er zuerst in Wut geraten und hatte großen Spektakel schlagen wollen. Aber dann, als er sich alles genauer ausmalte und auch unterdes wieder viel Schnaps getrunken hatte, war ihm urplötzlich seine alte, längst aufgegebene Lieblingsidee wieder eingefallen: die beiden Buchenhöfe miteinander zu vereinigen. Es war seit Jahren der erste Gedanke gewesen, der ihn aus seiner Säuferlethargie aufrüttelte und etwas wie eine frohe Begeisterung über ihn brachte.
Zwar die Sache schien auch ihm wahnwitzig, er wußte ja auch nichts Bestimmtes, nur den kurzen Bericht der alten Stenzeln, und so beschloß er, der Sache freien Lauf zu lassen. Jetzt kamen diese beiden und verdarben ihm den Plan. Er wandte sich um.
»Was habt Ihr eigentlich? Sie is a Stückel mit ihm gefahr'n. Weiter nischt!«
»Ja, und a hat's Pferd nich gehalten, wie sie abstieg. A feiner Kutscher is a, das wissen wir alle. Aber wie a sie heimgebracht hat, wie a sie um a Hals gehabt hat –«
»Schwindel! Halt's Maul!«
»Wir wissen's! Und alle Leute wissen's!«
Der junge Riedel sprang auf.
»Herr Schräger, es – es muß raus! Ich bin der Lotte gutt, sie gefällt mir, wenn sie auch das Arbeiten nich gelernt hat, und ich wollte heute – heute anfragen, wie's denn wär', wenn wir a Kram zusammenschmissen; aber wenn die Leute so reden, und wenn Sie nischt dagegen haben, und wenn so 'ne Wirtschaft hier is, da – da könnt's sein, ich besänn' mich noch anders.«
Schräger wurde krebsrot.
»Riedel! Pauerjunge! Denkste, das laß ich mir gefall'n? Das soll wohl 'ne Brautwerbung sein? Besänn a sich noch anders, der Schafkopp! Hab' ich dazu gespart und gearbeit't und die Lotte so viel lern'n lassen, daß mir so a Lausejunge so kommt? Mir, 'm Vater? Raus!«
»Menschenkinder, vertragt Euch, vertragt Euch!« beschwor der Barbier.
»Raus!« brüllte Schräger.
Der junge Riedel kochte vor Wut.
»Behalt' sie!« schrie er. »Behalt' sie! Pack schlägt sich, Pack verträgt sich.« Damit war er hinaus. Der Begleiter folgte ihm.
Schräger war wieder allein. Ein paarmal ging er durch die Stube und sprach vor sich hin. Dann sank er auf einen[203] Stuhl. Er wollte nachdenken. Es ging aber nicht. So holte er sich Schnaps und trank.
Allmählich flaute seine Erregung ab.
Eigentlich war's dumm, daß er den Riedel hinausgeworfen hatte. Der Riedel hatte Geld.
Aber Raschdorf hatte mehr. Viel mehr! Und die Ziegelei! Und die Höfe kamen zusammen!
Die Höfe! – – – Wenn er nur nicht Raschdorf hieß!
Ein Frösteln kam den Säufer an.
Der Sohn von dem anderen!
Manchmal kam er ja noch – der andere – in der Nacht, manchmal, wenn Schräger zu wenig getrunken hatte, oder wenn er krank war und nicht schlafen konnte.
Der Sohn! War das möglich? Würd's da besser mit ihm werden oder schlechter? Würde er sich mehr fürchten oder weniger? Damals, als der junge Raschdorf zur Steuer gewesen war, hatte Schräger in der Nacht gut geschlafen. – –
Und auftrumpfen läßt er sich nicht! Und nichts auf die Lotte sagen, nichts! Auch nicht auf den Jungen! Es sind die Kinder! Er hat's danach; er braucht sich und den Kindern nichts sagen zu lassen! Wieder ringt er nach einem klaren Gedanken, will einen bestimmten Vorsatz fassen. Es ist nicht möglich, es bleibt alles verworren. Er trinkt, und dann spricht er wieder mit sich selbst. Alles durcheinander. Manchmal gegen den Riedel, manchmal gegen den Raschdorf. Zuletzt lallt er:
»Hol' der Teifel! Egal, ganz egal! Aber Geld muß sein! Geld!« Und er greift nach der Rumflasche.
Es war Abend. Droben im Krankenzimmer lag die Lotte mit roten Wangen. Sie sah immer nach der Uhr und betrachtete mit qualvoller Ungeduld, wie träge die Zeiger weiterrückten. Jetzt schlug die Uhr neunmal.
Die alte Stenzeln rührte sich nicht vom Platze und bastelte an ihrem Strickstrumpf.
»Es ist neun, Stenzeln,« sagte die Lotte stockend.
»Ja, ja,« erwiderte die Alte, »die Zeit vergeht.«
Sie vergaß es. Wenn er jetzt kam und die Stenzeln nicht traf!
»Stenzeln. Es ist mir doch, als ob Ihr gestern gesagt hättet, um neun wollte der Raschdorf Heinrich –«
»Jesses, das hätt' ich vergessen! Na, die Uhr geht ja a bissel zu zeitig. Will ich doch gleich runter.« Sie ging.
»Stenzeln! Sagt ihm doch, ich – ich ließ mich bedanken, daß er mich heimgebracht hat, und daß er den Doktor geholt hat.«
»Werd's ausrichten!«
»Stenzeln! Fragt ihn doch auch, ob nicht seine Leute – ob sie nicht böse gewesen sind – ja?«
»Was sollen sie böse sein? Aber ich werd's ausrichten.«
»Stenzeln! Und dann, ich laß ihn wieder schön grüßen. Das muß ich doch, Stenzeln, nicht wahr?«
»Ja, freilich! Sonst noch was?«
»Nein! Geht nur schnell, daß Ihr ihn nicht verpasset.«
Die Stenzeln ging, und Lotte horchte hinab. Ihre Wangen brannten und ihre Augen waren weit geöffnet. Langsam verrann die Zeit. Wenn sie aufkönnte, ein einziges Mal ans Fenster könnte! Aber sie durfte sich ja nicht[205] rühren. Jetzt war eine ganze Viertelstunde vergangen. Wo nur die Stenzeln blieb? Hatte er sich verspätet? Oder hatte er ihr so viel zu sagen? So viel? – –
Die Stenzeln stand etwas abseits von der Haustür und hielt Umschau. Es war niemand zu sehen. Das Tor und die Tür vom Buchenhof waren geschlossen. Es war auch drüben in keiner Stube mehr Licht.
Wo blieb er? Der Stenzeln wurde die Zeit lang, und sie lief die Straße ein bißchen auf und ab und guckte sich um. Da kam jemand. Es war der Barbier.
»Ah – Stenzeln! Ich denke, Sie haben Krankenwache? Da steht man doch nicht auf der Straße und guckt sich um, als wenn wunder jemand kommen sollte?«
»Das geht kein'n Menschen was an! Und auf Sie hab' ich nich gewart't.«
»Das glaub' ich. Nur nicht gleich so ruppig, Großmutter! Ich wunder mich halt. Wie geht's der Lotte?«
»Schlecht!«
»Großmutter, Sie sind zwar 'ne stachelige Distel, aber wenn's Ihn'n recht is, wart' ich a bissel mit hier.«
»Nö! Ich brauch' niemanden. Ich schnapp' bloß a bissel Luft. Gehn Sie nur rein und löschen Sie Ihren Durst! Hier sein Sie a sehr überflüssiges Möbel! Gehn Sie rein!«
»Denke ja nich dran! Ich bin neugierig, auf wen Sie warten. Woll'n Sie etwa gar wieder heiraten und warten auf a Schatz?«
»Altes Schandmaul! Wissen Sie was? Jetzt geh' ich rein. Sie verderben mir die Luft, Sie windige Seifenblase!«
»Nu, so 'ne alte Säge! Hör'n Sie mal, Großmutter, ich will Ihn'n noch was sagen. Im Dorfe wird riesig gered't über a jungen Raschdorf und die Lotte –«
»Mögen sie reden! Der Schlimmste is jetzt nich dabei. 's böseste Maul is jetzt nich im Dorfe.«
»Hör'n Sie mal, Großmutter, warten Sie doch noch 'n Schlag! Es tut mir leid um die Lotte, denn der Raschdorf bringt sie bloß ins Gerede, na, und a is doch so gutt wie verheirat't mit der Liese.«
»Mit wem?«
»Nu, mit der Berger Liese. Na, Stenzeln, wissen Sie das nich?«
»Sie sind wohl beduselt?«
»Nu, was is da so zu wundern? Denken Sie, der alte Mathias hat was umsonste gemacht? Der hat nich schlecht spekuliert. Na, und der Heinrich, der kann ja gar nich anders, den hält doch der Mathias feste. Großmutter, na, warten Sie doch – – Fort is se, die alte Schwarte!«
»Nun, Stenzeln, Sie waren so lange?«
»Ja! A is nich gekommen.«
»Nicht gekommen? Ist das möglich?«
»A war nich da! Vielleicht hat a's vergessen.«
»Vergessen?«
»Lotte, 's beste is, ich geh nich mehr runter. 's hat ja kein'n Zweck. 's kann mich auch jemand erwischen. Heute hat mich schon der Bader gesehn. Der hat gesagt, die Leute reden über Dich und über a Raschdorf Heinrich, und der wär' doch so gut wie verheirat't mit der Liese.«
»Was? – – Mit wem? – – Stenzeln! Ooh!«
»Was is denn, Lotte, was schreiste denn?«
»Ach, mein Fuß – mein Fuß tut mir weh!«
»Der Fuß? Aber a liegt richtig! Na, 's beste wär' schon gewesen, Du hätt'st a Heinrich nich getroffen. Das tut amal nischt Guttes. Na, und da hat ja der Barbier recht, 'm Berger Mathias is es der Raschdorf schuldig, denn dem verdankt a ja alles.«
»Ja! – Ja, Stenzeln! – Es ist genug! – – Ich will schlafen! Seid jetzt ganz stille – ich bin so sehr müde!«

Drüben im Buchenhofe hatte Heinrich Raschdorf die Stenzeln wohl gesehen. Am Fenster hatte er gestanden, oben in seinem Zimmer. Als wenn er das Fieber hatte, so hatte es ihn geschüttelt. Ein paarmal war er nach der Tür gegangen, aber immer wieder umgekehrt; ein paarmal hatte er die Hand am Fensterwirbel gehabt, aber doch nicht geöffnet.
Dann, als sie fort war, hatte er sich auf sein Sofa geworfen. Er war tief unglücklich. Eine schwere Verachtung gegen sich selber bäumte sich in seinem Herzen auf. Er war kein Mann, kein Charakter, er hatte keinen Willen. Warum ging er nicht? Warum fragte er nicht die Stenzeln? Warum hielt er sein Versprechen nicht?
Warum? Er durfte nicht; es ging gegen sein Gewissen. Er mußte diese Liebe ausrotten mit Stumpf und Stiel; er durfte ihr nicht die mindeste Nahrung geben.
Denn es war unmöglich! Ganz unmöglich!
Die Heimat, die er noch gehabt hatte, würde er verlieren, die wenigen Menschen, die treu und ehrlich zu ihm[209] hielten, würde er sich entfremden, und er würde auch ihnen die Heimat nehmen.
So mußte er sich opfern, sich und – sie.
Sie? Nein, sie nicht! Sie wußte nichts von Liebe. Wenn ihr Fuß geheilt war, war sie wieder ganz gesund.
Aber unglücklich war sie auch, das hatte sie gesagt.
Der junge Buchenbauer verbrachte eine Nacht voller Kämpfe.
Er wollte sich rasch und stark durchringen zur Gerechtigkeit und zum Frieden. Der junge, weiche Mann! Er wußte nicht, was solche Kämpfe bedeuten, die Kämpfe, die alle Menschen mit klugem Kopf oder mit weichem Herzen zu bestehen haben, und bei denen der Sieg gar nicht kommt oder oft spät, wenn schon viele Wunden geschlagen sind.
Zum Frühstück brachte ihm die Liese den Kaffee. Sie war ein wenig blässer als sonst, aber ihr Gesicht war freundlich wie immer.
Ehe sie hinausging, sagte sie:
»Wie ich vorhin aus der Kirche kam, hab' ich die Stenzeln getroffen. Sie läßt sagen, gestern wär' es sehr gut mit der Lotte gegangen, aber in der Nacht hätte sie Fieber gehabt.«
Der Buchenbauer wurde rot.
»Ja – ja – ich danke, Liese – es ist mir ja ganz lieb, daß ich – daß ich etwas höre!«
»Ja, und dann läßt die Stenzeln noch sagen, sie will nicht mehr herunterkommen abends um neun, weil Du gestern nicht gekommen wärst, und weil es Aufsehen machen könnte.«
Heinrich starrte das Mädchen an und war nicht fähig, ein Wort zu sprechen.
»Willst Du noch mehr Brot haben, Heinrich?«
»Liese!«
Er sprang auf und ergriff ihre Hand. Das Mädchen erschrak und wich zurück.
»Liese! Du bist so engelsgut, und ich bin ein unglücklicher, schlechter Mensch!«
»Was ist mit Dir, Heinrich? Du bist doch nicht schlecht! Was hast Du?«
Er ließ ihre Hand frei.
»Ich weiß, ich bin undankbar, sprich nicht, ich weiß; Ihr tut mir alle Gutes, und ich –«
»Du tust uns allen auch Gutes, Heinrich!«
Sie war sehr rot und sehr verwirrt und ging schnell hinaus.
Er sah ihr nach. In diesem Augenblick wohnte ein hohes Gefühl für sie in seiner Brust. Er wäre imstande gewesen, alles für sie zu opfern, was er besaß. Maßlose Dankbarkeit erfüllte ihn, auch tiefes Mitleid.
Sie brachte ihm Nachricht von der anderen. Wie uneigennützig war dieses Wesen! Er dachte nur an sich, immer an sich.
Es mußte anders werden. Freundlich wollte er sein zu allen, er wollte sich selbst überwinden.
Was nur die Lene sagen würde, wenn sie erführe, daß er die Stenzeln bestellt habe? – Sie sagte nichts, als sie ihn traf. Die Liese hatte nichts verraten. Und da war er wieder dem blassen Mädel dankbar.
Mathias Berger ging einsam aufs Feld hinaus. Sehr langsam ging er. Es war, als ob etwas in ihm erstorben wäre. Eine alte, längstvergangene Zeit fiel ihm ein, da er als junger Bergmann tief unter der Erde war und mit tausend Qualen an seine verlorene Liebe dachte.
Ganz ähnlich war ihm jetzt wieder zumute. Im Grunde genommen ist verlorene Liebe ja doch immer verlorener Glaube.
Wo war für ihn noch eine Aussicht?
Doch nicht an sich dachte er nur. Heute oder morgen konnte er sein müdes Haupt zur Ruhe legen. Aber das Leben der anderen war lang …
Ein Mann sprach ihn an – der Barbier.
»Mathias,« sagte er scheinheilig, »ich weiß nich, ob Du mit mir reden magst. Getan hab' ich Dir ja eigentlich nischt, na, aber Du weißt ja –«
»Was willst Du von mir?«
»Mathias, es läßt sich eigentlich schwer sagen. Sieh mal, Du weißt ja, daß ich damals zum Schräger gehalten hab' –«
»Ja, das weiß ich!«
»Natürlich haste mir das übelgenommen. Aber ich hab' halt wirklich gedacht, der Schräger is ganz und gar unschuldig, und es tät ihm unrecht geschehn.«
Er machte eine Pause und sah lauernd auf seinen Begleiter. Aber der sagte kein Wort.
»Ja, aber jetzt –«
Mathias konnte doch nicht verhindern, daß er aufsah.
Der Barbier mäßigte seine Stimme.
»Behaupten will ich ja nichts, man muß ja sehr vorsichtig sein, aber es bleibt ja wohl unter uns.«
»Barbier, 's beste is, Du behältst Deine Geheimnisse für Dich. Ich will sie nich wissen.«
Die schroffe Abweisung verschlug dem andern nichts.
»Geheimnisse sind's ja eigentlich nich. Aber das möcht' ich im Vertrauen sagen: ich halt auf a Schräger nich mehr so große Stücke; ich glaub' nich mehr alles. Na, glauben kann man ja, was man will – was?«
Dem schlichten, ehrlichen Manne waren die versteckten Andeutungen zuwider.
»Sag' nur, was Du von mir willst; was Du mit 'm Schräger hast, is mir egal.«
»Na ja, ich hab' nischt mit ihm. Aber das will ich Dir sagen, der Schräger spekuliert wieder, daß die Höfe zusammenkommen sollen –«
»Was? Wieso?«
Der Barbier war froh, nun endlich doch das Interesse seines Begleiters geweckt zu haben. Deswegen sagte er eifrig: »Na, Mathias, mir is immer gewesen, als hätt' ich was mit Dir wieder gutt zu machen. Früher haste gesagt, der Schräger will die beiden Höfe haben; da biste bestraft worden, und die Leute haben sich gefreut, na, und ich: gefreut hab' ich mich ja nicht, aber ich hab' doch gedacht, der Schräger hätte recht –«
»Wozu die alten Geschichten?«
»Na, ich will Dir's sagen: Gestern hat der Schräger im öffentlichen Gasthause gesagt, daß a die Höfe zusammenbringen will.«
Berger blieb stehen.
»Wie kann a das sagen? Der Buchenhof ist in fester Hand.«
Der Barbier lachte vertraulich.
»Das sag' ich eben auch. Der Buchenhof ist in festen Händen, in guten Händen, und wie lange wird's dauern, da heirat't der Raschdorf Heinrich Deine Tochter und da –«
»Barbier, das verbitt' ich mir! Das geht keinen Menschen was an! Das will ich nich hören! Verstehst Du?«
Dem alten Manne zitterte die Stimme. Der andere blieb geschmeidig.
»Ja, nimm's nur nich übel, angehen tut's mich ja nischt, das is wahr, und ich red' ja kein Wert darüber, wahrhaftig nich 'n Wort, aber 's is ja selbstverständlich –«
»Was selbstverständlich? Wer sagt das? Wer kann das sagen?«
»Nu ja, die Leute sagen's, Du hast so viel für a Heinrich getan, und 's is vernünftig.«
»Die Leute! Die Leute geht nischt von uns an – nischt! Jetzt sag' mir endlich, was das alles zu bedeuten hat, und was Du eigentlich bezweckst?«
»Na, also sag' ich's halt gerade raus: Der Schräger hat sich gestern im offnen Lokale gerühmt, daß der Heinrich um seine Lotte geht.«
Berger schrak doch ein wenig zusammen.
»Gerühmt? Wieso gerühmt? Das würd' doch der Schräger gar nich zugeben!«
»Zugeben? Na, täusch' Dich nich, Mathias! Wenn der Schräger Geld spürt, da is a zu allem fähig. Und a hat's[214] ja öffentlich gesagt. A hat gesagt, dem Lumpenmannmädel würd' a den Goldfisch schon noch wegschnappen.«
Berger verlor die Fassung.
»Barbier – das – das – meine Tochter will den Heinrich gar nich – verstehst Du – mag ihn gar nich – sag' das den Leuten! Und jetzt geh' Deiner Wege! Wie kommst Du überhaupt dazu, Deinen Freund bei mir zu verraten? Ich will nischt mehr wissen – nischt!«
Er bog in einen Seitenweg ein, und der Barbier sah ihm nach.
»Der hat sein'n Hieb weg,« dachte er, »der wird jetzt schnell zulangen. Wär' der Geier, wenn wir den Raschdorf nich wegkriegten. Der könnte mir gerade passen im Kretscham. Und dann – die fünfzig Taler vom Riedel-Bauer!«
Die Straße entlang zogen singende, junge Männer. Sie waren in der Stadt zur Aushebung gewesen. Das ist ein Wendepunkt in dem Leben dieser Leute. Zum Militär kommen oder nicht, das bedeutet viel.
Da taten diese Leute, was unser guter, deutscher Stammesgenosse immer tut, wenn ihm etwas Außergewöhnliches passiert – sie tranken. Ob aus Schmerz oder Freude, das bleibt sich für den Durst gleich. Es wird getrunken, und je wichtiger das Ereignis ist, desto mehr wird getrunken.
Das ist nun schon ein schnurriger Kerl, der Herr Alkohol. Er ist überall auf der Welt ein bißchen zu Hause, betrügt im schönen Türkenlande den Mohammed und ist die einzige Person in der Grönländerhütte, für die etwas Erkleckliches ausgegeben[215] wird; er schwimmt auf allen Meeren, kraxelt auf alle Berge und marschiert auf allen Straßen.
Gar im lieben Deutschland hat er Ehrenbürgerrechte, denn er zahlt die meiste Steuer, ist populär beim Volke und persona gratissima bei Edeln und Fürsten. Da macht er sich breit bei Kindtaufen und Leichenschmaus, sitzt zwischen Bräutigam und Braut, wetzt dem einen das Rowdymesser und fungiert bei zwei anderen, die Brüderschaft trinken, als gemütlicher Ehrenzeuge.
Und den jungen Rekruten, die der König warb, kommandiert er auf dem Heimwege noch lange, ehe sie vereidet und eingekleidet sind, wie ein recht launiger Unteroffizier, bald »Rechts schwenkt«, bald »Links schwenkt«, bald »Beine hebt«, bald »Arme streckt« und manchmal auch »Knie beugt« oder »Legt Euch nieder«. –
Einer ging abseits – Hannes. Er hatte sich nicht betrunken und auch keine bunten Papierbänder an den Hut geheftet wie die anderen. Und doch hätte er nach landesüblichem Begriff das Recht dazu gehabt, denn er war »ausgezeichnet« worden.
Mit sehr gemischten Gefühlen schritt Hannes seines Weges. Daß er fortkam in die Stadt, fort aus der Einsamkeit, und eine bunte Uniform mit glänzenden Knöpfen tragen sollte, freute ihn. Eine Fülle von Vorstellungen, Plänen und Hoffnungen schwirrte durch seinen Kopf. Und doch war auch eine große Bangigkeit in ihm.
Da traf er die Lene, die den Leuten das Vesperbrot aufs Feld getragen hatte. Er erzählte ihr, daß er nun »ausgehoben« sei und zum Herbst fortkäme.
Das Mädchen wurde um einen leichten Schein blasser, als sie das hörte.
»Da freuste Dich wohl, daß Du endlich amal fortkommst?«
»Och ja! Ich freu' mich schon, Lene! 's soll ja sehr hübsch sein bei a Soldaten!«
Sie antwortete nicht und schritt schnell weiter.
Nach einer Weile sagte er: »Eigentlich freu' ich mich gar nich, Lene.«
Sie antwortete etwas hastig und stoßweise: »Warum nich? Du kommst fort zu Leuten; Du siehst und hörst was, und Sonntags kannst Du tanzen gehn mit a Stadtmädeln. Das wird Dir schon gefall'n.«
Er sprang vom hohen Wegrande herab und faßte sie erregt am Arme: »Nein, Lene, nein! Ich tanz' nich mit a Stadtmädeln, mit keiner einzigen tanz' ich, ich bin bloß Dir gutt, bloß Dir!«
»Nu, Hannes! Was fällt Dir denn ein?«
»Ich muß Dir's sagen, Lene, eh' ich fortkomm'! Sonst halt ich's nich aus; sonst lauf' ich fort am ersten Tage. Ich bin Dir so sehr gutt, und wenn Du mir nich wieder gutt bist, da wär's besser, ich wär' tot. Und du mußt mich heiraten, Du mußt, Lene!«
Sie sah ihn an und brach in ein schallendes Lachen aus.
»Lene, lach' nich! Lach' nich, Lene! Es is mei Ernst! Hör' auf zu lachen! Du machst mich verrückt!«
Aber sie lachte immer weiter.
»Warum lachst Du mich denn aus? Weil ich der arme Schafferjunge bin, und Du die Raschdorf Lene? Deswegen?«
Da wurde sie ernster.
»Na, deswegen grade nich! Aber daß Du Dir einbild'st, Du bist mir gutt, das is lustig. Da muß ich schon lachen. Mir is niemand gutt. Das weiß ich! Und Du zuallerletzt, denn Dich hab' ich am allermeisten geärgert.«
»Aber ich bin Dir gutt, Lene! Das muß ich doch besser wissen als Du. Immer schon! Schon, wie wir noch in die Schule gingen –«
»Weil Du keine andere kennst! Wenn Du in der Stadt sein wirst, da wirst Du schon eine andere finden.« Sie lachte wieder laut auf; dann fuhr sie fort: »Du bist doch a komischer Kerl, Hannes! Also wirklich, heiraten willste mich? Von was denn leben? Du hast nischt, ich hab' nischt! Und Du weißt wohl gar nich, daß ich beim Heinrich bleiben muß?«
Er blieb stehen.
»Lene, wenn ich a reicher Pauersohn wär', tät'st Du mich da mögen?«
»O ja! Kann sein! Da hätten wir was zu leben! Denn das muß sein, Hannes! Von nischt is nischt. Sieh mal, das is nich anders. Praktisch muß man schon sein, und wir zwei so als Knechtsleute auf 'm Buchenhofe, das tät mir nich passen.«
»Na, da – da warte, bis Dich a Reicher nimmt!«
Ihr Gesicht wurde weicher und ihre Stimme leiser.
»Ich hab' nich gesagt, daß ich ein'n andern will. Da biste sicher! Denn da hast Du das erste Anrecht auf mich, wo ihr uns so geholfen habt.«
Er lachte bitter.
»Geholfen! Wenn's darum wär'! Der Vater hat sein'n Lohn gekriegt und ich mein'n. Ihr seid uns nischt schuldig.«
Damit wandte er sich ab. Ganz ernst sagte sie:
»Wenn Du's nich glaubst, tut mir's leid. Ich tät's schon, aber es geht nich, und was nich geht, muß man sich aus 'm Sinn schlagen; sonst ist man dumm!«
Sie wartete auf eine Antwort; aber er setzte sich auf den Feldrain und sagte kein Wort.
»Hannes, wirste so im Zorne von mir fortgehn?«
»Ja!«
»Und da wirste mich für schlecht halten, Hannes?«
»Nein! Ich werd' bloß denken, daß ich Dir zu arm bin, und daß Du mich nich leiden kannst, und daß es für mich besser gewesen wär', ich wär' nie auf 'm Buchenhofe gewesen.«
Sie besann sich ein bißchen. Leise sagte sie:
»Hannes, wenn's ging, da tät ich Dich nehmen, wenn ich Dich auch nicht leiden könnt'. So viel hab' ich schon Dankbarkeit in mir, wenn's auch keiner glaubt. Aber 's geht nich, wir sind beide zu arm, und da hat's keinen Zweck. Und daß Du sagst, es wär' besser für Dich gewesen, wenn Du nie bei uns gewesen wärst, damit haste recht, denn bei uns is nischt zu holen wie Arbeit und Kummer.«
Ein paar Sekunden blieb sie noch stehen und wartete.
»Kommste mit?«
»Nein!«
Da ging sie. Als sie weit genug fort war, warf sich der »lustige Hannes« auf den blühenden Feldrain und weinte bitterlich.
Drüben auf der Straße sangen ein paar Burschen:
Da blieb unten am Berge die Lene stehen, und auch sie horchte auf das Lied. Dabei kam ihr Wasser in die Augen.
»Das haben sie davon, die Liese und der Hannes und auch der Schaffer und der Mathias. Das haben sie für ihre Schinderei all die Zeit! Undank! Undank! Der Heinrich will nich, und ich kann nich!«

Frühling und Sommer waren vergangen, der Herbst stand vor der Tür. Es war eine arbeitsreiche Zeit gewesen. Die Buchenhofleute waren noch viel stiller geworden als sonst, und sie gingen alle nebeneinander her wie Fremde.
Die Liese war vom Buchenhof weggezogen und wohnte unten im Dorf bei ihrer Tante. Und an einem trüben Herbsttag hatte auch Hannes Abschied genommen. Mit seinem kleinen Handkoffer war er in die Wohnstube getreten.
»Ich – ich komme bloß noch Adieu sagen. Es is Zeit auf die Bahn.«
Heinrich reichte ihm mit Herzlichkeit die Hand.
»Leb' gesund, Hannes! Laß Dir's gut gehen bei den Soldaten! Und hab' viel tausend Dank für alles!«
Hannes wandte sich ab.
»Ich – ich dank' auch für alles!«
»Du wirst uns fehlen, Hannes. Mir am meisten! Aber wenn die zwei Jahre um sind, kommst Du wieder zu uns.«
Hannes stand mit gesenktem Haupte da. Er sagte nicht ja noch nein. Er wollte sich beherrschen, aber der Atem ging ihm schwer, und er zitterte leise.
»Wenn Dir was fehlt, schreibst Du! Du darfst keine Not leiden. Hörst Du, Hannes?«
Der sagte kein Wort und stand nur mit bleichem Gesichte da und zerdrückte den Hut zwischen seinen Fingern.
»Hast Du mir noch was zu sagen, Hannes?«
»Nein! – Ich muß gehen! – Es – es ist Zeit. Adieu, Heinrich!«
»Lebe wohl, lieber Hannes!«
Er drehte sich um. Auf der Ofenbank saß die Lene und schälte Kartoffeln.
»Adieu, Lene!«
Das Mädchen wischte sich an der Schürze die Hand ab und reichte sie ihm hin.
»Leb' gesund, Hannes!«
Sie schaute nicht auf. So ging er aus der Stube, und Heinrich begleitete ihn bis in den Hof. Dort saß der alte Schaffer als Kutscher auf dem kleinen Korbwagen und tat ganz gleichgültig, hatte aber doch einen dunkelroten Kopf.
Bald darauf zogen die Pferde an. Ade, alte Heimat!
Es war eine »Mission« im Dorfe abgehalten worden. Ein paar fremde, tüchtige Geistliche hatten täglich mehrere Predigten abgehalten, und die Leute waren scharenweise zur Kirche gegangen.
Ein alter Franziskanermönch hatte auch gesprochen über den »Beruf« und also geschlossen:
»Gott hat einem jeden Menschen seinen Beruf ins Herz gelegt. Ihr aber, wenn Ihr seine Stimme höret, verhärtet Eure Herzen nicht!«
Danach war es zwischen Liese und ihrem Vater zu einer letzten Aussprache gekommen.
Mathias hatte unter allen in den letzten Monaten am meisten gelitten. Ihm war die Veränderung wohl aufgefallen, die mit Heinrich vorgegangen war. Er hatte gesehen, wie der junge Mann mit sich rang; wie er niemals wieder das Haus Schrägers betrat und dafür immer die Gesellschaft der Liese suchte. Er war so freundlich mit ihr in allen Dingen, und der kluge Mathias wußte wohl, daß Heinrich einen Weg, eine Möglichkeit suchte, daß er sich selbst bezwingen wollte, um schließlich, wenn er ein wärmeres Gefühl für die Liese hätte, doch noch den Herzenswunsch des Mathias zu erfüllen.
Und da hatte unverhofft eines Tages die Liese ihren Vater gebeten, daß sie vom Buchenhof weggehen und zur Tante hinunterziehen dürfe ins Dorf.
Mathias wußte, was das bedeutete, und er hatte sich gefügt. Er konnte dem stillen Mädchen nichts mehr versagen. Und ob das Kind all seine irdische Liebe bekämpft hatte und nun täglich in der Kirche kniete – die Frage quälte ihr zartes Gewissen: ob sie noch würdig sei, eine Dienerin Gottes zu werden.
Da kam ein recht stiller, schwermütiger Abend. Draußen auf der Dorfaue spielte der Wind mit welkem Laub, trug[223] es hin durch den Staub der Straße und senkte es drüben in den tiefen, schlummernden Teich.
Die Liese hatte lange hinausgesehen, auch nach den grauen Wolken, die am Himmel hingen. Dann wandte sie sich langsam um.
»Vater, ich will heut' zur Beicht', ich will fragen.«
Mathias sagte nichts. Er hatte darauf gewartet.
Er wandte sich ab und hörte kaum, was ihm die Liese noch einmal sagte von Beruf und Gnade, von Nächstenliebe und Herzensfrieden.
Zuletzt sagte er nur die Worte:
»Geh' in Gottes Namen!«
Dann ging er fort – in den Herbst hinaus, über die kahlen Felder bis in den gelben Wald. Aber wie er eine Weile gewandert war, faßte ihn eine furchtbare Bangigkeit und eine zehrende Sehnsucht nach seinem Kinde, und er kehrte um und ging dorthin, wo sie war.
Dunkel lag die Kirche. Das ewige Licht nur brannte rot und magisch vor dem Altar; hie und da flammte ein Lichtlein in den Bänken der Beter, und große Schatten huschten über die alten Bilder.
Mathias Berger kniete in eine Bank und durchlebte die schwersten Minuten seines Lebens.
Im Winkel dahinten im Beichtstuhl, bei dem Franziskaner, war seine Liese, und dort wurde entschieden über sie und über ihn.
Qualvoll langsam verging die Zeit. Sie war so lange, so lange! Freilich, ihre Frage war schwer.
Jetzt kam sie.
Er wandte sich um – sah sie an – fragend – bittend.
Sie lächelte leise und neigte bejahend das Haupt.
Dann kniete sie zu dem Bilde der schmerzhaften Madonna.
Mathias Berger legte das Gesicht auf seine Hände.
Und draußen klang die Abendglocke.
In der großen Wohnstube des Buchenhofes brannte die Petroleumlampe. Heinrich saß, wie fast immer an den Abenden, über einem Lehrbuch, und Lene nähte. Sonst war niemand da.
Da trat Mathias Berger ein. Lene erhob sich:
»Ich bring' Dir gleich das Essen, Mathias.«
»Laß, Lene, laß! Ich will nich essen.«
Sie sah ihn betroffen an.
»Was ist mit Dir, Mathias? Bist Du krank? Du bist ja kreideweiß im Gesichte.«
»Nein, ich bin nicht krank! Aber es – es ist was passiert, und ich muß mit Euch reden, mit Euch beiden.«
Die Geschwister schauten ihn fragend an. Mathias Berger setzte sich. Er sah sie an mit seinen guten, treuen Augen, weh und schmerzlich. – So würgte er hervor:
»Denkt amal: Meine – meine Liese geht ins Kloster!«
»Mathias!«
»Mathias!«
Sekundenlang war es still.
Mathias sprach weiter:
»Es geht ja schon lange drum, und ich hätt' auch schon was gesagt, aber es hat sich heute erst richtig entschieden.«
»Mathias, das – das ist ja nicht wahr, das kann ja nicht sein, das ist ja Unsinn, was Du sprichst.«
»Es ist wahr, Lene, es ist wirklich wahr!«
Heinrich hatte bis jetzt wie versteinert dagestanden. Nun sprach er gepreßt:
»Warum? Warum tut sie das?«
Mathias Berger schlug die Augen nieder.
»Sie sagt, sie hat Beruf dazu. Und das is ja wahr; sie war immer a frommes, guttes Kind, gar nich so für schöne Kleider und Vergnügen, und sie war auch immer gern bei Kranken, das is schon wahr!«
»Darum ist es?« fragte Heinrich. »Bloß einzig darum?«
Mathias antwortete nicht. Die Lene hatte die Schürze vor das Gesicht gepreßt. Wieder blieb es eine Weile still. Da schaute das Mädchen zornig und leidenschaftlich auf: »Nein, nich bloß deswegen! Sie is ihm gutt gewest – dem! Sie hat ihm alles zuliebe getan, immer freundlich, immer so freundlich, aber der hat nischt von ihr wissen woll'n. Tagelang, wochenlang hat a nich mit ihr gered't – und da – und da –«
Sie brach in einen Strom von Tränen aus. Und vor der leidenschaftlichen Anklage verstummte der, den sie anging, und auch der andere, der kein Wort der Entgegnung wußte.
Lene sprach weiter:
»Weißte, Mathias, was wir sind? Lumpe sind wir! Du – Du hätt'st uns damals sollen betteln gehen lassen – rausschmeißen lassen – verkommen – da – da wär's für Dich viel besser gewest! Jetzt haste a Dank!«
»So – so is das nich zu nehmen, Lene! Ihr seid immer freundlich und dankbar zu mir gewest – o ja! – Du mußt 'm Heinrich nich solche Vorwürfe machen; a kann doch nich dafür.«
»Wohl kann a dafür! A is a Mann! A kann durchsetzen, was a will! Und a hätt' a schmuckes, braves Weib gehabt an der Liese. Nein, a wollte nich! A gafft über die Gasse zu der Bande, auf die gezierte Gans.«
»Lene!«
Heinrich rief es, der bisher kein Wort zur Verteidigung gesagt hatte.
»Lene, das verbiet' ich Dir! Mir kannst Du antun, was Du willst, dem Mädel nichts – nichts! Ruhe biet' ich! Sie hat Dir nichts getan, mir nichts getan, uns allen nichts getan! Verdreh' die Augen, wie Du willst, vergreif' Dich meinetwegen an mir, wenn Du's wagst. Ich sag' Dir's geradezu ins Gesicht, auch dem Mathias: Ich kann nicht dafür, ich konnte die Liese nicht heiraten, weil wir beide unglücklich geworden wären.«
»Mensch, wagst Du das wirklich jetzt zu sagen, jetzt? Nein! Weil Du an der anderen hängst, an der – an der –«
»Ja, ich hab' sie lieb! Sehr lieb! Ich fürcht' mich nicht, das auch zu sagen. Ich hab' sie gern, und ich hab' genug gelernt, daß ich weiß, daß sich so was nicht ändern läßt. Aber ich hab' mir Mühe gegeben; ich hab' mit mir gekämpft, das weiß Gott! Es ist nicht gelungen.«
»Nich gelungen? Und das is alles? Und Du – Du sagst wenigstens nich jetzt – jetzt in der letzten Stunde noch,[227] eh' es zu spät is, daß Du die Liese haben willst, daß Du sie dem Mathias erhalten willst?«
»Nein! Ich kann nicht! Was auch passiert – ich kann es nicht!«
»Dann bist Du ein ganz ehrloser Kerl!«
Sie wandte sich nach der Tür, aber Mathias hielt sie zurück.
»Lene, geh nich fort! Bleib hier! Du tust ihm unrecht, Lene! Wenn a auch wollte, es wär' zu spät. Die Liese will ihn nich mehr, schon lange nich mehr, Lene!«
Das erbitterte Mädchen antwortete dem Mathias nicht, sondern wandte sich wieder an Heinrich.
»A ehrloser Kerl! Ich sag's noch amal! Dem Manne, dem wir alles danken, ohne den wir verhungert, verlaust, verlumpt wären, sein Kind nehmen und dann sich großspurig hinstell'n und nischt anderes sagen, wie von der andern reden, kein einziges guttes Wort – pfui – mir würd' der Bissen Brot im Halse stecken bleiben, den ich hier noch äß'. Wir sind fertig mitsammen, wir zwei, für immer fertig!«
»Lene, aber Lene, hör' doch –«
»Mathias, laß mich! Mir graut! Mir graut vor dem da! Ich komm morgen noch amal zu Dir und der Liese runter in Euer Häusel, hier is Zeit, daß ich fortkomme!«
»Lene, wart' doch –«
Sie war hinaus. Heinrich ging auf Mathias zu und streckte ihm beide Hände hin.
»Mathias! Jetzt woll'n wir mitsammen reden, jetzt, da sie raus ist – sie ist ja toll – jetzt mußt Du mir sagen, Mathias, ob Du mich auch für einen ehrlosen Kerl hältst.«
Mathias schüttelte den Kopf.
»Nein, Heinrich! Ich weiß, Du kannst nich dafür.«
Heinrich zitterte vor Erregung.
»Mathias, das schwör' ich Dir: Ich kann keinen Mann mehr achten und keinem mehr dankbar sein als Dir, das ist ja selbstverständlich, und ich hab' die Liese gern gehabt und eine Verehrung für sie gehabt, wie gegen kein anderes Mädel – aber, Mathias, zum Heiraten gehört doch die richtige Liebe, und wenn ich – wenn ich so – nein, das ging nicht! Mathias, das ist wahr, ich hab' Tag für Tag mir eingeredet, ich kann die Liese heiraten, und manchmal da war mir's auch so, als ob es gehen würde, aber dann – wenn ich bloß die Lotte einmal zufällig von weitem sah – da – da – – Mathias, es wär' ja gar nicht darum, ob ich glücklich bin oder unglücklich; ich bin ja mein Leben lang wenig oder gar nicht glücklich gewesen, aber konnt' ich denn Dich und die Liese so betrügen, konnt' ich das? – Und daß sie fortgehen würde ins Kloster, das hab' ich ja nicht gewußt.«
Mathias Berger sah den aufs höchste erregten, jungen Mann ruhig an.
»Setz' Dich, Heinrich, setz' Dich zu mir! Wir wollen ruhig miteinander reden. Es is gutt, daß Du so ganz offen zu mir bist, und ich will Dir auch alles sagen. – Ja, ich hab' darauf gehofft. Wie das so gekommen ist, weiß ich nich. Ich hab' Dir schon gesagt, daß ich Deiner Mutter gutt gewesen bin, als ich jung war. Ich war a armer Kerl und konnt' sie nich haben. Ich weiß, Heinrich, was das heißt, ich weiß! Dann hab' ich doch eine andere geheirat't. Sie hat nur noch a Jahr gelebt; aber ich glaube, wir wär'n gutt[229] zusammen ausgekommen. Wenn man jung is, denkt man, 's geht ohne so eine große Liebe nich. Ach ja, es geht doch, 's geht manchmal besser wie bei solchen Leuten, die vor der Hochzeit ganz vernarrt ineinander sind. Daran dacht' ich, wie ich sah, daß meine Liese an Dir hing, und daß Du so gar nischt davon wußtest und nich daran dachtest. Ich hoffte immer, es kann werden, es kann noch gutt werden. Nu is alles anders gekommen. Ich verhehl' Dir nich, Heinrich, mir is heute zumute wie zum Sterben, weil's doch gerade meine Allereinzige is.«
»Mathias! Mathias! Daß ich Dir das antun mußte, das ist schrecklich! Das ist zum Verzweifeln!«
»Heinrich, flenne nich! Böse bin ich ja gar nich auf Dich. Ich kenn' Dich schon. Das is halt gekommen, wie's kommen muß. Und sieh mal, die Liese wird ja nich unglücklich. Die geht ins Kloster; sie is glücklich darüber, das is ja mein Trost. Ich hab' immer die Mütze abgenommen, wenn ich 'ne Krankenschwester traf. Und wenn ich mich erst werd' besser reingefunden haben, da werd' ich ganz zufrieden sein. Bloß fürs erste fällt's halt schwer.«
Heinrich sah seinen alten Freund plötzlich verängstigt an.
»Mathias! Du wirst doch aber auch bei mir bleiben?«
»Nein! Erschrick nich! 's beste is, wir sprechen heute gleich alles aus.«
»Du willst fort? Fort von uns?«
»Ja, Heinrich! Reg' Dich nich so auf! Wir wollen ruhig reden. Sieh mal, ich muß fort!«
»Das ist die Strafe? Das?«
»Aber doch keine Strafe, Heinrich! Wir gehn in Friede und Freundschaft auseinander.«
Ein verzweiflungsvolles Lachen brach dem jungen Buchenbauer vom Munde.
»In Friede und Freundschaft! Und ich bleib' allein! Und hab' zuletzt niemand mehr auf der ganzen Welt! Und verlier' meinen einzigen Freund! In Friede und Freundschaft!«
Er sprang auf, trat ans Fenster und sah hinaus in die Nacht. Plötzlich wandte er sich um. Mit bitterer Stimme sagte er:
»Deshalb hast Du uns aufgezogen, den Hof aufgebaut, alles in Ordnung gebracht, daß Du jetzt fort willst, weil die eine Sache fehl ging? Und Du sagst doch selbst, ich kann nicht dafür!«
»Ja, Heinrich! Sieh mal, Mensch is Mensch! Ich könnte hier nich mehr sein. Ich würd' immer an die Liese denken müssen. Und dann, es is zu einsam. Es is mir so schon manchmal schwer geworden. Jetzt hielt ich's gar nich mehr aus. Glaub' mir's. Ich hab' darüber nachgedacht. Es geht nich! Rein verdüstern tät' ich. Ich will wieder fort zu Leuten.«
»Doch nicht wieder –«
»Als Lumpenmann? Jawohl, Heinrich! Gerade das! Das hat mir damals auch geholfen.«
»Das kannst Du nicht, Mathias? Was werden die Leute sagen?«
»Die Leute? Mögen sie sagen, was sie wollen. Das kümmert mich nischt. Ich bin's gewöhnt.«
Heinrich eilte auf den alten Mann zu und faßte ihn an beiden Schultern:
»Mathias! Wenn Du mir das antust, ich weiß nicht, was ich anfange. Mathias, kannst Du mir's nicht verzeihen im Herzen? Du sagst ja, Du bist nicht böse auf mich; aber Du bleibst nicht bei mir, Du willst fort, läßt mich allein, weißt, daß ich Dich brauch' wie das tägliche Brot, nicht bloß in der Wirtschaft, nein, tausendmal mehr als Mensch und als Freund, und Du willst fort! Besinn' Dich, Mathias, besinn' Dich anders, und wenn ich ein grundschlechter Kerl wär' – bleib' bei mir!«
Der Alte wandte den Kopf zur Seite.
»Bleib' da, Mathias! Ich bitt' Dich kniefällig!«
»Ich – ich kann nich, Heinrich! Ich brächt's nich fertig. 's geht über meine Kräfte. Und für Dich wär's auch nich gutt, wenn Du mich immer so sähest, und dann, wenn Du die Lotte heirat'st, ging' ich doch.«
»Wer sagt denn, daß ich die Lotte heiraten will? Daß ich ihr gut bin, das kann ich nicht ändern. Aber ich will sie doch nicht heiraten! Das denkt doch bloß die Lene!«
»Es kommt, Heinrich, es kommt bestimmt! Aber es is besser, wir reden lieber nich darüber. Für mich is heute schon a bissel viel gewest. Aber das hatt' ich mir schon lange vorgenommen, Dir's bald zu sagen, wenn sich's mit der Liese entschieden hätte, daß ich da fort will. Und daran will ich auch nichts ändern. Das muß jetzt sein!«
Heinrich trat zurück und lehnte sich bleich an den Tisch.
»So geh! Geht alle! Laßt mich allein, wenn Ihr denkt, daß ich das verdiene! – So sind also auch wir beide mitsammen fertig.« –
Es entstand eine schwere Pause.
»Und Du willst nicht, daß wir weiter Freunde sind, Heinrich?«
»Nein! Wenn Du mir das antust, dann tust Du mir mehr an als mein ärgster Feind!«
»So – so leb' gesund, Heinrich!«
Heinrich antwortete ihm nicht.
Da verließ Mathias Berger den Buchenhof.
Droben in ihrem Stübchen saß Lene Raschdorf und schrieb einen Brief. Dieser lautete:
Lieber Hannes!
Die Liese geht zu den Grauen Schwestern. Der Mathias sagt, sie habe Beruf und gehe gern ins Kloster. Aber ich weiß, daß die Liese unserem Heinrich gut gewesen ist und daß er sie nicht gemocht hat. Er sagt, er wäre mit ihr unglücklich geworden. Das ist aber nicht wahr, denn die Liese ist ein braves, tüchtiges Mädchen. Und er hat es bloß deshalb getan, weil er in die Lotte Schräger vernarrt ist und sie gern heiraten will. Lieber Hannes! Das ist eine solche Schande, daß der Heinrich so etwas tut und daß er unserem guten Mathias solches Herzeleid macht, daß er von jetzt ab nicht mehr mein Bruder ist. Und deshalb schreib' ich an Dich, daß ich Dich heiraten werd', wenn Du vom Militär los bist und wenn wir ein[233] Auskommen haben. Ich denke, Du gehst in die Kohlengrube. Wenn Du Dich eingerichtet hast, verdienst Du 15 Mark die Woche. Und ich werde für die Leute nähen. Da werden wir schon auskommen. Lieber Hannes! Ich will Dir heute schreiben, daß ich Dich lieb hab' und auch wirklich gern heirate. Aber damals, als Du von der Gestellung kamst, konnte ich es Dir nicht sagen, denn ich dachte, ich müßte immer beim Heinrich bleiben und ihm helfen und beistehen, wie es immer war. Aber Heinrich ist schlecht und verdient's nicht, und deshalb gehe ich fort, und es ist mir ganz egal, was jetzt aus unserem Hofe wird. Ich fahre zur Tante Emilie nach Waldenburg. Dort werde ich auch das Nähen lernen und bleiben, bis wir heiraten. Lieber Hannes! Du mußt mir aber versprechen, daß Du immer brav und ordentlich sein wirst, damit wir auskommen. Sonst sollst Du aber lustig sein, denn das habe ich an Dir immer gern gehabt, weil ich selber nicht lustig sein kann. Und ich werde Dich auch nicht ärgern, sondern gut mit Dir sein.
Besten Gruß
Lene Raschdorf.

Am Tage war der Novembersturm jäh und tückisch zur Höhe gefahren und hatte die Wolken angefaucht wie ein bissiger Steppenwolf eine Herde weißer, schwarzer und scheckiger Rosse, so daß alle ratlos durcheinander rannten, sich stießen und ängstlich drängten und alle in großer Not waren, während die ersten, vordersten von dem Ungetüm zerrissen wurden. Aber dann hatte sich die Herde gesammelt, war vorgerückt gegen den Feind, hatte ihn zurückgedrängt, langsam, schrittweise, und ihn erdrückt, als sie ihn am Erdboden traf.
Jetzt lagen die Himmelsrosse müde und sicher auf Feldern und Wiesen, und ein Mensch, der hinausging, mußte sich durchdrängen zwischen ihren weißen und grauen Leibern.
In trübseligem, grauem Licht lag die Wohnstube des Buchenhofes. Heinrich Raschdorf war allein. Lange war[235] er für sich auf- und abgegangen; jetzt lehnte er am Ofen und sah hinaus in den nebligen Tag.
Im ungewissen Licht des trüben Novembertages sah der Buchenbauer erschreckend aus. Die Augen waren tief eingefallen und hatten einen krankhaften Fieberglanz, die Wangen waren farblos, welk, und die ganze Gestalt matt und schlaff.
Das kam vom vielen Grämen am Tage und langen Wachen in der Nacht. Das kam von der Einsamkeit, kam davon, daß Heinrich Raschdorf erst in diesen Tagen ein gänzlich Heimatloser geworden war.
Lene war fort.
Einmal hatte er noch versucht, sich mit ihr auseinanderzusetzen, ihr alles zu erklären. Es war erfolglos gewesen. Nur in neuen Zorn waren beide geraten, und die Kluft zwischen ihnen hatte sich vertieft.
So war sie fortgegangen aus der Heimat. Fest und sicher war sie aus der Tür getreten und hatte den Wagen bestiegen, ohne sich noch einmal umzusehen.
Sie hatte auch keine Träne vergossen auf der ganzen Fahrt. So sagte der Knecht. Nur beim Mathias unten im Dorfe war sie abgestiegen und über eine Stunde geblieben.
Seit der Zeit war Mathias nicht mehr heraufgekommen, und Heinrich hatte ihn auch nicht aufgesucht. Ein bitterer Hochmut hatte ihn erfaßt, der allen denen als Helfer kommt, die sich ungerecht verurteilt glauben.
Was hatte er getan? Er war gegen sich selbst und gegen sein bestes Gefühl nicht treulos geworden. Deshalb hatten[236] sie ihn verlassen, alle verlassen in wenigen Tagen. Manchmal lachte er auf, wenn er daran dachte.
So mochte es sein! So würde er sich darein fügen und keinem mehr ein gutes Wort geben, so tot sein für sie alle, wie sie für ihn waren.
Die Einsamkeit spann ihn ein, aber sie brachte ihm keinen Frieden; sie band nur seine Seele fest, daß er alle Qualen widerstandslos erdulden mußte wie ein Kranker, der auf die Bank geschnallt wurde, an sich schneiden und brennen läßt.
Solange er draußen auf dem Felde war, war's erträglich, aber in dem leeren Hause packte ihn oft das Grauen. Und wenn die Abende kamen, saß er allein und fürchtete sich am eigenen Herde.
Dann meinte er, es gäbe nur einen Ort auf der Welt, wo es schrecklich sei: diese Heimat.
Oft überdachte er sein Schicksal. Schuldlos hatte er die Heimat verloren, hatte um eine neue Heimat gelitten, gekämpft, gebangt, hatte von allen den Millionen auf der großen, weiten Erde ein paar Menschen gefunden, die es gut mit ihm meinten, und auch diese wenigen wieder verloren.
Warum? Darüber brütete er. Wenn ihn ein Groll erfaßte gegen seine früheren Leute, dann war ihm noch wohl. Da war doch ein Kraftgefühl in seiner matten, vereinsamten Seele. Aber Stunden kamen, wo sich neben die graue, schweigende Frau Einsamkeit jene andere an seinen Herd setzte, ihre Tochter: die Reue.
Das sind die Quälerinnen. Die alte, häßliche, dürre Mutter Einsamkeit hält den Armen fest mit ihren Spinnenfingern,[237] bindet ihm jedes Glied, lähmt ihm jeden Muskel, umschließt ihm Mund und Ohren, daß er nicht schreien, nicht fortlaufen, nicht Hilfe holen kann, und derweil treibt ihr grausames Kind, die Reue, ein bestialisches Spiel, sticht und kratzt, brennt und schneidet, preßt das Herz zusammen mit rauhen Händen, greift durch die Stirn in den Kopf hinein, lockert dort Faden auf Faden, zerreißt die Stränge des Willens, trübt und verrückt die Bilder klarer Vorstellungen und gießt ein schleichendes, tödliches Gift in das wallende Gefühl. Wer sich nicht aufrafft mit energischer Kraft, die Alte beiseite schleudert, ihre Bande zerreißt und zu gesunden, frohen Menschen flüchtet, der ist verloren. Im günstigsten Falle ruft die Alte eine neue Tochter: die Schwermut, ein untüchtiges, krankes Weib mit lahmen Händen und traurigen Augen, und vermählt sie dem Opfer zu unlöslicher Ehe, oder ihr scheußlichster Sohn, der Wahnsinn, kommt und mordet ihn ab.
Heinrich Raschdorf hielt still. Manchmal dehnte er ein wenig die Glieder gegen die Bande, aber als der trübe November kam, gab er sich mutlos verloren.
Es waren gute, liebe Menschen gewesen. Sie waren gegangen. Folglich war er schuld, war er der Schlechte, sie die Gerechten. In diesem Zirkel bewegten sich schließlich beständig seine Gedanken.
So stand er an den Ofen gelehnt, indes draußen der weiße Nebel braute. Seit Mittag hatte er mit keinem Menschen ein Wort gesprochen. Und da war es auch nur ein Knecht gewesen, den er etwas gefragt hatte.
Wo war seine Kraft geblieben, der Mut, den er noch hatte, als er mit Mathias und Lene sprach, der Trotz, mit dem er schließlich die Schwester ziehen ließ?
Die Einsamkeit hatte ihn mürbe gemacht.
Jetzt trat er ans Fenster. Vielleicht, daß er einen Menschen vorbeigehen sah. Das würde ihm wohltun. Und dann – dort drüben wohnte das Mädchen, um dessentwillen alles gekommen war. Als Mathias und Lene ihn verlassen hatten, war stundenweise eine wilde Lust in ihm gewesen, ein Freiheitsgefühl, der Gedanke, erlöst zu sein von einer falschen Heimat, die Möglichkeit zu besitzen, nun sein Glück zu suchen, sein einziges, sein wahrhaftiges Glück.
O, wie liebte er die Lotte! Seit jenem Maitage war ihr Bild nicht mehr aus seiner Seele gewichen, was er auch getan hatte, es zu verhüllen. Eine taumelnde Freude hatte ihn erfaßt, wenn er das Mädchen einmal sah, und ob er das Gefühl bekämpfte wie Versuchung und Sünde, es kam immer wieder, immer in tiefgeheimer süßer Wonne.
Und auch jetzt, wie er so hinüberblickte, sah er sie. Sie trat, zum Ausgehen angekleidet, in die Haustür und spähte nach den Fenstern des Buchenhofes herüber. Heinrich wollte zurücktreten in die Stube, aber sie hatte ihn schon gesehen. So sahen sie sich ins Gesicht, wohl eine halbe Minute lang. Sie stand ganz bewegungslos, und ihr Blick hatte etwas Forschendes. Dann neigte sie grüßend ein wenig das Haupt und ging hinab nach dem Dorfe.
Heinrich geriet in schwere Aufregung. Die Stunde war da, wo er tobte gegen die Fesseln der Einsamkeit. Mit tausend Armen winkte es ihn hinaus aus diesem fürchterlichen[239] Hause, das keine Heimat war, das nie eine gewesen war.
Wie ein Rausch kam es über ihn; die Bangigkeit fiel von ihm ab wie ein toter Plunder, das Blut floß wieder jung und schnell durch die Adern, und der Wille straffte sich zu dem Entschluß: Geh ihr nach! Geh zu dem jungen, schönen Mädchen! Bei ihr ist Rettung und Glück!
Er suchte den Hut und band einen Kragen um.
Da grinste ihn warnend der alte Zweifel an.
Hinter einem Bilde seines toten Vaters sah er hervor. –
Er stand still. Er wagte nicht, sich umzusehen. Es war ihm, als ständen an der Stubentür all die Seinigen: Lene mit zürnend abwehrenden Armen, Mathias mit einer stummen Bitte in den guten Augen, die Liese mit traurigem Gesicht, und ganz im Hintergrunde, draußen auf dem dämmerigen Hausflur, schemenhaft die Toten: Vater und Mutter.
Entmutigt sank er auf einen Stuhl und stöhnte laut. Und die Einsamkeit ging und schloß die Tür, nahm ihm den Hut vom Kopfe und sang ihr monotones, totes Lied.
Aber sie täuschte sich. Sie sang das Lied um eine Nuance zu schauerlich, um ein klein wenig zu hart, um ein paar Grade zu höhnisch. Sie sang es unerträglich für den, der es anhören mußte.
»Ich ertrag's nicht länger; und wenn's unter tausend Flüchen wär' – ich geh ihr nach!«
Mit wenigen Schritten war er draußen. Mit roten Wangen stürmte er durch den Herbstnebel. Das Blut brauste ihm im Herzen und im Kopfe. Der Nebel hüllte ihn ein, er konnte den Weg ins Dorf nicht übersehen.
So lief er, jagte dahin, wie einer, der auf verzweiflungsvoller Flucht ist, oder einer, der dem letzten, rettenden Heil nachjagt, das er zu verlieren glaubt.
Jetzt – jetzt tauchte die Gestalt eines Mädchens aus dem Nebel auf. Ein paar Schritte noch, dann erkannte er sie deutlich.
»Lotte!«
Wie ein Schrei tönte der Name durch die stille Luft.
Sie wandte sich erschreckt um. Mit großen Schritten und glühendem Gesicht kam er ihr näher.
»Lotte – sei nicht böse – ich muß Dir nach – ich werde verrückt allein!«
»Heinrich, o Gott, Heinrich, was ist Ihnen? Wie sehen Sie aus?«
»Tu mir den Gefallen, Lotte, sprich »Du« zu mir, wie früher; sei ein klein bißchen freundlich! Ich halte so das Leben nicht mehr aus! Ich gehe zugrunde!«
»Heinrich! Lieber Heinrich!«
Sie sah ihn mit ihren schönen Augen mitleidsvoll an, und er stand vor ihr zitternd, bebend; der Atem ging ihm schwer, die Augen glühten ihm, und sie war so schön, so herrlich schön, und da riß er sie wortlos in seine Arme mit einer Wut und Glut, wie das Tier sein Opfer faßt aus schmerzhaftem Hunger, und überdeckte ihr Gesicht mit rasenden Küssen.
Wie mit eisernen Armen hielt er sie fest; wie ein Ertrinkender sich an seinen Retter klammert, so klammerte er sich an sie, und mit dem ganzen fiebernden Heißhunger einer glücksgierigen Seele küßte er sie. Sein Gesicht veränderte[241] sich, seine Augen bekamen einen fremden, unheimlichen Glanz; all die Leidenschaft, die jahrelang zurückgedämmt war, brach durch, all der brennende Durst nach Glück und Liebe wollte sich sättigen.
Sie lag erschreckt, aber glückselig an seiner Brust.
»Heinrich! Lieber Heinrich!«
»Du mußt mein sein, Lotte, und wenn die Welt in Stücke geht, und wenn sie mich ausstoßen wie einen Lump, und wenn's ein Verbrechen ist – Du mußt mein werden!«
Sie sah zu dem zitternden Manne auf.
»Hast Du mich lieb, Lotte? Ein bißchen lieb?«
»Ja, ich hab' Dich lieb, Heinrich!«
»Lotte!«
Ein jauchzender Jubelruf, ein Erlösungsschrei durchtönte die fahle Herbstluft. Der Heimatlose hielt das Glück in seinen zitternden Armen und schaute es an und hätte laut lachen mögen vor übergroßer Freude.
»Lotte, jetzt bin ich reich! Jetzt hab' ich alles gewonnen! Jetzt ist mir wohl! Jetzt werd' ich wieder leben können! Jetzt ist alles andere ganz gleichgültig.«
Sie sah ihn an, und ihre Augen glänzten feucht.
Eine lange, selige Pause kam, jene große Stille, in der alles tot ist, außer der Freude.
Doch allmählich breitete sich ein Schatten über ihr Gesicht.
»Heinrich! Sind sie wirklich alle fortgegangen von Dir um meinetwillen?«
»Ja, Lotte! Aber laß sie, sprich nicht von ihnen, denk' nicht an sie! Wenn ich Dich hab', mögen sie fort sein; alle – alle –!«
Er lachte wieder, ließ sie los und schüttelte sich, als ob er etwas Unsichtbares von sich abzuwälzen hätte.
»Komm, wir wollen ein Stück gehen, wir wollen alles miteinander besprechen.«
Sie gingen Hand in Hand, und die Nebel hüllten sie schützend ein. Er erzählte ihr von seiner Liebe zu ihr, wie sie eigentlich immer in ihm gelebt hätte seit den Tagen der Kindheit, wie er sie nur all die Zeit zurückgedrängt habe in langen, schmerzhaften Kämpfen, und wie diese Kämpfe furchtbar geworden seien nach jenen Tagen im Mai. Dann erzählte er ihr auch von der Liese, vom Mathias, von der Lene und von dem Ende.
Sie blieb stehen. Leise und bang fragte sie:
»So hab' ich Dir wirklich die Heimat zerstört, Heinrich? Ich?«
Er schüttelte nachdenklich das Haupt.
»Nein! Ich hab' viel darüber nachgedacht. Was ist überhaupt die Heimat? Ich weiß es nicht! Ich weiß bloß, daß ich nie eine gehabt hab', es wär' denn als Kind. Wir haben kein glückliches Leben gehabt – alle nicht! Und so wär' es geblieben, wenn ich die Liese genommen hätte. Nein, es wär' noch viel schlimmer geworden. Denn Dich hätt' ich doch nie aus dem Sinn gebracht, niemals!«
Sie lehnte den Kopf an seine Schulter, und er küßte sie wieder.
Tief aufatmend richtete er sich auf und stand still, als ob er sich besinnen müsse. Wie war ihm? Frei, leicht, stark war ihm zumute, so, als ob Lasten von seiner Seele geglitten und neue, heitere Wege ihm eröffnet wären.
»Lotte, jetzt wird das Glück kommen!«
Sie schmiegte sich an ihn und erzählte nun von sich, von ihrem trostlosen Heim, von der Seligkeit, die sie im Mai trotz ihres kranken Fußes empfunden über seine Fürsorge, von der langen, glücklosen Zeit, als täglich der Barbier aufs neue erzählt habe, wie sehr sich der Heinrich um die Liese bemühe, und der junge Riedelbauer sie mit seinen Zudringlichkeiten belästigt, und dann davon, wie sie gehört habe, die Liese gehe ins Kloster und Mathias habe sich mit Heinrich verfeindet. Da habe sich eine neue Hoffnung in ihr Herz geschlichen. In den Wochen darauf aber, als auch die Lene fort war und sie ihn so müde und krank herumgehen sah, da hätten die Mägde erzählt, der junge Buchenbauer werde tiefsinnig, er esse nicht mehr und wache ganze Nächte in seinem Zimmer, und dann sei wieder der Barbier gekommen und habe gesagt, der Heinrich gräme sich zu Tode um die Liese. Da sei es freilich aus gewesen mit all ihrer Hoffnung.
»Aber jetzt, Heinrich, jetzt ist doch alles anders!«
Die Glückseligkeit der Liebe strahlte auf dem Gesicht des Mädchens.
Er blieb stehen.
»Es ist mir etwas eingefallen, Lotte: Wo zwei Heimatlose sich treffen, die sich lieb haben, da wird eine Heimat.«
Sie sah ihn an voll Vertrauen und Glauben und nickte mit dem Kopfe.
Sie gingen ein Stückchen weiter. Das Mädchen kämpfte mit einem Gedanken, der endlich hervorbrach:
»Eines muß ich wissen, Heinrich: Was macht Ihr meinem Vater zum Vorwurf? Das mußt Du mir sagen!«
»Lotte, liebe Lotte, quälen wir uns doch jetzt in unserer ersten guten Stunde nicht mit den alten Geschichten.«
Sie senkte den Kopf.
»Doch, Heinrich, es ist nötig! Darüber müssen wir klar sein. Da darf nichts zwischen uns liegen! Dieses unausgesprochene Mißtrauen zwischen den beiden Höfen, das war ja das Schlimme. Das darf zwischen uns beiden nicht sein!«
»Es wird nicht sein, Lotte!«
»Aber wir müssen uns aussprechen!«
Sie machte wieder eine Pause. Dann brachte sie mit großer Überwindung heraus:
»Glaubt Ihr, daß – daß mein Vater – Euren Hof angezündet hat?«
»Nein, Lotte! Das ist ja gar nicht möglich! Er war ja immerfort zu Hause!«
»Aber – aber Ihr denkt, daß er jemand dazu angestiftet hat oder daß er davon gewußt hat?«
Heinrich zögerte.
»Du weißt, Lotte, daß Mathias das behauptet hat und darum auch bestraft worden ist.«
»Und Du?«
Sie sah ihm angstvoll in die Augen.
»Ich, Lotte – ich glaube es nicht! Es kann irgend jemand gewesen sein: ein Dienstbote aus Unvorsichtigkeit, ein Bummler, ein unbekannter Feind. Weiß Gott!«
»Es ist gut, Heinrich, denn sonst – und was macht Ihr ihm weiter zum Vorwurf? Was sagt die Lene? Sag' mir alles! Ich bitte Dich, Heinrich!«
»Lotte, es fällt mir schwer – gerade schon heut –«
»Ja, schon heut! Wenn es herunter ist vom Herzen, dann werden wir erst ganz glücklich sein. Was sagt die Lene?«
»Sie sagt – unser – unser Vater hat sich erschossen, weil ihm Dein Vater das Geld gekündigt hat.«
Lotte nickte.
»Ja, ich weiß! Der Vater hat mir's erzählt. Er ist bei Euch drüben gewesen und hat gut mit Deinem Vater reden wollen; aber der ist vergrämt gewesen und hat ihm sogar das »Du« gekündigt, und da – da hat mein Vater das Geld verlangt. Daß aber alles so kommen würde, hat er aber nicht geahnt. Und, Heinrich, daß das gekommen ist wie ein unvorhergesehenes Unglück, deshalb trinkt ja der Vater, das hat ihn ja zugrunde gerichtet.«
Sie weinte.
»Lotte, liebe Lotte! Du hast auch schon bittere Dinge erlebt.«
»O, Heinrich! Und ich hab' keine Seele gehabt, zu der ich mich aussprechen konnte. Niemand! Ich hab' alles für mich tragen müssen. Und der einzige, den ich lieb hatte, warst Du – und – und –«
»Liebes, liebes Mädel!«
Er küßte sie wieder, lange und innig.
»Ich bin so glücklich, Heinrich, daß wir das ausgesprochen haben. Wenn Du so schlecht von meinem Vater gedacht hättest, hätten wir uns ja nicht haben dürfen. Nein, Heinrich, gewiß nicht, dann wär' ich Deiner nicht wert, dann wär' es ganz unmöglich. Aber das kannst Du glauben: Mein Vater hat seine Fehler; aber etwas Schlechtes hat er nicht[246] getan. Deine Leute tun ihm unrecht, das kann ich Dir beteuern, und deshalb kann ich auch Deine Frau werden! Wenn Du's nur fest glaubst.«
»Ich glaube es, Lotte!«
Sie nickte glücklich, und sie gingen wieder ein paar Schritte weiter.
»Und was nun weiter, Lotte? Was wird Dein Vater sagen, wenn ich komme und Dich zum Weibe haben will?«
Sie senkte das Haupt.
»Er wird erschrecken, vielleicht auch sehr schimpfen. Das mußt Du nicht übel nehmen. Das ist ja natürlich. Aber er wird nicht »Nein« sagen, nicht auf die Dauer. Er kann mir keine einzige Bitte abschlagen – keine! Und Du – wie wird's bei Dir sein?«
»Ich? Ich bin mein eigener Herr! Ich hab's durchgesetzt bis jetzt und führ's zu Ende. Mit den andern hab' ich gebrochen. Ich bin jetzt zwar einsam, aber ich bin frei! Wenn ich Dich hab', Lotte, verschmerz' ich alles. Und die Zeit ändert manches. Meine Leute werden sich allmählich anders besinnen.«
»Hoffen wir es!« –
Lotte hatte im Dorfe einen Besuch machen wollen. Sie gab die Absicht auf.
Auf einem breiten, stillen Feldrain ging das junge Paar, und die Nebel schützten es vor neugierigen Augen. Von ihrer Zukunft sprachen sie und bauten an einer neuen Heimat. Von Westen leuchtete durch die weißen Nebel ein roter Schein. Dort ging die Sonne unter.
»Ich muß jetzt heim,« sagte Lotte. »Vielleicht, wenn der Vater allein ist, sag ich's ihm schon heute.«
»Lotte! Willst Du das wagen? Oder ist's nicht besser, wenn ich es tue?«
»Nein, Heinrich! Wenn's der Vater zugibt, tut er's bloß, weil er mich lieb hat und mir nichts abschlägt. Ich geb Dir Nachricht.«
Sie gingen ganz langsam heim. Als die Buchenhöfe aus dem dicken Nebel auftauchten, nahmen sie einen langen Abschied.
Als Heinrich in seine Stube trat, war's, als ob eine Trunkenheit ihn fasse.
Er vermochte nicht stehen zu bleiben an einem Ort, nicht zu sitzen; er ging immer hin und her in seliger Unrast, und manchmal schlug er die Hände vor das glühende Gesicht, und immer wieder trat er ans Fenster und sah hinüber über die Straße.
Er fühlte auch jetzt noch ihren weichen, warmen Mund. Das liebe Mädchen. Wenn sie sein würde, dann war alles gut, dann kam ein ganzes Meer von Sonne und Wonne in diese leere Stube, dann mußte hier eine herrliche Heimat sein.
Wenn er nur mit jemand reden könnte, jetzt nicht wieder allein sein müßte! Er besann sich und ging hinüber zum Schaffer.
Der Schaffer saß an seinem Tisch und studierte an einem Briefe. Er wollte das Schriftstück verstecken, aber dann besann er sich, schob es Heinrich hin und knurrte:
»Is egal! Da! Vom Hannes!«
Heinrich las:
Lieber Vater!
Indem ich Dir auch wieder einmal schreibe. Du sollst keinen Kummer um mich haben. Es geht mir gut. Aber ich hab drei Tage Arrest gekriegt. Du mußt aber keinen Kummer haben, denn sie sind schon rum. Und es war zum Aushalten. Weil nämlich die Lene an mich geschrieben hat, daß sie mich heiraten wird, da hab ich die Knöpfe nicht geputzt und bin zum Appell zu spät gekommen. Wobei einen der Unteroffizier gleich klemmt. Wogegen ich mir eins gepfiffen hab, wie ich im Kasten war. Denn ich freu mich so, daß mich die Lene heiraten tut, weil ich ihr gut bin, und weil sie ein schönes, starkes Mädel ist. Dann werde ich Bergmann, und sie näht. Da kommen wir aus, weil ich nicht trinke und auch nicht tanze. Lieber Vater, es tut mir sehr leid, daß die Lene mit dem Heinrich so Krach gemacht hat und weg ist. Die Tante Emilie, bei der sie jetzt ist, kann ich nicht gut leiden, sie ist eine alte Kröte. Aber ich muß jetzt tun wie tulpe und zu der Lene halten, weshalb ich ihr Bräutigam bin. Wo ich ja jetzt auch auf den Heinrich schimpfen muß, indem sie mich sonst nicht nimmt. Was aber alles bloß Getue ist. Denn der Heinrich ist immer mein Freund gewesen, und das laß ich nicht. Aber jetzt tu ich so und schimpf auf ihn, soviel ich kann. Das mußt Du ihm sagen, daß er's nicht übel nimmt, wenn er mal was hört. Wenn ich die Lene werd geheiratet haben, bin ich der Herr im Hause. Da wird's anders, da gibt's dann keinen Krach mit dem[249] Heinrich mehr. Hauptsache, erst heiraten! Daß Mathias auch weg ist und die Liese, das ist sehr schade. Indem sich das aber nicht ändern läßt. Und Du mußt bleiben auf dem Buchenhof, sonst geht alles pleite. Lieber Vater, wenn ich zu Weihnachten Urlaub krieg, fahr ich nach Waldenburg. Da mußt Du am ersten Feiertag hinkommen. Denn auf den Buchenhof komme ich wegen der Feindschaft nicht. Und wenn ich keinen Urlaub krieg, da komm ich überhaupt nicht. Wegen der drei Tage! Und mußt keinen Kummer haben und den Heinrich schön grüßen und ja nichts der Lene sagen von allem. Dann kannst Du mir nötig zehn Mark schicken.
Besten Gruß
Dein Sohn
Johannes Reichel.
»Weißt Du was, Schaffer,« rief Heinrich glücklich, »schick' ihm dreißig Mark! Da sind sie! Schick's ihm! Er ist ein Prachtkerl!«
Heinrich legte das Geld auf den Tisch.
Der Riese starrte ihn blöde an, aber dann grinste er und stützte je einen Finger seiner rechten Hand schwer auf die Goldstücke, als fürchte er, ein Luftzug könne sie wegblasen.
»Und Du, Reichel, Du bleibst mir treu? Was auch kommen mag? Ja? Du bleibst bei mir, wenn sie auch alle gehen – alle!«
Der Riese sann schwer nach. Dann sagte er:
»A alter Kater geht nich weg vom Hofe!«
»Das ist hübsch von Dir, Reichel! Wir bleiben Freunde! Und jetzt kommst Du mit hinüber. Wir wollen eine Flasche Wein mitsammen trinken, weil sich der Hannes verloben wird. Auf Hannes' Wohl, hörst Du? Nur auf Hannes' Wohl! Der hat's uns ja angezeigt.«
Reichel meinte, wenn er Wein trinken solle, müsse er sich erst waschen und die Sonntagsjacke anziehen und sein gesticktes Vorhemdchen ummachen, sonst ginge es nicht. Dann werde er aber kommen.
Als Heinrich wieder in den Hof trat, traf er die alte Stenzeln.
»Pst! Das is gutt! Da macht's kein Aufsehen! Hier! Vom Fräulein! Gute Nacht!«
Sie huschte davon.
In der Wohnstube erbrach Heinrich den Brief.
Lieber Heinrich!
Es ist alles gut. Der Vater wird einwilligen. Komm morgen früh um 10 Uhr zu uns herüber. Gute Nacht, Liebster! Es küßt Dich herzlich
Deine überglückliche Lotte.
Heinrich hob den Brief hoch und preßte ihn an seine Stirn. Dann sah er auf das große Bild seines Vaters, das an der Wand hing.
»Vater, du mußt »Ja und Amen« sagen. Ich bin zu glücklich, zu glücklich!«
Einsamkeit und Reue waren weit.
Der Mond hatte die Nebel vertrieben. In später Nacht lugte er in drei Stuben der Buchenhöfe.
Da sah er, wie der alte Schaffer seinem jungen Herrn die Hand gab und mit noch schwererer Zunge als sonst sagte:
»Die Lotte is gutt! Sie kann für nischt! Und es geht mich nischt an. Und ich bin Schaffer.«
Da schien er auch dem alten Schräger ins Gesicht, der heute nüchtern oben am Giebelfenster stand und hinuntersah nach dem Kirchhof und sagte:
»Nun sei zufrieden und laß mich in Ruh'.«
Und er streute silberne Funken auf Stirn und Mund der Lotte, die glückselig in ihrem Bette lag und von einer neuen, schönen Heimat träumte.

Draußen flockte leise der Schnee. Im Wohnzimmer des Buchenkretschams war es wohlig warm, und Lotte bereitete den Vespertisch. Heinrich sah ihr lächelnd zu. Jetzt setzte sie eine goldgeränderte Tasse vor ihn hin, darauf war geschrieben: »Dem Bräutigam«, und daneben stellte sie eine Tasse mit der Aufschrift: »Der Braut«.
»Aus den Tassen haben Vater und Mutter bei ihrer Hochzeit getrunken,« sagte sie.
Er sah sie an, wie sie in herziger Hausfrauenschönheit vor ihm stand, und legte den Arm um ihre Schultern.
»Lotte! Ich kann Dir nicht sagen, wie mir zumute ist. Ich denke, so mag einem sein, der aus einem Schiffbruch gerettet wurde und in einer sicheren, warmen Stube sitzt.«
Erst als sie draußen den Vater kommen hörten, gingen sie auseinander.
Mißmutig trat Schräger in die Stube.
»Was sagt man dazu – die Bande kommt nich! Alle lassen sie absagen, alle; der einzige Hirsel will kommen.«
Heinrich biß die Zähne aufeinander. Der Wirt hatte seine früheren Stammgäste, die in letzter Zeit immer mehr und mehr ausgeblieben waren, zu einer Verlobungsfeier eingeladen und zu diesem Zwecke ein Faß echten Bieres kommen lassen.
Nun wollte niemand erscheinen.
»Ja, es ist arg,« sagte Heinrich. »Ich hätte nicht gedacht, daß sie es so weit treiben würden. Aber der Riedel hat heute ein Fest unten im Dorfe in Polers Wirtshaus angesagt und Freibier versprochen, und der Barbier ist durchs ganze Dorf, um dazu einzuladen. Das ist niederträchtig, das ist einfach niederträchtig!«
Schräger grub die Hände tief in die Hosentaschen.
»Bankrott wird man noch werden,« knurrte er in tiefstem Unmut.
Ein Schatten flog über Heinrichs Gesicht. Lotte bemerkte es wohl und legte ihrem Vater die Hände auf die Schultern.
»Vater, sei nicht mürrisch! Nicht heute! Die Leute werden schon wiederkommen. Lange wird's ihnen beim Poler nicht gefallen. Dann kommen alle wieder zu Dir.«
Schräger knurrte etwas und ging hinüber nach der Wirtsstube. Dort goß er ein großes Glas voll Rum und trank es aus.
Das Mädchen ging nach der Küche, und Heinrich war allein. Er trat ans Fenster und sah nach seinem Hofe hinüber. Je eher, je besser wollte er die Lotte hinüberholen. Denn mit Schräger war auf die Dauer nicht auszukommen.
Wie er so dastand und in das Schneewetter hinaussah, dachte Heinrich an die letzten Tage und konnte sich keiner Stunde erinnern, die er glücklich und zufrieden mit seinem zukünftigen Schwiegervater zugebracht hätte, angefangen von dem Augenblick, wo ihm dieser Mann mit schwerer, lallender Zunge das Jawort gab, bis heute. Damals hatte er ihn angewidert. Nicht einmal an dem wichtigen Tage, da eine jahrelange Feindschaft begraben und die Verbindung seiner einzigen Tochter mit dem Gegner beschlossen werden sollte, konnte dieser Mann nüchtern bleiben. Und es war vormittags 10 Uhr gewesen. Aber die Lotte hatte auch damals ihren Vater zu entschuldigen gesucht und gesagt, er habe wohl in übergroßer Aufregung getrunken.
Er hatte sich das so schön, so feierlich, so groß vorgestellt, diese Stunde der Aussöhnung, und der – war betrunken. Er hatte nichts anderes sagen können als immer dasselbe: »Laß die Toten ruhen! Laß die alten Geschichten! Nehmt Euch! Alles is gutt! Ich kann für nischt! Laßt mich in Ruh'! Meinetwegen macht, was Ihr wollt.«
Und dann hatte er nach der Ziegelei und nach den Überschüssen des Gutes so gierig und interessiert gefragt, trotz seiner Trunkenheit, daß dem jungen Freiersmanne gegraut hatte. Und er hatte immer nach der lieblichen, unschuldigen Lotte sehen müssen, die mit schwerverhaltenen Tränen neben ihm saß, daß er nur Herr seiner selbst blieb.
Auch der schwachsinnige Bruder machte es ihm schwer. Dieser Bursche hatte eine ganz unbegreifliche Scheu vor ihm. Immer lief er fort, wenn er ihn nur witterte, und einmal, als die Lotte ihn eingeschlossen hatte, um eine Begegnung[255] zu erzwingen, und Heinrich ein ganzes Paket Schokolade mitbrachte, die der Bursche sehr gern aß, war er im letzten Augenblick schreiend durch das Fenster entflohen.
Eine ganze Nacht war er fortgewesen und erst am Morgen wiedergekommen. Seit der Zeit wurde er außer acht gelassen.
Der Buchenhof! Wie er so sacht einschneite und nun so friedlich dalag, so recht lockend und einladend, einzutreten und allen Sturm und alles böse Wetter draußen zu lassen, heimisch zu sein in diesen festen Mauern. Recht wie eine Heimat sah das Haus aus. Aber der, dem es gehörte, wußte, daß es keine Heimat war.
Jetzt eben dachte er wieder darüber nach, und ein Gedanke ging ihm durch die grübelnde Seele: Heimat ist nicht Raum! Heimat ist auch nicht Freundschaft! Wird Heimat Liebe sein? –
»Lotte, wenn es Dir recht ist, wollen wir bald nach Weihnachten heiraten,« sagte er zu seiner Braut, als sie zurückkam.
Das Mädchen sah ihn freundlich an.
»Ja, Heinrich; ich weiß auch, warum. Und Du hast recht.« Sie kam ganz nahe an ihn heran.
»Aber gar zu böse mußt Du nicht sein mit ihm. Im Grunde ist's ja doch aus Gram um Deinen Vater!«
»Ja, Lotte, ich weiß es!«
»Ist es Dir unlieb, wenn ich immer für ihn spreche?«
»Nein! Er ist Dein Vater. Wer keine gute Tochter war, wird kein gutes Weib.«
Heinrichs Verlobungsabend war gekommen. Schräger hatte trotz dringender Abwehr das große Bierfaß in die Wirtsstube heraufschaffen lassen. Das stand nun in seiner ganzen tragikomischen Größe in der einsamen Gaststube.
Die Stenzeln hatte ein gutes Abendbrot bereitet, das hatten Heinrich, Lotte und Schräger schweigend verzehrt. Zuweilen nur fluchte der Wirt stumpf vor sich hin.
Gegen sieben Uhr kam der alte Hirselbauer. Schräger lachte spöttisch.
»Na, Hirsel,« sagte er in grimmiger Selbstironie und klopfte auf das große Faß, »da kannste trinken, da kannste aber trinken!«
»Wird niemand kommen, niemand sonst?« fragte Heinrich. Hirsel schüttelte verlegen den Kopf.
»Verhetzt! Alle verhetzt! Der Barbier is a Schandkerl.«
»So setzen Sie sich, Herr Hirsel: ich werd's Ihnen nicht vergessen, daß Sie gekommen sind.«
Es war eine trübselige Verlobungsstimmung. Schräger stierte immer vor sich hin und schimpfte in sich hinein, Heinrich und Lotte hielten sich an den Händen, und der alte Hirsel saß vor seinem Bierglase und wollte nicht trinken. Vom Wetter sprachen sie schließlich, von den Rübenpreisen, von ein paar nebensächlichen Ereignissen aus dem Dorfe. Dann waren wieder lange Pausen, und die alte Wanduhr tickte trostlos, einförmig. Niemand wollte reden, niemand wußte etwas zu sagen.
Mitten in all dieser Stille war Heinrich in schwerer Erregung. Zuweilen preßte er die Hand des geliebten Mädchens. Da wünschte er sich weit fort mit ihr. Wenn er einen[257] einzigen Freund gehabt hätte, jemand, der sich mit ihm freute! So war er allein. Und das war der Abend, der für die meisten Menschen der strahlendste und glücklichste des Lebens ist, an welchem sich an jeden ein paar gute Menschen drängen, um Freundschaft zu zeigen, um Glück zu wünschen.
Hier war es so erschreckend öde. Kaum, daß ihm der alte Hirsel manchmal ein wenig zulächelte.
Dann dachte er daran, daß nun doch die eigentliche Verlobung vollzogen werden müsse. Wer sollte das tun? Wer? Schräger würde nicht anfangen.
Also er selbst! Aber es fiel ihm maßlos schwer, in solcher Umgebung und solcher Stimmung ein so schweres, entscheidendes Wort zu sprechen. Und dann, wie sollte er den Mann anreden? Jetzt mußte er »Vater« zu ihm sagen! Und es war ihm, als ob vor seiner Seele eine bleiche Gestalt auftauche und ihm mit gebietendem Blick sage: »Mißbrauche nicht meinen Namen!«
So schob er's auf in innerer Unrast, und es verging eine halbe Stunde und noch eine. Die Uhr schnarrte durchs Zimmer, und dann war wieder diese bedrückende Stille. Da, als ihn Lotte einmal bang anschaute, stand Heinrich auf: »Va– Vater, Sie haben mir Ihr Jawort gegeben bei meiner Werbung, und Lotte und ich werden uns jetzt mit Ihrer Zustimmung verloben.«
Er wartete auf eine Antwort. Schräger stierte auf.
»Ja,« sagte er, »ja, meinethalben! Prosit!«
Und er trank.
Heinrich wurden die Augen heiß, und Lotte fing leise an zu weinen. So steckte er ihr den goldenen Ring an den[258] Finger und sie ihm den seinen. Der alte Hirsel stand auf und sprach ein paar Glückwunschworte. Und dann war es wieder still. –
Da klopfte es ans Fenster.
»Und einen Hund, einen gro…o…oßen Hund!«
Der Bruder! Den ganzen Nachmittag war er schon wieder abwesend und nicht aufzufinden gewesen. Jetzt stand er draußen am Fenster und blökte die Zunge herein. Schimpfend erhob sich Schräger und ging hinaus. Nach kurzer Zeit kam er wieder und sagte, der Junge sei verschwunden. Vielleicht sei er nun schlafen gegangen. Man solle ihn sein lassen.
Draußen aber an der Gartenmauer des Buchenhofes kauerte Gustav Schräger. Er war unten im Dorfe gewesen in Polers Gasthaus, der Barbier hatte ihm viel Bier zu trinken gegeben, und alle hatten über den Idioten gelacht, bis ihn ein vernünftiger Bauer nach Hause jagte.
Jetzt kauerte der Bursche in halbem Dusel an der Gartenmauer. Manchmal sah er nach den erleuchteten Fenstern der Wirtsstube, ballte die Fäuste, knirschte mit den Zähnen oder blökte die Zunge heraus.
Dann suchte er in seinen Hosentaschen nach und brachte eine Schachtel Streichhölzer heraus. Ein böses Grinsen ging über das verblödete Gesicht, und die Fäuste ballten sich wieder.
Der Idiot betrachtete die Streichholzschachtel mit funkelnden Augen. Dann hielt er sie gegen das Ohr, schüttelte sie und freute sich an dem leisen Geklapper.
»Viel sind's,« grunzte er, »viel!«
Leise richtete er sich auf, wandte lauernd und spähend den Kopf und schlich endlich lautlos und gebückt die Gartenmauer entlang. Das Hoftürchen zum Buchenhof öffnete er. Es knarrte laut. Aber der Bursche ließ sich nicht abschrecken. Er sah sich nur ein wenig um und rannte dann schnell über den Hof bis zur Scheune.
Das Tor war nicht verschlossen, aber es verursachte ein Geräusch, als er öffnete. Nun war er in der Scheune. Er blieb stehen, holte tief Atem, und seine Augen funkelten.
»Oh! Ooh! Hoch! Hoch! Es wird brennen! Brennen!« Und er reckte die Arme in die Höhe.
Dann strich er ein Streichholz an. Es zerbrach und fiel verlöschend auf die leere Tenne. Ein zweites Streichholz! Es brannte, und in seinem Schein ging der Idiot nach dem getreidegefüllten Bansen.
»Du! Was machst Du da?«
»Jeses!«
Ein Schrei! Ein zweiter!
Das Streichholz erlosch. Eine Jagd ging los. Voran der Idiot, hinterher ein Knecht des Buchenhofes, der das Geräusch der Tore gehört hatte und dem Burschen nachgeschlichen war.
»Stehen bleiben! Halt! Stehen bleiben!«
Ein furchtbares Brüllen kam dem Jungen vom Munde. Er fiel über einen Gegenstand, stand auf, sprang weiter und fand in der Angst nicht das Tor. Es war rabenfinster. Man hörte das Keuchen der beiden Menschen. Ein paarmal streifte der Knecht mit der Hand den Jungen. Der aber[260] wich immer geschickt aus. Es war ein furchtbares, entsetzliches Suchen und Haschen. – Eine Leiter stand da, die nach dem Getreideboden führte – jetzt faßte der Idiot die Leiter und stieg hinauf, lautlos wie eine Katze.
Der Knecht stand unten lauschend still. Wo war er?
»Wo bist Du, Lump? Wart', vielleicht auf der Leiter – wart', da krieg ich Dich!«
Ein Rutschen – ein schwaches Knacken – dann ein markerschütternder Schrei, und ein schwerer Körper sauste aus der Höhe auf die Tenne. Einen lallenden Schreckenslaut stieß der Knecht aus. Dann war Totenstille.
Auf das Schreien des Knechtes kamen die Leute mit Lichtern nach der Scheune gestürzt, dann eilte eine Magd über die Straße hinüber nach dem Kretscham. Sie riß die Tür auf und schrie in die Stube:
»Jeses, a Unglück, a Unglück! Der Gustav hat unsre Scheune anzünden woll'n, und da is a von der Leiter gestürzt und hat a Hals gebrochen!«
»Du – Du – o Du – ich – i – was – was? –«
Lotte stierte in wahnsinnigem Entsetzen die Magd an; wollte reden, schreien, fragen, konnte es aber nicht.
Heinrich nahm sie fest am Arm.
»Schräger! Herr Schräger! Ihr Gustav! Ach Gott, ach Gott! Den Hals gebrochen!« wimmerte die Magd.
Schräger saß da wie ein Bild aus Stein, gänzlich wortlos. Er stöhnte nur. Ein dumpfes Gurgeln drang ihm aus der Kehle; die Augen stierten entsetzt die Magd an, die immerfort weiter schrie, weiter jammerte, dann fingen seine Hände[261] an zu tasten, seine Füße an zu rutschen, und so glitt er schwer unter den Tisch.
Ein paar Minuten später brachten sie den Verunglückten auf einer Futtertrage herüber. Er war tot.
Auf die Diele der Gaststube legten sie ihn und standen dann alle stumm an der Tür. Schräger, dem Hirsel und Heinrich auf die Bank geholfen hatten, hatte lautlos zugesehen. Jetzt erhob er sich. Er wollte hingehen, aber die Glieder versagten ihm. Mitten in der Stube fiel er nieder, und ehe ihn die anderen aufrichten konnten, kroch er wie ein Tier auf Händen und Füßen zu seinem toten Kinde, legte sich mit seinem Körper über die Leiche und blieb zuckend und wimmernd liegen. Lotte führten die Frauen hinüber nach der Wohnstube. –
In später Nacht ging Heinrich Raschdorf heim. Als er die Lampe angezündet hatte, sah er sich scheu um. Das große Bild seines Vaters schaute von der Wand herunter. Und der Sohn sah das Bild an in der Stille dieser seiner Verlobungsnacht, und ein tiefes Schauern ging ihm durch Leib und Seele.
»Nun bist Du gerechtfertigt, Vater! Gerechtfertigt und gerächt!«
Dann stieg er langsam wie ein Kranker hinauf in seine Stube.
Ein stürmischer Tag folgte dieser Nacht. Der Wind jagte die Schneewolken über Wald und Dorf und peitschte Häuser und Bäume. Und also stürmte es auch in den[262] Geistern der Leute. Wie ein Blitz ein schwarzes, enges Tal, in das kein Auge zu schauen vermochte, urplötzlich durchleuchtet, so war es hier. Die Leute erkannten nun, wer das erste Mal der Brandstifter gewesen war.
Die Arbeit ging an diesem Tage lässig in allen Häusern, denn alle Leute redeten, standen zusammen und plauderten erregt. Das fühlten alle: daß an den Buchenhofleuten schwer gesündigt worden sei. So manchen kam die Reue an, und er nahm sich vor, wieder gut zu machen, wo er etwa gefehlt habe. Die Männer namentlich bedauerten, daß sie der Einladung zur Verlobung im Kretscham nicht Folge geleistet hätten, weil sie dadurch den Raschdorf-Heinrich aufs neue gekränkt hatten. Den Barbier aber trafen die schwersten Vorwürfe, weil er dem Idioten Bier gegeben hatte, und alle meinten nun, er sei schuld an Gustav Schrägers grauenvollem Tode, er sei überhaupt immer der Hetzer und der Schuldige gewesen; ohne ihn wäre alles nicht so schlimm geworden.
So kam es, daß der Barbier in dieser Zeit seine Heimat verlor. Schon nach wenigen Wochen ließ sich ein flinker Konkurrent im Dorfe nieder, und ein wenig später zog der Barbier verachtet und heimatlos von dannen. Auch im Dorfleben ist die öffentliche Meinung souverän; wer bei ihr in Ungnade fällt, dem steht keine Berufung zu; er zieht in die Verbannung.
Über Schräger waren sich die Leute nicht einig. Seine Person blieb im Dunkel. Die Weiber waren geneigt, ihn zu verurteilen, aber die Männer meinten, nun sei es angebracht, recht oft in den Buchenkretscham zu gehen, um am Ende einmal etwas herauszukriegen oder zu erleben. –
Gegen neun Uhr vormittags ging Heinrich Raschdorf nach dem Kretscham. Die Leute hatten eben den Toten in eine leere Kammer zu ebener Erde gelegt. Eine Öllampe hatten sie ihm zu Häupten gestellt, die brannte in trübem Schein.
Erschüttert betrachtete Heinrich die Leiche. Der Verderber seines Hauses, der Bruder seiner Braut und alles in allem ein unglücklicher, beklagenswerter Mensch!
Draußen traf er die Stenzeln und fragte sie nach Lotte. Das Weiblein wischte sich mit der Schürze übers Gesicht. »Ach, du mein Gott! Die hat sich in ihre Stube geschlossen und kommt nicht heraus und gibt keine Antwort.«
Er stieg die Treppe hinauf und klopfte an ihre Türe.
»Lotte! Lotte!«
Ein leises Weinen.
»Lotte! Gib Antwort! Bist Du krank?«
»Heinrich, ich kann nicht heute – nicht heute –«
»Bist Du krank, Lotte? Sollen wir einen Arzt holen?«
»Nein, nicht – nicht! Ich bin nur müde – müde!«
»Reg' Dich doch nicht so auf, liebe Lotte! Ich bitte Dich!«
»Ja, Heinrich, ja!«
Er stand noch ein Weilchen an der Tür, aber sie sagte nichts mehr. So ging er und schärfte der Stenzeln ein, die Lotte nicht allein zu lassen.
Schräger war noch nicht zu sehen. Auch er hatte sich in seine Stube eingeschlossen und kam nicht heraus; er gab auch keine Antwort. Nur sein schlürfender Schritt war manchmal zu hören.
Schon gegen drei Uhr nachmittags erlosch der Tag. Heinrich kam aus der Stadt zurück, wo er einiges für das Begräbnis besorgt hatte. Wieder verlangte er Lotte zu sehen. Aber die Stenzeln überbrachte ihm nur die Bitte, sie ganz allein zu lassen.
»Stenzeln! Was macht sie denn? Was tut sie so allein?«
Die Frau zuckte die Schultern.
»O du mein lieber Gott! Was wird sie machen? Nischt! Sie sitzt da und grübelt und sagt kein Wort!«
»Stenzeln, bringen Sie ihr die Rosen und sagen Sie, ich will ihr heute Ruhe gönnen; aber morgen muß ich sie sehen. Auf jeden Fall! Und sie soll sich nicht grämen, der Gustav war ein armer, unglücklicher Mensch; er hat's nicht besser verstanden.«
Die Stenzeln nickte und versprach alles auszurichten. Dann ging Heinrich nach Hause.
Gegen sieben Uhr klopfte die Stenzeln an Schrägers Tür. »Herr Schräger, machen Sie auf! Sie müssen doch was essen!«
Er öffnete. Entsetzt wich die Stenzeln zurück. Dieser Mann sah aus wie ein zusammengeducktes, furchtsames Tier.
»Herr Schräger! Jeses! Wie sehn Sie denn aus?«
Er lehnte sich an die Wand und sah sie lauernd an.
»Ist jemand gekommen? Hat jemand gefragt?«
»Wer soll denn gekommen sein?«
»Niemand gefragt? Nach mir? Nach mir, Stenzeln?«
»Wer denn? O Gott, wer denn?«
»Stenzeln, wenn der Wachtmeister kommt, ich – ich bin nicht da! Hörst Du? – Nich da! – Fort – verreist! – Hörst Du?«
»O du mein Himmel, er kommt ja nicht! Ach Gott, so ein Unglück, so ein schreckliches Unglück!«
Er kam ihr ganz nahe.
»Stenzeln! Sagen die Leute was über mich?«
»Was sollen sie denn sagen?«
»Ich hab' nischt gewußt, Stenzeln! Hörst Du? Nischt gewußt! Sag's den Leuten! Ich – ich kann nich dafür, ich bin unschuldig! Hörst Du? Sag's den Leuten, sonst verklag' ich sie, sonst verklag' ich sie alle! Sag' ihnen das!«
Er sank auf einen Stuhl. Die Stenzeln fing an zu weinen.
»Kommen Sie doch mit herunter, Herr Schräger! Bleiben Sie doch nich so alleine!«
Er schüttelte sich.
»Geh' Stenzeln, geh' raus! Es kommt jemand im Hausflur. Geh'! Sachte! Sachte! Sag' nischt, Stenzeln, sag' nischt! Ich bin nich da! Hörst Du? Geh', geh' raus! Stenzeln, geh' raus!«
Er drängte sie durch die Tür und schloß hinter sich ab.
Tief in der Nacht war's. Die Lotte lag mit weit geöffneten Augen im Bett. Es war stockfinster in der Stube, und die Uhr war stehen geblieben. Draußen stieß der Sturm an den Giebel, und die Äste eines hohen Baumes schlugen manchmal an die Fenster.
Das Mädchen faltete die Hände. Da drückte sie etwas – das war der goldene Ring!
Sein Ring! Und drunten lag ihr Bruder!
Wie die Rosen dufteten!
»Er hat's nicht besser verstanden, der arme, unglückliche Mensch!«
So edel war der Heinrich!
Aber sie – sie? War es nicht ein Verbrechen, daß sie diesen Ring trug? Daß sie in einer Familie Liebe und Glück suchte, wohin ihr Bruder Armut, Not, Tod und Schande getragen?
Die Lene! O Gott, was würde die Lene sagen! Wenn sie das jetzt erfuhr, dann ruhte ihr Fluch über ihrer und Heinrichs Liebe, jetzt mit Recht.
Der Ring! Wie er grausam drückte!
Wenn sie sterben könnte, und das auslöschen könnte, dann stürbe sie gern, noch diese Nacht!
Da! – Draußen ging ein Schritt, ein ganz leiser Schritt! – Jetzt! – Ein matter Lichtschein huschte unten an der Türschwelle vorbei. Was war das? – Was war das? – Und nun ein Wimmern, ein furchtbares, schwer unterdrücktes Wimmern unten im Hausflur.
»O Gott, der Vater!«
Nach kurzer Zeit schlich sie die Treppe hinab. Sie beugte sich über das Geländer. Da sah sie ihn. In der offenen Tür zu der Totenkammer kniete er, zusammengekauert, den Kopf an den Türpfosten gepreßt.
Das Licht, das er getragen hatte, war erloschen; nur das Totenlämplein schien fahl aus dem Gewölbe.
»Vater! Vater!«
Sie flüsterte es. Entsetzt zuckte er zusammen.
»Wer ruft mich? O, Du Lotte, Du – bloß Du – bloß Du!«
Sie eilte hinab und faßte ihn an der Hand.
»Komm mit! Komm mit zu mir herauf!«
»Ja! – Ja! – Ja! – Lotte – zu Dir – oh – da – da –«
Er sah noch einmal auf den Toten, auf sein schreckliches, angstverzerrtes Gesicht und die zertrümmerte Stirn. Da schloß Lotte das Gewölbe.
Droben zündete sie mit bebenden Händen die Lampe an.
Als Licht wurde, stöhnte er auf. Dann würgte er um Worte.
»Ich halt's nich aus – ich muß Dir's sagen, es erwürgt mich – ich hab' so schrecklich Angst – Lotte – ich – ich bin schuld an allem!«
Sie sah ihn verständnislos an.
»Lotte, ich hab's ja gewußt, ich hab's ja immer gewußt.«
»Was? – Was?«
»Daß er – daß unser Gustav angezündet hat!«
»Das hast Du gewußt?«
Sie stammelte es.
Er sah sie an, duckte sich zusammen und stand wortlos da.
»Rede! Rede! Sag' alles! Alles! Rede! Sag's! Sofort! Sag' alles! Ich will's!«
Er ächzte, aber er brachte kein Wort heraus.
»Wann hast Du's gewußt?«
Der Verbrecher stand vor ihren zürnenden Richteraugen.
»Lotte! Hab' – hab' Erbarmen, Lotte!«
»Wann hast Du's gewußt?«
»Gleich – gleich am ersten Tage!«
»Vor dem Gerichtstag?«
»Ih – ih – ja – ja – vor dem Gerichtstag!«
Eine furchtbare Pause. Mit ganz leisem, teuflischem Pfeifen zog der Wind um die Ecke des Hauses.
»Du! – Du! – Du!«
Sie ging auf ihn zu mit furchtbarem Haß in den Augen.
»Sag' alles! Alles!«
»Ich – ich – ich hab' falsch – falsch geschworen, Lotte!«
Sie sprach nicht. Sie hörte nur –! Ein Posaunenstoß dröhnte übers Haus, ein Knirschen und Klappern und ein winselndes Wimmern.
»Falsch geschworen? Warum?«
»Den Buchenhof wollt' ich – den Buchenhof – für – für Euch.«
»Den Buchenhof wolltest Du?«
Das sagte sie mit gebrochener Stimme.
Dann ging sie langsam durch die Stube, schob den Vorhang vom Fenster weg und sah hinüber nach dem Buchenhofe.
Schräger setzte sich auf den Rand ihres Bettes und starrte sie an.
Sie stand regungslos, die Hände hingen ihr schlaff herab.
Nach langen Minuten wandte sie sich um. Langsam kam sie vom Fenster zurück und trat an den Tisch. Dort zog sie den goldenen Ring vom Finger, küßte ihn und legte ihn neben die Rosen.
»Was machst Du, Lotte?«
Sie sah ihn mit toten Augen an.
»Das ist jetzt natürlich aus! Die Tochter und die Schwester von solchen – solchen Verbrechern – – kann er nicht heiraten.«
»Was willst Du tun, Lotte?«
»Ich werd' ihm alles sagen!«
Er stöhnte auf.
»Ihm sagen!«
Dann war es still. Die Lampe qualmte auf. Nach einer Weile schlug ein Ast ans Fenster, und es sprang eine Scheibe. Da stand Schräger auf. Langsam ging er durch die Stube bis zu einem Korbe, nach dem er in der Zwischenzeit hingestarrt hatte.
Aus dem Korbe nahm er eine Wäscheleine. Lotte hörte das leise Geräusch, blickte auf und sah den Vater mit dem grauen Strick in der Hand.
»Vater!«
Er drehte sich nicht um.
»Vater!«
Sie war bei ihm, riß ihm den Strick aus der Hand und schleuderte ihn hinter sich. Er fiel auf ihr Bett und lag wie eine graue Schlange über den weißen Kissen.
»Wenn Du's ihm sagst, komme ich auf meine alten Tage ins Zuchthaus! Da is es besser – Schluß!«
»Vater, ich sag's ihm nicht – ich werd's ihm nicht sagen, ich werd' Dich ja nicht verraten, aber Du mußt alles tun, was ich will – alles!«

Im Buchenhofe schlug eine Uhr die dritte Morgenstunde. Heinrich Raschdorf lag wach im Bett. Aus dem Dämmerlicht leuchtete matt eine Silberschrift von der Wand: »Des Vaters Segen bauet den Kindern Häuser.«
Der Ruhelose schloß die Augen und sprach mit sich selbst, weil er sprechen mußte.
Der schuld war, lag drüben stumm und kühl. Seine arme Seele war hinüber. Und den Reinen gehört das Leben. Das zertrümmert nichts: kein Freundeszorn, kein Schwesterfluch. Auf ein reines Leben kommt kein Unsegen hernieder, auch nicht von einem Geopferten.
So kämpfte Heinrich Raschdorf wider sein empfindsames Herz. Er kämpfte lange vergebens. Drunten schlug die heisere Uhr viermal, dann fünfmal, ohne daß sich die Qual des jungen Mannes vermindert hatte. Erst gegen Morgen fiel er in schweren Schlummer.
Als der Tag lange schon ins Zimmer leuchtete, wachte Heinrich Raschdorf auf. Es war zehn Uhr vorbei. Hastig kleidete er sich an und ging sofort hinüber nach dem Kretscham.
»Ich hab's verschlafen, Stenzeln. Wie geht's? Was macht Lotte?«
Die Stenzeln ging nach der Kommode.
»'n Brief schickt sie, sie is in die Stadt. Um sieben schon. Sie muß sich ja die Trauersachen besorgen. Und der Herr is in seiner Stube und kommt nich raus. Da is der Brief! 's is a Jammer, wie das Kind ausgesehen hat heute früh.«
Heinrich zerriß den Briefumschlag und las einen Satz. Dabei schluckte er heftig, wischte sich mit dem Handrücken über die Augen und trat mit dem Briefe ans Fenster.
»Sie! – Sie! – Sie! – – Stenzeln! – – Da – da – sie ist ja fort – sie ist ja fort, Stenzeln!«
»Herr Raschdorf! Jeses, was reden Sie denn?«
»Stenzeln, sie ist fort! Sie kommt nicht wieder! Sie kommt nicht wieder!«
»Ach Gott, Herr Raschdorf, ach Gott. Das ist ja nich möglich – was –«
Er schob sie beiseite und stürmte die Treppe hinauf.
»Herr Schräger! Machen Sie auf!«
Von den Schlägen seiner Fäuste dröhnte die Tür.
Ein Stöhnen kam aus der Stube.
»Aufmachen! Ich hau' die Tür ein! Ich hau' wahrhaftig die Tür ein!«
Die Tür ging auf.
»Da – der Brief! Sie ist fort! Sie schreibt, sie will mich nicht heiraten! Sie kommt nicht wieder! Das ist ja verrückt! Das ist ja total verrückt!«
Schräger starrte mit bleichem Gesicht und weitgeöffneten Augen den rasenden jungen Mann an.
»So reden Sie doch! Reden Sie doch ein einziges Wort! Wissen sie, daß sie fort ist, daß sie nicht wiederkommt?«
Schräger keuchte.
»Ja!«
»Sie wissen's? Und Sie sagen mir nichts? Sie lassen sie fort? Sie lassen mich schlafen? Mensch!«
Er erhob die Fäuste gegen ihn. Schräger duckte sich zusammen.
»Wegen 'm Gustav! Bloß wegen 'm Gustav,« stammelte er.
»Wohin?! Wohin ist sie?«
»Ich – ich weiß nich.«
»Das ist nicht wahr! Das ist Schwindel! Das ist 'ne Lüge! Ich will's wissen! Wohin ist sie? Wohin ist die Lotte?«
»Sie – sie hat mir's nich gesagt.«
»Wohin ist sie?!«
Das schrie er.
»Ich weiß nich, wahrhaftig, ich weiß ja nich! Ich kann nischt dafür! Ich kann ja gar nischt dafür!«
Heinrich Raschdorf stand zitternd vor ihm. Auf Sekunden mußte er mit sich kämpfen, den Mann nicht zu mißhandeln, ihm nicht mit Gewalt das Geständnis zu entreißen. Dann aber warf er den Kopf zurück, grub die Hände in die Taschen und ging ein paarmal rasch durch die Stube. Schließlich setzte er sich auf einen Stuhl, Schräger gegenüber.
»Ich will ja vernünftig sein, ich will ja nicht schreien, ich will ja alles auf mich nehmen, aber das müssen Sie mir sagen, wohin sie ist. Es ist ganz klar, daß Sie mir das sagen müssen. Sie ist doch meine Braut!«
»Heinrich, ich weiß nich! Sie will weit fort. Und ich soll die Wirtschaft verkaufen, und dann soll ich nachkommen.«
»Wohin sollen Sie nachkommen?«
»Das weiß ich nich. Das wird sie erst viel später schreiben, sagte sie. Sie wird erst einen Ort suchen.«
Es wurde still. Heinrich Raschdorf starrte mit bewegungslosem Gesichte den alten Schräger an. Unten wurde die Tür geöffnet; – zwei Männer stapften in den Hausflur und setzten etwas nieder.
»Guten Tag! Wir bringen den Sarg!« sagten sie.
Der alte Schräger hörte es und legte die Hände über das Gesicht. »Ich wollte, es gält' mir!«
Heinrich hörte von alledem nichts. Nach einer Weile erhob er sich.
»Und sie hat nichts für mich hinterlassen als den Brief?«
»Sonst nichts!«
»Sagen Sie: Können Sie mir schwören, daß Sie nicht wissen, wohin sie ist, warum sie fortgeht, schon vor dem Begräbnis? Können Sie mir das schwören?«
»Schwören?! Nein, schwören tu ich nich! Nein! Aber ich weiß nich, wo sie hin ist. Ich hab' sie selber gefragt; sie sagte, ich würd' es Ihnen verraten, und gerade deshalb sagte sie mir's nich.«
»So leben Sie wohl, Herr Schräger! Ich hab' hier weiter nichts mehr zu tun.«
»Heinrich! Herr Raschdorf! Bleiben Sie noch, bleiben Sie noch ein kleines bißchen! Es ist schrecklich so alleine. Und dann – ich hab' eine Bitte, die hat mir noch die Lotte aufgegeben.«
»Was?«
Schrägers Gesicht wurde feuerrot, und das Wasser stieg ihm in die Augen.
»Was für eine Bitte?« drängte Heinrich.
»Kaufen Sie mir – kaufen Sie mir meine Wirtschaft ab. Ich – laß' sie Ihnen für das halbe Geld.«
Die Tränen liefen dem Manne übers Gesicht, und man sah, wie er die Worte unter furchtbarem Schmerz und schwerer Überwindung hervorbrachte.
»Ihre Wirtschaft? Das will die Lotte?«
»Ja! Ich hab's ihr in die Hand versprochen. Und wenn ich's nich tue, seh' ich sie nich wieder.«
Heinrich war nicht gleich fähig, etwas zu sagen. Nach einer Weile erst fragte er:
»Warum will sie das?«
»Sie meint, weil Ihr – weil die Raschdorfs durch uns – ich will sagen durch unseren armen Gustav geschädigt worden sind.«
»Ja so! Und vielleicht auch, weil sie mich ohne Abschied im Stich läßt. Da soll ich eine Wirtschaft zu halbem Preis kriegen. Eine Abfindung soll ich bekommen.«
Er lachte bitter. Sie ging nicht nur ohne Abschied von ihm, sie schied mit einer Beleidigung.
»Herr Schräger, ich mag Ihre Wirtschaft nicht, ja, Sie können erleichtert aufatmen! Ich mag sie nicht umsonst! Sie ist auch umsonst noch zu teuer. Wenn die Lotte das Gewissen drückte, dann hätte sie wissen müssen, daß es einen einzigen Schadenersatz für mich gab, und das war sie selbst. Mit einer Wirtschaft ist mir nicht gedient. Im Gegenteil![276] Wenn Sie den Buchenhof haben wollen, spottbillig haben wollen, können Sie ihn heute oder morgen haben. Heute oder morgen, je eher, je lieber!«
Ein ganz leises, verirrtes Leuchten blitzte durch die Äuglein des alten Wirts; es erlosch gleich wieder.
»Den Buchenhof? Billig? – Was nützt's! Es is zu spät! Es geht nich mehr!«
»Und hat Ihnen die Lotte nicht gesagt, wann sie Ihnen Nachricht geben will?«
»Ja! Zeitigstens in einem Jahre! Ich hab' ihr tausend Mark mitgeben müssen. So lange das reicht, schreibt sie nich.«
»So leben Sie wohl, Herr Schräger! Lassen Sie sich's gut gehen!«
»Bleiben Sie noch ein bißchen, ein kleines bißchen.«
»Nein! Ich hab' keine Zeit. Ich habe schon zu viel Zeit hier zugebracht. Leben Sie wohl!«
Die Treppe ging er hinab. Er hielt sich fest an das Geländer und schwankte doch und trat schwer auf.
Unten aus dem Hausflur klang Schritteschlürfen und gedämpftes Sprechen. Sie legten den Toten in den Sarg.
Heinrich wandte sich nicht um, und als die Stenzeln kam und ihn in der Haustür am Ärmel faßte, schüttelte er sie ab.
Drüben in seiner Wohnstube sah er sich um.
Da war er! Da kam er wieder! Er kam von drüben, kam wieder nach Hause.
Sein Lachen schallte unheimlich auf.
»Ist das schön! Ist das schön zu Hause!«
Langsam setzte er sich hinter den Tisch und lehnte den heißen Kopf gegen die kühle Mauer. Die Augen starrten ausdruckslos nach der Decke; der Mund war ein wenig geöffnet. Wie schwere Betäubung lag's auf seiner Stirn. Eine graue Spinne kroch aus einem Winkel, blieb an der Decke gerade über ihm stehen und starrte ihn mit ihren unbeweglichen Augen unheimlich an.
Lange saß er so am Tisch, ohne sich zu rühren. Dann ging er schwer durch die Stube, zog Lottes Brief aus der Tasche, öffnete den Ofen und warf den Brief hinein.
»Da, du verfluchter Wisch! Da brennst du, brennst wie Schwefel! Oho, da steht das Wort »Liebe«! Siehst du, wie schön eine Lüge brennt? O ja! Und jetzt ist's gut, jetzt ist's aus!«
Er setzte sich auf die Ofenbank. Des Vaters Jagdgewehr fiel ihm ein. Es war zweiläufig. Die eine Patrone war abgeschossen, die andere steckte noch. Am Ende wäre sie noch brauchbar. Schade um so eine Patrone, wenn sie jahrelang unbenutzt in einem Laufe steckt!
Er sah hinüber nach des Vaters Bilde.
»Jawohl, du – wir haben hübsche Nachbarsleute! Da ist was zu holen, etwas ganz Bestimmtes, das keiner zweimal braucht!«
Eine halbe Stunde verging. Grauen, Schmerz, Wut wechselten in seiner Seele ab, über alles ging eine riesengroße Verwunderung, die Verwunderung, daß ein Mensch so handeln könne wie die Lotte, die Verwunderung, daß einen Menschen ein so jammervolles Schicksal treffen könne wie ihn. –
Das Hoftürchen ging draußen, und ein Männerkopf wurde an den Fenstern sichtbar – Mathias!
Heinrich rührte sich nicht, sagte auch kein Wort, als es leise an die Tür klopfte. Da öffnete Mathias behutsam und trat ein.
»Heinrich!«
Der regte sich nicht und sah auf den Fußboden.
»Heinrich, die Lotte schickt mich zu Dir! Sie hat mir einen Brief geschrieben.«
»So? Dir auch? Da kannst Du lachen! Mein Brief steckt schon im Ofen!«
Mathias trat zu ihm und legte ihm eine Hand auf die Schulter.
»Wir müssen miteinander reden, Heinrich!«
»Reden? Nein! Ich will nicht! Tu mir den Gefallen und geh' wieder. Was kommst Du wieder? Ich kann niemand gebrauchen. Dich auch nicht! Wirklich nicht! Sieh mich nicht so an! Es ist mir lästig!«
Mathias legte ihm beide Hände auf die Schultern.
»Nein, alter Heinrich! Ich geh' nich! Ich geh' bestimmt nich! Ich geh' überhaupt nich mehr!«
Heinrich schüttelte die Hände ab.
»Gehst überhaupt nich mehr? Meinetwegen! Mir ist's egal! So bleib' halt!«
Mathias ging nach dem Tische, nahm sich einen Stuhl und setzte sich.
»Weißte was, Heinrich, ich hab' mir's auf 'm Wege hierher überlegt – Du mußt fort!«
Heinrich hob das Haupt und sah den Alten kurz und scheu an.
»Fort? Stimmt! Ich muß fort! Da hast Du recht.«
»Ja, wenigstens auf a Jahr. Nach Breslau mußt Du! Fort hier aus dem Loche, wo Dir das Leben leid wird. In Breslau mußte Dich amüsieren oder a bissel studier'n oder Geld totschlagen, is alles egal, bloß, Du mußt hin!«
Heinrich lachte.
»Täusch' Dich bloß nicht! Ich geh' schon, geh' schon, aber nach Breslau? Nein! Täusch' Dich bloß nicht!«
»Da is gar nischt zu täuschen! Du bist a ganz verpfuschter Kunde, Heinrich! Zum Bauer taugste nich, mit a Leuten verstehste Dich nich, der alte Großknecht und die Schwester laufen Dir fort, die Braut rückt och aus – Du paßt höchstens in die große Stadt. Dort wirste noch als a Staatskerl gelten, dort gibt's viele solche Knöppe wie Du einer bist!«
Heinrich sah auf.
»Weißt Du nicht sonst noch ein paar Witze, Mathias?«
»Witze sind das nich, Heinrich! Sieh mal, darauf kannste nu Gift nehmen: die allermeisten Menschen sind riesig dumm. Ich och und Du erst recht! Ich alter Esel rück' aus, weil mir was nich paßt, und Du junger Kerl sitzt dort, wo für Dich 's meiste Pech hingeschmiert is. Und das sag' ich Dir: die Schräger-Lotte hat zehnmal mehr Verstand im Leibe, wie Du und ich zusamm'n.«
Heinrich lachte höhnisch.
»Ja, das muß man sagen!«
»Man muß wirklich sagen! Die hat 'n Charakter! Das is amal eine, die nich an sich denkt. Dagegen sind wir alle klunkrige Kerle. Und was das Schlimmste is, daß ich das erst einseh'n lern', wo sie fort is. Das is a Prachtmädel, die Lotte!«
Heinrich stand von der Ofenbank auf.
»Ich möchte wissen, was das alberne Gerede für einen Zweck hat. In Wirklichkeit ist sie eine dumme Gans, oder religiös-verrückt, oder so – alles dasselbe! Weil ihr blödsinniger Bruder meinem Vater die Scheune angezündet hat, läuft sie mir fort, macht sie mich unglücklich. Damit sühnt sie das! Na, Mensch, siehst Du nicht ein, daß das hirnverbrannt ist?!«
Er lachte, daß er sich schüttelte.
Mathias sah ihn milde an.
»Auf a bissel Geschimpfe kommt's nich an, Heinrich. Aber das sag' ich Dir: wenn Du Dich etwa umbringen tät'st, wärste a Schmachtlappen!«
Der junge Buchenbauer fuhr wild auf.
»Was?! Wie?! Wer sagt das! Was geht Dich das an? Was? Hast Du mir was zu sagen? Du?!«
»Nö! Aber raten möcht' ich Dir was: Leg' Dich a bissel schlafen!«
»Mathias! Bist Du denn besoffen? Wie kommst Du denn bei meiner jetzigen Lage zu solch dämlichem Gerede?«
»Es wär' Dir sehr gutt, wenn Du a bissel schlafen tät'st, nachher könnt' man doch mit Dir reden. Ob Du nu willst oder nich, das is egal. Wir müssen auch endlich amal miteinander verrechnen. Wer weiß, was nu aus Dir wird, und um mein Geld möcht' ich nich kommen.«
Der Buchenbauer sah Mathias unsicher an.
»Das sind Ausreden! Um das Geld ist Dir's nicht. Ich versteh' Dich schon!«
»Schön, wenn Du mich verstehst! Jawohl, ich geh' Dir nich vom Halse, bis Du schläfst, oder bis Du wieder andere Augen hast – nich solche! Verstehste mich? Und rausschmeißen kannste mich nich, keen Knecht packt an, und alleine biste zu schwach. Ich geh' Dir nich vom Leder, Heinrich, Du magst machen, was Du willst.«
Heinrich Raschdorf trat mit verbissenem Zorn ans Fenster. Der Mann wollte ihn durch das Gerede um seine Stimmung bringen, um seine Stimmung. Das merkte er.
»Mathias, Du hast mich seither nicht gefunden, warum kommst Du jetzt? Ich brauch' Dich nich, ich will Dich nich! Ich will, daß Du mich machen läßt, was ich Lust hab'! Ich nehm' von Dir keine Lehre mehr an, verstehst Du! Und wenn Du durchaus hier bleiben willst, gehe ich!«
»Wenn Du gehst, geh'n wir zusammen, Heinrich,« sagte Mathias und erhob sich.
Voll Ingrimm sank der junge Buchenbauer auf einen Stuhl.
Bis gegen zwei Uhr nachmittags zankten sie miteinander. Gegen drei Uhr schlief Heinrich Raschdorf wirklich auf dem Sofa ein. Seit drei Nächten hatte er nicht mehr ordentlich geschlafen, und es lag wie schwere Betäubung auf seinem Hirn.
Mathias setzte sich in den Lehnstuhl am Fenster und wachte bei ihm. Durch den tiefen Ernst seines Gesichtes schimmerte ein Lächeln über den Sieg, den er errungen. Nach einiger Zeit kam der Schaffer in die Stube getappt.
»Pst! Tritt doch nich so auf, Mensch!«
Der Schaffer zog die Holzpantinen aus und nahm sie in die Hand.
»Is wahr?« fragte er leise und zeigte mit den Pantinen erst auf Heinrich und dann nach dem Kretscham.
Mathias nickte.
»Ja, sie is fort! Weil ihr Bruder angezünd't hat, denkt sie, sie darf nich als Frau uff a Buchenhof kommen. Sie hat zuviel Ehrgefühl.«
Dem Schaffer fiel eine Pantine auf den Fußboden.
»Pst – Mensch! Halt' doch Deine Latschen feste! A muß schlafen!«
»A is wull – a is wull – ganz disperate um a Kopp?«
»Ja, aber geh' lieber raus! Ich erzähl' Dir's heute abend.«
Der Riese bückte sich gehorsam nach seinem verlorenen Pantoffel und schlich aus der Stube.
Der Abend kam. Mathias saß noch immer im Lehnstuhl und sah nach dem Schlafenden, manchmal sehr sorgenvoll, aber dann auch wieder mit all seiner zärtlichen Liebe. Es war doch sein guter, lieber Heinrich! Er hatte ihn schwer vermißt die wenigen Wochen und nur immer keinen Mut gefunden, wieder zu ihm zu gehen. Jetzt kann er ihn ohne allen Groll anschauen. Die Liese ist im Frieden. Die einzige von allen, die im Frieden ist! Die anderen alle sind zerstreut in der Fremde.
Nun war es schon ganz finster, und Heinrich schlief noch immer. Draußen pfiff der Wind durch die Äste der Bäume.
Da ging die Tür leise auf. Eine dunkle Gestalt erschien und blieb regungslos stehen.
»Wer kommt? Wer ist da?« flüsterte Mathias.
Ein leises Schluchzen kam von der Tür.
»Mathias! Ich bin's!«
»Lene! Du?«
Er ging hin, faßte sie an der Hand, zog sie nach dem Hausflur und schloß vorsichtig die Tür.
»Wo kommst Du her? Was willst Du?«
»Die – die Schräger-Lotte hat an mich geschrieben. Heute nachmittag kriegt' ich den Brief.«
»Auch an Dich? Komm mit 'rauf, Lene; da drinnen schläft der Heinrich.«
In der Giebelstube saßen sie beide zusammen. Lene lag mit dem Gesicht auf dem Tisch. Mathias las den Brief.
Liebes Fräulein Raschdorf!
Eine Unglückliche schreibt an Sie. Ich bin die Braut Ihres Bruders geworden, weil ich ihn liebte und weil ich des festen Glaubens war, daß die Vorwürfe, die Sie und Mathias Berger meiner Familie machten, unbegründet seien. Durch den Tod meines unglücklichen Bruders habe ich die traurige Gewißheit gewonnen, daß ich mich getäuscht habe und daß Sie im Recht waren. Deshalb gebe ich die Verlobung auf, weil ich nicht in ein Haus eindringen will, das durch meine Familie so schwer geschädigt worden ist. Ich gehe in die Fremde und bin, wenn Sie diesen Brief bekommen, schon weit von der Heimat, wohin ich nie zurückkehren will. Ich gehe fort, weil Ihr[284] Bruder alles versuchen würde, mich umzustimmen, weil ich mich zu schwach fühle, auf die Dauer zu widerstehen, unfähig, ihm auch nur noch einmal unter die Augen zu treten, und weil ich nicht sein werden könnte, ohne ihn zu betrügen. Ich bitte Sie um alles Kummers willen, den Sie durch uns erfahren haben, um Verzeihung und flehe Sie an, zu Ihrem unglücklichen Bruder zurückzukehren, da er jetzt nicht allein sein kann und darf.
Charlotte Schräger.
Mathias Berger schob den Brief zurück und wurde rot im Gesicht.
»Lene, wir haben ihr unrecht getan. So – so wie die wird selten eine sein.«
Das Mädchen antwortete nicht; sie schluchzte nur heftig. Nach einer Weile sagte sie:
»Sie muß zurück – sie muß zurück zu ihm!«
»Geht nich, Lene, geht ja nich! Es weiß niemand, wo sie is, nich amal ihr Vater!«
Und an den zwei Menschen erfüllte sich wieder, was so alt ist wie die Welt: In allen Feindseligkeiten der Menschenkinder ist es die edle Tat allein, die den Sieg findet, die hinübergeht ins feindliche Lager, den Gegner anschaut mit milden, magnetischen Augen und, während sie ihn verwirrt und bestürzt macht, ihm die Waffen sacht, aber unwiderstehlich aus der Hand nimmt.
Die beiden schämten sich voreinander und vor sich selbst. Dann suchten sie einen Trost herbei: sie hätten's nicht besser gewußt.
Sie sprachen eine Weile miteinander, dann gingen sie leise hinab nach der Wohnstube. Die Lampe brannte, und Heinrich saß am Tisch. Er schaute nicht auf, als sie eintraten.
Wieder blieb die Lene an der Tür stehen; dann plötzlich eilte sie durch die Stube und kniete vor dem Tisch nieder.
»Heinrich!«
Er sah sie überrascht an.
»Lene – was willst Du hier?«
Das Mädchen war unfähig, ein Wort zu reden.
Mathias faßte Heinrich um die Schultern.
»Sei gut, Heinrich! Die Lotte hat an sie geschrieben. Sie sieht ja jetzt auch ein, daß sie der Lotte unrecht getan hat, und ich auch.«
Heinrich lachte.
»Das ist alles, was sein kann, daß Ihr das einseht! Das ist ja gerade noch zeitig genug. Nachdem alles kaput gegangen ist, sehen sie's ein!«
»Heinrich, laß mich wieder hier, laß mich wieder bei Dir!« schluchzte Lene.
»Nein! Wer fortläuft, braucht nicht wiederzukommen! Niemand! Nicht Mathias, nicht Du und auch die drüben nicht! Sie hätte nicht nötig gehabt, so heimlich zu tun; ich hätt' sie nicht geholt. Und Dich brauch' ich nicht mehr! Ich brauch' niemand!«
Die Lene erhob sich.
»Soll ich – soll ich wirklich gehen, Heinrich?«
»Ja!«
»Nein, sie geht nich, und ich geh' auch nich! Wir bleiben hier. Morgen früh, wenn Du willst, werden wir gehen.[286] Nich jetzt in dem Wetter und in der Nacht! Das kannste nich verlangen!«
Heinrich antwortete nicht. So setzten sich beide an den Tisch. Eine Weile waren alle stumm, dann sagte Mathias:
»Heinrich, willste uns nich sagen, was Du machen wirst?«
»Ist nicht nötig!«
Da sagte Mathias nichts mehr. Er wußte, daß der junge Buchenbauer, in dem es fürchterlich arbeitete, von selbst sprechen würde. So kam es auch. Er sprang nach einer Weile auf und reckte die Arme in die Luft.
»Fort muß ich – fort, fort aus diesem elenden, verfluchten Hause – oder – oder –«
»Heinrich, sieh mal, es wär' schon gutt, wenn Du vernünftig mit uns reden tät'st. 's beste is, Du verkaufst a Hof, und bis Du ihn los bist –«
»Soll ich hier bleiben? Hier? Nicht einen Tag! Nicht einen halben Tag mehr!«
»Das sag' ich auch. Du mußt bald fort! Morgen! Und daß die Wirtschaft nich allein is, bleiben die Lene und ich hier, bis wir sie los sind. Dann schicken wir Dir das Geld, und Du brauchst Dich um nichts weiter mehr zu kümmern, auch um uns nich.«
Darauf hörte Heinrich, und es kam eine Unterredung zustande, bei welcher Mathias Berger fast ganz allein sprach, in deren Verlauf er aber doch den jungen Buchenbauer vollends für seine Pläne zu bestimmen wußte.
So nahm Heinrich Raschdorf am anderen Tage Abschied vom Buchenhofe. Er war blaß, sonst verriet keine Miene seine Aufregung. Mit Mathias und Lene sprach er nur von rein geschäftlichen Dingen. Dem Mathias würde er alsbald eine gerichtliche Vollmacht schicken, den Buchenhof zu verkaufen.
Kurz nach Mittag gab er dem Schaffer den Befehl, anzuspannen. Er selbst trat noch einmal in die Wohnstube.
»Meine Kleider und Bücher schickt Ihr mir nach, wenn ich Euch meine Adresse werde geschrieben haben!«
»Ja, Heinrich!«
»Sonst bleibt alles hier! Ihr könnt ja Auktion machen. Und wenn Ihr selbst was zum Andenken behalten wollt, nehmt Ihr's Euch vorweg. Ich will nichts.«
»Ja, Heinrich!«
Er ging noch einmal durch die Stube und sah auf einige Sekunden zum Fenster hinaus. Dann wandte er sich um.
»So lebt wohl! Der Schaffer wird fertig sein.«
Die Lene brach in leidenschaftliches, lautes Weinen aus, und Mathias hielt sich bleich an der Tischecke fest.
Heinrich blieb mitten in der Stube stehen. Ein paarmal hob sich seine Brust krampfhaft, dann zuckte er die Schultern und ging rasch hinaus.
Unhörbar glitt der Schlitten aus dem weitgeöffneten Tor des Buchenhofes, das bald darauf ein Knecht verriegelte.
Mit geschlossenen Augen fuhr Heinrich Raschdorf den Bergweg entlang; erst als er in den Wald kam, blickte er auf.
Jetzt war nichts mehr von den Höfen zu sehen, nichts mehr vom Dorfe. Es lag alles hinter ihm begraben dort unten in dem verschneiten Tal. Nur die Stelle sah er, wo er ihr einmal die Maiglöckchen gepflückt hatte. Dort lag jetzt eine Schneeschanze. Und das Brünnlein, das damals so lieblich durch die Mittagsstille sang, war tot und still.
Ein Weilchen später tagte ein Turm auf. In dessen Nähe war der Bahnhof. Dort liefen in die weiße, dunstige Ferne die Eisenschienen hinaus in die Welt.
Gestern sie – heute er! Jedes seinen Weg! Viel Schienen laufen vom gleichen Platz, die sich auf keiner Station der Welt mehr kreuzen.

Auf dem Freiburger Bahnhof in Breslau stand ein Rekrut. Zwei Bahnschaffner und drei Frauen hatte er bereits gefragt, ob denn der Zug von Waldenburg her immer noch nicht komme, und jedesmal erfahren, daß er sich noch gedulden müsse. So setzte er sich verdrossen auf eine Bank der zugigen Halle, zog ein Telegramm aus der Tasche und las:
»Heinrich kommt vier Uhr nach Breslau. Abholen! Wichtiges vorgefallen. Mathias.«
Hannes befühlte seine Soldatenbeine. Es steckte jetzt noch ein furchtbarer Schreck darin, denn er hatte immer[290] gedacht, ein Telegramm könne bloß kommen, wenn jemand gestorben sei. Er hatte auch augenblicklich angefangen zu heulen, als ihm das Telegramm übergeben wurde, und dafür von seinem Hauptmann, der zufällig anwesend war, einen Rüffel und gleich hinterher »Nachturlaub« bekommen, als dieser das Telegramm gelesen hatte. So war der Alte: erst anschnauzen und dann von selber Urlaub geben!
Die Beine, die Beine! Hannes ist fest überzeugt, daß er hinkt, wie er so in schweren Gedanken wieder durch die Halle schreitet. Wichtiges vorgefallen! Er ahnte, daß es nichts Gutes sein könne, und war überhaupt nicht für »wichtige« Dinge.
Da fuhr der Zug donnernd in den Bahnhof! Der junge Vaterlandsverteidiger lehnte sich an eine Säule und ließ die Leute an sich vorübergehen. Nicht lange, da sah er ihn, den er suchte.
»Heinrich! Heinrich, was ist denn passiert? Was ist denn Wichtiges passiert?«
»Du – Hannes! Wo kommst Du her? Woher weißt Du denn, daß ich –«
»Vorsicht! Platz da! Vorsicht!«
Sie gingen hinaus auf den freien Platz vor dem Bahnhof.
»Heinrich, sag' mir, ist jemand gestorben?«
Der sah ihn ernst und wortlos an.
»Heinrich, sag' mir's doch! Ist – ist vielleicht mein Vater gestorben?«
Dem Rekruten schoß das Wasser in die Augen.
»Nein, Hannes! Sie sind alle gesund. Nur ich – nur ich wäre beinahe gestorben.«
»Du? Was fehlt Dir?«
»Jetzt nichts mehr! Jetzt fehlt mir gar nichts mehr!«
In einem Gasthause fanden sie einen stillen Winkel. Dort erzählte Heinrich kurz, hart, oft vom eigenen Lachen unterbrochen, was ihn hergeführt habe. Was er hier wolle, wisse er nicht. Nur von Hause wolle er fort sein. Es sei ja so herrlich in Breslau. Dann gingen sie auf Heinrichs Wunsch in ein Variété. Und ob Hannes noch im Gasthause steinunglücklich gewesen war, hier war er überrascht von den blendenden Dingen, die auf der Bühne vor sich gingen, und er vergaß vor lauter Staunen allen Kummer.
Heinrich saß still neben ihm. Er fühlte den Hohn dieser Lage. Vor einer Woche, ja noch gestern früh hätte er das nicht gedacht.
Eine Tiroler Sängertruppe trat auf. Sie sang ein Heimwehlied. Da ging Heinrich nach dem Büfett und trank ein Glas Bier, während Hannes in stummer Andacht dasaß. Die ganze Nacht saßen sie in Gasthäusern herum, und beiden glühte der Kopf. Bis zur Kaserne begleitete Heinrich seinen Freund.
»Gute Nacht, Hannes! Du warst noch der einzige, der mir treu geblieben ist, Du und Dein Vater. Jetzt werden wir uns ja hier auch manchmal sehen!«
Dann, wie er durch die nächtlichen Straßen irrte, wußte er: Es gibt keinen Ort, wo man so sterbensallein sein kann, wie in der großen Stadt.
Der Gymnasialdirektor war von jeher Heinrich Raschdorf sehr gewogen gewesen. Er erinnerte sich seiner sehr[292] wohl; denn Heinrich war ehemals ein Freund seines Neffen und als solcher auch einigemal im Hause des Direktors zu Besuch gewesen.
Jetzt, als er die Lebens- und Leidensgeschichte seines früheren Schülers erfuhr, wurde sein Interesse wieder in hohem Maße wach. Es ergab sich, daß die jahrelangen, eifrigen Studien Heinrichs von großem Erfolg gewesen waren, und der Direktor versicherte, wenn Heinrich Privatunterricht nähme und fleißig studiere, würde er alle Aussicht haben, beim nächsten Abiturium als Hospitant das Examen zu bestehen.
So mietete sich Heinrich ein Zimmer und ergab sich eifrig dem Studium. Es wunderte ihn, daß eine heimliche Freude in ihm aufgeblitzt war, als der Direktor ihm die erfreuliche Aussicht eröffnet hatte. Und als er sich selbst einen Stunden- und Arbeitsplan entwarf und seine Bücher ordnete und aufstellte, mutete ihn das neue, fremde Zimmer ein ganz klein wenig heimatlich an.
So kam es, daß Heinrich Raschdorf ein stiller Mann wurde, einer, der nie lachte, aber auch nicht mehr klagte oder mit dem Schicksal grollte.
An den Sonntagen besuchte ihn Hannes. Der brachte immer ein gut Teil urwüchsiger Laune mit. Heinrich ließ ihn plaudern und lachen. Nur von der Heimat durfte er nicht reden. Und Heinrich Raschdorf wußte gar nicht, daß er in diesem schlichten, gutmütigen Hannes immer noch ein Teilchen Heimat liebte und für seine Sonntagssehnsucht begehrte, denn ohne Hannes wäre kein Sonntag gewesen.
Kleine Episoden ereigneten sich, die den Kampf ums Vergessen erschwerten. Einmal stiegen die jungen Freunde auf die Liebichshöhe. Es steht da ein stattlicher Aussichtsturm, von dem man das Häusermeer der Stadt Breslau gut übersehen kann und auch einen schönen Fernblick genießt. Hannes verfiel wieder ins Staunen, Heinrich aber schaute über die Stadt hinaus. Weit in dunstiger Ferne, im Südwest waren die Waldenburger Berge sichtbar, die Berge seiner Heimat. Das wußte er noch von seiner ersten Gymnasialzeit her, wo er oft dort oben seine Träumer- und Heimwehstunden gehabt hatte. Und auch jetzt konnte sich seine verbitterte Seele der tiefen Poesie, die von den Bergen der Heimat herüberstrahlte, nicht ganz verschließen.
Ja, es ist so: Wenn uns Menschen eine Sehnsucht faßt, stehen wir immer auf einem hohen Turm, von dem wir nach der Heimat schauen.
»Du, Heinrich, wo guckst Du hin? Dort nach dem großen Hause mit dem runden Dache und dem Stern oben? Das is die Synagoge, das is nämlich die Judenkirche.«
Heinrich antwortete nicht, er stand ins Schauen versunken stumm da.
Da legte auch Hannes die Hand über die Augen und sah in die Ferne. Und da kam eine große Beweglichkeit in ihn.
»Du, Heinrich, was – was sind denn das für Berge ganz da hinten? Dort? Dort drüben!«
»Rat' mal, Hannes, rat' mal!«
»Ich weiß nich – es sind doch nich, es sind doch nich etwa –«
»Ja! Die Waldenburger Berge sind's!«
»Heinrich!«
Der stieg schon rasch die Treppe hinab, während der Rekrut wie gebannt dort oben stand und keinen einzigen Blick mehr übrig hatte für die große Stadt, sondern mit sehnsüchtigen Augen nach dem Horizont schaute, an dem doch nichts zu sehen war als ein paar matt abgegrenzte, graublaue Linien. –
Ein andermal kam Hannes zu Heinrich, legte ein Paket auf den Tisch und sagte:
»Da! Es ist Wurst! Es ist a Schiff von Hause gekommen, und da haste die Hälfte!«
Heinrich sah ihn unwillig an.
»Wer heißt Dich das, Hannes?«
»Niemand! Ich selber! Ich will mich auch amal nobel machen, weil Du mich doch immer freihältst.«
»Du nimmst das Zeug wieder mit, Hannes! Ich hab' genug zu essen!«
»Ich och! Und zu trinken och! Und für mich braucht keen Mensch mehr zu bezahl'n, wenn Du das nich nimmst; ich hab' meine Löhnung. Verstehste?!«
Heinrich mußte die Wurst behalten; aber an dem Abend, da er davon aß, konnte er nicht studieren. So schenkte er den ganzen Vorrat seiner Wirtin. –
Als das Frühjahr kam, wurde Heinrich unruhig: der Bauer regte sich in ihm. Täglich dachte er an die Feldarbeiten, für die nun die Zeit gekommen war, und einmal ging er soweit spazieren, bis er einen pflügenden Bauer traf. Dem sah er länger als eine halbe Stunde zu. Langsam und in[295] tiefen Gedanken ging er dann noch am Oderfluß entlang, und als er heimkam, schrieb er an Mathias, er solle einstweilen seine Bemühungen um den Verkauf des Buchenhofes einstellen. Er selbst werde allerdings nie nach Hause zurückkehren, aber es könne doch sein, daß er für den Hof noch eine andere Bestimmung träfe. – So kam die Zeit des Examens heran. In den letzten Monaten arbeitete Heinrich mit Anspannung aller Kräfte, und sein Gesicht wurde blaß und schmal. Die Hände waren längst wieder weiß und weich.
Einige Zeit später erhielt Hannes wieder ein Telegramm. Er erschrak abermals heftig, beschloß aber, sich diesmal in keine vorzeitige Trauer zu stürzen, sondern öffnete und las:
»Examen bestanden. Komme so bald als möglich zu mir. Heinrich.«
Der junge Kriegsmann stand ganz fassungslos, erstens, weil der Heinrich nun ein wirklicher Student war, und zweitens, weil es möglich war, aus demselben Ort, wo man lebt, ein Telegramm zu erhalten.
Er besorgte sich Urlaub, überzählte sein Geld, lieh sich noch drei Mark hinzu, kaufte einen Bierkrug und machte sich mit dem Geschenk auf den Weg zu Heinrich.
»Heinrich! Mensch! Ich bring' Dir ein sehr schönes, teures Bierseidel, weil Du doch jetzt Studente bist!«
Da lachte Heinrich Raschdorf seit langer Zeit wieder das erste Mal.
Er schüttelte dem Freunde die Hand.
»Hannes, alter Kerl! Freust Du Dich wirklich so?«
»Freuen? Ich freu' mich so schrecklich, daß ich jetzt bestimmt wieder mal Arrest krieg'. Denn ich hatte ganz gewiß gedacht, Du fällst durch!«
Als sie dann beisammen saßen und Heinrich aus dem neuen Kruge getrunken hatte, sagte er:
»Hör' mal, Hannes, nun wollen wir mal über die Zukunft reden. Bis jetzt war mir alles so recht egal, aber heute will ich wieder mal Pläne machen. Also ich studiere Medizin.«
»Was?«
»Weißt Du, ich werd' ein Doktor. Kranken Menschen helfen, das ist noch etwas, was sich lohnt. Die Liese ist auch glücklich, weil sie bei Kranken ist. Und Du, Hannes, wirst wieder Bauer, wenn Du vom Militär los bist. Mit dem Bergmann werden, das ist nichts für Dich.«
»Nee, wirklich nich! Aber es is um die fünfzehn Mark wöchentlich und um die Lene. Die will ich doch heiraten.«
»Ja natürlich! Also kurz gesagt: Du pachtest mir den Buchenhof ab.«
Hannes zwinkerte ihn wehmütig an.
»Den Buchenhof abpachten? Das wär' was! Mein ganzes Vermögen is a Taler Schulden.«
»Vermögen brauchst Du nicht; etwas hat ja die Lene. Du bezahlst die Zinsen, und was von dem Gute und von der Ziegelei jährlich heraushängt, das heißt, was übrig ist, davon gibst Du mir die Hälfte als Pacht, wenn das Jahr um ist.«
Wenn Heinrich Raschdorf dem Hannes seine mathematische Prüfungsaufgabe vorgerechnet hätte, so hätte ihm der mit keinem fassungsloseren Gesicht gegenüber sitzen[297] können als jetzt. Also gab ihm Heinrich einen langen, deutlichen Bericht über alle Ausgaben, die der Buchenhof erforderte, über die durchschnittlichen Erträgnisse und über den voraussichtlichen Gewinn, mit dem beide zufrieden sein könnten, wenn sie sich bescheiden einrichteten.
Das Ende vom Liede war, daß Hannes dem Heinrich um den Hals fiel und zum Steinerweichen zu heulen anfing. Erst allmählich gewöhnte er sich an das riesengroße Glück, das ihm bevorstand. Pächter vom Buchenhofe! Er, der arme Sohn des Schaffers! Und die Lene sein! Und er konnte wieder aufs alte, heimatliche Feld!
Nach einer Weile machte er plötzlich ein auffällig schlaues Gesicht, entschuldigte sich, ging auf eine Viertelstunde fort und kehrte mit vor Aufregung glühenden Wangen zurück.
»Weißte, was ich gemacht hab'?« fragte er, noch keuchend vor Aufregung. »Telegraphiert hab' ich! Nach Hause telegraphiert, daß ich Pächter bin. Die könn'n auch amal erschrecken, und ich kann mir das Telegraphieren leisten!«
Ein paar Tage später kam ein langer Brief des alten Mathias an Heinrich. Eine Stelle darin hieß:
»Ich bin so froh, daß Du Arzt wirst. Du wirst ein guter Doktor sein, weil Du fleißig und gewissenhaft bist. Es ist gut, daß Du hier los bist von der Landwirtschaft. Es war nicht Deine Sache. Die Liese ist jetzt als Schwester eingekleidet. Ich habe sie besucht, und ich schreibe Dir, lieber Heinrich, daß ich ganz glücklich und froh wiedergekommen bin. Ich werde auf meine alten Tage zufrieden sein, denn[298] der Liese geht es gut. Und es wird alles gut sein, wenn Hannes und die Lene die Wirtschaft haben. Ich will gern bei ihnen bleiben, ich bin viel zu alt, daß ich jetzt wieder so herumfahre. Und ich hab' gesagt: »Das ist unser guter Heinrich«, wie ich es von Hannes und der Lene hörte. Von Lene liegt ein Brief bei. Der Schaffer wollte auch gern einen schreiben, aber er bringt nichts zustande. Er arbeitet jetzt von früh bis spät und will bald gar nicht mehr schlafen gehen. Und manchmal, wenn er auch ganz allein ist, fängt er ganz laut an zu lachen. Sagen läßt er Dir bloß: er läßt sich schön bedanken. Aber da steckt alles darin. Die Dorfleute sind jetzt ganz verändert zu uns. Sie sind sehr freundlich zu mir, und wenn sie die Lene sehen, ziehen sie von großer Weite die Mützen. Und die Ziegeln kaufen sie auch aus dem Dorfe alle von uns. Das war ja früher nicht. Lieber Heinrich! Ich halte es für meine Pflicht, Dir jetzt noch zu schreiben, daß seit vorgestern die Lotte Schräger wieder zu Hause ist. Der alte Schräger hat die Wassersucht. Er hat ihr nicht nachreisen können. Da ist sie ihn pflegen gekommen. Sie ist in Pommern gewesen, bei einer Verwandten von ihrer Mutter. Wer es ihr vom Vater geschrieben hat, weiß niemand. Wir haben sie noch nicht gesehen, ich schäme mich jetzt, hinüber zu gehen. Wir haben jetzt mit dem Schräger manchmal verkehrt. Er hat von selbst mit uns angefangen. Er wollte mir immer für Dich den Kretscham verkaufen. Aber wie er dann krank wurde, wollte er nicht mehr fort von zu Hause. Die Lene ist auch manchmal drüben gewesen, als er krank war. Und wie jetzt die Lotte heimgekommen ist, hat die Lene fragen lassen, ob sie etwas helfen kann.[299] Aber die Lotte hat sagen lassen: Nein, sie lasse sich bedanken für den guten Willen. So mag alles Gott befohlen sein, und am meisten Du, mein lieber Heinrich.«
Zehnmal, zwanzigmal las Heinrich Raschdorf diesen Brief. Zuletzt setzte er sich auf das Sofa und schloß die Augen.
Sie war wieder zu Hause!
Zuerst war es ganz still in ihm. – Aber dann begann das Blut zu hämmern in seiner Brust und in seinen Schläfen. Ein Wirbeln faßte ihn an, und nach der dumpfen Gewitterschwüle trostloser, heißer Arbeitstage erhob sich ein Sturm, der jäh durch seine junge Seele ging. Unaufhörlich dachte er an sie und gab sich keine Mühe, wie sonst, den Gedanken los zu werden. Deutlich traten ihre Gestalt, ihr Gesicht vor seine Seele; er hörte ihre Stimme, fühlte wieder ihren Kuß.
Sie war zu Hause, war nahe, erreichbar! Lotte!
Was war geschehen mit ihm, in ihm? Der wonnige Schreck, den ihm die kurze Nachricht gebracht, hatte allen Trotz, alle Bitterkeit niedergebrochen, hatte liebe verschleierte Bilder enthüllt. Im leuchtenden Blitzfeuer seiner neu erwachten Leidenschaft lag das alte Land erhellt vor seinen Augen, das Land, aus dem er geflohen war und nach dem ihn seine Sehnsucht doch alle Tage wieder zurückwies.
Er vermochte an seinen trotzigen Prinzipien nicht festzuhalten, da das Blut dagegen revoltierte; denn er war jung, und all sein Kampf gegen sich war greisenhaft gegen das Gefühl, das ihn mit elementarer Kraft wieder faßte.
Ein kleiner, kurzer Zweifel kam noch, dann kniete er schon vor einer Kiste, warf Bücher und Briefe heraus und fand ein kleines Bild.
Das war die Lotte! Jetzt schauten ihn diese süßen Augen an, jetzt lächelte ihm dieser Mund zu, und ehe er Zeit hatte, sich Rechenschaft zu geben, riß er das Bild, das er in all den langen Monaten nicht einmal angesehen hatte, an die Lippen und küßte es, küßte es mit jenem Glückshunger, mit jener verzweifelten Gier, wie er einst die Lotte selbst geküßt hatte im Herbstnebel.
Ein weinendes Jauchzen ging ihm durch die Seele, die Liebe lohte heiß, flammend, leuchtend wieder auf in seinem Herzen. Die Stube ward ihm zu eng, er rannte hinaus, fuhr vor die Stadt, lief stundenweit und kam ebenso erregt, wie er gegangen war, wieder nach Hause.
Die Nacht kam, er fand keine Ruhe. Auch die Zweifel kamen wieder, die Kämpfe. Ehrlich wollte er sein, ehrlich auch mit sich selbst. Wieder rief er sich ihren Treubruch vor die Seele, den tiefen Jammer, den sie ihm gebracht, aber der Groll blieb aus, der Zorn, das Feindschaftsgefühl kam nicht wieder, die Hoffnung fegte sie weg wie dürres Laub. Er rief sich alles ins Gedächtnis, was Mathias und Lene zu ihrer Rechtfertigung gesagt, dachte erst jetzt zum erstenmal darüber redlich nach, wie groß das Leid für sie gewesen, ihn aufzugeben und fortzugehen. Denn sie hatte ihn geliebt, wahr und wahrhaftig geliebt, wie ein Weib nur einen Mann lieben kann.
O, er mußte sie wieder haben!
Sollte er nach Hause? Hin zu ihr? In kaum drei Stunden konnte er sie sehen!
In drei Stunden! Sie sehen, sie haben, sie nicht mehr loslassen!
Ein Zittern überlief ihn. Er zog sich an, sagte seiner Wirtin ein paar Worte und stürmte fort. Der Nachtzug mußte noch da sein. Ja! Er kaufte die Fahrkarte. Die Stimme zitterte ihm, als er die heimische Station nannte. Er kam noch zu zeitig. Die kühle Nachtluft strich um seine Stirn. Er ging erregt auf dem Bahnsteig auf und ab und blieb dann plötzlich stehen.
Machte er sich lächerlich? Wie würde das sein, wenn er jetzt in tiefer Nacht nach Hause käme? Dorthin, wohin er nie mehr zurückkehren wollte? Wohl, sie war auch wieder heimgekommen. Aber der todkranke Vater hatte sie zurückgerufen! Und was würde sie sagen? Die Schwester hatte sie nicht sehen wollen! Und ihn? Wenn sie ihn wieder abwies oder gar vor ihm aufs neue floh? War das nicht eine furchtbare Übereilung? Mußte er sich's nicht erst genauer überlegen?
So war er plötzlich wieder mitten drin in tollen Zweifeln.
»Steigen Sie ein, mein Herr!«
»Danke – danke, ich fahre nicht mit!«
Ein Pfiff, der Zug setzte sich in Bewegung und fuhr in die Nacht hinaus, der Heimat zu – ohne ihn.
Langsam schlich Heinrich die erhellten Straßen heim. Überall lustige, lachende Leute. Keiner von diesen allen sah ihn auch nur an. Eine schwere Verachtung gegen sich selbst wollte in ihm aufkeimen, aber es blieb bei dem Gefühl der Ratlosigkeit.
In seiner Stube brütete Heinrich lange vor sich hin. Es war indes Mitternacht vorbei. An Ruhe war nicht zu[302] denken. So kam er auf den Gedanken, an Lotte zu schreiben. Er schrieb einen Brief um den andern. Gefallen wollte ihm keiner. Endlich gegen vier Uhr glaubte er das richtige gefunden zu haben.
Er setzte sich ganz mit ihr auseinander. Er schrieb ihr von allen seinen Qualen und Leiden. Und er suchte ihre Bedenken zu zerstreuen. Der Bruder sei für seine Tat nicht verantwortlich; sie aber, Lotte, sei doch ganz unschuldig. Und wenn etwas zu sühnen wäre, so könne es nur dadurch geschehen, daß sie ihn glücklich mache. Auch die Stellung der Seinen zu ihr habe sich gänzlich geändert, nachdem diese eingesehen, eine wie rechtliebende Seele die Lotte sei. Und so schrieb er am Schluß:
»Ich will nicht ungeduldig sein; ich will Dir Zeit gönnen und Dich erst dann sehen, wenn Du es willst. Um eines aber bitte ich Dich, Lotte: Du hast noch meinen Ring. Steck' ihn wieder an, wenn Du diesen Brief gelesen hast; sei wieder meine Braut!«
Die Sterne glänzten am Himmel, die Straßen waren ganz leer. Da ging Heinrich Raschdorf abermals zum Bahnhof. Noch einmal las er die Briefaufschrift, die für ihn den teuersten Namen der Welt enthielt, und legte den Brief in den Kasten. Um neun Uhr am Vormittag würde sie ihn schon haben. Das war in vier Stunden. In nur vier Stunden!
Ein qualvoller Tag verging, eine lange Nacht. Mit überwachten Augen und doch mit brennend roten Wangen saß Heinrich Raschdorf frühmorgens am Fenster seiner Stube und lugte aus nach dem Briefträger. Endlich kam er; er kam auf das Haus zu. Heinrich Raschdorf ging durch die Stube[303] hinaus ins Entree und lehnte sich an die Tür. Jetzt! – Da! – »Herrn Heinrich Raschdorf!«
In seiner Stube besah er den Brief.
»Inliegend ein goldener Ring.«
Er tastete nach einem Stuhl. Dort öffnete er den Brief. Ein goldener Ring fiel heraus, klang kurz auf und rollte über die Diele. – Er las bruchstückweise:
»Sie beurteilen mich falsch, Sie können mir nicht in die Seele sehen – Sie wissen nicht alles – ich kann Sie nicht betrügen – kommen Sie nicht her –«
Als die Vermieterin in die Stube trat, fand sie ihren Zimmerherrn bewußtlos auf dem Fußboden liegen. Die Erschöpfung und Erregung war zu groß, die Enttäuschung zu grausam gewesen.
Es war ein Jahr später. Hannes saß bei Heinrich in der Stube und trug seinen Zivilanzug. Er war heute vom Militär entlassen worden.
Melancholisch starrte der Bursche vor sich hin.
»Nu freu' ich mich gar nich mehr a bissel, daß ich nach Hause komme.«
»Wart' nur, Du wirst Dich schon freuen! Wenn Du erst auf der Bahn bist und gar, wenn Du das Dorf sehen wirst –«
»Aber die Lene, Heinrich, die Lene! Das verwindet die ihr Lebtag nicht, daß Du nich zu unserer Hochzeit kommst, und ich – ich auch nich.«
Heinrich schwieg eine Weile; dann sagte er:
»Sieh mal, Hannes, es geht nicht! Wenn »sie« nicht mehr dort wäre, oder wenigstens nicht so in der Nachbarschaft, dann bestimmt. Aber so ist's unmöglich.«
»Und willste überhaupt nich mehr heimkommen?«
»Kaum! Vielleicht später einmal. Aber Ihr müßt mich besuchen, so oft Ihr könnt!«
Sie saßen wieder eine Weile stumm da.
»Daß mir's schwer fällt, Hannes, das kannst Du mir schon glauben. Ich hätte die Lene gern einmal wiedergesehen nach so langer Zeit und gar an ihrem Hochzeitstage. Sie ist meine einzige Schwester!«
Hannes seufzte beklommen. Dann sagte er:
»Der alte Schräger macht nich mehr lange. A hat jetzt auch noch Leberkrebs. Mathias hat's geschrieben. Na, und wenn a tot ist, wird ja die Lotte fort aus 'm Dorfe. Dann kannste wieder heimkommen.«
»Ja, dann komme ich wieder nach Hause.«
Beim Abschied weinte Hannes.
»Heinrich, vergelt' Dir Gott alles! Gerade, wenn Du halt noch zur Hochzeit gekommen wärst, da wär' unser Glück voll gewest.«
»Weine nicht, Hannes! Auf einen Hochzeitsgast kommt's ja nicht an. Sei halt froh, daß Du heiraten kannst. Grüß' schön und reise glücklich!«
Einige Wochen darauf klopfte es an Heinrichs Tür. Eine Frauensperson trat ein.
»Heinrich!«
»Lene! Du – Mädel – Du?«
Die Geschwister lagen sich in den Armen und küßten sich innig.
»Lene, was willst Du, was willst Du heute? Du hast doch morgen Hochzeit.«
»Ja, und ich komme Dich holen. Du mußt dabei sein, Du mußt! Ohne Dich mach' ich nich Hochzeit. Ich hab' keinen Vater, keine Mutter, keine Schwester, bloß ein'n einzigen Bruder, und der – der will auch noch nich mit mir in die Kirche gehn?«
»Lene, ich kann ja nicht, ich kann ja nicht –«
»Du kannst, und Du mußt auch! Im geschloss'nen Wagen fahr'n wir nach Hause, im geschloss'nen Wagen fährst Du mit in die Kirche; sie sieht Dich nicht, sie sieht keine Spur von Dir, und nach der Trauung kannst Du ja bald wieder fort.«
»Aber Lene, heute kommst Du, heute?«
»Ja! Vormittags sind wir auf dem Standesamt gewesen, und dann bin ich gleich nach Breslau.«
»Aber Mädel, warum kommst Du denn gerade an Deinem eigenen Polterabend?«
»Daraus mach' ich mir nichts, und wenn ich früher gekommen wär', hätt'st Du Dir's wieder noch anders besonnen. Jetzt mußt Du mit, jetzt nehm' ich Dich bald mit.«
Er sah das gesunde energische Mädchen an und konnte nicht hindern, daß seine Augen glänzten.
»Lene, was bist Du für eine hübsche Braut! Und dann, Courage hast Du, das muß ich sagen. Lene, ich freu' mich über Dich – ich bin stolz auf Dich – ich komme mit Dir!«
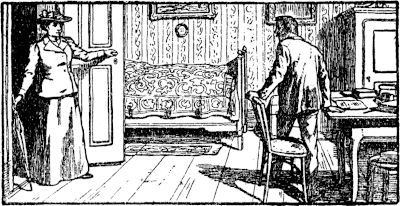
Mit dem Abendzuge fuhren sie heim. Sie redeten kaum miteinander. Zuweilen faßte Lene leise seine Hand. Und er lehnte im Winkel und sah hinaus in die Finsternis, aus der nur die Bahnlaternen oder Lichter eines friedlichen Dörfleins zuweilen aufblitzten.
Von Königszelt an waren sie allein im Wagen. Die Lichter von Freiburg schimmerten auf, dann keuchte der Zug hinauf auf die Waldenburger Hochebene.
»Ist es Dir ein so schweres Opfer, Heinrich?«
Er sah sie freundlich an.
»Wohl! Ach ja! Aber Du bist's wert, Lene!«
Sie faßte heftig seine Hand.
»Heinrich, Du glaubst gar nich, wie ich schon deswegen gelitten hab', daß Du gerade mein Glück gemacht hast, und daß ich Dir früher so im Wege gestanden hab'.«
»Laß gut sein, Lene! Ohne Dich wär's gerade so gekommen, wie's gekommen ist. Und das sind alte Geschichten und nun vorbei.«
Auf dem Bahnhof wartete der Schaffer. Als er den Heinrich mitkommen sah, geschah etwas, was noch nie in[308] seinem Leben passiert war: die Tabakspfeife fiel aus seinem sonst so hermetisch geschlossenen Munde. Er hatte das erste Mal in all seinen Erdentagen so etwas Ähnliches wie einen Juchzer getan.
»Hübsch is, hübsch is! Schön willkomm'!« Das war seine ganze Begrüßungsrede. Und Heinrich fühlte das Herz heftig schlagen, als er dem guten Riesen die Hand gab.
Dann ging es nach Hause. Eine schwere Aufregung ergriff den Heimkehrenden, und doch hätte er diese Reise jetzt nicht mögen ungeschehen machen. In alle Aufregung hinein wallte ein Gefühl der Freude, das auch dem ärmsten aller Menschen nicht ganz fern bleibt, wenn er nach Hause zieht.
Jetzt verließen sie den Wald; Lichter blitzten dort unten.
Die Buchenhöfe!
Mit geschlossenen Augen fuhr Heinrich am Kretscham vorbei und in seinen Hof hinein. Dort sprang er rasch aus dem Wagen und trat ins Haus.
»Der Heinrich kommt! Der Heinrich kommt! Hurra!«
Das war der Bräutigam. Er fiel dem Freunde um den Hals und war ganz außer sich vor Freude.
Und es trat einer leise heran: Mathias. Heinrich reichte ihm die Hand und wollte etwas sagen. Aber die Lippen zuckten ihm nur, und er brachte kein Wort heraus. So schlang Mathias den Arm um ihn, und die alten Freunde standen eine Weile stumm und still.
Etwas später stand Heinrich mitten in der Wohnstube und schaute sich um. Es war noch alles wie sonst: der Ofen strahlte eine behagliche Wärme aus, die große Petroleumlampe[309] brannte, und draußen polterte der Herbststurm mit den Weinspalieren.
Um ihn herum aber standen liebe Menschen mit strahlenden Gesichtern.
Da war es Heinrich Raschdorf doch, als ob er in eine Heimat gekommen sei.
Dann saßen sie um den großen Tisch und plauderten, und er wurde warm dabei und sagte auf einmal:
»Ich freu' mich, daß ich bei Euch bin!«
Wie sie darüber glücklich waren!
»So bleib' ein paar Tage hier, Heinrich!«
»Nein, Lene! Bald nach der Trauung fahr' ich. Du weißt schon, das ist Verabredung.«
»Und Du wirst gar nich amal mit aufs Feld oder in die Ziegelei?«
»Nein, Mathias; aber in die Ställe und in die Scheune gehe ich morgen früh einmal, wenn Du willst.«
Es war schon tief in der Nacht, da saßen noch alle beisammen.
Drüben im Kretscham hatte sich ein Schwerkranker im Bett aufgerichtet, als die Fuhre Heinrichs vorbeikam.
»Das is a – Lotte, das is a!«
Das Mädchen antwortete nicht.
»Geh, geh ans Fenster, Lotte! Sieh, ob a das is!«
»Nein, Vater! Ich gehe nicht ans Fenster.«
Der Kranke stöhnte und sank in die Kissen zurück.
»Ich – ich muß mit ihm – mit ihm reden; ich halt's nich aus – ooooh –«
Ein Schmerzensanfall kam. Das Mädchen beugte sich über den Kranken. Die Lampe beleuchtete ihr Gesicht. Es war so weiß und durchsichtig, als sei diese Pflegerin selbst eine Schwerkranke. Die Stenzeln kam ins Zimmer.
»Is a gekommen, Stenzeln?« fragte der Kranke.
»Ja! Ich hab' 'n geseh'n. A ging ganz schnell ins Haus rein. Aber a war's.«
Ein Zittern ging über den Körper Lottes.
»Stenzeln, geh wieder raus!«
Als er mit der Tochter allein war, keuchte Schräger:
»Schreib' ihm, Lotte – schreib' ihm 'n Brief – a soll rüberkommen zu mir – a soll kommen –«
»Ich kann ihm nicht schreiben, Vater – nein, ich kann nicht! Sei doch ruhig, sei doch ruhig!«
»Du weißt nich, Lotte, wie das is – ich kann nich sterben; ich kann ja nich sterben!«
Das bleiche Mädchen stand regungslos an dem Bette. Nur ein Zucken ging um ihren Mund. Tränen hatte sie nicht mehr. »Was willst Du denn von ihm, Vater?«
»Sagen will ich's ihm, alles sagen!«
»Vater!«
»Alles sagen – ich – ich – kann sonst nich sterben!«
»Du willst Dich selber verraten? Vater!«
»Die Schmerzen, Lotte – oooh, und der alte Raschdorf – mein – mein Freund – a kommt mir immer wieder ein – und nu soll ich runter – runter unter die Erde zu ihm – runter –«
Eine furchtbare Nacht kam, eine Nacht voll Qual und Gewissensangst und Furcht. Aber doch lebte in diesem[311] schmerzzerrütteten, todgeweihten Mann die Hoffnung, es würde leichter und besser sein, wenn er die Last von seinem Herzen abwälzte.
Gegen Morgen schrieb Lotte an Heinrich: »Mein schwerkranker Vater läßt Sie bitten, ihn vor Ihrer Abreise auf wenige Minuten zu besuchen. Charlotte Schräger.«
Schräger ergriff ihre Hand.
»Wirste dabei sein, Lotte, Kind – mei einziges, wirste dabei sein, wenn ich – wenn ich's ihm sag'? Sonst bring' ich's nich raus – sonst verzweifele ich!«
»Ja, ich werde dabei sein!«
Das sagte sie leise, aber fest.
Am Morgen ging die Stenzeln mit dem Brief nach dem Buchenhofe. Nicht lange, so kehrte sie mit der Antwort zurück.
»Ich reise sofort nach der Trauung meiner Schwester wieder ab und kann Ihren Vater, dem ich gute Besserung wünsche, nicht besuchen. Heinrich Raschdorf.«
Sie las es dem Vater vor. Der starrte sie mit weitgeöffneten Augen an. Dann lallte er:
»A kommt nich? A kommt nich?«
Sie schwieg. Nach einer Weile lachte er heiser.
»Da geh' ich halt so – halt so – so – hinüber – runter –«
Lotte stand am Fenster und hatte die Gardinen weit zurückgeschlagen. Jetzt fuhren drüben die zwei Hochzeitswagen vor.
Heinrich kam zuerst aus dem Hause und sah hinüber nach dem Fenster, an dem Lotte stand. Er erschrak und[312] zog den Hut, auch Mathias, der dabei war. Lotte rührte sich nicht. Dann kam das Brautpaar. So fuhren die Wagen hinab nach der Kirche.
Auch der alte Schräger hörte sie fahren.
»Nu sind sie fort,« sagte er mit einem irren Lächeln; »nu is der alte Raschdorf Brautvater!«
Lotte stand immer noch regungslos da.
»Brautvater!« Er fröstelte in sich hinein.
Eine Stunde verging. Da rief Lotte die Stenzeln ins Zimmer und ging selbst hinaus.
Über die Straße huschte sie – nach dem Buchenhofe.
»Ich werde hier auf Herrn Raschdorf warten, ich hab' mit ihm zu reden. Sagen Sie's ihm, wenn er kommt,« befahl sie einer Magd und setzte sich in den Lehnstuhl am Fenster der Wohnstube des Buchenhofes.
Sie sah sich um. Als kleines Mädchen war sie manchmal hier gewesen, seitdem nicht mehr. Das Bild des alten Raschdorf sah auf sie herab. Sie blickte es ruhig an. Es war alles teuer gesühnt.
Jetzt rollten die Wagen in den Hof. Im Hausflur erfolgte eine Begrüßung der Brautleute durch die Dienstleute, dann stieg die kleine Gesellschaft die Treppe hinauf.
»Was? – Was? – Wo?«
Das war er. Bald darauf trat er in die Stube im Hochzeitsanzug, den Zylinderhut in der Hand. Ein paar Sekunden lang stand er Lotte wortlos gegenüber; dann trat sie rasch ein paar Schritte auf ihn zu und sagte schnell und hastig: »Bitte um Verzeihung, aber ich muß Sie nochmals persönlich bitten, meinen Vater zu besuchen, er ist[313] ein Sterbender, und er hat dringend mit Ihnen zu reden.«
Er sah sie mit großen Augen und tieferschreckt an und sagte kein Wort. Da errötete sie und begann wieder:
»Nur auf wenige Minuten, er ist ein Sterbender –«
»Ich werde kommen –«
»Ich danke!«
Und sie ging rasch aus der Stube. Regungslos stand er noch auf seinem Platz, als sie schon über die Straße zurück war.
Mit Mathias sprach er noch ein paar heimliche Worte, dann ging er nach dem Buchenkretscham.
Er traf Schräger und Lotte allein. Der Kranke schloß die Augen, als er eintrat, er öffnete ein wenig den Mund, und der schwere, sieche Körper hob sich im Stuhl. Lotte lehnte bleich und bewegungslos an einem Schrank.
Heinrich ging rasch durch die Stube und streckte dem Kranken die Hand bin.
»Guten Tag, Herr Schräger! Wie geht es Ihnen?«
Der erregte Mann sah ihn furchtsam an.
»Danke, ganz gutt – geht mir's.«
Der Gast setzte sich auf einen Stuhl neben den Kranken und sprach mit ihm von seiner Krankheit. Schräger antwortete und fing an, selbst zu erzählen. Minute auf Minute verging. Von dem Bekenntnis kein Wort! Da blickte Heinrich auf die große Wanduhr und erhob sich.
»Meine Zeit ist sehr knapp. Ich wünsche Ihnen, Herr Schräger –«
»Sie woll'n geh'n?«
Angstvoll fragte es der Kranke.
»Ich muß gehen, ich blieb sonst noch ein wenig bei Ihnen –«
»Ich muß Ihnen – ich muß Ihnen ja was sagen –«
Ein furchtbarer Schmerzensanfall kam, und Lotte mußte dem Vater zu Hilfe eilen. Mit bleichem Gesicht beobachtete Heinrich die Szene.
»Lotte – Lotte – sag' – sag' Du's ihm – Du's ihm – ich – ich – ooooh –«
»Was ist denn – um Gottes willen, was ist denn?«
Lotte wandte sich zu Heinrich. Mit tonloser, schneller Stimme sagte sie:
»Mein Vater hat Ihnen ein Bekenntnis zu machen. Er hat von vornherein gewußt, daß mein Bruder die Scheuer angezündet hat, hat es vor der Gerichtsverhandlung gewußt – er hat falsch geschworen – er wollte den Buchenhof – daher alles – jetzt wissen Sie's!«
Sie hielt sich an dem Tisch fest; der Kranke starrte auf Heinrich, der wie eine Bildsäule dastand.
»Ich hab' – a Raschdorf reinbringen woll'n – mit den Aktien – und auch später – und ich hab' falsch geschwor'n.«
Heinrich setzte sich langsam auf den Stuhl zurück.
»Nu – nu gehen Sie auf die Polizei – ich – ich – es ist ja doch aus mit mir! Aus! Eh' sie mich – eh' sie mich reinbringen in die Stadt, bin ich tot.«
»Schräger!«
Eine lange Pause kam. Die drei Personen starrten sich nur an.
»Und das sagen Sie mir ins Gesicht?«
»Der – der Tod – Sie wissen nicht – wenn man sterben soll, nachher wird alles mit einem Male anders – anders wie sonst –«
»Und Sie haben wirklich meinen Vater in den Tod gehetzt? Sie – Sie –«
»Nein – daß – daß er sich erschießt, das wollt' ich nich – das wollt' ich nich – bloß – bloß a Hof – a schönen Hof!«
Heinrich Raschdorf erhob sich. Ein Fluch schwebte auf seinen Lippen, ein Fluch, der den Mann ins Grab und in alle Ewigkeit hinein begleiten sollte.
Da kniete Lotte vor ihm und küßte ihm die herabhängende Hand mit zuckenden Lippen.
»Und Du, Lotte, Du hast das auch gewußt?«
Es lag ein Entsetzen in dieser Frage.
»Ich weiß es seit der Nacht, da ich fortging.«
Er starrte sie an. Ein Licht ging ihm auf.
»Darum?! – Darum gingst Du fort? Nicht wegen des Bruders? Wegen des Vaters?«
»Ja!«
Er nickte langsam mit dem Kopfe.
»Ja, dann begreif' ich's! Du mußtest gehen! Mußtest! Es ist klar!«
Als ob er sich selbst Rechnung legen müßte, sprach er halblaut vor sich hin, und seine Augen stierten:
»Meinen Vater ins Gefängnis – dem Zuchthause nahe – in den Tod, uns alle ins Elend, in Not, Haß, Feindschaft – ooh – sterben Sie – sterben Sie, wie Sie wollen, Sie elende Kreatur!«
Lotte sprang auf.
»Nun bitten wir nicht mehr, Vater! Jetzt nicht mehr! Jetzt ist's genug! Jetzt haben wir bekannt und gesühnt! Gehen Sie, Herr Raschdorf!«
Er starrte sie an.
»Ja! Gehen Sie, gehen Sie!«
»Nich gehen – nich gehen – oooh – die Schmerzen – der Tod – der Raschdorf! – Nich gehen, Heinrich! Die Angst –«
Der Kranke stand auf vom Lehnstuhl, wollte auf Heinrich zu und fiel schwer auf den Fußboden.
Eine zuckende, stöhnende, sterbende Masse!
Da kam das Grauen, das stärker ist als alles andere, und einigte sie. Gemeinsam faßten sie an und hoben den Kranken in den Lehnstuhl zurück. Dessen Gesicht war blau, und seine Hände tasteten in die Luft. Und Heinrich Raschdorf, der so dem Tod ins verzerrte Gesicht sah, faßte eine maßlose Angst, ein grauenhaft Entsetzen. Es ging ihm wie so manchem Unglücklichen: Wenn ein schwerer Schreck die Rinde auf dem vereisten Herzen sprengt, dann springt wieder stark und klar die heilige Quelle der Barmherzigkeit.
»Herr Schräger, kommen Sie zu sich – zu sich – Schräger! Nicht sterben, nicht so!«
»Vater! O Gott, hörst Du's? Hörst Du's?«
Er hörte es nicht. Bewußtlos lag er in den Betten. Die Stenzeln kam. Sie bemühten sich alle um den Kranken. Keines konnte sprechen, nur Heinrich murmelte unverständliche Worte. Da – nach einer Viertelstunde kam Schräger zu sich. Er sah auf Heinrich und stöhnte entsetzt.
»Herr Schräger, geben Sie mir die Hand, es ist alles gut, alles gut!«
Der sah ihn verständnislos an.
»Ich hab' mich bloß übereilt, bloß im ersten Schreck so geredet – ich verzeih' Ihnen ja – Sie können ruhig sein, ganz ruhig –«
»Ruhig!«
Ein stammelndes Lachen kam dem Kranken vom Munde.
»Der Mathias – die Lene!« lallte er.
»Sie werden Ihnen auch verzeihen. Soll ich's ihnen sagen, ihnen gut zureden? Sollen sie kommen?«
Der Kranke nickte.
»Kommen! Bald kommen!«
Wenige Minuten später war Heinrich im Buchenhofe.
Die Lene weinte heftig. Dann nahm sie den Brautkranz vom Kopfe und ging mit Mathias und Heinrich hinüber in den Kretscham.
Der Kranke sah die Eintretenden mit großen Augen an. Er streckte ihnen die Hände hin, die sie stumm ergriffen. Dann sank er zurück und schloß die Augen.
Stumm und erschüttert standen alle. Die Uhr zählte Schlag um Schlag. Sie zählte nicht weit, da war Schräger hinüber. Lotte kniete bei ihm nieder, und Heinrich trat zu ihr und legte die Hand auf ihre Schulter.
Die anderen gingen leise hinaus.
Und die Uhr zählte – zählte.
Schwer und heiß lag seine Hand auf ihr.
Sie erhob sich. Sie drückte dem Vater das eine Auge[318] zu und er das andere. Nun lag er mit geschlossenen Augen, nun sah er nichts mehr.
Die beiden Lebenden schauten sich an.
Klein ist die Rache!
Ja, die Menschenrache ist klein!
Er führte sie hinaus.
Draußen auf dem Flur küßte er sie auf die Stirn.
»Der Kampf ist aus, Lotte! Jetzt muß endlich Friede sein!«
Drei Tage darauf wurde Julius Schräger begraben. Neben seinem Sohne fand er die letzte Ruhestätte. Nicht weit davon weg lag der alte Raschdorf. So waren sie auch im Tode Nachbarn.
Beim Begräbnis standen die Buchenhofleute vollzählig an Schrägers Grabe. Und die Dorfgemeinde sah es und erkannte darin ein Beispiel, wie Menschen vergeben und vergessen sollen.
Auf dem Heimwege ging Heinrich mit Lotte. Oben am wilden Kirschbaum blieb er stehen.
»Lotte, nun frag' ich Dich in dieser schweren, ernsten Stunde das dritte und letzte Mal, ob Du mein sein willst!«
Sie erschrak und wollte reden.
»Sprich nicht, Lotte! Was Du dagegen sagen kannst, gilt nichts – gar nichts mehr! Es ist alles oft gedacht, oft leidenschaftlich gesagt worden. Ich hab' selber alles gedacht, alles gesagt. Aber Leben und Tod haben uns alle widerlegt. Die Väter, die sich gestritten haben, liegen dort unten; zwischen uns ist nichts, was uns trennt.«
Der schwarze Schleier flatterte um sie; kalt pfiff der Wind über die Felder. Vor ihr lag der Weg in die Fremde,[319] in eine öde, schwere Zukunft. Und neben ihr ging der, den sie liebte, und der sie erretten konnte von allem Leid, der allein sie aus dieser Nacht führen konnte auf die strahlende Straße des Glückes.
Da sprach sie leise:
»Wenn Du mich nach allem noch haben willst – ich wäre glücklich – ich wär' ja so glücklich!«
Er sagte nichts, er küßte sie nicht, er faßte sie nur fest an der Hand und führte sie heim nach dem Buchenhofe.

Das ist Heimat – Heimat ist nicht Raum, Heimat ist nicht Freundschaft, Heimat ist nicht Liebe. Was ist Heimat? – Der Doktor Heinrich Raschdorf sann diesem Gedanken nach, als er an einem prächtigen Frühherbstnachmittag viele Jahre später dem Buchenhofe zuschritt.
Er war ein anderer geworden. Das weiche Gesicht hatte einen festen, männlichen Ausdruck bekommen. Ein sonniges Lächeln lag in seinen Augen, wie man es bei jenen reifen, gefestigten Menschen findet, die sich selbst und das Leben überwunden haben, das stille Lächeln, das jene haben, die viel lernten und vor nichts mehr so leicht freudig oder traurig erschrecken. Ein Stiller, ein Reifer und Kluger war er geworden.
Er war heute unten im Dorfe bei einer armen Kranken gewesen. Wenn er nach Hause kam, wollte er anordnen, daß ihr einige Nahrungsmittel hinabgesandt würden, das tat am meisten not. Es ist gut, wenn einer zugleich Bauer und Arzt ist, da läßt sich manche glückliche Kur machen.
Heinrich Raschdorf liebte seinen neuen Beruf, er hatte auch in der Gegend genug Gelegenheit, ihn auszuüben. Aber es blieb ihm zuweilen auch ein bißchen Muße, Bauer zu sein wie in alter Zeit.
Der junge Arzt blieb stehen und sah ins Dorf. Dort unten hatte er keinen Feind mehr. Lauter Freunde, lauter Verehrer, alles Leute, die sich freuten, wenn er mit ihnen sprach. Sogar der junge Riedel grüßte ihn.
Heinrich war frei von Selbstgefälligkeit, wenn ihm das Goethesche Wort jetzt einfiel:
Er freute sich nur des endlichen Sieges nach so langen Kämpfen.
Ein Wagen kam einen Feldweg entlang. Hannes saß darauf und machte ein mißvergnügtes Gesicht. Er hatte den Kretscham mit den dazu gehörigen Äckern gepachtet, seit Heinrich auf dem Buchenhofe selbst wieder als Herr eingezogen war.
»Nu, Hannes, fährst Du aufs Feld?«
Der brummte.
»Gar nich nötig wär's! 's sind Leute genug draußen, und wenn dann a Haufen Gäste in den Kretscham kommt, da is der Mathias alleine zum Einschenken. Das is gar keen richtiger Betrieb.«
»Ja, warum fährst Du denn aufs Feld, wenn Du im Kretscham so nötig bist?«
»Warum?! Schlaue Frage! Ich werd' mir immerfort von meinem Weibe die Gesichter ansehen und das Gebrumme anhören!«
»Aha! Deine Frau –«
Es entstand eine Pause. Heinrich lachte leise vor sich hin, während Hannes' Miene sich mehr und mehr umdüsterte.
»Ja, meine Frau! Sie is ja ganz gut und tüchtig, ja – aber ich och! Und kneipen tu ich doch nich; ich unterhalt' mich doch bloß mit a Gästen. Na, und das muß a Gastwirt. Sonst is keen Betrieb. Aber die, immer aufs Feld, immer aufs Feld jagt sie einen.«
»Sag' mal, Hannes, Du klagtest doch dieser Tage über Kopfschmerzen.«
»Ja, die hab' ich auch noch.«
»Du, dann tut Dir Bewegung in freier Luft sehr gut.«
»Jüh!«
Hannes hieb dem Pferde die Peitsche auf den Rücken und fuhr rasch davon.
Der junge Arzt sah ihm lachend nach. Ein guter, lustiger Kerl war der Hannes immer noch. Aber daß er das Regiment in seinem Hause führe, konnte nicht gut jemand behaupten. Und es schadete auch vielleicht nichts. Die Lene war bei aller Energie in ihren Mann so verliebt, wie nur je eine Frau. Sie kamen sehr gut fort in ihrer Wirtschaft. Nicht lange mehr, so würde Hannes den Kretscham kaufen können. Dann war der Traum des alten Schräger, die beiden Buchenhöfe zu vereinigen, endgültig zunichte. Über die Pläne des Menschen, die aufs Geld gegründet sind,[323] schreitet die Zeit, die größte Mammonsfeindin, lachend hinweg.
Eine hohe Gestalt ragte in der Ferne auf. Das war der Schaffer. Als sein Sohn Hannes die Wirtschaft übernahm, zog er mit ihm nach dem Kretscham. Aber schon nach acht Tagen kam er nach dem Buchenhofe zurück. Er hatte das Heimweh bekommen. Er konnte sich nicht an eine neue Wohnung, an neue Wirtschaftsräume und am allerwenigsten an neue Felder gewöhnen. Und wieder tat er den bedeutsamen Ausspruch: »A alter Kater geht nich weg vom Hofe« – und blieb Schaffer auf dem Buchenhofe, wo er sein Leben lang gehaust hatte. Abends nur ging er manchmal nach dem Kretscham und ließ seinen Sohn »etwas verdienen«.
Dann sah er mit Stolz, wie Hannes den Wirt spielte und mehr redete als alle seine Gäste zusammen. Am allerschönsten war's immer, wenn Hannes von Breslau erzählte, von der herrlichen Soldatenzeit und von seinen zahlreichen anderen Besuchen in der Hauptstadt, da Heinrich als verheirateter Student mit der Lotte dort gewohnt hatte. Und wenn der Schaffer den Sohn also seine schöne Redegabe entfalten sah, ging ihm das Herz auf, und er selbst war ganz schweigsam gegenüber solchen Talenten.
Der junge Doktor näherte sich den Buchenhöfen. Hannes' zahlreiche Nachkommenschaft spielte auf der Straße, und auch sein eigenes, dreijähriges Söhnchen war dabei. Sein Einziger! Der Knabe lief ihm jauchzend entgegen, und er hob ihn zärtlich auf den Arm.
Der alte Mathias guckte durchs Kretschamfenster. Er war abwechselnd bald hier, bald dort, wo er eben gebraucht[324] wurde. Sein Liebling unter allen aber war immer noch der Heinrich. Alle Jahre vor der Ernte besuchte Mathias einmal bei den Grauen Schwestern seine Liese, und alle Jahre zu Weihnachten bekam er einen Brief von ihr. Und ob er selbst alt wurde, er war hinaus über alle Bitterkeit und zufrieden mit der Art, in der sich die Schicksale um ihn her erfüllt hatten.
Jetzt glänzten seine guten Augen, als er den Heinrich sah.
»Ich bin wieder amal Vize-Gastwirt,« schmunzelte er.
»Ja, ich hab's schon gehört, daß Ihr den Hannes rausgegrault habt.«
»Das nich! Aber 's is ganz gutt so! Wenn a den ganzen Tag und a ganzen Abend hier sitzt, red't a sich kaputt! Lange wird a ja nich draußen sein. Dann komm' ich zu Euch rüber.«
»Schön, Mathias. Komme nicht zu spät!«
Frau Lotte erschien drüben im Buchenhofe in der Haustür, und Heinrich ging mit dem Knaben hinüber und reichte seinem strahlenden, jungen Weibe die Hand. Ein Schwarm Wandervögel zog rauschend über sie hinweg, weit in die Fremde.
»Siehst Du die Vögel? Nun wird es bald Winter werden.«
»Ich freu' mich auf den Winter,« sagte sie schlicht.
Sie verstanden sich. Ein freundliches, liebes Haus hat bunte Zauberfenster. Ewig malt sich durch sie die Welt draußen goldig und schön, ob der Regen rinnt oder die Sonne lacht; im Herbst und Winter sieht das Auge nichts Trübes durch seine magischen Scheiben.
Er zog sie an der Hand heraus in den Hof. Das Wohnhaus hatte einen neuen Anstrich bekommen, und über der Tür war eine Tafel in die Wand eingelassen worden, die noch auf eine Inschrift harrte.
Heinrich wies auf die Tafel und sagte:
»Weißt Du, was ich da eingraben lasse?«
Sie sah ihn fragend an, und er schaute ihr ernst, aber mit tiefer Liebe in die schönen Augen und sagte langsam und mit jener leisen Feierlichkeit, mit der man eine schwer gewonnene Lebensweisheit ausspricht:
»Heimat ist Friede!«
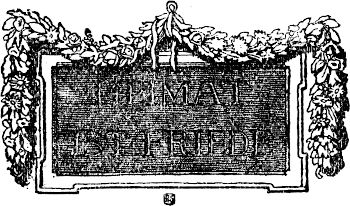
Der Künstler soll seine Kunst rein halten wie der Geistliche seine Kirche, der Lehrer seine Schule, sonst begeht auch er »ein Verbrechen im Amt«.
Aus Paul Keller »Hubertus«.
Paul-Keller-Bücher
In fremden Spiegeln Roman
Hubertus Ein Waldroman
Ferien vom Ich Roman
Das letzte Märchen Ein Idyll
Die alte Krone Roman aus dem Wendenlande
Die Insel der Einsamen Eine romantische Geschichte
Der Sohn der Hagar Roman mit dem Bilde des Verfassers
| Waldwinter | } | Romane aus den schlesischen Bergen |
| Die Heimat |
Altenroda Bergstadtgeschichten. 31.–52. Aufl. gebunden
Die fünf Waldstädte Ein Buch für Menschen, die jung sind. Mit Bildern. Gebunden
Stille Straßen Ein Buch von kleinen Leuten und großen Dingen. Mit Bildern. Gebunden
Das Kgl. Seminartheater Ein Stück eigener Lebensgeschichte und andere Erzählungen. Gebunden
Von Hause Ein Päckchen Humor aus den Werken von Paul Keller. Gebunden
Bisheriger Absatz all. Paul-Keller-Bücher rund zwei Millionen
Bergstadtverlag in Breslau 1.
Nanni Gschaftlhuber
Ein Wiener Roman
von Anna Hilaria von Eckhel
6.–10. Auflage gebunden.
… Wer recht von Herzen lachen will und zugleich innere Erhebung sucht, der lese diese Nanni Gschaftlhuber.
Alice Freiin von Gaudy.
… Wer eine so köstliche Figur zu schaffen gewußt hat, wie diese Nanni Gschaftlhuber, die alles im Schnellzugstempo erledigt, die das Mundwerk und das Herz auf dem rechten Fleck hat, die auf dem Sterbebette die Schrecken des Todes über der Liebe des Lebens vergißt, wer das Wiener Kleinbürgertum mit soviel Humor so anschaulich und liebevoll zu schildern weiß, ohne je trivial zu werden, von dem kann man noch Schönes erwarten.
»Was man wissen muß.«
Benedikt Patzenberger
Aus der Komödie seines Lebens von Roland Betsch.
6.–10. Auflage gebunden.
… Der Leser wird den Eindruck eines echten Kunstwerkes empfangen. Kein Dichter und Phantast hat je in seinen kühnsten und sternenfernsten Träumen das Leben übertroffen und die Ereignisse verwickelter und einfacher gestalten können.
Blätter für Volksbildung, Lesehallen.
… Hier ist ein deutsches, ein fröhliches und ein künstlerisch wertvolles Buch! …
K. von Perfall in der Kölnischen Zeitung
… Ein Werk voll des sprühendsten Witzes …
Volkslesehalle, Wien.
Zwischen Wellen u. Steinen
Novellen von Anna Hilaria von Eckhel.
1.–6. Auflage gebunden.
Triest, der Karst und das nahe Küstenland bilden den Schauplatz von fünf zu einem Ganzen vereinigten Novellen. Ihnen ist eine kurze poesievolle Widmung vorangestellt, die mit den Versen beginnt:
und mit jeder weiteren Zeile deutlich macht, mit welch großer Liebe Anna Hilaria an ihrer Heimat hängt. Ihr sind die Stoffe zu den Erzählungen entlehnt. In jeder ist ein tiefernstes Problem in herzbewegender Weise gelöst …
Wiener Zeitung.
… Die Handlung ist immer spannend, so daß sie den Leser zum seelisch bewegten Miterleben fortreißt …
Bayrischer Kurier.
Die Eine Liebe
von Annie Herzog.
Geschichten vom Haus am Rhein
1.–3. Auflage.
… Schlicht in der Form sind diese Erzählungen, aber durchglüht vom brausenden Strom des Blutes, auch die sanfte Heiterkeit fehlt nicht darin …
Hamburger Nachrichten.
Eine frische echte Heimatgabe! Frisch in Formen und Farben! In »Semele« erzählt die Verfasserin in stiller versonnener Dämmerstunde die keusch selige und unselige Studentenliebe, die Züricher Universität, das Restaurant »Rigiblick«, der Zürichberg erhält Leben und Seele. Plastisch wie aus Marmor und lebenswahr und -warm ist die Gestalt der Großtante am Rhein, skizzenhaft umrissen ihr Häuschen; durch sie, wie durch »Fräulein Doktor«, die »Stille Geschichte« geht die eine Liebe, die Frauenliebe, die in Sturm und Stille treu bleibt – zum Tode, nein: über das Grab hinaus.
Illustr. Schweizer Hausztg.
Bergstadtverlag in Breslau 1
Weitere Anmerkungen zur Transkription
Offensichtliche Fehler wurden stillschweigend korrigiert. Die Darstellung der Ellipsen wurde vereinheitlicht. Der Schmutztitel wurde entfernt. Zur besseren Navigation wurden unsichtbare Kapitelüberschriften ergänzt.
Korrekturen:
S. 65: s eh → seh
Na, seh och, was a für graue Haare gekriegt hat