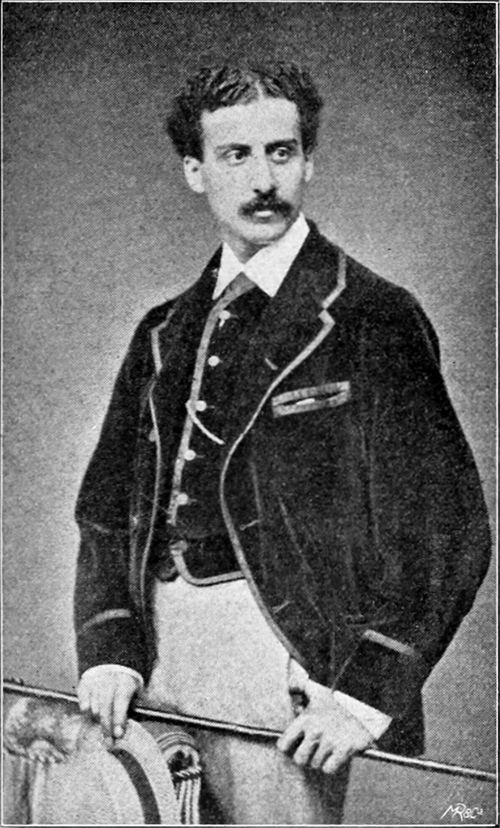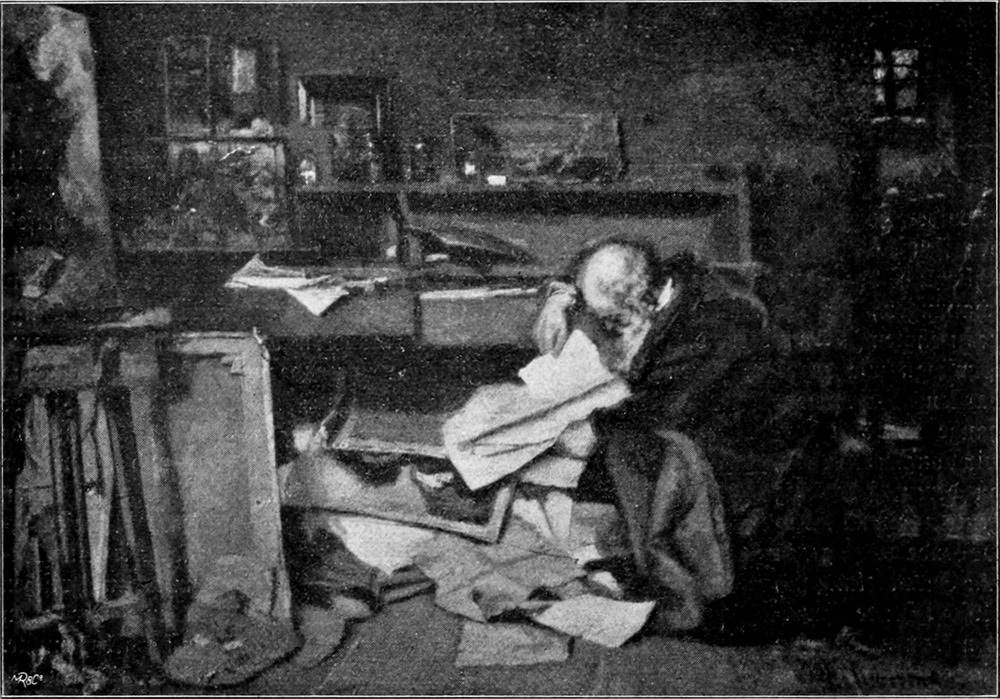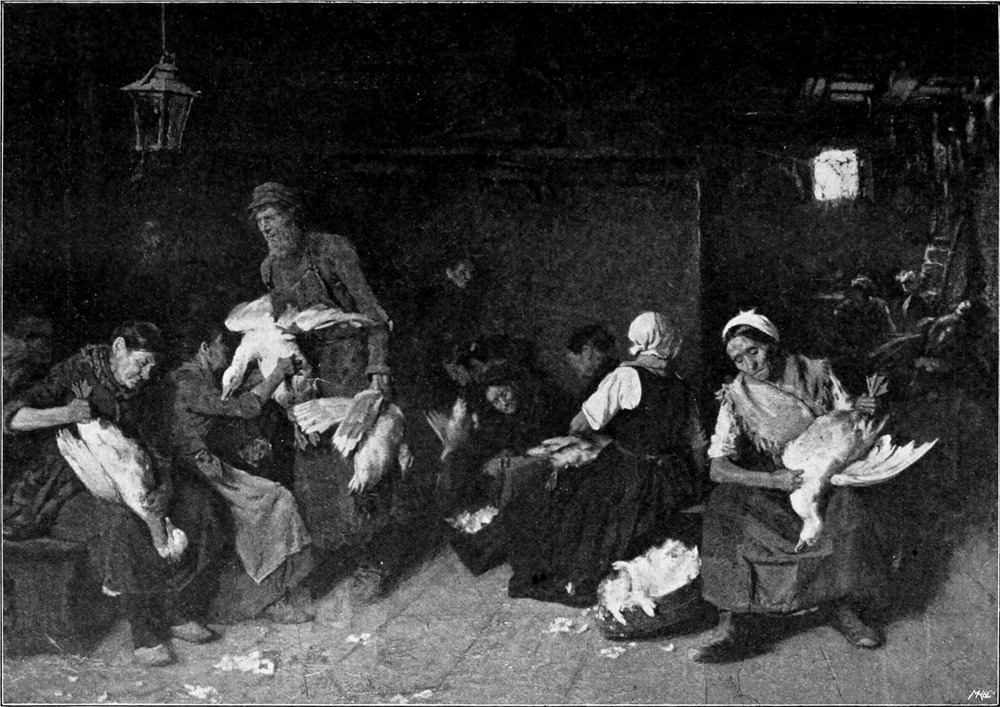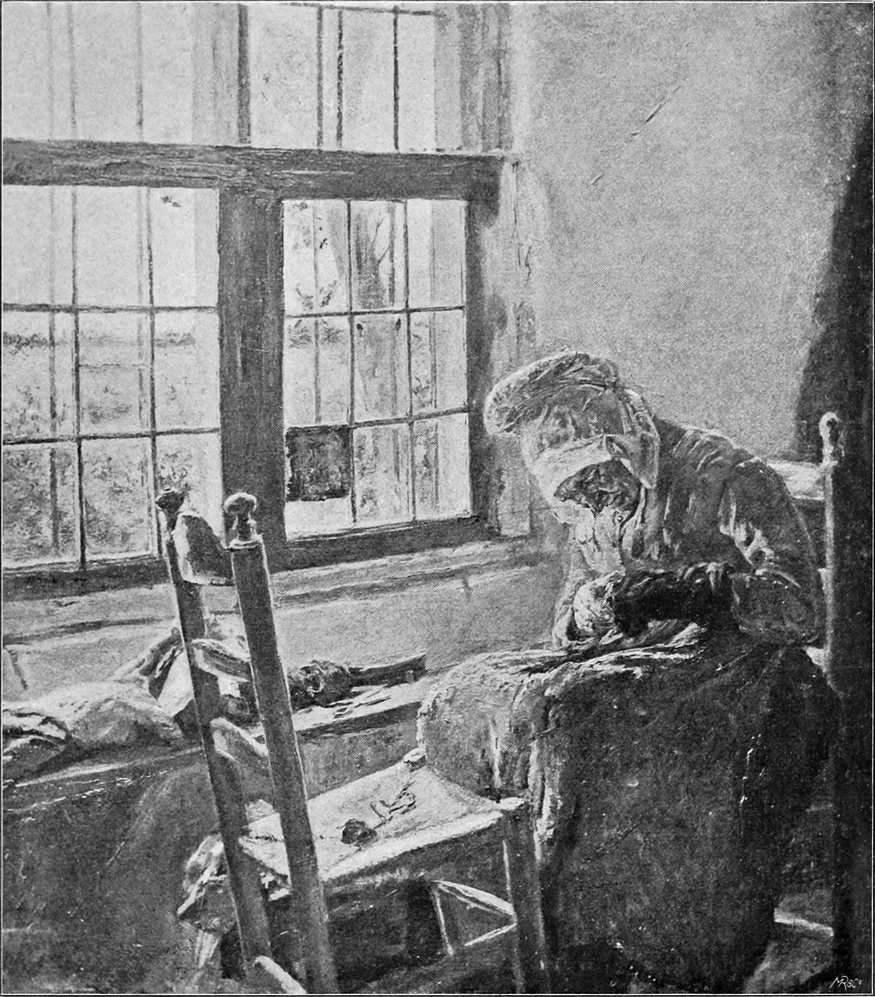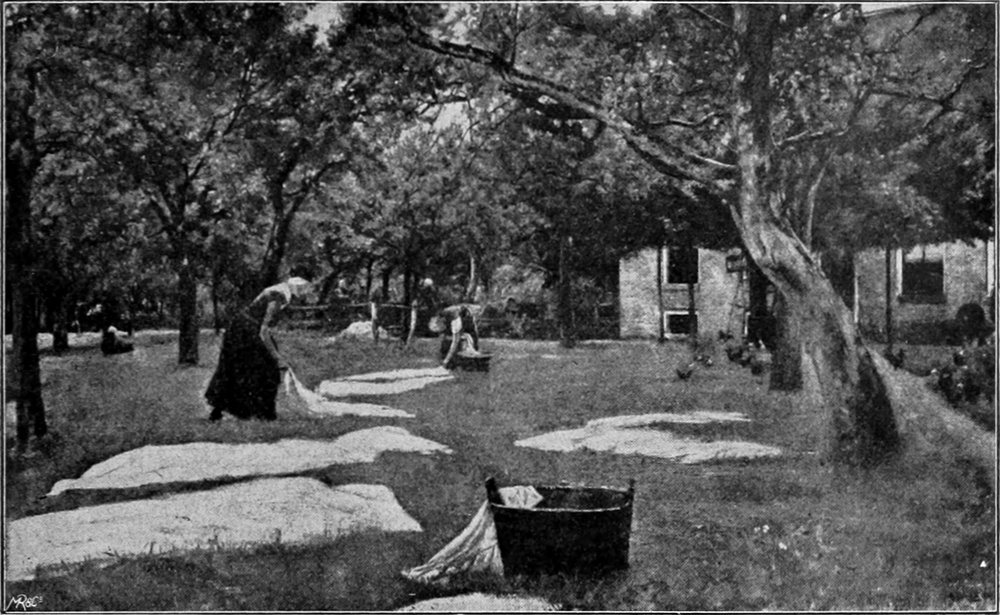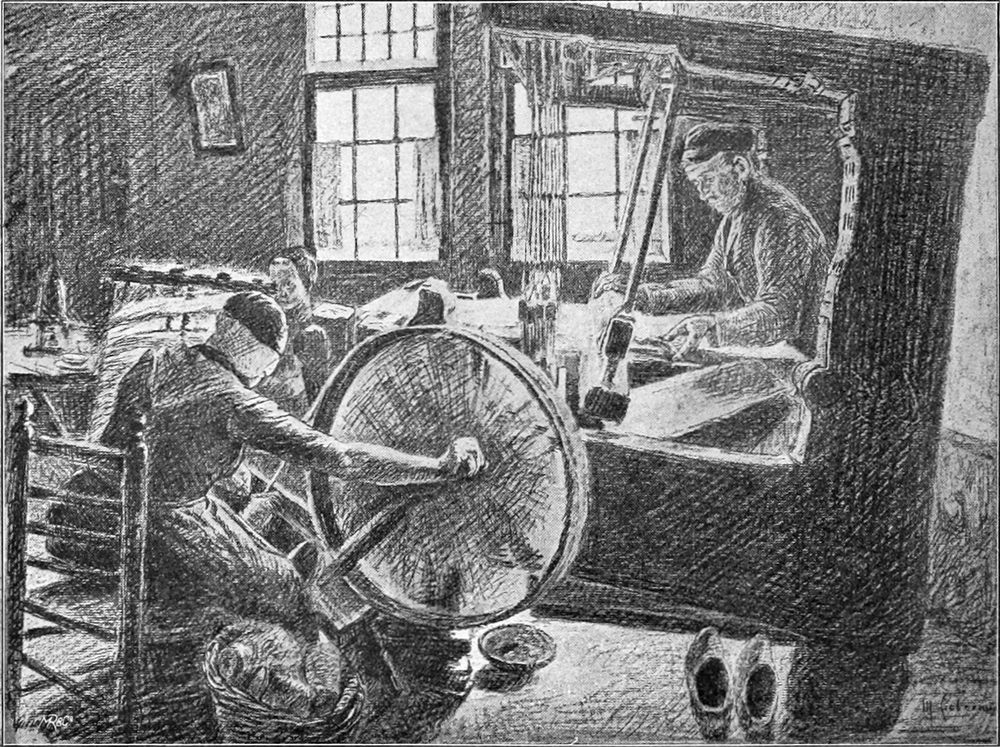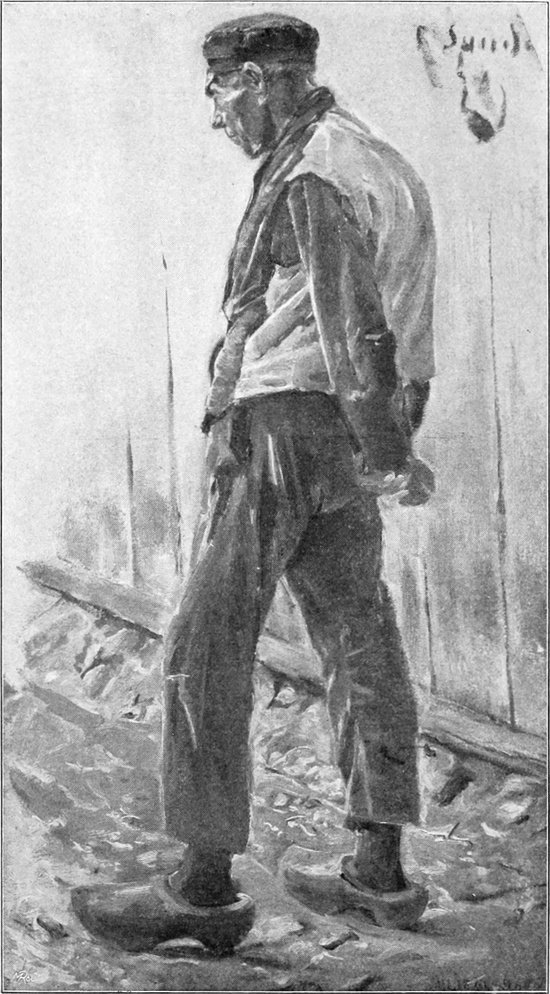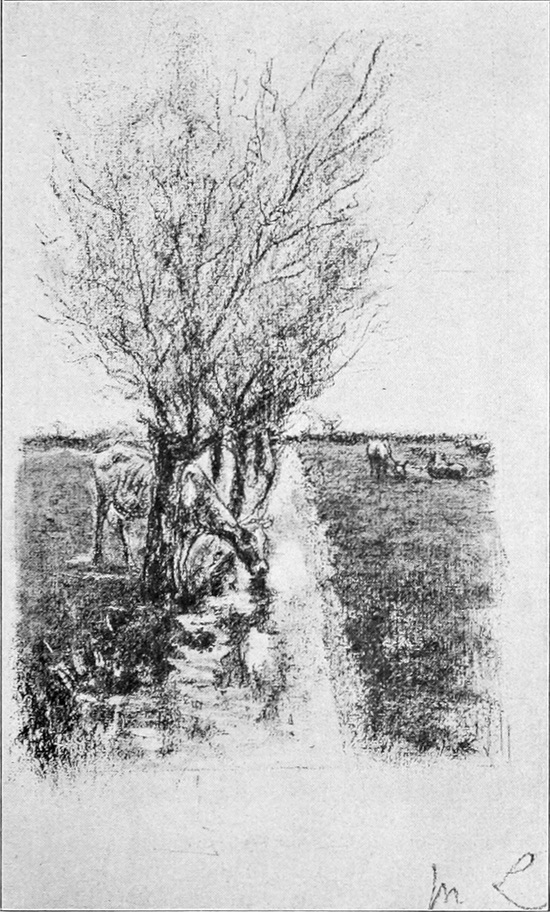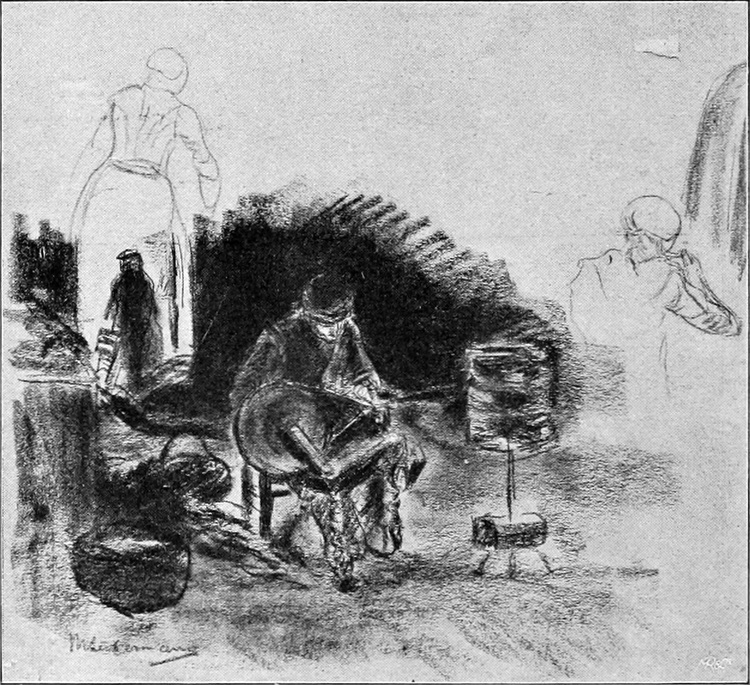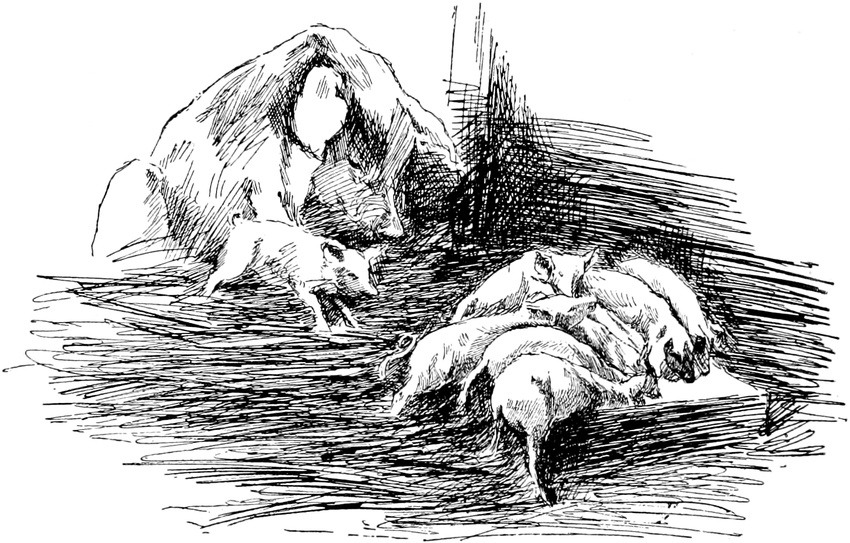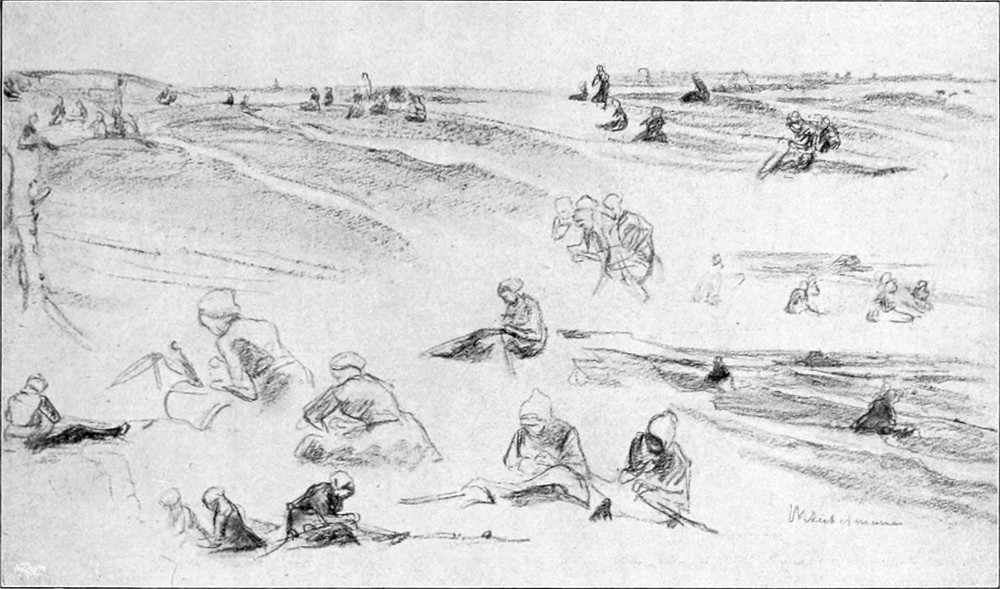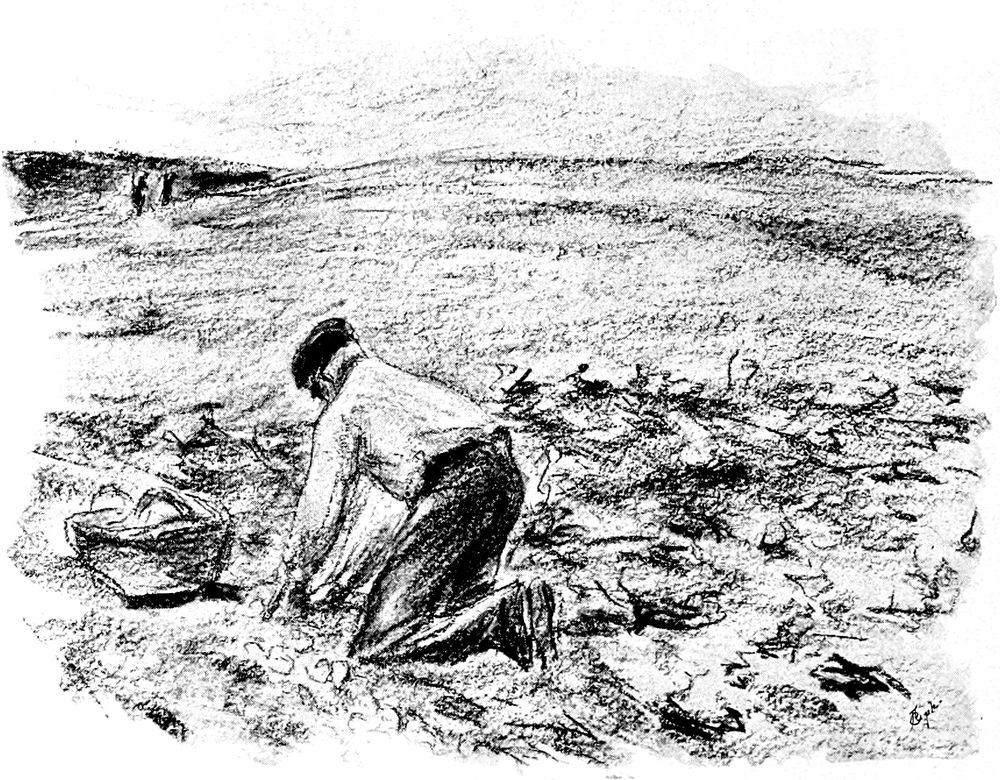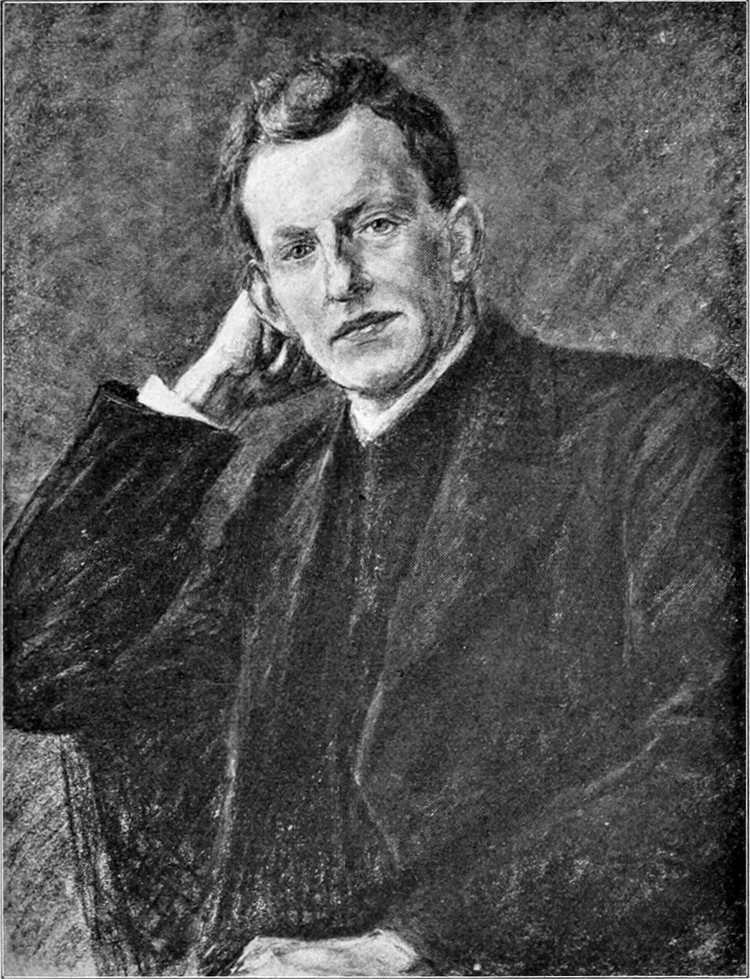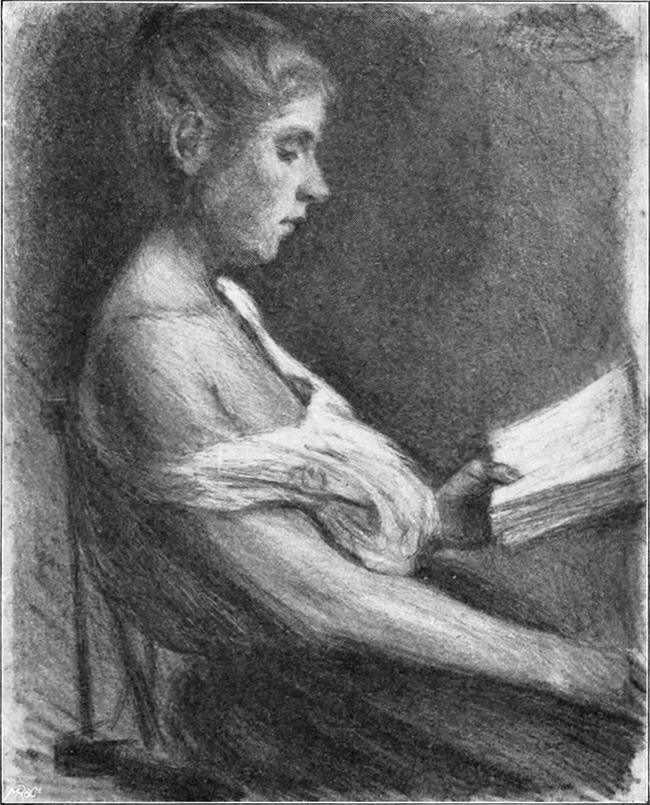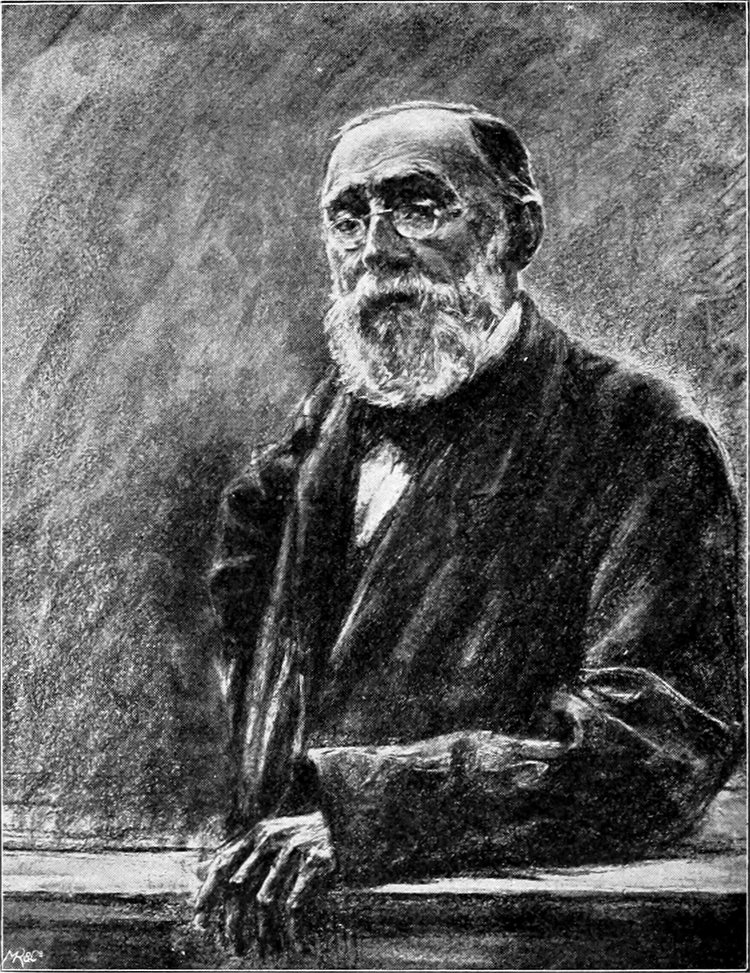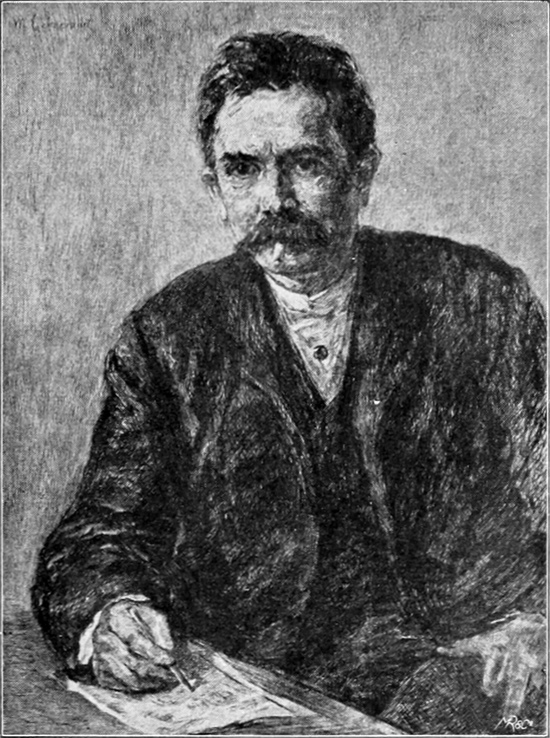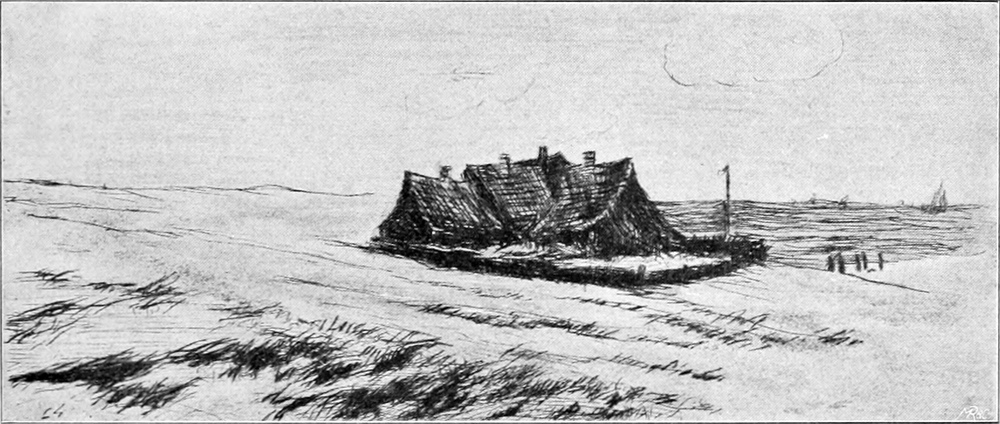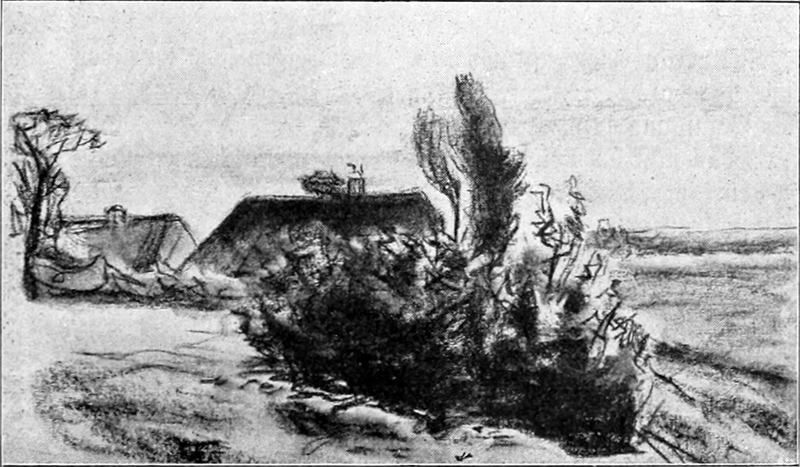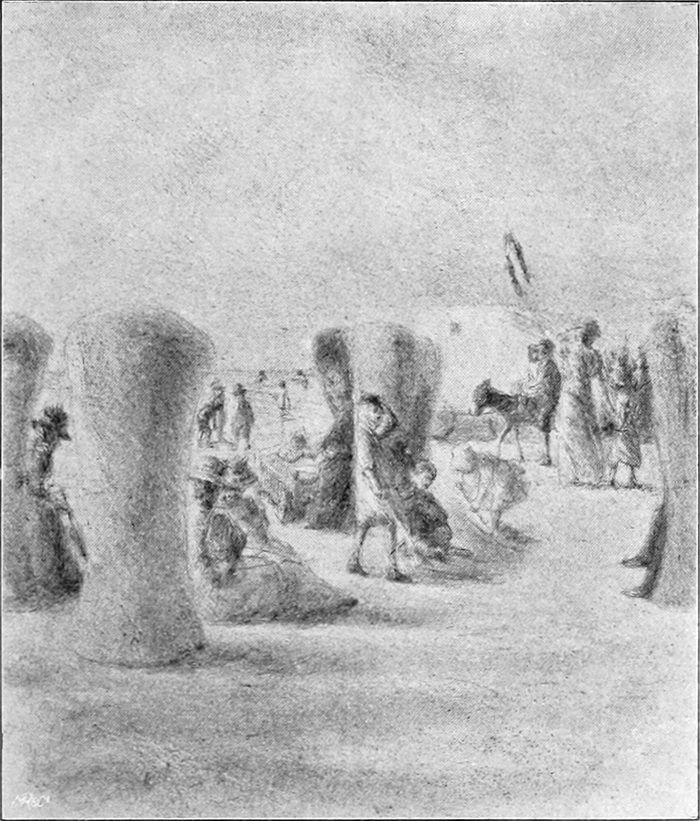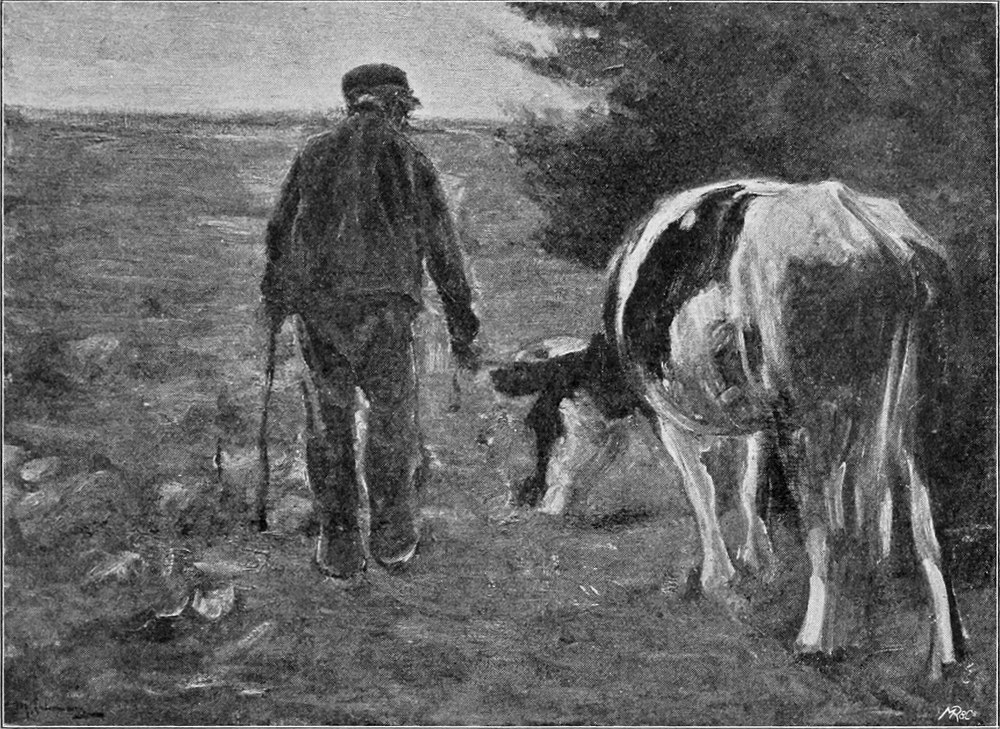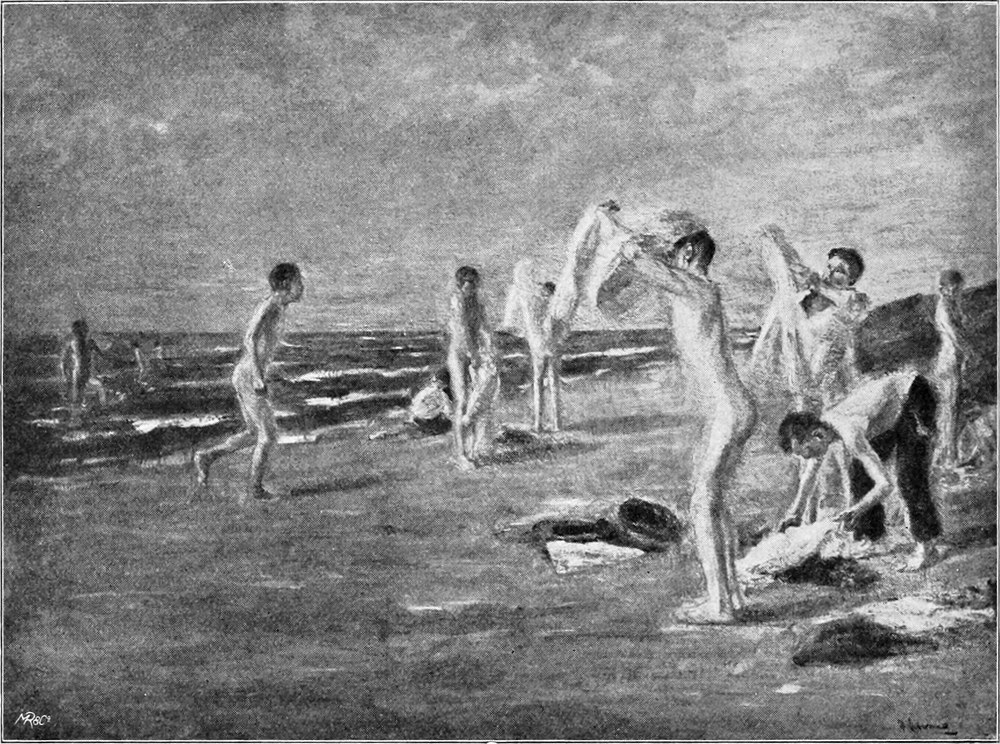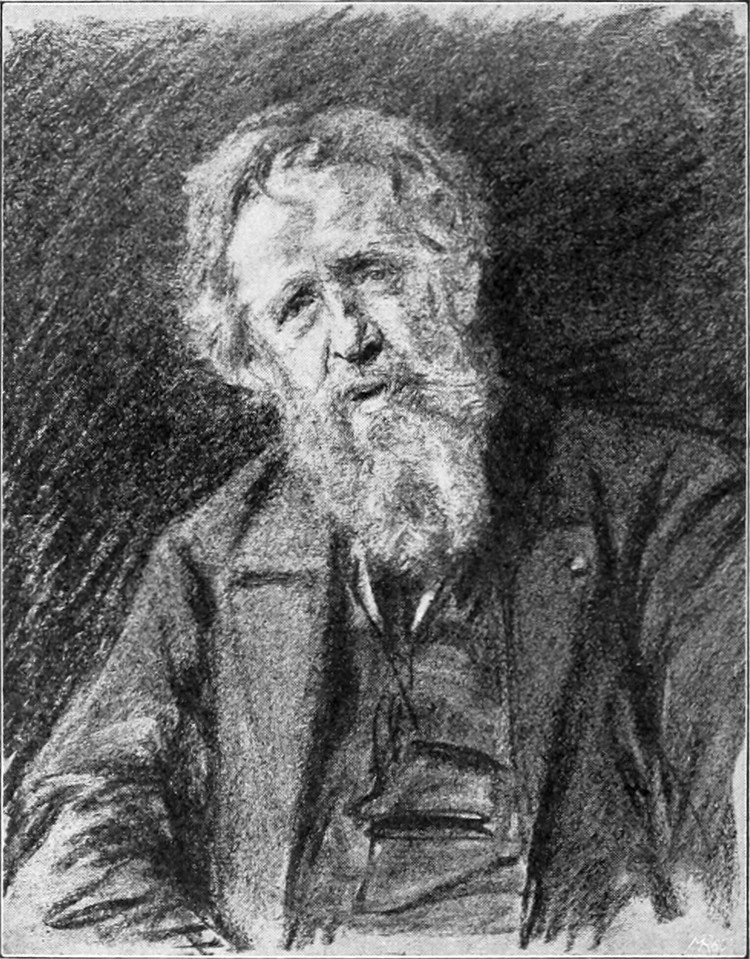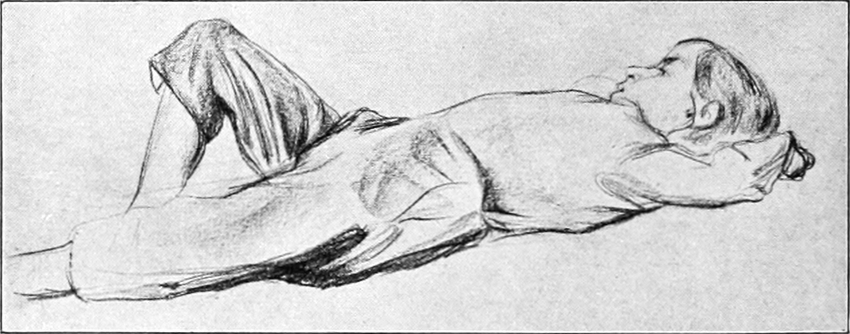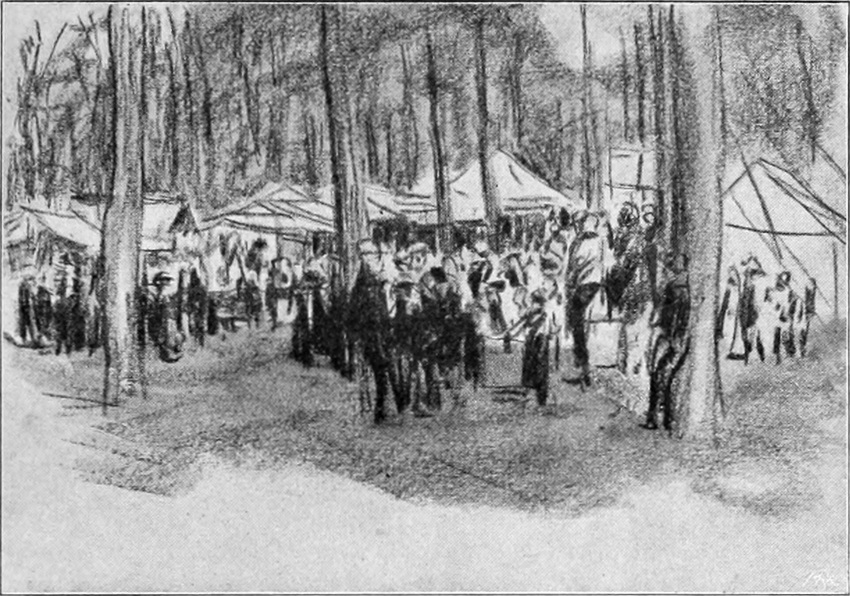The Project Gutenberg eBook of Liebermann, by Hans Rosenhagen
This eBook is for the use of anyone anywhere in the United States and
most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions
whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms
of the Project Gutenberg License included with this eBook or online
at
www.gutenberg.org. If you
are not located in the United States, you will have to check the laws of the
country where you are located before using this eBook.
Title: Liebermann
Author: Hans Rosenhagen
Editor: Hermann Knackfuß
Release Date: January 23, 2021 [eBook #64375]
Language: German
Character set encoding: UTF-8
Produced by: Peter Becker, Reiner Ruf, and the Online Distributed Proofreading Team at https://www.pgdp.net (This file was produced from images generously made available by The Internet Archive)
*** START OF THE PROJECT GUTENBERG EBOOK LIEBERMANN ***
Anmerkungen zur Transkription
Der vorliegende Text wurde anhand der 1900 erschienenen
Buchausgabe so weit wie möglich originalgetreu wiedergegeben.
Typographische Fehler wurden stillschweigend korrigiert. Ungewöhnliche
und altertümliche Schreibweisen bleiben gegenüber dem Original
unverändert; fremdsprachliche Zitate wurden nicht korrigiert.
Einige Abbildungen wurden zwischen die Absätze
verschoben und zum Teil sinngemäß gruppiert, um den Textfluss nicht zu
beeinträchtigen.
Das Original wurde in Frakturschrift gesetzt. Passagen
in Antiquaschrift werden im vorliegenden
Text kursiv dargestellt. Abhängig von der im
jeweiligen Lesegerät installierten Schriftart können die im Original
gesperrt gedruckten Passagen gesperrt, in
serifenloser Schrift, oder aber sowohl serifenlos als auch gesperrt
erscheinen.
Liebhaber-Ausgaben
Künstler-Monographien
In Verbindung mit Andern herausgegeben
von
H. Knackfuß
XLV
Liebermann
Bielefeld und Leipzig
Verlag von Velhagen & Klasing
1900
Liebermann
Von
Hans Rosenhagen
Mit 115 Abbildungen nach Gemälden und Zeichnungen
Bielefeld und Leipzig
Verlag von Velhagen & Klasing
1900
Von diesem Werke ist für Liebhaber und Freunde besonders luxuriös
ausgestatteter Bücher außer der vorliegenden Ausgabe
eine numerierte Ausgabe
veranstaltet, von der nur 50 Exemplare auf Extra-Kunstdruckpapier
hergestellt sind. Jedes Exemplar ist in der Presse sorgfältig numeriert
(von 1–50) und in einen reichen Ganzlederband gebunden. Der Preis
eines solchen Exemplars beträgt 20 M. Ein Nachdruck der numerierten Ausgabe, auf
welche jede Buchhandlung Bestellungen annimmt, wird nicht veranstaltet.
Die Verlagshandlung.
Druck von Fischer & Wittig in Leipzig.

Max Liebermann.
(Nach einer Aufnahme der Hofphotographen Reichard &
Lindner in Berlin.)
GRÖSSERES BILD
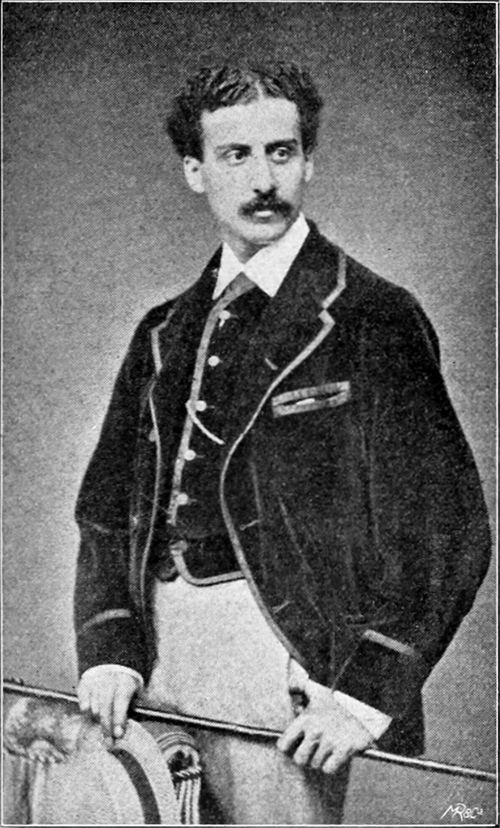
Max Liebermann als Fünfundzwanzigjähriger
in Weimar. Weimar 1872.

Die aufregendsten Begebenheiten in der Kunstgeschichte der letzten
dreißig Jahre, die widerspruchsvollsten Äußerungen der Zeitgenossen
über Künstler und Kunstwerke und schließlich der entscheidende Sieg
von Anschauungen, die der Kunst am Ende des neunzehnten Jahrhunderts
die charakteristische Physiognomie gegeben, stehen im unmittelbarsten
Zusammenhange mit dem Dasein von zwei Malern, an deren Bedeutung heute
nur noch Übelwollende oder gegen alle Entwickelung sich Abschließende
zweifeln können. Der eine dieser Maler ist Edouard Manet,
der andere Max Liebermann. Beide haben der Kunst neue Ziele
gesetzt, und wenn es auch bei Manet wahrscheinlich und bei Liebermann
gewiß ist, daß Andere vor ihnen Gleiches gewollt und dafür gekämpft
haben, so waren sie doch die ersten großen Künstler, die die latent
gebliebenen Ideen in vollkommenen Kunstwerken zusammenfaßten und damit
die Aufmerksamkeit der Mitwelt auf sie hinlenkten. Und darauf ist es
in der Kunst immer angekommen. Unzweifelhaft ist Manet der Kühnere
von beiden; aber darin begegnet er sich mit Liebermann, daß er nicht
in der Darstellung der Dinge an sich, sondern in der Schilderung
ihrer Zustände unter der Wirkung von Luft und Licht die zu lösende
künstlerische Aufgabe sah und so wieder zur Malerei kam, woraus sich
mit Notwendigkeit ein Zusammenhang zwischen ihm und der alten Kunst
ergeben mußte. Und auch darin besteht eine Gemeinsamkeit zwischen
beiden Künstlern, daß sie alle Bitternisse des Verkanntseins in ihren
Absichten, alle Beschimpfungen der Menge und die volle Verachtung der
in ihrem Schlummer gestörten Ästhetik kosten mußten. Manet hat leider
nicht mehr das Glück erlebt, die ungeheure Wirkung seines Beispieles
zu sehen; aber Liebermann wandelt noch[S. 4] in ungebrochener Kraft unter
uns und behauptet seine künstlerische Stellung mit einer Energie und
einem Erfolge, die nur den heroischen Erscheinungen der Kunstgeschichte
beschieden sind.
Fast alle diejenigen, die über Manet und Liebermann geschrieben,
haben — der Eine mehr, der Andere weniger — ihren Äußerungen den
Charakter von Verteidigungsschriften geben müssen, vor allem waren sie
genötigt, ihre Helden gegen den Vorwurf, die Gefühle des Publikums
durch die gewählten Stoffe verletzen zu wollen, in Schutz zu nehmen.
Das ist bezeichnend genug für die Art des Widerspruches, mit dem die
Allgemeinheit den Künstlern begegnete, die, wie jetzt feststeht, eine
neue Schönheit aus der Natur herausgesehen. Allerdings war der Abstand
von der neuen Schönheit, die jene beiden Künstler brachten, zu der, die
alle Welt anerkannte, noch niemals so groß gewesen. Man empfand das
Neue als eine Beleidigung und verhielt sich danach. Man sah das Wahre
in den Bildern Manets und Liebermanns für ein bewußtes Herauskehren
und Betonen des Häßlichen an, gegen das man sich wehren müsse um jeden
Preis. Die schwersten Geschütze aus dem Arsenal der Ästhetik donnerten
Vernichtung gegen die Frevler an den heiligsten Gütern der Menschheit.
Und doch war im Grunde weiter nichts geschehen, als daß ein paar Maler
das innerliche Bedürfnis gefühlt hatten, die Welt, wie sie war, zu
sehen und darzustellen, also soweit als möglich, objektiv zu
sein.
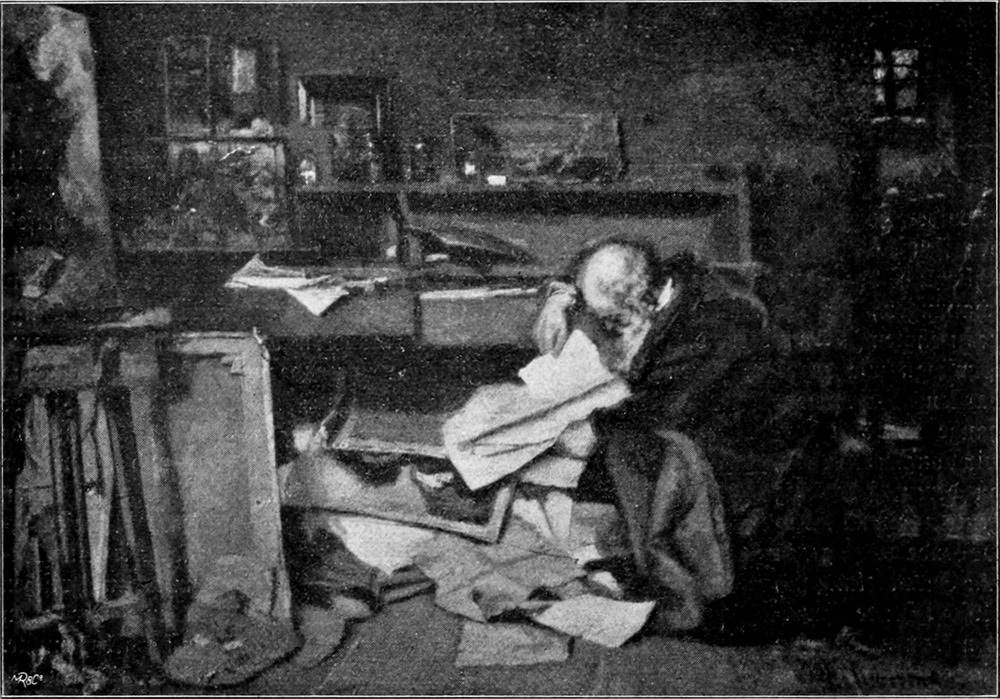
Abb. 1. Im Atelier (1872). Im
Privatbesitz in Berlin.
Es ist sehr fraglich, ob das Ach- und Wehgeschrei, das sich Ende
der siebziger Jahre des neunzehnten Jahrhunderts über die Verrohung
der Künstler in Deutschland zu erheben begann, verstummt wäre,
wenn man das Zeugnis Goethes dafür beigebracht hätte, daß dieser
verachtete Naturalismus die Morgenröte einer vorschreitenden Epoche
in der Kunst bedeute. Höchst wahrscheinlich würde man seinen von der
allertiefsten Einsicht in das Wesen der Kunst zeugenden Ausspruch:
„Alle im Rückschreiten und in der Auflösung begriffenen Epochen sind
subjektiv, dagegen aber haben alle vorschreitenden Epochen eine
objektive Richtung. — Jedes tüchtige Bestreben wendet sich aus[S. 5] dem
Inneren hinaus auf die Welt, wie man an allen großen Epochen sieht,
die wirklich im Streben und Vorschreiten und alle objektiver Natur
waren“ dahin ausgelegt haben, daß die Subjektivität auf seiten der
frechen Neuerer, und in ihren Werken der Niedergang der Kunst offenbar
sei. Aber es ist wohl überhaupt eine Schwäche der menschlichen Natur,
Subjektives und Objektives miteinander zu verwechseln. Eins ist
sicher: Niemals hat sensationslosere Kunst mehr Sensation gemacht als
in den Bildern[S. 6] Manets und Liebermanns, und wenn man heute von diesem
Sensationellen, das man einst den Werken dieser Künstler nachsagte,
nichts mehr bemerkt, so liegt darin schon eine Anerkennung ihrer
Bedeutung. Denn nicht sie haben sich geändert, sondern die ganze Kunst
hat getrachtet, ihnen ähnlich zu werden, ist ihnen nachgewachsen, so
daß kein äußerlicher Gegensatz mehr besteht.
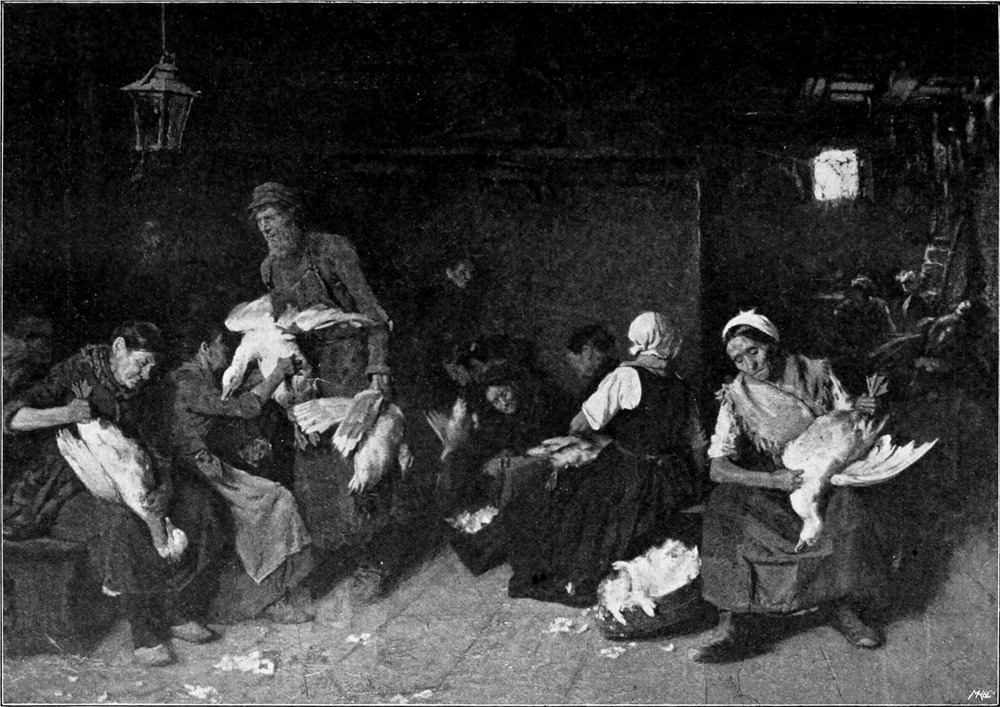
Abb. 2. Die Gänserupferinnen (1873).
In der königl. Nationalgalerie zu Berlin.
GRÖSSERES BILD

Abb. 3. Die Konservenmacherinnen
(1873). In Berliner Privatbesitz.
GRÖSSERES BILD
**
*
Um die kunstgeschichtliche Stellung eines Künstlers zu präzisieren und
ihm zugleich als Persönlichkeit gerecht zu werden, ist zweierlei nötig:
Nachzuweisen, was ihn mit der Vergangenheit verbindet und klarzulegen,
durch welches Neue er sich von ihr unterscheidet. Ehe jedoch die
künstlerische Thätigkeit Liebermanns eine Untersuchung in diesem Sinne
erfährt, dürfte es, um durch Wiederholungen von Thatsachen nicht zu
häufig aufgehalten zu werden, angebracht sein, über[S. 7] sein Leben und
seine Thätigkeit kurz zu berichten.

Abb. 4. Der Witwer (1873). Im
Besitz des Herrn Geheimen Kommerzienrat Spindler zu Berlin.

Abb. 5. Die Invaliden im Lotsenhause
(1874).
(Mit Erlaubnis der Herren Bruno und Paul Cassirer zu Berlin.)
Max Liebermann ist ein Berliner Kind. Er wurde am 20. Juli 1847[1]
als Sohn eines wohlhabenden Fabrikanten geboren, verlebte in dem
behaglichen Heim seiner Eltern eine glückliche Jugend und bezog
nach auf einem Gymnasium absolvierter Schulzeit 1868 die Berliner
Universität, wo er sich in die philosophische Fakultät inskribieren
ließ; freilich ganz gegen seine Neigung und nur, um ein Zerwürfnis
mit seinem Vater zu vermeiden, der von dem Wunsche des Sohnes, Maler
zu werden, durchaus nichts hören wollte. Aber anstatt sich mit den
Ideen Schellings und Hegels bekannt zu machen, zog es der junge
Liebermann vor, heimlich die Akademie zu besuchen und sich von Karl
Steffeck in der Kunst des Malens unterrichten zu lassen. Er malte
und zeichnete in dessen Atelier Menschen, Pferde, Hunde und war nach
einem Jahre[S. 8] so weit vorgeschritten, daß er an Steffecks großem Bilde
„Sadowa“ mitmalen durfte. Aber obgleich sich der Lehrer von seinen
Leistungen für befriedigt erklärte — Liebermann selbst fühlte die
Unzulänglichkeit seiner Ausbildung zu lebhaft, als daß er Genüge an
seinen Schülererfolgen gefunden hätte. Mit Einwilligung seines Vaters,
der sich am Ende doch entschlossen hatte, der Neigung des Sohnes
freien Lauf zu lassen, ging er nach anderthalbjährigem Studium bei
Steffeck im Jahre 1869 nach Weimar. Es war nicht Sympathie für den
dort noch vorhandenen Überrest von klassizistischer Kunst, die den
jungen Künstler dorthin führte. Aber in der Stadt Goethes wirkte als
Lehrer an der Kunstschule der Belgier Ferdinand Pauwels (geb.
1830), der als Schüler Wappers den glänzenden malerischen Stil und den
Realismus der belgischen Historienmalerei mitgebracht hatte. Liebermann
ging nun systematisch zu Werke; er zeichnete bei Thumann fleißig nach
Gips und malte bei Pauwels; jedoch seine Versuche, Bilder in der Art
seiner Lehrer zu malen, schlugen durchaus fehl. Da brachte ihn der
Zufall auf einen Weg, der künftig sein Weg werden sollte.
Nach einer glücklich überstandenen Krankheit spazierte er an einem
Sommermorgen vor den Thoren Weimars. Auf einem Felde, an dem sein Weg
vorüberführte, sah er einen Bauer mit seinen Leuten arbeiten, und wie
er gern erzählt, ist ihm beim Anblick dieser fleißigen Menschen zuerst
der Gedanke gekommen: Das mußt du malen,[S. 9] genau so, wie es ist. Wenn
es nun auch nicht sofort dazu kam, so war sich der junge Maler doch
darüber klar geworden, was ihn künstlerisch zu reizen vermochte. 1873
entstand Liebermanns erstes größeres Bild „Die Gänserupferinnen“,
jetzt im Besitze der Berliner Nationalgalerie. Als Malerei, trotz dem
von Munkaczy übernommenen schwärzlichen Kolorit, ziemlich akademisch,
erregte es durch seinen Inhalt überall den heftigsten Anstoß. Man
fand es unerhört, dem Publikum den Anblick eines so gewöhnlichen
Schauspieles zu bieten: Alte häßliche Weiber in einer schwärzlichen
Scheune bei einer zwar nützlichen, aber doch eigentlich gemeinen
Arbeit. Indessen das Bild machte, wo es auch gezeigt wurde — in
Weimar, Hamburg und Berlin — Aufsehen und fand schließlich, obwohl
sich die gesamte Kritik gegen den „Rhyparographen“, den „Apostel der
Häßlichkeit“ Liebermann aussprach, seinen Käufer. Das erhaltene Geld
benutzte der ermutigte Künstler zu einer Reise nach Paris, wo er sich
sogleich mit Munkaczy, den er in jener Zeit besonders lebhaft verehrte,
in Verbindung setzte. Ein Abstecher nach Holland ließ ihn das Motiv zu
den „Konservenmacherinnen“ finden, die er, nach dem kurzen Ausfluge
nach Weimar zurückgekehrt, sofort in Angriff nahm.

Abb. 6. Bauernhof (1875). Im
Privatbesitz in Paris.
In Weimar wirkte seit 1872 neben Pauwels noch ein zweiter Belgier an
der Kunstschule: der unter dem Einflusse Courbets stehende Charles
Verlat. Seine fabelhafte Routine im Malen, seine frische Art, die Natur
anzupacken, waren nicht ohne Eindruck auf Liebermann geblieben und
übten schon in dem neuen Bilde ihre Wirkung aus. Verlat war es, der
dem jungen Künstler den Rat gab, die „Konservenmacherinnen“ nicht in
Deutschland auszustellen, sondern auf die in Antwerpen im Sommer 1873
stattfindende Ausstellung zu schicken. Ein neuer Erfolg! Das Bild wurde
nicht allein verkauft, sondern mehrfach nachbestellt. Französische
und belgische Kunsthändler machten dem Berliner Maler Anerbietungen,
und[S. 10] der junge Künstler, dem das Ausland so viel mehr Verständnis und
Sympathien entgegenbrachte als sein Vaterland, entschloß sich kurzer
Hand, dauernden Aufenthalt in Frankreich zu nehmen. Im Dezember 1873
siedelte Liebermann nach Paris über.

Abb. 7. Arbeiter im Rübenfelde
(1876). Im Privatbesitz in Berlin.
GRÖSSERES BILD
Es gehörte damals einiger Mut dazu, sich als Deutscher nach Frankreich
zu wagen. Der Chauvinismus stand in üppigster Blüte, jeder Deutsche
wurde beargwöhnt. Liebermann jedoch blieb unangefochten. Munkaczy
und sein Talent hatten ihn empfohlen. Außerdem arbeitete er fleißig.
Die Werke der Troyon, Daubigny, Corot und vor allem die Bauernbilder
Millets, die er in Paris kennen lernte, machten in ihm den Wunsch
lebendig, auch selbst noch von den Vorteilen der Fontainebleau-Schule
zu profitieren. Im Sommer 1874 zog er nach Barbizon, jenem kleinen,
im Walde von Fontainebleau gelegenen Dörfchen, das durch Rousseau und
Millet für die Kunst des neunzehnten Jahrhunderts so wichtig geworden
ist, wie Weimar für dessen Litteratur. Millet lebte allerdings dort
noch unter den[S. 11] „Bäumen, die untereinander reden“; aber Liebermann
gelang es nicht mehr, mit ihm persönlich in Berührung zu kommen,
zumal Millet bald starb. Um so inniger schloß sich der junge Künstler
geistig an den verehrten Meister an. Seine im Salon 1876 ausgestellten
„Arbeiter im Rübenfelde“ zeugen besser als alle Worte dafür. Aber das
von Millet in die Seele des Berliner Malers gesenkte Samenkorn sollte
erst außerhalb Frankreichs wirklich aufgehen, in Holland.

Abb. 8. Die Geschwister (1876).
Im Privatbesitz in Mainz.
(Nach einer Radierung von Professor Karl Köpping.)

Abb. 9. Die Zimmermannswerkstatt
(1877). Im Privatbesitz in Berlin.
Man führt die Hollandschwärmerei, die die Landschafter der ganzen
Welt seit zwanzig Jahren befallen hat, gern auf ein litterarisches
Ereignis, auf das 1876 erfolgte Erscheinen von Eugène Fromentins
geistvollem Buche „Les maîtres d’autrefois“ zurück, in dem
der berühmte Orientmaler über die während einer Reise in Holland
empfangenen Eindrücke berichtet, und das wegen der feinen Analysen
des technischen und geistigen Inhaltes bedeutsamer Meisterwerke
in der Kunstlitteratur ganz einzig dasteht. Es ist deshalb nötig,
festzustellen, daß Liebermann, der die Aufmerksamkeit der deutschen
Maler auf Holland besonders gelenkt hat, seine Motive von dorther
geholt, ehe Fromentin jenes Signal gab und die Prophezeiung aussprechen
konnte, daß man „de la littéra[S. 12]ture à la nature, de la nature à la
peinture“ kommen werde. Die „Konservenmacherinnen“, die „Invaliden
im Lotsenhause“ und allerlei Studien waren gemalt, ehe Fromentin
seine Reise nach Holland antrat. Aber jenes Land, in dem so vielen
Malern die Augen für malerische Schönheit geöffnet wurden, ist noch
in anderer Beziehung für Liebermann von Bedeutung geworden: er erfuhr
von Franz Hals und Rembrandt, was große Kunst sei, und begann im
Freien zu malen. Paris verlor nach diesen holländischen Studienreisen
für Liebermann mehr und mehr an Interesse, und als im Jahre 1878 die
Eltern seine Rückkehr verlangten, setzte er ihren Wünschen keinen
Widerstand entgegen. Kaum wieder daheim, hatte er das Unglück, auf
der dunklen Treppe zu seinem Atelier auszugleiten und das Bein zu
brechen. Die Heilung nahm mehrere Monate in Anspruch, und schließlich
schickte man den Künstler zur gänzlichen Wiederherstellung nach
Gastein. Die guten Wirkungen des Bades blieben nicht aus, und mit
einer Reise durch Tirol nach Venedig suchte sich der Künstler für die
ausgestandenen Schmerzen zu entschädigen. Zwei Monate lang ließ er
den Zauber Venedigs und seiner Kunst auf sich wirken. Malte er nicht,
so weilte er mit Vorliebe in den Sälen der Akademie, die die figuren-
und wahrheitsreichen Bildercyklen von Gentile Bellini und Carpaccio
enthalten. In Venedig lernte Liebermann mehrere Münchener Künstler,
darunter auch Lenbach, kennen, die ihm die Vorteile, die München
einem Maler von seiner fortschrittlichen Richtung böte, so lebhaft zu
schildern wußten, daß er sich kurzer Hand entschloß, gar nicht erst
wieder nach Berlin zurückzukehren, sondern gleich nach München zu
gehen. Im Dezember 1878 langte er in Bayerns Hauptstadt an und machte
sich sogleich an ein großes Bild, mit dem er die Jahresausstellung von
1879 zu beschicken gedachte. Das Bild wurde vollendet, von der Jury der
Ausstellung mit Ausdrücken der Bewunderung entgegengenommen; aber die
Wirkung, die es im Glaspalast ausübte, äußerte sich doch in sehr viel
anderer Form, als der Künstler erwartet hatte. Das Bild stellte „Jesus
unter den Schriftgelehrten“ dar, in einer den bayerischen Klerus zu
hellen Zornausbrüchen veranlassenden realistischen Auf[S. 13]fassung. Sogar
im bayerischen Landtage kam das Bild zur Besprechung, und statt Ehren
und Ruhm erntete der Maler nur Ärger und Verdruß mit seiner Schöpfung.
Obgleich namhafte Künstler, wie Lenbach, Gedon und Wagmüller, auf
das Wärmste für Liebermann Partei nahmen und die außerordentlichen
künstlerischen Eigenschaften, die der junge Berliner darin gezeigt,
nicht genug zu rühmen wußten — die öffentliche Meinung ließ sich nicht
besänftigen. Liebermann hat nie wieder ein religiöses Bild gemalt.

Abb. 10. Mutter und Kind (1878).
Im Privatbesitz in Hamburg.
Während der Kampf um jenen „Jesus unter den Schriftgelehrten“ noch
tobte, weilte der Künstler schon wieder in Holland, um Stoffe zu neuen
Werken zu sammeln. München hatte zwar den Ruhm, einem bedeutenden
jungen deutschen Maler als Aufenthaltsort zu dienen; aber dieser zog
es nach den gemachten Erfahrungen doch vor, seine Bilder vorerst
nach Paris zu schicken, wo man künstlerische Empfindungen nicht mit
anderen zusammenwarf. Trotz alledem leugnet Liebermann nicht, daß der
Aufenthalt in München, die Anregungen, die sich aus dem Verkehr mit
gleichstrebenden Künstlern dort ergaben, sein Schaffen in günstigster
Weise beeinflußt hätten. Verließen doch in den sechs Jahren, die er
in München weilte, jene Werke sein Atelier, die seinen Ruhm begründet
und zur Verjüngung der deutschen Kunst das Meiste beigetragen haben.
Indessen ist weder München, noch Paris, noch Berlin als Wiege der
charaktervollen Kunst Liebermanns anzusehen, sondern allein Holland.

Abb. 11. Jesus unter den
Schriftgelehrten (1879).
Nach einer Zeichnung in Berliner Privatbesitz.
In Holland fand Liebermann sowohl in der Natur, wie bei den Bewohnern
der Küste das als gegebenen Zustand vor, was ihm bei Millet so
bewunderungswürdig erschienen war: die Einfachheit. Er gehört unter
die Ersten, die ihren Reiz ganz lebhaft empfunden und ihr in der
Kunst das Wort geredet haben. Und weil Liebermann die einfache Natur
geben wollte, die die meisten Menschen zu uninteressant finden, um
sie anzuschauen, mußte er suchen, sie künstlerisch zu verklären.
Er that es nicht,[S. 14] indem er sie in ihrem Wesen veränderte, sondern
indem er sie mit der Schönheit des Lebens umgab, die Luft und
Licht um die ärmlichsten Erscheinungen weben. Nichts war schön auf
Liebermanns Bildern als das Zuständliche. Im Jahre 1879 also malte
Liebermann während eines dreimonatlichen Aufenthaltes in Holland „Die
Kleinkinderschule in Amsterdam“, die er zusammen mit einer abgeänderten
und in der Farbe aufgehellten Wiederholung der „Konservenmacherinnen“
in die Pariser Salonausstellung von 1880 schickte. Im folgenden Jahre
entstand das köstliche „Altmännerhaus in Amsterdam“, das ihm in Paris
eine Medaille eintrug, die erste Auszeichnung, die einem Deutschen
nach dem Kriege in Frankreich zu teil wurde, und die „Alte Frau am
Fenster“. 1881 ist das Geburtsjahr der in der Berliner Nationalgalerie
befindlichen „Schusterwerkstatt“ und des auf dem Umwege über Paris
und Berlin 1900 in die Galerie des Städelschen Instituts zu Frankfurt
gelangten „Hofes des Waisenhauses in Amsterdam“. Das Jahr 1883 brachte
„Die Bleiche“ und 1884 ein Bild, zu dem er die Anregung in Bayerns
Metropole erhalten hatte: das „Münchener Bierkonzert“. Inzwischen
war Liebermann in Paris Mitglied der vornehmsten der dortigen
Künstlervereinigungen, des „Cercle des XV“, geworden, dem
Künstler wie Stevens und Bastien-Lepage angehörten, und stellte seitdem
alljährlich im Salon Petit aus. Der Aufenthalt in München nahm 1884 ein
Ende. Der Künstler verheiratete sich in Berlin, wo er seitdem seinen
ständigen Wohnsitz hat; aber Holland blieb seine Schatzkammer bis auf
diesen Tag. Die „Flachsscheuer in Laren“ (in der Nationalgalerie),
„Die Frau mit den Ziegen“ (Neue Pinakothek, München), „Die
Netzeflickerin[S. 15]nen“ (Kunsthalle zu Hamburg), „Holländische Dorfstraße“,
„Spitalgarten in Leyden“, „In den Dünen“ (Leipziger Museum),
„Dünenarbeiter“ (Königsberger Galerie), „Badende Jungen“, „Sonntag
in Laren“, „Schulgang“ und viele andere seiner vorzüglichsten Bilder
entstammen dieser Unerschöpflichen. Nur zuweilen einige Motive von wo
andersher, wie etwa bei der „Gedächtnisfeier für Kaiser Friedrich in
Kösen“, dem „Kinderspielplatz im Tiergarten“ oder dem „Biergarten in
Brannenburg“. Seit Anfang der neunziger Jahre hat sich Liebermann auch
der Bildnismalerei zugewendet. Seine Porträts gehören nicht nur zu den
eigenartigsten, sondern auch zu den künstlerisch stärksten, die in
Deutschland am Ende des Jahrhunderts entstanden sind. Bildnisse, wie
das des Bürgermeisters Petersen (Hamburg), das von Virchow, Gerhart
Hauptmann sind Proben eines Porträtstils, über den in der ganzen Welt
nur ein einziger Künstler — Liebermann — verfügt. Auch als Radierer
ist der Künstler von Bedeutung. Unter seinen Kalte-Nadel-Arbeiten sind
einige, die den Vergleich mit Blättern Rembrandts nicht zu scheuen
brauchen; in anderen tiefgeätzten Platten hat er Wirkungen erreicht,
die es an malerischer Haltung mit seinen Bildern aufnehmen.

Abb. 12. Studie zu den
„Konservenmacherinnen“ im Leipziger Museum.
Liebermann hat sich die Anerkennung seiner Künstlerschaft Schritt für
Schritt erobern müssen, wenigstens in Deutschland, und am allerlängsten
hat man in Berlin gezögert, seinem Talent die gebührende Würdigung zu
teil werden zu lassen. In Paris verstand und bewunderte ihn alle Welt,
in München wenigstens die Künstler, in seiner Vaterstadt hat man ihn so
lange übersehen, als es nur irgend anging; und noch heute sind gewisse
Kreise vorhanden, die nicht zu fassen vermögen, warum Liebermann,
dessen Schöpfungen ihrer Meinung nach so gar nichts Ideales haben, der
von der Schönheit, wie sie sie verstehen, nichts zu wissen scheint und
nichts wissen will, ein großer Künstler sein soll. Es war wohl immer so
in Berlin, daß man in[S. 16] Sachen des Kunstgeschmackes nicht auf der Höhe,
sondern recht eigentlich altmodisch war und nur das als künstlerisch
schön gelten lassen mochte, was außerhalb der jedem erreichbaren Sphäre
lag. Und ferner verbindet man in Berlin den Begriff von Schönheit
gern mit der Vorstellung einer höheren Bildung, die der gemeinen
Wirklichkeit mit Vorsicht aus dem Wege geht. Gegen die Schönheit, deren
Wesen Wahrheit ist, hat man in der Stadt der Intelligenz immer eine
Abneigung gehabt; und wenn Menzel nicht Gelegenheit gefunden hätte, der
Wahrheit, die er geben wollte, ein historisches Mäntelchen umzuhängen,
und nicht zugleich ein witziger Kopf gewesen wäre — die Berliner
würden vielleicht auch heute noch im Zweifel sein, ob er ein wirklicher
Künstler oder nur eine Modegröße ist.
**
*

Abb. 13. Zeichnung (1880). Im
Besitz des königl. Kupferstichkabinetts zu München.

Abb. 14. Altmännerhaus in Amsterdam
(1880). Im Besitz der Kunsthandlung Bruno & Paul Cassirer in Berlin.
GRÖSSERES BILD

Abb. 15. Studie zum Bilde
„Altmännerhaus in Amsterdam“ (1880).
Kein Meister fällt vom Himmel, am allerwenigsten in der Kunst, obschon
in dieser nicht selten Ereignisse zu bemerken sind, die unvermittelt
wirken. Beim näheren Zusehen aber findet man auch bei diesen in der
Regel den beruhigenden Zusammenhang mit vorhanden gewesenen Ursachen.
Sogar die großen Eroberer, von denen die Kunstgeschichte zu erzählen
weiß, sind nur Schritt für Schritt vorwärts gedrungen, haben Vorbilder
gehabt und benutzt, bis sie in sich so weit fertig waren, um Eigenes
bieten zu können. Es gibt keinen großen Künstler, der zu Beginn seiner
Thätigkeit nicht in die Fußstapfen seines Lehrers oder eines frei
gewählten Vorbildes getreten wäre. Mag man an Raffael oder Rembrandt,
an Dürer oder Tizian, an Franz Hals oder Velasquez denken. Sie gingen
von einem Vorhandenen aus, und daran mißt man ihre Größe, wie weit
sie über dieses hinausgelangt sind. Selbst Menzel, den man so leicht
geneigt ist, als ein künstlerisches Phänomen zu betrachten, ist nicht
als fertiger Künstler auf der Bildfläche erschienen, sondern hat sich
das Seinige mühsam zusammengesucht. Nur darin ist er[S. 18] ein Phänomen,
daß er sich außerhalb der Zeitströmung hielt, das Schöne nicht da
suchte, wo es Andere schon längst vorher entdeckt, sondern dort, wo es
die Anderen nicht vermutet hatten. Auch Liebermann hat sich, als er
anfing, sein künstlerisches Rüstzeug von Anderen geliehen. Er besaß
schon, als er bei Steffeck arbeitete, eine gründliche Abneigung gegen
den von Cogniet und Couture abstammenden Berliner Kolorismus. Er
empfand das Unwahre, Hohle, Gemachte dieser Art zu malen zu lebhaft,
als daß sie ihm irgendwie erstrebenswert erschienen wäre. Auch die
Malerei von Pauwels sagte ihm nicht besonders zu; er fand auch sie
noch zu pompös für die Darstellung der Wirklichkeit, um die es ihm nun
einmal ging. In München hatten auf der internationalen Kunstausstellung
von 1869 zum erstenmal Courbet und Munkaczy die Aufmerksamkeit der
jungen Künstler Deutschlands auf sich gelenkt. Die gemauerten, derben
Farben des Franzosen, die vornehm wirkende schwärzliche Untermalung
des Ungarn stellten den deutschen Kolorismus bedenklich in den
Schatten. Die sparsame Verwendung der warmen Töne bei dem Einen, die
Vermeidung aller ausgleichenden Lasuren bei dem Anderen imponierten dem
jüngeren Geschlecht. Die handfeste Manier Courbets stand so vorzüglich
in Übereinstimmung mit seinen Wirklichkeitsbildern, und Munkaczys
Düsterheit stimmte ausgezeichnet mit den romantischen Typen, die er
zu zeigen liebte. Courbet und Munkaczy waren es, an deren Bildern
Liebermann beim Malen seiner „Gänserupferinnen“ gedacht. Jener hatte
ihm Mut gemacht, anstatt des für Anfänger üblichen Historienbildes
ein völlig antiakademisches Motiv zu wählen; dieser ermöglichte es
ihm, eine malerische Ausdrucksweise zu zeigen, die von der allgemein
üblichen damals auffallend abwich. Man hat heute keine Empfindung[S. 19] mehr
für das Aufrührerische in der Tendenz des Liebermannschen Bildes; aber
vor dreißig Jahren wirkte es und sogar auf einen so vorgeschrittenen
Künstler wie Menzel. Er erkundigte sich bei dem Kunsthändler Lepke,
bei dem damals die „Gänserupferinnen“ (Abb. 2) zu sehen waren, nach
dem Maler des Bildes und drückte den Wunsch aus, ihn kennen zu lernen.
Liebermann, ungeheuer stolz auf das Interesse, das der von ihm
bewunderte Künstler an seinem Bilde nimmt, geht sofort nach seiner
Rückkehr von Paris zu Menzel und wird mit folgenden Worten empfangen:
„Also Sie sind der Liebermann, der das Bild gemalt hat. Wissen Sie
was? Das Bild sollte man Ihnen um die Ohren schlagen — es ist
ausgezeichnet; aber so etwas macht man erst mit fünfzig.“ Liebermann
hat erst lange nachher die Bemerkung des berühmten Künstlers richtig
verstanden, nämlich, daß er viel zu jung sei, um sich eine derartige
Auflehnung gegen die Tradition erlauben zu dürfen, daß eine Freiheit
der Mache in dem Bilde wäre, die sich für einen Anfänger nicht schicke.
Der beglückte junge[S. 20] Maler hörte in jener Zeit nur das Lob. Und was
hätte ihn mehr darin bestärken können, auf seinem Wege fortzuschreiten,
als es von dieser Seite zu empfangen! Es ist in der That etwas
Altmeisterliches in dem Bilde. Der schwärzliche Gesamtton hält die paar
Farben in den Kleidern und Schürzen der alten Weiber gut zusammen, und
wenn er dem Künstler bei der Berliner Kritik damals auch den Namen
„Sohn der Finsternis“ eintrug — es gab in jener Zeit wenige Bilder,
die „malerischer“ gewirkt hätten. Aber in einem wich das Bild noch
viel weiter von dem Üblichen ab: im Inhalt. Nach damaliger Gewohnheit
war es als „Genrebild“ registriert worden, wie unendlich fern jedoch
stand es dem eigentlichen Genre! Es erzählte nichts und unterhielt
nicht, der Künstler hatte in keiner Richtung den Versuch gemacht, an
das Gemüt oder den Verstand der Beschauer zu appellieren, auch nicht
die Spur einer Absicht gezeigt, sich deren Wohlwollen durch Wiedergabe
von Schönheit und Anmut zu erwerben. Das Bild war ein Bericht darüber,
wie es aussieht, wenn alte Weiber in einer dunklen Scheune sitzen
und Gänsen die feinen Federn ausrupfen, die für die Betten gebraucht
werden. Der Gegenstand erschien weder würdig im Sinne der alten
Ästhetik, noch spürte man jene von allen gemeinen Zufälligkeiten
gereinigte Natürlichkeit, die für erlaubt galt. Für den malerischen
Reiz des Bildes, die amüsante Wirkung der Lichtquelle im Hintergrunde
hatte man kein Gefühl. Man sah nur die Sache und fand sie scheußlich,
weil man nicht daran gewöhnt war, Kunst anders als mit dem Verstande zu
betrachten, und auch dieser nur auf das Unterhaltende und Belehrende,
nicht auf das Wirkliche und Richtige dressiert war.
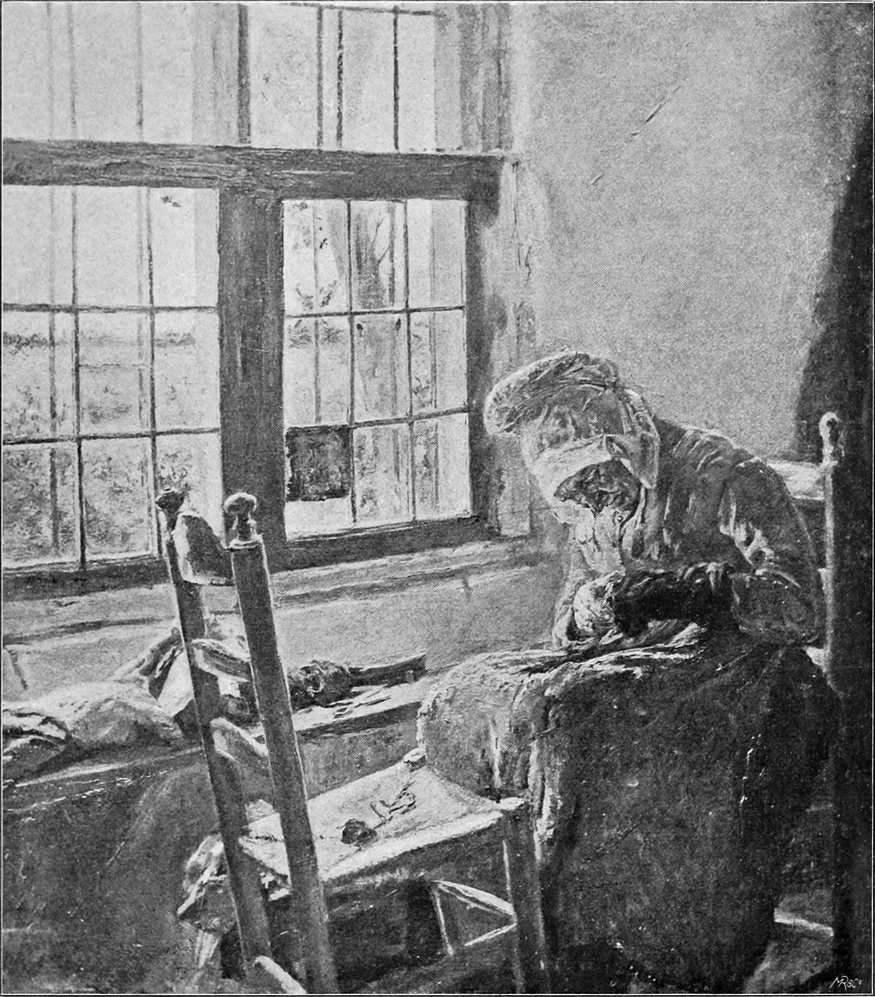
Abb. 16. Alte Frau am Fenster
(1880). Im Besitz der Kunsthandlung Bruno & Paul Cassirer in Berlin.

Abb. 17. Die Spinnerinnen (1880).
Im Besitz des Herrn Professor Franz von Defregger in München.
Der ein Jahr früher entstandene „Atelierwinkel“ (Abb. 1), in dem ein
alter Mann in Mappen herumkramt, war auch nicht malerisch im Sinne der
Zeit. Dazu hätten historische Kostüme, glänzende Waffen, der ganze
prunkende Apparat einer auch äußerlich auf Unterscheidung von der
Mitwelt bedachten Künstlerexistenz gehört. Liebermann gab die an sich
nüchterne Wand eines Arbeitsraumes mit ein paar darauf hängen[S. 21]den,
nicht erkennbaren Studien, ein Regal mit Farbentöpfen und eben jenen
alten Mann, der eine Zeichnung mit Aufmerksamkeit betrachtet. Das
Malerische daran war nicht die Sache selbst, sondern das sanfte Licht,
das in der bräunlichen Dämmerung leise über die Wand, das Regal und
das weiße Haupt des Alten floß, dort eine Farbe, hier einen Reflex,
da eine Form sichtbar werden ließ. Der junge Künstler läßt in diesem
Werke schon deutlich erkennen, daß er sich des Unterschiedes zwischen
pittoresk und malerisch wohl bewußt ist.

Abb. 18. Die Klöpplerin (1881).
Im Besitz der Kunsthalle zu Hamburg.
In den „Konservenmacherinnen“ und in den „Invaliden im Lotsenhaus“
beginnt sich der schwärzliche Ton der Liebermannschen Bilder schon
aufzulichten. Statt Beinschwarz verwendet der Künstler Asphalt,
auf dessen durchsichtigem Braun die Farben anfänglich warm und
leuchtend stehen, um allerdings später durch die zersetzende
Kraft des Bitumens stumpfer zu werden. Nach der psychologischen
Seite ist ein außerordentlicher Fortschritt zu konstatieren. Die
„Konservenmacherinnen“ (Abb. 3) — derbe, kräftige Weiber, abgerackerte
Arbeitsfrauen und wunschlos gewordene alte Mütterchen — sitzen auf
hölzernen Bänken und Fässern in einem dunklen, niedrigen Arbeitsraume
an einem improvisierten Tische und putzen mit kurzen Messern die
verschiedenartigsten Gemüse. Kein Blick aus all’ den Augen fällt auf
den Beschauer. Keine der Arbeiterinnen hat eine Empfindung davon, daß
eines Malers Auge auf ihr geruht. Die unendliche Natürlichkeit in dem
still vor sich Hinbrüten der Einen, die bewegliche Geschäftigkeit der
Anderen, der unbewußte Ausdruck der zwölf oder dreizehn Gesichter
gibt der Darstellung den wunderbarsten Reiz. Unwillkürlich gerät man
in Versuchung, Charakterstudien zu[S. 22] machen, und ist erstaunt, welche
Fülle von Individualitäten der Künstler in diesem einen Bilde gibt.
Freilich muß man lesen können in Menschengesichtern, wird dann aber
von diesem Bilde die Überzeugung mitnehmen, daß sein Urheber den
Menschen, die er dargestellt, bis ins Herz gesehen hat. Dieselbe
vollendete Natürlichkeit zeigen die „Invaliden im Lotsenhause“ (Abb. 5).
Dieses ruhige Herumsitzen in dem hohen verräucherten Raume um den
qualmenden Kamin, halb nachdenklich, halb gedankenlos, entspricht auf
das Vollkommenste dem Wesen der Männer, die gewohnt sind, wortlos
ihre Pflicht zu thun. Auch hier wieder wirkliche Menschen, nicht
bloße Typen, und das Rot in den Hemden der bedächtig ihre Thonpfeife
rauchenden Seeleute mit ihren sonderbaren hohen Hüten von feinster
malerischer Wirkung zwischen Schwarz und Braun.

Abb. 19. Ölstudie zu den
„Klöpplerinnen“ (1881 Venedig).

Abb. 20. Schusterwerkstatt (1881).
In der königl. Nationalgalerie zu Berlin.
Liebermanns Thätigkeit in Paris und Barbizon gipfelt in dem bald als
„Arbeiter im Rübenfelde“, bald als „Im Runkelpark“ bezeichneten großen
Bilde (Abb. 7), das als eines seiner Hauptwerke gilt. Der geistige
Vater dieses Bildes ist ja wohl ohne Zweifel Millet, aber doch nur
insoweit, als der junge Berliner durch diesen großen Künstler auf die
wirksame Verbindung und den geistigen Zusammenhang von Mensch und
Landschaft hingewiesen wurde. Die Anekdote, von der bis zum Erscheinen
Millets das Bauernbild seine Daseinsberechtigung hergenommen, war
für Liebermann von vornherein ein überwundener Standpunkt, und ehe
er Bilder Millets gesehen, war die Darstellung arbeitender Menschen
das, was ihn künstlerisch gereizt hatte. Nun gewann der Mensch als
Erscheinung in der Natur für ihn eine tiefere Bedeutung. Sein Gefühl
für das Verhältnis der Erscheinung zu ihrer Umgebung erfuhr durch das
Beispiel des bewunderten Meisters die erwünschte Bekräftigung. Auch das
in Barbizon entstandene Bild ist noch sehr dunkel, von einer schweren,
mehr an Courbet als an Millet erinnernden Farbe; aber in der Landschaft
und in der Beleuchtung kündigt sich schon ein Neues an. Ungehindert
schweift der Blick an ein paar Bäumen vorbei über weite Felder bis zu
der hoch gelegenen, von den Gestalten der im Vordergrunde thätigen
Arbeiter nicht überschnittenen Horizontlinie. Sechs Weiber[S. 23] und drei
Männer schaufeln, jäten und graben auf dem Acker. Zwei der Weiber
ruhen, auf ihre Hacken gestützt, aus. In den Figuren ist jede Art von
Bewegung dargestellt, die die Feldarbeit erfordert, so daß die mit
Ausnahme eines weiter vorgerückten Weibes in einer Reihe Arbeitenden
für die Betrachtung reiche Abwechselung bieten. Vielleicht aber ist
dieses Werk das einzige Liebermanns, bei dem man einen gewissen Mangel
an Frische und Unmittelbarkeit nachweisen könnte. Es zeigt des Malers
ganzes großes Können, aber es hat weniger Natürlichkeit als seine
sonstigen Bilder. Die Figuren sind zu nahe bei einander, und einige
posieren, was bei Liebermann sonst nie vorkommt. Das Programmatische
stört. Unter der Wirkung von Millet stehen auch zwei größere Skizzen,
die je einen Mann und eine Frau in einem Kartoffelacker arbeitend
zeigen. Hinter beiden Figuren sieht man dieselbe braunbewachsene
Böschung, über beiden den gleichen grauen Oktoberhimmel. Die
außerordentliche Einfachheit des Motives, die wenigen Farben bringen
diese Studien ähnlichen Schöpfungen des Meisters von Barbizon ganz
nahe. Aber schon in den „Geschwistern“ (Abb. 8) ist Liebermann wieder
frei von allen Erinnerungen und ganz er selbst. Wie ausgezeichnet ist
die Haltung und Bewegung des halbwüchsigen Mädchens gesehen, dem die
Last des kleinen Bruders zu schwer geworden, und das sich das Gewicht
zu erleichtern sucht, indem es das linke Knie hochzieht und damit das
Kind stützt! Ein Lichtstrahl, der den Kopf des Mädchens streift und
das Gesicht des Kindes voll beleuchtet, gibt Modellierung und farbige
Gegensätze. Die Annäherung an Franz Hals spürt man bei den Schöpfungen
dieser Zeit wohl am lebhaftesten bei dem Bilde „Mutter und Kind“ (Abb. 10),
das schon ins Monumentale gesteigerte Intimität ver[S. 24]rät und mit
einer geradezu verblüffenden Kraft und Breite hingestrichen ist.
Es spricht für die außerordentliche Beweglichkeit des Künstlers, daß er
nach dieser großzügigen Leistung sich einem Motiv zuwendet, das ganz
andere Ansprüche an ihn stellt und Fröhlichkeit und Liebenswürdigkeit
verlangt, um zu wirken; aber das Gebiet der Kinderdarstellung war schon
in den beiden letzten Bildern beschritten, und die Schilderung einer
„Kleinkinderschule in Amsterdam“ bot dem Künstler eine sehr dankbare
Aufgabe. Wer hätte dem Naturalisten Liebermann dieses offene Auge für
Kinderschönheit und Anmut zugetraut? Gegen diese hübschen, frischen,
naiven Mädchen und Bübchen, die sich mit der ganzen Unbefangenheit
wirklicher Kinder belustigen, hier miteinander plaudern, dort mit
großgeöffneten Augen der Erzählung einer Größeren lauschen, da Schreib-
und Malversuche machen oder zusehen, wie ein kleiner Hungriger
gelabt wird, wirken die meisten von Knaus gemalten Kinder geziert
und konventionell. Das Heitere und Bezaubernde der unschuldsvollen
Menschenblüten wird noch gehoben durch einen Gegensatz, durch die
Anwesenheit der alten und runzligen Herrscherin in diesem Reich,
die neben dem Kinderschulbänkchen auf einem erhöhten Sitz vor ihrem
Nähtisch sitzt und gedankenlos, das Geschwätz der Kleinen im Ohr, einen
Strumpf strickt. Und lustig wie die Kinder und hell wie der Tag, der
ins Zimmer hineinscheint, sind die Farben des Bildes, Weiß und Rosa,
Himmelblau und Rot. Der Maler sorgengefurchter Gesichter, zerarbeiteter
Hände, gebeugter Rücken und des hoffnungslosen Alters weiß auch
den Sonnenschein des Lebens, lachende Augen und blonde Kinderköpfe
darzustellen.

Abb. 21. Studie zur
„Schusterwerkstatt“.

Abb. 22. Der Hof des Waisenhauses in
Amsterdam (1881). Im Besitz des Städelschen Kunstinstituts zu Frankfurt
am Main.
GRÖSSERES BILD

Abb. 23. Studie zu einem
holländischen Waisenmädchen (1881).
Zwischen diesen Bildern des Lebens kann der „Jesus unter den
Schriftgelehrten“ (Abb. 11) nur als ein Intermezzo angesehen[S. 26] werden,
als ein Versuch des Künstlers, nachzuprüfen, ob sich seine Art mit
einem außerhalb der Malerei als solcher liegenden Gedanken verbinden
lasse. Auch als „Rückfall in die Menzelperiode“ hat man diesen Jesus
Liebermanns bezeichnet; aber mit der denselben Stoff behandelnden
Lithographie Menzels verbindet ihn nur die rationalistische Auffassung,
nicht die künstlerische. Menzel hätte nie gewagt, unwissenschaftlich
zu sein, um wahrer zu wirken. Während Menzels Jesus als ein
geistreich blickender Judenknabe mit der traditionellen Aureole
unter stattlichen, in reiche Gewänder gehüllten jüdischen Gelehrten
in einer Tempelhalle steht und seine Mutter in der Idealkleidung
der Marien herbeieilt, ist Liebermanns Jesus ein flinker, kleiner,
schlecht gewachsener, wie ein Händler mit den Händen gestikulierender
Judenjunge, die Gelehrten gleichen ehrbaren, polnischen Juden im
Gebetsmantel und Ort der Handlung ist irgend eine kleinstädtische
Synagoge. Man kann ohne weiteres zugeben, daß für den Christusknaben
sich leicht ein sympathischeres jüdisches Modell hätte finden lassen;
aber Liebermann hat wohl kaum die Absicht gehabt, einen neuen Typus
des jugendlichen Christus in die Welt zu setzen, ihm lag wohl mehr
daran, das Dramatische des Vorganges zum Ausdruck zu bringen. Wie
der Junge lebhaft und eindringlich und klug redet und die Männer
zuhören und über das Gehörte nachdenken und staunen, ist niemals
überzeugender, der Vorgang selbst niemals konzentrierter geschildert
worden. Menzel brauchte für seinen Jesus die Aureole, weil er sonst
unter den stattlichen Gestalten der Schriftgelehrten verschwunden
wäre; bei Liebermann ist der kleine unscheinbare Junge der natürliche
Mittelpunkt alles Geschehens auf dem Bilde, und als Malerei kann es
dieses Werk wohl mit fast allen Bildern aufnehmen, die dasselbe Thema
behandeln. Liebermanns „Jesus“ gehört heute Fritz von Uhde, der in
seinen Christusbildern Ähnliches[S. 27] gewollt, viel mehr Rücksicht auf
die Empfindungen der Allgemeinheit genommen, aber dafür auch niemals
die steile künstlerische Höhe erreicht hat, die der Berliner Maler in
dieser vielgeschmähten Schöpfung zeigt.
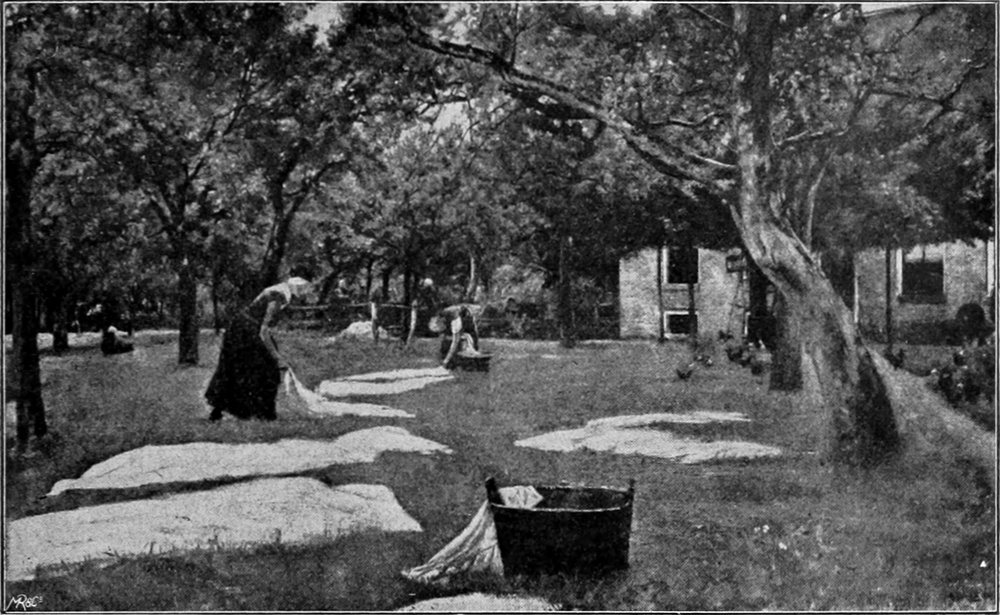
Abb. 24. Die Bleiche (1882).
Im Privatbesitz in Frankfurt am Main.
Vor sich selbst und seinen Freunden glich Liebermann diesen
Mißerfolg bei dem großen Publikum mit einem Bilde aus, das zu seinen
kostbarsten Schöpfungen gehört, mit nichts auf der Welt, als mit sich
selbst, verglichen werden kann und den jungen Künstler im Auslande
als den bedeutendsten Vertreter der deutschen Kunst erscheinen
ließ, mit dem „Altmännerhaus in Amsterdam“ (Abb. 14). Mag auch das
Prinzip Millets: „Mettre l’homme vrai dans son milieu vrai“
bei der Wahl des Stoffes mitbestimmend gewirkt haben — Millet
hätte dieses Bild schwerlich gemalt, schwerlich malen können, und
ebensowenig würde Menzel imstande gewesen sein, eine an sich so
wenig äußerliches Interesse bietende Wirklichkeit künstlerisch so
interessant zu gestalten. In dem „Altmännerhaus“ künden sich ferner
neue luminaristische Bestrebungen an, die für Liebermanns künftiges
Schaffen von besonderer Bedeutung werden. Man sieht in den hinten
von einem Laubengange abgeschlossenen Garten des „Oude Mannenhuis“.
In einer schattigen Allee sind zu beiden Seiten Bänke aufgestellt,
auf denen sitzend die Insassen des Hauses den schönen Tag genießen.
Alte würdige Herren, denen die schwarze Kleidung und die weiße Binde
den Anschein des Wohlgestelltseins gibt. Die Anstaltsmütze auf den
greisen Köpfen sitzen sie bei einander, brüten vor sich hin, rauchen
mit Behagen ihre langen Pfeifen, reden mit dem Nachbar, lesen Zeitung
oder lassen sich von der Sonne bescheinen. Ein paar von ihnen stehen,
andere schreiten in dem Laubengange auf und nieder. Über den Platanen
und Kastanien des Gartens steht leuchtend die warme Sonne und sendet
ihre goldenen Strahlen durch das grüne Laubdach. Lustig hüpfen sie
über die alten Gesichter, die welken Hände, die schwarzen Röcke der
Männer, über den sauberen Kiesweg zu ihren Füßen. Wie eine Stätte des
Friedens, wohin der Lärm des Lebens, seine Sorgen und Enttäuschungen
nicht mehr dringen, liegt der Garten da. Die auf den Bänken haben
abgeschlossen mit dem Dasein; aber der milde Sommertag thut ihnen
wohl, und seine goldene Sonne zaubert den Schein des Glückes um ihre
greisen Häupter. Ein prächtiges, versöhnliches Bild. Von ähnlicher
innerlicher und äußerlicher Schönheit ist die „Alte Frau am Fenster“
(Abb. 16),[S. 28] die so ganz in das Stopfen ihrer Strümpfe vertieft ist,
daß sie den hellen sonnigen Frühlingstag vor dem kleinen Fenster ihres
armseligen Zimmerchens nicht sieht. Sanft gleitet das Tageslicht über
ihre große weiße Haube, das von tausend Fältchen durchzogene Gesicht
und die alten steifen Hände. Man bemerkt schon, daß sie eine arme Frau
ist, aber Niemand wird verleitet, sie für besonders bedauernswert
zu halten. Sie ist weder mit den Augen eines Mitleidigen, noch mit
denen eines Spötters gesehen. Das ist das Leben, das Schwerste und
das Selbstverständlichste in einer Erscheinung. Anstatt unser Gefühl
für die bedürftige Armut anzurufen, läßt Liebermann sie arbeiten und
zeigt, wie selbst in der traurigsten Hütte die Natur für den, der sehen
kann, tausend Schönheiten ausbreitet. Seit Pieter de Hooch ist ein
holländisches Interieur nicht feiner gemalt worden, wenigstens nicht
mit mehr Empfindung für den Zauber des Lichtes im Raume. Ohne einem
alten Meister nachzugehen, erreicht Liebermann hier dasselbe, wie
jener, durch die sorgfältige Beobachtung der Natur, und was wichtiger
ist, ihrer malerischen Zustände. Nichts von Übernommenem in diesem
Bilde, jeder Pinselstrich die Niederschrift eines Erlebnisses vor der
Natur.

Abb. 25. Holländisches Interieur
(1882).

Abb. 26. Kinderspielplatz im Berliner Tiergarten
(1882) [unvollendet]. Im Privatbesitz in Berlin.
Aber es reizte den Künstler, dieselben Probleme in schwierigeren Fällen
zu lösen. Der „Hof des Waisenhauses in Amsterdam“ (Abb. 22) bedeutet
schon in der Farbe einen Fortschritt gegen das „Altmännerhaus“. Hier
erscheint zum erstenmal das wunder[S. 29]bare Liebermannsche Rot, ein Rot von
einer Nuance, die außer Liebermann Niemand hat, und das im Ensemble
seiner Farben geradezu berückend wirkt. Man hat rechts im Bilde die
Hinterfront des Waisenhauses mit den Backsteinpfeilern, zwischen
denen Bänke stehen, mit den hellgestrichenen Fensterumrahmungen, den
vergitterten Fenstern und dem Blumenschmuck davor. Ein langer Gang, den
links grüne Bäume einfassen, führt an dem Hause vorüber. An seinem Ende
eine Pforte in einem Quergebäude, aus der die Waisenmädchen in den Hof
gelangen. Ein schöner warmer Sommertag hat die Kinder herausgelockt,
und nun führen sie ihre halb schwarzen, halb roten Kleider, ihre weißen
Schürzen und Häubchen im Sonnenschein spazieren. Die Kleineren spielen,
die Älteren wandeln langsam unter den grünen Bäumen dahin, und die ganz
Gesetzten haben ihr Nähzeug zur Hand genommen und sitzen, an großen
Stücken Linnen arbeitend, auf den Bänken am Hause. Keins der Mädchen
sieht aus, als wäre es gemalt worden. Die vollendetste Natürlichkeit
in jeder Bewegung, im Gesichtsausdruck. Durch ein Wunder scheinen sie
da auf die Leinwand gebracht zu sein. Wie köstlich ist die Perspektive
des Bildes! Man meint, den Sommerwind in den Bäumen rauschen zu hören
und die Sonnenstrahlen auf dem Wege tanzen zu sehen. Als das Bild
1882 im Salon erschien, schrieb der Pariser Kunstkritiker Hochedé:
„Herr Liebermann hat der Sonne einige von ihren Strahlen gestohlen und
bedient sich ihrer wie Phöbus selbst.“ Auf alle Fälle ein Bild, wie
es noch nie gemalt worden war. Dasselbe kann man von dem zweiten, im
selben Salon ausgestellten, jetzt in der Nationalgalerie befindlichen
Bilde „Die Schusterwerkstatt“ (Abb. 20) sagen, das Hochedé mit den für
den deutschen Künstler höchst schmeichelhaften Worten begrüßte: „Wenn
Sie die Geheimnisse des Freilichts gefunden haben, mein lieber Manet,
Herr Liebermann versteht das Licht im Raume zu belauschen. Um sein
kleines Bild zu besitzen, würde ich gern 500 qm Malerei im Salon
hingeben.“ Aber nicht nur die Wirkung des grauen Tageslichtes im Raume
ist in unübertrefflicher Weise geschildert, auch die Darstellung der
Menschen — des Schusters und seines Lehrjungen — ist ausgezeichnet.
Jede Bewegung erscheint der Wirklichkeit abgesehen. So faßt der
Schuster die Zange, so hebt er den Arm, wenn er den Absatz rund machen
will. Und über die fleißigen Ar[S. 30]beiter fort blickt man durch ein großes
Fenster in die grüne Natur. Kein Schwarz, keine Dunkelheit mehr im
Bilde. Das Licht hat Alles besiegt. Liebermanns Bild gab den Anstoß zu
einer Bewegung in Deutschland, die man bis jetzt noch spürt. Ungefähr
in dieser Zeit — die Bilder sind 1881 gemalt — lernte der Künstler
Josef Israels, den größten Vertreter einer ähnlichen Richtung in
Holland, kennen. Man pflegt der damals beginnenden Freundschaft der
beiden bedeutenden Maler einen großen Einfluß auf die Entwickelung
Liebermanns zuzuschreiben; aber wohl kaum mit Recht. In Liebermanns
Entwickelung gibt es keine Brüche. Seit dem „Altmännerhaus“ ist er auf
einem selbstgefundenen Wege geblieben. Wohl möglich aber, daß Israels
ihn dazu ermuntert hat, sich mit den Problemen zu beschäftigen, die die
holländische Küste dem Landschafts- und Figurenmaler bieten. Nur einmal
hat Liebermann in einem Bilde ein Motiv behandelt, das Israels vor ihm
gemalt, im „Tischgebet“ (Abb. 32). Die Kunst des Holländers besitzt
viel mehr Traditionelles als die des Berliner Künstlers. In ihr steckt
noch ein gutes Teil von der malerischen Kultur, deren Vater Rembrandt
ist. Ohne Zweifel indessen hat Israels den jüngeren Künstler darin
bestärkt, den beschrittenen Weg weiterzugehen. Liebermann jedoch ist
ein zu starkes Temperament, um überhaupt im Fahrwasser eines Anderen
segeln zu können.
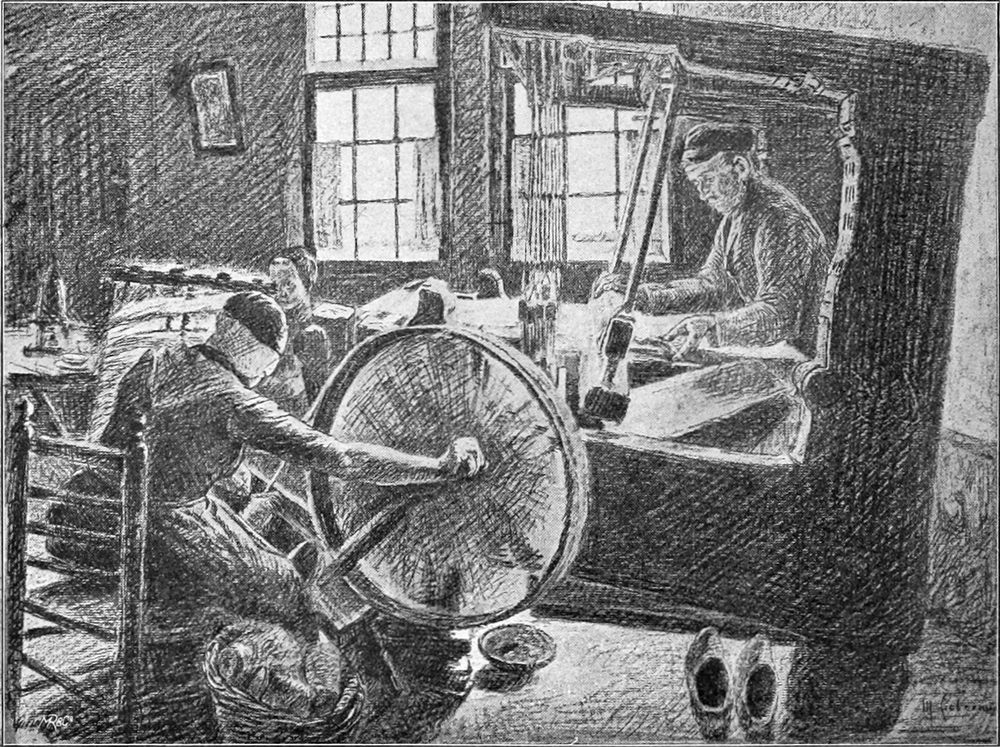
Abb. 27. Der Weber (1883).
Im Privatbesitz in Berlin.

Abb. 28. Münchener Bierkonzert
(1883). Im Besitz des Herrn von Kauffmann in Florenz.
GRÖSSERES BILD
Nachdem der Künstler sich einmal der Freilichtmalerei zugewendet,
haben ihn deren Probleme dauernd beschäftigt. In der 1882
entstandenen „Bleiche“ (Abb. 24) läßt er das Licht des Tages durch
die dichtbelaubten Äste eines Birnbaumes über grünen Rasen und weiße
Leinwand rieseln. Aber auch den Lichtwirkungen im Raume geht er noch
weiter nach. Vor der „Schusterwerkstatt“ waren 1880 „Die Spinnerinnen“
(Abb. 17) entstanden, die zu dreien mit ihren Rädern um einen mit
Kaffeeschälchen besetzten Tisch sitzen, während eine vierte am Herde im
Winkel hantiert. Neben dem Herde ist links ein Fenster, durch das man
in ein Gärtchen sieht. Das graue Tageslicht[S. 32] läßt die weißen Hauben
der Alten aufleuchten und wird von einer hellen Wand reflektiert. Zu
den feinsten seiner Bilder in dieser Art gehört jedoch „Der Weber“
(Abb. 27). Die Lichtquelle bilden zwei Fenster im Hintergrunde des
engen Gemaches. Der Weber sitzt in seinem Stuhle und will eben einen
neuen Faden einsetzen. Im Vordergrunde, auf einem Schemel, eine der
reizendsten Gestalten, die Liebermann geschaffen, ein Mädchen, das
mit einem großen Rade den Faden auf die Spule dreht. Es ist nun
wunderschön zu sehen, wie das Licht über das Gewebe im Stuhl läuft,
die verarbeiteten Züge des Webers beleuchtet, um schließlich auf dem
Häubchen des Mädchens, dem verschlissenen Rot ihrer Taille, ihrem
wohlgeformten Arm und dem sausenden Rade auszuruhen. Man muß schon
Terborch citieren, um eine Vorstellung von der malerischen Schönheit
der Kurbeldreherin anzuregen.
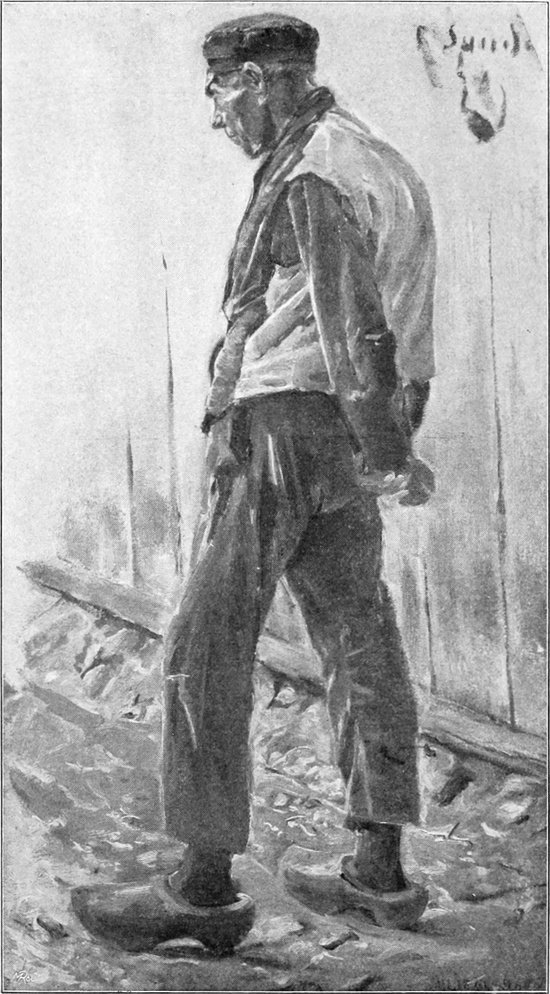
Abb. 29. Holländischer Bauer
(1886). Ölstudie.
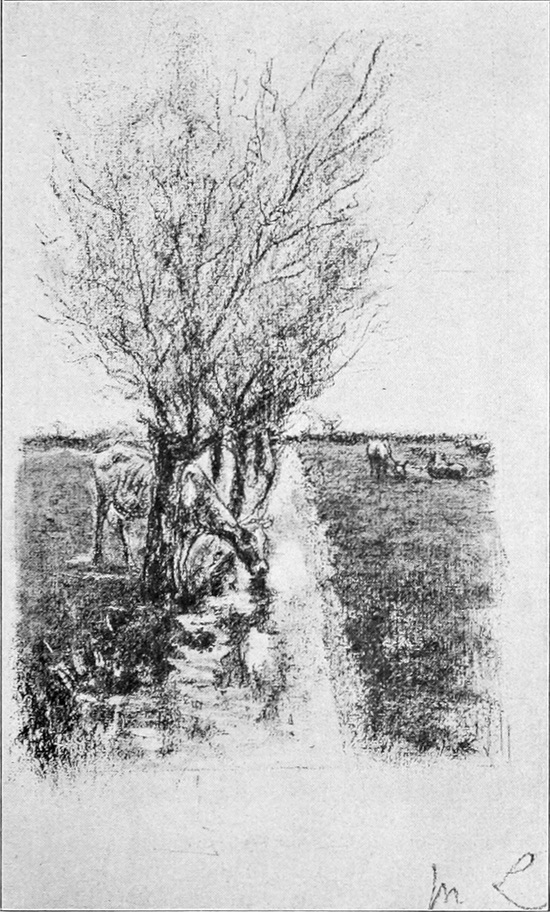
Abb. 30. Holländischer Kanal (1884).
Im königl. Kupferstichkabinett zu Dresden.
(Aus der Liebermann-Mappe. Verlag von Bruno & Paul
Cassirer in Berlin.)
Wenn man von einer Menzelperiode Liebermanns sprechen will, so
kann man[S. 33] es nur mit Hinsicht auf ein paar Bilder thun, in denen
der Künstler es versucht hat, in der Art Menzels eine Vielheit von
Erscheinungen in einem Bilde zu vereinigen. Das wichtigste dieser
Bilder ist das 1883 gemalte „Münchener Bierkonzert“ (Abb. 28), dem
1878 ein weniger bekannt gewordenes, von einem englischen Kunsthändler
falsch getauftes ähnliches kleines Werk „In den Champs-Elysées“ — es
zeigt ein paar Kinderfrauen mit ihren Schützlingen auf einer Bank im
Münchener Hofgarten — voraufgegangen ist. An Menzel erinnert vor allem
die zeichnerische Durchbildung des Ganzen. Jedes der vielen Gesichter
wirkt wie ein Porträt. Selbst den Posaunenbläser in dem Musikpavillon
im Hintergrunde sieht man noch ganz scharf. Liebermann bewährt sich in
dem Bilde, das bei Menzel vielleicht ein Gegenstück in dessen „Sonntag
im Tuileriengarten“ hat, sowohl als Beobachter, wie als Psycholog; aber
in mehr als einer Hinsicht bedeutet diese Leistung einen Schritt über
Menzel hinaus. Vor allem ist das „Bierkonzert“ malerischer als das
Menzelsche Bild, und die Pointen sind nicht unterstrichen. Liebermann
hat nicht den Versuch gemacht, den Menzel nie unterlassen haben würde,
den Beschauer mit einigen Gestalten in Verbindung zu setzen. Bei dem
älteren Künstler wäre man sofort darüber im klaren: Mit dem Manne[S. 34] hat
der Maler einen Dichter, mit jenem einen Lebemann, einen Künstler oder
sonst einen in der allgemeinen Vorstellung gültigen Typus darstellen
wollen. Diese billige Art, die Leute zu interessieren, hat Liebermann
durchaus verschmäht. Eine Gruppe von so entzückender Natürlichkeit,
wie die Kinderfrau mit dem kleinen Mädchen, das sie aus einem Glase
trinken läßt, konnte nur Liebermann geben, und ein so kindliches
Kind, wie den kleinen im Sande spielenden Blondkopf, hat Menzel in
all’ seinen Bildern nicht aufzuweisen. Es ist ungemein viel Leben
in dem Bilde, und es wird erhöht durch die überall umherhüpfenden
Sonnenstrahlen. Vielleicht läßt noch die „Gedächtnisfeier für Kaiser
Friedrich in Kösen“, 1888 gemalt (Abb. 50), an Menzel denken, an dessen
„Gottesdienst in Kösen“; aber doch nur für einen oberflächlichen
Beschauer. Liebermann gibt eine feierliche Impression von hohen
grünen Bäumen, fröhlichem Sonnenschein und schwarzgekleideten
Menschen, Menzel eine ausführliche Schilderung mit allerlei amüsanten
Nebensächlichkeiten. Bei Liebermann ist die Natur die Hauptsache,
bei Menzel die Gesellschaft, die den Gottesdienst im Freien in einem
beliebten Badeort besucht.

Abb. 31. Im Walde (1884).
Handzeichnung im Kupferstichkabinett zu Dresden. (Aus der Liebermann-Mappe.
Verlag von Bruno & Paul Cassirer in Berlin.)
1884 beschäftigen den Künstler noch einmal „Waisenmädchen“ (Abb. 36),
jetzt in der Hamburger Kunsthalle, 1885 malt er die „Holländische
Dorfstraße“ (Abb. 37). Wieder Holland, wieder Freilicht. Auf der
von einem heftigen Sommerregen nassen Dorfstraße begegnen sich zwei
frische, junge Dirnen; die eine hat auf dem Felde Gras geschnitten,
die andere will ihre Kuh auf die Weide führen. Die mit der Kuh bleibt
stehen, die mit der Karre hält an, und es werden ein paar Worte
gewechselt. Jede Bewegung ist ausgezeichnet beobachtet: Wie das Mädchen
den Strick hält, an den die Kuh gefesselt ist; wie diese das Gras an
der Straße abrupft, wie die zweite die Karre gefaßt hält, wie ein Mann
in Holzschuhen über die Straße geht, ein Junge eine Kuh treibt, ein
Ackerwagen dahinfährt, ein anderer Junge über einen Zaun steigt. Und
alles wird von einem weichen, grauen Licht und feuchter Luft umspült.
Die Pfützen auf der Straße spiegeln den Glanz des sich auflichtenden
Himmels wieder, und die nassen grünen Blätter der Linden an der Straße
schütteln sich über einem roten Häuschen.

Abb. 32. Das Tischgebet (1884).
Im Besitz des Herrn Claassen auf Knoop bei Kiel.
GRÖSSERES BILD

Abb. 33. Porträtskizze (1884).
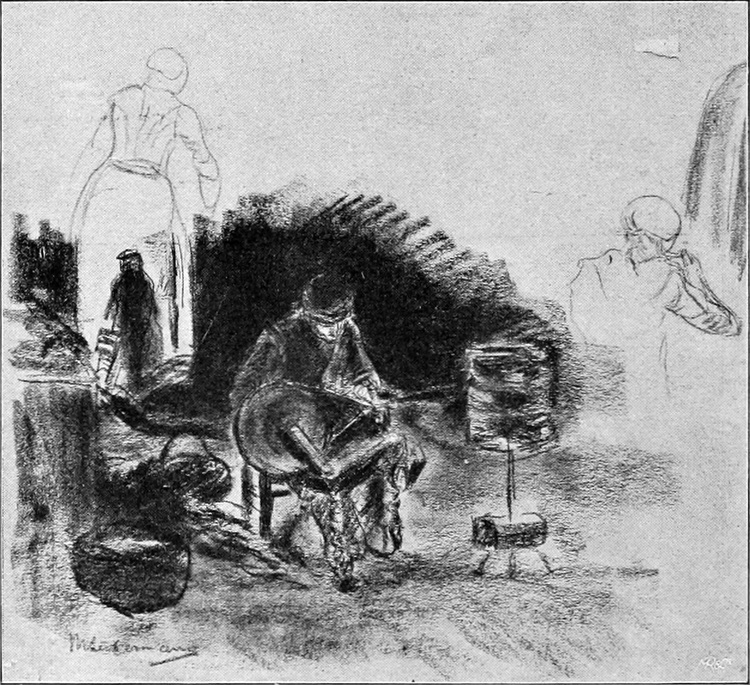
Abb. 34. Handzeichnung (1884).
Mit der „Flachsscheuer in Laren“ von 1887 (Abb. 44), einem der
wertvollsten Bilder der Berliner Nationalgalerie, tritt Liebermann in
die Periode seines Schaffens, die man die epische nennen möchte, wo er
eine Höhe, Macht und Vollendung der Anschauung und des künstlerischen
Ausdruckes erreicht hat, wie kein anderer zeitgenössischer Künstler.
Millet und Courbet haben zuerst gezeigt, daß der arbeitende Mensch
künstlerisch dargestellt werden könne, Courbet mit seiner massiven
Brutalität, Millet in zarter lyrischer Empfindung. Liebermann war es
vorbehalten, ihre Absichten ins Erhabene zu übertragen, das gewaltige
Schlußwort zu sprechen. Das Thema erscheint durch ihn vollkommen
erledigt, und Liebermann selbst hat sich, wohl aus Erkenntnis, daß er
Werke wie die „Flachsscheuer“ und die „Netzeflickerinnen“ in ihrer
Art nicht übertreffen könne, anderen Stoffgebieten zugewendet. Gegen
seine „Flachs[S. 36]scheuer“ wirkt Menzels vielbewundertes „Eisenwalzwerk“
kleinlich und komponiert. Man sieht auf Liebermanns Bild in einen
niedrigen, aus Holz gebauten Arbeitssaal, den links vier, hinten
ein Fenster beleuchten. Unter den Fenstern links sitzen auf kleinen
Bänken Burschen und Mädchen und drehen große Holzräder, die Spulen in
Bewegung setzen. In der Mitte des Raumes stehen, mit Flachsbündeln
unter dem Arm, aus denen sie die Fäden drehen, die jene aufspulen, fünf
Spinnerinnen, prachtvolle Gestalten von der Grenze des Kindesalters bis
zum reifen Weibe. Vor dem Fenster im Hintergrunde noch mehrere ähnliche
Erscheinungen, rechts ein paar Mädchen, die frischen Arbeitsstoff
bringen, und noch einige Spinnerinnen. Die Räder sausen, die Spulen
fliegen, und windschnell rühren die Mädchen die Hände, damit die
Fäden, die von ihnen aus bis zu den Spulen an den Fenstern gehen,
nicht reißen. Helles Licht strömt von links und von hinten durch den
Raum über die Köpfe der Raddreher fort und umspielt mit fröhlichem
Glanz die Gestalten der Spinnerinnen, ihre weißen Hauben und die
frischen Gesichter darunter, die blauen Schürzen, die dunklen Röcke,
die fleißigen Hände und den gelben Flachs. Es gleitet über die grauen,
mit Flocken bedeckten Dielen, die gelben Holzschuhe der Mädchen und
ruhet nimmer. Das Bild ist lebendig, wie die Wirklichkeit selbst: Man
denkt überhaupt gar nicht daran, daß es gemalt ist, und es ist doch
ganz anders gemalt, als die früheren Bilder des Künstlers, breiter,
wuchtiger, mit wenig Rücksicht auf Einzelheiten. Aber gerade diese
Art, wo eine Farbe einmal aus dem Ensemble stärker hervortritt,[S. 37]
weil das Licht sie voll trifft, andere Farben zurücktreten, weil sie
kein direktes Licht empfangen, gibt eine unvergleichliche Frische
und Wahrheit der Erscheinung. Die Impression gibt Impressionen. Das
Auge schafft da weiter, wo der Maler nur andeutet. Und wieder das
Wunderbarste: die Natürlichkeit. Keine Figur steht Modell, wie so
viele auf Menzels Bild. Alles ist wie die Wirklichkeit selbst, als
habe der Maler die Menschen heimlich durch einen Spalt in der Holzwand
beobachtet.

Abb. 35. Holländisches Mädchen
(1885). Zeichnung im königl. Kupferstichkabinett zu Dresden.
(Aus der Liebermann-Mappe. Verlag von Bruno & Paul
Cassirer in Berlin.)
Das landschaftliche Gegenstück zu diesem Prachtbilde sind die
„Netzeflickerinnen“ (Abb. 47) der Hamburger Kunsthalle, des
gigantischen Naturgefühles Liebermanns gewaltigste Offenbarung. Das
ist jenes Bild, vor dem man mit Leichtigkeit nachweisen könnte, daß
Liebermann ein kompletter Idealist ist. Jedenfalls hat niemand vor ihm
aus einem scheinbar so ärmlichen Gegenstande einen so reichen Schatz
erhabenster Poesie herausziehen und künstlerisch gestalten können.
Dabei ist weder der Natur oder, was dasselbe sagt, der Wahrheit die
geringste Gewalt geschehen. Man blickt über eine weite graugrüne,
öde Ebene, wie sie oft zwischen den Dünen und Deichen der Nordsee zu
finden ist. Auf dieser unendlichen, melancholischen Fläche sind Frauen
und Töchter der Fischer beschäftigt, die beim letzten Fange benutzten
Netze wieder in Ordnung zu bringen. Sie breiten sie auf den Boden
aus, um die beschädigten Stellen zu finden, ziehen die verzogenen
Maschen zurecht, ergänzen die zerrissenen mit der Filetnadel, knüpfen
und stopfen. Ganz in der Ferne fährt ein mit Körben beladener
Fischerkarren. Fast am Rande des Bildes sieht man vorn eine Gestalt
in das Bild hineinschreiten, eine junge Fischerstochter, groß, blond
und kräftig, mühsam ein schweres Netz schleppend. Und nicht allein mit
diesem hat sie zu thun, sondern auch mit dem heftigen Seewind, der
ihr im Rücken sitzt, sich in ihren Kleidern fängt und ihre blonden
Haare, die sie unter dem weißen Häubchen geborgen hatte, flattern
macht. Ein Sinnbild des im Kampfe mit den Elementen erstarkten Volkes
steht sie da, eine der charaktervollsten Erscheinungen, die Liebermann
geschaffen. Aber sie wäre bedeutungslos, wenn der sie nicht in diese
herbe, entsagungsvolle Natur hineingesetzt hätte, in dieses Stück Erde,
um das sich Sturm und Meerflut streiten, unter diesen[S. 38] grauen, von
zerrissenen Wolken bedeckten Himmel, inmitten dieser Menschen, die hart
um ihr Dasein ringen müssen. In innigerer Verbindung sind Mensch und
Landschaft kaum dargestellt worden, der auf seine Kraft angewiesene,
auf sich selbst gestellte Mensch und die rauhe Natur.

Abb. 36. Holländische Waisenmädchen
(1885). Im Besitz der Kunsthalle zu Hamburg.

Abb. 37. Holländische Dorfstraße
(1885). Im Provinzialmuseum zu Hannover.
GRÖSSERES BILD
Unter den Schöpfungen der folgenden Jahre erscheint noch einmal ein
Werk von fast gleich starker Wirkung: „Die Frau mit den Ziegen“
(Abb. 52), die der Münchener Pinakothek gehört. Auch hier wieder die
unlösbare Zusammengehörigkeit von Mensch und Scholle und wieder eine
ungemein[S. 40] charaktervolle Erscheinung, deren kräftige Silhouette gegen
die graugrüne Düne und den trostlos grauen Himmel man, einmal gesehen,
ebensowenig vergißt, wie die kühne jener blonden Fischerstochter. Wie
eine Personifikation der weltentrückten Einsamkeit zieht die Alte mit
ihren beiden Ziegen über die sandige Düne.
Mit dem „Spitalgarten in Leyden“ von 1890 kehrt Liebermann zu dem
Stoffkreis zurück, den er bereits in dem „Altmännerhaus“ mit so viel
Erfolg erschlossen hatte; aber in seiner Kunst ist schon mehr Freiheit,
sein Blick mehr auf das große Ganze als auf die Einzelheiten gerichtet.
Zogen in jenem Bilde die ernsten Gestalten der von dem Schauplatz des
Lebens abgetretenen Männer sogleich den Blick des Beschauers auf sich,
so sieht man hier zunächst den Spitalgarten mit seinen buntblühenden
Beeten und erst dann die alten Mütterchen auf den Bänken am Hause, die
der warme Sonnenschein hinausgelockt hat, wie sie, den Strickstrumpf
zwischen den welken, steifen Händen, die müden, alten Glieder wärmen.
Gibt er in diesem Werke eine Schilderung des vegetativen Daseins, so
zeigt er in dem Bilde „Die Seiler“ (Abb. 45) das Glück des stillen
Dahinarbeitens. Die ihre Taue drehenden Männer schreiten, unbekümmert
um jeden Zuschauer, ihre Bahnen unter dem grünen, sonnendurchleuchteten
Baumdach auf und nieder. Sie thun nichts, um den Zuschauer zu
amüsieren; sie arbeiten nur, und der Sonnenschein verklärt ihr Thun.

Abb. 38. Das Töchterchen des
Künstlers (1885). Besitzer: Der Künstler.
Der „Karren in den Dünen“ (Studie dazu Abb. 68) berührt noch einmal das
in der „Frau mit den Ziegen“ gelöste Motiv, ohne doch, obschon an sich
wieder eine durch ihre Selbstverständlichkeit imponierende Leistung,
die Wirkung jenes Bildes zu erreichen.
Im Jahre 1890 malt Liebermann das Bildnis des Hamburger Bürgermeisters
Petersen (Abb. 58) und stellt sich damit sogleich in die Reihe der
ersten Porträtmaler der Zeit. Die Verehrung des Künstlers für Franz
Hals wird in eine That umgesetzt, die die Bewunderung aller Kenner
findet, nur leider nicht die der Familie des Dargestellten, und die
darum bedauerlicherweise der Öffentlichkeit vorenthalten wird,[S. 41] der
sie von Rechts wegen gehört. Das Bildnis verdankt seine Entstehung
einer Anregung des um die Belebung des Hamburger Kunstlebens so hoch
verdienten Alfred Lichtwark, der es für die unter seiner Leitung
stehende Kunsthalle gewünscht hatte. Es stellt den etwas gebrechlichen,
alten Herrn in seiner schwarzen altholländischen Amtstracht mit dem
weißen Mühlsteinkragen, den spitzen spanischen Hut im Arm, vor einem
grauen Grunde stehend, dar. Auf den kräftig modellierten, von einem
kurzen Bart und starkem, weißem Haar umrahmten Kopf fällt volles Licht.
Der Darstellung fehlt jede Pose, wie der Künstler auch nichts gethan
hat, um die Runzeln und Falten des Alters auszulöschen. Man wird nicht
leicht ein geistreicher gemaltes Porträt finden und noch weniger leicht
eins, das trotz der altertümlichen Tracht keinen Zweifel darüber läßt,
daß der Dargestellte ein Mensch des neunzehnten Jahrhunderts ist. Um so
unbegreiflicher erscheint der Wunsch der Familie, daß das Bild in der
Kunsthalle nicht aufgehängt werde. Das später von dem Berliner Maler
Hugo Vogel gemalte und in der Kunsthalle zu sehende Bildnis desselben,
inzwischen verstorbenen Bürgermeisters ist die lobendste Kritik für
Liebermanns Schöpfung. Wie das Bildnis des Doktor Petersen nicht die
erste Leistung des Künstlers auf diesem Gebiete war, so blieb es, trotz
der ungünstigen Meinung der Familie des Porträtierten, nicht seine
letzte.

Abb. 39. Kinderstudie (1885).
Besitzer: Der Künstler.
Als Geschenk zu deren goldener Hochzeit schuf er 1892 das
Doppelbildnis seiner Eltern. Die Malerei ziemlich sachlich, die
Charakterschilderung sehr fein. Noch früher war das Bildnis
Wilhelm Bodes, des ausgezeichneten Direktors der Berliner Galerie,
entstanden, eine Kreidezeichnung für Schorers Familienblatt (Abb. 55).
Die Ähnlichkeit war schlagend, die Haltung des Gelehrten, der
Ausdruck, mit dem er die kleine Renaissancebronze in seinen Händen
kritisch prüft, von vollendeter Wahrheit. Nicht weniger hervorragend
als Persönlichkeitsschilderung war das Bildnis Fritz von Uhdes.
Die Porträts des Grafen Kayserlinck, des Professors Bernstein, ein
Damenbildnis, folgten. Besonders gelungen erscheint das Bildnis Gerhart
Hauptmanns (Abb. 63). Der feste Blick der sinnenden Augen unter der
geistreichen Stirn, der willensstarke Mund des Dichters der „Weber“
sind unglaublich gut beobachtet. Man hat[S. 42] sofort das Gefühl, einer
geistigen Gewalt gegenüber zu stehen. Das Bildnis Virchows (Abb. 71)
war bemerkenswert wegen der Sicherheit, mit der Liebermann den
durchdringenden Geist des Forschers mit der Zweifelsucht des Gelehrten
in dem Antlitz des berühmten Physiologen zu vereinigen gewußt hatte.
Eine überraschend farbenfrohe Leistung war das Porträt der Gattin des
Künstlers (Abb. 64), die en plein air auf einer Terrasse oder
einem Balkon sitzt. Die rosa Bluse der in einem Schaukelstuhl Ruhenden,
der orangefarbene Umschlag einer Zeitschrift, in der sie liest, die
helle sonnige Luft geben dem Bilde eine farbige Heiterkeit, die bei
Liebermann nicht gerade häufig erscheint. Eine der allerreizvollsten
Leistungen auf diesem Gebiete war das Bildnis der kleinen Käthe,
der Tochter des Künstlers, die in ihrem hellen Kleidchen vor einer
dunkelbraunen Renaissancetruhe steht und eifrig in einem Schälchen auf
ihrem Puppenherde rührt. In der auch lithographierten Zeichnung, die
Liebermann von Theodor Fontane gemacht hat (Abb. 81), sind sowohl die
Neigung für Humor, die der Dichter besaß, als auch sein liebenswürdiges
Poetentum und der vornehme, gute Mensch aufs glücklichste vereint zu
finden. Auch das Bildnis des belgischen Bildhauers Constantin Meunier
(Abb. 88) gibt die Art des merkwürdigen Mannes vorzüglich wieder. Aus
der letzten Zeit wären als besonders lebens- und geistvolle Schöpfungen
des Künstlers die Porträts des Dichters Eduard Grisebach (Abb. 75),
des durch seine Forschungsreisen in Persien bekannt gewordenen
Kunsthistorikers Dr. Sarre, des Kunstfreundes und Augenarztes
Dr. Max Linde in Lübeck und eines italienischen Herrn zu
erwähnen.

Abb. 40. Nähendes Mädchen (1886).
Federzeichnung.
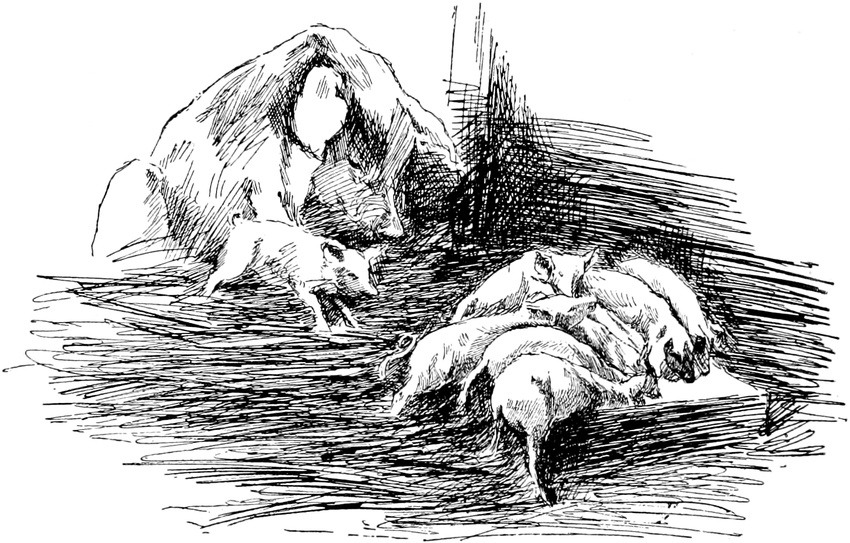
Abb. 41. Schweinefamilie (1886).
Federzeichnung.
[S. 43]

Abb. 42. Hände wärmen (1886).
Kohlenskizze.
Eine Sommerreise in die bayerischen Vorberge und nach Tirol 1893 lenkt
die Aufmerksamkeit Liebermanns auf ein Problem, das ihn schon in dem
„Altmännerhaus“ beschäftigt hatte: die Darstellung von Luft und Sonne
unter dem Grün der Bäume. Der Künstler hatte bemerkt, daß die Bewegung
der Blätter dem Sonnenlicht etwas Flimmeriges gibt, und daß dieses
Flimmern das Auge verhindert, einen Gegenstand in festen, bestimmten
Formen zu sehen. Um also einen der Wirklichkeit ähnlichen Eindruck
hervorzurufen, mußte auf etwas verzichtet werden, was bisher als ein
wichtiges Erfordernis in der Malerei galt, auf ein ausführliches
Betonen der Form. Der Künstler sah häufig unter der Wirkung des
zerstreuten Sonnenlichts nur einen aufleuchtenden Farbenfleck, wo
bei stetigem Licht unbedingt auch die Form vollkommen zur Geltung
gekommen wäre. Die Illusion des unter einem Blätterdache gefangenen
Sonnenlichtes ließ sich nur erreichen, wenn die aufdringliche
Sachlichkeit beseitigt wurde. Liebermann malte jene bekannten „Alleen
in Rosenheim“, wo die Sonne über dichten grünen Buchenkronen steht
und ihre Strahlen über den Waldboden tanzen läßt, immer und immer
wieder, bis er die Schwierigkeiten so weit überwunden zu haben
glaubte, um auch eine kompliziertere Aufgabe dieser Art bewältigen
zu können. Sie bot sich ihm in dem hübschen Städtchen Brannenburg,
nicht weit von Kufstein gelegen, wo es einen berühmten Biergarten mit
schönen hohen, alten Bäumen gibt. Diesen „Biergarten in Brannenburg“
(Abb. 67) hat Liebermann an einem schönen Sonntag, wenn von nah und
fern Gäste herbeiströmen, um sich an dem guten Biere des Wirtes im
Schatten der Bäume gütlich zu thun, gemalt. Die langen Bänke neben
den langen Tischen sind von Eingeborenen, Sommergästen und Fremden
dicht[S. 44] besetzt. Aus dem alten Wirtshaus links werden die Maßkrüge
getragen. Man ist lustig und guter Dinge; denn das Bier ist gut, und
der Aufenthalt unter den schattigen Bäumen angenehm. Man sieht sie alle
dasitzen, die braven Leute in der grünen Dämmerung, aber der vorwitzige
Sonnenschein blendet. Man bemerkt schon, daß da eine Bäuerin mit
weißen Hemdsärmeln, dort ein reicher Viehhändler, hier ein Stadtherr
sitzt, aber man erkennt die Menschen mehr an ihrer charakteristischen
Haltung, an einem besonderen Hut, an der aufleuchtenden Farbe des
Gewandes als an ihren Gesichtern. Die Illusion jedoch, daß man in einen
wohlgefüllten Gasthofsgarten voll schöner Buchenbäume blickt, in dem
die Sonnenstrahlen neckisch über den saubergekehrten Gang, über Tisch
und Bänke und die Köpfe der Leute hüpfen, ist vollkommen erreicht.
Das Liebermannsche Bild, eins der frischesten und heitersten, die er
gemalt, hängt jetzt im Luxembourg-Museum in Paris, für das es vom
französischen Staate erworben wurde. Ein noch komplizierteres Thema
behandelt der Künstler in dem „Schweinemarkt in Amsterdam“ von 1895, wo
ein Durcheinander von hin- und hergehenden Menschen, von Sonne, Luft
und Farben zu einem Bilde wechselvollster Lebensbethätigung gesammelt
erscheint.

Abb. 43. Schweinefamilie (1886).
Im Privatbesitz in Wiesbaden.

Abb. 44. Flachsscheuer in Laren
(1887). In der königl. Nationalgalerie zu Berlin.
GRÖSSERES BILD
Der sichere Blick Liebermanns für charaktervolle Typen, den man an
unzähligen Studien des Künstlers, die Männer und Frauen, Mädchen
und Kinder in allen möglichen Thätigkeiten darstellen, zu bewundern
Gelegenheit hat, ließ zwei sehr eigenartige Bilder entstehen, die wie
wenige andere von ihm dafür zeugen, daß in seinem Schaffen ein Zug ins
Monumentale vorherrscht. Es sind das die lebensgroßen Darstellungen
eines holländischen Käskopers, der einmal als „Schreitender Bauer“
(Abb. 69) (in der Königsberger Galerie), das andere Mal sitzend
ausruhend „In den Dünen“ (Abb. 74) (Leipziger Museum) von dem
Künstler gemalt wurde. Es gehört schon etwas dazu, aus einer solchen
Er[S. 46]scheinung, der die meisten Menschen im Leben nichts absehen
würden, ein Bild zu machen, ein lebensgroßes, anspruchsvolles
Bild; aber Liebermann fand keine Schwierigkeit darin, den Alten in
braunroter Jacke und geflickten Hosen, dessen Gesicht tausend Fältchen
durchziehen, in das volle Licht des hellen Tages hinzustellen und zu
malen. Und wie lebt dieser Kerl im Bilde, der seine Kiepe auf dem
Rücken, den derben Stock in der Hand, mit plumpen Stiefeln zwischen
den mit dürftigem grauen Hafer bewachsenen Dünen daherstapft! Nichts
Pathetisches in diesem wetterharten Gesellen, der, von dem schimmernden
Dünensande geblendet, die Augen zusammenkneift, nur Größe und Wahrheit.
Der sitzende Käskoper hat vor dem ein Jahr früher (1894) entstandenen
schreitenden vielleicht eine flottere malerische Behandlung voraus,
aber in der feinen Beobachtung der Wirklichkeit, besonders auch in der
schwierigen Wiedergabe der allseitigen Belichtung gibt keins der Bilder
dem anderen etwas nach.

Abb. 45. Die Seiler (1887).
Besitzer: Herr Geheimrat Dr. Hänel in Kiel.
Immer lebhafter fühlt sich der Künstler von solchen schwierigen
Lichtproblemen angezogen. Es reizt ihn, den Glanz der Sonne auf
unbekleideten Menschenkörpern zu malen, Reflexe wiederzugeben, die
von lichtgetroffenem Wasser und blitzendem Dünensande herrühren, und
er nimmt nach einem Aquarell, das badende Jungen an[S. 47] einem Landsee
zeigt, — auch als Radierung vorhanden (Abb. 84) — das große Bild
„Badende Jungen in Zantvoort“ (Abb. 86) in Angriff. Liebermanns Farben
sind nie die hellsten gewesen, und es ist nicht unwahrscheinlich, daß
seine „Badenden Jungen“ etwa neben der bekannten „Badenden“ von Anders
Zorn trübe und grau wirken würden; aber an sich ist das Liebermannsche
Bild so hell, so voll von Sonne, daß man förmlich geblendet ist,
wenn man längere Zeit auf diese von strahlendem Licht überschütteten
Knabenkörper, die glänzendweißen Hemden, den blinkenden Dünensand, das
funkelnde Wasser geschaut hat. Und welche Lichtwogen wirft erst der
halbbedeckte Himmel dem Beschauer ins Auge! Dabei ist nicht eine harte
Farbe, kein einziger starker Kontrast in dem Bilde. Milde und weich
umflutet die feuchte Luft alles: Land, Wasser und Menschen. Zugleich
bietet das Bild eine Fülle von Bewegungsmotiven. Alle Stadien des
Anziehens und des Abtrocknens. Diesen „Badenden Jungen“, die allerdings
bereits gebadet haben, von 1896 hat Liebermann 1899 eine wirkliche
Badescene entgegengesetzt, die die Jungen im Wasser zeigt, unter leicht
bedecktem Himmel, noch überzeugender und bei aller Helligkeit wunderbar
stark in der Farbe (Abb. 112). Ein Meisterwerk!

Abb. 46. Studie zu den
„Netzeflickerinnen“ (1887).
Neben jenem Zantvoorter Bilde hat Liebermann dann noch einmal „Weber“
gemalt, keine Wiederholung des köstlichen Arbeitsidylls von 1882,
sondern einen vergrößerten Betrieb mit vielen Personen und Maschinen,
auch nicht mit so viel Intimität in den Einzelheiten, aber mit erhöhten
Beleuchtungsschwierigkeiten.

Abb. 47. Die Netzeflickerinnen
(1888). Im Besitz der Kunsthalle zu Hamburg.
GRÖSSERES BILD
Das Jahr 1898 findet den Künstler wieder bei der Gestaltung von
Vorwürfen, die sich um die Darstellung von Menschen unter grünen
Bäumen, im Schein der Sonne drehen. Eins der liebenswürdigsten
dieser Bilder ist der „Sonntagnachmittag in Laren“ (Abb. 103) mit
den blitzsauberen fünf Mejsjes, die in ihrem Feststaat, mit blauen
und roten Schürzen und weißen Häubchen, Arm in Arm, lachend und
scherzend, die von[S. 48] Bäumen eingefaßte Dorfstraße entlangspazieren. Der
„Schulgang“ (Studien Abb. 94, 107, 108), der eine Fülle gutgesehener
Kindergestalten in farbigen Kleidern, dem vielfenstrigen Schulhause
zueilend, enthält, zeichnete sich durch Frische in der Darstellung
von Bewegungen laufender kleiner Mädchen, der „Kirchgang“ (Studie
Abb. 93) mit einer alten Bäuerin im Vordergrunde durch eine in ihrer
Bescheidenheit schöne, von warmer Sommersonne durchflutete Landschaft
aus. Dasselbe Jahr brachte dem Künstler die erste monumentale Aufgabe,
den Auftrag, den Festsaal eines in Mecklenburg gelegenen Schlosses
mit Fresken zu schmücken. Liebermann wählte eine Darstellung der
Jahreszeiten Sommer, Herbst und Winter (Abb. 101, 102) und gab darin
gleichzeitig einen Extrakt aus seinen Werken, wenigstens einige
besonders charakteristische Gestalten daraus, zugleich aber auch einige
für ihn neue Figuren, worunter der Pflüger hinter seinen[S. 49] Pferden
eine der vorzüglichsten ist, die er überhaupt geschaffen. Bei diesen
Arbeiten empfand man recht deutlich das Großzügige von Liebermanns
Kunst, seinen Geschmack, sein Gefühl für Raumwirkung und die unendliche
Vornehmheit seines farbigen Ausdruckes.
Im Jahre 1899 sammelte der Künstler Eindrücke für neue Arbeiten in
Scheveningen. Vor allem interessierte ihn das Leben am Strande. Er,
der bisher bestrebt war, die natürlichen Schönheiten der Nordseeküste,
das eigenartige Volk der Küstenbewohner und Fischer, den Menschen in
harter Arbeit, im mühseligen Ringen mit den Elementen, für die Kunst zu
gewinnen, findet Vergnügen daran, die internationale Gesellschaft in
einem Weltbade zu beobachten, den Reitern und Reiterinnen am Strande
nachzusehen, ein Auge auf glänzende Frauentoiletten zu werfen, sich um
die Haltung der Lawn-Tennis-Spieler zu kümmern, die Spiele der Kinder
zu inspizieren — kurz alles einzufangen, was ihm malerisch dünkt. Sein
Blick, der sich sonst an den reizvollen Dunkelheiten verräucherter
Fischerstuben, dem malerischen grauen Dunst der Dünen geweidet
hatte, fliegt durch die sonnendurchglänzte Luft über wohlgepflegte
Strandpromenaden, der Maler der Armen und Ärmsten achtet auf das
lustige Wehen weißer Strandkostüme, begeistert sich für Eleganz und
läßt diesen neuen Geist in glänzenden, freudigen, hellen Farben und
höchst amüsanten Kompositionen wiederklingen. Eine neue Jugend scheint
über ihn gekommen. Oder steht er vor neuen Zielen? Denn das ist das
Wunderbare an diesem Künstler, daß er immer vorwärts strebt, immer nach
neuen Wegen sucht, auf denen er der Natur entgegentreten, sie fassen
kann mit seinen starken Armen. Das erhebt ihn weit über diejenigen, mit
denen er einst in einer Reihe zu stehen schien. Er ist niemals fertig
in dem Sinne, daß er glaubt, auf dem erreichten Punkte stehen bleiben
zu können. Das Ziel der Meisten ist, in Behagen das gewonnene Ansehen
zu genießen, das Liebermanns ist, Kunst zu machen, die Grenzen seiner
Anschauung und seines Könnens zu erweitern. Mag man’s Ehrgeiz nennen,
wie man es auch heißen möchte — es bleibt künstlerischer Sinn, und
aus dem allein werden die großen Werke und der Ruhm geboren, der die
Jahrhunderte überdauert.
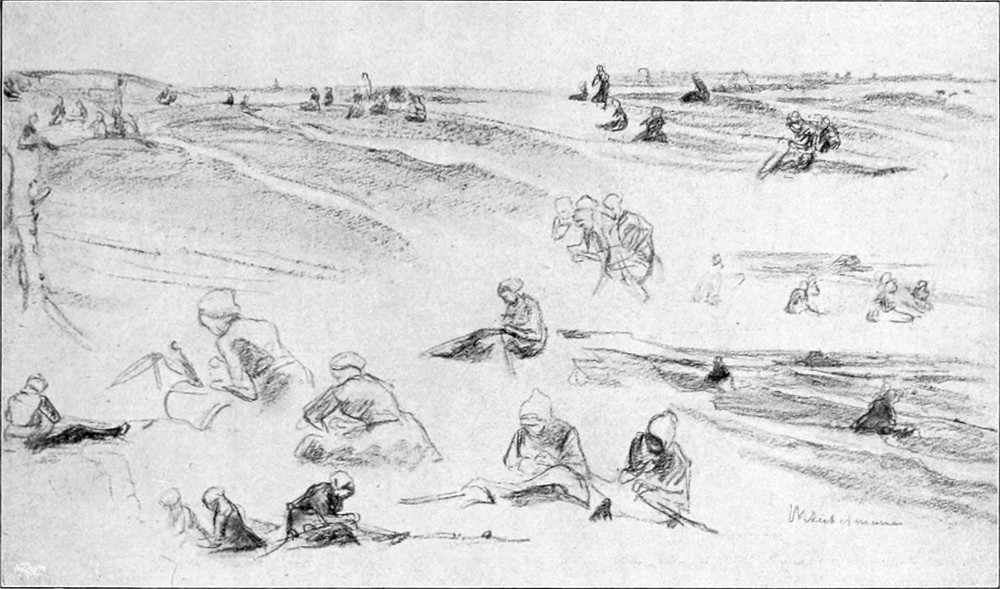
Abb. 48. Studie zu den
„Netzeflickerinnen“ (1887).

Abb. 49. Strickende Frau (1888).
Studie.

Abb. 50. Gedächtnisfeier für Kaiser
Friedrich in Kösen (1888). Im Privatbesitz in Berlin.
GRÖSSERES BILD

Abb. 51. Holländische Nähschule
(1889). Pastell. Im Privatbesitz in Berlin.
Liebermanns Thätigkeit ist im vorstehenden aber nur zum kleinsten Teil
geschildert worden. Weit größer als die Zahl seiner abgeschlossenen
Werke ist diejenige der[S. 50] der Meinung des großen Publikums nach
unfertigen, die man Skizzen oder Studien nennen mag. Es verlohnte
nicht, diese Arbeiten zu erwähnen, wenn in ihnen nicht ein großer Teil
von Liebermanns feinsten künstlerischen Offenbarungen steckte, und wenn
es möglich wäre, ein Bild von seiner eminenten Künstlerschaft zu geben,
ohne seine Leistungen auf dieser Seite einer eingehenden Betrachtung
zu unterziehen. Es gibt kaum einen zweiten Künstler in der Welt, in
dessen Studien und Skizzen sich der angeborene künstlerische Sinn so
auffällig bemerkbar machte, wie bei Liebermann. Wo andere ringen und
sorgen, das Richtige zu treffen, oder stümpern, folgt er ruhig seinem
Gefühl, und dieses ist bei ihm von einer solchen Zuverlässigkeit, daß
es ihn das Rechte sofort finden läßt. Das wunderbar wahre Wort Goethes:
„Das Werk eines großen Künstlers ist in jedem Zustande fertig“ paßt
prachtvoll zu Liebermanns Thätigkeit in dieser Richtung. Was heißt denn
das „Fertig“, von dem so viel gesprochen wird, wenn man neue Kunst zu
alter in Gegensatz bringen will? Gibt es überhaupt im letzten Sinne
„fertige“ Kunstwerke? Ganz gewiß nicht. Kunst besteht auch gar nicht
darin, etwas so fertig zu machen, so weit zu bringen, daß es mit der
Wirklichkeit verwechselt werden könnte, sonst wären die Figuren in
den Wachsfigurenkabinetten, die, wie gewöhnliche Menschen gekleidet,
herumstehen oder sitzen und vom Publikum ob ihrer Menschenähnlichkeit
angesprochen werden, die allerbewunderungswürdigsten Kunstwerke. Die
Kunst kann nie Wirklichkeit geben, nur den Schein derselben, und
dieser Schein soll Vorstellungen auslösen. Geschieht das nicht, so
taugt entweder die Kunst nichts oder der Beschauer hat kein oder nur
ein verkümmertes Vorstellungsvermögen. Die Kunst vermag Vorstellungen
allgemeiner Natur und solche[S. 52] besonderer Natur hervorzurufen.
Allgemeine sind die dimensionalen von Höhe, Breite und Tiefe, die
aufs innigste verbunden sind mit den Vorstellungen von Raum und
Form. Allgemeine Vorstellungen sind auch noch Mensch, Tier, Baum,
Gebäude u. s. w.; sie werden aber sofort zu besonderen, wenn dafür
gesetzt wird: Kind, Hund, Nadelbaum, Kirche. Je nach seiner Absicht
oder je nach Bedürfnis kann der Künstler allgemeine oder besondere
Vorstellungen erregen. Bis zu einem gewissen Grade vermag er z. B.
die Vorstellung von einem Menschen dadurch zu erzeugen, daß er ganz
oberflächlich die Verhältnisse einer menschlichen Gestalt, sei es mit
dem Zeichenstift, sei es mit Farbe auf einer Fläche richtig angibt.
Für bestimmte Zwecke genügt dieser angedeutete Mensch vollkommen, ist
für solch ein allgemeines Stadium fertig und kann sogar künstlerisch
gut sein. Die allgemeine Vorstellung von einem Menschen zu einer
besonderen und bestimmten zu machen, ist nur insoweit eine Aufgabe für
den Künstler, als es darauf ankommt, allgemeinen Vorstellungen eine
bestimmte Richtung zu geben. Soll die Vorstellung einer sich bückenden
Frau angeregt werden, wobei es nötig ist, daß man eine Frau sieht, die
diese und keine andere Bewegung macht, so ist es zunächst durchaus
nebensächlich, ob diese Frau näher zu erkennen ist oder nicht. Nur
eins ist bei den verschiedenen Stadien zur Erreichung bestimmterer
Vorstellungen unbedingt erforderlich: Daß das für das einzelne Stadium
Charakteristische herausgebracht ist. Man darf nicht in Zweifel sein,
ob die sich bückende Frau eine Verneigung macht, ob sie etwas aufhebt
oder eine Wurzel aus der Erde reißt. Und je einfacher die Mittel sind,
mit denen eine solche je nach Bedarf bestimmte oder unbestimmte, für
den einzelnen Fall aber charakteristische Vorstellung erzeugt wird,
um so größer die Kunst. Von hier aus wird man ausgehen müssen, um den
Begriff des Fertigen bei Kunstwerken festzustellen. Unfertig ist ein
Kunstwerk, im gegebenen Falle ein Bild dann, wenn es dem Künstler
nicht gelungen[S. 54] ist, die von ihm beabsichtigte Vorstellung beim
Betrachtenden zu erzeugen. Wenn Velasquez bei einigen seiner Porträts
die Vorstellung eines Mundes mit einem einzigen Pinselstrich gibt,
so mag dieser Mund sehr vielen Menschen auch unfertig erscheinen,
weil ihnen diese Art, einen Mund zu malen, zu einfach dünkt. Nun ist
aber die Art von Velasquez unzweifelhaft Kunst, während die Art, die
jenen Menschen als Kunst erscheint, der mühselig gemalte Mund mit den
deutlich sichtbaren Lippen und dem Glanzlicht auf deren Wölbungen,
meist nicht Kunst ist, sondern nur der allgemein üblichen Vorstellung
von einem Munde mehr entspricht. Der ganze Streit um „fertig“ und
„unfertig“ dreht sich also wohl darum, daß die Allgemeinheit unter
fertigen Kunstwerken solche versteht, bei denen die Ausführung der
Nebensächlichkeiten den konventionellen Vorstellungen von diesen
entspricht, unfertig dagegen jene nennt, bei denen das Wesentliche
auf Kosten der Nebensächlichkeiten charakteristisch und individuell
gestaltet wurde. Bei Beurteilung künstlerischer Leistungen kommt es
aber nur darauf an, ob es der Künstler vermocht hat, das, worauf es
ankommt, das Wesentliche, bestehe es nun in der Darstellung eines
Charakters, einer Erscheinung, eines Vorgangs, einer Bewegung, in der
Wiedergabe eines Licht- oder Farbenphänomens, einer Stimmung u. s. w.
charakteristisch und überzeugend zum Ausdruck zu bringen. Alle die
Bilder, auf denen die Nebensächlichkeiten die Hauptsache sind, kommen
als Kunstwerke gewöhnlich selten in Betracht; denn es widerspricht
dem Wesen der Kunst, der Natur in ihren tausend Einzelerscheinungen
zu folgen; sie muß generalisieren, muß ganze Erscheinungskomplexe
zusammenfassen, um bestimmte Eindrücke zu erzeugen.

Abb. 52. Die Frau mit den Ziegen
(1890). Im Besitz der königl. Pinakothek zu München.
GRÖSSERES BILD

Abb. 53. Ziegenstudien (1890).

Abb. 54. Junge mit Ziegen (1889).
Handzeichnung im Besitz der königl. Nationalgalerie zu Berlin.
Von diesem Standpunkt aus muß man, um das richtige Verhältnis zu ihnen
zu gewinnen, den Studien, Skizzen und Zeichnungen Liebermanns gegenüber
treten. Sie sind niemals fertig in dem gewöhnlichen Sinne, fast immer
aber fertig in jenem höheren, und darum nicht selten ganz hervorragende
Kunstwerke. In Liebermanns Kunst drängt alles ungestüm nach Charakter.
Für ihn gewinnen jedoch viele Erscheinungen erst Charakter durch
Bewegung, und er hat eine unglaubliche Gewandtheit darin erlangt,
Bewegungen zu beobachten und wiederzugeben. Von seinem „Mann mit der
Kuh“ (Abb. 85) sieht man eben nicht mehr, als den Rücken; aber auch
wenn dieser nicht gebeugt wäre, würde man aus der Art, wie der Mann
geht, den Schluß ziehen müssen, daß er alt ist. Die Kuh schnuppert
nicht nur am Grase, sie frißt; man kann gar nicht daran zweifeln. Wie
ausgezeichnet beobachtet ist die Bewegung des Jungen, von dessen[S. 55]
Ziegen die eine vor-, die andere rückwärts will (Abb. 54)! Die Studien
zu den „Spitzenklöpplerinnen“ (Abb. 19) und den „Netzeflickerinnen“
(Abb. 48), zum „Schulgang“ (Abb. 94), zu dem seine Sense dengelnden
Bauer (Abb. 60), zum „Schuster“ (Abb. 21) und viele andere sind
daraufhin anzusehen. Liebermann hat viele neue Bewegungsmotive in
die Kunst gebracht. Aber neben seiner außerordentlichen Fähigkeit,
mit einem Nichts von Mitteln zahlreiche Vorstellungen anzuregen,
wofür in besonderem Maße u. a. seine kleinen Landschaftszeichnungen
zeugen, treten noch zwei andere Eigenschaften bei seinen Studien und
Zeichnungen hervor, die ihn zu einer eigenartigen Erscheinung machen:
die malerische Empfindung und das sichere Gefühl für Raumwirkung.
Sollte man nicht glauben, daß einige der hier fast in Originalgröße
wiedergegebenen Blätter aus Liebermanns kleinem Taschenskizzenbuch, wie
„Kanal in Leyden“ (Abb. 105), „Kirmes in Laren“ (Abb. 109), „Schulgang“
(Abb. 94) Reproduktionen nach farbigen Originalen wären? Vermißt man
Farbe bei der Kohlenskizze der sich die Hände wärmenden Frau (Abb. 42),
bei der Kreidezeichnung „Nach Hause“ (Abb. 110), bei der Federzeichnung
„In den Dünen“ (Abb. 106)? Alle diese Blätter geben, obwohl sie
nur Zeichnungen, also schwarz und weiß sind, doch ganz vollkommene
Vorstellungen von den Farbenwerten (valeurs), die der Künstler
in der Natur fand. Natürlich kann man, wo es sich nicht um ein für
allemal feststehende Thatsachen, wie, daß Bäume grün, ein bewölkter
Himmel grau, ein Kornfeld gelb sind, handelt, über eine einzelne Farbe
im Unklaren sein, aber man ist niemals im Zweifel über das Verhältnis
der Farben zu einander, die Liebermann vor Augen hatte. Und das ist es,
worauf es ankommt. Zur Erreichung malerischer[S. 56] Wirkungen gehört aber
noch ein anderes: die Berücksichtigung der Lichtverhältnisse, im Grunde
also auch eine Darstellung von Bewegungen, aber nicht am Individuum,
sondern am Größeren, an der Natur. Hierin ist Liebermann ein Meister
ersten Ranges, und nur wenn es sich um Spezialbeobachtungen handelt,
wie etwa bei den Studienzeichnungen zum „Altmännerhaus“ (Abb. 15) oder
zu den „Konservenmacherinnen“ (Abb. 12) sieht er von einer Wiedergabe
luminaristischer Zustände ab. Welche bedeutsame Rolle spielt das Licht
bei dem schon erwähnten „Schulgang“ (Abb. 94), dem „Mann mit der Kuh“,
dem „Lesenden Mädchen“ (Abb. 66), bei dem Blatt „In der Sommerfrische“
(Abb. 98), bei der „Porträtstudie“ (Abb. 90), bei der Zeichnung des
Kindes in der Wiege (Abb. 57)! —

Abb. 55. Wilhelm Bode (1890).
Handzeichnung, im Besitz des Herrn Geheimrat
Dr. von Seidlitz in Dresden.

Abb. 56. Schweinefamilie (1890).
Im Privatbesitz in Berlin.
Nun zu dem Raumgefühl Liebermanns. Was heißt Raumgefühl? Zunächst
Empfindung für das Verhältnis der von einem Raum umschlossenen
Erscheinungen zu diesem, alsdann Empfindung für die wirkungsvollste
und richtige Verteilung der Erscheinungen im Raum und schließlich
für die Begrenzung des Raums selbst mit Rücksicht auf die von ihm
umschlossenen Erscheinungen und des mit diesen beabsichtigten
Eindrucks. Auf den Akademien sucht man den jungen Leuten eine Ahnung
von Raumgefühl in der Kompositionslehre beizubringen und kann doch
höchstens denjenigen damit einen Dienst erweisen, denen der Sinn für
räumliche Wirkung von Natur[S. 57] verliehen ist. Wäre Raumgefühl eine bei
der Mehrzahl der Künstler anzutreffende Eigenschaft, so würde man
keinen Grund haben, sie bei Liebermann zu rühmen. Raumgefühl spricht
sich darin aus, daß eine bildliche Darstellung, handele es sich um
ein Porträt, ein Figurenbild oder eine Landschaft, so beschaffen ist,
daß weder die Größe des dargestellten Gegenstandes zu der Fläche,
auf der er erscheint, noch der Ort, wo er auf dieser erscheint, noch
die Fläche selbst in ihrer Ausdehnung geändert werden können, ohne
eine empfindliche Schädigung der Gesamtwirkung herbeizuführen. Man
sehe daraufhin einmal Liebermanns Kohlenstudie „Kartoffelernte“ (Abb. 62)
an. Wäre es möglich, das Blatt nur um Fingersbreite irgendwo zu
beschneiden, ohne es des glücklichen und künstlerischen Verhältnisses
der Figur zur Scholle, der Scholle zur Luft zu berauben? Ganz gewiß
nicht. Die ganze Komposition müßte geändert werden, wenn auf der
Zeichnung „Junge mit Ziegen“ (Abb. 54) der Junge kleiner wirken sollte.
An den Verhältnissen des sitzenden „Käskopers“ in der Studie zum „Mann
in den Dünen“ (Abb. 73) kann auch nicht das Geringste geändert werden,
ohne das Beste an der Sache zu zerstören. Alles muß notwendig so
sein, wie es ist. Bei dem Bilde selbst hat Liebermann die Komposition
geändert, um das Abschließende der Dünen stärker zu betonen, als
ihre Öde. Der Kopf des Bauern ragt nicht mehr über die Horizontlinie
hinaus, sondern steht gegen das Graugrün der Düne. Um der Erscheinung
des Bauern mehr Masse zu geben, hat er ihn auf seinem Sitz mehr
vorgerückt, und die Kiepe auf dem Rücken spricht stärker mit, indem
man sie unverkürzt sieht. Man könnte die Aufstellung solcher Beispiele
für das feine Raumgefühl Liebermanns ins Unendliche fortsetzen. Nur
auf seine Bildnisse sei noch hingewiesen, wo es sich ebenfalls auf das
glücklichste offenbart. Aber das Lob, das man dem Künstler in dieser
Richtung spendet, würde übertrieben gescholten werden können, wenn man
nicht gleichzeitig betonte, daß Liebermanns Raumgefühl eine natürliche
Gabe ist, nicht das[S. 58] Produkt einer Überlegung. Es läßt sich manches
durch Herumprobieren finden, bei Liebermann ist die Entscheidung für
das Richtige, Wirksame sofort da. In dieser Selbstverständlichkeit
liegt ein großer Teil des Reizes, den des Künstlers flüchtige
Studienblättchen ausüben.

Abb. 57. Schlafendes Kind (1890).
Handzeichnung.
Eine gleich bedeutsame Begabung zeigen seine Ölstudien nach der
Seite der Farbengebung. Man möchte die Menschen bedauern, die nur
Klecksereien in einigen von diesen flüchtigen Farbennotizen sehen;
denn sie entbehren den großen Genuß, etwas unendlich Geschmackvolles
bewundern zu können. Es gibt für an großen malerischen Kunstwerken
erzogene Augen kaum einen angenehmeren Genuß, als gemalte Studien
Liebermanns anzusehen. Die Harmonie seiner wenigen Farben ist zuweilen
von hinreißender Schönheit, zeugt aber in den meisten Fällen mindestens
von einem ganz selten feinem Geschmack. Er verwendet niemals reine,
sondern fast immer gebrochene Farben, ohne daß diese jedoch flau oder
schwächlich wirkten — im Gegenteil! Das Ensemble seiner Farben ist
stets kräftig und sogar ausgesprochen herb. Der Künstler haßt in der
Farbe nur jede Brutalität, das Schreien und das Effektvolle, was so
vielen als das eigentlich Malerische gilt. Wenn die Bezeichnung nicht
den Beigeschmack von etwas Nachgemachtem, Akademischem hätte, möchte
man sagen, seine Farbengebung sei von altmeisterlicher Schönheit. Der
Künstler begegnet sich mit den alten Meistern jedoch nur in jenem
höheren Sinne, in dem alle große Kunst sich ähnlich sieht. Liebermanns
Kolorit ist viel zu individuell, als daß es von irgendwoher übernommen
sein könnte, aber es ist so fein, daß seine Bilder oder auch nur seine
gemalten Studien in eine Galerie alter Meister aufgehängt, neben den
Bildern der Alten ebensowenig verlieren würden, wie sie neben einem
japanischen Holzschnitt verlieren. Wer für das sprühende Temperament,[S. 59]
den Reiz der Handschrift in Liebermanns hingehauenen Studien kein
Verständnis besitzt, sollte wenigstens die außerordentliche Kultur
bewundern können, die in Liebermanns Farben steckt.

Abb. 58. Bürgermeister
Dr. Petersen † (1890).
Im Besitz der Kunsthalle zu Hamburg
Was an den Handzeichnungen des Künstlers zu rühmen war, gilt natürlich
auch für seine Radierungen. Es ist klar, daß jemand, der so malerische
Zeichnungen produziert, auch in seinen Nadelarbeiten nach ähnlichen
Wirkungen strebt. Zu den Tugenden von Liebermanns Handzeichnungen
treten nun noch die Zufälligkeitsreize der Radierung. Zu leichte oder
zu starke Ätzung der Platte, Verletzungen des Ätzgrundes, Entgleisungen
der Nadel, stehengebliebener Grat u. s. w. Vor einem Teil seiner
Radierungen muß man fast an Kohlenzeichnungen denken, so derb und rauh
und breit ist die Nadel über die Kupferplatte gefahren. Eine Zeit
lang hat er die Technik des vernis mou sehr bevorzugt;[S. 60] denn
diese Art, wo die Zeichnung auf einem über den erweichten Ätzgrund
gelegten dünnen Papier gemacht wird, gewährte ihm die Möglichkeit,
etwas herauszubringen, was seinen Handzeichnungen ähnlich sah und
gelegentlich noch malerischer wirkte. In der letzten Zeit findet er
Vergnügen daran, mit der kalten Nadel zu arbeiten. Die äußerst feinen
Linien, die die Schneidenadel in das Kupfer gräbt, sind sehr geeignet,
die Farblosigkeit von Dünenlandschaften, die weiche verschleiernde
Luft der Küste und duftig in der Ferne auftauchende Kirchtürme und
Maste wiederzugeben (Abb. 80). Und gerade diese Blätter sind es, vor
denen die Erinnerung an Rembrandt wach wird, an die sich weithin
dehnenden Ebenen und freien, hohen und weichen Lüfte seiner radierten
Landschaften.

Abb. 59. Die Schäferin (1890).
Besitzer: Fürst Lichtenstein in Wien.
[S. 61]
**
*
Wenn die neuere Kunstbetrachtung auch den Grundsatz hat, die Bewertung
von Kunstwerken nicht mehr in Abhängigkeit zu bringen von dem
Gegenständlichen, wenn sie auch überzeugt ist, daß ein gutgemalter
Kürbis ein größeres Kunstwerk ist, als eine schlechtgemalte Hochzeit
zu Cana, so steht sie doch nicht an, innerhalb der guten Malerei auch
dem Stoffgebiet eine bestimmende Stellung einzuräumen; denn sie kann
sich der Einsicht nicht verschließen, daß ein größerer Aufwand von
künstlerischer Intelligenz und Konzentration dazu gehört, eine Summe
von Lebenserscheinungen zusammenzufassen, als die Zustände eines
einzelnen leblosen Objekts darzustellen. Es ist einfach undenkbar,
daß Liebermann die Stellung als Künstler einnehmen würde, die man ihm
zuerkennt, wenn er nur Stilleben gemalt hätte, und ebensowenig wäre
man geneigt, das Genie Menzels besonders hoch einzuschätzen, würde er
sich darin erschöpft haben, die Reliquien des Rokoko künstlerisch zu
verherrlichen. Neben dem Künstlerischen hat auch der Stoff in der Kunst
seine Bedeutung. „Alles Talent ist verschwendet, wenn der Gegenstand
nichts taugt.“ Ein schöner Teil von Liebermanns Erfolgen beruht
unzweifelhaft auf dem Gegenstande seiner Kunst, und deshalb verdient
auch dieser eine nähere Betrachtung.

Abb. 60. Der Dengler. Radierung
auf weichem Grunde (Vernis mou) 1890.
Mit Erlaubnis der Photographischen Gesellschaft zu
Berlin.

Abb. 61. Katwyk (1890).
Zeichnung.
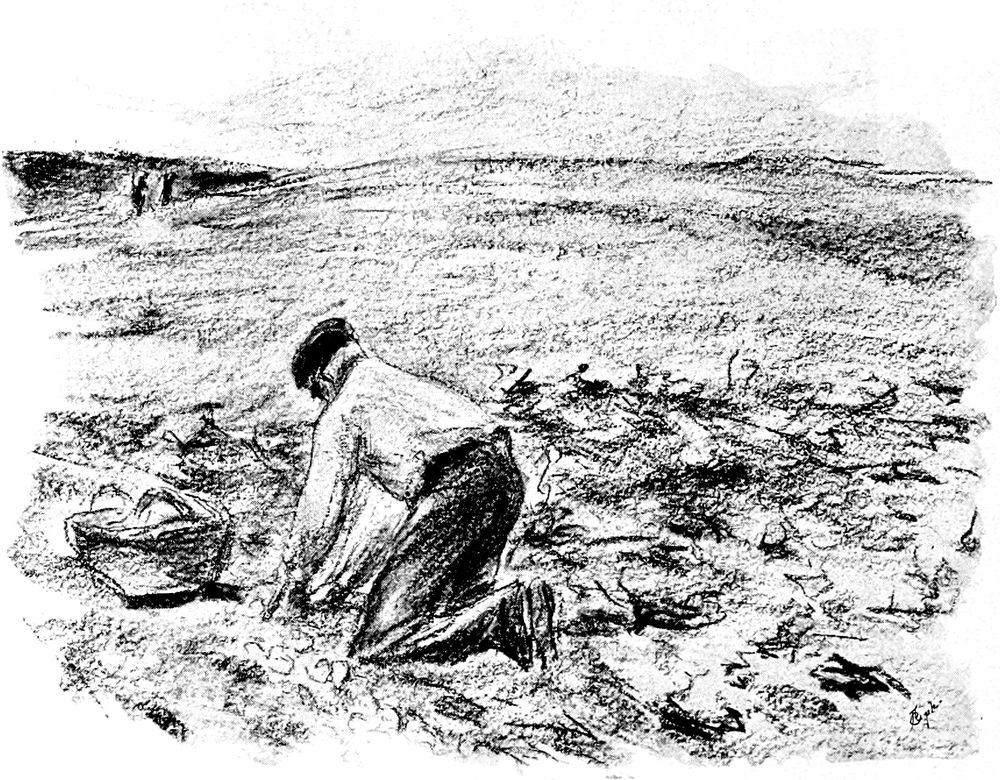
Abb. 62. Kartoffelernte (1891).
Kohlenstudie.
Es liegt eine gewisse Ungerechtigkeit darin, Liebermann immer als
den Nachfolger, wenn nicht gar Nachahmer Millets hinzustellen,
auch hinsichtlich seines Stoffgebietes. Wenn er nicht über Millet
hinausgekommen wäre, so würde man ebensowenig von ihm sprechen, wie
man von Fritz Werner spricht, der sich bemühte, die Wege Menzels[S. 62]
zu gehen. Man unterschätzt Liebermanns künstlerische Gesinnung und
die neue Schönheit, die er in die Kunst gebracht hat, wenn man ihren
Ursprung außer ihm sucht und zu finden meint. Niemand wird leugnen,
daß er derjenige war, der in Deutschland den Blick auf die Wandlungen
gelenkt hat, die in der französischen Kunst seit 1860 vor sich gegangen
waren, und so gleichsam ein Apostel neuer künstlerischer Lehren
geworden ist; wäre aber nicht zugleich ein starker Strom persönlicher
künstlerischer Macht von ihm ausgegangen, so würde man sich in
Deutschland vielleicht heute noch nicht viel um Millet und seine
künstlerischen Grundsätze bekümmern. Millet hat Barbizon entdeckt, mit
seinen stillen, wehmütigen Bauern, die, als verrichteten sie feierliche
Handlungen, das Feld bestellen, Bäume fällen, Strümpfe stricken und
Ähren sammeln. Liebermann zog für die Mitwelt den Schleier fort,
hinter dem eine vergessene Welt lag, voll Eigenart und Schönheit; er
that die Thüren auf zu den Schatzkammern, aus denen die feinsten Maler
des siebzehnten Jahrhunderts geschöpft, er fand Holland wieder, das
malerischste Land der Welt. Die Rousseau, Troyon, Daubigny, Dupré, die
Ehrwürdigen von Fontainebleau hatten die Prinzipien der holländischen
Landschafter des siebzehnten Jahrhunderts für die Gegenwart lebendig
gemacht. Liebermann ging zu den Quellen. Er hatte den Mut, sich
nicht darum zu kümmern, was und wo die anderen gemalt; er sah selbst
zu, was es zu malen gab. Diese Selbständigkeit im Ermitteln von
malerischen Motiven kündigt sich freilich in seinem ersten Bilde, den
„Gänserupferinnen“, noch nicht an. Die Idee zu solchen Bildern lag
in der Luft. Paul Meyerheim hatte 1871 eine „Schafschur“ gemalt. Es
sei ferner an Hirth du Frênes’ „Hopfenernte“ erinnert, auf der sich
sogar auch der dem Ostade, Jan Steen oder irgend einem anderen der
holländischen Sittenmaler abgesehene Lichteffekt mit dem Fenster im
Hintergrunde und den darunter in schummeriger Beleuchtung stehenden
Personen vorfindet. Nur daß Rudolf Hirth noch nicht so völlig darauf
verzichtet hatte, dem Publikum etwas zu erzählen und inmitten
der in ihre Arbeit vertieften Weiber[S. 63] ein Liebespaar setzt. Auch
Liebermanns erste „Konservenmacherinnen“ — die Abb. 3 gibt die zweite
Wiederholung; das im Leipziger Museum befindliche 1878 gemalte Bild
hat damit weder in Farbe noch Komposition Ähnlichkeit — zeigen noch
keine veränderte künstlerische Anschauung. Das Licht- und Schattenspiel
rechts im Hintergrunde ist beibehalten. Aber schon in den „Invaliden“
von 1874 kündigt sich die Gabe Liebermanns, eigenartige neue Motive aus
der Wirklichkeit herauszusehen, an, und auch die künstlerische Idee
gelangt fester und stärker zum Ausdruck. War auf den ersten Bildern die
Lichtquelle im Hintergrunde nur Episode, um dessen nächtliche Schwärze
aufzulichten, so ist sie hier eben schon hauptsächliche künstlerische
Idee, mit Verständnis, aber noch nicht eigentlich in einem neuen Sinne
durchgeführt. Auch der „Bauernhof“ von 1875 (Abb. 6) zeigt ein damals
noch ungewöhnliches Motiv, zugleich aber schon ein bemerkenswert
sicheres Gefühl für die Verteilung der hellen und dunklen Flecken im
Bilde.
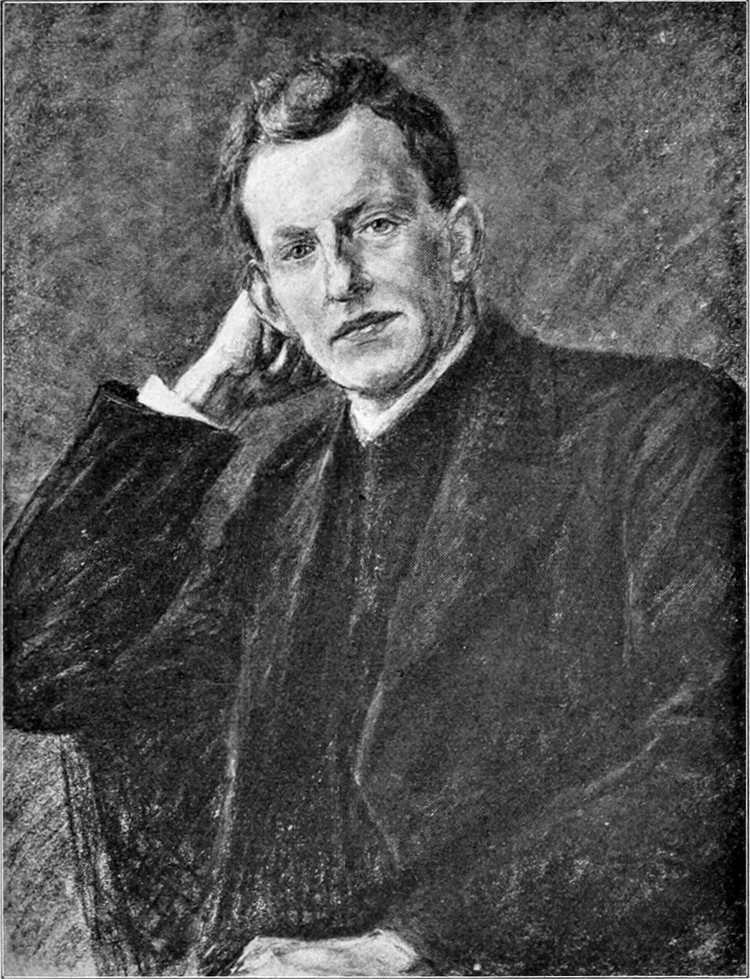
Abb. 63. Gerhart Hauptmann.
Pastell 1892. Besitzer: Fürst Lichtenstein in Wien.

Abb. 64. Damenbildnis (1892).
Im Privatbesitz in Berlin.
Den „Arbeitern im Rübenfelde“ glaubt man anzusehen, wie sich der
Künstler bemüht hat, dem Bannkreise Millets fern zu bleiben. Während
Millets Gestalten dessen Landschaften leicht beherrschen, läßt
Liebermann die Landschaft das große Wort führen. Die Figuren der
Arbeiter gehen fast darin auf. Daher erscheinen sie weniger bedeutend,
als die Millets, obgleich ihnen der Künstler einen gewissen starken
Ausdruck hat geben wollen. Von nun an läßt den Künstler die Empfindung,
daß es ein Mittel geben müsse, die Einzelerscheinungen zu Gunsten[S. 64]
einer größeren Gesamtwirkung zurücktreten zu lassen, nicht mehr
los. Daß es der bloße „Ton“, den es nur in Bildern und nicht in der
Natur gibt, nicht sein könne, wird ihm immer klarer, und er versucht
zunächst, das Sonnenlicht als Medium zu benutzen. Das kleine Bild
„In den Champs Elysées“ steht am Anfang der Versuche; es folgt das
„Altmännerhaus“ und als brillantes Schlußstück der „Waisenhaushof“.
Alle drei Bilder lassen wieder den fabelhaft sicheren Blick für
wirksame Motive bemerken. Dergleichen war noch nie gemalt worden. Hatte
das Sonnenlicht, das die Wärterinnen mit den Kindern auf der Bank
im Grünen umfloß, den Zweck, das Anmutige des Vorganges zu erhöhen,
so diente es auf den beiden anderen Bildern dazu, das Mitgefühl des
Beschauers mit den dargestellten Personen zu dämpfen, das an und für
sich Traurige der Situation der alten Hospitaliten und der elternlosen
Kinder zu verdecken. Dabei war kein Angriff auf die Wahrheit gemacht.
Man konnte das gegebene Objekt nicht leicht natürlicher in den Dienst
einer künstlerischen Absicht stellen. Heute, wo man die Entwickelung
Liebermanns ganz oder doch zum größten Teil überschauen kann, bewundert
man freilich weniger die Durchführung der künstlerischen Absicht, als
die ungeheure Energie, mit der der Künstler sich die Sache selbst
erobert hat. Es ist alles gesagt, kein ungelöster Rest geblieben,
eine Fülle von individuell schönen Erscheinungen, schönen Bewegungen
und schönen Farben gegeben. Nirgends eine Spur von Koketterie, sei es
mit technischen Fertigkeiten oder mit den Neigungen des Publikums.
Die „Kleinkinderschule“, die „Frau am Fenster“ und die „Schuster“
zeigen die Anwendung der gleichen künstlerischen Idee auf Innenräume,
zum Teil schon in meisterhafter Weise. Die vereinfachten Motive in
den beiden letzten Bildern erlauben dem Künstler der Beobachtung der
Zustände eine größere Aufmerksamkeit zu[S. 65]zuwenden, die künstlerische
Absicht konzentrierter zu geben. Bei der „Frau am Fenster“ und noch
auffallender bei den „Schustern“ beherrscht das Licht alles, so daß das
Sachliche eigentlich nur noch als dessen Träger erscheint. Hier ist der
Anschluß an die alten Meister bereits vollkommen erreicht, ohne daß
er durch historische Kostüme oder den sogenannten Galerieton markiert
wäre, lediglich durch das Bestreben in ihrer Art zu arbeiten, die im
fortwährenden Befragen der Natur bestand.

Abb. 65. Kinderbildnis (1892).
Federzeichnung.
Es ist hier vielleicht die beste Gelegenheit, darzulegen, warum das
eine That war, und warum die „Schuster“ Liebermanns ein größeres
Kunstwerk sind, als etwa Pilotys „Seni an Wallensteins Leiche“.
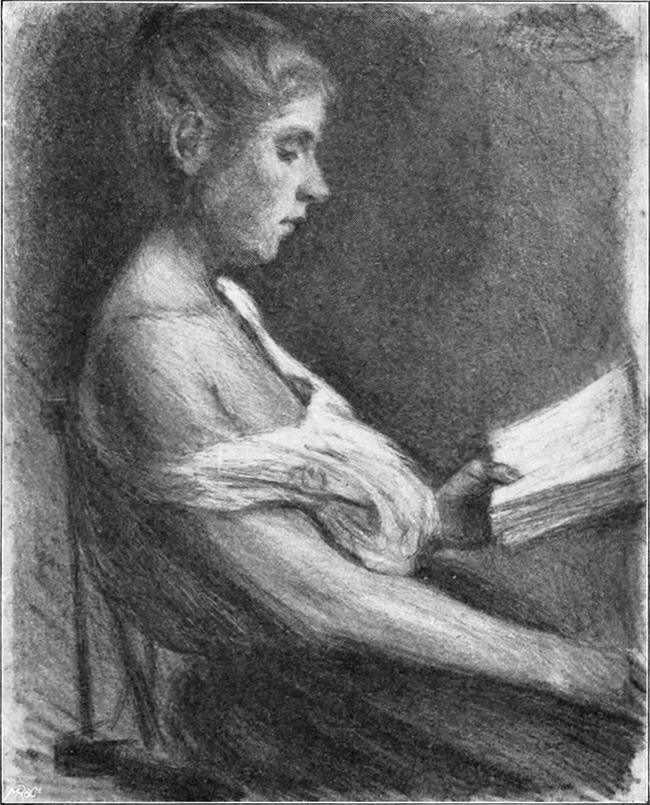
Abb. 66. Lesendes Mädchen (1893).
Originallithographie.

Abb. 67. Bierkeller in Brannenburg.
(1893). Galérie du Luxembourg in Paris.
GRÖSSERES BILD
Eigentlich wäre die Sache schon erledigt, wenn man darauf hinwiese,
daß Pilotys Bild eine Theaterscene sei, die „Schuster“ aber ein Stück
Wirklichkeit vorstellten. Nun könnte jedoch gesagt werden, daß der
selige Piloty sicherlich nicht ohne Modell gearbeitet, also auch
Wirklichkeit vor sich gehabt habe, genau wie Liebermann.[S. 67] Das läßt
sich nicht leugnen; es kommt nur darauf an, ob man der Wirklichkeit
die üblichen oder die feineren Schönheiten absieht. Auf Pilotys Bild
wird das Licht des grauenden Morgens von seidenen Stoffen und Vorhängen
zurückgeworfen, ein Durcheinander von prächtigen Farben glänzt auf.
Das Auge wird durch eine Fülle schöner, wohlklingender Töne geblendet.
Ein starker Effekt. Liebermann bedarf keiner glänzenden Farben, um die
Suggestion des Lichtes zu erzeugen, er wendet keines der Mittel an, die
man schon hundertmal gesehen, malt nicht Rezeptlicht, sondern jenes
Licht, das man nirgendwo anders sehen konnte, als in jener Werkstatt
mit dem breiten Fenster. Er malte kein lebendes Bild, sondern das
Leben, keine übernommene Anschauung, sondern eigene. Piloty konnte
nur eine überlieferte Vorstellung von Licht geben; denn er schilderte
kein persönliches künstlerisches Erlebnis, sondern ein geschichtliches
Ereignis. Von der Seite des Stoffes betrachtet, sind Seni und der tote
Wallenstein bedeutendere Erscheinungen, als der Schuster mit seinem
Lehrling; aber künstlerischer angesehen und wiedergegeben sind diese,
und sie stehen so hoch über jenen, wie das Leben über einem Schauspiel,
wie individuelle Beobachtung über konventionellem Nachahmen steht.

Abb. 68. Karre in den Dünen
(1894). Zeichnung.
In Liebermanns „Bleiche“ bemerkt man das Bestreben des Künstlers, die
Einzelheiten zurücktreten zu lassen, bereits deutlicher. Ein ruhiges
mildes Licht waltet im Bilde. Auch der „Weber“ ist schon einfacher
gemalt, als der „Schuster“. Zwischen diesen Werken erscheinen immer
wieder einige frühere Absichten noch einmal aufgenommen, wie bei der
„Zimmermannswerkstatt“ von 1879 (Abb. 9) und jenen alten „Spinnerinnen“
(Abb. 17). Der „Münchener Biergarten“ ist eine Fortentwickelung
und Vollendung der in den „Champs-Elysées“ angerührten Ideen. Die
„Holländischen Waisenmädchen“ von 1884 (Kunsthalle in Hamburg) (Abb. 36)
stehen in Zusammenhang mit den Waisenmädchen von 1881. Neben der
reizend intimen „Dorfstraße“ (Abb. 37) erscheint 1885 ganz unvermittelt
ein breit und keck gemaltes Bild der kleinen Tochter des Künstlers
(Abb. 38) im weißen Kleidchen, die mit einer roten Puppe spielt. Man
muß nun doch schon einen alten Meister zitieren, um den Eindruck dieses
Bildes nach der künstlerischen Seite hin festzustellen: Franz Hals.
[S. 68]

Abb. 69. Schreitender Bauer
(1894).
Im städtischen Museum zu Königsberg i. Pr.
Die 1886 gemalte „Schweinefamilie“ (Abb. 43) ist ein kühner Griff in
eine bisher für nicht darstellungswürdig gehaltene Sphäre. Das Publikum
sah nur, daß sich jemand erkühnte, ihm empörende Dinge anzubieten.
Der Gipfel des Naturalismus schien erreicht. Daß es Kunst war, die
sich darin offenbarte, wie Liebermann das lustige Gewuhsel kleiner
Ferkel am Futtertroge dargestellt, beachtete man nicht. Dann kam
die „Flachsscheuer in Laren“, das erste Bild des Künstlers, wo die
zeichnerische Durchbildung zurücktritt und die Form nur noch durch
Farbe unter Wirkung des Lichtes herausgebracht wird. Nicht allein die
Arbeitenden scheinen sich zu bewegen, man meint auch die Bewegung der
Luft zu sehen, die von den sausenden Rädern und fliegenden Spulen
erzeugt wird. Man hat nicht mehr den Eindruck von etwas Beobachtetem,
sondern den von Wirklichkeit. Noch gewaltiger erscheinen die
atmosphärischen Mächte in den „Netzeflickerinnen“. Der Sturm braust,
der salzige Odem des Meeres umhüllt Menschen und Landschaft. Nichts
von Zeichnung im gewöhnlichen Sinne, aber großartige Silhouetten und
eine Charakteristik der Bewegungen, wie sie noch nicht in der Kunst
existiert hat. Dann die „Frau mit den Ziegen“. Es wird immer bewundert
werden, wie Liebermann darin die Suggestion von Licht hervorruft. Gar
keine Gegensätze von Hell und Dunkel, sondern eine fast gleichmäßige,
trübe Farbe; dabei aber eine Leuchtkraft, als ob man in die Natur
sähe. Man müßte schließlich wieder alle Bilder des Künstlers einzeln
durchnehmen, um zu zeigen, wie er nicht nur[S. 69] durch neue, noch von
keinem Früheren entdeckte Stoffe, sondern auch durch eigenartige
Behandlung derselben wirkt.
**
*

Abb. 70. Studie zum schreitenden
Bauer (1894).
(Aus der Liebermann-Mappe. Verlag von Bruno & Paul
Cassirer in Berlin.)
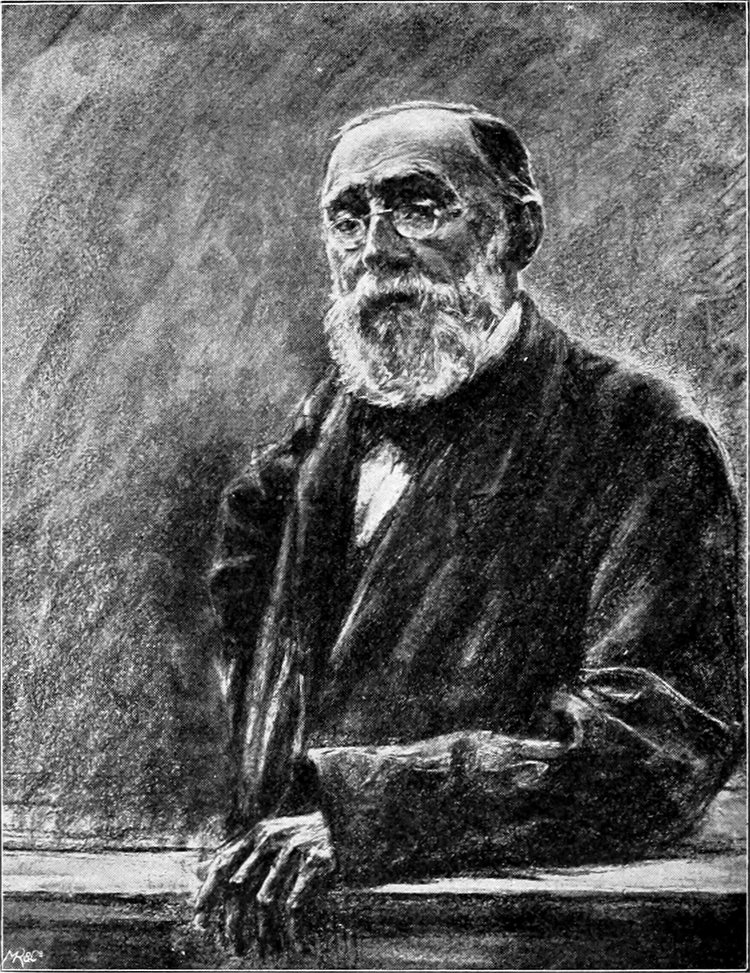
Abb. 71. Rudolf Virchow (1894).
Pastell. Im Privatbesitz in Berlin.
Was ist nun aber das Wesentliche in Liebermanns Kunst, ihr Sinn,
ihre Schönheit, und warum hat sie in so starkem Maße die Kunst am
Ausgang des neunzehnten Jahrhunderts beeinflussen können? Die Frage
ist ebenso leicht zu stellen, wie sie schwer zu beantworten ist.
Liebermanns Vorliebe für die scheinbar gleichgültigsten Dinge, für
wenige, schlichte Farben, für arbeitende Menschen, für Licht, seine
Abneigung gegen alles sogenannte Ideale, gegen Pose und Pathos und
gemeine Sensationen sind Charaktereigentümlichkeiten von ihm, aber das
Wesen seiner Kunst wird damit noch nicht gekennzeichnet; denn Kunst
ist, außer einer Summe von Fähigkeiten und Eigenschaften, auch das
Ergebnis einer Weltanschauung, wenigstens kann man das von jeder großen
Kunst behaupten. Weltanschauung! Wie schaut Liebermann die Welt
an? Die Einen sagen mit den Augen eines unerbittlichen Naturalisten,
die Anderen behaupten mit den Augen eines Mitleidigen. Vor allem sieht
Liebermann aber die Welt wohl als Maler an. Er hat selbst einmal
ausgesprochen, daß es ihm darum ginge, die Natur malerisch aufzufassen,
daß er keineswegs das sogenannte Malerische wolle, sondern die Natur[S. 70]
in ihrer Einfachheit und Größe. Sein Naturalismus bestand darin, daß
er der Ansicht war, man merke in den vorhandenen Bildern zu deutlich,
daß die Natur für den besonderen Zweck zurecht gemacht worden; und
sein Mitleid ist auf die einfache Erkenntnis zurückzuführen, daß man
Natürlichkeit dort suchen müsse, wo sie noch vorhanden sei, beim
Volke. Liebermann fand ferner, daß Malerei ein Handwerk geworden war
und aufgehört hatte, eine Kunst zu sein. Man bemühte sich nicht mehr,
das in der Natur selbst Gesehene, sondern dafür durch Übereinkommen
festgesetzte Hieroglyphen auf die Leinwand zu bringen. Er wagte es,
dieses Übereinkommen für albern, für der Kunst schädlich und gegen
ihre Weiterentwickelung gerichtet zu erklären. Er hat aber niemals
behauptet und zu beweisen gesucht, daß die ganze Kunst darin bestände,
die Natur nachzuahmen, und wenn man ihn für einen Naturalisten hält, so
nimmt man Natürlichkeit für Natur. Kunst besteht niemals in Nachahmung,
sondern in einem Übersetzen der Natur. Kunst setzt Empfindung und
geistige Thätigkeit voraus, und das aufgewendete Maß beider bestimmt
den Wert ihrer Erzeugnisse. Die Benutzung der Hieroglyphe aber drückt
den Aufwand von geistiger künstlerischer Thätigkeit auf ein Minimum
herab und beschränkt den Ausdruck der persönlichen Empfindung in hohem
Grade. Der vielgescholtene Naturalismus Liebermanns besteht eigentlich
nur darin, daß er darauf verzichtete, die Stoffe zu malen, die alle
malten, und so zu malen, wie die Akademien lehrten, kurzum, daß er das
Schema haßte und statt der bewährten alten Entdeckungen neue machen
wollte. Liebermann schaut die Welt als Empiriker an, und weil er
kein System dafür hat, wie er sich der Natur anders gegenüberstellen
könnte, denn als Einer, der von ihr belehrt sein will, ist eine[S. 71]
Naivetät in seiner Kunst, wie bei einem der Primitiven. Seine Kunst
wird ferner dadurch gekennzeichnet, daß er nach Größe strebt und
nach Einfachheit, in Formen und Linien sowohl, als in Farben, und
endlich durch sein Nachdrucklegen auf das Charakteristische. Alle
diese Neigungen erscheinen in seinen Schöpfungen vereint oder einzeln,
ganz stark oder schwächer, je nachdem ihn der Gegenstand künstlerisch
gereizt hat. Der Empiriker in Liebermann läßt diesen Künstler auch
immer frisch erscheinen. Er erschrickt weder vor den Wandlungen des
Geschmackes, noch vor neuen wissenschaftlichen Entdeckungen, die auf
die Anschauungen der Künstler Einfluß gewinnen können. Er ist immer
bereit, zu lernen, aber er verschmäht es, die empfangenen Belehrungen
von sich zu geben, ehe sie mit seinen Erfahrungen zusammengewachsen
sind. Darum hat seine Kunst niemals aufgehört, interessant zu sein, und
darum scheint sie auch dem Wechsel der Kunstmode so wenig unterworfen.
Man mag Liebermanns Bilder nicht alle gleich gut finden, niemals wird
man sagen können, sie seien langweilig; man weiß immer, warum, aus
welchem künstlerischen Grunde sie gemalt wurden, und wird stets das
Vorhandensein einer künstlerischen Pointe bemerken.

Abb. 72. Nähende Frau (1894).
Zeichnung.

Abb. 73. Studie zu: „In den
Dünen“.
Liebermanns Stoffkreis ist nur äußerlich charakteristisch für das Wesen
seiner Kunst. Nicht menschliches Mitleid ließ ihn Gefallen finden an
armen Arbeitern und Bauersleuten, sondern der Instinkt, daß bei ihnen
und auf ihrer Scholle viel mehr für einen Künstler zu holen war, als
zwischen den Mauern der Stadt. Weil er sie nicht mit den Augen eines
sich klüger, gebildeter oder wohlhabender Dünkenden ansah, weil er
sie nicht dem Gelächter preisgab, weil er sie in seinen Bildern weder
Komödien, noch Tragödien aufführen ließ,[S. 72] mußte er sie durchaus aus
Mitleid malen. Mit demselben Rechte könnte man behaupten, Menzel
zeichne einen Pferdemaulkorb aus der Barockzeit aus Freude darüber,
daß man den Tieren in unserer Zeit, auch wenn sie bissig wären, ein so
schweres Martyrium nicht mehr zumute. Es ist bezeichnend genug, daß man
nach menschlichen Vorwänden auch da forscht, wo künstlerische genügen
könnten und sollten. Schließlich ist es doch eigentlich Holland, das
Stück Erde, wo eine wassergesättigte Luft das Licht heller, die Umrisse
weicher, die Farben harmonischer macht, was Liebermann dazu bringt,
Fischer und Schäfer, Arbeiter und arme Leute zu malen. An Hollands
Atmosphäre konnte er die Bewegungen des Lichtes, an seiner Bevölkerung
Bewegungsmotive der menschlichen Gestalt besser beobachten, als
irgendwo. Das war für ihn entscheidend und vielleicht dazu der Wunsch,
den Leuten, die vom Künstler ideale Erscheinungen verlangen, zu zeigen,
daß man dieser nicht bedürfe, um sich als Künstler zu legitimieren.

Abb. 74. In den Dünen (1895).
In der städtischen Galerie zu Leipzig.
„Die Kunst soll für diejenigen Organe bilden, mit denen wir sie
auffassen; thut sie das nicht, so verfehlt sie ihren Zweck und geht
ohne die eigentliche Wirkung an uns vorüber.“ Darum verzichtet
Liebermann darauf, seinen Bildern einen unterhaltenden Inhalt zu
geben; denn er beabsichtigt nicht, sich an den Verstand der Beschauer
seiner Bilder zu wenden, sondern er will ihre Augen erfreuen, indem
er ihnen irgend etwas Schönes zeigt, was er mit seinen forschenden
Künstleraugen in der Natur oder in einer armen Hütte gesehen. Und
gerade weil er sich nicht darum kümmert, was das Publikum gemalt
haben möchte, hat seine Kunst von Anfang an etwas Provozierendes für
die Menge gehabt. Vielleicht nicht ganz ohne Schuld des Malers. Da
er sah, wie gründlich man ihn mißverstand, wie wenig Eindruck sein
ernsthaftes Ringen mit der Natur den Leuten machte, packte ihn wohl
manchmal die Lust, dem Philister gehörig einzuheizen. Er ging dem
Natürlich-Schönen gelegentlich nicht ohne Absichtlichkeit aus dem
Wege, um recht sinnfällig zu zeigen, daß es nur ein Schönes[S. 73]
gebe, das unantastbar sei, das Künstlerisch-Schöne. Jeder andere,
als ein wirklich großer Künstler, hätte dabei den Kürzeren gezogen.
Liebermann wuchs, je mehr Widerstände er zu überwinden hatte, seine
Kunst wurde immer freier, der letzte Rest von übernommener Technik
abgestoßen. Der Künstler scheint jetzt nur er selbst und keine Spur
von Anschauungen, die andere vor ihm besessen, ist in seinen Bildern
noch zu finden. Allerdings macht es manchmal den Eindruck, als fehle
seinen letzten Schöpfungen die Vollendung, die frühere Arbeiten von ihm
besitzen. Ein Irrtum! Wenn zwanzig Jahre vergangen sein werden, wird
man finden, daß Liebermanns letzte Bilder genau das enthalten, was der
Künstler zeigen wollte. Ist doch das Publikum hinter die Feinheiten
des „Altmännerhauses“ und der „Waisenmädchen“, des „Schusters“ und
der „Netzeflickerinnen“ erst gekommen, nachdem sie die Patina des
Alters angesetzt hatten. Das Wesen der Liebermannschen Kunst ist
Beweglichkeit, nicht in dem Sinne, daß der Maler heut diesen, morgen
jenen Anschauungen nachgeht, sondern darin, daß er sich bemüht, alle
künstlerischen Schönheiten, die in der Natur vorhanden sind, so
weit es ihm sein Talent erlaubt, festzustellen, nicht sprungweise,
vielmehr von Fall zu Fall. Seine Methode hat hierbei fast etwas von
Wissenschaftlichkeit. Zunächst fühlt er das Vorhandensein irgend eines
künstlerischen Reizes, er sucht ihm beizukommen, prüft ihn auf seinen
Wert und stellt ihn dann, nachdem seine Verwendbarkeit erwiesen, in den
Dienst größerer Absichten. Diese Methode hat dem Künstler mit Recht den
Ehrentitel eines „Pfadfinders“ und „Bahnbrechers“ eingetragen.
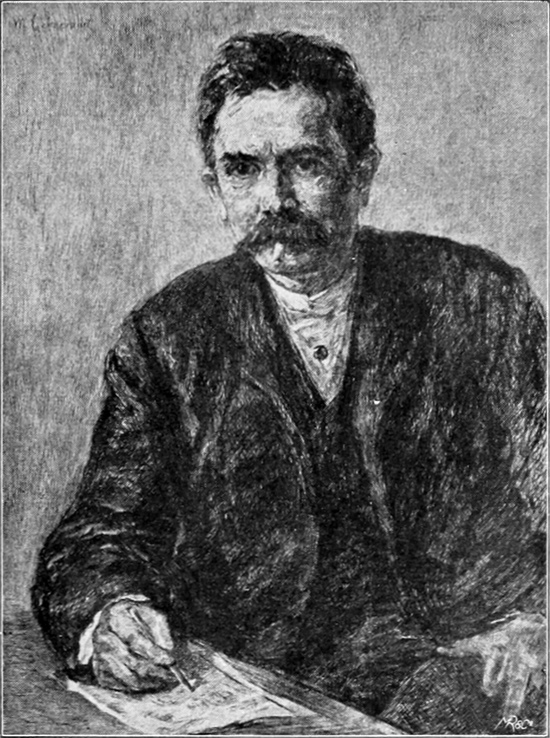
Abb. 75. Eduard Grisebach
(1896).
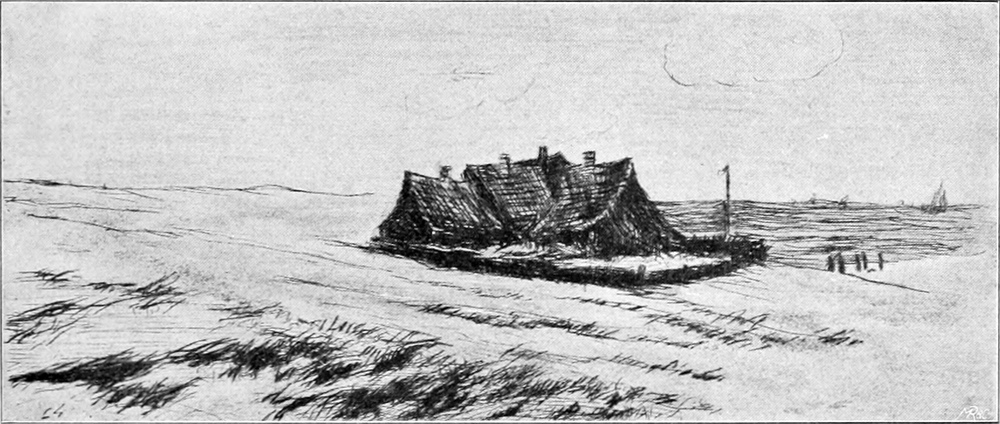
Abb. 76. Strandhäuser (1895).
Radierung. Im Besitz von Bruno & Paul Cassirer in Berlin.
Liebermanns Kunst hätte niemals be[S. 74]fruchtend wirken, niemals eine neue
Kunst in Deutschland zeugen können, wenn sie nicht absolut männlich
gewesen wäre vom ersten Augenblicke an. Darin liegt aber vielleicht
auch eine Erklärung für ihre verspätete Anerkennung von seiten des
Publikums. Wie Leibl, Menzel und Böcklin in Deutschland, Millet,
Courbet und Manet in Frankreich, brachte Liebermann zeugungsfähige
männliche Kunst zu einer Zeit hervor, wo eine weibliche Kunst mit ihrer
Neigung für das Unterhaltsame und Launische, für die Abwechselung alle
Aufmerksamkeit auf sich zog. Nicht im Gefühl eigener Armut, sondern aus
dem Bewußtsein heraus, daß es sein gutes Recht sei, das Gute seiner
Vorgänger zu benutzen, um möglichst bald und sicher zu seinen
Zielen zu gelangen, hat er Anschluß an Courbet und Millet gesucht. Er
hat auch, als er in Deutschland zu wirken begann, nichts Entliehenes
oder Fremdes weitergegeben, sondern Eigenes. Er ist kein Planet,
der sein Licht von einer Sonne erhält, sondern ein Fixstern, der im
eigenen Glanze am Himmel der Kunst leuchtet. Die herbe Männlichkeit in
Liebermanns Schöpfungen verhindert die Meisten, sich mit seiner Kunst
vertraut zu machen. Hat man sie aber einmal kennen und lieben gelernt,
so wird man finden, daß sie trotz ihrer scheinbaren Rauheit unendlich
fein ist und eine Fülle von zarten Schönheiten besitzt, wie kaum eine
andere.

Abb. 77. Lesendes Mädchen
(1895).
Original in der königl. Nationalgalerie zu Berlin.
Der Empiriker Liebermann arbeitet mit dem Künstler Liebermann
gemeinsam. Er ist immer geneigt, seine Entdeckungen den höheren
Gesetzen der Kunst unterzuordnen, was leider von vielen anderen Malern
vergessen wird, so daß ihre Bilder zuweilen eher wie physikalische
Demonstrationsobjekte als wie Bilder wirken. Als man entdeckt hatte,
daß das in seine prismatischen Bestandteile zerlegte Licht im Bilde
viel heller und lebendiger wirke als der einfache helle[S. 75] Ton, nahm
auch Liebermann diese Neuerung auf, aber in einer Weise, daß sie
sich niemand aufdrängte. Keine Spur von der auffälligen Manier der
Pointillisten und Neo-Impressionisten. Es ist einer der Grundsätze
Liebermanns, daß Kunst nie aussehen dürfe wie Arbeit. Und während
Andere Bilder malen, in denen neue Entdeckungen als Selbstzweck
erscheinen, wird man kein Bild Liebermanns namhaft machen können,
das diesen Eindruck hervorriefe; und doch war er selbst einer der
glücklichsten Entdecker, der von keinem Anderen noch empfundene und
entdeckte Stimmungsreize auf die Leinwand gebracht hat.

Abb. 78. Dünenlandschaft
(1895).
(Aus der Liebermann-Mappe. Verlag von Bruno & Paul
Cassirer in Berlin.)
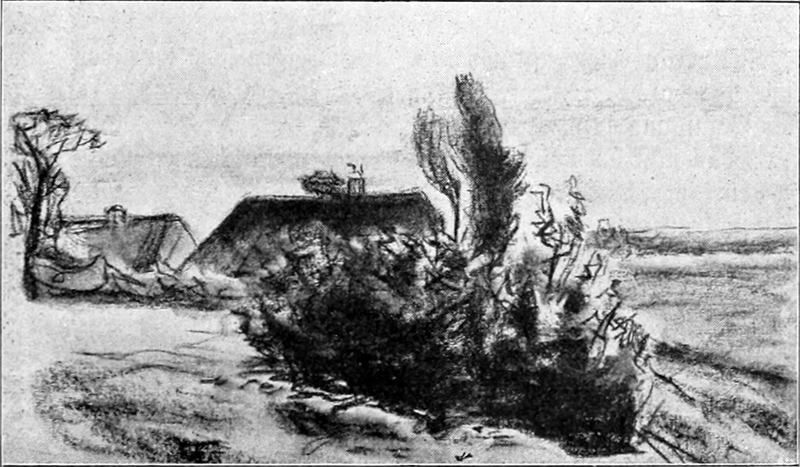
Abb. 79. Laren (1895).
Handzeichnung.
[S. 76]
**
*
Man kann von jeder starken Künstlerpersönlichkeit behaupten, daß
sie Wirkung auf die Kunst ihrer Zeit ausübe; aber nur dem ist es
beschieden, nachhaltigen Einfluß zu gewinnen, der die Grenzen der
künstlerischen Anschauungen zu erweitern vermag, der einen neuen
Geist, eine neue Gesinnung gegenüber dem Objekt der Kunst — der Natur
zeigt. Wenn Liebermann der deutschen Kunst am Ausgang des neunzehnten
Jahrhunderts eine veränderte Richtung gab, so hat daran das als wichtig
erkannte Neue in seiner Gesinnung mindestens ebensoviel Anteil als das
stofflich Neue in seinen Bildern. Die von ihm ausgehende Wirkung ist
nicht damit gekennzeichnet, daß gesagt wird, er habe den Naturalismus
oder Realismus nach Deutschland importiert. Das war gar nicht nötig,
denn man hätte ja, wenn das Bedürfnis vorgelegen haben würde, sich
mit dem Realismus bekannt zu machen, bei Menzel lange vor Liebermann
Gelegenheit dazu gehabt. Nein, Liebermanns That bestand darin, daß er
eine neue Art, die Wirklichkeit zu sehen, in die Kunst brachte, und
zeigte, daß es nicht darauf ankäme, die Wirklichkeit wiederzugeben,
sondern das, was dem Künstlerauge als Wirklichkeit erscheint.
Schon darum ist der Künstler kein Naturalist, wofern das Wesen eines
solchen darin besteht, daß er als Person gänzlich hinter seinem Werke
verschwindet. Im Gegenteil, Liebermann hat die Kunst recht eigentlich
vor der Gefahr bewahrt, im Naturalismus zu ersticken, indem er dahin
drängte, die Natur nicht im Kleinen, sondern im Großen und persönlich
zu sehen. An die Stelle der Beobachtung unwichtiger Kleinigkeiten
und Nebensächlichkeiten setzte er die Beobachtung des Wesentlichen,
der Gesamterscheinung, der farbigen Gegensätze, der sich aus diesen
ergebenden Linien und Formen und das Verhalten derselben unter der
Wirkung von Licht.

Abb. 80. Stranddorf (1895).
Kalt-Nadel-Arbeit.
Erschienen bei Bruno & Paul Cassirer in Berlin.

Abb. 81. Theodor Fontane (1896).
Kreidezeichnung.
In der königl. Nationalgalerie zu Berlin.
Liebermann war unter den deutschen Malern der erste, der die
Entdeckungen der Landschafter in konsequenter Weise auf das[S. 77]
Figurenbild übertrug, der den Übergang von der „Stimmung“ zum „Milieu“
fand. Seine Landschaften, in denen Menschen sich bewegen, sind ebenso
gut Milieudarstellungen, wie seine Interieurs Stimmungsstücke.
Diese Richtung des Blickes auf die Gesamterscheinung bedingt in
seinen Bildern alles. Er gerät selten in Versuchung, zu ausführlich
zu werden, weil er sich bewußt ist, daß Ausführlichkeit bei einer
gewissen Grenze die Wahrheit im großen aufheben muß; und um einen
Ersatz dafür zu bieten, strebt er nach Ausdruck, und zwar nach Ausdruck
durch Charakterisierung. Es war schon bei Erwähnung seiner Studien
darauf hingewiesen worden, mit welcher Unermüdlichkeit Liebermann
Charakteristik sucht. In einer Landschaft, so resümiert er, sieht man
in einiger Entfernung von dem einzelnen Menschen wenig mehr, als den
Umriß der Gestalt, und sucht sich unwillkürlich durch Beobachtung von
Haltung und Bewegungen über die Persönlichkeit klar zu werden; von
einem Baum bemerkt man, wenn man nicht in nächster Nähe ist, auch nur
die Form und die Farbe. Was das Auge nicht zu unterscheiden vermag,
darf im Bilde nicht durchgebildet werden. Während die alten Maler ihre
Bilder so malten, daß sie jeden Gegenstand auf denselben — einen
Baum, einen Menschen, eine Wiese, eine Ziege — für sich darstellten
und auf diese Weise den Eindruck hervorrufen, als verfügten sie zum
Unterschiede vom normalen Menschen über mehr als einen Augenpunkt,
sucht Liebermann, und mit ihm die ganze neuere Kunst, eine Landschaft
oder einen Innenraum mit den von ihnen umschlossenen Erscheinungen, von
einer ganz bestimmten Stelle aus, mit[S. 78] einem Augenpunkt gesehen,
wiederzugeben. Daher die große Rolle, die die Farben oder vielmehr
die durch das Licht nüancierten Tonmassen in seinen Bildern spielen.
Allerdings noch nicht in seinen ersten, obwohl er sich auch schon in
diesen zuweilen geneigt zeigt, die Lokalfarbe durch den Lokalton zu
ersetzen.

Abb. 82. Kinderbildnis (1896).
Besitzer: Der Künstler.
Trotz dieses scheinbar Negativen in Liebermanns Bildern wohnt ihnen
doch eine große suggestive Kraft bei. Das erreicht der Künstler durch
Anwendung einer Reihe von Mitteln, die einer Betrachtung wohl wert sind.
Sein Hauptaugenmerk richtet Liebermann vor allem darauf, bei dem
Beschauer das Gefühl des Räumlichen hervorzurufen. Bei seinen älteren
Bildern hat er sich mit Vorliebe der nach dem Hintergrunde verlaufenden
Linien hierzu bedient, später, wo er viel mit Horizontalen in der
Komposition arbeitet, gibt er das Räumliche lediglich durch Luft und
Farbenperspektive oder durch sinnvolle Lichtführung. Ein Meisterstück
in dieser Hinsicht ist die „Frau mit den Ziegen“, in dem er die riesige
Tiefe des Bildes durch eine fast unmerkliche Abtönung des Graugrüns
der Düne in Verbindung mit der Bewegung der Alten hervorruft. Von
ähnlicher Feinheit ist die Illusion des Räumlichen bei dem „Mann mit
der Kuh“, dem „Schreitenden Bauer“. Bei anderen Gelegenheiten sind es
Menschengestalten in äußerst wirksamen allmählichen Verkleinerungen,
durch die er die Vorstellung von einer unendlichen Ausdehnung des
Raumes erreicht, so besonders bei den „Netzeflickerinnen“, den
„Badenden Jungen“, beim „Biergarten in Rosenheim“, bei der „Bleiche“,
bei der „Gedächtnisfeier für Kaiser Friedrich“ und anderen Bildern.
Bei der Verfügung über das Räumliche seiner Bilder wird Liebermann von
einem bewundernswerten Feingefühl für die glückliche Verteilung der
Erscheinungen darin unterstützt. Es wird nie vorkommen, daß eine Figur,
wo er sie auch hingestellt haben[S. 79] mag, in irgend einem Verhältnis zu
groß oder zu klein wirkt oder die Meinung erweckt, sie würde an einer
anderen Stelle im Bilde vorteilhafter erscheinen. Keine Gestalt in dem
Bilde „Flachsscheuer in Laren“, die nicht an dem Platze wäre, wo sie
dem Gesamteindruck am meisten nützt. Dieses Gefühl, daß alles genau
so sein und bleiben müsse, wie es ist, gegenüber den Liebermannschen
Bildern trägt nicht wenig zu ihrer starken Wirkung bei. Es grenzt an
Naivetät, zu glauben, daß dieser Eindruck durch eine bloße Abschrift
der Natur hervorgerufen werden könne. Wenn auch natürliche Begabung
mitwirkt, es ist Kunst, die in diesem Falle als Natur erscheint. Von
Komposition in dem üblichen Sinne ist in den Bildern Liebermanns nichts
zu merken, aber man darf darum nicht meinen, sie fehle ganz. Wie sich
der Künstler bemüht, den Eindruck zu vermeiden, als habe irgend eine
der Figuren seiner Bilder Modell gestanden, ebenso ist er bestrebt,
den Gedanken an eine Gesetzmäßigkeit in der Anordnung des Bildinhaltes
nicht aufkommen zu lassen. Alles scheint Zufall und ist doch Absicht.
Eine Erklärung findet dieser Eindruck darin, daß der Künstler der Natur
gegenüber keine vorgefaßte Kompositionsidee im Kopfe hat. Er wendet
das Gesetz nicht auf die Gelegenheit an, sondern sucht das Gegebene
gesetzmäßig zu fassen, was viel mehr künstlerischen Geist verrät,
als wenn aus den Gesetzen der Komposition Zwangsjacken für die Natur
geschmiedet werden. Es ist kaum möglich, Liebermann auf diesem Gebiete
zu fassen. Wenn man glaubt, sich an einem seiner Bilder klar gemacht zu
haben, wie er komponiert hat, so läßt ein anderes Bild nur zu leicht
das Thörichte dieser Annahme erkennen.
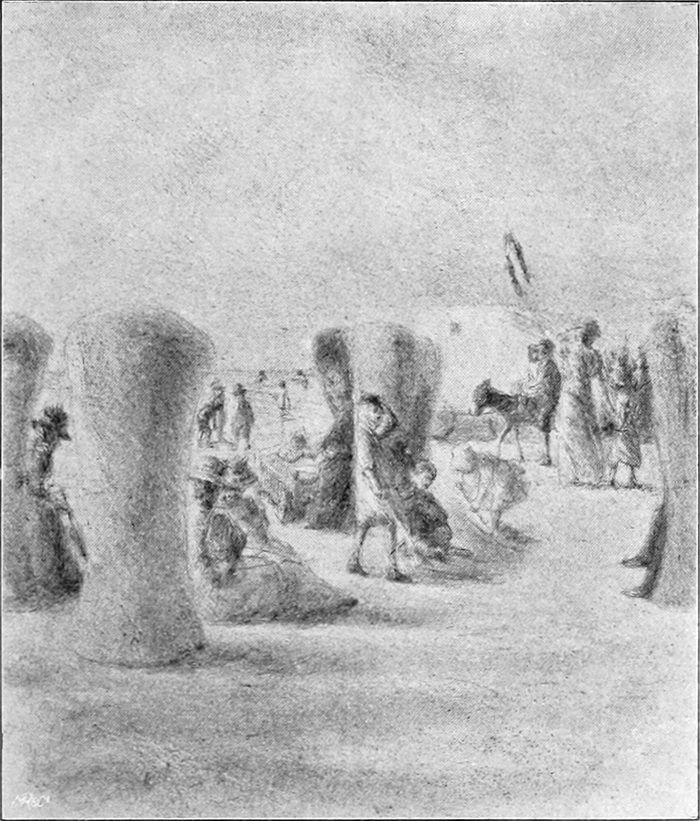
Abb. 83. Strand in Scheveningen
(1896). Lithographie.

Abb. 84. Badende Knaben (1896).
Radierung. Eigentum von Bruno & Paul Cassirer in Berlin.
GRÖSSERES BILD
Weder in den „Gänserupferinnen“, noch in den „Konservenmacherinnen“
ist die Komposition sehr originell zu nennen, obschon sie zwanglos
erscheint. Bei den „Arbeitern im Rübenfelde“ macht sich die Absicht,
von der Schablone loszukommen, angenehmer bemerkbar als die Art, wie
es geschieht. Es ist kein rechter Zusammenhang da. Die Unterordnung
der Figuren unter die Landschaft gibt eine etwas gewaltsame
Ge[S. 80]schlossenheit. Um so glücklicher ist die Abwendung von den Regeln
der Schule im „Altmännerhaus“. Man kann wirklich nicht leicht ein paar
Dutzend Menschen besser in einem Bilde verteilen, ohne sie einzeln
wirken und dabei doch den Raum so außerordentlich stark mitsprechen
zu lassen, wie es auf Liebermanns Bild der Fall ist. Die stark in
Verkürzung gesehene Bank links mit den Männern daraus wird aufs
unauffälligste durch den vor dem Zeitungsleser stehenden Alten, die
hinten im Gange stehende Gruppe und den im Laubengang Promenierenden
mit der Bank rechts und den darauf Sitzenden in Verbindung gebracht.
Wie mächtig und schließlich doch wie unauffällig wirkt der fast die
Hälfte des Bildes einnehmende Erdboden mit den leisen Sonnenflecken
als Stimmungsfaktor! Er ist es, der den Eindruck der Abgeschiedenheit
vom Leben, des einsamen Ausruhens, den die Gestalten der alten Männer
mit ihren schwarzen Röcken und weißen Halsbinden erwecken, verstärkt.
Der „Hof des Waisenmädchenhauses in[S. 81] Amsterdam“ hat scheinbar eine
gewisse Ähnlichkeit in der Komposition mit jenem Bilde, besonders
durch die mit Gestalten besetzte Diagonale, die die Fläche des Bildes
von rechts unten nach links oben schneidet; aber im Grunde ist doch
alles anders. Beim „Altmännerhaus“ schritt der Beschauer gewissermaßen
auf die Bank links zu, hier würde er geradeswegs auf die Pforte im
Hintergrunde stoßen. Das soll aber nicht sein, und so wird sein Blick
gefangen genommen durch die Gruppe der jungen Näherinnen rechts
im Vordergrunde. Um die Diagonale im Bilde zu unterbrechen und zu
verdecken und zugleich, um die das Auge auf sich ziehende Masse des
Weiß zu vermehren, sitzt das eine Mädchen mit seiner Näharbeit vor
den übrigen an der Erde. Die Gruppe erscheint in kühler Beleuchtung
und bildet dadurch einen wirksamen Gegensatz zu dem Sonnengeflimmer
im übrigen Bilde, was aber wieder durch die reichliche Verwendung
von Weiß unauffällig geschieht. Das Weiß von vorn klingt dann an den
verschiedenen Gestalten des Mittelgrundes in Schürzen und Hauben aus
und findet schließlich Abschluß in den sonnenbeglänzten Figuren im
Hintergrunde.
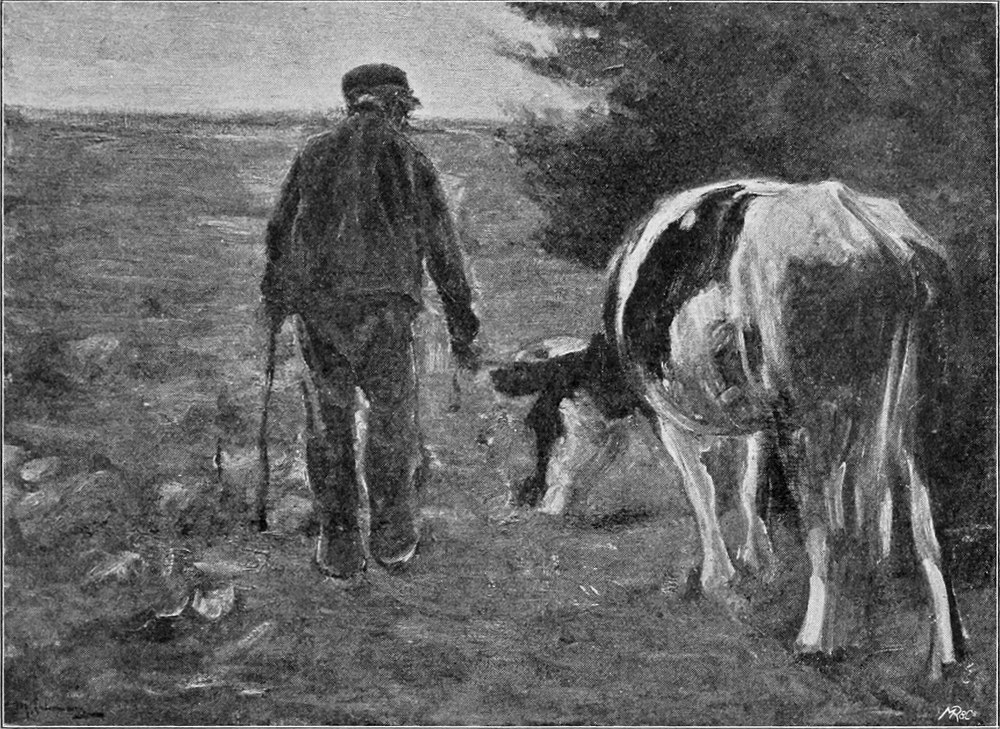
Abb. 85. Heimkehrender Bauer mit
Kuh (1896). Im Privatbesitz in Paris.
Eins der Geheimnisse der Wirkung von Liebermanns Bildern besteht
indessen ohne Zweifel darin, daß das Terrain als Stimmungsfaktor
verwendet wird. Sei es graugelb wie bei der „Flachsscheuer“, graugrün
wie bei der „Frau mit den Ziegen“, gelbgrün wie bei der „Kuhhirtin“,
warmbraun, mit kühlgrünen Reflexen dazwischen, wie bei dem „Sonntag in
Laren“ — immer ist dadurch der Ausdruck des Bildes bestimmt und ihm
eine unerschütterliche Tonigkeit gegeben. Dazu dient es in besonderem
Maße als Reflektor der Lichtmassen, die der Künstler vom grauen oder
sonnigen Himmel oder durch Fenster über Landschaften oder Innenräume
schüttet. Wenige Maler vor Liebermann — die Holländer des siebzehnten
Jahrhunderts nicht in Betracht gezogen — haben durch Benutzung einer
scheinbaren Nebensächlichkeit solche Wirkungen zu erreichen gesucht,
keiner besaß die Kühnheit, den nackten Boden in diesem[S. 82] Sinne zu
verwenden. Gras, Blumen, Wasser dürfen bei den Anderen nicht fehlen.
Man fürchtet sonst, uninteressant zu sein. Liebermann hat gezeigt, daß
es für einen wirklichen Maler nichts Uninteressantes gibt. Er ist von
unzähligen Künstlern nachgeahmt worden. Man hat ihm von den weißen
Mützen bis zu den Holzschuhen, von den Greisenspitälern bis zu den
Fischerhäusern ganz Holland abgesehen; aber kaum Einer hat etwas von
dem Wirksamen an Liebermanns Bildern in dessen Darstellung des Grundes
gesucht, aus dem seine Bäume wachsen, auf dem seine Menschen sich
bewegen. Und wenn man auch viele Bilder aufzählen könnte, bei denen die
Horizontlinie bis nahe an den oberen Rand des Rahmens oder gar noch
darüber hinaus liegt, wo also eigentlich alles Terrain ist — es sind
ganz wenige, wo eine gleich starke und zugleich diskrete Wirkung mit
so einfachen Mitteln erzielt wurde. Man stelle sich den „Schreitenden
Bauer“ oder die „Dorfstraße“ ohne den Stimmungsreiz vor, der dort von
der schmutziggrauen Düne, hier von der durchnäßten Straße kommt —
die Bilder wären nicht annähernd das, was sie sind. Bei den „Badenden
Jungen“ gibt der Licht und Wärme zurückstrahlende Strand erst die volle
Illusion des glühenden, hellen Sommertages.
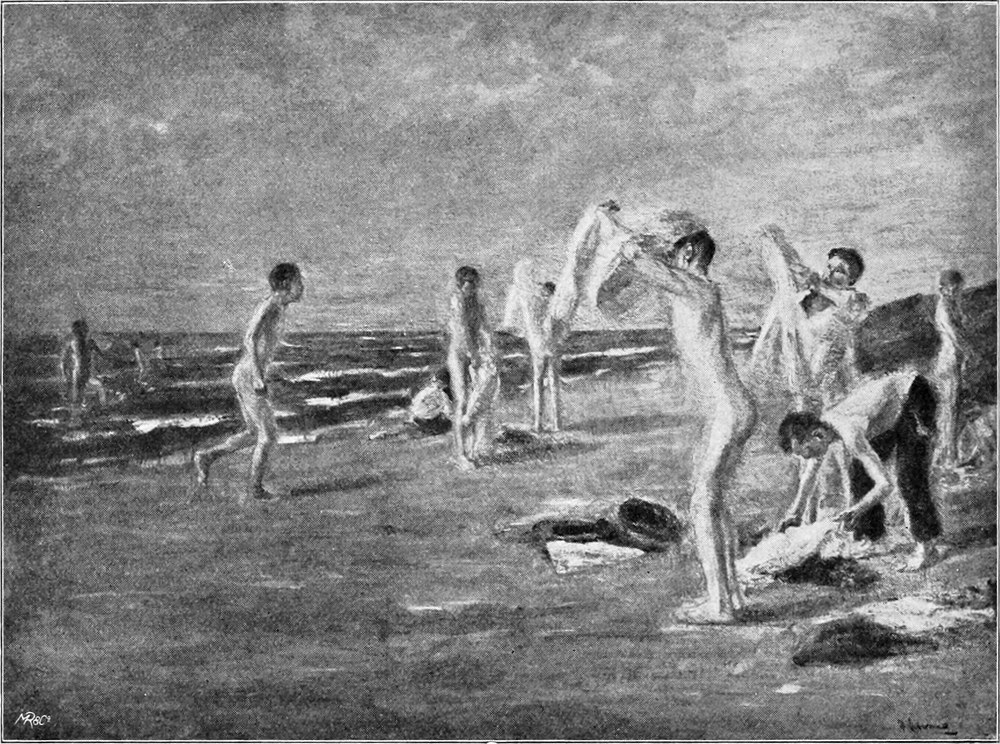
Abb. 86. Badende Jungen (1897).
Im Privatbesitz in Frankfurt am Main.
Um die Suggestion von „Luft“ im Bilde zu erzeugen, bedarf Liebermann
nicht des blauen Himmels oder der Wolken, nur des Lichtes. Er
nüanciert damit auf das feinste. Man vergleiche daraufhin nur den
„Kinderspielplatz im Tiergarten“ (Abb. 26) mit dem „Schulgang“ (Abb. 94),
den „Biergarten in Brannenburg“ (Abb. 67) mit der „Gedächtnisfeier
für Kaiser Friedrich“ (Abb. 50), worauf überall nicht das gefunden
wird, was bei Bildern „Luft“ heißt, aber man meint, in jedem Falle eine
andere Art von Luft zu empfinden, die da unter den grünen Bäumen weht.
Und wie malt er Licht! Es gibt viele Maler, die ungleich heller malen
als Liebermann, viele, deren Farben sehr viel weniger materiell
sind als die seinen; aber von wenigen Bildern hat man so lebhaft
die Empfindung, daß in ihnen das Wesen des Lichtes so vollkommen
ausgedrückt wäre,[S. 83] als von jenen Liebermanns; denn er malt nicht
Effekte, sondern Beobachtungen. Es liegt ihm gar nicht daran, zu
verblüffen. Daß man das absolute Licht nicht malen kann, weiß jeder. Es
muß also in seinen Wirkungen auf die Dinge dargestellt werden. Während
andere diese Wirkungen dort suchen, wo sie am meisten auffallen, wo
leuchtende Farben das Licht glänzend zurückwerfen und starke Gegensätze
von Dunkel und Helle entstehen, hat Liebermann in den Bildern seiner
mittleren Periode, die für die Beurteilung seiner Wirkung auf die
deutsche Malerei einstweilen noch als die ausschlaggebende gilt,
obwohl die letzte Periode vielleicht noch bedeutungsvoller werden
kann, bewiesen, daß man dergleichen nicht bedarf, um lichtvolle
Bilder zu malen. Die Farben in seiner „Flachsscheuer“, in den
„Netzeflickerinnen“, der „Frau mit den Ziegen“ sind alles andere,
nur nicht leuchtend; man kann sie eher trübe oder schmutzig nennen;
aber wer je diese Bilder unter anderen, farbigeren in Ausstellungen
gesehen hat, wird sich erinnern, wie luminös sie jenen gegenüber
erschienen, wie die Sonnigkeit der anderen Bilder verblich gegen das
milde Licht, das die Bilder Liebermanns ausströmten, auf denen es doch
nur graue, dunkle Wolken und schwere Farben gab. Die Erklärung für
diese Erscheinung ist wohl darin zu suchen, daß die Schatten in den
Liebermannschen Bildern in einem weniger gegensätzlichen Verhältnis zu
den Lichtpartien stehen als in anderen Bildern. Seine Bilder sind nicht
hell, aber sie wirken so, und das gibt den Ausschlag.

Abb. 87. Mädchen mit Kuh (1897).
Pastell. Im Privatbesitz in Berlin.
Liebermann hat in diesen Werken durchaus das Prinzip der alten
Meister zu dem seinen gemacht, und man kann ihre Wirkung kaum besser
beschreiben, als mit den Worten, die ein feiner Kenner[2] gebraucht,
um den Eindruck Rembrandtscher Bilder zu schildern: „Was bei dem
ersten Blick an seinen Gemälden frappiert, ist die massenhafte Wirkung
und harmonische Haltung. Man hänge eins seiner Bilder unter zwanzig
andere, auf der Stelle wird man es daraus hervorstechen sehen durch die
Fülle und Belebtheit des Kolorits, und mehr noch durch die mächtige
Harmonie der Tonart. Hierin[S. 84] ist er wirklich originell und meisterhaft,
und hiermit machte er zu seiner Zeit um so größeres Aufsehen, als
man damals fleißiges gelecktes Auspinseln mit glänzenden Farben für
koloriert hielt und vom Helldunkelen in weitläufigen Kompositionen, vom
Zusammenhalten des Lichts und Schattens in bestimmten Massen, welche
Gruppen bilden, keine wahre Vorstellung hatte.“
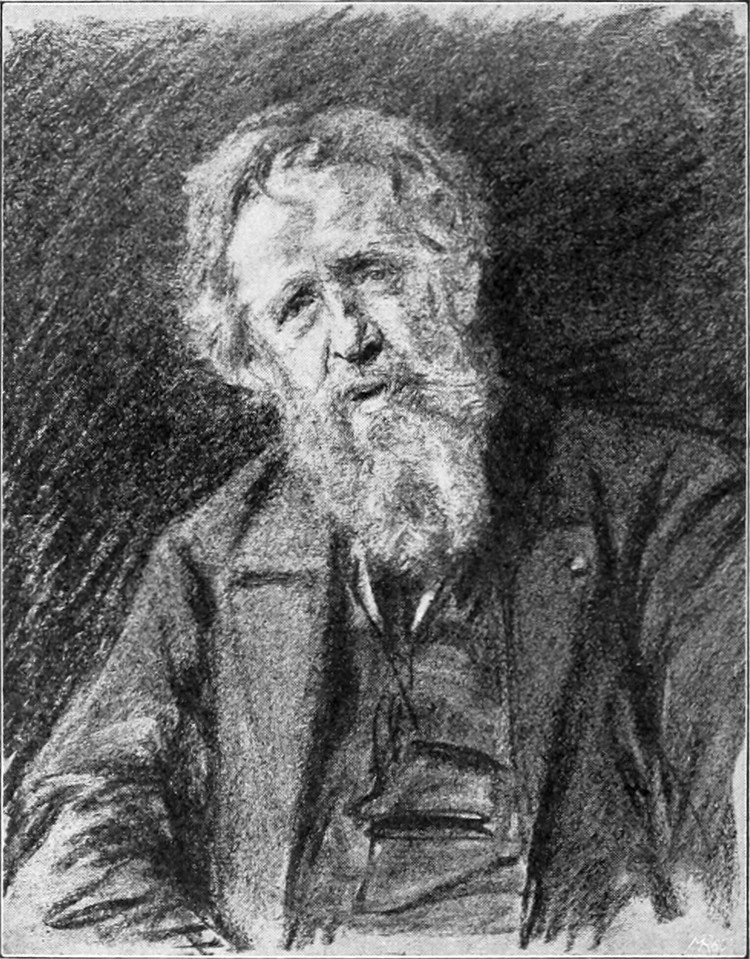
Abb. 88. Constantin Meunier (1897).
Im Besitz Constantin Meuniers.
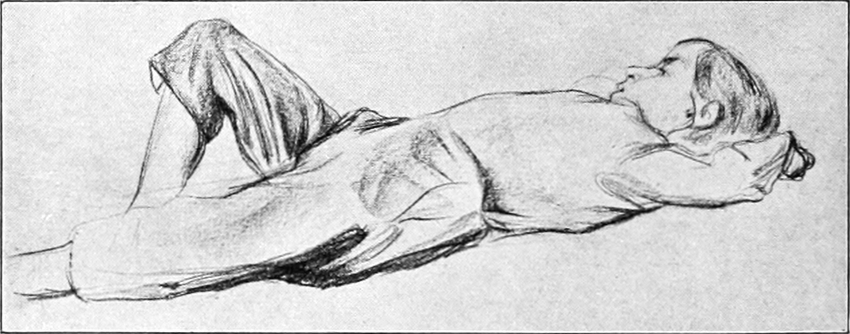
Abb. 89. Studie (1898).
In den Bildern seiner ersten Zeit, die für ihn als Maler weniger
charakteristisch sind als die von Anfang der achtziger Jahre
an entstandenen, erscheint Liebermann in gewissem Sinne fast
konventionell. Er ist geschmackvoller als die Zeitgenossen, ihnen in
geistiger Beziehung, vor allem in dem tiefen Ernst seiner Absichten und
Anschauungen überlegen, aber seine malerischen Ausdrucksmittel stimmen
im großen und ganzen doch mit denen der übrigen Künstler überein. Seine
letzte Periode, deren Beginn noch in die erste Hälfte der neunziger
Jahre fällt, zeigt den Künstler bei dem Bestreben, farbiger zu werden,
sein Kolorit aufzulichten. Er löst zu diesem Zweck die Tonmassen auf,
indem er nüanciert, viele Abstufungen sehen läßt. Dabei hat allerdings
sein „Strich“ gelitten und die Technik scheinbar etwas Kleinliches
erhalten, aber er ist der Natur wieder um einige Schritte[S. 85] näher
gekommen, und seine letzten Bilder lassen erkennen, daß er sich auch
in diesem neuen Sinne wieder einer Vollendung nähert. Trotz ihrer
großen Helligkeit fehlt diesen Bildern nicht das Ambiante. Liebermann
begegnet sich hier recht eigentlich mit Manet, mit dem Meister, dessen
künstlerische Grundsätze mit den seinen die größte Ähnlichkeit haben.
Das Verhältnis der beiden Künstler zu einander in ihrer Malerei ist —
mit vielen Einschränkungen natürlich — ähnlich wie das von Rembrandt
zu Velasquez.

Abb. 90. Porträtstudie (1898).
Im Privatbesitz in Berlin.
Der Vergleich mit Rembrandt drängt sich aber noch in einer besonderen
Beziehung auf. Es soll indessen damit Liebermann kein Relief gegeben
werden. Es handelt sich vielmehr darum, die von den farblosen
Reproduktionen seiner Bilder erzeugten Vorstellungen in einer
bestimmten Richtung zu ergänzen. Wenn man nämlich von Liebermanns
Farben sagt, sie seien wahr, so stellen sich vielleicht Viele diese
Farben so reich und bunt vor, wie man sie in der Natur zu sehen gewohnt
ist. Man würde genau denselben Irrtum begehen, wenn man Rembrandts
Farben, die doch auch für wahr gelten, in diesem Sinne mit denen in
der Natur vergleichen wollte. Die Wahrheit von Liebermanns Farben
besteht, gerade wie bei jenem Göttlichen, nur in der Wahrheit ihres
Verhältnisses zu einander. Wenn man zugibt, daß Rembrandts Weiß, das
wie heller Bernstein aussieht oder perlgrau ist, Weiß sei, so stimmen
auch alle übrigen Farben in ihrem vertieften Glanz dazu. Genau so ist
es bei Liebermann. Sein Grün gleicht nicht dem in der Natur, aber
neben der Hautfarbe seiner Menschen, dem dumpfen Ton ihrer Gewänder
wirkt es so wie in der Natur. Die Logik des farbigen Ausdruckes gibt
den Bildern des Künstlers jenen harmonischen Ton, der sie dem Auge
so angenehm macht. Das ist ja überhaupt Malerei, daß das Verhältnis
der Farben zu einander wahr und harmonisch, gesetzmäßig und zugleich
schön wirkt. Insofern erscheint die Kunst Liebermanns nicht sowohl auf
Beobachtung als auf Empfindung[S. 86] aufgebaut. Es steht nicht Wissenschaft,
sondern Kultur dahinter. Das Thatsächliche in seinen Bildern macht
immer den Eindruck, als habe es unter der Kontrolle eines besonders gut
organisierten Geschmackes gestanden. Jene, die von Liebermanns Bildern
behaupten, ihnen fehle die Schönheit, mögen doch einmal seine Farben
auf sich wirken lassen. Gewiß, sie gleißen nicht und glänzen nicht, sie
haben nichts Berauschendes und Pikantes, aber sie besitzen dafür eine
unendlich feine Harmonie in sich. Wie er ein Weiß zu Grau und Blau, ein
Grün zu Braun und dazwischen ein Rot setzt — das muß man sehen, um
bemerken zu können, daß so etwas nicht alle Tage mit diesem Geschmack,
mit diesem sicheren Gefühl für Schönheit im Verhältnis geschieht.
„Unbekümmert um akademische Schulregeln und Satzungen, versenkte er
sich in die unbetretenen Regionen des freien Naturwirkens und brachte
von seinen Ausflügen das Geheimnis einer Malerei mit, die zu ihren
Farben weniger Ocker und Asphalt als Herz und Seele verwendet.“

Abb. 91. Menukarte (1898).
Daß solchen Vorzügen gewisse Mängel gegenüberstehen müssen, ist bei
der Unzulänglichkeit der menschlichen Natur begreiflich. Liebermann
macht wundervolle Zeichnungen, aber er ist nicht eigentlich, was man
einen Zeichner nennt. Er sieht nicht Linien in der Natur, sondern
Farben, nicht Formen, sondern Flecken. Man vermißt daher bei seinen
letzten, malerischen Arbeiten jene Durchbildung, die eine Verschmelzung
zeichnerischer und malerischer Anschauung vorstellen würde, und die
das letzte Ziel der „Kunst in der Fläche“ bildet. Soll man ihm daraus
einen Vorwurf machen? Heißt es nicht seine Verdienste schmälern,
wenn man etwas von ihm verlangt, was außerhalb seiner Macht steht?
Daß Liebermann zeichnen kann, auch mit dem Pinsel, beweisen seine
ersten Bilder, die — es sei nur an das Bierkonzert erinnert — in
der zeichnerischen Durchbildung mit denen Menzels wetteifern könnten.
Unzweifelhaft sind diese ersten Bilder „fertiger“ als seine letzten;
aber sind sie künstlerischer? Kunst besteht nicht in Ausführlichkeit,
auch Schönheit nicht. Die künstlerischen Absichten Liebermanns haben
seit diesen ersten Bil[S. 87]dern eine Wandlung erfahren. Zu dem, was
er damals ausdrücken wollte, genügte jene, in ihren Mitteln wenig
eigenartige Methode; für die Darstellung der Phänomene, die ihn jetzt
anziehen, genügt sie nicht, ist dazu sogar ganz unbrauchbar. Das ist
überhaupt der Punkt, wo die ältere Richtung in der Kunst der neueren
völlig verständnislos gegenübersteht. Sie hält die impressionistische
Art zu malen für ein Ziel, während sie doch nur ein Mittel ist, um
auszudrücken, was in jener alten Art nicht ausgedrückt werden konnte.
Sie ist von dieser so verschieden, wie Rembrandts Kunst von der der
Eycks. Es wird immer nötig sein, einige Vorteile aufzugeben, um andere
zu gewinnen; es darf nur nicht unbedacht geschehen. Gewisse Dinge sind
allerdings vielleicht überhaupt unmöglich. Die klare Zeichnung Dürers
wird nie mit dem Ambianten von Velasquez zu vereinigen sein. Wenn
Liebermann sich beifallen ließe, seine letzten Bilder zeichnerisch
so durchzubilden, wie seine ersten, so würden sie unzweifelhaft das
verlieren, was er ihnen hauptsächlich geben wollte: Leben und Bewegung.

Abb. 92. Kinderstudie (1898).
Leben und Bewegung darzustellen, das ist es, worin Liebermann die
Aufgabe seiner Kunst sieht. Als er begann, war es die materiellste
aller Bewegungen, die ihn anzog, die Arbeit. Er hat Gänserupferinnen,
Konservenmacherinnen, Feldarbeiter, Weber, Seiler, Kartoffelgräber,
Netzeflickerinnen, Schuster, Klöpplerinnen, Näherinnen u. s. w. gemalt.
Dann kamen einfachere Bewegungen: Gehen, laufen, tragen, wiegen,
spielen, Vieh hüten, reiten, fahren und endlich die immateriellen
Bewegungen: das Wehen der Luft, das Eilen des Lichtes. Auf Liebermanns
Bildern geschieht nichts, sie wollen nicht mit dem Verstande
betrachtet, sie wollen gesehen sein. Was ist daran, wenn sieben junge
und wenig hübsche Holländerinnen (Abb. 51) in weißen Hauben, dunklen
Kleidern und blauen Schürzen vor dem Hause auf einer Bank sitzen und
nähen, die eine an einem großen Stück Linnen, die anderen an Tüchern
und dergleichen? Gar nichts, wenn nicht ein geschmackvolles Stück
Malerei gezeigt würde, wenn man nicht die verschiedenen Arten, ein und
dieselbe Arbeit zu verrichten, an ihnen beobachten könnte. Mag das Bild
auch den allgemeinen Vorstellungen von „fertig“ nicht entsprechen, Eins
ist bis ins Letzte vollkommen gegeben: die Bewegung des Arbeitens.
Kein anderer Künstler hat sie intimer dargestellt. Ein anderer
würde[S. 88] vielleicht Mühe darauf verwendet haben, die Gesichter mit den
gesenkten Augen, die Hände mit den flinken Fingern recht ausführlich
zu malen; Liebermann fand einer ganz genauen Darstellung nur wert, wie
die Mädchen sich beim Arbeiten halten, welche Bewegungen ihre Arme
machen. Er sah das Wesentliche, jener das Nebensächliche, Zufällige.
Kunst ist Wahl, wie Whistler meint. Bei solchen Gelegenheiten wird
man darüber klar, und in dem, was er wählt, erkennt man die Eigenart
eines Künstlers. Der triviale Künstler sucht das Leichtdarstellbare,
der bedeutende die Schwierigkeiten. Jener wiederholt und variiert
bekannte und oft dargestellte Motive, dieser schaut sich nach neuen
um. Daraus erklärt sich auch Liebermanns Vorliebe für Darstellungen
aus der sogenannten niederen Sphäre des Volkes, hinter der von
Einigen dekadente Neigungen vermutet werden. Was man dem in den
behaglichsten Verhältnissen von der Welt lebenden Künstler als eine
Marotte anrechnet, ist einfach ein konsequenter Vorgang in der
Entwickelungsgeschichte der Kunst. Die Kunst müßte nicht Spiegel der
Kultur sein, wenn die sozialen Bewegungen der Gegenwart ohne Wirkung
auf sie geblieben wären.

Abb. 93. Studie zum „Kirchgang
in Laren“ (1898).
Als die Religion die Gemüter beherrschte, als die Erlangung eines
Platzes im himmlischen Jenseits Zweck und Ziel des Lebens schien, malte
man die Gottheit und die Heiligen, zu denen man betend die Hände erhob;
als sich dann die Augen vom goldglänzenden Himmel zur Erde wandten,
sah man, wie schön diese war, wie voller Freuden. Und man malte, was
man von dieser Schönheit und diesen Freuden nur erreichen konnte: die
Macht des Fürsten und des Reichtums, die Anmut des Weibes und die
Kraft des Mannes. Darauf wieder ein kurzes Besinnen auf den Himmel,
auf die Macht der göttlichen Herrschaft, auf die Erlösungswerke des
Heilandes und der Heiligen, dann beginnt die Betrachtung der Welt vom
sozialen Standpunkt. Die Maler schildern nach einander den Glanz des
Königstums, die Pracht der Höfe, die adlige Eleganz der Vornehmen, die
stille Würde des Bürgertums. Ein Elementarereignis, die Revolution,
tritt hier ein und hindert die Kunst am Weitergehen. Sie vermag sich in
dem entstandenen Durcheinander von[S. 89] alten und neuen Anschauungen, von
Recht und Gewalt nicht zurechtzufinden und macht Selbstbetrachtungen,
sie flüchtet in die Vergangenheit und erlebt noch einmal ihr ganzes
Dasein. Erst als sie an dem Punkt angelangt ist, wo sie von der
Revolution gestört wurde, erwacht sie aus ihrem Traumleben und schaut
wieder mit wachen Augen in die Welt. Dem Bürgertum vermag sie nicht
mehr viel abzugewinnen, und nachdem sie sich eine kurze Zeit mit den
Bauern amüsiert, beginnt sie den Stand zu betrachten, der ihr jetzt als
der herrschende erscheint: den Stand der arbeitenden Menschen. Courbet
schuf das Programm, Millet entfernte das Tendenziöse daraus, Liebermann
verband den neuen Stoff mit neuen künstlerischen Ausdrucksmitteln.

Abb. 94. Studie zum „Schulgang“
(1898).
Es ist nicht anzunehmen, daß der Künstler aus einem Bedürfnis nach
Sensation sich seinen Stoffen zugewendet hat. Man würde dann irgendwo
ein Außerhalbstehen spüren. Nein, die Idee lag in der Luft und bot
der Kunst Aufgaben, die zur Lösung reizten, wenigstens einen Künstler
reizen mußten, der erkannt hatte, daß alles übrige bereits gesagt
war und die Malerei nicht weiter käme, wenn das Oftgesagte nur immer
wiederholt würde. Liebermann suchte das Leben zu packen an einer Seite,
an der man es in Deutschland noch nicht gepackt hatte. Es ist ziemlich
gleichgültig für die Beurteilung des Wertes von Liebermanns Schaffen,
ob man dem Künstler das als Instinkt oder als Überlegung, als ein
richtiges Gefühl oder kluge Absicht auslegen will — die Art, wie er
die Sache angriff und durchführte, erscheint zu unbefangen, wirkt zu
unmittelbar und lebhaft, als daß man an Berechnung glauben dürfte.
Jan Veth, der holländische Zeichner und Maler, der neben dem
ausgezeichneten Hermann Helferich, neben dem feinsinnigen Ludwig
Kaemmerer, Woldemar von Seidlitz, Cornelius Gurlitt, neben Richard
Muther und Richard Graul das Besondere von Liebermanns Kunst am
feinsten erfaßt hat, bestätigt diese Annahme, indem er sich über
ihn folgendermaßen äußert: „Ich möchte behaupten, der innere Wert
seines künstlerischen Wesens liege in der Unbefangenheit, wie er zu
sehen, nachzufühlen, wiederzugeben vermag. Ich als Holländer und
meine Landsleute, wir können das besser als andere erkennen. Haben
wir doch seit unserer Kindheit traulichen Verkehr mit allem dem, was
wohl die besten Gemälde Liebermanns uns schildern. Jene Gestalten
aus dem Altmännerhaus, jene Waisenmädchen, jene Flachsspinnerinnen,
Wäscherinnen und Klöpplerinnen, jene Fischer und Netzeflickerinnen,
jene Hirten, Schuster, Bauern und Weber, wir haben sie allesamt näher
kennen gelernt, als es Liebermann selbst möglich gewesen ist. Er aber
weiß an ihnen etwas Charakteristisches zu entdecken, etwas, das wir zu
sehen verlernt haben[S. 90] und das vielleicht doch ihr wirkliches Wesen am
nächsten berührt.“

Abb. 95. Alte Frau (1898).
Zeichnung. Aus der Liebermann-Mappe.
Wenn Liebermann sich aus anderen als künstlerischen Gründen der
Darstellung arbeitender Menschen und einer den Meisten reizlos
erscheinenden Natur zugewendet hätte, würde dieses nicht mit der
Andacht geschehen sein, die man seinen Schöpfungen anmerkt. Man
wird ihn nie auf einer gedankenlosen Betrachtung und Wiedergabe der
Natur ertappen, aber immer wird man finden, daß er den empfangenen
Eindruck möglichst unmittelbar überliefern will. Daher die
außerordentliche Frische in seinen Arbeiten, aber auch gelegentliche
Unvollkommenheit. Mehr als bei anderen Malern ist bei Liebermann die
Kunst Temperamentssache. Hat er irgend eine Erscheinung, eine Bewegung,
die ihn anregte, erfaßt und, sei es mit dem Pinsel, sei es mit dem
Stift, fixiert, so interessiert ihn leicht das übrige nicht weiter. Er
vermag seine Begeisterung nicht immer genügend lange warm zu halten,
und so erscheinen manche seiner Arbeiten nicht soweit gebracht, wie
man wohl wünschen möchte. Seine künstlerische Konzentration ist mehr
intensiver, als extensiver Art. Daher die im Verhältnis zu seinen
wichtigeren Schöpfungen so ungeheure Masse von Studien und Skizzen. So
wunderbar dieselben zum größten Teil sind, soviel echter künstlerischer
Geist darin steckt und so reich, gesund und schöpferisch Liebermann
in ihnen erscheint — es wird immer Bedauern erregen, daß diese
kolossale Potenz ihre Mittel nicht rationeller verwendet hat. Wenn
man auch von keinem Mangel an Wollen sprechen darf, die Thatsache,
daß Liebermann als Künstler häufig nur dem Augenblicke gelebt hat,
ist nicht zu leugnen. Indem man dieser Ansicht Worte gibt, fragt man
sich bereits, ob die impulsive Art, sich der Natur zu nähern, nicht
eigentlich das Große und Unbegreifliche in Liebermanns Kunst ist, ob
in diesen Augenblicksarbeiten nicht eine Erhöhung der Persönlichkeit
gefunden werden muß, die so beinahe hinreißender wirkt, als wenn sie
sich offiziell in äußerlich imposanten Werken darstellte? Es ist
nicht schwer, in einer umständlichen Beschreibung etwas zu schildern,
aber es gehört Geist dazu, in[S. 91] einem kurzen Satze das Wesen der
Sache erschöpfend zu kennzeichnen. Von solchem Geiste ist viel in
Liebermann, in seinen Studien und Skizzen. Er findet es langweilig,
eine Abhandlung zu liefern, wo es ein Aperçu auch thut. Und wenn man
seine Frische rühmt, die Lebendigkeit seines künstlerischen Ausdruckes
— denkt man da nicht fast mehr an seine mit schneller Hand auf die
Leinwand gebrachten Impressionen, als an seine eigentlichen Bilder?
Und Liebermanns Geschmack! Würde man ihn so hoch preisen dürfen,
wenn er nicht von jedem Wisch leuchtete, den er als Künstler berührt
hat? Wer außer Liebermann hat in Deutschland überhaupt Studien und
Skizzen von einer so starken künstlerischen Haltung, so persönlich
in allem aufzuweisen? Menzel! — nun ja, Menzel, aber bewundert man
sie nicht eigentlich mehr mit dem Verstande, als mit den Sinnen? Es
sind merkwürdige Arbeiten. Man ist erstaunt, welche Schwierigkeiten
überwunden wurden, welche Kraft des Sehens, welche unglaubliche
Handgeschicklichkeit der Künstler besitzt, aber es fehlt ihnen
das eigentlich Hinreißende, Erwärmende. Vor den Studien Menzels
erscheint die Kunst unendlich schwer, von denen Liebermanns möchte
man glauben, sie seien zu machen ganz leicht. Man bewundert dort die
außerordentliche Konzentration des Willens zum Sehen, hier Empfindung,
spielende Kraft und Inspiration. In Menzels Studien ist alles gesagt,
jeder Zweifel gelöst, aber auch jede mitschaffende Thätigkeit des
Beschauers ausgeschlossen; sie haben die überzeugende Kraft des
Positiven. Bei Liebermann dagegen ist alles Selbstverständliche
verschwiegen, nur das gesagt, was den Vorstellungen des Beschauers
ihren Weg vorschreibt. Er deutet nur an und nötigt dadurch den
Betrachtenden, Mitkünstler zu werden. Liebermanns Kunst ist in hohem
Grade suggestiv. Das ist der Grund, warum Menzel so Vielen, Liebermann
so verhältnismäßig Wenigen verständlich ist. Jener kann vollständig vom
Verstande begriffen werden, das Gefühl braucht ihm gegenüber kaum in
Thätigkeit gesetzt zu werden; diesem kann man nur mit dem Gefühl und
mit Aufwand eigener Phantasie näher kommen.

Abb. 96. Umschlagzeichnung für die
Liebermann-Mappe.
(XXV Lichtdrucke nach Max Liebermann. Verlag von Bruno &
Paul Cassirer in Berlin.)
Alle diese Vergleiche könnten überflüssig erscheinen, wenn es möglich
wäre, die Eigenart Liebermanns für sich darzustellen; aber er ist
gerade in dem groß, worin er sich von anderen Großen, also auch
von Menzel, unterscheidet, und man bekäme ein[S. 92] falsches Bild vom
deutschen Realismus, würde nicht gezeigt, wie wenig ähnlich sich
seine beiden bedeutendsten Vertreter sehen. Jedenfalls spielen die
so lebhaft gefühlten und schließlich nicht vollendeten Bilder in
Liebermanns Lebenswerk keine geringe Rolle. Die sich darin äußernde
Unerschöpflichkeit von künstlerischer Kraft, der beständig darin
vorhandene künstlerische Sinn sprechen lauter fast noch, als die
abgeschlossenen Werke, dafür, daß Liebermann eine „Natur“ ist, ein
Wesen, das das Maß seines Wertes in sich trägt. Und noch Eins kann
man diesen Skizzen nachrühmen und dem Meister, der sie schuf: sie
sind frei von aller Methode. Es ist unmöglich, Liebermanns Art, die
Natur anzupacken, in Regeln zu spannen. Auf immer neuen Wegen naht er
sich ihr und scheut nicht vor dem, was als nicht darstellbar gilt.
Dieser Kühnheit und Unerschrockenheit verdankt er seine schönsten
künstlerischen Erfolge und den Einfluß, den er auf die deutsche
Kunst noch besitzt, obgleich die Bewegung scheinbar über ihn bereits
fortgeschritten ist. Bei fast allen Künstlern in Liebermanns Alter ist
man gewiß, daß sie nichts Neues mehr bieten werden; von ihm, der nicht
aufgehört hat, sich zu rühren, kann man noch alles mögliche erwarten
und erwartet es auch.

Abb. 97. Studie zu einem
biblischen Thema (1898).
Die Wirkung, die Liebermann auf die deutsche Kunst noch immer ausübt,
beruht nicht zum wenigsten in der von ihm ausgehenden erzieherischen
Kraft. Er brachte als erster eine gegenwärtige, nicht eine der
Vergangenheit entnommene malerische Kultur nach Deutschland. Er zeigte,
daß die Harmonie der Farben in einem Bilde durch das Verhältnis der
Farben zu einander, nicht durch einen braunen, schwarzen[S. 93] oder grauen
Ton erreicht werden müsse; er wies auf Licht und Luft als die großen
Medien der Malerei hin, die Schönheit brächten und das Widerstrebende
vereinten. Er zeigte, daß Schönheit Charakter sei, bestimmt und
individuell ausgedrückt, daß es auf Beobachtung der Natur, nicht auf
ihre Nachahmung ankäme. Er predigte, ohne zu reden, Rückkehr zur Natur,
Einfachheit und Größe, erschütterte durch die Macht seines Beispiels
das Ansehen der toten und von den Akademikern so hochgehaltenen Ideale
und, was die Hauptsache ist: er brachte neue Ideale und half damit
den Glauben zerstören an die Ewiggültigkeit der von der alten Kunst,
besonders von der der Renaissance aufgestellten Ideale. Gerade hierin
geht er über Menzel hinaus, der freilich auch nicht gewillt war, sich
der Vergangenheit zu beugen, dessen Kunst aber die Großzügigkeit und
Einfachheit fehlt, ohne die es nun einmal keine Ideale gibt. Und trotz
alledem hat Liebermanns Kunst nichts Theoretisches. Er huldigt nur dem
einen Grundsatz, der Künstler müsse sich von der Natur inspirieren
lassen, von einem von ihr empfangenen Eindruck ausgehen und nicht mit
einem fertigen Plane vor sie hintreten. Für sich selbst hat er die
Richtigkeit dieses Grundsatzes jedenfalls schlagend bewiesen, und wenn
sich Andere dazu bekennen, so ist es freilich sehr fraglich, ob sie zu
denselben Resultaten gelangen werden, wie Liebermann, aber sie werden
sicher viele der Irrtümer vermeiden, mit denen sich die idealistische
Malerei um ihr einstiges Ansehen gebracht hat.
**
*

Abb. 98. In der Sommerfrische
(1898). Zeichnung. Im Privatbesitz in Berlin.
Die Anerkennung, die gegenwärtig nach langem Zögern und Zureden und
mit manchen Einschränkungen Liebermann entgegengebracht wird, macht
leider Halt vor seinen jüngsten Werken, in denen er sich der Lösung
luminaristischer Probleme widmet, und auch seinen Bildnissen steht die
Allgemeinheit noch sehr skeptisch gegenüber. Dafür gibt es nur zwei
Erklärungen: entweder hat sich die künstlerische Kraft Liebermanns
verringert, oder aber er ist, wie schon einmal, seiner Zeit wieder weit
voraus. Zu der ersten Annahme scheint man durch Beobachtungen, die man
bei anderen Künstlern sehr oft machen kann, berechtigt, die Möglichkeit
der anderen wird schon darum nicht gern zugestanden, weil sie geeignet
ist, das Kunstgefühl des Urteilenden als unsicher zu kennzeichnen. Es
bedarf indessen nur einigen Nachdenkens, um die Haltlosigkeit jener den
Künstler verkleinernden Meinung klarzustellen. Fast alle die Künstler,
bei denen man ein Nachlassen der künstlerischen Potenz bemerkt,
haben dasselbe meist dadurch verschuldet, daß sie ihr künstlerisches
Gewissen[S. 94] materiellen Vorteilen geopfert und, statt Kunst, Geld machen
wollten. Nicht geübte Fähigkeiten gehen verloren, und eines schönen
Tages bemerkt solch ein Künstler, daß es ihm einfach unmöglich ist,
eine neue künstlerische Aufgabe zu lösen. Er malt ruhig nach seinem
bewährten Rezept weiter; das Künstlerische in seinen Bildern wird immer
konventioneller, und schließlich hört er überhaupt auf, Künstler zu
sein. Nun hat Liebermann eher alles andere gethan, als aufgehört, seine
Fähigkeiten in Atem zu halten. Er hat nie die geringste Neigung zur
Bequemlichkeit gezeigt, und jedes neue künstlerische Problem entzündete
noch immer seinen ganzen Ehrgeiz. Wenn seine letzten Arbeiten weniger
wirksam erscheinen, als seine früheren, so wird man nie behaupten
können, daß ihnen die Frische fehle, und indem man ihnen diese
Eigenschaft zuerkennt, sagt man eigentlich schon, daß ein Überschuß
von Kraft da ist. Bei Abnahme von Kraft aber gibt es keinen Überschuß
mehr, und deshalb läßt sich die Behauptung von einem Nachlassen der
künstlerischen Kraft Liebermanns nicht gut aufrecht erhalten. So bleibt
schließlich nichts anderes übrig, als anzunehmen, daß dem Beschauer
die Fähigkeit mangele, die neuen Absichten des Künstlers zu erkennen,
und daß daraus die Unterschätzung seiner Leistung resultierte. Und so
ist es in der That. Man versteht diese neuen Bilder nicht, wenn man
nicht vergißt, wie der Künstler ähnliche Aufgaben im „Altmännerhaus“
und im „Waisenhausgarten“ behandelt hat. Man versteht auch Liebermanns
Bildnisse nicht, weil man all’ die glatten rasselosen Porträts im Kopfe
hat, denen man überall in unseren Häusern und noch öfter in unseren
Ausstellungen begegnet.

Abb. 99. Die Kuhhirtin. Im
Privatbesitz in Frankfurt am Main.

Abb. 100. Schreibende Dame
(1898). Zeichnung. Im Privatbesitz in Berlin.
Der Künstler verfährt bei seinen Bildnissen ähnlich, wie bei seinen
sonstigen Bildern. Er will Menschen darstellen und dabei auch den
flüchtigsten Ausdruck des Lebens festhalten. Daher fehlt seinen
Porträts das Feierliche, Zurechtgemachte, jede Art von Pose; zugleich
aber vermeidet[S. 95] Liebermann sorgsam jede Überhöhung des Ausdruckes.
Seine Menschen sind belebt, aber nicht aufgeregt. Sie sind gesehen
in einem Moment geistiger Gegenwart, während dessen sie nicht daran
dachten, einem Maler Modell zu sitzen oder zu stehen. Bei dem Bildnis
von Liebermanns kleinem Töchterchen (Abb. 38) bemerkt man dieses
Bestreben des Künstlers am deutlichsten, weil man zugleich die Ursache
vor Augen hat. Blitzschnell hat der Vater den Ausdruck der Lust
erfaßt, mit dem die Kleine die rote Puppe zwischen ihren Händchen
anjauchzt. In diesem momentanen Ausdruck liegt das ganze Wesen des
Kindes. Bei den Bildnissen der großen Menschen konnte er natürlich
den äußeren Anlaß für die augenblickliche Stimmung nicht mitmalen,
darum wird die Absicht des Künstlers von Vielen nicht verstanden.
Natürlichkeit erscheint den meisten noch nicht als eine notwendige
Art der Auffassung. Und doch: Wie weit entfernt sind Liebermanns
Bildnisse von der Momentphotographie! Das Zufällige ist ihm ein Reiz,
kein Endzweck. Knauf hielt es noch für nötig, Mommsens und Helmholtz’
Bedeutung für die Wissenschaft durch den Apparat des Studierzimmers
klarzustellen. Er hätte auch Virchow wohl im anatomischen Museum
oder mindestens mit dem Mikroskop beschäftigt vorgeführt. Liebermann
bedurfte gar keiner äußerlichen Zuthat, um den Gelehrten als solchen
zu charakterisieren. Ein Lichtstrahl thut’s auch, der über den feinen
Schädel gleitet und die tausend charaktervollen Linien beleuchtet, die
die Thätigkeit des Denkens und Forschens in das Antlitz des Gelehrten
gezeichnet, und der halb müde, halb beobachtende Blick der Augen. Wie
prachtvoll ist die nervöse Spannung im Gesicht des Dichters Grisebach
als charakterisierendes Moment benutzt, und wie köstlich ist die
Mischung von liebenswürdigem Selbstbewußtsein und freiem Menschentum
in Fontanes Wesen getroffen! Man ist bei uns nicht gewöhnt, praktische
Psychologie in Verbindung mit künstlerischen Absichten zu sehen und
zweifelt an der geistigen Vertiefung von Liebermanns Porträts, weil man
sich nicht vorstellen kann, daß der Künstler zwei Aufgaben gleichzeitig
löst. So betrachten die einen seine Bildnisse nur von der Seite der
Persönlichkeitsschilderung, die anderen nur von der Malerei. Dabei
fühlen sich beide Parteien wenig befriedigt, denn Liebermann hat die[S. 96]
geistige Auffassung von der künstlerischen nicht getrennt, so daß man
dem Psychologen Liebermann nicht folgen kann, wenn man sich um den
Maler nicht kümmert und umgekehrt. Auch hierin liegt ein Beweis für
das Streben des Künstlers nach Einfachheit, obgleich zunächst der
Anschein erweckt ist, als seien die Bildnisse Liebermanns komplizierte
Leistungen. Er sucht den Gegenstand mit dem künstlerischen Ausdruck zu
identifizieren, was entschieden eine Vereinfachung bedeutet. Und gerade
beim Porträt erscheint das schwierig, weil es mit seinem geistigen
Inhalt eine Unterordnung der künstlerischen Tendenz zu fordern scheint.

Abb. 101. Der Sommer (1898).
Wanddekoration für ein Schloß in Mecklenburg.

Abb. 102. Der Winter (1898).
Wanddekoration für ein Schloß in Mecklenburg.

Abb. 103. Sonntag in Laren (1898).
In Privatbesitz in Berlin. (Mit Erlaubnis von Bruno & Paul Cassirer in
Berlin.)
GRÖSSERES BILD
Je besser man Liebermann als Künstler kennen lernt, um so weniger
ist man geneigt, ihn für einen Naturalisten oder auch nur für einen
Realisten zu halten. Er ist vor allem Künstler, mithin mehr, als
bloß der Vertreter einer Richtung. Der Gegenstand der Kunst ist
doch nur teilweise bestimmend für die Wirkungen, die der Künstler
erzielt. Man kann sagen, Liebermann malt nichts Poetisches, aber
fehlt es darum seinen Bildern an Poesie? Wenn ein Maler die Stimmung
eines Sonntagsnachmittags auf einer Dorfstraße dem Beschauer so zu
übermitteln vermag, daß dieser das Behagliche der Stunde vollkommen
mitfühlt, und diese Wirkung dadurch erzielt, daß er ein paar Mädchen
zeigt, die am hellen Tage in sauberen Kleidern in einer Reihe auf der
Straße daherschlendern, so kann man die Wirkung wohl poetisch nennen.
Umgekehrt kann ein anderer Maler den Tanz der Horen malen und die
poetische Wirkung doch ausbleiben. Man verwechselt einfach wieder
Subjekt und Objekt. Die ideale oder reale Wirkung hat mit dem Objekt
des Künstlers gar nichts zu thun, sondern hängt von ihm, von seiner
Thätigkeit ab. Und wo man auch hinschaut in der Kunst — immer wirken
jene Werke am meisten ideal, die sehr realistisch[S. 98] sind. Mag man an
Homers Odyssee oder Michelangelos Moses, an Rembrandts Nachtwache oder
Goethes Faust, an Romeo und Julia oder die Hilanderas des Velasquez
denken. Wie an sich nichts gut oder böse ist, sondern erst das Urteil
dazu kommen muß, um zu entscheiden, so hängt die Bestimmung von
idealistisch und realistisch in der Kunst davon ab, ob der Künstler
Empfindungen zu erregen vermag, die über das Beschränkte des von
ihm gewählten Gegenstandes hinausgehen oder nicht. Je zwangloser
und zugleich sicherer die Phantasie des Kunstgenießenden geleitet,
und je stärker sie in Bewegung gebracht wird, um so idealer das
Kunstwerk. Das sind die stumpfen Geister, die das Ideale in der Kunst
in Handgreiflichkeiten suchen, die die Attribute idealer Erscheinungen
schon für das Ideale halten, für die der Todesengel etwa eine höhere
Vorstellung ist als der Tod. Für die wird Liebermann freilich immer der
Realist bleiben, weil sie nur das Wahre in seiner Kunst sehen, nicht
die wahre Empfindung, die unendlich viel mehr ist. Die Vorstellung
von Liebermann als Künstler hängt ja natürlich aufs innigste mit
dem Gegenstande seiner Kunst, mit weiten grauen Dünenlandschaften,
mit Waisenmädchen, mit Fischern und Arbeitenden zusammen, aber das
Wesentliche bleibt doch die Persönlichkeit Liebermanns, die Art, wie
er sich zu diesem Gegenständlichen verhalten hat. Geht man dem auf
den Grund, so wird man finden, daß sein Bestreben darauf gerichtet
war, in dieser armen Wirklichkeit das Schöne zu suchen, ihre Mängel
zu umkleiden mit dem Gewande der Kunst. Sein Verdienst ist aber um so
höher zu veranschlagen, als die von ihm gewählten künstlerischen Mittel
die allerfeinsten sind und die von ihm erreichten Wirkungen ihnen
entsprechen.

Abb. 104. Spielende Kinder
(1899). Zeichnung. Im Privatbesitz in Berlin.
Zu dem Begriff „realistische Kunst“ gehört ganz entschieden das
Unterstreichen der Wirklichkeit. Realistisch ist Menzel, weil ihm der
Fingernagel genau so wichtig ist, wie der ganze Mensch. Man denke sich
ihn ohne militärische Uniformen, ohne die prickelnden Niedlichkeiten
des Rokoko, kurz, ohne jene Einzelheiten, die seine Schöpfungen so
gut gesehen, so vollkommen erscheinen lassen, und man wird entdecken,
daß in ihnen, in all’ diesen kleinen Wirklichkeiten und Pikanterien
das Wesentliche von Menzels Kunst steckt und ihre Wirkung ausmacht,
während Liebermann nur die große Wirklichkeit gibt. Es ist auch ganz
sicher, daß[S. 99] die meisten Menschen von Menzels Bildern die Empfindungen
mitnehmen, sie seien treue Wiedergaben der Natur, und ebenso
sicher, daß sie bemerken, Liebermanns Bilder seien oberflächliche,
unvollkommene Wiedergaben der Natur. Ein Zeichen, daß sie keinen Sinn
haben für die großen Schönheiten der Natur, und daß sie Natur
nur dort sehen, wo es ins Einzelne geht, daß erst die unterstrichene,
bemerkbar gemachte Wirklichkeit ihnen Wirklichkeit zu sein scheint.
Hier sind aber die Grenzen zwischen realistischer und idealistischer
Kunst. Menzel betont die Realität bis ins äußerste, Liebermann nur
das Notwendige, ihre großen Formen: er scheidet sie in Wesentliches
und Unwesentliches, er entwickelt Urteilskraft, Menzel mehr Sehkraft
und Handgeschicklichkeit. Dieser geht der Natur mit Schrauben und
Hebeln zu Leibe, Liebermann sucht ihr mit Gefühl nahe zu kommen. Ohne
Menzels Bedeutung anzutasten, kann man doch sagen, daß seine Kunst
ohne erzieherische Kraft war, nicht weil sie nicht Kunst gewesen wäre,
sondern weil ihr das Befreiende fehlt. Liebermann aber, der so fein in
der Natur wählt, der nicht an das Verblüffen durch Fertigkeiten denkt
und, trotz manchmal trüber Farben, einen Farbengeschmack verrät, wie
ihn nur die Besten besaßen, übte Wirkung auf die zeitgenössische Kunst
aus. Und gerade das Idealistische bei Liebermann, sein Beispiel, wie
die Wirklichkeit gepackt werden könne, ohne das Nebensächliche, sein
inniges Verhältnis zu dem mächtigsten Idealisierer aller Wirklichkeit,
zum Licht, läßt ihn so einzig erscheinen.

Abb. 105. Kanal in Leyden (1899).
Zeichnung.

Abb. 106. In den Dünen (1899).
Federzeichnung.
Realistisch ist Liebermanns Kunst nur[S. 100] soweit, als sie keinen
idealistischen Inhalt besitzt und ihren Maßstab in der realen
Wirklichkeit hat; ihre Absicht aber, die Natur in ihrer Einfachheit
und Größe malerisch aufzufassen, ohne Atelier und Theaterkram und
Hadern, ist die idealste von der Welt, und „nicht was wir meinen,
sondern wie wir’s meinen“, darin liegt das Entscheidende. Man könnte
ja auch behaupten, Liebermann sei ein temperamentsloser Künstler, denn
in seinem ganzen Lebenswerk findet sich kein Bild, in dem es eine
Darstellung von leidenschaftlichen Empfindungen gibt. Ruhig, ernst,
ohne Lust und ohne Klage verrichten seine Menschen ihre Arbeit, selbst
seine Kinder führen nicht eigentlich ausgelassene Spiele. Es wird aber
niemand beifallen, diese Behauptung aufzustellen, denn die Art, wie
der Künstler diese ruhigen Existenzen schildert, zeugt von einem so
leidenschaftlichen Empfinden bei ihm, von einem so stürmischen und
begehrlichen Werben um die Natur und von einer solchen innerlichen
Begeisterung, daß die Bezeichnung „temperamentslos“ für Liebermann
und seine Kunst ganz sinnlos wäre. Nur für die alleräußerlichste
Betrachtung erscheint er uninteressiert. Aber noch Eins spricht für die
idealistische Tendenz der Liebermannschen Kunst: daß sie nach einem
Monumentalstil drängt.

Abb. 107. Studie zum „Schulgang“
(1899).

Abb. 108. Studie zum „Schulgang“
(1899).
Die ganze Anschauungsweise des Künstlers seit Mitte der achtziger Jahre
ist fest auf den Stil gerichtet, auf die Art, wie er die Erscheinungen
der Natur für das Auge als geschlossene Einheit, als Bild zusammenfaßt,
wie er vermeidet, daß die von ihm dargestellten Bewegungen als Unruhe
empfunden werden, wie er es erreicht, daß jede Einzelheit im Bilde
als abhängig vom Ganzen, als Notwendigkeit empfunden wird. Wenn man
das feine Raumgefühl Liebermanns rühmt, so lobt man eigentlich schon
etwas, was zu seinem Stil gehört. Die Gliederung des Raumes ergibt sich
natürlich auch bei ihm durch Linien, durch die beherrschende Macht der
Vertikalen und Horizontalen und Verwendung von Gegensätzen, sowohl
in Linien als in Proportionen. Je weniger Mittel, desto feiner die
Wirkung. „Die Größe der Bildfläche hat auch hier keine Bedeutung. Die
typische Größe der Form und Gestaltung, gleichviel ob farbig oder grau
in grau, ist allein maßgebend.“ Liebermanns Handzeichnungen haben nicht
weniger Stil als seine Bilder. Besonders fein ist, wie schon an anderer
Stelle hervorgehoben, bei ihm die Empfindung für das Verhältnis, ohne
die keine monumentale Wirkung denkbar ist. Die Hauptfigur in seinen
„Netzeflickerinnen“ (Abb. 47) wirkt darum so mächtig, weil sie einen
Gegensatz in der Kleinheit der anderen Gestalten hat. Ihre Bewegung,
an sich nicht stark, erscheint so, weil sie sich in dem geschleiften
Netz fortsetzt, weil die der anderen Gestalten viel weniger deutlich
gemacht ist. Die Erscheinung der „Frau[S. 101] mit den Ziegen“ (Abb. 52) macht
einen so ungeheuren Eindruck, weil sie in der Linie zusammenfließt mit
der der Ziege, die die Frau am Seil sich nachzieht. Wie auffallend wird
die Bewegung des Arbeitens der Mädchen in der „Flachsscheuer“ (Abb. 44)
gemacht durch die unbewegten Linien des Gebälkes und der den Raum
durchlaufenden Fäden. In diesem Bilde machen sich die Haltung gebenden
Vertikalen und Horizontalen besonders stark bemerkbar und ebenso die
Bevorzugung der Profilstellung, die an die Schöpfungen der Primitiven
denken läßt. Die vielen Vertikalen und Horizontalen geben aber den
Bildern Liebermanns nicht nur die Einfachheit und Größe, sondern auch
den ernsten Ausdruck. Selbst die einfachsten seiner Schöpfungen, wie
etwa die „Kuhhirtin“ (Abb. 99) oder der „Bauer mit der Kuh“ (Abb. 85)
oder die „Schafhirtin“ (Abb. 59), die durch ihren Inhalt harmlos
erscheinen könnten, erhalten durch die Darstellungsweise etwas
Erhabenes, Monumentales.
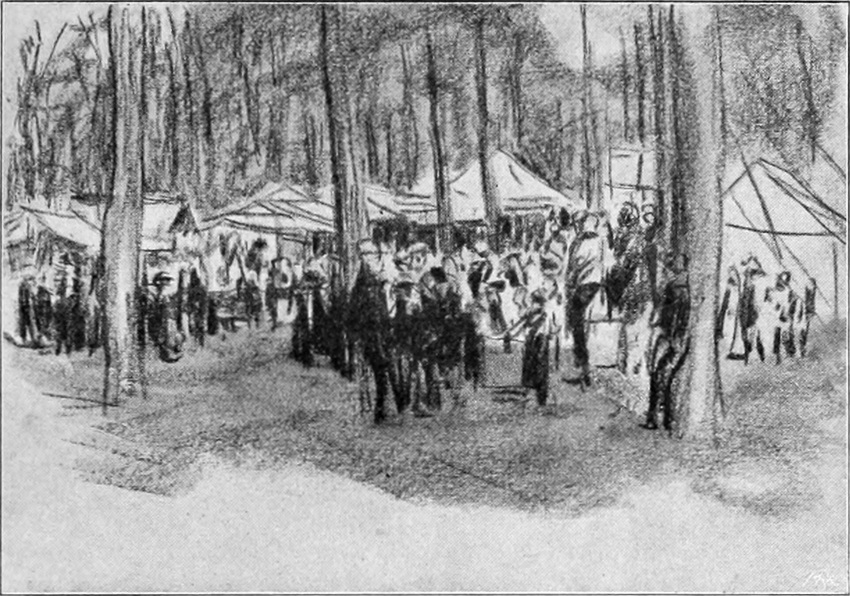
Abb. 109. Kirmeß in Laren (1899).
Zeichnung.

Abb. 110. Aus Scheveningen
(1899).
Von den einfachen stillen Farben, die durch sinngemäße Verteilung
und ruhige Fleckenwirkung soviel zu dem großzügigen Eindruck der
Bilder beitragen, war bereits die Rede. Alles kommt zusammen, um
eine Steigerung des Natürlichen ins Erhabene[S. 102] herbeizuführen und so
den Schöpfungen Liebermanns Stil zu geben. Wie er den Weg gewiesen
hat von dem bloß Malerischen zur wirklichen Malerei, so zeigt er
auch, wie man zu einem Stil gelangen kann, ohne die Eselsbrücke des
Stilisierens. Es ist ewig schade, daß man sich diese bedeutungsvolle
Seite von Liebermanns Kunst theoretisch klar machen muß, daß dem
Künstler keine Wandflächen zur Verfügung gestanden haben, wo er
vor allem Volke hätte beweisen können, wie groß und schön und rein
er eine Welt sieht und darzustellen weiß, die man bis zu seinem
Erscheinen ohne diese Eigenschaften glaubte. Die Dekorationen für den
Saal eines Mecklenburger Schlosses (Abb. 101 u. 102) sind leider der
Öffentlichkeit entzogen. Wie bestätigen sie aber die Ansicht, daß
Liebermanns Kunst alle Kennzeichen der Monumentalität trägt!
Es ist ein eigenes Schicksal, daß die einzigen drei Künstler des
neunzehnten Jahrhunderts, die berufen waren, einer von der Malerei
bisher noch nicht dargestellten Erscheinungswelt im Sinne großer
Kunst den höchsten Ausdruck zu geben, die vermocht hatten, Wesen und
Fühlen ihrer Zeit in neuer Weise zu fassen und zu gestalten, daß
diese drei Künstler — der Franzose Millet, der Deutsche Liebermann
und der Italiener Segantini — nicht Gelegenheit gefunden haben, der
Nachwelt in auch äußerlich monumentalen Werken Spuren ihres Daseins zu
hinterlassen. Um wieviel größer würden sie erscheinen! Aber trotzdem:
Die Kunst der drei wird ewig leben, weil sie einen ewigen Typus für die
Kunst lebendig gemacht hat, den des arbeitenden Menschen. Und gerade
das Zeitlose seiner Erscheinung ist es, was ihn so mächtig aus den
Werken der drei Künstler wirken läßt. —

Abb. 111. Nach Hause (1899).
Kreidezeichnung.
Vielleicht erwartet man jetzt eine Klarlegung der Mängel von
Liebermanns Kunst, und vielleicht wäre es nicht schwierig, sie
zu bieten, aber die Gelegenheit erscheint schlecht gewählt; denn
über Liebermann schreiben, heißt immer noch die Gründe darthun, um
derentwillen er bewundert werden muß. Eine eingeschränkte Bewunderung
aber macht niemandem warm. Jeder Künstler hat die Mängel seiner
Tugenden, also auch Liebermann. Es gab und gibt Künstler, die
Gewaltigeres vollbracht haben, die bezwingendere, erhebendere Werke
schufen, aber es gibt wenige Künstler, die die Natur inniger, treuer
erfaßt und natürlicher dargestellt haben. Er ist kein Virtuose. Das
wäre ein Widerspruch zu seiner ganzen Art; aber er hat Naivetät und
jene unbedingte Hingabe an seinen Gegenstand, ohne die große Kunstwerke
nicht geschaffen werden. Es sieht zuweilen unbeholfen aus, was er
macht, aber immer fühlt man, daß es ihm um die ganze, nicht um die
halbe Wahrheit und Kunst geht. Er ist mehr als bloß ein Maler, er
ist eine Persönlichkeit, eine feine,[S. 104] starke und im tiefsten Grunde
ihres Wesens künstlerische Persönlichkeit. Das gibt seinem Schaffen
die Bedeutung, seinen Werken die unvergängliche Lebenskraft und
erklärt die Größe seiner Wirkung auf die Kunst seiner Zeit, aber es
ergibt sich daraus auch die Schwierigkeit, das letzte Wort über ihn
zu sagen. Das Beste von Liebermanns Kunst läßt sich nur fühlen, nicht
durch die Sprache ausdrücken. „Es gibt in der Natur ein Zugängliches
und ein Unzugängliches. Dieses unterscheide und bedenke man wohl und
habe Respekt. Es ist uns schon geholfen, wenn wir es überall nur
wissen, wiewohl es immer sehr schwer bleibt, zu sehen, wo das eine
aufhört und das andere beginnt. — Wer es aber weiß und klug ist,
wird sich am Zugänglichen halten, und indem er in dieser Region nach
allen Seiten geht und sich befestigt, wird er sogar auf diesem Wege
dem Unzugänglichen etwas abgewinnen können, wiewohl er hier doch
zuletzt gestehen wird, daß manchen Dingen nur bis zu einem gewissen
Grade beizukommen ist und die Natur immer etwas Problematisches hinter
sich behalte, welches zu ergründen die menschlichen Fähigkeiten nicht
hinreichen.“

Abb. 113. Kartoffelernte
(1895).
Im Besitz der Kunsthandlung von Bruno & Paul Cassirer
in Berlin.
*** END OF THE PROJECT GUTENBERG EBOOK LIEBERMANN ***
Updated editions will replace the previous one—the old editions will
be renamed.
Creating the works from print editions not protected by U.S. copyright
law means that no one owns a United States copyright in these works,
so the Foundation (and you!) can copy and distribute it in the United
States without permission and without paying copyright
royalties. Special rules, set forth in the General Terms of Use part
of this license, apply to copying and distributing Project
Gutenberg™ electronic works to protect the PROJECT GUTENBERG™
concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark,
and may not be used if you charge for an eBook, except by following
the terms of the trademark license, including paying royalties for use
of the Project Gutenberg trademark. If you do not charge anything for
copies of this eBook, complying with the trademark license is very
easy. You may use this eBook for nearly any purpose such as creation
of derivative works, reports, performances and research. Project
Gutenberg eBooks may be modified and printed and given away--you may
do practically ANYTHING in the United States with eBooks not protected
by U.S. copyright law. Redistribution is subject to the trademark
license, especially commercial redistribution.
START: FULL LICENSE
THE FULL PROJECT GUTENBERG LICENSE
PLEASE READ THIS BEFORE YOU DISTRIBUTE OR USE THIS WORK
To protect the Project Gutenberg™ mission of promoting the free
distribution of electronic works, by using or distributing this work
(or any other work associated in any way with the phrase “Project
Gutenberg”), you agree to comply with all the terms of the Full
Project Gutenberg™ License available with this file or online at
www.gutenberg.org/license.
Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg™ electronic works
1.A. By reading or using any part of this Project Gutenberg™
electronic work, you indicate that you have read, understand, agree to
and accept all the terms of this license and intellectual property
(trademark/copyright) agreement. If you do not agree to abide by all
the terms of this agreement, you must cease using and return or
destroy all copies of Project Gutenberg™ electronic works in your
possession. If you paid a fee for obtaining a copy of or access to a
Project Gutenberg™ electronic work and you do not agree to be bound
by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person
or entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph 1.E.8.
1.B. “Project Gutenberg” is a registered trademark. It may only be
used on or associated in any way with an electronic work by people who
agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few
things that you can do with most Project Gutenberg™ electronic works
even without complying with the full terms of this agreement. See
paragraph 1.C below. There are a lot of things you can do with Project
Gutenberg™ electronic works if you follow the terms of this
agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg™
electronic works. See paragraph 1.E below.
1.C. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation (“the
Foundation” or PGLAF), owns a compilation copyright in the collection
of Project Gutenberg™ electronic works. Nearly all the individual
works in the collection are in the public domain in the United
States. If an individual work is unprotected by copyright law in the
United States and you are located in the United States, we do not
claim a right to prevent you from copying, distributing, performing,
displaying or creating derivative works based on the work as long as
all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope
that you will support the Project Gutenberg™ mission of promoting
free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg™
works in compliance with the terms of this agreement for keeping the
Project Gutenberg™ name associated with the work. You can easily
comply with the terms of this agreement by keeping this work in the
same format with its attached full Project Gutenberg™ License when
you share it without charge with others.
1.D. The copyright laws of the place where you are located also govern
what you can do with this work. Copyright laws in most countries are
in a constant state of change. If you are outside the United States,
check the laws of your country in addition to the terms of this
agreement before downloading, copying, displaying, performing,
distributing or creating derivative works based on this work or any
other Project Gutenberg™ work. The Foundation makes no
representations concerning the copyright status of any work in any
country other than the United States.
1.E. Unless you have removed all references to Project Gutenberg:
1.E.1. The following sentence, with active links to, or other
immediate access to, the full Project Gutenberg™ License must appear
prominently whenever any copy of a Project Gutenberg™ work (any work
on which the phrase “Project Gutenberg” appears, or with which the
phrase “Project Gutenberg” is associated) is accessed, displayed,
performed, viewed, copied or distributed:
This eBook is for the use of anyone anywhere in the United States and most
other parts of the world at no cost and with almost no restrictions
whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms
of the Project Gutenberg License included with this eBook or online
at
www.gutenberg.org. If you
are not located in the United States, you will have to check the laws
of the country where you are located before using this eBook.
1.E.2. If an individual Project Gutenberg™ electronic work is
derived from texts not protected by U.S. copyright law (does not
contain a notice indicating that it is posted with permission of the
copyright holder), the work can be copied and distributed to anyone in
the United States without paying any fees or charges. If you are
redistributing or providing access to a work with the phrase “Project
Gutenberg” associated with or appearing on the work, you must comply
either with the requirements of paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 or
obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg™
trademark as set forth in paragraphs 1.E.8 or 1.E.9.
1.E.3. If an individual Project Gutenberg™ electronic work is posted
with the permission of the copyright holder, your use and distribution
must comply with both paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 and any
additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms
will be linked to the Project Gutenberg™ License for all works
posted with the permission of the copyright holder found at the
beginning of this work.
1.E.4. Do not unlink or detach or remove the full Project Gutenberg™
License terms from this work, or any files containing a part of this
work or any other work associated with Project Gutenberg™.
1.E.5. Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this
electronic work, or any part of this electronic work, without
prominently displaying the sentence set forth in paragraph 1.E.1 with
active links or immediate access to the full terms of the Project
Gutenberg™ License.
1.E.6. You may convert to and distribute this work in any binary,
compressed, marked up, nonproprietary or proprietary form, including
any word processing or hypertext form. However, if you provide access
to or distribute copies of a Project Gutenberg™ work in a format
other than “Plain Vanilla ASCII” or other format used in the official
version posted on the official Project Gutenberg™ web site
(www.gutenberg.org), you must, at no additional cost, fee or expense
to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means
of obtaining a copy upon request, of the work in its original “Plain
Vanilla ASCII” or other form. Any alternate format must include the
full Project Gutenberg™ License as specified in paragraph 1.E.1.
1.E.7. Do not charge a fee for access to, viewing, displaying,
performing, copying or distributing any Project Gutenberg™ works
unless you comply with paragraph 1.E.8 or 1.E.9.
1.E.8. You may charge a reasonable fee for copies of or providing
access to or distributing Project Gutenberg™ electronic works
provided that:
• You pay a royalty fee of 20% of the gross profits you derive from
the use of Project Gutenberg™ works calculated using the method
you already use to calculate your applicable taxes. The fee is owed
to the owner of the Project Gutenberg™ trademark, but he has
agreed to donate royalties under this paragraph to the Project
Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payments must be paid
within 60 days following each date on which you prepare (or are
legally required to prepare) your periodic tax returns. Royalty
payments should be clearly marked as such and sent to the Project
Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in
Section 4, “Information about donations to the Project Gutenberg
Literary Archive Foundation.”
• You provide a full refund of any money paid by a user who notifies
you in writing (or by e-mail) within 30 days of receipt that s/he
does not agree to the terms of the full Project Gutenberg™
License. You must require such a user to return or destroy all
copies of the works possessed in a physical medium and discontinue
all use of and all access to other copies of Project Gutenberg™
works.
• You provide, in accordance with paragraph 1.F.3, a full refund of
any money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the
electronic work is discovered and reported to you within 90 days of
receipt of the work.
• You comply with all other terms of this agreement for free
distribution of Project Gutenberg™ works.
1.E.9. If you wish to charge a fee or distribute a Project
Gutenberg™ electronic work or group of works on different terms than
are set forth in this agreement, you must obtain permission in writing
from the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the manager of
the Project Gutenberg™ trademark. Contact the Foundation as set
forth in Section 3 below.
1.F.
1.F.1. Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable
effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread
works not protected by U.S. copyright law in creating the Project
Gutenberg™ collection. Despite these efforts, Project Gutenberg™
electronic works, and the medium on which they may be stored, may
contain “Defects,” such as, but not limited to, incomplete, inaccurate
or corrupt data, transcription errors, a copyright or other
intellectual property infringement, a defective or damaged disk or
other medium, a computer virus, or computer codes that damage or
cannot be read by your equipment.
1.F.2. LIMITED WARRANTY, DISCLAIMER OF DAMAGES - Except for the “Right
of Replacement or Refund” described in paragraph 1.F.3, the Project
Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project
Gutenberg™ trademark, and any other party distributing a Project
Gutenberg™ electronic work under this agreement, disclaim all
liability to you for damages, costs and expenses, including legal
fees. YOU AGREE THAT YOU HAVE NO REMEDIES FOR NEGLIGENCE, STRICT
LIABILITY, BREACH OF WARRANTY OR BREACH OF CONTRACT EXCEPT THOSE
PROVIDED IN PARAGRAPH 1.F.3. YOU AGREE THAT THE FOUNDATION, THE
TRADEMARK OWNER, AND ANY DISTRIBUTOR UNDER THIS AGREEMENT WILL NOT BE
LIABLE TO YOU FOR ACTUAL, DIRECT, INDIRECT, CONSEQUENTIAL, PUNITIVE OR
INCIDENTAL DAMAGES EVEN IF YOU GIVE NOTICE OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
1.F.3. LIMITED RIGHT OF REPLACEMENT OR REFUND - If you discover a
defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can
receive a refund of the money (if any) you paid for it by sending a
written explanation to the person you received the work from. If you
received the work on a physical medium, you must return the medium
with your written explanation. The person or entity that provided you
with the defective work may elect to provide a replacement copy in
lieu of a refund. If you received the work electronically, the person
or entity providing it to you may choose to give you a second
opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If
the second copy is also defective, you may demand a refund in writing
without further opportunities to fix the problem.
1.F.4. Except for the limited right of replacement or refund set forth
in paragraph 1.F.3, this work is provided to you ‘AS-IS’, WITH NO
OTHER WARRANTIES OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT
LIMITED TO WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR ANY PURPOSE.
1.F.5. Some states do not allow disclaimers of certain implied
warranties or the exclusion or limitation of certain types of
damages. If any disclaimer or limitation set forth in this agreement
violates the law of the state applicable to this agreement, the
agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or
limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or
unenforceability of any provision of this agreement shall not void the
remaining provisions.
1.F.6. INDEMNITY - You agree to indemnify and hold the Foundation, the
trademark owner, any agent or employee of the Foundation, anyone
providing copies of Project Gutenberg™ electronic works in
accordance with this agreement, and any volunteers associated with the
production, promotion and distribution of Project Gutenberg™
electronic works, harmless from all liability, costs and expenses,
including legal fees, that arise directly or indirectly from any of
the following which you do or cause to occur: (a) distribution of this
or any Project Gutenberg™ work, (b) alteration, modification, or
additions or deletions to any Project Gutenberg™ work, and (c) any
Defect you cause.
Section 2. Information about the Mission of Project Gutenberg™
Project Gutenberg™ is synonymous with the free distribution of
electronic works in formats readable by the widest variety of
computers including obsolete, old, middle-aged and new computers. It
exists because of the efforts of hundreds of volunteers and donations
from people in all walks of life.
Volunteers and financial support to provide volunteers with the
assistance they need are critical to reaching Project Gutenberg™’s
goals and ensuring that the Project Gutenberg™ collection will
remain freely available for generations to come. In 2001, the Project
Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure
and permanent future for Project Gutenberg™ and future
generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary
Archive Foundation and how your efforts and donations can help, see
Sections 3 and 4 and the Foundation information page at www.gutenberg.org.
Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation
The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non-profit
501(c)(3) educational corporation organized under the laws of the
state of Mississippi and granted tax exempt status by the Internal
Revenue Service. The Foundation’s EIN or federal tax identification
number is 64-6221541. Contributions to the Project Gutenberg Literary
Archive Foundation are tax deductible to the full extent permitted by
U.S. federal laws and your state’s laws.
The Foundation’s business office is located at 809 North 1500 West,
Salt Lake City, UT 84116, (801) 596-1887. Email contact links and up
to date contact information can be found at the Foundation’s web site
and official page at www.gutenberg.org/contact
Section 4. Information about Donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation
Project Gutenberg™ depends upon and cannot survive without widespread
public support and donations to carry out its mission of
increasing the number of public domain and licensed works that can be
freely distributed in machine-readable form accessible by the widest
array of equipment including outdated equipment. Many small donations
($1 to $5,000) are particularly important to maintaining tax exempt
status with the IRS.
The Foundation is committed to complying with the laws regulating
charities and charitable donations in all 50 states of the United
States. Compliance requirements are not uniform and it takes a
considerable effort, much paperwork and many fees to meet and keep up
with these requirements. We do not solicit donations in locations
where we have not received written confirmation of compliance. To SEND
DONATIONS or determine the status of compliance for any particular state
visit
www.gutenberg.org/donate.
While we cannot and do not solicit contributions from states where we
have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition
against accepting unsolicited donations from donors in such states who
approach us with offers to donate.
International donations are gratefully accepted, but we cannot make
any statements concerning tax treatment of donations received from
outside the United States. U.S. laws alone swamp our small staff.
Please check the Project Gutenberg Web pages for current donation
methods and addresses. Donations are accepted in a number of other
ways including checks, online payments and credit card donations. To
donate, please visit: www.gutenberg.org/donate
Section 5. General Information About Project Gutenberg™ electronic works
Professor Michael S. Hart was the originator of the Project
Gutenberg™ concept of a library of electronic works that could be
freely shared with anyone. For forty years, he produced and
distributed Project Gutenberg™ eBooks with only a loose network of
volunteer support.
Project Gutenberg™ eBooks are often created from several printed
editions, all of which are confirmed as not protected by copyright in
the U.S. unless a copyright notice is included. Thus, we do not
necessarily keep eBooks in compliance with any particular paper
edition.
Most people start at our Web site which has the main PG search
facility:
www.gutenberg.org.
This Web site includes information about Project Gutenberg™,
including how to make donations to the Project Gutenberg Literary
Archive Foundation, how to help produce our new eBooks, and how to
subscribe to our email newsletter to hear about new eBooks.