
Anmerkungen zur Transkription
Der vorliegende Text wurde anhand der 1916 erschienenen Buchausgabe so weit wie möglich originalgetreu wiedergegeben. Typographische Fehler wurden stillschweigend korrigiert. Ungewöhnliche und heute nicht mehr gebräuchliche Schreibweisen sowie Schreibvarianten bleiben gegenüber dem Original unverändert, sofern der Sinn des Texts dadurch nicht beeinträchtigt wird.
Das Original wurde in Frakturschrift gesetzt; Passagen in Antiquaschrift werden im vorliegenden Text kursiv dargestellt. Abhängig von der im jeweiligen Lesegerät installierten Schriftart können die im Original gesperrt gedruckten Passagen gesperrt, in serifenloser Schrift, oder aber sowohl serifenlos als auch gesperrt erscheinen.
Die Buchnummerierung im Umschlagbild wurde vom Bearbeiter hinzugefügt. Dieses Bild wurde in die Public Domain eingebracht. Ein Urheberrecht wird nicht geltend gemacht. Das Bild darf von jedermann unbeschränkt genutzt werden.

Liebe·Ehe·Heirat·Geburt·Religion·Aberglaube·
Lebensgewohnheiten·Kultureigentümlichkeiten·
Tod und Bestattung bei allen Völkern der Erde
Bearbeitet auf Grund der Beiträge hervorragender Fachgelehrter
von
Dr·Georg Buschan·
Dritter Band
Mit 477 Abbildungen im Text, 6 farbigen
Kunstbeilagen
und 9 Kunstblättern in Doppeltondruck

Stuttgart, Berlin, Leipzig * Union Deutsche Verlagsgesellschaft
Nachdruck verboten
Alle Rechte vorbehalten
Druck der Union Deutsche Verlagsgesellschaft in Stuttgart
|
|
Seite
|
|
Afrika (Schluß)
|
|
|
Westafrika
|
|
|
Sudan
|
|
|
Das Kongobecken
|
|
|
Amerika
|
|
|
Das arktische Amerika
|
|
|
Das übrige Nordamerika
|
|
|
Mittelamerika und die westindischen Inseln
|
|
|
Südamerika
|
|
|
Europa
|
|
|
Der germanische Kulturkreis
|
|
|
Die romanischen Völker
|
|
|
Die slawischen Völker
|
|
|
Die nichtslawischen Balkanvölker
|
|
|
Die übrigen in Europa vertretenen Stämme:
Lappen, Finnen, Basken, Zigeuner
|
Verzeichnis der Kunstbeilagen
|
|
Nach Seite
|
Zugehöriger
Text Seite |
|
Weib oder Vase?
|
||
|
Ein „Makenge“ genannter Würdenträger der Babende
|
||
|
Die Flötenzeremonie oder Lenya der Hopi-Indianer
|
||
|
Festzug bei einer Posada (Weihnachtsitte in
Mexiko)
|
||
|
Tariana-Indianer vom Rio Negro (Brasilien)
|
||
|
Eingeborenenfrau Südamerikas, die ihr Kind in
einem mit Pelz ausgefütterten, „Shihungju“ genannten Korb auf dem Kopf
trägt
|
||
|
Maskentänzer der Opaina, eines Stammes am
Apaporis River in Brasilien
|
||
|
Bauernhochzeit auf der Alb
|
||
|
Wendische Brautjungfer vor dem
Hochzeitshause
|
||
|
Bauernhochzeit in Oberschlesien
|
||
|
Königsfahrt bei den Slowaken
|
||
|
Braut und Bräutigam aus Wltschnov bei
Ungarisch-Brod
|
||
|
Bojarenhochzeit
|
||
|
Kinderverlöbnis in Griechenland
|
||
|
Totenwache, ein Brauch bei den spanischen
Zigeunern
|

[S. 1]

Westafrika, worunter ich die Küstengebiete vom Senegal südwärts bis zum Kongo verstanden wissen will, wird in der Hauptsache von den westlichen Sudannegern, in seinem südlichsten Abschnitte (Kamerun) auch von Bantustämmen eingenommen. Über diese Unterschichten haben sich in weiter Ausdehnung, aber ungleicher Dichte fremdländische, von Norden und Osten her eingewanderte Elemente gelagert, Hamiten und Araber, so daß stellenweise mannigfache Verschmelzungsprozesse entstanden sind. Diese Zuwanderer waren die Fulbe und die Haussa, von denen in dem Abschnitt Sudan ein wenig eingehender noch die Rede sein wird. Beide Völker haben in den vergangenen Jahrhunderten, die Fulbe im neunzehnten, die Haussa bereits im siebzehnten und achtzehnten, eine große politische Rolle gespielt und mächtige Staaten gegründet, die aber schon längst ihren Glanz eingebüßt haben.
Die wichtigste Gruppe der westlichen Sudanneger sind die Mandingo, eine nach Millionen zählende Menschenmasse, die sich vom Senegal in breiter Zone längs der ganzen Westküste und ihres Hinterlandes bis Togo hinzieht und durch das gemeinsame Band ihrer Sprache (Mandingo) miteinander verbunden wird. Im dreizehnten Jahrhundert bildeten die Mandingo ein mächtiges selbständiges Staatswesen. Zu ihnen zählen als wichtigste Stämme heutigestags die Soninke an der Küste Senegals, die Bambara am oberen Senegal und Niger, die Woluffen zwischen Senegal und Gambia, die Balante in Portugiesisch-Guinea, die Susu in der Rivière[S. 2] du Sud, die Mendi und Timni in Sierra Leone, die Wei und Kru in Liberia, die Aschanti und die Eingeborenen von Dahome, sowie die tschi- und ewesprechenden Stämme, die Yoruba und Timvölker (Tschaudjo, Bassari, Losso, Kaburi und so weiter) an der Gold- und Sklavenküste. Die letzteren rechnet man bereits zu den Guineanegern, zu denen in Kamerun noch die Bali, Bamum, Tikar, Wute, Dschamba, Musgu und Kanuri als die bedeutendsten Stämme hinzukommen würden. Unter diesem Himmelsstriche stoßen wir aber gleichzeitig noch auf die von Süden her zugewanderten Bantu, als deren wichtigste Stämme ich die Fang, Maka, Bakoko (mit den Duala) und Bakundu anführe. Schließlich wären noch Überreste der Zwergvölker (Bangielle) in Südkamerun zu erwähnen.

Der Typus (Abb. 2) der westafrikanischen Neger gleicht im allgemeinen dem der Sudan- und Bantuneger, wie wir ihn bereits geschildert haben, so daß wir von einer Wiederholung hier absehen können. Natürlich hat er durch die langjährigen Vermischungen mit den Fulbe und Haussa, desgleichen mit den in früheren Jahrhunderten eingewanderten Portugiesen vielfach eine Veränderung, oft genug zu seinem Besten, erfahren.
Die Bekleidung der westafrikanischen Neger ist je nach dem Grade, in dem sie von der europäischen Kultur beeinflußt worden ist, eine ganz verschiedene. Im Inneren gehen die Männer noch vielfach im paradiesischen Zustande einher, auch die Frauen, wenn man von Schmucksachen, die sie sich umhängen, absieht (Abb. 3 und 4). Meistens aber tragen sie schon einen kleinen Schamschurz; die Kinder pflegen indessen meistens ganz nackend zu erscheinen. An der Küste dagegen bedeckt man sich den Körper bereits in größerer Fläche mit Umhängen oder Tüchern (Abb. 5) nach Art einer Toga (Abb. 6 und 7), vielfach hat man sich auch bereits der europäischen Kleidung angepaßt (Abb. 9) und macht selbst die neuesten Moden mit; so aufgeputzte Schwarze wirken geradezu lächerlich.
Schmuck wird allenthalben getragen in Gestalt von Schnüren aus Perlen oder Metallreifen um Hals, Arme und Leib (Abb. 8, 10 und 12). Auch begegnen wir vielfach der Ausdehnung der Lippen und der Ohrläppchen durch Einführung immer stärker werdender Gegenstände, bis sie ganze Scheiben zu halten[S. 3] vermögen (Abb. 15 und 16), die öfters mit Samenkörnern, Perlen und Zinnauslagen verziert sind. Ebenso wird verschiedentlich auch Nasenschmuck (Abb. 11), Perlen, Korallen, Vogelklauen und so weiter, getragen. Sehr beliebt sind Tatauierungen, sowohl im Gesicht wie auch am Körper. Diese Muster, die entweder in feinen Punkten oder in Strichen bestehen (Abb. 3, 4, 13 und 14), dienen teils als Stammes- oder Herkunftsabzeichen, teils als Kennzeichen bestimmter Lebensabschnitte. Bei vielen Stämmen beginnt man mit der Tatauierung bereits in der Kindheit und fügt aus bestimmten Anlässen (Reifezeit, Hochzeit) neue Muster hinzu. Bei den Haussa vermag man aus den Tatauierungszeichen herauszulesen, welcher Stadt sie entstammen und welches Gewerbe sie betreiben. Die größeren Einschnitte in die Haut werden vielfach durch Einreiben verschiedener Mittel an der frühzeitigen Heilung gehindert, so daß mit der Zeit aus ihnen daumendicke Narben hervorgehen, was um so leichter zu erreichen ist, als gerade bei den Schwarzen die Haut große Neigung bekundet, üppig zu wuchern (Keloidbildung; Abb. 17). Ganz eigenartig und abwechslungsreich sind die Haarfrisuren der Neger, im besonderen derer von Kamerun, so daß es unmöglich ist, sie im einzelnen vorzuführen (Abb. 18 bis 27).


Alle Stämme Westafrikas haben bereits eine seßhafte Lebensweise angenommen. Sie wohnen entweder in runden Hütten, die aus aufeinandergeschichteten kreisförmigen Ringen aus Lehm aufgebaut sind und ein Kegeldach tragen (Abb. 30), oder in rechtwinkligen Giebeldachhäusern beziehungsweise in Übergangsformen zwischen beiden. In einzelnen Gebieten finden sich die Gehöfte (Hütten und Wirtschaftsgebäude) durch eine gemeinsame Umfassungsmauer zu einer Art Festung umgewandelt (Abb. 29). Die einzelnen so in sich geschlossenen Gehöfte sind wieder durch Löcher in den Mauern miteinander verbunden, so daß auf diese Weise wirkliche Labyrinthe entstehen. In Togo haben diese festungsähnlichen Anlagen eine besondere Form angenommen, die der Tambermaburgen. Dieselben sind dadurch gekennzeichnet, daß man zwei solcher umfriedigter Gehöfte aufeinander gesetzt hat, von denen das untere die Wirtschafts-, das obere die Wohnräume enthält (Abb. 28). Der Aufgang zu den Plattformen erfolgt auf Stiegen aus Lehm oder auf ausgehauenen Baumstämmen. — Als Erwerbsquelle der Neger steht der Feldbau im Vordergrund, daneben wird aber auch vielfach noch Viehzucht getrieben und ganz allgemein die Jagd (Abb. 31). An der Küste erstreckt sich diese auch auf das Wasser. Jedoch entwickeln die Neger auch eine gewerbliche Tätigkeit. Ehe europäische Erzeugnisse Eingang fanden, war die Hausindustrie in hoher Blüte, aber auch jetzt noch wird in mancher Hinsicht Bemerkenswertes[S. 4] geleistet. Die Eisengewinnung und Schmiedekunst ist ein in Afrika bodenständiges Handwerk; ebenso erfreuen sich Weberei und Töpferei ziemlicher Verbreitung. — Auch auf gewissen Gebieten der bildnerischen Kunst besitzen die westafrikanischen Neger eine große Geschicklichkeit. Berühmt sind die Bronzearbeiten und Elfenbeinschnitzereien aus Benin; die Aschanti sind vorzügliche Goldschmiede, die Yoruba Elfenbeinschnitzer.
Die Nahrung bieten den westafrikanischen Negern die Erträge des Feldbaus und der Jagd. In früheren Zeiten war auch Menschenfleisch eine wichtige Nahrungsquelle verschiedener Stämme, im besonderen der Wute und der Maka Kameruns. Während die meisten Kannibalen sich auf das Verzehren erschlagener Feinde beschränkten, mästeten die Maka ihre Opfer planmäßig, ja sie verkauften sogar ihre eigenen Eltern, wenn sie alt und arbeitsunfähig geworden waren, an Stammesgenossen. Sie wurden von diesen wie ein Stück Vieh gemästet und, wenn sie genügend Fett angesetzt hatten, zur Schlachtbank geführt, geköpft und sodann mit Wohlbehagen verzehrt. Als besondere Leckerei galten das Gehirn und die Augen. Die fetten Fleischteile wurden am offenen Feuer geröstet, die mehr trockenen dagegen geräuchert und aufbewahrt. In Sierra Leone bestand in früheren Zeiten eine geheime Gesellschaft, die bei ihren Zusammenkünften den Kannibalismus ausübte. Zu diesen wurde von den Mitgliedern irgendein harmloser Nachbar, Verwandter oder Sklave mitgebracht, in der Versammlung getötet und verspeist. Die Zusammenkünfte fanden zu Ehren des Fetischs Boffima statt, der in Gestalt einer großen Fruchtknolle (von der Form eines Straußeneis) verehrt wurde. Diese war mit einer geheimnisvollen Masse angefüllt und mit Leopardenhaut überzogen, die von Zeit zu Zeit mit Menschenfett eingesalbt werden mußte, damit der Fetisch seine Wunderkraft behalte.


Was die religiösen Verhältnisse der Westafrikaner anbetrifft, so hat vielfach unter ihnen, besonders im Sudan, der Mohammedanismus seit langem Anhänger gefunden, wodurch natürlicherweise die Gebräuche des einheimischen Kultus im allgemeinen dem Untergange geweiht sind. Dessenungeachtet haben sich dieselben verschiedentlich meist im geheimen, aber auch öffentlich, weitererhalten. Sogar für den zum Islam bekehrten Haussa ist die Welt mit allerlei Geistern oder Bori bevölkert, die seiner Ansicht nach meistens bösartig sind oder doch immerhin bei der geringsten Herausforderung Unheil anrichten, weswegen er bemüht ist, sie zu versöhnen[S. 6] (Abb. 1), oder wenigstens darauf bedacht, alles zu vermeiden, was ihre Aufmerksamkeit auf ihn lenken könnte. Die meisten dieser Bori sind Krankheitsgeister, manche von ihnen möglicherweise durch die Araber eingeführt, viele dagegen altheidnischen Ursprungs. Eine große Rolle spielten unter ihnen der Geist, der das Fieber, sowie der, der die Pocken schickt oder mitbringt. Die Abwehrmaßregeln (Abb. 33), die zum Beispiel die Neger der Goldküste gegen die Einführung der Pocken anwenden, sind besonders interessant. Zum Schutze gegen diesen Geist, der wie ein schleichendes Tier die Krankheit besonders bei Nacht ins Dorf bringt, stellen sie am Eingang desselben einen Wächter auf, aber nicht in Gestalt einer lebenden Person, sondern eines Amaga, das ist eines Idols, das ein auswärtiger Künstler der Dorfgemeinde auf ihre Kosten anfertigt. Kommt das Pockengespenst nun bei Nacht daher, dann stößt es auf diesen unter einem kleinen Dache sitzenden Wächter, erschrickt und kehrt um. Außerdem stellt man am Eingang zum Dorfe einen oder mehrere, etwa einen Drittelmeter hohe Zäune quer über den Weg, über die der Geist stolpern und gleichfalls durch Schreck zum Rückzug gezwungen werden soll. Auch kommt es vor, daß man allen mit tiefer Stimme krähenden Hähnen des Dorfes den Hals umdreht in der Meinung, daß dann der Pockengeist, wenn er am frühen Morgen beim Dorfe vorbeikommt, nicht mehr durch das Krähen auf dasselbe aufmerksam gemacht werden könne. Noch kindischer ist ein anderes Mittel, um die Aufmerksamkeit des Gespenstes abzuwenden, nämlich das Wuchernlassen des Grases auf den Hauptwegen, die zum Dorfe führen. Auf jedem vielbegangenen Wege pflegt der Graswuchs nur sehr gering zu sein. Findet der Pockengeist nun, daß ein Weg mit Gras bewachsen ist, dann nimmt er an, daß derselbe nicht begangen worden sei, somit auch zu keiner Ortschaft führen könne; er geht also vorüber.



Um auf die schon genannten Bori zurückzukommen, so gibt der Haussa, der Anhänger des Islams ist, wohl zu, daß Allah über allem stehe und die Bori ohne seine Erlaubnis nichts ausrichten können; trotzdem glaubt er auf der anderen Seite wieder recht häufig, daß Gebete an sie von mehr Erfolg begleitet seien als an Allah unmittelbar. Die Bambara glauben auch an einen [S. 8]allerhöchsten Gott, Allah, den Schöpfer und Beherrscher der ganzen Welt, dann weiter noch an Engel und schließlich noch an Gnena oder Dschinn, die in ganz derselben Weise wie die Menschen leben, sich freuen und leiden. Sie sind Allah untertan und können ebensowenig wie die Bori ohne seinen Willen etwas unternehmen; dessenungeachtet gelten sie in anderer Hinsicht doch auch wieder für allmächtig, weswegen die Bambara ihre Bittgesuche unmittelbar an sie richten. Endlich kennt derselbe Volksstamm noch die Gna oder Boli; es sind dies sehr böse Geister, die in beständigem offenen Widerspruch zu Allah stehen, weswegen dieser sie zum Flammentod verurteilt hat. Man stellt sie sich als ganz schwarz und häßlich sowie mit Hörnern versehen vor. Diesen bösen Geistern werden Hühner und Ziegen als Opfergaben dargebracht, und außerdem wird aus solchem Anlaß Bier in Unmenge vertilgt.




Auch das Christentum hat verschiedentlich an der ganzen Küste Westafrikas Fuß gefaßt, und zwar bereits seit einer Reihe von Jahrhunderten, seitdem nämlich im fünfzehnten Jahrhundert die Portugiesen von den Kanarischen Inseln aus ihre Entdeckungs- und Eroberungsfahrten längs der Küste ausdehnten. Dieser Umstand dürfte auch dazu beigetragen haben, daß wir verschiedentlich in der Religion der heidnischen Stämme Westafrikas Anklänge an die christliche Lehre finden, vor allem immer wieder auf die Verehrung eines höchsten Wesens stoßen, das zumeist für den Schöpfer und Lenker des ganzen Weltalls gilt, für gewöhnlich mit guten Eigenschaften ausgestattet ist und als der Herr über andere, mehr oder minder zahlreiche, niedere oder örtliche Gottheiten angesehen wird. Die Ibo benennen dieses höchste Wesen mit Chuku, die Edo mit Osa, die südlichen Stämme der Goldküste mit Bobowissi, die Akposo in Togo mit Uwolowu, die Ewevölker mit Mawu, die Analeute mit Buku, die Bakoke in Kamerun mit Ololume und so weiter; die Ekoi verehren sogar zwei höchste Gottheiten: Obassi Osaw (das heißt der vom Firmament) und Obassi Nsi (das heißt der von der Erde). Außer diesen Hauptgottheiten werden von den westafrikanischen Negerstämmen noch niedere Gottheiten, meistens die Vorfahren, auch besondere Schutzgottheiten, sowie zahlreiche[S. 10] Geister verehrt. Gerade die Geisterverehrung hat in Westafrika einen solchen Umfang wie wohl nirgends angenommen (Abb. 32, 34, 35, 36 und 38). Man bezeichnet diese Art von religiöser Anbetung als Fetischismus. Ein Fetisch (von dem portugiesischen Worte feitiço = Amulett abgeleitet) ist kein wirklicher Gott oder Götze, auch keine Seele eines Ahnen, sondern ein Geist, der in dem betreffenden Gegenstande, der dann auch seinerseits Fetisch genannt wird, lebt, ein Zaubermittel, das mittels desselben seine Wirksamkeit entfaltet (Abb. 39). Die westafrikanischen Neger halten nämlich jeden beliebigen, für uns unbelebten Gegenstand für beseelt von einem Geiste und treiben mit Hilfe eines solchen Zauberei. Zu einem Fetisch kann also jeder beliebige Gegenstand gemacht werden; dementsprechend begegnen wir darunter den nach unseren Begriffen sinnlosesten Dingen. So bestand der Hauptfetisch der Adele in Pereu (Togo) aus einem kleinen Holzschemel, an dem mit Hühnerblut angeklebte Vogelfedern saßen und kleine Metallglocken hingen. Des Fetischs Boffima in Sierra Leone, einer mit Leopardenhaut überzogenen Knollenfrucht, gedachten wir bereits auf Seite 4. Der Fetisch Legba, der vielfach in Dahome und in den Eweländern angetroffen wird und für ein sehr wirksames Zaubermittel zur Erhöhung der Liebeslust und der Zeugungskraft gilt, stellt eine ganz roh geformte sitzende Figur mit auffällig entwickelten Geschlechtsteilen vor. Bei einer Frau der Goldküste, deren Fetisch die Schuld an dem Tode mehrerer Verwandten beigemessen wurde, fand sich unter ihrer Haarfrisur eine kleine kupferne Pfanne mit einem Lehmkloß, in dem Papageienfedern steckten. Ein besonderes Interesse dürften die Fetische der Loangoküste beanspruchen. Es[S. 11] sind dies menschliche, auch wohl tierische Figuren aus Holz, die meistens an ihrer ganzen Oberfläche mit Bandeisenstücken oder Nägeln gespickt erscheinen (Abb. 40). Dieses Einschlagen der Nägel verfolgt einen doppelten Zweck. Einmal will derjenige, der diese Maßnahme an dem Fetisch vornimmt, dadurch seine Unschuld beweisen; er schwört gleichsam bei seinem Fetisch. Der Geist im Holze soll die durch das Einschlagen entstehenden Schmerzen genau wie ein Mensch fühlen und würde sich an dem Betreffenden, der sie ihm zufügte, falls er einen Meineid geschworen hätte, rächen, weil er ihm dann frevelhafterweise Schmerzen bereitet hätte. Im anderen Falle, wo es sich darum handelt, einen Dieb oder Mörder zu bestrafen, will man den Geist durch den ihm beigebrachten Schmerz dazu zwingen, den Dieb oder Mörder zur Strafe zu ziehen.



Es fällt sehr schwer, sich über die sehr verwickelten religiösen Verhältnisse der westafrikanischen Neger Klarheit zu verschaffen. Dadurch, daß sie alles, was sie umgibt, für belebt halten und unter diesen unzähligen übernatürlichen Kräften höhere und niedere Gottheiten unterscheiden, wird die Sache sehr verwickelt. Neben den Hauptgottheiten kennt man noch unzählige Scharen von Geistern, Ahnengöttern, lokalen Haus- oder Schutzgottheiten und dergleichen. Bald werden diese als Menschen, bald als Tiere oder als menschenähnliche, phantastische Ungeheuer gedacht. In der Nähe von Nsan im Ekoilande befindet sich ein kleiner See, der von den Geistern verstorbener Ekoi in Gestalt zahlreicher Krokodile und Schlangen bewohnt sein soll. Der besondere Schutzgott der Aschanti heißt Tando; er unterrichtet die Stammesmitglieder von den geheimen Anschlägen ihrer Feinde. Früher pflegte er sich gelegentlich in die Gestalt eines Knaben zu verwandeln und sich dann von den Feinden gefangennehmen zu lassen; sobald er auf diese Weise in ihr Land gekommen war, verwüstete er es durch die Pest, die er mitbrachte. Ihm ist die Treiberameise heilig. Dagegen stehen die Krokodile unter dem Schutze seiner Frau Katarwiri, eines Flußgeistes, der als sehr boshaft und fett geschildert wird. Ein sehr gefürchteter Geist der Aschanti ist der Sasabonsum, ein rotes Ungeheuer, das unterirdisch in den Tiefen der Wälder haust an den Stellen, wo die Erde rot ist, oder auch in Baumwollbäumen. In boshafter Weise überfällt es die Wanderer, nimmt sie gefangen und verzehrt sie; die rote Erde rührt von ihrem Blute her. Es wirft auch Bäume um, damit dadurch die[S. 12] Vorübergehenden erschlagen werden, hebt die Erde auf, damit die auf ihr stehenden Häuser umfallen, und treibt noch andere Grausamkeiten. — Der Kultus, den man diesen zahlreichen Göttern widmet, um sie bei guter Laune zu erhalten oder wieder zu versöhnen, ist im allgemeinen derselbe, wie wir ihn bereits bei anderen Naturvölkern kennen gelernt haben. In der Hauptsache sind es Opfer, die man ihnen darbringt in Gestalt von Lebensmitteln, zum Beispiel Getreide, Getränke, Hühner, Ziegen, seltener Rinder, Palmöl und so weiter (Abb. 75). Man schlachtet die Tiere für gewöhnlich und bestreicht mit ihrem Blute die Idole, die die Götzen darstellen sollen, reibt diese auch mit Öl ein, oder man stellt die Opfer vor ihnen auf. Die Frauen der Ibo bringen am Jahresschluß dem Aro, der Gottheit des Jahres, alte Töpfe, Kleider, Körbe und so weiter dar, in dem Glauben, daß sie damit Schmerzen, Krankheit und Unglück im kommenden Jahre von sich abwenden können. — In Dahome macht die Schlangenanbetung den wichtigsten Teil der Religion aus; die Pythonschlange gilt als das Sinnbild des Glücks und des Gedeihens. Es gibt unter der dortigen Bevölkerung verschiedene Priestersekten, in die jedes Kind, das mit einem dieser Kriechtiere in Berührung gekommen ist, aufgenommen werden muß. Auch dem Ozean bringt man Opfer in Gestalt von Getreide, Muschelgeld und Palmöl, früher brachte man ihm aus wichtigen Anlässen auch Menschenopfer dar. Die letzteren wurden — heutzutage wird dieser scheußliche Brauch wohl kaum mehr geübt — in kostbare Gewänder gekleidet und aus einem Kanu einfach ins Wasser geworfen. Auch dem bösen Geiste Sasabonsum wurden vormals von den Aschanti nach einem Erdbeben Versöhnungsopfer in Gestalt von Menschen dargebracht; beim Wiederaufbau der Häuser wurde zur Aufführung der Fundamente Menschenblut benutzt. Ganz besonders schrecklich ging es aber in dem früheren Königreich Benin im Bereiche des Nigerdeltas zu. Hier wurden den Gottheiten der Sonne, des[S. 13] Regens und der Jahre Menschenopfer dargebracht, und zwar in solchen Massen, daß man geradezu von Menschenschlächtereien sprechen konnte. Nach den Schilderungen von Augenzeugen besaß in der Blutstadt Benin jeder Häuserblock eine tiefe Grube voll abgeschlachteter Leichen und Sterbender. Überall fand man Menschenopfer umherliegen und namentlich Gekreuzigte an besonderen Baumgerüsten hängen oder begegnete ihren Schädelresten oder wenigstens Blutspuren an der Landstraße. Auch beim Tode eines Häuptlings oder wenn man ihm später einmal ins Jenseits Nachricht von seinen Angehörigen geben wollte, wurden Tausende von Opfern hinüberbefördert. Im Jahre 1897, nachdem der letzte König von Benin eine englische Gesandtschaft hatte niedermetzeln lassen, wurde die Stadt im Sturm genommen und den geschilderten Unmenschlichkeiten ein Ende bereitet.


Die Leitung des Kultus liegt in der Regel in den Händen des Familienoberhauptes oder des Dorfhäuptlings; vielfach ist sie aber auch Sache einer besonderen Gruppe von Menschen, der Priester oder Medizinmänner (Abbild. 37, 41, 43 u. 44). Ihnen fällt ferner die Aufgabe zu, Regen zu erzeugen beziehungsweise abzuwehren, und Krankheiten zu heilen (Abb. 42), oder diejenigen Personen ausfindig zu machen, die Trockenheit oder Krankheit verursacht haben. Vielfach bedienen sich diese Männer wirklicher Medizinen, deren gute Wirkung sie durch Erfahrung kennen gelernt haben, häufiger jedoch zahlreicher Zaubermittel, die aus den verschiedensten Bestandteilen zusammengesetzt sind, Teilen von Pflanzen und Tieren, auch vom menschlichen Körper, die oft zu Asche verbrannt und zu Brei gerührt dem Kranken entweder eingegeben oder auf die leidenden Körperteile gestrichen werden, auch, in ein Säckchen genäht oder in ein Ziegen- oder Antilopenhorn (Abb. 45) sowie in kleine Kalabassen gefüllt, als Amulette zu tragen verordnet werden. Der Glaube an die Wirksamkeit dieser Mittelchen hängt mit den fetischistischen Anschauungen der Neger zusammen. Dieser Glaube an die Geister hat auch zur natürlichen Folge, daß man bestimmten Männern und Frauen die Fähigkeit, mit übernatürlichen Wesen zu verkehren, in höherem Grade zuschreibt als ihren Mitmenschen, wodurch sie imstande sein sollen, Unglück, sogar den Tod über diese zu bringen, wenn sie sich der Hilfe solcher Geister bedienen. Aufgabe der Priester ist es nun auch, diese Zauberer (Abb. 46) ausfindig zu machen, desgleichen[S. 14] Verbrecher und Diebe, sowie die Zukunft vorauszusagen. Die der Zauberei Beschuldigten müssen sich natürlich einem Gottesurteil unterwerfen, das in ganz Westafrika in dem Hinunterschlucken eines Gifttrankes vor versammelter Menge besteht. Gibt der Angeschuldigte den Trank wieder von sich, dann wird dies als ein Zeichen seiner Unschuld angesehen, er wird gleichsam zur Entschädigung mit einem Gelage und Tanz gefeiert; der Ankläger hat seinerseits die Kosten dafür zu tragen und an den unschuldig Verdächtigten eine Buße zu zahlen. Wird der Angeklagte nach dem Genusse des Giftes krank, ohne aber wirklich zu sterben, dann betrachtet man ihn mit einem gewissen Argwohn und verweist ihn aus dem Dorfe; naht sich ihm aber schließlich der Tod, dann gilt er für gewiß überführt, und die Medizinmänner pflegen dann oft das Erwünschte, nämlich sein Ende, herbeizuführen. Bei geringeren Verbrechen besteht das Ordal darin, daß der Verdächtigte aus einem Gefäß mit siedendem Öl einen Ring herausgreifen muß. In Nigeria wird ein eigentümliches Verfahren angewendet, um gestohlene Sachen ausfindig zu machen, das bis zu einem gewissen Grade an ein Gottesurteil erinnert. Man tut in ein Gefäß eine kleine Schüssel mit Muschelgeld und anderen Abzeichen des Akekultus hinein und läßt es von einem Mädchen auf dem Kopfe in der Ortschaft umhertragen; der Besitzer des verloren gegangenen Eigentums geht mit und klingelt seinen Verlust aus, wobei er singt: „Den, welcher mein Huhn (zum Beispiel) genommen hat, mögen die Götter töten, wenn er es mir nicht zurückbringt.“ Gewissen Klassen von Medizinmännern bleibt es überlassen, Zauberer und Hexen sowohl ausfindig zu machen als auch zu bestrafen. Bei den Grebo in Nigeria besteht ein besonderer Bund, der Kwi-iru, dessen Zweck die Bestrafung solcher Personen ist, die anderen durch einen Fetisch Unglück zufügen. Das Haupt des „Geheimbundes von Kindern heimgegangener Geister“, worunter allerdings nur Erwachsene verstanden werden, oder der Vater dieser Vereinigung ist nur den Mitgliedern[S. 16] bekannt; wenn er öffentlich erscheint, ist er gut vermummt, so daß er von niemand erkannt werden kann. Die Mitglieder des Kwi-iru wirken für gewöhnlich des Nachts; wo sie gerade einen vermutlichen Missetäter antreffen, da nehmen sie ihn gefangen und zwingen ihn am anderen Morgen, die Probe zu bestehen.
Damit sind wir zu dem Kapitel der Geheimbünde (Abb. 47 und 48) gekommen, die sich gerade in Westafrika einer ungeheuren Verbreitung erfreuen. Besonders Sierra Leone und Kamerun bilden gleichsam die Mittelpunkte dieser Bünde, über deren Einrichtungen es äußerst schwer hält Näheres zu erfahren, in Anbetracht der großen Verschwiegenheit, die ihre Anhänger üben. So viel indessen ist über die Ziele dieser Gesellschaften bekannt geworden, daß sie teils politische Absichten verfolgen sollen, wie die in Kamerun, teils die Erziehung der Knaben und Mädchen fördern sollen, teils auch mit dem Totenkult in Verbindung stehen oder auch nur profanen Zwecken dienen, wie zum Beispiel Tänze aus besonderem Anlaß aufzuführen, wie bei den Bakongo und Ukuku. Die Einrichtung der Geheimbünde an der westafrikanischen Küste kann auf ein hohes Alter zurückblicken, denn bereits 1668 erwähnt der Geograph Dapper ähnliche Gebräuche für die Eingeborenen der Pfefferküste.
In Sierra Leone sind die beiden wichtigsten Geheimorden der Mendi der Porobund für die Männer und Knaben und der Bundubund für die Frauen und Mädchen. Es sind beides gleichsam vereidigte Brüder- beziehungsweise Schwesterschaften, deren Geschäfte mit unbedingter Geheimhaltung von seiten der Mitglieder geführt werden; aber gelegentlich treten diese doch an die Öffentlichkeit, so daß es den Forschungsreisenden möglich gewesen ist, sogar photographische Aufnahmen von ihnen zu machen.


Der Porobund beherrscht das ganze einheimische Leben im Lande der Mendi; früher war seine Macht nahezu unbegrenzt. Ähnlich wie im Mittelalter vor der Heiligen Feme, so konnte vor seinem Gerichtshof jeder Mensch verhört und verurteilt, das Urteil sogleich an ihm vollstreckt und seine Leiche im „Porobusch“ begraben werden, ohne daß die Außenwelt etwas von den Einzelheiten des Falles erfuhr. Bei den Versammlungen der Porobrüder, die man in einer Lichtung des Waldes im Porobusch dicht bei der Stadt abhält, werden alle Fragen politischer und sozialer Natur erörtert und erledigt. Zu ihnen haben nur vollberechtigte Mitglieder Zutritt, die sich zuvor einer strengen Belehrung von seiten des Ordens haben unterziehen müssen. Man unterscheidet drei Grade, den Yuira oder „ein Wort“ für die unteren Klassen, den Binni und Missi für mohammedanische Mauren und für „Teufelsmänner“ und als höchste Stufe den Kaimahun oder Häuptlingsgrad. Der letztere ist der Ausgangspunkt aller Porovorschriften; in seinem Hohen Rat kommt das Porokabinett zu den Beschlüssen, die die unteren Grade auszuführen haben. — Da die Mendi keine Schriftsprache kennen, so bedienen sie sich als Verständigungsmittel vertrauenswürdiger Boten, Wjas genannt; solche sind stets in der Porobrüderschaft anzutreffen, deren sämtliche Mitglieder auf „Landesmedizin“ vereidigt wurden, in dem Sinne, daß diese für sie verhängnisvoll werden solle, falls sie irgendein Geheimnis verrieten.

Die heranwachsenden jungen Leute treten entweder dem Poro- oder Bundubund bei, je nach ihrem Geschlecht. Ihre Aufnahme geht unter der größten Geheimnistuerei in der Abgeschlossenheit eines besonderen Poro- oder Bundubusches vor sich. Die Ausbildung, die für die Aufnahme in den Bund erforderlich ist, kann auf jeder Altersstufe zwischen sieben und zwanzig Jahren vorgenommen werden, dauert aber nur wenige Monate. Ein Knabe besitzt keinen eigentlichen Namen, bevor er in den Porobusch geht; er erhält einen solchen erst bei der Aufnahme. Zum Zeichen dessen wird er auf beiden Seiten längs des Rückgrats mit einem Grätenstichmuster gezeichnet, das er beständig trägt, so daß man ein Poromitglied sogleich daran erkennen kann. Die Aufnahmeförmlichkeiten (Abb. 49) erfordern viel Strenge und Entsagung; doch wird den Adepten gelegentlich auch eine Erholung außerhalb des Busches ermöglicht, für gewöhnlich in Form einer Tanzerei in der nächstgelegenen Stadt.[S. 19] Die letzte Aufnahmeförmlichkeit heißt „den Teufel austreiben“. Der Poroteufel befindet sich, wie man behauptet, im Busch, und die Knaben müssen ihn, da er, obwohl auch nur ein Mensch, mit allerlei zauberischen Kräften ausgestattet sein soll, auf eine bestimmte Art vertreiben, bevor sie den Busch verlassen dürfen. Daher drehen sie am festgesetzten Tage ein langes Seil aus dem den Poro versinnbildlichenden Farn „Kane“ und leiten es während der Nacht aus den oberen Zweigen eines Baumes im Busch auf die daneben stehenden Bäume. Die Bewohner der Stadt und der umliegenden Dörfer werden durch großes Geschrei aufgeweckt, das Seil wird ihnen gezeigt und gleichzeitig mitgeteilt, daß an ihm der Teufel sich zum Firmament begeben habe. Die Knaben gehen dann in der Stadt umher und werden nach weiteren geheimen Zeremonien Mitglieder des Poroordens.

Der Binni (Abb. 50) ist der zweite Grad des Bundes; der Zutritt zu ihm steht den Mohammedanern offen. Der Teufel dieses Grades ist ein ganz besonders mächtiger, da er in einer Person den Fetischeinfluß des Heiden mit der Magie des mohammedanischen Mauren vereinigt. Dementsprechend ist auch seine Tracht zusammengesetzt. Der Körper ist von einem langen Gewand aus Pflanzenfasern umhüllt, der Kopf von einer Kappe aus Haut; das Gesicht ist gänzlich durch sie verdeckt, ein paar kleine Löcher ermöglichen jedoch das Durchsehen. Neben am Kopfe stehen ein paar Seitenklappen ab. Soweit geht der Ausputz auf heidnische Beeinflussung zurück. Dazu treten dann auf Brust und Rücken des Binni streng mohammedanische Abzeichen: viele kleine Holztafeln mit arabischer Schrift, die Zauberkraft besitzen; sie hängen am Gewande. Bei Bewegungen des Binni zittert alles an ihm, und das Geklapper der Täfelchen verstärkt den allgemeinen unheimlichen Eindruck, den bei den Zuschauern schon das Freudengeschrei der Mitwirkenden und das Geräusch von einem halben Hundert kleiner Bambusstäbe hervorrufen, die von den begleitenden Musikanten unaufhörlich angeschlagen werden.

Das Bunduwesen wird mit noch mehr Heimlichkeit betrieben als das Porowesen des männlichen Geschlechtes;[S. 20] so viel aber steht doch fest, daß der Zweck jenes Ordens die Erziehung der jungen Mädchen und ihre Vorbereitung auf ihren zukünftigen Beruf als Gattinnen und Mütter ist. Jede Familie, die über die erforderlichen Mittel verfügt, hat das Recht, ihre Töchter in den Bundubund gleichsam in Pension zu geben; für schon Verlobte entrichtet der Bräutigam die Zahlung. Es besteht kein Zwang, dem Bunde sich anzuschließen; doch tritt ihm ein großer Teil der weiblichen Wesen bei, da die Mitgliedschaft eine bedeutende gesellschaftliche Stellung mit entsprechenden Vorrechten verleiht. Die Zeremonien des Bundubundes spielen sich ebenfalls an einer verborgenen abgeholzten Stelle im Walde in der Nähe der Stadt ab, im „Bundubusch“. Um den Unbeteiligten den Zutritt zu verwehren, sind die Pfade, die zum Busch führen, durch Verbotszeichen kenntlich gemacht. Bei ihrem Eintritt in den Bund, der bald im Alter von acht bis zehn Jahren, bald auch später (sogar von seiten bereits verheirateter Frauen) erfolgt, haben die jungen Mädchen eine Medizin zu genießen, die ihnen, wenn sie die ihnen anvertrauten Geheimnisse bewahren, nichts antun kann, sie aber, sobald sie sie verraten, töten wird; auch tragen sie dieselbe in einem Antilopenhorn (Abb. 45) mit sich herum. Ja noch mehr: diese Fetischmedizin wirkt auch in die Ferne auf Dritte, das heißt auf einen jeden ein, der es wagen sollte, die Geheimnisse des Bundes zu ergründen, sei es dadurch, daß er sich dem Busch nähert oder daß er mit den Mädchen anzubandeln sucht. Diese vermeintliche Wirkung genügt bereits, um Unberufene abzuhalten. Sollte sich dennoch einer vermessen, in die Bundugeheimnisse einzudringen, so haben die Bunduteufel das Recht, den Übeltäter mit einer Keule totzuschlagen oder ihn dem Häuptling auszuliefern, der ihn als Sklaven verkaufen läßt.

Der Zusammentritt eines Bundu findet für gewöhnlich zur Zeit der Reisreife statt. Zunächst erhält jedes Mädchen einen besonderen Namen, den es fortan zu führen hat. In allen Bundugesellschaften[S. 21] wiederholen sich die Namen nacheinander in derselben Reihenfolge. Nummer eins heißt immer Kehma, Nummer zwei Toulome und so fort, zum Beispiel Bandi, Jassa, Soko, Namo. Darauf wird jede Novize mit weißem Ton beschmiert, erhält ein großes Tuch als Umhang (Abb. 52) und wird beschnitten, sowie in der Nabelgegend tatauiert. In Liberia trägt jede Beschnittene das abgeschnittene Stückchen ihres Kitzlers getrocknet um den Hals gebunden als Zeichen ihrer Jungfräulichkeit. Bei ihren Ausgängen tragen die Mädchen eine besondere Tracht, sofern man darunter die zahlreichen Amulette oder „Medizinen“ (Abb. 51 und 73) verstanden wissen will, mit denen sie sich den mit weißem Ton kleidartig bemalten Körper behängen. Sehr wichtig ist darunter das schon erwähnte Horn einer kleinen Antilope, dessen „Medizin“ das Mädchen töten soll, falls es etwa seine Geheimnisse preisgäbe; auch darf dieses Amulett von keinem Manne berührt werden. Solange die Mädchen es tragen, ist ihnen jeglicher geschlechtliche Verkehr aufs strengste untersagt, auch den bereits Verheirateten mit ihrem Ehemann. Gelegentlich werden die Mädchen auch in die Öffentlichkeit geführt und müssen dann vor ihren Familienangehörigen und Freunden Tänze aufführen; dabei trägt jedes Mädchen ein besonders mannigfaltig ausgestattetes Gewand. Sie tanzen zierliche Schrittänze unter Begleitung der Segura, eines mit einem Netz umsponnenen hohlen Flaschenkürbisses, an dem kleine getrocknete Samenschalen hängen, bei deren Schütteln ein Ton entsteht. Die besten Tänzerinnen finden Anerkennung; sie werden unter tosendem Beifall von den älteren Frauen umarmt, beschenkt und mit Palmöl reichlich eingeschmiert.


Während ihrer Vorbereitungszeit (Abb. 53 und 54) werden die Zöglinge im Bundubusch in den praktischen Aufgaben der[S. 22] Hausfrau, wie Kochen, Nähen, Flechten, Spinnen, Färben der von den Männern gewebten Stoffe, ferner in der Kenntnis der heilkräftigen Kräuter, in der Einübung von Tänzen und der sie begleitenden Musik, im Erlernen von Spielen und schließlich auch in der Praxis des Geschlechtslebens unterwiesen. Die Aufsicht über die Mädchen und ihren Unterricht ist einer Anzahl älterer Frauen übertragen, die ihrerseits wieder in einander untergeordnete Grade eingeteilt sind. Wie für den Porobund bestehen auch hier drei Grade. Der niedrigste ist der der Digbas, der zweite der der Normehs oder Bunduteufel und der höchste der der Sowehs oder Leiterinnen (Abb. 57). Letzteren fällt die Aufgabe zu, die Oberaufsicht zu führen, die Medizin zu bereiten und bei vorkommenden Krankheiten den Arzt zu spielen. Auf letzterem Gebiet stehen sie auch sonst in großem Ansehen, denn selbst impotente Männer und unfruchtbare Frauen nehmen ihre Hilfe in Anspruch. Den Sowehs unterstellt sind die Normehs oder eigentlichen Bunduteufel. Bei öffentlichen Aufzügen pflegen sie jene in einer phantastischen Tracht (Abb. 56) zu begleiten; sie besteht in einem schwarzgefärbten Gewande, das mit langen zottigen, gleichfalls schwarzen Fasern besetzt ist und den ganzen Körper mit Ausnahme des Kopfes umhüllt. Dieser trägt eine Maske (Abb. 55). In der Hand halten die Normehs Rutenbündel, durch deren Bewegungen sie sich verständlich zu machen suchen, da ihnen das Sprechen untersagt ist. Den untersten Grad des Bunduordens bilden die Digbas oder Dienerinnen, die den Normehs Handreichungen zu leisten haben, auch, da diese ja stumm sein müssen, deren Wünsche oder Mitteilungen dem Volke kundgeben.


Nach Ablauf ihrer Probezeit werden die jungen Bundumädchen „fortgerissen“ und medizinisch „gewaschen“, wie man es zu nennen pflegt (Abb. 57). Dieser Austritt aus dem Busch endet für gewöhnlich mit einer Feier, an der die ganze Bevölkerung des Ortes, zum mindesten als Zuschauer, teilnimmt. Für solche, die vorher verlobt waren, pflegt man mit dieser Austrittsfeier das Hochzeitsfest zu verbinden. Die „Waschung“ wird mit großem Lärm und Umzug der Bunduteufel in ihrer Ordenstracht durch die Stadt eingeleitet. Am nächsten Nachmittag machen sich zahlreiche Frauen, die alle Äste oder Grasbüschel in den Händen tragen, unter Vorantritt der Sowehs und der sie begleitenden Bunduteufel nach der Ortschaft auf und durchziehen[S. 23] dieselbe unter großem Lärm, zu dem das Schütteln der Seguras den Takt abgibt. Die Teufel nehmen darauf, in völlig bewegungsloser Haltung verharrend, die zahlreichen Geschenke entgegen, die die zukünftigen Gatten der ausgewählten Bräute in Anbetracht der Sorge und Mühe, die sich der Orden mit ihnen gegeben hat, darbringen. Dabei suchen die Bräutigame einander oft in Freigebigkeit zu überbieten, indem sie immer neue Geschenke hinzufügen. Am Tage des Waschens selbst werden alle Mädchen, ob sie nun verlobt sind oder noch nicht, aus dem Bundubusch heraus mit ihren Verwandten und den Teufeln im Zuge in der Stadt herumgeführt, an der Spitze die oberste Medizinfrau oder Maschu (Abb. 61). Diese Prozedur heißt Tiffeh nach den Blättern, die die folgenden Frauen bei dieser Gelegenheit tragen. Nach solcher Schaustellung gehen die Bewerberinnen nach einem anderen Teil des Busches zurück, wo sie ihren Soboro oder die Teufelskappe in Empfang nehmen; diese besteht in einer Bedeckung des Kopfes mit einer Menge schwarzen Schlammes, der medizinisch zubereitet wurde. Sie müssen damit zur Wasserseite gehen und sich die Teufelskappe abwaschen lassen. Jedoch erhalten nur die Verlobten die Teufelsmütze und haben die damit verbundene Waschung durchzumachen; den übrigen wird nur mit der Bundumedizin das Gesicht gewaschen. Wenn ein ungewaschenes Mädchen sich später verlobt, muß es zum Bundubusch zurückkehren, bekommt die Teufelskappe und wird gewaschen. Mit dieser Handlung haben die Mädchen ihre Lehre im Bundu beendet und sind Vollmitglieder des Ordens geworden. Bevor sie aber ihre Freiheit wiedererlangen, müssen sie noch drei Nächte im Bari, dem mit bunten Tüchern geschmückten Hinterhause des Häuptlings,[S. 24] das für diesen Zweck besonders hergerichtet wurde, zubringen, gleichsam zur Erholung von ihren Anstrengungen, denn sie pflegen dort behaglicher Ruhe. Am Tage ist es ihnen erlaubt, bunt ausgeputzt in der Stadt umherzugehen, ihre Freundinnen zu besuchen und Geschenke zu empfangen. Man glaubt allgemein, daß, falls sich ein Mädchen nach seiner Rückkehr aus dem Busch mit einem Manne unpassend betragen sollte, die bewußte „Medizin“ dem Übeltäter eine Krankheit beibringen werde, die nur die Sowehs zu heilen vermögen.

Ein anderer Geheimbund in Sierra Leone ist der Yassiorden (Abb. 58), der sich hauptsächlich mit der Heilung von Kranken durch die Yassimedizin und mit Zauberei befaßt. Er hat eine besondere Einrichtung. Es scheint für diejenigen Frauen, die ihm beitreten wollen, die Pflicht zu bestehen, zuvor Angehörige des Bundubundes zu sein; aber umgekehrt brauchen nicht alle Bundufrauen der Yassigesellschaft beizutreten. Auch die Porobünde sollen Beziehungen zum Yassiorden unterhalten. Das Oberhaupt des Yassibundes ist die Mama Behku; ihr an Bedeutung am nächsten steht die Yamama; dann folgen die Kambehs oder Mitglieder der zweiten Stufe mit der Kambeh Mama als Schwertträgerin. Auch drei männliche Trommelschläger sind dabei. Die Yassimedizin ist meistens ein auf besondere Art zubereiteter Brei aus Kräutern und Blättern, der nicht im Busche, sondern in der Ortschaft in einem Yassihause, einer Lehmhütte, die durch Flecken gekennzeichnet ist, aufbewahrt wird. Diese Medizin wird nicht eingenommen, sondern übt ihre Wirkung auf andere Weise aus. Die Zauberei betreiben die Yassiweiber mittels der Minseri (Abb. 60 und 63), das sind Holzfiguren von stets weiblicher Natur, die in der Nähe der Medizin, durch einen Mattenverschlag von ihr getrennt, aufgestellt sind. Der Minserigott wird mit der Medizin eingerieben; dadurch gehen die Fähigkeiten dieser auf ihn über. Will jemand die Hilfe der Yassimedizin zu Rate ziehen, dann wendet er sich zunächst an die Yamama oder an die Kambeh, die das Orakel verwaltet. Diese betritt darauf, in ein weißes Gewand gehüllt, das Heiligtum, legt die Kleider aber hier sofort ab, da sie in Gegenwart der Medizin nackt erscheinen muß. Nach einer Weile kommt sie in der weißen Tracht wieder zurück, geht aber dabei rückwärts und trägt einen Minseri mit sich, dessen Vorderseite der Matte zugekehrt ist. Dann wendet sie sich den ihren Rat einholenden Leuten zu und schwingt den Götzen hin und her; gleichzeitig richtet sie an ihn bestimmte Fragen, wie etwa, wenn es sich um einen kranken Mann [S. 26]handelt, der vermutlich von einem Yassifetisch ergriffen wurde, ob er vielleicht zugesehen habe, wie die Yassifrauen die Medizin zubereiteten. Will der Minseri eine jenem günstige Antwort zuteil werden lassen, dann neigt er sich bis auf die Brust der Kambeh herab; das soll besagen, daß der Betreffende nichts erspäht hat. Bleibt der Götze aber unbeweglich, dann ist damit das Schicksal des Fragenden entschieden — er muß sterben. In den meisten Fällen erfüllt sich dann auch das Schicksal an ihm, entweder er stirbt vom bloßen Schreck oder er wird auf irgendeine geheime Weise umgebracht. Jeder ist mit der Entscheidung, wie es heißt, zufrieden; das Urteil des Minseri beziehungsweise der Kambeh gilt für unfehlbar.


Die Edo besitzen den Oviabund, der Sage nach die Schöpfung der Gattin eines Königs, die von ihrem Manne sehr geliebt, von den übrigen Frauen aber aufs beste gehaßt wurde und daher bei der Gründung bestimmte, daß nur Männer in diesen Geheimbund aufgenommen werden dürften. Zu Beginn der trockenen Jahreszeit begeben sich alle Männer ins Ovialager und schlafen dort einen Monat lang. Zwischendurch erscheinen sie bald am Tage, bald in der Nacht im Dorfe und dürfen dabei ihr Ordensgewand tragen, dessen hervorstechendstes Stück ein großer, mit Papageienfedern geschmückter Hut ist. Die Frauen ihrerseits besuchen das Lager nur während eines Zeremonialtanzes, doch dürfen sie ihre Männer begleiten, wenn diese sich im Orte befinden. Man behauptet von dem Oviabunde, daß seine Gebräuche dazu beitrügen, die Menschen am Leben zu erhalten.

Ein verbreiteter Geheimbund in Kamerun ist der Ekongolo. Er tritt in Tätigkeit, wenn eines seiner Mitglieder gestorben ist. Unmittelbar nach der Bestattung erscheinen die Bundesbrüder[S. 27] in Masken, die mit allerlei Flitterkram behangen sind, und mit Hörnern auf dem Kopfe unter der Menge, die sich mit Singen, Tanzen und Zechen unterhält, und rennen mit weiten, gleich Flügeln ausgebreiteten Ärmeln durch das Dorf. Bei ihrem Erscheinen schreit alles „Ekongolo, Ekongolo“ und stiebt kreischend auseinander; sobald man aber durch Geschenke die Ankömmlinge besänftigt hat, mischen sich diese friedlich unter die fröhlichen Festgenossen, versuchen aber von Zeit zu Zeit doch immer wieder zu lärmen und die Leute vor sich herzujagen. Erst am Ende des Festes, wenn die Angehörigen des Verstorbenen ihnen eine Ziege zum Geschenk gemacht haben, ziehen sie sich zurück. — Der Mungibund, der sich einer Verbreitung bis zum Kalabarflusse hin erfreut und wahrscheinlich mit dem Gotte Mungi in Verbindung steht, bezweckt den gegenseitigen Schutz seiner Mitglieder und übt gegebenenfalls eine Art Feme aus. Sobald die große Mungotrommel einen Hilferuf ertönen läßt, ist „der Mungi heraus“. Dann darf kein Nichtmitglied seine Hütte verlassen, weil es sonst Gefahr liefe, daß ihn der Mungi hole und auf Nimmerwiedersehen in den Wald schleppe. Auf den Trommelruf eilen alle Ordensbrüder mit getrockneten Palmblättern bekleidet zur nächtlichen Versammlung in den Busch; einer von ihnen stellt den Mungi dar. Er ist mit Federn, Hörnern, Glocken und allerlei Flitter phantastisch ausgeputzt; mittels einer einfachen Vorrichtung kann er seinen Körper bald auf die doppelte Höhe größer werden lassen, bald wieder verkürzen, indem er am Boden niederkniet. Der Zug bewegt sich, mit dem Mungi in der Mitte, unter furchtbarem Lärm durch die Straßen zum Walde hin. Hier fällt der Bund seinen Urteilspruch; Leute, die einen höheren Grad bekleiden, schreien aus dem Busch den Beschluß hinaus mit den Worten: „Der Mungi ist hier und sagt das und das.“ Einer von ihnen wird mit der sofortigen Vollstreckung des[S. 28] Urteils beauftragt. Mit einer wuchtigen Peitsche in der Hand eilt er in Begleitung eines lärmenden Gefolges ins Dorf zum Hause des Verurteilten, aus dem sich niemand hinauswagen darf, bis die Strafe vollzogen und meistens auch das ganze Haus niedergerissen worden ist. Darauf verkündet die Bundestrommel, daß der Mungi sich wieder in seine Waldeinsamkeit zurückgezogen habe. Damit ist die Tätigkeit des Bundes beendet.



Vorliebe für Musik (Abb. 59), Tanz (Abb. 62, 64 bis 67, 69) und Spiel (Abb. 72 und 79) ist den Negern gleichsam angeboren, wie wir bereits an anderer Stelle hörten. Auch die westafrikanischen Schwarzen neigen in hohem Grade dazu. Die Mendistämme schwärmen für den Ton der Segura und des Sangboi; allenthalben kann man den Klängen dieser beiden Musikinstrumente tagtäglich und selbst während der Nacht begegnen. Die Segura, ein ausgehöhlter Kürbis mit klappernden Steinchen, wird besonders von den Frauen gern und so geschickt geschüttelt, daß dadurch ein bis zu einem gewissen Grade melodischer Wohlklang erzeugt wird, der selbst den Beifall des Europäers findet, wenn er sich einmal daran gewöhnt hat. Die Segura fehlt daher weder bei einer der zahlreichen einheimischen Zeremonien noch bei den privaten oder öffentlichen Festlichkeiten. Das Entzücken der Männer dagegen bildet der Sangboi (Abb. 74) oder das Tamtam. Dieses Musikwerkzeug ist weiter nichts als ein ausgehöhltes Stück Baumwollbaum, das wie eine Trommel mit Haut überzogen ist und sich von einer solchen eigentlich nur dadurch unterscheidet, daß es mit den Händen angeschlagen wird. — Im übrigen ist bei allen Negern als Musik- oder besser gesagt Lärminstrument sehr beliebt die Trommel (Abb. 68). Sie besteht meistens aus einem mehr oder weniger langen Holzzylinder (ausgehöhlten Baumstamm), der bald an beiden[S. 29] Enden, bald nur an einem offen ist und ein Trommelfell aus Fell oder Eidechsenhaut trägt; dieses ist für gewöhnlich mit Holz- oder Metallstiften angenagelt, in einzelnen Gebieten (Kamerun) aber auch durch Riemen angespannt. Eine besondere Abart ist die Schlitztrommel, der wir besonders in Kamerun begegnen. Sie ist gleichfalls aus einem runden Stück Hartholz in der Weise hergestellt, daß man dieses der Länge nach mit einem Schlitz versieht und von diesem aus nach innen das Ganze wie einen Futtertrog aushöhlt; bei dieser Aushöhlung wird darauf geachtet, daß die eine Wand dünner als die andere ausfällt, so daß sie, angeschlagen, einen höheren Ton ergibt als diese. Diese Trommeln benutzt man nämlich zur gegenseitigen Verständigung, zur Trommelsprache. Die Trommeln werden mittels zweier Holzschlegel angeschlagen, in ähnlicher Weise, wie man solche bei einem Xylophon handhabt. Die Trommelsprache, die sich besonderer Ausbildung in Kamerun und Togo erfreut, dient der schnellen Verbreitung von Nachrichten, weswegen der Neger das dazu benutzte Instrument auch als „Mitteilungskiste“ bezeichnet. Man trommelt auf weite Entfernungen hin, um zum Beispiel die Kunde von einem wichtigen Ereignis, wie[S. 30] der Ankunft eines Fremden, dem Nahen eines Feindes und so weiter, mitzuteilen, ja selbst um sich gegenseitig mit Schimpfworten zu belegen, was zur Folge hat, daß der davon Betroffene eine Erwiderung „zurücktelegraphiert“. Bei der den Negern angeborenen Streitsucht beschimpfen sich die Dualaleute zum Beispiel stundenlang bei Tag und bei Nacht bis zur Erschöpfung auf diese Weise. Indessen ist nicht jedermann mit dieser Trommelsprache vertraut, sondern es pflegen meistens nur einige wenige im Dorfe zu sein, die sie beherrschen. Zu ihrer Erlernung gehört unendliche Geduld und viel Zeit. Jeder Stamm hat seinen Sonderkodex von Trommelzeichen; jedoch scheint auch ein gemeinsamer Kodex vorhanden zu sein, der von allen Stämmen eines bestimmten Gebietes verstanden wird. Der Trommler legt die „Nachrichtenkiste“ vor sich hin auf die ausgebreiteten Beine, während er auf dem Boden sitzt, oder bei einer Fahrt im Kanu über die Bordränder desselben; sind zwei (fellüberzogene) Trommeln in Gebrauch, wie es in Togo der Fall zu sein pflegt, dann stellt der Trommler die höher gestimmte, die die Ewe die männliche nennen, zu seiner Rechten, die tiefer gestimmte, die weibliche, zu seiner Linken auf. In der Trommelsprache werden feststehende Sätze gebraucht; sie ist also eine Sentenzensprache, die auf den musikalischen und dynamischen Akzenten der Silben beruht. Daher kann dazu nicht jede beliebige Redewendung verwendet werden, sondern nur feststehende Sätze, die auf verschiedene Ereignisse von Bedeutung Bezug nehmen.




Unter den Spielen begegnen wir in Westafrika dem gleichen Brettspiel, wie wir es bereits in Ostafrika kennen lernten. Bei den Mendi, wo es die Bezeichnung „Warri“ führt, hat es die besondere Form eines Kriegspieles angenommen. Es erfordert viel Überlegung und große Geschicklichkeit. Man spielt es zwischen zwei Personen auf einem kleinen Brett, das auf einem niederen Sockel steht und an seiner Oberfläche an jedem Längsrande sechs Löcher besitzt, so tief und breit, daß sie die Spitzen der ersten beiden Finger der rechten Hand aufnehmen können. Diese Löcher heißen die „Städte“; jedes Loch oder jede Stadt wird von vier Kriegsknechten, gewöhnlich in Gestalt von Bohnen, besetzt gehalten. Nachdem die zwölf Städte mit ihrer Kriegsmannschaft belegt worden sind, geht jede Partei darauf aus, die andere zu besiegen oder „aufzuessen“, wie sie es nennen. Das Spiel wird so lange gespielt, bis beide Armeen so weit geschwächt worden sind, daß weder auf der einen noch auf der anderen Seite ein Mann übriggeblieben ist. Als Sieger gilt derjenige, der die meisten Gefangenen gemacht hat. Jede Stadt pflegt ihr Warribrett zu besitzen, und der Mendi ist so in sein Spiel vernarrt, daß er, so oft sich Gelegenheit bietet, eine Partie macht. — Ein anderes volkstümliches Spiel desselben Volksstammes ist das „Se“ (Abb. 82), an dem sich vier Personen beteiligen. Es besteht darin, daß jeder Spieler einen kleinen aus Elfenbein geschnitzten Kreisel auf einer Matte wirbelt und aufpaßt, ob dieser einen oder alle Kreisel seiner Gegner verdrängt. Verlierer ist der, dessen Kreisel dem des anderen weichen mußte. In früheren Zeiten bestand der Einsatz, um den gespielt wurde, geradezu in Menschen. Ist dieses Spiel bis zu einem gewissen Grade schon Hasardspiel, so trifft dies noch mehr für das „Jiggi“ zu. Es wird mit vier Kaurimuscheln gespielt, deren konvexe Oberfläche abgeschliffen ist. Ein Spieler nimmt die vier Muscheln in die Hand und wirft sie mit einer geschickten Wendung in die Höhe. Je nach dem Ausfall des Wurfes bedeutet er Gewinn oder Verlust; fallen alle vier Muscheln mit der geschlossenen oder auch mit der offenen Seite auf den Boden, so hat der Spieler verloren; liegen aber zwei mit der geschlossenen und zwei mit der offenen auf dem Boden, so hat er gewonnen. Als ein ernst-wissenschaftliches Spiel der Mendi ist schließlich noch das „Ke“ zu nennen; man spielt es auf einem festen Stück Holz, das in schwarze[S. 33] und weiße Vierecke eingeteilt ist, mit kegelförmigen Figuren von zweierlei Größe, Männer und Frauen genannt. Die Züge sind dieselben wie bei unserem Damspiel.

Die schwangere Akkrafrau läßt deutlich auch nach außen hin ihren Zustand erkennen, indem sie ihre Tracht ändert. Sie läßt ihr Haar wachsen, stellt das Schminken ein und legt ihren Korallenschmuck ab; dafür wird ihr von der Priesterin eine Art Manschetten aus Bast im ersten Monat um die Handgelenke, dann um die Knie und in den letzten Monaten in dicken Wülsten um die Knöchel geschlungen, von denen überdies noch Knoten herabhängen, dies alles, um die Geburt zu erleichtern. Je näher ihre schwere Stunde rückt, um so mehr wird sie mit Amuletten behängt. In den letzten acht Tagen bestreicht ihr die Priesterin den Kopf außerdem noch mit einer weichen Masse, die diesen wie eine dicke Kappe bedeckt und erst nach der Geburt entfernt werden darf. Wird die Negerin der Goldküste zum ersten Male schwanger, dann treibt man sie unter Bewerfen mit Kot und unter Geschimpfe ins Meer, wo sie untertauchen muß. Von dem Tage an, an dem eine Ekoifrau merkt, daß sie Mutter werden wird, muß sie besondere Vorsichtsmaßregeln beobachten, aus deren Unterlassung Unheil entstehen könnte. So darf sie zum Beispiel nicht in die Nähe eines bestimmten Baumes gehen, dessen Rinde beim Fischen Verwendung findet; sie darf weder die Blätter des Kürbisses noch das Fleisch des Stachelschweines, des Wasserbisams oder des Elefanten essen; ihr Gatte steht, was den letztgenannten Leckerbissen anbelangt, unter dem gleichen Tabu. Ferner muß die Schwangere ihrem Hausfetisch opfern; zu diesem Zwecke füllt sie für gewöhnlich einen Topf oder auch eine Kalabasse mit Essen und durchsticht[S. 34] das Ganze mit einem Speer. Auch die Ewenegerin bringt den Fetischen der Geburt Opfer dar und wird von den Priestern mit allerlei Amuletten am ganzen Körper behängt. Der Hilfsmittel, die die Geburt erleichtern sollen, gibt es viele. Bei Agitome in Togo fanden sich bei einer bevorstehenden Entbindung vor dem Dorfe kleine rohgeformte Tonfiguren aufgestellt, die anscheinend den bösen Geistern den Zutritt verwehren sollten. Die Malangefrauen tragen stets eine kleine Kalabasse, die mit Erdnüssen und Palmöl gefüllt ist, bei sich, um eine leichte Entbindung zu haben.

Die Geburt eines neuen Gemeindemitgliedes wird allgemein mit Freuden nicht nur von den Eltern, sondern auch von den übrigen Dorfbewohnern begrüßt, besonders in fruchtbaren Gegenden, wo kein Mangel an Nahrung herrscht; denn ein Knabe bedeutet einen Zuwachs an Verteidigung, ein Mädchen an Arbeitskraft. Kindsmord kommt daher im allgemeinen selten vor und pflegt sich auf Zwillinge oder Mißgeburten zu beschränken. Die Auffassung von Zwillingsgeburten ist bei den einzelnen Negerstämmen jedoch eine verschiedene. Von den einen werden sie für eine gute Vorbedeutung angesehen — bei den Haussa bedeuten auch Drillinge Glück —, von anderen dagegen als ein Unglück. Die zweite Auffassung ist die häufigere. Daher pflegt man Zwillinge meistens unbarmherzig zu töten. In Altkalabar ist die Mutter gehalten, ihre beiden Kinder in ein Gefäß zu packen und so zum Fraße der Ameisen im Walde auszusetzen. Die Dahomeer warfen früher beide Kinder ins Wasser, pfählten die Mutter und schnitten ihr die Brust auf. Die Ibo vergiften die Zwillinge oder setzen sie in[S. 35] die Dschungel aus. Auch anderwärts tötet man verschiedentlich die Mutter, weil man Zwillinge für ein Zeichen begangener Untreue ansieht. Bei anderen Stämmen läßt man wenigstens einen der Zwillinge am Leben. Die Bassari begraben das schwächere der Kinder, wobei der Knabe den Vorrang einnimmt, lebendig in einem Topfe und geben ihm die Hälfte eines geopferten Huhnes mit hinein, dessen andere Hälfte in einem zweiten Gefäß daneben beigesetzt wird. Mit diesem Opfer soll der Geist des ausgesetzten Kindes versöhnt werden, damit er sich nicht an dem am Leben bleibenden räche. Eweeltern, die mit Zwillingen beschenkt werden, haben sich umfangreichen Förmlichkeiten zu unterwerfen, den sogenannten Venovidzidziförmlichkeiten, bevor sie ihre Hütte verlassen dürfen, was vor dem fünfundzwanzigsten Tage nicht erlaubt ist. Diese Gebräuche dürfen nur solche Personen an ihnen ausführen, die selber einmal Zwillinge hatten.

Die jungen Eltern setzen ein solches Paar zunächst von dem Erscheinen der Zwillinge in Kenntnis. Die Eingeladenen finden sich ein und lassen zunächst die neuen Zwillingseltern sich den Mund mit Wasser ausspülen, binden ihnen Blätterteile bestimmter Pflanzen (Palmen- und Gurkenart) um Hals, Knie, Arm und Fuß und baden die Zwillingskinder in der Nähe des Ausganges in einer Wanne, worauf die Eltern ihren Blick in einer bestimmten Richtung dem Sitze[S. 36] vieler Gottheiten zuzuwenden und weiter zwei Zwillingstänze unter Trommel- und Flötenbegleitung aufzuführen haben. Vorher aber müssen sie neunmal um die Trommeln herumgehen und während des Tanzes Pfeil und Bogen in der Hand halten. Es sind dies ganz besondere Trommeln, zu deren Klange nur Leute tanzen dürfen, die Zwillinge gezeugt, Leoparden getötet oder im Kriege jemand den Kopf abgeschnitten haben. Nach dem Tanze werden die Zwillinge in ein neues Lendentuch gewickelt. Weiter erfordert die Sitte, daß die Eltern an der Vorderseite ihres Hauses eine Art Gosse anlegen und nur das hier sich sammelnde Regenwasser, nicht das von der Hinterseite des Daches herabfließende trinken. Damit sind indessen die Förmlichkeiten des Venovidzidzi noch nicht erschöpft. Die Mutter muß sich das Kopfhaar scheren lassen bis auf drei, der Vater bis auf zwei Haarbüschel. Den Zwillingseltern ist es ferner verboten, das Fleisch des roten Affen zu essen, und anderes mehr. Erst wenn alle diese und noch andere Vorschriften erfüllt worden sind, ist es ihnen gestattet, sich wieder überall frei zu bewegen. Natürlich fehlt es auch hier nicht an einem Festmahl.

Die Wöchnerin gilt allgemein für unrein und darf erst nach einer gewissen Zeit, für gewöhnlich nach acht Tagen, ihr Haus verlassen; bis dahin bleibt sie mit ihrem Kinde abgesondert; eine Übertretung dieser Vorschrift würde für beide von großem Schaden sein. Das neugeborene Kind wird bei den Ekoi zwischen zwei Palmblätter gelegt und muß entweder von der Mutter selbst oder von der Großmutter zur Schwelle des Hauses gebracht werden; hier schüttet eine weibliche Verwandte Wasser aufs Dach, von dem das Kind Tropfen abbekommen muß, damit es nicht an Fieber erkranke. Eine Woche später bedeckt man es mit weißer Kreide, was Glück bringen soll, und trägt es umher, damit die Freunde der Familie es sehen. Die erste Locke wird von der Großmutter abgeschnitten, in einen Lappen gewickelt und in einem Kasten versteckt. Späterhin wird das Handgelenk eingeschnitten und Zaubermedizin in die Wunde eingerieben; diese wird entweder aus dem Zeigefinger des Schimpansen hergestellt und soll dann Kraft verleihen oder durch Zerquetschen schwarzer Ameisen gewonnen, was Regsamkeit geben soll. — Die Ngumba (Südkamerun) lassen ihr Neugeborenes am anderen Morgen je nach seinem [S. 38]Geschlecht entweder von einem heranwachsenden Burschen oder von einem Mädchen auf ein großes Blatt, auf das die Mutter eine mit Wasser angerührte Masse aus Rotholzfasern (Abb. 70) und Baumrinde gestrichen hat, vor die Haustür legen. Mit dieser „Medizin“ zeichnen die Umstehenden sodann einen Längsstrich auf die Brust des Kindes, ebenso der Träger sich selbst auf die Fußsohlen. Außerdem werden ähnliche Striche auf die Schwelle und die Türpfosten gemalt. Dieser Vorgang spielt sich vor einem jeden Hause des Dorfes ab. Verschiedentlich wird die junge Mutter nach der Geburt ausgeräuchert, offenbar um die bösen Geister von ihr fernzuhalten. Die Neger der Goldküste bringen nach der Geburt ihrem Fetisch Opfer dar und hängen den Neugeborenen Amulette um den Hals. — Die Negerin schleppt ihr Kleines beständig mit sich herum und hat es auch bei der Arbeit bei sich (Abb. 78).


Die Namengebung erfolgt bei den Mandingo meistens acht Tage nach der Geburt, bei den Wei unmittelbar nach ihr. Vielfach erfahren die ursprünglichen Namen später eine Abänderung. Bei den Mandingo zum Beispiel tauscht man den Namen bei der Beschneidung (zwölftes bis dreizehntes Jahr) und noch einmal um das fünfundzwanzigste Lebensjahr gegen einen dann bleibenden um. Die Neger der Goldküste geben den endgültigen Namen auch erst später, und zwar auf Grund vollbrachter Taten. Bei den Mandingo wird der Name gern von den Ereignissen oder Umständen hergenommen, die bei oder nach der Geburt von Wichtigkeit waren, oder er nimmt, falls das Kind von einem Schutzgeiste des Dorfes erbeten wurde, auf dessen Namen Bezug. Auch die Bambara und Ewe geben ihren Kindern solche Weihnamen;[S. 39] bei letzteren haben diese später die Verpflichtung, ihrem Schutzpatron gewisse Dienste zu leisten. Ist der Vater bereits verstorben, dann wird bei den Mandingo dessen Name (bei weiblichen Kindern mit entsprechender Abänderung) dem Neugeborenen beigelegt. Dies beruht auf der Annahme einer Seelenwanderung. Auf eine ähnliche Vorstellung ist es zurückzuführen, wenn Togoeheleute, falls ihnen bereits Kinder gestorben sind, ein Neugeborenes aus Furcht, es könnte ihm das gleiche Schicksal widerfahren, mit „Niemand kann das Leben kaufen“ oder, falls es Ähnlichkeit mit einem Verstorbenen der Verwandtschaft aufweist, mit „Das Wiederkehrende“ benennen. Die Neger der Goldküste und von Sierra Leone sollen ihre Kinder nach dem Wochentage benennen, an dem sie das Licht der Welt erblickten. Man sieht aus diesen wenigen Mitteilungen, daß bezüglich der Namengebung mannigfache Abwechslung herrscht. Die Persönlichkeit, die den Namen gibt, ist bald der Vater, bald eine andere, meistens hervorragende Person. Die Namengebung gestaltet sich für die Eltern und die übrigen Dorfbewohner in der Regel zu einem Festtag, an dem Tanz und Schmaus nicht zu fehlen pflegen. — Bei den Haussa und anderen mohammedanischen Stämmen versammeln sich am achten Tage die Malame oder Priester sowie die Verwandten; alle erhalten Kolanüsse als ein besonderes Festgeschenk. Gelegentlich wird auch ein Schaf oder gar ein Ochse geschlachtet und verzehrt; die Hebammen erhalten davon den Kopf, die Beine und die Haut, während der amtierende Malam sich den Rücken nimmt. Nachdem dem Kinde das Kopfhaar abrasiert worden ist, erhält es zwei Namen; der eine wird ihm allein ins Ohr geflüstert, der andere aber den Versammelten öffentlich bekanntgegeben. Die Malame segnen zum Schluß das Kind, wobei sie Allahs Schutz, besonders gegen Hexerei, herabflehen, und ebenso die Brüste der Mutter.


Die Angehörigen des männlichen[S. 40] Geschlechts werden meistens beschnitten. Das Lebensalter, in dem dieser Eingriff vorgenommen wird, schwankt bei den einzelnen Völkern innerhalb weiter Grenzen. So lassen die Duala in Kamerun ihn bereits an vier- bis fünfjährigen Knaben ausführen, die gleichfalls dort ansässigen Bakwiri erst an zwölf- bis vierzehnjährigen und die Dahomeer schieben die Beschneidung sogar bis zum zwanzigsten Lebensjahre hinaus. Allgemein ist es aber Sitte, daß sie vor der Verheiratung erledigt sein muß; Frauen verweigern die Ehe mit unbeschnittenen Männern. Die Beschneidung wird von hierfür bestimmten Männern in ähnlicher Weise, wie wir sie bereits kennen gelernt haben, vorgenommen. Im allgemeinen sind Feierlichkeiten, Prüfungen oder sonstige Förmlichkeiten mit der Beschneidung der Jünglinge nicht verknüpft. Nur bei den Mandingo gestaltet sich der Vorgang zu einer sehr festlichen Handlung. Schon zwei Monate vorher wird der Tag hierfür angekündigt. Die Knaben bleiben fortan von jeglicher Arbeit verschont, schließen sich zu Trupps zusammen und ziehen singend und tanzend in den Dörfern umher, wo man sie überall reichlich bewirtet. Am Beschneidungstage selbst wird das ganze Dorf festlich geschmückt. Bei den Soninke bestreuen die Beschnittenen den ihnen gekürzten Körperteil mit heißem Sand oder Asche, bleiben vier Wochen lang in einem besonderen Hause zusammen und vergnügen sich mit Nichtstun; das Essen bringt man ihnen hin. — Ebenso ist in Dahome die Beschneidung mit gewissen Förmlichkeiten verbunden. Die Anwärter werden älteren Männern übergeben und an einen abgelegenen Ort im Walde geführt, wo sie längere Zeit, meistens mit weißem Ton bestrichen, abgesondert leben müssen und in gewisse Geheimnisse eingeweiht werden. Sie bekommen dann auch einen neuen Namen. Wenn sie nach Ablauf dieser Einweihungsfeierlichkeiten wieder ins Dorf zurückkehren, geben sie sich den Anschein, niemand[S. 41] aus ihrer Umgebung mehr zu kennen, nicht einmal ihre nächsten Verwandten, und auch eine andere Sprache zu reden, die ihnen beigebracht wurde. Ein großes Fest bildet den Abschluß der Förmlichkeiten. Bei den Yaunde legen die Beschnittenen Weiberkleidung an, die ihnen am Schluß von den Frauen abgerissen wird. — Die Woluffen sollen ihre Vorhaut in getrocknetem Zustande zeit ihres Lebens bei sich tragen, weil sie dadurch besonders zeugungsfähig zu sein hoffen. — Über die Bedeutung der Beschneidung gehen die Ansichten auseinander; es scheint, daß sie in erster Linie aus religiösen Gründen vorgenommen wird. Mit der Beschneidung ist für die jungen Leute die Erlaubnis des geschlechtlichen Verkehrs verknüpft; gleichzeitig sind sie damit in die Gemeinschaft der Männer aufgenommen.


Auch die Mädchen werden vielfach beschnitten. Bei ihnen besteht der Vorgang in dem Abtragen eines Stückes des Kitzlers; er spielt sich für gewöhnlich bei Eintritt der Reife, vereinzelt aber auch schon früher ab. — Sobald in Togo ein Mädchen seiner Mutter mitgeteilt hat, daß sich bei ihm zum ersten Male die Regel eingestellt habe, werden alle Verwandten von diesem Ereignis verständigt. Sie und die Freundinnen begleiten das junge Mädchen am nächsten Morgen im Zuge zum öffentlichen Wasserplatz; dabei trägt es auf dem mit einem Tuche verhüllten Kopfe einen kleinen Topf. An Ort und Stelle taucht ein noch nicht entwickeltes Mädchen dreimal seine Hand ins Wasser und benetzt damit den Kopf der Freundin, womit angedeutet werden soll, daß fortan alles Unreine von ihr gewichen und es selbst ein Weib geworden ist. Nach etwa acht Tagen wird[S. 42] die Novizin von ihrer Mutter gebadet, gesalbt und mit Perlenschnüren geschmückt; nur mit diesen bekleidet geht sie, von zahlreichen Freundinnen begleitet, von Haus zu Haus. Ist sie bereits verlobt, dann bringt sie ihrem Zukünftigen einen von ihrer Mutter gekochten Mehlbrei und hält ihm beide Hände hin. Der Bräutigam gibt ihr von dem Brei hinein, und das Mädchen trägt das Empfangene in einem Topfe schleunigst nach Hause, wo sie es mit den sie begleitenden Genossinnen verzehrt. Der Bräutigam seinerseits ißt den Rest mit seinen Freunden auf. — Bei einer Reihe anderer Stämme der Küste müssen die Mädchen mit Eintritt der ersten Regel einige Zeit einsam in besonderen Hütten zubringen, die kein männliches Wesen betreten darf. Hier werden sie von alten Weibern in die Geschlechtsgeheimnisse eingeweiht; jedoch herrscht über die Einzelheiten, die sich hie und da in der Hütte abspielen, tiefes Geheimnis. — In Dahome werden zur Zeit der Getreideernte junge Mädchen im Alter von zehn bis zwölf Jahren von älteren Priesterinnen aufgegriffen, längere Zeit gefangengehalten und in den heiligen Gebräuchen und Tänzen für den Schlangengottesdienst unterwiesen, außerdem durch Schlangenfiguren, die man ihnen in die Haut einschneidet, als Eigentum des Schlangengottes geweiht; sie sind verpflichtet, strenges Stillschweigen über die Vorgänge zu beobachten. Nach einiger Zeit dürfen sie wieder zu ihren Eltern zurückkehren, müssen aber von Zeit zu Zeit im Tempel zu Ehren ihrer Gottheit Tänze aufführen und werden nach eingetretener Reife mit ihr, das heißt mit den Priestern[S. 43] vermählt. — Bei den Ekoi wird mit den jungen Mädchen eine Mastkur vorgenommen, da Wohlbeleibtheit für höchste Schönheit gilt. Bevor man sie in die für diesen Zweck besonders hergerichteten Masthäuser bringt, behängt man sie reichlich mit Schmuck, ordnet ihnen das Haar in sehr kunstvoller Weise, schmückt es mit Kämmen und dicken Federbüschen, bemalt das Gesicht mit merkwürdigen Figuren und bestreicht den ganzen Unterkörper von der Taille an mit roter Farbe. In den Masthäusern werden sie dann aufs sorgfältigste genährt und gepflegt; sie bleiben hier längere Zeit, von einigen Wochen an bis zu zwei Jahren. Währenddessen ist es ihnen verboten, sich das Gesicht zu waschen, auszugehen oder irgendeine Arbeit zu verrichten, nur das Bemalen der Wände ihres Gefängnisses zur Unterhaltung ist ihnen gestattet. Nach Ablauf ihrer Mastzeit wird ein großes Fest gefeiert.
Heirat (Abb. 76 und 77) ist das Ziel wohl jedes Negers in Westafrika. Nur wenige Eingeborene bleiben ihr Leben lang unverheiratet und fallen deswegen dem Gespötte der Menschen anheim. Für Männer liegt der Grund wohl meistens darin, daß sie sich eine Braut aus Armut nicht leisten können; Armut aber ist wieder ihrerseits ein Gegenstand der Lächerlichkeit für die Eingeborenen. — Verschiedentlich begegnen wir Kinderverlobungen. Die Eltern verständigen sich über eine etwaige Heirat, wenn ihre Kinder noch klein sind. Der junge Bursche arbeitet, sobald er das gehörige Alter erlangt hat, für seine Zukünftige und überreicht seine Ersparnisse den Schwiegereltern. In Kamerun ist es Sitte, daß wohlhabende Neger kleine Mädchen bereits für ihren noch im Knabenalter stehenden Sohn kaufen. Bei gewissen Stämmen der Elfenbeinküste legt die Mutter zum Zeichen, daß ihre kleine Tochter schon versprochen ist, ihr eine Schnur um den rechten Arm. Die Eweer verloben ihre Töchter bereits im Mutterleibe mit dem Sohn ihres Nachbars; als Pfand dient Kaurimuschelgeld. Trifft die Voraussetzung zu und kommt das erhoffte Mädchen zur Welt, so legt der junge Bräutigam beziehungsweise seine Eltern für die Zukünftige eine Pflanzung an, deren jährlicher Ertrag ihr vom Bräutigam dargebracht wird. Wird aber wider Erwarten ein Knabe geboren, dann legt man die vorher eingegangene Verpflichtung dahin aus, daß beide Knaben fortan gute Freunde bleiben sollen. Bei allen diesen Frühverlobungen bleibt aber meistens dem herangewachsenen Mädchen die endgültige Entscheidung vorbehalten.



Im allgemeinen werden die jungen Mädchen schon vor ihrer Reife, etwa im achten bis zehnten Jahre, verlobt, sie ziehen indessen dann noch nicht zu ihrem Gatten, sondern bleiben im Hause der Eltern. Die Heirat findet erst statt, wenn die Reife eingetreten ist. — Der junge Mann nähert sich für gewöhnlich dem Mädchen[S. 44] nicht, er schickt einige seiner Freunde oder einen besonderen Sprecher, um die einleitenden Schritte zu tun; hie und da wird dazu auch eine Frau gewählt. Diese Vermittler bringen dann schon Geschenke in Gestalt von Fleisch, Tabak, Schürzen, Branntwein, Kolanüssen und dergleichen mit. Manchmal reden sie bei ihrer Ankunft zunächst über ganz gleichgültige Dinge und kommen erst später mit ihrem Anliegen heraus. Bei den Mendi kleiden sie dieses in die artige Bemerkung: „Wir sehen einen schönen Edelstein in deinem Hause, und wir wollen ihn uns holen; wir bringen dir dafür dies Geschenk.“ Bei Annahme des Antrags pflegen der junge Mann und seine Eltern persönlich bei den zukünftigen Schwiegereltern vorzusprechen,[S. 45] wobei sie diese von neuem beschenken. Bei den Diamala der Elfenbeinküste ist damit noch eine besondere Verlobungsförmlichkeit verbunden. Der Zukünftige überreicht einem seiner Freunde ein Paket mit Kolanüssen. Dieser öffnet es, wählt zwölf Nüsse aus und packt sie zu einem besonderen Bündel zusammen, die übrigen verteilt er an die Anwesenden. Damit ist das Verlöbnis vor Zeugen besiegelt. — Die Bambara machen eine Ausnahme von der üblichen Art des Brautkaufes; bei ihnen gibt der Vater der Braut seiner Tochter noch eine Mitgift mit. Bei wohl allen übrigen Stämmen Westafrikas wird die Braut ausschließlich gekauft; der Preis fällt ganz verschieden aus und beträgt bald nur wenige Mark oder Franken, bald sind es deren mehr als tausend. Während der Verlobungszeit bleibt das junge Mädchen für gewöhnlich im Hause seiner Eltern, bei einzelnen Stämmen aber pflegt es schon jetzt geschlechtlichen Verkehr mit dem Auserwählten. Bei den Kopfjägern Nigerias kann der Bräutigam, wenn die Verlobung erfolgt ist, sofort seine Frau verlangen, wenn es sich um eine Geschiedene handelt; er muß aber bis zur nächsten Regenzeit warten, falls die Braut noch Jungfrau ist. Zu passender Zeit sammelt die Familie des Bräutigams große Mengen Negerhirse und sendet sie am Hochzeitstage in das Haus des Vaters des Mädchens; dort wird ein Festgelage und ein Tanz abgehalten, wobei jeder Teilnehmer so lange tanzt und sich betrinkt, als noch Bier vorhanden ist. — Bei den Haussa spricht der Jüngling zuerst mit dem Mädchen; denn, obgleich sie mohammedanischen Glaubens sind, leben die Frauen bei ihnen doch nicht abgesondert. Gibt es ihm sein Jawort, dann wird die Erlaubnis des Vaters oder Onkels eingeholt und ein Teil des Brautpreises[S. 46] entrichtet. Am vierten Tage vor ihrer Hochzeit wird die zukünftige junge Frau von ihren weiblichen Verwandten und Brautjungfern ergriffen, damit ihre Hände und Füße mit Hennah gefärbt werden (Abb. 71), wobei das Mädchen Widerstand leisten oder wenigstens vortäuschen muß. Sie trägt diese Farbe vier Tage lang und wird am Abend des letzten zur Wohnung ihres Gatten gebracht. Diesen trifft sie jedoch nicht an, da er für einige Tage im Hause des Brautführers wohnt. Nach Ablauf der Frist bringt dieser ihn zurück und überreicht den Brautjungfern, die sich noch in der Wohnung des Bräutigams aufhalten, Geschenke, wodurch er sie zum Gehen veranlassen will. Eine Haussafrau spricht den Namen ihres ersten Mannes niemals aus, sondern nennt ihn einfach „Herr des Hauses“ oder ähnlich; denn der wirkliche Name ist ein wunder Punkt, wenn sich seiner eine boshafte Frau bedient.


In gewissen Teilen des nordwestlichen Nigeria stehen die Eltern vor dem Hause, wenn der Bräutigam eintritt; zwei seiner Freunde halten das Mädchen bei den Beinen fest. Ist die Braut noch jungfräulich, dann wird den Eltern nach dem Hochzeitsakt ein weißes Tuch mit den üblichen Abzeichen gezeigt und es werden ihnen Geschenke dargebracht. Hat sich aber gezeigt, daß die junge Frau ihre Jungfernschaft bereits verloren hatte, dann errichtet der Mann vor seinem Hause eine Stange, hängt jene zum Schein daran auf und zerschlägt ihre Schüsseln und Töpfe. Er will damit andeuten, daß die Frau von selbst zu ihren Eltern zurückkehre; denn wenn sie aus freien Stücken von ihm geht, müssen ihre Eltern die Heiratsgebühr zurückerstatten, während sie den Brautpreis behalten, wenn der Mann sie forttreibt. — Bei den Filani wird Ende des Jahres ein Ritus, den sie Girewali nennen, im Walde abgehalten. Die Jünglinge stellen sich in einer Reihe auf, die Mädchen stürzen auf ihre Günstlinge zu und nehmen sie mit sich; nachdem ein Festmahl stattgefunden hat, schlafen die betreffenden Paare zusammen. — Bei den Sobo lebt die Ehefrau die erste Zeit im Hause ihrer Eltern, ihr Mann aber wohnt mit ihr nicht zusammen, sondern besucht sie nur jeden Abend; bei Tagesanbruch geht er dann wieder fort. Erst nach drei Monaten bringen Angehörige ihrer Familie die junge Frau in das Haus des Gatten. — Bei den Bassa-Komo pflegen alle Männer in einem Teile des Dorfes zu leben, alle Frauen in einem anderen; die Männer besuchen ihre Frauen oder umgekehrt die Frauen ihre Männer, wie es gerade die Gelegenheit ergibt. Bei den Mbres am Tschadsee besteht noch Gruppenheirat, die Männer müssen aber alle Brüder, die Frauen alle Schwestern sein. — Bei den Ekoi besteht die bindende Förmlichkeit darin, daß das Mädchen ein Hochzeitsgeschenk als solches annimmt; die Annahme verkündet darauf der Bewerber im ganzen Dorfe. Vor der Hochzeit muß das Mädchen, wie wir bereits hörten, eine Zeitlang im Masthaus bleiben; währenddessen geht es weder aus noch arbeitet es. Auf Mädchen, die sich dies nicht leisten können, entweder aus Mangel an Geld[S. 48] oder aus sonstigen Gründen, wird scheel herabgesehen. Wenn einer Mutter ihr zukünftiger Schwiegersohn nicht angenehm ist, so sucht sie es manchmal dahin zu bringen, daß er die Verlobung wieder rückgängig macht, indem sie ihm droht, ihre Tochter vor der Hochzeit knapp zu halten, damit sie nicht fett werde.


An der Goldküste führt man ein Mädchen, wenn es das Reifealter erreicht hat, an den Strand; dort wird es von anderen Mädchen gewaschen. An den Ufern des Stromes bringen Familienangehörige eine Opfergabe dar, die aus einem gekochten Yamwurzelbrei und Palmöl besteht; sie rufen dabei die Ortsgötter an und teilen ihnen mit, daß ihr Kind das heiratsfähige Alter erreicht habe. Darauf wird dem Mädchen ein Armband, bestehend aus einer weißen, einer schwarzen und einer goldenen Perle, die auf eine weiße Schnur gezogen sind, um das Handgelenk gelegt oder mit weißen Strichen ein solches angemalt, um seinem besonderen Schutzgeist dadurch anzukünden, daß es seiner Obhut nicht mehr bedürftig sei. Es wird sodann in ein seidenes Tuch gehüllt und mit allerlei Zierat geschmückt, den die Familie oder ihre Freunde besitzen; die obere Körperhälfte erhält einen weißen Anstrich von feinen Streifen. So ausgeputzt stolziert die jugendliche Schöne durch den ganzen Ort, begleitet von ihren Freundinnen, die zu Ehren ihrer Jungfernschaft Lieder anstimmen und gleichzeitig darauf hindeuten, es sei jetzt an der Zeit, daß diese aufhöre. Ein Bewerber läßt nun auch nicht lange auf sich warten, wenn das Mädchen nicht bereits im voraus verlobt worden ist. Ist die Familie des jungen Mädchens damit einverstanden,[S. 50] dann wird von dem Bräutigam der Brautpreis gezahlt und die Hochzeit ausgerichtet. Er schickt dazu Rum, Branntwein und andere berauschende Getränke, desgleichen Tabak in die Familie seiner Auserwählten, oder er läßt, wenn er besonders begütert ist, eine Menge Leute wertvollere Geschenke darbringen, mit denen diese, zu Ehren des Ereignisses Lieder absingend, durch den Ort marschieren. Darauf wird die Braut in ihr neues Heim geleitet, wo man ein Festessen veranstaltet. Nach demselben zieht sich das junge Paar zurück. Hat sich in der Hochzeitsnacht die Keuschheit der Braut herausgestellt, dann streut der beglückte Ehemann am nächsten Morgen getrockneten pulverisierten Ton über sie; sie selbst darf sich dann wieder in der Öffentlichkeit zeigen. Ist aber die Annahme, ein unberührtes Mädchen erhalten zu haben, nicht zutreffend gewesen, dann hat der Ehemann das Recht, seine Frau zurückzuweisen; in diesem Falle wird ihm nicht nur der Brautpreis zurückerstattet, sondern es werden ihm auch die Unkosten, die die Hochzeit ihm gemacht hatte, ersetzt.


In Liberia, wo das Mädchen eine ähnliche Schule wie in Sierra Leone (Bundubund) durchzumachen hat, wird die Braut, wenn die Vorverhandlungen erledigt sind, ganz und gar mit einer Salbe aus Tierfett und Palmöl eingerieben, mit besonderen Zeichen, die magische Eigenschaften besitzen sollen, geschmückt und dann in das Haus des Bräutigams gebracht, wo das übliche Fest sich anschließt. Im westlichen Liberia begleitet die Mutter das Paar, um zu erfahren, ob der junge Ehemann alles in Ordnung gefunden hat. Hat sich das Mädchen als nicht mehr jungfräulich[S. 51] erwiesen, dann löst sich die Hochzeitsversammlung auf, und die Familien geraten sofort über die Rückgabe des Kaufgeldes in Streit. In Dahome schickt der junge Ehemann am anderen Morgen, „wenn die Kalabasse zerbrochen ist“ (womit die vollzogene Beiwohnung gemeint ist) und er zufrieden war, seinen Freunden eine volle Flasche Schnaps; fand er die Sache aber nicht nach Wunsch, nur eine halbe Flasche. Bei den Bambara wird die Verlobung von der Zustimmung des Boli oder Familiengeistes abhängig gemacht. Am Abend der Hochzeit wird die Braut von Jünglingen und Mädchen unter Tanz, Gesang und Abfeuern von Gewehren in ihr neues Heim geleitet. Während sie sich unterwegs befindet, bringt der Priester den Boli dorthin und legt ihn auf das Lager der Jungvermählten, um alle bösen Geister auszutreiben. Die Brautjungfern lösen der jungen Frau das Haar, entfernen ihre Keuschheitsschürze und geleiten sie in das Gemach ihres Gatten. Nach einiger Zeit tritt das Paar heraus, und nachdem der Gatte die Gäste ihrer Jungfräulichkeit versichert hat, begibt sich die junge Frau zur Hütte ihrer Freundin und schläft dort, während der Bräutigam und seine Kumpane sich tüchtig betrinken. Die Kajjimütter legen der neuvermählten Tochter einen Gürtel um, an dem vorn und hinten ein schwanzähnliches Anhängsel herabhängt (Abb. 77).

Polygamie ist unter den Schwarzen sehr verbreitet, denn Frauen sind ein Zeichen des Reichtums und stellen außerdem eine Arbeitskraft dar. Besonders große Häuptlinge leisten sich eine stattliche Anzahl Frauen, soweit ihre Mittel dies erlauben. Einehe findet man seltener. Die erste Frau genießt ein besonderes Ansehen im Haushalte und ist die Vorgesetzte der übrigen Gattinnen sowie der Kinder; falls der Mann weitere Frauen zu nehmen wünscht, muß sie ihre Zustimmung geben.
Häufig wohnen die einzelnen Frauen getrennt in besonderen Hütten. — Ehebruch kommt häufig genug vor. Denn da die jungen Leute nicht immer mit genügend Glücksgütern gesegnet[S. 52] sind, um sich eine Frau zu kaufen, verschaffen sie sich eine solche durch Verführung. Vielfach werden die Ehebrecherin sowie ihr Galan mit dem Tode bestraft, anderwärts nur körperlichen Züchtigungen unterworfen, unter anderem mit dem Schwanze eines Stachelrochen durchgeprügelt, an den Geschlechtsteilen durchstochen, mit einer Messerklinge gegeißelt. Die Bassari üben an dem Missetäter Strafe, indem sie ihm die Geschlechtsteile mit Steinen zerklopfen, und anderes mehr. Mit zunehmendem europäischen Einflusse sind derartige harte Strafen mehr und mehr in Abnahme gekommen. Man ahndet jetzt Ehebruch mehr mit Geld. Die Ekoi besitzen ein merkwürdiges Mittel, um sich der Treue ihrer Frauen zu versichern. Mann und Weib saugen sich gegenseitig etwas Blut aus den Handgelenken. Vergäße sich die Frau, dann würde sofort das Blut des Mannes, das in ihren Körper übergegangen ist, sich empören und so mächtig durch ihre Adern strömen, daß schleunigst der Tod einträte. — Ehescheidung ist ein ganz geläufiges Vorkommnis, besonders seit der Abschaffung der körperlichen Züchtigung tritt sie häufiger in die Erscheinung.

Bei den meisten westafrikanischen Stämmen herrscht das mutterrechtliche System vor. Die Kinder gehören der Familie der Mutter an und werden, je nachdem diese Sklavin oder Freie ist, das eine oder das andere. Nach dem Tode der Mutter werden sie von deren Angehörigen auferzogen. Sie beerben auch den Onkel mütterlicherseits. Die Würde des Häuptlings geht bei seinem Tode nicht auf den eigenen Sohn über, sondern auf einen der Brudersöhne der Mutter oder in Ermanglung solcher Erben auf den ältesten Sohn der ältesten Schwester des Verstorbenen. Als Erben gelten die Brüder und Schwestern der Mutter, und ähnliches mehr. Sobald ein Mendimann stirbt, wird sein Geist zum Gegenstand der Furcht, und man ist bestrebt, ihn zu versöhnen und am Wiederkommen zu hindern. Damit er nun nicht zurückkehre und die Hinterbliebenen belästige oder gar umbringe, übt man ein eigentümliches Abwehrverfahren: die Hinterbliebenen lassen sich für etwa einen Tag einen Fußblock anlegen (Abb. 80). — Wenige Tage nach dem Verscheiden nehmen die Angehörigen die „Tewe-jama“ genannte Zeremonie[S. 53] vor; sie kochen dem Toten für seine lange Reise ins Jenseits, denn an ein solches glauben die Mendi, Speise. Am Vorabend des dritten oder vierten Tages, je nachdem es sich um ein weibliches oder männliches Familienmitglied handelt, begeben sich die Angehörigen und Freunde zum Grabe, wo das Familienoberhaupt ungefähr folgende Ansprache an den Toten hält: „Wir kommen, damit du erfährst, daß wir dich nicht vergessen haben. Wir wollen dir etwas als Wegzehrung mitgeben, wenn du dich auf die lange Reise begibst. Darum mußt du morgen früh auf uns warten.“ Darauf wird ein Huhn mit Reis gekocht und ein Teil davon für den Toten auf das Grab gestellt, während den Rest die Teilnehmer verzehren. Männer von Bedeutung bekommen über ihr Grab noch eine Hängematte gehängt, damit ihr Geist sie für die Reise benutze.

Ein Häuptling genießt das Vorrecht, im Orte selbst begraben zu werden; die übrigen Toten aber werden in der Regel außerhalb, meistens in einem schönen Hain, beigesetzt. Die Gräber (Abb. 81) sind vielfach mit allerlei kleinen Gegenständen bedeckt, die zur Aufnahme der von den Angehörigen dargebrachten Speiseopfer gedient hatten. Man pflegt diese Gräber oder „Orte zum Beten“, wie sie wohl genannt werden, des öfteren zu besuchen und mit den Abgeschiedenen eine Art Zwiegespräch zu halten; man ruft ihre Hilfe an, nicht nur die der jüngst Verschiedenen, sondern auch die Geister früherer Generationen. Man treibt also hier eine Art Ahnen- oder Geisterkult.

Die Mendi glauben im allgemeinen an ein zukünftiges[S. 54] Dasein. Das Reich der Toten verlegen sie in einen Berg in der Nähe einer bestimmten Stadt ihres Landes. Dorthin sollen sich die Toten begeben, nachdem sie auf langer Reise zuvor einen Fluß überschritten haben. Die obenerwähnte Zeremonie „Tewe-jama“ nimmt darauf Bezug, denn diese Bezeichnung heißt, wörtlich übersetzt: „über das Wasser gehen“. Aus diesem Jenseits will man in geheimnisvoller Entfernung Stimmen gehört haben, die auf die Klagelaute der Hinterbliebenen antworteten und sie aufforderten, nicht länger zu weinen, da der Verstorbene sein Ziel erreicht habe. Es wird auch noch erzählt, daß man oft den Verstorbenen, den Kopf in das weiße Leichentuch gehüllt, habe hinaufgehen sehen und vernommen habe, daß ihm, sobald er den Blicken entschwunden war, zur Begrüßung laute Willkommrufe entgegengerufen wurden.


Stirbt eine Angehörige des Yassibundes, dann tragen die Ordensfrauen die in ein Tuch gehüllte Leiche auf einer Matte um das Haus, tanzen und singen dabei zu dem Lärm der langen Holztrommeln und der Segura; die Kambehmutter eröffnet, ein langes Schwert gezückt vor sich haltend, den Reigen, eine andere Kambeh trägt in einem Horn die Yassimedizin. Alle Frauen sind nur um die Hüften mit einer Anzahl Perlenschnüre bekleidet, die infolge der Erschütterung beim Tanzen bald abfallen, so daß sie schließlich ganz nackt erscheinen; die Kambehfrauen sind außerdem auf der Stirn und an den Schultern fleckig geschminkt. Stets muß eine Nacht zwischen dem Eintritt des Todes und der Bestattung liegen. Diese verbringen die Yassifrauen mit Tanz und Gesang in dem Medizinhaus. Nachdem der Tanz beendet ist, begeben sich die Teilnehmer in das Haus. Ein paar der beteiligten Frauen müssen nun aus Blättern und Wasser ein bestimmtes[S. 55] Gebräu, Saweh genannt, durch Zerquetschen in einem Holznapfe herstellen. Darauf werden ein oder mehrere Hühner geschlachtet und mit den Federn in diese „Medizin“ hineingetaucht; mit den Flügeln der Tiere besprengt man jedes Haus in der Stadt und alle Menschen, die nicht Angehörige des Yassibundes sind, damit der Geist der Verstorbenen niemand belästige und auch eine schädliche Wirkung der Yassimedizin, die die Kambehmutter trägt, vermieden werde. Sobald die Frauen den geschilderten Obliegenheiten nachgekommen sind, wird die Leiche bestimmten Poromännern übergeben, die die Leichenbesichtigung vorzunehmen und festzustellen haben, ob die Verstorbene etwas mit Hexerei zu tun gehabt habe. Zu diesem Zwecke wird sie aufgeschnitten, ihre Lunge herausgenommen und in eine Schale mit Wasser gelegt; schwimmt die Lunge oben, so ist dies ein untrügliches Zeichen für die Unschuld der verstorbenen Person. Während der Leichenöffnung, die im Porobusch vor sich geht, müssen alle Leute den Ort verlassen, dürfen sich aber in der Nähe aufhalten. Stellt sich heraus, daß die Tote sich keine Zauberei hat zuschulden kommen lassen, dann stößt ein Teufel des Ordens, der Bahun, der zu dieser Zeit stets in der Nähe weilt, einen sonderbaren Schrei aus, worauf die große Trommel geschlagen wird, um den Bewohnern der Stadt anzukünden, daß die Verstorbene die Probe glücklich überstanden habe. Daraufhin kehren alle sofort nach dem Orte zurück; die Frauen heben ihre Wehklage an und tanzen und singen drei Tage lang. Die Leiche der Verstorbenen hat Anspruch auf alle mögliche Achtung, sie darf auch von den Angehörigen in der Stadt beigesetzt werden. Die[S. 56] Bestattung erfolgt durch Männer, doch muß zuvor noch der Rest der Sawehmedizin aus dem Napfe über die Tote gesprengt werden. Hat sich indessen herausgestellt, daß die Verstorbene nicht unschuldig war, weil ihre Lunge untersank, dann darf niemand sich erkühnen, zu jammern und zu klagen, sondern überall muß tiefes Schweigen herrschen. Es darf auch weder getanzt noch gesungen noch gespielt werden. Die Tatsache, daß die Tote sich mit Hexerei befaßt hatte, gilt als eine Schande für die Familie, und die Tote wird deshalb einfach unbekleidet im Busch begraben.

Glaubt ein Ekoi, daß seine letzte Stunde gekommen sei, dann bittet er den Priester des Juju Mfam, er möge ihm von dem heiligen Baume Zweige bringen. Sofern dann überhaupt noch die Möglichkeit besteht, daß wirklich noch nicht die Todesstunde naht, so hofft der Kranke sofort dadurch gesund zu werden. Wenn es aber tatsächlich mit ihm zu Ende geht, dann streicht der Priester leise mit den Zweigen über das Gesicht des Sterbenden, damit sein Geist ohne Schmerz in das Reich von Obassi Nsi eingehen könne. Nachdem die Leiche gewaschen worden ist, kommt sie in einen Sarg, der mit Stoff ausgelegt ist, zu liegen; die Hände werden ihr über der Brust gefaltet. Der Sarg wird in einer der Hütten in einer etwa sechs Fuß tiefen Grube beigesetzt und diese zugeschaufelt. Sodann finden verschiedene Tänze statt, und eine Kuh sowie eine Ziege werden geopfert. Ein Teil von dem Fleisch und von den Getränken wird den Vorfahren dargebracht, der Rest unter die versammelten Leidtragenden verteilt. Mehrere Tage, selbst Wochen[S. 57] lang wird Totenwache abgehalten. Stirbt ein Auswärtiger, dann wird er auf dem Wege, der ihn in die Stadt führte, begraben, damit sein Geist sich ohne Mühe in die Heimat wieder zurückfinden oder wenigstens nach ankommenden Freunden Ausschau halten könne.




Bei den edosprechenden Völkern hängt die Art des Begräbnisses davon ab, ob der Verstorbene kinderlos war oder nicht. In der Regel erfährt ein Mann oder eine Frau, die ohne Nachkommenschaft sterben, keine bessere Behandlung als ein Kind; dieses sowohl wie jene werden einfach in den Busch geworfen. Handelt es sich aber um eine Person mit Erben, dann wird sorgfältiger mit[S. 58] ihr verfahren. Nachdem die Leiche gewaschen, in ein weißes Tuch gehüllt und auf das Bett gelegt worden ist, wird eine Ziege oder ein Huhn zu ihren Füßen geopfert, damit der Geist kräftig genug werde, um den richtigen Ort aufzusuchen. Überlieferte Begräbnislieder werden bei der Beisetzung gesungen, manchmal auch, nachdem das Grab zugeschaufelt worden ist, noch ein weiteres Opfer auf ihm dargebracht. Sodann reinigen sich die Totengräber mit Wasser oder mit der läuternden Wirkung eines Huhnes. Jeder Schwiegersohn des Verstorbenen muß eine Opfergabe, bestehend in Stoffen, Yamwurzeln, Kokosnüssen und anderen Gegenständen, nicht zu vergessen die Ziege, darbringen; meistens wird mehrere Tage und Nächte hindurch geopfert. Am letzten Abend der Trauerfeier kleidet sich ein Familienglied wie der Verstorbene an und nimmt dessen Platz ein. — Wurde jemand von einem Krokodil aufgefressen, dann bringt man ein Palmblatt und einen Topf zu dem Wege, auf dem der Verstorbene den Ort verließ. Ein Sohn oder eine Tochter ruft ihm zu, er solle zurückkehren, und berührt die Erde mit dem Blatt, nimmt dann dieses und den Topf wieder mit nach Hause und legt die Sachen auf das Bett des Toten; hier werden noch einmal dieselben oder[S. 60] ähnliche Förmlichkeiten vollzogen. — Während der beiden letzten Monate in der nassen Jahreszeit dürfen Tote nicht begraben werden; bei einem währenddessen etwa eingetretenen Todesfall werden die Leichen in den Busch gebracht und hier so lange belassen, bis die Regenzeit vorüber ist.




Bei den tschisprechenden Völkern der Goldküste erhebt sich bereits, ehe ein Familienoberhaupt seinen letzten Atemzug getan hat, lautes Wehklagen, die Frauen stürzen schreiend aus dem Hause mit zerzaustem Haar und in Unordnung geratenen Tüchern. Die Leiche wird gewaschen, in kostbare Gewänder gekleidet und auch sonst ausgeputzt, darauf entweder auf eine Bettstatt hingelegt oder auf einen Schemel gesetzt; in solcher Paradestellung erhält sie den Besuch der Frauen, die sich zum Begräbnis einfinden und den Toten schelten, daß er von dannen gehe. Angehörige dagegen bereiten ihm seine Lieblingsgerichte und reden ihm dringlich zu, noch einmal davon zu essen. Draußen sitzen die Männer zum Empfang der Geschenke bereit, wie Gold, Schießpulver, berauschende Getränke, Eßwaren und Tücher, die die Freunde mitbringen; ihre Ankunft wird durch Gewehrschüsse und Trommelschlag angekündet. Vom Augenblick des Verscheidens an nehmen die Verwandten des Toten und seine sonstigen Hausgenossen, solange sie es nur aushalten können, keine Nahrung zu sich; dafür trinken sie reichlich berauschende Getränke, so daß die meisten von ihnen am Begräbnistage betrunken sind. Einen oder zwei Tage nach dem Tode wird der Verstorbene durch ein besonders dazu hergerichtetes Loch der Mauer aus dem Hause befördert und in ein Grab gelegt; Hühner, Schafe oder auch Ochsen werden ihm geopfert, damit deren Geister den seinigen in die nächste Welt begleiten können. Die Familie des Verstorbenen verteilt außerdem reichlich Rum unter die Trauergäste. Die Totenwache pflegte man früher so lange auszudehnen, als die[S. 62] Angehörigen es durchhalten konnten; heutzutage sind die Leute indessen sparsamer geworden und schränken die Festlichkeiten bei einem Begräbnis sehr ein. Auch legen sie nicht mehr wie vordem Goldsachen und andere Kostbarkeiten in die Särge. — Wenn es nicht möglich ist, die Leiche einzuholen, wird ein ganz kleiner Sarg angefertigt und mit einem weißen Tuche bedeckt. War der Betreffende ertrunken, dann bringt man diesen Sarg an den Strand und besprengt die Wellen mit ein wenig Rum, ruft den Verstorbenen dreimal herbei, schüttet Sand und Seewasser in den Sarg und begräbt ihn. Fand er seinen Tod aber in den Flammen, so wird etwas von seiner Asche oder von der des Hauses, in dem er umkam, oder auch etwas Erdboden aus dessen Umgebung in den Sarg getan. Jedesmal rufen die Hinterbliebenen vor der Beisetzung laut aus, daß der Verstorbene gesucht, aber nicht gefunden worden sei, damit sein Geist nicht denke, seine Angehörigen wären gegen ihn gleichgültig gewesen, und sie dafür bestrafe. — Gegen Ende August wird ein allgemeines Fest zur Erinnerung an die Toten abgehalten, die in den letzten zwei Jahren gestorben sind. Vom frühen Morgen an erhebt sich ein lautes Gejammer um sie. Eine jede Familie begibt sich zu dem Grabe ihres Angehörigen und opfert hier Hühner, Eier, Rum und Palmwein, schmeichelt dem Toten und ruft ihn um Schutz an. Darauf wird noch sieben Tage lang gegessen und getrunken; am folgenden Tage werden die gewöhnlichen Geräte, die während dieser Feste benutzt wurden, fortgeworfen und an ihrer Stelle neue in Gebrauch genommen.


Bei den Aschanti wurden früher aus Anlaß des Begräbnisses eines Königs Menschenopfer dargebracht. Es bestand bei diesem Volke nämlich die Sitte, daß, sobald ein König auf den[S. 64] goldenen Thron gehoben war, man zu seiner beständigen Bedienung eine Anzahl Jünglinge und Jungfrauen auswählte. Die Mädchen hatten die Pflicht, jedes Gericht, das auf die königliche Tafel kam, zu kosten, bevor es dem Herrscher vorgesetzt wurde, und die Männer bildeten seine Leibwache. Diese „Seelen des Königs“, wie sie hießen, genossen besondere Vorrechte, solange der König am Leben war; bei seinem Tode aber wurden sie getötet und mit ihm begraben, einmal, um in der anderen Welt ihn weiter zu bedienen, und zum anderen, um zu zeigen, daß der Verstorbene in der Tat ein mächtiger Fürst gewesen sei. Sie waren im übrigen mit diesem ihrem Schicksal auch ganz einverstanden und machten gar nicht einmal den Versuch, ihm zu entgehen, denn sie hielten es für selbstverständlich, daß sie im Jenseits eine ähnliche Stellung einnehmen würden wie hier auf dieser Welt. Immer, wenn der Todestag des Königs wiederkehrte, wurden neue Diener abgeschickt, das heißt abgeschlachtet, um dem Verstorbenen zu zeigen, daß er noch nicht vergessen sei, und auch, um den jenseitigen Bewohnern einen weiteren Beweis seiner Größe zu liefern.


Wenn eine Frau im Innern des Krulandes stirbt, beanspruchen ihre Eltern, falls sie aus einem anderen Dorfe stammte, von dem Gatten oder dem Häuptling eine Entschädigung; wird diese verweigert, dann töten sie alle Haustiere[S. 65] des Dorfes, zeitweilig war es ihnen sogar gestattet, dieses auszuplündern und selbst niederzubrennen. Die Familie eines jeden Verstorbenen jammert, sofern dieser ein Freier war, vierzehn Tage lang ohne Unterbrechung, die übrigen Ortsbewohner nur zwei Tage. Ein Sklave wird ohne weitere Förmlichkeit einfach in den Busch geworfen und verwest dort oder dient den wilden Tieren zum Fraße; ein verstorbener Freier aber wird für einige Tage zur Schau gestellt, bis er soweit in Verwesung geraten ist, daß man es nicht mehr in seiner Nähe aushalten kann. Darauf erst wird die Leiche in eine Matte genäht und begraben. Auf dem Grabe werden allerhand Stoffe (je nach der Wohlhabenheit des Verstorbenen), im besonderen auch seine Gebrauchsgegenstände, wie seine Pfeife, außerdem noch mancherlei Handelsartikel niedergelegt; auch werden Trankopfer (Palmwein oder Rum) am Grabe dargebracht. Für gewöhnlich stellt man auch noch eine leere Schüssel auf das Grab, die man dann und wann mit alkoholischem Getränk und mit Reis füllt. Die Wei errichten schließlich noch eine Fahne über ihm. Dieser Volkstamm legt seine Gräber in Gruppen in der Nähe des Dorfeinganges an; Häuptlinge begraben sie auch vorübergehend in ihrer eigenen Behausung.
Das Abzeichen der Trauer besteht in vielen Gegenden Liberias in Ringen aus getrocknetem Gras oder Palmrinde, die an den Fingern, um den Arm und auf dem Kopfe getragen werden, sowie in einer Blau- oder Grünfärbung des Körpers, auch im Bestreichen mit Asche. Ein Witwer muß seine Kinder durch ein Geschenk, das er der Familie seiner verstorbenen Frau sendet, gleichsam zurückkaufen; dadurch erwirbt er sich zugleich einen Anspruch auf die Schwester der Toten.

In Dahome gibt es ein eigentümliches Verfahren, um festzustellen, ob die[S. 66] Forderung eines Gläubigers an einen Verstorbenen zu Recht bestehe oder nicht. Das Wasser, mit dem die Leiche gewaschen wurde, füllt man in eine Flasche und bietet davon dem Gläubiger, wenn er seine Forderung eintreiben will, zum Trinken an. Verweigert er den Trunk, dann geht daraus hervor, daß der Verstorbene ihm nichts schuldete; nimmt er ihn dagegen an, dann bedeutet dies, daß jener bei ihm in Schuld war, und die Familie kommt dafür auf.


Die Bassari Togos sind selten davon überzeugt, daß ein Mensch eines natürlichen Todes gestorben sei, sondern schreiben seinen Tod meistens einem bösen Geiste oder dem Zauber einer ihm feindlich gesinnten Person zu. Daher pflegen sie sich stets an den Fetischpriester zu wenden, damit dieser entscheide, ob der Betreffende eines natürlichen Todes gestorben oder einem Zauber beziehungsweise einem Morde zum Opfer gefallen sei. Spricht sich der Priester für die zweite Annahme aus, dann lenkt er gleichzeitig den Verdacht auf eine bestimmte Person; sein Urteil gilt für heilig und darf niemals angezweifelt werden. Der Verdächtigte muß sich einem Gottesurteil unterziehen, meistens den Giftbecher leeren. — Die Leiche wird bei den Bassari gewaschen, häufig auch mit Rotholz eingerieben, in ein Fell oder Tuch gehüllt, auf einer Bambusbahre durchs Dorf getragen und schließlich bei Sonnenuntergang unter feierlichen Gesängen begraben, und zwar die eines Oberhäuptlings in seinem Gehöfte, die von anderen Männern, Frauen und Kindern im Busche. Hieran schließt sich, wie üblich, eine festliche Bewirtung der Gäste durch die Verwandten des Toten, außerdem wird drei bis vier Tage lang geschossen, um die bösen Geister zu vertreiben. Die Witwe muß vierzehn Tage lang unbekleidet in der Hütte bleiben und verläßt[S. 68] diese erst dann, wenn sie ein Bad genommen hat. Als Trauerzeichen legt sie sich ein dunkelblaues Tuch um. Der Körper des Verstorbenen gehört gewissermaßen der Familie des Vaters, die ihn auch zu beerdigen hat, an, dagegen die Haare, die man ihm abschneidet, der Familie der Mutter, die sie ihrerseits ebenfalls begräbt. Sobald sich die Kunde von einem Morde oder Totschlag verbreitet hat, werden die Haare des Toten den Familienmitgliedern mütterlicherseits übersandt und diesen dadurch gleichsam der Wunsch übermittelt, daß sie die Todesursache unparteiisch prüfen möchten. Werden die Haare von ihnen angenommen, so gilt dies für ein Zeichen, daß sie einen natürlichen Tod des Verstorbenen anerkennen. — Die Leichname von Schuldnern dürfen nur mit Einverständnis sämtlicher Gläubiger begraben werden. Andernfalls werden sie an einem öffentlichen Wege an einem Baum ausgesetzt und an ihrer Seite ihre wenigen Habseligkeiten aufgestellt. Da es aber als große Schande für eine Familie gilt, wenn man ihren Angehörigen kein würdiges Begräbnis zuteil werden läßt, so kommt es selten soweit mit der Leiche eines Verschuldeten.
Die Banjang am Croß River Nordkameruns begraben ihre Toten in der sogenannten Hockerstellung, die wir bereits bei anderen Völkern kennen gelernt haben. Die Leiche wird, bevor sie erstarrt ist, derartig gebogen, daß die Knie das Kinn und die Hände das Gesicht berühren, und dann fest verschnürt. Sie führen zu Ehren ihrer Verstorbenen auch Totentänze nach dem Takte der Trommeln und mit Gesängen auf; selbst die nächsten Angehörigen beteiligen sich daran. So sah Conrau die Tochter eines Häuptlings, mit dem Haumesser, der Jagdtasche und der Pulverflasche ihres verstorbenen Vaters behängt, beständig tanzen und dabei fortwährend gellende Klagen ausstoßen.

In Südkamerun pflegt man bedeutende Häuptlinge in Matten eingewickelt in hohlen Bäumen an abgelegener Stätte beizusetzen; auch hier feiert man das Ereignis durch Tänze, die sich viele Nächte lang wiederholen. Die übrigen Menschen werden entweder im Busch oder in ihrer Hütte beerdigt. Über dem Grabe wird ein Hügel aufgehäuft, den man mit Kleiderfetzen, Scherben und ähnlichem zu bedecken pflegt. In der Lichtung, die um das Grab im Walde geschlagen ist, hängt man an den Bäumen oft kleine Stäbchen auf, die anzeigen sollen, wieviele Weiber, Kinder und Sklaven der Verstorbene besaß und wieviele Menschen, Elefanten und Leoparden er tötete. Fand die Beisetzung in der Hütte statt, so wird diese mit Rindenstücken und Stangen verschlossen und bleibt fortan unbewohnt; draußen errichtet man Ruhebänke für die Besucher. Kleine Kinder werden häufig neben der Hütte bestattet; auf diese Weise soll sich die Mutter gegen Unfruchtbarkeit schützen.
[S. 69]

Den Teil des Schwarzen Erdteils, der sich südlich von der großen Wüste Sahara ausbreitet und von den Quellen des Nils bis zum Oberlauf des Nigers reicht, bezeichnet die Wissenschaft als Sudan. Aus praktischen Gründen teilt sie dieses weite Gebiet in drei Abschnitte ein: in den Ost-, Zentral- und Westsudan. Die Bevölkerung des Sudans bildeten ursprünglich wohl die nach ihm benannten Neger, aber frühzeitig lagerten sich über diese Urschicht hamitische Elemente, die von Norden und von Osten her mehr und mehr vordrangen und allmählich bis an die Westküste Afrikas gelangten. Zu den Völkerschaften des Sudans zählen, wenn wir im Osten anfangen, die verschiedenen nilotischen Stämme, wie Schuli, Dinka, Schilluk, Djur, Naër, Bari und andere mehr, die durch ihre tiefdunkle Haut auffallen, sowie die bei weitem helleren Mangbattu (Monbuttu) und Niam-Niam (A-Sandeh). Ihnen reihen sich weiter westwärts im Zentralsudan die Bewohner von Darfur, Wadai, Baghirmi, Bornu und Kanem, ferner die Musgu und die Leute der Haussastaaten an. Bei den noch weiter westwärts folgenden Negern des Westsudans treffen wir bereits auf alte Bekannte, wie die Mandingo, Woluffen, Kru, Wei und so weiter. Da wir uns mit ihnen bereits in dem Abschnitte Westafrika beschäftigt haben, so wollen wir an dieser Stelle von ihnen absehen. Auch die Bewohner der Haussaländer haben wir bereits mehrfach berührt, daher können wir uns über sie kürzer fassen.
Bereits in der Vorzeit scheinen hamitische beziehungsweise berberische Stämme in den Sudan vorgedrungen zu sein; in der geschichtlichen Zeit waren es vor allem zwei große Völkerstämme, die von Einfluß waren: die Haussa und die Fulbe. Die ersteren begründeten im siebzehnten und achtzehnten Jahrhundert unserer Zeitrechnung mächtige Staaten, die letzteren ein Jahrhundert später ebenfalls ein starkes Reich, aber beider Schöpfungen sind längst untergegangen, seitdem die Europäer von diesen Gebieten Besitz ergriffen haben.
Diese verschiedenen Einwanderungen fremder Elemente in die von den Sudannegern[S. 70] ursprünglich bewohnten Gebiete haben der Bevölkerung ihren Stempel natürlich auch in anthropologischer Hinsicht aufgedrückt; durchweg ist ein hamitischer Einschlag nicht wegzuleugnen, bei dem einen Volke tritt er mehr, bei dem anderen weniger in die Erscheinung. Am meisten verraten das hamitische Blut die Neger des Ostsudans. Im besonderen zeichnen sich diese Stämme vor den Schwarzen des Zentralsudans durch ihre große, schlanke Gestalt, hageren, aber dabei doch muskulösen Körperbau, sehr dunkle, tiefbraune, bis ins Schwärzliche gehende Haut, mehr gekräuseltes als wolliges Kopfhaar aus. Eine ihnen eigentümliche Erscheinung ist ihre seltsame Körperhaltung, die als Anpassung an ihre Umgebung zu erklären ist. Diese langbeinigen Gestalten pflegen nämlich stundenlang auf einem Beine zu verharren, wobei das andere im Winkel gegen das Standbein gebogen gehalten wird, so daß die Fußsohle das Knie desselben berührt (Abb. 84). Diese Stellung erinnert an die der Sumpfvögel, weswegen man diese Stämme auch als Sumpfneger bezeichnet hat.

Die Bekleidung der Niloten ist durchweg eine recht bescheidene. Unter den Männern bildet Nacktheit die Regel, die Frauen behängen sich ihre Hüften meistens mit einem gegerbten Fell oder auch mit einem Blätterbüschel. Bei verschiedenen Stämmen sind als Kleidungstück Tierschwänze beliebt, die man vom Hüftband über das Gesäß herabhängen läßt. Auch künstliche Anhängsel bindet man sich um, die an Pferdeschwänze erinnern, aus feinen Bindfäden hergestellt und mit Ocker rot gefärbt sind. Manchmal haben diese Schwänze eine solche Länge, daß sie hinterherschleifen. — Als Schmuck werden Ringe um die Arme und Beine (Abb. 85) sowie in den Ohren und Lippen getragen, um den Hals Ketten aus Muscheln, Nashornzähnen und anderem mehr. Manchmal sind die Beinringe von einem solchen Gewicht, daß die Leute sich kaum fortbewegen können. Die Armringe laufen bei einigen Stämmen in scharfe Stacheln aus und werben daher gleichzeitig als Waffe (Schlagring) benutzt. Ohrschmuck wird auch getragen, doch werden die Ohrläppchen niemals durch Hineinzwängen[S. 71] größerer Gegenstände verlängert. Dagegen kommen wohl Vergrößerungen der Lippen durch Holzscheiben (Abb. 86) vor. Auch finden wir verschiedentlich Durchbohrungen der Nasenscheidewand und Hineinstecken von kleinen Stäbchen, namentlich Quarzstiften.


Von sonstigen Körperverunstaltungen seien noch das Herausschlagen der Schneidezähne sowie das Anbringen von Narben (Abb. 93 und 103) erwähnt. Diese Tatauierungsmuster sind oft ganz geschmackvoll und in ihrer Anordnung sehr gefällig. Die Narben dienen verschiedentlich zur Bezeichnung der Stammeszugehörigkeit (bei den Dinka im besonderen Gesichtsnarben). Die Schuli bemalen sich das Gesicht mit rötlicher und grauer Farbe. — Besondere Fürsorge widmen die Nilbewohner des Ostsudans ihrem Haar. Man begegnet bei einzelnen Stämmen den drolligsten Frisuren, die sie dadurch zustande bringen, daß sie sich das Kopfhaar mit Ton, Kuhmist und Gummi einreiben, so daß eine zusammenhaltende Masse entsteht, die sich in die verschiedensten Formen gleichsam pressen läßt. Die Dinka (Abb. 87) zum Beispiel lassen ihr Haar in kleinen Büscheln wie Strahlen allseitig vom Kopfe abstehen, scheren sich aber auch wohl den Kopf bis auf eine stehenbleibende Locke über der Stirn. Ganz kunstvoll verfahren mit ihrer Frisur die Latuka. Jeder ihrer Stämme hat seine eigene wechselnde Mode, doch stimmen alle darin überein, daß sie ihr Haar nach Art eines Helmes (Abb. 88) formen. Verschiedene Jahre sind erforderlich, um diese Frisur zur höchsten Vollendung zu bringen. Sie verflechten ihr dichtes wolliges Haar mit feinem Bindfaden, bis es einer dicken Filzmatte ähnelt, die dann zu einem Helm geformt wird. Der Rand wird mit Garn zusammengenäht und bildet einen dicken Reifen. Ein Stück polierten Kupferblechs in Gestalt einer halben Bischofsmütze wird vorn kronenartig aufgesetzt. Ist der Besitzer reich genug,[S. 72] so benäht er das Ganze noch mit blauen und roten Perlen, die er so hübsch verteilt, daß der ganze Helm wie aus Perlen zusammengesetzt erscheint. Die kupferne Krone wird schließlich noch mit Straußenfedern besetzt und der Rand mit einer Reihe Kaurimuscheln bestickt, so daß dieser kunstvolle Aufbau in der Tat einen höchst würdevollen Eindruck hervorruft. Die Frauen der Latuka tragen das Haar merkwürdigerweise kurz.

Die nilotischen Stämme leben in walzenförmigen, sich nach oben zu wie ein Kegel verlängernden Hütten, die aus Geflecht und Lehm, manchmal nur aus letzterem aufgebaut sind und ein Grasdach (Abb. 89) tragen. Der Eingang zu ihnen ist oft so niedrig, daß man nur auf allen vieren hineingelangen kann. Die Hütten der Latuka ähneln in ihrer Form Glocken oder, richtiger gesagt, großen Kerzenauslöschern. Ihre Mauern sind nur etwa zweieinhalb Fuß hoch, dafür aber erhebt sich über ihnen das Dach bis zu mehr als zwanzig Fuß Höhe. Die Barihütten (Abb. 91) sind sehr sorgfältig gebaut, schön verputzt und stets von einem kleinen Hofe umgeben, dessen Boden mit einem lehmartigen festen Gemenge aus Ameisenhaufen, Kuhmist und Asche belegt wird. Die Acholi bauen Hütten, deren Dach bis auf die Erde reicht. Die Innenwände werden von ihnen mit Zeichnungen in Rot, Weiß und Hellgrau bemalt; diese Zeichnungen stellen entweder geometrische Muster oder herkömmliche Figuren von Menschen und Tieren dar; ganz eigenartig sind ihre Schlafhütten (Abb. 90).

Die meisten Niloten sind in ihrer Hauptbeschäftigung Hirten und verfügen über stattliche Herden; besonders bei den Dinka stellen diese einen großen Reichtum dar. Die Latuka erbauen in der Nähe ihrer Viehkrale hohe Plattformen (Abbild. 92), von denen aus sie eine weite Umschau[S. 73] halten können, damit sie beizeiten den Feind bemerken, der etwa einen räuberischen Überfall auf ihre Herden plant. Vieh gilt allgemein als Münze, und der Wunsch, sich die Herden des Nachbarn anzueignen, gehört gleichsam zur Tagesordnung und ist die Ursache der häufigen Raubzüge der einzelnen Stämme, die ihre Kriegführung ausmachen; die Dinka bekämpfen sich besonders auch untereinander. — Beim Umherziehen bedienen sich die Frauen der Araberstämme der Sänften (Abb. 95 und 96), die mitunter recht kostbar sind. Die Baggara reisen auch auf Ochsen (Abb. 108).


Als Waffen benutzt man hauptsächlich Speere und Schilde (Abb. 94), die bei den Acholi mit kleinen Messingknäufen in gleichmäßigen Abständen beschlagen sind. Auch die Speere weisen oft genug feinere Arbeit auf, ebenso die Pfeile. Denn auch Bogen und Pfeil gehören bei einzelnen Stämmen zu den Angriffswaffen. Die Dinka und Schilluk besitzen lange Stöcke, die sie wie Keulen schwingen. Die Bari (Abb. 97 und 98) sind vorzügliche Krieger; schon die Knaben üben sich im Gebrauch von Bogen und Pfeil und erreichen auf diese Weise beizeiten große Geschicklichkeit im Kriegshandwerk. Neben der Viehzucht befassen sich die nilotischen Stämme auch mit dem Anbau von Feldfrüchten, vor allem von Durra; bei einzelnen Stämmen macht der Ackerbau sogar die Hauptbeschäftigung aus. Andere geben sich mit Jagd und Fischfang ab. Die Bari liegen mit Vorliebe der Jagd auf Flußpferde ob, denen sie von ihren Flößen aus beizukommen suchen.
Die Dinka sind bei weitem die zahlreichsten der Nilanwohner, und trotzdem haben sie es bisher nicht fertiggebracht, sich zu einer Nation zusammenzuschließen. Die zahlreichen Stämme,[S. 74] die sich Jieng (daher das arabische Dinkawi, das wieder zu Dinka verenglischt worden ist) nennen, haben nie ein höheres Haupt anerkannt, wie dies zum Beispiel die Schilluk getan haben, sind auch niemals zwangsweise von einem militärischen Machthaber vereinigt worden. Jede Gemeinde regiert sich selbst unter der Führerschaft eines Häuptlings, der, in erster Linie geistiger Führer, das Dorf mit Hilfe der Ältesten leitet. Meistens pflegt in jeder Gemeinde der angestammte Regenmacher diese wichtigste Person zu sein; seinen Rat holt man bei jeglicher Gelegenheit ein, sein Wunsch ist für jedermann Befehl. Nach dem Glauben der Dinka birgt jeder Regenmacher den Geist eines großen Regenmacherahnen in sich. Ein solcher Mann besitzt, wie gesagt, große Macht in der Gemeinde; bei allen wichtigen Fragen wird sein Rat eingeholt, denn dadurch, daß er den Geist eines großen Ahnen in sich trägt, ist er weitsehender und klüger als andere Menschen. Zu alt läßt man die Regenmacher nicht werden, denn würden sie an Altersschwäche oder an einer schleichenden Krankheit sterben, so hätte das Volk darunter zu leiden; es würden Hungersnöte sich einstellen, die Herden sich vermindern, die Leute krank werden und sonstiges Unglück sich einstellen. Daher schützen gewisse Dinkastämme ihren Regenmacher auch nicht vor gewaltsamem Tod oder Beteiligung am Kampf. Sollte er bei einer solchen Gelegenheit sein Leben einbüßen, so würde sein Ahnengeist sofort auf einen geeigneten Nachfolger übergehen. Fühlt ein Regenmacher, daß er alt und gebrechlich wird, dann sagt er seinen Leuten, es sei für ihn jetzt an der Zeit zu sterben. Darauf graben sie ihm ein großes Grab, in das er sich legt. In dem Grabe verharrt er viele Stunden lang, ohne Speise und Trank zu sich zu nehmen; seine Angehörigen, Verwandten und Freunde versammeln sich um ihn, und er erzählt ihnen von der vergangenen Geschichte des Stammes und von seinem Wirken und gibt ihnen Ratschläge für die Zukunft. Hat er dann alles, was er auf dem Herzen hatte, vorgebracht, so deckt man ihn mit Erde zu und erstickt ihn dadurch. Von einem Stamme wird berichtet, daß sie ihren[S. 75] Regenmacher in seinem eigenen Hause erwürgt hätten; nachdem hierauf das Grab fertiggestellt war, hätten sie die Leiche gewaschen, einen Ochsen getötet, ihm die Haut abgezogen, das Grab mit ihr ausgelegt und schließlich den Toten beigesetzt. — Von einigen Stämmen heißt es, daß sie zusammen mit ihrem Regenmacher sogar einen Ochsen begrüben. Allgemein scheint aber üblich zu sein, daß man etwas Milch auf sein Grab sprengt und irgendeinen Gebrauchsgegenstand mit hineinlegt.



Die Schilluk dagegen stehen unter einem König. Er, seine Kinder, Enkelkinder und Urenkel stellen die Aristokratie dar; über vier Menschenalter hinaus wird königliche Abstammung nicht anerkannt. Für den König sorgt man in jeder Weise und behandelt ihn mit größter Hochachtung. Früher durfte er nicht einmal in den Krieg ziehen, und auch jetzt noch bewegt er sich nie ohne eine Leibgarde von etwa zwölf bis zwanzig Mann, die gut bewaffnet und jederzeit bereit sind, seinem leisesten Wunsch zu gehorchen. Sein Wort ist Gesetz, und die Geldstrafen, die er verhängt, werden aus guten Gründen schleunigst bezahlt. Zeugnis für den großen Einfluß, den er auf sein Volk ausübt, legt die Tatsache ab, daß der stattliche Hügel, auf dem sein Wohnhaus (Abb. 100) steht, trotz der den Schilluk angeborenen Trägheit mit größter Eile und ohne Widerspruch aufgeführt wurde. — Sobald sich an den Königen Spuren schlechter Gesundheit oder hohes Alter bemerkbar machen, fürchtet man, daß dadurch Unglück, wie Mißlingen der Ernte, allgemeine Krankheit, Schwäche des Viehs, über das Volk hereinbrechen könnte. Denn je älter und gebrechlicher ein König wird, um so mehr büßt auch der Geist seines Ahnen an Rüstigkeit ein, und man fürchtet, daß hieraus allgemeines Unglück entstehen könne. Daher tötet man den[S. 76] König, bevor er zu alt wird; sein Geist kann dann sofort auf eine andere, jüngere Persönlichkeit übergehen. Zu diesem Zwecke wurde in früheren Zeiten der König in eine besonders dazu hergerichtete Hütte gebracht, mit ihm eine heiratsfähige Jungfrau (man sagt eine der Töchter seines Bruders), auf deren Schoß er sein Haupt legte; darauf wurde der Eingang zur Hütte fest verschlossen und das Paar dem Hunger und Durst preisgegeben. Einige Monate später öffnete man die Hütte wieder, sammelte die Überreste der beiden in einem Fell und begrub sie in einem besonderen Grabe. Über diesem erstand eine neue Hütte, und diese wurde zu einem Götterschrein. Dieser Brauch soll vor ungefähr fünf Menschenaltern abgekommen sein, wie man sagt wegen der Qualen, die ein König erdulden mußte; dieser, der seine Gefährtin um ein paar Tage überlebte, gab der draußen versammelten Menge den Auftrag, sie dürften unter keinen Umständen seinen Nachfolger auf diese qualvolle Weise so langsam sterben lassen. Eine öffentliche Verkündigung vom Tode eines Königs scheint nicht stattgefunden zu haben; man ließ die Kunde davon ganz allmählich sich verbreiten. Während der so entstehenden Übergangszeit entschieden die mächtigsten Häuptlinge alle kleineren Angelegenheiten, während sie die wichtigeren dem neuen König vorbehielten, der von den Häuptlingen gewählt wurde. — Die Königswahl ist von zahlreichen Förmlichkeiten begleitet. Der neue König wird zunächst in ein Dorf in der Nähe der Hauptstadt Faschoda geleitet, während sich andere Häuptlinge an die nördlichen Grenzen des Reiches begeben und den Priestern eines Schreines im Akurwadorfe mitteilen, sie möchten den heiligen vierbeinigen Schemel und den Nyakang, ein roh geformtes Bildnis des Ahnherrn der Könige, haben. Wenn der Nyakang die Wahl des neuen Fürsten nicht billigt, dann wird nach dem Glauben der Schilluk sein Bildnis so schwer, daß man es nicht von dem Schrein wegnehmen kann. Ist er aber damit einverstanden, dann ziehen die Leute mit dem Schemel und dem Bildnis ab. Sobald sie bei ihrer Rückkehr mit dem neuen König und seinem Gefolge zusammentreffen, entspinnt sich ein Scheinkampf, der für jene stets glücklich abläuft. Darauf begleiten sie den König nach Faschoda. Hier wird der heilige Gegenstand, der Nyakang, in den dortigen Schrein getragen, bald darauf aber wieder herausgebracht und auf dem heiligen Schemel vor dem Eingange niedergesetzt. Der neuerwählte König hält ein Bein des Nyakang, ein vornehmer Häuptling das andere. Ein Ochse wird geschlachtet, doch genießen nur ein paar Auserwählte von seinem Fleisch. Der Nyakang wird schließlich wieder in den Schrein zurückgebracht, der König hochgehoben und auf den Schemel gesetzt; hier bleibt er eine Zeitlang sitzen, manchmal bis Sonnenuntergang, worauf man ihn zu drei neuen, für ihn besonders erbauten Hütten führt. Hier muß er drei Tage lang verharren, erst dann[S. 77] geleitet man ihn in aller Ruhe zu seinem königlichen Wohnort in Faschoda. Nachdem noch einmal ein Ochse getötet und verspeist worden ist, darf der König endlich zum ersten Male öffentlich erscheinen. Die drei neuen Hütten werden zerstört und ihre Bestandteile in den Fluß geworfen.
Die Bari sind in Gruppen eingeteilt, jede von ihnen besitzt einen Häuptling, der als das Oberhaupt in gemeinsamen Angelegenheiten anerkannt wird. Er ist gleichzeitig auch Regenmacher und erfreut sich großen Ansehens, solange ihm der Glaube entgegengebracht wird, daß er imstande sei, den Regen zur rechten Zeit herbeizuführen. Gelingt ihm dies aber nicht, so besteht oder bestand wenigstens früher für ihn die Möglichkeit, daß er umgebracht wurde. Die Regenmacher legen ihre Dörfer stets auf den Abhängen von ziemlich hohen Hügeln an, damit sie den Regen leichter anziehen können, denn erfahrungsgemäß schlägt sich die Feuchtigkeit aus den Wolken am ersten auf Bergen nieder. Zu Anfang dieses Jahrhunderts stand im Ruf eines Hauptregenmachers ein gewisser Ledju; ihm wurden auch noch andere Fähigkeiten zugesprochen: so glaubte man von ihm, er könne veranlassen, daß Frauen reichen Kindersegen bekämen, sobald er ein kurzes Spiel mit einem kleinen Eisenstab über ihnen vollzog. Diesen Stab bewegte er unter Zaubergemurmel über ihren Köpfen, wobei die Steine in den Kugeln an seinem Ende klapperten.


Zur Vollziehung der Regenzeremonie werden von den Bari hauptsächlich ausgehöhlte Gneisblöcke benutzt, die mit einem der unter den Negern üblichen Wetzsteine Ähnlichkeit haben. Sie werden in einer kleinen Umfriedigung aufgestellt; jeder von ihnen enthält in Aushöhlungen zwei bis acht Stücke Bergkristall oder Granit von Kegel- oder Kreisform. In der Nähe der Steine steht eine größere Anzahl irdener Töpfe; schließlich werden über die hohlen Steine noch viele Eisenstäbe von verschiedener Größe und Form gelegt (Abb. 99). Die Bitte um Regen wird dem Regenmacher für gewöhnlich durch das Dorfoberhaupt und einige Dorfälteste vorgetragen; dazu[S. 78] bringen sie ein Geschenk mit in Gestalt von Hühnern, Schafen oder Ziegen, je nach den vorhandenen Mitteln. Eines oder mehrere dieser Tiere werden getötet und gemeinsam verzehrt, wobei die Regenmacher den Löwenanteil erhalten. Nach der Mahlzeit begeben sich die Hilfsregenmacher zur Umfriedigung, entfernen die Eisenstäbe und lehnen sie gegen eine darüber ausgespannte Schnur. Darauf waschen sie die kleinen Steine und Kristalle mit Wasser aus den Töpfen und legen sie wieder in die ausgehöhlten Steine. Jeder Gehilfe hat seine eigenen Steine, die seiner besonderen Obhut unterstellt und ihm mit Namen bekannt sind; gewöhnlich sind dies Namen früherer Regenmacher. Jetzt findet sich der Hauptregenmacher ein mit einem kleinen Topf voll Fett oder Pflanzenöl. Nachdem er niedergehockt ist, gießt er sich etwas davon in die Hände, reibt die Flächen gegen einander, nimmt die Kristalle und kleinen Steine nacheinander aus ihren Löchern und reibt sie mit Öl ein, indem er singt oder etwas vor sich hin murmelt; dies ist die Bitte um Regen für die Ernte. Er ergreift auch einen der Eisenstäbe, deutet damit in die Richtung der Regenwolke, die er anziehen möchte, und bewegt die Arme auf und nieder, wodurch er die Wolke auf sich niederzuziehen vermeint. Will sie nicht kommen, dann nimmt er den Stab wie ein Krieger, stampft damit mehrmals auf den Boden, macht heftige Gebärden und stößt mit lauter Stimme seltsame Worte aus. Die Eingeborenen setzen sehr großes Vertrauen in das Können des Regenmachers während der Regenzeit. Gelingt es ihm aber nicht, es zu rechtfertigen, dann ist unter Umständen sein Leben bedroht und er kann genötigt sein, die Gegend zu verlassen. Die Regensteine werden als etwas Heiliges angesehen und vererben sich von Geschlecht zu Geschlecht. Jeder Regenmacher besitzt auch einen geweihten Speer, der in einer besonderen[S. 79] Hütte aufbewahrt, aber nur herausgenommen wird, wenn ein Bündnis geschlossen werden soll. Bevor er wieder in sein Heim zurückgeführt wird, muß ein Opfer dargebracht werden. — Bei den Nuba Kordofans, die ähnliche Maßnahmen zur Erzeugung von Regen kennen, wird dieser Speer aus seinem Aufbewahrungsort herausgenommen, um das Tier zu töten, das bei der Feierlichkeit geopfert werden soll.


Die religiösen Verhältnisse der nilotischen Stämme sind im vorstehenden bereits gestreift worden. Es wäre darüber etwa noch folgendes nachzutragen. Die Dinka gelten für sehr religiös. Sie beten ein höchstes Wesen an unter der Bezeichnung Dengdit, das ist „großer Regen“, oder auch Nyalich, das ist „der in der Höhe“, außerdem aber eine ganze Schar von Ahnengeistern, die sie Jok nennen. Dengdit aber gilt für den obersten Gott, den Schöpfer und Erhalter der Dinge im Weltall; er ist es auch, der Regen sendet aus dem „Regenort“, wo seine besondere Heimat liegt. In den gewöhnlichen Lagen des täglichen Lebens werden jedoch die Jok häufiger angerufen als Dengdit.
Unter den Dinka steht das Totemwesen in großer Blüte. Jeder Stamm zerfällt in eine Anzahl Klane, von denen wieder jeder sein bestimmtes Totemtier, manchmal auch eine bestimmte Totempflanze besitzt. Der Klan sieht in dem Totemtier seinen Ahn, das heißt er leitet seine[S. 80] Abstammung von einem Menschen ab, der als Zwillingsbruder des Tieres geboren wurde. Kein Mann darf sein Totemtier verletzen, muß ihm vielmehr die höchste Ehrerbietung entgegenbringen. Wenngleich die Kinder das Totem ihres Vaters übernehmen, so achten sie doch das ihrer Mutter nicht minder hoch, und dies noch mehrere Menschenalter hindurch. So würde ein Mann, dessen Großmutter väterlicherseits eine giftige Schlange als Totemtier besaß, falls er sähe, daß jemand eine Schlange aus dieser Gattung tötete, diese aus Achtung begraben, denn sie ist der Jok (Geist) der Mutter seines Vaters. Ferner wird ein Mann niemals das Totemtier seiner Frau, und umgekehrt nie eine Frau das ihres Mannes verzehren. Über die Entstehung der Toteme sind mancherlei Geschichten im Umlauf. Die Schlangenmenschen erzählen, daß früher einmal eine Schlange in die Hütte eines Mannes gekommen sei und dort ihre Jungen zur Welt gebracht, darauf den Besitzer der Hütte angeredet und ihm gesagt habe, er dürfe weder sie noch ihre Brut verletzen und müsse, falls von anderer Seite ein Tier ihrer Art getötet würde, wie beim Tode eines Verwandten ein Trauerband aus einem Palmenblatt um sein Haupt binden. Ein anderer Mann vom Schlangentotem berichtete, daß er, wenn er einer Schlange im Walde begegnete, ihr als Zeichen der Freundschaft Staub auf den Rücken streuen würde; damit würde er die Schlange versöhnen, im Falle sie ihm böse gesinnt wäre. Sollte sie sich aber nicht besänftigen lassen und ihn etwa beißen, dann würden beide, er und die Schlange, sterben. Umgekehrt: sollte die Schlange einen Mann mit einem anderen Totem beißen, dann würde dieser wohl davon sterben, die Schlange aber am Leben bleiben. Ein Mann aus dem Löwenklan behauptete allen Ernstes, daß ihm von seiten dieses Tieres keinerlei Gefahr drohe, daß er ungestraft im Freien schlafen könne, während die Leute anderer Klane ihre Hütten vor den Angriffen der Löwen schützen müßten. Sollte ein Löwe infolge eines Splitters in der Pfote oder eines Knochens[S. 81] im Halse Schmerzen empfinden, dann würde er die Hütte des Mannes aufsuchen und sich durch Brüllen bemerkbar machen, um von seinen Qualen Befreiung zu finden. Andere Klane erkennen das Krokodil, den Elefanten, die Hyäne, den Fuchs, das Nilpferd und so weiter als Totem an und berichten über die Art, wie sie zu ihren Totemen gekommen sind, ähnliche Geschichten, wie wir sie oben von den Schlangen hörten. Auch Pflanzentoteme scheinen vorhanden zu sein, diese aber kommen seltener vor und haben weniger Bedeutung. Es gibt auch einen Klan, der den Fluß als sein Totem betrachtet. Als Erklärung hierfür erzählen seine Anhänger folgende Sage. Ein schönes junges Mädchen sei vor langer Zeit vom Wasser ans Ufer gebracht worden. Einige Männer, die dies beobachteten, wollten es ins Dorf bringen; sobald sie es aber anzurühren versuchten, wurde das Mädchen flüssig wie Wasser und verschwand im Flusse; es nahm auch ein Kalb mit. Dieser Klan führt alljährlich, wenn die Regenzeit vorüber ist, eine Kuh mit ihrem Kalb und einen Ochsen zum Fluß, tötet den letzteren am Ufer und wirft ihn samt der lebenden Kuh und dem Kalb als Opfergabe in den Fluß.

Trotz der großen Ehrfurcht, die den Totemtieren von den Dinka erwiesen wird, kann man nicht behaupten, daß sie solche regelrecht anbeten. Es scheint, daß man die Totemtiere vielfach mit den Ahnengeistern, den Jok, zusammenwirft, deren Kultus besonders entwickelt ist. Daher mag es kommen, daß man den Totemtieren gelegentlich wohl auch Opfer darbringt. In einem Dorfe befindet sich ein Schrein, der aus dem Stamm eines kleinen Baumes angefertigt und in die Erde geschlagen ist; ein Stück Wirbelsäule und die Hörner einer Ziege hängen an seinen Ästestümpfen, desgleichen ein paar Enden Tau und mehrere kleine Kürbisse, während Knochenreste[S. 82] vom Nilpferd am Fuß des Stammes aufgestapelt liegen. Dieser Schrein ist nach Seligmann folgendermaßen entstanden. Als vor ungefähr vier Jahren die Kinder des Dorfoberhauptes erkrankten und nicht besser wurden, erschien nach einigen Monaten der Geist des Ahnen, der die Krankheit gesandt hatte, einem Manne im Traum und forderte eine Ziege. Dieser trug dem Vater auf, er solle einen Pfosten einschlagen und einen fetten Ziegenbock opfern. Der Stamm wurde hergerichtet und ein Loch gegraben, darauf die Ziege geschlachtet und das Blut wie auch der Inhalt des Darmes in das Loch geschüttet, darauf der Pfosten in dasselbe hineingestampft. Das Fleisch der Ziege aß man, ihre Knochen mit Ausnahme der Wirbelsäule und der Hörner, die man an dem Stamme aufhängte, zerbrach man und warf sie zusammen mit einem eisernen Armband in den Fluß, weil der Vater des Ahnen, der die betreffende Krankheit geschickt hatte, der Zwillingsbruder eines bestimmten Fisches war; damit sollte er beschwichtigt werden. Nachdem noch Fleischstücke in die vier Himmelsrichtungen geworfen worden waren, wurden solche auch auf die Erde vor den Baumstamm gelegt und folgendes Gebet gesprochen: „O mein Großvater, ich habe dir ein Opfer gebracht; laß meine Kinder nicht länger krank sein.“

Eine besondere Art von Götterschrein pflegt eine Dinkawitwe zu Ehren und zur Versöhnung ihres Gatten aufzustellen. In die Erde werden ein paar Ochsenhörner eingepflanzt und über der Stelle ein kleiner runder Erdhügel geformt, aus dem die Hörner hervorragen; für gewöhnlich steckt man noch einen Stock oder einen jungen Schößling in den Hügel, hängt an den Hörnern auch wohl einen Viehstrick auf. Die Ochsen dazu stellen die Söhne; wie sie auch den Schrein selbst für die Mutter herrichten.


Ein großer und mächtiger Ahnengeist ist Lerpiu; er soll bereits seit acht Menschenaltern in dem jedesmaligen Regenmacher sich verkörpert haben und augenblicklich von Biyordit, dem Regenmacher des Vorstammes, Besitz ergriffen haben. Man betet ihn in einer Hütte an, die seinen Heiligenschrein vorstellt (Abb. 102). In ihr bewahrt man einen besonders heiligen Speer auf, und draußen am Pfosten vor ihr hat man die Hörner vieler Ochsen, die dem Lerpiu geopfert wurden, aufgehängt; hinter der Hütte endlich steht noch ein geweihter Strauch, in dem die Jok während der großen Zeremonie des Regenmachens verweilen sollen. Diese Zeremonie, die im Frühjahr, ein paar Tage nach Neumond, abgehalten wird, besteht in einem Opfer an Lerpiu, damit dieser Dengdit bewege, Regen zu senden. Zwei Ochsen werden morgens zum Schrein geführt, worauf Biyordit sie an die Pfosten bindet und sämtliche Männer, Frauen, Knaben und Mädchen unter Trommelbegleitung um den Schrein herumtanzen. Nach einiger Zeit verlassen ihn alle mit Ausnahme der alten Leute. Biyordit spießt die Ochsen auf und schneidet ihnen die Kehle durch; während das Opfer zubereitet wird, singen die alten Leute: „Lerpiu, unser Vorfahr, wir haben dir ein Opfer gebracht; sei so gut und laß Regen fallen.“ Das Blut des einen Tieres wird in einem Kürbis aufgefangen, gekocht und von den angesehenen alten Männern des Klans genossen. Etwas von dem Fleisch, das mit sehr viel Fett gekocht wurde,[S. 86] bleibt ein paar Monate in der Nähe des heiligen Busches für die Jok übrig und wird schließlich von denjenigen aufgezehrt, die kein eigenes Vieh besitzen. Das Fleisch des anderen Ochsen wird sofort ganz verzehrt; seine Knochen werden fortgeworfen, die Hörner aber zu denen, die bereits den Pfosten zieren, hinzugefügt.


Bei den Schilluk erfreut sich großer Verehrung Nyakang, wie wir bereits hörten. Nyakang war ihr erster König, ein halbgöttliches Wesen, insofern er wohl Gestalt und sonstige Eigenschaften eines Menschen hatte, aber niemals starb, sondern verschwand und als Geist in seinen Nachkommen, den Königen, die ihm folgten, weiterlebt. Seit seinem Fortgang spielt er die Vermittlerrolle zwischen den Menschen und dem höchsten Gotte Jüok, der als gestaltlos und unsichtbar sich überall befindet, die Menschen erschaffen hat und für die Ordnung im ganzen Weltall sorgt. Dieser steht so hoch, daß er nur durch Nyakang, seinen Vertreter, mit Bitten angegangen werden kann. Dem Nyakang werden Opfer dargebracht, auf daß er den Gott Jüok bestimme, er möge den Menschen Regen und andere Wohltaten senden.
Die Schilluk scheinen auch zu glauben, daß die Geister der Abgeschiedenen überall gegenwärtig seien und manchmal ihren Hinterbliebenen im Traume erscheinen, um ihnen zu helfen und guten Rat zu erteilen. Jedoch darf man daraus nicht schließen, daß bei den Schilluk deswegen eine Totenverehrung bestehe. Ihre ganze Religion gipfelt eben nur in dem Kult des Nyakang, des halbgöttlichen Vorfahren der Könige. Diese Verehrung hat nun viele Schreine entstehen lassen (Abb. 101 u. 105). Nyakang besitzt deren nicht weniger als zehn, die alle Gräber heißen, obgleich man weiß, daß niemand darunter begraben liegt. Sie unterscheiden sich in ihrem Äußeren nicht von den Schreinen der anderen Schillukkönige, die wirkliche Grabstätten sind; an diesen, namentlich aber an den Schreinen des Nyakang werden Feierlichkeiten abgehalten.


Die Nuba (Abb. 104, 107 und 109) des nördlichen Kordofan haben bereits den Islam angenommen; die Hügelbewohner des südlichen Teiles dieser Provinz dagegen halten[S. 87] noch ziemlich an ihrer alten Religion fest. Trotzdem finden sich unter ihnen vielfach schon Gräber orthodoxer Scheiche oder heiliger Männer (Abb. 110). Es sind dies eirunde, mit Haferbrei bestrichene Steine, die man mit Opfergaben umgibt. Im übrigen haben die südlichen Nuba noch manche ihrer alten Gewohnheiten und abergläubischen Gebräuche bewahrt. So ruhen sich die Frauen auf ihrer Reise aus, indem sie sich an gewisse freiliegende Steinmassen anlehnen, die Soba genannt werden (Abb. 83), vielleicht nach der Königin Saba, die einst hier regiert haben soll, vielleicht auch in Erinnerung an Soba, die Hauptstadt des alten christlichen Königreichs Alloa, deren Überreste man noch an den Ufern des Blauen Nils, etwas südlich von Khartum, antrifft. Eine große Rolle im Leben dieser Nuba wie der Sudanneger überhaupt spielt der Ringkampf (Abb. 111, 112, 113). Männer und Weiber liegen ihm ob, die ersteren etwa so lange, bis sie mehrere Kinder haben, die letzteren bis zu ihrer Verheiratung. Zu seiner Ausübung ist große Geschicklichkeit und Kraft erforderlich; die stärksten und besten Kämpfer erfreuen sich daher auch der Bewunderung des anderen Geschlechts. Die männlichen Wettkämpfer gehen nackt bis auf einen Gürtel, der mit Federbüscheln und Schafschwänzen behangen ist. Der Geschlagene muß einmal mit beiden Füßen zugleich in die Luft springen, der Sieger wird, von seinen Freunden umgeben, mit Holzasche besprengt und mit biegsamen Stöcken leicht geschlagen, angeblich um ihn dadurch zu kräftigen und Krankheit zu verhüten. Den Wettkämpfen der jungen Mädchen zuzusehen, ist den Jünglingen nicht gestattet; jedoch kommt es öfters vor, daß sie dies von einem Felsen oder einem Baume aus in einiger Entfernung tun. Die Siegerinnen finden natürlich die meiste Gunst in ihren Augen. Vor Beginn des Ringkampfes knien die Mädchen, nur mit einem Blättergürtel bekleidet, in zwei[S. 88] Reihen, das Gesicht einander zugekehrt, nieder. Eine alte Frau eröffnet den Kampf, indem sie aus jeder Reihe ein junges Mädchen vorführt, die nun regelrecht miteinander ringen. Jede von beiden schlingt die Hände um den Rücken der Gegnerin, verschränkt die Finger ineinander und versucht unter heftiger Anstrengung die andere zu Fall zu bringen. Die Niedergeworfene steht ohne ein Wort zu sagen auf und tritt in ihre Reihe zurück, die Siegerin dagegen wird von ihrer Partei mit lautem Geschrei begrüßt und mit Gesang und Tanz gefeiert. Tänze und Spiele sind überhaupt bei den Niloten sehr beliebt.

Über besondere Gewohnheiten der Nilotenfrauen (Abbild. 114 und 115) aus Anlaß von Schwangerschaft, Niederkunft und Wochenbett wissen wir so gut wie nichts. Die Nubaweiber in den südlichen Bergen Kordofans tragen auf dem Kopfe einen Stein (Abb. 106), um in andere Umstände zu kommen.
Ebensowenig ist uns etwas Näheres über die Kindheit und Erziehung dieser Stämme bekannt. Bei den Dinka geht die Namengebung ohne besondere Förmlichkeiten vor sich. Der erste Knabe wird gewöhnlich nach dem Großvater väterlicherseits, entsprechend das erste Mädchen nach der Großmutter genannt. Spätere Kinder kann man nach den Namen der Kühe benennen, die für den Brautpreis der Mutter gezahlt wurden. Die Dinka formen als Spielzeug für ihre Kleinen ungeschlachte Lehmfiguren, die Rinder vorstellen, ein deutlicher Beweis für die große Wichtigkeit, die sie der Viehzucht beimessen.
Aufnahmezeremonien scheinen zu fehlen, aber alle Dinka und auch Schilluk lassen ihren Kindern die unteren Schneidezähne ausbrechen. Hübsch ist der Zug dieser Stämme, daß sie alle Knaben, die sich zu derselben Zeit der Prozedur unterworfen haben, als Gefährten ansehen und es ihnen zur Pflicht machen, sich gegenseitig das ganze Leben lang beizustehen. Den Prinzen bei den Schilluk dagegen läßt man die Zähne stehen, wohl in dem Gedanken, dadurch jene Sitte, die alle Menschen gleich macht, zu umgehen und den Unterschied zwischen einem Königsohn und dem gewöhnlichen Volke zum Ausdruck zu bringen.


Unter allen Stämmen ist es üblich, die Braut zu kaufen; der Brautpreis besteht fast nur aus Vieh und beträgt bei den Dinka etwa zehn Kühe. Je reicher ein Mann ist, um so mehr Frauen kann er sich leisten; daher findet man die meisten Frauen auch bei den ältesten Männern, was vielfach zu [S. 90]ehelicher Untreue führt. Während der Verlobung bleibt das junge Dinkamädchen so lange im Hause ihrer Mutter, bis der Brautpreis von ihrem Zukünftigen voll ausgezahlt ist. Nach Erledigung dieses Geschäftes stiftet der Vater des Mädchens einen Ochsen, der geschlachtet und verzehrt wird; auch ein Tanz findet aus diesem Anlaß statt. Abends wird die Braut in das Haus der Mutter des Bräutigams geführt. Dieser schlachtet nun gleichfalls einen Ochsen und bestreicht mit dem Inhalt des Dickdarms Brust und Schultern des Mädchens. Damit scheint der Hochzeitszeremonie Genüge geschehen zu sein.



Bei den mehr arabisierten Kababisch kommen häufig auch Kinderverlobungen vor. Die Eltern des Knaben schicken denen des Mädchens in diesem Falle Geschenke, und beide Teile warten ab, bis ihre Kinder das erforderliche Alter erreicht haben. Ist dieser Zeitpunkt eingetreten, so setzt der Feki, ein Mann, der im Rufe eines Heiligen steht, einen bestimmten Tag für die Hochzeit fest. Alle Vereinbarungen bezüglich der Heirat machen die beiderseitigen Väter untereinander ab, dagegen wird der Brautpreis nur an die Mutter ausgehändigt. Ein Mann würde es für unter seiner Würde halten, diesen anzunehmen. Ein begüterter Kababisch läßt vor die Türe seiner Braut zwei bis drei weibliche Kamele führen und schlachtet diese am anderen Morgen. Die Mutter der Braut und die des Bräutigams bekommen jede ein besonderes Stück des Fleisches, der Rest wird für die Hochzeitsgäste aufgehoben. Darauf bauen die Angehörigen des Mädchens in ihrem Dorf ein kleines Zelt, in dem der Bräutigam sechs Tage lang wohnen muß; währenddessen versorgt ihn seine zukünftige Schwiegermutter mit Speise. Am siebenten Tage wird ein vorläufiges Zelt in der Nähe errichtet, in das Angehörige der Braut diese geleiten. Dabei wird von den Frauen getanzt und gesungen. Der Bräutigam[S. 91] reitet auf dem besten Pferde, das er sich beschaffen konnte, auf dieses Zelt zu, weigert sich aber nach seiner Ankunft, von seinem Roß zu steigen, bis der Vater ihm ein Geschenk versprochen hat, das bei einem Minderbemittelten meistens aus zehn bis fünfzehn Schafen besteht, dagegen aus fünf bis hundert weiblichen Kamelen, wenn es sich um einen wohlhabenderen Mann handelt. Nach Vereinbarung dieses Geschenkes steigt der Bräutigam ab und betritt das Zelt[S. 93] in Begleitung eines kleinen Knaben, der sein Schwert trägt. Die Braut tritt jetzt heraus, wird dreimal um das Zelt herumgeführt und kehrt dann in Begleitung einer Wärterin in dasselbe zurück. Diese vier Menschen verweilen nun eine Zeitlang darin, wobei Bräutigam und Braut kein Wort sprechen dürfen. Darauf wird letztere wieder in das Zelt ihrer Mutter zurückgeführt, während sich der angehende Ehemann sieben weitere Tage in dem nämlichen Zelt aufhalten muß. Mittlerweile bauen die Angehörigen der Braut ein bleibendes Zelt an der Stelle des vorläufigen und statten es mit allerlei Gegenständen aus dem Haushalte der Brautmutter aus. Der Bräutigam stiftet ein Stück Vieh, das vor dem Eingang zum Zelt getötet wird, worauf er sich hineinbegibt und die Ankunft der Braut erwartet, die reichgeschmückt, von den Frauen begleitet, erscheint. Wenn sie die Schwelle überschritten hat, enthüllt der Bräutigam dreimal ihr Gesicht, das sie jedesmal wieder von neuem bedeckt, dann faßt er unter ihr Gewand, reißt ihr den mit Lederfransen besetzten Gürtel ab und wirft ihn auf einen Baumzweig, der vor dem Zelt in die Erde gestoßen ist; währenddessen ruft das draußen stehende Volk dem Paare allerhand gute Wünsche entgegen.




In dieser Nacht bleibt das junge Paar endlich zum ersten Male allein. Es bleibt dort eine ziemliche Zeit lang wohnen, die zwischen einem Monat bis zu zwei Jahren schwankt; darauf siedelt es in das Zelt über, das seither den Eltern des Bräutigams gehört hatte, wo dann das junge Paar für immer Wohnung nimmt, während die Alten sich ein neues Zelt herrichten.
[S. 94]

Das Kongobecken, der äquatoriale Teil Westafrikas, wird in der Hauptsache von Bantustämmen bewohnt, zwischen die eingesprengt sich vielfach noch mehr oder minder zahlreiche Pygmäen- oder Zwergstämme finden, wahrscheinlich die Überreste der Urbevölkerung, die einst ganz Mittel- und Südafrika eingenommen haben dürfte.
Von der Körperbeschaffenheit der Pygmäen war bereits an anderer Stelle die Rede, so daß wir hier nicht weiter darauf einzugehen brauchen. Nur ein paar Worte über ihre heutige Verbreitung mögen hier folgen. Der südlichsten Ausläufer dieser Rasse, der Buschmänner, gedachten wir ausführlicher schon oben. Weiter nördlich sitzen in den Urwäldern von Kamerun die Badjeri oder Bojaeli, die Bekerelle und die Bako, im Hinterlande der Loangoküste die Bakke-Bakke, Dongo und Obongo. Von der Westküste aus verbreiten sich die Zwergvölker über das Kongobecken hinaus in zum Teil zahlreichen Trupps (Bakoa, Batua, Bopoto und so weiter) bis zu den großen ostafrikanischen Seen hin, wo sie ihre größte Dichtigkeit zu erreichen scheinen. Man kennt sie hier unter den Namen der Tiki-Tiki, Akka, Wambutti, Ewé, Ituri, Batwa und anderer mehr. Teilweise sind sie bereits Kreuzungen mit den hochwüchsigen Nachbarnegern eingegangen.
[S. 95]

Die zentralafrikanischen Zwergvölker gehen zumeist gänzlich unbekleidet (Abb. 119), nur vereinzelt legen sie sich Streifen Rindenstoffes oder Blätter um die Hüften. Beachtenswert ist das gänzliche Fehlen von Schmuck bei ihnen. Tatauierung und Körperbemalung kennen sie auch nicht, ebensowenig sonstige Verschönerung beziehungsweise Verunstaltung des Körpers. Wo sich etwa solcher Schmuck findet, scheint er fremden Ursprungs zu sein. Die Pygmäen wohnen in den dichten, fast unzugänglichen Urwäldern und erwerben sich ihren Lebensunterhalt durch Jagd. Dabei bekunden sie eine bewunderungswerte Schnelligkeit und Gewandtheit, eine große Sicherheit im Gebrauch ihrer einfachen Waffen, eine ziemliche Erfindungsgabe, das Wild mit Fallen und Schlingen zu umstellen, und eine auffallende Unerschrockenheit den großen Tieren, wie Elefanten, Nashörnern und Löwen, gegenüber, denen sie tapfer zu Leibe gehen. Ihre Waffen bestehen nur aus Bogen und Pfeilen (Abb. 117). Die letzteren sind mit Holz- oder Knochenspitzen ausgestattet, jedoch kommen vielfach auch schon eiserne Pfeilspitzen vor, die aber als Entlehnung von den Nachbarvölkern anzusehen sind. Gleichfalls infolge von Berührung mit fremden Völkern sind sie heutzutage auch schon größtenteils in den Besitz von Speeren gelangt. Gegen die Erträge ihrer Jagd pflegen die Pygmäen verschiedentlich auf dem Wege des stillschweigenden Tauschverkehrs die Erzeugnisse des Ackerbaus von ihren[S. 96] hochwüchsigen Nachbarn einzuhandeln. Sie selbst betreiben keine Ackerwirtschaft. Ihrer umherziehenden Lebensweise entsprechen auch ihre Wohnungen, entweder einfache Windschirme oder primitive halbrunde Hütten (Abb. 118), die ihnen nur zum Schlafen dienen. Das Feuer erzeugen sie durch Quirlen mit einem senkrecht stehenden härteren Holzstabe in einem weicheren wagerecht liegenden Holz oder auch durch Aneinanderschlagen zweier Kiesel.

Über die sittlichen Anschauungen der Pygmäen wissen wir herzlich wenig. Es hat den Anschein, als ob dieselben nicht auf so niederer Stufe stehen, wie die der sie umgebenden hochgewachsenen Stämme.
Die Religion der zentralafrikanischen Pygmäenstämme kennt ein höchstes, im Himmel wohnendes Wesen, bald Waka, bald Nzambi oder Indagarra von ihnen genannt, das Herr über alles ist und auch als Schöpfer der ganzen Welt angesehen zu werden scheint. In seiner Hand ruht auch das Geschick der Menschen. Daher sind diese bestrebt, jenes Wesen durch Opfer günstig zu stimmen. Wird ein erjagtes Tier zerlegt, so erhält Waka das beste Stück; es wird auf dem Feuer verbrannt. Es wurde beobachtet, daß die Pygmäen bei ihren gemeinsamen Mahlzeiten von ihrem persönlichen Anteil ein Stückchen beiseite legten als Opfer für ihren höchsten Gott. Findet jemand im Walde Honig, so nimmt er nicht eher davon, als bis er ein wenig in den Wald und nach dem Himmel zu geworfen hat. Trinkt er Palmwein, so gießt er zuvor etwas [S. 97]auf die Erde. Dabei wird Waka angerufen und ihm gesagt, daß er seinen Anteil erhalte, wofür aber auch erwartet werde, daß er dem Spender Kraft und Gesundheit verleihe und seine Kinder vor Unheil bewahre. Beim Einsammeln der Nkulanüsse bringen gewisse Pygmäenstämme ihrem Gott Nzambi ähnliche Erstlingsopfer dar. Man pflückt eine schlechte und eine gute Nuß ab, wobei derjenige, der sie vom Baume herunterholt, mit dem Kopfe nach unten herunterklettern muß, legt sie beide in ein Loch unter dem Herde und zündet auf diesem ein neues Feuer durch Quirlen an. Um dieses tanzt man schließlich und singt dem Gotte Dankeslieder. — Fetische kennen die Pygmäen nicht, auch Zauberei und Priestertum gibt es unter ihnen nicht. Das einzige, das an Aberglauben erinnert, sind gewisse Mittel, mit denen sie sich ihr Jagdglück zu sichern suchen.


Die übliche Eheform der Pygmäen soll die Einehe sein; mehr als eine Frau legt man sich bei den Zwergvölkern selten zu. Von einigen Stämmen wird berichtet, daß die Mädchen sich frei nach ihrer Wahl den Mann suchen, aber auch wieder, daß dieser den Eltern seiner Erkorenen eine Gabe darzubringen pflegt, wohl als Entschädigung für den Verlust ihrer Tochter. Überbleibsel des Frauenraubs sollen bei der Hochzeit vorkommen. Wenn der Bräutigam sich zur Verehelichung einfindet, dann trifft er die Braut im Hause ihrer Eltern nicht an, sondern muß sie im Walde, wo sie sich versteckt hat, suchen. Von weiteren Förmlichkeiten ist nichts bekannt.
Ebensowenig werden besondere Feierlichkeiten bei Todesfällen abgehalten. Im allgemeinen begräbt man den Toten einfach in einem Loche. Die Batua geben ihm noch gewisse Zauberpflanzen mit ins Grab, die es ihm ermöglichen sollen, an denjenigen Rache zu üben, die seinen Tod verschuldeten. Andere Stämme legen neben den Verstorbenen Bogen und Pfeile. Beisetzungsfeierlichkeiten werden nicht veranstaltet; auch eine Trauer um den Toten gibt es nicht. Manche Stämme verlassen den Platz, wo sie den Verstorbenen beisetzten, und ziehen weiter. Der Grund hierfür dürfte in der Furcht vor der Wiederkehr des Toten zu suchen sein. Im großen und ganzen kennt man indessen bei ihnen meistens keine Geister- oder Ahnenverehrung. Nur die Batua glauben noch an ein Wiedererscheinen der Verstorbenen, die ihnen dann im Schlafe ihre Wünsche aussprechen[S. 98] sollen. Sie errichten auch kleine Hütten und stellen in ihnen Speise und Trank für die Verstorbenen auf.
Die hochwüchsigen Neger Zentralafrikas sind Bantu. Ihre körperliche Beschaffenheit (Abb. 121, 123 und 136), Kleidung (Abb. 127), Art, den Körper zu schmücken beziehungsweise zu verunstalten (Abb. 122, 124, 126, 129, 130, 131 und 144), Wohnung (Abb. 120) und Lebensweise sind im allgemeinen dieselben wie die der übrigen Bantu, weswegen wir an dieser Steile hierauf nicht einzugehen brauchen. Dagegen haben sie in mancher Hinsicht andere Sitten und Gebräuche.



Unter den Kongostämmen begegnen wir wie in Westafrika den verschiedensten Geheimbünden (siehe die farbige Kunstbeilage). Am Unterlauf des Kongo ist der verbreitetste der Nsi a Fwa, das heißt „Land des Totenbundes“. Wenn in dieser Gegend eine Krankheit allgemein auftritt oder die Geburtenziffer sehr herabgeht, dann gründet ein Hexendoktor eine Loge zur Aufnahme so vieler Personen jeglichen Geschlechts und Alters, als dem Bunde beizutreten wünschen. Die Aufnahme Begehrenden verfallen auf den Märkten oder auf der Straße in eine Art Starrkrampf und werden in die Loge getragen; hier bleiben sie monatelang bis zu zwei oder auch drei Jahren. Die Loge liegt in einem dichten Teil des Busches und bleibt so lange bestehen, wie sie sich für den Doktor und seine Helfershelfer bezahlt macht. Es heißt von den Mitgliedern des Bundes, ihr Körper zersetze sich bis zu dem Grade, daß nur ein einziger Knochen von einem jeden Menschen übrigbleibe. Die Familien der „Toten“ bringen täglich große Mengen Eßwaren hin und legen sie draußen vor der Loge nieder, damit der Doktor und seine Gehilfen die nötige Kraft bekommen, die Gebeine der Toten zu wenden. Die Mitglieder des Bundes gehen in der Loge nackend umher und tanzen viel; zur Begleitung dient ihnen nur ein Saiteninstrument, keine Trommeln. Da dieser Geheimbund die Brutstätte großer Unzüchtigkeit ist, wird er von den einheimischen Häuptlingen in manchen Teilen des Landes verboten. — Ein anderer Bund heißt Nkimbo (Abb. 116); in ihn dürfen nur Männer aufgenommen werden. Die Mitglieder reiben sich mit weißem Pfeifenton ein und tragen krinolinenartige Gewänder aus Gras oder aus Palmfasern. In dieser gespenstischen Tracht ängstigen sie unter einem seltsam trillernden Ruf ihre Mitmenschen, so daß diese ihren Forderungen nach Geld und Speise willig nachkommen. Dieser Bund scheint seinerzeit von Händlern ins Leben gerufen worden zu sein, um sich bei ihren Geschäftsreisen vor den Erpressungen fremder Häuptlinge zu schützen und einander unterwegs geschäftlich behilflich zu sein; mit der Zeit wurde der Bund so stark, daß er sich anmaßte, von vorüberziehenden Karawanen eine Abgabe zu verlangen. Jetzt ist seine Macht im Abblassen begriffen. Die Aufnahmegebühr belief sich auf etwa zehn Schilling Handelsware. Wer diese bezahlt hatte, wurde so lange rund um sich selbst gedreht, bis ihm schwindlig wurde, worauf man ihn bewußtlos in die Loge trug. Hier blieb er, bis er die geheime Sprache des Bundes erlernt hatte. — Ein Geheimbund am Kasai soll die Leichen der Verstorbenen ausgraben und sich im Schutze der Nacht an ihnen gütlich tun. Ihm gehören sowohl Männer wie Frauen an.

[S. 102]
Ein interessantes Gebiet ist die Religion der Kongovölker. In allen Kongosprachen kommt wohl ein Name für ein höheres Wesen vor, aber die Vorstellungen von ihm sind ganz unklar. Es wird als der hauptsächlichste Schöpfer aller Dinge angesehen, gilt für besonders stark, reich und gut, ja für so mild und gütig, daß es niemand etwas zuleide tut. Aus diesem Grunde hält man es auch nicht für nötig, diesem höchsten Wesen Opfer darzubringen oder Gebete an dasselbe zu richten. Dafür aber befassen sich die Eingeborenen um so mehr mit den zahlreichen Geistern, von denen sie sich umgeben glauben. An sie wenden sie sich, wenn sie etwas erreichen wollen, sei es, daß sie den Feinden des Bittenden Schaden zufügen oder diesem selbst Gutes erweisen sollen, was von der Macht des besonderen Fetisches abhängt, den man sich vom Medizinmann kauft. Auch Hexen beunruhigen die Leute, da sie die Macht besitzen, Unglück, Mißlingen ihrer Angelegenheiten, Krankheit und selbst den Tod über sie zu bringen. Gäbe es keine Hexen, keine Geister und keine Fetische, so behaupten die Kongoneger, dann würde es auch keinen Kummer, kein Unglück, keine Krankheit und selbst keinen Tod geben; die Menschen würden ohne Hexen ewig in einer Art Himmel auf Erden leben. Um den Machenschaften der Hexen zu begegnen, gibt es wieder zahlreiche Fetische und Hexendoktoren, denen die Aufgabe zufällt, jene bösen Mächte zu überlisten und die Menschen entweder vor deren Bosheit zu schützen oder diejenigen zu bestrafen, die sich lediglich aus Mutwillen und Bosheit zu Medien für die Verhexung von seiten der Geister hergeben.

Unter den Anwohnern des unteren Kongo gibt es mehr als fünfzig verschiedene Zauberdoktoren[S. 103] (Abb. 128), und jeder Stamm am oberen Kongo besitzt seine eigene, mehr oder weniger zahlreiche Gruppe von solchen. Sie stellen die Fetische her, mit deren Hilfe sich die Menschen vor Hexerei zu schützen und sich Gesundheit und Glück zu erhalten suchen. Manche Hexendoktoren besitzen Fetische, mit denen sie jegliche Krankheit sowohl herbeiführen als auch heilen können; andere wiederum vermögen damit ihre Kunden gegen jede Gefahr zu schützen, die man sich überhaupt denken kann. Manche Fetische verleihen beim Stehlen und Betrügen Glück, und andere wieder schützen den Besitzer vor Dieben; noch andere übertragen eine solche Geschicklichkeit zum Lügen und Stehlen, daß der Besitzer eines solchen Zaubermittels niemals entdeckt werden kann. Auch verspricht der Hexendoktor seinem Kunden, ihn bei anderen Menschen so beliebt zu machen, daß jeder Nachbar sich freundlich zu ihm stellen und ihm bei seinen Unternehmungen hilfreich zur Hand gehen müsse, sei es im geschäftlichen Verkehr oder im Kampf, bei Streitigkeiten oder in Liebesangelegenheiten. Versagt etwa das Mittel, dann liegt dies daran, daß der Gegner ein noch wirksameres Gegenmittel besitzt. Aber auch diesem Übelstand kann der betreffende Hexendoktor abhelfen; sein Kunde braucht nur noch mehr zu zahlen und erhält dafür einen einflußreicheren Fetisch von ihm angefertigt. Auf diese Weise kauft sich mancher an Zaubermitteln und Fetischen wirklich arm und bringt sich an den Bettelstab, nur um die Gebühren des Hexendoktors bezahlen zu können.

Die Fetische (Abb. 125, 132, 133, 134 und 140) sind von mancherlei Gestalt. Jeder Medizinmann oder Hexendoktor besitzt ein Bündel mit Zaubermitteln, von denen er annimmt, daß die Geister mit Vorliebe darin Wohnung nehmen, oder einen Beutel mit Dingen, die sie gern verspeisen. Um den Geistern eine Freude zu bereiten, werden diese Sachen in ein Fetischbildnis[S. 104] getan; dadurch erreicht der Zauberer, daß der Geist sich fortan in dem Fetisch aufhält und daß er ihn unter besonderer Aufsicht hat. Jeder Medizinmann muß einen solchen Fetischbeutel haben. Dieser enthält eine Mischung aller Zaubermittel, die einem bestimmten Geist gegenüber für wirksam gelten; je nach der Krankheit, auf die man ihm Einfluß zuschreibt, ist der Inhalt des Beutels verschieden. Er setzt sich demnach aus allen möglichen Dingen zusammen. Einer, den Doktor Bentley untersuchte, enthielt Federn von der Brust und den Flügeln eines Perlhuhns, zwei kleine Stücke Leopardenfell, einen Hirschkäfer, ein paar Perlen, Eisensteinspäne, einen Skarabäus, zwei kleine Kieselsteine und eine blaue Kalabarbohne. Die meisten Hexendoktoren des unteren Kongo ziehen Fetischgötzen vor, da sie sich bequemer tragen lassen als die Beutel, die oft groß und von ziemlichem Gewicht sind. Das Bildnis ist ein gewöhnliches Stück Holz, das eine grob geschnittene menschliche Person, Mann oder Frau, gelegentlich auch ein Tier darstellt und in seinem Inneren ein Teilchen von jedem Zaubermittel aus dem Fetischbeutel birgt; dadurch erhält es seine Kraft. Wenn nun ein Laie ein Zaubermittel zu kaufen wünscht, dann geht er zu einem Medizinmann, der einen mit den erforderlichen Eigenschaften ausgestatteten Fetisch besitzt, und erwirbt diesen für sich. Hat er die verlangte Gebühr dafür entrichtet, so nimmt der Medizinmann winzige Teilchen von allen Mitteln aus seinem Beutel, mischt sie gründlich und tut sie in ein kleines Horn, eine Muschel oder in einen Götzen; diesen Gegenstand überläßt er dann seinem Kunden. Das Horn wird als Schutzmittel getragen und kostet nicht viel. Die Muschel ist schon teurer, weil sie mehr Wirksamkeit besitzt; ihr Besitzer trägt sie entweder in seinem Schultersack mit sich herum oder läßt sie auch zu Hause, da sie auf jede Entfernung hin für ihn wirksam sein kann. Das teuerste ist aber der Fetischgötze, da er sozusagen die gleichen Fähigkeiten besitzt wie des „Doktors“ Fetischbeutel selbst; ihm wird die Eigenschaft zugeschrieben, er könne alles das bewirken, was sein Besitzer von ihm verlangt.


Am unteren Kongo werden den Fetischen regelmäßig Opfer dargebracht; indessen darf man nicht annehmen, daß diese etwa eine Art Anbetung bedeuten, vielmehr liegt solchem Opfer einfach der Gedanke zugrunde, daß es die Macht in dem Fetischbildnis oder in dem Bündel der Zaubermittel auf irgendeine Weise erneuere, den Fetisch gleichsam auffrische und ihn befähige, sein Amt als Beschützer seines Besitzers, als Strafvollstrecker an dessen Feinden und als Glückspender wirksamer auszuüben. Das Opfer soll auch einen etwa grollenden Fetisch besänftigen, damit er sich für seinen Besitzer aufs neue Mühe gebe. Es besteht darin, daß ein Huhn oder eine Ziege getötet und das Blut über den Fetisch oder das Bündel verspritzt wird; manchmal schneidet man auch einem Huhn oder einem Frosch die Zehe durch und läßt das hervorquellende Blut[S. 106] über den Fetisch tropfen. Soll dem Fetisch seine volle Kraft erhalten bleiben, dann ist es nötig, ihm regelmäßig Opfer darzubringen, das heißt, immer am Neumond oder an bestimmten Markttagen; eine je größere Gefälligkeit man von ihm erwartet, um so wertvoller muß die Gabe ausfallen. Die Stunde des Opfers pflegt der Sonnenuntergang zu sein; der Opfernde muß sein Gesicht der Sonne zukehren. — Schweine werden niemals als Opfer verwendet, weil sie für unreine Tiere gehalten zu werden scheinen.

Will ein Fetisch trotz der regelmäßigen Opfer nicht mehr richtig arbeiten, mit anderen Worten, hat sein Besitzer nur Mißerfolg in den verschiedensten Lebenslagen, dann bringt dieser ihn dem Zauberdoktor, von dem er ihn kaufte, zurück und trägt ihm auf, ihm neue Kraft zu verleihen. Die Maßnahmen, die der Medizinmann in solchem Fall vornimmt, sind verschieden; jeder hat sein besonderes Verfahren. Zumeist wird aber der angeblich unbrauchbar gewordene Fetisch, um ihn neu zu beleben, in folgender Weise behandelt: er wird geschlagen und es wird dabei auf einer Pfeife gepfiffen, um ihn aufzurütteln, oder es wird um ihn herum Schießpulver zur Explosion gebracht und er selbst in den Rauch gehalten.
Theorie und Praxis des Medizinmannes laufen darauf hinaus, entweder einen Menschen durch den Fetisch zu verfluchen, oder den Fetisch zu beruhigen und dadurch einen Fluch hinwegzunehmen. Glaubt jemand, ein bekannter oder unbekannter Feind habe ihm ein Leid zugefügt, und wünscht er, daß diese Person von Krankheit oder Tod betroffen werde, dann geht er zu einem Medizinmann und sucht ihn durch Bezahlung dafür zu gewinnen, daß er jenen Feind durch den Fetisch verfluchen lasse. Der Fetisch wird zu diesem Zweck mit einem Stocke geschlagen, wobei er den Auftrag erhält, dies oder jenes zu tun; darauf wird er dreimal in die Luft gehoben, ebenso oft in die Nähe des Erdbodens gesenkt und schließlich vor dem feindlichen Hause aufgehängt. Man nimmt dann an, daß der in dem Fetisch wohnende Geist nach dem betreffenden Orte hinfliege, um die ihm zuteil gewordenen Befehle auszuführen. Durch das nämliche einfache Verfahren kann jeder Laie seinen Feind verfluchen. Daher kann sich auch jeder, der keinen eigenen Fetisch besitzt, der mächtig genug ist, seinen Haß zu befriedigen, sich aber keine großen Unkosten [S. 108]durch Neubeschaffung eines solchen oder durch Inanspruchnahme eines Medizinmannes machen will, einen starken Fetisch zu einem geringen Preise borgen und durch ihn seinen Feind verfluchen. Der Name des Betreffenden braucht dabei gar nicht ausgesprochen zu werden; es genügt schon, zu sagen: „Der Dieb, der meine Sache stahl,“ oder: „Mein Feind, der mir Unglück sandte,“ oder: „Derjenige, der mich behext hat.“

Bei dieser großen Verbreitung des Zauberwesens im Kongogebiete kann es nicht wundernehmen, wenn das Kind, und zwar schon vor seiner Geburt, von allerlei Zaubermitteln umgeben wird. Steht seine Ankunft bevor, dann ruft man einen weiblichen Hexendoktor. Dieser kocht verschiedene Sorten Fleisch und Fische und zieht Perlen zu einer Halskette auf, der eine Muschel als Mittelstück gegeben wird. In diese tut das zauberkundige Weib etwas Kreide, ein bestimmtes Blatt, eine Prise Salz und einen Teil der durcheinander gekochten Speise. Die angehende Mutter hat nun die Pflicht, jeden Morgen an diesem Mischmasch zu lecken, damit sie ein gesundes Kind bekomme und dieses sich später leicht an allerhand Nahrung gewöhne. Nach der Zubereitung der geschilderten Speise gibt die Medizinfrau der Schwangeren etwas davon zu essen und trifft dann weiter eine ganz sonderbare Maßnahme. Sie kocht ein Huhn und legt ein Bein von ihm für das älteste Kind der angehenden Mutter beiseite oder, falls diese zum ersten Male niederkommt, für deren Schwester oder nächste weibliche Verwandte. Diese Person muß nun so tun, als wolle sie das Bein stehlen, worauf alle anwesenden Familienmitglieder sie einzufangen suchen und „Dieb, Dieb“ hinter ihr herrufen.

Das neugeborene Kind wird mit warmem Wasser gewaschen und von einer der anwesenden Frauen (aber nicht von der Mutter) den[S. 109] ersten Tag über gepflegt. Ist es nach einiger Zeit imstande, schon festere Speisen zu sich zu nehmen, so erhält es geröstete Kassava oder geröstete Erdnüsse, die ihm die Mutter vorgekaut hat; nach ungefähr drei Jahren wird es entwöhnt. Im Hause der Wöchnerin befindet sich stets ein Tiegel in der Nähe des Feuers, und derjenige Mann, der, ob alt oder jung, innerhalb der ersten zwei Tage eine Perle hineinwirft, kann das Kind, wenn es ein Mädchen ist, als seine zukünftige Frau beanspruchen; es muß aber ein Mann aus einem Klan sein, in den das Mädchen hineinheiraten darf. Wirft ein Fremder oder ein Mann aus einem für eine Heirat nicht in Frage kommenden Klan eine Perle in den Tiegel, dann wird sie ihm zurückgegeben. Erfolgt die Rückgabe der Perle aus keinem stichhaltigen Grunde, so wird dies als schwere Beleidigung aufgefaßt. Der Tiegel wird im allgemeinen streng bewacht, und nur ein kleiner Teil der neugeborenen Mädchen wird auf solche Weise versprochen. In diesem Falle darf niemand anders das Mädchen heiraten. Die hineingeworfene Perle wird als ein Geschenk an das Kind aufgefaßt und verleiht, wie gesagt, dem Spender das ausschließliche Recht auf dessen Hand, sobald es das heiratsfähige Alter erreicht hat. Ist dieser Zeitpunkt eingetreten, dann muß der Verlobte auch das Heiratsgeld, das man entsprechend der sozialen Stellung des Mädchens fordert, bezahlen. Ist die Forderung zu hoch gestellt, dann hat der Mann das Recht, seine „Geschenke“ zurückzuverlangen; auch ist es Rechtens, daß er einen entsprechenden Zinsfuß fordern darf, was unter Umständen zu Prozessen Anlaß gibt.


Gleich nach der Geburt wird ein frisch gebrochener Palmzweig über der Tür des Hauses befestigt, um das Kind vor einer doppelten Gefahr zu schützen. Sollte am Orte plötzlich ein Kampf ausbrechen, dann würde es kein Mensch, auch nicht der Feind, wagen, ein Haus zu belästigen, das durch einen solchen Palmzweig gekennzeichnet ist. Ferner verbietet der Zweig[S. 110] jedem, der das Tier ißt, das die Familie des Neugeborenen mit einem Tabu belegt hat, das Haus der Wöchnerin zu betreten; täte er es doch, so würde das Kind krank werden oder sogar sterben. Am Ende des ersten Monats wird der Palmwedel entfernt, weil man das Kind dann für kräftig genug hält, um von bösen Einflüssen unberührt zu bleiben. — Sollte eine Frau während ihrer Schwangerschaft von fließendem Wasser, von Schlangen oder Wassergeistern geträumt haben, dann fürchtet sie, das Kind könnte eine Wiedergeburt von einem Wassergeist sein. Daher wird das Neugeborene sofort in ein Tuch gewickelt, und niemand mit Ausnahme der Medizinfrau erfährt sein Geschlecht, bis es einen Namen erhalten hat. Einige Tage nach der Geburt eines solchen Kindes leitet die Medizinfrau einen Tanz ein, der die ganze Nacht hindurch anhält und Anlaß zu vielem Essen und Trinken gibt. Eine Laube aus Palmwedeln wird gebaut, in der Vater, Mutter und Kind Platz nehmen; alle Teller und Schüsseln, die bei der Entbindung gebraucht wurden, werden in der Nähe dieser Hütte aufgestellt. Bei Tagesanbruch nun taucht der „Doktor“ in einen Teller mit Palmwein einige Blätter, besprengt Eltern und Kind damit und fragt die Versammelten dreimal, ob sie den Namen des Kindes wissen; diese antworten mit „Nein, wir kennen seinen Namen nicht“. Darauf ruft der Doktor laut: „Er lautet Lombo.“ Die Leute machen sofort einen Heidenlärm, indem sie sich mit der flachen Hand auf den Mund schlagen. Sie wissen sofort, wenn sie diesen Namen hören, daß das Kind ein Mädchen ist; denn wäre es ein Knabe, so würde der Zauberer es Etoko genannt haben. Sie erkennen ferner an dem Namen, daß die schwangere Mutter von fließendem Wasser, Schlangen oder Wassergeistern geträumt hat. Die Geister bewohnen die Flüsse, und die Schlangen hausen zwischen Steinen[S. 111] in der Nähe von Wasserläufen; daher kommt es auf dasselbe hinaus, ob man geradezu von den Geistern oder ob man von Wasser und Schlangen träumt. Der Doktor erhält als Gebühr für seine Bemühungen ein Huhn, fünfzehn Perlschnüre und alle Gerätschaften in der Nähe der Hütte. Alle Mädchen, die Lombo, und alle Knaben, die Etoko genannt wurden, gelten als wiedergeborene Wassergeister und stehen in dem Ruf, nicht nur Glück verleihen, sondern auch Unglück verhängen zu können, weswegen sie von ihren Nachbarn mit großer Ehrerbietung behandelt werden und viele Geschenke von ihnen erhalten. Diese werden ihnen gemacht, um sie dem Spender geneigt zu stimmen. Bald merken aber die Kleinen ihren vermeintlichen großen Einfluß, unter anderem auch daran, daß Verwandte und Nachbarn sich scheuen, ihnen eine Forderung abzuschlagen, und fallen ihrer Umgebung sehr lästig. Man glaubt allgemein am Kongo, daß das einzig Neue an einem Kinde sein äußerer Körper sei, daß dagegen sein Geist oder seine Seele etwas Altes vorstelle und schon entweder in einer verstorbenen Person geweilt habe oder auch einer noch lebenden oder einem Wassergeist angehöre. Zweierlei hat zu solchem Aberglauben geführt: einmal der Umstand, daß ein Kind frühzeitig von fremdartigen Dingen spricht, die seine Mutter es nicht gelehrt haben kann, und zum anderen, daß es irgendeinem Vorfahren oder einem lebenden Verwandten ähnlich sieht. Im letzteren Falle ist dies für die betreffende Person keineswegs erfreulich, denn man glaubt dann, daß diese bald sterben werde. Darum ist auch niemand, dem man sagt, ein Kind habe Ähnlichkeit mit ihm, angenehm davon berührt. Ebensowenig darf man sagen, ein Kind sei fett, denn dann könnte die Vermutung aufsteigen, man wolle es „im Geiste“ verzehren, was seinen baldigen Tod zur weiteren Folge haben würde; auch ein schönes Kind darf man es nicht nennen, denn dann würde der böse Geist (Ndoki) es hören und das Kind wegnehmen, dieses also ebenfalls sterben. Dagegen darf man es, ohne Anstoß zu erregen, als stark bezeichnen. Eltern zählen ihre Kinder niemals, aus Furcht, der böse Geist könnte sie hören und ihnen einige durch den Tod entreißen.



Kongofrauen haben ungern Zwillinge, weil sie ihnen doppelte Last machen, daher lassen sie den einen Zwilling für gewöhnlich verhungern. Ist eines der Kinder gestorben, auf natürliche oder[S. 112] unnatürliche Weise, dann wird aus einem Stück Holz ein Bildnis geschnitzt, das dieses Kind vorstellt, und zu dem lebenden gelegt, damit es sich nicht einsam fühle. Sollte auch dieses Kind sterben, dann kommt das Bild mit in dessen Grab. Die Leiche wird auf Blätter gelegt, mit einem weißen Tuch bedeckt und an der Kreuzung zweier Wege begraben, wo man sonst auch Selbstmörder oder vom Blitz Erschlagene, also Ehrlose, beisetzt. Auch kommt es wohl vor, daß, wenn von Zwillingen der eine stirbt, die Mutter sich ein Kind in demselben Alter borgt und zu dem am Leben gebliebenen Zwilling legt, damit dieser sich nicht gräme. Das erste Zwillingskind wird mit einem feststehenden Namen benannt, ebenso das zweite, desgleichen das erste Kind, das nach einer Zwillingsgeburt auf die Welt kommt. Auch ein sechsfingriges Kind bekommt einen bestimmten Namen. — Am oberen Kongo sind bei Zwillingsgeburten bestimmte Gebräuche vorgeschrieben. Drei Tage nach der Geburt nimmt die Mutter die Kinder in die Arme und tanzt vor ihrem Hause; die Nachbarn sehen zu und singen einen bestimmten Kehrreim, nämlich „Die Zwillinge rufen nach dir“. Die Mutter wird am ganzen Körper mit vielem Grün geschmückt, und die Kinder erhalten die feststehenden Namen, die für Zwillinge üblich sind. Sie dürfen den Namen niemals wechseln, was anderen erlaubt ist. Der erstgeborene Zwilling wird stets auf dem rechten Arm, der zweitgeborene auf dem linken getragen. So oft die Mutter gegrüßt wird, muß sie zweimal danken, für jedes Kind einmal, und wenn sie selbst jemanden grüßt, dann muß sie dies zweimal tun, damit kein Kind etwas versäume. Aus demselben Grunde muß sie mit beiden Händen essen, sonst würde das eine Kind in seiner Ernährung[S. 114] zurückbleiben; sie erhält auch doppelte Geschenke, damit nicht das eine Kind sich zurückgesetzt fühle, erkranke oder gar sterbe. Man glaubt allgemein, daß Erkrankung oder Tod eines der Zwillinge auf eine solche Vernachlässigung von seiten der Mutter zurückzuführen sei. Von den Zwillingen selbst wird erwartet, daß sie zusammen lachen oder weinen und auch sonst stets die gleiche Gemütsverfassung bekunden. Die Bopoto stellen bei einer Zwillingsgeburt zu beiden Seiten des Weges, der in das Dorf führt, je ein Gefäß in das gablige Geäst eines Pfahles, um dadurch etwaigen bösen Einflüssen vorzubeugen, die den Zwillingen schaden könnten (Abb. 135).




Wenn sich Sternschnuppen zeigen, dann schließen die Mütter ihre Kinder schleunigst in den Hütten ein, aus Furcht, die Sternschnuppen, die sie für am Firmament spielende Geister halten, könnten auf die Kinder fallen und in sie hineingehen, wodurch die Kinder natürlich von einem bösen Geiste, dem Ndoki, besessen würden. Der erste Zahn, den ein Kind verliert, wird gegen die aufgehende Sonne geworfen und dabei die Bitte ausgesprochen: „Bring mir einen neuen Zahn, wenn du wiederkommst.“ Außerdem wird ein Stück Holzkohle gegen Westen geworfen mit der Bemerkung: „Nimm meinen alten Zahn fort; ich will ihn nicht wieder haben.“ Wenn sich dann mit der Zeit ein neuer Zahn einstellt, wird dies dem Einfluß der Sonne zugeschrieben. — Wenn ein Kind sich sehr eigensinnig oder ungehorsam gebärdet, dann schneidet sein Vater ein Stück von seinem eigenen Zeug ab, wickelt von seinem Haar etwas hinein und verbrennt das Bündel mit dem Fluche: „Du sollst niemals reich werden, sondern Gegenstand des Unglücks sein.“ Die Kinder haben eine schreckliche Angst vor einem solchen Fluch; jedes Unglück, das sich daraufhin einstellt, etwa eine Wunde, ein Unfall, eine Krankheit oder etwas derart, wird ihm schuld gegeben. Manchmal ändert ein Knabe in solchem Fall sein Betragen und erweist sich[S. 115] den Wünschen seiner Eltern zugänglicher; er bittet dann auch darum, daß der Fluch wieder von ihm genommen werde. Der Vater tut dies, indem er drei kleine Staubhäufchen auf jedes Knie legt, den Knaben vor sich niederknien und ihn die Häufchen hinwegblasen läßt, wobei der Vater zu ihm sagt: „Ich vergebe dir. Ich habe dir nicht mit dem Herzen, sondern nur mit meiner Zunge geflucht, und nun werde fortan reich.“ Sollte der Vater sterben, bevor er seinen Sohn von seinem Fluche befreit hat, dann sucht dieser einen Namensvetter seines Vaters, mit dem letzterer auf freundschaftlichem Fuße stand, auf, bringt ihm ein Huhn und bittet ihn, ihn von dem Fluch in der geschilderten Weise zu erlösen. Der Kongoneger kennt auf der anderen Seite auch wieder Segenswünsche für seine Kinder, die er aus besonderen Anlässen, entweder wenn sie eine längere Reise antreten oder der Familie ganz besondere Freude bereitet haben, über sie ausspricht. Dies geschieht in der Weise, daß der Vater oder auch die Mutter auf[S. 116] das Kind ausspeien und dabei feierlich ausrufen. „Mögest du besitzen alles, was ein Mensch besitzen soll; möge dir Segen und Glück zuteil werden und mögen deine Worte Anerkennung bei den Menschen finden.“ Ein solcher Segen wird von den jungen Leuten sehnsüchtig begehrt.
Kongoknaben und -mädchen müssen auch gewisse Familientabus beobachten, die ersteren ihr ganzes Leben lang, die letzteren nur bis zu ihrer Verheiratung; denn dann nehmen sie die Verbote ihrer Männer an. Diese anererbten Tabus bestehen zum Beispiel in dem Verbot des Genusses aller Vögel und Fische, die Flecke oder Zeichen haben. Wird ein solches Familientabu verletzt, dann glaubt man, daß als Strafe der Übertreter von einer bösen Hautkrankheit befallen werde. Außer diesen ständigen Tabus kommen auch vorübergehende vor. So legt zum Beispiel ein Medizinmann einem kranken Kinde ein Tabu auf und nimmt es ihm später wieder ab. Der verbotene Genuß kann eine Schweineschnauze, ein Ziegenkopf, ein bestimmter Fisch oder eine besondere Pflanzensorte sein; der Gegenstand solchen Verbotes ist rein willkürlich und steht außer Zusammenhang mit der Krankheit.

Im ganzen Kongogebiet treiben die heranwachsenden Kinder allerlei Spiele, wobei sie den Großen nachäffen; sie gehen im Scherz auf die Jagd, treiben Handel, kochen, kämpfen miteinander und dergleichen. Sonstige Spielsachen kennen sie wenig, außer dem, was sie sich aus den ihnen zur Verfügung stehenden Gegenständen selbst herstellen, wie Modelle von Häusern oder Kanus, ferner Schilde und Speere für ihre Schlachten. In mondhellen Nächten beteiligt sich die Jugend mit den Alten am Tanz oder führt auch eigene Wetttänze auf; Tänze von allerlei[S. 117] Art sind überall sehr beliebt und werden bei allen möglichen Gelegenheiten unter lärmender Musikbegleitung abgehalten (Abb. 137, 141, 143, 145 und 147 bis 150). In dunklen Nächten hocken sie um das Feuer und erzählen einander unter lebhaftem Gebärdenspiel allerhand Tiergeschichten, die in großer Zahl in ihren Köpfen herumspuken, oder sie geben sich gegenseitig Rätsel auf. Auch Fadenspiele (Abb. 152) sind bei alt und jung sehr beliebt; groß und klein bekundet eine große Geschicklichkeit in dem Abnehmen des Fadens, der ein Band von ein paar Meter Länge vorstellt. Man hat bis zu sechzig verschiedene Arten dieses Spiels gezählt. — Die jungen Leute haben sich vielfach Reifezeremonien zu unterziehen (Abb. 139).




Die Heirat kommt unter den Kongonegern durch Neigung zustande. Jedoch herrscht allgemein die Sitte, daß man nur in einen bestimmten Klan hineinheiraten darf. Die Grade des Verbots schwanken sehr zwischen den Bewohnern des unteren Kongogebiets, wo noch das Mutterrecht herrscht, und denen des oberen, wo bereits das Vaterrecht Geltung hat. Bei den ersteren darf ein junger Mann, der seine Wahl getroffen hat, weder mit seinem Mädchen sprechen noch ihm Geschenke machen. Um es zu gewinnen, muß er dagegen dem Onkel des Mädchens mütterlicherseits zunächst eine Kalabasse Palmwein darbringen und ihm vortragen, was er auf dem Herzen hat. Zeigt sich der Onkel geneigt, ihm Gehör zu schenken, dann dankt er dem jungen Manne und trinkt den ihm gebrachten Wein; dies ist aber nur ein Zeichen für seine[S. 118] Geneigtheit, ohne zunächst den Onkel zu weiterem zu verpflichten. Hat er den Wein getrunken, dann setzt er dem Jüngling Speise vor und bestimmt einen Tag, an dem dieser sich seine Antwort holen kann. Am festgesetzten Tage findet sich der Bewerber mit einer noch größeren Menge Palmwein ein und erhält von dem Onkel des Mädchens, nachdem dieser davon getrunken, Bescheid, ob er damit einverstanden ist, daß der junge Mann seine Nichte eheliche. Gleichzeitig verständigt er sich mit ihm über den Kaufpreis, der etwa in tausend, unter Umständen auch in fünftausend Paketen blauer Perlen — in jedem Paket befinden sich hundert Schnüre mit je hundert Perlen zum Preise von zwei Schilling für das Paket — zu bestehen pflegt, je nach der Stellung und dem Reichtum der Familie des Bewerbers. Man feilscht oft um die Höhe des Preises, und der Onkel ermäßigt ihn dann wohl auch. Jetzt ist es Sache des Bräutigams, die geforderte Summe durch Handelsreisen aufzubringen. Gelingt ihm dies, dann benachrichtigt er den Onkel, daß die Summe bereit liege, entweder in Gestalt von[S. 120] Perlen oder in einer entsprechenden Menge von Ziegen, Schweinen, Stoffen und so weiter. Der Onkel sucht jetzt das Dorf auf, wo der junge Mann wohnt, und nimmt dazu seinerseits Palmwein mit. Hier zählt er das Hochzeitsgeld nach und setzt, falls alles zu seiner Zufriedenheit ausgefallen ist, einen Tag fest, an dem der Vater des Mädchens seinen zukünftigen Schwiegersohn aufsuchen und ihn kennen lernen kann. Bei dieser Gelegenheit bringen Onkel und Vater des Mädchens dem Bewerber Kürbisflaschen voll Palmwein mit. Der Jüngling ruft seine Freunde zusammen, und man trinkt gemeinsam den Wein, zunächst den des Onkels, dann den des Schwiegervaters, worauf das Brautgeld vor Zeugen ausgezahlt wird. Der Vater erhält nur einen geringen Bruchteil davon, er spielt überhaupt bei der ganzen Angelegenheit eine völlig nebensächliche Rolle. Wenn alles so weit vorbereitet ist, dann muß noch die Zustimmung der Schwiegermutter eingeholt werden, ehe die Hochzeit stattfinden kann. Bei der Hochzeit pflegt man eine gewaltsame Entführung in Szene zu setzen. Der Bräutigam begibt sich am festgesetzten Tage mit ein paar Freunden in die Stadt der Braut; sie schießen beim Herannahen mit ihren Flinten, schreien und bemühen sich, möglichst viel Lärm zu machen. Damit soll nicht nur die gesellschaftliche Stellung des Bräutigams kundgetan, sondern auch die zukünftige Herrin geehrt werden. Bei der Ankunft im Dorf findet ein Scheinkampf statt mit dem Ausgang, daß die Braut mitgenommen wird. Die Gesellschaft zieht sich nun wieder in ihre eigene Stadt zurück, wo für die nächsten zwei bis drei Tage ein lustiges Leben herrscht. Große Menschenmassen sammeln sich an, viel Wein wird getrunken, zahlreiche Ziegen und Schweine werden verzehrt, es wird geschossen und gesungen und unter Trommelschlag getanzt. Am Tage vor der Hochzeit nimmt die Braut keine Nahrung zu sich.


Wenn die Menge sich verzogen hat, geben die Alten das Mädchen in die Hände des jungen Mannes unter ernsthafter Ermahnung in Zeugengegenwart. Der Frau prägen sie ein: „Du sollst deinen Mann und seine Familie achten und dich in deinem Hause anständig betragen“ und[S. 122] zu dem jungen Manne sagen sie: „Du sollst deine Frau und ihre Familie gleichfalls achten; du darfst sie nicht hart anfahren, auch nicht wie eine Sklavin behandeln, nicht auf ihre Sachen treten, sie selbst nicht mit Füßen stoßen.“ Darauf faßt der junge Mann einen der Zeugen beim Handgelenk, reibt eine Flintenkugel in dessen Handfläche und sagt darauf: „Ich habe alles, was gesagt wurde, gehört; sollte ich das Eheleben vernichten, dann möge mich diese Kugel treffen.“ Die Frau leistet denselben Eid, worauf die Alten das Haus der Neuvermählten betreten, die Herdsteine zurechtstellen und die Braut über ihre Pflichten als Hausfrau belehren. Die Verwandten der jungen Ehefrau werden schließlich beschenkt und in artiger Weise nach Hause komplimentiert. — Bei weniger wohlhabenden Leuten spielt sich die Hochzeit unter geringerem Gepränge ab; Festgelage, Tanz und sonstige Feierlichkeiten fehlen bei ihnen.



[S. 123]

Unter den Negern des oberen Kongo herrschen wiederum andere Werbungs- und Hochzeitsgebräuche; innerhalb dieser Gruppe stimmen sie aber mit geringen örtlichen Abweichungen untereinander ziemlich überein. Bereits ganz junge Mädchen, selbst Säuglinge werden manchmal einem jungen Manne für die Ehe versprochen. Der Zukünftige legt zum Zeichen dessen in Gegenwart von Zeugen ein messingenes Armband um den Arm des Kindes, wobei er sein Versprechen bestätigt mit den Worten: „Dies ist meine Frau.“ Sobald das Mädchen das heiratsfähige Alter erreicht hat, wird es seinem Gatten übergeben und diesem dabei Zuckerrohrwein zum Geschenk gemacht. — Auch unter Erwachsenen spielen sich die Förmlichkeiten ganz einfach ab. Gefällt einem jungen Manne ein Mädchen, so kann er zuerst entweder mit ihm oder mit dessen Vater reden. Sind beide mit der Werbung einverstanden, dann ruft der Jüngling seine Freunde herbei, die ihn zum Hause des Schwiegervaters begleiten. Nachdem das Mädchen geholt ist, tritt der Jüngling mit einem Speer in die Mitte der Gruppe, stößt ihn in den Boden und ruft aus: „Wenn das Mädchen mich lieb hat, dann soll es diesen Speer herausziehen.“ Empfindet das Mädchen Neigung, dann zieht es den Speer heraus und trägt ihn zu ihrem Vater mit den Worten: „Ich liebe ihn.“ Nach diesem Geständnis wird[S. 124] das Brautgeld, bestehend in einer Axt, einem Spieß, etwas Stoff, einem Spiegel und anderen Kleinigkeiten, dem Vater der Braut oder seinem Vertreter überreicht. Damit ist das Verlöbnis geschlossen. Die Eltern des Mädchens wachen über ihre Tochter so lange, bis der Bräutigam imstande ist, das ganze oder wenigstens den größeren Teil des Hochzeitsgeldes — etwa im Werte von zweihundert Mark gleich dem Preise von zwei männlichen oder weiblichen Sklaven — zu entrichten. Inzwischen darf er seiner Verlobten Geschenke machen, die sie gelegentlich erwidert, indem sie dem jungen Manne Gerichte kocht und zusendet. Oft genug lebt das Paar auch schon vor der Hochzeit zusammen, da beide Teile sich schon für gebunden halten.
Ist das Hochzeitsgeld ganz oder zu erheblichem Teile bezahlt, dann begeben sich die Eltern der Braut mit ihr, verschiedenen Nahrungsmitteln und einer Kalabasse voll Zuckerrohrwein zum Hause ihres Schwiegersohnes, wo der Brautvater seine Tochter in Gegenwart von Zeugen dem Bräutigam übergibt. Die Teilnehmer erhalten ihren Anteil an Speise und Trank — das Mitbringen derselben durch die Eltern soll ein Zeichen dafür sein, daß sie ihre Tochter dem Manne nicht als Sklavin, sondern als freie Frau verkauft haben —, tanzen zu Ehren des jungen Paares und dichten aus dem Stegreif Loblieder auf dasselbe. Nach Beendigung dieser Feier reibt sich die junge Frau mit Palmwein ein, bestreut sich mit Rotholzpulver, behängt sich mit möglichst viel Putz, den sie sich von ihren Freundinnen geliehen hat, auch mit Federn, und geht mit ihrem Mann im Dorfe auf und ab, damit alle sehen können, daß sie nunmehr Frau geworden ist. Hat der Gatte bereits andere Frauen, dann behängen diese die neue Gattin mit ihrem eigenen Schmuck und begleiten sie auf der Straße. Dieser Honigmonat dauert etwa zwei bis drei Wochen; währenddessen versorgt der Gatte seine Frau mit dem nötigen Essen. Nach Ablauf dieser Zeit nimmt die Jungvermählte wie die übrigen Frauen an der Feldarbeit teil.
Bei den Kongonegern darf der Mann so viel Frauen nehmen wie er erhalten kann; er ist verpflichtet, einer jeden eine eigene Hütte zu errichten, ihr gelegentlich Geschenke an Stoff zu machen und eine bestimmte Menge Fisch oder Fleisch im Jahre zu gewähren. — Am ganzen Kongo besteht für den verheirateten Mann die Forderung, daß er seine Schwiegermutter niemals zu Gesicht bekommt. Sobald er erfährt, daß sie in der Nähe ist, muß er sich verstecken, oder eines von beiden muß kehrtmachen, um dem anderen aus dem Wege zu gehen. Läßt es sich nicht vermeiden, daß beide zusammenkommen, um eine wichtige Angelegenheit zu besprechen, so haben sie sich in einiger Entfernung und die Rücken einander zugekehrt auf verschiedenen Seiten der Mauer oder des Hauses aufzustellen.
Wie oben gezeigt wurde, führen die Kongoneger alles Ungemach, das sie trifft, auf Hexerei zurück; auch den Tod schreiben sie ihr zu. Da sie sich dementsprechend, solange sie nicht behext sind, für unsterblich halten, so machen sie sich bei Lebzeiten um den Tod wenig Sorge. Kein Schuß kann sie treffen, kein Krokodil sie verletzen und keine Krankheit sie töten, sofern nicht etwa die Kugel, das Krokodil oder die Krankheit Zauberei in sich birgt. Daher läßt sich ein Mensch auch nicht zurückhalten, in den Kampf zu ziehen, solange er weiß, daß keine böse Vorbedeutung damit verbunden ist, oder einen Fluß zu durchschwimmen, der mit Krokodilen angefüllt ist, solange er in dem Glauben lebt, daß sie ihm nichts antun werden, oder in das Haus eines Pockenkranken sich unnötigerweise einzudrängen, solange er das sichere Gefühl hat, daß die Kraft seines Fetisches aller Hexerei entgegenwirken und ihn vor Krankheit schützen werde.
Ist ein Kongoneger gestorben, so ist es selbst bei Leuten von nur geringer Bedeutung Sitte, daß alle Frauen (Abb. 138), die seiner Familie angehören, sich aus den umliegenden Dörfern zusammenfinden, um bei dem Begräbnis behilflich zu sein. Sie lassen ihren Haushalt im Stich und wandern scharenweise nach dem Trauerhause, sitzen dort Tag für Tag, erteilen den Hauptleidtragenden allerlei Ratschläge und loben die Taten des Verstorbenen in Gesängen.[S. 125] Merkwürdig ist die Totenwache der Frau bei der Leiche ihres Mannes. Sie schläft dicht neben ihr auf einer Matte und hat außerdem die Aufgabe, die sich absondernde Flüssigkeit nach Möglichkeit mit dem Finger aus dem Körper herauszudrücken; sie tut dies so lange, bis der Körper zusammengeschrumpft ist. Ein Ehemann muß in ganz derselben Weise mit der Leiche seiner Frau verfahren, sofern sie aus guter Familie war. Wenn die Leiche soweit behandelt ist, wird sie auf ein Brett gelegt und über ein Feuer gestellt, damit sie noch gründlicher austrockne. Manchmal bewahrt man die Leiche zwei bis drei Jahre oder auch noch länger auf, ehe man sie begräbt.

Das Begräbnis eines vornehmen Mannes (Abb. 146 und 151) ist ziemlich kostspielig. Mancher macht schon bei Lebzeiten Ersparnisse, um sich ein vornehmes Begräbnis zu sichern. Monate hindurch bemüht sich die Familie, alle Hühner, Ziegen und Schweine auf den Märkten der Umgebung zu einem annehmbaren Preise aufzukaufen. Ist genügend Vieh auf diese Weise angesammelt worden, dann werden Einladungen versandt, und einer jeden Einladung wird ein Geschenk in Gestalt eines Huhnes bis zu zwei Ziegen, je nach der Stellung des Eingeladenen, beigefügt. Jeder, der eine solche Einladung erhält, bringt so viel Frauen, Sklaven und sonstiges Gefolge mit, als er nur kann; denn je größer sein ganzer Troß, um so höhere Achtung genießt er unter seinen Mitmenschen. Sind in Wirklichkeit nur etwa vierzig bis fünfzig Personen eingeladen worden, so finden sich doch zu dem Begräbnis mehrere Hunderte ein, die alle auf Kosten der Familie des Verstorbenen bewirtet werden. Außerdem aber bringt jeder Eingeladene für die trauernde Familie ein Geschenk mit, das unter Umständen wertvoller sein kann als die Ziegen, die die Einladung begleiteten; die Größe desselben hängt von dem Ansehen, das der Gast im Dorfe genießt, und von seinem Rang ab. Trotz dieser Geschenke kommen die Angehörigen bei den Feierlichkeiten, die mehrere Tage dauern und wegen des reichlichen Essens und Trinkens viel Geld verschlingen, nicht auf ihre Kosten.
[S. 126]
Eine Häuptlingsleiche wird in allen Straßen und Wegen der Stadt und an allen Häusern vorbeigetragen, damit der Geist des Verstorbenen von einem jeden noch Abschied nehmen könne; jeder Hausbesitzer feuert dann noch Salut, wenn der Leichenzug an seinem Haus vorüberkommt.
Das Begräbnis findet ungefähr um Sonnenuntergang statt; für diese Tagesstunde ist der Aberglaube maßgebend, daß der Geist, der sich bis zur Beerdigung im Körper aufhält, erst am späten Nachmittag in die Geisterwelt, einen großen geheimnisvollen Wald, einziehen kann, weil die dort schon vorhandenen Geister nicht eher Zeit haben, ihn bei seiner Ankunft zu empfangen; sie müssen geradeso wie bei Lebzeiten am Tage ihrer gewohnten Beschäftigung nachgehen und kehren erst gegen Sonnenuntergang in die Geisterstadt heim. Der Empfang, den der Tote im Geisterreich zu erwarten hat, hängt von seinem Stande beziehungsweise von dem Prunk ab, den seine Angehörigen beim Begräbnis entfaltet haben. Diese tun hierin auch schon aus dem Grunde, was sie nur können, weil sie auf diese Weise den Geist gut zu stimmen glauben; sonst müßten sie fürchten, daß er wieder zurückkommen und Krankheit oder Unglück mitbringen werde. Auch aus Eitelkeit wünscht man sich nach seinem Tode einen großartigen Empfang in der Geisterwelt, den man sich mit viel Lärm, Trompetenblasen, Wehklagen und Kanonendonner ausmalt; je glänzender man dort auftritt, um so großartiger, glaubt man, werde sich dann auch der Empfang gestalten.

Die Leiche wird in eine Unmasse Stoffe gehüllt und dann in das Grab gelegt (Abb. 142). Auf dieses werden als Erinnerungszeichen alle möglichen Dinge des Verstorbenen gelegt: Kannen, Schüsseln, Trinkbecher, Flaschen, Pfannen, Schemel und dergleichen; sie sollen gleichzeitig den Reichtum des Mannes anzeigen, mit dem er sein Dasein in der anderen Welt beginnt. Alle diese Sachen müssen aber zertrümmert sein, damit ihre Geister dem des Verstorbenen folgen können.

[S. 127]

Das arktische Amerika umfaßt in der Hauptsache die Eskimo und einige nordamerikanische Indianerstämme, die sich ihnen in ihrer Kultur zum Teil angeschlossen haben.
Die Eskimo oder, wie sie sich in ihrem Selbstbewußtsein nennen, die Innuit, das heißt Menschen, stellen in ihrem Äußeren einen ganz bestimmten Typus (Abb. 155) dar. Sie sind von mittlerer Körpergröße (Männer etwa hundertsiebenundfünfzig, Frauen hundertneunundvierzig Zentimeter) und von kräftigem Bau, der ihnen ungeheure Stärke und Ausdauer verleiht. Die unteren Gliedmaßen sind kurz, Hände und Füße recht klein, aber gut gebildet. Ihre Hautfarbe ist ein helles Braungelb, die unbedeckten Körperstellen weisen einen dunkleren Ton auf. Die üppigen Kopfhaare sind dick, grob, straff, von schwarzer Farbe. Der Bart der Männer ist meistens recht spärlich und beginnt erst in verhältnismäßig späten Jahren zu sprossen. Der Schädel ist ziemlich hoch, das Gesicht rund und breit, die Nase sehr flach mit breiten Flügeln. Der Unterkiefer zeichnet sich durch eine besonders mächtige Entwicklung seiner Masse, wenig vortretendes Kinn und sehr breite Äste aus. Die Wangenbeine springen weit vor; die dunklen Augen sind mongolenähnlich geschlitzt. In dieser ihrer äußeren Erscheinung lassen die Eskimo deutliche Beziehungen zu den nordamerikanischen Indianern, anderseits auch, und zwar noch augenfälliger, zu gewissen nordasiatischen Völkern erkennen; in kultureller Hinsicht zeigen sie einen ganz ausgesprochenen Zusammenhang mit ersteren. Auf Grund dieser Tatsache hat Boas[S. 128] die Behauptung vertreten, daß als ihre Heimat die Gebiete östlich der Beringstraße, anscheinend die Gegend zwischen Hudsonbai und Südalaska, anzusehen seien, von wo aus sie sich nach Westen, Osten und Norden verbreitet hätten. Bei Aufstellung dieser Vermutung hat man aber zu wenig der körperlichen Eigenart Rechnung getragen, die frühere Forscher veranlaßte, die Eskimo zu den sibirischen Völkern in Beziehung zu setzen. Vielleicht lassen sich beide Ansichten miteinander vereinigen, wenn man annimmt, daß die Entstehung der Eskimo überhaupt in den Gebieten um den Nordpol vor sich gegangen ist und daß sie möglicherweise die Überreste einer Urrasse vorstellen, die in dieser Gegend entstand und vielleicht auch der gelben Rasse den Ursprung gegeben hat. Diese Annahme schließt nicht aus, daß vor einigen Jahrhunderten ein neuer Nachschub von Amerikaeskimo nach Nordasien erfolgte, was geschichtlich festzustehen scheint.

Die Eskimo bewohnen heute die südlichen Teile der Ostküste und die ganze Westküste von Grönland, das nördliche Labrador, die südlichen Inseln des Archipels, die ganze Nord- und Nordwestküste von der Hudsonbai an bis nach Südalaska, die nördlichen Inseln der Beringstraße und das Kap Tschukotskoj auf dem asiatischen Festlande. Sie führen ein umherschweifendes Dasein längs der Meeresküsten, da sich ihre Hauptbeschäftigung auf Jagd und Fischfang beschränkt. Im Sommer hausen sie daher in Zelten (Abb. 153), die aus Seehund- oder Renntierfellen zusammengenäht sind und durch Ruder oder gewöhnliche Stangen gestützt werden; ein größeres, aus Seehunddarm hergestelltes Stück Zeug dient als Türverschluß. Im Winter dagegen beziehen sie feste Wohnungen, die sie sich im Erdboden aushöhlen und mit Moos oder Erde über einem aus Holz- oder Walfischrippengerüst hergestellten Dach bedecken, oder Schneehäuser (Abb. 154). Ein kurzer, niedriger Gang, in dem man sich meistens nur kriechend[S. 129] fortbewegen kann, führt nach dem einzigen Innenraum, an dessen Wänden sich eine hölzerne Pritsche als Schlafgelegenheit für die ganze Familie hinzieht. In diesen Gebäuden leben Männer, Frauen und Kinder verschiedener Familien dicht zusammengedrängt; in ihnen werden Menschen geboren, werden Menschen krank und sterben Menschen; aus ihnen trägt man sie auch zu Grabe.

Persönliche Sauberkeit ist keine Tugend der Eskimo. Die ursprünglichen Stämme sind in ihrem Äußeren und in ihren Gewohnheiten unbeschreiblich schmutzig, und es hält sogar schwer, den Eskimo, die bereits unter europäischem Einfluß angesiedelt worden sind, die einfachsten Begriffe von Reinlichkeit beizubringen. Es mag dies wohl auch daher rühren, daß Wasser eine schwer zu beschaffende Sache ist, denn es muß aus Schnee oder Eis mit Hilfe von kostbaren, weil ebenfalls schwer zu beschaffenden, Brennstoffen durch Schmelzen gewonnen werden und findet daher zu wichtigeren Zwecken als zum Waschen Verwendung. Unter diesen Umständen waschen sich die Eskimo nicht selten mit ihrem eigenen Urin.
Den hauptsächlichsten Lebensunterhalt liefert den Eskimo die Jagd (Abb. 156 und 157) auf Robben, Walfische und andere Seesäugetiere, auch auf Landtiere, wie Moschusochsen, Renntiere und Vögel, sowie der Fischfang (Abb. 158) (Lachse, Forellen und so weiter). Sie sind ein Seevolk, das sich selten von der Küste entfernt. In ihrem harten Kampfe ums Dasein sind sie in erster Linie vom Seehund abhängig, der ihnen Nahrung und Kleidung liefert und sie auch mit Licht und Feuerung versorgt. Sie sind echte Fleischesser. Im Sommer wagen sie sich in ihren Kajaks auf das weite Meer hinaus oder jagen hinter Moschusochsen und Renntieren her. Der Kajak ist ein aus Treibholz hergestelltes Einmannsboot, das mit einem strammsitzenden Überzug aus Seehundshaut versehen ist; in diesem ist nur eine kreisrunde Öffnung gelassen, in die der auf dem Boden des Bootes sitzende Mann vollständig hineinpaßt. Es wird daher von dem Erbauer dem Besteller wie ein Kleidungstück angemessen, und der Mann bildet mit seinem Boot gleichsam ein Ganzes. Zur Ausrüstung eines Kajaks gehören ein sogenannter Vogelpfeil, eine Harpune, eine Lanze und eine Fangblase aus Seehundleder, die hinter dem Ruderer liegt. Zur Fortbewegung bedient sich der Eskimo eines Doppelruders, dessen Handhabung besondere Geschicklichkeit erfordert. Eine andere Art Boote sind die Umiaks oder Frauenboote, so genannt,[S. 130] weil sie früher ausschließlich von Frauen gelenkt wurden; es sind dies offene Boote von der üblichen Form, ebenfalls aus einem Holzgerippe bestehend, das mit Fell überzogen ist.
Während des langen arktischen Winters leben die Eskimo eingepfercht in dem einzigen Raum ihrer Hütten, essen, trinken, schlafen, lieben und sind vergnügt. Niemals scheint es zu Unzuträglichkeiten zwischen ihnen zu kommen; Duldsamkeit und Liebenswürdigkeit sind die hervorstechenden Charaktereigenschaften der Eskimo; ja sie sollen nicht einmal ein Wort besitzen, mit dem Schelten ausgedrückt wird, auch keine Bezeichnung für Krieg. Überhaupt gehen sie sparsam mit ihren Worten um; ihre Sprache ist so wortarm, daß ein einziges Wort vielerlei ausdrückt, wofür andere Sprachen verschiedene Bezeichnungen haben. Entstehen Streitigkeiten unter den Eskimo, so pflegen sie sie auf ganz gelungene Art zu schlichten. Wer sich gekränkt fühlt, bringt seine Klage in einem Liede zum Ausdruck; hat er es beendet, so wird sein Gegner aufgefordert, zu erscheinen und das Lied anzuhören. Dabei entwickelt sich eine allgemeine gesellige Unterhaltung, zu der sich die Freunde beider Parteien einfinden. Der Beleidigte trägt sein Lied unter Trommelbegleitung vor; findet es Beifall, so wird dies als ein Sieg des Sängers angesehen, und seine Klagen werden als berechtigt anerkannt; drückt die Versammlung aber Unzufriedenheit mit seinem Liede aus, so gilt dies als Strafe. Bei solchen Zusammenkünften pflegt man auch noch zu tanzen, was die allgemeine Stimmung erhöht. — Die Eskimo sind auch außerordentlich gastfrei, besonders wenn ein Stamm einen anderen besucht. Dabei sind ein höchst merkwürdiges Vorkommnis sogenannte Grußduelle, bei denen die einander Begrüßenden mit Ohrfeigen einen richtigen Zweikampf ausfechten, anscheinend ein Überrest der ursprünglichen Abneigung gegen Fremde.

[S. 131]
Die Kleidung der Eskimo ist für beide Geschlechter ziemlich dieselbe. Sie besteht aus einem Ober- und Untergewand; jedes dieser beiden ist aus einer Ärmeljacke, die aber nur eine Öffnung zum Hineinschlüpfen besitzt und daher über den Kopf gezogen werden muß, und Hosen zusammengesetzt. Diese sind beim weiblichen Geschlecht kürzer, gleichen sozusagen Badehosen. Die Männer Südgrönlands tragen an ihrer Jacke noch eine Kapuze, die Frauen (Abb. 159) einen hohen Kragen aus schwarzem Seehundsfell, über ihm ein buntes, breites Halsgeschmeide aus Perlen. Dazu kommen noch die Kamils, Strumpf und Stiefel in einem Stück, die bei den Frauen wegen ihrer kurzen Hosen weiter hinaufragen. Sie bestehen aus einer inneren Socke von Seehundsfell, dessen Haar nach innen gewendet ist, und einem äußeren Schuh aus haarlosem, wasserdichtem Fell. Die Eskimo lieben es, ihre Gewänder mit farbenprächtigen Lederstreifen zu benähen. Diese werden mit dem Weibermesser (Ulo) in Form geometrischer Muster (Kreise, Rauten, Quadrate) zurechtgeschnitten, bunt gefärbt und in geschmackvoller Anordnung auf die Kleider aufgenäht. Hierin bekunden die Frauen eine ganz besondere Geschicklichkeit und guten Geschmack. Auf diese Weise hergestellte Gürtel bilden sogar einen Gegenstand lebhafter Ausfuhr.

Das Haar der Eskimo läßt sich wegen seiner Straffheit nicht leicht geschmackvoll anordnen; dessenungeachtet verstehen die Frauen es doch hier und da, sich ein nettes Aussehen zu geben. Die Männer lassen ihr Haar meistens wachsen, wie es will, und schneiden es sogar vielfach überhaupt nicht; aus dem Gesicht wird es mit einem Band oder Riemen zurückgehalten. Die Frauen dagegen vereinigen ihr Haar in einem Knoten oben auf dem Scheitel und fassen es hier durch[S. 132] ein Band zusammen. Dieser Haarknoten ist Gegenstand großen Stolzes; das Hauptbestreben seiner Trägerin geht dahin, den Knoten so steif wie möglich in die Höhe ragen zu lassen. Interessant ist die verschiedene Farbe des Bandes, das den Schopf zusammenhält. Jungfrauen tragen es rot, uneheliche Mütter grün, verheiratete Frauen blau und Witwen schwarz oder im Alter weiß. Von Körperverzierungen kommen vor Tatauierung (Abb. 160), Unterlippenpflöcke, Backenknöpfe und Ohrgehänge.

Die Eskimo sind große Freunde von Gesang und Tanz unter Begleitung moderner Musikwerkzeuge. Auch ihre heutigen Tänze gleichen den europäischen. Erwachsene wie Kinder erfreuen sich auch an Spielen (Abb. 162 und 165), zum Beispiel an einer Art Fußball mit der Fangblase oder an einem Peitschenspiel, bei dem es darauf ankommt, auf einer glatten Fläche (fest gefrorenem Schnee oder Eis) einen Knochen durch Peitschenhiebe nach einem bestimmten Ziel zu bringen. Alt und jung sind sehr sangesfroh und pflegen nicht selten ganz alltägliche Begebenheiten in Musik zu setzen.
Die Religion der Eskimo besteht in Geisterglauben. Der von ihnen am meisten gefürchtete Geist ist der des Todes, Torngak genannt. Er wohnt angeblich in einer Höhle im einsamen Gebirge. Da man annimmt, daß in seiner Hand Leben und Glück der Menschen liegen, so werden die verschiedensten Vorkehrungen getroffen, um ihn zu versöhnen. Vermittler zwischen ihm und dem Volke ist der Schamane oder Angekok. Der Schamane ist auch der Hüter und Herr der Familiengeister; davon rührt seine große Macht her. Wenn ein junger Eskimo mannbar geworden ist, dann kauft er sich seinen Familiengeist vom Angekok. Sehr drastisch schildert Stefansson einen solchen Einkauf. Ein junger Eskimo hatte erfahren, daß ein alter Schamane sein Geschäft allmählich aufgeben und ein paar gute Geister billig abgeben wollte. „Ich brauche sie nicht länger,“ sagte der Alte, „und dir werden sie nützlich sein. Möchtest du vielleicht meinen Polarbärengeist haben?“ „Am liebsten würde ich den Stromzerbrechergeist besitzen,“ erwiderte der andere. „Nein, den brauche ich bis zuletzt,“ gab der Alte zur Antwort. „Aber du sollst meinen Rabengeist haben. Das ist ein zuverlässiger und wirksamer Geist. An ihm wirst du gewiß deine Freude erleben.“ Daraufhin erstand der junge Eskimo den Rabengeist für ein neues Boot, zwanzig frische Häute, zwei Krüge mit Robbentran und einige andere nützliche Dinge. Entfaltet ein auf diese Weise erworbener Geist die versprochene Wirksamkeit nicht, so wird der Schamane als Ausrede sagen: „Ich kann dir nicht helfen; ich habe ihn dir in guter Absicht übertragen, und wenn du zu jenen gehörst, von denen die Geister nichts wissen wollen, dann kannst du mir leid tun.“ — Ein anderes Beispiel dafür, auf wie vertrautem Fuße die Schamanen vorgeblich mit den Geistern stehen, erzählt[S. 133] uns ebenfalls Stefansson. Eine der üblichsten Unterhaltungen während der langen Winternacht bildet bei den Eskimo die Reise des Schamanen nach dem Monde. Das ganze Dorf versammelt sich in der Hütte, Männer, Frauen und Kinder; sie sitzen auf den Bänken unten, während der Schamane oben am Dach in der Nähe des einzigen vorhandenen Fensters hockt. Einige Männer binden ihn hier mit Stricken ganz fest; darauf wird der Raum völlig verdunkelt. Außerdem müssen alle Teilnehmer die Augen schließen, den Kindern werden sie von den älteren Leuten zugehalten. Der Schamane hat ein Seil, an das ein fester Gegenstand, ein Hammer oder ein Stein, gebunden ist, in der Hand und läßt diesen umherschwirren; gleichzeitig stimmt er einen Gesang an. „Ich fühle mich nicht so schwer wie sonst,“ beginnt er, „mir ist, als säße ich nicht fest auf der Erde. Nun werde ich leicht wie eine Feder.“ Darauf fährt er mit verstellter Stimme, wie wenn sie aus der Höhe komme, fort: „Jetzt erhebe ich mich, nun fliege ich schon, und schneller und immer schneller ...“ schließlich: „jetzt schwebe ich hoch über euren Köpfen, jetzt fliege ich durch das Fenster“ und so fort. Die Stimme verschwimmt dabei immer mehr, und zuletzt flüstert der Schamane nur noch wie aus unendlicher Ferne. Darauf erlebt er alles mögliche auf dem Monde, unterhält sich mit dem Mann im Monde und mit dessen Frau über Jagdaussichten, wobei die Versammlung in tiefstem Dunkel und Schweigen verharrt. Schließlich, nach etwa einer halben Stunde, wird seine Stimme wieder lauter, und zuletzt hört man den Schamanen wieder deutlich rufen: „Jetzt schwebe ich wieder durchs Fenster zurück und komme auf den Boden. Nun öffnet die Augen und zündet die Lampen an.“ Er muß dann von seinen Erlebnissen auf dem Monde erzählen, wobei er seiner Phantasie nach Möglichkeit die Zügel schießen läßt, und alles hört andächtig zu. Das ist der Höhepunkt der Feier. Ebenso wie mit dem Monde versteht der Schamane mit allen möglichen Geistern zu verkehren, sei es, daß sie tief im Meere oder an geheimen Orten auf dem Lande hausen. — Bei den religiösen Festen trägt man groteske Holzmasken.

[S. 134]
Die heidnischen Gebräuche sind mehr und mehr im Abnehmen begriffen, denn die Eskimo sind dem Einflusse der Missionare sehr zugänglich gewesen, und viele von ihnen haben ohne Zögern das Christentum angenommen. Überhaupt bekunden die Eskimo eine große Neigung, sich die europäische Kultur anzueignen, da sie überzeugt sind, daß sie dabei besser fahren.

Hochzeitsgebräuche kennen die Eskimo nicht; die Ehe ist bei ihnen eine ganz nüchterne Sache. Braucht ein Mann eine Frau, so holt er sich einfach eine, die nun ihm gegenüber die eheliche Pflicht erfüllt; besondere Förmlichkeiten finden nicht statt. Wenn der Mann mit seiner Frau nicht zufrieden ist, so schickt er sie wieder nach Hause und versucht es mit einer anderen, oder er behält sie wohl auch bei sich, nimmt aber neben ihr eine zweite Frau. In diesem Falle erhält die zweite die Stellung einer Konkubine, rückt aber, falls die erste Frau sterben sollte, an deren Platz. — Polygamie ist nichts Ungewöhnliches. Auch ein Austausch von Frauen kommt vor. Als genügende Mitgift gilt es, wenn die Frau ihre Kleidung, eine Lampe und ein Messer mitbringt. Trotz der geschilderten leichten Art, Ehebündnisse zu schließen, legen die Eskimo großen Wert auf Verwandtschaft. — Das Los der Eskimofrau ist kein freudevolles, denn in ihrer häuslichen Beschäftigung steckt recht viel Arbeit. So muß sie die Felle zubereiten, um daraus Kleider zu machen. Die abgezogenen Seehundsfelle werden zu diesem Zweck zunächst mit dem Weibermesser und Schabern bearbeitet, gegerbt, gewalkt und geschmeidig gemacht, wobei die Frauen sie nicht selten mit den Zähnen kauen. Behandeln die[S. 135] Frauen das schwer zu bearbeitende Material, wie es oft vorkommt, andauernd auf diese Weise, so werden die Zähne vielfach bis auf das Zahnfleisch abgenutzt. Darauf werden die Felle zu Kleidern zurechtgeschnitten, und diese mit Knochennadeln und Seehunddarmstreifen zusammengenäht.


Jeder verheiratete Eskimo hat den Wunsch, männliche Nachkommenschaft zu erhalten. Für ihre Kinder haben die Eltern sehr viel übrig; sie behandeln sie mit einer solchen Sorgfalt und Liebe, wie man es unter den obwaltenden ungünstigen Verhältnissen nicht erwarten sollte. Von der[S. 136] Wiege bis zum Grabe muß der Eskimo um sein Dasein kämpfen, und dennoch tut er für seine Kinder, was er nur irgend kann. Ja vielfach beschränkt er sich nicht auf die eigenen Kinder, sondern nimmt auch bereitwillig Waisen an, selbst wenn er schon eine Anzahl Kinder zu versorgen hat. Diese angenommenen Kinder behandelt er dann mit derselben Güte und Gewissenhaftigkeit wie seine eigenen. — Die kleinen Kinder werden allgemein rücklings über den Schultern in einer Art Tasche, einer Erweiterung des Oberkleides, getragen, die mit Seehund- oder Renntierfell ausgefüttert ist und den Kleinen einen behaglichen, warmen und gesicherten Unterschlupf gewährt. Dadurch wird die Mutter nicht an der Ausführung ihrer Arbeit und sonstigen Pflichten gehindert.


Die Eskimo sind dem Untergang geweiht. Sie erreichen in der Regel kein hohes Alter, da ihr harter Kampf ums Dasein und im besonderen die oft unzureichende Nahrung manches Opfer unter ihnen fordert. Die Schwindsucht hat schon viele dahingerafft. — Die Leichen werden entweder in die Erde begraben oder in die See geworfen. Die Habe des Verstorbenen wird entweder auf dem Strande niedergelegt oder auf seinem Grabe (Abb. 161); man tut dies einmal, um nicht mehr an den Toten erinnert zu werden, und zum anderen, weil man annimmt, daß er sein Eigentum in der Geisterwelt gebrauchen könne. In früheren Zeiten wurde[S. 137] die Leiche in Häute eingewickelt und auf kahle Felsen gelegt; die Kleider und die einfachen Gegenstände, die der Tote bei Lebzeiten benutzt hatte, wurden ihm mitgegeben. Bei manchen Stämmen ist dies noch heute Sitte. Unter den mehr zivilisierten Stämmen werden Holzkisten, die man sich von Händlern beschafft, zu Särgen verwendet. Das Holz ist bei den Eskimo sehr rar und daher sehr gesucht; die wichtigste Quelle bildet das Treibholz von untergegangenen Schiffen. Die auf die angegebene Art beschafften Särge werden nur wenig tief in die Erde begraben, so daß es nicht selten vorkommt, daß die Hunde der Eskimo sie ausgraben und bei ihrer Gefräßigkeit die Leichen auffressen (Abb. 163), zumal es ihnen ohne Schwierigkeit gelingt, die in Ermangelung haltbarer Särge als Notbehelf dienenden schwachen Kisten zu erbrechen. Die Gewohnheit des Umherziehens bringt es mit sich, daß die Eskimo den Ort, an dem ein Begräbnis stattgefunden hat, nach kurzer Zeit verlassen, so daß die Hunde dann bald an ihre Arbeit gehen können. Diese Tiere, halb Wolf, halb Hund, sind sehr gefährlich und heimtückisch und fallen gelegentlich auch Menschen an. Ganze Menschenalter hindurch waren sie Freunde und Genossen der Eskimo in Labrador und wurden hauptsächlich als Vorspann der Schlitten verwendet (Abb. 164), sie werden aber neuerdings mehr und mehr durch das Renntier verdrängt, das von der Regierung in das Land eingeführt wurde. Der Vorteil des Renntiers besteht darin, daß es sich nicht nur als Zugtier bei den häufigen Reisen der Eskimo bewährt hat, sondern ihnen durch sein Fleisch auch eine willkommene Abwechslung in der Ernährung bietet.

[S. 138]

Die nordamerikanischen Indianer bilden eine auffallend gleichmäßige Völkermasse im Vergleich zu den verschiedenen Völkern von ähnlich großer Ausdehnung in der Alten Welt. Sie sind aller Wahrscheinlichkeit nach die Nachkommen von Vertretern einer Verschmelzung aufeinander folgender Einwanderungswellen, die in sicherlich sehr weit zurückliegender Zeit teils von Asien, teils von Europa her auf früher in größerer Ausdehnung vorhandenen Verbindungsbrücken — in der Miozän- und Pliozänzeit stand Nordamerika mit beiden Erdteilen noch in festem Zusammenhang — dorthin gelangten. Diese Einwanderung muß schon stattgefunden haben, bevor der Mensch die Metalle bearbeiten gelernt hatte; dies ergibt sich daraus, daß, als Kolumbus ankam, die meisten Stämme noch im Steinzeitalter lebten, nur ein paar von den weiter fortgeschrittenen, wie die Mexikaner und Peruaner, es bis zur Verwendung von Bronze gebracht hatten. Auch hatte der Mensch zur Zeit jener Einwanderung noch nicht viel auf dem Gebiete der Tierzähmung getan, da die Nachfolger des Kolumbus in Nordamerika einzig den Hund als Haustier antrafen; schließlich konnte der Mensch [S. 140]damals auch noch nicht angefangen haben, Ackerbau zu treiben, da feststeht, daß jene Einwanderer noch keine Kulturpflanzen aus der Alten Welt mitbrachten, sondern erst später eine einheimische Pflanze, den Mais (aus Zentralamerika), für ihr tägliches Brot zu bauen begannen. Dementsprechend können die ersten Ankömmlinge in Amerika sich erst auf der Stufe der paläolithischen Jäger und Fischer der Eisperiode befunden, möglicherweise einer der Zwischeneiszeiten angehört haben. Die bisherigen Ausgrabungen stehen im Einklang mit dieser Annahme: sie haben ergeben, daß das Vorhandensein des Menschen in Nordamerika bis in die warme Interglazialzeit zurückreicht, die anscheinend mit dem gleichen Zeitraum in Europa zusammengefallen ist. Für die Tertiärzeit ist der Mensch in Amerika noch nicht nachgewiesen. Als er hier erschien, müssen sich die Sprachen noch in einem so wandelbaren Zustande befunden haben, daß sie sich leicht spalten konnten. Der Ethnograph J. W. Powel hat allein nördlich von Mexiko achtundfünfzig getrennte Sprachgruppen unterschieden, die sich wiederum in unzählige verschiedene Dialekte teilen. — Für Südamerika weisen verschiedene Anzeichen darauf hin, daß hier auch noch von der Südsee her eine Einwanderung erfolgt sein muß. Die Forschungen hierüber befinden sich noch ganz im Anfangstadium.
Aus diesen europäischen und asiatischen Einwanderern hat sich im Laufe der Zeiten unter dem Einfluß der veränderten Umgebung und der Abgeschlossenheit ein besonderer Menschenschlag entwickelt, den wir als Indianer oder (wegen der roten Körperbemalung) als Rothäute bezeichnen. Er ist in seinen Grundzügen, wie schon gesagt, ganz einheitlich, zeigt aber in einigen Einzelheiten, im besonderen in der Körpergröße und der Schädelform, große Mannigfaltigkeit. Entsprechend ihrer verschiedenen Zusammensetzung erinnert der Typus der Indianer sehr an den der Mongolen, unterscheidet sich von ihm aber auch wieder durch die größere und kräftig vorspringende Nase, das größere Auge mit nur schwacher oder gänzlich fehlender Schrägstellung der Lidspalte und das braune Haar. Auf der anderen Seite aber lassen sich auch wieder Anklänge an den europäischen Typus nicht ableugnen, wie die Gesichtsbildung, im besonderen die kräftig gebogene Adlernase, die Körpergröße und manches andere. Die Indianer (Abb. 167 und 168) sind im allgemeinen von übermittelgroßer, kräftiger, ebenmäßiger Gestalt, die hier und da wohl sehr niedrig (Pueblos), aber auch wieder ausnehmend hoch (Irokesen, Patagonier) ausfallen kann. Ihre Hautfarbe ist kein Rot, wie Laien fälschlich annehmen, sondern ein rötliches ober gelbliches Braun; es kommen dabei alle Schattierungen von Schwarzbraun bis zum Hellbraun vor. Das Kopfhaar ist grob, straff, schwarz mit bräunlichem Glanze, oft sehr lang (auch beim männlichen Geschlecht). Am übrigen Körper wie auch im Gesicht ist das Haarsystem spärlich entwickelt; der Bart wird übrigens meistens entfernt (Abb. 169). Die Schädelform ist im allgemeinen kurzköpfig, es kommen aber auch langköpfige Stämme vor. Die Stirn ist gut gewölbt, das Gesicht breit, oval oder rund. Die Augen sind stets schwarz und liegen tief. Die Nase ist durchweg groß und vortretend, ihr Rücken gerade oder gebogen (Adlernase).
Die nordamerikanischen Indianer lassen sich in wirtschaftlicher Hinsicht in drei Gruppen unterscheiden. Die meisten von ihnen stehen auf der Stufe der Hackbauern, sind daher seßhaft und besitzen wohlangelegte Häuser. Eine zweite Gruppe, die Prärieindianer — die bekanntesten die Sioux —, liegen hauptsächlich der Jagd (auf Büffel, Elch, Biber und Hirsch) ob, sind daher stets auf der Wanderschaft begriffen und führen ihre Behausung in Form eines zerlegbaren Zeltes aus Fellen mit sich (Abb. 170 und 171). Die dritte Gruppe endlich bilden die Indianer Kaliforniens und Oregons; sie stehen alle noch auf recht niedriger Stufe. Sie verfügen zum Teil wohl schon über feste Häuser (Rundbauten), zum Teil nur über Windschirme. Ihre Nahrung beziehen sie durch Einsammeln von Pflanzen und Früchten (im besonderen Eicheln). Unter den Prärieindianern stand früher die Lederbereitung in Blüte; dementsprechend bestand auch ihre[S. 141] Kleidung ausschließlich aus diesem Stoffe, den bekannten Leggins (Beinfutteralen), den Mokassins (Schuhen), einem Ärmelwams und einem großen Mantel aus Büffelfell (Abb. 172). Die meisten Indianer kleiden sich heute bereits nach Europäerart.

Die Pueblos weisen eine ganz besondere Kultur auf, für die unter anderem die Bauart ihrer Siedelungen bezeichnend ist. Es sind dies die sogenannten Dorfhäuser auf isolierten Plateaus (Abbildung 173) oder auch in der Ebene, die einen ganzen Stamm beherbergen (deswegen Pueblos genannt) und daher aus zahlreichen einzelnen Zellen sich terrassenartig und gleichzeitig reihenweise über-, neben- und untereinander aufbauen; der Zugang zu ihnen ist nur auf Leitern möglich. Die Pueblos betreiben Ackerbau; einige Stämme verfügen über eine hochentwickelte Fertigkeit auf dem Gebiete der Flechtkunst, Weberei und Keramik (Hopi) (Abb. 174 und 175). Eigenartig ist das Verfahren der Puebloindianerinnen beim Frisieren des Haares (Abbildung 176 und 177).
Die nordamerikanischen Indianer glauben, sofern sie nicht zum Christentum übergetreten sind (Abb. 178 und 179), an eine Welt von Geistern, die der durch die fünf Sinne sich offenbarenden materiellen Welt nach ihrer Meinung übergeordnet ist. Die Geister (Abb. 180) befinden sich überall: in der Erde, in der Luft, im Feuer und im Wasser, wie überhaupt in allem, was von diesen vier Elementen umschlossen ist. Townshend führt hierfür eine interessante Beobachtung an. Er versuchte einmal einem Navajo einen neuen Bogen, den dieser sich selbst angefertigt und bereits zu einem glücklichen Schuß auf einen Hirsch benutzt hatte, abzukaufen, erhielt aber eine abschlägige Antwort. Der Indianer wollte ihn auf keinen Fall abgeben, denn, wie er sagte, besitze sein neuer Bogen, obwohl seiner Hände Werk, jetzt einen eigenen Geist,[S. 142] und der erste Schuß habe ihm bewiesen, daß dieser ihm freundlich gesinnt sei; daher getraue er sich nicht, sich von dem Bogen zu trennen. Dieser Mann erkannte wohl die guten Eigenschaften des Bogens, wie seine gelungene Form, die Straffheit seiner Sehne und die Dehnbarkeit an, dachte sich aber dahinter in dem Bogen ein Wesen mit einem, seinem eigenen ähnlichen Empfinden, das imstande und auch gewillt sei, ihm auf der Jagd zu helfen und unter Umständen zu schaden. In ähnlicher Weise denken sich die Indianer die ganze Welt um sich her von unzähligen Geistern bevölkert, deren Verhalten gegen sie von ganz unberechenbarer Bedeutung sei.



Die Algonkinsprache besitzt ein Wort manito oder manitou, das man oft als eine verallgemeinernde Bezeichnung anwendet, um damit die Summe der geheimnisvollen Mächte hinter der sinnlichen Welt auszudrücken. Kitchi Manitou oder großer Geist faßt man dann gleichsam als gleichbedeutend mit Gott auf. Inwieweit dieser Gedanke an einen großen Geist, der alle übrigen in sich einschließt, auf christliche Lehren, die die Missionare im Lauf der Jahrhunderte übermittelten, zurückzuführen ist, läßt sich schwer sagen. Die Vorstellung von einem großen Geist ist aber zweifellos unter den Indianern weitverbreitet, und je höher ein Stamm entwickelt ist, um so deutlicher tritt sie in die Erscheinung. Doch gilt dieser große Geist nicht immer für so gütig, wie er mächtig ist. Die Sioux- und Foxindianer schildern Kitchi Manitou in ihrer großartigen Schöpfungssage als ein Wesen, das seine Kinder erschlagen ließ aus Furcht vor ihrer Rivalität und zur Strafe dafür in eine Indianerhütte an der Küste des Weißen Stromes am Firmament (unsere Milchstraße) verbannt wurde. Sein ihn überlebender Sohn Wi-sa-kae machte die üblichen Abenteuer eines Kultheros durch: er versuchte[S. 144] auf den Flügeln des Bussards, der damals so bunte Farben wie ein Papagei trug, zu seinem ihm befreundeten Ahn, der Sonne, aufzufliegen. Der hinterlistige Bussard glitt aber unter ihm weg, und der Held fiel auf die Erde, wobei er nur mit knapper Not der Gefahr entging, in Stücke zerschlagen zu werden. Zur Strafe wurde das ganze Bussardvolk dazu verurteilt, Erdarbeiten zu verrichten, um die Erde für die Menschen, die Wi-sa-kae zu erschaffen gedachte, vorzubereiten. Auch haben von der Zeit an die Bussarde ihre prächtigen Farben verloren und sind dem Haß und der Verachtung der Menschen preisgegeben. Darauf schuf Wi-sa-kae aus roter Erde die Menschheit, lehrte sie allerlei Künste und Tänze und machte sie mit der Jagd und dem Maisbau bekannt, überhaupt mit allem, was zu ihrem Glück nötig war. Als er dies alles getan hatte, sagte er den Menschen lebewohl und teilte ihnen zugleich mit, daß er nach dem Norden gehe und in Eis und Schnee sich eine Hütte bauen wolle; er werde sie aber alljährlich beim ersten Schneefall wieder besuchen und eines Tages in seiner eigenen Gestalt, doch in Jugend und Schönheit, wieder vor ihnen erscheinen, um die Menschen dann in das glückliche Land im Westen zu führen, wo sein Bruder über die Geister ihrer Ahnen regiere; darauf werde er selbst wieder umkehren und die Welt, aus der er sie fortgeleitet hätte, zerstören. Diese Erwartung der Wiederkunft des Helden besteht bei den Indianerstämmen fast durchweg. Wie[S. 146] man in Europa während des Mittelalters von der Wiederkehr des Königs Artus, Karls des Großen und Barbarossas träumte, so erhofft der Indianer Nordamerikas fast täglich das Wiedererscheinen des Wi-sa-kae. Townshend beobachtete, wie die Pueblos jeden Morgen, in ihre Decken gehüllt, auf den flachen Dächern ihrer Häuser standen und Ausguck nach Osten hielten, von wo sie den Messias, der von ihnen gegangen, zurückerwarteten. Von Peru, Yukatan und Mexiko an bis zu den Jagdgründen des weiten Nordens warten die Indianer auf die Wiederkehr ihres halbgöttlichen Heros, der sie die Künste des Friedens und des Krieges lehrte. Nicht immer aber wird dieser Held für so wohlwollend und gerecht gehalten, wie die Sioux den ihrigen hinstellen; die Indianer schufen sich eben ihre Götter nach ihrem eigenen Ebenbild, und so war ihr Held nur zu oft mit denselben Tugenden und Lastern ausgestattet wie die Indianer selbst.



Selbstverständlich hat kein Stamm seine Überlieferungen unverändert zu erhalten vermocht; da sie von Geschlecht zu Geschlecht sich vererbten, ist manches vergessen oder falsch verstanden worden, und da auch die Lebensweise der Menschen sich manchmal änderte, so hielten die übernatürlichen Wesen damit Schritt und paßten sich den neuen Forderungen an, indem auch sie sich änderten. Die Navajo zum Beispiel, ein unstetes Hirtenvolk, haben keinen Oberhäuptling und denken sich ihre Geisterwelt ebenso demokratisch, wie sie selbst es sind. Sie glauben daher an viele mächtige Geister, die von ihnen versöhnt werden müssen, kennen aber kein höheres Wesen, das die übrigen beherrscht. Interessant ist es, daß der bedeutendste dieser Geister, Estsanatlehi, das heißt „die Frau, die jung ist“, als weiblichen Geschlechtes gilt. Es ist nicht unwahrscheinlich, daß man diese Vorstellung der Natur entnommen hat, die gegen Ende des Jahres alt wird und sich in jedem Frühjahr verjüngt. Dieser Geist, der auch unter dem Namen Whailahay bekannt ist, gilt für das höchste Wesen in der Welt der Abgeschiedenen, wo[S. 147] es die Flußübergänge bewacht, die überschritten werden müssen, um zu den glücklichen Jagdgründen oder Weideplätzen der Geister zu gelangen. Whailahay nimmt sich ihres Geschlechtes sehr an: ein Navajo, der bei Lebzeiten seine Frau mißhandelt hat, findet schwerlich Gnade vor ihr, wenn er den Fluß, der zum Paradies seines Stammes führt, überschreiten will. So kommt es, daß die Frauen der Navajo ganz im Gegensatz zu denjenigen anderer Stämme, die gewissermaßen nichts sind als geduldige Arbeitstiere, sich in hohem Grade am öffentlichen Leben beteiligen.
Welcher Art oder welchen Geschlechtes die Geister auch sein mögen, um deren Gunst sich die Indianer bemühen, alle müssen von ihnen in erster Linie durch besondere feierliche Handlungen, vor allem Tänze (Abb. 182), besänftigt werden. Vor einem solchen Zeremonialtanz unterziehen sie sich gewöhnlich einer Läuterung, entweder durch längeren Aufenthalt in einem Schwitzhaus oder durch Fasten; danach erscheinen sie entkleidet und bemalt, mit Masken und Perlen geschmückt, sowie mit Fuchsschwänzen und grünen Girlanden behängt, tanzen in langsamem, feierlichem Reigen und rufen die Geister an, daß sie ihnen Sonnenschein oder Regen, Fruchtbarkeit oder erfolgreiche Jagd gewähren. Die Pueblos und unter ihnen namentlich die Hopi pflegen Tänze, meist Maskentänze (Abb. 181, 183, 184, 185 und 188 sowie die farbige Kunstbeilage) aufzuführen, um sich die Hilfe ihrer Stammesahnen zu sichern; Maismehl oder Blütenstaub wird verstreut, wenn es sich darum handelt, die Erntegeister anzugehen. Menschenopfer werden wohl nur noch äußerst selten dargebracht. Von den Pawnees wird berichtet, daß sie vier Tage und ebensoviel Nächte tanzten, bevor sie ihrem höchsten Geist, Triava, Menschen opferten, um Kriegsglück und eine gute Ernte von ihm zu erlangen.

[S. 148]
Tänze sind indessen nicht die einzigen religiösen Handlungen, mit denen die Indianer sich ihren höheren Mächten nähern. Die Navajo zum Beispiel tanzen wenig, sie lassen dafür ihre Priester Gebete an die Götter richten und fromme Lieder dazu singen, auch ihnen Perlen- oder Federschmuck sowie Zigaretten opfern, die sie mit feststehenden Mustern bemalen. Ihre eigenartigste Anbetung besteht jedoch in der Herstellung heiliger Bilder im Sande, den sie auf dem Boden ihrer Medizinhütten ausbreiten. In ihm stellen sie Götterbildnisse nach überlieferten Mustern dar, indem sie Pulver verschiedener Färbung auf den glatten Sand streuen. Außerdem wird als Opfergabe noch Blütenstaub oder Maismehl über diese Figuren gestreut. In Krankheitsfällen werden Prisen des heiligen Sandes als Medizin verabreicht, bei einem lahmen Fuß zum Beispiel etwas von dem die Füße bildenden Sande, bei Kopfschmerz Sand vom Haupte des Gottesbildes und so weiter. Was dann von dem Bilde noch übrig bleibt, wird hinausgefegt.
Die Puebloindianer blasen bei ihren gottesdienstlichen Handlungen Daunenbläschen in die Luft, damit diese zusammen mit ihren Gebeten in die Höhe steigen.


Die Hopi führen einen besonders interessanten Tanz auf, den Schlangentanz. Er findet im August statt und dauert jedesmal neun Tage; die Hauptstätte dafür ist Walpi (Abb. 173 und 186). Seine Teilnehmer sind Mitglieder der Brüderschaften der Schlange und der Antilope, die offenbar aus früheren Familientclans hervorgegangen sind und sich zu diesen umfangreichen Gemeinschaften entwickelt haben. Die Priester werden in den Kiwas oder heiligen Kammern zu der ihnen zufallenden Arbeit geweiht; es sind dies Räume, die aus dem Sandsteinfelsen herausgehauen wurden und[S. 150] nur von oben her, mit Hilfe einer Falltür oder Leiter (Abb. 187), Zutritt gestatten. Adlerfedern, Wiesel- und Stinktierfelle schmücken die oberste Sprosse der Leiter. Man schafft bunten Sand in die Kiwas, der, ähnlich wie bei den Navajo, in einem kunstvollen Mosaik von überlieferten Mustern und religiöser Bedeutung zu Altären und Bildnissen verarbeitet wird (Abb. 189). Um die derart errichteten Altäre werden heilige Abzeichen und Fetische aufgestellt. Ferner wird ein Zaubertrank aus Kräutern, Honig und Kornblütenstaub zurechtgebraut und eine geweihte Pfeife mit großer Feierlichkeit nach den sechs Himmelsrichtungen zu geraucht. Die Hopi zählen deren nämlich sechs: Nordwesten, Südwesten, Südosten, Nordosten, Zenith und Nadir; jeder dieser Richtungen ist eine besondere Farbe und Gottheit zugeteilt. Die Festlichkeiten (Abb. 190 und 191) werden mit der Jagd auf Schlangen eingeleitet. Bei ihrem Beginn treten die Schlangenpriester, nur mit einem Lendenschurz und Mokassins bekleidet, mit aufgelöstem Kopfhaar hervor; sie sind mit einem Schlangenbüschel (Abb. 166), das aus einer oder zwei Adlerfedern an einem Griffe besteht, einem langen Stock zum Graben oder einer Hacke und einem Lederbeutel ausgerüstet. Jede Schlange, ausgenommen Wasserschlangen, wird von ihnen aufgestöbert. Treffen sie auf eine giftige, dann fahren sie mit dem Schlangenbüschel über sie hin; dies scheint eine Art hypnotischer Wirkung auf das Tier auszuüben, denn es verhält sich daraufhin ruhig. Nun ergreifen sie mit der einen Hand die Schlange beim Genick, oder, falls dies nicht möglich ist, beim Schwanz, lassen die andere Hand rasch bis zum Halse gleiten und stecken sie in den Beutel. Sind die Beutel gefüllt, dann bringen die Priester sie nach der Kiwa, wo geschickte Hände die Schlangen in große irdene Gefäße legen. Hier verbleiben sie für den Rest der Festtage; sie werden von den Priestern in einem heiligen Wasser gebadet, in heiligem Maismehl gerollt und zusammen mit den Fetischen in dem Sandmosaik des Altars gewälzt. Eine große Rolle spielen bei den Feierlichkeiten noch die Bahos oder Gebetstäbchen. Es sind dies lebhaft gefärbte, befiederte Stäbchen oder Brettchen von verschiedener Länge (wenige Zentimeter bis zu einem halben Meter, je nach ihrer Aufgabe), die man allenthalben, vielfach in Gruppen zusammengestellt, bald in der Nähe der Dörfer, bald auf freiem Felde, in Felsspalten oder im Triebsande antrifft; die Bahos sind von großer Bedeutung im Leben der Pueblos. Am häufigsten trifft man sie in nächster Nähe der Niederlassungen an, wo sie auf einem bis zu etwa einem Meter hohen Aufbau, einer Art Altar, neben Opfern der üblichen Art, darunter Flußgeröll, absonderlich geformte Steinknollen, Bruchstücke versteinerten Holzes sowie abgenutzte und zerschlagene Steingeräte, liegen. In weiterer Entfernung von den Dörfern finden sich die Bahos in Felsnischen aufgestellt. Die Bahos sind, wie gesagt, aus bestimmten Holzarten hergestellte Stäbchen oder Brettchen, die man mit bunten Farben anmalt und mit gewissen Kräutern, Vogelfedern, Baumwolle und mit einem mit Mehl oder Honig zur Nahrung des Baho angefüllten Maisblattsäckchen besteckt. Die Anfertigung geht unter bestimmten Förmlichkeiten (Rauchen vor und nach der Herstellung, Sprechen von Gebeten) vor sich. Diese Gebetstäbchen sollen eine Vereinigung von Symbolen darstellen, deren Deutung im einzelnen vielfach unsicher ist, und, nachdem sie geweiht sind, vermittelnd zwischen Gläubigen und Göttern wirken. Das Wesen des Baho ist einmal eine Bekräftigung oder Verkörperung des mündlichen Gebets, weiter aber auch ein symbolisches Gebet und schließlich noch eine Huldigung für die Götter beziehungsweise ein Opfer für sie. Oft werden zwei Bahos aneinander gebunden, sie sind dann das Sinnbild von Mann und Frau.
Während des Schlangentanzes der Hopiindianer nun werden solche Gebetstöcke auf dem Altar aufgestellt und hierauf während der ganzen neun Tage beständig Gebete gesprochen und andere feierliche Handlungen vorgenommen. Priester und Schlangen leben Tag und Nacht in der Kiwa zusammen. Am sechsten Tage wird in der Kiwa der Antilopengemeinde ein Mysterium[S. 151] über den Ursprung der Schlangenbrüderschaft aufgeführt. Zu diesem Zwecke werden ein junger Mann der Schlangen- und eine junge Frau der Antilopenbrüderschaft auserwählt und besonders ausgeputzt; der letzteren wird ein geweihtes Kornabzeichen in die Hand gegeben. Beide stellen sich vor dem Altar auf. Der Antilopenhäuptling eröffnet die feierliche Handlung mit einem Gebet, in dem er um reichlichen Regen für die Saat und um eine gute Ernte fleht. Hierauf werden sechzehn überlieferte Gesänge vorgetragen, die zum Thema die Legende von der Entstehung des Schlangenclans haben. Dieser zufolge ging vorzeiten eines Tages ein Hopijüngling mit Namen Tiyo bis an den Rand des Grand Cañon und sah dort die brausenden Gewässer des großen Koloradoflusses. Er baute sich eine Arche und fuhr den Fluß hinab, bis er zum Salzsee kam und in diesem auf einer Insel landete. Hier begegnete ihm die Spinnenfrau (die gleichzeitig auch die Erdgöttin ist); sie war sehr freundlich zu ihm und führte ihn auf einer Regenbogenbrücke über den See in ein anderes Land und hier wieder in eine Schlangenkiwa. Dort hingen Schlangenhäute an der Wand, und die Menschen waren ganz ebenso wie Tiyo selbst Rothäute. Als er dann aber aufgefordert wurde, sich umzusehen, da waren diese Menschen auf einmal mit den Schlangenhäuten angetan und glichen Schlangen. Die Spinnenfrau war unserem Helden nun behilflich, diesen Schlangen ein Mädchen namens Teuamana als Braut für ihn abzugewinnen und beiden die Heimkehr zu erleichtern. Aber erst nach vielen Abenteuern kam das Paar wohlbehalten in der Heimat des Hopijünglings an. Diesem Paar nun ist der Schlangenclan der Hopi entsprungen, und darum können die Leute ohne Furcht mit den wilden Schlangen als mit ihren Brüdern umgehen und sie dazu bewegen, ihre Gebete um Regen in die Geisterwelt zu tragen.


Zahlreiche andere Förmlichkeiten werden von den verschiedensten Indianerstämmen vorgenommen,[S. 152] um ihren Feldern Fruchtbarkeit zu verschaffen. Für gewöhnlich aber sind es Maskentänze, mit denen sie diesen Zweck verfolgen. Die Irokesen führen solche im Januar als sogenannte Neujahrstänze auf. Die Masken (Abb. 193), die sie dabei tragen, sind meistens aus Holz angefertigt und sollen bisweilen schon zwanzig bis hundert Jahre in Gebrauch sein. Sie verlangen Tabak als Opfergabe und sind böse, wenn nicht mit ihnen getanzt wird. Sie gleichen menschlichen Gesichtern mit weitgeöffnetem, breitem oder trichterförmigem Munde, sind meistens aus Holz angefertigt und tragen eine Perücke aus Haaren vom Pferdeschwanz, einen Streifen Büffelhaut, ein Geflecht von Maiskolbenhülsen und anderes derart. Ohne Zweifel sollen sie Vegetationsdämonen vorstellen. Die mit ihnen bekleideten Tänzer stecken in Anzügen aus zerrissenen Kleidern oder Maishülsen und haben darunter allerlei umfangreiche Gegenstände angebracht, so daß sie Krüppeln oder Mißgestalteten ähnlich sehen; sie tragen ferner eine Rassel und Keulen in den Händen. Ein derartiger Maskentanz wird von einem Augenzeugen folgendermaßen geschildert: Die Tänzer erschienen vor dem Beratungshause, wo sich die Männer versammelt hatten, und schlugen mit ihren Rasseln und Knütteln unter seltsam grunzenden Ausrufen an die Wände des Hauses. Die Schläge wurden immer heftiger, der Lärm immer ohrenbetäubender. Plötzlich flog die Tür auf und die Tänzer erschienen; sie krochen aber auf allen vieren herein, wanden sich dabei wie Krüppel und schüttelten ihre Rasseln und Stöcke über den Boden hin. Erst in der Mitte des Raumes richteten sie sich auf. Der Tanz dauerte nur kurze Zeit, worauf die Tänzer nach ihrem Gefallen im Beratungshause umhergingen und durch ihre Masken die Frauen anstierten und den Kindern[S. 153] Furcht einflößten. Gelegentlich rief der Leiter der Festlichkeit diesen und jenen von ihnen herbei, gab ihnen etwas Tabak, nachdem er solchen schon vor Beginn des Tanzes an alle Teilnehmer wohl als Opfergabe verteilt hatte, und forderte sie auf, noch auf eine bestimmte Art zu tanzen, verschiedene Tiere nachzuahmen oder auch Schlittschuhläufer, Lokomotiven und dergleichen. Dabei kam es zu ziemlich platten und schlüpfrigen Spässen.

Eine eigenartige Regenzeremonie (Abb. 194) kennen die Zuñi, die von einer besonderen Priestergenossenschaft, den zehn Koy-e-á-ma-shi, um die Sommersonnenwende in der Gestalt von Dämonen, zum Teil mit tierähnlichen Masken, ausgeführt wird. Sie stellen sich dabei in einer Reihe auf, wobei sie die Worte Du-mi-chim-chi, Du-mi-chim-chi-a-a singen, und bewegen sich halb gehend, halb trabend unter den Dachtraufen der Häuser hin durch alle Gassen und um die Außenmauern des Dorfes herum. Jeder läßt dabei seine Hände auf den Hüften seines Vordermannes ruhen, der Führer des Zuges hat die seinigen auf die Knie gestützt; die Leute gehen also leicht nach vorn gebeugt und sind, abgesehen von einem groben und rauhen dunkelblauen Tuch um die Lenden, nackt. Während dieser drollige Zug sich unter den vorspringenden Dächern der Häuser fortbewegt, stehen oben die Frauen mit Krügen voll Wasser, das teilweise nicht gerade von reinster Beschaffenheit ist, und gießen es auf die Köpfe und Leiber der Männer aus. Bisweilen wird vor Ankunft des Zuges, während die Frauen auf ihn warten, mit der Hand ein wenig Wasser aus dem Kruge geschöpft und ausgeschüttet, nach der Annahme von Fewkes,[S. 154] dem wir diese Schilderung verdanken, wohl eine Art Opfergabe. Die Mitglieder der Prozession suchen auf jede Weise möglichst naß zu werden und scheinen um so befriedigter zu sein, je mehr sie bei der Begießung eingeweicht werden. Während des ganzen Vorgangs werden nur die oben wiedergegebenen Worte wiederholt. Es handelt sich hierbei offenbar um Vegetationsdämonen, die die Feldfrüchte vertreten und an deren Stelle das befruchtende Naß empfangen. Die Zuñipriester der Koy-e-á-ma-shi beteiligen sich auch an den heiligen Tänzen, den Korkokshitänzen, die gleichfalls den Zweck verfolgen, Regen und gute Ernte zu erzielen. Sie betreten zusammen mit den Koko, den Haupttänzern, das Dorf und treiben allerlei Späße meist schlüpfriger Natur, die unter den Zuschauern sichtlich großes Vergnügen hervorrufen. Obgleich diese unanständigen Vorführungen mit dem eigentlichen Zweck der Feierlichkeit nichts zu tun haben, so geht ihnen sicherlich eine tiefere Bedeutung nicht ab; die beischlafähnlichen Bewegungen, die dabei meistens vollführt werden, sollen die Befruchtung andeuten. Auch die Moki, ein anderer Pueblostamm, kennen ähnliche religiöse Tänze zum Gedeihen des Pflanzenwuchses: die Anakatschina, bei denen die Ausführenden maskiert auftreten. Einer dieser Tänzer, der den Vegetationsdämon Kokopeli darstellt, ist mit einem ungeheuren Phallus und einem vogelartigen Schnabel ausgestattet.

Die kurze Skizze, die im vorstehenden von den religiösen Ansichten der nordamerikanischen Indianer entworfen wurde, gibt bei weitem keine erschöpfende Darstellung dieser Verhältnisse; sie sind viel zu verwickelt und zu verschieden, als daß man sie auf wenigen Seiten abtun könnte. Aber sie dürfte genügen, um einen ungefähren Überblick zu gewähren. Im Anschluß hieran seien dem Totem- und Clanwesen der nordwestlichen Jäger- und Fischerindianer noch einige Worte gewidmet. Bei ihnen zerfällt jeder Stamm in eine Reihe von matriarchalischen Clans oder Sippen mit je einem festen Totem. Unter einem Totem wird ein bestimmtes Tier (viel seltener eine Pflanze) verstanden, zu dem sein Besitzer in einem verwandtschaftlichen Verhältnis zu stehen glaubt, insofern er es für seinen Ahnherrn hält. Die Bilder des Totems, meistens ein Bär, Wolf, Adler, Rabe, Biber oder Walfisch, werden auf allen möglichen Gebrauchsgegenständen, Werkzeugen, Booten, Häusern und so weiter entweder in Malerei oder in erhabener Arbeit angebracht, ja selbst auf dem Körper eintatauiert. Vor den Häusern der Häuptlinge werden mächtige, bis zu zwanzig und mehr Meter hohe, längsgeteilte Stämme aus Zedernholz errichtet, die auf ihrer Rundseite mit allerhand Tieren in erhabener Darstellung bedeckt sind, sogenannte Totem- oder Wappenpfähle (Abb. 192). Diese Darstellungen beziehen sich auf den mutmaßlichen Ahnherrn und die verschiedensten Totemtiere aus der Sage des Clans; das oberste Bild gibt das Totemtier des Besitzers, das darunter befindliche das seiner Frau wieder. Die Sage des Clans kommt übrigens auch in dramatischen Veranstaltungen der Stämme zum Ausdruck. Clans, die dasselbe Totem besitzen, gelten [S. 156]als unter sich verwandt, selbst wenn sie verschiedenen Stämmen angehören; ihre Mitglieder dürfen nicht untereinander heiraten, sondern sich nur mit Angehörigen fremder Clans verbinden. Das Kind gehört dem Geschlecht der Mutter an (Matriarchat).


Außer seinem Wappentier besitzt jeder Clan noch eine Reihe persönlicher Schutzgottheiten oder Dämonen, die seinen Mitgliedern, sofern sie in die Geheimnisse eingeweiht sind, bestimmte Gaben oder Fertigkeiten verleihen, wie zum Beispiel unverwundbar zu sein, Menschenfleisch essen zu können und dergleichen. Diese Personen bilden Geheimbünde und führen, besonders zur Winterszeit, Maskentänze auf, in denen in dramatischer Weise die Gewinnung des Dämons und die durch ihn erlangten Fähigkeiten zur Darstellung gebracht werden. Die Religion hat mit diesen Geheimbünden wenig zu schaffen, denn eine eigentliche Verehrung der Schutzdämonen besteht nicht. Der vornehmste der zahlreichen Geheimbünde ist der der Hametzen (Hamatsa heißt Menschenfresser), deren Mitglieder in der Tat noch dem Kannibalismus huldigen. Gleich bei der Aufnahme muß der Kandidat den ersten besten Menschen, der ihm entgegenkommt, in den Arm beißen und Blut aus der Wunde saugen. In früheren Zeiten aßen die Hametzen Sklaven, heute verspeisen sie eingetrocknete Leichen, die ein bis zwei Jahre lang in Holzkisten auf Bäumen ausgesetzt waren. Ihr Fleisch wird in Wasser aufgeweicht, von den Knochen abgeschält und dann verzehrt.

Wir können die Beschreibung der barbarischen Bräuche unter den nordamerikanischen Indianern nicht schließen, ohne noch des Skalpierens zu gedenken, des Abziehens der Kopfhaut[S. 158] erschlagener Feinde als Siegeszeichen, einer Unsitte, mit der die Europäer zum ersten Male im Jahre 1520 unter Francesco de Garay während seines unglücklichen Zuges nach Panuco bekannt wurden. Das Skalpieren — der Name ist der englischen Sprache entnommen; Skalp bezeichnet ursprünglich Schale, Hirnschale — ist sowohl bei zahlreichen nordamerikanischen Stämmen, wenngleich nicht bei allen, als auch bei einzelnen südamerikanischen Indianerstämmen (im Chaco und in Guyana) Brauch gewesen; er scheint von den Gebieten um den Golf von Mexiko (Florida) seinen Ausgang genommen zu haben. Die Europäer haben seit der Entdeckung des neuen Erdteils nicht wenig zu seiner Verbreitung beigetragen, indem sie, wie Friederici festgestellt hat, durch ihre Feuerwaffen, die die Kriege viel verlustreicher gestalteten, durch ihre Stahlmesser, die das Skalpieren bedeutend erleichterten, und durch Aussetzen von Belohnungen auf die Herbeischaffung von Skalpen, wodurch das Verlangen nach Erbeutung solcher bedeutend gesteigert wurde, einen ungeheuren Aufschwung der betreffenden Jagden herbeiführten. Friederici hat ferner nachgewiesen, daß das Skalpieren aus den Kopfjagden, die früher sehr gepflegt wurden, hervorgegangen ist; die ursprüngliche Schädeltrophäe verwandelte sich in eine Skalptrophäe, weil die durch die leichtere Gelegenheit und größere Nachfrage stark vermehrte Zahl der erbeuteten Köpfe ihre Beförderung auf beschwerlichen Wegen und große Entfernungen sehr schwierig machte. Deshalb verfiel man auf den Gedanken, sich mit der abgezogenen Kopfhaut zu begnügen, denn nach der Ansicht der Indianer, wie der Naturvölker überhaupt, sind nicht nur Teile des Körpers gleichbedeutend mit ihm in seiner Gesamtheit, sondern auch Teile vom Teil mit dem vollständigen Teil. Die Gründe, die zu den Skalpjagden Veranlassung gaben, waren mannigfacher Natur; es sind ziemlich dieselben, wie wir sie bereits an anderer Stelle bezüglich der Kopfjägerei kennen gelernt haben, nämlich das Verlangen nach Ruhm und Ehre durch Beibringung dieses Zeichens der Tapferkeit, der Glaube an geheime Kräfte, die man sich durch die Erbeutung des Kopfes oder der Kopfhaut seines Feindes anzueignen hoffte, schließlich auch die Rachsucht. Der Vorgang beim Abziehen des Skalps war verschieden, je nach der Art, wie das Opfer das Haar trug. Friederici hat trotz der zahlreichen Haartrachten der Indianer doch zwei Hauptformen festgestellt: bei der einen lag die Skalplocke in der Mitte des Kopfes, hier gab es nur einen Skalp; bei der anderen war das Kopfhaar durch Scheitel oder zwei und mehr geflochtene Zöpfe in mehrere Teile geteilt, was zur Zerlegung der Kopfhaut in mehrere Skalpe führte. Um sich seiner Siegestrophäe zu bemächtigen, setzte der Indianer im ersten Falle seinem am Boden liegenden Opfer einen Fuß oder ein Knie auf Brust, Nacken oder Rücken, ergriff mit der linken Hand die Haare und zog sie fest an, während seine Rechte mit dem Messer oberhalb oder unterhalb der Ohren einen Kreis um den Kopf zog. Das ganze Abziehen, bei dem manchmal die Zähne, ein Strick oder die Bogensehne mithalfen, wurde bei einiger Geschicklichkeit in kaum einer bis zwei Minuten ausgeführt. Ein auf diese Weise gewonnener Skalp war verhältnismäßig groß und mußte, um echt zu sein, die Krone des Scheitels aufweisen. War der Haarschopf geteilt, so wurde eine Handvoll Haare oder einer der Zöpfe erfaßt, die Haut emporgehoben und mit dem Messer darunter durchgefahren; auf diese Weise wurden mehrere Skalpe beziehungsweise ein mehrteiliger Skalp gewonnen. Die blutige Trophäe pflegte der Sieger unter lautem Geheul in die Höhe zu halten und dann an seinem Gürtel zu befestigen. Die Indianer waren in so hohem Grade auf die Erlangung von Skalpen erpicht, daß sie keine Anstrengung und keine Entfernung scheuten, um in den Besitz des kostbaren Gutes zu gelangen.
Während der Schwangerschaft bestehen auch für die Indianerin, wie wohl überall bei den Naturvölkern, gewisse Vorschriften, die sie befolgen muß, damit das Kind keinen Schaden nehme, indessen scheinen diese bei den nordamerikanischen Stämmen nicht mehr so streng zu sein wie bei den südamerikanischen. Die Indianerinnen Kanadas essen während ihrer Schwangerschaft[S. 159] überhaupt wenig, und die Utah-Indianerinnen fasten geradezu in den letzten Wochen vor ihrer Niederkunft. — Bei den Ten’a-Indianern Alaskas muß die Schwangere vom dritten Monat an jede Nacht zwei- bis dreimal für etwa eine halbe Stunde ihren Schlaf unterbrechen und diese Zeit über sitzend auf ihrem Lager zubringen, auch am Tage sich körperlich viel betätigen, im besonderen Holz klein machen, wodurch die Geburt einen leichteren Verlauf nehmen soll. Wenn die Kreißende während des Geburtsvorgangs Stuhl oder Wasser unter sich läßt, dann wird dies als eine üble Vorbedeutung für das Kind angesehen. Man zieht in diesem Falle vor, das Neugeborene sogleich zu töten, indem man es unter der Nachgeburt erstickt. Die Ten’a-Indianer pflegen diese in ein Bündel einzuwickeln, zu trocknen und im Walde an einen Baum zu hängen, wo sie ihrem Schicksal überlassen bleibt. Nur wenn eine Frau fernerhin kein Kind mehr bekommen will, vergräbt sie den Mutterkuchen in der Erde und läßt ihn hier verfaulen; noch besser soll dies Mittel wirken, wenn sie ihn zuvor in etwa ein Dutzend Stücke zerreißt. Etwa vorhandenes Kindspech wird an den Handflächen des Kindes gelassen, da man glaubt, daß dies seine Nahrung im Mutterleibe gewesen sei und daß bei Befolgung dieser Vorschrift das Kind in seinem späteren Leben immer reichlich zu essen haben werde. Ist das Erstgeborene ein Mädchen, so halten die Ten’a dies für ein böses Vorzeichen. Nach der Geburt haben sich beide Eltern zwei bis drei Tage lang davor zu hüten, mit einem scharfen Werkzeug, Axt, Messer, Säge und dergleichen zu hantieren; man befürchtet nämlich, daß sie dadurch zufällig den vermeintlichen Lebensfaden des Kindes durchschneiden könnten. Darum holen in dieser Zeit Nachbarinnen und gute Freunde für die Eltern Holz aus dem Walde und zersägen und spalten es auch.


Der Nabelstrang wird vielfach einfach abgebissen, aber auch durchgeschnitten; früher benutzte man dazu ausschließlich Steinmesser. Die Tscheroki vergraben den Nabelstrang der Mädchen unter einem Kornmörser, damit das Kind eine tüchtige Brotzubereiterin werde, den der Knaben aber hängen sie im Walde an einem Baume auf, damit sie sich zu guten Jägern entwickeln. Die Kaiowäh nähen die Nabelschnur der Mädchen in kleine Perlensäckchen ein, die[S. 160] später von diesen am Gürtel getragen und nach ihrem Tode an einem Stock auf ihr Grab gesteckt werden. Die Scheyenne schließen die sorgfältig zusammengelegte Nabelschnur in einen Kasten oder Sack, der außerdem noch Kleidungstücke und Schmuck enthält, und behaupten, daß das Kind nicht eher Ruhe finde, als bis es darin seine Nabelschnur aufgestöbert habe.

Das Neugeborene wird bei vielen nordamerikanischen Indianerstämmen sogleich in kaltes Wasser getaucht, selbst bei strengster Kälte, was ihm im allgemeinen auch gut bekommt, darauf verschiedentlich mit Öl, Butter und Farbe eingerieben. Dadurch soll die Haut widerstandsfähiger gegen die Witterung gemacht werden. — Zwillinge werden verschiedentlich für glückbringend angesehen. Die Dakota halten sie für übernatürliche Wesen, die aus einer anderen Welt, dem Zwillingslande, stammen, und behandeln sie daher mit besonderer Sorgfalt. Die Nootka-Indianer Vancouvers setzen Zwillinge zu den Lachsen in Beziehung und sehen eine Zwillingsgeburt als günstiges Vorzeichen für ein reiches Lachsjahr an. Die Eltern errichten abseits vom Dorfe an einem Fluß im Walde eine kleine Hütte und stellen um sie herum hölzerne Bildnisse und Masken auf, die Vögel und Fische darstellen; in ihr müssen sie zwei Jahre lang fern von ihren Stammesgenossen verweilen. Der Vater muß sich ein ganzes Jahr lang durch Baden reinigen und sein Gesicht rot färben. Beim Baden muß er bestimmte Lieder singen, die nur für diesen Zweck in Gebrauch sind und ein Lob der Lachse sowie die Aufforderung enthalten, sich einzufinden, um die Zwillinge zu sehen. Wenn die Tiere diesen Gesang vernehmen und die zahlreichen Masken erblicken, dann kommen sie in großen Scharen an. Daher wird aus der Geburt von Zwillingen auf ein gutes Lachsjahr geschlossen. Nun kommt es[S. 161] allerdings auch vor, daß die ersehnten Lachsscharen ausbleiben; dann erblickt man darin eine Mahnung, die Zwillinge zu töten. Zwillingen ist es verboten, Lachse zu fangen; auch dürfen sie frische Lachse weder essen noch auch nur berühren. Ebenso dürfen die Eltern während der Zeit ihrer Absonderung weder Lachse essen noch anfassen. Zwillingen werden besondere Kräfte zugeschrieben, zum Beispiel die Fähigkeit, gutes und schlechtes Wetter zu machen. Um Regen zu erzeugen, füllen sie einen kleinen Korb mit Wasser und spritzen dieses in die Luft; um gutes Wetter zu machen, schwingen sie ein Stück Holz, das mit einer Schnur an einem Stock befestigt ist, und um Sturm hervorzubringen, streuen sie von einem Baume die Sprossen der Zweige herab. Solange Zwillinge noch Kinder sind, vermag die Mutter an ihrem Spiel zu erkennen, ob ihr Gatte erfolgreich von seiner Jagd zurückkehren wird oder nicht. Hauen oder beißen sie sich bei ihrem Spiel, dann wird der Mann bei seinem Ausflug von Glück begünstigt sein; verhalten sie sich aber ruhig, dann wird er mit leeren Händen zurückkehren. Ähnlichen Vorstellungen von der Bedeutung der Zwillinge begegnen wir noch bei anderen nordamerikanischen Indianerstämmen.

Fruchtabtreibung ist unter den Indianern ziemlich verbreitet, was zur Folge gehabt hat, daß viele Stämme dem Aussterben nahe sind. Die Gründe, die dazu führen, die Schwangerschaft durch künstliche Mittel zu unterbrechen, sind ziemlich dieselben, die wir schon anderwärts verschiedentlich kennen gelernt haben, wie Furcht vor Überbürdung und Mehrarbeit bei einer zahlreichen Familie, Nahrungssorgen, Besorgnis der Frauen, ihre Schönheit durch zu viele Kinder zu verlieren und frühzeitig zu altern, das verschiedentlich bestehende Gebot, jeglichen geschlechtlichen Verkehr während des Stillgeschäftes, das unter Umständen recht lange dauert, zu meiden, bei unverheirateten Mädchen auch die Furcht vor der Schande und anderes mehr. Auf eigenartige Weise wird die Abtreibung bei den Krähen- und Assiniboin-Indianerinnen vorgenommen.[S. 162] Die Schwangere läßt sich den Bauch kräftig kneten oder wälzt sich auf einem kleinen in der Erde steckenden Pfahl umher; auch streckt sie sich auf dem Boden aus, legt sich ein Brett auf den Bauch und läßt ihre Freundinnen auf dasselbe herauf- und hinunterspringen, bis die Frucht abgeht. Auch das Aussetzen neugeborener Kinder aus Mangel an Nahrungsmitteln ist bei einer Reihe Indianerstämme üblich. — Die Indianerin pflegt ihre Kinder ziemlich lange zu säugen, meistens zwei bis drei Jahre lang, aber auch Zeiträume von sechs bis sieben Jahren sind keine Seltenheit.
Die Odschibwä und andere nordamerikanische Stämme veranstalten bei der Geburt eines Kindes eine besondere Feierlichkeit religiösen Charakters. Kind, Eltern und Verwandte kommen mit den Medizinmännern im Tempelwigwam zusammen; letztere tanzen umher und machen mit ihren Trommeln und Kalabassen großen Lärm, während das Kind in der Mitte des Raumes liegt. Nach Beendigung dieser Feierlichkeit geben sie dem Vater Zaubermittel und Amulette, die für das Gedeihen des Kindes von Wert sein, im besonderen Schutz gegen Krankheit gewähren sollen.

Für gewöhnlich pflegen die Indianer ihren Kindern sogleich nach der Geburt oder doch nur kurze Zeit danach einen Namen zu geben, manchmal allerdings erst bei der Entwöhnung. Auch wird der ursprüngliche Name gelegentlich geändert, zum Beispiel bei Eintritt der Mannbarkeit oder eines ungewöhnlichen Ereignisses oder infolge besonders hervorragender Eigenschaften des Betreffenden. Maßgebend für den dem Kinde beizulegenden Namen sind entweder feste Regeln (in bestimmter Aufeinanderfolge) oder die Namen gewisser Tiere beziehungsweise von Teilen solcher und ihren Eigenschaften, wie roter Fuchs, weißer Marder und so weiter. Die Foxindianer legen ihren Kindern Namen bei, die zu dem Stamme des Vaters in Beziehung stehen; ist ein Stamm zum Beispiel dem Adler zugeordnet, so erhalten die Kinder Namen wie „Grauer Adler“, „Habicht“, „Große Feder“, „Großer Schnabel“ und so fort.
[S. 163]

Sehr verbreitet ist unter den nordamerikanischen Indianern die Unsitte der Schädelverunstaltung bei Kindern. Allerdings ist diese oft genug nicht beabsichtigt, sondern rührt von der eigentümlichen Form der Wiegen her, in denen die Frauen ihre Kleinen unterbringen und beständig belassen. Meistens sind diese Wiegen trogartig ausgehöhlte Brettchen, auf denen das Kind in ausgestreckter Haltung mit Riemen oder Bindfäden festgeschnürt wird. Einer dieser Querriemen pflegt auch über die Stirn beziehungsweise über ein auf ihr ruhendes Polster geführt zu werden, ein Kissen von Gras oder auch ein dreieckiger Klotz mit aufgerichteter Kante als Stützpunkt für den Nacken des Kindes zu dienen. Die Mutter führt ihr in solcher Wiege fest verschnürtes Kind gewöhnlich mit sich, wobei sie es an einem um ihre eigene Stirn gehenden Riemen oder an Achselbändern auf dem Rücken trägt; bei der Arbeit stellt sie die Wiege mit dem Kinde neben sich oder hängt sie am nächsten Baume auf. Zu Hause stellt sie sie an dem Pfosten der Hütte hin. Auf jeden Fall wird das Kind beständig in senkrechter Stellung gehalten und, damit es nicht rutscht, festgebunden; die Mutter pflegt es nur für kurze Zeit aus seiner Umschnürung herauszunehmen. Es leuchtet ein, daß durch eine derartige Vorrichtung auch die Form des kindlichen Kopfes beeinflußt werden muß, zumal wenn dieser als Schirm gegen die Sonnenstrahlen noch ein hartes Schutzdach erhält, das dem Schädel ebenfalls fest angepreßt wird. Die so entstehende Form läßt den Kopf von vorn nach hinten zusammengedrückt, abgeflacht und nach oben zu keilartig verlängert erscheinen. Zum Teil hilft man sogar einer derartigen Verunstaltung noch absichtlich nach, wenigstens wird von einer Reihe nordamerikanischer[S. 164] Stämme (zum Beispiel den Tschinuk, Natchez, Creeks, Maskoki, Athacapenen und anderen) berichtet, daß sie die Binden um den Kopf von Zeit zu Zeit immer fester anziehen. Ein Stamm der Selisch, bei dem die Schädelverunstaltung ganz besonders auffiel, wurde früher von den Europäern deswegen die Flatheads oder Flachköpfe genannt.

Die Indianer behandeln ihre Kinder im allgemeinen freundlich, teils weil sie an sich recht gutmütig zu sein pflegen, teils mit Überlegung, um zu verhüten, daß das Gemüt der zukünftigen Krieger eingeschüchtert, ihre Willenskraft gebrochen werde. Daher sind die Indianerkinder sehr frühzeitig selbständig, mutwillig und ungehorsam gegen ihre Eltern. Wie unsere Kinder treiben auch sie Spiele. Die Mädchen mögen Puppen gern — schon in den vorgeschichtlichen Mounds hat man solche gefunden —, die sie wie unsere Mädchen versorgen und in Wiegen schaukeln; die Knaben spielen mit Bällen und Kreiseln, Pfeil und Bogen, handhaben die Schleuder und so fort. Es reizt sie wie alle Kinder, die Hantierungen der Erwachsenen nachzuahmen; vielfach werden sie zu solcher Beschäftigung auch schon frühzeitig von Vater und Mutter angehalten, die Mädchen zum Kochen, Feueranzünden, zum Besorgen von Zelt oder Wigwam, die Knaben zum Gebrauch der Waffen, zum Jagen und Reiten — bei den Krähenindianern wird ihnen dieses, wie Irving sah, schon im dritten Lebensjahre beigebracht —, zur Verfolgung von Fährten und zum Viehhüten. Auch Bewegungspiele im Freien sind sehr beliebt. Bei den Choctaw war früher ein gemeinsames Spiel der Männer und Knaben sehr in Gebrauch, mit verbundenen Augen durch einen breiten Fluß zu schwimmen und an einem bestimmten Ziel zu landen, oder in Felle und Decken eingewickelt einen Hügel hinabzurollen; wer zuerst am festgesetzten Mal anlangte, war Sieger. Eines der Lieblingspiele der Omahakinder besteht darin, daß sie sich, etwa zehn bis zwanzig Kinder hintereinander, in einer Reihe aufstellen, die Knaben unter acht Jahren nackend bis auf eine Schnur, die um ihren geschmeidigen kleinen Körper gebunden ist, die Mädchen mit einem kurzen Rock angetan, und daß nun jedes Kind den Gürtel des vor ihm stehenden erfaßt und alle watschelnd im Gänsemarsch davontraben, im Takt eines im Kauderwelsch gesungenen Liedes. Während des Zuges, der um Bäume herum- und zwischen Zelten hindurchführt, wird allerlei kleiner Unfug verübt. So passen sie zum Beispiel die Gelegenheit ab, einer alten Frau, die gerade mit Maisstampfen beschäftigt ist, eine Rispe fortzureißen; versucht diese nun der Kinder habhaft zu werden und sie zu bestrafen, dann rennen sie auseinander, um Deckung in irgendeinem Versteck zu finden. Ein unter den Tschippewäindianern sehr beliebtes Spiel ist ein Schlagball, wobei sie aber nicht mit einem Scheit Holz, sondern mit einem aus ledernen Riemen geflochtenen Netz von der doppelten Größe des Balles den im vollen Lauf befindlichen Ball auffangen und über die Köpfe der Spielenden zurückschleudern;[S. 165] der Gegner hat dabei die Aufgabe, dem Ball möglichst schnell eine andere Richtung zu geben. Manchmal bilden die Kinder auch einen Kreis um das Herdfeuer in der Hütte, und Großvater erzählt ihnen dann Geschichten aus alter Zeit oder singt ihnen Lieder vor, zu denen sie tanzen.

Die angehenden Jünglinge der Indianer sind oder waren wenigstens früher Mutproben unterworfen, wenn sie in den Kreis der Krieger aufgenommen werden wollten; zu diesem Zweck hatten sie entweder strenge Entbehrungen, selbst Martern zu ertragen (mußten sich mit Ruten oder Dornen, ohne einen Seufzer auszustoßen, peitschen lassen, längere Zeit fasten, viel umherstreifen, ohne sich ausruhen zu dürfen, sich dem Sonnenbrand oder der bitteren Kälte aussetzen) oder sie mußten ihre Gewandtheit und Ausdauer im Bändigen junger Füllen, im Pfeilschießen und Schleudern darlegen. Bestanden sie diese Mutproben, dann wurden sie öffentlich zu Kriegern erklärt. Meist waren damit noch andere feierliche Bräuche verbunden; so mußten die Novizen die ganze Nacht hindurch Tänze aufführen, die ihnen von älteren Männern vorher beigebracht worden waren. Natürlich pflegte ein Mahl die Feierlichkeit zu beschließen. Wie schwer es den jungen Männern gemacht wurde, in den Stand der Krieger Aufnahme zu finden, dafür hier einige Beispiele. Besonders grauenerregend waren die Quälereien bei den Mandan. Nachdem der Jüngling vier Tage lang gefastet und die Nächte schlaflos zugebracht hatte, stießen ihm zwei als Masken verkleidete Männer ein spitzes Messer mit ausgezackter Klinge an verschiedenen Stellen des Körpers ins Fleisch und schoben spitze Holzpflöcke von der Dicke eines Fingers in die Wunde. An diese Pflöcke wurden dann Stricke befestigt und an ihnen der Gemarterte, der überdies noch durch Anhängen von Medizinbeuteln, eines Schildes und mehrerer Büffelköpfe beschwert ward, so weit in die Höhe gezogen, daß er die Erde nicht mit den Füßen berühren konnte. Nun drehte man den Aufgehißten um sich selbst, anfänglich langsam, dann immer schneller, bis er das Bewußtsein verlor. Nach fünfzehn bis zwanzig Minuten nahm man ihn herab und entfernte einen Teil der Pflöcke aus Brust und Schultern, während man andere im Körper stecken ließ. Damit waren die Martern aber noch nicht erschöpft. Zunächst wurde dem Jüngling zu Ehren des großen Geistes der kleine Finger, manchmal auch noch der Zeigefinger abgehackt, und dann schleppte man ihn ohne Schonung in wildem Lauf um die Medizinhütte herum, wobei er noch alle obengenannten Anhängsel mit sich führen mußte; endlich riß man ihm diese nebst den Pflöcken ab. Sobald das Bewußtsein wiedergekehrt war, erhob sich der Unglückliche und kroch nach seinem Wigwam zurück, wo ihm seine Wunden verbunden wurden. Bei den Scheyennen war die Folter kaum geringer. Dem Knaben wurden ebenfalls Einschnitte unter die Haut gemacht; durch diese zog man[S. 166] Riemen, mit denen das Opfer an einen Pfosten außerhalb des Dorfes gebunden wurde. Hier überließ man es seinem Schicksal. Seine Aufgabe bestand nun darin, sich von den Riemen zu befreien, die unter der Haut durchgezogen waren. Die meisten Knaben harrten einige Tage aus, bis infolge der Eiterung die Haut so weit gelockert war, daß die Hautbrücken mit Leichtigkeit durchrissen. Wer aber besonders mutig war, ergriff entschlossen mit beiden Händen die Riemen und führte sägende Bewegungen aus, bis er sich nach Verlauf einiger Stunden befreit hatte. Ein Knabe, der sich seiner Fesseln auf diese Weise entledigt hatte, erntete das Lob aller Männer und wurde als mutmaßlicher späterer Anführer auf dem Kriegspfade angesehen. Sobald ein Knabe losgekommen war, wurde er unter großer Ehrenbezeigung in das Lager zurückbegleitet und hier mit aller Sorgfalt gepflegt. Solange er an der Stange befestigt gewesen war, hatte er in der Hitze großen Durst ertragen müssen; die Frauen kamen mit ihren Wasserkannen wohl ganz in seine Nähe, aber keine bot ihm Wasser an, um seinen rasenden Durst zu löschen. Allerdings stand es ihm völlig frei, sich Wasser zu fordern, und ebenso, sich die Riemen durchschneiden zu lassen. Man hätte ihm willfahrt; aber dann hätte er die Folgen seines feigen Verhaltens auf sich nehmen müssen: er wäre nicht für einen Mann, sondern für eine Squaw (Weib) angesehen worden, hätte Frauenarbeit verrichten und Frauenkleider tragen müssen; anderseits hätte er keine Waffen tragen, nicht jagen, nicht in den Krieg ziehen dürfen; eine weitere Folge wäre gewesen, daß es jedes Mädchen abgelehnt hätte, einen solchen Weichling zum Manne zu nehmen. Diese entehrenden Folgen genügten fast immer, die jungen Leute die grausame Marter mit spartanischer Seelengröße ertragen zu lassen. Townshend schätzte seinerzeit, vor etwa vierzig Jahren, die Zahl dieser männlichen Squaws auf kaum mehr als zwei bis drei innerhalb des ganzen Stammes.
Auch die Indianermädchen haben sich bei Eintritt der Reife gewissen Förmlichkeiten zu unterziehen; meistens haben sie sich während der ersten Regel in eine besondere Hütte abseits des Dorfes zurückzuziehen und hier vollständig abgesondert zu leben. Nur die Mutter oder eine alte Frau dürfen sie besuchen; manchmal gehört Enthaltung von Speise und Trank mit zur Vorbereitung. Bei einigen Stämmen wird dem Mädchen auch das Gesicht angeschwärzt und ihm ein alter Hut mit großer Krempe aufgesetzt (damit es nicht durch seinen Blick den Himmel verunreinige) oder ein ganzer eigener Anzug angelegt. Nach Ablauf dieser Einschließung, die bei den Koluschen und Tinklit früher beinahe ein Jahr dauerte, pflegt man das Mädchen zu waschen, neu zu kleiden, bei den soeben genannten Stämmen ihm die Unterlippe zu durchbohren und als Zeichen der Reife einen Stift oder Pflock in die Öffnung zu stecken. Gewöhnlich finden zu Ehren des Mädchens auch Feste statt, bei denen tüchtig gegessen wird. Bei den Maskoki zum Beispiel gehört zu einem solchen Festmahl folgendes: gerösteter Hund, eine Suppe aus Truthahn, Hühner-, Rind- und Schweinefleisch, Bohnen, Kartoffeln und Mais, ferner Kuchen aus Kirschen, gemahlenen Kirschkernen und Talg, Ahornzucker, Weizen- und Maisbrot, gedörrte Pflaumen und eine Mischung von Ochsengalle und Zuckerwasser. Vielfach begegnen wir zur Feier des Ereignisses auch Tänzen, zu denen ebenso wie zum Festmahl die ganze Nachbarschaft eingeladen wird. Von den Hupa wird dieser Tanz Kin-Alktha oder Jungferntanz genannt; er wird von den Männern mit dem Mädchen getanzt, während die Frauen sich nur durch begleitenden Gesang daran beteiligen. Neun Abende lang tanzen die Männer ohne jenes, das sich vor ihnen versteckt halten muß. In der zehnten Nacht kommen dann zwei junge Männer und zwei alte Weiber der Verwandtschaft nach der Hütte, um die Jungfrau zu suchen und herauszuholen. Die jungen Burschen stülpen ihr eine Maske aus Leder und Schilf über den Kopf, die an einen Seelöwen erinnert, und nehmen das Mädchen in die Mitte; rechts und links davon stellen sich die alten Weiber auf. So begeben sich alle fünf zu den versammelten Männern und Frauen. Das Mädchen schreitet zehnmal vorwärts und rückwärts, hebt die Hände in Schulterhöhe und[S. 168] stimmt ein Lied an; beim letzten Male macht es einen Hochsprung. Zum Schluß wird es von der Versammlung mit lauten Zurufen begrüßt. Bei den Wintun muß die Jungfrau, nachdem sie sich würdig vorbereitet und unter anderem eine besonders zubereitete heilige Suppe gegessen hat, jedesmal, wenn neue Gäste von auswärts kommen, sinnliche Liebeslieder singend, den Hügel, auf dem sie erscheinen, hinunter- und um den Lagerplatz herumtanzen. Sobald sich alle Teilnehmer des Festes versammelt haben, was zwei bis drei Tage dauern kann, vereinigen sie sich zu einem großen Tanze, der eigentlich weniger ein Tanz ist als ein von Chorgesängen begleiteter Rundgang um das Dorf. Zum Schluß der ganzen Feier nimmt der Häuptling das Mädchen bei der Hand und tanzt mit ihm die ganze Reihe der Festgenossen entlang, wobei diese aus dem Stegreif Gesänge anstimmen. Diese Lieder sind manchmal recht schlüpfrig.

Die sittlichen Vorstellungen der nordamerikanischen Indianer scheinen im allgemeinen nicht hoch zu stehen, wenigstens nicht mehr zur gegenwärtigen Zeit. Von einigen Stämmen wird berichtet, daß sie früher auf keusches und tugendhaftes Leben der unverheirateten Mädchen hielten, so von den Mandan, Tschippewä, Pueblos und Pimas, von anderen aber wird wieder erzählt, daß sie bereits in ganz jungen Jahren sich einem ausschweifenden Leben hingaben und daß vorehelicher Verkehr der Mädchen nicht als Schande angesehen wurde, wohl aber seine etwaigen Folgen; man verstand aber, solchen vorzubeugen. Ja verschiedentlich soll es Sitte gewesen sein (Athapasken, Neheawayen, Oregon-Indianer), daß Bruder und Schwester, sowie Vater und Tochter geschlechtlich miteinander verkehrten. Bei den Nadowessiern, einem Siouxstamm, gaben sich die jungen Mädchen gelegentlich des „Reisfestes“ den Männern willig hin, ja sie setzten ihren Stolz darein, an diesem Tage mit möglichst vielen verkehrt zu haben. Bei einigen Indianerstämmen galt es als Freundschaftsdienst, die Ehefrauen miteinander auszutauschen.

Wir erwähnten bereits die Tatsache, daß bei den Scheyennen Jünglinge, die sich bei Ablegung der Reifeprobe als feige herausstellten, in Weiberkleidung gesteckt und auch als Weiber behandelt wurden. Solche „Mannweiber“ sind eine keineswegs seltene Erscheinung unter den Indianerstämmen; schon Schriftsteller des sechzehnten und siebzehnten Jahrhunderts berichteten von ihnen und fügen hinzu, daß sie vielfach zur sexuellen Befriedigung der Männer gedient haben und unter Umständen für diesen Beruf geradezu erzogen wurden. Die neueren Forschungsreisenden haben solche Personen wohl bei allen nordamerikanischen Stämmen kennen gelernt. Sie sollen sich öfter schon durch einen eigenen Typus auszeichnen, der wenig Männlichkeit verrät; dazu kommt, daß sie Weiberkleider tragen, weibliches Gebaren annehmen — manche putzen sich geradezu als Stutzer heraus — und weibliche Arbeiten ausführen, männliche Beschäftigungen dagegen gänzlich meiden: so gehen sie niemals auf die Jagd oder auf[S. 169] den Kriegspfad. Manche von ihnen sollen große Geschicklichkeit in der Verrichtung weiblicher Obliegenheiten bekunden. Von den Tschippewä wird erzählt, daß diese „Agoqwas“ in aller Form mit Männern verheiratet wurden; Ähnliches wird von den Acagehemen Kaliforniens berichtet. Es hat den Anschein, als ob es sich bei diesen Mannweibern vielfach um pervers veranlagte junge Leute handle. Ihr regelwidriges geschlechtliches Empfinden mag ihnen teilweise angeboren, teilweise auch anerzogen worden sein; eine Reihe Stämme bilden gewisse junge Leute zu solchen pervers-geschlechtlichen Zwecken geradezu aus. Ganz eigenartig ist die Art, wie die Pueblos Neu-Mexikos die Betreffenden „zu Weibern machen“. Zu einem „Mujerado“ wird der kräftigste Mann des Dorfes ausgewählt und an ihm täglich wiederholt Masturbation vorgenommen, um große geschlechtliche Reizbarkeit zu erzeugen, die mit der Zeit infolge der allzu häufigen Samenentleerungen zu einem Schwund der Keimdrüsen führt; jede Erektionsfähigkeit ist bei einem solchen Menschen schließlich erloschen. Mit dieser künstlichen Entmannung gehen gleichzeitig Veränderungen im Gemütsleben einher; der Mujerado verliert die Lust an seinen früheren Beschäftigungen und entäußert sich in körperlicher und geistiger Beziehung mehr und mehr aller Männlichkeit. Er kleidet sich nach Weiberart, meidet anfänglich die Männer und sucht die Frauen auf, gibt sich aber schließlich doch jenen zu homosexuellen Zwecken hin.

Kinderverlobungen sind unter den nordamerikanischen Indianerstämmen nicht gerade eine Seltenheit; man pflegt aber nicht immer gleichaltrige Kinder miteinander zu versprechen, sondern mit Vorliebe junge, zehn- bis zwölfjährige Mädchen mit Männern, die bereits voll erwachsen und imstande sind, eine Familie zu ernähren. — Von Werbungen der jungen[S. 170] Männer um ihre Mädchen ist wenig bekannt. Bei den Schwarzfüßen sorgen die Eltern für das Zustandekommen der Heirat, da es unter ihnen nicht Sitte ist, daß unverheiratete Mädchen mit Männern zusammenkommen. Sobald die Eltern des Mädchens sich einen Schwiegersohn ausgesucht haben, halten sie in der Weise um ihn an, daß der Vater ihm den Vorschlag macht, seine Tochter solle dem jungen Manne das Essen in seine Hütte bringen. Geht dieser darauf ein, dann tut dies das Mädchen einen ganzen Monat lang; währenddessen unterweist der Vater sie in den Pflichten, die sie als Ehefrau zu erfüllen hat. Nach Ablauf dieser Zeit findet eine Festlichkeit in der Hütte des jungen Mannes statt, zu der nur die Angehörigen eingeladen werden. Mutter und Tochter bringen das Essen bis an die Tür, die Braut tritt allein in das Zelt und setzt sich, ohne ein Wort zu sprechen, an die rechte Seite ihres Zukünftigen; darauf verteilt sie gestickte Mokassins an alle Gäste. Nach dieser Festlichkeit werden weitere Geschenke ausgetauscht. Die Mutter des Mädchens baut für die jungen Leute eine neue Hütte und schenkt dem Schwiegersohn einen neuen Buckskinanzug und für ihre Tochter wollene Decken, Gewänder aus Büffelhaut und ebenfalls ein Buckskinkleid. Bei den Schwarzfüßen tritt das Mädchen aus dem elterlichen Clan aus; auch die Kinder werden der Familie des Mannes zugezählt. — Es gehört zum guten Ton, daß die Schwiegermutter ihre Tochter nur in Anwesenheit von deren Manne besucht, da es jener sehr peinlich sein würde, wenn dieser etwa unerwartet auftauchte; sollte der Schwiegersohn gegen diese Sitte verstoßen, dann wäre dies nur dadurch gutzumachen, daß er seiner Schwiegermutter ein Pferd verehrt. Wo es dem Mädchen ausnahmsweise gestattet ist, sich den Mann zu wählen, besteht eine hübsche Art der Werbung. Die jungen heiratslustigen Krieger warten in Decken gehüllt vor ihrem Wigwam, bis ein Mädchen kommt. Wer es gern haben möchte, wirft ihm den Zipfel seiner Decke über den Kopf; ist das Mädchen mit dem Bewerber nicht einverstanden, so schreit es auf und wird sofort freigelassen, worauf ein anderer sein Glück versucht. Wer vor den Augen der jungen Schönen Gnade findet, dem erlaubt sie, seine Decke vollständig über sie zu ziehen, worauf beide zusammen abgehen.
Die Hauptzeremonie bei der Hochzeit besteht in der Darbringung von Geschenken. Der junge Ehemann beschenkt stets die Eltern der Braut (Abb. 197), und er sowie seine eigenen Eltern erhalten von diesen im allgemeinen Gegengeschenke; doch unterbleibt dies vielfach auch. Dort, wo die Sitte besteht, daß Geschenke nur von seiten des Bräutigams gegeben werden, artet die Ehe leicht zu einem einfachen Kauf- und Verkaufgeschäft aus. Wenn ein junges Paar durchgeht, so bringt dies der Familie zunächst Schande, bis die Sache durch nachträgliche Geschenke wieder gutgemacht ist.
Bedingung ist wohl bei allen nordamerikanischen Indianerstämmen, daß der Mann außerhalb seines Clans, gewöhnlich auch außerhalb seines Stammes heiratet; es kommt sogar vor, daß Ehen außerhalb des eigenen Volkes geschlossen werden. Polygamie ist sehr verbreitet. Durch die vielen Kriege, die die Indianer im Laufe der Zeiten geführt haben, büßten viele junge Männer ihr Leben ein; dies hatte zur Folge, daß die Zahl der Frauen unter ihnen überwiegt. So ist Vielweiberei vielfach zu einer sozialen Notwendigkeit geworden.
Unter den Tschippewä besteht eine Ordensbrüderschaft, deren Mitglieder, sobald sie die vierte Stufe des Ordens erreicht haben, imstande sein sollen, ein Pulver herzustellen, das als kräftiger Liebeszauber wirkt. Es besteht aus roter Farbe, gepulverter Schlangenwurzel, etwas Blut von einem Mädchen, das zum ersten Male menstruiert hat, und einem gepulverten Stück Ginseng, das aber gerade der Stelle der Wurzel entnommen worden sein muß, wo sie sich in zwei Äste teilt (wohl ein Anklang an den Unterleib des Menschen mit den beiden Beinen). Mit der Mischung dieser Bestandteile allein ist aber das Liebespulver noch nicht wirksam; dazu gehört noch ein Opfer aus Tabak an den Kitshi Manido, das von Gesang und dem Schall einer Zauberrassel[S. 171] begleitet sein muß. Will man nun das Mittel erfolgreich anwenden, muß man es der geliebten Person unter ihr Lager bringen.

Die Vorstellungen der nordamerikanischen Indianer von Krankheit und Heilung sind eng mit ihrer Religion verknüpft, und zwar in so hohem Grade, daß „Medizin“ das hergebrachte Wort für geistige Macht und der „Medizinmann“ weit mehr Priester als Arzt ist. Seine Wirksamkeit hängt von der Fähigkeit ab, den bösen Geist, der eine Krankheit verursacht hat, auszutreiben und zugleich die Hilfe der guten Geister anzurufen, die den Kranken, wenn sie wollen, wieder gesund machen können. Obwohl die Medizinmänner, um den Glauben an ihre Kunst zu stützen, nach außen hin mit allerlei Mummenschanz arbeiten, sind sie doch meistens schlau genug, auch wirkliche Heilmittel anzuwenden, da ihr Amt recht verantwortlich ist, unter Umständen ihnen wohl auch von seiten der Verwandten des Kranken Gefahr bringt. Zwar werden sie selten unterlassen, beim Mißglücken ihres Heilverfahrens einen der zahlreichen dem Volke einleuchtenden Gründe für den Tod des Betreffenden anzugeben; immerhin kommt es vor, daß die Angehörigen dem Medizinmann die Schuld beimessen und ihn mit seiner Familie zur Strafe abschlachten.
Sobald der Tod Einzug gehalten hat, glauben die Indianer, daß die abgeschiedene Seele des Verstorbenen in die Geisterwelt eingegangen sei, die sie überall umgibt. Darüber, wo dieses Jenseits zu suchen ist und welches Schicksal den Toten dort erwartet, herrschen zahlreiche Auffassungen. Ganz allgemein gesprochen, denkt man sich das zukünftige Leben ähnlich dem auf der Erde, nur unter glücklicheren Bedingungen. Die Hauptrolle spielen dabei reichliche Jagdgründe und ein friedfertiges Verhalten der Stämme untereinander. Wie sich die Navajo das Jenseits ausmalen, davon war schon oben die Rede. — Eine Begräbnisfeier der Zuñi schildert uns Cushing wie folgt. Sobald der Tote den letzten Atemzug getan hatte, wurde er von den Frauen seines eigenen Clans gebadet und ein Gefäß mit Wasser neben ihm zerbrochen; damit gab man ihn der Sonne zurück. Darauf trugen vier Männer die in Decken gehüllte Leiche unter dem Wehklagen der Frauen nach dem alten Begräbnisplatze und senkten sie ins Grab, während einer von ihnen, das Gesicht gegen Osten gewandt, ein Gebet sprach und Mehl, Speise und andere Gaben darüber streute. Vier Tage später brachten die Leidtragenden unter flehenden Bitten im Namen des Toten wunderschöne, mit Papageifedern geschmückte Gebetstöcke, die im religiösen Leben bei ihnen eine große Rolle spielen, als Opfer dar. Die Totenfeier wurde damit fortgesetzt, daß fünfzig Zuñimänner unter Anführung eines bemalten und geschmückten Priesters, dem der fackeltragende Feuergott folgte, sich gegen Westen auf eine Pilgerfahrt begaben, wie man sagte, „in die Stadt Ka-ka und in das Heim unserer verlorenen anderen“. Nach vier Tagen kehrten sie zurück und führten Körbe lebender Schildkröten in weiche Decken eingehüllt mit sich. Ein müder Mann brachte dem Gouverneur eine Schildkröte ins Haus und stellte sie auf die Erde, wobei er besonders zärtlich mit ihr umging; sie suchte sich aber so schnell wie möglich aus dem[S. 172] Staube zu machen. Die Angehörigen des Mannes gingen dem Tier in alle Ecken und Winkel nach, beteten und bestreuten es mit Maismehl. Als Cushing nun fragte, warum man das Tier nicht laufen lasse oder ihm nicht wenigstens etwas Wasser zum Trinken gebe, damit es nicht sterbe, wandte der Mann ihm langsam seinen Blick zu, wobei sich gleichzeitig Schmerz, Empörung und Mitleid auf seinem Gesichte ausprägten, und antwortete: „Ich sage dir, es kann nicht sterben; es wird morgen nur seine Wohnung wechseln und in das Heim seiner Brüder zurückgehen.“ Darauf wandte er sich wieder an die Schildkröte und rief ihr mit schmeichelnden Worten zu: „Ach, mein armes, teures, verlorenes Kind, Vater oder Mutter, meine Schwester oder mein Bruder, der du warst!“ Dabei begann er aufs rührendste zu weinen, seine Stimme vor Schluchzen zu beben; die anwesenden Frauen und Kinder fielen in das Heulen ein. Am nächsten Tage wurde die arme Schildkröte unter Gebet und Opfergaben schonend getötet; ihr Fleisch und ihre Knochen wurden dem kleinen Flusse in der Nähe übergeben, damit sie zum ewigen Leben im dunklen See der Toten zurückkehrten, und aus ihrer Schale wurde eine heilige Klapper angefertigt. Dieser eigenartige Brauch findet seine Erklärung in der Sage, daß, als die Menschen zuerst in dieses Land kamen, sie über einen großen Fluß mußten, bei dessen Überschreitung viele Frauen ihre Kinder einbüßten, indem sie ihnen vom Rücken glitten und in Schildkröten verwandelt wurden. Mit dem Ausdruck „unsere verlorenen anderen“ sind die Stammesmitglieder gemeint, die auf diese Weise hinter ihren Anverwandten zurückblieben und ihnen jenseit des Sees der Toten eine Heimat bereiteten.

Der Begräbnisarten gibt es unter den nordamerikanischen Indianern viele. Bald bestattet man die Leiche in der Erde (Abb. 196), bald setzt man sie in der Luft aus oder in Urnen; auch Einäscherung findet sich. Am verbreitetsten war die Sitte, ein rundes Loch zu graben und die in Felle oder Zeug eingewickelte, mit übereinandergelegten Beinen zusammengeschnürte Leiche senkrecht hineinzustecken; die Grube wurde manchmal noch mit Steinen ausgelegt. Wurde ein Grab in voller Länge des Toten ausgeschaufelt, dann wurde dieser für gewöhnlich wagerecht auf den Rücken gelegt, doch manchmal auch mit angezogenen Knien auf die Seite. Bei Bestattung in einer Grabkammer war es nichts Ungewöhnliches, daß man mehrere Leichen zu gleicher Zeit beisetzte. Es kam auch vor, daß man die Leiche auf die Erde legte, sie mit einer starken Lehmschicht überdeckte, darüber ein Feuer anzündete, so daß sich der Lehm zu einer schützenden Decke erhärtete, und diesen Lehmsarg schließlich mit Erde zudeckte. — Von den Stämmen der südlichen Küste des Atlantischen Ozeans balsamierten einige ihre Toten ein, so daß sie zu Mumien wurden. — In der großen Ebene geschah die Beisetzung der Leichen oft an der Luft. Der Tote wurde in das Zeug, das er bei Lebzeiten getragen hatte, vorsichtig eingewickelt und auf ein Gestell oder eine Bahre gelegt; diese wurde[S. 173] dann auf einem Baum (Abb. 195) oder auf einem Pfosten über der Erde aufgestellt, daß Wölfe und Hunde sie nicht erreichen konnten. Man gab dem Verstorbenen seine Waffen, allerdings in zerbrochenem Zustande, mit, damit er sich ihrer in der jenseitigen Welt bedienen könne, wie man ihn auch mit Essen für die Reise dorthin versah. An der Küste des nördlichen Stillen Ozeans verwendeten die seefahrenden Indianer als Sarg ein Kanu, das sie auf einem Pfosten aufstellten. — Das Begraben in Urnen kam selten vor; man kennt solche Fälle nur aus Arizona, wo man in den Grabstätten irdene Krüge mit den verbrannten Resten auffand. — Die Navajo Arizonas, die eine große Abneigung vor der Berührung mit Leichen haben, befestigten manchmal Stricke an dem unteren Ende der Stangen, aus denen ihre Winterhäuser aufgebaut sind, und rissen sie mit Hilfe der Stricke um, so daß das ganze Haus über dem Toten zusammenfiel und zum Grabmal für den Toten wurde; manchmal legten sie auch Feuer an und brannten das Ganze nieder.

Die Zeichen der Trauer waren von Stamm zu Stamm verschieden. Weitverbreitet als Ausdruck der Trauer war das Weinen und Wehklagen der Angehörigen, das Zerreißen der Kleider und das Aufstreuen von Asche oder Staub auf den Kopf; auch daß sich die Überlebenden Schnittwunden im Gesicht und an den Gliedmaßen beibrachten, kam vor. Das Eigentum des Verstorbenen pflegte man vielfach zu zerstören. Bei den Dakota mußte die Witwe vier Abende lang ein Feuer auf dem Grabe ihres Mannes unterhalten; sie mußte ferner bei Sonnenaufgang und Sonnenuntergang jammern, teilweise auch fasten und sich während der ganzen Trauerzeit, deren Dauer schwankend war, von der Außenwelt abschließen. War die Zeit vorüber, dann stattete die Familie des Toten sie von neuem aus, und es stand ihr dann frei, sich wieder zu verheiraten. Bei den Athapasken, die ihre Toten verbrannten, mußte sich die Witwe auf den Scheiterhaufen setzen und hier so lange verharren, bis sie gründlich angesengt und ihre Kopfhaare verbrannt waren.
[S. 174]

Mittelamerika. Das Hochland von Mittelamerika, das sich zwischen der Landenge von Tehuantepek und der von Panama ausdehnt, ist ein uraltes Kulturland, das unter der Mißwirtschaft der Spanier einen schweren Rückgang erlebt hat. Es wird von den Nahuavölkern bewohnt, einer Sprachgruppe, die vorzeiten aus ihrer ursprünglichen Heimat in nördlicher gelegenen Gebieten einwanderte, bis Guatemala (Pipilen), San Salvador und Nicaragua vordrang und die bis dahin ansässigen einheimischen Stämme, wie die Totonaken, Olmeca, Tarasken, Otomi, Mixteken, Zapoteken und Maya zurückdrängte. Zu diesen Nahuavölkern gehören unter anderem die Azteken beziehungsweise ihre Vorgänger, die Tolteken, die wahrscheinlich im vierten bis fünften Jahrhundert ankamen. Die Mayavölker, die übrigens wohl auch nicht als die Urbewohner anzusehen sein dürften, entwickelten eine hochstehende Kultur, zu der die Azteken eine ebensolche hinzubrachten; beide Kulturen sind im Lauf der Zeiten mehr und mehr miteinander verschmolzen und haben es zu recht ansehnlicher Blüte gebracht. Beide Völker bildeten wohlgeordnete Staatswesen mit monarchischer, dabei aber doch ziemlich demokratischer Regierungsform. Künste und Wissenschaften, nicht minder Handel und Industrie standen auf hoher Stufe. Leider erlaubt der zur Verfügung stehende Raum nicht, auf die merkwürdigen Kulturzustände der alten Mexikaner näher einzugehen; wir müssen uns auf eine Schilderung der neuzeitlichen Verhältnisse beschränken.

Das unmenschliche Regiment, das die Spanier seit der Entdeckung des Landes bis in den Anfang des neunzehnten Jahrhunderts hinein in Zentralamerika ausgeübt haben, hat nicht nur[S. 175] dazu beigetragen, die ursprüngliche Lebensweise der Bevölkerung, ihre Sitten und Gebräuche auszurotten, sondern auch die Stämme selbst. In abgelegenen Gegenden, wohin die Strenge der Eroberer nicht reichte, hat sich die altindianische Kultur bis auf unsere Tage noch verhältnismäßig rein erhalten. Der enge Verkehr der Spanier mit den Indianern hat nun ganz allmählich eine Bevölkerung entstehen lassen, in der der Anteil an indianischem Blut recht beträchtlich ist. Sehr großes Gewicht legt man in Mexiko auf den Grad der Blutmischung und hat daher eine ganze Reihe von Bezeichnungen für die verschiedenen Abkömmlinge, je nachdem Indianer- oder Negerblut in ihren Adern rollt beziehungsweise den Mischlingen in einer späteren Generation von neuem spanisches Blut zugeführt worden ist. Ist der Vater ein Spanier, die Mutter eine Indianerin, dann spricht man bei den Abkömmlingen von Mestizen; Kinder aus einer Verbindung von einem Weißen mit einer Mestizin heißen Castizen; kreuzt sich eine Castiza mit einem Spanier, so sieht man deren Kinder wiederum als Spanier an. Nachkommen von einem Spanier und einer Negerin führen die Bezeichnung Mulatten; aus der Verbindung einer solchen Mulattin mit einem Spanier geht ein Morisco hervor; eine Morisca erzeugt mit einem Spanier einen Albino, und erst die Kinder einer solchen Albina mit einem Spanier, die Tornatro heißen, werden wieder als Spanier angesehen. Mischlinge aus der Kreuzung eines Indianers mit einer Negerin heißen Sobo; ein Sobo ferner erzeugt mit einer Negerin einen Chino; der Nachkomme einer China und eines Indianers wird Cambujo genannt, und der Abkömmling schließlich eines Indianers und einer Mestizin Cayote. Das Volk ist im allgemeinen ganz ungebildet und des Lesens und Schreibens unkundig. Öffentliche Schreiber besorgen daher das Schriftwesen (Abb. 198). — Wirkliche Weiße, vor allem Spanier, die von Mischung mit Indianerblut gänzlich frei geblieben sind, kommen wenig vor; schätzungsweise höchstens ein Sechstel der mexikanischen[S. 176] Bevölkerung dürfte aus solchen Weißen bestehen, zu denen auch noch Vertreter anderer Völker gehören, die teils als Kaufleute, teils als Abenteurer eingewandert sind. In der Hauptsache haben sich diese Europäer ganz den Sitten der Spanier angeschlossen, die ihrerseits an den Gebräuchen der Heimat festgehalten haben.

Der mexikanische Indianer, der etwa die Hälfte der Bevölkerung des Landes ausmacht, unterscheidet sich von seinen nordamerikanischen Brüdern insofern, als er sich nicht wie diese auf das Kriegshandwerk verlegt hat, sondern ein friedliebender Ackerbauer geworden ist. Seine Kleidung wechselt nach den klimatischen Verhältnissen; in den Küstengebieten herrscht tropische Hitze, in den Gebirgsgegenden mehr gemäßigtes Klima und in höheren Lagen selbst Kälte. Aber stets ist das Hervorstechende an der Kleidung des Mexikaners die Buntheit der Farben und die Vorliebe für Schmuck (Abb. 199). Das wichtigste Kleidungstück ist die Zarape, eine vielfarbige Decke, die als Überwurf getragen wird, aber nebenbei noch mancherlei anderen Zwecken dient, und der Rebozo, ein mehrere Meter langer Baumwollstreifen (Schal) von oft recht reicher Musterung in blauer, gelber oder violetter Farbe; reiche Frauen tragen einen solchen aus Seide, der von derartiger Feinheit ist, daß er trotz seiner Breite durch einen Fingerring gezogen werden kann. Er wird als Schutz gegen die Sonne über Kopf und Nacken geschlungen und fällt geschmackvoll in Falten herab; oft aber wird er auch zusammengerafft und dient dann zum Tragen von Früchten und anderen Sachen, ähnlich wie unsere Schürze. Der Rebozo scheint aus dem spanischen Schleier hervorgegangen zu sein. Auf dem bloßen Leibe tragen die Indianerinnen noch ein bis zu den Knöcheln reichendes, oft reichbesticktes Hemd. Ihr Kopfhaar, dem sie viel Pflege widmen, durchflechten sie entweder mit bunten Schnüren und wickeln es [S. 177]rund um den Kopf oder sie lassen es als Zöpfe herunterhängen. Für gewöhnlich geht man im ganzen Lande barfuß, doch legen die Männer vielfach auch Sandalen aus Zwirn an.

Die Hauptunterhaltung des Mexikaners bilden Musik, Gesang und Tanz; als Nationaltanz kann der Jarabe gelten. Es gibt auch mystische Tänze, eine Verquickung von Aztekenlehre und christlicher Religion, die an die erste Zeit der spanischen Eroberung erinnern; sie werden zu bestimmten Jahreszeiten von Masken unter Begleitung von Trommeln und Pfeifen aufgeführt und weichen in ihren Einzelheiten nach der Örtlichkeit voneinander ab. Im weiten Süden ist die danza de la conquista, in der dargestellt wird, wie die Azteken bei der Ankunft des weißen Mannes von Furcht befallen werden, der bemerkenswerteste Tanz. Die Fiestas der Kirche, desgleichen die Namenstage der Heiligen sowie der Verwandten und Freunde werden von der Bevölkerung in lustiger Weise gefeiert; Tanz, Glückspiel, Hahnen- und Stierkämpfe bilden dabei die Hauptunterhaltung. Die genannten Tierkämpfe (Abb. 200 und 201) sowie das Kartenspiel (Baraja) sind ungemein fest wurzelnde Unsitten. Nächst dem Cura, das heißt dem Dorfpriester, und der Curandera, der Quacksalberin oder Dorfhexe, ist, was den größten Einfluß auf das Leben des Mexikaners ausübt, der Pulque, ein Nationalgetränk, das aus der Agave hergestellt wird. Wenn der richtige Augenblick gekommen ist, wird diese der Aloe ähnliche mächtige Pflanze gekappt und eine honigartige Flüssigkeit aus ihr gewonnen, die man vierundzwanzig Stunden lang der Gärung überläßt. Dadurch gewinnt man eine starkriechende Flüssigkeit, deren Genuß einen schweren Rausch erzeugt. Allenthalben gibt es im Lande Pulquerias, Verkaufstellen für dieses Getränk, für das der Mexikaner seinen letzten Centavo hergibt. Sie sind auch die Stätten, wo sich für den Fremden die beste Gelegenheit bietet, das einheimische Leben und Treiben zu beobachten.

Die Tätigkeit der mexikanischen Indianer auf dem Lande geht fast völlig in der Landwirtschaft auf. Die Frauen stellen die zum Leben erforderlichen einfachen Gegenstände her; besondere Fertigkeit zeigen sie in der Anfertigung von Erzeugnissen der Weberei und der Töpferei (Abb. 203).
[S. 178]
Die Religion (Abb. 202, 204 und 205) des Mexikaners ist dem Namen nach die der römisch-katholischen Kirche, in Wirklichkeit aber ein Gottesdienst, der gleichsam nur die Fortsetzung der Religion der Azteken und Maya bildet. Die Regierung hat zwar die Kirchenprozessionen abgeschafft, doch kommen sie auf dem Lande noch vor, in den kleinen Indianerdörfern, die aus Bambushütten mit Palmblattdächern bestehen. Dabei geht es recht eigenartig und übrigens auch sehr laut zu. Trommler und Pfeifer eröffnen den Zug der Gläubigen — alle Mexikaner sind sehr fromm —, die an langen Stangen geheimnisvolle Figuren aus buntem Papier tragen. Was letztere zu bedeuten haben, weiß kein Mensch; es fragt auch niemand danach, wie man auch nicht weiß, was die lateinisch gesprochenen Gebete besagen. Der Forscher aber weiß, daß diese seltsamen Figuren aus den Tagen der Vorfahren der heutigen Bevölkerung vor der Zeit der Eroberung durch die Europäer herstammen. Ähnlich verhält es sich mit den geweihten Opfern aus Blumen, die man auf jeden Schrein am Wege — diese sind höchstwahrscheinlich an die Stelle der ehedem bestehenden heidnischen Altäre getreten —, in Dorfkirchen und städtischen Gotteshäusern niederlegt; sie erinnern an die Opfer für den Menschgott Quetzalcoatl der alten Azteken. Die Vorliebe der Eingeborenen für Blumen ist außerordentlich groß. Außer in dem Darbringen von solchen Spenden äußert sie sich noch an den Blumentagen, jenen prunkvollen Festen im April am Vikokanal in der Nähe der Stadt Mexiko; dann sind die aztekischen Chinampas oder schwebenden Gärten eine einzige Blütenmasse, und Quetzalcoatl wird dabei offen als Gott der Natur verehrt.


Ein anderes Fest, das alljährlich unter großen Feierlichkeiten acht Tage lang vor Weihnachten begangen wird, sind die Posadas oder die Herberge, so genannt zur Erinnerung[S. 180] an die Herberge von Maria und Joseph zu Bethlehem. Eine Familie oder überhaupt eine befreundete Gesellschaft tut sich zusammen, um abwechselnd die Posadas zu geben, und wählt ein bestimmtes Haus zum Schauplatz der Festlichkeit aus. Das betreffende Haus wird festlich hergerichtet und mit Moos sowie Henno, einem schlingartigen Hängegewächs, das niemals fehlen darf, geschmückt; neben Lampions werden die sogleich zu besprechenden Piñates an der Decke und den Pfeilern aufgehängt. Am Abend begeben sich die Teilnehmer der Posada bei Fackelbeleuchtung unter Absingung der Litanei bis zu einem bestimmten Raum, wo für Maria und Joseph um Aufnahme gebeten wird (siehe die Kunstbeilage). Auf eine bejahende Antwort öffnen die Veranstalter des Zuges die Tür und stellen die Wachsfiguren dieser beiden Heiligen dort hinein. Darauf geht man zum Speisezimmer zurück und zecht die ganze Nacht hindurch. Dieser Vorgang wird an acht aufeinanderfolgenden Abenden, meistens abwechselnd in den Häusern der Teilnehmenden, wiederholt; am neunten kommt dann noch die Figur des Heilands als Kind zu der Gruppe hinzu, und am Tage darauf wird die Piñate zerschlagen. Ursprünglich ein Kochtopf, ist die Piñate auch in ihrer weihnachtlichen Umgestaltung nichts anderes: ein dickbauchiges Gefäß, das in seinem Innern kleine Geschenke birgt; es vertritt die Stelle unseres Weihnachtsbaumes. Natürlich ist der Topf auf der Außenseite vergoldet oder noch häufiger mit einem Tier- oder Menschenkopf versehen und mit Seidenpapierkostümen, Fellüberzügen, Bänder- und Schleifenausputz phantasievoll überkleidet. Die Kinder müssen versuchen, mit verbundenen Augen nach mehrfachem Irreführen im Hofe des Hauses (wie bei unserem Topfschlagen) die Piñate mit einem Stock zu zertrümmern (Abb. 206) und bekommen dann ihren meist aus Leckereien bestehenden Inhalt.
Kirche und Zauberei stehen einander in der Auffassung der Eingeborenen keineswegs feindlich gegenüber, eines ergänzt vielmehr das andere. Die Indianerin denkt eben, daß es nicht schaden könne, wenn sie von beiden Seiten Schutz erhalte; um so kräftiger werde die Wirkung sein. Das Zeichen des Kreuzes schützt selbstverständlich gegen den bösen Blick, aber in gleicher Weise tut dies auch der geheimnisvolle Trank der Curandera, der Dorfhexe; folglich wendet sie beides an. Sollte sie etwa einmal Anlaß haben, auf ihren Mann eifersüchtig zu sein, dann werden ihre Gebete an Gott und die Heiligen durch das Rezept, das ihr die Curandera verabreicht, sicherlich noch wirksamer werden. Überhaupt genießt die Curandera überall eine ganz bedeutende Macht; sie wird stets hinzugezogen und auf ihre Anordnungen großer Wert gelegt. Sie heilt auch Krankheiten und tut dies nicht selten mit Erfolg, da sie mit der Wirkung heilkräftiger Pflanzen bis zu einem gewissen Grade ganz gut vertraut ist, wie es auch ihre Vorfahren waren.
Die Verquickung von Religion und Aberglauben zeigt sich schon recht deutlich beim Erscheinen eines neuen Weltbürgers. Zunächst muß er natürlich, wie es die Kirche erfordert, getauft werden; auch wenn die Eltern nicht miteinander verheiratet sind, ist dies die erste Pflicht des Vaters, der er sich auch wohl niemals entzieht. Außerdem wird das Kind aber auch mit allerlei Amuletten behängt, die ihm in seinem ferneren Leben Glück bringen sollen; das Horoskop wird ihm von einem Kenner gestellt und Zaubersprüche ausgesprochen. Die Mutter liebt ihr Kind leidenschaftlich, besonders wenn es sich um einen Knaben handelt; sie trägt es stets mit sich herum, wenn sie unterwegs ist oder arbeitet, wobei es auf ihrem Rücken durch den Rebozo festgehalten wird. Sobald das Kind sprechen kann, muß es zuerst ein Gebet lernen, aber bald auch mit den Überlieferungen und Sagen des Volkes und anderen teils heidnischen, teils kirchlichen Dingen vertraut gemacht werden. Auf diese Weise werden alte aztekische Überlieferungen und Sagen von Geschlecht zu Geschlecht lebendig erhalten.

Das Liebesleben der Mexikaner setzt sehr frühzeitig ein und entbehrt nicht der Romantik, wie sie den Bewohnern des Mutterlandes Spanien eigentümlich ist. Mit vierzehn Jahren pflegt das Durchschnittsmädchen bereits verheiratet zu sein oder hat wenigstens einen Liebhaber. Solche [S. 182]Verbindungen werden im allgemeinen nicht als unsittlich aufgefaßt; dafür ist der Mexikaner doch zu sehr Kavalier, als daß er das Nichtbestehen einer gesetzmäßigen Ehe zum Vorwand nehmen sollte, sich einer etwa daraus entspringenden Verantwortlichkeit zu entziehen.
Das Leben der Frau spielt sich auf dem Felde oder in der Häuslichkeit ab. Sie bebaut den Acker und verrichtet die Hausarbeit; sie spinnt den Faden der Agave und mahlt das Korn, um daraus Tortillas oder flache Kuchen, die Lieblingspeise des Mexikaners, im Hause zu backen. Sie besorgt das Reinigen der Wäsche am Flußufer, sieht nach den Kindern und geht auf den Markt, sowohl um einzukaufen, wie auch um zu verkaufen. Hier hockt sie in einer höchst einfachen Bude, unter einer Matte, die als Schutz gegen die brennende Sonne auf vier Pfosten ruht, und bietet singend ihre Waren feil, die auf einer auf der Erde vor ihr ausgebreiteten zweiten Matte untergebracht sind. Der Herr Gemahl tut indessen nichts: er lungert umher und raucht beständig Zigaretten; außerdem besucht er eifrig die Pulquerias, an denen eine rote Fahne ihm anzeigt, wenn dort frischer Pulque zu haben ist. Er lebt im übrigen, ebenso wie seine bessere Hälfte, sorglos dahin und nimmt das Leben leicht.

Der Tod wirft nur vorübergehend einen Schatten auf seine Lebenslust. Von den ärmeren Volksklassen wird der Sarg oft für die Bestattung gemietet; es ist dies auch nur ein leichter Behälter, denn im allgemeinen dürfen die Gebeine der Toten nur ein paar Jahre in der Erde liegen, außer wenn man an die Kirche besondere Zahlungen macht. Aber stets muß eine Messe gelesen und Blumenopfer (an Stelle der sonst üblichen Kerzen) dargebracht werden; auch eine äußere Bekundung der Trauer durch schwarze oder lila Gewänder ist üblich. In den abgelegenen Indianerdörfern, die seit den Tagen der Eroberung wenig berührt wurden, nehmen die Bewohner,[S. 183] wie es scheint, noch altaztekische Gebräuche bei der Beerdigung vor; sie opfern sogar Hunde, Hühner und andere Tiere. Die Curandera besorgt dies auf irgendeine geheimnisvolle und wohl auch widerliche Art, um den allzeit gefürchteten bösen Blick wirkungslos zu machen.

Westindien. Westindien oder die Antillen bestehen aus vielen Hunderten von Inseln mit mehreren Tausenden kleiner und kleinster Eilande, die alle von sehr verschiedener Größe sind; Kuba und Haiti sind die größten darunter. Bei der Entdeckung Westindiens durch die Spanier setzte sich die Bevölkerung aus zwei Bestandteilen zusammen, die zu ganz verschiedenen Zeiten vom Festland aus die Inselwelt besiedelt haben müssen, den Aruaken und den Karaiben. Jene scheinen zuerst gekommen zu sein; wann dies geschah, vermögen wir nicht mehr festzustellen, sicherlich lange Zeit vor der Ankunft des Kolumbus. Die Karaiben erschienen erst viel später, nach Annahme einiger Forscher sogar erst kurz vor der Besitzergreifung durch die Europäer. Aruaken und Karaiben kamen offenbar aus Südamerika, vom Quellgebiete des Schingù her; die ersteren waren friedfertige Einwanderer, die letzteren dagegen ein sehr kriegerisches Volk, dem gegenüber die als grausam bekannten Spanier noch milde erscheinen mußten. Heutigestags ist diese indianische Urbevölkerung bis auf wenige Überreste (zum Beispiel zu Parotee Point auf Jamaika, auf Sankt Domingo, Sankt Vincent und Trinidad) vollständig verschwunden; die Spanier haben sie ausgerottet. An ihre Stelle sind Neger (Abb. 207 und 208) getreten, die vom sechzehnten bis neunzehnten Jahrhundert als Sklaven aus Afrika eingeführt wurden. Diese jetzt freigelassenen Neger machen zusammen mit Mulatten und Kreolen den Hauptteil der westindischen Bevölkerung aus. Die weiße Bevölkerung bildet eine schwache Minderheit; auf Haiti und Sankt Domingo fehlt sie so gut wie ganz. Auf der zuerst genannten Insel leben nur ein paar weiße Familien in Port-au-Prince; die geldleihende Klasse in den Städten auf Haiti sind die Syrier, die das[S. 184] Volk mit Unrecht als Ägypter bezeichnet. Auf Jamaika sind Ostindier als Kuli eingeführt worden. Mit den diesen eigenen weltlichen und religiösen Gebräuchen wird das ohnehin schon bunte Bild Westindiens noch schillernder und strahlender. Die größeren Inseln weisen überdies noch eine mehr oder weniger bedeutende Anzahl von Chinesen auf, die hauptsächlich in den Wäschereien beschäftigt sind, sich aber auch mit anderen, gleichfalls sehr einträglichen, wenn auch recht fragwürdigen Gewerben abgeben.

Die Neger Westindiens, mit denen wir uns bei der folgenden Betrachtung ausschließlich zu beschäftigen haben werden, stehen noch auf derselben Stufe des Aberglaubens wie ihre Vorfahren in der westafrikanischen Heimat, im besonderen dem Kongogebiet. Zwar wird dieser auf denjenigen der größeren Inseln, wo die Weißen eine feste Verwaltung eingesetzt haben, ziemlich im Zaume gehalten, dafür treibt er aber auf den Inseln, wo sie selbst das Regiment führen, im besonderen auf Haiti, um so üppigere Blüten. Die mildeste Form der Fetischanbetung (Abb. 210) trifft man auf Jamaika an, wo die Neger sich dem Namen nach zum Christentum bekennen. Sie befolgen diese Lehre auch wohl äußerlich, aber in ihrem Innern schlummert immer noch der nicht auszurottende afrikanische Instinkt. Er findet seinen Ausdruck in dem Fetischkultus, der Anwendung von Zaubermitteln, die alle Anschläge und Ränke der bösen Geister zunichte machen sollen. Nach der Überlieferung der Neger Jamaikas hat jeder Mensch zwei Geister, einen guten und einen bösen. Jener kehrt nach dem Tode in die afrikanische Heimat zurück; daher geben Angehörige und Freunde des Verstorbenen ihm Bestellungen auf den Weg, die er über das Meer mitnehmen soll. Der böse Geist dagegen verbleibt im Grabe bei der Leiche und kommt nachts in Gestalt eines Duppy hervor (Abb. 209). Diese Duppys entfalten ihre größte Tätigkeit in den beiden entscheidenden Augenblicken des menschlichen Lebens: wenn der Mensch in die Welt eintritt und wenn er aus ihr scheidet; daher werden für diese Fälle besondere Vorsichtsmaßregeln getroffen, um das Vorhaben der bösen Geister zu vereiteln. Der Hals eines Neugeborenen wird sofort mit einer Halskette aus grünen Perlen umschlossen, was vielleicht mit der Anbetung der grünen Schlange zusammenhängt; außerdem werden eine geöffnete Schere (Form des X) und eine Bibel unter sein Kopfkissen gelegt. Vor dem neunten Tage darf das Kind das Haus nicht verlassen, weil sich sonst der Duppy seiner bemächtigen würde. Stirbt jemand, dann wird alles umherstehende Wasser sofort weggeschüttet, da sich sonst ein Duppy in ihm niederlassen könnte. Um ihn zu versöhnen, werden dem Duppy aber Rum und Lebensmittel zur Verfügung gestellt, damit er Hunger und Durst stillen könne. Auch mit Zauberei kann man gegen die Duppys angehen.


Den bösen Einfluß des Duppy nachdrücklich zu bekämpfen, ist Aufgabe des Obeahmann, dem man den Besitz besonderer Kenntnisse und Fähigkeiten zutraut. Bei der Ausübung seiner Kunst verfährt der Obeahmann nach althergebrachten kabbalistischen Zeichen und geheimnisvollen Zauberformeln; auch gibt er sich damit ab, die Duppys „in Flaschen einzufangen“ und sie einem Feinde auf die Spur zu hetzen, sowie Zaubermittel, seltsame Zusammenstellungen von Federn, Haaren und Pflanzen, unter seine Kunden zu verteilen. Ein Obeahmann könnte gelegentlich auch einmal gefährlich und widerspenstig werden, aber die Regierung weiß dem vorzubeugen. Sollte sie ihre scharfe Überwachung unterbleiben lassen, dann würde die Entwicklung in ihrem Laufe nicht mehr aufgehalten werden können[S. 186] und der Vuduismus bald zu jener schlimmen Form ausarten, wie sie uns auf Haiti entgegentritt.

Zwischen der milden und der strengen Form des Vuduismus (Abb. 211) gibt es viele Übergänge und Abweichungen, die von der auf der betreffenden Insel herrschenden örtlichen Verwaltung abhängig sind (dänische, holländische, französische und amerikanische Regierung). In den alten spanischen Kolonien zum Beispiel hat die römisch-katholische Kirche es verstanden, den Fetischkultus in vernünftigen Grenzen zu halten, und ist nur dann scharf gegen ihn vorgegangen, wenn etwa ein zu kühner Obeahmann sich für einen neuen Gott ausgab und den Versuch machte, sich Anhänger zu gewinnen. Der Vuduismus ist hier die öffentliche Anbetung der grünen Schlange. Diese muß, wie wir es von den Göttern der Heiden schon vielfach erfahren haben, versöhnt werden, damit sie die bösen Geister fernhalte. Aus diesem Grunde werden Opfergaben zu einer Notwendigkeit. Hühner, Ziegen und „Ziegen ohne Hörner“, womit junge Menschenkinder gemeint sind, werden dargebracht. Zur Priesterschaft dieses Kultus in der Form, wie sie auf Haiti herrscht, gehören die Loupgarous oder religiösen Kinderräuber. Das „rollende Kalb“ in der Folklore von Jamaika, vor dem die Mütter ihre Kinder warnen, ist zweifellos eine Erinnerung an das frühere Opfern von Kindern. Man stellt es sich als den körperlosen Kopf eines Kalbes mit großen, rollenden Augen vor, der die Kinder beleckt, wovon sie entweder sterben müssen oder sonst verschwinden. Auf Haiti wird das Blut des Opfertieres den Adepten auf die Gesichter gestrichen und von dem amtierenden Priester getrunken. Bei einem Huhn beißen sie den Kopf ab und saugen das Blut aus dem Halse aus; bei einer Ziege reißen sie das Herz aus. Die Feier spielt sich nachts in den dunklen Tiefen des haitischen Waldes ab, dumpfer Tamtamschlag ertönt, Freudenfeuer brennen düster vor einer Kiste, in der [S. 188]die grüne Schlange, der man bei den Festen huldigt, liegt oder liegen soll. Die Szene wird immer wilder und schauerlicher; die Zuschauer beginnen mit dem Loiloichi oder Bauchtanz, der schließlich in eine regelrechte Orgie schlimmster Art ausartet und bis Tagesgrauen anhält, oder doch wenigstens so lange, bis Männlein und Weiblein trunken vor sinnlicher Erregtheit und Ermattung zu tiefem Schlaf auf die Erde sinken. Das größte dieser nächtlichen Feste soll zu Ostern stattfinden und mehrere Tage dauern. Auch die Fastenzeit gibt zu einem ausgelassenen Karneval Anlaß, der in den großen Städten, wie Port-au-Prince, am hellen Tage gefeiert wird.

Die Musikfreudigkeit der Negerrasse kommt auch bei der Bevölkerung der westindischen Inseln zum Ausdruck. Kein Fest wird gefeiert, ohne daß die Gitarre, ein wahres Nationalmusikwerkzeug, in ihr Recht tritt. Sie wird von den Negern ganz geschickt gespielt. Geradezu als Musiker ersten Ranges aber erweisen sich die Kreolen Kubas und Puerto Ricos. Die Musik auf diesen Inseln ist voll tiefer Empfindung, bevorzugt die Molltonarten und zeichnet sich durch einen ganz eigentümlichen Rhythmus aus, durch den sie sich leicht von der Musik anderer Länder unterscheidet. Sie ist auch in Spanien sehr volkstümlich geworden, wo das Volk diese Weisen aufnahm und sie mit seinen eigenen Volksliedern verschmolz. Die Tanzmusik der „Inseln“ hat sich fast über die ganze Welt verbreitet, und der Tango mit seinen eigenartigen Hüft- und Bauchbewegungen stammt aller Wahrscheinlichkeit nach von Kuba oder Puerto Rico; über Argentinien, wo er nach der Eigenart der Bewohner abgeändert wurde, hat er dann seinen Weg auch nach Europa genommen und hier seine bekannten Auswüchse erfahren.

[S. 189]

Die Eingeborenen Südamerikas zählen gleichfalls zu den Indianern, obwohl sie äußerlich in mancher Hinsicht von dem nordamerikanischen Typus abweichen. Ohne Zweifel sind nordamerikanische Indianer bereits in weit zurückliegenden Zeiten über die Landenge von Panama nach dem Süden vorgedrungen und haben sich dort ausgebreitet; später fand dann wieder eine Rückwanderung statt, die zur Zeit der Entdeckung Amerikas ihren Abschluß noch nicht gefunden zu haben scheint. Wir lernten als solche Rückwanderer bereits die Karaiben und Aruaken kennen.
Der südamerikanische Indianer nimmt in anthropologischer Hinsicht eine Mittelstellung zwischen der mongolischen, der kaukasischen und der polynesischen Rasse ein. Wir erwähnten bereits an anderer Stelle, daß die ursprüngliche Bevölkerung Amerikas teils aus Einwanderern aus Asien, teils aus solchen aus Europa hervorgegangen sein dürfte; wir haben ferner Anzeichen für die Annahme, daß auch von Polynesien aus auf vermutlich in früheren Zeiten bestehenden Inselbrücken malaiische Elemente nach Südamerika hinübergewandert sind und zu der Zusammensetzung der dortigen Bevölkerung beigetragen haben mögen. Der Typus der südamerikanischen Indianer weist eine ziemliche Mannigfaltigkeit auf. Dies zeigt sich schon an der Körpergröße. Wir begegnen recht großen Stämmen, wie den Tehueltschen oder Patagoniern und den Bororo, unter denen Gestalten von einhunderteinundneunzig bis einhundertzweiundneunzig Zentimetern durchaus keine Seltenheit sind; mit einem Mittel von[S. 190] einhundertfünfundsiebzig bis einhundertachtzig zählen beide Stämme zu den größten Menschen der Erde. Andererseits aber gibt es in Südamerika auch Indianerstämme, die von auffälliger Kleinheit sind, wie die Feuerländer mit nur einhundertachtundfünfzig Zentimetern, die merkwürdigerweise dicht neben den größten Menschen wohnen, ferner die Trumai, Puru, Karaiben von Guyana und andere. — Die Hautfarbe der südamerikanischen Eingeborenen zeigt im allgemeinen einen etwas helleren Ton, der etwa gelbgrauem Lehm gleicht; natürlich kommen hier und da auch dunklere Tönungen vor. Das Kopfhaar ist für gewöhnlich von grober, straffer Beschaffenheit und leuchtend-braunschwarzer Farbe; daneben gibt es unter manchen Stämmen auch verhältnismäßig häufig feines, leicht gewelltes Haar, ja selbst geringeltes und sogar gelocktes; fremde Blutmischung dürfte als Ursache hierfür nicht in Betracht kommen.

Die Kleidung entspricht dem jeweiligen Kulturstande; bei vielen Stämmen fehlt sie gänzlich, bei anderen ist sie sehr knapp bemessen. (Hierzu die Kunstbeilage.) Sie wird, wie Karl v. den Steinen nachgewiesen hat, in ihren ersten Anfängen hier nicht vom Schamgefühl gefordert, sondern entspricht dem Verlangen nach Schutz gegen Gefährdungen durch die Tierwelt, im besonderen von seiten einer Zeckenart und kleiner Fische, die mit Vorliebe beim Baden in die äußeren Geschlechtsöffnungen eindringen. Auf der ursprünglichen Stufe besteht die Kleidung des männlichen Geschlechts dementsprechend in einer Hüftschnur (Abbild. 212), oder es wird auch nur die Vorhaut zusammengebunden bzw. das Glied mit einem Überzug versehen; bei den Frauen tritt an dessen Stelle ein kleines, dreieckiges Stück Bast (Uluri), das über den Scheideneingang gebunden wird und diesen dicht verschließt. In weiterer Ausbildung kommt es zu Schambinden oder größeren Schürzen aus Rinde oder Bast. Ein eigenartiges Bekleidungstück sind breite, steife Gürtel (Abb. 213) aus Borke, Bast oder Perlschnüren, die um den Rumpf prall angelegt werden und diesen in dem Maße einschnüren, daß das Fleisch an den Rändern hervorquillt. Dieser „Schnürleib“ wird so selten wie möglich abgelegt und so lange getragen, bis es nicht länger angängig ist und der Gürtel gewechselt werden muß. In ähnlicher Weise werden die Gliedmaßen, Oberarme und Unterschenkel, eingeschnürt, damit die Muskeln gekräftigt werden; bei den Karaiben ist diese Verunstaltung eine kennzeichnende Stammeseigentümlichkeit, durch die sie schon den ersten Besuchern Amerikas aufgefallen waren. — Die in den kälteren Gegenden lebenden Indianer hüllen sich in Tierfelle (Abb. 214) oder Decken (Abb. 215; siehe auch die Kunstbeilage).
[S. 191]
Durchbohrungen im Gesicht, am meisten an den Ohren, der Nase und der Unterlippe, werden von den meisten Stämmen Südamerikas vorgenommen. In die dadurch entstandenen Löcher steckt man allerlei Zierat, so in die Ohrläppchen Pflöcke, Stäbchen, zusammengerollte Blätter oder bunte Federn, oft bis zu einer solchen Größe beziehungsweise Schwere, daß das Ohrläppchen bis auf die Schulter herabhängt (zum Beispiel bei den Botokuden); in der Nasenscheidewand (Abb. 216), den Mundwinkeln und der Unterlippe bringt man ähnliche Sachen an, wohl auch Muschelschalen, dünne Holzspäne und dergleichen. Eine sehr beliebte Körperverzierung ist auch das Anmalen, das gelegentlich eine solche Ausdehnung annimmt, daß die Leute, wie Koch-Grünberg sagt, beim ersten Anblick aussehen, als ob sie einen bunten, gestrickten Anzug trügen. Die Bemalung wird aus feierlichen Anlässen, bei Festen (Abb. 220) und Tänzen, beim Empfang von Gästen und sonstigen besonderen Gelegenheiten vorgenommen. Junge Leute betreiben dies gleichsam als eine Art Sport; sie lassen es sich angelegen sein, immer neue Muster auszuklügeln, und verbringen einen großen Teil ihrer Zeit damit, sich in dieser Weise auszuputzen; sie entsprechen insofern unseren Stutzern.
Tatauierung (Abb. 217 bis 219) kommt viel seltener vor; sie pflegt dann auch wohl immer ein Stammesabzeichen zu sein. Durch zierliche, arabeskenartige Muster zeichnen sich die Frauen der Kadiué aus.

[S. 192]
Der Pflege der Haare wird im allgemeinen weniger Beachtung geschenkt, doch versieht man sie gern mit schönem Federaufputz. Federschmuck (Abb. 221, 223 und 224) ist gerade für Südamerika recht bezeichnend. Es werden daraus schöne Mäntel, Oberarmbehänge, ja sogar ganze Anzüge in mühseliger Arbeit hergestellt, die ihrer Kostbarkeit wegen allerdings nur bei ganz besonders festlichen Anlässen getragen werden; in der Zwischenzeit bewahrt man sie sorgfältig in geflochtenen Schachteln auf. Den Stoff geben die farbenprächtigen Vögel der Tropenwelt ab: Papageien, Araras, Ibis, Reiher und andere.
Der sonstige Schmuck ist äußerst mannigfaltig; alle drei Reiche der Natur müssen dazu beitragen. Bald sind es Zähne der großen Säugetiere (Affe, Wildschwein, Jaguar und so weiter), Kieferstücke von Fischen, Klauen vom Gürteltier, schillernde Flügeldecken von Prachtkäfern oder Hörner des Hirschkäfers, Muschelschnecken, bald allerlei Fruchtkerne oder Fruchtkapseln, bald auch glänzende oder bunte durchbohrte Gesteine oder Perlen (Abb. 222), die man als Ketten oder Bänder um den Körper hängt.
Die wirtschaftliche Kultur der südamerikanischen Indianer ist sehr verschiedenartig; sie hängt mit dem Grade ihrer Zivilisation und mit der Umgebung, in der sie leben, zusammen. Ein Teil führt noch ein umherschweifendes Leben als Sammler oder Jäger; diese haben meistens keine festen Wohnungen, sondern leben unter einfachen Laubhütten oder in Erdlöchern. Die mehr seßhaften Stämme kennen richtige Grashütten (Abb. 226), die sich meistens zu Weilern, seltener zu eigentlichen Dörfern zusammenschließen. Auch Pfahlbauten sind bekannt; der Name Venezuela, das ist Klein-Venedig, rührt von der Ähnlichkeit her, die die von den ersten Ankömmlingen an der Lagune von Maracaibo angetroffenen Niederlassungen mit dem Bilde der italienischen Lagunenstadt zeigten. Sehr verbreitet, besonders unter den Karaiben und Aruaken, ist der Gebrauch von Hängematten; das englische Wort hammock stammt von dem aruakischen hamaca, mit dem man diese Schlafgelegenheit bezeichnete. Die Uaupés haben Sippenhäuser, in denen mehr als hundert Personen Unterkunft finden können. Die Beschäftigung dieser mehr seßhaften Indianer bildet der Hackbau oder der Fischfang (mit Bogen und Pfeilen, Harpunen, Reusen oder durch Vergiftung des Wassers); auch Viehzucht wird betrieben (Gran Chaco, Goajiro). Einige Stämme (Gran Chaco, südliches Argentinien) sind nach Einführung des Pferdes durch die Europäer vorzügliche Reiter geworden.


Die Hauptnahrungsquelle (Abb. 225 und 228) sind im allgemeinen Jagd und Fischfang. Fleisch und Fische pflegt man durch Rösten auf Bratständern oder an Spießen, häufig auch in Erdgruben genießbar zu machen; das eigentliche Kochen ist meistens unbekannt, weil vielfach Töpfe überhaupt fehlen. Die Karaiben[S. 193] und Aruaken stellen aus der sehr giftigen Wurzel der Manihotpflanze auf umständliche Weise ein Mehl her, das ihre Hauptnahrung ausmacht. Einzelne Stämme huldigen auch noch der Menschenfresserei (Abb. 227). Unter den Genußmitteln steht der Tabak oben an. Er wird geraucht und geschnupft. Geraucht wird der Tabak entweder in Form von großen, mit Maisblatt umhüllten Zigaretten, die häufig mit einer Gabel als Stützvorrichtung (Abb. 230) gehandhabt werden, oder in Pfeifen aus Holz oder Ton. Ganz merkwürdig verfährt man beim Schnupfen; man bläst sich selbst oder gegenseitig das Schnupfpulver mit Hilfe von Röhren in die Nase.




Als Waffen (Abb. 220 u. 229) dienen den südamerikanischen Indianern Bogen und Pfeile, erstere häufig prächtig verziert, sowie Wurflanzen mit in Gift getauchten Spitzen, die in manchen Gegenden mit einem Wurfbrett geschleudert werden, Stoßlanzen und besonders auch Keulen; hierzu tritt für einzelne Gebiete für die Jagd noch das Blasrohr (Abb. 231) mit gleichfalls vergiftetem Pfeil. Die Reiterstämme der Steppen bedienen sich mit Vorliebe des Lassos und der Bola, einer Wurfkugel. Die Verteidigungswaffen bestehen aus Schilden (Abb. 232) von Holz oder Fell und aus Rüstungen, die man aus Fellen oder Geweben herstellt. Eine Eigentümlichkeit besonders der Jivaros sind ihre Siegestrophäen aus den abgeschnittenen und auf besondere Art zubereiteten Köpfen erschlagener Feinde (Abb. 233 und 234), die sogenannten Tsantsas. Die Haut des möglichst tief abgehauenen Kopfes wird durch Längsschnitt am Hinterhaupt gespalten und mit Einschluß der Gesichtshaut auf geschickte Weise von den darunterliegenden Knochen abgeschält, darauf in Wasser, dem gewisse Kräuter, wohl zur Desinfektion, zugesetzt sind, gekocht und schließlich über einen runden, heiß gemachten Stein gezogen, den man nach und nach durch einen immer kleineren bis zur Größe einer Orange ersetzt, während die Weichteile mit einem anderen, ebenfalls heiß gemachten Stein wie mit einem Plätteisen[S. 194] von außen geglättet werden. Der auf diese Weise ausgetrocknete, gleichsam mumifizierte Kopf, in dessen Inneres man, um die Form zu erhalten, wohl noch heißen Sand schüttet, wird als Siegeszeichen an einer Schnur aufgehängt. Die Herbeischaffung eines Tsantsa von seiten eines Kriegers hat eine große Festlichkeit (Tsantsa-Tucui) im Gefolge, zu der er sich würdig vorbereiten muß. Dazu gehört auch eine lange Enthaltsamkeit vom Genusse gewisser Speisen (so jeglichen Wildes, das durch Pfeil erlegt wurde, und zahlreicher anderer Tiere); er darf nur Fische, Yukka, Bananen und einige kleine Vögel, die mit einem Blasrohr erlegt wurden, verzehren. Er muß ferner, wenn er sich ins Freie begibt, seine Lanze zu Haus lassen, was für einen Wilden eine große Entsagung bedeutet, und sich des geschlechtlichen Verkehrs enthalten. Außerdem bemalt er seinen Körper mit schwarzen Linien und zieht einen ebensolchen Streifen quer über das Gesicht von einem Ohr zum anderen. Diesen Enthaltsamkeitsvorschriften muß er mehrere Monate bis zu zwei Jahren nachkommen, man hörte selbst von einer Befolgung derselben auf sechs bis zehn Jahre. Wer dagegen verstößt, lädt großes Unglück auf sich und seine Familie, denn der Geist der Abgeschlachteten läßt ihn nicht in Ruhe. Eine so lange Vorbereitungszeit ist auch darum erforderlich, weil der junge Krieger sich erst die Nahrungsmittel zur Bewirtung der zahlreichen Gäste, die sich zum Fest einfinden, beschaffen muß; er muß Yukka und Bananen säen und sie ernten, um daraus durch Gärung eine ungemeine Menge von Chicha herzustellen; er muß auch große Jagden veranstalten, um das erforderliche Fleisch zu beschaffen, das dann für lange Aufbewahrung besonders zubereitet wird. Der großen Kosten wegen pflegen sich meistens mehrere Jünglinge zusammenzutun. Zum Feste selbst finden sich alle Angehörigen, selbst solche aus den entferntesten Gegenden ein. Ein mit der Leitung der Feier betrauter alter Mann nimmt aus den Händen des Kriegers, der nun wieder mit Lanze erscheint, den Tsantsa entgegen und taucht ihn nacheinander in eine Abkochung von Tabak, in Chicha und schließlich in reines Wasser; nachdem er hierauf den Helden des Tages genötigt hat, sich niederzusetzen, und ihm diese verschiedenen Flüssigkeiten eingeflößt hat, nimmt[S. 196] dieser seine Trophäe wieder in Empfang und hängt sie am Hauptpfosten seines Hauses auf, der mit Blumen, ausgestopften Vögeln und zahlreichen anderen Anhängseln verziert ist. Der Festleiter hält nun noch eine Rede auf den jungen Mann. Hieran schließen sich Tänze der Männer und ein Trinkgelage, meistens sechs Tage lang; dabei wird den verteilten Speisen eifrig zugesprochen. In der letzten Nacht wird noch eine Anzahl fetter Schweine geschlachtet und aus ihrem Fleisch eine Kraftbrühe hergestellt, von der am Morgen des siebenten Tages jeder der Teilnehmer trinkt. Diese kehren dann wieder heim, nachdem jeder von ihnen noch ein großes Stück Fleisch mitbekommen hat. Diese Festlichkeit soll den Zweck haben, den Geist des Getöteten zu versöhnen und geneigt zu stimmen. Fortan wird der Tsantsa zu einer Art Fetisch, der seinem Besitzer und dessen Angehörigen Reichtum, Fruchtbarkeit für die Felder, Glück in der Familie und Sieg über die Feinde sichert.




Über die religiösen Vorstellungen der südamerikanischen Indianer sind wir nur mangelhaft unterrichtet. So viel scheint indessen aus den bisherigen Beobachtungen hervorzugehen, daß sie auf Animismus und primitivem Dämonenglauben beruhen. Für den Indianer ist die sichtbare Welt mit zahlreichen bösen und guten Geistern bevölkert, die allenthalben in der Luft, im Wasser und auf der Erde wohnen und einen entscheidenden Einfluß auf das Schicksal der Menschen, vor allem auch auf ihren Tod ausüben. Auch Ahnenkultus ist damit verbunden. Daher läuft auch hier das Bestreben der Menschen darauf hinaus, die bösen Geister gut zu stimmen beziehungsweise zu versöhnen. Dies geschieht hauptsächlich durch Tänze, bei denen Masken (Abb. 235, 237 und 240 sowie die farbige Kunstbeilage) eine besondere Rolle spielen. Man trifft diese Tänze, die an unseren Karnevalmummenschanz erinnern, unter den südamerikanischen Waldindianern allenthalben an. Die dabei vorgeführten Masken sind ganz verschiedene. Bei den Kobéua zum Beispiel bestehen sie aus Überzügen von dickem, weißem Bast, die nach bestimmtem Plane mit mancherlei geschmackvollen Mustern bemalt sind, bei den Tikuna in ähnlichen Bastbezügen mit einem Menschen- oder Tierkopfe, der aus Baumwachs über einem Gestell geformt ist. Bei den[S. 198] Karaya sind die Masken walzenförmige Gebilde aus Schilf mit zierlichem Federschmuck, die auf dem Kopfe getragen werden, dazu ein dichter Blätterüberwurf, der den ganzen übrigen Körper bis hinab zu den Zehen umhüllt. Bei noch anderen Stämmen sind es eigentliche Tanzanzüge, aus einem Stück geflochten, zu denen vollständige Beinkleider, Ärmel und eine Kopfbedeckung gehören, und dergleichen mehr. Wir verdanken Koch-Grünberg, der auf seinen Reisen sich in die Vorstellungs- und Empfindungswelt einer Reihe südamerikanischer Stämme einzufühlen verstanden hat, fesselnde Einblicke in die Bedeutung dieser Maskenaufführungen. Bei den Kobéua und Káua werden solche Tänze bei Todesfällen aufgeführt (Abb. 236 und 238). Etwa acht Tage nach dem Begräbnis treten die Männer in der schon geschilderten Tracht auf und führen einen Tanz auf, der von etwa drei Uhr nachmittags bis zum nächsten Morgen währt; die Frauen und Kinder nehmen nicht daran teil, sondern sehen nur zu. Jede Maske stellt, so glaubt man, einen Teufel vor; er befindet sich in der Maske, ist in ihr verkörpert, nimmt aber nur vorübergehend von dem Tänzer Besitz, nur so lange, als dieser die Maske trägt. Nach Beendigung des Tanzes tragen die Beteiligten früh am Morgen ihre Masken nach der Dorfwiese, stellen sie auf Stöcken auf, binden die Ärmel der einen mit denen der nächsten zusammen und zünden sie an. Während nun die lange Reihe der Figuren von einem Ende bis zum anderen verbrennt, erhebt sich lautes Wehklagen aller Versammelten. Man behauptet, daß dadurch die Teufel gezwungen würden, wieder aus ihren[S. 199] Hüllen herauszugehen und an ihre gewöhnlichen Wohnorte zurückzukehren, die man wahrscheinlich auf irgend einen hohen Hügel oder in einen Wasserfall verlegt. Der gewöhnliche Sterbliche vermag diese Dämonen nicht zu sehen, wohl aber ist dazu der Medizinmann imstande, weil er mit übernatürlichen Kräften ausgestattet ist; er vermag auch mit ihnen zu sprechen. Die Geister, die man durch diese Tänze zu versöhnen oder an weiteren Untaten zu verhindern trachtet, sind die Geister von Tieren (Abb. 242, 243, 244 und 248), von mehr oder weniger bösen Geistern in menschlicher Gestalt, von Riesen (Abb. 241) oder Zwergen (Abb. 239). Merkwürdigerweise werden vielfach gerade solchen Tieren recht gefährliche Geister zugeschrieben, die besonders harmlos sind. So wird der große azurblaue Schmetterling Tataloko für einen der gefährlichsten Dämonen gehalten; von ihm, der in dem höchsten der Wasserfälle des Uaupé hausen soll, behauptet man allen Ernstes, daß er die Malaria zusammenbraue, so daß alle, die von dem Flußwasser trinken — und in der Tat ist sie wegen des stagnierenden Wassers gerade an dieser Stelle ziemlich verbreitet — die Krankheit bekommen.
Von anderen Stämmen werden Maskentänze aus anderen Anlässen veranstaltet, zum Beispiel von den Yuri, Passé und Tecuna bei Hochzeiten (Abb. 246) oder beim Ausreißen der Haare des neugeborenen Kindes und bei anderen Gelegenheiten. Fast stets sind sie aber mit religiösen (Abb. 247) oder mystischen Vorstellungen verbunden. So sollen die Aufführungen der Kobéua am oberen Uaupé, bei denen Masken in Vogel-, Fisch- und Eidechsengestalt auftreten, bewirken, daß die Männer beim nächsten Zuge des Stammes eine reiche Beute an Wild und Fischen mit heimbringen. Die Tänze werden stets von Musik begleitet. — Auch Federspiele und sonstige Spiele sind bei den Indianern Südamerikas sehr beliebt (Abb. 249 und 250).



Der Medizinmann spielt im Leben der südamerikanischen Indianer eine wichtige Rolle und wird oft auch sehr von ihnen gefürchtet. Vermöge seiner angeblichen Begabung mit übernatürlichen Kräften vermag er zwischen Menschen und der Geisterwelt Verkehr herzustellen, vor allem mit den Teufeln und den Geistern der Toten sich in Verbindung zu setzen, die ihm oft in Gestalt von Tieren erscheinen, und sie entweder zum Schutze oder zum Schaden seiner Mitmenschen sich dienstbar zu machen. Er tut dies auch in Krankheitsfällen, bespricht die Krankheit, hört auf den Rat der Geister und erfährt zugleich, was für einen Ausgang die Krankheit nehmen wird. Durch Zauberei versucht er, dem bösen Geist, der früher in einem Tiere lebte, jetzt aber in den Körper des Kranken gefahren ist, zu befehlen, daß er diesen wieder verlasse und seine alte Wohnstätte aufsuche. Anderseits[S. 200] ist der Medizinmann auch imstande, Krankheit und Tod über einen Menschen zu bringen, indem er den bösen Geist veranlaßt, von dessen Körper Besitz zu ergreifen. Auf dieser geheimnisvollen Kraft beruht der Einfluß und die Macht, die er auf die Mitglieder seines Stammes ausübt. Um ihnen den Glauben an seinen übernatürlichen Umgang mit der Geisterwelt beizubringen und mehr und mehr zu befestigen, treibt der Medizinmann seine Künste nachts in einer einsamen Hütte, wo er in sehr geschickter Weise alle möglichen Tierstimmen nachahmt und auf diese Weise den Fernstehenden vorspiegelt, daß er sich mit den Teufeln berate, die ihm als wilde Tiere erscheinen. Für gewöhnlich hat er auch die Fähigkeit des Bauchredens; er läßt zwei Stimmen sich miteinander unterhalten, bald so, als ob sie ganz in der Nähe, bald wieder, als ob sie in weiter Ferne wären. Bei seinen Offenbarungen und Heilungen scheint sich der Medizinmann durch Selbstsuggestion und andere Hilfsmittel in einen Zustand von Ekstase oder Zwangschlaf zu versetzen. Er raucht zum Beispiel fürchterlich, nimmt ganze Mengen Schnupftabak und verschiedene betäubende Mittel zu sich, tanzt und singt und macht mit seinem Zaubergerät — meist einer Kürbisklapper — stundenlang ununterbrochen ganz eintönige Musik, bis er selbst in eine Art von Verzückung gerät, in der ihm allerlei Sinnestäuschungen kommen. Hieran schließt sich ein Zustand völliger Betäubung, in dem er trügerische Bilder sieht und Stimmen hört. Diese beschreibt er, sobald er wieder erwacht ist, mit[S. 201] mancherlei Zusätzen und Ausschmückungen. Die Indianer nehmen alles, was er hierbei vorbringt und angeblich im Traumzustand gesehen und gehört hat, für eine Offenbarung. Außerdem treibt der Medizinmann, wenn es sich darum handelt, einen Kranken zu behandeln, noch allerlei Gaukelkünste; er räuchert diesen an, bläst ihm Tabakswolken ins Gesicht oder auf die erkrankte Körperstelle, knetet sie auch oder bespeit sie. Schließlich saugt er an der schmerzhaften Stelle und befördert nach einer Weile irgend einen Gegenstand, den er vorher wohlweislich verborgen gehalten hatte, aus dem Munde, wie einen Knochen, einen Dorn, Muschelschalen, Holzstückchen, Sand, Käfer, Tausendfüßler und Ähnliches; durch den großen, anhaltenden Lärm, das eintönige Gesinge und die anderen Mätzchen, die er macht, übt der Medizinmann auf den Kranken gewissermaßen einen einschläfernden Einfluß aus, so daß dieser schließlich selbst glaubt, daß die Ursache seiner Beschwerden herausgefunden und er nun geheilt sei.


Die Ausbildung eines Medizinmannes beginnt bereits in seiner frühesten Jugend und dauert oft jahrelang. Der Bewerber muß den Nachweis liefern, daß er die Macht besitzt, einen vertraulichen Verkehr mit der Geisterwelt zu unterhalten. Zu diesem Zwecke zieht er sich an einen einsam gelegenen Ort zurück, fastet hier ein ganzes Jahr lang ohne Unterbrechung, übt Stillschweigen und sonstige Enthaltsamkeit, nimmt starke Brechmittel ein, trinkt auch Tabakwasser und schlägt sich mit wilden Tieren, besonders dem Jaguar, herum oder gibt wenigstens vor, dies zu tun. Gleichzeitig wird der Neuling von einem alten Mitgliede der Brüderschaft in alle Geheimnisse seiner Kunst eingeführt. Man nimmt von einem Medizinmann an, daß er sich in ein Tier verwandeln könne — für viele Stämme ist dies der Jaguar — und daß nach seinem Tode seine Seele nicht nach dem Aufenthaltsort der Seelen der übrigen Menschen wandere, sondern für immer in Gestalt eines bösen Jaguars im Walde umherstreife und den Menschen gefährlich werde.
[S. 202]
Wie wir es von anderen Naturvölkern her kennen, haben auch bei den südamerikanischen Indianern die Schwangere und meistens auch ihr Ehemann ihre Lebensweise nach strengen Vorschriften zu regeln; bei den Mauhe zum Beispiel darf die werdende Mutter sich nur von Pilzen, Ameisen und einem Gebäck aus einer bestimmten Pflanze ernähren. Allgemein üblich ist, daß man das Fleisch bestimmter Tiere meidet, um zu verhüten, daß deren schlechte Eigenschaften auf das Kind übergehen. Äße, um ein Beispiel anzuführen, bei den Karaiben von Britisch-Guyana der Vater das Fleisch eines kleinen Vierfüßlers, dann würde das Kind mager und dünn ausfallen, einen bestimmten kleinen Fisch, dann würde es blind zur Welt kommen, von einem Wildschwein, dann würde es einen Rüssel bekommen, von einem besonderen Vogel, dann würde es stumm bleiben.


[S. 203]
Die Niederkunft der Indianerin geht entweder im Hause der Eltern oder in einer von den übrigen abgesonderten Hütte, auch wohl im Freien im Busche vor sich. In Nordwestbrasilien und Guyana, wo man in größeren Sippenhäusern wohnt, wird der Teil des Hauses, der der in Frage kommenden Familie gehört, von den Wohnungen der übrigen durch Matten abgetrennt. Die Mutter des Mannes leistet bei der Geburt hilfreiche Hand, sofern die Kreißende nicht auf sich selbst angewiesen ist; oft spielt sich der ganze Vorgang in Anwesenheit aller verheirateten Frauen des Dorfes ab. Männer dürfen meistens nicht zugegen sein, nicht einmal der Vater des zu erwartenden Kindes. Verzögert sich die Geburt, dann eilen bei den Payagua und Mbaya die Nachbarinnen mit kleinen Kürbisschalen oder Klappern herbei und schütteln sie eine Zeitlang möglichst kräftig, worauf sie sich wieder entfernen. — Die Nabelschnur[S. 204] wird entweder mit den Zähnen abgebissen, zumal wenn die Frau in ihrer einsamen Gebärhütte niemand zur Hilfeleistung hat, oder mit einem scharfen Steinmesser, einem Bambusspan, einer Muschelschale durchgeschnitten, auch wohl zwischen zwei Steinen zerquetscht, wodurch gleichzeitig die Blutung zum Stillstand gebracht wird. Bei den Macusi von Britisch-Guyana liegt die Durchtrennung der Nabelschnur der Mutter oder der Schwester der Gebärenden ob. Je nach dem Geschlecht des zur Welt gekommenen Kindes wird ein anderes Werkzeug dazu benutzt, bei Knaben ein scharf geschliffener Bambusspan, bei Mädchen ein Stück Pfeifenrohr. Von den Frauen verschiedener Stämme wird berichtet, daß sie früher die Nabelschnur beziehungsweise die Nachgeburt verzehrten.

Auch nach der Geburt setzen die Eltern meistens ihre streng geregelte Lebensweise fort. Zunächst halten sie sich wieder an eine bestimmte Ernährungsart oder fasten auch wohl für einige Tage ganz. Bei den Uaupé und Isana besteht ihre Nahrung ausschließlich aus Maniokwurzelmehl und gebackenen Ameisen. Die junge Mutter muß etwa fünf bis zehn Tage lang abgeschlossen in ihrer Hütte verbleiben; ihr Mann leistet ihr dabei Gesellschaft. Keines von beiden darf während einer gewissen Zeit eine Arbeit vornehmen. Bei den Taulipang erstreckt sich der Zeitraum, während dessen die Eltern nicht arbeiten dürfen, auf drei bis vier Monate. Die Frau darf wohl Wasser holen, aber nicht kochen; dies besorgt die Großmutter. Sie darf auch nicht auf dem Felde arbeiten. Ihr Mann darf kein Beil oder Messer anfassen, auch keine Pfeile zurechtmachen, ebensowenig mit einem Bogen schießen, damit [S. 206]er nicht „das Kind am Kopfe schneide, stoße oder treffe“. Jede Übertretung dieser und ähnlicher Verbote, die sich bezüglich der Nahrung für den Vater bei manchen Stämmen auf mehrere Monate, bei den Ipurina sogar auf ein ganzes Jahr erstrecken, würde dem neugeborenen Kinde Unheil bringen.

Eine unter den südamerikanischen Indianern ziemlich verbreitete Sitte ist das Männerkindbett. Während die Frau, oft genug sogleich nach ihrer Niederkunft, ihren häuslichen Pflichten nachgeht, zieht sich der Mann für einige Tage in den Raum zurück, wo die Geburt erfolgte, legt sich nieder, wartet und besorgt das Kind und beobachtet für seine eigene Person eine strenge Wöchnerinnenernährung oder fastet auch vollständig, all dies aus Furcht, bei Verletzung dieser Vorschriften könnte das Kind sterben oder wenigstens schweren Schaden nehmen. So glauben die Indianer von Britisch-Guyana, daß das Kind, wenn der Vater ein Nagetier mit stark vorspringenden scharfen Zähnen äße, ein ebensolches Gebiß bekäme, oder wenn er von dem Fleisch eines gefleckten Tieres nähme, das Kind eine scheckige Haut erhielte. Er darf auch nicht rauchen, sich nicht waschen, vor allem auch keine Waffe berühren, nicht einmal sich mit den Fingernägeln kratzen, wenn ihn jucken sollte; er muß in diesem Fall ein Stückchen von einem Blatt oder einen Halm benutzen, die man ihm eigens zu diesem Zweck vor sein Ruhelager legt. Bei den Passé in Ecuador färbt sich der Mann während der Zeit seines Kindbettes schwarz, und seine Frau hält sich einen Monat lang im Dunkeln auf.
Zwillinge werden meistens als ein böses Zeichen aufgefaßt, als Beweis für Untreue der Frau oder Besessenheit von einem bösen Geiste, der mit ihr Verkehr hatte, und daher getötet; manchmal tötet man auch nur einen der Zwillinge. Die Saliva züchtigen ihre Frauen bei einem solchen Vorkommnis auch noch für ihr vermeintliches Vergehen. Im alten Peru legte man den Eltern nach einer Zwillingsgeburt strenge Fasten auf, während deren sie abwechselnd mit je einem gebeugten Knie daliegen mußten, so lange, bis eine in die Kniekehle gelegte Bohne infolge der Wärme zu keimen begann. Darauf führte man das Paar noch an einem Stricke um den Hals öffentlich herum. Damit die vermeintliche Untreue nicht ans Tageslicht komme, begräbt eine Frau der Campa und Anti im heutigen Peru, die Zwillinge geboren hat, verstohlenerweise das zweite Kind lebendig; nur das erste gilt als das wahre Kind des Gatten.

In Nordwestbrasilien nehmen nach der Geburt beide Eltern und das Kind, wenn die fünf Tage der Abgeschlossenheit vorüber sind, unter ganz seltsamen Förmlichkeiten ein gemeinsames Bad im Flusse. Bei einigen Stämmen Brasiliens (Guarani, Tupinimba)[S. 207] pflegt der Vater seinem Neugeborenen, wenn es ein Knabe ist, unter Ermahnungen zur Tapferkeit kleine Waffen (Bogen und Pfeile) zu übergeben. Einige Tage nach der Geburt gibt der Großvater, seltener der Vater dem Kinde den Namen; bei den Stämmen am oberen Negro ist dieser Vorgang mit einem großen Zechgelage verbunden, zu dem alle Verwandten eingeladen werden. Die Knaben erhalten fast alle zwei Namen, die Mädchen nur einen. Die Namen beziehen sich meistens auf Tiere oder Pflanzen, Flüsse, Gliedmaßen, merkwürdige Ereignisse und Orte oder auf die Namen von Vorfahren oder Paten. Bei einigen Stämmen wird die Mutter des Kindes vor der Namengebung durchgeräuchert.




Schädelverbildung kommt gleichfalls bei einigen südamerikanischen Stämmen (Pampa, Araukaner, Patagonier) vor; sie beruht auch hier auf der eigentümlichen Form der Wiege (Lagerung des Kindes auf einem flachen Brett und Festbinden des Kopfes mit einem um das Brett geschlungenen Lederstreifen), die die Mütter, wie es die nordamerikanischen Indianerinnen tun, bei Reisen auf dem Rücken mit sich schleppen oder in der Ruhe senkrecht entweder an einen Baumast hängen oder mit den beiden Spitzen, in die das Wiegenbrett ausläuft, in die Erde stecken. — Das Stillgeschäft zieht sich sehr lange, bis auf drei und vier Jahre, hin. Koch-Grünberg erlebte es bei den Uaupé, daß ein etwa dreijähriger Junge seiner Mutter plötzlich die Zigarette aus dem Munde nahm, ein paar Züge daraus tat und sich ihr dann auf den Schoß setzte, um sich die Brust geben zu lassen.
Sobald das Reifealter eintritt, werden Knaben und Mädchen gewissen Förmlichkeiten unterworfen, um ihren Mut und ihren Gehorsam zu erproben. Diese fallen im allgemeinen[S. 208] ziemlich streng aus und tragen bei einigen Stämmen das Gepräge einer regelrechten Folter. Die Stämme von Nordwestbrasilien und Guyana lassen dem Mädchen das Kopfhaar ganz kurz abscheren. Am oberen Negro geschieht dies auch mit den jungen Männern; sie pflegen das abgeschnittene Haar sorgfältig aufzubewahren und legen es bei besonders festlichen Gelegenheiten wieder an. An die Haarschur schließt sich eine lange Fastenzeit von vier Wochen, während deren es dem Mädchen untersagt ist, das Fleisch größerer Fische und warmblütiger Tiere zu essen; auf das Fasten folgt sodann ein feierliches Bad. Der Vater singt am folgenden Morgen vor Sonnenaufgang einen langgezogenen, sich gleichbleibenden Ton und gibt eine Liste all der Pflanzen und Tiere bekannt, die das Mädchen fortan essen darf. — Bei den Baniwa von Guyana sitzt das Mädchen während der ersten vier Tage seines ersten Unwohlseins auf einer Matte mitten im Hause; es darf nur kleine Stückchen Maniokbrot verzehren, die ihm die Mutter oder eine weibliche Verwandte von Zeit zu Zeit darreicht, wobei diese aber eine unmittelbare Berührung mit dem Mädchen vermeiden müssen. Am Abend des vierten Tages versammelt sich die ganze Sippe im Kreise um den Medizinmann, der die ganze Nacht hindurch eintönig singt; die Anwesenden begleiten ihn dabei im Chor. Von Zeit zu Zeit bläst er auf eine aus Maniok gebraute Bowle, die dadurch entzaubert werden soll. In der Frühe des anderen Morgens bekommt das Mädchen davon zu trinken, und mit diesem Augenblick rückt es auf die Stufe der heiratsfähigen Frauen des Stammes auf. Es setzt sich sodann auf einen Schemel und erhält von dem ältesten oder angesehensten[S. 209] Mitgliede der Sippe zwei Schläge ausgeteilt. Hierzu wird eine Geißel aus geflochtener Palmfaser benutzt, an deren Ende der scharfe Zahn eines Fisches befestigt ist, so daß jeder Schlag eine blutende Wunde verursacht. Bevor der Alte zum Schlage ausholt, hält er eine feierliche Ansprache an das Mädchen und erinnert es an seine Pflichten der Sippe gegenüber. Das Ende der ganzen Feier bildet eine allgemeine Prügelei von Männern und Frauen, bei der es sehr derb zuzugehen pflegt. Schließlich kommen am folgenden Abend alle männlichen Teilnehmer zu einer Festlichkeit zusammen, um zu tanzen und vor allem auch, um sich tüchtig in Yaraki, einem leicht berauschenden einheimischen Getränk, das aus Maniokwurzel gebraut wird, zu betrinken. Dabei sind alle wieder gut Freund und vergnügt. Das Fest beginnt mit einem Maskentanz. Alle Beteiligten tragen Masken von verschiedenen Tieren und ahmen auch deren Stimmen und Gangart nach; dabei wird ein ohrenbetäubender Lärm mit Trommeln, Trompeten und Flöten gemacht. Man will dadurch den obersten aller bösen Geister, namens Mauari, und seine teuflischen Anhänger versöhnen. Frauen dürfen bei diesem Maskentanz nicht zugegen sein; sollte eine Frau etwa den Mauari zu sehen bekommen, dann würde der Tod ihr Los sein: ihr Vater, Gatte, Sohn oder Bruder oder, wenn keiner von diesen mehr am Leben sein sollte, ihr nächster sonstiger Verwandter ist gehalten, sie zu töten. — Bei den Taulipang artet die Mannbarkeitserklärung der jungen Mädchen in eine wirkliche Peinigung aus. Man setzt ihnen große schwarze Ameisen, die sich in einem Netz verfangen haben, mit diesem auf die Handflächen, Arme, Lenden und Fußsohlen; der Schmerz, den der Biß der zornigen Tiere hervorruft, ist äußerst[S. 210] heftig und hält stundenlang an. Die Großmutter des Mädchens, in selteneren Fällen die Mutter, tatauiert ihm die Mundwinkel mit dem Stammesabzeichen, wobei sie eine Kohle aus dem verbrannten Körper einer Honigbiene als Farbe benutzt; dies tun sie, „damit aller Kaschiri“, den sie aus der geriebenen Maniokwurzel herstellen, „süß wie Honig sei“. Außerdem wird dem Mädchen das Haar im Nacken abgeschnitten. Es muß ein paar Tage in der Hängematte verbleiben, die von dem übrigen Wohnraum der Familie durch einen Verschlag getrennt ist. Es darf währenddessen nur seine nächsten weiblichen Verwandten sehen, damit es nicht „das Gefühl der Sittsamkeit verliere“. Die Großmutter stellt ihm Sandalen aus Palmenstielen her und bestreicht ihm den ganzen Körper mit roter Farbe. Darauf schlägt ein alter Mann, für gewöhnlich der Großvater, das Mädchen mit einer Palmfaserpeitsche, deren Spitzen mit rotem Pfeffer eingerieben sind, damit die entstehenden Wunden auch tüchtig schmerzen. Für eine Reihe Monate muß das Mädchen außerdem noch eine streng geregelte Lebensweise befolgen: es darf nur ganz kleine Fische und solche Gerichte essen, die aus Maniok zubereitet sind; es darf sich das Haar nicht mit der Hand glätten, sondern muß einen Palmstiel dazu verwenden; auch darf es nicht an der Feldarbeit teilnehmen, keinen Korb tragen, kein Messer oder Beil anfassen, weil es sonst Schmerzen am Kopf und an den Armen bekäme; selbst lautes Sprechen ist ihm untersagt; ebenso, das Feuer mit dem Atem anzufachen, weil ihm sonst schwindlig werden könnte (es darf nur den Fächer benutzen). Sind fünf oder sechs Monate unter solcher Lebensweise verstrichen, dann bläst die Großmutter über alle Gegenstände hin, die dem Mädchen gehören, indem sie streng vorgeschriebene geheimnisvolle Formeln hersagt, um zu verhüten, daß aus der Benutzung dieser Dinge irgend ein Unglück entstehe. Ähnlichen Martern, wie soeben geschildert, begegnen wir bei den Karaiben von Britisch-Guyana sowie bei verschiedenen Amazonasstämmen, wie den Mundurukú, Tekúna, auch bei den Stämmen am Uaupéflusse. Im Gran Chaco sind solche Gebräuche unbekannt; hier wird der erste Eintritt der Regeln nur durch Tänze gefeiert. Bei den Ashluslay zum Beispiel steht das Mädchen mit verhülltem Gesicht da und die älteren Frauen tanzen um dasselbe herum mit Stöcken in den Händen, an die Klappern aus Tierklauen gebunden sind, während die Männer mit Kalebassen, in die man Getreidekörner getan hat, den Takt dazu schlagen. — Bei den Chané und Chiriguano wird das der Reifezeit sich nähernde Mädchen in einem Verschlag der elterlichen Hütte, einer Art Schrank, eingepfercht und ihm das Kopfhaar kurz geschnitten. Erst wenn dieses wieder halblang gewachsen ist, erlangt es seine Freiheit zurück. Es darf während jener Zeit sein „Gefängnis“ nur in Begleitung der Mutter verlassen, um die notwendigsten Dinge zu verrichten, zum Beispiel zu baden; zur Nahrung erhält es[S. 211] während der Einschließung ausschließlich gekochten Mais. Sobald seine Zurückgezogenheit abgelaufen ist, gilt das Mädchen als heiratsfähig.


Auch die jungen Burschen müssen sich strengen Mutproben unterziehen, wenn sie die Berechtigung erlangen wollen, als Männer anerkannt zu werden. Bei vielen Stämmen ist damit die Aufnahme in einen geheimen Männerbund verknüpft. Bei den Taulipang zum Beispiel bekommen alle Knaben zu dieser Zeit von dem Stammesältesten, vielfach dem eigenen Großvater, eine Tracht Prügel und müssen ein ganzes Jahr lang eine streng geregelte Ernährungsweise beobachten. Außerdem bringt ihnen der betreffende Alte an verschiedenen Körperstellen Schnittwunden bei, die er mit mancherlei Pflanzensäften einreibt, angeblich, damit der Knabe mit Pfeil, Bogen und Blasrohr auf der Jagd oder beim Fischen Erfolg habe. Zu demselben Zweck wird dem Jüngling ein Stück Palmfaser, das in dieselben Säfte eingetaucht wurde, einmal hin und her durch die Nase gezogen. Schließlich muß er sich noch dem Gottesurteil unterwerfen und sich von Ameisen am ganzen Körper beißen lassen. Besonders schwer haben die Oyanaknaben an dieser „Ameisenprobe“ zu leiden. Sie werden in dem Grade von den Tieren gequält, daß sie meistens ohnmächtig zusammenbrechen und bewußtlos in ihre Hängematte getragen werden müssen, wo sie dann für ein bis zwei Wochen mit Schnüren festgebunden werden, während noch obendrein ein Feuer unter ihnen unterhalten wird. Die ganze Zeit über dürfen sie auch nur eine kleine Sorte geräucherten Fisch und Maniokbrot essen, aber trotz der großen Hitze kein Wasser zu sich nehmen. Der Quälerei folgt ein großes, mehrere Tage dauerndes Tanzfest, bei dem die Gäste auch wieder in Masken gekleidet erscheinen und einen umfangreichen Kopfputz tragen; die Knaben werden hier wieder geschlagen. Allgemein ist es Vorschrift, daß[S. 212] die so behandelten Knaben — die „Ameisenprobe“ (auch Wespen werden verwendet) ist sehr gebräuchlich unter verschiedenen Stämmen Brasiliens — während des ganzen Vorgangs keinen Laut der Klage oder des Schmerzes von sich geben. Wer es doch tut, muß bei der nächsten Gelegenheit das ganze Verfahren noch einmal über sich ergehen lassen.

Bei den Karayá werden die Jünglinge aus den Hütten ihrer Eltern in besondere Häuser gebracht, die für die Junggesellen des Dorfes errichtet sind. Hier wohnen sie bis zu ihrer Verheiratung und führen ein sorgloses Leben, denn die ganze Gemeinde steuert in freigebiger Weise zu ihrem Unterhalt bei; auch empfangen die Burschen hier den Besuch der Mädchen. Die Zeit vertreiben sie sich mit Jagen und Fischen. — Die Mädchen genießen im allgemeinen die größte Freiheit und verfügen über ihren Körper ganz nach Belieben; früher scheint mehr Sittsamkeit gewaltet zu haben. Bei den Ashluslay- und Chorotistämmen im Gran Chaco ist Prostitution der Mädchen nichts Ungewöhnliches; das Chorotimädchen tut bei Liebesabenteuern zumeist den ersten Schritt: es entführt den Burschen, den es sich für die Nacht zum Liebhaber wünscht, ganz einfach vom Tanze fort in den Wald. Bei der Werbung der Mädchen um einen Mann kommt es öfters zu Eifersuchtszenen. Mit Boxhandschuhen aus Tapirhaut oder mit einem anderen widerstandsfähigen Gegenstand, schlimmstenfalls sogar mit Pfriemen aus Knochen, gehen die beiden Eifersüchtigen aufeinander los, um sich in den Besitz des geliebten Mannes zu setzen. Für gewöhnlich sucht sich ein Chorotimädchen nach ihrer ersten Menstruation einen Mann aus, der für einige Monate ihr Geliebter wird, dann wechselt sie und lebt für einige Jahre sorglos und in Freuden. Später entschließt sie sich dazu, sich einen ständigen Lebensgefährten zu wählen, und wird eine fleißige Hausfrau, treue Gattin und sorgsame Mutter. Ein Choroti- und Ashluslaymädchen küßt den Geliebten niemals; seine Verliebtheit findet in Kratzen und Anspeien des Gesichts ihren Ausdruck. Ganz anders steht es um die Sittlichkeit der Mädchen der Chané und Chiriguano, die doch ganz nahe bei jenen Stämmen im Chaco wohnen. Diese werden ängstlich von ihren Müttern behütet und zu Hause behalten, bis sich ein Mann für sie gefunden hat.



Im großen und ganzen währt die Freiheit für die jungen Mädchen nicht lange, denn im allgemeinen werden sie schon sehr früh verheiratet. Koch-Grünberg sah unter den Indianerinnen[S. 214] von Britisch-Guyana elf- bis zwölfjährige Weiber, die schon Mütter waren. Bei vielen Stämmen besteht noch heutigestags die Sitte des Frauenkaufs, so bei den Toba, gewissen Stämmen von Guyana, Kolumbia und einigen anderen. Der Vater des Mädchens, um das der Jüngling wirbt, bestimmt den Preis; er besteht für gewöhnlich aus einer gewissen Menge Vieh. Sobald der Jüngling diese Summe glatt erlegt hat, erhält er die Frau, die mit diesem Augenblick sein Eigentum wird. Eigenartig ist die Werbung eines Chané- und Chiriguanojünglings. Hat er ein Auge auf ein Mädchen geworfen, so sendet er den Eltern allerlei Jagdbeute oder er trägt vor ihrem Hause Holz als Geschenk zusammen. Nehmen sie es an und verwenden es, dann bedeutet dies, daß die Eltern einverstanden sind; bleibt das Holz aber unberührt, dann ersieht der junge Mann daraus, daß er abschlägig beschieden werden würde, falls er des Mädchens wegen persönlich anfragen sollte. Hat er mit seinem Geschenk Glück gehabt, dann hält er bei der Mutter des Mädchens um dieses an. Sie antwortet ihm, daß sie ja nicht wissen könne, ob er ein guter Mann und imstande sei, seine Frau geziemend zu versorgen. Um dafür den Beweis zu erbringen, tritt er bei seinen zukünftigen Schwiegereltern für ein ganzes Jahr in Dienst. Die Ehe ist also auch hier eine Art Kaufehe. Übrigens begegnen wir bei den verschiedensten Stämmen der Forderung, daß der Jüngling, bevor er die Einwilligung seiner zukünftigen Schwiegereltern erhält, Proben dafür beizubringen hat, daß er seine Frau auch zu ernähren, das heißt daß er aus Jagd und Fischfang genügende Erträge zu erzielen vermag. Bringt er reichliche Beute von seinen Zügen heim, dann zögert ein Jivarovater, besonders wenn der Freier kräftig und besonders geschickt ist, nicht, ihm wohl auch zwei oder drei seiner Töchter[S. 215] anzuvertrauen. Ist der Bewerber willkommen, so bindet der künftige Schwiegervater um die Arme des jungen Paares ein etwa zollbreites Baumwollband von brauner Farbe, das das Mädchen selbst gewebt hat; der Bräutigam bohrt sich zwischen Lippe und Kinn ein kleines Loch, in das er einen Zierat aus bunten Federn steckt, und bietet seiner Versprochenen ein Tarachi (Stück baumwollenen Stoffes zu einem Kleid) und einige andere weibliche Schmucksachen an. Das Paar malt sich schließlich noch an und putzt sich aus, so gut es kann. Ein alter Mann des Stammes, der anscheinend das Amt des Priesters versieht, gibt ihm noch einen Tabakaufguß zu trinken; die Feierlichkeit endigt mit einem Tanz, Gesängen und einem Zechgelage von zwei bis drei Tagen. Es ist dies die einzige Gelegenheit, bei der Männlein und Weiblein zusammen tanzen. Bevor der junge Mann heiratet, hat er noch ein Stück Boden urbar zu machen, Bananen oder Yukka anzupflanzen sowie eine Hütte zu bauen und einzurichten. In der Ehe hat er dann nur nötig, durch Jagd oder Fischerei für den Lebensunterhalt zu sorgen.


Sehr oft versprechen die südamerikanischen Indianer ihre Kinder bereits, wenn sie noch sehr jung sind. Bei den Jivaro geschieht dies schon, wenn die Kinder noch an der Brust liegen. Mit sechs Jahren sind dort die Mädchen bereits heiratsfähig und werden dann in das Haus des ihnen zugesagten Gatten übergeführt; manchmal schickt man ein solches Kind auch in noch jüngerem Alter dorthin. Dann nehmen die älteren Frauen des Mannes sich desselben an, pflegen es und ziehen es nach dem Geschmack des Gatten auf, bis es das heiratsfähige Alter erreicht hat. Einige[S. 216] Stämme bestimmen das letztere in eigenartiger Weise. Sie pflanzen bei der Geburt eines Mädchens drei bis vier Chontarurustämme (eine Palmenart) um ihr Haus und pflegen diese aufs sorgsamste. Sobald die Bäume die ersten Früchte tragen, gilt das Mädchen für reif zum Heiraten. In Britisch-Guyana ist indessen kein junger Mann, wenn er von seinen Eltern schon im Kindesalter verlobt worden sein sollte, an dieses Versprechen gebunden; er bittet dann einfach darum, daß seine Versprochene ihm alle ihr gemachten Geschenke, wie Perlen und andere Schmuckgegenstände, zurückerstatte, und ist dann wieder frei. — Bei den Cordado haben die zukünftigen Verwandten der kindlichen Braut die Pflicht, für diese zu sorgen. Stirbt ihr Vater oder verläßt er die Mutter, dann zieht das Mädchen zu ihren zukünftigen Verwandten, die fortan für seinen Unterhalt aufkommen. — Wenn bei den Aruaken von Guyana das Mädchen noch nicht das zur Heirat erforderliche Alter erreicht hat, dann gibt sein Vater dem jungen Manne, dem es versprochen wurde, entweder eine Witwe oder ein älteres unverheiratetes weibliches Wesen aus der Familie zur Frau, die dann später die Dienerin der eigentlichen Gattin wird. — Bei den Mura, einem noch sehr tiefstehenden Volkstamme, fechten die Anbeter eines jungen Mädchens die Entscheidung, wer sie bekommen soll, durch einen Faustkampf unter sich aus. — Bei den Aruaken besteht ferner eine eigentümliche Art der Werbung. Ein junger Mann, der ein Mädchen gern heiraten möchte, begibt sich zu dessen Vater und beginnt ihm sein Leid zu klagen, wie schlimm es einem Burschen gehe, der noch keine Frau habe. Der Vater pflichtet dem mit allerlei schönen Redensarten bei, überläßt aber seiner Tochter die Entscheidung, ob sie den Jüngling will. Setzt sie ihm Fleisch und Getränke vor, dann weiß er, woran er ist, daß nämlich seine Werbung ihre und ihres[S. 217] Vaters Zustimmung findet. Er ißt, was aufgetragen ist, und der Ehebund ist damit geschlossen. Unter den südamerikanischen Indianern fehlt es vielfach an einer Hochzeitszeremonie; doch wird die Eheschließung meistens mit Trinkgelagen und Tänzen festlich begangen. Bei den Tacuna am oberen Amazonenstrom führt man bei der Feier einer Hochzeit, aber auch bei der Reife der Mädchen und anderen Familienfestlichkeiten Maskentänze auf, die die Teufel zur Darstellung bringen sollen. Bei den Carajá trennen die jungen Eheleute als Zeichen der vollzogenen Ehe in der Hochzeitsnacht ihre langgefransten Kniebänder und Manschetten auf, die, solange die Ehe bestehen bleibt, nie wieder angelegt werden.


Die südamerikanischen Indianer leben vielfach in polygamer Ehe. Bei ihrer laxen sittlichen Auffassung pflegt Untreue der Ehegatten keine seltene Erscheinung[S. 218] zu sein. Indessen gibt es doch Stämme, wie zum Beispiel die Carayá, bei denen noch eine verhältnismäßig höhere Lebensauffassung besteht. Verläßt hier ein Mann seine Frau oder jagt er sie davon, dann ist er unter seinen Genossen geächtet und darf nicht wieder heiraten. Bei den Coróado kommt es zu Raufereien zwischen dem Verführer und dem betrogenen Ehemann; bleibt der erstere dabei mutig und trägt er den Sieg davon, dann wird die von ihm Geliebte ohne weiteres sein Weib; zieht er aber den kürzeren und muß er das Feld räumen, dann kehrt die verführte Frau reumütig zu ihrem bisherigen Gatten zurück.
Wir hörten bereits an anderer Stelle, daß die Indianer das Entstehen von Krankheiten dem Einflusse böser Geister zuschreiben und daß demgemäß ihre Behandlung in Austreibung beziehungsweise Versöhnung derselben besteht. Indessen werden gelegentlich auch die physikalischen Heilmethoden angewendet; so massieren die Ashluslay den leidenden Körperteil (Abb. 251). Ist die Krankheit eine epidemische und greift sie schnell um sich, so daß die üblichen Mittel versagen, dann bleibt nichts anderes übrig, als sich der Kranken zu entledigen, damit man nicht selbst Gefahr laufe, von dem bösen Geist befallen zu werden. Dies geschieht dadurch, daß man sie von den Gesunden trennt, indem man sie entweder weit vom Dorfe fortträgt oder dieses seinerseits aufgibt und auswandert.


Ist der Kranke gestorben, dann wird sein Geist ebenfalls gefürchtet, da man annimmt, daß er gegen die Überlebenden tückisch gesinnt sei und sie zu belästigen suche. Dieser Furcht entspringen eine Anzahl abergläubischer Gebräuche bei der Beisetzung, die darauf ausgehen, den Geist des Verstorbenen gut zu stimmen und seine Rückkehr zu verhindern. Die Indianer können nicht glauben, daß mit dem Tode für den Menschen alle irdische Freude ein Ende habe, sondern nehmen an, daß das irdische Leben in einem Jenseits seinen Fortgang nehme, daß also der Tote dort sein Wesen in ganz derselben Weise weiter treibe wie hier auf Erden. Sie pflegen daher dem Heimgegangenen alles das ins Grab mitzugeben, was zu seinen täglichen Lebensbedürfnissen gehörte, auch etwas von seinem persönlichen Eigentum. Da nun für den Indianer[S. 220] Jagd und Tanz das größte Vergnügen bedeuten, so begräbt man die Toten mit ihren Waffen (Bogen, Pfeil, Keule und so weiter) und vollständigem Schmuck, damit sie beides im Jenseits zur Hand haben; verstorbenen Frauen werden Gegenstände des Haushalts, wie Krüge, Körbe und anderes Hausgerät, mitgegeben. Um nicht die Rache des Toten auf sich zu ziehen, eignet man sich auch nichts von seinem persönlichem Besitztum an; was nicht ins Grab mitgegeben wird, macht man unbrauchbar. Auch die Lieblingstiere folgen dem Verstorbenen vielfach nach. Früher war es bei verschiedenen Stämmen Sitte, beim Tode eines großen Häuptlings ihm seine Getreuen oder seine Dienerschaft, manchmal auch seine Frauen, ins Grab mitzuschicken, und heutigestags soll es noch vorkommen, daß einer Mutter ihr Säugling mitgegeben wird. An Speisen- und Getränkebeigaben fehlt es auch wohl nie, denn auf seiner langen Reise ins Jenseits darf der Verstorbene nicht Hunger oder Durst leiden. Würden die Hinterbliebenen in dieser Hinsicht irgend etwas versäumen, so könnte der Tote von der diesseitigen Welt nicht loskommen und würde seine Rache an ihnen auslassen.
Die Furcht vor den Toten kommt auch in zahlreichen selbstauferlegten Strafen, wie Fasten, Züchtigungen, Selbstverwundungen und -verstümmelungen, zum Ausdruck, die die Überlebenden zum äußeren Zeichen ihrer Trauer an sich vornehmen. Für gewöhnlich werden Entsagungen oder Selbstpeinigungen nur der Witwe oder dem Witwer des Verstorbenen, seltener auch anderen Angehörigen zugemutet. Die harmloseste der Selbstverstümmelungen ist das Abschneiden des Haares, das allgemein üblich ist. Eine Witwe darf nicht eher wieder heiraten, als bis ihr Haar seine frühere Länge zurückerlangt hat. Hat eine Chiriguanofrau ihren Mann besonders liebgehabt, dann schneidet sie sich das Haar zweimal ab. Während der ganzen Trauerzeit trägt die Witwe keinen Schmuck, bleibt auch allen Festlichkeiten fern. Früher ging man in La Plata in der Trauer um einen Verstorbenen weiter; man schnitt sich jedesmal ein Fingerglied ab.
Die Furcht vor dem Geist eines Toten erstreckt sich auch auf alle Dinge, die mit der Leiche in Berührung kamen, ja sogar auf die Personen, die mit ihr zu tun hatten. Daher gelten auch alle, die an der Begräbnisfeier teilnahmen, für unrein; sie haben die Pflicht, sich zu reinigen, was meistens durch Baden geschieht. Die Hütte wird nicht selten verbrannt, zum mindesten verlassen, unter Umständen auch in wilder Hast das ganze Dorf aufgegeben.
Um den Toten möglichst an der Wiederkehr zu verhindern, werden eine Reihe Vorkehrungen getroffen. Oft versucht man seinen Geist durch Drohungen, Geschrei, den Lärm von Musikinstrumenten (Abb. 245), Flintenschüsse und ähnliche Mittel einzuschüchtern, sowohl während des Begräbnisses wie auch nach demselben. Das üblichste Lärmgerät ist das uns schon von Australien her bekannte Schwirrholz, ein längliches, flaches Stück Holz, das an einer Schnur geschwungen wird und einen unheimlichen, summenden Ton von sich gibt. Wie anderwärts besteht auch hier für die Frauen das strenge Verbot, ein Schwirrholz jemals zu sehen; wer ein solches zu Gesicht bekommt, kann mit dem Tode bestraft werden. Drollig ist die Art, wie man den Toten irreführen will, damit er die Spur verliere. Die Araukaner in Chile gehen beim Verlassen des Dorfes nach dem Tode eines Angehörigen kreuz und quer, damit der Geist ihren Fährten nicht folgen könne. Wenn die Bororó den Korb mit den Gebeinen eines kürzlich Verstorbenen aus dem Dorfe tragen, um sie an einem entlegenen Orte zu begraben, läuft einer hinter den Trägern her und zieht einen Palmzweig nach sich, damit alle Fußspuren verwischt und es für den Geist des Toten unmöglich werde, nach Hause zurückzufinden. Das wirksamste Mittel aber, um dem Toten die Rückkehr unmöglich zu machen und sich so vor seiner Belästigung zu schützen, besteht darin, daß man die Leiche festschnürt, so daß die Knie an das Kinn und die Arme über die Brust gekreuzt zu liegen kommen, oder ihn in einen Korb, ein großes Gefäß oder einen Trog einzwängt und die darauf geworfene Erde eigens feststampft, oder daß[S. 221] man die Grabstätte mit Steinen oder wuchtigen Holzkloben beschwert. Manche Stämme gehen in ihrer Furcht vor dem Toten sogar so weit, daß sie es vermeiden, seinen Namen auszusprechen und sich bemühen, jede Erinnerung an ihn aus ihrem Gedächtnis zu verwischen. So darf zum Beispiel bei den Goajiro in Kolumbia niemand in Gegenwart der Familie des Heimgegangenen dessen Namen aussprechen. Hat jemand gegen dieses Gebot gefehlt, dann wird er entweder sofort getötet oder muß eine schwere Strafe zahlen, die oft in zwei oder drei Ochsen besteht. Verweigert er diese Buße, dann wird ihm sein Vieh gewaltsam weggenommen. Im Gran Chaco ist es bei einigen Stämmen Brauch, daß nach einem Todesfall alle Überlebenden den Namen wechseln, damit der Geist nicht imstande sei, den herauszufinden, an dem er vielleicht seinen Zorn auslassen möchte. — Schließlich ist noch die Klage um den Toten ein Brauch, der bei vielen südamerikanischen Stämmen vorkommt. Er steht offenbar in engem Zusammenhang mit den oben geschilderten Schutzmaßregeln und ist stets unmittelbar mit etwaigen sonstigen Begräbniszeremonien verbunden. Die Angehörigen pflegen das Lob des Toten, im besonderen seine Heldentaten, in allen Tonarten zu singen, durch Lieder und durch sonstige Vorträge; die Feier endet dann meist mit lautem Weinen und Jammern.[S. 222] Bei den Coróado ziehen sich nur die weiblichen Angehörigen nach dem Begräbnis in eine abseits gelegene Hütte zurück, wo sie heftig weinend den Verlust betrauern.


Der Aberglaube, daß das Essen von dem Fleisch bestimmter Tiere die Eigenschaften dieser auf den, der es genießt, und selbst auf die Frucht in dessen Leibe übergehen lasse, mag Veranlassung dazu gegeben haben, daß viele Stämme die Aschenreste ihrer Vorfahren unter ihr Getränk mischen, um sich so deren gute Eigenschaften anzueignen. Die Kobéua, die diese Unsitte üben, halten dabei zugleich Tänze ab, wo die Masken eine große Rolle spielen, die wir eingangs schon kennen gelernt haben. Wir erinnern ferner an die unter vielen Naturvölkern verbreitete oder richtiger verbreitet gewesene Sitte der Menschenfresserei, die zumeist ähnlichen Zwecken dienen sollte wie das erwähnte Vermischen des Getränks mit der Asche Verstorbener. Sie war früher allgemein üblich und soll auch jetzt noch bei gewissen Stämmen, zum Beispiel den Uitóto, vorkommen. Der Indianer, der dies tut, will dadurch sowohl die guten Eigenschaften seines Feindes in sich aufnehmen als auch dessen Persönlichkeit vollständig vernichten und sich dadurch gegen die Rache des Geistes des Verstorbenen schützen.

Die Art und Weise der Bestattung ist ganz verschieden. Vielfach zwängt man den Verstorbenen in einen engen Behälter und vertraut diesen der Erde an, meistens auf einem allgemeinen Begräbnisplatz außerhalb des Dorfes. Auch ein Kanu, das dem Toten gehört hat, ist als Sarg üblich. Ein Chiriguanomann, der von einem Jaguar getötet wurde, wird mit dem Kopf nach unten begraben, damit er nicht als Jaguar umgehe. Die Beisetzung erfolgt häufig auch in der eigenen Hütte des Verstorbenen, die man dann aber verläßt. Befindet sich die Grabstätte außerhalb des Hauses, so wird über ihr noch häufig ein niedriges Dach errichtet, unter das man in der ersten Zeit immer noch Nahrungsmittel für den Toten zu stellen pflegt. Die Carayá graben die Leiche nach einiger Zeit aus, sammeln die Knochen und setzen sie in einer Urne von neuem bei. Hier werden der überlebenden Ehehälfte nach Ablauf der Trauerzeit auch wieder die Kniebänder angelegt zum Zeichen, daß nunmehr zu einer neuen Ehe geschritten werden darf.

[S. 223]

Die heutige Bevölkerung Europas ist in der Hauptsache aus einer Kreuzung dreier Rassen hervorgegangen, der sogenannten nordeuropäischen, der alpinen und der mittelländischen Hauptrasse.
Die nordeuropäische oder indogermanische Hauptrasse ist durch einen hohen Wuchs, länglichen Schädel, längliches Gesicht, ebenmäßige Züge, längliche, schmale Nase mit geradem oder leicht gebogenem Rücken, blondes oder rötliches Haupthaar von lockiger oder gewellter Beschaffenheit, blaue oder hellgraue Augen und weiß-rosige, pigmentlose Haut ausgezeichnet. Sie hat ihre reinsten Vertreter noch unter der Bevölkerung Schwedens, wo sie nachweislich seit Beginn der Steinzeit ansässig gewesen ist und höchstwahrscheinlich auch ihren Ausgang genommen hat. Die schwedische Bevölkerung besitzt eine durchschnittliche Körperlänge von 170,8 Zentimeter. Die nordeuropäische Rasse hat bereits in der vorgeschichtlichen Zeit weitgehende Wanderungen angetreten; sie ist dabei bis nach den äußersten Ecken Südeuropas vorgedrungen und hat selbst darüber hinaus auf der einen Seite bis Nordafrika und auf der anderen bis Indien hin sich verbreitet. Die westlichen und südlichen Gebiete des Ostseebeckens waren eine unerschöpfliche Quelle, aus der immer neue Völkerstämme strömten und Europa nach allen Richtungen hin überfluteten. Zu dieser nordischen Rasse gesellte sich bereits zur jüngeren Steinzeit von Osten her eine zweite hinzu, die alpine oder mitteleuropäische Rasse, Leute von untersetzter Gestalt (im Mittel 163 bis 164 Zentimeter), leicht hellbrauner oder auch weißer Hautfarbe, hellbraunen oder schwarzen Augen, braunem oder rötlichbraunem Kopfhaar von welliger Beschaffenheit, rundem, breitem Kopf und rundlichem Gesicht. Ihre eigentümliche Verteilung auf unserem Erdteil läßt darauf schließen, daß sie von Osten, von Rußland oder noch weiter[S. 224] von Mittelasien herankam und sich wie ein Keil zwischen die nordische und die sogleich zu besprechende südeuropäische Rasse bis an die Cevennen hineinschob. Die südeuropäische oder mittelländische Hauptrasse endlich gleicht in ihrer Schädel- und Gesichtsbildung der nordeuropäischen, weicht aber in ihrer Körpergröße (im Mittel 161 bis 162 Zentimeter) und in ihrer Hautfarbe deutlich von ihr ab. Der Farbenton der Haut schwankt von einem gelblichen Weiß oder Blaßbraun zum Rötlichen oder Rotbraun, die Augen sind schwarz oder tiefbraun, die Kopfhaare tiefschwarz. Als ihre Bildungstätte dürften die östlichen Gebiete der Mittelmeerländer anzusehen sein. Infolge der zahlreichen Wanderungen, die sich im Laufe der Zeiten in Europa von Norden nach Süden und gelegentlich auch in umgekehrter Richtung abspielten, sowie infolge des regen Verkehrs zwischen den drei Rassen hat sich eine starke Vermischung zwischen ihnen vollzogen, so daß reine Vertreter der einzelnen Typen zu den Seltenheiten gehören.

Zu diesen drei vorgeschichtlichen Hauptrassen gesellte sich in geschichtlicher Zeit von Osten her noch ein anderer Rassenbestandteil hinzu, die Vertreter der finnisch-ugrischen und türkischen Unterrasse, die in den östlichen Teilen Europas gleichfalls dazu beigetragen haben, eine noch weitere Rassenmischung herbeizuführen.

Ganz allmählich haben sich aus den genannten Rassen gewisse Gruppen herausgebildet, deren[S. 226] Angehörige weniger durch anthropologische Merkmale als vielmehr durch bestimmte kulturelle Anschauungen und Gewohnheiten zu einer Einheit verbunden werden. 1. Die germanische oder teutonische Kulturgruppe, die die Deutschen, einschließlich eines Teiles der Österreicher, die Niederländer und Flamen in Holland und Belgien, die Engländer, die aus Angelsachsen, Kelten und Normannen hervorgegangen sind, die Schweden, Norweger und Dänen umfaßt. 2. Die romanische Gruppe, zu der die Franzosen im Norden und Süden ihres Landes, die ersteren vorwiegend mit germanischem Einschlag, die Wallonen Belgiens, die Spanier, Portugiesen, Italiener, Rumänen und schließlich die Rätoromanen (Ladiner, Friauler) gehören. 3. Die slawisch-lettische Gruppe, in der sich die Letten und die große Masse der Slawenstämme Osteuropas vereinigen. Die letzteren zerfallen wieder in westliche, östliche und südliche Slawen; zu den westlichen zählen die Wenden, Kaschuben, Slowinzen, Tschechen, Polen und Slowaken, zu den östlichen die Russen (Groß-, Weiß- und Kleinrussen), zu den südlichen endlich die Serben, Montenegriner, Kroaten und Slowenen. 4. Die griechisch-illyrische Gruppe, die die Griechen, Albaner und Arnauten umfaßt. 5. Die keltische Gruppe, die nur in den Kelten der Bretagne, von Wales, Schottland (Gaëlen) und Irland ihre Vertreter besitzt. 6. Die finnisch-ugrisch-türkische Gruppe, die die Litauer, Ost- und Westfinnen (Karelier, Tawasten, Esten, Liven, Wogulen, Tscheremissen) und Ugrier sowie die Türken (Tataren, Baschkiren, Tschuwaschen, Bulgaren und Osmanlitürken) umfaßt.

Infolge der zahlreichen Völkerbewegungen, die sich im Verlaufe der Jahrtausende und besonders in neuer Zeit in Europa abgespielt haben, sind auch die Grenzen der ursprünglichen Sitten und Gebräuche mehr und mehr verwischt und diese teilweise zum Gemeingut aller Völker geworden; nordeuropäische Sitten und Gebräuche fanden daher Eingang in Südeuropa und umgekehrt, ebenso wurden osteuropäische Sitten nach[S. 227] Westen zu verbreitet. Ferner hat die christliche Religion das ihrige dazu beigetragen, daß die alten heidnischen Anschauungen und Gewohnheiten unserer Altvorderen unterdrückt oder auch vielfach durch eine der Kirche angepaßte Deutung umgewandelt wurden, und schließlich hat die alles gleichmachende moderne Kultur zur Folge gehabt, daß die etwa noch vorhandenen letzten Reste mehr und mehr hinweggewischt wurden. Alle diese Umstände vermochten jedoch nicht, die ursprünglichen Sitten, Gebräuche und Anschauungen gänzlich auszurotten. Allenthalben begegnen wir ihren Überbleibseln noch im Volke, besonders bei der ländlichen Bevölkerung in abseits gelegenen Gegenden, wohin der Einfluß der modernen Kultur nur langsam einzudringen vermochte.

Der germanische Kulturkreis umfaßt die Völkerstämme im Süden der Ost- und Nordsee bis etwa nach den Alpen zu, also, ganz allgemein gesagt, die Bewohner Skandinaviens, Englands, Hollands, teilweise auch Nordfrankreichs, ferner Deutschlands (einschließlich der deutschen Ostseeprovinzen), Deutsch-Österreichs und der deutschen Schweiz. Die Sitten und Gebräuche aller dieser Länder ähneln sich im großen und ganzen, sie hängen zu einem[S. 228] wesentlichen Teile mit altgermanischen heidnischen Anschauungen (Abb. 253 bis 256) zusammen. — Der Quellenkultus sowie die Verehrung vorgeschichtlicher Denkmäler sind unter anderem solche Überreste (Abb. 258 bis 260 und 265). — Leider ist viel von dem Ursprünglichen bereits abgebröckelt, aber es steht zu hoffen, daß die letzten Reste (Abb. 252), die oft genug auch an geschichtliche Ereignisse anknüpfen, erhalten und weiter gepflegt werden dank den Bestrebungen der Vereine und Persönlichkeiten, denen die Erhaltung deutscher Art und Sitte am Herzen liegt. Zunächst gilt dies für die teilweise recht malerischen Volkstrachten (Abb. 261 bis 264 und 266 bis 271), an denen die germanischen Stämme besonders reich sind. Belohnungen sind verschiedentlich ausgesetzt worden für diejenigen, die sich befleißigen, die alte, kleidsame Tracht ihrer Vorfahren wieder zu Ehren zu bringen, anstatt sie in den Truhen vermodern zu lassen. Verschiedentlich sind aus besonderen Anlässen die alten Gewänder der Großeltern wieder hervorgeholt worden und in festlichen Aufzügen von neuem zu Ehren gekommen. Volkstümliche Feste (Abb. 272 bis 275, 277 und 278) bieten dazu die beste Gelegenheit. In engem Zusammenhang mit den Volkstrachten stehen die Volkstänze (Abb. 276, 279 bis 284 und 286), die man ebenfalls der Vergangenheit vielfach entrissen und zu neuem Leben hat erstehen lassen. Ähnlich verhält es sich mit dem Gebrauch altertümlicher Musikwerkzeuge (Abb. 285 und 289) und mit den Volksspielen (Abb. 290). Ebenso hat man verschiedentlich die volkstümliche Hauskunst und Heimindustrie (Abb. 287) wieder neu belebt. Die alten anheimelnden Haustypen (Abb. 288) sind leider nicht mehr zu ersetzen, jedoch besteht neuerdings auch hier das Bestreben, die neu entstehenden Häuser dem althergebrachten Dorfbild nach Möglichkeit anzupassen. Es steht zu hoffen, daß auf diese Weise noch manche althergebrachte schöne Sitte ihre Wiederauferstehung feiern werde.
Die Namen unserer Wochentage, um mit diesen zu beginnen, sind heidnischen Ursprungs. Der Sonntag war der Sonne gewidmet und galt beim Volke als glückbringend. Wer an ihm geboren wurde, ein sogenanntes Sonntagskind, ist mit dem zweiten Gesicht begabt, das heißt er besitzt die Fähigkeit, in die Zukunft zu blicken und Geister zu schauen; seine Handlungen sind stets von günstigem Erfolge begleitet. Im Gegensatz dazu steht der Montag, der Tag des Mondes, vielfach im Rufe eines Unglückstags. Daher wechseln im Hannöverschen und in Schleswig-Holstein die Dienstmädchen an ihm niemals ihre Stelle; wer am Montag etwas unternimmt, wird immer Pech haben. Dem Dienstag, dem Tage des Gottes Tiu oder Tyr (englisch Tuesday, in Schwaben auch Zieseldi genannt), kommt keine besondere Bedeutung zu. Der Mittwoch, der ursprünglich dem Gotte Wodan heilig war (daher noch die englische Bezeichnung Wednesday und die westfälische Gauns- oder Godensdag), wurde im Mittelalter in den Tag der Jungfrau Maria umgewandelt und zu einem Fasttag gemacht. Der Donnerstag verrät wieder recht deutlich seine heidnische Herkunft von Thor oder Donar (englisch daher Thursday, skandinavisch Thorsdag), dem höchsten Gotte der altgermanischen Götterwelt. Mit ihm sind noch verschiedene abergläubische Vorstellungen im Volke verknüpft; solche Überreste des alten Thorkultus erblicken wir noch heutigestags in dem vielfach in Norddeutschland am Donnerstag üblichen Erbsengericht, denn die Erbse war eine dem Thor geheiligte Pflanze. Desgleichen geht der Name Freitag auf eine germanische Gottheit, Freia oder Frigga, die Gemahlin des Wodan, zurück. Auch dieser Tag gilt vielfach in den Augen des Volkes für einen Unglückstag, an dem nichts Neues unternommen, zum Beispiel keine Reise angetreten oder mit dem Schiff in See gestochen werden darf. Anderseits wieder werden gerade am Freitag in Dänemark mit Vorliebe Hochzeiten abgehalten, was damit zusammenhängt, daß bei den alten Römern dieser Tag der Venus, der Göttin der Liebe (daher im Französischen Vendredi, entstanden aus Veneris dies), geweiht war. Die katholische Kirche hat den Freitag zum Fasttag gestempelt. Der[S. 230] Sonnabend endlich, das heißt der Vorabend des Sonntags, soll seinen zweiten Namen Samstag von dem lateinischen Saturni dies erhalten haben; indessen wird diese Ableitung mit Recht angezweifelt. Die skandinavische Bezeichnung Löwerdag und Lördag wird mit dem alten nordischen Laugadagr in Verbindung gebracht und soll Badetag bedeuten, weil am Schlusse der Woche allgemein gebadet wurde, wie es übrigens noch heutigestags Familiensitte in Deutschland ist.


Ebenso wie die Namen der Wochentage gehen auch unsere kirchlichen und weltlichen Feste auf die religiösen Anschauungen unserer Altvordern zurück, und zwar in erster Linie auf ihren Sonnenkultus. Die Sonne spendet der Erde Licht und Wärme und damit die notwendigen Grundbedingungen für alles Leben. Daher feierten auch die alten Germanen, ebenso wie andere Völker des Altertums, den Zeitpunkt der Sonnenwende beziehungsweise des höchsten und tiefsten Standes der Sonne sowie der Tagundnachtgleiche und begingen dementsprechend das eine Fest um die Mitte des Sommers und des Winters, das andere im Frühling. Die altgermanische Vorstellung faßte den Wechsel der Jahreszeiten als einen Kampf des Lichtes mit der Finsternis auf; der Winter als böse Macht hat die Natur in Eis und Kälte erstarren lassen, also anscheinend die den Menschen gutgesinnte Macht, die Sonne, überwunden. Die Wintersonnenwende ist der Zeitpunkt, an dem es der Sonne nun gelingt, wiederum zu neuem Leben zu erwachen und mit der Dunkelheit des Winters den Kampf aufzunehmen. Zwölf Tage lang (die sogenannten Zwölften) währt derselbe, bis es sich deutlich an der zunehmenden Länge des Tages zeigt, daß die Sonne als Siegerin aus ihm hervorgehen wird. Daher sahen die alten Germanen den Tag der Wintersonnenwende mit Recht als den Anfang einer neuen Zeit an und begingen ihn festlich. Um den heidnischen Anschauungen sich anzupassen, verlegte die christliche Kirche auf diesen Tag der Wiedergeburt des Lichtes auch die Geburt des neuen Verkünders des Heils, des Messias. — Der endgültige Ausgang des Kampfes zwischen Licht und Finsternis, der vollendete Sieg des Lichtes gab unseren Altvordern wiederum Gelegenheit zu einem Feste, der Feier der Frühlings-Tagundnachtgleiche. Dementsprechend wurde von der christlichen Kirche der Sieg Christi über den Tod auf den gleichen Zeitpunkt verlegt und zum Osterfest gemacht. — Der Augenblick, an dem die Natur ihre Höhe erlangt und ihre größte Pracht entfaltet, ist der Mittsommertag, an dem auch die Sonne ihren höchsten Punkt erreicht hat. Er war für unsere heidnischen Vorfahren ebenfalls Gegenstand ausgelassener Freude. Die christliche Religion setzte diesen Tag der Erfüllung der Verheißung, der Ausgießung des heiligen Geistes über die Menschheit, gleich und verlegte in ungefähr dieselbe Zeit (allerdings[S. 231] einige Wochen früher) das letzte ihrer drei großen Hauptfeste, Pfingsten. Wir sehen also auf der einen Seite, der heidnischen, das Ringen zwischen Licht und Finsternis, auf der anderen, der christlichen, den Kampf zwischen Sünde und Erlösung, beidemal Anfang, Wachsen und Vollendung.

Das Weihnachtsfest hängt, wie wir soeben sahen, eng mit dem Kultus der Sonne und der Lichtgottheit zusammen. Die christlichen Lehrer verlegten bereits um die Mitte des vierten Jahrhunderts unserer Zeitrechnung auf den 25. Dezember, also den Zeitpunkt der heidnischen Feier der Wintersonnenwende, die Geburt des Heilandes. Im siebenten bis achten Jahrhundert fand diese Feier in Deutschland Aufnahme, wo man von jeher schon das Julfest beging. Wie der altheidnische Glaube es mit sich brachte, spähte man um diese Jahreszeit von hohen Bergen nach dem Wiederaufkommen der Sonne aus und begrüßte die Nachricht von ihrem Erscheinen mit größtem Jubel und festlichen Gelagen.
Das Hauptstück der ältesten christlichen Weihnachtsfeier machte die Weihnachtskrippe aus, eine Art Dramatisierung der Ereignisse bei der Geburt des Jesusknäbleins und vielfach auch geradezu die dramatische Vorführung dieses Vorgangs. Der strahlende Weihnachtsbaum (Abb. 291) ist erst verhältnismäßig spät in Erscheinung getreten — man sagt, vor etwa drei Jahrhunderten — hat sich aber heutigestags so ziemlich die ganze Kulturwelt erobert. Wenigstens ist er zu einem unbedingten Erfordernis der deutschen Weihnachtsfeier geworden; vor allem dort, wo es Kinder gibt, ist eine Feier ohne Baum nicht denkbar. Wo Mangel an Tannen oder verwandten Bäumen bestand, wurde der Weihnachtsbaum früher vielfach durch eine hölzerne, gleichfalls mit Lichtern besteckte Pyramide (Abb. 292) ersetzt, eine Sitte, die sich in manchen Gegenden bis in die Gegenwart herein erhalten hat. Daß gerade die Tanne oder ein ihr verwandtes Nadelgewächs im Lichterglanz des Heiligen Abends erstrahlt, mag wohl damit zusammenhängen, daß dieser Baum in den Augen des Volkes das schlummernde Leben in der Natur versinnbildlicht, denn er behält trotz des nordischen Winters mitten im Schnee allein von allen Bäumen des Waldes sein frisches Grün. Unter den strahlenden Weihnachtsbaum kommen bekanntlich allerlei Geschenke zu liegen; in den skandinavischen Ländern und auch vielfach in Norddeutschland pflegt man diese in zahlreiche, oft genug scherzhafte Umhüllungen[S. 232] mit besonderen Aufschriften einwickeln und durch vermummte Personen mit dem Rufe „Julklapp“ zur Tür hineinwerfen zu lassen.

In England feiert man das Weihnachtsfest nicht nach deutscher Art als ein Familienfest mit Tannenbaum und Geschenken, sondern begibt sich aufs Land und begeht das Fest hier möglichst in freier Luft. Man widmet sich allem möglichen Sport. Der zweite Weihnachtsfeiertag heißt daher im besonderen der Boxing day. An ihm wandert die Bevölkerung von London nach Hampstead Heath und belustigt sich mit Wettlaufen, Eselreiten, Boxen und Werfen nach Kokosnüssen, die auf kurzen in den Boden eingerammten Pfählen reihenweise dastehen, frönt auch reichlichem Wirtshausbesuch und ist in jeder Weise lustig. Der Weihnachtsabend ist kein Feiertag wie bei uns. Früher waren an ihm noch mancherlei Gebräuche im Schwange, die an das altheidnische Fest erinnerten. In vergangenen Jahrhunderten pflegten die Leute auf den Landsitzen der Adligen einen mächtigen Kloben Buchenholz zur Halle hereinzuziehen, anzuzünden und in allerlei Vermummung um das Feuer zu tanzen, während die Herrschaft und ihre Gäste dem lustigen Treiben zuschauten, auch sich gelegentlich selbst an ihm beteiligten. Als letzter Überrest dieses alten Brauchs ist allein noch die Sitte übriggeblieben, am Abend vor Weihnachten anstatt der alltäglichen Steinkohle einen Kloben Buchenholz (den Julblock) in die Glut des Kamins zu schieben, um den sich die ganze Familie setzt. Dieser Klotz muß jetzt die Form eines Kreuzes als Erinnerung an das Kreuz Christi haben. Den ersten Weihnachtstag begeht man in lustiger Gesellschaft bei einem leckeren Mahle. An der Mitte der Zimmerdecke fehlt wohl in keiner englischen Familie der Mistelzweig, jene zierliche, mattgrüne, auf den Bäumen[S. 233] schmarotzende Pflanze mit ihren perlgrauen, runden Beeren. Wer unter ihm steht, der hat das altverbriefte Recht, jedes weibliche Wesen, das sich absichtlich oder zufällig an derselben Stelle einfindet, zu küssen. In der Kirche jedoch ist die heidnische Mistel verpönt; an ihre Stelle ist hier die Stechpalme mit ihren brennendroten Früchten, auch wohl der Efeu oder das Immergrün getreten.

Am Weihnachtsabend und ebenso am ersten Festtage sind wohl überall bestimmte Gerichte zu den Mahlzeiten üblich. Dem Gotte Donar war der Eber heilig, daher wurde dieses Tier bei den gemeinsamen Opfern der alten Germanen gelegentlich des Julfestes mit Vorliebe verspeist. Noch heutigestags ist Eberkopf oder Wildschweinkopf ein beliebtes Weihnachtsgericht, besonders in England. Mit diesem alten Aberglauben hängt auch eine in Oxford in studentischem Kreise noch immer am Heiligen Abend geübte Sitte zusammen, die Wildschweinprozession. Vor den versammelten Professoren und der Studentenschaft bewegt sich zum Saale herein ein Festzug, dessen Erscheinen fröhliche Fanfaren ankündigen. An seiner Spitze schreitet ein in Weiß gekleideter Sänger, ihm folgen zwei Personen mit einer großen Platte, auf der der mit Lorbeer und Rosmarin bekränzte, mit einer goldenen Krone geschmückte und zwischen den Hauern eine Zitrone haltende Kopf eines Ebers ruht. Eine Anzahl Studenten, gleichfalls in Weiß, beschließen den Zug. Der Sänger stimmt beim Eintritt in den Saal ein Lied an, das in humorvoller Weise die kulinarischen Eigenschaften des Wildschweinkopfes preist und dessen Kehrreim vom Chor mitgesungen wird. Unter Absingung noch anderer Weisen, in denen den Festgenossen Gesundheit und langes Leben gewünscht wird, begibt sich der Zug langsam zur Professorentafel und setzt die Platte vor den[S. 234] Rektor hin. Dieser zieht die Zitrone mit feierlicher Gebärde aus dem Maule des Tieres und bietet sie dem Sänger an. Darauf drängen sich alle Anwesenden an den Tisch, um ihren Anteil bei der Verteilung der Lorbeerblätter und des Rosmarins zu erhaschen, denn beide stehen in dem Rufe, Glück zu bringen. Ist alles aufgeteilt, dann begibt sich der Zug zu einem üppigen Mahl, bei dem Truthahn und Plumpudding nicht fehlen dürfen. Der Truthahn, desgleichen der Karpfen waren als Sinnbild der Fruchtbarkeit der germanischen Göttin Freia heilig; man brachte sie in der Vorzeit ihr zum Opfer dar. Daher sind beide ein beliebtes Weihnachtsessen, der Truthahn allerdings nur in England, dagegen der Karpfen auch in ganz Deutschland. In Skandinavien bevorzugt man den Lütgefisk, dessen traniger Geruch die Nase gewaltig belästigt, weswegen man ihn auch meistens in der Küche zu verspeisen pflegt. Unmittelbar hinter den Fischgerichten kommt als Weihnachtsbraten das Geflügel; in England ist es, wie wir hörten, der Truthahn, in wohlhabenden Kreisen auch der Schwan, in Deutschland wie auch in Dänemark die Gans, in anderen Gegenden der Fasan und das Perlhuhn. Unter den Beigaben zur Tafel spielen Grünkohl, Hirse und Mohn allenthalben eine große Rolle. Merkwürdigerweise besteht in einzelnen Gegenden für Weihnachten ein Verbot des Genusses von Erbsen. — Wir dürfen endlich bei der Erwähnung der Weihnachtspeisen nicht des Backwerks vergessen, das wohl in keinem deutschen Hause zu Weihnachten fehlt. Zusammensetzung, Form und Benennung dieses Weihnachtsgebäcks wechseln nach den Provinzen und selbst von Stadt zu Stadt; man spricht in Österreich und in Schlesien von Striezeln, in Sachsen von Christstollen, in Thorn von Kathrinchen, in Königsberg und Lübeck von Marzipan, in Mecklenburg und Holland von Heetwecken, in Aachen von Printen, in Nürnberg von Lebkuchen, in Basel von Leckerli, und so weiter.


[S. 236]

Die zahlreichen Gebräuche, die sich an das Weihnachtsfest knüpfen, beginnen bereits vielfach mit dem Erscheinen des Nikolaus (vorzugsweise im südlichen Deutschland) und des Knecht Ruprecht (nördliches Deutschland), beide ein Schreckgespenst für unartige Kinder (Abb. 293). Den Sankt Nikolaus hat die christliche Legende zu einem Heiligen des dritten Jahrhunderts nach Christus gemacht, aber er ist nichts anderes als sein Genosse Ruprecht, gleich Hruodperaht, das heißt der von Ruhm Strotzende, womit wieder Wodan gemeint ist; beide haben somit ein und dieselbe Bedeutung. Sie erscheinen meistens bereits einige Wochen vor Weihnachten oder in einzelnen Gegenden am Heiligen Abend, und zwar entweder unbemerkt in der Nacht oder sichtbar gegen Abend. Im ersteren Fall stellen die Kinder ihre Schuhe oder auch Körbchen und Teller, in die sie Hafer oder Heu, in Belgien auch Rüben für das Pferd des Nikolaus legen — offenbar ist hiermit Sleipner, das Roß des Wodan, gemeint, auf dem er die Lüfte durchreitet — vor ihr Bett, in die Nähe des Schornsteins oder vor die Türe; die guten Kinder finden dann am anderen Morgen an Stelle dieser Gabe Äpfel, Nüsse und Zuckerwerk vor, während die bösen neben dem unberührt gebliebenen Futter noch eine Rute erblicken. Findet sich der Ruprecht in höchsteigener Person ein, dann hat er einen langen Bart, ist mit Pelz und hoher Mütze bekleidet und trägt auf dem Rücken einen Sack, in der Rechten eine Rute. Er fordert die erschreckten Kinder zum Beten auf und verteilt dann an die Kleinen Äpfel, Nüsse und Pfefferkuchen, die Unartigen aber züchtigt er mit der Rute oder droht ihnen wenigstens. In Österreich ist ein sehr beliebtes Geschenk für Kinder der Krampus (Abb. 294). In Pommern befinden sich in Begleitung[S. 238] des Weihnachtsmannes noch verschiedene Gestalten, die offenbar heidnischen Ursprungs sind, so der Schimmelreiter (eine Karikatur des auf seinem weißen Wolkenroß dahinjagenden Wodan), der Bärenführer mit dem Bären (Versinnbildlichung des Winters), der Ziegenbock (Erinnerung an Donar, den man sich mit einem Ziegengespann fahrend dachte) und der Storch (Sinnbild des Frühlingsgottes); alle diese Gestalten werden von verkleideten Burschen dargestellt, die ihre Kurzweil treiben, während der Ruprecht seiner Pflicht nachgeht. Nachdem dieser ein kleines Geldgeschenk erhalten hat, begibt er sich mit seinem Gefolge zum nächsten Haus.


Früher waren solche Umzüge (Abb. 295 und 296) sehr verbreitet, sie sind aber jetzt so ziemlich außer Gebrauch gekommen. Stets treten dabei phantastische oder mythische Gestalten in die Erscheinung, wie der soeben erwähnte Schimmelreiter und der Ziegen- oder Klapperbock in Pommern, Hans Trapp in Westfalen und noch andere Persönlichkeiten, die ihren Zusammenhang mit Wodan und seinen Begleitern bei der wilden Jagd erkennen lassen. In England begegnen wir den Überresten solcher Umzüge in den Carolussängern. In Kaltbrunn, Kanton St. Gallen, wird seit Jahrhunderten schon das „Klausnen“ geübt. Zwölf junge Burschen (Abb. 299), bekleidet mit weißem Hemd und Hosen, bestickten Hosenträgern und hellroter Krawatte, einem breiten Ledergurt, der eine große Kuhglocke trägt, und einer eigenartigen Kopfbedeckung, Inful genannt, deren oberer Teil zierliche Figuren in allen Farben durchsichtig erscheinen läßt, ziehen in der Stadt umher. Einer von ihnen, der Samichlaus, beschenkt die Kinder in den Häusern, die übrigen Kläuse erfreuen draußen die zahlreichen Zuschauer durch ihre reigenartigen Bewegungen, wobei die von innen erleuchteten Infuln und das vielstimmige Glockengeläute den Reiz noch erhöhen. Die Pausen füllen der „Dumme August“ und der Esel[S. 239] durch ihr übermütiges Treiben aus; eine weitere typische Figur ist der „Geißler“, der mit der dicken und langen Peitsche (Geißel) knallt (Abb. 300). Vor jeder Kirche verneigen sich die Kläuse, nachdem der Samichlaus drei Glockenschläge getan hat.

Die Christnacht gilt in den Augen des germanischen Landvolkes für hochheilig, und daher werden an diesem Abend, besonders um die mitternächtliche Stunde, allerlei abergläubische und mystische Handlungen vorgenommen. Besondere Sorgfalt läßt der Bauer seinem Vieh angedeihen. Er füttert es reichlicher als sonst und versieht es wohl auch mit besonderer Leckerspeise. In einzelnen Gegenden behauptet man, daß er dies aus dem Grunde tue, weil um Mitternacht der Teufel im Stalle erscheine und die Tiere ausfrage, ob sie mit ihrem Herrn und dem Gesinde zufrieden seien. Denn das Vieh besitzt nach dem Glauben des Volkes um die Weihnachtsmitternacht die Gabe zu reden, auch zu weissagen. Ebenso können Menschen unter Umständen um diese Stunde in die Zukunft schauen. Wenn ein Mädchen Schlag zwölf Uhr in einen Brunnen sieht, erblickt es darin das Bild seines Zukünftigen; desgleichen kann jemand erfahren, ob im kommenden Jahre eine Hochzeit oder ein Leichenbegängnis im Hause stattfinden wird, wenn er um Mitternacht mit verhülltem Kopfe aus der Haustür tritt, seine Hülle abwirft und nach dem Giebel sieht. In Belgien suchen junge Leute, die verlobt sind, auf eigentümliche Weise zu ergründen, ob ihre Ehe glücklich sein wird: sie werfen zwei Kastanien ins Feuer und achten darauf, ob sie gleichmäßig verbrennen oder nicht; trifft das erstere zu, dann wird die zukünftige Ehe gut ausschlagen; bersten die Kastanien aber oder springen sie aus der Glut, dann steht Unglück in ihr zu befürchten. In bestimmten Gegenden Deutschlands behauptet man, daß[S. 240] zur Geisterstunde der Heiligen Nacht sich die Berge öffnen und dem Mutigen ihre Schätze enthüllen, daß aber derjenige, der es unternimmt, sie zu heben, sich damit beeilen müsse.

In Skandinavien legt man große Bedeutung dem Julstroh bei. Die Mägde hängen am Abend, wenn sie das ganze Haus gereinigt und alles blitzblank gescheuert haben, mit Zierat versehene Strohkränze über dem Eßtisch auf und stecken kleine Bündelchen Roggenähren unter das Dach. Der Landmann legt Stroh in die Ställe, damit es Gänse und Hühner gegen Marder und Hexen schütze und die Kühe vor Krankheit und Fortlaufen bewahre, streut es ferner auf die Äcker, damit die Saat gedeihe, und windet es um die Obstbäume, damit sie reichlich Früchte tragen. Überhaupt ist der Bauer überall eifrig bemüht, auch den Bäumen seines Gartens und den Früchten des Feldes besondere Sorgfalt angedeihen zu lassen. So stellt er in Ungarn das auszusäende Korn unter den Tisch und deckt es mit Stroh oder Heu zu, weil er meint, daß in der Nacht das Jesuskindlein komme und ein wenig darauf ausruhe, was eine reichliche Ernte zur Folge habe. In anderen Gegenden begießt er die Obstbäume mit dem Wasser, in dem die Festspeisen geknetet wurden oder der Mohn angerührt wurde; in Alpach (Tirol) läßt er die Bäume von dem Mädchen, das den Teig zurechtmachte, mit den noch nassen Händen anfassen. Stellenweise begegnet man auch der Sitte, daß in die Rinde der Bäume Geldstücke gesteckt werden, damit sie reichlich tragen, oder, wie in Tirol, daß man die Bäume schlägt oder tüchtig schüttelt, oder, wie in Belgien, daß man sie am Weihnachtstage mit einem Beil anschlägt — alles dies, um ihre Fruchtbarkeit zu steigern.


Die Furcht vor der Tätigkeit böser Geister und Hexen, die in der Weihnachtsnacht ihr Unwesen treiben sollen, spukt noch allenthalben im Volke. Man sucht sich ihrer auf die verschiedenste Weise zu erwehren. In Tirol schüttet man die Speiseabfälle ins Feuer, damit die Hexen kein Zaubermittel daraus anfertigen können, in Ungarn in den Brunnen. Außerdem stellt man aus ihnen mit Hilfe von Mehl ein Gebäck in Gestalt einer menschlichen Figur her und schiebt dieses mit den Worten „Esset, schöne Frau!“ in den Ofen, um die Hexe dadurch gut zu stimmen. Früher war zur Vertreibung der bösen Geister verschiedentlich auch das Weihnachtschießen üblich. In Schweden und ebenso in Schleswig-Holstein hat sich der Glaube an böse Spukgestalten zu einem bestimmten Hausgeist, dem Niß, verdichtet, den man zu Weihnachten recht gut behandeln zu müssen glaubt, damit er dem Haushalt Segen bringe. Um ihn gut zu stimmen, stellt man auch eine Gabe für ihn hin, nämlich Stücke des Weihnachtsgebäcks,[S. 241] vor allem aber einen Topf mit Buchweizengrütze und Honig. — Auch seine und der Hausgenossen sowie des lieben Viehs Gesundheit kann man fördern, wenn man am Heiligen Abend diese oder jene Vorschriften beobachtet. In der Nahegegend darf die Frau den Flachs nicht zu Ende spinnen, sondern muß etwas stehen lassen, damit die Heilige Jungfrau es in der Nacht benutzen kann, um ihr Kindlein abzutrocknen. Dieser Flachs gilt dann für ein Heilmittel gegen allerlei Gebresten, sowohl bei Menschen wie bei Tieren. In der Mark Brandenburg und in Sachsen darf man während der Weihnachtszeit keine Hülsenfrüchte, im besonderen keine Erbsen, essen, sonst bekommt man Geschwüre und andere Krankheiten. In Tirol darf man im Garten kein Stück Wäsche zum Trocknen hängen lassen, weil man fürchtet, daß sonst das Vieh erkranke.
[S. 242]

Die Weihnachtsgebräuche nehmen vielfach ihre Fortsetzung in den Zwölften oder Zwölfnächten, der Zeit zwischen Weihnachten und dem Tage der Drei Könige, während deren die Tage zwar fortlaufend, aber nur sehr langsam an Länge schon etwas zunehmen, also nach der heidnischen Anschauung unserer Vorfahren der Kampf zwischen Licht und Finsternis gleichsam noch unentschieden ist; erst mit dem Dreikönigstage werden sie sichtlich länger, und der Sieg des Lichtes tritt nun deutlich in die Erscheinung. Die Zwölften sind die unheimlichste Zeit im Jahre, während deren nach dem Volksglauben den Geistern und den in Unholde verwandelten Gottheiten der Vorzeit die Macht gelassen ist, ihren Spuk zu treiben. Besonders sind es zwei Persönlichkeiten: Wode (Wodan), der wilde Jäger, und seine Gattin, vom Volke Frau Holle, auch Frau Harke oder Fru Gode genannt, die beide an der Spitze eines wilden Heeres, letztere mit ihren Hunden, die die Seelen der ungetauften Kinder sein sollen, nachts durch die Lüfte brausen und dabei den Menschen, die ihnen begegnen, allerlei Schaden zufügen. Diesen heidnischen Gottheiten zu Ehren wurden in der Vorzeit während der Wintersonnenwende Umzüge veranstaltet, deren Überreste (Abb. 298) sich bis auf unsere Tage forterhalten haben. Allerdings haben wir sie bei uns nur noch in bescheidenem Umfange in Gestalt der Dreikönigsänger, die in den Dörfern von Haus zu Haus ziehen und „Sternlieder“ singen, die vorzugsweise die Geschichte der drei Weisen aus dem Morgenlande zum Gegenstand haben. In der Hauptsache handelt es sich dabei um drei phantastisch ausgeputzte Männer, von denen zwei mit langen vergoldeten Spießen, der dritte mit einem Stern ausgestattet ist, weswegen man sie auch die Sternsänger nennt. Ferner begegnen wir solchen Umzügen am Dreikönigstag noch im Pinzgau und im Pongau in Österreich in den Berchtentänzen mit ihrem lustigen Treiben. Der Name stammt von der Göttin Berchta oder Perahta (das heißt der Glänzenden, Prächtigen), einer Bezeichnung für Wodans Gemahlin. Es beteiligen sich an diesen Umzügen viele Leute, alle in ebenso phantastischer wie eigenartiger Maskierung. Im Sarntal (Schweiz) ziehen die „Glöckelsinger“ mit dem sogenannten „Weibl“, einem als Strohpuppe verkleideten Manne, durch das Dorf und bitten unter Gesang um eine Gabe (Abb. 297). Nach dem jedesmaligen Vortrag wird das Weibl verprügelt. — In Skandinavien, England und Nordfrankreich finden die Weihnachtsgebräuche ihren Abschluß mit dem Bohnenfest am Dreikönigstage. Die Hausfrau bäckt zu diesem Zwecke einen Kuchen und mischt eine Bohne in den Teig hinein. Wenn die Gäste sich abends versammelt und um den Tisch Platz genommen haben, wird der Kuchen in so viel Stücke, als Teilnehmer vorhanden sind, zerschnitten, worauf eines der Kinder sich unter dem Tisch versteckt und der Reihe nach bestimmt, welches Stück jeder von dem Kuchen erhalten soll; das erste Stück wird dem „guten Gotte“ geweiht. Wem das Stück mit der Bohne zufällt, der wird König (Abb. 302) beziehungsweise Königin und wählt sich seinen Partner aus der Gesellschaft. Beide umgeben sich mit einer Art Hofstaat, dessen Mitglieder bestimmte ihnen zufallende Pflichten diesen Abend über erfüllen müssen. Sobald der König trinken will, ist die ganze Gesellschaft verpflichtet, das gleiche zu tun; wer sich weigert mitzumachen,[S. 245] muß ein Pfand an den Hofnarren zahlen. In England verteilt man jetzt die einzelnen Rollen des Hofstaates durch Lose, die in einigen Gegenden scherzhafte Verse enthalten. Diese Sitte hat in Holland und dem Marschlande die Form angenommen, daß die Bäcker ihre Waren am Dreikönigstage mit solchen, manchmal recht derben, Versen bekleben.
Der Umstand, daß in der heidnischen Vorzeit während der ganzen Dauer des Julfestes, also während der Zeit der Zwölf Nächte jegliche Arbeit ruhte, hat den Volksglauben entstehen lassen, daß man während dieser Zeit bestimmte Beschäftigungen, zum Beispiel Waschen, nicht vornehmen dürfe, weil dies sonst Unglück bringen würde.


In die Zeit der Zwölften fällt auch der Übergang des alten in das neue Jahr, Silvester. Die Zahl der Silvesterbräuche ist sehr groß; in der Hauptsache laufen sie darauf hinaus, beim Scheiden des alten Jahres Fragen an das Schicksal über die im neuen bevorstehenden Ereignisse zu stellen. Fromme Leute stechen mit einer Nadel oder einem Messer aufs Geratewohl in die Bibel oder ins Gesangbuch und schließen aus der dabei getroffenen Stelle auf Freud oder Leid, Glück oder Unglück im kommenden Jahre. Im lustigen Kreise ist das Bleigießen und Lebenslichter-Schwimmenlassen (Abb. 301) beliebt. Wer um Mitternacht über seinen Kopf hinweg rückwärts seine Schuhe wirft, kann aus der Lage derselben feststellen, ob er im nächsten Jahre am Orte bleibt oder fortkommt. Heiratslustige junge Mädchen suchen auf diese und noch auf andere Art zu erfahren, ob sie baldige Anwartschaft auf die Ehe haben, wer und was ihr Liebster sein wird und dergleichen. In der Gegend von Brünn in Mähren versteckt man am Silvesterabend, in Abwesenheit der sich daran Beteiligenden, verschiedene Gegenstände unter Töpfen; darauf wird jeder einzeln hereingerufen, um drei von den Töpfen aufzuheben. Deckt der das Orakel Befragende mehrere Male denselben Gegenstand, zum Beispiel Geld, unter dem Topfe auf, dann wird er das ganze Jahr lang solches besitzen; findet er wiederholt ein Stück Brot,[S. 246] dann wird er niemals an Nahrung Mangel leiden. Wer aber einen Kamm erwischt, dem wird es nicht gut ergehen.
In Belgien besteht in manchen Gegenden der Brauch, daß dasjenige Kind, das am Silvestermorgen als letztes in der Familie aus dem Bette steigt, mit dem Namen des heiligen Silvester angeredet wird und seine besten Spielsachen und Geschenke den Geschwistern überlassen muß. Auch Mädchen, die bis zum Jahresschluß eine Arbeit, mit der sie sich beschäftigen, nicht fertigbringen, setzen sich nach dem Volksglauben in manchen ländlichen Gegenden der Gefahr aus, wegen ihrer Unpünktlichkeit und Faulheit von Geistern verfolgt zu werden.

Das Umherziehen der Schuljugend im Dorfe, oft genug in spaßiger Vermummung, und das Absingen von Liedern unter Musikbegleitung, um sich damit ein kleines Geldgeschenk, Obst, Nüsse oder Zuckerwerk zu verdienen, ist verschiedentlich sowohl in Deutschland wie auch in Österreich und der Schweiz noch gang und gäbe, und zwar nicht nur am Silvester- beziehungsweise Neujahrstage, sondern auch während der ganzen Zeit der Zwölften. In Schleswig-Holstein bedient man sich zum Musikmachen des „Rummelpottes“, eines mit einer Tierblase überspannten Topfes, der wie eine Trommel geschlagen wird. Das Umherziehen und Lärmmachen ist sicherlich als ein Überrest des Vertreibens und Erschreckens der bösen Geister zu deuten, die, wie wir schon hörten, gerade in den zwölf Nächten nach Weihnachten ihr Unwesen treiben. Dahin gehört auch das Neujahrschießen und Neujahrwerfen, worunter man das Zertrümmern von alten Töpfen, Tellern und Scherben vor der Tür des Nachbars, auch das Werfen von Erbsen durch die Fenster versteht, eine über ganz Deutschland bis nach Holland hinein verbreitete Sitte. Vielleicht hängt mit dieser Anschauung auch der in den Dörfern Niederösterreichs verbreitete Brauch des Krönens eines Silvesterkönigs zusammen. Dem ungeschicktesten Knecht wird von einer Person aus dem Hausgesinde ein Strohkranz auf den Kopf gesetzt und ein Strohbüschel in die Hand gegeben, worauf er von den anderen mit einer aus Stroh geflochtenen Peitsche aus dem Hause gejagt wird. Draußen muß er so lange stehen bleiben, bis sich eine Magd, meistens die jüngste, seiner[S. 247] erbarmt und ihn zurückführt. Diejenige, die sich des Hinausgetriebenen erbarmt hat, ist im kommenden Jahre das Haupt des Gesindes und wird den ganzen Abend über beglückwünscht.
Wie an dem Heiligen Abend, so sind auch am Silvester bestimmte Gerichte für die Abendmahlzeit gleichsam vorgeschrieben. Hierunter sind in erster Linie Fische zu nennen, die man auf jeden Fall genießen muß, um im neuen Jahre von Unglück verschont zu bleiben. Besonders beliebt sind Karpfen, aber es müssen Rogner sein, damit man stets Geld im Beutel habe; auch ein paar Fischschuppen in der Börse bewirken dasselbe. Andere Silvesterspeisen sind Heringsalat, Hirsebrei, Linsen, Mohnklöße und die unter den verschiedensten Namen bekannten Gebäcke (Krapfen, Pfannkuchen, Kräppel, Pförtchen und so weiter), die beim Silvesterpunsch in fröhlicher Gemeinschaft verzehrt werden. Geselligkeit ist gerade an diesem Abend wohl überall in Deutschland Hauptbedingung. Meist treffen mehrere befreundete Familien bei einer derselben zusammen; wo solcher Anschluß fehlt, versammelt man sich in großen Wirtschaften und feiert gemeinsam den Abschied des alten und den Einzug des neuen Jahres mit Trinken, Singen und den schon angedeuteten Gebräuchen. Punkt zwölf Uhr in der Nacht beglückwünscht man sich, während in den kleineren Städten zur gleichen Zeit eine Musikkapelle vom Turm herab das neue Jahr begrüßt.

Das Neujahrsfest, das unter ähnlichen Veranstaltungen wie heutzutage schon von den ältesten Völkern gefeiert wurde, ist allenthalben Gegenstand der Freude und der Wünsche. Man besucht sich gegenseitig und spricht sich seine Glückwünsche aus oder tut dies auch schriftlich. Vielfach sind auch noch Neujahrsgeschenke üblich, die sich aber in Deutschland wohl zumeist auf Geldspenden der Herrschaft an Untergebene und Bedienstete oder kleinere Geschenke der Kaufleute an ihre Kunden beschränken. Diese kleinen Aufmerksamkeiten gehen auf die strenae der alten Römer zurück, deren Überreste sich außerhalb Deutschlands noch in wirklichen Neujahrsgeschenken unter Freunden und Familienangehörigen erhalten haben. In Holland zum Beispiel beschenkt man sich mit vergoldeten Kräuterkuchen oder kandierten Früchten, in England und Frankreich mit Orangen, früher jenseits des Kanales auch mit Handschuhen. — In Friesland findet am Neujahrsmorgen ein Wettlaufen mit Schlittschuhen auf dem Eise statt, in Schleswig-Holstein ein Wettschieben mit hölzernen, innen mit Blei beschwerten faustgroßen Kugeln (das sogenannte Eisbosseln), wobei nicht nur einzelne Gruppen von Menschen, sondern auch wohl ganze Dörfer gegeneinander kämpfen.
In der Schweiz feiert man in den ersten Tagen des neuen Jahres den Berchtelitag, der seinen Namen von der schon oben erwähnten Gattin Wodans erhalten hat. In Zürich ist diese[S. 248] Feier, die sich hier zu einem wirklichen Volksfest gestaltet, auf den 2. Januar verlegt worden. Die Kinder nehmen an verschiedenen Orten des Landes die sogenannten Neujahrstücke (Neujahrsblätter) in Empfang und erhalten Geldgeschenke, die den Namen „Stubenlitzen“ führen, da sie ursprünglich einen Beitrag für die Heizung der Zunftstuben bildeten. Andere durchziehen vermummt die Straßen und sprechen mit dem Rufe „Batz, Batz“ die Vorübergehenden um Gaben an. Die Erwachsenen veranstalten in der Stadt Zürich am Nachmittag Umzüge, und zwar bewegen sich dieselben zunftweise von den Zunfthäusern durch die Stadt, Reiter und Wagen mit Kostümgruppen an der Spitze. Gegen Abend versammeln sich alle auf einem freien Platze am See um einen Holzstoß, zu dem die sogenannte Bögg gebracht wird, eine groteske Figur aus weicher Baumwolle, mit irgendeinem Deckel auf dem Kopfe und einem umgestülpten Besen in der Hand; sie stellt die Verkörperung des Winters vor und wird auf dem Scheiterhaufen verbrannt, damit der Frühling seine Herrschaft ungestört antreten könne. Schlag sechs Uhr ertönt die historische zweitgrößte Glocke vom Turm des Großmünsters — daher wird die ganze Feier auch Sechseläuten genannt — und unter Musik und allgemeinem Jubel schlagen die Flammen um den mit Petroleum übergossenen Holzstoß und die Bögg empor (Abb. 303). Ist alles niedergebrannt, dann kehren die Zünfte in ihre Häuser zurück und „bächten“ die ganze Nacht, worunter Essen, Trinken, Singen und derbe Scherze verstanden werden.


Hinlänglich bekannt sind die an dem nächsten christlichen Fest, Mariä Lichtmeß (2. Februar), vorgenommenen Handlungen und Gebräuche, die noch recht deutlich ihren heidnischen Ursprung erkennen lassen. Ein eingehenderes Verweilen verdient der Valentinstag (14. Februar),[S. 249] der auf den Britischen Inseln Anlaß zu volkstümlichen Gebräuchen bietet. Hierunter ist in erster Linie das Valentinwählen zu nennen. Die junge Welt auf dem Lande meint allgemein, daß diejenigen Personen, die sich am Morgen dieses Tages zuerst erblicken, zu Ehegatten beziehungsweise Ehegattinnen bestimmt seien; natürlich sind Verliebte und alle die, die einem solchen Paar wohlwollend gesinnt sind, bestrebt, es nach Möglichkeit so einzurichten, daß sich die Richtigen zuerst zu Gesicht bekommen. Die Jünglinge stellen sich oft schon vor Sonnenaufgang in der Nähe des Hauses auf, in dem ihre Auserwählte wohnt, oder an einer Stelle, wo sie vorüberkommen muß; die Mädchen setzen sich am frühen Morgen mit geschlossenen Augen ans Fenster und warten so lange, bis sie die Stimme desjenigen vernehmen, den sie gern haben möchten. In den Städten ist es Brauch, sich gegenseitig kleine Geschenke scherzhafter Art (Valentine genannt), besonders Karten mit zwei Herzen, die von Liebespfeilen durchbohrt werden, mit der Post zu übersenden oder diese Karten an einen Apfel oder an eine Apfelsine gebunden persönlich zur Tür hineinzuwerfen. Ein anderer Brauch, der früher bis nach Nordfrankreich und selbst nach Lothringen hin verbreitet war, besteht darin, daß die jungen Leute am Vorabend des Valentinstages zusammenkommen[S. 250] und jeder seinen Namen auf einen besonderen Zettel schreibt, worauf man der Reihe nach die Namen der jungen Burschen und Mädchen paarweise verliest; die auf solche Weise Zusammengekommenen sind bis zum nächsten Jahre Valentin und Valentine und halten bei allen vorkommenden Gelegenheiten mehr oder weniger als solche zusammen.

Mit dem Valentinstag sind wir bereits in die Fastenzeit hineingekommen. Das Fasten, das heißt die Enthaltsamkeit von allen oder gewissen Speisen, meistens Fleischspeisen, ist eine uralte religiöse Einrichtung, die sich schon bei den Kulturvölkern des Altertums und ebenso noch bei den Naturvölkern der Gegenwart nachweisen läßt. So kennt auch die christliche Kirche eine Fastenzeit von vierzig Tagen mit Rücksicht darauf, daß Moses, Elias und Christus die gleiche Zeit über sich der Speisen enthielten. Es leuchtet ein, daß die Menschen sich für die durch die Fasten ihnen auferlegten Entbehrungen entweder vorher oder nachher schadlos zu halten suchen; daher begegnen wir wohl überall, wo die Religion längere Fasten vorschreibt, möglichst viel Genüssen und größerer Ausgelassenheit vor oder nach der Zeit der Entbehrungen. Wir können hier nur einen kleinen Teil der zahlreichen Gebräuche und Belustigungen aufzählen, die in den Gauen der nordeuropäischen Länder vorkommen; ihnen allen liegt mehr oder weniger der Gedanke eines Kampfes zwischen Licht und Finsternis, zwischen Frühling und Winter zugrunde, bei dem der siegende Teil seinen Spott an dem überwundenen ausläßt. Als solche Volksbelustigungen (Abb. 304, 307, 311 und 312) führen wir unter anderen an das Eselreiten am Rhein, das Ringreiten in Westfalen, das Hudlerlaufen in Bayern und Tirol, das Topfschlagen und Sacklaufen in Skandinavien und Schleswig-Holstein, das Schönbartlaufen in Süddeutschland, besonders in Nürnberg, und den Metzgersprung in München. Wir erinnern ferner an die prunkhaften Umzüge des Prinzen Karneval in Mainz, Köln, München und in anderen Städten des westlichen und südlichen Deutschlands.
[S. 251]

Der Karneval erreicht seinen Höhepunkt am sogenannten Rosenmontag und endet am darauffolgenden Fastnachtdienstag; an diesem Abend wird vielfach der Schluß der lustigen Karnevalszeit in den Familien mit einer Festlichkeit begangen, an der in Norddeutschland Pfannkuchen und Punsch nicht fehlen dürfen. Der darauffolgende Tag, der Aschermittwoch, stellt den Tag der Buße dar, denn an diesem Tage setzt die Fastenzeit ein. Eine am Aschermittwoch weitverbreitete Sitte ist das Stäupen (auch Kindeln oder Peitschen genannt) mit Birkenruten (dem heiligen Baum des Donar); damit soll das Austreiben der bösen Geister angedeutet werden, von denen die Menschen besessen sein könnten, ursprünglich aber wohl das Vertreiben des Winters durch den hereinbrechenden Frühling. Alle Langschläfer werden unsanft aus ihrem Schlummer geweckt und gestäupt oder wenigstens auf ihre Bettdecke mit Ruten geschlagen. Eltern und Kinder wetteifern miteinander, als die ersten aufzustehen, um dem Verhängnis zu entgehen. In Schleswig-Holstein muß der Langschläfer eine Hedwig spenden, ein gewürztes Brötchen in Keilform (Keil = wegg ist der Hammer des Thor). Hedwig ist durch Verunstaltung aus Hollewig hervorgegangen, einem Wort, das wieder mit der Göttin Holle zusammenhängt. Die Hedwig ist nicht das einzige Fastengebäck; man kennt in Deutschland noch eine ganze Reihe von Formen und Bezeichnungen der verschiedensten Art, wie Fastenbretzeln, Krapfen, Öhrle, Küchel, Heißwecken und so fort, die nur zur Fastenzeit hergestellt werden.
[S. 252]

Das Wort Fastnacht hat ursprünglich nichts mit dem Fasten zu tun, es hängt vielmehr mit dem alten deutschen Worte vahsen, das heißt in großer Ausgelassenheit toben, zusammen. In alten Zeiten gab es die Vahsnächte, die mit Mariä Lichtmeß begannen und sich bis Ostern hinzogen, in christlicher Zeit aber mit dem Beginn der Fastenzeit endeten. Weil man sich in diesem Zeitraume erst noch einmal ordentlich austoben wollte, bevor man sich Buße, Entbehrungen, Fasten auferlegte, wurde das Wort Vahsnacht in Fastnacht umgewandelt. In die Vahsnächte fiel auch der Frühlingsanfang, der Zeitpunkt der Frühlings-Tagundnachtgleiche, an dem der Frühling über den Winter endlich die Oberhand gewinnt, was Anlaß zu ausgelassener Freude gab. Nach der alten Sage wurde die Sonnengöttin vom Winterriesen geraubt und in ihrer Eisburg gefangengehalten; um den Menschen den Lenz bringen zu können, mußte sie befreit werden. In dieser Auffassung finden zahlreiche Spiele der Kinder ihre Erklärung. In Schleswig-Holstein wurde von den Kindern bis in die Neuzeit herein ein Spiel gespielt, bei dem sie einen Kreis (Mauer) mit einer in der Mitte sitzenden Person, der Königstochter (Sonnengöttin), bildeten und die übrigen Mitspielenden außerhalb des Ringes standen. Zwischen beiden Parteien entspann sich nun ein Wechselgesang, bei dem die Außenstehenden den Wunsch aussprachen, zur Königin gelangen zu wollen, die den Ring Bildenden aber ihnen den Zutritt verwehrten und schließlich nur unter der Bedingung gestatteten, daß sie die Mauer zerbrächen. Darauf stürmten die Außenstehenden die Kette, sprengten sie und führten die Königstochter im Triumphe davon. Anderen ums Frühjahr herum üblichen Spielen, wie[S. 253] Hahnschlagen, Katzenschlagen, Ringreiten, Türkenstechen, Rolandreiten und ähnlichen, liegt dieselbe Bedeutung zugrunde. Hahn und Katze, der eine dem Donar, die andere der Freia geweiht, sitzen unter dem Topfe; man sucht mit verbundenen Augen in die Nähe des Topfes zu gelangen und diesen zu zertrümmern, aber nicht um die Tiere zu töten, sondern um sie zu befreien. Beim Türkenstechen, Rolandreiten und so weiter handelt es sich um eine Art Kampfspiele, in denen Roland oder die Türken gleichbedeutend mit den Winterriesen sind.


Auch das Osterfest war ursprünglich ein Frühlingsfest, obgleich es sich, oberflächlich betrachtet, aus dem jüdischen Passah- oder Pesachfeste entwickelt hat, dem Feste zum Gedächtnis des Auszuges der Kinder Israel aus Ägypten, das mitzufeiern Jesus nach Jerusalem eingezogen war. Das Passahfest, das das nachweisbar älteste Fest der Juden[S. 254] ist und in Wirklichkeit schon lange vor der Zeit ihres Auszuges aus Ägypten gefeiert wurde, ist keineswegs als ein den Israeliten eigentümliches Fest anzusprechen, sondern war, wie die in noch früheren Zeiten in Ägypten und Babylonien begangenen Festlichkeiten, ursprünglich ein Frühlingsfest, ein Fest, an dem man Gebete an die Götter richtete, um Fruchtbarkeit für Tiere und Pflanzen von ihnen zu erreichen. Die alten Deutschen kannten gleichfalls ein Frühlingsfest, das sie zu Ehren ihres Gottes Thor und seiner Schwester Ostara oder Eostra feierten. An seine Stelle setzte die christliche Lehre das Passahfest. Mit allen Mitteln versuchte sie, den von den Juden überkommenen Namen für dasselbe beizubehalten; indessen blieb die Erinnerung an die heidnische Göttin in den Bezeichnungen Ostern und Easter beim deutschen und englischen Volke erhalten.



Das heilige Tier der Ostara war der Hase, ihr Lieblingsopfer waren Eier; beide galten als Sinnbilder der wiedererwachenden Natur und der Fruchtbarkeit, die im besonderen der Frühling mit sich bringt. Osterhase und Ostereier sind daher eng mit den deutschen Ostergebräuchen verknüpft. Lange vor dem Fest sammelt die Hausfrau möglichst viel Eier an, färbt und bemalt sie mit schönen Mustern (Abb. 305) und versteckt sie am Ostermorgen, in kleine Nestchen gelegt, auf die wiederum ein Osterhäschen gesetzt wird, im Haus, im Garten oder auf der Wiese, wo die Kinder sie dann suchen. Auch Erwachsene beschenken sich gegenseitig mit [S. 256]Ostereiern, wie die heidnischen Altvordern es bereits taten; indessen sind an Stelle der ursprünglichen Hühnereier jetzt zumeist Schokolade- oder Zuckereier, auch wohl Eier aus Porzellan oder Metall getreten, die die auserlesensten Erzeugnisse des Zuckerbäckers, in wohlhabenden Kreisen unter Umständen auch Gegenstände kostbarerer Natur, Goldsachen und Juwelen, als Inhalt in sich bergen. Mit den Ostereiern wird von den Kindern mancherlei Kurzweil getrieben. Sehr verbreitet ist das Eierpicken (Abb. 306). Zwei Spieler verbergen in der hohlen Hand ein Ei, so daß nur die Spitze hervorsieht, und picken, das heißt stoßen die beiden Eierspitzen aneinander; wessen Ei dabei unversehrt bleibt, der erhält das seines Gegners. Ein anderes am Ostertage sehr beliebtes Volksspiel ist das Eierkullern oder Eierwalen (Abb. 309). Auf einem Hügelabhang oder einer kleinen, besonders dazu hergerichteten und geglätteten schrägen Bahn lassen die Spieler die Eier hinabrollen; wessen Ei die der anderen trifft oder überholt, der hat gewonnen. Vielfach sind die Eier außer Gebrauch gekommen; an ihre Stelle sind Äpfel, Pfefferkuchen, sogar Würste getreten, die man den Abhang hinabwirft, worauf sich die zahlreich unten versammelten Kinder um sie balgen. In Süddeutschland wie auch in der Schweiz betreibt man das Eierlaufen. Auf einer abgesteckten Bahn, am besten auf einer Wiese, werden ein paar hundert Eier in Abständen von je einem Meter verteilt und am Anfang derselben ein Korb aufgestellt. Ein Teilnehmer an dem Spiel muß nun jedes Ei einzeln aufheben, zum Korbe zurückgehen und das Ei hineinlegen. Währenddessen läuft ein anderer zu einem etwa eine halbe[S. 257] Stunde entfernten Nachbardorf, um sich hier zu melden, und begibt sich ebenso schnell wieder zu seinem Ausgangspunkt zurück (Abb. 308). Wer nun seine Aufgabe zuerst gelöst hat, gilt für den „König“. Allerlei Lustbarkeiten schließen sich an dieses Eierlaufen an.

Die am Gründonnerstag gelegten Eier schätzt das Volk besonders hoch ein. In Süddeutschland behauptet man, daß diese bereits in der Henne geweiht seien, ehe das Tier sie legt, und am Ostertage durch den Priester eine zweite Weihe erhalten, so daß sie nunmehr eine besondere Wirksamkeit besitzen. Am Ostersonntag nüchtern getrunken, verleihen sie außergewöhnliche Kräfte, schützen vor Blitzgefahr, machen stichfest und so weiter. In der Oberpfalz und in Oberfranken vergißt der Hausherr niemals, ein Gründonnerstagsei zu essen, um gegen allerlei Krankheit gefeit zu sein. Er gibt ein an diesem Tage gelegtes Ei sogar dem Vieh zu fressen oder teilt ein solches in zwei Hälften, von denen er die eine, in ein Läppchen eingewickelt, im Pferde-, die andere im Kuhstall aufhängt, um dadurch Viehseuchen fernzuhalten. In Pommern steckt der Bauer jedem Stück Vieh vor dem ersten Austreiben ein Ei ins Maul und[S. 258] zwingt es, dasselbe hinunterzuschlucken; dadurch sollen die Kühe so rund wie die Eier werden. In anderen Gegenden werden bei dem Beginn der Feldarbeit zahlreiche Gründonnerstagseier über den Acker verstreut oder unter das Korn gemischt, um große Fruchtbarkeit zu erzielen oder die Saat vor Hagel zu schützen. Auch wirft man bei einem losbrechenden Gewitter ein solches Ei über das Dach des Hauses, um dieses vor Blitz zu schützen. Sieht man in der Kirche bei Sonnenschein durch ein solches Ei, dann vermag man die in der Gemeinde vorhandenen Hexen zu erkennen; überhaupt kann jeder, der ein solches Gründonnerstagsei bei sich trägt, vieles erkennen, das anderen Menschen verborgen bleibt.


Sehr verbreitet ist der Glaube an die heilende und verschönende Kraft des Osterwassers und an die reinigende des Osterfeuers. Die Sitte des Osterwasserschöpfens hängt wohl mit der Vorstellung zusammen, daß die Erde in derselben Weise, wie sie dem in sie hineingelegten Samen den Trieb zum Sprossen und Blühen mitteilt, so auch dem aus ihr fließenden Wasser eine besondere Kraft verleihe. Um Mitternacht oder wenigstens vor Sonnenaufgang müssen die jungen Mädchen an einen fließenden klaren Bach oder auch an den Dorfbrunnen (Abb. 313) gehen und daraus schöpfen. Während bei dieser Beschäftigung in den meisten Gegenden das Sprechen verpönt ist, wird es in anderen wieder gestattet oder sogar gefordert, insofern man einen bestimmten Spruch beim Schöpfen hersagen muß. In jenen suchen die Burschen, die die jungen Mädchen begleiten, sie aus Übermut durch allerhand Neckereien zum Sprechen oder Lachen zu bringen, und wer nun gegen die Vorschrift des Schweigens verstößt, für den ist die Zauberkraft dahin. Diese aber ist in den Augen des Volkes eine ganz außerordentliche. Osterwasser ist gleichsam ein Allheilmittel gegen alle möglichen Krankheiten. Besonders gern wird es gegen Hautkrankheiten angewandt; es soll dem Gesicht Schönheit und Anmut verleihen. Man kocht auch die Speisen am Ostertage mit solchem Wasser; ferner füllt man es auf Flaschen oder in Fässer, um es später gegen allerlei Gebrechen zu trinken. Ähnliche Kräfte werden dem Ostertau sowie etwa am Ostermorgen gefallenem Schnee zugeschrieben.


Die Sitte der Osterfeuer geht auf die reinigende Kraft der Flamme zurück, mit der ursprünglich die Hexen und Dämonen des Winters vertrieben werden sollten. In vielen Gegenden Deutschlands pflegt das Volk am Abend des ersten Ostertages mit Vorliebe auf Anhöhen, alten Opferstätten oder sonst durch Überlieferung geheiligten Plätzen haushoch aufgetürmte Haufen Holz oder Reisig als Osterfeuer anzuzünden. Vielfach wird noch mit Musik in festlichem Zuge zu der Stätte hinausgezogen und getanzt oder sonstwie gefeiert; auch die Kinder beteiligen sich mit allerlei Schabernack dabei. In einzelnen Gegenden läßt man mit Teer gefüllte Tonnen oder flammende Wagenräder die Berge hinunterrollen und begleitet diesen Vorgang mit lautem Gejohle. Der Glaube an die reinigende Kraft des Feuers tritt noch in einer ganzen Reihe anderer Gebräuche zutage. Im Braunschweigischen behauptet man, daß, soweit die Helle der Osterfeuer reiche oder der Rauch hinziehe, die Felder fruchtbar würden und von Hagel und Mißwachs verschont blieben; die Häuser in diesem Umkreis seien vor Feuersbrunst und Blitzschlag, ihre Insassen vor Krankheit geschützt. Man pflegt auch vielfach die Asche des heruntergebrannten
[S. 261]
Feuers auf die Äcker zu streuen oder unter das Futter beziehungsweise die Saat zu mischen, um Gedeihen für Tiere und Pflanzen zu erzielen. In der Altmark malt man mit Kohle das Zeichen des Kreuzes an die Haustür, um seine Bewohner vor Hexen zu schützen, und mehr dergleichen. In katholischen Gegenden werden am Ostersonntagmorgen überall auf den Dörfern die Speisen geweiht. Nach dem Gottesdienst drängen sich Frauen und Mägde um einen der Seitenaltäre zusammen und setzen hier ihre Körbchen nieder, in denen Osterspeisen liegen, in der Hauptsache mit Rosinen reichgespickte Kuchen, ein Stück Schinken und Salz. Der Priester spricht über sie den Segen aus. Die Speisen werden sodann mit besonderer Andacht zu Mittag gegessen, das Salz aber wird vielfach aufgehoben und muß das ganze Jahr hindurch als Heilmittel gegen Krankheit bei Menschen und Vieh dienen. Wie zu Weihnachten, so bäckt man auch zu Ostern besondere Gebäcke, die man in Sachsen Osterfladen, im Elsaß, in Oberbayern und in Böhmen Osterlaibel, in Wien Osterflecken nennt. Es sind meistens dünne, flache Kuchen, die auf das Sonnenrad anspielen. — Auch Umzüge finden zu Ostern hier und dort noch statt. In Wittichenau in Schlesien zum Beispiel setzen sich die männlichen Dorfbewohner auf festlich geschmückten Pferden von der Kirche aus in Bewegung; vor ihrem Aufbruch übergibt der[S. 262] Pfarrer den Teilnehmern ein Kruzifix und ein geweihtes Banner, jeder Reiter nimmt noch ein Psalmbuch mit, aus dem während des Rittes, dessen Ziel die umliegenden Dörfer sind, vorgelesen und gesungen wird (Abb. 310).

In England haben sich wieder ganz andere Osterbräuche erhalten, wenngleich manche in den Städten bereits so gut wie ausgestorben sind. Am Ostermorgen scharen sich die jungen Burschen zusammen und umringen jedes junge Mädchen auf der Straße mit den Worten: „Lösen Sie gefälligst Ihre Schuhe ein.“ Wenn es nicht sofort einen Penny spendet, zieht man ihm die Schuhe mit Gewalt aus, so daß es ohne solche nach Hause zurückkehren muß. Am Abend oder am nächsten Morgen nehmen die Mädchen dann aber Rache, indem sie von den Männern eine Hutsteuer verlangen und, wenn ihnen diese nicht sofort gezahlt wird, die Hüte der Betreffenden unfehlbar ins Feuer wandern lassen. Eine andere Steuer wird in der Gemeinde Hungerford (Berkshire) am dritten Osterfeiertag von allen Einwohnern erhoben; die Taxe lautet für jeden Mann auf einen Penny, für jede Frau auf einen Kuß. Wenn der Morgen graut, bläst der Chor der Stadtmusikanten vom Balkon des Rathauses seine Weisen, und wenn der letzte Ton verklungen ist, eilt alles auf die Straße, jede Frau und jedes Mädchen wird geküßt, und jeder Mann muß einen Penny bezahlen; dabei werfen alle Beteiligten Nüsse, Apfelsinen und Kupfermünzen unter die Kinder. In einzelnen Orten von Lancashire, Cheshire und im nördlichen Wales wird noch der alte Brauch des „heaving“ geübt, bei dem die Männer die Frauen (und umgekehrt) hochheben und dann küssen dürfen. Am Ostermontag genießt die männliche Bevölkerung dieses Vorrecht, am Osterdienstag die weibliche, und diese macht es sich nicht weniger zunutze als jene.

Bevor wir weitergehen, wollen wir noch kurz der volkstümlichen Gebräuche gedenken, die an den drei Festtagen der Karwoche, am Palmsonntag, am Gründonnerstag und am Karfreitag, geübt werden. In katholischen Gegenden Österreichs und Süddeutschlands pflegt man die jungen Triebe der Birken, Weiden, Haselnußbüsche und anderer Sträucher am Sonntag vor Ostern auf feierliche Weise vom Priester einsegnen zu lassen; sie werden dann entweder an die Gläubigen verteilt oder gegen ein paar Pfennige Gotteslohn verkauft. Denn diesen[S. 264] geweihten Zweigen, den sogenannten Palmen — in der Schweiz haben solche Palmen die Gestalt hoher Bäume angenommen (Abb. 314) — wohnt eine geheimnisvolle Macht inne. Die Wohnräume, die man mit ihnen schmückt, bleiben von Unheil verschont; man erreicht dasselbe auch, wenn man diese Kätzchen, wie sie auch heißen, auf glühende Kohlen des Herdes wirft. In der Umgebung Prags schlägt man die Knaben und Mädchen mit den Palmbüscheln, damit sie in der Schule nicht faul werden. In ähnlicher Weise schlagen die badischen Bauern ihr Vieh in der Form eines Kreuzes auf den Rücken, damit es gesund bleibe und reichlich Milch gebe. — Eine ganz eigenartige Sitte ist der Tallsackenmarkt, der am Palmsonntag in Warmbrunn in Schlesien abgehalten wird. Was diesem Jahrmarkt zu seinem Namen und zu seiner Beliebtheit bei alt und jung verholfen hat, das sind die Tallsäcke, die in Unmasse zum Verkauf gestellten, aus Semmelteig angefertigten menschlichen Figuren beiderlei Geschlechts. Die gangbarsten dieser verschiedenen Gebilde haben Augen aus Korinthen und drücken mit den nudelförmigen Armen ein buntgefärbtes Ei an die Brust. Damit der Käufer auch wisse, ob es sich um einen männlichen oder weiblichen Tallsack handelt, bringt man im Gesicht des ersteren als Andeutung des Bartes kleine Teigröhrchen an.

Der Gründonnerstag hat seinen Namen wahrscheinlich von der heidnischen Sitte erhalten, um diese Zeit die Erstlinge der Felder, die ersten grünen Gemüse, den Göttern zu opfern; diese Sitte kehrt in dem christlichen Brauch wieder, am Gründonnerstag entweder gänzlich zu fasten, was wohl mit dem Genuß des heiligen Abendmahls zusammenhängt, oder doch sich auf den Genuß grünen Gemüses zu beschränken. Daher schreibt die Volksitte noch jetzt vor, an diesem Tage Blumenkohl, Rapunzeln, Spinat, Schnittlauch, Sprossenkohl, Brennesseln, Taubnesseln, Kerbel, Scharbockskraut, Pimpernelle, Malven und andere Frühlingsgewächse zu verspeisen. Sie werden entweder als einziges Gericht (Salat) oder mit Teig verbacken genossen; in Böhmen sind dies die sogenannten Spinatkrapfen, in Schwaben die Laubfrösche oder Maultaschen. Von sonstigen Gründonnerstagspeisen erfreut sich noch großer Beliebtheit der Honig. Man nimmt an, daß dieser bei den Opfern, die man dem Thor darbrachte, eine große Rolle spielte. Daher schreibt man dem Genuß des Honigs zur Osterzeit, der besonders am Gründonnerstag auf keinem Tische fehlen darf, besondere Heilkräfte zu. Ein Honigbrot, das man an diesem Tage nüchtern verzehrt, soll vor dem Biß toller Hunde und giftiger Schlangen schützen. In Böhmen werfen die Knechte, nachdem sie sich am Ostermorgen durch Waschen in fließendem Wasser gereinigt haben, einen mit Honig bestrichenen Brotbissen in den Brunnen, um das Wasser vor Ungeziefer zu bewahren, oder spritzen zu demselben Zweck mit einer Rute Honig im Zimmer umher; auch legen sie mit Honig bestrichene Brotscheiben in die junge Saat oder binden vor Sonnenaufgang durch Honig gezogene Fäden um die Obstbäume, um deren Fruchtbarkeit zu steigern.
Eine in katholischen Fürstenhäusern übliche Zeremonie des Gründonnerstages ist die Fußwaschung,[S. 265] wie sie unter anderem an dem Kaiserhofe zu Wien in Anwesenheit des ganzen Hofstaates, der Minister und Diplomaten am Vormittag dieses Tages in der Hofburg an zwölf Greisen vom Kaiser selbst unter großer Feierlichkeit vorgenommen wird. An die Waschung schließt sich die Speisung von zwölf Armen an. Auch bei den Mennoniten und den Mitgliedern der Brüdergemeinde ist die Fußwaschung üblich. In dem protestantischen England begnügt man sich bei Hofe damit, Speisen an Arme zu verteilen, und zwar an so viel Personen, als der König und die Königin zusammen Jahre zählen. Die Speisen werden für jeden Armen, der damit bedacht werden soll, sorgfältig in einen Korb verpackt, weswegen der Gründonnerstag in England auch den Namen Korbdonnerstag führt. Etwas Ähnliches hat sich in Antwerpen erhalten. Hier werden im St.-Julien-Hospiz an diesem Tage zwölf Armen, die indessen sich schon an einer Pilgerfahrt beteiligt haben müssen, an einer Tafel die auserlesensten Gerichte und Getränke vorgesetzt. — Daß in christlichen Ländern am Abend des Gründonnerstags das Abendmahl zur Erinnerung an seine Einsetzung durch Christus mit besonderer Feierlichkeit von den Gläubigen genommen wird, verdient ebenfalls hervorgehoben zu werden.


An den Karfreitag oder Stillen Freitag knüpfen sich allerhand abergläubische Vorstellungen. In Deutschland herrscht durchweg die Meinung, daß man an diesem Tage, wie in manchen Gegenden in der Stillen oder Marterwoche überhaupt — in Flandern führt sie die Bezeichnung „Teufelswoche“ —, keine gewöhnlichen Arbeiten vornehmen, also nicht waschen und im Freien trocknen, nicht zimmern, schneidern, schustern, weben, keinen Dünger aufs Feld fahren, keine Reise unternehmen dürfe und so fort, da sonst Unglück heraufbeschworen werde; so wird beispielsweise auch selten ein Dienstmädchen am Karfreitag seine Stelle[S. 266] wechseln. Ferner knüpfen sich an diesen Tag verschiedene Gebräuche, durch die man allem Unheil vorbeugen und vor allem sich vor Krankheit schützen zu können meint. So glaubt man in England, daß am Karfreitag zu Pulver zerriebenes Brot ein Allheilmittel gegen alle möglichen Gebrechen sei, in Ungarn, daß das Abschneiden der Haare an diesem Tage den Träger ein ganzes Jahr lang vor Kopfschmerzen bewahre, sowie daß am Karfreitag aus dem Strom geschöpftes Wasser sich gegen Augenleiden heilsam erweise. Auch übernatürliche Kräfte kann man sich am Karfreitag aneignen, die übrigens ein an diesem Tage Geborener von vornherein besitzt. In Schwaben ist der Glaube verbreitet, daß man in der Abendstunde des Stillen Freitags imstande sei, verborgene Schätze zu entdecken, die Schlüssel zur Hölle zu schmieden, um damit den Fürsten der Unterwelt zu bannen, und dergleichen.

In katholischen Ländern besteht vielfach das Verbot, am Karfreitag die Kirchenglocken zu läuten. Um nun die Leute auf den Beginn der Messe aufmerksam zu machen, behilft man sich damit, daß man zur festgesetzten Stunde Chorknaben mit hölzernen Klappern, den sogenannten Ratschen, die Straßen durchziehen läßt und dadurch das Glockenläuten ersetzt. — Aus den deutschen katholischen Ländern kennen wir noch eine andere eigenartige Sitte. Am Morgen des Sonnabends vor Ostern werden in den Kirchen alle Lichter ausgelöscht und mit Hilfe von Stahl und Feuerstein, Brennspiegel oder Kristallinsen ein „neues“ Feuer erzeugt, an dem man dann erst wieder die Altarkerzen anzündet. In feierlichem Zuge begibt man sich danach auf den Kirchhof, wo vorher ein mächtiger Holzstoß errichtet wurde, und zündet diesen mit einer der Osterkerzen an, verbrennt auch in seiner lodernden Flamme die Wolle, die der Priester bei der Taufe oder beim Spenden der Letzten Ölung zum Abwischen des Wassers oder des heiligen Öles gebraucht hat, Kirchenlichterreste und alte Meßgewänder; schließlich wirft man an manchen Orten noch eine Strohfigur hinein, die den Verräter Judas Ischariot vorstellen soll. Hier haben wir es wiederum mit einem Überbleibsel jener alten heidnischen Freudenfeuer zu tun, die in der Vorzeit zu Ehren der im Kampfe mit den froststarrenden Winterriesen siegreichen Licht- und Frühlingsgöttin emporloderten und vermöge ihrer reinigenden Kraft die Unheil bringenden Dämonen vertreiben sollten.

Als ein Ausfluß derselben altgermanischen Anschauung sind auch die Gebräuche und Festlichkeiten anzusehen, die am ersten Mai stattfinden.[S. 267] Um den jungen Lenz zu begrüßen und den Göttern dafür zu danken, daß sie den Winter vertrieben haben, brachten unsere Vorfahren ihnen Opfer dar und schmückten Altar und Wohnstätten mit dem jungen Grün der Birke. Diese schöne Sitte, die Birke als Schmuck für Häuser und Wohnräume, Ställe und Brunnen zu verwenden, hat sich in Deutschland bis in unsere Tage herein erhalten, ist aber zum großen Teil in das Pfingstfest aufgegangen. In früheren Zeiten war es in den Städten sowohl wie auf dem Lande allgemeiner Brauch, den Maien in feierlichem Zuge aus dem Walde zu holen, ihn auf einem freien Platze des Orts aufzupflanzen und das Ereignis mit Tanz, Schmausereien, Gelagen und anderen Volksbelustigungen (Abb. 315) festlich zu begehen. Leider ist diese schöne Sitte schon so ziemlich in Abnahme gekommen; doch begegnet man ihr in Schweden, Thüringen, Bayern und Österreich auch heute noch vielfach. In Skandinavien errichtet man den Maibaum erst am Mittsommertag (Abb. 316). Der heutige Maibaum besteht aber zumeist nicht mehr aus der schlanken, nur mit Bändern geschmückten Birke, wie sie aus dem Walde kommt, sondern vielmehr aus einem hohen Maste, der an seiner Spitze ein Büschel Birkenzweige trägt und im übrigen mit bunten Bändern, Fahnen, Kuchen, Würsten, Figuren, Spielsachen und anderen derartigen Dingen besteckt ist (Abb. 318 und 319). Die jungen Burschen müssen hinaufklettern und sich diese Dinge herunterholen. In einigen Gegenden Schwabens zeichnet man auch den Ortspfarrer, den Lehrer und andere Personen von Rang und Würden durch das Pflanzen eines echten Maibaums vor ihrer Tür aus. Auch tragen hier und da Kinder (die Maijungen) kleine Birkenbäumchen von Haus zu Haus und stellen dem, der ihnen eine reichliche Gabe spendet, einen solchen Busch vor die Tür. Vielfach pflanzen auch die jungen Burschen ihrem Schatz über[S. 268] Nacht einen Maibusch vors Kammerfenster; je größer ihre Liebe ist, um so größer muß das Birkenbäumchen sein. Anderseits stecken sie aber auch einem Mädchen, das seinem Liebsten untreu geworden ist oder sich sonst keines guten Rufes im Dorfe erfreut, einen dürren Stock, auch wohl einen alten Besen oder eine Strohpuppe vors Fenster oder befestigen einen solchen Gegenstand am Dachfirst, um die Betreffende für jedermann deutlich zu brandmarken. Früher, und gelegentlich noch heute, stellte man auch dem Vieh im Stalle einen Maibaum an die Krippe oder an die Pfosten, in der Absicht, es vor den bösen Geistern zu schützen und die Kühe zu reichlicherer Milchabgabe zu veranlassen. Auch werden vielfach die Dorfbrunnen bekränzt, damit sie reichlich Wasser geben.
In der ersten Hälfte der Nacht vor dem ersten Mai, der Walpurgisnacht, läßt der Volksaberglaube die bösen Mächte, im besonderen die Hexen, zu einem eigenen Feste mit dem Teufel zusammenkommen und ihr Unwesen treiben. Als Orte dieser Zusammenkünfte gelten gewisse Berge, vor allem der Brocken oder Blocksberg im Harz sowie der Kniebis im Schwarzwald; übrigens besitzt wohl jede Gegend ihren eigenen Hexenberg. Wie man annimmt, verlassen in dieser Nacht alle Hexen ihre Wohnungen und reiten durch den Schornstein auf Besen, Mistgabeln oder Böcken im schnellsten Fluge nach ihrem Versammlungsplatz, wo der Teufel in Gestalt eines Bockes auf dem Throne sitzt und sich von ihnen huldigen läßt; ein ausgelassenes Gelage mit allen nur denkbaren Orgien bildet den Abschluß dieses Hexensabbats. Um sich vor der Bosheit der Hexen zu schützen, kennt das Volk zahlreiche Abwehrmittel und Vorbeugungsmaßregeln. Zu den harmloseren Mitteln gehört das Anbringen von drei Kreuzen über der Haustür oder das Heraushängen eines Besens. In Deutschböhmen werden die alten Kehrbesen, die man das ganze Jahr über schon für diesen Zweck aufbewahrt hat, im Hause zusammengesucht, mit Fett, Wagenschmiere und Teer getränkt und gegen Mitternacht auf einer Anhöhe angezündet, wobei die Burschen und Mädchen sie wohl mit den Worten „Die Hexen fliegen“ hoch in die Luft schleudern. Im Fränkischen Jura begeben sich die jungen Burschen nach Sonnenuntergang auf den Dorfplatz und beginnen an einigen Orten ein gewaltiges Peitschenknallen, an anderen eine Schießerei.

Pfingsten, das liebliche Fest, wie es der Dichter nennt, ist aus dem jüdischen Erntefest[S. 269] (Wochenfest) hervorgegangen, das die Kinder Israel, dem Mosaischen Gesetz zufolge, fünfzig Tage nach dem Passah feierten. Bei den Christen bedeutet es den Tag der Ausgießung des Heiligen Geistes und damit zusammenhängend das Stiftungsfest der christlichen Kirche. Daher besteht in katholischen Ländern von alters her der Brauch, am ersten Feiertag vor oder während der Predigt einen reich mit Flittergold und Bändern verzierten Kranz aus jungem Laub, in dessen Mitte der Heilige Geist in Gestalt einer Taube angebracht ist, langsam an einem Strick vom Gewölbe des Gotteshauses auf die Köpfe der Gläubigen hinabgleiten zu lassen. Die dabei etwa abfallenden Goldflitter oder Bänder werden von den Anwesenden aufgefangen und als von Gott verliehenes Pfingstgeschenk das ganze Leben lang im Gesangbuch aufbewahrt.

Wie schon angeführt wurde, gehört in erster Linie zum Pfingstfeste auch der Pfingstmaien (Birke); es dürfte wohl kaum einen Ort geben, wo man nicht mit Maien, in der Mark Brandenburg außerdem noch mit Kalmus, Häuser, Stuben, Ställe, Vieh und selbst die Wagen und Eisenbahnen schmückt. Schon am Abend vorher pflegt die Jugend den Maien einzuholen, vielfach unter besonderer Festlichkeit. Die jungen Burschen reiten in den Wald hinaus und kehren reich mit frischem Grün geschmückt im Triumph ins Dorf zurück. Solche „Pfingstritte“ finden verschiedentlich auch noch an den Pfingstfeiertagen statt. Bunt ausgeputzt mit grünen Zweigen und farbigen Bändern, veranstalten die jungen Leute auf ihren in derselben Weise geschmückten Pferden Umzüge oder Wettritte; auch versuchen sie wohl, einen Ring beziehungsweise einen Kranz, der an einer Ehrenpforte oder an einem Galgen aufgehängt ist, im Vorbeigaloppieren mit einem Stock, einer hölzernen Gabel oder einem anderen lanzenartigen Werkzeug herunterzuholen oder herabzustechen; man nennt dies Kranzreiten oder Ringstechen. Wem dies am besten gelingt, der wird zum „Pfingstkönig“ ernannt und im Triumph zum Dorfplatz geführt, wo ihm meistens von einer Dorfschönen ein Geschenk zuteil wird, während der, dem es nicht glückte, im Vorbeigaloppieren etwas zu erlangen, der „Pfingstjunge“ heißt und für Spott nicht zu sorgen braucht. In der Mark Brandenburg besteht das „Königsreiten“ in einem großen Umzuge; voran reitet der Pritschmeister, der in der neugierig umherstehenden Menge Platz schafft, an seiner Seite der „Mückenscheucher“, der einen großen Birkenstrauch mit einer Klingel in der Hand trägt und bald diesem, bald jenem auf den Kopf klopft. Diesen beiden folgt der „König“, meistens der älteste Knecht der Herrschaft,[S. 270] auf einem mit Grün, Blumen und Bändern schön geschmückten Roß, den Schluß bilden die übrigen jungen Burschen. Der Zug bewegt sich durch das Dorf; von jedem Besitzer wird ein Geldgeschenk erhoben, das nach Beendigung des Umzugs im Gasthof in Essen und Trinken umgesetzt wird. Eine schwere Rolle hat beim Umzug der „König“ zu spielen; er darf die ganze Zeit über nicht lachen, nicht einmal die Miene verziehen, selbst wenn die übrigen allen möglichen Unfug mit ihm treiben, sonst muß er im Gasthof für alle die Zeche bezahlen.

Auch unter den Pfingstbräuchen ist eine ganze Reihe, die den Sieg des Frühlings über den Winter widerspiegelt. So wird in der Gegend von Halle an der Saale ein Strohmann auf einen Karren gelegt; die Pfingstburschen des Dorfes geben sich alle erdenkliche Mühe, diesen Karren mit verbundenen Augen an den Rand einer Grube, die einem Grab nicht unähnlich sieht, zu fahren und seinen Inhalt hineinzuwerfen, um ihn dann zu vergraben. In der Altmark setzt man die Strohpuppe auf eine Kuh und jagt diese so lange herum, bis die Puppe herabfällt. In Bayern wird der Knecht, der am Pfingstmontag die Zeit verschläft, ergriffen, in den Wald geschleppt, ganz in Grün eingehüllt und auf ein Pferd gesetzt; auf diesem muß er in Begleitung des ganzen Dorfes zum nächsten Teich reiten, wo er feierlichst ins Wasser geworfen wird. Diese und ähnliche Gebräuche, denen wir, manchmal nur noch in ihren letzten Ausläufern, in den verschiedensten Gauen unseres Vaterlandes begegnen, sollen das Austreiben des Winters versinnbildlichen.
In vielen Gegenden besteht noch die alte Sitte, das Vieh zu Pfingsten, meistens am Sonnabend vor dem Fest, zum erstenmal auf die Weide zu treiben, wo es in katholischen Gegenden vielfach vom Priester eingesegnet wird (Abb. 317). Tags zuvor gehen die Hütejungen unter Peitschenknallen (auch dieses ein Zeichen der Austreibung des Winters) im Dorfe herum und sagen es den Knechten und Mägden an. Diese beeilen sich darauf, ihr Vieh möglichst frühzeitig hinauszutreiben; jeder setzt seinen ganzen Stolz darein, der erste am Platze zu sein. Der Kuh, die zuerst auf der Weide eintrifft, wird für gewöhnlich ein Kranz um den Hals und um die Hörner sowie ein Birkenbusch an den Schweif gebunden (Abb. 323). Der Knecht, der sich zuletzt mit seinem Vieh auf der Weide einfindet, heißt der Pfingstlümmel oder Pfingstochse, auch wohl der Pfingstbötel oder Pfingstkärel; er wird zum Gegenstand des Spottes und bleibt es das ganze Jahr hindurch. In Thüringen[S. 271] hüllt man den zuletzt Eintreffenden ganz in Tannen- und Birkenzweige ein und peitscht ihn durch das Dorf, wo er überall mit dem Zuruf „Pfingstschläfer“ begrüßt wird. Eine Magd, die sich am Pfingstsonntag zuletzt im Stalle zum Melken einfindet, erhält den Namen Pfingstbraut. Noch schlimmer ergeht es einem Mädchen auf dem Lande in Steiermark, das am Pfingstmorgen den Sonnenaufgang verschläft; es kommen dann die Nachbarburschen mit einer lebensgroßen, aus Stroh und Lappen angefertigten Puppe, die einem zerfetzten Vagabunden gleicht, und hängen sie zum Gespött an einem Baumast vor dem Fenster der Langschläferin auf. Wer von den jungen Burschen aber die Zeit verschläft, dem setzen die Mädchen einen Strohkranz auf den Kopf und rufen ihn als „Pfingstlücken“ oder „Pfingstnudel“ aus.

In manchen Orten Thüringens werden am Pfingstfest die Brunnen geschmückt, der Brunnenschaft mit Birkengrün umwunden, die kleine Ausflußröhre noch besonders mit einem Vergißmeinnichtkränzchen umgeben und das obere Ende der senkrechten Brunnenröhre mit einer Krone aus Tulpen geziert. Das Einholen des Grüns aus dem Walde, das sogenannte Waldfahrten,[S. 272] an dem sich alt und jung beteiligt, gestaltet sich zu einem wirklichen Volksfest (Abb. 324).

Bevor wir die Pfingstbräuche verlassen, über die sich noch sehr vieles sagen ließe, wollen wir noch einer ganz allein in dem Städtchen Echternach im Luxemburgischen heimischen Pfingstsitte gedenken, der Springprozession. An ihr pflegen sich für gewöhnlich weit über zehntausend „Springer und Beter“, wie sie vom Volke genannt werden, zu beteiligen; noch weit größer ist die Zahl der sich als Zuschauer Einfindenden. Nach einer Predigt auf der Sauerbrücke ordnet sich der stattliche Zug zum Einmarsch in die Stadt. Voran schreitet die Geistlichkeit unter Führung der Kirchenfürsten, gefolgt von Mönchen und Nonnen. Hieran schließen sich zunächst die in Gruppen geordneten Springer; jeder Gruppe geht eine Musikbande voran. Die Weise, die sie ertönen läßt, geht nach der bekannten Melodie: „Adam hatte sieben Söhne.“ Hierbei führen die Springenden einen Tanz auf, bei dem jeder Teilnehmer erst fünf Schritte vorwärts und dann drei Schritte rückwärts springt; in derselben Reihe Tanzende reichen sich die Hände oder verbinden sich miteinander durch Taschentücher. Da bei dem großen Gedränge des öfteren eine Stockung eintritt, so müssen die Springbewegungen häufig auf der Stelle ausgeführt werden. Etwa alle zehn Minuten tritt eine Pause ein, während deren entweder Gebete gemurmelt oder Erfrischungen eingenommen werden. Natürlich kommt der Zug unter diesen Umständen nur ganz langsam vorwärts; nach etwa anderthalb Stunden sind die Ersten der Wallfahrer[S. 273] bei der zur Statue des heiligen Willibrord hinaufführenden neunundsechzigstufigen Treppe angelangt. Dann beginnt aber erst das große Schauspiel für die Zuschauer. Die Stufen müssen „hinaufgetanzt“ werden, das heißt jeder Teilnehmer muß, wenn irgend möglich, immer fünf Stufen hinauf- und dann drei wieder herunterspringen. Oben in der Kirche schweigt die Musik, die Gläubigen treten zu dem Altar des heiligen Willibrord, der über dessen angeblichem Grabe errichtet ist, heran und legen ihre Opfergaben, meistens Geld, in die an der Steinfigur aufgestellten Körbe, berühren mit ihren Rosenkränzen oder sonstigen Gegenständen, die man weihen zu lassen wünscht, die Hände des Standbildes und gehen langsam durch die Tür auf der anderen Seite der Kirche wieder hinaus. Damit ist der heiligen Pflicht Genüge geleistet; die Menge löst sich sofort auf, und die Teilnehmer lagern sich erschöpft auf dem Platze oder in sonst verfügbaren Räumen. Sodann aber begeben sie sich in die Wirtshäuser und belustigen sich auf alle nur mögliche Weise, denn stets ist ein großer Jahrmarkt mit der kirchlichen Feier verbunden.


Wir kommen jetzt zu dem Johannisfest, das gleichfalls heidnischen Ursprungs ist, aber von der christlichen Kirche, gleichsam als Entsühnung, dem Andenken des heiligen Johannes des Täufers geweiht wurde. Es fällt in den Mittsommer oder die Sommersonnenwende, den Zeitpunkt, an dem die Tage ihre größte Länge erreichen, die Sonne also am höchsten steht oder, wie die alten Germanen annahmen, der Sonnengott Wodan auf seiner Fahrt die höchste Stelle am Himmelszelt erreicht hat und nun im vollen Gefühl seines Sieges über die feindlichen, lichtscheuen Mächte eine Weile rastet,[S. 274] um dann mit der Freia seine Hochzeit zu begehen. In den Augen der alten Nordländer war der Mittsommertag kein geringeres Fest als das der Wintersonnenwende.

Dem Gotte zu Ehren zündete man allenthalben Feuer an, die man unter Absingung von Sonnwendliedern umtanzte oder, um sich symbolisch zu reinigen, übersprang. Noch heutigestags flammen an vielen Orten, namentlich in Süddeutschland und Tirol, am Abend vor Johanni auf den Höhen Freudenfeuer empor (Sonnwendfeuer, Sungibtfeuer, Fro- oder Fronfeuer); meistens sind es Scheiter- oder Reisighaufen, zu denen die Jugend schon tagelang vorher den Brennstoff zusammentrug oder früher unter Absingung bestimmter Lieder sich zusammenbettelte. Die Burschen und Mädchen des Dorfes versammeln sich festlich gekleidet um die lodernde Glut; Paar um Paar springt unter Gesang über den im Auslöschen begriffenen Holzstoß. Mit diesem Sprung ist oft genug eine abergläubische Bedeutung verbunden: wer ihn ausführt, bleibt das Jahr über von Krankheit verschont, kann auf eine gute Ernte hoffen und darf auf sonstige Glücksfälle rechnen. Auch Kräuter, die in das Feuer geworfen werden — beliebt ist besonders Beifuß — bannen Krankheit und Unheil. Sehr gebräuchlich war früher auch, daß jeder Teilnehmer ein angebranntes Scheit mit sich forttrug, das er auf dem Herd seines Hauses aufbewahrte oder noch in derselben Nacht zur Erhöhung der Fruchtbarkeit auf seinen Acker steckte. In Schlesien, in den Rheinlanden und in Kärnten rollt man mit Stroh und Werg umwundene Holzräder oder Scheiben von den Höhen herab ins Tal (Scheibenschlagen); stürzt das Rad noch flammend in ein unten etwa vorhandenes Gewässer, dann kann man auf eine gute Ernte rechnen. Während die Scheibe hinuntersaust, spricht der „Scheibentreiber“ in manchen Gegenden einen Vers, der gleichsam eine Widmung enthält, oder er nennt den Namen einer Person, der zu Ehren er sie hinabrollen läßt; die jungen Burschen widmen die Scheibe natürlich ihrer Liebsten. Aber auch zur Beschimpfung und Verspottung von Personen, die sich etwas zuschulden kommen ließen oder sich mißliebig machten, werden Scheiben „geschlagen“; dieser Brauch erinnert insofern an das Haberfeldtreiben.


[S. 276]
Neben dem Feuer spielt zu Johanni auch das Wasser eine große Rolle; ihm kommt eine reinigende, alles Elend und alle Sünde fortspülende Kraft zu. Dieser Glaube hängt wohl mit der heidnischen Vorstellung von der Gewalt der wasserspendenden Gottheit zusammen, die im Hochsommer ihre Macht in zahlreichen Unwettern zum Segen oder Unsegen der Menschen kundgibt. Daher brachte man ihr früher auch Menschenopfer dar. Die Taufe durch Johannes ist die christliche Auslegung dieser heidnischen Anschauung. In Schwaben gilt ein am Johannistage genommenes Bad für neunmal heilkräftiger als ein gewöhnliches. Am Mittelrhein werden daher an diesem Tage die Brunnen gereinigt; wo man dies unterläßt, da wählt sich der Fluß von selbst seine Opfer durch Überschwemmung. Aus demselben Grunde darf man am Bodensee am Johannistage überhaupt nicht im See baden, und die Schiffer behaupten, man dürfe an ihm auch keine Antreibenden herausziehen, denn das hieße dem Wassergott seine Opfer wieder entreißen. Mit der Vorstellung von der reinigenden Wirkung des Johanniswassers hängt auch der Aberglaube zusammen, daß der an diesem Morgen eingesammelte Tau ein vorzügliches Mittel gegen Sommersprossen abgebe.

Einer ganzen Reihe von Pflanzen wird am Johannistage eine besondere geheimnisvolle Kraft zugeschrieben. Als solche heilkräftigen Kräuter gelten das Johanniskraut oder Hartheu, die Hauswurz, der Bärlapp oder das Hexenkraut, der Wermut oder Beifuß, das Eisenkraut, der Rittersporn, das Gottesgnadenkraut, das Kardobenediktenkraut, das Liebstöckel, der Steinfarn und noch andere Pflanzen. So befreit die Wurzel der Hauswurz, an einem roten Faden um die Schulter getragen, von Hämorrhoiden, Beifuß hält die Müdigkeit fern, Eisenkraut läßt durch Eisen geschlagene Wunden schneller heilen und versöhnt durch Streit entzweite Leute, der Same des Steinfarnkrautes macht unsichtbar oder läßt, neben Geld gelegt, dieses nicht weniger werden, auch wenn man davon nimmt, und so weiter. Besonders wirksam ist die Kraft aller dieser Zaubermittel, wenn sie in der Johannisnacht gepflückt werden. An der Spitze aller Johanniskräuter steht aber unzweifelhaft das Hartheu; es erfreut sich eines allgemeinen Rufes als Heilmittel bei Wunden, Quetschungen, Bruchleiden, Verrenkungen und allen möglichen anderen Gebrechen. Im Hause oder im Stall befestigt, schützt das Hartheu oder Johanniskraut ferner vor Feuersgefahr, Blitz, Ungewitter, Hexen und sonstigem Unheil. Selbst zu Weissagungen wendet das verliebte Bauernmädchen in Holstein es an. Will es nämlich erfahren, ob es mit dem Gegenstand seiner Liebe vereint werden wird, so bricht es am Johannisabend zwei Zweige des Hartheus ab, einen etwas längeren, der[S. 278] den Schatz bedeutet, und einen kürzeren, der es selbst darstellen soll; beide Zweige werden darauf stillschweigend mit den Spitzen nach unten in die Spalte eines Dachbalkens gesteckt; hier wachsen sie in allerlei Verschlingungen weiter fort. Vereinigen sich dabei die beiden Spitzen, dann deutet dies auf Erfüllung des stillen Wunsches; entfernt sich aber der eine Zweig von dem anderen, dann ist die Liebe hoffnungslos.



Aus Raumgründen ist es leider nicht möglich, auf die zahlreichen anderen Gebräuche teils an kirchlichen, teils an weltlichen Festen näher einzugehen, wie sie zum Beispiel üblich sind am Sankt Georgstag, Himmelfahrtstag, den drei gestrengen Herren, Fronleichnamsfest, Mariä Himmelfahrt, Peter und Paul, Lambertustag, Erntefest, Michaelistag, Allerheiligen und Allerseelen (Abb. 320), Hubertustag, Martinstag, Andreastag, Kirchweih (Abb. 321, 322 und 326), Weinlese (Abb. 327) und so fort (Abb. 325, 328 bis 336 und 345). Die meisten dieser Gebräuche entpuppen sich, wenn man ihnen auf den Grund geht, als Überreste aus heidnischer Zeit. Um ein Beispiel hierfür anzuführen, so verdanken Allerheiligen und Allerseelen, beides wichtige Feste der katholischen Kirche, ihre Entstehung altheidnischen Opferfesten, durch die man sich gegen die Macht der bösen Geister, die man vielfach als die Seelen Abgeschiedener auffaßte und an die Oberwelt zum Besuche ihrer Angehörigen zurückkehrend sich dachte, zu schützen beziehungsweise sie zu versöhnen trachtete. Die alten Römer (Lemurenfest), wie auch die alten Kelten, Skandinavier, Isländer (Kauri) und andere Völker des Altertums schlachteten zum Schutze gegen solche Geister Tiere und luden die Geister zum Mahle ein. Anklänge an solche Opfer finden wir an vielen Orten noch am Allerheiligentage. In Schweden und Finnland setzt man den Elfen, die man noch heute für die Geister Verstorbener[S. 279] ansieht, die der ewigen Seligkeit nicht teilhaftig werden können, an diesem Abend Speisen und Getränke vor. Die christliche Religion hat die Opfer an die Geister durch Gebete für die Seelen der Abgeschiedenen und durch andere fromme Gebräuche zu ihren Gunsten ersetzt. So zum Beispiel läuten Knaben im Elsaß am Vorabend des 1. November eine Stunde lang die Kirchenglocken, weil um diese Zeit die Seelen der Verdammten aus dem Fegfeuer gehen dürfen, und halten darauf einen Rundgang in den Häusern, um eigens für diesen Zweck gebackene Brötchen oder eine Belohnung in Geld zu erbetteln. In Flandern errichten die Knaben am Abend vor Allerseelen auf der Straße kleine, mit brennenden Kerzen beleuchtete Altäre und gehen die Vorübergehenden um milde Kuchenspenden an, für die Seelen im Fegfeuer, wie sie sagen. Allerdings übernehmen sie für diese gleichzeitig die Arbeit des Essens. Von den dabei erbettelten Geldstücken werden am nächsten Morgen die „Zielenbröderche“ (Seelenbrötchen) gekauft, ein feines, mit Mandeln in Kreuzform verziertes und zur Versinnbildlichung des Fegfeuers stark mit Safran und rotem Farbstoff gefärbtes Gebäck, mit dem man ebensoviel Seelen aus dem Feuer erlösen kann, als man Seelenbrötchen ißt. Ein ähnlicher Brauch besteht in einigen Gegenden Englands. Hier gehen die Kinder unter dem Rufe „Seele, Seele, um ein oder zwei Äpfel!“ herum und betteln um Kuchen, Bier und Äpfel. An vielen Orten Deutschlands kennt man für den Allerseelentag bestimmte Gebäcke, die als Seelenwecken, Seelenzöpfe, Seelenbrezeln und so weiter bezeichnet werden. — Sehr verbreitet ist auf den Britischen Inseln die Sitte, am gleichen Tage das Schicksal einer ehelichen Verbindung oder einen etwa bevorstehenden Todesfall im[S. 280] voraus zu erforschen, die man übrigens auch im schottischen Hochlande kennt. Hier zündet man am Allerseelenabend ein Feuer an, häuft seine Asche in Form eines Kreises auf und legt am Rande der Asche für jedes Familienmitglied einen Stein hin. Findet man am anderen Morgen diesen nicht mehr an der alten Stelle oder den Kreis sonstwie beschädigt, dann weiß man, daß die betreffende Person im nächsten Jahre sterben wird.
In den katholischen Ländern ist es allgemein Sitte, daß sich am Allerseelentage die Angehörigen von Verstorbenen zu dem Gottesacker begeben, um deren Grabstätten auszuschmücken — ein Rest des altheidnischen Opfers — und zu beten, und am Allerheiligentage werden die Heiligen um ihre Hilfe zur Erlösung der armen Seelen angerufen. Die evangelische Kirche feiert etwa um die gleiche Zeit, wenn auch nicht an einem bestimmten Kalendertage, ein ähnliches Erinnerungsfest, das Totenfest.


In derselben Weise wie an die Feste knüpft sich an die Verrichtungen und Ereignisse des täglichen Lebens allerlei zum Teil ganz grober Aberglaube, und zwar nicht nur bei denen, die zu den ungebildeten Gesellschaftschichten zählen, sondern sehr häufig auch bei solchen, die für gebildet und aufgeklärt gelten wollen. Eine Wiedergabe der zahlreichen Gebräuche, Gewohnheiten und Anschauungen,[S. 281] denen wir beinahe auf Schritt und Tritt begegnen, am meisten natürlich beim Landvolk, würde allein einen ganzen Band füllen; wir müssen uns deshalb darauf beschränken, auf einige wenige Beispiele hinzuweisen, wie das Anzaubern und Anhexen von Krankheiten, das Besprechen derselben zu ihrer Heilung, das Hersagen von sogenannten Segen (Diebessegen, Kugelsegen, Bienensegen und so fort) zur Abwendung von Gefahren oder zur Ermittlung des Verbleibs gestohlener Sachen, die Furcht vor dem bösen Blick sowie vor der Zahl dreizehn, die Verkündigung bevorstehenden Glücks oder Unglücks durch den Ruf gewisser Tiere und dergleichen. Länger wollen wir dagegen bei den drei wichtigsten Ereignissen des Lebens verweilen, der Geburt, der Heirat und dem Tode.

Der deutsche Volksglaube verlegt den Ursprung der neugeborenen Kinder teils in Gewässer, Flüsse oder Brunnen, teils in Felsspalten, Höhlen und hohle Bäume. Von hier holt sie der Storch (Norddeutschland) oder die Hebamme (Süddeutschland) und führt sie den Eltern zu. In England läßt man die kleinen Kinder aus weniger geheimnisvollen Orten herkommen, wie aus dem Kohlkopf, dem Petersilienblatt, dem Stachelbeerstrauch oder auch aus der Tasche des Doktors. Der Storch, an der Wasserkante Adebar genannt, wirft die Kleinen oben in den Schornstein hinein und beißt die Mutter ins Bein, weswegen sie einige Tage das Bett hüten muß; die Geschwister beglückt er mit Zuckertüten.
Bereits mit der Schwangerschaft setzen allerlei abergläubische Gebräuche ein. Das Versehen der Schwangeren spielt eine große Rolle beim Volke, weswegen man sich bemüht, alle schrecklichen und häßlichen Eindrücke von der angehenden Mutter fernzuhalten; sie darf[S. 282] unter anderem auch keinen verkrüppelten Menschen erblicken, weil sonst das Kind ebenso mißgestaltet werden könnte, kein brennendes Haus sehen, weil das Kind sonst ein Feuermal bekäme und mehr dergleichen. Vielmehr sucht man der Schwangeren immer nur möglichst schöne Gestalten und Bilder vor Augen zu führen. Mancherlei Tabus werden der Frau während ihres gesegneten Zustandes auferlegt. So darf sie sich nicht das Haar kürzen, weil sonst das Kind kahlköpfig werden würde, ihren Zustand nicht verleugnen, weil es sonst schwer sprechen lernen würde, nicht erschreckt oder gereizt werden, weil das Kind sonst leicht zornig werden könnte, auch nicht waschen oder spinnen, nicht unter etwas hindurchkriechen und so weiter. Auf der anderen Seite wieder wird es gern gesehen, wenn eine Frau, die guter Hoffnung ist, von einem Baume, der zum erstenmal Früchte trägt, etwas genießt, damit derselbe fortan reichlicher trage. In England darf keine Frau, die selbst nährt, zu einer Schwangeren gehen, denn dadurch könnte diese Gefahr laufen, ihr Kind später nicht selbst stillen zu können. Hat die Stillende diese Vorsicht doch außer acht gelassen, dann gibt es ein Mittel dies wieder gutzumachen: die künftige Mutter muß sich das Kind der Schuldigen heimlich zu verschaffen suchen und es mit Hilfe einer Freundin über ihre Schürze gleiten lassen.

Die Geburt sucht man auf mancherlei Weise zu erleichtern, so durch Darreichung von allerhand Tränklein, bei denen dem Honig eine wichtige Rolle zukommt, durch Umhängen von Amuletten, Unterlegen eines Gebetbuches oder eines Himmelsbriefes unter das Kopfkissen der Kreißenden und ähnliche Maßnahmen. In Norwegen muß man, wenn eine Entbindung bevorsteht, alle Knoten im Hause, besonders an den Kleidern, lösen. — Anklängen an die Couvade begegnen wir noch auf den Britischen Inseln. Vielfach glaubt man hier auf dem Lande, daß von den Geburtschmerzen der Mutter etwas auf den Vater übergehen könne, bei diesem aber eine andere Form annehme, zum Beispiel die heftiger Zahnschmerzen oder des[S. 283] Reißens. Eine Irin zieht bei der Niederkunft den Rock oder die Beinkleider ihres Mannes an, damit er die Schmerzen mit ihr teile und sie dadurch Linderung erfahre.

Das Neugeborene wird im Wasserbad gereinigt, zu dem man öfters Zusätze macht, zum Beispiel Milch, damit das Kind eine schöne weiße Haut bekomme, oder Weihwasser beziehungsweise einen Rosenkranz, damit es fromm werde, bei einem Mädchen wohl auch eine Spindel, damit es fleißig werde, bei einem Knaben Geld, damit er viel verdiene. Dem Badewasser wird nicht nur eine reinigende Kraft und Schutz gegen Zauberei für das Kind, sondern auch ein fördernder Einfluß auf alles Lebendige, das mit ihm in Berührung kommt, zugeschrieben; so sollen die Obstbäume, die man mit dem Badewasser begießt, reichlicher Früchte tragen. Im nordöstlichen Schottland wickelt man einen neugeborenen Knaben in ein Frauen-, dagegen ein Mädchen in ein Männerhemd, damit das Kind in seinem späteren Leben nicht ledig bleibe. In Friesland besteht ein eigenartiger Brauch bei der Geburt eines Sohnes. Die Freundinnen der Mutter beeilen sich, in möglichst großer Zahl sich in dem Zimmer der Wöchnerin einzufinden und hier Branntwein aus einem besonderen Becher zu trinken. Auch erheischt es die gute Sitte, daß jede von ihnen eine Torte mitbringe, die dann alle, manchmal zwanzig und mehr, im Zimmer aufgestellt werden. An der Zahl der Torten, die die junge Frau erhält, läßt sich die Größe ihres Ansehens und ihrer Beliebtheit ermessen, denn jede Torte bedeutet ja eine Freundin.
Mit einer sogenannten Glückshaube geboren zu werden, bedeutet Glück während des ganzen Lebens. Desgleichen steht solches einem Kinde bevor, dessen Kopf einen doppelten Haarwirbel aufweist. Aber gleichzeitig ist ihm auch eine unangenehme Beigabe mit auf die Welt gegeben, nämlich recht zornig und widerspenstig zu werden. Die Jahreszeit,[S. 284] der Tag und die Stunde besitzen vielfach ihre besondere Bedeutung. Kinder, die an einem Sonntag geboren sind, besonders wenn dieser auf den Anfang des Neumondes fiel (Österreich), sind Glückskinder, denen das Unglück nie etwas anhaben kann. Auch besitzen sie die Gabe des zweiten Gesichts und die Fähigkeit, Unglück und Hexen zu bannen, sowie verborgene Schätze aufzudecken. Ebenso sind Kinder, die zu Weihnachten oder in den Zwölften zur Welt kommen, vom Glück begünstigt. Als Unglückstage werden der Freitag und die ersten Tage des Monats angesehen. Von den Tagesstunden gilt die Stunde nach Mitternacht für glückbringend. Im westlichen Irland dagegen sieht man Mitternacht als eine gefährliche Zeit an. Um ein zu dieser Stunde geborenes Kind vor dem ihm bevorstehenden Unglück zu schützen, muß man es sofort mit Weihwasser besprengen und sieben Tage lang mit besonderer Sorgfalt behüten. — Am Abend des Tages der Geburt wird im Norden Großbritanniens, gelegentlich auch im Westen, eine Festlichkeit veranstaltet, bei der dem Käse eine wichtige Rolle zufällt. Der Vater schneidet ein „tüchtiges Glückstück“ von dem „stöhnenden Käse“ ab, zerlegt es in soviel Stücke als junge Mädchen anwesend sind — wobei er sich beileibe nicht in den Finger schneiden darf, weil das Kind sonst schon in jungen Jahren sterben würde — und verteilt an jedes ein Stück. Die Mädchen aber legen sich ihr Stück für die Nacht unter das Kopfkissen, um von ihrem zukünftigen Gatten zu träumen. In Yorkshire ißt man Pfefferkuchen zu dem Käse, in Cornwallis eine besondere Art Gebäck, den „Seufzerkuchen“.

Die Wöchnerin gilt sechs Wochen lang als unrein und während dieser Zeit auch dem Einflusse böser Geister ausgesetzt. Daher pflegt man in der Gemeinde Buchberg bei Kufstein zu deren Vertreibung dreimal mit einer Glocke um das Haus zu läuten. Mit ihren „Wochen“ ist für die junge Mutter allerlei Tabu verknüpft. Eine Wöchnerin darf nicht in den Garten gehen, sonst wüchse nichts mehr darin, kein Wasser aus dem Brunnen schöpfen, sonst würde er versiegen, kein anderes Haus betreten, sonst würde Unfriede dort entstehen, keinem Leichenzuge nachsehen, sonst stürbe bald ihr Mann, ebensowenig einem Hochzeitszug, sonst würde bald Streit zwischen den jungen Eheleuten ausbrechen, und was dergleichen mehr ist. Ihr erster Ausgang muß der Kirche gelten zur Einsegnung; lenkt sie ihre Schritte nach der Niederkunft anderswohin, dann bringt sie Unglück ins Haus oder Unfruchtbarkeit dem Acker. Auf ihren ersten Kirchgang pflegt sie ein Goldstück im linken oder drei Stückchen Brot im rechten Schuh mitzunehmen,[S. 285] beides gegen dämonischen Einfluß, der ihr auf dem Wege dorthin begegnen könnte. Vielfach bestehen auch bestimmte Speiseverbote, sowohl für die Wöchnerin wie für die ganze Familie. An manchen Orten ist eine ganz bestimmte Speisenfolge für die einzelnen Tage vorgeschrieben.

Bis zur Taufe bestehen auch für das Kind bestimmte Vorschriften. Es darf nicht allein gelassen werden, sein Bettchen darf nicht aufgedeckt bleiben, auch wenn es nicht darin liegt; man würde damit das Grab für das Kind zurechtmachen oder bösen Geistern den Zutritt ermöglichen. Aus demselben Grunde muß beständig nachts über Licht brennen und stets die Tür geschlossen gehalten bleiben. Die leere Wiege darf nicht geschaukelt werden, weil man sonst dem Kinde die Ruhe nehmen würde. Es darf vor der Taufe auch nicht gemessen werden, weil sich sonst bald der Tischler einstellen könnte, um für den Sarg Maß zu nehmen. — In katholischen Ländern, besonders in Österreich, wird der böse Blick sehr gefürchtet. Um das Kind gegen ihn zu schützen, werden viele Kunstgriffe angewandt. Sieht zum Beispiel jemand das Kind scharf an, dann macht man das Zeichen des Kreuzes über dasselbe oder tut so, als speie man es an, oder man zupft es an der Nase. An manchen Orten setzt man dem Badewasser für das Kind eine besondere Kräutermischung zu, an anderen bindet man ihm einen Wolfszahn um den Hals. Ein weit verbreitetes Abwehrmittel besteht darin, daß man dem Kinde ein rotes Bändchen um den Arm bindet oder ihm eins seiner Kleidungstücke verkehrt anzieht. — Auf den Britischen Inseln zeigt das Volk große Furcht vor dem Zauber der Feen, die erst durch die Taufe beseitigt werden kann. Damit nun kein ungetauftes Kind eine Beute der Feen werde, nimmt man seine Hilfe zu allen möglichen Vorbeugungsmaßregeln. Im Norden werden Mutter und Kind eingesegnet; dabei wird eine Fichtenholzkerze dreimal um das Bett getragen oder, wenn dies nicht möglich ist, um ihre Köpfe geschwenkt. Außerdem werden Bibel, Zwieback oder Brot und Käse mit der Bitte: „Möge der Allmächtige alles Übel von dieser Frau fernhalten, stets um sie sein und sie und ihr Kind behüten“ unter das Kopfkissen gelegt. In Irland glaubt[S. 286] man, daß der Vater mit besonderer Macht ausgestattet sei, seinen Sprößling gegen den Einfluß der Feen zu schützen. In Galway speit er sein Kind an; an anderen Orten muß er zu Hause bleiben, denn solange sein Atem in der Stube ist, können die Feen das Kind nicht stehlen noch ihm sonst etwas anhaben. In Schottland gilt die Kleidung des Vaters als Schutz gegen die Feen; daher werfen schottische Mütter ihres Mannes Rock oder Weste über die Kinder, um sie vor Unheil zu schützen. Wenn im schottischen Hochland ein Kind zum erstenmal ausgezogen wird, dreht seine Pflegerin es dreimal Hals über Kopf um, schüttelt es ebenso oft mit dem Kopf nach unten und segnet es. Durch dieses derbe Mittel glaubt sie die Feen von ihm fernzuhalten.
Die Taufe, der das Volk immer noch einen Schutz gegen allerlei Einflüsse zuschreibt, ist für jedes christliche Kind durchaus notwendig, in einzelnen Gegenden wird sie daher möglichst bald vorgenommen, denn stürbe das Kind vorher, so käme es nicht in den Himmel, sondern müßte als Irrlicht ein unstetes Dasein führen. Um die bösen Geister, die das Kind selbst noch bei der Taufe belästigen könnten, abzuhalten, steckt man dem Täufling vielfach einen heiligen Gegenstand, etwa ein Gebet- oder Gesangbuch, ein Blatt aus der Bibel, ein Heiligenbild, ein Kruzifix in das Kissen. In der Willkommenkirche, in der Nähe von Morwenstow (England), öffnet man während der Tauffeierlichkeit die sogenannte Teufelstür, damit der Teufel sich durch sie entfernen könne. Derselbe Gedankengang ist mit einer Tür in der Wroxallabtei verknüpft, obgleich diese schon vor langer Zeit zugemauert worden ist. In Westfalen und Ostpreußen müssen die Teilnehmer an einer Taufe, um die bösen Geister zu bannen, über eine Axt oder einen Besen, die man auf die Türschwelle gelegt hat, mit dem Kinde hinwegschreiten.

Die christliche Sitte erfordert eine Anzahl Paten für das zu taufende Kind, die zu ihm, wenn sie ihre Pflicht heute meistens auch nicht mehr so genau nehmen, in ein gewisses Verwandtschaftsverhältnis, gleichsam an Vater- und Mutterstelle treten. Ihr Verhalten am Tauftage ist nach dem Volksglauben von bestimmendem Einfluß auf das künftige Leben des Kindes. Im Harz verrichten sie daher, nachdem sie sich versammelt haben, erst noch einige Arbeiten; sie schreiben, lesen, graben, säen, nähen, stricken und so weiter, damit das Kind später in diesen Dingen geschickt und fleißig werde. Im Erzgebirge dürfen die Paten keinen Schlüssel bei sich tragen, weil sonst das Kind ein verschlossenes Herz bekäme. Die Paten pflegt man noch vielfach durch Gevatterbriefe einzuladen.
Auf dem Wege zur Kirche müssen die Teilnehmer am Taufzuge recht schnell gehen, damit das Kind auch schnell gehen lerne. Begegnet der Zug einem Manne, dann ist das von guter[S. 287] Vorbedeutung, wogegen die Begegnung mit einer Frau Unglück befürchten läßt. Während des Ganges nach und von der Kirche gibt man an manchen Orten mit Flinten, Pistolen oder Böllern Freudenschüsse ab.


Während der Taufhandlung wird das Kind durch die Hebamme der Reihe nach den verschiedenen Paten zum Halten übergeben. Schreit es während der heiligen Handlung, dann wird es ein guter Sänger werden. Das Taufwasser darf als solches nur einmal benutzt werden; sollte man etwa mehrere Kinder mit demselben Wasser taufen, dann würde bald eins von ihnen sterben. Vielfach besteht auch der Aberglaube, daß dem Taufwasser ganz besondere Eigenschaften anhaften. Man nimmt es zum Auswaschen des ersten Hemdchens oder kocht mit ihm ein Süppchen für das Kind, um es dadurch vor Krankheit zu behüten. Der Geistliche und der Küster pflegen von den Paten ein Geschenk zu erhalten, das von diesen auf den Altar oder den Taufstein niedergelegt wird. Im Taunus erhält der erstere ein Gebäck, das Bubenschenkel heißt. Auch der Täufling wird mit einem Geschenk bedacht, das ihm die Taufpaten in ein Papier einwickeln und unter den Kopf legen, meistens zusammen mit einem Patenbrief. — In England bestehen die Geschenke, die man dem Kinde macht, sowohl bei der Taufe als auch vielfach schon bei der Geburt, in einem Ei, in Salz, Silberstücken und einem Streichholz. Auf dem Heimwege werden die Taufpaten an manchen Orten von den Kindern durch Vorhalten eines bunten Bandes oder einer Stange am Weitergehen gehindert, bis sie sich durch ein kleines Geldgeschenk losgekauft haben. Zu Hause finden sie wohl auch die Tür verschlossen und können erst hinein, wenn sie ebenfalls ein Lösegeld gegeben haben.
[S. 288]
In Friesland (Holland) bilden beim Taufgange alle Mädchen aus der Verwandtschaft und Bekanntschaft, sofern sie über zwölf Jahre alt sind, einen Zug und begleiten das Kind auf dem Wege nach der Kirche; sie dürfen es der Reihe nach ein Stück Weges tragen. Keines von ihnen verzichtet auf dieses überkommene Vorrecht, zumal dabei der Aberglaube besteht, daß jedes Mädchen, das bei einer Tauffeierlichkeit einmal auf diese Weise mitgewirkt hat, in ihrer späteren Ehe reichlich mit Nachkommenschaft gesegnet sein werde.
Wird in England ein Knabe mit einem Mädchen zusammen getauft, dann trägt man das letztere zuerst zum Taufbecken, denn der Knabe könnte „seinen Bart im Wasser lassen“, und das könnte für das Mädchen unangenehme Folgen haben. Im Norden erhält der erste Mann oder die erste Frau, der man auf dem Wege zur Kirche begegnet, Kuchen, der oft noch von der Geburtsfeier herrührt, oder Brot und Käse, für gewöhnlich mit einem Schuß Whisky, und zwar ist, wenn der Täufling ein Knabe ist, die zuerst begegnende Frau der Empfänger, umgekehrt, wenn ein Mädchen getauft wird, der erste Mann. Die gute Sitte erfordert, daß die so ausgezeichnete Person sofort kehrt mache und den Taufzug ein Stück Weges begleite. In Cornwallis bezeichnet man dies mit dem Ausdruck „das Kind segnen“.
Wie dem ungetauften Kinde, so droht auch der Mutter, wie man in England glaubt, solange Unglück, als sie noch nicht in die Kirche gegangen ist. In Cornwallis pflegen die Frauen, die ihren ersten Kirchgang tun, einen „Seufzerkuchen“ mitzunehmen, den sie der ersten besten Person, die sie treffen, schenken.
Auch an die Wiege knüpft sich mancherlei Aberglaube. In Shropshire (England) darf eine solche für das Kind erst benutzt werden, wenn es getauft ist. Man darf eine leere Wiege auch nicht schaukeln, denn dies würde unverzüglich einen neuen Insassen zur Folge haben oder auch dem Kinde Unglück bringen. Auch darf man, so meint man in den schottischen Hochlanden, eine Wiege niemals leer versenden, sondern muß irgendeinen Gegenstand hineinlegen, gewöhnlich einen Hahn, eine Henne, Kartoffeln oder einen Mehlsack; es liegen hier offenbar Überreste eines alten Opferbrauches vor. Auch erfordert der Volksglaube, daß man, bevor das Kind die Wiege in Gebrauch nimmt, eine Henne oder einen Hahn hineinlege und daß man für den Erstgeborenen keine neue Wiege kaufe, sondern sich eine leihe.

Um die Kinder gegen Krankheiten zu schützen, gibt es in England allerlei abergläubische Gebräuche. Kinderzähne, die ausgefallen sind, bedeckt man mit Salz oder verbrennt sie, um zu verhindern, daß der folgende Zahn ein[S. 289] Hunde- oder Schweinezahn werde. Auf den Hebriden darf man kein Feuer aus einem Hause holen, in dem sich ein Kind ohne Zähne befindet, weil es sonst vielleicht überhaupt keine bekommen würde. Auch darf hier ein Kind nicht rückwärtslaufen, weil man fürchtet, es könnte dadurch das Leben der Mutter verkürzen. In Shropshire darf man das Kind nicht mit einem gestutzten Besen züchtigen, weil dadurch das Wachstum gehindert werden soll, sondern man muß dies mit einer schlanken Birkenrute tun. Noch heutigestags zieht man auf dem Lande ein Kind, das einen Bruch hat, durch eine gespaltene Esche hindurch.

In England soll man einem Säugling nicht die Handflächen waschen, weil man ihm sonst sein Glück damit fortwischen würde, und in Nord- und Westengland bleibt überhaupt die ganze rechte Hand ungewaschen, damit sie Reichtümer einsammle. Auch das Haarabschneiden ist eine bedeutungsvolle Sache. In manchen Gegenden Irlands nimmt der Vater dies zuerst vor. Die Nägel pflegt man im ersten Jahre nicht zu beschneiden, sondern die Mutter oder die Pflegerin beißt sie dem Kindchen ab. Wollte man sie mit einem scharfen Gegenstande kürzen, dann würde das Kind „lange Finger machen“, das heißt stehlen. Auch dürfen Kinder niemals gewogen oder gemessen werden.
Die herangewachsene Jugend beschäftigt sich schon frühzeitig mit der Frage nach der Person des zukünftigen Ehegenossen und dem Zeitpunkt der Vermählung. Um zu erfahren, ob ein Freier zu erwarten stehe und wann dies der Fall sein dürfte, sind allerlei abergläubische Gebräuche und Liebesorakel im Schwange.



An bestimmten Tagen, so behauptet der Volksglaube, gelingt es den jungen Burschen und Mädchen, den Schleier zu lüften; am meisten Aussicht hierfür bietet der Andreasabend. Beim Zubettgehen stößt man mit dem Fuß an das untere Ende der Bettstatt, sagt einen bestimmten
[S. 290]
Vers her und sieht dann den Geliebten im Traum, oder man wirft, den Rücken der Tür zugekehrt, nachts zwölf Uhr einen Pantoffel rückwärts über den Kopf: fällt derselbe mit der Spitze nach der Stube, dann ist dies ein Zeichen, daß sich bald ein Freier einfinden wird; fällt er aber umgekehrt, dann bleibt er aus. Das Mädchen kann auch um Mitternacht zu einem Brunnen gehen und hineinblicken, um das Bild des Zukünftigen zu schauen, oder um die gleiche Stunde nackend das Zimmer kehren, worauf der Gewünschte seinen Schatten an der Wand zeigt. An anderen Orten schreiben die jungen Burschen oder Mädchen die Buchstaben des Alphabets an die Stubentür und gehen verbundenen Auges mit vorgestreckter Hand auf sie zu; der Buchstabe, den sie dabei mit dem Finger berühren, zeigt ihnen den Anfangsbuchstaben des Namens ihrer späteren Ehehälfte an. Auch decken sie wohl Schlag zwölf Uhr nachts in der Mitte der Stube einen Tisch, stellen Lichter und zwischen diesen ein Glas Wasser, ein Glas Wein, ein Stück Brot und ein Messer auf, worauf sie aus einem Versteck der Dinge harren, die da kommen sollen. Der oder die Zukünftige erscheint dann und beginnt von den vorgesetzten Speisen zu genießen. Trinkt die Erscheinung von dem Wasser, dann wird man mit seinem Ehegespons ein armseliges Leben fristen, genießt sie dagegen von dem Weine, dann wird das gemeinsame Leben in Wohlstand verlaufen. Schneidet der gespenstige Besuch aber von dem Brote ab, dann muß der die Zukunft Erforschende am anderen Morgen das Messer vor Sonnenaufgang[S. 291] an einer verborgenen Stelle tief vergraben, weil er sonst Gefahr liefe, späterhin von seinem Gatten oder seiner Gattin erstochen zu werden. — Ähnliche Gebräuche bestehen am St. Thomastag (21. Dezember) und am Silvesterabend, auch in der Christnacht, zu Ostern und zu Johanni. Am Silvesterabend gießt man geschmolzenes Blei ins Wasser und deutet aus den seltsamen Gebilden, die dabei entstehen, den Beruf des Zukünftigen, oder man läßt in einer mit Wasser gefüllten Schüssel kleine Lichtchen oder Zettel mit Namen in einer Nußschale oder auf Korken schwimmen und beobachtet, welche Schiffchen aufeinander zuschwimmen oder zusammenstoßen (Abb. 301); diejenigen, denen sie gehören, geben dann ein Paar ab. In der Christnacht muß das Mädchen mit dem Schlüsselbund zum Fenster hinausklappern und aufpassen, aus welcher Gegend der Schall widerklingt; aus dieser steht der Freier zu erwarten. Oder es nimmt aus fließendem Wasser eine Anzahl Kieselsteine; ist ihre Anzahl paarig, dann heiratet es im nächsten Jahre. Auch kann sich das Mädchen völlig entkleidet auf den Feuerherd stellen und in den Schornstein oder in das Ofenloch gucken, dann erblickt es den ihm bestimmten Bräutigam. Auch kann es[S. 292] schließlich in der Weihnachtsnacht im Evakostüm in einen Spiegel sehen, bis der Zukünftige darin erscheint. — Auf den Britischen Inseln besteht ein ähnlicher Aberglaube. Auf der Insel Man deuten die Mädchen aus dem Verhalten der ausgeglühten Asche auf dem Herde am anderen Morgen ihre Zukunft, oder sie begeben sich am Abend vor Allerheiligen, den Mund mit Wasser und die Hände mit Salz gefüllt, zum übernächsten Hause und horchen auf den ersten Namen, der dort ausgesprochen wird; dieser ist dann der Name des Zukünftigen. Die Mädchen von Guernsey suchen neun Morgen lang stillschweigend, ohne vorher etwas gegessen zu haben, die Sankt Georgsquelle auf und legen silberne Sachen in eine dazu bestimmte Nische, dann steht in neunmal neun Wochen ihre Hochzeit bevor. Eine Irin pflegt dreimal um einen Spiegel herumzugehen und im Namen des Teufels einen Apfel mit neuen Stecknadeln zu bestecken; darauf erscheint ihr im Spiegel der Mann, der sie heiraten wird. Und auf den Hebriden legen sich die heiratslustigen Mädchen ein Stück Kohl unter ihr Kopfkissen, um von ihrem Zukünftigen zu träumen.
Zahlreich sind die Mittel, deren sich Verliebte bedienen, um Gegenliebe zu finden. Um ein paar Beispiele anzuführen, so muß der Betreffende Haare oder Kleidungstücke von der Person, die er an sich fesseln will, in einem neuen Gefäße kochen, worauf der sehnsüchtig Erwartete sich dort, wo seine Liebe „gesotten“ wird, einfinden wird. Auch kann man dem zur Ehe Begehrten Fledermausblut oder eigenes Blut, bei einem Mädchen Menstrualblut, oder andere Ausscheidungen des Körpers in das Bier schütten, wobei das Hersagen von Zauberformeln und Beschwörungen die Sache fördern soll, ferner die Kleider oder die Hand der geliebten Person mit der „Hand“ eines Frosches, den man in einen Ameisenhaufen vergraben hatte, berühren oder seine eigenen Kleider an diejenigen des anderen heften, und zwar mit einer Nadel, mit der man ein in Kopulation befindliches Froschpaar durchstochen hatte, und was dergleichen abergläubische Gebräuche mehr sind. Auf der anderen Seite aber kennt der Volksaberglaube auch Mittel und Wege, um eine lästig gewordene Person wieder von sich zu stoßen.


[S. 294]


Die Werbung (Abbildung 337) wird von den jungen Burschen entweder persönlich vorgebracht oder sie geschieht durch Vermittlung von Verwandten oder guten Freunden, die für ihre Bemühungen, falls sie zum Ziele führen, bei der Hochzeit belohnt werden, entweder mit Geld oder durch andere Geschenke, wie eine Weste, ein Paar Stiefel, früher auch ein Paar Beinkleider und selbst einen Pelz (daher der Name Kuppelpelz). Diese Vermittler gehen entweder ohne Umschweife auf ihr Ziel los oder sie schlagen allerlei Umwege ein, um ihr Anliegen vorzubringen, ganz wie wir dies früher mehrfach bei den Naturvölkern kennen gelernt haben. Zuweilen geben[S. 295] die Eltern der Auserwählten dem Werber durch die Art der Aufnahme zu verstehen, ob er ihnen willkommen ist oder nicht. Wird er zum Beispiel gut bewirtet, dann darf er sich Hoffnung machen, daß sein Vorschlag Gehör finden werde. In Schlesien erbittet er sich „e bißle Tobakfüer“. Wird ihm dieses verweigert unter dem Vorwand, daß kein Feuer vorhanden sei, dann bedeutet dies einen Korb; ebenso in Oberhessen, wenn man dem Vermittler Käse vorsetzt, während Bewirtung mit Wurst und Eiern ausdrückt, daß der Freier willkommen ist. Die abgewiesenen Burschen brauchen natürlich für den Spott der übrigen nicht zu sorgen. In Österreich wird bei der Brautschau zunächst gar nicht von dem eigentlichen Zweck des Besuches gesprochen, sondern ein Viehkauf oder ein ähnliches Geschäft vorgeschützt. Nachdem man darüber nach längerer Erörterung einig geworden ist, wird das Abendessen aufgetragen. Bei dieser Gelegenheit macht der junge Mann der von ihm Auserwählten in Gegenwart der Eltern Geschenke. In manchen Gegenden ist es üblich, daß er ein Kalb mitbringt und im Kuhstall stehen läßt; am Hochzeitstage wird dieses dann festlich ausgeputzt. Gefällt in Holland einem jungen Mann ein Mädchen, dann sucht er im besten Staat das Haus seiner Auserwählten auf und bleibt dort bis zum Abend; während der ganzen Unterhaltung verliert man kein Wort über den Grund des Besuches, obwohl dieser kein Geheimnis für die Eltern und ihre Tochter ist. Wenn dann die Zeit zum Schlafengehen gekommen ist, zieht sich die Familie in ihre Gemächer zurück, nur die beiden jungen Leute bleiben und unterhalten sich über alle möglichen Dinge, nur nicht über ihre Liebe. Das Mädchen gibt indessen auf andere Weise dem Bewerber zu verstehen, ob es ihm geneigt ist. Läßt es nämlich das Herdfeuer herunterbrennen, dann will es ihm damit[S. 296] andeuten, daß er sich keine Hoffnung machen dürfe; schürt es dagegen die Flamme, dann zeigt es dem Freier dadurch an, daß es ihm wohl gesinnt sei.


Noch eigenartiger sind die Werbegebräuche in Irland. Der Bräutigam und ein Freund von ihm finden sich abends, natürlich mit einer Flasche Whisky in der Tasche, im Hause der Auserwählten ein. Der Freund klopft und gibt bekannt, daß er „eine Frau haben will“. Nachdem längere Zeit hinter verschlossener Tür über diese Angelegenheit verhandelt worden ist, läßt man den Bewerber, falls er willkommen ist, herein. Unter großem Aufwand von Händeschütteln, Begrüßungen und Trinken wird man unter einander über die Mitgift einig; hierauf erst läßt man das Mädchen eintreten. Falls es sich nun etwa dem Beschlusse ihrer Angehörigen widersetzen sollte, kann es von diesen eine tüchtige Tracht Prügel erhalten. Am nächsten Morgen ladet man die Verwandten zum Abendbrot ein; bei dieser Gelegenheit wird die Hälfte der Mitgift erlegt. (Der Rest erst im nächsten Jahre, wenn das erste Kind geboren worden ist.) Zwei Tage darauf findet die Hochzeit statt.
Verlobte haben manche abergläubische Vorsichtsmaßregeln zu beachten, denn sie sind vielen schädlichen Einflüssen ausgesetzt. Sie dürfen sich gegenseitig keine Schuhe, ebensowenig eine Schere, ein Messer oder Nadeln schenken, weil sonst ihre Liebe zertreten oder zerschnitten werden könnte; sie dürfen, wenn sie zusammen sind, nicht Brot und Butter anschneiden, weil sonst Zwist zwischen ihnen entstehen könnte; sie dürfen auch nicht Pate stehen, weil sonst ihr Verhältnis sich wieder lösen könnte, nicht zusammen verreisen, weil sonst Unglück über sie hereinbrechen[S. 297] würde; die Braut darf sich vor ihrer Hochzeit nicht in ihrem Brautkleid sehen lassen — und noch viele andere derartige Verhaltungsvorschriften.


Das Glück der zukünftigen Eheleute wird auch vielfach von dem Tage, an dem die Trauung stattfindet, abhängig gemacht. Daher sind bestimmte Tage verpönt, unter anderem die Zeit der Fasten und des Advents, der Sonntag Jubilate, der Mittwoch und besonders der Freitag, weil sie Unglück bringen. Nach dem Volksglauben in Baden kehrt eine Braut, die am Mittwoch heiratet, bald wieder ins Elternhaus zurück. Dagegen sind der Dienstag und der Donnerstag sehr beliebt; beide Tage waren einst heidnischen Göttern geweiht, die der Ehe freundlich gesinnt waren: Tiu und Donar. Auch in Holland heiratet man meistens am Donnerstag, offenbar aus althergebrachten Gründen; um dieser Sitte gerecht zu werden, hat man sogar für diesen Tag die Traugebühren außerordentlich niedrig bemessen. — In Nordengland und in Wales ist dagegen gerade der Freitag als Hochzeitstag beliebt. — Vielfach legt man in Deutschland auch Gewicht darauf, daß die Hochzeit bei zunehmendem Monde stattfindet, denn dabei soll das Glück und der Reichtum der Neuvermählten geradeso wie der Mond zunehmen. Auch dem Verhalten des Wetters am Hochzeitstage wird Bedeutung beigelegt. Schlechtes Wetter, wie Sturm, Donner, Gewitter, Regen lassen auf Unglück in der Ehe schließen, dagegen Sonnenschein auf einen glücklichen Verlauf derselben. In manchen Gegenden dagegen bedeutet Regen umgekehrt Glück, und man sagt, daß „wenn es der Braut auf den Kranz regne, es ihr auch Glück und Kinder regnen werde“.


Die Einladung zur Hochzeit erfolgt entweder[S. 298] durch die Brautleute persönlich beziehungsweise einen ihrer nächsten Verwandten, meistens die Eltern, oder auch durch einen Hochzeitsbitter oder Hochzeitslader. Im ersteren Falle trägt das junge Paar in katholischen Gegenden geweihtes Salz in den Schuhen oder sonst einen geweihten Gegenstand mit sich herum, um sich vor bösen Einflüssen zu schützen. Natürlich sind beide Brautleute bei diesem ihrem Rundgang aufs festlichste geschmückt, meistens mit bunten Bändern, die Braut auch mit einer bunten Schürze angetan. Auch der Hochzeitsbitter pflegt geputzt zu sein, er trägt ein Sträußchen am Hute und im Knopfloch und oft einen Stock in der Hand, der gleichfalls geschmückt ist, in Österreich mit einem roten Apfel und einem Rosmarinstrauß. Die Einladungen werden mündlich vorgebracht, öfters in bestimmten Formeln und in gebundener Rede. Falls die Brautleute dieselben in eigener Person übermitteln, pflegen sie, besonders ihren Verwandten und Paten, allerlei kleine Geschenke mitzubringen und dafür allerlei für ihren zukünftigen Haushalt brauchbare Gegenstände als Gegengabe in Empfang zu nehmen. Früher erhielt die Braut darunter auch ein „Glücksbrot“, von dem sie einige Scheiben in die erste von ihr im neuen Haushalt zu kochende Suppe zu tun hatte, um Glück in der Ehe zu haben. In Holland werden die Eingeladenen durch Übersendung einer Schachtel Süßigkeiten und einer Flasche Wein, der die eigenartige Bezeichnung „Brautträne“ führt, zur Teilnahme an der Hochzeit aufgefordert. In Niederösterreich besteht die sonderbare Sitte, daß auch die Braut zu ihrer eigenen Hochzeit eingeladen wird, und zwar durch den Bräutigam und seine Trauzeugen, die sich in festlicher Kleidung morgens gegen zwei oder drei Uhr bei ihr einfinden und sie in der Wohnung zu suchen haben. Bei dieser Gelegenheit darf sich die Braut aber nicht im[S. 299] Schlafe überraschen lassen, weil man daraus schließen könnte, sie werde keine gute Hausfrau werden; anderseits darf sie auch nicht zu schnell von ihrem Zukünftigen gefunden werden, weil man sonst leicht annehmen könnte, sie habe es mit dem Heiraten sehr eilig. Deshalb versteckt sie sich, und je länger nach ihr gesucht wird, um so mehr fühlt sie sich geehrt.

In Norddeutschland ist es üblich, dem Hochzeitstage den Polterabend vorausgehen zu lassen, zu dem bereits die Hochzeitsgäste und sonstige Bekannte sich einzufinden und teilweise auch schon ihre Geschenke zu überreichen pflegen. Die Bezeichnung Polterabend rührt von dem großen Lärm her, den die Leute der Nachbarschaft, meistens Kinder, durch Zusammenwerfen von alten Töpfen und Scherben vor der Haustür zu machen pflegen, oder auch von dem Peitschengeknalle und Schießen von seiten der jungen Burschen. Es steckt in dieser Sitte wieder ein gut Stück heidnischen Aberglaubens, nämlich das Austreiben oder Bannen dämonischer Mächte, die den die Ehe Eingehenden Schaden bringen könnten. Noch deutlicher beweist dies die in Bayern übliche Sitte, an dem Abend vor der Hochzeit die bösen Geister unter entsetzlichem Gepolter, vom Keller bis zum Boden hinauf, und unter Gemurmel althergebrachter Bannformeln, durch Beklopfen der Wände, Umhersprengen von Wasser und sorgfältiges Verschließen aller Öffnungen des Hauses aus diesem zu vertreiben beziehungsweise von ihm fernzuhalten. — In Schottland bringt man am Abend vor der Hochzeit ein mit Salz angefülltes[S. 300] Nachtgeschirr in die Wohnung des angehenden jungen Paars und schüttet einen Teil seines Inhaltes auf den Boden aus zum Schutz gegen den bösen Blick.
Am Hochzeitstage legen Braut und Bräutigam (Abb. 338) in den ländlichen Gegenden, wo die alten Trachten noch zu Ehren bestehen, diese an, meistens die kostbaren Gewänder ihrer Vorfahren, die man für solche feierliche Gelegenheiten in den Truhen aufbewahrt hat (Abb. 339, 340 und 342). Wohl überall ist es Sitte, daß der Bräutigam sich an die linke Seite seines Rockes einen Myrten- oder Rosmarinstrauß steckt und die Braut, falls sie noch jungfräulich ist, sich einen Myrtenkranz und einen Schleier auf den Kopf setzt. In vielen Gegenden trägt sie einen zu diesem Zweck besonders bereitgehaltenen wertvollen Kopfputz in Gestalt einer reich gestickten Haube oder einer Krone, die mit Flittergold, Perlen, Blumen und bunten Bändern geschmückt ist (hierzu die farbige Kunstbeilage sowie Abb. 343 und 344). An den Brautkranz knüpft sich auch wieder mancherlei Aberglaube. Er darf von einem anderen jungen Mädchen nicht aufgesetzt werden, denn sonst verlobt sich dieses nicht. Ebensowenig darf die junge Frau ihn an ihrem Ehrentage vor zwölf Uhr nachts ablegen, weil es sonst in der Ehe Unglück gäbe. In England besteht der Glaube, daß sie auch das Brautkleid nicht vor der Hochzeit anziehen dürfe; in Yorkshire ist es ihr untersagt, es bei Kerzenlicht zu besehen. Einige Gebräuche am Hochzeitstage sind als Überreste früherer Raubehe zu deuten, so zum Beispiel, wenn der Bräutigam sich die Braut, die sich versteckt hat, erst suchen muß, oder wenn diese sich sträubt, bevor sie ihrem Zukünftigen zum Traualtar folgt.

[S. 301]
Zu jeder Hochzeit gehören Brautführer (Hochzeitsknechte, Kirchführer, Brautgesellen und so weiter) sowie Brautjungfern (Kränzlemädle, Kränzlerinnen, Kirchführerinnen, Hochzeitsmägde oder ähnlich; siehe die Kunstbeilage). Die ersteren begleiten den Bräutigam, die letzteren die Braut auf dem Wege zur Kirche. Vielfach pflegen auch noch kleine Kinder, die sogenannten Brautengel oder Vorbräute, Straußlesbuben, Kringlesmädle dem Zuge, den auf dem Lande meistens noch eine Musikbande begleitet (Abb. 347 und 348), voranzugehen und Blumen auf den Weg zu streuen. — Nicht selten trifft man noch die alte Sitte an, die Ausstattung der jungen Brautleute im Festzuge mitzuführen (Abbildg. 341 und 346).

Auch mit dem Gang zur Trauung ist mancherlei Aberglaube verknüpft. Die alte Vorstellung, daß irgendein böser Einfluß dem jungen Paare unterwegs schaden könnte, kommt in verschiedenen Gebräuchen zum Ausdruck. So ist es vielfach Sitte, daß die Brautleute zum Schutz gegen bösen Zauber stark riechende Kräuter, wie Kümmel, Dill, Wermut, Beifuß, Rosmarin und anderes derart bei sich tragen. Um mit Reichtümern gesegnet zu sein, müssen sie einen auf ihren Haushalt[S. 302] oder ihr Handwerk bezüglichen Gegenstand zu sich stecken, wie Brot, Messer, Gabel, Löffel, Getreide, Nähzeug (bei einem Schneider), Nägel (bei einem Schmied), etwas Geld (für gewöhnlich im Schuh der Braut) und manche andere Dinge. — Beim Verlassen des Hauses muß das Brautpaar über ein Messer oder ein Beil, auch wohl über einen Besen schreiten. Auf dem Wege zur Kirche sollen beide möglichst dicht nebeneinander gehen, damit der böse Geist nicht zwischen sie fahren könne; auch sollen sie fein sittsam auf den Boden sehen und sich ja nicht umsehen, weil sonst der Betreffende in der Ehe nach einem anderen Gatten Umschau halten und untreu werden könnte; die Braut darf auch bei Schmutzwetter ihr Kleid nicht aufheben, ebensowenig etwas, das auf der Straße liegt, an sich nehmen, weil es von Hexen herrühren könnte. Bestimmte Personen oder Tiere, die dem Brautpaar zuerst begegnen, werden als entscheidend für sein künftiges Schicksal angesehen; so bringen eine alte Frau, ein Fuhrwerk, ein Hase, eine Katze Unglück, hingegen ein Mann, ein Schwein, ein Schaf und anderes Glück. In England sind auch die Farben, die man trägt, für die Zukunft der Neuvermählten ausschlaggebend; ein Tabu ruht dabei auf Grün. Dies wird in Schottland sogar auf die Farbe des Gemüses für die Hochzeitstafel ausgedehnt. — In England wirft man ferner dem Brautpaar beim Antritt seines Kirchganges oder bei der Rückkehr von der Trauung ein paar alte Schuhe nach, damit die Ehe fruchtbar sei. — In Norwegen muß die junge Frau, wenn sie aus der Kirche kommt, rasch den Sattelgurt ihres Pferdes lösen, damit sie leichte Geburten habe.

Bei der Trauung weissagt man aus dem Verhalten der brennenden Altarkerzen während des Ringwechsels das Schicksal der Getrauten: wenn sie trübe brennen, flackern oder gar erlöschen, befürchtet man Unglück, Zwist und selbst frühzeitigen Tod dessen, auf dessen Seite die Flamme erlischt; brennen sie dagegen hell und gleichmäßig, so erhofft man ein glückliches, langes Zusammenleben, Friede und Freude. Fällt ein Ring zur Erde, dann bedeutet dies gleichfalls Unglück. Um die Herrschaft über die andere Ehehälfte zu haben, muß der Bräutigam beim Empfangen des Segens auf den Saum des Kleides seiner Braut niederknien, diese dagegen beim Aufstehen zuerst auf den Fuß des Bräutigams treten, und jeder von beiden muß versuchen, beim Händereichen seine eigene Hand nach oben zu bringen.



Nach Beendigung der Trauung pflegt man meistens schnell nach Hause zu eilen; fährt die Hochzeitsgesellschaft zu Wagen (Abbildung 349), dann wird der Weg nicht selten in rasendem Galopp zurückgelegt, offenbar, weil man den Unglück bringenden Mächten entrinnen will. Wie auf dem Wege zur Kirche, so wird auch jetzt das junge Paar vielfach mit Flinten- und Böllerschüssen oder Peitschengeknall begrüßt; in Irland zündet man ihm zu Ehren große Strohgarben an. Häufig begegnet man auch der Sitte, sowohl in Deutschland wie in England, daß den Neuvermählten bei der Rückkehr allerlei Hindernisse in den Weg gelegt werden; so zum Beispiel sperrt man die Landstraße mit Stricken (Abb. 350) oder Girlanden ab und nimmt von dem Paar ein Lösegeld, bevor man es hindurchläßt. Je größer in Wales die Anzahl dieser Stricke ausfällt, um so größeren Ansehens erfreut sich das junge Paar und für um so großartiger gilt die Hochzeit. Beim Betreten des Hauses findet die Hochzeitsgesellschaft nicht selten Tor und Tür verschlossen; auch hier muß das junge Paar sich durch kleine Geschenke erst wieder loskaufen. In Pommern müssen die Neuvermählten beim Betreten ihres neuen Heims ein Stück Brot abbeißen, damit sie an dieser Gottesgabe niemals Mangel leiden. In Österreich überreicht man der jungen Frau einen Laib Brot und ein hölzernes Messer mit dem Ersuchen, ein Stück Brot abzuschneiden, und weidet sich an ihrer Verlegenheit, wenn sie nicht damit zustande kommt. Indessen hat man die Frau meistens im voraus davon verständigt, und sie hat vorsorglich ein Taschenmesser zu sich gesteckt, mit dessen Hilfe es ihr leicht gelingt, dem Wunsche zu entsprechen. Das abgeschnittene Stück wird sorgfältig von ihr aufbewahrt, damit stets genug Brot im Haushalt vorhanden sei. In England pflegt man die junge Frau beim Betreten des neuen Heims mit Reis zu überschütten, in Deutschland verschiedentlich mit Erbsen und Getreidekörnern. In Irland wird über ihrem Kopfe ein Kuchen zerbrochen, den ihre Mutter während der Trauung gebacken hat. Im schottischen Hochland endlich wird ein Handtuch über ihren Kopf gelegt und darüber der Inhalt einer Brotschüssel ausgeschüttet, nach dem die Umstehenden haschen. Im nördlichen England verwendet man zu diesem Zweck statt Brot knuspriges Gebäck, und in manchen Gegenden muß der älteste Mann des Dorfes diese Handlung vornehmen. Hier und dort nimmt die junge Gattin beim ersten Betreten des Hauses noch manche andere zeremonielle Handlung vor, die vielfach auf alten überlieferten heidnischen Vorstellungen von der Bedeutung der Hausahnen und dem Vertreiben böser Mächte beruht. So muß sie sich zunächst vor den Feuerherd stellen oder um ihn herumgehen und sich vor ihm verneigen, sodann die Dungstätte auf dem Hofe betreten, in den Stall gehen und das Vieh füttern, sich den Bienenstöcken vorstellen und so fort. — An manchen Orten haben sich noch andere, ganz merkwürdige Gebräuche erhalten (Abbild. 351 bis 353). Überall sind wohl Hochzeitsgeschenke üblich, die verschiedentlich in Lebensmitteln und Wirtschaftsgegenständen für den neuen Haushalt bestehen (Abb. 354).


[S. 307]
Hieran schließt sich das Hochzeitsmahl (hierzu die Kunstbeilage und Abb. 356), bei dem es häufig genug hoch hergeht und besonders auf dem Lande Unheimliches im Essen und Trinken geleistet wird. Um ein Beispiel aus Pommern anzuführen, so wurden im Jahre 1907 gelegentlich einer Bauernhochzeit in Schwarzau laut Zeitungsbericht zur Bewirtung der Gäste angeschafft — und auch verzehrt: zweiunddreißig Zentner Weizenmehl, vier Schweine von je zweieinhalb Zentnern, zwei Kälber, drei Schafe, zweiunddreißig Gänse, acht Zentner große Fische, zehn Zentner kleine Fische, vierundfünfzig Tonnen Bier, fünfhundert Flaschen Wein und dreihundert Liter Branntwein.

Vor Beginn des Mahles pflegt in manchen Gegenden der Hochzeitsbitter einen Hochzeitspruch oder eine „Abdankung“ herzusagen. Das Weinglas, aus dem die Gesundheit des jungen Paares ausgebracht wurde, wird hinterrücks über die Schulter geworfen, so daß es in möglichst zahlreiche Stücke zerspringt, was Glück bringen soll, und zwar um so mehr, je mehr Scherben es sind.
In Irland erscheinen manchmal nach dem Mahle eine Anzahl „Bettler“ oder „Strohknaben“, so genannt, weil sie sich in Stroh einwickeln; ihr Anführer tanzt mit der Braut, und den übrigen werden Erfrischungen vorgesetzt. Der Tanz (Abb. 355) bildet wohl überall den Abschluß des Hochzeitsfestes. In manchen Gegenden ist er besonders auf diesen Zweck zugeschnitten. Den ganzen Abend über versucht man, der jungen Frau allerlei Schabernack zu spielen, der darauf hinausläuft, sie dem Gatten abspenstig zu machen, im besonderen sie ihm zu entführen;[S. 308] daher lassen die Brautjungfern sie nicht aus dem Auge. Gelingt den jungen Burschen ihr Spaß, dann führen sie die junge Frau in ein besonderes Zimmer und geben sie erst wieder her, wenn ihre Wächter Geschenke spenden. In Irland sucht die junge Frau ihrerseits nach dem Mahle zu entschlüpfen, wobei ihr die verheirateten Frauen behilflich sind. Wird sie dabei von den Gästen ertappt, dann muß sie den rechten Strumpf ausziehen und mit demselben nach ihnen werfen. Wer dabei getroffen wird, dem steht die nächste Heirat bevor.

Gegen Mitternacht geht die feierliche Handlung der Kranzabnahme und die sich daran anschließende der Haubung vor sich. Für gewöhnlich nehmen der Bräutigam, ein Brautführer und eine Brautjungfer der jungen Frau den Kranz vom Kopfe ab, wobei in Nord- und Mitteldeutschland ein Kreis um sie gebildet und unter Absingung eines eigens für diese Gelegenheit bestimmten Liedes im Reigenschritt um sie herumgezogen wird. Der Braut sind dabei die Augen verbunden, und sie bemüht sich, während des Reigens eins der sie Umtanzenden zu [S. 310]erhaschen; wen sie erhascht, der wird demnächst Bräutigam oder Braut. Nach der Kranzabnahme setzen die verheirateten Frauen der Neuvermählten die Haube auf, womit sie andeuten, daß sie sie nunmehr in ihre Gemeinschaft aufgenommen haben. Meistens pflegt sich die Braut nach Möglichkeit dagegen zu sträuben. In ähnlicher Weise wird das Sträußchen des jungen Ehemannes vertanzt. Schließlich wird der Brautschleier noch zerrissen und in kleinen Stückchen an die Gäste verteilt.

Vor seinem Fortgang pflegt das junge Paar noch einen „Ehrentanz“ zu tanzen, und zwar um drei brennende Lichter herum, die entweder auf dem Fußboden stehen oder von drei Mädchen gehalten werden. Es darf aber auf keinen Fall eins der Lichter von den Tanzenden ausgelöscht werden, da es sonst Unglück in der Ehe geben würde. Eine Weiterbildung dieser Sitte ist der bekannte Fackeltanz, wie er bei Hochzeiten im Hause der Hohenzollern aufgeführt wird.
Die Hochzeit endet in Norddeutschland mit dem sogenannten Kehraus, einer Polonäse, bei der die mit allen möglichen Wirtschaftsgegenständen bewaffneten Gäste nach einer bekannten Melodie durch das ganze Haus und auch durch die Ställe ziehen, wonach sie in frühern Zeiten schließlich mit einem Besen tatsächlich ausgekehrt wurden.


An den letzten Abschnitt des menschlichen Lebens, den Tod, knüpfen sich bei den Kulturvölkern wohl noch die meisten abergläubischen Vorstellungen. Die geheimnisvollen Mittel und Wege, den Schleier der Zukunft zu lüften und zu erfahren, ob etwa einem ein baldiges Lebensende bevorstehe, sind ziemlich zahlreich. Das Volk läßt manche Menschen mit der besonderen Gabe des „zweiten Gesichts“ ausgestattet sein, das heißt mit der Fähigkeit, im Geiste vorauszusehen, wer demnächst im Sarge liegen oder aus welchem Hause ein Leichenzug sich in Bewegung setzen werde. Es nennt solche Leute „Totenkieker“ oder „Schichtige“. Aber nicht nur sie vermögen den Tod vorauszuschauen, sondern auch jeder andere ist zu bestimmten geheimnisvollen Tagen und Stunden des Jahres dazu in der Lage; wie schon gezeigt wurde, sind solche Tage der Johannistag, der Sankt-Thomas-Abend, der Silvesterabend und andere. Der Volksglaube kennt auch noch zahlreiche andere Anzeichen eines bevorstehenden Todesfalls in manchen Erscheinungen der Tier- und Pflanzenwelt sowie des täglichen Lebens. Ein zu nächtlicher Stunde mit gesenktem Kopf bellender oder viele Löcher in die Erde scharrender Hund, ein an einem Hause nur mit großen Schwierigkeiten vorbeizubringendes Pferd, die Begegnung mit einem Schimmel bei Antritt einer Reise, das Entstehen von Maulwurfshaufen in der Diele des Hauses, das Komm-mit-Rufen des Käuzchens (oder Totenvogels), das ängstliche Flattern einer Schar Raben um ein Haus, das Hinauswerfen toter Jungen aus dem Nest von Störchen oder Hausschwalben, das Ticken oder „Dengeln“ des Holzkäfers (oder der Totenuhr) im Gebälk, das Erscheinen weißer Blätter und Stengel an Pflanzen des Gemüsegartens oder[S. 313] des Ackers, das plötzliche Eingehen von Obstbäumen, das Aufblühen einer einsamen Rose im Spätherbst, ein Strohhalm auf einem Hühnerschwanz (Hebriden), auffällige Geräusche unbekannten Ursprungs im Hause, wie Klopfen, Hämmern, Knallen und so weiter, das grundlose Stillstehen der Uhr, das Herabfallen von Wandbildern, das Selbstaufgehen von Türen und manches Ähnliche wird als eine Todesbotschaft für die Hausbewohner oder die Familienmitglieder angesehen.


Naht die Todesstunde, dann wird der Geistliche geholt, um bei den Evangelischen dem Sterbenden das Heilige Abendmahl darzureichen, bei den Katholischen ihn mit der Letzten Ölung zu „versehen“; die Familie und auch wohl die Freunde versammeln sich hinterher in dem Sterbezimmer. Bei schwerem Todeskampf öffnet man das Fenster oder hebt einen Ziegel vom Dach ab, damit die Seele nicht „hängen bleibe“, sondern frei zum Himmel fliegen könne. In Yorkshire legt man den Sterbenden auf den Boden, damit die Seele freien Ausgang habe. — Ist der Tod eingetreten, dann wird zunächst das Fenster geöffnet, darauf wieder geschlossen und dieses selbst sowie die Spiegel im Zimmer verhängt, das Uhrpendel angehalten, die Stühle umgekehrt, alles Wasser im Hause ausgegossen und dergleichen. In manchen Gegenden ist es Sitte, ein lautes Wehklagen anzuheben. In Böhmen, teilweise auch in Schwaben stellt man neben die Leiche ein Glas Wasser, ein Handtuch und ein brennendes Licht, damit die Seele sich reinigen könne, bevor sie vor ihren himmlischen Richter tritt; in Schwaben spricht man dabei[S. 314] von Seelenbad. Vielfach trifft man auch auf dem Lande die Sitte an, daß der Todesfall des Hausherrn den Tieren im Stalle sowie den Bienen mitgeteilt wird; wo in England die Bienenstöcke nicht auf so förmliche Weise davon benachrichtigt werden, hebt man doch die Körbe in dem Augenblick hoch, wo man die Leiche aus dem Hause zu Grabe trägt. Die Sitte beruht auf der Anschauung, daß die Haustiere gleichsam mit zur Familie gehören und daher in einem Abhängigkeitsverhältnis zum Hausvater stehen; um also dieses zu lösen und damit zu verhüten, daß der Abgeschiedene das eine oder das andere Familienmitglied nach sich ziehe, wird den Tieren der Tod eigens mitgeteilt. Aus demselben Grunde wird auch sämtliches Hausgerät, desgleichen das Getreide, das Obst, die Kartoffeln, die Mehlsäcke und dergleichen von seinem Platze bewegt, verrückt oder geschüttelt. Vielfach wird der Tote auch „ausgeläutet“ oder „heimgeläutet“.

Der Todesfall wird auch im Dorfe bekanntgegeben, entweder durch die Angehörigen selbst oder in manchen Gegenden auch durch einen Leichenbitter oder Leichenlader; wie bei der Hochzeit sind bei diesen Ansagen noch mancherlei stehende Formeln üblich. Die Leichenansager sind durch besondere Abzeichen, wie über der Brust gekreuzte Arme, weiße Stirnbinde, umflorten Stock und Dreimaster, kenntlich gemacht. Auch in Holland sind sie, unter der Bezeichnung „Anspreker“ eine bekannte Erscheinung. Sie sind hier von Kopf bis zu Fuß schwarz gekleidet und tragen ebenfalls besondere Abzeichen: je nachdem es sich um die Mitteilung von dem Tode eines Kindes, eines Junggesellen, einer Jungfrau und so fort handelt, werden verschiedenfarbige Rosetten von ihnen angelegt. Sie gehen von Haus zu Haus und sprechen bei allen, selbst solchen, die nur in weitläufiger Verwandtschaft zu dem Verstorbenen stehen, vor, um den Tod anzuzeigen, oft[S. 315] genug mit Worten, die einen komischen Beigeschmack haben. So sagt der Anspreker zum Beispiel: „Ich muß euch die Grüße des Schlächters (oder Schusters und so weiter) X. überbringen, und er ist tot.“ Früher und gelegentlich noch jetzt an abgelegenen Orten begleitet den Anspreker noch der Heilebolk, dem die Pflicht obliegt, in Tränen auszubrechen, nachdem von jenem der Tod gemeldet worden ist. In Irland verbrennt man ein kleines Strohkissen, auf dem der Tote seine Seele aushauchte, auf der Spitze des nächsten Hügels, um die Nachbarschaft in Kenntnis zu setzen. An manchen Orten Englands zeigt man den Todesfall durch feierliches Läuten an; man verbindet damit auf dem Lande noch den Aberglauben, daß der Ton der Glocke die bösen Geister vertreiben soll. Für gewöhnlich wird nur eine Glocke geläutet; wenn man aber glaubt, daß mehrere Glocken von größerem Erfolg sein könnten, läßt man mehrere ertönen. Auch das Verkünden des Todes von der Kanzel herab ist hier, wie auch in Deutschland, vielfach üblich.

Die Leiche wird gewaschen und in ein neues Hemd (Sterbehemd) sowie in den besten Anzug, oft das Hochzeitskleid, gesteckt und aufgebahrt, nachdem sie in katholischen Gegenden vorher noch mit Weihwasser besprengt worden ist. In Hindeloopen in Holland befinden sich in der Kirche eine ganze Reihe Bahren, eine neben der anderen aufgestellt; je nach dem Beruf des Verstorbenen wird von diesen Bahren eine bestimmte benutzt, also die eine etwa, wenn es sich um einen Schuhmacher handelt, während beim Tode eines Schneiders, Bäckers, Schmiedes und so fort je wieder eine andere Bahre in Gebrauch genommen wird. — Früher waren noch Leichenwachen Sitte, an denen sich vorzugsweise junge Mädchen beteiligten; auch jetzt begegnet man ihnen noch hier und dort. Stets aber pflegt man nachts wohl noch Kerzen[S. 316] bei den Toten brennen zu lassen. In England müssen es deren fünf sein, die man um die Leiche stellt; in Wales bleibt eine davon unangezündet. An anderen Orten zündet man nur drei Kerzen an, was wieder zu dem Aberglauben geführt hat, daß es Unglück bedeutet, wenn drei Kerzen in einem Zimmer brennen. Wenn in gewissen Gegenden Schottlands die Leiche aufgebahrt worden ist, zündet die älteste Frau die Totenkerze an, die von einer angeblichen Hexe oder von einer „unglücklichen Person“ herstammen muß, und schwenkt sie dreimal um die Leiche, worauf sie drei Hände voll Salz auf einen Teller häuft und diesen auf die Brust des Toten setzt; schließlich stellt sie noch drei leere Schüsseln ans Feuer. Jeder der Anwesenden verläßt nun das Zimmer, kommt dann aber rückwärtsgehend unter Aufsagung von Segensprüchen wieder herein.

Solange sich die Leiche im Hause befindet, herrscht allgemeine Ruhe und Stille, auch unterbleiben Haus- und Feldarbeiten. Jedoch ist es in manchen Gegenden noch Sitte, daß die Bekannten abends zusammenkommen und Gebete sprechen oder fromme Lieder singen.
Sehr verbreitet ist die Angst, daß der Tote wiederkommen oder auch ein anderes Familienmitglied holen könnte. Um dies zu verhindern, kennt man eine ganze Reihe Abwehrmaßregeln. So darf auf den Toten oder seine Gewänder keine Träne fallen, das Totenhemd darf nicht an einem Sonntage angefertigt werden, in dem Faden, mit dem es gemacht wird, darf sich kein Knoten finden, die Nadeln, die dazu benutzt werden, müssen entweder im Hemd stecken gelassen oder ins Feuer geworfen werden; keins der Bekleidungstücke, die man der Leiche anzieht, darf einen Namen aufweisen, etwa vorhandene Buchstaben oder Namen müssen herausgeschnitten werden, alle Leib- und Bettwäsche, die der Tote bei seinem[S. 318] Ableben benutzte, muß gewaschen, seine Kleider gereinigt werden, dem Toten darf kein Gegenstand, der einem Lebenden gehört, mit ins Grab gegeben werden und so weiter. Dagegen folgen häufig dem Toten mit ins Grab (oder aufs Grab; Abb. 357) seine Gebrauchs- und Lieblingsgegenstände, wie die Tabakspfeife, die Schnupftabaksdose, bei Kindern Spielsachen und so fort; vielfach wird ihm auch ein Zehrpfennig auf den Weg gegeben. Unter das Kopfkissen kommt für gewöhnlich ein Gesangbuch oder das Neue Testament zu liegen, auf die Brust ein Kruzifix oder ein Kreuz aus Blumen.

In manchen Gegenden wird der Tote nicht in den Sarg, sondern auf ein Brett gelegt, das in Bayern Rebrett genannt wird. Diese Bretter pflegt man mit dem Todesdatum und einigen Kreuzen, auch wohl mit frommen Sprüchen zu versehen und nach dem Begräbnis entweder in der Nähe des Hauses oder an einem viel begangenen Wege oder Platze aufzustellen, damit die Vorübergehenden, dadurch aufmerksam gemacht, für das Seelenheil des Verstorbenen beten (Abb. 358).
Das Begräbnis bietet hinsichtlich der Beteiligung, der Zusammensetzung und Anordnung des Trauergefolges, des Weges, den der Zug zum Friedhofe nimmt, sowie der verschiedenen Zeremonien, die unterwegs und am Grabe vorgenommen werden, mancherlei Verschiedenheiten. Beim Aufheben und Hinaustragen des Sarges werden auch wieder Abwehrmaßnahmen vorgenommen. In dem Augenblick, wo er das Haus verläßt, muß die Uhr wieder gerückt oder aufgezogen werden; der Tote darf nicht eine Treppe hinaufgetragen werden; er darf das Haus nur mit den Füßen voran verlassen; auf der Türschwelle muß er in Kreuzstellung zu dieser eine Zeitlang abgesetzt werden. Sobald die Leiche das Zimmer verlassen hat, wird dieses[S. 319] gekehrt und mit Kümmel und Wacholderstengeln, die über glühenden Kohlen verbrannt werden, ausgeräuchert; Fenster und Türen werden geschlossen. Stühle und Bänke, auf denen der Sarg gestanden hat, werden umgekehrt, der Weg von der Hausschwelle bis zur Hofgrenze, den der Leichenzug genommen hat, gefegt. Wenn der Sarg diese überschritten hat, wird Wasser über den Weg ausgeschüttet. Alles dieses und manches andere der Art geschieht, um zu verhindern, daß der Verstorbene wiederkomme und etwa noch ein anderes Familienmitglied nach sich ziehe. Aus eben diesem Grunde bewegt sich der Leichenzug möglichst schnell vorwärts, müssen die Teilnehmer in dicht geschlossenen Reihen gehen, dürfen sie sich auf dem Wege nicht umsehen und dergleichen.
Der Sarg wird auf dem Friedhof ins Grab gesenkt. Dieses darf nicht auf einmal hergestellt, sondern muß in drei Absätzen von ein und demselben Totengräber ausgeschaufelt worden sein; in Irland darf dies an keinem Montag geschehen. Bevor der Totengräber das Grab zudeckt, wirft jeder der Leidtragenden drei Hände voll Erde, auch wohl Blumen als Abschiedsgrüße hinein. In Westpreußen tut man dies auch mit dem Tischlermaß, mit dem die Größe des Sarges genommen wurde. Auf gewissen Inseln Irlands wirft man Münzen mit ins Grab hinein, um der Erde ihren Zoll zu entrichten. In anderen Gegenden sammelt man das Geld lieber als Gabe für den Priester oder als Bezahlung der Totenmessen für den Verstorbenen. Das Gegenstück dazu ist der Pastorenpfennig in Wales.

Ihren Abschluß finden die Begräbnisfeierlichkeiten in einem Leichenschmause oder Leichentrunk, entweder im Hause des Verstorbenen oder im Wirtshause; früher ging es dabei nicht[S. 320] selten hoch her, jetzt aber pflegen dazu nur die Verwandten oder nächsten Bekannten zusammenzukommen; da sich zu Leichenbegängnissen auch entfernter Wohnende einzufinden pflegen, so wird die seltene Gelegenheit gern benutzt, um die Familienbande enger zu knüpfen. Die Bewirtung dabei besteht aus Kaffee und Kuchen oder Brot (Sterbewecklein), auch wohl noch Wein.
Für die Trauer, die sich meistens auch noch entsprechend der seit dem Tode verflossenen Zeit abstuft, ist in vielen Gegenden, wo noch die Volkstrachten getragen werden, eine bestimmte Tracht vorgeschrieben (Abb. 359).

Die Grabhügel pflegt man mit Efeu oder mit Singrün zu bepflanzen und mit Zypressen oder Taxushecken, auch wohl mit Trauereschen einzufassen. Als Gräberschmuck dient in erster Linie die Rose, ferner die Lilie, die Ringelblume und der Rosmarin, eine den alten heidnischen Göttern Fro und seiner Gattin Holda geweihte Pflanze. Von Zeit zu Zeit, namentlich aber an bestimmten Tagen (Allerseelen, Totenfest, Karfreitag und anderen) schmückt man die Grabstätten mit frischen Blumen. In Schottland kennt man merkwürdigerweise keinen Gräberschmuck. Nebenbei bemerkt, sollen hier auch amputierte Gliedmaßen in aller Form beerdigt werden.
Der Aberglaube, daß der Tote nicht für immer seiner Familie entrückt sei, sondern noch längere Zeit, wenigstens solange er noch nicht verwest ist, mit ihr in Verbindung stehe und zurückkehre, ist fest eingewurzelt bei allen europäischen Völkern, offenbar ein altes Überbleibsel aus altheidnischer Zeit. Auf der einen Seite fürchtet man dieses Wiedererscheinen und sucht es durch allerlei Abwehrmaßregeln zu verhindern, wie schon mehrfach gezeigt wurde, anderseits aber wünscht man auch wieder, daß der Verstorbene möglichst lange in der Nähe weile. Man nimmt an, daß er unter anderem darum nach Hause zurückzukehren suche, um nachzusehen, ob alles in Ordnung sei und seinen alten Gang gehe. In Thüringen hängt man in der Wohnstube zu diesem Zweck ein Handtuch auf, hinter das der Verstorbene treten soll; man läßt für ihn bei Tisch einen Stuhl frei und stellt ihm Brot und Wasser hin. Einer im Wochenbett Verstorbenen setzt man an das Lager ihres Kindes nachts Wasser und einen Schwamm, damit sie ihren Liebling wasche und pflege, und was dergleichen Gebräuche mehr sind.
[S. 321]

Unter den romanischen Völkern wird, ganz allgemein gesagt, die Bevölkerung der westlichen Mittelmeerländer verstanden, also die Franzosen — in einem großen Teile Nordfrankreichs überwiegt allerdings das nordeuropäische, germanische Blut —, die Spanier, Portugiesen und die Italiener. Rassenanthropologisch betrachtet, gehören zu ihnen die Vertreter des brünetten mediterranen Typus (Abb. 362 und 398), der, wie schon oben gezeigt wurde, vielfach Kreuzungen mit der nordischen und der alpinen Rasse eingegangen ist, sich aber immerhin verhältnismäßig rein in den südlichsten Gebieten der Mittelmeergestade erhalten hat. Unter den Romanen begegnet man vielfach recht schönen Gestalten und ansprechenden Gesichtern, besonders in der Frauenwelt. In Frankreich haben die Frauen von Arles wegen ihrer großen Schönheit eine gewisse Berühmtheit erlangt, deren sie sich übrigens schon zur Römerzeit erfreuten. Die Schönheit der romanischen Frauen wird vielfach noch durch ihre malerische Tracht erhöht, die man hier viel häufiger als in Nord- und Mitteleuropa noch zu tragen pflegt, besonders in ländlichen Bezirken.
[S. 322]
Die einzelnen Trachten hier zu schildern, ist ganz unmöglich; es muß genügen, einige wenige im Bilde vorzuführen, denn es herrscht eine große Mannigfaltigkeit in dieser Hinsicht (Abb. 361, 363 und 365). Im allgemeinen sind bunte, leuchtende Farben in geschmackvoller Zusammenstellung für die südeuropäischen Trachten bezeichnend, neben denen in manchen anderen Gegenden aber auch weniger farbenfreudige Stoffe bevorzugt werden. Mit vielem Geschmack und vielem Geschick verstehen die Romaninnen sich darauf, ihre körperlichen Reize durch allerlei Beigaben, besonders in der Kleidung, zu erhöhen. Ein ständig wiederkehrendes Stück der Tracht, das seine größte Verbreitung unter den Spanierinnen (Abb. 366) hat und die anmutigen Gestalten außerordentlich vorteilhaft kleidet, ist das Spitzenschleiertuch (Mantille, Fichu).


Da die Südeuropäerinnen, soweit sie zum Volke gehören, meistens ohne Kopfbedeckung auszugehen pflegen, so widmen sie der Pflege ihrer Haare große Sorgfalt. Es klingt kaum glaublich und ist doch tatsächlich wahr, daß man in Süditalien überall Volkshaarkünstlerinnen antrifft, die ihr Gewerbe für fünf Centesimi ausüben, und zwar nicht im Innern der Häuser, sondern unter freiem Himmel auf der Straße. In den Volksvierteln Neapels ist es am Sonnabendnachmittag keine Seltenheit, die dunkeläugigen Frauen eine neben der anderen auf der Straße sitzen und darauf warten zu sehen, daß die Haarkünstlerin ihr tiefschwarzes Kopfhaar in gefällige Formen bringe. Dagegen wird in der Bretagne der Pflege der Haare[S. 324] keine besondere Sorgfalt gewidmet. In den Augen der dortigen Bevölkerung sind Locken geradezu verpönt. Ein junges Mädchen, das durch die Schönheit seiner Haare in Versuchung kommen sollte, nur ein einziges Löckchen unter der festsitzenden kappenartigen Kopfbedeckung hervorsehen zu lassen, würde Gefahr laufen, der Aussicht auf einen Freier verlustig zu gehen; denn die jungen Burschen würden sie für leichtfertig und ihrer Zuneigung nicht würdig erachten. Diese Sitte hat offenbar dazu geführt, daß die bretonischen Frauen und Mädchen, da sie ihr Kopfhaar nicht recht zur Geltung bringen können, es an umherziehende Leute, die sich alljährlich zu den Festen einfinden, verkaufen (Abb. 364). Die Männer dagegen pflegen ihr Haar lang wachsen zu lassen, oft bis über die Schultern herab, eine Sitte, die übrigens schon dem griechischen Satiriker Luzian von den Bretonen bekannt war. Eine besondere Bewandtnis hat es mit den schwarzen Schlapphüten der Männer, wie sie nicht nur in der Bretagne, sondern auch sonst in Frankreich getragen werden. Sie werden nämlich so gebogen, daß sie auf der einen Seite eine in die Höhe stehende Spitze bilden, und unverheiratete junge Männer setzen den Hut nun so auf, daß seine Spitze über dem Ohr zu stehen kommt, während Verheiratete dieselbe nach hinten, Witwer sie nach vorn tragen. Wer diese Sitte kennt, kann daher aus der Art, wie jemand den Hut trägt, leicht erraten, wie es in ehelicher Hinsicht mit ihm bestellt ist.

In Toulouse besteht noch heutzutage der merkwürdige Brauch der Verunstaltung des Schädels durch das beständige Tragen einer festen Kappe von frühester Kindheit an; der Schädel wird dadurch in eine langgezogene Form gedrängt. Einen schädlichen Einfluß auf die geistigen Fähigkeiten übt diese Verunstaltung indessen nicht aus. Sehr verbreitet ist unter den Romanen auch die Unsitte des Tatauierens. In Süditalien herrscht sie besonders im Gebiete[S. 325] von Loreto, wo sich nach dem Volksglauben das von den Engeln dorthin gebrachte Haus der Jungfrau Maria befindet. Zu Ehren der Himmelskönigin lassen sich die Tausende von Besuchern dieses Wallfahrtortes deren Monogramm in die Haut „einschreiben“.
Ebenso wie in körperlicher Hinsicht unterscheiden sich Romanen und Germanen auch in geistiger streng voneinander. Während der Germane ein ernstes, nachsinnendes, gemessenes Wesen zur Schau trägt, viel überlegt, nachdenkt, sich nur langsam und erst durch Vernunftgründe überzeugen läßt und zur Innerlichkeit neigt, zeigt der Romane ein heiteres, leichtlebiges, leidenschaftliches Temperament, begeistert sich schnell für alle Neuerungen, ohne viel zu überlegen, ist sehr leicht bestimmbar und läßt sich gern durch Äußerlichkeiten und Förmlichkeiten beeinflussen. Seine durchschnittliche Bildung steht auf einer viel niedrigeren Stufe als die des Nordeuropäers; es gibt unter den Spaniern und Italienern noch ungemein viel Leute, die weder lesen noch schreiben können. Daher haben in Städten und Dörfern auf Plätzen, in Straßen und vor den Posthaltereien öffentliche Schreiber ihre Buden aufgeschlagen, die einen kleinen Tisch mit Papier, Tinte und Feder enthalten; hier wird der Briefwechsel der Schreibunkundigen erledigt, eingelaufene Briefe ihnen vorgelesen und die Antwort geschrieben. Lebhaften Zuspruch erhalten diese öffentlichen Schreiber auch von Liebenden; über deren Angelegenheiten bewahren sie tiefstes Amtsgeheimnis.
Mit der leichten Erregbarkeit der Südländer hängt auch ihre große Vorliebe für Duelle (Abb. 370) zusammen. Dies gilt schon von Frankreich, noch weit mehr aber von Spanien und Italien. In Frankreich kommt der Zweikampf hauptsächlich unter den oberen Zehntausend vor, besonders unter Offizieren, Leuten, die im öffentlichen Leben stehen, und Journalisten. Sie tragen ihre Streitigkeiten meistens mit dem Florett aus, und zwar sind die Anlässe in der Mehrzahl der Fälle ganz geringfügig, ja lächerlich. Sehr wenige dieser Zweikämpfe endigen mit gefährlichen Verletzungen für die Kämpfenden; ein kleiner Stich mit dem Degen oder ein paar in die Luft abgegebene Schüsse genügen meistens, um die verletzte Ehre wiederherzustellen. Viel häufiger und ernster sind dagegen die Duelle bei den Leuten aus dem Volk auf der italienischen und der spanischen Halbinsel. Hier werden sie meistens mit dem Messer ausgetragen. Nur zu leicht fühlen sich die Südländer in ihrer Ehre verletzt und greifen daher sogleich zum Messer oder zum Revolver. Zahlreiche Kreuze, denen man auf seinen Wanderungen in Italien begegnet, legen davon Zeugnis ab, daß hier ein Mord begangen wurde, und bilden eine stillschweigende Mahnung an die Gesetzlosigkeit, die noch immer im Lande herrscht. Auch Eifersucht spielt bei der Entstehung derartiger Duelle eine große Rolle. Nicht selten ist die Italienerin stolz auf die Wunden, die ein verschmähter Liebhaber ihr im Gesicht beibrachte, um es zu entstellen; sagen sie ihr doch, daß sie imstande ist, Leidenschaften unter den Männern zu einfachen.

Sobald ein Mord begangen ist, flüchtet der Mörder in den nächsten Wald oder ins Gebirge; seine Freunde sorgen dafür, daß er unentdeckt bleibt, und bringen ihm Nahrung. Dagegen machen die Verwandten und Freunde des Ermordeten[S. 326] die größten Anstrengungen, des Angreifers habhaft zu werden und ihn gleichfalls niederzustechen oder, falls ihnen dies nicht gelingt, an seinen nächsten Verwandten Rache zu üben. Es ist dies die bekannte Blutrache, die Vendetta, die oft genug immer weitere Kreise zieht und sich vielfach von Geschlecht zu Geschlecht fortpflanzt. Bisher konnte sie durch keine Macht ausgerottet werden. Die Obrigkeit in Italien hat nicht die Macht, diesem gefährlichen Treiben Einhalt zu tun; das Volk kümmert sich eben nicht um die Gesetze der Regierung und regelt das Unrecht nach ungeschriebenem Sittenkodex. In Süditalien ist es die Kamorra, auf Sizilien die Mafia, die diese Volksgerichtsbarkeit in die Hand genommen haben. Beide Geheimbünde erfreuen sich immer noch eines guten Gedeihens, wenngleich sie dem Namen nach unterdrückt sein sollen. Denn gerade die Polizei, die sie zu Fall bringen sollte, ist ihr bester Freund und Bundesgenosse. Eine einheitliche Organisation besitzen weder die Kamorristen noch die Mafiosen; es bestehen vielmehr in verschiedenen Gemeinden verschiedene Verbände der Kamorra beziehungsweise Mafia, die unabhängig voneinander ihr Gebiet bearbeiten, manchmal aber auch sich gegenseitig befehden. Die Tätigkeit der beiden Geheimbünde ist nach den Örtlichkeiten verschieden, meistens besteht sie in gegenseitiger Selbsthilfe und gelegentlich im Rächen von Unbilden nach dem Faustrecht, aber auch in der Unterstützung unterdrückter, dem Bunde fernstehender Personen. Sie reicht von den niedrigsten bis in die höchsten Schichten hinein, so daß ebensogut die Wahl eines Gemeindedieners wie die eines Parlamentsmitgliedes von diesen Geheimbünden abhängen können, und zwar erstreckt sich ihr Einfluß über mehr als die Hälfte des ganzen Landes. Der feste Glaube, daß sein besonderer Schutzheiliger, dessen Reliquie der Kamorrist oder Mafiose in einem kleinen Beutel um den Hals trägt, ihn vor jeder Kugel der Truppen, die zu seiner Verfolgung ausgesandt werden, behütet, verleiht ihm den zu seinem gefährlichen Handwerk erforderlichen Mut.


Der Südländer mit seinem lebhaften Temperament ist sehr für Spiel und Tanz eingenommen. In Spanien ruft kein Vergnügen größere Freude und Begeisterung hervor, als der Stierkampf, die Corrida. In den Augen des Spaniers ist dies der einzige wissenschaftliche, heldenmütige und gleichzeitig künstlerische Sport. Kein anderes Land der Welt hat einen Sport aufzuweisen, der eine ähnliche Stellung einnimmt oder eine ähnliche Anziehungskraft auf die Bevölkerung ausübt. Er ist in dem Grade dem gesamten Volk gleichsam in Fleisch und Blut übergegangen, daß jeder Bürger mit allen Förmlichkeiten, Gesetzen und Regeln des Spiels — und bei einer Corrida wird ganz planvoll verfahren — vertraut ist, die Fehler, die etwa begangen werden, sogleich erkennt, die Teilnehmer, ganz gleich ob Mensch oder Tier, in ihren Leistungen streng beurteilt und unerschöpflich ist, wenn es gilt, über diesen Gegenstand zu plaudern. Pünktlichkeit kennt der Spanier sonst nicht, aber in Sachen des Stierkampfes läßt er auch hierin nichts zu wünschen übrig; zur festgesetzten Stunde findet er sich zum Stierkampf ein mit einer Pünktlichkeit, die geradezu überrascht. Wenn sich die Uhrzeiger der für die Schaustellung festgesetzten Stunde langsam nähern, dann wird der Stimmenlärm, der bisher in der tausendköpfigen Menge herrschte, beinahe zum Schweigen gebracht; alles ist ganz Ohr und Auge. Mit dem ersten Glockenschlag erscheint der Präsident in Frack und hohem Hut, wie es die Sitte vorschreibt, auf seinem Platze — sollte er nicht zur Stelle sein, dann würde er die Wut der harrenden Menge heraufbeschwören —, setzt sich, wartet einen Augenblick und gibt durch Schwenken eines Tuches das Zeichen zum Anfang. Zunächst erfordert es die Sitte, daß der Chiquero in aller Form eröffnet werde. Zu diesem Zweck erscheinen in dem Bogengang unter dem Platz des Präsidenten zwei vollständig in schwarzen Samt gekleidete, mit Mänteln aus demselben Stoff und mit Federhüten geschmückte Alguaciles auf sich bäumenden Rossen, traben, der eine nach rechts, der andere nach links, im Halbkreise um die Arena herum,[S. 328] bis sie sich auf der entgegengesetzten Seite begegnen, galoppieren darauf wieder zurück und begrüßen den Präsidenten, worauf sie durch die Eingangspforte wieder verschwinden. Einen Augenblick ist die Arena leer, dann treten die Alguaciles am gegenüberliegenden Eingang wieder auf, und mit ihnen vollzieht sich der eindrucksvolle Einmarsch der Kämpfer (Abb. 368). Voran reiten die Alguaciles, dicht hinter ihnen marschieren die drei Matadores nebeneinander, und zwar strenger Vorschrift gemäß in der Rangordnung des Alters (links der älteste). Den rechten Arm haben sie frei; von der linken Schulter hängt ihnen der glänzende Parademantel herab, der rings um die Taille geschlungen wird und dessen Enden von der linken Hand des Trägers auf der Hüfte gehalten werden. Hierauf folgen die Bandilleras in glänzenden Gewändern aus Samt und Seide und dann wieder Berittene, die Picaderos. Hinter ihnen kommen noch die Ringwärter in ihren roten Hemden, die die Aufgabe haben, die Wunden der Pferde mit Werg auszustopfen; sie müssen aber auch die gefallenen Tiere durch Schläge auf die Beine bringen, wenn sie noch imstande sein sollten, einen weiteren Angriff des wütenden Stiers zu ertragen, auch ihre toten Körper an die mit Schellen versehenen Maultiere, die den Nachtrab bilden, anschirren, um sie durch diese hinausschleppen zu lassen. Das Ganze bietet ein recht würdevolles, dabei malerisches und prächtiges Schauspiel und verfehlt nie, die Bewunderung und den lauten Beifall der Zuschauer hervorzurufen. Alle Teilnehmer[S. 330] des Zuges stellen sich gleichfalls vor dem Präsidenten auf und begrüßen ihn durch Aufheben ihrer Gerätschaften. Dieser erwidert ihren Gruß durch Lüften seines Zylinders, worauf sich der Zug verteilt. Die Maultiere aber verschwinden, ebenso die Picaderos bis auf zwei, die gegen die Barriere gelehnt dastehen, in gewisser Entfernung von der Tür, aus der der Stier erscheinen soll. Die Bandilleras und Espadas vertauschen ihre Parademäntel mit ausgebleichten, blutbefleckten roten und gelben Umhängen; die ersteren vertrauen sie guten Freunden unter den Zuschauern an. Ein Trompetenstoß ruft dann einen der Alguaciles herbei, der den Schlüssel zum Tor, den der Präsident herabwirft, mit seinem federngeschmückten Hut auffängt und einem alten Wärter übergibt, während er sich selbst in Sicherheit bringt. Der alte Bediente öffnet das Toril und tritt zur Seite. Tiefes Schweigen tritt jetzt ein. Der Stier erscheint, galoppiert in die Arena, wittert die seiner wartenden Picaderos und stellt sich so, als wolle er einen jeden von ihnen beim Vorbeistürmen angreifen. Dabei versetzen ihm die Picaderos einen leichten Stoß. Der Stier wird dadurch wütend gemacht, schnauft ärgerlich, scharrt die Erde auf und geht schließlich mit gesenktem Kopf auf einen der Reiter zu. Erst wenn ihm mindestens zwei Pferde zum Opfer gefallen sind, treten die Bandilleras in Tätigkeit, um den Stier dadurch in noch größere Wut zu versetzen, daß sie ihm eine Reihe mit Widerhaken versehener Lanzen in den sehnigen Nacken stoßen. So geschmückt, tritt der Stier nun einem Espada oder Matador gegenüber (Abb. 369), der ihn dazu verleitet, wiederholt einen Anlauf auf ihn zu nehmen. Sodann hebt er das Heft seines Schwertes in gleiche Höhe mit seinem Auge und zielt vorsichtig auf eine bestimmte Stelle des Stieres, der auf ihn losstürmt und in das Schwert bis an das Heft hineinläuft. In demselben Augenblick springt der Espada zur Seite, der Stier taumelt und fällt mit einem Krach auf den Boden. Der tote Körper wird an das schon erwähnte Maultierpaar gespannt und im Galopp hinausbefördert. Frischer Sand wird über die Blutlache gestreut, und die Trompeten verkünden die Wiederholung des grauenerregenden Schauspiels. Dem Espada aber, der dem Stier den Garaus gemacht hat, wird mächtige Begeisterung gezollt; je mehr Erfolge er aufzuweisen hat, um so mehr steigt er in der Achtung aller, besonders aber der Frauen, die geradezu einen Kultus mit ihm treiben und ihn beinahe vergöttern. Für den Nordeuropäer aber ist es nicht faßlich, daß Kulturmenschen an einem so widerwärtigen Vorgang, wie die Corrida es ist, Gefallen finden können; doch sind die Stierkämpfe nun einmal eine althergebrachte Leidenschaft des ganzen spanischen Volkes und werden es auch immer bleiben.



Auch Frankreich kennt Stierkämpfe; so finden solche in der Stadt Arles statt, aber hier sind es nicht wie bei der spanischen Corrida blutrünstige Metzeleien, an denen das Volk seine Freude hat, sondern die heiteren naiven Spiele, in denen die Gewandtheit des Menschen gegen die Stärke des Stiers zum Auftrag gebracht wird. Der Kämpfende muß nämlich dem Stier eine Kokarde, die er zwischen den Hörnern trägt, fortzureißen versuchen.
In Italien huldigt man mit Vorliebe dem Glückspiel. Dieser Sport ist über die ganze Halbinsel verbreitet und bildet die Haupteinnahmequelle für den Staat. Jede Woche finden in allen bedeutenderen Städten Lotterieziehungen statt, so daß für die Italiener, die schon seit Jahrhunderten einem süßen Nichtstun ergeben sind, das Spiel das sicherste Mittel ist, um noch immer ärmer zu werden. Die Gewinnaussichten sind nämlich recht gering, da die Regierung den Löwenanteil an den Einnahmen nimmt, indem sie den Wert der Gewinne nie den dritten Teil der Summe übersteigen läßt, die sich nach den Gesetzen der Wahrscheinlichkeitsrechnung aus den Einnahmen ergibt; auf diese Weise bringt sie es fertig, sich eine dauernde, freiwillig gespeiste Geldquelle zu verschaffen. Denn das Volk ist auf das Spielen, wie gesagt, rein versessen. Bei der Auswahl der zu spielenden Nummern spricht der Aberglaube viel mit. Das in Italien am meisten gelesene Buch ist das Traumbuch, eine alte, alphabetisch angeordnete[S. 331] Liste von Wörtern, deren jedem eine aufs Geratewohl zwischen eins und neunzig ausgewählte Zahl zugeordnet ist. Irgendein Ereignis oder ein Traum, der auf eins der dort verzeichneten Wörter anspielt, gibt den Ausschlag für die damit verbundene Zahl, und diese wird zur Nummer des zu spielenden Lotterieloses. Auch die Mönche werden nicht selten um Nennung einer glückbringenden[S. 332] Nummer angesprochen. Da sie in großem Ansehen stehen und auch eine gewisse Bildung besitzen, so meint das abergläubische Volk, daß sie auch mit der Gabe ausgestattet seien, vorauszusehen, welches Schicksal einem bevorsteht, was ein Traum bedeutet, welche Nummern in der Lotterie Erfolg haben werden und so fort. Es kann unter Umständen auch geschehen, daß ein solcher „Onkel“ Mönch, wenn er sich weigert, Auskunft zu erteilen, unbarmherzig durchgeprügelt wird.

Unter keinem Himmelstrich Europas bringt das Volk dem Tanzen so lebhaftes Interesse entgegen wie in Italien und vor allem in Spanien. Hier ist wieder Andalusien, wo die Herzen am raschesten schlagen und die Liebe am wildesten auflodert, entschieden das Wiegenland der spanischen Tänze, denn an dieser Stätte sind eine ganze Reihe derselben entstanden, und von hier aus haben sie sich nicht nur Spanien, sondern einzelne die ganze Welt erobert. Der älteste spanische Tanz, der Fandango, ist ein urechtes Kind des sonnigen Andalusiens, in dem die ganze Liebessehnsucht und Leidenschaft der Tanzenden zum Ausdruck kommt. „Ein getanztes Bekenntnis der Liebe“ hat man einmal den Fandango treffend genannt. Der spanische Tanz, mag er nun Fandango oder Cachucha, Bolero, Malequeña, Seguidilla oder sonstwie heißen, ist nämlich fast immer eine anmutig durchgeführte Pantomime, in der die Liebessehnsucht, Werbung, Erhörung oder Ablehnung zum Ausdruck kommen. Die einschmeichelnden Töne, die den Saiten der Gitarre, des Nationalinstrumentes der Spanier, entlockt werden, und der melodische Gesang, der sie begleitet, verleihen den spanischen Tänzen erst den vollen Reiz; alle drei sind unzertrennbar miteinander verbunden zu einem harmonischen Ganzen.
Der Süditaliener hat seine Tarantella (Abb. 371), einen Tanz, der gleichfalls der Erotik[S. 333] nicht entbehrt, aber hinsichtlich der Inbrunst, mit der er getanzt wird, wohl kaum dem Fandango gleichkommen dürfte. Für gewöhnlich schlagen die Tanzenden mit einem Tamburin den Takt dazu, während Musikanten mit der Gitarre oder dem Dudelsack die Begleitung spielen. Das lebhafte Temperament der Südländer kommt so recht in ihrer ausgelassenen Karnevalfeier zum Ausdruck (Abb. 367).

Alle Südeuropäer sind in hohem Grade strenge Anhänger der katholischen Kirche, der sie leidenschaftlich ergeben sind. Im besonderen gilt dies für die Spanier, unter denen sich der Katholizismus des allergrößten Ansehens erfreut. Nirgends in Europa begegnet man daher so viel Geistlichen, Ordensgesellschaften (Mönchen und Nonnen), Kirchen, Klöstern und Prozessionen, nirgends einem solchen Einfluß der alleinseligmachenden Kirche wie in Frankreich, Spanien und Italien. Der Reliquiendienst, desgleichen der Glaube an Wundertaten treibt hier besonders reiche Blüten. Mit großer Regelmäßigkeit wiederholen sich die Wunder in dieser oder jener Stadt. Die Grotte zu Lourdes ist bekannt. Sie hat dem Erscheinen der Jungfrau Maria ihr Entstehen zu verdanken; alljährlich pilgern viele Tausende von Kranken aus aller Herren Ländern nach dieser Wundergrotte, um Heilung von ihren Gebresten zu finden (Abb. 375 und 394). In Neapel fließt das geronnene Blut des heiligen Januarius alle Jahre an einem bestimmten Tage und zieht gleichfalls Hunderttausende von frommen Menschen an, die dieses Wunder mit eigenen Augen zu schauen begehren. Sankt Nikolaus in Bari besitzt ein Wunderknie, aus dem dauernd Wasser rieselt, das man in kleinen Gefäßen auffängt und im ganzen Lande als unfehlbares Mittel gegen alle möglichen Krankheiten,[S. 334] sogar gegen gebrochene Beine, verkauft. Und so ließen sich noch viele andere Stätten aufzählen, deren Besuch bei dem Gläubigen Wunder wirken soll.
Prozessionen (Abb. 374, 376, 378, 379 und 397) nach solchen Orten finden beständig statt. Aber nicht nur zu solchen Wunderstätten veranstaltet man feierliche Umzüge, sondern noch zu zahlreichen anderen heiligen Plätzen, Kirchen, Klöstern, Kreuzen und so weiter, die irgendwie mit einem der Heiligen in Beziehung stehen. Aus der Zahl der Heiligenbilder, die solche Stätten zieren, aus der Menge der Opfergaben, die dort hängen — sie bestehen aus verschiedenartigen Gegenständen, für gewöhnlich aus der Nachbildung eines einzelnen Körperteiles, der durch die wundertätige Vermittlung des besonderen Heiligen von seinem Schaden befreit wurde —, und aus der Anhäufung von Geldspenden kann man auf die Volkstümlichkeit eines Heiligen Schlüsse ziehen.


In der Bretagne wird an der Westküste, wo der Sardinenfang blüht, am Morgen des Sankt-Anna-Tages (26. Juli) die Fischerei gesegnet (Abb. 373). Zu diesem Zwecke begibt sich die Geistlichkeit unter Vorantragung von Kreuz und Heiligenbannern in feierlichem Zuge von der Kapelle Notre-Dame de L’Armor (Unsere liebe Frau zur See) zum Strand und schifft sich hier in Boote ein. Diese fahren etwa zwei bis drei Seemeilen hinaus, wo ihnen die Boote von L’Orient und anderen Küstenplätzen zu Hunderten entgegenkommen. Wenn alle Boote einen Kreis gebildet haben, dessen Mitte die Fahrzeuge der Priester einnehmen, wird von diesen der Segen gesprochen. — Gerade in der Bretagne haben sich noch zahlreiche andere[S. 336] fromme Gebräuche erhalten, die mit der Vergebung der Sünden in Verbindung stehen und Anlaß zu bemerkenswerten Volksfesten geben. Fast jede Kirche im Innern des Landes soll unter der Obhut eines Schutzpatrons stehen, der im Gegensatz zu den für den betreffenden Ort unwirksamen Heiligtümern der übrigen Kirchen nach dem Glauben des Volkes und den Lehren der Priester die Macht besitzt, Vergebung der Sünden zu erwirken. Manche dieser Heiligen sind berühmt wegen ihrer Fähigkeit, den Männern besonderen Schutz zu verleihen, andere wieder nehmen sich der Frauen und Kinder an, während einer von ihnen, Sankt Kornelius, das Vieh unter seine besondere Obhut genommen hat. Sein Vergebungsfest wird in der kleinen Kirche von Sankt Nicholas zusammen mit dem des heiligen Nikodemus gefeiert. Diese Vergebung findet alljährlich am ersten Sonnabend des Monats August statt; jeder Besitzer von Vieh bringt das seinige dorthin, so daß die Wiesen um die Kirche von Herden gleichsam übersät erscheinen. Die Segnung der Tiere geschieht in der Weise, daß der Priester mit verschiedenen Reliquien des Heiligen das Vieh berührt (Abb. 381). Darauf treibt jeder Eigentümer seine Tiere wieder nach Hause, in dem sicheren Glauben, daß sie im kommenden Jahre von Krankheit nicht heimgesucht werden können und reiche Nachkommenschaft haben werden. — In Italien ist der heilige Antonius Schutzpatron des Viehs. An seinem Festtage sucht der Geistliche alle Tiere in Haus und Hof auf, segnet sie und feit sie gegen Krankheiten und Unglücksfälle im kommenden Jahre. Bei derselben Gelegenheit werden auch Felder und Ernte gesegnet, um sie im besonderen gegen Hagelschlag und Heuschrecken zu schützen.

[S. 337]
Der religiöse Zug, der die Mehrzahl der Feste bei den romanischen Völkern auszeichnet, beeinträchtigt keineswegs ihren Frohsinn; besonders die Spanier sind wahre Vergnügungskünstler. Von Januar bis Dezember werden überall im Lande zahlreiche Ferias oder Fiestas gefeiert; von Nationalfesten allein besitzen sie wohl einige Dutzend. Dem Neujahrstage wird nicht viel Bedeutung beigelegt; die erste große Festlichkeit im neuen Jahre fällt vielmehr auf den 6. Januar. Die höheren Kreise feiern diesen Tag nach althergebrachtem Brauch, indem ihre Mitglieder sich gegenseitig besuchen und Karten austauschen, während die Armen sich von den Anstrengungen des Vorabends erholen, an dem sie die Ankunft der heiligen drei Könige erwarteten und sich vergnügten. Der nationale Karneval erstreckt sich über mehrere Februartage; die Bevölkerung des ganzen Landes feiert ihn auf der Straße, läuft in Masken umher, hält in den Theatern glänzende Bälle ab, wirft auf den Straßen Papierschlangen und Konfetti in ungeheuren Mengen und vergnügt sich vom frühen Morgen bis in die Nacht hinein. — Der Sankt-José-Tag (19. März) ist immer ein wichtiges Ereignis, denn dieser Heilige erfreut sich in ganz Spanien einer ungewöhnlichen Volkstümlichkeit. Man schickt an diesem Tage Geschenke, die in Blumen, Süßigkeiten und Karten bestehen, an Personen beiderlei Geschlechts, die den Namen des Heiligen führen. In Valencia herrscht die Sitte, am Sankt-José-Tage inmitten der Straßen Katafalke aus Leinwand und Holz aufzubauen und auf diese Figuren zu stellen, die die wichtigsten politischen Ereignisse des Jahres in scherzhafter Weise zur Darstellung bringen (Abb. 382).

Der Palmsonntag (Abb. 377) gibt Veranlassung zu einer allgemeinen religiösen Feier,[S. 338] ebenso zeichnen sich alle übrigen Tage der Karwoche durch eindrucksvolle Gottesdienste und Feierlichkeiten (Abb. 384) aus. Alles trägt in diesen Tagen schwarze Gewänder. Jede geschäftliche Tätigkeit außer der allernotwendigsten unterbleibt am Karfreitag und auch am vorangehenden Donnerstag; der Handel in den Straßen der großen Städte ist unterbrochen und ein feierliches Schweigen liegt über dem ganzen Lande. Am Gründonnerstag wäscht die Königin zur Erinnerung an die Fußwaschung der Jünger durch den Heiland einigen Armen, die sich zu diesem Zwecke im Palast zu Madrid einfinden, die Füße und macht am Nachmittag einen feierlichen Rundgang durch die Kirchen der Stadt. Der Karfreitag ist in jeder spanischen Stadt der Tag großartiger Umzüge (Abb. 383) durch die Straßen. Vielleicht am berühmtesten von allen solchen Veranstaltungen in der ganzen Welt sind die Umzüge von Sevilla (Abb. 380) wegen der großartigen Pracht, die dabei entfaltet wird, und der Schönheit sowie Kostbarkeit der sogenannten Pasos, geschnitzter Bildwerkgruppen, durch die einzelne Ereignisse aus der Leidensgeschichte Christi dargestellt werden. Sie werden unter großer Beteiligung von seiten der Mitglieder zahlreicher Brüderschaften, Orden und Gilden, die in lange schwarze, braune oder auch weiße Büßergewänder gehüllt und mit hohen Spitzmützen bedeckt sind, durch die Straße getragen; jede Brüderschaft begleitet den ihr gehörigen Paso. Das volkstümlichste Schauspiel nach dieser Richtung bietet die Gilde der Zigarettenmacher, deren Mitglied der König ist, und die Macarenos, die sich am Ostersonntag auf dem Stierkampfplatz in ihrem profanen Berufe zeigen. Ihre Pasos, für gewöhnlich der eine den gekreuzigten Christus, der andere die Mutter Gottes darstellend, werden auf blumenbekränzten Sänften getragen; sie sind von terrassenförmig aufsteigenden Kerzenreihen beleuchtet und von einem kostbaren Baldachin aus schwarzem Samt überdacht.

Auch Italien kennt solche Brüderschaften, die zusammen mit der Geistlichkeit, wenn irgendein heiliges Fest gefeiert wird, die Umzüge begleiten und die Standbilder der Heiligen in der Stadt umhertragen. Auch sie pflegen in ähnlicher Weise vom Kopf bis zu Fuß mit einem schwarzen Domino nebst Kappe bekleidet zu sein. Nebenbei betätigen sie sich meistens auch noch auf dem Gebiete der öffentlichen Wohltätigkeit, begleiten unter anderem die Begräbnisse oder nehmen sich, wie die Brüder der „Misericordia“ in Florenz, der auf der Straße Verunglückten an (Abb. 386).
Himmelfahrtstag und Fronleichnam (Korpus-Christi-Tag) werden in allen spanischen Städten gleichfalls aufs festlichste begangen. Der 1. und 2. November sind die Tage, an denen [S. 340]jeder Spanier dem Friedhof — bienenwabenähnlich angeordnete Nischen in hohen Mauern, die die Särge aufnehmen und dann zugemauert werden — seinen Jahresbesuch abstattet und Blumenschmuck sowie Totenkränze an den an der Außenwand dicht nebeneinander angebrachten Tafeln aufhängt. Heiligabend und Weihnachten bilden die letzten Festtage des an solchen überaus reichen spanischen Jahres. Den ersteren feiert man auf den Straßen, den Weihnachtstag selbst dagegen zu Hause. Am 24. Dezember begibt sich ganz Spanien auf den Markt; die Erwachsenen holen ihren Vorrat an Puten, Backwerk und Obst ein, der am anderen Tage zu Hause verzehrt wird, während die Kinder von Reichen und Armen sich einen Nacimiento kaufen, das ist eine Darstellung der Geburt Christi aus Pappe oder Terrakotta, die dann beleuchtet wird. Tannenbäume, Weihnachtskrippen und Geschenke sind dem spanischen Volke fremd. — Italien dagegen kennt Weihnachtskrippen. In Neapel kommen zur Weihnachtszeit ländliche Musikanten aus den benachbarten Bergen zusammen und spielen vor den Krippen (Abb. 372 und 389).

Der Franzose kennt Weihnachtsbräuche im allgemeinen nicht; nur in den wohlhabenderen Familien von Paris bürgert sich die Sitte des deutschen Weihnachtsbaumes mit seinem Lichterglanz mehr und mehr ein. Das einzige, was von der Heiligkeit des Weihnachtsfestes Zeugnis ablegt, ist die Mitternachtsmesse, die man um zwölf Uhr nachts in der Kirche abhält. Familienfestlichkeiten gibt es gar nicht. Früher speiste man wohl gemeinsam zu Hause, ehe man sich zur Messe begab; jetzt aber wird dieser „Reveillon“ mehr in die Wirtshäuser verlegt und hat dadurch das in den Familien ihm etwa noch anhaftende Stimmungsvolle gänzlich[S. 341] verloren. — Auch in Frankreich kennt man bestimmte Gerichte für das Weihnachtsmahl: getrüffelte Pute auf der Tafel der Reichen, geröstete schwarze Blutwurst auf dem Tische der ärmeren Klassen. Man beschenkt nur die Kinder, aber diese Freude wird ihnen nicht am Heiligen Abend, wie es bei uns zumeist üblich ist, zuteil, sondern erst am anderen Morgen. Vor dem Schlafengehen stellen sie ihre Pantöffelchen in den Kamin und finden sie beim Erwachen mit allerlei Spielsachen und Süßigkeiten vom Weihnachtsengel (le petit Noël), der hier die Stelle unseres Weihnachtsmannes oder Knechts Ruprecht vertritt, angefüllt. Im übrigen verläuft Weihnachten für die Kleinen sang- und klanglos; dazu kommt, daß es für sie keine Weihnachtsferien gibt: am 24. nachmittags wird die Schule geschlossen, und am 26. haben sich die Kinder schon wieder zum Unterricht einzufinden, da die Franzosen einen zweiten Weihnachtsfeiertag nicht kennen.
Eine charakteristische Erscheinung in Frankreich ist der Weihnachts- beziehungsweise Neujahrsmarkt, der vom 20. Dezember bis zum 5. Januar abgehalten wird (les baraques genannt), eine Art Jahrmarktsrummel, auf dem wie bei uns aus ähnlichem Anlaß in marktschreierischer Weise alle möglichen Sachen, vor allem Kinderspielzeug, das in scherzhafter Weise auf die in- und ausländische Politik anspielt, ausgeboten wird und alle möglichen Dinge gegen Geld öffentlich zu sehen sind. Neujahr ist dann der Tag, an dem sich die Erwachsenen in Frankreich beschenken. Diese Etrennes bereiten den Franzosen sehr bedeutende Ausgaben, denn die Zahl derer, die auf sie Anspruch machen, ist eine recht beträchtliche. Nicht nur die Mitglieder der Familie, Verwandte und Freunde werden mit einem Geschenk bedacht, sondern auch das[S. 342] ganze Heer von Untergebenen und sonstigen Leuten, die im Hause zu tun haben, die man aber sonst überhaupt nicht zu sehen bekommt, also die Dienstboten, der Pförtner, der im Pariser Hause eine sehr wichtige Rolle spielt, Briefträger, Zeitungsjunge, Laufburschen, Wäscherinnen, Friseur und noch manche andere. Es leuchtet ein, daß diese Trinkgelder eine ganz stattliche Höhe erreichen müssen, denn ausschließen kann man sich von ihnen nicht gut, weil die Sitte sie einmal vorschreibt. — Während die Pariser Weihnacht unseren deutschen Silvesterabend an Straßenlärm wohl noch bedeutend übertrifft, insofern hier die wildeste Ausgelassenheit bis zum hellen Morgen herrscht, unterscheidet sich die Pariser Silvesternacht keineswegs von den übrigen Nächten des Jahres. Man kommt nicht zusammen, trinkt keinen Punsch, ißt keine Pfannkuchen, gießt kein Blei, bringt kein Hoch auf das neue Jahr aus und lärmt nicht auf der Straße; die Nacht verläuft vollständig ruhig, alles bereitet sich anscheinend auf den folgenden Tag vor, der große Anforderungen an den Geldbeutel stellt.
In Süditalien ist vielfach noch der Weihnachtsbrauch des Ceppo üblich. In der Heiligen Nacht legt man feierlich auf den Herd des Hauses einen großen Holzklotz, zündet ihn an und läßt ihn mehrere Nächte hindurch brennen. Offenbar ist diese Sitte gleichbedeutend mit dem nordischen Julblock und höchstwahrscheinlich in weit zurückliegenden Zeiten durch Einwanderer germanischer Herkunft hierhin verpflanzt worden. Das Volk bezeichnet Weihnachten häufiger mit Feste del Ceppo (Fest des Holzblockes) als mit Natale (Geburtsfest des Herrn).


Die Karwoche und Ostern werden in Italien in ähnlicher Weise gefeiert wie überall in den südeuropäischen Ländern (Abbildung 385 und 395). Am[S. 344] Vorabend vor Ostern spielt sich in Florenz ein ganz eigenartiger Vorgang ab. Auf dem Platz vor der Kirche wird ein aufgeputzter Wagen aufgestellt und mit dem Hochaltar der Kirche durch einen Draht verbunden. An diesem Draht läßt man eine hölzerne Taube mit einer Rakete entlangfliegen, die der Geistliche am Hochaltar anzündet. Diese hat die Aufgabe, das auf dem Wagen befindliche Feuerwerk in Brand zu setzen. Gelingt dies beim ersten Versuch, dann bricht die versammelte Menge, die meistens aus Landleuten besteht, in laute Jubelrufe aus, weil sie darin einen göttlichen Hinweis erblickt, daß eine gute Ernte zu erwarten stehe; verfehlt die Taube aber ihr Ziel und ist sie nicht imstande, das Feuerwerk anzuzünden, dann verlassen die Zuschauer niedergeschlagen und enttäuscht den Platz, in dem Glauben, daß die Ernte dieses Jahres schlecht ausfallen werde.

Auf Sizilien, besonders in dem Städtchen Prizzi, finden am Palmsonntag Aufzüge statt, die den Einzug Christi in Jerusalem zur Darstellung bringen. Einer der Geistlichen stellt Christus vor; er reitet auf einer reich mit Blumen geschmückten Eselin, neben der ein Füllen einhertrabt, wie die Überlieferung es berichtet. Ihm folgen als die zwölf Apostel ebensoviel Geistliche mit Palmzweigen in den Händen; einer von ihnen stellt Judas dar und ist an einer Laterne als solcher kenntlich, die er in der Hand hält. An die Priester schließt sich eine große Volksmenge an; alles trägt Palm- oder Ölzweige. Am Tor der Stadt begrüßt der Bürgermeister den Zug und führt das Reittier Christi am Zügel weiter bis zum Altar der Kirche. Hier wird der Zug von dem Hosianna des Chors empfangen, worauf Christus absteigt und das Zeichen zur Palmenweihe gibt. Die gesegneten Zweige nimmt man nach Hause mit und befestigt sie hier als[S. 345] Abwehrmittel gegen alle möglichen bösen Einflüsse. — Die Stadt San Remo in Norditalien hat das Vorrecht, am Palmsonntag Palmzweige nach Rom zu senden.

In Neapel bietet Pfingsten (Pentecoste oder vom Volke lieber L’altra Pasqua, das zweite Ostern, oder auch Pasqua dei fiori, Blumenostern, genannt) Anlaß zu einem großartigen Pilgerzug, der sich am Pfingstnachmittag vom Monte Vergine zur Stadt ergießt. Schon am vorangehenden Donnerstag sind die Pilger zum Berge hinaufgestiegen, haben hier zu der braunen Madonna gebetet, reichlich der Kirche geopfert und sind in jeder Weise fromm gewesen. Nach drei Tagen kehren sie zurück, machen aber keineswegs den Eindruck von Büßenden im Pilgergewand und mit Pilgerstab, sondern von überaus lustigen Gesellen. Unter Gesang, Evvivarufen und Schreien, begleitet von den Tönen der Mandoline und Gitarre sowie dem Schall von Pfeifen, Trommeln und anderen Lärminstrumenten, bekränzt mit Blumengirlanden, die einen auf Karren, die anderen im Ein- oder Zweispänner oder auch[S. 346] in vornehmen Vierspännern, andere wieder hoch zu Roß — so erscheinen sie am Pfingstnachmittage in der Stadt, wo die zurückgebliebenen Neapolitaner, aufs festlichste geschmückt, sie mit Jubel begrüßen.


In Neapel, wie überhaupt in den Städten unter der Sonne Süditaliens, wo das Leben sich leidenschaftlicher und lauter abspielt, kennt man zur Sommerszeit eine ganze Reihe von Festen, die im Juni beginnen und fast ununterbrochen bis in den September hinein andauern. Jede der hundert Kirchen Neapels feiert in dieser Zeit ihr besonderes Fest. Dann verwandeln sich die Straßen in der nächsten Umgebung der betreffenden Kirche für einige Tage gleichsam in Festsäle mit Fahnen, Girlanden, Teppichen, Lampions, Kandelabern und bunten Lämpchen; Musikbanden lassen ihre Weisen ertönen, und am Abend knallt und sprüht das Feuerwerk; natürlich wird dabei auch dem Wein tüchtig zugesprochen. Ebenso ist es in anderen Städten. Das großartigste aller dieser Feste ist das des heiligen Paulinus oder der tanzenden Türme zu Nola, das zur Erinnerung an weit zurückliegende Zeiten begangen wird, als der Vandalenkönig Geiserich mit seinen Scharen Italien überflutete und der Bischof Paulinus im Jahre 460 aus der Gefangenschaft dieses Fürsten mit seinen Nolanern in die Heimat zurückkehrte. Schon Tags zuvor strömen die Pilger zu Tausenden zusammen und harren auf den Straßen, den Balkonen und den Dächern des eigenartigen Schauspiels. Auf dem Markte hat[S. 347] man nämlich auf einer festen Unterlage Türme aus Fachwerk errichtet, die die größten Häuser überragen; sie bestehen aus mehreren Stockwerken, von denen die unteren mit Teppichen und Gemälden (Szenen aus dem Leben des Heiligen) geschmückt sind, auch eine Rampe für Musikanten tragen, die übrigen bis oben hinauf mit Säulen, Standbildern und allerlei Zierat aus farbigem Stuck bekleidet sind; das Ganze wird von der lebensgroßen Figur eines Engels oder des Heiligen gekrönt (Abb. 387). Diese Türme sollen die „Lilien“ und andere Blumen des Sankt Paulinus bedeuten, die man in früheren Jahrhunderten bei den Prozessionen trug, mit der Zeit aber ins Ungeheure vergrößerte, indem einer mit dem anderen wetteiferte, die Pyramiden immer reicher auszuschmücken. Zu diesen „Giglii“ (Lilien) tritt nun noch des weiteren in der Mitte des Platzes ein mächtiges, bewimpeltes Schiff mit schwellenden Segeln, das ebenfalls auf einem Balkenwerk ruht und das Fahrzeug vorstellen soll, auf dem Paulinus der Heimat zueilte. An Stelle des Bischofs trägt es aber an Bord einen pechschwarzen, orientalisch gekleideten Mohrenkönig. Die Hauptsache bei der Feier des Paulinusfestes ist aber der Tanz dieser Türme. Zahlreiche kräftige Leute kommen mit Hebebäumen heran und heben die schwere Last samt dem ganzen Aufbau und der darauf sitzenden Musikbande hoch. Das eine Turmpaar bewegt sich auf das gegenüberstehende zu, dann wieder zurück; dasselbe tut das andere Paar, darauf gehen beide gleichzeitig aufeinander zu, drehen sich nach rechts und links, ziehen aneinander vorbei und kehren wieder auf ihren Stand zurück, alles geradeso wie bei unserem Kontertanz. Nachdem das Schiff schließlich noch einige Male um den Marktplatz gezogen worden ist, wiederholt sich das ganze Schauspiel noch verschiedene Male, wohl zwei Stunden lang; dabei sind die[S. 348] Beteiligten unermüdlich, denn Ermattung kennt der Italiener nicht, zumal wenn der tobende Beifall der Menge seinen Mut und Ehrgeiz immer von neuem anspornt. Hieran schließt sich dann eine Prozession rings um den Marktplatz unter einem Regen von Blumen und Konfetti. Ist diese Feierlichkeit vorüber, dann bedeckt sich der ganze Platz mit allerhand Buden, in denen man Heiligenbilder, Zuckerwerk, Obst und besonders Schnüre von gerösteten Kastanien und Haselnüssen feilbietet. Den Abschluß bilden, wie gewöhnlich, ein prächtiges Feuerwerk, Tanz und Musik. Auch fehlt an einem solchen Abend eine dem italienischen Volke eigentümliche Art von Stegreifgesängen, die Canti a figliuole, nicht; es sind dies Rezitative, die mit einem hohen Tone einsetzen und sich durch ein bis zwei Oktaven chromatisch hindurchwinden, um in einem langgehaltenen Grundton auszuklingen. Für gewöhnlich singen die jungen Burschen solche Canti, um ihren Mädchen aus der Ferne allerlei Liebes mitzuteilen, weswegen sie auch die Bezeichnung Canti a figliuole (Mädchenlieder) führen. Am Paulinusabend nun teilen sich die Sänger in zwei Parteien und besingen in edlem Wettstreit die Taten der Heiligen oder die Ereignisse des Tages in dieser Form, wobei sie sich in freien Erfindungen und kühnen Witzen zu überbieten suchen.
In Siena findet an zwei Tagen im Jahre, Mariä Heimsuchung und Mariä Himmelfahrt, auf dem Marktplatz zwischen den Vertretern von zehn Stadtbezirken ein sonderbares Wettrennen, der Palio, statt, bei dem der Siegespreis in einem seidenen, mit dem Bilde der Madonna geschmückten Banner besteht. Natürlich strömt zu diesem Schauspiel, bei dem die Abgeordneten der einzelnen Bezirke die Tracht des dreizehnten und vierzehnten Jahrhunderts in hellleuchtenden Farben tragen, eine vieltausendköpfige Menge zusammen. Unter Glockengeläute ziehen diese Vertreter zunächst in ihre Bezirkskirchen, um dort den Jockei und sein Pferd — es sind keineswegs Rennpferde an dem Wettrennen beteiligt, sondern gewöhnliche Arbeitspferde — vor dem Altar durch den Priester weihen zu lassen. Aus dem Verhalten der Rosinante wird vielfach schon der Erfolg vorausgesagt; wenn das Tier bei der Weihe scheu zurückfährt, was wohl meistens der Fall sein dürfte, sobald der Priester ihm plötzlich mit dem Weihwedel vors Gesicht fährt, dann sieht die Menge dies als gutes Vorzeichen an und bricht in endlosen Jubel aus. Von den Kirchen ziehen die Vertreter der Bezirke durch die Stadt auf den Festplatz; der heißersehnte Siegespreis, das Madonnenbanner, wird unter Trompetenschall auf einem von vier Pferden gezogenen altertümlichen Karren dorthin gefahren; den Schluß des Zuges bildet ein bunter Schwarm mittelalterlich gekleideter Gestalten. Das farbenprächtige Bild, das die Zuschauer in vergangene Zeiten versetzt, zumal Siena selbst mit seinen gut erhaltenen alten Bauten diese Vorstellung noch verstärkt, ruft den Jubel der Menge hervor, die an den Straßen, auf den mit Teppichen und Blumen geschmückten Balkonen und Tribünen sich angestaut hat. Der Beifall steigt aufs höchste, wenn der Zug auf dem Markt angekommen ist, die Jockeis im Rathause verschwinden, um ihre malerische Tracht mit einem einfachen Leinenkittel zu vertauschen, und bald darauf ein Kanonenschuß den Beginn der wilden Jagd (Abb. 393) anzeigt. Denn eine solche ist es in der Tat, die auf einer schmalen Rennbahn zwischen Tribünen und Häusern anhebt. Sie enthält eine Reihe von Hindernissen, das größte an der Ecke von San Martino ganz nahe beim Turm des Rathauses. Hier hat man an Stelle der Tribünen Matratzen aufgestellt, um die herabstürzenden Reiter nach Möglichkeit vor lebensgefährlichen Unfällen zu bewahren. Denn bei dem dreimaligen Durchreiten der Bahn auf ungesatteltem Pferde pflegt regelmäßig der eine oder andere Reiter oder auch eines der Pferde hinzustürzen. Dessenungeachtet rast man dahin und sucht die armen Gäule durch Knüttel noch anzuspornen. Mit stürmischem Evvivarufen und Hutschwenken wird der Sieger begrüßt und auf Händen im Triumph zu den Preisrichtern getragen, um den Siegespreis in Empfang zu nehmen und mit[S. 350] ihm in die Kirche zu ziehen, wo er der Madonna dafür zu danken hat. Die Mitglieder des betreffenden Bezirks aber feiern dieses frohe Ereignis noch ein bis zwei Wochen lang.


In Venedig bildet das Erlöserfest ein gleichfalls großartiges Schauspiel. Schon wochenlang vorher beginnt das Volk in freudiger Erwartung eifrig mit seinen Vorbereitungen. Am dritten Sonnabend des Juli nimmt das Fest dann seinen Anfang. Nachdem Glockengeläute seinen Beginn angekündigt hat, setzt sich die Bevölkerung von ganz Venedig nach der Insel Giudecca in Bewegung, wo sich die Kirche mit der Statue des Redemtore befindet, um hier zu beten und zu feiern. Das zweite scheint dabei die Hauptsache zu sein; denn um die Basilika herum sind viele Buden aufgeschlagen, und unter dem Sternendach der Julinacht entwickelt sich hier ein wirkliches Jahrmarkttreiben mit Musik, Tanz, Osterien, Garküchen, Seiltänzern, Menagerien und vielen anderen Lustbarkeiten. Zahllose Barken nähern sich aus den vielen Seitenkanälen dem Festplatze und fahren vor ihm auf und ab oder legen sich vor Anker; es sind dies aber nicht jene schwarzen, unheimlichen Gondeln, wie sie Venedig sonst nur kennt, sondern schwimmende Baldachine, Lauben aus Lorbeer- und Myrtenzweigen oder auch Weinranken, ferner Zelte aus bunter Seide und Musselin, alles lebhaft prangend im Schmuck der purpurnen Granat- und safranfarbigen Oleanderblüten und phantastisch beleuchtet von farbigen Glaslampions. In ihnen sitzen die vornehmen Patrizier der Lagunenstadt um kristallgedeckte Tische beim leckeren Mahl und perlenden Schaumwein. In bescheideneren, mit armseligen Papierlaternen geschmückten Gondeln erfreuen sich die Ärmeren aus dem Volke an einem Laib Polenta,[S. 351] aber alles ist ausgelassen lustig und singt unter Begleitung zahlreicher Musikbanden, die ihre Weisen auf dem Wasser ertönen lassen. Die Stimmung wächst um Mitternacht und erreicht ihren Höhepunkt in den ersten Morgenstunden, bis die Glocke die dritte Stunde verkündigt. Wie mit einem Schlage verstummen jetzt Musik, Singen, Lachen, Becherklang und Lärm. Die Fröhlichkeit ist verflogen und an ihre Stelle die graue Nüchternheit und tiefe Buße getreten. Sowie der letzte Glockenschlag verhallt ist, setzen die Boote sich schleunigst nach der Düne des Lido zu in Bewegung, wo bereits Tausende von Menschen, die soeben noch der ausgelassensten Fröhlichkeit hingegeben waren, in ernster Stimmung darauf warten, daß die Sonne sich goldig aus der Meeresflut erhebe. Ein Jubelschrei entringt sich allen Lippen bei ihrem Erscheinen, und die zahllose Menge sinkt andächtig in die Knie, um sich vor der majestätischen Naturerscheinung zu beugen und zu beten.

Daß eine religiöse Feier für die Romanen ohne gleichzeitige Lustbarkeit kaum denkbar ist, wie die angeführten Beispiele zur Genüge zeigen, liegt in dem Charakter dieser Völker. Ihre Religiosität ist auch keine tiefgehende, innerliche, sondern trotz sorgsamer Pflege durch die Kirche und ihre Diener meist eine nur äußerliche. Dafür spricht auch der Umstand, daß alle diese Nationen trotz ihrer Frömmigkeit noch tief im Aberglauben stecken; in Frankreich und Spanien sind vorgeschichtliche Steindenkmäler verschiedentlich noch Gegenstand abergläubischer Verehrung (Abb. 388). Die Furcht vor bösen Geistern, Hexen und anderen mißgünstigen Wesen ist überall in Stadt und Land verbreitet. In Italien ist es bekanntlich vor allem die Furcht vor dem bösen Blick, von dessen Einfluß das Volk in allen seinen Schichten fest überzeugt ist. Es dürfte in den romanischen Ländern wohl[S. 352] kaum einen Menschen geben, und zwar nicht allein unter dem niederen Volke, der nicht irgendein Amulett, sei es das Bildnis eines Heiligen oder irgendein anderer Gegenstand, bei sich trägt oder gegen eine ihm drohende Gefahr schnell die sogenannte Fica oder Feige macht, das heißt seine Hand nach der Seite, von woher ihm ein vermeintliches Unglück naht, oder nach der betreffenden Person ausstreckt und dabei den kleinen und den Zeigefinger vorhält, während die übrigen Finger eingeschlagen bleiben.

Besonders Kinder glaubt das Volk am leichtesten dem Einfluß der bösen Mächte ausgesetzt; um diesen abzuwehren oder wieder unschädlich zu machen, kennt es zahlreiche Mittel. Am beliebtesten ist das schon geschilderte Entgegenhalten der Hand, das übrigens schon von den alten Römern als Abwehrmaßregel geübt wurde; ferner kommen als solche Mittel noch in Betracht das Umhängen von Amuletten (kleine Nachbildungen der „Feige“ in Gold, Silber, Blei oder, was besonders wirksam sein soll, in roter Koralle, aus denselben Stoffen hergestellte figürliche Darstellungen von Sirenen, das sind Weiber mit Fischschwanz, kleine Hörner, Phalli, Türkise, Perlen und manches andere der Art) um den Hals der Kleinen, das Anbringen von großen Kuhhörnern an der Tür oder vor dem Hause, das Anspeien der Kinder in dem Augenblick, wo man annimmt, daß sie vom bösen Blick betroffen worden sind, und dergleichen (Abb. 391). Auch die sonst besonders bei den slawischen Völkern sehr verbreitete Furcht vor bösen Hexen, Zauberern, Druden und anderen dämonischen Wesen, die dem Kinde ein Leid antun, es wohl auch gegen einen sogenannten Wechselbalg eintauschen, spukt im italienischen Volke. Allgemein [S. 354]ist der Aberglaube, daß eine solche Hexe von dem Kinde Besitz ergreifen könne, wenn man seine Wäsche in der Nacht zum Trocknen draußen hängen läßt. Daher pflegt die italienische Mutter diese sorgsam vor Einbrechen der Dunkelheit hereinzuholen. Unterläßt sie diese Vorsichtsmaßregel, dann kann sie den Zauber dadurch wieder lösen, daß sie die Wäsche erst am anderen Tage hereinnimmt, nachdem sie tüchtig der Sonne ausgesetzt worden ist. Auch die kleinen Kinder, die über das Ave-Maria-Läuten hinaus im Freien bleiben, fallen nach dem Volksglauben den Hexen leicht zum Opfer. — In der Bretagne hängt man den Neugeborenen, um sie gegen Zauberei zu schützen, geweihtes Brot um den Hals oder steckt ihnen solches in den Ärmel, muß aber jeden Tag neues Brot dazu nehmen.


In Frankreich pflegen sich Schwangere einen Gürtel um den Leib zu binden, der von derselben Länge (zwei Meter) sein muß, wie ihn die Jungfrau Maria getragen haben soll, als sie sich in gesegneten Leibesumständen befand. In Quintin schenken, wie berichtet wird, die Ursulinerinnen ihren verheirateten ehemaligen Schülerinnen, wenn diese in andere Umstände gekommen sind, solche Gürtel mit frommen Inschriften zur Erleichterung der Geburt, und in der Kirche zu Saint-Germain-des-Prés soll es seit langem Brauch sein, den dort befindlichen Gürtel der heiligen Margarete zu dem gleichen Zweck an Frauen, die Mutterfreuden entgegensehen, auszuleihen. — In Spanien sind ziemlich dieselben Abwehrmaßregeln wie in Italien üblich.


Die Hochzeitsgebräuche sind in den großen Städten ziemlich die gleichen wie anderwärts in solchen Nordeuropas, aber in der „Provinz“ zeigen sie noch manche anziehende Besonderheiten. In Paris kommt wohl nur noch ganz vereinzelt die Sitte vor, daß beim Hochzeitsmahl ein Junge unter den Tisch kriecht und der jungen Frau heimlich das Strumpfband löst, das dann zerschnitten und unter die Gäste verteilt wird. Die Regel dürfte es heutzutage[S. 355] bilden, daß die Neuvermählte dem Knaben eine Anzahl bereits zugeschnittener Strumpfbänder in die Hand drückt. Am meisten haben sich noch in der Bretagne von den Vätern überkommene Sitten und Gewohnheiten erhalten, darunter auch verschiedentlich solche, die die Hochzeit betreffen. Ein solcher Brauch ist das „Suchen der Braut“. Wenn der Bräutigam sich in der Wohnung seiner Auserwählten einfindet, um sie in die Kirche zu führen, findet er zunächst das Haus verschlossen. Ist es ihm durch vieles Bitten gelungen, endlich Eintritt zu erhalten, dann führt man ihm nacheinander verschiedene junge Mädchen vor und gibt diese als seine Braut aus.[S. 356] Darauf beginnt er im Hause die richtige zu suchen, indem er alle Winkel durchstöbert; die jungen Burschen unter den Gästen sind ihm dabei behilflich. Derjenige, der sie erhascht, raubt ihr für gewöhnlich einen Kuß und erhält noch eine Tasse Kaffee oder eine andere Gabe zum Lohn. Nach der Trauung findet von neuem eine Trennung der jungen Eheleute statt; der Bräutigam geht mit seinen Angehörigen, die Braut mit den ihrigen nach Hause, und beide Parteien speisen für sich. Erst nach dem Mahl kommen sie wieder zusammen und tanzen bis zum Abend. Bevor die jungen Eheleute sich nun zurückziehen, überreichen die Burschen der jungen Frau einen Blumenstrauß nebst einem Kuchen und singen dabei ein Lied, das ihr ihre Pflichten als Hausfrau und Mutter vorhält. Nach jeder Strophe trinkt man auf ihr Wohl; alle Anwesenden tun Bescheid, indem sie gleichzeitig ein Bein und einen Arm heben. Ein diesem Brautsuchen ähnlicher Brauch besteht im Bourdonnais. Auch hier kommen der Bräutigam und seine Burschen zunächst vor verschlossenen Türen an. Sie preisen in Versen die schönen Geschenke, die sie mitbringen, finden aber seitens der Braut und der Brautjungfern vorläufig keine Erhörung. Erst wenn die jungen Leute draußen singen: „Einen jungen Burschen bringen wir euch auch“, öffnet sich das Tor. Aber die Mädchen haben sich inzwischen unter ein Tuch versteckt, und es ist nun Sache des Bräutigams, seine Braut zu erraten und die Hand auf sie zu legen, sonst wird sie den ganzen Abend von ihm ferngehalten. Am nächsten Tage wartet man auf die Neuvermählten, bis sie aus der Kirche kommen, und überreicht ihnen eine Schüssel Suppe, von der sie zum Zeichen ihrer nunmehrigen Gemeinschaft mit demselben Löffel kosten müssen; boshafte Gesellen sollen manchmal Pfeffer hineintun. Am Tage nach der Hochzeit „wird der Kohl gepflanzt“. Die jungen Leute setzen einen mit Blumen geschmückten Kohlkopf auf den Dachgiebel; die eine Hälfte von ihnen läuft mit einem langen Strick, dessen anderes Ende an den Kohlkopf gebunden ist, den[S. 357] unter den Hochzeitsgästen befindlichen Mädchen nach und sucht sie, soweit die Länge des Strickes es erlaubt, einzufangen. Wer nicht beizeiten davonlaufen kann, wird unter das Dach geführt und von den Kohlwächtern auf dem Dache mit Wasser begossen.
Im südlichen Teil der Bretagne, wo sich noch manche alte Hochzeitsbräuche erhalten haben (Abb. 392), wird vor dem Hochzeitshause ein Maibaum gepflanzt, sein Stamm mit dürrem Reisig umgeben und das Ganze angezündet, wenn das Brautpaar aus der Kirche kommt. Sobald die Flamme zu erlöschen droht, schießen die jungen Burschen hinein. Setzt die Flamme daraufhin aus, dann will dies besagen, daß die junge Frau es an Geduld und Pünktlichkeit in ihrer Wirtschaft fehlen lassen wird. Der Maibaum bleibt bis zur Taufe des Erstgeborenen stehen. Zu Plougastel pflegen sich mehrere Brautpaare zusammenzutun, um an einem Tage gemeinsam die Hochzeit zu feiern (Abb. 390). — Im Departement Orne besteht der sonderbare Brauch, daß der junge Mann nicht an der Festmahlzeit teilnimmt, sondern die Gesellschaft zu bedienen hat, während man alle Ehren nur der Frau erweist. Vielleicht ist dies ein Überrest des Matriarchats der Vorzeit.

Natürlich geht es überall auf Hochzeiten lustig zu. Fiedel und Dudelsack begleiten den Zug der Gäste nach und von der Kirche und spielen bei dem Mahle, das meistens recht reichlich ausfällt, und dem darauffolgenden Tanze auf. In der Normandie vereinigt man sich sogar am[S. 358] Sonntag nach der Hochzeit wieder, um noch einmal mit den Neuvermählten lustig zu sein. Im Departement Orne nennt man dies „die Katze peitschen“ oder „das Bettstroh der Schwiegertochter essen“. — In Arles pflegen sich die Hochzeitsgäste zu Pferde einzufinden, und zwar für gewöhnlich ein junges Paar auf einem und demselben Pferd; vorn reitet der junge Mann und hinter ihm sitzt, ihn fest umklammernd, sein Mädchen auf einer Art Sattelkissen (Abb. 360).
In Berry werden am Schluß des Hochzeitsfestes alle Frauen nebeneinander gestellt; man zieht ihnen Schuh und Strümpfe aus und bedeckt alle mit einem großen Tuche, das nur die Beine unverhüllt läßt. Darauf muß der junge Ehemann, dem sie den Rücken zukehren, unter ihnen seine Frau heraussuchen.

Zum Schluß wollen wir noch des Heiratsmarktes zu Ecaussines-Lélaing in Südfrankreich gedenken. Früher war es hier Sitte, daß die jungen Burschen dem von ihnen verehrten Mädchen in der Walpurgisnacht eine grüne Birke, den Maibaum, mitunter mit der Inschrift „Honneur à la jeunesse“ (Ehre der Jugend), vor das Haus pflanzten, um dadurch ihre Zuneigung zu erkennen zu geben. Zum Zeichen, daß der Jüngling ihm genehm sei, lud das Mädchen ihn nebst seinen Freunden dann zu Kaffee und Kuchen ein. Dieser schöne Brauch geriet allmählich in Vergessenheit, und damit nahm auch die Heiratslust der jungen Männer ab. Um diesem Übelstande abzuhelfen, hat man seit einer Reihe von Jahren einen Heiratsmarkt eingerichtet, der am zweiten Pfingstfeiertage abgehalten wird. Die jungen Burschen kommen dazu in großen Scharen zusammen und werden von den Mädchen bewirtet; man plaudert, scherzt, schäkert, singt und tanzt, und die dabei angeknüpften Bekanntschaften pflegen sich auch meistens zur Heirat zu verdichten.

[S. 360]
In Spanien, im besonderen in Valencia und Andalusien, ist als Werbeversuch noch die Serenade sehr beliebt. Der Liebhaber erscheint spät abends in Begleitung zweier Musikanten unter dem Balkon seiner Angebeteten und bekennt ihr seine Liebe durch den Mund eines Trovador, der sehr geschickt darin ist, Liebeslieder aus dem Stegreif abzufassen und vorzutragen. Nach vielem Bitten läßt sich das junge Mädchen endlich bewegen, anscheinend widerwillig auf dem Balkon zu erscheinen, um dem Bewerber eine Blume aus ihrem Haar hinabzuwerfen, als Zeichen, daß sie ihm gewogen sei. Dies alles ist aber nur Spiel, denn der Liebhaber hat bereits lange vor dieser öffentlichen Werbung die Zusage der Eltern und des Mädchens erhalten. — Wenn die Eltern der Auserwählten dem Freier ihre Einwilligung etwa hartnäckig verweigern sollten, dann wählt dieser ein durchgreifendes Mittel, indem er die Hilfe der Obrigkeit anruft. Der Alkalde in seiner Staatsuniform fährt bei den Eltern vor und fragt den Vater in seiner amtlichen Eigenschaft, ob er gewillt sei, seine Tochter dem Betreffenden zur Frau zu geben, vorausgesetzt, daß keine Gründe ernsterer Natur dagegen vorliegen. Beharrt der Vater trotzdem noch weiter auf seiner Weigerung, dann nimmt der Alkalde die Tochter einfach mit sich und bringt sie bis zur Hochzeit in einer angesehenen Familie unter. — In Kastilien trägt die Braut bei der Hochzeit eine weiße Blume an der Brust, in Andalusien einen Kranz von Nelken und roten Rosen im Haar. In Cadix kennt man keine Trauringe, die verheiratete Frau unterscheidet man dadurch von den unverheirateten Mädchen, daß jene rechts im Haar stets eine Blume trägt. — In der Umgebung von Madrid besteht ein ganz eigentümlicher Hochzeitsbrauch. Am Tage der Hochzeit stellen sich zwei Burschen vor der Haustüre der angehenden Frau auf und fangen, wenn sich genügend Volk versammelt hat, einen Wortwechsel über die Fehler und Mängel der Braut auf der einen Seite, ihre Tugenden und Vorzüge auf der anderen an; sie können dabei unter Umständen so in Erregung geraten, daß sie schließlich einander beschimpfen und selbst handgemein werden.

In Italien zeichnet sich das Liebesleben noch heute wie schon einst im alten Rom (siehe die Kunstbeilage) durch große Leidenschaftlichkeit aus. Die Werbung wird entweder von dem Jüngling persönlich vorgebracht oder der Vater tut dies für ihn. In der Regel müssen daraufhin die jungen Leute sich erst einige Zeit lang näher kennen lernen, ehe die Verlobung gefeiert wird, um zu erfahren, ob sie zueinander passen. Der Bräutigam pflegt seine Auserwählte mit allerlei Schmucksachen, Süßigkeiten und anderen Gegenständen zu beschenken. Eine Schere darf aber nie darunter sein, weil darin eine Anspielung auf eine scharfe Zunge erblickt werden könnte (nicht, wie bei uns, eine Hindeutung auf das „zerschnittene Tischtuch“ = Abbruch der Beziehungen), ebensowenig ein Kamm, weil Kämme gern von Hexen benutzt werden. In Toskana verlangt der gute Ruf des Mädchens, daß es niemals vor der Hochzeit das Haus des Bräutigams betritt, nicht einmal in dessen Nähe kommt und auf seinen Spaziergängen sogar einen Umweg um dasselbe[S. 361] macht. In Venedig ist es kostspielig, die Rolle des Brautführers zu übernehmen, und nur ein wohlhabender Bursche kann sich diese Ehre leisten. Er muß nämlich bereits am Tage vor der Hochzeit der Braut eine Schachtel mit Süßigkeiten senden, auf deren Deckel ein Wickelkind in Zucker angebracht ist, dazu zwei Blumensträuße, einen natürlichen und einen künstlichen, und Schmucksachen (Brosche oder Ohrringe). Am Hochzeitstage muß er für die Getränke beim Mahle sorgen, vier Kerzen für die Hochzeitsmesse anschaffen, vier Gondeln mieten, auf denen die Teilnehmer zum Gasthause gefahren werden, schließlich unter die Kinder und Bettler, die beim Austritt aus der Kirche Hochrufe auf die Neuvermählten ausbringen, Münzen verteilen; seine eine Hand ist beständig in der Tasche.

In den verschiedensten Gegenden Italiens wird der Brautzug von den jungen Burschen des Dorfes aufgehalten, meistens durch ein Band, das die Braut mit einer Schere durchschneiden muß, oft aber auch durch einen ordentlichen Verhau, den die das Paar begleitenden jungen Leute dann wegräumen müssen. Das Brautpaar zahlt den es aufhaltenden Jünglingen ein Sühnegeld, wofür diese es manchmal auch freihalten. — In Sardinien wird der Bräutigam, wenn er zur Verlobungsfeier eintrifft, in ein Zimmer geführt, wo möglichst viele Mädchen in einer Reihe nebeneinander sitzen, alle schweigsam und gemessen, ohne seinen Gruß zu erwidern. Der Brautvater führt ihn von einer der Schönen zur anderen und fragt ihn vor jeder: „Ist das etwa Euer Schaf?“ — der für den jungen Mann werbende Vater hat nämlich vorher erklärt, er suche das schönste und beste Schäfchen, das ihm aus der Herde verloren gegangen sei —, bis man zu der richtigen kommt und der Bewerber hier schließlich die Antwort gibt: „Ja, das ist es.“ In einigen Teilen der Insel gießt die Schwiegermutter[S. 362] ein Glas Wasser vor dem jungen Paar aus, wenn es die Schwelle der Hochzeitskammer überschreitet; offenbar soll damit ein Hindernis für böse Geister geschaffen werden, die in der Nacht die jungen Leute stören könnten.
Die Begräbnisgebräuche der südeuropäischen Völker weichen von denen der nordeuropäischen Länder wenig ab; im allgemeinen pflegt aber mehr Pomp entfaltet zu werden als bei uns; besonders in ländlichen Gegenden sind die Begräbnisse in dieser Hinsicht anziehend und malerisch. Die Kränze und Kreuze, die man den Toten aufs Grab legt, werden in Frankreich mit Vorliebe aus galvanisiertem Draht hergestellt, schwarz, weiß oder malvenfarbig angestrichen und mit Blumen aus gleichfalls angemaltem Blech oder mit Perlen geschmückt (Abb. 396). Eine besondere Eigentümlichkeit in französischen Gegenden ist die Sitte, in dem Grabstein eine kleine Vertiefung ausmeißeln, darin das Bild des Verstorbenen in verschiedener Ausführung, manchmal sogar in feinster Miniaturmalerei auf Elfenbein, anbringen und das Ganze mit einem Glasdeckel überdecken zu lassen. Schließlich sei noch auf den in Frankreich herrschenden Brauch hingewiesen, die Grabstätten nicht für lange Zeiten an die Angehörigen zu verkaufen, wie dies bei uns der Fall ist, sondern sie für ganz kurze Fristen nur zu verpachten. Wenn dann die Pacht abgelaufen ist, werden die Leichen ausgegraben und die Stätte von neuem verpachtet, damit andere auf ihr beerdigt werden können. Oft pflegt man nach solcher Ausgrabung die Särge mit den Gebeinen in einer Ecke des Friedhofes aufzuhäufen; vielfach aber schichtet man auch Schädel und Gebeine in sogenannten Beinhäusern zu vielen Tausenden übereinander, zündet vor ihnen heilige Kerzen an und läßt Seelenmessen abhalten.

[S. 363]

Die slawischen Völker nehmen, ganz allgemein betrachtet, den Osten Europas ein, also das europäische Rußland (über 73 Prozent seiner Bevölkerung sind Slawen) mit Ausnahme der nördlichen und südlichen Gebiete, wo nichtslawische Elemente, zum Beispiel die Samojeden, Lappen, Finnen, Esten, Tawasten, Tataren, Rumänen und andere Stämme ansässig geworden sind, ferner einen beträchtlichen Teil der österreichisch-ungarischen Monarchie, bis über die Donau hinaus, und die sich hieran anschließenden Strecken der Balkanhalbinsel, endlich kleine Enklaven in Deutschland. Man unterscheidet sprachlich unter ihnen drei große Gruppen: die Ost-, West- und Südslawen. Zu den ersteren zählen die Bewohner des russischen Reiches, die wiederum in Großrussen oder Moskowiter (größter Teil des Reiches), Weißrussen (westliches Rußland) und Kleinrussen (von Ostungarn und Galizien an bis zum Don: Ruthenen, Huzulen) zerfallen; die zweite Gruppe umfaßt die Tschechen mit den Slowaken in Böhmen, Mähren und Nordungarn, die Polen in Galizien und Schlesien, die Kaschuben in Hinterpommern und Westpreußen, die Slowinzen am Lebasee, die Wenden oder Sorben im Spreewalde; die Südslawen endlich setzen sich aus den Serben und Kroaten — der Unterschied zwischen beiden beruht ausschließlich auf der verschiedenen Konfession — einschließlich der Bosnier und Herzegowiner, den Montenegrinern, den Slowenen und den Bulgaren der Balkanhalbinsel sowie der nördlich und westlich angrenzenden Gebiete zusammen.
Von einem einheitlichen anthropologischen Typus der Slawen kann man nicht[S. 364] sprechen; der Grund hierfür liegt in den vielfachen Kreuzungen zwischen den ursprünglich wohl allein im Osten ansässig gewesenen Vertretern des alpinen Typus mit den zahlreichen Völkern und Rassenelementen, die im Laufe von Jahrtausenden teils von Nordwesten nach Südosten (germanische Stämme), teils in umgekehrter Richtung (Finnen, Mongolen, Türken) Osteuropa überfluteten. Man trifft dementsprechend unter den Slawen Leute an, die germanischen Einschlag zeigen (Polen mit vorwiegend blondem Haar, blauen oder grauen Augen und heller Gesichtsfarbe), und anderseits auch wieder solche, die deutlich mittelasiatische Herkunft verraten. Im allgemeinen kann man die Behauptung aufstellen, daß der durchschnittliche Typus des Slawen mehr Annäherung nach Osten (Asien) als nach Westen (Europa) zeigt.


Die Tracht der slawischen Völker ist keine einheitliche, die der Männer einförmiger und dunkler, die der Frauen mannigfaltiger und farbenprächtiger. Trotz oft ziemlich bunter Farben verstehen die slawischen Frauen es doch, sich recht geschmackvoll zu kleiden; besonders ihre Oberkleider sind reich mit Stickereien in ansprechenden Mustern verziert (Abb. 400, 402, 403 und 405). Die Tracht der Russen ist eine ziemlich gleichmäßige im ganzen Lande. Die der Männer besteht aus Pluderhosen, langen Schaftstiefeln und einem mit silbernen oder goldenen Besätzen bestickten Kaftan in Grün oder Dunkelrot, die der Frauen in dem anschließenden, meist bestickten Saraffan und einer eigenartigen Kopfbedeckung, dem Kokoschnik (Abb. 408). Die Tracht der übrigen Slawenvölker im einzelnen zu schildern, ist bei ihrer überaus großen Mannigfaltigkeit nicht möglich; ihre Darstellung im Bilde möge einen Begriff von der Verschiedenartigkeit in der Form und der Art der Verzierung [S. 366]der Gewänder geben. — In Bosnien bringen die Frauen nicht selten Tatauierungen auf den Armen an.

Die Slawen sind ein tanz-, gesang- und liederfrohes Volk (Abb. 420). Verschiedentlich, besonders in Bosnien, durchziehen noch heutzutage Sänger das Land, um nach Art der alten Barden in halb singendem, halb rezitierendem Ton die Heldentaten der Väter zu preisen (Abb. 401). — In wenigen Ländern dürfte auch das Tanzen eine solche Verbreitung gefunden haben, wie in den slawischen und vor allem in Rußland. Lieder melancholischen Charakters werden fast ausschließlich gesungen, hingegen solche heiteren Inhalts durch Tänze begleitet. Urplötzlich springt einer aus dem Chor auf, ein zweiter, dritter und noch andere folgen, und schließlich tanzt die ganze Gesellschaft unter dem einförmigen Klang der Ziehharmonika in merkwürdigen Verrenkungen (Abb. 410). Der russische Tanz besteht nämlich in einem Wechsel von Kniebeugen und Vorwärtsschleudern der Beine. Die Frauen nehmen daran nur geringen Anteil, insofern sie an der Hand ihres Tänzers ruhig dahinschweben, also die Sprünge der Männer nicht mitmachen. Bei den Kleinrussen ist der Tanz durch viel größere Grazie ausgezeichnet; die Liebeswerbung liegt ihm zugrunde: das begehrte Weib macht von seiner freien Entschließung Gebrauch, indem es bald diesem, bald jenem Tänzer folgt. — Die Südslawen haben als Nationaltanz den Kolo, einen Reigentanz, bei dem die Teilnehmer eine geschlossene Kette bilden (Abbildung 416). Unter stetem Gesang der Tanzenden setzt sich der Kreis in Bewegung, langsam und mehr schwermütig beginnend, dann schneller und lustiger werdend und schließlich in einen leidenschaftlichen Wirbel ausklingend. Natürlich kommen hierbei die verzehrende Sehnsucht und die glühende Leidenschaft so recht zum Ausdruck. Die Serben kennen noch einen besonderen Kriegstanz, bei dem sie mit Schwertern in der Luft umherfuchteln.






Ihrem Glauben nach bekennen sich die meisten Slawen zur griechisch-orthodoxen Kirche (Abb. 406 und 407); nur Tschechen, Polen, Kroaten und die Slawen Deutschlands sind Anhänger [S. 368]der katholischen Kirche. Unter den Letztgenannten gibt es auch Evangelische. — Zahlreich sind die Feste, die das slawische Volk feiert. Beginnen wir mit einer Schilderung der wichtigsten russischen Feste und Feiertage. Ihre große Zahl beginnt mit dem Feste der Wasserweihe (Abb. 409) am Erscheinungsfest, dem 6. Januar. Die Bevölkerung der an einer Wasserstraße, und sei es auch nur ein Gebirgsbach, gelegenen Gebiete strömt an diesem Tage festlich gekleidet zusammen. Am Flusse hat man eine Brücke oder Rampe in diesen hineingebaut und mit Blumen, Teppichen, Fahnen und so weiter ausgeschmückt. Begleitet von den Spitzen der Behörden, den Offizieren in Paradeuniform — in Petersburg nimmt auch der Zar mit dem gesamten Hofstaat an der Feier teil — und zahlreichen Bürgern des Ortes, begibt sich die gesamte Geistlichkeit, angetan mit ihren reichsten, von Gold strotzenden Gewändern, zum Flusse, wobei ein griechisches Kreuz auf einer langen Stange vorangetragen wird. Nachdem ein Tauflied gesungen worden ist, taucht der höchste geistliche Würdenträger das Kreuz am Ende der Brücke dreimal in die Fluten und besprengt die Umstehenden mit einem Weihwedel, den er ins Wasser getaucht hat. Die Frauen füllen sodann die mitgebrachten Krüge mit dem geweihten Wasser, um es das ganze Jahr lang aufzubewahren und teils zum Einfüllen in die Weihwasserbecken, teils zum Austreiben von allerlei Krankheiten und Gebrechen zu verwenden. In den ländlichen Bezirken endet die Wasserweihe mit einem größeren Volksfest, bei dem gegessen, getrunken und getanzt wird. — Unsere Fastnacht findet in Rußland ihr Gegenstück in der Masljanza oder Butterwoche, der Zeit ausgelassener Freude. Für die Unterhaltung des Volkes sorgen Jahrmärkte mit den üblichen Buden und sonstigem Zubehör; besonders in Moskau sind diese auf dem „Jungfernfeld“ stattfindenden Veranstaltungen zu einer Berühmtheit geworden. In den Familien feiert man die[S. 369] Butterwoche durch festliche Zusammenkünfte, zu denen man die Verwandten und Bekannten auf „Blini“ einladet. Blini sind Pfannkuchen, die mit zerlassener Butter, saurer Sahne und Kaviar genossen werden und ein Meisterstück der Hausfrau darstellen. — Die siebenwöchige Fastenzeit, die sich an die Butterwoche anschließt, wird in Rußland im allgemeinen ziemlich strenge innegehalten. Im Innern des Zarenreiches sind während dieser Zeit sogar geräuschvolle Vergnügungen und Tanz gänzlich verpönt. Mit dem Palmsonntag, der die letzte Fastenwoche einleitet, beginnt überall vollständige Ruhe einzuziehen. Besonders feierlich wird der Gründonnerstag begangen, vornehmlich in den beiden Hauptstädten. Hier spielt sich in den Hauptkirchen die Zeremonie des Fußwaschens in größter Feierlichkeit vor einer Kopf an Kopf gedrängten Menge ab. Mitten im Schiff des Gotteshauses ist eine Rampe errichtet, auf der zwölf Archimandriten Platz nehmen; mit ihren langen wallenden Bärten und bis auf die Schulter herabhängenden Locken machen sie ganz den Eindruck von Patriarchen der ersten christlichen Zeit. Unter den ergreifenden Gesängen der Domsänger vollzieht der Metropolit an jedem von ihnen die Fußwaschung in einem silbernen Becken. Nach der Feierlichkeit sucht jeder der Kirchenbesucher seine brennende Kerze noch flammend nach Hause zu bringen, denn wer sein Heim mit der unverlöschten Flamme erreicht, hat Glück und Segen im kommenden Jahre. Es gewährt einen drolligen Anblick, wie groß und klein auf der Straße sich bemüht, seine Kerze vor dem Erlöschen zu schützen. Am Karfreitag sind die Kaufläden und Auslagen nicht wie bei uns geschlossen, sondern es drängen sich im Gegenteil auf den Märkten und Plätzen die Leute an die massenhaft aufgespeicherten Lebensmittel, um sich für die Feiertage vorzusehen. In der Nacht vom Sonnabend der Karwoche zum Ostersonntag strömt alles wieder in die Kirchen, die buchstäblich bis auf den letzten Platz angefüllt sind, und wartet auf den Glockenschlag zwölf, wo der Geistliche aller Welt das „Christos woskress“, Christus ist auferstanden, verkündet. In Petersburg gestaltet sich dieser[S. 370] Augenblick ganz besonders feierlich und erhebend. Sobald der Priester die frohe Botschaft verkündet hat, stimmt der Domchor den Lobgesang an; Tausende von Kerzen erhellen plötzlich das Düster des Gotteshauses — jeder hat die mitgebrachte Kerze angezündet —, alle Glocken läuten, und die Peter-Pauls-Festung feuert einen Salut von hundert Schüssen. In der Kirche und auf der Straße pflanzt sich der Ruf „Christus ist auferstanden“ durch Tausende und aber Tausende von Kehlen fort; ein jeder antwortet darauf mit „Woistinje woskress“, Er ist wahrhaftig auferstanden, und besiegelt diese Wahrheit durch einen dreimaligen Kußwechsel (Abb. 411). Kein Mensch darf sich diesem Osterkuß entziehen, ob alt oder jung, ob reich oder arm, ob vornehm oder gering, alles küßt sich, selbst der Zar seine niedrigsten Soldaten. Alle Rang- und Klassenunterschiede sind in diesem Augenblick weggewischt, ein wirklicher Freudentaumel hat die ganze Bevölkerung ergriffen. Vor dem Hochaltar oder auch auf den Stufen vor der Kirche haben inzwischen die Gläubigen ihre Bündel geöffnet und die Osterspeisen ausgepackt, damit sie der Geistliche segne. Für gewöhnlich sind dies die Kulitsch, der hohe, unserem Napfkuchen ähnelnde Kuchen, die Pascha, eine Art Käsekuchen mit Rosinen, und die gefärbten Ostereier, die bei wohl allen slawischen Stämmen sich großer Beliebtheit erfreuen und mit schönen Zeichnungen versehen werden; durch den Reichtum und die vollendete Kunstfertigkeit ihrer Bemalung zeichnen sich die Ostereier der Huzulen und Slowaken, auch die der Wenden aus. In den Häusern der Vornehmen auf dem Lande setzt die Hausfrau ihren ganzen Stolz darein, einen prächtigen Ostertisch mit den eben genannten Speisen, wozu natürlich noch Kaviar und alle möglichen geistigen Getränke kommen, herzurichten und durch Ausschmückung mit Blumen in eine Art Gewächshaus zu verwandeln. Der Pope segnet hier gleichfalls die Speisen und besprengt auch das übrige Haus, ja sogar die Tiere mit Weihwasser. Das Gesinde, das der Feier beigewohnt hat, findet sich darauf mit prächtig bemalten Ostereiern bei der Herrschaft ein und tauscht sie gegen weniger schöne um. Natürlich besiegelt alles diesen Austausch mit einem Kuß. Die festlich gekleideten Burschen und Mädchen ziehen dann noch die Dorfstraße entlang und entbieten allen, die ihnen begegnen, den Ostergruß, den sie außerdem noch in die Häuser hineinrufen. Den übrigen Teil des Tages entschädigt sich alles durch tolle Ausgelassenheit für das siebenwöchige Fasten, wobei ähnliche Lustbarkeiten wie in der Butterwoche stattfinden (Abb. 404). Auf dem Lande haben sich auch noch allerlei abergläubische[S. 372] Gebräuche erhalten. Um ein paar Beispiele anzuführen, so wäscht man sich in der Frühe mit dem geweihten Wasser das Gesicht, um sich dadurch gegen Hautkrankheiten zu schützen, oder trinkt es wohl auch, um gegen allerlei Gebrechen gefeit zu sein. An dem gedeckten Ostertisch nimmt man niemals sitzend, sondern nur stehend seine Mahlzeit ein. — Acht Tage nach Ostern ist die „Krasnaja gorka“, das „rote Berglein“; an diesem Tage steigt die Jugend auf die sonnenbeschienenen Hügel und begrüßt mit frohen Liedern den Frühling. Am 9. Mai findet Mikula, das Fest des Wundertäters Nikolas, statt. Daran schließt sich der „Namenstag der feuchten Mutter Erde“ an, an dem die Zauberinnen, die wohl in keinem russischen Dorfe fehlen, unter Hersagen feierlicher Formeln zum erstenmal im Jahre auf die Suche nach heilkräftigen Kräutern gehen. Weiter folgt dann der Semik (das heißt der siebente Donnerstag nach Ostern), der Tag der Mädchenfreundschaften. An ihm zieht die weibliche Jugend, festlich gekleidet, in den Wald, flicht Kränze, tauscht Küsse aus und schließt Freundschaften für das ganze Leben. Die Kränze werden schließlich noch ins Wasser geworfen, um aus ihrem Verhalten in diesem einen Schluß auf die Zukunft zu ziehen. Den Dorfschönen, deren Kranz oben auf dem Wasser weiterschwimmt, steht in Bälde die Heirat in Aussicht; hingegen diejenigen, deren Kranz untersinkt, kommen noch nicht unter die Haube oder werden, falls sie doch heiraten sollten,[S. 374] schon frühzeitig Witwe werden. So gehen die Feste weiter bis zum Peter-Pauls-Tag, mit dem sie vorläufig ihr Ende finden; denn mit diesem Tage beginnt die Straba, die Arbeitszeit, die Zeit der Ernte (Abb. 421) und der Bestellung der Wintersaat.



Mit dem Weihnachtsfest beginnt dann ein neues Feiern. Die Sitte, einen Christbaum auszuputzen und anzuzünden, sowie die Familie und die Hausgenossen zu beschenken, hat in Rußland schon vielfach Eingang gefunden, selbst der Knecht Ruprecht stellt sich um diese Zeit ein, und zwar als „Weihnachtsgroßväterchen“. In manchen Gegenden Rußlands läßt man am Heiligen Abend einen Platz bei der Festmahlzeit unbesetzt für ungebetene Gäste, weil man annimmt, daß unter den Wanderern, die an diesem Abend möglicherweise um Nachtlager und Speise vorsprechen, sich der Herr Jesus in Verkleidung befinden könnte. Die Sage berichtet nämlich, daß in einzelnen Fällen solche Gäste von der Landstraße am anderen Morgen verschwunden waren, ohne daß die Tür oder das Fenster geöffnet wurde. Im allgemeinen ist Weihnachten in Rußland bei weitem nicht in dem Grade ein kirchliches Freudenfest wie bei uns. Es besteht vielmehr in einer Reihe von weltlichen Vergnügungen, die vom 25. Dezember bis zum 6. Januar dauern; an diesem Tage, den Drei-Königen, erreicht die Festesfreude ihren Höhepunkt. Besonders in Moskau geht es hoch her. Hier besteht der Weihnachtstrubel in allerlei Schießbelustigungen, Schlittenausflügen, Festgelagen und ähnlichem mehr. Gewerbe und Handel liegen in dieser Zeit ganz still danieder. — Überall ist zu Weihnachten das Wahrsagen beliebt, von dem man wohl gegen dreißig Arten kennt. In waldreichen Gegenden wird es in der Weise betrieben, daß ein Beil in einen Holzklotz geschlagen und dieser herumgedreht wird, wobei man die Namen der anwesenden Mädchen nennt; dasjenige, bei Nennung von dessen Namen das Beil zu wackeln beginnt, wird am ehesten der Freuden der Ehe teilhaftig werden. In anderen Gegenden suchen die Mädchen aus der Beschaffenheit eines Holzscheites, das sie mit verbundenen Augen aus einem Holzstoß hervorziehen, ihr eheliches Schicksal zu ergründen. Ein glattes Scheit mit dünner, gleichmäßiger Rinde zeigt einen hübschen und guten Bräutigam an, eines mit rauher Rinde einen häßlichen; ein Scheit mit dicker, aber gut erhaltener Rinde verkündet einen reichen, eines mit schadhafter Rinde einen armen, ein dickes Scheit einen dicken Zukünftigen; eines mit vielen Astansätzen endlich wird auf reichen Kindersegen gedeutet.[S. 375] Wieder in anderen Gegenden gehen die Mädchen nachts auf den Hof und lauschen auf Hundegebell. Aus der Richtung, aus der es ertönt, kommt der Bräutigam; hört man es leise, dann ist dieser ein schon älterer, erklingt es dagegen laut, ein junger Mann, und so fort. — In manchen Gegenden besteht auf dem Lande noch ein eigenartiger Weihnachtsbrauch, die Brautwahl der jungen Leute (Abb. 414). Am Heiligen Abend begeben sich die Dorfschönen zu dem Gemeindeältesten und setzen sich hier eine neben der anderen hin, worauf jede mit einem großen Tuch bedeckt und auf diese Weise unkenntlich gemacht wird. Die jungen Burschen kommen nach und nach in die Stube herein und gehen aufs Geratewohl auf eines der verhüllten Mädchen zu, machen ihm eine Verbeugung und lüften das Tuch. Das auf diese Weise zusammengekommene Paar gilt als verlobt. Natürlich ist das meistens eine schon vorher ausgemachte Sache. Das Mädchen hat mit seinem Liebsten ein Zeichen verabredet, das es ihm ermöglicht, die richtige herauszufinden.

Bei den übrigen Slawenstämmen verlaufen die Feste in ziemlich ähnlicher Weise; hier und da gibt es noch besondere Gebräuche (Abb. 413). So veranstalten die Slowaken Mährens zu Pfingsten einen prächtigen Aufzug, das Königsreiten oder Königsuchen, auch Königsfahrt genannt (hierzu die farbige Kunstbeilage, in deren Unterschrift statt Slowaken irrtümlich Slowenen gesetzt wurde). Die jungen Burschen bitten sich für den Pfingstmontag aus einer der angesehenen Familien des Dorfes einen etwa vierzehn- bis fünfzehnjährigen Jungen als König aus und stellen ihm zwei tüchtige „Adjutanten“, drei „Abgesandte“ und ebensoviele „Ausrufer“ und „Einnehmer“. Man vereinigt sich darauf zu einem Festzug in die Dörfer. Die[S. 376] Reiter tragen weiße Schürzen mit roten Schärpen und rote Fähnchen in den großen Schaftstiefeln; der „König“ ist als Mädchen verkleidet, trägt einen Blumenkranz auf dem Kopfe und reitet meistens auf einem Schimmel. Die Pferde sind sämtlich mit bunten Bändern und Tüchern ausgeputzt. Im Galopp reitet die Schar nun in die nächstgelegenen Dörfer und sammelt hier unter umständlichen Förmlichkeiten allerlei Fleisch- und Wurstwaren, die dann abends im Hause des Königs oder im Wirtshaus gemeinsam verzehrt werden, wozu der Vater des Königs das nötige Bier spendet. — Während es bei den Russen am Weihnachtsfest lustig und üppig hergeht, wird dieser Tag von den Slowaken sehr ernst und erhebend begangen. An ihm ruht alle Arbeit, in vielen Dörfern wird nicht einmal gekocht. In einzelnen Orten verbindet die Bäuerin sogar den Rindern das Maul, um zu verhindern, daß das Geräusch des Wiederkauens die Feiernden in ihren Gebeten und in dem Absingen frommer Lieder störe.

Das russische Landvolk verharrt noch vielfach in ganz krassem Aberglauben und hält mit großer Zähigkeit an allerlei Gebräuchen fest, die altheidnischen Ursprungs sind. Ganz allgemein verbreitet ist der Glaube an die Damovoi, elfen- oder zwergähnliche Wesen, die man sich schwarz oder rot bekleidet und mit einem langen grauen Barte sowie mit flachsgelben Haaren und roten, leuchtenden Augen vorstellt und in jedem Hause als ständige Genossen anwesend denkt. Von ihnen hängt das Wohl und Wehe der Insassen ab. Daher pflegt man die Überreste des Abendbrots noch eine Zeitlang auf dem Tische stehen zu lassen, um sich dadurch die Hausgeister gut zu stimmen; sollte man ihnen diese Wohltat etwa nicht erweisen, dann würden sie sich zu rächen suchen und das Haus samt seinen Bewohnern ins Unglück stürzen. Der russische Bauer kennt noch verschiedene andere geisterähnliche Wesen, die bestrebt sind, den Menschen Böses zuzufügen. Um ihnen den Eintritt in die Häuser zu wehren, kritzelt man in die Wand und in die Türe das heilige Kreuz und malt es rot oder weiß aus.

[S. 378]
In vielen Gegenden besteht auch die Sitte, daß der Pope bei Beginn des Frühlings die Häuser, Ställe, Scheunen, Wiesen und Äcker segnet, um dadurch die bösen Geister zu vertreiben, die etwa beim Aufbrechen des Eises aus dem Wasser auftauchen und sich an den genannten Orten einnisten könnten. Die Furcht vor Hexen, Teufeln, Zauberern und anderen übelwollenden Wesen ist unter allen Slawenvölkern sehr verbreitet; sie kommt in zahlreichen abergläubischen Vorstellungen und Handlungen bei wichtigen Lebensereignissen zum Ausdruck, hauptsächlich aber bei der Geburt eines neuen Weltbürgers.

Während der Entbindung klopft im Gouvernement Wilna die Hebamme mit einem Besen an die Zimmerdecke. Früher war es in ganz Rußland allgemein üblich, einen Besen in einen Winkel der Stube zu stellen; man glaubte dadurch die Wöchnerin und ihr Kind gegen böse Geister zu schützen, diese sollten damit gleichsam hinausgekehrt werden. Jetzt noch pflegt man bei einer Geburt alles im Hause zu lösen, also auch alle Knoten. Bei den Weißrussen nimmt man aus diesem Grunde der Kreißenden sogar die Finger- und Ohrringe ab — sie sind auch etwas Gebundenes, Geschlossenes — und öffnet vor Beginn der Geburt alle Kästen, Schübe und selbst die Ofentüren, weil auch alles Verschlossene geöffnet werden muß; die Kreißende selbst ruft durch Klopfen mit der Ferse auf die Schwelle des Zimmers die Ahnengeister, deren Sitz dort angenommen wird, zu ihrem Beistande an.
Wenn das Kind geboren ist, muß man sehr darauf achten, daß es nicht vertauscht wird mit einem sogenannten Wechselbalg, einem mißgestalteten Wesen, das vom Teufel mit einer Hexe erzeugt sein soll. Derartige Wechselbälge sind nach dem Volksglauben dadurch gekennzeichnet, daß sie bis zu ihrem zwölften Lebensjahre weiter nichts tun als essen, trinken, schlafen und schreien, daß sie ferner geistesschwach sind, aber über ungeheure Körperkräfte verfügen und mit Ablauf der ersten zwölf Lebensjahre in den Wald zu entwischen trachten. Gelingt ihnen diese Flucht nicht, so müssen sie zeit ihres Lebens unter den Menschen bleiben; sie werden dann zu bösen Zauberern. Um das eigene Kind wiederzuerhalten, muß man eine heilige Messe lesen lassen, doch darf das entführte Kind bis dahin noch nicht von den Speisen des Waldgeistes genossen haben. Trifft diese Voraussetzung zu, dann bringt der Geist das Kind wieder zurück. Man kann sich der Wechselbälge auch auf andere Weise entledigen, indem man sie mit geweihten Ruten peitscht — auf ihr Geschrei hin bringt die Drude oder der Waldgeist das geraubte Kind dann wieder — oder die Wiege umkehrt, so daß der Balg herausfällt.[S. 380] — Der Aberglaube, daß böse Mächte, die bald Waldfrauen oder Waldgeister, bald Hexen, Druden, Alpe, Nixen, Zwerge, Unterirdische und ähnlich heißen, darauf ausgehen, ihre eigene Brut gegen Menschenkinder auszutauschen, hat sich besonders bei den Slawen bis in unsere Tage herein unerschüttert erhalten. Als einem solchen Tausch am meisten ausgesetzt gilt die Stunde des Ave-Maria. Man schützt die Wöchnerin und ihr Kind gegen die Belästigungen von seiten der bösen Geister, indem man das Kind möglichst schnell taufen läßt oder wenigstens den Segen über dasselbe ausspricht, ein Gesangbuch unter sein Kopfkissen steckt, einen hölzernen Hammer und einen Besen kreuzweise unter sein Bett legt, und durch andere derartige Maßnahmen. Auch darf die Frau ihr Kind niemals ohne Aufsicht lassen; daher versammeln sich bei den Südslawen Bekannte und Verwandte sofort nach der Geburt im Hause der Wöchnerin und bleiben stets um sie, wobei sie einander durch Erzählen und Singen die Zeit vertreiben.


Auch der böse Blick wird von den Slawen für kleine Kinder sehr gefürchtet. Als bestes Schutzmittel dagegen gelten Kohlen. In der Ukraine achtet man darauf, daß kein Besucher und selbst nicht einmal die Angehörigen sich über das gute Aussehen des Kindes äußern, ohne eine Zauber- oder Verwünschungsformel herzusagen und gleichzeitig dreimal auszuspucken. In Serbien besteht der Aberglaube, daß man beim Herausnehmen des Kindchens aus seinem Bett dreimal über dasselbe spucken müsse. — Die Mutter pflegt auch mancherlei zeremonielle Handlungen an dem Kinde vorzunehmen, um es vor bestimmten Krankheiten zu schützen oder für seinen künftigen Beruf brauchbar zu machen. So muß sie bei den Serben das erste Brot, das sie ißt, mit den Zähnen abreißen, damit das Kind bald selbständig zu essen anfange, bei den Polen Oberschlesiens in den ersten sechs Wochen ihrem Kinde vor dem Baden den Rücken abreiben und dreimal auf den Ofen spucken, um ihren Liebling vor Schwindsucht zu schützen, bei den Tschechen das Badewasser von Knaben den Pferden, das von Mädchen den Kühen zu trinken[S. 381] geben, damit die Kinder später einmal mit diesen Tieren gut umgehen; bei den Ruthenen Galiziens darf die Mutter die Wäsche der Tochter nicht mit einem Waschholz klopfen, damit diese nicht später in der Ehe von ihrem Gatten Schläge bekomme, und was derlei Gebräuche mehr sind.

Für die heranwachsende Jugend beider Geschlechter bieten sich viele Gelegenheiten zusammenzukommen und miteinander anzuknüpfen; so die zahlreichen Feste mit ihren Lustbarkeiten, von denen wir oben bereits sprachen, vor allem auch die Reigentänze, bei denen meistens die ungezügelte Leidenschaft zum Durchbruch kommt, sowie die Zeiten des Pilz- und Beerensammelns in den Wäldern. Da die sittlichen Anschauungen beim russischen Landvolk (und nicht minder bei der vornehmen Stadtbevölkerung) ziemlich lax sind, so feiert die Liebe in diesen „Nächten des Rausches“, wie sie heißen, ihre Orgien, aber selten führt dies zu einer festen Verbindung. Denn die Ehe ist nach Ansicht des russischen Bauern weniger eine Sache der Neigung als vielmehr ein richtiges Kaufgeschäft; bei dem patriarchalischen Zusammenleben in einer großen Familie erwartet der Vater, daß sein Sohn ihm eine tüchtige, gesunde, leistungsfähige Frau als Arbeitskraft zuführt. Bis in die Neuzeit herein gab es in verschiedenen Gegenden Rußlands noch wirkliche Heiratsmärkte, auf denen die jungen Männer die auf dem Markte oder dem Kirchplatz aufgestellten Mädchen in Augenschein nahmen und die ihnen passend erscheinenden aussuchten. Heutzutage ist diese Sitte, die sich übrigens auch bei anderen slawischen Stämmen findet, mehr und mehr in Abnahme gekommen. Jetzt kommt vielmehr eine Heirat meistens durch eine gewerbsmäßige Vermittlerin, die Svacha, zustande. Mit den Worten: „Wir haben einen Käufer, ihr eine Ware; wollt ihr nicht eure Ware verkaufen?“ findet sich die[S. 382] Svacha im Hause der Eltern der Zukünftigen ein und fängt ein regelrechtes Feilschen um den Kaufpreis an, der nicht allein in Geld, sondern auch in Pelzwerk, Stiefeln, Branntwein, Fleisch, Getreide und anderen Gegenständen besteht. Wenn man sich endlich auch über den Tag der Hochzeit geeinigt hat — die Vermittlerin spielt gleichzeitig die Rolle einer Wahrsagerin, die aus den Karten einen für die Ehe glückbringenden Tag herausliest — wird der Handel durch Handschlag und ein sich daran anschließendes Zechgelage festgemacht. Das Volk nennt dies „die Braut vertrinken“. Die Verlobung (Abb. 399) ist sodann eine recht feierliche Handlung, bei der der Bräutigam seiner Auserwählten neben Brot, Salz und Mandelkuchen noch einen mit Türkisen besetzten Ring überreicht. Dieses Unterpfand der versprochenen Ehe wird von der Braut und ihrer Familie in hohen Ehren gehalten und gleichsam als Erbstück aufbewahrt, darf aber nie wieder zu demselben Zweck benutzt werden.
Schon acht Tage nach der Verlobung (hierzu die farbige Kunstbeilage sowie Abb. 422) findet die Hochzeit (Abb. 412, 417 und 418) statt, die, obwohl die Ehe eigentlich eine rein geschäftliche Sache ist, doch sehr festlich begangen wird und große Kosten verursacht, denn die Eltern halten darauf, daß die Tochter bei der Trauung möglichst kostbare Gewänder trage; diese selbst pflegt außerdem meistens noch der Jungfrau Maria der Kirche, in deren Bezirk sie wohnt oder die Trauung stattfindet, ein neues, prächtig besticktes Gewand darzubringen. In Südrußland erhält der Pope von ihr ein paar schneeweiße Tauben als Geschenk. Die kurze Zeit bis zur Hochzeit muß die Braut damit zubringen, mehrmals am Tage ihr grausames Geschick, das sie aus dem Hause der Eltern entführt und zwingt, „einem fremden Fremdling aus der Fremde“ zu folgen, mit Tränen und wehmütigen Liedern zu beklagen; Freundinnen und Verwandte wachen dabei streng darüber, daß sie dies auch in gehöriger Weise tue. Am „Jungfernabend“, der etwa unserem Polterabend entspricht, finden sich die Freundinnen der Braut ein. Diese löst ihren Zopf auf, der das Abzeichen des unverheirateten Mädchens ist, und schmückt mit den Bändern und Blumen aus ihrem Haar eine ihrer Freundinnen, meistens ihre jüngere Schwester, worauf diese sie ins Bad begleiten. Nach dem Bade setzen die Freundinnen ihren ganzen Stolz darein, der Braut das Haar wieder recht schön in Ordnung zu bringen und sie aufs beste herauszuputzen, wobei sie Lieder von der Liebe und dem Eheglück singen.

Am Hochzeitstage erwartet die Braut verhüllten Hauptes unter Absingung von Klageliedern ihren Zukünftigen. Wenn sich der Zug des Bräutigams nähert, öffnet der Brautvater die bis dahin verrammelte Tür. Ehe man aber die Gäste hereinläßt, spielen sich noch lustige Gespräche zwischen ihnen und dem Druzka (dem „Freundchen“) ab, einer Art Witzbold, der auf keiner Hochzeit fehlen darf; namentlich gibt dieser Rätsel zum Raten auf, die unter dem russischen[S. 383] Volke sehr beliebt sind. Der Bräutigam und der Brautvater müssen darauf ihren Platz neben der Braut sich durch Geldstücke erkaufen. Dann erst findet die Bewirtung der Gäste statt, bei der die Braut den „fremden Fremdling aus der Fremde“ noch einmal fragt, wie er heiße und woher er stamme. Ehe man sich zur Kirche begibt, wirft sich die Braut noch vor ihren Eltern auf die Knie, bittet sie um Verzeihung für alle ihnen bereitete Sorge und küßt sie sowie die Heiligenbilder. Sie bleibt noch immer verschleiert, bis ihr in der Kirche bei der Trauung, einer langatmigen, aber sehr anziehenden Zeremonie, bei der unter anderem wieder die Heiligenbilder geküßt werden, die Brautleute dreimal um den Altar herumgehen und so fort, der Schleier endlich abgenommen wird. Gleichzeitig spielt sich hier auch die Haubung ab, das heißt der lange Zopf wird in zwei kleinere geflochten und der Neuvermählten das Abzeichen der verheirateten Frau angelegt. Darauf begibt sich der Hochzeitszug, meistens zu Pferde, nach dem Hause des jungen Ehemanns. Hier wird das junge Paar von den Eltern mit Salz und Brot empfangen, womit der Wunsch angedeutet werden soll, daß es in dem neuen Haushalt nie an dem Nötigsten zum Leben fehlen möge. — Bei den Weißrussen müssen beide Eheleute nach der Rückkehr aus der Kirche, wie schon vorher beim Verlassen des elterlichen Hauses, über einen brennenden Scheiterhaufen reiten oder fahren, in den sie einige kleine Münzen werfen; offenbar soll damit ein Reinigungsopfer angedeutet werden und zugleich eine Abwehrmaßnahme gegen böse Geister, die dem jungen Paare etwa folgen könnten. — In Bosnien macht die junge Frau im neuen Heim drei feierliche Verbeugungen vor der Türschwelle, küßt diese und opfert einige Silbermünzen;[S. 384] die Schwelle wird, wie schon oben erwähnt, als der Sitz der Ahnen aufgefaßt. — Vielfach fährt die Hochzeitsgesellschaft in flottem Trabe von der Kirche heim; das für Rußland bezeichnende Fahrzeug ist das Dreigespann, die Troika (Abb. 419).

Bei dem nun stattfindenden Gastmahl geht es hoch her, und besonders wird dem Wodka gut zugesprochen. Die Eheleute werden gegen Abend von der Svacha und den Brautführern ins Hochzeitsgemach geleitet, wo die Frau dem Manne feierlich die Schuhe auszieht. Die Gäste feiern indessen mit Essen und Trinken weiter und fahren darin am nächsten Tage an dem „Fürstentisch“ fort, dem Gastmahl, das die Neuvermählten ihnen geben. Bei dieser Gelegenheit findet unter den Verwandten ein allgemeines Abküssen statt. In einzelnen Teilen des Reiches ist es Sitte, daß man bei der Hochzeit alle Türen, Fenster und selbst den Schornstein geschlossen hält, um den bösen Geistern den Zutritt zu verwehren.

Neben dieser legitimen Erwerbung der Braut kennt das Landvolk in Rußland noch die Raubehe. Haben sich die beiden Liebenden zur Flucht verabredet und den Popen durch Geld bestochen, daß er sie traue, so wählen sie eine dunkle Nacht zu ihrem Vorhaben aus; möglichst schnell suchen sie die nächste Kirche zu erreichen, wo dann die Trauung stattfindet, die nach dem Gesetz unanfechtbar ist. Für gewöhnlich glückt ihnen dies, worauf am nächsten Morgen die Neuvermählten ihre Eltern aufsuchen, um sich vor ihnen auf den Boden zu werfen und ihre Verzeihung zu erbitten. Diese bestrafen die beiden Ungehorsamen zunächst wohl durch Bearbeitung mit Peitsche und Ofengabel für ihr Vergehen, lassen sich dann aber doch versöhnlich stimmen und bewirten schließlich das junge Paar. Sollte aber die Sache ruchbar werden, bevor die Fliehenden das nächste Kirchdorf erreicht haben, dann machen sich der Vater der Braut und ihre übrigen Angehörigen auf die Verfolgung; holt man die Flüchtigen ein, dann versucht man die Braut „herauszuhauen“, wobei es selten ohne Blutvergießen abgeht.
Bei den Serben geht der Vater eines Jünglings, der sich verheiraten will, mit zwei Personen, meist Verwandten, auf die Freite. Sie bringen einen flachen, weichen Kuchen und einen Strauß Blumen mit; einer von ihnen ist auch mit einer Flinte oder Pistole ausgestattet, um das freudige Ereignis, wie es bei den Slawen vielfach Sitte ist, sogleich mit Schießen zu feiern. Die Brautwerber richten es so ein, daß sie zum Abendbrot dableiben. Während des Essens setzt einer von ihnen in passender Weise den Grund ihres Besuches auseinander. Darauf bringt der Vater des jungen Mannes den mitgebrachten Kuchen zum Vorschein und legt ihn auf den Tisch, daneben den Blumenstrauß und etwas Geld. Der Vater des Mädchens geht hinaus, um sich angeblich mit seiner Frau und Tochter zu besprechen, meistens haben aber schon vorher Unterredungen darüber zwischen ihnen stattgefunden. Nach einem Weilchen kehrt er zurück, [S. 386]gefolgt von seiner durch einen ihrer Brüder oder nächsten männlichen Verwandten hereingeführten Tochter. Diese geht zuerst zu ihrem zukünftigen Schwiegervater, verbeugt sich vor dem Tisch und küßt jenem die rechte Hand, worauf sie gegenüber den anderen Anwesenden ebenso verfährt. Darauf händigt ihr der Vater des Bewerbers den Blumenstrauß nebst den Münzen aus, indem er zugleich seinen Glückwunsch darbringt. Das Mädchen verbeugt sich zum Dank noch einmal vor ihm und küßt ihm wieder die Hand. Von diesem Augenblick an gilt es für die Verlobte des jungen Mannes. Schließlich legt der Schwiegervater noch ein Geldstück auf den Kuchen, das gleichsam den Brautpreis („das Geschenk für das Haus“) versinnbildlichen soll.



Bei der serbischen Hochzeit spielen drei Personen eine große Rolle. In erster Linie der Koom; er ist der hauptsächlichste Brautzeuge, für gewöhnlich der Sohn oder der nächste Verwandte des Mannes, der bei der Hochzeit der Eltern des Bräutigams dasselbe Amt versah. Die zweitwichtigste Person ist der Stavri svat, dem gleichsam die Aufgabe des Zeremonienmeisters zufällt. Als dritter endlich wirkt der Dever oder Führer der Braut mit, der als ihr besonderer Beschützer für diesen Tag ihr niemals von der Seite weicht. Nachdem sich die Hochzeitsgäste (Abb. 424) im Hause des Bräutigams versammelt haben, begeben sie sich zur Wohnung der Braut, und zwar für gewöhnlich zu Pferde. Voran reitet ein Mann mit einem großen Holzgefäß, das Rotwein enthält; er muß davon jedem, der ihm unterwegs begegnet, zu trinken geben. Außerdem ist er der Spaßmacher auf der Hochzeit. Ihm folgen auf einem Wagen die Brautjungfern mit den Hochzeitsgeschenken. Weiter schließt sich der Bräutigam an und endlich die lange Reihe der Gäste. Öfters stellen sich die Nachbarn mit Stangen und gekreuzten Schwertern dem Brautzug entgegen; da die Hochzeitsgäste trotz dieses Hindernisses weiterzukommen versuchen, entspinnt sich ein heißer Scheinkampf (Überreste der Raubehe), der erst beigelegt wird, wenn den Nachbarn Sühne gezahlt wurde. Wenn der Hochzeitszug endlich vor dem Hause der Braut eingetroffen ist, werden zunächst nur die Männer an den reichbesetzten Tisch geführt, während die Weiber die Braut ankleiden. Ist dies geschehen, dann wird sie von dem Bruder oder nächsten[S. 387] männlichen Verwandten zu dem Koom und dem Stavri geführt, deren Hände sie zu küssen hat, und darauf in die Küche, wo gegenüber dem brennenden Herd ihre Eltern Platz genommen haben. Sie wirft sich hier vor dem Herd auf die Erde, küßt diese oder die Herdsteine, verbeugt sich dann vor den Eltern, küßt ihnen die Hände und empfängt dafür ihren Segen. Darauf geht man in die Kirche zur Trauung (Abb. 415) und von dort nach dem Hause des jungen Gatten. Hier muß die junge Frau, wenn sie vom Wagen gestiegen ist, zunächst über einen Sack Hafer, einen Pflug und schließlich über die Türschwelle schreiten, sodann wird sie von einer Frau begrüßt, die ihr ein kleines Kind hinhält, das sie möglichst hoch aufheben und küssen muß. Dann erst darf sie ihr neues Heim betreten. Die Eltern des angetrauten Gatten empfangen sie in der Küche, wo sie sich gegenüber dem Herdfeuer niedergelassen haben. Nachdem sie auch deren Hände geküßt hat, führt die Schwiegermutter sie dreimal um den neuen Herd herum und gibt ihr in die Hand eine Schaufel, mit der sie die auf dem Herde brennenden Kohlen auf einen Haufen zusammenfegen muß. Damit sind die eigentlichen Hochzeitszeremonien erledigt; es beginnt darauf Schmausen, Trinken und Tanzen der Festgäste.
Ähnlich wie bei den Serben sind die Hochzeitsgebräuche mit geringen Abweichungen auch bei den Bulgaren. Hier begegnet man noch der eigentümlichen Sitte, daß die jung Verheirateten für eine Woche in ihrem eigenen Hause eingeschlossen werden, während deren niemand sie besuchen darf. Nach Ablauf dieser Zeit kommen die verheirateten Frauen und führen die junge Frau an den Dorfbrunnen oder zu einer Quelle, um die sie dreimal herumgehen muß, offenbar ein Fruchtbarkeitsritus, wie ihn die Volkskunde auch in Europa noch verschiedentlich nachgewiesen hat. Bei den Bulgaren Mazedoniens geht die Trauung durch den Priester vor einem eigenartig anmutenden Altare vor sich, nämlich einem Weinfaß, das auf einem Kuchen steht. Die Brautleute trinken bei der Trauung geweihten Wein aus einem Glase und gehen dreimal um diesen sonderbaren Altar herum, während die Gäste sie mit Süßigkeiten und Früchten bewerfen. Bei ihrer Ankunft im neuen Heim bestreicht die junge Frau alle Schwellen, die sie im Hause zu überschreiten hat, mit Honig, was gewiß auch als Überrest eines Opfers an die Ahnen aufzufassen ist. Schmaus, Tanz und Gesang machen auch hier einen wichtigen Bestandteil der Hochzeitsfeier aus (Abb. 425).

Mit den angeführten Beispielen sind die Hochzeitsgebräuche unter den slawischen Völkern (siehe die Kunstbeilage) bei weitem nicht erschöpft; man könnte über sie ein ganzes Buch schreiben, so verschieden untereinander und vielseitig sind sie bei diesen Völkern. Es soll nur noch kurz die Schilderung einer Hochzeit bei den Huzulen, einem Ruthenenstamm, gegeben werden, da die Gebräuche hierbei ganz besonders fremdartig anmuten. Der Bräutigam trägt während[S. 388] der Trauung einen Kranz, den man unter großer Feierlichkeit auf seiner Mütze befestigt hat. Er besteht aus Immergrünblättern und ist mit Flittergold und Münzen verziert; auch Knoblauch darf darin nicht fehlen, der wegen seines scharfen Geruchs als vorzügliches Abwehrmittel gegen alles Böse in hoher Gunst steht. In dem Brautkranz der Huzulin muß stets die Nadel stecken bleiben, mit der er zusammengenäht wurde. Als weiteres Schmuckstück tragen Braut und Bräutigam um den linken Arm einen großen Ring aus Käse. Nach der Trauung reitet die Braut mit ihrem Gefolge im Galopp nach ihrem Heim zurück, während der Bräutigam mit seinen Gefährten absichtlich etwas zurückbleibt. Erst wenn mit der jungen Frau zu Hause noch bestimmte Zeremonien vorgenommen worden sind, findet sich der junge Ehemann bei ihr ein. Seine Ankunft kündet er dadurch an, daß er seiner Gattin seinen Käsering hineinschickt. Diese erwidert die Aufmerksamkeit, indem sie dem Harrenden den ihrigen hinaussendet; hierauf erst nehmen die Festlichkeiten ihren Fortgang. Wenn die Braut das elterliche Haus verläßt, um zur Kirche zu reiten, gießt man ein Glas Wasser aus, damit „das Glück wie das Wasser komme“, eine Sitte, die ebenfalls als eine Schutzmaßregel gegen böse Geister aufzufassen ist.

Die Toten- und Begräbnisgebräuche bei den Slawen bieten wenig Eigentümlichkeiten. Bei den Balkanslawen trifft man die Vorbereitungen für das Begräbnis öfters lange vorher selbst; so besorgt man sich schon bei Lebzeiten seinen Sarg, schafft die Totenkleider an, die Taschentücher, die bei der Beisetzung an die Teilnehmer verteilt, sowie die Wachskerzen, die dabei angezündet werden sollen; auch stellt man ein Fäßchen des Nationalgetränkes bereit, das von dem Trauergefolge für das „Seelenheil“ getrunken werden soll. — Naht die letzte Stunde, so versammelt der Sterbende alle Verwandten und Freunde um sich und bittet jeden von ihnen um Verzeihung; man antwortet ihm darauf mit der stehenden Redensart: „Möge dir alles in dieser und in jener Welt vergeben sein.“ Hat der Betreffende dann seinen letzten Atemzug getan, dann öffnet man sofort die Fenster, damit die Seele davonfliegen könne. Der nächste Angehörige, meistens das Lieblingskind, drückt dem Verstorbenen die Augen zu. Die Frauen lösen darauf ihr Haar auf und lassen es weit über den Nacken hinunterfallen; ferner beginnen sie um den Toten ein Jammergeschrei zu erheben, das sie auch während des Begräbnisses und bei jedem späteren Besuch des Grabes wiederholen. Ihre Wehklage weist einen bestimmten Rhythmus auf und nimmt vielfach die Form von Fragen an den Verstorbenen an. So rufen sie ihm zu: „Was sollen wir jetzt tun, nachdem du uns verlassen hast? Was denkst du, daß aus unserer Familie jetzt wird? Werde ich nie mehr deine Stimme hören?“ und so fort. Solange die Leiche im Hause liegt, dürfen bei den Balkanslawen[S. 389] die Angehörigen keine Speisen zu sich nehmen. Man stellt in dem Sterbezimmer Salz, Brot und ein Glas Wein auf, weil man glaubt, daß der Tote noch eine Zeitlang im Hause weile und der Nahrung benötige.
Der Leichenzug (Abb. 426) wird durch Knaben eröffnet, die das heilige Kreuz und kirchliche Banner tragen; darauf folgen andere mit großen Mulden, die Eßwaren, und zwar vor allem Kolliva, enthalten. Ihnen schließt sich die Geistlichkeit in vollem Ornat unmittelbar vor dem Sarge an, der nicht zugedeckt, sondern offen getragen wird, so daß man den Toten in halbsitzender Stellung sehen kann. Hinter dem Sarge folgen darin endlich die Angehörigen, Freunde und Bekannten. Die Weiber singen, während der Zug in Bewegung ist, Klagelieder. Bei den Serben pflegt man sich auf dem Wege nach dem Kirchhof nicht umzusehen, wie man auch auf dem Heimwege nicht rückwärts blicken darf; man fürchtet, daß sonst leicht ein zweiter Todesfall eintreten könne. Auf dem Friedhof spricht der Priester den Segen und gießt bei den Balkanslawen über den Toten eine Mischung von Rotwein und Olivenöl in Form eines Kreuzes aus, worauf der Sarg versenkt wird. Auf dem Heimwege sucht man, wenn möglich, einen anderen Weg zu gehen. Zu Hause angelangt, waschen sich alle Teilnehmer an dem Begräbnis die Hände. Außerdem nehmen sie von einer Schippe, die ihnen ein junger Mensch hinhält, ein Stückchen glühender Kohle, lassen es von einer Hand in die andere gehen und werfen es schließlich über die linke Schulter hinter sich. Auf dem Lande schließt sich hieran noch ein wirkliches Festmahl (Abbildung 423), bei dem jeder ein paar Tropfen Wein „für die Seele des Toten“ ausgießt. In den Städten verteilt man an die Armen und Bettler Speisen, Kuchen und Geld, sowohl auf dem Friedhof wie auch zu Hause. Nach dem Begräbnis wird das Haus ausgekehrt. Den dazu benutzten Besen wirft man weg; er darf nie wieder ins Haus kommen, da sonst Unglück zu befürchten wäre.

Die Trauer der Frauen dauert ein Jahr; währenddessen dürfen sie weder singen noch Schmucksachen tragen, auch sich nicht mit Blumen putzen. An bestimmten Tagen des Jahres gibt es Erinnerungsfeste an die Verstorbenen, die stets auf den Sonnabend fallen und daher „Seelensabbate“ heißen. An ihnen strömt das Volk auf die Friedhöfe zum Besuch seiner Toten, und die Priester sprechen Gebete für sie. — Sieben Jahre nach dem Tode pflegt man das Grab zu öffnen, die Gebeine herauszunehmen und in einem kleineren Sarge endgültig beizusetzen. Große Bedeutung wird dabei der Beschaffenheit der Leichenreste beigelegt; sind sie vollständig in Verwesung übergegangen, so daß nur noch die Knochen übriggeblieben sind, dann gilt dies für ein sicheres Zeichen, daß dem Verstorbenen seine Sünden vergeben sind und seine Seele in Frieden ruht.
[S. 390]

Man versteht unter den nichtslawischen Balkanvölkern die Türken oder Osmanli einerseits und die Griechen, Rumänen und Albanier anderseits. Die ersteren gehören der finnisch-ugrischen Menschenrasse an, sind daher Verwandte der Ungarn und Finnen und stammen, wie man annimmt, aus Nordasien her, die letzteren, wohl ursprünglich Vertreter des nordischen Typus, wanderten bereits in der Vorzeit aus Nordeuropa in die von ihnen heutzutage eingenommenen Gebiete ein und vermischten sich zuerst mit den hier ansässigen Stämmen, wahrscheinlich Angehörigen der mittelländischen Rasse, später mit hinzugewanderten slawischen und türkischen Elementen. Von einem einheitlichen anthropologischen Typus kann daher weder bei diesen, noch bei jenen die Rede sein, denn auch die Türken haben auf ihren langen Wanderungen durch Mittelasien und Südrußland, wo überdies zu der Zeit ihrer Durchquerung Mischvölker schon ziemlich stark vertreten waren, viel fremdes Blut in sich aufgenommen, wozu nicht wenig die Erlaubnis der Lehre Mohammeds beigetragen hat, daß ihre Anhänger sich außer den erlaubten vier rechtmäßigen Gattinnen noch eine beliebige Zahl Sklavinnen halten dürfen, die man den unterjochten Völkern denn auch in reichlicher Menge entnahm. Die Türken haben annähernd vier Jahrhunderte den ganzen Balkan beherrscht und daher großen Einfluß auf die Rassenmischung dieser Völker sowie deren Kulturverhältnisse ausgeübt, anderseits aber auch selbst sehr viel von den Sitten und Gebräuchen dieser angenommen.
Die Kleidung der Türken (Abb. 428) ist eine ziemlich einförmige; sie besteht aus einem[S. 391] langen, kaftanähnlichen Rock, Pluderhosen und einem Fes, der bei festlichen Gelegenheiten mit einem weißen Turban vertauscht wird; dieser ist bei Mekkapilgern mit Gold durchwirkt und bei den Geistlichen, den Hodscha, mit einer purpurroten Verbrämung versehen. Die Türkinnen sind gekennzeichnet durch weite Pluderhosen, seidenes Hemd, gestickte Jacke, gelbe Schuhe und Verschleierung des Gesichts (Abb. 429). Die letztere dürfte kaum auf religiöse Vorschriften zurückzuführen sein — im Koran findet sich keine Stelle, die man in diesem Sinne auslegen könnte, und außerdem trugen die Frauen der Türken bereits lange vor Mohammed ihr Gesicht verschleiert —, sondern wahrscheinlich mit der Sitte der Türko-Tataren zusammenhängen, sich der Frauen durch Raub zu bemächtigen. Da man wohl nur solche Frauen raubte, die einem gefielen, dabei aber Gefahr lief, daß sie auch den Beifall anderer finden möchten, die stärker waren und sie wieder wegnehmen konnten, verfiel man auf den Gedanken, das Gesicht der geraubten Frauen zu verhüllen, um dadurch ein Urteil über ihr Aussehen unmöglich zu machen und ihrer Entführung vorzubeugen. Die Gewohnheit hat sich im Laufe der Zeiten fortgeerbt, scheint aber dank der modernen Reformbewegung auf dem Wege zu sein, mehr und mehr abzukommen.

Die Nationaltracht der Griechen (Abb. 431) ist den Albaniern (Abb. 430) entlehnt. Sie besteht aus einem Hemd mit weiten, fliegenden Ärmeln, kurzen Beinkleidern, reichbestickter, blauer oder roter, ärmelloser Jacke und dem typischen weißen, in Falten gelegten Röckchen von ähnlicher Form, wie es unsere Ballettmädchen tragen, der sogenannten Fustanella, deren Bund ein Ledergurt umschließt; an ihm werden Patronentasche und Waffen getragen. Dazu kommen noch lange rote Gamaschen, rote Schnabelschuhe mit einem Knauf an der Spitze und ein hoher roter Fes mit lang herabhängender Quaste. Die Frauen (Abbildung 434) tragen ein langes Hemd mit tiefsitzendem Gürtel und darüber[S. 392] einen kurzen, weißen, wollenen Rock; die unteren Enden der Ärmel sind reich bestickt. Das mit Ketten aus aneinandergereihten Münzen geschmückte Haar wird vielfach noch mit einem Fes bedeckt, den ebenfalls eine lange, golddurchwirkte Troddel ziert.

Für die Volkstracht der Rumänen ist die unter den Armen weit ausgeschnittene Pelzweste bezeichnend, die aus dem mit den Haaren nach innen gekehrten Schaffell hergestellt ist und von Männern und Frauen im Winter sowohl wie auch im Sommer getragen wird. Aus demselben Stoff sind auch die schwarze Pelzjacke und der lange Pelzmantel angefertigt. Auf dem bloßen Leibe tragen beide Geschlechter ein Hemd, das bei den Männern meistens kurz ist, selten bis an die Knie hinabreicht, hierüber die in Querfalten gelegte enge Hose, die um die Hüften von einem wollenen oder ledernen, zur Aufbewahrung von Messer, Geldbeutel, Pfeife und Tabak dienenden Gürtel umschlossen wird. Auf dem Kopfe sitzt die hohe, schwere Lammfellmütze oder ein breitkrempiger Filzhut (Abb. 432.) Das weite Hemd der Frauen, das im Gegensatz zu dem der Männer bis an die Knöchel reicht, pflegt an den Ärmeln und am Halse stets reich bestickt zu sein, ebenso der Rock und die übrigen Kleidungstücke (Abb. 438). Eine Eigentümlichkeit der Rumäninnen ist ihre große Vorliebe für kräftige, leuchtende Farben. Sie kommt besonders in der Foça zum Ausdruck, einem schürzenartigen Hüfttuch, das oft genug auch kostbare Stickereien trägt. Dieses breite Tuch wird ganz eng um den Unterkörper geschlungen, so daß es ihn rockartig umhüllt. Neben der Foça tragen die Rumäninnen noch wirkliche Schürzen, die Fransenschürze und die Catrinta; dies sind schmale Stücke Tuch, die, jedes mit einer besonderen Art von Muster bedeckt, vom Gürtel vorn und hinten herabhängen, so daß die Beine frei bleiben (Abb. 403). — Die Tracht der Albanierin weicht von der rumänischen völlig ab (Abb. 435).

[S. 393]
Der Religion nach sind die Türken Anhänger des Islams, und zwar befolgen sie die religiösen Vorschriften äußerst pünktlich (Abb. 427); die übrigen uns hier beschäftigenden Balkanvölker bekennen sich dagegen zum Christentum, vorwiegend griechisch-orthodoxer Richtung. Im großen und ganzen feiern diese die christlichen Feste in ähnlicher Weise, wie dies die Slawen tun.
Bei den Griechen gibt es wie in Rußland eine Wasserweihe am 6. Januar. Schon am Tage vorher gehen die Priester in die Häuser, um Weihwasser und Basilikumzweige zu segnen. Diese balsamische Pflanze gilt allgemein als heilig, da sie der Sage nach aus dem Grabe Christi entsprossen sein soll, woraus sich die Kreuzform ihrer Blätter erklären soll. Es gibt wohl kein Gärtchen im Lande, und sei es noch so ärmlich, in dem man die Pflanze nicht zieht, keinen Strauß, in dem sie nicht vertreten ist. Ein Bündel Basilikumreiser wird in der Stube aufgehängt und als unfehlbares Mittel gegen den bösen Blick hochgeschätzt. Am Vorabend des Erscheinungsfestes (des Tages der Wasserweihe) durchziehen die Kinder mit brennenden Laternen in festlichem Zuge die Straßen des Ortes und singen fromme Lieder. Am nächsten Morgen findet frühzeitig Gottesdienst in den Kirchen statt; am Schlusse desselben sprechen die amtierenden Priester ein Gebet über eine große silberne Urne aus, die Wasser enthält, und segnen ihren Inhalt. Darauf stürzt sich das Volk mit Gläsern auf dieses Gefäß, um etwas von dem geweihten Wasser zu erhaschen und mit nach Hause zu nehmen. Später begibt sich ein Festzug unter Vorantritt der geistlichen Würdenträger in ihren reichverzierten Kirchengewändern zum Hafen, falls es sich um einen Ort an der See oder einem schiffbaren Fluß handelt. Hier hat man einen Raum im Wasser abgegrenzt, in dem sich bereits eine Unmasse von Menschen tummelt. Der oberste Priester wirft das heilige Kreuz in das Wasser, worauf sich ein heftiger Kampf unter den Schwimmern entspinnt, um es aufzufischen und zu bergen. Wem das Glück günstig ist, es zu erhaschen, der darf es durch die ganze Stadt tragen und dabei Gaben sammeln. — Solange die Gewässer nicht eingesegnet sind, verläßt kein Schiffer den Hafen, da man von der Wasserweihe unter anderem auch günstiges Wetter für die Schiffahrt erhofft.
Die verschiedenen Johannestage werden gleichfalls festlich begangen, und zwar ist am volkstümlichsten der Namenstag Johannis des Täufers. Da man in Griechenland nicht seinen wirklichen Geburtstag, sondern den Tag seines Schutzheiligen feiert und viele Leute nach Johannes dem Täufer Yannis genannt werden, so pflegen diese ihren Namenstag gemeinsam zu feiern.


Auf der Insel Korfu wird das Fasten, das im übrigen in Griechenland strenger als sonst in der christlichen Kirche innegehalten wird, am Palmsonntag unterbrochen. An diesem Tage strömt alles vom Lande und den kleinen Orten in die Hauptstadt der Insel, um an der großartigen Prozession ihres Schutzpatrons, des heiligen Spiridion, teilzunehmen, natürlich aufs festlichste geputzt und voller Freude darüber, daß man nach dem langen,[S. 394] schweren Fasten sich zum ersten Male wieder dem Genuß von Speise und Trank hingeben darf. Die Teilnehmer an dem Zuge versammeln sich in der Kirche des Heiligen und ziehen von dort unter dem Donner der Kanonen und dem Schmettern der Trompeten in großartiger Prozession stundenlang durch die Straßen, unterwegs in verschiedenen Kirchen Einkehr haltend. Den Zug eröffnen Fahnenträger und eine lange Reihe Geistlicher in golddurchwirkten Gewändern, zahlreiche Schüler, alle in Uniform, und Soldaten; sämtliche Teilnehmer tragen geweihte Kerzen in den Händen. Ihnen schließt sich wiederum eine große Zahl von Priestern an, in ihrer Mitte der ehrwürdige Patriarch mit einer goldenen Krone auf dem weißen Haupte; in den Pausen, die die Musik macht, murmeln alle Gebete. Unmittelbar hinter dem Patriarchen folgt die Hauptsache des Zuges, der heilige Spiridion in eigener Person, das heißt seine wohlerhaltene Mumie. Sie ruht in einem innen mit Purpur ausgeschlagenen Glaskasten mit durchbrochenem Goldrahmen und wird von vier Priestern wie eine Sänfte getragen. Mit dieser Reliquie hat es eine eigene Bewandtnis. Sie gehört nämlich merkwürdigerweise nicht der Kirche, sondern ist Eigentum der korfiotischen Familie Bulgaris, die sie ihrerseits dadurch erworben hat, daß vorzeiten ein Bulgaris mit einem jungen Mädchen sich verheiratete, das die Gebeine des heiligen Spiridion als Mitgift erhielt. Für die Familie Bulgaris nun ist der Besitz der Reliquie zu einer dauernden, nicht zu verachtenden Einnahmequelle geworden. Sie hat damit zugleich allerdings die dauernde Verpflichtung übernommen, stets ein Mitglied Priester werden zu lassen, um durch diesen gegen Gebühren die Wohltaten zu vermitteln, die der Heilige bei[S. 395] allen möglichen Unglücks- und Krankheitsfällen spenden soll. Hinter der Mumie und ihren Trägern folgen wiederum zahlreiche Priester und endlich die Volksmenge, die ebenfalls festlich gekleidet ist und Palmzweige in den Händen trägt. Unterwegs drängt sich immer mehr Volk heran, besonders in die nächste Nähe des Heiligen, um durch ihn Erfüllung seiner Wünsche zu erhalten. Mütter lassen ihre kranken Kinder mit den Händchen den Sarg berühren oder legen sie wohl gar auf die Erde an der Stelle, über die der Zug kommen wird, so daß die Träger über sie hinwegschreiten müssen, andere sammeln den Staub an der Stelle, die jene betreten haben, ein oder fangen das Wachs auf, das von den Kerzen neben dem Sarge herabträufelt. — Damit ist übrigens nur eine Auswahl aus der großen Zahl derartiger Gebräuche gegeben.

Die Feier des griechischen Karfreitags beginnt schon am Abend vorher. Alles strömt dann bereits in die Kirchen, wo neben anderen Feierlichkeiten seidene Gewänder, in die eine Darstellung des im Grabe ruhenden Christus eingestickt ist, auf einer Art Katafalk inmitten des Schiffes ausgestellt und mit zahlreichen Blumenspenden geschmückt werden. — Der Ostersonntag wird auf dieselbe Weise, die schon bei der Darstellung der russischen Gebräuche geschildert wurde, eingeleitet und gefeiert. Die Straßen sind festlich geschmückt, und überall herrscht große Freude, die in allerlei Vergnügungen, namentlich in den Nationaltänzen (Abb. 433, 436 und 442) zum Ausdruck kommt. Auf dem Lande schlachtet jeder Hausvorstand an diesem Tage ein Lamm und bestreicht mit dessen Blut einen der Seitenpfosten an seiner Haustür[S. 396] sowie die obere Schwelle. — Bei den Rumänen besteht die schöne Sitte, daß am Ostermorgen die Frauen der wohlhabenderen Stände die Gefängnisse aufsuchen, um an die Gefangenen kleine runde Kuchen, denen das Kreuz aufgedrückt ist, zu verteilen. Ostern gilt ja auch bei der orthodoxen Kirche allgemein als das Versöhnungsfest. Die ländliche Jugend aber zieht am Osternachmittag in die Eichenwälder, um hier auf dem frischsprossenden Rasen der Waldwiesen das Auferstehungsfest durch ein lustiges Spiel zu feiern. Jedes Mädchen bringt in einem Weidenkörbchen eine Anzahl buntgefärbter Hühnereier mit. Im Walde stellen sich dann Burschen und Mädchen, je in einer Reihe, einander gegenüber auf und beginnen ein Spiel, das Tanz und Ballspiel in sich vereinigt, wozu Fiedel und Dudelsack ihre Weisen ertönen lassen. Die Mädchen werfen tänzelnd den Burschen die bunten, zerbrechlichen Bälle in hohem Bogen zu, wobei sie sowohl im Tanz wie auch beim Werfen eine bewunderungswürdige Geschicklichkeit und Anmut entwickeln. Aber auch die Burschen geben ihnen nichts nach und zeigen ihrerseits eine große Sicherheit im Auffangen, so daß nur selten ein Ei vorbeifliegt. Sind die Körbchen geleert, so beginnt das Spiel von neuem, nur mit dem Unterschied, daß jetzt die Rollen vertauscht werden, die Burschen also den Mädchen die Eier zuwerfen und diese sie auffangen. Auf solche Weise vergnügt man sich bis zum Anbruch des Abends, worauf der nationale Horatanz zu seinem Rechte kommt.

Um Weihnachten herum ziehen die Kinder in Griechenland von Haus zu Haus, singen Weihnachtslieder und heimsen dafür allerlei Leckerbissen, wie getrocknete Früchte, Nüsse, Oliven und Eier, ein. In Rumänien gehen sie dabei in ähnlicher Vermummung, wie bei uns an dem[S. 397] Feste der heiligen Drei Könige (Abb. 439). Da während der Adventszeit streng gefastet wird, so tut man sich am Heiligen Abend überall besonders gütlich. — Die Zeit der Zwölften wird in Griechenland besonders gefürchtet, denn in diesen Tagen oder, richtiger gesagt, Nächten steigen nach dem Volksglauben die längst verschwundenen heidnischen Götter wieder aus ihrer Versenkung empor, aber nicht in ihrer einstigen schönen Gestalt, sondern in der abergläubischen Einbildungskraft des Volkes zu tückischen Unholden verzerrt, meistens bocksfüßigen Ungeheuern — Anklänge an den alten Vater Silen —, die in Felshöhlen und Waldschluchten hausen, nachts ihr Unwesen treiben und besonders den Frauen nachstellen. Ganz gefährlich sind sie jungen Müttern; ein Kind, das in der Zeit der Zwölf Nächte geboren wird, ist ihnen rettungslos verfallen, es muß sein ganzes Leben lang nachtwandeln und nach dem Tode „umgehen“. Das Aussprechen eines Heiligennamens oder das Hersagen eines frommen Spruches, auch das Hinhalten eines Kreuzes zur rechten Zeit schlägt die bösen Mächte in die Flucht. Daher erblickt man auch an allen griechischen Haustüren große weiße Kreuze, und am Weihnachtsmorgen segnet der Priester feierlich jede Türschwelle, beräuchert sie und besprengt sie mit Weihwasser. Mit dem Morgen des 6. Januar aber ist die Macht der Unholde für ein Jahr wieder einmal endgültig gebrochen; der dritte Hahnenschrei scheucht alle Dämonen in die ewige Finsternis zurück.

Am Sankt-Basilius-Abend, der unserem Silvesterabend entspricht, ziehen ganze Scharen festlich gekleideter Kinder und Burschen unter fröhlichen Gesängen durch die Straßen und tragen dabei auf Stangen zierliche, mit bunten Bändern geschmückte Reisigbündel, in deren Mitte ein Glöckchen hängt. Vor jedem Hause lassen sie dieses erklingen, singen Lieder zu Ehren des Heiligen und erwarten von der Hausfrau ein kleines Geschenk in Gestalt von Äpfeln, Nüssen, Feigen oder Eiern, wofür sie ihr ein farbiges Seidenbändchen von dem „Strauße“ einhändigen, das ihr Glück bringen soll. In dieser Nacht vergißt wohl keiner, eine Granatfrucht in den Mondschein zu legen und sie am anderen Morgen in der Kirche einsegnen zu lassen. Nach der Rückkehr aus dem Gotteshause schleudert er die Frucht kräftig zu Boden, so daß sie zerspringt, ruft dabei aus: „Möge das Haus so reich an Segen sein wie dieser Granatapfel an Samen!“ und fügt, gleichsam die Hausgeister beschwörend, hinzu: „Ihr aber, Flöhe, Wanzen, Ungeziefer und Unglück aller Art, fliehet und lasset Gesundheit, Glück und Freude herein!“ — Alles, was am ersten Tage des Jahres geschieht, wird als Vorbedeutung für dasselbe ausgelegt. In den Neujahrskuchen, von dem jedes Familienmitglied, selbst der Säugling, ein Stück erhält, bäckt man eine Münze hinein; wem sie mit seinem Stück zuteil wird, der kann auf Glück rechnen. Ein Stück des Kuchens wird für den Hausaltar, das heißt die Heiligenbilder in der Stubenecke, zurückgelegt. Ein Teil von ihm wird den Armen gegeben, die mit großen Körben bettelnd von Haus zu Haus[S. 398] gehen und reichlich beschenkt werden. Jeder sucht einem anderen irgendein Geschenk zu machen, und wäre es auch nur eine wertlose Haselnuß; selbst die Bettler versäumen nicht, von ihrem Almosen an andere abzugeben. Diese Gebefreudigkeit ist sicherlich als ein Rest der strenae der alten Römer zu deuten.
Wie unter allen auf niederer Kulturstufe stehengebliebenen Völkern Europas, so spielt ganz besonders auch bei den Balkanvölkern der Aberglaube noch eine große Rolle. Vor allem der Furcht vor übelgesinnten Mächten und dem bösen Blick begegnet man allenthalben. Für ganz besonders bedroht hält man, wie dies auch bei der Betrachtung anderer südeuropäischer Völker berichtet wurde, schwangere Frauen und neugeborene Kinder.

In Griechenland sind es die Nereiden, die darauf ausgehen, den Frauen, die guter Hoffnung sind, und ihrer Leibesfrucht Schaden zuzufügen, unter anderem auch die Entbindung zu erschweren. Man sucht sich ihrer durch Amulette, bei denen der Jaspis eine große Rolle spielt, zu erwehren. Der Aufenthalt dieser bösen Mächte sind die Platanen oder Pappeln, auch die Quellen, weswegen eine Schwangere solche Stellen meiden muß, sich unter einem solchen Baume nicht aufhalten, neben einer Quelle sich nicht niederlegen darf. Schreitet jemand über eine Schwangere oder über ein neugeborenes Kind hinweg, so ermöglicht er den Nereiden ihre bösen Absichten, bringt jener Unglück und hindert dieses am Wachstum. Man kann dem Schaden dadurch vorbeugen, daß man sogleich wieder zurückschreitet. Der griechische Volksglaube kennt ferner noch andere bösartige Mächte in Gestalt geflügelter, häßlicher alter Weiber, die nachts durch die Lüfte ziehen, in die Häuser kommen, schlafenden Kindern das Blut aussaugen und ihnen sogar schon durch ihren Hauch schaden können. Um die Kinder gegen diese Unwesen zu schützen, legt man ihnen Jaspis in die Wiege, salbt ihnen die Stirn mit geweihtem Öl oder reibt sie mit dem Bodensatz eines Wassergefäßes ein. Gegen den nicht minder gefürchteten bösen Blick muß man das Kind und seine Umgebung ausräuchern, über dasselbe ausspucken oder die Hand mit ausgespreizten Fingern darüber halten, Knoblauch an seiner Wiege befestigen, dem Kinde ein dreieckiges, mit Salz, Kohlen und Knoblauch — diese Pflanze wird als Abwehrmittel gegen allerlei Zauber sehr geschätzt — gefülltes Amulett um den Hals hängen unter gleichzeitigem Hersagen von Verwünschungsformeln, und so fort. Natürlich darf die Wöchnerin in den ersten Wochen ihr Kind nicht aus den Augen lassen, erst recht nicht aus dem Hause gehen; ist sie zu einem Ausgang gezwungen, dann muß sie wenigstens vorher den Hausschlüssel oder einen anderen eisernen Gegenstand berühren. Man behauptet sogar, daß sie in der Zeit, wo sie durch die bösen Mächte gefährdet ist, auch anderen Leuten Unglück bringen könne; daher vermeiden Personen, die einen wirksamen Talisman zu besitzen glauben, damit in die Nähe einer Wöchnerin zu kommen, aus Furcht, derselbe könnte an seiner Kraft Einbuße erleiden. In Albanien machen in den ersten sieben Tagen nach einer Geburt die Nachbarn nachts einen gewaltigen Lärm, einmal, um die bösen Geister zu verscheuchen, und zum anderen, um Mutter und Kind am Einschlafen zu verhindern, da sie im Schlaf jenen leicht zum Opfer fallen könnten. —[S. 399] Außer den bösen Mächten kennt das griechische Volk auch noch wohlgesinnte Göttinnen, die Schicksalsfrauen, drei an der Zahl; sie erscheinen in der dritten Nacht nach einer Geburt, um das Schicksal des Neugeborenen zu bestimmen oder, wie der Ausdruck lautet, „das Glück des Kindes niederzuschreiben“. Man sucht sie natürlich auf alle mögliche Weise gut zu stimmen. Die Rumänen stellen zu diesem Zweck auf den Tisch unter das Heiligenbild allerlei Eßwaren für sie hin. Niemand darf dann in das Zimmer gehen, um nicht zu stören; vielmehr geht jeder in dieser Nacht, wo sie erwartet werden, möglichst frühzeitig zu Bett. Neben die Wiege des Kindes wird eine brennende Kerze gestellt. Selbst die Hofhunde werden für diese Nacht bei den Nachbarsleuten untergebracht, damit sie die Schicksalsgöttinnen durch ihr Gebell nicht verscheuchen. In Mazedonien muß sich unter den dargebrachten Eßwaren ein Honigkuchen befinden, den ein Mädchen gebacken hat, das noch beide Eltern am Leben hat. Dieser Kuchen wird am anderen Morgen an Ort und Stelle an die Hebamme und an Verwandte verteilt. Doch muß man dabei ja darauf achtgeben, daß keine Krume auf die Erde falle; sie könnte möglicherweise in die Hände von übelgesinnten Leuten geraten und Schaden bringen. Die Göttinnen schreiben das Schicksal des Kindes auf seine Stirn; irgendein auffälliges Merkmal oder eine Hautabschürfung an derselben wird als Beweis für diese Niederschrift angesehen.

Die Taufe findet für gewöhnlich am achten oder zehnten Tage nach der Geburt, und zwar meistens an einem Sonntage statt. Dieselbe Person, die bereits bei der Eltern Hochzeit Gevatter stand, pflegt bei der Taufe ihres Kindes das gleiche Amt auszuüben. Das Verhältnis zwischen dem Kinde und seinem Paten ist ein so inniges, daß die Mitglieder der beiderseitigen[S. 400] Familien nicht einmal untereinander heiraten dürfen. Ebensowenig ist es gestattet, daß ein Jüngling und ein Mädchen, die denselben Paten haben, die Ehe miteinander eingehen. — Bei den Rumänen schätzt man den Tag nach der Taufe, an dem das Salböl abgewaschen wird, ebenso hoch wie den Tauftag selbst. In das Bad zur Reinigung von dem Öle pflegt man eine Münze und ein Stück Brot zu werfen, was dem Kinde Glück und Reichtum bringen soll, desgleichen Basilikumkraut, um es begehrenswert zu machen.
Die Werbe- und Hochzeitsgebräuche sind bei allen Balkanvölkern ziemlich dieselben, was nicht wundernehmen wird, da sie alle jahrhundertelang unter der gemeinsamen Herrschaft der Türken gestanden haben. Vor Eingehung der Ehe wird im allgemeinen die materielle Frage erörtert, was indessen nicht ausschließt, daß gelegentlich auch Neigungsheiraten vorkommen. Für gewöhnlich bedient man sich eines Vermittlers, der die wichtige Frage der Mitgift zu regeln hat. Sind die Eltern nicht imstande, alle Kosten zu tragen, so nehmen wohl auch die Brüder des Mädchens einen Teil derselben auf sich. Im allgemeinen bleiben die Söhne so lange ledig, bis alle Schwestern unter die Haube gekommen sind, zumal wenn keine großen Altersunterschiede zwischen Söhnen und Töchtern bestehen. Außerdem ist es Sitte, daß die Töchter der Reihe nach verheiratet werden, so daß eine jüngere keine Ehe eingehen darf, bevor nicht die älteren versorgt sind. Bei der Verlobung werden Ringe zwischen den beiden jungen Leuten gewechselt, während die anwesenden Bekannten sie mit wohlriechenden Blüten des Mandelbaumes überschütten und ihnen eine recht baldige „Krönung“ (das heißt Trauung) wünschen. Erfrischungen werden herumgereicht, in manchen Gegenden wird auch ein festliches Mahl eingenommen. Auf Korfu besteht die Sitte, daß ein junges Mädchen, das verlobt ist, fortan eine Menge falscher Haare anlegt, die zu beiden Seiten des Gesichts aufgetufft und mit Streifen von rotem Stoff durchflochten werden. Diese unechten Haare werden später das ganze Leben lang getragen und vererben sich von einem Geschlecht auf das andere. — In Griechenland findet sich vielfach noch die Sitte des Kinderverlöbnisses (siehe die Kunstbeilage).


Zu Berlad in Rumänien findet im Frühling immer noch ein richtiger Heiratsmarkt statt, zu dem Mädchen armer Herkunft von ihren Eltern gebracht werden, um einen Freier zu finden. [S. 402]Die Männer, die sich dort einfinden, gehören auch den ärmeren Klassen an, sie müssen aber, falls sie eine Wahl treffen, den künftigen Schwiegereltern den Nachweis erbringen, daß sie eine Frau unterhalten können; auch erfordert es die gute Sitte, daß die Schwiegermutter zur Bekräftigung der getroffenen Abmachung ein kleines Geldgeschenk von ihnen erhält.

Die Hochzeit findet bei dem griechischen Volke für gewöhnlich an einem Sonntag statt, doch beginnen die Hochzeitsfeierlichkeiten bereits drei, bei den Bewohnern des südlichen Mazedoniens sogar schon acht Tage vorher. Hier wird nämlich am vorausgehenden Sonntag dem Bräutigam feierlich eine Abschrift des Ehevertrags übersandt, der seiner Verlobten dafür einige bescheidene Geschenke überbringen läßt, wie Süßigkeiten, Henna, Schminke und dergleichen, sowie für die Schwiegereltern einen Krug Wein. Während der folgenden vier Tage beschäftigt man sich mit dem Backen des Hochzeitskuchens. Am Freitag werden die Geschenke, die meistens in nützlichen Haushaltsgegenständen bestehen, im Zuge durch die Straßen getragen. Am Samstag fertigt man bei den Rumänen den Brautkranz an; auch pflegt man in Griechenland dann bereits die Braut für den folgenden Tag anzuputzen (Abb. 440). An manchen Orten trägt die Braut auch schon an diesem Vortage den Kranz, wenn der Bräutigam sie besucht. Bei der Ankunft tritt der Brautführer vor und sagt einen artigen Vers auf die Braut. Diese, die ein Gefäß mit Wasser und den Hochzeitskuchen neben sich stehen hat, besprengt zum Scherz die jungen Leute und verteilt an sie von dem Kuchen. Darauf begibt sich der Bräutigam noch einmal nach Hause und übersendet[S. 403] der Braut seine Geschenke, unter denen nie die Gewänder für den nächsten Tag fehlen einschließlich des Schleiers, der Goldschnüre und Blumen. An manchen Orten werden die Hochzeitsgeschenke erst am Samstag in feierlichem Zuge nach dem Hause des Bräutigams geschafft; beim Verlassen des Hauses und bei der Ankunft im neuen Heim werden Flintenschüsse abgegeben. Der nächste Tag ist der eigentliche Hochzeitstag. Die Braut wird von den Brautjungfern angezogen und geschmückt, die ihr auch das Haar kämmen und Orangenblüten hineinflechten sowie lange, bis an die Knie reichende Goldschnüre, für gewöhnlich auch heimlich eine silberne Münze, damit sie sich nie in Geldnot befinde; den Schluß bildet die Anlegung des Schleiers. Bei den Mazedoniern nimmt die Braut hierauf in einem Winkel des Zimmers, der besonders schön ausgeputzt ist, Platz, um ihren Bräutigam zu erwarten. Beim Verlassen des Hauses wird von der Mutter vor diesem und seinen Freunden ein Gefäß mit Wasser ausgegossen, auch ein Gürtel über den Weg gelegt, über den er hinwegschreiten muß. Auf dem Weg nach dem Brauthause wird von den Begleitern gesungen. — Einen wichtigen Bestandteil der Trauung bildet die sogenannte Kranzzeremonie oder die Krönung. Zwei kronenartige Kränze (Abb. 441) von Blumen oder Metall werden Braut und Bräutigam mit Hilfe der Trauzeugen aufs Haupt gesetzt und auf ein gegebenes Zeichen gewechselt. Darauf vereinigt der Priester die Hände des jungen Paares und ihrer Zeugen, und alle gehen dreimal um den Altar herum. Dabei stimmt der Geistliche einen besonderen Gesang, „Jesaias tanzt“, an, während dessen alle Anwesenden die jungen Eheleute mit Süßigkeiten, Weintrauben und Haselnüssen überschütten.

Nach der Trauung begibt sich alles in das neue Heim (Abb. 443). Hier wird die junge Frau bei den Rumänen von der neuen Schwiegermutter mit Salz und Brot, manchmal auch mit Honig und Butter bewillkommt. Bei den Griechen Mazedoniens empfangen die Mutter des Bräutigams und der Vater der Braut, die der Trauung nicht beigewohnt haben, das junge[S. 404] Paar und bewerfen es mit Zuckerpflaumen, Reis, Baumwollsamen, Gerste und auch Geld, das sich die Kinder, die dann nie fehlen, aufsammeln. Wenn die junge Frau ihr neues Heim betritt, muß sie erst über eine Pflugschar, die auf der Schwelle liegt, schreiten. Bei den Griechen ist es Sitte, daß sie bei ihrer Ankunft viermal über den Rücken des Maultieres, auf dem sie geritten ist, gehoben und dann rückwärts vor die verschlossene Haustür geführt wird. Auf deren Mitte muß sie eine Stelle mit Honig bestreichen, darauf wieder ein paar Schritte zurückgehen und einen Granatapfel gegen die Tür werfen, bis er bricht. Es gilt für eine gute Vorbedeutung, wenn aller Same am Honig hängen bleibt. Jetzt öffnet der junge Ehemann endlich die Tür und bietet seiner angetrauten Gattin ein Stück Brot mit etwas Salz an; diese tupft das Brot in das Salz und ißt davon. Bevor sie aber das Haus endgültig betritt, muß sie erst noch Wasser und Öl berühren. Nach diesem allen hebt der Gatte sie über die Türschwelle und setzt sie in eine Ecke mit dem Rücken gegen die Wand, worauf ihre ganze Aussteuer und alle anderen Geschenke vor ihr aufgebaut werden. Dort muß sie ruhig sitzen bleiben, ohne zu sprechen oder sich zu bewegen, während der Gatte und seine Freunde schmausen. Am nächsten oder an einem der folgenden Tage muß sie sich mit ihren Freundinnen zu der nächsten Wasserquelle begeben und ein Gefäß mit Wasser füllen, um die Najaden der Quelle zu versöhnen, auch eine Münze in diese fallen lassen. Bei ihrer Rückkehr gießt sie ihrem Gatten etwas Wasser über die Hände und erhält von ihm gewöhnlich ein kleines Geschenk.

Die Hochzeitszeremonien der Türken ähneln im allgemeinen denen der Moslems, über die an anderer Stelle dieses Werkes bereits berichtet wurde. Die Heirat wird meistens durch alte Frauen vermittelt, die von Harem zu Harem ziehen, um mit Gebrauchsgegenständen für das weibliche Geschlecht Handel zu treiben, dabei aber auch nach geeigneten Personen, die sie verkuppeln könnten, Umschau halten. Ist ein Paar, das zusammenzupassen scheint, von einer solchen Frau ausfindig gemacht worden, dann werden Geschenke zwischen den beiden Parteien ausgetauscht. Die Mutter des jungen Mannes sucht daraufhin das Haus ihrer zukünftigen Schwiegertochter auf und bringt rote Seide sowie einige Zuckerpflaumen mit. Nachdem die Seide auf der Erde ausgebreitet worden ist, tritt das junge Mädchen darauf und küßt seiner demnächstigen Schwiegermutter die Hand, die ihm darauf den Segen erteilt und einige Süßigkeiten überreicht. Ein Stück von diesen beißt das Mädchen entzwei und behält die eine Hälfte für sich, während sie die andere der Mutter ihres zukünftigen Gatten für diesen mitgibt. — Die bürgerliche Trauung findet acht Tage nach diesem Verlöbnis statt. Nachdem der Ehevertrag vollzogen und unterschrieben worden ist, erklärt der junge Mann vor dem Imam, dem türkischen Priester, dreimal seinen Willen, mit dem jungen Mädchen die Ehe einzugehen; die Verlobte gibt eine entsprechende Erklärung ab, wobei sie aber hinter der Tür des Frauengemaches steht. Vor dem Schluß der Hochzeitsfeierlichkeiten, die sich oft genug über einige Wochen und selbst Monate erstrecken, dürfen sich die beiden jungen Eheleute nicht sehen.

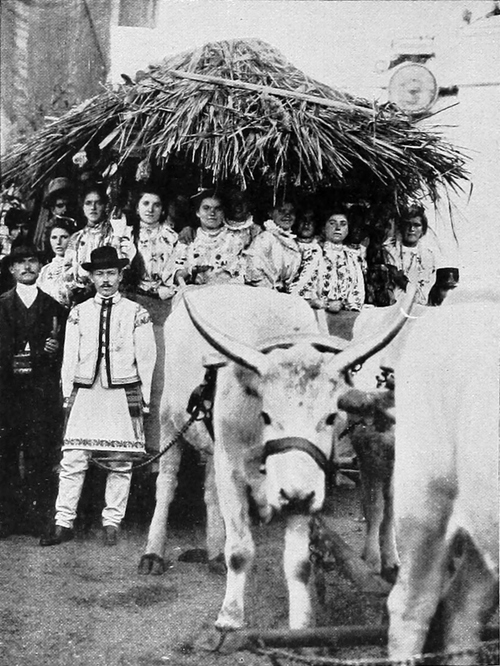
Die eigentliche Hochzeit beginnt in der Regel an einem Montag; an diesem Tage nämlich senden die Brauteltern die Ausstattung in das künftige Heim ihrer Tochter. Am folgenden Tage wird die Braut durch ihre Freundinnen ins Bad geleitet. Am Mittwoch empfängt ihre Mutter die weiblichen Verwandten des Schwiegersohnes und stellt ihnen ihre Tochter vor. Diese küßt ihrer Schwiegermutter die Hände und nimmt neben ihr Platz. Eine ältere Frau steckt letzterer ein Stück Zucker in den Mund und reicht es darauf der Schwiegertochter als Sinnbild der angenehmen Beziehungen zwischen beiden. Darauf verabschieden sich die Verwandten und gehen nach Hause, kehren aber gegen Abend noch einmal zurück, um der Zeremonie des Hennafärbens beizuwohnen, die unter großer Feierlichkeit mit Musikbegleitung vorgenommen wird. Am Donnerstag begibt sich die junge Frau in die Wohnung ihres Gatten; beim Verlassen des Elternhauses legt ihr der Vater einen Gürtel um, während er wie auch die Mutter über das Scheiden der Tochter Tränen vergießen. Bei ihrer Ankunft begrüßt der junge Ehemann seine Braut, zieht sich dann aber in die Männergemächer zurück, währenddessen die Frauen die Brautgeschenke besichtigen; darauf begibt er sich in die Moschee. Erst nach dem fünften Gebet darf er den Harem betreten und seine Frau zum ersten Male von Angesicht zu Angesicht sehen, nachdem zuvor eine alte Frau ihr den Schleier abgenommen hat. Ehe diese sich zurückzieht und das junge Paar allein läßt, hat sie noch eine eigentümliche Zeremonie vorzunehmen, nämlich den beiden Eheleuten einen Spiegel vorzuhalten und gleichzeitig deren Köpfe gegeneinander zu halten, so daß ihre Bilder im Spiegel dicht nebeneinander erscheinen. Mit dem Tage der Hochzeit hört für die junge Frau fast jeglicher Verkehr mit der Außenwelt auf; der Mann kann ihr verbieten, die eheliche Wohnung ohne seine Erlaubnis zu verlassen, ebenso ihr den Empfang von fremden Frauen in ihrem eigenen Hause untersagen. Auch die Erziehung der Kinder steht dem Vater zu, doch hat die Mutter das Recht, Knaben bis zum siebenten und Mädchen bis zum neunten Jahre zu beaufsichtigen und zu pflegen. Die Frau ist verpflichtet, ihrem Mann überallhin zu folgen, sofern der neue Wohnsitz nicht weiter als drei Tagereisen entfernt ist. Wenn ein Mann mit mehreren Frauen verheiratet ist — der Koran erlaubt deren bis vier, indessen wird nur in den seltensten Fällen von dieser Vergünstigung Gebrauch gemacht; gegen neunzig Prozent der Türken leben in Einehe —, so muß er alle gleich behandeln, gleichviel[S. 407] wie lange die Ehe mit den einzelnen Frauen besteht oder ob diese Mohammedanerinnen, Christinnen oder Jüdinnen sind. Der Gatte setzt selbständig die Zeit fest, die er bei jeder seiner Frauen zubringt; er darf aber keine von ihnen besonders bevorzugen und bei keiner über die festgesetzte Zeit hinaus verweilen. Geht er auf Reisen, so darf er sich nach Belieben von einer seiner Frauen begleiten lassen, ohne daß die zurückbleibenden berechtigt wären, dies als Zurücksetzung aufzufassen.

Die Begräbnisgebräuche der Griechen sind im großen und ganzen dieselben wie sie bei den slawischen Völkern geschildert wurden. Die Beerdigung findet meist schon ein bis zwei Tage nach dem Tode statt. In dem Augenblick, wo die Leiche das Haus verläßt, wird ein Krug mit Wasser ausgegossen. In Mazedonien tut man dies auch, wenn ein Leichenzug bei einem Hause vorüberkommt; dabei ruft man aus: „Möge Gott ihm seine Sünden vergeben, damit sie uns nicht erreichen.“ Offenbar handelt es sich bei diesem Brauch um eine Abwehrmaßnahme. Bei den Rumänen (Abb. 437) erfordert es die Sitte, daß, wenn jemand im Sterben liegt, man ihm eine Wachskerze in die Hand gibt; ist er selbst nicht mehr imstande, sie zu halten, dann muß ein Verwandter oder Freund ihm diesen Liebesdienst erweisen. Die Leiche wird mit heißem Wasser gewaschen. Das Leichenwasser darf aber nicht achtlos fortgeschüttet werden; man muß es vielmehr sorgfältig an einem Baum ausgießen und die Stelle mit dem Gefäß bedecken, in dem es gekocht wurde. Es gilt für Sünde, über eine solche Stelle hinwegzuschreiten. — In Griechenland trägt man die Leiche offen ohne Sargdeckel zum Friedhof; der Deckel wird dem Sarge aufrecht vorangetragen (Abb. 444). Bei den Griechen und Albaniern werden die Knochen einige Zeit nach dem Tode, im allgemeinen aber nach drei Jahren, ausgegraben und in kleineren Särgen von neuem beigesetzt. Stirbt ein Albanier im Ausland, so werden seine Gebeine in die Heimat übergeführt, wenigstens aber, wenn das Zurückbringen der ganzen Leiche Schwierigkeiten macht, einige wenige Knochen. Auch Seelensabbate sind den Griechen bekannt, an denen die Kirche feierliche Gedenkgottesdienste veranstaltet; sie finden am Pfingstsamstag statt. An diesem Tage begibt sich die ganze Bevölkerung in großen Scharen zu den Friedhöfen, um zu beten. Das türkische Begräbnis erfolgt nach mohammedanischer Sitte. Die nur mit einem Tuch bedeckte Leiche wird auf einem Brett zur Grabstätte getragen.
[S. 408]

Die Lappen. Das Gebiet, das wir als Lappland bezeichnen, liegt über den nördlichen Polarkreis hinaus, teils in Rußland, teils in Norwegen und Schweden. Seine Bewohner sind wahrscheinlich mongolischer Herkunft; sie zeichnen sich durch eine äußerst kleine Gestalt — beim Manne geht sie kaum über hundertfünfzig Zentimeter hinaus —, im Verhältnis zum übrigen Körper kurze, meist krumme Beine und lange Arme, breite Backenknochen, breite, platte Nase, schiefstehende Augen, schwarze Haare und schmutziggelbe Gesichtsfarbe aus. Im allgemeinen kann man sie als äußerst häßlich bezeichnen. Doch begegnet man unter ihnen hin und wieder auch Personen, besonders Mädchen, mit hellblauen Augen, blonden Haaren, schöner Gesichtsfarbe und edleren, europäisch anmutenden Zügen. Es handelt sich da um eine Folge der zahlreichen Mischungen zwischen Lappen und Norwegerinnen. Nicht selten nämlich gehen norwegische Mädchen armer Herkunft Ehen mit reichen Lappen ein. Es gibt unter diesen manche wohlhabende; einige Familien nennen gegen fünftausend Renntiere ihr Eigentum. Der umgekehrte Fall, daß ein norwegischer Bursche eine Lappin heiratet, dürfte äußerst selten eintreten, da die lappischen Mädchen gewiß nichts Verlockendes an sich haben.
Männer und Frauen sind fast gleich gekleidet (Abb. 448). Sie tragen Beinkleider aus Fell, die in hohen Pelzstiefeln stecken, ein Wams und eine mit einer Troddel geschmückte Spitzmütze. Die Küstenlappen pflegen während des Sommers an Stelle der sonst üblichen Gewänder[S. 409] aus Renntierfellen solche aus blauem Tuch von demselben Schnitt zu tragen, die meist mit reicher roter Stickerei versehen sind.
Ebenso einfach wie ihre Kleidung ist die Behausung der Lappen. Sie leben in Zelten (Abb. 445 und 447), die im Innern des Landes im Winter mit dicken Renntierfellen behängt werden, im Sommer dagegen nur aus einem leichten Stangengerüst aufgebaut und mit Birkenrinde oder Rasenstücken bedeckt sind. Oben an der Spitze des Zeltes befindet sich ein Abzugsloch für den Rauch, unten in der Mitte die Feuerstätte. Um sie herum lagert sich auf Renntierfellen als Bettstatt die ganze Familie; Eltern, Kinder und Verwandte schlafen sämtlich gemeinsam in diesem einzigen Raum.
Die Nahrung der Lappen besteht in der Hauptsache aus der Milch der Renntiere, der sie eine Art Brot aus Sauerampfer beimengen. Der Sauerampfer wird im Sommer gesammelt, breiartig eingekocht, in flachen, fladenartigen Broten getrocknet und für den Winterbedarf aufbewahrt. Renntierfleisch wird nur sehr selten genossen, meistens nur, wenn ein verunglücktes Tier geschlachtet werden muß. Die Renntiere machen den ganzen Reichtum der Lappen aus und bilden ihren wertvollen Handelsartikel, den sie bei ihrem Aufenthalt an der Küste gegen mancherlei Bedarfsgegenstände austauschen. — Männer und Frauen sind eifrig dem Genusse des Tabakrauchens ergeben.

Die Lappen führen alle ein äußerst bescheidenes Leben. Zum größten Teile sind sie Jäger und Fischer. Die umherziehenden Lappenstämme wohnen im Winter am Saume der großen Wälder und sorgen hier für ihre Herden. Kommt der Sommer, dann verlassen sie ihre kegelförmigen Fellzelte und ziehen in die Berge, den Renntieren nach, die frei umherlaufen.[S. 410] Bei der Rückkehr in die Zelte fangen sie ein Tier aus der Herde ein und hängen ihm eine Glocke um den Hals; durch diese werden die übrigen Tiere herbeigelockt und dann durch Hunde zusammengetrieben und zusammengehalten. Die Hunde spielen im Leben der Lappen eine wichtige Rolle als Haustiere; sie sind die ständigen Begleiter ihrer Herren, gehen sogar in die Kirche mit ihnen und halten sich während des Gottesdienstes bei ihnen auf; teils liegen sie dann still, teils balgen sie sich auch miteinander herum. Sie dienen zur Bewachung der Renntierherden. Auf ihren Reisen ziehen die Lappen in Schlitten (Abb. 455) oder auf Skiern (Abb. 446) umher und führen spatenähnliche Stöcke mit sich, um mit ihnen das Moos unter dem Schnee für die Renntiere auszugraben, die es sich übrigens auch selbst mit den Vorderhufen hervorholen. — Die Küstenlappen leben ausschließlich vom Fischfang, bei dem sie eine überraschende Geschicklichkeit bekunden.


Die Religion der Lappen ist das Christentum, für die skandinavischen das der lutherischen, für die russischen das der griechischen Kirche. Die kirchlichen Hauptfeste werden ebenso wie bei uns zu Ostern und im Dezember gefeiert; zu Ostern finden auch die meisten Einsegnungen und die meisten Hochzeiten statt. Oft werden drei bis vier Paare zu gleicher Zeit getraut. Als die Lappen noch Heiden waren, durfte in keinem ihrer Stämme ein Zauberpriester fehlen, ein sogenannter Noide, der sich mit Hilfe einer besonderen Trommel mit den unsichtbaren Mächten, den Göttern und den Geistern der Verstorbenen, in Verbindung setzen konnte. Nicht ein jeder vermochte Noide zu werden; man mußte dazu auserlesen sein, bereits mit einem Zahn im Munde zur Welt gekommen sein und sich durch Hunger, Einnehmen von Kräutersäften und dergleichen Maßnahmen, die das Nervensystem stark aufregten und reizten, vorbereitet haben, schließlich durch einen erfahrenen alten Noiden zuvor in die Geheimnisse eingeführt werden. Die Zaubertrommel, die eine große Rolle spielte, war von verschiedener Größe, aber stets von länglichrunder Form. Sie war aus einem Baumstamm durch Aushöhlen hergestellt und mit einem Renntierkalbfell überspannt; auf dieses waren mit rotem Saft aus Ebereschenrinde Zeichen und Bilder gemalt. Außerdem gehörte zu einer solchen Zaubertrommel noch ein Zeiger oder Weiser und ein Hammer, der in Form eines T aus Renntierknochen angefertigt war. Die Trommel diente in erster Linie zum Wahrsagen. Der Zeiger wurde unter Verbeugungen und dem Hersagen von Sprüchen auf das Bild der Sonne in der Mitte des Trommelfells gelegt und dadurch in Bewegung gesetzt, daß in seiner Nähe anfangs leise, dann stärker mit dem Hammer aufgeschlagen wurde. Machte der Zeiger bei einer Figur halt, dann war die Zeremonie, die von dem Zauberer und den Umhersitzenden mit dem eintönigen Absingen von Liedern zu Ehren der Gottheit, an die man ein Anliegen hatte, begleitet wurde, beendet und die Kundgebung geschehen. Das betreffende Bild zeigte dann an, was für ein Tier geopfert werden sollte, ferner welcher Gottheit und an welcher Stelle, ob ein Krankheitsfall tödlich verlaufen werde oder nicht und so fort. Die Trommel wurde auch, obwohl seltener, geschlagen, wenn der Zauberpriester einen Zustand von Verzückung herbeiführen wollte, um sich in ferne Gegenden zu versetzen. Er verfiel dabei infolge seiner hochgradigen nervösen Reizbarkeit in eine Art Dämmerzustand und berichtete nach seinem Erwachen, welche Orte er auf seiner Wanderung in die Ferne aufgesucht und was er dort gesehen habe. Es bedarf wohl keines weiteren Nachweises,[S. 413] daß der Zauberpriester der Lappen mit seiner Trommel an den Schamanen der nordsibirischen Völker erinnert, und es ist wohl anzunehmen, daß die Lappen diese Gebräuche von dorther mitgebracht haben.
Die kleinen Kinder der Lappen werden in eine Art Lederfutteral (Abb. 450) eingewickelt, aus dem sie nur gerade mit dem Gesicht herauslugen; sie sehen dann eingewickelten Mumien nicht unähnlich. Diese Futterale werden gleichzeitig als Wiegen benutzt, die man zwischen zwei Birkenstämmen aufhängt und schaukelt.
Bevor der Lappe eine Ehe eingeht, erkundigt er sich ganz genau nach der Höhe der Mitgift seiner Zukünftigen, da er in diesen Dingen sehr nüchtern denkt. Bei der Hochzeit sind Braut und Bräutigam in der Regel mit roten Gewändern, roten seidenen Schärpen, weißen Schuhen, Pelzgamaschen sowie roten Handschuhen angetan. Die Hauptsache bei der Hochzeit (Abbildung 449) ist das Essen, das in gekochtem Fleisch besteht. Aus einer gemeinsamen Schüssel nimmt sich jeder der Gäste ein großes Stück heraus, zerschneidet es mit seinem Messer, das er ständig im Gürtel bei sich trägt, in kleinere Stücke und schlingt diese hinunter.
Die Beerdigungen finden für gewöhnlich um Ostern statt, wenn die Erde aufgetaut ist. Den Winter über werden die in Särge gelegten Leichen in einem kleinen Turm in der Nähe der Kirche aufbewahrt (Abb. 452). Das Wehklagen und Geheul, das Männer und Frauen über den Verlust des Toten anstimmen, hat große Ähnlichkeit mit Hundegeheul.

Die Finnen. Dieser Stamm hatte[S. 414] seinen ursprünglichen Sitz in Sibirien, von wo er bereits in weit zurückliegenden Zeiten nach Osteuropa auswanderte. Die nächsten Verwandten der Finnen in unserem Erdteil sind die Ungarn und Türken; sie bilden mit diesen beiden Völkern die finnisch-ugrische Völkergruppe. Zu den Finnen zählen die Esten, Liven und Suomi oder Finnen im engeren Sinne mit verschiedenen Unterstämmen, zum Beispiel den Kareliern; diese alle faßt man als Westfinnen (am Baltischen Meere) zusammen. Ferner gehören zu den Finnen die Tschuwaschen, Mordwinen, Wotjäken, Permier und Wogulen in der Gegend des Urals (Ostfinnen). Infolge der anhaltenden Kreuzung mit mongolischen und vor allem nordeuropäischen Rassenbestandteilen, die in Rußland teils schon vorhanden waren, als die Finnen einwanderten, teils deren Weg kreuzten, hat ihr Äußeres mancherlei Züge von diesen Völkern angenommen, so daß von einem eigentlichen finnischen Typus nicht die Rede sein kann (Abb. 451). Bemerkenswert ist unter den Finnen die große Zahl von blonden Leuten — unter den Permiern zum Beispiel gibt es sechsundfünfzig Prozent Blonde und ebenso auffallend viel Blauäugige —, die sicherlich auf Mischung mit Nordländern (Germanen) beruht.

Schon im Mittelalter wurden die Finnen zum Christentum bekehrt. Doch hat diese Lehre trotz der langen seitdem verflossenen Zeit nicht vermocht, den alten heidnischen Glauben vollständig zu verdrängen (Abb. 458 und 473), denn neben dem christlichen Gott beten verschiedene finnische Stämme immer noch zu den Göttern der Vorfahren, vor allem dem[S. 415] Sonnengott und den Seelen der Ahnen. Auch die abergläubische Scheu vor meist bösen Geistern, die die Luft und die Erdoberfläche bevölkern und den Menschen übel gesinnt sind, spukt im Volke noch viel herum. In jedem Hause gibt es auch einen Schutzgeist, der mit dem Ehrentitel „Nachbar“ oder „Brüderchen“ belegt wird. Sobald bei den Permiern ein neues Wohnhaus errichtet worden ist, nimmt der Hausherr aus dem Heiligenschrein ein Heiligenbild, stellt sich damit vor den Verschlag neben den Ofen und ruft dem Schutzgeist zu: „Nachbar, Brüderchen, komm mit uns ins neue Heim; wir wollen im neuen Hause so gut leben, wie wir im alten gelebt haben; liebe meine Familie und mein Vieh!“ Darauf begibt sich alles ins neuerbaute Haus; der Hausherr läßt zuvor einen Hahn hinein und wartet ab, bis dieser gekräht hat. Das Heiligenbild wandert nun wieder in den Schrank zurück und der „Nachbar“ wird aufgefordert, im Verschlag neben dem Ofen seinen neuen Wohnsitz einzunehmen. — Auch Zauberpriester kennen die Permier noch, die zwischen den Geistern und den Menschen vermitteln sollen.

Die Hochzeitsgebräuche bei den finnischen Stämmen sind ziemlich verwickelt. Teilweise kommt noch Raubehe bei ihnen vor, wobei es nicht selten zwischen den Anhängern des Bräutigams und seinen Gegnern zu einem ernsten Handgemenge kommt. Gewöhnlich werden die Ehen durch einen Vermittler oder Brautwerber eingefädelt. Nachdem auf solche Weise der Boden vorbereitet worden ist, erscheint bei den Mordwinen der Vater des Bräutigams im Hause der Braut, wird hier auf den Ehrenplatz unter den Heiligenbildern geführt und beginnt die Verhandlungen über den Brautpreis, die Aussteuer, die Ausrichtung der Hochzeit und ähnliche Fragen. Sind beide Parteien einig geworden, dann wird ein brennendes Licht auf den Tisch gestellt und alles betet zu Gott um Schutz und Beistand; daneben ruft man aber auch die Hilfe der heidnischen Gottheiten und der verstorbenen Ahnen an und spendet ihnen Salz und Brot, indem man diese Gaben an der Schwelle, wo man sich ihren Aufenthalt denkt, niederlegt. Diese Zeremonie nennt man „das Gebet der Hochzeitskneiperei“. Darauf folgt das sogenannte „Vertrinken“. Vater und Mutter des Bräutigams begeben sich in das Haus der Brauteltern und fragen noch einmal feierlich an, ob diese geneigt seien, ihrem Sohne die Tochter zur Frau zu geben. Erklären sie ihr Einverständnis, dann stellen die Angehörigen des Bräutigams den mitgebrachten Branntwein und die Speisen, unter denen gesalzene Brassen als Zeichen der Fruchtbarkeit und Kuchen als Sinnbild des Sonnengottes nicht fehlen dürfen, vor den Brautvater auf den Tisch und nehmen an diesem Platz; darauf beginnt ein meist wüstes Trinkgelage. Bei dieser Gelegenheit wird die Braut zum ersten Male ihrem Zukünftigen gezeigt, auch noch um ihre Einwilligung[S. 416] gefragt und gleichfalls mit Branntwein bewirtet. Von diesem Tage an hat der Bräutigam das Recht, jede Nacht bei ihr zuzubringen. Verlust der Jungfernschaft gilt bei den Mordwinen keineswegs als Schande, im Gegenteil ein vor der Ehe erzeugtes Kind wird begrüßt als Anzeichen dafür, daß die zukünftige Gattin fruchtbar sein wird. Vor der Hochzeit findet eine Art Polterabend statt. Dabei schreit, heult und jammert die Braut ohne Unterlaß und bittet ihre Freundinnen, sie lieber in die dunkle Erde einzubetten, als unter die fremden Leute zu bringen. Diese singen inzwischen lustige Lieder, in denen sie die Braut verherrlichen, den Bräutigam aber auf alle erdenkliche Art verspotten; auch uralte nationale Heldengesänge, darunter die Kalewala, werden bei dieser und bei anderen festlichen Gelegenheiten vielfach noch gesungen (Abb. 454). Am Abend erscheint der Schwiegervater mit einer bedeutenden Menge Honigbier und bewirtet die Braut samt ihren Eltern. Am Hochzeitstage versammeln sich die Freunde des Bräutigams vor seinem Hause. Sein Vater zündet Lichter vor den Heiligenbildern an und setzt ein besonders großes an der Schwelle nieder. Darauf betet er zu den Heiligen und legt neben die Schwelle an die Seite des großen Lichtes ein Stück Brot, wobei er auch den Sonnengott um Beistand anfleht. Der Sohn begibt sich nun in das Haus seiner Braut. Wenn man ihn kommen sieht, schließt man eilig die Haustür zu, worauf sich zwischen den beiden Parteien ein Gespräch über die Person, die Einlaß begehrt, und den Zweck ihres Besuches entspinnt. Da dem Bräutigam und seinen Freunden das gewaltsame Öffnen der Tür nicht gelingt, so erkaufen sie sich den Eintritt endlich mit einigen Münzen. Nach einer kurzen Unterhaltung erscheint die Braut, fällt ihren Eltern zu Füßen und erbittet deren Segen. Der Vater entspricht der Bitte unter Anrufung heidnischer Gottheiten, denen er von einem Laibe Brot opfert, demselben, den schon vorher der Vater des Bräutigams gebraucht hatte, um den Sohn zu segnen. Hierauf hebt ein männlicher Verwandter der Braut diese auf die Arme und trägt sie in den Wagen. Das Mädchen stellt sich dabei sehr störrisch, kneift, kratzt, schreit und sucht sich beim Verlassen des Hauses sogar noch an der Tür festzuhalten. Noch auf dem Wege zur Kirche versucht die Braut zu entwischen: sie steigt vom Wagen, wirft sich vor die Füße der Pferde und bittet diese, sie nicht zu fremden Menschen zu fahren, putzt die Tiere auch mit Bändern aus und verspricht ihnen, dies immer zu tun, wenn sie ihr den Gefallen tun wollten, sie wieder nach Hause zu fahren. Da dies nichts hilft, sucht sie fortzulaufen, wird aber von den Freunden ihres Verlobten eingefangen.

Die Trauung geht in der Kirche nach griechischem Ritus vor sich. Auch hier spielt die Braut von neuem die Widerspenstige; der Aufforderung des Priesters, ihren Gatten zu küssen, widersetzt sie sich, schlägt und knufft diesen vielmehr. Nach Beendigung der Zeremonie müssen[S. 417] die jungen Burschen wieder Gewalt anwenden, um die junge Frau in den Wagen zurückzubringen. Ist dies gelungen, geht es im Galopp nach Hause in das neue Heim. Bei ihrer Ankunft wird die junge Frau von der Schwiegermutter empfangen (Abb. 456) und von einem anderen Verwandten mit Hopfen überschüttet. Sie setzt sich dann neben den Herd und muß von neuem die Schimpfreden der jungen Mädchen über ihren Mann mitanhören. Ihre Brüder oder in Ermanglung solcher andere junge Burschen erhalten von den Verwandten des jungen Ehemanns kleine Geschenke und bewirten die Freundinnen mit Branntwein; hienach fallen sie über diese her und treiben sie mit Fußtritten aus dem Hause. Die junge Frau wird sodann ebenfalls ergriffen und trotz ihres Sträubens zu ihrem Manne in die Scheune gebracht, wo man das Beilager zubereitet hat; die Tür wird hierauf hinter dem Paar verschlossen.

Noch umständlicher sind die Hochzeitsfeierlichkeiten bei den Kareliern. Hat ein junger Mann ein ihm gefallendes Mädchen gefunden, dann bespricht er sich mit seinen Angehörigen und macht sich in Begleitung von zwei oder drei Freunden und einem weiblichen Wesen, gewöhnlich gegen Abend, auf den Weg zu seiner Zukünftigen. Flintenschüsse verkünden stets bei solcher Gelegenheit dem Dorfe, daß wieder einmal ein junger Mann ausgegangen ist, um sich ein „wollenes Halstuch“, das ist eine Frau, zu suchen. Auf dieselbe Weise begrüßt man seine Ankunft im Heim der Auserwählten. Der Freier und seine Begleitung werden sogleich zu[S. 418] den Ehrenplätzen geleitet und unterbreiten den Eltern des Mädchens ihr Anliegen, worauf alle Verwandten zusammengerufen werden — unter ihnen darf ja nicht der Pate des Mädchens fehlen —, um die Angelegenheit hinter verschlossenen Türen zu beraten. Ist Einverständnis unter ihnen erzielt worden, dann zündet der Vater eine Kerze vor dem Heiligenbilde an und fordert seine Tochter auf, sie entweder wieder auszulöschen oder brennen zu lassen, wodurch sie ihre eigene Entscheidung bekunden soll (Abb. 453). Löscht die Tochter die Kerze nicht aus, dann erklärt sie sich dadurch mit dem Antrag einverstanden, und damit ist die Verbindung ein für allemal eine beschlossene Sache. Die nächsten männlichen Verwandten beider Parteien bestätigen dies mit Händedruck und durch Klingenlassen von Geld vor dem Heiligenbilde. Das Mädchen gilt fortan als verlobt. — Die neue Braut setzt sich nun in die Frauenecke und an ihre Seiten je eine Freundin als Klageweib. Von der anderen Seite des Hauses kommt die Mutter mit weiteren weinenden Frauen herzu (Abbildung 461). Beide Gruppen gehen einander entgegen und begeben sich dann gemeinsam in die Frauenecke, um hier den Verlobungsgesang zu „weinen“.
Die Einladungen zur Hochzeit und das Übergeben von Hochzeitsgeschenken sind gleichfalls von Weinen begleitet; ja ein oder mehrere Berufsweiner helfen dabei noch tüchtig mit. Für jeden Einzuladenden müssen zwei Lieder unter Weinen vorgetragen werden, ein Bittgesang und ein Dankgesang; dabei strengen die Einladenden nicht nur ihre Kehle, sondern auch ihren Rücken an, denn sie müssen beim Dankweinen den Kopf von Zeit zu Zeit bis auf die Erde vor dem Spender neigen.

Die Hochzeitsfeierlichkeiten beginnen meist am Samstag abend. Die Mädchen erwärmen das Badehaus, fordern die Braut unter Weinen auf, es zu betreten, und stimmen in dem Raum, während sie badet, ein Klagelied in althergebrachter blumenreicher Sprache an (Abb. 457). Nach dem Bade werden der Braut die ersten Geschenke dargebracht, und zwar bietet sie ihr der Bräutigam selber auf einer Platte an. Nach langen Einwendungen berührt sie diese endlich mit der Hand, worauf der Vater oder ein anderer naher Verwandter sie in Empfang nimmt. Die Gegengeschenke von seiten der Braut, die für die Angehörigen und Verwandten des Bräutigams bestimmt sind, werden sodann auf dieselbe Platte gelegt; über ihre Verteilung beschließt eine eigens dazu bestimmte Person, der Saajannainen, das heißt Begleiter, Helfer. Bei dieser Gelegenheit fließen wiederum reichlich Tränen.


Am Vormittag des darauf folgenden Hochzeitstages versammeln sich allerhand Leute, alte wie junge, vor dem Hochzeitshause und vertreiben sich die Zeit mit Spielen (Abb. 468). Die Braut (Abb. 466) geht mit den Weinenden unter ihnen umher und bittet sich Geschenke aus. Hat sie es auf eine bestimmte Person abgesehen, bei der es sich verlohnt, ein Geschenk zu erbitten, dann legt das Mädchen die Arme um deren Hals und weint so lange, bis sie eine Gabe herausgerückt hat, worauf die Braut dann wieder noch den Dank zu „weinen“ hat. Nach einiger Zeit wird durch Flintenschüsse die Ankunft des Gefolges des Bräutigams angekündet, das bei dem Katshotus, das ist dem ersten feierlichen Erscheinen der Braut vor den Angehörigen ihres Zukünftigen zugegen sein will. Zunächst läßt man sich an dem langen Familientisch, der in den finnischen Häusern unter dem mittleren Fenster, der Eingangstür gegenüber, zu stehen pflegt und als Ehrenplatz gilt, und an weiteren, kleineren Tischen nieder. Der Patvaska oder Zeremonienmeister streut Salz unter das Tischzeug, nimmt ein Brot, das vom Hause des Bräutigams mitgebracht wurde, und ein zweites aus dem Hause der Braut, schneidet aus der Mitte beider je ein rundes Stück heraus, tut Salz in die so entstandenen Löcher, paßt die herausgeschnittenen Stücke wieder hinein und legt die Brote auf die Familientafel. Die Klagemädchen weinen so lange, bis der Pate oder Bruder hinausgeht, um die Braut fertig zu machen. Über die gewöhnlichen Alltagskleider wird ihr das beste Zeug angezogen, das sich die Mädchen unter Klagen und Weinen ausbitten. Der Pate oder Bruder reicht das Hemd und hält es der Braut über den Kopf, wie wenn er es ihr anziehen wollte. Zweimal stößt diese es von sich, beim dritten Male aber zieht sie es an. Während des ganzen Vorgangs wird ununterbrochen geweint. Beim Anlegen des Unterrockes und des Rockes wiederholen sich dieselben Umständlichkeiten. Bevor man sich in die Kirche begibt, nimmt der Zeremonienmeister in der Frauenecke noch gewisse Maßnahmen vor, um das Paar vor Zauberei zu schützen (Abb. 462). Sodann wird die[S. 421] Braut in die Frauenecke geleitet; fünf Frauen lösen ihr auf dem Wege dorthin den Haarknoten auf (Abb. 471). Sind sie zur Ecke gekommen, dann zieht die Hebamme einen Vorhang vor, zieht ihn aber wieder zurück, nachdem ihr der Zeremonienmeister einige Kopeken gegeben hat; nun erblickt der Bräutigam seine Braut. Nachdem das Paar herumgegangen ist, zündet der Zeremonienmeister drei Stückchen Feuerschwamm an, von denen Braut und Bräutigam je ein Stück hinunterschlucken müssen; das dritte wird unter eine Bratpfanne gelegt, die sich auf der Erde befindet. Während sich nun die Gäste in die Kirche begeben, bleibt der Zeremonienmeister als Vertreter der alten heidnischen Gebräuche der christlichen Feier fern. Ehe die Braut das elterliche Haus verläßt, wird über sie ein Heiligenbild mit einem Tuche gehalten (Abb. 467). — Vor der Kirche überreicht der Bräutigam seiner Braut das Kopftuch, an dem er sie hineinführt. Auf dem Rückwege fordert er seine nunmehrige junge Frau sowie die Gäste auf, in sein Haus oder, falls er von auswärts sein sollte, in ein ihm zu diesem Zweck von Verwandten zur Verfügung gestelltes zu kommen und weiter zu feiern.
Die Feier besteht in der Hauptsache in Branntweintrinken. Dabei schüttet das junge Paar zu drei Malen Branntwein kreuzweise unter den Tisch, um den Schutzgeist des neuen Hauses gut zu stimmen. Mann und Frau müssen die dazu benutzten Becher möglichst nahe aneinander auf den Tisch stellen, damit kein Streit oder Unfriede einkehre. Nachdem man reichlich dem Branntwein zugesprochen hat, beginnt das Verteilen der Geschenke.

Wenn die Abschiedstunde für die junge Frau naht, wird ihr das Stirnband, das Zeichen der Mädchenschaft, abgenommen und hierauf ein Kasten, der voll Sachen sein muß, in die Frauenecke gebracht. Die junge Frau setzt sich auf ihn, nachdem ein Verwandter sie dreimal um den Kasten geführt hat. Jetzt bemächtigen sich ihrer zwei alte Frauen, kämmen ihr das zuletzt lose herabhängende Haar und flechten es in zwei Zöpfe anstatt des bisherigen einen, den die Mädchen tragen. Der Zeremonienmeister übergibt ihr ein großes Tuch, mit dem sie vollständig verhüllt wird, so daß sie selbst nichts sieht und auch von niemand erblickt werden kann. Nur ein schöner kleiner Knabe zu ihren Füßen darf unter das Tuch sehen; man will sie dadurch an ihren zukünftigen Beruf als Mutter erinnern. Beim Zurechtmachen der jungen Frau singen zwei oder drei alte Frauen das Lied vom Anlegen des Kopfschmuckes. Das Gefolge des Mannes muß die Frauenecke verlassen, darf aber nur gegen Erlegung von Geld hinaus, das eine Freundin der Jungvermählten einsammelt. Nachdem dies geschehen ist, stellen sich die jungen Leute in einer Reihe auf dem Hofe auf und warten auf die junge Frau, die bald darauf von ihrem Paten hinausgeleitet wird. Sie ist[S. 422] noch immer mit dem Schleiertuch bekleidet und wird so vor ihren Gatten geführt, vor dem sie sich dreimal tief verbeugt. Dann übergibt der Pate sie dem Gatten mit einer kurzen Ansprache, in der er beiden Ratschläge erteilt. Unter anderem sagt er zu dem jungen Ehemann: „Gehorcht sie dir nicht, dann nimm einen Strohhalm und schlag sie damit; wenn sie dir dann noch nicht gehorcht, so nimm ein Birkenreis und tu das gleiche; gehorcht sie dir aber auch dann noch nicht, so nimm eine härtere Waffe, auch wohl eine Zuberstange, und schlag sie. Hüte dich aber davor, ihr dabei das Leben auszublasen, denn wir besitzen eine ausgedehnte Bekanntschaft, die bereit ist, die Pflicht der Blutrache zu übernehmen.“ Darauf geht der Mann dreimal um seine junge Frau herum und sieht unter die Verhüllung, um sich zu überzeugen, ob sie es auch in Wirklichkeit ist.
Die ganze erste Nacht wird durchgefeiert; der Zeremonienmeister muß sorgfältig achtgeben, daß nichts Ungesetzliches vorkommt. Deshalb folgt er selbst dem jungen Paar in sein Schlafgemach. Die junge Frau schläft diese Nacht vollständig angekleidet. — Die Mutter drückt, wenn die junge Frau das elterliche Haus verläßt, ihren Schmerz darüber durch Weinen aus (Abb. 472).
Diese umständlichen Hochzeitsgebräuche, zu denen noch verschiedene hier übergangene weitere Einzelheiten gehören, werden von den Kareliern streng beobachtet. Es kommt vor, daß, wenngleich der Priester das Paar kirchlich getraut hat, dieses sich nicht eher als verheiratet betrachtet, als bis es alle überlieferten Vorschriften erfüllt hat. Nicht jeder kann sich aber wegen der Kostspieligkeit der Zeremonien ihnen allen unterziehen. Daher gibt es auch ein abgekürztes Verfahren, das anscheinend noch ein Ausläufer der früheren Raubehe ist. Der Freier tritt vor das Mädchen, das ihm als Gattin zusagt, verbeugt sich und bietet ihr den Zipfel eines Kopftuches an. Lehnt sie es dreimal ab, dann will sie dem Manne damit kundgeben, daß er ihr nicht gefalle; nimmt sie es aber an, dann erklärt sie ihr Einverständnis. Darauf bedarf es keiner weiteren Förmlichkeiten, als daß irgendeine Frau das Haar des Mädchens in zwei Zöpfe flicht und ihm einen Hut auf den Kopf setzt; damit ist es zur jungen Frau gemacht.

Zum Schluß noch einige Einzelheiten über die Hochzeit der Esten. Während der Hochzeitszug sich in die Kirche begibt, müssen der Bräutigam und die Brautführer dicht neben dem Wagen der Braut reiten und mindestens einer von ihnen ein Schwert tragen, mit dem er unterwegs des öfteren Lufthiebe austeilt, um die bösen Geister zu vertreiben. Wenn das junge Paar am Abend der Hochzeit sein Lager aufsucht, nimmt der Vater der jungen Frau ihr mit dem Schwerte den Schleier ab und steckt das Schwert sodann in die Decke des Zimmers, gleichfalls zum Schutze gegen böse Geister. Bei einzelnen Stämmen wird die Braut, sobald die Gäste erscheinen, in eine Kammer versteckt, wo man sie mit zwei anderen Mädchen unter einer[S. 423] Decke verhüllt warten läßt, bis die Gäste sie gefunden haben; der Brautführer muß dann aus den drei verborgen gehaltenen Mädchen die Braut herausfinden und in die Stube führen. In einzelnen Gegenden versteckt man auch an Stelle der Braut drei ihrer Brüder oder drei junge Burschen in Weiberkleidung. Die von dem Brautführer aus ihnen herausgesuchte vermeintliche Braut wird unter Jubel in die Feststube geführt, wenn man aber den Irrtum eingesehen hat, sogleich wieder hinausgejagt. Hierbei scheint es sich ebenfalls um eine Abwehrmaßnahme zu handeln: die falsche Braut soll das Unglück auf sich nehmen, indem man hofft, die Geister durch sie über die Person der wahren Braut zu täuschen.
An die Schwangerschaft und an das neugeborene Kind knüpfen sich ebenfalls mancherlei abergläubische Vorstellungen, die die Abwehr böser Geister bezwecken. So muß die Schwangere, um ein paar Beispiele anzuführen, bei langsam fortschreitender Geburt dreimal Salz hinter sich werfen; wenn sie das Neugeborene in die Wiege legt, muß sie einen Kreuzschlüssel, ein Messer und etwas rotes Garn mit hineintun, und so weiter.

Über die Totengebräuche nur wenige Worte. Wenn bei den Permiern der Tod eingetreten ist, dann werden die Verwandten oder auch Fremde eingeladen, um die Leiche zu waschen und den Sarg anzufertigen. Bevor man mit dem Waschen beginnt, sagt der damit Beauftragte zu dem Toten: „Ärgere dich nicht; ich will dich waschen.“ In ähnlicher Weise entschuldigt man sich bei ihm, wenn der Sarg hereingebracht wird. Im allgemeinen schafft man[S. 424] die Leiche möglichst bald aus dem Hause nach dem Friedhof, und zwar geschieht dies im Trab auf einem Schlitten. Auf den Sarg wird ein Laib Brot gelegt, den man dem ersten besten, der dem Zuge begegnet, zuwirft, anscheinend der letzte Rest eines Totenopfers. Beim Hinablassen des Sarges wird der Deckel hochgehoben, damit der Verstorbene zum letzten Mal die Welt betrachten könne. Vielfach bleibt der Schlitten, der den Toten hinausbrachte, über dessen Grabhügel liegen, in welchem Falle ein Friedhof durch die vielen Schlittenüberreste einen ganz merkwürdigen Anblick bietet; auch die Werkzeuge, die beim Auswerfen des Grabes benutzt wurden, werden zurückgelassen.
Bei dem sich anschließenden Totenmahl werden brennende Lichter auf die Fensterbretter und zu beiden Seiten neben die Tür gestellt, eine Zeitlang auch diese offen gelassen; außerdem wird der Schatten des Verstorbenen aufgefordert, sich am gemeinsamen Mahle zu beteiligen. Er erhält auch einen Platz an der vorderen Ecke der Tafel angewiesen, was äußerlich dadurch gekennzeichnet wird, daß eine Mütze oder ein Kopftuch (je nach dem Geschlecht) dorthin gelegt und Gefäße für Kuchen, Sauermilch, Branntwein und Haferbrot darum gestellt werden. Jeder Gast hält es für seine Pflicht, einen Teil seiner Speisen in diese Schüssel zu tun mit der Aufforderung: „Iß, Brüderchen“ oder „Iß, Gevatter“. Nach der Mahlzeit stellt man die Schüssel in einem abseits gelegenen Winkel des Feldes ins Gras und sieht nach einiger Zeit nach, ob etwas von den Speisen darin geblieben ist. Sind sie nicht vollständig verschwunden, das heißt von den Krähen und Raben nicht ganz aufgefressen worden, dann erblickt man darin ein Zeichen dafür, daß der Verstorbene die ihm vorgesetzten Speisen aus Zorn verschmäht hat. Am neunten und am vierzigsten Tage nach dem Tode sowie am Jahrestage desselben finden nochmalige feierliche Bewirtungen des Toten statt.

[S. 425]
Die Basken. Die Basken oder Euskaldunak, wie sie selbst sich nennen, wohnen zu beiden Seiten der Pyrenäen am Biskayischen Meerbusen. Sie sind hinsichtlich ihrer Herkunft bislang immer noch ein rätselhaftes Volk geblieben. Die abenteuerlichsten Vermutungen sind hierüber geäußert worden, ohne daß man zu einem einwandfreien Ergebnis gekommen wäre. Nach dem augenblicklichen Stande der Forschung wird man nicht fehlgehen, wenn man annimmt, daß sie aus Nordafrika stammen, schon in der Vorzeit nach Spanien einwanderten, wo sie ursprünglich eine viel größere Verbreitung als heute hatten — die alten Iberer dürften als ihre Vorfahren anzusehen sein —, und infolge ihrer Isolierung auf einer früheren Kulturstufe stehen geblieben sind. Denn sie zeigen noch mancherlei Gebräuche und Gewohnheiten, die an ähnliche primitive Zustände der Vorzeit oder an solche bei wenig vorgeschrittenen Naturvölkern erinnern. Das Merkwürdigste und am wenigsten Aufgeklärte bei diesem Volke ist seine Sprache, die, wie zum Beispiel das Chinesische und einige amerikanische Sprachen, Agglutination aufweist. Die baskische Sprache steht daher unter den übrigen westeuropäischen Sprachen ganz vereinzelt da; v. der Gablentz und andere Forscher wollen Ähnlichkeit zwischen ihr und den Berbersprachen Nordafrikas herausgefunden haben.

Auch die äußere Beschaffenheit der Basken läßt deutliche Verwandtschaft mit der nordafrikanischen Bevölkerung erkennen. Wenngleich kein einheitlicher Menschenschlag, so ist der Baske doch durch eine Anzahl besonderer Eigentümlichkeiten gekennzeichnet, wie mittlere Körpergröße, schlanke, aufgeschossene Gestalt, kurzen oder auch länglichen, an den Schläfen merkwürdig stark gewölbten Schädel, langes, schmales, von den Jochbeinen an auffallend scharf nach unten sich zuspitzendes Gesicht mit außerordentlich spitzem, leicht fliehendem Kinn, dünne gebogene[S. 426] Nase, die sich in die gerade aufsteigende, etwas schmale Stirn unmittelbar fortsetzt, dunkle Augen, dunkles Haar und brünette Hautfarbe. Die Untersuchung hat ergeben, daß diesem Typus der der sogenannten mittelländischen Rasse zugrunde liegt, also derjenige, dem die Bewohner von Südeuropa und Nordafrika angehören. Offenbar haben sich zu diesem noch kurzköpfige Elemente (alpiner Typus) hinzugesellt, und durch große Abgeschlossenheit unter lange Zeit sich gleichbleibenden äußeren Bedingungen hat sich in Verbindung mit Inzucht der heutige Typus der Basken entwickelt.
Die nationale Tracht (Abb. 465) der Basken bestand bei den Männern aus breiten schlaffen Kniehosen, schwarzen Strümpfen, weißem Hemd mit hohem, bis auf die Wangen reichendem weichen Kragen, schwarzer Jacke und runder, flacher, aus Wolle gewirkter Mütze, der Chapelak; die Frauen trugen blauen Rock mit bunter Schärpe silbergesticktes, schwarzes Mieder, das vorn über dem sichtbar bleibenden Hemd verschnürt wurde, bunte Umhängetücher und ein kleines Tuch für den Haarknoten. Bis auf die typische Mütze und die Kopftücher ist diese Tracht jetzt so ziemlich im Aussterben begriffen.
Die Basken sind vorwiegend Ackerbauer, treiben aber auch Viehzucht und etwas Schiffahrt. Ihre Sprache nimmt die Bezeichnungen für die verschiedenen Abschnitte des Jahres von der Landwirtschaft her. So heißt der November der Saatmonat (Azilla), der Juni der Gerstenmonat (Garagarilla), der Juli der Weizenmonat (Garilla edo Uzteilla), der Oktober der Einsammlungsmonat (Bildilla), der Februar der Stiermonat (Zezeilla) und so weiter. Vom Sommer leitet man die Namen für den Frühling (Udaberri = neuer Sommer) und für den Herbst (Udazkena = letzter Sommer) ab. Bei der Ausübung des Ackerbaus haben die Basken noch einige ursprüngliche Arbeitsweisen bewahrt. So benutzen sie Karren (Abb. 476) mit mächtigen massiven Holzscheiben als Rädern, die sich zugleich mit der fest mit ihnen zusammenhängenden runden Achse drehen; den Aufbau dieser Karren bildet ein Kasten aus Brettern oder ein Rutengeflecht, die Deichsel läuft bis nach hinten durch. Beim Kochen von Flüssigkeiten, besonders von Milch, wenden die Basken das althergebrachte Verfahren der Steinkocherei an, das heißt des Hineinwerfens von glühend gemachten Steinen in einen mit der zu kochenden Flüssigkeit gefüllten Holztrog.

[S. 427]
Die Basken sind große Freunde von Tanz, Musik und Spiel. Der Nationaltanz, eine Art Haschtanz, hat allerdings schon vielfach den neuzeitigen europäischen Tänzen weichen müssen, dagegen haben sich die alten Musikwerkzeuge, mit denen er begleitet wurde, noch immer erhalten. Das Nationalspiel der Basken ist die Pelote, ein Ballspiel, das sich bei alt und jung großer Beliebtheit erfreut, so daß, wie man sagt, bei ihm der Baske Essen und Trinken vergessen kann. Es wird vor dem Fronton gespielt, einer breiten und hohen, oben mit einem Fangnetz gekrönten Mauer; von dieser läuft ein viereckiger Spielplatz aus, der links und rechts eingezäunt, an der Zugangseite aber offen ist (Abb. 460). Zwei Parteien, blau und rot, spielen gegeneinander. Ein Spieler wirft mit der Chistera (Abb. 459), einem aus starken Weidenruten hergestellten Wurfwerkzeug in Kahnform, an dessen hinterem Ende in einem dort angebrachten Ledersack die Hand fest eingeschnürt ist, einen Ball kräftig gegen den Fronton, während ein Spieler der Gegenpartei die Aufgabe hat, ihn im Rückflug oder nach dem ersten Aufprall vom Boden aufzufangen und seinerseits gegen die Mauer zu schleudern. Das Spiel erfordert ungemeine Geschicklichkeit.
Bei den Basken besteht noch die Auffassung, daß die Frau die Untergebene des Mannes sei, was auf mancherlei Art zum Ausdruck kommt. Bei der Trauung sagt der Priester zu den Brautleuten: „Mann und Frau sind wie die beiden Hände des Menschen, jener entspricht der rechten, kräftigeren, diese der linken, schwächeren Hand.“ Nach der Trauung bekleidet der Küster die Jungvermählten mit der Stola; während er sie aber dem Manne um die Schultern hängt, legt er sie der Frau auf den Kopf zum Zeichen ihrer Unterwerfung unter die Herrschaft des Gatten. Das männliche Wochenbett kommt heutigestags unter den Basken wohl nicht mehr vor; nach der, allerdings fraglichen, Annahme verschiedener Gewährsmänner soll es aber in vergangener Zeit unter den Basken bestanden haben. Dagegen ist erwiesen das Vorrecht der ältesten Tochter vor allen Söhnen in der Erbschaft, sofern sie älter als die Söhne ist und im elterlichen Hause verbleibt. Dies ist offenbar ein Überrest des Mutterrechts früherer Zeiten.

An den kirchlichen Festen finden fast immer Kinderumzüge statt, bei denen gesungen und um Almosen gebettelt wird. In der Karwoche, wo die Kirchenglocken nicht läuten dürfen, machen die Kinder Lärm mit Knarren. Am Tage vor Ostern bringen sie Wasser und Feuer in die Kirchen, lassen den priesterlichen Segen darüber aussprechen und schaffen beides dann in die elterlichen Wohnungen, damit die Häuser vor Blitzschlag und Ungewitter verschont[S. 428] bleiben. Mit demselben geweihten Wasser besprengt man auch das Korn auf den Feldern, um es vor allerlei Schädlichkeiten zu schützen und sein Gedeihen zu fördern. Für noch wirksamer gilt das Wasser, das man in der Johannisnacht schöpft. In der dem San-Juan-Tage (24. Juni) vorausgehenden Nacht strömen die Leute aus dem gesamten Baskenlande nach Cambos und eilen mit dem Glockenschlage zwölf auf die Brunnen zu, um sich in gierigen Zügen so viel einzupumpen, als sie nur fassen können; denn je mehr sie sich davon einverleiben, um so besser leben sie im neuen Jahre. Auch schleppen sie in Kesseln und Krügen schwere Lasten des heilkräftigen Wassers mit sich, um ihre Lieben zu Hause desselben ebenfalls teilhaftig werden zu lassen. Am Johannistage selbst segnet der Priester Blumen, meist Lilien und Weißdorn, die später an den Haustüren angebracht werden, ebenfalls zu dem Zwecke, Unheil abzuwehren.
Von besonderen Begräbnisgebräuchen ist folgendes zu erwähnen. Kinder, die noch nicht der ersten Kommunion teilhaftig geworden waren, werden in offenem, weißem Sarge zum Friedhof gebracht, während Erwachsene in einem schwarzen, alte Jungfern in einem ebenfalls schwarzen, aber mit weißen Schleifen geschmückten Sarge beigesetzt werden. Alten Leuten wird ein geweihtes Hemd angezogen, das man im nächsten Kloster kauft. Wer gestorben ist, ohne gebeichtet zu haben, findet im Grabe keine Ruhe, sondern muß umgehen. Doch kann auch ein solcher noch den Eingang ins Himmelreich finden, wenn der unmittelbar vor ihm im Dorfe Verstorbene ein kleines Mädchen gewesen ist.

Die Zigeuner. Das „fahrende Volk“ der Zigeuner ist von einer gewissen Romantik umwoben. Bis vor etwa fünfzig Jahren wußte man nicht einmal, von wo sie herstammten. Bei ihrem ersten Erscheinen in Deutschland verbreiteten sie selbst die Fabel, daß ihre Vorfahren in Ägypten gesessen und die Eltern Christi auf ihrer Flucht dorthin nicht aufgenommen hätten, weswegen Gott sie verflucht und zu beständiger Wanderung, wie den Ewigen Juden, verdammt habe. Daraufhin galt als Heimat der Zigeuner bis etwa in die Mitte des vorigen Jahrhunderts hinein allgemein das Pharaonenland; die englische (Gipsy), spanische (Gitano), ungarische (Pharaonenvolk) und ähnliche Bezeichnungen für sie gaben dieser vermeintlichen ägyptischen Herkunft auch Ausdruck. Die neueren Forschungen indessen, im besonderen solche sprachlicher Natur, haben zweifellos festgestellt, daß als Urheimat der Zigeuner Vorderindien anzusehen ist, wo in den Sümpfen des Indus und des Pendschab ihre Verwandten noch heute unter dem Namen Dschab hausen. Als deren und ihre gemeinsame Vorfahren bezeichnet die Wissenschaft die Zott. Die Körperbeschaffenheit der Zigeuner, die dem europäischen Typus, vor allem demjenigen der südländischen Bevölkerung sehr ähnelt, spricht dafür, daß die Zott den Indern, das heißt den Nachkommen europäischer Einwanderer (vermischt mit einheimischen Elementen) verwandt gewesen sein müssen. Der Zeitpunkt, wann die indischen[S. 429] Zott sich von ihren Stammesgenossen trennten und auf die Wanderschaft begaben, ist nicht mehr genau festzustellen. Nur das eine ist geschichtlich belegt, daß im fünften Jahrhundert nach Christus eine größere Anzahl Zott, etwa zwölftausend, auf Veranlassung des persischen Herrschers Bahram Gur aus Indien nach Persien kamen, damit sie die Einwohner dieses Landes im Lautenspiel unterrichteten. Demnach scheinen die Zigeuner bereits damals eine große Vorliebe für Musik gehabt zu haben, wie dies noch jetzt für sie zutrifft. Der persische Dichter Firdusi (um 1000 nach Christus) nennt diese Einwanderer Luri, und noch heute bezeichnet man die Zigeuner in Persien so.

Von Persien aus überschwemmten die Zott zunächst die Ebene des Euphrat und Tigris, Armenien, wie überhaupt Kleinasien; hier blieben sie anscheinend längere Zeit ansässig. Darauf teilten sie sich. Die eine Gruppe setzte um die Mitte des neunten Jahrhunderts nach Europa über, wo sie zunächst auf der Balkanhalbinsel festen Fuß faßte, der Zug der anderen Gruppe richtete sich über Syrien nach Ägypten und Nubien bis nach dem Sudan und dem übrigen Nordafrika. Auf dem Balkan erfolgte wiederum eine Zweiteilung: ein Zug ging längs der Donau nach Ungarn, Böhmen, Polen, Finnland. Skandinavien, Deutschland und Spanien, ein anderer von Serbien aus über Slawonien nach Italien und Frankreich. Nicht einmal an den Grenzen Europas machten die Zigeuner halt, denn sie sind auch über das große Wasser nach Amerika gezogen. — In Deutschland tauchten sie im fünfzehnten Jahrhundert zum erstenmal auf.
Der Zigeunertypus ähnelt im allgemeinen dem des Südeuropäers. Mittelgroßer, schlanker Wuchs, meist länglicher Schädel, gerade Nase, breites bis ovales Gesicht, gelbbraune Hautfarbe, schlichtes, schwarzes Haar, reichlicher Bartwuchs von derselben Farbe und braune Augen (Abb. 469 und 474) kennzeichnen ihn. Unter den Frauen finden sich häufig wirkliche Schönheiten (Abb. 464 und 477).
[S. 430]
In ihrer Tracht (Abb. 469 und 475), Ernährung und Religion schließen sich die Zigeuner im allgemeinen dem Volke an, unter dem sie als Schmarotzer leben. Teils sind sie ansässig, manchmal auch zwangsweise angesiedelt worden (wie auf dem Balkan und in Ungarn); sie wohnen dann in halb unterirdischen Lehmhütten dicht bei den Städten und Dörfern, seltener in eigenen Ortschaften. Teils führen sie ein Nomadenleben, sind auf beständiger Wanderschaft begriffen und hausen dann in Leinwandzelten oder auf ihren Wagen (Abb. 463). Ihre Gesellschaftsordnung ist eine patriarchalische. Die nomadisierenden Zigeuner beschäftigen sich zumeist mit solchen Gewerben, die sich im Umherziehen betreiben lassen; sie sind Kupferschmiede, Kesselflicker, Korbmacher, auch Schirmmacher und Schirmflicker, Bärenführer, Artisten, Gaukler, Seiltänzer und Pferdehändler. Die bereits ansässig Gewordenen bevorzugen den Pferdehandel und die Musik (Abb. 470). Besonders die ungarischen Zigeuner erfreuen sich als Musikanten einer großen internationalen Beliebtheit. Dabei kennen sie meistens keine Noten — die Zigeunermusik weist daher auch keine Musikliteratur auf —, spielen vielmehr alles aus dem Gedächtnis oder auch aus dem Stegreif. Die musikalischen Gedanken und Weisen pflanzen sich auf dem Wege der Überlieferung von einem Geschlecht zum anderen fort und werden unaufgeschrieben mit ängstlicher Treue bewahrt. — Die Darbietungen der Zigeuner sind durchweg solche instrumentaler Art, besonders im Geigenspiel sind sie wahre Meister. Der Gesang tritt bei ihnen stark in den Hintergrund. — Die Zigeunerweiber gehen, wo die Stämme ansässig sind, auf die Felder zur Bestellung und schleppen Holz herbei; ihre Hauptbeschäftigung besteht aber in Wahrsagen, Kartenschlagen und Traumdeuten. Mit bewunderungswürdiger Schlauheit verstehen sie es, ihren Opfern dabei Geld abzuschwindeln. Alle diese Beschäftigungen der Zigeuner sind indessen fast nur scheinbare; in Wirklichkeit gehen sie dem Diebstahl in den verschiedensten Formen nach und fristen auf diese Weise ihr Leben.
Im ganzen zählt man noch etwa eine halbe Million Zigeuner auf der Erde, von denen gut drei Viertel auf Südosteuropa kommen.

Obwohl dem Namen nach Christen beziehungsweise Mohammedaner, verharren die Zigeuner durchweg noch in krassem Aberglauben. Eine große Rolle spielen dabei die Urmen oder Schicksalsfrauen, denen ein Haupteinfluß auf das menschliche Leben zugeschrieben wird. Die Urmen sind „ausgereifte Baumseelen“ und leben unter der Oberhoheit einer Königin in unzugänglichen Schluchten hoher Gebirge, und zwar in Palästen, die aus Gold und Silber erbaut sind. Man stellt sie sich als weibliche Wesen von ungewöhnlicher Schönheit vor, solange sie jungfräulich bleiben, ausgestattet mit zwei Flügeln, vermöge deren sie durch die Lüfte ziehen können. Solange sie sich mit keinem Manne eingelassen haben, bleiben sie, wie gesagt, jung und schön; nach etwaigem Verkehr mit einem männlichen Wesen aber gebären sie sogleich drei Urmen auf einmal, verwandeln sich in alte Weiber, werden als ehrlos von der Königin verstoßen und ziehen sich in einsame Hütten zurück. Von den drei Urmengeschwistern [S. 432]ist die eine ein böses, schlechtes Wesen, die beiden anderen dagegen gute. Jene sucht das Schicksal des Menschen zum Schlechten zu wenden; die beiden guten Urmen dagegen sind die Beschützerinnen der Menschen und Tiere und haben jede unter den Menschen sieben Lieblinge, denen sie Hilfe und Schutz angedeihen lassen, und ebensoviele Tiere. Eine andere Art von Schicksalsfeen sind die Keshalyi oder Waldgeister, die im Hochgebirge auf Felsvorsprüngen sitzen und ihr oft meilenlanges Haar in die Täler wallen lassen, wodurch sich die Entstehung des Nebels erklären soll. Ihr Verhältnis zu den Menschen ist ein ähnliches wie das der Urmen. Außer den genannten Naturgeistern verehren die Zigeuner noch eine ganze Reihe anderer Dämonen, wie die Niwaschi oder Wassergeister, die Pçuvusche oder Erdmenschen, Riesen und Zwerge, Jiuklanusche oder Hundemenschen und verschiedene Krankheitsdämonen.


Dem Einfluß der bösen Geister sucht man auf alle nur mögliche Weise zu begegnen, durch Opfer, Amulette, Beschwörungen und manches andere. Bevor man die Zelte zur neuen Wanderung abbricht, umreitet man dreimal das Lager, um die bösen Geister zu bannen. Aus demselben Grunde speit man dreimal in das Wasser, wenn man auf der Wanderung eine Brücke überschreitet. Erwachsene tragen häufig Stechapfelsamen als wirksames Abwehrmittel in den Schuhen bei sich, um bei wichtigen Unternehmungen Glück zu haben, hängen sich kleine aus Lindenholz, gleichfalls einem kräftigen Zaubermittel, geschnittene Täfelchen auf den bloßen Leib, um vor ansteckenden Krankheiten bewahrt zu bleiben, schlingen sich eine aus Eselshaaren geflochtene Schnur um den linken Oberschenkel, um bei Frauen Glück zu haben, und wenden noch eine ganze Reihe ähnlich gearteter Maßnahmen an. Helferinnen erstehen den Menschen in den Zauberfrauen. In erster Linie sind diese ihnen sowie den Tieren nützlich als Heilkünstler, denn sie gelten als mit besonderen Kenntnissen und Kräften ausgestattet, um das Schlechte, die Krankheitsdämonen, aus dem Körper zu vertreiben. Hiervon abgesehen, verstehen sie sich aber auch darauf, das Gelingen eines Unternehmens zu fördern, Liebe und Haß zu entfachen, die Seele des Menschen zu „binden und zu lösen“, das Wetter zu regeln, das Bild der Zukünftigen herbeizuzaubern, die Toten zu bannen und dergleichen. Ihre übernatürlichen Kräfte werden meistens vererbt und von den älteren Zauberfrauen bei den dafür Begabten weiterentwickelt. Aber auch durch geschlechtlichen Verkehr mit den Wassergeistern (Niwaschi) oder Erdmenschen (Pçuvusche) kann man zur Zauberin werden.

[S. 433]
Die Zauberfrauen sind auch bei der Geburt zugegen, um diese durch Gebete und andere Mittel zu fördern. Kinder sind ein unbedingtes Erfordernis der Ehe. Ein kinderloses Weib wird verachtet; man behauptet von ihm, daß es vor der Ehe ein Liebesverhältnis mit einem Vampir gehabt habe. Mancherlei Aberglaube beeinflußt das Leben einer Schwangeren. Frauen, die sich in anderen Umständen befinden, tragen Bärenklauen am Gürtel; sie müssen ihn, wenn sie einen Regenbogen erblicken, diesem zuschwenken, damit das Kind schön werde.


Naht die Geburtsstunde, so löst man an den Kleidern der Kreißenden und an denen ihrer Umgebung alle Knoten. Ferner wird vor dem Zelt ein Feuer angefacht, um die bösen Geister abzuschrecken; die Weiber, denen diese Pflicht obliegt, speien dreimal in die Flamme, rufen dabei: „Komm, gute Urme, und hilf!“ und murmeln dann noch weitere Sprüche; bei den siebenbürgischen Zigeunern läßt man dieses Feuer bis zur Taufe brennen. Um die feindlich gesinnten Dämonen zu verscheuchen, ziehen die Zeltzigeuner um Mutter und Kind einen kreisförmigen Ring, innerhalb dessen Stechapfelsamen[S. 434] ausgestreut wird. Die Balkanzigeuner stellen zu Häupten der Mutter einen Napf mit in Honig gekochter Hirse oder Weizen auf und stecken drei Löffel in den Brei, damit sich die Urmen daran laben können; zuweilen stellen sie auch drei Stückchen Speck und drei Gläschen Schnaps bereit. Darauf müssen sich alle Leute aus dem Zelte oder der Hütte und ihrer allernächsten Nähe entfernen. Nur die Zauberfrau bleibt vor dem Zelte, in dem Mutter und Kind liegen; hier sitzt sie und murmelt Gebete bis zur Morgendämmerung. Außer ihr ist es nur äußerst selten den Menschen vergönnt, die Urmen zu sehen; so zum Beispiel ist dazu nur die siebente Tochter in einer durch keinen Knaben unterbrochenen Mädchenreihe imstande, und umgekehrt sogar nur der neunte Sohn in einer durch kein Mädchen unterbrochenen Knabenreihe. — Gegen Mitternacht nach der Geburt des Kindes erscheinen dann die drei Urmen und bestimmen das zukünftige Geschick des neuen Weltbürgers. Die erste bestimmt die Zahl der Lebensjahre des Kindes und seine dereinstige Todesart, die zweite, ob es reich oder arm, in der Ehe glücklich oder unglücklich werden soll, und die dritte endlich sucht die Wünsche ihrer Schwestern zu entkräften.

Verläßt die Wöchnerin ihr Lager, so muß sie, falls sie einen Sohn geboren hat, zwischen einem entzweigeschnittenen Hahn, wenn eine Tochter, zwischen einer entzweigeschnittenen Henne hindurchgehen, worauf das betreffende Tier von den Frauen verzehrt wird. Bei ihrem ersten Ausgang muß sie ihr Kind auf die Erde legen und dreimal darüber hinweg- und wieder zurückschreiten, damit es nicht geistersichtig werde; hierauf hebt der Vater es von der Erde auf, wobei er ihm einen roten Faden um den Hals hängt, um es dadurch öffentlich als sein eigenes anzuerkennen.
[S. 435]
Schon frühzeitig regt sich bei den jungen Leuten die Liebe. Die Liebespoesie nimmt einen breiten Raum im Leben der Zigeuner ein. Zahlreich sind auch die Geheim- und Zaubermittel, durch die ein Verliebter die Gunst des Gegenstandes seiner Liebe zu erreichen sucht. Will ein junges Mädchen einen Mann an sich fesseln, dann sucht es zum Beispiel eine Weidenrute mit Knoten, da man diese als von Feen geschlungen ansieht, schneidet diese Knoten ab und steckt sie in den Mund, worauf es die Worte spricht: „Dein Glück esse ich, dein Glück trinke ich; dafür gebe ich dir mein Glück, du bist nun mein.“ Schließlich muß es die Knoten noch unbemerkt in das Lager der geliebten Person stecken.

Hat ein junger Zigeuner die Absicht, zu heiraten, so kauft er sich ein Tuch und hängt es an das Zelt seiner Auserwählten. Wenn diese es an sich nimmt, so gibt sie damit ihr Einverständnis zu verstehen. Natürlich muß auch die Zustimmung der Eltern des Mädchens eingeholt werden, was durch Darbringung von zahlreichen Geschenken erreicht wird. Die Zigeunerheirat ist nämlich ein richtiger Kauf, insofern der Bräutigam den Eltern seiner Auserwählten eine bestimmte Summe zu zahlen hat, deren Höhe sich vielfach nach der Schönheit des Mädchens richtet.
Um zu erfahren, ob die Ehe fruchtbar sein wird, begibt sich das Brautpaar eine Woche vor dem Hochzeitstage nachts an das Ufer des nächstgelegenen Flusses und stellt hier zwei brennende Kerzen auf. Löscht der Wind eine derselben aus, dann gilt dies als böses Vorzeichen; die Brautleute beeilen sich in diesem Fall, Äpfel und Eier ins Wasser zu werfen, um die bösen Wassergeister zu besänftigen.
Die Einladung zur Hochzeit pflegt der Zigeunerbursche persönlich zu überbringen; in Begleitung von mehreren Musikanten begibt er sich von Zelt zu Zelt und trägt seine Einladung unter Musikbegleitung singend und tanzend vor. Dabei ist er unter anderem durch einen mit Bändern verzierten Haselstock gekennzeichnet, der das junge Paar vor dem Einfluß der bösen Wassergeister (Niwaschi) bewahren soll. Während der Bräutigam die Pflicht der Einladung erfüllt, verbrennt die Braut nächtlicherweile an einem Kreuzweg ihre sogenannten Glücksträußchen, damit sie keinem anderen Mädchen in die Hände fallen, wodurch das Herz des Verlobten abwendig gemacht werden könnte. Die Glücksträußchen sind Gnaphaliumblüten, die die jungen Mädchen alljährlich in der Johannisnacht sammeln und, zu kleinen Sträußchen gebunden, unter ihren Habseligkeiten aufbewahren, damit sie ihre Besitzerin vor Krankheit und Schande schützen.
Drei Tage vor der Hochzeit findet eine Vorfeier statt, zu der die Stammesgenossen zusammenkommen;[S. 436] die Brautleute tauschen dabei bunte Tücher oder Ringe aus. Bei einigen Stämmen holen die Weiber am letzten Tage vor der Hochzeit junge Bäume aus dem Walde, die sogenannten Glückstangen, und stellen sie vor der Wohnung des Bräutigams auf, damit seine Liebe zu seiner Auserwählten in Zukunft „holzfest und immergrün“ erhalten bleibe, er muß sie für diese Aufmerksamkeit mit Branntwein belohnen. Schon am frühen Morgen des Hochzeitstages finden sich die Gäste vor dem Zelte ein und bringen dem Brautpaar allerlei Geschenke dar, meist in Gestalt von Eßwaren und Getränken, aber auch von hauswirtschaftlichen Gegenständen und Geld. Darauf begeben sich alle Teilnehmer unter Vorantritt von Musikanten, aber zunächst ohne Sang und Klang, in festlichem Zuge in die Kirche. Zuerst der Bräutigam, umgeben von den Burschen und Männern, darauf in bestimmter Entfernung die Braut in Begleitung der Frauen und Mädchen sowie eines einzigen, und zwar des ältesten Burschen, der aufzupassen hat, daß die Braut nicht entführt werde. Ist er dabei nachlässig, so muß er einen Teil der Hochzeitskosten tragen. Nach der Trauung begibt sich der Zug unter Gejohle und Musizieren wieder zum Zeltlager zurück. Hier angekommen, wird das junge Paar mit Nüssen beworfen, früher auch mit Hirse, mit Wasser begossen und dann mit einem Beutel aus Wieselfell, der Stechapfelsamen enthält, abgerieben, was gegen Unglück und bösen Blick schützen soll; beim Betreten des Zeltes werden ihm Schuhe und Stiefel nachgeworfen, was die Fruchtbarkeit steigern soll, und so fort.

Krankheit wird von den Zigeunern bestimmten Dämonen zugeschoben, gegen die man eine Zauberfrau zu Rate zieht. Diese sucht sich mit dem Kranken sofort in magische Beziehung zu setzen, indem sie dessen verschiedene Körperstellen mit einem Säckchen voll Stechapfelsamen reibt und den Dämon herbeiruft, daß er ihr das Heilmittel verrate. Hat das Eingreifen der Zauberfrau keinen Erfolg, so bereitet man sich und den Toten auf dessen letztes Ende vor. Man bringt ihn samt seinem Hab und Gut vor das Zelt, damit, wenn sein letztes Stündchen wirklich schlagen sollte, die Seele den Körper ruhig verlassen könne und nicht an irgendeinem Gegenstand des Toten haften bleibe, denn dafür würde sie später schwere Rache an den Hinterbliebenen nehmen. Bei verschiedenen Stämmen ist es auch Sitte, die Fußsohlen des Sterbenden durch einen weißen Hund belecken zu lassen.
Nach dem Eintritt des Todes wird die Leiche mit Salzwasser gewaschen. Mit diesem Abwaschwasser tränkt man später das Vieh, damit es gut gedeihe. Nach dem Waschen wird die Leiche ins Freie geschafft, falls dies nicht schon vorher geschehen sein sollte. Der Weg wird dabei aber nicht durch die übliche Eingangstür genommen, sondern an einer anderen Stelle nach Aufheben der Zeltwand oder durch die Fensteröffnung. Im Freien erfolgt dann die Aufbahrung[S. 438] der Leiche. Gleichzeitig stimmen die Weiber Klagelieder an, die je nach dem Geschlecht des Verstorbenen verschieden ausfallen und eines poetischen Schwunges nicht entbehren. Neben die aufgebahrte Leiche setzen die Stammesgenossen Speisen und Getränke, die später von ihnen verzehrt werden. Bei dieser Totenfeier kommt es vielfach zu wüsten Orgien (siehe die Kunstbeilage).

Nach dreitägiger Aufbahrung wird der Tote außerhalb der Ansiedlung beerdigt. Sobald das Grab zugeworfen ist, häufen die Frauen alle von dem Verschiedenen benutzten Sachen um den Grabhügel auf und verbrennen dieselben; anderenfalls würde die Seele des Toten wiederkehren, um dessen Verwandte zu quälen und sein Eigentum von ihnen zurückzufordern. Außerdem soll das Feuer die Seele bei ihrer Wanderung durch kalte Gegenden ins Totenreich erwärmen. Ehe nicht das Fleisch von den Knochen abgefault ist, kann die irrende Seele dieses nicht finden. Auf dem Wege dorthin, der recht beschwerlich und gefährlich ist, muß sie unter anderem an sieben Bergen vorbeiziehen, die miteinander streiten, gegen eine den Weg verteidigende Schlange ankämpfen und gegen einen eisigen, schneidenden Wind marschieren. Um die Lebenden gegen den etwa zurückkehrenden Geist zu schützen, umgab man früher das Grab noch mit Dornen.

Den Namen eines Verstorbenen nennt man nur noch einmal, und zwar am siebenten Tage nach der Beerdigung. An diesem entfernen sich nämlich die nächsten Anverwandten des Verstorbenen mit Einbruch der Nacht von den Zelten, rufen den Toten mit Namen und machen ihm klar, daß er für ewige Zeiten aus der Welt geschieden und kein Mensch mehr sei; er möge daher mit seinem Schicksal zufrieden sein und nicht mehr daran denken, zu seinen Angehörigen zurückzukehren oder als Geist sein Unwesen zu treiben.
Von da an wagt man den Namen eines Verstorbenen nicht mehr auszusprechen.
[S. 439]