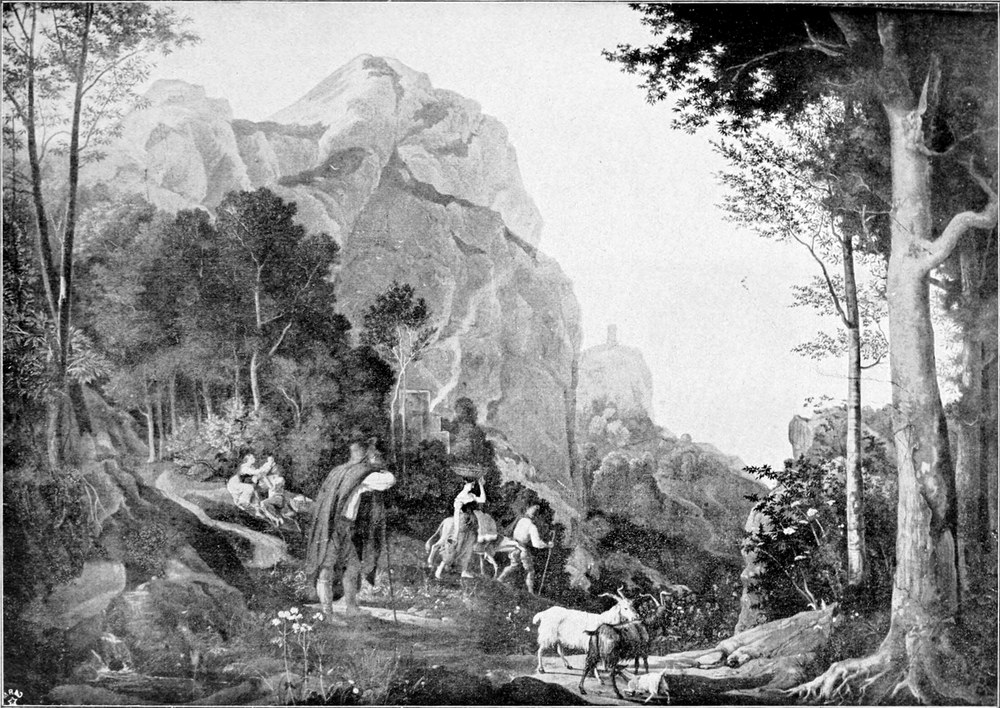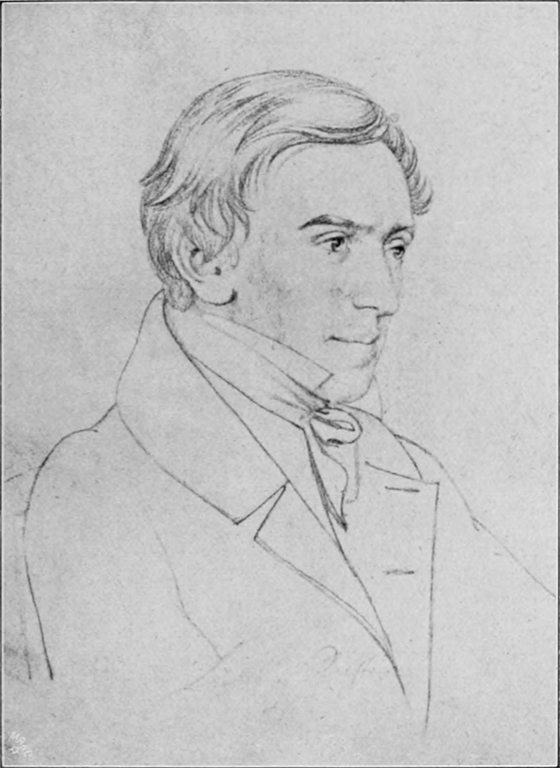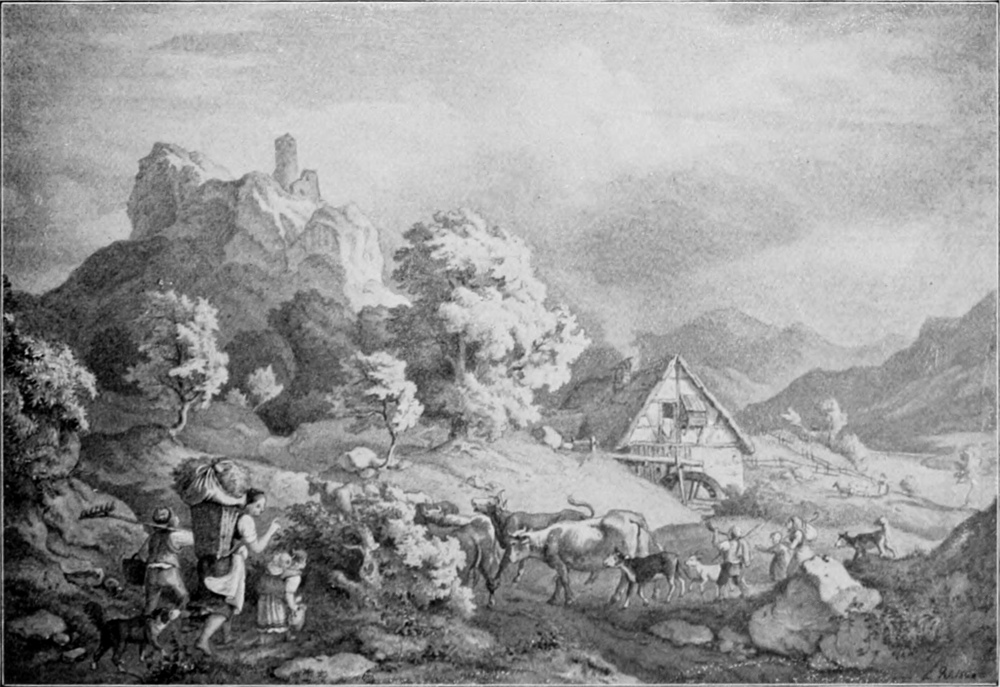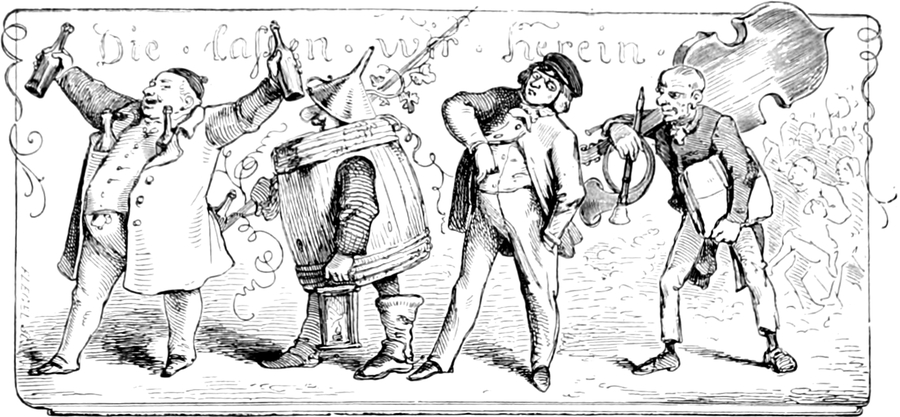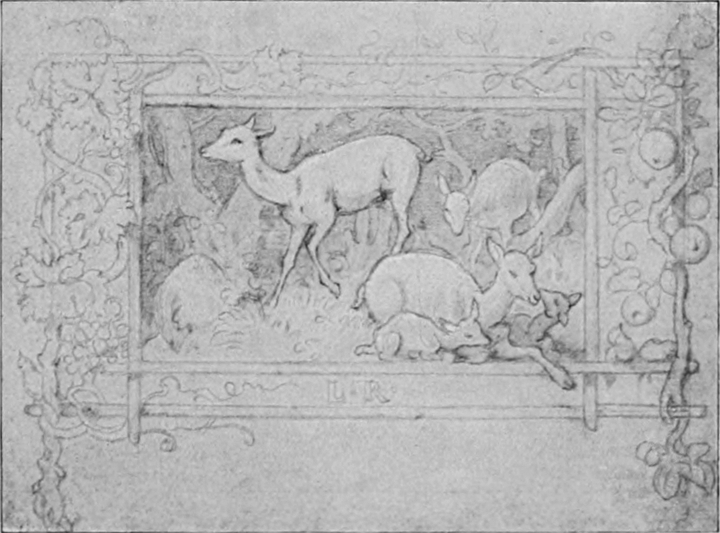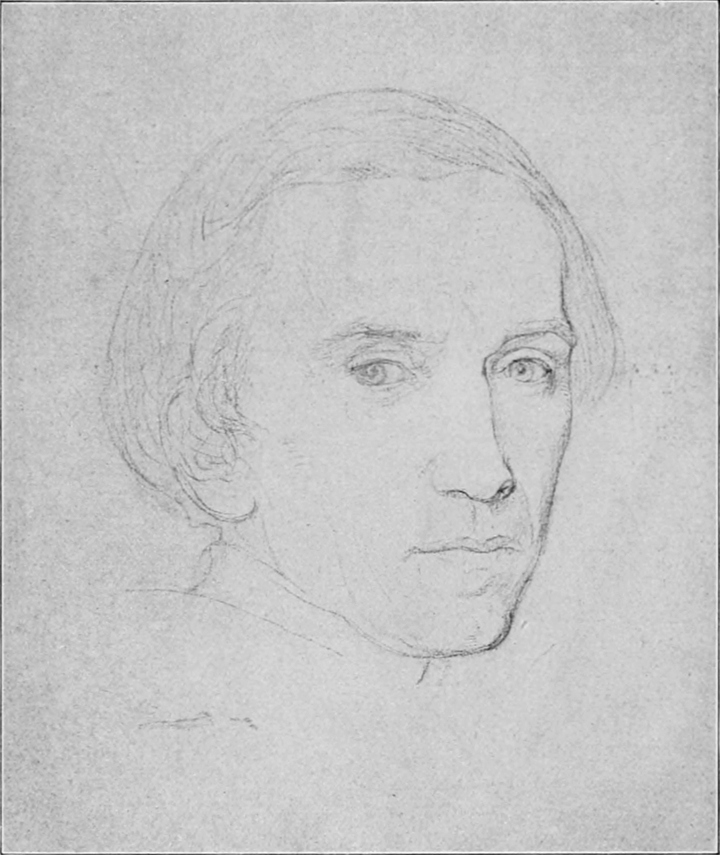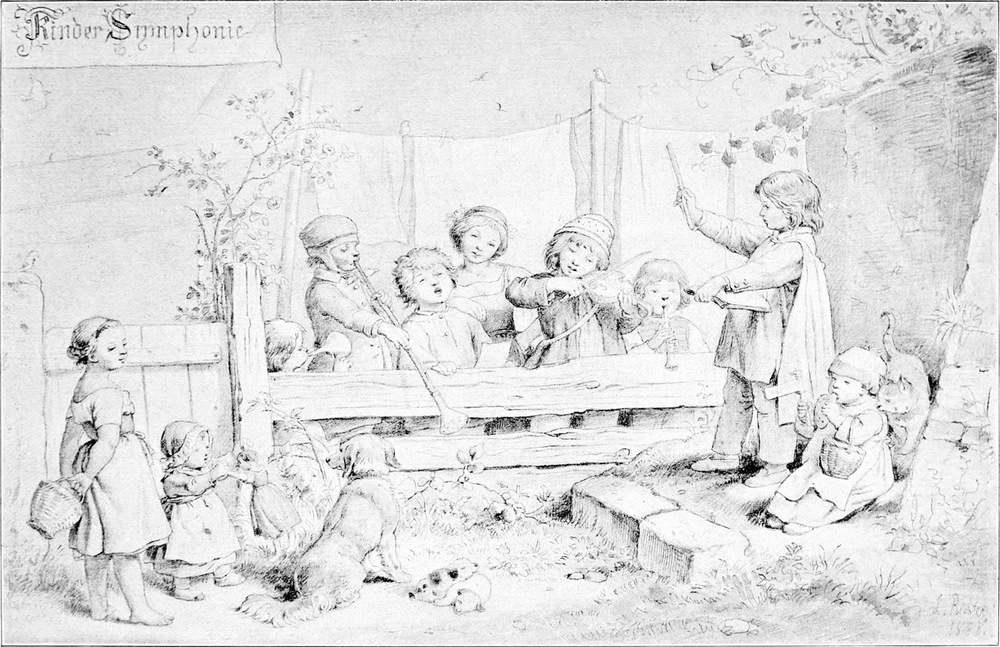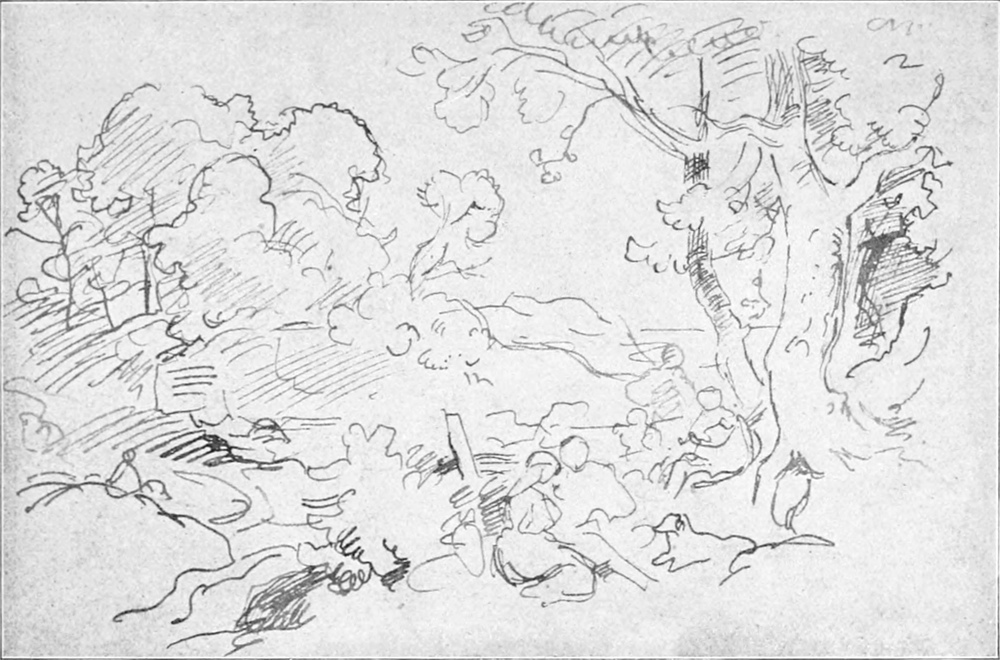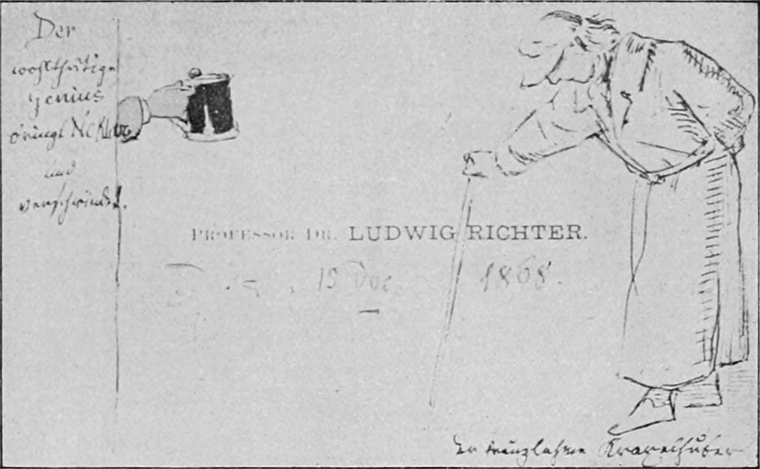The Project Gutenberg eBook of Ludwig Richter, by Viktor Paul Mohn
This eBook is for the use of anyone anywhere in the United States and
most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions
whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms
of the Project Gutenberg License included with this eBook or online
at
www.gutenberg.org. If you
are not located in the United States, you will have to check the laws of the
country where you are located before using this eBook.
Title: Ludwig Richter
Author: Viktor Paul Mohn
Editor: Hermann Knackfuß
Release Date: June 25, 2022 [eBook #68401]
Language: German
Produced by: Peter Becker, Reiner Ruf, and the Online Distributed Proofreading Team at https://www.pgdp.net (This file was produced from images generously made available by The Internet Archive)
*** START OF THE PROJECT GUTENBERG EBOOK LUDWIG RICHTER ***
Anmerkungen zur Transkription
Der vorliegende Text wurde anhand der 1906 erschienenen
Buchausgabe so weit wie möglich originalgetreu wiedergegeben.
Typographische Fehler wurden stillschweigend korrigiert. Ungewöhnliche
und altertümliche Schreibweisen bleiben gegenüber dem Original
unverändert; fremdsprachliche Zitate wurden nicht korrigiert.
Einige Abbildungen wurden zwischen die Absätze
verschoben und zum Teil sinngemäß gruppiert, um den Textfluss nicht zu
beeinträchtigen.
Das Original wurde in Frakturschrift gesetzt. Passagen
in Antiquaschrift werden im vorliegenden
Text kursiv dargestellt. Abhängig von der im
jeweiligen Lesegerät installierten Schriftart können die im Original
gesperrt gedruckten Passagen gesperrt, in
serifenloser Schrift, oder aber sowohl serifenlos als auch gesperrt
erscheinen.
Liebhaber-Ausgaben
In Verbindung mit Andern herausgegeben
von
H. Knackfuß
XIV
Ludwig Richter
Bielefeld und Leipzig
Verlag von Velhagen & Klasing
1906
Ludwig Richter
Von
V. Paul Mohn
Mit 193 Abbildungen nach Gemälden, Aquarellen, Zeichnungen
und Holzschnitten,
sowie einem Brief-Faksimile.
Vierte Auflage
Bielefeld und Leipzig
Verlag von Velhagen & Klasing
1906
on der ersten Auflage dieses Werkes ist für Liebhaber und
Freunde besonders luxuriös ausgestatteter Bücher außer der vorliegenden
Ausgabe
eine numerierte Ausgabe
veranstaltet, von der nur 100 Exemplare auf Extra-Kunstdruckpapier
hergestellt sind. Jedes Exemplar ist in der Presse sorgfältig numeriert
(von 1–100) und in einen reichen Ganzlederband gebunden. Der Preis
eines solchen Exemplars beträgt 20 M. Ein Nachdruck dieser Ausgabe, auf
welche jede Buchhandlung Bestellungen annimmt, wird nicht veranstaltet.
Die Verlagshandlung.
Druck von Velhagen & Klasing in Bielefeld.

Nach dem Ölgemälde von Leon Pohle aus dem Jahre 1879. Im
Museum zu Leipzig.
[S. 3]
Ludwig Richter.
elten hat sich in einem deutschen Maler deutschen Volkes Art und Sitte
so rein und unverfälscht widergespiegelt als in Ludwig Richter, dem
unvergleichlichen Malerpoeten des neunzehnten Jahrhunderts.
Seine zahllosen Blätter und Blättchen, die über unser gesamtes, liebes
deutsches Vaterland verbreitet sind und, soweit die deutsche Zunge
klingt, geliebt und geschätzt werden, zeugen alle von dem innersten
Wesen des deutschen Volkes. Poesie und Gemüt, naive Anschauung,
tiefinnerste Religiosität und Freude an Gottes herrlicher Schöpfung
atmet seine Kunst. Durch alle seine Arbeiten geht ein Hauch poetischer
Verklärung; wie unsere herrlichen Volkslieder muten sie uns an.
Der schlichte, kindlich fromme Mann schreibt einmal wie ein
Künstlerbekenntnis nieder:
„Der Künstler sucht darzustellen in aller Sichtbarkeit der Menschen
Lust und Leid und Seligkeit, der Menschen Schwachheit und Torheit, in
allem des großen Gottes Güt’ und Herrlichkeit.“
Das ist Richters Standpunkt in seiner Kunst, den er unentwegt
festgehalten hat.

Abb. 1.
Das Geburtshaus Ludwig
Richters. (Zu
Seite 9.)
Seine lieblichen Engelgestalten, seine naiven fröhlichen Kinder, die
schämigen, aber gesunden Mägdlein und Jungfräulein, die Mütter im
Kreise der Kinder, spinnend, belehrend oder wehrend; die Großmütter
am warmen Kachelofen, den Enkeln — und es sind ihrer nie wenige —
Märchen erzählend; die Familie um den Tisch zu Andacht oder Mahlzeiten
versammelt; Kirchgang und Hochzeit, Taufgang und Friedhof, Abschied
und Wiedersehen, Weihnachten und Ostern und Pfingsttag, die schönsten
und weihevollsten Stunden unseres deutschen Familienlebens, unserer in
der deutschen Häuslichkeit[S. 4] begründeten Gemütlichkeit, im Hause und im
Verkehr mit der Natur, in Feld und Wald und Heide, bei Sonnenschein und
Regen oder bei still herabfallenden Schneeflocken, im Gärtchen am Hause
mit seinen Rosen und Tulpen und Nelken, am Sonntagmorgen oder beim
Abendläuten oder bei funkelndem Sternenhimmel, am schattigen Mühlbach
in der stillen Mühle oder droben im Schloß oder in der Kapelle aus
sonniger Höhe, und was er sonst in den Bereich seiner Darstellungen
ziehen mag, das alles ist durchweht von Poesie, im deutschen Gemüt
wahrhaft begründet, aus ihm gleichsam herausgewachsen und mit kindlich
naiven Augen geschaut, alles ist durchleuchtet von einem tiefen
religiösen Gefühl.
In der Vorrede zu seinem Holzschnittwerk „Fürs Haus“ schreibt er im
Jahre 1858: „Schon seit vielen Jahren habe ich den Wunsch mit mir
herumgetragen, in einer Bilderreihe unser Familienleben in seinen
Beziehungen zur Kirche, zum Hause und zur Natur darzustellen und somit
ein Werk ins liebe deutsche Haus zu bringen, welches im Spiegel der
Kunst jedem zeigte, was jeder einmal erlebt, der Jugend Gegenwärtiges
und Zukünftiges, dem Alter die Jugendheimat, den gemeinsamen Blumen- und
Paradiesesgarten, der den Samen getragen hat für die spätere Saat und
Ernte. Gelingt es nun, das Leben in Bildern schlicht und treu, aber mit
warmer Freude an den Gegenständen wiederzugeben, so wird ja wohl in
manchem der einsam oder gemeinsam Beschauenden der innere Poet geweckt
werden, daß er ausdeutend und ergänzend schaffe mit eigener Phantasie.“
Und wie ist es dem Meister gelungen, schlicht und treu in diesen
Gegenständen das alles zu schildern und zu bilden und wiederzugeben!

Abb. 2.
Ludwig Richters Vater.
Gemalt von A. Graff. (Zu
Seite 10.)
Seine religiösen Bilder haben ein echt evangelisches Gepräge, das Wort
„evangelisch“ hier in seiner eigentlichsten und weitesten Bedeutung
genommen. Er schließt sich hierin an Fiesole und ebenso an Dürer
und die übrigen altdeutschen Meister, selbst an Rembrandt an; der
liebenswürdige und innige Fiesole hat es ihm aber doch am meisten
angetan. Innig und zart sind seine religiösen Darstellungen, und wie
treuherzig weiß er immer wieder diese schon so viel dargestellten
Gegenstände neu zu gestalten und uns näher zu bringen! Immer wieder muß
es gesagt werden: der Volkston — er ist auch hier wieder so klar und
sicher angeschlagen.
Charakteristisch für Richter ist eine handschriftliche Notiz von
ihm: „Als die beiden Pole aller gesunden Kunst kann man die irdische
und die himmlische Heimat bezeichnen.[S. 5] In die erstere senkt sie ihre
Wurzeln, nach der anderen erhebt sie sich und gipfelt in derselben.“
Wir sehen hieraus, wie bei Richter Christentum und Kunst eng ineinander
verschlungen sind. Nie aber wird man ihm nachsagen können, daß sein
wahrhaftes Christentum sich unnötig vordrängte: es ist ihm eben nur
um die innersten Wahrheiten zu tun; nichts liegt ihm auch ferner
als Kopfhängerei oder Pietismus. Ebensowenig wird man aus seinen
Schöpfungen erraten können, daß er Katholik war. Sein Standpunkt
war über den enggezogenen Grenzen christlicher Konfessionen. Mit
künstlerischem Instinkt packt er sein Volk im kleinbürgerlichen
Leben und hält sich stets fern und frei vom „Modernen“. Folgen wir
ihm willig, wenn er uns z. B. einen „Sonntag“ (in dem Werke gleichen
Namens) schildert. Es ist, als ob er leise den Vorhang lüftete und uns
lauschen ließe in die stillen, behaglichen, engen Stuben der kleinen
Stadt. Wie gern folgen wir ihm von der Morgenandacht zur Kirche ins
Chorstübchen, zum Besuch der Kranken, zum Spaziergang am Nachmittag
aus den dumpfen Mauern durchs Tor hinaus aufs Land und am Abend beim
aufsteigenden Vollmond zur Stadt zurück, und wenn wir das letzte Blatt
„Gute Nacht“ aus der Hand legen, sagen wir uns: Schöner kann man einen
deutschen Sonntag nicht feiern.

Abb. 3.
Ludwig Richters Mutter.
Gemalt von A. Graff. (Zu
Seite 10.)
Welch köstlichen Humor hat Richter in seinen Bildern ausgestreut
— und Humor ist bei uns rar geworden —! Wir nennen hier nur die
beiden prächtigen Blätter aus „Fürs Haus“ „Bürgerstunde“: „Hört ihr
Herren, laßt euch sagen, die Glocke hat zehn geschlagen“ (Abb. 141)
und das „Schlachtfest“ (Abb. 140). Seine Philistergestalten sind
unvergleichlich komisch; wenige Künstler in Deutschland hatten für
diese Art deutschen Daseins so viel Blick wie er; nie wird er aber in
solchen Schilderungen bitter, satirisch oder häßlich, auch hier weiß er
zu verklären.
Die Tiere sind ihm, als zum Hause gehörig, unentbehrlich. Ein Spitz
oder junge Hündchen mit ihrem komischen Gebaren, ein schnurrendes
Kätzchen zu Füßen des spinnenden Mädchens, die Tauben auf dem Dache im
Abendsonnenschein, die Sperlinge im Kirschbaum oder an der Scheuer ihr
Anteil einheimsend; die Schäfchen und Zicklein[S. 6] mit munteren Sprüngen
zur Seite der Kinder, — das alles gehört bei ihm zum behaglichen
Dasein der Menschen. Er drückt alle Kreatur liebend an sein Herz. Gern
greift er auch ins „Romantische“ und schildert uns da auch in ebenso
treuherziger Weise unseres Volkes Märchen wie kein anderer deutscher
Künstler in schlichten Zügen. Wie hochromantisch sind, um hier nur
einiges anzuführen, „Gefunden“ (Abb. 139), „Schneewittchen“ (Abb. 185),
und „Die Ruhe auf der Flucht“ mit den singenden und musizierenden
Engeln (Abb. 189)! Diese Werke gehören in das Schatzkästlein der
deutschen Kunst. — Und wie schlicht und demütig er über seine Stellung
in der Kunst denkt, darüber spricht er in seinem letzten Lebensjahre,
als Nachklang seines 80. Geburtstages, „halb blind, halb taub, aber
in seinem Gott zufrieden“: „Kam meine Kunst nun auch nicht unter die
Lilien und Rosen auf dem Gipfel des Parnaß, so blühte sie doch auf
demselben Pfade, an den Wegen und Hängen, an den Hecken und Wiesen,
und die Wanderer freuten sich darüber, wenn sie am Wege ausruhten,
die Kindlein machten sich Sträuße und Kränze davon, und der einsame
Naturfreund erquickte sich an ihrer lichten Farbe und ihrem Duft,
welcher wie ein Gebet zum Himmel stieg. So hat es denn Gott gefügt,
und mir ist auf vorher nicht gekannten und nicht gesuchten Wegen mehr
geworden, als meine kühnsten Wünsche sich geträumt haben: Soli deo
gloria!“

Abb. 4.
Ludwig Richters Großvater und
Großmutter väterlicherseits.
Gemalt um 1816. (Zu
Seite 10.)
Solange deutscher Sinn und deutsches Gemüt bestehen werden, wird Ludwig
Richter im deutschen Volke fortleben und geliebt und geschätzt werden.
Der Strauß duftender Blüten, den er unserem deutschen Volke gepflückt
und hinterlassen hat, soll und wird nicht verwelken. Das deutsche Volk
wird festhalten an dem ihm Eigenen, und deutsche Art und Sitte wird nie
untergehen.
[S. 7]
Ihm aber, dem verewigten Meister, dem 1898 in seiner Vaterstadt ein
ehernes Denkmal errichtet wurde, wollen wir Deutschen alle ein noch
unvergänglicheres Denkmal errichten, indem wir und unsere Kinder und
Kindeskinder bis in die fernsten Geschlechter den unvergänglichen und
unvergleichlichen Tönen seiner Muse lauschen und seine Werke allezeit
lieb und wert und hoch halten!
* *
*
Richters Persönlichkeit war die eines schlichten sinnigen Mannes; er
war demütig und bescheiden, kindlich rein und tief religiös. W. H.
Riehl sagt in seinen „Kulturgeschichtlichen Charakterköpfen“ über ihn:
„Unserem volkstümlichen deutschen Meister eignete von jeher eine echt
deutsche Künstlertugend: die Bescheidenheit. Mit seinem Griffel gab
er ganz sich selbst und legte die innersten Falten seines Wesens dar,
weil er’s nicht anders konnte; mit seiner Person zog er sich still und
anspruchslos vor der Welt zurück, und die Welt lernte ihn fast nur so
weit kennen, als sie ihn in seinen Werken lieben gelernt hatte.“
Von großer Liebenswürdigkeit gegen jedermann, war er doch scheu, fast
unsicher und still Fremden gegenüber; zu denen aber, die ihm nahe oder
näher standen, war er von großer Herzlichkeit und Mitteilsamkeit.

Abb. 5.
Ludwig Richters Großmutter
mütterlicherseits, geb. van der Berg. (Zu
Seite 10.)
Bei Gesprächen über das, was ihn am allerinnersten bewegte, über
Christentum und Kunst, erglänzten oft seine großen grauen Augen, wie
wenn die Sonne durch lichtes Gewölk hervorbricht. Oft schauten sie
wieder so träumerisch ins Weite; wie Verklärung lag es dann über
dem lieben Antlitz. Ein Zug von Wehmut war ihm eigen. In seiner
Unterhaltung war er immer anregend und geistig lebendig, sicher im
Urteil über Kunst und Literatur. Bei der Beurteilung von Kunstwerken
war ihm das eigentlich „Künstlerische“ maßgebend, gleichviel ob das
Kunstwerk dieser oder jener Richtung oder Stilweise angehörte; er
begeisterte sich ebenso an Rembrandts Darstellung der „Hirten an der
Krippe“, über die Goethe in seinen Briefen an Falkonet, ihm wie aus dem
Herzen gesprochen, sich ausläßt, wie an den Werken des kindlich frommen
Fiesole.
[S. 8]
Er war von hoher, hagerer Gestalt, seine Haltung etwas nach vorn
übergebeugt; sein kluges Gesicht, freundlich und wohlwollend, war von
einer Fülle schneeweißen Haares umrahmt. So sehen wir ihn in dem von
Leon Pohle im Auftrage des bekannten Kunstfreundes Eduard Cichorius
für das Museum zu Leipzig gemalten Porträt (Titelbild). In diesem
Bildnis, zu dem unser Altmeister im Jahre 1879 saß, gerade in der Zeit,
als sein jahrelanges Augenleiden unaufhaltsam so weit vorgeschritten
war, daß er den Zeichenstift aus der Hand hatte legen müssen, ist eine
unverkennbare Trauer über das Antlitz gelagert; ihm, dem unermüdlich
Schaffenden, war eine Grenze gesetzt; er sollte nun seine fleißigen
Hände ruhen lassen. Seine Wirksamkeit als Künstler war abgeschlossen,
worüber er in seinem Innern sehr schmerzlich bewegt war. Aber er fügte
sich in Demut in das Unvermeidliche und trug es ohne Klage; war es
ihm doch wie wenigen Künstlern vergönnt gewesen, bis in sein hohes
Alter in seiner Kunst tätig sein zu dürfen, und wenn ihm auch in den
letzten Jahren die „Motive“ spärlicher kamen, so arbeitete er doch
unausgesetzt, frühere Darstellungen vielfach variierend, unfertige
frühere Zeichnungen vollendend oder landschaftliche Skizzen mit
Figurengruppen belebend, und zeichnete und malte noch eine ganze Reihe
prächtiger Blätter, wenn auch mit großer Mühe und Anstrengung. —
Inzwischen hatte er auf Anregung seines Freundes E. Cichorius und auf
Betreiben seines Sohnes Heinrich angefangen, auf Grund eigenhändiger
Tagebuchaufzeichnungen seine Selbstbiographie „Lebenserinnerungen
eines deutschen Malers“ (Frankfurt a. M., Johannes Alt) zu schreiben,
und vermochte diese auch noch 1879 so weit zu Ende zu führen, wie
es von Anfang an geplant war. Diese Biographie gehört mit zu dem
Hervorragendsten, was Deutschland auf diesem Gebiete der Literatur
besitzt.

Abb. 6.
Brandruinen des alten Schlosses
in Pillnitz. 1818. Kolorierter Stich. (Zu
Seite 13.)
Richter durfte noch seinen 80. Geburtstag feiern, geliebt und geehrt
vom deutschen Volke. Still und freundlich waren seine letzten Jahre,
wenn ihm auch Schweres zu tragen bis zuletzt nicht erspart wurde. Am
letzten Morgen seines Erdendaseins schrieb er in sein Tagebuch:
Groß denken, im Herzen rein,
Halte dich gering und klein,
Freue dich in Gott allein.
[S. 9]
In gedrängter Kürze wollen wir den Entwickelungsgang des Meisters
darzustellen versuchen.

Abb. 7.
Dresden von der Bärbastei. 1820.
Aus „Dreißig malerische An- und Aussichten von Dresden und der nächsten Umgebung“.
Verlag von Carl Gräf (E. Arnold) in Dresden. (Zu
Seite 16.)

Abb. 8.
Aus Avignon. 1820.
(Zu
Seite 16.)
Adrian Ludwig Richter wurde am 28. September 1803 in
Dresden-Friedrichstadt geboren, „einem Stadtteil, welchen“, wie er
selbst sagt, „die haute volée zu ihrem Sitze nicht erkoren
hatte“. Das Geburtshaus (Abb. 1), Friedrichstraße 44 Gartenhaus, war
lange in Vergessenheit gekommen, bis es 1898 wieder entdeckt wurde.
Nach einer alten Familientradition stammt die Familie Richter von
Luther ab. Sein Vater,[S. 10] Karl August Richter (Abb. 2), geboren 6. Juli
1778 im Dorfe Wachau bei Radeberg, war Zeichner und Kupferstecher und
Professor an der Dresdener Kunstakademie, ein Schüler Adrian Zinggs,
seine Mutter Johanne Eleonore Rosine Dorothee geborene Müller (Abb. 3).
Sein Großvater väterlicherseits, Heinrich Karl Richter (Abb. 4),
geboren 1741, war Kupferdrucker, seine Großmutter (Abb. 4) war die
Tochter eines Schullehrers in Wachau. Der Großvater trat, als ihm
durch einen katholischen Geistlichen der Druck der neu auszugebenden
Talerscheine dafür in Aussicht gestellt wurde, zur katholischen Kirche
über, aus dem Druck wurde aber nichts. Die Großmutter kämpfte lange
mit sich, ob sie ihrem Manne beim Wechsel der Konfession folgen sollte
oder nicht; in ihrer Bedrängnis wandte sie sich an ihren Bruder,
den protestantischen Pfarrer in Döbrichau bei Wittenberg, der ihr
riet, ihren Kindern das Opfer zu bringen, Gott sei in dieser wie in
jener Kirche, und so entschloß sie sich schweren Herzens endlich zum
Übertritt; sie hat dreißig Jahre in völliger Erblindung gelebt. Der
Großvater betrieb in späteren Jahren, als das Kupferdrucken nicht
mehr recht ging, die Uhrmacherei. „Er wohnte in einem engen düsteren
Hof eines Hauses hinter der Frauenkirche über der Judenschule,“ im
abgelegenen Stübchen des Hinterhauses hingen zahllose Uhren, die
rastlos durcheinander tickten. Der ruhige, in seinem Wesen wunderliche,
ironische Mann beschäftigte sich auch leidenschaftlich mit Alchimie und
Goldmacherei, bei ihm verkehrten geheimnisvoll allerlei Alchimisten und
alte originelle Judengestalten. Fast hundertjährig schied er aus diesem
Leben.

Abb. 9.
Studie aus Salzburg. 1823.
(Zu
Seite 18.)
Der Großvater mütterlicherseits, Johann Christian Müller, ein langer,
hagerer, leicht auffahrender und polternder Mann, war ein kleiner
Kaufmann in Dresden-Friedrichstadt, die Großmutter Christiane Luise
(Abb. 5), geboren in Amsterdam als Tochter des dortigen Kaufmanns
van der Berg, gestorben 1813, eine phlegmatische, etwas stolze Frau.
Weiter läßt sich das Herkommen der Familie nicht mehr verfolgen, da
die Kirchenbücher in der Kriegszeit verloren gegangen sind. Das Leben
in Großvater Müllers engem Kaufmannslädchen und dem anstoßenden,
noch engeren Stübchen, in dem von Nebengebäuden eingeschlossenen Hof
und dem sehr großen Garten, mit dem Blick über Kornfelder nach den
Höhen von Roßtal und Plauen, schildert Richter in der Biographie
gar köstlich, nennt auch den ehrbaren Friedrichstädter Bürger und
hochachtbaren Verleger der im Lädchen aufliegenden, in grobem
Holzschnitt ausgeführten und grell bunt bemalten Bilderbogen, Meister
Rüdiger, den Adam, Stammvater und das ehrwürdige Vorbild der Dresdner
Holzschneider. Die beiden großelterlichen Häuser mit den originellen
Gestalten, die dort ein- und ausgingen, boten ein interessantes Bild
aus dem achtzehnten Jahrhundert; sie hatten sich dem Enkel Ludwig
tief eingeprägt. Die wunderlichen Menschen, die er dort sah, mögen
oft bei seinem späteren reichen Schaffen und künstlerischen Gestalten
in seiner Erinnerung aufgetaucht und ihm Modell gestanden haben. Es
waren Figuren, wie wir sie bei Chodowiecki in dessen zahllosen Stichen
sehen und kennen; Richter erzählte oft und gern in seinem späteren
und spätesten Alter von diesen Originalen und wußte sie auch bis ins
kleinste lebendig zu[S. 11] schildern. Dagegen war das elterliche Haus in
seiner Erinnerung ärmer an derartigen und dauernden Eindrücken gewesen.
Es mögen in diesen frühesten Jugenderinnerungen die Wurzeln liegen
für seine Originale und Kapitalphilister, die er in seiner späteren
Zeit uns mit so sicherem Strich gezeichnet hat. Dresden war voll von
solchen Originalgestalten,[S. 12] und unser Ludwig machte förmlich Jagd
auf Chodowieckifiguren. Otto Jahn schreibt in seinen Mitteilungen
über L. Richter: „Die eigentümliche, schalkhafte und doch treuherzige
Pietät, mit welcher Richter seine Philister behandelt, wird aber erst
recht begreiflich, wenn man sieht, wie sie in den ersten und liebsten
Erinnerungen seiner Kinderjahre wurzelt.“ Die Kriegswirren, die
Massen von Truppendurchzügen der Franzosen und der Russen mit ihren
asiatischen Kriegsvölkern und der Österreicher, die Not der Stadt
Dresden während der Schlacht, das Hin und Her in dieser Zeit bis zur
endlichen Niederlage Napoleons bei Leipzig, das alles war für ihn reich
an Eindrücken und Abwechslungen. Der Besuch der katholischen Schule
(er war in der protestantischen Kreuzkirche in Dresden getauft) hörte
im zwölften Lebensjahre infolge der Kriegsdrangsale auf, und nun fand
Ludwig seinen Platz neben des Vaters Arbeitstisch, wo er zeichnete
und radierte. Es war selbstverständlich, daß der Sohn den Beruf des
Vaters erwählte und als Zeichner und Kupferstecher sich ausbildete;
auch seine drei jüngeren Geschwister „Willibald, Hildegard und Julius
griffen, sobald sie konnten, zu Papier und Bleistift und zeichneten
drauf los nach irgend einem Original aus Vaters Mappen“. Unseren Ludwig
befriedigte aber derartiges Zeichnen und Kupferstechen wenig, das
„Malen“ kam ihm viel schöner vor. Der Vater stach damals Kupferplatten
für den Fürsten Czartorysky, der ihn nach Warschau ziehen wollte und
ihm eine gut besoldete Professorenstelle anbot; der Mangel an Kenntnis
der französischen Sprache und an Mitteln zur Bestreitung der Kosten
des Umzugs mit Frau und Kindern nach[S. 13] dort bestimmten ihn jedoch, das
Anerbieten abzulehnen. Er hatte eine Anzahl Schüler, die er im Zeichnen
und Kupferstechen unterrichtete.

Abb. 10.
Rocca di Mezzo. 1825.
Ölbild im Museum zu Leipzig. (Zu
Seite 23.)

Abb. 11.
Landschaft von Tizian. Nach
einer eigenhändigen Pause. (Zu
Seite 26.)
Neben den Arbeiten für den Fürsten mußte der Vater, da die Bezahlung
eine sehr knappe war, als Brotarbeit auch Bilder für Volkskalender und
Ansichten von Städten und Gegenden radieren. Für die Kalenderbilder
wurden Schlachten, der Wiener Kongreß, Feuersbrünste, Erdbeben,
Mordtaten und was sonst die damalige Zeit in weitesten Kreisen
bewegte, dargestellt, und bei diesen kleinen Arbeiten durfte der Sohn
Ludwig helfend mitwirken, kopieren und arrangieren, später sogar
diese selbst radieren; mit stolzem Gefühl nimmt er die Erlaubnis auf,
die Geschichte vom Apfelschuß Tells auf der Platte „umreißen“ zu
dürfen. Die Auftraggeber für diese Kalenderbilder waren Buchbinder,
die solche Kalender verlegten, und alljährlich zum Herbstjahrmarkt
kamen diese Kleinverleger mit ihren Aufträgen. Diese Buchbinder
und Geschäftsfreunde waren auch großenteils höchst originelle
Gestalten, von denen einige Richter noch im späten Alter lebhaft vor
Augen standen. Ein alter, längst verstorbener Chirurgus in Meißen
erzählte mir, daß er sehr oft mit seinem Vater, einem Buchbinder und
Herausgeber solcher Kalender, in Dresden bei Richters Vater in solcher
Angelegenheit war, und wie er unseren jungen Richter neben Vaters
Tisch habe arbeiten sehen; er schilderte ihn als einen schmalen langen
Jüngling, wie wir ihn uns leicht vorstellen können nach dem vielleicht
zehn Jahre später gezeichneten Porträt (Abb. 15).
Er zeichnete nun auch bald nach der Natur, und wir fügen hier eine
Radierung nach einer Zeichnung von ihm, dem damals Fünfzehnjährigen,
die Brandruinen des alten Schlosses in Pillnitz (Abb. 6) bei. Die
Nationalgalerie besitzt eine in Bleistift sehr tapfer gezeichnete
Vorgrundstudie, Distelblätter, aus seinem zwölften Jahre und aus
seinem fünfzehnten Jahre ein aquarelliertes Blatt „Bewachsene Steine“,
das noch in dem damals herrschenden Manierismus behandelt ist. Die
Zopfzeit, eine der schlimmsten Zeiten deutscher Kunst, stand noch in
voller Blüte; es wurde noch Baumschlag nach ganz besonderen Methoden
gemacht, Eichen gezackt, Linden in gerundeter Manier; es war eine Zeit
der Unnatur und eines verwahrlosten Geschmacks. Richter schildert
selbst in dem Kapitel „Wirrsale“ seiner Biographie, wie er, entgegen
der herrschenden Geschmacklosigkeit und dem Manierismus die Natur
draußen so ganz anders sieht, und doch ist er befangen und weiß sich
nicht herauszufinden.

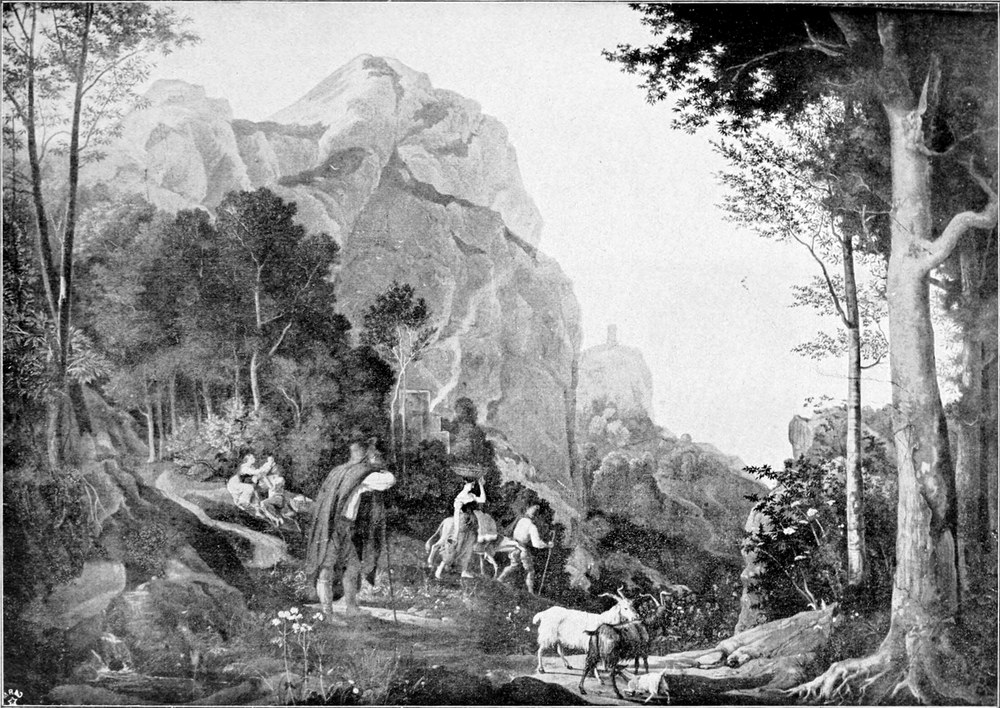
Abb. 13.
Blick in das Tal von Amalfi.
1826. Ölbild im Museum zu Leipzig. (Zu
Seite 31.)
Den Sohn des Romanschriftstellers Wagner in Meiningen, der als
Spielgenosse des Erbprinzen an dessen Erziehung teilnehmen durfte, ließ
der Herzog in Tharandt unter Cotta Forstwissenschaft studieren. In
seinen Mußestunden arbeitete der junge Wagner als Schüler bei Richters
Vater. Er brachte eines Tages eine von ihm aus der Umgebung Tharandts
nach der Natur in Deckfarben gemalte landschaftliche Studie mit: eine
Felsschlucht mit kleinem von Farnkräutern und weißen im Sonnenschein
glänzenden Sternblumen umrahmten Wasserfall. Diese Studie machte einen
tiefen Eindruck auf unseren Richter; wie hier die Natur gesehen war,
entsprach so ganz seinem Sinn, so sah auch er die Natur. Und wie ganz
anders war das, als die Zinggsche Schule lehrte. In einer Kunsthandlung
fand er ein Heft radierter Landschaften von Joh. Christoph Erhard
(1795–1822), voll feinen Naturgefühls und großer Frische. Diese[S. 14]
Blätter gefielen ihm so, daß er sie kaufte und mit ihnen hinaus nach
Loschwitz ging, um in dieser ihm neuen Art nach der Natur zu zeichnen.
Die überaus feine, naive und ganz manierlose Wiedergabe der Natur,
die sonnige Wirkung in den Radierungen dieses Meisters entzückten
ihn, sie haben einen unverkennbaren Einfluß auf seine Art zu zeichnen
gehabt, sind ihm treue Berater und Begleiter durch seine ganze
Künstlerlaufbahn[S. 15] gewesen; er hatte sie immer bei sich am Arbeitstisch,
alle seine Schüler hat er danach zeichnen lassen.
In Dresden bekämpfte der Landschaftsmaler Kaspar David Friedrich aus
Greifswald die herrschende Unnatur durch seine eigenartigen Bilder, die
mit strengstem Naturstudium und mit tiefem Naturgefühl die einfachsten
Vorwürfe der Natur, wenn auch oft stark symbolisiert, behandelten.
Im Jahre 1818 kam der Norweger Landschafter Christian Dahl nach
Dresden, der durch seine frischen, naturalistischen, norwegischen
Gebirgslandschaften ungeheures Aufsehen unter der Jugend erregte. Die
Alten aber lachten oder schüttelten die Köpfe über diese Neuerer.

Abb. 14.
Auguste Freudenberg.
9. Dezember 1826. (Zu
Seite 33.)
Aber die ersten Schimmer der Morgenröte der sich vorbereitenden
neudeutschen Kunst zeigten sich bereits. Schon hatte August Wilhelm
von Schlegel seine Abhandlung über „Christliche Kunst“ geschrieben,
Eindrücke und Gedanken, die er vor den in Paris aufgestapelten, von
Napoleon zusammengeraubten Kunstschätzen Deutschlands und Italiens
aufgezeichnet, ein Werk der damaligen literarischen Romantik, das man
als einen der Ecksteine der neudeutschen Kunst bezeichnen muß.
Schon waren Cornelius, Overbeck, Veit und Schnorr als ausübende
Künstler tätig. In der heranwachsenden Jugend fing es an zu gären.
Die Zeit der tiefsten Erniedrigung und der großen nationalen Erhebung
Deutschlands, die Befreiungskriege, wirkten auch befruchtend auf
die junge deutsche Künstlerschaft; deutsche Kunst wurde wieder
angestrebt, die altdeutschen herrlichen Meister wurden wieder
Lehrmeister. Das nationale Bewußtsein brach sich auch in der Kunst
wieder Bahn. Und auch unseren jugendlichen Richter durchzog es
ahnungsvoll.
Eines Tages kam der Buchhändler Christoph Arnold zum Vater Richter; der
Sohn bemerkte, daß dieser ihn beobachtete, schließlich aber freundlich
mit ihm sprach; er[S. 16] übertrug dem Vater die Ausführung eines größeren
Werkes in Radierungen: „Malerische An- und Aussichten der Umgegend von
Dresden“, dabei aber den Wunsch aussprechend, daß der Sohn mit dabei
beschäftigt werde.
Beim Fortgehen gibt er dem Jüngling die Hand, dabei treten ihm Tränen
in die Augen; draußen sagt er dem Vater, daß er beim Anblick des
Sohnes an seinen jüngst verstorbenen Sohn, dem Ludwig sehr ähnlich
sei, erinnert worden sei. Von da an hatte er großes Interesse an
unserem Ludwig Richter, wie sich in der Folge zeigte. Das in Auftrag
gegebene Werk erschien 1820 unter dem Titel: „Siebzig malerische An-
und Aussichten der Umgegend von Dresden, aufgenommen, gezeichnet
und radiert von C. A. Richter, Professor, und A. Louis Richter“,
ebenso erschienen in demselben Jahre noch dreißig malerische An- und
Aussichten von Dresden und der nächsten Umgebung. Aus dieser Folge
bringen wir „Dresden von der Bärbastei“ von unserem jungen Künstler
gezeichnet und radiert (Abb. 7). Beide Folgen waren zum Kolorieren
bestimmt, deswegen sind die Lüfte leer gelassen.

Abb. 15. Jugendporträt L. Richters vom
Jahre 1827, gez. von C. Peschel.
Museum zu Dresden. (Zu Seite 13 und 36.)
Im Jahre 1820 begleitet unser junger Richter, der inzwischen für sich
gezeichnet und gemalt, auch an Bilder sich gewagt hat, den Fürsten
Narischkin, Oberstkämmerer der Kaiserin von Rußland, sieben Monate als
Zeichner auf dessen Reise über Straßburg und Marseille nach Nizza. Die
Skizzen nach der Natur von dieser Reise, die noch vorhanden sind und
nach denen er ausgeführte Zeichnungen für ein Album, das der Kaiserin
von Rußland bei der Rückkehr überreicht werden sollte, fertigte, haben
oft noch etwas „Zopfiges“ an sich; er war, trotzdem er sich frei zu
machen suchte, weil ein lebendiges Naturgefühl ihn durchdrang, noch
in der Art und Weise der Zeit befangen und gebunden. Wir bringen von
diesen Skizzen ein Blatt (Abb. 8) aus Avignon. Nach der Rückkehr
radierte er für Arnold wieder dreißig Ansichten zu dem „Taschenbuch
für den Besuch der sächsischen Schweiz“. In diesen Radierungen, die
nichts weiter als Prospekte sein sollten (dieses Taschenbuch entsprach
ungefähr in seinen Zwecken unseren heutigen Bädekerreisebüchern),
macht sich, wie in den vorerwähnten siebzig und dreißig Ansichten,
schon in der Ausbildung der figürlichen Staffage der eigene Zug
Richters geltend, die Natur immer nur in Verbindung mit dem Menschen zu
schildern.[S. 17] — Aber diese Arbeiten befriedigten ihn nicht, es drängte
ihn nach ganz anderen Zielen. Und zur Erreichung dieser sollten ihm die
Wege geebnet werden.
Der väterliche Freund Arnold gab ihm die Mittel zu einer Studienreise
nach Rom auf drei Jahre (jährlich 400 Taler), — nach Rom, wo
Cornelius, Overbeck und Philipp Veit im Hause des preußischen
Generalkonsuls Bartholdy die Geschichte Josephs in Fresken (jetzt in
der Nationalgalerie in Berlin) bereits ausgeführt und die Merksteine
der neuen Ära aufgerichtet hatten, wo dieselben Künstler, denen sich
Schnorr 1818 zugesellte, in der Villa des Fürsten Massimi die Fresken
zu Dantes „Göttlicher Komödie“, zu Tassos „Befreitem Jerusalem“ und zu
Ariostos „Rasendem Roland“ zu malen begonnen hatten. — Die Kunde von
diesen Werken, die für die neue deutsche Kunst von so außerordentlicher
Bedeutung sind, war auch nach Dresden gedrungen, und man kann sich
vorstellen, wie die herrliche Aussicht, nun so bald in diese Zentrale
der neudeutschen Kunstbewegung kommen zu sollen, unseren jungen
Künstler mit Begeisterung erfüllte. Jetzt war er erlöst und konnte dem
innersten Zuge seines Herzens folgen; — „ich war mit einem Schlage
frei von dem Drucke ägyptischer Dienstbarkeit, die hoffnungslos auf
meinem Leben lastete, mit einem Zuge war der Vorhang weggeschoben, und
der selige Blick sah das gelobte Land vor sich liegen, das Land einer
bisher hoffnungslosen Sehnsucht, wohin der Weg nun gebahnt war.“
Auf der Kunstausstellung im Sommer 1822 tauchten einige kleinere Bilder
deutscher Künstler in Rom auf, die über die „neue Richtung“ der jungen
Künstlergeneration Aufschluß gaben. Es waren Bilder von Götzlaff,
Klein, Catel, Rhoden. Diese Bilder machten durch ihr strenges und
höchst liebevolles Anschließen an die Natur, durch das Stilgefühl,
welches ihre Urheber den alten deutschen und italienischen Meistern
abgelernt, auf unseren jungen Künstler tiefen Eindruck; wie war das
so ganz anders angeschaut und wie war das empfunden! Wie hohl und öde
waren dagegen die Werke von Klengel und den anderen Zopfmalern, die vor
lauter „Baumschlag“ und „Kunstrezept“ und „Kunstregel“ so ganz abseits
von der Natur gekommen waren.
[S. 18]

Abb. 16.
Landschaft aus der römischen
Campagna. Federzeichnung. 1828. (Zu
Seite 39.)
Von Dresden waren bereits Alters- und Gesinnungsgenossen nach Rom
gezogen; Richter kannte aber nur wenige von ihnen und stand außerhalb
ihres Kreises. Sein Vater wollte von diesen „Neuerern“ nichts wissen,
die obendrein in altdeutschen Röcken und Sammetbaretts, mit langen
Haaren und Fechthandschuhen einhergingen.

Abb. 17.
Brunnen bei Arriccia. Nach
einer Aquarelle. 1831. (Zu
Seite 39.)
1823 trat er die Reise über Salzburg an. Er zeichnete viel auf seiner
Wanderung durch die Alpen, Landschaftliches und Figürliches. Abb. 9 ist
eine Figurenskizze aus dem Salzburgischen, in der Art der Zeichnung
und Charakteristik Philipp Fohrs, auf den wir später noch kommen. Die
Nationalgalerie besitzt ein aquarelliertes Blatt, eine Landschaft[S. 19] von
1823, auf dieser Reise gefertigt, worin auch das Figürliche ähnlich
im Schnitt und räumlich sehr hervorgehoben ist. In Innsbruck, wo er
Nachrichten aus der Heimat erwartete, fielen ihm Schlegels Abhandlungen
über „Christliche Kunst“, die wir früher schon erwähnten, in die Hände,
und als er jenseits der Alpen, in Verona, zuerst altitalienische
Kunstwerke sah, wurden ihm Schlegels Aussprüche erst recht verständlich
und lebendig; hier sah er in der Kirche St. Giorgio das bekannte Bild
von Girolamo dai Libri: „Die Madonna auf dem Thron von singenden Engeln
umgeben“ und wurde von dem Bilde wunderbar ergriffen. Als fünfzig
Jahre später auf dieses Bild die Rede kam, schrieb er mir in seiner
Begeisterung eine kurze Abhandlung über dies Bild aus den „Gesprächen
über die Malerei in Italien“ von L. Lanzi mit der vorzüglichen
Anmerkung dazu von Quandt ab; er war noch immer von der höchsten
Begeisterung für dieses Gemälde erfüllt. Am 28. September, am Abend
seines zwanzigsten Geburtstages, zog er durch die Porta del Popolo in
Rom ein; Glockengeläute und Kanonendonner verkündeten die Wahl Papst
Leos XII. „Da lag mein Schifflein im ersehnten Hafen.“

Abb. 18.
Der Watzmann. 1830. Verlag
von C. G. Boerner in Leipzig. (Zu
Seite 40.)
Hier traf er nun mit den ihm von Dresden her bekannten jungen Malern
Wagner und Ernst Oehme zusammen. „Hier in Rom entdeckten wir (Oehme
und Richter) bald, daß ein anderes liebes Geheimnis uns verband; denn
er hatte eine Emma, wie ich eine Auguste, in der Heimat und im Herzen,
beide Mädchen kannten sich, beide wurden von Pflegeeltern erzogen,
welche einander nicht unbekannt waren, und so konnte es nicht fehlen,
daß wir uns ebenfalls vertraulich nahe fühlten.“
Großen Einfluß auf ihn gewann zuerst vor allem der aus der Sturm- und
Drangperiode herübergekommene Landschafts- und Figurenmaler Joseph
Anton Koch, das originelle derbe und biedere Tiroler Landeskind.
Besonders seine historischen Landschaften wirkten auf den jungen
Künstler bestimmend. Noch im Laufe des ersten Winters in Rom,
1823–1824, malte Richter ein Bild, den Watzmann darstellend. Während
er daran arbeitete, besuchte ihn Koch, der von da an großen Anteil an
seinem Schaffen[S. 20] nahm und in herzlichen Verkehr zu ihm trat; ihm hat
Richter für seine künstlerische Fortentwickelung viel zu danken. Auch
Julius Schnorr aus Leipzig trat Richter jetzt freundschaftlich näher.
Schnorrs Persönlichkeit und Geistesrichtung berührten Richter innerlich
noch mehr, weil er eine ihm verwandte Natur war. Koch suchte das Große
und Gewaltige mit Pathos in der Formengebung auszudrücken, wogegen der
lyrische Schnorr durch seinen Schönheitssinn und die Anmut in seiner
Gestaltung, durch blühende Phantasie und Romantik in unserem jungen
Künstlergemüt gleichgestimmte Saiten erklingen machte.

Abb. 19.
Castel Gandolfo. Radierung.
1832. Verlag von C. G. Boerner in Leipzig. (Zu
Seite 40.)
Im „Kunstblatt“, Jahrgang 1824, wird über dies Bild vom Watzmann, das
er in Dresden ausgestellt und seinem Gönner Arnold überließ, berichtet:
„Die Meisterhaftigkeit, mit welcher dieses Bild ausgeführt ist, der
schöne und tiefe Sinn für Natur, der sich darin spiegelt und in Treue
und Wahrheit den Charakter dieser Berggegend wiedergibt, die gut
gedachten Effekte der Licht- und Schattenpartien erfreuen uns um so
mehr, da der Künstler noch sehr jung ist und bei solchen Anlagen und
so früher Entfaltung von praktischer Geschicklichkeit das Höchste in
dieser Kunst zu erwarten berechtigt.“ Und von Quandt schreibt ebenda:
„Das Romantische, das, was in der Natur ans Unbegreifliche und in der
Darstellung ans Unglaubliche reicht, ohne die Grenzen des Möglichen
und Wirklichen zu überschreiten, ist ganz des jungen Malers Fach,
und er vermag es mit solcher Wahrheit vor die Augen zu stellen, daß
uns ganz das Gefühl des Erhabenen durchdringt, welches der Anblick
im reinsten Sonnenlicht strahlender Gletscher, ungestümer Bäche und
ernster Waldungen, welche als Landwehr den Bergstürzen und Lawinen sich
entgegenstellen, uns einflößt.“ Die Dresdener Akademie gewährte ihm auf
dieses Bild ein Stipendium von hundert Talern. Abends zeichnete Richter
mit größtem Eifer mit den Genossen in der sogenannten Academia, die
Passavant und einige Freunde eingerichtet hatten, nach dem lebenden
Modell; er vergleicht diese Figurenstudien mit[S. 21] denen, die zu der
Zeit in Deutschland gezeichnet wurden, und sagt, daß man dort solche
Figurenstudien in eine gewisse manierierte Schablone brachte, weil der
Respekt vor der Natur fehlte; aber „hier zeichnete man mit der größten
Sorgfalt, mit unendlichem Fleiß und großer Strenge in der Auffassung
der Individualität, so daß diese Zeichnungen oft kleine Kunstwerke
wurden, an denen jeder seine Freude haben konnte; denn es war eben ein
Stück schöner Natur.“
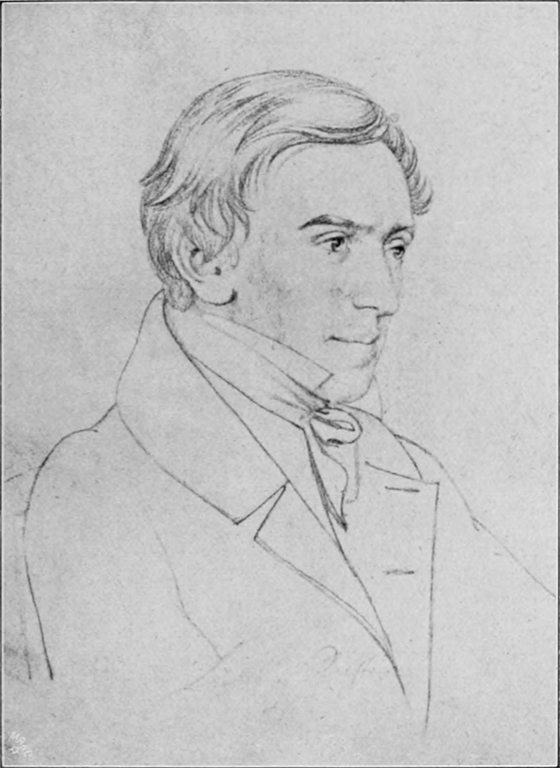
Abb. 20.
Porträt Ludwig Richters.
Gezeichnet 1831 von Adolf Zimmermann. (Zu
Seite 40.)

Abb. 21.
Vertreibung aus dem
Paradies. 1832.
Aus „Biblische Historien“ von Zahn.
Mit Genehmigung der Verlagshandlung A. Bagel in Düsseldorf. (Zu
Seite 40.)
Im Frühling 1824 zog unser Landschafter ins anmutige Albanergebirge,
später nach Tivoli, wo er mit Philipp Veit am Tempel der Sibylla
zusammentraf. An einem Regentage wurde hier beschlossen (Oehme,
Wagner, Götzlaff und Rist waren die Genossen Richters), daß jeder bis
zum Nachmittag eine Komposition entwerfen sollte. Richter schreibt
darüber: „Ich hatte eine Gruppe sächsischer Landleute mit ihren
Kindern gezeichnet, welche auf einem Pfade durch hohes Korn einer
fernen Dorfkirche zuwandern, ein Sonntagmorgen im Vaterlande. Diese
Art von Gegenständen war damals nicht an der Tagesordnung und in
Rom erst recht nicht. Das Blatt machte deshalb unter den anderen
einige Wirkung; — ich erinnere mich wohl, wie ich das Blatt ohne
Überlegen, gleichsam scherzweise, meinen damaligen Bestrebungen und
Theorien entgegen, hinwarf, und dieser Umstand ist mir in späteren
Jahren wieder eingefallen und deshalb merkwürdig erschienen, weil
das recht eigentlich improvisierte Motiv der erste Ausdruck einer
Richtung war, die nach vielen Jahren wieder in mir auftauchte, als
ich meine Zeichnungen für den Holzschnitt machte. Es waren liebe
Heimatserinnerungen, sie stiegen[S. 22] unwillkürlich aus einer Tiefe des
Unbewußten herauf und gingen darin auch wieder schlafen, bis sie
später in der Mitte meines Lebens mit Erfolg neu auferstanden.“
Richter beschloß die Studien für diesen Sommer und Herbst in Olevano
im Sabinergebirge. Dieses einzige Stückchen herrlichen Landes hatte
Koch einige Jahre vorher[S. 23] entdeckt; seit Jahren ist die Serpentara, die
kleine felsige Kuppe mit einem Wald deutscher Eichen, der Glanzpunkt
von Olevano, in Verfolg einer Anregung deutscher Künstler in Erinnerung
dort verbrachter Studienzeit in den Besitz des Deutschen Reiches
übergegangen.

Abb. 22.
Erntezug in der römischen
Campagna. 1833. Ölbild im Museum zu Leipzig. (Zu
Seite 40.)

Abb. 23.
Der Wasserfall bei Langhennersdorf.
Radierung. 1834.
Verlag von Carl Gräf (E. Arnold) in Dresden.
(Zu
Seite 40.)

Abb. 24.
Das Tor auf dem Neu-Rathen.
Radierung. 1834.
Verlag von Carl Gräf (E. Arnold) in Dresden.
(Zu
Seite 40.)
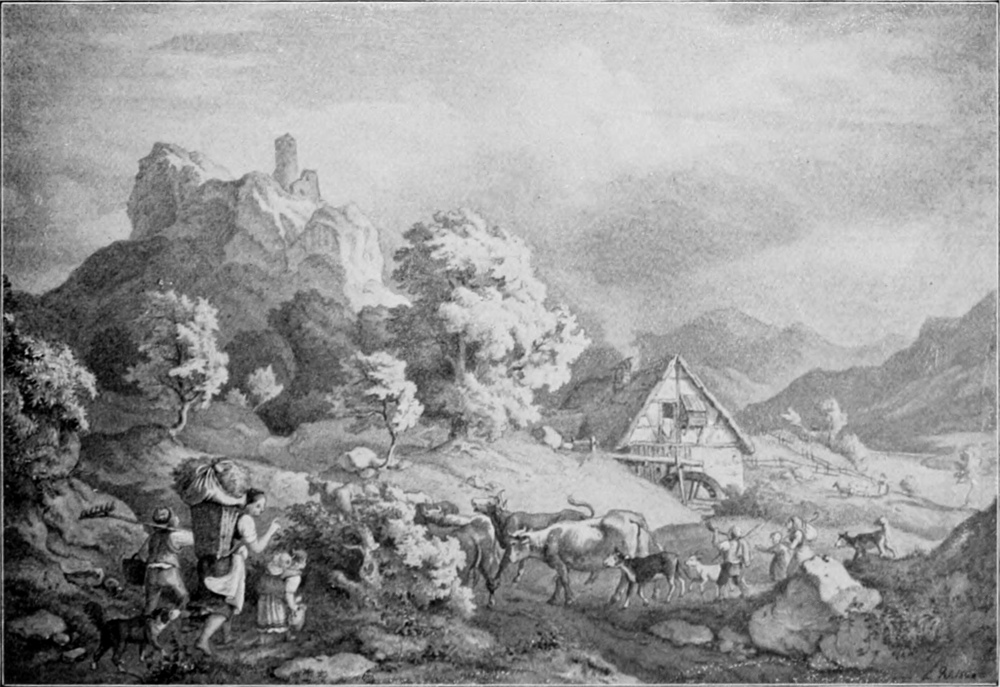
Abb. 25.
Aufsteigendes Gewitter am
Schreckenstein. Nach einem Aquarelle von 1836. (Zu
Seite 42.)
Nach Rom zurückgekehrt, malte Richter im Winter das Bild „Rocca di
Mezzo“ (Abb. 10), welches durch Vermittelung Schnorrs der Baron Speck
von Sternburg erwarb; es befindet sich jetzt im Museum zu Leipzig. Bei
Philipp Veit, dem Sohn von Dorothea von Schlegel, mit dem er in Rom
unter einem Dach wohnte, sah er zwei Bände Holzschnitte und Stiche
Dürers, von denen ihm bisher wenige bekannt waren. Veit erschloß ihm
den Reichtum an Schönheiten und die Bedeutung dieser Werke; er ist
von[S. 24] der volkstümlichen Art, deutsches Leben und Wesen wiederzugeben,
ganz begeistert, und für die Folge haben diese Eindrücke fördernd und
bestimmend auf unseren jungen Künstler eingewirkt und vielfältige
und herrliche Früchte gezeitigt. In der Galerie Camuccini sah er ein
seitdem in England verschwundenes Bild von Tizian, eine Landschaft
mit einem Zechgelage von Göttern und Göttinnen, welches einen
unauslöschlichen Eindruck auf ihn machte. „Ich war ganz hingerissen
von diesem herrlichen Gemälde, der großartigsten Landschaft, die ich
je gesehen,“ schreibt er in seiner Biographie, und weiter dann in
den Tagebuchaufzeichnungen vom Jahre 1824: „Aus Tizians ‚Bacchanal‘
weht eine wunderbare[S. 26] Frische und holde Lebensfülle; das Kolorit ist
wahre Zauberei, eine Kraft, ein Glanz und eine Glut in den Farben, die
einen wunderbaren Reiz wirken und schon für sich die höchste poetische
Stimmung im Beschauer erwecken. Die Komposition ist höchst einfach,
grandios und edel. Auf einem lustigen Plätzchen am grünen Walde haben
sich die Götter zum fröhlichen Feste versammelt und niedergelassen.
Die Figuren sind schön gemalt, voll Ausdruck und Leben, aber ziemlich
gemein, ja völlig travestiert dargestellt.“ Er schildert dann weiter
die Landschaft und schließt mit dem Ausruf: „So müssen Landschaften
gemalt werden, so muß die Natur aufgefaßt werden! Das ist der Stil, der
sich zu Heldengedichten eignet; er ist größer, edler, als der lyrische.
So groß, so sinnvoll und lebendig und so einfach nun auch deutsche
Natur aufgefaßt!“ Und noch nach fünfzig und mehr Jahren geriet er in
Begeisterung, wenn die Rede auf dieses Bild kam; er zeichnete bei einer
solchen Gelegenheit dem Verfasser nach einem Stich in dem bekannten
Werk von Agincourt die hier (Abb. 11) wiedergegebene Pause und
schwelgte dabei in Erinnerungen.

Abb. 26.
Überfahrt am Schreckenstein.
1837. Ölbild im Museum zu Dresden.
Nach einer Originalphotographie von F. & O. Brockmanns Nachf. (R. Tamme) in
Dresden. (Zu
Seite 36 und
42.)

Abb. 27.
Die Figuren zur Überfahrt am
Schreckenstein. Nach einer Zeichnung im Museum zu Dresden. 1837. (Zu
Seite 43.)

Abb. 28.
Aimée in der Badewanne.
12. März 1835. (Zu
Seite 44.)
Außerordentlich anregend für unseren jungen Maler, freilich nach einer
anderen Seite hin als das Bild von Tizian, waren die Arbeiten zweier
Künstler, die beide im Beginn ihrer Laufbahn starben: Karl Philipp
Fohr aus Heidelberg und Franz Horny aus Weimar. Fohr ertrank 1818 beim
Baden im Tiberfluß bei Aqua Acetosa vor den Toren Roms, Horny starb
im folgenden Jahre in Olevano. Richter schreibt in seiner Biographie:
„Das Andenken beider lebte noch warm in den Genossen, und die
Naturstudien wie die Kompositionen, welche sich noch im Besitz ihrer
Freunde vorfanden, versetzten[S. 28] mich in einen Rausch der Begeisterung;
insbesondere war das bei Fohr der Fall. Frühere, noch in Deutschland
gemachte Naturstudien zeigen eine so feine, liebevolle Beobachtung der
Natur und manierlose, naive Darstellung, daß, weil diese Eigenschaften
mit einem großen Stilgefühl sich verbanden, die reizvollsten
Zeichnungen entstehen mußten.“ Er schildert sodann einige solcher ganz
vorzüglichen Zeichnungen, die unbestritten zu den hervorragendsten
Arbeiten aus dieser Zeit gehören und für alle Zeiten mustergültig
bleiben werden. Von Hornys Arbeiten schreibt unser Meister: „Höchst
originell, eine großartige, strenge, ja herbe Auffassung und Behandlung
liebend, studierte er meist in den sterilen Bergen von Olevano und
Civitella. Die Zeichnungen dieses Künstlers sind auch von großem und
hohem künstlerischen Werte.“

Abb. 29.
Zeichnung zu einem Ölbilde:
Ruhende Pilger. 1840. (Zu
Seite 45.)
Auf dem Boden der Kirche in Olevano sah Verfasser 1866 eine Reihe von
Arbeiten dieses Künstlers; es waren runde Stationsbilder, die an diesem
Orte seit fünfzig Jahren verborgen lagen. Vor Richters Ankunft in Rom
war der geistreiche Radierer Joh. Christ. Erhard, dessen deutsche
Blätter unseren Richter so anregten und entzückten, aus diesem Leben
geschieden; er war nicht angelegt, der romantischen Richtung der Zeit
folgen zu können, aus Kummer darüber erschoß er sich in Rom 1822.
Richter schreibt in seiner Biographie: „Erhard litt an Melancholie,
welche sich oft bis zum Unerträglichen steigerte, und verzagte in
solcher Stimmung gänzlich an seinem Talente. Ich glaube auch, daß
sich die italienische Natur für seine künstlerische Eigentümlichkeit
nicht eignete.“ Den Freund Erhards, den liebenswürdigen Maler Reinhold
aus Gera, besuchte Richter oft und erfreute sich an dessen ganz
vortrefflichen Naturstudien; auch mit dem höchst talentvollen Ernst
Fries aus Heidelberg, dem Freunde Fohrs und Rottmanns, kam er öfters
zusammen.

Abb. 30. Zeichnung zum
Gehörnten
Siegfried. Aus den Volksbüchern von Marbach. 1838.
Mit Genehmigung der Verlagshandlung von Otto Wigand in Leipzig.
(Zu
Seite 46.)
Hier in Rom sah Richter auch die 1823 in Wien erschienenen wundervollen
Steinzeichnungen von Ferdinand von Olivier, die sogenannten sieben Tage
der Woche; es sind Bilder aus Salzburg und Berchtesgaden, fast alle mit
köstlicher Staffage belebt; diese Blätter gehören mit zu den schönsten
Werken aus jener Zeit, streng und vornehm in der Formengebung, dabei
von einer seltenen Liebenswürdigkeit und Anmut. Ferdinand von Olivier,
geboren 1785 in Dessau, lebte, ehe er nach Rom ging, in Wien und traf
dort mit Overbeck und Julius Schnorr zusammen. Des letzteren Bild im
städtischen Museum zu Leipzig, „Der heilige Rochus“, ist in dieser Zeit
in Wien gemalt; es erinnert sehr an die Art und Weise Oliviers. Die
Illustrationen Burgkmaiers zum „Trostspiegel in Glück und Unglück von
Petrarca“, diesem so wunderlichen Buche, haben die deutschen Künstler
in Rom ganz besonders geschätzt und viel danach gezeichnet. Von Richter
existieren noch Pausen nach diesen Holzschnitten aus dieser Zeit; er
besaß dieses Buch und hat viel Anregung daraus empfangen.
[S. 29]

Abb. 31. Zum
Gehörnten Siegfried.
Aus den Volksbüchern von Marbach. (Zu
Seite 47.)

Abb. 32. Zeichnung zum
Gehörnten
Siegfried.
Aus den Volksbüchern von Marbach. (Zu
Seite 46.)
In jener Zeit las Richter auch Stillings „Jugend- und Wanderjahre“;
gerade hier in Rom mußte dieses Stück deutschen Volkstums großen
Eindruck auf ihn machen. Besonders aber berührte ihn der fromme Sinn
des Buches und traf eine wunde Stelle seines Herzens, deren Heilung
ihm immer mehr Bedürfnis wurde. Das religiöse innere Leben Richters
war ganz unentwickelt, verkümmert, halberstickt, aber es arbeitete
mächtig in ihm. Bei dem erkrankten Freunde Oehme lernte er den
Landschaftsmaler J. Thomas und den Kupferstecher N. Hoff aus Frankfurt
und Ludwig von Maydell aus Dorpat kennen; letzterer war ein ehemaliger
russischer Ingenieuroffizier, der gegen Frankreich mitgekämpft hatte.
1824 am Silvesterabend suchte Richter, nachdem er bis zehn Uhr an
Oehmes Krankenbett gesessen, Maydell in dessen nahegelegener Wohnung
auf, wo er Hoff und Thomas traf; er erzählt von diesen für ihn so
hochbedeutenden Stunden, wie Maydell einen Aufsatz über den achten
Psalm vorgelesen, die Freunde sich dann des weiteren unterhalten, und
sagt dann: „Ich habe keine Erinnerung von dem, was an jenem Abend
gesprochen wurde; es war auch nichts Einzelnes, was mich besonders
tiefer berührt hätte; aber den Eindruck gewann ich und wurde von
ihm überwältigt, daß diese Freunde in ihrem Glauben an Gott und an
Christum, den Heiland der Welt, den Mittelpunkt ihres Lebens gefunden
hatten und alle Dinge von diesem Zentrum aus erfaßten und beurteilten.
Ihr Glaube hatte einen festen Grund im Worte Gottes, im Evangelio von
Christo. Der meinige, welcher mehr Meinung und Ansicht war, schwebte in
der Luft und war den wechselnden Gefühlen und Stimmungen unterworfen.
Still, aber im Innersten bewegt, hörte ich den Reden der Freunde zu
und war mir an[S. 30] jenem Abend der Umwandlung nicht bewußt, die in mir
vorging.“ — „Und als nun das beginnende Geläute der Mitternacht den
Schluß des alten und Anfang des neuen Jahres verkündete und Thomas uns
aufforderte, diesen Übergang mit dem alten schönen Choral ‚Nun danket
alle Gott‘ zu feiern, — da konnte ich recht freudigen Herzens mit
einstimmen. Oehmes Krankheit war der äußere Anlaß gewesen, welcher uns
zusammengeführt hatte; eine gemeinsame Geistesrichtung, die aus dem
tiefsten Bedürfnis des Herzens kam, war in dieser Stunde hervorgetreten
und hat uns für das ganze Leben treu verbunden bis ans Ende dieser
Erdentage; denn sie ruhen nun alle, und nur ich, der jüngste von
ihnen, bin der Überlebende und segne noch heute diesen für mich so
hoch bedeutsamen Silvesterabend.“ Wie ein Jauchzen erklingt es in
ihm am Neujahrsmorgen 1825: „Ich habe Gott, ich habe meinen Heiland
gefunden; nun ist alles gut, nun ist mir ewig wohl!“ und weiter: „Das
Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden.“ Maydell, der
vielbelesene Protestant, nahm sich des Suchenden herzlich an und half
ihm getreulich. Besonders machte er ihn mit der Bibel und mit Luthers
Schriften bekannt. Auch Richard Rothe, der damals Prediger an der
preußischen Gesandtschaftskapelle in Rom war, nachmaliger Doktor und
Professor der Theologie und geheimer Kirchenrat zu Heidelberg, ein
Mann von großer Bedeutung, gewann viel Einfluß auf unseren suchenden
Jüngling. Auf Wunsch eines großen Teiles der evangelischen Künstler
Roms veranstaltete Rothe (Brief an seine Eltern vom 21. Februar 1824
und andere Nachrichten, vergl. Friedrich Nippold „Richard Rothe“)
Vorträge über Kirchengeschichte zur Förderung des evangelischen Sinnes
und Glaubens; diese Vorträge gingen wohl auch in recht lebhafte
Gespräche über und gaben zu mannigfaltigen Erörterungen Anlaß. Hieran
beteiligte sich unser Künstler mit größtem Eifer. Den damals in Rom
lebenden deutschen Künstlern war Kunst ohne Religion undenkbar; die
beiden Elemente waren ihnen zu einem verschmolzen, von welchem sie
tief durchdrungen waren. Wie ernst die Künstler ihr Christentum nahmen
und hielten, darüber spricht sich unser Meister nach vierundvierzig
Jahren in einer Tagebuchaufzeichnung[S. 31] vom 20. August 1868 aus:
„Bedeutend ist die romantische Kunstperiode in Rom im Vergleich zu
den gleichzeitigen Bestrebungen der romantischen Dichter in Beziehung
zum Christentum. Die ersteren machten Ernst damit, machten es zur
Lebensaufgabe; bei letzteren war es teils Dekoration oder ästhetische
Ansicht und Meinung, bei den Künstlern ein Leben, nicht sowohl nach
ihrem Glauben, sondern aus dem Glauben.“ Die Protestanten fanden
vielfach, dem romantischen Zuge der Zeit entsprechend, in ihrer Kirche
nicht das, was sie suchten, es neigten viele zur katholischen Kirche;
unter anderen traten die Maler von Rhoden aus Kassel und der Lübecker
Overbeck zum Katholizismus über. Es mag viel gestritten und gerungen
worden sein. Hier war auch bei den Streitigkeiten hin und her der
Vergleich zwischen den beiden christlichen Kirchen gebraucht worden,
man möge sich beide wie zwei verschiedene Regimenter vorstellen, die,
verschiedene Uniformen tragend, doch einem Könige dienten.

Abb. 33.
Die Lutherlinde in Ringetal.
Radierung. 1839.
Verlag von Carl Gräf (E. Arnold) in Dresden. (Zu
Seite 47.)
In dem Hause des damaligen preußischen Gesandten beim päpstlichen
Stuhle, Freiherrn von Bunsen, fand Richter eine freundliche und sehr
wohlwollende Aufnahme.
In dieser Zeit hatte Schnorr einen Teil seiner viel bewunderten und
großes Aufsehen machenden Landschaften gezeichnet. Es sind über hundert
Blätter geworden, die im Besitze seines Freundes Eduard Cichorius
aus Leipzig sind. Diese Zeichnungen beeinflußten Richter stark; sie
waren ihm ein Wegweiser, wie stilvolle Auffassung mit Naturwahrheit zu
verbinden sei.
Im Frühjahr 1825 ging Richter nach Neapel und Amalfi bis Pästum, später
mit Maydell bis zum Herbst nach Civitella, wo er viele Zeichnungen
und Studien sammelte. Wir bringen aus dieser Zeit nur eine figürliche
Zeichnung (Abb. 12).
Er fühlte sich krank, Brustschmerzen quälten ihn besorgniserregend,
er hatte viel mit Schmermut zu kämpfen. In der Biographie ist ein
Gedicht von ihm, „Sehnsucht“, abgedruckt, das einen tiefen Einblick
in seine Stimmung gewährt. Nach Rom ins Winterquartier zurückgekehrt,
ging er an die Ausführung eines größeren Ölbildes „Blick in das Tal
von Amalfi“, die Komposition dazu hatte er nach seinen in Amalfi im
Sommer gesammelten Studien in Civitella vorbereitet. Wir geben hier
eine Nachbildung des Gemäldes, das sich jetzt im Museum in Leipzig als
Geschenk von E. Cichorius befindet (Abb. 13).

Abb. 34.
Luther auf der Wartburg. 1840.
Aus Duller, Deutsche Geschichte.
Verlag von Gebr. Paetel in Berlin. (Zu
Seite 47.)
Aus dem sonnigen, lachenden, an der Küste des Mittelländischen Meeres
liegenden Amalfi hinaufsteigend gelangt man in ein herrliches Tal
mit zu beiden Seiten terrassenförmig abfallenden,[S. 32] zum Teil steilen
Wänden. Zwischen Zitronen- und Orangengärten und Kastanienwäldern
taucht gar bald der im weichen Blau hell schimmernde Golf von Salerno
auf, und hier ist ungefähr der Standpunkt, den Richter für sein Bild
gewählt hat. An einem im Wald sich verlierenden Pfad lagert ein junges
Menschenpaar, ein Kindlein herzend. Talabwärts schreitet elastischen
Schrittes ein stattliches Weib, neben ihm ein Mann, der einen bepackten
Esel führt. Im blumigen Vorgrund steht, auf seinen Stab gestützt,
ein Hirt, nach dem Meer hinausschauend, links ein klares Wässerchen,
zierliche weiße Doldenpflanzen an seinen Rändern; rechts zwei Ziegen
mit einem säugenden Zicklein. Im weiteren Mittelgrunde die stolzen
Felswände, hinter dem Walde Häuser, aus denen leichter Rauch aufsteigt.
Richter schreibt über dieses Bild in seinen Lebenserinnerungen: „Auch
meine Landschaft trägt den charakteristischen Zug an sich, welcher fast
allen Bildern eigen ist, die in jener Zeit von deutschen Künstlern in
Rom gemalt wurden: eine gewisse feierliche Steifheit und Härte in den
Umrissen, Magerkeit in den Formen, Vorliebe zu senkrechten Linien,
dünner Farbenauftrag usw. Die Vorliebe für die altflorentiner und
altdeutschen Meister bannte auch in deren Handweise.“ An einer anderen
Stelle findet sich die nachfolgende hochinteressante Bemerkung, die wir
hier einfügen wollen, weil sie für die damaligen Anschauungen maßgebend
war: „Über das Zurückgreifen zu den ältesten Meistern, Giotto, Eyck
und ihren Zeitgenossen, ist mir die Äußerung des berühmten Canova zu
Baptist Bertram, dem Freunde Boisserées, merkwürdig erschienen, als er
dessen Sammlung altdeutscher und altniederländischer Gemälde, damals
noch in Heidelberg, jetzt in München, betrachtet hatte. Er meinte, hier
bei dieser ältesten Kunst müßten die Maler wieder den Faden anknüpfen,
wenn sie auf lebensvollere Bahnen kommen wollten; wer von Raffael
ausgehe, könne nicht weiter hinauf-, sondern nur hinabsteigen.“ (S.
Boisserée, „Leben und Briefe“).

Abb. 35. Zeichnung zum
Landprediger von
Wakefield von Oliver Goldsmith. Übersetzt von Ernst Susemihl. 1811. Fünfte
Auflage. C. F. Amelangs Verlag in Leipzig. (Zu
Seite 38 und
47.)
Welch einen Fortschritt zeigt dieses Bild gegen das vorher gemalte
„Rocca di Mezzo“, in dem das Absichtliche und Kulissenhafte trotz
großer Reize in der Zeichnung weniger befriedigend wirkt. Das Tal von
Amalfi ist das schwungvollste seiner italienischen Bilder und als ein
wichtiger Wendepunkt in Richters künstlerischer Entwickelung in Italien
zu betrachten. Schnorr, der ihn, als er mit der Aufzeichnung des
Bildes fertig war, besuchte, erbot sich, die ziemlich großen Figuren
des Bildes auf einer Pause zu überzeichnen; diese Überzeichnung war
so schön ausgeführt, daß Richter darüber hoch[S. 33] beglückt war; er hat
sie bis an sein Lebensende als ein teures Angedenken bewahrt. Das Bild
mit seinen Figuren erregte auf der Ausstellung in Dresden Aufsehen. Um
nun bei seinen weiteren Bildern in den Figuren nicht zurückzubleiben,
mußte er sich noch eingehender mit dem Studium menschlicher Figuren
beschäftigen, und schon bei einem nächsten Bilde, das er in Dresden
ausführte, gelangen ihm dieselben noch besser, und so ging es
schrittweise vorwärts, bis endlich in den späteren Zeichnungen für
den Holzschnitt die Figuren zur Hauptsache wurden und die Landschaft
in den Hintergrund trat. Insofern zweigte sich hier sein späterer und
wohl recht eigentlicher Weg von der seitherigen Bahn ab. Noch war er
sich aber bewußt, daß die ideale, sogenannte historische Landschaft
seiner innersten Neigung entsprach. Wie ganz anders aber sollte sich
seine Künstlerlaufbahn in der Folge gestalten, nach wie ganz anderen
Zielen wurde er gedrängt! Im Herbst desselben Jahres kamen noch drei
sächsische Landsleute nach Rom, die Geschichtsmaler Karl Peschel,
Zimmermann und W. von Kügelgen. Mit diesen drei Männern entwickelte
sich in der Folge ein seltenes Freundschaftsverhältnis, das in den
tiefsten und heiligsten Überzeugungen des Herzens begründet war. Und
besonders rührend war Richters Verhältnis zu Peschel, mit dem er über
vier Dezennien an der Kunstakademie als Lehrer tätig war; beide nahmen
an den gegenseitigen Arbeiten, bis der Tod sie schied, den innigsten,
ernstesten Anteil.
Am 1. April 1827 wanderte Richter wieder nordwärts, zur Porta del
Popolo hinaus, begleitet von seinem lieben Freunde Maydell und den
anderen Genossen. Am Ponte Molle trank man den üblichen Abschiedstrunk,
Maydell wanderte mit ihm bis zum Monte Soracte, hier übergab er ihm ein
kleines Büchlein, in welches er im Laufe des Winters mit der feinsten
Feder auf über 90 Seiten je 2 Bibelsprüche eingeschrieben hatte, auch
Richard Rothe hatte einige solcher hinzugefügt, dann trennten sich mit
Tränen in den Augen beide Freunde, Maydell kehrte nach Rom zurück,
Richter schritt der Heimat zu, wohin ihn ein holder Magnet zog.

Abb. 36. Zeichnung zum
Landprediger
von Wakefield. (Zu
Seite 47.)
In Dresden angekommen, eilte er von den Eltern weg sogleich zu
seiner „Auguste“, einer Bekanntschaft aus der „Tanzstunde“. Auguste
Freudenberg (Abb. 14), deren Eltern in der Niederlausitz ein Landgut
in Pacht und in den Kriegsjahren große Not und die schwersten Zeiten
durchgemacht hatten und früh gestorben waren, wurde als vierjähriges
Kind von kinderlosen Verwandten, dem Akziseinnehmer Ephraim Böttger in
Dresden, an Kindes Statt angenommen und für ihre Erziehung auch höchst
gewissenhaft gesorgt. „Augustens anspruchsloses, ruhiges Wesen, das
sich doch überall resolut und heiter in praktischer Tat erwies“, war
so recht nach unseres Künstlers Sinn! Es ist wie ein Bild, von ihm
gezeichnet,[S. 34] wie er dieses Wiedersehen in seiner Biographie schildert.
Sein nächstes Bild in der Heimat war „Aus dem Lauterbrunner Tal“;
wohin das Bild gekommen, ist nicht bekannt. Der durch seine bedeutende
Galerie von Gemälden und Handzeichnungen bekannte Baron von Quandt in
Dresden, der damals viel Einfluß auf Kunst und Künstler hatte und sich
für Richter interessierte, ermutigte ihn zur Ausführung dieses Bildes,
um es zur Ausstellung nach Berlin zu schicken, wo man einen Lehrer für
das Landschaftsfach der Akademie suchte. Das Bild gefiel aber dort
nicht, und es kam zu keiner Berufung. Quandt bestellte bei ihm zwei
italienische Landschaften, nach Motiven von Arriccia und Civitella.

Abb. 37. Zeichnung zum
Landprediger
von Wakefield.
(Zu
Seite 47.)
An einem Sonntagmorgen in aller Frühe, am 4. November 1827, rollte
durch die noch ganz dunklen, stillen und engen Gassen Dresdens ein
Wagen und hielt vor der erleuchteten evangelischen Kreuzkirche;
Gemeindegesang und das Orgelspiel verhallten, der Frühgottesdienst war
zu Ende. Ein junger Mann mit seiner Braut entstiegen dem Wagen; es war
unser Richter, der, „nachdem er sieben Jahre um seine Rahel gedient und
geseufzt“, mit seinem Gustchen zum Altar trat; „wir gaben uns die Hände
in Gottes Namen und empfingen den Segen der Kirche.“ „Die angetraute
Gefährtin,“ schreibt er in der Biographie, „ward mir ein Segen und das
treueste Glück meines Lebens während der 27 Jahre, welche Gott sie mir
geschenkt.“
So war denn ein, wenn auch sehr bescheidener Hausstand gegründet. Von
einer Hochzeitsreise war selbstverständlich nicht die Rede.

Abb. 38. Zum
Landprediger von
Wakefield.
(Zu
Seite 47.)
Innerhalb der nächsten Monate vollendete er das für Quandt bestimmte
Bild „Abend und Heimkehr der Landleute nach Civitella“. Das Mädchen,
welches sich nach dem Beschauer wendet, trägt die Züge seines
„Gustchen“. Eine[S. 35] freie Wiederholung dieser Komposition aus späterer
Zeit ist Abb. 180, unter welche Dantes Vers geschrieben ist:
„Der Tag ging unter, und des Äthers Bräune
Rief die Geschöpfe, die da sind auf Erden,
Von ihrer Mühsal. — —“

Abb. 39.
Teil des Figurenfrieses vom
Vorhang des alten Dresdener Hoftheaters. 1843.
Nach der Farbenskizze. (Zu
Seite 49.)

Abb. 40.
Teil des Figurenfrieses vom
Vorhang des alten Dresdener Hoftheaters. 1843.
Nach der Farbenskizze. (Zu
Seite 49.)
Es ist eine Eigenart Richters, daß er die menschlichen Figuren in
seinen Bildern weit über den Rahmen der „Staffage“ hinaus behandelt
und darstellt, eine Eigenart, die sich gleich bei den ersten Bildern
(Abb. 10 und 13) auffällig macht. In den „Biographischen Aufsätzen“ von
Otto Jahn finden wir in den ausgezeichnet geschriebenen „Mitteilungen
über Ludwig Richter“ diese Eigentümlichkeit unseres Meisters sehr
interessant beleuchtet und entnehmen denselben folgendes: „Man würde
irren, wollte man das Charakteristische der Richterschen Landschaft
darin sehen, daß die Staffage mit mehr Vorliebe und Sorgfalt oder
mit mehr Geschick behandelt sei, als es gewöhnlich der Fall ist.
Man kann bei Richter gar nicht mehr von Staffage sprechen, insofern
diese eine an sich unwesentliche Zugabe, ein willkommener, aber auch
wohl entbehrlicher Schmuck der Landschaft ist. Er benutzt nicht
menschliche Figuren und Gruppen, um Lücken der landschaftlichen
Komposition auszufüllen, um Abwechselung hineinzubringen, oder den
Vorgrund[S. 36] zu beleben, nein — der Mensch in jenen einfachen natürlichen
Verhältnissen, welche in Wahrheit der eigentlichste und höchste
Vorwurf aller Kunst sind, ist der selbständige Gegenstand seiner
Darstellungen.“ Auch Schinkel äußert sich bei Betrachtung dieses Bildes
in den dreißiger Jahren in ähnlicher Weise: „Es wäre ein Irrtum,
wollte man meinen, das Landschaftliche sei von Richter zurückgedrängt
und etwa zum Rahmen oder auch zum Hintergrunde für die Darstellung
menschlicher Empfindung oder Tätigkeit herabgesetzt. Im Gegenteil, die
Landschaft erscheint in ihrer vollen Selbständigkeit, als ein Ganzes in
Auffassung und Ausführung und nicht bloß äußerlich als Grundlage und
Umgebung des menschlichen Tuns und Treibens“ usw. Er sagt zum Schluß:
„Für einen solchen wahren Künstler existieren schulmäßige Gegensätze
nicht, wie die von Genre und Landschaft; aus sich heraus schafft er
Werke, aus denen die Theorie lernen mag, daß die echte Kunst frei und
unerschöpflich ist, wie die Natur, deren Grundgesetze auch die ihrigen
sind.“
In den folgenden Ölbildern, die des Meisters Staffelei verlassen,
hält er unentwegt fest an dieser Steigerung des Figürlichen: er
hebt dasselbe sogar in einigen Bildern noch mehr hervor, wie in der
„Überfahrt am Schreckenstein“ (Abb. 26) und in dem „Brautzug im
Frühling“ (Abb. 58). Ein einziges Bild kenne ich von ihm, in welchem er
sich im Figürlichen nur auf eine untergeordnete Staffage beschränkt;
es ist die „Apenninenaussicht“, ein Blick auf das Volskergebirge vom
Stadttor von Palestrina.
Aus dem Jahre 1827 ist das Porträt Richters, von seinem Freund Karl
Peschel gezeichnet (Abb. 15).

Abb. 41.
Helene. Gezeichnet 1842.
(Zu
Seite 51.)

Abb. 42.
Abendandacht. Ölbild. 1842.
Museum zu Leipzig. (Zu
Seite 51.)
Die Aussichten wurden jetzt für Richter recht trübe. Freund Arnold,
welcher ihm einen Jahresgehalt von 800 Talern auf mehrere Jahre in
Aussicht gestellt hatte, zog, infolge von Geschäftsverlusten entmutigt,
sein Anerbieten zurück, und Richter mußte nun wieder in der Hauptsache
„An- und Aussichten“ radieren.
1828 wurde ihm eine erledigte Lehrerstelle an der neben der berühmten
königlichen Porzellanmanufaktur in Meißen bestehenden Zeichenschule,
eine Filiale der Dresdener Kunstakademie, mit 200 Talern Gehalt
angetragen; er nahm diese Stellung an, und nach vierzehn Tagen
siedelte er nach Meißen über. Die malerisch am Ufer der Elbe gelegene
altertümliche Stadt, überragt von der herrlichen Albrechtsburg und
dem Dom, zog ihn sehr an; hatte er sich doch in Rom im stillen immer
gewünscht, in solch einer Stadt schaffen und arbeiten zu können, hatte
er doch noch ganz besonders auch an Meißen dabei gedacht. Freilich
sah das in Wirklichkeit etwas anders aus, und zu rechter Freudigkeit
kam er dort nicht. Er schildert selbst zwar das Leben in dem an der
hohen Schloßbrücke gelegenen alten Hause, dem „Burglehen“, mit sieben
Stockwerken, von denen fünf unter dem Niveau der Schloßbrücke lagen,
die behagliche im obersten Stockwerk befindliche originelle Wohnung,
mit dem herrlichen Blick auf das altehrwürdige Schloß und die weite,
weite Fern- und Umsicht; er schildert das Leben im Hause mit der
jungen Frau [S. 38]und später mit den Kindern (am Tage Mariä Himmelfahrt
1828 war sein erstes Kind Maria geboren), wie er am Abend, den Kindern
zeichnend Geschichten und Märchen erzählte, oder zur Gitarre am blauen
Bande sang, wie das in damaliger Zeit allgemein beliebt war und welche
besonderen Freuden- und Festtage es waren, wenn die Freunde aus Dresden
ihn besuchten. Hier im Hause fanden die jungen Eheleute freundlichen
Verkehr mit einer Predigerswitwe und deren zwei liebenswürdigen schönen
Töchtern; Richter erinnert sich dieser später, als er die Blätter zum
Landprediger von Wakefield zeichnete (Abb. 35). Der Kunstforscher J.
D. Passavant suchte ihn in Meißen auf, auch Freund Maydell auf seiner
Rückreise nach Rußland, ebenso Richard Rothe auf der Reise von Rom nach
Wittenberg, wohin er als Lehrer am theologischen Seminar berufen war.
Richter schreibt über den Besuch des letzteren: „Mir war es eine innige
Freude, den teuren römischen Freund wiederzusehen; denn für mich waren
diese ‚Römer‘ alle mit einer Lichtatmosphäre umgeben, im Gefühl der so
glücklich mit ihnen in Rom verlebten Tage.“ An einer anderen Stelle
der Biographie schreibt er: „Welches Glück und welchen Segen gewährt
eine Verbindung mit so herzlichen Freunden in der frischen Jugendzeit,
wenn sie gemeinsam nach den idealsten Zielen streben; in einer
Umgebung, welche die reichsten, bedeutendsten Anregungen bietet. Durch
nichts beengt, genügsam und deshalb um so sorgenfreier, durchleben
sie einige Jahre goldener Freiheit; die Erinnerung daran durchduftet
wie ein Blumengeruch das ganze Leben und trägt Poesie in die Prosa
oder Schwüle, welche spätere Jahre unvermeidlich mit sich bringen und
bringen müssen, wenn der Mensch sich tüchtig entwickeln soll.“

Abb. 43. Zu
Stumme Liebe. Musäus’
Volksmärchen. 1842.
Mit Genehmigung der Verlagshandlung Haendcke & Lehmkuhl in Hamburg. (Zu
Seite 51.)
Die Meißner Zeichenschule war wie die Porzellanmanufaktur in der
Albrechtsburg untergebracht, die Schule selbst mit guten, zum Teil
vorzüglichen alten Gemälden, unter anderem Bilder von Palma vecchio,
ausgestattet, welche nach Schließung der Schule in die Dresdener
Galerie, von der sie einst entlehnt waren, zurückgebracht wurden. Der
Meister wanderte nun täglich — er wohnte hoch oben über der Stadt
im Bereiche zweier Burgtore — über die mit hohen Zinnen bekrönte
Schloßbrücke mit herrlichem Blick auf das Meisatal, auf die tief
unten liegende Stadt, den Elbstrom und das weite Tal bis nach den
böhmischen Bergen hin, durch das innere Burgtor über den schönen
Dom- und Schloßplatz, aber, wie schön das auch war — er fühlte sich
wie verbannt und vereinsamt.[S. 39] Die mit ihm tätigen Lehrer, unter
ihnen der sehr geschätzte Glasmaler Scheinert, kamen in kein näheres
Verhältnis zu ihm; zudem war seine Gesundheit nicht die beste und
nicht die festeste, und so ist ihm die Zeit bis zum Dezember 1836,
wo die Zeichenschule aufgehoben wurde, eigentlich doch mehr eine
Leidenszeit gewesen. Von seinen ersten Schülern nennen wir Pulian, der
später in Düsseldorf lebte, und den früh in Rom verstorbenen Haach.
Aus dem Jahre 1828 ist die reizvolle Federzeichnung (Abb. 16), eine
komponierte Landschaft: Blick über hügeliges, mit jungem Kastanienwald
bestandenem Terrain nach aus der Ebene sich erhebenden Bergzügen (es
ist der Monte Gennaro mit den Vorbergen von Monticelli). Für einen
Kunstfreund Demiani in Leipzig führte er seine erste Aquarelle —
vielleicht schon 1828 — aus, einen Erntezug in der Campagna, eine
zweite Aquarelle kam in die Sammlung des Königs Friedrich August;
die Aquarellmalerei machte ihm große Freude. Hier in Meißen malte er
nun eine Reihe Ölbilder nach italienischen Motiven: 1829 die schon
genannte Apenninenaussicht nach dem Volskergebirge und weiter Rocca di
Mezzo; 1830 eine Gegend am Monte Serone während eines Gewitters, jetzt
im Städelschen Institut in Frankfurt am Main, eine Ansicht von Bajä,
Blick auf Ischia und Capri, und einen Brunnen bei Arriccia an der alten
Via Appia; letztere 1831 noch einmal, mit anderen Figuren belebt, in
Aquarell (Abb. 17); sodann einen Brunnen bei Grotta Ferrata, 1834 ein
Motiv vom Lago d’Averno bei Neapel. Von den meisten seiner Bilder, die
er an den sächsischen Kunstverein verkaufte, aber auch von Bildern von
E. Oehme, Lindau in Rom, Genremaler Hantzsch, Most und Mende, radierte
er treffliche Blätter für die Kunstvereinschronik.

Abb. 44. Zu
Rübezahl. Musäus’
Volksmärchen. 1842. (Zu
Seite 51.)
Die Gedächtnisfeier des dreihundertjährigen Todestages Albrecht Dürers
wurde von den Künstlern in allen deutschen Gauen mit hoher Begeisterung
begangen. Bei Gelegenheit der Feier in Dresden wurde, angeregt durch
Freund Peschel, der Sächsische Kunstverein gegründet, welcher in der
Folge unserem Richter eine große Stütze wurde, den Künstlern vielen
Segen brachte und noch heute in Dresden in Blüte steht. Wenn ich nicht
irre, war der sächsische einer der ersten, wenn nicht überhaupt der
erste Kunstverein in Deutschland, Goethe zählte zu seinen Mitgliedern.
Am Abend dieses Tages, an welchem unser junger Meister einsam,
dienstlich verhindert,[S. 40] in Meißen sitzt, — sein Gustchen war noch in
Dresden zurückgeblieben, weil die gemietete Wohnung noch nicht frei
war, — und an die in Dresden festlich versammelten Genossen denkt,
bringt ihm der Postbote eine Sendung von Arnolds Kunsthandlung in
Dresden: „Dürers Leben der Maria.“ Mit welch wonnigem Gefühl betrachtet
er die herrlichen Blätter, die er bei Philipp Veit in Rom kennen
gelernt! Für 22 Taler waren sie sein eigen geworden! Welche hohe Summe
für seine Verhältnisse! Aber wieviel Zinsen hat sie ihm auch gebracht!
— 1830 radierte er eine Folge von sechs Blättern „Malerische Ansichten
aus den Umgebungen von Salzburg“ für C. Börner in Leipzig, der in
Rom als Maler mit ihm zusammen war, die ausübende Kunst aber aufgab,
einen Kunsthandel und Kunstverlag gründete und bis an sein Lebensende
mit Richter in regem Verkehr blieb; 1832 erscheint eine zweite Folge:
„Malerische Ansichten aus den Umgebungen von Rom“ in demselben Verlag.
Wir bringen von jeder Folge ein Blatt (Abb. 18 und 19).

Abb. 45. Zu
Stumme Liebe. Musäus’
Volksmärchen. 1842. (Zu
Seite 51.)
1831 zeichnete Freund Adolf Zimmermann unseres jungen Meisters Bild bei
Gelegenheit eines Besuches in Meißen (Abb. 20). 1832 erschien das Buch
„Biblische Historien“ von Franz Zahn. Richter war aufgefordert worden,
im Verein mit C. Peschel und Berthold Illustrationen für Lithographie
zu diesem Buche zu zeichnen; er übernahm davon dreizehn Blatt,
davon ist eins „Die Vertreibung aus dem Paradies“ (Abb. 21). Diese
Zeichnungen waren der Anfang seiner Tätigkeit als Illustrator; ein
kleiner Anfang und — bis ans Ende seiner gesamten Tätigkeit hat man
3336 Blätter gezählt, welche er für Vervielfältigungen jeglicher Art
gezeichnet hat; nicht eingeschlossen ist die lange, stattliche Reihe
von Handzeichnungen. Welch eine reiche Tätigkeit! Noch ahnte Richter
aber nicht, wo bei ihm der Schwerpunkt seiner hohen künstlerischen
Veranlagung lag. Im folgenden Jahre malte er den „Erntezug in der
römischen Campagna“, jetzt im Museum zu Leipzig (Abb. 22), 1834 eine
„Abendandacht vor einem Madonnenbilde, Gegend am Monte Serone.“ Für
die Arnoldsche Buchhandlung radierte er „Die Sächsische Schweiz“, eine
Anzahl größerer und kleinerer Darstellungen. Wir geben 2 davon in
Abb. 23 und 24. Nun wurde er auch beauftragt, zum historischen Bildersaal
der sächsischen Geschichte von A. Textor Zeichnungen für Lithographie
zu liefern, bis zum Jahre 1836 dreiundzwanzig Zeichnungen. Er wagt
sich an die rein figürlichen Darstellungen, fürchtet sich aber vor der
abfälligen Kritik der Fachmänner, der Figurenmaler.
Inzwischen hatte er auch versucht, weil die Erinnerungen an die
italienische landschaftliche Natur mehr und mehr an Intensivität
verloren haben mochten, Bilder kleineren[S. 41] Formates nach Motiven aus
Meißen und Umgebung zu malen, unter anderem eine Ansicht des imposanten
Meißner Schlosses, einen herbstlichen Wald mit Staffage und 1835 eine
Sommerlandschaft aus dem Triebischtal. Er ist aber immer noch im Bann
der italienischen Landschaft.

Abb. 46. Zu
Melechsala. Musäus’
Volksmärchen. 1842. (Zu
Seite 51.)
Jetzt kam eine schwere Zeit für Richter. Das 1834 gemalte Ölbild vom
Lago d’Averno verkaufte er nicht, ebensowenig das unter Krankheit
vollendete „Rocca di Mezzo“. Bis jetzt waren die Einnahmen noch
auskömmlich gewesen, nun wurde seine Lage sehr ernst. Durch den
Geschichtsmaler Karl Bähr, später Lehrer an der Kunstakademie in
Dresden, wurde ihm der Auftrag, für einen Kunstfreund in Reval eine
italienische Landschaft zu malen. Nach einigen Monaten war das Bild,
ein Motiv von Aqua Acetosa, dem Sauerbrunnen am Tiber bei Rom, fertig.
Bähr beabsichtigte mit dem Architekten Herrmann nach Rom zu reisen
und hätte unseren Richter gern mitgenommen, deshalb hatte er die
Bestellung auch ausgewirkt. Richter konnte an eine so weite Reise
nicht denken, hoffte aber, Freund Bähr bis nach Oberitalien begleiten
zu können, um am Gardasee, dem Eingang zum „gelobten Lande“, Studien
zu machen. Für die italienischen Seen und deren Seitentäler hatte er
immer eine besondere Schwärmerei. 1867 schreibt er nach Rom an dort
weilende Schüler: „Ich denke im Herbst dieses Jahres einen Anlauf auf
den Gardasee zu nehmen. Ich bin immer der Meinung, es müsse dort etwas
Erkleckliches für den Landschafter abfallen können; auch scheint mir
das Italien, wie man es an jenen Seen findet, dem Ideal zu entsprechen,
das man im allgemeinen in Deutschland von dem schönen Lande hat.“ Da
erkrankte seine Frau schwer und ernst an einer Abszeßbildung, die große
Schmerzen verursachte und lebensgefährlich war. Ernst Rietschels, des
Bildhauers, erste Frau war demselben Leiden kurz vorher erlegen. Die
Kranke wurde schwächer und schwächer, bis nach langen, bangen Wochen
endlich eine Wendung eintrat und die Gefahr vorüber war. Inzwischen
waren die Reisegefährten längst nach Italien abgereist und Richters
Reisekasse durch die Krankheit arg zusammengeschmolzen. Auf Zureden
seiner genesenen Frau unternahm er eine zwölftägige Reise durch das
Elbtal nach Böhmen. Jedem, der[S. 42] aus Sachsen bei Tetschen in das
Böhmerland eintritt, wird der mit einemmal ganz veränderte, weitaus
mehr südliche Charakter der Landschaft überraschen. Das hat auch unser
wandernder Maler erfahren. Die Augen gingen ihm plötzlich auf über die
Schönheit dieser deutschen Landschaft. An der Elbe zwischen Aussig und
Lobositz sammelte er nach Möglichkeit Skizzen. Am Schreckenstein, der
Lurlei der Elbe, einem steil in die Elbe abfallenden Klinksteinfelsen
von ziemlicher Höhe, bekrönt durch malerische, ausgedehnte Ruinen der
von den Hussiten 1426 zerstörten Burg, fand er besonders reiche und
schöne Motive. Und nun war unser Meister von seiner fast krankhaften
Sehnsucht nach Italien geheilt.
„Aug’, mein Aug’ was sinkst du nieder?
Goldne Träume, kehrt ihr wieder?
Weg, du Traum, so Gold du bist;
Hier auch Lieb’ und Leben ist!“

Abb. 47.
Harmlose Freude. Aus
Nieritz’ Volkskalender. 1855.
Verlag von Georg Wigand in Leipzig. (Zu
Seite 54.)
Mit Begeisterung ging er an die Ausführung neuer Bilder nach
böhmischen Motiven. Gleich das erste Bild, „Aufsteigendes Gewitter am
Schreckenstein“, fiel auf der Ausstellung auf und wurde vom Kunstverein
angekauft; jetzt ist es durch Schenkung des Herrn E. Cichorius im
Museum zu Leipzig. Wir geben eine Abbildung nach einer gleichzeitigen
Aquarelle (Abb. 25). Seine „Überfahrt am Schreckenstein“ machte
1837 besonderes Aufsehen. Herr von Quandt erwarb das Bild für seine
Galerie; jetzt ist es im Museum zu Dresden (Abb. 26). Über den ruhig
dahingleitenden, den Abendhimmel widerspiegelnden Fluß fährt ein mit
allerhand Menschen besetzter Kahn; ein Greis singt zur Harfe; zu
seinen Füßen lehnt über den Bord des Kahns ein Knabe, einen Zweig ins
Wasser tauchend; zwei Wanderer folgen, der eine sitzt mit gesenktem
Kopf, in Nachdenken versunken; der andere steht auf den Stab gestützt,
das Ränzel auf dem Rücken, ein Zweiglein an der Mütze und schaut
zur einsamen Ruine hinauf, er trägt die Züge des jüngsten Bruders
Richters: Julius; inmitten des Nachens ein Liebespaar; das still vor
sich hinschauende, dem Gespräche ihres Schatzes lauschende Mädchen mit
dem Sträußchen in der Hand ist eine echte Richtersche Mädchengestalt,
sinnig und — selbstverständlich blond. Ein Mädchen mit dem Rechen,
neben ihr ein Korb mit frisch gemähtem Grase und der alte Fährmann mit
seinem verwetterten Gesicht, das Pfeifchen im Munde, mit seinem Ruder
den Kahn langsam leitend, bilden den Schluß, und so schwimmt die liebe
Gesellschaft dem jenseitigen Ufer zu. Bewaldete Höhen und weit draußen
Berge im Abendsonnenschein, am gelben Abendhimmel schwimmende, in Rosa[S. 43]
getauchte, zarte, langgezogene Wölkchen, oben im Blau des Himmels die
Mondsichel. Es klingen beim Betrachten dieses Bildes traute Volkslieder
in der Seele des Beschauers an; wie leise Musik tönt es, und es bannt
uns in den Zauberkreis echter deutscher Romantik.

Abb. 48.
Wir gratulieren. Aus
Nieritz’ Volkskalender. 1855. (Zu
Seite 54.)
Abb. 27 ist die Wiedergabe einer größeren Zeichnung zu den Figuren,
die jetzt im Kabinett der Handzeichnungen im Museum zu Dresden sich
befindet. Riesenschritte hat der Meister im Figürlichen vorwärts getan,
und was von der allergrößten Bedeutung ist, der deutschen Natur ist er
zurückgewonnen, die Schönheiten der deutschen Natur sind ihm wieder zum
klaren Bewußtsein gekommen! Von nun ab hat er nur noch Sinn und Augen
für sein deutsches Vaterland und für sein Volk!
[S. 44]
Am 12. März 1835 zeichnete er sein zweites Töchterchen Aimée, wie es
vergnüglich in der Badewanne sitzt (Abb. 28).

Abb. 49. Zu
Jeremias Gotthelfs
Besenbinder. Aus Nieritz’ Volkskalender. 1852. (Zu
Seite 54.)
Am 24. Dezember 1835 wurde die Meißner Zeichenschule aufgehoben,
und im Frühjahr 1836 zog Richter, der nun ein Wartegeld erhielt,
wieder nach Dresden. Hier war er nun wenigstens mit den Freunden und
Gesinnungsgenossen wieder vereinigt. Die Kunstakademie wurde endlich
unter Minister von Lindenau reorganisiert, Zopf und Manierismus mußten
die Lehrsäle verlassen, die neu erwachte deutsche Kunst zog siegreich
ein. Das Landschaftsfach wurde noch ganz in Zinggscher Weise geleitet,
auch Richters Vater lehrte hier noch. Letzterer wurde nun plötzlich
seiner Stellung enthoben und in den Ruhestand versetzt; der Sohn aber
sollte im Erzgebirge als Zeichenlehrer an einer neu zu errichtenden
Gewerbeschule angestellt werden; er war, wie man sich leicht denken
kann, über diese neue „Verbannung“ höchst unglücklich. Auf seine
Vorstellung hin beim Minister von Carlowitz wurde die Anstellung an der
Gewerbeschule zurückgezogen, und er rückte nun an die Stelle seines
Vaters als Lehrer an der Akademie in Dresden ein. Man kann sich denken,
wie peinlich für ihn wieder diese neue Lage seinem Vater gegenüber
war. Aber es half ihm nichts, daß er an Quandt sich wendete und ihm
seine Lage schilderte; er erfuhr von diesem nur, daß sich an der Sache
nichts ändern lasse; wenn er nicht annehmen wolle, müßte ein anderer
gesucht werden, sein Vater wäre und bliebe entlassen. Richter mußte
sich nun schweren Herzens fügen. So trat er denn sein Amt an, dem er
über vier Dezennien mit großer Gewissenhaftigkeit und Hingebung für
seine Schüler vorstand. Eine stattliche Reihe von Schülern ist aus
dieser Lehrtätigkeit hervorgegangen. Der weitaus bedeutendste war
unstreitig einer seiner ersten Schüler in Dresden, Heinrich Dreber gen.
Franz, an dessen köstlichen Federzeichnungen[S. 45] aus dieser Zeit er bis
an sein Lebensende sich erfreute. Weiter müssen wir noch den höchst
talentvollen Ernst Hasse nennen, dessen geistreiche Tierzeichnungen
ungemein geschätzt und gesucht waren und weit verbreitet sind.

Abb. 50.
Zu Lauterbach hab’ i mein’
Strumpf verloren.
Aus „Alte und neue Volkslieder“. 1846.
Mit Genehmigung der Verlagshandlung von Alphons Dürr in Leipzig. (Zu
Seite 54.)

Abb. 51.
Liebespaar. Gezeichnet zu
„Alte und neue Volkslieder“. 1846.
Aus „Aus der Jugendzeit“. Verlag von Alphons Dürr in Leipzig. (Zu
Seite 54.)
Im Auftrage des Baron von Schweizer malte Richter 1840 ein Bild nach
Motiven aus dem Wallfahrtsort Mariaschein bei Teplitz. Unter alten
schattigen Linden am Brunnen haben sich Pilger gelagert; draußen
sieht man sonnige Kornfelder. Wir geben hier eine Abbildung nach
einer Zeichnung zu den Figuren (Abb. 29). Im folgenden Jahre malte er
das Bild „Einsamer Bergsee im Riesengebirge“, ein Motiv vom „kleinen
Teich“. Hieran schließen sich: „Kirche auf dem Friedhof in Graupen“, am
Fuße des Erzgebirges, dann ein italienischer Nachzügler, „Brunnen bei
Arriccia“ für Quandt,[S. 46] 1839 „Genoveva in der Waldeinsamkeit“ für den
Sächsischen Kunstverein und 1845 „Dorfmusikanten“ für G. Wigand.
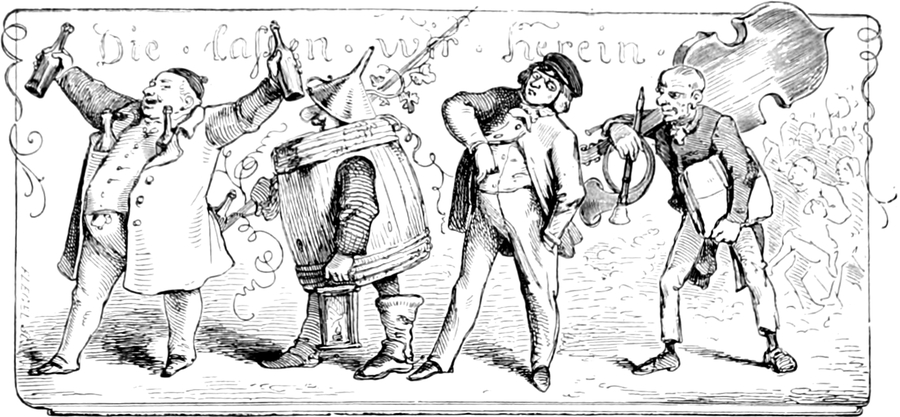
Abb. 52.
Nur fröhliche Leute. Aus
„Alte und neue Studentenlieder“. 1844.
Aus „Aus der Jugendzeit“. (Zu
Seite 54.)

Abb. 53.
Gestern, Brüder, könnt ihr’s
glauben.
Aus „Alte und neue Studentenlieder“. 1844. Aus „Aus der Jugendzeit“.
(Zu
Seite 55.)
Durch eine sonderbare Fügung — es bestanden zwischen den Buchhändlern
Arnold in Dresden und G. Wigand in Leipzig Differenzen wegen Nachdrucks
— wurde Richter mit dem letzteren bekannt. Dieser unternehmungslustige
Verleger beschäftigte Richter sogleich und gab ihm den Auftrag,
zunächst Zeichnungen zum „Malerischen und romantischen Deutschland“
zu liefern. Zuerst mußten die noch fehlenden Blätter zur Sächsischen
Schweiz beschafft werden. Diese Zeichnungen wurden in Stahl gestochen.
Hieran anschließend lieferte Richter dann die trefflichen Zeichnungen
zum Harz 1838, Franken 1840 und zum Riesengebirge 1841. Diese Arbeiten
waren der Übergang zu der reichen Tätigkeit für den Holzschnitt, die er
im Auftrage Wigands entfalten konnte. 1838 bis 1849, in dreiundzwanzig
Bänden, mit einhundertfünfundvierzig Zeichnungen, erschienen auch bei
Otto Wigand, dem Bruder Georg Wigands, die deutschen Volksbücher,
herausgegeben von H. O. Marbach, Geschichte der Griseldis, der edlen
und schönen Melusina, der schönen Magelone, vom Kaiser Oktavian,
von den sieben Schwaben, der Genoveva, von den vier Haymonskindern,
vom gehörnten Siegfried usw. Von letzterem geben wir die Abb. 30
und 32 dazu, um zu zeigen, auf welch niederer Stufe die Technik des
Holzschneidens damals stand, den Holzschnitt von[S. 47] Ritschl (Abb. 31).
1839 radierte er zehn Ansichten merkwürdiger Gegenden in Sachsen für
Arnold; ein Blatt davon, die Lutherlinde im Ringetal, fügen wir bei
(Abb. 33). Auch diese Blätter waren zum Kolorieren bestimmt, deshalb
sind auch hier die Lüfte leer gelassen.
1840 erscheint die „Geschichte des deutschen Volkes“ von Eduard Duller
bei Georg Wigand. Richter zeichnete dazu vierundvierzig Blätter für
Holzschnitt. Wir geben eine Abbildung nach einer köstlichen Zeichnung:
„Luther auf der Wartburg“ (Abb. 34). Der große Reformator sitzt am
Tische in einer Fensternische; die Hände faltend, schaut er nach oben;
er beginnt sein Tagewerk, fleht um Segen und Erleuchtung zu seiner
großen Arbeit, der Übersetzung der Bibel. Ein Strauß Blumen steht
auf dem Tische. Durch das Butzenscheibenfenster scheint die helle
Morgensonne. Ein Fensterflügel ist geöffnet, man atmet die frische,
reine Morgenluft, die von den Bergen des Thüringer Waldes herüberweht,
und ahnt den erquickenden Blick auf die herrlichen Waldungen, welche
die stille Wartburg umgeben.
Dazwischen (1841) zeichnet unser Meister dreiundsechzig Zeichnungen
zur deutschen Ausgabe des „Landpredigers von Wakefield“ von Oliver
Goldsmith, im Auftrage von Georg Wigand. Wir geben davon drei
Zeichnungen, Abb. 35, 36 und 37, das letztere Blatt dazu von Nicholls
in Holz geschnitten (Abb. 38), um die Schnittart der englischen Schule
zu zeigen. Es ist hier wohl der Ort, auch der Holzschneidekunst in
ihren Beziehungen zu unserem Meister zu gedenken. Die Technik der
Holzschneidekunst war in Deutschland verloren gegangen; wie sich diese
nun in Leipzig und später in Dresden wieder anbahnt und entwickelt, das
erfahren wir aus den in Hoffs Katalog zum Abdruck gebrachten Berichten
von Ritschl, Georgy und Riewel, die wir hier im Auszug mitteilen.

Abb. 54.
Es fiel ein Reif in der
Frühlingsnacht.
Aus „Alte und neue Volkslieder“. 1846.
Aus „Dichtung und Sage“. Verlag von Alphons Dürr in Leipzig. (Zu
Seite 55.)

Abb. 55.
So hab’ ich nun die Stadt
verlassen.
Aus „Alte und neue Volkslieder“. 1846.
Aus „Deutsche Art und Sitte“. Verlag von Alphons Dürr in Leipzig.
(Zu
Seite 55.)
Jacob Ritschl von Hartenbach, geboren 1796 in Erfurt, hatte sich
als Autodidakt mit Holzschneiden beschäftigt und schreibt aus
Schneidemühl 22. Juli 1876: „Im allgemeinen kann ich mitteilen, daß
ich zur Ostermesse 1837 nach Leipzig berufen, nur kurze Zeit für B.
G. Teubner merkantile Gegenstände schnitt, von da ab bis 1840 einzig
und allein mit Richterschen Zeichnungen beschäftigt war, die mir
Otto und Georg Wigand lieferten. Sie begannen mit den Volksbüchern
von Marbach, in welche sich später Dullers ‚Deutsche Geschichte‘
einflocht. Es gingen damals die Zeichnungen auf dem Papier ein und
wurden von mir selbst auf die Holzplatten übertragen.“ Später zeichnete
Richter selbst auf den Holzstock auf, und Ritschl berichtet, die
erste dieser Platten sei die zu Dullers Geschichte „Hus im Gefängnis“
gewesen. Der Holzschneider Wilhelm Georgy, geboren 1819 in Magdeburg,
berichtet an derselben Stelle: „Einige Jahre lang war Ritschl der
einzige, dem Richtersche Zeichnungen zum Schnitt anvertraut wurden.
Er[S. 48] pauste dieselben auf ungrundierte Holzstöcke und schattierte mit
schwarzer Tusche mittels Pinsel ohne Andeutung von Strichlagen und
Kreuzschraffierungen; dieselben schnitt er gleich mit dem Stichel,
wie sie ihm bequem und stichelrecht zur Hand lagen, wobei er überall,
wo es nötig, seine primitiven Kreuzlagen anbrachte. So entstanden
jene in der Ausführungsweise sehr manierierten, der Richterschen
Zeichnungsweise mehr oder weniger unähnlichen Holzschnitte.“ (Siehe
Abb. 31.) Ludwig Richter erzählt in seiner Biographie, Georg Wigand
sei auf die in England von Thomas Berwick an sich entwickelte und
herangebildete Holzschneiderschule aufmerksam geworden und habe einige
tüchtige Holzschneider von London veranlaßt, nach Leipzig zu kommen.
Er nennt Nicholls Benworth, John Allanson, letzterer ein Schüler
von Berwick, die auch in der Folge Richtersche Zeichnungen in Holz
schnitten, und klagt sodann, daß ihm der Anblick der sonst sauber
gearbeiteten Holzschnitte den gelinden Angstschweiß auf die Stirne
getrieben, da den Engländern charakteristischer Ausdruck Nebensache
war. Sie setzten ihren Stolz in die höchste Eleganz der Strichlagen und
Tonwirkungen (siehe Abb. 38). Mit der Zeit bildet sich nun in Dresden
um den Meister eine Holzschneiderschule. In den die Biographie des
Meisters ergänzenden Nachträgen sagt der Sohn Heinrich Richter: „Ein
Hauptverdienst um die treue xylographische Wiedergabe vieler dieser
Bilder hat der Holzschneider August Gaber (geboren in Köppernig bei
Neiße 1823, gestorben in Berlin 1894). Anfänglich Schriftsetzer, hatte
er sich, aus Neigung auf eigene Faust zum Holzschneider herangebildet
und hatte in Dresden 1848 Gelegenheit, einige kleine Richtersche
Illustrationen für das letzte Heft der Volksbücher ‚Das Leben Jesu‘ zu
schneiden. Richter fand in diesen Blättern etwas besonders Frisches
und Treues in der Wiedergabe seiner Zeichnungen. Der Umstand, daß
Gaber als Autodidakt frei von irgend einer Schulmanier war, dazu sein
Talent, in Zeichnungen die Individualität des Künstlers herauszufühlen
und wiederzugeben, verliehen seinen Arbeiten den Reiz künstlerischer
Naivetät, und beides machte ihn in der Folge zu einem der tüchtigsten
Faksimileholzschneider. Viele seiner späteren Schnitte nach Richter,
Schnorr, Rethel, Führich gehören zu den hervorragendsten Leistungen der
neueren Holzschneidekunst.“ Von den Holzschnitten unseres Buches sind
No. 83, 84, 131,
139, 140, 154,
155 von Gabers Meisterhand geschnitten.
Aus Gabers Atelier sind viele tüchtige Holzschneider hervorgegangen.
1852 heiratete Gaber des Meisters zweite Tochter Aimée. Weiter schreibt
in Hoffs Katalog Edmund Riewel, geboren 1829 in Leipzig: „Ich habe in
den fünf Jahren (1850 bis 1855) meines xylographischen[S. 49] Wirkens in
Dresden eine Menge Richterscher Zeichnungen geschnitten. Die besten
Holzschneider, die damals mit mir in Dresden gearbeitet haben, waren
außer Gaber (der selbstverständlich obenan gehört, denn er war der
erste, der uns zeigte, wie Richtersche Zeichnungen geschnitten werden
müssen), Bäder, Geringswald (der leider bald starb), Hertel (ein ganz
vorzüglicher Holzschneider), Illner, Manger, W. Obermann, Reusche
und meine Wenigkeit. Ich darf sagen, das war eine Gesellschaft, wie
sie nicht früher und nicht später mehr zusammengekommen ist. Flegel
in Leipzig, der erste deutsche Holzschneider, der seinerzeit (in
den vierziger Jahren) Richtersche Zeichnungen noch am treuesten
wiedergegeben hat, und Professor H. Bürkner, der sich nicht als
Techniker, aber als Künstler um die deutsche Holzschneidekunst sehr
verdient gemacht hat. Gewöhnlich ging man mit der fertigen Arbeit zu
dem betreffenden Künstler und legte sie ihm vor, um seine Meinung zu
hören; war sie zu seiner Zufriedenheit gediehen, so lieferte man sie
an Gaber ab.“ — „Welchen Nutzen, im Interesse der guten Sache, diese
Methode hatte, und wie bildend sie war, ist einleuchtend.“

Abb. 56.
Studie zur Illustration zu
dem Volksliede „Wenn ich ein Vöglein wär’“. 1846. (Zu
Seite 55.)
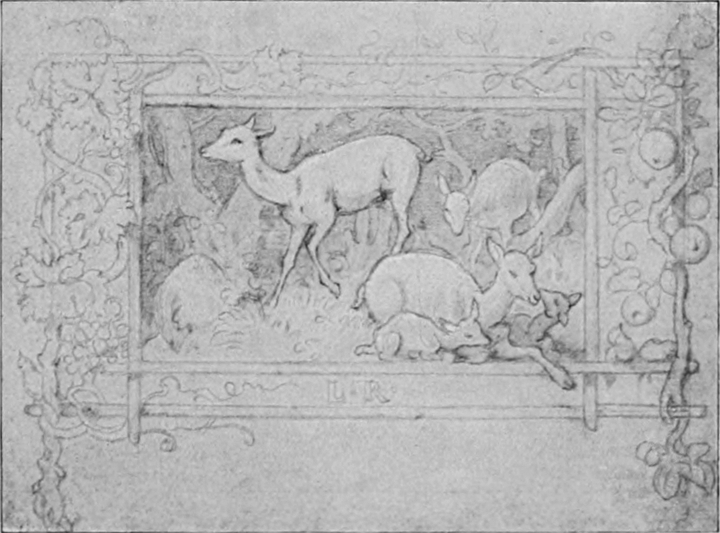
Abb. 57.
Ruhe im Walde. Zum
Vaterunser von Ammon. 1845. (Zu
Seite 55.)
Bei all diesem Schaffen solcher figürlicher Darstellungen wird Richter
das ängstliche, die Kritik fürchtende Herz leichter, als er bald über
seine Arbeiten Worte freundlichster Teilnahme und großer Anerkennung
hört. Noch während er an den Zeichnungen für den „Landprediger von
Wakefield“ arbeitet, fordert ihn Julius Hübner auf, die Hälfte des
unteren Figurenfrieses am Vorhang des von Semper erbauten (1869
abgebrannten) Hoftheaters zu malen. Es galt die bedeutsamsten Gestalten
der tragischen Dramendichtung in ornamentaler Verbindung darzustellen
(Abb. 39 und 40). Anfangs will er den Auftrag nicht übernehmen, weil
er Figuren in so großem Maßstab noch nicht versucht hatte, allein
Hübner ließ ihn nicht los, und so zeichnete er denn Hamlet, Lear,
[S. 51]Romeo und Julia, Justina, den wundertätigen Magus, den standhaften
Prinzen, letztere drei von Calderon, Götz, Faust, Egmont, Wallenstein,
die Jungfrau von Orleans und Tell. Das gemeinsame Arbeiten mit Hübner,
Oehme, von Oer und Metz bereitete ihm viel Freude.

Abb. 58.
Brautzug im Frühling.
Ölbild. 1847. Im Museum zu Dresden.
Nach einer Originalphotographie von F. & O. Brockmanns Nachf. (R. Tamm)
in Dresden. (Zu
Seite 36 und
55.)

Abb. 59.
Genoveva nach einer
Aquarelle von 1850.
Im Besitz des Herrn Cichorius in Dresden. (Zu
Seite 75.)
1842 zeichnet er das Köpfchen seiner dritten Tochter Helene (Abb. 41).
In demselben Jahre vollendet er das Bild „Abendandacht“, das von
Quandt für seine Galerie erwarb, jetzt im Museum zu Leipzig (Abb. 42).
Frauen und Kinder, vom Ährenlesen kommend, vor einem mit Gewinden von
Kornblumen und Feldmohn geschmückten Marienbilde unter alten Linden.
Aus der Höhlung eines alten Baumes schauen fröhliche Kindergesichter.
Rechts halb versteckt ein Mönch, der das in den Ästen der Linde
befestigte Glöckchen läutet, — es ist „Ave Maria“. Im schattigen
Vorgrund lagert eine reizende Gruppe von Kindern mit Schäfchen. Draußen
im letzten Abendschimmer sieht man ein Stückchen flachen Landes, von
einer schmalen blauen Ferne umsäumt. Das poesievolle Bild schildert
Eindrücke aus dem Ostragehege in der Friedrichstadt-Dresden, alten
schönen Lindenalleen, die sich durch Elbwiesen nach dem Schloß Uebigau
hinziehen und jetzt zum Teil neuen Hafenanlagen gewichen sind.

Abb. 60. Maria. Gezeichnet 1846.
Bei Georg Wigand erschienen im selben Jahre J. K. A. Musäus’
„Volksmärchen der Deutschen“, herausgegeben von Ludwig Klee. Hier
sollte Richter in Verbindung mit den beiden Düsseldorfer Figurenmalern
R. Jordan und A. Schrödter illustrieren. Da erfaßte ihn wieder große
Bangigkeit, ob sein „figurales Können“ auch ausreichen würde, neben
solchen Männern einigermaßen bestehen zu können. Der Erfolg hat
es gelehrt, daß er diesen Künstlern wohl gewachsen war. Die zwölf
Haupttitelblätter zu diesem Buche, lithographisch vervielfältigt,
sind erst 1845 erschienen; sie sind hochvollendet in Silberstift
ausgeführt und gehören mit zu den herrlichsten Zeichnungen, die
Richter geschaffen. Sie befinden sich im Städelschen Institut in
Frankfurt a. M. Wir geben eine spätere Wiederholung eines solchen
Blattes zu „Stumme Liebe“ (Abb. 43). Von den übrigen Illustrationen zu
Musäus’ Volksmärchen bringen wir drei Abbildungen nach Zeichnungen:
zu den „Legenden von Rübezahl“ (Abb. 44), zu „Stumme Liebe“ (Abb. 45)
und zu „Melechsala“ (Abb. 46). Richter zeichnete zu diesem Buche
hunderteinundfünfzig Blätter. In dieser Zeit kamen Alfred Rethel
und Richters alter Freund, der Kupferstecher Julius Thäter, nach
Dresden. Rethel zeichnete im Winter in Dresden Kartons für seine[S. 52]
großartigen Freskomalereien im Rathaussaale zu Aachen, die mit zu den
mächtigsten, gewaltigsten und epochemachendsten Werken deutscher Kunst
im neunzehnten Jahrhundert gehören. Rethel verkehrte viel im Hause
Richters, wo er sich besonders wohl fühlte, und noch, als sich bereits
die ersten Anzeichen der späteren geistigen Umnachtung bemerkbar
machten, die sich über diesen unglücklichen Künstler so viele Jahre bis
zu seiner endlichen Erlösung durch den Tod legte, suchte er das stille
Haus Richters gern und oft auf.

Abb. 61.
Studie zu Genoveva. (Zu
Seite 58.)
1836 erschien „Reinecke Fuchs“ bei Renger in Leipzig, jetzt Amelangs
Verlag, mit elf Lithographien nach Zeichnungen Richters, zehn Jahre
vor dem Erscheinen des von Kaulbach gezeichneten Reinecke. Wie
grundverschieden treten beide Künstler an diese Aufgabe heran! Unser
Meister hat es auch hier verstanden, in der ihm eigenen Weise ohne
Schärfe und Bissigkeit, aber mit großem Humor der Dichtung seine Bilder
abzugewinnen! Anschließend erschienen 1841 bei Volkmar in Leipzig zwölf
Holzschnitte zum Reinecke Fuchs, neun von den vorher lithographiert
erschienenen Blättern und drei nach neuen Zeichnungen.
Bis ungefähr zum Jahre 1840 sah es mit den Bilderbüchern für Kinder in
Deutschland sehr traurig aus; das Minderwertige, Handwerksmäßige, das
der Kinderwelt bis zu dieser Zeit geboten wurde, war geradezu kläglich.
Nun aber macht sich eine Bewegung bemerklich, die erkennen läßt, daß
man bestrebt ist, „den Kindern das Beste“ zu bieten. Und hier haben nun
eine Anzahl von Verlegern, vor allem die Wigands, im Verein mit unserem
Künstler mit sicherer und glücklichster Hand eingegriffen und wirklich
wie im Sprunge Versäumtes nachzuholen sich bemüht. Ihr Bestreben war
aber auch vom schönsten Erfolg gekrönt, die Bücher mit Bildern von
unserem Ludwig Richter wurden von alt und jung mit Jubel aufgenommen.

Abb. 62.
An der Krippe. Aus
„Illustrierte Jugendzeitung“. 1847.
Verlag von Otto Wigand in Leipzig. (Zu
Seite 59.)

Abb. 63.
Rübezahl. Radierung. 1848.
Verlag von Alphons Dürr in Leipzig. (Zu
Seite 58.)
Außer einer Anzahl von Blättern für Lithographie zu Erzählungen von
Karl Stöber folgen 1842 bis 1856 siebzig Zeichnungen für Radierungen
und Holzschnitt zu Nieritz’ Volkskalender.[S. 54] Die sehr vollendeten
Zeichnungen: „Harmlose Freude“ (Abb. 47) und „Wir gratulieren“ (Abb. 48),
radierte Hugo Bürkner. Zu Jeremias Gotthelfs Erzählung „Der
Besenbinder“ ist die Zeichnung Abb. 49. Unter diesen Blättern befinden
sich auch die ungemein humoristischen Weinproben vom Most, Rheinwein,
Burgunder, Steinwein bis herab zum Grüneberger. Hieran reiht sich noch
ein Ölbild nach einem Motiv aus Böhmen, „Hirten mit der Herde durchs
Wasser gehend“, im Besitz des Herrn Hoff in Frankfurt a. M.

Abb. 64.
Betendes Kind. Aus
„Illustrierte Jugendzeitung“. 1847. Keils Märchen. Verlag von Otto Wigand in
Leipzig. (Zu
Seite 59.)
1844–1846 erschienen bei Gustav Mayer in Leipzig „Alte und neue
Studenten- und Volkslieder“ mit hunderteinunddreißig Bildern. Die
ebenda erschienenen „Soldaten- und Jägerlieder“ hatte Pocci, vor dessen
Geschicklichkeit Richter großen Respekt hatte, illustriert. Franz Graf
Pocci, 1807 in München als Sohn des Grafen Pocci aus Viterbo und der
Freiin Xaveria von Posch aus Dresden geboren, war Dichter, Zeichner und
Musiker, später Hofmusikintendant in München. Die geschickte Art, wie
er in den obenerwähnten Soldaten- und Jägerliedern usw. die Buchseiten
mehr „dekorierte“, war für unseren jungen Meister sehr anregend und
fördernd. Diese Illustrationen sind ebenso wie die Neureuthers von
großem Einfluß auf ihn gewesen. Poccis Arbeiten, soweit sie hier in
Betracht kommen, zeugen trotz ihres dilettantischen Gepräges und
trotz des Mangels an Können doch von einem kindlich naiven Sinn. Der
Meister erwähnt selbst Pocci in der Biographie; er sieht dessen mit
Guido Görres herausgegebenen Festkalender, als er noch in Meißen
war, und sagt: „Pocci interessierte mich doch bei weitem am meisten
und wirkte höchst anregend auf mich.“ Wie hat es nun unser Richter
verstanden, in dem engen gegebenen Raum, der für ihn neben Noten und
Text übrig blieb, bei aller Freiheit hauszuhalten und in den kleinen
Illustrationen bei so schlichter Form den geheimnisvollen Zauber
unserer Volkslieder, ebenso wie die Frische und Fröhlichkeit und den
Humor unserer Studentenlieder wiederzugeben! Von den Volksliedern seien
genannt: „Zu Lauterbach hab’ i mein Strumpf verloren“, Abb. 50. Das
„Liebespaar“ mit dem lieblichen Mädchen, welches das Licht putzt (Abb. 51),
wurde erst 1875 in „Aus der Jugendzeit“ veröffentlicht. Eine so
innige Gruppe, wie das Liebespaar, das in sein stilles Glück versunken
in die Ferne hinausschaut, zu „Kein Feuer, keine Kohle kann brennen
so heiß, als heimliche Liebe, von der niemand nicht weiß“ kann nur
unser Richter zeichnen. Voller Humor sind „Nur fröhliche Leute lassen
wir herein“ (Abb. 52) und „Gestern, Brüder, könnt ihr’s glauben ...
gestern[S. 55] kam der Tod zu mir“ (Abb. 53). Wie ergreifend sind die Bilder:
„Es zogen drei Burschen wohl über den Rhein“ und „Es fiel ein Reif in
der Frühlingsnacht“ (Abb. 54), wie innig die Gruppe der beiden Kinder,
die „verdorben, gestorben“! Ferner das prächtige Bildchen: „So hab’ ich
nun die Stadt verlassen, wo ich gelebet lange Zeit“, — in Gedanken
versunken wandert der Bursch aus der Stadt, er denkt an die „eine“,
sie aber denkt auch an ihn, und wie lieblich und hold ist sie, die
oben, hinter dem Vorhang lauschend, dem Wandernden sinnend nachschaut
(Abb. 55). — Das liegende Mädchen, eine schön gezeichnete Studie (Abb. 56)
zu „Wenn ich ein Vöglein wär“ erregte Rethels größtes Interesse;
er betrachtete oft mit besonderem Wohlgefallen diese fein empfundene
naive Zeichnung. — Diese Volks- und Studentenliederbilder sind
1875–1878 in vier Bänden, mit Illustrationen zu Musäus’ Volksmärchen
durchsetzt, wieder im Buchhandel erschienen unter den Titeln: „Aus
der Jugendzeit“, „Deutsche Art und Sitte“, „Aus dem Volksleben“ und
„Aus Dichtung und Sage“. 1845 vollendete Richter ein Ölbild, einen
Mondscheinabend, für Bendemann in Berlin. Aus dem in demselben Jahre
erschienenen „Vaterunser“ von Ammon bringen wir die reizende Rehgruppe
„Ruhe im Walde“ (Abb. 57). Ein Ölbild, das ihn so recht kennzeichnet:
den „Brautzug im Frühling“ (Abb. 58) vollendet er 1847. Aus dem im
Frühlingsschmuck prangenden Walde tritt der festliche Hochzeitszug,
des Müllers Töchterlein mit ihrem Angetrauten, der stattliche Müller
mit der stillen Frau Müllerin und weiteres Gefolge, voran fröhliche
Kinder mit Blumengewinden. Im Mittelgrund eine liebliche Hirtengruppe,
ein Hirtenbübel schwenkt den Hut. Vom hohen Giebel der unterhalb
des Schlosses liegenden Mühle weht eine stattliche Fahne, im jungen
Tannenwald lauschen Rehe, draußen stille, blaue Fernen. Ein seltener
Liebreiz mutet uns beim Betrachten dieses hinsichtlich der Konzeption
schönsten Bildes Richters an, es macht Haydnsche, auch Mozartsche
Weisen in uns erklingen. Interessant ist ein Vergleich dieses Bildes
mit seinem hervorragendsten italienischen Bild „Tal von Amalfi“ (Abb. 13).
Die Anregung zu diesem Bilde wurde ihm bei der Erstaufführung von
Wagners Tannhäuser 1845. Auf der Ausstellung in Dresden erwarb es die
Lindenaustiftung und überwies es der dortigen Gemäldegalerie. Die neue
deutsche Kunst, die in Rom durch Cornelius, Overbeck, Schnorr und Veit
in der Mitte des zweiten Dezenniums des 19. Jahrhunderts einsetzte,
war eine Sezession radikalster Art; durch sie waren alle Traditionen
der Ölmaltechnik ebenso wie der Freskotechnik durchschnitten worden
und schließlich verloren gegangen. Es hat in Deutschland trotz allen
Ringens einer langen Reihe von Jahren bedurft, bis man dies erkannte
und der Technik in der Malerei wieder den ihr gebührenden Platz
einräumte, die Art des Studienganges änderte und nicht nur einseitig
vom Umriß und von der Zeichnung ausging, sondern auch die Farben zu
Wort kommen ließ, bei der Komposition auch mit Ton- und Farbenwerten
rechnete. Die Unzulänglichkeit des technischen Könnens[S. 56] im Ölmalen
empfand Richter oft genug. Er sprach sich in späteren Jahren oft dahin
aus, daß ihm ursprünglich ein ganz früher Frühlingstag vorgeschwebt
habe, er wollte den Wald in seinem ersten Lenzesschmuck, knospende
und blühende Bäume, die Eichen mit dem lichten zarten Grün der jungen
Blättchen, kurz, einen wonnigen ersten Frühlingstag in dem Bilde
schildern, aber die Kraft dazu habe ihm versagt, die Studien dazu
gefehlt. Auf der Weltausstellung in Paris 1855 wurde ihm für dieses
Bild die goldene Medaille zuerkannt; der Bildhauer E. Rietschel wurde
dort ebenso ausgezeichnet; die Künstlerschaft Dresdens brachte beiden
Männern daraufhin einen Fackelzug.

Abb. 65. Zu:
Das Kind an der Mutter Grab.
Aus „Illustrierte Zeitung für die Jugend“. 1849. (Zu
Seite 59.)

Abb. 66.
Zu Himmelsmütterlein. Aus
„Die schwarze Tante“. 1848.
Verlag von Georg Wigand in Leipzig. (Zu
Seite 60.)
1846 vollendet er ein Frühlingsbild „Mädchen am Brunnen“, das er 1849
variiert als Radierung wiederholte (Abb. 78). Er sprach oft den Wunsch
aus, dieses Bild einmal wiederzusehen; es schien, als erinnere er sich
dessen mit einer gewissen Befriedigung. Es folgen die „Hymnen für
Kinder“ von Thekla von Gumpert mit sechzehn Zeichnungen.
Vielleicht 1846 hat der Meister seine älteste Tochter Maria gezeichnet
(Abb. 60), die im April 1847 an einem unheilbaren Brustleiden im
blühenden Alter von achtzehn Jahren starb. Inmitten einer Zeit voll
reichen Schaffens durchweht tiefe Trauer sein Herz und das seiner
Frau; sie sehen, wie die geliebte Tochter nach und nach hinsiecht, der
Arzt weiß keine Rettung mehr und gibt alle Hoffnung auf. „Erschüttert
und tiefgebeugt knieen die Eltern am Bett und begleiten die erlöste
Seele unter Tränen mit ihren Gebeten in das Jenseits!“ Mit diesen
Worten schließt Richter seine Biographie ab; er konnte sich nicht
entschließen, dieselbe weiterzuführen, und fügt derselben dann nur noch
Tagebuchnotizen als Anhang bei.

Abb. 67.
Zu Himmelsmütterlein.
(Zu
Seite 60.)
1848 starb, siebzigjährig, Richters Vater; sein arbeitsreiches Leben
war zu Ende; viel Mühsale und unverdiente Kränkungen hatte er getragen;
sein Lebensabend gestaltete sich etwas freundlicher, tätig war er bis
zum Tage vor seiner letzten Erkrankung. Er hatte wohl nicht so recht
den Platz in seiner Kunst gefunden, für den er von Haus aus bestimmt
und geeignet war. Unser Meister sprach oft davon, wie schon in seinem
Vater unverkennbar die Neigungen durchblickten, die ihn, den Sohn,
auf seinen Weg brachten, und daß, wenn die äußeren Verhältnisse des
Vaters günstigere[S. 57] gewesen wären, dieser als Landschaftsmaler gewiß
Bedeutendes geleistet haben würde, mehr als in der Kupferstecherei,
zu der er entschieden weniger Veranlagung hatte. Schon in des Vaters
Zeichnungen war die Art der Staffage abweichend von der landläufigen
Manier; was von den wenigen Zeichnungen bekannt ist — seine meisten
Blätter sind, in der Hauptsache unter Zinggs Namen, nach Polen
gewandert — bestätigt dies. In demselben Jahre starb auch unseres
Meisters jüngster Bruder Julius in Warschau an der Cholera; er war dort
seit vielen Jahren als Aquarellmaler tätig gewesen. Der zweitälteste
Bruder Willibald, der während einer Reihe von Jahren die Gräfin Potocka
auf deren Reisen durch Europa als Zeichner und Aquarellmaler begleitet
hatte, lebte in Wien. Sein Zeichenunterricht war in den dortigen
Hofkreisen sehr geschätzt und gesucht; er starb kinderlos in Wien
1880. Die einzige Schwester Richters, Hildegard, die sehr tüchtig im
Blumenmalen war, starb als Witwe des Kunstgärtners Ludwig Liebig in
Dresden an ihrem 90. Geburtstage 1898.

Abb. 68.
Aus der Schmiede.
Schmiedjakobs Geschichten von Horn. 1852.
(Zu
Seite 61.)

Abb. 69.
Aus der Schmiede.
(Zu
Seite 61.)
1847 und 1848 entstanden die beiden Kompositionen „Genoveva“ und
„Rübezahl“, die Richter dann im Auftrage des Sächsischen Kunstvereins
so meisterhaft radierte. Frieden des Waldes atmet das Blatt „Genoveva“.
Vor der von lauschigem Wald umschlossenen Höhle sitzt im Sonnenschein
die sinnige liebliche Frauengestalt, in ihren Schoß gelehnt ihr zur
Seite Schmerzensreich, die Hirschkuh liebkosend; im Rasen wilde Tauben,
Spechte und allerhand andere Vögel, auch Häschen haben sich zutraulich
gelagert, Eichhörnchen tummeln sich; im Vorgrund, mit Erdbeeren
besäumt, ein frisches Wässerchen, das unter mit Farnen bewachsenen
Steinen hervorsprudelt; über der Höhle gegen dunklen Tannenwald
schreiten Hirsch und Hirschkuh. Es ist eine köstliche Waldidylle, wie
sie schöner nicht gezeichnet werden kann. Wir geben hier (Abb. 59) eine
Variante der lieblichen Figurengruppe mit einfacherem landschaftlichen
Hintergrund nach einer Aquarelle von 1850 in farbiger Reproduktion.
Die Genoveva ist auch hier[S. 58] innig und lieblich; wie seelenvoll ist
der Ausdruck des Kopfes der Dulderin! Auch in der Art wie der Meister
die Farben nur andeutend sprechen und wirken läßt und worin er so
unerreicht und einzig ist, mutet uns das Bild so außerordentlich
wohltuend an. Zu dem aufgelösten Haar der Genoveva zeichnete er
eine Studie nach seiner Tochter Aimée mit wenigen Bleistiftstrichen
(Abb. 61). Die andere Komposition „Der Rübezahl“ (Abb. 63) schildert
den bekannten Vorwurf: die Mutter ruft, um einen ihrer Schreier zum
Schweigen zu bringen, Rübezahl, er möge ihn mitnehmen, da — plötzlich
steht Rübezahl vor ihr und fordert das Kind. Wie die Küchlein bei
drohender Gefahr sich zur Henne flüchten und sich zu verbergen suchen,
so schmiegen sich die erschrockenen Kinder schutzsuchend an die ebenso
erschrockene Mutter, die die schützenden Arme um sie schließt und
betroffen, aber doch der Gefahr trotzend, den bärtigen „Rübezahl“
anstarrt; nur den kleinen an der Erde liegenden Schreihals kümmert
Rübezahl nicht, er schreit und strampelt fort; als Kuriosum sei hier
erwähnt, daß das am Boden liegende Kind zwei rechte Füße hat. Die über
den Figuren sich erhebende Gruppe von Bäumen ist von großer Schönheit.
Über sonnige Höhen schaut man auf in duftigem Blau liegende Bergzüge,
am schattigen Waldesrand lagert Rotwild. Das ist Bergespoesie! Die
Gestalt des Rübezahl, um die Hauptsache nicht zu vergessen, ist voller
Humor: halb drohend, aber mit dem Ausdruck eines gutmütigen Schalks,
einen entwurzelten Baum in der Linken haltend, die Rechte nach den
Kindern ausgestreckt, als Köhler gekleidet, steht er mit gespreizten
nackten Beinen vor der erschrockenen Mutter. Er gehört mit der ebenso
komischen Rübezahlgestalt von Schwind, die leider so wenig bekannt
ist, zu den weitaus besten Darstellungen dieser urwüchsigen Figur
aus dem Sagenkreise des Riesengebirges. Denselben Gegenstand hatte
Richter schon früher im „Musäus“ ähnlich behandelt. Er war gerade beim
Ätzen dieser beiden Kupferplatten, als Kanonendonner und Knattern
von Gewehrsalven die Luft erdröhnen machten; preußische Regimenter
halfen den 1849er Maiaufstand in Dresden, das infolge des Feldzugs in
Schleswig-Holstein von Militär fast entblößt war, niederzuwerfen; unser
Richter stand im unvermeidlichen Hauspelz an seinem Ätztisch in seine
Arbeit vertieft und kümmerte sich nicht um das, was in den Straßen der
Stadt sich abspielte. In Kupferstecher Thäters Biographie finden wir
von 1848 folgende Aufzeichnung: „Wer hätte wohl noch vor wenigen Wochen
sich träumen lassen, daß die beiden friedliebendsten Menschen, Richter
und ich, einem ‚Deutschen Verein‘ und einer ‚Akademischen Legion‘
beitreten und täglich zwei Stunden mit dem Schießprügel sich tummeln
würden? Wir hätten eher daran geglaubt, ins Gras, statt in Patronen
beißen zu müssen. Und doch konnte es nicht umgangen werden; wir müssen
eben mit fort, wie jeder andere auch.“ Von den Dienstleistungen der
„Akademischen Legion“, die in dieser wunderlichen Zeit[S. 59] gebildet
worden war und die nicht „zu martialisch“ in ihrer ganzen Erscheinung
gewesen sein soll, wurde er aber enthoben. Das Exerzieren war ihm
recht unbequem, wie man sich leicht denken kann. Kurz vor Ausbruch
des Maiaufstandes wurde des Meisters Sohn Heinrich, mit einem Freunde
auf einer Wanderung nach Meißen begriffen, in Dresden-Neustadt, weil
er eine, wenn auch verrostete Waffe unter dem Rock verborgen trug,
vom Militärposten abgefaßt und mit vielen anderen Sistierten in der
Frauenkirche gefangen gehalten. Unser Meister wurde aus seiner stillen
künstlerischen Tätigkeit herausgerissen, als er diese Nachricht
erhielt; mit größter Mühe und nur durch schwerwiegende Fürsprache
gelang es, die an sich so harmlosen Arrestanten erst nach zwei schweren
langen Tagen wieder frei zu machen. Für unseren Meister waren es Tage
großer Aufregung.
Für die Illustrierte Jugendzeitung Otto Wigands und die Illustrierte
Zeitung für die Jugend (Brockhaus) zeichnete Richter 1846 bis 1852
achtundachtzig Blätter; wir bringen davon die Abbildungen 62, 64
und 65, von denen besonders die beiden letzten Blätter durch ihr
überaus warmes Empfinden hervorragen. Weiter folgen eine Reihe von
Illustrationen zu verschiedenen Jugendschriften, 1847 bis 1853, auch
unter anderen bei Justus Naumann in Dresden „W. Redenbachers neueste
Volksbibliothek“, wozu Richter siebzehn Zeichnungen lieferte, die
lithographisch vervielfältigt wurden. Unter diesen Zeichnungen, die
hier als Vorlage für den Lithographen dienten, sind eine Reihe ganz
vorzüglicher Blätter, von größter Vollendung in der Zeichnung und
lebendigster Charakteristik. Es sei hier nur das eine Blatt genannt:
„Wie Parzival von seiner Mutter in der Wildnis Soltane erzogen wird“,
vom Jahre 1853. 1848 erscheint „Robinson der Jüngere“ bei Fr. Vieweg
in Braunschweig, mit achtundvierzig Holzschnitten. Wer von uns hätte
diesen Robinson in jungen Jahren nicht in der Hand gehabt und sich
daran begeistert!

Abb. 70.
Titelblatt zu Rheinische
Dorfgeschichten von Horn. 1854.
(Zu
Seite 61.)
Gleichzeitig erscheint die erste Ausgabe des „Richter-Album“ bei Georg
Wigand, hundertfünfzehn Blatt Holzschnitte, die in vorhergehenden
Werken bereits publiziert[S. 60] waren. Diese Ausgabe hat zur Verbreitung
Richterscher Kunst in den weitesten Kreisen und Schichten des deutschen
Volkes ungemein viel beigetragen. Es war eine glückliche Idee, diese
Bilder so zwanglos aneinanderzureihen und, mit kleinen Textstellen
versehen, noch zugänglicher für das allgemeine Verständnis zu machen.
Sehr bald folgt ein zweiter Band mit hundertachtundfünfzig Blatt.
Seitdem ist diese Sammlung wohl fünf- oder mehrmal aufgelegt worden.

Abb. 71.
Zu Der Geizhals und sein Nachbar.
Spinnstubengeschichten von Horn. 1855. (Zu
Seite 61.)

Abb. 72.
Zu Zwei geholzte Ohrfeigen.
Spinnstubengeschichten von Horn. 1856. (Zu
Seite 61.)

Abb. 73. Zu
Der Schleicher.
Spinnstubengeschichten von Horn. 1856. (Zu
Seite 61.)

Abb. 74. Zu
Jörjakob.
Spinnstubengeschichten von Horn. 1860. (Zu
Seite 62.)
Aus dem Buch „Die Schwarze Tante“, Märchen und Geschichten für Kinder
(von Frau Professor Fechner in Leipzig), mit vierundvierzig der
liebenswürdigsten Illustrationen, erschienen 1848 bei Georg Wigand,
sind zwei Bilder zum „Himmelsmütterlein“ besonders reizvoll. Die
sterbende Mutter nimmt Abschied von ihrem Töchterchen und ermahnt
es, brav zu bleiben (Abb. 66), und weiter der Traum des Kindes
(Abb. 67): das verstorbene Mütterlein erscheint dem in der dunklen
Kammer eingesperrten Kinde, nimmt es zu sich auf den Schoß und
erzählt ihm vom himmlischen Paradies. — 1849 bis 1860 folgen die
Illustrationen zur „Spinnstube“ und zu „Gesammelte Erzählungen“,
ferner zu „Des alten Schmiedjakob Geschichten“ und zu den „Rheinischen
Dorfgeschichten“, sämtlich herausgegeben von W. O. von Horn; im
ganzen fünfhundertvierundsiebzig Zeichnungen. 1873 erschien der
weitaus größte Teil derselben in einer Separatausgabe bei Sauerländer
in Frankfurt am Main. Die Verlagshandlung hatte Richter alle
Holzschnitte vorher zur Durchsicht eingesendet, der Meister zog mich
zur Auswahl[S. 61] zu; für manches dieser köstlichen Blätter mußte ich
eifrigst eintreten, um es der geplanten Ausgabe zu erhalten, und so
haben denn schließlich vierhundertfünfzig Blatt die Revue passiert.
Die Verlagshandlung berichtet bei dieser Ausgabe, daß Richter sich zu
dem echt volkstümlichen, gemütreichen Ton der Hornschen Erzählungen
so hingezogen fühlte, daß er sich bereits 1847 um deren Illustrierung
selbst bewarb und mit ganzer Hingebung über ein Jahrzehnt dafür wirkte.
Sein 1859 eingetretenes Augenleiden zwang ihn, die ihm lieb gewordene
Arbeit aufzugeben. In der Vorrede schreibt Dr. Weißmann am 28. August
1873: „Wenn einer der Volksschriftsteller unserer Tage würdig gewesen,
von Ludwig Richter illustriert zu werden, so ist es Horn. Hat doch
kein Künstler das deutsche Volk in seiner Erscheinung verstanden und
sein ganzes Gebaren in Leid und Freud, in ruhigem Behagen, wie in
leidenschaftlicher Erregtheit, in der naiven Lust der Kindheit, in
der herzigen Verschämtheit und Unbeholfenheit der Jugend, wie in der
steifen Selbständigkeit und in der ehrwürdigen Entsagung des Alters
dem Auge darzustellen gewußt, wie Ludwig Richter. ‚Traulich mit dem
Volke verkehren,‘ sagt Horn an einer Stelle, ‚bringt reichen Lohn.
O wieviel Tüchtiges und Treffliches umschließt das tiefe Gemüt des
Volkes! Wieviel Poesie liegt da verborgen!‘ Das hat auch Richter
erkannt, und wenn er vielleicht auch nicht in dem Maße, wie durch
seinen Seelsorgerberuf der Dichter, eindringen konnte in das innere
Leben, sein treues Auge und sein liebevolles Herz hat ihn nicht minder
vertraut gemacht mit dem Volke.“ Von den uns zur Verfügung stehenden
Handzeichnungen zu dieser Publikation bringen wir die Blätter Abb. 68
bis 76. Die beiden Zeichnungen zu der Geschichte „Jörjakob“, gezeichnet
um 1860, sind von seltener Schärfe der Charakteristik und erschütternd
im Ausdruck. Der Knabe am Bett[S. 62] der sterbenden Mutter, seine Hand auf
die ihrige legend, lauscht schmerzbewegt ihren letzten Segensworten
(Abb. 74). Und weiter dann die Frau und die Kinder am Bett des
verstorbenen Mannes und Vaters (Abb. 75)! Der letzte Atemzug ist getan,
die Seele aus dem Körper geschieden. Wie ist das Weib groß und echt
und wahr gezeichnet, wie sie laut schluchzend, mit beiden Händen die
Schürze vors Gesicht hält, und die Kinder, wie sie in ihrem Schmerze an
der entseelten Hülle ihres geliebten Vaters knieen. Das Kleinste steht
so unbeholfen und erstaunt neben der Mutter, wie Schutz suchend, das
kleine Wesen begreift noch gar nicht, was vorgegangen ist. Dieses Blatt
hat etwas von der Größe und Wucht und Charakteristik Rethelscher Art.
Das prächtige, höchst geistreich leicht gefärbte Blatt „Unterredung“
(Abb. 77) ist möglicherweise eine Vorarbeit zu „Eine Geschichte, wie
sie leider oft passiert“ aus den Spinnstubengeschichten von 1851.

1849 erscheinen „Musenklänge für Deutschlands Leierkasten“ mit
vierundzwanzig Zeichnungen von kernigem, fast derbem Humor — und
weiter die hochkomischen, gesund und kraftvoll charakterisierten
Gestalten der „Sieben Schwaben“.

Abb. 76. Zu Die Spinnerin.
Spinnstubengeschichten von Horn. 1860.
Um 1850 folgen unter anderm die drei schönen Radierungen zu „Deutsche
Dichtungen mit Randzeichnungen deutscher Künstler“ (Düsseldorf,
Buddens), „Frühlingslied des Recensenten,“ das letzte von den bekannten
Frühlingsliedern Uhlands, dessen letzte Strophe lautet:
„Daß es keinen überrasche,
Mich im grünen Feld zu sehen!
Nicht verschmäh’ ich auszugehen,
Kleistens Frühling in der Tasche“
(Abb. 78). Junge schmucke Mädchen schöpfen Wasser am Brunnen unter[S. 63]
blühenden Fliederbüschen, aus jung belaubten Buchenmassen heraus tritt
der Recensent: „Störche kommen und Schwalben“, drohend hebt er den
Finger: „Nicht zu frühe, nicht zu frühe!“ Weiter folgt das „Schlaflied“
von Tieck. Unter schattigem Busch, vom Wandern ermüdet, schlafen ein
Mann und eine schlanke junge Frau; aus dem im Mittagssonnenschein
träumenden Walde ziehen Rehe zum Quell in moosigem Gestein. —
Das dritte Blatt behandelt auch ein Gedicht von Tieck aus dessen
„Verkehrter Welt“ (Abb. 79). Am Waldesrand am Fuße einer mächtigen
alten Buche sitzt eine Hirtenfamilie, ein junger Hirt bläst auf einer
Schalmei, in den dichten Wald fallen einzelne Sonnenlichter. Diese
Radierungen sind von großer Gewandtheit in der Nadelführung und
besonders das letzte Blatt kraftvoll und energisch in der Wirkung.
Unsere Abbildungen sind nach Probedrucken aufgenommen.
1850 folgen zwei Holzschnitte für die Bibel von Cotta, zu der auch
Rethel so hervorragende Zeichnungen lieferte; die letzteren sind leider
in der neuen Ausgabe weggelassen worden. Diese Rethelschen Blätter
gehören zu dem Bedeutendsten, was auf diesem Gebiete geschaffen worden.
Solche kernige Bibelbilder dürften unter keinen Umständen dem deutschen
Volk, schon aus erzieherischen Rücksichten, vorenthalten werden.
Hieran reihen sich 1850–1854 vierzehn Zeichnungen zu Shakespeares
dramatischen Werken, bei Duncker erschienen, und das „Märchenbuch für
Kinder“ von Ferdinand Schmidt (Otto Wigand), mit sechs sehr anmutigen
Bildern.
1850–1854 erscheinen: „Was bringt die Botenfrau“ und „Nach Belieben,
Kraut und Rüben“, „An der Krippe zu Bethlehem“, „Knecht Ruprecht“,
„Die Familienlieder“, „Kreuz und Grab des Erlösers“ u. a. von J. T.
Löschke, mit zusammen hundertundsechzig Holzschnitten. Die mit R.
Heinrich bezeichneten Lieder in „Familienlieder“ sind von des Meisters
Sohn in jungen Jahren in Musik gesetzt. Aus der „Botenfrau“ folgen die
Abbildungen 80 und 81.
1851 erschienen C. Andersens Märchen mit sechzehn Zeichnungen, von
denen wir Abb. 82 bringen, und Hebels alemannische Gedichte, ins
Hochdeutsche übertragen von R. Reinick, mit fünfundneunzig Zeichnungen.
Letztere zählen zu den hervorragendsten Illustrationen des Meisters.
Wir geben davon die Abbildungen 83–90. Die ersten vier sind zu der
Geschichte „Der Karfunkel“. Abb. 90 „Der Sperling am Fenster“ ist von
des Meisters Tochter Aimée geschnitten.

Abb. 77. Zu
Eine Geschichte, wie sie
leider oft passiert. Spinnstubengeschichten von Horn. 1851.
(Zu
Seite 62.)
Zu „Der arme Mann im Toggenburg“, herausgegeben von E. Bülow, ist
das reizende Titelblatt, Abb. 91. Wir fügen hier eine leichte
Porträtzeichnnng nach Richter von Eduard Bendemann aus dieser Zeit ein
(Abb. 92).
1853 folgt „Bechsteins Märchenbuch“ (bei Georg Wigand), mit
einhunderteinundsiebzig Bildern, die in Deutschland die freudigste
Aufnahme gefunden und noch heute alles überstrahlen, was nach dieser
Seite hin geschaffen wurde. Zu bedauern ist, daß die unvergänglichen,
durch die Brüder Grimm gesammelten Märchen unserem Richter[S. 64] nicht zum
Illustrieren übergeben wurden; das wäre ein Werk geworden, wie kaum
ein zweites in Deutschland. Wie mag es gekommen sein, daß sich die
Fäden dazu nicht knüpfen ließen? Wir geben aus Bechsteins Buche eine
farbige Vervielfältigung nach einer Originalzeichnung „Dornröschen
bei der Alten im Turmstübchen“ (Abb. 93). Wer Handzeichnungen von
Richter gesehen, wird sich durch die liebenswürdige Art des Vortrages
gewiß angezogen fühlen. „Nie ein Strich zuviel, nie einer zu wenig.
Das ist die echte Bescheidenheit in der Kunst“, sagt Otto Ludwig, der
Dichter des „Erbförsters“. Einfach, schlicht ist seine Zeichnung, aber
geistvoll und lebendig. Er liebt es, seine Zeichnungen mit leichten
Tönungen zu versehen, und versteht mit knappen Farbenandeutungen
ein reizvolles und voll befriedigendes Bild hervorzuzaubern. Oft
unterstützt er die leichten Farbentönungen mit wenigen Federstrichen.
Weiter folgt die Hirtenszene zu dem Schluß des reizenden Märchens: „Der
Müller und die Nixe.“ Auf einsamer Bergeshöhe über dem stillen Wald
beim aufgehenden Vollmond sitzen Hirt und Hirtin; der Hirt bläst die
Flöte, die Hirtin lauscht den Tönen und gedenkt jenes Abends, an dem
sie am Weiher beim Vollmond auf der goldenen Flöte geblasen und — die
verzauberten jungen Jägersleute erkennen sich wieder (Abb. 94). Sehr
anmutig ist die Knabenfigur „Goldener“, wie schauen seine Augen so
träumerisch unter dem lichten Haar hervor (Abb. 95)! Voll köstlichen,
liebenswürdigen Humors ist der Holzschnitt „Der kleine Däumling kehrt
mit seinen Brüdern ins Elternhaus zurück“ (Abb. 96). Das die Tür mit
Blumengewinden schmückende anmutige Mägdlein ist zum „Mann ohne Herz“,
unsere Abbildung 97 eine spätere Wiederholung „Zum Geburtstag“ in
„Altes und Neues“. — In den beiden Blättern „Rotkäppchen im Walde,
Blumen pflückend“ (Abb. 98), und „Hänsel und Gretel“ (Abb. 99) zeigt er
seine Meisterschaft im Zeichnen mit der Feder.

Abb. 78.
Frühlingslied des Recensenten
von Uhland. Radierung von 1850.
Mit Genehmigung der Verlagshandlung von Hermann Vogel in Leipzig. (Zu
Seite 62.)
Im November 1853 wurden Richter und sein Freund J. Schnorr zu
Ehrenmitgliedern der Münchener Akademie ernannt; er schreibt darüber,
wie es ihm eine ganz besondere Freude mache, daß solche Ehrung ihm
gerade von München zuteil wird. In[S. 65] demselben Jahre zeichnet er für
seinen Sohn Heinrich, der in Leipzig Musik studierte und bei Georg
Wigand wohnte, aus Scherz eine Musikkapelle, einen Kapellmeister und
zwölf Musikanten, stark aufgetragene, tolle Gestalten; Wigand ließ
diese Blätter, als er sie zu Gesicht bekam, ohne weiteres in Holz
schneiden. Diese Gestalten tauchen in seiner Erinnerung 1868 (Abb. 170)
wieder auf.
1854 wurde die „Christnacht“ (Abb. 100) als Vereinsblatt des
sächsischen Kunstvereins beendet. Eine köstliche Radierung, die größte,
die aus Richters Hand hervorgegangen! In dieser poetischen Komposition
klingt der ganze geheimnisvolle Zauber der deutschen Weihnacht wieder.
Hoheitsvoll und lieblich und rein, wie Engel von Fiesole, obwohl etwas
vollblütiger als die des liebenswürdigen Fra Angelico, schweben zwei
größere Engelgestalten in reicher fliegender Gewandung, den brennenden
Christbaum in stiller, dunkler Sternennacht zur Erde bringend. Unter
den Zweigen des Baumes, in einem von Fruchtgewinden umschlossenen, von
lieblichen kleinen Engeln getragenen Körbchen, auf weißem Linnen liegt
das Christkind — eins der Englein schüttet als „Knecht Ruprecht“ seine
Gaben herab. Unten in der Stadt weihnachtlich erleuchtete Fenster,
der Pfarrer schreitet hinab zur Kirche zur Weihnachtsandacht, vom
Turm ertönt Gellerts Lied. „Dies ist der Tag, den Gott gemacht, sein
werd’ in aller Welt gedacht.“ — Um zu erkennen, wie gesund Richter
empfindet und darstellt, vergleiche man mit seiner „Christnacht“ den
Christbaum des Düsseldorfer Künstlers Theodor Mintrop; hier sehen wir
ein ganzes Aufgebot von Engeln, eine ganze „Konzertkapelle“, eine Reihe
von Engeln verteilt Spielwaren an Kinder, eine andere Reihe ist sogar
mit der Anfertigung der Spielwaren beschäftigt! Wie weiß unser Meister
dagegen mit sicherem Blick in seiner Darstellung das Wesentliche vom
Unwesentlichen zu scheiden und Maß zu halten!
Das lange und angestrengte Arbeiten an dieser so vollendet ausgeführten
Kupferplatte griff des Meisters Augen sehr an, von dieser Zeit datiert
sein Augenleiden.

Abb. 79.
Ruhende Hirtenfamilie.
Radierung. 1850.
Mit Genehmigung der Verlagshandlung von Hermann Vogel in Leipzig. (Zu
Seite 63.)
[S. 66]

Abb. 80 und 81.
Tanzendes Kind und
Großmutter. Besuch bei der Kranken. 1850. (Was bringt die Botenfrau?) Aus
Sturm, Kinderleben.
Verlag von Ferd. Riehm in Leipzig. (Zu
Seite 63.)

Abb. 82. Zu „
Der Schweinehirt“ aus
Andersens Märchen. 1851.
Verlag von Abel & Müller in Leipzig. (Zu
Seite 63.)

Abb. 83.
Der Karfunkel. Hebels
alemannische Gedichte. 1851.
Verlag von Georg Wigand in Leipzig. (Zu
Seite 63.)
1851–1855 erschien bei Georg Wigand in Lieferungen „Beschauliches
und Erbauliches“ mit achtunddreißig Zeichnungen. Wir nennen daraus
die herrlichen Blätter „Lob des Weibes“, „Aller Augen warten auf
dich“, die überaus humoristischen Darstellungen vom „Tischlein deck’
dich, Esel streck’ dich, Knüppel aus dem Sack“; von letzterem ist das
Schlußbild (Abb. 102). „Ehre sei Gott in der Höhe“ (Abb. 101) ist eine
Erinnerung an die Meißener Zeit, wie Abb. 100; am Weihnachtsabend
singen Kinder vom hohen Stadtkirchturm herab Weihnachtslieder in die
dunkle Nacht hinaus. Wie mag unser Richter mit seinem „Gustchen“ am
offenen Fenster oben am Afraberg dem lieblichen Gesange gelauscht und
an dem Lichterschimmer auf dem Turme sich erfreut haben! — „Was ihr
getan habt dem geringsten meiner Brüder, das habt ihr mir getan“ (Abb. 103).
Eine Mutter mit ihrem Töchterchen besuchen eine arme, kranke
Frau. Liebreizend ist die Kindergruppe, das Mädchen, welches dem Kinde
die mitgebrachten Kleider anziehen will und das staunende Kind. Lustig
und heiter ist das Bild „Der Schäfer putzte sich zum Tanz“ (Abb. 105).
Anmutig tanzt die schmucke Maid mit ihrem Liebsten, mit einem Jauchzer
hebt der zweite Bursch seine Tänzerin in die Höhe, der dritte kommt
singend mit seinem Mädel und mit seinem Maßel; der kennt den Spruch:
„Wer nicht liebt Wein, Weib, Gesang, der bleibt ein Narr sein Leben
lang.“ Anmutig[S. 67] ist das Blatt „Kinderlust“, von dem wir eine farbige
Reproduktion geben (Abb. 104). „Ich habe mein Feinsliebchen so lange
nicht gesehen“, höchst behaglich und lauschig mutet das Plätzchen
an dem gotischen Türchen der Mühle an, wo die schämige Müllersmaid
dem schmucken Jäger die Hand reicht. Er streicht mit seiner Rechten
über ihr blondes, welliges Haar. Jägers Teckel sitzt etwas abgewendet
blinzelnden Auges da, ihn geht’s halt nix an. Die Müllersfrau oben
am Fensterchen hebt wie drohend den Finger, es scheint aber so ernst
nicht gemeint, sie hat doch ihres Mädels Schatz gern (Abb. 106). Die
Darbietungen Richterscher Muse in dieser Heftform, mit „Beschauliches
und Erbauliches“ beginnend, halte ich, so groß und hochbedeutend auch
sonst seine Tätigkeit als Illustrator ist, und in der er wohl noch
unübertroffen dasteht, für seine größten Leistungen; er hat hierin so
recht eigentlich für die weitesten Kreise des deutschen Volkes gewirkt,
hier wirklich Nationales geschaffen und Samen ausgestreut, der gewiß
tausendfältige Frucht getragen und noch tragen wird in der deutschen
Familie, im deutschen Hause. Das Erscheinen dieses Heftes bezeichnet
wieder einen Wendepunkt in seiner Künstlerlaufbahn. Er seufzt über das
Hetzen und Jagen der Verleger beim Illustrieren und freut sich, daß er
seine Stoffe jetzt sich selbst wählen und freier arbeiten und gestalten
kann. Er tritt auf die höchste Stufe seiner künstlerischen Tätigkeit,[S. 68]
reicht seinem Volk die schönsten Blüten seiner Muse. Die Zeit von 1848
bis 1859 ist als des Künstlers eigentlicher Höhepunkt zu betrachten.

1849–1851 lieferte Richter für Georg Scherers „Alte und neue
Kinderlieder“ zehn Radierungen auf Zink und eine auf Kupfer („Der
Schnitzelmann von Nürnberg“), die in späteren Auflagen, 1863 und 1873,
weil ausgedruckt, durch Holzschnitte ersetzt wurden; weiter zeichnet er
1854–1875 zu Scherers „Deutschen Volksliedern“ (späterer Titel: „Die
schönsten deutschen Volkslieder mit ihren eigentümlichen Singweisen“)
dreißig Blätter für Holzschnitt. Zu der 1855 bis 1858 erscheinenden
„Deutschen Geschichte in Bildern von Dr. F. Bülau“ (Dresden bei
Meinhold und Söhne) zeichnet Richter drei Blätter, von denen wir in
Abb. 107 einen Entwurf zu „Otto I. an der Nordsee“ geben. 1853 zum 14.
November zeichnet er sein erstes Enkelchen (Abb. 108) dem Schwiegersohn
Gaber und schreibt darunter das Verschen:
Das Margaretli bin ich genannt,
noch winzig klein, wie euch bekannt,
werd ich erst ein groß Jungferli sein,
wird mich Großpapa wohl besser konterfein.
1857 skizziert er dasselbe Enkelchen, das, wie es scheint, keine rechte
Lust zum Sitzen hat, noch einmal (Abb. 109); sein Wort hat aber der
Meister nicht gehalten. Wohl versuchte er um 1870, die inzwischen zum
Jungfräulein herangereifte Enkelin wieder zu zeichnen, aber seine Augen
versagten, und es blieb bei einem Versuch.

Abb. 87. Aus „
Der Statthalter von
Schopfheim“.
Hebels alemannische Gedichte. 1851. (Zu
Seite 63.)
1853–1856 zeichnet er vierzig Blatt zum Goethe-Album. Für Goethe hatte
er stets eine besondere Vorliebe, er hat ihn frühzeitig schätzen
und verstehen gelernt; er reiste selten, ohne einen Band Goethe
„mit im Täschel“ zu haben. Die Bilder zum Goethe-Album sind alle
unvergleichlich schön, und man weiß eigentlich nicht, wo anfangen, um
zu schildern. Wie poetisch ist das Plätzchen, wo’s Liebchen sitzt, in
dem Bilde „Ist sie das?“ Und weiter Schäfers Klagelied: „Da droben
auf jenem Berge“ und Jägers Abendlied: „Im Felde[S. 69] schleich’ ich still
und wild“, das Frühlingsorakel: „Du prophetischer Vogel du“ und der
Schatzgräber: „Holde Augen sah ich blinken“ (Abb. 110). Die Spinnerin:
„Als ich still und ruhig spann“ und Edelknabe und die Müllerin: „Wohin,
wohin? schöne Müllerin?“ und „Junggesell und der Mühlbach“: „Wo willst
du, klares Bächlein, hin so munter?“ Und weiter „Der Müllerin Verrat“,
„Da drang ein Dutzend Anverwandten
herein, ein wahrer Menschenstrom,
da kamen Vettern, guckten Tanten,
es kam ein Bruder und ein Ohm“,
und dann „Der Müllerin Reue“. Wie muten uns diese Bilder so wohltuend
an! Zu den hervorragendsten dieser Bilder gehören die Zeichnungen zu
„Hermann und Dorothea“, von denen wir Abb. 111 bringen: „Und so saß
das trauliche Paar, sich unter dem Torweg über das wandernde Volk mit
mancher Bemerkung ergötzend.“ Es atmet dieses Blatt die friedliche
Stille und Behaglichkeit der kleinen Stadt! Trefflich sind die Bilder
zu „Götz von Berlichingen“: „Schreiben ist ein geschäftiger Müßiggang“
(Abb. 112) und „Es[S. 70] war einmal“ (Abb. 113). Wie lauschig ist das
behagliche Turmstübchen, und von welcher Anmut das Figürchen der Maria!
Wie ist das alles deutsch gedacht und empfunden!

Abb. 88.
Erhalt Gott meinen
Friedel.
Hebels alemannische Gedichte. 1851. (Zu
Seite 63.)

Abb. 89.
Der Bettler. Hebels
alemannische Gedichte. 1851. (Zu
Seite 63.)
1855 erscheint, von seinem Schwiegersohn A. Gaber herausgegeben,
„Die Christenfreude“, eine Sammlung von geistlichen Liedern mit
einundvierzig Bildern von Richter, die übrigen sind von Jul. Schnorr
und Carl Andreä. Der Tod seiner Frau — sie starb 1854 — lastete
schwer auf ihm, es weht uns ein schwermütiger Ton aus diesen Bildern
entgegen; innere Anfechtung wechselte in ihm mit gläubigster
Christenhoffnung. Die Liedertexte wählte er selbst, sie sind von
tiefer Glaubensfreudigkeit durchdrungen; dem Maler merkt man die
niedergedrückte Stimmung seiner Seele an: „Es fehlt mir immer etwas,
und ich sehe mich manchmal um, als müßte es von außen kommen, was die
schmerzhafte Lücke im Herzen gemacht hat, und sie wieder heilen; aber
dann besinne ich mich, und der Loschwitzer Friedhof und der noch kahle
Sandhügel steht mir vor Augen. Und da heißt es ‚Glauben‘. Sichtbar ist
der Tod, unsichtbar das Leben geworden,“ so schreibt er am 4. November,
an welchem Tage vor siebenundzwanzig Jahren er seine Auguste zum Altar
führte. Sich selbst zeichnet er in dem Bildchen (Abb. 114) zu dem
melancholischen Herbstlied von Heinrich Albert:
„Der rauhe Herbst kommt wieder:
Jetzt stimm’ ich meine Lieder
In ihren Trauerton,
Die Sommerlust vergehet,
Nichts in der Welt bestehet:
Der Mensch muß endlich selbst davon.“
Auf dem kleinen Friedhof sitzt der tief gebeugte Meister am Grabhügel
seiner Frau. Der Wind weht die letzten Blätter von[S. 71] den Bäumen, am
Himmel steht die feine Sichel des zunehmenden Mondes, ein langer Zug
von Wandervögeln strebt nach dem Süden, Herbstzeitlosen sprossen im
Grase. Das Bildchen ist mit so wenig Strichen, so schlicht und einfach
gezeichnet, und wie berührt es uns innerlichst, wie mitempfindet man
des Meisters wehmütige Stimmung. Es ist tiefpoetischer Volksliederton,
der uns auch hier wie so oft aus seinen Schöpfungen so wohltuend und
sympathisch entgegenklingt.

Abb. 90.
Der Sperling am Fenster.
Hebels alemannische Gedichte. 1851. (Zu
Seite 63.)
Voller Innigkeit und edler Anmut sind auch die übrigen Bilder, von
denen wir zwei in Nachbildungen nach Handzeichnungen bringen: „Ich
und mein Haus wollen dem Herrn dienen“ (Abb. 115); hier zeichnet der
Meister sich wieder selbst im Kreise der Seinen bei der Hausandacht,
und zu Paul Flemmings herrlichem Liede: „Ein getreues Herz zu wissen,
hat des höchsten Schatzes Preis“; die Abb. 116 ist nach einer späten
Wiederholung aus „Altes und Neues“. Weiter folgen die Holzschnitte
zu Matthias Claudius’ Lied: „Der Mond ist aufgegangen“ (Abb. 117),
zu: „Jesu, komm doch selbst zu mir“ (Abb. 118), zu: „Es kostet viel,
ein Christ zu sein“ (Abb. 119) und zu: „Müde bin ich, geh zur Ruh’“
(Abb. 120). Zur „Christenfreude“ zeichnete auch Julius Schnorr die
schöne Komposition für das Lied: „Jerusalem, du hochgebaute Stadt!“
Unser Meister erzählte oft, wie Schnorr in Rom in der Kapelle der
preußischen Gesandtschaft im Palazzo Caffarelli auf dem Kapitol, damals
der einzigen protestantischen Kirche in der Tiberstadt, mit anderen
jungen Künstlern als Kirchensänger bei den Gottesdiensten mitgewirkt
und als Vorsänger gerade dieses Lied mit so ergreifender Innigkeit und
Gläubigkeit gesungen habe. Diese Komposition malte Schnorr in späten
Jahren noch als sein letztes Ölgemälde.
Auch aus dem Jahre 1855 datiert die Zeichnung: „Kunst bringt Gunst“
(Abb. 121). 1856 zeichnete Richter zu „Das rote Buch, neue Märchen
für mein Kind“, von Julius Stern (Leipzig, Breitkopf & Härtel), ein
Titelblatt, überschrieben „Der Spielengel“, ein überaus ergreifendes
Blatt. Auf den Untersatzbogen der Originalzeichnung hat er geschrieben:
„Der Kindheitsengel besucht den kindisch gewordenen Greis.“ — Der Alte
lauscht mit ineinander gelegten Händen dem Englein, das ihm ins Ohr
flüstert und nach „oben“ zeigt (Abb. 122). In demselben Jahre erschien
das „Vaterunser“, eine köstliche Folge von neun Holzschnitten. Wir
geben davon drei Blätter: „Geheiliget werde dein Name“ (Abb. 123) —:
Bauersleute gehen am Sonntagmorgen durchs Gärtchen hinaus zur Kirche,
die runden Mädel pflücken sich Rosen, über wogende Kornfelder sieht man
in die lachende Landschaft, in der Höhe schwebt ein Engel mit Glöckchen
und Weihrauchgefäß — ein liebliches Sonntagsbild, es ist, als hörte
man die Lerchen jubilieren. „Dein Reich komme“ (Abb. 124): Die Mutter
lehrt die Kinder beten, Englein lauschen dazu. Hochromantisch ist die
Komposition „Erlöse uns von dem Übel“ (Abb. 125): Durch das Fensterchen
des engen Stübchens fällt der letzte Strahl der untergehenden
Sonne, eine sterbende Mutter auf ihrem Krankenlager streckt die
Arme verlangend nach der Tür, in der eine lichte Engelsgestalt[S. 72] mit
Wanderstab steht und leise winkt. Die Kinder wehklagen und jammern:
das kleinste schaut den Engel erstaunt, aber auch wie vertraut an, im
dunklen Wald ein einsames Reh. Ein ergreifendes Bild! Das „Vaterunser“
erschien im Verlage des Schwiegersohnes August Gaber und des Sohnes
Heinrich Richter. Später führte Heinrich Richter den Verlag allein,
bis ums Jahr 1873 sein Freund Franz Meyer in diesen mit eintrat. Der
gesamte Verlag ging dann schließlich in den Besitz von Alphons Dürr
in Leipzig über. Heinrich Richter hat (er war ein geistvoller und
außerordentlich belesener Mann, auch von großer musikalischer Begabung)
dem Vater bei der Inszenesetzung neuer Folgen mit Rat und Tat zur Seite
gestanden. Er war es, der Richters Lieblingsidee, „Ein Werk fürs Haus“
zu zeichnen, in die Wege leitete und hat sich um dieses hervorragende
Werk wie um die späteren Veröffentlichungen große Verdienste erworben.
Dieser Kunstverlag wurde für Vater und Sohn die Quelle wechselseitiger
Anregung und befriedigenden Schaffens. Ebenso hat er sich auch um die
Herausgabe der Selbstbiographie seines Vaters sowie der Auszüge aus
den Tagebüchern sehr verdient gemacht. Er war in Meißen am 11. März
1830 geboren, litt seit frühester Jugend an Melancholie und hat daran
schwer zu tragen gehabt. „Durch sein ganzes Leben zieht sich ein Faden
menschlichen Mißlingens.“ Er stand mit vielen hervorragenden Männern
der Kunst und Wissenschaft in Verbindung und suchte sich auf allen
Gebieten der Wissenschaft Kenntnisse zu erwerben, doch sein Innerstes
blieb unbefriedigt, sein Suchen und Ringen dauerte fort, und seine
Seele litt oft sehr. Der wundervolle 47. Psalm „Wie der Hirsch schreiet
nach frischem Wasser, so schreiet meine Seele, Gott, zu dir. Meine
Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott“ usf. erklang oft in
ihm wieder. Er beschloß sein Erdendasein am 12. Juli 1890 in Bad Boll,
wo er oft und gern, Ruhe und Frieden suchend, verweilte.
1857 erschien „Aus Ludwig Richters Skizzenbuch“. Zwölf Blatt
landschaftliche Studien mit Staffagen, nach den Originalen
lithographiert von Woldemar Rau. Die Übertragung auf den Stein durch
fremde Hand hat von der reizvollen Zeichnung viel verloren gehen
lassen. Annähernd aus dieser Zeit stammt das Fragment zum Märchen
„Marienkind“ (Abb. 126).

Abb. 91. Titelbild zu „
Der arme Mann im
Toggenburg“. 1852.
(Zu
Seite 63.)

Abb. 92.
Dornröschen bei der Alten im
Turmstübchen.
Aus Bechsteins Märchenbuch. 1853.
Verlag von Georg Wigand in Leipzig. (Zu
Seite 64.)
Es folgt das „Lied von der Glocke“. In sechzehn Bildern führt Richter uns[S. 73] an der Hand
der Dichtung durch das Leben. In einem Briefe an seinen Freund Julius
Thäter vom 1. November 1857 schreibt er: „Ich wollte dem Dinge erst
den Titel geben: ‚ebensbilder nach Motiven aus Schillers Glocke‘,
weil ich ganz frei gegangen und auf meine Weise die Gegenstände
aufgefaßt, aber mich nicht in die Schillersche Anschauung versetzt
habe. — Zuletzt bin ich aber doch bei dem einfachen Titel geblieben,
und die Hauptsache bleibt mir, ob die Bilder an und für sich lebendig
genug ausgefallen sind.“ — Man will in diesem Werke eine gewisse
Befangenheit herausfinden, und es deckt sich diese Empfindung in etwas
mit dieser seiner eigenen Äußerung. Die Richtersche volkstümliche
Schlichtheit war ja von dem hohen Schwung und Pathos Schillers in der
Tat weit entfernt. Doch auch diese Folge ist reich an künstlerischen
Schönheiten. Wie eine schöne leise Musik anmutet das Blatt „O zarte
Sehnsucht, süßes Hoffen, der ersten Liebe gold’ne Zeit“ (Abb. 127).
Lieblich und innig ist das Liebespaar, das über der Mühle droben am
Waldesrand auf der Moosbank im Abendsonnenschein sitzt. Tauben girren
in den Ästen der alten Eiche, ein Vogel huscht über den Wald, das
ist sicher der Kuckuck; still und feierlich geht der Vollmond auf.
Ein zweites Bild (Abb. 128) „Zum Begräbnis“: „Ach, die Gattin ist’s,
die teure, ach, es ist die treue Mutter“, — das hatte der Meister
wenige Jahre vorher selbst erlebt und durchgelitten; der Abschied des
Mannes, — er trägt des Meisters eigene Züge, — und die schluchzenden
schmerzbewegten Kinder sind ergreifend gezeichnet.
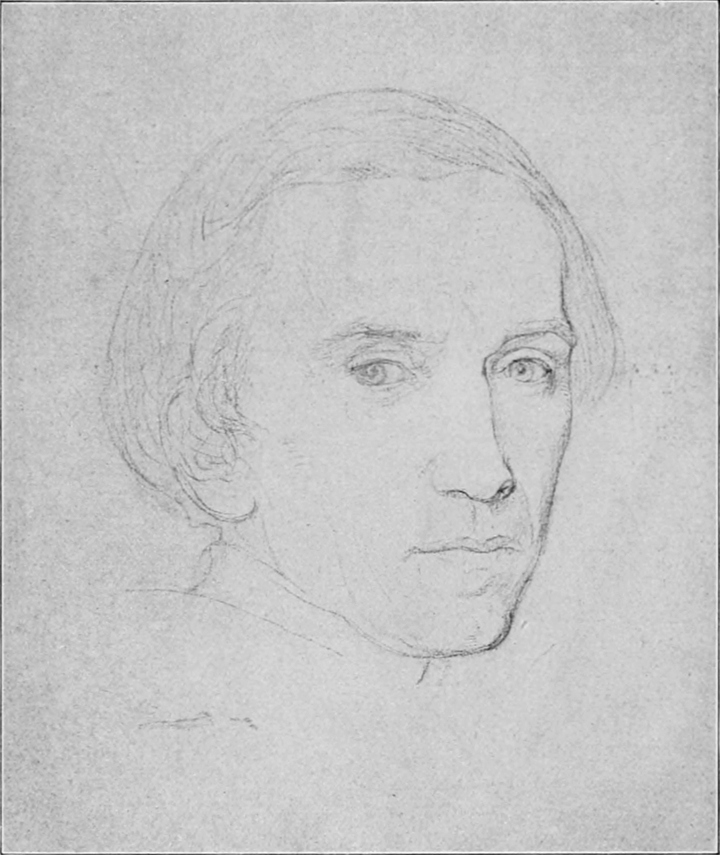
Abb. 93.
Porträt Richters. Von
Bendemann gezeichnet. 1852 (?). (Zu
Seite 63.)
1858 erscheint „Voer de Goern“, Kinderreime, alt und neu von Klaus
Groth mit zweiundfünfzig Zeichnungen, davon 38 von Richter. Der
Meister reiste, ehe er die Zeichnungen begann, nach Holstein, um an
Ort und Stelle sich mit Land und Leuten bekannt zu machen. Diese
Illustrationen sind von großer Frische, gesund und markig. Wir geben
davon die Handzeichnung: „Anna Susanna, geh du na Schol!“ (Abb. 129).
Die dralle, aber anmutige Anna Susanna und die hand- und wetterfesten,
gesundheitstrotzenden Jungen sind köstliche Kindergestalten. Abb. 130
im Holzschnitt: „Kleine Maus, große Maus“, ist eine liebliche
Kindergruppe im Rosenbusch. In demselben Jahre bringt uns der
Meister noch ein Bilderbuch für die Kleinen: „Der Kinderengel“, ein
Spruchbüchlein für fromme Kinder, mit „Luthers Brief an sein Söhnlein
Hänsigen“[S. 74] und zwanzig Holzschnittzeichnungen, von denen einige von
C. Peschel gezeichnet sind. Aus diesem Kinderbüchel bringen wir nur
die reizende Gruppe „Gott zum Gruß“ (Abb. 184), das prächtige gesunde
Bübchen, die Mütze in der rechten, den Blumenstrauß in der linken Hand,
hinter ihm das Schutzengelchen, das ihm leise zuflüstert, als wollte es
beim Aufsagen des gelernten Versleins „wenn’s stockt“ nachhelfen. —

Abb. 94. Zu „
Der Müller und die Nixe“.
Bechsteins Märchenbuch. 1853.
Verlag von Georg Wigand in Leipzig. (Zu
Seite 64.)

Abb. 95.
Goldener. Bechsteins
Märchenbuch. 1853.
(Zu
Seite 64.)

Abb. 96.
Der kleine Däumling. Aus
Bechsteins Märchenbuch. 1853.
(Zu
Seite 64.)
1858 bis 1861 erscheinen die vier Hefte: „Frühling, Sommer, Herbst und
Winter“, unter dem Gesamttitel: „Fürs Haus“, des Meisters Hauptwerk,
im Verlage von Heinrich Richter. Die Vorrede dazu teilten wir in der
Hauptsache am Eingang bereits mit. Epiphanias leitet die Bilderdichtung
ein. Am Neujahrsmorgen sehen wir in das trauliche Wohnstübchen; die
Kinder sagen ihr Neujahrsverschen auf, die Stufen zur Haustür herauf
kommt der Briefträger und bringt Neujahrsgrüße von lieben Entfernten.
Schneeflocken fallen leise zur Erde; oben Englein, die das niedere
Dach mit Tannenreis bekränzen, um das neue Jahr festlich zu empfangen,
darüber Strahlen der aufgehenden Sonne. Wie lieb ist das Bild: „In
der Badestube“! Ein anderes Bild: „Marthens Fleiß, Mariens Glut“,
ist in der Brautzeit seiner früh verstorbenen Schwiegertochter Agnes
komponiert und die Originalzeichnung ihr gewidmet. Und weiter ein
Bild „Dämmerstündchen“ — „Sonst und Jetzt“ (Abb. 131). Ein Alter im
Lehnstuhl, sein Pfeifchen rauchend, vergangener Zeiten gedenkend,
die auf demselben Blatt geschildert sind: ein junges Ehepaar am Ofen
in stiller Freudigkeit im beseligenden Glück harmonischen Daseins.
Im leichten Ornament hockt ein einsamer Spatz. Wie ist der Alte in
seiner Einsamkeit so trefflich gezeichnet! Es ist unser Meister
selbst! „Weine nicht, Helmchen“ (Abb. 132): Schwesterchen trocknet
dem frierenden Brüderchen die Tränen. „Tages Arbeit, abends Gäste,
saure Wochen, frohe Feste,“ und ferner die trauliche „Hausmusik“ (Abb. 133):
wie ist es behaglich in dem vom Ofen durchwärmten Stübchen,
während es draußen regnet und stürmt! Solche Behaglichkeit verstehen
nur die Deutschen. Ein liebliches Frühlingsidyll ist das Blatt: „O
Himmelsschlüssel sind’s, so nennt das Volk sie mit dem Mund des
Kind’s!“ (Abb. 134.) Weiter folgt[S. 75] das Blatt: „Wem Gott will rechte
Gunst erweisen, den schickt er in die weite Welt“ (Abb. 135). Flotten
Schrittes ziehen zwei junge Burschen ihre Straße, jubelnd schwenkt
der eine den Hut. Das ist deutsche Wanderlust! Am Rand des Bildes
unter dem Schriftband ist ein Vogelbauer gezeichnet, darin sitzt der
Philister mit seiner behäbigen Ehehälfte und sucht durch Wiegen den
schreienden Spätling zu beschwichtigen; draußen auf dem zugebundenen
Schmierbüchsel sitzt ein leichtbeschwingter Spatz. Ungemein reizvoll
schildert der Meister die Szene: „Hänsel und Gretel am Häuschen der
Hexe“ (Abb. 136). Das Herbstbild: „Am Rhein, am Rhein, da wachsen
unsre Reben,“ zeigt eine anmutige Mädchengruppe in der Weinlese (Abb. 137).
— Schwungvoll, wie ein vielstimmiger Chor, ist das Blatt:
Psalm 65: „Du krönst das Jahr mit deiner Güte“ (Abb. 138). Der Jubel
der Hirtenkinder auf sonniger Höhe, die wogenden Kornfelder, hinter
hohen Bäumen fast versteckt das Kirchlein, ein weiter, weiter See
mit vielen Einbuchtungen, blaue endlose Fernen in sonnigem Duft, der
Regenbogen, der das ganze Bild überspannt, in den Wolken Engel, die
Gefäße ausgießen, den befruchtenden Regen andeutend: das ist so ganz
der Jubelton der königlichen Harfe Davids. Ferner nennen wir das
hochromantische „Gefunden“ (Abb. 139). Auf stolzem Rößlein reitet ein
junger Rittersmann mit seinem Schätzchen durch den Wald unter einer
alten Eiche vorüber, in deren Stamm ein vielleicht von dem Mägdlein
selbst mit frischen Waldblumen geschmücktes Marienbild. Wilde Tauben
fliegen im Geäst, im üppigen Waldesvorgrund rieselt ein Wässerchen über
moosiges Gestein. Das Mägdlein, das der Ritter mit dem Arm schützend
umfaßt, schaut lieblich sinnend vor sich hin. Ein köstliches Bild
deutscher Waldpoesie! Im „Schlachtfest“ (Abb. 140) schildert er voller
Humor gewiß Jugendeindrücke. So ähnlich mag er solches „Ereignis“
wohl in Friedrichstadt-Dresden beim Großvater Müller gesehen haben.
Die Lokalität dazu wurde von mir 1861 in Meißen gezeichnet. Behaglich
schildert „Bürgerstunde“ (Abb. 141) das kleinbürgerliche Leben; es
sind köstliche humoristische Philistergestalten, denen die stattliche
Magd „heimleuchtet“; trefflich charakterisiert ist der im Helldunkel
hinschreitende „Schwärmer“, der zu den Sternen aufschaut, oder schaut
er nach seiner Liebsten[S. 76] Fenster? Wir wollen nun noch des vorletzten
Blattes „Heimweh“ gedenken, das die Tonart des kleinen Bildes Abb. 114
anklingt, er zeichnete es, als nach kurzer glücklicher Ehe seine
Schwiegertochter Agnes starb. Am Wege unter einem Betsäulchen sitzt,
den Kopf mit der Hand gestützt, ein müder alter Mann; neben ihm lagert
ein Mädchen, drüben ist der Eingang zum Friedhof. Heimweh durchklingt
und durchdringt unseren Meister: „Ich wollt’, daß ich daheime wär’!“
Von diesem Bilde hat er eine ganze Reihe von Varianten gezeichnet
und gemalt, immer aber klingt dieselbe Tonart an: Wehmut, Heimweh,
Wandernsmüdigkeit. Wir geben hier eine Abbildung (142) nach einer
Zeichnung vom Jahre 1865, mit etwas veränderter, reicher ausgestalteter
landschaftlicher Szenerie. Man sieht über einen weiten See hinaus;
draußen verschwimmen die Fernen in lichten, sich auftürmenden
Wolkenmassen; zur Rechten stehen herbstliche Eichen am Hang, wilde
Rosen ranken am Kreuz, im Vordergrund sprossen Herbstzeitlosen.
Der Alte sitzt mit ineinander gelegten Händen da, gebeugt, wie in
tiefes Nachdenken versunken. Das an der Erde liegende Mädchen schaut
träumerisch aus dem Bilde heraus. „Ein ergreifender Herbstgesang“,
wehmütig, melancholisch! Eine seiner größten und schönsten Aquarellen
behandelt dasselbe Thema; auch in kleinen Federzeichnungen begegnet es
uns des öfteren, so auch im Holzschnitt (Abb. 168). Aus dem „Sommer“
sei noch das schöne Blatt erwähnt: „Es ist ein Schnitter, der heißt
Tod“ (Abb. 143). Dieses Blatt hat er in Aquarell nach dem Tode seiner
Schwiegertochter seinem Sohne gemalt und der zarten weiblichen Gestalt
die Züge der Verstorbenen gegeben. Es ist heute noch im Besitz der
Witwe des Sohnes, welcher nach dem Tode seiner ersten Frau Agnes
Hantzsch deren Schwester Julie heiratete. Dieses Blatt war die
Veranlassung, daß der Sohn anfing, Zeichnungen und Aquarelle des Vaters
zu sammeln; mit den Jahren war diese Sammlung zu einer der größten und
reichsten geworden. Wie oft habe ich im Hause des Sohnes im Beisein des
Meisters diese Sammlung durchgesehen! Wie interessant waren dabei seine
Bemerkungen bei einzelnen Blättern, wenn er vielleicht Nebenumstände
schilderte, unter denen sie entstanden, oder was ihm dazu Anregung
gegeben, oder auch Urteile anderer Künstler über das eine oder andere
Blatt mitteilte! Diese Sammlung ist später zum größeren Teile in den
Besitz der Berliner Nationalgalerie übergegangen. Sie umfaßt die
allererste und früheste Jugendzeit Richters bis zu seinen letzten
Arbeiten im Alter. — Damit schließen wir die Betrachtungen über „Fürs
Haus“. Es würde zu weit führen, Blatt um Blatt zu schildern; an Stoff
dazu würde es nicht fehlen. Es ist ein Reichtum von Gedanken mit
vollen Händen in diesen Kompositionen ausgestreut. Man gebe sich nur
der Betrachtung dieses Werkes hin, flüchte sich in diesen Zauberkreis,
den Richters Muse uns schuf, und lasse den stillen Frieden, der so
wohltuend aus diesen Bildern weht, und das durchaus „deutsche“,
gesunde, nie sentimentale Empfinden auf sich wirken.
[S. 77]

Abb. 97.
Zum Geburtstage. Aus
„Altes und Neues“. 1873.
Verlag von Alphons Dürr in Leipzig. (Zu
Seite 64.)
Unser stillfriedfertiger Meister war in seiner Stellung an der
Kunstakademie als Vorstand eines Ateliers für Landschaftsmalerei
auch Mitglied des Senates, oder, wie man es in Dresden nennt, des
„akademischen Rates“; er hat in Ausübung dieser Amtsverpflichtung sich
oft recht unbehaglich gefühlt. 1853, am 6. November, schreibt er in
sein Tagebuch ein: „In einer großen Kunst- und Künstlerstadt gibt’s
Parteien, und die besten Leute, wenn sie einer Parteifahne folgen,
saufen Unrecht wie Wasser, wie schon Hiob sagt, und schütten das Kind
mit dem Bade aus. Es ist ja bei uns Malern auch so, und ich bin froh,
daß ich, wie ich glaube, einen Standpunkt über den Parteien gefunden
habe. Ich weiß, was die Kunst ist und was sie fordert, freue mich
ihrer vielfachen Abstufungen und Richtungen, kenne ihre Verirrungen
und Abwege und begnüge mich freudig mit dem Winkelchen, wo mir meine
Stellung angewiesen ist, mögen sie andere über- oder unterschätzen,
das macht mich nicht irre.“ Zu solchen Äußerungen wurde er offenbar
durch lokale Vorkommnisse veranlaßt: In den Sitzungen des akademischen
Rates waren die Verhältnisse unter den einzelnen Mitgliedern etwas
zugespitzt. Es standen die sogenannte Münchener und die Düsseldorfer
Malerschule, durch Schnorr einerseits und Bendemann und Hübner
andererseits vertreten, rivalisierend sich einander gegenüber,
ebenso der große Bildhauer Ernst Rietschel, der geniale Schöpfer der
Braunschweiger Lessingstatue, des Goethe-Schillerdenkmals in Weimar,
der Urheber der gewaltigen „Luthergestalt“ in Worms, gegenüber dem
Bildhauer Ernst Hähnel, und es mag unserem Meister, dem nichts ferner
lag als Parteigetriebe, oft der Unfriede das Herz beschwert haben. Wie
oft seufzte er über die Last solcher Sitzungen! Er schreibt am 13.
Dezember 1849: „Ich lege kein sonderliches Gewicht darauf, ob einer
ein Künstler Nummer eins oder Nummer fünf oder sechs werde. Darauf
aber lege ich alles Gewicht, daß einer die empfangenen Gaben in gutem
Sinne für den Bau des großen, zukünftigen und in der Entwicklung stets
vorhandenen Gottesreiches zu verwenden gelernt hat. Keine Kraft, auch
die kleinste nicht, geht da verloren; sie ist ein Baustein für den
großen Tempel, den der Herr in, aus und mit der Menschheit sich erbauen
will und erbauen wird.“ Eine weitere Niederschrift vom Jahre 1850
beginnt: „Mir ist jedes Kunstwerk mehr Ausströmung der Empfindung,
ein flüchtiges Tummeln im Blütengarten der Kunst. Wenn die Nachtigall
in den Blüten singt, so ist das herrlich, aber wenn eine kleine Biene
drinnen summt, so freut man sich[S. 78] auch darüber, sie gehört ebensogut
in den Frühlingsgarten hinein wie Lerche und Nachtigall, und sie kann
auch gerade so viel davon genießen als jene Hauptkünstler, wenn sie
eben nur ihrer Natur getreu ist. Nur der eitle Kuckuck ist lächerlich.“
In Dresden, der Hochburg des Klassizismus, wurde er vielfach, seiner
„Kleinkunst“ wegen, hochmütig von oben herab angesehen, wie aus solchen
Aufzeichnungen auch klar hervorgeht. Die Zeiten wurden aber andere.
1858 bestellte die Fürstin Wittgenstein eine Zeichnung zu einem
Geschenk für Franz Liszt. Unser Meister zeichnete die Kindersymphonie
(Abb. 144). Das reizende Blatt erregte aber bei der fürstlichen
Bestellerin „Bedenken“: sie sandte es zurück. (Im Verlag von Gaber
& Richter erschien davon eine Lithographie von A. Karst.) 1859, zu
Schillers hundertjährigem Geburtstage, ernannte die philosophische
Fakultät der Universität Leipzig unseren Meister zum Ehrendoktor.

Abb. 98.
Rotkäppchen im Walde.
Bechsteins Märchenbuch. 1853.
(Zu
Seite 64.)
1859 vollendet Richter für E. Cichorius das Bild „Im Juni“, eine
Frühsommerlandschaft; es will scheinen, als wären römische Erinnerungen
in ihm wieder aufgetaucht, als hätte Tizians Landschaft in der Galerie
Camuccini (Abb. 11) ihn hierzu mit beeinflußt. Im Vorgrund in blumiger
Wiese unter blühenden Heckenrosen sitzt ein Liebespaar (ähnlich
wie in Rembrandts Radierung „die Landschaft mit den drei Bäumen“),
vielleicht Florizel und Perdita aus Shakespeares Wintermärchen; am
Rand eines Eichenwaldes lagert eine Hirtenfamilie, im Mittelgrund
erhebt sich junger Buchenwald, durch den über Felsen ein Wässerchen
rieselt, draußen sieht man einen in weite Fernen sich verlierenden
See, am Himmel schwimmen ballige Wolken, zwischen denen ein Stück
Regenbogen sichtbar ist. Abb. 145 ist nach einer flüchtigen Federskizze
zu diesem Bild, das in der Farbe schwer, aber in der Behandlung
weitaus breiter als frühere ist. Über zehn Jahre hatte das Ölmalen
des Illustrierens wegen[S. 79] ganz geruht. Die Frage drängt sich auf: Wie
würde der Meister sich fortentwickelt haben, wenn er im Anschluß an
den „Brautzug im Frühling“ weitere Ölbilder geschaffen hätte? Es ist
sein letztes größeres Ölbild. Eine etwas kleinere Wiederholung, von
seinem Schüler Adolf Arnold untermalt, vollendete er um das Jahr 1864
und stiftete es für die Lotterie zum Besten eines Fonds zur Erbauung
eines Künstlerhauses in Dresden. Für die Seinen, für seinen Sohn
Heinrich, für seinen Schwiegersohn Theodor Kretzschmar und seine beiden
Töchter Helene und Elisabeth, malte er in der Folge noch einige kleine
Ölbilder, meist Vorwürfe, die er bereits in Aquarell behandelt hatte.
Er ließ sich diese Bildchen von Schülern untermalen und machte sie dann
fertig. Eins dieser kleinen Bilder ist eine freie Wiederholung vom
„Kleinen Teich im Riesengebirge“. Eine „Ruhe auf der Flucht“, dasselbe
Motiv, das er in einer seiner letzten Aquarellen (Abb. 189) ähnlich
behandelte, ein Bild von nicht zu großem Umfang, untermalte er Anfang
der sechziger Jahre, auf Anraten eines sogenannten „Malenkönners“,
braun in braun; diese Untermalung ist aber, weil sie sich als ganz
unbrauchbar erwies, liegen geblieben; sein zunehmendes Augenleiden
erschwerte ihm das Malen mehr und mehr.

Abb. 99.
Hänsel und Gretel.
Bechsteins Märchenbuch. 1853. (Zu
Seite 64.)
Bei der Radierung der Platte „Christnacht“ hatten des Meisters Augen,
wie vorher schon berichtet, sehr gelitten; um das Jahr 1859 steigert
sich das Augenleiden, und es machen sich bereits in den Figuren gewisse
Verschiebungen und ein auffallendes mehr in die Breite Ziehen der
Formen bemerklich, eine Erscheinung, die mit den Jahren sich immer
mehr steigert und augenscheinlicher wird. Von jetzt ab muß er beim
Aufzeichnen auf den Holzstock fremde Hilfe heranziehen; man merkt
an den Holzschnitten die andere Hand gar bald heraus, besonders am
Figürlichen. Die Freiheit und Kraft des Striches geht verloren,
trockene Linienführung und ebenso trockene Strichlagen zeigen sich mit
wenig Ausnahmen mehr und mehr in den Holzschnitten.
[S. 80]

Abb. 100.
Die Christnacht.
Radierung. 1854.
Verlag von Alphons Dürr in Leipzig. (Zu
Seite 65.)

Abb. 101.
Ehre sei Gott in der Höhe!
Aus „Beschauliches und Erbauliches“. 1855.
Verlag von Georg Wigand in Leipzig. (Zu
Seite 66.)

Abb. 102.
Esel streck’ dich. Aus
„Beschauliches und Erbauliches“. 1851. Verlag von Georg Wigand in Leipzig.
(Zu
Seite 66.)
Ein reizendes Blatt ist die „Heimkehr vom Felde“, 1858 gezeichnet
(Abb. 146).
1858–1859 folgen vierundzwanzig Zeichnungen für Berthold Auerbachs
„Deutschen Familienkalender“, 1860 das Buch für kleine Kinder:
„Der gute Hirt“ mit neun Zeichnungen und 1862 „Es war einmal“ mit
einundvierzig Bildern.
[S. 81]
Die Anspruchslosigkeit dieser Bücher im Vergleich mit den oft
auffrisierten modernen Kinderbüchern hat etwas Wohltuendes und gibt
zu denken. Es sei uns gestattet, hier — gleichsam in Parenthese —
etwas abzuschweifen und vor dem Einfluß des „Fremden“ in unseren
Kinderbilderbüchern ein warnendes Wort auszusprechen. Um das Jahr
1880 brachen wie eine Sündflut englische Kinderbilderbücher von Kate
Greenaway u. a. über Deutschland herein. Richter sah die ersten dieser
Bücher sehr befremdet an. Die gemachte und gewaltsame englische
Naivetät und die Unnatur dieser Bücher wurden gar bald in Deutschland
Mode. Der Exportbuchhandel trug dazu mit bei. Nun verschwinden Moden
glücklicherweise bald wieder, aber wir kranken eigentlich immer noch
an deren Nachwirkungen. Das „Gemachte“, dem die englische Nation in
solchen Werken stark zuneigt, liegt uns doch zu fern und widerstrebt
dem deutschen Wesen. Möchte auch auf diesem Gebiete der von Grund aus
gesunde Sinn unseres deutschen Volkes solches Fremde, Unwahre und
Unechte fernerhin ablehnen und an seiner deutschen Eigenart festhalten!
Wenn wir uns doch das Schielen nach „Fremdem“ abgewöhnen wollten! Unser
Meister Richter hat uns hier die rechten Wege gewiesen und mit sicherem
Blick die Ziele gezeigt, welche zu erstreben sind. Man vergleiche
seine anspruchslosen, schlicht empfundenen Kinderbücher mit solchen
fremdländischen. Wir bringen aus dem Buche:[S. 82] „Es war einmal“ nur das
Schlußbild (Abb. 191): „Alles Ding hat seine Zeit, Gottes Lieb’ in
Ewigkeit.“

Abb. 103.
Was ihr getan habt dem
geringsten meiner Brüder —
Aus „Beschauliches und Erbauliches“. 1853. (Zu
Seite 66.)
Von „Folgen“ erschien 1861: „Der Sonntag“, über den wir schon anfangs
sprachen; wir bringen daraus den Holzschnitt „In der Kirche“ (Abb. 147).
Der Meister führt uns in das sogenannte „Betstübchen“ einer
protestantischen Kirche; Bürgersleute mit ihren Kindern lauschen
mit Andacht der Predigt; durch das Fenster sieht man im Gotteshaus
den Prediger auf der Kanzel und darunter die Gemeinde. Welch eine
liebreizende Gestalt ist das junge Mädchen, das so sinnend vor sich
hinschaut und das Gehörte in seinem Herzen bewegt! Weiter folgt das
romantische Blatt: „Ich bin krank gewesen, und ihr habt mich besucht“
(Abb. 148). Das genesende Kind sitzt vor dem Haus im Sonnenschein unter
blühendem Holunder, die Mutter erhebt dankerfüllt die Hände zu Gott;
ihr, der Witwe, „Liebling und Einziges“ ist von schwerer Krankheit
gesundet und zum erstenmal wieder unter Gottes freiem Himmel. Ein
kleines Mädchen bringt ihm einen Strauß Blumen von der Waldwiese,
Kätzchen und Hündchen spielen zu seinen Füßen, Tauben sonnen sich auf
dem niederen Dach; auf dem Waldwege schreitet zum Besuch des Kindes
eine weibliche Gestalt, begleitet von [S. 83]einer Dienerin, über beiden
Figuren schwebt ein Engel. Gewiß ist die schöne Komposition A. Rethels
„Die Genesende“ nicht ohne Einfluß auf die Gestaltung dieses Bildes
gewesen. Es folgt der Holzschnitt (Abb. 149) und eine Zeichnung (Abb. 150)
„Heimkehr“. Eltern und Kinder kehren vom Besuch auf dem Lande
durch wogende Kornfelder bei aufgehendem Vollmond nach der Stadt
zurück; von großer Anmut und Lieblichkeit sind die beiden singenden
Mädchen, die, Kränze im Haar, Blumengewinde und Lilien im Arm, den
Eltern voranschreiten. Nichts von unwahrer Künstelei oder[S. 84] Gemachtem
oder gar flacher „Steckbriefprosa“, wie sich unser Meister bei
Gelegenheit einmal ausdrückt!

Abb. 104.
Kinderlust. 1848. Aus
„Beschauliches und Erbauliches“. 1851.
Verlag von Georg Wigand in Leipzig. (Zu
Seite 67.)

Abb. 105.
Der Schäfer putzte sich zum
Tanz. Aus „Beschauliches und Erbauliches“. 1851.
(Zu
Seite 66.)
Im Jahre 1862 unterhandelte der preußische Kultusminister von
Bethmann-Hollweg mit Richter wegen einer Berufung an die Kunstakademie
in Berlin; er schätzte und verehrte unseren Meister sehr, die
Unterhandlungen zerschlugen sich aber, da der Minister bald darauf sein
Amt niederlegte. Erst im Jahre 1874 wurde Richter zum Mitgliede der
Berliner Akademie ernannt, als er bereits Stift und Palette aus der
Hand gelegt hatte.
1863 starb des Meisters Mutter, die große stattliche Frau, die bis
an ihr Lebensende sich ziemlich frisch und rege erhalten hatte; am
12. Oktober desselben Jahres starb auch seine zweite Tochter, Aimée,
verehelichte Gaber, im Alter von neunundzwanzig Jahren. Dr.
Heydrich schrieb der Heimgegangenen folgenden Nachruf:
O Herz voll Liebe, schlicht und treu,
Dein Tagewerk ist früh vorbei!
In Demut und in Frömmigkeit
War’s frisch und rüstig allezeit.
Leb wohl, Du Herz so tief und mild,
Leb wohl, Du lieblich Frauenbild!
Aufs neue mußte er durchkämpfen: „Wie ist das Kreuz so bitter!“
Aber auch diese Heimsuchungen ertrug er gottergeben, wenn auch tief
erschüttert. — Ins Jahr 1863 fällt eine Arbeit Richters, welche die
Freunde des „Daheim“ besonders interessieren wird: die gemütvolle
Kopfzeichnung des beliebten Familienblattes, welche den ganzen
traulichen Zauber des deutschen Hauses wiedergibt und von keinem
ähnlichen übertroffen wird (Abb. 151).

Abb. 106.
Ich habe mein Feinsliebchen so
lange nicht gesehn.
Aus „Beschauliches und Erbauliches“. 1851. (Zu
Seite 67.)
Um das Jahr 1864 erhielt Preller infolge der Ausstellung seiner
Odysseekartons einen Ruf an die Akademie in Dresden; diese Berufung
kränkte und verwundete Richter; er sprach wiederholt die Absicht
aus, seine Akademiestellung aufzugeben. Preller folgte schließlich
diesem Rufe nicht, der Großherzog hielt ihn in Weimar fest. Die
spätere Richtung Prellers schmeckte Richter zu sehr[S. 85] nach dem
Kompositionsrezept nach N. Poussin, seine späteren Zeichnungen nach
der Natur waren ihm zu sehr „geschrieben“. Die derbe Art Prellers im
persönlichen Verkehr hatte zudem für unseren zartbesaiteten Meister oft
etwas Unbequemes.

Abb. 107.
Entwurf zu Otto I. an der
Nordsee. Aus Bülau, Deutsche Geschichte. 1855–1858.
Verlag von Otto Spamer in Leipzig. (Zu
Seite 68.)
1864 folgt der „Neue Strauß fürs Haus“, — sechzehn Blätter. Von
dieser köstlichen Folge bringen wir zuerst das „Kleinhandel“ benannte
Bild (Abb. 152). Diese Komposition zeichnete Richter im Auftrage des
bekannten Goethe-Freundes S. Hirzel in Leipzig im Jahre 1856. Hirzel
hatte wiederholt den Wunsch geäußert, von Richter eine Zeichnung zu
besitzen zu der Stelle aus Goethes „Geschwistern“: „Mir ist’s eine
wunderliche Empfindung, nachts durch die Stadt zu gehen. Wie von der
Arbeit des Tages alles teils zur Ruhe ist, teils danach eilt und man
nur noch die Emsigkeit des kleineren Gewerbes in Bewegung sieht. Ich
hatte meine Freude an einer alten Käsefrau, die mit der Brille auf
der Nase beim Stümpfchen Licht ein Stuck nach dem anderen ab- und
zuschnitt, bis die Käuferin ihr Gewicht hatte.“ Der Meister ging mit
großem Interesse an den Auftrag und gestaltete so das prächtige,
malerische Bild, das unsere Nachbildung nach einer Wiederholung der
getönten Zeichnung aus demselben Jahre bringt. Der Holzschnitt von
Gerhard Jördens ist eine Musterleistung. Ein weiteres Blatt dieser
Folge ist das „Johannisfest“ (Abb. 153). Anmutig und frisch sind die
Kinder gezeichnet, die um die Blumenpyramide einen Reigen tanzen, ein
Brauch, der in Mitteldeutschland seit den sechziger Jahren wohl ganz
verschwunden ist; es liegt ein Zug holden Behagens über diesem Bilde.
Auch dieser Holzschnitt, von Kaspar Oertel, einem Schüler August
Gabers, wie Gerhard Jördens, ist eine vorzügliche Leistung. In der
Abb. 154 schildert unser Meister das erste Ofenfeuer. Wie ist’s hier
gemütlich im Stübchen! Draußen wettert es, Bello, der Hofhund, sitzt
auch im Trockenen. Es folgt Abb. 155: „Gruselige Geschichten“ erzählt
die Großmutter, alles Spiel ruht, hell leuchten die Augen der Kinder,
erschreckt fährt ein Kind beim Platzen des Bratapfels im Ofen zusammen.
Lieblich sind in dem folgenden Blatt die Kinder gezeichnet, die im[S. 86]
Walde Beeren gesammelt haben: „Beiß mal ab, Hänschen“ (Abb. 156). In
dieser Folge begegnen wir auch einem Blatt „Mondnacht“ und finden
hier dieselbe landschaftliche Szenerie, wie auf dem früher erwähnten
untermalten Bild und ähnlich wie in Abb. 189, aber mit veränderter
Figurengruppe. Weiter folgt „Weihnachtstraum“, die schöne Komposition
der Radierung „Die Christnacht“ variiert, aber vereinfacht, wie es das
kleinere Format des Holzschnittwerkes verlangte. Die hier angefügte
Gruppe der armen, frierend in einer Ecke sitzenden Kinder sind ein
glücklich gewählter Gegensatz zu dem Weihnachtszauber, der über das
ganze Bild ausgebreitet ist.

Abb. 108.
Zum 14. November 1853.
Kinderporträt.
(Zu
Seite 68.)
1866 radiert der Meister sein letztes Blatt, für E. Cichorius.
Die Platte trägt die Unterschrift: „Meinem Freunde E. Cichorius“.
Dargestellt ist eine Mutter, die vom Felde heimkehrt und ihr Knäblein
zärtlich herzt, zur Seite ein größeres Mädchen und der Spitz, der die
Sache betrachtet. Die liebenswürdige Gruppe von Mutter und Kind finden
wir bereits ähnlich in den Löschkeschen Büchern von 1852 und öfters
noch wiederholt und vielfach variiert, so auch in Abb. 146 in „Altes
und Neues“ usw.

Abb. 109.
Kinderporträt. 1857.
(Zu
Seite 68.)
Im selben Jahr erscheint „Unser täglich Brot“ mit achtzehn
Holzschnitten. Der Titel zeigt im Schriftband die Worte: „Alles
Vergängliche ist nur ein Gleichnis.“ Diese Folge schildert das Korn
vom Feld bis zur Mühle und als Brot im Haus, mit dem „Säemann“ und
„Engel gießen den Tau über die Fluren“ beginnend. Von der Ährenlese
geben wir in Abb. 157 eine freie und reicher gestaltete Wiederholung
der Komposition aus diesem Zyklus. Nach weiteren schönen Blättern
folgt „Zur Mühle“ (Abb. 158). Im Tale liegt lauschig unter schattiger
Linde eine kleine Mühle;[S. 87] im Gärtchen, das von Rosenbüschen eingehegt,
bleicht die Müllersmaid Wäsche, über den Zaun lehnt sich ein junger
Bursch und schaut dem Mädchen, das ihm Rosen an den Hut steckt,
treuherzig ins Gesicht; draußen windet sich durch sonnige hügelige
Landschaft der Weg nach der Höhe. Wie ein Bild von Van Eyck ist der
Schlußakkord: „Denn dies ist das Brot Gottes, das vom Himmel kommt und
gibt der Welt das Leben“ (Abb. 159). Maria sitzt mit dem Christuskinde
im dunklen Wald vor einem klaren, von Waldesblumen umsäumten Bronnen,
ihr zu Füßen musizierende und singende Engelchen voll kindlicher
Naivetät und Innigkeit. Allerhand Waldgetier und Waldvögel lauschen
den himmlischen Tönen; im Vordergrund links und rechts je ein
Wappenschild: das eine zeigt einen Apfel, das andere eine Rose im Kreuz
(beiläufig Luthers Wappen), das verlorene und wiedergewonnene Paradies
andeutend. Hinter der überaus lieblichen, zarten und reinen Gestalt
Marias ein Teppich und Geranke wilder Rosen, nach Art altdeutscher
und altitalienischer Meister, ihr zu Häupten halten zwei Engel das
Schriftband. Oben über dem Wald sieht man in hügeliger Gegend ein
Kapellchen im Sonnenschein erglänzen, darüber erheben sich hohe Berge.

Abb. 110.
Holde Augen sah ich blinken.
Zu „Der Schatzgräber“.
Aus dem Goethe-Album. 1853–1856. Verlag von Georg Wigand in Leipzig.
(Zu
Seite 69.)
Wir reihen hier das Blatt voll liebenswürdigen Humors und feiner
Charakteristik ein, das „ländliche Fest“ (Abb. 160). Trefflich ist die
Gruppe rechts, der junge Bursche, der so unbeholfen dem schüchternen
Mädchen, das, die Hände auf dem Rücken, am Baume steht, einen Strauß
Blumen reicht; es ist, als wenn das Mädchen sich bedächte, das
freundliche Gesichtel strahlt aber doch. Lieblich sind die tanzenden
Kindergruppen.
[S. 88]
1867 erscheinen bei Heinrich Richter fünfzehn Handzeichnungen in
Photographien, darunter vier italienische Landschaften mit Staffagen.
Die letzteren nebst einer ganzen Reihe solcher Blätter zeichnete er,
angeregt durch Berichte seiner Schüler C. W. Müller, A. Venus und
Verfassers aus Rom. In einem Briefe vom 25. April 1867 schreibt er
nach Rom: „Wie glücklich würde ich sein, wäre es mir möglich, noch
einmal die alma Roma zu sehen und zugleich fleißig einzuheimsen,
was mir früher nicht nach Wunsch gelingen wollte, weil ich noch zu
unreif war ... Die römischen Erinnerungen — vielleicht die schönsten
des Lebens — und die Sehnsucht, das Verlangen dahin regte sich von
neuem recht mächtig in mir.“ — Er suchte seine Studien aus Italien
hervor, machte sie mit kräftigeren Strichen fertiger, setzte Staffagen
hinein und erging sich in Erinnerungen. Wir geben von diesen Blättern
„An der Via Appia“ (Abb. 161) und „Brunnen bei Arriccia“ (Abb. 162),
letzteres eine freie Wiederholung von Abb. 17 vom Jahre 1831. In
diesem Hefte finden wir auch in etwas veränderter Form die im Korn
schlafenden Kinder, die er bereits früher in „Fürs Haus“ gebracht
hatte: die Schwester und der Bruder sind eingeschlafen, das ihrer Obhut
anvertraute kleine Geschwisterchen im Wägelchen ist in traulicher
Unterhaltung mit einem Engel in lichtem Gewande. Diese Komposition
hat er einmal in Aquarell ausgeführt; es ist das größte Blatt seiner
zahlreichen Aquarellen. Eine Variante desselben Gegenstandes, eine
köstliche Aquarelle vom Jahre 1861 geben wir hier in einer farbigen
Reproduktion (Abb. 164). Ein lauschiges, stilles Plätzchen im wogenden,
reifen Korn, das der Wind leise bewegt; silberne Wölkchen schwimmen am
Himmel, auf dem sich im Korn verlierenden Pfad lauscht ein Häschen;
das Brüderchen hält sein Mittagsbrot und ein Sträußchen in den Händen,
Schwesterchen hat den Arm schützend über das Brüderchen gelegt. Am
Tragkorb lehnt das Wasserkrügel, das Hündchen hält getreulich Wacht,
links im Vordergrunde ein rieselndes Quellchen, am Feldrand ein Strauch
blühender Heckenrosen, — ein Bild friedlicher, mittägiger Stille.
Gleichzeitig gab Heinrich Richter auch das „Photographische
Richter-Album“ in Kabinettformat heraus, fünfzehn Originale, in der
Zeit von 1858–1865 gezeichnet, die meistens schon als Holzschnitte
in verschiedenen Werken erschienen waren. Wir finden hier auch eine
reizvolle Variante der Komposition „Genoveva“ von 1865 und die 1858
gezeichnete Kindersymphonie.

Abb. 111.
Zu Hermann und Dorothea.
Aus dem Goethe-Album. 1853–1856. (Zu
Seite 69.)
[S. 89]
1867 starb des Meisters alter Freund, der Maler Wilhelm von Kügelgen,
der Verfasser des weit bekannten Buches: „Jugenderinnerungen eines
alten Mannes“, der in treuester, herzlichster Freundschaft seit den
römischen Jugendtagen ihm zugetan war.
1869 erscheint „Gesammeltes“ mit achtzehn Holzschnitten. Ein anmutiges
Schneewittchen eröffnet die Reihe der Bilder, dann folgt die
„Laurenburger Els“ mit dem Knäblein im Arm, aus der „Chronika eines
fahrenden Schülers“ von Clemens Brentano. „Auf dem Berge“ (Abb. 163),
eine Gruppe anmutiger lieblicher Mädchen auf einem Hügel gelagert,
draußen ein herrliches Landschaftsbild mit weiten Fernen über einem
See. Diese Komposition hat er mehreremal in Aquarellen wiederholt, die
sich durch einen besonders feinen Farbenton auszeichnen und zu seinen
vollendetsten Blättern zählen. Eine lustige Kinderszene (Abb. 165)
spielt in blumiger Wiese am Mühlbach. Die Abb. 166 schildert humorvoll
den noch bis zu Anfang des neunzehnten Jahrhunderts in Thüringen
und im übrigen Mitteldeutschland gepflogenen Brauch der Aufzüge der
heiligen drei Könige, zu dem bekannten Goetheschen Liede: „Die heil’gen
drei Könige mit ihrem Stern, sie essen, sie trinken und zahlen nicht
gern.“ Und weiter folgt „Feierabend“ (Abb. 167): Auf der Straße
belustigen sich Kinder mit „Ringel-Ringel-Reihe“, Mütter und Großmütter
erfreuen sich am munteren Spiel der Kleinen. Im Gärtchen ein Mädchen,
Rosen pflückend, im Gespräch mit einem jungen Mann, sicher einem
braven Handwerksmeister. Lange Schatten breiten sich über die tiefer
liegende Stadt; der alte, im Abendsonnenschein glänzende Turm wird
von Turmschwalben umkreist, die Abendglocke läutet. Auch hier tauchen
Erinnerungen an die Meißner Zeit im Meister auf. Es ist ein eigenes
Ding mit Erinnerungen aus der Jugendzeit; Leid und Weh, und seine
Meißner Zeit war für ihn vielfach eine Leidenszeit, verblassen mehr und
mehr, ein rosiger Schimmer verklärt die längst entschwundenen Zeiten.
1869 zeichnete er zu einem zweiten Band von Georg Scherers
„Illustriertem Deutschen Kinderbuch“ neunzehn Blätter für Holzschnitt
und ein Blatt, die „verirrten Kinder“, zu einer Radierung, von L.
Friedrich ausgeführt. Von den Holzschnitten geben wir nur Abb. 168,
eine Variante der bereits früher besprochenen „Herbststimmung“ (Abb. 142).
Es existiert aus derselben Zeit von demselben Gegenstand eine
sehr schöne, leicht getönte Zeichnung.

Abb. 112.
Schreiben ist ein geschäftiger
Müßiggang. Götz von Berlichingen. Aus dem Goethe-Album. 1853–1856.
(Zu
Seite 67.)
[S. 90]
Vom 15. Dezember 1868 datiert ist eine auf der Vorder- und Rückseite
bezeichnete Visitenkarte (Abb. 169 und 170). Der Meister war durch
„Hexenschuß“ verhindert, am Stammtisch zu erscheinen; teilnehmend gibt
einer der Genossen an der Tür ein frisches Glas „Echtes“ ab. Gerührt ob
solcher Tat zeichnete er die Karte.
Der alte Freund Richters, der Münzgraveur Krüger, den Heinrich Richter
in den Nachträgen zur Biographie so trefflich charakterisiert, war
ein Feind der Photographie; die Freunde des Stammtisches wünschten
aber ein Bild von diesem originellen Mann zu besitzen. Da zeichnete
Richter das Blatt (Abb. 171), „Den Stammtischgenossen 1870“ gewidmet,
„Die Einsiedler von Loschwitz“ mit Luthers Lied an die Frau Musica. In
der Lünette oben links sitzt lesend der Meister selbst, rechts davon,
seinen Garten bestellend, und drunten, im Stübchen geigend, sehen wir
den Münzgraveur.
Beim Beginn des Wintersemesters 1869 ließ sich der Meister seines
zunehmenden Augenleidens wegen von dem Klassenunterricht an der
Akademie entheben und dieses Amt auf jüngere Schultern legen. Von da ab
leitete er nur noch das Atelier für Landschaftsmalerei.

Abb. 113.
Es war einmal. Götz von
Berlichingen.
Aus dem Goethe-Album. 1853–1856. (Zu
Seite 70.)
Am 13. November 1870 starb des Meisters alter Freund, der Kupferstecher
Professor Julius Thäter in München, bekannt durch seine Stiche nach den
Camposantokompositionen von Cornelius, nach Schnorrs Freskomalereien
in München, nach Schwinds „Ritter Kurts Brautfahrt“ usw. Das denkbar
innigste Freundschaftsverhältnis, das zwischen beiden Künstlern seit
vielen Dezennien bestand, fand damit seinen Abschluß. Thäter, geboren
in Dresden 7. Januar 1804, wirkte in Dresden, Weimar und München.
Seine Tochter Anna hat seine Selbstbiographie und Briefe unter dem
Titel: „Julius Thäter, das Lebensbild eines deutschen Kupferstechers“
(Frankfurt a. M., Johannes Alt) herausgegeben. Wir finden hier auch
den Briefwechsel zwischen beiden Freunden, aus denen man ersieht, wie
beide Künstler sich verstanden, wie ihre beiderseitigen religiösen
Anschauungen sich deckten und sie durch diese innerlich verbunden waren.
Um 1870 beschäftigte sich Richter mit den ersten Entwürfen zur „Schönen
Melusine“; der Stoff war ihm vertraut von den Volksbüchern her, die er
in den vierziger Jahren illustriert hatte. Nur ein Blatt ist fertig
gezeichnet: die Begegnung Raimunds mit Melusine an der Waldquelle
(Abb. 172). Der Meister ließ dann aber den Plan, diesen romantischen
Stoff in einer Reihe von Bildern zu behandeln, wieder fallen. Möglich,
daß der 1871 in Dresden ausgestellte wundervolle Zyklus zur „Schönen
Melusine“ von Schwind ihn lahm legte, vor allem aber mag die abnehmende
Schaffenskraft und das fortschreitende Augenleiden ihn an der weiteren
Verfolgung des Planes gehindert haben.
[S. 91]

Abb. 114.
Der rauhe Herbst kommt wieder.
Aus „Christenfreude“. 1855.
Verlag von Alphons Dürr in Leipzig. (Zu
Seite 70.)
Es liegt nahe, bei dem Namen Schwind die Verwandtschaft und die
Unterschiede zwischen ihm und Richter zu beleuchten. Friedrich Pecht
sagt in dem trefflichen Aufsatz über Richter in „Deutsche Künstler des
XIX. Jahrhunderts“: „Am meisten verwandt ist Richter unstreitig mit
Schwind, der ja aus dem gleichen Dürerschen Quell geschöpft. Aber wo
der eine anfängt, hört der andere auf; sie ergänzen sich wechselseitig,
ohne sich eigentlich zu berühren, denn wie Richter, selbst dazu
gehörend, nur das Volk, den niederen Bürgerstand schildert, so Schwind,
ein geborener Edelmann, nur die höheren Stände, das Rittertum, kurz das
Aristokratische.“ H. W. Riehl schreibt in seinen „Kulturgeschichtlichen
Charakterköpfen“: „Schwind und Richter waren zwei so grundverschiedene
und zugleich so geistesverwandte Persönlichkeiten, — der hagere,
ruhige, innerlich so warme Sachse und der gedrungene, korpulente,
vollblütige, lebensprühende Wiener. In ihrem Ideal und in neidloser
Anerkennung standen sich beide brüderlich nahe: Richter, der das Wahre
so poetisch, und Schwind, der die Poesie so wahr gemalt hat.“ — Es
hat etwas Rührendes, wie beide Meister sich gegenseitig wahrhaft
hochschätzten. Für Schwind und dessen Kunst war unser Meister hoch
begeistert. Wie erglänzten seine Augen, wenn er über dessen romantische
Schöpfungen sprach! Es gab keinen Zeitgenossen, für den er so schwärmen
konnte, wie für Schwind. Beide Meister verstanden sich, wie es
wohl selten wieder der Fall sein wird. Über Schwinds etwas scharfe
„Ausdrucksweise“ und Bemerkungen, die dieser treffliche Künstler
oft beliebte, ging unser Meister, wenn ihm diese erzählt wurden,
mit Lächeln und Stillschweigen oder wenigstens mit großer Nachsicht
hinweg; ihm war die Kunst dieses Mannes so ans Herz gewachsen, daß er
solche kleine „Eigenheiten“ gern übersah. Um 1845 bemühte sich die
Dresdener Akademie, Schwind zu berufen; die Unterhandlungen zerschlugen
sich aber. Richard Wagner spricht sich bei Gelegenheit darüber aus,
wie es ihm imponiert habe, daß die Dresdener Maler sich so „neidlos“
um Schwinds Berufung bemüht; da wird wohl unser Richter mit einer
der ersten gewesen sein, der dem trefflichen Meister Sympathien
entgegenbrachte. — Am 11. Februar 1871 schreibt unser Meister ins
Tagebuch: „Am 8. Februar, nachmittags fünf Uhr, ist der liebe Freund,
der große Meister Schwind, den ich verehrte fast wie keinen anderen,
gestorben. Sein letztes, tief ergreifendes, mit Mozartscher Schönheit
erfülltes Werk: ‚Die schöne Melusine‘, läßt den unersetzlichen Verlust
doppelt schmerzlich empfinden. (Schwinds Zyklus zur ‚Melusine‘ war,
als die Todesnachricht kam, in Dresden ausgestellt.) Die ‚Melusine‘
ist das wehmütige Ausklingen einer großen, herrlichen Kunstepoche.
Jetzt geht alles auf äußeren Glanz und Schein, mit wenig oder gar
keinem idealen Gehalt. Wo der Glaube an die höchsten Dinge schwindet,
wo unser heiliger Christenglaube nicht die Grundlage bildet, nicht
die Zentralsonne ist, entsprießt kein lebenquellender Frühling mehr,
entstehen nur künstlich glänzende Treibhausfrüchte einzelner[S. 92] Talente.
Das ist meine feste Überzeugung! Und darüber ließe sich gar viel sagen
und schreiben; aber wer versteht es, und wer nimmt es auf?“ Richter war
fest davon überzeugt, daß die eigentliche große Kunst nur im Dienst
der Kirche sich entwickeln und gedeihen könne; in den letzten Jahren
sah er aber, wie man in der Kunst immer mehr andere Wege einschlug.
Heute gibt es, wenigstens was die Malerei betrifft, eine kirchliche
Kunst kaum mehr. An den Pflegestätten der Kunst, den Kunstakademien in
Deutschland, wird sie nicht mehr gepflegt, es finden sich dafür auch
keine Lehrer mehr. In Wien suchte man 1895 eine akademische Lehrkraft
für katholische kirchliche Kunst, an Stelle Trenkwalds, des Nachfolgers
Josef von Führichs, fand aber für dieses Fach keine geeignete und hat
vorderhand davon absehen müssen, diese Stelle überhaupt zu besetzen.
Die Maler haben sich von den religiösen Darstellungen mehr und mehr
abgewendet, sie können die rechte Begeisterung dazu nicht mehr finden.
Die religiösen oder biblischen Werke der letzten Jahrzehnte vermochten
auch nicht mehr, im Volke innerlich anregend zu wirken. Was mag die
Ursache dieser auffallenden Erscheinung sein? Es hat den Anschein,
als bereite sich auf religiösem Gebiet eine große Umwandlung vor.
In vielen Schichten der germanischen Völker arbeitet es mächtig auf
„Vertiefung“ hin, auf Erweiterung der Anschauungen über die höchsten
Dinge, aus einem „tiefernsten, innerlichen religiösen Sehnen“ heraus.
Wir haben jetzt nur noch einen einzigen Künstler in Deutschland,
der, wenn auch mit einer gewissen Unfreiheit, an die alten Meister
anknüpfend, es versteht, mit wirklicher Begeisterung und innerem Feuer
biblische Stoffe uns wieder nahe zu bringen, das ist E. v. Gebhardt in
Düsseldorf. Am Anfang des Jahres 1884 sah Richter von ihm das Bild „Der
Leichnam Christi im Hause der Maria“. Er erwähnt das Bild in dem am
Schluß angefügten Briefe.

Abb. 115.
Ich und mein Haus wollen dem
Herrn dienen. Aus „Christenfreude“. 1855.
(Zu
Seite 71.)
Die Kriegsjahre von 1866 und 1870 forderten Richters ganze Teilnahme.
Mit einer wahrhaft gehobenen Stimmung ging er, begleitet von seinem
Sohn und vom Verfasser,[S. 93] zur Ausübung seiner Wahlpflicht für den ersten
Norddeutschen Reichstag zur Wahlurne; es war, als ahnte er die
kommende große Zeit der endlichen Zusammenfügung unseres Deutschen
Reiches, unseres Vaterlandes. Die Einigung der deutschen Völker
innerhalb acht Tagen nach der Kriegserklärung im Jahre 1870 ist ihm
„wie ein Wunder“ und reißt ihn zu heiliger Begeisterung hin. Wie Gott
unsere Kriegsheere so herrlich von Sieg zu Sieg führte, der große Tag
von Sedan, der endliche Einzug in Paris und der Friede von Frankfurt,
der diesen Riesenkampf der Germanen mit den Romanen abschloß, —
das alles erfüllte ihn mit innigster Dankbarkeit gegen Gott. Seine
Aufzeichnungen aus dieser Zeit sind durchdrungen von der Größe und
hohen Bedeutung dieser Ereignisse. Er erwartete wohl auch, daß diese
große Zeit befruchtend auf die deutsche Kunst einwirken würde, wie dies
in seiner Jugend die nationale Erhebung und die Befreiungskriege getan.
Es sind eine ziemliche Zahl von Zeichnungen vorhanden, die ursprünglich
Pausen zur Übertragung auf den Holzstock waren; in den letzten Jahren,
in denen Richter nur noch mit Mühe arbeiten konnte, ließ er sich
solche Pausen auf Börners Rat aufziehen, überarbeitete und färbte sie
leicht in seiner so geistreichen Art und vollendete auf diese Weise
noch manches reizvolle Blatt oder Blättchen; das im Gras sitzende
Mädchen (Abb. 173) ist ein solches Blatt und stammt wohl aus der
Zeit nach 1870. — 1871 berichtet Richter in seinen Aufzeichnungen
von dem schon früher erwähnten Bilde von Schnorr zu dem Liede
„Jerusalem, du hochgebaute Stadt“: „daß der Meister Schnorr es selbst
seinen Schwanengesang nennt“, und fährt dann fort: „Der Gedanke ist
sehr schön, für die Ausführung reichen die Kräfte nicht mehr aus.
Es hat etwas tief Rührendes, eine solche Künstlergröße im letzten
Abendsonnenstrahl zu sehen; denn wenn er auch noch eine Reihe von
Jahren verleben sollte, so fühlt und sieht man doch, daß seine Kraft
sehr gebrochen ist. Die Größe seines Talentes bleibt unbestritten;
aber daß er ein edler, reiner, höchst gewissenhafter und frommer Mann
ist, das ist wohl das Erfreulichste und Schönste.“ Im Jahre 1872 nahm
der Tod unserem Meister auch diesen Freund, für den er sein ganzes
Leben hindurch seit den herrlichen Jugendtagen in Rom eine unbegrenzte
Verehrung hegte und bis an sein eigenes Lebensende bewahrte, wie ich so
oft aus seinem Munde zu hören Gelegenheit hatte.

Abb. 116. Ein getreues Herz zu wissen.
Aus „Altes und Neues“. 1873.
Seinem Freund Cichorius zeichnet er Weihnachten 1871 das Blatt „Aus
der Jugendzeit“: Der Freund mit seinem Bruder, späterem Bürgermeister
von Leipzig, in der Kinderzeit mit der Mutter in einem der reizenden
Loschwitzer Täler. (Abb. 174.)[S. 94] Zum 4. September 1873 zeichnet er
wieder ein Enkelkind (Abb. 176) dem Schwiegersohn Kretzschmar und fügt
das Verslein bei:
Bruder Martin bin ich genannt,
auch als Hahnekämmchen bekannt,
Großpapa, der schlecht sieht, hat mich gemalt,
derweil ich gewackelt, gelacht und gedahlt,
dafür hab’ ich auch nichts bezahlt.
Der liebe Gott laß mich gedeihn und wachsen
und mache aus mir einen braven Sachsen.
Amen.
1872 erschienen in Photographien die bereits 1845 als Lithographien
herausgegebenen zwölf Titelblätter zu Musäus’ Volksmärchen nach den
Originalen im Städelschen Institut in Frankfurt a. M. Wir brachten eine
freie spätere Wiederholung des einen Blattes, zu „Stumme Liebe“, früher
in Abb. 43.

Abb. 117.
Der Mond ist aufgegangen.
Aus „Christenfreude“. 1855. (Zu
Seite 71.)
1873 folgte „Altes und Neues“, fünfzehn Zeichnungen in Lichtdruck.
Eine Sammlung von gleicher Schönheit und poetischer Gestaltung wie
die vorangegangenen. Wir geben zuerst eine Aquarelle von 1865 in
farbiger Reproduktion, „Kartoffelfeuer“, ein Herbstidyll (Abb. 175),
die bis auf kleine Abweichungen im Mittelgrund dem in dieser Folge
aufgenommenen Blatt gleich ist; weiter aus der „Christenfreude“
wiederholt die liebenswürdige, innige Gruppe zu „Ein getreues Herz zu
wissen“ (Abb. 116). „Mailust“, ein Frühlingsidyll von graziöser Form,
im Loschwitzer Charakter, mit einer reizenden Staffage (Abb. 177). „Zum
Geburtstage“ (Abb. 97), „Sub rosa“ (Abb. 178): ein junges Paar schaut
träumerisch aus dem rosenumrankten Erker des Hauses — es ist offenbar
ein Jägerhaus — in eine romantische Landschaft hinaus. Unten auf
grüner Matte schreiten Hirsche und Rehe, weiter sieht man einen See mit
steil abfallenden Ufern, leichte Wolken ziehen an den Bergen hin. Im
Vordergrund Blumentöpfe und „Waldmann“. Als sechstes Blatt fügen wir an
„Wenn ich dich hätte“ (Abb. 179) vom Jahre 1870. Die Anregung zu dieser
Kindergruppe gab dem Meister die Stelle aus Goethes „Werther“ vom
26. Mai: „Das erste Mal, als ich durch einen Zufall an einem schönen
Nachmittag unter die Linden kam, fand ich das Plätzchen so einsam. Es
war alles im Felde; nur ein Knabe von ungefähr vier Jahren saß an der
Erde und hielt ein anderes, etwa halbjähriges, vor ihm zwischen seinen
Füßen sitzendes Kind mit beiden Armen wider seine Brust, so daß er ihm
zu einer Art von Sessel diente, und ungeachtet der Munterkeit, womit er
aus seinen schwarzen Augen herumschaute, ganz ruhig saß. Mich vergnügte
der Anblick; ich setzte mich auf einen Pflug, der gegenüberstand, und
zeichnete die brüderliche Stellung mit vielem Ergötzen.“ Zum Schluß
bringen wir noch „Heimkehr der Landleute nach Civitella“, eine freie
Wiederholung des 1827 gemalten Bildes, das wir früher erwähnten
(Abb. 180).
[S. 95]
Das folgende Jahr brachte „Naturstudien, zehn Vorlegeblätter für
Landschaftszeichner“, in Lichtdruck, im Verlage von Meyer & Richter,
und seine letzte Folge von Zeichnungen „Bilder und Vignetten“. Aus
letzterer sind die vier Jahreszeiten und ländliche Szenen, die Richter
nach 1862 im Auftrage des damaligen Erbprinzen von Meiningen für dessen
Landhaus in Bad Liebenstein in Thüringen zeichnete. Er verzichtete
zum großen Kummer seiner Schüler darauf, diese Arbeiten selbst an
die Wand zu malen, die Kartons in der wirklichen Größe zu zeichnen
und lieferte nur die Kompositionen in kleinen Zeichnungen. Über die
Ausführung selbst überließ er dem Erbprinzen freie Verfügung. Diese
Zeichnungen wurden von den Gebrüdern Heinrich und August Spieß in
München vergrößert und an den Außenwänden zwischen den Fenstern al
fresco gemalt. Wir geben davon nur den „Sommer“ (Abb. 181) und
weiter von den anderen Bildern dieser Folge die reizende Vignette
„Alles mit Gott, so hat’s keine Not“ (Abb. 182) in Holzschnitten und
zwei Nachbildungen nach fein empfundenen Zeichnungen: (Abb. 183)
„Ein Mädchen, das ein im Arm haltendes Knäbchen küßt“ und (Abb. 184)
„Zwei kleine sich küssende Kinderchen“. Während Richter seither nur
teilweise noch selbst auf den Holzstock aufzeichnete, mußte er hier,
seines vorgeschrittenen Augenleidens wegen, die Aufzeichnung ganz von
fremder Hand herstellen lassen; dadurch haben diese Holzschnitte in
der Wiedergabe der Zeichnung leider sehr viel von ihrer ursprünglichen
Frische verloren.
Gleichzeitig bringt derselbe Verlag vierundzwanzig vierfach vergrößerte
frühere Holzschnitte als Wandbilder, die, vom deutschen Volke
freundlichst aufgenommen, in den Kinderstuben und in manchem engen
Stübchen, vielleicht als einziger Schmuck an der Wand, ihren Platz
fanden.
Bei Velhagen & Klasing erschien in demselben Jahre „Robert Reinicks
Märchen-, Lieder- und Geschichtenbuch“ in zweiter Auflage, wozu Richter
noch eine Illustration für den Holzschnitt zu „Der schmelzende Koch“
zeichnete: Kinder belustigen sich mit einem Schneemann. Der Holzschnitt
ist mit der Jahreszahl 1873 bezeichnet. Dies ist des Meisters letzte
Illustration.

Abb. 118.
Jesu, komm doch selbst zu mir.
Aus „Christenfreude“. 1855. (Zu
Seite 71.)
1876 erschienen „Biblische Bilder“ mit Versen von Julius Sturm bei F.
Riehm in Basel. Elf dieser Holzschnitte stammen aus den Jahren 1850
bis 1855 und sind für die kleinen Schriften Löschkes: „An der Krippe
zu Bethlehem“, „Kreuz und Grab des Erlösers“ u. a. gezeichnet worden,
fanden aber dort keine Aufnahme. Wir nennen nur: „Die Hirten und Kinder
an der Krippe“ und „Die Flucht nach Ägypten“, beide lehnen sich an
Rembrandtsche Kompositionen an. „Lasset die Kindlein zu mir kommen!“
— wie oft hat er diesen Gegenstand behandelt! Immer weiß er ihm eine
neue Seite abzugewinnen. „Der gute Hirt“ in diesem Buche ist von E.
Peschel gezeichnet. Das reizvollste Blatt in dieser Folge ist „Herr,
bleibe bei uns“; durchaus deutsch in der Auffassung ist[S. 96] hier besonders
die Landschaft und von entzückender Schönheit. Derselbe Verlag brachte
gleichzeitig „Kinderleben“ in Bild und Wort, mit Versen von Jul. Sturm.
Es sind die Holzschnitte aus den Löschkeschen kleinen Büchern von
1850 bis 1853: „Was bringt die Botenfrau“, „Kraut und Rüben“ und die
„Familienlieder“, Werke, die wir schon früher erwähnten.

Abb. 119.
Es kostet viel, ein Christ
zu sein.
Aus „Christenfreude“. 1855. (Zu
Seite 71.)
Eine der romantischsten Kompositionen, aus dem Jahre 1870, ist das
„Schneewittchen“ (Abb. 185), eine zarte, liebreizende Märchengestalt,
die zu des Meisters anmutigsten Gebilden zählt; unberührt und sinnig,
halb träumerisch schaut sie auf die Rehe, die aus ihrem aufgenommenen
Kleid ihr Futter nehmen. Die landschaftliche Szenerie ist von echter
Waldespoesie durchdrungen: Ein trauliches Plätzchen am plätschernden
Brunnen, mit Tauben und allerhand Waldvögeln und Eichhörnchen belebt,
unter hängenden Rosen windet sich zwischen Felsen ein Treppchen hinauf,
oben in der Felsnische hängt ein Glöckchen, draußen dunkler Tannenwald.
Die schöne Aquarelle befindet sich in der Nationalgalerie. Der Zufall
hat es gefügt, daß eine Wiederholung derselben aus gleicher Zeit, durch
das Vermächtnis des Sohnes des Konsuls Wagner (des Stifters des Stammes
der Nationalgalerie), auch ebendahin gekommen ist. Einen ersten Entwurf
zu der Gestalt des Schneewittchen (Abb. 186) und eine Skizze nach der
Natur (Abb. 187) fügen wir bei.

Abb. 120.
Müde bin ich, geh’ zur
Ruh’.
Aus „Christenfreude“. 1855. (Zu
Seite 71.)
Zu des Meisters siebzigstem Geburtstage geht ein überaus gnädiges
und wohlwollendes Handschreiben mit Glückwünschen vom König Ludwig
II. von Bayern ein.
Richters so reiche Phantasie versiegte allmählich: das Augenleiden[S. 97]
verschlimmerte sich und machte ihm das Arbeiten fast unmöglich.
Trotzdem zeichnete und malte er noch einige wenige Blätter, wenn
auch mit großer Mühe und vielfacher Unbequemlichkeit. Aus der Zeit
des „Ausklingens“ dieser großen schöpferischen Kraft stammt die
Aquarelle „Schlafende Kinder“ (Abb. 188), eine freie Wiederholung der
Radierung „die verirrten Kinder“ in Scherers illustriertem „Deutschen
Kinderbuch“. Auf einer Anhöhe auf grüner blumendurchwirkter Matte
schlummern, ermüdet von der weiten und beschwerlichen Wanderung, ein
Mädchen und ein Knabe; es ist so einsam[S. 98] und still da droben, draußen
ragt über blauen Bergzügen ahnungsvoll ein Schneeberg hervor. Die
Aquarelle ist von großer Vollendung in Ton und Farbe.

Abb. 121.
Kunst bringt Gunst. 1855.
Zu Bürkners Holzschnittmappe. 1858. (Zu
Seite 71.)
Es folgt um 1873 seine letzte ausgeführte Aquarelle „Ruhe auf der
Flucht“ (Abb. 189), in der Nationalgalerie. Maria, an einem Feuer
sitzend, nährt das Kind, sie schaut wie in Gedanken versunken; unter
blühenden Fliederbüschen, an die Felswand angelehnt, ist Joseph
eingeschlafen, auf einem vorspringenden Felsen sitzen drei singende
und musizierende Engel in lichten Gewändern, ein Reh mit Jungen hat
sich im Gras gelagert, draußen im Dämmerlicht ein stiller Waldsee,
hinter dunklen Baumsilhouetten der Vollmond. — Das ist des Meisters
romantischer Schwanengesang. Mit wieviel Mühe, Geduld und Ausdauer
hat er an diesem Blatt noch gearbeitet; die Augen wurden schwächer
und schwächer und trotz der Lupe wollte es mit dem Arbeiten nicht
mehr gehen. Die Verschiebungen in der Zeichnung, die das Augenleiden
verursachte, wurden immer stärker und auffallender, die Köpfe der
Figuren machten ihm dadurch noch ganz besondere Schwierigkeiten. Der
Kopf der Maria wurde so oft geändert und weggewaschen, bis schließlich
das Papier durchgerieben war und er tief bekümmert die sonst fertige
Arbeit beiseite gestellt hatte; doch wurde hier Rat geschafft, und
endlich konnte er dieses Blatt noch vollendet aus der Hand geben. Eine
farbige Zeichnung ist vom Meister selbst bezeichnet: „Meine letzte
Zeichnung. 1874. L. Richter.“ Am Silvesterabend 1873 schreibt er:
„Seit dem Herbst konnte ich nichts mehr arbeiten, die Augen waren zu
schwach. Überhaupt fühle ich das Alter, und die Kräfte, Leibes- und
Seelenkräfte, nehmen ab.“

Abb. 122.
Der Spielengel.
Titelbild zu Stern: „Das rote Buch“. 1856.
Mit Genehmigung der Verlagshandlung Breitkopf & Härtel in Leipzig. (Zu
Seite 71.)
Die nun abgeschlossene künstlerische Tätigkeit dieses mit so reichen
Gaben ausgestatteten Künstlers, dieses gottbegnadeten Poeten, liegt wie
eine stille blumige Waldwiese vor uns, mit Sternblumen und Steinnelken,
Ranunkeln und Vogelstern und Arnika, blauen Glocken und hochstengeligem
Enzian, bunt durcheinander, in reicher Fülle, herzerfreuend und
herzerquickend. Sein gesamtes künstlerisches Schaffen ist wie ein
Dokument; verbrieft und gesiegelt, schildert es wahr und treu unser
deutsches Volk. Seine Werke sind wie ein sprudelnder frischer Quell, an
dem sich noch die fernsten Geschlechter erquicken werden!
[S. 99]

Abb. 123.
Geheiliget werde dein Name.
Aus dem Vaterunser. 1856.
Verlag von Alphons Dürr in Leipzig. (Zu
Seite 71.)

Abb. 124.
Dein Reich komme. Aus dem
Vaterunser. 1856. (Zu
Seite 71.)
Ernst Förster nennt in seiner deutschen Kunstgeschichte Richter
„einen Künstler, der seinesgleichen nicht nur nicht hat und gehabt
hat in keinem Lande und zu keiner Zeit, sondern der auch mit seinen
Schöpfungen alle Welt entzückt, sich eine Wohnung gemacht hat in
allen natürlich empfindenden Herzen, bei jung und alt, bei männlich[S. 100]
und weiblich, durch dessen Hände die Natur selbst spricht und die
Seele und dessen Zeichnungen der wahrste Ausdruck des Besten sind,
was das Vaterland an Land und Leuten Herzerfreuendes und Erquickendes
hervorgebracht.“
In den Jahren 1869 bis 1879 schrieb Richter seine Biographie, 1880 und
1881 die Nachträge dazu.

Abb. 125.
Erlöse uns von dem Übel.
Aus dem Vaterunser. 1856. (Zu
Seite 71.)

Abb. 126.
Märchen vom Marienkind.
(Zu
Seite 72.)

Abb. 127.
O zarte Sehnsucht, süßes
Hoffen, der ersten Liebe gold’ne Zeit.
Aus Schillers Glocke. 1857. Verlag von Alphons Dürr in Leipzig. (Zu
Seite 73.)
In dem oberhalb Dresden reizend gelegenen Loschwitz brachte Richter
mit den Seinen seit 1852 jeden Sommer bis zum Jahre 1883 zu. Hier
starb, wie schon vorher erwähnt, 1854 seine geliebte Frau. Mitten in
heiterster Stimmung, umgeben von den Ihrigen und von Freundinnen,
sank sie plötzlich im Garten nieder und hauchte nach wenig Stunden in
der Nacht vom 3. zum 4. August ihre Seele aus. Seinem Freunde Thäter
schreibt der Meister (Nachträge zur Biographie von H. Richter): „Am[S. 101]
3. August waren wir nachmittags mit Oehmes und einigen jungen Leuten
fröhlich beisammen, Gaber und Heinrich waren zufällig auch da. Meine
Frau war besonders heiter und recht innerlich fröhlich; da sank sie
plötzlich mit gebrochenen Augen vor mir zusammen in das Gras, und das
Bewußtsein verlor sich. Sie sprach nichts, winkte, drückte mir die
Hand, und wir trugen sie bestürzt in das Stübchen der Wirtin. Der Arzt
kam schnell herbei. Er fand einen Schlaganfall. Sie kam nicht wieder
zum Bewußtsein, kurz nach Mitternacht hörte das treue Herz auf zu
schlagen. — Binnen drei Stunden gesund und tot! Ich war wie betäubt,
doch ruhig. Er, der Herr, weiß, warum er es geschehen ließ; sein Wille
ist ja immer gut und heilig. — Aber mir ist es noch, als wäre mir das
halbe Herz herausgerissen. — Ach, wie lieb hatte ich sie, und sie
verdiente es — doch still! —“ Sie ruht auf dem Loschwitzer Friedhof
unten an den blumigen Ufern der Elbe. Im Oktober 1854 schrieb er in
sein Tagebuch: „Wir sitzen immer noch auf unserem Berge (Loschwitz),
werden aber wohl in nächster Woche das Stadtquartier beziehen. So schön
es hier noch ist, so sehne ich mich doch nun, in Ordnung zu kommen.
Ich kehre nun ohne die liebe Mutter heim, das liegt mir immer in
Gedanken. Wo weilt sie jetzt? Diese Frage drängt sich mir oft herbei.
Aber da schweigt alles Wissen und wird schweigen, solange irdisches
Leben dauert, und doch ist’s auch da nicht ganz Nacht geblieben; die
Aussprüche unseres Herrn stehen da wie helle, liebliche Sterne; sie
sind fest und herrlich glänzend auf diesem nächtlichen Grunde, aber
sie sprechen mehr zum Herzen, als daß ich sie begreifen und fassen
könnte. Des Heilandes eigene Auferstehung steht wie ein Morgenrot am
Himmel, und ‚wo ich bin, da soll mein Diener auch sein‘, und ‚in meines
Vaters Hause sind viele Wohnungen, und ich gehe hin, euch eine Stätte
zu bereiten‘, das sind Morgensterne. Aber mehr als dieses Ahnen gibt
mir die Lehre meiner Kirche auf Grund der Schrift, die Lehre von der
Kirche selbst, welche ist die Gemeinde der Erlösten im Himmel und auf
Erden, miteinander verbunden durch die Liebe, Gebet und gegenseitige
Fürbitte.“ — „Und daß wir einen solchen Himmel voll Sterne der
Verheißung haben, Lichter einer höheren Welt, die so fröhlich
herunterleuchten, dafür sollten wir recht dankbar sein und in unserem
Falle unseren Glauben daran üben und stärken.“ — Seine Tochter Helene[S. 102]
führte ihm nun das Haus mit freundlichem Wesen und großer Umsicht, bis
sie 1856 mit dem Kaufmann und Fabrikbesitzer Theodor Kretzschmar in
Dresden den Bund fürs Leben schloß und das väterliche Heim verließ.
Jetzt übernahm des Meisters jüngste Tochter, Elisabeth, die Führung
des Hausstandes; sie hat bis an des Vaters Lebensende, achtundzwanzig
Jahre, seiner gewartet und ihn gepflegt mit aller und seltener
Hingebung und Aufopferung, wie es ein weibliches Wesen nur vermag. Sie
hat ihm die Augen geschlossen, als der Herr den Wandermüden zu sich
rief, lebte dann lange[S. 103] in Bad Boll, das sie mit ihrem Vater bei dessen
Lebzeiten so gern aufsuchte, und lebt jetzt ganz zurückgezogen in der
Nähe von Dresden. — Es wuchs eine Schar blühender[S. 104] Enkel (vier Mädchen
und zwei Knaben) in des Schwiegersohnes Kretzschmar Hause heran; hier
weilte der Meister so gern, und diesem glücklichen Familienleben hat
er so manches Motiv entnommen; wir erinnern nur an das eine Blatt aus
„Fürs Haus“: „Großvaters Leiden und Freuden in der Kinderstube.“ Ein
Enkelchen kämmt den geduldigen Großvater, ein anderes bringt ihm Puppen
und Bilderbücher, und das Bübele zeigt ihm seine neue Trompete. Die
Zeichnung, die vor dem erwähnten Holzschnitt entstand, auf der die
Enkel porträtähnlich sind, auch der Großvater des Meisters Züge trägt,
stiftete er für die Kinderstube des Kretzschmarschen Hauses. Die Enkel
sind längst verheiratet und die vierte Generation bereits erblüht, der
liebe Vater Kretzschmar hat das Zeitliche 1900, kurz nach vollendetem
83. Lebensjahre, gesegnet.

Abb. 128.
Zum Begräbnis. Ach, die
Gattin ist’s, die teure. Aus Schillers Glocke. 1857.
(Zu
Seite 73.)

Abb. 129.
Anna Susanne, geh du na Schol.
Aus Klaus Groth, Voer de Goern. 1858.
Verlag von Georg Wigand in Leipzig. (Zu
Seite 73.)

Abb. 130.
Kleine Maus, große Maus.
Aus Klaus Groth, Voer de Goern. 1858. (Zu
Seite 73.)
In Loschwitz hat Richter viel nach der Natur gezeichnet, viele seiner
Holzschnittbilder und Aquarellen geschaffen. Wie oft sah ich ihn „in
seinem stillen Taborplätzchen“, wie er sein schlichtes Hüttchen oben
am Berge gern nannte, an seinem Arbeitstisch! Durch die von Weinreben
umrankten Fenster schaute man über Obstbäume und Gärten und blühende
Büsche, über Hügel und Täler, über Felder und Wälder und über den wie
Silber glänzenden Elbstrom in die weiten, blauen Fernen des Erzgebirges
oder nach der im Sonnenduft schwimmenden Stadt und nach den Weinbergen
der Lößnitz, nach der alten Markgrafenstadt Meißen zu. In den an
der Rückseite des Hauses sich anschließenden Waldungen, fern vom
Geräusch der Stadt, erging er sich gern, in Betrachtungen versunken,
und dachte am Spätabend seines Lebens viel über seine arbeitsreiche
Künstlerlaufbahn und über die Wege, die ihn der Herr geführt, nach.
Fast jeden Morgen suchte er den alten Freund, Münzgraveur Krüger,
auf, den originellen Junggesellen, der im einsamen Häuschen oben am
Waldesrande hauste (siehe Abb. 171), — oder er wandelte in schattigen
Waldwegen, oft von Freunden oder den Seinen begleitet, in anregendem
Gespräch und Gedankenaustausch. Der Dichter Dr. Moritz Heydrich,
Verfasser des Lustspiels „Prinz Lieschen“, der sich mit dramaturgischen
und literarhistorischen Studien beschäftigte, eine gutherzige frische
Natur, empfänglich für alles Gute und Schöne, bewohnte in stiller
Zurückgezogenheit ein kleines Häuschen in[S. 105] Loschwitz, an halber Höhe
des Berges gelegen, über dessen Eingangstür er die Worte „Immer heiter,
Gott hilft weiter“ hatte anbringen lassen. Er hatte sich auf allerhand
Umwegen zu einer christlichen Glaubensüberzeugung durchgerungen und
schloß sich in aufrichtiger Liebe und Verehrung an Richter an. Er holte
unseren Altmeister des öfteren zu Spaziergängen in den Wald ab. Auf
solchen Spaziergängen wurde viel über die höchsten Dinge gesprochen.
Thomas Carlyles und Charles Kingsleys treffliche Schriften und
Anschauungen, mit denen sich Heydrich viel beschäftigte, bildeten gar
oft den Stoff ihrer Unterhaltungen. Heydrich erwähnt in der von ihm
bei Gelegenheit der Enthüllung des Richterdenkmals in Loschwitz am 28.
September 1884 gehaltenen Rede diese Gespräche und läßt den Meister
u. a. sagen: „Wie ist es hier so schön! Wie ist hier beim Blick vom
Berge aus die weite Gegend so himmlisch schön! Ich danke Gott recht
von Herzen, wenn ich die schöne Morgenluft hier im Walde einatme, die
wie Balsam sich ans Herz legt, ans Herz, das in Gottes Stille ruht
und in dieser Burg sich sicher fühlt, wie im Vorhofe des Himmels.
Dies stille beglückende Wohlgefühl in der schönen, freien, ländlichen
Natur ist ja doch nicht so wohl im Selbstvergessen, als im Vergessen
des Leides, des Schmutzes, der allem Erdendasein anklebt. Psyche, die
so oft eingekerkert ist, wird auf Momente hier frei, dehnt die Flügel
und[S. 106] fühlt sich in ihrem Elemente, weil alles in Harmonie steht und ein
seliger Frieden des ganzen Daseins sich bemächtigt.“ Heydrich machte
unseren Meister mit Otto Ludwig, dem Verfasser von „Zwischen Himmel
und Erde“ und der trefflichen „Shakspearestudien“ bekannt. Richter und
Ludwig verstanden sich gut, begegneten sie sich doch in einem Punkte:
beide strebten nach Einfalt, Schlichtheit und Wahrhaftigkeit.

Abb. 131.
Dämmerstündchen. Sonst und
Jetzt. Aus „Fürs Haus“. 1859. Verlag von Alphons Dürr in Leipzig. (Zu
Seite 74.)
In Loschwitz haben Richters Schüler viel Studien gesammelt und sich
so manches Motiv zu Bildern geholt. Die alten behaglichen Hütten,
die Waldwege und Stege, die lieblichen Wiesengründe, die Bäche und
Mühlen, die bunten Gärtchen, Obsthänge und Weingelände, — wie wußte
er den Schülern die Schönheit und Poesie dieser idyllischen Natur zu
erschließen! Die strohbedeckten Häuser unter blühenden Linden- oder
Obstbäumen, mit einem Blick in die blaue Ferne, waren ihm wie Bilder
von Van Eyck.
Bei Gelegenheit eines Ausfluges von Ostende, wo er zur Stärkung seiner
angegriffenen Nerven weilte, nach Brügge, schreibt er unter dem
Eindruck der herrlichen Bilder Eycks und Memmlings am 19. August 1849
in sein Tagebuch: „Ich möchte jetzt nur meine sächsischen Gegenden und
Hütten malen und dazu die Menschen, wie sie jetzt sind, nicht einmal
mittelalterliches Kostüm. Ein Frühlingstag mit grünen Korn- und gelben
Rübsenfeldern, jungbelaubte Linden- und Obstbäume, der Bauer, der da
ackert im Schweiße seines Angesichts und auf Hoffnung von Gottes Segen,
und die kleinen talkigen, unschuldigen Bauernkinder, die dem Vater
einen Trunk bringen oder heiter spielen und Sträuße binden, da sie
noch im Paradieszustände der Kindheit leben, während der Alte arbeiten
muß; dazu Schwalben in der Luft, Gänse auf der Wiese und Goldammer im
Gebüsch, der Hausspitz oder die Kühe auch bei der Hand; das alles,
so recht treu, streng, innig und lieblich wiedergegeben in Memmlings
Sinn und frommer, einfältiger und liebevoller Weise, das hätte gewiß
Interesse und Bedeutung genug. Wir können nicht immer und nicht alle
Heiligenbilder machen.“

Abb. 132.
Weine nicht, Helmchen.
Aus „Fürs Haus“. 1858.
(Zu
Seite 74.)
Man nennt Ludwig Richter den Maler und Jean Paul Richter den Dichter
der deutschen Gemütswelt. Unser Meister schreibt darüber, wie er
Jean Paul mit innigster Freude betrachtet und in wie wundervoller
Poesie dieser die Schönheit kleinster Verhältnisse[S. 107] und Dinge
schildert: „Ist es nicht verdienstlich, auch in malerischer Form die
Schönheit des Lebens und seiner Erscheinung, selbst in den kleinsten
und gewöhnlichsten Gegenständen, aufzudecken? Die Liebe macht ja
alles bedeutend und wirft einen Himmelsschimmer auf alles, was sie
betrachtet. Was sie anrührt, wird Gold.“

Abb. 133.
Hausmusik. Aus „Fürs Haus“.
1858. (Zu
Seite 74.)
Richter verstand es wie wenige Künstler, dem kleinen und engen
Erdendasein Schönheit abzugewinnen und es in künstlerisch-schöner Form
wiederzugeben; ihm war ein Hüttchen am blumigen Hang unter Obstbäumen
mit dem stillen Getriebe seiner Bewohner der Darstellung wert; er
verstand es, uns solch ein einfaches Motiv sympathisch ans Herz zu
legen, solche einfache Vorwürfe in der ihm eigenen Art in Form und
Farbe und immer mit entsprechender reizvoller und liebenswürdiger
Staffage belebt, künstlerisch beseelt zu verklären. — Seinen Schülern
gegenüber war unser Meister sehr teilnehmend und ermunternd. Seine
Schule trägt ein ganz bestimmtes Gepräge; die Zeichnungen seiner
Schüler haben einen ganz bestimmten Typus. Leicht mit der Feder
gezeichnet oder leicht mit Farben angehaucht, angetönt, haben sie etwas
von der Innigkeit des Meisters in der treuen Wiedergabe der Natur, je
nach der individuellen Veranlagung, wie das ja selbstverständlich ist;
auch in der Art der Staffage ist ein gewisser Schnitt unverkennbar. Es
geht ein liebenswürdiger Zug durch alle Arbeiten aus seiner Schule.

Abb. 134.
Auf der Wiese. Aus „Fürs
Haus“. 1859. (Zu
Seite 74.)

Abb. 135.
Wanderschaft. Aus „Fürs
Haus“. 1859. (Zu
Seite 75.)

Abb. 136.
Hänsel und Gretel. Aus
„Fürs Haus“. 1860. (Zu
Seite 75.)

Abb. 137.
Am Rhein, am Rhein, da wachsen
unsre Reben. Aus „Fürs Haus“. 1861. (Zu
Seite 75.)
Zu Anfang ließ er die jungen Schüler die ihm von früher Jugend an
so lieb gewordenen landschaftlichen Radierungen J. C. Erhards oder
die des geistreichen Franzosen Eugen Bleury oder solche von A. van
Everdingen, A. Waterloo, H. van Svanefelt, J. de Boissieu oder
Zeichnungen nach der Natur von ihm, seinem Jugendfreund Oehme oder von
seinen früheren Schülern in Blei, Feder oder Aquarell kopieren. Die
köstlichen Federzeichnungen von Franz Dreber bevorzugte er besonders
und wußte auf das eingehendste die Schönheiten solcher Zeichnungen,
das Besondere oder Eigenartige in der[S. 108] Auffassung des Gegenstandes,
dem Studierenden klar zu machen, das Verständnis zu fördern und ihn
für die Arbeit zu begeistern. Daß es ihm oft schwer wurde, mit dem
weniger veranlagten Schüler etwas „anzufangen“, besagt eine Stelle
aus einem Briefe: „Das Atelier macht mir jetzt wenig Freude, obwohl
alle (Schüler) recht liebe Leute sind, nur zu viel Prosa und damit
verstehe ich nichts zu machen.“ Wer lehrt oder gelehrt hat, gleichviel
in welchem Fache, weiß, wie schwer es ist, dem weniger Veranlagten
als Lehrer wirklich „etwas zu sein“. Obwohl es ihm ganz fern lag,
bestimmenden Einfluß auf die Schüler auszuüben, wirkte doch die Macht
der Persönlichkeit des edlen Meisters auf die Nachstrebenden. Er
wußte, wie wenige Lehrer, das heilige Feuer der Begeisterung in seinen
jungen Schülern anzuzünden und ihnen die Augen zu öffnen für das
Verständnis der altdeutschen Meister, vor allem der Brüder van Eyck,
Memmlings und Dürers, der großen Niederländer Rubens und Rembrandt,
für Holbein und den großen Venezianer Tizian, ganz besonders aber für
die Romantiker, Schwind obenan. Wie verstand er, die Schüler für seine
Kunstideale zu erwärmen und sie auf die eigentlichen Aufgaben wahrer
Kunst hinzuweisen! Gern zog er hierbei das Gebiet der Literatur, in dem
er wohl bewandert war, mit heran und versuchte, Kunst und Literatur
mit- und durcheinander vergleichend, seine Anschauungen zu begründen.
Durch derartige Belehrungen, an welche sich oft die eifrigsten
Disputationen anschlossen, wurde so manches Samenkorn in die jungen
Künstler versenkt. — Solcher höchst anregender Gespräche erinnere ich
mich gern; sie fielen meist in die Zeit der beginnenden Abenddämmerung,
in welcher der würdige Meister des öfteren zwanglos zum Atelier kam,
das neben seiner Wohnung lag, im üblichen grauen[S. 109] Hauspelz, mit der
langen holländischen Tonpfeife. — Das Studium der Natur war ihm das
Wichtigste, und wenn der Frühling eingezogen war, litt er keinen
der Schüler mehr im Atelier, dann mußten sie hinaus und sammeln und
arbeiten für den Winter. Es gehörte gewissermaßen zu den feierlichen
Momenten, wenn im Spätherbst das ganze Ergebnis der Arbeiten des
Sommers dem Meister vorgelegt und etwaige Pläne zur Verwertung der
Studien besprochen wurden, sofern nicht schon Entwürfe für Bilder
nach den Studien vorhanden waren. Mit wenigen Worten wußte er die
Phantasie anzuregen und Fingerzeige zu geben, in welcher Art dies oder
jenes Motiv, sei es durch Beleuchtung oder Staffage, künstlerisch zu
gestalten und zu verwerten sei. Oft griff er dabei ein und rückte, mit
sicherster Hand ordnend, die Pläne zusammen, und man konnte sicher
sein, daß es dann das Rechte war. Nach den alten Meistern in der
Gemäldegalerie mußten die Schüler skizzieren und kopieren. Das Studium
der menschlichen Figur hielt er für unerläßlich nötig und äußerst
wichtig für den Landschaftsmaler; er betonte, wenn er zu diesem Studium
dringend ermahnte, wie die Figurenmaler aller Zeiten doch eigentlich
das weitaus Hervorragendste in der „Landschaft“ geleistet, und wies
dabei immer besonders auf Tizian hin. Die historische Landschaft war
ihm die höchste Aufgabe (nur wollte er von dem „Poussinschen Rezept“
nichts wissen), er freute sich herzlich, wenn er unter vorgelegten
Entwürfen solche sah, die aufs „Historische“ hinzielten. Der Hoffsche
Katalog zählt fast die ganze Reihe seiner Schüler aus der Dresdener
Zeit auf. Schon an früherer Stelle wurde einer seiner ersten Schüler
in Dresden, Dreber, als der talentvollste, und Hasse genannt. Mehrere
sehr veranlagte Schüler, Heinrich Müller, W. von Döring, L. Nitzschke
und H. Lungwitz, gingen Ende der 40er Jahre, ihrem Freiheitsdrange
folgend, nach Amerika. Von den Schülern aus den sechziger Jahren
seien nur Adolf Thomas, C. W. Müller und Albert Venus, aus dem Anfang
der [S. 111]siebziger Jahre Rudolph Schuster genannt. Letzterer hat auch
eine Reihe tüchtiger Ölbilder in Düsseldorf, Stuttgart, Berlin usw.
gemalt, wurde aber durch Krankheit vielfach an freierer Entfaltung
seines Talentes verhindert. Das betrifft die Landschaftsschule.
Eine eigentliche Schule für das Illustrationsfach hat Richter nicht
gemacht. Wie und was sollte er hier auch lehren? Sein Schaffen darin
hatte etwas „Unbewußtes“, „wie der Blütenbaum, der von seiner Pracht
nichts weiß“. Aber anregend und befruchtend hat er auf das ganze
Illustrationsgebiet und auf die Entwickelung des Holzschnittes gewirkt.
Ein Richterscher Holzschnitt mit seinem kräftigen gesunden Strich wirkt
heute nicht veraltet, er hält sich neben der sonst so anders gewordenen
Art und dem später herrschenden Streben, die diesem Kunstfache
gezogenen Grenzen zu verschieben, [S. 115]die einfache schlichte Art der
Formengebung durch dem „Kupferstich“ ähnliche Tonwirkung zu steigern.
Gegenwärtig ist der Holzschnitt ebenso wie der Kupferstich durch die
verschiedenen mechanischen Reproduktionsverfahren fast ganz verdrängt.
Der Holzschnitt dient fast ausschließlich nur noch der Industrie, der
Kupferstich wird noch mühsam durch die Kunstakademien über Wasser
gehalten. Nur die Radierkunst wird seit längerer Zeit wieder eifriger
gepflegt.

Abb. 138.
Psalm 65. Aus „Fürs Haus“.
1860. (Zu
Seite 75.)

Abb. 139.
Gefunden. Aus „Fürs Haus“.
1861. (Zu
Seite 75.)

Abb. 140.
Schlachtfest. Aus „Fürs
Haus“. 1861. (Zu
Seite 75.)

Abb. 141.
Bürgerstunde. Aus „Fürs
Haus“. 1861. (Zu
Seite 75.)
Unser Altmeister fühlte sich in den letzten Jahren seines Lebens mehr
und mehr vereinsamt, er schreibt zu Anfang des Jahres 1871 nieder:
„Unsereins fühlt sich jetzt als Künstler unter seinen Berufsgenossen
wie ein Fremdling, welcher die Sprache der anderen nicht versteht
und von ihnen nicht verstanden wird. Was man schätzt und liebt und
hochhält, daran geht die jüngere Generation kalt und unberührt vorüber;
was sie hochpreist und entzückt bewundert, erregt unsere Teilnahme
wenig.“ Weiter schreibt er auch 1882: „‚Propheten und Sibyllen male
ich nicht, denn ich habe noch keine gesehen‘, sagte N. N. Freilich
laufen in den Gassen der Stadt keine mehr herum, aber eben der ideale
Mensch sieht sie in seinem Innern und etwas von ihnen zuweilen
auch außen. Vor allem muß er aber eine Verwandtschaft mit ihnen selbst
haben; denn in dieser Sphäre kann sich nur das Verwandte wirklich
erkennen.“ Am 15. August 1870 schreibt er an seinen Freund Thäter in
München: „Ich komme mir jetzt vor wie ein Schauspieler, der, von der
Bühne heruntergestiegen, in den Reihen des Publikums sitzt und sich
nun von anderen Kollegen was vorspielen läßt, denn meine künstlerische
Tätigkeit reduziert sich beinahe auf Null — teils, weil meine Augen so
schlecht geworden, auch die Hand sehr unsicher ist, hauptsächlich aber,
weil die Phantasie sehr lange ausruht, ehe sie wieder einmal — nicht
zum Auffliegen — nein, nur zum Aufstehen kommt. Die nervösen Zufälle
im vorigen Jahre haben mich nun in der Tat alt gemacht; das fühle ich,
und schon lange gehe ich mit dem Gedanken um, mich pensionieren zu
lassen und ganz vom Kunstschauplatz zurückzuziehen; wenigstens von den
akademischen Tätigkeiten, die mir keine Freude machen und in welchen
ich vermöge meiner Kränklichkeit nicht mehr belebend wirksam sein kann.
Es muß junges Blut an die Stelle der Alten.“ — In den Lichtungen des
Loschwitzer Waldes wurde mit Eifer an den Sonntagnachmittagen, wenn
die zahlreichen Glieder der Familie versammelt waren, Boccia gespielt,
jenes bekannte italienische Spiel, bei dem mit Holzkugeln nach einem
Ziele, dem Lecco, geworfen [S. 117]wird. Wie war der Altmeister mit Interesse
dabei, selbstverständlich aber nie leidenschaftlich erregt, immer
gleich freundlich und liebenswürdig!


Abb. 143.
Es ist ein Schnitter,
der heißt Tod.
Aus „Fürs Haus“. 1860. (Zu
Seite 76.)
In dem damals noch einfachen, ländlichen Gasthof in Loschwitz trafen an
einem bestimmten Abend in der Woche in den Sommermonaten die Genossen
vom Stammtisch des Winters zusammen. In liebenswürdigster Unterhaltung
wußte unser Altmeister immer den Gesprächen eine ernstere Wendung zu
geben, war immer anregend und geistig belebend, oft schalkhaft launig
und konnte auch recht herzlich lachen; immer lag aber über seinem Wesen
eine wohltuende Stille und Zartheit. Die Stammtischgenossen waren meist
hohe Staatsbeamte, Professoren von verschiedenen Lehranstalten und
unser Münzgraveur Krüger, Peschel, des Meisters Sohn und Schwiegersohn,
Dr. Heydrich, Bildhauer Professor Dr. Gustav Kietz, der
Freund Richard Wagners, dem wir ein treffliches Buch „Richard Wagner in
den Jahren 1842 bis 1849 und 1873 bis 1875“ verdanken (Dresden, Carl
Reißner), und so mancher andere treffliche Mann. Beim Nachhausegehen
war unser Münzgraveur stets der Lichtspender; er kam nie zu solchen
Abenden, [S. 119]ohne sein Laternchen mitzubringen, und in den dunklen
Weinbergswegen leistete das auch seine guten Dienste. Unserem Meister
waren freilich die Wege längst vertraut. Wie oft in der langen Reihe
von Jahren ist er dieselben hinauf- und hinabgestiegen! Künstlerische
Gestalt haben solche Abende z. B. gewonnen in dem Bilde: „Bürgerstunde“
(Abb. 141). Der „Eingeweihte“ fand in solchen Bildern Richters oft
Gestalten aus der Tafelrunde. Des Abends nach dem Abendbrot ging er
oft noch im Vorgärtchen des Häuschens, in dem er die Sommermonate
zubrachte, mit sich beschäftigt, auf und ab, im Nachdenken über
manches Schwere, das ihm zu tragen beschieden war. Besonders sein Sohn
Heinrich, der so viel an Melancholie litt, machte seinem Vaterherzen
große Sorgen. Wir finden in der Biographie eine Aufzeichnung vom
28. August 1872: „Ich ging des Nachts im Weingang vor dem Hause auf
und ab. Das niedere Häuschen lag schwarz vor mir, die Haustür offen
und vom Licht in der Küche erhellt. Oben funkelte das Sternbild des
‚Himmelswagen‘ über dem Dache. Es war mir so traurig im Herzen über
das viele Elend auf Erden. Und gibt es denn etwa noch mehr Not und
Jammer auch auf all den Sternen? Vielleicht sind das aber Welten voll
Jauchzens oder voll stillseligen Glückes?“ Wir sehen, wie seine Seele
leidet unter der Last, wie er die Blicke nach oben richtet.
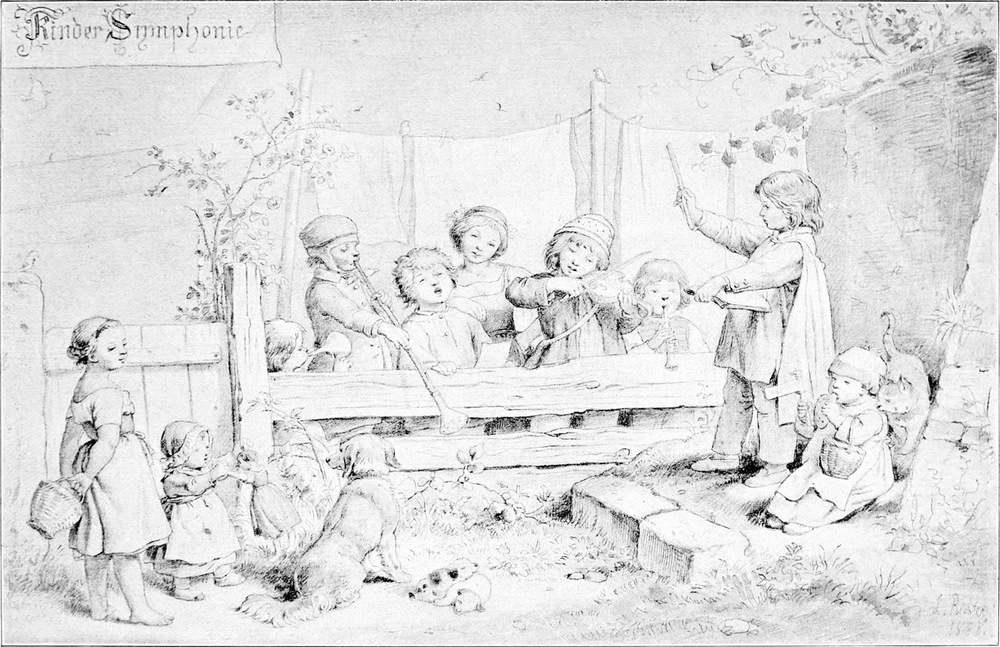
Abb. 144.
Kindersymphonie. Verlag
von Alphons Dürr in Leipzig. 1858. (Zu
Seite 78.)
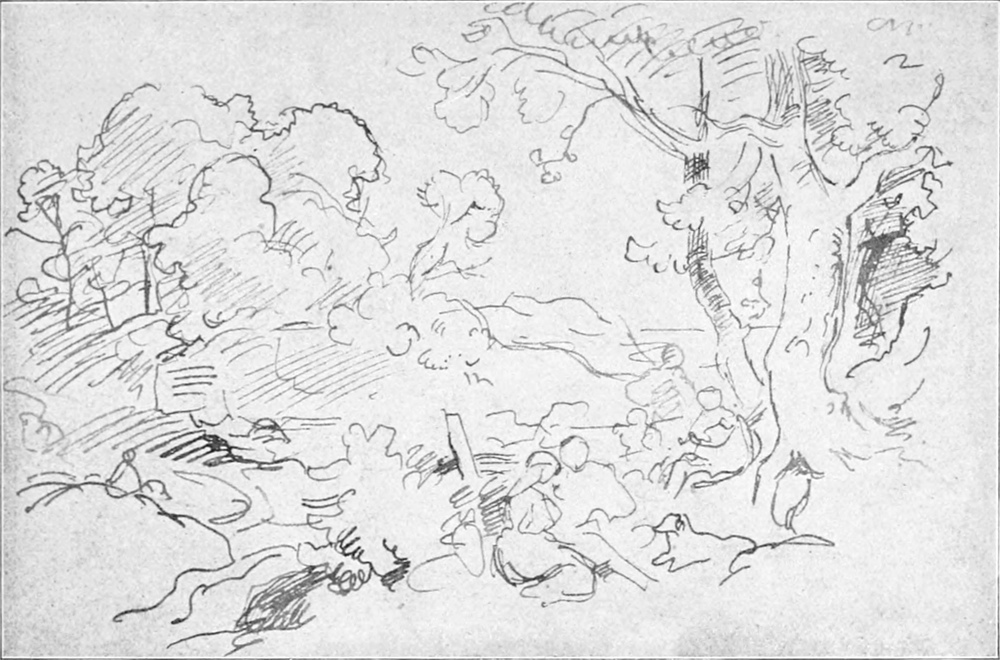
Abb. 145. Skizze zu dem Ölbilde „
Im
Juni“. 1857. 1858. (Zu
Seite 78.)
Wie oft habe ich den würdigen Greis in diesem Weingang wandeln sehen,
wie oft ging ich im Gespräch an seiner Seite! In stiller, friedlicher
Abgeschlossenheit lag des Meisters kleines Asyl, in dem er in den
letzten zwölf Jahren mit seiner Tochter Elisabeth die Sommermonate
zubrachte, in Obstbäumen und Weinstöcken halb versteckt, abseits von
den modernen Villen und vom lärmenden Fremdenverkehr, so ganz nach
seinem Sinn. Kleine, niedrige Zimmer zu ebener Erde, die auf einen
Flur mündeten, von dem man in den Garten und durch den Weingang zur
Gartentür gelangte; vor der Tür wogende Kornfelder, hinter denen sich
der Wald erhob. 1871 schrieb er nieder: „Ein stilles, friedliches
Daheim, ein kleines, freundliches Asyl, mit einem Blick ins Weite,
in das kleinste Stück Natur, mit der Kunst und mit Gott, ist mir
das[S. 120] Beste, Liebste und Höchste. Alles so äußerliche, bloß kluge,
anspruchsvolle und dem Schein huldigende Treiben, wie es jetzt in den
großen Städten vorherrscht, ist mir im Innersten zuwider.“ In der
Hauptsache entsprach dieses Häuschen seinen bescheidenen Wünschen und
Anforderungen, und wie war es hier so traulich, bei ihm zu sitzen und
ihm zuzuhören oder ihm vorzulesen, wie war er immer mitteilsam und
voller Interesse für alles das, was in seinem Ideenkreise lag! Man
ging nie von ihm, ohne irgend welche Anregung empfangen zu haben, und
wie war er dankbar, wenn man ihm, dem mehr und mehr Vereinsamten, von
der Welt draußen berichtete, von den neuen Strömungen in der Kunst ihm
mitteilte, die nach ganz anderen Zielen als die seinen drängten. Mit
seinen schwachen Augen konnte er neue Bilder ja kaum mehr sehen! Am
Silvesterabend 1874 schreibt er nieder: „Die letzten Lebensjahre haben
mich zu tieferer Einkehr und Prüfung geführt, ich danke Gott von Herzen
dafür und fühle in mir einen Frieden und ein Glück, wie es die Welt
nicht geben kann. Der Herr sei ewig dafür gelobt!“ Freilich wurde ihm
dieser innere Friede oft genug gestört, aber er blieb stets ruhig und
gottergeben.

Abb. 146.
Heimkehr vom Felde. 1858.
(Zu
Seite 80.)

Abb. 147.
In der Kirche. Aus
dem „Sonntag“. 1861.
Verlag von Alphons Dürr in Leipzig. (Zu
Seite 82.)
Liebe Erinnerungen sind mir zwei Ausflüge, welche die Mitglieder des
Stammtisches unternahmen. Der erste, um die Mitte der siebziger Jahre,
führte über Aussig und Camayk bis Leitmeritz, in die Gegenden, in
welchem ihm, italienkrank, vor vierzig Jahren zum erstenmal wieder die
Augen für die Schönheiten der deutschen, vaterländischen Natur geöffnet
wurden. Wie war unser Meister trotz seiner siebzig und mehr Jahre
frisch und heiter, wie freute er sich, wie lachte ihm das Herz, als er
an der von Eichen umschlossenen „Eiskapelle“ oberhalb Camayk stand, wo
er vor vielen Jahren mit seinen Schülern geweilt, von wo der Blick in
glänzende, zitternde Fernen des schönen gesegneten Böhmerlandes sich
verliert und man den Lauf des silbernen Elbstromes weit, weit verfolgen
kann, wo draußen Burgen und Ruinen, Städte und[S. 121] Dörfer, Felder und
Wälder und schönlinige Bergzüge im Sonnenglanz verschwimmen! Er sah
das schöne Land zum letztenmal, sein Fuß hat es nicht wieder betreten.
Der zweite Ausflug führte nach einer romantisch im Wald liegenden
früheren Besitzung v. Quandts in Dittersbach bei Pirna, in der Peschel
in Lünetten einer Gartenhalle Bilder zum Erlkönig, König von Thule usw.
al fresco ausgeführt hatte. Diese Besitzung war auch deshalb
noch von besonderem Interesse, weil v. Quandt hier des öfteren die
bedeutendsten Künstler Dresdens, unter diesen auch den hochbedeutenden
Architekten Gottfried Semper, um sich versammelte. Semper teilte
Richard Wagners Schicksal, auch er war in die Dresdener Maiereignisse
von 1849 verwickelt und mußte flüchten. Weitere schöne Erinnerungen
sind mir die Weihnachtsfeste, welche die gesamte vielgliederige Familie
im Hause des Schwiegersohnes Theodor Kretzschmar feierte und denen
ich seit 1873, seitdem ein verwandtschaftliches Verhältnis mich noch
enger mit dem Meister verband, mit beiwohnen zu dürfen das Glück hatte.
Unter dem lichterglänzenden Tannenbaum scharten sich all die Kinder,
Schwiegerkinder und die fröhlichen Enkel und die weiteren Verwandten,
zu denen auch Peschel zählte, um den würdigen, auch in seiner äußeren
Erscheinung wirklich Ehrfurcht gebietenden Senior der Familie. Mit
wieviel Liebe und Güte und Freundlichkeit verkehrte er mit all den
Seinen! Und doch hatte er seinen Kindern und Enkeln gegenüber etwas
Zurückhaltendes, etwas Unnahbares, Reserviertes. In den Zeiten, in
denen er aufgewachsen, war das Verhältnis zwischen Eltern und Kindern
sehr viel anders als heute gewesen; schon an sich [S. 123]charakteristisch
für diese Zeit war, daß in vielen Familien bis in die sechziger Jahre
Vater und Mutter mit „Sie“ angeredet wurden. In des Meisters Hause
herrschte freilich das „Du“, wenigstens solange ich mich entsinnen
kann. — Am 9. September 1875 schreibt er aus Wildbad Gastein, das
er seines Nervenleidens wegen wieder[S. 124] sucht: „— — Wir haben hier
viel liebe und zum Teil sehr interessante Menschen kennen lernen und
ich bin diesmal fast gewaltsam aus meiner Stille in einen großen
Verkehr gezogen worden. Es fiel mir das oft recht schwer, weil das
Bad meine alten Übel, große Abspannung und Schlaflosigkeit, viel mehr
steigerte als verminderte. Ich hoffe bei alledem einen guten Erfolg.
— — — Hoffentlich sehen wir uns in nächster Woche; denn trotz der
großen Schönheit hiesiger Natur, die ich so leicht nicht vergessen[S. 125]
werde, stellt sich doch die Sehnsucht nach dem lieben Daheim mit den
vertrauten Lieben recht heftig ein.“ —

Abb. 148.
Ich bin krank gewesen, und ihr
habt mich besuchet. Aus dem „Sonntag“. 1861. (Zu
Seite 82.)

Abb. 149.
Heimkehr vom Lande. Aus
dem „Sonntag“. 1861. (Zu
Seite 83.)

Abb. 150.
Heimkehr. Aus dem „Sonntag“.
1861. (Zu
Seite 83.)

Abb. 151.
Titelkopf des „Daheim“.
Nach der Originalzeichnung im Besitz der Verlagshandlung. 1863. (Zu
Seite 84.)

Abb. 152.
Kleinhandel. 1856.
Aus „Neuer Strauß fürs Haus“. 1864.
Verlag von Velhagen & Klasing in Bielefeld und Leipzig. (Zu
Seite 85.)
In den letzten fünfzehn Jahren ging der Altmeister fast jährlich
nach Bad Boll in Württemberg, zu den hoch bedeutenden evangelischen
Pfarrern Blumhardt, Vater und Sohn. Hier in der herrlichen Luft, in
so anregendem und ihn besonders interessierendem Verkehr mit diesen
beiden Männern und mit so manchem, der das Gleiche wie er suchte,
erfrischte und stärkte er sich immer für die lange Winterszeit, die ihm
besonders viel schlaflose Nächte brachte. In einem Briefe vom 18. Mai
1880 schreibt er aus[S. 126] Boll: „Vor acht Tagen sind wir hier angekommen
und haben seitdem die wundervollsten Frühlingstage durchlebt. Ich
bewohne ein Eckzimmer in schönster Lage, und vom ehrwürdigen Gipfel
des Hohenstaufen und des Rechberg, wie aus dem nahen Eichenwald weht
eine so erfrischende, balsamische Luft mir entgegen, daß man sie mit
Entzücken[S. 127] einatmet, dazu mittags und abends die Gesellschaft des
höchst geistvollen Christoph Blumhardt und einiger sehr interessanter
Persönlichkeiten — Herz! was willst du[S. 128] mehr? Ich fühle mich hier
sehr glücklich und danke Gott dafür. Könnten nur alle die Lieben da
sein, die ich mir herwünschte, sie würden sich mit mir freuen!“ — —
In einem Briefe vom 4. August 1882 schreibt er ebendaher: „— — hier
in Boll bin ich in einer Stimmung, die mich an Uhlands Gedicht ‚Die
verlorene Kirche‘ erinnert, welches Kietz mir vor einiger Zeit zufällig
vorlas und das ich im Schlußblatt zum ‚Täglichen Brot‘ (siehe Abb. 159)
im Sinn hatte. Boll hat nach außen und innen etwas davon!
— — — befinde ich mich doch so, daß ich ganz zufrieden bin, und die
mannigfaltigen geistigen Anregungen geben täglich reichen Stoff zum
Nachdenken und Besprechen.“ —

Abb. 153.
Johannisfest. Aus „Neuer
Strauß fürs Haus“. 1864. (Zu
Seite 85.)

Abb. 154.
Erstes Ofenfeuer. Aus
„Neuer Strauß fürs Haus“. 1864. (Zu
Seite 85.)

Abb. 155.
Gruselige Geschichten.
Aus „Neuer Strauß fürs Haus“. 1864. (Zu
Seite 85.)
Kaiser Wilhelm I. hatte im Jahre 1871 dem Komponisten der „Wacht am
Rhein“ und dem Schöpfer des Hermannsdenkmals auf dem Teutoburger
Walde einen Ehrensold ausgesetzt. Der Bildhauer von Bandel war der
erste von beiden, der das Zeitliche segnete, und nun wurde am 11.
Oktober 1876 unser Altmeister vom Kaiser mit diesem Ehrensold auf
Lebenszeit bedacht. Am 1. Dezember 1876 trat unser Meister nach einer
achtundvierzigjährigen Dienstzeit in den wohlverdienten Ruhestand.
Das Ministerium des Innern hatte mit König Alberts Genehmigung in
Anerkennung seines künstlerischen Wirkens den Ausfall am Gehalt als
„Ehrengehalt“ ersetzt, den die Landstände ihm dann auch bestätigten,
so daß ihm sein seither bezogener voller Gehalt als Pension verblieb.
Von der Mitgliedschaft des „Akademischen Rates“ wurde er aber noch
nicht enthoben, er mußte an den Sitzungen desselben nach wie vor noch
teilnehmen, was ihm sehr beschwerlich war; aber er blieb dadurch doch
noch in Verbindung mit der Akademie und fühlte sich nicht so ganz
abseits.

Abb. 156.
Beiß mal ab, Hänschen!
Aus „Neuer Strauß fürs Haus“. 1864. (Zu
Seite 86.)

Abb. 157.
Ährenlese. 1866.
(Zu
Seite 86.)
[S. 130]

Abb. 158.
Zur Mühle. Aus „Unser
täglich Brot“. 1866.
Verlag von Alphons Dürr in Leipzig. (Zu
Seite 86.)
Vor seinem Abgänge von der Kunstakademie bereitete die Dresdener
Künstlerschaft unserem Meister am 9. März 1876 ein wohlgelungenes
Fest. Die Festteilnehmer erschienen als Richtersche und oft recht
drollige Figuren; die einzelnen zusammengehörigen Gruppen brachten dem
Meister ihre Huldigung dar; es gab dabei sehr lustige Szenen; [S. 132]Hermann
und Dorothea waren wohl ein dutzendmal vertreten, und Hermann hatte
dreißig oder mehr Mütter. Obwohl er schweren Herzens — ihm waren alle
offiziellen Feiern, und nun gar ihm selbst bereitete, etwas Unbequemes
— zu der Feier sich begab, war er doch sichtlich ergriffen ob all der
Liebe und Verehrung, die ihm, wie er liebenswürdigst behauptete, so
unverdient entgegengebracht wurde.
Am 18. Februar 1878 wurde er, auf sein dringendes Ansuchen, aus dem
„Akademischen Rat“ der Kunstakademie entlassen. Die Sitzungen waren ihm
mit der Zeit eine immer schwerere und drückendere Last geworden. Am 22.
Dezember 1878 ernannte ihn die Stadt Dresden zum Ehrenbürger.

Abb. 159.
Denn dies ist das Brot Gottes.
Aus „Unser täglich Brot“. 1866. (Zu
Seite 87.)

Abb. 160.
Ländliches Fest. 1866.
(Zu
Seite 87.)
Das Augenleiden hatte sich in den letzten Jahren so verschlimmert,
daß er kaum noch lesen konnte. Es waren auf der Netzhaut der Augen
durch Springen und Vernarbungen von Blutgefäßen unempfindliche Stellen
entstanden, die nicht mehr funktionierten, so daß er die Dinge um sich
her nur teilweise sah. Schreiben konnte er nur noch mit Hilfe der Lupe,
er fand die Zeilen nicht mehr und schrieb oft durcheinander, wie der
angefügte Brief zeigt.
Im Jahre 1880 ungefähr schreibt er einmal: „Außer dem Evangelium,
das göttliche Gesundheit atmet, lese ich jetzt nur Goethe und
Jeremias Gotthelf, allerdings eine wunderliche Zusammenstellung, aber
mir ist wohl, wenn ich dabei bin.“ Jeremias Gotthelf war ihm ein
Lieblingsschriftsteller geworden. Dieser kernige, gesunde Schweizer
verstand es, unseren Meister zu fesseln, wie er auch Cornelius
gefesselt hatte. Die wuchtigen, markigen Männergestalten mit all ihrem
germanischen und bäuerlichen Eigensinn und ihren Schrullen und Ecken
und ihrem trefflichen inneren Kern, die Männer,[S. 133] die mit dem Mist an
den Stiefeln in die Stube treten, im Gegensatz zu Berthold Auerbachs
Bauern, die sich erst säuberlich vor der Tür die Stiefeln abstreichen,
— die entzückend geschilderten Mädchen- und Frauengestalten, die
kerngesunde Charakteristik, — [S. 135]das alles packte und fesselte
ihn. Die reizende kleine Erzählung, das „Erdbeer-Mareili“, die ans
Romantische streift, war ihm besonders lieb. Gestalten wie Uli der
Knecht und der Hagelhans und dessen Tochter Vreneli waren nach seinem
Sinn. Fritz Reuters urgesunder Humor und ausgezeichnete Charakteristik
erfreuten ihn; er hat beim Vorlesen aus der „Stromtid“, aus der
„Franzosentid“ und den übrigen Werken oft herzlich gelacht. 1868
war Richter mit Skizzen zu Gotthelfs und Fritz Reuters Schriften
beschäftigt, ließ aber diesen Plan wieder fallen und zeichnete statt
dessen die Folge „Gesammeltes“. Charles Dickens’ (Boz’) Werke, so
dessen David Copperfield und andere, haben ihm immer sehr behagt.

Abb. 161.
An der Via Appia. Nach
einer Originalphotographie. 1867. (Zu
Seite 88.)

Abb. 162.
Brunnen bei Arriccia.
Nach einer Originalphotographie. (Zu
Seite 88.)

Abb. 163.
Auf dem Berge. Aus
„Gesammeltes“. 1869. Verlag von Alphons Dürr in Leipzig. (Zu
Seite 89.)

Abb. 164.
Mittagsruhe im Korn. 1861.
Aquarelle im Besitz des Herrn Cichorius in Dresden. (Zu
Seite 88.)

Abb. 165.
Kinderszene. Aus
„Gesammeltes“. 1868. (Zu
Seite 89.)
Vor allem schätzte er aber Goethe und Shakespeare, wie wir das aus
seinen Aufzeichnungen schon ersahen. Eine besondere Vorliebe hatte er
für die Romantiker, wie Tieck, Novalis, Clemens Brentano. Hier war die
romantische Richtung aus der Zeit seiner Jugend bestimmend für sein
ganzes Leben, wenn er auch in späteren Jahren sehr klar sah, was in
jener Zeit krankhaft und gemacht war. Brentanos herrliches Fragment
„Aus der Chronika eines fahrenden Schülers“ schätzte er ganz besonders;
er hat dazu das prächtige Blatt „Die Laurenburger Els“ im „Gesammelten“
gezeichnet. Brentanos Märchen, herausgegeben von Guido Görres, vor
allem das „Vom Rhein und dem Müller Radlauf“, die Romanzen vom
Rosenkranz und die Aufzeichnungen der Visionen der Nonne von Dülmen,
Katharina Emmerich, letztere wegen des Anregenden für die Darstellung
der Leidensgeschichte Christi, interessierten ihn sehr. Den würdigen
Matthias Claudius hatte er besonders ins Herz geschlossen; wie oft habe
ich ihn rezitieren hören:
Wir stolzen Menschenkinder
Sind eitel arme Sünder
Und wissen gar nicht viel.
Wir spinnen Luftgespinste
Und suchen viele Künste,
Und kommen weiter von dem Ziel.
Gott, laß dein Heil uns schauen,
Auf nichts Vergänglich’s trauen,
Nicht Eitelkeit uns freu’n.
Laß uns einfältig werden
Und vor dir hier auf Erden
Wie Kinder fromm und fröhlich sein.

Abb. 166.
Dreikönigslied. Aus
„Gesammeltes“. 1869. (Zu
Seite 89.)

Abb. 167.
Feierabend. Aus
„Gesammeltes“. 1867. (Zu
Seite 89.)
[S. 138]

Abb. 168. Zu „
Gott sorgt für uns“.
1865. Aus Georg Scherers „Illustriertes deutsches Kinderbuch“. II. Band. 1869.
Verlag von Alphons Dürr in Leipzig. (Zu
Seite 89.)
Die angeführten Strophen, von denen er bei Gelegenheit sagt:
„Jede Zeile eine Perle!“ — „enthielten für Richters Denk- und
Empfindungsweise die Quintessenz aller praktischen, christlichen
Lebensweisheit“. Auch für die Schriften Gottfried Heinrich von
Schuberts, die wissenschaftlichen wie die erbaulichen, hatte er das
größte Interesse; er nennt ihn in der Biographie neben Kempis und
Claudius seinen Lehrer und Führer; er lernte ihn 1850 persönlich durch
Schnorr in München kennen. „Schubert galt ihm als der protestantische
und der edle Bischof Sailer von Regensburg († 1832) als der katholische
Hauptvertreter jener milden Geistesrichtung, welche das Christentum
universell zu fassen weiß und die konfessionellen Gegensätze und
formalen Differenzen innerhalb der Christenheit nicht zu Schranken
werden läßt, durch die sich glaubensbedürftige Menschen innerlich
voneinander getrennt sehen.“ „Sailers Gebetbuch, Kempis und der alte
Claudius tuen mir am wohlsten, und vor Allem die Bibel“, schreibt er
1873; (das Gebetbuch schenkte er seiner Enkelin Margarete als Mitgabe
in den Ehestand). Eckermanns Gespräche mit Goethe, Richard Rothes
„Stille Stunden“ und das von Fr. Nippold herausgegebene Buch „Richard
Rothe, ein christliches Lebensbild“, auf Grund der[S. 139] Briefe Rothes
entworfen (Wittenberg, Herm. Kölling), waren ihm höchst wertvoll und
hochsympathisch.
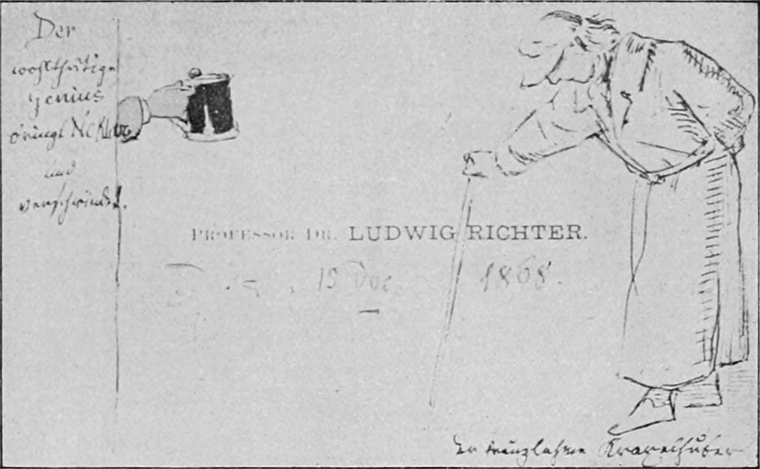
Abb. 169.
Der kreuzlahme Kraxelhuber.
1868. (Zu
Seite 90.)
Mit hoher Begeisterung betrachtete er die Werke Joseph Führichs,
die dieser hochbegabte Künstler in den letzten fünfzehn Jahren
seines Lebens dem deutschen Volke darbrachte. Die auffallend freiere
Entfaltung dieses großen Talentes in dessen späteren Jahren, das
hohe Stilgefühl, die Romantik und die tief religiöse Anschauung
erregten seine größte Bewunderung. Die Bilder zum Bethlehemitischen
Weg, zu Thomas von Kempens vier Büchern von der Nachfolge Christi,
zu den Psalmen usw. bereiteten ihm bei ihrem Erscheinen eine wahre
Herzensfreude. Auch die Overbeckschen sieben Sakramente erfüllten ihn,
als er sie um 1865 zum erstenmal sah, mit aufrichtiger Bewunderung,
obwohl in den späteren Overbeckschen Werken im Gegensatz zu dessen
Jugendarbeiten ihn manches innerlich weniger berührte; hier aber schien
ihm Overbeck auf der Höhe zu stehen. Daß ihn die Werke Rethels, dieses
größten Meisters auf dem Gebiet der Geschichtsmalerei im neunzehnten
Jahrhundert, dessen „Totentanz“, die Kompositionen zu den Fresken für
den Rathaussaal in Aachen aus dem Leben Karls des Großen, ferner der
„Tod als Freund“ und der „Tod als Erwürger“ und die früher erwähnten
Bibelblätter aufs höchste mit Bewunderung erfüllten, versteht sich von
selbst. Von den Kartons für Aachen sah er einige in Dresden entstehen.
Er sprach oft über den den Sturz der Irmensäule darstellenden Karton,
und wie ihm ganz besonders die stilvolle und so eigenartig behandelte
Landschaft behagte.

Abb. 170.
Wen solche Taten nicht
erfreuen. 1868.
(Zu
Seite 90.)
Von Cornelius’ Kunst hatte er immer einen mächtigen Eindruck. Mit
ungewöhnlichem Interesse stand er Mitte der siebziger Jahre, als er
von einem Aufenthalt auf Sylt auf der Rückreise Berlin berührte, vor
den Camposantokartons in der Nationalgalerie.[S. 140] Die Cornelianischen
„Nachtreter“ lehnte er ab; hier sah er sicher und klar, was „Eigenes“
war, und zitierte oft scherzend, wenn er vor „cornelianisch“ sein
sollenden Kompositionen stand: „Wie er sich räuspert und spuckt, das
haben sie ihm glücklich abgeguckt.“ Besonders hoch hielt unser Meister
auch die Werke von Ludwig Knaus. Bei Gelegenheit eines Besuches in
der Privatgalerie von Johann Meyer in Dresden, wo die beiden Bilder
„Durchlaucht auf Reisen“ und die „Beerdigung auf dem Lande“ dieses
größten deutschen Genremalers des neunzehnten Jahrhunderts sich
befinden, wurde er nicht müde im Betrachten, kam auch immer wieder auf
diese beiden Werke zurück. Die treffliche Charakteristik in beiden
Gemälden, die scharfe Beobachtung, die Individualisierung jeder
einzelnen Gestalt, und nun gar der liebenswürdige Humor in „Durchlaucht
auf Reisen“ und die meisterhafte Durchführung beider Bilder machten
den größten und nachhaltigsten Eindruck auf ihn. Das in der Dresdener
Galerie befindliche Bild von Knaus „In der Kunstreiterbude“, die
Unterhaltung eines Roués mit einer „Kostümierten“, war ihm des
dargestellten Gegenstandes wegen unsympathisch; er war darüber
ungehalten, daß man von diesem von ihm so hochgeschätzten Meister
gerade dieses Bild erworben hatte. Über die Ausstellung in München 1869
schreibt er: „Mich interessierten nur die Bilder von Knaus und Steinles
‚Christus geht bei Nacht mit den Jüngern‘ und sein herrlicher Karton in
Farben: ‚Schneeweißchen und Rosenrot‘. Ähnliches möcht’ ich machen!“
Für die Landschaften von C. F. Lessing aus dessen früherer
Periode hatte Richter eine besondere Vorliebe; im Städelschen Institut
in Frankfurt a. M. befindet sich ein Bild von diesem Meister: Unter
schattigen Bäumen am Brunnen ruht ein Ritter, draußen sieht man auf
braune, im Mittagssonnenschein glänzende Heide; dahinter dunkler Wald.
Dieses Bild liebte er sehr, er besaß eine kleine Nachbildung davon, die
er gern und mit großer Freude betrachtete.

Abb. 171.
Den Stammtischgenossen.
1870.
(Zu
Seite 90.)
Sein Haus war schlicht und einfach, ebenso sein Tisch anspruchslos
bürgerlich; er sah gern einen oder zwei Tischgäste bei sich,
selbstverständlich möglichst Nahestehende aus der Verwandtschaft, dann
war er ungeniert und konnte in dem gewohnten Hauspelz sitzen. Das kurze
Tischgebet sprach er schlicht und einfach, daß man ihm mit Ehrfurcht
folgen mußte. Bei Tisch pflegte er eine gleichmäßig freundliche
Unterhaltung und würzte das Mahl durch manchen trefflichen Gedanken,
dabei immer demütig und voll innerster und wahrster Herzensgüte.
Seit einer Reihe von Jahren sorgte ein Hamburger Kunstfreund (ich
denke, es ist in dessen Sinne, wenn ich seinen Namen verschweige) für
vorzügliche Weine und sonstige Stärkungsmittel, deren sein hohes Alter
bedurfte. Wenn er solch kostbaren Stoff kredenzte, gedachte er stets
mit rührender Dankbarkeit, aber immer im Gefühl des Unverdienten, des
freundlichen Spenders. Ebenso einfach waren[S. 141] die Abende bei ihm; vor
dem Abendtisch wurde eine, auch zwei Stunden lang vorgelesen; das
Gehörte gab beim Abendessen Stoff zu anregender Unterhaltung. Der
Meister war oft heiter, erzählte gern fröhliche Episoden aus seinem
oder seiner Freunde Leben, ließ oft seinem wirklich guten und echten
Humor, den er in hohem Maße besaß, freien Lauf, hörte aber auch gern
zu. Nach Tisch wurde dann weiter gelesen, er saß dabei im bequemen
grauen Hauspelz in seiner Sofaecke, über den Augen einen großen, grünen
Schirm, die Hand am Ohr, da er schließlich auch schwerer hörte; so
konnte er stundenlang dem Vorleser zuhören und war stets mit regstem
Interesse dabei, sprach oft dazwischen, geistreich und lebendig
anknüpfend an irgendwelche Stelle des eben Vorgelesenen.

Abb. 172.
Melusine am Brunnen. 1870.
(Zu
Seite 90.)

Abb. 173.
Sitzendes Mädchen.
(Zu
Seite 93.)

Abb. 174.
Aus der Jugendzeit. 1871.
(Zu
Seite 93.)
Sein Tagewerk begann Richter mit dem Lesen einer Morgenandacht und
der Herrnhuter Losungen; er wechselte bei diesen Morgenbetrachtungen
mit den Büchern und sprach oft längere Zeit über das Gelesene mit
den Seinen, belehrend und fördernd. Die Abb. 115 schildert eine
solche Morgenbetrachtung in seinem Hause, im Kreise der Seinen. In
der Folge mußten ihm auch diese Andachten vorgelesen werden. Darauf
begab er sich in sein Arbeitszimmer. In seiner Vaterstadt Dresden
hat man jetzt auf Betreiben des Stadtarchivars Dr. Richter im
Stadtmuseum, in[S. 142] der Nähe seiner Wohnung, in der er sein reiches Leben
abschloß, ein Ludwig Richter-Zimmer eingerichtet, in dem Reliquien des
verehrten Altmeisters aufgestellt sind. Hier ist der Arbeitstisch, an
dem er viele Dezennien so fleißig geschafft, mit allem, was darauf
untergebracht war, bis auf die kleine Vase, in der einige Blümchen,
je nach der Jahreszeit, sein Auge erfreuten, und was sonst noch von
Inventar sich erhalten; man hat annähernd dort einen Eindruck von der
Anspruchslosigkeit in seinem Hause. Über seinem Arbeitstisch hing das
kleine, in Öl gemalte Selbst-Porträt seines römischen Jugendfreundes
Maydell und das von Amsler so schön gestochene Porträt Fohrs; wie oft
mögen, wenn seine Augen über diese beiden Bildnisse hinstreiften, die
römischen Jugenderinnerungen an ihm vorübergezogen sein! „Karl Philipp
Fohr war sein künstlerisches Jugendvorbild auf dem Gebiete stilvoller
und dabei manierloser Naturauffassung.“ Zur Seite des Tisches standen
Mappen mit seinen Lieblingsblättern, Stiche und Radierungen, die er
oft betrachtend durch seine Finger gleiten ließ und sich zur eigenen
Arbeit daran erfrischte und anregte. Es war eine gewählte Gesellschaft,
die da, still aneinander gereiht, zusammenlag. Der größte Teil davon
waren, außer den trefflichen Radierungen J. C. Erhards, Blätter aus der
romantischen Zeit, in der er aufgewachsen war, aber auch Rembrandt,
Berghem, Dietrich, Ostade, Teniers, vor allem Dürer, Fiesole usw. waren
vertreten. Er bewahrte auch einen kleinen Schatz von Handzeichnungen
dabei, unter anderen solche von Schnorr, Schwind, Overbeck, Horny,
Fohr, Berthold, Erhard, Chodowiecki, Dreber, Hasse und anderen. Auch
Pausen nach Schwind, Reinhold usw. waren hier eingereiht. Ehe er
an seine Arbeit ging, skizzierte [S. 143]er oft nach Dürer oder anderen
altdeutschen Meistern eine oder mehrere charakteristische Figuren oder
Teile aus einem Blatt, Bäume, Hügel, ein Stück Ferne und Wolken. Diese
Handübungen wanderten dann in den Papierkorb. Sobald er bei seinen
eigenen Arbeiten über den darzustellenden Gegenstand im klaren war,
zeichnete er mit zartem Strich die Figuren und die ganze Komposition
hin. Oft machte er drei, vier und mehr Skizzen auf Papier verschiedenen
Formates und Tones, bis er das annähernd im Aufbau erreicht hatte,
was er suchte; das, was ihm nun am gelungensten erschien, führte er
weiter aus. Die Abbildungen 145 und 186 sind solche Entwürfe. Von der
Gruppe zu dem Bild „Die Laurenburger Els“ besitze ich allein sechs
Entwürfe. Wenn er später solche wieder zu Gesicht bekam, war er oft
verwundert über seine eigene Wahl, er fand, daß er nicht immer den
richtigen Entwurf zur weiteren Ausführung gewählt. Den einen oder
anderen dieser beiseite gelegten Entwürfe führte er später wohl auch
noch aus. Bei der Arbeit pflegte er manchmal leise vor sich hin zu
singen oder zu pfeifen, beliebige Volksliedmelodien, heitere und
ernste. Sobald der Tag sich neigte, legte er die Arbeit fort und eilte
zum Spaziergang nach dem „Großen Garten“, dem öffentlichen königlichen
Park in Dresden, wo er mit Freunden in einem kleinen engen Lokal
„Beim Hofgärtner“ seinen Kaffee einnahm und wo dann eine lebhafte
Unterhaltung gepflegt wurde. Früher hatten im Café Meißner solche
Zusammenkünfte stattgefunden, an denen außer Künstlern wie Rietschel,
Hähnel, Bendemann, Peschel usw. auch Schriftsteller und Schulmänner
teilgenommen; mit den Jahren hatte sich dieser Kreis aufgelöst. Später
finden wir dann den Meister, nachdem er seinen Spaziergang gemacht,
an dem Stammtisch im British Hotel, den wir schon erwähnten. Die
Abend- oder gar Nachtstunden hat er zur Arbeit nie mit herangezogen,
diese wurden nur für die laufenden Korrespondenzen und für das Lesen
ausgenützt, letzteres erstreckte in jüngeren Jahren sich oft bis in
späte Nachtstunden. Briefschreiben war ihm immer eine Last, er schreibt
einmal: „— aber vor dem Tintenfasse habe ich eine Scheu, wie die
Kinder vor dem schwarzen Feuerrüpel“ (Schornsteinfeger). — Sein Freund
E. Oehme z. B. hatte die Gewohnheit, zu jeder Stunde der Nacht, wenn
ihn irgend eine Stelle eines in Arbeit befindlichen Bildes beunruhigte,
wieder aufzustehen und sich vor die Staffelei zu setzen. Richter sprach
darüber oft, als über etwas, das er nicht verstehen könne.

Abb. 175.
Kartoffelernte. 1865. Aus
„Altes und Neues“. 1873.
Verlag von Alphons Dürr in Leipzig. (Zu
Seite 94.)

Abb. 176.
Bruder Martin. 1873.
(Zu
Seite 94.)
Für Musik hatte Richter großes Interesse; besonders fesselnd und
anregend waren ihm die Trio- und Quartettabende, in denen die
hervorragendsten Künstler und Mitglieder der königlichen Hofkapelle
die beste Musik in edler, künstlerischer Weise vorführten; diese
Aufführungen waren ihm stets ein besonderer Hochgenuß. Den
Opernvorstellungen und dem Schauspiel war er in den letzten Jahren
seiner Augen und seines Gehörs wegen fern geblieben. Bach, Haydn,
Gluck, Mozart, Beethoven begeisterten ihn. Bei Wagners Opern
interessierten ihn besonders die Stoffe, wenn ihn auch manches in[S. 144]
Wagners Musik, insonderheit in der späteren Periode, die mit den
„Meistersingern“ beginnt, etwas befremdete; 1869 zeichnete er auf: „Die
Meistersinger von Wagner habe ich zweimal gehört. Prinzipiell nicht
einverstanden mit seiner Richtung, bin ich doch hingerissen von der
romantischen Schönheit seiner Musik und seiner Stoffe.“ Am liebsten
aber war es ihm, wenn er im eigenen Hause, in seinem behaglichen
Hauspelz, in einer Ecke sitzend, Musik hören konnte. Sein Sohn
Heinrich, der in Leipzig und München früher Musik studiert hatte und
in letzterer Stadt auch mit dem Sänger Ludwig Schnorr, dem Sohn Julius
Schnorrs, verkehrte, spielte ihm oft vor; es wurde auch viel vierhändig
gespielt, auch öfters von den weiblichen Verwandten gesungen. Und
so trug gute Musik, von kunstverständiger und kunstsicherer Hand
ausgeführt, zur Verschönerung seines Lebensabends wesentlich bei.
Ich mußte dabei oft an die Bilder des Meisters denken, in denen er
„Hausmusik“ schilderte und verherrlichte, wie in Abb. 133 und besonders
in dem schönen Titelblatt zu Riehls Hausmusik, das er 1855 gezeichnet
hatte.

Abb. 177.
Mailust. Aus „Altes und
Neues“. 1873. Verlag von Alphons Dürr in Leipzig. (Zu
Seite 94.)
Der Kreis der alten Freunde lichtete sich mehr und mehr. 1879 nahm ihm
der Tod auch seine alten Freunde Krüger und Peschel. Carl Peschel,
einer der Getreuen aus der Zeit des römischen Aufenthaltes, war ihm
ein lieber und trefflicher Freund, der bis in sein hohes Alter (er
war 1798 geboren) sich Frische und Produktionskraft erhielt; zeigten
doch seine letzten Arbeiten, Kartons zu Fenstern für eine Kirche in
England, noch wesentliche Fortschritte. In seiner Kunst schloß er sich
den altdeutschen Meistern an. Er hat eine Reihe tüchtiger Altarbilder
aus innerster religiöser Überzeugung geschaffen, die zu den besten
Werken kirchlicher Kunst aus dieser Epoche gehören. Es sei hier nur
eine „Kreuzigung“ genannt, die er als Altarbild für die Kapelle des
Prinzenpalais in Dresden ausführte. War Richter eine produktive Natur,
so war die Peschels mehr kontemplativ, und so ergänzten sich beide sehr
gut. Peschel zählte zu[S. 145] den Hauptstützen der Dresdener Akademie; er
unterrichtete viele Jahre mit größter Gewissenhaftigkeit im Antiken-
und Aktsaal und zeigte warmes Interesse für seine Schüler. Die an seine
Braut gerichteten Briefe aus seiner römischen Studienzeit, die über die
Entwickelung der neudeutschen Kunst gewiß vieles Interessante enthalten
haben, sind seiner Witwe auf deren ausdrücklichen Wunsch mit in den
Sarg gelegt worden. — Auch der alte Freund Julius Hübner schied Anfang
der achtziger Jahre von dieser Erde.

Abb. 178.
Sub
rosa. Aus „Altes und Neues“. 1873. (Zu
Seite 94.)
Unser Meister war nun recht einsam und verlassen, aber doch nicht
vergessen. Das sah er zu seiner Freude an seinem achtzigsten
Geburtstage, an welchem ihm so viele Zeichen und Beweise treuer
Liebe und dankbarer Verehrung aus allen Gegenden Deutschlands von
alt und jung entgegengebracht wurden. Er war tiefbewegt von alledem,
aber demütig und fast verlegen nahm er solche Huldigungen entgegen.
Am meisten freuten ihn Zuschriften und kleine Aufmerksamkeiten aus
dem Volke, die oft in recht drolliger und humoristischer Weise die
Verehrung für den Meister zum Ausdruck brachten. Wir wollen hier nur
eine Zusendung anführen, die aus Schlesien an diesem Tage einging:

„Wer uns den Rübezahl erschuf,
Wie unser Ludwig Richter,
Der ist ein Maler von Beruf
Und von Beruf ein Dichter.
[S. 146]
Bei allem Herben leuchtet vor,
Aus Mensch- und Tiergestalten,
Des Lebens Trost, deutscher Humor,
Gott mög’ ihn dir erhalten!
Gott segne dich, du edler Greis,
Du Freund von Alt und Jungen!
Aus Schlesien wird’s zum Festtagspreis
Dem Achtziger gesungen!
Der Sänger und der Dichter
Ist auch (jedoch Amts-)Richter,
Reist stets noch mit dem Ränzel
Heißt Amtsgerichtsrat .......“
In seiner Biographie klagt er, daß die Anforderungen, die dieser Tag
an ihn gestellt, über seine Kräfte gingen, und schreibt dann: „Ich
fühlte mich noch an den folgenden Tagen durch diese vielen Ehren- und
Liebeszeichen freudig gehoben, aber ebensosehr innerlich gebeugt:
denn wodurch hatte ich dieses alles verdient? Meine Arbeiten waren
doch meine eigene höchste Lust und Freude gewesen, und das Gute und
Lobenswerte daran lag doch gerade in dem, was man nicht bloß lernen
oder sich selber geben kann, sondern es war das, was uns geschenkt
wird: die Gottesgabe, das Talent.“ Aus diesen Worten erkennt man wieder
den durch und durch demütigen Menschen und Künstler.

Abb. 179.
Wenn ich dich hätte. 1870.
Aus „Altes und Neues“. 1873. (Zu
Seite 94.)
Im Jahre 1856 war der bekannte feinsinnige Kunstfreund Eduard Cichorius
aus Leipzig zum erstenmal nach Dresden gekommen und hatte hier durch
August Gaber unseren Meister kennen gelernt. Es entwickelte sich
in der Folge ein warmes Freundschaftsverhältnis zwischen beiden
Männern. Cichorius fing an, Zeichnungen von Richter[S. 147] zu sammeln,
und mit sicherem Blick und feinem Verständnis für die Eigenart des
Meisters brachte er die größte und hervorragendste Sammlung zusammen,
der er auch eine stattliche Reihe von Handzeichnungen J. Schnorrs,
viele von den Zeichnungen zu dessen großem Bibelwerk und die früher
erwähnten Landschaften aus Italien einverleibte. Er erwarb auch eine
Reihe von Ölbildern Richters, von denen er einige dem Städtischen
Museum in Leipzig überwies. Der Meister kam, so oft Cichorius
wieder in Dresden weilte, viel zu ihm ins Hotel, wo sich dann beim
Betrachten der Zeichnungen die interessantesten Gespräche anknüpften.
Cichorius schreibt in der „Liebesspende“ für die Kinderheilanstalt in
Dresden (von Zahn & Jaensch, Dresden) im Dezember 1884 darüber: „Im
vertraulichen Gespräch, wo Richter sich gehen ließ, sich ganz frei
fühlte, war er der anziehendste, geistvollste Gesellschafter, der sich
nur denken läßt. Ein solches sich stundenlang ausdehnendes Zwiegespräch
war von hohem Genuß; ein lebhafter Austausch, ein gegenseitiges Geben
und Empfangen, bei wesentlicher Übereinstimmung im ganzen. Kleine
Abweichungen in den Ansichten bilden ja erst die rechte Würze der
Unterhaltung.“ Und weiter schreibt er an derselben Stelle: „Wohl
trennte uns vielfach Neigung und Meinung, vorzugsweise in politischen,
aber auch in Fragen nach den höchsten Dingen, und es traten hier oft
schärfere Gegensätze hervor, aber er bewährte sich auch hier als ein
echter Freund; er gab seine Meinung nicht auf, vertrat sie aber immer
auf sanfte und milde Weise. So blieb unser Verhältnis ungetrübt, und
dabei war das Verdienst ganz und gar auf seiner Seite.“ In diesen
vortrefflichen Aufsatz werden auch Briefe Richters an Cichorius aus
den Jahren 1876–1883 zum Abdruck gebracht, aus denen man ersieht, wie
freundschaftlich er ihm zugetan war. Das Freundschaftsverhältnis war
bis an Richters Lebensende das denkbar beste, Cichorius bewahrt ihm das
treueste Gedenken.

Abb. 180.
Heimkehr der Landleute nach
Civitella.
Aus „Altes und Neues“. 1873. (Zu
Seite 94.)
An freudigen und ernsten Ereignissen in der Familie nahm Richter
herzlichsten Anteil. 1880 und 1881 griff der Tod mit rauher Hand in ein
stilles, glückliches Familienleben ein: drei blühende Urenkel fielen
tückischen Krankheiten zum Opfer; er[S. 148] war auch hier in Tagen schwerster
Prüfung und Heimsuchung, die so plötzlich hereinbrachen, durch sein
unerschütterliches „Wie Gott will!“ eine rechte Stütze und wußte die
zerschlagenen Elternherzen aufzurichten. In solchen Zeiten schwerer
Sorgen schreibt er aus Boll am 18. Mai 1880: „Zunächst möchte ich gern
wissen, wie es Euch ergeht? Hoffentlich zieht die dunkle Wolke nun
vorüber, Ihr armen Schwergeprüften! — Grüße zunächst Deine Frau Gretel
und die beiden Kinder; die Geschwister haben ihr Pfingsten in der
‚Oberen Gemeinde‘ gefeiert, gewiß recht selig und in Jubel. Die Tränen
sind nur hier zu Hause. Gott sei mit Euch.“
Schon in Rom hatte Richter eifrig den Gottesdienst in der
protestantischen Kapelle im preußischen Gesandtschaftspalast aufgesucht
und zu Richard Rothe, dem damaligen Gesandtschaftsprediger, sich
in nahe Verbindung gebracht; sein Intimus Maydell war ein eifriger
Protestant. Nach Deutschland zurückgekehrt, besuchte er fast regelmäßig
die protestantische Kirche und suchte sich an den Predigten zu erbauen,
soviel er konnte. Die in den dreißiger und vierziger Jahren herrschende
Strömung in unserer protestantischen Kirche befriedigte ihn aber
wenig. In Thäters Biographie finden wir vom Jahre 1844 aus Dresden
eine Aufzeichnung, die uns einigermaßen Einblick in die damaligen
kirchlichen Verhältnisse verschafft; sie lautet: „Mit Recht klagt man
über unsere arme Kirche. Hier steht’s schlimm damit. Wir möchten gern
Gottes Wort hören, wenn wir wüßten, wo es gepredigt würde. Doch wir
haben die Bibel und finden darin Trost und Erquickung. Aber in den
Schulen fehlt es ganz. Meine Freunde, Oehme und Richter, berieten sich
erst neulich mit mir, wohin wir unsere Kinder könnten in die Schule
schicken. Wir finden keine, wo der Religionsunterricht von der Art
wäre, wie wir ihn für unsere Kinder wünschen müssen.“

Abb. 181.
Sommer. Aus „Bilder und
Vignetten“. 1874.
Verlag von Alphons Dürr in Leipzig. (Zu
Seite 95.)
Rom zog Ende der dreißiger Jahre die Zügel sehr straff an; besonders
bei den „Mischehen“ wurde die seitherige Milde aufgegeben und durch
Strenge ersetzt; der Fürstbischof von Breslau, Graf Leopold Sedlnitzky
von Choltitz, legte infolge dieser strengen Richtung sein Amt nieder.
Wir wissen nicht, inwieweit dieses Vorgehen[S. 149] Roms auch auf Richters
Haus und Familie einwirkte, seine Kinder (seine Frau war Protestantin,
und er war mit ihr in der protestantischen Kirche getraut) hat er
protestantisch erzogen. Dabei blieb er immer ein Glied der katholischen
Kirche, er stand aber, wie ich schon sagte, über den Grenzen der
Konfessionen. Später fand er auch in den protestantischen Predigten,
als eine neue, ihm sympathischere Richtung Platz gegriffen, viel
Erbauung. Bis um die Mitte der siebziger Jahre hörte er an Sonntagen
oft Predigten in der protestantischen Hofkirche, der Frauen- und
Annenkirche in Dresden, des öfteren habe ich ihn begleitet. Er stand
im Verkehr mit hervorragenden protestantischen Theologen, weilte, wie
bereits erwähnt, oft in Boll bei Blumhardt. Für die Selbstbiographie
des Grafen Leopold Sedlnitzky (Berlin, W. Hertz) hatte er großes
Interesse; die schonende Art des Grafen gegenüber der katholischen
Kirche, die seinem endlichen Übertritt zur evangelischen Kirche
(1863 in Berlin) vorangegangene lange innerliche Vorbereitung waren
Richter besonders sympathisch. Der Sohn schreibt in den Nachträgen
zur Biographie, „daß Richter in den letzten Lebensjahren sich mehr
an die katholische Kirche anschloß und Sonntags nicht, wie früher,
einer protestantischen Predigt, sondern der Messe in der katholischen
Hofkirche beiwohnte, gab in den ihm näher stehenden Kreisen Anlaß zu
der Vermutung, es habe sich — vielleicht unter äußerer Beeinflussung
— in seinen religiösen Anschauungen eine wesentliche Wandlung
vollzogen. Diese Meinung ist nicht zutreffend. Der von kirchlichem
Dogmatismus ganz unabhängige praktische Kern seines Christentums ist
allzeit unverändert geblieben, nur die Formen, Ausdrucksweisen und
Bedürfnisse seines religiösen Lebens haben im Laufe der Jahre unter
äußeren und inneren Einflüssen Wandlungen durchgemacht.“ Der Sohn läßt
sich hierüber noch des weiteren aus; es seien denjenigen, die sich
dafür noch besonders interessieren, die letzten Seiten der „ergänzenden
Nachträge“ zum Nachlesen empfohlen.

Abb. 182.
Alles mit Gott.
Aus „Bilder und Vignetten“. 1874. (Zu
Seite 95.)

Abb. 183.
Kindergruppe.
Aus „Bilder und Vignetten“. 1874.
(Zu
Seite 95.)

Abb. 184.
Kindergruppen.
Aus „Kinderengel“ 1858 und „Bilder und Vignetten“ 1874. (Zu
Seite 95.)
Die letzten Lebensjahre verbrachte er in stillster Beschaulichkeit.
Als es mit seinem künstlerischen Schaffen zum Stillstand gekommen
war, wurde die Ausnutzung der Tagesstunden selbstverständlich eine
ganz andere. Nach Beendigung der Morgenbetrachtungen brachte er
einige Stunden an seinem Arbeitstisch zu, ordnete Mappen, schrieb
die notwendigsten Briefe mit vieler Mühe, wenn es die geschwächten
Augen gestatteten, ging vor Tisch auf Anordnung des Arztes spazieren
und, wenn es das Wetter erlaubte, meist nach dem „Großen Garten“. Ich
sehe ihn noch greifbar vor mir: die stattliche,[S. 150] würdige Erscheinung,
in etwas vorgebeugter Haltung, den Stock in der Hand, mit meist
offenem Überrock, so schritt er auf der Straße dahin, mit seinen
schwachen, aber so freundlichen Augen ins Ungewisse hinausschauend; das
silberweiße Haar leuchtete unter dem schwarzen, breiten Filzhut hervor,
aus dem schwarzseidenen Halstuch lugten die spitzgeschnittenen kleinen
Stehkragen (sogenannte Vatermörder), man sah ihm schon von weitem den
bedeutenden, aber schlichten und bescheidenen Mann an. Wir finden in
seiner Biographie eine Aufzeichnung vom 19. Februar 1883, die uns einen
solchen Spaziergang schildert: „Wie gewöhnlich ging ich gegen Mittag
nach dem ‚Großen Garten‘. Der Himmel war bedeckt und alles so still.
Da ertönte aus einiger Entfernung von den noch dürren Baumwipfeln
ein ‚witt, witt, witt‘, und zugleich ließ ein kleines Vögelchen sein
eifrig lustiges Gezwitscher aus dem Gebüsch neben mir laut werden. Als
dritte Stimme klang aus der Ferne das Gurren einer Waldtaube. Dann ward
es wieder ganz still, — das war die erste Frühlingsahnung in diesem
Jahre, der erste Gruß eines kommenden Frühlings, der mir in die Seele
drang. Ich setzte mich auf eine Bank unter den großen Eichen, brannte
mir eine Zigarre an zur Vollendung der Frühlingsfeier, und dabei
umschwärmte ein Kreis kleiner Mücken das aufsteigende Rauchwölkchen.“
Eine friedliche Seelenstimmung klingt aus dieser kurzen Aufzeichnung
heraus; Frieden lag so wohltuend über ihm ausgebreitet bis an sein
Ende. Vom 6. März 1883, kurz nach dieser Tagebuchaufzeichnung, ist
die einem bestimmten Zweck dienende Skizze, zu der er, die Stellung
selbst angebend, eine Viertelstunde saß (Abb. 190). Vom 1. April
1884 ist der angefügte Brief, der letzte, den ich vom teuren Meister
erhielt. Er sendet gleichzeitig das Märzheft der „Deutschen Rundschau“
mit einem größeren Aufsatz von Herrmann Grimm: „Cornelius betreffend“
zurück. Bedauerlich ist, daß er seine Gedanken über das in dem Aufsatz
herangezogene Bild von E. von Gebhardt nicht mehr niederschreiben
konnte. Anfang des Jahres 1884 überwies des Meisters Sohn dem
königlichen Kupferstichkabinett in Dresden eine kostbare[S. 154] Sammlung
von Probedrucken der Holzschnitte des Meisters in neun von Hoff
geordneten Bänden.


Abb. 185.
Schneewittchen. 1870.
Aquarelle in der königl. Nationalgalerie zu Berlin. (Zu
Seite 96.)
Im Nachtrag zur Biographie schildert der Sohn des Meisters letzte
Lebenstage wie folgt: „Sein letztes Lebensjahr, 1884, hatte er in
leidlichem Wohlsein angetreten, aber im Verlaufe des Winters und
Frühlings stellten sich zuweilen Ohnmachtsanwandlungen ein, die
ihn jedesmal für längere Zeit matt und kraftlos machten. Im Juni
erkrankte er an einer Herzentzündung. Die Krankheit selbst verließ
ihn zwar schon nach wenigen Tagen wieder, seine Kräfte aber blieben
so erschöpft, daß er tagsüber meist auf dem Sofa ruhen mußte. Geistig
erhielt er sich ungetrübt und zeigte, wie immer, liebevolles Interesse
für seine Umgebung und für alles, was in sein Bereich kam. Besondere
Freude machte ihm stets, wenn ihm etwas vorgelesen wurde. Da er den
Wunsch äußerte, wieder einmal eine gute, christliche Lebensgeschichte
zu hören, so brachte ich ihm einen Band von Knapps ‚Christoterpe‘.
Daraus las ihm die älteste Tochter seines verstorbenen Freundes, des
Kupferstechers Ludwig Gruner, die Biographie Ludwig Hofackers vor,
dessen gedruckte Predigten Richter besaß und schätzte. In diesem
Lebensbilde wird eine längere geistliche Betrachtung in Gebetform
mitgeteilt, welche Hofackers Mutter an der Leiche ihres Gatten für
ihre Kinder niedergeschrieben hatte. Von den schlichten Worten dieser
kindlich frommen, glaubensstarken Frau fühlte er sich eigentümlich
bewegt. Er erzählte mir, es sei ihm dabei die Stimmung seiner
glücklichsten und innerlich reichsten Zeit zurückgekehrt, jener Zeit in
Rom, wo ihm in der Neujahrsnacht 1825 der Glaube an einen lebendigen
Heiland plötzlich wie ein Geschenk von oben ins Herz gegeben wurde
und ihn mit vorher nicht gekanntem Frieden und Glück erfüllte. Er
kam auf dieses Thema wiederholt zurück. Noch an seinem Sterbetage,
an dem ich ihn vormittags besuchte, nicht ahnend, daß ich den lieben
Vater zum letztenmal lebend sah, brachte er das Gespräch auf Hofackers
Biographie, deren Fortsetzung er zu hören wünschte, und auf den um
Richard Rothe gescharten römischen Freundeskreis. An diesem Tage — es
war Donnerstag der 19. Juni — fühlte er sich zwar matt, aber besonders
heiter gestimmt und empfing, auf dem Sofa liegend, tagsüber viele
Besuche.“

Abb. 186.
Skizze zum Schneewittchen.
1870. (Zu
Seite 96.)
[S. 155]
Die Deutsche Kunstgenossenschaft hatte ihn zum Ehrenmitglied ernannt.
Sein Dankschreiben vom 16. Juni 1884, dessen Abfassung ihm Sorgen
machte, weshalb er Freund Cichorius dazu zu Rate zog, lautet: „Bereits
telegraphisch habe ich Ihnen meinen innigsten und freudigsten Dank
für die Ernennung zum Ehrenmitglied der Deutschen Kunstgenossenschaft
ausgesprochen, lassen Sie mich denselben hier noch einmal schriftlich
wiederholen. Diese ehrenvolle Kundgebung seitens der deutschen Künstler
kam mir um so überraschender, da es leider so manches Jahr her ist, daß
ich durch die zunehmende Trübung meiner Augen genötigt war, meiner so
geliebten künstlerischen Tätigkeit gänzlich zu entsagen. Wohl empfing
ich während dieser Zeit unfreiwilliger Muße von vielen Seiten her
mannigfache Zeichen freundlicher Anerkennung, die mich freudig erhoben,
da sie mir sagten, daß es mir vielleicht hier und da gelungen sei, das,
was in vielen deutschen Herzen lebt, auf meine Weise auszusprechen und
künstlerisch zu gestalten. Nun ist es mir aber von hohem Wert, auch von
seiten der Kunstgenossenschaft diese Anerkennung und Zustimmung zu dem,
was ich erstrebt und, wie meine Freunde sagen, auch bisweilen erreicht
habe, bestätigt zu sehen. Die Kunst der Gegenwart geht ja vielfach auf
anderen Bahnen, und ihre Ziele sind teilweise andere, als diejenigen
waren, denen ich und meine Altersgenossen zustrebten. Um so ehrenwerter
ist es daher, wenn auch das jüngere Geschlecht der Künstlerschaft sich
an uns Alte noch mit Wärme und Anteil erinnert. Empfangen Sie, geehrte
Herren, nochmals den Ausdruck meines Dankes, sowie Gruß und Handschlag
von Ihrem ergebenen Ludwig Richter.“
Es sind seine letzten Schriftzüge. Eine halbe Stunde nach Eingang des
Schriftstückes beim damaligen Hauptvorstand in Düsseldorf meldete der
Telegraph das Ableben des gefeierten Meisters.

Abb. 187.
Skizze zum Schneewittchen.
(Zu
Seite 96.)
Am Abend des 19. Juni stellte sich plötzlich bei ihm, nachdem er noch
vorher mit seiner Tochter Elisabeth das Abendbrot in gewohnter Weise
eingenommen hatte, Frost ein; er begab sich zu Bett. Kurz darauf trat
die Tochter in das Schlafzimmer, um nach seinem Befinden zu fragen; er
antwortete ihr noch ganz klar und ruhig, begann auf einmal zu röcheln,
und nach wenigen Minuten hörte er auf zu atmen. Ohne Kampf löste sich
die erdenmüde Seele von ihrer leiblichen Hülle.
„Ich wollt’, daß ich daheim wär’,
Und aller Welt nicht diente mehr.
Ich hab’ doch hie mein Bleiben nicht,
Ob’s morgen oder heut geschicht.
Daheim ist Leben ohne Tod
Und ganze Freude ohne Not.“
[S. 156]
Dunkle, schwere Wolken zogen am Himmel, strömender Regen ging nieder,
als der teure Tote, es war am Abend des 21. Juni, einem Sonnabend,
bei Fackelschein von den Dresdener Künstlern nach der Friedhofshalle
übergeführt wurde. Seine Vaterstadt Dresden erwies ihrem Ehrenbürger
durch das feierliche Geläute sämtlicher Kirchenglocken die letzte
Ehre. Auf dem neuen katholischen Friedhof der Friedrichstadt, des
Stadtteiles, in dem seine Wiege stand, wurde er beerdigt. Sein
Grabstein trägt die gleiche Inschrift wie der seiner Frau auf dem
Loschwitzer Friedhof: „Christus ist mein Leben, und Sterben ist mein
Gewinn.“
Aus der Grabrede, die ihm der Kaplan Eberhard Klein am 23. Juni hielt,
ist folgende Stelle hervorzuheben: „Richter hat die Himmelsgabe,
die ihm Gott geschenkt, mit priesterlicher Ehrfurcht gehandhabt und
gehütet. Seine Kunst hat sich ihren wahren Adels- und Freiheitsbrief
der Tendenzlosigkeit bewahrt und nichts anderes sich zum Zwecke
gesetzt, als in Gott wohlgefälliger Weise die Mitmenschen zu erfreuen.
Seine Kunst war eine Art Gottesdienst, war eine Ausübung der
Nächstenliebe, wie sie selbstloser und edler nicht gedacht werden kann.
Und wie er malte, so war er, seine Kunst ist sein Wesen.“ —

Abb. 188.
Schlafende Kinder. 1872.
(Zu
Seite 97.)

Abb. 189.
Ruhe auf der Flucht. Des
Meisters letzte Aquarelle. 1873. In der königl. Nationalgalerie zu Berlin. (Zu
Seite 98.)
„Je mehr ein wahrhaft gesundes Gedeihen der Kunst auf ihrer
Volkstümlichkeit beruht, desto mehr hat diese selbst ihre Ideale treu
und rein zu hüten. Die Abwege ins Äußerliche, Naturalistische und
Leere liegen unserer heutigen Kunst, vor allem der Malerei deshalb so
gefährlich nahe, weil der Zug der Zeit ein überwiegend realistischer
ist. Drum muß die Kunst ihr ewiges Erbteil des Idealen wahren, muß
treu, wahr und tief sich dem Leben hingeben, aber in den Erscheinungen
desselben nicht die blendende Hülle, sondern den unvergänglichen Gehalt
zu erfassen suchen. Das ist ihre Aufgabe, ihr Beruf, das ist die
Bedingung für ihre lebendige Fortdauer,“ so schließt Wilhelm Lübke 1860
sein treffliches Werk „Grundriß der Kunstgeschichte“. Richter [S. 158]hat
treu und mit großem Ernst die Aufgaben und Bedingungen echter Kunst
gelöst und erfüllt.
Unsere deutsche Kunst ist aber gegenwärtig in einer Zeit des
Überganges; ein Tasten hin und her, ein unruhiges Suchen; es ist, als
ob man die verloren gegangene, irrende Seele wiederzufinden suche.
Die Technik ist hoch entwickelt, und viel Können zeigt sich überall.
Möchten die richtigen Pfade bald wiedergefunden werden! Möchte das
deutsche Volk auch das Verständnis für unseren verewigten Ludwig
Richter, einen der größten und ersten Meister der deutschen Kunst, nie
verlieren! Möchte es des Mannes nie vergessen, der, wie Otto Jahn so
trefflich sagt, eine Naturgeschichte des deutschen Volkes gezeichnet
hat, treuer und lebendiger, als es die geistreichste Feder liefern kann.
* *
*
Fast wollte es eine Zeitlang scheinen, als sei, nachdem unser
Altmeister seine irdische Laufbahn abgeschlossen, das Verständnis für
seine Kunst in der Abnahme begriffen. Sein hundertster Geburtstag hat
aber gezeigt, daß er und seine Kunst noch nicht vergessen und das
deutsche Volk seiner noch in Liebe und Verehrung gedenkt, sich an
seinen Werken noch erfreuen kann. In allen Gauen Deutschlands wurde an
diesem Tage seiner pietätvoll gedacht, in zahllosen Schriften das in
seiner Kunst „Unvergängliche“ mit großer Wärme gefeiert.
Die Dresdener Künstler hatten einer „Sächsischen Ausstellung“ im
Hinblick auf die hundertste Wiederkehr des Geburtstages eine sehr
reiche „L. Richter-Ausstellung“ in den geschickt und stimmungsvoll
umgestalteten, an sich so wenig intimen Ausstellungssälen auf der
Brühlschen Terrasse angegliedert. Die Ausstellung gab in aus Museen
und Privatbesitz entlehnten Zeichnungen, Aquarellen und Ölgemälden,
soweit dies in den immerhin engen Räumen im Verhältnis zu der großen
Produktivität des Meisters möglich war, ein ziemlich klares Bild von
seiner Entwickelung und vom Wesen seiner Kunst.

Abb. 190.
Porträtskizze. 1883.
(Zu
Seite 150.)
Auch Loschwitz, in dem der Meister dreißig Sommer verlebte, hatte das
Seine, wenn auch in bescheidenerem Rahmen, getan, dankbare Erinnerungen
an den Heimgegangenen zum Ausdruck zu bringen.
Ebenso wurde Berlin Gelegenheit gegeben, eine kleinere Zahl von Werken
des Meisters in einer Sonderausstellung zu sehen. — Leider muß erwähnt
werden, daß in diesen Ausstellungen auch Kopien, und zwar recht
minderwertige, sich befanden.
Der überaus rege Besuch dieser Ausstellungen legte Zeugnis davon
ab, daß die Sprache unseres Meisters noch verstanden wurde, daß die
Beschauer die Innigkeit[S. 159] und Behaglichkeit, die Liebe zur Natur und
den gesunden Humor und nicht zum wenigsten auch sein tief religiöses
Empfinden noch nachempfinden konnten und in ihrem Innern verwandte
Töne erklingen fühlten. „Der Geist, den seine Werke atmen, gehört zum
Besten, was wir besitzen.“

Abb. 191.
Alles Ding währt seine Zeit.
Aus „Es war einmal“. 1862.
Verlag von Alphons Dürr in Leipzig. (Zu
Seite 82.)
Nur an der Hand des mit unendlichem Fleiß und großer Liebe verfaßten
Kataloges: „Adrian Ludwig Richter, Maler und Radierer, des Meisters
eigenhändige Radierungen, sowie die nach ihm erschienenen Holzschnitte,
Radierungen usw., usw., von Johann Friedrich Hoff“ war es möglich,
die chronologische Reihenfolge der Werke und Arbeiten des Meisters
wiederzugeben. Herr J. F. Hoff in Frankfurt a. M., ein Freund und
Schüler des verewigten Meisters, hat in jahrelanger rastloser Arbeit
ein selten vollständiges Verzeichnis zusammengebracht und dem Meister
noch bei Lebzeiten (das Werk erschien 1877 bei J. Heinrich Richter)
damit eine große Freude gemacht.
Bei dem knappen Raum war es nicht möglich — es lag auch nicht in
meiner Absicht — jedes einzelne Blatt oder alle die kleineren Werke,
für die Richter gearbeitet, in dieser Monographie zu erwähnen.
Es galt, in knapper Form ein Bild von der reichen Tätigkeit des
Meisters zu geben. Wenn wir den größeren Teil der Abbildungen, die
in Holz geschnitten wurden, nicht im Holzschnitt, sondern nach den
Originalzeichnungen wiedergegeben haben, so hat das seinen Grund
darin, daß die eigenartige Zartheit der Handzeichnung auch durch
den vollkommensten Holzschnitt nicht ganz genau wiederzugeben ist.
Die Handzeichnungen, die wir hier vervielfältigt darbieten konnten,
verdanken wir dem überaus gütigen Entgegenkommen der Direktion der
Königlichen Nationalgalerie in Berlin durch Herrn Professor Dr.
von Donop, des Herrn E. Cichorius in Dresden, des Herrn A. Flinsch
in Berlin, des Herrn E. Theodor Kretzschmar in Dresden †, der Frau
Boerner in Leipzig usw. — Die Erlaubnis zur Vervielfältigung der
Handzeichnungen wurde von Herrn Georg Gaber in Berlin und den
verschiedenen Herren Verlegern der Richterschen Werke auch für die
Wiedergabe der Holzschnitte und Radierungen freundlichst erteilt.

Das Ludwig Richter-Denkmal auf der
Brühlschen Terrasse in Dresden.
Werke von Ludwig Richter
im Verlage von Alphons Dürr in Leipzig.
Fürs Haus. 60 Holzschnitte nach den vier Jahreszeiten
geordnet. Folio. Eleg. in Leinwand gebunden. 20 Mark. Dasselbe in
vier Abteilungen apart:
a) Winter.
b) Frühling.
c) Sommer.
d) Herbst.
Je 15 Holzschnitte in Mappe à 6 Mark.
Vater Unser in Bildern. 9 Holzschnitte in
eleganter Mappe. gr. Folio. 6 Mark.
Der Sonntag in Bildern. 10 Holzschnitte. Folio.
In Mappe. 3 Mark.
Unser tägliches Brot in Bildern. 15 Holzschnitte
in Mappe. Folio. 7 Mark 50 Pf.
Christenfreude in Lied und Bild. Die schönsten
geistlichen Lieder mit Holzschnitten, elegant gebunden in Leinwand mit
Goldschnitt. 14. Auflage. 4 Mark 50 Pf.
Schillers Lied von der Glocke in Bildern. 16
Holzschnitte in eleganter Mappe. Folio. 4 Mark.
Gesammeltes. Fünfzehn Bilder fürs Haus. In Mappe.
Folio. 7 Mark 50 Pf.
Naturstudien. 10 Vorlegeblätter für
Landschaftszeichner. In eleganter Mappe. 5 Mark.
Bilder und Vignetten. 15 Holzschnitte in Mappe.
5 Mark.
Altes und Neues. 15 Originalzeichnungen in
Lichtdruck ausgeführt. Folio. In Mappe. 10 Mark.
Aus der Jugendzeit. Scherz und Ernst in
Holzschnitten. Elegant kartoniert 1 Mark 25 Pf.
Aus der Dichtung und Sage. Scherz und Ernst in
Holzschnitten. Elegant kartoniert 1 Mark 25 Pf.
Der Kinderengel. Spruchbüchlein für Kinder mit
Bildern. 3. Auflage. Kartoniert 1 Mark 50 Pf.
Daraus einzeln:
Luthers Brief an sein Söhnlein Hänschen. Mit Bildern. Geh. 15 Pf.
Der gute Hirte. Gebetbüchlein für fromme Kinder aus dem Schatze
der Kirche gesammelt von G. Weber. Mit Bildern. 2. vermehrte Auflage.
Kartoniert 1 Mark 20 Pf.
Es war einmal. Ein Bilderbuch von Dresdener Künstlern. Märchen
und Kinderlieder mit Bildern. kl. 8o. Kartoniert 2 Mark.
Christnacht. Originalradierung. Plattengröße: Höhe 56½ cm,
Breite 43 cm. Imperialfolio auf chinesischem Papier. 9 Mark. Dasselbe
auf weißem Papier. 6 Mark.
Gevatterbriefe. Mit Randzeichnungen. gr. 4o. 100 Stück 4 Mark.
Christlicher Haussegen. Holzschnitt in Tondruck mit rot
eingedruckten Bibelsprüchen. Imp.-Folio 1 Mark.
Genoveva. Originalradierung. Royalfolio auf chinesischem Papier.
4 Mark 50 Pf.
Rübezahl. Originalradierung. Royalfolio auf chinesischem Papier.
4 Mark 50 Pf.
Volksbilder. Vierfach vergrößerte Holzschnitte als
Wandbilder. Nr. 1–24 à Blatt 50 Pf. Ein ausführlicher
Prospekt mit Beschreibung der einzelnen Blätter steht zur Verfügung.
Goethe, Hermann und Dorothea. Mit 12 Holzschnitten
nach Zeichnungen von L. Richter. 2. Auflage. Gebunden mit
Goldschnitt 5 Mark.
Zwölf Kinderreime aus Klaus Groths „Vaer de Gaern“.
In Musik gesetzt von Ingeborg von Brousart. Mit
hochdeutschem, plattdeutschem und englischem Text und 10 Holzschnitten von
L. Richter. Kartoniert 1 Mark 50 Pf.
Hebel, Alemannische Gedichte für Freunde ländlicher
Natur und Sitten. Im Originaltext. Mit Bildern nach Zeichnungen von
L. Richter. 4. Auflage. Gebunden mit Goldschnitt 4 Mark.
— — Dasselbe ins Hochdeutsche
übersetzt von Robert Reinick. 7. Auflage. Gebunden mit
Goldschnitt 4 Mark.
Richter-Album. Eine Auswahl von Holzschnitten nach
Zeichnungen von L. Richter. 6. Ausgabe in 2 Bänden.
Gebunden mit Goldschnitt 20 Mark.
Richter-Bilder. Zwölf große Holzschnitte nach
älteren Zeichnungen von L. Richter. Herausgegeben von
G. Scherer. Kartoniert 3 Mark.
Beschauliches und Erbauliches. Ein
Familienbilderbuch von L. Richter. 7. Auflage. Gebunden
8 Mark.
Der Familien-Schatz. Fünfzig schöne Holzschnitte
nach Originalzeichnungen von L. Richter. 2. veränderte
Auflage. Gebunden 3 Mark.
Goethe-Album. Illustrationen zu Goethes Werken von
L. Richter. 40 Blatt. 2. Auflage. Gebunden 8 Mark.
Tagebuch. Ein Bedenk- und Gedenkbüchlein für alle
Tage des Jahres mit Sinnsprüchen und Vignetten von L. Richter.
5. Auflage. Gebunden mit Goldschnitt 3 Mark 50 Pf.
Ludwig Bechsteins Märchenbuch. Taschenausgabe mit
84 Holzschnitten nach Originalzeichnungen von L. Richter.
54. Auflage. Gebunden 1 Mark 20 Pf.
— — Dasselbe. Illustrierte
Prachtausgabe mit 153 Holzschnitten und 4 Tondruckbildern nach Originalzeichnungen
von L. Richter. Mit den Bildnissen L.
Bechsteins und L. Richters. 8. Auflage. gr. 8o.
Elegant gebunden 6 Mark.
*** END OF THE PROJECT GUTENBERG EBOOK LUDWIG RICHTER ***
Updated editions will replace the previous one—the old editions will
be renamed.
Creating the works from print editions not protected by U.S. copyright
law means that no one owns a United States copyright in these works,
so the Foundation (and you!) can copy and distribute it in the United
States without permission and without paying copyright
royalties. Special rules, set forth in the General Terms of Use part
of this license, apply to copying and distributing Project
Gutenberg™ electronic works to protect the PROJECT GUTENBERG™
concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark,
and may not be used if you charge for an eBook, except by following
the terms of the trademark license, including paying royalties for use
of the Project Gutenberg trademark. If you do not charge anything for
copies of this eBook, complying with the trademark license is very
easy. You may use this eBook for nearly any purpose such as creation
of derivative works, reports, performances and research. Project
Gutenberg eBooks may be modified and printed and given away—you may
do practically ANYTHING in the United States with eBooks not protected
by U.S. copyright law. Redistribution is subject to the trademark
license, especially commercial redistribution.
START: FULL LICENSE
THE FULL PROJECT GUTENBERG LICENSE
PLEASE READ THIS BEFORE YOU DISTRIBUTE OR USE THIS WORK
To protect the Project Gutenberg™ mission of promoting the free
distribution of electronic works, by using or distributing this work
(or any other work associated in any way with the phrase “Project
Gutenberg”), you agree to comply with all the terms of the Full
Project Gutenberg™ License available with this file or online at
www.gutenberg.org/license.
Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg™ electronic works
1.A. By reading or using any part of this Project Gutenberg™
electronic work, you indicate that you have read, understand, agree to
and accept all the terms of this license and intellectual property
(trademark/copyright) agreement. If you do not agree to abide by all
the terms of this agreement, you must cease using and return or
destroy all copies of Project Gutenberg™ electronic works in your
possession. If you paid a fee for obtaining a copy of or access to a
Project Gutenberg™ electronic work and you do not agree to be bound
by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person
or entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph 1.E.8.
1.B. “Project Gutenberg” is a registered trademark. It may only be
used on or associated in any way with an electronic work by people who
agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few
things that you can do with most Project Gutenberg™ electronic works
even without complying with the full terms of this agreement. See
paragraph 1.C below. There are a lot of things you can do with Project
Gutenberg™ electronic works if you follow the terms of this
agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg™
electronic works. See paragraph 1.E below.
1.C. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation (“the
Foundation” or PGLAF), owns a compilation copyright in the collection
of Project Gutenberg™ electronic works. Nearly all the individual
works in the collection are in the public domain in the United
States. If an individual work is unprotected by copyright law in the
United States and you are located in the United States, we do not
claim a right to prevent you from copying, distributing, performing,
displaying or creating derivative works based on the work as long as
all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope
that you will support the Project Gutenberg™ mission of promoting
free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg™
works in compliance with the terms of this agreement for keeping the
Project Gutenberg™ name associated with the work. You can easily
comply with the terms of this agreement by keeping this work in the
same format with its attached full Project Gutenberg™ License when
you share it without charge with others.
1.D. The copyright laws of the place where you are located also govern
what you can do with this work. Copyright laws in most countries are
in a constant state of change. If you are outside the United States,
check the laws of your country in addition to the terms of this
agreement before downloading, copying, displaying, performing,
distributing or creating derivative works based on this work or any
other Project Gutenberg™ work. The Foundation makes no
representations concerning the copyright status of any work in any
country other than the United States.
1.E. Unless you have removed all references to Project Gutenberg:
1.E.1. The following sentence, with active links to, or other
immediate access to, the full Project Gutenberg™ License must appear
prominently whenever any copy of a Project Gutenberg™ work (any work
on which the phrase “Project Gutenberg” appears, or with which the
phrase “Project Gutenberg” is associated) is accessed, displayed,
performed, viewed, copied or distributed:
This eBook is for the use of anyone anywhere in the United States and most
other parts of the world at no cost and with almost no restrictions
whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms
of the Project Gutenberg License included with this eBook or online
at
www.gutenberg.org. If you
are not located in the United States, you will have to check the laws
of the country where you are located before using this eBook.
1.E.2. If an individual Project Gutenberg™ electronic work is
derived from texts not protected by U.S. copyright law (does not
contain a notice indicating that it is posted with permission of the
copyright holder), the work can be copied and distributed to anyone in
the United States without paying any fees or charges. If you are
redistributing or providing access to a work with the phrase “Project
Gutenberg” associated with or appearing on the work, you must comply
either with the requirements of paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 or
obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg™
trademark as set forth in paragraphs 1.E.8 or 1.E.9.
1.E.3. If an individual Project Gutenberg™ electronic work is posted
with the permission of the copyright holder, your use and distribution
must comply with both paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 and any
additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms
will be linked to the Project Gutenberg™ License for all works
posted with the permission of the copyright holder found at the
beginning of this work.
1.E.4. Do not unlink or detach or remove the full Project Gutenberg™
License terms from this work, or any files containing a part of this
work or any other work associated with Project Gutenberg™.
1.E.5. Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this
electronic work, or any part of this electronic work, without
prominently displaying the sentence set forth in paragraph 1.E.1 with
active links or immediate access to the full terms of the Project
Gutenberg™ License.
1.E.6. You may convert to and distribute this work in any binary,
compressed, marked up, nonproprietary or proprietary form, including
any word processing or hypertext form. However, if you provide access
to or distribute copies of a Project Gutenberg™ work in a format
other than “Plain Vanilla ASCII” or other format used in the official
version posted on the official Project Gutenberg™ website
(www.gutenberg.org), you must, at no additional cost, fee or expense
to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means
of obtaining a copy upon request, of the work in its original “Plain
Vanilla ASCII” or other form. Any alternate format must include the
full Project Gutenberg™ License as specified in paragraph 1.E.1.
1.E.7. Do not charge a fee for access to, viewing, displaying,
performing, copying or distributing any Project Gutenberg™ works
unless you comply with paragraph 1.E.8 or 1.E.9.
1.E.8. You may charge a reasonable fee for copies of or providing
access to or distributing Project Gutenberg™ electronic works
provided that:
• You pay a royalty fee of 20% of the gross profits you derive from
the use of Project Gutenberg™ works calculated using the method
you already use to calculate your applicable taxes. The fee is owed
to the owner of the Project Gutenberg™ trademark, but he has
agreed to donate royalties under this paragraph to the Project
Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payments must be paid
within 60 days following each date on which you prepare (or are
legally required to prepare) your periodic tax returns. Royalty
payments should be clearly marked as such and sent to the Project
Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in
Section 4, “Information about donations to the Project Gutenberg
Literary Archive Foundation.”
• You provide a full refund of any money paid by a user who notifies
you in writing (or by e-mail) within 30 days of receipt that s/he
does not agree to the terms of the full Project Gutenberg™
License. You must require such a user to return or destroy all
copies of the works possessed in a physical medium and discontinue
all use of and all access to other copies of Project Gutenberg™
works.
• You provide, in accordance with paragraph 1.F.3, a full refund of
any money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the
electronic work is discovered and reported to you within 90 days of
receipt of the work.
• You comply with all other terms of this agreement for free
distribution of Project Gutenberg™ works.
1.E.9. If you wish to charge a fee or distribute a Project
Gutenberg™ electronic work or group of works on different terms than
are set forth in this agreement, you must obtain permission in writing
from the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the manager of
the Project Gutenberg™ trademark. Contact the Foundation as set
forth in Section 3 below.
1.F.
1.F.1. Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable
effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread
works not protected by U.S. copyright law in creating the Project
Gutenberg™ collection. Despite these efforts, Project Gutenberg™
electronic works, and the medium on which they may be stored, may
contain “Defects,” such as, but not limited to, incomplete, inaccurate
or corrupt data, transcription errors, a copyright or other
intellectual property infringement, a defective or damaged disk or
other medium, a computer virus, or computer codes that damage or
cannot be read by your equipment.
1.F.2. LIMITED WARRANTY, DISCLAIMER OF DAMAGES - Except for the “Right
of Replacement or Refund” described in paragraph 1.F.3, the Project
Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project
Gutenberg™ trademark, and any other party distributing a Project
Gutenberg™ electronic work under this agreement, disclaim all
liability to you for damages, costs and expenses, including legal
fees. YOU AGREE THAT YOU HAVE NO REMEDIES FOR NEGLIGENCE, STRICT
LIABILITY, BREACH OF WARRANTY OR BREACH OF CONTRACT EXCEPT THOSE
PROVIDED IN PARAGRAPH 1.F.3. YOU AGREE THAT THE FOUNDATION, THE
TRADEMARK OWNER, AND ANY DISTRIBUTOR UNDER THIS AGREEMENT WILL NOT BE
LIABLE TO YOU FOR ACTUAL, DIRECT, INDIRECT, CONSEQUENTIAL, PUNITIVE OR
INCIDENTAL DAMAGES EVEN IF YOU GIVE NOTICE OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
1.F.3. LIMITED RIGHT OF REPLACEMENT OR REFUND - If you discover a
defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can
receive a refund of the money (if any) you paid for it by sending a
written explanation to the person you received the work from. If you
received the work on a physical medium, you must return the medium
with your written explanation. The person or entity that provided you
with the defective work may elect to provide a replacement copy in
lieu of a refund. If you received the work electronically, the person
or entity providing it to you may choose to give you a second
opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If
the second copy is also defective, you may demand a refund in writing
without further opportunities to fix the problem.
1.F.4. Except for the limited right of replacement or refund set forth
in paragraph 1.F.3, this work is provided to you ‘AS-IS’, WITH NO
OTHER WARRANTIES OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT
LIMITED TO WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR ANY PURPOSE.
1.F.5. Some states do not allow disclaimers of certain implied
warranties or the exclusion or limitation of certain types of
damages. If any disclaimer or limitation set forth in this agreement
violates the law of the state applicable to this agreement, the
agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or
limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or
unenforceability of any provision of this agreement shall not void the
remaining provisions.
1.F.6. INDEMNITY - You agree to indemnify and hold the Foundation, the
trademark owner, any agent or employee of the Foundation, anyone
providing copies of Project Gutenberg™ electronic works in
accordance with this agreement, and any volunteers associated with the
production, promotion and distribution of Project Gutenberg™
electronic works, harmless from all liability, costs and expenses,
including legal fees, that arise directly or indirectly from any of
the following which you do or cause to occur: (a) distribution of this
or any Project Gutenberg™ work, (b) alteration, modification, or
additions or deletions to any Project Gutenberg™ work, and (c) any
Defect you cause.
Section 2. Information about the Mission of Project Gutenberg™
Project Gutenberg™ is synonymous with the free distribution of
electronic works in formats readable by the widest variety of
computers including obsolete, old, middle-aged and new computers. It
exists because of the efforts of hundreds of volunteers and donations
from people in all walks of life.
Volunteers and financial support to provide volunteers with the
assistance they need are critical to reaching Project Gutenberg™’s
goals and ensuring that the Project Gutenberg™ collection will
remain freely available for generations to come. In 2001, the Project
Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure
and permanent future for Project Gutenberg™ and future
generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary
Archive Foundation and how your efforts and donations can help, see
Sections 3 and 4 and the Foundation information page at www.gutenberg.org.
Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation
The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non-profit
501(c)(3) educational corporation organized under the laws of the
state of Mississippi and granted tax exempt status by the Internal
Revenue Service. The Foundation’s EIN or federal tax identification
number is 64-6221541. Contributions to the Project Gutenberg Literary
Archive Foundation are tax deductible to the full extent permitted by
U.S. federal laws and your state’s laws.
The Foundation’s business office is located at 809 North 1500 West,
Salt Lake City, UT 84116, (801) 596-1887. Email contact links and up
to date contact information can be found at the Foundation’s website
and official page at www.gutenberg.org/contact
Section 4. Information about Donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation
Project Gutenberg™ depends upon and cannot survive without widespread
public support and donations to carry out its mission of
increasing the number of public domain and licensed works that can be
freely distributed in machine-readable form accessible by the widest
array of equipment including outdated equipment. Many small donations
($1 to $5,000) are particularly important to maintaining tax exempt
status with the IRS.
The Foundation is committed to complying with the laws regulating
charities and charitable donations in all 50 states of the United
States. Compliance requirements are not uniform and it takes a
considerable effort, much paperwork and many fees to meet and keep up
with these requirements. We do not solicit donations in locations
where we have not received written confirmation of compliance. To SEND
DONATIONS or determine the status of compliance for any particular state
visit
www.gutenberg.org/donate.
While we cannot and do not solicit contributions from states where we
have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition
against accepting unsolicited donations from donors in such states who
approach us with offers to donate.
International donations are gratefully accepted, but we cannot make
any statements concerning tax treatment of donations received from
outside the United States. U.S. laws alone swamp our small staff.
Please check the Project Gutenberg web pages for current donation
methods and addresses. Donations are accepted in a number of other
ways including checks, online payments and credit card donations. To
donate, please visit: www.gutenberg.org/donate
Section 5. General Information About Project Gutenberg™ electronic works
Professor Michael S. Hart was the originator of the Project
Gutenberg™ concept of a library of electronic works that could be
freely shared with anyone. For forty years, he produced and
distributed Project Gutenberg™ eBooks with only a loose network of
volunteer support.
Project Gutenberg™ eBooks are often created from several printed
editions, all of which are confirmed as not protected by copyright in
the U.S. unless a copyright notice is included. Thus, we do not
necessarily keep eBooks in compliance with any particular paper
edition.
Most people start at our website which has the main PG search
facility:
www.gutenberg.org.
This website includes information about Project Gutenberg™,
including how to make donations to the Project Gutenberg Literary
Archive Foundation, how to help produce our new eBooks, and how to
subscribe to our email newsletter to hear about new eBooks.