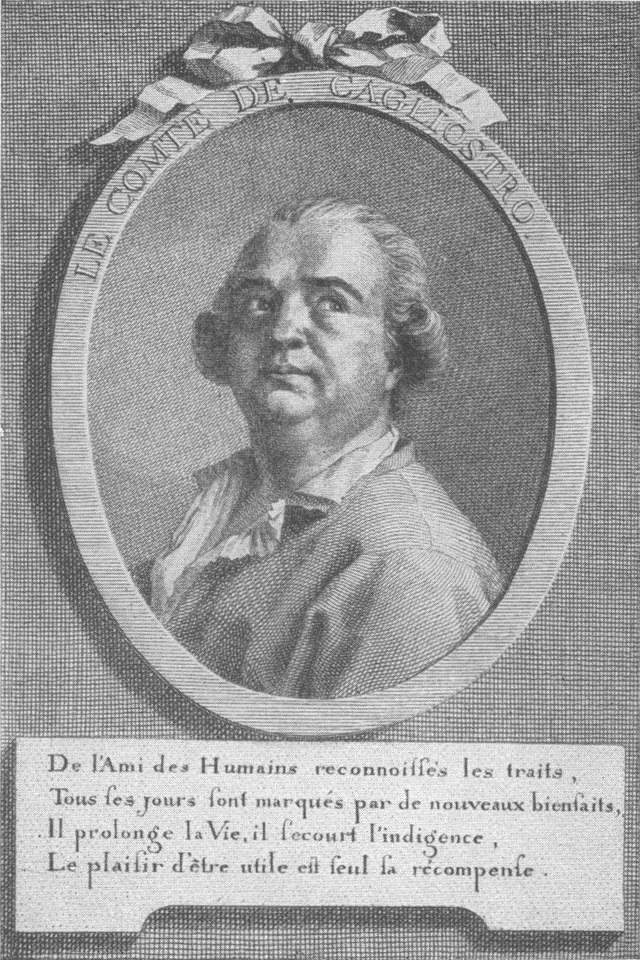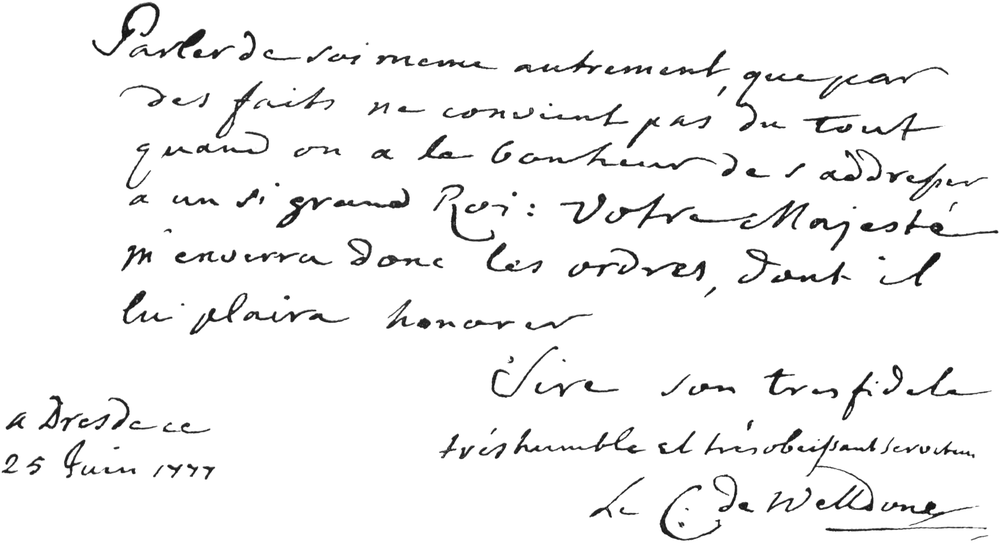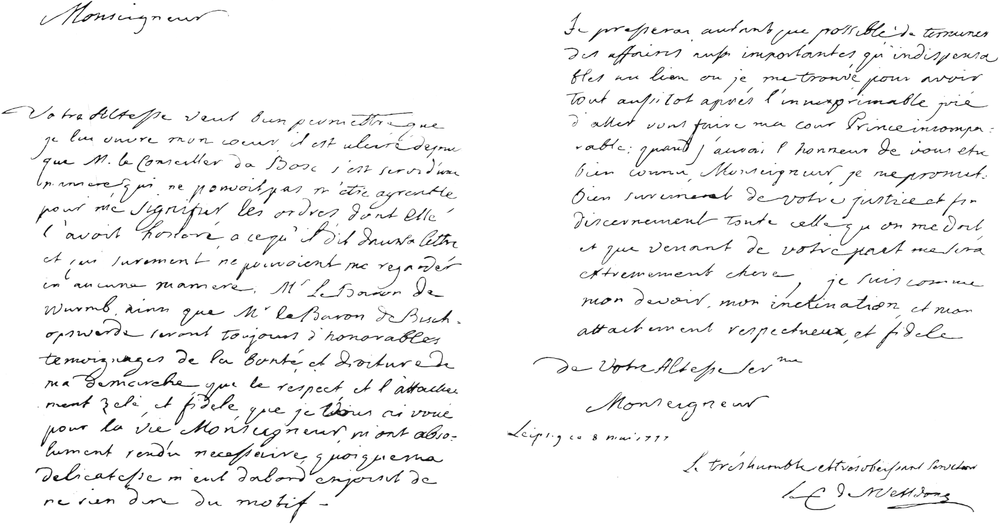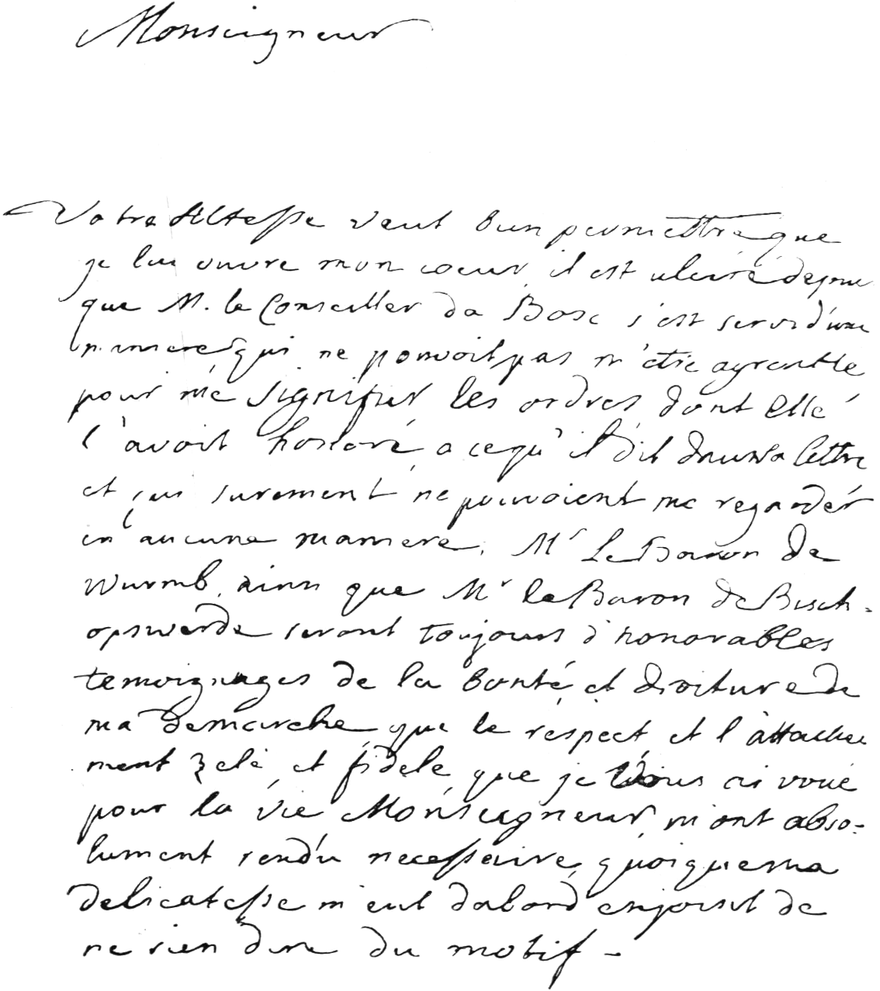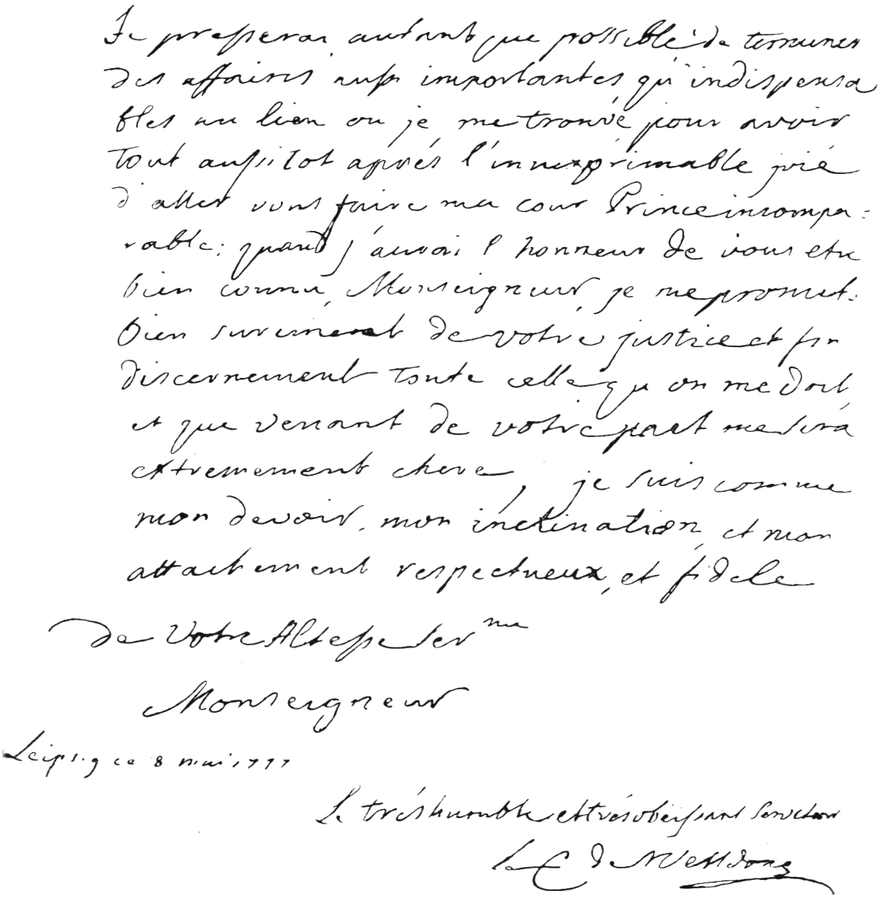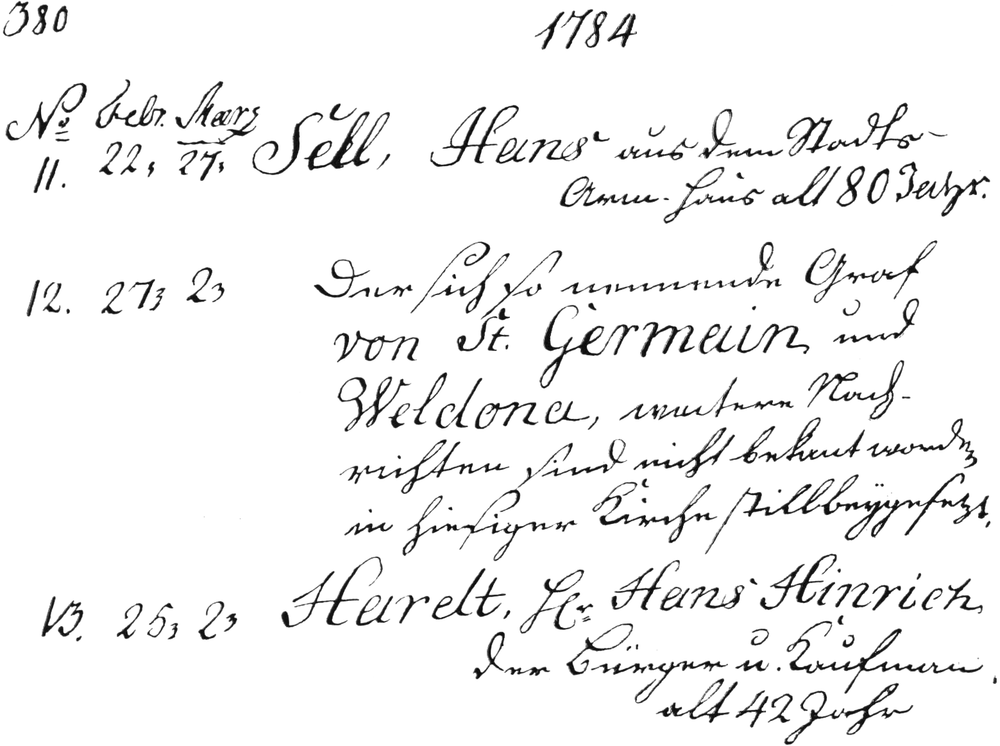*** START OF THE PROJECT GUTENBERG EBOOK 68838 ***
Anmerkungen zur Transkription
Der vorliegende Text wurde anhand der Buchausgabe von
1923 so weit wie möglich originalgetreu wiedergegeben. Typographische
Fehler wurden stillschweigend korrigiert. Ungewöhnliche und heute
nicht mehr gebräuchliche Schreibweisen bleiben gegenüber dem Original
unverändert.
Das Inhaltsverzeichnis wurde
vom Berarbeiter der Übersichtlichkeit halber an den Anfang des Texts
verschoben. Die Seitenzahlen im Abbildungsverzeichnis
wurden an die Positionen der Bilder im Text angeglichen.
Abhängig von der im jeweiligen Lesegerät
installierten Schriftart können die im Original gesperrt gedruckten Passagen gesperrt, in
serifenloser Schrift, oder aber sowohl serifenlos als auch gesperrt
erscheinen.
OPAL-BÜCHEREI

Der Graf von Saint-Germain
Stich von Nicolas Thomas nach einem Gemälde im
Besitz der Marquise von Urfé
DER GRAF
VON SAINT-GERMAIN
DAS LEBEN EINES ALCHIMISTEN
Nach großenteils unveröffentlichten Urkunden
Herausgegeben und eingeleitet von
GUSTAV BERTHOLD VOLZ
*
Deutsch von
FRIEDRICH VON OPPELN-BRONIKOWSKI
Mit 16 Bildbeigaben
*
PAUL ARETZ VERLAG
DRESDEN

Original-Titelseite
Alle Rechte, insbesondere das der
Übersetzung in fremde Sprachen, vorbehalten. Copyright 1923
by Paul Aretz Verlag, Dresden
INHALT
|
EINLEITUNG
|
|
Der „berühmte Alchimist“ S. 5. — Das Rätsel seines
Ursprungs S. 7. — Das Rätsel seines Alters S. 10. — Das erste
Auftreten S. 11. — Sein Aufenthalt in Frankreich S. 13. — Die
Mission des Grafen Saint-Germain im Haag S. 15. — Saint-Germain in
Rußland S. 20. — Das Abenteuer von Tournai S. 23. — Ausgang S. 27. —
Saint-Germains Künste und Geheimnisse S. 31 — War Saint-Germain
Freimaurer und Kabbalist? S. 34. — Saint-Germains Persönlichkeit und
die Legendenbildung S. 37. |
|
|
|
|
ALLGEMEINE DARSTELLUNGEN, ANEKDOTEN
UND FÄLSCHUNGEN
|
|
Aus den „Erinnerungen“ des Barons von Gleichen
|
|
|
Aus dem „Tagebuch eines Weltkindes“ von Graf
Lamberg
|
|
|
Schreiben des Grafen Lamberg an Opiz
|
|
|
Aus Lambergs „Kritischen, moralischen und
politischen Briefen“
|
|
|
Epigramm des Grafen Lamberg auf Saint-Germain
|
|
|
Grabschrift Saint-Germains auf den Grafen Lamberg
|
|
|
Zur Kritik Lambergs (Moehsen)
|
|
|
Aus den „Denkwürdigkeiten“ der Gräfin Genlis
|
|
|
Aus Grosleys „Nachgelassenen Schriften“
|
|
|
Anekdoten
|
|
|
|
|
|
Aus den „Denkwürdigkeiten“ der Lady Craven
|
|
|
Aus den „Erinnerungen“ der Marquise von Créquy
|
|
|
Aus den „Denkwürdigkeiten zur Geschichte des
Grafen Cagliostro“. Cagliostros Besuch bei Saint-Germain.
Eine Satire (von Luchet)
|
|
|
Charakteristik des Grafen Saint-Germain
|
|
|
Kritik der „Charakteristik“ von Meister
|
|
|
Saint-Germain und Cagliostro
|
|
|
Graf Saint-Germain (von Luchet)
|
|
|
Charakteristik des Grafen Saint-Germain
|
|
|
Kritik der „Charakteristik“
|
|
|
|
|
URKUNDEN ZUR LEBENSGESCHICHTE
DES GRAFEN SAINT-GERMAIN
|
|
Saint-Germain in London (1743-1745)
|
|
|
I.
|
Aus dem Briefwechsel von Horace Walpole
|
|
|
II.
|
Aus: „The London Chronicle“
|
|
|
Saint-Germain in Frankreich
|
|
|
I.
|
Aus Casanovas „Memoiren“ und dem „Monolog eines
Denkers“
|
|
|
II.
|
Aus den „Denkwürdigkeiten“ der Madame du Hausset
|
|
|
III.
|
Bericht Hellens (1760)
|
|
|
IV.
|
Saint-Germain auf Schloß Chambord. (Aus dem
Schriftwechsel des Marquis von Marigny)
|
|
|
V.
|
Aus einem Schreiben des Grafen Bernstorff (1779)
|
|
|
VI.
|
Aus den „Episoden meines Lebens“ des Grafen
d’Angiviller
|
|
|
Die Mission Saint-Germains im Haag (1760)
|
|
|
I.
|
Aus dem Schriftwechsel des Herzogs von Choiseul
|
|
|
II.
|
Denkschrift des Grafen d’Affry an die
Generalstaaten
|
|
|
III.
|
Protokoll der Sitzung der Generalstaaten
|
|
|
IV.
|
Aus den Aufzeichnungen des Grafen Bentinck
|
|
|
V.
|
Aus Yorkes Korrespondenz
|
|
|
VI.
|
Aus Hellens Korrespondenz mit Friedrich dem
Großen
|
|
|
VII.
|
Aus der Korrespondenz von Knyphausen und
Michell mit Friedrich dem Großen
|
|
|
VIII.
|
Aus Mitchells Korrespondenz
|
|
|
IX.
|
Berichte Reischachs an Graf Kaunitz
|
|
|
X.
|
Aus Kauderbachs Korrespondenz
|
|
|
XI.
|
Friedrich der Große und Voltaire
|
|
|
XII.
|
Aus der „Geschichte des Siebenjährigen Krieges“
von Friedrich dem Großen
|
|
|
XIII.
|
Aus: „The London Chronicle“
|
|
|
XIV.
|
Graf Danneskjold-Laurwigen an Saint-Germain
|
|
|
Saint-Germain in Holland (1762)
|
|
|
I.
|
Aus dem Schriftwechsel des Herzogs von Choiseul
|
|
|
II.
|
Aus den Aufzeichnungen Hardenbroeks
|
|
|
Saint-Germain in den österreichischen
Niederlanden (1763)
|
|
|
I.
|
Aus dem Schriftwechsel des Grafen Karl Cobenzl
|
|
|
II.
|
Aus den „Erinnerungen“ des Grafen Philipp Cobenzl
|
|
|
III.
|
Aus Casanovas „Memoiren“
|
|
|
Saint-Germain in Ansbach (1774-1776)
|
|
|
„Aufschlüsse über den Wundermann, Marquis
Saint-Germain, und sein Aufenthalt in Ansbach, von einem
Augenzeugen“ (Freiherr von Gemmingen).
|
|
|
Saint-Germain in Leipzig und Dresden (1776-1777)
|
|
|
I.
|
Aus den Tagebüchern des Grafen Lehndorff
|
|
|
II.
|
Aus dem Briefwechsel Friedrichs des Großen mit
Prinz Heinrich, der Prinzessin Wilhelmine von Oranien und
Alvensleben
|
|
|
III.
|
Aus den Briefen des Kurfürsten Maximilian III.
Joseph von Bayern
|
|
|
IV.
|
Aus dem Briefwechsel des Prinzen Friedrich August
von Braunschweig
|
|
|
Saint-Germain in Berlin
|
|
|
I.
|
Aus den „Erinnerungen“ Thiébaults
|
|
|
II.
|
Aus Zimmermanns „Fragmenten über Friedrich den
Großen“
|
|
|
III.
|
Graf Saint-Germain („Berlinische Monatsschrift“)
|
|
|
Saint-Germain in Hamburg (1778)
|
|
|
Saint-Germain in Schleswig und Eckernförde
(1779-1784)
|
|
|
I.
|
Aus den „Denkwürdigkeiten“ des Prinzen Karl von
Hessen-Kassel
|
|
|
II.
|
Prinz Karl von Hessen an Prinz Christian von
Hessen-Darmstadt (1825)
|
|
|
III.
|
Prinz Ferdinand von Braunschweig an Prinz Friedrich
August von Braunschweig (1779)
|
|
|
IV.
|
Aus Briefen des Grafen Warnstedt (1779)
|
|
|
V.
|
Friedrich der Große an die Königin-Witwe Juliane
von Dänemark (1784)
|
|
|
Saint-Germains Tod in Eckernförde
|
|
|
I.
|
Aus dem „Totenregister“ der St. Nikolaikirche in
Eckernförde
|
|
|
II.
|
Aus den „Einnahmen an Begräbnißöffnung und
Vestegeldern“
|
|
|
III.
|
Aus dem Verzeichnis der „Glockengelder“
|
|
|
IV.
|
Aufruf von Bürgermeister und Rat der Stadt
Eckernförde
|
|
|
V.
|
Nachruf des Professors Remer in den „Neuen
Braunschweigischen Nachrichten“ (1784)
|
|
|
PERSONENVERZEICHNIS
|
|
|
ORTSVERZEICHNIS
|
|
|
VERZEICHNIS DER ABBILDUNGEN
|
|
Der „berühmte Alchimist“
Der Name des Grafen Saint-Germain führt uns mitten hinein in die
Welt der Abenteurer, Projektenmacher und Betrüger, von denen das
18. Jahrhundert, so stolz das Jahrhundert der Aufklärung genannt,
wimmelte; denn selten stand das Abenteurertum in solch üppiger Blüte
wie damals. In unaufhörlicher Wanderung von einem Staate zum anderen,
hier untertauchend, um unvermutet dort wieder zu erscheinen, dabei
chamäleonartig Namen und Gestalt wechselnd — so flutet der Strom der
abenteuerlichen Gesellen durch ganz Europa. Vor allem sind Frankreich,
England und Italien die gesegneten Stätten ihres dunklen Wirkens;
aber auch Rußland, das sich seit Beginn des Jahrhunderts aus einem
asiatischen Reiche zu einem Mitglied der europäischen Staatenwelt
zu entwickeln begann, war ein dankbares Feld ihrer Tätigkeit. Sie
bewegen sich nicht nur in den niederen und mittleren Sphären, wie es
zu allen Zeiten gewesen, sondern einige Erwählte dringen auch in die
Kreise der höchsten Gesellschaft bis in die unmittelbare Nähe der
Fürstenthrone. Und auch ihr Gewerbe ist keineswegs das der kleinen
Schelme und Betrüger. Sie kommen mit großen Plänen zur Beglückung der
Völker, sie gebärden sich als Wohltäter der Menschheit, und was ihrer
Tätigkeit den[S. 6] besonderen Stempel aufdrückt, sie umgeben sich mit dem
Schimmer des Geheimnisvollen, indem sie bald als Alchimisten, bald als
Geisterseher oder gar als Magier auftreten.
Auf dem einzigen Bildnis, das wir von Saint-Germain besitzen, ist er
denn auch als der „berühmte Alchimist“ bezeichnet. Überschwänglich wird
von ihm gerühmt, daß er die Herrschaft über die Natur besaß, die ihm
ebenso wie dem Schöpfer willig gehorchte.
Schon seit altersgrauen Zeiten schwebte den Forschern in dem großen
Buche der Natur als höchstes Ziel ihres Strebens die künstliche
Erzeugung der Edelmetalle vor. Das war die Aufgabe, die sich eben
die Alchimie stellte. Ihre Wiege stand in Ägypten. Als die Araber im
7. Jahrhundert dieses Land eroberten, machten sie sich diese geheime
Wissenschaft zu eigen, verpflanzten sie nach Spanien, von wo aus sie
ihren Siegeszug durch ganz Europa antrat. So blühte denn die Alchimie
durch das ganze Mittelalter hindurch bis in die neuere Zeit hinein,
und erst die Entwicklung der Chemie zu einer Wissenschaft machte
diesem Spukglauben ein Ende. So zählte denn auch Saint-Germain zu
den letzten großen Vertretern der „Adepten“, wie die Meister dieses
Geheimnisses hießen, die im Besitz des „Steines der Weisen“ waren; denn
letzten Endes lief alles Forschen und Experimentieren darauf hinaus,
die materia prima, den Urstoff für die Gewinnung des „Steines
der Weisen“, zu finden, mit dem sich das Problem der künstlichen
Herstellung von Gold und der Metallverwandlung lösen ließ. Und wer den
„Stein der Weisen“ besaß, der besaß damit zugleich auch das Geheimnis
der Universalmedizin oder des „Elixiers“, das schier unvergängliche
Dauer des Lebens gewährte.
[S. 7]
Das mystische Dunkel, mit dem Saint-Germain seine Person geheimnisvoll
umgab, ist bis heute noch kaum gelichtet. Über das Anekdotenhafte
kommen die meisten der bisher bekannten Berichte — überdies zum
Teil apokrypher Art — kaum hinaus. Nur die Aufzeichnungen der
Madame du Hausset, der Kammerfrau der Marquise von Pompadour, und
des Ansbachischen Ministers Freiherr von Gemmingen machen davon
eine Ausnahme. Aber auch sie erhellen nur kurze Wegstrecken in dem
wechselvollen Leben dieses Abenteurers. Die zahlreichen neuen Urkunden,
die wir im folgenden aus verschiedenen Archiven mitteilen und die gut
die Hälfte dieses Buches umfassen, bringen daher nicht nur weitere
wertvolle Aufklärung über sein Schicksal, ja sie gewähren überhaupt
erst die Möglichkeit, die Umrisse seiner Gestalt deutlich zu zeichnen.
Und wenn auch nicht alle Rätsel gelöst werden können, so sinkt doch der
Schleier. Der Nimbus des „Adepten“ schwindet, und es bleibt allein das
Bild eines abenteuernden Industrieritters.
Das Rätsel seines Ursprungs
Mit höchster Kunst verstand Saint-Germain, über seine Herkunft einen
Schleier zu breiten. Mit Vorliebe deutete er auf seine Abstammung aus
fürstlichem Geschlecht; ja, er nannte sich wohl selbst im vertraulichen
Gespräch einen Nachkommen des letzten siebenbürgischen Fürsten. Andere
leiten seine Herkunft aus dem letzten spanischen Herrscherhause ab.
In grellem Kontraste dazu stehen die Angaben, nach denen er ein
portugiesischer Jude gewesen sein soll. Endlich wird er als Sohn
eines savoyischen Steuereinnehmers namens Rotondo oder auch als der[S. 8]
italienische Geigenspieler Catalani bezeichnet[1]. Wie steht es um die
Zuverlässigkeit dieser einzelnen Nachrichten?
Zunächst die Frage seiner Abstammung von Franz II. Rakoczy, dem letzten
Fürsten von Siebenbürgen. Verworren sind alle Angaben des Prinzen
Karl von Hessen. So macht er unseren Helden zum Sohne aus erster Ehe
des Fürsten mit einer Tököly; diese war aber nicht die erste Gattin,
sondern die Mutter desselben. Saint-Germain spricht von zwei Brüdern.
Tatsächlich wurden dem Fürsten drei Söhne geboren, aber der älteste,
Leopold Georg, für den Saint-Germain sich selbst ausgibt, starb
nachweislich im Kindesalter; er wurde 1696 geboren und starb 1700.
Wohl trifft es zu, daß die beiden Brüder, Joseph und Georg, am Wiener
Hofe aufwuchsen, wo sie den Namen Marquis de San Marco und Marquis
della Santa Elisabetta erhielten. Aber beide flüchteten (1726 und
1734) — also sie unterwarfen sich nicht feige und demütig ihrem Lose,
wie Saint-Germain dem preußischen Gesandten von Alvensleben und dem
hessischen Prinzen erzählt, und damit entfällt auch die Pointe, daß er
sich selbst, im Gegensatz zu diesem erniedrigenden Verhalten seiner
Brüder, den „heiligen Bruder“, Sanctus Germanus (Saint-Germain)
genannt habe. Man sieht: die ganze Fabel der Abstammung aus dem
siebenbürgischen Fürstenhause steht auf schwachen Füßen. Verdächtig ist
auch der Umstand, daß bereits alle Mitglieder des Hauses tot waren,
deren Zeugnis ihn der Lüge hätte überführen können. Tot war auch der
letzte Fürst aus dem Hause Medici, der ihn nach der Erzählung des
Hessen als zweiter Vater aufgezogen haben sollte.

Fürst Franz II. Rakoczy
Gemälde von Adam Manyoki
Nicht größeres Vertrauen erweckt die Fabel seiner Abstammung aus dem
spanischen Königshause. Nicht daß[S. 9] Karl II. († 1700) sein Vater
gewesen wäre. Die Königin — Maria Anna von Pfalz-Neuburg — soll
ihm während ihres Aufenthaltes in Bayonne (1705) als Frucht einer
illegitimen Verbindung das Leben geschenkt haben. Damit erscheint er
gewissermaßen als Prätendent des durch den Tod Karls II. erledigten
spanischen Thrones, und nur wenn man sich diesen historischen
Hintergrund vergegenwärtigt, wird die von Grosley überlieferte Frage
des spanischen Granden bei der Rückkehr der Königin nach Madrid
verständlich: „Ist sie in anderen Umständen?“ Und sollte sich auch,
wie gerüchtweise behauptet wird[2], Saint-Germain verschiedentlich als
„Prinz von Spanien“ unterzeichnet haben, so läge auch darin
noch kein zwingender Beweis für seine Abstammung aus diesem Hause. Im
Gegenteil, diese Unterschrift würde eher beweisen, daß sein Anspruch
falsch ist, da die spanischen Prinzen offiziell den Titel „Infant
von Spanien“ führten.
Für seine portugiesische Abkunft spricht die mehrfach bezeugte Kenntnis
der Sprache, die um so überraschender ist, als Portugal bereits damals
keine große Weltrolle mehr spielte. Dazu kommt, daß er, wie von
verschiedenen Seiten bezeugt wird, bei seinem Aufenthalt in Holland
im Frühling 1760 bei reichen portugiesischen Juden in Amsterdam und
im Haag wohnte, eine durchaus natürliche Erscheinung, wenn er deren
Stammesbruder war.
Aber auch die Hypothese, daß er aus dem savoyischen Flecken San Germano
stamme, ist nicht einfach von der Hand zu weisen; denn sie würde seine
Namensgebung auf die einfachste und natürlichste Weise erklären.
Mit seiner Herkunft, sei es aus Portugal, sei es aus Savoyen, wäre
auch leicht seine Antwort auf die diesbezügliche[S. 10] Frage der Prinzessin
Amalie von Preußen zu vereinbaren; denn nach Thiébaults Bericht
erwiderte er, seine Heimat sei ein Land mit angestammten Fürsten. Dies
aber trifft sowohl auf Portugal wie auf Savoyen zu.
Was endlich die der Marquise von Créquy in den Mund gelegte Version
betrifft, daß Saint-Germain der Sohn eines jüdischen Arztes Wolf
aus Straßburg gewesen sei, so ist zu bemerken, daß wir es bei den
„Erinnerungen“ dieser Dame mit einer groben Fälschung aus späterer
Zeit zu tun haben. Ebensowenig kommt die Erzählung von Montaigne[3]
in Betracht, der von einem Germain berichtet, den er in Vitry gesehen
habe, und der als Mädchen aufgezogen sei, bis ein Zufall sein wahres
Geschlecht ans Licht gebracht habe.
Wird das Rätsel seines Ursprunges also auch nicht ganz gelöst, so viel
steht fest, daß er nicht fürstlicher Abkunft war; denn auch nicht die
Spur eines Beweises läßt sich dafür beibringen.
Das Rätsel seines Alters
Nicht minder geschickt, wie er seine Herkunft zu verschleiern wußte, so
auch sein Geburtsjahr. Er deutete an, daß sein Lebensalter nicht nach
Jahren und Jahrzehnten, sondern nach Jahrhunderten zähle. Der Spaßvogel
„Mylord Gower“, von dem der Baron von Gleichen berichtet, mußte ihm
als Schrittmacher für die Fabel dienen, daß er schon ein Zeitgenosse
Christi gewesen sei. In seinen Gesprächen ließ Saint-Germain gern
durchblicken, daß er schon in früheren Jahrhunderten gelebt habe.
Für denjenigen, der, wie Alvensleben, ihn stellen wollte, hatte er,
in die Enge getrieben, die Antwort bereit, daß er sich[S. 11] von Zeit zu
Zeit aus dem Treiben der Welt zurückziehe. Vergeblich suchen die
einzelnen Berichterstatter aus seiner äußeren Erscheinung Schlüsse
auf sein Lebensalter zu ziehen. Gegenüber all den Zeugnissen fremder
Personen, wie der Gräfin Gergy, die ihn nach Jahrzehnten im Äußeren
unverändert wiederfinden wollte, fällt das eigene Geständnis des Grafen
Saint-Germain schwer ins Gewicht, der dem Prinzen von Hessen nach
dessen Aufzeichnung erklärte, er sei bei seiner Ankunft in Schleswig
(1779) 88 Jahre alt gewesen. Das würde ungefähr mit dem Lebensalter
stimmen, das für den Sohn des Steuereinnehmers aus San Germano
angegeben wird.
Aber, so könnte man einwenden, spricht nicht für sein Alter das
Stammbuch mit den Eintragungen von Montaigne und dem älteren Grafen
Lamberg? Darauf läßt sich mit der Gegenfrage antworten: waren diese
echt? Schon der jüngere Lamberg spielt auf die Möglichkeit einer
Fälschung an. Waren sie jedoch echt, wo ist dann der Beweis, daß das
Album nicht erst später in den Besitz Saint-Germains gelangt ist? Denn
jene Einzeichnungen sind ganz unpersönlicher Art. Damit scheidet das
Stammbuch als Argument für die Frage des Alters des Grafen aus.
Das erste Auftreten
Gleichwie die Abstammung Saint-Germains ist auch die erste Hälfte
seines Lebens ins Dunkel getaucht. Es heißt, daß er in Mexiko durch
Heirat zu einem großen Vermögen kam und damit nach Konstantinopel
durchbrannte. Für das Jahr 1735 ist sein Aufenthalt im Haag
nachweisbar; denn von dort aus richtete er am 22. November dieses
Jahres ein Schreiben an den englischen[S. 12] Gelehrten Sloane, das über
einen alten Bibeldruck handelt, aber sonst keinerlei persönliche
Angaben enthält[4].
Erst mit seinem Erscheinen in England ums Jahr 1744 gewinnen wir festen
Boden unter den Füßen, und zwar erwähnt ihn Horace Walpole in einem
Schreiben vom 9. Dezember 1745. Wir sehen Saint-Germain als Teilnehmer
an dem Kampfe, den Karl Eduard Stuart, der Enkel des 1688 vertriebenen
Königs Jakob II., um seine Ansprüche auf die Krone mit der englischen
Regierung führte. Wagemutig war der Prätendent in Schottland gelandet,
hatte Edinburg genommen und stand Anfang Dezember bereits in Derby,
um auf London zu marschieren. Doch unter dem Druck der schottischen
Häuptlinge, die ihm die Gefolgschaft versagten, mußte er umkehren, und
die Niederlage bei Culloden (27. April 1746) besiegelte sein Schicksal.
Nach Walpoles Bericht war Saint-Germain offenbar mehr ein Mitläufer
als ein Mitstreiter, wenn er nicht gar, wie es die Nachricht des
London Chronicle von 1760 besagt, unschuldig in den Aufstand
des Prätendenten verwickelt wurde. Jedenfalls aber spielte er keine
Heldenrolle, denn die Untersuchungsakten über den Aufstand schweigen
über ihn völlig[5].
Größere, doch unblutige Lorbeeren erntete er, als er sich als
Geigenvirtuose vorstellte. In diese Zeit fällt wohl auch die Entstehung
seines „Traktats über die Musik nach den Regeln des gesunden
Menschenverstandes für[S. 13] die englischen Damen, die den wahren Geschmack
in dieser Kunst lieben“[6].
Immerhin hören wir, daß das Andenken an seinen Londoner Aufenthalt bei
den Engländern auch 1760 noch nicht erloschen war.
Das folgende Jahrzehnt liegt wieder im Dunkel. Während dieser Zeit
unternahm der Graf zwei Reisen nach Indien. So wenigstens erzählt er
in einem späteren Briefe aus dem Jahre 1773, den sein Freund, Graf
Lamberg, uns überliefert hat. Aber nur über die zweite Reise erfahren
wir einiges Nähere. Er will sie mit dem Admiral Watson und mit Robert
Clive, dem berühmten Eroberer Ostindiens, im Jahre 1755 angetreten
haben. Allein die Einzelheiten, die er meldet, sind so nichtig und
albern, daß es schwer fällt, diesen Bericht ernst zu nehmen. Dabei soll
keineswegs bestritten werden, daß er weite Reisen gemacht und auch den
Orient besucht hat; denn wie wir von kritischen Ohrenzeugen vernehmen,
wußte er anregend zu erzählen, und dies läßt voraussetzen, daß er
selbst Land und Leute gesehen hat, die er so fesselnd zu schildern
verstand.
Sein Aufenthalt in Frankreich
Wir kommen jetzt zu seinem Aufenthalt in Frankreich, der den Höhepunkt
seines Lebens darstellt.
Wann Saint-Germain nach Frankreich gekommen ist, steht nicht fest.
Nach den Aufzeichnungen Casanovas zu[S. 14] urteilen, mit dem sich seine
Wege mehrfach kreuzten, ist er dort schon 1757 oder 1758 gelandet.
In Chambord erscheint er 1758, während ihn der anonyme Verfasser der
„Anecdotes“[7] erst 1759 in Frankreich auftreten läßt.
Hier ging sein Stern auf. Er erlangte die Gunst der Marquise von
Pompadour. Höchst anschaulich ist der Bericht ihrer Kammerfrau, Madame
du Hausset, über seinen Verkehr am Hofe; denn durch die Marquise trat
er auch in Beziehungen zu Ludwig XV., dem er vorgestellt wurde, an
dessen Tafel er speiste und mit dem er alchimistische Studien trieb.
Darin lag kluge Berechnung der Pompadour. Sann sie doch unablässig auf
Mittel und Wege, wie sie dem der Geschäfte überdrüssigen Herrscher
die Langeweile vertreiben könnte. Zu diesem Zwecke hatte sie ihm in
Versailles ein intimes Theater eingerichtet, an dem sie und ihre
Vertrauten mitwirkten. Dann, als sie selbst zu altern begann, hatte
sie den berüchtigten Hirschpark geschaffen. Nun zog sie Saint-Germain
heran, um alchimistischen Versuchen mit dem regierungsmüden König
obzuliegen.
Die Stellung, die er bei Hofe genoß, der Ruf eines Alchimisten, der wie
eine Aureole sein Haupt umschwebte, der Glanz seines Reichtums, über
den fabelhafte Gerüchte umliefen, — all das kam zusammen, um ihm hohes
Ansehen und auch politischen Einfluß zu verschaffen. Der Sturz des
Generalkontrolleurs Silhouette, der die französischen Finanzen leitete,
soll, so berichtet der preußische Gesandte von der Hellen[8], sein Werk
gewesen sein.
Er fühlte sich ferner berufen, das wirtschaftliche Leben Frankreichs
zu heben. Durch die Ausbeutung eines Geheimmittels[S. 15] für Farben und
Farbstoffe, in dessen Besitz zu sein er vorgab, sollte dieser Plan
ins Werk gesetzt werden. Es erregte daher in den weitesten Kreisen
gewaltiges Aufsehen, als ihm der König für seine Arbeiten Räume in dem
Schloß Chambord, dem einstigen Sitz des Marschalls von Sachsen, zur
Verfügung stellte.
Ist es nach alledem verwunderlich, daß es diesem offenbaren Schoßkind
Fortunas nicht an geheimen Gegnern und Neidern fehlte? Schon hatte sein
Ansehen Einbuße erlitten, der Ruf seines unermeßlichen Reichtums war
untergraben — so erfahren wir von einem Augenzeugen —, da lächelte
ihm noch einmal das Glück: in geheimer Mission ward er im Auftrag des
Hofes zu Anfang des Jahres 1760 nach Holland entsandt.
Die Mission des Grafen
Saint-Germain im Haag
Zum Verständnis der Rolle, die Saint-Germain im Haag spielte, müssen
wir kurz den allgemeinen politischen Hintergrund zeichnen.
Seit mehreren Jahren schon währte der englisch-französische
Kolonialkrieg, rangen die Mächte Europas in erbittertem Kampfe
miteinander. Mancherlei Versuche, den Frieden wieder herzustellen,
waren im Sande verlaufen. Immer größer wurde indessen in Frankreich
das Friedensbedürfnis, aber auch in England bestand eine starke
Friedenspartei. Da bot im Herbst 1759 die spanische Krone ihre
Vermittlung an.
Weit bedeutsamer war der Schritt, zu dem sich im November des Jahres
die englische und die preußische Regierung entschlossen. Sie erklärten
sich bereit, an einen noch zu bestimmenden Ort Bevollmächtigte zur[S. 16]
Verhandlung mit den Gegnern über die Einleitung eines allgemeinen
Friedens zu senden. Prinz Ludwig von Braunschweig, der Vormund des
oranischen Erbstatthalters, übernahm es, den Vertretern des feindlichen
Dreibundes im Haag (Graf d’Affry, Baron Reischach und Graf Golowkin)
diese Erklärung zu übermitteln. Auf dem Schlosse zu Ryswijk fand
am 25. November dieser feierliche Akt statt. Darauf brachten die
Generalstaaten Breda als Konferenzort in Vorschlag. Aber der Plan des
Kongresses scheiterte, da die drei eingeladenen Mächte (Österreich,
Frankreich und Rußland) am 3. April 1760 durch ihre Vertreter dem
Prinzen Ludwig ihre Gegenerklärung abgeben ließen, daß sie ohne
Zuziehung ihrer übrigen Verbündeten (Kursachsen und Schweden) sich mit
Preußen auf nichts einlassen könnten.
Der Versailler Hof, der bereits mit der Londoner Regierung durch die
beiderseitigen Gesandten im Haag, Graf d’Affry und General Yorke, in
geheime Besprechungen eingetreten war, fügte noch die weitere Erklärung
hinzu, er sei zu einem Sondervergleich mit England bereit. Das Londoner
Kabinett stand vor der Frage, ob es seine Verbündeten, Preußen und die
übrigen deutschen Fürsten, mit denen es Subsidienverträge abgeschlossen
hatte, preisgeben sollte. Doch William Pitt, der Leiter der englischen
Politik, beharrte auf ihrem Einschluß in den Frieden. So kam es auch
zwischen England und Frankreich zu keiner Verständigung, und der
allgemeine Krieg ging weiter.
Neben den Verhandlungen, die von den beglaubigten Vertretern der Mächte
geführt wurden, liefen andere einher, die des förmlichen Charakters
entbehrten. Eine Zeitlang (1759) hatte Voltaire das Amt des Mittlers
zwischen Friedrich dem Großen und dem französischen Premierminister,[S. 17]
dem Herzog von Choiseul, versehen. Im Februar 1760 war der junge
Freiherr von Edelsheim als geheimer preußischer Agent nach Paris
geschickt worden. Nun erschien auch Saint-Germain im Haag auf der
Bildfläche, um sich die diplomatischen Sporen zu verdienen.
Um die Mitte des Februar 1760 war er in Holland angelangt, hatte
zunächst in Amsterdam verweilt. Als dann Anfang März im Haag die
Vermählung der Schwester des Erbstatthalters gefeiert wurde, tauchte er
in Hollands Hauptstadt auf. In der Öffentlichkeit sprach er von einer
Anleihe, die er für Frankreich vermitteln sollte, von der Aufgabe,
die er habe, die Verpflegung der vom Mutterland abgeschnittenen
französischen Kolonien sicherzustellen. Einem Freunde vertraute er an,
er sei beauftragt, sich über den Gang der Friedensverhandlungen zu
unterrichten. Insgeheim aber setzte er sich mit Yorke in Verbindung,
um ihm Eröffnungen über einen englisch-französischen Friedensschluß zu
machen.
Auf drei mächtige Gönner berief er sich: auf die Pompadour, den
Kriegsminister, Marschall von Belle-Isle, von dem er zwei Briefe nebst
einem Paß vorweisen konnte, und — im Verlauf einer zweiten Unterredung
— auf den Grafen von Clermont, einen Prinzen von Geblüt, der im Jahre
1758 den Oberbefehl über die französischen Armeen in Westdeutschland
geführt hatte.
Trotzdem war Saint-Germains Verhandlung ein vorzeitiges und
unrühmliches Ende beschieden. Zwar wußte er den Grafen Bentinck, den
er zu seinem Werkzeug ausersehen hatte, geschickt für seinen Plan
zu gewinnen[9]. Aber das Schreiben, das er mit dieser Mitteilung
am 11. März an die Marquise von Pompadour richtete, wurde ihm zum
Verhängnis. Die Marquise stellte den Brief[S. 18] dem Herzog von Choiseul
zu; denn Saint-Germains Version, daß dieser Brief durch „Diebstahl“ in
dessen Besitz gelangt sei[10], ist nicht ernst zu nehmen. Daraufhin
verbot der Herzog dem Grafen unter heftigen Drohungen jede Einmischung
in die Politik. Und als er gar von Saint-Germains Eröffnungen, den
Friedensschluß betreffend, erfuhr, befahl er, auf das höchste erbost,
dem Botschafter Graf d’Affry, die Auslieferung des „Abenteurers“ von
Holland zu fordern. Ja, am liebsten wäre ihm gewesen, hätte d’Affry
ihm eine Tracht Prügel verabfolgen lassen, um den „Halunken“, der die
Kreise seiner Politik zu stören wagte, vor aller Welt in Verruf zu
bringen. Wenigstens sorgte er aber dafür, daß eine Mitteilung in die
Zeitungen gelangte, in der Saint-Germain mit schärfsten Ausdrücken des
Mißbrauchs der ihm in Frankreich gewährten Gastfreundschaft beschuldigt
wurde[11]. Bevor der Botschafter seinen förmlichen Antrag bei den
Generalstaaten stellte, unterbreitete er den Entwurf dazu dem Herzog.
So kam es denn erst am 30. April zur Übermittelung der Denkschrift mit
dem förmlichen Auslieferungsgesuch an die holländische Regierung. Diese
begrub den Antrag durch seine Verweisung an Kommissionen. Überdies
war er gegenstandslos geworden, da Saint-Germain beizeiten von der
ihm drohenden Gefahr Wind bekommen und mit Hilfe Bentincks sich nach
England geflüchtet hatte.
Aber auch hier war seines Bleibens nicht. Sofort in polizeilichen
Gewahrsam genommen, wurde er nach kurzer Frist wieder abgeschoben, da
die englische Regierung fürchtete, daß sein Aufenthalt in England sie
Frankreich[S. 19] gegenüber kompromittiere. Es war von seiner Übersiedlung
nach Ostfriesland die Rede, wo ihm König Friedrich unter der Bedingung
Zuflucht gewähren wollte, daß er sich künftig von jedem politischen
Treiben fernhielt. Allein er begab sich wiederum nach Holland, wo er
Unterschlupf fand.
Man vergleiche diese Darstellung, die sich auf die Berichte der
Beteiligten stützt, mit dem Bilde, das Saint-Germain in seinem späteren
Briefe an Graf Lamberg von den Geschehnissen entwirft. Da sind es
Lügenmärchen, die er auftischt!
Zum Schluß noch die Frage: hat Saint-Germain bei seinen
Friedenseröffnungen an General Yorke im Auftrage des Hofes gehandelt?
Hat Ludwig XV. hinter dem Rücken seines Premierministers, wie dieser
nach Gleichens Darstellung ihm vorwirft, eigene Politik gemacht? Waren
also der König und die Pompadour seine geheimen Auftraggeber? Diese
Frage ist zu verneinen. Denn erstens steht es fest, daß die Pompadour
es war, die den Herzog von Choiseul auf die Spur Saint-Germains setzte,
indem sie ihm den Bericht überlieferte, den ihr der Graf sofort über
seine politische Tätigkeit im Haag erstattet hatte. Einen zweiten
Beweis liefert das Schreiben, in welchem der Marschall Belle-Isle
seinem Schützling, wenn auch in schonender Form, sein Verhalten
vorwirft und ihm bedeutet, daß für die Behandlung politischer Fragen
der Botschafter d’Affry zuständig sei[12].
Aber, so wird man einwenden, worauf bezogen sich dann die Schreiben von
Belle-Isle und Clermont, die Saint-Germain dem General Yorke gleichsam
als seine Beglaubigung vorlegte? Alles spricht dafür, daß sie die 30
Millionen-Anleihe betrafen, die er für den geldbedürftigen[S. 20] Versailler
Hof und, wie wir hinzufügen dürfen, in seinem Auftrag vermitteln
sollte[13]. Über diese Anleihe hat er offenbar in Amsterdam und auch im
Haag mit seinen Gastgebern, den jüdischen Bankiers, verhandelt.
So lockte ihn der politische Ehrgeiz, auf eigene Faust die Rolle des
Friedensstifters zu spielen oder, wie Kauderbach schreibt, gleich
einer zweiten Jungfrau von Orléans Frankreich abermals zu retten. Doch
seine diplomatische Laufbahn fand ein schnelles und klägliches Ende:
sein Erscheinen auf der politischen Weltbühne glich einer schillernden
Seifenblase, die nach kurzem Fluge jählings zerplatzt.
Saint-Germain in Rußland
Die bisherige Überlieferung nimmt an, daß Saint-Germain nach seinem
unglücklichen politischen Debut im Haag und nach seiner Ausweisung aus
England seine Schritte nach Rußland gelenkt und bei der Revolution, als
deren Opfer Zar Peter III. im Juli 1762 um Thron und Leben kam, eine
wichtige Rolle gespielt habe. Aber in allen Quellen und Darstellungen
der Zeit findet sein Name nirgends Erwähnung. Durch die neuesten
Forschungen ist festgestellt, daß nur ein einziger Ausländer an jenen
Ereignissen beteiligt war, nämlich der Piemontese Odart, der in
Diensten Katharinas II. stand[14].
Demgegenüber ist die Frage, wie es sich mit der uns überlieferten
Äußerung des Fürsten Gregor Orlow, des bekannten Günstlings der
Zarin, verhält, die das völlige Gegenteil bekundet. Nach Gleichens
Mitteilung soll er auf der Durchreise durch Nürnberg von unserem
Helden[S. 21] gesagt haben: „Dieser Mann hat eine große Rolle bei unserer
Revolution gespielt.“ Aber Gleichens Bericht ist nicht zuverlässig.
Er verwechselt die Brüder: nicht Gregor, sondern Alexei Orlow kam
durch Nürnberg. Gleichen war auch nicht Augen- und Ohrenzeuge, wie
der ansbachische Minister von Gemmingen, der von diesem Ausspruche
Orlows nichts weiß: er begnügt sich, Gleichen zu zitieren. Mit diesem
Ausspruche steht ferner in unvereinbarem Widerspruch, was Alvensleben
1777 als „feststehende Tatsache“ meldet: Alexei Orlow habe dem
Grafen Saint-Germain, zu dem er „in engen Beziehungen“ stehe, einen
Empfehlungsbrief an seinen Bruder, den Fürsten Gregor, gegeben und
diesem den Grafen als „seinen Busenfreund“ ans Herz gelegt. Zählte nun
aber Saint-Germain zu den Verschwörern von 1762, was bedurfte es da für
ihn einer besonderen Empfehlung an Gregor, der doch mit Alexei zusammen
eine der Hauptrollen bei dem Drama gespielt hatte?
Der letzte Zweifel wird durch die entscheidende Tatsache beseitigt,
daß sich Saint-Germains Aufenthaltsort für jene kritische Epoche
sicher nachweisen läßt. Seit er aus England zurückgekehrt war, hatte
er in Holland unter fremden Namen ein unstetes Leben geführt, bis er
sich im Frühjahr 1762 auf seiner neuerworbenen Besitzung Ubbergen bei
Nimwegen, nach der er den Namen Surmont annahm, niederließ.
Damals geschah es denn auch, daß auf die Anfrage des Grafen d’Affry
der Herzog von Choiseul ausdrücklich auf die weitere Verfolgung des
Abenteurers in Holland verzichtete[15]. War Saint-Germain bisher noch
des öfteren in Amsterdam eingekehrt, so zog er im August 1762 — so
bestätigt ausdrücklich[S. 22] Hardenbroek — von dort weg, wahrscheinlich
zur vollständigen Übersiedlung nach Ubbergen, worauf er dann, wie
wir im folgenden Abschnitt sehen werden, im Frühling 1763 in Brüssel
auftauchte, um dem österreichischen Minister Graf Cobenzl daselbst
seinen folgenschweren Besuch abzustatten.
Danach gehört Saint-Germains Teilnahme an der russischen Revolution
endgültig ins Reich der Erfindung. Dasselbe gilt für die Korrespondenz,
die er angeblich mit der Zarin Katharina II. führte.
Auch seine Beziehungen zur Familie Orlow erfahren einige Einschränkung.
Immerhin trifft soviel zu, daß er nach dem Ausdruck unseres
Gewährsmannes „das Glück“ hatte, den Grafen Alexei kennen zu lernen,
mit dem er nach seiner beliebten Praxis alchimistische Studien trieb,
bis dieser seiner überdrüssig wurde[16]. In Italien, wo Alexei während
des Türkenkrieges (1768-1774) längere Zeit als Admiral der russischen
Flotte weilte, scheint die Bekanntschaft erneuert zu sein. Wenigsten
berichtet Gleichen von ihrem Zusammentreffen in Livorno im Jahre 1770.
Indessen ist nicht ganz aufgeklärt, was für eine Bewandtnis es mit
dem russischen Generalspatent hat, das ihm angeblich von Alexei in
Nürnberg auf der Heimreise nach Rußland überreicht wurde. Vielleicht
steht es mit den Kämpfen in Zusammenhang, die während des Türkenkrieges
im Archipel stattfanden, die aber, wie der Leipziger Bankier Dubosc
1777 boshaft bemerkte, Saint-Germain trotz aller seiner Erzählungen
nicht mitgemacht hatte. Und so wäre denn auch das Patent als dreiste
Fälschung zu buchen, um so mehr, da es auffälligerweise nur die
Unterschrift des Grafen Alexei, aber nicht der Zarin trug.
[S. 23]
Und doch hat Saint-Germain, wie sich aus unseren bisher noch
unbekannten Quellen ergibt, den heiligen Boden Rußlands betreten —
zwar nicht als Verschwörer und politischer Abenteurer, wie er es
darstellen möchte, sondern als schlichter Kaufmann, der aus seinen
schönen Erfindungen Kapital schlagen wollte. Gleichwie in Frankreich
waren es seine Farben, mit denen er sein Glück versuchte. In einer
Kattunfabrik in Moskau war er tätig, aber mißgünstig wandte ihm Fortuna
den Rücken, so daß er bettelarm die Stätte seines neuen Wirkens
verlassen mußte. Voll Mitleid las ihn, den fußkrank und mühselig des
Weges Dahinziehenden, der Schweizer Hotz von der Straße auf, wie er es
hernach 1777 in Leipzig, wo er Saint-Germain wieder traf, erzählte[17].
Aber dieser russische Aufenthalt bildete für Saint-Germain doch keinen
völligen Fehlschlag. Er wollte ein Bergwerk entdeckt haben, das schöne,
den Topasen ähnliche Halbedelsteine lieferte und dessen Ausbeutung
ihm zustand. Seitdem trug er sich mit dem Gedanken, daraus einen
ertragreichen Handelszweig zu machen, ohne daß er freilich für seine
Pläne viel Glauben und Entgegenkommen fand[18].
Aller Wahrscheinlichkeit nach fällt diese russische Episode in die Zeit
zwischen dem Abenteuer von Tournai, zu dem wir uns nunmehr wenden, und
dem Ausbruch des Türkenkrieges.
Das Abenteuer von Tournai
Zu Anfang des Jahres 1763 kam Saint-Germain, der, wie erwähnt, sich
inzwischen in Holland angekauft und[S. 24] sich den Beinamen Surmont
zugelegt hatte, nach Brüssel, wo er die Bekanntschaft des Grafen
Karl Cobenzl, des bevollmächtigten Ministers der österreichischen
Niederlande, machte und sie geschickt auf seine Weise ausbeutete. Erst
durch die von uns erschlossene Korrespondenz Cobenzls mit dem Hof- und
Staatskanzler Graf Kaunitz sind wir über diese Episode aus dem Leben
Saint-Germains aufs Zuverlässigste unterrichtet. Sie war bisher fast
völlig unbekannt.
Sofort fand Cobenzl an der Unterhaltung mit Saint-Germain Gefallen.
Geschickt wußte dieser das Gespräch auf seine alchimistischen
Kenntnisse zu bringen; er führte ihm einige Experimente vor und begann
von Millionengewinnen zu erzählen, die sich mit seinen Geheimmitteln
erzielen ließen. In heller Begeisterung ging Cobenzl darauf ein, um so
mehr, als Saint-Germain versicherte, „aus reiner Freundschaft“, nur
gegen eine kleine Belohnung, seine Geheimnisse hergeben zu wollen.
In der Besitzerin des Brüsseler Handlungshauses, Madame Nettine,
die in freudigem Enthusiasmus mit ihm wetteiferte, fand Cobenzl die
Persönlichkeit, die mit den erforderlichen Geldmitteln zur Begründung
des Unternehmens einsprang. Kaunitz suchte den Eifer zu dämpfen; er
warnte vor großen und vorzeitigen Ausgaben. Und um seinen Worten
erhöhtes Gewicht zu geben, schickte er ein anekdotisches Portrait mit,
das von einem Kundigen, der Saint-Germain von Paris her kannte, in
recht düsteren Farben entworfen war.
Cobenzl, der im Banne Saint-Germains und seines großen Planes stand,
war nicht gesonnen, sich Wasser in seinen Wein gießen zu lassen. Er
überhörte die Warnung und erklärte leichthin, auf die Person komme es
nicht an, wofern man nur in den Besitz der Geheimmittel[S. 25] gelange. Diese
betrafen ein billiges Herstellungsverfahren für Farben und Farbstoffe,
für gefärbte Hölzer, das Gerben und Färben von Fellen, die Herstellung
eines goldähnlichen Metalls, die Raffinerie von Ölen und die Anlage
einer Hutfabrik.
Doch eine unliebsame Überraschung folgte der anderen. Zunächst handelte
es sich um die Einsendung von Proben; es waren Färbmittel, gefärbte
Hölzer, Leder- und Metallproben. Bei der Prüfung durch Sachverständige,
die Kaunitz vornehmen ließ, stellte sich heraus: die Farben waren
minderwertig; sie standen mit einer Ausnahme hinter den in Österreich
hergestellten zurück, geschweige denn, daß sie den Vergleich mit den
englischen und französischen Fabrikaten aushielten. Ja, die Farbenskala
war nicht einmal vollständig, da Blau und Grün fehlten. Und es war auch
nur ein magerer Trost, wenn Saint-Germain verhieß, daß er für seine
Farben das verlangte billige Herstellungsverfahren noch finden werde.
Ebensowenig taugten die Holz- und Metallproben, während lediglich das
Urteil über das Leder günstiger ausfiel.
Eine zweite Enttäuschung bildete der Anschlag des Unternehmens.
Saint-Germain, der den Riesenerfolg auf die billige Herstellung der
Fabrikate gründete, begnügte sich mit einer Gegenüberstellung der
hohen alten und der billigen neuen Preise, bei denen der Unterschied
allerdings mehrere 100 Prozent ausmachte. Aber da jede weitere
Unterlage, wie z. B. der Überschlag des zu erwartenden Absatzes,
fehlte, so schwebte der ganze Anschlag in der Luft.
Eine dritte Enttäuschung war, daß trotz der Warnungen aus Wien mit der
Ausführung des Planes in Tournai bereits begonnen, Häuser und Geräte
bereits gekauft[S. 26] waren. Es stellte sich heraus, daß die Ausgaben schon
die artige Summe von 100000 Gulden betrugen. Dabei waren noch keinerlei
Rohstoffe beschafft, noch keine Gelder für die Arbeitslöhne angewiesen!
Wie hatte alles so schnell und so weit gedeihen können? Es war das
Werk Saint-Germains. Solange der Plan des ganzen Unternehmens nur auf
dem Papier stand, mußte er befürchten, daß alles zu Nichts zerrann,
sobald man von Wien aus ein Veto einlegte. Also drang er — „mit
äußerstem Eigensinn“, wie Cobenzl vorwurfsvoll bemerkt — auf schnelle
Inangriffnahme der Ausführung. Und da Madame Nettine vorschoß, ging
alles flott vonstatten. Damit saß der Gimpel auf der Leimrute fest,
denn es gab kein Zurück mehr oder nur unter schweren Verlusten.
Doch bald kam es anders, als Cobenzl ursprünglich gedacht hatte.
Von einer Hergabe der Geheimnisse, die „aus reiner Freundschaft“
oder nur gegen eine kleine Belohnung erfolgen sollte, war nicht mehr
die Rede. Im Gegenteil, es wurde ein Kontrakt geschlossen, der dem
Grafen Saint-Germain die Hälfte des Reingewinns sicherte. Also kein
unrentables Geschäft, wenn das Unternehmen aufblühte! Doch es lag
immerhin in einiger Ferne. Saint-Germain indessen zog nach dem Wort
der Bibel den Spatzen in der Hand der Taube auf dem Dache vor. Mit
Hilfe eines Geschäftsfreundes aus Nimwegen, der bezeugte, dem Grafen
gehörige Wertsachen im Betrage von mindestens einer Million im Depot
zu haben, erschwindelte er sich von Madame Nettine Vorschüsse, die
von seinem künftigen Anteil am Reingewinn abgezogen werden sollten.
Die Wertpapiere waren in Wirklichkeit fast wertlos, die gutgläubig
darauf geleisteten Vorschüsse aber — und das war eine neue bittere
Enttäuschung — beliefen sich ebenfalls auf rund[S. 27] 100000 Gulden.
Damit stieg die Summe der bereits gemachten Aufwendungen auf 200000
Gulden, ohne daß die geringste Sicherheit für Erfolg bestand, von den
Millionengewinnen ganz zu schweigen.
Auf den Bericht, den Kaunitz der Kaiserin Maria Theresia erstattete,
lehnte diese die Übernahme des Unternehmens rundweg ab, und dieses ging
nunmehr in die Hände der Madame Nettine über, die sich schon vorher
damit einverstanden erklärt hatte. Cobenzl erteilte daraufhin dem
Grafen Saint-Germain sofort den Laufpaß. Bevor dieser Tournai verließ,
gab er der Nettine die Zusicherung, binnen wenigen Monaten werde er ihr
die Auslagen zurückerstatten. Andernfalls, so fügte er mit blutigem
Hohne hinzu, möge sie sich von seinen Geheimmitteln bezahlt machen.
Damit entpuppte sich sein ganzes Unternehmen als raffiniert angelegtes
Schwindelmanöver. Er war als gemeiner Betrüger entlarvt, der, nachdem
er die Opfer in sein Netz gelockt, sie listig zu rupfen gewußt hatte.
Mit seiner Beute verschwand er alsbald aus Brüssel, um sich, wie es
hieß, nach Deutschland zum Markgrafen Karl Friedrich von Baden-Durlach
zu begeben. Tatsächlich aber scheint er den Weg nach Rußland
eingeschlagen zu haben, wo er, wie wir schon hörten, sich in Moskau
niederließ.
Ausgang
Auch die nächsten zehn Jahre sind wieder in Dunkel gehüllt. Doch
scheint Saint-Germain während dieser Zeit zunächst in Rußland und dann
vornehmlich in Italien geweilt zu haben; denn wir hören, daß er in
Mantua, in Venedig, in Pisa und Livorno gewesen ist. Dann tauchte er in
Deutschland auf.
[S. 28]
Aber Saint-Germains Auftreten ist doch ein anderes geworden. Von seinen
Reichtümern ist nicht mehr die Rede; im Gegenteil, es geht ihm offenbar
dürftig. Er sucht nicht mehr die große Welt, sondern eine stille
Stätte, wo er, in sicherem Hafen gelandet, das Haupt zur Ruhe legen,
den Abend seines Lebens verbringen darf. Doch darin bleibt er sich
getreu, daß er nach wie vor sein geheimes Wissen als Aushängeschild
benutzt, daß er es auf die Großen der Welt abgesehen hat.
Freilich ist hier die Art seines Vorgehens verschieden. Indem er den
scheinbar Uneigennützigen spielt, gebärdet er sich als Wohltäter der
Menschheit unter dem durchsichtigen Namen Welldone, den er sich
nunmehr beigelegt hat. So verfuhr er gegenüber dem großen Preußenkönig,
dessen scharfer Blick indessen den Schwindel sofort durchschaute.
König Friedrich winkte ihm energisch ab, als Saint-Germain ihm mit
einem Begleitschreiben — der einen von den drei uns erhaltenen
Schriftproben seiner Hand — sozusagen seine Preisliste einschickte.
Er ließ ihm sagen, er möchte anderswo sein Heil versuchen, da man in
Berlin „sehr ungläubig“ sei. Mehr Glück hatte Saint-Germain, als er den
„Adepten“ herauskehrte und sich an Fürsten wandte, die alchimistischen
Neigungen huldigten. So bei dem Markgrafen Alexander von Ansbach, dem
er 1774 durch dessen mütterliche Freundin, die Schauspielerin Clairon,
vorgestellt wurde, und dann 1779 bei dem Prinzen Karl von Hessen in
Schleswig, dem er sich zunächst aufdrängte, den er aber dann in seine
Fesseln zu schlagen wußte.
In rückschauender Erinnerung hat der Ansbacher Minister, Freiherr
von Gemmingen, seinen Bericht über Saint-Germains Aufenthalt im
Ansbachischen, in Schwabach[S. 29] und Schloß Triesdorf, aufgesetzt[19].
Ein typisches Bild: der „Adept“ und sein fürstlicher Schüler im
Laboratorium an der Arbeit. Oder er weilt in den ihm zugewiesenen
Räumen, über seinen Farben-Rezepten brütend, an deren Vervollkommnung
er hinter verschlossenen Türen und Fenstern unablässig arbeitet.
Dazwischen fallen praktische Versuche, die er gemeinsam mit dem Fürsten
und dessen Minister anstellt, deren Ausfall den letzteren freilich
wenig befriedigt. Zwei Jahre vergingen so, während deren Saint-Germain
das Geheimnis seiner Person sorgsam gewahrt hatte, bis dann der Fürst
auf einer italienischen Reise über die Person seines seltsamen Gastes
aufgeklärt wurde. Der Markgraf fühlte sich hintergangen. Dennoch wollte
er dem Grafen das Asyl weiter gewähren, wenn dieser ihm die Briefe,
die er im Lauf der Jahre an ihn gerichtet hatte, herausgab und sich
still verhielt. Aber Saint-Germain, der sich entlarvt sah, zog es vor,
den Stab weiter zu setzen. Wollte er sich ob aller fehlgeschlagenen
Versuche rechtfertigen oder dem Fürsten den Verlust, den er mit seinem
Scheiden erlitt, eindrucksvoll vor Augen führen? Genug, in der letzten
großen Aussprache mit dem Minister drückte er sein Bedauern aus,
daß gerade in diesem Augenblicke der Bruch eingetreten[S. 30] sei, wo er,
Saint-Germain, im Begriffe gestanden habe, „das, was er versprochen,
ins Werk zu setzen.“
Im Oktober 1776 traf er in Leipzig ein. Der sächsische Hof machte
einen Versuch, ihn zu gewinnen. Doch es kam zu keiner Verständigung;
vielmehr beklagte sich Saint-Germain bei dem preußischen Gesandten
in Dresden bitter über die unfreundliche Aufnahme, die er in Sachsen
gefunden hatte, und trug nun seine wertvollen Dienste dem Preußenkönig
an. Wir hörten es schon, Friedrich dankte ironisch. Trotzdem scheint
Saint-Germain sich damals nach Berlin begeben zu haben, wo er ein Jahr
in stiller Zurückgezogenheit lebte.
Im Herbste 1778 begegnen wir ihm in Hamburg, und ein Jahr darauf, im
Spätsommer 1779, erfolgte endlich seine Übersiedlung nach Schleswig.
Prinz Karl von Hessen, sein neuer Gönner, hat in seinen Erinnerungen
geschildert, wie Saint-Germain ihn in seine Geheimnisse einführte.
In dem nahegelegenen Eckernförde wurde dann ebenfalls wie in Tournai
seligen Angedenkens der Versuch gemacht, mit seinen Geheimmitteln, den
Farben und Farbstoffen, eine Industrie zu begründen.
Während der Prinz sich auf Reisen befand, ist Saint-Germain, von
düsterer Melancholie gequält und von Gewissensbissen heimgesucht, so
erzählt Frau von Genlis, still und einsam, wie er das letzte Jahrzehnt
seines Lebens verbracht hatte, am 27. Februar 1784 in Eckernförde
gestorben. Drei Tage darauf, am 2. März, erfolgte seine Beisetzung
in der dortigen Nikolaikirche; doch ist nicht mehr zu ermitteln,
an welcher Stelle in der Kirche sich seine Grabstätte befindet.
Mit der Nikolaikirche bildet das alte Fabrikgebäude, heute das
Christianspflegehaus, die letzte sichtbare Erinnerung an Saint-Germains
dortigen Aufenthalt.
[S. 31]
Saint-Germains Künste und
Geheimnisse
Für die Kulturgeschichte des 18. Jahrhunderts bildet die von uns zum
erstenmal veröffentlichte Liste seiner Kunstfertigkeiten, die er 1777
für den Preußenkönig aufsetzte, ein Dokument ersten Ranges; denn in
authentischer Form findet sich darin ein Überblick über seine ganzen
Künste.
Den breitesten Raum nehmen in der Liste seine geheimen Mittel ein,
die zur praktischen Verwertung in der Industrie bestimmt waren. Hier
behaupten seine Farben und Färbmittel den Vorrang. Sie bildeten ganz
offenbar seine Spezialität, auf die er reiste; denn schon von seinen
Aufenthalten in Frankreich, in Brüssel, Moskau und Schwabach sind sie
uns wohlbekannt. Ebenso kennen wir von Tournai her seine Kunst der
Lederbearbeitung. Dazu kommen neue Verfahren zum Waschen von Seide, zum
Bleichen von Leinewand, Baumwolle usw.
Eine zweite Kategorie bilden seine Geheimverfahren für Metalle. Zwar
war das nicht die Goldmacherei, wie sie das heißerstrebte Ziel der
Alchimisten bildete, aber man gab sich in der Alchimie auch schon
mit bescheideneren Erfolgen zufrieden; man begnügte sich statt der
Metallveredlung mit der Metallverwandlung und brachte auf diese Weise
Mischungen und Kompositionen zuwege, wie das in unseren Urkunden öfter
erwähnte Similor, ein Erzeugnis, von dem freilich Graf Kaunitz
nichts wissen wollte. Von den Künsten Saint-Germains auf diesem Gebiete
erzählt auch der Ansbacher Minister, aber doch nur in allgemeinen
Andeutungen, die keine sicheren Schlüsse auf sein Geheimverfahren
gestatten.
An dritter Stelle steht sein „Lebenselixier“. Zwar hütet er sich
in seiner Liste für König Friedrich wohlweislich,[S. 32] sein Präparat
mit diesem Namen zu bezeichnen. Worin bestand es und worauf lief es
hinaus? Es handelt sich um einen noch heute unter dem Namen des Grafen
gehenden Tee, den sog. „Saint-Germain-Tee“, dessen Hauptbestandteil
Sennesblätter bilden und der eine abführende Wirkung hat. Dieser Tee
hatte seine Bedeutung in dem System, nach dem Saint-Germain lebte. Er
befolgte in seiner Lebensweise, in seiner Ernährung eine strenge Diät,
an der er beharrlich festhielt, die im weiteren Verfolg denn auch dazu
beitrug, seiner Person den Anschein des Besonderen und Ungewöhnlichen
zu geben.
Endlich rühmte er sich auch des Geheimnisses, auf künstlichem Wege
Edelsteine herstellen zu können. So erzählt er in seinem Briefe an
Graf Lamberg von einem großen Diamanten, den er mit dem Grafen Zobor
zusammen nach vielem Bemühen hervorgebracht habe. Aber dieser Diamant
spielt eine Rolle nur in der lügenhaften Erzählung, die er von seiner
angeblichen Verhaftung im Jahre 1760 gibt. Danach sind wir berechtigt,
auch seinen Bericht von der künstlichen Herstellung von Diamanten
anzuzweifeln.
Anders steht es offenbar mit der ihm ebenfalls zugeschriebenen,
aber in der Liste von 1777 nicht angeführten Kunst, Flecken aus
Diamanten zu entfernen. Zwar sind dafür die von Madame du Hausset und
Casanova und von dem Prinzen von Hessen berichteten Beispiele noch
immer keine einwandfreien Beweise. Aber wenn der Schweizer Pictet
dem französischen Diplomaten Corberon erzählt, sein Schwiegervater
Magnan, ein Diamantschleifer, habe alle Diamanten mit irgendwelchen
Flecken für Saint-Germain zurückgelegt, so ist das ein Zeugnis, das
sich nicht einfach von der Hand weisen läßt, und das zweifellos zu
Saint-Germains Gunsten spricht. Auch[S. 33] die Kunst, Perlen zu vergrößern
und ihnen ein schönes Wasser zu geben, wollte ihm der berühmte Arzt und
Nationalökonom Quesnay, wie Madame du Hausset erzählt, nicht abstreiten.

Nikolaikirche in Eckernförde. Saint Germains
Grabstätte
Mit den oben angeführten Mitteln ist die Liste seiner Kunstfertigkeiten
von 1777 noch nicht erschöpft. Flüchtig deutet er ferner auf seine
Kunst der Herstellung von Ölen, Likören, kosmetischen Mitteln, der
Weinveredlung, auf Geheimmittel für die Landwirtschaft. Damit erscheint
er als ein Mann von staunenswerter Vielseitigkeit. Aber was soll man
dazu sagen, wenn es in Nr. 25 der Liste heißt: „Herstellung anderer
nützlicher Dinge, über die ich schweige.“ Und ferner am Schluß: „Über
einen weiteren Punkt kann hier aus mancherlei Gründen nichts gesagt
werden. Er bleibt vorbehalten.“ Das war nichts anderes als die Sprache
des Marktschreiers!
Fassen wir das oben Gesagte zusammen. Mochte auch Saint-Germain in
seinem mehrfach genannten Briefe an Graf Lamberg sich des Besitzes
des „Steines der Weisen“ rühmen — ein „Adept“ war er nicht. Das
Geheimnis der künstlichen Herstellung des Goldes besaß er nicht. Als
Taschenspielerei erscheint denn auch die Probe dieser Kunst, die er vor
Casanova in Tournai ablegte. Seine übrigen Arbeiten auf dem Gebiete
der Metallverwandlung und -veredlung, die in das Gebiet der Alchimie
gehören, waren nach sachkundigem Urteil minderwertige Leistungen. Was
er als „Lebenselixier“ ausgibt, stellt sich als ein recht harmloses
Rezept dar.
Nicht besser war es um seine Geheimnisse und Geheimverfahren bestellt,
die sich auf das Wirtschaftsleben erstreckten.
Auf ihnen liegt, wenn wir sein Leben überblicken, der eigentliche
Schwerpunkt. Ihre Ausbeutung war das[S. 34] Hauptziel seiner Tätigkeit.
Sein großer Gaunerstreich von Tournai zeigt jedoch, daß es ihm dabei
nicht auf ehrlichen Erwerb und Gewinn ankam. Damit gehört er zu
der großen Heerschar der Industrieritter, die das 18. Jahrhundert
unsicher machten, vor denen König Friedrich seine Nachfolger in seinem
politischen Testament von 1752 mit besonderem Nachdruck warnte.
Mochte er sich immerhin auf die Kunst verstehen, fehlerhafte Diamanten
von ihren Flecken zu befreien — das ändert nichts an dem Bilde des
Abenteurers, unter dem uns sein Leben und Treiben erscheint.
War Saint-Germain
Freimaurer und Kabbalist?
Während des Mittelalters und noch in der neueren Zeit spielte neben
der Alchimie die Geheimlehre der Kabbalisten eine bedeutsame Rolle.
Die jüdische „Kabbala“, d. h. die überkommene Lehre, war ursprünglich
ein Geheimwissen, das sich mit der Lehre vom Göttlichen und von der
Schöpfung beschäftigte. Doch näherte sie sich dann immer mehr der
Magie, die sich des Besitzes übernatürlicher Kräfte rühmte. Das große
Ziel war der Einblick in die Zukunft. Dazu diente ihr als Hilfsmittel
die Punktierkunst; Zahlen, Worte und Buchstaben erhalten geheime
Bedeutung. Im Mittelalter blühte die Kunst der Kabbala gleich der
der Alchimie in Spanien, um sich ebenfalls von dort über Europa zu
verbreiten.
Ein ähnlicher Vorgang wiederholte sich in der Freimaurerei. Während der
ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts vollzog sich in ihren europäischen
Logen eine Bewegung, die über das alte Ziel der Förderung der Humanität
in Gesinnung[S. 35] und Betätigung hinausgriff. Auch hier erfolgte eine
Wendung zum Mystischen. Das Freimaurertum behauptete, das Geheimwissen
der Templer, das der Welt mit dem Untergange des Ordens verloren
gegangen war, im Orient wieder erlangt zu haben, und es erhob daraufhin
den Anspruch, in den höheren Graden die Geheimnisse der Magie zu
enthüllen.
Als Freimaurer trat der berüchtigte Graf Cagliostro auf. Aber er erfand
ein eigenes System, das er als ägyptische Freimaurerei bezeichnete.
Neben alchimistischen Künsten betrieb er auch die Geisterbeschwörung.
Als sein Lehrer und Meister wird Graf Saint-Germain angegeben,
jedoch mit Unrecht; denn dazu stempeln ihn erst die „Mémoires
authentiques pour servir à l’histoire du comte de Cagliostro“,
eine Fälschung aus der Feder des Marquis de Luchet, die nach
Saint-Germains Tode 1785 anonym erschien. Luchet stand als Geheimer Rat
im Dienste des Landgrafen von Hessen-Kassel. Er war ein überzeugter
Gegner aller freimaurerischen Bestrebungen, und so schrieb er diese
„Denkwürdigkeiten“, die sich als derbe Verspottung des Freimaurertums
kennzeichnen. Er läßt Cagliostro mit seiner als Marquise eingeführten
Gattin seine Fahrt in die Welt antreten. Dieser beschließt, da er
sich für Paris, die Hochburg des Abenteurertums, noch nicht reif
fühlt, nach einem mißglückten Debut in Wien sich in Rußland für seine
Laufbahn vorzubereiten. Um sie würdig zu beginnen, läßt er sich zuvor
mit seiner Frau in Schleswig vom Grafen Saint-Germain die Weihe
erteilen. Daß diese Zeremonie in höchst grotesker Form vor sich geht,
ist nach der Tendenz der Schrift selbstverständlich. Die von dem
bekannten Schriftsteller Melchior Grimm geleitete „Correspondance
littéraire“ verfehlte nicht, vor diesen „Denkwürdigkeiten“ mit
ihren[S. 36] „entweder falschen oder waghalsigen Anekdoten“ zu warnen.
Noch in einem zweiten Buche, das einige Jahre später und gleichfalls
anonym erschien, zog Luchet gegen Saint-Germain zu Felde, und zwar in
einer politischen Streitschrift gegen den im Jahre 1776 aus idealen
Beweggründen gestifteten Illuminatenorden, den er gefährlicher,
umstürzlerischer Pläne bezichtigte. Auch hier wird Saint-Germains
Geheimwissen, mit dem er die Welt, zumal die Großen, zu fangen suchte,
mit Spott und Hohn überschüttet.
Durch diese „Denkwürdigkeiten“ ist zu erklären, daß Cagliostro, der den
Grafen Saint-Germain wahrscheinlich niemals gesehen hat, mit diesem in
Verbindung gebracht ward, um fortan als sein Schüler zu gelten.
Aber Saint-Germain war kein Kabbalist. In allen gleichzeitigen
Nachrichten findet sich dafür keinerlei Anhaltspunkt.
Für die weitere Frage, welche Stellung er zum Freimaurertum einnahm,
bringt die von uns mitgeteilte maurerische Korrespondenz des Prinzen
Friedrich August von Braunschweig, der Großprior der Logen in
Preußen war, reichen Aufschluß. Im Kreise dieses Prinzen bildete
Saint-Germain während seines Leipziger Aufenthalts den Gegenstand
größter Aufmerksamkeit. Sehen wir auch von dem Bankier Dubosc ab, der
in dem „rätselhaften Mann“ nur einen Betrüger erblicken wollte, so
stimmen sowohl der sächsische Minister von Wurmb, der ihm ernstlich
„den Puls fühlte“, wie Bischoffwerder, der von dem Prinzen ausdrücklich
um seine Ansicht angegangen wurde, in dem Urteil überein: „Er ist
keiner der Unsrigen“ — ein Urteil, dem auch der Rosenkreuzer Frölich
aus Görlitz, ein Schüler Schrepfers, mit den Worten beipflichtete:[S. 37]
„Er ist kein Maurer; er ist auch kein Magus, auch kein Theosoph[20].“
Ähnlich wie diese, suchte 1778 Dresser, der vier Jahre lang Meister
vom Stuhl in der Hamburger Loge Georg gewesen war, das Geheimnis jenes
seltsamen Fremden zu ergründen[21]. Aber Saint-Germain hielt sich allem
maurerischen Treiben fern, obwohl er als Mitglied der Straßburger Loge
„de la Candeur“ (1776) bezeichnet wird[22] und selbst zugab,
den vierten Grad zu besitzen. Ja, er machte kein Hehl aus seiner
Gleichgültigkeit[23]. Danach kann von einer führenden Rolle, die er in
der Freimaurerei gespielt haben soll, nicht gesprochen werden!
Saint-Germains
Persönlichkeit und die Legendenbildung.
Obwohl seine Künste und Geheimnisse, wie wir sahen, im ganzen recht
zweifelhafter Art waren, hat sich Saint-Germain doch einen Namen zu
erwerben gewußt, der seinen Tod überdauerte. Worin liegt das Rätsel
seines Erfolges?
Zusammenfassend dürfen wir sagen: in dem Zauber seiner Persönlichkeit.
Nicht, daß in seiner Natur etwas Dämonisches lag, das die Menschen
wie mit übernatürlicher Gewalt in seinen Bann zwang. Ganz anderer Art
war die Macht, die er ausübte. Er war ein glänzender Gesellschafter,
der die Menschen anzuziehen wußte. Er besaß die Gabe fesselnder
Unterhaltung; man lauschte ihm gern, wenn er von seinem Leben, seiner
Jugend, seinen[S. 38] Reisen, wenn er von den Wundern der Welt erzählte. Er
bestrickte die Hörer, denn er sprach mit Eifer und Begeisterung. Er
besaß, so berichtet Alvensleben, „eine hervorragende Redegabe“, oder
wie Yorke es nennt, „Zungenfertigkeit“. Als der preußische Gesandte ihn
stellen wollte, entglitt ihm Saint-Germain, indem er den Offenherzigen
zu spielen vorgab, aber mit vielen Worten nichts zu sagen verstand.
Dabei liebte er die Debatte, spie aber Feuer und Flamme gegen den, der
ihm zu widersprechen wagte. Stieß er hingegen auf ernsten Widerstand,
so gebrauchte er die Taktik rechtzeitigen Schweigens.
Dabei verstand er in ungewöhnlichem Maße, sich seiner Umgebung
anzupassen. Genau sah er sich die Menschen an, mit denen er zu tun
hatte. Schnell fand er heraus, was er ihnen bieten durfte. Den dummen
Gläubigen band er dreist seine Lügen auf, während er sich den Klugen
gegenüber zurückhielt. Da ließ er nur durchblicken, was er offen zu
sagen sich nicht getraute. Zumal liebte er das Spiel mit halben Worten,
die die Phantasie des Hörers anregten. Das gelang ihm um so leichter,
als seine dunkle Kunst, deren er sich rühmte, unwiderstehlichen Reiz
auf die Menschen übte.
So besaß er in hohem Grade die Kunst der Menschenbehandlung. Und so war
es ihm möglich, in die hohen Kreise zu dringen, die der Mehrzahl der
schlichten Menschen verschlossen sind. Was aber noch weit mehr besagen
wollte, er wußte sich dort auch zu behaupten. Unbestreitbar spielte
er am Hofe Ludwigs XV. eine Rolle, bis das Haager Abenteuer ihm das
Genick brach. Trotzdem gelang es ihm später, noch zu anderen Fürsten
in nähere Beziehung zu treten, wie der Ansbachische Markgraf, der
Hessische Prinz, der ihm seine Huld bis zu seinem Tode bewahrte. Einen
Grafen Cobenzl, der eine hohe[S. 39] Staatsstellung bekleidete, wußte er
sogar derart zu bestricken, daß dieser von ihm rühmte: „Er ist Dichter,
Musiker, Schriftsteller, Arzt, Physiker, Chemiker, Mechaniker und ein
gründlicher Kenner der Malerei. Kurz, er hat eine universelle Bildung,
wie ich sie noch bei keinem Menschen fand[24].“
Man würde irren, wollte man ihm jedes Wissen und alle Kenntnisse
abstreiten. Ernsthafte Zeugen sind es, die zu seinen Gunsten aussagen.
„Er ist ein hochbegabter Mann mit sehr regem Geiste,“ so schildert
ihn Alvensleben[25]. Zugleich aber nennt er ihn „urteilslos“, „maßlos
eitel“ und kriecherisch. Eitelkeit sei die Triebfeder, die seinen
Mechanismus in Bewegung setze. Wir hören ferner, daß er mit seiner
angeblichen hohen Herkunft zu prahlen liebte. Er vermaß sich zu dem
Ausspruch: „Ich halte die Natur in meinen Händen, und wie Gott die
Welt geschaffen hat, kann auch ich alles, was ich will, aus dem Nichts
hervorzaubern.“
Seine „Gauklerkünste“, so bezeugt wiederum Alvensleben, öffneten ihm
die Häuser der Großen. Aber sie dienten ihm auch dazu, die Menschheit
auszubeuten. Wir wundern uns daher nicht, ihm ebenfalls im Salon der
Marquise von Urfé, den ja auch sein Bildnis schmückte, mit einem
Schwindler vom Schlage Casanovas zu begegnen, ein würdiges Paar, das
gleichmäßig die dem Wunderglauben ergebene Dame schröpfte, während
er doch sonst die Welt mied, in der ein Casanova und Cagliostro sich
bewegten.
Von diesen unterscheidet ihn auch die Tatsache, daß die Frauen in
seinem Leben keine Rolle spielten, mag er auch, wie Gleichen erwähnt,
der Tochter eines Chevalier Lambert in Paris den Hof gemacht und, wie[S. 40]
Hardenbroek als Gerücht verzeichnet, die Absicht geäußert haben, sie
zu heiraten. Noch fraglicher erscheint, ob jene unbekannte Dame in
Amsterdam, von der Grosley so geheimnisvoll erzählt, überhaupt je etwas
mit ihm zu tun hatte. Und mit allen übrigen Berichten über sein Ende
steht die Angabe Gleichens in Widerspruch, daß Saint-Germain sich in
seinem letzten Lebensjahr „wie ein zweiter Salomo“ von Frauen pflegen
und hätscheln ließ und in ihren Armen gestorben sei.
Was neben seinen dunklen Künsten dazu beitrug, ihm eine Stellung in
der großen Welt zu sichern, war die Fabel von seinen märchenhaften
Reichtümern. Er prunkte mit seinen Edelsteinen — aber ihre Echtheit
wird bestritten. Er erwarb Landgüter in Frankreich und Holland — aber
er konnte sie nicht bezahlen. Die Madame Nettine in Brüssel mußte zu
ihrem Schaden erfahren, was es mit seinen in Nimwegen deponierten
Wertsachen für eine fatale Bewandnis hatte. Auch der Wert seiner
Gemäldesammlung wird angefochten. Notorische Tatsache ist es endlich,
daß es ihm beim Markgrafen von Ansbach und in Leipzig kümmerlich ging.
Sogar seine Wohnung in Paris war bescheiden. Aber überraschend ist, daß
er sich trotz alledem den Ruf eines reichen Mannes zu geben verstand
und daß man es ihm glaubte.
Ein weiteres Rätsel, das seine Person bot, war endlich der Umstand,
daß er dauernd unter fremdem Namen auftrat, obwohl er den eines
Grafen Saint-Germain, unter dem er auf die Nachwelt gekommen ist,
bevorzugte[26].[S. 41] Dieser dauernde Namenswechsel scheint durch seinen
abenteuerlichen Wandel hinreichend begründet. Aber es ist bezeichnend
für ihn, daß er auch dafür eine geheimnisvolle Erklärung zu geben
wußte. Der Ansbacher Minister von Gemmingen hat es uns überliefert.
Danach handelte es sich um einen großen Unbekannten, der die
Beweise seiner Abkunft in Händen hatte, der ihn verfolgte, vor dem
Saint-Germain sich verbergen mußte. Und nur eine weitere Ausschmückung
dieses Märchens ist es, wenn er im Elternhause der Frau von Genlis
erzählte, daß er als siebenjähriger Knabe flüchten mußte, da ein Preis
auf seinen Kopf gesetzt war.
Man sieht: es fehlt kein Zug, um das Bild des Abenteurers vollständig
zu machen. Alles ist vorhanden: die rätselhafte Abstammung, der große
Unbekannte, der ihn verfolgt, die unbekannte Schöne, der fabelhafte
Reichtum. Dazu treten alle die Wunder, die sich mit dem Namen des
„berühmten Alchimisten“ verbanden. Er hat den „Stein der Weisen“, er
kennt das Geheimnis der künstlichen Herstellung des Goldes, er besitzt
das Lebenselixier.
Ist es daher verwunderlich, wenn in der späteren Überlieferung,
wie bereits in den Aufzeichnungen eines Lamberg und Gleichen, das
Geheimnisvolle und Rätselhafte immer mehr das Geschichtliche der
gleichzeitigen Berichte überwuchert? Denn wir hören später kaum
noch von allen seinen gewerblichen Künsten, wie der Färbkunst, der
Lederbehandlung, die doch das Hauptfeld seiner Tätigkeit ausmachten.
Statt dessen ist er ein Goldmacher. Und noch größeren Spielraum
bot sein Lebenselixier der menschlichen Phantasie. Da wird er zum
Zeitgenossen Christi, und eine Lady Craven, die ihn nur von Hörensagen
kennt, malt nun in ihren Denkwürdigkeiten[S. 42] die Fabel immer weiter
aus, indem sie dieselbe mit allerlei barocken Einfällen verziert. Da
das Lebenselixier andrerseits die Wirkung des Jungbrunnens in sich
schließt, so entsteht die Geschichte von der diebischen Kammerzofe, die
sich an dem Elixier vergreift, das ihre Herrin um teures Geld erstanden
hat, und die nun infolge der genossenen allzu starken Dosis wieder ein
kleines Kind wird. Aus der einen Zofe im London Chronicle (bei
Grosley) und bei Gleichen macht dann der Fälscher der „Erinnerungen der
Marquise von Créquy“ mit drastischer Übertreibung deren zwei. Und den
Höhepunkt erreicht der Spaß bei Lamberg mit der alten Frau, die sogar
wieder zum Embryo wird.
Indem wir die gleichzeitigen Urkunden, die von ihm erzählen, und die
späteren Aufzeichnungen, die über ihn entstanden sind, im folgenden
zusammenstellen, tritt uns zum erstenmal das geschichtliche Bild des
abenteuerlichen Betrügers entgegen. Zugleich gestattet aber dieser
Überblick, den Prozeß der allmählich einsetzenden und von ihm selbst
mit Geschick genährten Legendenbildung zu verfolgen, durch die er zum
„berühmten Alchimisten“ ward, als der er bis auf unsere Tage fortlebt.
—
Um den streng historischen Charakter des Buches zu wahren, ist
grundsätzlich davon Abstand genommen, rein literarische Erzeugnisse zu
berücksichtigen. Dahin gehören z. B. die phantasievollen Schilderungen
von Besuchen Saint-Germains in Wien, am Hofe Karl Augusts in Weimar,
am Hofe der Königin Maria Antoinette, wie sie Franz Gräffer in
seinen „Kleinen Wiener Memoiren“ (Wien 1845) bringt, A. v. d. Elbe
in der Erzählung „Brausejahre“ („Gartenlaube“, Jahrg. 1884) oder der
Romanschriftsteller Etienne Léon de Lamothe-Langon in den anonym
herausgegebenen „Souvenirs sur Marie Antoinette[S. 43] et sur la cour de
Versailles par Madame la comtesse d’Adhémar, dame du palais“ (Paris
1836); denn, um dies ausdrücklich zu betonen, die Gräfin d’Adhémar
ist nachweislich keine historische Persönlichkeit, sondern das reine
Erzeugnis dichterischer Phantasie. So hat auch die einzige bisher
vorliegende Biographie des Abenteurers, das unvollendet gebliebene Werk
der Theosophin J. Cooper-Oakley: „The comte de Saint-Germain“ (Mailand
1912) keinen Anspruch auf wissenschaftliche Bedeutung, da sie kritiklos
auch aus jenen Darstellungen schöpft und die Märchen der angeblichen
Gräfin d’Adhémar als historische Begebnisse erzählt; der Wert ihres
Buches beruht allein auf ihren Mitteilungen aus fremden Archiven.
Für die Fülle neuer Aufschlüsse, die mir zahlreiche Archive und
Bibliotheken, zumal in Berlin, Wien und Wolfenbüttel gewährten, bin ich
der Leitung derselben zu großem Dank verpflichtet. Ferner möchte ich an
dieser Stelle auch Herrn Notar Langeveld im Haag meinen aufrichtigen
Dank für die liebenswürdige Unterstützung aussprechen, die er meiner
Arbeit geliehen hat.
[S. 45]
ERSTER TEIL
ALLGEMEINE DARSTELLUNGEN, ANEKDOTEN UND FÄLSCHUNGEN
[S. 47]
AUS DEN „ERINNERUNGEN“ DES
BARONS VON GLEICHEN[27]
Bei meiner Rückkehr nach Paris im Jahre 1759[28] besuchte ich die
Witwe des Chevalier Lambert, eine alte Bekannte. Nach mir sah ich
einen mittelgroßen, sehr stämmigen Mann eintreten, der mit gesuchter,
prächtiger Einfachheit gekleidet war. Er warf Hut und Degen auf das
Bett der Hausfrau, setzte sich auf einen Lehnstuhl am Kamin und
unterbrach den gerade redenden Herrn mit den Worten: „Sie wissen nicht,
was Sie reden. Für diese Frage bin ich allein zuständig. Ich habe sie
erschöpft, so gut wie die Musik, die ich aufgegeben habe, weil ich bis
zur äußersten Grenze gelangt war.“
Erstaunt fragte ich meinen Nachbar, wer dieser Mann sei, und ich
erfuhr, daß es der berühmte Saint-Germain[S. 48] war, der die seltensten
Geheimnisse besaß, dem der König[29] eine Wohnung im Schloß Chambord
eingeräumt hatte, der in Versailles ganze Abende mit Seiner Majestät
und Frau von Pompadour verbrachte und dem alle Welt nachlief, wenn er
nach Paris kam. Frau Lambert lud mich zum Essen für den nächsten Tag
ein und setzte mit triumphierender Miene hinzu, ich würde mit Herrn von
Saint-Germain speisen, der, nebenbei gesagt, einer ihrer Töchter den
Hof machte und in ihrem Hause wohnte.
Die Dreistigkeit des Mannes hielt mich bei diesem Diner lange in
respektvollem Schweigen. Schließlich wagte ich ein paar Bemerkungen
über die Malerei und verbreitete mich über Verschiedenes, was ich
in Italien gesehen. Ich hatte das Glück, Gnade vor den Augen von
Saint-Germain zu finden. „Ich bin mit Ihnen zufrieden,“ sagte er zu
mir, „und Sie verdienen, daß ich Ihnen alsbald ein Dutzend Gemälde
zeige, dergleichen Sie in Italien nicht gesehen haben.“ In der Tat
hielt er fast Wort; denn die Bilder, die er mir zeigte, trugen sämtlich
ein Gepräge von Eigenart oder Vollendung, das sie anziehender machte,
als manche klassischen Werke, insbesondere eine Heilige Familie von
Murillo, die an Schönheit dem Raffael in Versailles gleichkam.
Aber er zeigte mir noch ganz andere Dinge: eine Menge Edelsteine,
insbesondere farbige Diamanten von erstaunlicher Größe und Vollendung.
Ich glaubte, die Schätze von Aladins Wunderlampe zu sehen. Unter
anderem sah ich einen Opal von ungeheuerlicher Größe und einen eigroßen
weißen Saphir, der alle Edelsteine, die ich daneben hielt, durch seinen
Glanz überstrahlte. Ich wage mich als einen Juwelenkenner zu rühmen und
kann[S. 49] versichern, daß das Auge nichts zu entdecken vermochte, was einen
Zweifel an der Echtheit dieser Steine hätte begründen können, zumal sie
ungefaßt waren.
Ich blieb bis Mitternacht bei ihm und verließ ihn als sein getreuer
Anhänger. Sechs Monate lang folgte ich ihm mit der unterwürfigsten
Beharrlichkeit, und ich habe nichts von ihm gelernt als die Praktiken
und die Eigenart des Scharlatanismus. Kein Mensch besaß wie er die
Gabe, die Neugier zu stacheln und die Leichtgläubigkeit auszunutzen.
Er wußte seine Wundergeschichten je nach dem Maße der Empfänglichkeit
seiner Zuhörer abzustimmen. Erzählte er einem Dummkopf eine Begebenheit
aus der Zeit Karls V., so vertraute er ihm offen an, daß er
dabeigewesen sei. Sprach er mit einem etwas weniger Leichtgläubigen,
so schilderte er bloß die kleinsten Umstände, Miene und Gebärde der
Sprechenden, ja selbst das Zimmer und den Fleck, an dem sie standen,
mit allen Einzelheiten und einer Lebendigkeit, daß man den Eindruck
erhielt, einen wirklichen Augenzeugen des Vorgangs zu hören. Bisweilen,
wenn er eine Rede Franz’ I. oder Heinrichs VIII.[30] wiedergab,
spielte er den Zerstreuten und sagte: „Der König wandte sich an mich
—“, verbesserte sich aber rasch und fuhr, wie ein Mann, der sich
verschnappt hat, hastig fort: „wandte sich an den und den Herzog.“
Im allgemeinen kannte er die Geschichte bis ins kleinste. Er hatte sich
Bilder und Szenen zurechtgelegt und sprach von den fernsten Zeiten
mit solcher Natürlichkeit, wie kaum ein Zeitgenosse von der jüngsten
Gegenwart.
„Die dummen Pariser“, sagte er eines Tages zu mir, „glauben, daß ich
500 Jahre alt sei, und ich bestärkte[S. 50] sie in dieser Annahme; denn ich
sehe, daß ihnen das viel Spaß macht. Ich bin freilich ungleich älter
als ich aussehe,“ setzte er hinzu, denn auch mich wünschte er bis zu
einem gewissen Grade irrezuführen. Aber die Pariser waren nicht nur so
dumm, ihm ein mehrhundertjähriges Alter zuzuschreiben, sie machten ihn
sogar zum Zeitgenossen Christi, und zwar aus folgendem Anlaß.
In Paris lebte ein kurzweiliger Mann, den man Mylord Gower nannte,
weil er die Engländer hervorragend nachmachte. Nachdem die Regierung
ihn im Siebenjährigen Kriege als Spion beim englischen Heere verwandt
hatte, wurde er zum Spielzeug einiger Leute am Hofe, die die
einfältigen Pariser zum besten haben wollten. Man steckte ihn in die
verschiedensten Kostüme und ließ ihn alle möglichen Menschen kopieren.
So wurde dieser Mylord Gower im Marais[31] als Herr von Saint-Germain
eingeführt, um die Neugier der Damen und Maulaffen dieser Stadtgegend
zu befriedigen, die sich leichter nasführen lassen als die Leute in
der Gegend des Palais Royal. Auf diesem Schauplatz erlaubte sich unser
falscher Adept seine Rolle zu spielen. Anfangs übertrieb er nur wenig.
Als er jedoch sah, daß man alles bewundernd aufnahm, griff er von einem
Jahrhundert aufs andere bis auf Jesus Christus zurück. Von ihm sprach
er mit solcher Vertrautheit, als wäre er sein Freund gewesen. „Ich habe
ihn sehr gut gekannt,“ sagte er. „Er war der beste Mensch auf Erden,
aber romantisch veranlagt und unbesonnen; ich habe ihm oft gesagt, er
würde ein schlimmes Ende nehmen.“ Dann ging unser Schauspieler auf
die Dienste ein, die er ihm durch Vermittlung der Frau des Pilatus zu
leisten versuchte, in deren Haus er täglich verkehrte. Er behauptete,[S. 51]
die heilige Jungfrau, die heilige Elisabeth[32], ja selbst deren alte
Mutter, die heilige Anna[33], gut gekannt zu haben. „Der“, sagte er,
„habe ich nach ihrem Tode einen großen Dienst geleistet. Ohne mich wäre
sie nie heilig gesprochen worden. Zu ihrem Glück war ich beim Konzil zu
Nicäa[34], und da ich mehrere der dort versammelten Bischöfe kannte,
bat ich so innig und stellte ihnen so oft vor, eine wie brave Frau
sie gewesen sei und wie wenig es ihnen kostete, so daß sie dann auch
wirklich heilig gesprochen wurde.“ Diese abgeschmackte Posse wurde in
Paris ziemlich ernsthaft weitererzählt und trug Herrn von Saint-Germain
den Ruf ein, im Besitz eines Lebenselixiers zu sein, das ihn verjüngte
und unsterblich machte. Daraus entstand die Schnurre von der alten
Kammerfrau einer Dame, die eine Phiole dieser göttlichen Flüssigkeit
heimlich bewahrte. Die alte Kammerfrau grub sie aus und trank so viel
davon, daß sie immer jünger und schließlich zum kleinen Kinde wurde.
Obwohl alle diese Fabeln und mehrere Anekdoten über Saint-Germains
Alter weder Glauben noch Beachtung bei vernünftigen Menschen verdienen,
so bleibt immerhin wunderbar, was mir zahlreiche glaubwürdige
Personen über seine lange Lebensdauer und die fast unbegreifliche
Unveränderlichkeit seines Äußeren bestätigt haben. So hörte ich
Rameau[35] und die alte Verwandte eines französischen Botschafters in
Venedig[36] versichern, als sie Saint-Germain dort 1710 kennen lernten,
habe er[S. 52] wie ein Fünfzigjähriger ausgesehen. Im Jahre 1759 schien
er 60 Jahre alt zu sein, und damals erneuerte Morin, mein späterer
Gesandtschaftssekretär, für dessen Wahrhaftigkeit ich einstehe, in
meinem Hause die Bekanntschaft mit ihm, die er 1739 auf einer Reise
in Holland gemacht hatte, und war baß erstaunt, daß er nicht um ein
Jahr älter aussah. Alle Personen, die ihn danach bis zu seinem Tode
kennen gelernt haben — der, wenn ich nicht irre, 1780 in Schleswig[37]
stattfand — und die ich über sein vermeintliches Alter befragte,
haben mir stets geantwortet, er mache den Eindruck eines guterhaltenen
Sechzigers. Ein Mann von 50 Jahren ist also im Zeitraum von 70 Jahren
nur um 10 Jahre gealtert — das scheint mir das Außerordentlichste und
Bemerkenswerteste an seiner Geschichte.
Er besaß mehrere chemische Geheimmittel, besonders zur Herstellung
von Farben und Färbstoffen und einer Art von Similor von seltener
Schönheit. Vielleicht hat er auch die erwähnten Edelsteine, deren
Echtheit nur durch die Probe mit der Feile widerlegt werden könnte,
selbst angefertigt. Aber von einer Universalmedizin habe ich ihn nie
reden hören.
Er lebte sehr mäßig, trank nie beim Essen, purgierte sich mit
selbstbereiteten Sennesblättern und gab seinen Freunden keinen anderen
Rat, wenn sie ihn fragten, was sie tun müßten, um lange zu leben.
Überhaupt pries er nie wie andere Scharlatane übernatürliche Kenntnisse
an.
Seine Philosophie war die des Lukrez: er sprach mit geheimnisvoller
Begeisterung von den Tiefen der Natur und eröffnete der Phantasie
unbestimmte, dunkle und unendliche Ausblicke auf die Art seines
Wissens, seine Reichtümer und seine vornehme Abkunft. Gern erzählte[S. 53]
er Züge aus seiner Kindheit und schilderte sich selbst, wie er mit
zahlreichem Gefolge auf prächtigen Terrassen in einem herrlichen Klima
lustwandelte, gleich als wäre er der Erbe eines Königs von Granada zur
Zeit der Mauren gewesen. Allerdings hat kein Mensch, keine Polizei je
herausbekommen, wer er war und woher er stammte.
Er sprach fließend Deutsch und Englisch. Französisch sprach er mit
piemontesischem Akzent, Italienisch ausgezeichnet, aber besonders
Spanisch und Portugiesisch ohne den geringsten Akzent.
Wie ich hörte, hat er neben mehreren deutschen, italienischen und
russischen Namen, unter denen man ihn in verschiedenen Ländern glänzen
sah, in früherer Zeit auch den eines Marquis von Montferrat
getragen. Wie ich mich entsinne, sagte mir der alte Baron Stosch[38],
er hätte in Florenz zur Zeit des Regenten[39] einen Marquis von
Montferrat gekannt, der für einen natürlichen Sohn der Witwe Karls
II.[40], die sich nach Bayonne zurückgezogen hatte, und eines Madrider
Bankiers galt.
Saint-Germain verkehrte im Hause des Herzogs von Choiseul[41] und
war dort gern gesehen. Wir waren daher sehr erstaunt, als dieser
Minister seiner Gattin gegenüber eine sehr ausfallende Bemerkung über
ihn machte. Er fragte sie plötzlich, warum sie nichts trinke, und
als sie antwortete, sie wende gleich mir mit Erfolg die Lebensdiät[S. 54]
Saint-Germains an, entgegnete Choiseul: „Der Baron, der, soviel ich
weiß, eine besondere Vorliebe für Abenteurer hat, ist sein eigener
Herr und kann leben, wie er will. Ihnen aber, Madame, deren Gesundheit
mir kostbar ist, verbiete ich, die Narrheiten eines so zweideutigen
Menschen nachzuahmen.“ Um dem peinlich werdenden Gespräch eine andere
Wendung zu geben, fragte der Komtur von Solar[42] den Herzog von
Choiseul, ob die Regierung wirklich die Herkunft eines Mannes nicht
kenne, der in Frankreich auf so vornehmem Fuße lebe. „Gewiß kennen
wir sie,“ versetzte Choiseul (aber er log), „er ist der Sohn eines
portugiesischen Juden, der die Leichtgläubigkeit des Hofes und der
Stadt zum besten hat. Seltsam,“ fuhr er, sich erhitzend, fort, „daß
man erlaubt, daß der König oft fast allein mit einem solchen Menschen
ist, während er nur von Garden umgeben ausgeht, als ob die Welt von
Mördern wimmelte.“ Dieser Zornesausbruch kam von seiner Eifersucht auf
den Marschall Belle-Isle[43], dem Saint-Germain sich mit Leib und Seele
verschrieben hatte: ihm hatte er den Plan und das Modell der berühmten
Flachboote gegeben, mit denen eine Landung in England[44] gemacht
werden sollte.
Die Folgen dieser Feindschaft und der Argwohn Choiseuls kamen wenige
Monate später zum Ausbruch[45]. Der Marschall spann immerfort Ränke
zur Herbeiführung eines Sonderfriedens mit Preußen und zum Bruch
des Allianzsystems zwischen Österreich und Frankreich, mit[S. 55] dem der
Herzog von Choiseul stand und fiel. Ludwig XV. und Frau von Pompadour
wünschten diesen Sonderfrieden, Saint-Germain redete ihnen ein, ihn
zum Prinzen Ludwig von Braunschweig nach dem Haag zu schicken, dessen
Busenfreund er sich nannte. Er versprach, auf diesem Wege erfolgreiche
Verhandlungen anzuknüpfen, deren Vorteile er durch seine Beredsamkeit
ins hellste Licht setzte.
Der Marschall setzte die Instruktionen auf, und der König übergab
sie ihm persönlich mit einer Chiffre für Saint-Germain, der, im Haag
angelangt, sich berufen fühlte, die Rolle des Gesandten zu spielen.
Infolge seiner Indiskretion kam d’Affry, damals Botschafter im
Haag[46], hinter das Geheimnis dieser Sendung und schickte einen Kurier
an Choiseul, bei dem er sich heftig beschwerte, daß er einem alten
Freund seines Vaters und der Würde eines Botschafters den Schimpf
antäte, durch einen obskuren Ausländer Friedensverhandlungen unter
seinen Augen anzuknüpfen, ohne ihn überhaupt davon in Kenntnis zu
setzen.
Choiseul schickte den Kurier sofort zurück und befahl d’Affry, mit
aller denkbaren Energie von den Generalstaaten die Auslieferung
Saint-Germains zu fordern. Danach sollte er ihn, an Händen und Füßen
gefesselt, in die Bastille einliefern. Am nächsten Tage verlas
Choiseul im Kronrat d’Affrys Bericht und seine Antwort darauf.
Dann blickte er im Kreise herum stolz auf seine Kollegen, heftete
seine Blicke abwechselnd auf den König und Belle-Isle und schloß:
„Wenn ich mir nicht die Zeit genommen habe, die Befehle des Königs
einzuholen, so geschah es in der Überzeugung, daß hier niemand so
dreist wäre, ohne Wissen des Ministers des Auswärtigen[S. 56] Eurer Majestät
Friedensverhandlungen zu führen!“ Er wußte, daß der König den Grundsatz
aufgestellt und stets beobachtet hatte, kein Minister dürfte sich in
die Geschäfte eines anderen einmischen. So kam es, wie er vorausgesehen
hatte: der König senkte schuldbewußt die Blicke, der Marschall wagte
kein Wort, und Choiseuls Schritt wurde gebilligt. Aber Saint-Germain
entwischte ihm. Die Generalstaaten beteuerten ihre Willfährigkeit und
schickten ein großes Aufgebot zur Verhaftung Saint-Germains. Der aber
war heimlich gewarnt und entfloh nach England.
Aus einigen Nachrichten glaube ich zu entnehmen, daß er bald wieder
abreiste und nach St. Petersburg ging. Dann tauchte er in Dresden,
Venedig und Mailand auf, verhandelte mit den dortigen Regierungen, um
ihnen Geheimnisse der Färberei zu verkaufen und Fabriken zu begründen.
Er machte damals den Eindruck eines Glücksritters und wurde in einer
kleinen Stadt in Piemont wegen eines verfallenen Wechsels verhaftet.
Doch er zeigte dem Inhaber für über 100000 Taler Wertsachen, bezahlte
auf der Stelle, behandelte den Bürgermeister dieser Stadt als Kaffern
und wurde unter den ehrerbietigsten Entschuldigungen freigelassen.
Im Jahre 1770 tauchte er in Livorno auf, mit russischem Namen und
in Generalsuniform. Graf Alexei Orlow[47] behandelte ihn mit einer
Auszeichnung, die der stolze und hochfahrende Mann sonst niemandem
bezeigte. Das muß in engem Zusammenhang mit einer Bemerkung seines
Bruders, des Fürsten Gregor Orlow, gegenüber[S. 57] dem Markgrafen von
Ansbach stehen. Saint-Germain hatte sich einige Jahre darauf bei diesem
niedergelassen[48] und ihn bestimmt, den berühmten Günstling Katharinas
II. bei seiner Durchreise in Nürnberg zu besuchen[49].
Da sagte Orlow
ganz leise zum Markgrafen über Saint-Germain, den er aufs feierlichste
begrüßte: „Dieser Mann hat eine große Rolle bei unserer Revolution
gespielt.“
Er wohnte in Triesdorf und hauste dort nach Belieben mit einer
Herrenfrechheit, die ihm ausgezeichnet stand. Den Markgrafen behandelte
er wie einen Schulknaben. Stellte ihm dieser bescheidene Fragen über
seine Wissenschaft, so antwortete er: „Sie sind zu jung, um Ihnen
dergleichen zu sagen.“ Um sich an diesem kleinen Hofe noch mehr in
Respekt zu setzen, zeigte er von Zeit zu Zeit Briefe Friedrichs
des Großen. „Kennen Sie diese Hand und dies Siegel?“ fragte er den
Markgrafen, indem er ihm den Brief in seinem Umschlag zeigte. „Ja, es
ist das kleine Siegel des Königs.“ — „Wohlan, was drin steht, sollen
Sie nie erfahren.“ Damit steckte er den Brief wieder ein.
Der Markgraf behauptet, er habe sich überzeugt, daß Saint-Germains
Edelsteine falsch waren: es sei ihm gelungen, durch seinen Juwelier
einen Diamanten heimlich mit der Feile prüfen zu lassen, als der Stein
der im Bette liegenden Markgräfin[50] gezeigt wurde; denn Saint-Germain
paßte scharf auf seine Steine auf und ließ sie nicht aus den Augen.
[S. 58]
Schließlich starb der außerordentliche Mann bei Schleswig beim Prinzen
Karl von Hessen, den er vollständig bestrickt und zu Spekulationen
veranlaßt hatte, die jedoch fehlschlugen. In seinem letzten Lebensjahre
ließ er sich nur von Frauen bedienen, die ihn pflegten und ihn wie
einen zweiten Salomo verhätschelten. Nach allmählichem Kräfteverfall
starb er in ihren Armen.
Umsonst gaben sich die Freunde, die Bedienten und selbst die Brüder des
Prinzen[51] alle Mühe, ihm das Geheimnis seiner Herkunft zu entlocken.
Da der Prinz aber alle Papiere Saint-Germains erbte[52] und alle Briefe
erhielt, die nach seinem Tode eintrafen, muß er mehr darüber wissen
als wir, die wahrscheinlich nie mehr erfahren werden. Ein so seltsames
Dunkel ist seiner Gestalt würdig.
[S. 59]
AUS DEM „TAGEBUCH EINES
WELTKINDES“ VON GRAF LAMBERG[53]
Eine seltsame Erscheinung ist der Marquis von Aymar oder
Belmar, bekannt unter dem Namen Saint-Germain. Er
wohnt seit einiger Zeit in Venedig, wo er hundert Frauen, die ihm
eine Äbtissin verschafft, mit Versuchen zum Bleichen des Flachses
beschäftigt, dem er das Aussehen von italienischer Rohseide gibt.
Er glaubt 350 Jahre alt zu sein, und wohl um nicht zu arg zu
übertreiben, behauptet er, den Thamas Chouli-Kan in Persien[54] gekannt
zu haben.
Als der Herzog von York[55] nach Venedig kam, beanspruchte er beim
Senat den Vorrang vor diesem. Als Grund gab er an, man wisse wohl, wer
der Herzog von York sei, kenne aber noch nicht den Titel des Marquis
von Belmar.
Er besitzt einen Verjüngungsbalsam: eine alte Frau, die sich zu stark
damit einrieb, wurde wieder zum Embryo.[S. 60] Einem seiner Freunde gab er
eine Haarwickel und diesem zahlte ein Bankier, der den Marquis nicht
kannte, auf Sicht 200 Dukaten in bar.
Ich fragte ihn, ob er nach Frankreich zurückkehre. Er versicherte mir
mit überzeugter Miene, daß die Flasche (mit Lebenselixier), die den
König in seinem jetzigen Gesundheitszustand erhalte, zu Ende ginge.
Infolgedessen werde er mit einem glänzenden Streich wieder auf der
Bühne erscheinen und sein Name werde in ganz Europa bekannt werden.
Er soll in Peking gewesen sein, ohne sich irgendeinen Namen beizulegen;
als die Polizei ihn drängte, seinen Namen zu nennen, entschuldigte er
sich damit, er wisse selbst nicht, wie er heiße. „In Venedig“, sagte
er, „nennt man mich den Herrn ‚Was geht’s dich an’, in Hamburg: ‚Mein
Herr’, in Rom: ‚Monsignor’, in Wien: ‚Pst’. In Neapel pfeift man nach
mir, in Paris beäugt man mich, und auf dieses Zeichen spreche ich
gern jeden an, der mich anschaut. Mein Name kann Ihnen, meine Herren
Mandarinen, also gleichgültig sein. Solange ich bei Ihnen lebe, werde
ich mich wie der Träger eines erlauchten Namens benehmen. Ob ich
Erbse oder Bohne, Piso[56] oder Cicero
heiße, mein Name muß Ihnen gleichgültig sein.“ Selbst in Venedig erhält
er Briefe, auf denen bloß „Venedig“ steht. Der Rest ist freigelassen,
und sein Sekretär verlangt auf der Post einfach Briefe ohne jede
Anschrift.
Der König (von Frankreich) gab ihm beim Tode des Marschalls von
Sachsen[57] das Schloß Chambord und umarmte ihn, als er ihn verließ.
Saint-Germain verkehrte in[S. 61] allen vornehmen Häusern und wurde sogar mit
Auszeichnung empfangen. Er ging oft zur Fürstin von Anhalt-Zerbst[58],
der Mutter der jetzigen Zarin. „Ich muß“, sagte er zu ihr, „recht gern
bei Ihnen sein, um zu vergessen, daß mein Wagen seit zwei Stunden auf
mich wartet, um mich nach Versailles zu bringen.“
Übrigens weiß niemand, wer dieser seltsame Mann ist. Man hält ihn für
einen Portugiesen. Er besitzt tausend Talente, die bei einem einzigen
Menschen selten vereint sind. Er spielt hervorragend Violine, aber
hinter einem Wandschirm; dann glaubt man fünf bis sechs Instrumente
zugleich zu hören.
Er spricht viel und gut. Jeden redet er mit so passenden Fragen
an, daß es anfangs überrascht. In einer Art von Stammbuch, in dem
Unterschriften mehrerer Berühmtheiten stehen, zeigte er mir eine
lateinische Eintragung meines Ahnherrn Kaspar Felix, der 1686 starb,
mit seinem Wappen und der folgenden Beischrift: „Lingua mea calamus
scribae velociter scribentis. Ps. 44, Vers 2“[59]. Die Tinte und
selbst das Papier waren sehr verblaßt und nachgedunkelt und schienen
mir alt. Das Datum ist 1678. Eine andere Eintragung von Michel
Montaigne[60] ist vom Jahre 1580: „Kein Mensch ist so bieder, daß
er wohl nicht zehnmal den Galgen verdient, auch wenn er alle seine
Handlungen und Gedanken der Prüfung der Gesetze unterwirft. Und doch
wäre es sehr schade und ungerecht, einen solchen zu bestrafen und zu
hängen.“
Ich schließe aus alledem, daß es ebenso leicht ist, zwei gleiche
Handschriften herzustellen, wie zwei ganz ähnlich[S. 62] aussehende Menschen
zu finden. Le Vayer[61] gibt Beispiele an, aus denen man folgern
könnte, daß es vorzeiten ein Verdienst war, Handschriften nachmachen zu
können ...
Die beiden genannten Eintragungen könnten das Alter des Marquis
bestätigen, spräche die menschliche Natur nicht dagegen. Von welchem
Zeitalter er auch spricht, man trifft selten auf einen Irrtum. Er
erwähnt sehr zurückliegende Daten am rechten Ort und spielt sich dabei
keineswegs auf. Er ist ein seltener, überraschender Mann, und was
einem Spaß macht: er hält der Kritik stand. Mit großer Überredungsgabe
verbindet er eine ungewöhnliche Gelehrsamkeit und das umfassendste
Gedächtnis, obgleich es örtlich beschränkt ist. Er behauptet, Wildmann
die Kunst gelehrt zu haben, Bienen zu zähmen und den Schlangen Sinn für
Musik und Gesang beizubringen. Da beides auf feststehenden Tatsachen
beruht, gibt es der Eigenart des Marquis kein anderes Gepräge als das
der Neuheit, die er oft anderen anerkannten Vorzügen vorzieht.
Ich habe einen sehr fesselnden Brief abgeschrieben, den er mir 1773 aus
Mantua sandte.
Schreiben von Saint-Germain
an Lamberg
„Ich sah ihn (Wildmann) im Haag, als ich dort verhaftet wurde[62].
Bevor ich meinen Degen abgab, bestand ich darauf, d’Affry, den
französischen Botschafter bei den Generalstaaten, zu sprechen. Ich
wurde in meinem Wagen hingebracht, in Begleitung des Offiziers,
der mich zu bewachen[S. 63] hatte. Der Gesandte empfing mich, als ob er
überrascht sei, mich zu sehen; bald aber gebot er dem Wächter, sich
zurückzuziehen und vor allem den Herren Bürgermeistern zu melden,
daß ich die Protektion des Königs besäße und somit unter dem Schutz
Sr. Majestät stände, solange ich in Holland bliebe. Ich glaubte, dem
Offizier einen Diamanten von reinstem Wasser und von, wenn ich so sagen
darf, ungewöhnlichem Karat anbieten zu sollen, aber er lehnte ihn ab,
und da all mein Zureden fruchtlos blieb, zerschlug ich den Stein mit
einem großen Hammer in mehrere Stücke, die die Lakaien zu ihrem Profit
auflasen. Der Verlust des Diamanten, der in Brasilien und im Reiche des
Mogul als solcher anerkannt worden, war mir indes nicht gleichgültig,
zumal seine Herstellung mir unendliche Mühe gekostet hatte. Graf Zobor,
der Kammerherr des verstorbenen Kaisers[63] (ein unvergeßlicher Fürst
durch seine erhabenen Eigenschaften wie durch den Schutz, den er den
Künsten gewährte), hat Diamanten mit mir gemacht[64]. Prinz T.... hat
vor etwa sechs Jahren einen von mir hergestellten für 5500 Louisdors
gekauft und ihn dann mit 1000 Dukaten Gewinn an einen reichen Narren
verkauft. Man muß in der Tat ein König oder ein Narr sein, sagte der
Graf von Barre, um für einen Diamanten erhebliche Summen auszugeben. Da
die Narren im Schachspiel[65] übrigens den Königen am nächsten stehen,
so verletzt das griechische Sprichwort: Βασιλεῦς ἤ Ὄνος (König oder
Esel) und das andere: Aut regem aut fatuum nasci oportet[66]
keinen Menschen. Frau[S. 64] von S... hatte einen vom gleichen bläulichen
Wasser und ebenso schlecht geschnitten wie jener; in der Fassung sah er
wie ein großer böhmischer Stein mit mattem Schliff aus.
„Nun, mein Herr, ein Mann wie ich ist bei der Wahl seiner Mittel sehr
oft in Verlegenheit, und wenn es zutrifft, daß die Narren oder die
Könige die einzigen sind, denen man einen großen Diamanten anbieten
kann, so verdiente ich die Ablehnung des Offiziers; das Unrecht war
ganz auf meiner Seite. Übrigens ist der Mensch geneigt, bei den
Kunstfertigkeiten oft gewisse Leistungen, die allein auf Rechnung des
Künstlers kommen, der Natur zuzuschreiben. Ein Pott, ein Marggraf, ein
Rouelle[67] verkünden von ihrem Dreifuß, daß niemand Diamanten gemacht
hat, weil sie die Gründe nicht kennen, die dem Gelingen entgegenstehen.
Wenn alle diese Herren (ihre Zahl ist groß) die Menschen mehr studieren
wollten als die Bücher, so würden sie bei ihnen Geheimnisse entdecken,
die sie in der „Goldenen Kette Homers“ und dem großen und kleinen
„Albertus“, in dem geheimnisreichen Band „Picatrix“[68]
usw. nicht finden. Die großen Entdeckungen werden nur dem zuteil, der
reist.
„Ich verdanke die Entdeckung des Schmelzens der Edelsteine der zweiten
Reise nach Indien, die ich 1755 mit dem Oberst Clive[69] unter dem
Befehl des Vizeadmirals Watson[70] machte. Auf meiner ersten Fahrt
hatte ich nur sehr geringe Kenntnisse über dies wunderbare Geheimnis
erworben. Alle meine Versuche in Wien,[S. 65] in Paris, in London galten
nur als Proben; den Stein der Weisen zu finden, war mir in der
genannten Zeit beschieden.

Max Joseph Graf v. Lamberg
Stich von Maag
„Aus guten Gründen gab ich mich bei dem Geschwader nur als Graf C...z
aus. Überall, wo wir landeten, genoß ich die gleichen Auszeichnungen
wie der Admiral. Ohne mich nach meinem Vaterlande zu fragen, erzählte
der Nabob von Baba mir nur von England. Ich entsinne mich, mit welchem
Vergnügen er meiner Beschreibung vom Pferderennen zu Newmarket zuhörte.
Ich erzählte ihm, daß ein berühmtes Pferd namens Eclipse schneller
sei als der Wind, und ich log nicht; denn angenommen, daß dies Pferd
in einer Minute eine englische Meile lief, d. h. 82½ Fuß in der
Sekunde, könnte man, selbst wenn es diesen rasenden Lauf nur ein bis
zwei Minuten aushielt, ohne Gefahr begründeten Widerspruchs behaupten,
daß ein solches Pferd vor dem Winde herlief; denn dessen größte
Geschwindigkeit beträgt 85 Fuß im freien Raum, und ein Schiff, das
auch nur ein Drittel seines Anpralls aushielte, würde 6 (französische)
Meilen in der Stunde vorwärts getrieben werden, was der größten
bekannten Fahrtgeschwindigkeit entspricht.
„Der Nabob schlug mir vor, ihm meinen Sohn, den ich mithatte,
dazulassen. Er nannte ihn seinen Lord Bute[71], nach dem Muster seiner
Höflinge, die sämtlich englische Namen trugen. Dieser Nabob hatte unter
seinen Kindern einen Prinzen von Wales, einen Herzog von Glocester,
einen Herzog von Cumberland usw. Als Watson ihn besuchte, erkundigte er
sich nach dem Befinden des Königs Georg, und als er erfuhr, daß dieser
einen Sohn verloren[S. 66] hatte[72], rief er seufzend aus: „Auch ich habe
meinen Prinzen von Wales verloren!“
Der Marquis Belmar.“
Eine Gabe, die Herr von Belmar allein besitzt und die in den Familien
gelernt und gepflegt zu werden verdiente, ist, mit beiden Händen
zugleich zu schreiben. Ich diktierte ihm etwa zwanzig Verse aus
„Zaïre“[73], die er auf zwei Blättern Papier in denselben Schriftzügen
zugleich schrieb. „Ich tauge nicht viel,“ sagte er zu mir, „aber Sie
werden zugeben, daß ich meinen Sekretär ganz umsonst ernähre. Die
Fortschritte in den Kunstfertigkeiten sind langsam; man beginnt mit
Versuchen und gelangt schließlich zu einem festen System.“
**
*
Am Schluß berichtigt Lamberg die Angabe der in Florenz erscheinenden
Zeitung „Le notizie del mondo“, die im Juli 1770 unter der
Rubrik „Nachrichten aus der Welt“ die Mitteilung gebracht hatte:
„Tunis, Juli 1770. Der kaiserliche Kammerherr Graf Maximilian Lamberg
hat der Insel Korsika einen Besuch abgestattet, um verschiedene
Forschungen anzustellen. Er weilt hier seit Ende Juni in Gesellschaft
des Herrn von Saint-Germain, der in Europa wegen seiner umfassenden
politischen und philosophischen Kenntnisse berühmt ist[74].“
Lamberg dementiert diese Nachricht mit dem Hinweise, daß ihn die
Zeitung zum Reisegefährten Saint-Germains in Afrika mache, „zu einer
Zeit, wo Herr von Belmar aus Genua an einen Freund in Livorno
schrieb, er wolle[S. 67] nach Wien gehen, um den Prinzen Ferdinand von
Lobkowitz[75] wiederzusehen, dessen Bekanntschaft er 1745 in London
gemacht hatte.“
Schreiben des Grafen Lamberg an Opiz[76]
„Herr von Saint-Germain hat ziemlich lange in Paris gelebt und das
allgemeine Gespräch gebildet. Er behauptete tatsächlich, vierhundert
Jahre alt zu sein. Ich war sehr gespannt, ihn zu sehen. Eines Tages
traf ich ihn bei der verstorbenen Prinzessin von Talmond. Ich fühlte
ihm auf den Zahn und hörte ihm aufmerksam zu. Er schien mir sehr
kenntnisreich und sehr unterhaltend. Abends erzählte ich von der
zufälligen Begegnung in einem Hause, wo ich zur Nacht speiste. Ich
sagte, ich hätte den berühmten Grafen von Saint-Germain gesehen. Man
fragte mich, ob er wirklich 400 Jahre alt sei, wie er behaupte. Ich
entgegnete kalt: „Ich glaube, er übertreibt. Er sieht nicht älter aus
als 200 Jahre.“ Im übrigen empfiehlt sich dieser berühmte Abenteurer,
der einen guten Teil seines Lebens mit der Leichtgläubigkeit der
Menschen gespielt zu haben scheint, durch seine Kenntnisse und Talente.
Die Eigenartigkeit ist durchaus nicht sein einziger Vorzug; man täte
ihm Unrecht mit der Annahme, daß sein Ruf nur darauf beruht. Seine
Reisen und Forschungen würden eigenartiges und nützliches Material für
einen Schriftsteller liefern, der über sichere Nachrichten verfügt.“
[S. 68]
Aus Lambergs „Kritischen,
moralischen und politischen Briefen“[77]
Cagliostro[78] ist undurchdringlich und ebenso eigenartig wie der
Graf von Saint-Germain, dessen Schüler er sein soll, wenn er auch
seinem Meister an Talenten und Genie weit nachsteht. Dieser verdankte
seine Berühmtheit seinem Wissen; jener verdankt sie dem Glück und dem
Ränkespiel: Mundus vult decipi[79].
Epigramm des Grafen Lamberg auf
Saint-Germain[80]
Dreihundert Jahre bin ich für die Welt.
Zweihundert zähle ich für meine Freunde.
Beim Trinken bin ich fünfzig Jahre alt.
Bei Iris sind es fünfundzwanzig bloß.
Ich bin zwar nicht Fortunas Feind in allem,
Doch macht sie mich zu ihrem Spielball nicht:
Ich selber war’s, der stets mit ihr gespielt.
Grabschrift Saint-Germains auf den
Grafen Lamberg[81]
Um einen Weltmann traure, braver Bürger,
Der Gottes Freund, Freund von Gesetz und Recht,
Des Kaisers Freund und auch des Nächsten war.
Lamberg starb arm, doch unverdienstlich nicht.
[S. 69]
Er ward es satt, lichtscheuer Dummheit Licht
Zu bringen, doch das Schicksal war gerecht:
Der Nachwelt weiht es seinen teuren Namen,
Den siechen Leib den Würmern, und sein Herz
Dem Vaterland, der Freundschaft seine Seele,
Den Musen aber seinen hohen Geist.
Zur Kritik Lambergs
Der brandenburgische Forscher Moehsen schreibt im Anschluß an
Lamberg in seinen „Beiträgen zur Geschichte der Wissenschaften in der
Mark Brandenburg“, S. 22 (Berlin und Leipzig 1783):
„So hat auch in unseren Tagen der berühmte Marquis Belmar oder
Graf Saint-Germain von der außerordentlichen Kraft eines solchen
Verjüngungsbalsams eine große Erfahrung durch einen Apostolischen K.
K. Kammerherrn bekannt werden lassen. Eine alte Dame hatte sich zu
stark damit gerieben und sahe sich in kurzer Zeit in den Zustand eines
Embryons versetzt, und man kann sich vorstellen, wie künstlich und
beschwerlich es dem Herrn Grafen geworden, wenn er sie wieder zur Welt
bringen und aufpäppeln müssen.“
[S. 70]
AUS DEN „DENKWÜRDIGKEITEN“ DER GRÄFIN
GENLIS[82]
Ich komme nun zu einer seltsamen Persönlichkeit, die ich länger als
ein halbes Jahr fast täglich gesehen habe. Das war der berühmte
Schwindler Graf Saint-Germain. Er sah damals höchstens wie ein
Fünfundvierzigjähriger aus, aber nach dem Zeugnis von Leuten, die ihn
30 bis 35 Jahre vorher gesehen, war er sicherlich weit älter.
Er war nicht ganz mittelgroß, gut gewachsen und hatte einen sehr
leichten Gang. Seine Haare waren schwarz, seine Haut stark gebräunt,
sein Gesichtsausdruck sehr geistreich, seine Züge ziemlich regelmäßig.
Er sprach fließend Französisch, ohne eine Spur von Akzent, ebenso
Englisch, Italienisch, Spanisch und Portugiesisch.
Er war ein hervorragender Musiker, begleitete auf dem Klavier aus dem
Kopfe alles, was man sang, und mit solcher Vollendung, daß Philidor[83]
darüber erstaunt war, ebenso über sein Präludieren.
[S. 71]
Er war ein guter Physiker und ein großer Chemiker. Mein Vater, der
das wohl beurteilen konnte, bewunderte seine Kenntnisse auf diesem
Gebiet sehr. Er malte auch in Öl, freilich nicht hervorragend, aber
doch nett. Er hatte ein Geheimverfahren für wirklich prachtvolle
Farben, durch das seine Bilder hervorragend ausfielen. Er malte im Stil
der Historienmalerei; seine Frauengestalten waren stets mit Juwelen
geschmückt. Für diese Schmuckstücke benutzte er seine Farben, und seine
Smaragde, Saphire, Rubinen usw. hatten wirklich die Leuchtkraft, den
Wiederschein und Glanz der wirklichen Steine. Latour, Vanloo[84] und
andere Maler besichtigten seine Gemälde und bewunderten aufs höchste
den erstaunlichen Kunstgriff dieser leuchtenden Farben, die allerdings
den Nachteil hatten, die Gesichter auszulöschen und ihre Naturwahrheit
durch ihre überraschende Täuschung zu zerstören. Aber für die
Ornamentalmalerei hätten diese seltsamen Farben von großem Nutzen sein
können, hätte Saint-Germain das Verfahren nicht geheim gehalten.
Im Gespräch war er belehrend und unterhaltend. Er war viel gereist
und beherrschte die neuere Geschichte mit erstaunlicher Kenntnis der
Einzelheiten. Man sagte daher, er spräche von längst verstorbenen
Personen, als hätte er mit ihnen gelebt. Aber ich habe dergleichen aus
seinem Munde nie gehört.
Er zeigte die besten Grundsätze, erfüllte gewissenhaft alle äußeren
Pflichten der Religion, war sehr wohltätig und, wie allgemein zugegeben
wurde, von größter Sittenreinheit. Kurz, in seinem Benehmen wie in
seinen Reden war alles gesetzt und moralisch.
[S. 72]
Dieser Mann erschien außergewöhnlich durch seine Talente, seine
umfassenden Kenntnisse und alles, was persönliche Achtung verschafft
— Wissen, vornehmes, gesetztes Wesen, lauteren Wandel, Wohlstand
und Wohltätigkeit. Trotzdem war er ein Schwindler oder doch ein
halber Narr, der sich Maßloses auf seine paar besonderen Geheimmittel
einbildete, die ihm eine kräftige Gesundheit und ein längeres Leben
als das des Durchschnitts der Menschen verschafft hatten. Ich bin
überzeugt, und mein Vater glaubte es fest, daß Saint-Germain, der
damals höchstens 45 Jahre alt schien, mindestens 90 alt war. Triebe
der Mensch nicht Mißbrauch mit allem, so würde er insgemein noch zu
höheren Jahren kommen; Beispiele dafür sind vorhanden. Ohne unsere
Leidenschaften und unsere Unmäßigkeit würden wir 100 Jahre alt werden
und bei sehr hohem Alter 150 bis 160 Jahre. Dann stände man mit 90
Jahren in der Kraft eines Vierzig- bis Fünfzigjährigen. Somit hat meine
Annahme über Saint-Germain nichts Ungereimtes, vorausgesetzt, daß er
mit Hilfe der Chemie die Bereitung eines Trankes oder einer Flüssigkeit
gefunden hätte, die seinem Temperament entsprach. Auch ohne an den
Stein der Weisen zu glauben, könnte man annehmen, daß er damals viel
älter war, als ich hier voraussetze.
In den ersten vier Monaten unseres vertrauten Umgangs tat Herr von
Saint-Germain keine maßlose Äußerung, ja nicht mal eine ungewöhnliche.
In seinem Wesen lag etwas so Gesetztes und Achtenswertes, daß
meine Mutter ihn gar nicht über die Seltsamkeiten, die man von ihm
behauptete, zu fragen wagte. Eines Abends jedoch, als er mich beim
Vortrag mehrerer italienischen Arien nach dem Gehör begleitet hatte,
sagte er zu mir, ich würde in vier bis fünf Jahren eine sehr schöne
Stimme[S. 73] haben. „Und wenn Sie siebzehn bis achtzehn Jahre alt sind,“
setzte er hinzu, „würden Sie dann nicht gern in diesem Alter bleiben,
wenigstens für eine lange Reihe von Jahren?“ Ich wäre entzückt darüber,
entgegnete ich. „Wohlan!“ fuhr er tiefernst fort, „das verspreche ich
Ihnen.“ Und sofort ging er auf andere Dinge über.

Frau von Genlis
Steindruck von Henry Meyer
Diese paar Worte ermutigten meine Mutter, ihn kurz darauf zu fragen,
ob er wirklich aus Deutschland stamme. Da schüttelte er geheimnisvoll
den Kopf und versetzte mit einem tiefen Seufzer: „Alles, was ich Ihnen
über meine Herkunft sagen kann, ist, daß ich mit sieben Jahren in
Begleitung meines Gouverneurs durch die Wälder irrte und daß auf meinen
Kopf ein Preis gesetzt war!“ Bei diesen Worten schauderte ich, denn die
Ehrlichkeit dieser großen Offenbarung stand für mich außer Zweifel. „Am
Tage vor meiner Flucht“, fuhr Saint-Germain fort, „befestigte meine
Mutter, die ich nicht wiedersehen sollte, ihr Bild an meinem Arme.“
„Ach Gott!“ rief ich aus. Bei diesem Ausruf blickte Saint-Germain mich
an und schien gerührt, weil er meine Augen voller Tränen sah.
„Ich will es Ihnen zeigen“, sagte er.
Damit schlug er seinen Ärmel zurück und zeigte ein Armband mit schöner
Emailmalerei, das eine bildschöne Frau darstellte. Ich betrachtete es
mit tiefer Bewegung. Saint-Germain sagte nichts weiter und ging auf ein
anderes Thema über.
Als er fort war, machte sich meine Mutter zu meinem großen Kummer über
seine „Ächtung“ und seine „Königin-Mutter“ lustig; denn der Preis,
der mit sieben Jahren auf seinen Kopf gesetzt war, die Flucht in die
Wälder mit seinem Gouverneur ließen durchblicken, daß er der[S. 74] Sohn
eines entthronten Herrschers war. Ich glaubte an diesen Königsroman und
wollte daran glauben, so daß die Scherze meiner Mutter mich sehr
verdrossen. Seit jenem Tage sagte Saint-Germain nichts Bemerkenswertes
mehr in dieser Hinsicht; er sprach nur noch von Musik, Kunst und
Merkwürdigkeiten, die er auf seinen Reisen gesehen.
Er brachte mir jedesmal ausgezeichnete Bonbons in Fruchtform mit, die
er, wie er versicherte, selbst gemacht hatte. Von allen seinen Talenten
war mir dies nicht das unliebste. Er gab mir auch eine sehr merkwürdige
Bonbonniere, deren Deckel er angefertigt hatte. Die Schachtel war aus
schwarzem Perlmutter und sehr groß. Der Deckel war mit einem weit
kleineren Achat verziert. Stellte man die Schachtel ans Feuer und nahm
sie gleich darauf wieder fort, so sah man den Achat nicht mehr, sondern
an seiner Stelle eine hübsche Miniatur, die eine Schäferin mit einem
Blumenkorb darstellte. Diese Figur blieb so lange, bis die Schachtel
wieder erwärmt wurde; dann erschien der Achat wieder und verdeckte die
Darstellung. Das wäre ein reizendes Mittel, ein Bild zu verbergen. Ich
habe seitdem eine Zusammensetzung entdeckt, mit der ich alle möglichen
Steine, selbst durchsichtige Achate, täuschend ähnlich nachahme. Durch
diese Erfindung habe ich den Kunstgriff von Saint-Germains Schachtel
erraten.
Um mit meinen Erinnerungen über den seltsamen Mann zu schließen, muß
ich sagen, daß ich 15 bis 16 Jahre später bei der Durchreise durch
Siena in Italien erfuhr, daß er in dieser Stadt wohnte und daß man
ihn nicht für älter als 50 Jahre hielte. 16 bis 17 Jahre darauf, als
ich in Holstein war, hörte ich vom Prinzen von Hessen, dem Schwager
des Königs von Dänemark und Schwiegervater[S. 75] des (heute regierenden)
Kronprinzen[85], daß Saint-Germain ein halbes Jahr vor meiner Reise
nach Holstein bei ihm gestorben sei. Der Prinz ging auf alle meine
Fragen über den berühmten Mann ein. Wie er mir sagte, sah er zur Zeit
seines Todes weder alt noch gebrechlich aus; nur schien er von einer
unbezwinglichen Trübsal verzehrt. Der Prinz hatte ihm in seinem Schloß
eine Wohnung angewiesen und machte mit ihm chemische Experimente.
Saint-Germain war nicht als armer Mann zu ihm gekommen, doch ohne
Begleitung und ohne glänzendes Auftreten. Er besaß noch mehrere schöne
Diamanten. Er starb an Auszehrung, und zwar unter Zeichen furchtbarer
Todesangst. Selbst sein Verstand war getrübt. Zwei Monate vor seinem
Tode war er ganz geistesgestört. Alles an ihm deutete auf ein gequältes
Gewissen hin, das sein Inneres in ungeheuren Aufruhr versetzte. Diese
Erzählung betrübte mich; ich hatte noch immer viel für diesen seltsamen
Mann übrig.
[S. 76]
AUS GROSLEYS „NACHGELASSENEN
SCHRIFTEN“[86]
Unter den Flüchtlingen, die Holland aufnimmt, gibt es Leute, deren
fabelhafte Abenteuer unaufklärbar sind und bleiben. Im Jahre 1758
kam aus Frankreich nach Utrecht eine Frau von 36 Jahren, die durch
Ton, Wesen und Benehmen eine gute Erziehung, ja vielleicht vornehme
Herkunft verriet. Daran änderte sich nichts in den vier Jahren, die
sie in einem Zimmer des Gasthofes, in dem ich wohnte, verbrachte.
Sie hatte keine Bekannten und keinen Verkehr nach auswärts, außer
daß sie vierteljährlich eine sehr anständige Rente erhielt. Umsonst
hatte sie die besorgte Neugier des Wirtes erregt, der nach ihrem
Fortgehen vergeblich seine Nachforschungen fortsetzte. Er schien
noch voller Bewunderung für die Frömmigkeit und unveränderliche
Sanftmut der „schönen Dame“, die er im Verdacht hatte, mit einem
berühmten Abenteurer in Verbindung zu stehen: dem sogenannten Grafen
Saint-Germain, der in Holland glänzend auftrat, mit allen europäischen
Herrschern in Briefwechsel zu stehen behauptete, sich ein Alter von 74
Jahren beilegte, obwohl er erst ein Fünfziger zu sein schien, und den
Stein der Weisen zu besitzen vorgab.
[S. 77]
Seit zehn Jahren war die „schöne Dame“ von Utrecht nach Amsterdam
übergesiedelt, und da ihre Rente ausblieb, hatte sie eine Stelle in
einer alten Wohltätigkeitsanstalt der französischen Kirche erhalten.
Sie bildet noch heute die Erbauung dieser Anstalt durch ihre Sanftmut
und Frömmigkeit und alle christlichen und menschlichen Tugenden. Hätte
ich Holland über Amsterdam statt über Utrecht verlassen, so hätte ich
durch gründliche Nachforschungen vielleicht alles herausgebracht, was
von ihr zu erfahren war.
Das Ergebnis meiner Nachforschungen über den Grafen Saint-Germain,
dessen Geschichte mit der ihren verknüpft war, bilden folgende
Einzelheiten, die ein Engländer seinen Landsleuten im London
Chronicle vom 5. Juni 1760 zum besten gegeben hat. Der Graf
Saint-Germain hatte Paris auf höheren Befehl verlassen und war nach
London gegangen[87], wo er die öffentliche Aufmerksamkeit bald
erregte und sie so lange fesselte, bis er nach den nordischen Ländern
spurlos verschwand. Nachfolgend die wörtliche Übersetzung jenes
Zeitungsartikels.
Der London Chronicle
vom 5. Juni 1760
„Welche Gründe den geheimnisvollen Fremdling hierher geführt haben,
ist völlig unbekannt, ebenso weshalb der Hof solches Aufheben von ihm
gemacht hat. Sein rätselhaftes Leben und die seltsamen Dinge, die von
ihm erzählt werden, geben seinen gewöhnlichsten Handlungen, deren
Schauplatz ganz Europa ist, etwas Besonderes.
„Die ehrenvollen Titel, mit denen er sich schmückt, verdankt er weder
seiner Geburt noch irgendwelcher[S. 78] Fürstengunst. Selbst sein Name ist
ein Geheimnis, das bei seinem Tode noch mehr Verwunderung erregen
wird als alle wunderbaren Ereignisse seines Lebens. Sein jetziger
Name ist angenommen.
„Das Wort „Unbekannter“, mit dem man ihn bezeichnet, ist zu schwach;
die Bezeichnung „Abenteurer“ und „Glücksritter“ aber gehen von
niedrigen Voraussetzungen aus, die nicht seinem Wandel entsprechen.
Sie träfen nur zu, wenn man damit einen Mann — ich möchte fast
sagen, einen vornehmen Mann — bezeichnete, der viel ausgibt und von
niemandem abhängt, dessen Einnahmequellen unbekannt sind, der aber
die der Gauner verschmäht, und dem von keinem Menschen und nirgendwo
nachgesagt werden kann, daß er ihn benachteiligt hätte.
„Unsere Kenntnis über sein Vaterland ist ebenso gering wie über seine
Herkunft. Die gewagtesten Vermutungen füllen die Lücken aus, und auf
dieser Grundlage hat niedrige Gesinnung, die überall etwas Schlechtes
annimmt und sieht, Geschichten erfunden, die ebenso lächerlich wie
für ihren Helden entehrend sind. Es wäre aber recht und billig, mit
dem Urteil zurückzuhalten, bevor man ihn kennt, und Menschenpflicht
wäre es, diese widersinnigen, haltlosen Geschichten nicht kritiklos
hinzunehmen. Beschränkt man sich auf das, was bekannt ist, so
erscheint er nur als ein Unbekannter, dem niemand etwas vorzuwerfen
hat und dem Mittel unbekannten Ursprungs zur Verfügung stehen, um in
dieser Weise seit geraumer Zeit aufzutreten. Vor Jahren tauchte er in
England auf[88]. Seitdem hat er die größten europäischen Höfe mit dem
glänzenden Gefolge eines vornehmen Fremden besucht.
[S. 79]
„Gil Blas’ Meister[89] hatte stets Geld, ohne daß man wußte, woher.
Das trifft auch auf unseren Unbekannten zu. Sein Wandel ist unter den
heikelsten Umständen beobachtet und verfolgt worden, und er hat sich
als harmlos und geregelt erwiesen. Zwischen dem Romanhelden und dem
unseren besteht nur der Unterschied, daß er alle seine Schätze in
winzigem Umfange von unbekannter Form mit sich zu führen scheint. Man
könnte den Vergleich mit der Phiole der Alchimisten ziehen, die die
Grundstoffe enthält, mit denen sie alle ihre Operationen vornehmen.
Nie hat man vor seiner Haustür Tonnen voll Silber abladen sehen,
deren er doch bedurft hätte, um ein so großes Haus zu führen.
„Geschickt erfaßt er die Lieblingsneigung jeder Nation, bei derer
sich zeigt; dadurch hat er sich überall anziehend und angenehm
zu machen gewußt. Bei seiner ersten Reise nach England fand er
eine große Vorliebe für Musik vor und entzückte uns durch sein
Geigenspiel. Seine Begabung für dies Instrument ist so hervorragend,
daß man mit einem unserer Dichter sagen könnte, er sei mit der
Violine in der Hand geboren. Italien fand ihn seinen Virtuosen
ebenbürtig, ebenso seinen feinsten Kennern der alten und neueren
Kunst. Deutschland stellte ihn auf die gleiche Stufe mit seinen
geübtesten Chemikern.
„Bei seinen umfangreichen und mannigfaltigen Kenntnissen bildete es
eine besondere Empfehlung, daß er sich niemals mit einer anderen
Kunst beschäftigt zu haben schien als eben der, in der er hervorragen
wollte. So trat er in der Musik als ausübender Künstler wie als
Komponist stets mit der gleichen Virtuosität und dem gleichen[S. 80] Erfolg
auf, und seine Unterhaltung drehte sich stets um diese Kunst, der er
tausend bildliche Ausdrücke entlehnte.
„Aus Deutschland brachte er nach Frankreich den Ruf eines perfekten
Alchimisten mit, der den Stein der Weisen und die Universalmedizin
besaß. Er sollte Gold machen können, eine Behauptung, die sein
glänzendes Auftreten und seine Ausgaben zu rechtfertigen schienen.
Die Sache kam selbst dem Minister zu Ohren, der lächelnd sagte, er
werde schon herauskriegen, aus welcher Mine er sein Gold bezöge.
Doch vergebens stellte er die genauesten Nachforschungen über das
Papiergeld und die Wechselbriefe an, in denen er jene Mine erblickte.
Während dieser zweijährigen Nachforschungen lebte Saint-Germain
wie gewöhnlich, bezahlte überall in klingender Münze, ohne daß man
entdecken konnte, daß ein Wechselbrief für ihn nach Frankreich
gelangt wäre. Dadurch wurden die Gerüchte bestärkt, er sei im
Besitz des Steines der Weisen, und man schrieb ihm nun auch ein
Allheilmittel, selbst ein Elixier gegen das Altwerden und seine
Folgen zu.
„Eine vornehme Dame wollte die Probe machen. Als gefallsüchtige Frau
sah sie mit Schmerz, daß die Jahre ihre Züge zu entstellen begannen.
Sie geht zu dem Fremdling und sagt: „Herr Graf, was ich Ihnen sagen
werde, wird Ihnen vielleicht etwas wunderlich erscheinen. Aber Sie
sind die Gefälligkeit selbst; darum zur Sache. Wie man sagt, besitzen
Sie noch etwas Besseres als das Geheimnis, Gold zu machen: die Gabe,
die Gebrechen des Alters zu heilen, ja ihnen vorzubeugen. Noch bin
ich von ihnen verschont, doch die Jahre gehen hin, und ich möchte
nicht warten, bis ich es nötig habe. Reden Sie frei heraus: besitzen
Sie diese Art Medizin? Wollen Sie sie mir geben, und unter welchen
Bedingungen?“
[S. 81]
„Der Unbekannte hüllte sich in geheimnisvolle Zurückhaltung und
sagte nur, wer solche Geheimnisse besäße, vermiede es, daß man davon
erführe. „Das weiß ich wohl“, entgegnete die Fragerin und versprach
ihm Geheimhaltung. Da sagt er zu, und am nächsten Tage bringt er ihr
ein Fläschchen von 4 bis 5 Löffeln Inhalt und verordnet ihr, von
diesem Elixier zehn Tropfen beim ersten Mondviertel und beim Vollmond
zu nehmen. Das Mittel sei ganz harmlos, aber äußerst kostbar, und
wenn es vergeudet werde, ließe es sich vielleicht nicht erneuern.
„Die Dame schloß das Fläschchen in Gegenwart ihrer Kammerfrauen ein.
Sei es nun, um ihre Schwachheit zu verbergen oder die Neugier ihrer
Kammerfrauen abzulenken, sie sagte ihnen, es sei ein Kolikmittel. Am
selben Abend bekommt die erste Kammerfrau heftiges Leibschneiden. Sie
geht an das Fläschchen, öffnet es, hält es an die Nase, kostet es,
und da sie den Geschmack ebenso köstlich findet wie den Duft, trinkt
sie es aus. Das Mittel wirkt ebenso rasch wie sicher. Die Flüssigkeit
war wasserhell. Um ihren Diebstahl zu verbergen, füllt sie das
Fläschchen mit gewöhnlichem Wasser, in der Hoffnung, daß ihre Herrin
nicht so bald Gebrauch davon machen werde; dann sinkt sie in tiefen
Schlaf.
„Gegen Morgen kommt ihre Herrin nach Hause, geht in ihr Zimmer,
ruft ihre Kammerfrauen zum Auskleiden und blickt die an, die das
Fläschchen ausgetrunken hat. „Was machen Sie hier bei mir?“ fragt
sie. „Woher kommen Sie?“ Die Gefragte macht statt jeder Antwort
eine tiefe Verbeugung. „Nun, was wollen Sie hier?“ fährt die Herrin
ärgerlich fort. „Ich habe Sie nicht bestellt. Gehen Sie fort.“ —
„Die Gnädige behandelt mich ungewöhnlich streng“, versetzt die
Gescholtene. „Ich habe nie meine Pflicht versäumt. Leider war ich
eingeschlafen,[S. 82] aber ist das etwas so Schlimmes?“ — „Wollen Sie mir
was vormachen?“ entgegnet die Dame. „Ich kenne Sie nicht und habe Sie
noch nie gesehen. Ich habe kein so junges Ding in meinem Dienst.“ —
Damit klingelt sie und ruft nach Radegonde (so hieß die Kammerfrau,
die das Fläschchen ausgetrunken hatte). „Aber hier bin ich ja,
gnädige Frau!“ ruft sie aus. „Erkennen Sie mich nicht mehr?“ Sie
blickt in den Spiegel und sieht zu ihrer größten Überraschung, daß
sie wie ein sechzehnjähriges Mädchen aussieht, obwohl sie 45 Jahre
alt ist.
„Ganz Frankreich hat bei diesem seltsamen Ereignis ein Wunder
ausgeschrieen. Aber der Fremde war verschwunden, und die unglückliche
Dame sah sich dazu verdammt, eine alte Frau zu werden.
„So erzählt man sich die Geschichte in Paris und wird sie wohl noch
mehrere Menschenalter erzählen. Hatte der Inhalt des Fläschchens
die Fünfundvierzigjährige zur Sechzehnjährigen gemacht? War diese
Metamorphose nicht von dem Grafen ins Werk gesetzt? Ich vermag es
nicht zu entscheiden.“
Wägt man die Einzelheiten, wie sie London Chronicle angibt,
so wird man sie nicht sowohl als Nachrichten über den Grafen
Saint-Germain, als vielmehr als Nachrichten von ihm ansehen,
die er der englischen Zeitung mitgeteilt hatte, um Nachforschungen zu
vereiteln und die für seine Rolle nötige Illusion aufrechtzuerhalten.
Diese Rolle war zweifellos die eines Spions in höherem Auftrage, dem
seine Auftraggeber die Mittel gaben, durch sein glänzendes Auftreten
und seine hohen Ausgaben zu imponieren, wozu dann noch die großen
Talente des Grafen traten, die alle zusammengenommen das ausmachten,
was die Italiener un gran furbo nennen.
[S. 83]
Herr de l’Épine Danican hatte sich ihm während seines Aufenthalts
in Frankreich angeschlossen und sich seine sehr ausgedehnten
metallurgischen Kenntnisse zunutze gemacht, um die bisher unbekannten
Bergwerke in der unteren Bretagne auszubeuten. Derselbe Danican
wollte den Grafen von Saint-Germain in einem gut aussehenden Manne
wiedererkennen, der zeitlebens im Zuchthause von Brest eingekerkert
war, weil er bei Hofe zur Zeit des Attentats[90] auf den König eine
Schmähschrift geschrieben hatte, derentwegen er auf Befehl des
Ministers lebenslänglich eingekerkert wurde, ein Befehl, den seine
Nachfolger bestätigt oder nicht widerrufen haben.
Dieser Mann, den ich 1776 in dem genannten Zuchthause sah, war von
guter Figur, imponierendem Äußern und ehrwürdigem Alter. Seine Zelle
stieß an einen der Säle des Zuchthauses. Er bekam sein Essen vom Tische
des Zuchthausdirektors, ging täglich zur Messe, kommunizierte jeden
Sonntag und nannte sich Ludwig von Bourbon. Die Fürsten und Minister,
die seitdem nach Brest kamen, haben ihn dort gesehen und gesprochen.
In den Denkwürdigkeiten zur Geschichte dieses Jahrhunderts wird er als
Doppelgänger des Mannes mit der eisernen Maske[91] dastehen. —
Drei Jahre nach der Niederschrift des Vorstehenden sagte mir ein
Holländer, es sei in Holland bekannt, daß der Graf Saint-Germain der
Sohn einer zu Anfang dieses Jahrhunderts nach Bayonne geflüchteten
Fürstin[92] und[S. 84] eines Juden aus Bordeaux sei. Bei der Rückkehr in die
Heimat wurde sie von einem Großwürdenträger des Hofes ihres Gemahls
mit einer Ansprache vorgestellt, die des Lobes von ihr voll war. Der
Marchese del Carpio, der mit ihrem Empfange betraut war, trat auf den
Redner zu, und statt jeder Antwort sagte er ihm leise ins Ohr: „Ist sie
in anderen Umständen?“
I
König Friedrich der Große liebte nach der Überlieferung seines
Kammerhusaren Schöning[93] folgende Anekdote zu erzählen: „Der
bekannte Graf Saint-Germain gab vor, daß er über 2000 Jahre alt sei und
sich unter anderem viel im Gelobten Lande aufgehalten habe. ‚Sie müssen
also Herrn Jesus Christus gesehen haben?’ frug ihn jemand. — ‚Ich habe
ihn wohl gekannt. Man konnte sehr gut mit ihm auskommen. Aber seit
der Geschichte mit dem Tempel hatte ich ihn aus den Augen verloren.’
Dieser wandte sich darauf an Saint-Germains Bedienten, um zu sehen, ob
der auch so gut wie sein Herr lügen könnte: ‚Ist es denn wahr, lieber
Freund, daß Ihr Herr so alt ist?’ — ‚Ach, mein Herr, das kann ich
Ihnen nicht sagen; denn ich bin erst 300 Jahre in seinen Diensten.’“
II
Der französische Geschäftsträger in Petersburg, Chevalier
Corberon, erzählt in seinen Aufzeichnungen[94] unter dem 30.
März 1776 von einer Unterhaltung mit einem Kaufmann Pictet aus Genf:
[S. 86]
„Die Rede kam auf den Grafen von Saint-Germain, den Pictet kannte.
Ihm hat er Dinge über seine Familie erzählt, ebenso dem Marquis
du Gouffier[95] über die seine. Pictet hält ihn für einen großen
Chemiker und glaubt, daß er ein Geheimmittel besitzt, um einen
fleckigen Diamanten tadellos zu machen. Und zwar glaubt er das, weil
Pictets Schwiegervater, der Steinschleifer Magnan, alle Diamanten mit
irgendwelchen Fehlern beiseite legte und sagte, dies geschähe für den
Grafen Saint-Germain.“
III
Graf Lehndorff (1727-1811), der ehemalige Kammerherr der
Gemahlin Friedrichs des Großen[96], berichtet im Februar 1776 über eine
Unterredung mit dem Malteserritter, Graf Sagramoso, der Gesandter in
Warschau war:
„Er hat den berüchtigten Grafen Saint-Germain sehr gut gekannt, der
sich für ewig ausgibt, und mir von ihm die folgende Anekdote erzählt:
Bei einer Aufführung des Trauerspiels ‚Mariamne’[97] erklärte er, er
sei doppelt davon gerührt, da er diese liebenswürdige Fürstin sehr
gut gekannt habe. Eine anwesende Dame, die ihn in Verlegenheit setzen
wollte, nahm darauf das Wort und sagte zu ihm: ‚Dann haben Sie auch
wohl unseren Herrn[S. 87] Jesus Christus gekannt?’ — ‚Ob ich ihn gekannt
habe!’ erwiderte er; ‚so gut, daß ich ihm sagte, als er jene Geschichte
im Tempel hatte: Lieber Freund, das kann nicht gut enden.’“
IV
Madame Campan, Kammerfrau der Königin Marie Antoinette,
berichtet in den „Anekdoten über die Regierung Ludwigs XV.“[98] von
einer Frau von Marchais:
„Sie behielt im höchsten Alter das schönste Haar. Angeblich hatte
ihr der berüchtigte Graf Saint-Germain, der am Hofe Ludwigs XV. als
hochberühmter Alchimist auftrat, ein Elixier gegeben, das die Haare
erhielt und sie vor dem Ergrauen bewahrte.“
V
Der weimarische Legationsrat Friedrich Johann Justin Bertuch
(1747-1822) erzählt in seiner Verdeutschung der Schrift: „Cagliostro in
Warschau“, S. 28 Anmerkung (Straßburg 1786) vom Grafen Saint-Germain:
Sein sogenannter Kammerdiener war ihm heimlich durchgegangen und
hatte ihm das Rezept zu seinem Wunderpulver gestohlen. Man bringt ihm
die Nachricht, daß der Kerl sich irgendwo etabliert habe und damit
kurieren wolle, und sagt ihm, es müsse ihm doch höchst unangenehm sein,
sein arcanum auf diese Art gemißbraucht zu sehen. — „Nichts
weniger!“ antwortet Saint-Germain darauf, „ich werde machen, daß es in
des Kerls Händen nicht wirkt!“
[S. 88]
VI
Graf Mirabeau (1749-1791), der berühmte französische
Schriftsteller und Politiker, schreibt in seinem Werke „De la monarchie
prussienne sous Frédéric le Grand“, Bd. 5, S. 69 (London 1788):
Saint-Germain, der von einem Grafen Lamberg in seinem „Tagebuch eines
Weltkindes“ angekündigt worden war[99], hatte Jahrtausende gelebt. Er
hatte einen Tee entdeckt, vor dem alle Krankheiten verschwanden. Er
machte im Handumdrehen faustgroße Diamanten. Er schloß sich eng an den
Prinzen Karl von Hessen an und vergaß, wie seine Vorgänger, nicht zu
sterben.

Elisabeth von Ansbach und Bayreuth (Lady Craven)
Stich von Friedr. Wilh. Nettling
[S. 89]
AUS DEN „DENKWÜRDIGKEITEN“ DER LADY
CRAVEN[100]
Ein anderer Wundermann war Saint-Germain, der am Hofe Ludwigs
XV. eine Rolle spielte und hier, wie auf seinen Reisen, von der
Leichtgläubigkeit der Menschen Vorteil zog. Der Graf von Lamberg[101]
war sein Johannes gewesen und hatte ihn feierlich verkündet. Dieser
Graf von Saint-Germain hatte mehrere tausend Jahre gelebt und mit
den ausgezeichnetsten historischen Personen aller Jahrhunderte
genauen Umgang gepflogen; denn er war im Besitz eines Tees, der alle
Krankheiten vertrieb und ein wahres Kraut gegen den Tod war. Nur zu
seiner Unterhaltung machte er Diamanten von unermeßlicher Größe. Als
ein Unsterblicher nahm er nie leibliche Nahrung zu sich. Wenn er bei
den Großen zur Tafel geladen worden, berührte er kein Brot, kein
Fleisch, setzte kein Glas an seine Lippen, sondern begnügte sich, der
Gesellschaft aus dem Schatz seiner tausendjährigen Erfahrung allerlei
lehrreiche Geschichten zu erzählen. Mit Cäsar hatte er sich oft über
die Mittel[S. 90] unterhalten, der in Verfall geratenen römischen Republik
durch eine monarchische Verfassung ein neues, frisches Leben zu geben.
Cäsar hatte darüber ganz eigene Ideen gehabt, die durch Unterhaltungen
mit den Druiden in Britannien[102] in ihm geweckt worden. Einer
von diesen Druiden sei sogar Privatsekretär bei Cäsar gewesen, und
Saint-Germain hätte von ihm über den alten Zustand von Britannien viel
Interessantes erfahren. Den Apostel Petrus hatte der Graf sehr genau
gekannt und ihm oft freundschaftlich geraten, seine Heftigkeit zu
mäßigen. Johannes sei ein schlanker, hübscher Mann gewesen, von sanftem
Charakter und etwas zum Mystizismus geneigt; er habe seine Schriften
dem Saint-Germain vor der Bekanntmachung mitgeteilt, der auch einige
dunkle Stellen korrigiert habe.
Solche und ähnliche Geschichten erzählte der Graf mit der größten
Ernsthaftigkeit, und gelehrte Männer hatten dabei nicht selten
Gelegenheit, seine historischen Kenntnisse zu bewundern.
Er gesellte sich zuletzt zu dem Prinzen Karl von Hessen, dem er den
Kopf verdrehte. Am Ende aber wurde dieser Unsterbliche des Lebens müde
und starb wie jeder andere gewöhnliche Mensch, und wie alle seine
Vorgänger auch getan haben.
[S. 91]
AUS DEN „ERINNERUNGEN“ DER MARQUISE VON
CRÉQUY[103]
Die Marquise von Urfé[104] trachtete immerfort nach dem Pulver zur
Verwandlung von Kupfer in Gold und arbeitete Tag und Nacht, um sich
ein Lebenselixier herzustellen. Sie verließ ihr Laboratorium kaum
noch und gewährte nur wenigen Zutritt dazu. Ihr Verkehr beschränkte
sich auf Adepten und Rosenkreuzer[105]; sie ging[S. 92] nur noch mit Öfen,
Retorten und Destillierkolben um. Vier Jahre lang arbeitete sie mit
dem angeblichen Grafen von Saint-Germain an Kabbala und dem Stein der
Weisen, was ihr 100000 Taler gekostet hat ...
Der Graf von Saint-Germain war ein Zeitgenosse Christi, des Kaisers
Tiberius und des Vierfürsten Herodes von Galiläa, von dem er eine dicke
braune Haarsträhne besaß. Er kannte Pontius Pilatus aus Jerusalem und
aus Grenoble, seinem späteren Exil, aber dieser Mann war ein solcher
Tropf, daß er vor Bekanntwerden der Evangelien nur eine undeutliche
Erinnerung an Christus hatte ...
Eines Tages besuchte ich Frau von Urfé in Gesellschaft der Gräfin von
Brionne. Obwohl die Alchimistin kaum noch Besuche annahm, wurde die
Toreinfahrt beim Anblick meiner Livree geöffnet, und wir gingen hinauf.
Man führte uns ohne Anmeldung zu ihr, wie es in diesem geheimnisvollen
Hause Brauch war, und wir fanden die Marquise — es war im Juli —
bei einem starken Kaminfeuer sitzend. Ihr gegenüber saß ein Mann, der
wie zu Olims Zeiten gekleidet war. Auf dem Kopfe trug er eine große
betreßte Kappe. Beim Erscheinen der Gräfin nahm er sie weder ab, noch
stand er auf. Sie war darob sehr betroffen.
„Ich habe gestern einen Brief von Herrn von Créquy-Canaples erhalten“,
sagte die Marquise von Urfé zu mir. „Er klagt, daß er in den Hundstagen
im Artois friert.“ Teilnehmend setzte sie hinzu: „Er ist offenbar nicht
mehr klar im Kopfe.“
„Bei Gott!“ rief der Herr laut und barsch, „ich weiß, woher das kommt!
Ich kannte den alten Kardinal de Créquy[106].[S. 93] Ich habe ihn während
der ersten Tagung des Konzils von Trient[107] oft gesehen. Er redete
da nichts als dummes Zeug. Ich kann Ihnen versichern, daß er völlig
überspannt war. Damals war er Bischof von Rennes.“
Ich erriet, daß ich Herrn von Saint-Germain vor mir hatte, dessen
Aufschneidereien und die Geschichten, die man davon erzählte, mich
stets geärgert hatten. Ich wandte mich mit offener, harmloser Miene an
ihn und sagte:
„Sie meinen wohl: Bischof von Nantes?“
„Nein, Madame, Bischof von Rennes, Rennes in der Bretagne. Ich weiß
sehr wohl, was ich sage und von wem ich rede!“
„Mein Herr,“ entgegnete ich etwas von oben herab und mit
herausfordernder Lustigkeit, „Sie wissen offenbar nicht, mit wem Sie
reden.“
„Madame!“ rief er mit Donnerstimme und warf mir wütende Blicke zu.
„Regen Sie sich doch nicht auf, mein Herr“, versetzte ich. „Und da Sie
so vieles wissen, sagen Sie mir doch gütigst, wie ich heiße.“
„Unter anderem“, rief er im Ton eines Hierophanten, „tragen Sie einen
Namen, dessen Wurzel kufisch, hebräisch und samaritanisch ist, einen
gesegneten, sieghaften Namen, aber blutbedeckt, seines Glanzes beraubt
und verderblich!“
„Ach!“ unterbrach ich ihn mit vorwurfsvoller, verletzter Miene, „ein
durchaus kufischer und vor allem verderblicher Name! Dem werde ich
gewiß nicht beistimmen!“
„Wie haben Sie nur erraten, daß sie Viktoria heißt?“ fragte ihn Frau
von Urfé mit zärtlich bewunderndem Blick.
[S. 94]
„Es wäre mir lieber gewesen,“ fuhr ich etwas frostig fort, „wenn
der Herr uns gesagt hätte, daß ich die Marquise von Créquy bin. Der
Kardinal von Créquy“, setzte ich hinzu, „ist nie etwas anderes gewesen
als Bischof von Nantes und Amiens, Erzbischof von Tyrus und Patriarch
von Alexandria. Auch das Beiwort alt trifft auf ihn nicht
zu, denn er starb mit 45 Jahren an der Pest, und was das dumme Zeug
anlangt, das er bei der ersten Tagung des Konzils von Trient im Jahre
1545 geredet haben soll, so darf man ihm keinen allzu schweren Vorwurf
daraus machen, denn er war damals erst fünf bis sechs Jahre alt ...“
„Madame, Sie beleidigen mich!“
„Nein, mein Herr, ich gebe Ihnen bloß eine Antwort, und ich beleidige
Sie so wenig damit wie die Wahrheit.“
„Ich wette um 10000 Louisdors.“
„Mein Herr, ich lebe vom Ertrag meiner Landgüter und habe nicht 10000
Louisdors zu verwetten.“
„Dann wette ich um 100 Louisdors.“
„Lassen Sie es dabei bewenden“, entgegnete ich ihm in gebieterischem
Tone, so daß er seine Schwindeleien und Grobheiten herunterschlucken
mußte. „Nur Engländer oder Lakaien können eine Dame mit ‚Ich wette! Ich
wette!’ herausfordern. Und auch nur, wenn sie keine triftigen Gründe
haben.“
Frau von Urfé, die ich dabei anblickte, schien mir lächerlich verwirrt.
Sie bat mich, weder zu Hause noch sonstwo darüber zu reden; denn sie
fürchtete sich vor dem Kardinal Fleury[108], der kein Freund der
Schwindler war, und das versprach ich ihr gern. Die Folge war, daß[S. 95] die
Tür ihres Laboratoriums mir nur noch halb geöffnet wurde, und auch nur,
wenn sie allein war.
Der Baron von Breteuil hatte als Minister des Königlichen Hauses[109]
in den Archiven ausfindig gemacht, daß der angebliche Graf von
Saint-Germain der Sohn eines jüdischen Arztes aus Straßburg war und
eigentlich Daniel Wolf hieß. Er war 1704 geboren, damals also 68 Jahre
alt, während er sich als Mann von 1814 Jahren ausgab — dank einem
Lebenselixier, dessen Rezept er angeblich einer ihm sehr gewogenen
Königin von Judäa verdankte. Mit 68 Jahren sah er aus wie ein Mann in
diesem Alter, der sich kräftiger Gesundheit erfreut. Er hielt sich
gerade und hatte einen raschen Gang, sprach bestimmt und gut, wenn auch
mit leichtem Elsässer Akzent. Sein Blick war fest, ja frech, seine Haut
weiß und glänzend, sein weißes Haar voll, sein Bart üppig, desgleichen
die Augenbrauen. Frau von Urfé pflegte deshalb zu sagen, er gleiche
Gottvater[110] ...
Eine andere kräftige Abfuhr, die viel von sich reden machte und recht
amüsant war, erfuhr Saint-Germain durch den Grafen von Chastellux in
einer Gesellschaft bei Herrn Le Normand d’Étioles[111]. Saint-Germain
hatte sich nach den Tischgästen erkundigt und sich besonders über Herrn
von Chastellux Rat geholt, Bücher gelesen und sich schnell so auf
sein Thema vorbereitet. Als der Graf von Chastellux gemeldet wurde,
eilte er auf ihn zu und fragte ihn, ob er nicht ein Nachkomme des
Marschalls[S. 96] von Chastellux[112] sei, der im 14. Jahrhundert Statthalter
der Normandie war. Herr von Chastellux entgegnete, er glaubte sein
Nachkomme im siebenten Grade zu sein.
„Ihr erlauchter Ahn war ein Held,“ versetzte Saint-Germain. „Der
König[113] bezahlte für ihn im Jahre 1418 2500 Livres Lösegeld. Ich
werde mich zeitlebens erinnern, daß ich ihn als Schirmherrn des
Domkapitels und Ehrendomherrn der Kathedrale von Auxerre im Chor sitzen
sah. Zu dem Zweck trug er ein Chorhemd über seinem Harnisch, einen
Chorherrenmantel darüber und den Marschallstab von Frankreich in der
Hand. Seine ehrwürdige Mutter, Alix von Bourbon-Montpeyroux[114], war
die leibliche Nichte seines Vaters. Ja, Herr Graf, dieser ehrwürdige
Marschall, Ihr Vorfahr, war mein Busenfreund, und seinen ältesten Sohn
liebte ich wie meinen Augapfel. Sie wissen? Sein ältester Sohn, Johann
III. von Beauvoir, Herr von Chastellux und Vicomte von Avallon, der
die Tochter des Herrn von Aulnery geheiratet hatte. Ich sehe sie vor
mir und versichere Ihnen, sie war im Jahre 1493 eine reizende Frau!
Der junge Mann hatte nur einen Fehler, er war verschwenderisch wie ein
Landsknecht, und wenn er in Ihren Wäldern von Coulanges und Baserne
die hohen Bäume abholzen ließ, war sein Vater wütend auf ihn. Ja, der
alte Marschall war knauserig! Ich entsinne mich: eines Tages zu Ostern
wollte er seine Familie und seine Leute weiter fasten lassen, weil in
seiner Küche eine große Menge Fische übrig geblieben war, die er zur
Fastenwoche hatte fischen lassen.“
[S. 97]
„Verzeihen Sie, Sie verwechseln den Großvater mit dem Enkel“,
entgegnete Graf Chastellux mit vornehmer Höflichkeit und größter
Kaltblütigkeit. „Der Marschall war von prachtvoller Freigebigkeit.
Philipp II. von Chastellux, sein Enkel, galt für — sparsam.“
Nun gab es einen chronologischen Disput und beiderseitige Zitate; der
Abenteurer brauste auf, aber die Diskussion fiel durchaus zugunsten
des Grafen von Chastellux und der Freigebigkeit seines Vorfahren, des
Marschalls, aus. Man ließ zwei alte Bücher aus der Bibliothek holen und
brachte zwei alte Spottverse von Alain Chartier und Saint-Gelais[115],
die 92 Jahre auseinanderlagen, zum Beweise bei. Somit war erwiesen,
daß der Graf von Saint-Germain nur ein ungeschickter und schlecht
unterrichteter Schwindler war.
Eine andere schöne Geschichte ist die des Prinzen von Craon, den
Saint-Germain nicht von Angesicht kannte und der eines Tages im
Hotel Uzès in eine große Gesellschaft hineinplatzte, wo besagter
Saint-Germain seine Flausen gerade zum besten gab und man ihm mit
offenem Munde zuhörte. Es war von Nicolas Flamel[116] und seiner Frau
Perronelle, ihrem Lebenselixier und ihrem sympathischen Pulver die Rede.
„Mein Gott!“ rief der Prinz von Craon, „wissen Sie denn nicht, was eben
bei der Gräfin von Sennecterre geschehen ist?“
„Was denn? Was denn?“ fragte Saint-Germain, der ihr für bare 200
Louisdors ein Fläschchen seines Elixiers „überlassen“ hatte.
[S. 98]
„Denken Sie nur, mein Herr,“ entgegnete jener, „der Herr Graf
Saint-Germain, ein guter Bekannter der Gräfin Sennecterre, hat ihr
aus Großmut ein Fläschchen ätherischer Flüssigkeit geschenkt, das sie
verjüngen sollte, wenn sie einen Tropfen mit 50 Jahren, zwei nach
vollendeten 60 Jahren, vier mit 90 Jahren und so fort nahm. Sie wollte
ihrem Gatten, der erst 71 Jahre alt ist, die Sache verheimlichen.
Offenbar findet sie ihn noch zu jung.“
„Keine spitzen Bemerkungen! Bitte zur Sache!“ rief die Herzogin von
Uzès, die vor Ungeduld und Besorgnis umkam, da sie dasselbe Mittel
eingenommen hatte.
„Frau von Sennecterre hatte ihr kostbares Fläschchen einem Fräulein
Jacoby anvertraut, einer alten, biederen und sorgsamen Person. Gestern
ging Frau von Sennecterre auf einen Ball, und als sie um 5 Uhr morgens
zurückkommt — wen findet sie da, meine Damen? Ein kleines Mädchen
von sieben bis acht Jahren, das auf allen Möbeln herumkletterte und
wie ein Zicklein durch die Zimmer hüpfte. ‚Aber was ist denn das
für ein dreistes kleines Ding, das da herumspringt? Wo sind meine
Kammerfrauen?’ — ‚Wie, Frau Gräfin,’ erwiderte das Mädchen mit heller,
kecker, kichernder Stimme, ‚Sie erkennen Fräulein Jacoby nicht, die Sie
seit Ihrem vierten Jahre erzogen hat? Das ist doch arg!’ — ‚Aber wie
ist denn das möglich?’ — ‚Ach Gott, ich hatte Leibweh und wollte von
dem Wasser des Herrn von Saint-Germain trinken. Es hat mich so prächtig
kuriert! Und doch hab’ ich nur ein Schlückchen getrunken.’ — ‚Das
war wohl das mindeste, daß Sie mir ein paar Tropfen in dem Fläschchen
übrig ließen’, sagte Frau von Sennecterre mit kaum verhehltem Ärger.
‚Schicken Sie mir wenigstens die Julie zum Auskleiden. Wo ist denn
Julie?’ — ‚Da, Frau Gräfin’, sagte ihre alte Erzieherin und lachte
wie närrisch. Damit[S. 99] wies sie auf ein kleines Kind von höchstens sechs
bis acht Wochen, das auf dem Teppich saß und am Daumen lutschte. ‚Das
ist Julie. Sie hat alles ausgetrunken, Frau Gräfin, und nun ist sie so
verjüngt, daß man sie kaum mehr sieht.’“
„Ich versichere Ihnen,“ fuhr der Prinz von Craon mit unerschütterlichem
Ernst fort, „man muß bei der Verabreichung des Lebenselixiers sehr
vorsichtig sein. Herr von Saint-Germain bringt uns in Gefahr, wieder
zu Kindern zu werden, und hat man Prozesse zu führen oder Töchter zu
verheiraten, so ist es nicht immer angebracht, zum Sabberlatz und
Gängelband zurückzukehren. Also man kann nicht vorsichtig genug sein.“
Herr von Saint-Germain hatte sich aus dem Staube gemacht, sobald er
merkte, daß der Prinz von Craon ihn zum besten hielt. Seitdem machte
sich jedermann über Saint-Germain lustig.
[S. 100]
AUS DEN
„DENKWÜRDIGKEITEN ZUR GESCHICHTE DES GRAFEN
CAGLIOSTRO“[117]
Cagliostros Besuch bei
Saint-Germain
Eine Satire
Sie (das Ehepaar Cagliostro) gehen nach Wien. Im Adel, in der
Geistlichkeit und im Kaufmannsstand herrschte solche Unzufriedenheit,
daß sie gleich weiterfahren und nach Holstein reisen. Dort hatte der
berüchtigte Graf Saint-Germain sein Tabernakel errichtet[118]. Dieser
große Mann genoß seit mehreren Jahren die Wonnen der Unsterblichkeit
und bildete friedlich das Glück dreier Personen, die ihn mit Champagner
und Ungarwein tränkten — zum Dank für den Goldstrom, den er in ihr
Land geleitet hatte.
[S. 101]
Graf Cagliostro bat ihn um eine Geheimaudienz, um sich vor dem Gott der
Gläubigen niederzuwerfen. Saint-Germain gab ihm 2 Uhr nachts an.
Als der Augenblick nahte, legten er und seine Frau eine weiße Tunika
an, die ein aurorafarbener Gürtel zusammenhielt und stellten sich so
im Schlosse ein. Die Zugbrücke senkte sich, ein sieben Fuß großer
Mann in langem grauen Gewand führt sie in einen schlecht erleuchteten
Saal. Plötzlich öffnet sich eine große Flügeltür, und ein von tausend
Kerzen strahlender Tempel blendet ihre Blicke. Auf einem Altar saß der
Graf; zu seinen Füßen hielten zwei Ministranten goldene Schalen, aus
denen süße, sanfte Wohlgerüche emporquollen. Auf der Brust trug der
Gott eine Diamantplatte von fast unerträglichem Glanze. Eine große,
weiße, durchsichtige Gestalt hielt in ihren Händen eine Schale, auf der
„Elixier der Unsterblichkeit“ stand. Etwas weiter erblickte man einen
riesigen Spiegel, vor dem eine majestätische Gestalt auf und ab ging.
Über dem Spiegel stand geschrieben: „Zuflucht der irrenden Seelen.“
Düsteres Schweigen herrschte in dem heiligen Bezirk. Eine namenlose
Stimme rief: „Wer seid Ihr? Woher kommt Ihr? Was wollt Ihr?“
Da warf sich der Graf Cagliostro nebst der Marquise zu Boden, und nach
ziemlich langem Schweigen stammelte er:
„Ich komme, den Gott der Gläubigen, den Sohn der Natur, den
Vater der Wahrheit anzurufen. Ich komme, ihn um eins der
vierzehntausendsiebenhundert Geheimnisse zu bitten, die er im Busen
trägt. Ich komme, um sein Knecht, sein Apostel, sein Märtyrer zu
werden.“
Der Gott gab keine Antwort. Doch nach ziemlich langem Schweigen erklang
eine Stimme: „Was will Deine Gefährtin?“
[S. 102]
Sie antwortete: „Gehorchen und dienen.“
Da folgte Finsternis auf die Nacht, Lärm auf die Stille, Furcht auf
Vertrauen, Verwirrung auf Hoffnung, und eine schrille Stimme sagte
drohend: „Wehe dem, der die Prüfungen nicht erträgt!“
Der Graf und die Marquise wurden getrennt. Sie sah sich in ein Gemach
eingeschlossen mit einem bleichen, hageren, Fratzen schneidenden
Manne. Er erzählt ihr von seinem Glück auf Erden, seinen Schätzen,
verliest ihr Briefe der größten Herrscher, und in plötzlicher Wendung
fordert er ihr schließlich die Diamanten ab, die ihre Stirn schmücken.
Entzückt, sie so leichten Kaufes los zu sein, entledigt sie sich ihrer
schleunigst.
Auf diesen ersten Prüfer folgte ein Mann in sehr unanständiger
Kleidung. „Bedenken Sie, Frau,“ sagte er, „daß Sie Ihre Blicke stets
auf mein Antlitz richten müssen.“ Der Mann war sehr schön und hatte
die ausdrucksvollsten Augen. Alles war gefährlich: ihn anzuhören, ihn
anzusehen oder die Blicke zu senken.
Nach dieser peinlichen Viertelstunde kam eine Alte und sprach: „Ich
allein kann Ihre Tugend erkennen. Die Prüfung, die Sie bestanden haben,
besteht in der Feststellung, wie weit Ihre Sinne den Reizen kecker
Jugend widerstehen können.“
„Tun Sie, was Ihres Amtes ist“, sagte die Marquise.
Die Alte tat es und übergab ihr dann ein Pergament; es war ein Patent
des Widerstandes. Dann führte sie sie in einen großen Keller. Dort sah
sie angekettete Männer, Frauen, die bis aufs Blut gepeitscht wurden,
Scharfrichter, die Köpfe abschlugen, Menschen, die aus Giftbechern den
Tod trinken mußten, glühende Eisen, Galgen mit Schandaufschriften.
„Das“, sagte die Alte, „sind die Märtyrer unserer Kunst. So lohnen die
Menschen, deren[S. 103] Glück wir uns weihen, unsere Gaben und unseren Eifer.“
Die Marquise blickte ruhigen Auges die traurigen Opfer der angeblichen
menschlichen Gerechtigkeit an und verriet nicht die geringste Bewegung.
Die Prüfungen des Grafen waren anderer Art. Man versuchte ihn durch
Lobsprüche zu ködern, zeigte ihm sein Weib in den Armen eines
liebenswürdigen Mannes, um zu sehen, ob er aus Eifersucht in die
lächerlichen Wallungen verfallen werde, die das Hirn der Ehemänner
umnebeln. Schließlich las man ihm einen Abschnitt aus dem berühmten
Buche der Zukunft vor, das die ihm bevorstehenden Verfolgungen enthielt.
Nach dieser Zeremonie wurden sie in den Tempel zurückgeführt. Dort
erklärte man ihnen, sie sollten zu den göttlichen Mysterien Zutritt
erhalten, sobald die Wölbung von ihren Gelübden widerhallte. Ein Mann
in langem, unter dem Arm gerafften Mantel ergriff das Wort und hielt
diese Rede, die jeder Adept behalten muß, ohne sie niederschreiben zu
dürfen:
„Wisset, das große Geheimnis unserer Kunst ist, die Menschen zu
regieren, und das einzige Mittel ist, nie die Wahrheit zu sagen.
Richtet euch nie nach den Regeln des gesunden Verstandes; sprecht
der Vernunft Hohn und bringt tapfer den größten Blödsinn zutage.
Wenn ihr fühlt, daß diese großen Grundsätze nachlassen, so zieht
euch zurück, geht in euch und durchwandert die Welt. Da werdet ihr
sehen, daß der größte Blödsinn Anbetung findet. Die Torheiten kehren
unter verschiedenen Namen wieder, aber sie sind ewig. Das Grab des
heiligen Medardus[119] hat den Schatten des heiligen Petrus[S. 104] ersetzt,
Mesmers[120] Zauberkasten den Teich des nazarenischen Philosophen[121].
Gedenkt, daß die erste Triebfeder der Natur, der Staatskunst, der
Gesellschaft die Fortzeugung ist, daß das Hirngespinst der Sterblichen
die Unsterblichkeit und die Kenntnis der Zukunft ist, selbst wenn sie
die Gegenwart nicht kennen, daß sie Geist sein wollen, wo doch sie
selbst und alles, was sie umgibt, Stoff ist.“
Nach dieser Ansprache verneigte sich der Redner vor dem Gott der
Gläubigen und verschwand. Dann traten zwei junge Mädchen vor und
entkleideten den Grafen, während drei junge Männer bei der Marquise
die gleiche Zeremonie erfüllten. Als sie im Naturzustand waren, sprach
die schon vernommene Stimme: „Nun wird dem einen die kostbare Gabe der
Kraft und der anderen die noch köstlichere der Schönheit verliehen.“
Im selben Augenblick packte der sieben Fuß große Mann die Marquise an
einem Beine, gebot ihr, ihre Hand auf seine Nase zu legen, und trug
sie vor den Gott der Gläubigen. Der bedeckte ihren schönen Leib mit
Wohlgerüchen und salbte ihr mit rosenfarbenem Öl die Partie zwischen
den Lippen, die Rosenknospen ihres Busens, den Nabel und die Schenkel.
Dann flüsterte er ihr etwas ins Ohr, und der sieben Fuß große Mann trug
sie in eine anstoßende Kapelle.
„Hier werdet Ihr die Weihe vollenden,“ sprach er, „und unsere heiligen
Mysterien mit dem großen Werk der Natur krönen. Indes stehen Euch
die Mittel frei, und sofern unser beider Wesen sich verschmelzen und
Zuflucht in dieser Kapelle finden kann, braucht Ihr Euch nicht den
gewöhnlichen Formen zu unterwerfen.“
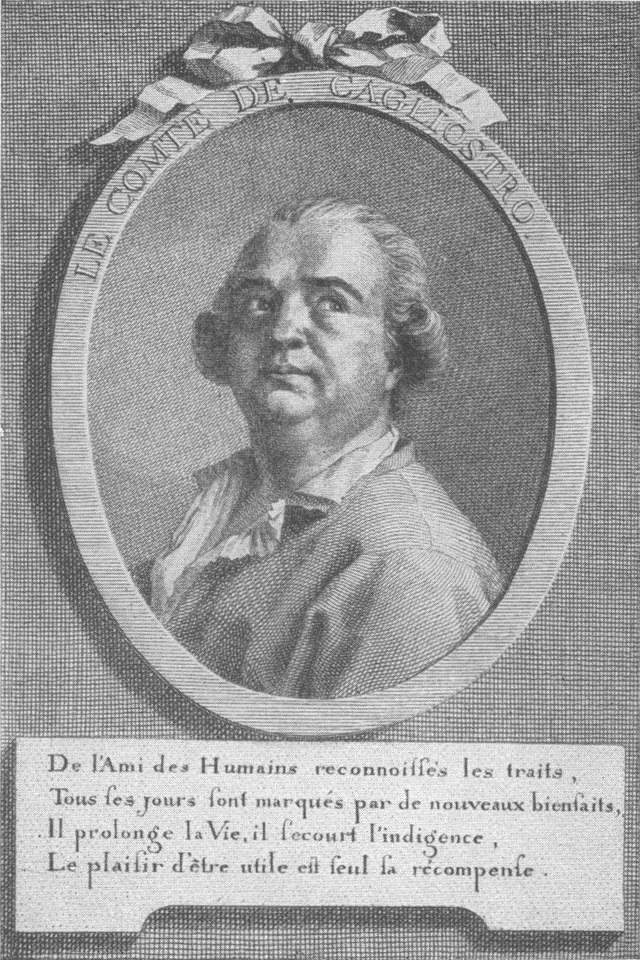
De l’Ami des Humains reconnoisses les traits,
Tous ses jours sont marqués de nouveaux bienfaits,
Il prolonge la Vie, il secourt l’indigence,
Le plaisir d’être utile est seul la récompense.
Cagliostro
Stich von Charles Guérin
[S. 105]
„Als ich den Fuß in diesen hehren Bezirk setzte,“ entgegnete die
Marquise, „habe ich jeglichen Willen abgelegt. Wenn Ihr aber wollt, daß
die Begierde dem Opfer vorangeht und es herbeiführt, so laßt mich ein
Weilchen zu Atem kommen und sagt mir, unter wessen Messer ich fallen
soll?“
„Gern,“ sprach er, „obwohl dies eigentlich nicht der Augenblick zu
langem Gerede ist. Von zartester Jugend auf zu Großem berufen, habe
ich mich bemüht, zu erkennen, worin der wahre Ruhm besteht. Die
Staatskunst dünkte mich nur eine Kunst des Betruges, die Kriegskunst
nur die Kunst des Mordens, die Philosophie nur ein dünkelhafter Wahn,
Unsinn zu reden, die Naturwissenschaft nur ein schöner Traum über
die Natur und ein fortwährendes Irren des Menschen in unbekannten
Ländern, die Theologie nur eine Kenntnis des Elends, zu dem der
menschliche Hochmut führt, die Geschichte nur ein trauriges, eintöniges
Studium von Verirrungen und Niedertrachten. Daraus schloß ich, daß
der Staatsmann nur ein geschickter Lügner ist, der Kriegsheld ein
erhabener Narr, der Philosoph ein Sonderling, der Naturforscher ein
beklagenswerter Blinder, der Theologe ein Lehrer des Fanatismus und der
Geschichtschreiber ein Wortkrämer. Ich hörte vom Gott dieses Tempels
sprechen; ich schüttete in seinen Busen meinen Kummer, meine Zweifel,
meine Wünsche aus. Er bemächtigte sich meiner Seele, bildete sie und
ließ mir alle Dinge in neuem Lichte erscheinen. Fortan begann ich
in der Zukunft zu lesen, und diese so beschränkte, so enge, so öde
Welt weitete sich. Ich lebte nicht nur mit den Gegenwärtigen, sondern
auch mit den Toten. Da ich jung und leidenschaftlich war, brachte er
mich mit den schönsten Frauen des Altertums zusammen. Ich lebte mit
Aspasia, mit[S. 106] Leontion[122], mit Sappho, Faustina[123], Semiramis und
Irene[124], von denen man so viel gesprochen hat. Ich fand es sehr
hold, alles zu wissen, ohne etwas zu lernen, über die Schätze der
Welt zu verfügen, ohne die Könige darum anzubetteln, den Elementen
zu gebieten, statt den Menschen. Der Himmel schuf mich freigebig,
jetzt kann ich meine Neigung befriedigen: alles, was mich umgibt, ist
reich. Dieser Augenblick beweist das eben Gesagte. Ihr seid zweifellos
eines der schönsten Weiber auf Erden, ich halte Euch in meinen Armen,
und wenn Ihr darauf achtgeben wollt, werdet Ihr merken, daß die
Wollust, auf die bei gewöhnlichen Sterblichen Ermattung folgt, ebenso
unsterblich ist wie der Gott, der mir diese Gabe verlieh.“
Hier unterbrach sich der Redner, in der Annahme, auch einmal etwas
beweisen zu müssen und den Glauben der Eingeweihten nicht auf eine zu
harte Probe zu stellen. Er bewies also die Macht des ihn beseelenden
Gottes mit unwiderstehlicher Tatkraft.
Mittlerweile wurde der Graf Cagliostro in ein anderes Mysterium
eingeweiht. Man gab ihm zu bedenken, daß die angenehmsten Dinge keine
Eintönigkeit ertrügen, daß das gebildeteste Volk der Welt die Griechen,
der weiseste Sterbliche Sokrates gewesen sei, daß der liebenswürdigste
Mann Alkibiades geheißen habe, daß das frömmste Volk die Italiener
seien und daß er in seiner bevorstehenden Laufbahn jene Gefügigkeit
haben müsse, die sich allen Gelüsten hingibt. Es war Antinous, der so
den Demosthenes spielte. Der Graf unterwarf sich und wurde wie Cäsar
behandelt.
[S. 107]
Nachdem man sich wieder angekleidet, beschloß ein prächtiges Mahl die
Zeremonie. Im Laufe des Festes erfuhren sie, daß das Lebenselixier nur
aus Tokaier bestand, der je nach Bedarf rot oder grün gefärbt sei, daß
sie Leute von Geist fliehen, verabscheuen und verleumden, Dummköpfe
umschmeicheln, lieben und verblenden müßten, daß sie geheimnisvoll
verbreiten sollten, Saint-Germain sei 500 Jahre alt, daß sie Gold und
Tee machen und vor allem die Leute anführen sollten.
Mit diesen Weisungen reisten die etwas ausgerenkte Marquise und der
etwas beschädigte Graf nach Petersburg, wo sie sich als Heilkünstler
ausgaben.
Charakteristik des Grafen
Saint-Germain[125]
Der vor einigen Jahren verstorbene und schon vergessene Graf
Saint-Germain war ein ernsthafter Narr. Er besaß wenig Geist, einige
chemische Kenntnisse, war für einen Schwindler nicht unverschämt
genug, für einen Fanatiker nicht beredt genug und besaß nicht die
Verführungskunst, um Halbwissende zu bestechen. In Chambéry bot er dem
Marschall von Bellegarde seine Chemie an. Sie begannen zu schmelzen,
doch der Schmelztiegel lieferte einen Stoff, der zwar Farbe und
Gewicht, nicht aber die Dehnbarkeit des Goldes besaß. Diese Versuche
fanden auf einem Landgute statt, wo der Graf binnen sieben Monaten
dreimal Vater wurde. Das Geld schmolz zusammen, er hatte überall
Schulden, und man riet ihm, abzureisen. In Paris das gleiche Spiel. Er
hatte sich mit einem berühmten Gauner zusammengetan, einem früheren
Spion des Marschalls Belle-Isle[126], der sich seitdem nach[S. 108] Bercy[127]
zurückgezogen hatte, wo er das Ludwigskreuz auf einem zerlumpten Anzug
und das Henkermal auf dem Rücken trug. Sie machten zusammen Vitriolöl.
Das war der Vorwand zum Goldmachen. Sie verzankten und schlugen sich.
Der Graf zog den kürzeren und verließ eine Stadt, die ihre Arme allen
Betrügern öffnet.
Kritik der „Charakteristik“ von
Meister[128]
November 1785.
Diese Schilderung ist in vieler Hinsicht falsch. Der Graf von
Saint-Germain machte auf alle, die ihn kennen lernten, den Eindruck
eines sehr geistvollen Mannes. Er besaß jene natürliche Beredtsamkeit,
die mehr als alles andere besticht. Er besaß so große Kenntnisse in
der Chemie und Geschichte wie wenige. Er besaß die Gabe, das Gespräch
auf die bedeutsamsten Ereignisse der alten Geschichte zu bringen und
von ihnen zu erzählen wie von einer Tagesneuigkeit, mit den gleichen
Einzelheiten, in der gleichen fesselnden Art und mit der gleichen
Lebhaftigkeit.
Saint-Germain und Cagliostro[129]
„Ungeachtet aller seiner Talente und Geistesgaben verließ diesen
Wundermann (Saint-Germain) sein Hang[S. 109] zum Wunderbaren nie, und er
wußte davon gar klüglich Nutzen zu ziehen; denn seine sogenannten
arcana verkaufte er sehr teuer. Übrigens wurde er Stifter
geheimer Gesellschaften und initiierte mit vielem Gepränge und Aufwand.
Selbst den bekannten Abenteurer Cagliostro soll er in einen solchen
mystischen Isisorden aufgenommen haben, und man muß gestehen, daß (die
Gelehrsamkeit ausgenommen) Saint-Germain an ihm ein seinen geheimen
Absichten vollkommen entsprechendes Mitglied fand.“
[S. 110]
GRAF SAINT-GERMAIN[130]
Hat der Graf Saint-Germain, der so kräftig beschützt worden ist, etwas
anderes getan, als Guillaume Postel[131] nachzuahmen, der den Sparren
hatte, sich für älter auszugeben, als er war? Um seinen Bekannten etwas
vorzumachen, schminkte er sich, färbte sich die Haare schwarz und
nannte sich demgemäß Postellus restitutus. Wie seine Nachfolger
versicherte Postel, der Engel Resiel hätte ihm göttliche Geheimnisse
offenbart. Was sagen heute die zurückhaltendsten Biographen von ihm?
„Er hätte den Wissenschaften zur Zierde gereicht, hätte er nicht
infolge seiner Vertiefung in die Rabbiner und der Beobachtung der
Gestirne den Kopf verloren“ ...
Nachdem Saint-Germain in dreißig Städten Ärgernis erregt und
zweihundert Neulinge in der Chemie angeführt hat, trifft er einen
freigebigen und feinfühligen Großen[132] und nimmt sich vor, seine
Gaukeleien mit ihm zu beschließen. Er sagt folgendes zu ihm: „Seit
fast 80 Jahren[S. 111] (er war damals 77 Jahre alt) suche ich einen Menschen,
einen Menschen, den ich zum auserwählten Gefäß machen kann, das den
himmlischen Tau aufnimmt, den ich im Gelobten Lande gesammelt habe.
Er darf nichts wissen und muß zu allem befähigt sein. An Stelle der
alten Kenntnisse muß ich seinen Geist mit neuem Wissen erfüllen. Licht
und Finsternis, Reines und Unreines, Gott und Mensch können nicht
beieinander wohnen. Ich selbst kenne Sie wenig, aber ich weiß viel
von Ihnen durch die, welche Sie nicht kennen, aber eines Tages kennen
werden. In Ihre reine Seele hat der Himmel die Keime aller guten
Eigenschaften gelegt; lassen Sie mich sie entwickeln! Werden Sie das
himmlische Behältnis für die überirdischen Wahrheiten. Sie sind zum
Herrscher über große Reiche bestimmt oder werden dazu berufen werden.
Schenken Sie Ihre Fürsorge und Ihren Geist den Menschen, aber widmen
Sie Ihre Zeit und Ihr Forschen dem höchsten Meister. Im Alter von 27
Jahren werden Sie binnen wenigen Monaten 90 Jahre alt sein. Ich werde
für Sie sorgen, wirken, schaffen. Als Wunder für die übrige Menschheit
werden Sie doch in Gottes Augen nichts tun, wenn Sie sich begnügen,
das Licht eines Planeten zu sein. Als Träger der erstaunlichsten
Geheimnisse können Sie dem Lauf der Gestirne Halt gebieten und in Ihren
Händen das Schicksal von großen Reichen halten. Aber das Wissen ist
nur dann ein Schatz, wenn der, welcher es lehrt, auch die Anwendung
überwacht.“
Erstaunt, ein Genie zu sein, entzückt, ein Wunderwesen zu werden,
außer sich bei dem Gedanken, daß er Europa regieren wird, schlägt der
Große die Augen nieder, wirft sich zu Boden und steht wieder auf,
um ein des Wundermannes würdiges Schloß zu erbauen. Als dieser gut
untergebracht war, begannen die Zurüstungen, und[S. 112] der große Tag wurde
festgesetzt. Welche Geheimnisse sah man nun erblühen? Die Kunst, dem
Kupfer mehr Glanz und Biegsamkeit zu geben, die Kunst, Edelsteine
von Flecken zu befreien, zwei Wunder, die drei deutsche Chemiker in
ihren gelehrten Vorträgen gelehrt haben. Was sah man weiter? Ein
Purgiermittel, das jeder Apotheker herstellt und dem Volke verkauft,
eine Menge von Flüssigkeiten, deren geheimes Herstellungsverfahren
schon mehrere Fabrikanten in Frankreich und Italien gekauft hatten.
Im übrigen bewegten sich die Gestirne wie vorher, Europa erfuhr
keinerlei Umwälzung, und selbst das kleinste Ländchen lehnte die ihm
zugedachte politische Medizin hartnäckig ab. Man lebte jahrelang von
Versprechungen; nichts ereignete sich; man ertappte den Gott sogar
bei sehr menschlichen Verrichtungen. Nie wurden die Augen aufgetan;
und noch beim Begräbnis des Propheten glaubte man an seine wunderbare
Himmelfahrt.
Charakteristik des Grafen Saint-Germain
(von dem anonymen Übersetzer)
Saint-Germain, Welldone, oder unter was für mehr Namen er
hier und dort gewallet haben mag, war unleugbar ein Scharlatan,
nachdem er lange genug Aventurier gewesen war. Von einem
Manne, der sich so weit und breit in der Welt herumgetrieben hat, ist
es höchstwahrscheinlich, daß er auch mit einer oder mehr geheimen
Gesellschaften in Bündnis getreten sei. Aber Schwärmer war er gewiß
nicht, am wenigsten ein religiöser. Eben den hellen Kopf, den man
in des Grafen von Lambergs „Mondain“[133] an Saint-Germain
wahrnimmt, behielt er[S. 113] bis an sein Ende. Als ein Mensch, der mit
aufmerksamen Augen und Ohren die Welt durchreiset war, ein gutes
Gedächtnis und die Gabe eines interessanten Vortrags hatte, war er
ein guter Gesellschafter und unterhaltender Tischgenosse, dessen
Anekdotenvorrat unerschöpflich schien. Und Tischgenossen von guter
Unterhaltung (ich rede ganz ernsthaft) sind seltener und gesuchter als
die von bloß gutem Appetit. Aber Saint-Germain hatte auf seinen Reisen
nicht bloß nach Anekdoten gehascht; er hatte außer einigen andern,
vielleicht zweideutigeren, auch wirklich nützliche Arcana
gesammelt, die ihn einem wohltätigen Patrioten eines Landes, das rohe
Produkte ausführt und solche verarbeitet von Fremden wiederkauft, weil
es ihm noch an Manufakturen und Fabriken fehlt, sehr willkommen machen
mußten, und die ihm auch wirklich an manchem Orte eine beneidete,
gute Aufnahme erwarben. Freilich mochte er oft mehr von sich erwarten
lassen, als er zu leisten imstande war. Aber kann ein Mann, der gut
gekleidet, mit einigen kostbaren Nippes in Gesellschaften
erscheint, dafür, wenn man ihn für reicher hält, als er wirklich ist?
Oder ist es meine Pflicht, jedermann, von dem ich nichts borgen will,
den genauen Zustand meines Vermögens anzugeben? Was hat man nicht alles
von Wunderessenzen, die Menschen zu verjüngen, von Universalarzneien
gegen alle Krankheiten und Tod, ja von dem mehr als Methusalemischen
Alter dieses sonderbaren Abenteurers, das er sich beilegen sollte,
erzählt und fast allgemein geglaubt! Aber ist ein Märchen deswegen
auch schon wahr, weil man es allgemein erzählt und fast durchgängig
glaubt? Daß mich der Himmel davor behüte, der Verteidiger oder
Lobredner irgendeines Scharlatans zu werden! Ich gestehe vielmehr
offenherzig, daß ich jeden Geheimniskrämer wegen verbotener Absicht[S. 114]
auf anderer Beutel in Verdacht habe. Aber es tut mir weh, wenn
ich sehe, daß man einen Namen wie Saint-Germain, ohne irgendeinen
ersichtlichen Zusammenhang mit der Materie, mit Gewalt herbeizieht
(denn von Scharlatans ist ja nicht die Rede, sondern von einer für die
bürgerliche Gesellschaft höchst schädlichen, theosophisch-magischen und
nach Universalmonarchie strebenden Sekte[134]), um durch den Beisatz:
„der so kräftig beschützt worden“, ein falsches Licht auf eine
Person zu werfen, die, wenn sie auch aller öffentlichen, der Ordnung
der Staaten gemäß, Respekt fordernden Würden entkleidet wäre, durch
ihre höchst edle Art zu denken und zu handeln die Verehrung und selbst
Liebe aller rechtschaffenen Menschen verdient.
Es tut mir weh, zu sehen, daß sich ein Mann es anmaßet, die Menschheit
gegen eine geheime Sekte, die er weder zu nennen noch deutlich
zu bezeichnen wagt, zu warnen, der sich solche mutwillige (wer
einigermaßen starke Ausdrücke liebte, würde sagen: pasquillenhafte)
Ausfälle auf wirklich edle Menschen erlaubt und also dadurch, daß
er mit solchen Stellen, wie diese und einige andere in seinem
Buche, tiefen Unwillen erweckt, seine Absicht verdächtig, seine mit
unterlaufenden Wahrheiten zweifelhaft macht und sonach das, was er
sonst Gutes gewirkt haben könnte, vereitelt.
Kritik
der „Charakteristik“[135]
Rezensent stößt hier auf eine Note, wo der Übersetzer dem Verfasser
wirklich unrecht tut. Der Verfasser vergleicht[S. 115] nämlich den
berüchtigten Saint-Germain mit einem älteren Narren und bedient sich
bei dieser Gelegenheit der Worte: „Saint-Germain, der so kräftig
beschützt worden ist.“ Dies bringt den Übersetzer in eine Wärme,
welche sich die meisten Leser schwerlich werden erklären können. Dabei
verteidigt er den Saint-Germain, nennt ihn einen hellen Kopf und möchte
die Leser gern überreden, daß er gar der Mann nicht gewesen sei, den
man in eine solche Parallele stellen sollte. Rezensent, der Gelegenheit
gehabt hat, von dem Manne, dessen sich hier der Übersetzer so warm
annimmt, sehr authentische Nachrichten zu erhalten, muß hier aber
demselben widersprechen.
Saint-Germain war nichts weniger als ein heller Kopf, wie schon der
einzige Umstand beweisen kann, daß er noch auf seinem Totenbette
verjüngt zu werden hoffte und andern versicherte, daß das, was
Auflösung war, Vorbereitung zu seiner bevorstehenden Verjüngung sei.
Andere Umstände läßt Rezensent hier unberührt, weil sie nicht hierher
gehören. Besser hätte indessen der Übersetzer getan, er hätte seine
Note zu Saint-Germains Rechtfertigung weggelassen; denn sie erregt auch
gegen seine Aufrichtigkeit nicht unbegründeten Verdacht.
[S. 117]
ZWEITER TEIL
URKUNDEN ZUR LEBENSGESCHICHTE DES GRAFEN SAINT-GERMAIN
[S. 119]
SAINT-GERMAIN IN
LONDON (1743-1745)
I
Aus dem Briefwechsel von Horace Walpole[136]
Horace Walpole an den Ritter Man[137]
9. Dezember 1745.
Wir beginnen Volk aufzugreifen[138], aber so vorsichtig und zaghaft,
wie Frauen von Stand, die zum erstenmal ihre Juwelen versetzen. Wir
haben noch keinen großen Schlag gewagt. Der Propst von Edinburg ist in
polizeilichem Gewahrsam. Kürzlich wurde ein Narr verhaftet, der unter
dem Namen Graf Saint-Germain lebt. Er ist zwei Jahre hier gewesen und
will nicht sagen, wer und woher er ist. Aber zwei ganz wundervolle
Sachen gibt er zu, erstens, daß er nicht unter seinem richtigen Namen
lebt, und zweitens, daß er nie mit einem weiblichen Wesen etwas zu tun
gehabt hat... Er singt, spielt wundervoll Violine, komponiert, ist
verdreht und nicht sehr feinfühlig. Er soll Italiener, Spanier oder
Pole sein; ein hergelaufener Mensch, der in Mexiko durch Heirat zu[S. 120]
großem Vermögen kam und mit den Juwelen seiner Frau nach Konstantinopel
durchbrannte; ein Priester, ein Fiedler, ein vornehmer Mann. Der Prinz
von Wales[139] war unbändig neugierig auf ihn, doch umsonst. Indes
ist nichts gegen ihn geschehen. Er ist freigelassen, und — was mich
überzeugt, daß er kein Edelmann ist — er bleibt hier und behauptet, er
sei als Spion verhaftet worden.
Horace Walpole an John Chute[140]
Paris (8. Januar 1766).
Ich will nichts mit den französischen „Gelehrten“ und Philosophen zu
schaffen haben und beneide Euch nicht gerade um Rousseau[141]. Er ist
eben solch ein „Scharlatan“ wie Graf Saint-Germain, der sich selbst zu
einem wunderlichen Menschenkinde stempelt und von sich reden macht ...
So sehr ich seine Fähigkeiten bewundere, habe ich doch erkannt, daß
weder er noch irgendein „Genius“ genügend gesunden Menschenverstand
besitzen, um der Maßlosigkeit ihrer Ansprüche die Wage zu halten. Sie
hassen die Priester, können aber doch die Kirche nicht entbehren. Aus
diesem Grunde ziehe ich ihre Lektüre ihrer persönlichen Bekanntschaft
vor.
II
Aus: „The London
Chronicle“[142]
13.–15. Mai 1760.
Mittwoch, 14. Mai. Wie der Herausgeber der „Gazette de
Bruxelles“[143] uns erzählt, ist der hier kürzlich aus[S. 121] Holland
angekommene sogenannte Graf von Saint-Germain 1712 in Italien geboren.
Er spricht ebenso geläufig deutsch und französisch wie italienisch
und drückt sich auf englisch recht gut aus. Er ist in allen Künsten
und Wissenschaften bewandert, ein guter Chemiker, Musikvirtuose und
zugleich ein sehr angenehmer Gesellschafter.
Im Jahre 1745 kam er in England in eine sehr schlimme Lage. Ein Mann,
der wegen einer Liebesgeschichte eifersüchtig auf ihn war, steckte
ihm einen falschen Brief des jungen Prätendenten[144] in die Tasche
(worin dieser ihm für seine Nachrichten dankte und ihn bat, damit
fortzufahren), dann ließ er ihn sofort verhaften. Da die Untersuchung
seine völlige Unschuld ergab, wurde er in Freiheit gesetzt und von
Lord H... zu Tisch eingeladen. Wer ihn kennt (sagt Herr Maubert), wird
sich ärgern, zu hören, daß er sich die Ungnade des Allerchristlichsten
Königs[145] zugezogen hat.
[S. 122]
SAINT-GERMAIN IN
FRANKREICH
I.
Aus Casanovas „Memoiren“[146]
(1757)
Die angenehmste Mahlzeit, die ich (bei der Marquise von Urfé)[147]
einnahm, war in Gesellschaft der Frau von Gergy[148], die den berühmten
Abenteurer mitbrachte, der als Graf Saint-Germain bekannt ist. Statt
zu essen, sprach er vom Anfang bis zum Ende des Mahles, und ich machte
es beinahe ebenso, indem ich ihm mit größter Aufmerksamkeit zuhörte.
Allerdings konnte man kaum besser sprechen als er.
Saint-Germain gab sich für einen Wundermann aus. Er wollte verblüffen,
und das gelang ihm oft. Sein Ton war bestimmt, aber so einstudiert, daß
er nicht mißfiel. Er war gelehrt, beherrschte die meisten Sprachen,
war ein großer Musiker und Chemiker, hatte ein angenehmes Gesicht und
verstand alle Frauen zu kirren; denn er gab ihnen zugleich Schminken
und Schönheitsmittel und schmeichelte ihnen mit der Hoffnung, nicht,
sie zu verjüngen — denn er war so bescheiden, zu gestehen, daß[S. 123] er
dies nicht vermöchte —, wohl aber, sie in ihrem jetzigen Zustande zu
erhalten, und zwar mittels eines Wassers, das er ihnen schenkte, obwohl
es ihm selbst, wie er sagte, viel Geld kostete.
Er hatte die Gunst der Frau von Pompadour zu erlangen gewußt, die ihm
eine Unterredung mit dem Könige verschaffte, und diesem hatte er ein
hübsches Laboratorium eingerichtet. Denn der liebenswürdige Monarch,
der sich überall langweilte, glaubte etwas Unterhaltung oder doch
Zerstreuung beim Herstellen von Farben zu finden. Der König hatte ihm
eine Wohnung im Schlosse Chambord angewiesen und ihm 100000 Franken zum
Bau eines Laboratoriums gegeben. Wie Saint-Germain behauptete, wollte
der König durch seine chemischen Produkte die französischen Fabriken in
Blüte bringen.
Dieser eigentümliche Mann, der zum Betrüger großen Stiles geschaffen
war, sagte in selbstgewissem Ton und gleichsam beiläufig, er sei
dreihundert Jahre alt, besitze das Allheilmittel, mache mit der Natur,
was er wolle, besitze das Geheimnis, Diamanten zu schmelzen und aus
zehn bis zwölf kleinen einen großen von reinstem Wasser zu machen,
ohne daß ein Gewichtsverlust einträte. Alle diese Operationen waren
für ihn ein Kinderspiel. Trotz seiner Aufschneidereien, offenkundigen
Lügen und maßlosen Wunderlichkeiten brachte ich es doch nicht über
mich, ihn unverschämt zu finden. Achtbar fand ich ihn auch nicht, aber
unwillkürlich und fast unbewußt fand ich ihn verblüffend; denn er
verblüffte mich ...
Der seltsame Mann erschien oft in den besten Häusern der Hauptstadt zum
Diner, rührte aber keinen Bissen an und behauptete, sein Leben hinge
von seiner Ernährungsweise ab, die niemand außer ihm kennen könne. Mit
dieser[S. 124] Wunderlichkeit fand man sich ab, denn man war nur auf seine
Erzählerkunst erpicht, die ihn tatsächlich zur Seele aller von ihm
besuchten Gesellschaften machte.
(Februar 1758)
Zu Tisch erschien Saint-Germain, aber wie stets aß er nicht, sondern
redete nur. Mit unerschütterlicher Sicherheit erzählte er unglaubliche
Dinge, und man mußte so tun, als ob man sie glaubte; denn er war stets
Augenzeuge oder Held der Geschichte gewesen. Nur als er etwas erzählte,
das ihm begegnet war, als er mit den Vätern des Konzils von Trient[149]
speiste, mußte ich lachen.
Frau von Urfé trug am Halse als Schmuckstück einen großen Magneten.
Eines Tages, so behauptete sie, würde dieser Magnet den Blitz anziehen,
und sie würde auf diese Weise zur Sonne aufsteigen. Der berühmte
Schwindler versicherte ihr sofort, die Sache sei unfehlbar, aber er
allein besäße die Macht, den Magneten ums Tausendfache zu verstärken.
Ich entgegnete ihm kalt, ich wollte um 20000 Thaler wetten, daß er ihn
nicht einmal um das Doppelte verstärken könne. Frau von Urfé legte
sich ins Mittel, um die Wette zu verhindern, und nach Tisch sagte sie
mir unter vier Augen, ich hätte sie verloren; denn Saint-Germain sei
Magier. Man kann sich wohl denken, daß ich ihr recht gab.
Ein paar Tage darauf reiste der angebliche Magier nach Chambord, wo
der König ihm eine Wohnung und 100000 Franken angewiesen hatte, um
in voller Freiheit an seinen Farben arbeiten zu können, mit denen er
den französischen Tuchfabriken den Vorrang vor denen aller anderen
Länder sichern wollte. Saint-Germain hatte den König dadurch bestrickt,
daß er ihm in Trianon ein[S. 125] Laboratorium einrichtete, in dem er sich
bisweilen die Zeit vertrieb, so gering auch seine chemischen Kenntnisse
waren. Aber der König langweilte sich überall, außer auf der Jagd: der
Hirschpark betäubte ihn nur und stumpfte ihn immer mehr ab.
Die gefällige Marquise hatte den Adepten dem König zugeführt, in der
Hoffnung, ihm die Langeweile zu vertreiben, indem sie ihm Geschmack für
die Chemie beibrachte. Zudem glaubte die Pompadour, von Saint-Germain
das Lebenselixier bekommen zu haben, und so wollte sie ihm einen großen
Vorteil verschaffen. Dies Wunderwasser, das man genau in der von dem
Schwindler vorgeschriebenen Dosis einnehmen mußte, besaß nicht die
Kraft, den Menschen zu verjüngen — er gab zu, daß dies unmöglich war
—, sondern nur die, ihn für mehrere Jahrhunderte nicht altern zu
lassen. Tatsächlich hatte dies Wasser — oder sein Erfinder — wo nicht
auf den Körper, so doch auf den Geist der berühmten Frau gewirkt: sie
hatte dem König versichert, daß sie nicht altere.
Auch der König war ganz im Banne des Betrügers; eines Tages zeigte er
dem Herzog von Zweibrücken[150] einen zwölfkarätigen Diamanten von
reinstem Wasser, den er selbst gemacht zu haben wähnte. „Ich habe
24 Karat kleinere Diamanten geschmolzen,“ sagte Ludwig XV., „daraus
erhielt ich diesen, der durch Schleifen auf 12 Karat verkleinert ist.“
Infolge dieser Voreingenommenheit hatte der König jenem berühmten
Abenteurer den früheren Wohnsitz des Marschalls von Sachsen[151]
angewiesen. Ich habe diese Anekdote vom Herzog von Zweibrücken selbst
gehört, als ich in Metz mit ihm und dem schwedischen Grafen Lewenhaupt
speiste.
[S. 126]
Ferner erzählt Casanova in seiner Schrift „Monolog eines Denkers“, S.
34 f. (Prag 1784):
Der unlängst in Schleswig verstorbene Saint-Germain war niemand anders
als der Geigenspieler Catalani. Er war groß unter dem Namen
eines Marquis de la croix noire in England, wunderbar unter dem
Namen eines Grafen Saint-Germain in Frankreich und Spanien, und
einzig unter dem eines Grafen Belmar in Italien. Was war das für
ein Mensch! Selbst von ihm angeführt zu werden, gereichte nicht zur
Unehre. Sein Gesicht war angenehm, vornehm sein Auftreten. Er war ein
guter Erzähler, wenn er auch manchmal aufschnitt, sprach alle Sprachen
gut. Dazu war er ein großer Chemiker, ein großer Musiker, besaß die
Formen der guten Gesellschaft, zeigte sich selten, war zurückhaltend,
höflich, witzig, geistvoll — kurz, er war von solcher Art, daß selbst
die, die auf ihn hereingefallen waren, es ohne Erröten zugaben. König
Ludwig XV., der sich, wo er auch war, langweilte, fand Zeitvertreib in
dem von Saint-Germain ihm eingerichteten Laboratorium. Er gab ihm eine
Wohnung im Schloß Chambord und 100000 Franken.
II. Aus den „Denkwürdigkeiten“ der Madame du
Hausset[152].
Bei Frau von Pompadour verkehrte oft ein Mann, der einer Zauberin kaum
etwas nachgab. Das war der Graf Saint-Germain, der glauben machen
wollte, daß er mehrere Jahrhunderte alt war.
Eines Tages fragte Madame ihn in meiner Gegenwart bei der Toilette:
„Wie sah Franz I.[153] aus? Das war ein[S. 127] König, den ich geliebt
hätte.“ — „Er war auch sehr liebenswert“, versetzte Saint-Germain.
Dann schilderte er seine Gesichtszüge und seine ganze Erscheinung
wie bei einem, den man sich genau angesehen hat. „Leider war er nur
zu hitzig. Ich hätte ihm gern einen trefflichen Rat gegeben, der
ihn vor all seinem Unglück bewahrt hätte, aber er hätte ihn nicht
befolgt; denn es scheint ein Verhängnis über den Fürsten zu walten,
die ihre Ohren — die Ohren des Geistes — den besten Ratschlägen
verschließen, besonders in kritischen Augenblicken.“ — „Und was sagen
Sie von dem Connétable[154]?“ fragte Madame. — „Ich kann weder
allzu Gutes noch allzu Schlechtes von ihm sagen“, entgegnete er. —
„War der Hof Franz’ I. sehr schön?“ — „Sehr schön, aber der seiner
Enkel[155] übertraf ihn unendlich. Zur Zeit der Maria Stuart[156]
und der Margarete von Valois[157] war er ein Zauberland, der Tempel
der Genüsse, auch der geistigen. Beide Königinnen waren gelehrt,
sie machten Verse, und ihnen zuzuhören, war ein Genuß.“ Lachend
versetzte Madame: „Wie es scheint, haben Sie das alles gesehen.“ —
„Mein Gedächtnis ist stark,“ sagte er, „und ich habe die französische
Geschichte eingehend studiert. Bisweilen erlaube ich mir den Spaß,
die Leute zwar nicht glauben zu machen, aber glauben zu
lassen, daß ich in den ältesten Zeiten gelebt habe.“ — „Aber
schließlich sagen Sie doch nicht, wie alt Sie sind, und Sie geben
sich für sehr alt[S. 128] aus. Die Gräfin von Gergy, die vor 50 Jahren
Botschafterin war, ich glaube in Venedig[158], behauptet, Sie so
gekannt zu haben, wie Sie jetzt sind.“ — „Allerdings Madame, habe ich
die Gräfin von Gergy vor langer Zeit kennen gelernt.“ — „Aber nach
dem, was sie sagt, müßten Sie jetzt über 100 Jahre alt sein.“ — „Das
ist nicht unmöglich,“ sagte er lachend, „aber wie ich zugebe, ist es
noch möglicher, daß die verehrte Dame Unsinn redet.“ — „Sie behauptet,
Sie hätten ihr ein Elixier von wunderbarer Wirkung gegeben. Sie hätte
infolgedessen lange wie eine Vierundzwanzigjährige ausgesehen. Warum
geben Sie dem König das Elixier nicht?“ — „Ach, Madame,“ versetzte er
mit einer Art von Schauder, „wenn ich mir beikommen ließe, dem König
eine mir unbekannte Arznei zu geben, müßte ich wahnsinnig sein[159].“
Ich begab mich auf mein Zimmer, um dies Gespräch aufzuschreiben.
Ein paar Tage darauf war zwischen dem König, Madame, einigen Edelleuten
und dem Grafen Saint-Germain die Rede von dem Geheimmittel, das er
besaß, um Diamanten von Flecken zu befreien. Der König ließ sich
einen mäßig großen Diamanten bringen, der einen Fleck hatte. Man ließ
ihn wiegen, und der König sagte zum Grafen: „Er wird auf 6000 Livres
geschätzt, aber ohne den Flecken wäre er 10000 wert. Wollen Sie es
übernehmen, mich 4000 Franken verdienen zu lassen?“ Dieser prüfte ihn
genau, dann sagte er: „Das ist möglich. In einem Monat werde ich ihn
Eurer Majestät wiederbringen.“

Giacomo Casanova
Nach einem Pastellbild seines Bruders Francesco
Nach einem Monat brachte der Graf dem König den Diamanten fleckenlos
zurück. Er war in Asbestwatte[S. 129] gewickelt, die er entfernte. Der König
ließ ihn wiegen, und er wog fast genau soviel wie vorher. Der König
schickte ihn durch Herrn von Gontaut[160] zu seinem Juwelier, ohne
ihm irgend etwas zu sagen, und der brachte 9600 Livres wieder. Aber
der König ließ den Diamanten zurückfordern, um ihn der Wissenschaft
halber zu behalten. Er konnte sich von seiner Überraschung nicht
erholen und sagte, Herr von Saint-Germain müsse millionenreich sein,
besonders, wenn er das Geheimnis besäße, aus kleinen Diamanten große zu
machen. Der sagte weder ja noch nein, versicherte aber sehr bestimmt,
er könne Perlen vergrößern und ihnen ein schöneres Wasser geben. Der
König behandelte ihn achtungsvoll, ebenso Madame, von der ich das eben
Gesagte erfuhr. Betreffs der Perlen hat mir Herr Quesnay[161] gesagt:
„Die Perlen entstehen durch eine Krankheit der Austern, und es ist
möglich, ihr auf den Grund zu kommen. Somit kann Herr von Saint-Germain
Perlen vergrößern; trotzdem aber ist er ein Scharlatan; denn er hat ein
Lebenselixier und läßt durchblicken, daß er mehrere hundert Jahre alt
ist. Übrigens ist der König vernarrt in ihn und spricht bisweilen von
ihm, als ob er von erlauchter Geburt sei.“
Ich habe ihn mehrfach gesehen. Er schien 50 Jahre alt, war weder fett
noch mager, hatte eine schlaue, geistreiche Miene, war sehr schlicht,
aber geschmackvoll gekleidet und trug sehr schöne Diamanten an den
Ringen wie an seiner Tabaksdose und Uhr. Eines Tages, bei einem großen
Hoffest, kam er mit so schönen Schuhschnallen und Kniebändern, die
mit echten Diamanten besetzt[S. 130] waren, zu Madame, daß diese sagte, sie
glaube nicht, daß der König so schöne hätte. Er ging ins Vorzimmer,
um sie abzumachen, und brachte sie dann wieder, damit man sie näher
ansehen könnte. Herr von Gontaut, der dabei war, verglich die Steine
mit anderen und sagte, sie seien wenigstens 200000 Franken wert. Am
selben Tage trug er eine unschätzbare Tabaksdose und Manschettenknöpfe
von funkelnden Rubinen. Kein Mensch wußte, woher dieser so reiche und
außergewöhnliche Mann stammte, und der König duldete nicht, daß man
verächtlich von ihm sprach und über ihn spottete. Er war angeblich der
Bastard eines portugiesischen Königs ...
Eines Tages sagte Herr von Saint-Germain zum König: „Um die Menschen zu
achten, darf man weder Beichtvater noch Minister noch Polizeidirektor
sein.“ — Der König setzte hinzu: „Und König.“ — „Ach, Sire,“ rief
er, „Sie haben den Nebel vor einigen Tagen gesehen, man sah keine vier
Schritt weit. Die Könige sind — allgemein gesprochen — in noch viel
dichtere Nebel gehüllt, die Ränkeschmiede, treulose Minister um sie
entstehen lassen, und in allen Volksklassen ist man sich darin einig,
ihnen die Dinge in falscher Beleuchtung zu zeigen.“ Dies hörte ich aus
dem Munde des berühmten Grafen Saint-Germain, als ich bei Madame war,
die unpäßlich war und im Bette lag. Der König besuchte sie, und auch
der Graf wurde als willkommener Gast empfangen. Herr von Gontaut, Frau
von Brancas[162]
und der Abbé de Bernis[163] waren dabei ...
[S. 131]
Eines Tages besuchte Graf Saint-Germain Madame, die unpäßlich war und
auf ihrem Diwan lag. Er zeigte ihr ein Kästchen voller Topase, Rubine
und Smaragde. Anscheinend besaß er Schätze davon. Madame rief mich,
um all die schönen Dinge zu besehen. Ich blickte sie verblüfft an,
machte aber hinten herum Madame ein Zeichen, daß ich alles für falsch
hielte. Der Graf suchte etwas in einer Brieftasche, die doppelt so
groß war wie ein Brillenfutteral, zog zwei bis drei kleine Päckchen
hervor, wickelte sie aus, zeigte einen prachtvollen Rubin und warf
geringschätzig ein kleines Kreuz auf den Tisch neben ihm. Es bestand
aus weißen und grünen Steinen. Ich betrachtete es und sagte: „Das ist
nicht zu verachten.“ Ich legte es an und machte eine Miene, als ob ich
es sehr hübsch fände. Sogleich bat der Graf mich, es anzunehmen. Ich
weigerte mich, er blieb dabei. Madame schlug es gleichfalls für mich
aus. Schließlich drängte er so, daß Madame, die sah, daß es nicht mehr
als 40 Louisdors wert sein konnte, mir winkte, es anzunehmen. Ich nahm
das Kreuz, sehr befriedigt über die Liebenswürdigkeit des Grafen, und
ein paar Tage darauf schenkte Madame ihm eine emaillierte Dose mit dem
Bild irgendeines griechischen Weisen, eine Anspielung auf ihn. Übrigens
ließ ich das Kreuz prüfen; es war 1500 Franken wert.
Er schlug Madame vor, ihr ein paar Emailbilder von Petitot[164] zu
zeigen, und sie sagte ihm, er solle am Nachmittag während der Jagd
wiederkommen. Er zeigte seine Bilder, und Madame sagte zu ihm: „Man
erzählt von einer reizenden Geschichte, die Sie vor zwei Tagen beim
Souper beim Premier zum besten gaben und deren Augenzeuge Sie vor 50
bis 60 Jahren waren.“ Er lächelte und sprach: „Sie ist etwas lang.“
— „Um so besser“,[S. 132] entgegnete Madame und schien ganz entzückt. Herr
von Gontaut und die Damen kamen, und man ließ die Tür schließen. Dann
winkte Madame mir, hinter einem Wandschirm Platz zu nehmen. Der Graf
entschuldigte sich sehr, daß seine Geschichte vielleicht langweilen
werde. Manchmal erzähle man gut, und ein andermal hätte man weniger
Glück.
Saint-Germains
Erzählung
„Der Marchese von San Gil[165] war zu Anfang dieses Jahrhunderts
spanischer Botschafter im Haag. In seiner Jugend war er mit dem Grafen
von Moncada befreundet gewesen, einem spanischen Granden und einem der
reichsten Herren des Landes. Einige Monate nach seiner Ankunft im Haag
erhielt er einen Brief des Grafen, der ihn bei seiner Freundschaft
beschwor, ihm einen sehr großen Dienst zu leisten. „Wie Sie wissen,
lieber Marchese,“ schrieb er ihm, „hatte ich den Kummer, den Namen
Moncada nicht fortpflanzen zu können. Doch kurz nachdem ich Sie
verlassen, erhörte der Himmel mein Flehen und schenkte mir einen Sohn.
Der zeigte frühzeitig eines Mannes seiner Abkunft würdige Neigungen,
aber das Unglück wollte, daß er sich in Toledo in die berühmteste
Schauspielerin der dortigen Truppe verliebte. Ich schloß die Augen
über diesen Jugendstreich, da ich bisher stets zufrieden mit ihm war.
Als ich aber erfuhr, daß ihn die Leidenschaft derart verblendete,
daß er das Mädchen heiraten wollte, und daß er ihr ein schriftliches
Eheversprechen gegeben hatte, bat ich den König, sie einsperren zu
lassen. Als mein Sohn von[S. 133] meinem Schritt erfuhr, kam er ihm zuvor
und entfloh mit der Geliebten. Seit über einem halben Jahre weiß ich
nicht, wohin er seine Schritte gelenkt hat, aber ich habe Grund zu der
Annahme, daß er im Haag ist.“ Nun beschwor der Graf den Marchese im
Namen seiner Freundschaft, die genauesten Nachforschungen anzustellen,
um ihn ausfindig zu machen und ihn zur Heimkehr zu bewegen. „Es ist
recht und billig,“ schrieb der Graf, „dem Mädchen eine Versorgung
zu geben, falls sie das Heiratsversprechen, das sie sich ausstellen
ließ, wieder herausgibt. Ich überlasse es Ihnen, die Entschädigung zu
bestimmen und meinem Sohn so viel auszuzahlen, daß er in anständigem
Aufzuge nach Madrid zurückkehren kann. Ich weiß nicht, ob Sie Kinder
haben“, schloß der Graf. „Wenn ja, so können Sie sich einen Begriff von
meiner Sorge machen.“ Dem Brief lag eine genaue Beschreibung seines
Sohnes und seiner Geliebten bei.
Sobald der Marchese ihn erhalten hatte, ließ er in allen Gasthöfen
von Amsterdam, Rotterdam und dem Haag nachforschen. Doch umsonst! Er
brachte nichts heraus. Er begann schon am Erfolg seiner Schritte zu
verzweifeln, als er auf den Gedanken kam, einen sehr geweckten jungen
französischen Pagen dazu zu benutzen. Er versprach ihm eine Belohnung,
falls es ihm gelänge, die so dringend gesuchten Personen zu entdecken,
und er gab ihm deren Beschreibung. Mehrere Tage streifte der Page
vergebens an allen öffentlichen Orten umher. Endlich, eines Abends im
Theater, erblickte er in einer Loge einen jungen Mann und eine Dame,
die er aufmerksam betrachtete. Als er merkte, daß beide, durch seine
Aufmerksamkeit betroffen, sich in den Hintergrund der Loge zurückzogen,
zweifelte der Page nicht mehr am Erfolg seiner Nachforschungen. Er ließ
die Loge nicht[S. 134] aus den Augen und beobachtete gespannt alles, was darin
vorging.
Als das Stück aus war, stand er in dem Gange, der von den Logen zum
Portal führte, und als der junge Mann an ihm vorbeiging, bemerkte er,
daß seine Tracht diesem offenbar auffiel, und daß er sein Taschentuch
vor den Mund hielt, um sich unkenntlich zu machen. Unauffällig folgte
er ihm bis zum Gasthof „Vicomte de Turenne“, in den er ihn mit seiner
Begleiterin eintreten sah. Dann eilte er, seiner Sache gewiß, zu dem
Botschafter, um ihn zu benachrichtigen.
Der Marchese von San Gil begab sich sofort, in einen Mantel gehüllt
und von seinem Pagen und zwei Dienern gefolgt, nach dem Gasthof.
Dort angelangt, fragte er den Wirt, wo sich das Zimmer eines jungen
Mannes und einer Dame befände, die seit einer Weile bei ihm wohnten.
Der Wirt machte zunächst einige Schwierigkeiten, es zu sagen, wenn
der Name der beiden nicht angegeben würde. Aber der Page machte ihn
darauf aufmerksam, daß er mit dem spanischen Botschafter spräche, der
seine Gründe hätte, mit diesen Personen zu reden. Da sagte der Wirt,
sie wünschten nicht bekannt zu werden und hätten verboten, jemand bei
ihnen einzulassen, der ihren Namen nicht nenne. Aus Hochachtung vor
dem Botschafter jedoch gab er ihm das Zimmer an und führte ihn selbst
ins oberste Stockwerk in ein elendes Stübchen. Er klopfte an, aber es
dauerte ein Weilchen, bis die Tür geöffnet wurde. Endlich, als er von
neuem stark gepocht hatte, wurde sie halb geöffnet, aber beim Anblick
des Botschafters und seines Gefolges wollte der, welcher sie geöffnet
hatte, sie wieder schließen, indem er sagte, man irre sich wohl. Da
stieß der Botschafter sie mit Gewalt auf, trat ein und gebot seinen
Leuten, draußen zu warten.
[S. 135]
Als er allein im Zimmer stand, sah er einen jungen Mann von sehr
hübschem Äußeren, das vollkommen zu der Beschreibung paßte. Bei ihm war
ein junges Weib, schön und von guter Figur, dessen Haarfarbe, Wuchs
und Gesichtsschnitt gleichfalls mit der Beschreibung des Grafen von
Moncada übereinstimmte. Der junge Mann brach zuerst das Schweigen. Er
beschwerte sich über das gewaltsame Eindringen bei einem Fremden, der
in einem freien Lande sei und unter dem Schutz der Gesetze lebe. Der
Botschafter trat auf ihn zu, um ihn zu umarmen, und sprach: „Verstellen
Sie sich nicht, lieber Graf! Ich kenne Sie und komme nicht her, um
Ihnen Verdruß zu bereiten, auch der jungen Dame nicht, die mir sehr
fesselnd erscheint.“
Der Jüngling entgegnete, er irre sich. Er sei kein Graf, sondern der
Sohn eines Kaufmanns aus Cadix. Die junge Frau sei seine Gattin, und
sie reisten zu ihrem Vergnügen. Der Botschafter warf einen Blick in das
elend ausgestattete Stübchen, in dem nur ein einziges Bett stand, sowie
auf das armselige Gepäck, das herumlag. „Wohnt hier, liebes Kind —
gestatten Sie mir diese Anrede, zu der mich die zärtliche Freundschaft
zu Ihrem Herrn Vater ermächtigt —, wohnt hier der Sohn des Grafen
Moncada?“ Der junge Mann behauptete immer noch, nicht zu verstehen, was
er meinte. Schließlich aber ward er durch den eindringlichen Zuspruch
des Botschafters besiegt und gestand weinend, daß er Moncadas Sohn sei,
daß er aber niemals zu seinem Vater zurückkehren werde, falls er das
angebetete Weib verlassen müsse.
Auch sie brach in Tränen aus, warf sich dem Botschafter zu Füßen und
sagte, sie wolle nicht die Ursache des Unglücks des Grafen Moncada
sein. Indem ihre Hochherzigkeit oder vielmehr ihre Liebe über ihren
eigenen[S. 136] Vorteil siegte, erklärte sie sich bereit, da es sich um sein
Glück handle, sich von ihm zu trennen.
Der Jüngling gerät in Verzweiflung, macht seiner Geliebten Vorwürfe und
erklärt, er wolle sie nicht verlassen und nicht dulden, daß ihr edles
Herz sich gegen sie selbst, gegen ein so liebenswertes Wesen kehre. Der
Botschafter entgegnet, es sei nicht die Absicht des Grafen Moncada,
sie unglücklich zu machen, vielmehr sei er beauftragt, ihr eine
angemessene Summe zu geben, damit sie nach Spanien zurückkehren oder
leben könne, wo sie sonst wolle. Ihre vornehme Gesinnung und ihre echte
Zärtlichkeit, sagte er, flößten ihm die größte Anteilnahme ein und
bestimmten ihn, die Summe, die er ihr gegenwärtig zu geben beauftragt
sei, so hoch wie möglich zu bemessen. Somit verspräche er ihr 10000
Gulden (etwa 30000 Franken), die ihr ausgezahlt werden sollten, sobald
sie das ihr gegebene schriftliche Heiratsversprechen ausliefere und
der Graf Moncada zum Botschafter übergesiedelt sei und nach Spanien
zurückzukehren gelobt habe.
Das junge Weib achtet scheinbar nicht auf die Summe und denkt nur an
ihren Liebhaber und den Schmerz, ihn zu verlieren, an das grausame
Opfer, zu dem Vernunft und Eigenliebe sie zwingen. Dann zieht sie aus
einer kleinen Brieftasche das Heiratsversprechen des Grafen und sagt:
„Ich kenne sein Herz zu gut, um dies nötig zu haben“, küßt es mit einer
Art Überschwang mehrere Male und überreicht es dem Botschafter, der ob
solcher Seelengröße erstaunt ist. Er verspricht dem jungen Weibe, sich
stets ihrer anzunehmen, und versichert dem Grafen, daß sein Vater ihm
verzeihen werde. Mit offenen Armen, sagt er, werde er den verlorenen
Sohn aufnehmen, der zu den untröstlichen Seinen zurückkehre; das Herz
eines Vaters sei eine unerschöpfliche Quelle der Zärtlichkeit. Wie[S. 137]
glücklich werde sein so lange bekümmerter Freund sein, wenn er diese
Nachricht erhalte, und wie glücklich fühle er sich selber, das Werkzeug
dieses Glückes zu sein! So redete der Botschafter auf den Jüngling ein,
und dieser schien lebhaft gerührt.
Da der Botschafter indes befürchtete, die Liebe möchte in der
Nacht ihre ganze Gewalt wieder erlangen und über den hochherzigen
Entschluß der Dame siegen, drängte er den jungen Grafen, ihm in sein
Haus zu folgen. Die Tränen und Schmerzenslaute, die diese grausame
Trennung hervorrief, sind schwer zu beschreiben und rührten das
Herz des Botschafters tief. Er versprach, der jungen Dame seinen
Schutz angedeihen zu lassen. Das kleine Gepäck des Grafen war leicht
fortgeschafft, und am Abend befand er sich im schönsten Gemache des
Botschafters, der hocherfreut war, dem erlauchten Hause Moncada den
Erben seiner Größe und so vieler prächtiger Besitzungen wiedergegeben
zu haben.
Als der junge Graf am Tage nach diesem glücklichen Ereignis aufsteht,
sieht er Schneider, Stoff- und Spitzenhändler usw. erscheinen, und
er braucht nur zu wählen. Zwei Kammerdiener und drei Lakaien warten
in seinem Vorzimmer, und zwar Leute, die der Botschafter unter den
klügsten und ehrlichsten ausgewählt hat. Sie melden sich bei ihm zum
Dienste. Der Botschafter zeigt dem jungen Grafen den Brief, den er
soeben an dessen Vater geschrieben hat. Darin beglückwünscht er ihn
zu einem Sohne, dessen Gesinnung und Eigenschaften seinem erlauchten
Blut entsprechen, und meldet ihm seine baldige Heimkehr. Die junge
Frau ist nicht vergessen. Er gesteht, daß er ihrer Hochherzigkeit die
Unterwerfung seines Sohnes zum Teil danke, und zweifelt nicht, daß der
Graf das Geschenk von 10000 Gulden gutheißen werde.
[S. 138]
Diese Summe wurde der edlen, fesselnden Person noch am selben Tage
zugestellt, und sie reiste alsbald ab. Auch die Zurüstungen zur
Abreise des Grafen wurden getroffen. Eine prächtige Garderobe, ein
ausgezeichneter Wagen wurden in Rotterdam auf ein Schiff verladen, das
nach Frankreich in See ging und auf dem der Graf ebenfalls abfahren
sollte, um sich von dort nach Spanien zu begeben. Bei seiner Abreise
erhielt er eine erhebliche Geldsumme und beträchtliche Wechsel auf
Paris. Rührend war der Abschied des Botschafters von dem jungen Herrn.
Voller Ungeduld erwartete der Botschafter die Antwort des Grafen
Moncada und genoß dessen Freude, indem er sich an seine Stelle
versetzte. Nach vier Monaten traf sie endlich ein. Aber umsonst wird
man versuchen, die Überraschung des Botschafters zu schildern, als er
folgendes las:
„Der Himmel hat mir nie die Genugtuung gewährt, Vater zu sein, lieber
Marchese. Er hat mich mit Gütern und Ehren überhäuft, aber mir den
Kummer bereitet, keine Erben zu haben und mein erlauchtes Geschlecht
mit mir aussterben zu sehen, und so hat er mein Leben mit dem
bittersten Gram erfüllt. Ich sehe zu meinem tiefsten Leidwesen, daß Sie
durch einen jungen Abenteurer getäuscht worden sind, der die Kenntnis
von unserer alten Freundschaft gemißbraucht hat. Aber Euer Exzellenz
sollen nicht der Angeführte sein. Den Grafen Moncada haben Sie sich
zu verbinden geglaubt; er hat die Pflicht, das zu begleichen, was Sie
ihm in hochherziger Freundschaft vorgestreckt haben, um ihm ein Glück
zu bereiten, das ihn aufs höchste erfreut hätte. Ich hoffe also, Herr
Marchese, Sie werden ohne Widerstreben die beiliegende Summe von 3000
Louisdors laut ausgestellter Rechnung annehmen.“
[S. 139]
**
*
Die Art, wie der Graf Saint-Germain den jungen Abenteurer, seine
Geliebte und den Botschafter reden ließ, brachte die Zuhörer
abwechselnd zum Weinen und zum Lachen. Die Geschichte ist buchstäblich
wahr, und der Abenteurer ist nach Aussage derer, die ihm zuhörten,
geschickter als Guzman von Alfarache[166]. Madame hatte den Einfall,
ein Lustspiel daraus zu machen, und der Graf schickte ihr die
Geschichte schriftlich, so wie ich sie hier abgeschrieben habe.
III. Bericht Hellens[167]
Haag, 8. Januar 1760.
Wie ich höre, befindet sich in Paris ein Mann, dessen Auftreten wichtig
genug scheint, um E. M. zu berichten, was ich davon erfahren konnte. Es
ist eine Art Abenteurer, der unter dem Namen eines Grafen Saint-Germain
in Deutschland und England gereist ist. Er spielt vorzüglich Violine,
macht auch den Alchimisten und tritt überall groß auf. In Paris
wohnt er bei einem englischen Bankier Selwin. Vielleicht haben E. M.
von dem Manne schon gehört. Der angebliche Graf soll gegenwärtig am
Versailler Hofe eine hervorragende Rolle spielen und sogar Zutritt zu
den Privatgemächern des Königs von Frankreich und der Marquise (von
Pompadour) haben. Wie man mir versichert, besuchen ihn alle Minister,
um sich bei ihm einzuschmeicheln, nicht nur, weil er in hohem Maße die
Gunst ihres Gebieters besitzt, sondern auch, um sich Rat bei ihm zu
holen.
[S. 140]
Was ihn in so hohe Gunst gebracht hat, ist schwer zu sagen, aber
allem Anschein nach hat er der Favoritin und dem König weisgemacht,
daß er ihnen das Geheimnis des Steins der Weisen zeigen würde. Die
Geistesschwäche des Königs und seine bloße Neugier für alles, was
mit den Naturwissenschaften zusammenhängt, dazu die Habsucht der
Marquise, machen diese Annahme sehr wahrscheinlich. Übrigens soll er
dem König von Frankreich bereits einige recht merkwürdige chemische
Entdeckungen mitgeteilt haben, unter anderem ein Geheimmittel zur
Herstellung dauerhafter Farben. Wie dem aber auch sei, der Mann spricht
den französischen Ministern seine Meinung mit größtem Freimut aus. Er
wiederholt ihnen oft, sie hätten die größte Torheit begangen, sich
mit E. M. zu entzweien und in den Kontinentalkrieg einzugreifen[168].
Er rät ihnen, schleunigst Frieden zu machen. Er gibt sich überhaupt
als großen Bewunderer E. M. aus. Als die beiden Niederlagen gegen
Rußland[169] bekannt wurden, hat er immerfort vorausgesagt, was
tatsächlich eingetreten ist, nämlich daß E. M. Mittel und Wege finden
würden, den Schaden wieder gut zu machen, und daß man sehen würde, daß
Ihre Feinde keinen Schritt weiter gekommen seien.
Anscheinend hat er Anteil am Sturze des letzten
Generalkontrolleurs[170]. Zum mindesten hat er ihn in einem Brief an
einen Freund im Ausland in einer Weise angezeigt,[S. 141] daß diese Annahme
fast berechtigt erscheint. „Ich habe Ihnen mein Versprechen gehalten,“
schreibt er, „Silhouette, der Henker Frankreichs, ist gestürzt.“
IV. Saint-Germain auf Schloß Chambord
(Aus dem Schriftwechsel des Marquis von Marigny[171])
Collet[172] an den Marquis von Marigny
Chambord, 10. Mai 1758.
Ich benutze das freundliche Anerbieten des Grafen Saint-Germain, ihn
nach Paris zu begleiten, um einige ihn betreffende Angelegenheiten zu
ordnen und einige Geschäfte zu erledigen, die vor Ende nächster Woche
beendet sein müssen.
Der Abbé de la Pagerie an den Marquis von Marigny
Blois, 12. August 1758.
Herr von Saint-Germain, der die Neugier des ganzen Landes erregt, wird
täglich erwartet. Ich habe zweimal mit ihm zu Mittag gespeist. Er
scheint ein Mann von großem Wissen und von Grundsätzen zu sein.
Der Marquis von Marigny an den Abbé de la Pagerie
Versailles, 2. September 1758.
Ich erhielt Ihren Brief vom 12. vorigen Monats. Tatsächlich hat der
König Herrn von Saint-Germain eine[S. 142] Wohnung in Chambord angewiesen,
und Sie sagen mit Recht, daß er ein Mann von Verdienst ist. Ich
hatte Gelegenheit, mich davon bei mehreren Unterredungen mit ihm
zu überzeugen. Von seinen hervorragenden Kenntnissen darf man sich
wirklichen Gewinn versprechen.
Collet an den Marquis von Marigny
Chambord, 4. Dezember 1758.
Graf Saint-Germain ist am letzten Sonnabend (2. Dezember) mit zwei
Herren hier eingetroffen. Er will fünf bis sechs Tage hier bleiben und
geht dann nach Paris. Er ist so freundlich, mich mitzunehmen.
Herr von Saumery[173]
an den Marquis von Marigny
Paris, 15. April 1759.
Ich glaube, die Nebengebäude werden als Wohnung für die Arbeiter
hinreichen, die Graf Saint-Germain zur Errichtung seiner Manufaktur
mitbringen will.
Collet an den Marquis von Marigny
Chambord, 8. Mai 1759[174].
Graf Saint-Germain ist am letzten Sonnabend (5. Mai) hier eingetroffen.
Dies ist sein zweiter Aufenthalt in Chambord. Ich habe zwei Zimmer für
einige seiner Leute zurechtgemacht, sowie drei andere mit Küche und
Speisekammer im Erdgeschoß zu seiner Bequemlichkeit. Ich habe in diesem
Teil des Schlosses nichts verändert, sondern nur dringende Reparaturen
machen lassen.
[S. 143]
V. Aus einem Schreiben des Grafen
Bernstorff[175]
(1779).
Ich war weder sein Freund noch sein Bewunderer. Hoffentlich hat
er vergessen, wie sehr er sich darüber ärgerte, aber seither sind
zweiundzwanzig Jahre verflossen ... Jetzt halte ich mein Urteil zurück,
gestehe aber, daß ich noch immer sehr zum Mißtrauen gegen einen Mann
neige, dessen Persönlichkeit stets ein Rätsel blieb, der mit unsinnigen
Behauptungen um sich warf, der immerfort seinen Namen wechselte und
sich bald als Adepten, bald als vornehmen Herrn ausgab, den die
Vorsehung besonders reich gesegnet habe.
VI. Aus den „Episoden meines Lebens“ des Grafen
d’Angiviller[176]
Ich kannte den Grafen Saint-Germain, der vom Prinzen Karl[177] so
begünstigt worden ist. Ich war noch sehr jung, aber trotz meiner
Jugend, trotzdem er mich gut behandelte und mir sogar schmeichelte,
ließ ich ihn nicht etwa friedlich die Ehren genießen, die man seinem
Scharlatanismus erwies, sondern trumpfte immerfort erbarmungslos gegen
ihn auf.
[S. 144]
DIE
MISSION SAINT-GERMAINS IM HAAG (1760)
I
Aus dem Schriftwechsel des Herzogs von Choiseul[178]
Graf d’Affry[179]
an Choiseul
Haag, 22. Februar 1760.
Herr Astier[180] schreibt, daß sich in Amsterdam ein gewisser Graf
Saint-Germain aufhält, der, soviel ich weiß, früher lange in England
gelebt hat und einen recht sonderbaren Eindruck macht. Er spricht in
ungewöhnlicher Weise von unseren Finanzen und unserem Ministerium und
behauptet, mit einer wichtigen finanziellen Mission für Frankreich
betraut zu sein.
Haag, 10. März 1760.
Graf Saint-Germain hat mich vorgestern hier aufgesucht. Er führte mir
gegenüber dieselben Reden, wie er sie in Amsterdam geführt haben soll.
Er hat soeben mein[S. 145] Haus verlassen; seine Gespräche drehten sich um
die gleiche Sache. Er sagte mir zuerst, er könne mir unsere Finanzlage
nicht trüb genug schildern; er besitze einen gewissen Plan zu ihrer
Aufbesserung; mit einem Wort, er wolle das Königreich retten. Ich ließ
ihn reden, soviel er wollte, und als er innehielt, fragte ich ihn, ob
der Generalkontrolleur über diesen Plan Bescheid wisse. Er verneinte
es und sagte bei dieser Gelegenheit viel Übles über den Vorgänger des
Herrn Bertin[181].
Er schien besonders den Herren Pâris de Montmartel
und Duverney[182] feindlich gesinnt.
Wie er mir sagte, hätte er enge
Beziehungen zum Herrn Marschall von Belle-Isle[183]; auch zeigte er mir
zwei Briefe von ihm, die er seit seiner Ankunft in Holland erhalten
hat. Darin spricht sich Herr von Belle-Isle anerkennend über seinen
Eifer aus, aber sie enthalten nur allgemeine Wendungen und keine
Einzelheiten.
Ich gestand Herrn von Saint-Germain, daß ich seinen Plan durchaus
nicht begriffe. Er gab mir seinerseits zu, daß er ihn schlecht erklärt
hätte, und versprach mir, ihn mir morgen mitzubringen. Ich fragte ihn,
was seine Reise nach Holland mit diesem Plane zu tun hätte. Er gab mir
darauf keine klare Antwort und sagte nur, sein allgemeines Vorhaben
sei, uns den Kredit der vornehmsten hiesigen Bankhäuser zu sichern.
Ich werde mich beehren, Herr Herzog, Ihnen am nächsten Freitag (14.
März) zu berichten, was Herr von Saint-Germain mir morgen etwa sagt
und mitteilt. Ich weiß nicht, ob alle seine Behauptungen völlig
wahrheitsgemäß sind, aber er hat sicherlich sehr ungewöhnliche
Ansichten.
[S. 146]
Haag, 11. März.
Herr von Saint-Germain hat mir seinen Plan mitgeteilt, der Herrn Bertin
bekannt ist und sogar von ihm empfohlen wird.
Graf Saint-Germain an die Marquise von Pompadour
[Haag] 11. März 1760.
Gnädige Frau. Meine reinen und aufrichtigen Wünsche für die Wohlfahrt
Ihres verehrten Volkes und für Sie selbst werden, wo ich auch in
Europa weile, unverändert bleiben. Doch will ich nicht unterlassen,
Ihnen Beweise dafür in aller Reinheit, Aufrichtigkeit und Stärke zu
geben. Ich bin jetzt im Haag und wohne beim Grafen Bentinck, Herrn van
Rhoon, zu dem ich enge Beziehungen habe[184]. Ich war so erfolgreich,
daß ich glaube, Frankreich hat keinen verständigeren, treueren und
beständigeren Freund. Des seien Sie versichert, gnädige Frau, wenn Sie
auch das Gegenteil davon hören sollten.
Herr von Bentinck ist hier ebenso allmächtig wie in England, ein großer
Staatsmann und vollendeter Ehrenmann. Er ist mir gegenüber völlig
offen. Aus der Fülle meines Herzens sprach ich ihm von der reizenden
Marquise von Pompadour. Meine Gefühle gegen Sie, gnädige Frau, sind
Ihnen längst bekannt und gewiß der Herzensgüte und Seelenschönheit
wert, die diese Gefühle erweckten. Er war so begeistert davon, daß er
ganz bezaubert ist; mit einem Wort, Sie können sich auf ihn verlassen
wie auf mich.
[S. 147]
Ich glaube mit gutem Grunde, daß der König angesichts seiner Macht,
seiner Aufrichtigkeit und Redlichkeit große Dienste von ihm erwarten
kann. Wenn der König glaubt, daß meine Beziehungen zu ihm irgendwie
von Nutzen sein können, so will ich mich aufs äußerste bemühen, ihm zu
dienen. Meine freiwillige, selbstlose Hingebung an seine heilige Person
muß ihm ja bekannt sein. Sie kennen die Treue, die ich Ihnen geschworen
habe, gnädige Frau: befehlen Sie, und ich gehorche. Sie können Europa
ohne die Verdrießlichkeiten und Schwierigkeiten eines Kongresses den
Frieden geben. Ihre Befehle werden mir völlig sicher zukommen, wenn
Sie sie an den Grafen van Rhoon im Haag senden oder, wenn Sie es für
besser halten, an die Herren Thomas und Adrian Hope[185], bei denen
ich in Amsterdam wohne. Was ich Ihnen zu schreiben habe, erscheint
mir so bedeutsam, daß ich mir schwere Vorwürfe machen müßte, gnädige
Frau, wenn ich es Ihnen verschweigen wollte, da ich nie etwas verborgen
habe noch verbergen werde. Wenn Sie keine Zeit haben, mir selbst zu
antworten, so bitte ich Sie, es durch eine sichere, vertrauenswürdige
Person zu tun. Aber verlieren Sie keinen Augenblick; ich beschwöre
Sie bei aller Liebe und Zuneigung für den besten und würdigsten aller
Könige.
Graf d’Affry an Choiseul
Haag, 14. März 1760.
Ich habe den Plan gesehen, von dem Herr von Saint-Germain mir
gesprochen hatte. Ich habe ihn an ihn zurückgesandt und werde ihm bei
nächster Gelegenheit sagen, daß derartige Geschäfte mit meinem Amte
nichts zu tun haben. Ich könnte mich ohne Auftrag nicht damit[S. 148] befassen
und wünschte selbst, Kredite für die Staatsfinanzen in Amsterdam oder
in anderen holländischen Städten zu finden ...
Wie Herr von Saint-Germain mir sagte, hat Herr Bentinck van Rhoon
sich über meine Zurückhaltung bei ihm beschwert; ich spräche mit ihm
nie von Geschäftssachen. Wie er hinzusetzte, hat Herr Bentinck ihm
versichert, niemand sei weniger englisch gesinnt als er; er sei ein
guter Patriot und mehr Franzose, als ich glaubte. Ich antwortete Herrn
von Saint-Germain mit allgemeinen Wendungen, ließ aber durchblicken,
daß ich es seltsam fände, daß Herr Bentinck ihm diesen Auftrag gegeben
hätte, und noch seltsamer, daß er ihn übernommen hätte. Ich halte mich
für verpflichtet, Ihnen alles mitzuteilen, was zwischen diesem Manne
und mir stattgefunden hat.
Choiseul an Graf d’Affry
Versailles, 19. März 1760.
Ich sende Ihnen einen Brief des Herrn von Saint-Germain an die Marquise
von Pompadour[186], der die unglaubliche Art dieses Mannes hinreichend
beweist. Er ist ein Abenteurer ersten Ranges und zudem, soweit ich
sehen kann, sehr töricht. Ich bitte Sie, ihn sofort nach Empfang meines
Briefes zu sich kommen zu lassen und ihm zu sagen, ich wisse zwar
nicht, wie man im Finanzdepartement über ihn dächte, gäbe Ihnen aber
den Befehl, ihm zu eröffnen: sobald ich erführe, daß er sich irgendwie
im Großen oder im Kleinen in die Politik einzumischen wage, so könne er
sich darauf verlassen, ich würde beim König den Befehl erwirken, ihn
bei seiner Rückkehr nach Frankreich für den Rest seiner Tage in[S. 149] einem
Kerkerloch einzusperren. Sie wollen hinzusetzen, er möge ganz sicher
sein, daß diese meine Absichten ebenso ernst sind, wie daß sie bestimmt
ausgeführt werden, falls er mir Anlaß gibt, mein Wort zu halten.
Nach dieser Erklärung werden Sie ihn auffordern, nie wieder einen Fuß
in Ihr Haus zu setzen, und Sie werden gut daran tun, allen fremden
Gesandten sowie den Amsterdamer Bankiers das Kompliment bekanntzugeben,
das Sie diesem unausstehlichen Abenteurer in meinem Auftrage gemacht
haben.
Graf d’Affry an Choiseul
Haag, 21. März 1760.
Graf Rhoon van Bentinck hat mich nicht nur durch Herrn von
Saint-Germain unterrichtet, sondern mir auch durch andere Personen
sagen lassen, wie sehr ihm daran liege, sich mit mir in Verbindung zu
setzen. Ich gab zur Antwort, da ich bisher keinerlei Beziehungen zu
ihm gehabt hätte, schiene es mir zwecklos, jetzt damit zu beginnen.
Ich wäre jedoch stets bereit, mit Personen zusammenzugehen, die es
als gute holländische Patrioten für ihr Land für vorteilhaft hielten,
die Freundschaft und das Wohlwollen Seiner Majestät zu pflegen. Ich
wüßte, daß Herr von Bentinck diese für sein Land wie für ihn selbst
so wünschenswerten Grundsätze stets außer acht gelassen hätte und
daß seine diesbezügliche Sinnesänderung Beweise von längerer Dauer
erheischte, als ihm recht sein möchte. Er hat meine Antwort erhalten,
sich dadurch aber nicht entmutigen lassen.
Ich hielt mich für verpflichtet, den Ratspensionär[187], Herrn van
Slingelandt[188] und Herrn von Hompesch zu[S. 150] benachrichtigen. Wie sie
mir sagten, wünscht Herr von Bentinck eine Annäherung an uns nur,
um seinen Kredit hier und in England aufzufrischen, und er möchte
wahrscheinlich zu einem der Bevollmächtigten der Republik auf dem
künftigen Kongreß[189] ernannt werden.
Haag, 5. April 1760.
Ihren Erlaß vom 19. März über den Grafen Saint-Germain kann ich erst
heute beantworten, weil das indiskrete Benehmen dieses Abenteurers (um
nicht mehr zu sagen) mir Nachforschungen nötig erscheinen ließ, bevor
ich Ihnen Bericht erstatte. Aber dies Benehmen ist derart, daß ich es
für meine Pflicht halte, es zur Kenntnis Seiner Majestät zu bringen.
Am Tage nach Empfang Ihres Schreibens suchte Herr von Saint-Germain,
der aus Amsterdam kam, mich auf. Er kam mit Herrn von Brühl und
Kauderbach[190] und sagte mir, die Herren wollten mit ihm zum Grafen
Golowkin[191] nach Ryswijk, wohin auch ich wollte. Ich sagte Herrn von
Saint-Germain, daß ich ihn vorher zu sprechen wünschte, und teilte ihm
zugleich den Inhalt Ihres Schreibens über seinen Plan mit. Er war davon
niedergeschmettert. Zuletzt bat ich ihn, am nächsten Morgen um 10 Uhr
zu mir zu kommen. Kurz darauf teilte ich Kauderbach den Inhalt Ihres
Schreibens mit, worauf er sofort beschloß, Saint-Germain nicht nach
Ryswijk mitzunehmen.
Saint-Germain ist nicht zu mir gekommen, und da ich glaubte, meine
sehr deutlichen Erklärungen würden hinreichen, um ihn vorsichtig zu
machen, ja ihn zum Verlassen[S. 151] des Landes bestimmen, so hielt ich es
nicht für erforderlich, ihn nochmals zu mir zu bitten, sondern ließ es
dabei bewenden, das, was Sie mir geschrieben haben, an die vornehmsten
Vertreter der Republik und an einige fremde Gesandte mitzuteilen, sowie
Herrn Astier in Amsterdam anzuweisen, die größten Bankhäuser vor den
etwaigen Vorschlägen Saint-Germains zu warnen. Wie Herr Astier mir
mitteilte, haben unter anderen die Herren Thomas und Adrian Hope seinen
Aufenthalt bei ihnen als sehr lästig und peinlich empfunden und wollen
die erste Gelegenheit wahrnehmen, um ihn loszuwerden.
Aber die beiden Briefe des Marschalls Belle-Isle, die Sie mir gesandt
haben, scheinen mir zu beweisen, daß der Mann sich nicht an die
ihm von mir erteilten Weisungen gehalten hat, sondern uns in neue
Schwierigkeiten verwickeln wird. Diese Briefe erhielt ich Dienstag
(1. April). Ich ließ Herrn von Saint-Germain auffordern, mich am
Mittwoch früh aufzusuchen, aber er kam nicht, und vorgestern, am
Donnerstag, sagte mir der Prinz von Braunschweig[192] in Gegenwart
der Herren Golowkin und von Reischach[193], nachdem wir ihm unsere
Gegenerklärungen[194] mitgeteilt hatten, er hätte erfahren, auf Befehl
Seiner Majestät seien die Briefe, die Saint-Germain nach Versailles
gerichtet hat, an mich übersandt worden. Wahrscheinlich würde ich bald
noch andere erhalten; denn er wisse, daß Saint-Germain noch mehrere
sehr lange geschrieben hätte, seit ihm mein Haus von mir verboten[S. 152] sei.
Er selber hätte sich bestimmt geweigert, ihn zu empfangen. Trotzdem
sei ihm bekannt, daß er andere Personen gesehen hätte und daß dieser
Mensch hier noch immer Ränke spänne. Es ließe sich ihm zwar nichts
zur Last legen, aber er sei in diesem Augenblick und hierzulande eine
sehr gefährliche Person, und ein Mensch von solcher Dreistigkeit
könne eine Unterhandlung durch einen einzigen Schritt erschweren und
verzögern. Nun glaubte ich das Wort ergreifen zu müssen und sagte
zum Prinzen Ludwig, ich sei vollauf ermächtigt, ihm sowie den Herren
Golowkin und Reischach zu erklären, daß Saint-Germain von uns völlig
desavouiert werde und daß auf irgendwelche Äußerungen von ihm über
unsere Angelegenheiten oder unsere Regierung nichts zu geben sei. Ich
sagte dem Prinzen von Braunschweig ferner, wenn er Gelegenheit habe,
Herrn Yorke[195] zu sehen, vielleicht am gleichen Tage, so bäte ich ihn
ernstlich, ihm von mir aus die gleiche Erklärung abzugeben. Dasselbe
tat ich gestern morgen beim Ratspensionär und beim Greffier[196].
Vorgestern Abend, nach meiner Rückkehr aus Ryswijck, sandte ich zu
Herrn von Saint-Germain und ließ ihn um seinen Besuch bitten. Er war
nicht zu Hause. Ich sandte ihm eine schriftliche Einladung, mich
gestern früh um acht Uhr aufzusuchen. Ich mußte nochmals nach ihm
schicken; schließlich kam er. Ich hielt es nicht für angezeigt, ihm die
Briefe des Herrn von Belle-Isle zu übergeben, da er schlechten Gebrauch
davon machen könnte, aber ich sagte ihm, der Herr Marschall hätte mir
auf ausdrücklichen Befehl des Königs geboten, alles anzuhören, was
er mir zu sagen hätte. Ich fragte ihn, ob seine Eröffnungen sich auf
unser Militär bezögen; er[S. 153] verneinte es. Ich fragte ihn, ob sie unsere
Flotte oder unsere Finanzen beträfen. Er verneinte es gleichfalls.
Hierauf entgegnete ich, sie könnten also lediglich politischer
Natur sein, und darauf las ich ihm alles vor, was Sie mir über sein
ihm bevorstehendes Schicksal bei seiner Rückkehr nach Frankreich
geschrieben haben. Anfangs trug er große Gleichgültigkeit zur Schau,
dann drückte er sein Erstaunen über die Behandlung aus, mit der man
einen Mann seines Ranges bedrohe, aber schließlich schien ihn die Sache
zu verwirren. Da er indes anscheinend nicht gesonnen war, den Plan,
den sein Betätigungsdrang ihm eingibt, fallen zu lassen, warnte ich
ihn beim Abschied nochmals sehr ernstlich und sagte ihm, wenn er sich
noch weiterhin irgendwie in die Angelegenheiten und Interessen Seiner
Majestät einmische, so würde ich Ihnen das melden und hier öffentlich
sagen, daß alles, was er hier verbreitet habe, von Seiner Majestät und
dessen Ministern völlig dementiert werde.
Sogleich ging ich zu Herrn Yorke ... und fragte ihn, ob Saint-Germain
in seinem Hause gewesen sei. Er sagte, er sei zweimal bei ihm
gewesen[197]. Beim ersten Besuch hätte er mit ihm vom Frieden
gesprochen, und er selbst hätte sich lediglich in allgemeinen Wendungen
über Englands ehrlichen Friedenswillen geäußert. Beim zweiten Besuch
sei er, Yorke, zurückhaltender geworden, da er gehört habe, daß ich
Saint-Germain mein Haus verboten hätte. Er fügte hinzu, daß der Herzog
von Newcastle[198] auf seinen Bericht über den ersten Besuch des Mannes
an ihn geschrieben hätte, er möge ihm erwidern, daß Eröffnungen über
den Frieden von seiten Frankreichs in London stets willkommen seien,
einerlei durch wen sie[S. 154] gemacht würden. Aber ich weiß nicht, ob Herr
Yorke ihm diesen Bescheid mitgeteilt hat.
Ich bitte Sie, Herr Herzog, diesen Bericht dem Herrn Marschall von
Belle-Isle mitzuteilen. Ich bin sicher, daß er jeden brieflichen
Verkehr mit einem Manne abbrechen wird, der sich in der von mir
geschilderten Weise benommen hat. Anbei folgen die beiden Schreiben
zurück, die er mir für Saint-Germain zugesandt hat.
Ich habe Ihnen noch zu sagen, daß Herr von Saint-Germain so anmaßend
ist, überall zu behaupten und sogar mir zu sagen, daß Seine Majestät
so gütig waren, ihm das Schloß Chambord unter den gleichen Bedingungen
zuzuweisen wie dem verstorbenen Marschall von Sachsen, mit Ausnahme der
Einkünfte, die er, wie er sagte, gar nicht zu haben wünschte.
Choiseul an Graf d’Affry
Versailles, 11. April 1760.
Aus meinem besonderen Schreiben über den Grafen Saint-Germain[199]
haben Sie ersehen, welche Meinung ich von diesem unausstehlichen
Abenteurer habe. Ich kann Ihnen versichern, daß alle Minister Seiner
Majestät ebenso denken, und der König läßt Ihnen ausdrücklich befehlen,
Sie sollen den sogenannten Grafen Saint-Germain nicht nur bei allen
Personen in ganz Holland, von denen Sie annehmen können, daß sie diesen
Halunken kennen, mit Schimpf und Schande in Verruf bringen, sondern
Seine Majestät wünscht auch, daß Sie mit Berufung auf die zwischen ihm
und Holland bestehende Freundschaft die Verhaftung dieses Burschen
durchsetzen, damit er nach Frankreich überführt und gemäß der Schwere
seines[S. 155] Vergehens bestraft wird. Es liegt im Interesse aller Herrscher
und der öffentlichen Moral, daß mit solcher Unverschämtheit aufgeräumt
wird, die sich in die Angelegenheiten einer Macht wie Frankreich
einzumischen wagt, ohne dazu ermächtigt zu sein. Nach meiner Meinung
ist das Auslieferungsverlangen in diesem Falle ebenso berechtigt, wie
sonst bei Verbrechern. Somit hofft der König nicht ohne Grund, daß
Saint-Germain auf Ihren Antrag verhaftet und mit sicherem Geleit nach
Lille gebracht wird.
Ich muß gestehen, daß Sie nach meiner Meinung sehr schonend mit ihm
verfahren sind und daß ich vielleicht nach Ihrer letzten Unterredung
mit ihm den Befehl hätte geben sollen, ihm eine gute Tracht Prügel
verabfolgen zu lassen.
Was er Ihnen über Chambord gesagt hat, ist eine Lüge ersten Ranges. Der
König will durchaus, daß dieser Abenteurer alsbald in den Vereinigten
Provinzen in Verruf und Mißkredit gebracht und, wenn möglich, so
bestraft wird, wie sein Unterfangen es verdient. Seine Majestät hat
mich ausdrücklich beauftragt, Sie in seinem Namen aufzufordern, daß Sie
der Sache Ihre volle Aufmerksamkeit widmen.
Nachschrift. Wäre es nicht möglich, außer dem Antrag auf
Auslieferung Saint-Germains bei den Generalstaaten einen Artikel in
die holländischen Zeitungen zu bringen, durch den dieser Halunke ein
für allemal diskreditiert wird, damit alle Betrüger, die ihn nachahmen
wollen, eine Lehre erhalten? Auch dies hat der König vollauf genehmigt,
und Sie werden es voll ausführen, wenn Sie es für möglich halten.
[S. 156]
Graf d’Affry an Choiseul
Haag, 17. April 1760.
Ich habe den Kurier bis heute zurückbehalten, um Ihnen über die
Ausführung Ihrer Befehle, betreffend den sogenannten Grafen
Saint-Germain, eingehend berichten zu können. Gestern suchte ich den
Ratspensionär auf, las ihm alles vor, was Sie mir betreffs dieses
dreisten Abenteurers geschrieben haben, und bat um dessen Verhaftung
und Auslieferung im Namen Seiner Majestät. Das schien ihm Verlegenheit
zu bereiten, aber er versprach mir trotzdem, alles zu tun, was in der
Sache von ihm abhinge ...
Der Greffier sagte mir, er zweifle nicht, daß dieser Mann an uns
ausgeliefert würde. Da jedoch Herr von Bentinck der Vorsitzende des
ständigen Ausschusses ist, von dem die Sache während der Abwesenheit
der Generalstaaten geprüft werden muß, fürchtete ich sofort, man werde
Saint-Germain das Entkommen erleichtern, und diese Befürchtung ist
eingetroffen.
Ich erwartete gestern morgen weitere Nachrichten, als Herr Kauderbach
zu mir kam und mich fragte, ob ich schon von Saint-Germains Flucht
gehört hätte? Ich verneinte es. Darauf sagte er mir, vorgestern abend
zwischen 7 und 8 Uhr sei Herr von Bentinck im Hause dieses Abenteurers
gewesen[200] und hätte es vor 9 Uhr verlassen. Dann wäre Herr Pieck
van Soelen[201] hingekommen, aber nicht lange geblieben. Darauf wäre
Herr von Bentinck zwischen 9 und 10 Uhr nochmals erschienen und bis
nach Mitternacht dageblieben. Herr von Saint-Germain sei zu Bett
gegangen; um 5 Uhr früh hätte er Tee getrunken, und[S. 157] ein Bedienter des
Herrn von Bentinck sei mit einem vierspännigen Mietswagen vor der Tür
erschienen. Der Schwindler hätte ihn bestiegen, aber der Wirt könne
nicht angeben, welche Straße er eingeschlagen habe, noch könne er
sagen, ob Herr von Bentincks Bedienter mitgefahren sei. Diese Abreise
geschah so hastig, daß er im Wirtshause seinen Degen und Koppel,
sowie ein Paket mit Silber- oder Zinnspänen und ein paar Flaschen mit
einer unbekannten Flüssigkeit hinterlassen habe. Ich hielt an mich,
um Herrn Kauderbach meine Entrüstung über das Benehmen des Herrn von
Bentinck zu verbergen. Ich sagte ihm nicht mehr, als ich ihm über das
Auslieferungsgesuch sagen sollte, und fragte nur, ob er all der mir
angegebenen Einzelheiten sicher sei. Er entgegnete mir, er habe sie
von Saint-Germains Gastwirt, einem Sachsen, und schlug vor, diesen zu
mir zu senden. Wir ließen ihn holen, und er bestätigte alles, was Herr
Kauderbach mir gesagt hatte.
Als Herr Kauderbach mein Haus verlassen hatte, ließ ich den
Ratspensionär um eine Audienz bitten. Er war gerade von einem großen
Mahle zurückgekehrt, bei dem er seit 7 Uhr gewesen war, und schob
meinen Besuch bis heute 9 Uhr morgens auf. Ich ging zu ihm und fragte
ihn, wie die Angelegenheit mit Saint-Germain stände. Er entgegnete,
er allein könne die Verantwortung nicht auf sich nehmen, und ich
müsse durchaus Herrn von Bentinck, dem Vorsitzenden des ständigen
Ausschusses, eine Denkschrift überreichen. Der Ausschuß werde wohl
Saint-Germains Verhaftung beschließen, nicht aber seine Auslieferung,
bevor er nicht von den Staaten von Holland bei ihrem demnächstigen
Zusammentritt dazu ermächtigt sei. Ich erwiderte, daß ich auf die
Überreichung einer Denkschrift an Herrn von Bentinck verzichte und ihm[S. 158]
auch den Grund dafür sagen wolle. Dann erzählte ich ihm Saint-Germains
Flucht mit allen Einzelheiten und dem, was vorhergegangen war, ohne
den Gastwirt weiter zu erwähnen, und stellte alles so dar, daß er
glauben mußte, ich hätte das Ein- und Ausgehen des Herrn von Bentinck
in dem Gasthofe und das Erscheinen seines Bedienten mit dem Mietswagen
nur durch die Wachsamkeit meiner Spione erfahren. Er schien mir über
alles, was er hörte, ehrlich entrüstet. Darauf sagte ich ihm, da man
dem Abenteurer vom Haag aus zur Flucht verholfen hätte, hätte er
vielleicht Zuflucht in Amsterdam gefunden, und ich wolle an unseren
Marinekommissar, Herrn Astier, schreiben, er solle den Schurken im
Namen Seiner Majestät verhaften und bis auf weiteren Befehl in sicherem
Gewahrsam halten lassen ... Ferner sagte ich dem Ratspensionär, da
der Abenteurer vielleicht in anderen Provinzen der Generalstaaten
Zuflucht gesucht habe, würde ich zugleich die Genehmigung Seiner
Majestät einholen, einen Antrag an die Hochmögenden zu stellen, und
falls insbesondere die Provinz Holland oder eine andere diesen Akt
der Gerechtigkeit abschlagen oder ihn dadurch vereiteln sollte,
daß sie Saint-Germain zur Flucht behilflich sei, so würden wir ihn
schon zu finden wissen, und ich sei sicher, wenn er in England oder
sonstwo ermittelt würde, daß er nach Friedensschluß unmittelbar an
uns ausgeliefert würde. Letzteres schien den Ratspensionär sehr in
Verlegenheit zu setzen, und es sollte mich nicht wundern, wenn er
in Amsterdam auf unseren Antrag hin verhaftet würde, aber ich bin
überzeugt, daß er die Grenze der Republik bereits erreicht hat.
Die Denkschrift[202], zu deren Einreichung an die Generalstaaten ich
Ihre Erlaubnis erbitte und deren Entwurf ich[S. 159] hier beilege, kann, wenn
es Seiner Majestät genehm ist, in allen Zeitungen erscheinen. Sie wird
diesem Abenteurer einen Stempel aufdrücken, den er nie wieder los
werden wird. Sie ist eine Art von Verurteilung in contumaciam,
die ihn in ganz Europa brandmarkt.
Ich glaube, der Schwindler ist in arger Geldverlegenheit. Er hat sich
von dem Juden Boas[203] 2000 Gulden geborgt, für die er bei dem Juden
drei Opale, falsche oder echte, in einem versiegelten Papier als Pfand
hinterlassen hat. Die 2000 Gulden sollen am 25. d. M. bezahlt werden,
und Herr Boas sagte gestern zu Herrn Kauderbach, wenn der Wechselbrief
am 25. nicht einträfe, würde er die drei Opale öffentlich versteigern
lassen. Betreffs des Herrn von Bentinck werde ich gemäß Ihrem letzten
Erlaß handeln, falls Seine Majestät mir nicht neue diesbezügliche
Befehle erteilt. Wenn ich ihn dieser Tage treffe, werde ich mit ihm
von Herrn von Saint-Germain und dessen Abreise sprechen, ohne mich
bloßzustellen, aber so, daß ich ihn zwinge, sein Benehmen und seine
Beziehungen zu diesem Abenteurer ein für allemal abzuleugnen.
Choiseul an Graf d’Affry
Versailles, 24. April 1760.
Der König genehmigt, daß Sie den Generalstaaten die Denkschrift über
den sogenannten Grafen Saint-Germain einreichen, deren Entwurf Sie mir
übersandten.
Graf d’Affry an Choiseul
Haag, 25. April 1760.
Man glaubt, daß der sogenannte Graf Saint-Germain sich nach England
begeben hat. Ich hörte sagen, er hätte[S. 160] solche Angst vor der Verhaftung
gehabt, daß er nicht in der Stadt Hellevoetsluis zu bleiben gewagt hat,
sondern sich sofort auf ein Paketboot begab, wo er bis zum Augenblick
der Abfahrt blieb, ohne den Fuß an Land zu setzen. Andere glauben, er
sei nach Utrecht gefahren, von wo er Deutschland erreicht haben muß.
II
Denkschrift des Grafen d’Affry an die Generalstaaten[204]
Haag, 30. April 1760.
Hochmögende Herren! Ein Unbekannter, der sich Graf Saint-Germain nennt
und dem mein Herr und König Zuflucht in seinem Reiche gewähren wollte,
hat seine Gnade gemißbraucht. Er ist vor einiger Zeit nach Holland und
seit kurzem nach dem Haag gekommen, wo er ohne irgendeine Vollmacht
Seiner Majestät und des Ministeriums und ohne irgendeinen Auftrag in
schamloser Weise ausgesprengt hat, er wäre zu Unterhandlungen im Namen
des Königs ermächtigt. Mein Herr und König befiehlt mir ausdrücklich,
dies Ihnen, hochmögende Herren, öffentlich mitzuteilen, damit niemand
in Ihrem Machtbereich durch einen derartigen Schwindler getäuscht werde.
Seine Majestät befiehlt mir ferner, die Auslieferung dieses Abenteurers
von dunkler Herkunft zu beantragen, der von Anfang an die ihm
gewährte Zuflucht gemißbraucht hat, indem er sich beikommen ließ,
von der Regierung des Königreiches mit ebenso großer Dreistigkeit
wie Unkenntnis zu reden und die falsche und dreiste Behauptung zu
verbreiten, er sei mit Vertretung der wichtigsten[S. 161] Interessen meines
Herrn und Königs betraut. Seine Majestät zweifelt nicht, daß Sie,
hochmögende Herren, ihm die Gerechtigkeit nicht versagen werden, die
er von Ihrer Freundschaft und Gerechtigkeit erwarten darf, und daß
Sie veranlassen, daß der angebliche Graf Saint-Germain verhaftet und
mit guter Bedeckung nach Antwerpen gebracht wird, um von dort nach
Frankreich überführt zu werden. Ich hoffe auf unverzügliche Gewährung
dieser Bitte.
III
Protokoll der Sitzung der Generalstaaten[205]
Haag, 30. April 1760.
In der Versammlung wurde die Denkschrift des Herrn Grafen d’Affry,
Botschafter Seiner Majestät des Königs von Frankreich, die die Person
eines sogenannten Grafen Saint-Germain reklamierte, verlesen.
Darauf wurde in die Beratung eingetreten. Die Deputierten der
verschiedenen Provinzen haben die erwähnte Denkschrift in Abschrift
entgegengenommen, um sie in ihren Provinzen weiter mitzuteilen. Ferner
wurde einstimmig beschlossen, die Abschrift der obigen Denkschrift dem
Herrn Pieck van Soelen und anderen Mitgliedern der Generalstaaten,
die zum auswärtigen Ausschuß gehören, zur weiteren Prüfung und
Berichterstattung an die Versammlung zu übergeben[206].
[S. 162]
IV
Aus den Aufzeichnungen des Grafen Bentinck[207]
Sonntag, 9. März 1760.
Saint-Germain erzählte mir, England würde dem Frieden keine Hindernisse
in den Weg legen, Frankreich dagegen Schwierigkeiten bereiten. Der
französische König und Frau von Pompadour, der ganze Hof sowie das
gesamte Land verlangten leidenschaftlich nach Frieden. Der Herzog von
Choiseul sei der einzige, der dies Bestreben zu vereiteln suche. Er
habe seinen Einfluß gewonnen, als er am Wiener Hof weilte[208]. Alles
Elend und Mißgeschick in Europa habe der Versailler Vertrag von 1756
verursacht. Durch eine geheime Klausel in demselben sei Flandern dem
Infanten zugesichert, und dafür solle Schlesien nach seiner Eroberung
der Königin von Ungarn abgetreten und übertragen werden[209]. Einen
Weg aus dieser Verlegenheit gebe es: nämlich der Friedensschluß
zwischen England und Frankreich. Das übliche System von Präliminarien,
Kongressen und Konferenzen würde nur die Lösung unbegrenzt
hinausschieben und zu einem neuen Kriege führen. Der bloße Gedanke
lasse einen erschaudern.[S. 163] Sobald man nur einige annehmbare Vorschläge
vorbrächte oder nur etliche aufrichtige und vertrauenswürdige Männer
sich ins Mittel legten, würde seiner Ansicht nach der Friede zustande
kommen, den England ebenso dringend gebrauche wie Frankreich. Der König
und Frau von Pompadour verlangten sehnsüchtig nach Frieden, nicht
minder der englische König. Ebenso wären der Herzog von Newcastle[210]
und Lord Granville[211] dafür eingenommen.
Pitt[212], der jetzt mit
ihnen beiden gemeinsame Sache mache, hätte bisher stets seine Pläne
durchkreuzt; aber er wäre dem Könige verhaßt.
Ein Schotte, namens Crammon, der in Paris lebe, habe ein Schreiben
von Neufville in Amsterdam[213] erhalten, mit dem Auftrage, sich auf
seinen Empfang vorzubereiten. Er bekam noch einen weiteren Brief über
Brüssel aus London, und dieses letztere Schreiben enthielt Andeutungen
über einen Sonderfrieden zwischen Frankreich und England. Diese
Andeutungen kamen vom Herzog von Newcastle und Lord Granville. Frau von
Pompadour habe ihn von dem Inhalt dieses Schreibens unterrichtet; sie
sei hocherfreut gewesen und habe ihm aufgetragen, Choiseul davon in
Kenntnis zu setzen. Nach anfänglicher Weigerung habe er, Saint-Germain,
schließlich nachgegeben. Aber Choiseul verwerfe alles.
Dienstag, 11. März 1760.
Wie Saint-Germain mir sagte, hat er Frau von Pompadour mitgeteilt,
was zwischen mir und ihm vorgefallen[S. 164] ist[214], ... und auch an
den Minister in diesem Sinne geschrieben. Auf meine Frage, wie der
Minister diese Nachricht aufnehmen werde, sagte er lächelnd, doch
mit zuversichtlichem Blick, es werde sich in Versailles bald manches
ändern, und er gab mir zu verstehen, daß es nicht in Choiseuls Macht
liegen werde, den Frieden noch lange zu hintertreiben.
Freitag, 4. April 1760.
Der Ratspensionär Steyn erzählte mir, d’Affry hätte ihm mitgeteilt, daß
die Weisungen Choiseuls, betreffend Saint-Germain, in der Hauptsache
darauf hinausliefen, alles, was Saint-Germain für den Frieden getan
hätte oder tun würde, zu desavouieren. Ferner sei er beauftragt,
Saint-Germain davon zu unterrichten und die Drohung hinzuzufügen, bei
weiterer Einmischung würde er bei seiner Rückkehr nach Frankreich
eingekerkert[215] ...
An demselben Tage speiste Saint-Germain zusammen mit mir und erzählte
mir, d’Affry habe ihm die Befehle mitgeteilt und Choiseuls Brief[216]
gezeigt. Er hätte geantwortet, das werde ihn nie an der Rückkehr nach
Frankreich hindern und diese Drohungen würden nie zur Ausführung
gelangen; sie stammten lediglich von Choiseul. Ferner berichtete er,
er hätte Yorke schon vor 17 Jahren als Kind kennen gelernt und die
Familie Yorke wäre stets die Güte selbst zu ihm gewesen. D’Affry
hätte ihm auch seine häufigen Besuche bei mir vorgehalten, aber er,
Saint-Germain, hätte erklärt, daß er damit fortfahren würde. Dann habe
d’Affry ihm Choiseuls Brief zusammen mit dem gezeigt, den er selbst an
Frau von Pompadour[S. 165] geschrieben habe[217]. Dazu bemerkte Saint-Germain,
nach seiner Überzeugung hätte Choiseul diesen der Frau von Pompadour
gestohlen. Wiederholt hätte ihm d’Affry gesagt, Frankreich werde
nie Vertrauen in mich setzen. Nach allem scheint es, als ob sich
Saint-Germain aus den Weisungen, die d’Affry empfangen hat, wenig
macht, und noch weniger aus Choiseul selbst.
Dienstag, 15. April 1760.
Der Ratspensionär erzählte mir, d’Affry habe ihm die in der letzten
Nacht durch Kurier überbrachten Befehle gezeigt, in denen es hieß,
daß Saint-Germain „ein bloßer Landstreicher“ sei, und daß alles, was
er etwa vorgebracht habe, dementiert werden solle. Es solle Klage
gegen ihn erhoben, er solle festgenommen und nach Lille zur weiteren
Überführung nach Frankreich gebracht und dort eingekerkert werden[218]
... Demgegenüber entwickelte ich meine Ansicht, daß Saint-Germain,
wie andere Fremde, im Vertrauen auf den Schutz der Gesetze
hergekommen sei und auf seine persönliche Sicherheit rechne; daß er
kein Kapitalverbrecher sei, wie Mörder oder Giftmischer, denen kein
Herrscher Schutz gewähre, und daß das Asylrecht in unserer Republik als
geheiligt gelte ... Er stimmte dem zu, schien aber sehr besorgt wegen
der Aufnahme in Frankreich.
Darauf ging ich zum Greffier, der mir in Gegenwart des Ratspensionärs
und ebenso wie dieser von d’Affrys Besuch und seinen Forderungen
erzählte und daß er ihm geraten habe, sich an die Regierung selber
zu wenden usw., daß er aber nicht glaube, die Regierung werde jemand
ausliefern, der im Lande im Vertrauen auf dessen Schutz[S. 166] lebe, und der
sich kein scheußliches Verbrechen, dem kein Herrscher Schutz gewähre,
habe zu schulden kommen lassen.
Mittwoch, 16. April 1760.
Als ich Yorke mitteilte, was ich soeben über Saint-Germain gehört
hatte, erwartete ich, er werde ihn in Schutz nehmen; denn Yorke hatte
mit Saint-Germain zu verhandeln begonnen und ihn ermutigt. Ich habe
seine Originalbriefe an Saint-Germain selbst gesehen; sie sind sehr
freundlich und ermutigend. Statt aber Saint-Germain in Schutz zu
nehmen, nahm er seinen harten, hochmütigen und anmaßlichen Ausdruck
an und sagte, es sei ihm „sehr lieb, Saint-Germain in den Händen
der Polizei zu sehen“. Ich war wie vom Donner gerührt und sagte ihm
mit voller Absicht meine Meinung, freilich in sehr höflicher und
vorsichtiger Weise, um ihn nicht zu verletzen. Aber Yorke blieb dabei
und sagte, er „wüsche sich betreffs Saint-Germains die Hände in
Unschuld“. Auch verweigerte er mir einen Paß für das Paketboot, um den
ich ihn bat. Als ich ihn drängte, sagte Yorke schließlich, wenn ich
einen Paß als persönliche Gunst erbäte, werde er ihn mir „mit
Rücksicht auf meine Stellung“ nicht abschlagen. Ich nahm es an und
betonte, daß d’Affry uns eine Menge Scherereien machen könne, denen
sich vorbeugen ließe, wenn man Saint-Germain die Flucht ermöglichte.
Darauf rief Yorke seinen Sekretär und ließ einen Paß bringen, den er
unterzeichnete und mir unausgefüllt aushändigte, so daß Saint-Germain
seinen eigenen Namen oder irgendeinen anderen hineinsetzen konnte, um
sich den Verfolgungen d’Affrys oder seiner Agenten zu entziehen. Ich
ging mit dem Paß fort, ohne Yorke zu zeigen, wie sehr ich über diesen
Vorfall verletzt und empört war.
[S. 167]
18. April 1760.
D’Affry besuchte mich, und als er von Linnières und seinen Beziehungen
zu Saint-Germain sprach[219], fiel mir dieser Name auf und erregte
meine Neugierde, da ich viel über ihn in England gehört hatte, wo er
längere Zeit gewesen war und in den besten Kreisen verkehrt hatte.
Kein Mensch dort wußte, wer er war. Aber das wunderte mich nicht,
da es in England keine Geheimpolizei gibt. Um so erstaunlicher war
dagegen, daß er in Frankreich unbekannt war. Nur der König, so erzählte
d’Affry, kannte ihn, und in England, wie er glaubte, der Herzog von
Newcastle. Ich berichtete d’Affry, was ich über Saint-Germain, sein
Gebaren, seinen Reichtum, sein prächtiges Auftreten gehört hatte,
ebenso über die Regelmäßigkeit, mit der er seine Schulden bezahlte,
und über die großen Summen, die er in England, wo das Leben teuer ist,
ausgab usw. Darauf bemerkte d’Affry, sicher wäre er ein merkwürdiger
Mann; die seltsamsten Geschichten würden von ihm erzählt, eine immer
abgeschmackter als die andere. Z. B. solle er den Stein der Weisen
besitzen, 100 Jahre alt sein, obwohl er noch nicht wie ein Vierziger
aussähe usw. Meine Frage, ob er ihn persönlich kenne, bejahte er; im
Hause der Prinzessin Montauban sei er ihm begegnet. Saint-Germain sei
in Versailles hochwillkommen und eine bekannte Persönlichkeit gewesen
und habe oft Frau von Pompadour besucht. Er sei verschwenderisch und
trete prächtig auf. Unter anderem erwähnte er seine kostbaren Gemälde,
Juwelen und Kunstgegenstände. An Weiteres erinnere ich mich nicht
mehr ...
[S. 168]
Auf die Mitteilung von Linnières, daß ich seine Bekanntschaft wünschte,
machte mir Saint-Germain im März seinen Besuch. Seine Unterhaltung
gefiel mir außerordentlich; sie war glänzend, voll Abwechslung und
reich an Schilderungen der verschiedenen Länder, die er gesehen hatte
— alles sehr fesselnd. Seinen Urteilen über Personen und Sachen, die
mir bekannt waren, konnte ich nur beipflichten. Sein Auftreten war sehr
höflich und bewies, daß er in der besten Gesellschaft aufgewachsen war.
Mit Frau Geelvinck und Herrn A. Hope[220] war er von Amsterdam
herübergekommen, wo er täglich im Hause des Bürgermeisters
Hasselaar[221] verkehrte. Er hatte von der Hasselaarschen Familie
Empfehlungen an Herrn van Soelen im Haag, der ihn zu Frau von Byland
und anderswohin mitnahm. Am Geburtstag des Prinzen von Oranien[222]
nahm ich ihn nach dem „Alten Hof“ (Oude Hof), wo ich seinen
Namen nannte, zum Ball mit, wo er von den Hasselaars, Frau Geelvinck
und Frau Byland und anderen angesprochen wurde.
Er wollte ursprünglich am Tage nach dem Ball wieder abreisen und hatte
zu dem Zwecke eine Kutsche aus Amsterdam gemietet, um mit den beiden
Damen, die mit ihm gekommen waren, dorthin zurückzukehren. Aber sie
hielten ihn drei bis vier Tage länger auf. Während dieser Zeit war
er täglich mit d’Affry zusammen, bei dem er auch speiste, bevor er
wieder nach Amsterdam abreiste. Ich hatte verschiedene Unterredungen
mit ihm, doch ist das meiste meinem Gedächtnis entfallen. Ich muß noch
bemerken, daß während der Zeit,[S. 169] die zwischen dem Ball und seiner
Abfahrt verstrich, d’Affry im steten Glauben, daß er abreisen wolle,
ihm täglich Wein und Fleisch sandte. Das kann ich persönlich bezeugen,
da ich zugegen war, als d’Affrys Bote ihm zwei Tage hintereinander die
Sachen brachte. Da aber Saint-Germain trotzdem nicht abreiste, kam er
zu Tisch in d’Affrys Haus ...
Ich ging selbst zu Saint-Germain und riet ihm in seinem eigenen
Interesse, sobald als möglich fortzugehen[223]. Ich erzählte, ich wäre
von dritter Seite unterrichtet[224], daß d’Affry Befehl habe, seine
Festnahme zu bewirken, worauf er unter Bedeckung an die Grenze gebracht
und an Frankreich ausgeliefert werden solle, damit er dort für den Rest
seines Lebens eingekerkert würde. Er war außerordentlich überrascht,
nicht sowohl über Choiseuls Befehle, als darüber, daß d’Affry daran
dächte, sie in einem Lande, wo Recht und Gesetz noch Geltung hätten,
zur Ausführung zu bringen. Er stellte eine Menge Fragen, eine immer
gemessener als die andere, und mit der größten Ruhe der Welt. Ich
wollte mich auf keinerlei Erörterung einlassen, da es mir zu schwierig
schien, alle seine Fragen zu beantworten und alle Punkte, die er zur
Sprache brachte, aufzuklären. Ich sagte ihm, dazu wäre keine Zeit; er
solle vielmehr an sofortige Abreise denken, wenn ihm seine Sicherheit
lieb wäre. Bis zum anderen Morgen hätte er für seine Vorbereitungen
Zeit, da d’Affry die Schritte, die er etwa vorhätte, nicht vor 10 Uhr
am nächsten Morgen unternehmen könnte. Vor diesem Zeitpunkte müsse also
Saint-Germain seine Pläne gefaßt und ins Werk gesetzt haben. Darauf
wurde Art und Weise und Ziel der Reise besprochen. Für das erstere
stellte ich mich zur Verfügung; für das letztere riet ich zu England.[S. 170]
Wir einigten uns darüber, und ich erbot mich, ihm von Herrn Yorke den
Paß zu besorgen, dessen er zur Einschiffung auf dem Paketboot bedurfte.
Da ein Schiff am nächsten Tage fahren sollte, drängte ich ihn, sich so
schnell als möglich nach Hellevoetsluis zu begeben. Sei das geschehen,
kämen alle Schritte d’Affrys zu spät ...
Abends zwischen 7 und 8 Uhr brachte ich Saint-Germain den Paß. Er
richtete einen Haufen Fragen an mich, auf die ich aber nicht einging;
vielmehr bat ich ihn, lieber an Wichtigeres zu denken als Fragen zu
stellen, die in der gegenwärtigen Bedrängnis abgeschmackt und nutzlos
seien. Er entschloß sich zur Abreise. Da keiner von seinen Bedienten
Sprache, Straßen und Bräuche des Landes kannte, bat er mich, ihm
einen der meinigen zu leihen, was ich mit Vergnügen tat. Ja, ich
tat noch mehr, ich bestellte einen Mietswagen mit vier Pferden, der
ihn angeblich nach Leiden bringen sollte, für den nächsten Morgen
um 4½ Uhr vor mein Haus und beauftragte einen Diener, den Grafen
Saint-Germain auf den richtigen Weg zu bringen und bei ihm zu bleiben,
bis dieser ihn zu mir zurückschicken würde.
V
Aus Yorkes Korrespondenz[225]
Yorke an Lord Holdernesse[226]
Haag, 14. März 1760.
Da Seine Majestät[227] geruht hat, Frankreich seine Meinung über
die europäischen Verhältnisse im großen und[S. 171] ganzen mitzuteilen und
durch mich seinen Wunsch nach Wiederherstellung der öffentlichen Ruhe
auszudrücken[228], nehme ich an, daß der Versailler Hof diesen Weg als
den gangbarsten ansieht, um sich mit England in Verbindung zu setzen.
Das ist wenigstens der nächstliegende Grund für Frankreichs Versuche,
mich durch einen Dritten auszuforschen.
Euer Lordschaft kennen die Geschichte des seltsamen Mannes, der unter
dem Namen eines Grafen von Saint-Germain bekannt ist. Er hat sich eine
Zeitlang in England aufgehalten[229], ohne irgendwie hervorzutreten;
die zwei bis drei letzten Jahre hat er in Frankreich verbracht, wo
er auf vertrautestem Fuße mit dem König von Frankreich, Frau von
Pompadour, dem Marschall von Belle-Isle usw. stand. Das hat ihm das
Geschenk des königlichen Schlosses Chambord eingetragen und ihn instand
gesetzt, in jenem Land eine gewisse Rolle zu spielen. In meinen
Privatbriefen glaube ich schon einmal von diesem Phänomen gesprochen zu
haben.
Der Mann ist vor ein paar Tagen hier angekommen. Er tauchte für einige
Tage in Amsterdam auf, wo er sehr umschmeichelt wurde und wo man viel
von ihm redete. Anläßlich der Hochzeit der Prinzessin Karoline[230]
kam er nach dem Haag, wo er der gleichen neugierigen Aufmerksamkeit
begegnete. Seine Zungenfertigkeit warb ihm Zuhörer; der Freimut, mit
dem er über alles mögliche sprach, erregte allerlei Vermutungen,
nicht zuletzt die, daß er als Friedensunterhändler gekommen sei. Herr
d’Affry[S. 172] behandelt ihn mit Achtung und Aufmerksamkeit, ist aber sehr
eifersüchtig auf ihn. Ich für mein Teil kümmerte mich nicht um ihn
und habe mir nicht einmal die Mühe gegeben, meine Bekanntschaft mit
ihm zu erneuern. Trotzdem sprach er bei mir vor, ich erwiderte seinen
Besuch, und gestern wünschte er mich zu sprechen, erschien aber nicht
zur bestimmten Stunde. Heute früh wiederholte er seine Bitte, und ich
empfing ihn.
Er sprach zunächst von der schlechten Lage Frankreichs, von seinem
Friedensbedürfnis und seinem Wunsch, Frieden zu schließen, sowie
von seinem eigenen Ehrgeiz, zu einem für die gesamte Menschheit so
erwünschten Ziele beizutragen. Schließlich betonte er seine Vorliebe
für England und Preußen, die ihn nach seiner Behauptung in Frankreich
jetzt beliebt mache. Da ich ihn zur Genüge kenne und mich auf eine
Unterhaltung mit ihm, ohne näher unterrichtet zu sein, nicht einlassen
wollte, war ich zuerst sehr ablehnend und sagte ihm, dergleichen
Dinge seien zu heikel, um sie mit unberufenen Leuten zu erörtern; ich
wünschte daher seine Absichten kennen zu lernen.
Dies Verfahren verfehlte seinen Zweck nicht; denn sofort zeigte er mir
als Beglaubigungsschreiben zwei Briefe des Marschalls von Belle-Isle
vom 14. und 26. Februar. In dem ersteren sandte ihm der Marschall einen
Blankopaß des Königs von Frankreich mit der Erlaubnis, ihn auszufüllen.
In dem zweiten wartete er mit Ungeduld auf Nachrichten von ihm, und
in beiden ergeht er sich in Lobeserhebungen über seinen Eifer, sein
Geschick und die Hoffnungen, die er auf den Zweck seiner Sendung setze.
An der Echtheit beider Briefe zweifle ich nicht. Nachdem ich sie
gelesen und ihm ein paar übliche Komplimente gemacht hatte, bat ich
ihn, sich zu erklären, was er folgendermaßen tat.
[S. 173]
Der König, der Dauphin, Frau von Pompadour, der ganze Hof und das
gesamte Volk, mit Ausnahme Choiseuls und Berryers[231], wünschen
Frieden mit England. Sie könnten nicht anders, da die innere Lage es
fordere. Die wahre Gesinnung Englands ist ihnen unbekannt, und sie
wünschen mit Anstand aus der Sache herauszukommen. Herr d’Affry ist
nicht eingeweiht, und der Herzog von Choiseul ist so österreichisch
gesinnt, daß er nicht alles ausplaudern wird; aber das hat nichts zu
bedeuten, denn er wird hinausgesetzt werden. Frau von Pompadour ist
nicht für den Wiener Hof, aber sie ist unentschlossen, weil sie nicht
weiß, auf wen sie sich verlassen kann. Sie wird aber entschlossen
werden, sobald sie des Friedens gewiß ist. Der Marschall von Belle-Isle
hat mit Wissen des Königs von Frankreich den Grafen Saint-Germain als
Fühler vorgeschoben. Auf Spanien rechnet man nicht und macht sich in
dieser Hinsicht keine Hoffnungen[232], obgleich der Herzog von Choiseul
sich bemüht, diesen Glauben zu erwecken. Das und vieles andere brachte
der politische Abenteurer vor.
Ich schwankte sehr, ob ich ihm gegenüber auf die Sache eingehen sollte;
da ich aber von der Richtigkeit seiner Sendung überzeugt war, glaube
ich keine Mißbilligung zu finden, wenn ich in allgemeinen Wendungen
antwortete. Ich sagte ihm also, der König wünsche ernstlich den
Frieden, und daran sei kein Zweifel möglich, da er ja inmitten seiner
Erfolge, die seitdem noch beträchtlich zugenommen hätten, die Hand
zum Frieden geboten habe. Mit unseren Verbündeten[233] sei die Sache[S. 174]
leicht, aber ohne sie unmöglich, und Frankreich kenne unsere Lage zu
gut, um sie erst von mir erfahren zu müssen. Auf Einzelheiten könne
man jedoch erst eingehen, wenn wir vom ernstlichen Friedenswunsch der
Gegner überzeugt seien; zudem sei ich nicht eingeweiht. Ich ging dann
auf Frankreichs Abhängigkeit von den beiden Kaiserinnen[234] und auf
die unangenehmen Aussichten ein, die sich für Frankreich böten, selbst
wenn der König von Preußen Unglück hätte. Aber ich hütete mich wohl,
über die allgemeinsten, wenn auch durchaus positiven Versicherungen
hinauszugehen, daß Seine Majestät die Wiederherstellung des Friedens
wünsche.
Als das Gespräch lebhafter wurde, fragte ich ihn, welcher Verlust für
Frankreich am empfindlichsten gewesen sei? Ob es Kanada[235] wäre?
„Nein,“ sagte er, „denn wir wissen, daß es uns 36 Millionen gekostet
hat, ohne uns etwas einzubringen.“
„Guadalupe?“
„Deswegen wird der Frieden nicht scheitern, denn wir haben auch ohne
diese Insel Zucker genug.“
„Ostindien?“
„Das ist der empfindliche Punkt, denn es hängt mit unserer Finanzlage
zusammen.“
Ich fragte ihn, was man von Dünkirchen dächte.
„Man wird es ohne Schwierigkeit schleifen; darauf können Sie sich
verlassen.“
Nun fragte er mich, was wir von Minorka dächten.
Ich entgegnete ihm, wir hätten es vergessen, wenigstens spräche niemand
mehr davon.
[S. 175]
„Das“, sagte er, „habe ich ihnen hundert und tausendmal gesagt. Auch
die Kostenfrage brächte uns sehr in Verlegenheit.“
Das sind die Hauptpunkte einer dreistündigen Unterredung, über die ich
ihm zu berichten versprach.
Er bat mich um Geheimhaltung und sagte, er ginge nach Amsterdam und
Rotterdam, bis er erführe, daß ich eine Antwort erhalten hätte.
Ich habe ihn nicht ermutigt, darauf zu warten, aber auch nicht das
Gegenteil getan.
Ich hoffe, Seine Majestät wird mein Benehmen nicht mißbilligen. Es ist
in solchen Verhältnissen nicht leicht, das Rechte zu treffen, aber
ich kann diese Verhandlungen ebenso leicht abbrechen, wie ich sie
angeknüpft habe. Der König scheint ja dem Frieden eine Tür öffnen zu
wollen, und Frankreich scheint ihn sehr nötig zu haben. Die Gelegenheit
scheint günstig, aber bevor ich weiter gehe, erwarte ich Weisung. Ein
allgemeiner Friedenskongreß scheint nicht nach Frankreichs Geschmack,
und man scheint weiter gehen zu wollen, als man gesagt hat, aber es
wäre Frankreich sehr angenehm, wenn man ihm irgendein Angebot machte;
denn Seine Allerchristlichste Majestät und die Marquise sind etwas
schwer von Entschluß.
Lord Holdernesse an Yorke
Whitehall, 21. März 1760.
Ich kann Ihnen zu meiner Freude mitteilen, daß Seine Majestät Ihr
Verhalten bei der Unterredung mit dem Grafen Saint-Germain, die Sie
durch Geheimbericht vom 14. melden, durchaus billigt. Insbesondere ist
es dem König lieb, daß Sie so vorsichtig waren, nicht auf Einzelheiten
einzugehen, bevor er die beiden Briefe des Marschalls von Belle-Isle
vorzeigte, die, wie Sie richtig bemerken,[S. 176] eine Art Vollmacht waren.
Da Sie ihm gegenüber nur in allgemeinen Wendungen und gemäß Ihren
früheren Instruktionen gesprochen haben, würde es auch nichts schaden,
wenn Ihre Worte öffentlich bekannt würden. Seine Majestät hält es
für wahrscheinlich, daß der Graf Saint-Germain — vielleicht sogar
mit Vorwissen des Königs von Frankreich — von einigen Mitgliedern
des Staatsrats tatsächlich beauftragt war, so zu reden, und es ist
einerlei, durch welche Mittelsperson man zum erwünschten Ziele kommt.
Weiter aber dürfen die Unterhandlungen zwischen einem beglaubigten
Gesandten Seiner Majestät und einer Persönlichkeit wie Saint-Germain,
so wie dieser bisher auftritt, nicht gehen. Alles, was Sie sagen,
ist offiziell, wogegen Saint-Germain kurzerhand verleugnet werden
kann, wenn es dem französischen Hofe paßt. Deshalb ist sein Auftrag
auch nicht nur dem französischen Gesandten im Haag unbekannt, sondern
auch dem Minister des Auswärtigen in Versailles, der, wenn ihn auch
das gleiche Los treffen kann, wie seinen Vorgänger, Kardinal von
Bernis[236], doch der offizielle Minister ist.
Seine Majestät wünscht also, daß Sie dem Grafen Saint-Germain
sagen sollen: in Beantwortung des Berichtes, den Sie mir über Ihre
Unterredung mit ihm schrieben, hätten Sie Befehl erhalten, ihm zu
sagen, Sie könnten mit ihm über so wichtige Dinge nur reden, wenn
er einen authentischen Beweis dafür beibrächte, daß er tatsächlich
mit Wissen und Wollen Seiner Allerchristlichsten Majestät handle.
Zugleich aber können Sie hinzufügen, da der König stets geneigt
sei, die Reinheit seiner Gesinnung und seinen ehrlichen Wunsch nach
Vermeidung jedes weiteren Vergießens von Christenblut zu beweisen, sei
er bereit, sich über die Friedensbedingungen auszulassen,[S. 177] wenn der
französische Hof einen gehörig beglaubigten Unterhändler schickte.
Dabei werde jedoch vorausgesetzt, daß, wenn beide Kronen sich über
die Friedensbedingungen einigten, der französische Hof ausdrücklich
und zuverlässig seine Zustimmung erklärte, daß die Verbündeten
Seiner Majestät, insbesondere der König von Preußen, in das Abkommen
einbegriffen werden. Ich brauche nicht hinzuzufügen, daß England sich
auf keine Friedensunterhandlungen einläßt, in die Seine Majestät nicht
als Kurfürst [von Hannover] eingeschlossen wird.
Yorke an Lord
Holdernesse
Haag, 28. März 1760.
Gestern morgen besuchte mich der Graf Saint-Germain, da ich ihn hatte
wissen lassen, daß ich ihn sprechen möchte. Ich erklärte ihm offen,
weitere Verhandlungen mit ihm seien unmöglich, wenn er nicht eine
Vollmacht, die von dem König von Frankreich oder in dessen Namen
ausgestellt sei, vorweisen könne. Ich sagte ihm, ich sei beglaubigt
und er nicht, und daher könne alles, was er sage, sogleich desavouiert
werden, wogegen alles, was von mir käme, das Gepräge der mir vom
König verliehenen Eigenschaft trage. Ich betonte das als Einleitung
zu den Eröffnungen, die ich auf Weisung Eurer Lordschaft vom 21. ds.
Mts. machen sollte. Ich setzte hinzu, obwohl es klar sei, daß die
Meinungen am französischen Hofe auseinandergingen, würden wir nicht mit
verschiedenen Personen unterhandeln, die teils Vollmacht hätten und
teils nicht. Da, wie er wisse, der König seinen Feinden einen Kongreß
offen angeboten habe und dank der unvergleichlichen Hochherzigkeit
Seiner Majestät Unterhandlungen mit Herrn d’Affry hätten angeknüpft
werden[S. 178] können, sei jede weitere Erörterung über die Nutzlosigkeit und
Unzweckmäßigkeit weiterer Schritte von unserer Seite zwecklos, wenn wir
keine Gegenliebe fänden.
Nachdem ich dies vorausgeschickt hatte, sagte ich zu ihm: Ganz
abgesehen von der Person, deren Briefe er mir früher gezeigt hätte,
und in der Überzeugung, daß er ein so heilsames Werk ehrlich zu
fördern wünsche, hätte der König mir erlaubt, ihm mitzuteilen, daß
Seine Majestät auch künftig einer Aussöhnung mit dem französischen
Hofe geneigt sei. Das könne jeden Wohlmeinenden von der Lauterkeit der
Gesinnung Sr. Majestät überzeugen. Demgemäß teilte ich ihm die Weisung
Eurer Lordschaft mit und erlaubte ihm auf seine Bitte, Abschrift von
dem letzten Teile zu nehmen, von den Worten: „Seine Majestät wünscht
also“, bis zum Schluß.
So weit bin ich gemäß dem mir erteilten Auftrag gegangen. Da jedoch
seit meinem letzten Bericht über den Grafen von Saint-Germain ein
Zwischenfall eingetreten ist, über den d’Affry (der noch nichts über
meine Unterredung mit ihm weiß) ganz offen gesprochen hat, wünschte ich
die Geschichte aus seinem eigenen Munde zu hören, und er erzählte mir
folgendes:
Am Sonntag (23. März) erhielt d’Affry einen Kurier vom Herzog von
Choiseul mit der Weisung, zu erklären, Saint-Germain hätte keinerlei
Auftrag vom Versailler Hofe, und er (d’Affry) solle ihn wissen lassen,
daß er nicht in seinem Hause verkehren dürfe, ja er solle ihm dies
sogar verbieten[237]. Das teilte d’Affry dem Saint-Germain am Mittwoch
(26. März) bei seinem Besuche mit, und zwar im Namen des Königs von
Frankreich. Als dieser aber den Befehl zu sehen verlangte, da er sich
nicht denken[S. 179] konnte, daß er vom König selbst käme, räumte d’Affry
ein, daß der Befehl nicht vom König selbst, sondern vom Herzog von
Choiseul als Staatssekretär des Auswärtigen käme. Dies begleitete er
mit Versicherungen seiner Hochachtung und drückte zugleich den Wunsch
aus, ihn am nächsten Tage nochmals zu sprechen. Saint-Germain jedoch
lehnte dies ab, da er nicht gewillt sei, den Gesandten nochmals zu
einem Verstoß gegen seine Befehle zu veranlassen, die er bereits
durch seinen Empfang übertreten hätte. D’Affry ließ einfließen, daß
dieser Befehl die Folge eines Briefes sei, den Saint-Germain an die
Marquise von Pompadour geschrieben hätte[238], und durch den er, wie
er sich ausdrückte, in Versailles in Teufels Küche geraten sei, obwohl
er leugnete, von dem Inhalt des Briefes das geringste zu wissen.
Saint-Germain berief sich auf die ihm bei seinem ersten Besuche
gegebenen Beweise dafür, daß er nicht ohne Vollmacht sei, und erklärte,
daß die möglichen Folgen seiner Briefe ihm keine Kopfschmerzen
verursachten, was den Gesandten einigermaßen mißtrauisch machte.
Schließlich verabschiedete er sich kurzerhand. Nichtsdestoweniger ließ
d’Affry sich gestern wieder nach ihm erkundigen. Dabei ließ er ihm sein
Bedauern ausdrücken, ihn nicht gesehen zu haben, und seine Besorgnis,
er möchte unpäßlich sein. Ob er seitdem bei ihm war, weiß ich nicht.
Diese neue Episode in dem Roman Saint-Germains verwundert mich nicht
sehr. Ebensowenig sollte es mich wundern, wenn über kurz oder lang ein
mächtiger französischer Minister seinem Treiben ein Ende macht, obwohl
er behauptet, sich vor nichts zu fürchten.
[S. 180]
Ich war jedoch begierig zu erfahren, was er nun vorhat und wie er sein
Unternehmen fortsetzen will. Mir scheint, fürs nächste wird er nicht
recht wissen, was er tun soll. Ob aus Furcht vor dem Groll des Herzogs
von Choiseul, oder, wie er behauptet, wegen der Tatlosigkeit des Königs
von Frankreich und der Unschlüssigkeit der Marquise, vermag ich nicht
zu sagen. Aber ich fand ihn im Zweifel darüber, ob er nicht versuchen
solle, den Herzog von Choiseul selbst für das System zu gewinnen, das
seine eigenen Auftraggeber seiner Ansicht nach vertreten. Es war nicht
meines Amtes, ihn dazu zu ermutigen, und so sagte ich nur, die Sache
schiene mir, aus der Entfernung gesehen, heikel zu sein und könnte
seine Beschützer in Ungelegenheit bringen.
Dann suchte ich von ihm zu erfahren, in welcher Weise er von meinen
Eröffnungen Gebrauch machen werde, und ob er selbst nach Versailles
zu gehen gedächte. Dies lehnte er fürs erste ab, da er, wie er sagte,
sonst gleich wieder zurückgeschickt würde und nur neuen Argwohn
erregen müßte. Doch wollte er einen seiner Diener mit drei Briefen
absenden, einem an die Frau von Pompadour, einem an den Marschall von
Belle-Isle und dem dritten an einen Prinzen von Geblüt, den Grafen von
Clermont[239], den er anfangs als seinen Busenfreund und als einen
Mann hingestellt hatte, der des Königs Vertrauen unabhängig von seinen
Ministern besäße und sehr für einen sofortigen Friedensschluß mit
England einträte.
Um jeden Verdacht zu zerstreuen, zeigte er mir tatsächlich einen Brief
dieses Prinzen an ihn vom 14. d. M., der in den freundschaftlichsten
und herzlichsten Ausdrücken[S. 181] gehalten war, seine Abwesenheit beklagte
und seine baldige Rückkehr herbeiwünschte. Er hegte keinen Zweifel,
daß er von den beiden Letztgenannten Antworten erhalten würde. Von
Frau von Pompadour, sagte er, erwarte er dies nicht, denn es wäre bei
ihr Grundsatz, über Staatsangelegenheiten nichts zu schreiben,
obwohl es unbedingt nötig sei, sie zu unterrichten, damit sie in den
Stand gesetzt werde, ihrerseits zu wirken.
Das alles klingt sehr wahrscheinlich, aber der Erfolg muß sich erst
noch zeigen. Inzwischen ist es klar, daß die französischen Minister
gegeneinander arbeiten und somit verschiedene Systeme verfolgen.
Welches den Sieg davontragen wird, hängt nicht von uns ab, aber es kann
für den königlichen Dienst nicht nachteilig sein, daß die Gesinnung
Seiner Majestät am französischen Hofe bekannt wird, einerlei durch
welche Mittelsperson dies geschieht.
Daß d’Affry dem Grafen Saint-Germain noch Komplimente macht, nachdem er
ihm den Befehl des Herzogs von Choiseul mitgeteilt hatte, ist ebenso
ungewöhnlich wie das übrige, zumal er dessen Beziehungen zum Marschall
von Belle-Isle sehr wohl kennt und den vom König ihm ausgestellten Paß
gesehen hat.
Dies ganze Mysterium wird nach und nach aufgeklärt werden, und ich
werde nicht verfehlen, Euer Lordschaft von allem zu unterrichten,
was ich darüber erfahren kann. Ich ließ Saint-Germain wissen, daß
er oder irgendeine andere gehörig beglaubigte Person England genehm
sei. Was wir gegenwärtig einzuwenden hätten und was die ganze Sache
zum Stillstand brächte, sei der Mangel einer richtigen, ausreichenden
Vollmacht.
[S. 182]
VI
Aus Hellens Korrespondenz mit Friedrich dem Großen[240]
Hellen an König Friedrich
Haag, 15. März 1760.
Hier ist soeben eine Person eingetroffen, die vielleicht weitgehende
Aufträge hat. Es ist eine Art Abenteurer, ein Mann, dessen Vaterland
unbekannt ist. Er durchstreift seit mehreren Jahren die Welt, tritt
überall groß auf, spricht alle neueren Sprachen und nennt sich Graf
Saint-Germain. Ich hatte bereits die Ehre, E. M. einen Immediatbericht
darüber zu senden, wie weit dieser Mann es verstanden hat, sich beim
Versailler Hofe beliebt zu machen[241]. Wie man mir versichert, hat ihm
der König von Frankreich soeben das Schloß Chambord geschenkt. Er ist
seit etwa 3 Wochen in Holland, mit einer Empfehlung an Herrn Hope[242],
den reichsten Kaufmann in Amsterdam, bei dem er sogar vierzehn Tage
gewohnt hat. Hier hat er Empfehlungen an die reichsten portugiesischen
Juden. Wie behauptet wird, hat er den Auftrag, über 30 Millionen
(Anleihe) für Frankreich zu verhandeln, aber ich neige zu der Ansicht,
daß er andere Aufträge hat, und zwar ohne Wissen des Grafen d’Affry,
der ihn zwar höflich behandelt, aber im Grunde sehr eifersüchtig auf
ihn ist.
Gestern bat er um eine Unterredung mit dem General Yorke, die 2 Stunden
gewährt hat. Das sagte mir dieser[S. 183] am Abend ins Ohr, mit dem Zusatz,
er schiene beauftragt, ihn auszuforschen, und er würde mir bei anderer
Gelegenheit mehr darüber sagen. Ich hoffe, mit der nächsten Post
darüber berichten zu können[243].
Heute muß ich mich auf die Meldung beschränken, daß der Mann viel
schwatzt, sich als Gegner Österreichs ausgiebt und Frankreich wegen
seines Bündnisses mit Wien laut tadelt. Dagegen ist er ein großer
Anhänger Eurer Majestät. Ich selbst hörte ihn neulich ganz laut in
Gesellschaft und fast in nächster Nähe des Barons Reischach[244] sagen,
Frankreich hätte sich sehr unklug benommen.
König Friedrich an Hellen
Freiberg, 22. März 1760.
Ich kann mir kaum vorstellen, daß der König von Frankreich einen
Menschen, den man eigentlich nur als Abenteurer ansehen kann, mit
einem so wichtigen Auftrag wie Friedensverhandlungen betraut. Sie
werden daher gut tun, sich nicht auf den Anschein noch auf unbestimmte
Gerüchte zu verlassen, sondern dem Mann scharf auf die Finger zu sehen.
Es scheint mir wohl möglich, daß er den Auftrag hat, wegen einer
Anleihe zu verhandeln, aber dreißig Millionen kommen mir doch etwas
stark vor.
Freiberg, 23. März 1760.
Ihr Bericht vom 18. d. M.[245] ist mir richtig zugegangen. Sehr
befriedigt hat mich Ihre genaue Wiedergabe der[S. 184] Unterredung zwischen
Yorke und dem Grafen von Saint-Germain. Es giebt wohl nichts
Seltsameres, aber sie ist sehr fesselnd.
(Hellen soll Yorke im Namen des Königs für die Mitteilung danken und
ihm Verschwiegenheit zusichern.)
Indes habe ich meinem Gesandten in England einiges über diese
Unterredung vertraulich mitgeteilt und ihn angewiesen, beim englischen
Ministerium nach Kräften darauf zu dringen, daß es jetzt sobald wie
möglich seine Weisungen dem General Yorke giebt, damit er genau weiß,
welche Friedensbedingungen England für sich und seine Verbündeten
Frankreich gegenüber stellt, und was es von seinen Eroberungen behalten
oder den Franzosen zurückgeben will. Ist man erst soweit, dann lassen
sich schnell bestimmte, klare und unzweideutige Präliminarartikel
vereinbaren, die zur Herstellung des Friedens und als Grundlage für den
allgemeinen Kongreß dienen können.
Hellen an König Friedrich
Haag, 29. März 1760.
(Hellen berichtet über die weitere Unterredung Yorkes mit
Saint-Germain am 27. März, vgl. S. 177 ff.)
Mittlerweile ist ein sonderbarer Zwischenfall eingetreten. Am
vergangenen Sonntag (23. März) erhielt Graf d’Affry einen Kurier vom
Herzog von Choiseul mit dem Befehl, den Grafen von Saint-Germain nicht
mehr zu empfangen und den alliierten Gesandten[246] zu versichern,
daß er keinerlei Auftrag hätte. Man wird ja bald sehen, ob Frankreich
diesen Mann als Unterhändler benutzen oder ihn verleugnen und den
Gesandten mit Unterhandlungen betrauen wird. Das letztere würde
beweisen,[S. 185] daß der Staatssekretär und die österreichische Partei noch
das Übergewicht haben.
Haag, 1. April 1760.
Es wäre sicherlich recht eigenartig, wollte Frankreich einen Mann
wie den Grafen Saint-Germain mit einer so wichtigen Unterhandlung
wie der des Friedens betrauen. Zieht man jedoch in Betracht, daß
diese Persönlichkeit — welcher Art sie auch nach Aussage aller aus
Frankreich kommenden anständigen Leute ist — in Versailles aus und
ein geht, mit der Favoritin, dem Marschall Belle-Isle und den ersten
Personen am Versailler Hofe auf bestem Fuße steht, daß der König
von Frankreich ihm ganz gewiß das Schloß Chambord geschenkt hat,
daß der Marschall Belle-Isle ihm persönlich einen Blankopaß Seiner
Allerchristlichsten Majestät schickte, — so erscheint es keineswegs
unmöglich, daß er in höherem Auftrag handelt.
Als er hier ankam und dem Grafen d’Affry diesen Blankopaß und die
Schreiben (Belle-Isles) zeigte, empfing ihn der Botschafter mit
Auszeichnung, gab ihm Soupers, führte ihn in seine Theaterloge usw.
Allerdings hat er ihm darauf, wenn auch äußerst höflich, gesagt: „Sie
haben sich in Versailles furchtbare Unannehmlichkeiten durch einen
Brief an die Marquise zugezogen. Ich habe eben einen Kurier mit einem
Befehl des Königs erhalten, Sie nicht mehr bei mir zu empfangen.“
Darauf verlangte der Graf von Saint-Germain diesen Befehl zu sehen,
und d’Affry mußte einräumen, daß er nicht von Sr. Majestät selbst
stamme, sondern vom Staatssekretär. Hierauf erwiderte Saint-Germain:
„Das macht mir wenig aus“ und verabschiedete sich ziemlich plötzlich
von dem Gesandten, der ihn bat, am nächsten Tage wiederzukommen, da er[S. 186]
sehr gern mit ihm plaudern werde. Doch jener entgegnete: „Gestatten
Sie, Herr Botschafter, daß ich dies nicht tue. Ich möchte Sie nicht ein
zweites Mal in Gefahr bringen, Ihren Befehlen zuwiderzuhandeln.“
So hat Saint-Germain den Vorfall dem General Yorke selbst erzählt[247].
Aber noch merkwürdiger ist, daß Graf d’Affry am übernächsten Tage
nochmals zu ihm geschickt haben soll, um sich nach ihm zu erkundigen,
indem er sagen ließ, er fürchte, daß er nicht wohl sei, da er seinen
Besuch am Tage zuvor erwartet und ihn leider nicht gesehen hätte.
Übrigens hat der Graf dem englischen Gesandten noch einen sehr
freundschaftlichen Brief des Grafen von Clermont vom 14. März gezeigt,
worin dieser ihn fast wie seinesgleichen behandelt[248]. Nach seiner
Angabe steht Graf Clermont in hohem Ansehen und ist sehr zum Frieden
geneigt.
Haag, 5. April 1760.
Der Herzog von Choiseul, der sich dem Wiener Hofe verkauft hat, besitzt
ständig großen Einfluß in Versailles. Das sieht man wieder an der Art,
wie er gegen den Grafen Saint-Germain verfährt. Der Staatssekretär
hat dem Grafen d’Affry mit der Pferdepost soeben einen zweiten Brief
geschrieben, worin er ihm befiehlt, ihm bei seiner Rückkehr nach
Frankreich mit einem Kerkerloch zu drohen, falls er sich noch weiter in
Dinge mischte, zu denen er keinen Auftrag hätte[249]. Dieser ganze Zorn
kommt von einem ersten Briefe des Genannten an die Marquise[250], den
sie so schwach war, dem Staatssekretär mitzuteilen. Soviel ich glaube,
war dies aber noch nicht der Bericht über seine Unterredungen[S. 187] mit
dem englischen Gesandten. D’Affry hat den Befehl gestern ausgeführt,
aber der Graf hat ziemlich selbstbewußt geantwortet, wenn man ihm
(Choiseul) den Inhalt seines ersten Briefes mitgeteilt hätte, würde
man ihm wahrscheinlich auch die folgenden mitteilen. Recht merkwürdig
ist jedoch, daß der Marschall Belle-Isle dem Grafen durch Vermittlung
des Grafen d’Affry geantwortet und ihn dabei etwas ausgescholten hat,
freilich in sehr schonender Form. Er sagt, der König von Frankreich
habe im Haag einen Gesandten, der sein Vertrauen besitze, und er werde
dem Grafen d’Affry selber schreiben; trotzdem sei er überzeugt, daß den
Grafen Saint-Germain die besten Absichten beseelten.
Bei alledem glaubt der englische Gesandte, der Mann sei nicht
zuverlässig und seiner Sache nicht hinreichend sicher. Er wies darauf
hin, daß Saint-Germain, als er ihm den Befehl seines Hofes mitteilte,
die Neigung durchblicken ließ, den Staatssekretär auf irgendeine Weise
in Kenntnis zu setzen, während er doch früher gesagt hatte, er wolle
ihn stürzen. Er besann sich dann freilich eines anderen und sagte,
er wolle nur an die Favoritin, den Marschall und den Grafen Clermont
schreiben[251]. Seitdem ist er nicht mehr beim englischen Gesandten
erschienen und hat nur für gestern abend um eine Audienz gebeten, aber
ich weiß noch nicht, ob er vorgelassen wurde oder nicht ...
Übrigens erzählte Graf d’Affry dem englischen Gesandten, welche Befehle
er betreffs Saint-Germains erhalten hätte, und fragte ihn, ob er ihn
gesehen habe. Der Gesandte antwortete, er hätte ihm nichts gesagt,
was er nicht überall wiederholen könne. „Das hat er mir auch selbst
gesagt“, entgegnete der Franzose[252].
[S. 188]
König Friedrich an Hellen
Freiberg, 8. April 1760.
Die Einzelheiten Ihres Berichtes vom 29. März waren sehr beachtenswert.
Was den Grafen Saint-Germain und das Rundschreiben über ihn betrifft,
das der Herzog von Choiseul an die Gesandten der Verbündeten
Frankreichs im Haag erlassen hat, so muß sich jetzt bald herausstellen,
ob der Graf Vollmacht hatte oder nicht. Im ersteren Falle ist es
klar, daß der Staatssekretär über die wirkliche Denkweise und die
wahren Absichten seines Hofes nicht genau Bescheid weiß. Wie dem
aber auch sei, durch die Schritte des Grafen sind die Dinge zwischen
Frankreich und England in Fluß gekommen, und wenn Frankreich ernstlich
gewillt ist, die Partie abzubrechen und Frieden mit uns Alliierten zu
schließen, so muß es sich jetzt England gegenüber bald erklären.
Hellen an König Friedrich
Haag, 22. April 1760.
Soviel steht fest: die Reden, die Graf Saint-Germain geführt hat,
haben wenigstens die Wirkung gehabt, daß der Herzog von Choiseul der
Friedensströmung im Versailler Kabinett nicht ganz hat widerstehen
können. Unseres Wissens hat man ihm auch nicht die letzten Berichte
des Grafen mitgeteilt. Wenigstens schien der Botschafter davon keine
Kenntnis zu haben, aber der besagte Staatssekretär ist so in Wut auf
den armen Teufel geraten, daß er den Grafen d’Affry beauftragt hat,
seine Verhaftung und Auslieferung zu beantragen. Dieser hat auch schon
tatsächlich mit den Vertretern der Republik darüber gesprochen. Als
aber Graf Bentinck davon erfuhr, hat er[S. 189] Saint-Germain mit Wissen des
Prinzen Ludwig[253] sofort davon benachrichtigt und ihm einen Paß vom
General Yorke beschafft, damit er nach England fliehen kann[254].
Gekränkt, wie er ist, kann der Graf dort sehr gute Nachrichten über die
jetzigen Finanzen Frankreichs geben, über die er genau Bescheid weiß.
Haag, 3. Mai 1760.
E. M. werden in der Leidener und Amsterdamer Zeitung den genauen
Abdruck des Antrages finden, den Graf d’Affry am 30. April bei den
Generalstaaten wegen der Auslieferung des Grafen Saint-Germain gestellt
hat[255], obwohl er, wie er nicht abstreitet, schon wußte, daß dieser
bereits vor einigen Tagen nach London abgereist ist. Die Hochmögenden
haben diesen Antrag im Schoße von Kommissionen begraben[256], offenbar
um ihn nicht zu beantworten.
VII
Aus der Korrespondenz von Knyphausen und Michell mit Friedrich dem
Großen[257]
Knyphausen und Michell an König Friedrich
London, 1. April 1760.
Das hiesige Ministerium erhielt gestern die Schreiben des Generals
Yorke vom 28. vorigen Monats, worin er[S. 190] über eine Unterredung
berichtet, die er tags zuvor mit dem sogenannten Grafen Saint-Germain
wegen seiner Eröffnungen über den Frieden hatte[258] ... Wir
beschränken uns auf den Hinweis, daß das hiesige Ministerium sehr in
Verlegenheit ist, sich ein richtiges Urteil über den Zwischenfall
zwischen Graf d’Affry und besagtem Saint-Germain zu bilden. Nur das
eine läßt diese Kabale erkennen, daß die Meinungen im Versailler
Staatsrat sehr geteilt sind. In Erwartung einer Aufklärung über die
Gesinnung des Versailler Hofes ist man hier sehr zufrieden, dem
General Yorke eine gleichmäßige Sprache sowohl dem Botschafter wie dem
Unterhändler gegenüber vorgeschrieben zu haben.
London, 22. April 1760.
Wie wir in diesem Augenblick erfahren, soll der sogenannte Graf
Saint-Germain mit dem heutigen Postschiff in England angekommen
sein[259], nicht als Unterhändler, sondern um Zuflucht vor den
Gewaltakten des Herzogs von Choiseul zu suchen, der über sein
Auftreten im Haag entrüstet ist. Diese Geschichte scheint den Einfluß
des Ministers und seine Bundestreue gegen den Wiener Hof von neuem
zu bestätigen. Ein Schlachtopfer mußte offenbar fallen, um dafür
öffentlich Zeugnis abzulegen.
London, 29. April 1760.
Der Graf Saint-Germain hat sich seit seiner Ankunft hierselbst nicht
öffentlich gezeigt und unseres Wissens keinen Minister gesehen. Wir
haben jedoch dauernd ein Augenmerk auf sein Tun und Lassen und werden
alles in dieser Hinsicht Beachtenswerte gewissenhaft melden.
[S. 191]
König Friedrich an Knyphausen
Meißen, 30. April 1760.
Es ist leicht zu merken ..., daß der Herzog von Choiseul wieder die
Oberhand über seinen König und Herrn erlangt und im Staatsrat über die
Friedenspartei gesiegt hat. Was dem Grafen Saint-Germain zugestoßen
ist, ist ein schlagender Beweis dafür. Ebenso sieht man, daß Frankreich
unter dem Einfluß des Wiener Hofes jetzt nicht ernstlich an Frieden
denkt, sondern daß es England nur hinhalten und hintergehen will.
Immediatbericht Knyphausens an König Friedrich
London, 6. Mai 1760.
Ich habe E. M. zu melden, daß nach Ansicht des englischen Ministeriums
der Aufenthalt des sogenannten Grafen Saint-Germain in England nach
außen hin den Verdacht erwecken kann, als ob geheime Unterhandlungen
mit England stattfinden, und daß er vielleicht auch im Lande selbst
nachteilig wirkt. Deshalb hat Herr Pitt[260] sich nicht nur geweigert,
ihn zu empfangen, sondern er besteht auch durchaus auf seiner Abreise.
In der Verlegenheit, in die besagter Graf Saint-Germain dadurch
gekommen ist, hat er sich entschlossen, sich an mich zu wenden, und
Herrn Pitt, der ihn polizeilich überwachen ließ, gebeten, ihm eine
Unterredung mit mir zu verschaffen.
Als ich ihn also auf Wunsch des Ministers aufsuchte, erklärte er, er
könne um seiner Sicherheit willen nicht nach Holland zurückkehren, und
da Herr Pitt durchaus auf seiner Abreise bestehe, habe er beschlossen,
sich zu E. M. zu begeben und Sie um Zuflucht in Ihren Staaten[S. 192] gegen
die Gewaltakte des Herzogs von Choiseul zu bitten. Wie er hinzufügte,
sei dies seine Absicht schon bei der Abreise von Holland gewesen, aber
Graf Bentinck habe ihm geraten, vorerst nach England zu gehen[261].
Ich brauche E. M. nicht zu versichern, wie peinlich mir diese Eröffnung
war. Da ich jedoch voraussah, daß das Erscheinen dieses Mannes E. M.
sehr unliebsam wäre, und da es nicht in meiner Macht stand, ihn daran
zu hindern, habe ich im Einvernehmen mit Herrn Pitt mit ihm vereinbart,
daß er unter dem Namen Graf Cea nach Aurich reisen und von dort
bei E. M. anfragen solle, welches Ihre Absichten seien, so daß E. M.
also Ihre Maßnahmen in voller Freiheit treffen können.
Damit er nicht argwöhnte, ich suchte seine Reise zu hintertreiben,
habe ich ihm sogar Abschrift des beifolgenden Briefes an E. M. gegeben
und ihm gesagt, daß ich ihn aufs wärmste empfohlen hätte. Ich habe
hinzugefügt, ich hätte ihm lediglich deshalb geraten, in Aurich Station
zu machen, weil ich fürchtete, er könne ohne Regelung seines Reiseweges
in österreichische oder französische Hände fallen.
Die Entscheidung steht jetzt bei E. M. Inzwischen glaube ich, E. M.
einen Dienst erwiesen zu haben, indem ich die Abreise des Grafen
Saint-Germain nach Sachsen[262] hinausgezögert habe. Sie zu verhindern,
lag nicht in meiner Macht, so gern ich es getan hätte.
Im übrigen habe ich bei meiner Unterredung mit ihm nichts erfahren,
was für E. M. von Belang sein könnte und was Sie nicht schon aus den
Briefen aus dem Haag wissen.
Nachschrift. Nach Abschluß dieses Berichtes hat Herr Pitt, mit
dem wir nochmals eine Unterredung[S. 193] hatten, uns stark zugesetzt, E. M.
nach Möglichkeit abzureden, den Grafen Saint-Germain zu empfangen,
damit daraus keine Umtriebe oder Unannehmlichkeiten entstehen.
Knyphausen an das Kabinettsministerium
London, 6. Mai 1760.
Beiliegend die Abschrift meines Immediatberichts an den König,
betreffend einen recht eigenartigen Zwischenfall, den ich mit dem
sogenannten Grafen Saint-Germain hatte. Da dieser mir seit Jahren
bekannte Mann[263] von gefährlichem Ungestüm ist und den König
bestricken und zu vielen falschen Maßregeln verleiten könnte, bitte ich
Euer Exzellenz, Ihr möglichstes zu tun, um seine Reise nach Sachsen zu
verhindern.
König Friedrich an Knyphausen
Meißen, 10. Mai 1760.
Der Graf Saint-Germain sucht in England wohl nichts anderes als eine
Zuflucht vor den Verfolgungen des Herzogs von Choiseul, mit dem und
dessen Partei er, wie man deutlich sieht, völlig zerfallen ist.
Meißen, 19. Mai 1760.
Was Herr Pitt Ihnen über den Grafen Saint-Germain gesagt hat, leuchtet
mir völlig ein. Bisher hat dieser nicht an mich geschrieben. Sollte er
es noch tun, so will ich ihm Zuflucht in Emden oder besser in Aurich
geben, falls er sich in nichts einmischt[264]. Ich fürchte nur, der
seltsame Mann wird so unbesonnen sein, hierher zu[S. 194] kommen, ohne an mich
zu schreiben und vorher um meine Erlaubnis zu bitten, wofür ich keine
Verantwortung übernehme.
VIII
Aus Mitchells Korrespondenz
Mitchell[265]
an Lord Holdernesse
Freiberg, 27. März 1760.
Der König von Preußen geruhte, mir Kenntnis von einem außergewöhnlichen
Gespräch zu geben, das der Graf Saint-Germain am 14. im Haag mit
General Yorke hatte[266]. Er bemerkte, obwohl der Mann und seine ganze
Art höchst ungewöhnlich seien, hätte General Yorke doch Recht getan,
Euer Lordschaft über den Vorfall unmittelbar zu berichten, daß nämlich
der Graf mit diesem geheimen Auftrage sehr wahrscheinlich vom Marschall
Belle-Isle ohne Kenntnis der übrigen französischen Minister betraut
worden sei, da das Kabinett sehr geteilter Meinung ist. Er fragte
mich, ob ich den Grafen Saint-Germain kenne, der, wie er gehört habe,
eine Zeitlang in England gewesen sei[267]. Ich antwortete, ich hätte
ihn dort gesehen, hätte aber nie geglaubt, daß er zum Unterhändler
werden würde. Seine Preußische Majestät entgegnete, er hätte gehört,
daß der Graf Mittel und Wege gefunden hätte, sich die Gunst des Königs
von Frankreich zu verschaffen. Er hätte ihn mit einigen chemischen
Versuchen unterhalten, und der König hätte ihm das Schloß Chambord
geschenkt.
[S. 195]
Freiberg, 20. April 1760.
Nach Ansicht Seiner Preußischen Majestät erhellt aus allen Gesprächen
der Herren d’Affry und Saint-Germain im Haag deutlich, daß das
französische Ministerium in seiner Meinung geteilt sei. Einige seien
für den Frieden, andere für Fortsetzung des Krieges, aber aus allem
bisher Gesagten ließe sich unmöglich folgern, welchen Entschluß sie
fassen würden und ob die Friedenswinke ernst gemeint oder nur gegeben
seien, um Zeit zu gewinnen.
Lord Holdernesse an
Mitchell[268]
Whitehall, 6. Mai 1760.
Sie werden aus meinen letzten Briefen ersehen haben, was zwischen
General Yorke und dem Grafen Saint-Germain vorgefallen ist, und ich bin
überzeugt, General Yorke wird Sie jedenfalls davon in Kenntnis gesetzt
haben, daß Herr von Choiseul ihn in aller Form desavouiert hat und
daß Saint-Germain beschlossen hat, nach England zu gehen, um sich den
weiteren Verfolgungen des französischen Ministers zu entziehen[269].
Infolgedessen ist er vor einigen Tagen hier eingetroffen. Aber es
liegt auf der Hand, daß er keine Vollmacht hatte, auch nicht von den
französischen Ministern, in deren Namen er zu sprechen vorgab. Da sein
hiesiger Aufenthalt unzweckmäßig ist und üble Folgen haben kann, wurde
für angemessen erachtet, ihn bei seiner hiesigen Ankunft zu verhaften.
Sein Verhör hat nichts sehr Belangreiches ergeben. Sein Benehmen und
seine Sprache sind verschlagen, mit einem wunderlichen Einschlag, der
schwer zu bestimmen ist.
Alles in Allem hielt man es für durchaus angezeigt, ihn nicht in
England zu dulden. Demgemäß ist er am[S. 196] letzten Sonnabend (3. Mai)
früh abgereist, mit der Absicht, Zuflucht im preußischen Staate zu
suchen, da er sich in Holland nicht sicher fühlte. Auf seine dringende
wiederholte Bitte hin besuchte ihn Baron Knyphausen während seiner
Haft[270], aber keiner der königlichen Beamten.
Der König hielt es für richtig, Sie von diesen Vorgängen zu
unterrichten. Sein Wunsch ist, daß Sie den Inhalt dieses Briefes Seiner
Majestät dem König von Preußen mitteilen.
IX
Berichte Reischachs an Graf
Kaunitz[271]
Haag, 18. (März) 1760.
Der Ew. Excellenz bekannte Freund (Prinz Ludwig von Braunschweig[272])
hat mich vorgestern besuchet, ... um mich zu bereden, ihm die in Händen
habende Contre-Declaration[273] einsehen oder ablesen zu lassen. Ich
beharrte aber darauf, daß mich dermalen noch nicht im Stande befinde,
sondern, wie ihm schon gemeldet, das weitere von dem Herrn Grafen von
Starhemberg[274] gewärtige.
Worüber derselbe (Prinz Ludwig) gemeldet, er besorge, man werde
mit einer solchen Contre-Declaration solang zuwarten, daß indessen
Frankreich soviel Zeit gewinnen werde, um mit Engelland einen
Frieden zu schließen.[S. 197] Herr Graf d’Affry habe vor etwas mehr als
acht Tagen durch den allhiesigen preußischen Minister von Hellen dem
engelländischen Minister Yorke ein Rendezvous in Ryswijk oder in
selbiger Gegend antragen lassen ...
Es befinde sich ein gewisser Fremder, der sich Comte
Saint-Germain nennt, schon einige Zeit in Amsterdam, allwo er bei dem
sehr reichen und geschickten Negocianten Hope[275], welcher dermalen
die meiste französischen Geschäften in Amsterdam verrichtet und durch
seinen Credit große Geldsummen dem französischen Hofe verschaffe,
wohnhaft, seit den allhiesigen Heirats-Festivitäten[276] aber in
dem Haag gegenwärtig seie, allwo er den Mr. Yorke besuche und seit
kurzem mit ihm eine dreistündige Unterredung tête-à-tête
gehabt habe[277], so daß er um so weniger zweifle, er müsse von dem
französischen Hofe mit Friedensgeschäften beladen sein, als man
wahrnehme, daß dessen allhiesige Anwesenheit den Herrn Graf d’Affry
alarmiere und er sein Mißvergnügen hierüber nicht verbergen könne.
Ich trachtete, denselben (Prinz Ludwig) zu verleiten, sich gegen
mich weiters zu eröffnen, was nämlich Herr Graf d’Affry dem Mr.
Yorke beigebracht habe und in weme dann des Mr. le Comte de
Saint-Germain obhabende Commissionen bestehen möchten.
Derselbe ließe sich aber weiter nicht heraus, als daß er eingestanden,
Saint-Germain gebe aus, „daß er sich schmeichle, Frankreich durch
seinen Aufenthalt in Holland zu retten“. Über die Unterredung des
Herrn Graf d’Affry mit Mr. Yorke wollte er sich gar nicht eröffnen,
sondern widersetzte mir, daß, weil ich ihm von dem Inhalt der
Contra-Declaration nichts beibringen wolle, er mir auch[S. 198] von dem, was
zwischen besagten zweien Ministres vorbei gehe, nichts mitteilen
könne ...
Als der sogenannte Comte Saint-Germain aus Amsterdam allhier
angelanget, so befragte den Herrn Graf d’Affry, ober von dessen
Ankunft von seinem Hofe preveniret und ob ihm bekannt, daß er
in Holland, wie es verlaute, mit einigen Commissionen beladen sei.
Derselbe wollte weder von dem einen noch von dem andern etwas wissen,
sondern brache den Discours ab, mit Vermelden, daß er allzeit
vor ein espèce d’aventurier passiret habe.
Von solcher Zeit hat derselbe den Herrn Graf d’Affry besuchet, welchen
mehrmalen in Compagnie bei ihm angetroffen. Vor 2 Tagen ist er
wiederum nach Amsterdam zurückgekehret, solle aber, wie von Herrn Graf
d’Affry selbst vernommen, inners ungefähr 8 Tagen wiederum allhier
zurück eintreffen.
Man versicheret mich, daß man nicht eigentlich weiß, wer dieser
sogenannte Comte Saint-Germain sei. Er redet fast alle
europäische Sprachen in perfection, hat sich viele Zeit in
Polen, Teutschland, Italien, Spanien, Engelland, Frankreich, auch
vor diesem in Holland aufgehalten, allwo er unterschiedliche Namen
geführet. Er ist in der Music und sonderbar in Spielung
der Violine sehr erfahren, und scheinet aus seinem Umgang, daß er
allerorten die große Welt frequentiret habe. Dermalen soll
er aus Frankreich kommen, allwo der König ihm das Schloß Chambord,
so ehevordem Mr. le maréchal Comte de Saxe[278] zugehöret,
überlassen haben soll. Es fehlet ihm an der Leichtigkeit, sich zu
explicieren, und an Geist nicht. Wann er aber mit Geschäften beladen,
so gedeucht mich, daß er zu viel rede und seine Discours nicht
genügsam nach den Reglen der Prudenz abmesse.
[S. 199]
Haag, 25. März 1760.
Vorgestern hat Graf d’Affry wiederum einen Expressen, aber nur aus
Brüssel von dem Mr. Lesseps[279] erhalten; wie er mir gestern gemeldet,
hat derselbe ihm Depêchen von seinem Hofe mitgebracht, wodurch
der Herr Duc de Choiseul ihm auftraget, dem sogenannten Comte
de Saint-Germain, von welchem in meinem ehevorigen Berichtschreiben
Meldung beschehen und [welcher] dermalen wiederum von Amsterdam in
dem Haag angelanget ist, auf das schärfeste zu untersagen, sich nicht
zu unterstehen, in die Politique sich einmischen zu wollen,
widrigenfalls demselben sein Haus zu verbieten oder gar ihn arretieren
zu lassen[280].
Haag, 28. März 1760.
Der Herr Graf d’Affry hat dem sogenannten Comte de Saint-Germain
ernstlich untersaget, sich in Friedens- oder politische Geschäften
einigermaßen einzumischen, mit Bedrohen, daß er widrigenfalles ihn gar
nicht mehr sehen werde.
Mir ist indessen von guter Hande zu vernehmen gekommen, daß
Saint-Germain sich allhier gegen einem Freunde über dieses gegen
ihm ausübendes Verfahren ungemein beschweret und demselben ein
Originalschreiben von dem Herrn maréchal Duc de Belle-Isle
vorgezeiget habe, in welchem derselbe ihm zu erkennen gegeben, daß er
von ihm eine Antwort über seine allhiesige Verrichtungen mit vielem
Empressement erwarte[281]. Ferner habe derselbe ihm, Freunde,
vertrauet, daß er beladen worden, Mittel und Wege auszufinden, daß die
französisch-amerikanische Insuln und Colonien, welche directe
aus Frankreich[S. 200] nicht wohl approvisionniert werden können,
von hier aus mit Lebensmitteln und andern Notwendigkeiten versehen
werden; wo beinebens er auch chargiret worden sei, alles
anzuwenden, den Credit der französischen Finanzien allhier wiederum
zu erheben und emporzubringen, auch einzuberichten, was ihm von dem
Friedensgeschäft zu Ohren kommen möchte. Dieses letztere habe er nicht
besser zu bewirken gewußt, als den Herrn Grafen von Bentinck und Mr.
Yorke zu sehen[282]. Der erstere habe sich wider Herrn Graf d’Affry
beschweret, daß er von ihm gänzlich negligiret werde, da er
doch imstand sich befinde, der Krone Frankreich allhier in Friedens-
und andern Geschäften nützlich sein zu können. Mr. Yorke habe ihm
die stärkste Versicherung erteilet, wie sehnlich und aufrichtig
Engelland einen baldigen Frieden wünsche und suche; diese Krone werde
den König in Preußen nicht verlassen, jedoch denselben vermögen,
daß von ihm Ihro Majestät der Kaiserin[283] raisonnable und
acceptable Friedensvorschläge gemacht werden. Von welchem allem
er nach Versailles seinen Rapport abgestattet, darüber aber noch keine
Antwort erhalten habe. Saint-Germain habe sich gegen diesem seinem
Freunde herausgelassen, in was für großem Credit er bei der Madame
la marquise de Pompadour und dem Herrn Duc de Belle-Isle
stehe und nicht anders glauben könne, als daß Herr Graf d’Affry die
an ihm vollzogene Ordre von Herrn Duc de Choiseul (von welchem
ihm, Comte de Saint-Germain, nichts committiret worden)
erhalten habe. Er werde aber auf das stärkeste arbeiten, daß alles ohne
Anstand repariret und seine hierin verletzte Réputation auf das
bäldeste und vollkommenste hergestellt werde.
[S. 201]
Was mir von der Conduite und Verrichtungen des sogenannten
Comte de Saint-Germain beigebracht wird, höre ich zwar an,
jedoch hüte mich, einigermaßen in Sachen mich einzumischen, die mich
nicht weiters interessieren können, als davon die Wissenschaft zu haben.
Haag, 8. April 1760.
Der sogenannte Mr. le Comte de Saint-Germain befindet sich noch
allhier und hat dem Mr. Yorke und Herrn Grafen von Bentinck ein und das
andere Mal besuchet. Von diesem letzteren wird derselbe wohl angesehen
und hält sich unterweils mehrere Stunden bei ihm auf. Derselbe hat auch
verlanget, bei dem Herrn Herzog Louis von Braunschweig aufgeführet
zu werden. Er hat aber ihn bishero nicht vorkommen lassen wollen,
welches er dem Herrn Grafen d’Affry, Herrn Grafen von Golowkin und
mir, als wir uns bei Übergebung der Contre-Declaration in Ryswijk
beisammen eingefunden, selbst erzählet und zugleich zu verstehen
gegeben, daß dessen Anwesenheit allhier das Friedensgeschäft leichtlich
embrouilliren und sehr schädlich sein könnte[284].
Herr Graf d’Affry gab die kräftigste Versicherungen, daß er ihm
bereits aus Ordre seines Hofes auf das nachdrucksamste untersaget,
sich in einige politische Affairen, so seinen Hof betreffen,
einzumischen, wie dann er ihm auch sein Haus wirklich verboten
habe[285] und ihn nicht anderst als einen aventurier ansehen
könne.
Und da der Herr Herzog ihm hierauf zu erkennen gegeben, daß
Saint-Germain von der Zeit, als er ihm obiges Verbot getan, den Mr.
Yorke nochmals besucht und sich mit ihm unterhalten habe[286], so hat
Graf d’Affry demselben erwideret, daß er ihn sogleich zu sich kommen[S. 202]
lassen und ihm bedeuten wolle, daß, wann er hiervon nicht sogleich
gänzlich abstehe, der französische Hof schon Mittel finden werde, ihn
einzusperren und in eine basse-fosse[287] setzen zu lassen,
wobei er den Herrn Herzog ersuchte, all solches dem Mr. Yorke zu
hinterbringen.
Ich beobachtete hierbei, daß besagter Herr Herzog mit vielem Eifer
sich wider Saint-Germain an Laden gelegt[288], welches mich urteilen
gemacht, daß er vielleicht besorgen dürfte, es möchte durch seinen
Canal ein Fried zwischen der Krone Frankreich und Engelland mit
Ausschluß der engelländischen Aliirten beförderet werden.
Von Herrn Grafen d’Affry habe inzwischen vernommen, daß er obgemeldete
Bedrohungen dem Saint-Germain wirklich eröffnet und er hierdurch
ungemein betroffen worden sei.
Haag, 18. April 1760.
Gestern ist ... der bekannte Graf Saint-Germain von hier abgereiset,
ohne daß man weiß, wohin er sich begeben will.
Haag, 22. April 1760.
In meinem letztern Berichtschreiben habe Ew. Excellenz zu melden die
Ehre gehabt, daß der sogenannte Graf Saint-Germain von hier abgereiset,
ohne daß bekannt ist, wohin er sich begeben habe. Ich bin aber gleich
hinnach ganz sicher informiret worden, daß er so gähling und
unvermutet dieses Land verlassen habe, weil Herr Graf d’Affry durch
den Courier, wovon in meinen letztern zwei Berichtschreiben Meldung
getan, von seinem Hofe Befehl erhalten, das Ansuchen allhier zu
machen, daß er arretiret und an Frankreich ausgeliefert werde, wovon,
als Herr Graf d’Affry, wiewohl ganz in geheime, dessentwegen[S. 203] einige
passus gemacht, derselbe benachrichtiget worden und sich
alsdann sogleich aus dem Staube gemachet hat. Man weiß zwar noch nicht
positive, wohin er sich verfüget; es wird aber durchaus dafür
gehalten, daß er nach Engelland abgegangen sei. Hierbei hat sich noch
dieser notable Umstand ergeben, daß Herr Graf von Bentinck ihn
vor seiner Abreise nachts um 9 Uhr besucht und bei demselben bis nach
Mitternacht verblieben sein soll, worauf Graf Saint-Germain gegen
anbrechendem Tage in einer mit 4 Pferden bespannten Kutsche abgereiset
ist. Man will sogar behaupten, daß ein Bedienter des Herrn Grafen von
Bentinck die Pferde und Wagen zu solcher Abreise veranstaltet habe[289].
Herr Graf d’Affry hat mir vor zwei Tagen von der empfangenen Ordre,
den Saint-Germain allhier arretieren zu lassen und daß er dessentwegen
in der Stille einige passus gemacht, Kenntniß erteilet, mit
dem Beisatz, daß er den dessentwegen erhaltenen Courier wiederum
zurückgesendet und sich bei seinem Hofe angefraget habe, ob er die
Ursachen, warum Saint-Germain habe sollen arretiret werden, allhier
kundmachen solle oder nicht.
Haag, 25. April 1760.
Man prätendiret, nunmehro sichere Nachricht zu haben, daß
der sogenannte Comte de Saint-Germain von hier gerad nach
Hellevoetsluis abgegangen und den 20. dieses mit dem Paquetbot nach
Engelland abgefahren sei.
Von sicherer Hand vernehme, daß derselbe von hier aus ein Schreiben
an Madame la marquise de Pompadour erlassen, in welchem
er unter anderm den Nutzen und die Notwendigkeit vorstellt, den
allhiesigen Graf von[S. 204] Bentinck von Seiten Frankreich wegen seinem guten
Willen, dieser Krone bei gegenwärtigen Umständen nützliche Dienste
zu leisten, und wegen von ihm allhier und bei dem engelländischen
Ministerio besitzenden besonderen Credit nicht nur allein sehr zu
menagiren, sondern auf alle Weise zu cultivieren[290].
Welches Schreiben aber von dem französischen Hofe an Herrn Graf d’Affry
communiciret worden.
Aus allem, was mir zu Ohren kommet, muß ich urteilen, daß Herr Graf
Bentinck sehr suchet, sich in künftiges Friedensgeschäft einmischen
zu können. Es ist auch gewiß, daß Comte Saint-Germain während
seines allhiesigen Aufenthalts sehr vielen Umgang mit ihm gepflogen und
deswegen aller Anschein vorhanden ist, daß er mit seinem Wissen und
vielleicht aus seinem Rat nach Engelland abgegangen, er auch suchen
wird, ihn allda zu protegieren.
Haag, 2. Mai 1760.
Herr Graf d’Affry hat vorgestern bei den Generalstaaten abschriftlich
anliegendes Mémoire[291] überreichet, wodurch er das Ansuchen
tuet, daß der bekannte Comte de Saint-Germain angehalten, ausgelieferet
und gefänglich nach Antwerpen geführet werde. Da nun derselbe,
jedermann bekanntermaßen, schon vor mehr als 14 Tagen sich von hier
hinweg begeben und von Hellevoetsluis nach Engelland abgegangen ist,
so scheinet nicht möglich zu sein, daß die Absicht des französischen
Hofes auf dessen Anhaltung zähle, sondern etwa dahin gehen möchte,
das Publicum dardurch zu belehren, daß demselben, wo er sich befinden
möchte, kein Glauben und noch viel weniger einiges Vertrauen
beigemessen werde, maßen Herrn Graf d’Affry[S. 205] nicht unbekannt sein kann,
daß er sich allhier verlauten lassen, daß, wann der französische Hof
ihm wegen jenem, was mit ihm allhier vorgefallen, nicht Satisfaction
geben werde, er sich im Stand befinde, Sachen von demselben an Tage zu
legen, welche ihn vollkommen rechtfertigen, demselben aber ungemein
nachteilig sein werden.
Was die Generalstaaten über obiges Mémoire entschlossen, ist
mir noch nicht bekannt. Und da der widrige Wind noch immer anhaltet,
so können keine engelländischen Nachrichten hier ankommen, wodurch man
etwa vernehmen könnte, wie derselbe in Engelland angesehen werde oder
wie er sich allda betrage.
Beilage zum Bericht Reischachs vom 13. Mai 1760
(Mitteilung eines englischen Correspondenten)
(London, Mai 1760.)
Die Denkschrift des Herrn Grafen d’Affry über den Grafen
Saint-Germain[292], die Sie mir gütigst zugesandt haben, steht auch
in den französischen Zeitungen. Allerdings lohnt es sich nicht, wie
Sie sehr richtig bemerken, so viel Lärm über diese Sache zu schlagen.
Man erweist diesem Abenteurer zu viel Ehre, wenn man viel Wesens von
ihm macht. Der hiesige Hof glaubte, den Kundgebungen des Mißtrauens,
die der französische Hof gegen diesen Mann in Szene gesetzt hat, nicht
trauen zu dürfen; denn er verdient nur Verachtung. Sie hat ihn bei
seiner Ankunft mit dem Paketboot sofort in polizeilichen Gewahrsam
genommen und ihn erst außer Augen gelassen,[S. 206] als er wieder an Bord
gebracht wurde, um über das Meer zurückzukehren. Ein scherzhaftes
Abenteuer!
Haag, 16. Mai 1760.
Der sogenannte Mr. le Comte de Saint-Germain ist den 11.
dieses mit dem Paquetbot aus Engelland zu Hellevoetsluis angelanget
und hat sogleich seine Reise über Rotterdam nach Teutschland und,
wie hier ausgegeben wird, nach Berlin fortgesetzet. Mehrere allhier
halten dafür, daß das engelländische Ministerium denselben aus
Attention vor Frankreich sogleich aus Engelland weggeschaffet
habe, aus welchem sie inferiren, daß diese Kron sehr geneigt sei
oder Hoffnung habe, mit Frankreich den Frieden in Bälde zu schließen.
Haag, 13. Juni 1760.
Wo der bekannte sogenannte Graf von Saint-Germain sich dermalen
befinde, ist allhier nicht bekannt; es wird aber von mehreren
öffentlich versicheret, daß derselbe schon von geraumer Zeit her einen
Espion vor den König in Preußen gemachet habe, dergleichen
derselbe an allen Höfen haben und solche reichlich bezahlen solle.
X
Aus Kauderbachs Korrespondenz[293]
Kauderbach an Graf Wackerbarth-Salmour
Haag, 14. März 1760.
Wir haben hier gegenwärtig einen höchst seltsamen und ganz
außergewöhnlichen Mann, der sich Graf Saint-Germain[S. 207] nennt. Er
sieht höchstens wie 45 Jahre alt aus, und doch behauptet man, daß
er mindestens 110 Jahre zählt. Wie mir Herr d’Affry versicherte,
wäre er viel älter als wir beide zusammen, und doch sind wir beide
über die Sechzig. Fest steht, daß ein fast siebzigjähriges Mitglied
der Generalstaaten mir gesagt hat, er habe diesen seltsamen Mann im
Hause seines Vaters gesehen, als er selbst noch ein Kind war, und
er hätte fast genau so ausgesehen wie heute. Trotzdem macht er den
gelenken, munteren Eindruck eines Dreißigjährigen. Seine Waden sind
wie gedrechselt, sein eigenes Haar schwarz und voll, und er hat
sozusagen keine Runzel im Gesicht. Fleisch ißt er fast nie, außer
etwas Hühnerbrust; seine Nahrung beschränkt sich auf Grütze, Gemüse
und Fische. Gegen Kälte schützt er sich sehr, aber er schont sich
nicht übermäßig durch frühes Schlafengehen und hat uns, gleichsam aus
Gefälligkeit, bis 1 Uhr nachts Gesellschaft geleistet, ohne daß man
es ihm am nächsten Morgen anmerkte. Gelingt es mir, dem guten Alten
sein Geheimnis zu entlocken, so glaube ich, dem König[294] einen
wesentlichen Dienst zu leisten, wenn ich es Euer Gnaden mitteile, um
Sr. Majestät ein so kostbares und für seinen Dienst so nützliches Leben
zu verlängern.
Saint-Germain besitzt unermeßliche Reichtümer, und wenn man ihm
glauben will, auch die schönsten Geheimnisse der Natur. Er spricht
gelehrt darüber, ohne den Geheimnisvollen zu spielen, und sucht durch
seine Beweisführungen auch die Ungläubigsten zu bekehren, anscheinend
ohne jede Hintergedanken. Seine Reichtümer sind eine feststehende,
in ganz Frankreich bekannte Tatsache. Er steht in höchster Gunst
beim Allerchristlichsten König,[S. 208] der ihm das Schloß Chambord zum
lebenslänglichen Wohnsitz angewiesen hat. Er zeigte uns Steine von
unschätzbarem Wert und sämtlich von unvergleichlicher Größe und
Schönheit. Beiliegend übersende ich E. E. der Wissenschaft halber die
Maße eines seiner schönsten Opale, der von tadelloser Reinheit und
herrlicher Schönheit ist. Nach seiner Behauptung besitzt kein Herrscher
der Welt solche Schätze, wie er sie in Steinen zu besitzen vorgibt. Er
sagt, daß alle irdische Größe ihm gleichgültig sei und daß er nur auf
den Titel eines Bürgers Anspruch erhebe.
Von Frankreichs Unglück gerührt, hat er dem König[295] seine Dienste
angeboten, um das Land zu retten, und zu diesem Zweck ist er nach
Holland gekommen. Aus seinem Auftrag oder wenigstens dessen Zweck
macht er kein Geheimnis. Wir sind gespannt, welche Mittel er hat; nach
seiner Behauptung sind sie unfehlbar, da sie von ihm allein abhängen.
Er ist ein großer Fürsprecher der Frau von Pompadour und sucht sie von
dem Makel zu befreien, den man ihr hier angeheftet hat. Er schreibt
ihr das beste Herz zu, die redlichsten Absichten und beispiellose
Uneigennützigkeit. Ich hatte mit ihm ein langes Gespräch über die
Ursachen von Frankreichs Mißgeschick und über die Ministerwechsel.
Folgendes sagte er mir hierüber:
„Das Grundübel ist die Schwachheit des Monarchen. Seine Umgebung kennt
seine übergroße Güte und mißbraucht sie, und diese Umgebung besteht
nur aus Kreaturen der Brüder Pâris[296], die allein Frankreichs ganzes
Unglück verschulden. Sie haben alles verderbt und die Pläne des besten
französischen Bürgers, des Marschalls von Belle-Isle, durchkreuzt.
Daher die Uneinigkeit und die Eifersucht unter den Ministern, die
jeder einem anderen[S. 209] Herrscher zu dienen scheinen. Alles ist durch die
Brüder Pâris verderbt: mag Frankreich zugrunde gehen, wenn sie nur ihr
Ziel erreichen, 800 Millionen Vermögen zu erwerben. Unglücklicherweise
besitzt der König mehr Güte als Scharfblick, um die Bosheit seiner
Umgebung zu durchschauen. Da diese seine Charakterschwäche kennt, tut
sie nichts, als seinen Schwächen zu schmeicheln, und findet dadurch vor
allen anderen Gehör. Die gleiche Charakterschwäche zeigt sich bei der
Mätresse. Sie kennt das Übel, hat aber nicht den Mut, ihm zu steuern.“
Er also, Saint-Germain, will die radikale Heilung unternehmen und
macht sich anheischig, durch seine Maßnahmen in Holland zwei Männer zu
stürzen, die dem Staate so schädlich sind und die man bisher für ganz
unersetzlich hielt. Hört man ihn so frei von der Leber sprechen, so muß
man annehmen, daß er seiner Sache gewiß ist, oder man muß ihn für den
größten Gimpel auf Erden halten.
Ich könnte Euer Gnaden noch manches über diesen seltsamen Mann und
seine physikalischen Kenntnisse erzählen, müßte ich nicht fürchten, Sie
durch Berichte zu ermüden, die mehr romanhaft als wirklich erscheinen.
Doch halte ich mit meinem Urteil noch zurück. D’Affry erweist ihm die
größten Aufmerksamkeiten und scheint ihn für ein Wunder zu halten.
Saint-Germain hat die ganze Welt durchstreift und spricht die meisten
bekannten Sprachen. Er war mehrmals in Dresden und, wie er mir sagte,
dem verstorbenen König[297] wohlbekannt. Auch in der Musik leistet
er Hervorragendes. Er spielt vollendet Violine und Klavier und singt
entzückend. Man läuft ihm hier das Haus ein, wie einem Wundertier, und
er ist in der Tat ein sehr angenehmer Gesellschafter.
[S. 210]
Kauderbach an den Fürsten
Golizyn[298]
Haag, 14. März 1760.
Wir haben hier einen seltsamen Mann. Es ist der berühmte Graf
Saint-Germain, der in ganz Europa wegen seiner Kenntnisse und seiner
ungeheuren Reichtümer bekannt ist. Er ist mit einem wichtigen Auftrag
in diesem Lande betraut und redet viel davon, er wolle ähnlich wie
früher die Jungfrau von Orleans Frankreich retten. Wir müssen abwarten,
wie er es anfangen wird. Er hat ein Lager von Edelsteinen von größter
Schönheit. Er behauptet, der Natur ihre tiefsten Geheimnisse entrissen
zu haben und sie durch und durch zu kennen. Das Merkwürdigste aber ist,
daß er über 110 Jahre alt sein will. Er sieht indes nicht älter als
45 aus. Gaudeant bene nati[299]! Ich wünschte, ich könnte sein
Geheimnis für Sie und auch für mich selbst erlangen! Er ist ein warmer
Verteidiger der Frau von Pompadour und des Marschalls von Belle-Isle
und verabscheut die beiden Brüder Pâris, denen er die Schuld an allem
Mißgeschick Frankreichs zuschreibt.[300] Er spricht sehr frei über die
französischen Verhältnisse — vom König bis zum Hanswurst.
Haag, 19. März 1760.
Ich schrieb Ihnen bereits von dem berühmten Saint-Germain, der
gegenwärtig in Amsterdam bei Herrn Hope wohnt. Er hat Herrn Yorke in
seinem Hause aufgesucht und ist drei Stunden bei ihm geblieben[301].
Er hat hier weder zu Herrn d’Affry geschickt noch sich an ihn gewandt,
und doch hat er mir selbst erklärt, er sei mit einem wichtigen
Auftrage betraut. Um jedoch die Wahrheit zu[S. 211] sagen, erscheint er mir
zu anmaßlich und unvorsichtig, als daß man ihm glauben könnte, daß er
ein allerhöchst beauftragter Unterhändler ist. Ich stelle ihn auf eine
Stufe mit dem berüchtigten Macanas, den Euer Exzellenz hier 1747 kennen
lernten, oder wenigstens mit dem Grafen Seckendorff, der im letzten
Jahre herkam[302]. Ich müßte mich sehr in ihm täuschen, wenn er mit
seinem Auftrag Erfolg hat. Unsere Holländer sind zu schwerfällig, um
auf solche Schliche einzugehen. Immerhin zweifle ich nicht mehr, daß
wichtige Unterhandlungen im Gange sind.
Graf Wackerbarth-Salmour[303]
an Kauderbach
Dresden, 23. März 1760.
Ihre Königlichen und Kurfürstlichen Hoheiten lesen stets mit
Vergnügen, was Sie mir schreiben. Sie haben das Bild, das Sie mir
von Saint-Germain entwarfen, sehr fesselnd gefunden. Wir können es
noch nicht bis ins einzelne deutlich erkennen. Aus der Ferne wirkt es
schön, aber man muß es sich näher daraufhin ansehen, ob alle seine
Züge übereinstimmen und zutreffen, woran ich stark zweifle. Vor 50
Jahren lernte ich den berüchtigten Huldashop kennen und verkehrte mit
ihm. Er behauptete, über 80 Jahre alt zu sein. In Danzig heiratete er
25 bis 30 Jahre später eine Prinzessin von Holstein, die ihn nach den
öffentlichen Nachrichten kurz darauf ermorden ließ, um sich in Besitz
seiner Forschungen und Geheimmittel zu bringen[304]. Ich kannte einen
Mann, den man als Mitschuldigen[S. 212] an diesem Mord in Verdacht hatte; er
hat durch seinen Reichtum eine große Rolle gespielt und großes Aufsehen
erregt. Derartige Wundermänner blenden eine Zeit lang; man verliert sie
aus dem Gesicht, wenn man es am wenigsten glaubt.
Der Opal, dessen Maße Sie mir schickten, scheint mir nicht so
außerordentlich. Ich besitze einen orientalischen von fast gleicher
Größe, und der König hat viel ansehnlichere in seinem Schatze. Wie Sie
wissen, sind farbige Steine, so schön und hart sie scheinen mögen,
stets mit Vorsicht zu genießen. Bei den Diamanten handelt es sich
darum: besitzt er viele? sind sie groß und von tadellosem Wasser?
Seine politischen Erörterungen bedürfen m. E. gründlicher Beweise und
Darlegungen.
Am meisten zu seinen Gunsten scheint mir zu sprechen, daß ihm der
König von Frankreich in seiner Huld das Schloß Chambord geschenkt hat;
denn ein so bedeutendes Lehen kann er nur infolge von hervorragenden
Leistungen im Dienste der Krone erhalten haben.
Kauderbach an Graf Wackerbarth-Salmour
Haag, 4. April 1760.
Wir kennen den angeblichen Grafen Saint-Germain bisher nur nach
dem Rufe, den er geflissentlich selbst verbreitet: über seine
geheimnisvolle Herkunft, sein hohes Alter und seine Geheimnisse.
Trotzdem steht fest, daß er am französischen Hofe eine Zeitlang hoch
in Gunst stand und sehr ausgezeichnet wurde. Aber das alles war von
kurzer Dauer und hat sich sehr geändert. Herr d’Affry hat mir indes
versichert, er sei von Stand, wenn auch kein geborener Franzose. Er
selbst behauptet, Spanier zu sein.
[S. 213]
Haag, 24. April 1760.
Wie ich soeben erfahre, hat der Kurier, den d’Affry letzten Montag
(14. April) erhielt, ihm Befehl gebracht, bei den Generalstaaten die
Verhaftung und Auslieferung des berüchtigten Grafen Saint-Germain zu
beantragen, da er ein gefährlicher Mensch sei, mit dem Se. Majestät
aus guten Gründen unzufrieden ist. D’Affry hat diesen Befehl dem
Großpensionär mitgeteilt und letzterer dem ständigen Ausschuß der
Provinz Holland Bericht erstattet. Der Vorsitzende dieses Ausschusses,
Graf Bentinck, hat den Mann gewarnt, ihn nach England abreisen lassen,
und zwar hat er ihm dazu seinen eigenen Wagen geschickt[305]. Am Tage
vor seiner Abreise war Saint-Germain vier Stunden beim englischen
Gesandten[306]. Er hat sich gerühmt, mit der Herbeiführung des Friedens
beauftragt zu sein. Ich habe jedoch die Schriftstücke gesehen, auf die
er sich für seine Mission beruft[307], und habe darin nichts gefunden,
was seine Behauptung erhärtet. Belle-Isle pflegt mit den elendesten
Zeitungsschreibern und Projektenmachern in Briefwechsel zu stehen und
ihre Offenbarungen sehr teuer zu bezahlen.
Dieser Saint-Germain hat uns so viele andere grobe und elende Märchen
erzählt, daß man ihn nur mit Widerwillen zum zweitenmal hört, es sei
denn, daß man sich über dergleichen Aufschneidereien belustigen will.
Dieser Mann kann kein zehnjähriges Kind betrügen, geschweige denn
aufgeklärte Männer. Es ist also anzunehmen, daß die Protektion, die
er findet, andere Gründe und Zwecke hat, als Verhandlungen durch ihn
anzuknüpfen. Ich betrachte ihn als Abenteurer ersten Ranges, der mit
seinen Mitteln am Ende ist, und ich würde mich sehr täuschen,[S. 214] wenn er
kein tragisches Ende nähme. Unter den englischen Offizieren, die hier
sind, haben einige ihn in London vor 20 Jahren gekannt und sprechen
mit größter Verachtung von ihm. Sie halten ihn für einen einfachen
Violinspieler.
Haag, 2. Mai 1760.
Der Abenteurer hat sich hier als geheimer Unterhändler des Marschalls
Belle-Isle aufgespielt und Briefe von ihm[308] gezeigt, denen
allerdings die Glaubwürdigkeit nicht ganz abzusprechen ist. Er ließ
durchblicken, daß Belle-Isle ganz im Sinne der Frau von Pompadour,
aber im Gegensatz zu Choiseul, leidenschaftlich nach Frieden trachte.
Er hat stark aufgetragen und mit den stärksten Farben die Kabalen, die
Not und die Zwistigkeiten geschildert, die in Frankreich herrschen
sollen, und durch solche Schmeicheleien hat er das Vertrauen der
englischen Partei zu gewinnen geglaubt. Andrerseits hat er an den
Marschall Belle-Isle geschrieben[309], d’Affry wisse die Bestrebungen
des Grafen Bentinck-Rhoon weder zu würdigen noch zu unterstützen.
Dabei sei Bentinck von den besten Absichten beseelt und wünsche nichts
so sehr, als die französischen Verhandlungen mit England zu fördern.
Diese Briefe sind an d’Affry zurückgesandt worden, mit der Weisung,
zu verhindern, daß Saint-Germain sich in irgendeine Angelegenheit
einmische, falls er seine Dreistigkeit nicht damit büßen wolle, daß
er bei der Rückkehr nach Frankreich seine Tage in einem Kerkerloch
beschlösse[310].
Trotz dieses Verbots fuhr Saint-Germain fort, Reden zu halten und
Schritte zu tun, um sich auch weiterhin das[S. 215] Ansehen eines bedeutenden
Mannes zu geben. Er hat beharrlich den englischen Gesandten besucht,
der ihn aber scheinbar verachtete. Herr von Rhoon hat ihn beschützt,
ihn bevorzugt und viel Aufhebens von ihm gemacht, und als d’Affry seine
Auslieferung verlangte, hat er ihn vor der ganzen Stadt nach London
reisen lassen[311]. Ich fürchte, der Elende wird noch Anlaß zu manchen
Skandalgeschichten geben. Er hat gedroht, alle Urkunden nebst einer
Rechtfertigungsschrift zu veröffentlichen. Er ist ein Gauner, der eine
Rolle spielen will.
XI
Friedrich der Große und Voltaire[312]
Voltaire an König Friedrich
15. April 1760.
Ihre Gesandten werden in Breda[313] wohl mehr erfahren, als ich weiß.
Der Herzog von Choiseul, Graf Kaunitz und Herr Pitt verraten mir ihr
Geheimnis nicht. Bekannt soll es nur einem Herrn von Saint-Germain
sein, der einst in der Stadt Trient mit den Vätern des Konzils gespeist
hat und wahrscheinlich die Ehre haben wird, E. M. in etwa fünfzig
Jahren zu besuchen. Der Mann ist unsterblich und allwissend.
König Friedrich an Voltaire
Meißen, 1. Mai 1760.
Ein Kongreß in Breda wird nicht stattfinden, und ich lege die Waffen
erst nach drei weiteren Feldzügen nieder.[S. 216] Das Pack soll sehen, daß es
mein Entgegenkommen gemißbraucht hat, und der König von England wird
den Frieden nur in Paris und ich ihn in Wien unterzeichnen ... Der Graf
von Saint-Germain ist nur ein Ammenmärchen[314].
XII
Aus der „Geschichte des Siebenjährigen Krieges“ von Friedrich dem
Großen[315]
Der König sandte einen Unterhändler nach Frankreich, der die Absichten
des Versailler Hofes sondieren und ihm, sowie dem König von England
Bericht erstatten sollte. Die Wahl fiel auf einen jungen Edelsheim[316]
... Er wurde in Paris leidlich aufgenommen. Man bedeutete ihm in
unbestimmten Ausdrücken, daß die Erledigung seines Auftrages von der
mehr oder minder schnellen Beilegung der Streitpunkte zwischen England
und Frankreich abhängen würde. Man habe jedoch gehört, der König von
Preußen gedenke, den König von Polen auf Kosten zahlreicher deutscher
Kirchenfürsten zu entschädigen[317], die er säkularisieren wolle.
Das aber könne der Allerchristlichste König nie und nimmer zugeben.
Edelsheim brachte dem König den Bescheid nach Freiberg und reiste dann
nach London, um ihn den großbritannischen Ministern zu übermitteln.
[S. 217]
Zugleich mit Edelsheim tauchte in London ein anderer Politiker auf,
eine rätselhafte Erscheinung, über deren Wesen man nie ins klare
gekommen ist. Er nannte sich Graf Saint-Germain, hatte in französischen
Diensten gestanden und sich bei Ludwig XV. so in Gunst gesetzt, daß der
König ihm das Schloß Chambord schenken wollte. Nun spielte er die Rolle
eines Gesandten, befaßte sich ohne Vollmacht mit Unterhandlungen und
äußerte sich zugleich in beleidigender Weise über Frau von Pompadour
und den Herzog von Choiseul. Die Engländer behandelten ihn als
Abenteurer und wiesen ihn aus.
Ob nun aber das englische Ministerium Saint-Germain nicht traute oder
infolge seiner Eroberungen die Hoffnungen höher schraubte, oder ob es
gar mit der Erklärung des Versailler Ministeriums über den Kongreß[318]
unzufrieden war, kurz, das Ministerium beauftragte den englischen
Vertreter im Haag, Yorke, mit der Mitteilung an den französischen
Gesandten d’Affry, der König von Großbritannien wäre zum Frieden
geneigt und böte seine Hand zur Abhaltung eines Sonderkongresses,
falls Frankreich die ungeschmälerte Erhaltung Preußens zur Grundlage
der Präliminarien mache. Frankreich antwortete, es wünsche zwar nichts
sehnlicher als die Beilegung seiner Streitigkeiten mit England. Da
es aber mit Preußen gar nicht im Kriege liege, so könne es über die
Interessen des Königs von Preußen nicht zugleich mit denen Seiner
Britischen Majestät verhandeln. Mit dieser Antwort schwand die ohnedies
schwache Hoffnung, die man auf die ganze Verhandlung gesetzt hatte.
[S. 218]
XIII
Aus: „The London
Chronicle“[319]
Freitag, 2. Mai 1760.
Haag, 26. April. Ein gewisser Graf Saint-Germain, von dem seit über
drei Monaten viel gesprochen wurde, ist verschwunden. Auf Antrag einer
benachbarten Macht sollen die Generalstaaten einen Verhaftsbefehl gegen
ihn genehmigt haben. Er ist nach London entflohen, der Abfallgrube von
Paris und Rom.
Montag, 5. Mai 1760.
Der Graf Saint-Germain, der in unserer letzten Nummer als aus Holland
hier angekommen gemeldet wurde, ist ein Ausländer, dem der König von
Frankreich in seinem Lande Zuflucht gewährt hat. Da er fand, daß die
Freiheit, mit der er von den öffentlichen Angelegenheiten sprach, ihn
in eine schiefe Lage bringen konnte, verließ er Paris und ging nach
Holland, wo er angeblich mit ganz geheimen Unterhandlungen zwischen
Frankreich und der Republik betraut war. Herr d’Affry stellte einen
förmlichen Antrag, ihn zu verhaften und ihn unter guter Bedeckung nach
Antwerpen zu schicken[320], von wo er nach Frankreich gebracht werden
sollte. Aber der angebliche Graf bekam rechtzeitig Wind davon und
entfloh nach England.
Freitag, 9. Mai 1760.
Der Mann, der in Holland unter dem Namen Graf Saint-Germain auftrat ...
und kürzlich in England eingetroffen ist, wurde in seiner Wohnung in
London ermittelt und in polizeilichen Gewahrsam gebracht.
[S. 219]
Montag, 26. Mai 1760[321].
Rotterdam, 18. Mai. Der Graf Saint-Germain ist in London in Freiheit
gesetzt worden und hier eingetroffen[322]. Noch während seiner
Gefangenschaft hatte er zahlreiche Unterredungen mit mehreren
Mitgliedern des Geheimen Rats, die zu noch weiteren Mutmaßungen Anlaß
geben. (Gazette de Bruxelles.)
Montag, 30. Juni 1760[323].
Wie wir aus Paris erfahren, haben mehrere vornehme Personen beim König
Schritte zugunsten des Grafen Saint-Germain getan, der so viel von sich
reden machte. Seine Majestät war im Begriff, ihm zu verzeihen, als es
sich herausstellte, daß der Graf ein Spion des Königs von Preußen am
französischen Hofe und sein Vertreter bei Frau von Pompadour war.
Freitag, 22. August 1760.
Wie wir erfahren, hat der berühmte Graf Saint-Germain, der vor kurzem
hier war, sich in Altona niedergelassen.
XIV
Graf Danneskjold-Laurwigen[324]
an Saint-Germain
Kopenhagen, 3. April 1760.
Gern hätte ich den brieflichen Verkehr mit Ihnen fortgesetzt, solange
ich nicht das Glück habe, Sie zu sehen.[S. 220] Aber ich kenne leider Ihre
Adresse nicht, und ich wagte Sie nicht zu stören, bis der Kammerherr
Baron von Gleichen[325] mir versicherte, daß Sie mich mit Ihrem
Angedenken beehrten. Nehmen Sie dies als Zeichen meiner Dankbarkeit
und meiner Freude an, von neuem Gelegenheit gefunden zu haben, Ihnen
für all die Güte und Freundschaft zu danken, womit Sie mich in England
beehrt haben. Den Degen, den Sie mir geschenkt, und die Briefe, die
Sie mir geschrieben haben, habe ich als einen Besitz bewahrt, der zu
kostbar ist, um mich je davon zu trennen, aber die Ehre, daß Sie meiner
gedenken, ist zu tief in mein Herz geschrieben, als daß ich diese
Gelegenheit nicht benutzte, um Sie der tiefen Achtung zu versichern,
die ich Ihrem teuren Selbst schulde. Bitte, geben Sie mir Nachricht von
sich und Ihren Wünschen, falls ich Ihnen hierzulande irgendwie dienlich
sein kann. Und glauben Sie mir, ich bin so erfreut, meinen Freund
wiederzufinden (gestatten Sie mir diesen Ausdruck), daß ich nicht weiß,
wie ich Ihnen all meine Dankbarkeit ausdrücken soll. Bitte nehmen Sie
diesen Brief freundlich auf und glauben Sie mir, ich kann mit ehrlicher
Freude versichern, daß ich bin und zeitlebens sein werde Ihr usw.
[S. 221]
GRAF
SAINT-GERMAIN IN HOLLAND (1762)
I
Aus dem Schriftwechsel des Herzogs von Choiseul[326]
Graf d’Affry an Choiseul
Haag, 23. März 1762.
Der sogenannte Graf Saint-Germain, der vor zwei Jahren mit der
angeblichen Vollmacht zum Abschluß eines Friedens zwischen uns und
England hierher kam und dessen Auslieferung als Betrüger zu beantragen
ich Befehl erhielt[327], hat sich seitdem in den Provinzen der Republik
und in deren Nachbarschaft unter fremdem Namen heimlich herumgetrieben.
Doch erfuhr ich in den letzten Tagen, daß er unter dem Namen eines
Amsterdamer Kaufmanns Noblet ein Gut in Geldern namens Ubbergen vom
Grafen von Welderen gekauft und dafür noch nicht mehr als ungefähr
30000 Franken in französischer Währung gezahlt hat. Ich hielt es für
meine Pflicht, Sie davon zu benachrichtigen und zu fragen, ob Seine
Majestät wünscht, daß ich gegen diesen Mann durch eine neue Eingabe
bei den Generalstaaten vorgehen oder ob ich ihn lieber laufen lassen
soll, da ja der Hauptzweck meines Einschreitens erreicht ist; denn ich
habe ihn derart[S. 222] in Mißkredit gebracht, daß er sich seitdem nicht mehr
hervorwagt und sein Leben dadurch zu fristen suchen muß, daß er mit
Hilfe seiner chemischen Geheimmittel Gimpel fängt.
Choiseul an Graf d’Affry
Versailles, 10. April 1762.
Wir haben den sogenannten Grafen Saint-Germain für die Unverschämtheit
und Betrügerei seines Unterfangens bestraft und müssen es diesem
Abenteurer überlassen, sich selbst vollends in den Mißkredit zu
bringen, in den wir ihn schon versetzt haben.
II
Aus den Aufzeichnungen Hardenbroeks[328]
20. März 1762.
Der sogenannte Graf Saint-Germain wohnt jetzt auf Ubbergen bei
Nimwegen. Er besitzt noch eine Art Rittergut in der Nähe von Zutphen.
Er hat ein großes Laboratorium in seinem Hause, in dem er tagelang
sitzt. Er versteht die schönsten Farben allen nur denkbaren Dingen, wie
Leder usw., zu geben, ist ein großer Philosoph und Kenner der Natur.
Er spricht sehr schön, erscheint tugendsam, sieht wie ein geborener
Spanier von erlauchter Abstammung aus, spricht von seiner verstorbenen
Frau Mutter mit großer Ehrerbietung. Manchmal unterschreibt er sich:
„Prinz von Spanien“[329]. Er ist stolz.
[S. 223]
Er will die Fabriken der Republik fördern, doch ohne die eine oder
andere Stadt der Provinz vor den übrigen zu bevorzugen. Amsterdam
hatte ihm nämlich für die Erlangung ausschließlicher Vorrechte
besondere Vorteile angeboten. Viele Dienste hat er dem Grafen
Gronsfeld[330] durch Herstellung und Lieferung von Farben für seine
Porzellanfabrik bei Weesp geleistet. Mit Herrn van Rhoon[331] steht
er sehr gut, spricht und korrespondiert immer mit ihm. Er führt auch
eine außerordentliche ausländische Korrespondenz, ist an allen Höfen
bekannt. Von dem verstorbenen Prinzen von Wales[332], der einen
schlechten Charakter hatte, wurde er sehr schlecht behandelt. Da aber
Saint-Germain unschuldig war, ist ihm bei seiner Freilassung volle
Genugtuung gegeben worden[333]. Mit den ersten Leuten in Frankreich
hat er in Briefwechsel gestanden, und er spricht viel Gutes von Frau
Pompadour usw.
Er ist sehr oft in Amsterdam, kommt viel zu G. Hasselaar[334]. Er
besitzt ungewöhnlich schöne Steine, Rubine, Saphire, Smaragden und
Diamanten. Man sagt, daß er die Kunst verstände, Diamanten helleres
Wasser zu geben und Edelsteine zu verschönern usw. Er ist sehr
freigebig, besitzt große Güter in der Pfalz und sonst in Deutschland.
In Amsterdam wohnt er einmal im Hotel der vornehmen Welt, dann wieder
wo anders und bezahlt überall gut.
[S. 224]
**
*
Später, im August 1762, ist er von Amsterdam fortgezogen. Er hat
Kleider, Spitzen, ja selbst Geld von dem Perückenmacher Chaudon
geliehen, das er ihm binnen acht Tagen zurückzahlen sollte. Er hat ihn
jedoch brieflich um weitere acht Tage Aufschub gebeten.
Er hat überdies eine Wohnung in Chambord in Frankreich gehabt[335].
Dort soll er sich geäußert haben, daß er die Tochter eines gewissen
Lambert[336] heiraten wolle. Dadurch sind diese Menschen ruiniert
worden.

Karl Graf Cobenzl
[S. 225]
SAINT-GERMAIN
IN DEN ÖSTERREICHISCHEN NIEDERLANDEN (1763)
I
Aus dem Schriftwechsel des Grafen Karl
Cobenzl[337]
Cobenzl an Kaunitz
Brüssel, 8. April 1763.
Vor etwa drei Monaten ist der unter dem Namen Saint-Germain bekannte
Mann hier durchgekommen und hat mich aufgesucht. Ich fand in ihm den
seltsamsten Menschen, der mir im Leben begegnet ist. Seine Herkunft
kenne ich noch nicht genau; ich glaube jedoch, daß er einer heimlichen
Verbindung aus einem mächtigen und berühmten Hause entsprossen ist. Er
ist im Besitz großer Mittel, lebt aber äußerst einfach. Er weiß alles
und zeigt eine bewundernswerte Rechtschaffenheit und Seelengüte.
In einem zahlreichen Bekanntenkreise hat er vor meinen Augen einige
Versuche gemacht, von denen ich Eurer Exzellenz einige Proben senden
werde. Die wesentlichsten bestehen in der Verwandlung von Eisen in
ein Metall, das ebenso schön ist wie Gold und sich wenigstens ebenso
zu allen Goldschmiedearbeiten eignet, ferner[S. 226] in der Färbung und
Bearbeitung von Leder in einer solchen Vollkommenheit, daß es alle
Maroquins der Welt und die vollkommensten Gerbverfahren übertrifft.
Auch die Seiden- und Wollfärberei hat er zu einer bisher unbekannten
Vollendung gebracht. Hölzer färbt er in den lebhaftesten Farben, und
zwar durch und durch, ohne Indigo oder Cochenille, mit den einfachsten
Zutaten und somit sehr billig. Er stellt auch Malfarben her, das
Ultramarin so tadellos wie das aus Lapislazuli gewonnene. Schließlich
nimmt er den zum Malen verwendeten Ölen den Geruch und stellt aus Rüböl
und anderen noch schlechteren Stoffen das beste Provencer Öl her.
Alle diese Erzeugnisse sind vor meinen Augen hergestellt und befinden
sich in meinen Händen. Ich habe sie aufs schärfste prüfen lassen, und
da ich einen Millionengewinn darin erblicke, habe ich die Freundschaft,
die er mir erweist, dazu benutzt, ihm alle seine Geheimnisse zu
entlocken. Er überläßt sie mir und verlangt nur einen angemessenen
Gewinnanteil, wohlverstanden, erst wenn ein Gewinn da ist.
Da alles Wunderbare notwendig zweifelhaft erscheinen muß, habe ich die
zwei Klippen vermieden, mich täuschen zu lassen und mich auf übermäßige
Ausgaben einzulassen. Zur Vermeidung der ersten Klippe habe ich einen
Vertrauensmann herangezogen, in dessen Gegenwart ich die Versuche
vornehmen ließ. Dabei habe ich mich voll überzeugt, daß es mit diesen
Erzeugnissen seine Richtigkeit hat und daß sie billig sind. Betreffs
des zweiten Punktes habe ich Herrn von Surmont — so nennt
sich Saint-Germain jetzt — einen guten, zuverlässigen Kaufmann aus
Tournai[338] beigegeben, bei dem er jetzt arbeitet. Die sehr geringen
Vorschüsse habe ich durch Frau Nettine[339][S. 227] zahlen lassen, deren Sohn
und Schwiegersohn, Herr Walckiers[340], diese Manufaktur leiten sollen,
sobald die Einnahmen aus den ersten Versuchen uns in den Stand setzen,
sie ohne Risiko anzulegen. Der Augenblick des Gewinnes steht schon
bevor, denn zwei unserer besten Kaufleute, Barbieri und Francolet, sind
über die Schönheit der Seidenfarben so entzückt, daß sie mir zur Zeit
alle Seiden zum Färben geben, die sie in den hiesigen Provinzen wie in
ganz Niederdeutschland vertreiben.
Diese Einzelheiten sind noch sehr unvollkommen, aber ich bitte E. E.,
sie nur als vorläufigen Bericht über eine Sache zu betrachten, die für
die Staatsfinanzen und die Wohlfahrt der Völker Ihrer Majestät von
größter Bedeutung werden kann und muß. Zugleich versichere ich E. E.,
daß ich keine beträchtliche Summe aufs Spiel setzen werde. Bald werde
ich ausführlicher berichten und eine genaue Berechnung des Gewinns,
die ich schon in Arbeit habe, einsenden. Inzwischen bitte ich um
Gutheißung des Geschehenen. Ich glaube mich nicht zu täuschen, wenn
ich versichere, daß die Sache für das Wohl der Monarchie von größter
Wichtigkeit ist.
Kaunitz an Cobenzl
Wien, 19. April 1763.
Ich will heute nur auf die Wunder eingehen, die der berüchtigte
Graf Saint-Germain aus Freundschaft für E. E. vollbringen will.
Ich sehe die Dinge aus der Entfernung und somit ohne den Zauber
der Aufmachung. Aber Sie schreiben mir von Tatsachen, von unter
Ihren Augen gemachten Versuchen, die die strengsten Prüfungen und
Untersuchungen siegreich bestanden haben. Was soll[S. 228] man dazu sagen?
Nur das eine, daß der Zweifel, ob das alles richtig gesehen wurde,
hier um so begründeter ist, weil einerseits auch die gescheitesten
Leute auf chemische Versuche hereingefallen sind, und weil andrerseits
zwischen Versuchen im Kleinen und der Herstellung im Großen ein
himmelweiter Unterschied ist. Ein Modell ist noch keine Maschine, und
ein Versuch beweist noch nichts zu Gunsten einer Fabrik, deren Anlage
kostspielige Vorbereitungen, unsichere Vorschüsse und sehr teure
Betriebseinrichtungen kostet. Ich weiß nicht, was E. E. bereits für den
Betrieb im Großen beschlossen haben. Frau Nettine scheint die gleichen
Erwartungen wie E. E. an den Erfolg dieser Unternehmung zu knüpfen.
Herr Walckiers leitet den wirtschaftlichen Teil, d. h. die Verwaltung.
Das kann auch den ängstlichsten Finanzmann beruhigen.
Aber der Charakter des sonderbaren Mannes, der mehr geeignet ist, die
Menschen zu betören als sie zu überzeugen, flößt mir kein Vertrauen und
keine Sicherheit ein. Beiliegend ein paar Anekdoten über sein Leben.
Ich stehe zwar nicht für ihre Richtigkeit ein, doch war ihr Verfasser
an den Szenen beteiligt, die sich in Frankreich abgespielt haben. Der
Rest ist allgemein bekannt. Das Stück ist in der Tat eine Komödie.
Nur fürchte ich ein wenig, wir werden den Stoff für ihren letzten Akt
liefern, und darum halte ich es für unklug, für die Inszenierung eine
beträchtliche Summe aufs Spiel zu setzen.
Zudem sprechen E. E. sehr zuversichtlich von den Reichtümern des Herrn
von Surmont. Welche Gewißheit haben Sie darüber? Welcher Art sind
diese Reichtümer? Bestehen sie in Geld, Wertpapieren, Landbesitz,
Handelseffekten? Hier sind viele Nebel zu verscheuchen, bevor wir klar
sehen. Ich möchte, daß E. E. sowohl über die Grundlage des Unternehmens
wie über die Verhältnisse[S. 229] des Erfinders Auskünfte einziehen, um
meine Zweifel zu beheben, und daß Sie die mir in Aussicht gestellte
Denkschrift durch einen Sachverständigen ausarbeiten lassen, der die
Einzelheiten klar und deutlich anordnet und in seinem Gutachten soviel
Licht verbreitet, daß wir die Dinge zu beurteilen vermögen.
Alles, was ich Ihnen schreibe, steht noch unter dem ersten Eindruck
Ihrer Mitteilung von den Wundern, die Sie uns verheißen. Ohne die von
Ihnen angeführten Tatsachen hätte die Sache mich eher belustigt als mir
Eindruck gemacht. Aber es kommt gegenwärtig vor allem darauf an, die
Interessen Ihrer Majestät nicht aufs Spiel zu setzen. Das muß ich Ihnen
besonders anempfehlen. Ich erwarte mit Spannung positivere Auskünfte.
Anekdoten über die wunderbare Persönlichkeit,
die sich gegenwärtig in Brüssel aufhält[341]
Vor vier Jahren lebte dieser eigenartige Mann in Frankreich unter dem
Namen eines Grafen Saint-Germain.
Er besaß angeborene Beredtsamkeit, sprach mehrere Sprachen fließend,
war fein gebildet, verstand den Geschmack, die Neigungen und Schwächen
derer zu erfassen, deren Vertrauen er gewinnen will, kannte alle
Kniffe und Pfiffe der Adepten gründlich und wußte sich von den Großen
am Versailler Hofe bewundern und umwerben zu lassen, ja sogar mehrere
geheime Unterredungen mit dem König und der Marquise (von Pompadour)
zu erlangen. Er fand solchen Anklang, daß man nicht nur von seiner
erlauchten Herkunft überzeugt war,[S. 230] sondern auch glaubte, er werde die
Finanzen durch sein tiefes Wissen und seine wunderbaren Geheimmittel
wiederherstellen, und Wohlstand werde unter seiner wohltätigen
Schöpferhand erblühen. Diese Bezauberung währte eine Weile. Er hielt
alle, die sich einen Anteil an seiner Freigebigkeit und an den von
ihm versprochenen Wundern versprachen, in einer Art von Ehrfurcht,
so daß sie sogar auf das Recht des Zweifels verzichteten. Sie wagten
ihm nicht die geringste Frage über die Möglichkeit seiner wunderbaren
Geheimmittel zu stellen, um dies schöpferische Wesen nicht zu kränken.
Trotz seiner einstudierten Miene und seines wohl überlegten Benehmens,
seiner zurechtgelegten Reden und seines stets auf die Umwelt
berechneten Auftretens entschlüpften ihm Unvorsichtigkeiten und
Prahlereien, die die Illusion hätten zerstören müssen. Eines Tages
vergaß er sich so weit, an einer Tafel, an der die erlauchtesten
Personen des Hofes saßen, zu sagen, nur das Haus Bourbon sei ihm auf
Erden ebenbürtig.
Ein Mann, der einem seiner größten und erlauchtesten Bewunderer
nahestand, sah mit Kummer, wie dieser Herr sich blindlings in die
Hirngespinnste des Grafen Saint-Germain verrannte, und wagte ihm
gegenüber einige Zweifel zu äußern. Er fand zunächst schroffe
Zurückweisung, ließ aber nicht locker und setzte es durch, den Grafen
Saint-Germain in seiner Wohnung in Paris überraschen zu dürfen. Er ging
tatsächlich hin und fand ihn in einer ziemlich unsauberen Wohnung. Er
fragte ihn über seine Geheimmittel aus, bekam von ihm aber nur ein paar
Farbproben zu sehen, sowie eine Art von Zauberbuch, eine alte Scharteke
mit Angaben über chemische Prozeduren, deren Wertlosigkeit schon bei
flüchtiger Durchsicht sofort erhellte.
[S. 231]
Diese Feststellungen, die er dem genannten Herrn mitteilte,
erschütterten Saint-Germains Kredit. Obwohl er immer nur von seinen
Reichtümern, von seinen Geldmitteln an allen Plätzen Europas, von den
Schiffen, die er auf dem Meere hatte, und von seiner Beteiligung an
allen bekannten Banken erzählte, beging er die Unklugheit, vom Grafen
Saint-Florentin ein Landgut für 1800000 Franken zu kaufen und einen
förmlichen Kaufvertrag aufzusetzen. An den Tagen, wo die Raten fällig
waren, trafen keine Zahlungen noch Wechselbriefe ein, und der Käufer
verließ Frankreich.
In Holland angelangt, sprengte er aus, er hätte vom Allerchristlichsten
König Vollmacht zu Friedensverhandlungen mit England[342]. Herr d’Affry
schöpfte Verdacht, meldete Saint-Germains Äußerungen an seinen Hof und
erhielt vom Minister des Auswärtigen Befehl, ihn verhaften zu lassen.
Saint-Germain bekam Wind davon und entfloh nach England. Dort hielt er
sich nur sehr kurz auf, vermutlich, weil das englische Ministerium,
das damals mit dem Versailler Hof unterhandelte, eine Frankreich
verdächtige Person nicht aufnehmen wollte. Man riet ihm, das Land zu
verlassen.
Seitdem hat die Öffentlichkeit den eigenartigen Mann aus den Augen
verloren. Man glaubte, er hätte sich nach Berlin begeben, aber
wahrscheinlicher ist es, daß er sich in Holland verborgen hielt.
Kaunitz an Maria Theresia
Wien, 22. April 1763.
In der Generalverwaltung der Niederlande bereitet sich eine Szene vor,
deren Ausgang mir so zweideutig erscheint,[S. 232] daß ich mich verpflichtet
fühle, Eure Kaiserliche und Apostolische Majestät schon jetzt darauf
vorzubereiten, wie ich diese Komödie ansehe.
Aus dem beiliegenden Auszug eines Berichtes des Grafen Cobenzl[343]
ersehen E. M., welche Wunder ein seltsamer Mann, der vor vier Jahren
unter dem Namen eines Grafen Saint-Germain in Frankreich auftrat, zur
Bereicherung Ihrer Finanzen und Untertanen vollbringen will. Graf
Cobenzl spricht mit solcher Zuversicht von dem völligen Gelingen
mehrerer unter seinen Augen gemachter Versuche. Mehr noch: Frau Nettine
geht so hitzig darauf ein, daß ich die Möglichkeit der Sache nicht
abzustreiten wagte, obgleich ich versucht bin, das Ganze als bloße
Vision und Betrügerei anzusehen. Ich habe den Grafen Cobenzl also
aufgefordert, äußerst vorsichtig zu sein, keine Staatsgelder aufs Spiel
zu setzen und Nachforschungen über die Reichtümer seines angeblichen
Orakels anzustellen, von denen er und Frau Nettine mit solcher
Begeisterung, indessen ohne nähere Angaben, sprechen. Zu dem Zweck habe
ich dem Grafen Cobenzl die gleichfalls beiliegende Antwort erteilt
und die Anekdoten über das Leben des angeblichen Grafen Saint-Germain
beigefügt[344], die zu meiner Kenntnis gelangt sind.
Damit habe ich ihre großen Pläne weder verworfen noch gebilligt.
Möglicherweise befinden sich unter der großen Zahl von Geheimmitteln,
deren Ausbeutung so glänzende Erfolge verspricht, auch ein paar recht
brauchbare. Möglicherweise aber löst sich auch alles in Dunst auf. Auf
jeden Fall wäre es angezeigt, wenn E. M. den Inhalt meines Berichts
geheim halten wollten; denn im ersteren Falle würde Saint-Germain
zu sehr eine Entlarvung fürchten, und im zweiten müßte man die
Schwachheit[S. 233] der Regierung, die sich von einem Schwindler anführen
ließ, mit einem Schleier zudecken.
Eigenhändiges Marginal Maria Theresias
Ich bin völlig überzeugt, daß das von Ihnen entworfene Bild mehr
zutrifft als das Cobenzl’sche und daß diese Torheit geheim gehalten
werden muß. Ich wünschte, der Minister wäre von ihr geheilt.
Cobenzl an Kaunitz
Brüssel, 28. April 1763.
Auf den Erlaß vom 19. d. M. versichere ich zunächst, daß die Wunder,
die ich täglich sehe, so groß und zugleich so einfach und so leicht
sind, daß es mich gar nicht wundern würde, wenn E. E. nicht daran
glauben wollten. Auch mir fiel es schwer, das zu glauben, was ich
selbst gesehen habe und dann andere sehen ließ, die bessere Augen haben
als ich. Jedes chemische Verfahren muß selbst denen verdächtig sein,
die in dieser Wissenschaft besser Bescheid wissen als ich. Aber wie
soll man den Glauben an etwas verweigern, das sich vor den eigenen
Augen abspielt, das man selbst macht und das im großen wie im kleinen
das gleiche sein muß? Denn es ist doch ausgeschlossen, daß mit einem
Mittel, womit ein Stück gefärbt wird, nicht auch hundert Stück zu
färben sind. Dazu kommt die völlige Klarheit der physikalischen Gründe,
so daß man erkennt, daß Ursache und Wirkung gleich unfehlbar sind.
Wie ich E. E. schon berichtete, sind die Kosten nicht übermäßig, und
die weiteren Ausgaben sollen aus dem Gewinn bestritten werden. Zur
Verwandlung des Eisens, zum Färben von Holz, Wolle, Seide, Stoffen und
Leder[S. 234] sind bereits folgende Einrichtungen getroffen. Wir haben einen
guten, zuverlässigen Fabrikanten in Tournai[345] angenommen und lassen
dort die nötigen Vorbereitungen treffen. Wir haben ihm den jungen
Lannoy beigegeben, den E. E. in Wien oft gesehen haben. Alles wird so
weit vorbereitet, daß Frau Nettines Sohn am 15. oder 16. Mai, nach
der Rückkehr seiner Mutter von ihrer Reise nach Paris, die sie am 1.
antritt, nach Tournai fahren kann, um dort das Verfahren zu sehen, das
Geheimnis zu erfahren und die Herstellung zu lernen.
Bevor ich Punkt für Punkt auf die Mitteilungen über unseren Mann
antworte, bitte ich E. E. zu bedenken, daß er nichts von uns
verlangt und mir sein Geheimnis überlassen will. Seine persönlichen
Eigenschaften sind uns ziemlich gleichgültig, wofern er uns sein
Geheimnis preisgibt, das ich zum Teil schon besitze und das ich auf die
obengenannte Weise ganz erfahren werde. Nur darauf kommt es an.
Ich sprach zuversichtlich von den Reichtümern dieses Mannes. Folgendes
weiß ich darüber. Er besitzt ein Landgut in Holland, das zu zwei
Dritteln bezahlt ist, und Wertsachen, die der Kaufmann, der sie in
Seeland verpfändet hat, auf über eine Million schätzt. Diese Wertsachen
läßt er herkommen, um sie bei Frau Nettine zu hinterlegen. Alles soll
in einer Denkschrift von berufener Feder ausführlicher dargelegt
werden. Bis dahin bitte ich E. E. versichert zu sein, daß ich sparsam
und nur im Einvernehmen mit Frau Nettine vorgehen werde.
Ich komme zu den Anekdoten, die E. E. mir gütigst mitteilten. Die
großen Fähigkeiten, die man unserem Manne zuschreibt, sind Tatsache,
aber, wie ich hinzufügen muß, verachtet er die Adepten, und abgesehen
von[S. 235] den Unterredungen, die er mit dem Allerchristlichsten König, der
Marquise und den Ministern hatte, besitzt er viele Briefe von der
Marquise und den Ministern, von denen er Gebrauch machen könnte, wenn
er sich für die Härte rächen wollte, mit der Frankreich ihn behandelt
hat.
Er stammt bestimmt aus einem erlauchten Hause, aber das tut nichts zur
Sache, und so muß ich ihm gegenüber das Geheimnis wahren, das er mir
darüber anvertraut hat. Er prahlt allerdings gelegentlich damit, aber
unmöglich kann man an seinen Wundern zweifeln. Ich habe ihm tausend
Einwände gemacht, aber er hat sie alle widerlegt: Ursache und Wirkung
haben mich völlig überzeugt.
Die unbesonnene Bemerkung, die ihm entfahren sein soll, kann zutreffen.
Wie gesagt, ist er in dieser Hinsicht ruhmredig. Ein Mensch, der seine
Herkunft verbergen will, macht bisweilen ungewöhnliche Äußerungen, um
die, welche ihn ausforschen wollen, irrezuführen. Aber nochmals: das
tut nichts zur Sache.
Die Person, die ihn durch Überraschung entlarven wollte, hat ihn
nicht gekannt. Er hat tausend Chemikalien in seinem Zimmer, mit denen
er gar nichts macht. Er streut sie umher, damit man nicht auf die
kommt, die er wirklich benutzt. Bei seinem Charakter wird man ihm sein
Geheimnis durch Überrumplung nicht entreißen. Er überläßt es mir aus
Freundschaft, und sicher wird er es nicht anders überlassen.
Er spricht von seinen Reichtümern und muß große besitzen; denn überall,
wo er war, hat er prachtvolle Geschenke gemacht, viel ausgegeben und
nie jemand um etwas gebeten, auch nirgends Schulden hinterlassen. Der
Umstand mit dem Landgut des Herrn von Saint-Florentin[S. 236] ist mir nicht
bekannt. Aber ich habe Einsicht in Schriftstücke gehabt, aus denen
ich den Grund seiner Reise nach Holland ersah. Es handelte sich um
folgendes.
Der Marschall Belle-Isle, dem er besonders nahestand, schickte
ihn insgeheim nach Holland, um mit dem General Yorke über einen
Sonderfrieden zu verhandeln. Das hat er getan; d’Affry wurde
eifersüchtig und beschwerte sich lebhaft. Der Herzog von Choiseul
war über die Sache wie über die Form aufgebracht und verfuhr gegen
Saint-Germain in der allgemein bekannten Weise[346].
Ich habe die Schriftstücke gesehen und finde auf Saint-Germains Seite
kein Verschulden. Aber selbst wenn ein solches vorläge, täte es
nichts zur Sache; denn hier handelt es sich nur um Erlangung seiner
Geheimmittel. Ich habe anfangs gefürchtet, daß Frankreich, nachdem es
ihn aus Holland und England vertrieben hat, ihn auch hier verfolgen
möchte. Aber er ist schon seit vier Monaten hier, und Frankreich hat
bisher nichts unternommen. Daß dies noch geschehen könnte, fürchte ich
um so weniger, als Frau Nettine den Grafen Starhemberg[347] und Herrn
de Laborde[348] aufklären wird, und diese werden sicher verhindern, daß
Frankreich bei uns seinethalben vorstellig wird.
Nach seiner Abreise aus England hat er sich in Holland aufgehalten. Er
hatte dort besonders enge Beziehungen zum Grafen Bentinck[349], Herrn
van Gronsfeld-Diepenbroek[350] und dem Bürgermeister Hasselaar[351]
in Amsterdam. Er hat das Gut Ubbergen gekauft[352], nach dem er sich
Surmont nennt. Dort wollte er eine Manufaktur einrichten.[S. 237] Der
Zufall führte ihn hierher, und er besuchte mich auf der Durchreise.
Seine Kenntnisse in der Malerei und Zeichenkunst bildeten den
Anknüpfungspunkt; allmählich kam er auf seine Entdeckungen zu sprechen.
Infolge meiner Ungläubigkeit ging er auf Einzelheiten ein. Da ich für
Freundschaft empfänglich bin, bezeigte ich ihm die meine und machte ihn
mit Frau Nettine bekannt. Die ausgezeichnete Erziehung, die sie ihren
Kindern gibt, machte ihm Eindruck, und er schloß sich derart an sie und
an mich an, daß ich glaube, wir könnten ihn zu allem bringen.
Das ist seine ganze Geschichte. E. E. werden sobald wie möglich
genaue und ausführliche Einzelheiten über alle unsere Versuche nebst
den Proben unserer Erzeugnisse erhalten und daraus erkennen, daß die
Sache ihre Richtigkeit hat. Inzwischen wollen E. E. überzeugt sein,
daß wir uns auf übermäßige Ausgaben nicht einlassen werden, und daß
ein glücklicher Zufall uns durch diesen Mann, mag er sein, wer er
will, ein Mittel geschenkt hat, um unsere Provinzen zu bereichern und
den Staatsfinanzen einen vielleicht über Erwarten großen Gewinn zu
verschaffen.
Kaunitz an Cobenzl
Wien, 10. Mai 1763.
Die Auskünfte Eurer Exzellenz zur Behebung meiner Zweifel an all den
Wundern, die Herr von Surmont zugunsten unserer Finanzen wirken soll,
vermehren nur meine Überraschung. Noch einmal: ich habe gegen Tatsachen
nichts einzuwenden und glaube, wie E. E. schreiben, daß man mit einer
Chemikalie, mit der man ein Stück Stoff färbt, auch mehrere färben
kann. Weniger leicht ist der Nachweis, daß, wenn das Färben eines
Stückes nur[S. 238] einen Gulden kostet, das Färben von tausend Stück sich
nur auf tausend Gulden beläuft. Zur Herstellung im Großen bedarf es
der Vorbereitungen, besonders bei chemischen Verfahren. Dazu kommt die
Verwaltung, die Notwendigkeit, seine Geheimverfahren einer großen Zahl
von Menschen mitzuteilen, tausend Zufälle, die durch Nachlässigkeit,
Untreue oder Faulheit der Arbeiter entstehen, die Preissteigerung der
Herstellungsmittel infolge starken Bedarfes. Alle diese Unkosten müssen
berechnet und von dem Gewinn abgezogen werden, der aus einem Versuch im
Kleinen errechnet ist. Hier gilt nicht die gewöhnliche Rechnung, daß
zwei mal zwei vier ist. Deshalb gab ich E. E. zu bedenken, daß zwischen
einem Versuch im Kleinen und der Herstellung im Großen ein himmelweiter
Unterschied ist, und daß man bei dergleichen Untersuchungen nicht
auf einfachen Versuchen fußen kann. Bliebe mir somit auch nicht
der geringste Zweifel mehr über das Vorhandensein der wunderbaren
Geheimverfahren des Herrn von Surmont, so kann ich mich doch nicht
überzeugen, daß sie im Großbetrieb einen so sicheren und gewaltigen
Gewinn abwerfen, wie er ihn in Aussicht stellt.
Auch die Geschichte von seinen Wertsachen, die auf eine Million
geschätzt und doch in Seeland verpfändet sind, erscheint mir höchst
verdächtig. Ein so schwer reicher Mann, der ein ganzes Peru in seiner
Brieftasche trägt, verpfändet seine Wertsachen und besitzt ein Landgut,
das er noch nicht bezahlt hat! Wie Sie mir zugeben werden, lieber Graf,
sind das auffällige Widersprüche.
Aber schließlich halten die von Ihnen gesehenen und von
Sachverständigen geprüften Tatsachen mich ab, diesen Zweifeln und
Schwierigkeiten ganz nachzugeben. Ich bin nicht überzeugt, aber ich
möchte es werden, und deshalb[S. 239] mache ich mir Sorge darüber, daß Sie
sich für die Anlage von so kostbaren Manufakturen eine Stadt an der
Grenze ausgesucht haben. Sie müssen dort notgedrungen die ganze
Aufmerksamkeit und Eifersucht unserer Nachbarn erregen. Auch Herr
von Surmont selbst ist dort nicht völlig sicher. Ich bin wirklich
überrascht, Herr Graf, daß Sie, der Sie sich als Augenzeuge gewiß mehr
von seinen Geheimmitteln versprechen, als ich bisher zu hoffen vermag,
nicht gefürchtet haben, den ganzen Kram so aufs Spiel zu setzen, indem
Sie ihn in Tournai anlegen. Doch auch das wird seine Gründe haben.
Somit erwarte ich mit Spannung Ihre Denkschrift und Ihre Proben.
Cobenzl an Kaunitz
Brüssel, 19. Mai 1763.
Ich will E. E. heute nicht mit langen Einzelheiten über Herrn von
Surmont belästigen; denn ich hoffe, bald einen eingehenden Bericht
übersenden zu können. Alles Wunderbare oder Unbegreifliche überrascht,
selbst wenn man es greifbar vorgeführt sieht. Die vorzügliche Qualität
und die Billigkeit muß uns den Vorrang in der Färberei und Gerberei
geben. Ich hoffe, die Proben zu erhalten, und werde sie E. E. sofort
übersenden. Inzwischen darf ich versichern, daß ich keinen Schritt
ohne Frau Nettine tue, und daß wir uns in den Ausgaben beschränken.
Als Ort habe ich Tournai bestimmt, weil die Anlage dort billiger
ist und ich dort einen Vertrauensmann und Sachverständigen für die
Manufakturen (Rasse) habe, schließlich auch, weil ich dort am wenigsten
Schwierigkeiten mit den abscheulichen Zünften befürchte. Mein Mann
kommt heute aus Tournai zurück und wird in zwei bis drei Tagen mit
Herrn von Nettine wieder hinfahren. Dieser letztere allein soll in das
Geheimverfahren eingeweiht werden,[S. 240] und dies ist derart, daß weder die
Arbeiter noch die Werkmeister es je erraten können. Frau Nettine hat
bei ihrer Reise nach Paris nichts Ungünstiges über unseren Mann gehört
und sich durch ihre Schwiegersöhne die Sicherheit verschafft, daß wir
bei keiner einzigen Unternehmung Widerstand zu befürchten haben. Sobald
Herr Nettine das Geheimverfahren kennt, werden wir einen richtigen
Vertrag aufsetzen, den ich E. E. zur Genehmigung unterbreiten werde.
Damit werden unsere großen Hoffnungen, die ich auf das Unternehmen
setze, zur Gewißheit werden.
Brüssel, 27. Mai 1763.
Ich beehre mich, E. E. die Proben von Metall, gefärbter Seide,
Wolle, Leder und Holz zu übersenden. Ich habe die Päckchen mit den
vom Erfinder versehenen Aufschriften und den von ihm gegebenen
Erläuterungen gelassen. Ich hoffe, E. E. werden alles vortrefflich
finden. Ich wiederhole nur, daß all diese schönen Färbungen mit den
einfachsten Mitteln hergestellt sind, und daß keine Cochenille verwandt
ist; somit ist alles sehr billig. Alle anderen Farben sind in gleicher
Weise zu erzielen. Grün gefärbte Seide, Wolle oder Holz habe ich nicht
gesehen, aber wie mein Mann sagt, kann er auch das machen.
Sehr wichtig ist, wie ich selbst nachgeprüft habe, daß man nach
erfolgter Färbung aus dem Farbwasser die schönsten Malfarben, selbst
Ultramarin, gewinnt; bisher aber brauchte man zum Blau Cochenille. Der
Erfinder glaubt jedoch, ein Verfahren zu finden, wo dies sich erübrigt.
Doch ich kann nur für das einstehen, was ich selbst sah.
Nächsten Sonntag[353] fährt er mit Nettine nach Tournai und wird
uns alle seine Geheimverfahren angeben. Nettine[S. 241] wird sie selbst
ausprobieren, bis er sicher ist, sie nachahmen zu können. Danach werden
wir unseren Vertrag entwerfen, und ich werde ihn E. E. zur Genehmigung
vorlegen.
Ich brauche wohl nicht hinzuzufügen, daß diese Farben nicht die
einzigen sind, mit denen wir färben können. Befehlen E. E. noch andere
zu haben, so bedarf es nur der Zusendung einer Probe.
Brüssel, 28. Mai 1763.
Nach Abgang der Proben, die ich E. E. übersandte, übergab mir Herr
von Surmont die beiliegende Denkschrift, die zur weiteren Erläuterung
dient[354]. Ich hoffe, in einigen Tagen melden zu können, daß er uns
seine Geheimverfahren angegeben hat; denn er wird morgen bestimmt mit
dem jungen Nettine abreisen.
Dorn[355]
an Cobenzl
Wien, 8. Juni 1763.
Der Herr Kanzler wollte heute die drei Briefe E. E. vom 27. und 28. Mai
d. J. beantworten, wurde aber durch eine starke Kolik daran verhindert.
Ich beehre mich also, E. E. in seinem Auftrage mitzuteilen, daß die
Proben von gefärbter Seide und Wolle hier nicht die gleiche Bewunderung
erregt haben wie in Brüssel. Das Färben von Holz ist keine Seltenheit
und eignet sich nicht zu[S. 242] einem Handelsartikel, der in Wettbewerb mit
über fünfzig indischen Holzarten treten muß. Diese sind eine schöner
als die andere und sämtlich von einer Überlegenheit in den Farben und
auch sonst für die Kunstschreinerei so viel besser geeignet, daß man
sie stets Ihren billigen gefärbten Hölzern vorziehen wird. Die Metalle
sind das verdächtigste und zugleich das belangloseste von all diesen
Wundern. Nur das Leder scheint einige Beachtung zu verdienen. Es
werden Musterkarten von gefärbter Seide und Wolle, die wir hier haben,
aufgestellt werden. Neben jeder Gattung wird der Preis für ein Pfund
vermerkt. Eine andere Musterkarte wird über gefärbtes Leder aufgestellt
werden. Die Metalle werden chemisch geprüft und analysiert werden.
E. E. sollen alle Auskünfte erhalten, die wir uns über diese Dinge
beschaffen können.
Inzwischen aber sind wir weit entfernt, sie für so äußerst
gewinnbringend zu halten, wie man es in den Niederlanden hofft. Der
Herr Kanzler kann also nicht umhin, E. E. mitzuteilen, daß alle
Vorarbeiten, die etwa zur Herstellung im Großen im Gange sein sollten,
einzustellen sind, und daß mit Herrn von Surmont nichts abzuschließen
ist, bis wir in der Lage sind, Ihnen den ausdrücklichen Befehl Ihrer
Majestät hierüber kundzugeben.
Damit soll aber nicht alles verworfen werden. Unter diesen
Geheimverfahren befinden sich einige, die, im Kleinen angewandt, wohl
etwas Gewinn abwerfen könnten. Aber nach den Proben zu urteilen,
befindet sich darunter nichts, dessentwegen man so große Ausgaben aufs
Spiel setzen dürfte, wie sie schon die Vorbereitungen zur Anlage eines
Großbetriebes vielleicht erfordern.
Herr von Surmont verspricht uns in seiner Denkschrift zwar Fortschritte
in der Feinheit und Leuchtkraft der Farben; er müßte aber doch wissen,
daß wir uns ein[S. 243] Urteil darüber nur aus den Proben bilden können, und
die sprechen so wenig zu seinen Gunsten, daß unsere hiesigen Farben
für Seide weit besser sind als die seinen. Es überrascht uns hier
etwas, daß man seine Erzeugnisse nicht mit anderen verglichen hat,
oder, wenn dies geschehen ist, daß man sich hat täuschen können. Man
hat in Brüssel — oder sollte sie doch haben — die prachtvollen
englischen und die glänzenden, schönen französischen Farben, mit denen
die des Herrn von Surmont keinen Vergleich aushalten. Werden diese
doch selbst von unseren Wiener Farben übertroffen. Die Billigkeit
kann diesen Mangel nicht aufwiegen; denn entweder will man nur für
den Absatz in den Niederlanden arbeiten, und dann ist die Sache gewiß
nicht der Mühe wert, oder man will auch ans Ausland verkaufen und
dessen Seiden zum Färben ins Land ziehen. Im letzteren Falle würden
aber die Frachtkosten und Kommissionsgebühren, der Zeitverlust und
zu alledem die Minderwertigkeit der Farben den Gewinn, der aus der
Billigkeit entspringen könnte, auf ein Nichts herabdrücken. Das Färben
ohne Cochenille und Indigo ist kein Kunststück. Kunckel, Lémery[356]
und viele andere sehr verbreitete Bücher geben das Geheimnis und das
Verfahren der Herstellung an. Nur wenn man ohne diese Farbstoffe so
lebhafte, schöne, leuchtende und haltbare Farben herstellen könnte wie
diejenigen, die auf Cochenille, Indigo und anderen teuren Farbstoffen
beruhen, so wäre das ebenso ertragreich wie selten. Aber gerade das
vermißt man bei den Surmont’schen Proben.
Was ich E. E. mitzuteilen habe, schließt nicht aus, daß Sie Herrn
von Surmont in der bisherigen Weise weiter empfangen. Im Gegenteil,
man darf ihm kein[S. 244] Mißtrauen zeigen. E. E. wollen nur darauf bedacht
sein, nichts zu unternehmen, nichts abzuschließen und keine erhebliche
Ausgabe zu machen, bis der Herr Kanzler Ihnen die Absichten Ihrer
Majestät über die Gesamtheit Ihrer Unternehmungen mitteilen kann.
Hiervon wollen E. E. auch Frau Nettine in Kenntnis setzen.
Dorn an den Kommerzienrat Thys in Klagenfurt
(Wien, 9. Juni 1763.)
Im Vertrauen auf Ihre Einsicht und Rechtschaffenheit möchte der Herr
Kanzler Sie über eine Angelegenheit um Rat fragen, die für Ihre
Heimat, die Niederlande, ebenso belangreich ist wie für den Dienst
Ihrer Majestät. Somit möchten Sie nach Empfang dieses Schreibens oder
wenigstens baldmöglichst mit der Post hierher kommen. Die Reisekosten
werden Ihnen erstattet.
**
*
Über das Ergebnis der Untersuchungen von Thys berichtet Kaunitz
am 21. Juli 1763 an Maria Theresia:
„Da es sich um eine Unternehmung handelte, die nach Cobenzls ständig
wiederholter Versicherung von größtem Nutzen für den Staat sein sollte,
und ich in meinem Eifer dies Ziel sehnlichst herbeiwünschte, ließ
ich aus Klagenfurt den Kommerzienrat Thys kommen, um ihn insgeheim
zu Rate zu ziehen. Er hatte der hiesigen Beurteilung der Proben von
Surmonts Geheimverfahren und der Unzuträglichkeit ihres Staatsbetriebes
nichts hinzuzufügen und hielt es gleichfalls für unmöglich, diesen
Erzeugnissen einen Absatz zu verschaffen, der den in den Niederlanden
gehegten überspannten Erwartungen entsprach. Durch einen praktischen
Versuch in Gegenwart des Departements-Referenten[357][S. 245] stellte er
fest, daß die meisten Surmont’schen Farben nicht mal die erforderliche
Qualität besaßen. Auch war er überzeugt, daß das Gelb, wenn es auch
leuchtender war als das hiesige, gegen das französische und englische
Gelb nicht aufkommen kann. Schließlich hatte Surmont in seiner
Denkschrift[358] erklärt, daß in den Niederlanden niemals Stoffe aus
Ziegenhaar gefärbt worden seien, wie er sie zu färben sich anheischig
machte, aber Thys versicherte, er selbst hätte Brüsseler Kamelott in
dem gleichen Kübel mit Tuch zusammen scharlachrot gefärbt, und beides
sei gleich gut ausgefallen.“
Cobenzl an Kaunitz
Brüssel, 19. Juni 1763.
E. E. erhalten demnächst einen ausführlichen Plan der Manufaktur in
Tournai. Wenn die Sache auch nicht so großartig ist, wie ich geglaubt
habe, werden hoffentlich E. E. die Überzeugung gewinnen, daß der
Versuch sich lohnt.
Kaunitz an Cobenzl
Wien, 21. Juni 1763.
Die Vorstellung, die Sie immer noch von den angeblichen Geheimnissen
Ihres Adepten haben, steigert sich nachgerade zur Begeisterung. Das
geht über meine Begriffe. Da Sie an Ort und Stelle die gefärbten
Stoffe mit den englischen, französischen und holländischen vergleichen
und durch sachkundige Kaufleute den Umsatz der Färberei in Europa
abschätzen lassen können — wie ist es da denkbar, daß Sie sich
einbilden, Ihre Farben, die, bis auf das Gelb, tatsächlich ganz
gewöhnlich sind, würden[S. 246] Nachfrage finden oder es ergäbe sich die
Möglichkeit zu einem anständigen Gewinn? Dabei spreche ich gar nicht
einmal von dem Riesengewinn, den man Ihnen eingeredet hat. Da Sie
absolut nichts Neues zu bieten haben, kommt auch ein Monopol gar nicht
in Frage, der einzige Weg, auf dem sich Neuheiten wenigstens für eine
Zeitlang ausbeuten lassen.
Ihre Hölzer und Metalle sind nur Armseligkeiten — verzeihen Sie mir
den Ausdruck, mein lieber Graf! Von dem Holze zu reden, lohnt nicht
einmal die Mühe. Was haben Sie mit dem Metall vor? Gesetzt, es eignete
sich zur Herstellung von Leuchtern, Lichtputzern, Feuerzeugen usw.,
wollen Sie für das alles Werkstätten anlegen oder das Metall in Barren
oder Blöcken verkaufen? In diesem Falle wird es entweder nachgeahmt,
und Sie haben nur die Unkosten davon, oder es kommt in Mißkredit durch
die Mängel, die so viele verschiedene minderwertige Verbindungen von
Kupfer und Zink in Verruf gebracht haben, wie Tombak, Similor u. a.
m., die eines guten Goldüberzuges bedürfen, um erträglich zu sein. Im
ersten Falle aber frage ich: Wo ist die Aussicht auf Riesengewinne?
Wo ist auch nur die Möglichkeit, die Konkurrenz so vieler, schon
bestehender derartiger Fabriken aus dem Felde zu schlagen? Welche
Sicherheit haben Sie, auch nur die Anlage-, Verwaltungs- und
Betriebskosten zu decken?
Von Ihren Ölen will ich schweigen. Wie ich mir Ihren Abenteurer
vorstelle, muß ich glauben, daß es ihm gelingen wird, Ihnen auch
hierbei wie bei allem übrigen etwas vorzumachen. Wie, Herr Graf?
Jemand, der anderthalb Millionen Vermögen und so wunderbare
Geheimmittel besitzt, sollte nicht selbst Gebrauch davon machen,
sondern Ihnen aus purer Freundschaft seine Reichtümer ausliefern?
Wahrhaftig, ein derartiges Benehmen spricht[S. 247] aller Wahrscheinlichkeit
zu sehr Hohn, als daß es auf irgendwen Eindruck machen könnte. Wäre der
Mann seiner Sache gewiß, er brauchte Sie nur um Genehmigung zu bitten
und dann auf eigene Rechnung zu arbeiten. Aber seine Geheimmittel
werden teuer zu stehen kommen, so sagen E. E. jetzt selbst, und doch
soll ihre Ausbeutung spottbillig sein. Mich deucht, wir stehen damit
vor der Lösung des Knotens, und so erklärt sich auch die Freundschaft,
die ihn zu seinen vertraulichen Eröffnungen gedrängt hat.
Wie dem aber auch sei, ich habe Sie rechtzeitig gewarnt, kein Geld auf
Kosten Ihrer Majestät aufs Spiel zu setzen. Ich nehme daher an, daß Sie
nicht zu weit gegangen sind, und warne Sie nochmals, etwas aufs Spiel
zu setzen, bis wir auf Grund Ihrer Denkschrift klar, ganz klar sehen.
Erst dann können wir Sie zu beträchtlichen Ausgaben oder kostspieligen
Verpflichtungen ermächtigen.
Cobenzl an Kaunitz
Brüssel, 25. Juni 1763.
Ich berichte E. E. ganz gehorsamst über alles, was ich mit meinem
eigenartigen Manne abgeschlossen habe. Der Ordnung halber muß ich einen
Teil von dem wiederholen, was ich in meinen früheren Berichten gesagt
habe.
Der Mann suchte mich hier gleichsam nur auf der Durchreise auf.
Trotzdem seine Lebensgeschichte und selbst seine Person in
geheimnisvolles Dunkel gehüllt ist, fand ich bei ihm hervorragende
Begabung für alle Künste und Wissenschaften. Er ist Dichter, Musiker,
Schriftsteller, Arzt, Physiker, Chemiker, Mechaniker und ein
gründlicher Kenner der Malerei. Kurz, er hat eine universelle Bildung,
wie ich sie noch bei keinem Menschen fand, und er spricht alle Sprachen
fast gleich gut, am besten[S. 248] Italienisch, Französisch und Englisch. Er
hat fast die ganze Welt bereist, und da er bei all seinen Kenntnissen
sehr unterhaltsam war, verbrachte ich meine Mußestunden sehr angenehm
mit ihm. Ich kann ihm nur häufige Prahlereien über seine Talente und
seine Herkunft zum Vorwurf machen.
Bis dahin drehten sich unsere Gespräche nur um Gegenstände der Bildung
und Unterhaltung. Als er aber von seinen Geheimmitteln anfing, mir
davon Erzeugnisse zeigte und Hoffnung machte, sie mir mitzuteilen,
wollte ich mich nicht länger auf mich allein verlassen und machte
ihn mit Frau Nettine bekannt. Sie war von den Talenten des Herrn von
Surmont nicht weniger begeistert als ich. Er bezeugte die größte
Freundschaft für sie, ihre Familie und für mich selbst, und wir ersahen
daraus, daß es nur von uns abhing, in Besitz aller seiner Geheimmittel
zu kommen. Also prüften wir eifrig ihre Brauchbarkeit und ersahen aus
manchen Proben und den Gutachten aller Sachverständigen, daß sein
Metall vielleicht gut ist, daß seine Färbstoffe hervorragend sind, daß
seine Hölzer weit besser ausfallen als die in Frankreich gefärbten, daß
seine Lederarten von größter Bedeutung sind, und daß seine Hüte einen
sehr erheblichen Handelsartikel bilden können.
Je weiter wir mit ihm kamen, desto mehr erkannten wir, daß seine
seltenen Gaben Hand in Hand mit äußerstem Eigensinn gingen, daß
er unseren Wünschen nur entgegen kam, damit wir uns den seinen
anbequemten, und daß es kein anderes Mittel gäbe, seine Geheimmittel
zu erlangen, als in die Anlage einer Fabrik zu willigen. Hierzu wählte
ich die Stadt Tournai aus den früher genannten Gründen[359]. Doch
dazu waren Ausgaben nötig. Um mich darauf einzulassen,[S. 249] hätte es der
vorgängigen Erlaubnis bedurft, die ich aber von E. E. nicht erlangen
konnte. So sprang denn Frau Nettine mit ihrem gewohnten Eifer ein und
erklärte sich, wie sie selbst an den Herrn Referendar schrieb[360],
gern bereit, das Unternehmen auf eigene Rechnung zu führen, falls Ihre
Majestät es nicht übernehmen wolle.
Die Anlage 1 enthält die Aufstellung der von ihr bereits aufgewandten
sowie der noch weiter erforderlichen Summen.
Wir haben also unsere Manufaktur begründet. Der Graf ist mehrfach nach
Tournai gereist, und der Kaufmann Rasse, bei dem ich ihn untergebracht
hatte, hat ihn mit größtem Eifer unterstützt.
Unterdessen erzählte der Graf uns von seinen Reichtümern, insbesondere
von den Wertsachen, die er in Holland hätte. Wir wollten Erkundigungen
darüber einziehen, und der Kaufmann aus Nimwegen, sein Geschäftsfreund,
veranschlagte sie auf mindestens eine Million. Da der Graf kein Geld
hatte und seine Wertsachen herkommen lassen wollte, machte Frau Nettine
ihm die in Anlage 2 aufgeführten Vorschüsse. Wir merkten indes, daß
der Nimweger Geschäftsfreund mit ihm unter einer Decke stecken mußte;
die hier eingetroffenen Wertsachen waren ganz unbedeutend, und was in
Holland verblieben ist, besteht nur aus Gemälden, die er sehr hoch
bewertet, die aber wenig Wert zu haben scheinen. Außerdem merkten wir,
daß der Graf verschuldet war und von seinen Gläubigern in Holland
gedrängt wurde. Dazu herrscht in seinen Privatverhältnissen so wenig
Ordnung und Sparsamkeit, daß wir angesichts seiner Kenntnisse darüber
staunen.
[S. 250]
Wir konnten also nur wünschen, ihn loszuwerden, seine Geheimmittel
möglichst billig zu erfahren, jede weitere Ausgabe zu vermeiden und
die Leitung des Unternehmens einem Manne fortzunehmen, der bei seinem
Mangel an Ordnung die Einkünfte in unmäßigen Ausgaben vergeudete. Zu
dem Zweck schickte ich den Vicomte von Nettine nach Tournai, damit er
sich dort alle Geheimmittel angeben ließ und sie selbst ausprobierte.
Sobald ich sicher war, daß wir sie besaßen, schickte ich meinen
Neffen[361] mit Herrn Walckiers nach Tournai, um den Handel mit dem
Grafen abzuschließen. Das haben sie unter den in Anlage 3 angegebenen
Bedingungen getan.
Wir sind jetzt also im Besitz folgender Geheimverfahren: Wir können
Eisen in Metall verwandeln. Ist dies Metall gut, so ist es ein
Vorteil mehr. Taugt es nichts, so ist die Ausgabe verschwindend,
und wir gebrauchen auch nur wenig, da für das zum Färben der Häute
erforderliche Wasser nicht viel nötig ist. Aber diese Färberei ist von
höchster Bedeutung, und das Metallwasser besorgt nicht bloß das Färben,
sondern zieht auch die Häute zusammen, wodurch sie stärker werden und
auch kernig bleiben. Wir haben also eine Gerberei eingerichtet, von der
in Anlage 4 die Rede ist. Anlage 5 enthält die Gegenüberstellung der
bisher landesüblichen Preise für die Häute und der Preise, wie sie sich
nach unserem Verfahren stellen.
Wir besitzen das Verfahren zum Färben von Wolle, Seide, Garn,
Ziegenhaar und Baumwolle. Die Wichtigkeit dieser Sache ergibt
sich aus dem in Anlage 6 dargelegten Preisunterschied zwischen
unserem Färbverfahren und[S. 251] dem bisher angewandten. Der Absatz ist
sichergestellt; denn unsere größten Kaufleute haben uns bereits
schleunigst ihre Tuche, Kamelotte, Seiden und Wollstoffe zum Färben
gegeben. Schon dieser Gewerbszweig allein kann Ihrer Majestät
beträchtlichen Gewinn und den hiesigen Provinzen unendlichen Segen
verschaffen.
Der Rückstand wird danach zum Färben des Holzes benutzt, was ein
kostenloser Gewinn ist. Wäre er auch unbedeutend, so verdient er als
Reingewinn doch Beachtung.
Die Malfarben, die, wie wir wissen, von französischen Malern
ausprobiert sind, bilden ebenfalls einen Reingewinn ohne jede Kosten,
denn sie werden nur aus dem Bodensatz der obigen, bereits benutzten
Färbstoffe gewonnen.
Die Hutfabrikation schließlich ist auch ein sehr beträchtlicher Posten,
wie sich aus Anlage 7 ergibt.
Aus allen diesen Einzelheiten ersehen E. E., welche Verfahren wir
erworben haben, welchen Gewinn wir uns davon versprechen können und
welche Auslagen wir bereits gemacht haben. Ich brauche nur noch über
die weiter erforderlichen Ausgaben zu berichten, was in Anlage 8
ausgeführt ist.
Nun kommt es auf die Allerhöchste Entscheidung an, ob Ihre Majestät
das Unternehmen der Frau Nettine überlassen oder es auf eigene
Rechnung übernehmen will. Das letztere scheint mir in jeder Hinsicht
empfehlenswert. In diesem Falle müßte man Frau Nettine ihre Vorschüsse
auf das Unternehmen mit vier Prozent verzinsen und das Kapital nach
und nach aus dem Gewinn zurückzahlen. Auch wäre es recht und billig,
ihren Sohn zum Generaldirektor des Unternehmens zu ernennen. Er
eignet sich dazu besonders durch seinen Eifer und seine Einsicht
und[S. 252] als Alleinbesitzer des Geheimverfahrens. Er brauchte nur Seiner
Königlichen Hoheit[362] und der Überwachung des Ministers unterstellt
zu werden. Der Staatsrat und Lotteriedirektor Walckiers[363] könnte
zum Königlichen Kommissar für das Unternehmen ernannt und dies
der Lotterieverwaltung angegliedert werden. In Anbetracht des zu
erzielenden Gewinns könnte Nettine entweder ein festes Gehalt oder
einen Gewinnanteil bekommen.
Ich bitte E. E., mir über dies alles die Befehle Ihrer Majestät
zukommen zu lassen, und bemerke nur noch, daß ich in alledem mit
höchster Billigung Seiner Königlichen Hoheit verfahren bin und diesen
Bericht, den ich ihm vorgelesen habe, nur auf seinen Befehl absende.
BEILAGEN
1. Aufstellung der für die Manufaktur in Tournai
ausgegebenen Gelder
Färberei und Lager
Zwei große Häuser, das eine zum Abschweifen der Seide und zum Färben
überhaupt, das andere als allgemeines Lager, nebst zwei kleinen
anstoßenden Häusern. Kaufsumme in Gulden Kurant
31.035 Gulden.
5 Sols, 4 Pfennig
[364]
(NB. Von diesen 31.035—5—4 Gulden sind nur 12.400 bezahlt. Der Rest
ist auf die Häuser in Hypotheken zu 4 Prozent aufgenommen.)
[S. 253]
|
|
Gulden
|
|
Ein Haus, das mit dem ersten in Verbindung steht,
|
3000—
|
|
Zum Ankauf eines Geländes zwecks Erweiterung der
Wasserleitung, die durch den Garten der Färberei läuft,
|
630—
|
|
Anlagen zur Benutzung der Wasserleitung
|
1000—
|
|
Reparaturen an den vorgenannten Häusern
|
7500—
|
|
Noch im Gange befindliche Reparaturen höchstens
|
3000—
|
|
Ein großer Zinnkübel und Kessel aus Gelbkupfer für
die Färberei
|
5300—
|
|
Kleine Kübel aus Zinn u. Steingut, Pressen und
anderes notwendiges Färbereigerät
|
3000—
|
|
Drei Zylinder
|
2000—
|
|
Gesamtausgabe für die Färberei
|
56135—5—4
|
Gerberei
|
|
Gulden
|
|
Ankauf eines Hauses für die Gerberei
|
7800—
|
|
Für notwendige Umbauten
|
9000—
|
|
Für die notwendigen Geräte
|
2500—
|
|
Gesamtausgabe für die Gerberei
|
19300—
|
Hutfabrik
|
|
Gulden
|
|
Ankauf eines Hauses für die Hutfabrik
|
1500—
|
|
Vorgenommene und noch vorzunehmende Reparaturen
|
2760—
|
|
Gerät für 6 Walken
|
1440—
|
|
Gesamtausgabe für die Hutfabrik
|
5700—
|
|
[S. 254]
|
Gulden
|
|
Ankauf eines Hauses für den Grafen Surmont
|
13500—
|
Verschiedene andere Ausgaben
|
|
Gulden
|
|
Kosten und Gebühren für den Ankauf der obigen Häuser
|
800—
|
|
Verschiedene Ausgaben des Herrn Rasse für die
Manufaktur
|
4500—
|
|
Zusammen
|
5300—
|
Gesamtaufstellung
|
|
Gulden
|
|
Ausgaben für die Färberei und das Lager
|
56135—5—4
|
|
„ „ „ Gerberei
|
19300—
|
|
„ „ „ Hutfabrik
|
5700—
|
|
Das Haus für den Grafen
|
13500—
|
|
Verschiedene Ausgaben
|
5300—
|
|
Gesamtsumme Gulden Kurant
|
99935—5—4
|
2. Aufstellung der Vorschüsse und Auslagen für den
Grafen Surmont
|
|
Gulden
|
|
Verschiedene Vorschüsse der Frau Nettine
|
81720—
|
|
Auslagen des Herrn Rasse und der Frau Nettine für
den Unterhalt des Grafen sowie für seine Reisen nach Tournai usw.
|
12280—
|
|
Gulden Kurant
|
94000—
|
3. Vorläufige Bedingungen, die zwischen Graf Cobenzl und dem Grafen
Surmont vereinbart sind
Der Graf von Surmont wird lebenslänglich[365] an den jetzt in
Tournai errichteten Manufakturen zur Hälfte beteiligt.
[S. 255]
Von dem ihm zufallenden Gewinn sind die ihm vorgeschossenen Summen und
die für ihn zu machenden Auslagen abzuziehen. Nach erfolgtem Abzug soll
er über seinen Gewinn frei verfügen.
Der Graf verpflichtet sich dem Grafen Cobenzl gegenüber noch zur
Angabe der Herstellung von Blau und Grün, der Verfeinerung von Ölen,
des Krempelns von Leder zur Herstellung von Hüten oder zu jedem
anderen, ihm bekannten Gebrauch, sowie zur Bekanntgabe jedes anderen
Geheimverfahrens oder jedes geeigneten Mittels, um die Manufakturen zur
größten Vollendung zu bringen.
Graf Surmont hat diese Bedingungen unterzeichnet.
4. und 5. Gerberei usw.
Eine Ochsenhaut im Gewicht von 70 Pfund kostet, gegerbt und
zugerichtet, einschl. des Arbeitslohns und der Unkosten 14 Gulden 15
Sols. Die Haut verliert gewöhnlich die Hälfte ihres Gewichts und wird
mit 9 Sols das Pfund verkauft, somit 35 Pfund = 15 Gulden 15 Sols. Der
Gewinn auf jede Haut beträgt 1 Gulden 10 Sols oder 11 Prozent.
Eine Kuhhaut im Gewicht von 45 Pfund, gegerbt und zugerichtet, kostet 7
Gulden 15 Sols. Völlig appretiert wiegt sie nur 15 Pfund und wird das
Pfund zu 14 Sols verkauft, also für 10 Gulden 10 Sols. Der Gewinn für
jede Haut beträgt 2 Gulden 15 Sols oder etwa 29 Prozent.
Eine Kälberhaut im Gewicht von 12 Pfund, gegerbt und zugerichtet,
kostet 3 Gulden. Appretiert wiegt sie nur 4 Pfund und wird das Pfund zu
17,5 Sols verkauft, also für 3 Gulden 10 Sols. Gewinn 10 Sols pro Haut
oder 16 Prozent.
[S. 256]
1 Dutzend Ziegenfelle im Gewicht von 20 Pfund kommt auf 23 Gulden.
Appretiert wiegen diese Häute nur 18 Pfund und werden das Pfund zu 2
Gulden, also zu 36 Gulden verkauft. Gewinn für 1 Dutzend also 13 Gulden
oder etwa 55 Prozent.
Mit Sumach in Fett gegerbtes Maroquinleder, gleichfalls im Gewicht von
20 Pfund, kommt pro Dutzend auf 18 Gulden 15 Sols. Appretiert wiegt es
nur 16 bis 17 Pfund und wird das Pfund zu 2 Gulden 16 Sols verkauft,
also etwa 44 Gulden 5 Sols. Der Gewinn für 1 Dutzend beträgt also 25
Gulden 10 Sols oder etwa 135 Prozent.
Rotes Maroquinleder, mit Galläpfeln gegerbt, kostet im Dutzend bei
gleichem Gewicht 32 Gulden 10 Sols. Appretiert wiegt es 12 Pfund und
wird das Pfund für mindestens 4 Gulden 15 Sols verkauft, somit 57
Gulden. Gewinn 25 Gulden 10 Sols pro Dutzend oder 68 Prozent.
Ebenso weißes Maroquinleder.
Das alles wird ohne die Geheimverfahren des Grafen Surmont hergestellt,
und zwar durch Mittel, mit denen sich noch weit schönere Farben noch
billiger herstellen lassen.
6. Färberei
Abschweifen der Seide
Durch das Geheimverfahren des Grafen Surmont sind bereits 50 Prozent
Gewinn erzielt; denn die Seide verliert nur ⅛ ihres Gewichts, beim
gewöhnlichen Verfahren das doppelte. Außerdem ist es weit billiger,
denn das Abschweifen der Seide kostet gewöhnlich 10 Sols pro Pfund,
hier aber höchstens 6.
Außer diesen Vorteilen ist die Seide weit schöner, stärker, voller und
nimmt die Farbe weit besser an als bisher.
[S. 257]
Färben der Seide
Rot. Ein Pfund Seide karmoisinrot zu färben kostet nur 21 Sols,
in Antwerpen 42 Sols. Der Unterschied beträgt also 100 Prozent. Die
gleiche Menge in Ponceaurot kostet nur 4 Gulden, in Antwerpen 24. Das
macht einen Unterschied von 500 Prozent. In Hochrot kostet die gleiche
Menge nur 40 Sols, in Antwerpen 12 Gulden; Unterschied 600 Prozent.
Feines Kirschrot kostet nur 20 Sols, in Antwerpen 4 Gulden; Unterschied
400 Prozent. Rosa 20 Sols, in Antwerpen 3 Gulden; Unterschied 300
Prozent.
Violett. Ein Pfund Seide in feinem Purpurviolett und anderen
Violettarten kostet nur 18 Sols, in Antwerpen 36 Sols; Unterschied 200
Prozent.
Gelb. Ein Pfund Seide in kräftigstem Gelb, z. B. für Litzen,
kostet nur 2 Gulden, in Antwerpen 10 Gulden; Unterschied 500 Prozent.
Die anderen Schattierungen entsprechend.
Färben von Tuch, Wolle, Kamelott,
Ziegenhaar usw.
Rot. Das Färben von Tuch, Wolle, Kamelott und Ziegenhaar in
Karmoisinrot, Hochrot, Scharlachrot und allen feinen roten Farben
kostet nur 7 Sols. Hier kosten diese Farben 28 Sols. Der Unterschied
beträgt 400 Prozent. Rosa unter 5 Sols, sonst 10 Sols; Unterschied 200
Prozent.
Violett. Tuch, Wolle, Kamelott und Ziegenhaar kosten das Pfund
nur 6 Sols, sonst 24; Unterschied 400 Prozent.
Gelb. Tuch, Wolle, Kamelott und Ziegenhaar kosten pro Elle und
Pfund nur 2 Sols, sonst 4 Sols; Unterschied 200 Prozent.
[S. 258]
Holzfärben
Nach Färben der Seide oder Wolle eignet sich das in den Kübeln
zurückbleibende Färbwasser nicht mehr zum Färben von Stoffen, wohl
aber zum Holzfärben ohne irgendwelche Unkosten. So wenig Gewinn diese
verschieden gefärbten Hölzer also abwerfen mögen, es ist Reingewinn.
Malfarben
Nach dem Holzfärben wird der Färbstoff niedergeschlagen. Auf dem Grunde
bleibt eine sehr schöne Malfarbe zurück, die gleichfalls nichts kostet.
7. Hutfabrikation
Graf Surmont besitzt ein Geheimverfahren zur Hutfabrikation, das sehr
großen Gewinn bringen kann. Er hat versprochen, es zu zeigen. Aber auch
ohne dies Verfahren wird die Hutfabrikation einen sehr anständigen
Gewinn abwerfen.
|
Gattung
|
Bisherige
Kosten im
Engros-
Einkauf
in Gulden
|
Künftig,
inbegriffen
Arbeitslohn
und sonstige
Unkosten
|
Gewinn
|
|
in
Gulden
|
in
Prozenten
|
|
Hochfeiner Biber
|
9—7—8
|
7—14—
|
1—13—8
|
18
|
|
Gewöhnlicher Biber
|
7—9—8
|
6—10—8
|
—19—
|
13
|
|
Halbbiber
|
5—2—8
|
4—11—
|
—11—8
|
11
|
|
Gewöhnl. Halbbiber
|
4—13—8
|
4—4—8
|
—9—
|
10
|
In Betrieb sind 6 Walken. Jede stellt pro Tag 16 Hüte her, somit
tägliche Gesamtproduktion 96, in 250 Arbeitstagen jährlich 24000 Hüte
mit einem Gewinn von mindestens 20000 Gulden Kurant.
[S. 259]
8. Aufstellung des Personals zur Leitung der
Manufakturen
|
|
Gulden
|
|
Herr Rasse, Direktor
|
3000
|
|
„ de Lannoy, Subdirektor
|
2500
|
|
„ de Lannoy junior für die Korrespondenz
|
500
|
|
1 Buchhalter für die Färberei
|
500
|
|
„ „ „ Gerberei
|
500
|
|
1 Lagerverwalter
|
1000
|
|
Gulden
|
8000
|
Cobenzl an Kaunitz
Brüssel, 2. Juli 1763.
E. E. haben jetzt alles Material über unser Geheimverfahren in Händen.
Ich erwarte Ihre Entscheidung und möchte zu Ihrem Schreiben (vom 21.
Juni) nur noch ein paar Bemerkungen hinzufügen.
In solchen Dingen, glaube ich, täuscht man sich aus der Nähe wohl
leichter als aus der Entfernung. Die Gegenwart und Beredsamkeit
des Mannes kann blenden. Aus der Entfernung aber sieht man nur die
Tatsachen und prüft sie unbefangen. Um aber auch hier unbefangen zu
sein, habe ich Sachverständige zu Rate gezogen, und ein jeder hat
alle gefärbten Stoffe durchweg für wunderbar erklärt. Die geringen
Herstellungskosten geben ihnen gewiß hohen Wert. Unser Tressenfabrikant
und Seidenhändler Barbieri, unser Kamelottfabrikant Francolet und unser
Tuchfabrikant t’Kint bitten mich kniefällig um Beschleunigung dieser
Färberei, die sie für äußerst wertvoll für den Staat halten.
Die Holzfärberei ist ein Nebenprodukt, das keinerlei Ausgaben
verursacht. Wollen unsere und die Pariser[S. 260] Kunstschreiner das Holz
kaufen, so ist das ein Gewinn mehr; wo nicht, läßt man die Sache fallen.
Ist das Metall gut, wie ein von mir befragter Chemiker glaubt, so kann
es einträglich sein; wo nicht, so stellt man nur soviel her, als man
zur Herstellung des Wassers braucht, das sich zum Schwarzfärben des
Leders vorzüglich eignet. Die Herstellung von hundert Pfund Metall
genügt zum Färben von mehreren tausend Häuten. Ich nenne dies Wasser
wunderbar; denn ich habe selbst die Probe gemacht und es mit frischem
Wasser, im Verhältnis von 1 zu 60, gemischt. Es färbt das Leder
augenblicklich durch und durch, und zwar im schönsten Schwarz. Läßt man
das Leder ein paar Stunden darin, so zieht es sich derart zusammen,
daß eine sehr starke Kuhhaut so dünn wird wie ein Doppelbogen Papier,
ohne daß sie die Form verliert. Ich glaube mich nicht zu täuschen, wenn
ich sage, daß dies äußerst belangreich ist. Die Hutfabrikation ist
ebenfalls wichtig, und das gleiche gilt erwiesenermaßen für die Öle.
Wenn ich von all diesen Tatsachen überzeugt bin, so doch nicht vom
Reichtum meines Mannes. Ich sehe ein, daß er mir sein Geheimverfahren
überlassen hat, weil er in größter Not war und es selbst nicht
verwerten konnte.
Der Eventualvertrag, den ich mit ihm abgeschlossen habe[366], beweist,
daß die Geheimverfahren zwar durch die an ihn gezahlten Vorschüsse und
die Anlagekosten teuer zu stehen kommen, in der Folge aber tatsächlich
nichts kosten; denn diese Summen kommen in Anrechnung auf den dem
Grafen Surmont zugesagten Gewinnanteil. Auch habe ich für Ihre Majestät
nichts aufs Spiel gesetzt; denn Frau Nettine übernimmt das Ganze sehr
gern auf[S. 261] eigene Rechnung. Wenn aber Ihre Majestät, wie ich wünsche,
das Unternehmen für sich behält, so ist Frau Nettine bereit, den
Vorschuß zum üblichen Zinsfuß von 4 Prozent zu geben.
Würde dies Unternehmen mit dem Lotto und der Lotterie verbunden, so
wird sich hoffentlich bald zeigen, daß diese drei Unternehmungen eine
beträchtliche Einnahmequelle für die Staatsfinanzen bilden.
Kaunitz an Cobenzl
Wien, 5. Juli 1763.
Auf Ihren Bericht (vom 25. Juni) mit den ärgerlichen Einzelheiten
Ihrer Unternehmung in Tournai könnte ich sofort mitteilen, daß Ihre
Majestät sich nicht mit einem Pfennig beteiligt[367]. Doch ich will
der formellen Entschließung, die Ihnen zugehen wird, nicht vorgreifen.
Ich will auch nicht auf den Wechsel Ihrer Ansichten über die Person und
die Geheimmittel dieses Schwindlers hinweisen. Es genügt mir, ihn Ihnen
als solchen gekennzeichnet zu haben, trotz dem zuversichtlichen Ton,
mit dem Sie von seinen Reichtümern, seinem erhabenen Wissen und von den
Millionen reden, die er uns aus Freundschaft[367] für Sie und die
Familie Nettine verschaffen will.
Wenn ich auch in meiner Antwort auf Ihren ersten Bericht[368] über Ihre
Unternehmungen, der, wie ich jetzt sehe, etwas spät[367] kam,
Ihnen nicht unumwunden sagen wollte noch konnte, daß Ihre Begeisterung
Ihnen den klaren Blick für die Dinge trüben könne, so gab ich es Ihnen
doch — Sie werden sich dessen entsinnen — ziemlich deutlich zu
verstehen durch meine Abneigung, den von Ihnen berichteten Tatsachen
Glauben zu schenken. Ich gebrauchte[S. 262] den Ausdruck: Gegen Tatsachen
lasse sich nichts einwenden als das eine, ob man sie richtig gesehen
habe. Zu diesen Zweifeln fügte ich vorsichtshalber die Warnung, die
Interessen Ihrer Majestät nicht aufs Spiel zu setzen[369].
Diese Vorsicht war durchaus nötig. Sie schrieben mir damals: „Ich habe
Vorschüsse in sehr geringem Betrage[369] durch Frau Nettine geben
lassen.“ Heute übersteigt dieser sehr geringe Betrag[369] bereits
190000 Gulden[370]!
Das Bild, das ich Ihnen zugleich von diesem berühmten Abenteurer oder
Gauner gab — denn schließlich ist ein Betrüger nichts anderes — blieb
offenbar eindruckslos; denn Sie mögen geglaubt haben, das Rätsel zu
lösen, wie man seine Talente nutzbar machte, ohne seine Betrügereien
fürchten zu müssen. War doch Ihre stete Antwort auf meine Warnungen:
„Was kümmern uns seine Fehler, wenn wir nur seine Geheimmittel haben!“
Indessen war Ihre Majestät bei meinem Bericht über Ihren Brief und über
meine Antwort anderer Meinung. Der Schluß meines Berichtes lautete:
„Damit habe ich ihre großen Pläne weder verworfen noch gebilligt.
Möglicherweise befinden sich unter der großen Zahl von Geheimmitteln,
deren Ausbeutung so glänzende Erfolge verspricht, auch ein paar
recht brauchbare. Möglicherweise löst sich aber auch alles in Dunst
auf. Auf jeden Fall wäre es angezeigt, wenn Eure Majestät den Inhalt
meines Berichtes geheim halten wollten; denn im ersteren Falle würde
Saint-Germain zu sehr eine Entlarvung fürchten, und im zweiten Falle
müßte man die Schwachheit der Regierung, die sich von einem Schwindler
anführen ließ, mit einem Schleier zudecken[371].“
Das war mein Standpunkt im ganzen Verlauf unseres Schriftwechsels.
Obwohl er auf Sie scheinbar keinen[S. 263] Eindruck gemacht hat, habe ich
Ihnen lediglich aus Rücksicht und Freundschaft nicht mitgeteilt,
welches die Worte Ihrer Majestät über meinen Bericht waren. Ich teile
sie Ihnen hierdurch im größten Vertrauen mit:
„Ich bin völlig überzeugt, daß das von Ihnen entworfene Bild mehr
zutrifft als das Cobenzl’sche, und daß diese Torheit geheim gehalten
werden muß. Ich wünschte, der Minister wäre von ihr geheilt[372].“
Die Torheit ist also begangen, und die arme Frau Nettine, die ich von
Herzen bedauere, schwebt in großer Gefahr, die ganze Zeche zu bezahlen.
Wie ist es möglich, daß sie diesem Elenden auf seine schönen Augen hin
81720 Gulden vorschießen konnte? Wie konnten Sie Ihrerseits zusehen,
daß er 12280 Gulden bloß für Reisen und Verpflegung vertan hat[373]?
Wie konnte man sich abgesehen von alledem auf eine Ausgabe von 99935
Gulden[374] einlassen, ohne daß bisher für einen Pfennig Betriebsmittel
oder Rohstoffe für Ihre Fabriken angeschafft sind, ja ohne von dem
Betrüger die Geheimnisse erfahren zu haben, die scheinbar noch am
meisten versprechen? Sie sind seiner sicher, sagen Sie. Jawohl, so
sicher, daß ich mich nicht wundern würde, wenn er mit allem, um was
er Sie geprellt hat, eines schönen Morgens das Weite suchte und Sie
mit all Ihren Reichtümern und Ihren vier- bis fünfhundertprozentigen
Gewinnen sitzen ließe!
Doch nach allem, was ich Ihnen darüber schon geschrieben habe, ist
jede weitere Aussprache zwecklos. Ihre Berechnungen kommen mir vor wie
die eines Handwerkers, der sich sagt: „Ein Gehilfe bringt mir täglich
¼ Gulden ein; ich will also 400 annehmen; das macht 100 Gulden pro
Tag“. Aber wird man ihm auch soviel Arbeit liefern, daß er vierhundert
Gehilfen beschäftigen[S. 264] kann? Werden Sie soviel Absatz für Ihre ganz
gewöhnlichen gefärbten Stoffe finden, daß Sie dabei oft Ihre 4-500
Prozent verdienen, daß Sie auch nur die bisherigen Unkosten decken?
Hat man den Bedarf an gefärbten Stoffen im Inland berechnet? Denn an
das Ausland ist nicht zu denken, weder an England noch an Frankreich,
Holland, Italien, Deutschland usw.
Aber sei dem, wie ihm wolle, ich werde Ihrer Majestät über alles
genauen Bericht erstatten und dabei zu folgenden Schlußfolgerungen
kommen:
1. Die Fabriken eignen sich nicht zu Staatsbetrieben, weder der Sache
nach noch im Hinblick auf das Einzelne und die Verwaltungskosten.
2. Sollte trotz allem, was ich dagegen angeführt habe, die Herstellung
oder Ausbeutung von Surmonts Geheimverfahren einen Ertrag abwerfen, so
hat Frau Nettine den allerersten Anspruch darauf.
3. Somit kann man ihr nicht den Schutz und die Erleichterungen
abschlagen, die sie bei der Regierung beantragen wird, zumal es
Regierungsgrundsatz ist, den Manufakturen jede Förderung zu gewähren,
die mit der Verfassung des Landes vereinbar ist.
Ich hoffe, daß Ihre Majestät diese Schlußfolgerungen gutheißen wird,
kann mich aber nicht dafür verbürgen. Inzwischen geben bereits meine
früheren Briefe E. E. die erforderlichen Richtlinien.
Kaunitz an Maria Theresia
Wien, 21. Juli 1763.
Eure Kaiserliche Majestät werden sich erinnern, daß ich am 22. April
d. J.[375] einen Bericht des Grafen Cobenzl
[S. 265]über die Riesengewinne
vorgelegt habe, die er sich von den Geheimverfahren in der Färberei
und mehreren anderen Handelsartikeln verspricht, die eine eigenartige
Persönlichkeit, früher als Graf Saint-Germain bekannt, zu besitzen
vorgibt.
Kaunitz wiederholt den Inhalt des Berichts von Cobenzl vom 8. und
seiner Antwort vom 19. April[376].

Staatskanzler Graf Kaunitz
Stich von Pazzi
E. M. haben meine Auffassung der Sache und meine Weisungen an den
Grafen Cobenzl gebilligt. Die großen Projekte dieses Ministers sind
Ihnen selbst als eine Torheit erschienen, die geheim gehalten werden
müsse, und von der E. M. ihn geheilt zu sehen wünschten.
Was mir Graf Cobenzl seither über seinen Wundermann wie über dessen
Projekte berichtete, hat meine anfängliche Auffassung nur zu sehr
bestätigt. Je verdächtiger also die Sache wurde, desto mehr war ich
darauf bedacht, die Interessen E. M. sicherzustellen, und das ist mir,
glaube ich, auch gelungen. Trotzdem konnte ich nicht verhindern, daß
Frau Nettine bereits fast 200000 Gulden Vorschüsse für die Fabriken in
Tournai gezahlt hat[377], die von Graf Cobenzl auf Drängen Surmonts
angelegt worden sind.
Ehe ich jedoch auf diese Anlagen und ihre Bestimmung näher eingehe, muß
ich E. M. über die schwankenden Angaben des Grafen Cobenzl, über die
Persönlichkeit und die Reichtümer ihres Begründers berichten.
Zuerst sprach der Minister von diesen Reichtümern in einem Tone,
der jeden Zweifel ausschließen mußte. Trotzdem zweifelte ich und
ersuchte den Grafen Cobenzl um Angabe, welche Gewißheit er über diese
angeblichen Reichtümer hätte und welcher Art sie wären, ob sie in
Geld, Wertpapieren, Landbesitz oder Handelseffekten beständen.[S. 266] Auch
teilte ich ihm Anekdoten mit, aus denen hervorging, daß dieser Mann in
Frankreich gleichfalls mit seinen Reichtümern geprahlt hatte und in
seiner Dreistigkeit so weit gegangen war, vom Grafen Saint-Florentin
ein Landgut im Werte von 1800000 Livres in aller Form zu kaufen, daß
aber an den Zahltagen die versprochenen Rückstände und Wechselbriefe
nicht eintrafen und daß der Käufer Frankreich verlassen mußte[378].
Auf das alles antwortete mir der Minister am 28. April[379], Surmont
hätte das Gut Ubbergen in Holland gekauft, es zu zwei Dritteln bezahlt
und den Namen dieses Gutes angenommen. Außerdem besäße er Wertsachen,
die er bei Frau Nettine hinterlegen werde, und der Mann, der sie in
Seeland verpfändet hätte, schätze ihren Wert auf über eine Million.
Wie Graf Cobenzl zugab, spräche Surmont viel von seinen Reichtümern.
Doch wiederholte er, er müsse sehr reich sein; denn überall, wo er sich
aufgehalten, hätte er fabelhafte Geschenke gemacht und viel ausgegeben,
ohne irgendwo Schulden zu hinterlassen[380].
Von dem Gutskaufe vom Grafen Saint-Florentin wußte der Minister nichts.
Im übrigen suchte er meine anderen Einwände über Surmonts Charakter
und Leben mit dem Hinweis zu entkräften, daß dieser Mann nichts von
uns verlangte, und daß er ihm seine Geheimmittel aus Freundschaft
überlassen wollte; somit müßten uns seine persönlichen Eigenschaften
einerlei sein, wenn man nur in den Besitz seiner Geheimmittel käme.
Diese Aufklärungen vermochten die Eindrücke nicht zu verwischen, die
ich aus den sonstigen Nachrichten von diesem Manne gewonnen hatte.
Welche Vorstellung könnte man sich auch von den Reichtümern eines
Unbekannten[S. 267] machen, dessen Wertsachen verpfändet sind und dessen
Grundbesitz nicht bezahlt ist? Ich machte den Grafen Cobenzl am 10.
Mai[381] auf diese Widersprüche aufmerksam und verhehlte ihm angesichts
der Abenteuer Surmonts in Frankreich meine Befürchtung nicht, er möchte
in einer Grenzstadt wie Tournai, wo Graf Cobenzl die Fabrik anlegen
wollte, nicht allzu sicher sein.
Der Minister antwortete mir auf alle diese Bedenken nur mit der
Versicherung, Frau Nettine hätte bei einer Reise nach Paris nichts
Nachteiliges über Surmont erfahren und sich durch ihre Schwiegersöhne
vergewissert, daß wir bei keiner einzigen Unternehmung Widerstand zu
befürchten hätten[382].
Das fortdauernde Vertrauen, das Frau Nettine auf diesen Mann nach
Befragung ihrer Schwiegersöhne in Paris setzte, begann meine Zweifel zu
zerstreuen. Ich verhehlte dies dem Grafen Cobenzl in meinem Briefe vom
31. Mai nicht. Als aber ein paar Tage darauf die Proben von Surmonts
Kunst eintrafen, sah ich deutlich, daß er es verstanden hatte, über die
Tatsächlichkeit seiner Geheimmittel ebenso zu täuschen wie über seine
persönlichen Verhältnisse. Auch rühmte sich Graf Cobenzl in seinem
Briefe vom 9. Juni nicht mehr, diese Geheimmittel aus Freundschaft
zu erhalten. Er meldete schon damals, sie würden teuer sein, und
am 25. Juni änderte er seine Sprache über Surmonts Reichtümer und
Charakter völlig. Ich lege diesen Bericht nebst allen Anlagen[383]
bei. Wie er gestand, hatte er sich durch einen Nimweger Kaufmann und
Geschäftsfreund Surmonts nach dessen Reichtümern und besonders nach den
Wertsachen erkundigt und erfahren, daß diese mindestens eine Million
wert seien. Da er trotzdem ohne Geld war und seine[S. 268] Wertsachen nach
Tournai kommen lassen wollte, hatte Frau Nettine ihm 81720 Gulden
vorgeschossen. Weiterhin aber hätte man gesehen, daß der Nimweger
Kaufmann im Einverständnis mit ihm war, daß nur sehr geringe Wertsachen
nach Brüssel gekommen waren, und daß die in Holland zurückgebliebenen
nur aus Gemälden bestanden, die zwar Surmont sehr hoch schätzte, die
aber sehr wenig wert zu sein schienen. Zudem hatte sich herausgestellt,
daß er verschuldet war, von seinen holländischen Gläubigern gedrängt
wurde und in seinen Privatverhältnissen keine Ordnung und Sparsamkeit
walten ließ. Trotzdem erschien er dem Grafen Cobenzl noch immer als
Besitzer wunderbarer Geheimnisse. Zugleich klagte dieser über seine
Launen und sein wunderliches Wesen.
Das alles steht in schroffem Gegensatz zu den ersten Berichten des
Ministers über seine Redlichkeit, seine schlichten Sitten und seine
Reichtümer. Ich begreife nicht, wie man sich so lange hat täuschen
lassen können, während ich bei den ersten Nachrichten aus Brüssel
alles aufgeboten habe, um den Grafen Cobenzl vor der Redegabe und der
eigentümlichen Begabung dieses Schwindlers zu warnen, das Vertrauen
auch der Ungläubigsten zu gewinnen. Ich wies ihn namentlich auf
Surmonts Abenteuer in Frankreich hin und sagte ihm wörtlich, dieser
hätte es dort verstanden, alle, die an seiner Freigebigkeit und an
den von ihm verheißenen Wundern teil zu haben hofften, in einer Art
von Ehrfurcht zu halten, so daß sie sogar auf das Recht des Zweifels
verzichteten. Trotz meiner Warnung ist es ihm nur zu gut gelungen, den
Grafen Cobenzl und die Familie Nettine ebenso zu beeinflussen, wie es
bei einem Teil des französischen Ministeriums eine Zeitlang der Fall
war.
[S. 269]
Nach den Vorschüssen und den großen Ausgaben zu urteilen, die lediglich
für seine Person erfolgt sind und die sich bereits auf 94000 Gulden
belaufen[384], muß die Begeisterung in Brüssel sogar noch weiter
gegangen sein als in Paris. Offenbar hat Graf Cobenzl, als er hinter
Surmonts Fehler kam, sich für befähigt gehalten, seine Talente nutzbar
zu machen, ohne seine Betrügereien fürchten zu müssen; denn auf meine
Verdachtsgründe entgegnete er immer wieder: Was liegt uns an seinen
Fehlern, wenn wir nur seine Geheimmittel besitzen?
Diese Denkweise hätte berechtigt erscheinen können, hätte man die
Tatsächlichkeit seiner angeblichen Geheimmittel und die Riesengewinne
aus ihnen vorher genau festgestellt. Aber zu einer Zeit, wo es noch
fraglich ist, ob man den von einem Abenteurer versprochenen Wundern
Glauben schenken soll, gebietet die Vorsicht, seine Sitten, seinen
Charakter, seine Privatverhältnisse, seine früheren Abenteuer usw.
stark in Betracht zu ziehen. Das alles aber spricht durchaus gegen den
angeblichen Grafen Surmont und wäre allein genug, um seine Projekte
abzulehnen.
Kaunitz prüft die Vorschläge von Cobenzl für Übernahme der
Manufakturen in Staatsbetrieb und kommt zu ihrer Verwerfung, da sie
den verheißenen Gewinn nicht einbringen würden. Die eingesandten
Proben seien minderwertig und trotz des niedrigen Preises keine
großen Umsätze zu erwarten. Zu Cobenzls Bericht vom 25. Juni
übergehend, bemängelt Kaunitz die Unsicherheit der Unterlagen, bei
den Farben überdies das Fehlen von Blau und Grün.
Wenn die neuen Manufakturen in Tournai schon aus sachlichen Gründen
nicht für uns in Frage kommen, so erst recht nicht wegen der großen,
bereits entstandenen Kosten und der kostspieligen Verwaltung, die sie
nach[S. 270] Angabe des Grafen Cobenzl erfordern. Wie schon oben betont, hat
Frau Nettine Surmont bereits 94000 Gulden vorgeschossen oder für ihn
ausgelegt, ohne daß es bisher gelungen wäre, die Geheimverfahren aus
ihm herauszulocken, die scheinbar noch am meisten versprechen. Die
Ausgaben für die Fabrikanlagen belaufen sich bereits auf 99935 Gulden,
5 Sols, 4 Pfennig, ohne daß bisher für einen Pfennig Betriebsmittel
oder Rohstoffe angeschafft wären oder daß man das Geringste für
Beschaffung von Arbeitern ausgegeben hätte. Zudem spricht aus allen
diesen Ausgaben eine Verschwendung, die keine günstigen Schlüsse auf
die künftigen laufenden Ausgaben erlaubt.
Allein für Surmonts Unterhalt und seine Reisen sind 12280 Gulden
verausgabt. Ein Wohnhaus für ihn in Tournai ist für 13500 Gulden
gekauft worden, und die verschiedenen nicht näher belegten Auslagen
des Kaufmanns Rasse, der einer der Direktoren werden soll, belaufen
sich auf 5300 Gulden[385]. Der vom Grafen Cobenzl entworfene
Verwaltungsplan zeigt keine größere Sparsamkeit. Die Gehälter für die
beiden Direktoren und die übrigen Angestellten betragen 8000 Gulden
jährlich[386]. Außerdem schlägt der Minister vor, den Sohn der Frau
Nettine, dem Surmont allein seine Geheimverfahren anvertraut hat,
zum Generaldirektor des ganzen neuen Unternehmens zu ernennen und
ihn lediglich Sr. Kgl. Hoheit und der Oberaufsicht des Ministers
zu unterstellen. Ferner meint er, daß der Staatsrat Walckiers zum
Königlichen Kommissar bei diesem Unternehmen bestellt, dessen Leitung
mit der der Lotterie verbunden werden und daß E. M. dem jungen Nettine
aus dem Gewinn ein festes Gehalt oder einen Gewinnanteil gewähren
könnte.
[S. 271]
Zugleich übersendet mir Graf Cobenzl den vorläufig mit Surmont
abgeschlossenen Vertrag[387], wonach dieser für Lebenszeit an den
in Frage stehenden Unternehmungen zur Hälfte beteiligt wird, die
ihm vorgeschossenen Summen von seinem Gewinnanteil abgezogen werden
und Surmont sich seinerseits verpflichtet, die Herstellungsart von
Blau und Grün, die Verfeinerung der Öle, das Krempeln des Leders für
die Hutfabrik oder zu jedem anderen ihm bekannten Gebrauch, sowie
jedes andere Geheimmittel oder Verfahren anzugeben, durch das die
Manufakturen zur größten Vollendung gebracht werden können.
Surmont hat es also nicht nur verstanden, eine Summe von fast 100000
Gulden herauszuschlagen, deren Rückzahlung auf einem zum mindesten sehr
zweifelhaften, wo nicht gänzlich hinfälligen Gewinn beruht, sondern er
hat sich auch die Möglichkeit weiterer Gewinne aus seinen angeblichen
Geheimverfahren gesichert; denn er hat sich die anscheinend wichtigsten
vorbehalten und wird sie sich zweifellos teuer bezahlen lassen.
Außerdem verspricht er, etwas zu lehren, was er nach eigenem Geständnis
selbst noch nicht versteht, nämlich die Herstellung des Blaus. Es
kann sich dabei nur um die Herstellung ohne Cochenille handeln; denn
von etwas anderem war nie die Rede. Nun schreibt mir Graf Cobenzl am
27. Mai ausdrücklich, Surmont kenne diese Herstellungsart nicht und
hoffe nur, ein Verfahren zu finden, das diese teure Zutat unnötig
macht. Nicht anders dürfte es mit dem Grün stehen, das er herstellen
zu können behauptet, aber von dem der Minister noch nie eine Probe zu
sehen bekommen hat[388]. Von diesen zwei Farben ist denn auch, wie oben
gesagt, in der Aufstellung der Preise der neuen Farben nirgends die
Rede.
[S. 272]
Das alles tritt zu den Gründen, die von einem Unternehmen auf
Staatskosten abraten. Trotzdem hält Graf Cobenzl dies für das
Zweckmäßigste. Er will, falls E. M. darauf eingehen, der Frau Nettine
ihre Vorschüsse für die genannten Unternehmungen in Höhe von 193935
Gulden, 5 Sols, 4 Pfennig mit 4 Prozent verzinsen und sie aus den
Überschüssen allmählich zurückzahlen.
Dabei versichert er mir immer wieder, falls E. M. den Betrieb der
Surmont’schen Fabriken nicht auf Staatskosten übernehmen wollten, würde
Frau Nettine ihn gern auf eigene Rechnung übernehmen. Außerdem erklärt
er mir, in der ganzen Sache mit Zustimmung Sr. Kgl. Hoheit gehandelt zu
haben, und bittet mich, ihm die Allerhöchste Entscheidung E. M. darüber
kundzugeben.
Aus allem Gesagten geht hervor:
1. Graf Cobenzl, Frau Nettine, ihre Familie sowie alle, die an dem
lächerlichen Mysterium der angeblichen Geheimmittel dieses Abenteurers
beteiligt sind, haben sich derart hereinlegen lassen, daß sie
Vorschüsse und Auslagen in Höhe von fast 100000 Gulden nur für seine
Person und auf Rechnung seiner ungeheuren Reichtümer gemacht haben, die
sich, wie sie heute zugeben, auf Nichtigkeiten beschränken und sich
vielmehr in Schulden verwandelt haben, die sicherlich aus ähnlichen
Schwindeleien wie die in Brüssel verübten herrühren.
2. Nachdem sie sich so gröblich über den Charakter dieses Gauners
getäuscht haben, trotzdem sie seine Geschichte und seine Abenteuer
kannten, geben sie uns das Recht, ihrem Urteil über die Geheimmittel
zu mißtrauen, die er ihnen so teuer aufgeschwindelt hat. Dies
berechtigte Mißtrauen wird bestärkt durch die Abweisungen, die Surmont
in Frankreich, in Holland, in England und überall erfahren hat, wo er
seine kümmerlichen[S. 273] Geheimmittel wie bei uns angepriesen haben wird.
Ich hätte mir also alle Vergleichungen, Berechnungen, Proben und
Prüfungen ersparen können.
Aus ihnen hat sich ergeben:
3. Die gefärbten Seiden- und Wollstoffe bieten dem Publikum durchaus
nichts Neues und können daher die Vorteile der Neuheit und des Monopols
nicht beanspruchen. Sie bieten selbst in den bekannten Farben nichts
Hervorragendes und sind bei weitem nicht in allen Farbgattungen
vorhanden. Schon die Wiener gefärbten Stoffe übertreffen in dieser
Farbenskala die seinen; um wieviel weniger könnten sie sich also
gegenüber den englischen, französischen und holländischen behaupten!
4. Somit beruhen alle ihre Erwartungen nur auf dem Absatz in den
Niederlanden. Aber sie haben dessen Umfang nicht berechnen können oder
wollen, obgleich dies der einzige feste Anhaltspunkt wäre, um die Höhe
der Einnahmen zu berechnen und ihr die Kosten gegenüberzustellen. Denn
ohne einen solchen vorherigen Anschlag kann, ja muß es geschehen, daß
sie bei dem überstürzt und höchst unbesonnen begonnenen Großbetrieb in
einem Monat mehr Stoffe färben, als die einheimischen Fabriken in einem
Jahre verbrauchen können.
5. Günstigsten Falls, d. h. wenn man den ganzen inneren Markt
versorgen könnte, wäre das Unternehmen moralisch unrecht und politisch
verkehrt. Unrecht, denn man brächte alle Privatfärbereien mit Güte
oder mit Gewalt an den Bettelstab. Mit Güte, wenn man sie durch den
billigen Preis überflügelte; mit Gewalt, wenn man zur Billigkeit
noch das Monopol fügte. Politisch wäre das Unternehmen verkehrt;
denn selbst bei der Annahme, man könnte alle Privatindustrieen
verstaatlichen — was der täglichen Erfahrung völlig widerspricht
—, wären[S. 274] diese Industrieen in Privathänden für den Staat weit
wertvoller als beim Staatsbetriebe. Denn im ersten Falle begünstigen
sie den Bevölkerungszuwachs, spornen den Wetteifer an, vermehren
die Umlaufskanäle, setzen den einheimischen Handel in Nahrung,
vervielfältigen seine Werte und unterstützen die Landwirtschaft und
die Landesverteidigung. Beim Staatsbetriebe dagegen fallen durch die
Zusammenfassung alle diese günstigen Faktoren fort; der Unterhalt von
tausend Familien wird von hundert Angestellten und Arbeitern verzehrt,
und hundert Menschen verarmen, um einen einzigen zu bereichern. Ein
derartiges Unternehmen würde den Untertanen E. M. also keineswegs
nützlich sein, wie man dreist behauptet hat, sondern sie zugrunde
richten. Sie würden sich mit Recht laut beklagen, und wir zögen uns
die bittersten Beschwerden und Klagen der Stände auf den Hals. Sind
dies aber im günstigsten Falle die notwendigen Folgen eines solchen
Unternehmens, dann kann man unmöglich mit dem Grafen Cobenzl in der
Billigkeit allein das Mittel sehen, um den ganzen Verbrauch der
Niederlande an gefärbten Stoffen an sich zu reißen. Damit sinken
alle seine Erwartungen in Nichts zusammen, und es bleibt ihm nichts
als die Reue, so große Opfer gebracht zu haben. Und tatsächlich hat
Cobenzl unrecht; denn er hat nicht bewiesen, daß es möglich ist, die
Privatindustrie mit allen ihren Hilfsquellen auszuschalten und ihr für
alle Zeit die Kenntnis des Geheimverfahrens zu entziehen, das nach
Aussage der Frau Nettine ziemlich leicht zu erraten ist. Ebensowenig
hat er schließlich bewiesen, daß es möglich ist, die Privatindustrie
durch Schönheit und Güte der Farben und durch Billigkeit des Preises zu
übertreffen, wenn sie erst einmal nach seinem Geheimverfahren arbeitet.
[S. 275]
Aus meiner Darlegung ergibt sich ferner:
6. Daß die Gewinne aus der Gerberei heute von den einheimischen Gerbern
gemacht werden, und daß Graf Cobenzl diese Gewinne durch Surmonts
Geheimverfahren nur zu vergrößern hofft. Dabei verdient die Gerberei
unter den angeblichen Geheimverfahren noch am meisten Beachtung, und
gerade darüber wissen sie noch am wenigsten; denn alle ihre positiven
Angaben beschränken sich auf das Gewicht der heute von unseren Gerbern
verarbeiteten und verkauften Felle. Ebensogut könnte man sagen: Es
gibt in den Niederlanden 10000 Schuhmacher; jeder verdient täglich
soundsoviel. Man braucht also nur alle Stiefel und Schuhe, die diese
Schuhmacher anfertigen, auf Rechnung des Staates herzustellen und
hat allein den ganzen Gewinn davon. Wenn man so weiter fortfährt,
alle Gewerbe an sich reißt und sie selbst ausübt, und angenommen, es
gelingt, so muß man E. M. neue Untertanen verschaffen, die soviel Geld
haben, um alle diese Waren zu kaufen; denn die Ihren wären zugrunde
gerichtet und verarmt. Daß bei der Gerberei Geld zu verdienen ist,
wußten wir ohnehin. Daß aber der Staat diesen Gewerbszweig auch noch
an sich reißen müsse, das sollte man nicht vorschlagen, ohne vorher
deutlich nachzuweisen, was für wirkliche und neue Vorteile für die
Bevölkerung daraus entspringen.
Für die Hutfabrik gilt genau das gleiche.
7. Surmont hat ihnen ebensowenig das Geheimverfahren angegeben, durch
das gewöhnliche Öle geruchlos gemacht und derart verfeinert werden, daß
sie einen Ersatz für das feine Provenceröl bilden. Dieser Artikel wäre
der einzige, der den Staatsfinanzen ohne Schaden für die einheimische
Industrie und den einheimischen Handel die größten Einkünfte
verschaffen könnte; denn[S. 276] es gibt noch nirgends eine derartige Fabrik,
die Rohstoffe hätten wir in den Niederlanden, und somit würden neue
Werte geschaffen. Aber die Ankündigung dieses Geheimverfahrens
ähnelt der uns gegebenen über die Verwandlung von Eisen in ein
goldartiges Metall. Beides ist gleich unwahrscheinlich; denn schon das
Geheimverfahren zur Verfeinerung von Ölen in der angegebenen Weise wäre
Surmont in Holland und England zu jedem von ihm geforderten Preise
abgekauft worden.
8. Die uns vorgeschlagene Verwaltung ist ebensowenig sparsam, wie
das Benehmen gegen Surmont von Anfang an bis auf diesen Tag klug
war. Sie würde sieben bis acht Werkstätten zu verwalten haben, deren
jede die ganze Tatkraft und Wachsamkeit, den ganzen Fleiß und die
ganze Sparsamkeit mehrerer sehr erfahrener Geschäftsleute in Anspruch
nähme. Das Verwaltungsbüro allein würde 8000 Gulden jährlich kosten.
Fast ebensoviel würden die Zinsen für die bereits so leichtfertig
ausgegebenen Summen erfordern. Dabei ist noch kein Pfennig inbegriffen
für die Löhne eines Schwarmes von Arbeitern und für die Beschaffung von
Rohstoffen.
Aus all diesen Schlußfolgerungen ergibt sich als offenkundig und
unbedingt notwendig, daß diese gewagten Unternehmungen weder der Sache
nach noch in ihrer Verwaltung und in ihrem Betrieb den Staatsfinanzen
entsprechen. Da jedoch Frau Nettine aus eigener Tasche den unsinnigen
Vorschuß von fast 200000 Gulden gemacht hat und sie diese Fabriken
auch übernehmen will, so ist es recht und billig, daß E. M. sie ihr
überlassen und gleichzeitig Ihre Regierung beauftragen, ihr alle
Erleichterungen und Vergünstigungen zu gewähren, die sich mit der
Wohlfahrt der Staatsfinanzen und der Landesverfassung vereinbaren
lassen.
[S. 277]
Eigenhändiges Marginal Maria Theresias
Placet. Ich billige alle Vorschläge des Kanzlers.
Cobenzl an Kaunitz
Brüssel, 22. Juli 1763.
Seit dem Erlaß E. E. vom 5. ist von der Sache in Tournai nicht mehr die
Rede. Ich war Zeuge davon, daß Herr Bürgermeister Hasselaar[389] über
unseren Mann sehr günstig gesprochen hat, aber von der Anlage einer
Manufaktur war zwischen ihnen nie die Rede.
Maria Theresia an Prinz Karl von Lothringen
Wien, 24. Juli 1763.
Mein Hof- und Staatskanzler hat mir über seinen ganzen Schriftwechsel
mit dem Grafen Cobenzl betreffs der angeblichen Geheimmittel für
Fabriken und Manufakturen berichtet, die ein gewisser Surmont besitzen
will, sowie über die Manufaktur, die Graf Cobenzl infolgedessen mit
Genehmigung Eurer Hoheit in Tournai bereits eingerichtet hat[390].
Ich teile Ihnen hierdurch mit, daß wir das Ganze aufs unparteiischste
und gewissenhafteste haben prüfen lassen, und daß sich daraus ergeben
hat, daß diese Manufaktur weder in der Sache noch ihrer Verwaltung
nach meinem königlichen Dienst entspricht und bei einem Staatsbetrieb
— falls er überhaupt Erfolg hat — eine große Zahl meiner getreuen
Untertanen zugrunde richten würde. Ich trete also dem bei, was mein
Hof- und Staatskanzler dem Grafen Cobenzl hierüber schon mitgeteilt
hat[391], und lehne den Gedanken völlig ab, das fragliche Unternehmen
auf Rechnung des Staates betreiben zu lassen. Auch soll[S. 278] der Staat für
die bereits erfolgten Ausgaben in keiner Weise herangezogen werden.
Da jedoch die Witwe Nettine, die für das neue Unternehmen schon
beträchtliche Vorschüsse gezahlt hat, es auf eigene Rechnung übernehmen
will, so ermächtige ich Eure Hoheit, ihr zu diesem Zweck die nötige
Genehmigung zu geben und ihr alle Erleichterungen und Vergünstigungen
zu gewähren, die sich mit der Wohlfahrt meiner Finanzen und der
Verfassung meiner belgischen Provinzen vereinbaren lassen.
Cobenzl an Kaunitz
Brüssel, 2. August 1763.
Ich erwarte heute die Nachricht von der Abreise des Herrn von
Surmont und hoffe, daß Frau Nettine ihre großen Vorschüsse wieder
herauswirtschaften wird. Sicherlich steckt in seinem Geheimverfahren
etwas Gutes; zum mindesten ist dies bei der Hutfabrikation und Gerberei
anerkannt, und alle unsere Seiden- und Tuchhändler finden die gefärbten
Stoffe wunderbar. Se. Kgl. Hoheit wird die diesbezüglichen Befehle
Ihrer Majestät[392] mit größter Genauigkeit ausführen.
Kaunitz an Cobenzl
Wien, 14. August 1763.
Ich verstehe nicht recht, was die Wendung in Ihrem Berichte vom 2.
bedeutet: „Ich erwarte heute die Nachricht von der Abreise des Herrn
von Surmont.“ Geht er freiwillig oder jagt man ihn endlich fort? Im
ersteren Falle dürfte er wohl nicht nur das Geld der von mir aufrichtig
bedauerten Frau Nettine mitnehmen, sondern auch die freie Verfügung
über seine schönen Geheimmittel behalten.[S. 279] Im zweiten Fall wird man
ihm hoffentlich noch das Geheimnis der Verfeinerung von Ölen entlockt
haben. Offen gestanden, Herr Graf, könnte ich mir noch heute kein
Bild machen, hätte ich nicht schon in meiner ersten Antwort[393] die
Begeisterung unterstrichen, mit der dieser Schwindler Sie alle erfüllt
hat, ganz ähnlich, wie es ihm auch in Frankreich geglückt ist. Aber zu
etwas sind schlimme Erfahrungen doch gut, und ich hoffe, in Zukunft
wird man bei Ihnen auf der Hut sein, und die Abenteurer werden kein
gewonnenes Spiel haben.
Cobenzl an Kaunitz
Brüssel, 23. August 1763.
Herr von Surmont ist nicht ausgewiesen worden. Aber in Erwartung der
Entscheidung, ob Ihre Majestät die Manufaktur selbst übernehmen oder
an Frau Nettine weitergeben will, hatte diese ihren Sohn in Tournai
gelassen, um alle Geheimverfahren des Herrn von Surmont kennen zu
lernen. Da man nun von ihm alles erfahren hatte, was er wußte, und
seine Anwesenheit nicht mehr nötig war, habe ich ihm nach Eintreffen
der Allerhöchsten Befehle geschrieben, Ihre Majestät wolle von seinen
Geheimverfahren nichts wissen. Zugleich hat Nettine ihm eröffnet,
daß seine Mutter sie als Deckung für ihre Vorschüsse behielte, daß
sie ihm aber weitere Vorschüsse nicht machen wolle. Darauf hat er
sich sofort zur Abreise entschlossen, wobei er erklärte, das Ganze
im Laufe weniger Monate zurückzuzahlen. Andernfalls könne man seine
Geheimverfahren benutzen, und falls man irgendeiner Aufklärung bedürfe,
sei er bereit, sie zu geben, wo immer er sich auch befinde. Er ist nach
Lüttich abgereist und wird sich wohl nach Karlsruhe zum Markgrafen von
Baden-Durlach[394][S. 280] wenden. Frau Nettine hofft noch, wenigstens einen
Teil ihrer Vorschüsse zurückzubekommen.
Man muß den Mann gesehen haben, um unsere Leichtgläubigkeit zu
entschuldigen. Auch die vor uns auf ihn Hereingefallenen können uns
teilweise entschuldigen, aber sicherlich haben wir die Erfahrung
gemacht, daß der Mensch durch etwas betrogen werden kann, was er sieht
und mit Händen greift.
Kaunitz an Cobenzl
Wien, 3. September 1763.
Der Fall Surmont ist für mich erledigt. Ich wünschte, daß das, was er
in Brüssel getan hat und tun ließ, sich so leicht wieder gutmachen
ließe, daß ich es vergessen kann.
Cobenzl an Kaunitz
Brüssel, 2. Oktober 1763.
Ich erhalte von nirgendswoher Nachricht, was aus Herrn von
Saint-Germain geworden ist. Die in Tournai begründete Manufaktur
beginnt sich zu entwickeln; ich glaube bestimmt, Frau Nettine wird
dabei auf ihre Rechnung oder wenigstens auf ihre Kosten kommen.
II
Aus den „Erinnerungen“ des Grafen Philipp Cobenzl[395]
Gegen Mitte Juni schickte mein Oheim mich nach Tournai, um für ein paar
Tage das Benehmen eines[S. 281] berüchtigten Abenteurers zu überwachen[396],
auf den mein Oheim, Frau von Nettine und viele andere gründlich
hereingefallen waren. Dieser Mann war in Brüssel unter dem Namen eines
Grafen Surmont aufgetreten, nachdem er sich anderswo Graf Saint-Germain
genannt hatte. Er führte sich bei meinem Oheim in sehr geheimnisvoller
Weise durch ein paar Empfehlungsbriefe, ich weiß nicht von wem, ein.
Tagsüber ging er nie aus, und zur Zwiesprache mit meinem Oheim stellte
er sich nur in vorgerückter Nachtstunde ein. Er erbot sich, mittels
seiner angeblichen Geheimverfahren dem Hof große Dienste zu leisten.
U. a. handelte es sich um ein Metall, das zwar kein Gold war, aber
Farbe, Gewicht und Hämmerbarkeit des Goldes und somit alle Vorzüge
desselben besaß. Er hatte, wie er sagte, hervorragende Kenntnisse
in der Färberei und konnte Leder, Wolle und Seide sehr billig die
glänzendsten Farben geben. Er wollte die feinsten Hüte zu billigerem
Preise herstellen, als sonst die Anfertigung der gröbsten Hüte
kostete. Fleckige Diamanten wußte er von ihren auffälligsten Flecken
zu befreien. Er stellte Arzeneien gegen alle Krankheiten her und
besaß Mittel zur unberechenbaren Verlängerung des Lebens. Alle
Wissenschaften, von denen man sprach, beherrschte er im höchsten Maße.
War von Musik die Rede, so sprach er als Meister davon, setzte sich
ans Klavier und trug eigene Kompositionen vor. Sprach man von Malerei,
so behauptete er, im Besitz einer hervorragenden Gemäldesammlung
zu sein, sagte aber nicht, wo sie war. Welches seine Heimat sei,
sagte er nicht, aber er sprach sehr gut Französisch, Italienisch,
Englisch, Portugiesisch und Spanisch. Wie alt er war, sagte[S. 282] er nicht;
anscheinend zählte er 50 Jahre, aber er sagte, das Menschenleben ließe
sich unglaublich verlängern, und er sprach von Ereignissen, die um
Jahrhunderte zurücklagen, und deren Augenzeuge er gewesen war.
Er redete wenig und so, daß man mehr erriet als begriff. Durch diese
Art von Marktschreierei hatte der gewandte Mann das Vertrauen meines
Oheims zu gewinnen verstanden, der mehr als einen Vorteil für den
Staat aus einem Teil seiner Geheimmittel zu ziehen hoffte, indem er
in Tournai eine Färberei, eine Papierfabrik und eine Werkstätte zur
Herstellung des kostbaren Metalls einrichtete. Bestochen hatten meinen
Oheim sehr schöne Proben aller dieser Dinge, die der Abenteurer ihm
vorlegte, mit der Behauptung, er wolle ihm alle seine Geheimnisse
nur aus reiner Freundschaft abtreten; denn er besäße alles, was er
wünschte, und hätte nichts nötig. Um meinen Oheim davon zu überzeugen,
sagte Graf Surmont eines Tages, als von Malerei die Rede war und mein
Oheim äußerte, nur sehr wenige Privatleute könnten sich rühmen, einen
echten Raffael zu besitzen, das träfe zwar zu, aber in seiner Sammlung
fehlte es nicht daran, und zum Beweis dafür kam vierzehn Tage bis drei
Wochen später ein Gemälde an, das Herr von Surmont meinem Oheim als aus
seiner Sammlung stammend schenkte, und ein paar Künstler der Stadt,
Kenner oder nicht, denen mein Oheim dies Bild zeigte, erklärten es für
ein Original Raffaels. Surmont wollte es jedoch nicht zurücknehmen und
bat ihn, es als Zeichen seiner Freundschaft zu behalten.
Ein andermal zeigte er meinem Oheim einen großen Solitär mit einem
Flecken und sagte, er werde ihn in wenigen Tagen tadellos machen.
Tatsächlich brachte er ihm nach ein paar Tagen einen Solitär vom
gleichen Schnitt, der tadellos und ohne Flecken war, mit der
Versicherung,[S. 283] es sei der gleiche Stein. Als mein Oheim ihn genau
geprüft und bewundert hatte, wollte er ihm den Stein zurückgeben, aber
jener nahm ihn nicht an und beteuerte, er hätte Diamanten genug, mit
denen er nichts anzufangen wisse, und mein Oheim möchte diesen als
Erinnerung an ihn behalten. Mein Oheim, der keine Geschenke annehmen
wollte, wehrte sich lange dagegen und gab erst nach, als Surmont ihm
drohte, Brüssel sofort mit all seinen Geheimmitteln zu verlassen, wenn
mein Oheim durch das Ausschlagen dieser Kleinigkeit bewiese, daß er
seinen Worten nicht traute.
Es wurde also beschlossen, alle obengenannten Unternehmungen in Tournai
zu begründen, und zwar auf Verlangen des Urhebers sogleich in großem
Stil. Zunächst mußten Häuser gekauft und teils neu gebaut, sowie alle
möglichen Materialien nach einer Liste Surmonts beschafft werden, der
die Ausführung mit Hilfe einer Summe unternahm, die man ihm zu diesem
Zweck vorschießen mußte. Frau von Nettine übernahm ein paar Aktien,
mein Oheim desgleichen; der Rest wurde auf Staatskosten übernommen.
Surmont war hierauf nach Tournai gereist, um Hand ans Werk zu legen;
ein paar Monate später wurde ich hingesandt, um zu sehen, wie die Dinge
standen. Ich blieb vierzehn Tage dort und ließ meinen Mann tags und
nachts nicht aus den Augen. Aus meinem nach meiner Rückkehr erstatteten
Bericht ergab sich, daß gar nichts geschehen war, und daß alle diesem
Manne vorgeschossenen Summen verschwunden waren. Kurz darauf verschwand
er selbst, und man mußte sogar noch zahlreiche Schulden bezahlen, die
er unter Mißbrauch der ihm leider erteilten Vollmachten gemacht hatte.
Später erfuhr man, daß dieser Mann unter verschiedenen Namen schon
ähnliche Streiche in anderen Ländern gespielt hatte. Ich weiß nicht,
wohin[S. 284] er sich nach Verlassen der Niederlande begab. Mehrere Jahre
später hörte ich, er sei in Hamburg, wo er auch starb[397], ohne daß
jemand erfahren hätte, woher er stammte noch wovon er lebte.
III
Aus Casanovas „Memoiren“[398]
Am nächsten Tage kam ich (aus Dünkirchen) in Tournai an. Als ich ein
paar Stallknechte auf schönen Pferden reiten sah, fragte ich sie aus
Neugier, wem sie gehörten.
„Dem Grafen Saint-Germain, dem Adepten, der seit einem Monat hier ist
und niemals ausgeht.“
Diese Antwort bewog mich, ihn zu besuchen. Kaum im Gasthof angelangt,
schrieb ich an ihn und fragte ihn, wann ich ihn aufsuchen dürfte.
Nachstehend seine Antwort, die ich mir aufgehoben habe:
„Infolge meiner Beschäftigung kann ich niemand empfangen. Doch Sie
machen eine Ausnahme. Kommen Sie, wann es Ihnen paßt; man wird Sie
in mein Zimmer führen. Sie brauchen weder meinen noch Ihren Namen zu
nennen. Ich biete Ihnen nicht die Hälfte meines Mittagessens an, denn
meine Nahrung eignet sich für niemand, am wenigsten für Sie, wenn Sie
noch Ihren alten Appetit haben.“
Ich ging um neun Uhr hin und fand ihn mit einem zwei Zoll langen
Stoppelbart. Er hatte eine Anzahl Retorten[S. 285] voller Flüssigkeiten im
Zimmer. Einige machten einen chemischen Prozeß durch; sie lagen auf
Sand bei natürlicher Wärme. Wie er mir sagte, arbeitete er zu seiner
Kurzweil an der Herstellung von Farben und richtete eine Hutfabrik
ein, um dem Grafen Cobenzl, dem Minister Maria Theresias in Brüssel,
gefällig zu sein. Der Graf hätte ihm nur 105000 Gulden gegeben, die
aber nicht hinreichten, doch er würde das Weitere hinzulegen[399]. Dann
sprachen wir von Frau von Urfé.
„Sie hat sich durch eine zu starke Dosis von Universalmedizin
vergiftet“[400], sagte er. „Ihr Testament beweist, daß sie sich für
schwanger hielt. Sie hätte es sein können, wenn sie mich um Rat gefragt
hätte. Das Unternehmen ist sehr schwierig, aber ganz sicher, obgleich
die Wissenschaft das Geschlecht des Kindes noch nicht zu bestimmen
vermag.“
Als er hörte, an welcher Krankheit ich litt[401], beschwor er mich,
drei Tage in Tournai zu bleiben. In dieser Zeit wollte er alle
meine Drüsenschwellungen beseitigen und mir dann fünfzehn Pillen
verschreiben, die ich in fünfzehn Tagen einnehmen sollte und die mich
ganz wiederherstellen würden. Er zeigte mir seine „Lebenskraft“, die er
„Atoëter“ nannte, eine weiße Flüssigkeit in einem festverschlossenen
Fläschchen. Diese Flüssigkeit, sagte er, sei der Universalgeist der
Natur; der Beweis dafür sei, daß der Geist sofort das Fläschchen
verließe, wenn man das Wachs ganz leicht mit einer Nadel durchbohrte.
Ich bat ihn, mir das Experiment zu zeigen. Er gab mir das Fläschchen
und eine Nadel. Ich stach leicht in das Wachs, und in der Tat wurde das
Fläschchen ganz leer.
[S. 286]
„Herrlich!“ sagte ich. „Aber was ist der Zweck davon?“
„Das kann ich Ihnen nicht verraten: es ist mein Geheimnis.“
Wie gewöhnlich hatte er den Ehrgeiz, mich in Verwunderung zu setzen,
und so fragte er mich, ob ich kleines Geld bei mir hätte. Ich zog ein
paar Münzen hervor und legte sie auf den Tisch. Ohne mir zu sagen,
was er vorhätte, stand er auf, legte eine glühende Kohle auf eine
Metallplatte, bat mich um ein Zwölfsousstück, das unter den Münzen lag,
legte ein schwarzes Körnchen darauf und das Geldstück auf die Kohle und
blies sie mit einem gläsernen Blasrohr an. Binnen zwei Minuten war es
glühend.
„Warten Sie, bis es abgekühlt ist“, sagte der Alchimist. Es war in
einer Minute geschehen. „Nehmen Sie es mit,“ fügte er hinzu, „denn es
gehört Ihnen.“
Ich nahm es: es war Gold. Ich zweifelte keinen Augenblick, daß er die
Münze vertauscht und mir eine andere gegeben hatte, die er zweifellos
vorher blank geputzt hatte. Ich wollte ihm keine Vorwürfe machen. Damit
er aber nicht glaubte, er hätte mich zum besten gehabt, sagte ich: „Das
ist wunderbar, Graf. Das nächste Mal aber müssen Sie, um ganz sicher
zu sein, daß Sie auch den schärfsten Beobachter verblüffen, ihm vorher
sagen, welche Verwandlung Sie vorhaben. Dann kann er sich die Münze
ansehen, bevor Sie diese auf die glühende Kohle legen.“
„Wer an meiner Wissenschaft zweifeln kann, ist unwert, mit mir zu
sprechen“, entgegnete der Schwindler.
Dies anmaßliche Benehmen kennzeichnete ihn; es war mir indes nichts
Neues. Das war das letztemal, daß ich den berühmten und gelehrten
Betrüger sah; vor sechs bis[S. 287] sieben Jahren ist er in Schleswig
gestorben[402]. Sein Geldstück war lauteres Gold. Zwei Monate darauf,
in Berlin, überließ ich es Mylord Keith[403], der sich neugierig darauf
zeigte.
[S. 288]
SAINT-GERMAIN IN ANSBACH
(1774–1776)
„Aufschlüsse über den Wundermann, Marquis Saint-Germain, und sein
Aufenthalt in Ansbach, von einem Augenzeugen“[404]
Dieser sonderbare Mann, der zu seiner Zeit manches unverdiente Aufsehen
erregte, lebte verschiedene Jahre in dem Fürstentume Ansbach, ohne daß
man nur von weitem ahnen konnte, er sei der rätselhafte Abenteurer, von
dem man so manche wunderbare Sagen verbreitete.

Alexander, Markgraf von Ansbach und Bayreuth
Stich von Daniel Berger
Es war im Jahre 1774, als dem nun verstorbenen Herrn Markgrafen von
Brandenburg Karl Alexander[405] angezeigt[S. 289] wurde, daß sich zu
Schwabach ein Fremder aufhalte, der sich für einen russischen Offizier
ausgebe, sehr eingezogen lebe, zugleich aber manche Handlungen der
Wohltätigkeit ausübe. Der damals noch zwischen Rußland und der Pforte
obwaltende Krieg[406] und die Anwesenheit der russischen Flotte in dem
Archipelago erregten die Vermutung, daß das russische Gouvernement
vielleicht einen vertrauten Menschen nach Franken geschickt habe, um
ohne Aufsehen die über Italien gehende Korrespondenz zu besorgen. Und
der ebenso gütige als menschenfreundliche Fürst gab den Befehl, diesem
Fremden insolange den ruhigen Aufenthalt zu gestatten, als er der
Polizei keine Veranlassung geben würde, ihn näher zu beobachten.
Einige Zeit nachher meldete der reformierte Geistliche zu Schwabach,
Herr Dejan, daß der Fremde, der seit seiner Anwesenheit daselbst bloß
mit ihm und dem damaligen Stadtvogt Greiner Umgang gepflogen habe,
sehr wünsche, dem Herrn Markgrafen, wenn es ohne Aufsehen geschehen
könne, vor seiner Abreise aus der Gegend aufzuwarten und ihm für den so
liberal gewährten Schutz zu danken. Dieser Wunsch wurde ihm gewährt,
und der Markgraf sah ihn zum erstenmal im Winter abends bei der
berühmten Schauspielerin Clairon[407], die zu eben dieser Zeit sich zu
Ansbach befand.
Der Fremde schien damals ein Mann zwischen 60 und 70 Jahren zu sein,
von mittlerer Größe, mehr hager[S. 290] als stark, der seine grauen Haare
unter einer Perücke verbarg und vollkommen einem gewöhnlichen alten
Italiener gleich sah. Sein Anzug war so einfach als möglich; sein
Ansehen verkündigte nichts Außerordentliches.
Nachdem er dem Markgrafen in französischer Sprache (der Akzent verriet
einen Italiener) für die Erlaubnis gedankt hatte, sich in seinen Landen
ungestört aufhalten zu dürfen, sagte er ihm viel Schönes über seine
Regierung, sprach über große Reisen, die er gemacht hatte, und endigte
damit, zu versichern, daß er zu Bezeugung seiner Dankbarkeit dem
Markgrafen Geheimnisse anvertrauen wolle, welche geeignet seien, das
Glück und den Wohlstand seines Landes zu befördern. Natürlich mußten
Äußerungen dieser Art Aufmerksamkeit erregen, die bald aufs höchste
gespannt wurde, als er eine Menge sehr schöne Steine vorzeigte, die
man für Diamanten ansehen konnte, und die, wenn sie echt waren, von
ungeheurem Wert sein mußten.
Der Markgraf lud ihn nun ein, auf das Frühjahr nach Triesdorf, dem
Sommeraufenthalt des Fürsten, zu kommen, und Graf Tzarogy[408]
— denn unter diesem Namen hatte er sich vorstellen lassen — nahm
diese Einladung unter der Bedingung an, wenn man ihm gestatten wolle,
dort nach seiner eigenen Weise, ganz unbemerkt und in der Stille leben
zu dürfen.
Zu Triesdorf wurde er in die unteren Zimmer des Schlosses logiert,
dessen oberen Teil Mademoiselle Clairon bewohnte. Der Markgraf und
dessen Gemahlin wohnten im Falkenhause. Er hatte keinen Bedienten,
speisete nur auf seinem Zimmer, das er selten verließ, und dies so
einfach als möglich. Seine Bedürfnisse waren mehr[S. 291] als eingeschränkt.
Er vermied allen Umgang, und nur die Abendstunden brachte er in der
Gesellschaft der Mademoiselle Clairon, des Markgrafen und derjenigen
Personen, die dieser Herr gern um sich haben mochte, zu. Man konnte
ihn nicht bewegen, an der fürstlichen Tafel zu speisen, und nur einige
Male sah er die Frau Markgräfin, die auch begierig war, den sonderbaren
Menschen kennen zu lernen.
In Gesprächen war er äußerst unterhaltend, verriet viele Welt- und
Menschenkenntnis und ließ hier und da einige mysteriöse Reden fallen,
von denen er ebenso geschickt abzuspringen und den Discours auf
andere Gegenstände zu lenken wußte, wenn man etwas Näheres zu wissen
verlangte. Vorzüglich sprach er gerne von den Jahren seiner Kindheit
und von seiner Mutter, die er nie ohne scheinbare Rührung und bisweilen
mit Tränen in den Augen nannte. Ihm zu glauben, hatte er fürstliche
Erziehung genossen.
Er war absprechend, aber nie unhöflich. Daß er, wie der sonst so
wahrheitsliebende Baron Gleichen sagte, „zu Triesdorf nach Belieben
gehauset, daß er den Markgrafen wie einen Schulknaben behandelt[409]“,
ist weder wahr noch wahrscheinlich. So leutselig der Markgraf in
dem gesellschaftlichen Umgange war, so gut wußte dieser Fürst die
Achtung zu behaupten, die man seiner Geburt, seinem Range und seinen
guten moralischen Eigenschaften schuldig war. Er würde es nicht
gelitten haben, daß man ihm beföhle; viel weniger würde er dies einem
Unbekannten übersehen haben.
Womit sich dieser Sonderling den ganzen Tag über beschäftiget,
war schwer zu bestimmen. Er hatte keine Bücher bei sich als eine
verschmutzte Ausgabe von dem „Pastor[S. 292] fido“[410]. Man wurde
selten bei ihm vorgelassen, und dann fand man ihn meistenteils den Kopf
in ein schwarzes Tuch gehüllt. Seine vorzüglichste Beschäftigung mag
wohl in Bereitung allerlei Farben bestanden haben; denn die Fenster
seines in den Garten hinausgehenden Zimmers waren so mit Farben
allerlei Art überschmiert, daß man nicht durchsehen konnte. Bald nach
seiner Ankunft zu Triesdorf fing er an, dem Markgrafen Anweisung zu
verschiedenen Zubereitungen zu geben, die den Grund zu einträglichen
Fabriken legen sollten. Unter diesen zeichneten sich vorzüglich
allerlei Arten von Saffian, Korduan und Juchten aus, die aus dem
schlechtesten Schafleder hervorgebracht werden sollten, die Zubereitung
des schönsten türkischen Garns usw.
Der Markgraf ließ die Rezepte durch den Verfasser dieser Beiträge
aufnehmen, und nun ging man an die Versuche selbst, die nach seinem
Verlangen mit dem größten Geheimnis angestellt werden sollten. In einem
besonders dazu bereiteten Laboratorio wurde die Arbeit angefangen, und
die Versuche wurden bei verschlossenen Türen angestellt.
Lebhaft erinnert sich noch nach so manchen Jahren der Verfasser der
lustigen Auftritte dieser Versuche, und wie oft und herzlich er mit
dem Markgrafen darüber gelacht, den Fürsten und seinen Vertrauten in
einer Werkstatt zum Gerber und Färber umgeformt zu sehen. Man wollte
alles versuchen und das Gute behalten. Allein die Hoffnung sank bald
unter näherer Prüfung. Schon hatte man mit leichter Mühe und geringen
Kosten den schönsten Korduan hervorgebracht, und in der Freude[S. 293] seines
Herzens ließ sich der Verfasser Schuhe daraus verfertigen, die sehr gut
ausfielen, aber in den ersten 24 Stunden in Stücken zersprangen. So
unhaltbar war das türkische Garn, und so war es mit mehreren Artikeln.
Tzarogy schob, wenn man ihn zu Rate zog, die Schuld auf fehlerhafte
Manipulation, die doch sicher in den Ingredienzien lag, deren man sich
bediente. Er versprach von Zeit zu Zeit, selbst die Hand anzulegen, um
die wahren Vorteile zu zeigen, und so vergingen einige Wochen, während
welcher der Unbekannte abwechselnd sich zu Triesdorf und Schwabach
aufhielt. War er zu Schwabach, so schrieb er oft an den Markgrafen
und an den Verfasser, schickte immer neue Proben von zubereitetem
Leder, von gefärbter Seide und Tüchern ein, wovon der Verfasser noch
eine ganze Schachtel voll besitzt. Die Proben waren meistenteils mit
Tzarogys eigener Hand überschrieben, z. B. auf Lederproben:
„Völlig unbekannte Lederarten; man zerschneide sie und wird die
Haltbarkeit merken.“
„Sehr billige Lederarten, die ganz allein ohne den geringsten
Kunstgriff aus Abfällen hergestellt werden, die zur Bereitung von
Häuten nicht mehr verwendbar sind.“
Auf gefärbte Tuchmuster: „Bei allen diesen Farbproben läßt sich immer
größere Schönheit, Feinheit und Haltbarkeit erzielen, ich glaube bis
ins Grenzenlose. Um sich davon zu überzeugen, braucht man nur das
Schwarz dieser Musterkarte mit den am letzten Dienstag eingesandten zu
vergleichen. Dann wird man den Unterschied sehen; man kann noch viel
weiter gehen.“
Auf einem anderen Muster: „Dies kostbare Schwarz ist ohne Vitriol,
ohne Galläpfel und ohne Sieden erzielt. Es verschießt nie und wird
aus feinem Russisch Blau hergestellt. Dies unvergleichliche Gelb wird
in lauterem,[S. 294] kristallklarem, kristallreinem Wasser eingefärbt.“ Und
dergleichen mehr.
So erhielt er die Aufmerksamkeit und die Hoffnung, daß doch vielleicht
unter so vielen vorgelegten Proben sich einige nützliche, bisher
unbekannte Gegenstände finden dürften.
Einstmals zeigte Tzarogy dem Markgrafen an, daß er einen Kurier von
dem eben aus Italien zurückkehrenden Grafen Alexis Orlow[411] mit
der dringenden Einladung erhalten habe, ihn zu Nürnberg auf seiner
Durchreise zu besuchen. Er schlug zugleich dem Markgrafen vor, diese
Gelegenheit zu benutzen, um den Helden von Tschesme kennen zu lernen.
Der Vorschlag wurde angenommen, und der Verfasser begleitete den
Markgrafen nach Nürnberg, wo der Graf Alexis Orlow bereits angekommen
war.
Orlow kam dem Grafen Tzarogy, der nun zum ersten Mal in russischer
Generalsuniform einher trat, mit offenen Armen entgegen, hieß ihn
mehrere Male „caro padre“, „caro amico“ usw. Er empfing
den Markgrafen mit ausgezeichneter Höflichkeit und dankte ihm vielmals
für den Schutz, den er seinem würdigen Freunde gegönnt habe. Und
bei dieser Gelegenheit fiel diejenige Äußerung vor, die der Baron
Gleichen dem Fürsten Grégoire Orlow (den der Markgraf nie gesehen)
zuschreibt[412], eine Äußerung, aus der man schließen mußte, daß
Tzarogy eine große Rolle bei der Revolution von Anno 1762 in Rußland
gespielt habe.
Man speiste bei dem Grafen Orlow zu Mittag. Die Unterhaltung war
äußerst interessant. Man sprach viel von dem Feldzuge im Archipelago,
noch mehr aber von[S. 295] nützlichen Erfindungen. Unter andern zeigte Orlow
dem Markgrafen ein Stück unverbrennbares Holz, das nach angestellter
Probe, als es angezündet wurde, weder Flammen noch Kohlen gab, sondern
bloß, nachdem es wie ein Schwamm aufgeschwollen war, in eine leichte
Asche zerfiel.
Nach der Tafel führte Orlow den Grafen Tzarogy in ein Nebenzimmer, in
welchem sie eine geraume Zeit beisammen blieben. Der Verfasser, der
an dem Fenster sich befand, unter welchem die Wagen des Grafen Orlow
standen, bemerkte, daß einer von den Leuten des Grafen einen Wagen
aufschloß und aus dem Sitzkästchen einen großen Beutel von rotem Leder
herausnahm und in das Zimmer hinauftrug.
Man beurlaubte sich in einiger Zeit, und auf der Rückreise hatte
Tzarogy alle Taschen voll venetianische Zechinen, mit denen er auf
eine nachlässige Art zu spielen schien. Daß dieser Mann zuvor kein
Geld hatte, wußte man ganz sicher, weil man auf alles, was ihn betraf,
aufmerksam war.
Der Frau Markgräfin brachte er im Namen des Grafen Orlow eine schöne,
silberne, auf den Sieg von Tschesme geschlagene Medaille. Nach der
Zurückkunft zeigte er zum erstenmal sein unter kaiserlich großem
Siegel ausgefertigtes Patent als russischer General, und in der Folge
vertraute er dem Markgrafen, daß der Name Tzarogy ein zersetzter,
angenommener Name sei, daß er eigentlich Rakoczy heiße und als letzter
Sprosse von dem unter Kaiser Leopold geächteten Siebenbürgischen
Fürsten Rakoczy[413] abstamme.
Alle diese Umstände zusammen genommen vermehrten die Neugierde, welche
aber bald nachher auf eine,[S. 296] diesem sonderbaren Manne nicht sehr
günstige Art gestillt wurde.
Der Markgraf reiste im Jahre 1775, begleitet von dem Verfasser dieser
Bemerkungen, nach Italien. Zu Neapel erfuhr man, daß der letzte
Abkömmling des Rakoczyschen Hauses, das sich dort ansässig gemacht
hatte, schon längstens verstorben und von diesem Namen nichts mehr
übrig sei[414]. Zu Livorno hörte man bei dem englischen Konsul Sir
John Dick, daß der Unbekannte kein anderer als der berüchtigte Graf
Saint-Germain sei, daß er in Italien die Bekanntschaft des Fürsten
Grégoire Orlow und seines Bruders Alexis gemacht und das Vertrauen
dieser Herren sich in einem hohen Grade zu erwerben gewußt habe.
Aus einer anderen, nicht minder glaubhaften Quelle brachte man in
Erfahrung, daß er aus Sankt Germano, einer kleinen Stadt in Savoyen,
gebürtig sei, woselbst sein Vater, der sich Rotondo genannt,
Gefälleinnehmer gewesen und bei einem beträchtlichen Vermögen in
ziemlichem Ansehen gestanden habe. Dieser habe seinem Sohn eine
sehr gute Erziehung gegeben, sei aber nachher in Verfall geraten
und wegen übler Verwaltung seines Dienstes entsetzt worden. Um den
Unannehmlichkeiten zu entgehen, welche das Schicksal des Vaters dem
Sohne hätte zuziehen können, habe dieser seinen Namen mit dem Namen
seiner Vaterstadt vertauscht und sich Saint-Germain geschrieben. Von
dieser Zeit an sei er als Abenteurer in der Welt herumgezogen, habe
sich zu Paris[S. 297] und London Saint-Germain, zu Venedig Conte
de Belle mare[415], zu Pisa Chevalier Schöning, zu Mailand
Chevalier Welldone und zu Genua Soltikow genannt und
könne damals ungefähr 75 Jahre alt gewesen sein.
Natürlich mußten Entdeckungen dieser Art den Markgrafen gegen
einen Mann aufbringen, der auch ihn mystifizieren wollte, und
der ihn über seine Herkunft und mehrere andere Dinge auf eine so
unverschämte Art belogen hatte. Er gab also nach seiner im Jahr
1776 erfolgten Zurückkunft dem Verfasser dieses den Auftrag, sich
nach Schwabach zu begeben, den Abenteurer über alle diese von ihm
erfahrenen Nachrichten zur Rede zu setzen und ihm das Mißfallen
des Fürsten über den Mißbrauch, den er von seiner Güte gemacht, zu
erkennen zu geben, zugleich ihm zu bedeuten, daß er sich nicht mehr
vor ihm sehen zu lassen und die Briefe zurückzugeben habe, die ihm
der Markgraf von Zeit zu Zeit geschrieben. Im Fall er diese Briefe
unverweigerlich zurückgeben würde, sollte ihm erlaubt sein, solange
er wolle und solange er sich ruhig verhalte, zu Schwabach zu bleiben;
im entgegengesetzten Fall aber sollte er arretiert, seine Papiere ihm
abgenommen und er über die Grenze gebracht werden.
Bei seiner Ankunft zu Schwabach traf der Verfasser dieses den Grafen
Saint-Germain zu Bette liegend an; denn trotz seines Pochens auf seine
Gesundheit und sein hohes Alter hatte er oft Anfälle von Gicht.
Er gestand auf den ihm gemachten Vorhalt, den er sehr gelassen
anzuhören schien, daß er alle oben bemerkten Namen, bis auf den
von Soltikow, von Zeit zu Zeit angenommen habe; daß er aber
allenthalben unter diesen Namen als ein Mann von Ehre bekannt sei,
und[S. 298] daß, wenn ein Verleumder sich etwa erlauben sollte, ihm schlechte
Handlungen aufzubürden, er bereit sei, sich auf eine genügende Art
auszuweisen, sobald er wisse, wessen man ihn beschuldige und wer der
Ankläger sei, der gegen ihn aufzutreten gedenke. Er fürchte keine
Verfolgungen als diejenigen, welchen ihn sein Name aussetzen könne.
Er behauptete standhaft, dem Markgrafen keine Unwahrheit in Ansehung
seines Namens und seiner Familie gesagt zu haben. Die Beweise seiner
Herkunft befänden sich aber in den Händen einer Person, von der er
abhängig sei; eine Abhängigkeit, die ihm in dem Laufe seines Lebens die
größeste Verfolgung zugezogen. Eben diese Verfolgungen und Attentate,
wie er sich ausdrückte, hätten ihn verhindert, die großen Kenntnisse,
die er besitze, werktätig zu benutzen. Er habe sich dieserhalben an
einen Ort zurückgezogen, in dem er unbekannt und unbemerkt leben zu
können geglaubt. Jetzt sei der Augenblick gekommen, in welchem er das,
was er versprochen, in das Werk setzen könne und werde, wenn man ihn
nicht selbst daran hindere.
Auf die Frage: warum er den Markgrafen nicht von den verschiedenen
Namen praeveniert habe, unter denen er in so manchen Staaten
und Städten aufgetreten, erwiderte er, daß er dieses nicht für nötig
gefunden habe, weil er geglaubt, daß man ihn, da er nie etwas von dem
Markgrafen verlangt, da er niemand beleidigt oder in Schaden gesetzt
habe, nicht hiernach, sondern nach seinen Handlungen beurteilen
würde. Niemals sei es ihm beigegangen, das Vertrauen des Markgrafen
zu mißbrauchen; er habe seinen wahren Namen angegeben; in kurzer
Zeit würden seine Handlungen keinen Zweifel über seine Denkungsart
hinterlassen, und dann würde er Proben seiner Herkunft vorlegen können.
Die ungünstige Meinung,[S. 299] die man dem Markgrafen gegen ihn beigebracht
habe, falle ihm sehr empfindlich. Er werde aber, falls man das, was
jetzt vorgehe, heimlich halten wolle, fortfahren, seine Versprechungen
zu erfüllen und den Markgrafen dadurch zwingen, ihm seine Achtung
wieder zu schenken; im Gegenteil werde er sich genötigt sehen, das Land
zu verlassen.
In dem weiteren Verfolg dieser Unterredung äußerte er, daß er die
erste Bekanntschaft des Grafen Orlow zu Venedig gemacht habe. Das
Patent, das er von ihm erhalten, und das er bei dieser Gelegenheit
nochmals vorzeigte, war von dem Grafen zu Pisa ausgefertigt und auf
den Chevalier Welldone verlautend. Auch erwähnte er hierbei des
Vertrauens, mit welchem ihn Ludwig XV. beehrt, der ihn in den 1760er
Jahren zur Einleitung einer Friedensunterhandlung mit England heimlich
gebraucht. Seine genaue Bekanntschaft mit dem Maréchal von Belle-Isle
habe ihm aber den Haß des Grafen Choiseul zugezogen, der nach England
geschrieben und seine Verhaftung von dem Minister Pitt verlangt.
Der König habe ihn hierauf von dem ihm bevorstehenden Schicksal
unterrichtet und ihm den Rat gegeben, nicht wieder nach Frankreich zu
kommen[416].
Diese Anekdote stimmt also mit demjenigen, was Baron Gleichen in seinen
Mémoires erwähnt[417], vollkommen überein, und noch weit stärker
wird sie durch dasjenige bestätiget, was Friedrich II. in seinen
Oeuvres posthumes, tome IV, page 73 anführt[418]. (Der König
bezeichnet ihn hier als einen Menschen, den man nie habe enträtseln
können.)
[S. 300]
Die Briefe des Markgrafen gab er mit scheinbarer Rührung bis auf einen
einzigen zurück, den er, wie er sagte, dem Grafen Orlow mitgeteilt habe.
Nach diesem Vorgang blieb er noch einige Zeit ganz still in Schwabach,
von wo aus er über Dresden, Leipzig und Hamburg sich nach Eckernförde
im Schleswigschen verfügte und daselbst zu Anfang des Jahres 1780[419]
an einem Schlagfluß, der ihm gleich die Zunge lähmte, wahrscheinlich
in einem Alter von etlichen 80 Jahren seine abenteuerliche Laufbahn
beschloß.
Sonderbar ist sie genug, diese Laufbahn. Es bleibt sonderbar, daß ein
Mann, der sich in seinem ganzen Leben unter so verschiedenen Namen in
der großen und kleinen Welt herumgetrieben, nie dem Richter oder der
Polizei in die Hände gefallen. Unstreitig verstand er die Kunst, die
Neigung der Menschen zum Wunderbaren zu benutzen und zu unterhalten,
und wie oft mag er Veranlassung gefunden haben, mit Figaro auszurufen:
„O, que les gens d’esprit sont bêtes[420]!“
Daß er große chemische Kenntnisse besessen, davon kann sich der
Verfasser dieser Beiträge nicht überzeugen. Seine Präparate fielen
in die Augen, allein es waren lauter Versuche im Kleinen; zu den
Fertigungen und Zubereitungen von Leder kamen ätzende Sachen, als
Vitriolspiritus, Vitriolöl u. dgl. Dies beweisen die Muster, die noch
übrig sind und wovon, wie es der Augenschein gibt, das Papier, in
das sie gewickelt waren, zerfressen worden. Nie hat er, solange er
in Schwabach war, irgendeinen[S. 301] Artikel ins Große gefertigt. Die oben
bemerkten Steine, deren auch Baron Gleichen gedenkt[421], waren zwar
schön und würden vielleicht, unter echten Schmuck gefaßt, selbst das
Auge eines Kenners getäuscht haben; aber es waren keine Edelsteine.
Sie widerstanden der Feile nicht, und ebensowenig hatten sie das
Gewicht echter Steine. Saint-Germain selbst hat sie nie für Brillanten
ausgegeben. Der Verfasser besitzt noch einen dieser Steine und ein
Stück von der Masse, aus der sie vermutlich gefertigt worden. Das
Similor, das Saint-Germain als eine wichtige Erfindung ausgab, verlor
in kurzer Zeit seinen Glanz und wurde so schwarz wie das schlechteste
Messing. Eine Fabrik von diesem Metall, die zu L. errichtet worden,
fiel nach kurzer Zeit.
Unter den Proben seiner geheimen Künste zeigte er einst ein großes
Taschenmesser, wovon die Hälfte wie Blei biegsam, die andere aber
unbiegsam und hartes Eisen war. Er wollte dadurch einen Beweis
des Geheimnisses geben, das er besitze, das Eisen so biegsam und
ductile[422] wie Blei zu machen, ohne daß es dadurch etwas
von seinen übrigen Eigenschaften verliere. Diese Erfindung wäre nun
freilich von bedeutendem Nutzen gewesen, allein man konnte ihn nie
bewegen, den Versuch im Großen zu machen.
Seine chemischen Kenntnisse waren allem Anschein nach empyrisch. Der
nun verstorbene Stadtvogt Greiner zu Schwabach, ein Mann von vielen
Kenntnissen, besonders im technischen Fache, versicherte mehrmals,
bei seinen Unterhaltungen mit Saint-Germain auch nicht die geringsten
theoretischen Kenntnisse entdeckt zu haben.
Besonders rühmte der Marquis sich, medizinische Kenntnisse zu
besitzen und durch diese zu einem hohen Alter gelangt[S. 302] zu sein.
Seine Vorschriften bestanden besonders in einer strengen Diät[423]
und dem Gebrauche eines Tees, den er Thée de Russie oder Acqua
benedetta[424] nannte. Von dieser Wunderarznei erhielt der Markgraf
die Abschrift des Rezepts von dem oben benannten englischen Konsul zu
Livorno. Sie wurde auf der russischen Flotte im Archipelago gebraucht,
um die Gesundheit der Equipage[425] unter jenem heißen Himmelsstriche
zu erhalten.
Was für Ressourcen Saint-Germain gehabt haben möge, um die
nötigen Ausgaben seiner Existenz zu bestreiten; dürfte schwer zu
erraten sein. Verfasser dieses vermutet, er habe des Geheimnis
besessen, Diamanten von Flecken zu reinigen, die man bisweilen in
solchen antrifft und wodurch ihr Wert ansehnlich verringert wird. Doch
ist dieses eine bloße Vermutung.
Lieblos würde es sein, diesen Mann für einen Betrüger zu erklären.
Hierzu gehören Beweise, und diese hat man nicht. Solange er im
Verhältnisse mit dem Markgrafen stand, hat er nie etwas begehrt, nie
etwas von dem mindesten Wert erhalten, nie sich in etwas gemischt, das
ihn nicht anging. Bei seiner äußerst einfachen Lebensart waren seine
Bedürfnisse sehr eingeschränkt. Hatte er Geld, so teilte er’s den Armen
mit. Daß er irgendwo Schulden hinterlassen, ist nicht bekannt; doch
hat der Verfasser lang nachher erfahren, daß er in den letzten Zeiten
seines Aufenthalts in Schwabach einen Baron von L. zu Spekulationen
verleitet, die ihn um manche tausend Gulden ärmer gemacht haben. Da
aber diese Sache nicht zur Klage kam, so scheint kein Betrug dabei
untergelaufen zu sein. Unerklärbar bleibt es immer, durch welche Mittel
dieser Abenteurer, besonders in großen Städten wie Paris und London,
auf eine anständige Art[S. 303] leben und in der großen Welt den Zutritt bei
höheren Ständen finden konnte.
Sein in jüngeren Jahren gefertigtes Porträt fand der Markgraf in Paris
bei Madame d’Urfé oder Rochefoucauld[426]; er brachte eine Kopie davon
zurück, und diese befindet sich noch zu Triesdorf in den Zimmern, die
Saint-Germain einst bewohnte.
[S. 304]
SAINT-GERMAIN IN
LEIPZIG UND DRESDEN (1776–1777)
I
Aus den Tagebüchern des Grafen
Lehndorff[427]
2. Mai 1777.
Ich treibe mich in Leipzig viel auf der Messe herum und besuche den
Kupferstecher Bause und den Maler Graff[428].
Von da begebe ich mich zu dem merkwürdigsten Mann im heutigen Europa,
dem Grafen Saint-Germain, der unter diesem Namen seit 50 Jahren bekannt
ist, gegenwärtig aber den Namen Welldone angenommen hat, was
im Englischen Wohltäter bedeutet. Von diesem Menschen behauptet man,
er habe schon zur Zeit Christi gelebt. Er selbst sagt das zwar nicht,
er gibt aber zu verstehen, daß er schon lange gelebt habe und nicht
glaube, sterben zu müssen, und daß die Menschen, wenn sie seiner
Lebensweise folgen würden, zum mindesten ein hohes Alter frei von
allen Gebrechen erreichen könnten. Es steht fest, daß er selbst eine
strenge Diät befolgt. Er befleißigt sich großer Mäßigkeit, trinkt nur
Wasser, niemals jungen Wein und nimmt nur einmal am Tage ein leichtes
Mahl ein[429]. Seine Unterhaltung ist interessant. Er predigt immer die
Tugend,[S. 305] die Mäßigung, die Wohltätigkeit und zeigt diese Eigenschaften
an sich selbst. Man kann ihm nicht die geringste anstößige Handlung
vorwerfen. Er soll nicht mehr so reich sein, wie es früher den Anschein
hatte. In Frankreich, in England und in Venedig gab er jährlich 6000
Dukaten aus, ohne daß man wußte, woher das Geld kam. Hier in Leipzig,
sagt man, mangele es ihm an Geld, ohne daß er jedoch jemand darum
angegangen hätte; statt dessen soll er aber eine Menge Diamanten
besitzen.
Sein Gesichtsausdruck ist außerordentlich geistvoll. Er spricht
begeisternd und treffend, liebt aber Widerspruch nicht. Er behauptet,
auf dem Gesicht lesen zu können, ob jemand befähigt sei, ihn zu
verstehen oder nicht. Im letzteren Fall mag er die Person nicht
wiedersehen.
Was mich anbetrifft, so habe ich ihm mit großem Vergnügen zugehört. Er
schien mir viel Freundschaft entgegenzubringen, so daß ich ihn in 3
Tagen wohl 24 Stunden gesehen und gehört habe. Er ist sehr fesselnd.
Man dichtet ihm übrigens vieles an, was er gar nicht gesagt hat. Einige
glauben, er sei ein portugiesischer Jude; andere schätzen sein Leben
auf ein paar Jahrhunderte und nehmen an, er sei irgendein entthronter
Fürst. Man beschuldigt ihn, daß er die Leute glauben machen wolle, er
sei der dritte Sohn des Fürsten Rakoczy[430].
Er hält sich für einen großen Physiker. Vor allem ist er Arzt und
spricht viel von seinem köstlichen Pulver, das man wie Tee trinke. Ich
ließ mir eine Tasse davon geben. Es schmeckte nach Anis und führte
etwas ab. Unaufhörlich predigt er vom richtigen Gleichgewicht zwischen
Leib und Seele. Wenn man das genau beobachte, so könne, meint er, die
Lebensmaschine niemals in Unordnung geraten.
[S. 306]
Seit meiner frühesten Jugend hatte ich von dem Manne immer reden hören,
und nun bin ich entzückt, ihn hier zu treffen. Vor mehr als 30 Jahren
schon erzählte man mir, wie er bei der Aufführung der „Mariamne“
in Paris, der er mit mehreren Damen in einer Loge dort beiwohnte,
sehr gerührt wurde und sagte: „Ich muß es sein; denn ich habe diese
liebenswürdige Fürstin gut gekannt.“ Man unterbrach ihn mit der kurzen
Frage: „Sie haben also auch Jesus Christus gekannt?“ — „Nur zu gut!
ich war damals ein ganz junger Mensch, als er die Geschichte im Tempel
hatte, und sagte ihm sogleich: „Lieber Freund, das wird schlecht
ablaufen!“[431] Mir hat er dergleichen nicht vorgeschwatzt, doch schien
er mir überzeugt zu sein, daß er nicht eines natürlichen Todes sterben
werde.
II
Aus dem Briefwechsel Friedrichs des Großen mit Prinz Heinrich, der
Prinzessin Wilhelmine von Oranien und Alvensleben
Alvensleben[432]
an König Friedrich
Dresden, 10. März 1777.
Der berüchtigte Saint-Germain, der in verschiedenen Ländern auch
unter dem Namen eines Marquis von Belmar oder eines Herrn
Castelane[433] aufgetreten ist, befindet sich seit Oktober unter
dem Namen eines Herrn von Welldone in Leipzig. Was mich zur
Erwähnung dieses Mannes[S. 307] bestimmt, ist, daß man öffentlich erzählt, er
sei von E. M. mehrfach mit Briefen beehrt worden. Aus diesem Grunde
dürfte der seltsame Mann, der für E. M. sonst wenig zu bedeuten hat,
Ihre Aufmerksamkeit erregen.
König Friedrich an Alvensleben
Potsdam, 15. März 1777.
Versuchen Sie auch zu ermitteln und teilen Sie mir sofort mit, in
welcher Absicht der von Ihnen erwähnte Saint-Germain nach Leipzig
gekommen ist. Sie werden es leicht durch Kaufleute erfahren, die
Beziehungen zu Leipzig haben.
König Friedrich an die Prinzessin Wilhelmine von
Oranien[434]
Potsdam, 17. März 1777.
Man droht uns hier mit dem Erscheinen eines berühmten Abenteurers,
eines gewissen Saint-Germain, der sich in Frankreich und England
aufgehalten hat und von dem man Wunderdinge erzählt. Ich mag dies Volk
nicht; es hinterläßt gewöhnlich unangenehme Spuren an der Stätte seines
Wirkens. Indes, er ist noch nicht angekommen.
Alvensleben an König Friedrich
Dresden, 24. März 1777.
Der berüchtigte Saint-Germain ist noch immer unter dem Namen
Welldone in Leipzig. Ich habe viele Tatsachen[S. 308] und Anekdoten
über diesen seltsamen Mann gesammelt, aber das alles ist augenblicklich
noch so unzusammenhängend, daß ich es E. M. nicht zu berichten wage,
ohne mich lächerlich zu machen. Ich werde mir jedoch alle Mühe geben,
Näheres über ihn zu erfahren, und ich verfolge ihn so genau, daß ich
hoffe, E. M. Befehle bald erfüllen zu können. Sicher ist, daß er
in engen Beziehungen zum Grafen Alexis Orlow steht, daß dieser ihm
Briefe an seinen Bruder, den Fürsten[435], gegeben hat; denn damals
beabsichtigte er, nach Rußland zu gehen. In diesen Briefen bat Orlow
seinen Bruder, ihn wie seinen Busenfreund zu behandeln, da er ihn als
einen der achtbarsten Menschen der Welt erkannt habe.
Bevor er nach Leipzig kam, hat er ein volles Jahr in Nürnberg,
Schwabach und im Ansbachischen zugebracht[436]. Aus allem, was jetzt
über ihn geredet wird, geht hervor, daß er ein äußerst geistvoller und
kenntnisreicher Mann ist, der die Menschen kennt, mit denen er spricht,
und der seine Reden dem Geist und der Auffassung eines jeden anzupassen
versteht.
Der Zweck seines Aufenthaltes in Leipzig ist noch unbekannt; denn
alles, was man sich darüber erzählt, ist mehr als unwahrscheinlich.
Dresden, 28. März 1777.
Der berüchtigte Saint-Germain weilt noch immer in Leipzig. Er wird
sogar noch während der Messe dort bleiben, aber nicht hierher kommen,
obgleich er mehrfach dazu aufgefordert ist. Er wollte dem Magistrat
von Leipzig mehrere Projekte vorlegen, man ist aber nicht darauf
eingegangen. Obgleich es ihm nicht eigentlich schlecht geht, wird ihm
das Geld gegenwärtig knapp. Und doch:[S. 309] als Graf Marcolini eigens zu
seinem Besuche nach Leipzig kam und ihm Belohnungen versprach, falls
er dem Staate durch Mitteilung seiner Geheimmittel einen wesentlichen
Dienst leistete, hat er ihm geantwortet, man irre sich sehr, wenn man
dergleichen bei ihm annähme; sein einziges Ziel sei, die Menschheit
zu beglücken, und gelänge ihm das, so fühle er sich hinreichend
belohnt[437]. Wie man zugibt, hat er in Leipzig nichts getan, was
diesen Grundsätzen widerspräche, allerdings auch nichts, was sie
bestätigte.
König Friedrich an Alvensleben
Potsdam, 29. März 1777.
An Saint-Germain nehme ich aus bloßer Neugier Anteil. Nur aus diesem
Grunde erwarte ich Ihren Bericht über das, was Sie noch von ihm
erfahren sollten. Angesichts seiner alten Beziehungen zum Grafen Orlow
wäre es wohl möglich, daß er auf den Einfall kommt, seinen Freund
während der schönen Jahreszeit in Rußland zu besuchen.
König Friedrich an die Prinzessin Wilhelmine von
Oranien
Potsdam, 30. März 1777.
Der Saint-Germain, von dem ich Dir neulich schrieb, ist noch in
Leipzig. Wie ich höre, will er nach Petersburg. Wäre der alte Narr
gescheit, er wartete in Florenz ruhig den Tod ab, statt sein altes
Gerippe am Ufer des Eismeers spazieren zu führen.
[S. 310]
Alvensleben an König Friedrich
Dresden, 25. Juni 1777.
Da ich erwartete, daß der unter dem Namen Saint-Germain bekannte Graf
Welldone dies Land verlassen und nicht mehr von sich reden
machen würde, habe ich ihn in meinen letzten Berichten nicht mehr
erwähnt. Da er sich jedoch schon über fünf Wochen dauernd hier aufhält
und die Absicht geäußert hat, nach Berlin zu reisen, habe ich erneut
auf ihn achtgegeben und mich nach Kräften bemüht, ihn auszuforschen.
Das ist mir um so lieber, als er mir vor einigen Tagen sagte, er
wolle sich unmittelbar an E. M. wenden. Vielleicht wird er mir noch
heute einen Brief für E. M. zusenden, in dem er sich auf Geheimmittel
bezieht, die nach seiner Behauptung ans Wunderbare grenzen. Sein Plan
und E. M. Wunsch, Näheres von ihm zu erfahren, entschuldigen mich
vielleicht, wenn ich allzusehr auf Einzelheiten eingehe, um nach meiner
schwachen Einsicht ein Charakterbild dieses angeblichen Wundermannes zu
entwerfen.
Seine Äußerungen über seine Persönlichkeit, die ich selbst gehört habe,
sind voller Eitelkeit und Hochmut. Verschiedene Unterhaltungen, die
ich mit ihm hatte, seine Komplimente, die er urteilslos und wahllos an
jeden verschwendet, und die lebhaften, ernstlichen Debatten, in die er
sich leicht einläßt, bestimmen mich zu folgendem Urteil. Er ist ein
hochbegabter Mann mit sehr regem Geiste, aber völlig urteilslos, und
seinen eigenartigen Ruf hat er nur durch die niedrigste und gemeinste
Schmeichelei erlangt, deren ein Mensch fähig ist, sowie durch seine
hervorragende Redegabe, zumal wenn man sich durch den Eifer und die
Begeisterung hinreißen läßt, mit der er sich auszudrücken versteht
und die auf schwache Gemüter[S. 311] stets Eindruck macht. Dazu ist seine
Redeweise mit allerlei oberflächlichen Kenntnissen und Tatsachen
verbrämt, die er auf seinen Reisen gesammelt hat. Da sie aber in einem
so wenig klaren Kopfe wie dem seinen schlecht geordnet sind, wird
daraus ein dauerndes wirres Gerede, sobald er aus seinem Hohlkopf
neue Gedanken entwickeln will. Maßlose Eitelkeit ist die Triebfeder,
die den ganzen Mechanismus in Bewegung setzt, und diese Eitelkeit muß
volle Befriedigung finden, wenn er von jüdischer Abstammung ist, wie
die Leute behaupten, die ihn am besten zu kennen glauben. Denn es ist
sicher erwiesen, daß er lediglich wegen seiner Gauklerkünste Eingang in
die Häuser der Großen findet und von vielen mit stummer Bewunderung,
die an Verehrung grenzt, als ein neuer Prophet angesehen wird.
Sein Alter — er ist nahezu 70 Jahre — und seine zahlreichen Reisen,
die er in Europa, an den Küsten Afrikas, in Ägypten und Kleinasien
gemacht haben will, haben seinen Kopf mit zahlreichen Anekdoten und
vielen, vielleicht sehr oberflächlichen Handelsprojekten erfüllt.
Dadurch ist er auch in Gesellschaft anregend und unterhaltend, solange
er bloß erzählt. Sobald er aber eigene Gedanken entwickeln will, zeigt
sich seine ganze Schwäche. Denn dann gerät er mit dem gesunden Verstand
und mit den klar bewiesenen Grundbegriffen in Widerstreit. Aber wehe
dem, der ihm zu widersprechen wagt! Dann kennt er keine Grenzen mehr,
speit Feuer und Flamme und redet mit einer Begeisterung, daß man Angst
bekommen könnte. Ja, dann geht er so weit, Bannflüche gegen jeden
Zweifler an seinem System zu schleudern, obwohl dies System sich selbst
widerlegt und in Widersprüche verwickelt. Wenn aber trotzdem jemand den
Mut hat, ihm die Stirn zu bieten, nicht an seine Lehren zu glauben[S. 312] und
sie mit Gründen zu bekämpfen, erwählt er das klügere Teil und schweigt
still.
Wer ihn so reden hört, ist stets geneigt, sich für seinen engsten
Vertrauten zu halten. Allerdings fühlt man sich etwas gedemütigt,
wenn man bemerkt, daß die Zahl seiner Vertrauten mit der Zahl seiner
Bekannten in gleichem Maße wächst. Seine Schmeichelei erschöpft alles,
was die ausschweifendste Phantasie zu ersinnen vermag. Ich sah Leute
darüber erröten, die sonst nicht gerade an Bescheidenheit leiden. Um
E. M. nicht durch Wiederholung all seiner platten Schmeicheleien zu
ermüden, will ich als einziges Beispiel dafür anführen, daß er mir
vertraulich versichert hat, ich spräche wie eine Perle des Orients, ein
Ausdruck, den er besonders betonte.
Er spricht fließend französisch, aber Kenner versichern, daß er dabei
viele fremdartige Wendungen einfließen läßt. Auch beweisen zahlreiche
Briefe, die er an hiesige Damen gerichtet hat, daß er die Gabe hat,
Ausdrücke zu prägen, die der Französischen Akademie gewiß noch
unbekannt sind.
Er nennt sich Fürst Rakoczy, und zum Beweise seines besonderen
Vertrauens sagte er mir noch, er hätte zwei Brüder[438], die aber so
niedrig dächten und so wenig hohen Sinn hätten, daß sie sich ihrem
elenden Lose unterwürfen. Er dagegen habe zu einer gewissen Zeit den
Namen Saint-Germain angenommen, das bedeute: „der Heilige der
Brüder“.
Wie er sagt, hat er fünfzehn Jahre lang einen Franzosen namens Boissy
in Indien und China auf seine Kosten gehalten, um sich durch ihn alle
Stoffe und Kenntnisse zu verschaffen, deren er bedurfte.
Er verachtet alle Ärzte, Arzneien und Hausmittel; trotzdem vertreibt er
ein Pulver, von dem er Wunderdinge[S. 313] erzählt, und er selbst duftet wie
eine wandelnde Apotheke.
Er hat mir eine Liste seiner Geheimmittel[439] gezeigt, aber ich
sah sie nur einen Augenblick. Sie umfaßt über zwanzig Punkte, läßt
sich jedoch, wenn mein Gedächtnis mich nicht täuscht, auf folgende
zusammenziehen:
1. Färben von Häuten in den kräftigsten Farben.
2. Herstellung aller möglichen Farben, besonders von Weiß, in
vorzüglicher Art.
3. Veredlung der minderwertigsten Häute, selbst der Schaffelle, so daß
sie dreißig Jahre lang als Hängeriemen für Kutschwagen zu brauchen sind.
4. Ein Ersatzstoff für Cochenillefarbe.
5. Bleichen der Leinwand in kürzester Zeit und besser als in den
Niederlanden, doch ohne den Stoff anzugreifen.
6. Veredlung von Seidenstoffen und Färbung mit den schönsten Farben.
7. Herstellung eines Lebenselixiers.
Diese Geheimmittel bestimmt er für die russische Zarin[440], für die
er eine ganz besondere Zuneigung hegt. Doch sollen sie nach seiner
Behauptung als Grundlage für den Handelsverkehr zwischen Sachsen und
Rußland und für ihre gegenseitige politische Verbindung dienen. Beide
Länder sollen durch diese Erwerbung zu vollkommenem Glück und zum
Überfluß gelangen, sodaß sie sich gegenseitig nicht mehr entbehren
und ohne einander nicht glücklich werden können. Gegenwärtig ist er
jedoch mit Sachsen und mit dem Empfang, den er hier gefunden hat,
unzufrieden, und so scheint es, als ob die Staaten E. M. an Stelle von
Sachsen treten sollen, nicht bloß,[S. 314] um ihr Glück zu begründen, sondern
auch, um das bestehende Bündnis zwischen Preußen und Rußland[441] zur
Notwendigkeit zu machen und auf ewig zu besiegeln. Ich nehme an, daß
dies der Hauptinhalt seines Briefes und seines Planes ist, wenigstens
nach einigen Äußerungen zu schließen, die er mir darüber gemacht hat.
Er ist sogar fest entschlossen, Sachsen als zu kleinen Schauplatz
für einen so großen Geist wie den seinen zu verlassen, aber trotzdem
wird er einige Menschen glücklich machen, die ihm als getreue Apostel
anhängen. Nach seiner Behauptung hat diese Fülle von Geheimmitteln
ihm Millionen gekostet, doch soll das Land, das er mit diesen Gaben
beschenkt, aus ihrem Gebrauch jährlich mindestens 12 Millionen netto
gewinnen, wobei er hinzufügte: „Das habe ich mir nicht erst seit
gestern ausgerechnet.“ Und da er über so große Reichtümer verfügt,
könne kein Herrscher ihn belohnen noch ihm ein Los bereiten, das ihn zu
reizen vermöge, da er selbst ein Fürst sei.
Ich wagte ihm drei Fragen zu stellen, mit denen ich ihn in die Enge
zu treiben glaubte, aber er hat sich als geschickter Gaukler aus
der Klemme gezogen. Zunächst fragte ich ihn, warum er seine Blicke
gerade auf Rußland gerichtet habe, um es zu beglücken, da er mir doch
früher gestanden habe, er besäße ein Buch, in das er fünf Herrscher
und Fürsten eingetragen habe, die er bewundere und denen er besonders
zugetan sei, nämlich E. M., die Zarin von Rußland, den Kaiser[442],
den König von Sardinien[443] und den Markgrafen von Baden[444].
Zweitens, warum er so spät auf seine Weltbeglückungspläne käme, da
er ja so hochherzige[S. 315] und menschenfreundliche Gesinnungen zur Schau
trüge. Drittens, ob er sein langes Leben tatsächlich der Wirkung des
Lebenselixiers verdanke.
Bei jeder dieser Fragen näherte er sich mir mit geheimnisvoller Miene
und versicherte mir, er müsse mir ein großes Geheimnis enthüllen. Im
Grunde sagte er mir aber weiter nichts als große Worte und schwatzte
so unzusammenhängendes Zeug, daß es unmöglich wäre, den Inhalt
kurz anzugeben noch zu begreifen, wieso ich daraus die erwünschten
Erklärungen entnehmen sollte. Nur über die letzte Frage konnte ich
einigen Aufschluß erlangen. Ich hatte nämlich betont, daß, wenn sein
angebliches Geheimmittel dazu verleiten könnte, an die Berichte
über sein hohes Alter zu glauben, mich eine Bemerkung von ihm, die
er kurz vorher gemacht hatte, daran fast irremachen könne. Denn
als ich an dem besonderen Vergnügen gezweifelt hatte, das er beim
Lesen von Swifts[445] Werken empfände, wofern er nicht die kleinsten
Einzelheiten jener Zeit kenne, da habe er mir erwidert, er kenne sie
aus sehr ausführlichen zeitgenössischen Schilderungen, die er sich
zu verschaffen gewußt habe. Das wäre doch unnütz gewesen, wenn er zu
jener Zeit gelebt hätte. Darauf entgegnete er nur: Diese Bemerkung
widerspräche seinem Geheimmittel nicht; denn es sei sehr möglich, daß
er damals für zehn bis fünfzehn Jahre zurückgezogen in einem anderen
Lande gelebt hätte, z. B. in Portugal; somit müsse er sich an die
Berichte von anderen halten. Zudem wäre es öffentlich bekannt, daß er
oft für Jahre verschwunden gewesen sei, ohne daß man seinen Wohnsitz
gekannt hätte.
[S. 316]
Aus diesen Antworten ersehen E. M., daß er zwar nicht unumwunden ja
sagte, aber doch durchblicken ließ, daß er sein Alter auf Jahrhunderte
berechnet.
Oft sagte er: „Ich halte die Natur in meinen Händen, und wie Gott die
Welt geschaffen hat, kann auch ich alles, was ich will, aus dem Nichts
hervorzaubern.“
Eines Tages, als ich mit ihm von dem Posten des
Generalkontrolleurs[446] sprach, den er, wie man sagte, erhalten
sollte, versicherte er mir, er hätte diese Stellung nicht ausschlagen
können, da sie ihm nie angeboten worden sei. Allerdings hätte man im
Kronrat offen gesagt, zum Generalkontrolleur wäre ein Kopf wie der
seine nötig. Das träfe auch zu, obgleich er als Fürst weit entfernt
sei, eine Stellung anzunehmen, die von Gesindel und von Habenichtsen
bekleidet worden sei.
Außer den schon aufgeführten Geheimmitteln schreibt man ihm im Publikum
noch die Kunst zu, Kapwein herzustellen und Metalle und Steine zu
veredeln.
Da ich mich für verpflichtet hielt, den Charakter eines Mannes, der
sich an E. M. persönlich wenden will, genau zu schildern, und mir dies
nicht möglich schien, ohne auf Einzelheiten einzugehen, hoffe ich auf
E. M. gnädige Nachsicht, wenn ich die Grenzen überschritten habe, die
die kostbare Zeit E. M. mir sonst bei meinen Berichten ziehen muß.
Nachschrift I
In diesem Augenblick bringt Graf Welldone mir persönlich die genaue
Aufstellung der Geheimmittel, über die er mit E. M. selbst zu reden
wünscht, um sie darauf zum Wohl Ihrer Staaten ans Licht bringen zu[S. 317]
können. Die beifolgende Aufstellung ist von seiner eigenen Hand. Er
hat sie mir für E. M. übergeben, nebst einigen auf seine Geheimmittel
bezüglichen Proben. Er hat keinen Brief geschrieben, wie ich annahm,
denn er befürchtete, daß die Einzelheiten, auf die er eingehen müßte,
zu lang wären, und er wollte lieber in einigen Tagen selbst nach
Potsdam reisen, um E. M. seine Künste zu unterbreiten, obwohl ich ihm
klarzumachen suchte, daß er besser täte, hier E. M. Antwort abzuwarten.
Das Geheimmittel, über das er keine Auskunft geben will[447], betrifft
die Veredlung von Edelsteinen. Allein durch diesen Gewerbszweig will er
stündlich Millionenverdienste herbeiführen. Ich wiederhole lediglich,
was er gesagt hat.
Nachschrift II
Obgleich Graf Welldone mir keinen Brief an E. M. in Aussicht gestellt
hat, sendet er mir eben das beifolgende Kuvert, das wie ein Brief
aussieht[448].
Neue Physik in Anwendung auf mehrere Handelsartikel, die ebenso
wichtig wie neu sind[449]
1. Verfahren, das allen Sorten von Häuten und Leder eine bisher
unbekannte Festigkeit, Güte, Schönheit, Haltbarkeit usw. gibt und
besonders den Schaffellen einen wirklichen, sehr beträchtlichen Wert
verleiht.
2. Verfahren zur Veredlung von Wolle, durch das diese weit mehr
Haltbarkeit, Feinheit, Güte usw. erhält.
3. Verfahren zur äußersten, vollständigen Bleichung von Leinwand,
Hanf, Flachs und deren Gespinsten, durchaus[S. 318] besser als in Harlem in
Holland, ein Verfahren, das die Stoffe nicht wie dort angreift und
nur kurze Zeit beansprucht.
4. Verfahren zum Waschen von Seide, durch welche die italienische
Seide den allerschönsten Seiden der Welt überlegen, glänzender und
stärker wird.
5. Verfahren zur Veredlung von Angoraziegenfellen, so daß man aus
ihnen vorzügliche, glänzende Kamelotts herstellen kann, die nicht
reißen, wie die früheren, weil das Fell bei diesem Verfahren fast
seidenweich wird.
6. Verfahren zur vollständigen Bleichung und größeren Haltbarkeit von
Leinwand und Baumwollgespinsten.
7. Verfahren zum Färben von Häuten und Leder in Blau, Grün,
Schwarz, echtem Purpurrot, echtem Violett und feinem Grau von ganz
außerordentlicher Schönheit und Güte.
8. Herstellung von unveränderlichen Malfarben in Gelb, Rot, Blau,
Grün, Purpur, Violett usw. von vollendeter Schönheit und Güte.
9. Herstellung von Deckweiß in einer alle Begriffe übersteigender
Güte. Die Farbe, die man umsonst zu allen Zeiten gesucht hat, bleibt
stets weiß, verbindet sich mit allen guten Farben, denen man sie
beimischt, verschönert und erhält sie. Kurz, dies Weiß ist ein wahres
Wunder.
10. Herstellung von schwarzem Leder mit sehr reiner und sehr schöner
Farbe aus Russisch Blau ohne irgendeinen anderen Zusatz. Das ergibt
ein unnachahmliches schwarzes Leder von hervorragender Schönheit und
Güte.
11. Herstellung von Leinwand und Hanfgespinsten in unvergleichlich
reinem und glänzendem Gelb, das sich mit Seifenwasser waschen läßt
und in der Luft nicht verschießt, in mehreren Schattierungen.
[S. 319]
12. Herstellung von Baumwolltuchen und Gespinsten von vorzüglichem
Gelb in mehreren Schattierungen, gut waschbar und in der Luft nicht
verschießend.
13. Herstellung von Leinwand in feinem Grau, mit Seifenwasser
waschbar und nicht verschießend.
14. Herstellung von Baumwollstoffen und Gespinsten in feinem Grau,
mit Seifenwasser waschbar und nicht verschießend.
15. Herstellung von Leinwand, Leinen- und Hanfgespinsten in echtem
Purpur, echtem Violett, echtem Rot usw., gut waschbar und durchaus
nicht verschießend, in mehreren Schattierungen.
16. Herstellung von sehr feinen, sehr schönen, sehr haltbaren und
ganz neuen Seidengeweben.
17. Herstellung von bunter Leinwand in ganz neuen und feinen Farben,
namentlich in Grau und Schattierungen, die weder durch Säuren, noch
Luft, noch Seifenwasser ausbleichen.
18. Herstellung von Silbertressen, mindestens ein Drittel billiger
und viel weißer, glänzender und dauerhafter als die schönsten Lyoner
Tressen.
19. Verschiedene Verfahren bei Edelmetallen, d. h. ohne Gold
und Silber, die von großem Nutzen und großer Ersparnis sind und
sicherlich das Erstaunen jedes guten Chemikers bilden werden, auch
die ungeheuren, verderblichen Luxusausgaben verringern.
20. Herstellung eines ganz neuen Metalls, dessen Eigenschaften höchst
überraschend sind.
21. Verschiedene Verfahren bei kostbaren Gegenständen, die völlig
unmöglich erscheinen und sämtlich auf Verringerung der ungeheuren
Luxusausgaben hinauslaufen.
22. Herstellung von Papier, Federn, Elfenbein, Knochen[S. 320] und gefärbtem
Holz in prachtvollen, feinen und sehr schönen Farben.
23. Gute und heilsame physikalische Verfahren bei verschiedenen
Weinen.
24. Herstellung von Rossoli-Likör aus Fruchtkernen usw. von
vortrefflicher Qualität und zu sehr billigem Preis.
25. Herstellung anderer nützlicher Dinge, über die ich schweige.
26. Vorbeugungsmittel gegen Krankheiten und Unpäßlichkeiten aller Art
usw.
27. Richtige Purgiermittel, die dem Körper nur schädliche Stoffe
entziehen. Nota bene.
28. Echte, sichere und wohltuende kosmetische Mittel.
29. Hochfeines Olivenöl, in 12 Stunden in Deutschland hergestellt.
Was die Landwirtschaft usw. betrifft, bleibt für später vorbehalten.
L. P. T. C. von Welldone.
Über einen weiteren Punkt kann hier aus mancherlei Gründen nichts
gesagt werden. Er bleibt vorbehalten usw.
Die Ausführung dieses neuen Handelsplanes kann der Staatskunst
zu höchstem Nutzen gereichen und eine ganz unlösliche Verbindung
zwischen gewissen Großmächten herbeiführen.
von Welldone.
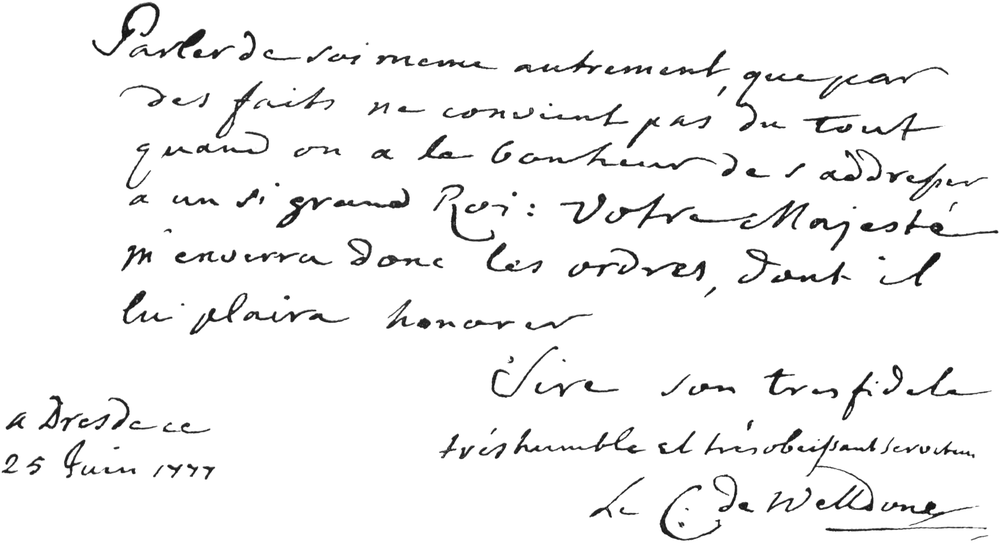
Schreiben Saint-Germains an Friedrich den Großen
Saint-Germain an König Friedrich[450]
Dresden, 25. Juni 1777.
Sire. Von sich selbst anders zu reden als durch Taten, ist durchaus
unpassend, wenn man das Glück hat, sich an einen so großen König zu
wenden. Eure Majestät[S. 321] werden mir also die Befehle schicken, mit
denen Sie mich zu beehren geruhen.
Eurer Majestät
untertänigster und gehorsamster Diener
Graf von Welldone.
König Friedrich an Alvensleben
Potsdam, 30. Juni 1777.
Ich halte es nicht für angezeigt, dem Herrn Saint-Germain auf seinen
Brief unmittelbar zu antworten. Ich ermächtige Sie daher, ihm von mir
zu sagen, es stände ihm frei, hierher zu kommen, ihn aber zugleich
darauf aufmerksam zu machen, man sei hier sehr ungläubig und glaubte
im allgemeinen nur an Dinge, die sich handgreiflich beweisen lassen.
Somit täte er gut, sich selbst zu fragen, ob er gewillt ist, seine
Wissenschaft und seine Geheimmittel vorzuführen. Sonst würde er
hier seine Zeit gewiß verlieren, während er sie anderswo vielleicht
nützlicher anwenden könnte.
König Friedrich an die Prinzessin Wilhelmine von
Oranien
(Potsdam) 30. Juni 1777.
Man droht uns mit dem Erscheinen eines Abenteurers namens
Saint-Germain, der mit Projekten, alchimistischen Rezepten,
medizinischen Geheimmitteln und Rezepten für den Stein der Weisen durch
die Welt zieht. Ich bezweifle, daß er hier sein Glück macht.
König Friedrich an Prinz
Heinrich[451]
(Potsdam) 2. Juli 1777.
Der berüchtigte Abenteurer Saint-Germain kommt hierher, um uns in
seine Obhut zu nehmen. Er will[S. 322] unser Einkommen um 6 Millionen
bereichern. Aber ich glaube, kein Mensch möchte sein Gehalt auf diese
Einnahmequelle angewiesen sehen.
(Potsdam) 9. Juli 1777.
Saint-Germain ist noch nicht angelangt. Vielleicht besinnt er sich;
denn ich habe ihn vor dem hier herrschenden Unglauben warnen lassen.
Anbei eine Denkschrift über seine Kunstfertigkeiten, die er mir
gesandt hat[452]. Könnte er Gold machen, so hätte er sich selbst
damit versorgt, aber diesen alten Köder wagt er nicht auszuwerfen.
Für uns besteht die einzige Kunst des Goldmachens in der Hebung von
Landwirtschaft und Handel, aber auch damit kommt man nicht weit;
denn die Ein- und Ausfuhrstoffe sind durch unsere Erzeugnisse und
unseren Bedarf bedingt. Somit ist es klar, daß wir es bei den jetzigen
Verhältnissen nicht so weit bringen werden wie Krösus und Montezuma.
Man kann sehr glücklich sein, ohne von Gold zu strotzen; Seelenruhe und
Frohsinn sind mehr wert als alle Schätze Perus.
Prinz Heinrich an König Friedrich
Rheinsberg, 15. Juli 1777.
Ich danke Dir, lieber Bruder, für die mir freundlich übersandte
Denkschrift mit den Wundern, die Saint-Germain zu vollbringen weiß.
Allerdings verheißt er viel; aber er weiß auch viel, muß umfassende
Studien getrieben haben und hat stets für einen Wundermann gegolten.
Daher ist wohl möglich, daß er das Geheimnis besitzt, gewisse Stoffe
auszunutzen und zu vervollkommnen. Ein Versuch mit zwei bis drei von
ihm vorgeschlagenen[S. 323] Gegenständen kann keine großen Kosten verursachen
und würde, wenn er glückt, immerhin einen beträchtlichen Gewinn
eintragen, zwar nicht die Schätze eines Krösus oder Montezuma, aber man
kann reich, ja riesig reich sein, ohne sich mit ihnen vergleichen zu
können. Den Maßstab für den Reichtum bilden die eigenen Bedürfnisse.
Wer sein Genügen findet, büßt nichts von der Heiterkeit und dem Frieden
seiner Seele ein, ja, er steigert sie noch, wenn er das Los der
Unglücklichen und Bedürftigen zu erleichtern versteht.
III
Aus den Briefen des Kurfürsten Maximilian III. Joseph von Bayern
(1727-1777)
Kurfürst Maximilian an seine Schwester, die
Kurfürstin-Witwe Maria Antonia von
Sachsen[453]
München, 27. März 1777.
Man sagt, bei Euch hielte sich ein Mensch auf, der 200 Jahre alt ist.
Schreibe mir doch, was ist wahres daran.
München, 10. April 1777.
Wenn dieser Saint-Germain wirklich 200 Jahre zählt, ohne daß er danach
aussieht, so ist er zweifellos ein Adept.
[S. 324]
IV
Aus dem Briefwechsel des Prinzen Friedrich August von
Braunschweig[454]
Dubosc[455]
an Prinz Friedrich August
Leipzig, 15. März 1777.
Im Besitz des huldvollen Schreibens Eurer Hoheit[456] hatte ich nichts
Eiligeres zu tun, als dem angeblichen Grafen Saint-Germain den Brief[456]
zu senden, mit dessen Übermittlung Eure Hoheit mich beauftragt hatten.
Ich habe der Sendung eine sehr dringende Aufforderung beigefügt,
gemäß den Wünschen Eurer Hoheit seine Abreise nach Berlin nicht
aufzuschieben. Ich hätte ihm das mündlich und nicht schriftlich sagen
müssen, aber wir haben uns entzweit, weil ich ihm gegenüber Mißtrauen
für angezeigt hielt.
Nachstehend eine kurze Darstellung unserer flüchtigen Beziehungen. Nach
einem rätselhaften Aufenthalt von etwa drei Monaten kam der jetzige
Graf Saint-Germain, der damals unter dem Namen Graf Welldone
bekannt war und geflissentlich durchblicken ließ, daß dies nur ein
Deckname für seinen wirklichen Namen Fürst Rakoczy sei, auf den
Einfall, sich mit mir anzufreunden. Ich gestehe, daß ich aus Mißtrauen
über diesen Annäherungsversuch nicht so geschmeichelt war, wie ich es[S. 325]
hätte sein sollen. Wurde er doch von einem Manne von Stand gemacht, der
angeblich das höchste Wissen besaß und nach seiner Versicherung nur zur
Bereicherung und Beglückung der Menschheit lebte. Heftig kämpfte in mir
meine Abneigung mit dem heißen Wunsche, meine Einsicht zu vergrößern
und zu berichtigen.
Unsere erste Zusammenkunft begann mit Lobeserhebungen über seine
Talente und gewaltigen Leistungen in der Chemie, über die große Rolle,
die er in Rußland gespielt hätte, über seine Teilnahme am Krieg im
Archipel[457] (den er aber gar nicht mitgemacht hat), über seinen Beruf
der Menschheitsbeglückung, über die Millionen, die er für Wohltaten
ausgegeben hätte. Schließlich wandte er sich meiner Person zu, rühmte
meine Kenntnisse, meine Rechtschaffenheit und viele andere Vorzüge.
Höchst sonderbar! Woher wußte er das wohl? Denn er kannte mich ja
gar nicht, und ich selbst erkannte mich in diesem Charakterbild
nicht wieder. Darauf zeigte er mir Seidenstoffe in allen möglichen
Farben, gewöhnliches Leder, aus dem Maroquin oder feines Leder von
verschiedener Farbe gemacht, grobes Leinen, das in spanische Leinwand
umgearbeitet war. Er sprach von seinem Geheimverfahren zur Verbesserung
von Edelsteinen und von anderen unwichtigeren Geheimmitteln.
Als ich ihn verließ, war ich überrascht von seiner Zungenfertigkeit und
Überredungskunst, aber keineswegs überzeugt. Wir sahen uns noch mehrere
Male; jede Sitzung dauerte sieben Stunden. Ich hatte Zeit genug, um
meine Zweifel zu bestärken; ich überzeugte mich, daß er keineswegs ein
Adept war. Ich sah in ihm nur einen geistvollen Mann, der viel gelesen,
gesehen und[S. 326] versucht hat, einen Mann, der ein paar Geheimmittel und
verschiedene chemische Kenntnisse besaß, ohne deswegen ein methodischer
Forscher geworden zu sein, kurz einen Mann ohne festes System. Ich
erkannte, daß er nichts weniger als Theosoph war, daß er weit entfernt
war, das unendliche All in der Gesamtheit der einzelnen Teile zu sehen
oder einen rechten Begriff von der schöpferischen Ursache aus der
Analyse der Schöpfung zu gewinnen.
Es schien mir, daß ein Mann, der nur auf der Welt ist, um sie zu
beglücken und Schätze auszuteilen, nicht in die Lage kommen kann noch
darf, daß es ihm an allem fehlt und daß er keinen Groschen hat. Ich
gebe zu, daß ein Adept in der bescheidensten Weise auftreten kann, aber
er ist nie in dringender Notlage; er prahlt nie mit seiner Einsicht
noch seiner Herkunft. Er ist, was er sein soll: schlicht, offen und
ehrlich.
Mein Roman endete schließlich, wie ich es voraussah. Er borgte mich in
Erwartung seiner Reichtümer an, ich hielt es aber nicht für angezeigt,
ihm etwas zu leihen. Damit endeten unsere Beziehungen.
Ich stellte bei ihm mehrere Widersprüche fest und noch mehr Lügen.
Jemand verlangte von ihm 4000 Gulden zurück, die er in Schwabach oder
Umgegend aus der Zeit seines dortigen Aufenthaltes noch schuldig ist.
Er machte ihm weis, daß er sie aus dem Erlös eines Wechselbriefes von
4000 Rubeln bezahlen würde, den er mir zum Verkauf übergeben hätte.
Diese Lüge hat er sich in der Zeit geleistet, wo er mich beschwor, ihm
durch ein Darlehen aus der Verlegenheit zu helfen.
Kann ein Weiser lügen? Gegenwärtig soll es mit seinen Finanzen besser
stehen; er hat einen Leichtgläubigeren gefunden, mit dem er beim
Goldmachen ist.
[S. 327]
Ich hoffe, Eure Hoheit werden diese vielen Worte entschuldigen, aber
ich glaubte, Ihnen meine Ansicht über diesen Sonderling nicht verhehlen
zu sollen.
Nachschrift. Soeben übersendet mir Saint-Germain den
beifolgenden Brief für Eure Hoheit[458].
Bischoffwerder[459]
an Prinz Friedrich August
Elsterwerda, 25. März 1777.
Ich gestehe, daß ich zu wenig aufgeklärt bin, um ein Urteil über
einen Mann wie Herrn von Saint-Germain zu haben. Aber ich will Ihnen
gehorchen und Ihnen frei meine Gedanken über den Brief des Bruders
Dubosc[460] und den des Grafen Welldone[458] aussprechen.
Obwohl man von jenem sagen kann: Ecce vere Israelita, in quo dolus
non est[461], glaube ich doch (aus Erfahrung), daß er in seinem
Urteil über sehr achtbare Personen recht vorschnell ist. Der Vorwurf
einer Lüge bedarf stichhaltiger Beweise; zudem muß er wissen, daß die
größten Kenntnisse mit Armut sehr wohl vereinbar, ja bisweilen (durch
das Gesetz) von ihr nicht zu trennen sind. Man kann ungeheure Schätze
austeilen und doch davor zurückscheuen, eine sehr mäßige Summe aus
Laune auszugeben. Der Bruder Dubosc muß aus den Berichten aller, die
Herrn von Saint-Germain seit lange kennen, doch wohl wissen, daß er
oft in die Lage gekommen[S. 328] ist, sich Geld zu borgen, aber daß er es
durch Anweisung beträchtlicher Summen stets ehrlich zurückgezahlt
hat. Kurz, es macht den Eindruck, als ob der Bruder Dubosc durch das
Darlehnsgesuch des Grafen von Welldone verblüfft worden ist und in
diesem Augenblick alles in falschem Licht gesehen hat.
Andrerseits ist der Brief des Grafen Welldone nicht anders, als man von
einem Kenner des T[462] erwarten kann. Ich sehe daher nicht die
mindeste Gefahr darin, daß Sie seine Bekanntschaft machen, zumal wenn
Sie, wie ich überzeugt bin, nichts verlangen, was mit der Moral und mit
dem Berufe[463], zu dem er sich in seinem Briefe bekennt, nicht völlig
im Einklang steht, und wenn Sie die Anknüpfung besonderer Beziehungen
bis zu dem Zeitpunkt hinausschieben werden, den er Ihnen angibt und den
die Guten zum Ruhm Gottes herbeiwünschen.
Frölich[464]
an Prinz Friedrich August
Görlitz, 28. März 1777.
Von Saint-Germain werden Ihro Durchlaucht in der Maurerei keine
Aufschlüsse bekommen. Dieser Mann ist in Leipzig eine geraume Zeit
unter dem Namen Sieur Welldone gewesen. Ich habe bei Dubosc mit
ihm gegessen. Ich kenne ihn sehr speziell. Dieser Sieur Welldone
ist kein Maurer; er ist auch kein Magus, auch kein Theosoph. Seine
Rolle wird in Leipzig traurig ablaufen, wenn er nicht einen gutherzigen
Freund kürzlich gefunden, der[S. 329] ihm Geld vorschießt. Ich melde solches
Ihrer Durchlaucht als Maurer, damit (er), wenn er nach Berlin kommt,
sich nicht auf eben diese Weise zu remboursieren sucht.
Dubosc an Prinz Friedrich August
Leipzig, 2. April 1777.
Da Eure Hoheit anscheinend Interesse an dem angeblichen Grafen
Saint-Germain nehmen und ihn sogar mit der Einladung nach Berlin beehrt
haben, halte ich mich für verpflichtet, Eurer Hoheit zu berichten,
was nach und nach über die Vorgeschichte dieses rätselhaften Mannes
zutage kommt. Wie man sagt, ist er in Frankreich geboren, von niederer
Herkunft und soll ein Handwerk gelernt haben. Folgendes weiß ich
aber positiv von einem meiner Freunde, einem verdienstvollen Mann,
einem Schweizer Offizier, Namens Hotz, der als Oberstleutnant in
der Garde des russischen Großfürsten steht[465] und zur Zeit in
Familienangelegenheiten hier weilt. Wie er mir versichert, hat er
unseren Saint-Germain unterwegs in Rußland getroffen, wie er traurig zu
Fuß des Weges zog. Wegen eines Fußschadens schleppte er sich nur mühsam
weiter. Voll Mitleid ließ ihn der Offizier in seinen Wagen steigen.
Er muß in Moskau oder Umgegend ein[S. 330] Fabrikunternehmen gehabt haben,
das aber nicht gehen wollte. Er hatte das Glück, den Grafen Orlow[466]
kennen zu lernen, mit dem er eine Weile chemische Versuche anstellte,
aber schließlich hatte der Graf diese fruchtlose und kostspielige
Arbeit satt und entließ ihn. Von den Wohltaten dieses Herrn hat er
lange Zeit sein Leben gefristet. Seitdem hat er sich in mehreren
Gegenden Deutschlands herumgetrieben, wie die Schulden beweisen, die er
namentlich in der Gegend von Schwabach gemacht hat. Hier ging sogar ein
von ihm ausgestellter und nicht bezahlter Wechselbrief eines Ansbacher
Juden in Höhe von 20000 Gulden ein.
Gegenwärtig erfahre ich, daß er den Brief Eurer Hoheit[467] überall
herumzeigt und zum Lesen gibt. Er erzählt jedermann, man bestürme ihn
allerorten, zu kommen und der Welt seine erhabenen Kenntnisse nicht
vorzuenthalten. So spielt er einen gegen den anderen aus. Verzeihen
Eure Hoheit, daß ich solche Geschichten berichte. Aber sie tragen dazu
bei, den Betrüger zu entlarven. Ich wollte schließen, vergaß aber
noch eine bezeichnende Anekdote. Gestern war ich in einem Hause, in
dem ein Ring gezeigt wurde, den er einem seiner hiesigen Beschützer
geschenkt hat. Es war ein ziemlich großer gelber Stein, der Feuer
besaß. Als er ihn verschenkte, betonte er, daß es ein gelber Diamant
sei, und schätzte ihn auf mindestens 1000 Taler. Ein anwesender
Juwelier und großer Kenner prüfte den Ring und sagte: „Ei gewiß, dieser
Stein kann wohl acht Groschen wert sein.“ Das scheint mir ein recht
charakteristischer Zug für ihn.
[S. 331]
Bischoffwerder an Prinz Friedrich August
5. April 1777.
Alles, was ich bezüglich des Grafen Welldone hinzufügen kann, ist,
daß er nicht P[rior] Cler[icorum] ist, und daß ich Ihnen trotz der
Beweise seines Wissens nicht anraten möchte, ihm Briefe zu schreiben,
die nicht öffentlich gezeigt werden können. Eine kurze Unterredung mit
den Maurern, die ich in Leipzig antreffen werde, soll dies Geheimnis
lichten.
Dubosc an Prinz Friedrich August
Leipzig, 12. April 1777.
Auf Befehl Eurer Hoheit will ich mit dem angeblichen Saint-Germain
sprechen. Hoffentlich macht meine Vorhaltung mehr Eindruck, als ich
erwarte. Der Mann weiß sich nicht besser ins Licht zu setzen, als
dadurch, daß er mit geheimnisvoller Miene Briefe vorzeigt, deren Inhalt
einen hohen Begriff von ihm geben kann. Derart gelingt es ihm, für
einen Wundermann zu gelten.
Hat man recht viele Anekdoten aus seinem Leben gehört und vergleicht
man sie miteinander, so kommt man allmählich hinter seine Schliche. Ich
möchte jetzt wetten, daß er jüdischer Abstammung ist. Er ist eine Weile
in einer Kattunfabrik in Moskau gewesen, weil er Farben herstellt,
worin er nach seiner Behauptung große Kenntnisse besitzt. Da er sich
dort nicht zu halten vermochte, scheint das Gegenteil bewiesen. Hält
man diesen Umstand mit der Zeit seiner Reise nach Rußland zusammen,
so ergibt sich, daß es derselbe Fremde ist, mit dem einer meiner
Freunde[468], ein höchst kenntnisreicher Mann, die Reise nach Moskau
teilweise gemacht hat. Das stimmt sowohl mit der Zeit, wie mit den
Talenten, deren er sich[S. 332] rühmte, und der Schilderung, die mein Freund
von ihm gemacht hat. Hier erzählt er immerfort, er sei am russischen
Hofe wohlbekannt und sehr beliebt und habe dort eine große Rolle
gespielt. Das alles beweist zum mindesten, daß er stark aufschneidet.
Gestern unterhielt ich mich sehr lange mit einem meiner Freunde, einem
großen Steinschneider, der auf alles, was darauf Bezug hat, sehr
erpicht ist. Er kennt unseren Sonderling gut, weiß über ihn Bescheid
und hat sich nach seinem Geheimverfahren zur Herstellung wie zur
Verbesserung von Edelsteinen erkundigt. Wie er mir beteuerte, kann
Saint-Germain keine Edelsteine herstellen noch fehlerhafte Diamanten
verbessern und vervollkommnen. Das Verfahren, dessen er sich rühmt,
kann sich höchstens auf Topase oder Halbedelsteine beziehen; er hat
einen Versuch mit braunen Topasen gemacht, und zwar mit Erfolg; sie
sind ganz weiß geworden. Mein Freund hat den Versuch mit Diamanten
mehrfach wiederholt, aber vergeblich; das Mittel blieb völlig
wirkungslos.
Die einzigen Steine, die Saint-Germain besitzt und die er sehr hoch
veranschlagt, stammen aus einem Bergwerk, das er in Rußland entdeckt
hat und das er nach seiner Behauptung ausbeuten darf. Er macht
erstaunlichen Lärm darüber und möchte den Leuten weismachen, daß sich
daraus ein sehr ertragreicher Handelszweig machen ließe. Man hat
ihm jedoch bewiesen, daß dazu keine Aussicht ist; denn diese Steine
bestehen aus einer Kristallart, die zwar sehr hart ist, aber weit unter
den Topasen steht, da sie weder deren Schönheit noch Glanz haben. Sie
sind wie die Kieselsteine, die man bei uns und anderswo findet.
Es ist sehr wohl möglich, daß Herr von Sagramoso[469] ihn in Florenz,
Pisa und Venedig gesehen hat, denn er hat[S. 333] sich tatsächlich in Italien
herumgetrieben. Aber bei aller schuldigen Hochachtung vor der Einsicht
des Herrn von Sagramoso kann ich nicht so günstig von ihm denken wie
dieser. Sonst müßte er sich seither gewaltig verändert haben. Aber
warum soll ein Mensch sich zum Schlechteren verändern? Auf diese Weise
behauptet man weder seinen Ruf noch erwirbt man Anhänger. Ich bleibe
also bei meiner Ansicht: Er ist einschmeichelnd, geschmeidig, er redet
allen nach dem Munde, aber wehe dem, der auf ihn hereinfällt! Graf
Orlow kann ein Lied davon singen[470]. Ob Saint-Germain schon einmal in
Dresden war, bezweifle ich; niemand hat ihn dort gesehen. Er redet von
so vielen Städten, aber von Dresden sagt er kein Wort. Auch hier muß
ich mich über Herrn von Sagramoso wundern.
Saint-Germain ist noch hier; er hat sich nicht gerührt. Graf Marcolini,
der eigens hergekommen ist, um mit ihm zu sprechen und ihn nach Dresden
mitzunehmen[471], falls er mit ihm zufrieden wäre, ist schleunigst
wieder abgereist und hat ihn hier gelassen. Das beweist nicht gerade,
daß er befriedigt war. Trotzdem muß Herr von Sagramoso, der den Grafen
Marcolini begleitete, von Saint-Germain eine hohe Meinung gehabt haben.
Dieser lebt hier weiter im Dunkeln und macht einige Bekanntschaften,
aber es dauert nie lange; man überwirft sich sehr bald mit ihm.
Herzog Karl von Kurland[472]
an Prinz Friedrich August
Dresden, 22. April 1777.
Bruder B[ischoffwerder] ist diese Nacht nach Leipzig abgereist, wo er
rechnet, die Bekanntschaft des seltsamen[S. 334] Mannes zu machen, der sich
seit einigen Monaten in Leipzig aufhält und über dessen Kenntnisse wir
noch im unklaren sind.
Bischoffwerder an Prinz Friedrich August
Dresden, 2. Mai 1777.
Eure Hoheit werden durch den Bruder Decker die Gründe erfahren haben,
aus denen Graf Welldone Ihren Brief gezeigt hat[473].
Frölich an Prinz Friedrich August
Görlitz, 7. Mai 1777.
Saint-Germain befindet sich noch in Leipzig, und man ist immer weniger
attent auf ihn, da alle Hoffnung wegfällt, daß er nur im geringsten in
der Maurerei Kenntnis hat.
Saint-Germain an Prinz Friedrich
August[474]
Leipzig, 8. Mai 1777.
Eure Hoheit wollen gestatten, daß ich Ihnen mein Herz öffne. Es blutet,
seit der Herr Rat Dubosc mir in einer für mich peinlichen Form die
Befehle zukommen ließ, mit denen Sie ihn seiner Angabe zufolge beehrt
haben. Sie galten aber sicherlich nicht mir. Herr Baron von Wurmb[475]
und Herr Baron von Bischoffwerder werden stets für mich rühmliches
Zeugnis ablegen, daß mein Schritt voller Berechtigung und Redlichkeit
war, daß meine Ehrerbietung und meine eifrige und treue Hingabe, die
ich für alle Zeit Eurer Hoheit gelobt habe, ihn mir unumgänglich[S. 335]
geboten, obwohl ich zunächst voll Zartgefühl meinen Beweggrund
verschweigen wollte. Nach Möglichkeit will ich hier die Abwicklung
meiner ebenso wichtigen wie unerläßlichen Geschäfte beschleunigen, um
alsbald die unaussprechliche Freude zu haben, Ihnen meine Aufwartung
zu machen. Unvergleichlicher Fürst, wenn ich erst die Ehre habe, Ihnen
genau bekannt zu sein, verspreche ich mir von Ihrer Gerechtigkeit
und Ihrem Scharfblick zuversichtlich alles, was mir zukommt und was
mir, da von Ihnen kommend, lieb und wert sein wird. Ich bin aus
Pflicht, Neigung und ehrerbietiger, treuer Hingebung Eurer Hoheit
ehrerbietigster und gehorsamster Diener
Graf Welldone.
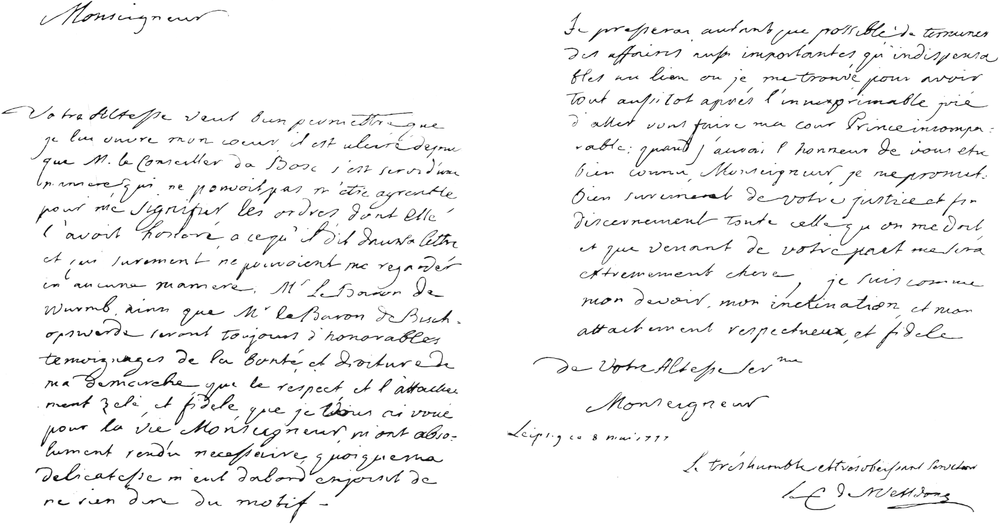
Schreiben Saint-Germains an Prinz Friedrich August
von Braunschweig
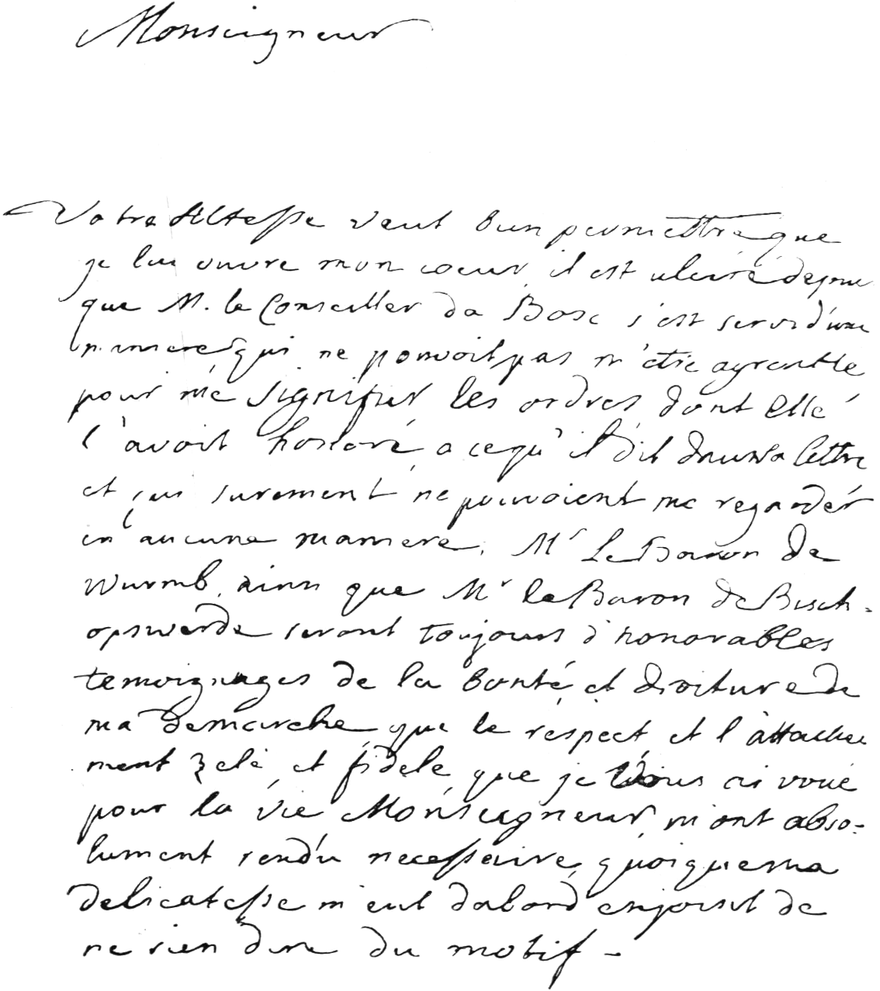
Schreiben an Friedrich August von Braunschweig;
linke Seite
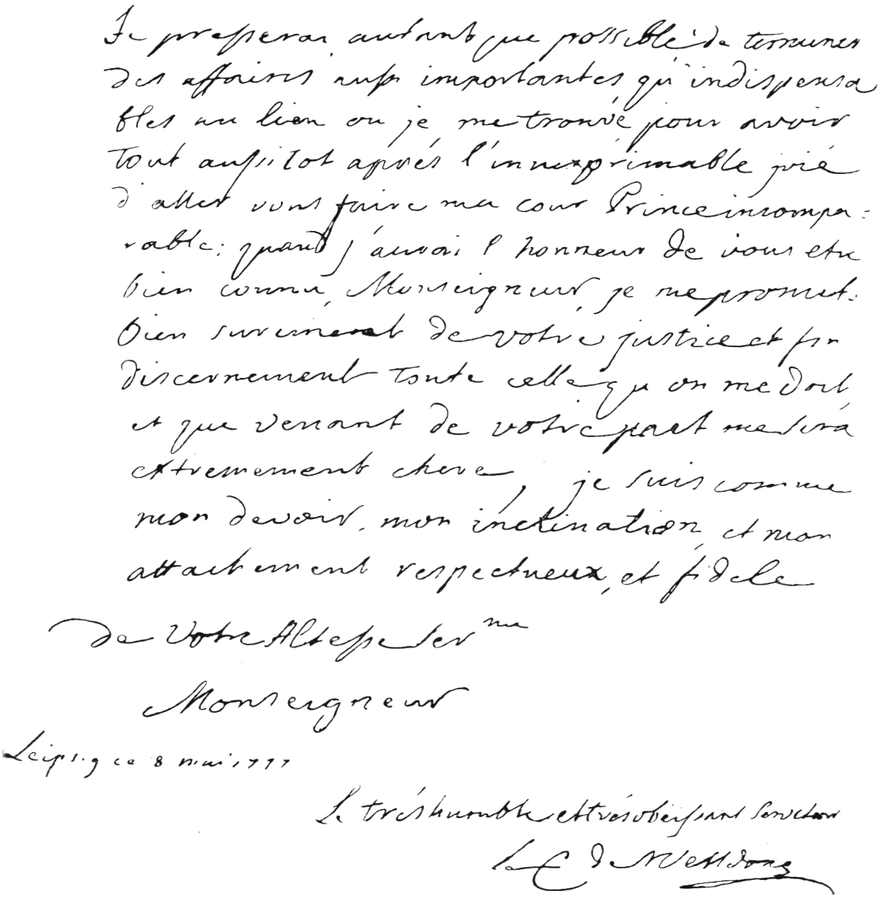
Schreiben an Friedrich August von Braunschweig;
rechte Seite
Minister von Wurmb[476]
an Prinz Friedrich August
Dresden, 19. Mai 1777.
Ich habe meinen vierzehntägigen Aufenthalt in Leipzig benutzt, um dem
berühmten Saint-Germain, der sich jetzt Graf Welldone nennt,
den Puls zu fühlen. Auf meine Bitte ist er sogar auf einige Zeit
hergekommen. Da er, wie ich weiß, es einigen nachträgt, daß sie ihn
durchaus zum Wundermann machen wollten, habe ich das Gegenteil getan
und ihn als gewöhnlichen Menschen behandelt, dessen chemische und
physikalische Kenntnisse meine Neugier erregt haben.
Ich fand einen Mann von 60 bis 70 Jahren, sehr lebhaft für sein
Alter. Er spottet über die, welche ihm ein außerordentliches Alter
zuschreiben. Er macht zwar keineswegs den Eindruck eines Neugeborenen,
hat aber bei seiner geregelten Lebensweise und den guten Medizinen, die
er[S. 336] angeblich besitzt, starken Anspruch darauf, noch lange zu leben.
Trotz alledem sieht er äußerlich nicht so aus, als ob er es noch lange
triebe. Man kann nicht leugnen, daß er schöne Kenntnisse besitzt. Ich
werde mit ihm an einigen Artikeln der Färberei und der Verarbeitung von
Wolle und Leinen arbeiten, um zu sehen, ob sich für unsere Manufakturen
etwas herausschlagen läßt. Was mir mißfällt, ist, daß er oft von
Millionen spricht, während er weit entfernt ist, darüber zu verfügen,
und anscheinend nicht einmal Gold zu machen versteht.
Nachdem ich sein Vertrauen gewonnen hatte, brachte ich das Gespräch
auf die Freimaurerei. Ohne Eifer noch selbst besondere Aufmerksamkeit
für die Sache gestand er mir, er sei im vierten Grade, entsänne sich
aber der Zeichen nicht mehr. Daher konnte ich nicht näher mit ihm
darauf eingehen; denn er bewies durch nichts irgendwelche Kenntnisse
des Systems der strikten Observanz. Schließlich bekundete er selbst
Neugier über die Angelegenheit Schrepfers[477], und als ich ihm so viel
davon sagte, als ich sagen konnte, tischte er mir eine Geschichte auf,
die ihm in Paris begegnet war. Dort hatten eine Gesellschaft von etwa
200 Personen, an deren Spitze der blöde Herzog von Bouillon stand, und
ein paar Damen, die für das System des Grafen Gabalis[478] schwärmten,
seine Bekanntschaft zu machen gesucht, weil sie ihn für einen Oberen
hielten. Aus alledem glaube ich zu schließen, daß[S. 337] er entweder sich
sehr verstellt oder keiner der Unsrigen ist. Letzteres halte ich für
wahrscheinlicher, zumal er in Dingen der Religion und der Philosophie
ein nackter Materialist ist.
Bischoffwerder an Prinz Friedrich August
Elsterwerda, 9. Juli 1777.
Graf Welldone ist tatsächlich keiner der Unsrigen. Aber wenn er
wirkliche Geheimnisse besitzt, so bin ich im Besitz des wichtigsten.
Obgleich es gegen alle Regeln der Wahrscheinlichkeit ist:
1. daß die Sache überhaupt möglich ist,
2. daß ich zum Träger eines so reichen Arkanums bestimmt bin,
3. daß ich es als Novize empfangen habe, will ich doch mein Urteil von
heute ab auf 14 Tage hinausschieben, wo kein Zweifel über die Sache
mehr möglich sein wird. Nur Ihnen vertraue ich es an und werde ich
sagen, was daran ist. Wäre es wohl eine Prüfung neuer Art? Denn es
scheint mir bedenklich, daß ein so kostbares Arkanum mir durch die Hand
eines Laien, eines Atheisten, angeboten wird.
Elsterwerda, 16. September 1777.
Die Versuche, die ich mit den mir von Saint-Germain mitgeteilten
Geheimverfahren angestellt habe, sind von erstaunlicher Wirkung. Stets
unter der mindesten Bedingung meines Ehrenwortes, zu schweigen; ich
begreife bis heute nicht, warum ich ihr Träger geworden bin.
[S. 338]
SAINT-GERMAIN IN
BERLIN[479]
I
Aus den „Erinnerungen“
Thiébaults[480]
Ein ungewöhnlicher Mann, in der Welt als Graf Saint-Germain bekannt,
kam nach Berlin und blieb dort über ein Jahr. Der Abbé Pernety[481]
besuchte ihn als Adept sofort und erzählte uns Wunderdinge von ihm.
Der Graf war ein Greis, dessen Alter und Heimat unbekannt war. Er war
indes noch sehr rüstig, obgleich[S. 339] etwas beleibt. Wie man sagte, besaß
er das Geheimnis, Gold zu machen, ja sogar Diamanten. Er lebte — was
weit wichtiger ist — seit ich weiß nicht wieviel hundert Jahren. Er
war der ewige Jude, etwas ganz Wunderbares, zumal er alle europäischen
Sprachen beherrschte. Saint-Germain nahm ein paar Zimmer in einem der
ersten Gasthöfe Berlins. Er lebte dort sehr zurückgezogen, hatte zwei
Diener und einen Mietswagen, der den ganzen Tag vor der Tür stand. Er
bezahlte ihn gut, benutzte ihn aber nie.
Der alte Freiherr von Knyphausen[482] besuchte ihn sogleich als alten
Bekannten und lud ihn dringend ein, bei ihm zu speisen. „Gern,“ sagte
Saint-Germain, „aber nur, wenn Sie mir Ihren Wagen schicken. Ich kann
keine Mietswagen brauchen; sie hängen zu schlecht in den Riemen.“
Bemerkenswert ist, daß der Unbekannte den Freiherrn immer nur „mein
Sohn“ anredete.
Die Prinzessin Amalie[483] wollte ihn sehen, und er stellte sich
pünktlich ein. Sie fragte ihn, aus welchem Lande er sei.
„Ich bin aus einem Lande,“ entgegnete er, „das nie Ausländer zu
Herrschern gehabt hat.“
In dieser geschickten, rätselhaften Art beantwortete er alle Fragen
Ihrer Königlichen Hoheit, die zuletzt ganz sprachlos war und ihn
verabschiedete, ohne etwas von ihm erfahren zu haben.
Auch Frau du Troussel[484] wollte ihn sehen. Der Abbé Pernety spielte
den Vermittler bei dieser Staatsaktion, und eines Abends kam der Graf
zu ihr und speiste bei ihr. Man brachte das Gespräch auf den Stein der
Weisen. Er[S. 340] bemerkte jedoch nur, die, welche sich damit beschäftigten,
begingen zumeist eine wunderliche Torheit, indem sie nur das Feuer als
Hauptelement in Anwendung brächten. Sie bedächten aber nicht, daß das
Feuer auflöst und zerteilt und daß es somit widersinnig sei, mit Feuer
zu arbeiten, wo es sich um eine neue Zusammensetzung handle. Hierüber
redete er lang und breit und ging dann zu alltäglicheren Dingen über.
Er hatte feine, durchgeistigte Züge; man sah ihm den Mann aus guter
Familie und von guter Erziehung an. Er soll der Lehrmeister des
berüchtigten Cagliostro gewesen sein[485], der bekanntlich in Paris
den Kardinal von Rohan[486] und so viele andere zum besten gehabt hat.
Aber der Schüler konnte sich in keiner Weise mit dem Lehrer messen. Hat
sich dieser doch bis zu seinem Tode ohne irgendein peinliches Abenteuer
behauptet, wogegen der dreistere Cagliostro oft alles aufs Spiel
gesetzt und seine Laufbahn in den Kerkern der römischen Inquisition
beschlossen hat, ein trauriges, aber viel zu mildes Schicksal.
Die Geschichte des Grafen Saint-Germain zeigt einen klügeren
und vorsichtigeren Abenteurer und nichts, was gegen die Ehre im
eigentlichen Sinne verstößt. Nichts ist unredlich, alles wunderbar,
nirgends Niedertracht und Ärgernis. Wenn es wahr ist, daß er Damen, die
bei dem Trauerspiel „Mariamne“ weinten, gesagt hat: „Wie wäre es erst,
meine Damen, hätten Sie sie wie ich gekannt, hätten Sie gesehen, wie
liebenswürdig, reizvoll und schön sie war[487]!“ — wenn es wahr ist,
daß er vom Leiden Jesu Christi gesagt hat: „Es war seine eigene Schuld;
ich hatte es ihm vorhergesagt, daß er ein schlimmes Ende nehmen[S. 341]
würde, wenn er seine Ziele nicht änderte“, — so sind das lächerliche
Redensarten, aber im Sinne der Gesellschaftsordnung keine Verbrechen.
Als jener seltsame Mann in Berlin weilte, wagte ich eines Tages, mit
dem französischen Gesandten, Herrn von Pons Saint-Maurice[488], über
ihn zu reden. Insbesondere drückte ich mein Erstaunen über seine
besonderen, nahen Beziehungen zu hochstehenden Personen aus, z. B. zum
Kardinal de Bernis[489], von dem er vertrauliche Briefe aus der Zeit
haben sollte, wo dieser Minister des Auswärtigen war. Der Gesandte ließ
sich darüber nicht aus, brachte dann aber Mutmaßungen vor, die recht
wahrscheinlich klangen.
„Ich nehme an,“ sagte er zu mir, „daß ein wirklich eigenartiger Mensch
den Entschluß faßt, sich ein außerordentliches Schicksal zu zimmern
und in der Welt eine Rolle zu spielen, die Erstaunen und allgemeines
Aufsehen erregt. Ich nehme an, daß dieser Mann, einzig von dieser
Vorstellung beherrscht und sich ihr ganz widmend, Geist besitzt,
Kenntnisse erwirbt, auf alle Umstände ein scharfes Augenmerk hat und
noch mehr Beharrlichkeit in der Ausführung seines Planes zeigt. Ich
nehme besonders an, daß er seine Absichten in den Schleier tiefster
Verschwiegenheit zu hüllen versteht und daß es ihm im Bedarfsfalle nie
an Geistesgegenwart und Geschmeidigkeit fehlt. Ich nehme schließlich
an, daß er ein beträchtliches Vermögen geerbt oder erworben hat,
etwa 20000 Franken festes Einkommen. Wie wird ein solcher Mann sich
nun benehmen? Er wird weder von seinem Alter noch von seiner Heimat,
Familie und Person offen sprechen; er wird sich in den tiefsten
Schleier des Geheimnisses hüllen, seine[S. 342] Einkünfte für ein paar Jahre
zurücklegen und dadurch ein Kapital erübrigen, das er sicheren und
bekannten Bankhäusern anvertraut. Wenn er nach Berlin kommt, wird er
seine Gelder z. B. in Leipzig haben. Ein Berliner Bankhaus wird den
Auftrag erhalten, ihm 20000 Franken oder mehr auszuzahlen. Er wird
sie abheben und sie an ein Bankhaus in Hamburg senden, das sie ihm
dann zurückschickt. Das gleiche Spiel wird er mit einigen Frankfurter
Bankhäusern und in anderen Städten spielen; aber es wird stets das
gleiche Kapital sein, bei dem er nur einige Prozente verliert, und er
wird seinen Zweck erreichen; denn man erfährt, daß er allwöchentlich
beträchtliche Summen von überall erhält, und wird nicht erfahren, was
er damit macht, zumal wenn er wenig ausgibt und sich auf keinerlei
Geschäfte einläßt. Alle anderen Wunderdinge, die man von solchen
rätselhaften Unbekannten erzählt, lassen sich ebenso leicht natürlich
erklären, wie die Gelder, die der Graf Saint-Germain so häufig erhält,
obwohl er so wenig ausgibt.“
II
Aus Zimmermanns „Fragmenten über Friedrich
den Großen“[490]
Madame du Troussel[491] hatte Zufälle, die man in Berlin für unheilbar
hielt; deswegen begab sie sich in die Kur des berühmten Grafen von
Saint-Germain. Dieser heilte[S. 343] sie aus dem Grunde, und sie zeigte
jedermann einen Stein von der Größe eines Hühnereies, der ihr von
Saint-Germain abgetrieben sei. Dennoch war das Berlinische Publikum
argwöhnisch genug, zu glauben, was auch höchstwahrscheinlich ist:
Saint-Germain habe sie bloß von einem Nachlasse ihrer Liebe für den
schändlichen Bischof von Breslau[492] geheilt. Zwei Jahre nachher starb
diese nicht unberühmte Berlinische Dame an einem hitzigen Fieber.
III
Graf Saint-Germain[493]
Dieser vor zwei Jahren im Dänisch-Holsteinischen verstorbene Abenteurer
war ein würdiges Gegenstück des verstorbenen Grafen Cagliostro[494].
Auch er fand Bewunderer und Anhänger in Menge, und in welchem Tone
ward er bewundert! Eben itzt bekomme ich einen großen Kupferstich[495]
zu Gesichte, worin er mit einer unbedeutenden vornehmen Hofmannsmiene
in einem prachtvollen Pelzkleide zu sehen ist, und worunter höchst
merkwürdige Verse stehen, die mir eine Anzeige zu verdienen[S. 344] scheinen,
um die Denkungsart solcher Menschen bekannt zu machen, die sich nicht
schämen, von Zeit zu Zeit dergleichen Dinge in die Welt zu streuen.
Ich habe sehr wohl gewußt, daß viele Hohe und Niedere sich von diesem
Menschen betören ließen, der weder öffentliche noch geheime wahre
Künste und Wissenschaften besaß, obgleich er das Geheimnis verstand,
viele glaubend zu machen, daß er ein Wundertäter sei; ein Geheimnis,
das itzt so öffentlich, und man kann hinzusetzen, so plump getrieben
wird, daß man nachgerade einsieht, wie leicht es ist, sobald nämlich
nur jemand mit seinem Gewissen fertig wird, um alle Mittel zu seinem
Zwecke anzuwenden.
Dieser Mensch, der mancherlei, aber nicht das geringste gründlich
verstand, den in Dresden und Berlin kein gescheiter Mann achtete,
der nicht die gemeinste Kenntnis von dem, was große Gelehrte in den
wichtigsten Fächern geleistet haben, besaß, der nie etwas wirklich
Gutes oder Schönes zustande gebracht hat, der nichts ordentlich
gelernt hatte, sondern statt des schweren Studierens die leichtere
Mühe magischer Zauberworte anwenden wollte: dieser Mensch war dreist
genug, zu verstehn zu geben, daß er alles wisse und alles könne. Und
er fand, leider! selbst unter den deutschen Fürsten manche, die ihm
glaubten. Er sollte nicht bloß ein großer Tonkünstler sein, sondern
die Geige so spielen, als wenn man drei Geigen zugleich hörte[496],
und er spielte seine eine höchst mittelmäßig. Er sollte nicht bloß
Leder und Wolle verbessern, sondern auch Diamanten von ihren Flecken
reinigen und sogar mehrere zusammenschmelzen können, obgleich alle, die
ihm in den erstern leichtern Künsten trauten, mit ihrem Schaden seine
eitlen Versprechungen[S. 345] erfahren haben und die letztern schwerern Stücke
niemals ein Mensch gesehen hat. Er sollte Gold machen können; doch wer
kann das anitzt nicht? Er verstand, verjüngende oder gar unsterblich
machende Arzeneien, namentlich ein gewisses Salz, zu verfertigen, so
daß erdigte Teile dem aus Erde gebaueten Menschen ein überirdisches Los
zusicherten. Er kaufte Häuser und Landgüter, ohne sie zu bezahlen, und
man bewunderte, wo er das Geld dazu herbekäme usw.
Alles dies weiß ich sehr wohl. Auch weiß ich, daß er sogar dann noch
Glauben fand, wenn er teils durch andere sagen ließ, teils wie aus
Übereilung selbst zu verstehen gab, teils geradezu erklärte: er sei
ganz ungemein alt; welches aber, nach Beschaffenheit der Umstände, sehr
verschieden angegeben ward. Bald hatte er nur mit Kaiser Leopold[497]
noch Briefe gewechselt, bald schon mit dem Adepten aus der Gold-
und Rosenkreuzergesellschaft, Federico Gualdo[498][*], von dessen
Kindheit an in Freundschaft gelebt, bald gar unserem Herrn Christus
allerlei Rat in Absicht seines Verhaltens gegeben[**]. Ich weiß sogar,[S. 346]
daß manche itzt noch, da er gestorben ist, glauben: er lebe und
werde bald lebendig hervorgehn! Da er doch wirklich mausetot ist und
wahrscheinlich itzt schon fault und stinkt, wie ein ganz gemeiner
Mensch, der keine Wunder verrichten kann, und den nie ein Prinz begrüßt
hat, auch tun würde.
Obgleich ich alles dies wußte, so hatte ich doch nie glauben können,
daß man die unsinnige Verehrung eines solchen Menschen so weit treiben
könnte, als ich es auf dem erwähnten Kupferstiche fand. Hier ist die
ganze lobpreisende Unterschrift desselben:
Graf Saint-Germain,
berühmter Alchimist.
Prometheus gleich raubt’ er vom Himmelszelt
Die Lebensflamme, die das All erhält;
Natur folgt seinem Wort, von ihm gemeistert;
Ist er nicht Gott, hat ihn ein Gott begeistert
[499].
Wer hätte glauben sollen, daß in unseren Tagen der Name Alchimist
ein im Ernst gegebener Ehrenname sein könnte! Übrigens verdient der
freilich ein berühmter Alchimist zu heißen, dessen Stimme die Natur
gehorcht und auf dessen Ruf sie sich bewegt. Die Natur! Weiß man, was
man sagt, wenn man solche Worte gebraucht? Aber die letzte Zeile, die
letzte Zeile!
„Ist er nicht Gott, hat ihn ein Gott begeistert!“
Der bedingende Ausdruck des Gedankens im Vordersatze nimmt denselben
offenbar als vielleicht wirklich und als zuverlässig möglich an. Und
welchen Gedanken!
[S. 347]
Ich bin gewiß weder intolerant noch verketzernd, ich brauche nicht
gern harte Worte und starke Beschuldigungen, wo noch lachender Spott
hingehören kann; aber ich würde fürchten, mich des Namens eines
Gottesverehrers unwürdig zu machen, wenn ich hier nicht ernsthaft und
anklagend sagte: daß dieser schändliche Ausdruck eine der rasendsten
Blasphemien enthält, deren sich je der verirrte menschliche Verstand
schuldig gemacht hat. Gesetzt auch, dieser Mensch wäre so weise und
einsichtsvoll gewesen, als er töricht und unwissend war, so edel,
groß und bescheiden, als er kindisch, eitel und prahlerisch, so
erhaben gesinnt, als er eigennützig, so offen und wahrhaft, als er
ränkevoll und betrügerisch war usw. — so müßte doch jeder Mensch
davor zurückbeben, diese Worte, die ich mich schäme, noch einmal
hinzuschreiben, von ihm zu gebrauchen. Klarer, plumper Atheismus,
der itzt wieder laut zu werden anfängt, ist minder schädlich und
gefährlich als solch eine Menschenvergötterung. Traurig genug, wenn
ich unter Mitbürgern leben sollte, die den erhabensten Gedanken nie
gedacht hätten, die keinen Begriff von dem allgemeinen Vater der Natur
und aller Menschen hätten, bei deren Moralität ich mich bloß auf ihr
Gefühl oder die Furcht vor Strafen verlassen müßte! Aber tausendmal
willkommen sei mir ihre Gesellschaft gegen solche Leute, die es für
möglich, für denkbar halten können: daß ein schwacher Mensch, wie ich
und sie, die ganze Natur regiere, daß ein beschränktes Wesen die Kraft
in Händen habe, wodurch alles lebt und wodurch die Welt existiert,
und daß dieser Mensch folglich den uneingeschränktesten Gehorsam,
die unwiderstehlichste Befolgung in allen seinen Befehlen und wahre
göttliche Verehrung verdiene! Ich schaudere, wenn ich mir vorstelle,
wohin dies in Absicht der gesunden Vernunft, des[S. 348] Gewissens und der
Regeln menschlicher Handlungen führen müßte.
Und wer braucht diesen Ausdruck? Nicht etwa barbarische Kamtschadalen,
deren roher Verstand sich einen Gott gebildet hat, den der schmutzigste
Erdensohn übertrifft, und die folglich einen Taschenspieler leicht
vergöttern könnten. Nein, kultivierte Europäer tun es, deren Begriffe
reiner sein müssen, und die wissen, daß der angestrengteste Verstand
sich umsonst bemüht, einen Schatten von den großen Eigenschaften
der Gottheit sich lebhaft zu denken, wenn er auch das Erhabenste,
was seit Jahrtausenden die Welt kannte, in seiner Vorstellungskraft
zusammensetzt. Noch mehr, die einzig fromm und rechtgläubig sein
wollenden Christen tun es! Denn dieselben Menschen, die der
Geisterseherei, der Goldmacherei und allen verworfenen Träumereien
von geheimen Kräften der Natur und von itzigen Wundern anhängen, die
den Vorspiegelungen eines Cagliostro, eines Saint-Germain, eines
Schrepfer[500], eines Güldenfalk[501], eines Plumenoek[502] usw.
Glauben beimessen, die im „Mystère de la Croix“ und im Buche
„De l’erreur et de la vérité“[503] menschenbeglückende Weisheit
suchen: eben diese sind es ja, die sich der höchsten Reinheit der
Glaubenslehre rühmen und immer Frömmigkeit und echtes Christentum im
Munde führen. Sie wissen ja so höhnend von Theologen[S. 349] nach der neuen
Art, von Spöttern der Religion usw. zu reden, wenn denkende Köpfe die
Kraft ihres Verstandes und ihren Untersuchungsgeist auch auf wahrhaft
wichtige Dinge anwenden und dadurch zu Begriffen gelangen, die freilich
von dem gerade itzt im Schwange gehenden System abweichen, die aber
näher zur Sache zu treffen scheinen und schon von tausend frommen und
rechtschaffenen Christen in mehreren Jahrhunderten auch gedacht wurden,
wovon freilich diese Menschen von gestern her nichts wissen, deren
Mangel an Sach- und Sprachkenntnis, Unwissenheit in der Geschichte,
Bequemlichkeit im Nachbeten, Unvermögen im Selbstdenken und Aberglauben
in williger Annehmung der abgeschmacktesten Behauptungen nur noch von
ihrer hartherzigen Verdammungslust übertroffen wird. Diese sich selbst
so nennende wahre reine Christen machen sich dann solcher Blasphemien
schuldig, die den Grund aller Religion, aller Moralität und Tugend,
alles Menschenverstandes und gesunder Vernunft untergraben! Dahin,
dahin führt endlich der Weg dieser betrügerischen Heuchler, denen kein
Deckmantel, auch der der christlichen Religion nicht, zu heilig ist!
**
*
Der bekannte Berliner Schriftsteller und Verleger Friedrich
Nicolai (1732-1811) schreibt ähnlich[504]:
„Saint-Germain ward für einen Gott ausgegeben und erregte die
Aufmerksamkeit vieler Fürsten und anderer gar nicht geistloser Köpfe.“
[S. 350]
SAINT-GERMAIN IN
HAMBURG (1778)
Dresser
an Baron Uffel[505]
Hamburg, 23. Oktober 1778.
Jetzt muß ich Ew. Hochwürden von einem besonderen Phänomen Nachricht
geben. Ein sich nennender Graf Saint-Germain, der seine Abkunft nicht
bekannt machen will, logiert hier in dem Wirtshause: Kaiserhof. Er
führt großen Staat; es fehlt ihm nicht an Geld; er bezahlt alles
comptant, erhält gleichwohl keine Rimessen[506]. Er schreibt
Nacht und Tag, hat Correspondance mit den größesten gekrönten
Häuptern, frequentiert außer der Gräfin Bentinck[507] und dem
französischen Herrn Minister[508] nicht gern Gesellschaft. Seine
Connaissance zu erlangen hält schwer. Er ist ein Liebhaber der
Naturgeschichte, hat die Natur studiert und den dadurch erlangten
Kenntnissen es zu verdanken, daß er jetzt 182 Jahr alt ist und so jung[S. 351]
aussieht, wie ein Mann von 40 Jahr. Im engsten Vertrauen hat er einem
Freunde von mir gesagt, daß er gewisse Tropfen besäße, wodurch er das
alles, auch transmutationem metallorum[509] pp. bewirkte. In
seiner Gegenwart hat er einen kupferreichen Gulden durch einige Tropfen
in das feinste Silber, schlechtes Leder in das beste englische Leder
und böhmische Steine in Diamanten verwandelt. Dabei ist er beständig
vor sich, communiciert sich nicht leicht jemand, hat Überfluß an allen
Sorten Gold und silbernen Münzen, die aussehen, als wenn sie erst aus
der Münze kamen. Hat sich neulich ein ganz komplettes, silbernes,
modernes Tafel-Service nach dem Modell, welches die Frau Gräfin
Bentinck hat, machen lassen und sogleich baar in neuen vollwichtigen
Dukaten bezahlt. Und doch erhält er von niemand Rimessen und ist auch
an keinen Kaufmann adressiert. Wie geht das zu? Sollte der Mann wohl
einer von denen sein, die wir bisher suchen?
Ich gebe mir alle Mühe, mit ihm auf eine gute Art bekannt zu werden;
denn Zudringlichkeit würde schaden. Ein hier durchgereister dänischer
Legationsrat hat den Mann in Paris, London und Haag gekannt und mir
versichert, daß er daselbst ebenso, wie hier, sich verhalten hätte;
daß er allenthalben bei Hofe gewesen und besondere Distinctions
genossen hätte; daß man demohngeachtet nie seine wahre Abkunft habe
erfahren können. Von der russischen Kaiserin[510], von der Prinzessin
Amalia in Berlin[511] empfängt er fast posttäglich Briefe. Unsere
Herren Ministers hier machen ihm die Cour, aber er familiarisiert
sich nicht mit ihnen, sondern schreibt beständig und noch[S. 352] dazu im
Dunkeln. Seine Bediente wissen nichts von ihm; er schafft sie ab,
sowie er einen Ort verläßt. Nur einen Kammerdiener hat er bei sich,
den der Legationsrat, mein Freund, schon in Paris, London und Haag bei
ihm gesehen. Sollten Ew. Hochwürden mir etwas davon zur Aufklärung
mitteilen können, so werde ich alles wagen, um den Mann näher zu
entdecken.

Karl Prinz von Hessen
Stich von Jos. Esaja Nilson
[S. 353]
SAINT-GERMAIN IN
SCHLESWIG UND ECKERNFÖRDE (1779-1784)
I
Aus den
„Denkwürdigkeiten“ des Prinzen Karl von Hessen-Kassel[512]
Bei meiner Rückkehr aus Berlin und Hanau sah ich in Altona[513] den
berüchtigten Grafen Saint-Germain, welcher mir seine Freundschaft
zuzuwenden schien, besonders als er hörte, daß ich kein Jäger sei und
auch keine anderen Liebhabereien habe, welche dem Studium der höheren
Naturwissenschaften hinderlich sind. Er sagte mir damals: „Ich werde
Sie in Schleswig besuchen, und Sie sollen sehen, was wir zusammen für
große Dinge ausrichten werden.“ Ich gab ihm zu verstehen, daß ich viele
Gründe hätte, die Gunst, die er mir erweisen wolle, für den Augenblick
nicht anzunehmen. Er entgegnete: „Ich weiß, daß ich zu Ihnen kommen
muß, und ich muß Sie sprechen.“ Ich wußte kein anderes[S. 354] Mittel, um den
Erörterungen auszuweichen, als ihm zu sagen, der Oberst Koeppern[514],
welcher krank zurückgeblieben war, würde mir in einigen Tagen folgen
und er möchte mit diesem darüber reden. Dann schrieb ich an Koeppern
einen Brief, um ihm zu sagen, er möchte sein Möglichstes tun, um
dem Grafen Saint-Germain zuvorzukommen und ihm, soviel als möglich,
abzuraten, hierher zu kommen. Koeppern kam nach Altona und sprach mit
ihm, aber der Graf antwortete ihm: „Sie können sagen, was Sie wollen,
ich muß nach Schleswig gehen und werde nicht davon abstehen. Das Übrige
wird sich finden. Sie werden Sorge tragen, mir dort eine Wohnung bereit
zu halten usw.“ Koeppern teilte mir dies Ergebnis ihrer Unterhaltung
mit, welches ich nicht billigen konnte.
Ich hatte übrigens bei der preußischen Armee[515] viele Erkundigungen
über diesen ungewöhnlichen Mann eingezogen und hatte besonders mit
meinem Freund, dem Obersten Frankenberg, über ihn gesprochen. Dieser
sagte mir: „Sie können überzeugt sein, daß er kein Betrüger ist, und
daß er große Kenntnisse besitzt. Er war in Dresden, als ich mit meiner
Frau dort war. Er wollte uns Beiden wohl. Meine Frau wollte ein Paar
Ohrgehänge verkaufen; ein Juwelier bot ihr eine Kleinigkeit dafür. Sie
sprach in Gegenwart des Grafen davon, welcher zu ihr sagte: ‚Wollen
Sie sie mir zeigen?’ Was sie auch tat. Dann sagte er: ‚Wollen Sie mir
dieselben für einige Tage anvertrauen?’ Er gab sie ihr zurück, nachdem
er sie verschönert hatte. Der Juwelier, welchem sie meine Frau[S. 355] darauf
zeigte, sagte: ‚Das sind schöne Steine; die sind ganz anders als die,
welche Sie mir früher zeigten!’ und er bezahlte mehr als das Doppelte
dafür.“
Saint-Germain kam bald darauf nach Schleswig. Er sprach mit mir von
großen Dingen, welche er zum Besten der Menschheit tun wolle usw. Ich
hatte keine Lust dazu, aber zuletzt machte ich mir ein Gewissen daraus,
Kenntnisse, die in jeder Hinsicht wichtig waren, auf Grund einer
vermeintlichen Weisheit oder aus Geiz zurückzuweisen, und ich wurde
sein Schüler.
Er sprach viel von der Verschönerung der Farben, welche fast nichts
kostete, von der Verbesserung der Metalle, indem er hinzufügte, daß
man durchaus kein Gold machen müsse, selbst wenn man es verstände,
und diesem Grundsatz blieb er unbedingt treu. Die Edelsteine kosten
den Einkaufspreis; aber wenn man ihre Verbesserung versteht, so wird
ihr Wert unendlich gesteigert. Es gibt fast nichts in der Natur, was
er nicht zu verbessern und nützlich zu machen verstand. Er vertraute
mir fast alle seine Kenntnisse von der Natur der Dinge an, aber nur
die Anfangsgründe, und ließ mich dann durch Versuche die Mittel zu
Erreichung des Zwecks selbst suchen und freute sich ungemein über meine
Fortschritte. So machte er es in Bezug auf die Metalle und die Steine;
aber die Farben teilte er mir wirklich mit, sowie einige andere sehr
wichtige Kenntnisse.
Man wird vielleicht neugierig sein, seine Geschichte kennen zu lernen,
und ich will sie durchaus wahrheitsgetreu mit seinen eigenen Worten
wiedergeben und nur die nötigen Erklärungen hinzufügen.
Wie er mir erzählte, war er 88 Jahre alt, als er hierher kam, und er
starb in einem Alter von 92 oder 93. Er sagte mir, er sei der Sohn des
Fürsten Rakoczy von Siebenbürgen[S. 356] und dessen erster Gattin,
einer Tököly[516]. Er wurde unter den Schutz des letzten Medici[517]
gestellt, der ihn als Kind in seinem eigenen Zimmer schlafen ließ.
Als er hörte, daß seine beiden Brüder, Söhne der Prinzessin von
Hessen-Rheinfels oder Rotenburg, wenn ich mich nicht irre, sich dem
Kaiser Karl VI. unterworfen und nach dem Kaiser und der Kaiserin[518]
die Namen San Carlo und Santa Elisabetta erhalten
hätten, sagte er zu sich selbst: „Gut, dann will ich mich Sanctus
Germanus, den heiligen Bruder, nennen[519].“
Ich kann allerdings seine Herkunft nicht verbürgen; aber daß er von dem
letzten Medici außerordentlich begünstigt wurde, das habe ich auch von
anderer Seite gehört. Dieses Haus war, wie bekannt, in den höchsten
Wissenschaften bewandert, und es ist nicht zu verwundern, daß er dort
seine ersten Kenntnisse schöpfte. Aber er behauptete, die Kräfte der
Natur durch seinen eigenen Fleiß und seine Untersuchungen erforscht
zu haben. Er kannte die Kräuter und Pflanzen aus dem Grunde und hatte
Arzneien erfunden, deren er sich ständig bediente, und welche sein
Leben und seine Gesundheit verlängerten. Ich habe noch alle seine
Rezepte, aber nach seinem Tode eiferten die Ärzte sehr heftig gegen
seine Wissenschaft.[S. 357] Wir hatten einen Arzt Lossau, welcher Apotheker
gewesen war, und dem ich jährlich 1200 Taler gab, um die Arzneien
zuzubereiten, welche der Graf Saint-Germain ihm vorschrieb, unter
anderen und vorzugsweise seinen Tee, den die Reichen gegen Bezahlung
und die Armen umsonst erhielten. Letztere genossen auch die Pflege
dieses Arztes, welcher eine Menge Leute heilte und welchem meines
Wissens niemand starb. Aber nach dem Tode desselben ward ich der
Äußerungen müde, die ich von allen Seiten zu hören bekam, nahm alle
meine Rezepte zurück und ersetzte Lossau nicht wieder.
Die Farbenfabrik wollte Saint-Germain hier im Lande gründen. Die
des verstorbenen Otte[520] in Eckernförde stand leer und verlassen.
Ich hatte somit Gelegenheit, diese Gebäude vor der Stadt billig zu
kaufen, und setzte den Grafen Saint-Germain dorthin. Auch kaufte ich
Seidenzeuge, Leinen usw. Außerdem waren vielerlei Gerätschaften zu
einer solchen Fabrik erforderlich. Ich sah dort nach der Art, wie ich
es gelernt und in einer Tasse selbst versucht hatte, 15 Pfund Seide in
einem großen Kessel färben. Das gelang vollkommen. Man kann also nicht
sagen, daß es im Großen nicht gehe.
Das Unglück wollte, daß der Graf Saint-Germain, als er nach Eckernförde
kam, unten in einem feuchten Zimmer wohnte, wo er einen sehr starken
Rheumatismus bekam, von welchem er sich trotz aller seiner Heilmittel
nie wieder ganz erholte.
Ich besuchte ihn oft in Eckernförde und kehrte nie ohne neue höchst
interessante Belehrungen zurück, da ich mir häufig die Fragen
aufschrieb, welche ich ihm vorlegen wollte. In seiner letzten
Lebenszeit fand ich ihn[S. 358] eines Tages sehr krank und, wie er glaubte,
auf dem Punkte zu sterben. Er schwand zusehends dahin. Nachdem ich in
seinem Schlafzimmer das Mittagessen eingenommen hatte, mußte ich mich
allein vor sein Bett setzen, und er sprach dann viel rückhaltsloser
über viele Dinge, sagte mir vieles voraus und ersuchte mich, so bald
wie möglich wiederzukommen, was ich auch tat. Indes fand ich ihn bei
meiner Rückkehr weniger krank, dafür aber desto schweigsamer. Als ich
1783 nach Kassel ging, sagte er mir, daß ich, im Fall er während meiner
Abwesenheit sterben sollte, ein versiegeltes Billet von seiner Hand
finden würde, welches mir genügen werde. Aber dieses Billet fand sich
nicht; vielleicht hatte er es ungetreuen Händen anvertraut. Oftmals bin
ich in ihn gedrungen, mir noch während seines Lebens das mitzuteilen,
was er mir in diesem Billet hinterlassen wollte. Dann ward er traurig
und rief: „Ach, wie unglücklich würde ich sein, mein lieber Prinz, wenn
ich zu sprechen wagte!“
Er war vielleicht einer der größten Weltweisen, welche je gelebt haben.
Er liebte die Menschheit; Geld verlangte er nur, um es den Armen zu
geben. Er liebte selbst die Tiere, und sein Herz beschäftigte sich nur
mit dem Glück anderer. Er glaubte, die Welt dadurch zu beglücken, daß
er ihr zu billigeren Preisen neue Vergnügungen, schönere Stoffe und
schönere Farben verschaffte; denn seine herrlichen Farben kosteten
fast nichts. Ich habe nie einen Mann von klarerem Geiste gesehen, und
dabei besaß er eine Gelehrsamkeit, besonders in der Geschichte, wie ich
selten gefunden habe.
Er war in allen Ländern Europas gewesen, und ich kenne fast keines, wo
er sich nicht längere Zeit aufgehalten hätte. Er kannte sie alle von
Grund aus. In Konstantinopel[S. 359] und in der Türkei war er oft gewesen.
Frankreich schien jedoch das Land zu sein, welches er am meisten
liebte. Er wurde Ludwig XV. bei der Frau von Pompadour vorgestellt und
nahm auch an den kleinen Soupers des Königs teil. Ludwig XV. hatte viel
Vertrauen zu ihm. Er benutzte ihn unter der Hand, um einen Frieden mit
England zu unterhandeln, und schickte ihn nach dem Haag[521]. Es war
die Gewohnheit Ludwigs XV., ohne Vorwissen seiner Minister Emissäre zu
benutzen, die er jedoch im Stiche ließ, sobald sie entdeckt wurden.
Der Herzog von Choiseul hatte von seinen Umtrieben Kunde erhalten
und wollte ihn festnehmen lassen. Er flüchtete aber noch bei Zeiten.
Er vertauschte nun den Namen Saint-Germain mit dem eines Grafen
Welldone.
Seine philosophischen Grundsätze über Religion waren der reine
Materialismus, den er aber so scharfsinnig vorzutragen wußte, daß es
schwer war, ihm siegreiche Beweise entgegenzustellen; aber ich hatte
öfters das Glück, die Mängel der seinigen darzutun. Er war nichts
weniger als ein Verehrer Christi, und da er sich in Bezug auf diesen
Äußerungen erlaubte, die mir unangenehm waren, so sagte ich zu ihm:
„Mein lieber Graf, es hängt von Ihnen ab, ob Sie an Jesus Christus
glauben wollen oder nicht; aber ich gestehe Ihnen offen, daß Sie
mir vielen Kummer verursachen, wenn Sie bei mir gegen Den sprechen,
welchem ich so gänzlich ergeben bin.“ Er blieb einen Augenblick
nachdenklich und antwortete: „Jesus Christus ist Nichts; aber Ihnen
Kummer verursachen, das ist Etwas. Also verspreche ich Ihnen, nie
wieder darüber mit Ihnen zu reden.“ Auf seinem Sterbebette, während
meiner Abwesenheit, trug er eines Tages Lossau auf, mir, wenn ich von
Kassel zurückkäme, zu sagen,[S. 360] daß Gott ihm die Gnade erwiesen habe, ihn
seine Ansicht noch vor seinem Tode ändern zu lassen, und fügte hinzu,
er wisse, wieviel Freude mir das machen und daß ich noch viel für sein
Glück in einer anderen Welt tun werde.
II
Prinz Karl von
Hessen an Prinz Christian von Hessen-Darmstadt[522]
17. April 1825.
Was Saint-Germain betrifft, so bin ich der einzige, dem er sich
anvertraut hat. Er war der größte Geist, den ich kannte. Er starb bei
vollem Verstande in Eckernförde. Ich war damals in Kassel. Er ließ mir
durch seinen Arzt[523], der ein eingeweihter Bruder war, sagen, er
stürbe im Glauben an Jesus Christus; das würde mich freuen. Wir haben
viel zusammen über Religion gesprochen, aber er war nichts weniger als
ängstlich.
III
Prinz Ferdinand von Braunschweig an Prinz Friedrich August von
Braunschweig[524]
Middelfort, jenseit des Kleinen Beltes, 2. November 1779.
Ich habe die Bekanntschaft des Grafen Saint-Germain gemacht und bin
davon sehr befriedigt. Dreimal war ich
[S. 361]bei ihm. Er hat große
Kenntnisse in der Erforschung der Natur erworben ... Seine Kenntnisse
sind sehr ausgedehnt, und seine Unterhaltung ist denkbar lehrreich.

Christianspflegehaus in Eckernförde
IV
Aus Briefen des Grafen
Warnstedt[525]
Schleswig, 24. November 1779.
Wir haben hier auch den berüchtigten Abenteurer Saint-Germain. Er
ist der kompletteste Charlatan, Narr, Schwätzer, Windbeutel und in
gewisser Hinsicht Gauner, der seit lange gelebt hat. Unser Prinz[526]
schätzt und ehrt ihn nach besten Kräften und ganzem Herzen. Er folgt
darin seiner angeborenen Neigung für Leute dieses Schlages. Er nimmt
täglich drei Stunden Unterricht bei ihm. Hoffentlich wird sein Leibarzt
sich mit guten Mitteln versehen, um all die Winde zu vertreiben, mit
denen Seine Hoheit sich zur Zeit so zuversichtlich vollpumpt. Dieser
Saint-Germain mag trotz seiner allgemeinen Menschenliebe die Stadt
Kopenhagen nicht leiden und wird sie nicht besuchen. Der Schlüssel des
Rätsels liegt darin, daß Graf Bernstorff ihn vor langen Jahren in Paris
als das erkannt hat, was er ist[527].
Schleswig, 11. Dezember 1779.
Ich verbrachte zwei Abende bei dem berüchtigten Saint-Germain. Ich bin
so sicher wie von meinem Dasein überzeugt, daß er ein Abenteurer und
ein Charlatan in jedem Belange ist. Zudem besitzt er eine glühende
Einbildungskraft[S. 362] und betrügt sich daher vielleicht manchmal selbst,
wie er andere betrügt. Er ist voller Geist und Kenntnisse — wahrer
und falscher —, aber noch weit mehr erfüllt von Dünkel, Hochmut
und maßloser, seltener Eigenliebe. Eine Religion hat er wohl nicht;
er ist ein Materialist, ein zweiter La Mettrie[528]. Ich halte ihn,
nach seinem Aussehen und seiner unsicheren Sprechweise zu schließen,
unbedingt für einen portugiesischen oder spanischen Juden. Der Prinz
macht sich mit diesem Manne unglaublich lächerlich. Er behauptet, nur
86 Jahre alt zu sein. Übrigens ist es unrecht von mir, schlecht von ihm
zu reden; denn er liebt mich sehr.
V
Friedrich der
Große an die Königin-Witwe Juliane von Dänemark[529]
Potsdam, 16. Oktober 1784.
Der Prinz von Hessen wird nach Kopenhagen reisen, um seine Tochter[530]
mit dem Kronprinzen zu vermählen und, wenn er kann, Dänemark zu
beherrschen. Er hat den Schwindler Saint-Germain verloren, und zum
Trost dafür wird man ihn allmählich in die Staatsgeschäfte einführen.
[S. 363]
SAINT-GERMAINS TOD
IN ECKERNFÖRDE
I
Aus dem
„Totenregister“ der St. Nikolaikirche in Eckernförde[531]
„Gestorben am 27. Februar 1784. Am 2. März der sich so nennende Graf
von St. Germain und Welldone — weitere Nachrichten sind
nicht bekannt worden — in hiesiger Kirche still[532] beigesetzt.“
II
Aus den
„Einnahmen an Begräbnißöffnung und Vestegeldern“[533]
„1783[534], 1. März, den allhie verstorbenen Grafen von St. Germain
eine Begräbniß-Stelle in der hiesigen St. Nikolai-Kirche in das
Begräbniß sub Nr. 1 auf 30 Jahr Verwesungs-Zeit: 10 Rthlr., und
für Eröffnung desselben: 2 Rthlr. — zus[ammen]: 12 Rthlr.“
[S. 364]
III
Aus dem Verzeichnis der
„Glockengelder“[535]
„Der Herr Graf von St. Germain d[en] 2. März in der Kirche
beigesetzt morgens ... 12 Mark.“
IV
Aufruf von Bürgermeister und Rat der Stadt Eckernförde[536]
Wir, Bürgermeister und Rat der Stadt Eckernförde, fügen allen, so daran
gelegen, hiedurch zu wissen:
Demnach der auswärts sowohl als hieselbst unter dem Namen Comte de
Saint-Germain und Welldone bekannte und sich in den letzten
4 Jahren in hiesigen Landen aufgehaltene Herr Graf von Saint-Germain
ohnlängst hieselbst zu Eckernförde Todes verfahren, dessen Nachlaß
unter gerichtlicher Versiegelung genommen und es nötig gefunden
worden, sowohl an seine etwanige Intestaterben, inmaßen von einem
nachgelassenen Testamente bis hiezu nichts constiret[537], als
an dessen etwanige Gläubiger ein öffentliches Proclama, diese
Erbrechte und Forderungen gehörig anzugeben und zugleich in einem
gewissen Termin zu rechtfertigen, ergehen zu lassen, —
als befehlen wir hiedurch allen und jeden, welche an den Nachlaß
des obgedachten, hieselbst verstorbenen, sich genannten Grafen
von Saint-Germain und Welldone einige, zu Recht bestehende
Praetensiones[538] und Ansprüche, dieselben rühren her vel
ex capite hereditatis, vel debiti,[S. 365] vel alio quocungue capite vel
causa[539] sie immer wollen, zu haben vermeinen, hiemit ein
für allemal und sub poena praeclusi[540], daß sie solche
samt und sonders, und zwar die Einheimischen innerhalb 6, die
Auswärtigen aber innerhalb 12 Wochen a die publicationis[541],
im hiesigen Stadt-Secretariat rechtsbehörig angeben, die in Händen
habende Documenta und Beweistümer in originali
produciren, beglaubte Abschriften davon beim Protocollo
zurücklassen, auch die unter hiesigem Foro[542] nicht
Angesessenen Procuratores[543] ad Acta bestellen, mit
der ausdrücklichen Commination[544] und Verwarnung, daß
diejenigen, welche solches in den praefigirten[545] 6 und
12 Wochen zu thun verabsäumen, nach deren Ablauf nicht weiter
gehöret, vielmehr praecludiret[546] und ihnen dann als itzt,
und itzt als dann, perpetuum silentium[547] imponiret sein
solle. Inmaßen dann auch zu Justificirung dieser Angaben
sämtliche Profitentes[548] hiedurch ein für allemal und also
peremtorie[549] citiret und verobladet werden, am 14. October
dieses Jahres coram Magistratu[550] zu erscheinen, ihre Angaben
gehörig zu justificiren und nach vorkommenden Umständen und
Beschaffenheit des Nachlasses rechtliche Verfügung und Erkenntnis,
eventualiter der Erstigkeit halber, zu gewärtigen. Wornach sich
ein jeder, dem daran gelegen, zu achten und für Schaden zu hüten hat.
Signatum Eckernförde, den 3. April 1784.
Bürgermeister und Rat hieselbst.
[S. 366]
V
Nachruf des Professors
Remer in den „Neuen Braunschweigischen Nachrichten“
In dem 56. Stück der „Nachrichten“ vom 6. April 1784 heißt es: „Der
große Chemiker Macquer[551] ist in Paris im vorigen Monate gestorben,
wie auch in demselben der bekannte marktschreierische Herumstreicher
der Graf von Saint-Germain.“
In dem 59. Stück vom 12. April steht der folgende Widerruf[552]:
Niederelbe, den 9. April 1784.
„Der Graf von Saint-Germain, dessen Tod in diesen Blättern erwähnt
ist, verdient die beleidigenden Beiwörter keinesweges, deren man sich
dabei von ihm bediente. Er hatte Eigenheiten, die aber bei einem
Genie fast jedes Mal gefunden werden. Personen, die ihn genau gekannt
haben, und deren Urteil nicht zweifelhaft ist, geben ihm das Zeugnis,
daß er ein Mann von tiefen Einsichten in die Geheimnisse der Natur
war, der das, was er wußte, bis ans Ende seines Lebens mit großer
Tätigkeit zum Wohl der Menschheit anwandte. Große und einsichtsvolle
Prinzen haben ihn ihrer Gewogenheit und ihres Schutzes[S. 367] gewürdigt.
Als er schon vom Schlage gerührt war, so blieb er sich noch stets
selbst bewußt und ertrug die Führung des großen Urhebers des
Ganzen mit einer besonders hervorleuchtenden und Beispiel gebenden
Unterwürfigkeit. Er starb den 24.[553] Februar.“
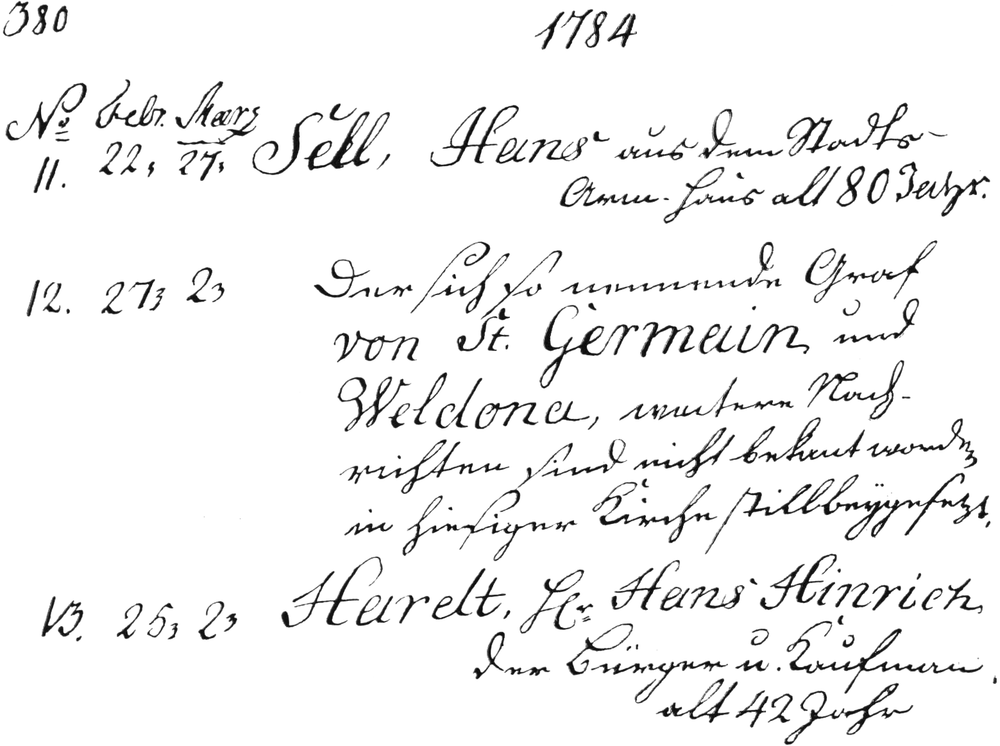
Kirchenbuch von Eckernförde. Saint-Germains Tod
[S. 368]
PERSONENVERZEICHNIS[554]
- A
- Adhémar, Gräfin 43.
- Affry 16, 18, 19, 21, 55, 62, 63, 144-161, 164-171, 173, 176-179,
181, 182, 184-190, 195, 197-205, 207, 209, 210, 212-215, 217, 218,
221, 222, 231, 236.
- Aladin 48.
- Alfarache 139.
- Alkibiades 106.
- Alvensleben 8, 10, 21, 30, 38, 39, 306-321.
- Angiviller 143.
- Anhalt-Zerbst:
- Johanna Elisabeth, Fürstin 61.
- Anna, die heilige 51.
- Ansbach-Bayreuth:
- Alexander, Markgraf 28, 29, 38, 40, 57, 288-300, 302, 303.
- Karoline, Markgräfin 57, 290, 291, 295.
- Antinous 106.
- Aspasia 105.
- Astier 144, 151, 158.
- Aulnery 96.
- B
- Baba, Nabob 65, 66.
- Baden:
- Karl Friedrich, Markgraf 27, 279, 280, 314.
- Barbieri 227, 259.
- Barre 63.
- Bause 304.
- Bayern:
- Maximilian III. Joseph, Kurfürst 323.
- Bellegarde 107.
- Belle-Isle 17, 19, 54-56, 107, 145, 151, 152, 154, 171-173, 175, 180,
181, 185, 187, 194, 199, 200, 208, 210, 213, 214, 236, 299.
- Bentinck, Graf, Willem, Herr van Rhoon 17, 18, 146-150, 156-159,
162-170, 188, 192, 200, 201, 203, 204, 213-215, 223, 236.
- Bentinck, Gräfin, Charlotte Sophie 350, 351.
- Bernis 130, 176, 341.
- Bernstorff 143, 361.
- Berryer 173.
- Bertin 145, 146.
- Bertuch 87.
- Biester 343.
- Bischoffwerder 36, 327, 328, 331, 333, 334, 337.
- Boas 159.
- Bode 110.
- Boissy 312.
- Bouillon, Herzog 336.
- Bourbon, Ludwig von 83.
- Brancas, Herzogin 130.
- Braunschweig-Wolfenbüttel:
- Ferdinand, Prinz 360, 361, 366.
- Friedrich August, Prinz 36, 324-337, 360.
- Ludwig, Prinz 16, 55, 151, 152, 189, 196, 197, 201, 202.
- Breteuil 95.
- Brionne, Gräfin 92.
- Brühl 150.
- Bute 65.
- Byland, Frau von 168.
- C
- Caesar 89, 90, 106.
- Cagliostro, Graf, Alexander 35, 36, 39, 68, 100-109, 340, 343, 348.
- Cagliostro, Gräfin, Lorenza 35, 100-107.
- Campan, Frau 87.
- del Carpio 84.
- Casanova 13, 32, 33, 39, 122-126, 284-287.
- Catalani 8, 126, 306.
- Cea 192.
- Chartier 97.
- Chastellux, Claude, Marschall 95-97.
- Chastellux, Graf, Johann III. 96.
- Chastellux, Graf, Philipp II. 97.
- Chastellux, Graf 95-97.
- Chastellux, Gräfin, Alix 96.
- Chaudon 224.
- Choiseul, Herzog, Franz Stephan 16-19, 21, 53-56, 144-160, 162-165,
169, 173, 176, 178-181, 184-188, 190-193, 195, 199, 200, 214,
215, 217, 221, 222, 231, 236, 299, 359.
- Choiseul, Herzogin, Luise Honorine 53, 54.
- Christus (Jesus Christus) 10, 41, 50, 85, 87, 92, 304, 306, 340, 341,
345, 359, 360.
- Chute 120.
- Cicero 60.
- Clairon, Hippolyte 28, 289-291.
- Clermont 17, 19, 180, 181, 186, 187.
- Clive 13, 64.
- Cobenzl, Graf, Karl, Minister 22, 24, 26, 27, 38, 39, 225-283, 285.
- Cobenzl, Graf, Philipp 250, 280-284.
- Collet 141, 142.
- Corberon 32, 85.
- Crammon 163.
- Craon 97-99.
- Craven, Lady 41, 89, 90.
- Créquy, Antoine, Kardinal 92-94.
- Créquy, Marquise 10, 42, 91-99.
- D
- Dänemark:
- Christian VII., König 74.
- Friedrich (VI.), Kronprinz 75, 362.
- Juliane, Königin 362.
- Sophie, Kronprinzessin 75, 362.
- Danican 83.
- Danneskjold-Laurwigen 219, 220.
- Decker 334.
- Dejan 289.
- Demosthenes 106.
- Dick 296, 302.
- Dorn 241-245, 249.
- Dresser 37, 350-352.
- Dubosc 22, 36, 324-334.
- E
- Edelsheim 17, 216, 217.
- Elisabeth, die heilige 51.
- England:
- Heinrich VIII., König 49.
- Georg II., König 65, 163, 170, 174-178, 181, 196, 216, 217.
- Friedrich Ludwig, Prinz von Wales 65, 66, 120, 223.
- Friedrich, Herzog von York 59.
- F
- Fagel 152, 156, 165.
- Faustina 106.
- Figaro 300.
- Flamel, Nicolas 97.
- Flamel, Perronelle 97.
- Fleury 94.
- Francolet 227, 259.
- Frankenberg 354, 355.
- Frankreich:
- Karl VI., König 96.
- Franz I., König 49, 126, 127.
- Franz II., König 127.
- Karl IX., König 127.
- Heinrich III., König 127.
- Ludwig XV., König 14, 19, 38, 48, 54-56, 60, 63, 83, 89, 121,
123-126, 128-130, 139-141, 147-149, 151-156, 158-163, 167, 171-173,
175-180, 182, 183, 185, 187, 191, 194, 198, 207-210, 212,
213, 216-219, 229, 231, 235, 299, 359.
- Ludwig, Dauphin 173.
- Maria Stuart, Königin 127.
- Margarete von Valois, Königin 127.
- Maria Antoinette, Königin 42.
- Frölich 36, 328, 329, 334.
- G
- Gabalis 336.
- Gedicke 343.
- Geelvinck, Frau 168.
- Gemmingen 7, 21, 28, 29, 31, 41, 288-303.
- Genlis, Gräfin 30, 41, 70-75.
- Gergy, Gräfin 11, 51, 122, 128.
- Gleichen 10, 19-22, 39, 40, 42, 47-58, 220, 291, 294, 299, 301.
- Golizyn 210, 211.
- Golowkin 16, 150-152, 184, 188, 201.
- Gontaut 129, 130, 132.
- Gouffier 86.
- Gower 10, 50.
- Graff 304.
- Granville 163.
- Greiner 289, 301.
- Grimm 35.
- Gronsfeld-Diepenbroek 223, 236.
- Grosley 9, 40, 42, 76-84.
- Gualdo 345.
- Guarini 292.
- Güldenfalk 348.
- Guzman: siehe Alfarache.
- H
- Hardenbroek 9, 22, 40, 222-224.
- Hasselaar 168, 223, 236, 277.
- du Hausset, Madame 7, 14, 32, 33, 126-239.
- Hellen 14, 139-141, 182-189, 197.
- Herodes der Große, Vierfürst 86, 92.
- Hessen-Darmstadt:
- Christian, Prinz 360.
- Hessen-Kassel:
- Wilhelm IX., Landgraf 58.
- Friedrich, Prinz 58.
- Karl, Prinz 8, 11, 28, 30, 32, 35, 38, 58, 74, 75, 88, 90, 110,
111, 143, 353-362.
- Sophie, Prinzessin: siehe unter Dänemark.
- Holdernesse 153, 170-181, 194-196.
- Hompesch 149, 150.
- Hope, Gebrüder 20, 147, 149, 151, 168, 182, 197, 210.
- Hotz 23, 329, 331, 332.
- Huldashop 211.
- I (J)
- Jacoby, Fräulein 98.
- Johannes der Täufer 89.
- Johannes, Apostel 90.
- Irene, Kaiserin 106.
- K
- Kauderbach 20, 150, 156, 157, 159, 206-215.
- Kaunitz 24, 25, 27, 31, 196-206, 215, 225-280.
- Keith 287.
- Knyphausen 183, 184, 189-193, 196, 339.
- Koeppern 354.
- Krösus 322, 323.
- Kunckel 243.
- Kurland:
- Karl, Herzog 333, 334.
- L
- Laborde 236.
- La Houze 350.
- Lamberg, Graf, Kaspar Feli 11, 61.
- Lamberg, Graf, Maximilian Joseph 11, 13, 19, 32, 33, 42, 59-69, 88,
89, 112, 128.
- Lambert 39, 47, 48, 224.
- La Mettrie 362.
- Lannoy sen. 259.
- Lannoy jun. 234, 259.
- La Pagerie 141.
- Latour 71.
- Lehndorff 86, 87, 304-306.
- Lémery 243.
- Le Normand d’Étioles 95.
- Leontion 106.
- Lesage 79.
- Lesseps 199.
- Le Vayer 62.
- Lewenhaupt 125.
- Linnières 167, 168.
- Lobkowitz 13, 67.
- Lossau 357, 359-361.
- Lothringen:
- Karl, Prinz 252, 270, 272, 277, 278.
- Luchet 35, 36, 100, 110.
- Lukrez 52.
- M
- Macanas 211.
- Macquer 366.
- Magnan 32, 86.
- Man 119.
- Marchais, Frau von 87.
- Marcolini 309, 333.
- Marggraf 64.
- Maria 51.
- Mariamne 86, 306, 340.
- Marigny 141, 142.
- Maubert 120, 121.
- Medardus 103.
- Medici: siehe unter Toskana.
- Meister 108.
- Mesmer 104.
- Michell 189, 190.
- Mirabeau 88.
- Mitchell 194-196.
- Moehsen 69.
- Moncada 132, 133, 135-138.
- Montaigne 10, 11, 61.
- Montauban, Prinzessin 167.
- Montezuma 322, 323.
- Montfaucon: siehe Villars.
- Montmorency 127.
- Morin 52.
- Moritz, Marschall von Sachsen 15, 60, 125, 154, 198.
- Murillo 48.
- N
- Nettine, Frau 24, 26, 27, 40, 226, 228, 232, 234, 236, 237, 239, 240,
244, 248, 249, 251, 254, 260-268, 270, 272, 274, 276, 278-281, 283.
- Nettine, Vicomte 227, 234, 239-241, 250-252, 270, 279.
- Neufville 163.
- Newcastle 153, 163, 167.
- Nicolai 349.
- Noblet 221.
- O
- Odart 20.
- Österreich:
- Karl V., Kaiser 49.
- Leopold I., Kaiser 295, 345.
- Karl VI., Kaiser 356.
- Franz I., Kaiser 63, 68.
- Maria Theresia, Kaiserin 27, 162, 174, 200, 227, 229, 231-233, 242,
244, 247, 249, 251, 252, 260-279, 285.
- Joseph II., Kaiser 314.
- Elisabeth, Kaiserin 356.
- Opiz 67.
- Oranien:
- Wilhelm V., Prinz 16, 168.
- Karoline, Prinzessin 17, 171, 197.
- Wilhelmine, Prinzessin 307, 309, 321.
- Orléans:
- Philipp II., Herzog, Regent von Frankreich 53.
- Orléans, Jungfrau von 20, 210.
- Orlow, Graf, Alexej 21, 22, 56, 294-296, 299, 300, 308, 309, 330, 333.
- Orlow, Fürst, Gregor 20, 21, 56, 57, 294, 296, 308.
- Otte 357.
- P
- Pâris-Duverney, Joseph 145, 208-210.
- Pâris de Montmartel, Jean 145, 208-210.
- Parma:
- Philipp, Herzog 162.
- Pernety 338, 339.
- Persien:
- Thamas Chouli-Kan 59.
- Petitot 131.
- Petrus, Apostel 90, 103.
- Philidor 70.
- Pictet 32, 85, 86.
- Pieck van Soelen 156, 161, 168.
- Pilatus 50, 92.
- Pitt 16, 163, 191-193, 215, 299.
- Plumenoek 348.
- Pompadour, Marquise 14, 17, 19, 48, 55, 123, 125-132, 139, 140,
146-148, 162-165, 167, 171, 173, 175, 179-181, 185-187, 200, 203,
208-210, 214, 217, 219, 223, 229, 235, 359.
- Pons 341, 342.
- Postel 110.
- Pott 64.
- Preußen:
- Friedrich der Große, König 19, 28, 30, 31, 34, 57, 85, 139, 140,
174, 177, 182-196, 200, 206, 215-217, 219, 299, 306-323, 362.
- Heinrich, Prinz 321-323.
- Amalie, Prinzessin 10, 339, 351.
- Q
- Quesnay 33, 129.
- R
- Radegonde 82.
- Raffael 48, 282.
- Rakoczy: siehe unter Siebenbürgen.
- Rameau 51.
- Rasse 226, 234, 239, 249, 254, 259, 270.
- Reischach 16, 151, 152, 183, 184, 188, 196-206.
- Remer 366.
- Resiel 110.
- Rhoon: siehe unter Bentinck.
- Rohan 340.
- Rotondo 7, 11, 296.
- Rouelle 64.
- Rousseau 120.
- Rußland:
- Elisabeth, Zarin 174.
- Peter III., Zar 20.
- Katharina II., Zarin 20, 22, 57, 61, 313, 314, 351.
- Paul, Großfürst-Thronfolger 329.
- S
- Kur-Sachsen:
- August II., Kurfürst, König von Polen 209.
- August III., Kurfürst, König von Polen 207, 212, 216.
- Friedrich Christian, Kurprinz 211.
- Karl: siehe unter Kurland.
- Maria Antonia, Kurprinzessin 211, 323.
- Sachsen-Weimar:
- Karl August, Herzog 42.
- Sagramoso 86, 332, 333.
- Saint-Florentin 231, 235, 266.
- Saint-Gelais 97.
- Salomo 40, 58.
- San Gil 132-139.
- Sappho 106.
- Sardinien:
- Victor Amadeus III., König 314.
- Saumery 142.
- Schaffgotsch 343.
- Schöning 83.
- Schrepfer 36, 336, 348.
- Seckendorff 211.
- Selwin 139.
- Semiramis 106.
- Sennecterre, Gräfin 97, 98.
- Siebenbürgen:
- Franz II. Rakoczy, Fürst 7, 8, 295, 296, 305, 312, 355, 356.
- Helene, Fürstin 8, 356.
- Charlotte Amalie, Fürstin 356.
- Leopold Georg, Prinz 8, 356.
- Joseph, Prinz 8, 296, 312, 356.
- Georg, Prinz 8, 296, 312, 356.
- Silhouette 14, 140, 141, 145.
- Slingelandt 149, 150.
- Sloane 12.
- Soelen: siehe unter Pieck van Soelen.
- Sokrates 106.
- Solar 54.
- Spanien:
- Karl II., König 9.
- Maria Anna, Königin 9, 53, 83, 84.
- Starhemberg 196, 236.
- Steyn 149, 150, 152, 156-158, 161, 164, 165, 213.
- Stosch 53.
- Stuart, Karl Eduard 12, 119, 121.
- Swift 315.
- T
- Talmond, Prinzessin 67.
- Thiébault 10, 338-342.
- Thys 244, 245.
- Tiberius 92.
- Toskana:
- Giovanni Gasto (Medici), Großherzog 8, 356.
- du Troussel, Frau 339, 342, 343.
- U
- Uffel 350-352.
- Urfé, Marquise 39, 91-94, 122, 124, 285, 303.
- Uzès, Herzogin 98.
- V
- Vanloo 71.
- Villars 336.
- Voltaire 16, 66, 86, 215, 216.
- W
- Wackerbarth-Salmour 206-209, 211-215.
- Walckiers 227, 228, 250, 252, 270.
- Walpole 12, 119, 120.
- Warnstedt 361, 262.
- Watson 13, 64, 65.
- Welderen 221.
- Wildmann 62.
- Wolf 10, 95.
- Wurmb 36, 334-337.
- Y
- Yorke 16, 17, 19, 38, 152-154, 164, 166, 170-184, 186, 187, 189, 190,
194, 195, 197, 200-202, 210, 213, 215, 217, 236.
- Z
- Zimmermann 342, 343.
- Zobor 32, 63.
- Zweibrücken-Birkenfeld:
- Christian IV., Herzog 125.
[S. 375]
ORTSVERZEICHNIS[555]
- A
- Ägypten 311.
- Afrika 311.
- Altona 219, 353, 354.
- Amsterdam 9, 17, 20, 21, 40, 77, 144, 147, 148, 150, 151, 158, 168,
171, 175, 182, 197-199, 210, 223, 224.
- Ansbach 288-303, 308.
- Antwerpen 161, 204, 218.
- Asien 311.
- Aurich 192, 193.
- B
- Bayonne 9, 53, 83.
- Berlin 28-30, 206, 231, 287, 310, 324, 329, 338-344.
- Blois 141.
- Bordeaux 84.
- Breda 16, 215.
- Brest 83.
- Brüssel 22, 24, 27, 31, 40, 225-283.
- C
- Chambéry 107.
- Chambord 14, 15, 48, 60, 123-126, 141, 142, 154, 155, 171, 182,
185, 194, 198, 208, 212, 217, 224.
- China 312.
- D
- Dresden 56, 209, 300, 310-323, 333, 335-337, 344, 354.
- E
- Eckernförde 30, 52, 284, 287, 300, 357-361, 363-365.
- Emden 193.
- F
- Florenz 53, 332.
- G
- Genf 85.
- Genua 297.
- Granada 53.
- Grenoble 92.
- H
- Haag 9, 11, 15-20, 38, 52, 55, 62, 63, 144-175, 177-189, 194-215,
218, 221-224, 231, 236, 351, 352, 359.
- Hamburg 30, 37, 60, 284, 300, 350-352.
- Harlem 318.
- Hellevoetsluis 160, 170, 203, 204, 206.
- I (J)
- Jerusalem 92.
- Indien 13, 64, 65, 312.
- K
- Karlsruhe 27, 279.
- Kassel 29, 358-360.
- Klagenfurt 244.
- Konstantinopel 11, 120, 358, 359.
- Kopenhagen 361.
- L
- Lausanne 29.
- Leipzig 30, 36, 40, 300, 304-309, 324-335.
- Lille 155, 165.
- Livorno 22, 27, 56, 66, 296.
- London 12, 18, 20, 21, 56, 65, 67, 77-79, 119-121, 144, 159, 167,
169, 171, 189-195, 198, 203-206, 213-215, 217-220, 231, 236, 297,
299, 302, 305, 307, 351, 352.
- Lüttich 279.
- M
- Madrid 9.
- Mailand 56, 297.
- Mantua 27, 62.
- Meißen 192.
- Metz 125.
- Mexiko 11, 119.
- Moskau 23, 27, 31, 329-331.
- N
- Neapel 60, 296.
- Newmarket 65.
- Nicäa 51.
- Nimwegen 21, 26, 40, 222, 249, 267, 268.
- Nürnberg 20-22, 57, 294, 295, 308.
- P
- Paris 13-15, 17, 24, 31, 39, 40, 47-54, 60, 61, 65, 67, 77, 82, 107,
108, 122-132, 139-141, 167, 171, 182, 185, 198, 218, 228-232, 240,
266-269, 296, 302, 303, 305, 307, 336, 351, 352, 359, 361.
- Peking 60.
- Persien 59.
- Petersburg 56, 85, 309, 329.
- Pfalz 223.
- Pisa 27, 297, 299, 332.
- Polen 198.
- Portugal 9, 315.
- Potsdam 317, 321, 322.
- R
- Rom 60.
- Rotterdam 175, 206, 219.
- Rußland 20-23, 57, 294, 308, 325, 329, 331, 332.
- Ryswijk 16, 150, 152, 197, 201.
- S
- San (Sankt) Germano 9, 11, 296.
- Schleswig 11, 28, 30, 35, 52, 58, 74, 75, 100, 126, 287, 353-355,
361, 362.
- Schwabach 28, 29, 31, 289, 293, 297, 300-302, 308, 326, 330.
- Siena 74.
- Spanien 198.
- Straßburg 10, 37, 95.
- T
- t’Kint 259.
- Tournai 23-27, 30, 31, 33, 34, 226, 234, 239, 240, 245, 248-250,
252, 254, 261, 265, 267-270, 277, 279, 280, 282-285.
- Trient 93, 94, 124, 215.
- Triesdorf 29, 57, 290-293, 303.
- Tunis 66.
- U
- Ubbergen 21, 22, 221, 222, 234, 236, 266.
- Utrecht 76, 77, 160.
- V
- Venedig 27, 51, 56, 59, 60, 128, 297, 299, 305, 332.
- Vitry 10.
- W
- Weesp 223.
- Wien 60, 64, 67.
- Z
- Zutphen 222.
[S. 378]
VERZEICHNIS DER ABBILDUNGEN
|
Der Graf von Saint-Germain
|
|
|
Fürst Franz II. Rakoczy
|
|
|
Nikolaikirche in Eckernförde
|
|
|
Max Joseph Graf von Lamberg
|
|
|
Frau von Genlis
|
|
|
Elisabeth von Ansbach und Bayreuth (Lady Craven)
|
|
|
Cagliostro
|
|
|
Giacomo Casanova
|
|
|
Karl Graf Cobenzl
|
|
|
Staatskanzler Graf Kaunitz
|
|
|
Alexander Markgraf von Ansbach und Bayreuth
|
|
|
Schreiben Saint-Germains an Friedrich den Großen
|
|
|
Schreiben Saint-Germains an Prinz Friedrich August von
Braunschweig
|
|
|
Karl Prinz von Hessen
|
|
|
Christianspflegehaus in Eckernförde
|
|
|
Kirchenbuch von Eckernförde
|
|
Von diesem
Werke wurde eine Vorzugsausgabe
von vierhundert Exemplaren auf Bütten
in der Spamerschen Buchdruckerei in Leipzig gedruckt.
Diese Vorzugsausgabe ist numeriert und
in Ganz- und Halbleder
gebunden.
*** END OF THE PROJECT GUTENBERG EBOOK 68838 ***