
Anmerkungen zur Transkription
Der vorliegende Text wurde anhand der Buchausgabe von 1919 so weit wie möglich originalgetreu wiedergegeben. Typographische Fehler wurden stillschweigend korrigiert. Ungewöhnliche und heute nicht mehr verwendete Schreibweisen bleiben gegenüber dem Original unverändert; fremdsprachliche Ausdrücke wurden nicht korrigiert.
Die in den Kopfzeilen der gedruckten Fassung dargestellten kurzen Zusammenfassungen wurden als Randnotizen beibehalten. Diese wurden an den Anfang des betreffenden Abschnitts gestellt.
Die Anmerkung Nr. 38 auf S. 238 (Nr. 16 in der gedruckten Ausgabe) zum Kapitel ‚Antike Gastmähler‘ wurde im Original fälschlicherweise doppelt aufgenommen, wodurch sich die Nummerierung der nachfolgenden Endnoten verschiebt. In der vorliegenden Ausgabe wurde die überzählige Endnote aber entfernt, wodurch die korrekte Zuordnung der Anmerkungen wiederhergestellt wurde.
Die gedruckte Ausgabe ist in Frakturschrift gesetzt. Passagen in Antiquaschrift werden hier kursiv dargestellt. Abhängig von der im jeweiligen Lesegerät installierten Schriftart können die im Original gesperrt gedruckten Passagen gesperrt, in serifenloser Schrift, oder aber sowohl serifenlos als auch gesperrt erscheinen.
Theodor Birt
Aus dem Leben der Antike
THEODOR BIRT
2. Auflage

1 • 9 • 1 • 9
QUELLE & MEYER-LEIPZIG

Alle Rechte vorbehalten
Copyright 1919 by Quelle & Meyer in Leipzig
Einbandzeichnung von Paul Hartmann
Ohlenrothsche Buchdruckerei
Georg Richters
Erfurt
Meinen Jugendfreunden
Rudolf Ballheimer
in Hamburg
Ludwig Martens
in Berlin
Richard Gaede
in Danzig
die im Leben nun bald fünfzig Jahre
mit mir Schritt gehalten,
in treuer Gesinnung
zugeeignet.
[S. vii]
Antikes Leben! ein unerschöpflicher Gegenstand! Bisher habe ich ihm drei größere literarische Versuche erzählenden und kulturgeschichtlichen Inhaltes gewidmet, Bücher, die wie langgezogene Bilderfriese in sich Einheiten bilden und darum vielleicht wie Bilderfriese ermüden. Daneben tritt dies vierte Buch, das zusammenhangslos und in Auswahl sein Schlaglicht nur auf dies und jenes, auf antikes Reiseleben, Frauenleben, Kinderliebe, Verkehr auf dem Büchermarkt u. a. wirft: Einzelbilder in engem Rahmen, von denen ich hoffe, daß sie das Nähegefühl steigern und das Leben der Vergangenheit mit noch größerer Deutlichkeit vor das Auge stellen.
Zum Teil sind diese Aufsätze schon vor dem gegenwärtigen Weltkrieg, zum Teil aber erst während des Krieges entstanden, und man wird sich also nicht wundern, daß den letzteren der Einfluß der großen Zeitereignisse, in denen wir heute stehen, deutlich anzumerken ist. Denn kein Schriftsteller kann sich diesem Einfluß entziehen, und die Antike mit dem Leben der gegenwärtigsten Gegenwart zu vergleichen, war mein ständiges Augenmerk. Daher habe ich auch von der „Laus“ gehandelt; denn auch sie ward für uns Ereignis.
Eben darum könnte man mir vielleicht verargen, daß ich in dieser Zeit des Entbehrens und der Ernährungsnöte, wo fast nur noch der Gauner einen vollbesetzten Tisch hat, auch über „antike Gastmähler“ rede. Ich hab’s gewagt. Die Erinnerung an frühere gesegnetere Stunden darf uns nicht kränken; denn auch der Erblindete zehrt gern von der Erinnerung an das, was er einstmals mit gesunden Augen gesehen und genossen hat.
Als Leser dieser Blätter denke ich mir gern jeden Gebildeten, der sich darüber klar ist, daß es nicht nur unterhaltsam, sondern daß es auch immer noch heilsam ist, die Kulturhöhe des sogenannten klassischen Altertums zu kennen und in das eigenartig bunte Treiben im alten Rom der Cäsaren sich zu[S. viii] vertiefen, um daran, was wir heute sind und haben, zu messen. Um diesem Leser zu dienen, ist jeder gelehrte Apparat vermieden und von mir streng in den Anhang verbannt worden, wo die „Anmerkungen“ Nachweise, aber auch allerlei Zusätze und Exkurse im Verborgenen bringen. Vielleicht findet der Anhang gleichwohl das Auge des Fachmanns, des Schulmanns und Gelehrten: dann hat auch er seinen Zweck erreicht.
Marburg a. L., 24. Januar 1918.
Der Verfasser.
Das Buch, das freundliche Aufnahme gefunden hat, lege ich jetzt durchgebessert, doch im Wesentlichen unverändert nochmals dem Publikum vor. Einige Zusätze haben die „Anmerkungen“ erfahren. Zu Dank bin ich Herrn O. Roßbach verpflichtet, der mir durch seine Besprechung in der Berliner philologischen Wochenschrift 1918 Sp. 1206 ff. zu mehreren Berichtigungen den Anlaß gab. Anderes habe ich ändern müssen, da es der politischen Lage des Vaterlandes nicht mehr entsprach. Denn all unsere stolzen patriotischen Hoffnungen, denen ich Worte verlieh, sind nun zerschlagen. Nicht der Feind, unser unselig verhetztes Volk selbst und der törichte Wilsonglaube unserer Pseudopolitiker hat sie zerstört.
Marburg a. L., 20. Mai 1919.
Der Verfasser.
[S. ix]
|
Die Römerin
|
|
|
Rom und der Genius Roms. Heldinnen. Stellung der Mutter zum Sohne. Keuschheit.
Lose Eheverhältnisse. Energie der Römerin. Mangelnde Tierliebe. Ehebruch.
Organisation der Bürgerinnen. Hetärenwesen. Messalina. Schönheitsideal.
Frisur. Kleiderstoffe. Frauenbildung. Musizieren. Gelehrte Frauen. Juvenal.
Grabschriften. Frauengestalten der Kaiserzeit. Cornelia bei Properz.
|
|
|
Antike Gastmähler
|
|
|
Ästhetische und wirtschaftliche Gesichtspunkte. Beginn des
Luxus in Rom. Übertreibende Schilderungen. Kochbücher. Zahl und Auswahl der
Gäste. Tischordnung. Schatten. Klienten. Damen. Tageseinteilung. Eßsäle.
Gesellschaftskleidung. Tische und Klinen. Beginn des Essens. Zahl der Gänge.
Nachtisch. Braten. Pikantes Vorgericht. Brechmittel. Beleuchtung. Parfümerien.
Getränke. Unterhaltung bei Tisch. Gastgeschenke. Bezug der Eßwaren. Import.
Bereicherung der Fauna und Flora Italiens. Nachwirkung auf unsere moderne
Ernährung. Der Koch und seine Hilfsmittel; seine Wunderleistungen. Der
scissor. Essen mit den Fingern. Mundtücher. Brot.
Analecta. Zwei Bibelstellen erläutert. Würdigung
des Tafelluxus. Abendtrunk. Schluß.
|
|
|
Auf der römischen Heerstraße
|
|
|
Modernes Verkehrsleben. Ruhe des Südens. Griechen, Perser,
Karthager. Späte Entwicklung Roms. Stadtklatsch in Rom. Maueranschläge.
Brieftafel. Archive. Die ersten Straßen. Telegraphie. Meldedienst.
Gesandtschaften. Eilmärsche. Ausbildung des Straßenwesens. Gallisches
Fuhrwesen. Das Heer auf dem Marsch. Train. Kauffahrer. Welthandelsverkehr.
Römerstraßen der Kaiserzeit. Das Reisen. Reiseziele. Gattungen des Wagens.
Prunkwagen. Handelshafen; Handelsschiffe. Erholungsreisen der großen Herren.
Fußwandern und Pilgern. Die Meile. Wandernde Berufsarten. Apostel Paulus.
Götterschutz. Gasthöfe. Reichsverwaltung und Reichspost. Ihr Betrieb.
Postboten. Reisescheine. Schnelligkeit Hadrians. Der Brief und seine
Beförderung; Siegelung usf. Publizierte Briefe. Tageszeitung. Senatsprotokolle.
Vergleich der modernen Zeiten. Mangel an Kompaß. Winterstille;
[S. x]
im Winter der Nachrichtendienst und die Zufuhren behindert.
|
|
|
Die Laus im Altertum
|
|
|
Modernes; russische Mönche. Byzantiner. Die Laus in Hellas
bei Bauern und Fischern; sie fehlt bei Aristophanes und sonst. Reinlichkeit
der Städter. Bad, Gymnastik, Rasieren. Die griechischen Frauen. Sokrates.
Kyniker. Läuse fehlen auch in der römischen Literatur; bei den Spottdichtern.
Anders in der älteren Zeit Roms: Komödie, Lucilius. Die Fabel Sullas. Petron.
Kaiser Julian. Phtheiriasis. „Läusefresser“ bei den Barbaren damals und heute.
|
|
|
Der Mensch mit dem Buch
|
|
|
Der blinde Homer ohne Buch. Schreibmaterial der ältesten
Zeit. Weitere Dichter ohne „Buch“. Import der Papyrusrolle. Entstehung der
Buchliteratur bei den Griechen. Herstellung des Papiers. Seine Haltbarkeit.
Umfang der Rollen. Buchteilungen. Ausstattung. Bibliothek. Bildliche
Darstellung von Schreibenden und Lesenden. Langsam lesen; in Abschnitten
lesen. Anfangs beschränkter Leserkreis; Steigerung in der Spätzeit. Der
Gestorbene mit der Rolle dargestellt. Grabessymbolik. Die Rolle als Spruchband
im Mittelalter. Michelangelos Delphica. Der Himmel als Buch.
|
|
|
Verlagswesen im Altertum
|
|
|
Vervielfältigung der Bücher nach Diktat. Bücherpreise.
Erhielt der Autor Honorar? Theaterstücke hoch bezahlt. Selbstverlag der
reichen Autoren. Der Verleger Atticus. Witzliteratur. Vertrieb der erhabenen
Dichtwerke. Horaz. Widmung ist Eigentumsübertragung. Die Gönner besorgen den
Verlag. Fürsorge der römischen Kaiser. Soziale Stellung des unbemittelten
Autors.
|
|
|
Woher stammen die Amoretten?
|
|
|
Amoretten heute und in der Renaissancekunst; im Altertum.
Geflügelte Götter. Eros und Eroten in der älteren Kunst. Interesse am Kinde.
Kinderscharen in den Häusern der Reichen seit der Alexandrinerzeit.
Deliciae. Die stoische Lehre begünstigt ihren
Gebrauch. Belege. Deliciae sind „Spielkinder“.
Ihre Schwatzlust. Camerius bei Catull. Nacktheit der Kinder. Flügellose Putten
in der Kunst. Pausias. Aufkommen der Amoretten als geflügelte Spielkinder;
erfunden in Alexandria. Vogelnatur.[S. xi]
Kindernest. Die Bedeutung der Liebe ausgeschaltet. Geflügelte
deliciae. Kinderspiele der Flügelkinder.
Dieselben als Handwerker. Putten mit Falterflügeln. Psyche als Schmetterling.
„Wer kauft Liebesgötter?“ Kinderhandel. Auch lebende Spielkinder mit Flügeln
ausgestattet. Rückblick. Verwendung als Füllfiguren, als Engel, als
Gräberschmuck.
|
|
|
Seneca
|
|
|
Senecas Vielseitigkeit; scheinbare Widersprüche in ihm.
Einheit seines Wesens. Stoische Religion. Der Ethiker für den lateinischen
Okzident. Grundgedanken. Die gleiche Tendenz in seinen Dramen. Lesedramen;
Vergleich mit Shakespeare. Herkules Oetaeus. Biographisches: Verbannung.
Erzieher Neros. Schrift an Polybius. Schrift gegen den Zorn. Agrippina
zurückgedrängt; Senecas Reichsverwaltung. Lehrschriften über Gnade und
Wohltun, über Reichtum u. a. Geldwirtschaft. Stellung zu Nero. Rücktritt
und Ende. Sein Einfluß auf die Folgezeit. Augustus sein Vorbild. Schrift gegen
den Aberglauben.
|
|
|
Griechisch-römischer Mummenschanz und die Verhöhnung
Christi
|
|
|
Christi Verhöhnung. Die Sakäen. Der Arme als König.
Saturnalienkönig als Tölpel. Der Tölpel als König im Mimus. Sardi venales.
Vitellius’ Ende. Brutalität des Militärs. Das Königtum des Cynikers.
|
|
|
Witzliteratur und Gesellschaft in Rom
|
|
|
Simplizissimus und Fliegende Blätter. Die Zote. Tendenzlose
Späße und Belustigungen. Die Invektive. Die Satire. Togatkomödie. Pasquille:
Catull gegen Caesar, Vergil gegen Noctuin und Sabinus. Horaz’ Epoden und
Lydia-Ode. Domitius Marsus. Martial. Die Epigrammdichtung spät entwickelt.
Proben aus Martial. Spätere Epigrammatiker. Soldaten und Priester geschont.
Toleranz im Religiösen. Kein Rassenhaß. Anders die Satire. Religiöse
Aufklärung: Persius, Seneca, Juvenal. Juvenal gegen den Fanatismus. Satire der
Kirchenväter. Völkerhaß in der Gegenwart.
|
|
|
Anmerkungen
|
Weltgeschichte ist Kampf der Völker. Die Frau arbeitet und nährt, aber sie kämpft nicht in Waffen oder hat doch den Kampf verlernt. Daher ist die Weltgeschichte eine Geschichte des Mannes. Der Mann ist Kauffahrer, und er führt zugleich das Schwert, um den Erwerb zu schützen und zu erweitern. So ist auch die römische Geschichte Männergeschichte. Römerkastelle, Römerstraßen, Schlachtfelder, Triumphbögen, Arenen zeigen uns immer dieselben Gestalten. Die römische Tugend selbst ist männlich; denn sie heißt virtus (französisch vertu), leitet sich also von vir her. So wie iuventus die Eigenschaft des Jünglingsalters (iuvenis), senectus die Eigenschaft des Greisenhaften (senex), so war virtus zunächst nichts weiter als die Eigenschaft, ein reifer Mann, vir, zu sein. Dieser Eigenschaft zu gleichen, erschien aber als das Ideal für alle. Und als reifer Mann steht in der Tat auch das Römervolk selbst fechtend und knechtend, triumphierend und Ordnung schaffend unter den Völkern. Ja, das Nämliche gilt sogar von der Tiberstadt selbst. Die Stadt heißt freilich Roma, als wäre sie ein Feminin[1]; allein wenn Rom statuarisch als weibliche Göttin gebildet und in Tempeln aufgestellt wurde, so war das gleichwohl unrömisch, und es geschah durch Griechen nach dem Vorbild griechischer Stadtgöttinnen wie der Athene. Römisch und echt ist dagegen, daß Rom, wie jeder Mann, einen Genius hat, den man göttlich verehrte. Der „Genius Roms“ bedeutet das Lebensprinzip des Staates, und aller Genius ist männlich[2].
Wer sich nun aber mit dem Wirken dieses Genius, mit römischer Kultur andauernd beschäftigt und durch Bauwesen, Rechtsleben, Verwaltung und Krieg, Kunst und Religion forschend hindurchgeht, in dem regt sich bald laut und lauter die unausbleibliche und dringliche Frage: wo ist die Frau? und warum wird von ihr geschwiegen? Sei es auch nur der schönen Abwechslung wegen: wir haben ein Verlangen, ihr zu begegnen. Im Ernst: was wäre heute und seit Ewigkeit alle Tatkraft des[S. 2] Mannes ohne sie? Was ist unsere heutige Kultur ohne die Frauen? und was war ohne sie Rom?
Wir wollen nicht schön färben. Wir wollen nur kennen lernen. Ein flüchtiger Aufriß! Sei denn der Versuch gemacht, den Zeitgenossinnen des Scipio, Caesar und Trajan, der Römerin des großen Altertums einmal etwas näher zu treten.
Wer die stolzen Römerinnen von heute in der Geselligkeit, im Korso oder auch im Negligé des Alltags gesehen hat, mag sich von jener ein Bild machen: oft sinnfällig schön, aber früh alternd; dazu sprühend energisch, beredt, leichtgläubig und ihren starken Trieben ganz ergeben, träge und wild wie Panther. Die alte Sage hat aus den Römerinnen Heldinnen gemacht. Aber das galt vornehmlich nur für die große alte Zeit: Clölia, die sich aus Feindeshand befreit; jene Frauen, die sich das Haupt scheren und aus ihren schönen Haaren Stricke flechten, damit die Verteidiger der Stadt ihren Bogen mit Sehnen bespannen können (daher der Tempel der Venus calva). Als Camillus gegen Brennus und die Gallier ficht, opfern die Römerinnen sogar ihren Goldschmuck, damit der Staat Geld hat (ein Vorbild für alle Zeiten), und dies wurde ihnen ewig gedankt; denn in der Stadt, wo sonst niemand mit Wagen fuhr, erhielten die Frauen seitdem das Vorrecht, zu den Gottesdiensten fahren zu dürfen[3]. Im Grunde aber war dem Römer das Mannweib doch unbehaglich; schrecklich wie ein Gespenst erschien die Fulvia, die Gattin des Mark Anton, die Urheberin des Perusinischen Krieges; denn diese Fulvia ging selbst in Waffen und hetzte die Legionen gegen Octavian auf. Sympathischer immerhin Agrippina, die mit ihrem Gatten Germanicus bei den Legionen am Rhein steht und dort im gefährlichen Augenblick den Feldherrn selbst vertritt, persönlich zur Rheinbrücke eilt und durch energisches Kommando den verhängnisvollen Abbruch der Brücke verhindert, damit die Truppen sich vor den Germanen des Arminius noch über den Strom retten können; eine echte Soldatenfrau und in allem[S. 3] gewaltig (ingens animi); dem Kaiser Tiberius ist aber diese Agrippina eben deshalb verhaßt gewesen.
Vor allem nun aber die Römerin als Mutter! Sie ist es, die die Knaben, und wenn der Vater früh starb, auch noch die Jünglinge im Hause hütet und ihr zukünftiges Schicksal auf dem Herzen trägt[4]. In Gedichten ist die Mutter zwar nie verherrlicht worden, und es verrät eine Engheit der Ausdrucksfähigkeit, daß der Naturlaut verwandtschaftlicher Zärtlichkeit im Altertum so selten zum Ausdruck kommt. Wohl aber kennen wir Cornelia, die greise Mutter der Gracchen. Es ist die Niobe Roms, die all ihre Söhne bis auf zwei durch frühen Tod verlor; nun erheben sich diese beiden Söhne zu Führern im gräßlichen Ständekampf, und die Mutter fleht zu ihrem Gajus umsonst, daß er warte, eine kurze Frist warte, bis sie tot sei. Sie muß beide, sie muß auch Gajus, den herrlichen, in den Straßen Roms verbluten sehen. Großartiger noch die Sagengestalt der Veturia, wie Plutarch sie schildert. Ihr einziger Sohn Coriolan, der starke Held, wird vom Volk beneidet, geschmäht, gekränkt, entweicht aus der Stadt zum Landesfeind, den Volskern, und bedrängt Rom nun grollend und siegreich mit Heeresmacht. Alle Hilfe versagt. Da tun in der Not sich alle Frauen Roms zusammen und dringen in Veturia, und Veturia, die Mutter, zieht selbst ins Feldlager des Feindes hinaus, eine seltsame Gesandtschaft, und überrascht den Sohn. Sie hat seine Frau und seine Kinder mitgebracht. Aber der Sohn sieht nur sie, hört nur sie, die Mutter; sein verfinstertes Herz erschrickt vor dem eigenen Haß, und in langer stummer Umarmung und in Tränen hinschmelzend löst sich ihm auf einmal alle Qual der Erbitterung. Wie tief, wie wahr diese Allmacht der Mutter! Aber sein Schicksal ist entschieden. Veturia selbst entscheidet es, da sie ausruft: „Kind, wie kann ich noch fürder für dich beten, wenn dein Heil den Untergang Roms bedeutet?“ Er gibt den Kampf auf. Die Volsker töten ihn. Sie hat das Vaterland vor ihrem Sohn gerettet. Sonst stünde heute Rom nicht. So die Dichtung.
[S. 4]
Nur die Gelegenheit erzeugt das Außerordentliche, und die Tapferkeit gedeiht nicht im Frieden. Aber auch für das Ideal der Keuschheit, die die eigentliche virtus des Weibes ist[5], suchte man die Belege in alter Vorzeit: es ist Lucretia, die durch Selbstmord, es ist Virginia, die durch ihren Vater vor Schande gerettet wird. Gleichwohl war es Sitte gerade der alten Zeit, daß der Mann, der vom Lande heimkommt, zuvor durch einen Boten bei seiner Frau sich melden läßt. Die augusteische Zeit weiß das Jahr — 154 v. Chr. — anzugeben, wann aus Rom die alte Keuschheit entwichen sei[6].
Es ist dasselbe bei allen Völkern, und auch bei uns Germanen. Das Wunschbild geschlechtlich lauteren Lebens (im Sinne der Monogamie) wird in die fernste deutsche Urzeit projiziert. Unsere Gegenwart, die Großstädte voran, belehren uns jedoch eines ganz anderen, und so bedenklich wie heute stand es damit schon dereinst im deutschen Mittelalter, im Bauernstand wie im Adel und selbst am deutschen Kaiserhof. In der Dichtung aber ist das Ideal, das der Volksseele lieb und heilig ist, zu allen Zeiten unverrückbar lebendig und findet in gewissen mittleren Kreisen der Gesellschaft, die durch Erziehung, Einsicht und maßvolles Temperament sich dazu eignen, eine segensreiche Verwirklichung.
Nicht anders stand es in Rom. Eigenartig ist hier nur, daß auch die Bande der Ehe selbst sich lockerten.
Die rohe altrömische Rechtsauffassung der Ehe, wonach der Vater die Tochter wie eine Ware an den Schwiegersohn weggibt, war unter dem humanen griechischen Kultureinfluß bald zurückgetreten. Daraus, daß die Frau ursprünglich in Rom Eigentum des Mannes war, mag sich die später noch herrschende Sitte erklären, daß Mann und Frau trotz so mancher Feste, an denen man sich sonst gegenseitig beschenkte, sich nichts schenken durften. In der Folgezeit kann nun aber eine Verlobung nicht mehr ohne die persönliche Einwilligung der Braut geschlossen werden; auch nimmt die Frau nicht mehr wie früher den Namen des Mannes an. Das war die Emanzipation[S. 5] der Frau. Auch der priesterliche Segen (confarreatio) tritt mehr und mehr bei der Hochzeit zurück, und die Ehe ist nur Zivilehe (Form der coemptio). Dabei ist es allerdings nur der Bräutigam, der der Braut den eisernen Verlobungsring gibt, nicht auch umgekehrt. Und diese Ehe war Schriftehe; das Dokument des Ehevertrags erschien so wichtig, daß es auf keiner Abbildung von Hochzeitspaaren so leicht in der Hand des jungen Ehemanns fehlte. Das Wichtigste an diesem Vertrag ist, daß die Frau das Recht auf ihr Vermögen behält. Ihr Geschäftsträger verwaltet es abgesondert.
Bedeutsamer aber erscheint noch, wie leicht der Vertrag lösbar war. Flüchtiges Mißfallen, schon die üble Laune genügte, die Lösung der Ehe herbeizuführen. In den vornehmen Kreisen wurde schon im ersten Jahrhundert v. Chr. die Ehescheidung gang und gäbe, und die Laxheit steigerte sich noch in der Kaiserzeit. So war Ovid dreimal vermählt, Pompejus fünfmal, und so in hundert Fällen. Auch Ciceros Tochter Tullia heiratete dreimal. Und nicht etwa nur der Gatte war es, der der Frau den Abschied gab[7]: von Paula Valeria meldet Cicero in einem Brief, soeben werde ihr Mann aus der Provinz zurückerwartet, sie aber vollziehe vorher rasch und ohne Grund zur Klage die Ehescheidung; ihr genügte als Grund, daß sie den Didius Brutus heiraten wollte. Die strenge Forderung der Gesellschaft ging freilich dahin, daß die einmal geschiedene Frau ganz ebenso wie die Witwe sich nie wieder verheiraten dürfe; nicht etwa erst die christlichen Kirchenväter haben das gepredigt, und univira, d. h. „die im Leben nur einen Mann hatte“, blieb ein Schmuckwort und Ehrenwort auf den Grabsteinen der Römerinnen. An den geschiedenen Mann dagegen wurde die gleiche Anforderung keineswegs gestellt.
Aber wir brauchen uns nicht zu besorgen. Die Römerin wußte sich schadlos zu halten; denn sie besaß die urwüchsige Energie ihrer Rasse. Die griechische Ehefrau lebte still eingezogen[8]; die römische bewegte sich, von Dienern gefolgt, frei auf der Straße; sie erscheint bei den Gastmählern sicher und[S. 6] stolz unter den Männern, und sie herrscht im Haus. „Der Römer herrscht über die Welt, die Frau herrscht über den Römer,“ so sagte Cato. In den römischen Lustspielen, dem Volksstück der Togatkomödie, kam das, wie wir noch erkennen, besonders lebendig zum Ausdruck, und wir können nicht genug beklagen, daß sie für uns verloren ist. Die handfeste Jungfrau, die ihren Mann steht; die Frau scheltend und wetternd im Haus; schallende Ohrfeigen: wehe dem Gatten, der zu spät nach Hause kommt! Derb und frisch war das alles gezeichnet. „Das Weib liebt oder haßt, ein drittes gibt es nicht,“ lautet eine Sentenz, die übrigens ebensogut auch modern sein könnte. Es gibt zu denken, wenn uns von zwei Schwägerinnen, die in einem Haus zusammenwohnen, rühmend hervorgehoben wird, daß es ihnen gelang, friedlich miteinander auszukommen: es ist die Gattin und die Schwester Trajans. Denn auch die Schwestern sind auf die Liebe neidisch, die ihr Bruder vergibt. Aber nicht nur die Liebe, auch der Ehrgeiz ist allmächtig, vor allem in den Müttern. Für den Sohn wird alles gewagt, und eine Agrippina geht durch Ränke, Blut und Verbrechen, bis sie den jungen Sohn zum Kaiser gemacht hat. Es war Nero, der Knabe! Vespasia, die Kleinstädterin in dem dörflichen Gebirgsnest Reate, hat zwei Söhne; auch sie will hoch hinaus mit ihnen, und der eine, Sabinus, wird wirklich Stadtpräfekt Roms, der andere gar wiederum Kaiser der Welt: es ist Vespasian, der sich nach seiner armen Mutter Vespasia so nennt und in seinem Namen den ihren verewigt hat.
Die Kinderliebe der Frauen ist nun freilich eine selbstverständliche Sache, und es wäre lächerlich, dafür noch nach weiteren Belegen zu suchen. Aber auch solche gab es, die nicht gebären wollen und mit Geheimmitteln sich die Frucht abtreiben. Um Kinder zu haben, kaufen sie sie lieber armen Leuten ab, was nicht viel besser ist, als wenn man sich ein Haustier anschafft. Was ich dagegen vermisse, ist die Tierliebe, und das ist immerhin auffallend. In der ganzen römischen Literatur der Blütezeit kommt meines Wissens keine liebe Dame mit[S. 7] dem Schoßhündchen vor, wie man sie bei uns nahezu in jedem besseren Hause antrifft[9]. Die Geliebte des Ovid hält sich freilich einen Papagei, die Lesbia des Catull ihren bissigen Sperling, den sie, wenn sie verliebt ist, neckt und reizt; aber die Hundeliebe steht höher, und daß sie so sehr zurücktritt, mutet uns an wie ein Symptom der Herzlosigkeit.
Ehrgeizig, das waren die Römerinnen, wie wir sahen, und so stehen sie denn in der Gesellschaft auch mächtig als Kapitalistinnen da, ob vermählt, unvermählt, geschieden oder verwitwet. Durch ihren Prokurator kaufen sie Güter oder Fabriken auf, spekulieren sie, schenken sie. Schon ein Städtchen wie Pompeji zeigt uns das, wo von der Priesterin Eumachia eine der größten gemeinnützigen Bauanlagen, die dort dem Geschäftsverkehr diente, mit fast 40 Meter breiter Front, in zentraler Lage am Forum selbst, herstammt, wie die Inschrift am Frontispiz rühmend aussagt und ihr am Ort gefundenes Standbild bestätigt. Eine zweite Frau, Mamia, die gleichfalls ein Priestertum verwaltete, war es, die dortselbst mutmaßlich den Augustus-Tempel am Forum gestiftet hat. Der Senat der Stadt votierte dieser Mamia dann einen schönen Begräbnisplatz an der so stimmungsvollen Gräberstraße Pompejis. Und auch an den Wahlschlachten beteiligten sich diese Pompejanerinnen. Unter den Wandinschriften, die auf städtische Wahlen Bezug haben, lesen wir nicht nur: „Agna bittet“, „Caprasia bittet (zu wählen)“, sondern auch: „Caprasia wählt“, „Iphigenie wählt“. Stimmberechtigte Grundbesitzerinnen! Es fehlte bei dieser Emanzipation nur noch, daß sie sich auch selbst wählen ließen, und in der Tat: in den Vorstand der großen Begräbnisgilden waren auch Frauen wählbar.
Und nun die Liebe. Es ist schmerzlich zu sehen, wie wenig liebenswürdig die antike Literatur gegen die Frauen ist. Das heißt: einzelne Frauen werden gelobt, wie Marcia und Helvia bei Seneca, Priscilla bei Statius, Serena bei Claudian, aber immer so, als seien sie wundervolle Ausnahmen. Das weibliche Geschlecht als Ganzes wird durchgängig beschuldigt, aber dabei[S. 8] wenig Fleiß auf seine besondere Erziehung oder Läuterung verwandt; und der Ehebruch ist die ständige Anklage. Der Vermögensverwalter der Frau ist ihr Cicisbeo. Einen Liebhaber zu haben ist Sache des Ehrgeizes für jede Weltdame. Nur die Reizlosen können sich ihrer Treue rühmen, und die Frauen halten den für einen Mägdejäger, der nicht mit einer verheirateten Frau (uxor) ein Verhältnis hat und ihr ein Jährliches zahlt[10]. So tönt es von allen Seiten. Wir wollen die Namen der Cäcilia Metella, der Clodia und der sonstigen großzügigen Vorgängerinnen der Messalina nicht aufzählen. Die Ausschweifung war grotesk. An Sentimentalität, vergebliches Sehnen und Schmachten wird nicht gedacht. Verliebt sich die vornehme Frau in einen Kutscher oder Fechter, so weiß sie seiner auch habhaft zu werden. Vor allem aber umgibt sie sich mit einem Hof vornehmer junger Männer, und es herrscht die Polyandrie in dreistester Weise. Die Badeorte, wie Bajä, waren ihre beliebtesten Stationen.
Das Altertum liebt in allem die Deutlichkeit. Es kennt kein Versteckenspielen. Charakteristisch ist folgende Geschichte über die Neugier der Matronen der alten Zeit. Damals mußten die unerwachsenen Söhne der Senatoren noch in den Senatssitzungen zuhörend mit anwesend sein, um zu lernen. Der kleine Papirius wird nun nach einer Senatssitzung von seiner Mutter ausgefragt: „Was ist da losgewesen?“ Der Knabe zuckt die Achseln: „Die Sache war wichtig und ich soll schweigen.“ Da wird die Mutter unendlich neugierig und dringt so sehr in den Jungen, daß er in seiner Not sie belügt. Er sagt, es wurde darüber beraten, ob es besser sei, wenn ein Mann zwei Frauen hat oder eine Frau zwei Männer. Nun gerät die Mutter in höchste Aufregung und bringt die Sache gleich bei allen Matronen herum, und bei der nächsten Senatssitzung erscheint eine Prozession von Frauen, die da flehen, man solle durchsetzen, daß eine Frau zwei Männer haben dürfe, nicht umgekehrt[11]; ein Aufzug, der Suffragettes würdig, die in London das Parlament zu bestürmen pflegten. Das Gelächter der hohen Herren vom Senat[S. 9] kann man sich denken. Das Auskultieren der jungen Leute in den Sitzungen aber wurde seitdem abgeschafft.
Man sieht an dieser Erzählung übrigens, wie die Frauen zusammenhielten, sich organisierten, sich als eine feste Gruppe im Staate betrachtet und als solche zur Geltung gebracht haben. Dafür gibt es der Belege noch mehr. Bringt der gestrenge Cato ein Gesetz gegen den übertriebenen Luxus der Frauen ein, gleich rotten sich alle Matronen zusammen, agitieren und bringen es so zu Fall. In der Kaiserzeit ging das so weit, daß sie geradezu einen Frauensenat bildeten, der also wohl auch regelmäßig Sitzungen hielt[12].
Bei den Griechen im Osten der damaligen Welt hatte sich das Hetärentum ausgebildet, d. h. während die griechische Hausfrau an die Enge der Häuslichkeit gebunden blieb, waren es freigeborene Mädchen, oft hoher Intelligenz und feinster gesellschaftlicher Bildung, die dem Verlangen nach freier Liebe genügten, aber zugleich den geistigen und künstlerischen Interessen der Männerwelt blendend und klug nachgingen. Sie erhoben sich zu Trägerinnen des Zeitgeistes. Dies berufsmäßige Mätressenwesen war aus der griechischen Welt natürlich längst auch in Rom eingedrungen. Aber die stolzen Ehefrauen Roms ließ das nicht ruhen. Sie waren diesen Personen durchaus gewachsen, und so fällt es uns oft schwer, wenn wir die römischen Liebesdichter lesen, die angebetete Frau von der Mätresse zu unterscheiden[13]; puella ist unterschiedslos ein Wort für beide. Das ist freilich das Recht der Poesie: im Weib, das man vergöttert, schwinden alle Unterschiede. Für den aber, der nach den gesellschaftlichen Verhältnissen fragt, ist diese Tatsache sehr anmerkenswert. Ist es nicht betrübend, erschreckend, zu sehen, wenn dem Dichter Properz von einem Freunde zugemutet wird, ihm die Liebe seiner hochgefeierten Cynthia zu verschaffen, und Properz dies Ansinnen nicht etwa empört zurückweist, sondern den Freund nur warnt: er werde mit der Launischen ebenso schmerzliche Erfahrungen haben wie er selber? Die Polyandrie der Frau galt als selbstverständlich, und die Eheflucht in[S. 10] der Männerwelt war ihr Komplement und ihre Voraussetzung.
Zur Tragödie steigert sich das in den Orgien Messalinas, der Gattin des Kaisers Claudius, deren Herrscherbild auf Münzen stand und die gar in den Kreis der frommen Vestalinnen aufgenommen war. Sie ist zum Typus weiblicher Unersättlichkeit geworden. Schließlich wagte sie es, als Gattin des Kaisers, als Mutter des kaiserlichen Thronfolgers, sich vor Zeugen und in festlichem Kreise mit dem schönen Silius trauen zu lassen. Der Kaiser, dieser „Kürbis“, war seit langem abgestumpft; er wollte auch das nicht bemerken. Die Hofbeamten, freigelassene Sklaven, waren es, die die scheinbar allmächtige Frau vornehmsten Geblüts aus dem Taumel schrankenlosen Genusses in den Tod zerrten. Sie wurde in den lukullischen Gärten von einem Tribun erdrosselt. Was aber war Messalinas Schuld? Ihre Schuld war nur, daß sie aus der Freiheit der Sitten der Zeit ohne Scham und Scheu die letzten Folgerungen zog[14]. Einst war Rom in Angst gewesen, daß Kleopatra aus Ägypten siegreich in Rom einziehen könnte. Kleopatra ging zugrunde, aber ihr blendendes königliches Laster zog mit fliegenden Fahnen dennoch ein, und es gelang den Römerinnen bald, die Königin zu überbieten. Denn das Überbieten war römische Eigenart. Der Römer blieb nie bei seinem Vorbild stehen.
Doch wir haben hier nicht den Sittenrichter zu spielen. Auch läßt sich vielleicht bei alledem noch nicht einmal behaupten, daß das Geschlechtsleben jener Zeiten gesetzloser war als etwa das heutige in Paris, Marseille, Neapel oder Rom. Die heutige Zeit versteht sich besser auf die Heimlichkeit und das Vertuschen, und das beweist zunächst nur einen Defekt an Ehrlichkeit.
Werfen wir also lieber auf die römische Frau selbst das Auge: so gilt in der Tat Schönheit als ihre erste Tugend. Und zwar war Venus das Ideal der Griechin, Juno dagegen das der Römerin. Junonisch, hochgewachsen, großäugig, reif, in sich gefestigt, streitbar, dazu grenzenlos temperamentvoll, so schildern uns die Dichter ihre Schönen. Der Putz aber ist ihr[S. 11] Hauptaugenmerk, und im Toilettenzimmer werden viele Stunden verbracht. Die Mütter halten darauf, daß ihre jungen Töchter als virgines schmächtig niedrige Schultern haben sowie durch starke Schnürung schlank erscheinen. Anders die Erwachsenen, und sie waren Virtuosinnen in der Kleidung. Ich rede dabei nicht vom Zahnpulver, nicht vom Schminken, Schönheitspflästerchen (splenia) und den künstlich verlängerten Augenbrauen — denn die zusammengewachsenen Augenbrauen galten als Schönheit —, auch nicht von den Masken aus weichem Brot, die dem Teint Zartheit geben sollten; denn von diesen Hilfsmitteln durften die Männer nichts wissen. Wohl aber ein lobendes Wort zur Frisur: denn die armselige Schablone der modernen Haartracht kannten damals die Frauen nicht, sondern jede Dame formte sich ihr Haar individuell, jede verschieden. Ein selbständiger Schönheitssinn waltete. Das breite Gesicht braucht über der Stirn den Haarknoten oder ein hohes Toupet, das schmale braucht den flachen Scheitel usf. Dabei war aber wieder künstliche Nachhilfe beliebt, und wie der dunkle Italiener noch heute für das deutsche Blond schwärmt, so kauften sich auch damals die Römerinnen das Blondhaar der Germanen. An Haarnadeln mit echten Perlen fehlte es nicht. Später wurde der Haaraufbau immer höher, turmartig, barock, und der Ungeschmack siegte. Wir sehen das u. a. an den Marmorbüsten der Kaiserinnen; bei manchen läßt sich das Haar wie eine marmorne Perücke abnehmen; denn die Büste sollte wie die Kaiserin selbst nach Belieben die Frisur wechseln können. Am feinsten urteilt Ovid, der nichts reizender findet als eine gewisse Nachlässigkeit der Frisur; wir sollen meinen, sie stamme noch von gestern und das Haar wäre nur leicht übergekämmt.
Und die Kleidung? Da ist vor allem dem Wahn zu begegnen, als ob die antiken Frauen sich in Weiß gekleidet hätten. Man glaubt heute eine Muse darstellen zu können, wenn man sich ein kalkweißes Bettuch malerisch umhängt. Für eine Iphigenie ist das annähernd richtig, aber nur sofern sie Priesterin[S. 12] war. Sonst spielen vielmehr alle Farben im frohen Wechsel, wofür uns die reizenden bemalten Terrakotten, vor allem aber die Wandgemälde Pompejis Zeugen sind. Das Kleid, die Tunika, wurde nur von gewissen Damen fußfrei, von den Hausfrauen dagegen wie ein Talar lang wallend getragen (stola). Unten war eine Falbel aufgesetzt (institum). Dabei waltet Rot und Gelb vor; das Blau tritt zurück; dann ist Grün beliebt, weil in ihm Gelb enthalten, sowie Violett, weil es am Rot Anteil hat. Vor allem griff man gern nach schillernden Stoffen. Nicht grelle, sondern mild gedämpfte, nicht schwere, sondern flimmernd spielende und gehauchte Farbentöne entzückten das Auge. Dazu kam dann der Umhang, der gern zwei Farben zeigt, z. B. rot an der Oberseite, gelblich das Futter; und immer hat das Kleid darunter andere Farbe als der Umhang. Nimmt man dann endlich noch die bunten Decken und Kissen hinzu, die bei Geselligkeiten auf den Sesseln liegen, so müssen wir über diese Farbenfreudigkeit staunen; aber sie ist durch das feinste Studium geregelt und symphonisch abgewogen. Übrigens wußten die blassen Damen, daß ihnen Schwarz, die negerhaft dunklen, daß ihnen Weiß am besten stand[15].
Die altmodischen Wollstoffe wurden allmählich durch feines Leinen (byssus) und Baumwolle (carbasus) verdrängt. Dann aber kam die kostbare chinesische Seide und schlug auch diese aus dem Felde. Die ebenso dreiste wie unkünstlerische Dekolletierung der Modernen, durch die Nacken und Büste unorganisch in der Mitte quer durchschnitten wird, kannte das ganze Altertum nicht, aber es entschädigte sich anderweitig. Netzartig durchscheinende Seidenstoffe wurden auf der Insel Kos gewebt, und in diesen koischen Gewändern in der Farbe des Porphyr bewegten sich wie in einer transparenten Wolke die Schönen der ersten Kaiserzeit. Die Seide war damals übrigens meist Halbseide. Kostbarer noch das goldgestickte Schleppkleid (cyclas), das, rings mit Akanthus bestickt, anscheinend wie eine Glocke stand und jedenfalls so schwer war, daß es beim Gehen Streifen im Sande zog. Die Damen des Hofes wie der Halbwelt[S. 13] trugen es. Und so trat also auch die Cynthia des Properz aus ihren Gemächern hervor in den Kreis ihrer Bewunderer, von exotischen Parfüms umwogt, in der Halskette schimmernde Edelsteine, zum Glück ohne Handschuhe, aber die Füße in feinen roten Lederschuhen, in denen ihr Gang sich lässig und weich bewegte.
Was ist Frauenbildung? Sie besteht nicht im Bücherlesen; sie besteht schon im Anstand allein, in der Kunst, sich selbst darzustellen, durch die heute eine schlichte Italienerin alter Rasse so manche deutsche Studentin schlägt. Diese Italienerin ist eben die Erbin antiker Kultur, und die Kultur ist in ihr Natur geworden. Wir hören, daß der Jüngling, der seiner Dame gefallen will, sein Haar mit Hilfe duftender Salben frisiert und vor allem sich eine sanfte und wie zögernde Gangart anerziehen muß. Man tritt eben nicht wie ein Briefträger in das Wohnzimmer. So gab es nun auch Vorschriften für die Frauen. Die Mädchen lernten es, schön zu lachen, sie lernten es, schön zu weinen. Keine Verzerrung der Züge, auch bei der heftigsten Aufwallung! Des Properz’ Geliebte ist „auch im Rasen noch schön“. Lange Nägel sind gefährlich; daher ist es Vorschrift, sie kurz zu schneiden. Und nur die schmale Hand ist schön. Hast du rundlich fleischige Finger, so gestikuliere nicht. Man zeige stets nur das Vorteilhafte.
Dem Properz aber schien alle äußere Eleganz an seiner Cynthia nur Tand und Flitter. Er weiß anderes an ihr zu rühmen. Zwar mit Handstickerei beschäftigte sie sich nicht; denn die wundervollen Stickereien des Altertums auf Teppichen und auf Gewändern in Kreuzstich oder Plattstich waren fast ganz oder ganz ausschließlich Sache der Männer; die Berufssticker hießen phrygiones. Nur spinnend und webend weilt Cynthia unter ihren Mägden und klagt ihnen dabei offenherzig ihr Liebesleid. Dann aber greift sie einsam zur Leyer und spielt und singt. Sie musiziert künstlerisch.
Das war damals (40–20 v. Chr.) etwas Ungeheures. Denn nur die Griechen waren die Musikanten des Altertums. Kein[S. 14] Römer singt öffentlich. Keiner der römischen Dichter, und selbst nicht Horaz, hat, soviel wir wissen, Musik zu schreiben verstanden. In Cynthia steht also die fortschrittliche Frauenbildung der Zeit vor uns. Die Römerin hat sich nunmehr der Griechin ganz gleichgestellt. Der Gesanglehrer sang vor und unterrichtete dabei mehrere Damen zugleich, die auf Lehnsesseln um ihn herumsaßen[16]. Später war es Kaiser Nero, der als Dichter, Sänger und Kutscher sich produzierte. Für den echten Römer war das ein Grauen, eine moralische Unmöglichkeit.
Aber Cynthia tanzt auch, und auch das war wieder etwas Neues. Horaz meldet mit Entsetzen, daß damals die Römerinnen Tanzstunden nahmen, und zwar im regelmäßigen Walzertakt (Ionicus). Properz hingegen bewundert es. So platzen die Ansichten aufeinander. Der Tanz des Altertums war eben kein Rundtanz, den wir heute auch im Halbschlaf tanzen. Er war Solotanz! er war ein Wagnis. Beim Gelage erhebt sich Cynthia und gibt vor den berauschten Blicken der Männer ein Schauspiel im bacchischen Stil, wie eine im Wirbel bewegte Mänadenstatue oder wie jene schwebenden Frauen Pompejis, die selbst noch als verblaßte Gemälde eine Wonne für unser Auge sind. Natürlich geschah derartiges nur im geschlossenen Raum, nur im Privatkreise.
Aber noch mehr. Cynthia dichtet: sie war Dichterin! und es gab noch mehr dichtende Frauen. Einige Versschnitzel weiblicher Herkunft sind uns sogar erhalten. Aber wir legen keinen besonderen Wert darauf. Denn wie sehr auch Properz, um den Horaz zu ärgern, die lyrischen Strophen rühmt, die Cynthia dichtete, sie sind doch vor den Oden des Horaz sofort verblaßt. Jedenfalls aber wird damit bewiesen, daß das Unternehmen des letzteren nicht ganz originell war[17]. Das Wichtigste aber ist, daß wir sehen, wie sehr sich allmählich der Interessenkreis jener Frauenwelt erweitert hat. Der Antonia schickt Krinagoras die Werke des Anakreon. Auch der Octavia, der Schwester des Augustus, wurden Bücher gewidmet, und sie[S. 15] war sogar die Gründerin einer großen öffentlichen Bibliothek. Auch auf Bildern sehen wir jetzt häufiger einsame Frauen als Leserinnen mit dem Buch. Ovid schreibt vor, daß, wer um das Herz der Mädchen wirbt, sich hübsch in Versen an sie wenden soll. Derselbe zählt uns die Liebesdichter auf, die die Mädchen besonders gern lasen. Für Properz aber ist es die Geliebte einzig und allein, deren „reines Ohr“ und heller Sinn über den Wert und Unwert seiner Poesie zu entscheiden hat.
Was wollen wir mehr? Wir fragen nicht, wie weit das Leben der großzügigen Frauen jener Zeiten gesetzlos war. Sie gehorchten ihrer Zeit. Aber sie haben viel getan. Denn an ihnen hat sich die grandioseste Liebespoesie entzündet, die die Weltliteratur kennt. Ich rede vor allem von Properz und Catull, jenen ungestümen Troubadouren, die da jede Zeile mit ihrem Herzblut schreiben, als rängen sie im Aufschrei und Sehnsuchtsruf um Leben und Tod. Die Frauen waren das Genie dieser Dichter; so wird uns gesagt. Mehr als das: die Frauen waren für sie auch das richtende, maßgebende Publikum. Was wäre der Troubadour ohne die Königin seiner Seele, die da den Preis der Liebe gibt, die also urteilt, die also an Intelligenz über ihrem Verehrer steht? Und die Minnedichtung des Mittelalters, die eigentliche Poesie der Troubadoure selbst, hat sich eben, wie wir wissen, an jene Augusteische Liebeselegie, von der ich rede, angelehnt und ist von ihr eine Fortsetzung und Weiterbildung gewesen[18]. Die Zeit des Augustus war monarchisch geworden, und ein einziger Herr, ein dominus, herrschte über die Welt. So kam eben damals der Sprachgebrauch zuerst auf, nun auch die Geliebte domina, Herrin, zu nennen. Daher die Donna, die Madonna der späteren Zeit. „Wie bist du meine Königin,“ so singt auch noch Brahms! Eine schwärmerische Huldigung des unterjochten Ichs! Die Frau rückt auf. Sie wird zur erklärten Herrscherin in der Welt des Dichters.
Eins aber fehlt damals noch fast ganz, die gelehrte Frau.[S. 16] Denn jene Frauen, so kunstgebildet sie waren, sie liebten den Aberglauben, und sie brauchten also das Wissen nicht. Eine Ausnahme macht hierzu, wenn ich mich nicht täusche, nur die fünfte Frau des Pompejus (sie hatte den Namen Cornelia, der uns so häufig begegnet); diese junge Frau, die geradezu den Typus der Studentin trägt, spielt in der Kulturgeschichte Roms eine bemerkenswerte Rolle, denn sie ist als diejenige Römerin zu merken, die tatsächlich zuerst fleißig Musik getrieben hat; aber sie war obendarein auch hochgelehrt, hörte bei griechischen Philosophen und trieb vor allem sogar Mathematik; das war mißliebig und in des Pompejus Bekanntenkreis nicht gerne gesehen. Dann taucht erst 150 Jahre später die gelehrte Frau von neuem bei Juvenal auf; und zwar stellt sie Juvenal mit der turnenden und fechtenden Frau zusammen. Vielleicht hat er damit so unrecht nicht. Nach Seneca ging die Emanzipation so weit, daß die Frauen auch mit um die Wette trinken; dann verlieren sie die Haare und bekommen Podagra[19]!
Der hämische Frauenspiegel, den Juvenal geschrieben, wirkt auf uns erschreckend, ein grausig verzerrtes Spiegelbild. Sein Weiberhaß hat alle naive Grazie des Lebens erdrosselt. Er argumentiert z. B. so: Die Rachsucht ist verwerflich, warum? weil alle Frauen rachsüchtig sind. Erhänge dich lieber, als daß du heiratest, ist daher sein Rat. Mit ihrem hoc volo, sic iubeo knebelt die Frau den Mann. Wie soll man noch eine erträgliche Person finden? Sie ist ein so seltener Vogel (rara avis). So wie Juvenal[20] denkt aber auch Publilius Syrus, der von der Bühne herunter ins Publikum ruft: „Ein Weib ist nur dann gut, wenn sie offen schlecht ist!“
So ist zu meinem Bedauern das laute Schelten wieder an unser Ohr gedrungen, das Schelten der griesgrämigen Moralisten und der nüchternen Sozialpolitiker, die sich in ihrem Tadel einig sind. Es erweckt schließlich unseren Überdruß. Haben wir nach anderen Tönen Verlangen und wollen die Frauen auch einmal inbrünstig loben hören, so müssen wir ihre Grabsteine aufsuchen.[S. 17] Denn die Vergangenheit ist wie ein Friedhof, und abertausende von solchen Steinen sind uns aus dem Altertum erhalten. Der trauernde Witwer ist es, der in der verstorbenen Gattin allerdings eitel Tugend sieht; das sagen uns die Inschriften auf den Steinen. Nach ihrem Tod erschallt ihr Lob. Daß sie treu, daß sie häuslich und fleißig war, das ist da allemal ihre Tugend[21]. Daß sie treu? Wir lesen es gern, aber wir wundern uns doch. Denn welcher deutsche Mann würde es heute seiner Frau wohl über dem Grab ausdrücklich nachrühmen mögen, daß sie die Ehe nicht gebrochen habe[22]?
Dann aber wenden wir uns zu Plinius, dem Zeitgenossen des Trajan und der Plotina, der kaiserlichen Philosophin. Wie viel liebenswürdiger als Juvenal urteilte damals Plinius, der uns in seinen Briefen so manches Stadtgeschwätz mitteilt! Rufin, erzählt er, ist so alt und dekrepid, daß er sich die Zähne von anderen putzen lassen muß; trotzdem hat eine junge, vornehme Witwe ihn geheiratet; man hat das beiden schwer verdacht; aber die junge Frau pflegt den Mann nun auf das rührendste, und er belohnt sie eben jetzt durch ein reiches Vermächtnis.
Die Ehre der Wittib schien damit hergestellt. Dem sei wie ihm sei, wir wissen aus eben jener Zeit von edlen Frauen genug, die einer solchen Nachsicht nicht bedurften, auch solchen, die mit ihren Männern wie Heroinen in der Verfolgung litten und starben. Berühmt ist die ältere Arria, berühmt das „Paete, non dolet“[23] in ihrem Munde. Vor allem an Willenskraft und Haltung hat es auch noch jenen Römerfrauen nicht gefehlt.
Ich fuhr über den Comer See, berichtet derselbe Plinius. Da wies mich ein älterer Reisegenosse auf eine Villa am Ufer hin. Ein Zimmer des Hauses ragte weit über den See. „Dort hat sich vor Zeiten,“ erzählte er mir, „eine unserer Mitbürgerinnen herabgestürzt.“ Warum? „Ihr Gatte war krank, mit Schwären behaftet; ärztliche Hilfe fehlte; sein Leiden schien schmerzhaft und unheilbar. Da beschloß sie ihn vor weiteren[S. 18] Qualen zu bewahren, band ihn an ihren eigenen Körper fest und stürzte sich von oben mit ihm in die Flut.“ — Wir zucken zusammen. Die Energie einer Barbarin! Plinius indes fragt nur: Ist dieses Weibes Opfermut etwa geringer als der Opfermut Arrias? Aber der Ruhm wird ungleich verteilt im Leben; denn die eine Frau war von Adel, die andere war namenlos.
In Rom ist eine Vestalin erkrankt und wird aus dem Atrium Vestae, dem Vestalinnenkloster auf dem Forum, entlassen und zur Pflege der vornehmen Fannia übergeben. Fannia war die Enkelin eben jener Arria, von der ich sprach. Die Krankheit war aber ansteckend; Fannia wird von ihr ergriffen und verfällt rasch dem Tode. An ihrem Sterbelager rühmt sie der nämliche Plinius: Welcher Verlust für unsere Gesellschaft, daß sie dahingeht! Zweimal hatte sie schon mit ihrem Gatten das Exil geteilt; da erscheint aus der Feder ihres Mannes ein Werk, das den Helvidius, den Vater Fannias, verherrlichte. Dieser Helvidius war ein Vorkämpfer der Sittlichkeitsbestrebungen jener Zeit und der großen stoischen Gemeinde Roms, war ein Widersacher erst Neros, dann auch Vespasians gewesen. Fannia selbst aber wird darauf vor Gericht gezogen und nimmt alle Schuld auf sich allein: sie hat den Gatten das Werk zu schreiben veranlaßt; sie hat ihm dazu das Material gegeben. Sie allein wird verbannt, ihr Vermögen kassiert.
Eine vornehme Vestalin wird unter Domitian verdächtigt, in Liebesverkehr mit etlichen Männern gestanden zu haben. Sie leugnet. Das Publikum glaubt an ihre Schuld. Der Kaiser selbst entzieht ihr jede Gelegenheit, sich zu verteidigen, greift kurzerhand auf die alten Satzungen Roms zurück und läßt die für schuldig gehaltenen Männer öffentlich zu Tode peitschen, die Vestalin selbst lebendig begraben; eine Tragödie im Stil der Antigone. Mit der stolzen Miene verkannter Unschuld ging die Frau in den Tod. Als sie in die offene Grube hinabstieg und ihre lange Schleppe am Grabesrand hängen blieb, wandte sie sich noch einmal um und nahm das Kleid sorglich zusammen. Der gemeine Henkersknecht wollte sie anfassen; da schnellte sie zurück[S. 19] und kehrte sich ab, als könnte seine Berührung ihre gottgeweihte Reinheit entehren. Alle Zeugen des Auftritts waren ergriffen. Wer konnte noch an ein „schuldig“ glauben? Das Publikum hatte den Eindruck des Erhabenen.
Wir aber wollen zum Schluß die Gedanken einer Kernrömerin aus friedlicheren Zeiten vernehmen. Es ist Cornelia, nicht die Frau des Pompejus, nicht die Mutter der Gracchen, sondern eine jung gestorbene Frau der augusteischen Zeit gleichen Namens, und es sind Gedanken, die diese Frau auf ihrem Sterbebette hegt. Da hören wir, wie sie stolz ist auf die Vornehmheit ihres Blutes, stolz auf das Ansehen ihres Bruders, stolz auf ihren eigenen, fleckenlosen Namen. Gleichwohl wendet sie sich voll Zartsinn an den Gatten Paulus: „Du sollst nun auch, da ich zu den Toten zähle, Mutterstelle bei unseren Söhnen und Töchtern vertreten und sie zärtlich auf den Arm nehmen. Küssest du sie, so füge auch jeden Morgen die Küsse der Mutter hinzu. Härmst du dich um mich, so laß doch die Kleinen deine Tränen nicht sehen. Die Nacht magst du mit Trauer um mich ermüden, und ich will kommen und will im Traum bei dir sein. Ihr aber, meine Kinder, sollt, wenn der Vater sich neu vermählt und eine Stiefmutter mein Lager besteigt, es ertragen, sollt es loben, was der Vater tut, und euch so verhalten, daß ihr das Herz der Stiefmutter besiegt. Lobt mich vor ihr nicht zu offen; es könnte sie kränken, wenn sie sich mit mir vergleicht. Bleibt aber der Vater ehelos und hängt nur mir an, auch wenn ich Asche bin, so bemüht euch, dem Verwitweten sein kommendes Alter zu lindern, und laßt ihn keine Sorgfalt vermissen. So viele Lebensjahre mir geraubt sind, um so viel länger möget ihr unter der Sonne wandeln, und wenn er auf euch blickt, soll Paulus Freude daran haben, alt zu werden!“
Wie natürlich, wie kernhaft, wie schlicht diese Frauenworte! Mit solchen Gedanken sterben edle Frauen und werden sterben zu allen Zeiten. In der „Königin seiner Elegien“ hat Properz diese Worte zusammengestellt.
[S. 20]
Motto: Ingeniosa gula est (Martial 13, 62).
Indem ich von Gastmählern zu handeln beginne, muß ich befürchten, die Erwartungen des Lesers auf das schwerste zu enttäuschen. Wer sich zu Roms Blütezeit, wer sich zu den sogenannten klassischen Völkern zurückwendet, pflegt dies aus idealistischem Bedürfnis zu tun; die Kunst der Alten ist in ihrer Vollkommenheit wie keine andere geeignet, uns zu läutern und zu erbauen, die Wissenschaft und Philosophie der Alten in ihrer naiven Klarheit wie keine andere, uns auf dem Wege zur Wahrheit zurechtzuweisen. Hier soll nun gleichwohl die Wahrheit auf sich beruhen bleiben und unser Kunstsinn soll darben. Wir greifen ins Alltägliche und fragen: Was haben jene klassischen Alten zu Mittag gegessen? und wie haben sie es getan? Das menschliche Leben ist wie ein Haus mit mehreren Stockwerken. Im Erdgeschoß wohnt die Moral; eine Treppe darüber die Wissenschaft; im obersten Stock, dem Himmel am nächsten, wohnt die Kunst; wir begeben uns heut ins Kellergeschoß, wo der Materialismus seine Küche und seine Weinschränke hat.
Eine Betrachtung über die Mahlzeiten der Alten ließe sich freilich sowohl in ästhetischer wie in wirtschaftlicher Hinsicht ausbeuten und vertiefen. Ästhetisch: denn wie wir schon aus unserem Schiller wissen, nicht nur Poesie, Plastik, Musik und der Tanz fallen unter den Begriff Kunst, sondern auch die Formen des Verkehrs selbst und der menschlichen Geselligkeit; ein Gastmahl gehört aber zur Geselligkeit und beansprucht und hat in jedem Falle schönheitliche Wirkung. Somit würde sich fragen lassen, inwiefern in dieser Beziehung die Alten hinter uns zurückstanden und inwiefern wir doch auch andererseits von ihnen lernen und unseren Kanon des Schönen erweitern könnten.
[S. 21]
Aber auch in das Licht eines größeren wissenschaftlichen Interesses ließen sich die mehr oder minder merkwürdigen Einzelheiten rücken, die wir zusammenstellen wollen: in das Licht nationalökonomischer Betrachtung. Von der Art, wie sich der Einzelmensch und wie sich ein Volk ernährt, ist seine Gesundheit abhängig, zunächst seine körperliche, dann aber auch seine geistige Gesundheit. Freilich paradox übertrieben und darum grundfalsch wäre es zu sagen, daß, wer nicht gut lebt, darum auch nicht gut lebt[24]! Jedenfalls aber muß ein Volk, das nicht Wert auf seine Speisen und auf eine gewisse Mannigfaltigkeit in der Ernährung legt, notwendig auch in seiner sonstigen Kultur auf niederer Stufe stehen. Die Früchte der geistigen Kultur brauchen, um zu gedeihen, einen materiell gut genährten Boden. Der Luxus kann so heilsam wirken wie der Wohlstand, der seine Ursache ist.
Wilhelm Roscher unterschied dereinst einleuchtend und mit Grund zwei Arten des Luxus, die sich zeitlich ablösen: den Luxus der roheren Zeiten, wie des Mittelalters, wo es zwar Prunk einzelner Großen, aber noch keine Gepflegtheit des Lebens gibt, welche größeren Teilen des Volkes gemeinsam wäre, und den Luxus entwickelter Kulturepochen, in denen jener Prunk zurücktritt und die Wohlgepflegtheit das Leben der Nation wirklich behaglich erfüllt. Derartig entwickelte Epochen sind einerseits unsere Gegenwart, etwa vom Zeitalter Ludwigs XIV. ab gerechnet[25], andererseits die römische Kaiserzeit. Die Aufgabe liegt nahe, beide Perioden aus volkswirtschaftlichen Gesichtspunkten zu vergleichen, die ähnlichen Erscheinungen auf ähnliche Ursachen zurückzuführen, hier und dort das Verhältnis des Luxus zum Nationalwohlstand nachzuweisen und danach die Frage nach der Dienlichkeit des Luxus, insbesondere des Tafelluxus zu erörtern.
An keine der beiden angedeuteten Aufgaben können wir indes hier herantreten. Denn es erfordert schon Zeit genug, von den Tatsachen selbst Kenntnis zu nehmen, auf die ich mich darum vorsätzlich beschränke. Die Vergleichungsresultate für[S. 22] das Einzelne wie für das Ganze werden sich dabei manchem stillschweigend von selbst ergeben. Sollte aber der ernste Ton, der mir Pflicht ist, im Verfolg hie und da in das Heitere umschlagen, so wolle man gelinde sein und Nachsicht üben: über gewisse Dinge kann eben auch der Ernsthafte nur mit Lächeln reden.
Die Periode des größten Luxus in Rom war die Zeit von Augustus bis zu Neros Tod, wie Tacitus ausdrücklich sagt. Hernach, seit Vespasian und Trajan, erfuhr er, so scheint es, erhebliche Einschränkung. Schon Cicero aß gut, und die Zeit des strammen Altrömertums, wo man sich bäurisch mit Bohnen, Rüben und steifem Gerstenbrei den Bauch füllte und alle Leute nach Knoblauch und Zwiebeln aus dem Munde rochen, war damals längst vorüber. Was billig ist, schmeckt nicht: dieser Grundsatz der Protzen kam schon in den letzten Jahren der Republik in Aufnahme, und der Staat sah sich damals veranlaßt, wiederholt Gesetze wider den Tafelluxus zu erlassen. Aber erst seit Caesar und Lucull beginnt dieser Luxus wirklich zu herrschen; damals beginnt die Einfuhr außeritalienischer Viktualien nach Italien und Rom im großen Stil. Wir beschränken uns im folgenden vorzüglich auf die Zeit von Caesar bis etwa Domitian.
Die Alten sind selbst schuld, daß wir uns um ihre Ernährung bekümmern. Warum reden sie so viel davon? Wenn ich die Quellen angeben wollte, aus denen die folgende Darstellung gewonnen ist, würde ich die meisten zeitgenössischen Autornamen zu nennen haben. Diese Schriftsteller zerfallen in zwei Klassen: die einen, wie z. B. Plinius, sind Stoiker von Gesinnung und berichten über alles nur mit bedeutendem Stirnrunzeln und in unverständig asketischer Tendenz; die anderen, geringer an Zahl, tragen den Epikur, der in ihnen steckt, ehrlich zur Schau. Epikur selbst war freilich nicht schuld, daß sich diese Feinschmecker der römischen Kaiserzeit gerade nach ihm benannten. Ihm war alle Übertreibung ein Laster, und auch seine Gegner bezeugen, daß dieser griechische Lebenskünstler[S. 23] von Wasser und Brot lebte und bestenfalls dazu etwas Käse nahm (griechischen Inselkäse von Kythnos).
Am ausführlichsten ist Petronius, der uns das Gastmahl des Trimalchio mit unvergleichlicher Komik geschildert hat. Allein wir können leider nur gelegentlich von ihm Gebrauch machen; denn die Absicht des Erzählers ist dabei lediglich, durch abenteuerliche Übertreibungen die Wirklichkeit zu überbieten; sein Held Trimalchio ist Libertin, Emporkömmling und Geldprotze, der noch gestern nichts war, der einen Lumpenhändler Echion, einen Steinmetz Habinnas und ähnliche dunkle Existenzen zu Gästen hat und sich von ihnen in albernster Weise huldigen läßt. Dabei sagt er ihnen ins Gesicht: „Gestern gab ich geringeren Wein und hatte doch viel bessere Leute zu Tisch, als ihr seid,“ und alles geht dabei möglichst verrückt und möglichst unfein zu.
Ebensowenig aber wie dieser Trimalchio dürfen auch gewisse andere Nachrichten, die man in früheren Zeiten besonders gern heranzog, über wüsten Luxus und Tollheiten einzelner, insbesondere einiger römischer Kaiser, für unsere Auffassung maßgebend sein. Im Ruf eines Vielfraßes stand so der Kaiser Vitellius; er nahm vier Mahlzeiten am Tag; sein Bruder gab ihm einen Ehrenschmaus, wobei 2000 Stück Fische, von den besten Sorten, und 7000 Stück Vögel die Tische belasteten. Vitellius ist in der Vertilgungskunst nur von dem halbbarbarischen König Mithridat übertroffen worden. Derselbe Vitellius stellte einmal ein Gericht zusammen, das in Rom lange unvergessen blieb, bestehend aus Leber von Makrelen, Pfauenhirn, Flamingozungen und ähnlichem. Caligula opferte täglich entweder Flamingos oder Trappen und Pfauen; das Beste von seinem Opfer verzehrte natürlich der Opfernde selbst. Elagabal aß Straußenhirne. Aesop, der große tragische Schauspieler, trank einmal eine köstliche Perle, im Wein aufgelöst, die Metella im Ohr getragen; derselbe ließ 6000 Singvögel, insbesondere Nachtigallen, auf einmal braten; das kostete ihn an die 20000 Mark. Solche Verrücktheiten und Barbareien bezeugen[S. 24] gerade dadurch, daß sie uns mit Entsetzen berichtet werden, daß sie vollkommen aus der Gewohnheit der damaligen Zeit herausfielen.
Noch sei hier aber an etwas Wertvolleres erinnert. Die Vorfahren von Davidis’ Kochbuch reichen weit ins Altertum zurück; das älteste Kochbuch war wohl das des Simos[26] um das Jahr 400 v. Chr. (natürlich in Versen). Diese ersten Lehrschriften betrafen zunächst die Zubereitung der Fische. Ein Epos derart fing mit der Zeile an, die den Anfang der Odyssee parodiert: Δεῖπνα μοι ἔννεπε, Μοῦσα, πολύτροφα καὶ μάλα πολλά. Leider ist dieser Vers in seiner parodischen Feinheit unübersetzbar[27]. Diese tiefsinnige Literatur wurde hernach immer häufiger, und unter des großen Schlemmers Apicius Namen liegt uns nun ein solches Kochbuch noch wirklich vor. Ein ähnliches Buch schrieb der Römer Matius. Ja, auch Frauen haben sich an dieser gastronomischen Schriftstellerei beteiligt; eine Charlotte Birchpfeiffer kann sich für ihre Taten auf Sappho berufen, eine Davidis auf jene Gnathaina, die gewiß nicht ohne Humor eine „Gesetzgebung für Gesellschaftsessen“, einen Nómos syssitikós verfaßt hatte, wovon man auf der großen alexandrinischen Bibliothek ein Exemplar wirklich aufbewahrte.
Das Altertum war sehr gastfrei, um so gastfreier, da das Gasthofswesen so wenig entwickelt war und man eleganter Speisewirtschaften entbehrte[28]. Um ein größeres Essen zu geben, mußte man sich nun vor allem klarmachen, wen man und wie viele man einladen wollte. Nur ja nicht zu viele, dies predigt uns Plutarch. Die Gäste dürfen ja nicht zu eng sitzen. „Lieber Mangel an Wein, als Mangel an Platz!“ Meistens, besonders in älterer Zeit, lud man nicht mehr als neun Personen (die Zahl der Musen). Die Zimmer faßten nicht mehr, und solche „Triklinien“ für neun Gäste sind aus Pompeji bekannt genug. Dies blieb also Regel, obwohl man in der Kaiserzeit sich auch besondere Eßsäle baute, die es möglich machten, in einem Privathause auch 27–36 Personen bequem[S. 25] zu vereinigen; die größte Zahl, von der wir hören, sind einmal 270 Personen an 30 Tischen. Plutarch sagt: „Wer selten einlädt, muß mehr Personen bitten, daher sei lieber öfter gastfrei.“ Und man war das in der Tat. Kam ein Auswärtiger nach Rom und hatte persönliche Beziehungen, so sah er sich sogleich zu Tisch gebeten. Die verhältnismäßig geringe Anzahl der Gäste aber ist bei der Würdigung des Tafelluxus der Römer immer gegenwärtig zu halten.
Sodann aber: wen laden wir ein? Plutarchs Weisheit hilft uns auch hier. Die Gesellschaft muß zueinander passen; bitte nur die zusammen, die sich miteinander gut stehen. Wer Großwürdenträger bittet, eine Zelebrität der Börse oder des öffentlichen Lebens, der sorge, daß auch die übrigen Gäste damit harmonieren. — Die Einladungsbilletts müssen rechtzeitig geschrieben werden. Man lernte sie künstlerisch abzufassen, und Beispiele davon zieren die antike Literatur. — Wichtig ist dabei auch, ob man Plätze belegen soll. Wir fragen denselben Plutarch um Rat; er urteilt hier wiederum mit Kennerblick. Man unterscheide Mahlzeiten mit guten Bekannten und steife Festessen; nur bei den letzteren sind Plätze zu belegen. Freilich dürfen wir nicht glauben, daß man etwa Zettel, daß man Tischkarten legte, wie wir es tun. Ein besonderer Sklave (nomenclator) war dazu da, jedem Gast seinen Platz anzuweisen.
Durch dreierlei aber unterscheidet sich eine antike Tischgesellschaft doch wesentlich von der unsrigen. Erstens konnte jeder Geladene stets auch noch sonst Freunde mitbringen, die nicht geladen waren; diese Ungeladenen nannte man Schatten, umbrae; sie waren höchst willkommen. Der Wirt mußte also seinen Küchenvorrat und seine Tischordnung immer auf solchen Zuwachs einrichten. War es doch alte Hausregel in Rom, daß stets auf dem Tisch noch etwas Eßbares übriggeblieben sein mußte, wenn er fortgetragen wurde.
Zweitens sind hier die sogenannten Klienten zu nennen. Unter Klienten versteht die Kaiserzeit die Unmasse derjenigen[S. 26] freien Einwohner Roms, die, ohne Beschäftigung, ohne Einkommen und Lebensstellung, sich von der Gunst und Freigebigkeit vornehmer Gönner und Schutzherren ernährten. Die Anzahl solcher schmarotzerhaften Existenzen, die sich an ein vornehmes Haus hängten und unter denen sich oft auch gerade die geistreichsten Leute, wie der Dichter Martial, befanden, konnte bis hundert, ja zu mehreren Hunderten anwachsen. Diesen Klienten nun lieferte der Patron ihr Mittagbrot, und zwar entweder ins Haus (es wird dann geschätzt auf etwa 13 Groschen pro Tag; dies Geld hieß „Sportel“), oder aber er zog auch einzelne von ihnen zu seiner Tafel. Die Klienten erhielten dann aber oft abseits einen besonderen Tisch angewiesen und bekamen geringere Speisen vorgesetzt. Darüber lesen wir manches bittere Klagelied: die Speisen schmeckten nach schlechtem Öl; es gab Tiberfisch, der in der Nähe der Kloaken gefangen war, zum Schluß nur einen schäbigen Apfel. Dazu dann noch der hochfahrende Ton der Bedienung! Aber auch abgesehen von diesen Nebenumständen erhält die antike Tischgesellschaft durch die Anwesenheit der Klienten eine wesentlich andere Physiognomie als die unsrige.
Drittens aber — und dies stelle ich nicht ohne einige Bestürzung fest — waren die Festessen zumeist nur Herrenessen. Daß auch Damen teilnahmen, wird selten erwähnt. Nur die Hausfrau mit den Kindern war öfter gegenwärtig, ja sie bekümmerte sich sogar bisweilen auch um die Bewirtung. Daß die Gäste ihre Frauen mitbrachten, war nicht häufig der Fall. Waren aber solche da, wie z. B. bei dem Priesterfestessen des Lentulus, an dem neun Männer und sechs Frauen teilnahmen, dann erhielten die letzteren ein besonderes Sofa für sich. Von einer „bunten Reihe“ wußte man also gar nichts[29]. Kein alter Schriftsteller schwärmt daher auch je von seiner Tischnachbarin. Dies ist es, was wir, wie gesagt, nicht ohne Enttäuschung wahrnehmen.
Verfügen wir uns ins Haus des Gastgebers. Wir setzen als Jahreszeit etwa den Herbst an. Denn Aristoteles sagt, ich weiß[S. 27] nicht, ob mit Recht: im Herbst ißt der Mensch am meisten. Schon tags vorher hat der Hausherr — denn die Frau des Hauses bekümmert sich in der Regel um diese Dinge wenig — die nötigen Anweisungen an seine Diener, insbesondere an den Aufseher der Tischbedienung gegeben, und schon früh am Morgen stellen die Hausdiener alles zurecht und decken den Tisch, d. h. aber ohne Tischdecke. Tischdecken, mit dem Zweck, die schöne Tischplatte zu schonen, wie wir sie im „Abendmahl“ Lionardos sehen, kamen etwa erst im zweiten Jahrhundert auf[30].
Der Hausherr selbst ist, nach der Gewohnheit, morgens etwa gegen 6 Uhr ausgestanden (nur Tagediebe wie Horaz standen erst um 10 Uhr auf); und schon so früh, um 6 Uhr, ist die Visitenstunde für die Klienten, die der Patron im Atrium empfängt. Erst gegen 9 Uhr nimmt der Herr das erste Frühstück (ientaculum), nichts weiter als Brot, Wein, Honig und etwas Käse. Dann folgt die Geschäftszeit bis 12 Uhr; wer gerade nichts Besseres vor hatte, der konnte die Geschäftszeit bis 4 Uhr nachmittags ausdehnen[31]. Gegen 12 Uhr aber regt sich der Hunger doch schon mit Macht; das zweite Frühstück (prandium), um 12 Uhr, war darum schon ziemlich nahrhaft; man nahm dazu, wie uns Plautus belehrt, auch aufgewärmte Sachen vom gestrigen Mittag. Dann, nach gestilltem Hunger, war man glücklich für ein Mittagsschläfchen (meridiatio!) reif; ganz Rom lag zwischen 1 und 2 Uhr tief im Schlafe; dies war eben die Stunde, in der Alarich Rom eroberte. Sodann aus der Schlummerecke ins Bad! Das Bad, zwischen 2 und 4 Uhr, schien keinem, dem Vornehmsten wie dem Geringsten, entbehrlich. Wenn man dann dem Kaltwasserbassin oder der warmen Dusche entstieg und noch etwas Ball gespielt hatte, brachte man zur Tafel die leckerste Genußsucht und einen herrlichen Hunger mit. Es ist inzwischen gut 5 Uhr geworden. Das Gastmahl kann beginnen.
Der Hausherr harrt natürlich seiner Gäste. Zeichen des ungebildeten Protzentums ist es, wenn Trimalchio sich erst dann[S. 28] in den Saal tragen läßt, wenn seine Gäste schon alle bei Tisch sind. Auch Kaiser Tiberius machte es übrigens nicht anders. Auch die aufwartenden Kellner, für jeden Gast mindestens einer, stehen bereit: schöne alexandrinische Pagen, dazwischen zur Abwechslung ein Mohr und ein gelber Indier. Das Haus hat zwei Eßsäle; der eine, für den Winter, liegt der wärmenden Sonne zugekehrt; der andere ist laubenhaft kühl und tief verschattet; ihn benutzt man in der warmen Jahreszeit. Denn Heizung fehlte. Die Wände im Saale sind mit köstlichen Vorhängen drapiert; es waren ohne Zweifel Gobelins mit bildlichen Darstellungen; sonst hätte man die Wandmalereien des Saales gewiß nicht mit ihnen zugedeckt[32]. Unter der getäfelten Decke hängen wohl auch frische Girlanden. In den Saalecken stehen die Kandelaber, mit Lämpchen reichlich behängt. Der Fußboden ist blanker Marmor oder festes, buntstrahlendes Mosaik. Fußteppiche gibt es nicht. Ein prächtiger Nebentisch (abacus) aus Bronze oder Marmor tut etwa die Dienste unseres Büfetts und trägt das silberne Trinkgeschirr, den Ruhm des Hauses.
Es fällt den Gästen nicht schwer, rechtzeitig zu erscheinen, wenn man nicht etwa vormittags ins Theater gegangen war, wodurch sich leicht alles verschob. Plutarch tadelt einmal seine Söhne, daß sie aus dem Theater zu spät zu Tisch gekommen sind, ganz außer Atem (τρεχέδειπνοι), was doch nicht einmal gesund ist. Sonst sorgt schon der Diener, der im Haus die Stunden ausruft und die Taschenuhr ersetzt, für Pünktlichkeit. Man kommt in Gesellschaftstracht; Toga und Schuhe oder Stiefel trägt man nämlich nur auf der Straße, und nicht einmal das; denn die Toga kam überhaupt ab. Zu Tisch geht man dagegen auf leichten Sandalen und in einem Tischrock (synthesis) aus grünem oder lila Kattun oder Seide; d. h. man geht eben nicht, sondern läßt sich in der Sänfte tragen. Man begrüßt sich endlich; man legt sich an seinen Platz. Jeder hat auch noch seinen eigenen Diener mitgebracht[33].
Man legt sich an seinen Platz? Ganz richtig. Es klingt zwar äußerst sybaritisch und scheint vor allem die unvernünftigste[S. 29] Raumverschwendung. Die Alten sitzen nicht, sie liegen beim Essen.
Vergegenwärtigen wir uns die Verhältnisse genauer.
Ausziehtische kannte man nicht. Es ist ein Unding, wenn wir heute 20–30 Personen um ein solches Rechteck herumsetzen, das zehnmal so lang wie breit ist. Wir reden wohl vom „Cercle“, vom „Gesellschaftskreis“ und von „Tafelrunden“, aber wir wissen diese Runde nicht zu verwirklichen. Die Alten hielten streng auf zentrale Anordnung, so daß bei der Tafel möglichst jeder jedem ins Gesicht sah, und sie hatten also entweder geradezu Rundtische, die tragbar waren und um die im Hemizyklium nicht mehr als etwa 8 Personen radial liegend Platz fanden auf einem Rundsofa, dessen Lehne nach der Tischseite zu hochgepolstert war (dies ist aus den ältesten Abendmahldarstellungen bekannt; man nannte dies Rundsofa auch Sigma, weil der Buchstabe Sigma die Halbkreisform hat); oder aber jeder Tisch hatte genau quadratische Form. Dies war die Regel, und er war alsdann an drei Seiten von Ruhebetten, Longchaisen, umgeben. Diese Lager hießen griechisch Klinen und danach der Speiseraum Triklinium, der Raum für die drei Klinen. Die vierte Seite eines solchen quadratischen Tisches blieb dagegen unbesetzt; an diese leere Seite trat von der Tür aus der Bediente, um die Gerichte aufzusetzen und wegzunehmen. Auf jedem der drei Speiselager können immer je drei Personen liegen; die Ehrenplätze sind auf dem mittelsten. An jedem Tisch liegen somit höchstens neun Personen, und es war also auch hier erreicht, daß jeder mit jedem sprechen konnte. Waren außerordentlicherweise mehr als neun Mitesser, so wurde an mehreren Tischen gegessen, also mehrere Zentren geschaffen. Kam noch ein unerwarteter Gast dazu, so mußte er im Notfall mit einem Stuhl vorlieb nehmen. Die Frauen saßen nur und lagen nicht, zum wenigsten in den Häusern, wo bessere Sitten herrschten.
Das Speiselager war nicht flach, sondern nach der Tischseite zu erhöht; man bestieg es von der Außenseite und lag[S. 30] nicht etwa der Tischkante parallel, sondern radial ansteigend auf das Zentrum des Tisches gerichtet, die Füße nach außen; man stützte dabei den linken Ellbogen auf ein loses Kissen, so daß der Abstand des Mundes vom Tisch recht groß war und es erhebliche Schwierigkeit gemacht haben muß, die Tischplatte zu küssen; denn auch dies kam vor[34]. Man hatte endlich zum Essen immer nur die rechte Hand frei. Dies ist vielleicht das bemerkenswerteste: die Römer waren Eßkünstler, wie es heut keinen gibt; sie mußten mit einer Hand essen.
Kaum liegen wir, wirklich ungemein behaglich, auf den purpurnen Pfühlen, die mit deutschen Gänsefedern gestopft sind (die Klinen selbst sind, wenn auch nicht massiv aus Silber und Gold, so doch kostbar mit Edelmetall oder Elfenbein inkrustiert), so kommen die Tafeldiener und waschen uns die Hände und wohl gar auch die Füße. Die Sohlen werden abgelegt. Dann folgt das Tischgebet (deos invocare), das nie fehlt, sodann vor allem erst ein Gläschen Glühwein (calda), möglichst heiß! Denn das Bad bekommt eben nicht, wenn man nicht solch heißen Schluck daraufsetzt. Und nun — nun kommt hoffentlich eine gute Fleischbrühe? eine kräftige Julienne? O nein, wir verrechnen uns. Hier stellt sich gleich ein bedeutendes Defizit der antiken Speisekarte heraus. Suppe gab es weder zu Anfang noch nachher (die berüchtigte spartanische Blutsuppe war nur ein Ragout, nach Art unseres Schwarzsauer, und auf das alte Sparta beschränkt). Ein römisches Essen fing eben ab ovo an; d. h. man verspeiste ein paar pflaumenweiche Eier zu Anfang.
Studieren wir etwas die Speisekarte. Eigentlich ist dies freilich unerlaubt. Die Speisekarte liegt immer nur in einem Exemplar auf dem Tisch, und zwar beim Hausherrn, der danach still und geheimnisvoll seine Befehle an die Dienerschaft gibt. Drei, vier oder auch fünf Gänge stehen uns bevor, jeder Gang aber zu sehr vielen Schüsseln. Der Gang heißt missus. Jede reichere Mahlzeit teilt sich vor allem in drei deutlich abgesonderte Teile: erstlich das Entree; zweitens die mittleren[S. 31] Gänge (oder Gang) mit den morceaux de résistance (man verzeihe die vielen Fremdwörter; ich winde mich, aber kann sie nicht vermeiden); drittens der Nachtisch. Nur der mittlere dieser drei Teile heißt eigentlich Mahlzeit, cena.
Die Speisefolge auszuwählen, haben Geschmack und diätetische Rücksicht zusammengewirkt. Denn die Ärzte des Altertums wandten der Diätetik und so auch den Tafelspeisen die allerhöchste Achtsamkeit zu. Beginnen wir mit dem letzten, so war der Nachtisch äußerst leicht: Nußtorte, Schokoladencreme, Schlagsahne (ἀφρόγαλα) fehlen gänzlich; man nimmt nur leichtestes trockenes Backwerk, wohl auch etwas Alpenkäse, den man schon damals besonders schätzte (caseus Vatusicus), griechische Mandeln, persische Wallnuß, rohes oder auch eingemachtes Kernobst, letzteres so „phäakisch“ schön, wie es der Süden damals gewiß, aber schwerlich noch heute erzeugt; dabei schloß man jedoch als zu schwer Pfirsich und Aprikosen aus. Daher heißt der Nachtisch bellaria, „nette Kleinigkeiten“.
In dem mittleren Teil der Mahlzeit, der eigentlichen cena, fanden sich die schweren Gerichte zusammen. Sonst hatte der Süden, auch schon in jenen Zeiten, starke Neigung zum Vegetarianismus; hier dagegen erscheint der Mensch als eifriger Carnivore; und zwar herrscht hier in ganz auffallender Weise das Schweinefleisch vor, das doch das fetteste und widerstehendste ist. Das Altertum nährte sich aber überhaupt vornehmlich vom Schwein. Das Rind, als Pflugtier, schlachtete man schon aus Pietät weniger; vielleicht galt aber sein Fleisch auch als minder lecker. Rindfleisch, „bubula“, erscheint mehr als Hausmannskost[35]. Daraus, daß man das Rindfleisch nicht kochte, erklärt sich auch, daß man keine Suppe hatte[36]. Von zahmen Tieren lösten übrigens gelegentlich Kalb, Lamm und Esel den Schweinsbraten ab; denn auch das Eselfleisch hatte seine Verehrer. Besonders beliebt war Schweinseuter und sodann der Eber, das Wildschwein. Beim Gastmahl des Nasidienus erscheinen außerdem noch Kranichbraten, Gänseleberpastete mit Feigen, vom Hasen nur die Vorderläufe (Keule[S. 32] und Rücken des Hasen schätzte man weniger) und Taubenbrüste; beim Prunkessen des Lentulus kommt ein Fischragout hinzu, Entenbrüste (man aß nur Hals und Brust der Ente), daneben Entenfrikassee, Hasen, gebratene Hühner, endlich eine Creme mit Stärkemehl. Beim Trimalchio erscheinen außer Schwein und Kalb Krammetsvögel mit Datteln und gebackenem Teig, überdies eine Pastete von Krammetsvögeln mit Rosinen, endlich gar für jeden Gast ein Masthuhn mit Gänseei[37], eine Zusammenstellung, die augenscheinlich mit Entsetzen von den Gästen aufgenommen wird.
Den Hasen erklärt Martial für seinen Lieblingsbraten[38], und darin folgte er offenbar dem Volksmunde; denn das Volk glaubte, wer Hasen gegessen hat, wird in sieben Tagen schön[39]. Woher dieser Glaube? Lateinisch lepus „der Hase“ und lepos „die Anmut“ sind ja fast dasselbe Wort; wer also den lepus aß, aß gleichsam die Schönheit selber[40].
Ganz besondere Sorgfalt verwendete man endlich aber auf den ersten Teil der Mahlzeit, die Vorspeisen. Dieser erste Gang (gustus, promulsis) wird planvoll aus leichten und vornehmlich aus kalten Speisen zusammengesetzt, und wir nehmen wahr, daß, je feiner das Essen ist, desto mehr Ausdehnung diesen leichten Einleitungsspeisen gegeben wird, so daß sie gelegentlich die eigentliche Mahlzeit an Zahl der Nummern weit überbieten.
Die Alten haben uns neben so vielen anderen Erkenntnissen auch die vorweggenommen, daß saure und scharfe Speisen Appetit machen. So wie wir also heute unsere Suppe pfeffern oder gar vor der Suppe Austern oder Kaviar mit Zitrone oder eine schwedische Schüssel, eine russische Sakuska geben, so bestand jedes Entree — deutsch „Voressen“ — in Rom regelmäßig aus solchen Gerichten wie Melone in Essig und Pfeffer, Latuk (besonders bekömmlich), sauren Gurken (das Ideal des Kaisers Tiber), ferner Oliven, Artischocken, Champignons, Sardinen, Salzfisch; aber auch Austern und anderen Muscheltieren. Der Austernpark des Lucriner Sees war berühmt durch Jahrhunderte. Dazu kamen dann bei glänzenderen[S. 33] Festen noch leichtere Fleischspeisen, dampfende Würste, ein warmer Fischgang wie Muränen, Weindrosseln, Feigenschnepfen, Hühnerpasteten. Froschkeulen dagegen fehlen noch, wie man sieht; ebenso fehlt noch die Schildkröte.
Soviel von der Speisenfolge, die an Umfang und an erlesener Mannigfaltigkeit es wohl mit unseren besten aufnehmen konnte. Ja, für den edlen Römer war es oft eingestandenermaßen eine heiße Arbeit, sich hindurchzuessen, und er verschmähte nicht, auf ausdrücklichen Rat der griechischen Ärzte hin, während[41] oder doch nach der Tischzeit sich durch Medikamente zu erleichtern, deren vulkanische Wirkung uns allerdings durchaus nicht ästhetisch erscheint. Man hatte eben damals weder Kaffee noch Liköre, womit wir heute dem überlasteten Magen zu Hilfe kommen. Hämisch sagt daher Seneca: vomunt ut edant, edunt ut vomant[42]. Übrigens fehlt es bei uns nicht an Leuten, die, um im Schlemmen fortfahren zu können, rasch etwas Natron nehmen. Bei den Römern dauerte ein großes Gesellschaftsessen nun aber sehr lange, bis 7, ja 8 Uhr; während des Essens wurden die Kandelaber mit Licht versehen. Der Genuß verteilte sich also auf gut drei Stunden; auch das war ein Umstand, der dem Magen seine Arbeit erleichterte. Nur steigerte sich leider die Hitze bei den qualmenden Lampen schließlich bis ins Unerträgliche. Ein vorsichtiger Herr wechselt daher während der cena neunmal das leichte Speisekleid zur ständigen Abkühlung; so gerät er nicht in Schweiß und braucht sich hernach auf dem Heimweg nicht zu erkälten[43]. Daher auch die vielen Salben und Parfüms, mit denen der Gastgeber die Tafelrunde zu erquicken für seine Pflicht hielt. Sie sollten offenbar vornehmlich dem üblen Geruch der offenen Öllampen entgegenwirken. Es gab aber auch sonderbare Käuze, bei denen man nicht satt wurde und die sich begnügten, ihre Gäste in solche Wohlgerüche einzuhüllen. Martial singt einmal:
Wir haben uns aber schwer gegen Geist und Geschmack des römischen Gastgebers versündigt, indem wir so lang und breit über seine Speisen reden. Zur Ehre jener sogenannten römischen Schlemmer sei es hervorgehoben, daß man in guter Gesellschaft über das Essen grundsätzlich nicht sprach. Wer dies tut, wie Nasidienus bei Horaz, macht sich damit nur lächerlich. Mäcenas geht wegen solcher Gespräche entrüstet vom Tisch. Man wußte jene Raffinaden stillschweigend zu schätzen und sich auch sonst vortrefflich zu unterhalten. Ja, die lange Dauer der Mahlzeit erklärt sich vor allem aus den langen Pausen, die das Essen unterbrochen und in denen man ausschließlich des Weines und der Unterhaltung pflog.
Denn in diesen Pausen entsprach der treffliche Wein seinem Zweck, Geist und Herz zu beleben, auf das beste, wenn schon man ihn natürlich stets nur mit Wasser gemischt trank; denn der südländische Wein war schwer wie heut der spanische. An die Bedienung wurden die größten Anforderungen gestellt; der Sklave mußte jedem durstigen Gast beim Mischen helfen. Dazu kühlte man den Trunk mit Eis oder Schnee. Eis und Schnee wurden in Gruben für den Sommer aufbewahrt. Sechsjährige griechische, fünfzehnjährige kampanische Weine pflegten um den Preis zu konkurrieren. Denn man bot meist mehrere Sorten zugleich an und griff dabei gleich anfangs, wo man noch am sachtesten trank, zu dem feinsten (Cäcuber, Chier, Falerner, Mareotiker, Massiker). Besonders eifrig trank man hinter dem Fisch; denn schon Trimalchio sagt: „Fische wollen schwimmen“ (pisces natare oportet). Ein guter Dessertwein wuchs bei Verona: es war der Lieblingstropfen des Tiber.
Eine Hauptpause trat vor dem Nachtisch ein. Sie war ernster Natur. Man spendete den Hausgöttern, indem man Salzkörner knisternd in die Flamme warf, libierte auf das[S. 35] Wohl des Kaisers und wünschte sich untereinander munteren Geist und dauerndes Wohlsein. In den übrigen Pausen war die Unterhaltung so lebhaft, wie es eben von Südländern zu erwarten ist. Hier besonders wurde der Stadtklatsch Roms ausgeschüttet, über Gladiatorenspiele und Zirkuskutscher mit Leidenschaft gestritten, mit großem Eifer aber auch das sogenannte gebildete Gespräch betrieben und geradezu systematisch ausgebildet. Gute Proben solcher Tischgespräche liegen uns noch vor. Man redet, fragt und rätselt über Götterlehre, Tierkunde, Grammatik, Medizin usw. Es bildet sich geradezu der Begriff des Tischgelehrten aus, und es war beliebt, einen Literaten mit zum Speisen zu laden, sei er auch nur Klient; der mußte sein Bestes geben[44].
Aber das meiste hat doch der Gastgeber zur Unterhaltung beizutragen; er sorgt für Tafelmusik (bald Chor, bald Orchester), er sorgt für deklamatorische Vorträge (so gab man die schmachtenden Frauenbriefe Ovids zum besten), er läßt gar ein Ballett aufführen (wir dürfen hier an die entzückenden Tänzerinnen Pompejis denken[45]), in einer anderen Pause Akrobaten auftreten, in einer dritten Leute, die einen Gesang aus der Ilias deklamieren; wieder in einer anderen öffnet sich oben die Saaldecke, und ein Regen von Blumen fällt auf die staunenden Gäste. Welche Ablenkung! welch anmutiger Zeitverbrauch, diese überraschenden Intermezzi! Und wie mundete danach wieder der nächste Gang! Schlimm war es nur, wenn der Wirt sein Manuskript holte und seine eigenen Verse vorlas. Würde doch lieber der Fisch darin eingewickelt[46]! Eine Überraschung, auf die sich alle vorauf freuten, fiel in die zweite Hälfte des Essens; hier wurden an sämtliche Gäste Geschenke mit Devisen verteilt; allerdings meist nur Kleinigkeiten, wie Pantoffeln, Eßsachen, Fliegenwedel, woran sich aber doch immer Heiterkeit und ungezwungene Scherze knüpfen mußten. Diese verschiedenen Tischunterhaltungen erzeugten für den Gastgeber natürlich nicht unerhebliche Extrakosten. Doch an solche unsinnige Verschwendung dachte man sonst nie, wie sie der Kaiser Verus beging,[S. 36] der die köstlichsten Gefäße, Maultiergespanne und ähnliches bei Tische verschenkte, so daß ihn sein Gelage, wie die märchenhafte Nachricht besagt, im ganzen an die 1200000 Mark in modernem Gelde kostete. Dies ist dieselbe Tyrannenmanie wie bei Nero, der bei einem für Freunde veranstalteten Gastmahl, wie man fabelte, für die Rosen allein über 900000 Mark vergeudet hat[47].
Erst jetzt, nachdem wir uns vergewissert haben, daß sich unsere Gäste gut unterhalten und daß sie dabei auch nicht zu platt und geistlos sind, jetzt können wir die Tischgesellschaft wohl einmal sich selbst überlassen. Unsere Neugier lockt uns aus dem Speisesaal; wir wollen unserem Wirt noch ein bißchen hinter die Kulissen sehen. Drei Fragen stellen sich von selbst ein. Erstlich: wie und von wo bezog man die Zutaten für die Mahlzeiten? zweitens: wie war die Zubereitung? und drittens: wie wurde das Essen aufgetragen?
Die Antworten müssen sich, da ich mich der Kürze befleißige, auch hier auf Andeutungen beschränken.
Einkäufe zur Mahlzeit mußten natürlich morgens gemacht werden. Während der ersten Hälfte des Tages herrschte auf den Märkten Roms (Fischmarkt, Gemüsemarkt, Schweinemarkt) und um die Verkaufsbuden der Geschäftsquartiere lautestes, buntestes Leben; vor allem aber am Tiberkai, dem Emporium. Hier führten Treppen aus gewaltigen Quadern zum Fluß hinunter, und da legten die Tiberkähne an, die aus Ostia, dem nahen, von Kaiser Claudius großartig hergestellten Handelshafen, die Waren des Auslandes in Massen flußaufwärts der Welthauptstadt zuführten.
Der Stand und der Betrieb der Kauffahrer, der mercatores, deren Frachtschiffe in Ostia löschten, hatte seit Caesars und Augustus’ Zeiten in ganz ungewöhnlichem Grade an Bedeutung und Rentabilität gewonnen. Die früher doch minder rege Nachfrage nach ausländischer Ware hatte in dem Grad in Rom zugenommen, daß man schon kaum noch etwas auf den Tisch nahm, das sich nicht nach einer fernen Meeresküste[S. 37] benennen ließ. So bezog man ja das Korn selbst von außen. Nach Alexandrien konnte der Kauffahrer in neun bis zehn Tagen, nach Spanien in sieben Tagen fahren, und er brachte aus Spanien Wein, Öl, Honig, Salzfische, Quittenmarmeladen, aus Gallien das beste Schweinefleisch (besonders gallischen Schinken), aus Afrika Perlhühner, Artischocken. Nach einem Kaufmann Mattius hießen die importierten Mattianischen Äpfel. Ägypten lieferte die besten Datteln, es lieferte den Majoran, es lieferte die Flamingos. Aus Indien brachten alexandrinische Schiffe Pfeffer, Zimmet, Kardamom und den Ingwer, der besonders zu Würsten gebraucht wurde. Die besten Mandeln kamen aus Naxos, Damaszener Pflaumen aus Damaskus. Ebenso aber waren Fische von den fernsten Küsten erwünscht; „die Gurgeln Roms fischen alle Meere leer,“ ruft Juvenal; der Fischmarkt war unter allen Märkten der belebteste und interessanteste, wie noch heute in den Küstenstädten des Mittelmeeres.
Für die Kultur Italiens in Flora und Fauna sind die Folgen der so wachsenden Tafelbedürfnisse äußerst günstig gewesen. Erst damals wurde eine Reihe von Obstsorten, wie die Kirsche und die Bergamotte, in Italien gepflanzt, erst damals die Flora daselbst mit einer Reihe von Kräutern, wie die Petersilie (petroselinum) bereichert. Die Zitronen- und Orangegärten hat freilich erst das Mittelalter gebracht. Die römischen Großgrundbesitzer suchten ihren Küchenbedarf nach Möglichkeit selbst zu befriedigen. Darum führten sie z. B. auch damals die Fasanenzucht in Italien ein (vom Fluß Phasis in Südrußland, phasiani); damals kam der Pfau dorthin; man zog und mästete die Pfauen und anderes Geflügel im größten Stil. Eine merkwürdige Manie besaßen die Römer für Tauben und großartige Taubenhäuser (columbaria), die bis zu 5000 Vögel und mehr enthielten[48]. Zur Zucht des Wildschweines dienten die endlosen Eichen- und Buchenwälder der Latifundien. Dazu die Schneckenzucht! Am bekanntesten aber sind vielleicht die piscinae, die Fischteiche, der römischen Villen am[S. 38] Meer, die mit Seewasser gefüllt und in denen die seltensten Sorten zu finden waren. Der Name einer vornehmen Familie stammte daher: die Lucinier nannten sich Murenae; die Zucht der Muräne war ihr Ruhm[49].
Wir Deutschen sind uns meist nicht bewußt, wie viele Ausdrücke der Küche und der Speisezutaten und Würzen unsere Sprache dem römischen Altertum verdankt; in dieser sprachlichen Entlehnung spricht sich aus, daß Nordeuropa und Germanien diese Dinge eben von der antiken Kultur unmittelbar empfangen hat. Um von den Kapaunen (capones) und Fasanen (phasiani) nicht zu reden, so haben wir von den Römern, wie der Wortlaut selbst zeigt, Spargel (asparagus) und Lattich (lattuca), Kohl (caulis), Kappes (caputium), Linse (lens) und Wicke (vicia), Kürbis (cucurbita), Rettich (radix), Zwiebel (cepula, cepulla), Bete (beta) und Kümmel (cuminum), Petersilie, Lavendel, Melisse, Polei, Anis (anisum) und Fenchel (feniculum), Kapern, Koriander und Kerbel (caerefolium) erhalten; und so geben uns diese deutschen Wörter, indem wir sie nennen, einen Einblick in den reichen Küchengarten des Altertums selber. Dazu kommen dann noch Senf (sinapis), Pfeffer (piper), Zimmet (cinnamomum) und andere importierte Zutaten. Die Römer haben uns gleichsam vorgekostet, und der moderne Genußmensch ist — auch wider Willen — ein Erbe des klassischen Altertums, selbst im Alltäglichsten.
Für Eßvorrat ist gesorgt; es fehlt die Bereitung. Wollen wir uns getrauen, auch noch in die Küche einzudringen? „Küchendunst“ ist ein Wort, das Plautus als Schimpfwort verwendet, um einen unangenehmen Menschen zu bezeichnen. In der Küche aber werden wir genug Küchendunst finden! Vielleicht genügt es uns hier, nur einmal durch die Türritze geschaut zu haben. Nicht etwa, daß uns die Köchin vertriebe. Denn die Köchin, der Augapfel unserer deutschen Hausfrauen, war damals noch eine gänzlich unerfundene Größe (wie überhaupt weibliche Bedienung). In der Küche herrscht der Koch mit seinen Küchenjungen. Er ist der Liebling seines Herrn,[S. 39] er ist in seinem Tagewerk ein wahrer Tausendkünstler, und nichts wurde darum dankbarer begrüßt, als wenn man an den Saturnalien, d. h. zum großen Geschenkfest im Dezember, unserem Weihnachten, einen guten Koch geschenkt bekam. Ein guter Koch kostet im Sklavenhandel halb soviel wie ein guter Schauspieler. Sein Reich, die Küche, ist ein Raum von den größten Dimensionen; Plinius sagt übertreibend, zwei Morgen Landes genügten kaum für eine Küche! Küchengeräte aber hat uns in Mengen Pompeji erhalten: Eimer und Kessel und Kannen, Schnellwagen, Schöpflöffel, Schaumlöffel, Löffel zum Bratenbegießen, Kasserolen, Pfannen zu Spiegeleiern, Durchschläge u. a. m. Wer im Neapeler Museum war, wird dies in anmutiger Erinnerung haben.
Um nun die Leistungen des Kochs einigermaßen zu würdigen, müssen wir uns wenigstens dies gegenwärtig halten, daß er erstlich keinen Zucker hatte; Zucker wurde durchweg mit Honig ersetzt; zweitens, daß er auch keine Butter verwenden konnte (die „Butter“ des Altertums war augenscheinlich noch erheblich von der unsrigen verschieden), daß er vielmehr, wie noch heute in Italien geschieht, feines Öl an ihre Stelle treten ließ. Das Fleisch wurde übrigens meistens nur in seinem eigenen Fett gebraten, und dies ist der Grund, weshalb man die Mästung aller Tiere mit so grausamer Energie betrieb. Ferner fehlt in seinem Küchenapparat auch die Zitrone[50]. Sehr verschwenderisch ist er dagegen mit der Zwiebel; nicht nur Hasen brät er in Zwiebeln, sondern kocht sogar auch die Spargeln damit.
Ein Hauptprinzip des römischen Kochs, dessen Durchführung uns wirklich mit Bewunderung erfüllen muß, war ferner: jedes Tier kommt womöglich ganz und unzerlegt aufs Feuer. Vorschriften hierfür erhalten wir schon aus der Zeit des Aristoteles. Aber dies war ein kostspieliges Verfahren[51]. Der Kaiser Domitian beruft bei Juvenal c. IV seinen Reichsrat eigens wegen eines enormen Steinbutts, der bei Ancona gefangen ist; er kostet so viel, daß man auch den Fischer selbst dafür[S. 40] hätte kaufen können, und der Reichsrat beschließt: „Er wird nicht zerschnitten, er darf nicht zerschnitten werden: es muß ein Extratopf gebaut werden.“ Aber auch die Eber wurden so ganz gebraten; der Bratspieß glüht, mit dem der Koch das Schwein durchstößt: so dringt die Glut in alle Teile des Fleisches[52], und so gebraten wurde es dann in einer Riesenwanne in den Speisesaal getragen. Solche Schüssel konnte allein 64 Kilogramm wiegen[53].
Genie und Findigkeit konnte der Koch dagegen erst entfalten, wenn er seine so vortrefflichen Brühen, Farcierungen nach Art unserer Würste und gar die verschleierten Gerichte bereiten durfte, die, fein gehackt oder doch in Sauce gelegt, die Neugier erregen und durch scharfe Würzung überraschen, beispielsweise Schweinenetz mit Trüffeln oder Hachés von Champignons und anderen Pilzen; die Spanferkel mit Datteln gestopft; Geflügel mit Oliven gefüllt. Beim Anrichten entfernte er aber die Füllung wieder, und nur der feine Geschmack blieb davon zurück. Allein für Hasenbraten und Hasenragout bringt uns Apicius nicht weniger als dreizehn verschiedene Rezepte; für Schweinefleisch hatte man fünfzig verschiedene Bereitungsformen. Ein Koch konnte mit einem Kürbis, den er siebenmal verschieden vorsetzte, ein Daueressen bereiten, und keiner erkannte, daß es derselbe Kürbis war. Daher prahlt Trimalchio von dem seinen: „Er macht auf Verlangen aus Schweinseuter einen Fisch, aus Pökelfleisch eine Taube, aus einem Hüftknochen eine Henne! Es gibt keinen kostbareren Menschen!“
Soll ich fortfahren und etwa noch die leckeren Bratwürste rühmen, mit Piniolen gestopft? die vielerlei Kompotts? das Mandelbrot oder Marci-pan? Begleiten wir die fertigen Speisen vielmehr in den Speisesaal. Alle Schüsseln eines Ganges werden vom Diener jedesmal auf einer großen Platte oder Repositorium, ursprünglich auch ferculum genannt, auf den Eßtisch gesetzt; hat man zugelangt, so nimmt er Repositorium und Schüsseln zugleich wieder fort. Diese gewaltige Setzplatte war aus Silber, so wie alle Schüsseln. In den vornehmen[S. 41] Häusern, von denen wir reden, wurde nur Silber gesehen; Glas mißfiel[54]. Der bekannte Hildesheimer Silberfund gibt uns Anschauung von solchen Schüsseln[55], und das Service (lat. ministerium) war somit etwa das Kostspieligste bei einer römischen Mahlzeit. Die Braten sind auf das geschmackvollste angerichtet und aufgeziert. Bei Fasanen und Reihern bleibt der Kopf in den Federn. Einige Speisen, wie die Bratwürste, kommen auf einem zierlichen Feuerbecken noch quillend und brodelnd auf die Tafel. Auch Statuen aus gebackenem Teig überraschen das Auge. Pasteten zeigen Muschelform; solche Pastetenformen sind uns in Pompeji erhalten.
Am Nebentisch aber entfaltet eine der bedeutendsten Persönlichkeiten beim Gastmahl seine Tätigkeit; dies ist der scissor, der Vorschneider. Es wird uns einmal sehr schwungvoll geschildert, wie das Messer in seiner Rechten saust, er selbst aber die allergraziösesten Posen einzunehmen weiß und tänzelnd seine höchst verantwortliche Aufgabe löst: denn er muß jeden Knorpel vermeiden und ausschalten und darf dabei doch nur ganz winzige Stückchen schneiden, nur Häppchen, so groß wie ein Mund voll (offa). Daher hieß ein solcher Mann Carpus, weil er das Fleisch „zerpflückt“. Der berühmteste Vorschneider Roms aber war Trypherus; er machte Schule, und man übte sich im Zerlegen an Holzmodellen. Warum aber, fragen wir befremdet und mit Recht, warum darf Trypherus vom Braten keine großen Scheiben schneiden, nach denen doch der Ehrgeiz jedes modernen Zerlegers steht? Warum diese das Auge enttäuschende Zerstückelung des kostbaren Materials in lauter kleine „Bissen“?
Auf diese Frage lautet die unerbittliche Antwort: weil man mit den Fingern ißt. Man hatte zum Essen weder Teller noch Gabel, noch Messer. Man hatte ja auch beim Liegen nur die eine rechte Hand frei! Also an Zerschneiden des Fleisches war für den Speisenden selbst gar nicht zu denken. Einen Zahnstocher hatte man freilich; der aber wurde nur in den Pausen benutzt.
[S. 42]
Irre ich nicht, so hat, wer dies liest, über unseren alten Tischgenossen sofort den Stab und vielleicht schon mehr als einen Stab gebrochen. Aber versuchen wir etwas gerecht zu sein, damit wir den Gegenstand unseres bisherigen Interesses nicht gar mit einem unbegründeten Unwillen und üblem Nachgeschmack verlassen.
Wir bedienen uns jetzt sogar für das Spargelessen eines Instrumentes; wir essen sogar den Fisch nicht mehr mit Hilfe des Brotes. Und ein so feiner Weltmann wie Kaiser Otho hätte wirklich mit der Hand ins Frikassee gelangt? Mit der Hand hätte ein Augustus die Rehkotelette aus der Schüssel geholt? eine Agrippina die Endivien mit den Fingern zum Munde geführt? Freilich, so ist es. An Kaiser Justinian, der immer nur wenig aß, fiel auf, daß er das Essen nur mit den äußersten Fingerspitzen faßte; das heißt eben, die anderen machten es anders. Und man mußte sich vorsehen; man durfte nicht zu gierig zugreifen, sonst verbrannte man sich[56]. Denn das Messer war freilich sehr bekannt, und wie schön der scissor seine Klinge zu führen verstand, sahen wir vorhin. Aber man scheint nur gelegentlich darauf verfallen zu sein, auch einmal jeden der Gäste damit zu bewaffnen; dies sollte eben späteren, erleuchteteren Zeiten vorbehalten bleiben. Die Eßgabel sodann war damals überhaupt noch nicht erfunden; es existiert auch gar kein lateinisches Wort dafür. Denn furca (Forke) ist die Mistgabel. Und endlich Löffel hatte man zwar; die üblichsten Löffel waren klein; sie hießen cochlearia; allein sie dienten, wie schon ihr Name angibt, lediglich für Muscheltiere, daneben auch noch zum Eieressen. Größere Löffel, ligulae, waren allerdings auch vorhanden; sie werden aber selten erwähnt und dienten wohl nur zu gewissen Mehlspeisen[57]. Vergessen wir nicht, daß das ganze Mittelalter, ja daß auch noch die so hochgebildete Renaissancezeit nicht viel besser daran war; auch beim Abendmahl Lionardos und sonstigen Darstellungen gedeckter Tafeln aus jener Zeit fehlen noch die Eßinstrumente ganz oder fast[S. 43] ganz, und nur das Salzfaß steht da, das auch auf keinem antiken Eßtisch fehlte.
Nun wohl, Fleisch und Gemüse ließen sich schließlich auch mit der Hand anfassen. Wie aber aß man die Speisen mit Aufguß, die köstlichen Fischtunken? Man tunkte eben direkt den Finger hinein, und zwar alle in dasselbe Gefäß; oder aber, wenn man umständlicher sein wollte, so tunkte man die Brühe mit Brot auf. Die Folgen, die solcher Gebrauch der Hand nach sich ziehen mußte, habe ich wohl nicht nötig auszumalen. Bezeichnend genug, daß einmal Ovid in seiner Ars amandi den Mädchen, welche gefallen wollen, unter anderem auch den Rat gibt, sie sollen sich bemühen, hübsch sauber zu essen und sich vor allem nicht mit der fettigen Hand ihr liebliches Angesicht beschmieren.
Dies sind schlimme Tatsachen; allein es wäre, wie gesagt, ungerecht, wollten wir nicht zugleich auch zur Entschuldigung folgendes mit in Erwägung ziehen.
Der Reinlichkeitstrieb, durch den sich die klassischen Völker doch sonst so ganz besonders auszeichnen, hat das Altertum auch in diesem Falle nicht verlassen können. Man genügte diesem Triebe, so gut es eben anging, durch eine Reihe von Hilfsmitteln.
Hinter jedem Gericht wusch man sich allemal aufs neue mit Hilfe des Pagen die Hände. Was Mund und Angesicht betrifft, so hatte man zu ihrer Säuberung ganz so wie wir Mundtücher oder Tellertücher, mappae; sie waren natürlich schon gleich nach einer Mahlzeit durchfeuchtet und fettgetränkt und mußten in die Wäsche oder wurden weggeworfen. Auf dem Armpolster hatte der Schmausende diese Tücher neben sich liegen, nachdem er sie entweder selbst mitgebracht oder nachdem der Wirt sie an seine Gäste als Geschenk ausgeteilt hatte. Servietten waren eines der billigsten und häufigsten Festgeschenke in jener Zeit. Denn jeder brauchte sie eben täglich neu. Daher auch die Serviettendiebe, eine ganz besondere, elegante Abart von Gelegenheitsdieben im Altertum, die auch gerade in der besseren Gesellschaft sich vorfanden. Offenbar[S. 44] waren die Tücher noch nicht „gezeichnet“ wie bei uns und luden dazu ein, den Eigentümer zu wechseln. Eine Verhöhnung des Gastes aber war es, wie Horaz bemerkt, begreiflicherweise, wenn der Wirt ihm ein schon einmal gebrauchtes Mundtuch anbot. Dies also der Zweck der Reinlichkeit. Aber dieselben Tücher ließen sich auch sonst verwenden; man pflegte beim Nachtisch Näschereien und Konfekt darin einzuwickeln und für die Kinder mit nach Hause zu nehmen — ganz so, wie es ja auch noch unsere sorglichen Hausmütter und Hausväter bisweilen tun. Denn sogar auch der Sklave zu Hause erwartete zum mindesten ein paar Äpfel; sonst empfing er seinen armen Herrn mit Brummen[58].
Aber damit noch nicht genug; zur sofortigen Säuberung der doch stets benetzten Finger standen drittens noch große Massen weichen Brotes in silbernen Brotkörbchen jedem zur Hand. Oder die Pagen liefen mit solchen Körben herum und boten an. Unausgesetzt trocknete man sich die Finger im Brote. Dabei konnte freilich ein anderer Übelstand nicht wohl ausbleiben: daß die so benutzten Krumen vielfach nieder zur Erde und auf den Mosaikboden fielen. Aber auch für diesen Mißstand war bis zu einem gewissen Grade gesorgt. Denn waren nicht etwa Hunde im Saal, was häufig vorkam, die sich den Fraß nicht entgehen ließen[59], so fegte ein Sklave das Nebenhergefallene zwischen jedem Gang mit schönen Besen aus Myrten oder mit Palmblättern hinaus, oder es kam auch vor, daß dieser Sklave die ganze Tischzeit aufsammelnd unter dem Tische zu sitzen hatte! Man nannte das Aufgesammelte die analecta. Aber vieles blieb auch ruhig liegen. Ein herrlicher mosaizierter Fußboden, der aus einem antiken Eßsaal in Rom selbst stammt, ist erhalten und in Rom im Lateran aufgestellt[60]; in diesem Mosaikwerk sind auf das naturgetreueste und ergötzlichste die analecta selbst dargestellt, wie sie bei einem antiken Gastgelage tatsächlich auf dem Boden herumlagen: Fischgräten, Krebsbeine, abgenagte Weintrauben, Muscheln und Nußschalen, Salatblätter, ein Hahnenfuß, sogar ein regelrechtes[S. 45] „Ziehbein“. Ein klassischer Realismus! Wir möchten uns bücken, um es aufzulesen, und haben den Eindruck, als hätte das Essen erst gestern stattgefunden.
Ich will hier nicht unerwähnt lassen, daß auch zwei allen sehr wohlbekannte Stellen unseres biblischen Textes durch das zum Schluß Vorgetragene erst ihre nähere Erläuterung erhalten. Die Brosamen, die von des Herrn Tische fallen, von denen das Gespräch mit dem kananäischen Weibe redet, sie sind eben jene Brosamen, welche wir soeben die Hunde oder den Sklaven unter dem Tisch auflesen sahen; es sind die Analekta der antiken Gastgelage. Und wenn Jesus beim Ostermahle eigentümlicherweise den Judas Ischarioth als seinen Verräter mit den Worten bezeichnet: „Der mit mir die Hand in die Schüssel taucht, der wird mich verraten,“ so wird dies gemeinsame In-die-Schüssel-tauchen der Hände eben nur durch das Fehlen des Löffels bei den Mahlzeiten der alten Völker verständlich, über das wir geredet haben.
Wir haben nunmehr hinlänglich gesehen, sowohl was die Alten bei ihren Gastmählern aßen als auch wie sie es aßen. Was die ästhetische Beurteilung betrifft, so muß ich befürchten, daß alle sonstigen Vorzüge die zuletzt festgestellten Mängel in unserer Vorstellung nicht auszulöschen vermögen, weder Rosenflor noch Silbergeschirr, noch Tafelmusik, noch die geistreichste und gebildetste Tischunterhaltung. Fassen wir sodann aber den römischen Tafelluxus als solchen ins Auge, so hat er, so reich und so fein durchgebildet er auch war, doch den Tafelluxus unserer Neuzeit, wie er in den großen Hauptstädten und Kulturzentren Europas oder Amerikas im Schwange ist, gewiß in keiner Beziehung übertroffen, und wir werden anstehen, eine Meinung zu teilen, die aus ungenügender Kenntnisnahme der Tatsachen sich herleitet, als zählten für den Untergang der römischen Kultur die Schmausereien und Schlemmereien der Vornehmen mit zu den wesentlichen Ursachen. Daß der Koch in Rom sein Geschäft verstand oder daß durch den lebhaften Handel die schöneren auswärtigen Erzeugnisse auf die[S. 46] Tafel kamen, kann doch, wie sehr auch darüber die zeitgenössischen Stoiker, ein Plinius oder Seneca, sich ereifern, bei unbefangener Betrachtung nur als Vorteil gelten. Wer macht es einer Familie des deutschen Mittelstandes zum Vorwurf, daß sie zu einem gewöhnlichen Frühstück ostindischen Tee nimmt, westindischen Zucker und englischen Käse, vielleicht sogar ein Gläschen spanischen Wein und ein Brötchen mit russischem Kaviar? Nur wenn Deutschland wie eine Festung vom Feinde zerniert ist, müssen wir uns all dies grollend versagen. Roms Herrlichkeit ist an ganz anderen sittlichen und sozialen Schäden zugrunde gegangen. Wenn je die frugalen Ostasiaten es dahin bringen sollten, unsere moderne europäische Kultur zu überwinden, so wird man doch auch hoffentlich dafür nicht die gute Küche als wesentliche Ursache betrachten, durch die gerade das tüchtigste Bürgertum bei uns (man denke an Hamburg) sich hervortut.
Es ist inzwischen 8 Uhr geworden. Das Gastmahl, von dem ich geredet habe, ist zu Ende, und die Zecherei, die comissatio, das Symposion, hat schon begonnen, das sich unmittelbar anschließt. Die Herren haben Kränze aufgesetzt, und es ist schon so lustig, so ausgelassen an der Tafel, daß die Frau des Hauses, die den Nachtisch noch mitgenoß, sich taktvoll entfernt hat. Es dürfte für uns geraten sein, es ihr nachzutun. Freilich werden wir dann in den so mannigfaltigen griechischen Trinkkomment mit all seinen lustigen Kniffen und Pflichtleistungen nicht eingeweiht — denn ein Präside oder Thaliarch fehlt nicht —, und es entgeht uns die so wünschenswerte gründliche Kenntnisnahme der griechisch-römischen Weine und der Bowlen! Denn auch diese verstand man für die Symposien zu brauen: Bowlen von Pfirsich, Bowlen von Aloe, Ysop, Salbei, Bowlen von Narde, von ätherischen Ölen, unter denen aber wohl doch die Veilchenbowle die denkwürdigste sein dürfte. Ihr Rezept steht bei Apicius. Die Veilchen mußten sieben Tage im Wein ziehen; dann kam der Honig hinzu, und sie war trinkbar.
[S. 47]
Die Mehrzahl unserer Trinklustigen wird übrigens gewiß schon vor Mitternacht sich im Bette befinden. Denn sie sollen ja schon vor 6 Uhr wieder aufstehen[61]. Auch die schlechten Leuchtkörper trugen dazu bei, daß man früh Schluß machte[62]. Möge ihnen denn das Gastmahl allseitig gut bekommen sein, möge auch das Räuschchen, das doch nicht leicht ausbleibt, schon um das erste Morgengrauen wie ein Traum verfliegen, und möge insbesondere der Wirt und Gastgeber, der für seine Gäste so viel getan hat, nach seinem Fest am anderen Morgen sich selbst so aufgeräumt wiederfinden wie seinen Speisesaal, in dem die Hausdiener in der Frühe sogleich mit Besen, Schwämmen und Tüchern jede Spur des Vorgefallenen zu vertilgen wissen.

[S. 48]
Je größer die Welt, je mehr wächst das Bedürfnis nach Annäherung, je erfinderischer sinnt der Geist auf Mittel, die den Menschen zum Menschen führen. Heute hat der Verkehr mit seinen Spinnenbeinen den ganzen runden Erdball wie eine eingefangene Fliege umfaßt. Die Erde schrumpft unter ihm zusammen. Jeden Tag hat man — in Friedenszeiten — in Berlin die Kursnotierungen der New Yorker Börse: Das Kabel tut’s. Die englischen Stahlwaren wollen von Liverpool rasch nach Japan; der Panamakanal muß sie hindurchlassen. Die Kohlenindustrie ist es, die das alles bewirkte; sie hat durch ihre Gaben die Welt verkleinert: Schnelldampfer, Eilzüge, Autos, drahtlose Telegraphie, Fernsprecher — welche Fülle der Bewegung, der Mitteilungsmöglichkeiten; dazu die Radler, die Flieger. Wer als altmodischer Fußgänger über die Landstraße trollt, begegnet kaum noch ab und an einem Bauernwagen mit trabenden Gäulen und nickender Peitsche; auch der zweispännige Doktorwagen fehlt. Auf dem Rad fliegt der Arzt in die Dörfer hinaus, fliegt sogar der Pfarrer mit wehendem Rock auf seine Filiale. Dieselbe Straße führt mich am Bahnkörper entlang; plötzlich tönen Signale, tönt gleichzeitig das Huphup. Ein Automobil jagt ratternd hinter mir auf, in Wettfahrt mit dem donnernden Expreßzug zur Rechten; überrascht schaue ich nach oben; denn auch über mir lärmt es. Ein Luftschiff ist’s; es schießt in gleicher Richtung um die Wette. Da sind schon alle drei verschwunden. Wer von ihnen ist zuerst am Ziel? Der Mensch sitzt still, die Maschine rennt sich außer Atem. Ganze Bevölkerungsmassen hebt sie so über Ströme und Gebirge dahin, von Ozean zu Ozean. Der Wandersmann hemmt seinen Schritt, versonnen, an seinen Stecken gelehnt; auch er beginnt plötzlich zu fliegen, aber nur sein Gedanke ist es, der fliegt; die Gegenwart versinkt, der Gedanke trägt ihn im Nu in die fernsten Vergangenheiten. So mich, und den Leser mit mir. Denn nichts ist reizvoller als das Vergleichen. Dereinst hat die Kultur[S. 49] der Griechen und Römer ohne alle Kohlenindustrie ihre vielbewunderte Höhe erklommen, und schon das römische Kaiserreich hat die ganze damalige gebildete Menschheit und eine Fülle von Nationen zu einer großen Verkehrseinheit zusammengefaßt. Die antike Heerstraße taucht vor uns auf, der Falernerwein und sein Versand, die Depeschenboten des Senats, der Vergnügungsreisende, der es in Rom nicht aushält, der Apostel Paulus, dessen Wirken ohne angemessene Beförderungsmittel nicht denkbar war. Wenn Paulus Briefe schrieb, so mußten sie auch befördert werden; wenn er von Jerusalem nach Korinth und Rom wollte, so mußte ein Passagierschiff ihn mitnehmen. Hat das antike Verkehrswesen seinen Aufgaben genügt? und läßt es sich mit dem heutigen annähernd vergleichen[63]?
Wir betreten die sonnigen Länder des Mittelländischen Meeres. Da fehlt jede Hast; alles atmet die Ruhe des Südens, der Antike. Die Affekte der Menschen sind lebhaft und heiß, der Arbeitstrieb dagegen ist gemächlich und liebt das Ausruhen. Die Straße belebt das Maultier, das Ochsengespann, und am Lastkarren kreischen die Räder, die schwere Radscheiben sind, wie man sie jetzt noch in der Türkei hat. Dies unser erster Eindruck. Daß wir heute die Lokomotive lateinisch benennen, ist ein närrischer Umstand; ebenso ist Veloziped lateinisch. Aber modernes Latein; der Römer kannte diese Wörter nicht. Wohl aber ist das „cito“, das wir früher auf unsere Eilbriefe setzten, römisches Erbe; lateinisch auch der „Kurs“ unserer Kursbücher und die „Stationen“. Sobald aber die physikalische Wissenschaft eingreift und ihre Erfindungen bringt, stellt sich das Griechisch ein. Mit „Auto“ bezeichnen wir, was immer sich automatisch bewegt. Auch „elektrisch“ ist griechisch, griechisch „Telephon“ und „Telegraph“; die Doppelsilbe „Tele“ bedeutet uns alle Fernwirkung ins Endliche und Unendliche, und es ist darum zu verwundern, daß wir unser Geschütz Mörser und Kanone und nicht lieber „Telemach“ nennen. Denn Telemach, des erfinderischen Odysseus Sohn, ist eben der aus der Entfernung Kämpfende.
[S. 50]
Das alte Griechenland war freilich viel zu winzig, um selbst praktisch vorzugehen. Denn in zwei Tagen lief ein Läufer von Hauptstadt zu Hauptstadt, von Athen nach Sparta[64]. Was wollte man mehr? Wozu erst durch das wilde arkadische Gebirge Straßen schlagen? Auf der felsigen Insel Rhodos fuhr überhaupt nie ein Wagen[65]. Der Schnelläufer (der Hemerodrom) war Griechenlands Ruhm, und er genügte. Wohl aber hat uns Griechenland die Ideale geliefert: es ersann den Botengott Merkur, der mit dem Stab und auf dem Flügelschuh durch die Luft springt. Darum schmückt Merkurs Gestalt noch heute bei uns tausend Bahnhöfe. Er ist der intelligente Bote, und alle Meldung richtet er nur mündlich aus. Anders die Göttin Iris, die die Briefpost vertritt. Wie der Regenbogen schnellt Iris durch den Äther, aber der Gottvater Zeus traut ihrem Gedächtnis nicht und gibt ihr seinen Auftrag oft schriftlich in die Hand: Himmelsbriefe, die jedem Sterblichen sein Schicksal, Freudiges und Trauriges, bringen[66]. So ist es mit den Briefen auch noch heute.
Nicht Hellas, sondern das große Perserreich des Darius hat dereinst vorbildlich das Straßenwesen und Nachrichtenwesen entwickelt. Im Buch Esther lesen wir vom bösen König Ahasver, der dort von Indien bis zum Mohrenland herrscht. Der König erhebt sich im Grimm und schickt an einem Tage an alle seine „hundertsiebenundzwanzig Länder“ Boten mit dem schriftlichen Erlaß der Judenverfolgung; jeder Erlaß in anderer Landessprache. Da sehen wir, so kurz die Worte sind, die große staatliche Organisation des Meldewesens, das damals über Persien und die ganze Türkei ausgriff, vor Augen. Daher auch die persischen „Parasangen“, die Meilenmessung der Straßen, und die „Angaren“ (berittene Eilboten), von denen der alte Herodot uns redet. Die Karthager waren die Schüler der Perser und haben dann alles dies in ihrem nordafrikanischen Landbesitz früh nachgeahmt. Die raschen Züge und Ritte Hannibals und anderer punischen Führer setzten unbedingt einen hochentwickelten Straßenbau voraus. Das straßenlose[S. 51] Meer dagegen haben die Griechen, diese echtesten Seeleute, im Wettbewerb mit den Phöniziern, erschlossen, das Meer, das für den Schwimmer selbst Straße ist. Wundervoll schön und reich entwickelt war die schlanke Triëre, das griechische Kampfschiff, das wie ein Tausendfüßler auf seinen Rudern daherschoß; nützlicher das Frachtschiff, das in der Größe unserer Briggs und Schoner mit hohen Segeln und starken Masten sich in die Wogen legte und in langen Karawanen durch die Wasserwüste Poseidons zog, um Gefäße und Metallwaren, Korn und Wein, Baumaterial und tausend Rohstoffe und Industriewaren im Austausch von den Mutterstädten in die fernen Kolonien zu tragen.
Wie anders das Römervolk! Ein wasserscheues Bauernvolk war es von Haus aus, träge und bis zum Stumpfsinn unbeweglich, und hat erst spät, erst als das Bedürfnis dringend wurde, all jene Dinge dem regsamen Ausland abgelernt. Die Zeit der lokalen Kleinkriege war vorüber; die Verhältnisse zwangen plötzlich zu großen Leistungen, und sogleich half den Römern die griechische Intelligenz. Die griechischen Techniker machten alsdann alles. Der herrische Römer ließ andere für sich arbeiten, aber er wußte treffsicher mit politischem Weitblick und Scharfblick die Ziele zu setzen. Charakteristisch ist, daß der Eigenname „Cursor“, der „Läufer“, nur an einer römischen Familie, der Papirier, haftete. Vom Papirius Cursor redet uns der Historiker Livius. Der haltungsvolle Römer lief sonst nicht gern; der alte Papirius fiel durch seine Schnellfüßigkeit auf[67].
Die Hügelstadt Rom selbst besaß in ihrem Inneren nur wenige fahrbare Straßen wie die „via lata“, auf denen die Transporte in die Stadt per Achse kamen (die „sacra via“ war Prozessionsstraße). Man schritt und kletterte sonst nur durch schmale Gassen (clivi und vici), die man darum zusammenfassend „Gänge“, itinera (von ire), nannte. Aus Gängenvierteln und einigen Marktplätzen bestand die Stadt. Die müßige Menge sammelte sich, wie es noch heute im Süden[S. 52] ist, an gewissen Standorten, und sie war nun auch ihr eigener Bote und Berichterstatter; geschah etwas Neues, so rauschte es in der Stadt gleich von Mund zu Mund. Wenn die Senatoren beraten, staut vor der Sitzungshalle sich die Menge und lärmt so lange, bis jemand notgedrungen heraustritt und die Neugier vorläufig befriedigt. Heulender Protest erhebt sich, wenn ein mißliebiges Edikt herauskommt[68]. Ein Gesetz gegen den Frauenluxus soll es geben; der strenge Cato ist am Werk: da rotten sich die Weiber, die davon hören, an allen Kreuzpunkten, umstellen geradezu das Forum, so daß ihnen kein Mannsbild entgeht, und bearbeiten sämtliche Stimmfähigen, damit der böse Antrag zu Fall kommt[69]. Agitation und Klatsch: das ist römisches Straßenleben. Es verlautet, daß ein gewisser Rutilus gestern ein glänzendes Essen gegeben hat, und Rutilus ist doch so arm! Gleich wissen das alle Müßigen, und das Räsonnieren geht los, in den Tempelvorhallen, in den Thermen und Friseurbuden[70].
Aber auch das Ausrufen ersetzte die Meldung. Das Kalenderwesen war schwierig; das Publikum mußte wissen, wie in jedem Monat gewisse Termine lagen; an jedem Ersten erschien auf dem Kapitol ein Priester (pontifex) und rief den Eintritt der „Nonen“ aus[71]. Dazu nun die Ausrufer von Beruf, die die Stadt bezahlte, jene altmodischen Figuren, die wir auch in unseren deutschen Kleinstädten noch vor etwa 50 Jahren an den Straßenecken regelmäßig tätig sahen, als Ersatz für Tageblatt und Lokalanzeiger. In Rom fehlte ihnen die Schelle; sie hatten nur ihr dröhnendes Organ und verkündeten nicht allein lautschallend die Angebote bei den Auktionen, sondern auch Wichtigeres: „Morgen, ihr Bürger, die feierliche Beisetzung des großen Aemilius Paulus, der den König von Mazedonien besiegte; als Leichenspiel wird eine Fabel des Terenz gespielt;“ oder: „Die Gladiatoren aus Capua sind da; morgen wird das Forum für sie mit Sand bestreut.“ Auf demselben Forum Roms, diesem Zentrum der Weltgeschichte, finden die Herren Senatoren sich natürlich täglich zusammen;[S. 53] Cicero steht da plaudernd mit Pompejus und Lukull, macht seine Witze und freut sich, wenn Lukull ihn freundlich zu Tisch einladet: da fährt der Ausrufer dazwischen und schreit: „Die Sitzung geht an!“ und die Herren schieben sich in die Kurie, um über die Eroberung Galliens oder über die Schulden des jungen Königs von Ägypten zu beraten.
Aber auch das schriftliche Verfahren bestand. Durch Anschrift an den Mauerwänden wurden die neuen amtlichen Verfügungen bekanntgegeben. So, wie heute der Landrat im „Blättchen“ seinen Kreis zur Feststellung der Menge des vorhandenen Schlachtviehes auffordert oder mitteilt, daß die Blutlaus den Obstbau schädigt und daß von ihrem Auftreten der Behörde sofort Anzeige zu machen ist, so las das Publikum damals im Maueranschlag das neue Korngesetz oder den Wehrbeitrag, den der Bürger fortan zu zahlen hatte. Am Schluß des Jahres gab es in gleicher Form ein Verzeichnis aller wichtigen Jahresereignisse, von den Schlachten an, die der Römer wieder einmal gewonnen hatte, bis zum fünfbeinigen Kalb, das irgendwo auf dem Lande geboren war, und jeder konnte sich Abschrift nehmen von dem, was ihn anging. Proskriptionen hießen solche öffentlichen Maueranschläge. Als Sulla seine Menschenhetze eröffnete, gab er in derselben Weise die Namen seiner Opfer vorher in allen Straßen Roms bekannt, am ersten Tage 80 Namen; an den folgenden ging es in die Hunderte. Dadurch sind die unschuldigen Proskriptionen zu einem Wort des Schreckens geworden; es waren „Anschläge“, die der Tyrann auf das Leben seiner Mitbürger machte.
So gab es im städtischen Verkehr viel zu lesen. Aber man las und schrieb natürlich noch viel mehr. Persönliche Grüße und Wünsche kreidete man den Freunden und Freundinnen an ihre Tür oder auf den Türpfosten, oder auch der Sklave kam mit einer schriftlichen Ausrichtung ins Haus und ersuchte, die Antwort gleich wieder mitnehmen zu dürfen. Die Wachstafel war eine hochwichtige Sache, und man hatte sie immer zur[S. 54] Hand; der Diener, ohne den niemand ausging, hielt sie bereit. Alles das Schreibwerk war rasch vergänglich, unendlich viel bedeutsamer dagegen die Gotteshäuser, ich meine die Außenwände der Tempel. Da waren in monumentalen Bronzetafeln wie für die Ewigkeit alle wichtigsten Dokumente, die Staatsgesetze, die Bündnisverträge Roms mit auswärtigen Völkern befestigt und aufgehängt. Solche Tafeln sah man zu Tausenden. Bei dem Tempelbrand auf dem Kapitol des Jahres 69 n. Chr. gingen allein 3000 zugrunde[72].
Soweit die enge Hauptstadt selbst. Sobald aber die treibenden Lebensinteressen über die Stadtmauern hinausreichen, da wird die Landstraße nötig und der Überlandbote oder Kurier. In dem Bauernland Italien gab es zunächst nur ungepflegte Kommunalstraßen und Feldwege oder Vicinalwege, die durch das Ackerland von Dorf zu Dorf führten und die der Anwohner in Ordnung hielt[73], und damit hat sich das siegreiche Rom 400 Jahre lang begnügt. Erst nachdem es das Umland Neapels, das schöne Kampanien, erobert hatte, führt Rom im Jahre 312 v. Chr. die erste festgedämmte Chaussee, die unter staatlicher Aufsicht stand, die berühmte Via Appia, südwärts bis nach Capua. Erst in den Jahren 241 und 220 kommen dann die Via Aurelia und Flaminia hinzu, die beide nordwärts nur bis Pisa und Rimini reichen. Hannibal, der im Jahre 218 in Italien einrückte, konnte diese Straßen schon benutzen. Sonst blieb der Römer auch noch im Hannibalkriege mit seinen zahllosen Marschanforderungen ganz auf die dörflichen Fahrwege alten Stils angewiesen.
Ebenso unausgebildet aber, bis zum Stumpfsinn, war damals auch noch das Nachrichtenwesen, der militärische Meldedienst. Meldungen mit Fanalen, mit Leuchtfeuern sind völlig oder fast völlig unbekannt; auch die Taubenpost hat der Römer nie ausgebildet, obwohl doch die Tauben schon damals, wie heute in Venedig, Heuschreckenschwärmen gleich, um alle Dächer flogen. Im 2. Jahrhundert v. Chr. erfand der geniale griechische Historiker Polybius im Dienste des ersten Feldherrn der[S. 55] Zeit, des jüngeren Scipio Africanus, die eigentliche Telegraphie im heutigen Wortsinn. Wir kennen das telegraphische System des Polyb genau; es war eine wirkliche Vorwegnahme unserer Morsetelegraphie; aber es blieb auf dem Papier stehen und ist nie zur Anwendung gekommen, und 2000 Jahre haben vergehen müssen, bis es in neuer Form wieder auferstand. Der genannte große Feldherr winkte einfach ab. Solche Sache war für den grobsinnigen Römergeist zu fein und kompliziert; man wäre dadurch, wo es sich oft um Geheimmeldungen handelte, zu sehr in Abhängigkeit vom dienenden griechischen Personal geraten; denn die Griechen hätten den technischen Apparat auf alle Fälle bedienen müssen.
Wie tropfenweise und spät die politischen Nachrichten damals noch in der Hauptstadt eingingen, zeigt uns des Livius Geschichtserzählung[74]. Wir sehen dabei, wie aus dem Luftschiff, von oben in die Stadt Rom hinein. Hannibal hat soeben am Trasimenischen See gesiegt. Ein einzelner Bote taucht in Rom auf mit der vagen Nachricht, und der Schreck, der entsteht, ist grenzenlos. Das Volk staut sich auf dem Markt; die Matronen irren in Scharen durch die Gassen. Ein endloses Fragen den ganzen Tag. Niemand weiß etwas. Man ruft nach den Magistraten, die sich verstecken. So ist es ja immer, daß die Regierungen Unglücksnachrichten unterdrücken wollen. Endlich, als es Abend wird, tritt wirklich der Praetor Pomponius heraus und bekennt wortkarg: „Wir sind in einer großen Schlacht besiegt.“ Bestimmtes weiß auch er noch nicht; aber das Gerücht geht um: „ein Konsul ist tot; zahllos die Gefallenen.“ Jeder bangt um seine Söhne. Indes vergehen noch mehrere Tage; die Weiber postieren sich in Haufen an den Stadttoren auf, um den ersten Flüchtling, den ersten Boten abzufangen. Es hat also tagelang, trotz der Nähe des Schlachtfeldes, an Eilboten, die der Staatsbehörde die offizielle Meldung brachten, gefehlt: bis endlich wirklich die Erwarteten kommen, und das endlose Ausfragen beginnt. Natürlich fehlen dann auch Ohnmachten und Schlaganfälle nicht. In den Armen ihres[S. 56] Sohnes verscheidet eine Römerin; eine andere rührt der Schlag infolge einer Falschmeldung.
Nicht besser die Beweglichkeit der damaligen Diplomatie im Ausland. Hannibal belagert Sagunt in Spanien; eine römische Gesandtschaft sucht ihn dort auf, um dagegen Protest zu erheben. Hannibal läßt sie gar nicht vor. Da machen sich die römischen Herren nach Karthago selbst auf, um dort gegen ihn zu wühlen, denn Hannibal hat in seiner Vaterstadt zahlreiche Feinde. Aber Hannibal selbst schickt gleich seine Eilboten, die viel schneller sind, dorthin, und als die Römer in Karthago glücklich anlangen, ist Rat und Bürgerschaft schon völlig in Hannibals Sinn bearbeitet[75]. Bald danach setzt Hannibal über den Ebro und will, um Rom anzugreifen, durch Südfrankreich, durch das gallische Land. Da kommen, um das zu verhindern, römische Gesandte zu den Galliern und fordern: die Gallier sollen das punische Heer nicht durchlassen. Schallendes Gelächter empfängt sie. „Ihr kommt zu spät,“ heißt es, „Hannibals Gesandte waren schon längst hier; der Vertrag ist mit ihm längst geschlossen, der Durchzug gewährt[76].“ Protzig und träge, das war das altrömische Wesen. Die Barbaren lachten mit Recht.
Aber so blieb es nicht. Eben jetzt lernte der Römer in der höchsten Not vom Feinde. Hamilkar hieß der „Blitz“, er hieß Hamilkar „Barkas“; Hannibal, sein Sohn, war so blitzschnell wie er. In Scipio Africanus, dem älteren, aber erstand dem Hannibal ein großer Nachahmer, und durch ihn veränderte sich alles. Auch dieser Scipio hieß „der Blitz“[77]. Von da an beginnen die oft erstaunlichen römischen Rapidmärsche im Felde. Für den normalen Tagesmarsch setzt Vegetius in seiner Schrift über das Heerwesen 30 km an[78]. Scipio aber zog damals vom Ebro nach Cartagena in Spanien in 7 Tagen, also täglich 60 km[79]. Darf man auch solche Angaben nicht allzu genau nehmen, auf alle Fälle ist die erstaunliche Schnelligkeit der Bewegung fortan ein Vorzug vieler römischer Feldherren; ich nenne Lukull, Caesar, Trajan, wobei der Zweck ist, den unfertigen[S. 57] Gegner zu überraschen, wie es Hannibal tat. Gewiß hat dies Caesar von Lukull gelernt. Wichtig war auch das Pferdematerial. Erst seit Spanien erobert war, hatte man auch gute Pferde, und das schnelle Reiten begann, die berittenen Eilboten oder Staffetten (equites citati)[80].
Seit jener Zeit gestaltete sich nun alles anders. Bald war ganz Italien mit musterhaften, chaussierten Heerstraßen versehen, und in ihrem Dienst entwickelte sich der Brückenbau, der Tunnelbau. Unter den Kaisern aber durchschnitten sie zielbewußt weitausholend und verhundertfacht die ganze damalige Welt, und es gab für den Reisenden direkte, durchgehende Verbindung von Rom nach Marseille, Lyon, Paris; von Marseille nach Toledo; von Rom nach Wien; großartig vor allem die Straße, die von Lyon über Straßburg, Ulm, Regensburg, Wien, immer die Donau entlang, direkt bis zur Donaumündung, bis zur Dobrudscha lief. Sie verband den Abend mit dem Morgen, Spanien mit dem Schwarzen Meer, und das gab Anschluß bis zum Euphrat. Es gemahnt an unsere Bagdadbahn. Noch in Napoleons Ära hat das moderne Europa diesem Straßenwesen nichts annähernd Gleichwertiges zur Seite zu stellen gehabt; ich meine jene harmlosen Zeiten der Stellwagen und Kutschen, in denen unsere Vorväter, Chodowieckis Zeitgenossen, mit Brezeln und Koteletts und anderen Lebensmitteln für volle acht Tage sich verproviantierten, um von Berlin nach Wien zu kommen, und dabei auf den tiefen Sandwegen im fliegenden Staub erstickten oder im Morast versanken, der bis zum Kutschbock hochspritzte.
Aber, merkwürdig genug, das Fuhrwesen hat wiederum der Römer nicht selbst ausgebildet. Das Schiffahrtswesen nahm er von den Griechen, die Straßenbautechnik von den Puniern und Griechen, das Fuhrwesen von den gallischen Barbaren. Der Römer hat zur Bezeichnung des Wagens selbst nur wenige Worte zur Verfügung. Die Gallier saßen in der norditalienischen Ebene um Mailand, und von ihnen übernahm man die verschiedensten und brauchbarsten Wagenformen, vor allem den[S. 58] Reisewagen (raeda) und das Kabriolett (cisium). Sogar in Smyrna, in Kleinasien, fuhr man damit[81]. Auch die gallischen Maultiere (mulae Gallicae) hatten als Bespannung den Vorzug[82]. Im Jahre 222 v. Chr. wurde Nord-Italien endgültig römischer Besitz; aber das gallische Fuhr- und Spediteurwesen bleibt dort seßhaft noch in Caesars Zeiten. Damals verhöhnte Vergil den Spediteur Sabinus in Cremona. Vor allem aber ist jener Ventidius Bassus berühmt, der das ganze Transportwesen für Caesars große Kriege in der Hand hatte: ein Emporkömmling bäurischer Herkunft aus der Gegend zwischen Venedig und Ancona, der sich schon als junger Kerl betriebsam auf den Dörfern Maultiere und Wagen zusammengekauft hatte. Bald wurde sein Speditionsgeschäft bekannt; die römischen Herren mieteten seine Wagen, und so kam er schließlich auch zu Caesar in Beziehung. Da ging der Betrieb gleich ins Kolossale; Ventidius wurde der größte Kutscher der Weltgeschichte; er wurde kraft seiner Leistungen sogar Senator, Konsul, wenn schon er wohl immer noch nach dem Stalle roch. Man begreift das Entsetzen der gebildeten Welt.
Diese Verse las man damals an den Straßenmauern Roms[83].
Die berühmten römischen Fahrstraßen hießen „viae“, und „viae“ kommt von „vehere“, „fahren“, her. Wegen des Fahrens die feste Dämmung. Kein Wagen konnte da einsinken. Gleichwohl sind sie Militärstraßen gewesen und im Dienst des Krieges entstanden; aber die Truppen wurden natürlich nie per Achse befördert[84]. Sie marschierten nur, und auf dem harten Basaltpflaster der Militärstraßen marschierte es sich gewiß nicht gut. Sogar die Offiziere, sogar die Höchstkommandierenden hielten oft mit Schritt. Sie fuhren nicht, aber sie ritten auch nicht. So, zu Fuß, ist Marius von Rom aus gegen die Teutonen ausgezogen, hat Caesar z. T. Frankreich durchmessen. Es war ein Ruhm des Feldherrn, wenn er dasselbe[S. 59] leistete wie der geringste Mann. Nicht anders Trajan in Dacien[85]. Mark Aurel war freilich dazu zu schwächlich, als er durch Siebenbürgen bis nach Böhmen vordrang; daher sein Reiterstandbild. Er mußte reiten. Nicht also für die Truppen selbst, sondern vielmehr für den Wagentroß, der dem Heere folgte, waren jene Militärstraßen chaussiert. Ließen die Soldaten den Train hinter sich, so hießen sie expediti, „die da fußfrei einhergehen“; so konnten sie wesentlich rascher und auch auf schlechten Wegen vorankommen; und davon hat die „Expedition“ ihren Namen, die ursprünglich die kurzfristige Unternehmung ohne hemmenden Troß bedeutet hat[86]. Gleichwohl war ein Feldzug ohne Train (commeatus), ohne Beigabe von Proviantmassen, von Gerät und Geschützen, wie ein Flug ohne Flügel, wie eine Lokomotive, die kein Wasser hat. Wir wissen das auch heute.
Nun aber der Kaufmann! Auch er strebt hinaus über die Landesgrenzen. Wer aber wird glauben, daß die Kaufmannswelt sich an jene Musterstraßen gebunden fühlte? daß sie nicht schon vor ihrem Vorhandensein weit ausgriff und rege war? Nicht der Krieg erschließt die Welt; der Handel schafft sich selber Wege, auch unter Menschenfressern und Kannibalen, und ob er über den schwindelnden Saumpfad klettern, durch endlose Wälder und grundlose Sümpfe sich drängen muß, ob er mit der Wüstenkarawane der Fata Morgana nachrennt und von Stürmen über fremde Meere sich tragen läßt. Ostindien, Westindien, das Goldland am Niger, die Bernsteinküste der Ostsee, der Kaufmann war es, der sie entdeckte. Um neue Absatzgebiete, um neue Produkte für die Einfuhr zu entdecken und in seine Hand zu bekommen, stürzt er sich in alle Gefahren. Italiens Hauptexportartikel war sein wundervoller Wein, der in mannigfaltigsten Sorten und in Fülle gedieh. Viele Marken waren schwer berauschend, und der Barbar kaufte sie mit Gier, wie der Chinese das Opium. So kam der Wein Italiens schon früh zu den Galliern, Spaniern und Germanen. Schwer belastet trugen die Flußschiffe die gefüllten Fässer die Rhone[S. 60] und Saône hinauf und den Rhein hinab, und wo Flüsse fehlten, kamen die Lastkarren mit kreischendem Rad. An allen Küstenplätzen, Cartagena, Toulouse, ja auch im Inneren der eroberten Gebiete setzten sich die römischen Händler fest, bildeten Gesellschaften und vertrieben als solche die Landesprodukte, verarbeiteten, verluden sie und schafften sie nach Rom, dem großen Konsumenten und Magen, der alles verschlang. Freilich betrieben das die römischen Herren zumeist nicht in Person, sondern durch ihre Freigelassenen, denen ihr Kapital und Kredit zur Verfügung stand und die hernach selbst unter die reichen Bürger mit aufrückten.
Aber nicht nur in den Nordländern: in dicken Massen, wie Schmeißfliegen auf der Wunde, saßen die römischen Händler und Wucherer im unterjochten Kleinasien. Man staunt, zu hören, daß der letzte große Rächer des Griechentums, Mithridates, dort an einem Tag bis zu hunderttausend Römer aufgreifen und töten ließ, indem er die Wut der Griechen auf sie hetzte. Karthago, Korinth mußten fallen, Rhodus, Athen, auch Marseille völlig geschwächt werden, damit der „mercator“ Roms alles in seine Hand bekam, und er warf nun aus allen fruchtbaren Gegenden das Getreide nach Rom, lieferte indische Gewürze und Edelsteine, Bauholz vom Schwarzen Meer, feines Holz für die Möbelschreiner aus Marokko, Sklavenmassen aus Syrien und was sonst die Welt hergab, vom gallischen Schinken bis zu den erhabenen griechischen Götterfiguren, mit denen man Promenade und Park verzierte. Silbergruben, Bleigruben erwarben sich die Konsortien in den Provinzen, produzierten selbst Fischbrühe in Spanien für den Massenversand, der in mächtigen Krügen mit der Aufschrift „Fischbrühe der Kompagnie“ (garum sociorum) geschah, ernteten das Pfriemengras (spartum), das in Spanien wild wuchs und aus dem man Matten und Seile machte, brachten gar die altägyptischen Papyrusfabriken in ihre Hände usf. Der Import in Italien übertraf den Export wohl vielhundertfach; aber Rom hatte Geld und konnte alles zahlen. Das Großkapital saß in Rom[S. 61] und nährte sich und schwoll durch ungeheuren Zinswucher. Es sollte freilich die Zeit kommen, wo die römische Kultur in den Provinzen das Mutterland Italien gewaltig überholte. Da versank Italien und Rom endlich in zunehmende Verarmung. Es war wie Rache und Vergeltung.
Wie nun dieser Warenaustausch durch den Bau der römischen Heerstraßen, der sich in die fernsten Fernen erstreckte, befördert worden ist, begreift sich leicht. Unaufhaltsam Menschen suchend, dringt die Straße von Siedelung zu Siedelung und bietet ihre Gaben an, sättigt überall tausend alte Bedürfnisse und erweckt tausend neue, wie heute die Eisenbahn, und knüpft so die Völker zur Menschheit zusammen. Bequemer freilich und billiger war damals wie heute der Wassertransport, und das Mittelmeer stand allen offen und trug gutwillig alle Lasten, wofern nur ein günstiger Wind die Segel schwellte. Das Mittelmeer war die Hauptverkehrsstraße der alten Welt.
Wir aber verweilen zunächst noch auf dem Lande. Die Lastfuhren drängten sich. Aber nicht nur der Kaufmann füllte die Landstraßen, sondern auch der Reisende. Allein schon die hohen Herren Verwaltungsbeamten, die mit großem Personal in die Provinzen eilten und oft jährlich wechselten. Aber auch die Gesundheits- und Vergnügungsreise gedieh; auch die Neugier trieb hinaus in die Ferne; die Straße ermöglichte das. Straßenräuber und Piraten gab es kaum noch, und man streute sein Geld, indem man durch die Länder bummelte, und erzählte Wunderdinge, wenn man nach Hause kam. In manchen Tempeln geschahen Wunderheilungen, und ganze Wallfahrten zogen dahin. Übrigens ging der Schwindsüchtige wie heute gern nach Ägypten oder an die Riviera. Auch die Heilquellen von Teplitz, Baden bei Zürich und Bath in England haben die alten Römer schon benutzt. Aber auch diese Gesundheitsreisen dienten zugleich oft genug dem flotten Luxusleben und dem unersättlichen Verlangen nach Zerstreuung. Man hatte[S. 62] Zeit, und es galt sie totzuschlagen. Die Straße stand dem Händler, sie stand auch dem Müßigen offen.
Ständig strömten die Provinzleute nach Rom; das begreift sich; man mußte einmal im Leben in Rom gewesen sein, oder man wollte einmal den Kaiser gesehen haben oder auch andere berühmte Männer, wie den Vergil oder Livius. Der Römer selbst dagegen weidete, wenn er reiste, alle Sehenswürdigkeiten der Griechenstädte ab; denn er war nun einmal Griechenschwärmer von Erziehung. Parthenon und Olympia, die Diana von Ephesus, der Koloß von Rhodos, die Venus von Knidos, der Eichbaum, unter dem Alexander der Große während der Schlacht von Chäronea sein Zelt gehabt hatte, alles wurde mit Hilfe der Reiseführer umständlich besichtigt; natürlich auch die Pyramiden und Sphinxe und heiligen Ibisvögel am Nil. Daher das Horazgedicht: Andere mögen Rhodos loben und Mitylene; ich liebe mein Tivoli am rauschenden Aniofluß. Wozu nach Smyrna reisen? so fragt derselbe Horaz: Ob du hier in Rom oder in dem verwunschensten Nest sitzt: wer gesunden Sinn hat, ist überall glücklich; wo immer du bist, lebe in Anmut!
An den Straßen gibt es in gewissen Abständen Stationen für Pferdewechsel, und da ächzen nun all die schweren Last- und Möbelwagen (plaustra) über Land und die Karren mit Bauholz (carri). Sie halten an; denn da kommt im Trab eine gedeckte Kutsche mit vier Pferden daher (raeda), eine ganze Familie darin, das Reisegepäck hinten auf. Elegante Leute fahren sausend im vergoldeten oder silberbeschlagenen Wagen (essedum) mit Beduinen als Vorreitern; für Damen ist wieder eine besondere Wagengattung (das carpentum) bestimmt, auch diese schön und kostbar: darin fahren die Frauen zum Gottesdienst; so kutschiert Cynthia, des Properz Geliebte, selbst rosselenkend zur Fütterung der heiligen Schlange nach Lanuvium; zwei Ponys mit gestutzter Mähne hat sie vorgespannt. Alle diese Fahrzeuge aber überholte das auch noch heute in Italien so beliebte zweiräderige Gig oder Kabriolett (cisium) mit dem[S. 63] Schnelltraber, oft nur ein simpler, offener Kasten auf zwei Rädern, der vor allem dem Geschäftsreisenden diente. Die Gäule und Mäuler tragen Hufeisen, das jedoch die Form eines vollständigen Schuhes hat; sie werden auch nicht wie heute an Stränge oder in die Deichselgabel eingespannt, sondern vorn an der Deichselstange ist ein Joch, an dem sie ziehen.
Einmal begegnen wir auch dem Philosophen Seneca auf der Landstraße. Der reiche Mann ist der Verfechter stoischer Gesinnungen. Er fährt da mit einem Freund und ein paar Dienern, durch irgendwelchen Umstand veranlaßt, ohne Gepäck, auf einem gemeinen Bauernwagen. Aber die Scham befällt ihn, als ihm immerfort die eleganten Reisenden aus Rom, die ihn z. T. gewiß persönlich kannten, auf der Straße begegnen, und er ärgert sich über seine Scham. Da kommen sie gefahren mit fetten Paradehengsten oder spanischen Rennern und Zeltern; um im Wagen zu speisen, haben sie goldenes Tafelgerät mit, und ungeheurer Staub wirbelt auf, denn Schnelläufer oder afrikanische Vorreiter eilen vor ihnen her, um mit Gewalt Platz zu schaffen, weil die Straße mit Wagen gestopft ist. Als Bedienung werden außerdem noch junge schöne Pagen hinterhergefahren, deren Gesicht mit Schminke belegt ist, damit ihre zarte Hautfarbe nicht durch die Sonne leide. „Wohin,“ ruft da Seneca, „ist die Zeit eines Cato, der sich noch dereinst mit einem einzigen Klepper begnügte?“ Cato ritt durchs Land und brauchte das Tier nicht einmal ganz; denn einen Teil nahm der Reisesack ein, der rechts und links vom Sattel herunterhing[87].
Da sehen wir einmal, flüchtig angedeutet, den Betrieb auf der Via Appia, die Überfüllung der italienischen Landstraßen. Überfüllter aber war noch das Mittelmeer, und uns öffnet sich endlich auch der Blick auf die See. Die Landstraße führt den Seneca nach Puzzuoli (Puteoli), den großen italienischen Welthafen jener Zeiten, die Reiseherberge der ganzen Welt[88]. An die zwanzig Molen streckten sich da, festgemauert, ins Meer, zwischen denen die Schiffe Anker warfen. Seneca erlebt, wie[S. 64] die Schiffe aus Alexandria dort in Sicht kommen; es sind Kurierschiffe, die melden, daß die große Flotte mit den Warentransporten aus Ägypten bald eintreffen wird. Auf allen Molen stehen da die Menschen in dicken Haufen, die sich drängen und hinausspähen: der alexandrinische Schiffstypus wird von ihnen festgestellt; an der Art der Segel erkennt man ihn; denn keine anderen Schiffe setzen sonst auf der Strecke zwischen Kapri und Puzzuoli das Toppsegel (supparum) auf. Seneca selbst hält sich indes fern; er erwartet zwar wichtige Postsachen aus Ägypten, aber er bezähmt seine Ungeduld[89].
Einen anderen Ton schlägt der Satiriker Juvenal an. In dem grimmigen Ton, der ihm eigen ist, belebt er uns das Meer, indem er den Kauffahrer mit dem Seiltänzer, der für Geld sein Leben wagt, vergleicht. Von Kreta kommt die Brigg mit Flaschen voll Rosinenwein und Säcken, die schon von weitem nach Gewürzen riechen, daher. Millionär will der Kauffahrer werden. Das wollen sie alle. Ja, sieh nur die See, wie sie voll ist von Gebälken! Der größte Teil der Menschen lebt heut auf dem Wasser. Daher ist uns auch das Mittelmeer zu eng geworden; man fährt jetzt, an Gibraltar vorüber, auch dreist in den offenen Atlantischen Ozean, wo die Welle aufzischt, wenn die heiße Sonne in ihm untergeht. Unter Kuratel sollte man den Wahnsinnigen stellen, der seinen Zweimaster bis zum Rand mit Waren überfrachtet, so daß die Welle fast über Bord schlägt. Getreide und Pfeffer hat der Mann zusammengekauft. Ein Gewitter kommt. „Löst das Ankertau,“ ruft er trotzdem; „das bißchen Wolken hat nichts zu sagen.“ Morgen aber ist er vielleicht schon als Schiffbrüchiger ins Meer gestürzt und möchte sich retten; aber er schwimmt nur mit der linken Hand, weil er mit der rechten und mit den Zähnen die Geldkatze festhält[90]. Die Zahl der Schiffbrüchigen war im Mittelmeer zur Zeit des Altertums in der Tat unendlich viel größer als heute — als ob dort deutsche Unterseeboote am Werk wären.
Lassen wir indes den Zorn Juvenals verrauschen, der sich gegen die Geldgier des Kaufmanns richtet. Sein Zorn ist selbst[S. 65] wie Sturm. Eine wirkliche Erholung war das Reisen gelegentlich für die großen Staatsmänner und Feldherren. Mark Anton hatte nach dem großen Sieg bei Philippi endlich sich zum Herrn des Orients durchgerungen; schlachtenmüde erholte er sich danach einige Monate lang in Hellas und Kleinasien (warum sollte er es nicht so gut haben wie andere?), sah sich leutselig die berühmten Wettspiele an, ließ sich über griechische Altertumskunde vortragen und war dabei aufgeräumt und überlustig. Als auch die Winkelstadt Megara ihn um seinen Besuch bat und ihm ehrgeizig ihr altertümliches Rathaus zeigte, sagte er nichts als: „Klein, aber verwahrlost.“ Es war schwer, dem großen Herrn zu imponieren. Genaueres teilt uns Tacitus über des Antonius Enkel, den liebenswürdigen kaiserlichen Prinzen Germanicus, mit. Es ist der Germanenbekämpfer der Jahre 14 bis 16 n. Chr. Drei Jahre hatte Germanicus im rauhen Norden gestanden, durch die tiefen Wälder und Sümpfe des wilden Germaniens seine Legionen zum Kampf getrieben, auf der tosenden Nordsee persönlich schwersten Schiffbruch gelitten, als Tiberius ihn nach Syrien entsandte; er sollte nunmehr sogleich den Osten verwalten. Aber er nahm sich Zeit; er brauchte sichtlich Ruhe und Ausspannung, und so suchte er erst Actium auf, den denkwürdigen Küstenplatz, wo vor 50 Jahren die Seeschlacht bei Actium geschlagen wurde. Er fand da noch wirklich die Reste des Heerlagers des Antonius selbst, Anlaß genug, allerlei trüben und frohen Erinnerungen nachzuhängen. So fuhr er auch nach Lesbos, deshalb, weil ihm dort seine Tochter Julia geboren war, fuhr zum alten Troja, das jeder Römer wie seine Urheimat verehrte, sättigte seinen Schönheitssinn, indem er weiter alle wundervollen Küstenstädte des griechischen Meeres und so auch Konstantinopel (Byzanz) besuchte, überall natürlich wie ein Fürst empfangen. Bei Kolophon gab es eine berühmte Orakelstätte; in einer heiligen Grotte trank da der Seher, ehe er seine Weissagungen vorbrachte, aus einer geheimnisvollen Wunderquelle; so auch diesmal, und da soll dem Germanicus sein frühes tragisches Ende geweissagt worden[S. 66] sein. Doch war es ihm im folgenden Jahre (19 n. Chr.) noch beschieden, nach dem Wunderland Ägypten zu gehen, den märchenhaft berühmten Koloß der Memnonsäule bei Sonnenaufgang klingen zu hören, und er ging dann noch weiter stromauf bis nach Assuan, wo die Stromschnellen des Nil sind, deren Wirbel nicht zuließen, daß man mit dem Senkblei die Wassertiefe maß[91]. Am Bein der Memnonsäule, dieses zertrümmerten Sitzbildes, finden sich noch heute eine Menge Inschriften eingekratzt erhalten, Worte von römischen Reisenden, die froh bezeugen, daß sie den Koloß klingen hörten. Jahrhundertelang reiste man wundersüchtig dorthin, um das zu hören.
Wieviel die hohen Herren auf solchen Reisen zu Fuß abmachten, läßt sich nicht genauer feststellen. Wohl aber gilt es zu wissen, daß im Altertum trotz allem, was ich bisher mitgeteilt, die Fußreise vorherrschte, daß für den Durchschnittsmenschen das Reisen zu Land ein Wandern, ein Pilgern war. Die Wenigsten konnten sich Wagen mieten, und dadurch, durch die Züge der Fußgänger und Pilger, belebt und ergänzt sich uns das Bild der Landstraße nun noch weiter. Die Reise heißt „iter“; „iter“ aber ist „der Gang“ auf deutsch und setzt zunächst durchaus das Gehen voraus; ebenso das Wort „pilgern“, peregrinari; wo nicht ein Fahrzeug besonders genannt wird, wird auch beim Pilgern nie an Fahren gedacht. Und so sagt uns ja auch Horaz, daß, wer bei Regenwetter von Capua auf der Appischen Straße nach Rom eilt, von Kot überspritzt ankommt[92]; die Wagen sind es, durch die der Fußgänger so bespritzt wird. Ausonius schildert in seinem berühmten Reisegedicht „Mosella“ seine Fahrt auf der Mosel. Er steigt aber nicht etwa einfach bei Trier oder bei Neumagen ins Schiff, sondern von Bingen a. Rh. geht er aus und wandert zunächst zu Fuß einsam, und also nicht etwa auf der Poststraße[93], durch die Wälder des Hunsrück[94]. So hat denn der junge Dichter Persius, wie man glaublich vermutet, eine Gedichtsammlung „Wegwandergedichte“ (ὁδοιπορικά) geschrieben[95], und ein solches[S. 67] Wegwandergedicht besitzen wir noch; Catull gibt es uns, carmen 46: es ist Frühling; aus dem Inneren Kleinasiens, aus Bithynien, wo der Dichter mit jungen Altersgenossen amtlich beschäftigt war, strebt er an die Küste, um von da weiter nach Rom heimzufahren, und singt:
Da haben wir den Fuß, der ausgreift! Vergessen wir nicht, daß ja auch, wie wir sahen, die höchsten Heerführer ihren Legionen oft zu Fuß voranschritten. Wer es eilig hat, von dem sagt Catull: er verschluckt seinen Weg vor Gier[96]. Und was bedeutete die Meile für den Römer? Sie war nichts als ein Schrittmaß und bedeutete 1000 Doppelschritte des Marschierenden, die also nicht in Luftlinie, sondern nur am Lauf der Straße abgemessen werden (man rechnete nach milia passuum); die Meilenpfeiler gaben dem Fußgänger von Stelle zu Stelle an, wieviel Schritte er hinter sich, wie viele er vor sich hatte. Die Straße war Wanderstraße.
So belebt sich uns die Landstraße mehr und mehr mit den mannigfaltigsten Gestalten. Denn wir erinnern uns nunmehr auch der ambulanten oder wandernden Berufsarten. Die Sendboten des Christentums tauchen vor uns auf, und ihr Fuß trägt sie dahin von Land zu Land, zu allen Völkern. Aber nicht nur sie. Weil es in unzähligen Landstädten Theater oder Amphitheater gab, ziehen nun auch die Schauspielerbanden, ziehen die Mimen, die Jongleure von Ort zu Ort; ebenso auch die[S. 68] Gladiatoren, die zu je hundert oder mehr vermietet werden und auf Bestellung hier und dort ihre Fechterspiele geben. Da sind aber auch die Ärzte, die, um ihre Kundschaft auszudehnen, gern und oft ihren Standort wechselten und dabei Heildiener und Apotheke mitbrachten; da sind auch noch die Kunstredner des Altertums, halb Prediger, halb Professoren: Kanzel und Katheder in eins. Unsere Sonntagsgottesdienste mit Predigt gab es noch nicht; sie ersetzten diese Wanderredner mit ihren schwungvollen Moralvorträgen, die kunstvoll ausgebaut waren. Aber sie glichen zugleich auch unseren gefeierten Berufshistorikern, die heut herumreisen, um ihren Bismarck-Vortrag überall zum besten zu geben; und der Zulauf, der Lernhunger, der Trieb zur Andacht war grenzenlos. Gewisse volkstümliche Philosophen, Volksbeglücker und Wahrheitsverkünder kamen überhaupt gar nicht weg von der Straße: dafür ist das berühmteste Beispiel der Wundermann Apollonius von Tyana um die Zeit der Zerstörung Jerusalems; sein langes Leben, das früh zum Roman ausgedichtet wurde, stellt sich als eine unausgesetzte Pilgerschaft dar, die ihn von Syrien nach Persien, nach Ägypten, Athen und Italien führte. Und dadurch wird uns weiter das rastlose Reiseleben Kaiser Hadrians verständlich[97]; aber auch der Apostel Paulus.
Die Apostelgeschichte, die von Paulus erzählt, ist wie ein Reisebuch. Wie Apollonius von Tyana, so reist auch Paulus, wenn er nicht zu Schiff fährt, stets nur als Fußgänger[98]. Viele Städte hatte er schon so besucht, in Saloniki, Philippi, Korinth Gemeinden gegründet, als ihm der Prozeß gemacht wird, und er tritt, um sich in Rom dem kaiserlichen Urteilsspruch zu stellen, zu Schiff als Staatsgefangener seine letzte und längste Reise von Caesarea nach Rom an. Vorschrift war, daß, wer zum gerichtlichen Termin nach Rom bestellt wird, auf der Reise täglich 20 römische Meilen oder 30 km machen soll[99]. Aber das ließ sich für Paulus nicht innehalten; denn es war schon Spätherbst; das stampfende Schiff lief bei hoher See, der Sturm verschlug ihn bis nach Malta, und da hielt der[S. 69] Winter ihn drei ganze Monate fest. Dann brachte ihn und seine Fahrgenossen ein alexandrinisches Schiff im ersten Frühling glücklich nach Puzzuoli, jenem großen Weltemporium, auf dessen Molen auch Senecas Augen geruht haben, und von da wandelte der Verkünder Christi auf der nämlichen Appischen Straße, auf der wir auch Seneca fahren sahen, nach Rom. Ob die Augen beider Männer und Verkünder der Menschenliebe je ineinander geruht haben? Wir wissen es nicht.
Das Schiff, auf dem Paulus landete, war nun aber mit dem Gallionbild der heidnischen Götter Castor und Pollux geschmückt. Es ist auffallend, daß die Apostelgeschichte dies ausdrücklich erwähnt[100]. Unter dem Schutz dieser Götter der guten Schiffahrt kam der Apostel Christi sicher ans Ziel. Viele Schiffe zeigten so irgendein Gottesbild, wie das der Isis. Denn der antike Reisende war gefährdet und brauchte die Fürsorge seiner Götter; vor allem auf See. Gebete und Gelübde vor der Abreise geschahen ständig. Daher die schönen Geleitsgedichte (Propemptica) für die Abreisenden, die wir noch besitzen. Und mit der Landreise stand es nicht anders; am Weg standen darum vielfach die Altäre der Straßen-Laren (Lares viales und semitales[101]), denen man Opfer gab. Bei Landtransporten, die glücklich verliefen, gab man auch dem Herkules den Zehnten des Gewinns[102]. Es war dies die einzige Form des Versicherungswesens, die dem Altertum zur Verfügung stand.
Und nun endlich die Gasthöfe. Wer in Eile war und die Nacht durchfuhr, konnte sie freilich entbehren; aber das kam wohl selten vor[103]. Sonst aber mußte man bei Dauerreisen nachts irgendwo einkehren. Glücklich der, dem ein Gastfreund alsdann sein Privathaus öffnete. Der Apostel Paulus ist auf seiner Fußwanderung nach Rom in der Station Tres Tabernae eingekehrt, die wir auch aus Ciceros Briefen kennen. So hatten sich bei dem gewaltigen Anwachsen des Verkehrs an allen Straßen feste Stationen gebildet und überall das Gasthauswesen entwickelt: „mansiones“ hießen solche Herbergen, vom „Verweilen“ (manere), und daher kommt das französische[S. 70] „maison“. Aber es waren meistens nur Tabernen, budenartige Gebäude und der Aufenthalt gewiß nicht sehr verlockend. Wer möchte wohl heute in den Gasthöfen für Geschäftsreisende, im Hotel Terminus oder Rebecchino oder wie sie heißen, dauernd leben? Ganz dieselbe Frage stellt auch schon Horaz[104]. Eine Nacht genügt. Und ein Hotel Terminus ist gewiß noch golden gegen jene Tabernen des Altertums, die zudem oft von Schlafgästen überfüllt waren[105]. Einmal ist uns das Gespräch eines Reisenden mit der Wirtin aus einer dörflichen Herberge noch erhalten. „Wirtin, laß uns abrechnen.“ „Geliefert ein Schoppen Wein, dazu Brot: macht 1 As; warme Speise: macht 2 As.“ „Das stimmt.“ „Dazu ein Mädchen: macht 8 As.“ „Auch das stimmt.“ „Heu fürs Maultier: 2 As[106].“ Das ist die ganze Rechnung[107]. Die Ernährung des Tieres kam also fast ebenso teuer (oder billig), wie die des Menschen. Es wird wohl nicht überall so gewesen sein.
Nun aber der Staat! die Reichsverwaltung! Sollte sich nicht auch der Staat selbst die wunderbare Entwicklung des Straßenwesens zu Nutzen machen? Von der einen Tiberstadt aus sollte er die Türkei, Ägypten, Tunis, Frankreich, Spanien, Südengland, die Schweiz, Tirol verwalten: für die zahllosen jährlichen Einläufe, Meldungen, Rechenschaftsablagen, Erlasse, Edikte setzt dies ein rasch und regelmäßig funktionierendes und dabei unendlich verzweigtes Nachrichtenwesen, einen grenzenlosen Depeschenbetrieb voraus. Der Senat beschickte von sich aus die ihm unterstellten senatorischen Provinzländer; im übrigen war das Reich kaiserlich und der Kaiserpalast auf dem Palatinhügel der zentrale Wirbelpunkt der Dinge, wo sich die Büros der Hausministerien, die kaiserlichen Sekretariate (ein griechisches, ein lateinisches) mit unendlichem Personal für Abfassung und Versand der allerhöchsten Verfügungen (ab epistulis), für Bittschriften und ihre Erledigung (a libellis) befanden. Wer den täglichen, hastenden Betrieb auf sämtlichen preußischen Ministerien, Finanz, Handel, Unterrichtswesen, Justiz usf. zusammennimmt, mag sich davon annähernd ein[S. 71] Bild machen. In die Hauptstädte der Provinzen, Lyon, Lambese, Antiochia, Salonae, Tarragona, Corduba, Tanger, wo die kaiserlichen Legaten und Prokuratoren saßen, mußten, ungehindert durch Zeit und Raum, die Arme der kaiserlichen Verwaltung hinüberreichen, um Kontrolle zu üben, tausend Entscheidungen zu übermitteln. Die Akten, die Papiere flogen hin und her. Daher hat auch schon Augustus, der erste große Weltordner vor Kaiser Hadrian, die Reichspost eingeführt, die man den „Staatskurs“ (cursus publicus) nannte und die durch alle Länder lief. Auf dem Meere dienten hierfür die leichten Kurierschiffe des Staates[108], Schnellsegler, zumeist Liburnen, für deren Schiffstypus man das Muster von den Dalmatiern, den besten Seeleuten an der illyrischen Küste der Adria, nahm, wo auch heute noch die kühnsten Seeleute zu finden sind (eben darum möchte sich Italien heute gern dies Dalmatien einverleiben, wenn es könnte)[109]. Die Wagenpost über Land aber hatte Relaissystem; d. h. an allen Stationen wurde immer wieder umgespannt[110], und die Pferde und Mäuler standen dafür also in den Stallungen immer bereit (mutationes). Der Postgaul heißt „veredus“, das Extrapferd „paraveredus“, ein halbwegs gallisches Wort, wovon letzten Endes unser deutsches Wort „Pferd“ sich herleitet. Jedoch fuhr die Post nicht an bestimmten Tagen und Stunden, und feste Fahrpläne, Reichskursbücher, gab es nicht. Die Post hielt sich immer nur an den Ausgangsstationen bereit, und wo Passagiere sich meldeten, wurde gefahren.
Es waren dies aber ausschließlich nur offizielle Personen der Reichsverwaltung und ihre Beauftragten; für den Privatverkehr diente die Reichspost nicht. Schon ohne ihn war die Inanspruchnahme enorm. Wollte sie ausnahmsweise ein Privatmann benutzen, so mußte er von der Regierung und an höchster Stelle sich dazu eine Bescheinigung, Permeß (Diplom) erwirken. In dringenden Fällen gab es Eilpost in Extrawagen (cursus velox)[111]. Der Postbetrieb selbst aber erforderte nun wieder ein starkes Beamtenpersonal an Postdirektoren, Stallmeistern,[S. 72] Wegaufsehern usf., ein Personal, das, wie heute unsere Briefträger und Eisenbahnschaffner, militärischen Charakter trug und sich an allen größeren Plätzen zu Innungen oder Collegia zusammentat[112]. Die Kosten des Ganzen aber mußten die Provinzländer, die von der Sache den Vorteil hatten, tragen, indem sie die Transportmittel lieferten: eine Belastung, die erst Kaiser Hadrian, der große Neuordner des Reichs, wesentlich erleichtert hat. Hadrian war der berühmte Reisekaiser, der persönlich unausgesetzt durch alle Länder eilte, und er zentralisierte darum auch die Weltpost, ungefähr so, wie wenn man heute das Eisenbahnsystem ganz Europas mit allem Betriebsmaterial unter die einheitliche Leitung Berlins oder Wiens stellen wollte.
Es versteht sich, daß zur kaiserlichen Post auch noch das amtliche Meldewesen gehörte, ein Botenverkehr über Land mit Ablösung in der Weise, daß z. B. zwischen Lyon und Rom 40 Boten sich ablösen und die Schriftsachen weitergeben, so daß in 8 Tagen die Botschaft am Ziel ist[113]. Es waren Schnelläufer, die, wo es anging, Richtwege benutzten.
Ein vom Kaiser für Privatleute ausgestellter Reiseschein war aber nur so lange gültig, als der Kaiser lebte. Bei Regierungswechsel mußte man sich daher vorsehen. Einem gewissen Coenus ging es damit übel. Es war dies ein Grieche, einer der gerissenen und schwerreichen Leute des Freigelassenenstandes, zur Zeit der Thronwirren des Jahres 69 n. Chr. Kaiser Otho war eben in der Schlacht besiegt und hatte sich selbst getötet; sein Gegner und Nachfolger Vitellius funktionierte aber noch nicht als Kaiser. Coenus will gern die Eilpost nach Rom benutzen; dazu hat er von Kaiser Otho einen Permeß in Händen, der nun eben seine Gültigkeit verloren hat. Nun lügt er den Senatoren, die noch schwanken, wen sie jetzt als Kaiser Roms anzuerkennen haben, vor, Otho lebe noch, habe soeben noch einmal einen Sieg gewonnen, sein Reiseschein sei also noch gültig; und so kam Coenus damit auch wirklich nach Rom. Aber er büßte den Kniff mit dem Tode. Vitellius[S. 73] ließ sich hernach das Vergnügen nicht entgehen, ihn hinzurichten[114].
Aus derselben Zeit haben wir die Nachricht von der schnellsten Reise, die unseres Wissens das römische Postwesen möglich gemacht hat. In unseren Augen ist sie freilich nicht allzu erstaunlich. Die Sache spielt ein Jahr früher als die vorige, im Jahre 68, und wieder ist einer der Griechen dabei die Hauptperson; er heißt Ikelus. Der alte, über 70jährige Kriegsmann Galba steht in Spanien und ist dort von den Regimentern zum Kaiser ausgerufen worden. Nero hört das in Rom und tötet sich vor Entsetzen selbst. Der Senat ist bereit, Galba als Kaiser anzuerkennen. Ikelus freut sich des; er ist des Galba Kreatur; Galba hat diesen Griechen, der einst Sklave war, zum römischen Ritter gemacht. In Wirklichkeit aber war Kaiser Galba vielmehr die Kreatur des Ikelus; um seinerseits zu herrschen, sucht dieser Mensch das Kaisertum Galbas auf alle Weise durchzusetzen. So wirft er sich in Ostia auf einen Schnellsegler, schifft kühn und in gerader Linie nach Tarragona durch das offene Meer, wirft sich dort in die Eilpost und ist schon in sieben Tagen in dem Nest Clunia, um Galba die Anerkennung des Senats zu überbringen. Eile tat Not. Unglaublich fand Plutarch diese Leistung[115]. Um so träger und schwerfälliger vollzog dann freilich der alte Herr seinen Einzug in Rom. Aber er war doch Kaiser geworden, setzte sich in Neros Palast fest, und Ikelus konnte nun in Galbas Namen sich bereichern, konfiszieren und rauben.
Denkwürdiger ist noch Kaiser Hadrian, und wir wüßten gern über ihn Genaueres. Auch Hadrians Eilfahrten wurden angestaunt, und daß er über Land den Postwagen benutzt hat, scheint selbstverständlich, zumal er die Kaiserin Sabina zumeist mit sich führte. Auch der ganze Regierungsapparat, die Minister, die Bureaus zogen mit ihm, vom Tajo bis zum Euphrat. Es mag Zufall sein, daß der Wagen uns in den Berichten kaum je ausdrücklich erwähnt wird. Jedenfalls aber hat der großartige Mann — er selbst ein Schnelläufer — auch[S. 74] weite Strecken zu Fuß hinter sich gebracht[116]. Er reiste stets ohne Hut, auch bei dem schlimmsten Unwetter, bei Regen und Kälte, und aus diesem Umstand wird ausdrücklich seine schwere Erkrankung, die ihm den Tod brachte, hergeleitet[117]. Wer aber im Wagen sitzt und darin den Hut abnimmt, wie wir es heute in der Eisenbahn tun, dem kann das Unwetter nichts anhaben.
Soweit das Postwesen des Altertums; gewiß eine großartige Organisation, die die Regierung schuf. Hiernach gilt es noch eine geringfügige Sache zu erwähnen, die man gleichfalls ihr verdankte. Ich meine die Zeitung, und die Frage regt sich, ob das alte Rom nicht auch schon den Zeitungsschreiber, den Journalisten, kannte. Indem wir uns aber diesem Gegenstand zuwenden, ist zugleich auch vom Brief zu handeln. Denn aus dem Brief ist die Zeitung des Altertums hervorgegangen.
Zunächst also der Privatbrief. Wir denken an die Briefe des Apostels Paulus, des Cicero — eine tägliche Riesenkorrespondenz aus Millionen Häusern von Menschen, von Bürgern, die sich lieben, sich hassen, die Geld fordern, Grüße senden, schelten, trösten und beraten, ein tägliches Durcheinanderreden aus allen Weltwinkeln: Geschäftsbriefe, Liebesbriefe, Plauderbriefe, Kondolenzbriefe, Einladungsbilletts, Lehrbriefe. Wie mannigfaltig der Inhalt! Der reisende Brief war noch zahlreicher als der reisende Mensch. Schnell war er hingeschrieben; er wollte auch schnell ans Ziel; denn er mußte den Römern Telegraph und Telephon ersetzen. Aber die Staatspost beförderte ihn nicht. Der Brief mußte selbst sehen, wie er ans Ziel kam.
Dazu hatte jeder Bürger seine Dienerschaft. Irgendeiner der Diener war als Briefträger immer ganz wohl abkömmlich; andernfalls taten auch Freigelassene, die überhaupt oft als Geschäftsreisende fungierten, den Dienst sehr gern. Denn sie bekamen dabei die weite Welt zu sehen, bekamen gutes Zehrgeld mit und wurden überall wie die Engel aufgenommen;[S. 75] denn auch das Wort „Engel“ heißt ja der Bote auf deutsch. Übrigens halfen sich auch die Bekanntenkreise aus. Expediert heut Freund Markus Briefe nach Patras, nach Brindisi, dann kann der und jener seinem Boten die eigene Post gegen angemessene Vergütung mitgeben. Derartige Gelegenheiten gab es immer unendlich viele. Für uns ist der Postbote heute eine Maschine, die regelmäßig geht wie der Zeiger an der Uhr, und wir sind ihm zwar im Prinzip wohlgesinnt, geben aber auf seine Person oft kaum noch acht. Im Altertum war schon, wenn er sich von weitem zeigte, freudige Erregung; er wurde im Haus festgehalten, gespeist, beschenkt, in gute Stimmung versetzt, denn man wollte ihm neue Post mitgeben, und dabei wurde zugleich sein Charakter, seine Zuverlässigkeit erprobt. In den dicken Bündeln, die er trug, steckten oftmals Briefe von vielen Händen, die man paketweise zusammengetan hatte, ja, auch Briefe an viele, die es jetzt zu verteilen galt. So stand z. B. Cicero in Massenkorrespondenz mit dem Heerlager Caesars in Gallien und Britannien und seinen Offizieren. Der Betrieb war geradezu organisiert[118]. Wenn Cicero auf seiner pompejanischen Villa saß, erhielt er dorthin binnen drei Tagen die Briefe des Atticus aus Rom[119]. Alle Briefe wurden immer genau datiert. Das war nicht nur Pedanterie; am Datum konnte man feststellen, wie schnell der Bote gelaufen, ob er nicht säumig gewesen war. Jener Atticus, Ciceros Gewissensrat, einer der reichsten Herren mit zahlloser Dienerschaft, außerdem der Hauptbuchverleger Roms und daher auch mit Schreiberpersonal reich versehen, hatte für postalische Zwecke stets einen Läufer bereit, und Cicero ist darum auch in der Lage, oft täglich mit ihm Briefe zu wechseln. Oft schreibt er nur rasch einen Gruß hin, um doch etwas geschrieben zu haben, so wie wir heut völlig inhaltlose Ansichtspostkarten schicken. Ein Gruß genügt. Es ist doch immer ein Lebenszeichen[120]!
Sorglich wurde jeder Brief versiegelt; mit Siegel sicherte man außerdem auch noch das geschnürte Briefbündel. Denn[S. 76] die Zuverlässigkeit der Läufer war doch nicht immer gesichert. Schon die bloße Neugier verlockte zum Lesen, es geschah aber auch oft im Auftrag. Denn in politisch erregten Zeiten war das Spionieren gang und gäbe; die Leute wurden bestochen, das Briefgeheimnis war gefährdet. In der Zeit der römischen Bürgerkriege wurden die Postsäcke so geplündert, wie England es im verwichenen Kriege machte, indem es sogar die Schiffe der neutralen Mächte bestahl[121]. In wichtigen Fällen sicherte man sich deshalb durch Geheimschrift, brauchte sogar auch sympathetische Tinte, die sich unsichtbar machen läßt[122]. Am schlimmsten stand es damit in den Schreckensjahren unter Nero; im Jahre 67 n. Chr. hatte in Rom alle Privatkorrespondenz völlig aufgehört. Die Angst vor der Zensur von oben war zu groß. Die Briefträger (Grammatophoren) brachten damals nur noch die Meldungen von den letzten Hinrichtungen in die Häuser. Es war die Zeit des Grauens, und das Publikum wehrlos, denn die Garde sicherte den Tyrannen[123]. Zum Glück lebte damals Seneca nicht mehr, und niemand konnte seinen Briefen noch etwas anhaben.
Dieselben Schreckensmeldungen von den Justizmorden in Rom hat man damals gewiß auch in der Zeitung lesen können. Denn auch eine Zeitung, ein stadtrömisches Tageblatt, gab es damals, das man über alle Provinzen verschickte. Es fehlte den alten Römern nur an Kaffee und Zigarren, sonst hätten sie mit ihrer Zeitung just so dagesessen wie wir.
In Ciceros Zeit war sie entstanden. Es war natürlich, daß in jenen Zeiten des erregtesten politischen Lebens, wo es in der Hauptstadt täglich Weltentscheidungen gab, die Römer, die im Ausland standen, mit gewisser Regelmäßigkeit erfahren wollten und mußten, was los war, was da vor sich ging. So schrieben berufene Männer zunächst nur private Berichte in Briefform über das Neueste an ihre Freunde. Muster solcher Berichte besitzen wir von Ciceros Hand[124]. Indem sie sich wiederholten und häuften, entstanden Serien in Zeitfolge, und auch der Privatcharakter blieb nicht gewahrt. Der Empfänger[S. 77] las die Briefe seinen Freunden im Club vor; ja man verbreitete sie in Abschriften: Abschrift aber ist immer Veröffentlichung. So wurden ja auch des Apostels Paulus Lehrbriefe publiziert; Paulus schickte seine Sendschreiben an die Korinther-, die Römergemeinde, die Gemeinde aber sorgte durch Kopie für geziemende Verbreitung, und so erhielt sich der Text und wuchs an Bedeutung mit dem Wachsen des Christentums.
Den erzählenden Brief, in dem feuilletonistisch Wichtiges und Unwichtiges planlos durcheinanderstand, hat man den Zeitungsbrief genannt; aus diesen Zeitungsbriefen ist durch Veröffentlichung damals die Tageszeitung hervorgegangen. Man gedenke zum Vergleich an die Feldpostbriefe aus dem vergangenen großen Krieg; auch aus ihnen, die damals in der Tat so vielfach abgedruckt wurden, hätte man leicht eine vollständige Kriegszeitung zusammenstellen können, und Versuche der Art wurden ja auch gemacht. Julius Caesar war es, der in Rom im Jahre 59 v. Chr. die amtliche Herausgabe täglicher Berichte, der acta diurna, wie man sie nannte[125], die unter den späteren Kaisern die Hofkanzlei beaufsichtigte, veranlaßte, also eine Staatszeitung, deren Ruhm allerdings nur darin besteht, daß sie 400 Jahre ununterbrochen bestanden hat. Welches moderne Blatt kann auf solches Alter zurückblicken? Journalistische Talente aber, die es einem Cicero gleich täten, übten sich nicht daran. Die Zeitung war jedenfalls völlig anonym. Keine Verfasser werden uns genannt; kein erheblicher Schriftsteller scheint sich beteiligt zu haben. Wer schreiben konnte, schrieb lieber im großen Zusammenhang Geschichtsbücher oder Memoiren, und der Inhalt der „acta“ mag also ledern genug gewesen sein. Übrigens aber kamen daneben als wichtige Ergänzung zeitweilig auch die Parlamentsberichte heraus. Sie betrafen den Senat. Stenographisch wurden die Reden der Senatoren während der Sitzung nachgeschrieben und gingen in Buchform unter der Bezeichnung „Senatsakten“ (acta senatus) ins Publikum aus. Ohne diese ist der Historiker Tacitus nicht denkbar[126]. Die geistvollsten und besten Männer, die der[S. 78] römische Staat besaß, kamen darin zu Worte; die wichtigsten Entscheidungen konnte man da in ihrer Entstehung verfolgen. Wer bei Tacitus die wundervollen Schilderungen der Senatsverhandlungen unter Kaiser Tiberius und Claudius liest, erinnere sich dabei an jene offizielle Quelle, aus der sie stammen. Ganz anders das Tageblatt der acta diurna; es ist damals von den Historikern als Geschichtsquelle nie gebührend ausgebeutet worden; ja auch das großartige Bibliothekswesen Roms scheint die Zeitung, in die wir so gern einmal einen Blick würfen, einer sorglichen Aufbewahrung kaum wert gefunden zu haben[127]. Auf alle Fälle aber war durch sie für das wißbegierige Volk und den Nachrichtenhunger des Publikums ausreichend gesorgt; wer die neuesten Nachrichten haben wollte, konnte sie haben.
Blicken wir zurück, so scheint der Eindruck unabweislich, daß in den wichtigsten der Dinge, die ich besprochen, im Straßenbau und Reichspostwesen das Europa der Zeit Kaiser Hadrians das Europa der Zeit Friedrichs des Großen und Napoleons ganz erheblich übertroffen hat. Denken wir nur, wie lange ein Reisender im 18. Jahrhundert brauchte, um von Madrid nach Wien, wie lange ein Warentransport, um von Cöln nach Konstantinopel zu kommen! und wie hätte man es damals wohl fertig gebracht, ein Heer von Paris bis an den Euphrat zu werfen? Diese Fragen sind voll berechtigt. Und doch — den Hauptnachteil des antiken Verkehrslebens habe ich noch gar nicht berührt, und damit ändert sich das Bild sofort. Das ist das Aussetzen der antiken Schiffahrt bei Sturm; ich meine das Altertum im Winter. Das Mittelmeer war die große Hauptverkehrsstraße der Antike. Sie war im Winter völlig unbenützbar. Das ganze Leben war durch den Winter blockiert.
Den Mangel der Kohlenindustrie teilte das 18. mit dem 2. Jahrhundert; aber die Neuzeit hatte den Kompaß, das Altertum hatte den Kompaß nicht. Dieser scheinbar so geringfügige Mißstand war es, der das ganze Altertum, das sonst so tatkräftig, entdeckungsfreudig war, lahm setzte. Wie sollte man auf offener See Weg und Richtung nicht verlieren? Man[S. 79] mußte sich immer ängstlich in Sicht des Landes halten, eine beklagenswerte Gebundenheit, und nur der Tollkühne wich bei allerhöchster Not hiervon ab, so wie jener Ikelus, als er dem Galba die wichtige Kaiserbotschaft brachte. Es ging für ihn auf Leben und Sterben. Eben darum vermied man auch nachts auf offener See zu fahren und ging abends in den ersten besten Hafen. Selten, daß einmal zur Nachtfahrt ein Schiff wirklich Lichter aufsetzt[128]. Die kühnen Entdecker unter den Seefahrern, die durch die Straße von Gibraltar stießen, ein Hanno, ein Pytheas, sie sind allerdings bis England und Jütland gefahren, den Nordstürmen Trotz bietend, haben sogar auf der Straße Vasco de Gamas Afrika bis in die Nähe des Äquators zu umschiffen begonnen, denn das war auch bei kompaßloser Küstenfahrt möglich; den Vorstoß nach Amerika hat man dagegen im Altertum nur vorausgesagt, aber nicht ausführen können.
Nun aber der Winter. Im ganzen Winter war kein Schiff mehr auf dem weiten Mittelmeer zu sehen; alles wie weggeblasen; wie eine leere Tenne; wie der Tanzboden, wenn der Wirt Schluß macht und alle Lichter auslöscht. Der Gott Poseidon blieb vier volle Monate in seiner schäumenden Wasserwüste mit seinen Delphinen und Haifischen allein: alle Schiffe und Boote an Land gezogen und auf den Staden aufgelegt. Kapitän und Bootsmann strecken die Glieder aus und ruhen. So hörten wir ja schon vom Apostel Paulus: monatelang blieb er, als er zu Schiff nach Rom wollte, im Winter auf der Insel Malta liegen. Wenn die Sturmwolken gingen, konnte man in der dicken Luft und in der Lichtlosigkeit die Küsten nicht sehen: dies war nach Vegetius der Grund[129], den wir vollauf begreifen. Ganz so wie Paulus wird auch ein gewisser Kephalion, der dem Atticus Briefe überbringen soll, „viele Monate“ zurückgehalten[130]. Mindestens 40 Tage brauchte im Winter ein Brief von Rom nach Spanien, weil er da eben über Land laufen mußte[131]. Cynthia, des Properz Geliebte, will mit einem hohen Beamten nach Epirus reisen, aber Gottlob[S. 80] ist es noch Winter; sie kann noch nicht auf See. „Wenn der Frühling kommt,“ so droht ihr der Dichter, „werde ich am Strand stehen, um dir, wenn du abfährst, nachzuschauen, und dir schlechte Fahrt wünschen.“ Der Frühling kommt, da bleibt Cynthia in Rom, sie reist nicht, und der Liebende ist glücklich.
Um so bewunderungswürdiger war die geniale Kühnheit Caesars[132], der im Bürgerkrieg gegen Pompejus alles riskierte und sein Heer zu solcher Jahreszeit über die Adria und hernach nochmals von Sizilien nach Tunis warf[133]. Erst wer die Dinge, die ich hier vortrage, beachtet, kann solche Leistungen voll würdigen. Es waren ganz vereinzelte, heroische Ausnahmen. Und nun werden uns auch auffallende Erscheinungen im politischen Leben des Altertums verständlich. Markus Antonius, der Triumvir, verbringt den Winter des Jahres 41 auf 40 v. Chr. mit Kleopatra untätig in Alexandria; während dessen macht seine ehrgeizige Gattin Fulvia, die selber in Waffen einherging, in Italien Krieg gegen den Machthaber Oktavian; auch des Antonius Bruder Lucius ist dabei und führt das Heer; der Winterkrieg um Perusia entbrennt. Perusia, die Stadt, fällt; Lucius kommt um; Fulvia selbst muß aus Italien fliehen. Von all dem ahnt Mark Anton in Ägypten gar nichts, bis das Frühlingsäquinoktium vorüber ist und das erste Kurierschiff von Puteoli nach Alexandria läuft. Da sieht der Herr des Orients plötzlich die kolossal veränderte politische Lage und muß rasch seine Entschlüsse fassen[134]. Es war, als wäre das Kabel gerissen, und es erinnert uns unwillkürlich an das, was wir während des Weltkriegs Ende April 1916 erlebt haben. In Dublin erhebt sich plötzlich der Aufstand Irlands gegen die Engländer; das Postgebäude, die Bahnhöfe werden dort von den Iren besetzt; in London aber weiß man davon nichts, bleibt ganz ohne offizielle Nachrichten, bis zufällig ein paar Reisende die Sache in London erzählten; „eine vollständige Überraschung“. Die Iren hatten diese Isolierung dadurch bewirkt, daß sie das Kabel nach England und außerdem in ihrem Lande selbst alle Telegraphendrähte durchschnitten[135].[S. 81] Ganz ähnlich begründet war die Überraschung, war die Nachrichtenlosigkeit des Mark Anton.
Nun denke man sich das antike Rom oder Neapel im Winter. Italien konnte sich nicht selbst ernähren. Jedes Jahr mußte es sich bis zum Herbst und zum Schluß der Schiffahrt von außen vollständig verproviantieren; die Handelsflotten mußten ausreichende Wintervorräte an Korn und an anderen Eßwaren, auch an Schreibpapier, von den Provinzen herangeschafft haben. In mächtigen Speichern lagen die Vorräte aufgehäuft. Dann kam die tiefe Winterstille über Stadt und Land, die große Siesta. Die Kaufherren hatten nichts zu tun, der Export und Import regte sich nicht. All die Tausende von Werkleuten waren unbeschäftigt. Eine Industrie gab es kaum im Lande, wenn wir die großen Ziegeleien und Topffabriken nicht rechnen. Auch die ungedeckten Theater und Amphitheater waren beim Winterregen schlecht zu benutzen. Was sollte man weiter tun, als zu Haus Feste feiern, schmausen und schlafen? Man saß also in seinen kalten vier Wänden, vertrieb sich im Kleinleben die Tage, so gut es ging, vertrank den ganzen Monat Dezember[136], rechnete sein Soll und Haben nach; auch für Senatsdebatten war vollste Muße, für Redeturniere und Dichterdeklamationen. Dazu aber kam noch eins: man stand spät auf und ging früh zu Bett, mit der Wintersonne. Man hatte damals noch die natürliche Zeit, die sich nach dem Tageslicht richtet; der Wintertag war kürzer als der Sommertag. Man konnte sich ausschlafen — bis endlich der Frühlingsanfang kam: der beglückende 5. März, die Eröffnung der Schiffahrt! Die Wintervorräte waren aufgebraucht. Zur Feier des Tages wurde aus allen Häfen am 5. März ein menschenleeres Schiff ins Meer hinausgestoßen. Mochte es in den Wellen untergehen; es war ein Opfer, das man den Göttern darbrachte, und zwar der Göttin Isis. Denn nach Ägypten, dem Lande der Isis, ging doch immer fast aller Seehandel, auch der Transit. Das Schiff war als Spende für die Göttin prächtig geschmückt und mit Spezereien[S. 82] angefüllt. So trieb es hinaus, indes froh andächtig das Volk im Festschmuck am Ufer stand und ihm nachspähte. Die Winterblockade war aufgehoben.
Eine Blockade! Soll ich mit dem Wort enden? Uns Deutsche muß das Wort heute nachdenklich stimmen. Muß es uns nicht in der schicksalsschweren Gegenwart, in der wir leben, unwillkürlich an unser Deutschland erinnern? Auch wir sind ja bis heute blockiert, und es ist uns ein Wort der Qual geworden. Wann kommt der Tag, wo wir, endlich wieder ein freies Handelsvolk wie jene Alten, ein Schiff festlich schmücken können, um es hinaus ins Meer zu treiben? Wir glauben an keine Isis mehr. Aber wir glauben an den guten Geist in uns und über uns, der uns zur rechten Stunde endlich doch das Gelingen geben wird.
[S. 83]
Das Altertum nannte einen Grabbau von gewisser Großartigkeit ein Mausoleum. Der Name rührt von dem berühmten Grabmal des kleinasiatischen Königs Mausolos her. Im letzten Krieg ist daraus der Scherzname Lausoleum entstanden; der Name war Scherz, die Sache selbst aber bitterer, ja erbitterter Ernst. Es waren damit die trefflich organisierten Entlausungsstätten für unsere wackeren, schwer geplagten Krieger, aber auch für die feindlichen Gefangenen gemeint, die aus dem Feindesland, vor allem aus dem östlichen, der Heimat aller Unsauberkeit, nach Deutschland kamen und vor dem Überschreiten der Grenze einer gründlichen Reinigung unterzogen wurden. Sie erlitten es gern, denn das Schrecklichste fiel von ihnen ab. Auch das Lausoleum war somit eine Grabstätte, wenn wir den Scherz, der in dem Namen liegt, ausschöpfen wollen. Es war die Grabstätte des ärgsten deutschen Landesfeindes geworden; aber nicht die Laus, sondern der Körper, der sie trug, feierte aus diesem Grab die Auferstehung, den Übergang in ein besseres Dasein, und er fühlte sich selig, wie im Himmel.
Da das Wort Lausoleum eine gelehrte und klassische Reminiszenz ist und an das Griechische und Antike anklingt, so möchte man fragen, ob denn das so oft und gern gepriesene klassische Altertum die Läuseplage etwa auch schon kannte, und wie es sich ihrer erwehrt hat. Hat jener König Mausolos, den ich nannte, mit Verlaub, sich nicht auch gelegentlich gegen einen peinlichen Hautreiz wehren müssen? In den Museen stehen all die griechischen Götter und Heroen, Apoll und Hermes und Meleager, die griechischen jungen Speerträger und Ringer (um von den Göttinnen ganz zu schweigen) in Gips und Marmor so appetitlich und sauber da. Hat wirklich das trivialste und zudringlichste aller Insekten ihre Haut nie berührt? Im Jahrgang 1915 der Hygienischen Rundschau Nr. 24 befindet sich ein anregender Aufsatz über „Die Laus in der Kulturgeschichte“[137].[S. 84] Da werden ungefähr alle Zeiten und Völker in bezug auf diesen Schmarotzer des menschlichen Körpers in Betracht gezogen, und wir hören insbesondere von den östlichen Völkern manches Erstaunliche; so auch von der Toleranz und Schonung, die die orthodoxen Christen des byzantinischen und des russischen Reichs, vor allem die dortigen Mönche in ihrem Klosterleben, die aber auch die frommen Buddhisten in Indien gegen diese widerwärtigen Blutsauger, die auf ihnen zur Weide gingen, ausgeübt haben. Man tötete sie nicht! Der Satz „Liebet eure Feinde“ wird da in unerhörter Weise verwirklicht: eine erschreckende Verirrung der Tierliebe und der Gottesfurcht. Ja, auch unser alter deutscher Dichter Fischart, auch Rabelais dient in jenem Aufsatz als Zeuge für diese und ähnliche Dinge, und so bringt er endlich auch einige aufklärende Angaben, die die alten Griechen und Römer betreffen. Doch lohnt es sich, bei diesen beiden Völkern uns etwas ausführlicher umzusehen, da wir damit in eine Kulturperiode der Menschheit Einblick erhalten, die unserer modernen in so manchen Punkten ebenbürtig, in manchen sogar auch überlegen war[138].
Es sei vorangestellt, daß das Tier, das uns jetzt beschäftigen soll, auf griechisch phtheir[139], auf lateinisch pediculus heißt.
Wer an den großen, wundervollen Homeros denkt, wird die Reinlichkeitsfrage gar nicht erst erheben. Wer möchte in solchem Zusammenhang den Namen Achills oder der Helena aussprechen? Odysseus kehrt zu seiner Penelope heim. Der Haushund lebt noch, der einst jung war, als Odysseus Ithaka verließ; jetzt liegt das Tier im Verscheiden und ist räudig geworden. Aber Homer schildert uns das Ungeziefer nicht, das auf ihm nistet.
Aber dem Homer, dessen Person unter der modernen Kritik zum Schatten geworden ist — denn wer kann ihn sich noch deutlich als Menschen denken? —, ihm ist im Altertum eine ausführliche Biographie angedichtet worden, und da lesen wir:[S. 85] der Dichter der Iliade, der weithin Griechenland durchwandert, findet irgendwo am Meeresstrand Fischersleute und läßt sich in ihrer Gesellschaft nieder; da kommen die Söhne der Fischer vom Meer, steigen aus den Booten, aber ohne Beute, und geben nun das berühmte Rätsel auf:
Selbst ein Geist wie Homer löst dies Rätsel nicht; denn er ist zu erhaben für solche Dinge. Die Läuse sind’s, um die es sich handelt; erst wenn sie gefangen sind, hören sie auf, bei uns zu sein; die nicht gefangen sind, die eben haben wir!
Diese Stelle steht fast einsam da in der griechischen Literatur. Die Zoologie der Griechen, Aristoteles und seine Nachfolger, haben die Laus natürlich beachtet und in ihr System aufgenommen. Aber ihr eigenartiges Leben und Weben, ihr Kribbeln und Krabbeln, ihre Tücke und blutgierige Menschenliebe uns lebendig zu schildern, dazu lassen sich solche Autoren nicht herbei. Schon das Homer-Erlebnis aber verrät uns: nur bei Fischern und anderen Leuten rein dörflichen Lebens, oder doch nur da, wo vollkommene Armut herrscht, sind diese leidigen Parasiten zu finden; nur da sind sie von uns vorauszusetzen; die schönheitssüchtige Literatur der Griechen blickt selten in diese dörfliche Volksschicht hinab und nimmt auch dann, wenn sie es tut, solcher Armseligkeiten nicht wahr. Bei dem derben Lustspielschreiber Aristophanes tritt einmal die „Armut“ als Person auf die Bühne, und von ihr heißt es da in der Tat: sie bewirkt, daß um das Haupt des Armen Läuse, Wanzen und Flöhe sich tummeln, so daß er aus dem Bett springt: „auf, an die Arbeit!“[140] Für den, der solche Plage mit sich herumtrug, gab es auch ein besonderes Wort, der „Läuseheger“ und „Läuseträger“. Wir reimen darauf noch: der Läusejäger. Aber das Wort steht nur in den Lexika[141]; wir finden nicht, daß es bei den Schriftstellern selbst in Gebrauch war.
Es gab außer den Dorfleuten in der älteren Zeit noch eine[S. 86] andere Sorte von Menschen, auf die der Ausdruck paßte. Das waren gewisse Anhänger des alten Pythagoras, die Pythagoristen, die so fromm sind, daß Hades, der Gott der Unterwelt sie, wenn sie sterben, zum Lohn mit an seinen Tisch zieht, obschon sie im Schmutz starren. Sie tun das aus philosophischer Überzeugung. Wir hören, wie man in Athen diese Sonderlinge, die nur Kräuter essen, nur Wasser trinken, sich aber nie waschen und den Rock voll Läuse haben, verhöhnt hat[142]. Aber sie standen außerhalb der Gesellschaft; das war kein wirkliches griechisches Leben.
Höchst auffällig, daß sonst die ganze Literatur von solcherlei Menschen nichts zu wissen scheint, und zwar nicht nur die griechische, sondern nahezu ebenso auch die der Römer! Die antike Literatur ist immun und von früh an insektenfrei. Aristophanes, derselbe Dichter, den ich schon nannte, er war keineswegs nur der anmutige Possenreißer, im Gegenteil: ein Unflat war er, der sonst wahrlich kein Blatt vor den Mund nimmt, um in derbsten Tönen alle sexuellen Realitäten wie auch die Dinge der Leibesnotdurft vorzuführen. Aber die Insektenplage?
Den geflügelten Mistkäfer führt er zwar vor, in Riesengröße; der Held des Stückes fliegt auf dem Mistkäfer gen Himmel unter Gestank. Den Philosophen Sokrates läßt er ferner mit Flöhen umgehen; der Floh ist der Aristokrat unter diesen Tieren, und Sokrates nützt ihn gleich zu wissenschaftlich-experimentellen Zwecken aus; er will wissen, wie weit Flöhe springen können. Ein Floh hopste vom Kopfe des Chairephon auf den Kopf des Sokrates; nun werden die Flohfüße in Wachs abgegossen und dann irgendwie die Sprungweite gemessen[143]. So heißt es noch anderswo bei demselben Dichter, daß die jungen Mädchen tanzen wie die Flöhe in den wollenen Bettdecken[144]. Ja, auch Schaben und Wanzen fehlen da nicht und sitzen im Haus am Mauerwerk fest[145]. Insonderheit der Reisende fürchtet sich vor den Wanzen in den Nachtherbergen[146]. Aber Läuse? Nein! Die Weiber ziehen sich in naturwüchsigstem[S. 87] Gebaren bei Aristophanes aus und an und reden dabei die natürlichsten Dinge. Läuse fehlen. Auch eine Rasierszene ist da, wo alles voll Ulk und sehr umständlich hergeht; Anlaß genug, solche Gäste in den Barthaaren zu finden; sie finden sich nicht[147]. Der bäuerische Volksmann Dikäopel sitzt frühmorgens einsam in der leeren Volksversammlung, wartet, daß die anderen Bürger kommen, und gähnt und rekelt sich derweilen, zupft sich die Haare und tut sonst noch, was wenig anständig ist; aber er laust sich nicht.
Nur Andeutungen gestattet sich der Dichter; sein Stück „die Wolken“ fängt bei Nacht an; ein alter Athener liegt da zur Nachtruhe und kann nicht schlafen; „will es noch nicht Tag werden? mich beißen die Sorgen,“ seufzt er, und nochmals: „mich beißt die Sorge vor dem Exekutor aus dem Bett heraus!“ Da haben wir die beißende Sorge als Ersatz.
Aber wie bei Aristophanes, so steht es auch sonst. Die Hirtenpoesie des Theokrit, die sich unter Ziegen und Kuhherden bewegt, wahrt auch sonst gern allerlei realistische Züge; erst recht tut dies die Tierfabel des Aesop (Phädrus, Babrius). Aber nur Mücken und Ameisen erscheinen da; vom Biß der Ameise wird da gehandelt. Weiter greift auch die Fabeldichtung nicht hinab.
Wohl aber verrät uns Aristophanes an einer Stelle, daß es in der groben Bühnendichtung früherer Zeiten doch anders hergegangen war. Da, wo er stolz vor sein athenisches Publikum tritt und darlegt, wodurch er all seine Vorgänger übertreffe und wie er es sei, der das Lustspiel zu etwas Neuem, Großem und Herrlichem gemacht, da lesen wir, daß die früheren rohen Volksdichter Athens sich begnügten, Leute aus dem Volk, die in Lumpen gehen, vorzuführen, und solche, die da „mit Läusen fechten“[148].
Da taucht also die Laus auf, nach der wir mit der Lupe suchten, und sogar ein Gefecht, eine Phtheiromachie; aber nur, um wieder fast völlig für uns zu verschwinden. Aristophanes hat an der angegebenen bedeutsamen Stelle das Programm[S. 88] der ganzen klassischen Literatur aufgestellt: das Programm der Läuselosigkeit.
Woran liegt das? Die Antwort kann nur sein: an der außerordentlichen Reinlichkeit der Städter, die selbst für die kleineren Stadtgemeinden („Poleis“) Altgriechenlands bezeugt oder doch vorauszusetzen ist. Das leidet keinen Zweifel. Denn nicht nur in den Gymnasien allerorts war Wasch- und Badegelegenheit; es gab auch noch besondere Badeanstalten mit Wannen[149], und auch selbst in den Häusern der kleinen Bürger gab es regelmäßig Badetröge, Badewannen, Badestuben. Man lese dafür solche Stellen wie in des Aristophanes Wespen (v. 141) und Thesmophoriazusen (v. 559). Ein unzurechnungsfähiger, unruhiger Alter will aus seinem Haus; er wird aber nicht herausgelassen; die Tür ist abgeschlossen. Da fürchtet man, er könne von seiner Badestube aus durch den Wasserablauf schlüpfen und so den Ausgang finden. Ein andermal hat sogar angeblich ein Mord in der Familie stattgefunden, und unter der Badewanne im Haus hat man den Ermordeten eingescharrt. Das gibt uns Einblick in die bescheidenen bürgerlichen Wohnhäuser Alt-Athens im 5. Jahrhundert v. Chr., in denen sonst die Hühner und Schweine mit herumliefen. Ein vielgescholtener Demagog Athens war damals Kleon; von ihm wird uns berichtet, wie er den „Demos“ auf das schlaueste gängelt und verzieht; er läßt ihn morgens Gericht halten, schickt ihn dann ins Bad, dann zum Essen und zahlt ihm dazu Tagegelder aus der Staatskasse. Der „Demos“ aber ist das Gesamtvolk der Stadt; ganz Athen badete, wenn der geschäftige Vormittag vorüber[150]!
Was die Männerwelt betraf, so kommt nun die Nackt-Turnerei in den geschlossenen Räumen der Gymnasien dazu; und dazu diente das Öl. Ein Turner ohne Einölung der gesamten Körperhaut war für die Griechen nicht denkbar; ständig wurde deshalb auch nach dem Abschluß der Sportübungen mit dem Striegel Öl und Schweiß vom ganzen Körper abgeschabt. Wo war da noch Raum, ein geruhsamer Wirkungskreis[S. 89] für Insekten? Man denke an den marmornen „Schaber“ des Lysipp im Vatikan. Wie können an solchem Jüngling Parasiten haften?
Eine gleichsam absolute Reinlichkeit, die sich noch steigerte, als nun gar auch das Rasieren Pflicht wurde. Durch 500 Jahre geht das ganze Altertum, und zwar auch die alten Herren, mit so ausrasiertem Gesicht wie Napoleon, Goethe und Schiller. Man denke an den Alexanderkopf, an Julius Caesar, Augustus, Menander. Im Bartwuchs aber findet sonst das lausige Getier gern Unterschlupf, wie das Wild im Walde[151]. Der Unterschlupf war damit niedergelegt. Nur gewisse Fanatiker des Naturwüchsigen, Philosophen und dergleichen, fügten sich der neuen Mode nicht.
Etwas anders steht es mit den Frauen. Sie badeten zwar fleißig, aber sie turnten nicht und ölten sich nicht ein[152], und insbesondere ihre Frisur konnte leicht zur Heimstätte des Gefürchteten werden. Es bestand die Redensart, wenn eine Frau in Trauer war und darum ihr Haupthaar sich glatt wegscheren ließ, sie werde bis auf die Laus geschoren[153]. Das läßt freilich tief blicken.
So begegnet uns denn in der Tat ein einziges Mal eine Dame der feinen Welt, die auch wirklich an diesem Übel litt. Die bessere griechische Gesellschaft und ihr Geistesleben war nicht denkbar ohne die schöne Halbwelt; die Hetären waren, wie allbekannt, Vertreterinnen der besten Bildung, des guten Tons und des Geschmacks, und Künstler, Dichter, Politiker und Philosophen wurden von ihrer Lebenskunst gefesselt. Daher besitzen wir ganze Kataloge von Namen dieser anziehenden Schönheiten. Eine einzige unter ihnen, die Phanostrate, führte den Spitznamen „die am Läusetor“ (Phtheiropyle, gebildet wie Thermopyle), warum? Weil sie die Gewohnheit hatte, vor ihre Haustür zu treten und sich dort die Läuse abzusuchen. Es war gewiß gut, daß sie dies Geschäft nicht in ihrem Hause besorgte. Demosthenes hat in seinen Reden diese Person erwähnt; aber er gibt uns den garstigen Spitznamen nicht; ein[S. 90] Demosthenes nimmt den nicht in den Mund. Nur das Volk Athens hat die Dame so gerufen[154]!
Nichts ist auffallender als Sokrates, den uns Plato in unzähligen Schriften schildert und hinstellt, als ob er vor uns lebte. Plato weiß ganz wohl, daß es Läuse gibt, und da, wo er über verschiedene Künste handelt, stellt er einmal auch mit der Kunst der Strategie und der Jagd die Kunst des Läusefangs zusammen; neben der Strategie und Thereutik steht also die Phtheiristik[155]. Man sollte sich diesen Ausdruck merken, da wir für alle guten Künste so gern griechische Fremdwörter brauchen! Von Sokrates nun aber versichert uns Plato, daß er sich, mit wenigen glorreichen Ausnahmen, nie wusch und badete und daß er immer barfuß ging. Trotzdem kann der Verdacht, eine Laus an Sokrates zu finden, nicht aufkommen. Plato selbst läßt solchen Verdacht nicht zu. Ist es nur Pietät? sollte von ihm nur deshalb, weil er der erhabene Träger aller edelsten Gedanken ist, das gemein Triviale ferngehalten werden? Vielmehr ist Sokrates in Wirklichkeit sauberer als sein Ruf gewesen. Er war durchaus hoffähig, so schlicht er auftrat. Die eklen Standesunterschiede, die heute leider dem Adligen und Landbaron mit dem Fabrikarbeiter, dem Professor mit seinem Flickschuster einen täglichen Verkehr nicht gestatten, gab es in jenem glücklichen Athen noch nicht. Ob reich ob arm, der Männerverkehr stand ausschließlich auf Du und Du: selbst den Kaiser Roms hat jeder armseligste Eckensteher geduzt; und Sokrates, der dürftige, zieht also auch, ohne Anstoß zu geben, die ersten Größen der Stadt, wo er will und so oft er will, in seine Gespräche und tritt, wie er ist, als gern gesehener Gast in die vornehmsten Häuser Athens ein. Er hat durch das, wonach wir suchen, sicherlich keinen Anstoß gegeben; er war immun.
Und was von ihm galt, gilt nun auch von den eigentlichen Straßenphilosophen, die sich deshalb die Hundsphilosophen, die Kyniker nannten, weil sie bedürfnislos wie die Tiere leben wollten. In der Tat sind die Kyniker für die Bettelmönche des[S. 91] Mittelalters, insbesondere für das Mönchtum der griechisch-orthodoxen Kirche, die eigentlichen Vorgänger gewesen. Aber wenn diese christlichen Mönche die Läuse, mit denen Gott der Herr sie plagt, als eine Zuwendung des Höchsten sorglich hüten, die wahren Läuseheger und Läuseträger, so läßt sich das von einem Diogenes und seinesgleichen keineswegs behaupten. Es ist jener Diogenes, der in Athen in einem tönernen Faß auf dem Tempelgrundstück des Metroons seine Wohnung aufschlug. Sehen wir näher zu, so erfahren wir, daß der Mann badete wie jeder andere, ja daß er sich auch einölte, wie ein rechter Grieche. Er war eben Städter und kein Dorfbewohner. Überdies stellte er sich gelegentlich nackt in den Winterregen, so daß alle über seine Abhärtung staunten. Als er in eine Badeanstalt kommt, die nicht sauber genug gehalten ist, fragt er: „Wo reinigen sich die, die hier baden[156]?“ Ein beredteres Zeugnis für die Bedeutung des Bades bei den Griechen, als dieses, kann es nicht geben.
Mit dem Römervolk steht es nun aber nicht anders als mit den Griechen. Wer kann es wagen, einen Cicero, Vergil, Seneca und Tacitus in Zusammenhang mit diesen Dingen zu bringen? Der Stich der Wassermücke war unangenehm; der wird in einem kleinen Epos von Vergil oder einem Vergilnachtreter einmal wirklich gefühlvoll besungen[157]: ein schlafender Hirte wird durch den Stich der Wassermücke geweckt, als gerade eine Schlange im Gras auf ihn lauert, und das Tierchen hat so dem Menschen das Leben gerettet; aber eine Laus naht sich dem Hirten nicht. O nein! Begreiflich genug. Denn die römische Kultur war eben im Geistigen und Technischen, in allem Nützlichen und Schönen griechisch. Ja, gerade für das Badewesen hat der Römer nicht nur in der Tiberhauptstadt, sondern auch in den kleinsten Nestern Italiens und allen Provinzialstädten wie Trier, auch in den Soldatenlagern wie im Kastell der Saalburg noch viel mehr getan als der Grieche. Es war ein Schlemmen in wohliger Nässe in den öffentlichen römischen Thermen, die gerade nur für das niedere Volk bestimmt[S. 92] gewesen sind und, um große Volksmassen aufzunehmen, die Größe unserer größten Kirchenbauten durch ihren Umfang weit übertrafen. Kleine Badeanstalten von Privatunternehmen gingen noch nebenher; der Reiche hatte seine eigenen Marmorbäder in seinen Villen und Palästen und protzte damit, so daß die Ärzte warnen: es wird zuviel gebadet, das Volk wird verweichlicht! Die weit über Land geführten römischen Wasserleitungen waren womöglich noch großartiger als ihre berühmten Militärstraßen. In all dem Wasser mußte das Fußvolk der Läuse zu Grunde gehen.
Spottdichter, die auch das Widerwärtigste heranziehen, hat Rom genug gehabt; alte Vetteln, die bei lebendigem Leibe verfaulen[158], mit grünen Zähnen und krankem Zahnfleisch; Grind und Aussatz am Kopfe und übler Mundgeruch; Bocksgeruch der Männer; Triefäugige; einer, der sich mit Urin die Zähne putzt; vergoldete Nachtstühle und ihre Benutzung[159], und noch Ärgeres sind ihre Themen. Nicht nur Catull und Horaz, vor allem hat uns Martial zwölf ganze Bücher voll schlimmster Anzüglichkeiten hinterlassen. Daß aber vor Unsauberkeit sich jemand einmal jucken muß, wird von ihnen niemals irgend jemandem aufgemutzt. Die Laus fehlt[160]. Jemand sitzt einsam; es wird gefragt: „Ist jemand bei ihm?“ Antwort: „Nicht einmal eine Fliege!“ Über die Fliege geht die Phantasie nicht hinaus[161].
Einmal taucht allerdings auch die Wanze auf. Im Haus des Furius, sagt Catull, herrscht ein solches Hungersystem, daß sogar die Wanze auswandert, weil sie da ihr Dasein nicht fristen kann[162]. Diese Plage fand sich also allerdings in vielen Häusern; aber sie gehört nicht zu unserem Gegenstand.
Hieran reiht sich die Beobachtung, daß ja auch die Tiere Läuse haben. Auch das entzog sich natürlicherweise der Kenntnis der Alten nicht; vielmehr gingen sie so weit, wo es nötig schien, auch an den Tieren die Läuse sorglich zu entfernen. Hoch entwickelt war die Pferdezucht, Fischzucht, Geflügelzucht, und betreffs der Hühner galt nun die Vorschrift, daß[S. 93] man den Kücken in der Zeit, wo die Federn sich bilden, die Läuse „häufig“ absuchen soll; so schreibt es der gelehrte Landwirt Varro in seinen landwirtschaftlichen Gesprächen vor (De re rustica III, 9, 14). Das förderte die gesunde Entwicklung der Tiere.
So viel von der Sauberkeit des Römers. Aber so war es nun doch nicht immer in Rom. Ganz anders steht es auffälligerweise in der altrömischen Poesie, als sie noch in ihren Anfängen steckte. Da regte sich wirklich das Tierleben noch auf der Menschenhaut. In den alten Bühnenstücken, da regt es sich. Woher kommt das? Das Bäderwesen fehlte nachweislich zu jenen Zeiten in Rom noch, oder es war noch ganz unentwickelt; ich meine die Zeiten der Scipionen und Gracchen, das 3. und 2. Jahrhundert v. Chr., und damit wird es um so klarer, daß am Bäderwesen alles liegt.
„Du hast ja eine einsame Laus von ungeheurer Größe auf deiner Nase sitzen!“ so wird in jenen Theaterstücken gerufen[163]. Es war natürlich sehr auffallend, daß es nur eine war, denn man traf sonst immer viele gesellig beisammen. „Der Lausbedeckte“ ist eine altlateinische Wendung, die an Anschaulichkeit nichts zu wünschen übrig läßt[164], und ein solcher Mensch kam damals in den Volksstücken des Titinius auch wirklich auf die Bühne, wo es hieß: solcher Dreckmensch gehört aufs Land[165]. In den Liebeshändeln, die Plautus uns vorführt, sind die bösen Kuppler, die schöne Mädchen anpreisen und von den Jünglingen Geld erpressen, ständige Figuren. Plautus nennt diese Kuppler, diese Aussauger, die Läuse, Wanzen und Flöhe der Großstadt[166].
Noch älter als er ist der Dichter Livius Andronicus, der ein Soldatenlustspiel „Das Schwertlein“ (Gladiolus) schrieb; wir besitzen es nicht; aber eine Stelle ist uns daraus erhalten, die uns so viel erkennen läßt. Der Kriegsmann prahlt immer in hohen Tönen und wird deshalb immer zum Narren gehalten. Hier prahlte er in einem Schlachtbericht, den er gab, ungefähr so:
[S. 94]
Prompt folgt darauf die höhnische Frage:
Da haben wir also sogar den Kampf mit den Läusen, die Phtheiromachie, die sich unseren Augen bisher völlig entzog; es wird die Möglichkeit vorausgesetzt, daß damals ein Kriegsmann in offenbar höherer Charge einen solchen furchtbaren Kampf wirklich zu bestehen hatte. Schlimmer aber noch eine Szene in den Satiren des Lucilius; leider sind uns auch diese Satiren nur in dürftigen Fetzen erhalten. Auf alle Fälle erkennen wir, daß sich da irgend jemand bei dem Dichter einschmeicheln will, und was tut er? Es heißt: „Als der Kerl mich sieht, strahlt er mich an, dann tätschelt er mich mit der Hand, fängt an, mir den Kopf zu krauen und sammelt die Läuse[167].“ Da haben wir Alt-Rom. Da haben wir noch echtes, ungebadetes Leben. Auch in der Plautus-Komödie „Vidularia“ wurde etwas Ähnliches erzählt[168]. Und in solcher Hilfe zeigte sich also die Liebenswürdigkeit der Menschen. Einer hilft dem andern. Nicht anders machen es ja die Affen; nicht anders machen es aber auch die Leute noch heute im sonnigen Neapel, auf offener Straße, in Neapel, das seine antiken Volksbäder leider seit langem verloren hat.
Ich bemerke noch, daß jene altrömischen Lustspieldichter, die ich erwähnte, zwar ihren Stoff vielfach von den griechischen Dichtern entlehnt haben; aber solche Einzelzüge trugen sie nach freiem Ermessen hinein. In den griechischen Vorlagen stand sicher davon nichts; daher bietet uns auch der feinste der römischen Komiker, Terenz, nichts derart; er folgte am treuesten den griechischen Originalen.
Mit den Ackerknechten zu Sullas Zeit stand es begreiflicherweise noch nicht besser als in den Verkehrskreisen des Lucilius. Sulla ist es, der den Stadtrömern drohend von dem Bauer erzählt, den bei der Arbeit die Läuse bissen. Zweimal ließ der Mann geduldig den Pflug stehen und suchte seinen Kittel[S. 95] sorgsam nach ihnen ab; als sie ihn dann aber noch weiter bissen, schmiß er den Rock ins Feuer. Sulla will sagen: so ist Rom der Rock, den ich trage, ihr Römer seid die schmarotzenden Kerfe mit dem Saugrüssel, die ihn bevölkern; verbrennen werde ich Rom, wenn ihr nicht aufhört mich zu plagen[169].
In der Umgegend Neapels, da spielt nun aber auch der satirische Roman des Petron, und damit stehen wir in der Zeit der Hochkultur, in der Zeit des Kaisers Nero. Beim Gastmahl des höchst ordinären Geldmannes Trimalchio sind auch ein paar Leute aus dem niedrigsten Volke zu Gast, die unendlich plebejische Reden führen. Da steht auch ein Satz, der uns an den bekannten biblischen Satz vom Splitter und Balken im Auge erinnert; es werden dabei die gemeine Laus und die große Schaflaus unterschieden, und der Kerl sagt also: „Am andern siehst du die Laus; die Schafslaus, die du selber hast, siehst du nicht!“ (in alio peduclum vides, in te ricinum non vides. Petron. c. 57). So etwas war also damals in Süditalien möglich, wo auch gerade die Schafzucht besonders blühte. Wohlgemerkt aber steht dort diese Wendung nur als Sprichwort und bildlicher Ausdruck, ganz so wie wir den Splitter und Balken im Auge nicht wörtlich nehmen, und es wird bei Petron nicht etwa vorausgesetzt, daß Trimalchio’s Gäste auch von jenen Tieren behaftet waren.
Es bleibt noch Kaiser Julian, der im 4. Jahrhundert n. Chr. lebte, und damit nähern wir uns der geheiligten Majestät selbst auf dem Thron der Welt. In seiner Satire über das Barttragen tut dieser Kaiser so, als hätte er wirklich höchstselbst Läuse im Bart. Um sich den weichlich verwöhnten Großstädtern in Antiochia, die ihn ohnedies hassen, noch grauenhafter zu machen, sagt er das. Das ist bizarr; der Mann ist greller Ironiker, und wir brauchen seine Versicherung ganz gewiß ebensowenig ernst zu nehmen wie das, was wir im Petron lasen[170].
Ordinäres Volksleben geben uns endlich vielfach auch die spätlateinischen „Glossare“, lexikalische Sammlungen, die heute[S. 96] im Abdruck reichlich vier Bände füllen. Da sehen wir endlich auch noch gelegentlich den pediculus und den pediculosus mit verzeichnet. Das gehörte zu Vollständigkeit solcher Wörtersammlungen. Aber ein Schimpfwort, das unserem „Lausbub“ oder „Lausekerl“ entspräche, hat der Römer nie gebildet; auch der Grieche nicht. Es muß an Anschauung gefehlt haben; sonst hätte die reiche und unverblümte Sprache des Altertums sich solches Kraftmittel, die Verachtung auszudrücken, gewiß nicht entgehen lassen.
Habe ich meinen Gegenstand hiermit erschöpft? Man wird mich an den Tod Sullas erinnern. Sulla, der Tyrann Roms, den ich schon einmal erwähnte, starb an der entsetzlichen Krankheit der Phtheiriasis. Es tat den alten Völkern wohl, wenn böse Menschen gerade durch sie, durch diese „Läusekrankheit“ zu Grunde gingen, so wie auch den Herodes, den König der Juden, die Würmer zerfraßen[171]. Am öftesten werden die „Läuse“ von den Griechen und Römern gerade nur in Anlaß dieser Krankheit erwähnt, aber gerade da täuschten sie sich vollständig. An Geschwüren ging Sulla zugrunde; auf den ausbrechenden Geschwüren bildete sich Gewürm; daß man dies Gewürm für Läuse hielt, die gar durch Urzeugung da erst ihre Entstehung fanden, war ein naiver Irrtum; darüber ist sich die heutige medizinische Wissenschaft wohl einig, und es verrät sich uns auch darin, wie wenig genau jene alten Kulturvölker die Laus im Grunde gekannt haben. Charakteristisch ist auch, was wir beim Aelian „Über die Tiere“ IX, 19 lesen: wenn das Tier Galeotes (anscheinend eine Eidechse) in Wein fällt und darin stirbt, so schadet das nichts; ertrinkt es dagegen in Öl, so stinkt das Öl und, wer davon trinkt, dem wachsen die Läuse aus der Haut hervor! Wir können diese Unkenntnis der klugen Leute nur mit Neid betrachten.
Lassen wir also jene abenteuerlichen Krankheitsberichte ganz beiseite. Aus alledem aber erklärt es sich nun endlich auch, daß die Griechen die ihnen so fremd gewordene Insektenplage[S. 97] gelegentlich an auswärtigen, barbarischen Völkern als Merkwürdigkeit hervorhoben; es geschieht wiederum offenbar mit Erstaunen und Entsetzen.
Als der edle Grieche Phalanthos aus seiner schönen Heimat auswandern muß, überfällt ihn in der Fremde, im „Elend“, diese Plage; seine Frau aber ist mit ihm, nimmt ihn auf den Schoß und säubert ihm das Haupt. So erzählte die Sage[172]. Dann aber meldet sich der alte Ethnograph Herodot (im 5. Jahrhundert v. Chr.) zum Wort. Die ägyptischen Priester, so erzählt er, sind reinlicher als die sonstigen Ägypter und treiben es darin bis zum äußersten; sie bescheren sich den ganzen Körper, jeden dritten Tag, damit keine Laus noch anderes Ungeziefer sich einfinde; auch die leinenen Kleider, die sie tragen, sind immer frisch gewaschen[173]; und von einem anderen, unkultivierteren afrikanischen Volksstamm erzählt Herodot: ihre Weiber waschen sich die Haare, und wenn eine von ihnen von einer Laus gebissen wird und sie erwischt, so beißt sie sie zunächst aus Rache wieder und beißt sie tot, bevor sie sie wegwirft[174]. Die griechischen Geographen aber, Strabo voran, die die Gegend nördlich der Krim und des Asowschen Meeres (Maeotis) beschreiben, verzeichnen da ein Volk, das von den Griechen kurzweg die „Läusefresser“, die Phtheirophagen, genannt wurde[175]. Wegen ihrer Ruppigkeit und ihres Schmutzes hießen sie so, wie Strabo uns sagt.
Und damit sind wir glücklich in Südrußland angelangt. Die „Phtheirophagen“, so könnten auch jetzt noch die Südrussen heißen! Schon um die Zeit vor Christi Geburt war es im Don- und Wolga- und Dnjeprgebiet nicht anders, als es jetzt ist. Ja, wir dürfen voraussetzen, daß diese Spezialität auch damals schon bedeutend weiter nach Norden und bis in die Gegend von Warschau, von Pinsk und Minsk reichte. Auch unsere Feldgrauen in Polen und Littauen redeten ja mit Hohn und Ingrimm von den „Läusefressern“, als hätten sie den Ausdruck aus Strabo genommen. Die Läuse, die dort in den[S. 98] Kriegsjahren unter unsäglicher Pein und Beschwerde von unseren braven deutschen Kriegern gefangen wurden, sind ein zähes Geschlecht, von uraltem Adel, dessen Ahnen schon in den alten Geschichtsbüchern der Griechen verzeichnet stehen. Es erben sich Gesetz und Rechte, es erben sich auch der Läuse Geschlechter wie eine ewige Krankheit fort.
Und dazu kommen noch die Serben. Ich sehe eben ein prächtiges Bild in der „Jugend“, 1916, Nr. 5; es ist von A. Schmidhammer gezeichnet. Die flüchtigen Serben sind auf Korfu gelandet; im Garten des kaiserlichen Achilleions steht dort die Statue des herrlichen jungen Achill; ein alter, müde gehetzter Serbe schläft zu Füßen der Statue ein, und die Läuse krabbeln nun von dem ungewaschenen Kerl aus gierig am Bein des hohen Griechenhelden hinan, der sich ganz befremdet an den glatten Schenkel faßt und seine erhabene Gestalt zu der niedrigsten aller Untersuchungen herunterbückt. Modernes Slawentum und klassisches Altgriechentum! Da haben wir den Gegensatz im Bilde!
Wohl uns Deutschen, daß wir uns sagen können: unser deutscher Soldat ist der saubere Erbe jener alt-hellenischen Kultur, die das Leben erst lebenswert machte[176]. Krieg allen Phtheirophagen! Es lebe im Deutschen das Griechentum! Mit keinem besseren Schlachtruf könnte ich diese meine Betrachtung schließen.
[S. 99]
Oft haben im Leben der Völker handwerksmäßig mechanische Erfindungen von der größten Unscheinbarkeit die größte Tragweite für den Aufstieg der Kultur gehabt. Prometheus, der das Feuer vom Himmel holte, ich meine: der Mann, der den ersten Funken aus dem Stein schlug, er stellte die Menschheit auf einen anderen Boden; dasselbe tat der Mann, der das erste Schiffssteuer erfand und die erste Meerfahrt wagte — oder der andere, der zuerst aus dem Bergwerk das Eisen holte und es schmieden lehrte: sie änderten das Wesen der Menschheit. Nicht minder denkwürdig ist aber auch der namenlose Erfinder des ersten Buches, des Buches, das — wie das Schiff — Transportmittel, und zwar das wertvollste Transportmittel ist, da es das kostbarste aller Güter, das Geistes- und Gedankenleben der Völker, das menschliche Erinnern von Land zu Land und von Jahrhundert zu Jahrhundert trägt. Auch das Buch gehört im Hochtrieb der Welt zu den wichtigsten Hilfen und ist als solche noch lange nicht genug gefeiert worden.
Ich meine das Buch, das sich vervielfältigen läßt. Das gilt nicht von den Backsteinbibliotheken der alten Babylonier; es gilt vom Buch der Ägypter und der Griechen.
Die erste Offenbarung des Griechentums war Homer; aber Homer war für die Griechen nicht der Erfinder des Buches. Er hatte es noch nicht. Es ist wichtig, dies klarzustellen, und damit muß ich beginnen[177].
Der Naive denkt sich den alten Homer, wie er dasitzt und die 48 Bücher der Ilias und Odyssee dichtend niederschreibt. Auch neuerdings machen sich solche naive Vorstellungen wieder geltend, aber sie widersprechen auf alle Fälle den offen liegenden Tatsachen. Homer kannte die Schrift, allerdings. Einen Brief auf der Schreibtafel erwähnt er selbst einmal bei Gelegenheit des Abenteuers des Bellerophon. Es ist der Geheimbrief, der den Tod des Überbringers fordert. Aber die Tafel ist kein Buch, von dem ich rede. Wer dem Homer das Buch[S. 100] in die Hand gibt, kann ihm auch die Brille aufsetzen; das eine war seinerzeit noch ebenso fremd wie das andere. Andernfalls hätte er ja auch in Prosa schreiben können und die Sache viel leichter gehabt; denn sobald das „Buch“ bei den Griechen wirklich auftaucht, wird Sage und Geschichte sogleich planvoll in Prosa niedergeschrieben.
Alle Poesie der Urzeiten geht im Vers einher, und der Zweck des Verses ist da überall Gedächtnishilfe, die deshalb nötig ist, weil das Buch fehlt. Eben dazu, zur Hilfe des Gedächtnisses dient aber obendarein auch das auffallend Typische in der epischen Sprache, nicht nur in dem „tondapameibomenos“ und tausend anderen ständigen Einführungsformeln, die später zur Parodie einluden, nicht nur in den ewig gleichen und festklebenden Schmuckwörtern wie dem „im Donnergewölk Zeus“, sondern auch in der Repetition ganzer Abschnitte, die so weit geht, daß man meint, Homer plündert sich selbst aus.
Der gute Dichter kommt uns sogar selbst zur Hilfe; denn er läßt in seiner Odyssee selbst den Sänger Demodokos auftreten, der da ganz in homerischer Weise von Heldendingen erzählt; aber Demodokos ist blind und ist ohne Buch, er kann also nicht lesen und muß lediglich seinem eigenen Geist und Gedächtnis vertrauen[178]. In Demodokos zeichnet sich uns Homer, und nun bedeutet gar der Name „Homeros“ selbst den „Blinden“, nichts anderes. Das sollte Zufall sein? Ilias und Odyssee, die langen Epen sind Blindenpoesie.
Wir besitzen eine alte Biographie des Homer; darin steht: der Dichter hieß ursprünglich Melesigenes; er wurde blind und deshalb, als er in Kyme war, Homer genannt; denn in Kyme nennt man die Blinden „Homere“[179].
So ist der Dichter denn auch in der griechischen Plastik, die sein Porträt formte, von Anfang an deutlich als Blinder dargestellt worden. Das entsprach schon seinem Namen; es war nicht anders möglich.
In primitiven Zuständen sind die blinden Leute auch sonst[S. 101] häufig die Träger der Poesie und des Volks- und Heldengesangs; sie sind die Vortragenden auf den Märkten und Gottesfesten. Schon das deutsche Mittelalter ist Zeuge; denn da heißt es: „so singent uns die blinden“. Ebenso erscheinen sie auch bei den Serben; die lebendigste Anschauung aber gibt, was ich über die Balladendichtung in Palermo lese. Da bestand noch in neuester Zeit und besteht vielleicht noch jetzt eine Kongregation der Blinden, 30 Mitglieder stark, von denen die einen nur vortragen, die anderen aber Neues erfinden; heiliger Ernst ist es ihnen dabei. Von Kindern lassen sie sich führen, wenn sie auftreten. Schon im Jahre 1661 ist diese Blindengilde dort gegründet worden. Was sie aber singen, sind Banditengeschichten von Testalonga, Fradiavolo, Tabbuso und Zuppa. Das sind die Achill und Odysseus, die Helden dieser sizilianischen „Homere“[180].
Daß es nun auch bei den Griechen jener alten Zeiten mehr als einen „Homer“, d. h. mehr als einen blinden Sänger gab, ist zweifellos. Es war offenbar auch bei ihnen ebenso wie bei den Deutschen, den Serben und den Leuten in Palermo der allgemeine Beruf des Blinden, der sonst keine Beschäftigung hat, zu singen und Geschichten zu ersinnen. Man braucht nur den blinden Demodokos neben den Dichter des homerischen Apollohymnus, der sich sogar selbst den „blinden Mann“ nennt, zu halten, um das einzusehen.
Wollen wir nun gleichwohl ansetzen[181], daß die blinden Berufsdichter, auf die Ilias und Odyssee zurückgehen, doch auch schon Schreibergehilfen hatten, die die neuen Gesänge entweder sogleich oder bald hernach schriftlich sicherstellten, so waren, wenn wir genau zusehen, gegen 500 Schreibtafeln nötig, um die etwa 28000 Zeilen der beiden Epen aufzunehmen[182]. An eine Wahrung der Texteinheit war dann also schlechterdings nicht zu denken; sie war vollständig zertrümmert und eine chaotische Verwirrung der vielen hundert Holztäfelchen die fast unausbleibliche Folge.
Homer ist sonach in jedem Fall der Mensch ohne Buch. Im[S. 102] Verfolg soll dagegen vom Menschen mit dem Buch, wie ihn das Leben zeigte und die Kunst der Alten ihn dargestellt hat, die Rede sein.
Woher das Buch nehmen? Der Boden Griechenlands selbst war an vegetabilischen Erzeugnissen zu arm oder das praktische Genie der Griechen war nicht entwickelt genug, um das „Papier“ zu erzeugen, durch das allein ein Buch ermöglicht wird, das sich für literarische Zwecke eignet.
Die Schrift war allerdings längst da. Man zeichnete sich ein Bild an die Wand und verstand sich. Nichts war natürlicher. Dann kürzte man das Bild zu andeutenden Linien ab, und der Buchstabe war fertig. Einen großen Fortschritt bedeutete es, als der Grieche die Silbenschrift des Orients, die den Vokal nicht ausdrückt, zur Buchstabenschrift, die jedem Einzellaut im Wort gerecht wird, verfeinerte. Das war die erste große grammatische Leistung des Griechentums im Dienste der Phonetik. Aber worauf schreiben?
An Schreibflächen fehlte es nicht[183]. Man ritzte die Grüße oder Anweisungen, die man auf dem Herzen hatte, in die Haustüren oder in den Baum am Weg oder in die nächste Felsenwand. An den Grenzen der Feldfluren standen oft Ölbäume: in ihre Rinde grub der Eigentümer regelmäßig den Grenzvermerk (arbores notatae). So bekamen auch Sklaven und Vieh Zeichen eingebrannt, damit man wußte, wem sie gehören; man tätowierte gelegentlich den ganzen Menschen, schon damals. Staatsgesetze aber grub man schon früh in die glatten Außenwände der Tempel oder unmittelbar in die hohe Einfassungsmauer, die den Richtplatz umgab. Gräber wurden mit beschriebenen Steinplatten versehen. Sollte aber der Text transportabel sein, so griff man zum Fell, zur Kuhhaut, lieber noch zur rollbaren Bleiplatte und zur Holztafel. Die handliche kleine Holztafel hat sich der Grieche endlich früh mit Wachs überzogen, und er begann im Wachs zu schreiben, ein Merkmal der Vergänglichkeit: denn aus dem Wachs ließ sich die Schrift gleich immer wieder hinwegglätten.
[S. 103]
Was nützte das aber den Dichtern, die unmittelbar auf Homer folgten und in ihren Versen nun auch — anders als er — mit ihrem eigenen Ich kräftig hervorzutreten begannen? Die erste Elegie entstand, das erste Streitgedicht des Archilochos, das erste Chorlied, das Alkman kunstvoll gestaltete. Wie sollten diese Männer ihren Text sichern? Was sie dichteten, hatte immer nur geringen Umfang; sie legten davon eine einmalige Niederschrift im Tempel nieder; das war die einzige Sicherung: das Werk sollte nicht untergehen. Die Tempel sind im 7. Jahrhundert v. Chr. die alleinigen Archive für solche Poesien gewesen[184]. Vervielfältigung durch Abschrift aber gab es noch kaum, und die Veröffentlichung geschah lediglich durch mündlichen Vortrag. Auch diese Männer harrten immer noch auf das „Buch“.
Das gilt auch vom Hesiod. Von Hesiod besitzen wir die „Theogonie“ und die „Werke und Tage“. Wer aber diese beiden Werke liest, der staunt über den Mangel an Ordnung und Plan, die häufige Zusammenhangslosigkeit des Inhalts. Dabei ist jedes derselben doch nur etwa 1000 Zeilen stark. Der Schaden kann sich nur daraus erklären, daß der Text, wie das vorhin Gesagte ergibt, ursprünglich auf etliche kleinere Schreibflächen verteilt war. Erst nachträglich können die Teile in einem „Buch“ zusammengestellt worden sein. Daher die Uneinheitlichkeit. Wir hören von einem uralten Exemplar des Hesiod auf Blei, das sich auf dem Berg Helikon anscheinend gegen Witterung ungeschützt bei der berühmten Quelle, der Hippokrene, befand. In diesem Blei haben wir eine wertvolle Probe des Urzustandes des griechischen Schreibwesens. Daß aber der Text der „Werke und Tage“ auf dem Blei vollständig stand, ist kaum zu glauben. Denn unzählige antike Bleirollen sind gefunden worden, und sie enthalten immer nur ganz geringe Textumfänge und wohl kaum mehr als 50 Zeilen[185].
Wie sollte nun gar in der Folgezeit des großen Thukydides Prosawerk vom Peloponnesischen Krieg, wie sollte Platos Staat möglich sein? Das „Papier“ war schreiendes Bedürfnis, und es fand sich nicht.
[S. 104]
Da kam das Große. Ägypten eröffnete endlich seinen Außenhandel. Ägypten hatte längst das ersehnte Papier, es hatte längst das Buch der Zukunft. Im 7. Jahrhundert geschah es; damals hat der griechische Handel mit Ägypten eingesetzt. Der Name König Psammetichs I., der um 670 bis 616 regierte und sein Land erschloß, ist darum unvergeßlich. Um 630 v. Chr., da mag die erste Papierrolle wirklich vom Nil nach Athen oder Milet oder Sizilien gekommen sein. Und die eigentliche griechische Buchliteratur konnte beginnen. Sie entwickelte sich plötzlich und rasch.
Es handelt sich nicht um Lumpen- oder Hadernpapier, erst recht nicht um unser modernes Holzpapier. Vielmehr aus dem Mark des Nilschilfs wurde das Material, das man Charta nannte, in langen Fahnen kunstvoll hergestellt, und zwar geschah das dort schon seit Jahrtausenden. Die ganze schreibselige Kultur der Ägypter beruht eben hierauf, auf der Charta. In dichten Schichten liegen in Ägypten noch jetzt die beschriebenen Papyrusmassen unter dem sandigen Erdboden und werden heute ausgegraben, fast so, wie man bei uns die Steinkohlen gräbt; oder die stummen Mumien sind darin eingewickelt, und ganze Kisten voll gehen davon alljährlich nach Europa (vorausgesetzt, daß kein Weltkrieg ist), um in den Bibliotheken und Museen von Oxford, London, Berlin, Wien, Paris, Florenz, Genf, Straßburg aufgerollt, entziffert, studiert zu werden.
Neidisch hatte das enge Pharaonenland dies herrliche Papier der Welt so lange vorenthalten. Das Schreiben darauf war des Ägypters besondere Wollust. Millionenmal haben jene Leute sich, vielfach auch gerade die vornehmsten Würdenträger des Nillandes, in schreibender Stellung hockend, statuarisch oder im Relief abbilden lassen, oft ganze Gruppen, die nach Diktat schreiben, also im Begriff sind, einen Text zu vervielfältigen[186].
Jetzt endlich hatten die Griechen also ein Buch gewonnen, das sich in der Tat leicht hundertfach vervielfältigen ließ.[S. 105] Der Großbetrieb konnte einsetzen: Abschriften der besseren Werke in beliebiger Anzahl, Buchverkauf, Buchhandel.
Und so beginnt eben jetzt, im 6. Jahrhundert, wirklich die griechische Prosaschriftstellerei, die schlechthin das Buch voraussetzt, da Prosa sich nicht nach Art eines epischen Gedichtes auswendig lernen läßt. Aber auch die griechische Dichtkunst veränderte nun sogleich ihr Wesen und bereicherte sich wunderbar; denn auf einmal entsteht jetzt die große Lyrik, und es entsteht die Tragödie, Oratorium und Oper; d. h. auch die Musik kann sich jetzt plötzlich auf das reichste entwickeln. Das Wesen der griechischen Musik erkennen wir an den Versmaßen. Kunstvolle Versmaße werden jetzt möglich, eine Rhythmik mit mannigfachem Wechsel der Taktarten, die ohne sorgliche Niederschrift des Textes und auch der Musiknoten nicht denkbar war. Ich nenne nur den großen Stesichoros, der jetzt — um das Jahr 600 beginnend[187] — auf Sizilien seine gewaltigen, ausgedehnten, halbdramatischen, oratorienartigen Chordichtungen schreibt, und Äschylus, der in Athen bald danach die Tragödie schafft. Auch diese Offenbarung des griechischen Kunstgenies, die Tragödie, war erst jetzt möglich. Weiter aber: auch der Homertext wurde nunmehr in der Form, wie wir ihn haben, endlich zum erstenmal in Buchform redigiert und gesichert, und auch dies ist, wie jetzt unbedingt feststeht, in Athen geschehen[188]. Es ist dies das erste unvergängliche Verdienst, das sich Athen um die Weltliteratur erworben hat.
Und nun taucht auch Herodot, der Vater der Geschichte, vor uns auf. Herodot und andere seinesgleichen schreiben jetzt in Prosa die Sagengeschichte und Staatengeschichte ihres Landes, Anaxagoras und andere Philosophen vor ihm ihre kühnen und ewig denkwürdigen Entwürfe über Sein und Werden und die Natur und Entstehung des Alls. Der wundervoll treibende Griechengeist hatte jetzt einen Boden gewonnen, auf dem er blühen und wuchern konnte, so wie, wo sich frische Erdkrume bildet, sogleich eine Vegetation entsteht. Plato, Demokrit, Aristoteles erhoben ihre breiten Wipfel. Das Buch erzeugte die Literatur.
[S. 106]
Und wie geschmeidig war dies Buch! Federleicht lag es in der Hand. Fliegende Blätter hatte man, und wer deren viele zusammenklebte, erhielt eine Fläche von beliebiger Länge, die er beschrieb und leicht zusammenrollte. Denn das Buch war nur Rolle. Heftung kannte man nicht.
Und wie fest und klar stand die tief dunkle Schrift auf dem hellen Grunde! Das Papier war weiß, aber nicht blank und warf keine Reflexe: eine Wohltat für das Auge. Das Schreiben war jetzt auch kein Gravieren und Ritzen mehr; es war Farbenauftrag. Mit der weichen Feder malte man die Buchstaben. Und das ging rasch. Massenkopien gab es gleich. Buchunternehmer hielten sich ein Sklavenpersonal, das die Kopien nach Diktat schnell genug lieferte; denn leicht konnten so nach Diktat 50 Exemplare auf einmal, 1000 in einer Woche hergestellt werden. Und man kaufte sich jetzt also die Platodialoge oder die Euripidesstücke, nahm sie auf die Seereise mit und las sie auf dem Schiffsdeck. Der Buchhandel und Versand ging von Athen überall hin, nach Sparta, Kleinasien, zu den Städten des Schwarzen Meeres. Dabei verwahrte man die Rollen in hübschen Kapseln aus Holz. Auch in der Schule hatte jetzt schon jeder Knabe sein Lernbuch, und der Gebildete konnte sich darin nicht genug tun; er kaufte sich schon lesehungrig alle möglichen Autoren, Homer, Epicharm, Tragödien, Schriften über Baukunst, Kochbücher u. a. zusammen, und vereinzelt entstehen schon wohlgeordnete kleine Büchereien. Sie sind vorläufig nur Privatbesitz. Mit der ersten Bibliothek aber war auch der erste Überblick über den Bestand der griechischen Literatur gegeben; das Griechentum wurde sich seines geistigen Besitzes bewußt; eine Literaturgeschichte konnte entstehen[189].
So ging die Entwicklung zunächst durch drei Jahrhunderte, vom 6. bis zum 4. Jahrhundert v. Chr.
Im Nildelta, und zwar in den breiten und schlammigen Seitenarmen des Nil, da wuchs und gedieh das Papyrusschilf in ganzen Wäldern. Inselartig standen diese Wälder in den[S. 107] seichten Wasserflächen. Sie wuchsen jedoch nicht etwa wild; vielmehr wurde das Schilf sorglich gepflanzt, gehegt und jeder Ausfall ersetzt; ein Riesenvermögen steckte für die Besitzer in diesen Wasserpflanzungen. Es waren hohe Schäfte mit graziös gefiederten Wipfeln und Blätterbüscheln, die im Seewind rauschen und leicht sich wiegen; der Schaft mehr als armstark. Fußpfade, die so schmal waren, daß nur ein Mann hindurch konnte, und auf denen der Heger sich bewegen und die Ernte eingebracht werden konnte, führten durch die Dickichte hindurch[190].
Jahrtausendelang hat dort im Altertum diese wichtige Kultur bestanden. Wie anders jetzt! Seitdem die Pflege fehlt, ist der Papyrus dort im Nil völlig verschwunden.
Für die Fabrikation war die Stadt Saïs, die Residenz des Königs Psammetich, der Hauptsitz, und eine ganze Reihe von Sorten der Charta wurden hergestellt, die sich nach der Qualität, nach Größe, Färbung, Feinheit und Dauerhaftigkeit unterschieden. Denn für wichtige Aktenstücke der Staatsverwaltung und für schöne Gedichtbücher brauchte man bessere Qualitäten, als der Kaufmann sie in seinem Laden zum Rechnungschreiben nötig hatte.
Anschauung von dieser „Charta“ kann heute jeder haben, der einmal unsere größeren Museen und Universitätsbibliotheken besucht, wo Proben davon in Glas und Rahmen ausgestellt werden. Die Fabrikation aber war schwierig und erforderte viel Zeit und ein beträchtliches Personal. Denn das feste Mark des Schilfs wurde auf das mühsamste in möglichst lange und möglichst dünne Streifen zerlegt und diese Streifen dann glatt zusammengeklebt, indem man sie netzförmig übereinanderlegte. Leicht lösten sich aber die Fasern wieder, und wiederholte Pressung und erneutes Kleben, endlich ein sorgliches Trocknen der Ware war immer nötig. Damit war aber zunächst nur ein Einzelblatt von etwa 34 × 20 cm Größe gewonnen, und aufs neue mußten die Kleber mit ihrem feinen Leim daher, um aus je 20 Blättern die Buchfahnen,[S. 108] die in den Handel kamen, zusammenzufügen. Auf die Fahne setzte man die Schrift in Spalten nach Art der Spalten unserer Zeitungen. Reichten für das beabsichtigte Buch 20 Blätter nicht aus, so klebte man wieder etliche Fahnen aneinander, je nach Bedürfnis.
Schon aus dieser Art der Herstellung erklärt sich, daß das Papier im Altertum sehr teuer gewesen ist[191]; und je mehr die Nachfrage zunahm, je teurer mußte es werden. Denn bald sollte für die ganze damalige gebildete Welt, für Griechenland, Syrien, Mazedonien, Italien, Spanien, Südfrankreich das kleine Nildelta allein das Papier liefern. Ja, die Fabrikanten im Delta bildeten einen Trust und trieben obendarein die Preise gemeinsam künstlich höher, wie Strabo uns meldet. Ungeheure Werte steckten also in den großen Büchereien des Altertums, wie sie die römische Kaiserzeit besaß. Die Literatur war auch im Hinblick auf das Papier, auf dem sie stand, eine Kostbarkeit.
In Großstädten wie Rom lagerte das Papier, die unbeschriebenen Rollen, auf Vorrat in großen Speichern, die der Staat beaufsichtigte. War die Papyrusernte am Nil schlecht ausgefallen, so trat in der Welt Papiernot ein, die fast so schlimm war wie die Hungersnot, die drohte, wenn das Korn nicht aus Ägypten kam, und die Behörde mußte alsdann eingreifen und den Verkauf regulieren. Auf dem Lande war oft gar kein Papier zu haben. Auch wir wissen seit dem jüngst erlebten Kriege davon zu erzählen, wie die Regierung alle Vorräte der Waren an sich nimmt, um der größten Not zu steuern.
In Rollen zu lesen, denken wir uns heute sehr unbequem, und anfangs herrschten auch wirklich noch große Mißstände im Bücherwesen der Griechen. Erträglich war die Sache, wenn es sich um Rollen von etwa 20 Seiten handelt. Herodot aber wird heute auf 600 Seiten abgedruckt, und für solch umfangreiche Werke ergaben sich damals Rollen von 50, 70 oder 100 Meter Länge. Als solche endlose Konvolute haben wir uns die ersten Ausgaben des Herodot, des Thukydides zu denken; so hatte noch Alexander der Große Ilias und Odyssee in Händen. Eine einschneidende[S. 109] Reform war darum nötig. Kallimachos war es, der den berühmten Ausspruch tat: „ein großes Buch ein großes Übel.“ Seitdem, d. i. seit dem 3. Jahrhundert v. Chr., wurde es Sitte, die größeren Bücher zu zerschneiden (davon kommt der Ausdruck Tomus, „der Schnitt“), d. h. die Buchteilung in der Schriftstellerei wurde Sitte; sie wurde erzwungen[192]. In 12 Rollen ließ darum Vergil seine Äneide, in 3 Rollen ließ Cicero sein Werk „vom Redner“ erscheinen; und die Kunst des Disponierens steigerte sich dabei wunderbar. Man lernte fortan seinen Stoff jedesmal so einzuteilen, daß womöglich in jeder kleineren Rolle ein in sich abgeschlossener „Abschnitt“ des Werkes stand, der für sich allein gelesen, genossen werden konnte.
Aus diesem sehr äußerlichen Grunde erklärt sich die sonst so befremdliche Durchführung der Buchteilungen in den alten Autoren.
Besonders die Dichter las man in möglichst dünnen Rollen; ein Odenbuch des Horaz stand auf einer Papierfahne von nur 20 Seiten, kaum mehr. Das ist auch heute noch so; man denke an Mirza-Schaffy und Frauen-Liebe und Leben; auch wir wollen für unsere zärtlichen Dichter keine großen Formate. Wollte man überdies noch Effekt machen, so stattete man das Röllchen hübsch prunkvoll aus, schob es in einen farbigen Mantel (so wie wir unsere Tischservietten) und steckte noch ein vergoldetes Stäbchen mitten hinein. Besonders reizvoll und glanzvoll müssen die Bilderbücher gewesen sein; wer die Rolle auseinandernahm, sah eine Folge farbiger Bilder, Porträts, Kampfszenen aus den Römerkriegen u. a. Vor allem hing nun noch aus den Rollen immer ein festes, pergamentenes Zettelchen heraus, das man gern purpurn färbte und auf dem der Titel zu finden war. Dieser Zettel selbst hieß der „Titel“. Im Bibliothekszimmer standen Schränke oder an den Zimmerwänden zogen sich „Nester“ hin; darin lagen die Rollen wie die Vögelchen beisammen, bereit auszufliegen, allemal hübsch mit dem Kopf nach vorn, an dem der Titel hing. Es war gewiß[S. 110] allerliebst, in solchem Bücherzimmer sich aufzuhalten; alles, Bücher und Borte und Wände, bunt bemalt und in Farben strahlend; dazu edler Statuenschmuck; auch gemalte Porträts der Lieblingsdichter. Die Nester waren nur in bequemer Höhe angebracht, auch die Schränke nur niedrig, zu 3 Borten. Man brauchte nicht auf Leitern zu steigen, um seinen Plato oder Livius zu finden[193].
Wie nun der lesende Mensch mit dem Buch umging? Dem modernen Menschen fehlt dafür jede Anschauung; aber die reiche antike Kunst kann sie uns geben[194]. Hier ist der Ort, die Plastik und Malerei der Alten heranzuziehen. Selten ist uns Gelegenheit gegeben, die Zweckmäßigkeit und Sinngemäßheit der künstlerischen Motive, insbesondere in bezug auf die Haltung der Hände, so festzustellen wie in diesem Falle.
Auch unsere modernen Künstler kommen bisweilen in die Notlage, einen Menschen mit dem Buch darstellen zu müssen. Aber ihnen fehlt dafür eine Tradition oder die Achtsamkeit, und sie irren sich oft seltsam. Wer z. B. die schöne Goethe-Statue Schwanthalers in Frankfurt a. M. betrachtet, wird mutmaßlich wenig darauf achtgeben, daß der Dichter den Kranz in der Linken, das Buch aber in der Rechten hält. Warum sind die Gegenstände auf die Hände nicht anders, nicht umgekehrt verteilt? Eine müßige Frage! Wer hat Zeit, sich damit aufzuhalten? Der Künstler macht das eben, wie es am besten aussieht. So machte man es aber im Altertum nicht, und die moderne Kunst der Porträtstatue ist doch ein Erbe aus dem griechischen Altertum. Wer das Buch in der Rechten hat, will vorlesen; wer es in der Linken hält, hat vorgelesen. Goethe aber kann seinen Kranz erst erworben haben, nachdem er sein Werk vortrug. Die griechische Kunst hätte Kranz und Buch somit anders verteilt, und so ist es tatsächlich geschehen auf einem Pompejanischen Wandgemälde (Helbig, Campanische Wandgemälde, Nr. 1454).
Viele lieben es heute, sich mit dem Buch photographieren zu lassen, die strebsame höhere Tochter, der Schulmann, Gelehrte[S. 111] und Diplomat „in seinem Heim“, schließlich aber auch die Metzgersfrau und der Sergeant und Ladenjüngling. Warum auch nicht? Wir alle haben heute Schulbildung, und das Buch ist unser! Meistens wirkt dabei freilich die Verlegenheit mit: die Hände müssen irgendwie beschäftigt sein, wenn sie nicht gerade in Handschuhen stecken. So kann die Laune des Photographen den Kellner zum Gelehrten machen und die Putzmacherin zur Dichterin.
In der antiken Porträtkunst war das anders, und zwar schon in der ägyptischen. Da ist alles sinngemäß und zweckmäßig. Im alten Ägypten unterschieden sich die Stände darnach, wer schreiben und wer nicht schreiben kann. Das Buch adelt. Wer nicht lesen kann, ist der Esel, wer lesen kann, der Eseltreiber: so dachte man. Man gestatte, daß ich hier von „Buchhaltern“ rede, ich meine die Personen, die sich mit dem Buch zeigen. Die „Buchhalter“ auf den ägyptischen Bildwerken sind da die höheren Beamten. Mit eigensinniger Konsequenz und massenhaft sieht man daher die Buchrolle oder das Schreibgerät in der festgeballten Hand gerade nur der Vornehmen auf den Reliefs der großen Tempelwände, der Gräber und Pylonen des Pharaonenlandes. Berühmt und wundervoll realistisch auch so manche Schreiberstatue, wie die im Louvre: wohl nie ist ein hoher Bureaubeamter und vortragender Rat so verherrlicht worden wie da; sie zeigt ihn angespannt in seiner Tätigkeit. Freilich ist er sehr dürftig bekleidet. Ein Schurz genügt.
Der freie Grieche dachte anders. Er hatte kein Königtum, ebensowenig eine Bureaukratie, die in Staffeln bis zum Monarchen hinaufging und sich auf das Buch gründete. Bei den Griechen wurden Buchabschriften zumeist nur von der unfreien Dienerschaft angefertigt. Sah sich der Freie gezwungen, selbst einen Text zu kopieren, so schämte er sich dessen und hat sich nicht schreibend abbilden lassen. Die ganze überreiche griechisch-römische Kunst vermeidet es, einen Menschen darzustellen, der ein Buch schreibt. Denn das Schreiben in Rollen war mühsam[S. 112] und erzeugte eine unedle Haltung. Die Hilfe des Tisches wurde beim Lesen und Schreiben stets vermieden. Man schrieb auf der Hand. Dazu kam, daß man mit dem flüssigen Farbstoff die Finger sich beschmutzt hätte. Der Vornehmere schrieb daher auf Wachstafeln (codices, codicilli), in deren eingerahmte Wachsfläche er mit dem dolchartig spitzen Metallstift die Buchstaben nur zu ritzen brauchte. Das war saubere Arbeit; sie „fleckte“, aber sie befleckte nicht. Auf Wachstafeln schrieb der Bankier seine Kontos und Quittungen, schrieb der Liebhaber sein Billett an die Dame, die gleich in dieselbe Tafel auch die Antwort ritzte, schrieb endlich der Dichter seine Entwürfe, die dann sein Amanuensis kopieren durfte.
Also keine Schreiber, wohl aber Leser zeigt uns die alte klassische bildende Kunst. Man las aber allemal nur in Rollen; denn nicht nur in Ägypten beherrschte die Rolle das Bücherwesen durch Jahrtausende; auch bei den Griechen und Römern ist sie von etwa 600 v. Chr. bis 400 n. Chr. so gut wie der alleinige Träger aller Lesebücher und wohl auch Bilderbücher gewesen. Das ergibt wiederum ein Jahrtausend. Das Prinzip des Heftens der Bücher ist zwar schon im Altertum, aber doch erst merkwürdig spät aufgetaucht, und es fand alsdann im wesentlichen nur für Pergamenthandschriften Anwendung, die den ärmeren Volksschichten dienten[195]. In gehefteten Handschriften liest kein einziger Mensch auf den unzähligen Bildwerken der Alten, die hierfür in Betracht kommen. Die jüdische Synagoge hat die Rolle bekanntlich bis auf den heutigen Tag beibehalten. Dabei dienen Stäbe dazu, die Rolle anzufassen; denn die heiligen Schriften dürfen nicht mit der Hand berührt werden. Die Griechen im Profanleben wußten von solcher Scheu natürlich nichts; die Hände sind es, die mit dem Buch umgehen.
Man muß den Akt des Lesens selber kennen, um die Motive zu verstehen, die die antike Kunst hierfür verwendet. Wer zu lesen beginnen will, hält die geschlossene Rolle zunächst in der rechten Hand. Die Linke öffnet dann das Konvolut, löst das[S. 113] Band und Siegel, falls ein solches vorhanden (man denke an das Buch mit sieben Siegeln der Apokalypse) und zieht die erste offene Seite zu sich nach links. Eine Textspalte nach der anderen zieht also die linke Hand zu sich herüber, indem sie das Gelesene zugleich wieder zusammenrollt. Am Schluß der Lektüre ruht die Rolle somit allemal, aufs neue geschlossen, in der linken Hand. Daraus ergibt sich die Auffassung, die wir an alle Bildwerke herantragen: die Gestalt, die das Buch in der Rechten hält, will erst lesen, abgesehen von den Fällen, wo sie es einem anderen Menschen überreichen will (denn man überreicht stets mit der rechten Hand); die Gestalt, die es in der Linken hält, ist mit dem Lesen jedenfalls fertig; sie hat nicht die Absicht zu lesen. Und das letztere finden wir nun ganz überwiegend dargestellt. Es handelt sich eben fast immer um Repräsentationsfiguren. Das Buch soll da nur andeuten; es ist für den Moment gleichgültig; nur die Würde der Person drückt sich in dem Schriftstück aus. Nicht sinnend oder in sich gekehrt steht solch ein römischer Konsular mit dem Buch vor uns; er wendet sich mit offener Seele an das Publikum, das ihn betrachtet.
Und das Lesen selber? Es sah graziös genug aus, und es schmückte gleichsam den Menschen. Nichts ist reizender als solch eine lesende griechische Frau, die mit dem weit offen hängenden Rollenband zwischen den Händen einherwandelt (Neapel, National-Museum), oder als die Muse, die als Konzertsängerin auf das Zeichen zum Einsetzen wartet, das der Saitenspieler, der die Begleitung spielt, ihr geben soll, und die dabei das Blatt tief gesenkt zwischen den Händen hält wie unsere Sängerinnen, wenn sie warten, daß das unleidlich lange Vorspiel zu Ende gehe (Vase in Athen). Nichts ist schöner als der vorlesende Homer der Bilderchronik (Antiquarium in Berlin), nichts lebendiger als der die Lektüre unterbrechende, in Nachrechnen versunkene Mathematiker des Codex Arcerianus in Wolfenbüttel; nichts ergreifender als der Christus mit der gleichsam himmelweit aufgerissenen Rolle zwischen den Händen, von Jüngern umgeben, wie ihn die Lipsanothek von Brescia zeigt[196].
[S. 114]
Aber dies Lesen war zugleich unbequem und anstrengend; es war eine Fesselung des Lesers im eigentlichsten Sinne, und ein Bedauern erfüllt uns, wenn wir uns klar machen, daß man das durch Jahrtausende hat ertragen müssen. Man denke, daß jede Nebenhandlung unmöglich war. Denn nicht nur die rechte Hand war beschäftigt; die linke durfte zudem die abgerollte Papiermasse nie fahren lassen, und es wurde auf das strengste vermieden, daß die Charta sich auflöste und zum Boden niederfloß; denn ihre Fasern waren zart und splitterten leicht, und die Gefahr, daß ein Blatt und damit das ganze Buch zerriß, war ständig. Wir trinken beim Zeitungslesen oder schlürfen Eis im Café, wenn wir durstig sind. Der Grieche hatte keine Hand frei. Er konnte das nicht. Ein Glück, daß man damals noch nicht rauchte! Cicero hätte während des Lesens auf die Zigarre verzichten müssen; denn er hätte sie nicht halten können. Wer einen Hautreiz empfindet, der kratzt sich, das ist sein Recht; und wem eine Fliege sich auf den Kahlkopf setzt, der will sie verjagen. Las der antike Mensch, so waren beide Hände gleich gefesselt, und alles das war für ihn eine Unmöglichkeit.
Und nun der Inhalt des Buches! Das Aufwickeln muß für den Leser, der vor Neugier brannte, eine wahre Folter gewesen sein. Kein moderner Mensch würde das ertragen. Wir naschen heut im Buch, wir blättern hin und her, durchfliegen die Kapitelüberschriften, lesen am liebsten den Schluß zuerst. Brechen wir ab, so legen wir ein Lesezeichen hinein oder machen gar ein Eselsohr. Alles das war damals gänzlich ausgeschlossen. Vor allem der Schluß des Buches blieb immer ein tiefes Geheimnis; er war durch die Rollung selbst fest zugedeckt. Der Inhalt „entwickelte sich“ eben beim Lesen mit den Seiten in unerbittlicher Allmählichkeit. Das Frühere deckte das Spätere undurchdringlich zu. Das Buch glich dem Leben. Dieser Satz gilt schon hier. Wer kann wissen, was folgt? Wer kann wissen, was das Ende ist?
So gelangen wir dazu, den antiken Leser zu bemitleiden[S. 115] oder, was noch besser, zu bewundern. Er schlang nicht, er naschte nicht. Sein Geist nahm die Speise ruhevoll und ergeben in der Folge, die der Dichter wollte, der die Speise bereitet hatte. Um so tiefer ließ er den Inhalt auf sich wirken. Er erlebte ihn. Dazu kam, daß man von einem Werk am Tag kaum mehr als 1000 Zeilen oder 30 Seiten las. Das dankte man den scheinbar so zwecklosen Buchteilungen der antiken Werke. Zum wenigsten von den größeren Unterhaltungsschriften, den Epen und Romanen, waren die Einzelrollen nie umfangreicher. Die zwölf Bücher der Äneis Vergils wollten an zwölf Tagen gelesen sein (das gilt übrigens auch noch von Ariost): der Grieche und Römer stand seiner Literatur anders, er stand ihr hingebender und gebundener gegenüber als wir der unseren.
Dabei gilt es nun aber die Zeiten zu unterscheiden. Wer die Fülle der griechisch-römischen Schildereien auf Vasen, Grabsteinen, Münzbildern oder Gemälden durchgeht, bemerkt, daß auf den älteren von ihnen der Mensch mit dem Buch noch recht spärlich anzutreffen ist; in den späteren Jahrhunderten sind die Beispiele dagegen massenhaft. Das ist symptomatisch. In der Zeit des Sophokles und der großen Tragödie diente das Buch vornehmlich zum Fixieren und Aufbewahren des Textes und noch verhältnismäßig wenig zum Lesen. Die große Masse las damals noch nicht allzu viel in Büchern. Ihr genügten vor allem die öffentlichen Volksvorlesungen der Rhapsoden und das Theater, das heißt das Hören, und nur wenige Bevorzugte hielten sich Bibliotheken, so wie man seine Stuben auch noch nicht mit Wandmalereien schmückte. Daß sich das Laienpublikum mit bildender Kunst und mit Literatur wirklich eingehend beschäftigte, ein Studium daraus machte, seine Erzeugnisse sich käuflich erwarb und gar eigene Kunsturteile entwickelte, geschah erst, als die große Kunst selbst dahin war, seit der Alexandrinerzeit, besonders zur Zeit der Herrschaft Roms. Das kluge Urteil ist das Merkmal des Epigonen, und Giganten in der Literatur sind unmöglich, wo die Bildung der Laien und[S. 116] der Volksmassen, die mit Hilfe des Buches erworben ist, den Geschmack beherrscht.
Damit hing die Ausbreitung des Schulunterrichts zusammen, eine Verbreitung der Bildung, die keineswegs zugleich eine Vertiefung zu sein pflegt, auch heute nicht. Vor allem seit dem 2. Jahrhundert n. Chr. haben die römischen Kaiser das Volksschulwesen der damaligen Welt organisiert und ausgedehnt, verstaatlicht, seine Wirksamkeit gesteigert. Seitdem las und schriftstellerte, was da Odem hatte, nicht nur in den Hauptstädten, nein, auch in allen Provinzen des Römerreichs, und zwischen Fachmann und Laie verwischte sich die Grenze mehr und mehr. Das war es aber zugleich, was der christlichen Religion zum Sieg verhalf; denn das Christentum war die Religion des Buches. Der Zeusdienst oder Apollodienst wirkte nur durch den Kultus und nicht durch Schriften. Anders der Christusdienst. Durch planvollen Vertrieb der heiligen Texte und Massenschriftstellerei hat sich dieser im zweiten bis fünften Jahrhundert das lesende Publikum, das heißt die Welt, erobert.
So ist es nun gekommen, daß auch die Bildwerke des zweiten bis fünften Jahrhunderts n. Chr., die unsere Altertumsmuseen anfüllen, plötzlich übersät sind mit Darstellungen der Buchrolle; vor allem die Sarkophage und unter diesen vor allem die christlichen. Es ist erstaunlich, das zu sehen.
Der Kaiser selbst wandelt jetzt wie pflichtgemäß mit solchem Buch einher (zum Beispiel auf dem Relief der Trajanssäule); das Buch ist in diesem Falle Symbol, ein Attribut, das die rechtsprechende, gesetzgebende Macht des Herrschers andeutet. Danach erhält auch Christus ständig das Buch; denn auch er ist König; nicht aber Maria; das heißt Maria war damals noch nicht Himmelskönigin, worauf der Dogmatiker achten möge. Aber auch der Beamte, der Advokat, auch der Schiffsbauer und der Handelsmann werden jetzt oft und gern mit dem gleichen Attribut versehen. Alles das erklärt sich aus der Berufseigenschaft der Personen zumeist mit Leichtigkeit; denn der Schiffbauer trägt seine Bauzeichnungen in der Hand, der Kaufmann[S. 117] sein Geschäftsbuch. Wenn aber auf den Marmorsarkophagen dieser Spätzeit der Verstorbene die Rolle trägt, was bedeutet sie da? Wie oft sieht man da den Verstorbenen so, im Muschelmedaillon, als Schmuck seiner eigenen Totenlade! Unzählig sind die Beispiele. Sind das lauter Beamte, Advokaten oder gar lauter Literaten oder Gönner der Literatur, die uns da erscheinen? Das wäre ungeheuerlich oder doch schwer zu glauben. Die gestellte Frage ist gewiß nur teilweise zu bejahen. Denn das Buch hatte noch eine tiefere Bedeutung.
Auch das Schicksal schreibt. Auch Götter haben ihre Bibliotheken. So wie wir in der Johannes-Apokalypse sehen, daß im Himmel die guten und schlechten Handlungen aller Lebenden und Toten, die da auferstehen, in Büchern verzeichnet sind, die von Dienern des Allmächtigen vor seinem Thron aufgerollt und verlesen werden — ein unendliches biographisches Archiv im Himmel —, ganz ebenso besitzen auch die römischen Parzen oder Schicksalsfrauen im unterweltlichen Raum ein großes Archiv: darin sind von ihnen die Lebensläufe aller derer, die geboren werden sollen, im voraus in Büchern aufgeschrieben und festgelegt. Dies schildert uns Ovid. Ein Buch ist da also ein Mensch: ein Buchinhalt ist ein Menschenleben! Daher nun also auch jene Verstorbenen auf ihren Marmorsärgen im Lateran und überall: das Buch, das sie halten, ist vielfach nichts anderes als Symbol ihres eigenen Lebens. Das Buch ist zu Ende abgerollt, d. h. das Leben ist zu Ende gelebt, das die Parze schrieb und das vom Schicksal im voraus gebucht ist. In der Tat halten jene Figuren die wieder zusammengefaltete Rolle regelmäßig in der Linken, wobei sie obendrein die Finger der rechten Hand oftmals noch still auf den Kopf der Rolle legen, als sprächen sie: „Nun bin ich fertig; mit meinem Lebensbuch bin ich nun am Schluß, und ich kann ruhen.“ Diese stille Grabessymbolik wirkt ergreifend, und sie scheint spezifisch römisch, nicht griechisch zu sein, so wie auch die schreibende Parze nicht griechisch, sondern römisch-etruskisch war[197].
[S. 118]
Im fünften Jahrhundert hatte das Christentum endgültig gesiegt. Zugleich aber war die kostbare Buchrolle aus Charta durch den gehefteten Pergament-Kodex, der billiger, unendlich viel haltbarer und daher in jeder Beziehung praktischer war, allmählich verdrängt worden. Seitdem haftete an der Buchrolle, die man in Bildwerken doch oft noch beibehielt, ein Schimmer des Heiligen und Sakrosankten. Denn die kirchliche Kunst liebt das Archaisieren. Evangelisten, Propheten und Heilige halten sie jetzt gern. So erklettern diese gestreckten biblischen Figuren die hohen Kirchenwände und füllen in Reihen, auf Goldgrund strahlend, die Apsiden und Triumphbögen der Basiliken; jeder, der in Italien gereist ist, hat ganze Völker von ihnen gesehen; ich erinnere nur an S. Paolo (fuori l. m.) in Rom und an Ravenna. Buchhalter! jawohl, dies sind jetzt wahre „Buchhalter“ des Himmels; das heißt, sie halten das Buch, das auf das Heil Bezug hat, wie ein Heiligtum ostentativ vorzeigend, im Dienst der Christenheit, damit die Gemeinde es gewahr werde, und nicht mehr sie selbst sind Benutzer des Buches, sie lesen nicht und wollen nicht lesen, sondern sie tragen es wie ein Plakat, damit die schauende Menge den frommen Spruch im Auge habe, der weithin sichtbar auf den offen hängenden Blattfahnen steht. Das war phantastisch, unwirklich und unantik, und der Gebrauch veräußerlichte sich im Mittelalter dann immer mehr. Aus der offen hängenden Rolle entsteht endlich das in eckigen Falten flatternde Spruchband, das die Engel in Glorien durch die Lüfte tragen.
Woher stammt unser Wort „Rolle“? Es ist gar kein Deutsch; von rotulus kommt es und stammt aus dem mittelalterlichen Latein her.
Im Mittelalter, wo es keinen Papyrus mehr gab, sind gleichwohl, nach dem Vorbild der Thorarollen der Juden, noch häufig Rollen aus Pergament hergestellt worden, und diese erreichen aufgerollt bisweilen die ungeheuerliche Länge von 100 bis 200 Fuß: Exultetrollen, Wappenrollen, Nekrologien, die noch vielfach erhalten sind. Sie zu benutzen, ist[S. 119] freilich für den heutigen Historiker eine Pönitenz. Aber auch im wirklichen Leben, im geistlichen Theaterspiel, fanden die rotuli damals noch Anwendung; ich meine das „Prophetenspiel“, in welchem die Propheten und Sibyllen selbst auftraten und ihren frommen Spruch vor der Gemeinde aufsagten, indem sie dabei ein offenes Spruchband in der Hand hielten, auf dem für das Publikum zu lesen stand, was sie, die Personen, bedeuteten oder welche „Rolle“ sie spielten[198]. Daher stammt es, wenn wir auch noch heute sagen, daß der Schauspieler eine „Rolle“ spielt. Die wenigsten unserer heutigen Bühnengrößen wissen wohl, was diese Redensart bedeutet. Aber auch in dieser Anwendung war die Rolle, wie man sieht, zu einem bloßen Merkzeichen und toten Emblem herabgesunken, ganz so wie auf den Wandschildereien, von denen vorhin die Rede war.
Der natürliche Verkehr des Buchträgers mit dem Buch war in der kirchlichen Kunst des Mittelalters aufgehoben. Aber Michelangelo hat ihn, als sie zu Ende ging, wiederhergestellt, und hier dürfen wir also einen der größten Namen nennen. Es war eine der Großtaten Michelangelos, daß er in der Sistina seine Sibyllen und Propheten endlich wieder in eine natürliche Beziehung zum Buch brachte. Diese Männer und Frauen der Weissagung, sie lesen, sie studieren wirklich — wie ausdrucksvoll ist das gegeben! — sie suchen, um zu weissagen, im geschriebenen Wort forschend das Zukünftige, oder sie schauen auch über das Buch weg.
Aber das Buch behält dabei seinen praktischen Wert. Das gilt zumal von der Delphischen Sibylle. Diese ergreifendste und ergriffenste Figur des Meisters, die Delphica, ist, wie ich überzeugt bin, bisher nicht richtig verstanden worden. Das sage ich nicht nur im Hinblick auf Justis „Michelangelo“, sondern auch auf Steinmanns Werk „Die Sixtinische Kapelle“. Nicht „der Mensch mit dem Buch“, der Übermensch mit dem Buch erscheint in der Delphischen Sibylle, und zwar in ganz neuer Konzeption. Die Seherin späht[S. 120] mit den Augen in die Zukunft wie in die Ferne, die Lippen leise geöffnet. Ihr Mantel bläht sich im Winde, und auch ihr Haar ist vom Wind bewegt. Mit der linken Hand aber hält sie eine unbeschriebene offenhängende Rolle gewaltsam weit nach rechts hinüber, so daß der Windhauch, der sichtlich durch das Bild fährt, auch diese Rolle selbst ergreift und aufbläht. Danach ist der Sinn klar und nicht zu verkennen: der Geist Gottes ist hier der Handelnde; denn der Geist Gottes ist Hauch, ist Wind! Er schwellt Mantel und Buch zugleich. So wird die bisher leere und unbeschriebene Rolle voll des heiligen Geistes, und der Geist tut das Mirakel, das ihm zukommt, und füllt sie mystisch unsichtbar mit Worten der Verkündigung des Heils. Es ist derselbe Geist, der auch die Evangelien geschrieben.
Das ist die höchste Vergeistigung des Buches in der Kunst. Eines blieb freilich noch übrig. In Heinrich Heines Nordseebildern lesen wir: „Und mit starker Hand aus Norwegs Wäldern reiß’ ich die höchste Tanne und tauche sie ein in des Ätna glühenden Schlund, und mit solcher feuergetränkten Riesenfeder schreib’ ich an die dunkle Himmelsdecke: Agnes, ich liebe dich!“ Hier wird das Buch in anderer Weise sublimiert; hier beginnt es die Welt zu umfassen. Der Himmel selbst ist Buch; der Dichter schreibt darauf wie auf einem Bogen.

Heine ist ein superlativischer Dichter. Aber er hat seine hochgegriffene Erfindung in diesem Falle der Antike entlehnt und hat sich selbst dabei beiläufig mit den Göttern des Altertums verwechselt. Die Göttin Ceres ist es, die bei dem römischen Dichter Claudian im „Raub der Proserpina“ die höchste, Wälder überragende Zypresse aus dem Boden reißt und in den Schlund des Ätna taucht, um sie als flammende Fackel zu brauchen; denn sie sucht nach ihrer verlorenen Tochter. Daß der Himmel aber ein entrolltes Buch ist, das steht schon im Jesaias und in der Johannes-Offenbarung zu lesen, und Euripides (fr. 506 N.) setzt den Fall, daß gar Gott Zeus selbst weithin in die Fläche des Himmels die Sünden der Sterblichen schriebe[199]. Gott Zeus, der sich reckt und in das Gewölbe der unendlichen Sphären wie in eine aufgerollte Rolle die Sünden schreibt! Erhaben ist der Gedanke, und er ist alt. Welcher Künstler aber vermöchte das darzustellen? Michelangelo hat es versäumt. Kein Apelles und kein Genie des Altertums, ein Michelangelo wäre dazu imstande gewesen.
[S. 122]
Es gibt Laien und auch Gelehrte, die meinen, daß unser Buchhandel und Verlagswesen etwas wesentlich Modernes ist, das etwa erst in den Zeiten Gutenbergs oder Luthers und Huttens sich ausgebildet habe; und in der Tat weiß das Mittelalter mit seinen schwerfälligen Pergamentkodizes vom Verlagswesen nichts, und den Buchhandel hat es nur spärlich entwickelt. Aber nicht aus dem Mittelalter, aus dem klassischen Altertum stammt unsere Kultur. Die Griechen und Römer, die uns so viel anderes vorweg nahmen, Theater und Konzerte und Volksbäder, dazu das höhere Schulwesen bis zur Universität mit ihren Studentenverbindungen und Kneipkomment, auch den ganzen Sport bis zum Fußballspiel, dieselben Griechen und Römer haben auch schon den Buchhändler und Sortimenter gekannt, der das Publikum mit dem modernsten Lesestoff versorgte und den Verfassern ihre Manuskripte abnahm, um sie herauszugeben.
Schriftsetzer und Druckmaschine waren allerdings den Alten unbekannt. Es wurde alles mit der Hand geschrieben. Aber wenn Caesar sein Bellum Gallicum, Horaz seine Satiren oder Ovid seine „Kunst zu lieben“ herausgab, so wurden doch gleich 500 Exemplare, ja vielleicht das Doppelte, das Dreifache in den Handel gegeben. Das pikante Ovidgedicht wurde von der flotten Damenwelt, das Caesarwerk von den Politikern, die Horazsachen von den Ästheten und Witzbolden verschlungen. Wie aber stellte man so viele Exemplare her? Durch Diktat. Ein „Diktator“ mag sonst etwas Übles sein; in der Literatur war er unentbehrlich. Der Diktierende sprach lautstimmig den Text; etwa hundert Schreiber — rühriges, kluges Arbeiterpersonal — hockten in Reihen an der Erde und schrieben nach. Die Hände flogen; die Feder kratzte nie; denn das Schreiben war ein Malen. Hübsch ausgestattet kamen die Buchrollen dann in den Verkaufsladen. Der Buchhändler hatte alle Borte und Kisten voll davon. An die Außenpfosten seiner Budike[S. 123] nagelte er das Neueste, um die Straßenbummler anzulocken, und er nahm gewaltig hohe Preise. Die Literatur war damals ein gewaltiger Luxus. Eine Rolle von 40 Seiten stellte sich nach modernem Geldwert auf etwa 16 Mark. Wer also den ganzen Livius kaufen wollte, hatte über 1500 Mark zu zahlen. Das Geld kassierte der Verleger oder zunächst der Sortimenter ein; denn die Verlagsartikel wurden aus Rom oder Alexandria in alle anderen Städte verschickt und dort von Sortimentern vertrieben.
Und was bekam der Autor selbst? Wurde etwa wirklich, wie man geglaubt hat, kein Honorar gezahlt? Lebten die Schriftsteller von der Luft? Begnügte sich der Poet im Geist mit den Musen auf dem Helikon zu schwärmen, indes der Buchhändler mit seinen oft epochemachenden Versen einen gedeihlichen Handel trieb? Und vor allem die anderen Literaten — soll Sallust, der doch sonst auf seinen Vorteil bedacht war, seinen herrlichen „Jugurthinischen Krieg“ ruhig und selbstlos den Händlern in die Hand gedrückt haben, daß sie damit ihr Geschäft machten? Die Sache wäre zu töricht; im Märchen wäre so etwas möglich, nicht unter ausgewachsenen Menschen der Wirklichkeit. Der Römer bestand doch sonst auf Recht und Eigentum, und der Grieche auch.
In der Tat: so spärlich auch unsere Nachrichten über diese Dinge sind und sein müssen, so läßt sich doch das Gegenteil leicht erweisen[200]. Die Sache wird schon deutlich, wenn uns Seneca sagt: „Wir sprechen von Büchern Ciceros; der Buchhändler Dorus aber nennt sie trotzdem sein Eigentum, und beides ist richtig; dem einen gehören sie, sofern er sie schrieb, dem anderen, sofern er sie sich käuflich erwarb.“ Der Buchhändler zahlte also auf alle Fälle, in diesem Fall mutmaßlich an Ciceros Erben; er kaufte; ohne das verfügte er über die Werke nicht, konnte sie also auch nicht verkaufen.
Und der Autor oder seine Erben hatten demnach wirklich Vorteil und Gewinn. Achten wir zuerst auf die Theaterstücke. In Rom tanzt der allbeliebte Solotänzer Paris; er stellt im[S. 124] Tanz mythologische Szenen dar, wie den König Pentheus, der von seiner Mutter Agaue in der Raserei umgebracht wird. Der Tänzer braucht dazu Musik, auch einen begleitenden Chorgesang, und dazu ist wieder ein Textbuch nötig; dies Textbuch lieferte ihm Statius, und Paris bezahlte dem Statius seine Textbücher so glänzend, daß Statius damit groß dastand und nebenher auch noch Epen schreiben konnte, die ihm nichts einbrachten. Vom alten Dichter Plautus gingen an die hundert Lustspiele um; manche davon rührten gar nicht einmal von ihm selbst her. Man sagte aber, Plautus habe so viel geschrieben, um reich zu werden; denn er verkaufte seine Stücke und war auf die Einnahme versessen; ob die Stücke nachher auch gefielen oder nicht, war ihm ziemlich gleichgültig. An den Götterfesten wurde Theater gespielt; der Staatsbeamte, der Aedil, der das Fest ausstattete, brauchte dazu jedesmal ein neugeschriebenes Stück, und er kaufte es vom Dichter. In anderen Fällen war auch der Chef der Schauspieltruppe der Käufer. Gewaltig hohe Summen, die die Dichter Terenz und Varius für ihre Dramen einkassierten, werden uns wirklich genannt. Tantiemen bei Wiederaufführungen gab es nicht[201]; das erklärt sich aus dem Gesagten. Um so berechtigter war die Höhe der Summen.
Denn das so verkaufte Lustspiel gehörte alsdann eben dem Dichter nicht mehr. Sollte ein Stück wie der Miles gloriosus oder die Adelphen nach seinen Bühnenerfolgen nun aber auch als Lesedrama und in Buchausgabe in den Handel kommen, so mußte der Buchhändler — sagen wir sachgemäß der Verleger — das Manuskript vom Aedilen oder vom Schauspieldirektor, der es jetzt rechtlich besaß, nicht aber vom Dichter kaufen, der sein Eigentumsrecht abgegeben hatte.
Es ist auch heute so: Theatersachen bringen am meisten ein. Man denke an „Alt-Heidelberg“ und ähnliches. War auch nur eine Operette ein Schlager, so können Komponist und Dichter gleich ihre Dachstube verlassen und sich in bester Gegend eine Villa bauen. Wer dagegen etwa Moltkes oder Mörikes Briefe herausgibt, wer ein Buch über das antike Buchwesen schreibt[S. 125] oder gar mit seinen ersten lyrischen Versuchen hervorkommt, ist bei uns in seinen Erwartungen und Ansprüchen sehr bescheiden. Und so war es auch im Altertum. Trotzdem hat ein Mann wie Cicero ganz gute Schriftstellereinnahmen gehabt, zwar nicht mit seinen philosophischen Versuchen, den Tusculanen u. a., wohl aber mit seinen berühmten Reden, die tatsächlich jedesmal ein Ereignis für Rom waren und wie Pamphlete wirkten. Man bedenke, daß es damals noch keine Zeitungen gab, die heutzutage die Parlamentsreden in jedes Haus tragen.
Um sich die Sache klar zu machen, sei Apollinaris Sidonius benutzt. Dies war einer der reichsten, vornehmsten Herren in der Römerwelt des 5. Jahrhunderts n. Chr., der zeitweilig sogar mit dem Kaiserhof in nächster Verbindung stand. In seiner vielköpfigen Dienerschaft oder Klientel hat der Mann auch einen eigenen Buchhändler, und dieser Buchhändler muß nun helfen, als Sidonius seine eleganten Schriften herausgeben will; aber er überläßt diesem nun nicht etwa das Geschäft selbst mit den anfänglichen Geschäftsunkosten und dem hernach erzielten Gewinn, sondern er zahlt ihm nur jährlich ein Fixum, und dafür muß der Angestellte den Vertrieb besorgen, was eben voraussetzt, daß er den Gewinn an den Herrn selbst abzuliefern hat; denn anderenfalls hätte das Fixum keinen Sinn. Dieser Angestellte heißt deshalb „besoldeter Buchverkäufer“ (mercennarius bibliopola). Vielleicht hatte dieser Mann in verschiedenen Städten eigene Verkaufsbuden, wo er die Sachen vertrieb; er konnte sie auch gegen Zahlung an verschiedene andere seinesgleichen, d. i. also an Sortimenter, verschicken und weitergeben.
Dies Verfahren ist Selbstverlag, und es ist das Verfahren, das alle großen und wohlmögenden Herren, die sich mit Schriftstellerei abgaben, eingehalten haben müssen, z. B. der große Rechtsgelehrte Ulpian, der in Rom Gardepräfekt und der mächtigste Mann neben dem Kaiser war. Die Fülle seiner juristischen Schriften, die nur in Fachkreisen Verständnis fanden, kann Ulpian nur in dieser Weise selbst vertrieben haben; nicht anders aber auch Cicero. Jedoch wurde die Sache dem Cicero,[S. 126] der für einen viel größeren Leserkreis arbeitete, bald unbequem, und sein ausgezeichnet geschäftskundiger Freund Atticus kam ihm zum Glück zur Hilfe. Der vornehme Geldmann Atticus ist der großartigste Verleger des Altertums, den wir kennen. Er hielt sich ein besonders zahlreiches Abschreiberpersonal und gab mit dessen Hilfe in trefflicher Ausstattung berufsmäßig griechische und römische Autoren in Fülle heraus. Da sehen wir nun, wie Cicero ihm seine neuen Arbeiten, die gleichsam noch warm und kaum gar vom Ofen kommen, zuschickt, und wie dann in den Abschriften, die Atticus herstellt, doch gelegentlich ein Fehler sich einstellt und rasch etliche Schreiber heran müssen, um, ehe es zu spät ist, den Schaden aus allen Exemplaren zu beseitigen; denn in dem Werk, wenn es einmal heraus ist, läßt sich nichts mehr korrigieren: nescit vox missa reverti. Als Atticus im Jahre 46 v. Chr. auch Ciceros Rede pro Ligario vertrieben hat — offenbar riß sich sogleich alles darum —, da ruft der Verfasser voll Entzücken: „Du hast meine Rede mit so großartigem Erfolge verkauft: hinfort sollst du von allem, was ich schreibe, den Vertrieb haben,“ woraus folgt, daß Atticus vor dem genannten Jahre keineswegs alle Sachen Ciceros verlegte. Vor allem aber sehen wir, daß Cicero sich an dem Verkauf freut; er hatte persönlich Gewinn davon.
Aber wir hören mehr. Nichts wird so gern gekauft wie die Witzliteratur, die sich bei den Alten vor allem in der „Satire“ auslebte. Die Satire war das humoristische Feuilleton der Alten. Vom Satiriker Menipp hören wir nun zufällig einmal ausdrücklich, daß er seine prickelnden Schriften mit großem Geldgewinn abgesetzt hat. Wie? wird nicht gesagt. Uns genügt zu wissen, daß auch er als Verfasser eine Einnahme, und dazu eine gute, erzielt hat.
Aber auch von den Spottdichtern, die nur kurze Gedichte und Epigramme zum besten gaben und dabei wie die „Wespen“ stachen, erfahren wir dasselbe. Über einen solchen wird einmal, weil er zu viel Geld verdient, mit Entrüstung hergefallen,[S. 127] und da heißt es von ihm: „Du verkaufst deine Witzverse (Jamben) wie der Kaufmann sein Öl; was hast du für Verdienste um unser Gemeinwohl, daß du mit deinem Schimpfen so viel Geld machst?“ Es ist also auch hier so: der Schriftsteller hat seinen guten Vorteil.
Eine angesehene Verlagsanstalt in der Zeit des Kaisers Augustus waren die „Gebrüder Sosii“; sie waren die Verleger der Oden des Horaz, und damit erhebt sich die wichtige Frage, die noch übrig bleibt: konnten auch solche Dichter, die nicht für die Bühne, sondern nur für das lesende Publikum schrieben, und die dabei sich auf den erhabenen Stil beschränkten, auf das gleiche rechnen? konnten sie von ihrer Kunst leben? Hier liegt die Sache in der Tat anders, und wer dem sorglich nachgeht, erhält einen interessanten Einblick in die eigenartigen gesellschaftlichen Verhältnisse der Antike; es wäre verfehlt, diese Verhältnisse nach den unsrigen zu beurteilen.
Der Betrieb der Gebrüder Sosii war genau so, wie wir es nach allem, was ich vorausschickte, erwarten müssen; denn über sie wird uns wörtlich mitgeteilt: „Sie erwarben sich gute Werke durch Kauf und hatten dann beim Verkauf großen Gewinn, indem sie Vorräte von ihnen herstellten.“
Also auch sie „kauften“ die Manuskripte, ehe sie verkauften. Das versteht sich von selbst. Gleichwohl war die Sachlage für die Dichter doch höchst ungünstig, und insofern können wir unsere Gegenwart zunächst noch ganz wohl zum Vergleich heranziehen. Denn auch heute kann, wer ein Epos oder gar lyrische Gedichte macht, froh sein, wenn er sein Werk überhaupt gedruckt sieht; er zahlt womöglich noch etwas zu und jauchzt auch dann noch, wenn er das erste fertige Exemplar in die Hand bekommt. So sagt denn auch Seneca von den Dichtern erhabenen Stils: „Sie dichten nicht um Gewinn, sondern sind zufrieden, wenn sie nur Dank ernten.“ Sie sind also von vornherein bescheiden; es fragt sich aber immerhin, worin der „Dank“ bestand, auf den sie rechnen.
Horaz hat in seinem ganzen Leben nicht mehr als zehn kleine[S. 128] Bücher fertig gebracht, die heute zusammen nur ein einziges schmächtiges Bändchen von etwa 250 Druckseiten ergeben. Wie hätte er davon dreißig Jahre lang (in den Jahren 40–8 v. Chr.) leben können, wenn die Gebrüder Sosii ihm auch wirklich für jedes der zehn Büchlein ein gewisses Sümmchen ausgezahlt hätten? An den ersten fünf seiner Bücher schrieb der Dichter zehn volle Jahre lang, von 41–31 v. Chr.; für jedes derselben hätte er vom Verleger also eine Einnahme, die für volle zwei Jahre reichte, ausgezahlt erhalten müssen: was undenkbar ist.
So steht es denn auch sonst. Die Dichter sind die Sorgenkinder der Muse; denn das Talent pflegt arm zu sein. „Ihr lest meine hübschen Produkte,“ scherzt der arme Martial, „aber mein Geldsack weiß nichts davon“ (nescit sacculus ista meus). Ein reicher Nabob und Konsular wie Silius Italicus, der mochte immerhin sein langweiliges Epos über Scipio aus eigenem Vermögen mit Hilfe des Selbstverlags ins Publikum bringen; der arme Dichter dagegen geht so vor, daß er sein Werk einem vornehmen Manne widmet. Der Vornehme legte auf solche Widmung den höchsten Wert; denn von Dichtern rühmend genannt zu werden, galt für mehr als alle Verewigung durch Inschriften[202]; und er setzt also, um sich erkenntlich zu zeigen, seinen Ehrgeiz darein, den Dichter, an dessen Talent er glaubt, nun auch materiell sicher zu stellen; er schafft ihm sorgenfreie Muße; denn nur in solcher freien Muße läßt sich Bedeutendes schaffen. Er geht dann gelegentlich auch weiter und stellt dem Dichter selbst seine großen Aufgaben, wie sie dem Zeitbedürfnis entsprechen[203]. So hat sich Mäcenas durch seinen Klienten Horaz, wie jeder weiß, seinen unvergänglichen Namen erworben.
Wie aber war alsdann das Verfahren der Herausgabe der Gedichte? wie stand Horaz geschäftlich zu seinem Verleger? Die Antwort lautet: er hatte gar keine Beziehung zu ihm; sein reicher Gönner trat ganz für ihn ein.
Hier gilt es vom Wesen der „Widmung“ zu handeln. Heutzutage ist das Widmen nichts als ein Ausdruck „hochachtungsvollster[S. 129] Verehrung“; der Jüngling schreibt vor seine Liebesverse „meiner angebeteten Klotilde“, der Doktorand bringt seine lateinisch geschriebene Doktorschrift seinen Eltern dar, die gar kein Latein verstehen. Was hatte Anton Springer davon, wenn er sein Buch über mittelalterliche Baukunst dem Herrn Boisserée, was Mommsen, wenn er seine Römische Geschichte seinem Kollegen Moritz Haupt widmete? Er erntete dafür ganz gewiß nichts weiter als ein Wort wärmsten Dankes, der Jüngling von seiner Geliebten vielleicht überdies einige Zärtlichkeiten. Das ist alles.
Dies Dedizieren haben wir zwar von den Alten gelernt; im Altertum hatte es aber einen ganz anderen Zweck, eine andere und höchst praktische Bedeutung. Es gab zwei Arten von Widmungen. Der alte Cato richtete seine Lehrschriften an seinen Sohn; derartiges geschah oft, und da liegt der bloße Lehrzweck zutage. Cato war Senator, Konsul, war Zensor in Rom und brauchte sich durch seine Schriften keine Gönner zu erwerben. Wer aber zu den wirtschaftlich Schwachen zählt, wendet sich mit seiner Gabe an die Größen der Börse, an fürstliche Personen, an die Könige und Kaiser selbst, und das „Dedizieren“ (dedicare) ist alsdann ein Schenken (donare) in eigentlichstem Wortsinn gewesen; als Schenkung wird es uns ausdrücklich bezeichnet; d. h. es war völlige Eigentumsübertragung, ganz ebenso wie das Verkaufen, und der Empfänger der Widmung ist fortan Eigentümer des Originalmanuskriptes mit allen Folgen, die das in sich schließt, ganz so, wie wenn heute ein Student dem anderen einen Spazierstock oder ein schönes Bierglas „dediziert“; er hat alsdann an der Sache gar kein Recht mehr, und der Empfänger kann hinfort damit machen, was er will.
Der Dichter hat also an seiner Dichtung alle Rechte preisgegeben, und wollte nun ein Buchhändler das Werk vertreiben und in Verlag nehmen, so mußte er es zwar selbstverständlicherweise käuflich erwerben, aber nicht vom Dichter, sondern von dem vornehmen Manne, dem es jetzt gehörte. Die Sache liegt[S. 130] just so wie bei den Lustspielen des Plautus. Damit war der Poet allen Verlagssorgen enthoben; sein Werk war ihm entzogen; aber er rechnete auf den „Dank“ seines Gönners, der ihn fortan wirtschaftlich sicherstellte und für ihn sorgte durch jährliche Unterstützung. Das nannte man salarium. Er wurde gefüttert wie eine gezähmte und eingefangene Nachtigall. So erklärt sich die eigentümliche Erscheinung, daß es der Empfänger der Widmung ist, der entscheidet, ob das Werk überhaupt in den Handel kommen soll oder im Kasten bleibt (wohl viele Werke sind uns so entgangen); ja, er ist es, der Verbesserungen im Text anordnet und endlich auch für eine anständige oder pomphafte Ausstattung sorgt. Der Dichter aber hat sich damit eine Sinekure verschafft. So sitzt Horaz bei Tivoli auf dem Land, verpachtet den größeren Teil seines Gütchens, speist als echt frugaler Epikureer seine „Oliven, Cichorien und Malven“ und meißelt dabei aus dem spröden, dunklen Marmor der lateinischen Sprache seine Oden, nur etwa jeden Monat eine.
In dieser Weise hat die Poesie fast hundert Jahre lang in Rom geblüht. Daher sagt Martial: So lange es Mäcene gibt, gibt es auch Vergile! Dann aber gingen die Protektoren ein. Das Angebot an Versen wurde zu groß, und man hatte allmählich von Orest und Thyest genug gehört. Seitdem die hohen Herren den Hunger nach Dichtkunst verloren, verhungerte schließlich die Dichtkunst selbst. Juvenal singt in seiner siebenten Satire ihr krächzendes Grablied. Die Poeten darbten jetzt bei ihrer Öllampe unterm Dach im fünften Stock, und erst etwa zwei Jahrhunderte später ist die Poesie in der lieben „Mosella“ des Ausonius an unserer Mosel zu einer bescheidenen Nachblüte neu entstanden.
Die Verdienste der römischen Kaiser um die Wissenschaft sind noch gar nicht genug gewürdigt worden. Ich rede hier nicht von den vielen Schulbüchern, die hübsch gemeinverständlich abgefaßt wurden; die brauchten zu ihrer Verbreitung keiner höheren Fürsorge; denn sie konnten von vornherein auf reichen Absatz rechnen. Die Lehrer trieben mit ihren Lehrschriften regelmäßigen[S. 131] Handel; die Schüler mußten sie kaufen, und so sieht sich denn auch gelegentlich der Verfasser eines solchen Buches gedrängt zu versichern, daß er es „nicht um des Gewinnes willen“ schreibe. Solche Bücher waren also „lukrativ“. Dagegen hatten es die Gelehrten mit ihren streng wissenschaftlichen Arbeiten, die dazu meistens noch sehr umfangreich waren, oft schwer, ans Tageslicht zu treten. Heute ehrt es unsere Verleger, wenn sie Werke so schweren Kalibers wirklich drucken und auflegen; sie bringen damit oft ein rühmliches Opfer. In jenen Zeiten aber haben nicht selten die Kaiser selbst geholfen; dafür war das Hofamt „für gelehrte Dinge“ (a studiis) da. Ich erinnere nur an Kaiser Mark Aurel, dessen Zeitgenosse, der Philologe Herodian, ein epochemachendes Werk über die Betonung der Silben im Griechischen und über die Akzentschreibung schrieb, das ganze 21 Buchrollen füllte. Dem Mark Aurel widmete er die Rollen, und wir wissen jetzt, was das bedeutete; der Kaiser, der die Widmung annahm, veranlaßte ihre „Edition“, ihre Vervielfältigung und Verbreitung, so wie bald danach auch der Sohn Mark Aurels, der Kaiser Commodus, für das gelehrte Lexikon des Pollux die Fürsorge übernahm. Es nützte freilich in beiden Fällen wenig; die Werke waren mit Stoff allzu überladen; das gelehrte Dickicht schien zu undurchdringlich; man machte Auszüge daraus, und nur diese Auszüge liegen uns heute noch vor, aber sie sind uns immer noch eine reichliche Quelle der Belehrung.
Die Kaiser waren die eigentlichen Besitzer der öffentlichen Bibliotheken Roms, die Bibliothekare waren ihre Angestellten, und man konnte sicher sein, daß sie in den Schränken dieser großen kaiserlichen Büchereien selbst, die jedem zur Benutzung offen standen, gute Abschriften niederlegen ließen, und das war das wichtigste. Vespasian und Titus eroberten Jerusalem; der Jude Josephus erlebte als Freiheitskämpfer die Katastrophe mit; er wurde aber von den Römern gefangen und huldigte jetzt den Kaisern, die ihn für seine Gesinnungslosigkeit ehrten, ihm die Freiheit schenkten, Gehalt zahlten, ja, in Rom im kaiserlichen[S. 132] Palast wohnen ließen. Es ist begreiflich, daß Josephus, als er nun seine jüdische Geschichte schrieb, damit das Interesse dieser beiden Kaiser gewann, das sich auch auf das beste bewährt hat. Wir sind glücklich, die Bücher des Josephus noch heute zu lesen.
Auf die sozialen Verhältnisse aber fällt aus dem, was ich hier besprochen habe, ein grelles Schlaglicht. Es handelt sich um das Genie ohne Geld. Der unbemittelte Schriftsteller, wie anders als heute stand er damals in der Gesellschaft! Es war die Zeit der Mäcene. Der Dichter lebte allerdings im Grunde ein höchst bequemes Leben; er brauchte durchaus nicht sehr produktiv zu sein; niemand zwang, niemand hetzte ihn. Aber er war zeitlebens abhängig von der Gunst und Laune der Großen. Heute wissen wir zum Glück von Patronen und Klienten nichts mehr; unsere Schriftstellerei ist frei, und jeder Autor wählt sich selbst seinen Verlag. Gewiß. Aber man wird vielleicht bemerken, daß sich unsere buchhändlerischen Verhältnisse doch neuerdings den antiken mehr und mehr analog entwickeln. Unsere großen modernen Verlagsanstalten wachsen an Macht und stehen im Literaturleben der Gegenwart vielfach schon wie die Patrone da; sie kreieren Autoren, begünstigen sie und stellen ihnen ihre Aufgaben und haben vor allem auch wie die Patrone des Altertums die Entscheidung in der Hand, die gegebenenfalls die Veröffentlichung eines Werkes für lange Zeit oder für immer verhindert. Dazu kommt der Geldpunkt. Gemurrt wird wohl heute genug; es wäre nicht erwünscht, wenn es dazu käme, daß wir uns nach den Verhältnissen der Zeiten des Augustus und Nero zurücksehnen müßten.
Im Altertum sind die Verleger indes schwerlich zu großen Reichtümern gelangt. Jener Atticus mit seinem Riesenverlag, von dem ich berichtete, war augenscheinlich ein Idealist, aber er war zugleich Großkapitalist und konnte das Risiko tragen. Warum war der Beruf der Verleger wenig ergiebig? Kaum hatten sie ein Werk herausgebracht, so fiel das Publikum rücksichtslos darüber her. Rechtsschutz gab es nicht; wer nicht kaufen[S. 133] wollte, machte sich eigenhändig eine Abschrift, und dem Bücherverkauf wurde dadurch die empfindlichste, ja eine ganz unerhörte Konkurrenz gemacht. Es war eine Ausplünderung, viel ärger als der Nachdruck, der noch in unserem 18. Jahrhundert die Verleger so gröblich schädigte. Von dem ersten besten guten Bekannten borgte man sich ein Buchhändlerexemplar und kopierte es nach Belieben. Das war billig; es kostete nur etwas Zeit und Papier; aber man nahm meistens schlechtes Papier dazu, die Rückseite von alten Aktenbogen und ähnlichen; wir haben davon noch viele Proben erhalten. Tausendfach und ständig ist das geschehen, und diese „Privatabschrift“ hat — besonders in der christlich gewordenen Welt — den Verlag und Buchhandel des Altertums schließlich geradezu ertötet. Vollends kam sie in den Schreibstuben der Klöster zum Sieg. Die Mönche kauften grundsätzlich nicht vom Buchhändler. Daß im Altertum ein Buch, es mochte noch so vortrefflich sein, viele „Auflagen“ erlebte, war daher ausgeschlossen.
[S. 134]
Von Amoretten soll im Nachstehenden die Rede sein, von jenen geflügelten Putten, die, dem modernen Auge so geläufig, auf Gemälden und Standbildersockeln wie an Häuserfassaden, auf Geschäftsreklamen und Waschtisch-Stickereien von unseren Künstlern, Kunsthandwerkern und Damen oft auf das gedankenloseste wiederholt werden, als ein bequemer Hausrat für die erfindungsmüde Phantasie der Gegenwart, ein immer erwünschtes Füllsel für alle leeren Ecken und Winkel; und, wo immer wir sie sehen, erscheinen sie allezeit gefällig oder doch niemals störend; denn es läßt sich leicht über sie hinwegsehen. Von gewisser Originalität waren jene Greenaway-Bilderchen, mit denen uns vor längerer Zeit die Erfindungsgabe englischer Frauenseelen beglückt hat; sie waren gleichsam auf dem Boden und Plan des englischen „Kindergartens“ erwachsen. Sie sind natürlich stets hübsch bekleidet. Anders die Putten, und schon ihre Nacktheit kann dem Nichtwissenden verraten, daß sie ein Anlehen aus freieren Zeiten sind. Wir verdanken sie der lebensfrohen italienischen Renaissance, und schon zu den Füßen der Sixtinischen Madonna, in den Glanzhimmeln des Correggio führen sie ja ihr göttlich schönstes Kinderleben. Die kleine Flügelrasse war seitdem nicht zu verderben; selbst das Klima des Rokoko bekam ihnen leidlich; sie wurden sichtlich fetter, trugen jeden Thronhimmel, den sie sollten, und überstanden jede Verrenkung. Ihre Ahnen indes, jene Flügelknaben der großen italienischen Kunst, hatten gleichsam reineres Venusblut, sie hatten voraus den Adel der Wahrheit und Schönheit, in Süßigkeit und Zauber des Leibes und der Gebärde. Sie dienten jenen Künstlern bald als Engel, bald als Amorinen, bald als Genien zu durchsichtiger Symbolik. Es ist jene Zeit, wo man auch den Sohn Gottes im Schoße Marias für immer der stumpfen Bekleidung entledigte, die ihn in der Kirchenbilderei des gotischen Mittelalters wie die Wolke die Morgensonne zudeckte, um alle Virtuosität[S. 135] Raphaelischen Könnens an diesem heiligsten Kinderleibe zu üben.
Also die Renaissance. Aber sie war nur Renaissance, sie war nur wiedererstandenes Altertum. Jene köstlichen Putten haben als Ahnen noch echtere griechische Venuskinder; die Renaissance ließ sie auferstehen aus den Gräbern des Altertums, aus jenen antiken Marmorsärgen, die so massenhaft mit dem Volk der Amoren geschmückt sind.
Wollen wir die Frage stellen nach der ersten Entstehung der Amoretten, so gilt es bis in das griechische Altertum selbst zurückzugehen. Wie konnten diesen Kindern die Flügel wachsen? und was bedeuteten sie dem antiken Publikum? Hat, was man heute ziemlich gedankenlos als Gemeingut hinnimmt, dereinst einen eigentümlichen Sinn gehabt? und wie weit hatte das Cinquecento Recht, die griechischen Putten in dreifacher Verwendung als Amoren, als Engel, als Genien nachzubilden?
Was ich im Vorliegenden darbiete, ist von mir mit umständlicheren Belegen und in leider der Ungnade verfallener Sprache anderen Orts ausgeführt[204]; für den, der nachprüfen will, sei im Anhang mit Seitennennung auf jene Ausführungen kurz verwiesen. Da auch in den neuesten Arbeiten über diesen Gegenstand die richtige Auffassung noch fehlt, lohnt es sich, sie noch einmal vorzutragen[205].
Der Leib des Menschen sehnt sich wohl nach dem Fliegenkönnen so, wie die Seele des Menschen sich sehnt nach der Unsterblichkeit. Es ist beides der Trieb nach Unendlichkeit, dort in das Räumliche hinaus, hier hinaus in die Länge der Zeiten. Wie schön, das Ersehnte leibhaft vorzustellen! Der Kinderkörper ist der leichteste; sein Bau kommt dem des beneideten Vogels noch am nächsten, wenn wir achtgeben auf das Verhältnis der Höhe zur Breite; ein Kind läßt sich schon am ehesten harmlos schwebend denken. So erregt es ein seliges Gefühl wie erfüllte Sehnsucht, der Anblick der schwebenden Eroten.
Für den alten Ägypter war der Vogel gelegentlich selbst[S. 136] göttlich, selbst Gottheit gewesen; er schuf den Gott Horos mit dem Sperberkopf; der Fittich war ihm allgemein Abzeichen des Göttlichen. Anders der Grieche. Der Grieche schuf Gott nach seinem Bilde und verschmähte jenes Abzeichen durchaus, außer wo er phönizischen Einflüssen Raum gab[206]. Die olympischen Götter schreiten vorgeneigt durch den Luftraum, durchmessen die Himmelsstrecken mit leichtestem Sprung, aber sie bedürfen des Flugapparates nicht; auch beim Hermes ist er lose Zutat und mehr Merkmal als Werkzeug der Eile dieses Berufsboten. Die Flügel sparte jene Kunst für ihre Windgottheiten, für ihre Siegesgöttin, die Nike, auf, um an ihnen die stürmende Hast vorzüglich auszudrücken. Amor aber — griechisch Eros — ist die Liebe. Die Liebe (Sappho bezeugt es) ist dem Winde, dem Sturme gleich; man weiß nicht, von wannen sie kommt und geht; sie ist überraschend beglückend, göttlich, aber ephemer, eine Unsterblichkeit des Augenblicks, wie Nike, der geflügelte Sieg[207]. So ist Eros — nach einigen ein Sohn des Zephyr — stets geflügelt gebildet worden.
Aber auch in anderem Sinne ist die Liebe flugbegabt. Jene Sehnsucht des Sterblichen nach dem Unendlichen, nach dem Fliegenkönnen, in der Liebe ist sie gleichsam erfüllt; denn sie ist ein Schweben des Liebenden außer sich, d. h. im Unbegrenzten. Der Menschenseele selbst, die da liebt, wachsen somit Schwingen; oder aber — in anderer Auffassung — die Liebe selbst in ihr ist ein Flügelwesen. Als man bei den Griechen begann, über die Beflügelung Betrachtungen anzustellen, beim Plato im Phädrus, wird uns eben dies gesagt. Nicht wesentlich weicht hiervon ab, wenn es in einem Spruche aus der Komödie heißt: „Schnell wächst Gefieder dem Eros, wenn er hofft, und schnell entfiedert ist er, wenn ihm die Hoffnung schwand“[208].
Nicht also die Befiederung der Amoretten bedarf einer weiteren Erörterung, wohl aber ihr kindliches Alter und ihre Vielheit, desgleichen die Art ihrer Verwendung oder Beschäftigung.
[S. 137]
Es gilt zum Verständnis die verschiedenen Zeitalter des Griechentums zu sondern, die Wandelungen des Zeitgeistes in ihm zu beobachten. Das Griechentum gleicht der Natur und dem warmen blühenden Jahre; nicht jeder Monat brachte die gleiche Flora. Die Amoretten waren Spätlinge des Jahres und entstanden, als der Geist und die Kunst schon herbstete.
Die eigentlich klassischen Zeiten eines Perikles und Plato wußten im wesentlichen nur von einem Eros. Die Vorstellungen über ihn waren erst allmählich innerhalb der Literatur und Kunst selbst ausgebildet worden. Er war von den Einen im Interesse der Schöpfungsgeschichte als Schöpfungsgeist oder Lebensprinzip des Weltalls, von anderen minder abstrakt als Entzünder der Liebe innerhalb des Menschenlebens aufgefaßt. In dem letzteren Sinne, der je mehr überwog, je breiteren Raum die Liebespoesie gewann, festigte sich erst nach und nach die Vorstellung vom Eros als dem Sohne der Aphrodite. Die Kunst aber gab diesem einen Eros ganz vorwiegend die Gestalt des Halbjünglings oder reiferen Knaben, in einem Alter zwischen 9 oder 10 bis zu 16 Jahren. Und wir sehen diesen „jüngsten“ und „schönsten“ der Götter zunächst nicht sich beschäftigen; er steht oder er fliegt daher, hält Symbole, die auf Lenz und Liebe deuten, bis er endlich zum Bogenspanner ausgebildet ist, der die Herzen verwundet mit dem Pfeil der Venus.
Es konnte nicht ferne liegen, von diesem Venussohn zu einer Mehrheit gleichartiger Gestalten zu gelangen. Eros ist die Personifikation eines Triebes. Man konnte der Liebe die Begierde „Himeros“ zum Bruder geben, als dritten dazu die Sehnsucht, den „Pothos“, gesellen. So tat es in der großen Kunst nur Skopas in der ersten Hälfte des vierten Jahrhunderts v. Chr. Die Vasenmalerei und kleinere Kunst aber schlug entweder dasselbe Verfahren ein (die Beischriften bezeugen es), oder sie zeigte „Liebe“ und „Gegenliebe“ (Eros und Anteros), oder sie verfiel endlich auch geradezu auf eine Anzahl von gleichartigen ununterschiedenen Eroten, bis etwa zu sechsen an der Zahl auf einem Stück. Es scheint dies zunächst ein ähnlicher[S. 138] Hergang, wie wenn man den einen Gott Pan, den ziegengestaltigen, vermehrte und aus ihm einen ganzen Tragödienchor seinesgleichen schuf[209]. Und doch liegt die Sache anders[210].
Da Liebe immer nur als die Liebe eines Menschenherzens zu verstehen ist, so waren gewiß so viele Eroten denkbar, als da Herzen lieben. So sprach auch die Euripideische Tragödie, die die Liebe zuerst zum großen Gegenstande der Bühne machte, mehr als einmal im Plural von „Eroten“. Sogar ein Pindar war vereinzelt darin vorgegangen. Allein jene Vasenbilder geben uns diese Eroten noch allzu deutlich als abstrakt symbolische Figuren; sie ordnen sie schematisch und nach äußerlicher Entsprechung (besonders ist die Zweizahl bevorzugt), so daß oftmals der Eindruck entsteht, das bloße Bedürfnis nach Symmetrie sei hier auf die Erfindung von Einfluß oder entscheidend gewesen; und was wichtiger, sie vereinigen diese Eroten noch nicht unter sich zu einer Handlung. Es waren noch keine Amoretten.
Auch fehlte noch immer das eigentliche Kindesalter. Zwar konnte es nicht fern liegen, sich Amor klein vorzustellen, und auf diese Anschauung konnte hinleiten, was Sophokles von ihm sang: „Der du auf weichen Wangen des Mägdleins lauernd gelagert bist.“ Es ist dies nichts als der Person gewordene „Glanz der Liebe auf Purpurwangen“ (Phrynichus). Wo aber war damals der Künstler, der dies auch nur annähernd in Stein oder Farbe wiederzugeben wagte und wagen konnte? Auch weiß z. B. der Komiker Alexis in seiner eingehenden Charakterzeichnung des Gottes noch nichts von seiner Kindlichkeit[211].
Die Erfindung der Amoretten wurde erst möglich, nachdem bei den Künstlern das Interesse an Darstellung von Kindern wach geworden, die Fähigkeit, Kinder darzustellen, ausgebildet worden war, und wir stellen schon hier den Satz auf: das Interesse am Kinde war die Erzeugerin; nicht Aphrodite, sondern die Kinderliebe ist in Wirklichkeit die Mutter der Amoretten gewesen. Als Kennzeichen für sie stellen wir fest: erstlich[S. 139] das Kindesalter, zweitens ihre Vielheit, die zur vorherrschenden Regel wird, endlich ihre Beschäftigung, die nur zum Teil sich noch nach außen hin auf Götter- und Menschenherzen richtet, sondern zumeist nur ein Spiel miteinander und ein Untersichsein ist. Um dieser Beschäftigung willen war eben die Vielheit zweckmäßig und Vorbedingung.
Die größte Zeit starken männlichen Zuges mußte erst vorüber sein. Erst mußten die Phidias und Polyklet, Praxiteles und Lysipp, naiv erhaben, ihrem Volke seine großen Stadtgötter hingestellt haben, das Ideal steigernd und verwirklichend, eine steinerne Theologie; erst mußte die Kunst die Behandlung des männlichen und des weiblichen Körpers, des gewandeten und des ungewandeten, an den Göttern wie an der Bildung sieggekrönter Sterblicher zu Ende geübt und bis zur höchsten Vollkommenheit gebracht, mußte in ihr den letzten Reiz des Neuen und Schönen erschöpft haben, bis sie sich endlich auch des Kindes erinnerte, über das sie gleichsam hinweggesehen, und hier eine Aufgabe übrig fand, um Anmut in Fülle auszuschütten, wo die Stärke und Erhabenheit verbraucht war.
Es beginnt seit Alexander dem Großen die Ära der großen griechischen Königreiche, die Greisenzeit des Griechentums, der Hellenismus. Das Publikum überließ die Politik den Königen; es verlor den politischen Ehrgeiz; es wurde weltbürgerlich, es wurde sentimental. Die Interessen und Aufgaben gingen in das Kleine und Menschliche; man sah gern und man schilderte gern Landschaft und Natur, die liebe Alltäglichkeit und die alltägliche Liebe, schwärmte für Hirten und Fischersleute und sehnte sich in Übersättigung und Empfindsamkeit zurück in die unverderbte Einfalt des Lebens[212]. Man wurde groß im Kleinen; es war wie die Nachlese desjenigen, der das Leben ausgeschöpft hat. Damals hub auch die sentimentalische gerührte Freude am Kinde an. Erst aus der sentimentalischen Liebe zu Kindern ist die Idee der Amoretten, erst aus der Darstellung von Kindern ist die Darstellung von Amoretten[S. 140] hervorgegangen. In jener Zeit, als Christus, vom Berge predigend, das Wort sprach: „Lasset die Kindlein zu mir kommen“ und sie herzte und küßte, war jene Kinderliebe allerorts in vollster Blüte, und das Evangelium hat dafür einen edelsten, reinsten Ausdruck gefunden.
Wie nun der griechische Geist diese Kinder bildete? Er war alt geworden, dieser Geist, aber von gereiftestem Schönheitssinn, und hat tändelnd eine Fülle ewiger Grazie über diese Gebilde ergossen. Es sind Kinder der Liebe, und sie sind mit dem Auge der Liebe gesehen.
Sei es noch einmal wiederholt: es ist für die Amoretten wesentlich, außer dem Kindesalter, daß sie gern viele sind und daß sie auch bloß unter sich ihr Spiel treiben, also selbst eine Szene bilden. Dieses beides wird sich uns eben aus dem ersten und grundlegenden, der kindlichen Natur selbst erklären. Wenn aber im Verfolg von Kindern die Rede ist, so ist dabei ausschließlich an das Alter gedacht bis höchstens zum sechsten Lebensjahr, an das Alter der Putten.
Der alexandrinische Zeitgeist, den wir nach der geistigen Hauptstadt des griechischen Ostens so benennen, der Umbildner der menschlichen Gesellschaft, hat sich zunächst in den drei letzten Jahrhunderten vor Christi Geburt dargestellt. Doch sind die vielen Bücher, die damals geschrieben wurden, leider bis auf einen ärmlichen Rest gründlich vernichtet. Vornehmlich nur aus seinen Nachwirkungen erkennen wir den alexandrinischen Geist; er tritt erst bei den Römern seit der Zeit Ciceros in das helle Licht der Geschichte. Denn römisches Leben ist fortan hellenistisches Leben. Wir sind befugt und gehalten, aus der wundersamen Kinderliebe der augusteischen Zeiten auf die gleich ausgebildete Liebhaberei in den Modellen der nächsten Vorzeit zurückzuschließen.
Die Kinderliebe konnte so auf eigene, wie auf fremde Kinder gerichtet sein. Auch blasierte Mütter gibt es und gab es genug, die ihre Kleinen an andere zur Erziehung geben und sie sich nur als Spielzeug in leeren Augenblicken auf den Arm[S. 141] reichen lassen aus flüchtiger Lachlust und halber Neugierde; dies tadelt der ehrenfeste Plutarch. Den gefallsüchtigen Hausfreund sehen wir schon beim Theophrast, wie er den Gastgeber nach seinen Kleinen fragt, sie fabelhaft ähnlich findet, sie küßt, mit ihnen betulich ist, ihr Ruf- und Laufspiel eifrig mitspielt und sie auf seinem Schoß schlafen läßt. Von hier aus ist bis zum Kindersport noch ein guter Schritt; aber er wurde eben damals getan[213].
Zunächst ist ohne Frage schon folgende Gepflogenheit von großem Einfluß gewesen. Es war die Sitte reicher Familien, für den kleinen Sohn des Hauses eine Schar von Sklavenkindern gleichen Alters als Gespielen zu halten, die zum Apparat der ersten Erziehung ebenso gehören wie die „Amme“. Dies sind die öfters zu nennenden „Gespielen“ oder conlusores. Der kleine Sohn speist dann natürlich mit bei Tisch, die Gespielen umlungern die Tafel, gern geduldet, und lassen sich Naschsachen zustecken. Wir sehen solche Szene im Garten des Septimius Severus, als er noch nicht Kaiser war[214]. Schon dies kann uns das Bild der spielenden Puttenschwärme geben, wie wir sie in der Kunst zusehen gewohnt sind.
Aber nicht dies ist, was ich als Sport bezeichnete. Man hielt sich überhaupt Kinder zur Ergötzung, womöglich viele. Ohne diese großmächtige und uns Modernen so völlig fremdartige Art des Kinderluxus scheint das Leben der Vornehmen Roms kaum zu denken. Ganz dasselbe soll heute noch bei den reichen Türken im Gebrauch sein. Vorzüglich Frauen, heißt es, waren die Liebhaber dieses Menschenspielzeugs, doch auch zärtlich besaitete Männerseelen. Wir begegnen solchen lebendigen Putten nicht nur im Kaiserhause, sondern auch bei vielen wohlhabenden Privatleuten, endlich sogar zu öffentlichen Zwecken verwendet. Ihr lateinischer Name ist deliciae. Sie sind es vorzüglich, die die Kunst als Amoretten nachahmend in ihrem Spiegel auffing, als Spielkinder der Venus in ihre Sprache übersetzte[215].
Kaiser Augustus ist uns zunächst ein klassisches Beispiel.[S. 142] Ein einsamer Mann auf dem Thron, war er kinderlieb wie wenige. Seine zarten Enkel Gajus und Lucius kaufte er dem Agrippa ab und wollte nie ohne sie sein, hatte sie bei Tisch auf seinem Lager, ließ sie auf Reisen vor sich auffahren. Ein allerliebstes Kind der Verwandtschaft stellte er, als es starb, als Amorette in seinem Zimmer auf und küßte das Bild, so oft er es erblickte. Derselbe Augustus pflegte aber auch in seinem Palast mit kleinen Kindern zu spielen, die er „von allen Seiten sich kaufte“; er spielte mit ihnen Astragalen oder das Knöchelspiel, Nüssewerfen u. a. Sein Lieblingsputto hieß Sarmentus; Sarmentus war um ihn bei den Gastgelagen und bekam vom schweren besten Falerner zu trinken.
Und schon bei der Hochzeit des Kaisers im Jahre 38 v. Chr. hatten diese Kinder eine Rolle gespielt. Sie fand im Hause des Claudius Nero statt, der hier selbst seine Gattin Livia an Octavian verheiratete. Die Sache war anstößig. Beim Festmahl lag nun Octavian mit Livia auf dem Speiselager vereint, jener Claudius alleine. Die deliciae aber waren im Saal, und eines davon stellte sich tadelnd vor Livia und sagte vorlaut die peinlichen Worte: „Herrin, was tust du dort? Dein Mann liegt ja drüben,“ und wies auf ihn.
Auch war Octavian in seiner Liebhaberei nicht ohne Anleitung. Sein Jugendlehrer war der stoische Philosoph Athenodorus von Tarsus gewesen, der ihn auch weiterhin in Rom beeinflußte. Derselbe soll auch des Tiberius Erzieher gewesen sein. Er verfaßte eine Schrift „über ernsthafte und heitere Lebensführung“ und empfahl darin den Gebrauch der Delicien durch Beibringung von Belegen aus früherer Zeit. War es doch beliebt bei den Stoikern, vom Sokrates zu erzählen, wie es ihm Freude war, mit solchen Kleinen zu spielen; denn es zieme sich, in schuldlosem Scherz sich zu erholen[216]. Selbst Herkules, im Drama des Euripides, so führte man an, habe ein Kindlein auf dem Arm geherzt und die Worte gesprochen:
Athenodorus aber berief sich vor allem noch auf Archytas von[S. 143] Tarent, den Philosophen und Staatsmann der Platonischen Zeit, der bei aller Größe des Geistes doch an den kleinen Kindern seiner zahlreichen Sklavenschaft im Spiel hingebend sich erfreute; am meisten Spaß aber hatte er an ihnen beim Trinkgelage. Man denke hier an den Sarmentus des Augustus. Und endlich erzählte man in gleichem Zusammenhang von Massinissa, dem Numidierkönig aus der Zeit des Hannibalkrieges, der unter anderem die sämtlichen Kinder seiner Söhne (und es waren viele Söhne!) und seiner Töchter bei sich aufzog; wenn sie aber drei Jahre alt waren, ersetzte er sie durch neue. So berichtete von ihm Ptolemäus Euergetes, der König Ägyptens[218]. Hierbei denke man an die Enkel Gajus und Lucius, die Augustus zu sich nahm.
So hatte die stoische Weltlehre, die da gleiche Menschenwürde und Menschenliebe predigte, auch die Kinderliebe in ihr Programm aufgenommen. Sie näherte sich darin dem Sinne der Bergpredigt. Die häßlichen Auswüchse der so entstehenden Sitte konnte sie freilich nicht mit verantworten. Ein einsamerer Kaiser noch war Tiberius. Auch sein düster märchenhaftes Asyl auf Capri bevölkerten jene unschuldigen Scharen; die Phantasie seiner Verleumder aber umgab die Kunde hiervon mit Gerüchten von allerlei Schändlichkeit.
Im Hause Domitians treffen wir sie wieder. Die Unschuld wurde hier Ursache an dem Tode des Schuldigen. Domitian schlief und hatte ein Verzeichnis derer, die er dem Tode bestimmte, unter dem Kopfkissen; die Kleinen waren im Zimmer. Eines zog neugierig die Schreibtafel hervor und hielt sie nichtsahnend in seinen Händchen, als Domitia herzukam, die Namen las und die Ermordung des Kaisers beschloß und einleitete.
Eine sehr ähnliche Szene kehrt unter Kaiser Commodus wieder; vor allem sind die Verhältnisse immer die gleichen. Ein Kind pflegt das bevorzugte, das dreisteste, der Favorit zu sein und wird durch Eigennamen ausgezeichnet, den nun die Weltgeschichte überliefert.
[S. 144]
Das Kaiserhaus machte aber durchaus nur die Mode der Zeiten mit. Zahlreich sind sonstige Belege, wie sie der Zufall bietet. Grabsteine solcher deliciae sind ausgegraben. Die Schriftsteller selbst, vornehmlich die Vertreter der epigrammatischen Dichtung, ließen sich herbei, sie in zärtlichem Scherz zu schildern oder rührsame Grabesaufschriften zu geben für solch einen kleinen Verstorbenen: „Kalläschros ist gestorben, der kleine Fant, um nun ein Spielzeug zu sein im Haushalt der Proserpina.“ Ein Zweijähriges fiel von der Leiter; der Herr lief herzu; „da streckte es nur noch einmal die zarten Händchen und verschied.“ Oder der Dichter an seine verstorbenen Eltern: „Mein kleines Erotion, das so zum Küssen ist, kaum sechs Jahre alt, kommt schon zu euch in den Orkus; sorgt doch, daß es vor dem Höllenhund sich nicht erschrecke; und so spiele es denn nun mit euch alten Herrschaften und schwatze von mir. Die Erde aber möge ihm leicht sein; denn es ist selber ihr nie schwer gewesen“ (Martial). Zu diesen Spielzeugen gehörte auch der Camerius des Catull (carm. 55) in Ciceros Zeit, zu ihnen auch die Bissula des späten Ausonius, jene Bissula, der die moderne Romanliteratur zu einer kurzen Auferstehung hat verhelfen wollen. Auch Bissula war Putte (pupa), im deutschen Kriege erbeutet; sie war in einer Schar derselben die kleine Favoritin (dominatur in deliciis).
In diesem Zusammenhang erklärt sich auch Folgendes. Wie Abraham den Lot befreite, da heißt es im Bibeltext einfach: „und schlug sie (die Feinde) und jagte sie .. und brachte alle Habe wieder, dazu auch Lot, seinen Bruder, mit seiner Habe, auch die Weiber und das Volk.“ Der Dichter Prudentius, um das Jahr 400 n. Chr., hält sich verpflichtet, dies auszumalen und zählt nun als Bestandteil jener „Beute“ neben Gefäßen, Pferden und Halsschmuck auch „die Kleinen“ auf, in deutlichem Hinblick auf die deliciae, die eben in der Habe des Reichen damals nicht fehlen[219].

Es ist nicht zu verwundern, daß man in der großartig brutalen Phantastik römischer öffentlicher Feste auch den Zauber[S. 145] des Anblicks dieser Kinder gelegentlich zu verwerten wußte. Man ließ sie wirken durch den Kontrast. In der Arena sollten Löwen auftreten; die Kinder erschienen zuvor, für die Bestien frischen Sand zu streuen und mit dem Rechen zu ebnen. Ein gräßlicher Anblick folgte; ein Löwe ergriff und zerriß etliche. Martial beweint dies und preist die Wölfin, die einst den Romulus und Remus verschonte. So sehr war das Leben der Zeit an diese Niedlichkeiten gewöhnt, daß sie das Volk als Verzierung der Tierhetze in der Arena zu sehen begehrte[220].
Mit Teilnahme und nicht ohne Lächeln sehen wir jene Vornehmen Roms, geschmackvolle Müßiggänger, übersättigt, lebensklug und immer noch Leute großen Stils, sich verlieren in das kindische Getriebe, an seiner jungen, Funken sprühenden Wärme die kühl gewordene Seele beleben. Man schaute zu, wie possierlich sie sich tollten, ließ sie auf sich herumklettern (es sei erinnert an die Statue des Nil), ließ sich von ihnen den Kopf krauen, spielte das Nüssespiel mit ihnen, ließ sie sich verstecken und haschte sie, voller Zärtlichkeit und Wohlgefallen an der Hübschheit des kleinen Körpers, vor allem an dem unablässigen süßen Geschwätz. Es gefiel vornehmlich das zwitschernde Plaudern, das dummkluge Fragen, die drolligen Wahrheiten aus Kindermund[221] und die kleinen ahnungslosen Unanständigkeiten. Tadelnd sagt Seneca: „Man kauft die Kinder um ihrer kecken Reden willen und sucht sie darin noch zu steigern.“ Anschauung kann vor allem das folgende Gedicht des großen Liebesdichters Catull gewähren[222], auf das kleine Bübchen Camerius, der entwischt ist, unter Rosen im Korbe der Blumenmädchen sich versteckt und nicht reden und nicht zu seinem Herrn zurück will:
Die Kleinheit des Kindes ist hier scherzhaft übertrieben. Es ist die Komik der Liliputgeschichten, die bei den Alten aus diesem Anlaß typisch war[223].
Eines aber fällt noch besonders auf: Camerius heißt „nackt“. Zum Wesen des Putto gehörte das Unbekleidetsein; so urteilte nicht nur die Kunst, deren Zweck es war, den Kinderkörper selbst naturwahr zu behandeln, sondern auch das Leben. Wir erfahren durch ausdrückliches Zeugnis: jene Delicien liefen in den Häusern stets nackt herum; es war dies so sehr bezeichnend für sie, daß sie von den Schriftstellern technisch einfach als „die Nackten“ eingeführt werden[224]. Der Anblick verletzte kein Schamgefühl; die Schuldlosigkeit der unverhüllten Natur im Kinde ist paradiesisch und hat etwas Heiliges. Darum haben eben die großen Meister das Christuskind nur nackt bilden wollen, und auch heute ist der sonst so wenig klassische Zeitgeschmack dem zugeneigt: wie gerne lassen unsere zärtlichen Mütter ihr liebes Jüngstes in süßer Blöße im Körbchen hockend photographieren!
[S. 147]
So hat denn auch die antike Plastik diese flügellosen Putten nach dem Leben wiederholt dargestellt. Unsere Gelehrten sollten nur aufhören, diese Figuren „flügellose Eroten“ zu nennen, da es einfacher und das Zutreffende ist, vielmehr die Eroten als geflügelte Kinder zu bezeichnen. Vielfach sind es Einzelstatuetten[225], wo das Kind bald nur dasteht, bald Nüsse oder Astragalen spielt (so auch ein Bildwerk des Berliner Museums), bald in die Fußfessel geschlagen trauert; zweie, die sich balgen und in sich verbeißen, in entzückender Wahrheit (Statuette in Vienne). Ein Relief im Garten der Villa Pamfili zeigt bei einem Trinkgelage sechs nackte Kinderchen als Spielzeug der Zechgenossen. So liebte sie Archytas von Tarent. Dazu die hübschen Kinder als Brunnenfiguren, ein häufiger Schmuck antiker Atrien (in Rom), einen Vogel oder Delphinkopf haltend[226].
Auch das pompejanische „Bad eines Knaben“, an dem nur Frauen beteiligt, ist es wohl müßig als mythische Szene aufzufassen[227].
Die Kinderkörper sind hier wie sonst mit vollkommener Kenntnis behandelt: die Gliedmaßen kurz, das Fleisch weich gedunsen, die mondrunden Köpfchen mit echtesten Pausbacken und vollem Kinn, die Nase noch schüchtern klein und charakterlos, so auch das Mündchen. Über der Stirn meist der kokette Haarknoten, ein putziger kleiner Verwandter des Haarknotens Apolls. Berühmt ist vor allem des Boethos Knabe mit der Gans, eine Kampfszene und Parodie auf den siegreich ringenden Herkules: der kleine Held kaum höher als das Tier; Energie und Vergnügen im hellen Gesicht; die weichen Glieder in mannhafter Anspannung, ein allerliebster Kontrast; der Oberkörper heftig zurückgebeugt, das kleine Beinwerk wie Säulen fest aufgestemmt. Mit den Pätschchen umschlingt er, ihn an sich drückend, den Hals des zischenden Vogels[228].
Dies Meisterwerk führt uns hinauf bis mindestens in das zweite Jahrhundert v. Chr. Das dritte Jahrhundert aber scheint die Zeit der Erfindung der Amoretten gewesen zu sein[229].
[S. 148]
Wir sahen: von Phidias bis zu Lysipp hinab bildete man Amor noch nicht als Putte. Zuvor mußte die Kunst sich am Kinde selbst versucht haben, und die Hochgewachsene, nach oben Schauende bückte sich gleichsam mühsam danach. Polyklets nackte spielende Knaben sind auffallend früh; der Künstler der Niobiden vermied noch, ein wirkliches Kind einzuführen. Der kleine Bacchus im Arm des olympischen Hermes beweist, wie wenig Auffassung und Übung für solchen Gegenstand vorhanden war, und so erregt der Plutos des Kephisodot im Arm des „Friedens“ auch in seiner neu aufgefundenen Gestalt[230] unerwünschte stilistische Bedenken. Die Grabstelen Athens zeigen dann Fortschritte, die Beispiele mehren sich langsam; zur Zeit Alexanders des Großen, an der Schwelle der sentimentalischen Zeiten, war es der Maler Pausias, der auf das Genre, und zwar unter anderem das massenhafte Malen von Knaben (pueri) in kleinen Formaten sich beschränkte; daß hierunter vorwiegend eigentliche Putten zu verstehen sind, wird nicht gezweifelt[231]. Aber an Beflügelung dachte er so wenig wie Boethos bei seinem Gänsebuben.
Treten wir von hier über das Jahr 300 in das Idyll der alexandrinischen Zeiten ein, so sehen wir zuerst und auf einmal die Eroten, jetzt winzig und in Scharen, durch Baumkronen flattern, in Zweigen sich wiegen „wie Nachtigallen“, „mit rosigen Äpfeln vergleichbar“; so Theokrit. Die wirklichen Amoretten sind plötzlich da[232], dieselbigen, die die Wandgemälde Pompejis bevölkern, die über die steinernen Sarkophage Jahrhunderte lang ihr munteres Leben ergießen, die aber auch im kleinen und kleinsten den Metallrand des Handspiegels zierten oder als Ohrgehänge das schöne Oval antiker Frauen einfaßten.
Eroten, Amoren, so benannte sie fast einstimmig die alte Literatur. Wie war dies gedacht? Wir finden oft 7, 10, 12 oder 15 vereint. Sollte Frau Venus so fleißig geboren haben, trotz unvergänglichster Jugendschöne? Aber diese Kinder sind überall deutlich gleichaltrig. Sollte dies ein einziges wunderbares[S. 149] Wochenbett der Himmlischen gewesen sein? Schwerlich plagte sich die Phantasie sogleich mit derlei dogmatischen Fragen. Spätere aber geben uns Auskunft: es sind Söhnlein vieler Mütter; nur einer heißt Sohn der Schaumgeborenen selber; die übrigen sind Nymphenkinder und sind bloß seine Gespielen[233]. Jeder erkennt: hier ist das Institut der Gespielen, der conlusores, die der Reiche für sein Söhnchen sich hält, ganz einfach in die Fabel übertragen; und so wie beispielsweise Severus seinen Fünfjährigen mit einem Schwarm von Gleichaltrigen umgab; so will auch Venus ihren Amor nicht allein wissen im Eden von Paphos; von den dienenden Nymphen nimmt sie die Kinder als conlusores. Die Kunst in ihrem schimmernden Bilde illustriert uns auch hier das tägliche Leben.
Noch mehr aber muß der Gebrauch der deliciae oder der kleinen Spielkinder diese Erfindung beeinflußt haben. Die bildende Kunst der Alten idealisiert gern; sie liebt es, das wirkliche Leben in göttlicher Verkleidung vorzuführen. So wie sie nicht Gastgelage von Griechen oder Römern, sondern von Satyrn, Panisken und Nymphen zu schildern pflegt, in denen dann aber doch das Herkommen der Wirklichkeit waltet, so beruhigte sie sich nicht bei den Kindern des Pausias und schuf ein überwirkliches Kinderleben nach dem Bilde der Wirklichkeit. Wir werden gleich hören, wie die deliciae auch im wirklichen Leben zu theatralischer Wirkung als Liebesgötter aufgeputzt worden sind. Dies wird uns nur wie zufällig mitgeteilt; es kann weit öfter geschehen sein.
Wir fragen zunächst, wo der Typus der uns geläufigen Liebesgötter ausgebildet worden ist. Alexandria war die große Lehrstätte des hellenistischen Luxus. Die pompejanischen Wandmalereien sind in überzeugender Weise zu großen Teilen auf alexandrinische Vorlagen zurückgeführt worden. Schon hierdurch sind wir hauptsächlich an Alexandrias Dichter und Künstler gewiesen. Daß dabei diese Künstler von anderer Seite schon Anregung empfingen, braucht nicht ausgeschlossen zu sein; die Amoretten von Tanagra weisen auf Einfluß attischer Kunst.[S. 150] Daß eine eigentümliche Plastik in Alexandria bestand, ist insbesondere von Th. Schreiber dargetan worden. Dazu stimmt nun aber auf das trefflichste, daß eben diese Stadt auch im Leben als ein Hauptplatz für den Gebrauch der deliciae sich erweisen läßt. Denn schlechthin „alexandrinisch“ nennt Quintilian jene nackten Kinder. Vom Nil, sagte auch Statius, pflegte man sich die kleinen Plauderer zu kaufen[234]; dazu kommt als leibhaftiger Zeuge die letzte alexandrinische Königin Kleopatra, die mit einem Schwarm von ihnen sich umgab, als sie auf goldenem Schiffe märchenhaft blendend dem Antonius entgegenfuhr, sie selbst als Venus, die Kleinen als Amoretten angetan. Und wenn sie von ihnen sich „fächeln“ ließ, so fallen uns Wandbilder Pompejis ein, wo die Amorette an eine sitzende schöne Frau sich lehnt, einen blattförmigen Fächer in der Rechten. Ohne Frage alexandrinisch ist auch die herrliche Statue des Nil zu Rom; der Flußgott mit mächtigem Leibe, gemächlich aufgestützt daliegend; 16 Putten, ungeflügelt, hocken und klettern ohne Scheu um ihn und über ihn; sie können nur für den Nil erdacht, nur am Nil geboren sein. Eine eigenste Erfindung ägyptisch-griechischen Geistes aber endlich ist die Figur des Gottkindes Harpokrates, eine Erscheinungsform des Horos, auch dies ein nackter Putto mit dem Haarknoten (Zeuge ist schon Catull, carm. 72); die Hand hält er als Zeichen des Schweigens zum Munde; eben diese Gebärde selbst gewiß eine alexandrinische Erfindung, erdacht, um den Gott auszuscheiden aus der Alltäglichkeit; den ägyptischen Kindern wurde ja, wie gezeigt, nichts so nachgesagt wie die Schwatzhaftigkeit. Daher heißt nunmehr auch Amor „der immer schwatzende“; auch er ist jetzt als Alexandriner naturalisiert[235].
Der starke Fittich des älteren, stürmischen Amor ist abgeschafft und vergessen. Die Kinder schaukeln sich auf dem stumpfen und gleichsam unentwickelten Flügel des jungen Vogels, des Singvogels. Auch diese Art der Beflügelung zu ersinnen, lag nicht fern. Der Gedanke scheint zwar künstlich; aber schon[S. 151] die Proportion empfahl ihn, und er beruhte zudem auf durchaus volkstümlicher Denkweise.
Kinder sind „Küchlein“; schon Äschylus hatte sie einst liebkosend so genannt; dies blieb seitdem beliebt in der griechischen Dichtung[236]. Wie man heute sein Nesthäkchen hat oder eine schlimme Mutter Rabenmutter schilt, so dachten die Alten noch ständiger die Kinder als junge Vogelbrut. Folgerichtigkeit ist die Tugend der antiken Phantasien. Vom „Kindernest“ redete darum schlechtweg die Komödie; im Nest hat Horaz sich als kleiner Junge dereinst die Flügel wachsen lassen; Tauben haben ihn, den Säugling, gehegt. Singen oder Zwitschern (pipiare) nannte man das Plappern der kleinen Bälge. Der Glücksmensch gilt sprichwörtlich als Sohn der weißen Henne, die Mehrzahl von uns aber sind gemeine Küchlein, aus Unglückseiern gebrütet. So konnte denn das uns so fremdartige Märchen entstehen von der Geburt der Kastoren aus dem Ei der Leda; wie in der Theogonie Eros selbst, der Weltgeist, aus dem Weltenei sollte geboren sein[237]. Auch wir nennen wohl heute ein niedliches blankes Kind wie aus dem Ei gepellt (Fr. Reuter). Und hiernach sehe man nun jenen, von manchen so seltsam gefundenen Marmorbaum im Museum des Vatikan mit den Nestern darauf, voll von ungeflügelten Kinderchen; man sieht, es war dies ein durchaus volkstümliches Genremotiv, und das Monument ist von höchstem Werte für uns als bezeichnendster Beleg dieser Denkweise. Genial aber war es, an dies Volkstümliche anzuknüpfen und die Kinder, die man im Leben wie die Küchlein um sich sammelte, nun selbst als junge Flieger, als Tummler in den Lüften darzustellen[238]. Zu der Erfindung der Amoretten hat sicherlich diese Anschauungsweise in erster Linie die Anregung gegeben. Die beschwingte Putte, das Kind als Vogel, kaum erdacht, fiel dann von selbst mit dem altgewohnten Eros zusammen. Auch blieb man sich seiner Vogelnatur bewußt; vom Vogel Amor reden wiederholt die Dichter. „Nachtigallen gleich“ nannte die Eroten Theokrit. Gleichwohl — und dies scheint sehr beachtenswert[S. 152] — sind diejenigen Darstellungen bei weitem die häufigsten, wo die Amoretten von ihrer Vogelnatur keinen wirklichen Gebrauch machen, sondern wie rechte Kinder nur laufen, stehen, dasitzen und mit aufgesetzter Sohle der Erdenschwere gehorchen.
Aus der kindlichen Natur erklärt sich aber nun weiter auch die Vielheit der Amoretten und die Art ihrer Beschäftigung. Spielen ist des Kindes Beruf, und ohne Beruf kein Leben. Es kann ihm ganz für sich allein obliegen, so stundenlang; da summt es und schwätzt es vor sich hin und personifiziert jeden Gegenstand, den es anfaßt. Dramatisch aber wird die Sache sogleich, wo etliche Kleine zusammenspielen. Allein schon, wie sie schön tun und sich lieb haben. Und das Spielgenie steigert sich hier. Was die noch tief träumenden Seelen beschäftigt, tritt jetzt aus ihnen als Handlung heraus; das Innenleben wird Außenleben. Dies Leben, dies Drama war, was der Darsteller brauchte. Daher griff er so gern zur Vielheit von Amoretten, daher ließ er die vielen so gern unter sich beschäftigt sein.
Wir werden uns also nicht mehr verwundern, daß die sogenannten Liebesgötter so oft von den Dingen der Liebe absehen. Auf den pompejanischen Wandbildern des älteren („dritten“) Stils ist dies noch seltener der Fall; hier nehmen sie dem Herkules bei der Omphale die Waffen weg und ähnliches; in der großen Masse der Bilder indes und auf den Sarkophagen sind sie in Handlungen begriffen, die sie scheinbar nichts angehen; sie ahmen sogar Berufshandlungen Erwachsener nach, halten Olivenernte usf. Ist hier die Bedeutung der „Liebesgötter“ verblaßt? oder sollen wir sie vielmehr für Genien nehmen, für Kindergenien, die jene Berufshandlungen in den Bereich göttlicher Heiterkeit hinaufziehen und also sie weihen und verherrlichen? Den Begriff „Genius“ indes kannte ja das Altertum selbst gut genug; aber es hat keinen Genius je als Kind gebildet. Wohl aber hat es den Alten freigestanden, die Flügelknaben, die die Kunst bildete, auch einmal nicht für Eroten anzusehen; zwei derselben umgeben Venus[S. 153] auf Julischen Münzen; Horaz spricht den einen in seinen Liedern als Cupido, den anderen aber als Jocus an, und Lucian braucht einmal für sie sogar den Namen Epainoi, d. h. Personifikationen des Lobes, welche die Göttin der Redekunst umflattern[239]. Er sagt ausdrücklich, sie ähneln den Eroten, aber es sind keine. Auch der antike Ausdruck Genius paßt hier nicht. Wir nennen sie „Personifikationen“, und als solche waren also die Flügelkinder beliebig verwendbar[240]. Bezeichnend aber ist noch, daß Lucian zugleich auch noch auf die sechzehn flügellosen Putten vergleichend hinweist, die die Statue des Nil umspielen. Dies sind deutlich deliciae, aber sie sind auch hier zur Personifikation verwendet; sie bedeuten die 16 „Ellen“, um die der Nil bei seinen Überschwemmungen zu steigen pflegt.
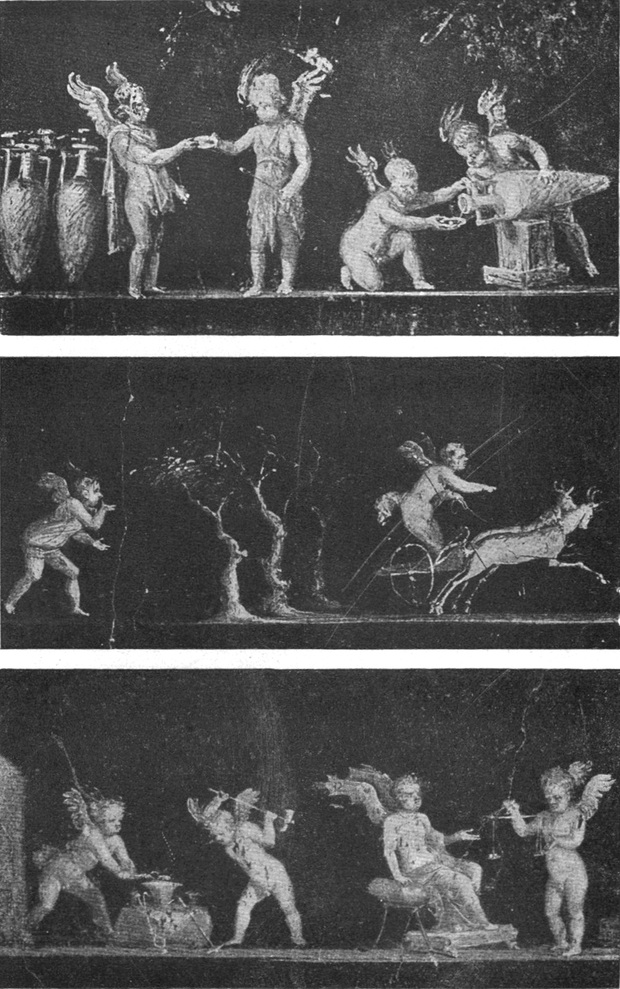
Die Amoretten an den Wänden der vornehmen Häuser waren nichts als das verklärte Spiegelbild jener deliciae und conlusores, die in den Atrien und Marmorsälen sich umtrieben. Nur so sind sie entstanden; daher denn der Künstler gelegentlich, wo es ihm bequem war, unbedenklich ungeflügelte Putten unter die geflügelten reihte[241]. Sie sind, wo sie unter sich sind, nur gelegentlich in den Dienst der Liebessymbolik gestellt worden[242]. Nur aus der Kenntnis der deliciae erklärt sich das behandelte Problem, und man hüte sich, in jenen Schildereien weiteren tieferen Sinn zu suchen, es sei denn, soweit er überhaupt oft im kindischen Spiele liegt. Die Amorettendarstellungen erschließen uns eben jene Kinderwelt. Kinder spielen das Menschenleben; sie ahmen traumhaft im Kleinen nach, was sie im Großen um sich sehen und noch nicht begreifen. Gewiß waren darin jene nackten Delicien besonders erfindungsreich oder wurden besonders dazu angehalten. Der affenartige Nachahmungstrieb des Kindes gab Anlaß zu jenen allerliebsten Erfindungen, worin das Flügelkind lachend verrichtet, was dem Menschen in Sorge und Arbeit und im Kampf um das Dasein auferlegt ist. Es sind idealisierte Spielkinder mit idealisierten Kinderspielen.
[S. 154]
Die Kunst selbst ist aber nichts als eine Offenbarung des Spieltriebes; und die Spiele der Kinder selbst sind schon Kunst oder spielende Nachahmung des Lebens. Dies ist der tiefbestrickende doppelte Reiz all solcher Puttendarstellungen: die Phantasie des Malers spielt hier mit dem Spiel des Kindes; die Nachahmung ahmt die Nachahmung nach; die bewußte Kunst übt sich an der unbewußten mit Entzücken und Wohlgefallen.
Zunächst Einfacheres. Wer wird zweifeln, daß die sich den Dorn ausziehende Amorette bloße Nachbildung ist des berühmten Dornausziehers? daß die Einzel-Amoren, die mit der Gans oder dem Schwane kämpfen oder sich schleppen, des Boethos Knaben mit der Gans voraussetzen? Tanagräische Terrakotten, schon etwa des dritten Jahrhunderts v. Chr., schwebende Eroten, halten einfaches Kinderspielzeug. Kinder, kleine Vögel zärtlich haltend, sind häufig; man gab ihnen beiläufig vielmals Flügel. Auch erscheinen oftmals in Terrakotten die nämlichen Figuren bald geflügelt, bald nicht[243]. Delphine lieben Kinder schwärmerisch[244]; wie einladend war es, Amoretten an ihre Stelle zu setzen! Der Delphin war ja selbst der Liebling der Venus des Meeres! Ein unartiges Spielkind, das etwa ein Gefäß zerbrach, wird zur Strafe in Fußfesseln geschlagen und weint[245]; wie verwendbar auch dies für den bösen Buben Amor, der so viele Herzen zerbricht! So ist es ferner nach dem Leben, wenn der kleine Gott Amor durchgeht und mit Sorge gesucht und mit Not gefunden wird; man denke an Catulls Camerius. Nach dem Leben ist es, wenn er mit Ganymed, der jetzt auch Putte geworden[246], Astragalen spielt; nach dem Leben, wenn Eroten auf der Schaukel sich vergnügen, ihrer Flügel uneingedenk. Und so fort.
Nicht anders aber das sinnvollere Kindergetriebe, die eigentlichen Imitationsspiele der Kinderwelt. Wir lesen: die Söhnchen des Vornehmen in der Rüstkammer ihres Vaters kriechen einher zwischen Schilden und Harnisch[247]; können sie dann laufen, so spielen sie Soldat[248]; nichts ist daher beliebter als Eroten unter Waffenstücken oder die Siegestrophäe tragend.[S. 155] Und weiter: Kinder spielen Pferd und Wagen; so auch die Eroten. Kinder spielen „Königsein“, Gerichtsszenen, Athletenkampf; nach dieser Analogie sehen wir Eroten auf der Palästra im Faust- und Ringkampfe[249]. Kinder spielen Trinkgelage und imitieren die Trunkenheit; eben dies tun typisch die Eroten. Zur Erklärung erinnere man sich noch, wie man zu den Symposien Erwachsener die Delicien zuzog, sie vom Falerner trinken ließ und sich gewiß auch nur zu oft an ihrem Rausche ergötzte. Wohl manch geistig angeregterer Junge spielt heute Gottesdienst und hält Predigt vom Stuhl herunter (wie dies Schiller getan); von Ambrosius, von Athanasius wissen wir, daß sie schon als Kinder den Bischof nachäfften[250]; so imitieren die antiken Kinder auch heidnische Opferhandlungen; ebenso tun dies die Eroten.
Es ist nun selbstverständlich, daß die Putten in jenen Bildern die Imitation der Vorgänge des Lebens viel vollkommener ausführen, als dies meist Kinder in Wirklichkeit vermögen. Dies ist das Recht der echten Kunst; je getreuer der erwachsene Beschauer sich in der Kinderseele wiederfindet, je tiefer faßt ihn die Bezauberung, je inniger ist sein Lächeln, je gelungener ist die Kunstwirkung. Ebenso aber war es ihr Recht, die Idee, daß das Kinderspiel das Leben nachahmt, frei fortzusetzen und durchzuführen und auch auf Handlungen auszudehnen, die dem Kinde in Wirklichkeit überhaupt nicht möglich sind.
Da sind zwei Flügelkinder als Landleute geschäftsmäßig beim Ziegenmelken; wieder zwei beim Traubenpflücken, mit angesetzter Leiter. Hier angeln sie. Hier liegt ein großes Brett über Holzblöcken; zwei kleine Heinzelmännchen durchsägen es mit großer Säge; ein Hammer liegt daneben.
Die Weinpresse ist aufgestellt: Amoretten stehen als Arbeiter am Werk und steigern den Druck der Maschine mit Hammerschlag; der rote Most fließt ab, und ein beschwingter Kollege rührt ihn im Kessel um, den er auf einen kleinen Ofen gestellt hat. — Ein Schusterladen: fertige Ware auf Börtern im offenen Schrank und sonst frei aufgestellt, den Käufer zu[S. 156] locken; die Inhaber sitzen am Kindertischchen, zwei Amoretten, der eine das Händchen wie prüfend im Schuh, der andere daran mit dem Leisten tätig. — Oder die Ölbereitung: ein Flügelkind sammelt unter dem Ölbaum von der Erde die Früchte im Korb; ein anderes steht bis ans Knie im Kasten voll Oliven und tritt den Saft aus; ein weiteres schleppt neue Last herzu; wieder eines dreht die Ölmühle. — Und das Kränzewinden: viere sitzen so recht seelenvergnügt um den Tisch auf Bänken verteilt; man sieht, wie sie plaudern. Die Tischplatte ist voll geschnittener Blumen; ein Gestell wie ein Laubgitterdach darüber; von ihm hangen über den Tisch herab bald ein Dutzend Girlanden, unfertige; die fleißigen Putten halten das Ende, um sie zu verlängern. Links holt ein Flügelkind aus dem Korb neue Blumen; rechts wird ein anderes abgeschickt, die fertigen Gewinde zum Verkauf zu tragen.
Vor allem berühmt geworden sind neuerdings die Bilder des Vettierhauses in Pompeji. Da fanden sich in einer Stube ganze Wandstreifen mit solchen Szenen, die in Photographien, in Farbendrucken alsbald in alle deutschen Häuser kamen, und auch da sehen wir acht oder neun solcher kleinen Persönchen eifrig am Werk: farbige Stoffe werden gewalkt, Feingold geschmiedet usf., ein süßer Kinderzauber. Die bunten Flügelchen stehen wie große Achselklappen auf den nackten Schultern; sie sind Dekoration; sie dienen zu nichts.

So weit das Kinderspiel in seiner Idealisierung. Wer fühlte, diese Bilder vorurteilslos betrachtend, den Antrieb zu ihrer Erfindung nicht heraus, den Spaß an puppenstubenmäßiger Verkleinerung der allzu ernsthaften Wirklichkeit? Es fällt aber noch auf, daß bisweilen einige dieser Putten nicht Vogel-, sondern Falterflügel haben. Hiermit kann weibliches Geschlecht angedeutet sein, und sie sollten also wohl den Delicien weiblichen Geschlechts entsprechen. Übrigens kann hier jedoch auf die Psychefrage von mir nicht eingegangen werden, und es mag unerörtert bleiben, in wie weit man ungeflügelte Mädchengestalten kindlichen Alters mit Recht für Psychen in Anspruch[S. 157] genommen hat; man denke an die zärtlich in Umschlingung sich küssende kapitolinische Kindergruppe.
Nur dies eine. Das Wort „Psyche“, die Seele, bedeutete zugleich auch den Falter. Etwa seit dem Anbeginn der hellenistischen Zeit stellte man die Seele selbst einfach als Falter bildlich dar. Schmetterlinge zu fangen, zu quälen, am Faden fliegen zu lassen, ist aber eine der jauchzendsten Kinderfreuden. Wie bequem ist hier wieder die Handhabe zu symbolischer Behandlung gewesen, und wie treffend und entzückend wahr ist das Symbol! Auch die Amorette spielt also fortan mit dem Schmetterling, zerrt ihn am Faden usf.: es ist die Liebe, die die Seele hascht und peinigt! — Doch finden wir z. B. auf einem griechischen, gewiß nicht späten Marmorsarge[251] festfeiernde flügellose Kinder geschildert, deren zwei (als Pendants) je einen Schmetterling sorgsam schonend am Flügel emporhalten in jauchzender Gebärde! Der Falter ist hier die Seele des Verstorbenen. Die hat hier aber im Tode gewiß nichts mehr mit erotischen Dingen zu tun. Man fasse die Kinder schlechtweg als das jenseitige Leben, in das „die Seele“ nun eingegangen oder eingefangen ist.
Die „Liebesgötter“ sind Delicien in idealischer Verwandlung. Dieser Satz kann uns nun auch noch zur richtigen Auslegung von Szenen verhelfen, die von jeher, seit sie bekannt sind, die sinnige Betrachtung an sich zogen. Goethe gab von ihnen eine dichterische Inhaltsangabe (Ekphrasis) unter dem Titel „Wer kauft Liebesgötter?“ Das Gedichtchen ist anspruchslos und soll hier nicht bekrittelt werden; aber daß es den Sinn trifft, ist zu bestreiten.
Zwei der pompejanischen Wandbilder (älteren Stiles) kommen in Betracht. Uns genüge das eine, das einer genaueren Analyse bedarf[252]. Eine halb offene Halle, säulengestützt, zeigt Fernsicht auf das Gebirge; das Haus ist vornehm. Ein Mann in Handwerkertracht, mit nackten Füßen, hat einen Vogelkasten voll Putten hereingetragen und übergibt sie, Stück für Stück, einer jungen schönen Frau, die sinnend weich aufgestützt dasteht;[S. 158] die edle Gewandung, das Diadem im vollgelockten Haar verrät uns die Herrin des Hauses. Eine Amorette, mit Kränzchen als Spielzeug in den Händen, schwebt schon flügge hoch oben zwischen den Säulen; der gedankenvolle Blick der Frau schaut aber in die Weite an ihr vorüber. Ein zweites Flügelkind steht sodann hinter der Herrin, als versteckte es sich vor dem groben bärtigen Manne: dieses Kind ist von ihr schon soeben in Besitz genommen, wie der Augenschein lehrt. Aber sie will sich an dem einen nicht genügen lassen. Der Alte hat den Deckel schon wieder vom Käfig genommen, und ein süßes Bürschchen zieht er am Fittich heraus, das altklug kokett die Beinchen wirft und die Arme spreitet, wie um möglichst vorteilhaft den allerliebsten Leib zu zeigen. Zwei weitere endlich warten noch im Gitterkasten; sie sitzen darin bequem genug ausgebreitet; das eine lugt neugierig hervor. Diese zwei aber, wohl gemerkt, haben keine Flügel, obschon Raum genug da war, sie zu zeichnen. Wenn die schöne Dame ihr Nachdenken beendet, hat sie vielleicht alle fünf gekauft.
Welche Grazie in dem Ganzen, welch schelmischer Zauber in der Verteilung und in den Verhältnissen! Auf großem Tafelbild die große Halle; links zur Seite weggerückt ein hochragendes Weib, rechts ebenso die grobgegliederte gebückte Gestalt des Mannes; als Mittelpunkt aber im Vordergrunde das eine so winzige Kind, am Flügel gefaßt, von breitem, freigelassenem Raum umgeben, mit der wichtigen Miene, als riefe es in die Welt: Seht den Wicht; da bin ich! und um mich handelt es sich hier!
So wie die Frau nachsinnend im Bilde steht, so stehen wir nachsinnend davor. Wohl hat es Reiz, die Szene rein symbolisch zu fassen; möge der Reiz uns nicht verführen. Die Beflügelung ist nicht durchgeführt; und wäre es wahr, daß, wer die Amorette kauft, sich damit im Symbol den Geliebten erwirbt oder einem bestimmten Liebeserlebnis hingibt, so wäre es höchst bedenklich, daß die Schöne sich so sichtlich nicht mit der einen begnügt! Wir würden ihr raten, doch lieber wenigstens für das nächste Halbjahr das zweite Amörchen sich aufzusparen.[S. 159] So lange hält die Flamme denn doch auch in einem südlichen Herzen vor.
Wir haben inzwischen von der Zutat des Flügels abzusehen gelernt. Die Möglichkeit, hier das Alltagsleben selber in poetischer Umgestaltung zu erkennen, steht uns auf alle Fälle offen, und so erklärt sich alles ohne Künstelei und ohne das Suchen und Versteckenspielen tiefsinniger Gedanken. Wir tun hier einen Einblick in den antiken Kinderhandel. Von ihm und seiner Anschauung kam dem ersten Erfinder die Anregung, von ihm gewiß ganz allein. Auf den großen Sklavenmärkten jener Zeiten muß der Kleinkindermarkt eine ganz regelmäßige Abteilung gebildet haben. Wie oft wurde das Motiv von verkauften Kindern schon in der Komödie des vierten Jahrhunderts verwandt! Seit die deliciae Modeartikel wurden, war die Nachfrage um so größer. Die Kunst verschmähte es, diesen Handel selbst in seiner rohen Form zu vergegenwärtigen; sie fügte zunächst auch hier nur die Flügel hinzu und entrückte das Anstößige in den phantastisch lieblichen Bereich des Märchens. An Seeplätzen waren vorzüglich jene Märkte; daher heißt es in dem Gedichte des Meleager, das vom Verkauf des Eroskindes handelt: „Wenn ein Kaufmann, der gerade in See gehen will, es zu kaufen Lust hat, so trete er heran“[253]. So über See und durch solchen Kaufmann müssen damals notwendigerweise die alexandrinischen lebenden Putten nach Rom und an die sonstigen Plätze gekommen sein.
Ein alter Hausdiener hat hier nun etliche von ihnen auf dem Markt eingekauft — ihn zeigt uns das Gemälde — und bringt sie wie die Hühner oder Tauben im käfigartigen Behälter in das Haus seiner Herrin, einer vornehmen, solchem Luxus ergebenen Dame. Ein alter Zeuge sagt ausdrücklich, Frauen waren es besonders, die sich die nackten Delicien hielten[254]. Und es sind nun nicht einer, sondern gleich mehrere, denn an ihrer „Vielheit“ freuten sich die Frauen, nach demselben Zeugen. Den Vogelkäfig hat der Künstler sinnig verwandt, weil man ja die Kinder allgemein mit jungen Vögeln verglich; gröber[S. 160] freilich war es in der Komödie des Aristophanes zugegangen, wo der Einwohner Megaras sein Töchterlein nicht im Käfig, sondern als Schweinchen im Sack auf den athenischen Markt bringt, um sie an den „Liebhaber“ loszuschlagen. Weil aber endlich der Künstler die Kinder in Eroten verkleidete, so war es dichterisch folgerichtig und künstlerische Pflicht, wenigstens einen derselben auch schwebend zu zeigen: Flügelkinder, die sämtlich nicht fliegen, scheinen zwecklos erdacht, d. h. unkünstlerisch.
Der Dichter dieser Bilder übertrug also auch hier nur die Wirklichkeit in das Märchen. Er glaubt an sein Märchen, wie jeder gute Erzähler es muß, und wird die Figürchen auf Anfrage in der üblichen Weise einfach Eroten genannt haben, die Frau aber kann nichts anderes sein als eine Figur des wirklichen Lebens, weil ja auch der bärtige Diener dies ist. Sie ist eine Dame der großen Welt. Denn der Künstler wußte, daß die Schönen des eleganten Stils es liebten, sich selbst als Göttinnen und ebenso die Spielkinder in Amoretten zu verkleiden. Für diese Tatsache haben wir vier sprechende Belege: die Königin Kleopatra, von der im Vorausgehenden (S. 150) die Rede war, weiter die parvuli, die bei Apulejus (met. 10, 32) als Amoretten im Theater auftreten; sodann die Cynthia des Dichters Properz, die diese geschwätzigen Bübchen ebenso ausgestattet über die Straße schickt, um den säumigen Geliebten zu sich zu holen[255], und endlich die Lesbia bei Catull. Catull findet sich in stummer Nacht mit seiner Lesbia zusammen; um beide Liebenden aber läuft derweil, wie er es schildert, ein kleiner Kupido hin und her im krokusgelben Hemdchen, durch das der weiße Kinderkörper hindurchleuchtet[256]. Der Bub läuft auch hier, er fliegt nicht. Seine Lesbia nennt da der Dichter „Göttin“[257], den Buben nennt er „Kupido“; der Knabe aber war so wenig Kupido selbst, wie Lesbia wirklich Göttin war[258]. So kauft sich also auch auf dem Gemälde die schöne Frau, die das Diadem einer Göttin trägt, die Kinder, die sie hinfort als Amoretten umschwirren sollen, damit sie selbst der Venus selber gleiche[259].
[S. 161]
Auf wie viele andere Bilder und Motive dieselbe Weise der Auslegung noch anzuwenden, in wie vielen Fällen die Annahme einer besonderen Liebessymbolik noch abzuweisen ist? Es ist unmöglich, dem nachzugehen und auf den weiten üppigen Beeten dieser Phantasien jede Blume zu bestimmen. Denn wie veredelte Gartenblumen verwildern und zur ersten Natur zurückkehren, je weiter sie wuchern, so ist es, als ob hier anfangs wenigere und noch deutlicher symbolische Motive angepflanzt worden seien, die dann, je massenhafter sie variiert wurden, je mehr und mehr ihre symbolisierende Füllung verloren und zur prototypen Einfachheit zurückkehrten. Doch sei in Kürze erinnert, daß die Amorette, die mit einsamen Frauen plaudert[260], deutlich Wiedergabe des Spielkindes ist, mit dem sich die Frauen zerstreuten; ebenso, wenn sie beim Putz behilflich ist[261], ebenso endlich sogar bei Liebesszenen selbst. Man denke nur an das Catullgedicht Nr. 56, wo Catull und Lesbia mit dem pupulus zu dreien sich vergnügen[262].
Wir haben zu zeigen versucht, wie die Vorstellung und Darstellung der Amoretten zustande kam. Ihre Verwertung als wirkliche Liebesgötter haben wir auf einen verhältnismäßig nicht allzu weiten Kreis eingeschränkt gefunden; dies blieb da zumeist ihre Rolle, wo sie mit Göttern und Heroen, mit erwachsenen Menschen und ihrem Schicksal und Leben in Verbindung gebracht sind. Und so gehören diese „Liebesgötter“ zum Inventar der Kunst bis heute.
Die breite Masse der Darstellungen der unter sich spielenden Amoren bedurfte dagegen einer besonderen Würdigung. Aus ihnen ist bei Späteren die Vorstellung der Kindergenien oder der Putten als symbolische Figuren abgeleitet. Rafael gibt sie, um an ein Beispiel zu erinnern, in den Stanzen des Vatikan seiner Figur der Poesie zu dienenden Begleitern und läßt sie die erklärende Aufschrift halten: „numine afflatur“. Dies gemahnt auffallend an die Gestalt der Redekunst mit den „Epainoi“ beim Lucian. Die sinnreiche Gegenwart steckt ihnen beliebige Embleme in die Hand, oder sie verwendet sie nicht einmal[S. 162] symbolisch, sondern nach Schablone als gefügige Lückenbüßer und Eckensteher, an Postgebäuden, an Öfen, auf Guldenscheinen, wo eben ein leerer Fleck nach winzigem Zierrat zu verlangen scheint. Aber schon das Altertum selbst ist in seiner Verfallszeit auch hierin vorangegangen. Auf schlechteren Sarkophagen, die in Masse erhalten sind, sehen wir ganz ebenso die Putten außerhalb der szenischen Komposition, die den Flächenschmuck ausmacht, Fruchtgirlanden haltend, Medaillon tragend, oder bloß hockend, stehend, an den Ecken, auf den Deckelkanten, das Mittelfeld durchschneidend, angebracht: ein abgegriffenes Motiv, halb sinnlos und zur Schablone geworden. Nicht einmal in der Entwertung der Flügelkinder zu Statisten der Kunst hat die Gegenwart also etwas Neues gebracht. Doch muß über die Putten als Gräberschmuck endlich noch ein weiteres Wort hinzugefügt werden.
Blicken wir zur Renaissance noch einmal hinüber.
Auch als Engel erfüllten die Geschwader jener Amoretten den katholischen Himmel der Renaissancekunst; sie musizieren dort vor der Madonna des Vivarini; sie schwimmen im Gewölke zu Füßen der himmelerhobenen Maria (Ferrari); umgeben die heilige Familie Morettos (zu Berlin) und ungezählter anderer Meister. Täuschend ist die Erinnerung an die in Bäumen flatternden Eroten in Tizians Martyrium Petri oder späterhin in Trevisonis Ruhe auf der Flucht. Nicht selten genügen Köpfchen und Flügelchen und der Körper fehlt: so auf den glasierten Terrakotten Luca della Robbias. Auch diese Putten christlicher Seligkeit, diese „Gespielen“ des Jesusknaben, stammen nicht aus dem Alten und Neuen Bunde, sie stammen von den Marmorsärgen des Heidentums[263].
Diesem sogenannten Heidentum wohnte seit dem Untergang seiner Freiheit und Jugend, seitdem es hellenistisch, seitdem es sentimental, seitdem es modern geworden war, die weltflüchtige Sehnsucht inne nach Jenseits und nach Seligkeit. Die drei Jahrhunderte vor und die drei nach Christi Geburt zeigen das in großem Zug immer heftiger werdende Wettwerben der Weltreligionen[S. 163] in der Zusicherung eines beglückten ewigen Lebens. Seligkeit ist Unschuld; im Diesseits war beides nur im Kinde zu finden. Jene deliciae waren doch nicht nur eine phantastisch üppige Verzierung des Lebens; wer sie kaufte, tat es doch nicht immer in herzloser Verachtung des ewigen Wertes des Individuums. Lasterhafter Mißbrauch der Einfalt kam vor; wer bezweifelt es? Aber es kann doch hier nicht in Betracht kommen. Schon alles Voraufgehende gibt Zeugnis und redet laut: der Zug der Zeit zum innigen Verweilen beim Kinde und zur liebreichen Idealisierung seines Treibens, er war zu groß, er ging zu sehr ins Breite, als daß er nicht auch Tiefe gehabt hätte. Der sittlich Verdorbene fand hier Unschuld, der Unwahrhaftige fand hier Wahrheit; er sah mit Staunen, wie ein Kind seine Affekte noch nicht verbergen, noch nicht fälschen kann. Wer ein Kind auflachen sieht in hellem goldigem Entzücken, der darf wohl heilig ergriffen sein von der Echtheit dieses Tones; hier ist nicht Metall und Schlacke; die ganze Seele ist ein flüssiges Gold, sie schwimmt noch in sich strahlend in ungeteiltem großem Gefühl; sie ist eine Glocke mit immer nur einem Ton; der aber ist tief und voll und rein und muß ihr Glockenmetall ganz durchbeben.
Wer wundert sich hiernach, daß Augustus den kleinen Urenkel, den er zärtlich liebte und sterben sah, als Amorette bei sich behielt und in seinem Gemach als Bild aufstellte? Das Kind war apotheosiert, verklärt, war nach christlicher Märchensprache zum Engel geworden. Auf dem Pariser Tiberius-Cameo ist das Flügelkind in der Apotheose ähnlich gedeutet worden. So verwendete man nun aber auch auf den Gräbern seiner Verstorbenen gern Putten als Gräberschmuck, und ihre Gestalten häufen und drängen sich hier je mehr und mehr.
Besonders oft begegnet da zunächst die Einzelfigur des Flügelknäbleins, das müde hingesunken friedlich auf der Grabstätte schlummert, und zwar durchgängig mit Löwenfell und Keule, den Abzeichen des Herkules. Wie seltsam und doch wie fein erdacht ist auch diese Erfindung! Das Leben des Verstorbenen[S. 164] war wohl ein Herkulesleben, voll Dienst und Arbeit gewesen; jetzt schlummert er so in Frieden wie dieses Kind, und die Waffe darf rasten neben ihm. Aber Herkules errang sich mit ihr einst das himmlische unvergängliche Leben; darum sind hier diesem Herkuleskinde die Flügel gewachsen! Die Stoa redet hier wieder zu uns: die Freude am Kinde hatte sie empfohlen, und derselben Stoa Ideal war Herkules.
Zahllos endlich auf Sarkophagen, und nicht etwa nur auf Kindersarkophagen, im Relief die vielfigurigen Kinderszenen. Sie sind im Voraufgehenden schon vielfach von mir benutzt und zugrunde gelegt. Was sollten denn, fragen wir, auf der Marmorlade, die den Leichnam barg, jene Kinder, die da bald in sinnigen Spielen, das Leben nachbildend, sich ergehen, bald im Festrausch einherziehen oder Opferhandlungen verrichten, aber immer sorglos tändelnd und immer fröhlich sind? Sie umgaben den Toten mit dem, was man als das seligste Leben im Diesseits kannte und für das Jenseits erhoffte, und verhüllten dem Leidtragenden mit der unschuldigen Wonne dieser Seligkeit den herben Anblick des grabstummen Sarges. Es war Hoffnung, Verkündigung. Und zwar genügten hierzu oft die ungeflügelten Kinder; öfter aber brechen die Vogelschwingen hervor, und das Überirdische ihres Glückes, das doch erst jenseits des Todes zum zweiten Male volle Wirklichkeit werden kann, hat hiermit in ihnen Gestalt gewonnen. Die christliche Phantasie könnte diese Gebilde wohl fast mit gleichem Recht Engel nennen wie jene auf Rafaelischen und Tizianischen Entwürfen; im Wesen aber waren sie von den antiken Amoretten nicht verschieden gedacht.
Und so ergibt sich zwischen scheinbar Getrenntestem die schöne Ahnung eines Zusammenhanges. Die Kinder, die den Himmel des klassischen Altertums als Eroten bevölkerten, sind im Grunde wie eine Illustrierung des Satzes gewesen: „denn ihrer ist das Himmelreich,“ die in eben jenen Zeitläuften geschah, als dieser Satz von kundigstem Munde gesprochen wurde[264].
[S. 165]
Jedes Ich ist ein Problem, und unsere Mitmenschen zu verstehen die wertvollste Aufgabe, die uns das Leben stellt. Daß wir dies lernen, darum ist unsere moderne Dichtkunst, die die Probleme sucht, unablässig bemüht. Aber auch der Mensch der Vergangenheit ist unser Mitmensch, und er ist erst recht Problem. Man versteht die Gegenwart, man versteht vor allem die Vergangenheit nicht, deren Geschenk die Gegenwart ist, wenn man die Persönlichkeiten, die großen Menschen selbst nicht begreift, deren Namen uns die Weltgeschichte zuwirft. Auch hat sich unsere fleißige Menschheitsforschung ihrer Pflicht stets erinnert, ihr hellstes Licht um die epochemachenden Geister der Vorzeit zu verbreiten. Aber einen Mann hat sie nahezu vergessen, und seine angemessene Würdigung vermisse ich da, wo ich sie suche; dies ist der „Philosoph“ Seneca, der Lehrer Kaiser Neros, der einzige große Vertreter der stoischen Religion in lateinischer Sprache. Einer der neuesten Darsteller der römischen Kaisergeschichte hat ihn einfach mit dem Ausdruck „der glatte Schwätzer Seneca“ abgetan. Wir werden sehen, wie durchdacht dieses Urteil ist.
Wer uns heute die Geschichte der schicksalsvollen römischen Kaiserzeit erzählt, steht immer noch zu sehr auf dem Standpunkt Suetons und gibt uns aufgereiht die Biographien der großmächtigen Kaiser selbst und ihrer Frauen. Wir hören da immer nur von den Titelhelden, von den Protagonisten im Drama. Seneca war nur Deuteragonist; er spielte keine Titelrolle; er wollte es nicht. Seneca hat keine Kriege geführt, er hat keine Justizmorde verübt, und wer prickelnde Personalien braucht, tut gut, über ihn zu schweigen. Und doch ist jeder kleinste Lebenszug, den wir von ihm erspähen, wie Goldglanz und tausendmal bedeutsamer als die rastlosen Albernheiten und hirnlosen Schandtaten eines Nero, mit denen man die Seiten füllt.
Darum habe ich in meinem Buch „Römische Charakterköpfe“ Seneca als eine Haupt- und Eckfigur der römischen Kaisergeschichte[S. 166] hochgestellt, noch stärker vielleicht die grundlegende Bedeutung seines Wirkens in dem Büchlein über römische Kulturgeschichte betont. Um so mehr drängt es mich zu dem Versuch, von ihm, wenn auch nur skizzenhaft, ein Sonderbild zu zeichnen.
Seneca, sofern er Philosoph war, wird in den Geschichten der Philosophie abgehandelt, und wir erfahren da, wieviel er in seiner Lehre seinen Vorgängern verdankt. Seneca, sofern er Schriftsteller war, wird wieder in anderen Büchern, in den Literaturgeschichten, abgehandelt, und er erhält da beiläufig eine ungünstige Note, weil er nicht klassisch, d. h. kein für unsere Primaner brauchbares, ciceronisches Latein schreibt. Auch als Staatsmann hat Seneca kürzlich eine Separatbehandlung erfahren[265]. Aber zum Verständnis des Menschen führt dies nicht. Ein vielseitiger Mann verlangt eine vielseitige Betrachtung[266]. Was nützt es, den Adam in seine Rippen zu zerlegen? Wer ihn nicht ganz läßt, sieht nicht, wie ihn Gott geschaffen. Wer will einen Lionardo in einen Physiker, Mechaniker und Künstler, wer will einen Wilhelm von Humboldt in einen Staatsmann und Sprachforscher zerschneiden? Es wäre ein sonderbares Unternehmen.
Wer Senecas wundervollen literarischen Nachlaß liest — über Seelenruhe, über die Muße, über Wohltätigkeit usf. —, der glaubt zunächst einen Asketen, einen Prediger im härenen Rock und Philosophenbart, den Mann der Weltflucht und Entsagung vor sich zu sehen, dessen unermüdliche Sittenpredigt in Heiligung gipfelt und endigt, in einem Gottesdienst der Tugend, in Freiheit des Ichs, das heißt: in Niederkämpfung und Besiegung der Leidenschaften.
Lesen wir dieselben Schriften genauer, so merken wir, daß er nicht nur ein Verächter aller Luxusdinge der Großstadt, sondern auch ihr Kenner gewesen ist. Musik, Architektur, Kunstgärtnerei, Prunk des Hausrats, die ganze Kulturblüte der ersten Kaiserzeit hat er gesehen, durchlebt; sie lebt in ihm. Aber nicht nur das: er ist auch eine politische Größe, und die Historiker, Tacitus, Cassius Dio, halten es für ihre Pflicht, über ihn zu[S. 167] berichten: der erste Finanzmann Roms, voll weltlicher Geschäftskenntnis, Großgrundbesitzer[267], von vielhundertköpfigem Personal umgeben, Großkapitalist, der mit mächtigem Gefolge über die Straßen zieht, beiläufig auch nicht bärtig, sondern das Gesicht glatt ausrasiert, endlich Hofmann und Staatsmann, so erscheint er uns hier, und der Verdacht erhebt sich, daß da Lehre und Leben in seltsamem Widerspruch stehen, als zeigte Seneca zwei Gesichter, ein anderes der realen Welt, ein anderes seinen Lesern, ein anderes seiner Gegenwart, ein anderes der Zukunft. Der idealste, bravste, treu sorgfältigste Sittenlehrer der römischen Literatur ein bloßer Wortdrechsler der Tugend?
Und das Rätselhafte ist damit noch nicht erschöpft. Denn Seneca war, wie man glaubt, auch Theaterdichter, und die einzigen römischen Tragödien, die wir besitzen (es sind neun), stammen von ihm. Wozu die Leidenschaften Medeas oder Phädras vorführen, wenn es doch gilt, die Leidenschaften zu unterdrücken? Plato war konsequent und verbannte den tragischen Dichter aus seinem Staat; der Dichter Seneca läßt das Laster spielen, das er verurteilt? Hat der eitle Mann auch nach dem Lorbeer geschielt? und war ihm der läppische Beifall des Theaterpublikums ein Bedürfnis?
Wenn diese Widersprüche uns stören oder gar beleidigen, so bleibt Seneca in seiner genialen Natur doch auch so eine erste Größe in der Geschichte der Menschheit.
Der Staatsmann Seneca steht als Mann des Fortschritts und des sozialen Friedens ehrwürdig und wie eine Lichtfigur auf dem dunklen Grunde der Neronischen Zeit.
Der Dichter Seneca hat mit seinem vibrierenden Pathos auf das pathetische Schauspiel der Neuzeit seit der Renaissance und seit Marlow und Shakespeare tiefgehende, bleibende Einflüsse gehabt, die, je mehr man dem nachgeht, um so deutlicher hervortreten[268].
Unendlich aber ist der Segen, den Seneca als Moralist geübt, und schon darum müßte man ihm in unserem Zeitalter der ethischen Kultur Denkfeiern begehen und Denkmäler errichten. Zum mindesten, man müßte ihn lesen!
[S. 168]
Die Widersprüche aber, von denen ich sprach, sind nicht einmal vorhanden. Der Mann ist eine Einheit, eine große und ehrliche Gestalt aus einem Guß. Auch als Dichter war Seneca Ethiker, auch als Staatsmann ist er es gewesen.
Es ist nur zu natürlich, daß man schon im Altertum gegen den Mann einen hämischen Ton anschlug und über ihn die Nase rümpfte. Warum lebte er im großen Weltgetriebe und warf die Reichtümer nicht hinter sich, er, der Wortführer der Bedürfnislosigkeit? Das waren die stumpfsinnigen Winkelmoralisten, die so redeten. Seneca war großzügig und tapfer und machte die Riesenkapitalien, die ihm zufielen, seinen guten Zwecken dienstbar. Denn Geld ist Macht. Es war besser, daß die Macht in seiner Hand war, als in der Hand der kaiserlichen Buhlerinnen und Libertinen.
Es ist, wenn man gut sein will, nichts bequemer, als sich aus den großen Händeln zurückzuziehen[269]. Der bessere Mann ist der, der die schnöden Mittel dieser Welt festhält, ihre Benutzung organisiert und dem Fortschritt der Gesellschaft dienstbar macht. Der beste ist der, der mit solchen Zwecken sogar den Thron gewinnt. Seneca stellte sich hart neben den Thron Neros.
Wir verkennen seine Schwächen durchaus nicht. Denn nur durch ein gewisses Nachgeben war in dieser Welt der rohen Gewalten ein solches Ziel zu erreichen. Die Einheit seiner Natur aber ist schon hiernach klar. Den Aposteln und Heiligen der christlichen Kirche kommt es zugute, daß wir ihre Biographie meist nicht kennen, und wir können sie also unbedenklich für heilig halten und tun es gerne. Die Lebensauffassung Senecas leugnet dagegen, daß es heilige Menschen gibt. Für ihn sind auch die Besten sittlich immer unvollkommen. So stellt er auch sich selbst vor uns hin. Aber daß man sich bestreben soll, vollkommen zu werden, das ist seine kategorische Forderung.
Seneca ist vielleicht in demselben Jahr wie Christus geboren, und unsere Zeitrechnung und Jahreszählung beginnt ungefähr mit seinem Geburtsjahr. Der Trieb zur religiös sittlichen Wiedergeburt[S. 169] der Menschheit ging damals durch Orient und Okzident; denn Orient und Okzident bildeten ein Reich, das Römerreich. Das Römerreich war die Menschheit. So wurde damals auch Seneca wie der Apostel Paulus zu einem Verkünder einer neuen ethischen Religion.
Es handelt sich um die stoische Philosophie. Sie war in der Hauptstadt Rom vor gut hundert Jahren durch Panaetius und den großen Posidonius eingebürgert worden. In dieser stoischen Propaganda, die weitherzig auch aus Platos, aus Epikurs Lehre das Beste mit aufnahm, wuchs der junge Seneca auf, und er übernahm von den Genannten die Milde der Gesichtspunkte.
Philosophie war damals das griechische Wort für Religion; und sie gab nicht nur Moralgesetze; sie verlor sich eingehend auch in Erforschung der Natur, in Betrachtung des Alls[270]. Seneca selbst hat die Wirkungen des Vulkanismus des Vesuv, der sich im Jahre 63 n. Chr. zum ersten Male regte, sogleich studiert[271], er hat eine Afrika-Expedition nach den Nilquellen angeregt[272], noch mehr, er hat die Entdeckung Amerikas schon damals prophezeit und gefordert[273]. Aber diese Naturforschung (die quaestio naturalis) führte unmittelbar auf die große Grundursache und Einheit des Alls, auf Gott. Die Himmel rühmen des Ewigen Ehre — das ist der Grundgedanke bei Seneca. Seine Naturbetrachtung ist Andacht. Wer das liest, möchte in die Kniee sinken.
Da aber das All in Gott ist, ja, da das All Gott ist, müssen wir Sterbliche auch in Gott sein und gottgleich werden, da wir es nicht sind. Daher die Lichtsehnsucht Senecas. „Wir gehen im Dunkeln und im Halblicht. Wir wollen ins volle Licht, in den Himmel zurück, aus dem wir stammen“[274]. Daher der Drang nach innerer Läuterung. Diese Läuterung geschieht durch Übung, durch Ausübung. Lerne deine Pflichten gegen dich selbst, gegen den Nebenmenschen! Das ist der rechte Gottesdienst.
So entstand die umfassendste und feinste Pflichtenlehre, die[S. 170] die römische und vielleicht auch die nachrömische Welt gesehen: Ratschläge für alle Konflikte des Lebens, aus der Fülle der Erfahrung geschöpft. Selbstbeherrschung, Selbstzucht ist die Vorstufe. Nächstenliebe, die Sorge für die Mitmenschen, ist die Hauptsache. Es ist jene Menschlichkeit, die in dem Satz gipfelt: Liebet eure Feinde, d. h. seid um ihr Heil bemüht.
Diese Lehre gehört dem Seneca ganz persönlich; sie ist ganz individuell gefärbt[275]. Gleichwohl waren die Grundgedanken nicht neu. Man predigte sie schon seit 300 Jahren von allen Dächern. Aber alle außer Seneca sprachen griechisch. Das taten hernach ja auch die Verkünder Christi. Seneca war der einzige, der diese Gedankenwelt lateinisch faßte, und schon das war eine Großtat, ein Ereignis für Westeuropa. Denn alle anderen wandten sich an die niedrigen Volksschichten, die in weitester Ausdehnung auch in Italien, in Südfrankreich und anderen Provinzen griechisch durchsetzt waren; das Volk hatte also längst seine Lehrer und religiösen Erzieher. Seneca dagegen wollte die entscheidenden Instanzen der großen Welt, die römischen Herrenmenschen, die Söhne seiner Senatoren und Ritter, die künftigen Provinzialverwalter des Weltreichs, er wollte den Kaiser selbst eingewöhnen in die Denkweise der Menschlichkeit.
Und daher auch die glänzende Art seines Vortrags. Sie war bestimmt durch die Adresse. Sollte Seneca etwa im breiten Wortschwall Ciceros sich ergehen? Er wollte keine Wassersuppe geben. Oder hätte er versuchen sollen den naiven Volkston anzuschlagen, wie ihn später das christliche Evangelium braucht? Die Leute, an die er sich wandte, hätten ein Buch im Bibellatein damals nicht angesehen. Seneca mußte dem hochgeschraubten Kunstgefühl der vornehmen Welt Roms genügen, und es ist ihm gelungen. Durch seine Schreibweise selbst hat er sie herbeigelockt. Die Aufgabe war groß und neu, und er hat sie mit Geist und Würde und Feingefühl gelöst.
Der deutsche Gelehrte stellt sich[276], wenn er Senecas Stil beurteilt, planvoll auf den Standpunkt des geistig Armen, wenn[S. 171] er nicht überhaupt diesen Standpunkt inne hat, und schüttelt den Kopf voll Bedenken, weil der Mann, der da von Tugend redet, auch Geist hat. Die Franzosen wissen besser zu urteilen; denn ihnen ist jener Standpunkt fremd und sie wissen, daß Geist und Herz sich nicht ausschließen und daß auch ein wahrhaftiges und ein heißes Gefühl sich in scharfgeschliffenen Deduktionen und blitzenden Antithesen bewegen kann.
Gleichwohl wirken ethische Schriften leicht eintönig, auch wenn sie ein Seneca geschrieben. Und wer mag heute überhaupt über Tugend lesen? Heute interessiert nur die Literatur des Lasters und der Schwäche. Damals aber waren Senecas Sittlichkeitsstudien aktuell, kühn und ergreifend.
Denn nie stank die Sünde so zum Himmel wie damals in der Millionenstadt, in dem „Babel“ Rom. Wir reden wohlgemerkt nicht von der antiken Welt überhaupt, sondern nur von ihrer Hauptstadt[277]. Das zügellose Sichausleben war nie so zum Prinzip erhoben, das Laster nie so gesellschaftsfähig, so hoffähig, wie dort unter dem ersten Kaisertum. Die schauerliche Dekadenz des städtischen Adels: Vermögensunterschlagung, Völlerei, Feigheit, Blutschande, Verwandtenmord, Erpressung, Verworfenheit; die Bordellwirtschaft Messalinas im Kaiserpalast, Agrippinas gieriger Ämterschacher — das war der freche Ruhm der Großen dieser Welt. Dazu auf dem Richtplatz die Leichenhaufen der Verurteilten; dazu gar die grotesken Volksbelustigungen, die Blutbäder der Gladiatoren in der Arena. Was war da noch der Mensch? Was war da noch Menschenwert?
Da läßt Seneca in die Paläste seine Schriften ausgehen, die den Wert der Einzelseele, des Individuums verkünden. Mit Verachtung wendet sich der reichste und mächtigste Mann Roms von den großen Sensationen der Arena ab[278]; aber er schilt nicht; er ermahnt und überredet.
Das Laster, sagt er, beherrscht uns alle; es ist eine ansteckende Krankheit. Aber wir wollen genesen. Woher die Heilung nehmen? Verachte alles Vergängliche; das gibt die Heilung;[S. 172] habe Ekel vor den Begierden; kämpfe mit deinem Fleisch. Aber stehe aufrecht und fürchte dich nicht[279].
Und freue dich des Leidens. Der gute Mensch wird nur stark durch Erschütterung (marcet sine adversario virtus). Der Steuermann bewährt sich erst im Sturm. Wir sollen den Sturm suchen[280]; wir sollen die Wunden suchen, wie ein Athlet[281]. Und wir sind zur Liebe da, nicht zum Hassen. Was soll der Zorn? Der dich beleidigte, der irrte nur. Also vergib ihm. Hilf deinem Nächsten und warte nicht auf Dank; denn auch die Gottheit fragt nicht nach Dank, wenn sie dir wohltut. Nur der lebt, der vielen nützt; wer träge zu Haus sitzt, sitzt in seinem eigenen Grabmal, und man müßte ihm auf seine Marmorschwelle schreiben: „Er ist vor seinem Tode gestorben“[282].
Weiter: sei menschlich und dankbar auch gegen den Sklaven; denn alle Menschen sind gleich vor Gott.
Der Körper aber ist nur eine Last, ein Gefängnis. Der Tod ist der Geburtstag des Ewigen (der natalis aeterni). Sterben ist Gewinn. Halte dich reisefertig (anima in expedito est habenda). Wir fliegen zu unserem Ursprung zurück[283]. Aber der Tod genügt nicht; wir sollen auch unseren Tod noch wertvoll machen. Wir sollen haben, wofür wir sterben[284].
Solche Gedanken nehmen, wie in der christlichen Lehre, den breitesten Raum ein. „Ich liebe das Leben, weil ich sterben darf“[285]: das gibt den Grundton. Aber auch der freiwillige Tod Catos wird als Rettung aus der Not der Zeit, den Greueln der Tyrannei, gebilligt. Und so ist Seneca endlich auch ein Seelsorger und Tröster der Trauernden. Auch wer untröstlich am Grabe seines Kindes steht, findet bei ihm ein helfendes Wort: „Kein Leben ist zu kurz, wenn es gut war“[286]. Von den sinnlichen Freuden des Paradieses aber weiß er nichts. Im Jenseits sind alle Herzen offen und durchsichtig: das ist das Schönste, was Seneca vom seligen Leben zu verkünden weiß[287].
So überschwenglich reich diese Diatriben Senecas sind — reich auch an frischen, echt volkstümlichen Wendungen im Stile[S. 173] Bions und unmittelbar anschaulichen Bildern aus dem Leben, — so sehr enttäuschen seine Tragödien. Aber auch bei ihnen muß ich verweilen. Denn an solchem Manne ist nichts unbedeutend. Wo ist der Staatsmann, der Richelieu oder Bismarck, der neben seinem großen politischen Wirken noch eine neue Ethik und noch Tragödien bleibenden Wertes schrieb?
Der Stimmungsbereich ist in Senecas Dichtungen freilich eng. Er greift immer nur nach dem Gräßlichen, Entsetzlichen. Eine Iphigenie, Antigone, ein Philoktet liegt ihm nicht. Und der Grund dafür ist durchsichtig. Die blutrünstigen Laster seiner eigenen Zeit sind es, die Seneca in ihren tragischen Konsequenzen zeigen will: frenare nescit iras[288]! Brudermord, Familienschande, kannibalische Rachsucht bis zum Äußersten. Es sind Abschreckungsbilder, die er gibt, und sie dienen der Moral. Mitten in die furchtbaren Tiraden seiner Helden aber drängt sich das Chorlied, das da die Armut der kleinen Leute, den ländlichen Frieden, das Hirtenleben sehnsüchtig preist[289]. Niemand scheint bemerkt zu haben, daß Seneca selbst uns in der Schrift De ira (II, 5) den deutlichen Hinweis gibt, was die Tragödie für ihn bedeutet. Denn als Beispiel für die üble Wirkung des Zornes führt er dort den „Aiax“ des Sophokles an. Ganz ebenso sind seine eigenen Tragödien groß angelegte Belegstücke für seine Theorie von der Verderblichkeit der Leidenschaft. Die Überspannung bis zum äußersten, die uns in ihrem Ton belästigt, da sie sich nirgends genug tun kann, lag im Zweck des Dichters.
Es gilt dabei zu wissen, obgleich dies meistens verkannt wird, daß diese Stücke nur Lesedramen, daß sie nie zur Aufführung bestimmt gewesen sind. Daher eben sind sie uns allein erhalten. Sie verdrängten alle Spieldramen der Früheren, eines Pomponius und Accius, durch ihre Lesbarkeit. Es war bequeme Buchlektüre.
Woraus läßt sich das entnehmen? Aus ihrer Unaufführbarkeit. Ich rede hier nicht vom Ortswechsel, den der Dichter zuläßt, nicht von den eingelegten, oft schier meilenlangen Gesängen,[S. 174] die kein Chor wirklich absingen konnte; auch nicht von den Helden selbst, die sich nicht entwickeln, sich nicht wechselweise beeinflussen, sondern zumeist nur Abhandlungen oder Sinnsprüche reden über Liebe und Haß, Wut und Neid, an denen jeder Schauspieler hätte verzweifeln müssen. Es sei vor allem auf eines hingewiesen:
Shakespeare läßt seinen Julius Caesar auf offener Bühne erstechen, und das ist sein Haupteffekt. Bei Sophokles dagegen wird der böse Aegisth sorglich hinter die Kulisse geschafft, um da durch des Orest Schwert zu fallen. Das ist der tiefstgreifende Unterschied zwischen antiker und moderner Tragödie. Die antike vermeidet solche sinnfälligen Effekte ganz. Das ist, was sie so vornehm erscheinen läßt: keine Tötung, kein Handgemenge. Seneca aber steht auf dem Boden des Shakespeare, nicht des Sophokles: das ist das kunstgeschichtlich Merkwürdige; er bricht mit der antiken Tradition und nimmt vollkommen das Moderne vorweg.
Es ist klar, daß die Gepflogenheit des Altertums durch das Kostüm bedingt war. Der Schauspieler der Kaiserzeit ging auf dem Kothurn; er balancierte auf einer hohen hölzernen Stelze. Bei jeder lebhafteren Bewegung fiel er um, das lange Schleppkleid schlug in die Höhe, die Stelzen starrten in die Luft, und das Publikum brach in furchtbares Gelächter aus[290]. Nicht einmal ein Trinken und Essen konnte vorgeführt werden; denn die mächtige Gesichtsmaske hinderte.
Seneca nahm auf diese Schwierigkeiten gar keine Rücksicht. Vor unseren Augen erschießt Herkules mit dem Bogen seine fliehenden Kinder, und die Leichen werden vor unseren Augen untersucht; sie haben den Pfeil im Nacken. Vor unseren Augen steigt Medea aufs Dach und ersticht da höhnend ihren kleinen Sohn, während Jason von unten zusieht und jammert. Hippolyts Leiche ist zerstückelt; vor unseren Augen werden Kopf, rechte und linke Hand und andere Gliedmaßen herbeigebracht und der Körper mühsam wieder zusammengelegt, damit Theseus seinen Sohn erkennt. Grauenvoller noch der Thyest, und dies ist vielleicht der Gipfel der Dichtkunst Senecas.
[S. 175]
Atreus haßt seinen Bruder Thyest. Ein tödlicher Haß. Er lockt des Thyest drei Söhne an sich, schlachtet sie und setzt sie dem Bruder als Speise vor. Die Türen zu einem Innenraum werden geöffnet: drinnen liegt Thyest kauend und schon satt am Tisch auf dem Polster und zecht und singt berauscht noch ein Lied. Plötzlich erfaßt ihn Schwermut; er muß weinen; er ruft in Sehnsucht nach seinen Kindern. Da tritt triumphierend Atreus herzu und sagt ihm in zweideutigen Worten: daß er sie schon hat, daß er sie schon umfängt. Er selbst ist seiner Kinder Grab. Inzwischen hat die Sonne, hat das Weltall sich vor Entsetzen verdunkelt. Das letzte Drittel des Stückes spielt in völliger Nacht; nur der Eßsaal ist künstlich erleuchtet. Kein antikes Theater konnte das vorführen[291].
Die Schrecknisse der Shakespeareschen Kunst, die Erdrosselung Desdemonas im Othello, die Blendung des Gloster im Lear, sind also in den Lesedramen Senecas vorweggenommen. Es ist sicher, daß Shakespeare in dieser seiner nervenerschütternden Praxis nicht etwa durch unseren Seneca selbst beeinflußt war; denn auch die Passionsspiele und Moralitäten des Mittelalters hatten es ja nicht anders gemacht; man denke an Christi Geißelung und Kreuzigung, die man in allen Kirchen leibhaftig vorführte. Aus Gideons Kampf mit den Philistern wurde damals im „Prophetenspiel“ wirklich eine Schlacht, so daß die Zuschauer selbst die Angst ergriff[292]. Gleichwohl haben Senecas Dramen, seitdem sie wieder bekannt wurden[293], für dies grob drastische Verfahren eine nachträgliche klassische Sanktion gegeben.
Am denkwürdigsten aber ist Senecas Herkules Oetaeus[294], und jeder Theologe und Evangelienforscher sollte dies Stück, den Herkules auf dem Oeta, einmal lesen, so peinigend auch das enorme Pathos ist, das ihn erfüllt. Denn da erhebt sich die stoische Religion dazu, einen Gottessohn darzustellen, der auf Erden erschienen ist, um zum Gottvater erhöht zu werden: eine Konkurrenzdarstellung zu den Evangelien, aber schon um das Jahr 55, vor dem Ur-Matthäus und Marcus geschrieben.[S. 176] Herkules wird nicht gekreuzigt, aber unter Höllenqualen vergiftet und durch den Feuertod erlöst. Die Mutter aber, die ihn vom höchsten Gott empfangen und geboren, Alkmene, steht vor ihrem sterbenden Sohn und erlebt die Passion mit durchbohrtem Herzen und ringt nach Fassung, um der Welt zu zeigen, wie eine Mutter um ihren Sohn trauern muß[295].
Dieser Herkules, mit seinem Flammentode, war ein altes Ideal der Stoa[296], und er hat dem Christusdienst auch sonst Konkurrenz gemacht; dies dürfen wir folgern aus jener Erzählung vom Peregrinus Proteus (bei Lucian), der erst Christ ist, dann aber sich zur Herkulesreligion bekehrt, vor dem Volke einen Scheiterhaufen errichtet und den Tod des Gottessohnes Herakles auf sich nimmt.
Alles dies beweist genug. Es ist unglaublich, daß einsichtige Philologen verkannt haben, wie eng verknüpft Senecas Tragödien mit seinem Gesamtwirken gewesen sind.
Nun aber sein Leben selbst. Es fragt sich: was hat der Mann mit seinen Lehrschriften gewollt? Wann und zu welchem Zweck hat er sie geschrieben?
Seneca war Spanier von Herkunft, ein Sohn Cordobas, ein Kind des Sonnenlandes Andalusien. Der Spanier galt als brav und bedürfnislos; er galt als heroisch, wenn man ihn marterte[297]. So ist uns Senecas Vater als ehrenfester Mann bekannt. Der Sohn dachte gar nicht daran, Berufsphilosoph, Kathederphilosoph, wie er es selbst nennt: philosophus cathedrarius[298] zu werden. Er nahm die stoische Lehre nur früh in seine Gesinnung auf; sie stärkte ihn bei schweren Krankheitsfällen [299]. Der griechische Weise Demetrius, der als Bettler (seminudus) in Rom einherging, war ihm ein lieber Verkehr, er verehrte ihn zeitlebens schwärmerisch und hielt ihm die Treue. Seneca aber wollte von vornherein etwas ganz anderes als dieser: er wollte ein tätiger Staatsbürger, ein Mann der Tat und nicht der Betrachtung, ein Mann der actio, nicht der contemplatio sein. Das sagt er uns ausdrücklich: sein Leben war ein Geschäftsleben ohne Ferien[300]. Als junger Mann schon[S. 177] wurde er Senator[301] und zugleich der erfolgreichste Sachwalter in den gewaltigen Prozessen jener Zeit, die vor Kaiser und Senat geführt wurden. Das Leben des Senators aber war das angespannteste: das müßige Volk lief in die Bäder; die Senatssitzungen währten vom Morgen bis in die Nacht.
Der Kaiser Caligula aber war über die Erfolge dieses ernsthaften Menschen wütend und zwang ihn, die Sachwaltertätigkeit aufzugeben. Da beschränkte sich Seneca auf das, was er nennt: tacita advocatione cives iuvare, „mit stummer Advokatur den Mitbürgern zu helfen“[302]; er stellte sich als Ratgeber zur Verfügung, ohne als Redner zu wirken[303]. Und in dieser Stellung und nicht durch seine Schriften gewann er schon damals große Kreise von dankbaren Anhängern; denn als die Kaiserin Messalina ihn im Jahre 41 nach Corsica verbannt — Seneca war den nichtsnutzigen herrschenden Hofkreisen unbequem —, da wird bemerkt, daß das ein Schlag gegen die öffentliche Meinung der Hauptstadt war.
Man brachte gegen ihn das Unbewiesene vor, daß er Liebhaber der verführerischen Prinzessin Julia Livilla, der Schwester Agrippinas, war. Beide Schwestern, Livilla und Agrippina, waren der Messalina verhaßt. Diese wilden weiblichen Katzen verbissen sich ineinander, bis Livilla sich verblutete.
Sicher ist, daß Seneca mit Livilla und Agrippina irgendwie liiert war[304] und daß Messalina in ihrem schamlosen Treiben sich vor Seneca fürchtete oder durch ihn behindert fühlte. Denn so lange sie lebte, duldete sie seine Rückkunft aus Corsica nicht. Kaum aber ist sie tot, da wird er von Agrippina nach Rom berufen und beherrscht auf einmal die Lage der Dinge, den Senat, den Hof.
Seneca wurde der Lehrer Neros. Ob Nero oder nicht vielmehr der junge Prinz Britannicus Kaiser werden würde, war noch unentschieden, und so ist es von Interesse zu erinnern, daß auch dieser Britannicus damals seinen Erzieher hatte, den Sosibios, der vom Kaiser Claudius einmal eine Million geschenkt erhielt, weil er sich auch als Berater des Hofes bewährte[305].[S. 178] Auf diesem Wege ist auch Seneca ein Berater des Hofes geworden. Sein Lehrauftrag betraf nur die Redekunst; wir wissen aber, daß solche Rhetoriklehrer in den vornehmen Familien den ersten Zweck hatten, für die sittliche Haltung ihres Zöglings zu sorgen[306]. Dadurch gewannen sie oft genug maßgebenden Einfluß im Hause.
Aber er war noch immer kein „Philosoph“. Die einzige bemerkenswerte ethische Lehrschrift, die Seneca bisher verfaßt, war die gegen den Zorn[307]. In den acht Jahren auf Corsica hatte er Muße genug, hat aber allem Anschein nach nicht daran gedacht, diese Schriftstellerei da fortzusetzen. Er war zeitlebens Mann des Geschäftsfleißes, der actio, ein Organisator großen Stils. Daher war ihm das Exil so unerträglich. Er war lahmgesetzt[308]. In der Zurückgezogenheit wird solche Natur unproduktiv und versinkt in pflanzenhafte Stille. Nur im Getriebe des großen Lebens, durch tägliche Reibung, entzünden sich ihre Fähigkeiten, steigert sich ihr Können und Wollen, und sie wächst mit ihren Zwecken ins Große.
Wie mit dem Cyniker Demetrius, so war Seneca mit dem griechischen Gelehrten Polybius befreundet. Dieser augenscheinlich vortreffliche Mann war Freigelassener des Kaisers und hatte als solcher das Hofamt für Bittschriften zu verwalten. Als Polybius seinen Bruder verlor und schwer um ihn trauerte[309], richtete Seneca im ersten Jahre seiner Verbannung an ihn ein Trostschreiben; da war es naheliegend, ja selbstverständlich, daß er die Gelegenheit benutzte, um in derselben Schrift nun auch sein dringendes Verlangen nach Rückberufung aus dem Exil zu äußern; Polybius sollte dafür wirken. Diese Schrift war aber nicht etwa als Privatbrief abgefaßt; vielmehr veröffentlichte sie Seneca, legte sie also selbst dem großen Publikum der Hauptstadt vor; die Sache war für dies Publikum somit von Interesse, und sie war völlig ohne Anstoß; sonst hätte er dies nicht tun können, und es ist also ganz müßig, sie ihm heute als Fehlgriff oder gar als Selbstentwürdigung anzurechnen[310]. Zugleich preist er in dieser Schrift die guten[S. 179] Eigenschaften des Claudius in vollen Tönen — solches Lob war damals nichts als eine andere Form der Ermahnung[311] —, während zum Lobe der Kaiserin Messalina kein Wort darin steht. Es folgt daraus aber, daß Seneca auf Claudius, der ohne Frage manche guten Eigenschaften besaß und der damals, im Jahre 43 auf 44, eben erst die Herrschaft begonnen hatte, tatsächlich noch große Hoffnungen gesetzt hat. Dieser Kaiser mit der schwachen Willenskraft bedurfte nur der Leitung, und dem moralischen Einfluß Senecas hatte er sich überdies schon zugänglich gezeigt; denn als in Rom Senecas Verdammungsschrift gegen den Zorn bekannt wurde, erließ Claudius sogleich naiv gutherzig ein Edikt, in dem er versprach, seine Neigung zum Jähzorn hinfort bemeistern zu wollen. Konnte Seneca zunächst mehr verlangen? Er durfte damals also erwarten, daß er den Kaiser auch weiterhin günstig würde beeinflussen können, falls er aus Corsica fort und wieder in Rom war.
Allein die Kaiserin stand dem Plan gehässig im Wege, und erst als Messalina starb, wurde sein Wunsch erfüllt.
In jener Mahnschrift über den Zorn hatte Seneca unter anderem auch über Knabenerziehung gehandelt, und diesen Ausführungen dankte er es ohne Zweifel, daß ihn Agrippina gleich nach seiner Rückkehr zum Erzieher ihres Sohnes Nero berief[312]. Überhaupt aber veröffentlichte er in der nämlichen Schrift sein Lebensprogramm und gleichsam seine Methode. Kein revolutionärer Sturm und Drang steckte in ihm, keine Gracchus-, keine Brutusnatur. Seine Tapferkeit war defensiv, nicht offensiv[313]. Inmitten der furchtbaren Brutalitäten will er nur andauernd und grundsätzlich die Milde und Ruhe wahren und die stoische Lehre, daß man nie Böses mit Bösem vergelten soll[314], wirklich wahrmachen. Mit Verachtung blickt er auf die Germanen; denn die Germanen sind ein Volk des Jähzorns, ein Volk der Rache. Bessern, nicht strafen soll man den Gegner — auch das öffentliche Strafrecht wird von ihm auf diesen Satz gegründet[315] —, und ist der Kaiser selbst der Beleidiger, so soll man es mit Lächeln tragen[316]. Das mag uns[S. 180] fremd berühren und in seiner Durchführung als Schwäche erscheinen; wir dürfen aber nicht vergessen, daß es ein kranker Mann ist, der so denkt und schreibt. Hager und abgezehrt, ein Opfer der Neuralgie, vor allem zeitlebens von schwerem Herzleiden gepeinigt[317], war Seneca auf die frugalste Ernährung, auf die Verhütung aller jähen Erregungen angewiesen. Er kannte die Nähe des Todes und bewahrte eben darum eine gleichmäßige Heiterkeit[318].
Kaum tritt nun dieser schwächliche Mann in das Zentrum der Ereignisse, so muß er erleben, wie das Regiment gleich in seinen Fugen zusammenkracht. Es war das Jahr 54 n. Chr. Agrippina, die Kaiserin, vergiftet den Kaiser Claudius, ihren Gatten; sie läßt auch den Narciß umbringen, den gefürchteten Hausminister des Kaisers.
Agrippinas Sohn Nero ist unmündig; Agrippina will jetzt selbst Kaiser Roms sein; die starrsinnig übermütige Frau will ihr schmähliches Raubsystem, ihre Mißhandlung des Senats fortsetzen. Da erhebt sich Seneca. Mit zwei meisterhaften Schachzügen wirft er sie um, vernichtet er die Autorität der Kaiserin, indem er ihr gleich bei einer der ersten großen kaiserlichen Audienzen geschickt den Vorsitz entzieht[319] und durch seine geistsprühende Satire, die man Apokolokyntosis nennt, ihr politisches Ansehen vollständig zertrümmert[320], und regiert jetzt auf einmal selbst, gestützt auf Burrus, den Präfekten der Garnison, das Weltreich, die Welt von Armenien bis Spanien und England. Denn der junge Kaiser Nero, dieser Ästhet, diese schillernde Molluske, dieser knochenlose Polyp, war für ernste Dinge nicht zu haben. Seneca mußte sich mit dem Versuch begnügen, seine gefährlichen Triebe zu mäßigen, seinen Allmachtsrausch zu dämpfen. Nero war nur der Zeiger, nur das Schlagwerk an der Uhr, Seneca fortan die stille Feder im Uhrwerk, die niemand sah und deren stählerne Kraft alles bewegte. Als Schützer des Vaterlandes betrachtet er jetzt sich selbst[321]. Es waren nur etwa 7–8 Jahre: die vielbesungene goldene Zeit Roms.
[S. 181]
Der junge Kaiser mußte Senecas ausführliches Regierungsprogramm im Senat wörtlich vorlesen. Und dies Programm wurde wirklich durchgeführt: Seneca kehrte zu den Grundsätzen des Idealkaisers Augustus zurück, desselben Augustus, dem er auch in seiner Claudiussatire voll Verehrung das entscheidende Wort erteilt[322]; der Senat ist nun wirklich wieder die selbständige gesetzgebende Körperschaft, der Kaiser nur der erste Bürger der Stadt, und kein Justizmord geschieht mehr[323], keine Staatsämter sind mehr käuflich; das scheußliche Denunziantentum, die Gesinnungsriecherei hört auf; das Gerichtsverfahren ist wieder das alte[324]. Man spricht wieder von der alten Freiheit; denn die Monarchie ist zur Freiheit kein Gegensatz[325].
Dazu kamen aber auch Reformen[326], eine Reform des Steuerwesens[327], vor allem die Zentralisierung der Reichsfinanz in der Hand des Kaisers, indem das Ärarium des Senats in den kaiserlichen Fiskus aufging. Das war Senecas nützlichstes Werk. Aber auch dem Gedeihen der Reichsprovinzen galt seine Fürsorge; er hält darauf, daß die Provinzen gegen die Statthalter in Rom unbehindert Klage erheben können[328].
Wie sehr Senecas Reformen ins Einzelne gingen, lernen wir jetzt aus den ägyptischen Papyri. Seneca hat gleich im Jahre 55 für Ägyptens Hauptstadt eine neue Gemeindeordnung[329] sowie für militärische Aushebungszwecke eine Neuordnung der Namenlisten der Dienstfähigen in Ägypten eingeführt[330]. Er war selber früher in Ägypten gewesen; daher das Interesse[331].
Im übrigen rufe ich den Apostel Paulus zum Zeugen. In Paulus’ Römerbriefe, der im Jahre 54 oder bald danach geschrieben ist, wird im Kapitel 13 die Reichsverwaltung Senecas anerkannt mit der Bezeichnung, daß sie Gottes Dienerin zum Guten sei[332], vor der sich die Bösen, aber nicht die Guten zu fürchten haben. Diese Worte schrieb Paulus damals in Korinth, fern von Rom. Der Segen wurde überall empfunden[333].
Und eben erst damals begann nun auch die große Schriftstellerei[S. 182] Senecas. Das ist das Erstaunlichste. Sie war also aktuell im höchsten Grade. Diese Schriften sind Erzeugnisse der actio, nicht der contemplatio.
Zunächst allerdings Neros persönlichste Wünsche! Nero wünschte Gedichte zu sehen. Wer weiß, was für Arientexte der junge Sänger von seinem Lehrer erwartete? Seneca aber schrieb ihm damals zu seiner Warnung jene schreckhaften Tragödien, von denen ich sprach, mit den berühmten Schlagwörtern gegen die Tyrannen und der Mahnung: „rex velit honesta“[334].
Doch das ist belanglos. Jetzt schreibt er vor allem die große Hauptschrift über die Wohltätigkeit[335] und die andere über die Gnade des Herrschers. Er rafft seine Kräfte; er will jetzt sein Bestes tun. Die zweite ist eine Erziehungsschrift, dem jungen Kaiser überreicht, der vor Tyrannei, Blutvergießen und jeder herrischen Wallung dringend verwarnt wird und Milde lernen soll, wie der große Kaiser Augustus sie übte. Es ist bedeutsam, daß Seneca diese Mahnschrift nicht nur dem jungen Kaiser in die Hand legte, sondern zugleich kühn ins Publikum warf. Damit band er sich selbst vor der Öffentlichkeit. Der Öffentlichkeit vertraute der Minister an, was er von seinem Monarchen forderte. Nur sein Sturz konnte sein Programm aufheben. Wichtiger noch das Werk über das Wohltun[336]. Es ist in der Tat das Vollkommenste, was die Antike über Menschenliebe, d. h. über die Pflicht sozialer Hilfe gebracht hat[337]. Keiner vor Seneca hat etwas Ähnliches, praktisch Brauchbares geschrieben. Die Sophismen der griechischen Philosophen schiebt er in überlegener Weise beiseite, alles Schulmäßige streift er nach Möglichkeit ab[338]. Und diese Sachen kamen von der höchsten Stelle im Reich; das ist das ganz Eigenartige: die Regierung selbst predigt eine neue Ethik.
So hatten es einst auch Lykurg und Solon bei den Griechen gemacht; so Moses bei den Juden. So macht es jetzt der römische Staatsmann.
Und so ist denn auch die Tragweite, die Einwirkung seiner[S. 183] Ethik die tiefstgehende gewesen; sie reicht deutlich erkennbar durch die nächsten Jahrhunderte, ja, sie reicht bis heute. Wenn Paulus in dem genannten Kapitel, nachdem er Senecas Regierung als weltliche Autorität anerkannt hat, hinzufügt: „Du sollst deinen Nächsten lieben (ἀγαπᾶν) wie dich selbst[339]“, so war das eben der Gedanke, den Seneca damals von oben her in die Welt warf und den Paulus billigte. Die spätere christliche Kirche konnte in der Tat nichts tun, als diese Lehre festzuhalten, und es läßt sich schwerlich sagen, daß sie sie wesentlich weiter gefördert hat[340]. Ich erwähne das Sklaventum. Noch Thomas von Aquino, der Fürst der katholischen Dogmatik im 13. Jahrhundert, hält an der Sklaverei als einer staatlichen Einrichtung fest und ist betreffs der menschlichen Behandlung der Unfreien nicht über das hinausgekommen, was Seneca lehrt[341].
Eine persönlichere Note haben andere Schriften Senecas, wie De vita beata, d. h. „über reiche Lebensführung“ oder über das Wesen des Reichtums, und die Schrift über die Seelenruhe, De tranquillitate animi. Man hatte ihm vorgeworfen, daß sich durch Neros launenhafte Güte ein übergewaltiges Vermögen[342] in seinen Händen ansammelte. Seneca legt nun erstlich dar, daß das Arbeiten für Staat und Vaterland die höchste Pflicht des Lebens ist[343], sodann aber, daß nur der Reichtum einen wirksamen Gebrauch der Tugend möglich macht, d. h. nur die Geldkraft ermöglicht die soziale Hilfe[344]. Das Kapital muß nur in den rechten Händen sein[345].
So dachte er. Nirgends aber finden wir dabei den Ton des Stolzes oder protzenhafter Selbstüberhebung; vielmehr geht eine gutherzige und liebenswürdige Bescheidenheit durch all seine Schriften, die echt ist und sich gleich bleibt[346].
Senecas großes Bankinstitut — so können wir es nennen; es war gleichsam eine Reichsvorschußzentrale — gab Darlehen durch alle Länder, über ganz Europa und Afrika. Wir hören einmal, wie die jungen Gemeinden in England, welches Land damals eben erst römische Provinz geworden war, eine Anleihe[S. 184] von 10 Millionen Sesterz bei ihm gemacht haben und wie er das Geld kündigen muß, weil die Zinsen nicht einlaufen[347]. Es ist kindisch zu sagen, daß er keine Zinsen hätte fordern sollen[348]. Seneca wußte, daß eine von der Regierung selbst geleitete Bank für den Staat ein Segen, daß sie aber ohne Sicherungen nicht operieren kann. Staatsbanken kannte das Altertum noch nicht. Das Privatinstitut Senecas kam dem am nächsten. Man erinnere sich, um die Sache richtig zu verstehen, daß auch der kaiserliche Fiskus das Privatvermögen des Kaisers war, das aber in den Dienst des Reichs gestellt wurde. Just ebenso machte es Seneca mit seinem Fiskus.
Ganz abzusondern von dieser gewaltigen geldwirtschaftlichen Arbeit ist Senecas eigene Lebensführung, seine persönliche großartige Mildtätigkeit, die, wie wir lesen, auch noch den Nachlebenden als leuchtendes Vorbild galt[349]. Er selbst äußert sich maßvoll: er gab nur mit Wahl. „Ich habe einen Geldsack, der leicht aufgeht, aber nicht durchlöchert ist, aus dem viel genommen wird, aber nichts herausfällt“[350]. Doch hatte eben alles bei ihm großen Stil. Ja, Tacitus erzählt, daß viele Kinderlose damals dem Seneca ihr Vermögen vermachten; man wußte das Geld nirgends besser aufgehoben als bei ihm.
In Nero aber war längst die Bestie erwacht. Das Gräßlichste geschieht. Nero läßt seine Mutter Agrippina ermorden. Es hieß: Agrippina hätte auch ihrem Sohne nachgestellt. Das war auch für Seneca die Katastrophe. Was sollte er tun? Er suchte trotz allem Nero zu halten. Ja, er mußte Neros Schandtat bemänteln. Er mußte es; denn er brauchte ihn. Er konnte ohne des Kaisers Zustimmung nicht wirken[351]. Wenn nur dieser Nero ihm ferner gefügig blieb!
Hier müssen wir uns der antiken Denkweise erinnern. Dem Seneca erschien der jedesmal regierende Kaiser, er sei gut oder schlecht, unantastbar und durch sein Amt geheiligt, ein Stellvertreter Gottes[352], ungefähr wie der Papst dem römisch-katholischen Christen. Suchen wir eine Analogie aus unserer Zeit, so läßt sich in der Tat nichts anderes sagen: der Kaiser Roms war[S. 185] Oberpontifex; er war der Papst des Heidentums. Er ist wie das Wetter, das wir, ob es uns auch vernichtet, willenlos hinnehmen und nicht ändern können[353].
Hätte Seneca damals rasch entschlossen Nero, den Muttermörder, selbst aus der Welt geschafft, er hätte es mutmaßlich gekonnt; das Volk hätte ihm zugejauchzt, und er wäre selbst Kaiser geworden. Es gab in der Tat Leute, die das von ihm erwarteten. Aber Seneca war kein Sejan; ihm fehlte der Wille[354]. Nur ein Soldat konnte Imperator sein, und das war er nicht.
Nun wurde er bald genug Neros Opfer. Im Jahre 65 starb er. Nero hatte, von dem nichtswürdigen Tigellinus beherrscht, Seneca schon aus den Geschäften verdrängt, auch die Riesenkapitalien ihm abgenommen, um das Geld für seine goldenen Palastbauten zu verschwenden, und stand fortan sprungbereit, seinen Lehrer umzubringen. Aber er wagte es nicht. Seneca war zu angesehen. Nero war zu feige. Das zog sich hin durch drei Jahre namenloser Erregung[355]. Aber Senecas Philosophie, sagen wir besser seine Natur, bewährte sich. Seine Seelenruhe ist bewundernswert. Denn obschon er jetzt, beständig bedroht, wie auf einem Vulkan lebte, fand der Rastlose in dieser Zeit trotzdem die Ruhe, nicht nur ein vollständiges System der Moralphilosophie, das uns verloren ist, sondern daneben sein großes naturforschendes Werk (wir könnten es den „Kosmos“ der römischen Literatur nennen), eine Arbeit wirklich wissenschaftlicher Haltung, vor allem aber seine 124 Moralbriefe zu schreiben, die uns sein Innerstes erschließen und der gedankenreichste, unvergänglichste Nachlaß seiner Feder sind. Er wußte, was ihm bevorstand. In seinem 26. Briefe steht: „Ob ich tapfer bin, werde ich in meiner Todesstunde zeigen.“ Er hat das durch den qualvollsten Tod bewahrheitet. Sein gräßliches Martyrium war vernichtend für Nero, für ihn selbst war es Verklärung. Die antiken Martyrologien erzählten davon[356]; seine „letzten Worte“ wurden lange Zeit aufbewahrt[357].
[S. 186]
Sein Werk aber blieb unverloren. Schon Nero nannte es mit seinem unreinen Munde ein Werk für die Ewigkeit, munera aeterna[358]. Der beste aller Kaiser Roms war Trajan, auch er ein Spanier wie Seneca; Trajan aber hat ausdrücklich an Seneca angeknüpft mit der Äußerung, die Leistungen aller anderen Kaiser stünden hinter Senecas Verwaltung zurück[359]. Gleichzeitig tönt uns aus Juvenal die Stimme des Volkes entgegen: „Hätte das Volk damals zu wählen gehabt, es hätte Seneca zum Kaiser gewählt“[360]. So führt die Höhenlinie der großen römischen Kaisergeschichte von Augustus über Seneca zu Trajan und zu Mark Aurel.
Auch der Kaiser Mark Aurel war Spanier, und in Mark Aurel hat sich nun das Ideal ganz verwirklicht: der Philosoph und Menschenfreund hatte endlich den Thron selbst bestiegen. Schon vorher aber war Kaiser Titus, „die Liebe und Wonne des Menschengeschlechts“, wie wir mit Zuversicht ansetzen, durch mittelbare oder unmittelbare Beeinflussung Senecas zu dem Musterkaiser geworden, wie Sueton ihn schildert[361].
Dann zerfiel das römische Reich. Aber das Erbe der Humanität Senecas lebte unverloren weiter. Denn eben diese Humanität ist es, die dem klassischen römischen Rechte der späteren Kaiserzeit zugrunde liegt und in ihm praktisch wurde; sie fand aber zum Teil auch Eingang in die Pflichtenlehre der christlichen Kirchenväter und hat so hineingewirkt bis in unsere neueste Zeit. Die Kirchenväter hielten seit dem 5. Jahrhundert Seneca sogar fälschlich für einen Christen; hätten sie es nicht getan, seine Schriften wären uns mutmaßlich gar nicht erhalten worden.
Jetzt ist jeder, der das Liebesevangelium des Christentums würdigen will, verpflichtet, Senecas Schriften zu kennen.
Wir aber halten daran fest, daß Seneca ein Mensch aus einem Guß war, kein Heros, aber doch ein Mann der Aktion großen Stils[362] und ein seltener Mann: der im Ewigen zu leben versucht, aber sich weltbestimmend mitten in die Endlichkeit stellt. Wir halten ebenso daran fest, daß seine wichtigsten[S. 187] Schriften keine Schulabhandlungen oder gar müßige Stilübungen, wie viele zu glauben scheinen, sondern daß sie von hervorragend praktischer Bedeutung und das wichtigste Hilfsmittel des Staatsmannes waren, der da einsah, daß ohne sittliche Hebung, ohne Brechung des Egoismus, ohne Erweckung der sozialen Impulse, ohne eine neue Ära des Menschentums die Gesellschaft nicht zu retten war.
Auch darin aber stand er ganz auf dem Standpunkt seines Vorbildes, des Kaisers Augustus.
Augustus gab seine berühmte Ehegesetzgebung; in gleichem Interesse schrieb Seneca seine inhaltreiche Schrift „über die Ehe“. Wer will hier noch den Zusammenhang verkennen[363]? Aber auch sonst hatte Augustus das Volk, insbesondere die höheren Stände, durch Verbreitung moralischer Schriften sanieren wollen. Da der Kaiser sie aber nicht selbst verfassen konnte, so hob er, wie Sueton erzählt, aus der besten Literatur der Vergangenheit persönlich viele wertvolle Stellen aus und verbreitete sie durch Vorlesung und durch Abschriften mit Hochdruck. Es war ihm bitter ernst damit[364]. Erst durch diese Parallele wird Senecas Schriftstellerei ganz verständlich. Auch sie war in ihren wichtigsten Teilen ein Produkt der actio, nicht der contemplatio. Seine Schriften sind Regierungshandlungen, Erzeugnisse der Staatsfürsorge, die aber aus einem warmen, ja, weichen Herzen kommen, mit dem apostolischen Aufruf an jeden Einzelnen: Laß dich überzeugen! Der Guten sind zu wenige[365]. Werde gut, lerne Menschenliebe, lebe dem Staat und stütze das Ganze. Denn die menschliche Gesellschaft ist wie ein schwebendes Tonnengewölbe. Ein Stein muß dem anderen Halt geben, ein gegenseitiges Tragen: sonst bricht das Ganze zusammen[366].
An die Spitze aber stellte er das alte Gebot, das vetus praeceptum, das jeder Frömmste auch heute von ihm annehmen kann: Folge Gott! deum sequere[367].
Nur in einem ist Seneca bewußt und geradezu umstürzlerisch über sein Vorbild Augustus hinausgegangen: in seiner Polemik[S. 188] gegen den Aberglauben — de superstitione —, in der er weitausholend und in schneidendem Tone die Äußerlichkeiten im Ritus der herkömmlichen Gottesdienste sowohl der römischen Staatsreligion wie beiläufig auch der jüdischen bekämpft hat[368] von dem Grundsatz aus, daß der Mensch mit Gott überhaupt nur innerlich verkehren kann und der Ritus der äußerlichen Gebärden eine Torheit ist[369]. Auch über das Begräbniswesen hat er sich auf das freieste geäußert[370]. Hier steht Seneca als fortschrittlicher Theologe vor uns, der, wo immer er den Volksvorstellungen nicht nachgeben zu müssen glaubte, aus Trieb mehr noch als aus dogmatischen Gründen im Monotheismus lebte. „Gott hat so viele Namen wie Gaben,“ sagt er[371], d. h. der Polytheismus ist nur eine Vielnamigkeit Gottes. Es ist klar, daß er mit jenen Ausführungen damals in vielen Herzen dem Christentum freie Bahn geschafft haben muß; jedenfalls hat er dem Christentum gegen die heidnischen Kulte die schärfste Waffe geliefert, bis die Kirche selbst dem Ritus der äußerlichen Gebärden verfiel.
Man möchte wissen, ob er auch diese destruktive Schrift in der Zeit seiner Reichsverwaltung geschrieben hat[372]?
[S. 189]
Im Lager der römischen Truppen sitzt Pilatus, der Landpfleger, im Gebäude des Prätorium zu Gericht über Christus, der sich den König der Juden genannt hat. Christus ist zum Tode verurteilt. Während er hinausgeführt wird und durch das Lager schreitet, fallen die Soldaten über ihn her und treiben grausame Späße mit ihm: sie krönen ihn, geben ihm Krönungsmantel und Zepter; die Krone machen sie aus Dorngestrüpp; der Mantel ist wirklicher Purpur (πορφυρᾶ), das Zepter ein Rohr (κάλαμος). Dies tun sie, wie wir betonen, weil Christus sich selbst König genannt hat.
Wir nehmen an, daß dies tatsächlich so vorgefallen. Denn der Vorgang hat nichts innerlich Unglaubwürdiges. Es ist aber die Frage, ob die Legionäre ganz aus freien Stücken auf diese grausam theatralische Art der Verhöhnung, die der Hinrichtung voraufging, verfielen oder ob gewisse verbreitete Anschauungen ihnen dazu die Anregung gaben. Waren sie nun aus Gallien, Spanien, Germanien oder einem anderen Teil des Reichs dorthin versetzt, ohne Zweifel standen sie doch unter dem Einfluß griechisch-römischer Tradition und Lebensweise. Es ist in diesem Sinne von verschiedenen Gelehrten verschiedenes kombiniert worden, Glaubliches und Unglaubliches[373]. Das vollkommen Zutreffende scheint mir noch nicht gesagt zu sein.
Mancher wird wohl mit Scheu Teile der Passionsgeschichte, die der Gegenstand seiner andächtigen Versenkung sind, in Beziehung gebracht sehen zu sehr trivialen Verhältnissen des damaligen Lebens. Aber Christi Leidensgeschichte ist doch in die Gesamtgeschichte der Menschheit fest eingewebt, und so ist es ein begreifliches Verlangen, wenn wir die unscheinbaren Fäden zu verfolgen suchen, durch die sie mit ihrer nächsten Umgebung, mit dem Leben der profanen Wirklichkeit zusammenhängt. Sie selbst wird dadurch an Glaublichkeit nur gewinnen.
Auf der Suche nach Analogien ist man freilich bis zu den[S. 190] Skythen gelangt. Die Saker (Σάκαι) waren ein Skythenvolk nördlich von Persien. In Babylonien und bei den Persern feierte man ein nach ihnen benanntes Fest, die Sakäen (Σάκαια), von dem die Griechen wiederholt berichten. Der Redner Dio von Prusa weiß darüber mehr als andere und gibt seinem Publikum den sensationellen Bericht zum besten: Um das Fest dem Ritus gemäß zu begehen, hatte man einen zum Tode verurteilten Verbrecher nötig. Der Verbrecher wird auf den Thron des Königs gesetzt, wird mit dem Königsornat bekleidet und man läßt ihn üppig leben, auch den Kebsweibern des Königs beiwohnen; dann aber wird er entkleidet, wird gepeitscht und verbrannt. Es ist das Prinzip der Henkersmahlzeit vor der Exekution. Wer kann darin aber im Ernste eine Übereinstimmung mit der evangelischen Erzählung finden? Und was haben die Gewohnheiten der Römer und Griechen mit den Sakäen zu tun? Vor allem aber besteht der unabweisliche Verdacht, daß der Redner Dio hier phantasiert oder nur eine Fabelei anderer zum besten gibt. Dies haben schon andere[374] mit Recht gesagt. Denn die ältesten, zuverlässigsten Nachrichten über die Sakäen wissen von Menschenopfern an diesem bacchantischen Feste nichts.
Im Altertum war das Königwerden die Traumsehnsucht des Armen. Das ist Märchenton. „Ich werde König heißen,“ so träumt der darbende Fischer Gripus beim Plautus, als er einen Goldfund in seinem Netz hat; „ich will Bürger Athens, nein, ich will Archont, nein, ich will König werden!“ so träumt auch der gedrückte Sklave bei dem Popularphilosophen Teles[375]. Mit Rührung wird uns darum erzählt, wie Alexander der Große einmal einen Veteranen seines Heeres im Schnee liegen und verschmachten sieht und wie er ihn großmütig auf seinen Thron setzt, um ihn zu retten[376]. Noch beweglicher die Geschichte von dem Kyprier Alynomos, der vornehm, doch ganz verarmt, einsam in einem Garten lebt. Da wird das Königtum in Paphos erledigt. Alexander der Große läßt nach Alynomos suchen. Das Männlein begoß eben ein Beet mit Wasser und[S. 191] erschrak heftig, als des Königs Gesandte ihn fanden. Im schlichten Kittel wird er vor Alexander geführt. Der kleidete ihn allsogleich in Purpur und machte ihn zum König von Paphos. „So macht das Glück Könige,“ ruft Plutarch aus, der uns dies erzählt; „nur der Anzug wird gewechselt, und man hofft und gewärtigt es selber nicht.“
Nur der Anzug wird gewechselt! Verkleidung! Maskerade! Es wäre begreiflich, wenn auch das Volkstheater damals gelegentlich derartige Traumkönige auf die Bühne gebracht hätte.
Lassen wir uns darum zunächst an die Saturnalien Roms erinnern, denen ein griechisches Kronosfest (Κρόνια) entsprach; es ist ein Umweg, den wir gehen, aber er wird sich als nicht zwecklos erweisen. In diesem glückseligen Karneval der alten Saturnalien, dem großen Schenkfest des Dezember, an dem alljährlich sieben Tage lang die Sklaven als Freie und die Armen als Reiche galten, gab es auch einen Narrenkönig, der durchs Los gewählt wurde[377].
Lucian ist uns dafür Hauptzeuge, und er redet von einem zweifachen Königtum. Erstlich war es der Gott Saturn (Kronos), der beim Fest selbst auftrat und von jemandem aus der Gesellschaft dargestellt wurde, und zwar nicht etwa als grämlicher Greis, sondern munter und kräftig, und, was das wichtigste, im Königsornat[378]. Es ist ja auch kein Zweifel, daß der Kronos-Saturn, mit dem der geistreiche Lucian in dem Schriftenkomplex Nr. 70 sich und seine Leser unterhält, nicht der Gott selbst, sondern des Gottes Maske ist, d. h. der von einem Menschen im Mummenschanz dargestellte Festkönig Kronos, der, wenn er den Traurigen fröhlich machen will, ihm nicht etwa, wie sonst die Götter, im Traum erscheint, sondern ihn leibhaftig von hinten am Ohr faßt und ihn gehörig schüttelt, mit dem sich also auch bequem die allerlustigsten Gespräche führen lassen und der da auch Briefe erhält und schreibt (der erste dieser Briefe ist von „Ich“ an den Kronos gerichtet). Was Lucian da gibt, ist nichts anderes als eine Karnevalszeitung, in der Prinz Karneval-Kronos die Hauptperson ausmacht. Desselben[S. 192] Majestät erläßt denn daselbst auch Gesetze für das Fest, die die Reichen sich in ihren Atrien auf einer Säule aufstellen sollen; dazu die arge Drohung: Wer die Gesetze übertritt, den wird dieser König zum Kybelepriester und Eunuchen machen[379].
In allen Städten, ob groß ob klein, auch in den Feldlagern und Kasernen war so alljährlich König Kronos zu sehen. Zu seinen Aufgaben aber gehörte nicht nur, daß er selbst allen voran sich betrank, würfelte und liebte, sodann auch dies, daß er wieder Festkönige schuf, die ihm irgendwie unterstellt waren (ἄρχοντας καθιστάναι 70 1, 2). Beim Wettrinken und Würfeln, heißt es, verleiht er den Sieg und macht, daß der, der ihn darum recht bittet, König wird[380], so daß der so zum Herrscher Erhobene allen alles befehlen kann, dem einen, daß er einen satyresken Tanz zum besten gibt, dem anderen, daß er selbst sich als niederträchtig und gemein beschimpfe, dem dritten, daß er mit der Musikantin auf dem Arm dreimal ums Haus renne u. a. m. Leider, sagt Kronos, ist dies Königtum, das ich verleihe, nur kurz; aber das meine währt ja nicht länger[381].
Man kann indes annehmen, daß die von Kronos, d. h. die durch das Los kreierten Festkönige und der König Kronos selbst gewiß häufig in einer Person zusammenfielen[382]. Wie dem auch sei, jedenfalls sah sich auf diese Weise so mancher arme Schelm aus der Masse des Volkes oftmals in lustiger Verkleidung zum König erhoben, bis dann mit dem Fest auch sein Glanz erlosch. Das war also gleichsam ein Theaterspiel, in dem das schmausende und zechende Publikum selbst die Rollen übernahm, ein Mummenschanz, in dem der erste beste, er sei noch so kläglich, als König und Hauptperson Gegenstand parodischer Huldigungen und durchgängig sehr harmloser Späße wurde[383].
Endlich aber beachte man nun noch, daß von Seneca, wie es scheint, mit solcher Narrenkönigsrolle die Regierung des Kaisers Claudius verglichen worden ist. Seneca sagt, daß dieser Claudius sich Zeit seines Lebens wie ein „Saturnalicius princeps“ benahm[384]. Damit kann freilich auch nur gesagt sein, daß Claudius ein Kaiser (princeps) war, der die Saturnalien[S. 193] liebte. Aber es ist gewiß echter, weil pointierter, wenn wir verstehen: er benahm sich stets wie ein Saturnalienkönig[385]. Das will besagen: seine Diener und Freigelassenen spielten dem Kaiser auf der Nase herum, und über der unermeßlichen Vergnügtheit vergaß er alle Pflichten. Ist dies aber zutreffend, so ist auch der Charakter der Rolle des Saturnalienkönigs noch weiter klargestellt: wir stellen fest, daß für ihn der Charakter des Tölpels oder des „Stupidus“ — denn dies war Claudius — wesentlich war.
Allein diese gutmütigen und platten Späße nützen uns anscheinend in unserer Sache nichts. Jede Analogie zur Verhöhnung Christi fehlt. Es fehlt auch jede körperliche Mißhandlung. Es handelte sich ja bei dem Fest auch nicht um einen zum Tode verurteilten Verbrecher; und der Saturnalienkönig nannte sich denn doch mit Recht Saturnalienkönig, Christus nannte sich nach Ansicht seiner Peiniger mit Unrecht König der Juden.
Jedenfalls aber ist als unglaubwürdig und schwindelhaft beiseite zu lassen[386], was uns um das Jahr 300 n. Chr. einmal in den Akten des Hl. Dasius zur Sache gesagt wird. Um nämlich das Heidentum in Verruf zu bringen, ersannen die christlichen Martyrienerzähler damals Schreckensmären von Menschenopfern: wenn die Soldaten im Heerlager das Fest begingen, habe sich der Saturnalienkönig, nachdem er an allen Freuden des Lebens einige Tage lang sich gütlich getan, den Göttern schlachten lassen müssen. So wird der Hergang auf einmal ähnlich dem am Sakäenfest, von dem Dio fabelt. Davon weiß aber das Altertum tatsächlich nichts. Es ist tendenziöse Erfindung.
Gehen wir weiter. Jener Mummenschanz, mit dem das Volk Roms und Griechenlands sein Verbrüderungsfest verschönte und der oft auch den Armen und Geringen für wenige Tage zum König machte, ließ sich nun auch wirklich auf das Theater bringen. Dafür haben wir einen Nachweis. Philos Schrift gegen Flaccus cp. 5 f. ist Zeuge. In Alexandrien in Ägypten trug sich Folgendes zu.
[S. 194]
Der Judenhaß war in Alexandria eine Macht. Gleichwohl und obgleich er gewarnt war, begab sich der König der Juden, Agrippa I., von Rom aus in die erregbare Stadt. Alsbald aber fiel die Spottlust des Janhagels über ihn her, so oft er sich auf der Straße sehen ließ, und der römische Präfekt Flaccus rührte sich nicht; er ließ die Straßenpolizei nicht einschreiten. Als sich Agrippa im Gymnasion zeigte, da griffen die jungen Leute sich einen nackten, d. h. dürftig gekleideten und blödsinnigen Menschen (μεμηνώς τις) mit Namen Karabas, der das Gespött der Straßenjungen war, von der Gasse auf, stellten ihn auf ein Podium, krönten ihn, indem sie eine offene Buchrolle auf seinem Kopf zum Diadem zusammenlegten, hingen ihm einen Fußteppich als Krönungsmantel um und gaben ihm endlich statt des Zepters ein Stück von einem Schaft des Papyrusschilfs, das weggeworfen auf dem Pflaster lag. Das geschah aber, sagt Philo, in Nachahmung der Mimen im Theater (ὡς ἐν θεατρικοῖς μίμοις). Denn diese Leute hatten keine feinere Bildung (βραδεῖς τὰ καλὰ παιδεύεσθαι), sondern bei den Dichtern der gemeinsten Volksschwänke gingen sie in die Lehre (ποιηταις μίμων καὶ γελοίων διδασκάλοις χρώμενοι)[387].
Ein Papyrusschaft als Zepter! eine Buchrolle als Krone! Derartige Verkleidungen sah man damals also wirklich auch auf der Bühne. Aber auch von dem, was Philo noch weiter hinzufügt, werden wir annehmen dürfen, daß darin dieselben Theaterstücke nachgeahmt sind, wenn schon Philo dies nicht ausdrücklich sagt. Denn der Bericht geht weiter. So stand also Karabas als König da. Junge Leute stellten sich (jedenfalls auf demselben Podium) als Gefolgschaft um ihn herum und spielten eine Szene; sie huldigten ihm (ἀσπάζεσθαι) und gingen ihn dann um Rechtsentscheidungen und um Entscheidungen in Verwaltungssachen an. Die Menge aber bildete um die Gruppe einen Kreis, wie um den Pulzinellkasten, und auf einmal scholl aus dem Publikum der Ruf: „Maris!“ Maris hieß nämlich, sagt Philo, auf syrisch „der Herr“. Agrippa selbst aber war Syrer.
Wir dürfen voraussetzen, daß solche Szenen wie die geschilderte[S. 195] im Volksschwank oder Mimus damals beliebt waren. Daraus hat ein Gelehrter[388] den zunächst wirklich naheliegenden Schluß gezogen, daß auch die Kriegsknechte im Evangelium diesen nämlichen Volksschwank gekannt haben und daß in der Verhöhnung Christi dieser Schwank von ihnen nachgebildet, gespielt worden ist. Das Leiden des Herrn eine Theaterszene! Christus ein Opfer der Parodie und des Mimus!
In der Tat liebte der Schwank die Parodie; er liebte auch das Improvisieren, und um den königlichen Prunk nachzuahmen, konnte er sich damit begnügen, Krone, Mantel und Zepter mit geringwertigen Gegenständen, wie sie sich eben darboten, zu ersetzen; das wirkte drollig und rührsam zugleich. Dementsprechend erhält also auch Christus von den Soldaten das Rohr statt des Zepters, zur Krone aber werden Dornen verwandt, von denen wir annehmen können, daß sie am nächsten zur Hand waren. Die Übereinstimmung ist augenfällig.
Aber wir dürfen auch die Unterschiede nicht übersehen, und der irrt, wer da glaubt, die biblische Erzählung aus Philo wirklich hinlänglich erklären zu können.
Der Pseudokönig Karabas, von dem Philo redet, wird auch aufgefordert, Recht zu sprechen. Es bleibt aber zweifelhaft, ob das wirklich zu seiner eigenen Verhöhnung geschah. Wie die Handlung in solchem Königsmimus verlief, wissen wir gar nicht. Auch Philo sagt es uns nicht[389]. Es ist aber denkbar und vorläufig die nächstliegende Annahme, daß darin einfach der Glückstraum des Armen, von dem ich sprach, verwirklicht wurde und also die Verlegenheit eines Menschen wie Alynomos zur Darstellung kam, der, aus der Armut aufgelesen, plötzlich im Purpur Recht sprechen und regieren soll. Da der Mimus vielfach ein Spiel aus dem Stegreif war, wurde dabei, wie gesagt, auch das Königsornat improvisiert und der erste beste Gegenstand dazu verwendet.
Jedenfalls ist bei Philo nicht Karabas selbst das Ziel des Hohnes, sondern Agrippa. Nur angesichts des anwesenden Königs Agrippa erhielt die Karabasszene die Pointe beißender[S. 196] Satire und diente dem Zwecke der Verhöhnung. Das ist klar. Agrippa sollte sich in dem armseligen Tropf wiedererkennen. „Auch Agrippa ist nichts als solch ein kümmerlicher Regent von Glückes Gnaden, der da vom Herrschen und Richten nichts versteht!“ das war der Sinn, das war der Witz der Sache.
Suchen wir uns das Theaterstück, von dem die Karabasszene nur eine Nachahmung war, selbst vorzustellen, so hatte dasselbe sicher keine Spitze gegen die Juden Alexandriens[390]. Denn nirgends steht hiervon irgend etwas angedeutet. Aber auch sonst war das Stück gewiß tendenzlos und viel mehr rührsam als roh[391]: sein Gegenstand ein armer Schlucker, der, wie er sich vielleicht heimlich gewünscht, oder auch ganz gegen seinen Willen, plötzlich König wird, der sich aber als Stupidus ausweist und schließlich erleichtert wieder in sein Nichts zurücksinkt.
Dieser Mimus braucht also von den Königsmaskeraden des Saturnalienfaschings gar nicht wesentlich verschieden gewesen zu sein. Im Gegenteil! Kein Zweifel, daß auch die Saturnalienkönige in schlichteren Verkehrskreisen und in den Kleinstädten nicht etwa immer in Gold und kostbare Stoffe gekleidet wurden, sondern daß man sich dabei gerade so, wie wir es beim Karabas sehen, um den Spaß zu steigern, in echt karnevalistischer Sorglosigkeit mit geringwertigen und parodistischen Hilfsmitteln begnügte. Vor allem aber beachte man, daß nach Philo jener Karabas, der den König darstellt, ein Blödsinniger oder Schwachsinniger ist. Der dämlichste Mensch wird ausgesucht; er war für diese Rolle just der geeignetste. Ganz ebenso haben wir aber vorhin auch für den Saturnalienkönig den Charakter des Tölpels und Stupidus festgestellt, genauer den Charakter des „fatuus“ oder Blödsinnigen, der auch im Sprichwort ausdrücklich mit dem „König“ zusammengebracht wurde; ich meine das Sprichwort, von dem Seneca in seiner Claudiussatire ausgeht: aut fatuum aut regem nasci oportere: „ein wahrer König oder ein wahrer Stumpfbold kann man nur von Geburt sein!“ Kaiser Claudius aber,[S. 197] der Saturnalienkönig, war sogar beides in eins, fatuus und rex[392].
Aber die Ähnlichkeit zwischen Karabas und dem Kaiser Claudius geht noch weiter. Die wirklichen Verdienste dieses Regenten kommen hier natürlich nicht in Betracht, sondern nur die Anschauung, die über ihn in seiner eigenen Familie, in der vornehmen Welt Roms und, als Claudius starb, auch bei Seneca herrschte. Danach war Claudius „fatuus“, schwachsinnig und unzurechnungsfähig von Geburt an[393], wie Karabas. Aber er hatte gar keine Aussichten, König zu werden, und lebte die längste Zeit seines Lebens ganz verborgen und verachtet[394], wie Karabas. Wider den eigenen Willen wird er dann zum Monarchen erhoben, wie Karabas. Aber er benimmt sich dabei wie ein alberner Saturnalienkönig, so wie sich ohne Frage auch Karabas in der Mimusszene seiner Natur gemäß verhalten haben muß. Nach dem Ausdruck Senecas[395] dehnte Claudius die Saturnalien als Saturnalienkönig über das ganze Jahr aus; d. h. sein Narrenregiment kam nie zu Verstande. Wer will leugnen, daß zwischen der Vorstellung vom Saturnalienkönig und dem einfältigen König im Mimus bei Philo kein wesentlicher Unterschied, sondern vielmehr ein naher Zusammenhang besteht?
Blicken wir endlich zurück und vergleichen nochmals den Evangelienbericht, so ergibt sich nun mehr als ein Unterschied. Denn in der Bibel will Christus selbst König sein, und das ist es, weshalb er verhöhnt wird. Bei Philo will Karabas selbst durchaus nicht König sein, und darum richtet sich der Hohn der Mitspieler auch nicht gegen ihn, sondern nur gegen den König Agrippa, der zuschaut. Der Unterschied liegt auf der Hand. Er macht aber die vorhin bemerkte Übereinstimmung zwischen der Karabasszene und dem Evangelienbericht vollkommen illusorisch.
Dazu kommt der zweite und bedeutendere Unterschied, daß dem Mimus nämlich augenscheinlich jede rohere Handlung abging. In den Evangelien gipfelt ja die grausame Komödie[S. 198] darin, daß die Soldaten, die eben noch vor Jesus knieten und ihn begrüßten: „Sei gegrüßt, König der Juden!“ ihn plötzlich anspeien und ihm mit dem gewiß sehr festen Rohr, das als Zepter dient, aufs Haupt schlagen. In der Szene, die Philo gibt, denkt niemand daran, Karabas zu vergewaltigen. Wir müssen also den griechischen Mimus mit Nachdruck von aller Schuld lossprechen: zu der Christuspassion hat sein Vorbild ganz gewiß keinen Anlaß gegeben.
Es fehlt demnach immer noch der Nachweis, woher es kommt, daß dieselbe Person, der man den königlichen Schmuck anlegt, auch Gegenstand der Verhöhnung, ja, auch der Züchtigung und Peinigung wird.
Man wird ein weiteres Suchen wertlos und zwecklos finden. Die Geschichte der Schrift, kurz und ergreifend wie sie ist, erklärt sich aus sich selber. Die Handlung entstand aus der Situation. Ganz ohne Zweifel! Wozu also noch weitere Analogien? Und doch wird, was wir lesen, begreiflicher, es verliert gleichsam das Zusammenhanglose und stellt sich auf den Boden der Zeitgeschichte, wenn wir uns noch an anderes erinnern und bei den Römern selbst weitere Belehrung suchen. Wir fragen nicht den Mimus, sondern die Geschichte.
Ich denke zunächst und vor allem an die „Sardi venales“ Roms, so seltsam sie klingen und so verschüttet auch ihr Andenken bei den Historikern ist. Als die Etrusker niedergeworfen, als Veji, die mächtigste Feindin in Roms Nähe, erobert war, wurde in Rom an den kapitolinischen Spielen[396], die nie staatlich, sondern von einer Privatgenossenschaft im Oktober ausgerichtet wurden, eine symbolische Handlung üblich, die seitdem jährlich sich wiederholte; es war eine Auktionsszene. Aus der Schar der verkäuflichen Sklaven wurde ein möglichst kümmerlicher Greis (senex deterrimus) ausgewählt, in das königliche Prachtornat der Etrusker nebst goldner „bulla“ eingekleidet und so fürstlich angetan zum Verkauf vom Forum auf das Kapitol über die Sacra via geführt. Es war dies also der König Vejis selbst, in tragikomischer Travestie, an dem sich[S. 199] das übermütige Volk der Sieger „voll Hohn“[397] immer wieder belustigt hat. Wie leicht hätte da auch schon der Spott die Formel finden können: „Sei gegrüßt, König der Etrusker!“ In Wirklichkeit wird uns auch hier wieder (wie bei Karabas und Kaiser Claudius) die Dummheit dieses Königs betont[398]; sonst hören wir nur, daß ein Marktschreier (praeco) den Spottkönig nebst Gefolge mit dem Ausruf „Sardi venales“, d. h. „hier sind Sarder zu kaufen!“ begleitete. Die Etrusker leiteten sich nämlich von Sardes in Kleinasien her.
Zu körperlichen Mißhandlungen kam es jedoch hierbei nicht. Denn man hatte den König Vejis nicht selbst vor sich, sondern nur sein mimisches Abbild. Sowohl Einkleidung aber wie Verhöhnung liegt hier, wie man sieht, tatsächlich vor; nach Plutarchs Zeugnis sah man diesen Spottkönig in Rom wirklich alljährlich bis in seine Zeit, d. h. bis zum Jahre 100 n. Chr. und später[399], also eben in der Zeit, als die Evangelien geschrieben wurden, und wir beginnen schon jetzt zu begreifen, wie es gekommen, daß auch die Einkleidung des „Königs der Juden“ Jesus Christus und seine Verhöhnung von den Kriegsleuten eben desselben Volkes geschah, bei dem solcher brutaler Mummenschanz zum alljährlichen Festprogramm gehörte.
Ein paar Jahrzehnte aber nach Christi Leiden spielt sich in Rom der Tod des Kaisers Vitellius ab. Da hören wir[400]: Vespasians Truppen rücken gegen Roms Mauern. Vitellius ist besiegt. Er hat seinen Purpur abgeworfen und verbirgt sich auf dem Palatin, in Lumpen gekleidet, um nachts nach Terracina zu entweichen. Die feindlichen Soldaten aber, die sein Kaisertum nicht anerkennen und bekämpfen, suchen nach ihm, finden ihn beschmutzt und mit Blut besudelt. Sie zerreißen ihm das Kleid am Leibe, binden ihm wie einem verurteilten Verbrecher die Hände auf den Rücken, führen ihn über die Sacra via, wo er noch gestern im königlichen Wagen fuhr, auf das Forum, wo er sonst als Herrscher Recht gesprochen. Und die einen schlagen ihn nun, die anderen zupfen ihn am[S. 200] Kinn, alle verspotten ihn voll Übermut, indem sie ihm sein wollüstiges Leben vorwerfen. Er senkt den Kopf vor Scham. Da stechen sie ihn von unten mit den Dolchen ins Kinn, so daß er das Haupt aufrichten muß. Ein keltischer Soldat hat Mitleid und versucht Vitellius zu töten, um ihm weitere Grausamkeiten zu ersparen. Aber der Versuch mißlingt, und mit Gelächter geht es weiter bis zum Gefängnis. Endlich wird er niedergehauen.
Christus und Kaiser Vitellius! welch eine Zusammenstellung! Und doch haben wir in jener wüsten Greuelszene endlich ein wirkliches Pendant zu dem gefunden, was die Soldaten dem Heiland vor seiner letzten Stunde angetan. Hier haben wir das, was im Mimus bei Philo vollständig fehlt: der Mann, der da leidet, ist Prätendent; Vitellius prätendiert Kaiser zu sein; Christus prätendiert König zu sein. Darum und durch diesen Anspruch lenken beide den Hohn auf sich, und darum werden sie auch gepeinigt, damit sie nämlich an ihrem Leibe ihre Wehrlosigkeit merken und wie wenig sie in Wirklichkeit König sind. In beiden Fällen handelt es sich außerdem um die Hinrichtung des Prätendenten; in beiden Fällen aber kann die Soldateska Roms sich nicht entschließen, sie sofort zu vollstrecken, sondern treibt zuvor, wie das Raubtier mit seiner Beute ein grausames Spiel, wobei zu den Spottreden die Stockschläge kommen (ῥαπίζειν Cassius Dio; διδόναι ῥαπίσπατα Evangel. Johann. 19, 3).
Es ist gut, den römischen Soldaten zu kennen, wenn man sein Verhalten verstehen will. Was ich aber behaupte, ist zweierlei, und dies muß scharf unterschieden werden.
Wenn die Soldaten auf den für sie ergötzlichen Einfall kamen, Christus als König zu verkleiden und zu krönen, so ist ihnen das gewiß eingegeben durch die Erinnerung an einen Mummenschanz, der, wie gezeigt, damals auch sonst im Schwang und weit verbreitet, der gelegentlich im Volkstheater des Mimus zu sehen, der vor allem in Rom alljährlich im Oktober beim kapitolinischen Fest der Sardi venales und gleich[S. 201] danach im Dezember beim Saturnalienfest gang und gäbe war. Das Wichtigste an dem Hergang im Evangelium erklärt sich jedoch vielmehr aus dem historischen Moment selbst, aus unmittelbarer Eingebung und aus der brutal kaltherzigen Grausamkeit des gemeinen Mannes im Heer, jenes römischen Söldlings, der die Könige Mazedoniens und Numidiens dereinst gefangen nach Rom geschleppt und für den jetzt eben die Zeit herankam, wo er frevelhaft übermütig die Kaiser Roms selbst machte und wieder vernichtete. So sehen wir, wie er sich daran weidet, als Henkersknecht seine Übermacht an dem Wehrlosen auszulassen, der den Purpur beansprucht, ohne ihn behaupten zu können. Diese unheimlich gärende Macht, die sich zuerst beim Tode des Vitellius vor uns so grausig und erschreckend enthüllt, dieselbe ist es auch, die sich im gleichen Triebe, aber voll Mißverstand an dem „König“ Christus vergriffen hat.
Wir haben bisher nur die roheren Volksschichten des antiken Lebens, die einer höheren Schulbildung und dem veredelnden Einfluß der griechischen praktischen Philosophie nicht ausgesetzt waren, ins Auge gefaßt. Das ist aber ungerecht. Versuchen wir daher schließlich auch noch, uns vorzustellen — und das ist wertvoller als alles bisher Gesagte —, welchen Eindruck die evangelische Erzählung, von der wir gehandelt, zur Zeit, als sie erschien, auf die wirklich gebildete griechische Welt machte, d. i. vor allem auf solche Männer — und sie zählten allerorts zu Tausenden —, denen Religiosität und Trieb zur sittlichen Läuterung damals die wichtigsten Werte und Kraftquellen der Kultur und aller menschlichen Existenz schienen. Ich meine die Anhänger der Stoa und des Cynismus, die da Reichtum und Ehre und Luxus und selbst die Liebesfreuden verachten lehrten, sich allen sog. Glücksgütern entzogen und die Selbstzucht bis zur Bedürfnislosigkeit trieben. So sehr sie auf den Kaiser Roms herabsahen: der Königsbegriff stand als Gipfel des Wünschenswerten doch auch bei diesen Männern obenan. Diogenes braucht einen Alexander den Großen,[S. 202] um sich sagen zu können: ich bin mehr als er. König sein! das ist auch hier das Schlagwort. Mit lang hallendem Echo geht das Wort durch die Jahrhunderte hindurch: „Wer entsagt, ist König!“ Rex eris! Wozu Belege häufen? Ich zitiere für hundert Stellen nur die eine, wo Epiktet in seinen herben Diatriben von dem, der sich, rasch entschlossen, dem mönchischen Leben des Cynikers zuwendet, sagt, daß er nach Zepter und Königtum greift und daß Zeus selbst es ist, der ihn mit Zepter und Diadem bekleidet[401].
Zepter und Krone! Gott gibt sie dem, der sich selbst überwindet! In diesem Sinne und als geläufiges Symbol für den moralischen Sieg der Vollkommenheit im Guten muß damals die Krönung Christi auch auf den stoisch-cynisch erzogenen Griechen tief gewirkt haben. Die Krieger hatten an Christus wider Willen das Rechte getan.
[S. 203]
Die erhabene Muse, die Begeisterung und Andacht wirkt, greift nur in den Himmel zu den Göttern oder in die Vergangenheit, wo die sagenhaften Helden wachsen, auf die kein Staub des platt Alltäglichen und der trivialen Wirklichkeit fällt. Wer die Ideale eines Volkes kennen lernen will, lausche ihrer erhabenen Dichtkunst; wer ihre natürlichen Triebe und Instinkte, der suche seine Scherz- und Spottpoesie auf. Auch sie hat ihre Muse, hat Kunst und Grazie; aber diese Muse schaut nach unten. Indem ein Volksgenosse mit Witzen oder Sticheleien über den anderen herfällt, lernen wir seine Opfer, lernen wir auch ihn selbst, der da redet, nahezu persönlich kennen, und das Menschentum selbst steht lebendig vor uns.
Die alte römische Literatur ist an Invektiven reich; der Römer war in allem stark und wuchtig, so auch im Schimpfen; er verstand sich aber auch auf die Kurzrede, auf den scharfen Schliff des Worts.
Dabei ist es wichtig, zu beachten, welche Angriffsobjekte gewählt werden und welche man vermeidet. Denken wir an unsere heutigen Witzblätter. Der „Simplizissimus“, dessen künstlerische Leistungen so hoch stehen, kannte keine Rücksicht und Vorsicht und übergoß, weit ausgreifend, auch den Offiziersstand, auch hohe Chargen und Würdenträger, auch Geistliche mit seinem ätzenden Hohn. Gutherzig zurückhaltend sind dagegen die „Fliegenden Blätter“, auch „Meggendorf“. Unser Wilhelm Busch hat sich wohl gelegentlich am Hlg. Antonius vergriffen, den Militärstand hat er geschont. Bauern in ihrer tollpatschigen Naivität führen uns die „Fliegenden Blätter“ vor, Gauner vor Gericht, Geldprotzen, die gern adelig wären oder sonst dick tun, verstiegene Dichterlinge, Hausfrauen, die nicht kochen können, oder solche Schönen, die, um zu glänzen, ins Bad reisen wollen und ihrem ächzenden Gatten das Geld aus[S. 204] der Tasche locken, um der Mode zu frönen; dazu auch junge Leutnants mit dem Monokel und palmenhaft schlanker Taille. Man lacht über all die Albernheit, aber man lernt trotzdem das Volk, insonderheit den süddeutschen Menschenschlag, dabei lieben; man muß ihm gut sein.
So führen uns nun auch die römischen Spottdichter in das Stadtvolk, allerdings leider nur in das römische Stadtvolk ein. Auch Rom hatte seine fliegenden Blätter; aber sie fliegen nicht mehr, sondern vieles ist davon verloren und verflogen; der Rest ist festgeheftet im Buch der strengen Literaturgeschichte, und wir müssen sie erst wieder herauslösen und sie wieder in Flug bringen, damit sie leben und lachen.
Wenn wir hier auch von der großen Komödie des Plautus und Terenz ganz absehen, so bleiben noch Dichter genug, an die wir uns halten können: die Reste der Togatendichtung, des Lucilius und der Atellane, sodann Catull, Horaz, die sonstigen Satiriker, vor allem Martial. Gröbster Schimpf, harmlose Scherze klingen da durcheinander. Sehen wir einmal nach, was sie uns bringen und sagen können.
Ein beträchtlicher Teil fällt da freilich gleich für uns weg: das Gebiet der Unanständigkeiten. Die Zote gehörte damals als etwas Selbstverständliches zum Witz, bei Griechen und Römern, ein Merkmal primitiver Urwüchsigkeit, und war nahezu die ergiebigste Quelle für die Satire. Um jemanden gesellschaftlich tot zu schlagen, war dies die bequemste Waffe: man warf ihm sexuelle Gemeinheiten vor. Ob wahr oder unwahr, es blieb immer etwas haften. Auch Julius Caesar ist dem nicht entgangen.
Aber das war nicht nur im Altertum so. Das Christentum hat darin keinen Wandel geschaffen. Das Obszöne gehörte zum Witz durch das ganze Mittelalter (man denke nur an die Fastnachtspiele); es machte sich auch im 16. Jahrhundert erschrecklich breit, ja es reicht noch weiter bis in unsere nächste Nähe. Erst das 19. Jahrhundert hat sich gründlicher davon gesäubert. Diese Dinge bilden ein Stoffgebiet für sich, das wir nicht übersehen[S. 205] dürfen. Wir stellen sein Vorhandensein fest, aber wir wollen nach Möglichkeit vermeiden, es zu betreten.
Drei Arten derjenigen Dichtkunst, die sich nicht in rein ernsthaftem Ton hält, lassen sich, wenn schon die Grenzlinien oft nicht scharf verlaufen, unterscheiden. Oft hat sie nur den Zweck der tendenzlosen Belustigung, was die Griechen u. a. Hilarodia (ἱλαρῳδία) nannten. Man soll nur sorglos lachen. Dahin gehören solche Sachen im Stil der Jobsiade wie der Margites der Griechen oder die Geschichte, wie Odysseus den Zyklopen übertölpelt; dann aber auch das ganze Gebiet der Travestie, die dabei leicht in das Schlüpfrige geht; man denke an Offenbachs Schöne Helena; und diese Spaßmacherei und Ulk wird schließlich kraß realistisch in der Gartendichtkunst der Priapeen.
Anders liegt die Sache beim persönlichen Angriff, wo sich die Bosheit regt. Das Lachen, das da entsteht, ist Schadenfreude, moralische Vernichtung der Zweck. Hier regt sich der Schimpf und greift zu allen Mitteln der Übertreibung und des Grotesken. So fiel schon Nävius über den großen Scipio her, Catull und Calvus über Caesar, Cicero über Antonius, Claudian über Eutrop, den allmächtigen Eunuchen am christlichen Kaiserhof. Tapfer ist es, wenn die Dichter sich dabei offen mit Namen nennen, und Nävius erntete für seine Angriffe Kerkerhaft, Antonius ließ Cicero köpfen. Am häufigsten waren dagegen anonyme Pasquille, die man an die Türen heftete und die das Volk durch die Gassen schrie, so die Verse über den Kaiser Tiberius:
Oktavian, der Triumvir, war ein schlechter Feldherr. Die Militärs in Rom hatten ihren Spaß daran, wie kläglich es ihm im Seekrieg mit Sextus Pompejus bei Sizilien erging. Da ging der Vers um:
[S. 206]
Auch aus dem Kleinleben des verschütteten Pompeji sind uns solche Anwürfe bekannt. Man kreidete sie an die Wände, um den Mitbürger zu ärgern, und da stehen sie z. T. noch heute. Zum Beispiel „Samius wünscht seinem Kollegen, er möge sich erhängen!“ oder „Der Restitutus hat oft viele Mädchen betrogen,“ oder in der Schenke an der Wand:
Während diese Sachen meist kurz sind, je kürzer, je wirksamer, wie gespitzte schlanke Pfeile, liebt die dritte Dichtungsform, von der ich zu reden habe, vielmehr den breiten Aufbau; sie schreitet im breiten Faltenwurf daher. Es ist die römische Satire. Der römischen Satire genügt das Spotten nicht; sie will erziehen. Griechische Humoristen, die zwar bitter ernst in das Leben sahen, aber das Laster nur für eine Torheit der Seele, die Tugend nur für Klugheit hielten, haben die satirische Predigt erfunden. Sie lag dem Römer vortrefflich, er ergoß sein ganzes eigenartiges Wesen hinein und hat sich in ihr ausgelebt von dem großen Lucilius an bis Juvenal und weiter. Die Spottgedichte Martials sind nur kleine lachende Kobolde; die Satire schreitet hochgewachsen, matronenhaft als weise Frau und Gouvernante von Beruf mit strengem Blick und greller Stimme durch die Jahrhunderte Roms, unermüdlich und mit spitzer Zunge scheltend, polternd und ermahnend; denn sie will Rechtschaffenheit, anständige Gesinnung, Wahrheitssinn, bisweilen auch Güte des Herzens lehren und den kleinsinnigen, abgefeimten Praktikern des Lebens die edleren Werte vorhalten, sie an das Sittliche gewöhnen. Da greift sie sich dann den und jenen aus dem Publikum, legt ihn übers Knie und schwingt die Rute, daß er es fühlt und die Zuschauer lachen, aber durch das statuierte Beispiel klug werden. Dann ruht sie aus, schlägt die Hände zusammen und schüttelt sich vor Lachen. Römische Satire und Kapuzinerpredigt: da ist kaum ein Unterschied.[S. 207] Wir wissen, wie der Kapuziner zu den Wallensteinern spricht. Abraham a Santa Clara ist der nächste Verwandte Juvenals.
Die Satire hat in der Tat einen hohen Beruf erfüllt und will ernst genommen werden. Die winzigen Spottepigramme dagegen, im Distichon, Jambus oder Phaläceus, sind Späße des Augenblicks, und der Leser huscht rasch von einem zum anderen. Wozu sie behalten? Es lohnt nicht.
Für den Spätgeborenen aber lohnt das Verweilen doch; ich meine für den, der den Augenblicksmenschen der Gegenwart in der Vergangenheit wiederzufinden sucht. Im Epigramm ist das Leben lebendig: natürliches Leben; Augenblicksleben; römisches Volksleben! Das ist es, was uns jetzt kurz beschäftigen soll.
Einen Vorklang dessen, wonach wir suchen, bringt schon das alte Volkslustspiel der sogenannten Togatkomödie. Nävius, Titinius, Atta und Afranius waren ihre Vertreter. Nur kurze Späßchen sind uns leider daraus erhalten; aber sie wirken mitunter wie Epigramme und werfen ein kurzes Schlaglicht auf die Personen, die da auftraten und die für uns sonst ganz im Dunkeln stehen. „Armselig die Eheherren, die bei ihren Frauen die Magd spielen! Nur die große Mitgift macht’s[404].“ Und diese Weiber sind dem Wein nicht abhold: „Gebt ihr zu trinken,“ heißt es; „denn sie ist eben in Wut[405].“ Ein Modefatzke tritt auf, und man fährt ihn an: „Du trägst ja gedrehte Stirnlöckchen wie ein Hermaphrodit[406].“ „Deine Frau ist zu protzig,“ rät ein Freund dem anderen; „schaff’ Wagen und Maultiere ab und laß sie zu Fuß trollen[407].“ Das Straßenleben tut sich auf, und wir hören den Vorwurf: „Du schreist so auf offener Straße? Schämst du dich nicht vor dem Publikum[408]?“ Endlich der weise Satz: „Es lohnt sich für das Kind nicht, daß seine Eltern leben, wenn sie lieber Furcht als Ehrfurcht erregen wollen[409].“
Die Stücke, aus denen dies genommen ist, waren noch altrömisch; sie fallen noch früher als Ciceros Zeit. In der Zeit Ciceros, da blühte in Rom nun auch schon das Pasquill,[S. 208] und da hören wir auch Namen. Das kühne Wort herrscht. Ein Versteckenspielen gibt es nicht. Ein gewisser Caninius war Konsul in Rom geworden; aber schon folgenden Tages mußte er wieder aus dem Amt; er hat also in seiner hohen Würde nur allzu wenig Schlaf gefunden. Cicero selbst war es, der ihn darum dem Gelächter preisgab:
Allerliebst ist das, aber immerhin noch harmlos. Das Gegenteil des Harmlosen aber war Catull, Ciceros jüngerer Zeitgenosse. Lieb und treuherzig, warm und herzgewinnend in seinen anderen Gedichten, die von Liebe und Freundschaft singen, ist Catull Gift und Galle, wo er angreift, und das unsauberste Wort ist dem Schonungslosen da gerade recht. Abwischpapier nennt er das neue Epos des Volusius. So warf er sich auch auf Julius Caesar. Caesar wurde eben damals groß. Er wurde es durch die Unterstützung des großen Pompejus. Gleichzeitig gab Caesar dem Pompejus seine junge Tochter Julia in die Ehe; Pompejus war also Caesars Schwiegersohn. Den gallischen Krieg hatte er durchgefochten; Mamurra hieß da der Hallunke und Durchgänger, der im gallischen Krieg Caesars rechte Hand war, nicht nur als Genieoffizier, der beim Brückenbau und allem Kriegstechnischen half, sondern auch als Räuber und Ausplünderer des neu unterjochten Landes. Nicht nur mit der rechten, mit beiden Händen griff damals Caesar und seine Kreaturen nach Galliens Reichtümern. Wie ein Wutschrei der Entrüstung sind die Verse, mit denen Catull sofort über Caesar und Mamurra herfällt. Für den Augenblick hastig hingeworfen, sind sie doch ewige Geschichtsdenkmäler, diese Verse. Das Hauptstück sei, damit jenes erregte Leben vor uns aufgehe, hierhergesetzt, indem ich jedoch nicht versäume, einige unerhört krasse Ausdrücke zu mildern[410]:
Lärm und Orkan der großen, der größten Weltgeschichte: davon spüren wir etwas in diesem Probestück. Caesar suchte seinen Frieden mit diesem jungen, sprühenden Genie zu machen; aber Catull beruhigte sich nicht, und wir hören, wie er noch weiter droht: „Abermals sollst du dich über meine Jamben erbosen, du einziger Feldherr[411].“ Dann starb der heißblütige Dichter. Er starb früh; Caesar überlebte ihn.
Der Lärm verstummte. In weit engere Verhältnisse führt uns zu jener Zeit der große Dichter Vergil. Er war der Dichter des edlen Brusttons und des sentimentalen Pathos; sentimental sind nicht nur seine Helden: auch seine Hirten. Aber so war Vergil nicht immer; seine großen Werke schrieb er erst als reiferer Mann und abgekühlten Blutes. Auch er war einst jung und fuhr übermütig derb um sich, wie die anderen, wenn ihn die Torheit der Glücksritter reizte, zu der Zeit, als er noch in seiner norditalienischen Heimat, in Mantua und Cremona lebte, wo er geboren war.
[S. 210]
In Cremona lebte der Inhaber einer Töpferei, mit Namen Atilius. Der „stolze Noctuinus“ kommt und heiratet dessen Tochter. Aber Noctuin ist, so scheint es, Trinker, und heiratet auch noch gleich den Weinkrug, den der Schwiegervater fabriziert. Nach volkstümlicher Redeweise wird der Krug als Tochter des Töpfermeisters gedacht, der ihn geschaffen hat. Nun kommt Vergil dem Noctuin mit einem kleinen boshaften Hochzeitspoem, das für den heutigen Gelehrten unendlich wertvoll ist; denn es ist für uns die einzige erhaltene Probe der sog. „Fescenninen“, des Hochzeitsulks der alten Römer. Der Dichter steht auf der Gasse und ruft das Volk zusammen:
Ob sich Noctuinus nicht an dem Dichter gerächt hat? Denn im Schreibtisch blieb das Gedicht sicher nicht liegen. Anschaulicher noch das andere Stück auf den Sabinus, den Parvenü, der früher bloß Quintio hieß, der in Cremona einst Pferdeknecht gewesen, dann sich zum Spediteur heraufgearbeitet hat. Es war die Zeit von Caesars Gallierkriegen, von denen schon vorhin die Rede war. Große Militärtransporte gingen damals für das Heer über Norditalien nach Frankreich. Allein aus dem nachfolgenden Vergilgedicht lernen wir drei dort ansässige Transportfirmen kennen; berühmter noch war der Großbetrieb des Spediteurs Ventidius Bassus, den Caesar um seiner Verdienste willen hernach zu den höchsten Staatsämtern beförderte. Der Sabinus aber gab, als er glücklich reich geworden, in[S. 211] Cremona sein Geschäft auf, wurde Duumvir oder der höchste Magistrat am Ort und ließ nun in der Vorhalle des Tempels des Castor und Pollux — oder der „Castoren“ — sein Sitzbild aufstellen, das jeder mit Hohn und Ingrimm sah, der ihn einst als Knecht gekannt hatte. Auch den jungen Vergil packt der Grimm, und wir hören:
Dies Gedicht ist in seiner lateinischen Fassung ein Meisterwerk ersten Grades; die Übersetzung kann davon kaum eine Vorstellung geben[412]. Und was das Erfreulichste: sonst bewegt sich alle römische Poesie nur in Rom selbst; hier haben wir einmal echten Lokalton, muntere, kecke italienische Kleinstadtpoesie, wie wir sie sonst nirgends finden.
[S. 212]
Übrigens hätte Vergil sein Gedicht so oder ähnlich auch noch heute schreiben können. Ich denke an den Maultiertreiber Mr. Kerkens in Kansas in Nordamerika. Im Januar 1910 ging durch unsere Zeitungen folgende Notiz: „Der amerikanische Millionär Richard C. Kerkens in St. Louis, der für die Vereinigten Staaten als Botschafter nach Wien geht, hat einen etwas ungewöhnlichen Lebenslauf hinter sich. Er ist in Irland geboren und in seiner Jugend in Fort Leavenworth (Kansas) als Mauleseltreiber beschäftigt gewesen. Später rückte er zum Hilfswarenaufseher auf. Von Leavenworth siedelte er nach Arkansas über und von dort nach St. Louis, wo er in Eisenbahnspekulationen den Grundstein zu seinem heutigen Vermögen legte.“
Alles wiederholt sich nur im Leben; ewig neu ist nur die Poesie.
Satiriker von Beruf war Horaz; er war überdies auch Spottdichter in seinen Jamben (oder Epoden), und es lockt von Vergil zu ihm hinüberzublicken. Denn gleich jenes Sabinusgedicht hat Horaz nachzuahmen versucht[413]; auch bei ihm handelt es sich um einen Emporkömmling, der jetzt stolz mit dreiellenlang-schleppender Toga über die Heilige Straße fegt. Die Sache ist nach Rom verlegt. Aber Horaz duckt sich; er wagt keinen Namen zu nennen. Der Schlag ist ein Schlag ins Wasser. Die Invektive entwaffnet sich und wird zum bloßen Sittenbild.
Gleichwohl gibt uns auch Horaz ein Meisterwerk. Ich meine das berühmte: „Beatus ille qui procul negotiis.“ Mit diesen Worten hebt das Gedicht an[414]. Irgendeine Stimme ist es, die da redet und das schlichte Landleben preist: „Glückselig, wer heute keinen Wucher treibt, sondern wie einst unsere Voreltern sein Feld bestellt! Die Rebe rankt er bräutlich um die Pappel, pfropft Obst und sammelt Honig, liegt zur Sommerzeit im Gras und lauscht dem rieselnden Bach und dem Vogelsang, fängt im Winter Vögel im Garn und jagt den Eber. Da vergißt man alle grauen Geschäftssorgen; Frau und Kinder[S. 213] sind um dich; das Vieh brüllt dir im Pferch und wird gemolken, und man lebt vegetarisch von Oliven, Malven und Sauerampfer, der auf den Wiesen wächst, und nur zum Festtag schmaust man das Opferlamm.“ Wer spricht da? Ist es der Dichter? O nein. Zum Schluß erhalten wir plötzlich die geschäftlich kurze Mitteilung: ein rechter Pflastertreter der Großstadt, ein Wucherer ist es, der sich in diese Phrasen hüllt:
Sonst sind es leider zumeist nur alte Weiber und Megären, die Horaz verhöhnt. Wenn er liebt, liebt er im Grunde nur die Körperlichkeit der Schönen; wenn er höhnt, verhöhnt er nur den Schönheitsverfall und redet von ihren grünen Zähnen und ähnlichem. Man möge das im Horaz selber nachlesen; zum Übersetzen lockt es nicht. Auch noch, als er seine Oden dichtet, laufen dem Horaz solche Motive mit unter; aber er redet jetzt maßvoller. Ein Beispiel ist die Ode I, 25 auf die Lydia; es ist das einzige Liebesgedicht, das ich hier einreihe:
Aufregend war das nicht. Wer frug danach, wer diese Lydia war? Sicher ein Geschöpf der niederen Frauenwelt, deren es tausende gab. Anders Ovid, der eine vornehme Römerin, Furia, verspottete und sagte: „Da du Furia heißt, warum soll ich dich nicht eine Furie nennen?“
Das scheußlichste der Art hat damals übrigens Kaiser Augustus gedichtet. Es sind Schimpfverse auf die Fulvia, die stolze Gattin des Mark Anton, aus der Zeit, als der große Mann und künftige Weltbeglücker noch um die Herrschaft rang. Wir wollen das Epigramm mit Nacht bedecken. Es ist ein Jammer, daß es sich bis auf uns erhalten hat.
Sehen wir uns nach anderem um. Da ist Bavius mit seinem Bruder: ein neues Motiv von der zärtlichen Bruderliebe. Die beiden sind vielleicht sogar Zwillingsbrüder und einander, wie wir hören, so treu, daß sie zeitlebens alles, Landsitz, Stadthaus und Geldwirtschaft miteinander teilen; es war ein Odem und eine Seele in zwei Körpern. Wie rührend! Aber Bavius heiratet; auch die Frau soll gemeinsamer Besitz werden: da kracht die Freundschaft auseinander; das macht der Zorn, und zwei Königreiche mit zwei Gebietern sind entstanden, die sich fürchterlich mit Krieg bedrohen.
Dies kleine Genrebild führt uns nun endlich auf Martial hin. Denn es ist von Domitius Marsus verfaßt, und Martial war der große Nachahmer und Fortsetzer des Catull und des Domitius Marsus. Martial, der unerschöpflich reiche Epigrammatiker aus der Zeit des Kaisers Domitian: ein Spanier von Herkunft, unverheiratet, fest eingelebt in das System der kaiserlichen Despotie, pflichtenlos und gedankenvoll, ein poetischer Bummler, den seine immer gute Laune ernährt: eine Schmeichelkatze ohne viel Ehrgefühl, eine Klientennatur mit dem Talent, auf das anmutigste zu necken, zu loben und zu betteln, der sich als Tischgenosse und Badegenosse der Vornehmen,[S. 215] als Witzemacher und Verseschmied erster Güte Eingang in alle ersten Häuser der Weltstadt verschaffte. Auch als er in den Ritterstand erhoben ist, lungert und katzbuckelt er weiter. Aber seine göttliche Munterkeit, seine Menschenkenntnis und Darstellungskunst steigert sich noch, und wir müssen sie bewundern.
Wie war ein solcher Dichter damals möglich? und warum entfaltete sich die epigrammatische Dichtung in Rom erst so spät? Denn zur wirklichen Entfaltung, zum vollen Sichausleben kam sie tatsächlich erst durch Martial. Die Antwort gibt Vergil. Es gab zu Vergils Zeit in Rom noch keine große Kunst, die sich sehen lassen konnte; wozu sollte man also die kleine pflegen? Ein schreiender Literaturhunger bestand, und mit den winzigen Brocken Catulls ließ er sich nicht stillen. Wer einen Festsaal schmücken will, kann dazu nicht Miniaturen brauchen; große Tafeln muß er aufhängen, großmächtige Schildereien erst einmal entwerfen lassen. Daher warf Vergil seine kleinen Jugendversuche hinter sich und schuf das große Epos, die Äneide. Horaz gab Muster der Satire und erhabenen Lyrik, Properz seine großen Elegienkränze, Ovid den Decamerone seiner Metamorphosen. Das war die Augusteische Literatur; aber sie war noch keineswegs überreich an guten Werken, und daher hat die zweite Blütezeit unter Nero 50 Jahre später mit gutem Grund noch an denselben Aufgaben festgehalten und demselben großen Stil gehuldigt. Der junge Nero selbst dichtete; auch Seneca, sein großer Ratgeber, tat es; und da gab es also neue Hirtengedichte, neue Oden, das Epos des Lucan und des Nero, die Satiren des Persius; ja, sogar auch Tragödien gab es, die einzigen römischen Tragödien, die uns erhalten sind, in denen Cassandra, Phädra, Medea auf hohem Kothurn schreiten und wunderbar fließend Latein sprechen. Nur die Griechen sind es, die damals in Rom das kleine witzige Sinngedicht, das uns angeht, gepflegt haben.
Die Römer selbst aber? Der Großbetrieb war einmal im Gange, und er ging immer noch rastlos weiter; er kulminierte[S. 216] unter Kaiser Domitian, in den fünfzehn Jahren 81–96. Dieser herrische Kaiser war der eifrige Patron aller redenden und singenden Künste; aber er war ein Tyrann und Feind der Freiheit. Da man unter ihm nicht frei denken, also auch nicht philosophieren, nicht einmal Geschichte schreiben durfte, so flüchtete nun alles zur Dichterei; ein angstvolles Gedränge auf dem Parnaß. Der Mensch braucht Geistesgymnastik; aber nur der Turnboden der Verskunst stand damals für diese Gymnastik noch offen. Ein Genie wie Statius tummelte sich da, aber auch Dilettanten in Fülle. Von Jason und von Phineus, von Achill, Diomed und anderen abgestorbenen Helden hallte Rom täglich wieder: diese alten Geschichten konnten freilich den Tyrannen nicht kränken. Aber der Reiz der Neuheit fehlte; das Auge hatte sich an den großgezerrten Heldenbildern längst müde gesehen. Wir kennen das auch heute: wer stundenlang Rubens bewundert hat, atmet glückselig auf, wenn er vor Metsu und Teniers und Netscher, den kleinen munteren Holländern, steht. Auch da, in den Holländern, zeigt sich unendliche Kunst!
Solch ein Holländer ist Martial gewesen. Unter Domitian tat er sein Atelier plötzlich auf, und er brachte Neues. Aus den verstaubten Büchergestellen zog er den fast verschollenen Catull und Domitius Marsus wieder hervor, um sie zu modernisieren; aber er knüpfte zugleich an die feinen Sinngedichte der Griechen an. Und es war gleich wie ein Wunder, eine Offenbarung. Alles riß sich gleich um Martials kleine Bücher. Da war plötzlich ein Meister der Miniaturkunst, ein Dichter, der es wagte, groß im Kleinen zu sein, indem er dreist ins ganz alltägliche Leben griff. Dem Martial ging es im Vergleich zu dem großen Epiker Statius so, wie es Lessing neben Klopstock erging: „Wer wird nicht einen Statius loben? doch wird ihn jeder lesen? Nein. Wir wollen weniger erhoben, doch fleißiger gelesen sein.“ Etwa jedes Jahr warf Martial ein Buch heraus, in jedem Buch nur etwa hundert Nummern. Die Sachen gefielen so, daß sie, obschon für den Moment[S. 217] gedichtet, doch alle Zukunft beherrscht haben. Sie haben das Verdienst, daß sie uns auch erhalten sind.
Versenken wir uns denn in diese Bücher, und ob es auf Kosten unserer Geduld geschieht, indem wir die etwa 1200 Gedichte sortieren. Römisches Großstadtleben wollen wir kennen lernen: dieser Poet zeigt es uns wie kein anderer. Eine Unmasse von Eigennamen wirbelt uns entgegen. Es ist, als ob wir mit dem Stock in einen Ameisenhaufen stießen.
Da ist der Kaiser selber, der sich „Gott und Herr“, man könnte auch übersetzen „Herrgott“[416], nennen läßt; aber er ist unkenntlich hinter einem dicken Vorhang von Weihrauchdunst und Schmeicheleien. Ob er höchstselbst des Dichters Gedichtbücher lesen wird? Die Hofleute müssen sie ihm, wenn er gnädiger Laune ist, in die Hände spielen. Da ist am Hof der Kämmerer Parthenius, der Mann für Bittschriften Entellus usf. Insbesondere Domitians junger Mundschenk, der „Frühlingsknabe“ Earinus wird als der Ganymed des Allmächtigen von Martial besungen. Dazu kommen die großen Paläste der Reichen, des zukünftigen Kaisers Nerva, des Dichters Silius Italicus, der Witwe des Dichters Lucan, des dichtenden Konsularen Stella, des großen Sachwalters Regulus. Da speist unser Dichter gern, läßt sich obendarein beschenken und lobt alle diese hochmögenden Personen mit Namennennung. Sie sind durch ihn verewigt bis heute. Witz und Spott reicht an sie natürlich nicht heran, es sei denn, daß der Dichter Geld braucht. Da wendet er sich einmal an den Regulus (VII, 16):
Der große Herr wird sich wohl amüsiert und hoffentlich auch seine Hand aufgetan haben.
Wo Martial dagegen wirklich spottet und hänselt, da nennt er die wahren Namen nicht. Er sichert sich durch das Pseudonym. Er ist kein geharnischter Catull. Ein Catull war damals nicht mehr möglich. Gerade durch das Pseudonym hat[S. 218] sich Martial den Erfolg in allen Häusern glatt gesichert. Um so offener konnte er reden, und so sind die Personen, die er uns vorgaukelt, Typen, aber echte Typen, wie die Personen unserer Fliegenden Blätter Typen sind. Wenn er die Menschen grob oder giftig anfährt oder mit schallendem Hohn, da handelt es sich fast immer um verliebte Sünden; das sind die altüberkommenen Schändlichkeiten gewisser Kreise; und es bleibt oft zweifelhaft, ob dem Dichter mehr Entrüstung oder Behagen dabei die Feder führt. Im übrigen aber welche Gutmütigkeit! welch friedliches Geplätscher! Diese Fülle menschlicher Schwächen, wie scharf werden sie beobachtet, aber wie milde beurteilt! Kein Zorn packt den Leser an; nur ein malitiöses Lachen, ein wohlgefälliges Lächeln braucht er aufzuwenden. Im Halbtraum nach dem warmen Bade, wo man keine Aufregung, sondern nur leichteste Zerstreuung will, da ist es Zeit für den Römer, in seinem Martial zu blättern.
Zunächst der Dichter selbst. Er wird in der Gesellschaft leider nicht immer gut behandelt, und er unterläßt nicht, sich zu beschweren. Vor allem das liebe Essen. Er geht zu Gast; man legt sich hungrig auf die Speiselager; aber der Wirt läßt nichts auftragen und begnügt sich, einige Parfümerien zu verteilen (III, 12). Schlimmer noch, wenn ein genialer Koch sich darauf versteht, aus bloßem Kürbis ein solennes Essen von vier Gängen zu bestreiten; Linsen und Bohnen, auch Pilze, auch Datteln, auch der Kuchen zum Nachtisch wird aus dem einen kleingehackten Kürbis hergestellt. Das soll was extra Feines sein, und es kostet nichts! Welche Enttäuschung! (XI, 31). Bei einem Vornehmen wohnt der Dichter auf dem Land. Der Mann zieht sein seltenes, exotisches Obst hinter großen Glasscheiben in weiten sonnigen Räumen. „Mir, dem alten Hausfreund, gibt er eine lichtlose Klause, die nur eine handgroße Luke statt des Fensters hat; nicht einmal ein Eiszapfen möchte darin wohnen. Wäre ich doch dein Obst,“ ruft der Dichter. „Da ginge mir’s besser!“ (VIII, 14.) Und überhaupt die öden Pflichten, wenn man Klient ist; man sollte sie[S. 219] einem Dichter doch erleichtern. Martial wendet sich an den Labull.
In diesem Gedicht hören wir auch schon gleich von Martials literarischen Gegnern. Gegen die ist er natürlich unverlegen. Schlagend ist seine Abfertigung:
Einem anderen, der sich selbst vorträgt, dient er folgendermaßen:
Schwieriger als die Konkurrenten ist oft das Publikum selbst. Es gibt so viele, die nur das, was alt ist, bewundern und meinen: was neu ist, kann nicht klassisch sein. Aber Martial ist guten Mutes:
[S. 220]
Nun aber die weitere Umwelt. Wie gutherzig menschenfreundlich ist dieser muntere Geist da oft! Man merkt, er ist der Sohn einer reiferen, menschlicheren Kulturperiode. Von einem Trinker heißt es, gnädig genug:
Von einem unweltlichen Menschen:
Und gar, wie rührend der Vers von dem Blinden:
Alles das könnte auch ebenso noch heute gelten. Aber weiter. Soll ich aus der Fülle noch ein paar Themen auf gut Glück, wie die Zettel aus der Urne, herausgreifen? Über Standesunterschiede im Liebesverkehr (III, 33); von unfähigen Advokaten (VIII, 7); von Emporkömmlingen, die groß tun, bald ist es ein Schuster, bald ein Schneidermeister (IX, 73; III, 18); vom Schulmeister, der mit der Rute fuchtelt (IX, 68) und dem Glück der sommerlichen Schulferien (X, 62); von Bauwut (IX, 46) und sonstiger lächerlicher Verschwendung (VIII, 5; VII, 98); den Toilettenmitteln der Römerinnen (IX, 37). Dazu der sonderbare Mamurra, der in allen Läden stundenlang herumsteht, um mit Kennermiene die Kostbarkeiten zu betrachten, aber gar nichts kauft (IX, 59); Hermogenes, offenbar ein Mensch aus guter Familie, der die Manie hat, überall die Tischservietten zu stehlen (XII, 29). Dazu ein gewisser Klytus, der an Habgier leidet und es verstanden hat, im letzten Jahr achtmal seinen Geburtstag zu feiern, weil es da Geschenke regnet; Martial sagt mit Recht: Auf diese Weise,[S. 221] junger Mensch, wirst du früh zum Greise; denn so wirst du jedes Jahr gleich 8 Jahre älter, ein Neunjähriger kann so schon gleich zweiundsiebzig werden. Auch der Barbier gibt endlich ein nettes Thema. Die Barbiere hatten im Altertum noch keine Seife und mußten sich abmühen, um alle Haare gründlich wegzunehmen. Da kommt der Rasierjunge; er hat ein so glattes Gesicht; aber während der endlos langen Arbeit, die er verrichtet, wächst ihm selbst ein Bart (XI, 84 und VIII, 52).
Doch des Aufzählens genug. Hören wir lieber den Dichter selber. Cinna ist unleidlich, weil er in den Gesellschaften immer so leise spricht:
Es folgt Phileros mit den sieben Frauen, die er beerbt:
Und der frostige Redner Aulus:
Da ist auch Fabulla, die sich für schön hält:
Dann aber tauchen die Zähne der alten Frauen vor uns auf, aber in milderer Beleuchtung als einst bei Horaz:
Gern wurden die Hausärzte beschimpft, die Handlanger der Unterwelt. Davon habe ich schon anderenorts eine blendende Probe gegeben[418]. Hier eine zweite:
Man sieht: der Mensch ist verpflichtet, nicht an Krankheit, sondern an seinem Arzt zu sterben! Rom war eigentlich keine gesunde Stadt; leichtes Fieber stellte sich sehr häufig ein; aber man lief sorglos damit herum. Auch das schildert uns einmal unser Dichter:
Schlimmer ist, wenn Martial einmal den Verdacht des Verbrechens[S. 223] erhebt. Es handelt sich um Brandstiftung. Tongilianus wird von ihm angeredet:
Da sieht man, wie unsere moderne Feuerversicherung im alten Rom ersetzt wurde. Geschäftsfreunde bildeten ein Konsortium, und dem Betroffenen wurde geholfen. Es lag aber auch damals schon nahe, diese Hilfe zu mißbrauchen.
Aber nun endlich Issa, und genug der Alltagsmenschen. Auch zu Issa, dem Hündchen, beugt sich unser Dichter herab. Bei seinem Freund Publius hat er das Tier gesehen. Dies sei das letzte Stück meiner Auslese.
Das ist römisches Leben, bis herab zum Stubenhündchen; wie intim berührt das alles! Aber ich lasse nunmehr den Vorhang fallen. Alle dürftig und ungenügend ist, was ich hier geboten, und wer es kann, sollte den Martial selber lesen. Denn alle Übersetzungen sind doch nur bestenfalls Talmigold oder Simili-Brillanten[419]; in den meisten seiner Miniaturen aber bringt der lebhafte Dichter nebenher noch eine solche Fülle von Anspielungen, daß zum Verständnis eine einfache Übersetzung gar nicht ausreichen würde. Auf alle Fälle aber wird mein Leser begreifen, daß Martial alsbald und durch viele Jahrhunderte immer wieder eifrige Nachahmer gefunden hat.
Aus der Spätantike erwähne ich die Dichter der sog. Anthologia latina, sowie den Ausonius und Luxorius. Die beiden zuletzt genannten sind Christen; gleichwohl steigert sich noch bei ihnen das geflissentliche Aufsuchen des Unanständigen bis zum Monströsen. Wertvoller ist Claudian, der Dichter des christlich gewordenen Kaiserhofes um das Jahr 400; denn in ihm ersteht endlich wieder ein Kämpfer, der es wagt, mit offenem Visier zu beleidigen[420]. Offenbar war es der kaiserliche Hof selbst, der ihn dabei deckte. Neues, was uns fesseln könnte, bringen diese Spätlinge nicht. Nur freilich den Flieger. Der Flieger taucht bei Luxorius auf. Man staune indes nicht allzu sehr; denn in Wirklichkeit war es nur ein Equilibrist. Luxorius lebte im Anfang des 6. Jahrhunderts im afrikanischen Vandalenreich, wo immer noch die altrömische Kultur blühte und es immer noch römische Amphitheater gab. In solchem Raum geschah das Wunder: einen Riesenweitsprung, der dem[S. 225] Flug gleichkam[421], vollführte da ein junger Zirkuskünstler durch die ganze Länge der Arena, wenn wir es glauben wollen, 40 Meter weit. „Es ist kein Mensch,“ sagt der Dichter; „nur Vögeln ist das möglich, und ich wundere mich nicht mehr, daß ein Dädalus einst auf Flügeln über das Meer flog. Guten griechischen Wein hab’ ich dem jungen Menschen kredenzt. Er ist so leicht wie eine Schwalbe, aber der Wein soll ihn schwer machen.“
Wir wollten lernen. Haben wir hiermit endlich genug gelernt? und sind wir in der Lage, ein Endurteil zu fällen? Keineswegs! sondern das Wertvollste bleibt noch übrig. Wer urteilen will, hat nicht nur auf das Vielerlei, das in den Dichtern steht, er hat auch auf das, was diese Dichter verschweigen, achtzugeben. Denn lehrreicher ist oft, was das Altertum nicht sagt, als was es sagt. Und die Beobachtung, die sich da ergibt, ist rasch erledigt; ich meine nur dies, daß bei allen diesen Dichtern nahezu jeder Ausdruck des Rassenhasses fehlt, ferner jeder religiöse Gegensatz, jeder konfessionelle Hader völlig unberührt bleibt und sich nirgends ein Wort gegen die Priester findet, ja, daß endlich auch der Soldatenstand von keinem je verunglimpft wird. Nichts merkwürdiger, nichts charakteristischer, nichts bewunderungswürdiger als das!
Plautus hatte einst den Miles gloriosus geschrieben. Da wurde der dumme griechische Offizier, der sich für den schönsten aller Männer hält und mit den unglaublichsten Großtaten renommiert, unendlichem Gelächter preisgegeben. Das spätere Rom weiß davon nichts mehr. Das römische Militär war unantastbar. Auch die römischen Feldwebel und Rekruten, auch der Legionär und der Tribunus militum werden gewiß ihre Schwächen gehabt haben, und nichts war frecher im Auftreten als die kaiserliche Garde in der Hauptstadt selbst. Aber unsäglicher Respekt umgab sie. Kein Wort des Spottes hören wir je. Nur einmal bringt Martial das zahme Distichon:
[S. 226]
Die gleiche Schonung gilt prinzipiell auch den Trägern der Gottesdienste. Nur Afranius hat in alter Zeit einmal ein Stück „Der Augur“ auf die Bühne gebracht, wo solch ein Priester, dem die Vogelschau oblag, ein Augur, die gefürchtete Hauptperson war: der einflußreiche Mann schreit und rast so, daß der Himmel darüber einzustürzen droht; aber sein Gesichtsausdruck ist falsch und widerwärtig wie eine angemalte Wand[422]. Das war Afranius, und das ist alles. Späterhin ist es nur einmal noch der Christ Luxorius, der über einen trunksüchtigen Priester seiner Kirche herfällt[423].
Die Sacerdotes waren eben schon durch ihr Amt geschützt. Überdies aber waren es in der vorchristlichen Zeit den besten Kreisen, ja, dem Hochadel angehörende Männer und Frauen, die, zumeist verheiratet, von der sonstigen vornehmen Welt sich im täglichen Leben durch nichts abhoben, da sie in ihren Privathäusern lebten und nur während der heiligen Handlung des Opfers und Gebetes das Priestergewand anlegten. So hielt es ja auch der Kaiser selbst, der als Oberpriester, Pontifex maximus, persönlich die Staatsopfer vollführte. Eine anspruchsvolle Isolierung und Weihe des geistlichen Standes, die den Spott oder Widerwillen des Unfrommen hätte herausfordern können, gab es noch nicht.
Nur die asiatischen Cybelepriester hat Martial in der Tat mit seinem Hohn verfolgt[424], deshalb, weil sie mit ihrer schändlichen Menschenjagd, die sie in den Städten Italiens betrieben, auch amtlich verfehmt waren, und so trifft denn einmal auch die Göttin Cybele selbst, die die Entmannung ihrer Anbeter forderte, ein entrüstetes Wort[425].
Das steht für sich. Sonst aber wird von den fast unzähligen Religionen, die damals in den Mittelmeerländern durcheinander wogten, kaum eine einzige von diesen Dichtern angetastet oder der Kritik ausgesetzt. Isis, Serapis, Mithras, Anubis, Jehova, das Christentum — um von den überkommenen römischen Nationalgöttern ganz zu schweigen —, alle diese Gottheiten und Bekenntnisse fanden damals ihre Verehrer. Wer[S. 227] aber mag sie in ihrem Glauben stören? Religion ist Privatsache; der Witz biegt vor diesen Dingen aus. Vor allem ist von diesen Dichtern, soweit ihre Werke uns vorliegen und eine Kontrolle möglich ist, nie Christus verhöhnt worden. Das scheint mir ewig denkwürdig.
Und was von den Religionen gilt, gilt endlich annähernd auch von den Rassenunterschieden. Massenhaft dienten z. B. die Syrer in Rom als elegante Sklaven und Sänftenträger, so unbeliebt sie auch wegen ihres durchtriebenen Charakters waren; aber nur einmal trifft sie bei Martial eine angreifende Wendung[426]. Auch gegen die sonst so gerne verfolgten Juden ist er nur an einer Stelle ausfällig[427]. Wo er auf der Gasse jüdische Bettler sieht, findet er durchaus kein bösartiges Wort[428], wohl aber muß er sich seinerseits gegen einen jüdischen Widersacher, der ihn angegriffen hat, verteidigen[429]. Ärgerlich war es, daß die römischen Mädchen, wenn Germanen, Juden oder Perser nach Rom kamen, sich gleich in diese Fremden verliebten und die römischen jungen Herren alsdann als Luft behandelten. Den Ärger darüber kann uns der Dichter nicht verschweigen[430].
So begegnen wir nun einmal wirklich auch einem Germanen in Roms Gassen, und das muß unsere besondere Neugier erwecken. Ein Unfreier ist’s, vielleicht ein von der städtischen Verwaltung zur Straßenreinigung angestellter Sklave. Aber der Mensch benimmt sich sehr rücksichtslos, als wäre er der Herr Roms. Aus einem Wasserbehälter der Fernleitung, der mit köstlichem Gebirgswasser gespeist wird, will ein Knabe, ein römischer Bürgerssohn, trinken; der Germane kommt und stößt ihn herrisch fort, weil er zuerst trinken will. So geschehen zu Rom im Jahre 96 n. Chr. Daß Martial den Menschen grob anfährt, das können wir ihm wohl nicht verargen[431]. Erheiternder aber ist es noch zu lesen, wie einmal ein Gallier, auch dies ein Kraftmensch, von ihm eingeführt wird; da erhalten wir wieder einmal ein Straßenbild, und zwar bei Nacht:
[S. 228]
So weit die Spottdichtung und das Sinngedicht, so weit die fliegenden Blätter Roms. Welche Zurückhaltung sich diese leichtlebige Kunst im Altertum auferlegte, haben wir gesehen. Ganz anders die große römische Satire, zu der wir uns jetzt noch wenden. Indem wir auch sie noch zu Wort kommen lassen, hört alsogleich das Behagen auf; die Lehre beginnt, und sie reißt uns aus all der Heiterkeit, die uns bisher umgab, in den Ernst hinüber, der bis zum Ingrimm geht, und in die Sorgen um die schweren Grundfragen des Lebens. Denken wir nur an die religiöse Frage. Die Satire ist es, mit deren Hilfe wir einem der größten menschheitlichen Ereignisse, dem Übergang aus dem Polytheismus in das Christentum, der großen religiösen Umwälzung der Antike, die eben zu jenen Zeiten langsam vor sich ging, nähertreten können. Es sind die etwa fünf Jahrhunderte von 200 v. Chr. bis 300 n. Chr. In diese Entwicklung hat auch die große römische Satire mit eingegriffen; denn ihre Aufgabe war eben die Erziehung des Volkes. Aber das Aufstellen von tugendhaften Lehrsätzen genügte[S. 229] ihr nicht; sie rief auch dabei wieder den Spott zu Hilfe. Alle falschen Werte riß sie mit Hohn herunter; alles, was hohl und vermorscht, schlug sie in Trümmer.
Ich sehe hier von der wichtigen Aufklärungsarbeit der griechischen Philosophen ab und halte nur auf Rom, das Zentrum der Welt, das Auge gerichtet. Da hatte dereinst schon der Dichter Ennius im 2. Jahrhundert v. Chr. kaltsinnig an dem alten Götterglauben gerührt und für die Entstehung der Vorstellungen von Jupiter und den anderen Nationalgöttern trivial-euhemeristische Erklärungen vorgetragen, die sich wie ein amüsanter Roman für die Halbbildung lesen. Das übermütig freche Volkstheater, der sog. Mimus, wirkte überdies schon lange ganz im gleichen Sinne. In den Schwänken, die es da gab, wurde Jupiter, der höchste Gott, wie ein alter Onkel hübsch begraben, die Göttin Diana machte ihr Testament, und ähnliche Scherze mehr, wobei immer das Sündhafteste dem Publikum gerade das liebste war. Dann kam Varro, der Philologe, mit schwerstem Geschütz, der in einem dicken Sammelwerk den ganzen bunten Götterglauben des Altertums mit seinen tausend Namen redlich buchte, aber diesen Glauben dabei als nichtig nachwies und nur die Naturkräfte im All noch als göttliche und heilige Mächte gelten ließ. Derselbe Varro schrieb aber auch Satiren, z. B. einen „gefälschten Apoll“, in denen er von den Göttern handelte und die Volksvorstellungen nur deshalb bestehen ließ, um possierlich mit ihnen zu spielen[433]. Gleichzeitig mit Varro wirkte dann auch Cicero, und er machte diese freien Ansichten populär; Ciceros berühmte Schrift „Über die Natur der Götter“ ist das erste große Aufklärungswerk gewesen, das durchschlug. Der Staatskultus mit seinem reichen Tempeldienst bestand freilich ungeschmälert weiter, aber jeder Gebildete dachte dabei hinfort, was er wollte. In Wirklichkeit haben sich damals alle, die nachdachten, auf die stoische Religion zurückgezogen, die von den Philosophen ausging und deren Lehre sich mehr und mehr und immer deutlicher zum geistigen Monotheismus hindurchrang.[S. 230] Die Frage war nur, was aus den herkömmlichen Göttern schließlich werden sollte.
Wundervoll geläutert sind schon die Vorstellungen, die Persius zu Kaiser Neros Zeit in seinen Satiren vortrug. Es handelt sich um das Gebet; albern und gottlos, sagt Persius, sind die Menschen, die sich Bargeld und sonstige angenehme Dinge wünschen und mit solchen Bitten die hohen Götter behelligen. Gott ist gütig, und er weiß selbst am besten, was uns not tut. Und neben Persius stand nun auch schon Seneca, der endlich die Axt an die Wurzel legte, indem er sich gegen den herrschenden Gottesdienst selbst, gegen den Ritus mit seinen Opfern und Zeremonien wandte. Gott ist ein Geist; er bedarf dieser menschlichen Armseligkeiten nicht. „Über den Aberglauben“, de superstitione, betitelte Seneca sein umstürzendes Buch, von dem wir gewisse Abschnitte unbedingt zur Satirenliteratur rechnen; denn die beißendste Satire war darin seine Waffe. So wie die Satire immer das Extreme aufsucht, so hat hier Seneca gerade die lächerlichsten Auswüchse der sog. Frömmigkeit, die ihm als Aberglaube gilt, geschildert, und wir lesen seine Schilderung mit Staunen. Es handelt sich an der einen Stelle, die uns vorliegt, um das vornehmste Gotteshaus der altrömischen Trinität Jupiter, Juno und Minerva: „Ich kam auf das Kapitol. Man muß sich schämen über die Tollheit, die sich da öffentlich zeigt, und wozu sich eine sinnlose Schwärmerei verpflichtet hält. Einer legt da dem Gott das Hauptbuch (über die Verwaltung des Tempelvermögens) vor, ein anderer meldet dem Jupiter, wieviel Uhr es ist; einer steht als Lictor oder Platzmacher herum; wieder einer ist des Gottes Einsalber und tut mit einer zwecklosen Armbewegung so, als salbte er ihn wirklich ein. Auch an Personen, die der Juno und Minerva das Haar machen, fehlt es nicht; aber sie stehen von den Götterbildern, ja sogar vom Tempel selbst weit ab und bewegen nur so die Finger, als frisierten sie sie. Andere halten den Spiegel dazu. Dann kommen welche, die (in eigener Prozeßsache) die drei Götter zu einer Bürgschaftsleistung einladen, ihnen ihre[S. 231] Anklageschrift bringen und ihren Fall vortragen. Auch einen Schauspieldirektor von guter Schule, aber schon alt und verlebt, sah ich da, der täglich auf dem Kapitol sein Rollenfach mimte, als könnten die Götter an ihm, den kein Mensch sich mehr ansehen mochte, noch Vergnügen haben. Und so sind da alle Sorten von Künstlern oder Kunststückmachern vertreten, die ihre Zeit damit vergeuden, die unsterblichen Götter zu ehren. Alle diese Leute tun nun gewiß, was überflüssig ist, allein sie entehren sich doch nicht selber; aber auch Weiber, die meinen, sie könnten mit Jupiter in Liebesverkehr treten, hocken auf dem Kapitol, und nicht einmal der Anblick Junos schreckt sie ab, die ja doch, wenn die Dichter recht haben, sehr leicht in Zorn gerät.“
Jetzt wissen wir, wie es da zuging. Diese Schilderung Senecas gibt uns endlich das, was Martial verschweigt: eine köstliche Ergänzung zur Kenntnis des römischen Stadtvolks, besonders in seinen unteren Schichten. Leider ist uns aus Senecas Schrift sonst fast nichts erhalten; der Kirchenvater Augustin hat nur eben dies daraus ausgezogen, weil es seiner christlichen Tendenz besonders zu Hilfe kam. Wir würden gerne auch das Weitere und Gewichtigere lesen.
Auf Seneca aber endlich folgt Juvenal, der letzte und wuchtigste der Satiriker. In machtvoller Breite rollen seine Predigten daher. Die Gesellschaft sittlich zu heben, die Herzen zu reinigen, das war auch Juvenals Zweck; was aber Seneca schon geschrieben hatte, brauchte er nicht zu wiederholen. So wandte er denn seinen Zorn gegen ein anderes drohendes Gespenst, den religiösen Fanatismus, der im Orient seit langem sich regte. Nach Ägypten kehrte er seine Augen; da war unlängst Ungeheuerliches geschehen, und er beschloß dies erschreckende Beispiel in grausiger Schilderung aller Zukunft zur Warnung hinzustellen. Es ist Juvenals 15. Gedicht.
Zwei ägyptische Nachbarstädte, Omboi und Tentyra, waren es. Beide haben andere Götter, und sie hassen sich deshalb bis zur Raserei. Bei den Ombiten ist gerade Festtag, und[S. 232] sie begehen ihn mit rauschendem und berauschendem Gottesdienst. Da werden sie von den Leuten aus Tentyra überfallen, eine Rauferei beginnt; sie zerschlagen sich erst nur die Gesichter. Dann wird schon mit Steinen geworfen; dann greift man zum Messer, bis die Angreifer fliehen; einer der Fliehenden aber wird ergriffen und von der siegreichen Menge zerrissen und in unerhörtem Kannibalismus verspeist. Alle sättigen sich an der Mahlzeit. Der letzte, der nichts abbekam, leckt gierig noch das Blut von den Fingern des Opfers. Gott, der Weltenschöpfer, sagt Juvenal, erhob den Menschen über das Tier, indem er uns die Menschenliebe und den Trieb gab, daß einer dem anderen helfe. Wo aber ist die Bestie, die ihresgleichen frißt? Die religiöse Wut, der Haß gegen die Götter des Nachbarn bringt das fertig.
Ob hier Juvenal übertrieben hat? Jedenfalls ist klar, welchen Standpunkt er im Hader der Religionen einnahm, und um so wohltuender berührt es uns, daß er in all seinen Dichtungen kein hämisches, wegwerfendes Wort gegen das Christentum findet. Um das Jahr 130 konnten dem Juvenal die stark angewachsenen Christengemeinden nicht unbemerkt bleiben; denn das Evangelium scholl schon vernehmlich über die Gasse in den Griechenquartieren Roms. Juvenal, dieser energische Ethiker und Volkserzieher, lebte ganz in der stoischen Sittenlehre, die der christlichen tatsächlich so nahe stand. Vielleicht dürfen wir annehmen, daß er eben darum zu satirischen Angriffen gegen die neue Völkerlehre keinen Trieb und keinen Anlaß fand.
Anders das Christentum selbst. Kaum war Juvenal verstummt, so erhob das Christentum selbst seine Stimme zur Polemik, und die große Satire der christlichen Kirchenväter im Kampf mit den heidnischen Göttern hob an. Denn auch dies war Satire. Den Ton bittersten Spottes und grenzenloser Entrüstung entlehnten die Kirchenautoren dabei von Juvenal, aber von vornherein sind sie viel siegesgewisser als er. Denn ihre Aufgabe war leicht; sie konnten ja ihre Argumente von den aufgeklärten Heiden selbst entnehmen, und sie nahmen sie wirklich[S. 233] getreu aus Varro, Cicero und Seneca. Aber auch im römischen Volkstheater waren die Götter ja, wie wir sahen, längst entheiligt und zu lustigen Figuren gemacht. Auch dies bot den Christen die willkommenste Hilfe. „Erröten müßt ihr über eure Götter,“ so hebt einmal Tertullian an[434]. „Ich weiß nicht, soll ich lachen über eure Torheit oder auf eure Blindheit schelten.“ Da haben wir also das Lachen; es ist das Lachen des Satirikers. Und dann geht es weiter: Der alte Gott Saturn soll Sohn des Himmels sein; Himmel heißt caelum auf Latein; caelum aber ist ein Neutrum. Wie kann ein Neutrum Kinder erzeugen? Saturn soll ferner schon eine Sichel besessen haben; eine Sichel setzt das Schmieden voraus, aber der Schmiedegott Vulkan, der das Schmieden erfand, war doch erst Saturns Enkel! Wie konnte also Saturn schon eine Sichel haben? Weiter hat man den Herkules zum Gott gemacht, weil er so viele wilde Tiere erschlug; warum aber nicht lieber den Pompejus, der all die Piraten beseitigte? Denn die unzähligen Piraten waren viel schlimmer als die paar wilden Tiere. Besonders lachhaft sind die unzähligen kleinen Stadtgötter im Land; denn jedes kleine Nest hat einen anderen; „ich lache über diese göttlichen Magistrate, deren Ansehen nicht weiter als bis zu ihrer Stadtmauer reicht. Und was soll man weiter zu Romulus sagen, der Rom gründete und dabei seinen Bruder totschlug? Wenn alle Stadtgründer gleich Götter werden sollen, dann kann es freilich viele geben!“[435]
Und so rollt die Polemik weiter. Nicht anders wie Tertullian redeten hernach auch noch die Späteren, Arnobius, Lactanz, Augustin; und wer sollte ihnen da widersprechen? Gepriesen sei die Zeit, wo das Christentum nur mit solchen Waffen, mit den Waffen der klugen Rede, focht und siegte! Es sollte die Zeit kommen, wo es zu anderen griff. Juvenal hatte umsonst gewarnt. Die Zeit kam, wo der Fanatismus aufs neue zum Schwert griff und das Blut floß. Es war der Fanatismus des Christentums und seiner erstarkten Kirche.
Wozu daran erinnern? Die Religionskriege liegen ja gottlob[S. 234] weit hinter uns. Der schöne Gedanke des Altertums, daß der Polytheismus nur eine Vielnamigkeit Gottes, daß die vielen Götter der Erdenvölker also nur viele Versuche sind, den Einen zu nennen, und die religiöse Duldung, die in diesem freundlichen Gedanken wurzelt, hat allmählich auch unsere Gegenwart erobert, und wir hoffen, daß sie einmal voll und ganz siegen wird. Schlimmer steht es heut mit dem Rassenhaß, dem Völkerhaß, der Entzweiung der Völker Europas. In dem Weltkrieg, der in den letzten Schreckensjahren unseren Weltteil zerfleischte, schlugen nicht nur die Waffen, die Vulkan geschmiedet, aufeinander; auch das Wort kämpfte wieder, aber völlig entartet, und die gemeinste Schmähsucht war losgelassen. Mit den niedrigsten, verlogensten Beschimpfungen fielen die Völker, die unsere Vernichtung beschlossen hatten, über uns Deutsche her, weil unser Volk den unerhörten Mut hatte, sich innerhalb seiner Grenzen selbständig und kraftvoll auszuleben. Aller Witz der Rede, aller Feinsinn, alle Grazie erstickte dabei in geschmacklosester Karikatur und häßlich kreischender Verleumdung. Das verrät einen sittlich kulturellen Tiefstand der Gegenwart, der Europa weit, weit hinter das Zeitalter des Horaz und Juvenal zurückwirft und uns mit völlig hoffnungsloser Trauer erfüllt. Denn die Völker, von denen ich sprach, lebten ja schon damals; sie alle sind die gemeinsamen Erben der Zivilisation von Rom und Hellas. Damals zwang die Römerherrschaft die hochbegabten Nationen, die sie umfaßte, zur Eintracht, zum Fleiß und dauernd glücklichem Dasein. Wird jetzt der geplante „Völkerbund“ wirklich alle Nationen friedlich umfassen? oder müssen wir wünschen, daß wieder wie einst ein Zwingherr ersteht, der die Welt in seine starke Hand und sichere Verwaltung nimmt? Beklagenswert die Welt, die zu ihrem Glück, zur Wahrung ihrer Würde, gezwungen sein will. Denn Glück ist nur in der Freiheit, und der wahre Beruf der Völker ist, in freier Einigung die reine Menschheit in sich darzustellen.
[S. 235]
[1] Vielleicht ist das Wort roma, ruma ursprünglich etruskisch und hernach latinisiert worden; man hat es neuerdings als „Brust“ gedeutet; alsdann war Roma aber vielleicht ursprünglich die Benennung für einen Mann gewesen, also wirklich als Maskulinum gedacht und nur der Form nach weiblich, sowie auch die Feminina Ahala, Sura, Pansa, Bucca Körperteile bezeichnen und zugleich römische Männernamen sind, und Romulus war, dies vorausgesetzt, von dem männlichen Roma nur die Verkleinerung. Vgl. G. Herbig in der Berliner philol. Wochenschrift 1916, S. 1477.
[2] D. h. der genius urbis war eben der genius populi, und populus ist maskulin. Die Aufschrift, die sich auf dem Kapitol befand: genio urbis Romae sive mas sive femina (Servius zu Aen. 2, 351) kann nicht alt gewesen sein, da die ursprünglichere Bezeichnung genius populi Romani gewesen sein muß. Denn genius bedeutete eigentlich den männlichen Zeugungstrieb (vgl. meinen Artikel „Genius“ in Roschers Mythologischem Lexikon). Jene Inschrift verrät das Befremden, das Spätere dem genius eines weiblichen Wesens gegenüber empfanden.
[3] Marquardt-Mau, Privatleben, S. 728, 8.
[4] Über die „Hut der Mutter“, matris tutela, matris custodia, vgl. Rheinisches Museum 70, S. 269. So sehen wir den jungen Properz unter der custodia matris stehen, aber auch den jungen Dichter Persius. Horaz hat dagegen seine Mutter früh verloren; denn er erwähnt nur den Einfluß des Vaters auf seine Kindheit. Vielleicht mag sich aus diesem Umstand des Horaz eigentümliche Stellung zu den Frauen erklären; denn er huldigt, anders als Properz, keiner Frau der vornehmen Gesellschaft, er hat ihren Umgang augenscheinlich nicht gesucht. Nur an Männer sind seine Briefe gerichtet. Die edle Frauenverehrung aber pflegt mit der Verehrung der Mutter anzuheben.
[5] Die virtus gehört den viri, die pudicitia den matronae: Livius 10, 23.
[6] Properz 2, 6, 25 und Plinius nat. hist. 17, 244.
[7] Domitius warf dem Crassus vor: „Hast du nicht geweint, als dir die Muräne starb, die du im Fischbehälter aufzogst?“ Crassus antwortete: „Hast du nicht etwa nicht geweint, als du dich von deiner Frau trenntest?“
[8] Das griechische Ideal der Ehe gibt uns Plutarch, Praecepta coniug. 9: Der Mond strahlt nur dann, wenn er der Sonne nicht zu nahe steht. Umgekehrt die Frau: sie strahlt am schönsten, wenn sie zusammen mit ihrem Manne erscheint; ist er nicht da, so gleicht sie dem Neumond! Diese Lehre gipfelt in dem Satz: die Frau soll der Spiegel ihres Mannes sein.
[S. 236]
[9] Erst im 2. Jahrhundert n. Chr. tauchen Römerinnen, die in eine Hündin verliebt sind, auf, bei Juvenal VI, 654 und Lucian de merc. conductis 34 (letztere Stelle wurde mir von Dr. Hasenclever, Würzburg, nachgewiesen), früher findet sich nichts dergleichen. Es war dies also eine Mode der Spätzeit. Wohl treffen wir dagegen Männer, auch junge Männer an als zärtliche Liebhaber ihrer Hunde; ich erinnere an das Hündchen Issa bei Martial (s. S. 223). Das reizende Grabgedicht auf die Hündin Myia (Carmina epigraphica 1512) stammt freilich von einer Frau, aber aus Gallien, nicht aus Rom. Aus Rom stammt die marmorne Grabschrift auf die Jagdhündin Margerita (ebenda 1175), von der dort ausgesagt wird, daß sie oft im Schoß ihres Herrn oder ihrer Herrin von der Jagd ausruhte. Hier ist die Herrin also einmal mit erwähnt. Die Katze fehlte in den Häusern; sie wurde vom mäusefangenden Wiesel (mustela) vertreten; aber auch zum Wiesel sehen wir die Römerinnen nie in einem näheren Verhältnis.
[10] Seneca de benef. 1, 9. Die Frau, die außer ihrem Ehemann nur einen Liebhaber hat, steht noch gut da; man sagt von ihr, daß sie in Doppelehe lebt, und dies eine adulterium wird als ein zweites matrimonium gerechnet; s. Martial VI, 10 und „Römische Charakterköpfe“ 3. Aufl., S. 235.
[11] Gellius 1, 23.
[12] mulierum conventus, senatus matronalis, Script. hist. Augustae Heliogab. 4, 3.
[13] Cicero nennt die Clodia geradezu meretrix.
[14] Helvius Cinna hatte schon unter des großen Julius Caesar Begünstigung geradezu die Einführung der Polygamie vorgeschlagen (Sueton, Caes. 52); die Kaiserin Messalina führte dies durch; weiter nichts.
[15] Ovid ars 3, 189.
[16] Horaz sat. 1, 10, 91.
[17] s. Rheinisches Museum 70, S. 270.
[18] Vgl. W. Schrötter, Ovid und die Troubadours.
[19] Seneca epist. 95, 21.
[20] Zur Frauensatire Juvenals vgl. Rhein. Museum 70, S. 527 ff.
[21] Domum servavit, lanam fecit (Carmina epigraph. 52) ist typisch. Charakteristische Monumente sind die Grabschrift auf Turia (Dessau n. 8393) und das neuerdings gefundene der Potestas (Kroll im Philologus 73, S. 274 f.); sie geben eine ausführliche Schilderung. Ich nehme hier die Gelegenheit wahr, eine schwierige Stelle in dem Lobgedicht auf Potestas (das um das Jahr 300 n. Chr. entstanden ist) zu erklären. Die Körperschönheit, Brust und Beinwerk der Frau, werden da sehr[S. 237] drastisch gelobt; dann heißt es im v. 22, daß die Frau eine glatte Haut hatte, ja, daß sie sich alle Haare zu entfernen pflegte:
Hier hat das anxia die sonderbarsten und künstlichsten Erklärungen hervorgerufen; der Zusammenhang der Sätze zeigt aber unzweifelhaft, daß dies Wort „behaart“ bedeuten muß. Es kann nichts anderes sein als ein Vulgarismus des Spätlateins und ein barbarisch entstelltes griechisches Lehnwort; nämlich ἄξοος, das von ξέω gebildet worden ist (nach der Analogie von ἄπνοος, εὔρροος) im Sinne von ἄξεστος, „der ungeschorene“ (vgl. Callimachus Frgm. 105), und hier ebenso auf die Rauheit der Haare Bezug hat, wie das ξεστός bei Oppian von den Haaren des Elephanten steht. Sie ist non anxia, heißt also soviel wie: sie ist toto corpore expolita, wie wir in der Vita des Heliogabal 5,5 lesen. Der Vulgarismus aber zeigt sich in dem Wort anxia statt axoa dreifältig, im Eintreten des i, im Eindringen des Nasals, in der Bildung einer Femininform vom komponierten griechischen Adjektiv. Das ἄξοος wurde offenbar mit dem geläufigen Adjektiv ἄξιος zusammengeworfen. Dann ist das Wort weiter an das echt lateinische Wort anxius völlig angeglichen, und eben der Anklang an dies geläufige lateinische Wort hat die Nasalierung begünstigt. Das Eindringen des unechten Nasals aber ist dasselbe wie in thensaurus, coniunx, und die Gegenbildungen dazu sind Schreibungen wie Quictilis, provicia u. a., die man auf Inschriften findet. Insbesondere ist bronchus als Nebenform von brocchus, brochus zu vergleichen; auch καχάζω, καγχάζω, Pimplêus und Piplêus (Catull 105, 1). Nicht glücklich ist die Stelle von Mesk in der Berliner Phil. Wochenschrift 1915, S. 62 behandelt worden.
[22] Auch an der Priscilla weiß Statius (Silven V 1, 57) im Grunde nur dies zu rühmen und daß sie Tag und Nacht für das Wohl des Gatten zu den Göttern gebetet hat (v. 72).
[23] Arrias Wort an den Gatten: „o Pätus, der Tod schmerzt nicht.“
[24] Schiller sagte doch bekanntlich nur: „Satt zu essen muß der Mensch haben, wenn sich die bessere Natur in ihm regen soll.“ Vgl. Säkularausgabe Bd. XIII, S. XXXII.
[25] Über Tafelfreuden, Kochbücher u. a. des 16.-18. Jahrhunderts findet man einen hübschen Aufsatz in Reclams Universum, Jahrgang 34, Heft 12 (1917).
[26] S. Das antike Buchwesen, S. 434.
[27] Etwa: „Singe mir, Muse, Diners mit vielerlei Gängen und viele!“ Aber der Anklang an den homerischen Vers ist damit nur teilweise wiedergegeben.
[S. 238]
[28] Ich sehe von solchen Tabernen ab, die üblen Zwecken dienten.
[29] Außer in gewissen leichtlebigen Geselligkeiten, von denen hier nicht die Rede ist.
[30] Vom Kaiser Elagabal hören wir, daß er für jeden Gang ein neues Tischtuch (mantele) auflegen ließ, und zwar waren auf dem Tuch die Speisen abgebildet (picta), die es gab (Script. historiae Augustae c. 27).
[31] In dem Gedicht Anthol. Pal. 10, 43 heißt es: „Sechs Stunden am Tag sind für die Arbeit, die siebente bis zur zehnten sind für das Sichausleben“; in feiner Witzform wird das vorgetragen. Die griechischen Buchstaben für die Zahlen 7, 8, 9, 10 sind nämlich ΖΗΘΙ, und ζῆθι bedeutet: „genieße das Leben.“
[32] Wir erfahren, daß diese Vorhänge wirklich Gegenstände der Betrachtung waren; s. Valerius Maximus 9, 1, 5.
[33] Martial 12, 87 und sonst.
[34] Die Gäste küssen den Tisch, um Gespenster oder ein böses Omen abzuwehren; Petron, c. 64.
[35] Deshalb war ein Fisch teurer als ein Rind; Plutarch, Sympos. 663 B.
[36] Unser Wort „Suppe“, italienisch zuppa, heißt eigentlich das Eintauchen von Brot in eine Flüssigkeit; vgl. R. Kleinpaul in der Kölnischen Zeitung 1911, Nr. 453, drittes Blatt: „Das Alter der Suppe.“
[37] Friedländer erklärt die Stelle des Petron, c. 65: gallinae altiles circumlatae sunt et ova anserina pilleata quae ut comessemus, ambitiosissime (a) nobis Trimalchio petiit dicens exossatas esse gallinas nicht richtig; quae weist nicht nur auf ova, sondern zugleich auf gallinae zurück: „Trimalchio drängte uns, daß wir von beiden essen sollten, indem er anmerkte, die Masthühner seien übrigens ohne Knochen.“
[38] Vgl. Martial 13, 92.
[39] Plinius, Nat. hist. 28, 260; Martial 5, 29; Lampridius Alex. c. 38.
[40] Es lag allerdings für die Volksetymologie nahe, lepus und lepos in ähnliche Beziehung zu setzen wie decus und decor, (h)onus und honos.
[41] Vgl. Martial 3, 82, 8.
[42] Seneca ad Helviam 10.
[43] Vgl. Martial 5, 79.
[44] Vgl. Martial 9, 35.
[45] Vgl. Martial 5, 78, 26.
[46] Vgl. Martial 3, 50.
[47] Diese Umrechnungen sind nicht genau zu nehmen, da der Wert des Geldes starken Schwankungen unterworfen war. Bei Derus werden 6 Millionen, bei Nero 4 Millionen Sesterz angegeben.
[S. 239]
[48] Varro, De re rust. 3, 7.
[49] Man vergleiche dazu Sergius Orata; orata ist der Goldfisch.
[50] Hierfür wie für manches andere sei auf Victor Hehn, Kulturpflanzen und Haustiere (6. Auflage, S. 433 ff.) verwiesen.
[51] Dies führt Martial 7, 27 aus.
[52] Plutarch, De esu carnium, p. 997 A.
[53] Friedländer, Petron S. 282. Auf einem Relief von St. Germain sieht man eine Tischrunde, ein Sigma dargestellt; in der Mitte steht ein ganzer Eberkopf serviert: s. Robert, Sarkophagreliefs Bd. III, Tfl. 88, N. 272.
[54] Wohl aber war das Trinkgeschirr oft aus Glas und die Glasfabrikation hoch entwickelt.
[55] Ein Feldherr, der im Jahr 58 n. Chr. in Germanien Krieg führte, hatte 12000 Pfund Silbergeschirr in seinem Hauptquartier (Plinius nat. hist. 33, 143).
[56] Digitis ustis, Martial 5, 78, 6.
[57] In der Casa del Centauro zu Pompeji wurden dreizehn silberne Löffel ausgegraben, sechs kleinere und sieben größere. Eine Abbildung der kleineren findet man bei Overbeck-Mau, Pompeji, 4. Auflage, S. 444.
[58] Petron c. 66.
[59] Martial 7, 22, 17.
[60] Vgl. W. Helbig, Führer durch die Sammlungen der klassischen Altertümer in Rom, Nr. 715.
[61] Die Gelage enden der Regel nach nie spät; nur der Berufssäufer trinkt bis zum Morgen; es schien schon ungeheuerlich, daß Nero epulas bis noctem protrahebat (Suet. Nero 27).
[62] Hierüber meine Kulturgeschichte, 3. Aufl., S. 49 f.
[63] Für die nachfolgende Studie kam mir das Buch von Wolfgang Riepl zur Hilfe: „Das Nachrichtenwesen des Altertums mit besonderer Rücksicht auf die Römer“ (Leipzig 1913); es ist von mir besprochen in der Historischen Zeitschrift, Bd. 113, S. 571 ff.
[64] Vgl. Herodot V, 105.
[65] Philostrat II, S. 378, 12 ed. Kayser.
[66] Über Iris vgl. Neue Jahrbücher XIX (1907), S. 707 f.
[67] Plinius handelt in seiner Naturgeschichte VII, 84 über namhafte Schnelläufer und ihre Leistungen; aber er weiß da als Beispiele nur Griechen zu nennen, und indem er schließlich auch nach einem römischen Namen sucht, findet er keinen einzigen außer Tiberius, der Tag und Nacht zu seinem erkrankten Bruder Drusus nach Germanien eilte, aber im Wagen! Das ist bezeichnend.
[S. 240]
[68] Livius 26, 35.
[69] Livius 34, 1, 5 und 2, 12.
[70] Juvenal 11, 2.
[71] Varro de lingua lat. 6, 27.
[72] Sueton, Vespasian c. 8.
[73] Von den viae vicinales sind die Kommunalstraßen, viae communes, und von diesen wieder die viae publicae verschieden; an den Vicinalwegen steht angeschrieben, wer den Weg in Ordnung zu halten hat; s. Agrimensoren ed. Thulin I, S. 110.
[74] Livius 22, 7.
[75] Livius 21, 9.
[76] Livius 21, 20.
[77] Cicero pro Balbo 34; Lucrez 3, 1032.
[78] d. h. 20 Millien; Vegetius de re mil. 1, 9.
[79] Riepl, S. 129. Ich entnehme dem Buch Riepls einige weitere Angaben. Caesar soll einmal am Tag 75 km zurückgelegt haben (S. 132); der mazedonische König Philipp III. gar 90 km (S. 134). Mit welcher Vorsicht solche Angaben aufzunehmen sind, habe ich im Rhein. Museum Bd. 70, S. 253 f. gezeigt: Hannibal sollte nach der Schlacht bei Cannä in fünf Tagen mit seiner Reiterei in Rom sein und Rom einnehmen können; Riepl bemüht sich ernstlich, dafür die tägliche Kilometerzahl auszurechnen. Ich habe aber nachgewiesen, daß die Fünfzahl im Altertum nur eine ungefähre Summe ist, die nichts weiter als „in kurzer Zeit“ bedeutet. Die Beispiele, die ich für diesen Sprachgebrauch dort beibrachte, könnte ich jetzt noch vermehren, und so wird es dann auch wohl mit der Angabe nicht besser stehen, daß Ämilius Paulus in 5 Tagen von Delphi zu seinem Heer nach Mazedonien eilte (Riepl, S. 151). Zur Vergleichung seien noch einige Marschleistungen der neueren Zeit hierhergesetzt, deren Kenntnis ich der Güte des Generalleutnants August Beß, Exzellenz, verdanke. Man rechnet heute als höchste Marschleistung in 24 Stunden für Kavallerie und reitende Artillerie 80 km, für Kavalleriepatrouillen 120 km, für Infanterie 50 km. Die Leistungen werden aber oft beeinträchtigt durch den Einfluß der Jahreszeit und Witterung, der Wege und der Größe des Truppenverbandes selbst. Friedrich der Große und Prinz Heinrich haben nicht selten 30 bis 40 km an mehreren aufeinanderfolgenden Tagen von ihren Truppen verlangt, obwohl sie damals noch in steter Schlachtbereitschaft marschierten. Einzelleistungen: auf der Verfolgung nach Jena im Jahre 1806 hat die Avantgarde des Korps Lannes auf tiefsandigen Wegen 100 km in 50 Stunden zurückgelegt, also 48 km in 24 Stunden. Unter Diebitsch wurde 1831 von Wysoko nach Pyski an einem Tag 7 Meilen, 50 km marschiert. 1864 zog das dritte preußische Korps von Christiansfeld bis Warnitz-Apenrade in 12 Stunden 6½ Meilen (bis 45 km); 1870 am 16. und 17. Dezember das neunte Korps bei starkem Regen und sehr schlechtem Wetter von Blois nach Orleans, etwa 70 km in 33 bis 36 Stunden (einschließlich Nachtruhe).
[S. 241]
[80] Riepl, S. 149.
[81] Philostrat II, p. 43, 27 ed. Kayser.
[82] Noch Claudian schrieb ein Gedicht De mulabus Gallicis.
[83] Gellius 15, 4.
[84] Anders als im letzten Weltkriege. Ich möchte die Worte hierher setzen, die Exzellenz Gröner Anfang März 1917 in Düsseldorf im Verein der Eisenhüttenleute gesprochen hat: „Heute müssen die Heere auf Räder von Eisen gestellt werden, und so rollen sie dem Feinde entgegen, von einem Kriegsschauplatz zum anderen, und die Eisenindustrie liefert dem Heere nicht nur die Beine, sondern vor allem auch die stahlgepanzerte Faust.“
[85] Die Sache scheint befremdlich (vgl. H. Delbrück, Preußische Jahrbücher Bd. 167, S. 211 Anmerkung); für Trajan aber haben wir das Zeugnis der Trajanssäule und Plinius Panegyr. 14; für Alexander Severus die Vita 48, 4; für Caesar Sueton Caes. 57; für Marius Plutarch Mar. 13. Weniger beweisend ist das περιϊών bei Plutarch im Leben des Antonius c. 47 und Lukull als πεζός Plut. Lukull 28. Dagegen sehen wir den Agricola zu Pferde (Tacitus Agr. 35), ebenso Sulla (Plut. Sulla 21), ebenso Maximin (Script. historiae Aug. Maximin 12); vgl. auch Livius 22, 3, 11 u. 49, 3. Genauer schreibt Claudian De IV. consul. Honorii 349 dem Imperator vor: nunc eques in medias equitum te consere turmas, nunc pedes assistas pediti; d. h. schließt der Oberfeldherr sich der Infanterie an, so soll er zu Fuß gehen, mit der Kavallerie reiten.
[86] Expedire heißt eigentlich den Fuß befreien, wie impedire den Fuß hemmen, compedire die Füße mit Fesseln zusammen schließen. Jenes bestand darin, daß man das schleppende Kleid hoch gürtete; der Kriegsmann geht cinctus, d. h. er gürtet das Kleid. Wichtig zum Verständnis ist, daß der alte Plautus Amph. 308 schreibt: cingitur: expedit se: „er gürtet sich, er will freien Fußes losfahren.“ Das wird hernach im übertragenen Sinn gebraucht, und Livius schreibt 38, 21: expedire se ad pugnam, d. i.: „alles Gepäck beiseite werfen, um kämpfen zu können.“ Deshalb heißt „Expedition“ in der alten Heeressprache dasjenige militärische Unternehmen, bei dem ein Wagentroß nicht mitgeführt wird; so wiederum bei Livius: cum promptissimis iuvenum praedatum atque in expeditiones ire. Wer promptus ist, ist expeditus. Vgl. auch Hirtius, Bellum Gallicum VIII, 34, wo es die expediti sind, die nächtliche „Expeditionen“ unternehmen.
[87] Seneca, Epistel 87 und 123, 7. Gute Abbildungen bespannter Wagen sind selten; um so wertvoller das neugefundene griechische Marmorrelief aus älterer Zeit: Archäol. Jahrbuch 1918, Anzeiger S. 15, Abb. 13.
[S. 242]
[88] Statius Silven 3, 5, 75.
[89] Seneca Ep. 77.
[90] Juvenal 14, 265 ff.
[91] Tacitus Ann. 2, 53 und 61.
[92] Horaz, Ep. 1, 11, 11.
[93] iter solum per avia nemorosa, Mosella Vers 5.
[94] Auf „Gehen“ weisen alle Wörter, die da Ausonius braucht: transieram V. 1, ingrediens V. 5, per avia V. 5, praetereo V. 7. Ich verstehe nicht, wie Hosius S. 26 seiner Ausgabe ansetzen kann, Ausonius sei dort auf der Römerstraße mit der Reichspost gereist.
[95] ὁδοιπόρος ist der Reisende nur, sofern er zu Fuß geht (vgl. z. B. Plutarch Antonius c. 62). Nach der Überlieferung lautet der Titel des Gedichtbuches des Persius freilich nur „opericon librum unum“ (Sueton p. 75 R.). Äußerlich näher läge es, dies in „ὀπωρικῶν librum unum“ zu verbessern. Dies wären Lieder zur Obsternte. Indes ist ὀπωρικός ein Wort, das sich kaum belegen läßt, und ich halte deshalb an dem im Text Gegebenen fest. Vgl. übrigens hodoeporium genus (?) cantilenae; G. Esau, Glossae ad rem librariam pertinentes, Marburg 1914, S. 109.
[96] viam vorare, Catull 35, 7. Man hat hierfür an den modernen „Kilometerfresser“ erinnert.
[97] Rhein. Museum Bd. 69, S. 390.
[98] Apostelgeschichte 20, 13: πεζεύειν.
[99] Digesten II, 11, 1; Riepl, S. 145.
[100] Apostelgesch. 28, 11, vgl. übrigens E. Aßmann in Baumeisters Denkmälern, S. 1623.
[101] Vgl. Rhein. Mus. 65, S. 474; meine Katalekton-Ausgabe, S. 123.
[102] G. Wissowa, Religion und Kultus der Römer, 2. Aufl. S. 277.
[103] Vgl. Cicero pro Roscio Amerino 18.
[104] Horaz, Ep. I, 11, 11.
[105] Cicero pro Cluentio 163: Ambivius homo multorum hospes, copo de via Latina.
[106] Marquardt-Mau, Privatleben, S. 472. Ein As sind etwa 4 Pfennige.
[107] Das Bett ist offenbar bei dem Posten „Mädchen“ mit eingerechnet.
[108] naves tabellariae, naves cursoriae.
[109] Ein anderer herrlicher Schiffstyp waren die myoparones der kleinasiatischen Piraten, deren sich z. B. Mithridates bediente, um an Sertorius in Spanien rasche Nachricht zu bringen: vgl. Cicero Verrinen 1, 86 f.
[110] Sueton, Octavian 49.
[111] Riepl, S. 221.
[112] Riepl, S. 263.
[113] S. 181.
[114] Tacitus Historien 2, 54.
[115] Plutarch Galba 7.
[116] Vgl. das ambulare per Britannos, Vita Kap. 16. Einmal hören wir, daß Hadrians Wagen zerbricht; er reist dann zu Fuß und überholt den gleichzeitig laufenden Militärboten: Vita 2, 6.
[S. 243]
[117] Vita Kap. 23.
[118] Ein gewisser Oppius hatte das damals zeitweilig in Händen.
[119] Riepl, S. 142.
[120] Den regen Betrieb veranschaulicht uns auch Cicero ad Atticum 2, 12: Cicero reist eben über Land und hat auf der uns bekannten Station Tres Tabernae schon frühmorgens einen Brief an Atticus abgehen lassen. Als er nach Forum Appi kommt, ist es immer noch Vormittag; da schreibt er abermals an ihn und erzählt nun: „eben war ich in Tres Tabernae angelangt, da läuft Curio (ein guter Bekannter), der aus Rom kommt, mir entgegen, und gleich kommt da auch dein Diener mit den Briefen von dir an. Erst höre ich den Curio erzählen; politische Neuigkeiten: „weißt du’s noch nicht? Publius will Tribun werden.“ „Und was macht Caesar?“ und so fort. Ich umarme ihn, entlasse ihn und reiße sofort deine Briefe auf; sie melden dasselbe.“ Diesen Brief kann Cicero nun aber nicht gleich an Atticus abgehen lassen; ein Bote fehlt, und er wird erst am folgenden Tag abgeschickt (Riepl, S. 259).
[121] Riepl, S. 280 f.
[122] Riepl, S. 309.
[123] Cassius Dio 63, 114.
[124] Cicero ad fam. VIII, 1.
[125] Die acta diurna hießen auch acta urbana, weil nämlich nur Dinge der Hauptstadt darin standen, sie hießen auch acta publica, sofern sie unter Aufsicht des Staates redigiert wurden.
[126] In des Tacitus Zeit wurden die Senatsakten freilich nicht mehr vollständig, sondern nur in Auswahl publiziert, aber ihm, als Senator, standen die vollständigen Verhandlungsberichte ohne Frage zur Verfügung.
[127] Auffällig ist auch, daß diese Akta nie mit Buchzählung zitiert werden, welche doch, falls eine Unzahl von Buchrollen, die die Jahrgänge enthielten, sich ansammelte, unerläßlich war. Daß wir sie nie als Jahrgänge, d. h. nach dem Jahr ihres Erscheinens zitiert finden, erklärt sich schon daraus, daß das Altertum eine Jahreszählung überhaupt nicht hatte.
[128] Philostrat, Apollonius von Tyana VII, 16.
[129] Vegetius de re militari V, 9.
[130] Cicero ad Att. XI, 16, 4.
[131] Cicero ad fam. X, 31 u. 33.
[132] Bei Plutarch (Caesar 37) wird es dem Caesar zum Vorwurf gemacht, daß er beim Wintersturm über das Meer setzt, was selbst ein Gott nicht könne; vgl. auch Plut. Antonius 7; Lucan V, 504 ff.
[133] Im Winter bringen auch dem Vespasian, der in Alexandrien ist, seine Verehrer aus Rom persönlich die Nachricht, daß Vitellius tot ist: Tacitus hist. III, 48: dies ist ein Merkmal dafür, wie wichtig es damals war, sich des neuen Kaisers Gunst sofort zu sichern.
[S. 244]
[134] Bei Cassius Dio 51, 45 wird noch ein ähnlicher Fall erzählt, wo Antonius im Winter über das, was Oktavian treibt, völlig ohne Nachricht bleibt. Übrigens stand es um das Jahr 400 n. Chr. ähnlich zwischen den getrennten Reichen des Arkadius und Honorius; von Constantinopel kommen nur verspätete und unzuverlässige Nachrichten nach Rom. Vgl. den Historiker Eunapius fr. 74 (meine Claudian-Ausgabe S. XXXIV, Anmerkung).
[135] Unter „London“ 28. April berichteten unsere deutschen Zeitungen folgende Mitteilungen. Daily Telegraph meldet: Die Nachricht von dem Aufruhr in Dublin wurde gestern früh hier durch Reisende aus Irland herübergebracht. Sie sprach sich vormittags in der Stadt herum. Daily Chronicle: Die Mitteilungen des Staatssekretärs für Irland im Parlament waren für das Haus eine vollständige Überraschung. Basel, 28. April: Der Überfahrtsverkehr von England nach Irland ist eingestellt. London, 27. April: Im Unterhaus sagte Birrell, er wisse nicht, ob die Postverbindung mit Irland funktioniere; zwei Dampferlinien seien unterbrochen. London, 28. April: Im englischen Oberhaus fällt die Äußerung, die Aufständischen haben das Kabel durchschnitten. Dann wird noch gemeldet, daß sie in Dublin das Hauptpostamt und zwei Bahnhöfe besetzten und alle Drähte durchschnitten.
[136] Juvenal 7, 97.
[137] Der Verfasser ist Dr. Ernst Schultze.
[138] In den umfassenden Werken über griechische und römische Altertümer und Sittengeschichte der Alten, die wir besitzen, von C. F. Hermann und seinen Fortsetzern, von Marquardt-Mau, von Blümner und Friedländer habe ich mich umsonst nach Auskunft über diesen Gegenstand umgesehen. Diese Werke notieren leider immer nur das, was die Alten besaßen, nicht, was ihnen fehlte; und oftmals ist das letztere noch charakteristischer für die Kultur als das erstere. Gleichwohl hoffe ich, daß mir in der nachfolgenden Zusammenstellung an Nachweisen über die Laus nichts Wesentliches entgangen ist.
[139] Diese vielen phth in der Transkription griechischer Wörter, wie phtheir, Phthiriasis, Naphtha, Diphthong, Diphtheritis, Ophthalmologie u. a., sind überaus lästig für jeden Leser; seit der Renaissancezeit sind diese Schreibungen leider eingebürgert und schwerlich zu beseitigen. Die richtige lateinische Umschrift ist vielmehr ptheir, Naptha, Dipthong usf.
[140] Plutos 537.
[S. 245]
[141] φθειροκομίδης bei Hesych.
[142] Beim Komiker Aristophon fr. 12 und 13 (Kock). Chr. Jensen machte mich auf diese Stelle aufmerksam. Wenn es dort im fr. 13 heißt: φθεῖρας δὲ καὶ τρίβωνα τήν τ’ ἀλουσίαν οὐδεὶς ἄν ὑπομείνειε τῶν νεωτέρων, so ist es verfehlt, an dem τῶν νεωτέρων zu rühren. Das ergibt sich schon aus dem, was ich dargelegt. Für die jüngere Generation waren solche Leute damals unerträglich geworden. Auch darf das fr. 12 mit fr. 13 nicht zu einer Texteinheit zusammengefaßt werden.
[143] Wolken 145.
[144] Thesmoph. 1180.
[145] Wespen 372.
[146] Frösche 115.
[147] Thesmoph. 218 ff.
[148] Friede 740.
[149] Vgl. z. B. Arist. Ritter 1060.
[150] Ritter 51.
[151] Ich erinnere an Kaiser Julian, der in seiner humoristischen Schrift „Misopogon“ wirklich von den Läusen in seinem Barte redet.
[152] Arist. Ekklesiaz. 63.
[153] Der Komiker Eubulos, fr. 32 K. Man vergleiche dazu Celsus VI, 6, 15 von der Läusekrankheit (worüber unten): wer an ihr leidet, dem muß der Kopf bis auf die Haut geschoren werden (caput ad cutem tondendum).
[154] Athenaeus p. 586 A.
[155] Plato im Sophisten, p. 227 B.
[156] Diog. Laert. VI, 39–47.
[157] Im „Culex“.
[158] Vgl. dazu auch die σαπρά bei Aristophanes Thesmoph. 1025.
[159] Martial I, 37.
[160] Auch in dem üblen Martialgedicht XII, 59 steht nichts von ihr. Erst barbarische „Textverbesserer“ der Neuzeit haben in dies Gedicht die Läuse gebracht. Vgl. Rheinisches Museum 71, S. 274.
[161] Sueton Domit. 3.
[162] Catull c. 23; danach Martial XI, 32.
[163] Novius 107.
[164] Festus, pag. 210: pedibus obsitum.
[165] Titinius 177.
[166] Plautus Curc. 500.
[167] Lucilius v. 882 ed. Marx; Marx hat die Stelle nicht richtig verstanden.
[168] Vidularia, fr. XIX: ubi quamque pedem viderat, subfurabatur omnis: „wo immer er eine Laus sah, pflegte er sie gleich alle zu entfernen.“
[169] Appian, Bell. civil. I, 101.
[170] Hinzugefügt sei endlich noch Plutarch, Quomodo adulator eqs. pg. 49 C, der sagt: wie die Läuse den toten Menschen, so verlassen die Schmarotzer den reichen Mann, der verarmt. Vielleicht aber hat auch noch das Rätsel in der Anthologia Palatina XIV, 19 auf die Laus Bezug; s. Ohlert, Rätsel und Gesellschaftsspiele (1886), S. 143.
[S. 246]
[171] Auch Pheretime, die Königin, stirbt so; vgl. Herodot IV, 205.
[172] Pausanias X, 10, 6 ff.
[173] Herodot II, 37.
[174] Von den Adyrmachiden: Herodot IV, 168.
[175] Strabo IX, p. 492, 497 u. 499; auch bei Ptolemäus. In des Plinius Zeit hieß dies Volk Salae oder Saltiae; vgl. Plinius, nat. hist. VI, 14.
[176] Das Waschen oder Baden bei den alten Germanen hebt schon Tacitus Germ. 22 hervor; vgl. Plutarch Mar. 19.
[177] Die Homerfrage ist von mir genauer erörtert in meinem Buch „Kritik und Hermeneutik nebst Abriß des antiken Buchwesens“, München 1913, S. 89 f. und 247 f.
[178] Man hat den Umstand, daß Homer kein Buch erwähnt, gedankenlos genug, damit wegzudeuten versucht, daß Homer archaisiere und es deshalb, weil es den alten Helden nicht anstehe, unterdrückt habe. Warum erwähnt Homer denn doch die Schreibtafel? Es ist, wie auf der Hand liegt, zweierlei zu unterscheiden. Gewisse Dinge, wie vor allem die von Aristophanes so begünstigten turpia naturalia, verschweigt Homer, weil sie dem Heldenstil nicht anstehen, andere Dinge deshalb, weil er sie noch nicht kennt. Er redet noch nicht von Münzen, von Götterbildern, noch nicht von der Jahreszeit des Herbstes und so manchem anderen, was erst die spätere Kultur und Gedankenentwicklung brachte. Auch Hühner kennt Homer noch nicht, die erst später aus Asien zu den Griechen kamen. Mit Überzeugung stellen wir hierzu auch das Buch, das, sobald es aufkam, ein Stolz des Griechen war; denn, wie die Bildwerke uns zeigen, traten die Dichter und Sänger stets mit der Buchrolle in der Hand vor ihr Publikum. Es war nicht nur Hilfsmittel, es war Abzeichen ihres Berufs. — Die Schrift auf der Schreibtafel des Bellerophon war übrigens gewiß nicht die phönizisch-griechische, sondern die ältere Zeichenschrift, also die „ägäische“, worüber Evans, Cretan pictographs, London 1895. Vgl. Petersdorff, Germanen und Griechen (1902), S. 49 f.
[179] Eine andere Überlieferung besagt, daß Homer blind geboren war und daß ὅμηροι bei den Doriern die Blinden hießen; vgl. die Scholien zu Lucian, ed. Jacobitz IV, S. 191.
[180] Vgl. hierüber Gregorovius, Wanderjahre in Italien Bd. 3, (1881), S. 299. Auch in Bosnien treten übrigens Blinde noch heut als Volkssänger auf, wennschon sie keine Gilde bilden; s. Sitzungsber. d. Wiener Akad. Bd. 173 (1914), 3. Abh., S. 16.
[S. 247]
[181] Diese Möglichkeit hielt mir Rudolph Wagner im Korrespondenzblatt für die höheren Schulen Württembergs 21 (1914), S. 456 entgegen.
[182] Es sind 27803 Hexameter, die auf 466 Tafeln stehen konnten, wenn jede Tafel 60 Verse aufnahm.
[183] Zum folgenden vergleiche Kritik und Hermeneutik S. 249 ff.
[184] Vgl. a. a. O. S. 277.
[185] Über die Hesiodfrage a. a. O. S. 220 ff.
[186] Vgl. hierzu: „Die Buchrolle in der Kunst“, Leipzig 1907, S. 10 ff.
[187] Man setzt das Leben des Stesichoros schätzungsweise in die Jahre 640–555; früher als das Jahr 600 aber braucht keins seiner Werke entstanden zu sein.
[188] Hierüber vergleiche Rud. Herzog: „Die Umschrift der älteren griechischen Literatur in das jonische Alphabet,“ Leipzig 1912; Kritik und Hermeneutik S. 133 und 379. Weitere Bestätigung brachten J. Wackernagels Sprachliche Untersuchungen zu Homer, Göttingen 1916.
[189] Vgl. zum Vorstehenden Kritik und Hermeneutik S. 307; Das antike Buchwesen (Berlin 1882) S. 433 ff., Die Buchrolle in der Kunst S. 212 f.
[190] Die Schilderung ist nach Achilles Tatios p. 121 ed. Hercher gegeben. Vergleiche übrigens Kritik und Hermeneutik S. 203 ff.; Die Buchrolle in der Kunst S. 6 f.
[191] Vgl. Kritik und Hermeneutik S. 278 f. und 351 f.
[192] a. a. O. S. 295.
[193] Vgl. über die Ausstattung der Bücher a. a. O. S. 327 ff.; über die Bilderbücher S. 305; über die Einrichtung der Bibliotheken S. 335 ff. Genaueres, Die Buchrolle in der Kunst S. 282 ff., 228 ff.
[194] Was ich hier vortrage, ist in dem Buch „Die Buchrolle in der Kunst“ ausführlich dargelegt.
[195] Das erste geheftete Literaturbuch ist nachweislich im Jahre 84 oder 85 n. Chr. hergestellt worden; auch in den nächsten 100 Jahren blieb es eine Seltenheit; s. Kritik und Hermeneutik S. 345 ff.
[196] Vgl. die Abbildungen „Die Buchrolle in der Kunst“ S. 142–168 und 195.
[197] Vgl. hierzu Neue Jahrbücher Bd. 19 (1907), S. 714 ff.
[198] Vgl. „Buchrolle“ S. 325.
[199] Vgl. auch Claudian Stilicho II, 476; bei Prudentius Peristeph. I init. schreibt so Christus.
[200] Nachweise für das Folgende findet man großenteils in dem Buch „Kritik und Hermeneutik“ S. 315–327; Ergänzendes im Rheinischen Museum 72, S. 311 ff.
[S. 248]
[201] Der Eunuch des Terenz macht eine Ausnahme; s. Donat. I, S. 266 ed. W.: ut rursus esset vendita et ageretur iterum pro nova.
[202] Dies betont Horaz mit Nachdruck in der Ode IV, 8.
[203] Durch solche Aufgabenstellung sind Vergils Georgica und Aeneis entstanden.
[204] De Amorum in arte antiqua simulacris et de pueris minutis apud antiquos in deliciis habitis commentariolus Catullianus alter. Marpurgi 1892 (Elwertscher Verlag). Ich verweise im nachfolgenden kurz auf diese Schrift mit lateinischen Seitenzahlen. Nochmals habe ich den Gegenstand in der Deutschen Rundschau, Bd. 74, S. 370 ff. behandelt, ein Aufsatz, der im Vorliegenden wiederholt wird.
[205] Der Verfasser des Artikels „Eros“ in Pauly-Wissowas Realenzyklopädie scheint meine einschlägigen Arbeiten nicht gekannt zu haben.
[206] Vgl. E. Knoll, Über das Attribut der Beflügelung, München 1888; vorher J. Langbehn, Flügelgestalten, 1880. Paradox hierüber Victor Hehn, Reisebilder aus Italien und Frankreich (1894), S. 72, in Anknüpfung an Rafaels Vision des Ezechiel; mit diesem Gemälde Rafaels kann vielmehr das pompejanische Bild des fliegenden Zephyros mit Chloris (in Neapel) verglichen werden.
[207] Die Nikeflügel wurden mit den Erosflügeln identifiziert von Aristophon im Pythagoristen (fragm. comic. II, p. 280, Kock).
[208] Vgl. De Am. p. XLII. Bei Alexis (Kock a. a. O., S. 305) steht als Ansicht der „Sophisten“: nicht der Eros selbst könne fliegen, sondern die Liebenden; aus Irrtum malten die Maler ihn selbst mit Flügeln.
[209] Vgl. Roscher, Mytholog. Lexikon III, S. 1410 und 1462.
[210] Die Analogien, die Usener „Götternamen“ S. 298, heranzog, sind nicht zutreffend. Er verkannte, daß die Amoretten gar keine Götter, kein Gegenstand der Religion waren; denn sie hatten keinen Kultus. Sie sind lediglich ein Spiel der dichtenden Phantasie, und solchem Phantasie-Spiel kann man nicht auf gleichsam grammatischem Wege mit Analogien, wie Usener sie bringt, beikommen. Wer Poesie erklären will, muß in das volle Menschenleben greifen; denn alle Dichtung ist Reflex des Lebens, und das Leben ist kompliziert. Ein paar Zeilen genügen nicht, um die Sache zu erledigen.
[211] Alexis im Phaidros bei Kock, Bd. II, 386.
[212] Man vergleiche den Ausspruch des Ptolemäus bei Athenäus S. 536 E.
[213] Vgl. De Am. p. X.
[214] Vgl. p. XXXVII.
[215] Vgl. zum Folgenden p. X ff.
[216] Vgl. Seneca de tranquill. animi 17, 4.
[S. 249]
[217] Eurip. fr. 856 Nauck, aus Aelian var. hist. 12, 15. Schon die Anführung des Herkules verrät, daß dies stoisch-zynische Ausführungen waren.
[218] Vgl. hierzu Aelian a. a. O.; Athenäus B. XII, S. 518 f., die auf gleiche Quelle (Favorinus?) zurückgehen.
[219] Prudentius in der Psychomachia, praef. v. 30.
[220] Ähnlich Kinder in der Rennbahn bei Cassius Dio 72, 13.
[221] Vgl. p. XXXV ff. „Wein und Kinder reden die Wahrheit“ war ein griechisches Sprichwort (Philol. Suppl. Bd. VI, 1891, S. 249).
[222] Catull c. 55; zur richtigen Lesung des Textes dieses vielfach mißverstandenen Gedichts vgl. Philologus LXIII, S. 447 f.
[223] Vgl. p. XIII ff.
[224] Vgl. p. XVIII.
[225] Vgl. zum Folgenden p. XIX ff.; nackte Putten, Terrakotten von Zypern, s. Mitteilungen des Deutschen archäologischen Instituts in Athen, Bd. VI, S. 249.
[226] Vgl. auch das alte Werk Delle Antichità di Ercolano, tom. VI (1771), p. 183–195.
[227] Helbig, Campan. Wandgemälde, Nr. 1390; vgl. auch daselbst in den Friesbildern unter Nr. 1401 b die Szene mit liegendem nacktem Kind und den zwei nachdenklichen Frauen. Delicien auf Vasenbildern z. B. bei Benndorf, Griechisch-sicilische Vasenbilder (1869), Tafel 36, Nr. 1 und 5; Kinderköpfe auf wertvollen Steinen z. B. bei Arneth, Monumente des Wiener Münz- und Antikenkabinetts (Kameen), Tafel 21, Nr. 3 und 9. Wozu hier von Amoren reden? Man sage nicht mehr aus, als man sieht.
[228] Man vergleiche auch den Knaben mit der Fuchsgans, in den Jahresheften des österreich. archäol. Instituts VI (1903), S. 226 ff.
[229] Im Hera-Heiligtum zu Olympia, wo auch der Hermes des Praxiteles stand, war unter vielen Einzelstatuen die bronzene Aphrodite des Kleon von Sikyon aufgestellt, „vor ihr“ aber die Statuette eines „nackten, kleinen Kindes vergoldet“, ein Werk des genannten Boethos. Es war dies klärlich kein Eros, sonst hätte ihn Pausanias, der die Nachricht gibt (V, 17, 4), Eros benannt; sondern ein Kind ohne Flügel; es war ferner klärlich ein Werk ohne Erfindungszusammenhang mit der Venus, vor der es aufgestellt war. Boethos hat, soweit wir wissen, nur flügellose Kinder gearbeitet. Dies sei erinnert im Hinblick auf Dümmler (Mitteilungen des archäologischen Instituts in Athen, Bd. X, S. 27 ff.).
[230] Vgl. Mitteilungen des Deutschen Instituts in Athen, Bd. VI, Tafel 13.
[231] Vgl. p. XXX.
[232] Beispiele des dritten Jahrhunderts in Terrakotten, dazu die Marmorstatue von Beirut, s. Dümmler a. a. O.
[233] So Claudian; vgl. meinen Index zu diesem Dichter unter Amor; so schon vor Claudian und zuerst Philostrat, der raffinierte Ausleger von Gemälden, die nicht einmal wirklich vorhanden waren, sondern nach vorhandenen Motiven so fingiert sind, daß die Beschreibung vollstes Leben gewinne; unten Anmerkung 242.
[S. 250]
[234] Vgl. p. XXXI und XXXVII.
[235] Vgl. p. XXXVIII.
[236] Vgl. zum weiteren p. XXXVIII ff.
[237] Auch das Kind Enorches war aus dem Ei zur Welt gekommen (siehe das Scholion zu Lykophron v. 212). Ein höchst merkwürdiges Vasenbild zeigt uns auf einem Altar ein großes Ei liegend, darin ein munteres kleines Kind, ohne Flügel, das lebendig ans Tageslicht verlangt: eine Frau steht davor und betrachtet es neugierig oder erwartungsvoll. Es scheint mir nach allem Gesagten nicht nötig, mit E. Braun (in Annali dell’ Istituto 1850, p. 214 ff.) die Erfindung dieses Bildes aus einem bestimmten Mythus herzunehmen. Weiteres über das Ei der Leda bei R. Kekulé, Bonner Festschrift für das römische Institut 1879.
[238] Die Beflügelung war hier nicht kühner als bei jenen großgeflügelten Mädchengestalten bei Helbig a. a. O. Nr. 926–937, die als „freie Produkte der Phantasie ohne Anspruch auf mythologische Benamung lediglich künstlerische Motive zur Darstellung bringen.“
[239] Vgl. p. XXI f.
[240] Auch Phosphorus erscheint als „Amorette“ fliegend; vgl. Wörmann, Landschaft in der alten Kunst, S. 241; auch S. 264. Auch die Jahreszeiten sind so dargestellt: ebenda S. 258; auch Zephyr bei Philostrat, Gemälde I, 9.
[241] Vgl. p. XXII; so auch Archäologische Zeitung 1848, Tafel XXIII, Nr. 1; vgl. auch Tafel XXII, Nr. 4.
[242] Ein Muster allegorischer Auslegung gibt der antike Sophist und kunstreiche Gemäldebeschreiber Philostrat in seiner berühmten Schilderung des Erotenbildes; daß ganz vorzüglich diese Philostratstelle auf die Amorettenerfindungen Rafaels, Dürers, Tizians Einfluß geübt, suchte H. Grimm darzutun: Fünfzehn Essays, neue Folge (1875), S. 102 ff. Jenes Bild mit seiner überfüllten Komposition, das Philostrat beschreibt, hat sichtlich nur in seiner Einbildung bestanden; er hat darin eine Fülle von Amorettenmotiven, die in Wirklichkeit verstreut vorkamen, zusammengehäuft, und in dieser Kombination zu einem Ganzen lag der Witz, lag der Reiz für den antiken Leser. Hier bei Philostrat finden wir es zuerst ersonnen, daß die Amoren (außer dem einen) nur Kinder von Nymphen sind; und sie sind so viele, „weil die Begierden der Menschen so mannigfaltigem nachstreben“. Zusammen von diesen Nymphen und diesen Eroten wird ein Götterbild der Aphrodite verehrt; die Kleinen halten Apfelernte, um der Göttin Äpfel, die Frucht, die ihr symbolisch eignet, darzubringen. Sie jagen einen Hasen, um ihn ihr lebendig als Opfertier zu weihen; es ist das Tier der Venus und der Fruchtbarkeit. Weiter aber: „Vier der allerschönsten! Das eine Paar wirft sich Äpfel zu, das andere schießt mit dem Bogen aufeinander; .... sie bieten die Brust den Pfeilen dar. Da will uns der Maler etwas zu raten aufgeben. Ob wir es wohl herausbringen? Das soll Liebe und Sehnsucht bedeuten. In denen dort, die mit den Äpfeln spielen, regt sich das erste Verlangen. Der eine küßt einen Apfel und wirft ihn dem anderen zu, und der ... wird ihn wieder küssen und zurückwerfen. Die beiden Bogenschützen aber treiben mit den Pfeilen die schon erwachte Liebe tief in ... die Herzen hinein. Und so sage ich: jene dort spielen mit der Liebe zum Beginn, diese hier geben ihr ewige Dauer.“ Man sieht, Philostrat hat mit Sorgfalt vor allem solche Szenen in sein Gemälde gesammelt, die allegorisch deutbar waren, wo die Eroten als Eroten „Sinn“ hatten. Bei anderem, wie bei ihrem Ringkampf, verzichtet er hübsch auf solches Auslegen, und bei den unten von mir zu besprechenden Genreszenen würde er erst recht darauf verzichtet haben. Überhaupt war es augenscheinlich schon eine Leistung, zu der ein Philostrat seine sophistischen Künste benötigte, auch nur jenen erotischen Bezug des Apfelküssens, Bogenschießens und Hasenjagens herauszugreifen und festzulegen. Es sind dies einige von den wenigen Fällen, wo die geflügelten Spielkinder noch wirklich ihrem Namen zu entsprechen schienen. Und man fragt schließlich verwundert: wozu hießen sie eigentlich noch Eroten? was hatten Kinder von Nymphen im Grunde noch mit Venus, mit der Liebe wirkenden Macht zu tun? Man sieht, die ganze Konstruktion Philostrats von den Nymphenkindern und ihrem Kultus des Venusbildes ist nachträglich und willkürlich ersonnen. Auch beachte man, daß diese Kinder bei ihm die Liebe der Menschen gar nicht entzünden; sie lieben nur untereinander. Das konnten schließlich auch die wirklichen Deliciae tun, und das Erotenspiel ist auch hier beim Philostrat nur eine Nachahmung des Menschenlebens, keine Beeinflussung desselben.
[S. 251]
[243] Furtwängler bei Roscher, Mythol. Lex. I, S. 1368.
[244] Vgl. p. XXII, Anm. 3.
[245] Vgl. p. XXII und die Statuette daselbst Abbildung VI; Helbig, Führer, 3. Aufl. Nr. 1556.
[246] Daß auch Ganymed zum kleinen Kinde verjüngt wurde, scheint von den Gelehrten nicht genügend beobachtet zu sein; dies ist notwendig überall der Fall, wo er als collusor mit Eros Astragalen spielt; ebenso denkt ihn sich Lucian, vgl. p. XXXVII. Es ist also kein Anlaß, die Marmorgruppe in der Galleria dei candelabri im Vatikan, die den Ganymed als Kind vom Adler rauben läßt, um dieses Umstandes willen für unantik zu halten; vgl. Helbig in Annali dell’ Istit. 1867, S. 351; Overbeck, Griechische Kunstmythologie, Bd. I, S. 539, Anm. 217.
[S. 252]
[247] Claudian, de III cons. Honor. v. 22.
[248] Vgl. p. XXVI über Clodius Albinus.
[249] Vgl. p. XXV ff.
[250] Für Athanasius vgl. Sozomenos II, 17; Sokrates I, 15. Wie in der katholischen Schweiz Kinder im Ernst und doch scherzend die Messe nachmachen, schildert H. Federer, Das Mätteli-Seppi, S. 501 ff.
[251] Bei Baumeister, Denkmäler, Nr. 1617.
[252] Z. B. bei Baumeister, Nr. 545.
[253] Vgl. p. XXXII f.
[254] Cassius Dio, Buch 48, Kap. 44.
[255] Properz II, 29; vgl. Kritik und Hermeneutik S. 123.
[256] Catull 68, 133 f. Auch im Acmegedicht des Catull, Nr. 45, läuft das Spielkind als Amor um das Liebespaar herum und niest: vgl. Berl. philol. Wochenschr. 1919, S. 575.
[257] Catull 68, 70.
[258] Nie nennt sonst ein Dichter seine Geliebte diva. Vgl. Philologus LXIII, S. 451 f.
[259] Wie wenig evident die bisher übliche Auslegung ist, bekennt auch O. Jahn. Wie kam gerade ein gemeiner Handwerksmann dazu, einer solchen Frau wirkliche Liebesgötter, also Liebe oder Liebreiz, zu verkaufen? Insbesondere machte der hinter der Frau sich versteckende Erot unlösbare Schwierigkeiten; der treffliche Gelehrte tröstete sich damit, „daß einst auch pompejanische Beschauer bei diesen Vorstellungen verschiedene Gedanken und Empfindungen gehabt haben werden“. Es blieb dies also eine Rechnung mit mindestens einer Unbekannten. Eben diese Schwierigkeiten räumt die oben gegebene Auslegung hinweg. O. Roßbach erhebt in der Berl. philol. Wochenschr. 1918, S. 1208 gegen meine Erklärung immer noch das Bedenken, daß die Frau als Göttin charakterisiert sei. Aber wie oft haben sich Herrscher als Götter, hohe Frauen als Göttinnen darstellen lassen! Auch erinnere ich nochmals an die Lesbia als Diva bei Catull und an Kleopatra, die die sie umgebenden Kinder als Eroten zurechtmachte, während sie gleichzeitig selbst die Venus spielte; sie muß da doch auch die Stephane der Göttin getragen haben. Man nenne also die Frau auf dem Bilde meinetwegen Kleopatra. Aber es wird wohl mehr solche phantastische hochgestellte Frauen gegeben haben. Jedenfalls ist sie eine Sterbliche, da es der Diener ist, der ihr die Putten bringt.
[260] Man sehe z. B. bei Helbig die Nummern 1413, 1429–1431. Eros unter Frauen auch Nr. 312.
[261] Vgl. z. B. Helbig, Nr. 1439; auch 303, 305? beim Hermaphroditen 1369.
[262] So erklärt sich z. B. der scheinbar zwecklose Eros in der Paris- und Helenaszene Pompejis (bei Helbig Nr. 1310). Noch beiläufig zwei lehrreiche Beispiele, Helbig Nr. 1140: Eros hebt neugierig das Gewand des Priap empor und erstaunt über den Anblick; es sind hierfür sonst flügellose Putten üblich; vgl. De Am. p. XXIV. Tellus erscheint mit zwei Flügelkindern bei Benndorf, Griechisch-sicilische Vasenbilder, Tafel 57, Nr. 9; diese Kinder sind aber ursprünglich flügellos, vgl. De Am. p. XXIV und das Relief, Archäologische Zeitung X, Tafel CXIX, Nr. 2, sowie Baumeister, Nr. 1449. Auch das Element Erde wird als Matrone mit zwei Kindern dargestellt auf einem Florentinischen Relief und sonst; s. Wörmann S. 257.
[S. 253]
[263] Man vgl. hierzu den oben angeführten Aufsatz H. Grimms.
[264] Einige weitere Nachweise, die sich mir für den besprochenen Gegenstand nachträglich darbieten, stelle ich noch an den Schluß des Ganzen. Daß die ältere griechische Kunst noch nicht Kinder darstellte, weiß auch Pausanias V, 11, 3. — Schon in der jüngeren griechischen Komödie, an die die alexandrinischen Dichter unmittelbar anschlossen, kommen die frechen Spielkinder in den Häusern vor; s. besonders Plautus Persa v. 204 ff.; 229; 807; 849; auch Pseudolus 767, 783. Kinderkauf in der Komödie: Captivi 8, Rudens 39, Poenulus 86. — Auch Tertullian erwähnt contra Marc. IV, 23 den Kinderliebhaber, parvulorum dilector. Über das Wort parvuli vgl. Archiv f. Lex. VII, S. 79 und 95. — Kinder, die man sich als conlusores hält, zeigt uns auch Plautus, Capt. 19 f., 982 f., 1013. — Daß Kinder den Gladiatorenkampf im Spiel nachahmen, sagt uns Epiktet, Man. 29, 3; auch findet man solche dargestellt bei A. Bougot, Une galérie antique (Paris 1891), S. 499, der sie aber sinnlos für Amoren erklärt. — Ein Haufe Spielkinder begegnet uns in Alexandria selbst im Tempeldienst beschäftigt bei Dio von Prusa Or. 32, 13. — Daß man die Kinder im Amphitheater mit Hilfe von Maschinen in die Höhe fliegen ließ, deutet vielleicht Juvenal IV, 122 an. — Auch Plautus weiß, Trucul. 908, daß Säuglinge wie Vögel groß gezogen werden. Vom schwatzenden Kindernest spricht auch Juvenal V, 143; in den Sokratikerbriefen Nr. 21 lesen wir von den νεοττοί des Sokrates; vgl. übrigens Theophrast Char. 2. Ein Relief zeigt Romulus und Remus; in einer Grotte nährt da der Picus Martius zwei Junge im Nest: Berl. philol. Wochenschr. 1918, S. 1066, aus dem Anzeiger für Schweiz. Altertumskunde XX, Heft 2, S. 99. — Von dem süßen Schwatzen der kleinen Kinder gibt endlich Minucius Felix Oct. 2 eine entzückte Beschreibung; dazu auch Artemidor in der Traumdeutekunst 4, 19.
[265] René Waltz, Vie de Sénéque, Paris 1909; vgl. Historische Zeitschrift, herausgegeben von Meinecke, Bd. 104, S. 605.
[S. 254]
[266] Diese hat Friedländer einmal zu geben versucht, Historische Zeitschrift, Bd. 85, S. 193 ff.; aber er läßt die Hauptsache vermissen, eine zusammenhängende Würdigung der Ethik Senecas, sowie den Nachweis des Zusammenhangs seiner Schriftstellerei mit seinem Leben und Lebenszielen.
[267] Er hatte auch außerhalb Italiens, in Ägypten, Grundbesitz: trans mare possides, De vita beata 17, 2. Über dort gefundene Quittungen mit γῆ Σενέκα s. Gercke, Seneca-Studien, S. 302.
[268] S. J. Cunliffe, The influence of Seneca on Elizabethan tragedy. Vgl. auch Brandl in d. Sitzungsber. der Berl. Akademie, 14. Dez. 1917. Übrigens ist hier auch Chaucer zu nennen; wenn es bei Chaucer heißt:
so stammt dies aus Senecas Agamemnon. V. 260:
Vgl. R. Peiper in Fleckeisens Jahrbb. 97 (1868), S. 65.
[269] Seneca weiß sehr wohl, daß der Mensch, der sich isoliert, leichter der Verfehlung entgeht: meliores erimus singuli (De otio 1, 1); aber die Bürgerpflicht und Menschenpflicht zwingt ihn, die Isolierung zu vermeiden.
[270] Was Gegenstand der Philosophie sein soll, zählt Seneca De brev. vitae 19 auf; da wird auch die ganze Physik mit einbegriffen, der sich Seneca auch auf Korsika widmete; s. ad Helviam 20.
[271] Auf Grund der Aussagen von Augenzeugen; s. Natur. quaest. VI, 31, 3 und sonst. Der Ätna soll ihm zu Ehren bestiegen werden: Epist. 79, 2.
[272] Ich betrachte es als selbstverständlich, daß zu dieser Expedition, die Nero unternehmen ließ und die, wie es scheint, die Form eines kriegerischen Vorstoßes annahm, die Anregung von Seneca kam, der der Hauptvertreter der geographisch-physikalischen Interessen jener Zeit war, selbst in Ägypten gelebt, ein Buch über Ägypten geschrieben hatte (vgl. dazu Nat. quaest. VI, 26) und dauernde Beziehungen zu dem Nilland bewahrte; worüber unten.
[273] S. Medea 375. Andere wissenschaftliche Voraussagungen „veniet tempus“ eqs. s. Nat. quaest. VII, 25, 4 f. u. 30, 5.
[274] Epist. 79, 11 f.
[275] Dies hebt E. Zeller mit Recht hervor.
[276] Dies tut leider auch Friedländer a. a. O. Daß Senecas schriftstellerischer Erfolg weit mehr durch die Form als den Inhalt bedingt war (derselbe S. 226), ist allerdings richtig; denn ausgedehnte Sittlichkeitsvermahnungen pflegen die Menge durch ihren herben Inhalt stets abzuschrecken, und nur die Art des Vortrags macht sie wirksam.
[277] Vgl. Zur römischen Kulturgeschichte, 3. Aufl., S. 146 f.
[S. 255]
[278] Gegen die Tierhetzen u. ä. redet Seneca z. B. ausdrücklich De brev. vitae 13, 6 f.; De clementia 1, 25, 1. Gleichwohl kannte er natürlich die Kampfarten der Gladiatoren genau: De constantia 16, 2; De ira III, 43, 2.
[279] „Für Gott ist es der schönste Anblick, im Unglück Cato aufrecht stehen zu sehen,“ De provid. 4.
[280] De provid. 4.
[281] Epist. 78, 16.
[282] Epist. 60, 4.
[283] Ad Marciam 23.
[284] De otio 1, 4: selbst unser Tod soll noch nützlich sein.
[285] Ad Marciam 20, 3.
[286] Epist. 77, 4: vita non est imperfecta, si honesta est.
[287] Ad Marciam 26, 4. In Senecas Tragödie „Troades“ V. 392 ff. leugnet der Chor eine Fortexistenz der Seele, die nach dem Tode wie der Rauch verfliegt — post mortem nihil est ipsaque mors nihil usf. Dies erklärt sich jedoch aus dichterischen Rücksichten. Dem gestorbenen Achill zu Ehren soll dort die Jungfrau Polyxena geschlachtet werden; der Chor der Frauen will dagegen beweisen, daß dies Opfer sinnlos ist; denn der Tote, Achill, hat davon keine Wahrnehmung. Daher also die pessimistischen Ausführungen; Andeutungen der Hoffnung auf Glück im Jenseits waren eben hier in diesem Zusammenhang unbrauchbar. Zum Schluß aber hat doch derselbe Chor, v. 407, auf die Frage, wo bleibt denn die Seele des Gestorbenen? die genaue Antwort: da, wo die noch Ungeborenen sind. Damit ist, was Seneca persönlich glaubt, zum wenigsten angedeutet, und das genügte. Denn dasselbe lehrt Seneca auch in seiner Trostschrift an Marcia: Der Zustand der Ruhe nach unserem Tode ist derselbe wie vor unserer Geburt (19, 5), d. h. die Seele war präexistent und wird im Tode wieder, was sie war. So kann denn dort auf Grund dieser Voraussetzung im c. 23 weiter ausgeführt werden, daß, wer stirbt, ad superos geht (die Existenz der inferi, einer Unterwelt, wird, wie jenes Chorlied zeigt, geleugnet), und daß er damit zu seinem Ursprung zurückkehrt, und im c. 24 u. 25 die Ausmalung der jenseitigen Existenz noch weitergeführt werden.
[288] Medea 866.
[289] Vgl. Herc. fur. 139 f. u. 191 f.; auch Agam. 102 f. Der Arme ist nur unglücklich, weil es Reiche gibt, mit denen er sich vergleicht: Troad. 1018 ff. Über das Unglück und die Arglist der Könige Agam. 57 f.
[290] Dies schildert uns Lucian im Somnium cp. 26.
[291] Dieser Satz ist von mir eingehender in den Neuen Jahrbüchern XXXVII (1911), S. 336 ff. begründet worden.
[292] In Riga, i. J. 1204; J. W. Creizenach, Geschichte des neueren Dramas I, S. 70. Daselbst S. 94, auch 315 und sonst über Christi Passion. Um die schwer gemarterten Heiligen darzustellen wurden freilich Puppen verwendet: S. 265. In einem der Marienmirakel (S. 145) wird auf der Bühne von einer Äbtissin ein Kind geboren, wobei die hlg. Maria selbst bei den Wehen Beistand leistet. Das Kind ist da. Dann untersucht die Hebamme auf der Bühne den Leib der Äbtissin und stellt fest, daß sie nicht geboren hat.
[S. 256]
[293] Um das Jahr 1300 tauchten sie aus der Vergessenheit auf. Der englische Mönch Nikolaus Treveth schrieb sogleich zu ihnen einen Kommentar, und die italienischen Dichter des 14. Jahrhunderts Lovato und Mussato sind schon von ihnen beeinflußt: Creizenach, S. 436 f. Vgl. auch P. Stachel: Seneca und das deutsche Renaissancedrama, Berlin 1907.
[294] Die Zweifel an der Echtheit des Hercules Oetaeus habe ich längst fallen lassen. E. Ackermann De Senecae Hercule Oetaeo (Philologus Suppl. Bd. X und Rheinisches Museum, Bd. LXVII) hat die Echtheit dargetan und wird gegen Einwendungen anderer Recht behalten. Seneca selbst referiert den Inhalt dieses Dramas De benefic. I, 13, 2 f., wo das caelum tenuit voransteht.
[295] Herc. Oet. v. 1852. Daß so wie Maria eine Himmelfahrt hat, auch Alkmene nach Elysium entrückt und ihr Grab leer gefunden wird, zeigt Fr. Pfister, Wochenschrift f. klass. Phil. 1911, Nr. 3, S. 83.
[296] Kleanthes, der Stoiker, hieß der zweite Herakles (Diog. La. 7, 170); Zeno aber übertraf den Herakles sogar (ib. 7, 30). Eine stoisch-zynische Tragödie „Herakles“ gab es schon unter dem Verfassernamen des Diogenes von Sinope.
[297] Das heutige Südspanien schildert uns M. Andersen Nexö, „Sonnentage, Reisebilder aus Andalusien“, 1909. Die Schilderung ergibt, daß im Altertum dort Bevölkerung und städtische Kultur einen anderen Charakter trug und daß sie sich heute keineswegs günstiger zeigt als damals.
[298] De brev. vitae 10, 1. Wenn seine Gegner ihm höhnend eine professoria lingua vorwerfen (Tacit. Ann. 13, 17), so wäre es primitiv, daraus zu folgern, daß Seneca jemals wie Epiktet als professor oder Lehrer wirklich auftrat. Weil Seneca eben damals als Moralschriftsteller weiter ausholte, warf man den Staatsmann höhnend mit den Graeculi zusammen.
[299] Epist. 78, 3.
[300] Autobiographisches über seine Jugendzeit s. Epist. 108, 15. De otio 7 steht die Unterscheidung der drei Lebensführungen, genera vitae: unum voluptati, alterum contemplationi, tertium actioni (deditum). Seine eigene Entwicklung als Mann der actio deutet er De tranquill. animi 4 an; auf seine gegenwärtige Stellung weist er 10, 6 hin: multi quidem sunt quibus necessario haerendum sit in fastigio suo usf. Weiteres De vita beata 17 f. Diesen Ausführungen widerspricht die Schrift De brevitate vitae, die gleich nach der Rückkehr aus Corsica, aber noch, bevor Seneca Neros Lehrer wurde, in Rom abgefaßt ist, keineswegs. Sie predigt in sehr schulmäßiger Ausführung das philosophische otium, weil Seneca selbst eben damals noch ohne Stellung und Pflichten war. Das sollte sich bald ändern. Übrigens ist er da noch ganz rezeptiv im Betrieb des stoischen Studiums; er ist noch unselbständig und befragt nur die Weisen (15, 2 f.).
[S. 257]
[301] Vgl. ad Helviam 5, 4: er gewann früh pecuniam, honores, gratiam.
[302] De tranquill. 44, 3.
[303] Hierauf blickt er Epist. 49, 2 mit den Worten zurück: causas agere coepi ... desii velle agere ... desii posse.
[304] Da der sonderbare Claudius, ein Mensch ohne alle Willenskraft, sich ganz und gar und bis zur Schwachsinnigkeit von Messalina gängeln ließ, kann man es den Nichten des Claudius, Livilla und Agrippina, nicht verdenken, daß sie gegen Messalina Front machten, ihr ihren Einfluß nicht gönnten; und wenn in diesen Hader am Hof Seneca verwickelt war, so stand er jedenfalls auf der Seite der Frauen, von denen sich damals für den Staat noch irgend etwas hoffen ließ.
[305] Sestertium decies, Tacit. Ann. XI, 4.
[306] Plin. epist. III, 3, 7.
[307] Aber auch diese Schrift De ira hatte offenbar nicht systematischen, sondern persönlichen und praktischen, programmatischen Zweck. Die kleine Abhandlung De constantia betrachte ich als einen Ableger von De ira Buch III; der sachliche Zusammenhang ist der engste. Das Delatorenwesen ist damals mächtig (De const. 9, 2); alle Vornehmen und die hohen Beamten gelten als male sani (13, 2); die verächtlichen Äußerungen über die Sklaven (13, 4) verraten einen Standpunkt, den Seneca später überwunden hat. So ist auch noch De brevitate vitae eine Vorstudie Senecas. Diesen Sachen hängt daher in ihrer Abfassungsart noch der pedantisch schulmäßige Charakter an, der später bei dem souveränen Staatsmann Seneca so viel mehr zurücktritt. Was endlich die Consolatio ad Marciam betrifft, so wäre es Verkennung, sie für eine philosophische Schulschrift oder auch nur für eine Trostschrift zu halten, die nichts weiter will, als die Trauernde aufzurichten. Wäre sie dies, so wäre ihre Veröffentlichung überflüssig gewesen. Sie war vielmehr eine politische Gelegenheitsschrift in der Form der Consolatio, die auf Sejans Mißherrschaft tadelnd zurückblickt, pietätvollen Sinn für die Caesars bekennen will (c. 15), besonders Augustus und Livia verherrlicht, welcher Kaiser Augustus des Seneca staatsmännisches Ideal dauernd geblieben ist, und vor allem das echte Römertum preist und damit eine tüchtige staatsbürgerliche Gesinnung fordert: scire quid sit vir Romanus (auch im cap. 13 kommt er darauf zurück). Die politischen Zustände sind schlimm, iniqua tempora (22, 8); sunt istic hostes cruenti, cives superbi usf.; daher ist der Tod nützlich; er befreit aus dem Elend eines schlechten Staatslebens (20, 2 f.): ein Manifest, aus dem damals jeder sollte ersehen können, was von Seneca, wenn er entscheidenden Einfluß gewann, zu erhoffen war.
[S. 258]
[308] Schon Ad Marciam 20, 2 sagt er, daß jeder exul stets sein Auge auf die patria gerichtet hält. Die Schriften ad Helviam und Ad Polybium entstanden gleich in den Anfangsjahren der Verbannung, und daß dies keine Lehrschriften sind, liegt auf der Hand. Mit Unrecht habe ich als möglich zugestanden (Histor. Zeitschr. 104, S. 608), daß Seneca auf Corsica De providentia und De constantia schrieb. Ad Helv. 20 schildert er selbst seine Beschäftigung im Exil: von Schriftstellerei sagt er dort nichts, sondern redet nur von literarischen Studien, d. h. Lektüre, besonders auf dem Gebiet der Physik. Auch daß er Tragödien auf Corsica schrieb, ist schlechterdings unerwiesen (vgl. Neue Jahrbücher XXVII, S. 353 ff.) Die Epigramme aber aus dem Exil sind unecht; dies ergibt die Verstechnik, und der neuerdings mit vielem Fleiß unternommene Versuch, aus phraseologischen Anklängen ihre Echtheit zu erweisen, ist ein Schlag ins Wasser, da ein solches Beweismittel nichts beweist. Es handelt sich darum, daß Seneca (wie Calpurnius) in seinen Hexametern nie eine Verschleifung zuließ; das ist, so geringfügig die Sache scheint, ein deutliches Erkennungszeichen, und es ist interessant, in solchem Punkt einmal den Einfluß des Lehrers auf den Schüler zu beobachten; denn auch in Kaiser Neros erhaltenen Hexametern fehlt ganz ebenso jede Elision. Das sollte Zufall sein? Natürlich sind auch Calpurnius und der Lobdichter auf Piso von dieser Theorie abhängig gewesen. Die Epigramme aus Corsica zeigen dagegen die Elision (vgl. Kritik und Hermeneutik, S. 235 f.)
[309] Wie leidenschaftlich die Geschwisterliebe bei den Alten und wie tief gerade der Schmerz um den Verlust eines Bruders ging, habe ich Kritik und Hermeneutik, S. 108 f. in Anlaß der Antigone und ihrer vielbesprochenen Worte dargelegt.
[310] Dies habe ich in den Neuen Jahrbüchern XXVII, S. 596 ff. näher ausgeführt.
[311] Man muß sich klar machen, daß sich an den Kaiser — wie heute etwa an den Papst — direkte Ermahnungen nicht richten ließen; das einzig mögliche Erziehungsverfahren war, dem Allmächtigen die guten Eigenschaften zuzuschreiben, die man von ihm forderte; daher sagt Seneca selbst Epist. 94, 39, daß die laudatio eine Gattung der monitio sei; eben dasselbe sagt uns auch schon Cicero ad fam. XV, 21, 4; später Julian p. 254 B u. C; Apollinaris Sidonius Epist. VIII, 10; vgl. auch Cic. ad Quintum fratrem I, 1, 7 und 18.
[S. 259]
[312] Vgl. Neue Jahrbücher XXVII, S. 348.
[313] Man kann gut sein, auch ohne physisch tapfer zu sein; dies sagt Seneca nicht, aber es liegt dem Satz: L. Bibulus melior quam fortior vir (Ad Marciam 4, 2) zu Grunde.
[314] De ira II, 32.
[315] De constantia 12, 3; De ira I, 16.
[316] De ira II, 33; den Freimut gegen einen Sejan preist Seneca (ad Marciam 22, 4 f.), der gegen den Kaiser scheint ihm unmöglich.
[317] Das aeger nervis steht bei Tacitus 15, 45. Über sein Herzleiden redet Seneca Epist. 26, 54, 58. Aber schon in der Schrift De constantia (16, 4), also etwa 45jährig, schildert er sich selbst als kahlköpfig, schwachsichtig, mit dünnen Hüften und auffälliger Statur; denn man wird diese Schilderung doch wirklich auf ihn beziehen müssen. Eine Büste Senecas (in Berlin) zeigt ihn uns kurzhalsig und kahlköpfig.
[318] Mens serena: De clementia 2, 5, 4.
[319] Nero hatte armenische Gesandte empfangen; Agrippina kam, als sie das hörte, herbei und wollte den kaiserlichen Haut-pas ersteigen. Ehe sie dies konnte, ging ihr Nero auf Senecas Wink entgegen und hielt sie mit einer Begrüßung auf, und die Audienz wurde abgebrochen und verschoben. Agrippina kam nicht wieder: Tacit. Ann. XIII, 5; Waltz S. 204.
[320] Agrippina hatte eigenmächtig, als wäre sie jetzt Kaiser, den verstorbenen Kaiser Claudius zum Gott erhoben. Senecas Satire legt die Sinnlosigkeit dieser Apotheose dar, indem sie nicht nur mit gröblichem, aber siegreichem Witz über die geistige Impotenz des Claudius herfällt, sondern vor allem dem Groll und der Empörung über seine Schandtaten und Justizmorde Worte leiht. Agrippina selbst wird in der Schrift totgeschwiegen; jeder Leser merkte, daß ihr Verfahren das Ziel des Angriffs war. — Der überlieferte Titel Apotheosis ist natürlich richtig. Die Bezeichnung Apocolocyntosis beruht auf falscher Kombination, die auch heute noch gilt, weil gefeierte Gelehrte sie hingenommen haben. Apocolocyntosis heißt „Verwandlung in einen Kürbis“. Daß der Mensch, wenn er gestorben ist, in Tiere oder Pflanzen verwandelt wird, ist jedoch eine ausschließlich pythagoräische Vorstellung, von der die vorliegende Satire nichts weiß und die zu der unterweltlichen Szene, die sich an ihrem Schluß abspielt, durchaus nicht paßt. Es ist also gedankenlos, anzusetzen, eine solche „Verkürbsung“ sei an ihrem Schluß glatt weggefallen. Die Satire ist vollständig.
[321] Patriae tutor und amicorum propugnator, De vita beata 15, 4. Der Ausdruck tutor stammt hier aus Ciceros Schrift De republica II, 51. Seneca kannte diese Schrift genau.
[322] Schon ad Marciam äußert er diese Augustusverehrung programmatisch; oben Anmerkung 307.
[S. 260]
[323] Seneca sagt mit Genugtuung von sich selbst, daß keinem Bürger durch ihn, trotz seiner Machtstellung, die Rechte verkümmert seien; nullius per me libertas deminuta (est), De vita beata 20, 5.
[324] Auf die accusandi rabies, die unter Tiberius herrschte, blickt Seneca jetzt, Benef. 3, 26, 1, als auf etwas Fernstehendes zurück.
[325] Schon ad Marciam 16, 2 steht: Bruto libertatem debemus, d. h. die alte durch Brutus erworbene Freiheit besteht noch; so besteht denn auch die libera civitas unter Senecas eigener Staatsverwaltung, De benef. 2, 12, 2; optimus civitatis status sub rege iusto, ib. 2, 20, 2.
[326] Freilich keine Aufhebung der Kornverteilungen in Rom (De benef. 4, 28, 2), an die überhaupt nicht zu denken war.
[327] Admodum aequa, Tacit. 13, 51. Daher war auch noch im Jahre 62 der Stand der Finanzen befriedigend, Tacit. 15, 18; Waltz S. 411.
[328] Diesen Sinn hat es, wenn der Kaiser, d. h. Seneca, im Jahre 55 den Provinzialverwaltern verbietet, in den Provinzen Spiele zu geben, mit denen sie das Publikum für sich günstig zu stimmen pflegten: Tacit. 13, 31.
[329] Vgl. Rhein. Mus. 65, S. 317 „Zur Phylenordnung Alexandrias“.
[330] Von dem Gros der ägyptischen Bevölkerung, den sogenannten λαογραφούμενοι wurden die zahlreichen Anwohner griechischer und römischer Abstammung, von denen besonders Alexandria erfüllt war, gesondert. Daß die Namen der letzteren, der ἐπικεκριμένοι, in besonderen Listen, τόμοι ἐπικρίσεων, geführt wurden, beginnt aber wiederum im Jahr 54 auf 55; s. Paul M. Meyer, Das Heerwesen der Ptolemäer und Römer in Ägypten, Leipzig 1900, S. 116–122.
[331] Er besuchte als jüngerer Mann in Ägypten seinen Oheim, C. Galerius, der dort 16 Jahre lang an der Spitze der kaiserlichen Verwaltung stand (Genaueres hierüber Revue de philol. 1909, S. 173–177); weiteres oben Anm. 267 und über Senecas Beziehungen zu Ägypten und zu Claudius Balbillus im Jahre 55 Nipperdey zu Tacit. 13, 22. Auch noch in seinen letzten Lebensjahren hatte Seneca persönlich geschäftliche Interessen in Alexandria: quis illic esset rerum mearum status, überlegt er, als er Handelsschiffe von dort einlaufen sieht, Epist. 77, 3, wo res meae nicht auf Geldgeschäfte, sondern auf Grundbesitz sich bezieht; denn Seneca hatte dort tatsächlich Grundbesitz (s. oben); status aber heißt „Wohlstand“.
[332] θεοῦ διάκονος εἰς τὸ ἀγαθόν.
[333] Vgl. hierzu Rhein. Museum 69, S. 383.
[334] Thyest. 213. Aussprüche über Tyrannei finden sich Oed. 699 ff., 520 ff.; Phoen. 654 f.; Med. 195 f.; Phaedr. 490 f.; Agam. 995 usf. Vgl. Neue Jahrbücher XXVII, S. 350 f.
[335] Es scheint, daß das vierte Buch De beneficiis von Agrippinas Ermordung noch nichts weiß, also früher fällt; denn die Stelle IV, 31, 2 blickt auf die Bluttaten Caligulas in einer Weise zurück, als biete die Gegenwart nichts Ähnliches.
[S. 261]
[336] Daß sich Seneca in De beneficiis an ein großes Publikum richtet, zeigen solche Wendungen wie si quis existimat (I, 15, 1); nemo haec ita interpretetur (I, 14, 2); die Anrede vos, vobis (IV, 13, 1). Er selbst ist praeceptor, praecipit, er gibt monitiones (I, 15); aber er redet dabei zu dem Durchschnittsmenschen, nicht zum vollkommenen Weisen (II, 18, 4). In bezug auf die Sklavenfrage will er den Übermut der menschlichen Gesellschaft zerstoßen, contundere insolentiam hominum (III, 29, 1).
[337] Seneca sagt von sich, daß er die societas generis humani sancit, d. h. das soziale Wirken zum unverbrüchlichen Gesetz erhebt, De benef. 1, 15, 2; über die societas auch 4, 18, 2 f.
[338] Gegen die griechische Behandlungsweise der Wohltätigkeitslehre, z. B. die des Chrysipp, die mehr spitzfindig als praktisch, wendet er sich Benef. I, 3 und 4. Chrysipp ist magnus vir, sed Graecus. Damit ist er für den Praktiker schon verworfen. Was sollen z. B., heißt es, die albernen Redereien über die drei Grazien? Damit ist nichts gewonnen. So weicht denn auch Ton und Ausführung in De beneficiis I-IV von Senecas älteren Schriften De ira und De constantia, die noch mehr den griechisch-sophistischen Geist zeigen, wesentlich ab. In den Büchern V-VII De beneficiis gibt Seneca nur einen Anhang, und in ihnen herrscht gelegentlich wieder mehr der sophistisch schulmäßige Ton.
[339] Römerbrief 13, 9: ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς ἑαυτόν, ἡ ἀγάπη τοῦ πλησίον κακὸν οὐκ ἐργάζεται.
[340] Vgl. Zur römischen Kulturgeschichte S. 152 f. und betreffs der Haltung der Sklaven S. 66.
[341] Josef Vilmain, Die Staatslehre des Thomas von Aquino, Leipzig 1910, S. 80 u. 97 ff.
[342] Nicht das größte; es gab Freigelassene, die noch reicher waren: Tacit. 14, 55.
[343] Über den animus ad civilia erectus agendique cupidus s. De tranquill. 2, 9. Wer keine führende Stellung einnehmen kann, soll wenigstens durch Akklamation helfen, si a prima te reipublicae parte fortuna submoverit, stes tamen et clamore iuves, ebenda 4, 5, wo stes tamen et clamore iuves offenbar aus einem Hexameter stammt, also Zitat ist. Auch De otio beschäftigt er sich aufs neue mit diesen Fragen: imperfectum bonum est virtus sine actu usf. (6, 3). Daselbst 6, 4 das posteris prodesse; und 6, 5: Chrysippus lebte im otium; er hatte nicht den Reichtum und die Machtstellung (ergänze: wie ich, um dasselbe wie ich zu versuchen).
[344] Das ist das maiorem virtuti materiem subministrare (De vita beata 21, 4).
[S. 262]
[345] Das Geld, das einem Natalis zufällt, ist wie in die Kloake geworfen: Epist. 87, 16. „Der Reichtum ist mein Diener; andere sind Knechte des Reichtums,“ De vita beata 22, 5.
[346] Gegen die nimia aestimatio sui redet Seneca De v. beata 8, 3.
[347] Cassius Dio 62, 2, wo das Wort ἄκουσιν darauf geht, daß die britische Bevölkerung zum Teil der römischen Geldwirtschaft widerstrebte; s. 62, 3: πενία ἀδέσποτος πλούτου δουλεύοντος προφέρει. Schon die Regierung des Kaisers Claudius hatte große Geldsummen in diese neue Provinz geworfen, aber sie gleichfalls wieder zurückgenommen (ebenda). Das ist nicht „Geldwucher im Großen“, was Kaiser Claudius trieb; dasselbe gilt von Seneca.
[348] Nicht der strengste Stoiker hätte das von Seneca verlangt; auch Zeno hatte Geld auf Zinsen geliehen (De benef. 4, 24, 1). Daß Seneca etwa Wucher trieb, ist durch nichts angezeigt. An verächtlichen Äußerungen gegen die feneratores fehlt es bei ihm nicht: De ira 3, 33; De const. 6, 7; Benef. III, 15; so aber auch gegen die Reichen, De provid. 6: die Reichen sind innerlich schmutzig; wie ihre Stubenwände sind sie nur äußerlich dekoriert; der glänzende Stuck ist dünn und fällt ab.
[349] Martial 12, 36; Juvenal 5, 109.
[350] De vita beata 23, 5. Auch Epist. 120, 8 tadelt er: multi sunt qui non donant, sed proiciunt. Genaueres über die Art seiner Wohltätigkeit De v. beata 24.
[351] Seneca brachte also der Staatsraison zuliebe ein Gewissensopfer. Wer das beurteilen will, muß seinen Grundsatz kennen, den er wie für diesen Konfliktsfall vortrefflich so formuliert hat: facit (lies faciet) sapiens etiam quae non probabit, ut etiam ad maiora transitum inveniat, nec relinquet bonos mores, sed tempori aptabit et quibus alii utuntur in gloriam aut voluptatem, utetur agendae rei causa. Dies stand in seinen Exhortationes (Lactanz Inst. III, 15, 14), die gewiß auch in Senecas Spätzeit fallen.
[352] Ja, nach weit verbreiteter Anschauung ist der Kaiser selber Gott; der Kaiser Augustus ist der, qui dis genitus et deos geniturus dicatur, Seneca ad Marciam 15, 1.
[353] Kaiser Claudius war, nach Seneca, wie die Fortuna, die leicht zur mala fortuna wird (benef. 1, 15; 6). Straft der Kaiser einen Unschuldigen, so muß man es hinnehmen: rex ... si innocentem (punit), cede fortunae (De ira 2, 30). Man kann sich nicht einmal gegen die Geschenke eines tyrannischen Herrschers wehren: diesen Satz veröffentlicht Seneca, benefic. 2, 18, 6, nachdem er selbst von Nero wider seinen Willen mit Reichtümern überschüttet war.
[354] Es ist nicht wahr, daß Seneca De benef. 7, 20, 3 die Möglichkeit der Ermordung Neros zugesteht; Seneca sagt dort nur: den wahnsinnig gewordenen Tyrannen soll man beseitigen, und denkt dabei nicht an Nero, der trotz seiner Exzesse durchaus nicht als geisteskrank galt, sondern nur an Caligula zurück, der als wirklicher furiosus, d. h. im Irrsinn endete; dessen Beseitigung wird auch De brev. vitae 18, 6 gebilligt, und beide angezogenen Stellen erklären sich gegenseitig.
[S. 263]
[355] Wo Seneca in diesen Jahren den Nero erwähnt (in den Briefen tut er es nie), zeigt er sich sehr zurückhaltend; s. Nat. quaest. VI, 17 und 21. Eine Höflichkeit liegt darin, daß er einmal einen geschickten Vers Neros mit Anerkennung zitiert (ib. I, 5, 6). Wenn sich endlich ib. VI, 8, 3 eine lobende Äußerung, insbesondere über Neros veritatis amor, findet, so handelt es sich dort um die von Nero veranstaltete Expedition nach den Nilquellen; Seneca quittiert für diese Unternehmung mit Dank; denn es kann kein Zweifel sein, daß Nero mit ihr einer Anregung Senecas selbst entsprochen hatte. So teilt Seneca denn auch ihr Ergebnis mit. Vgl. oben Anm. 272.
[356] Nämlich zunächst bei Tacitus. Mutmaßlich ist aber schon in dem Werk des C. Fannius über die exitus occisorum unter Nero, das unfertig blieb, aber bis zu drei Büchern gedieh (Plin. epist. 5, 5), auch Senecas Tod erzählt worden. Vielleicht ist die Schilderung des Tacitus davon abhängig. Wir haben keineswegs nötig, nur an Fabius Rusticus als Quelle zu denken. Vgl. W. Schmidt, De ultimis morientium verbis, Marburg 1914, S. 12.
[357] Noch 50 Jahre später waren sie so bekannt, daß Tacitus sie zu zitieren für unnötig hält (Ann. 15, 63 u. 67). Hätte er es doch trotzdem getan!
[358] Tacit. Ann. 14, 55.
[359] Es ist das goldene quinquennium Neros: Aurelius Victor 5, 2; Epit. 5, 3; Waltz S. 243.
[360] Juvenal 8, 212.
[361] Vgl. Römische Charakterköpfe, 3. Aufl., S. 262 f. u. 267.
[362] Das „planvoll“, certus consilii, das er fordert De brev. vitae 3, 3, gilt wirklich von ihm. Vgl. Epist. 23 über die Freude: die Freude kommt ins Herz durch ein gutes Gewissen, durch richtig Handeln, durch ein planvolles Leben.
[363] Vielmehr bezog sich Seneca nachweislich auf die Ehegesetze des Augustus; s. Fragm. 87 ed. Haase. Auch die historischen Rückblicke auf die pudicitia Altroms und die ehelichen Exzesse, die Seneca dort gab, entsprachen ganz dem Begründungsverfahren des Augustus.
[364] Vgl. Römische Kulturgeschichte S. 141.
[365] Bonorum egestas: De tranquill. 7, 6.
[366] De benef. 7, 1, 7.
[367] De vita beata 15, 5.
[S. 264]
[368] Einige Proben hat uns der Kirchenvater Augustin aus dieser Schrift erhalten; einen Absatz daraus habe ich oben S. 231 f. wiedergegeben.
[369] Religio deos colit, superstitio violat, sagt Seneca De clem. 2, 5, 1.
[370] Seneca De remediis 5, 4 lehrt: Kümmere dich nicht um dein Begräbnis. Denn das Begräbniswesen ist gar nicht um der Toten willen, sondern nur im Interesse der Lebenden eingeführt: non defunctorum causa, sed vivorum inventa est sepultura.
[371] De benef. 4, 7, 2.
[372] Man könnte ansetzen, daß sie etwas früher fällt und ungefähr aus der Zeit der Apotheosissatire stammt, in der die gleiche sarkastische Nichtachtung der Götter herrscht und gerade auch wie in der Schrift De superstitione altrömische Götterschemen wie die Vica Pota vorgeführt werden. Aber auch De tranquill. 26, 8 berührt Seneca noch dasselbe Thema, besonders aber Epist. 95, 47, wo auch das speculum teneri Iunoni und die Sätze stehen: deum colit qui novit; primus est deorum cultus deos credere.
[373] Eine vorsichtige und vernünftige Behandlung der Frage gab J. Geffken im Hermes, Bd. 41, S. 220 ff.
[374] Hermes 41, S. 223.
[375] Hierzu und zum Folgenden siehe meine Schrift „Elpides“ S. 61–65.
[376] Valerius Maximus 5, 1 ext. 1; Curtius Rufus 8, 4, 15.
[377] Epiktet, Dissertat. I, 25, 8.
[378] βασιλικῶς ἐνεσκεύαστο Lucian 70, 2, 10; vgl. in den Acta S. Dasii bei Cumont, analecta Bollandiana XVI, S. 11 das βασιλικὸν ἔνδυμα und κατὰ τὴν αὐτοῦ Κρόνου ὁμοιότητα. Bei keinem Gott war die Bezeichnung, daß er „König“ ist, so ständig wie bei Saturnus-Kronos; Varro de re rustica III, 1, 5: Saturnus rex; mehr gibt Maximilian Mauer bei Roscher, Mythol. Lexikon II, S. 1458.
[379] 70, 2, 12.
[380] βασιλέα μόνον ἐφ’ ἁπάντων γενέσθαι 70, 1, 4.
[381] Ebenda.
[382] So in den Acta S. Dasii.
[383] Diese Harmlosigkeit betont Lucian 70, 2, 13.
[384] Siehe Bücheler zu Seneca Apotheosis c. 8.
[385] Ich sehe, daß auch G. Wissowa, Religion und Kultus der Römer, S. 207, diese Auffassung teilt.
[386] Siehe Geffken a. a. O. S. 222 f.
[387] H. Reich, Neue Jahrbücher 1904, S. 726, 1 versteht diesen Wortlaut nicht richtig, da er γελοίων διδάσκαλοι grammatisch verbindet; γελοίων hängt aber ohne Frage von ποιηταί ab: „Mimen- und Ulkdichter dienen als Lehrer der Leute.“
[S. 265]
[388] Reich a. a. O.
[389] Auch der Mimusrest des Oxyrhynchospapyrus ergibt dafür nichts.
[390] So Reich S. 279.
[391] Der Mimus ahmte realistisch, oft auch mit Humor und Ironie Typen des Lebens nach, aber er höhnte nicht und stand dadurch im Gegensatz zur alten Komödie eines Aristophanes: so Reich selbst, Der Mimus I, S. 327, nach Jacob Bernays.
[392] S. Seneca a. a. O. c. 1. Auch Kaiser Augustus betrachtete sein Leben als einen Mimus; er fragte auf dem Sterbebett, ob er ihn gut durchgeführt habe; „wenn das Stück gut war, klatschet Beifall,“ war sein letztes Wort. Aber er denkt dabei nicht an den Königsmimus, sondern allgemeiner an den mimus vitae (Sueton Aug. 99), von dem in der Popularphilosophie jener Zeit oft die Rede ist.
[393] nec cor nec caput habet, Seneca c. 8; dis iratis natus; tria verba cito dicat et servum me ducat c. 11. Das Urteil, das Seneca fällt, gilt nicht bloß von der Regierungszeit, sondern ebenso vom früheren Leben des Claudius; mit gleichem Hohn hatte Tiberius auf seine Bewerbung ums Konsulat weiter nichts geantwortet als: „anbei 40 Louisd’or für die Saturnalien und Sigillarien“ (Bücheler). Daher endlich ließ Seneca den Claudius in einen Kürbis verwandelt werden; in welchem Sinne, habe ich in der Schrift De Senecae apocolocyntosi et apotheosi Marburg 1888/1889 ausgeführt.
[394] Diesen Umstand beachtete Mommsen nicht, als er bei Seneca a. a. O. c. 1, wo überliefert ist: obiit ille qui verum proverbium fecerat aut regem aut fatuum nasci oportere, zu lesen vorschlug: qui bis verum proverbium fecerat. Das Sprichwort gibt ein Entweder oder: „entweder ein König oder ein Narr muß man von Geburt sein.“ Diesen Satz hat Claudius wahr gemacht, da er nur eine der beiden Eventualitäten erfüllte, da er Narr von Geburt, aber nicht auch König von Geburt war. Er war kein Porphyrogennetos oder in purpura natus. Daß er das Sprichwort doppelt (bis) wahr gemacht, trifft also nicht zu.
[395] a. a. O. c. 8: si mehercules a Saturno petisset hoc beneficium, cuius mensem toto anno celebravit Saturnalicius princeps.
[396] S. Festus p. 322 M.; Plutarch Romulus 25 und Aitia Romana c. 53.
[397] μετὰ χλευασμῷ sagt Plutarch.
[398] Plutarch: ἑπισκώπτων αὐτοῦ τὴν ἠλιθιότητα καὶ ἀβελτερίαν.
[399] Plutarch an beiden Stellen; dem widerspricht das Zeugnis des Festus nicht.
[S. 266]
[400] Auszüge des Cassius Dio 65, 20 f.
[401] Epiktet IV, 8, 30 u. 34. Die betreffenden Worte sind: εὐδὺς ἐπὶ τὸ σκᾶπτρον, ἐπὶ τὰν βασιλείαν, sowie ὁ Κυνικὸς τοῦ σκήπτρου καὶ διαδήματος ἠξιωμένος παρὰ τοῦ Διός.
[402] Dies bezieht sich nicht nur auf des Tiberius Zerwürfnis mit seiner eigenen Mutter (Sueton Tiberius 50 f.); Tiberius ist zugleich allen Müttern in Rom verhaßt, deren Söhne er umbringen ließ.
[403] Nach v. Duhn, Pompeji (1906), S. 102 ff.
[404] Titinius v. 70 Ribb.
[405] Titinius v. 78.
[406] Titinius v. 112.
[407] Titinius v. 140.
[408] Atta v. 7 Ribb.
[409] Afranius v. 33 Ribb.
[410] Vgl. Philologus Bd. 63, S. 459.
[411] Catull C. 54; vgl. Das antike Buchwesen S. 404.
[412] Doppelt erstaunlich ist die Kunst dieses Vergilgedichtes, da das Ganze fast Wort für Wort eine Travestie und die Umdichtung eines Catullgedichtes von ganz anderem Inhalt ist.
[413] Epode 4.
[414] Epode 2.
[415] Das heißt: In den Strom wirft. Der Hebrus ist ein Strom im winterlichen Thrazien, die heutige Maritza.
[416] Dominus deus; vgl. Römische Charakterköpfe 3 S. 282.
[417] Vgl. zu diesem Gedicht Donats Bemerkung zu Terenz Adelph. 540.
[418] Römische Kulturgeschichte S. 52. Man wolle indes darum nicht glauben, daß die Medizin im Altertum auf einer niedrigen Stufe stand. Im Gegenteil: bis zu welcher bewundernswerten Höhe die wissenschaftliche Medizin sich damals entwickelt hat, ist weltbekannt. Ich habe in meinem Roman „Menedem der Ungläubige“ davon beiläufig ein Bild zu zeichnen versucht.
[419] Einige weitere Übersetzungen habe ich in meine Gedichte, die den Titel „Artiges und Unartiges“ tragen, eingeschaltet.
[420] In Curetium; in Hadrianum.
[421] Man vergleiche hierzu die Erklärung des petaurista bei Festus p. 206 M.
[422] Afranius v. 8 Ribb.
[423] Anthologia latina Nr. 303.
[424] Martial VI 62, vgl. VII, 95, 15.
[425] Martial X, 2, 13.
[S. 267]
[426] Martial X 76. Die Sänftenträger werden z. B. VII, 53, 10; IX, 2, 11 und 22, 9 erwähnt.
[427] VII, 55, 7.
[428] XII, 57, 13.
[429] XI, 94.
[430] VII, 30.
[431] XI, 96; vgl. hierzu meine Schrift „Die Germanen“ (München 1917), S. 107.
[432] In der Übersetzung dieses Gedichtes habe ich ausnahmsweise mir erlaubt, die Schlußwendung etwas abzuändern, da sie sonst weniger verständlich wäre.
[433] Vgl. Rhein. Museum Bd. 69, S. 387.
[434] ad nationes II, 12 f.
[435] Ebenda 11, 8 f.
[S. 268]
Verlag von Quelle & Meyer in Leipzig
Theodor Birt
Römische Charakterköpfe
Ein Weltbild in Biographien
3. Auflage. 320 Seiten. Gebunden M. 9.60
Das ist ein geradezu wundervolles Buch! Ohne eigentlich die Absicht zu haben, mich gleich eingehend mit ihm zu beschäftigen, fing ich an zu lesen und ward so gefesselt, daß ich jede freie Minute zum Weiterlesen benutzte. Nie vordem sind mir die Träger der römischen Geschichte von Scipionen und Gracchen an bis hin zu Hadrian und Marc Aurel so lebendig entgegengetreten, nie sind mir die Motive ihres Handelns so deutlich geworden; von manchen — Pompejus, Cäsar, Marc Anton, Lucull — habe ich auch ein nicht unwesentlich anderes Bild erhalten, als es mir vom Geschichtsunterricht her in der Erinnerung stand. Was diese Lebensbilder so überaus reizvoll macht, ist die psychologische Kunst, mit der der Verfasser es versteht, die Gestalten zu beseelen; was er bietet, ist nicht trockene Geschichtsschreibung, sondern künstlerische Formgebung.“
Die Deutsche Schule.
Charakterbilder Spätroms
und die Entstehung des modernen Europa
ca. 400 Seiten mit 6 Tafeln. Gebunden M. 12.—
War in den „Charakterköpfen“ die Entstehung und Entwicklung der römischen Universalmonarchie bis zu ihrem Höhepunkt vorgeführt d. h. bis zur Zeit der Antonine, die für die Reichsländer die Zeit des größten Erdenglücks bedeutet hat, so handelt es sich jetzt um den Prozeß der allmählichen Auflösung des römischen Weltreichs, den unermüdlichen Kampf der Kaiser gegen die drohende Zerrüttung, das gleichzeitige Erstarken, Werden und Wachsen der christlichen Kirche, endlich um Völkerwanderung und den Sieg der Germanenrasse. Auch diesmal gibt der Verfasser ein Weltbild, und wieder in der Form von aneinandergereihten Biographien. Auch diesmal hat der Verfasser versucht, überall das Menschliche zu betonen und die Personen durch Belebung dem Gefühl der Gegenwart nahezubringen, zugleich aber auf die Kultur und das Geistesleben jener Zeiten scharfe Streiflichter geworfen, damit man auch den Hintergrund sieht, vor dem all jene Gestalten sich bewegen.
Ausführliche Prospekte und Kataloge unentgeltlich und postfrei
Verlag von Quelle & Meyer in Leipzig
Theodor Birt
Aus dem Leben der Antike
2. Aufl. 282 Seiten mit 11 Tafeln. Gebunden M. 10.—
„Das Buch enthält eine Fülle von ansprechenden, in engstem Rahmen gefaßten Bildern, die in ihrer Kleinmalerei farbenprächtige Darstellungen aus dem bunten Treiben im alten Rom der Kaiserzeit bieten. Dabei versteht es der Verfasser in geistreicher Weise, aus dem Altertum Brücken zur unmittelbaren Gegenwart zu schlagen und uns zu zeigen, daß wir keinen Grund haben, auf unsere Fortschritte dem Altertum gegenüber besonders stolz zu sein. Das Buch, das sich ebensosehr an den Fachmann wendet als an jeden Freund klassischen Altertums, sei hiermit weitesten Kreisen bestens empfohlen.“
Konservative Monatsschau.
Novellen und Legenden
aus verklungenen Zeiten
2. Auflage. 313 Seiten mit 6 Tafeln. Gebunden M. 8.—
„Einer unserer besten Kenner des Altertums gibt in diesem ansprechenden Werk ‚Novellen und Legenden‘ aus der griechischen Literatur. Ein zarter Reiz jenes lyrisch gestimmten Geistes strömt aus den einzelnen Motiven heraus ... Die Geschichten sind in ihrer schlichten und doch klassischen Schönheit voller eigentümlicher Werte, die es verständlich erscheinen lassen, daß gerade in jetziger Zeit die versonnene, freie Art des Altertums wieder wachgerufen wird.“
Die Post.
Von Haß und Liebe
Fünf Erzählungen aus verklungenen Zeiten. 296 Seiten. Geb. M. 8.—
Flucht aus der Gegenwart: wer brauchte sie nicht heute? Nur die Phantasie kann uns helfen; durch sie sind wir „Zeitgenossen aller Zeiten“. Wie lange atmet schon Held Odysseus nicht mehr! Ihn und den alten Rechner Archimedes, Roms Cäsaren, vor allem ein paar holde Griechinnen aus der gottseligen Heidenzeit beleben diese Novellen; dem grauen Hades sind sie entrissen, auf daß sie noch einmal hassen und lieben, lachen und grollen wie einst, dahinwandelnd in Roms Gassen oder auf den wonnigen Inseln des Mittelmeers.
Zur Kulturgeschichte Roms
3. verbesserte und vermehrte Auflage. 159 Seiten. Gebunden M. 1.50
„Birt ist nicht nur ein gründlicher Kenner der Antike, sondern auch ein glänzender Schriftsteller. Farbenprächtige, lebensdurchpulste Bilder zaubert er vor unser geistiges Auge. Wir durchwandern mit ihm die Straßen des alten Roms, bewundern die privaten und öffentlichen Bauten und beobachten im Gewühl die vorbeiflutende Menge.“
Vossische Zeitung.
Verlag von Quelle & Meyer in Leipzig
Geschichte der römischen Kaiser
Von Geheimrat Professor Dr. A. von Domaszewski
2. Auflage 4. u. 5. Tausend. Zwei Bände zu je 336 Seiten mit 12 Bildnissen auf Tafeln und 8 Karten
In zwei Geschenkbänden zusammen M. 18.—
„Domaszewskis Werk tritt also in die Lücke ein, die in Mommsens römischer Geschichte klafft: die Persönlichkeiten der Kaiser und der Charakter des Reichsregiments, die im 5. Bande nicht zur Anschaulichkeit gebracht wurden, stehen in dieser Darstellung im Vordergrund ... Die glänzende Herausarbeitung des Gegensatzes der Persönlichkeiten des Trajan und Hadrian, die in diesem eintretende Peripetie in der Entwicklung, die unter Septimius Severus zur Vernichtung des Römertums und der antiken Zivilisation führt, weil Barbaren die Herrschaft gewinnen und die bisher in Knechtschaft gehaltenen Schichten sich gegen die Kulturträger erheben, die Verbindung illyrischer Roheit und aramäischer Verderbtheit in Caracalla, das Ringen der Illyrier und Orientalen miteinander und die endliche Herrschaft der Illyrier in der Armee und im Reiche — diese wesentlichen, einer verwirrenden Menge von schlecht überlieferten Einzelheiten zugrunde liegenden Tatsachen sind bisher noch nie so anschaulich und überzeugend herausgehoben worden.“
Berliner Philologische Wissenschaft.
„Denn in der Tat, zu den besten Büchern der schönen und wissenschaftlichen Literatur pflegen solche zu gehören, die geschrieben sind, um den Autor zu befreien. Wärme der Empfindung jedenfalls erwarten wir in solchem Buch zu finden, und sie zeigt sich fast auf jeder Seite dieser Kaisergeschichte. Bewunderung und Verurteilung tragen hier den Charakter einer gegenüber Mitlebenden geübten Kritik. Was aber zu dieser Wärme hinzukommt, gibt dem Werk einen Wert, der weit hinaus ragt über das, was man von einem Buch erwartet, welches durch die Widmung die polarisierende Tendenz kundgibt.“
Das humanistische Gymnasium.
Verlag von Quelle & Meyer in Leipzig
Griechische Kultur im Bilde. Von Professor Dr. H. Lamer. 2. Aufl. 96 Tafeln u. 64 S. Text. Geb. M. 1.50
„Ein ganz prächtiges kleines Buch ... Man blättert die Abbildungen schmunzelnd durch, man liest Lamers erstaunlich reichen und doch knappen Text mit steigendem Interesse, man legt das Buch aus der Hand mit dem Gefühl, eine Sache, die man genau zu kennen glaubte, in einem ganz neuen Lichte gesehen zu haben. Wir stehen nicht an, das Lamersche Buch als eine wahre Musterleistung populärer Darstellung zu bezeichnen.“
Wissenschaftliche Rundschau
Römische Kultur im Bilde. Herausgegeben u. mit Erläuterungen versehen von Professor Dr. H. Lamer. 3. Aufl. 175 Abb. auf 96 Tafeln u. 64 Seiten Text. Geb. M. 1.50
„Dermaßen glücklich hat der Autor den ungeheuren Stoff gemeistert, hat ihn immer wieder gesiebt und gesiebt, bis zum Schluß das Wesentlichste übrig blieb, das jedem Leser, auch dem nicht humanistisch vorgebildeten, einen klaren Begriff von der römischen Kultur gibt.“
Neues Wiener Tageblatt
Das alte Rom. Sein Werden, Blühen und Vergehen. Von Professor Dr. E. Diehl. 2. Aufl. 126 S. mit zahlr. Abb. Gebunden M. 1.50
„Rom, sein Werden, Blühen und Vergehen von den ersten Anfängen bis zum Ende des weströmischen Reiches lernen wir hier kennen an Hand einer klaren Darstellung, unterstützt von Bildern und Karten ... Nicht nur dem Italienreisenden, sondern jedem, der sich mit römischer Geschichte befaßt oder kunstgeschichtliche Studien treiben will, wird das Büchlein von Wert sein.“
Der Architekt
Zur Kulturgeschichte Roms. Von Professor Dr. Th. Birt. 3. verbesserte u. vermehrte Aufl. 159 S. Geb. M. 1.50
„Birt ist nicht nur ein gründlicher Kenner der Antike, sondern auch ein glänzender Schriftsteller. Farbenprächtige, lebensdurchpulste Bilder zaubert er vor unser geistiges Auge. Wir durchwandern mit ihm die Straßen des alten Roms, bewundern die privaten und öffentlichen Bauten und beobachten im Gewühl die vorbeiflutende Menge.“
Vossische Zeitung
Cäsar. Von Hauptmann Gg. Veith. 190 Seiten. Mit einem Porträt und Kartenskizzen. Gebunden M. 1.50
„Der Verfasser gibt auf Grund langjähriger Beschäftigung mit seinem Helden eine lebendige und anziehende Schilderung der Entwicklung und Tätigkeit Cäsars auf den verschiedensten Gebieten. Es ist ein mit Begeisterung geschriebenes und Begeisterung bei dem Leser erweckendes Lebensbild.“
Wochenschrift für klass. Philologie
QUELLE & MEYER, VERLAG IN LEIPZIG
Karl Gjellerup
Der goldene Zweig Dichtung u. Novellenkranz aus der Zeit des Kais. Tiberius. 9.-13. Taus. 339 S. Geh. M. 5.—. Geb. M. 7.—
„Es sind Bilder von überwältigender Schönheit. Mit der Gestaltungskraft und der Kennerschaft des historischen Forschers und philosophischen Denkers läßt er äußeres und inneres Leben erstehen und malt in bezaubernden Farben die südliche Landschaft und den Prunk römischer Kunst und Verschwendung. Über seinem Buche liegt die Weihe eines Bekenntnisses zur sieghaften Kraft der christlichen Heilslehre und des germanischen Wesens.“
Hamburgischer Correspondent.
Die Gottesfreundin Roman. 397 S. Geh. M. 5.—. Geb. M. 7.—
„Eine Reihe farbenprächtiger, tiefgründiger Bilder, die sich auf dem düstern Hintergrund des 14. Jahrhunderts mit seinem Aberglauben und seinen Hexenprozessen abspielen. Wie die Herrin der Burg Langenstein den Führer der „Ketzer“ schützt, und wie der zelotische Bischof Ottmar, der die Ketzer verfolgt, vom Saulus zum Paulus wird, und mit der Burgherrin, die er in fröhlicher Jugend heiß geliebt hatte, als sieghafter Besiegter in den Tod geht, das wird uns in hochdramatischer, von dichterischem Schwung beseelter Darstellung berichtet.“
Berliner Morgenzeitung.
Seit ich zuerst sie sah Roman. 430 S. Geh. M. 5.—. Geb. M. 7.—
„Dieses schöne Idyll mit seinem tragischen Ausgang ist eins der wundervollsten Werke Gjellerups. Ein ganzer Liebesfrühling ist hier in die Stimmungsbilder aus Dresden und aus der sächsischen Schweiz hineingezaubert; tiefe Wehmut, tragischer Schmerz verleihen dem Roman sein wunderbares, unvergeßliches Aroma ... Der Verfasser fesselt, mag er nun die Natur, die Kunst oder die Menschen schildern. Immer vertieft er sich in seinen Stoff.“
Aarhus Stiftstidende.
Das heiligste Tier Ein elysisches Fabelbuch. ca. 400 Seiten. Geheftet ca. M. 7.—. Gebunden ca. M. 10. —
Nur ein Dichter von Gjellerups Gestaltungskraft, seinem sonnigen Humor, seiner tiefen, auf reichem philosophisch-historischen Wissen beruhender Weltanschauung konnte sich an einen solchen Stoff heranwagen. Im Elysium erwacht unter den in ewiger Heiterkeit auf der Asphodeluswiese wandelnden Tieren der Wunsch, ein Tier möge heilig gesprochen und von allen anderen verehrt werden. Dies entfacht sofort den Ehrgeiz, die Parteibildung, den Wettkampf. Die einst im Leben berühmten Männern angehörenden Tiere übernehmen die Führerrolle und werden zu Trägern der Ideen ihrer Herren. Erhabene und groteske Szenen wechseln sich so ab, und in unterhaltendster Form rauschen die großen weltgeschichtlichen Vorgänge an uns vorüber. Eine einzigartige Dichtung.