
Anmerkungen zur Transkription
Das Original ist in Fraktur gesetzt. Im Original gesperrter ist so ausgezeichnet. Im Original in Antiqua gesetzter Text ist so markiert.
Weitere Anmerkungen zur Transkription befinden sich am Ende des Buches.

Landesverein Sächsischer Heimatschutz Dresden
Monatsschrift für Heimatschutz, Volkskunde und Denkmalpflege
Band XV
Inhalt: Bodentreue – Bedeutungswandel von Vor- und Familiennamen – Naturdenkmäler – 15 000 Mark – Naturschutz und Gesetzgebung – Verwaiste Storchniststätten im Niederlande um Oschatz – Die sächsische Schule und der Heimatschutzgedanke – Aus unserem Landesmuseum für Sächsische Volkskunst – Die Wohnräume, ausgestellt vom Landesverein Sächsischer Heimatschutz auf der »Jahresschau 1925« – Die Himmelmühle im Erzgebirge – Bücherbesprechungen – Naturschutz
Einzelpreis dieses Heftes 3 Reichsmark
Geschäftsstelle: Dresden-A., Schießgasse 24
Bankkonto: Commerz- und Privatbank, Abteilung Pirnaischer Platz, Dresden
Bassenge & Fritzsche, Dresden
Dresden 1926
Dresden, am 22. Februar 1926
An unsere werten Mitglieder!
Erstmalig befindet sich in diesem Heft eine Beilage, die der Bauberatung unseres Vereins dient und sicherlich eine Bereicherung unserer Veröffentlichungen bedeutet. Wir verweisen dieserhalb auf das Vorwort unseres verdienstvollen Mitarbeiters, des Herrn Regierungsbaurat Dr. Goldhardt.
Da nun diese Beilage bei den weiten Kreisen unserer Mitglieder sicherlich nicht allen von Interesse sein wird, andererseits die Kosten sehr erheblich sind, weiterhin die heutige Zeit eiserne Sparsamkeit gebieterisch verlangt, möchten wir die weiteren Hefte dieser Sonderbeilage nur denjenigen Mitgliedern zustellen, die dafür Interesse haben. Wir bitten daher alle diejenigen unserer geschätzten Mitglieder, die auch weiterhin in den Besitz der Beilage gelangen wollen, um Mitteilung auf beigefügter Karte. Ob es möglich sein wird, die Zeitschrift kostenlos zu liefern, nachdem ja die Mitgliedsbeiträge außerordentlich schwer eingehen und es großer Mühe bedarf, für die ausgetretenen Mitglieder, die uns hauptsächlich aus wirtschaftlichen Gründen verlassen mußten, Ersatz zu finden, steht dahin. Wir sind aber der Überzeugung, daß keiner, dem es um eine gesunde Baukunst ernst ist, wegen der 1.50 M., die die Beilage jährlich kosten würde, auf sie verzichtet.
Wenn es irgendwie möglich ist, werden wir die Beilage auch weiterhin allen denjenigen umsonst beilegen, die es wünschen, ist es aber mit der wirtschaftlichen Lage des Vereins nicht vereinbar, dann werden wir im vorhinein die Interessenten der Beilage davon unterrichten, daß wir den Betrag von 1.50 M. jährlich besonders erheben müssen.
Wir würden uns freuen, wenn die Beilage »Bauberatung« das verdiente Interesse finden und unter unseren Mitgliedern regste Verbreitung erhalten würde.
Mit deutschem Gruß
Landesverein Sächsischer Heimatschutz
[1]

Die Mitteilungen des Vereins werden in Bänden zu 12 Nummern herausgegeben
Abgeschlossen am 31. Januar 1926
Von A. Eichhorn, Glashütte
(Gustav Schüler.)
Kämpfer und Dulder waren und sind die Menschen droben im Kammland unseres Erzgebirges. Festgedrückt an den Boden erscheinen die niedrigen, schindelbedachten Berghütten. So geschaut, wandeln sie sich zum Ausdruck der Seelenstimmung ihrer Bewohner: Festhalten, einkrampfen in den Boden, den der Vorfahr in langer Geschlechterfolge durch kraftverzehrende Arbeit der Wildnis entriß und damit die Wetterkräfte in ihrer urgewaltigen Wirkung minderte. Bleiben, kämpfen oder dulden, aber nicht weichen, wenn fremder Zunge Bodengier nach der »Hamit« leckt.
»Silva liminaris«, Grenzwald, nennt eine Urkunde des Klosters Ossegg vom Jahre 1203 das wilde Waldgebirge zwischen Sachsen und Böhmen. Eine[2] lebendige Schutzmauer war der dickichtstrotzende, moorbergende, tagereisenbreite Urwald für Böhmen. Nur wenige Saumpfade liefen durch die Wildnis, martervolle Wegfahrten für die Reisenden. Einzelne »Landestore«, porta terrae, öffneten die Waldmauer um dieses Jahrhundert: So bei Kulm, Graupen, an der Riesenburg, bei Preßnitz und Graslitz. Den Grenzwaldklöstern ward der Grenzschutz geboten. Leute deutscher Abstammung betreuten die Landestore und besserten auf Geheiß der Klostermänner in friedvollen Zeiten die steinigten und wurzelüberflochtenen Pfade zu gangbaren Handelswegen. Deutsches Blut heimatete zuerst im wilden Waldland.

Auf steilem Einzelfelsen oder schroff absinkender Talwand bauten im elften und zwölften Jahrhundert thüringische und fränkische Ritter ihre Wohnstätten,[3] anfangs wohl nur aus einem Turm bestehend und erst im Zeitenlauf sich zur trotzenden Schutzfeste wandelnd. Die Wahrzeichen deutscher Besiedelung sind die Burgen unseres Erzgebirges, Wächter, die sich einhorsteten in die Wildnis, zu fördern deutsche Kulturarbeit und wo nötig, zu trotzen slawischem Wesen. Nach ihrer alten Heimat sandten die Ritter ihre Unternehmer, um »Kolonisten« zu werben fürs neue Land. Mancher Einwanderer erschrak, als ihm sein Stück Land zur Rodung zugewiesen ward, schlich verzweifelnd am Abend zur Blockhütte, wenn das Ringen mit Baum, Stein und Tier schier übermenschlich werden wollte in der maßlosen Wildnis. Heute künden die langen, strauchbestandenen Steinrücken von harten Tagen vergangener Geschlechter und säumen in mittlerer Höhenlage schenkenden Boden. Wie von gewaltigen Recken gebaut, lagern die Steinwälle droben bei Gebirgsneudorf. So urhafte Mauern, kaum sind sie wieder zu finden im ganzen Gebirge, konnte nur ein Wille türmen, der den bezwungenen Boden ewig haben wollte.
Was aber lockte die Menschen einst bis hinauf ins Kammland, wo schwankender Grund keinen Fuß tragen will und ungebändigte Wildnis ehedem eine rauhere Luft aushauchte als in unseren Tagen? Der Berge erzene Adern wollten sie ritzen, ausschmelzen den erzschwangeren Fels. »Montes metalliferi«, Erzgebirge, wurde das Gebirge benannt. Reicher Bergsegen ward gehoben. So gab es auch im kalten Kammland Brot, und den Erzgräbern fiel das Bleiben nicht schwer. Deutsche Bergleute waren es, die von Freiberg aus allmählich den sanftansteigenden Nordabhang hinaufsiedelten, des Hochlands Erzgänge »fündig« machten und auch seinen böhmischen Teil mit manchem Bergstädtlein betupften. Da kamen friedlose Zeiten auch zum Bergmann in der hohen Einsamkeit. Als der Krieg begann, in dem katholische und lutherische Heere dreißig Jahre lang miteinander stritten, kam nach der Schlacht am Weißen Berge bei Prag der Jesuit ins Erzgebirge. Duldung war ihm ein unbekannt Wort. Mit roher Gewalt hieß er die »Bekehrungsdragoner« ihres Amtes walten. Bürgerrecht, Amt und Handwerk verlor die Glaubenstreue. Hinaus aus dem Land, wenn du nicht unsere Messe hörst! Mancher traurige Zug von vertriebenen, doch innerlich starken Menschen, bewegte sich über die Grenze nach Sachsen. Oft nur wenige Minuten von der alten Heimat entfernt gründeten die Exulanten das neue Heim. Johanngeorgenstadt, Neuschönberg, Rothenthal, Zinnwald, Neugeorgenfeld, Gottgetreu und noch manch anderer Ort im Grenzgebiet wurde von ihnen gegründet. Das Jahrhundert jesuitischer Gewalt beraubte das böhmische Kammland seiner besten Siedler, nur gut, daß sie nicht fortgegangen, sondern nur Schritte gewichen, denn mancher Notruf kam von »drüben«, den ihre helfende Hand zu leiserem Klingen brachte, wenn sie nicht selbst ärgste Not bedrückte. Der Krieg suchte ja alle Winkel im Gebirge auf. Oft hallten Marterschreie im Bergwald wieder. Verängstet schlichen die Flüchtlinge wieder aus dem Moor. Ein Häuflein Asche lag auf dem Eigengrund. Lange standen sie ratlos auf den Trümmern ihrer Heimstätten.
Die Häuslein erstanden wieder.
[4]
Da klang es erst hier und dort, dann vielerorts und bald im ganzen Gebirge von einem Gespenst, das zwingen würde, fortzugehen. Bald ward das heimlich Gefürchtete schlimme Wirklichkeit: Der Berge erzene Adern hatten sich vertrieft. Jahre kamen, da mußten die Erzsucher um längst verdienten Lohn bitten, waren zufrieden, wenn ihnen »Brot und Geleucht« gewährt ward. Bleiche, vermühte Männer wandelten zum Stollen. Kamen sie aus ihrer sonnenlosen Werkstatt, dann war nur zu oft auch draußen das Tageslicht von schleichendem Nebel gedüstert. Schwermütig gingen sie zwischen den geisternden Stämmen ihrer Hütte zu. Aber treu blieben sie ihrer Arbeit, treu ihrem Häusel. Es war zu schwer fortzugehen, weil des Schichtglöckleins Ruf zu bindend geworden, zumal denen, die seiner Stimme ein Leben lang gefolgt. Und als das grausame Wort erklang: Sucht anderswo nach Brot, der Tag der Ablohnung ist nicht mehr fern, da vertrauten sie noch immer der Wünschelrute, daß neue Gänge fündig würden und hofften auf bergtechnischen Fortschritt, der die noch ruhenden Schätze lohnender zu heben vermöchte.
Als der Bergmann sein Gezähe aus der Hand legte, da feierten auch die Zimmerleute, die den Stollen stützten, des Hammerschmieds Wasserrad schufen und besserten, die Hammerstiele schnitzten. Seltner rauchte ein Meiler. Runde, schwarze Flächen auf dem Waldgrund sagten noch eine kurze Zeit, daß hier die rußigen Kohlenbrenner geschafft. Heute weckt nur noch des Flurnamens Klang die Erinnerung an des Köhlers Arbeitsplatz.
Was tun im unwirtlichen Hochland? Fortgehen, das Häusel verlassen? Nein, von den Bergen steigen wir nicht. Bleiben wir treu dem Kammland, dann wird auch uns der Boden treu bleiben mit seiner schlummernden Kraft!
Nun begann ein zäher Kampf mit den schwamm- und flechtenüberwucherten Holzriesen, die sich mit ihrem unterirdischen Wurzelreiche zu einem einzigen Wesen verschlangen. Die Siedler gingen sie an mit Feuer, Säge, Axt und Keil, daß die urhaften Holzleiber krachend stürzten; sie rangen mit Wurzeln und Felsen, legten Pfade durch moorigen Boden, entwässerten und wandelten so in schweren Wochen jungfräulichen Grund zur viehnährenden Wiese.
Mit festem Willen ermunterten die Starken die Verzweifelnden, sprachen von besserer Ernte, wenn das Neuland erst an ein Fruchttragen gewöhnt, zeigten, wie ein schützender Zaun zu bauen sei, damit der Hirsch die mühsam gezogene Saat nicht wieder zertrample, wußten das stolze Bewußtsein in den Mitringenden zu stärken: Wir haben einen Boden zum Geben gebracht, der noch keine Bauernarbeit lohnte. Die Erkenntnis ward starker Wille: Den geben wir nimmermehr her.
So geht das Mühen um kargen Ernteertrag noch heute droben im Gebirge von etwa achthundert Metern an. Wohl milderte jahrhundertlange Kulturarbeit die zerstörende Macht der Wetterkräfte, doch allzukurz ist die Reifezeit zwischen Schneeschmelze im Frühjahr und Neuschnee im Herbst. Die Hälfte der Jahrestage lasten und hasten Nebel über dem Kammland, kürzen selbst in Sommermonden die kostbaren Sonnentage. Hat künstliche Düngung den Boden auch gezwungen, die brotfruchttragende Ähre zu gebären, so bleibt diese Ernte[5] doch gering. Es gilt auch zu eilen, daß der Hafer nicht versilbert oder die Kartoffeln auf dem Ernteschlitten heimfahren. Darum ist die Wiese mit dem Milchvieh des Häuslers Haupterwerb.
Milch und Butter trägt er in die Industrieorte am Südfuße des Gebirges. Am frühesten Morgen steigt er hinab, und er klettert schon wieder zur Hochfläche, wenn der Fremde seine Tageswanderung beginnt.
Für sein Vieh heißt es: Karge Nahrung, kurze Herbstweide hocken in ärmlichem Stalle.
Zwergwirtschaften vermag das Kammland nur zu tragen, und kommt der Winter einmal allzufrüh (1919!), dann geht ein Jammern durch die Siedlerhütten und darbende Menschen suchen nach Brot.
Beispielswirtschaften sind seit einigen Jahren auch im Hochland unseres Erzgebirges eingerichtet. Sachkundige Berater suchen mit strebsamen Landwirten Wirtschaftsverbesserungen einzuführen. Der Kleinbauer findet beim Beispielswirt manche Maßnahmen für Fütterung, Pflege und Zucht des Viehes, gute Raumnutzung und Reinigung des Saatgutes. Bei gemeinsamen Begehungen der dazugehörigen Felder wird er vertraut gemacht mit zweckmäßiger Flureinteilung, Bodenbearbeitung und Feldbestellung, Fruchtfolge und Düngung. Grundsatz ist: Nur solche betriebsverbessernde Maßnahmen einzuführen, die wenig Geld verlangen und sicheren Erfolg bringen. Der kleinste Bauer soll sie nachahmen können. Dank den Beispielswirten im herben Kammland! Sie machen ihre Nachbarn bodenfest.
Der Wald gibt Brot. Mutter und Kinder sammeln Wurzeln und Kräuter. Der Vater trägt die Heilung in die Stadt. Beeren und Pilze schafft er »wägeleweis’« hinab. Mit bescheidenem Erlös kehrt er müde heim.

Leichter Rauch über den Wipfeln kündet den Holzschlag. Ein Feuer kocht das einfache Mahl für die Holzer, das sie verzehren, wenn die Sonne über den Hochpunkt geht. In mittäglicher Stille zittert die Luft über dem Baumkirchhofe.

Dann nagt wieder die Säge, kerbt die Axt, drängt der Keil zu rauschendem Fall und dumpfem Aufschlag. Mit Ernst und Liebe sind die Waldmänner bei ihrer Baumarbeit. Wenn die Sonne hinter den schwarzgezackten Waldrand hinabrollt, dann schreiten sie heimwärts, erst stückweise gemeinsam, dann jeder einzeln den verstreutliegenden Hütten zu. Im Abenddämmern sitzt die Holzerfamilie um das dampfende Erdäpfelmahl oder löffelt die Milchbrotsuppe.

Im Frühtau geht es wieder in den Wald, um mit dem »Baumhackel« (Specht) um die Wette zu spalten. Die Waldlaute sind ein Stück Holzerglück.
Ist es um die Mittsommerzeit, ehe das Heuen auf den Hochwiesen anhebt, dann schreitet auch sein Weib mit zum Walde, um auf dorfferner Lichtung das borstige Buschgras für die Ziege zu holen. Es ist ein mühsam Sicheln um die alten sich abschälenden Stöcke. Gar behutsam gilt es, jeden Schritt zu tun, denn versteckt im hohen Grase sproßt in zartesten Anfängen der junge Tann.
[10]

Auf holprigen Wald- und Feldsteiglein wandeln gebückte Gestalten unter getürmter Last dem Hochdorf zu.
Aus Fichtenholz formt der Vater Schaufel, Mulde und Rechen, Nudelholz, Klopfer, Quirl und ander Küchengerät.
Die Drechsler von Kallich, Göttersdorf, Katharinaberg, Seiffen, Olbernhau, Rothenthal drehen zierliche Dosen, Teller, Krüge, Kannen und Becher.
Künstler ihrer Art sind die Spaltringdreher. Unter feinfühliger Führung des Stahles entsteht in kreisender Scheibe Menschlein und Tierlein in Grundform.
Sie wandern von Hand zu Hand, bis des Pinsels buntende Kraft die rohen Gestalten gar unterschiedlich beseelt. Kinderhand hilft mit beim Schaffen von wundersamem Spielrat und hölzernem Nutzgerät.
Seit Jahresfrist steht der Bastwebstuhl im Hause. Mit sicherem Griff hängt die Linke den Basthalm an den Zugstab, den die Rechte in ruhiger Bewegung durch gespannte Halme zieht und Breite um Breite mit gleichmäßigem Zug zur Decke fügt. Nimmerrastende Hand fordert der Webstuhl von früh bis spät abends, ehe er neun Kronen (eine Mark) zum Taglohn gibt. Die runzeligen Hände der Alten flechten zitternd Streifen um Streifen zum »Elfhalm« und »Siebenhalm«, das Meter um Bruchteile eines Pfennigs.
Hart ergreift die Kinder das Ringen ums Brot, deren Drang nach Bewegung durch vielstündig Sitzen arg gefesselt wird. Oh, heute bleiben wir noch ein Weilchen auf der Wiese hinterm Schulhause und spielen! Kommen wir später zum Basthalm, dann kann die Mutter nicht böse sein: Der Lehrer war ja mit dabei, heute dauerte die Schule »halt« länger.
Bei spärlichem Ölflammenschein gleiten die weißen Halme durch Kinderfinger. Die Stadtkinder im Lande drinnen schlafen schon.
Aber wir habens auch so fein. Um unser Häusel ist alles so frei und der Wald gleich dabei. Schickt uns die Mutter nach Schwämmen, da dauerts nicht lange, ist’s Mittagessen gesucht. Wie gut es immer in der Stube nach Pilzen riecht, wenn die Schwammdörre anfängt. Dann fädeln wir um die Wette die Pilzscheiben auf und hängen die Schnure an die Sonne oder übern Herd. Und das Schwarzbeerholen ist auch so fein.
Im Winter knallts Stockholz so tüchtig, das der Vater im Sommer gezerrt hat. Unsere Heutür am Giebel ist dann die Haustür. Vom Dache fährt der Schlitten fein hinab. Und in die Schule brauchen wir auch nicht jeden Tag. Der viele Schnee und tüchtiger Sturm sagts schon früh dem Lehrer, daß wir nicht kommen. Die Stadtkinder bekommen den Schnee gleich weggenommen, sagt der Vater. Da haben wirs besser.
O Kinderauge, du Märchenauge!
Ein lieblich Bild: Auf der Gasse vorm Hause Mutter und Kinder am Klöppelstock. Geschickte Finger werfen die klappernden Klöppel hinüber, herüber und schließen die freien Fäden zu kunstvollem Muster.
Und doch steckt hinter diesem wohltuenden Anblick, wie hinter jeder erzgebirgischen Heimarbeit, tiefe Not. Aus versonnenem Schauen wird der[11] Fremde aufgeschreckt durch des Heimschaffers Wort: Bleibe hier und verdiene dein Brot! Bleibe bei uns Spankorbmachern und arbeite mit vom Morgendämmern bis in späte Nacht! Darfst aber auch deine Kinder nicht rasten lassen, mußt sie einen halben Tageslauf gebückt sitzen sehen, mußt es verwinden können, daß sie ermüdet zur Schule gehen, bleich wieder zur Tür hereinschleichen, wenn zwölf Mark dein Wochenlohn sein soll. Dann halte Haus! Erwirb dafür Kleidung, Nahrung, Licht und Feuer, begleiche Miete und Steuer!
Werkstatt und Heim sind beisammen. Kultur- und Lebensgemeinschaft könnte die Familie sein. Doch unter solcher Not spinnen sich nicht die feinen Fäden häuslicher Erziehung. Körper und Geist erschlaffen.
Trübe ist deine Zukunft, o Kammland, denn deine Jugend verkümmert.
Verweile bei uns Handschuhmachern, und wirst du ein Höchstleister, daß du bei vierzehnstündigem Nähen sechs Paar Handschuhe abliefern kannst, dann mußt du mit fünfundachtzig Pfennigen deine Tagesbedürfnisse bestreiten.
Es klagen die Gorlnäher und Strumpfbesticker, die Knüpfer und Klangholzmacher.
Es geht nicht mehr an, Kegelhölzer für die Drechsler zu schneiden. Fünf Kronen gibts für ein Schock. Das Holzgeld kommt dem Lohne gleich.
Nur Abfälle können die Nagelschmiede kaufen. Kaum ein Kleidungsstück läßt sich bei zehn Mark Wochenlohn erschaffen. Ein wenig besser Sein ist dem beschieden, der ein Rad ans Wasser bauen konnte und die Schneidmaschine drehen läßt. Der Fuhrlohn macht das Eisen teuer. Die Schienenstraße windet noch länger den Südhang herauf. Schon mancher Blasebalg hat zum letztenmal gefaucht. Das Gebirge will die Nagelschmiede nicht mehr tragen und gab ihnen doch Brot hundert um hundert Jahre. Ja, käme elektrische Kraft ins Dorf, dann könnten sie gleich bestehen mit denen unten im Lande. So meinen die Nagelerzeuger von Natschung und Heinrichsgrün.

Mit schwerem Herzen stiegen viele Gebirgler in die qualmüberwallte Ebene, als nach Mißernte in Kriegs- und Nachkriegszeit Frau Sorge droben keine Feierstunde mehr kannte. Sie gingen ins Eisenwerk oder ließen sich in finstere Schächte sinken. Übermüde wankten sie nach der Schicht aus der dröhnenden Werkstatt zum Bahnhof, wurden erst froh, wenn die ersten Bäume vorbeihuschten und der Wald bei der bergwindenden Fahrt immer tiefer hinabsank.
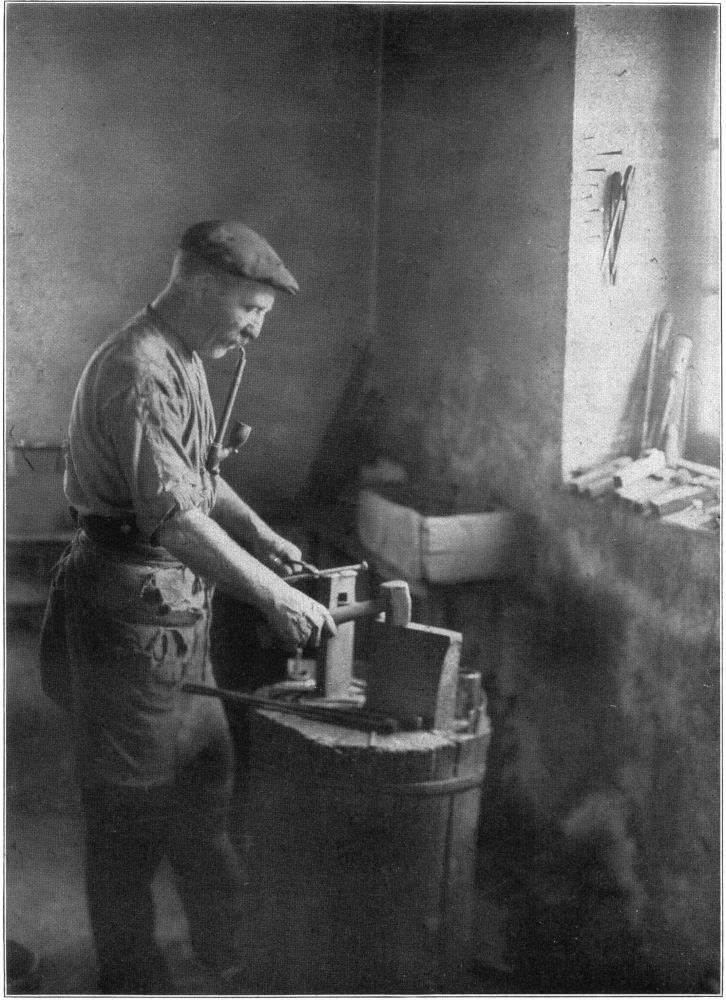
Die im Kohlenbergwerk schafften, wurden gar bald inne, daß sie zu solchem Tun nicht taugten. Sie wichen dem tschechischen Grubenmann und ertrugen die harte und ungerechte Anklage, Mitschuldige zu sein an der Hingabe der Kohlenschätze in slawische Hand. Konnten sie, die von Jugend an nur »karges Brot« gegessen, Gleiches schaffen mit denen, die ein reicher Boden genährt? Die vom ersten Atemzug an reine Bergluft gesogen, konnten nicht atmen in erstickenmachender Tiefe. Und die der Arbeitsart gefolgt, weil sie einst schon in der Heimat die Gruben lange getragen oder verjüngtes Bergmannsblut in ihren Adern rann, hatten nicht bedacht, daß Kohlen- oder Erzgräber zu sein[14] zwei Welten bedeutet. Sehnsucht nach Wald, Wiese und Moor ward drängende Macht. Aus staubschwangerer Stollenfinsternis stiegen sie wieder hinauf in die Bergnacht, standen ehrfurchtsvoll versunken beim kindheitsgewohnten Schauen, wenn der Nebel sich lockerte und das Funkelgewölbe entschleiert Hochland überdachte. Reich schuf sie das tiefe Naturerleben in ihrer Armut. Fester wurde nach dem kurzen Fernsein die Liebe zur Bergheimat, fester der Glauben an den Boden: Trägst du die Tanne, trägst du auch mich. Vuglbärbaam, iech gieh nett mi fort!
In der Kohlenstadt hatte er das Schreinerhandwerk erlernt. Seine Freude bekundete der Meister oft über die Geschicklichkeit des Bergkindes. Als die Lehrjahre vergangen, mahnte der Meister: »Versuch hier unten dein Glück, die Einsamkeit dort droben hat kein Begehren für deine Kunst!« Doch immer ging der Blick zum Hochland und mit dem Schauen wuchs auch die Sehnsucht nach ihm. Als Geselle schuf er fleißig bei seinem Lehrmeister. Doch wenn Wochenschluß nahte, dann flog der Hobel hastiger über die Bretter. Wenn am Samstagabend sich die Täler verschatteten, des Hochdorfs Fenster im letzten Sonnenfeuer brannten, stand er oben und lauschte aufs Abendglöcklein. Manchmal sah ihn der Meister erst am zweiten Werktage wieder. Als jene Zeit kam, da zwei liebgewordene Augen nach dem Heimkehrer schauten, da klomm er in nebelschwerer Herbstnacht zum Kammland, fürchtete nicht den schneeverschütteten Bergwald und seine todbringenden Stürme. Bald kam ein Tag, da spielte der Bergwind mit Myrte und Schleier. Nun schafft der Bodentreue schlichten und kunstvollen Hausrat fürs Hochland, daheim im Heim.
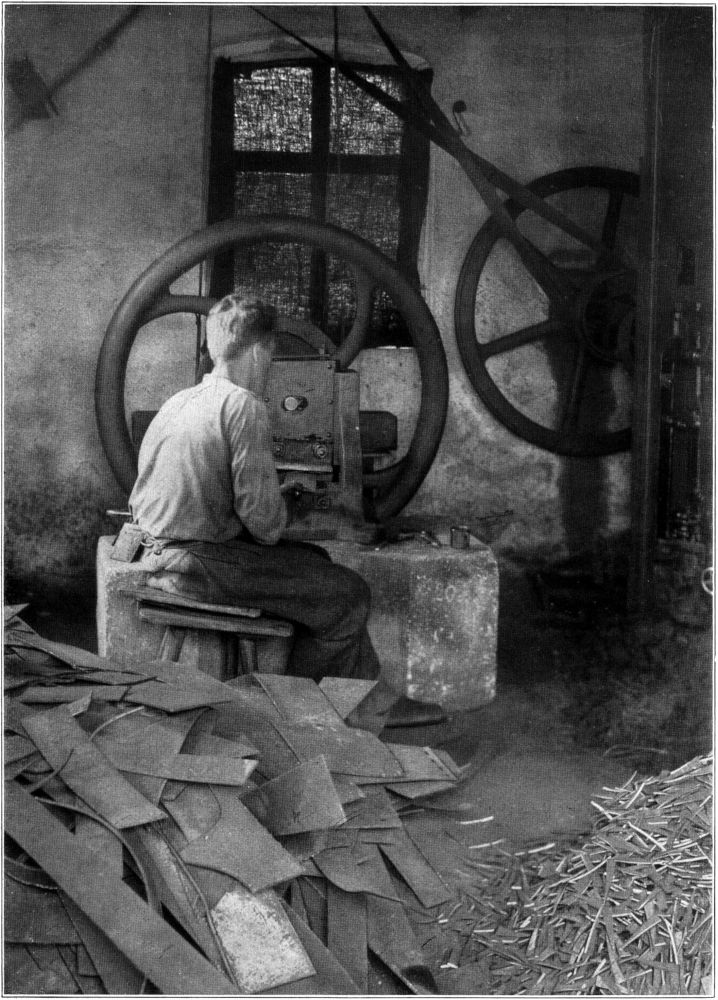
Vierzig Jahre hindurch hackt der Alte in der »Moorbodengrube«. Er schürfte immer nur die oberste Schicht vom Urland zum heilenden Moorbad für den Kurgast in Eichwald. Auf den wieder unberührt gelassenen Flächen siedelt von neuem die Birke, Trunkel- und Moosbeere. Im Winde baumeln die Wollgrasschöpfe. Vier Jahrzehnte einen Arbeitsplatz! Wieviel sonnenlose Tage mag er gegraben haben hier in der Nebelheimat. Der Boden hielt ihn fest wie ein Magnet.

Zu all dem Ringen um ärmliches Leben kommt in die Häusel im böhmischen Teil des Kammlandes noch eine tiefe Bitternis. Das Recht am Boden wird dem Deutschen vom Slawen bestritten.
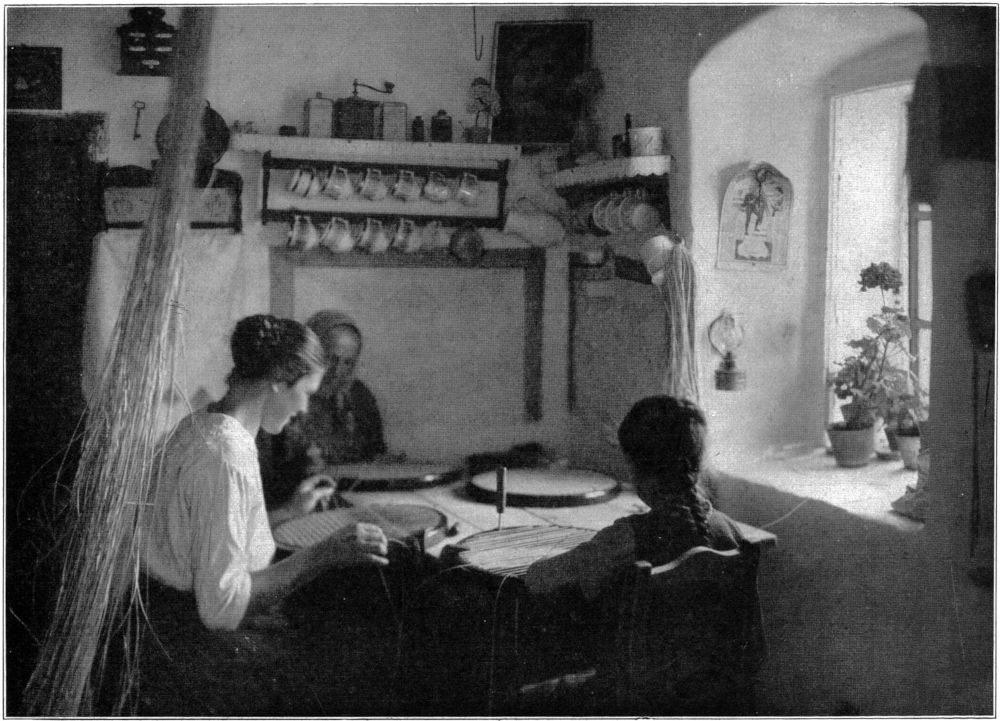
Noch einmal erinnern wir uns daran: Deutsche Bauern und Handwerker kamen aus Sachsen, Franken, Schlesien und Flandern, vom Rhein und Neckar, deutsche Bergleute ins wilde Waldgebirge und verschmolzen in Leid und Arbeit zum Volk der Deutschböhmen.

Nun soll deutsches Blut unterwürfig darben und nur noch ein Gnadendasein führen im dürftigen Hochland. Deutsche Sprache soll verstummen, deutsche Sitte versickern in fremden Volkes Art. Im entlegensten Bergwinkel klingt schon slawischer Laut, slawisches Schriftwort hat den Vorrang auf der Tafel am ersten und letzten Haus im Kammdorf. Drunten am Bahnhof fand die deutsche Wegetafel fürs Gebirge keine Duldung mehr. Von Tag zu Tag seltener wird der deutsche Beamte am Schienenweg. Deutscher Geist soll[21] nimmer den Bergwald betreuen, nur die tschechischen Heger herrschen im Forst. Mit scharfen Augen überwacht der slawische Gendarm das Tun der Leute im Kammdorf.

Mit tränenfeuchten Augen steht ein Häusler im kleinen Kirchhof, überblickt versonnen die Hügel: Oh, ihr Gewesenen, wüßtet ihr, wie’s steht im Landl. Nichts mehr gilt deutsche Meinung, Haus um Haus verliert das Dorf an fremde Art. Ein grausam Wort: Froh wird der Deutsche sein, als Ochsenknecht einst hier zu frohnen, an euren Hügeln nur wird deutschen Laut er sprechen dürfen. O qualvoll Schicksal: Zu sein ein Heimatloser in der eigenen Heimat!

Mancher ahnte schon das Zukunftsbild, und mahnend hieß er seine Enkel treu zu bleiben deutschem Wesen. Nur gut, daß auch im weltfernen Schulhaus ein mutiger Mann den Kindern kernig deutsche Sprüche an die Wand hing. Sie mahnen Stund um Stunde: Flieht nicht! Bleibt treu der Heimat, treu dem Boden, den des Vorfahrs Schweiß genetzt! Habt starke Herzen, wenn friedloses Sein die Treue will zermürben und rastloses Bangen um ererbten Grund zum Schollenflüchtling drängt!
Und doch könnte es einen Einklang geben zwischen dem Deutschen und Tschechen, denn mancherlei gemeinsam haben beide Völker. Gemeinsam ist die Freude an den Tönen, gemeinsam ein mystisch Neigen zur Natur. Sitte, Brauch und Sage ähneln einander.
Freilich herrschen will der Slawe, seit ihm die Macht ward, Deutsche wie Ware zu verhandeln. Nur wenn gleichberechtigt die Deutschen neben den Tschechen schaffen können, dann wird ein friedlich Wohnen auf gleichem Boden möglich sein.
Wandere hinauf zu den Heimattreuen im Kammland! Wenn die Nebel wie ein Sorgenschleier die Hütten verhüllen, dann raste darinnen! Manch schlichtes Wort wird dir kundtun, wie tief diese Menschen durch Geschichte und Kulturgeschehen mit ihrem Ahnenboden verbunden, hüben und drüben. Achtung vor ihrem Ringen um Brot und Heimatboden wird dir kommen, wirst dann nicht gleichgültig weitergehen, wenn solche Herzen entdeutscht werden sollen.
Auf deine Art hilf stärken ihre Bodentreue!
Von Dr. phil. R. Trögel, Auerbach i. V.
Die eigenartige sprachliche Erscheinung, daß Personennamen in Gattungsbezeichnungen übergehen, ist schon mehrfach Gegenstand der Untersuchung gewesen[1]. Da aber die seelischen Grundursachen für diese Art des Bedeutungswandels, die von Wundt in seiner Völkerpsychologie als »singuläre Namensübertragung[2]« gekennzeichnet worden[22] ist, immer wieder im Laufe der sprachlichen Entwicklung wirksam sind, lassen sich mancherlei Ergänzungen bringen, die teils im Schrifttum verborgen lagen, teils aber auch als erst in den letzten Jahren entstanden überhaupt noch nicht schriftlich aufgezeichnet worden sind.
Schon die Tatsache, daß bis in die neueste Zeit hinein Eigennamen zu Gattungsnamen werden, beweist den engen inneren Zusammenhang zwischen den beiden Arten. Freilich, scheinbar und bei flüchtiger Betrachtung liegt darin geradezu ein tiefer Widerspruch. Der Eigenname ist, wie der Name sagt, das ureigenste Besitztum einer Person, mit seinem Träger untrennbar fest verbunden, weil er dessen Wesen als Einheit nach außen hin im Gegensatz zu anderen Persönlichkeiten zur Erscheinung bringt. Umfaßt nicht jeder Gattungsname eine ganze Zahl mannigfaltiger Einzelwesen, indem er die ihnen gemeinsamen wesentlichen Merkmale zusammenschließt? Von einer Gegensätzlichkeit kann jedoch bei näherer Prüfung keine Rede sein. Die Unterschiede sind, soweit solche überhaupt bestehen, nur solche des Grades, und da, wo oberflächliche Beobachtung unüberbrückbare Gegensätze annimmt, sieht der Blick des Forschers enge Verwandtschaft und ewigen Kreislauf. Aus Gattungsnamen erwachsen Eigennamen, und diese wieder erhalten aus irgendwelchen Ursachen appellativischen Sinn. Besonders auffällig tritt diese Begriffswandlung an dem Vornamen Karl zutage. Daß es ursprünglich ein Gattungsname war, bezeugt ahd. charal, mhd. Karl = Mann, Ehemann, Geliebter, das mundartlich in der ablautenden Form Kerl lebendig ist. Die gewaltige Persönlichkeit des großen Frankenherrschers hat seinen Namen fast über ganz Europa verbreitet, und bei den slawischen Völkern des Ostens erhielt derselbe den allgemeinen Sinn eines Appelativums »König, Herrscher« (polnisch król, russisch karóli, lit. karâlius, albanisch kralj, magyarisch király). Der Eindruck einer Persönlichkeit von sehr hervortretender Eigentümlichkeit und starke Affektwirkung hatten, wie Wundt dartut, zu dieser Assoziation herausgefordert. In weitaus den meisten Fällen wird sich der Eintritt des Bedeutungswandels kaum auf eine bestimmte Persönlichkeit und auf einen bestimmten Zeitpunkt zurückführen lassen. Die Voraussetzungen sind ebenso wie die seelischen Ursachen nie dieselben, immer ganz individueller Art. Das will Wundt mit dem Ausdruck singuläre Namenübertragung sagen. Die Übertragung von Personennamen beschränkt sich aber nicht auf Personen; es liegt tief im Wesen der menschlichen Natur begründet, auch Tiere und selbst leblose Dinge zu verpersönlichen, und die Sprache ist voll von solchen Personifikationen. Das bedeutet aber wieder einen Übergang des Eigennamens zu einem Gattungsnamen.
Wenn es sich nun darum handelt, in die Fülle von Beispielen irgendwie Ordnung und Übersichtlichkeit zu bringen, so treten zunächst zwei Gruppen deutlich auseinander. Am Anfang der Entwicklung hat bei allen Völkern die Einnamigkeit gestanden; der Vorname mußte genügen, eine Persönlichkeit nach ihren körperlichen und seelischen Eigenheiten zu kennzeichnen. Erst spät (im 17. Jahrhundert) kam man darauf, Doppelvornamen zu geben, die Familiennamen stellen den Abschluß der Namengebung dar. Es ist darum nicht verwunderlich, daß die Zahl der Vornamen, die einen Bedeutungswandel in dem angedeuteten Sinne erfahren, die der Familiennamen bei weitem übertrifft. Innerhalb jeder dieser beiden Gruppen kann wieder darnach unterschieden werden, ob der Name auf eine andere Person, auf Tier oder Pflanze oder endlich auf einen Gegenstand übertragen wird. Die Übersicht beschränkt sich auf die deutsche Sprache; nur vergleichsweise werden Fälle aus anderen Sprachen angeführt.
Wenn Itschner[3] Typen und Gattungsnamen als Ergebnis der Bedeutungserweiterung – denn um eine solche handelt es sich immer – scheidet, so kann auch diese Trennung nur um äußerer Gründe willen gerechtfertigt werden. Auch hier liegen schließlich nur Gradunterschiede vor; denn ein Typus stellt in einer Persönlichkeit die Summe aller der Eigentümlichkeiten dar, die einer ganzen Reihe von menschlichen Individuen gemeinsam zukommen, sofern diese in irgendeiner Beziehung gleichartig sind. Eine große Zahl von biblischen, antiken, sagenhaften und geschichtlichen Personen, sowie[23] von Gestalten aus Werken der Literatur wird zum Abbild einer ganzen Menschengattung, eines Standes, Berufes oder einer Gesellschaftsklasse: Ein Mensch von besonderer Größe und Stärke ist ein (Riese) Goliath nach 1. Sam. 17, 14; ein ausgezeichneter Jäger wird als Nimrod, ein Mann von recht hohem Alter als Methusalem bezeichnet; einen ruchlosen Menschen nennt man wohl übertreibend einen Satan; die reuige Sünderin erscheint, allerdings unter falscher Auffassung von Luk. 7, 36 und 8, 2, als büßende Magdalena. Ein Adonis ist ein bildschöner Jüngling, der Argus ein mißtrauischer Wächter; ein Krösus verfügt über ungeheure Reichtümer, Ganymed, der Mundschenk der Griechengötter, wird zum Kellner überhaupt; jeder Beschützer der Künste und Wissenschaften wird als Mäcen gefeiert; der unerfahrene Jüngling hat einen Mentor wie einst Telemachos. Es erübrigt sich, die Reihe über Xanthippe, Don Juan, Schweppermann, Byron usw. bis in die Gegenwart weiterzuführen. Der Verbreitungsbereich ist aus leicht erkennbaren Gründen auf die Gebildeten beschränkt. Nur in ganz wenigen Fällen ist der Kreis weiter gezogen; dann schreitet die Entwicklung auch fort zur Bezeichnung von leblosen Gegenständen, wie wenn im Französischen ein Judas nicht bloß der hinterlistige Verräter ist, sondern auch das »Guckloch in der Tür« (den gleichen Bedeutungswandel zeigt im Deutschen der Begriff Spion).
Den germanischen Vorfahren galt die Namengebung als heiliges und bedeutsames Fest innerhalb des Geschlechtsverbandes, und so sind die deutschen Vornamen als Erbe jener Zeit voll tiefen Sinnes. Frühzeitig gesellten sich fremdsprachliche zu ihnen, christliche Taufnamen wie Jakob, Adam bereits seit dem 9. Jahrhundert. Das hohe Mittelalter ist arm an Vornamen; eine Bereicherung stellen nur die Namen der Heiligen dar wie Martin = Martinus, Lorenz = Laurentius, Anton = Antonius. Erst der Humanismus setzt wieder größere Mannigfaltigkeit an Stelle der Eintönigkeit der vorangegangenen Zeit. Der aristokratische Zug, den diese Geistesströmung aufweist, äußert sich in der Geringschätzung der allgemein üblichen Vornamen, an denen das Volk festhielt. Je weiter verbreitet sie waren, desto tiefer sank ihr Ansehen; eine Abschwächung des Gefühlswertes und Stimmungsgehaltes war die notwendige Folge.
Längst, wahrscheinlich auch schon im Zeitalter der Einnamigkeit, hatten sich im tagtäglichen Verkehr Kurz- oder Koseformen herausgebildet, und gerade von diesen in zahllosen Abwandlungen auftretenden Kosenamen, die stark gefühlsbetont waren, ging der Bedeutungswandel aus. Ihre Bildungskraft ist unerschöpflich; noch jetzt entstehen vor allem in den Mundarten und in der Umgangssprache immer neue Formen, die unter Erweiterung des ursprünglichen Begriffsinhalts zum Gattungsnamen werden. Der wesentlichste Anteil muß dabei dem Gefühl zugeschrieben werden; das reine verstandesmäßige Element tritt völlig zurück. Daraus erklärt sich der Umstand, daß viele dieser Neubildungen, aus einer flüchtigen Stimmung heraus unter ganz individuellen Bedingungen geboren, nur kurze Lebensdauer besitzen oder nur bestimmten Kreisen eigen sind, leichtlebige Augenblicksgeschöpfe, die der Schriftsprache entgehen und darum in die Wörterbücher selten Aufnahme finden. Diejenigen jedoch, die zum Dauerbesitz der hochdeutschen Sprache geworden sind, erweisen ihre Kraft, indem sie in andere Wortklassen übergehen, Tätigkeiten und Eigenschaften bilden, oder sich zu Zusammensetzungen vereinigen.
Nach diesen allgemeinen Bemerkungen folgen die Vornamen mit ihrer abgewandelten Bedeutung in alphabetischer Ordnung[4].
1. August, ursprünglich lateinisches Eigenschaftswort, von augere = vermehren, erheben, verherrlichen abgeleitet, mit der Bedeutung, erhaben, geheiligt, wurde Augustus, seitdem ihn der erste römische Kaiser Cäsar Octavianus angenommen hatte, zum Beinamen[24] aller römischen Kaiser und der Fürsten überhaupt. Der Humanismus machte ihn auch in Deutschland in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts beliebt, so beliebt, daß sich das Volk seiner bemächtigte. Mit der weiten Verbreitung sank sein Wert derart, daß er zur stehenden Bezeichnung der lächerlichen Figur im Zirkus wurde. Die Gestalt des »dummen August« soll um 1864 in England von Tom Belling geschaffen und gegen 1878 von dem Franzosen Guyon dem Geschmack seiner Landsleute angepaßt worden sein. Seit jener Zeit hat er seinen Siegeszug durch die lustige Welt genommen. Die Franzosen geben ihm jetzt meist den Kosenamen Gupusse = Gustchen. Die deutsche Ra. »So ein August« wird in verächtlichem Sinne von einem törichten Menschen gebraucht.
2. Barbara, verwandt mit Barbar, barbarisch, Barbarei, eigentlich ein zum Hw. erhobenes griechisch-lateinisches Ew. mit der Bedeutung, »die Fremde, Nichtgriechin«. Volkstümliche Kurzformen sind nicht nur Bärbel, Bärbchen, sondern ebenso Babette und Babine. In der Gegend von Penig ist Babine tadelnde Bezeichnung für ein zimperliches Frauenzimmer und dann noch allgemeiner Schelte für jemanden, der eine Torheit begangen hat.
3. Bartholomäus über Griech.-Lat. zum Hebräischen zurückgehend > Barthel: Schmutz-, Dreck-, Sau- oder Schweinebarthel als Schelten für unsaubere Kinder. Vielleicht liegen darin eher Ableitungen von Schmutzbart oder Dreckbart vor, die dann Analogiebildungen erzeugten (auch Präsch-, Dösbarthel).
4. Beate von lat. beatus = die Glückselige, nach Albrecht, die Leipziger Mundart § 166 Gattungsname für eine steife, förmliche, auch frömmelnde Person.
5. Christian und Christine, eigentlich Ew. aus dem griech.-lat. christianus. Christian, nd. Krischan, ist in Mecklenburg der Knecht schlechthin, Christel wird in verächtlichem Sinne von liederlichen, unsauberen Mädchen und Frauen gebraucht (Vogtland, Erzgebirge).
6. Christoph < Christophorus = der Christusträger, Name aus der Heiligenlegende, kam wie Christian seit dem 17. Jahrhundert in Aufnahme, sank aber von den bürgerlichen Kreisen schnell in die bäuerliche Bevölkerung, deren frommer Sinn ihn bis zur Gegenwart gehalten hat. Stoffel und Toffel, Stöffel und Töffel waren noch zu Gellerts Zeiten Namen für den Bauern schlechthin; durch den gleichen Bedeutungswandel, der sich in Tölpel aus mnd. dörper, franz. vilain (Gegensatz courtois = hövesch = hübsch) offenbart, wurden sie, besonders aber Toffel, zum Gattungsnamen für einen ungeschickten oder dummen, einfältigen Kerl. Weiterbildungen: abtoffeln = grob abfertigen; betoffelt = verlegen, betroffen; Pflaumentoffel.
7. Daniel, biblischer Name, > mundartlich Danel, vogtländisch = ein alter, neugieriger Kerl, in Meißen ein Mensch von besonderer Länge; einen Menschen mit wunderlichen Ansichten nennt man in der Kirchberger Gegend (Wolfsgrün) Pfaardanel = Pferdedaniel.
8. David. Der biblische Bericht von der Geschicklichkeit des jugendlich-flinken David im Schleuderwurf und Harfenspiel bietet den Grund dafür, wenn die Koseform Davidchen, Davidel einen flinken, geschickten Burschen bezeichnet. Sogar die Uhr geht »wie ein Davidel«.
9. Eva wird auf Grund der mosaischen Schöpfungsgeschichte (1. Mos. 3, 20) übereinstimmend mit dem Französischen zur Bezeichnung für jede Frau, ganz besonders aber für eine neugierige (Evastochter, Fille d’Eve). Im Schwäbischen versteht man eine wollüstige Person darunter (Z. f. d. Ma. 5, 221).
10. Friedrich, echt germanisch, die weibliche Entsprechung Friederike erklärt sich aus dem mlat. Fridericus. Kurzformen sind Fritz und Fritzsch – jetzt Familienname – beziehungsweise Fritze, dieses für männliche und weibliche Personen. Die außerordentliche Beliebtheit, zu der sicherlich die volkstümliche Gestalt des »Alten Fritz« beigetragen hat, hatte zur Folge, daß Friedrich gleich Johann zum Gattungsnamen für den Diener, Hausdiener oder Kutscher wurde.
[25]
In Zusammensetzungen mit Tätigkeitsbegriffen bezeichnet die Kurzform in tadelndem Sinne Personen, die die im Bestimmungswort ausgedrückte Tätigkeit im Übermaß ausübt. Diese Bildungsweise ist im Volke außerordentlich beliebt und gestattet zahllose Abänderungen: Mäkel-, Quassel-, Trödel-, Tiftel-, Lorken- oder Schnokenfritze (einer, der voller Schnurren und Schelmereien steckt); Blinzel-, Heul-, Tran-, Märfried(e) usw. In der Soldatensprache bedeutete »Zappelfritze« im Felde den Radfahrer. In der Gaunersprache bezeichnet nach Albrecht »Tittelfritze« den Rechtsanwalt.
11. Georg, der Name des Schutzheiligen St. Georg, dessen Verehrung namentlich infolge der Kreuzzüge allgemeiner wurde, ist aus dem griechischen Gattungsbegriff georgós = Landmann, Ackersmann hervorgegangen. Der Kappadozier Georgius, der im Jahre 361 als Märtyrer gestorben war – die Erinnerung daran lebt im ahd. Georgsliede – wurde im Volksglauben zum Drachentöter. Mit Hans und Heinz, Kunz und Peter, Toffel und Michel war auch Jörg unter den Bauern als Vorname beliebt. Wie jene, so konnte auch Jörg im geringschätzigen Urteil der oberen Stände den beschränkten Dörfler bezeichnen, wie es noch bei Hauff im »Bild des Kaisers« heißt: »Er (d. h. der Sohn, von dem der napoleonisch gesinnte Vater erzählt) hat oft Stunden, wo es ihm lächerlich, ja töricht erscheint, daß er in meinem bequemen Schloß wohnt, und Nachbar Görge und Michel ... nur mit einer schlechten Hütte sich begnügen müssen.«
12. Gottfried, Gottlieb und Gottlob sind gleicherweise, besonders aber die beiden letzteren, stark in der Wertschätzung gesunken, seit naive Frömmigkeit der Aufklärung als rückständig erschien. Die Kurzformen Fried, Lieb und Lob müssen es sich darum gefallen lassen, einen beschränkten, schwerfälligen Menschen zu bezeichnen, besonders in den Zusammensetzungen: Märlieb, Quatschlob. Ein Breilob ist mit Brei aufgezogen, darum ein schwächlicher Mensch ohne Saft und Kraft in Rede und Tat.
13. Heinrich, ebenso wie Konrad, mittelalterlicher Lieblingsname nach den zahlreichen Fürsten, die ihn im Laufe von mehreren Jahrhunderten trugen, hat eine ganze Reihe von Kurzformen entwickelt: Heinz, Hinz, Heinze, Heinzel, Hein, Heun. Nach Fr. L. Jahn war Hinz Blaufink der Anführer der Gassenbuben in den Hansestädten. Neben anderen Namen wurden die aus Heinrich abgeleiteten Kurzformen auf geisterhafte, dem Menschen freundliche oder feindliche Wesen übertragen: Freund Hein (der Tod), Heinzelmännchen. Die Soldatensprache kennt den Leichenheinrich = Lazarettgehilfe. Der Quasselheinrich ist ein Schwätzer, der Kulmuckenheinrich ein Kopfhänger und Eigenbrötler (Erzgeb.).
14. Jakob, ein hebräischer Mannesname von schwer festzustellender Bedeutung, erzeugt je nach der Betonung die Kurzformen Jäckel, Jockel (schweizerisch Joggeli) und Köpke. Wie man in Frankreich 1358 die aufständischen Bauern les jacques (les jacquiers) und die furchtbare Bewegung Jacquerie nannte, weil der Anführer Guillaume Caillet (Charlet?) den Beinamen Jacques Bonhomme führte, einen Namen, der den einfältigen Bauern, nach Larousse sogar das ganze französische Volk bezeichnete, so galt auch Jäckel im 16. Jahrhundert z. B. bei Fischart Garg. 73 als Gesamtbezeichnung für die Bauern, und zwar mit besonderer Betonung ihrer rohen Dummheit. Die Zusammensetzungen Pferde-, Hunde-, Tauben-, Bienen-, Bilderjokel oder -gokel, unter denen Liebhaber und leidenschaftliche Sammler zu verstehen sind, müssen wohl eher zu Gokel in der Bedeutung Narr gestellt werden. Albrecht führt für die Leipziger Gegend Jokel = Bursche, Kerl an. Der englische Name des Bereiters Jockey ist die Verkleinerung von Jock, das im nördlichen England üblich ist für Jack = Jakob.
15. Jeremias, der große jüdische Strafprediger, hat den Untergang seines Volkes in ergreifenden Liedern beklagt. Wie französisch Jérémie bezeichnet darum auch der deutsche Name verächtlich einen Menschen, der endlos klagt und jammert, einen Jammerlappen.
[26]
16. Johann, Johannes, der Name des Apostels, außerordentlich gebräuchlich und darum eine fast unübersehbare Fülle von appellativischen Bezeichnungen entwickelnd. Johann ist der Hausknecht, der Kutscher der Herrschaft, ebenso wie in Frankreich Jean, in England John und in Rußland Iwan. Die Koseform Hans lebt in Verbindungen wie: Hans im Glück, Hans in allen Gassen (oder in allen Hägen bei Reuter), Hans Dampf in allen Gassen – Titel einer Erzählung von Zschokke –, Hans Guckindieluft, Hansnarr, Hanskaspar (Dreikönigsspiele!), Hans Unvernunft, Hanswurst, die lustige Person, die in Jean Potage ihr französisches Gegenbild hat; das Mittelalter kannte Gaff-, Knapp-, Lauf-, Schnarch- und Prahlhansen; die großen Hansen waren die vornehmen Herren. Nur die Gegensätze Prahlhans und Küchenmeister Schmalhans leben jetzt noch fort. Ein langer Mensch ist ein langer Hans oder sächsisch ein Hansdromnaus (Hans oben hinaus) genannt; der alberne Hans hat nur Torheiten im Kopfe. Im Volkswitz hieß der Henker, dessen unehrlichen Namen man ebenso ungern aussprach wie den gefürchteten des Teufels, Meister Hans oder Schnurhänslein (neben Meister Peter oder Matz). Der hochdeutschen Form Johann entspricht die niederdeutsche Jahn, Jan in Janhagel, das als Spottname der Seeleute eine wie durch Hagelschlag zusammengebrachte Volksmenge bedeutet und von Bürger als Johann Hagel verhochdeutscht worden ist. Ähnlich beschimpften sich Bauern und Landsknechte gegenseitig als Hanst Mist und Hans Marter. Der Dummrian ist nichts anderes als ein Dummerjahn, wie aus der Schreibung dummer Jan in Seb. Francks Sprichwörtersammlung hervorgeht. (Die übrigen Hauptwörter gleicher Bildungsweise stellen eine satirische deutsch-lateinische Mischbildung der Humanisten dar: Grob-ianus, > Grobian, Schlendrian, Liedrian, Stolprian.)
Im Erzgebirge und den angrenzenden Gebieten nennt man einen Tierquäler einen Schinderhannes nach dem berüchtigten Räuberhauptmann Johannes Bückler. Mörike spricht im »Stuttgarter Hutzelmännlein« von einem einfältigen Menschen als von einem Hans Leand oder Leard, < Johann Leonhard und leitet davon die Tätigkeit, verhansleardlen mit der Bedeutung, »auf eine einfältige Weise verlieren, versäumen« ab.
17. Josef, unter einem »böhmischen Seff« versteht der Sachse allgemein den Böhmen, insbesondere den böhmischen Maurer.
18. Karl, latinisiert Cárolus, davon abgeleitet der weibliche Name Karoline > Karline, der als Schelte üblich ist, »so eine alte Karline!« Die Soldaten scheinen besondere Vorliebe für Karl zu hegen: Der Schellenbaumträger bei der Regimentsmusik heißt Bimmelkarl, der Arresthausaufseher Fockenkarl; die Sachsen nannten im Felde den Fahnenschmied Hufkarl. »Klebekarl« für den Gerichtsvollzieher ist nach Müller-Fraureuths Wb. der obersächs. und erzgeb. Ma. ein Dresdner Ausdruck.
19. Kaspar, Melchior und Balthasar waren die drei Könige aus dem Morgenlande, beliebt beim Volke seit den im 15. Jahrhundert aufkommenden Sternsingerumzügen. Kaspar war »der schwarze und der kleine«, von dem Goethe singt: »... und mag wohl auch einmal recht lustig sein«. Die Bedeutung spaltete sich: »Der schwarze Kasper«, unheimlich und gefürchtet, wurde zum Beinamen des Teufels; anderseits trat das Merkmal des »Lustigmachers« in den Vordergrund, so daß Laroche im 18. Jahrhundert dem wiederbelebten Hanswurst den Namen Kasper gab. Im Kasperletheater ist noch jetzt Kasperl den Kindern liebvertraut. Jeder närrische Mensch, der herumkaspert, erhält die Bezeichnung Kasper. Wer Suppe leidenschaftlich gern ißt, wird als Suppenkasper verspottet.
20. Katharine > Käthe, Kathrine, Trine. Die Koseformen haben wie die anderer weiblicher Vornamen – Trude, Trutschel, Trautschel < Gertrud, Liese < Elisabeth – meist wegwerfenden Sinn: Dumme Trine, Heulliese, Bauerntrutschel. »Das laufend Katterl«, »Die schnelle Katharina« und »Jungfer Kathrine« sind verhüllende Bezeichnungen und vielleicht als eine Art Schulwitz aufzufassen (Katarrh?).
[27]
21. Konrad ist eine althochdeutsche Zusammensetzung aus kuoni = kühn und rât = Rat, als Name vornehmer Herren überaus häufig, daher mit Hinz zusammen in der Koseform Kunz allmählich zur Gattungsbezeichnung für den Bauern herabsinkend. Charakteristisch ist der Name des süddeutschen Bauernbundes »Der arme Konrad«, der fälschlich als »Kein Rat« gedeutet wurde. Für die Häufigkeit dieser und ähnlicher Vornamen und ihre typische Bedeutung spricht recht deutlich das Personenverzeichnis eines Lustspiels aus dem Jahre 1540 (mitgeteilt Z. f. d. U. 10, 395). Es führt folgende »Menner« an: Heintz der erst Schultheis, Contz sein son, Gotz der nachbeuren son, Seitz (< Siegfried) sein zechgesel, Ditz (< Dietrich).
22. Laban, in der Ra. »langer Laban« in Norddeutschland ein langer, aber schlaffer Mensch; in Schlesien ist dafür der Ausdruck »Labander« üblich.
23. Leonore, Lenore aus dem englischen Eleonore gekürzt, mit der weiteren Kurzform Lore. In Neustadt und in der Lausitz erhält ein in weiblichen Handarbeiten ungeschicktes Mädchen den Spitznamen »Pfefferlore«.
24. Lorenz, aus lat. Laurentius, verkürzt zu Lenz. Die Deutung Faulenzer als einen faulen Lenz, der bei Hans Sachs als »Der faul Lenz« vorkommt und zur Schreibung Faullenzer Anlaß gegeben hat, wird jetzt allgemein abgelehnt. Man sieht in der Tätigkeit faulenzen eine der für Süddeutschland charakteristischen Bildungen auf -enzen = nach etwas schmecken, riechen, aus der dann erst das Hauptwort Faulenzer entwickelt worden ist. Wenn aber eine tiefe Verbeugung »krummer Lorenz« genannt wird, so ist dabei an den Menschen zu denken, der sie ausführt.
25. Ludwig, der schöne altgermanische Mannesname, ist auch in der französischen Form Louis seit dem Sonnenkönig Louis XIV. in Deutschland außerordentlich häufig und hält sich in manchen Gegenden, so im Vogtlande, mit Hartnäckigkeit, obwohl er infolge der Sittenlosigkeit am Hofe der französischen Ludwige in seiner Bedeutung tief gesunken ist. Er bezeichnet den Zuhälter, in Frankreich insbesondere die Dirne, während für jenen die Namen Adolphe und Alphonse, wahrscheinlich literarische Typen, gebräuchlicher sind.
26. Magdalene, biblischen Ursprungs, eigentlich die aus Magdala am galiläischen Meer Gebürtige, verkürzt zu Lene, gilt in Frankreich als Gemeinname für gefallene Mädchen und solche von lockerem Lebenswandel.
Lene kann auch Kürzung aus Helene sein. »Die fromme Helene« ist ein durch Wilh. Busch geschaffener Typus.
27. Margarete ist im Mittelalter bereits außerordentlich verbreitet, so daß Margret, Grete eine weibliche Person schlechthin bezeichnen: Hans und Grete, eine faule Grete (Liese). Wie Marie < Maria, als Name der Gottesmutter während der mittelalterlichen Marienverehrung auf Millionen frommer Lippen, schließlich so gemein wurde, daß er verächtlich das derbe Bauernmädchen bezeichnete – noch jetzt wird die reiche altenburgische Bauersfrau in den angrenzenden sächsischen Gebieten als Bauernmärge (-marie) und ein plumpes bäurisches Mädchen auch in der Stadt als Bauernmieke (Koseform für Marie) verspottet, so gilt auch Grete, Grite oder Gritte als Gemeinname für ein boshaftes Frauenzimmer.
28. Martin, der Name des Heiligen, dem der 11. November geweiht ist. In Süddeutschland tritt der Pelzmärtel an die Stelle des Knecht Nikolaus oder Ruprecht; er heißt auch der gute Märtel. Meister Martin ist der mittelalterliche Sammelname für die Metzger.
29. Matthias und Matthäus < Mathis, Mathes > Matz in Hemden-, Hosen-, Spiel-, Tändel-, Plaudermatz oder in Verbindung mit einem den Familiennamen nachahmenden Übernamen wie Matz Fott = unmännlicher, feiger Mensch, Matz Pump = einfältiger Mensch oder Matz Klotz = derber, plumper Gesell; aus der bloßen Namensform Matz für einen einfältigen Menschen entwickelte sich die Verkleinerung Mätzchen zur Bezeichnung von Narrenspossen. Nach Schmellers bayr. Wb. bedeutet auch Hiesel < Matthias einen[28] dummen Menschen; von dem Gemeinnamen wird die Tätigkeit hieseln = jemanden zum Besten haben, abgeleitet wie von Gabel, Gaberl < Gabriel gabeln = übereilt handeln.
30. Max < Maximilian, spätlat. Maximinianus, ist eigentlich der zum Geschlecht des Maximinus Gehörige. Volkstümlich wurde er besonders durch den »letzten Ritter«. »Max und Moritz« sind nach Busch zwei Musterknaben. Während des Weltkrieges entstand »Knallmaxe« als humorvoll-grimmige Benennung für die unaufhörlich schießenden Franzosen. Die Ra. »den Maxen machen«, bedeutet den Geprellten spielen. »Ein strammer Max« ist im Kaffeebaum zu Leipzig ein mit gehacktem Rindfleisch und einem rohen Ei belegtes Brot.
31. Mechthild, neben Mathilde veraltet, ist in der Kurzform Metze ein Schulbeispiel für die Bedeutungsverschlechterung: Aus dem stolzen Namen der Fürstin wird allmählich der überaus häufige Vorname von Bauernmädchen – in dem bereits erwähnten Personenverzeichnis des Lustspiels aus der Reformationszeit erscheint Metz als die Tochter der alten Genßhertin – die Pfaffenköchin und Lagerdirne und damit das verächtliche, feile Weibsbild überhaupt.
32. Michael, der biblische Erzengel, verschmolz bei den christlichen Germanen mit dem Schlachtengott Wodan, wurde darum in der Kurzform Michel – das ahd. Ew. mihil = groß, stark, mag mit eingewirkt haben – auf die deutschen Kämpfer übertragen und zur Bezeichnung der Deutschen überhaupt: Der deutsche Michel. Das Schlagwort hat mannigfache Wandlungen erfahren, ehe es seit den Freiheitskriegen zum Sinnbild des gesamten deutschen Volkes wurde. In der Reformationszeit galt es allgemein als Spottname für den einfältigen, tölpelhaften Deutschen, so daß es Stieler im »Teutschen Sprachschatz« Sp. 2277 durch idiota, indoctus erklärt. Diese Bedeutung lebt in der Gegenwart fort: Quatsch-, Heulmichel; Linkmichel (in der Kundensprache ein Handwerksbursche, der sich noch nicht aufs Fechten versteht). Nach Mörike (Novelle »Der Schatz«) wird im Schwäbischen ein Jüngling, der das weibliche Geschlecht ängstlich meidet, ein »kalter Michel« genannt. Vetter Michel, den Goethe mit überlegener Ironie malt, wenn er sagt: »Laßt den Witzling uns besticheln, glücklich, wenn ein deutscher Mann seinem Freunde Vetter Micheln guten Abend bieten kann,« ist das Urbild des deutschen Philisters. Sich anbiedern wird darum auch durch: sich vettermicheln, sich anmicheln gegeben. Michelei, Micheltum sind Neubildungen der letzten Jahre.
In der dichterischen Anschauung nimmt jedes Volk von ausgeprägter äußerer und innerer Eigenart persönliche Gestalt an. Das französische Volk wird durch Marie-Anne, das Weib aus dem Volke, versinnbildlicht, das nach Heine als Sinnbild der wilden, ungebändigten Volkskraft 1830 »eine fatale Bürde abwirft«. John Bull ist die Verkörperung der englischen Wesensart, am nächsten verwandt mit ihm ist der amerikanische Vetter Uncle Sam. Tommy, wie die deutschen Soldaten jeden Engländer nannten, ist der Schottländer, Paddy (Koseform von Patrik, dem Schutzheiligen der Insel) der Bewohner des grünen Eilands, Tom der Neger. Im Elsaß ist Méchel (Michel) der Spitzname der Deutschen.
33. Nikolaus, der Name des früh schon heilig gesprochenen Bischofs zu Myra in Lyzien, kommt schon bei Oswald von Wolkenstein im 15. Jahrhundert in der Kurzform Nickel als Personenname vor. Er verband sich frühzeitig mit der Vorstellung des Kleinen, Unbedeutenden, die aus dem bei Luther vorkommenden Gegensatz des kleinen Nickels zum großen Hansen hervorging. Deshalb bezeichnet man damit nicht bloß Kinder, im Schwäbischen eigensinnige Mädchen, sondern auch erwachsene Personen, die mit etwas Tadelnswertem, das den Wert des Menschen herabsetzt, behaftet sind: Gift-, Zorn-, Filz-, Gron-, Laus- und Notnickel, Sau-, Schweinnickel; Schinder-, Schimpf-, Rußnickel. Auch auf liederliche Weibspersonen wird Nickel angewandt. Hansnickel war um 1680 zu Mühlhausen in Thüringen der Scharfrichter.
Der heilige Nikolaus war der Schutzheilige der Seefahrer. Darum heißt der Matrose außer Jack auch Klas, häufig mit wertverminderndem Beiwort: grober, dummer Klas, Drömklas.
[29]
In der Adventszeit – der 6. Dezember ist sein Namenstag – kehrt der Nikolaus bei den Kindern ein, und sie beten: »Ach lieber Sankt Nikolaus, schütt doch den Sack voll Nüsse aus.« (Auch Knecht Niklas oder Pelznickel.) Wenn im Französischen Nicolas den einfältigen Dummkopf – auch in der Verkleinerungsform Colas – bedeutet, so ist sicherlich die lautliche Ähnlichkeit mit nigaud von bestimmendem Einfluß gewesen. Das weibliche Colette bezeichnet ein zimperliches Frauenzimmer (Zimperliese).
34. Oskar ist ein im Norden (Schweden) häufiger Name < Ansgar. Eine Person von zudringlicher Frechheit wird mit der Ra. »frech wie Oskar« charakterisiert. Der Name ist im Französischen zur Bezeichnung des Zuhälters herabgesunken, auf welchem Wege, deutet H. Taine an: Ossian avec Oscar, Malvina et sa troupe, fit le tour de l’Europe et finit vers 1830 par fournir des noms de baptême aux grisettes et aux coiffeurs.
35. Peter < Petrus wird in appellativischer Verwendung gleich dem Hans bevorzugt: Dummer, fauler, hölzerner, trauriger, langweiliger Peter, Heul-, Quatsch- oder Seich-, Schrei-, Märpeter, Lügen-, Dreck-, Karnickelpeter (Liebhaber von Karnickeln); Tran- und Traumpeter. Ein strubbliger d. h. zerzauster Kopf verhilft seinem Besitzer zur Bezeichnung Strubbelpeter, literarisch berühmt geworden als »Struwelpeter« durch den Dichter Heinrich Hoffmann. Chamissos Peter Schlemihl lebt auch unter denen, die die Dichtung nicht kennen, in der Ra. »Du bist mir ein schöner Schlemihl« fort. Wer dasitzt, wie Peter Bumm, ist völlig teilnahmslos. In sächsischen und thüringischen Gegenden wird ein schlechter Mensch als Peter Meffert verächtlich gemacht.
36. Philipp, aus dem Griechisch-Lateinischen stammend, abgekürzt > Lipp, Lips. Ein unruhiges Kind wird als »Zappelphilipp« oder Zappelliese getadelt. Der »Vater Philipp« ist in der Soldatensprache der Arresthausaufseher (vgl. Fockenkarl).
37. Ruprecht, gleich den Nebenformen Rupert, Robert, aus ahd. hruod-beraht = der Ruhmglänzende (vgl. Bertha < Berchtha), begleitet als des Christkindleins getreuer Knecht dasselbe bei der weihnachtlichen Bescherung. Die Kinder fürchten die polternde Gestalt mit der Rute als den Rupert oder Rupperich, so daß der Name die allgemeine Bedeutung »Schreckgestalt« annimmt. Nach Eisels Sagenbuch des Vogtlandes werden da und dort gewisse schauerliche Waldstätten »Rupprechte« geheißen; ein solcher Rupprecht schließt sich nach Eisel an die Talschlucht Lerche bei Tscherma an und ist arg verschrien.
Die Koseform Rüpel < ahd. Rûpilo, Rûpo, war noch im 16. Jahrhundert, z. B. bei Fischart, Eigenname; als Familienname Rüp(p)el hat sie sich erhalten. Da der Knecht Ruprecht vermummt oder geschwärzt auftrat, mit grober Stimme redete und derb zuschlug, in den Weihnachtsspielen den Spaßmacher darstellte, nahm der Name die appelativische Bedeutung einer schwarz aussehenden Gestalt einerseits wie eines groben, ungezogenen Gesellen anderseits an. Wer von der Sonne verbrannt ist, sieht schwarz aus wie ein Riepel (Rüpel), die Mohren sind schwarze Riepel, und der Essenkehrer heißt im Erzgebirge und Vogtland, ohne daß dabei sein Benehmen getadelt wird, Feierriebel = Feuerrüpel. Auf der anderen Seite steht der Rüpel als der ungeschliffene Grobian mit seinen Rüpeleien. Abgeleitet ist das Tätigkeitswort rüpeln.
Die französische Koseform Robin < Robert ist zum Gemeinnamen des tölpelhaften Bauern geworden, der den Pfiffigen spielen will, im weiteren Sinne bezeichnet sie den Spaßvogel, in Sprichwörtern den Menschen überhaupt. Robinette ist der Name der Dienstmagd.
38. Susanne, hebräisch die Lilie. Man spricht auf Grund des biblischen Berichts von einer »keuschen Susanne« ebenso spöttisch wie von der frommen Helene. Die gekürzte Form Suse, die allgemein eine langsame, träge, träumerische Person (Mär-, Traumsuse) bezeichnet, aber auch andere tadelnswerte Eigenschaften hervorhebt (Heulsuse), wird häufig sogar auf männliche Personen angewendet. Mörike nennt im »Stuttgarter Hutzelmännlein« ein aufgeputztes Mädchen eine »Susanne Preisnestel« nach dem Saum (Preis) am Hemde und dem zum Einfassen gebrauchten Band.
[30]
39. Thomas, nach Joh. 20, 24 ff. der hartnäckige, erst durch den Augenschein überzeugte Zweifler wird zum Typus des Ungläubigen: ein ungläubiger Thomas.
40. Ulrich, Koseform Uz, wird in den Ra. »den Ulrich anrufen« = sich erbrechen und »Ulrich von der Feuerwehr« (letztere im Vogtland gebräuchlich für irgendeinen Menschen, der zum Spott herausfordert) verwendet. Von Uz wird auch uzen = foppen abgeleitet, wenn auch diese Herleitung nicht allgemein anerkannt ist.
41. Ursula, lateinischer Name = Bärin, appellativisch in der Form Ursel, Urschel für eine dicke Frau; französisch Ursèle ist die alte Jungfer oder die Magd.
42. Wenzel aus dem Slawischen ins Deutsche gedrungen; der Brogl = Wenz ist bei Mörike (Stuttgarter Hutzelmännchen) der Prahler (sich broglen = prahlen).
Vornamen dienten seit jeher als Glimpfnamen (Euphemismen) für Personen oder Wesen, die man aus abergläubischer Furcht nicht bei ihrem wirklichen Namen zu nennen wagte. Daß der Henker Meister Hans, Schnürhänslein, Peter oder Matz gerufen wurde, ist bereits angeführt worden, ebenso daß Kobolde und Wichte Heinzel- oder Petermännchen, Peterlein, Hollepeter, Chiemke (nd. Verkleinerung von Joachim), Wolterken (Walterchen) oder Nissen hießen. Der Name des Metalls »Nickel« entstand, wie Kobalt aus dem neckenden Kobold, aus der Bezeichnung des Bergdämons, der die Häuer äffte, indem er ihnen Kupfer vortäuschte. Der Tod ist Freund Hein oder Henn. Unendlich mannigfaltig sind die Bezeichnungen des Teufels, die er teilweise mit dem Henker gemeinsam hat: Hans, Hanske = Hänschen, Junker Hans, Grau- oder Grünhans, Hans vom Busch, Heinrich, Grauheinrich, Hinz, Kunz, Nickel, Großnickel, Marten oder Merten, Kaspar oder Käsperle, Dewes = Tobias, Rüpel, Stöffel oder Junker Stof = Christoph, Peterlein, Velten = Valentin unter Anlehnung an mhd. vâland usw.
Von jeher hat der Deutsche in enger Vertrautheit mit der Tierwelt, zunächst natürlich mit den Tieren seines Hauses, aber ebenso mit solchen des Waldes, nützlichen und schädlichen, gestanden. Die Tiersage offenbart das innige Verhältnis zwischen Mensch und Tier auch dadurch, daß dieses einen menschlichen Namen trägt. Das männliche Pferd heißt allgemein Hans (bekannt war vor Jahren »Der kluge Hans«), die Stute Liese oder Lotte; ein Dackel wird wohl auch Seppl gerufen. Freilich sind dies gewissermaßen Eigennamen wie im Tierepos, aber der Übergang zum Gattungsbegriff ist außerordentlich leicht gegeben. Auch der »Matz« war ursprünglich Name eines Vogelindividuums mit Haustierrechten, eines Kanarienvogels oder zahmen Stares. Durch Bedeutungserweiterung wurde die Bezeichnung auf jeden Star – Starmatz – und jeden kleineren Vogel übertragen: Piepmatz (Wandelung dieses Begriffs: Der kriegt einen Piepmatz ins Knopfloch = einen Orden, du hast wohl einen Piepmatz (Vogel)?) Sogar Ungeziefer wird von den Kindern als Matzeln bezeichnet. Der Papagei heißt allgemein Lore oder Lorchen. Rabe und Krähe tragen in Zwickau den Namen Jakob, die Dohlen heißen vielerorts Klas, die Rotkehlchen in der Lausitz wohl auch Rotkätel. Besonders zahlreich sind die Benennungen des Sperlings: bei den Franzosen Pierrot und Pierette, bei den Niederdeutschen Jochen, Johann Klappstert, Dackpeter. Das Schwein heißt Kuntz, auch Suse, Heinz ist der Kater, dann auch das männliche Kaninchen (vogtländisch Hàànz). Nicht belegt für Sachsen ist Hermann als Name des Ziegenbocks. Der Pariser ruft den Bären des Zoologischen Gartens Martin; Martine ist das weibliche Kaninchen; auch andere Tiere heißen im französischen nach dem heiligen Martin.
Naturgemäß ist die Zahl der Pflanzen mit menschlichen Namen weit geringer; erwähnt seien nur »Das fleißige Liesel« = eine lange blühende Topfpflanze und »Der gute Heinrich« = Chenopodium.
Die Figuren des Kasperletheaters, Nachbildungen häufiger menschlicher Typen, lassen den Vorgang des Bedeutungswandels deutlich erkennen. Den Zuschauern werden die[31] Puppen ebenso lebendig, wie ein Kind mit seinem Püppchen umgeht, als wäre es lebendig. Die alte Bezeichnung für die Gestalten des Puppentheaters war Kunz, Kunzchen, Künzel, Heinz oder Jäckel; nach ihnen hieß der Puppenspieler Kunzmann (noch jetzt Familienname) und Kunzenjager oder Kunzenspieler. Vom französischen Marion, der Koseform von Marie, ist die noch jetzt herkömmliche Bezeichnung Marionetten abgeleitet. Eine andere Kurzform desselben Vornamens Marotte, noch heute in der Normandie ein junges, halbwüchsiges Mädchen bezeichnend, ist nicht bloß der Puppenkopf am Narrenstab, sondern auch die Narrheit, der närrische Einfall.
Mit dem Namen Heinz werden eine ganze Reihe technischer Werkzeuge und Geräte belegt, ursprünglich wohl im Bergbau eine Wasserhebemaschine nach dem geschäftigen Kobold, dann auch die Schnitzbank des Böttchers. Schmeller führt als bayrisch an Stiefelhänsel oder Stiefelhainzel = Stiefelknecht und Heuhainz = im Allgäu ein Gestell zum Trocknen des Heus (hainzen = diese Art des Trocknens). Französisch Saint-Jean ist nicht bloß alles, was der Setzer braucht, in der Druckersprache, sondern auch allgemein das Handwerkzeug: prendre son S.-Jean = die Werkstatt verlassen. Dietrich, wie Friedrich und Johann häufig für Diener, wird zum Namen des Diebs- oder Nachschlüssels. Die Rute erscheint den Kindern euphemistisch als Birkenhänsel oder Birkengottfriedel, wie auch im Französischen der Eseltreiberstock martin genannt wird.
Von jeher hat der Soldat in seiner Waffe ein ihm vertrautes lebendiges Wesen erblickt. Aus der gleichen Gesinnung heraus, die Körner dazu antrieb, das Schwert an seiner Linken als sein Liebchen, als Eisenbraut zu besingen, entstanden im Mittelalter die Beinamen der Geschütze und Waffen. Hans v. Schweinichen erzählt in seiner Lebensbeschreibung, daß der junge Herzog von Liegnitz sein Rapier »allezeit meine Jungfer Käthe geheißen« habe, mit der er oft ein Tänzlein getan habe. Ein Geschütz aus dem 14. Jahrhundert, das sich in der Arsenalsammlung zu Dresden befindet, hieß »Faule Magd«; noch berühmter war die »Faule Grete«, beide ihrer Schwerfälligkeit wegen so benannt, wie ja auch die deutschen Riesenmörser des Krieges allgemein »Dicke Bertha« hießen. Der Soldat gibt dem Gewehr die zärtlichsten Namen: meine Karline, Laura, Pauline, Bertha. Auf ein zärtliches Liebesverhältnis deutet auch, wenn der Schnapsbruder von der Flasche als von der Karline oder Pauline spricht. Die Kaffeekanne heißt manchmal Kaffeekarline.
Eine andere Art von Bedeutungsübertragung liegt vor, wenn Speisen und Getränke nach einem menschlichen Vornamen heißen: Ein geringes Bier, wie es die Knechte tranken, nannten die Schöppenstädter »armer Heinke«; im Erzgebirge ist der »Großpeter« ein dicker mit Milch übergossener Brei, als Sommerspeise beliebt, in Süddeutschland der »Biernickel« eine Kaltschale; der Reisbrei lebt in der Soldatensprache als »stolzer Heinrich«. Im südlichen Deutschland gibt es Pfannkuchen unter der Bezeichnung »Pauternickel«; in Westfalen entstand der berühmte Pumpernickel, über dessen schwierige Etymologie viel geschrieben worden ist; der zweite Teil ist auf jeden Fall der Vorname Nickel. Warum heißt in Sachsen ein Käse »alter Theodor«? Die Pflaumentoffel, die hie und da auf den Christmärkten verkauft werden, sind aus Dörrpflaumen zusammengesetzte Männlein in Essenkehrergewandung; auch der Name Pflaumenrüpel kommt vor. Der Ziegenpeter oder Bauerwetzel ist eine Krankheit der Halsdrüsen, vielleicht bei Hütejungen als Folge von Erkältungen häufig vorkommend. Seltsame Laune des Sprachgeistes, das Fensterkreuz als Fensterpeter, die große Klingel am Pferdekumt im Winter als Lore (Erzgeb.), den Abort als Lotte (Leipzig) zu bezeichnen! Das beliebte Gesellschaftsspiel »Schwarzer Peter« soll seinen Namen von einem berüchtigten Räuberhauptmann in Mecklenburg, Peter Nikoll, genannt der schwarze Peter, empfangen haben; dann wäre es über hundert Jahre alt; denn 1817 ist er in Glückstadt enthauptet worden. Die vier Wenzel sind die Unter, die Baste (Koseform von Sebastian wie Bastel) ist der Grünober im Schafkopfspiel. Auch Schar- oder Scherwenzel soll ursprünglich den Unter des Kartenspiels bezeichnet haben; Jean Paul, Freytag und andere nennen einen schlechten Tabak Lausewenzel. Manche Dresdner verstehen unter »großem Friedrich« die große Zehe, die Leipziger[32] sprechen von der »grünen Anna« und meinen damit den Polizeiwagen. Bei Dähnhardt, Naturgeschichtliche Volksmärchen 1, 102 heißt der Regenschirm beispielsweise »die baumwollene Minna«.
Die Zahl der Familiennamen in appellativischer Verwendung ist, an der Menge der Vornamen, unter denen keiner von älteren und gebräuchlicheren fehlt, verschwindend gering. Von vornherein ist auch klar, daß es sich, wenn Familiennamen zu Gattungsbezeichnungen geworden sind, nur um die allerbekanntesten, über weite Gebiete verbreiteten handeln kann. Aus dem hohen Alter und der Häufigkeit des Auftretens erklärt es sich, daß sich die Bedeutung nicht bloß erweitert, sondern auch in den meisten Fällen verschlechtert. Obwohl die Freizügigkeit das ursprüngliche Bild stark verändert hat, lassen sich doch noch immer auch inbezug auf die Verbreitung gewisser Familiennamen landschaftliche Verschiedenheiten nachweisen. Daneben aber gibt es Namen, die aus kulturgeschichtlichen Gründen gleichmäßig über ganz Deutschland verbreitet sind. An diese vor allem knüpft die Bedeutungswandlung an; nur selten wird ein Personenname von begrenztem Geltungsbereich zu appellativischer Verwendung gelangen. Ein flüchtiger Blick in die Wohnungs(Adreß-)bücher der Großstädte offenbart in überwältigender Fülle, welche Personennamen als die häufigsten gelten können. Der Volkswitz hat den Vers geschaffen: »Müller, Schulze, Lehmann, Schmidt – die machen jeden Mumpitz mit.« Die Lesart schwankt zwischen Müller und Meier, aus dem richtigen Bewußtsein heraus, daß unbedingt der Meier in die Reihe gehöre. Die Häufigkeit dieser fünf Namen wird erst dann recht deutlich, wenn die verschiedenen Formen der Rechtschreibung, unter denen sie vorkommen, in Betracht gezogen werden:
Nun mag der Volkswitz auf der Straße und im lustigen Blatt über diese Namen denken, wie er wolle, ihre Geschichte ist uralt, und sie waren einst ebenso geachtet, wie sie jetzt unwillkürlich ein Lächeln hervorlocken, wenn sich jemand als Müller oder Schulze vorstellt.
Der Schmied ist vielleicht der älteste aller Handwerker, hochgeachtet im deutschen Altertum wie bei Griechen und Römern, so daß die Heldensage von göttlichen und fürstlichen Schmieden berichtet (Wieland der Schmied, Jung Siegfried). Die strenge Arbeitsteilung des mittelalterlichen Zunftwesens schuf eine Fülle von Einzelhandwerken (Blech-, Kupfer-, Eisen-, Hammer-, Messer-, Gabel-). Die appellativische Verwendung in der Gegenwart ist verhältnismäßig beschränkt. Wohl nur im Altenburgischen wird ein Faulpelz in prachtvoller Anschaulichkeit als »kalter Schmied« bezeichnet (Müller-Fraureuths Wb. 2, 451). Das Erzgebirge nennt einen Springinsfeld, »Huppe(r)schmied«, womit ursprünglich ein Springkäfer gemeint war. Ganz geschickte Leute werden in Sachsen mit den Worten gelobt: »Du hast’s ja weg wie Schmidts Katze«. Wer schnell und plötzlich verschwindet, ist »weg wie Schwenke«. Natürlich handelt es sich in diesen Redensarten, in denen auch andere Eigennamen an die Stelle der angeführten treten, nicht um Gattungsbezeichnungen im eigentlichen Sinne.
Müller, wohl unmittelbar aus lateinisch molinarius entlehnt, verdrängt die ältere deutsche Benennung quirn, die in den Familiennamen Kerner oder Körner fortlebt. Ein leichter, luftiger Bursche (Luftikus) wird »Windmüller« gescholten. Als Müller werden hie und da Maikäfer und Kohlweißlinge bezeichnet. Müllerknechte sind Mehlklümpchen im Brote, Müllermädeln die Aurikeln. Planvolle, tägliche Körperstählung faßt die Tätigkeit »müllern« zusammen (der Erfinder heißt Müller).
Meier aus lateinisch maior = der größere gehört in die vornehme Verwandtschaft der fränkischen Hausmaier (Maior domus), des französischen maire (Bürgermeister) und des[33] deutschen Majors. Der Meier saß ursprünglich als Pächter oder Aufsichtführender auf einem größeren Gute (Meier Helmbrecht, der Meier in Hartmanns »Armem Heinrich«). Aus dem Gattungsnamen entstand der Familienname, dieser wieder nimmt appellativische Bedeutung an: Er bezeichnet einmal irgendeine Person aus der Gattung Mensch, deren Namen nicht bekannt ist oder nicht genannt werden soll; zu Tante Meier oder zu Lehmanns geht, wer seine Bedürfnisse auf dem Abort befriedigt. Albrecht verzeichnet den »feinen Meier« als den elegant Auftretenden; wer das tut, beißt den feinen Meier heraus. In großer Zahl werden vom Volke Zusammensetzungen gebildet, in denen das Grundwort Meier oft einen Vornamen ersetzt oder verdrängt: Angstmeier, Heulmeier (neben -fritze, -peter, -liese) ironisch auch für Sänger gebraucht, Bietelmeier neben -liese (Kind, das angibt oder klatscht), Kirchmeier (fleißiger Kirchenbesucher), Kraftmeier (ursprünglich der Turner, dann jeder, der in Taten oder auch nur Worten mit seinen Kräften prahlt; Kraftmeierei, Kraftmeiertum); Nietenmeier oder -fritze (Lotteriekollekteur); Piepmeier, Schlaumeier, Schwafelmeier neben Schwafellob, -hanne; Simpelmeier (Dummkopf); Kohlmeier (Aufschneider); Schwindelmeier, einer, der etwas vorschwindelt; Spielmeier; Strampelmeier (Radfahrer); Windmeier (Flausenmacher). Abmeiern bedeutet ursprünglich: einen Bauern auf irgendeine Weise von seinem Gute vertreiben; daraus erklärt sich meiern = foppen, anführen. Der besitzlose Bauer war der Gemeierte (übervorteilen, betrügen, auch der Geblaßmeierte). Wer im Vereinsleben aufgeht, ist ein Vereinsmeier.
Schulze ist die gekürzte Form von Schultheiß, dem Namen des Ortsvorstehers. Wie die anderen bezeichnet auch Schulze appellativisch jede beliebige Person. Die Ra. »Das ist mir Gottlieb Schulze« drückt aus, daß einem etwas völlig gleichgültig ist.
Lehmann, noch in Urkunden des 17. Jahrhunderts auch Lehemann, ist eigentlich der mittelhochdeutsche Lehensmann, der mit einem Gut oder Amt Beliehene. Jetzt ist dieser Familienname Gemeinname für Dummkopf: Das sieht Lehmann im Finstern. Irgendeinen Menschen vertritt der Name in der Ra.: Es wird wieder besser mit’m alten Lehmann, wenn z. B. die Frage nach dem Befinden gestellt wird.
Pietzsch, zu Peter gehörend wie Dietzsch zu Dietrich, ist in Sachsen ebenso häufig wie Lehmann. Darum ist unter den Kindern der Vers üblich: Pietzsch und Lehmann kam’n in’n Laden: Woll’n fer’n Dreier Käsemaden! Käsemaden hammer nich’ – Pietzsch und Lehmann drückten sich. Ein eifriger Turner heißt spöttisch Muskelpietzsch.
Huber, mhd. huober neben huobener, gehört mit Hübner zu Hufe, bezeichnet also den Besitzer einer Hufe. Der Name ist in Süddeutschland verbreitet und konnte darum Appellativum werden: Wühlhuber (unruhiger Hetzer), Quellenhuber (so nennt G. Roethe eine bestimmte Richtung von Forschern), Gschaftlhuber.
Auch in der Welt der Wörter gibts keinen Stillstand. Ein ewiger Kreislauf offenbart sich selbst an dem scheinbar Allerbeständigsten, an den Personennamen. Die Schöpferkraft der deutschen Sprache ist noch nicht versiegt.

Fußnoten:
[1] R. Needon, Vornamen als Gattungsnamen. Z. f. d. d. Unt. 10, 198 ff. A. Kölbel, Eigennamen als Gattungsnamen. Studien (zum französischen Wortschatz). Diss. Leipzig 1907.
[2] Wundt, Völkerpsych. I, 2. S. 579.
[3] Itschner, Sprachlehre 1911, S. 110.
[4] Abkürzungen: Ra. = Redensart; Hw. = Hauptwort; Ew. = Eigenschaftswort; ahd. = althochdeutsch; Ma. = Mundart; Wb. = Wörterbuch; > = wird zu, < = geworden aus: Z. f. d. d. U. = Zeitschrift für den deutschen Unterricht.
[34]
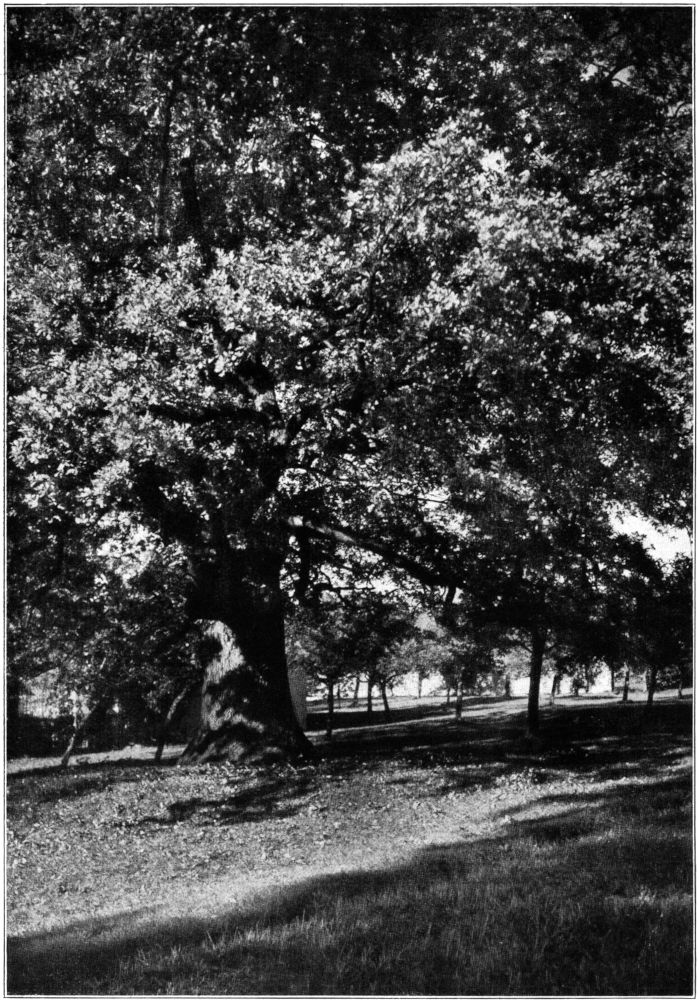
[35]

[36]
In Buchstaben: Fünfzehntausend Mark.
Nach einigem Zögern hatte auch ich mir ein Los der 5. Sächsischen Geldlotterie des Landesvereins »Sächsischer Heimatschutz« geleistet. Warum auch nicht! Wer opfert nicht von Herzen gern eine Mark und fünfzig Pfennig gerade für diesen Verein! Und sollte man es sogar in der Befürchtung tun, nichts zu gewinnen! Aber nein, für mich kam die Sache ganz anders. Meine Losnummer endete mit einer eins, und durch die Gewinnliste, die ich mir für zehn Pfennig kaufte, erfuhr ich die große Tatsache: alle Lose, die mit einer eins endigen, haben eine Mark und fünfzig Pfennig gewonnen, oder mit anderen Worten: sie erhalten den Loseinsatz zurück! So steckte ich also mein wohlverwahrtes Los ein und fuhr mit der Elektrischen von meiner Vorstadt aus bis auf den Pirnaischen Platz, von dort aus lenkte ich meine großen Schritte nach der Schießgasse zu. Vor der Geschäftsstelle des Landesvereins hielt ein leeres Auto. Warum sollte vor der Geschäftsstelle des Landesvereins nicht einmal ein leeres Auto halten? Konnte ihm nicht eben der Herr Hofrat Seyffert entstiegen sein? Doch nein, fast möchte ich’s nicht glauben: der Herr Hofrat, der noch vor kurzem durch das ganze liebe Sachsenland gewandert ist, um Schätze für sein Paradies in dem früheren Jägerhof drüben auf der Asterstraße zu sammeln, wird auch bis auf die Schießgasse nicht erst ein Auto nehmen. Wie dem auch sei: vor der Geschäftsstelle des Landesvereins hielt ein leeres Auto. Ich ließ es dort stehen, solange es wollte, und stieg behutsam die alte steinerne Treppe hinauf. Im Vorraum der Geschäftsstelle zeigte ein großer Pfeil nach links, nach dem Zimmer nämlich, in dem die Gewinne ausgestellt wurden. Ich schwenkte also, was ich sonst nie tue, nach links, mein Los in der Hand, und bemerkte auf den Stühlen des Vorraumes Männer und Frauen, die sich gar geheimnisvoll zuflüsterten. Ich ahnte, daß sie alle einmütig zusammengehörten. Jetzt erst trat ich in den großen Raum ein. An dem langen Zahltisch stand neben mir ein stattlicher Mann, etwa dreißig Jahre alt, einfach gekleidet, aber ohne den geringsten Tadel. Der legte, genau wie ich es nach ihm tat, sein Los auf die Tafel, um seinen Gewinn abzuholen. Aber er hatte eine ganz andere Nummer gezogen als ich: 86 156! Und das wußte ich noch von der Gewinnliste her, die ich mir für zehn Pfennig gekauft hatte: »Die Prämie von fünfzehntausend Reichsmark fiel auf die Nummer 86 156 mit einem Gewinn von fünfundzwanzig Reichsmark.«
So stand ich also neben dem Glücklichen, der in jenem Augenblick ein reicher Mann wurde. Aufgeregt war er, das merkte man ihm an. Ja, wenn nun auch nur eine Ziffer nicht gestimmt hätte, oder wenn ... na kurz, er glaubte es selbst erst, als die Beamten die Nummer nachgeprüft hatten und ihm nun 15 000 M., in Buchstaben: fünfzehntausend Mark auf einem großen Zahlbrett auszahlten. Auf die fünfundzwanzig Mark verzichtete er freiwillig, und während er das viele, viele Geld in seine Brieftaschen steckte, gab er immer und immer wieder die Versicherung ab, diesmal sei der Gewinn wirklich in gute Hände geraten. Bald wußte ich auch seinen Namen und seinen Wohnort, ich war der erste, der ihn beglückwünschte, dann aber zog ich mich bescheiden zurück; denn ich wollte nicht gleichzeitig auch der erste sein, der ihn ... anbettelte! Er wird schon bald danach bemerkt haben, wie beliebt er überall ist, wo er sich nur irgend sehen ließe. Jetzt kam ich selbst an die Reihe und ließ mir meinen Gewinn auszahlen: eine Mark und fünfzig Pfennig. Und als ich wieder in den Vorraum kam, fand ich meine Vermutung bestätigt: mitten im Kreise – es war wohl sein Verwandtschaftskreis – stand er, der reiche Mann, und er zeigte ihnen soviel gutes Geld, wie sie wohl noch nie gesehen hatten: 15 000 Mark! Ob er schon wußte, was er mit seinem Gewinn anfinge? Ich für meinen Teil überlegte nicht lange, ich ging in den zweiten Raum, legte zu meinem Gewinn noch eine halbe Mark hinzu und bezahlte an den Landesverein meinen Mitgliedsbeitrag, mit dem ich noch weit im Rückstande war. Ich zahlte nun sogleich für zwei Monate auf einmal! Und blieb noch immer ein großes Stück hinter dem Heereszug zurück. Als ich die steinerne Treppe wieder bedächtig hinuntergestiegen war, füllte sich das Auto mit vergnügt[37] aussehenden Männern und Frauen. Töff, töff, und fort ging die Fahrt. Nun ich einmal mitten in der Stadt war, benutzte ich die Gelegenheit, hier und da noch etwas zu erledigen, und erst in später Abendstunde trat ich meinen Heimweg an. Sonderbarerweise kam mir gar nicht der Gedanke, mit der Elektrischen heimzufahren; nein, Schritt für Schritt marschierte ich heraus in meine Vorstadt. Mir war, als fänden die Vorübergehenden etwas Besonderes an mir; sollten sie mir es etwa ansehen, daß ich heute Augen- und Ohrenzeuge eines so großen Ereignisses gewesen war? Oder glaubten sie etwa gar ...? Nein, das – gewiß nicht. Von Zeit zu Zeit griff ich an meine Tasche; ich konnte unbesorgt sein: ich hatte sie noch immer bei mir, meine – Quittung über den Mitgliedsbeitrag für zwei Monate auf einmal!
Als ich bei uns daheim ankam, lagen die Meinen bereits in stiller Ruh, wie einstmals Babylon, und ich bemühte mich, sie nicht zu stören. Leise ging ich in mein Zimmer, tastete nach einem Streichholz und brannte die Gaslampe an; nur halbhell ließ ich es im Zimmer werden; denn für meine Gedanken brauchte ich keine grelle Beleuchtung. Eigentlich wollten wir schon längst elektrisches Licht haben, aber immer wieder reichte der Draht nicht, und so verpaßten wir den Anschluß vom Treppenhaus aus bis in die Wohnung. Für heute jedoch war es gut so: wird man doch mit elektrischer Beleuchtung wohl kaum Dämmerlicht erzeugen können, wie ich es gerade brauchte. Dichten und trachten – und sei es auch böse von Jugend auf – man muß es doch bisweilen tun, und mir will es nur dann gelingen, wenn ich um mich herum blaue Wölkchen aufsteigen sehe, die sich phantastisch gestalten, bis sie sich in einer bestimmten Höhe beruhigen und zu einem dicken Strich verdichten. Darum setzte ich zuerst eine Zigarre in Brand und dann mich selbst ganz allein um den großen Tisch herum, der für gewöhnlich noch meine Frau und zwei erwachsene Kinder um sich versammelt sieht. Im Dämmerlicht schrieb ich mit festen Zügen auf ein großes Blatt Papier:
1,50 M.
Und wie ich so dasaß und sann und sann, da machte sich plötzlich und unerwartet das scheinbar unscheinbare Komma auf die Wanderschaft und rückte nach rechts bis hinter die erste Null. Da waren aus meinem Gewinn schon hundertfünfzig Mark geworden. Ich fügte noch eine Null hinzu, und das Komma stellte sich dahinter. 1500 Mark las ich jetzt halblaut vor mich hin. Noch einmal griff ich zum Blei, nicht zum tödlichen, sondern nur, um noch eine Null hinzuzuschreiben; denn, dachte ich mir, aller guten Dinge sind drei. Und als ich die letzte Null oben verschloß, krach! da brach die Spitze des Bleistiftes ab und ward nicht mehr gesehen! Auch mein Komma war verschwunden, zum mindesten habe ich ihm keine Beachtung mehr geschenkt, und ich schenke doch sonst so gern! Da hatte ich sie wieder vor mir, die große Zahl, die mich heute nicht aus ihrem Bannkreis weichen lassen wollte:
15 000 M.!
Fünfzehntausend Mark! Hätte ich doch meinen Gedanken nicht so ganz freien Lauf gelassen! Aber schon war es zu spät! Fünfzehntausend Mark! Auf den letzten Pfennig genau war es derselbe Betrag, der mein einst war und den ich vor ein paar Jahren in den Händen meines deutschen Vaterlandes kleiner und immer kleiner werden sah, bis er sich eines schönen Tages, oder sagen wir lieber eines schlimmen Tages, in ein Nichts aufgelöst hatte. Doch, machen wir es ganz wie unser Vaterland: reden wir nicht davon! Fünfzehntausend Mark! Um sie zu erlangen, braucht es schon anderer Vorbedingungen, als sie bei mir erfüllt sind, da muß man Z... heißen, aus Gr... in der sächsischen Lausitz stammen und in der 5. Sächsischen Heimatschutz-Geldlotterie das Los 86 156 ziehen. Immerhin, wer es auch gewonnen hat, es sind und bleiben doch fünfzehntausend Mark. Nach dieser unwiderlegbaren Feststellung muß ich wohl oder übel meinem griechischen Freunde Morpheus in die weichen Arme gefallen sein; denn nach kurzer Zeit hatte ich das beglückende Gefühl, als besäße ich fünfzehntausend Mark. Und mit all meiner Freud’, was fang’ ich wohl an? Nun, laßt mich in der mir angeborenen Bescheidenheit mit mir[38] selbst beginnen! Oder halt: schnell erst eintausend Mark auf die Seite geschoben für arme Leute als Weihnachtsgeschenk, es könnte sonst zuletzt nichts mehr übrigbleiben! Dann kommt mein Teil. Ach, wie schäbig sieht mein »guter« Anzug aus, den ich mir vor dem Kriege nach Maß bauen ließ. Nichts ist mehr schön daran als die Knöpfe allein. Richtig, vor ein paar Jahren gewann ich bei einem Preisausschreiben fünfzig Mark, und als ich die Summe brüderlich teilte, da sprang für mich eine neue Steinnußknopfgarnitur heraus. Morgen also will ich zu einem Dresdner Schneider gehen, der nur nach der ersten Taxe berechnet und womöglich auch da noch etwas draufschlägt, und vor dem Christfeste noch muß der Anzug fertig sein. Dann kaufe ich mir Bücher über Bücher; ich bin den jetzt lebenden Dichtern noch soviel Dankbarkeit schuldig: von manchen besitze ich ein Buch, von den meisten aber auch das nicht einmal. Ganz verarmt bin ich in literarischer Beziehung, und mit einer wahren Todesverachtung verschlang ich noch bis gestern sämtliche Weihnachtskataloge, die mir mehrere Buchhändler freundlichst überreicht hatten. Das soll nun anders werden: von morgen an begnüge ich mich nicht mehr mit empfehlenden Extrakten, sondern ich trinke nun wieder an der Quelle und werde da lange, lange sitzen bleiben können. Gegenwärtig sitze ich noch im Dämmerlicht der Gaslampe, und meine Füße ruhen auf den selbstbraunfleckig gestrichenen Dielen. Im ersten Jahre unserer sonst so glücklichen Ehe schenkten uns reiche Verwandte sechzig Mark für einen Teppich. Wir brauchten aber das Geld für höhere Zwecke, und so verwandelte sich der Teppich in einen Zukunftstraum und ist es geblieben bis auf den heutigen Tag. Aber das soll nun anders werden, morgen schon kaufe ich einen Teppich, nicht für einmal, nicht für zweimal, nein, für siebenmal sechzig Mark, wenn es so teure überhaupt gibt, nun, bei Weymar auf der Schloßstraße wird wohl Rat werden. Und alle unsere Zimmer sollen in elektrischem Licht erstrahlen.
Und jetzt kommt ihr an die Reihe, meine beiden Kinder! Du, Reinhart, mein Sohn, brauchst nun keine Hosen mehr zu tragen, in die deine Mutter einen ganz bestimmten Teil neu einsetzen mußte, brauchst auch weder abgenutzte Hüte, Schlipse und Schuhe deines Vaters noch weiter abzutragen; du sollst schon morgen vom Scheitel, den du immer so fein pflegst, bis zur Sohle, die du seit langem schon durch Pneumette-Einlagen aus dem Reka gangbarer zu gestalten trachtest, neu ausstaffiert werden. Und während ich dich von der höheren Schule wegnehmen mußte, weil ich die Millionen und Milliarden nicht mehr erschwingen konnte, gehst du nun dank den drei Nullen, die ohne Komma an der fünfzehn hängen, wieder aufs Gymnasium, wo du trotz deiner reichgeschmückten Oberlippe aufgenommen werden wirst. Dann siedelst du nach Klein-Paris über, das bildet seine Leute, da kannst du studieren und singen nach Herzenslust. Und für dich, Sieglinde, meine Tochter, brauchen wir nun nicht mehr die Möbel an die Wand zu malen; in das feinste Dresdner Möbelhaus, in die Hellerauer Kunstwerkstätten wollen wir gehen, nein ... fahren, und für dich Möbel aussuchen, das sich gewaschen hat. Dann wird mir noch immer Geld genug übrigbleiben, und so kann ich zu meiner Schwester Martha, die sich im Kriege am Krankenlager der Soldaten viel zu schaffen gemacht und sich dabei eine schwere Krankheit zugezogen hat, sagen: mach dir keine Sorge um deine Gesundheit, gehe den ganzen Winter nach dem warmen Süden, und komme im Frühjahr geheilt zurück!
So träumte ich noch lange Zeit dahin. Plötzlich hörte ich, und das war schon kein Traum mehr, zwei Türen ganz verdächtig quietschen, die eine, die vom Schlafzimmer nach dem Vorsaal, und die andere, die von dort nach meinem Zimmer führt. Richtig, dachte ich schnell noch im Vollbesitz meiner fünfzehntausend Mark, auch sämtliche Türen meiner Wohnung lasse ich morgen ölen! Und vor mir stand sie, meine Lebensgefährtin, die mich auch in den Jahren der Armut Tag für Tag mit Liebe und Treue umgeben hat. Behutsam weckte sie mich aus meinem Halbschlummer und führte mich in das Gefilde der Wirklichkeit zurück, die doch auch so schön, ach, so schön ist. Ich umarmte sie lange und berichtete ihr freudestrahlend von meinem doppelten Glück: einmal hatte ich Mitgliedsbeitrag gezahlt für zwei Monate auf einmal, und umgaukelt hatte mich ein schöner Traum!
Paul Krause.
[39]
I.
Für die meisten Menschen in unserem engeren Vaterlande sind die Begriffe »Heimatschutz« und »Naturschutz« gleichbedeutend mit der Arbeit unseres »Landesvereins«. Und doch haben die wenigsten eine rechte Vorstellung davon, wie wir unsere Aufgaben eigentlich zu lösen versuchen. Jetzt, da der Staat uns zu stützen verspricht, ist es vielleicht angebracht, einen Rückblick zu werfen auf Umfang und Art unserer bisherigen Arbeit. Die unerläßliche Grundlage aller Heimatschutzarbeit ist ihre Resonanz in den breitesten Volksschichten. Unser Volk muß wissen und fühlen, welche Fülle von wirklichen Naturschönheiten, von unersetzlichen Gemütswerten unsere Heimat birgt, weil nur dieses Gefühl uns fest an die Scholle binden kann, uns, die wir leider in so vielen Dingen schon allzusehr entwurzelt sind. Dieses Heimatgefühl im Volke zu wecken, es durch Belehrungen tiefer zu begründen, ist deshalb die erste und vornehmste Aufgabe des Landesvereins. Er sucht sie zu lösen durch Wort und Bild, durch Zeitschrift und Vorträge. Nun erst kommt der eigentliche »Schutz«, sei es einzelner Pflanzen, Tiere, Felsen, sei es ganzer Schutzbezirke, sogenannter »Naturschutzparke«. Eine Aufgabe, die wiederum nur dann recht erfüllt wird, wenn sie getragen wird von der Volksmeinung, wenn das Volk Träger des Schutzbegehrens ist, nicht der Vereinsvorstand.
Wie wir im einzelnen den Schutz ausüben, sei an einigen Beispielen gezeigt. Da hat irgendein Bauer auf seiner Wiese eine herrliche, breitkronige Buche stehen. Sie verdämmt zwar in ihrer Umgebung den Graswuchs, aber in ihrem Schatten kann man ruhen und weit hinaus ins Bergland blicken. Am benachbarten Waldrande wachsen seltene Blumen, Türkenbund und sibirische Schwertlilien, Mondviolen und Einbeeren. Ein Heimatschutzmann, der das Herz auf dem rechten Flecke hat und der die Volksseele zu nehmen weiß, geht hin, drückt seine Freude über dieses Naturbild, seine Sorge um dessen Erhaltung aus. Er findet bei dem Bauern den echten Heimatstolz und das volle Verständnis. Bald ist man handels- und herzenseins. »Solange ich lebe, soll keine Axt an den Baum, keine Sichel an die Blumen kommen.« Ein mannhafter Händedruck und ein »Naturschutzvertrag« ist geschlossen – wäre es immer so! Ein anderer Bauer hat inmitten seiner Wiesen einen Fleck mit seltenem Enzian. Er ist arm, kann nicht auf die Nutzung verzichten – der »Landesverein« pachtet ihm den kleinen Fleck ab, schützt ihn durch eine Drahteinfassung. Oder es handelt sich um eine ganze Wiese, ein Gehölz. Wir kaufen sie und verpachten die Nutzung, nur mit der Einschränkung, daß wir den Zeitpunkt des Schnittes bestimmen, nämlich dann, wenn unsere seltenen Blumengäste verblüht und ihre Samen ausgestreut haben. Der Erfolg ist verblüffend, in wenigen Jahren ist ein Blütenteppich von entzückender Buntheit entstanden, und am Gehölzrand glüht verschämt selbst die köstliche Feuerlilie. Wenn es freilich einmal ein richtiger großer Schutzbezirk werden soll, dann gehen die Vereinsgelder aus –[40] aber dann hilft vielleicht eine »Heimatschutzlotterie« aus den Nöten. Aber Geld allein tut es nicht, ein wenig Schlauheit gehört auch zum Handel! Denn die biederen Grundstücksbesitzer können es nicht fassen, daß jemand so dumm ist, Land zu kaufen, nur um darauf Pflanzen und Tieren eine Freistatt zu gewähren. Sie wittern weitblickende Spekulationen – vielleicht will man ein Sporthotel, ein Radiumbad errichten, ein Bergwerk auftun – und da möchte man doch mit bei der Partie sein und richtet die Preise entsprechend ein. In einem anderen Dorfe steht eine Jahrhunderte alte Linde, die schon viele Menschengeschlechter kommen und vergehen sah. Nun wird sie auch altersschwach. Der Stamm zeigt eine bedenkliche Höhlung, der Sturmwind bricht einen Hauptast ab; die übrige Krone ist in ihrem Bestande gefährdet. Ein ärztlicher Eingriff könnte wohl helfen, aber die Gemeinde hat hierfür keine Mittel, vielleicht nicht einmal Verständnis für den heimatgeschichtlichen Wert des Baumes. Da kommt der Landesverein: »Wir wollen den Stamm auszementieren, die Äste durch eiserne Klammern sichern, damit Eure Nachkommen sich noch an dem Baum freuen, die vielleicht mehr Heimatliebe besitzen!« Freilich, wir müssen wieder in den Beutel greifen, und der ist nicht sehr prall – so riskieren wir einen Bettelbrief, und irgendein großes Eisenwerk wird zum Wohltäter, indem es uns die Eisenstäbe stiftet. Oft ist der Fiskus der Besitzer des schutzbedürftigen Naturdenkmals. Der Fiskus ist ein seelenloses, liebeleeres Gebilde, das nur von Paragraphen regiert wird. Aber wir können ihm eine Seele geben, wenn wir anstatt des Unpersönlichen die Persönlichkeit irgendeines Staatsvertreters setzen. Was kann uns z. B. ein heimattreuer Amtshauptmann alles nützen, wenn er erzieherisch auf seine Beamten einwirkt, wenn er uns rechtzeitig Warnungen zugehen läßt, uns Kenntnis von wichtigen Aktenvorgängen und Gelegenheit zu gutachtlicher Aeußerung gibt. Wie wichtig kann uns ein Forstmann werden, der seine Bäume wie seine Kinder liebt, der sich als Pfleger des Waldes fühlt! Ohne große Kosten läßt sich mitten im geregelten Umtrieb hier ein besonders stattlicher Baum, dort eine zerzauste Wetterfichte erhalten oder eine malerische Felsgruppe etwas freilegen. Es gibt natürlich auch andere, die im Baume nur das Nutzholz, im seltenen Raubvogel nur den Schädling sehen. Man muß versuchen, sie freundlich zu beeinflussen – glückt es nicht, nun, dann geht man eben eine Instanz höher und versucht von dort aus das Widerstreben zu besiegen. Ohne Diplomatie geht es auch im Heimatschutz nicht! Aber leider manchmal auch nicht ohne Polizei. Unsere Trollblumen und Märzenbecher, Orchideen und Maiglocken, das sind uns rechte Sorgenkinder! Wer wollte es einem Naturfreund verargen, wenn er sich ein Sträußlein dieser Frühlingskinder mit in die grauen Mauern der Großstadtwohnung nimmt! Zwar selbst die »Sträußlein« können der nächsten Umgebung einer Großstadt gefährlich werden. Wo haben wir in unmittelbarer Nähe Dresdens z. B. noch einen wirklich bunten Blumenteppich auf der Wiese, wo sind die Leberblümchen, wo die Himmelschlüssel hin? Aber brutal wirkt erst der richtige Massenraub. Geht einmal zur Trollblumenzeit zum Abendzug an den Bahnhof in Gottleuba! Wir haben es erlebt, daß ganze[41] Familien hinausgezogen, mit nicht mehr zu umspannenden Blumenbündeln heimkehrten, die Blumen verkauften und mit dem Erlös sämtliche Reisespesen deckten! Eine Sonntagspartie mit gestohlenen Blumen bezahlt. Und an Wochentagen konnten wir die Körbe der Marktfrauen mit ihrer Blütenlast bewundern. So ging es nicht weiter. Wir riefen nach der Polizei, nach behördlichem Schutz. Wir führten die Polizeibeamten selbst hinaus in die Natur, damit sie dann ihre Pflicht tun konnten mit einigem Verständnis für das, was auf dem Spiele steht, mit wirklicher Liebe und mit ehrlichem Zorn. Wir gingen zu den Bauern und legten ihnen nahe, ob sie nicht die Spitzbuben, die ihnen überdies die Wiesen zertrampelten, nicht einmal mit einer Tracht gut deutscher Prügel bezahlen wollten. Es ist schon besser geworden; aber noch viel gibt es zu tun, bis das Volk die gefährdeten Pflanzen kennt und den Blumenraub als unmoralisch brandmarkt.
Es sind noch andere Schwierigkeiten, mit denen der Heimatschutz zu kämpfen hat und die leider die harmlosen Idealisten unter den Naturfreunden viel zu wenig würdigen. Das sind vor allem jene Fälle, in denen Naturschutzbestrebungen in Konflikt mit großen volkswirtschaftlichen Interessen geraten. Da ist z. B. im Gebirge ein weithin das Landschaftsbild beherrschender Basaltgipfel. Tausende suchen ihn auf und blicken vom Aussichtsturm in die Ferne. An seiner Flanke hat menschliche Vernichtungstätigkeit eine Wunde gerissen, damit aber gleichzeitig eine neue Sehenswürdigkeit in Form von prächtigen Basaltsäulen geschaffen. So ist einstweilen Natur und Kultureingriff friedlich ausgeglichen. Aber die Gemeinde braucht Geld. Der Steinbruch wird einer ortsfremden Firma übertragen, die mit Brechwerk und Drahtseilbahn den Vernichtungskampf im großen führt. Im Schoße des Gemeinderates war noch die Liebe zum Geld mit der Liebe zur heimatlichen Scholle gepaart. Jetzt kommt der kühlrechnende Fremde, überschätzt, wieviel Jahre oder Jahrzehnte nötig sind, um den ganzen Berg »aufzuarbeiten«. Das sind keine Utopien – wir haben schon Berge aufgearbeitet! Im Hohburger Gebiet, in der Lausitz sieht man die Großindustrie eifrig an der Arbeit! Und geht der Betrieb gut, so kann sich der Unternehmer sogar als Wohltäter der Gegend aufspielen – er schafft ja Arbeit und Verdienst für die Beschäftigungslosen! »Was nützt mir die schönste Aussicht, wenn ich Hunger leide«, sagte kürzlich ein solcher Industrievertreter, und zwar nicht ganz mit Unrecht. Was ist in solchen Fällen zu machen? Zuerst fangen gewöhnlich die ortsansässigen Touristen- oder Verschönerungsvereine an zu schreien. Die Presse wird mobil gemacht. »Unersetzliche Heimatwerte stehen auf dem Spiel.« Unterdessen arbeitet der Industrielle unbeirrt und zielbewußt. Er kennt die Stellen, wo man für volkswirtschaftliche Belange Verständnis hat; er hat seinen Rechtsbeistand, der genau weiß, welche Paragraphen als Bundesgenossen dienen können. Es kommt zu einem Verwaltungsstreitverfahren. Der Amtshauptmann beruft eine Ortsbesichtigung durch die Beteiligten und bittet vielleicht den »Landesverein« um Entsendung eines Sachverständigen. Der ist überzeugt, daß mit dem Direktor einer Steinbruchsgenossenschaft nicht so leicht Kirschenessen[42] ist wie mit dem schlichten Bauersmann, der an seiner Scholle hängt. So wird er versuchen, ob er den Betrieb nicht von der gefährdeten Stelle ablenken kann. Könnte man nicht mehr nach der Tiefe arbeiten und den Gipfel schonen? Könnte man nicht praktischer in der Richtung auf die nahe Bahnlinie abbauen? Ist nicht in der Nähe ein anderes ähnliches Gesteinsvorkommnis zu erwerben? Manchmal glückt es; manchmal läßt sich auf Grund genauer geologischer und einiger technologischer Kenntnis ein Vorschlag machen, der dem Betriebsleiter entgangen ist. Aber im allgemeinen haben die großen Werke so durchgebildete Oberbeamte, daß man ihnen nichts Neues sagt. Höchstens denken sie im stillen: Schön, das könnte man auch noch machen! So bleibt zunächst nur übrig, durch Überredungskunst wenigstens einiges zu retten, eine Bereitwilligkeitserklärung herauszulocken, daß dieser oder jener Teil des Felsens unberührt bleiben solle, »falls es sich mit dem Betrieb vereinbaren läßt«. Es wird ein Protokoll aufgenommen, sehr vorsichtig abgefaßt. Man geht friedlich auseinander – und nach ein paar Jahren kommt ein neuer Schmerzensschrei: Die Zerstörung geht weiter – es hat sich nicht anders mit dem Betrieb vereinbaren lassen! Warum kauft aber der Heimatschutz den Berg nicht? Sehr einfach, weil er dazu kein Geld hat! Wer würde uns die Mittel geben, den Scheibenberg, den Geising, Wilisch oder auch nur die »Kleine Landeskrone« bei Löbau oder den Spitzberg bei Wurzen zu kaufen? Und wenn wir ihn gekauft hätten, wäre es doch kein vollständiger Schutz. Wenn allgemeine volkswirtschaftliche Notwendigkeiten vorliegen, würde der Staat keinen Augenblick zögern, unser opferfreudig erworbenes Naturschutzgebiet zu enteignen! Manchmal hilft uns allerdings das Gesetz aus der Verlegenheit. Da hat ein Unternehmer begonnen, einen Steinbruchsbetrieb mitten in ein in der Planung bereits festgelegtes Villengelände oder in Parkanlagen vorzutreiben. Gemeinde und Unternehmer kommen in Streit, die Grundstücksbesitzer legen Beschwerde ein; wieder soll der Heimatschutz das Zünglein an der Wage sein. Der Sachverständige findet nach langem Abwägen, daß hier auf beiden Seiten volkswirtschaftliche Werte auf dem Spiele stehen und er findet einen Ausweg in der Berufung auf das Gesetz über die »Verunstaltung von Stadt und Land«. Sein Gutachten fällt gegen den Unternehmer aus; die Behörde entscheidet dementsprechend. Gemeinderat und Grundstücksbesitzer atmen auf; der Unternehmer hat forthin »kein Interesse mehr für den Heimatschutz«. Genug der Beispiele! Ob sich wohl unsere Mitglieder von all diesen Schwierigkeiten ein richtiges Bild gemacht haben? Eines möchten unsere Aufführungen zeigen: Wir können nicht jeden Baum, jeden Fels schützen, weil irgendein paar Naturschwärmer ihn für schön erklären. Es muß schon eine große Gemeinde von Naturfreunden ihr Interesse und vielleicht auch ihre Opferfreudigkeit bekunden, wenn der Landesverein sich schützend vor das Naturdenkmal stellen soll. Den kleinen örtlichen Organisationen bleibt noch immer ihr Betätigungsfeld offen. Und endlich, der Landesverein würde den Heimatschutz falsch auffassen, wenn er nicht auch für die heimische Volkswirtschaft ein warmes Herz hätte! Wir wissen, wir haben in den Kreisen der Industriellen manchen[43] scharfen Gegner; wir wissen auch, daß wir vielen Naturfreunden lange nicht weit genug in unseren Schutzbestrebungen gehen. »Naturlandschaft« und »Kulturlandschaft« können nun einmal nicht ohne Kampf nebeneinander bestehen! Wir können nur eins versprechen: mit warmem Herzen der Schönheit unserer Heimat und mit volkswirtschaftlicher Einsicht der Volkswohlfahrt zu dienen. Ob uns das neue Gesetz in andere Arbeitsgeleise zwingt, davon später ein Wort!
Von Georg Dörfel, Calbitz b. Oschatz
Er ist ein seltener Gast bei uns geworden, Freund Stelzbein mit seinen leuchtenden deutschen Farben schwarzweißrot. So selten ist er geworden, daß das letzthin verwaiste Nest auf der Malkwitzer Friedhofslinde als ein Naturdenkmal allerersten Ranges galt, als eine Art Nationalheiligtum der Vogelwelt westlich der Elbe. Und doch waren früher die Störche bei uns bekannte Gäste, mit deren Rückkehr man im Frühjahr ebenso rechnete, wie mit der anderer Zugvögel. Die Chronisten bezeugen uns, daß früher das Storchengeschlecht über ganz Sachsen verbreitet war, mit Ausnahme des rauhen Obererzgebirges. Auch im mittleren Erzgebirge nisteten sie, in Gegenden, wo man sie heute vergeblich sucht. So lebten und brüteten welche bis ins siebzehnte Jahrhundert hinein in der Gegend von Schneeberg, wie ein Chronist Meltzer in seiner »Bergläuffigten Beschreibung der Bergstadt Schneeberg« aus dem Jahre 1684 erzählt. Krenkel berichtet dasselbe in seinen »Blicken in die Vergangenheit der Stadt Adorf« unterm Jahre 1862. Georg Fabricius erzählt in seinen »res misnicae« unterm Jahre 1564, daß der weiße Storch (ciconia alba) mit seinem Vetter, dem schwarzen Waldstorche (ciconia nigra), der heute nur noch ganz vereinzelt in Norddeutschland brütet, in den Elbauen ein guter Bekannter war. Was sagen die Chroniken aus dem nordsächsischen Flachlande über die Störche? Sie waren einst hier überaus häufig. In der Chronik der früheren Stiftsstadt Wurzen berichtet Christian Schöttgen, daß 1679 zu 1680 der Winter so warm gewesen ist, daß die Leute barfuß gingen und die Störche bereits am 19. Hornung wiederkamen. Hieraus sieht man, daß man mit ihrer Wiederkehr ebenso rechnete, wie mit der anderer Zugvögel, selbst in der alten Pleißenstadt Leipzig. Adam Friedrich Glasig bemerkt nämlich in seiner 1721 erschienenen »Geschichte des Hauses Sachsen«: »Störche pflegen absonderlich zu Leipzig in der Stadt auf den Dächern der Häuser jährlich zu hecken.« Johannes Kleinpaul erwähnt in seinem kulturgeschichtlich wertvollen Büchlein »Anno dazumal« unterm Jahre 1591 ein Nest an der Grimmaischen Straße nahe der Nikolaikirche, und noch 1830 soll nahe der Peterskirche in Löhrs Garten eine besetzte Niststätte gewesen sein. In der Mügelschen »Ehren- und Gedächtnissäule« aus dem Jahre 1709 berichtet der damalige Pastor Fiedler: »Anno 1621, den 28. Juli, ist eine ungewöhnliche und unzählbare Menge[44] Störche hierher kommen / die jedermann mit großer Verwunderung angesehn / haben sich auf Kirche und Schloß niedergelassen / und kaum Raum zu sitzen gefunden. Man hat daraus ominieren und deuten wollen / daß man künftige Zeit würde Gäste ins Land bekommen / wie auch geschehen.« (Dreißigjähriger Krieg.) Aus all diesen Angaben ist zu ersehen, daß es vor zwei- bis dreihundert Jahren im Niederlande noch Störche genug gegeben hat. Der große Rückgang des Storchengeschlechts in Sachsen erfolgte zu Ende des neunzehnten und zu Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts. Im Jahre 1906 hat der Ornithologe R. Heyder noch zehn besetzte Nester in Westsachsen festgestellt, alle im Gebiet der vereinigten Mulde und Pleiße, sowie einige bei Oschatz. Rudolf Zimmermann ergänzt und erwähnt fürs Pleißengebiet welche in Regis, bei Berbisdorf, drei in Deutzen, zwei in Blumroda, weitere in Röthigen, Görnitz, Großzössen. Im Muldengebiet waren Storchnester in Großbardau bei Grimma, in Golzern, Gornewitz, Wäldgen, Kühren, in Burkhardtshain bei Wurzen nach meinen Erkundigungen sogar vier. Auch im Tieflande um Oschatz nisteten um 1900 und vorher noch eine Anzahl Störche. Durch Umfragen ist es mir gelungen, diese nunmehr verwaisten Niststätten zu ermitteln. Ich habe ihrer zwölf erfahren können, das Malkwitzer ungerechnet.
Als das älteste ist wohl das Nest von Görzig bei Strehla anzusehen. Nach Mitteilungen soll es bereits den ältesten Leuten des Ortes als Kindern bekanntgewesen sein. Angeblich stammt es aus dem Jahre 1840. Als Standort wird eine Eiche am sogenannten Eichberge angegeben. Als im Jahre 1907 ein Wintersturm das Nest herabwarf, bauten die Störche nicht wieder. Die Eiche selbst brach 1919 infolge hohen Alters zusammen. Noch jetzt sollen sich zeitweilig Störche auf den angrenzenden feuchten Elbwiesen aufhalten. Sicher sind es Gäste von preußischen Nestern, da ja diese Tiere oft sehr weit auf Nahrungssuche fliegen. Im Nachbardorfe von Görzig, in dem schon auf preußischem Gebiet liegenden Paußnitz, ist noch so ein beflogenes Nest. – Eine gleichfalls sehr alte Niststätte war in Lampertswalde an der sogenannten Winterseite des Ortes auf einem Eichbaum inmitten einer Wiese. Eiche und Niststätte sind verschwunden. Wann, ist nicht genau zu ermitteln, soviel ich herausbekommen habe, vor fünfzig bis sechzig Jahren. – In diesem Orte gab es noch zwei weitere Nester. Das erstere war auf einer Pappel des Gutsbesitzers Böhme (Nummer 21). Die Störche nisteten und brüteten hier von 1902 bis 1906. Einer starb in diesem Jahre. Im folgenden Jahre wurde das Nest nur von einem Tiere beflogen, das sich aber nicht paarte. Seit 1908 ist es völlig verwaist. – Die dritte Niststätte war auf dem Dache eines Seitengebäudes bei Gutsbesitzer Frost. – Zwei weitere Nester sind in Zaußwitz gewesen. Genauere Mitteilungen über diese verdanke ich Herrn Kantor Büttner, Zaußwitz. Das eine war bei Gutsbesitzer Oskar Kühne (Gut Nummer 32) auf einer Pappel, das andere auf einer Eiche bei Gutsbesitzer Hermann Kühne (Gut Nummer 45). Das Nest auf der Pappel ist 1897 errichtet worden. Die Störche brüteten bis zum trockenen Sommer des Jahres 1911. Die Folge der Trockenheit war eine entsetzliche Mäuseplage, so daß man diesen Nagern mit Phosphor[45] zu Leibe rücken mußte. Die Alten und die schon hochgekommenen drei Jungstörche fraßen solche vergiftete Tiere und gingen daher ein. – Das Nest auf der Eiche von Gutsbesitzer Hermann Kühne hatte 1910 zum letzten Male Storchengäste, doch nur für kurze Zeit. Sie nisteten nicht wieder, weil der Horst schief hing und blieben schließlich ganz weg. – Zum Oschatzer Nest. Genaueres erfuhr ich durch Herrn Uhrmachermeister Lehmann. Die Niststätte war auf dem strohgedeckten Dache eines Hauses, das nahe Ecke Gartenstraße an der Viehweide, nicht weit von der Gasanstalt stand. Es gehörte einem gewissen Streubel. Die Störche brüteten dort von 1867 bis 1870. Als das Haus 1871 umgebaut und mit Ziegeln umgedeckt wurde, errichtete der Besitzer ein Wagenrad darauf, um so die Störche beim Horstbau zu unterstützen. Nach ihrer Rückkehr aus dem Süden siedelten sie sich aber nicht darauf an, obwohl sie sich zuweilen auf Dach und Wagenrad niederließen. Man hat das Paar oft auf dem alten Stadtturme hinterm Amtsgericht beobachtet. Im Jahre 1872 ist es nicht wieder gesehen worden. – Die Störche von Luppa. Sie nisteten lange auf der Brennereiesse des jetzigen Gutes von Rudolf Knoll, Wendisch-Luppa. Wenn dann in den Herbst- und Wintermonaten die kleinen Brennereien in Tätigkeit traten, wurde allemal der Horst durch ein großes, angefachtes Strohbündel weggeräuchert. Nach Mitteilungen des Herrn Gutsauszüglers Winkler, Deutsch-Luppa, sollen die Störche in den achtziger Jahren angeblich nach Malkwitz übergesiedelt sein. Möglich ist es, da die Malkwitzer Linde gerade in dieser Zeit infolge zu dichten Laubwuchses einmal verwaist war. – An der Westgrenze unseres Bezirkes war ein Nest auf dem strohgedeckten Dache einer Scheune in Göttwitz-Döbern. Errichtet 1862 oder 1863, mußte es 1879 entfernt werden, weil das schadhaft gewordene Strohdach durch Schieferdach ersetzt wurde. Neuerdings hat der Wirt der Pappelschenke in demselben Orte, Herr Höhne, auf dem Scheunendache eine Niststätte befestigt, in der Hoffnung, die auf den naheliegenden Wiesen sich aufhaltenden Störche darauf zu bekommen. Leider ohne Erfolg, wie er mitteilt. Wahrscheinlich sind die Gäste der bekannten Göttwitzsee-Wiesen unsere Malkwitzer Freunde.
In der Klostergärtnerei Sornzig entdeckte ich ein Wagenrad auf dem First eines kleinen Wirtschaftsgebäudes. Nach meiner Erkundigung in der Vogtei sollen hier seit zwanzig bis dreißig Jahren keine Störche genistet haben. – Eine Niststätte, die nur ein Jahr von Störchen besucht wurde, war auf einer Erle auf Lonnewitzer Flur. Herr Oberlehrer i. R. Marx teilt dazu mit, daß dieser Baum an einem aus dem Zöschauer Teiche abfließenden Bache nahe der Dresdner–Leipziger Staatsstraße gestanden hat.
Als das jüngste verwaiste Nest ist das von Lorenzkirch anzusehen. Die Störche errichteten es im Jahre 1915 auf einer etwas geköpften Pappel vor dem Gehöft des Gastwirts Förster. In den Jahren 1915 und 1916 sind fünf und drei Junge erbrütet worden. Leider wurde im letzteren Jahre kurz vor der Abreise nach dem Süden das Männchen von einem gewissenlosen Schützen abgeschossen. Das Weibchen erschien 1917 allein wieder und legte unbefruchtete Eier, die sie aber bald wieder abwarf. Eine stumme Anklage gegen den[46] unvernünftigen Schützen! Bis 1921 wurde das Nest von einzelnen Störchen beflogen. Zur Brut kam es jedoch niemals.
| Lfd. Nr. | Name des Ortes | Platz der Niststätte | Jahr der Errichtg. | Jahr der Verwaisg. | Grund des Ausbleibens |
| 1. | Görzig bei Strehla | Auf einer Eiche am Eichberg | Vor 1840 | 1907 | Abst. des Nestes d. Winterstürme |
| 2. | Göttwitz bei Wermsdorf | Auf Strohdach in Gehöft Nr. 3b | 1862 od. 63 | 1879 | Umdeckung des Daches |
| 3. | Lampertswalde | Auf einer Eiche | ? | Vor etwa 50 Jahren | ? |
| 4. | Lampertswalde | Auf einer Pappel, hinter Gehöft Nr. 21 | 1902 | 1908 | — |
| 5. | Lampertswalde | Auf dem First eines Seitengebäudes in Gehöft Nr. 36 | ? | ? | ? |
| 6. | Lonnewitz | Auf einer Erle am Abflußbach des Zöschauer Teiches | Um 1900 | ? | |
| 7. | Lorenzkirch | Auf einer Pappel vor Gehöft Nr. 20a | 1915 | 1921 | Abschuß eines Alten |
| 8. | Wendisch-Luppa | Auf der Brennereiesse des Gutes Nr. 7a | ? | Nach 1880 | ? |
| 9. | Oschatz | Auf dem Strohdach eines Hauses Ecke Gartenstraße | 1867 | 1871 | Umdeckung des Daches |
| 10. | Sornzig | Auf dem First eines kleinen Wirtschaftsgebäudes im Klostergut | Vor etwa 30 Jahren | ? | |
| 11. | Zaußwitz | Auf einer Pappel bei Gehöft Nr. 32 | 1897 | 1911 | Verendung d. Mäusegift |
| 12. | Zaußwitz | Auf einer Eiche bei Gehöft Nr. 45 | 1898 | 1910 | Verleidung des Nestbaues |
Über die Gründe dieses raschen Aussterbens der Störche hat ja Klengel in dem Aufsatze »Unsere sächsischen Störche und Storchnester« in Band VI und VII der Heimatschutzmitteilungen genauere Ausführungen gemacht. Fremde und Heimat sind von Einflüssen nicht frei. Viele Tiere erliegen in den warmen Zonen Südafrikas nach dem Genusse vergifteter Heuschrecken. Weiter hat man in diesen Gegenden ganze Züge zu allen Zeiten des Jahres gesehen, was vielleicht mit einer klimatischen Verschiebung zusammenhängt. In der Heimat werden viele ein Opfer der Hochspannungsdrähte, sowie immer noch der Jagdleidenschaft mancher Jäger, obwohl Adebar für Deutschland bereits unter Schutzgesetz steht. Vielleicht liegt es daran, daß er in storchenreichen Gegenden, wie Mecklenburg, Pommern ab und zu Junghasen oder Gelege von Hühnervögeln aufnimmt. Die Ansichten über seine »Nützlichkeit« und »Schädlichkeit«[47] gehen jedenfalls in Jagdkreisen weit auseinander. Um mit Schiller zu sprechen: »Von der Parteien Gunst und Haß verwirrt, schwankt sein Charakterbild in der Geschichte«. Wir in Sachsen hätten allen Anlaß, ihn zu schonen. Als Hauptgründe des raschen Aussterbens im nordsächsischen Niederlande kommt wohl hauptsächlich die Entwässerung weiter Strecken Landes in Frage, wodurch ergiebige Nahrungsquellen versperrt werden. Dazu kommt weiter, daß ihm Rauch, Ruß und Fabriklärm, sowie neuerdings das Geknatter der Motorpflüge und Zugmaschinen der Landwirtschaft ungebetene Gäste sind. Ihm wird das friedliche Treiben vergällt, so daß er abwandert. Nicht unerwähnt soll bleiben, daß auch auf der Reise viele umkommen. Professor Thienemann, Rossitten, hat nachgewiesen, daß viele Vögel mit völlig leerem oder fast leerem Magen fliegen, um schneller vorwärts zu kommen. Dieser Vorteil bringt Nachteile. Dem Kopfe und Hirn fehlt es an Blut. Das schwächt die Urteils- und Sehkraft, so daß die Tiere entgegentretenden Hindernissen wie Schiffstakelwerken, Zäunen, Bäumen oft nicht auszuweichen vermögen, so daß sie flügellahm niederfallen und verenden. Möglich ist es, daß dem männlichen Malkwitzer Storche in diesem Jahre auf der Rückreise ein ähnliches Unheil widerfahren ist, so daß schließlich das Nest verwaisen mußte, weil es das Weibchen nur noch beflog und schließlich ganz wegblieb. Ich habe das Nest noch nicht mit in der Zusammenstellung verwaister Storchnester aufgenommen, da ich hoffe, daß in diesem Jahre sich ein neues Paar einstellt. Über das Nest selbst, das gerade im letzten Jahre sehr vom Unstern des Glücks verfolgt wurde, noch etliche Bemerkungen, besonders über seine Geschichte.
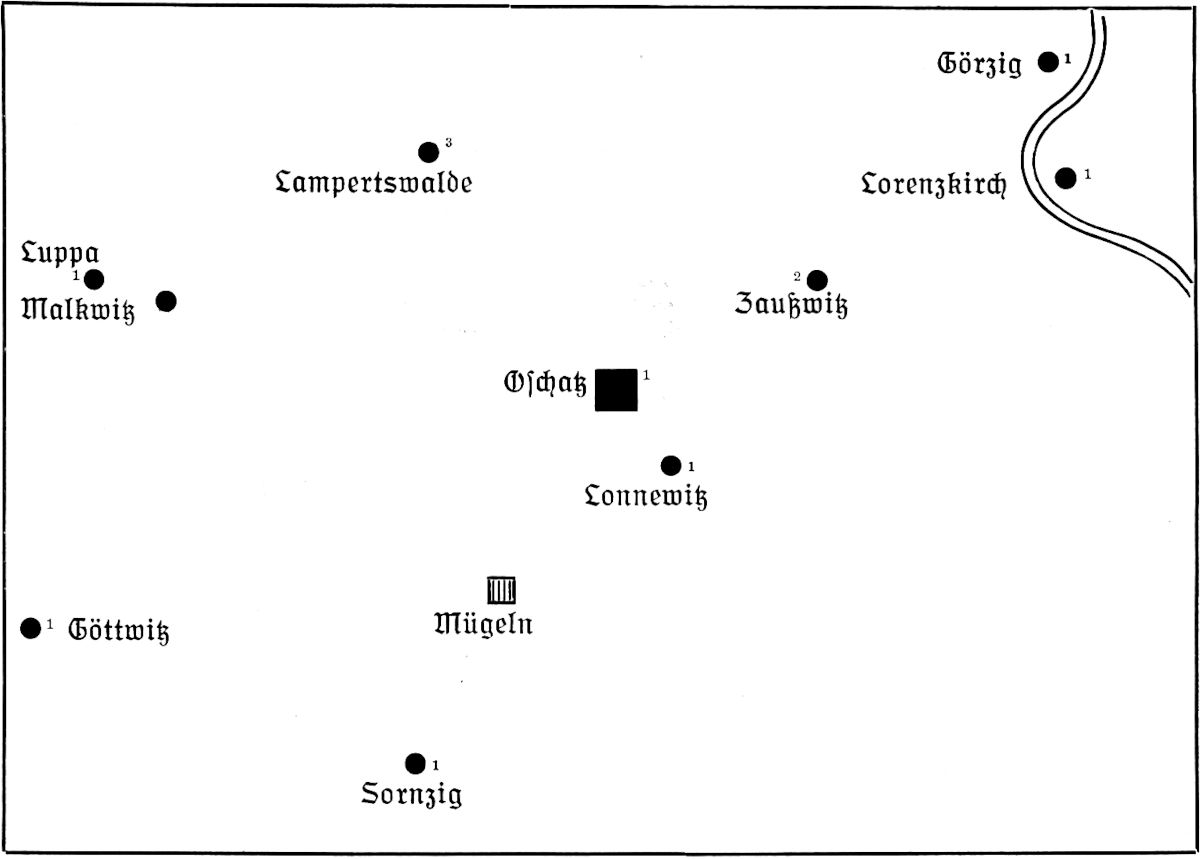
[48]
Es ist alt und soll ursprünglich, bereits 1852, auf dem strohgedeckten Dache eines Gehöftes gewesen sein. Im Winter des Jahres 1873 starb die Besitzerin des Gutes, die diesen Tieren immer besonderen Schutz gewährte. Nach der Rückkehr aus dem Süden nahmen die Störche die alte Niststätte nicht an, sondern bezogen die hohe Friedhofslinde, die in unmittelbarer Nähe des Grabes ihrer Beschützerin war. Das mag zufällig geschehen sein, doch sah die Bevölkerung in diesem Tun ein Zeichen von Treue und Anhänglichkeit. Ein Beweis, welche Rolle der Storch im Volksglauben spielt. Jährlich sind im Nest zwei bis fünf Junge erbrütet worden. Einmal, in den achtziger Jahren,[49] blieben die Störche aus, als die Linde oben recht zugewachsen war. Ein Schornsteinfeger stellte den Schaden ab, der ausgeästete Baum wurde im nächsten Jahr erneut beflogen. Die Jahre kamen und gingen. Die Linde wurde morsch, so daß man schließlich einmal ihren Sturz befürchten mußte. Da beschlossen 1923 die Kirchgemeindevertretung Malkwitz und Kircheninspektion Oschatz unter Teilnahme eines Vertreters des Heimatschutzes (Klengel, Meißen), am Firste des nahen Kirchendaches ein dauerhaftes Wagenrad zu befestigen. Der Plan wurde ausgeführt, der Storch nahm die Niststätte nicht an, sondern ging wieder nach dem altgewohnten Horst. Mir kam schon in dieser Sitzung der Gedanke einer Auszementierung der Linde, da ich aber nur als Gast zugegen war, machte ich davon keinen Gebrauch. In den Jahren 1923 und 1924 kamen zwei und drei Dunenjunge hoch. Sie wurden beringt und tragen die Nummern 11 741 bis 11 745 der Vogelwarte Rossitten. Einzelfragen über die Störche, wie Zugrichtung, Zugschnelligkeit, Heimat- und Nesttreue, Dauerehe usw. sollen durch solche Beringungen immer mehr geklärt werden. Anfang April 1925 kehrte das Malkwitzer Storchenweibchen zurück. Das Männchen blieb aus, so daß schließlich auch das Weibchen dem Neste fernblieb. Am 22. September trat nun das Unglück ein, von dem bereits in der Tagespresse berichtet wurde. Die morsche Linde wurde bei heiterstem Herbstwetter, sagen wir ein Opfer der Windstille. Der »Heimatschutz« ließ um diese Zeit einen Aufsatz durch sächsische Tageszeitungen gehen, betitelt »Erhaltung von Naturdenkmälern«. Der betreffende Mitarbeiter spricht da von der Malkwitzer Linde als einem herrlichen Naturdenkmal, um das wir ärmer geworden sind. Er fragt weiter, ob dieses beklagenswerte Ereignis nicht noch für eine lange Reihe von Jahren hätte aufgehalten werden können, wenn man rechtzeitig für eine zweckentsprechende Sicherung des Baumes gesorgt hätte. Zunächst ist da zu bemerken, daß der Baum an sich, man wolle mich recht verstehen, gar kein Naturdenkmal mehr war; denn einen Lindenstumpf, der seit drei Jahren nicht mehr ausschlug und so die Spuren sich verjüngenden Lebens an sich gezeigt hätte, kann man nicht als solches bezeichnen. Für die Sicherung des Nestes war bereits Anfang 1923, wie weiter oben erwähnt, etwas geschehen. In diesem Frühjahre nun will sich die Gemeinde ebenfalls wieder dafür einsetzen, daß sich ein Storchenpaar an der verwaisten Stätte niederläßt. Es wird an derselben Stelle von drei acht bis zehn Meter langen starken Stämmen eine Art Dreibock (/|\) errichtet und darauf ein Wagenrad befestigt. Ob die Störche das neue Heim annehmen? Wir hoffen es zuversichtlich. Freilich scheint es mir bald, als wäre die Zeit nicht mehr ferne, da es auch von den Störchen Sachsens heißt: Die Ruinen des einen braucht die allzeit wirksame Natur zum Leben des anderen. Die vielen verwaisten Nester reden eine zu deutliche Sprache.
[50]

Von Rudolf Schumann
Schon vor dem Kriege begann die Schule, den Begriff der Heimat immer mehr in ihre Arbeit hereinzunehmen, und vor allem in den letzten Jahren hat die Heimat eine höhere Beachtung gewonnen. Ist doch der Heimatkundeunterricht von einem Jahr auf zwei Jahre ausgedehnt worden, und ist doch in allen späteren Schuljahren dauernd zurück auf die Heimat zu greifen. Der »Lehrplan für die einfachen Volksschulen des Königreichs Sachsen« von Kockel führt in seiner 11. Auflage 1911 als Ziel der eigentlichen Heimatkunde an: »a) Das heimatliche Gebiet nach geographischen Gesichtspunkten erhellen ..., anleiten, damit die Kinder ihre Heimat genau kennenlernen, geographische Grundbegriffe sich aneignen ...; b) das Kartenverständnis vermitteln ...; c) Liebe zur Heimat einpflanzen, die ihnen einen sittlichen Halt für das ganze Leben bietet und sich leicht zur Vaterlandsliebe weiter aufschließt« (nach Grüllich). Die Heimat bietet danach also reiche Anschauungen und Apperzeptionshilfen. Sie ist aber auch die Grundlage zu bilden imstande nicht nur für den späteren geographischen Unterricht, sondern auch für eine sittliche und ästhetische Entwicklung, vermag doch die Heimat Schönheitsbegriffe zu vermitteln und ist dauernd jedem zugänglich, was vor allem für ein verarmtes Volk von großer Bedeutung ist. »Die Heimat wird für den ideal veranlagten Menschen zum Paradies der höheren Freuden, wenn durch Erziehung und Bildung die Fähigkeit gegeben wurde, in der Natur die Leiden des Daseins zu vergessen.« (Blätter für Naturschutz 1920, 11/12 S. 6.) Der Lehrplan von Kockel weist ferner 1911 schon auf die Bestrebungen des Landesvereins Sächsischer Heimatschutz hin, und im Jahre 1908 hat das Kultusministerium laut Gesetz-Verordnung vom 12. August 1908 deren Unterstützung empfohlen.
Ehe auf die Heimatschutzarbeit der Schule eingegangen werden kann, erscheint es notwendig, einen Blick auf Grundlage und Notwendigkeit von bewußtem Heimatschutz zu werfen. Daß der Natur- und Heimatschutz von eigens dafür geschaffenen Organisationen in die Hand genommen wird, ist eine Erscheinung der Neuzeit. Noch bis in das vorige Jahrhundert hinein kann man von einem natürlichen Heimatschutz reden. Der große Teil der Bevölkerung war in irgendeiner Weise bodenständig, entweder als Handwerker oder als Landwirt, und unter der noch nicht ins Ungemessene gewachsenen Zahl der Beamten und Arbeiter gab es viele, die eigenen Grund und Boden, ein eigenes Haus besaßen. Einer bodenständigen Bevölkerung ist aber der Schutz der Heimat etwas Gegebenes, nicht nur aus praktischen Gründen, sondern auch aus dem Gefühl der Zugehörigkeit zu ihrer Scholle heraus. Ferner konnten bei wenig dichter Bevölkerung Maßnahmen einzelner, die gegen Natur und Heimat verstießen, nicht allzu schwer schädigende Folgen haben, wie bei einer dichten Bevölkerung. Die bewußte Durchführung[51] des Heimatschutzes ist also zu betrachten als eine Reaktion gegen irgendeine Aktion, ein Ereignis des letzten Jahrhunderts. Als dieses Ereignis kann ganz allgemein genannt werden das plötzliche und rasche Vorwärtsschreiten der Zivilisation: die Ausnutzung der Dampfmaschinen und Eisenbahnen, das Entstehen der Fabriken und die Vermehrung der Verwaltungsarbeit. Damit Hand in Hand ging eine rasche Bevölkerungszunahme, vor allem in der Industriearbeiter- und Beamtenschaft. Dadurch entstanden die Hemmungen gegen die Durchführung des natürlichen Heimatschutzes, und zwar direkter und indirekter Art. Aus einem natürlichen war das Leben der Menschen mehr und mehr in einen Zwangsverlauf gedrängt worden.
Die erste Folge genannter Ursache war direkter Art. Es wurden Fabriken gebaut, Eisenbahnlinien gezogen, es mußten neue Wohnstätten geschaffen werden, als deren einer Typ jetzt auch die Mietkaserne auftrat. Die harte Lebensnotwendigkeit verlangte die leichtere Zugänglichmachung entlegener Ackerbaugebiete, überhaupt einen regeren Austausch zwischen Stadt und Land, die Bebauung schöner Landstrecken, die Regulierung von Wasserläufen, und als Folge der Konkurrenz trat die Reklame auf. Es mußten ferner Fabrikabwässer beseitigt werden, wodurch ganze Flüsse vergiftet wurden, Rauch, Ruß und Benzingeruch nahmen der Luft ihre ursprüngliche Frische. Das engere Zusammenwohnen von Menschen verlangte die Anlage von Schuttablagerungsplätzen. In stillen Tälern erscholl jetzt das Pfeifen der Lokomotive, das Rattern von Maschinen, die Sprengschüsse von Steinbrüchen, die den Anblick ehemals reizender Landschaftsbilder auf ewig verdarben. Die Anforderungen des Lebens rechtfertigten diese Maßnahmen. Jedoch wurde oft darauf losgewirtschaftet, ohne Rücksicht auf die Natur und heimatliche Schönheit zu nehmen. So brachte die Bauweise der Gründerzeit Formen, zu denen unser Volk keine inneren Beziehungen fand, sowohl bei Villen als auch bei Mietkasernen. Fabriken wurden in erster Zeit nur unter dem Gesichtspunkte des Praktischen gebaut, was besonders dann häßlich und aufdringlich wirkte, wenn sie an Stelle ehemaliger idyllischer Mühlen gesetzt wurden. Bei der Anlage von Steinbrüchen versagte man die Schonung oft den reizendsten Gegenden. Da man die Folgen einer so raschen Entwicklung noch nie kennengelernt hatte, fehlten auch die Erfahrungen, wie man ihre üblen Folgen vermeiden könnte, ja diese wurden überhaupt erst als solche erkannt, als schon viel verloren war. Im einzelnen Fall und dem einzelnen war die Gefährdung heimatlicher Schönheit kaum ins Auge gefallen. Erst bei einem Rückblick nach einem längeren Zeitabschnitt trat sie als vollendete Tatsache auf.
Neben diese immerhin noch natürliche Entwicklung trat aber auch immer mehr eine unnatürliche. Die Gier nach Luxus und die Ausnützung der Natur zu Geldzwecken versetzten der Heimat an ihren schönsten Punkten die schwersten Schläge. Wo früher der einsame Wanderer nach beschwerlichem Wege von einer Hochwarte aus die Augen ins weite Land schweifen ließ, dahin baute man[52] Luxushotels, erreichbar auf breiten, staubigen Automobilstraßen oder durch Gebirgsbahnen. Um die Schönheit dieser Punkte heute noch zu genießen, genügt nicht mehr gemütvolles Auffassen. Wer nicht über geldliche Mittel verfügt, ist an solchen Stellen meist ein wenig gern gesehener Gast, er ist heimatlos geworden in seiner Heimat. Dieses Spekulantentum ohne Ideale macht sich auch in anderer Weise breit. Weit ins Land schauende Berge wurden eingeschätzt nach dem Werte der Steine, die sich aus ihnen gewinnen ließen, und es bedurfte erst des Eingreifens der Behörden, ehe sie geschützt wurden. Aus rauschenden Bächen errechnete man lediglich Kilowattstunden, und romantische Gebirgslandschaften regten zu gewinnbringenden Filmaufnahmen an. Unter all diesen Erscheinungen litt die Natur direkt mehr oder weniger.
Dadurch, daß diese Entwicklung auch andere Menschen schuf, trat noch eine indirekte, aber nicht minder große Bedrohung und Gefährdung der Heimat ein. Durch die starke Bevölkerungszunahme und die immer häufiger werdende Beschäftigung als Beamter oder Arbeiter trat eine Entwurzlung weiter Schichten ein. Das innere Verhältnis zwischen Arbeit und Arbeiter – besonders wenn die Arbeit eintönig war –, zwischen Scholle und Bewohner – wenn dieser nicht selbst Besitzer war – schwand. Der einzelne war auch nicht mehr an den Ort in dem Maße gebunden wie vorher, zudem machten ihm die Verkehrsmittel einen Ortswechsel sehr leicht. Von dem, was eigentlich Heimat ist, lernten viele ihre ganze Kindheit hindurch in den Mauern der Stadt fast nichts kennen. Die Folgen dieser Entwurzlung waren verschiedener Art: Gemütsverflachung, völlige Gleichgültigkeit, Gemütsverderbnis, aber auch der Trieb nach oben, nach einem eigenen, vielleicht neuen Boden.
Die Gemütsverflachung tritt uns entgegen in der Oberflächlichkeit weiter Kreise. Der Sinn nach Tand, kleinlichem Luxus, Vergnügen, steter Abwechslung ist ihr Kennzeichen, ferner der Drang nach unsolider Lebensweise. Daneben kann nicht mehr der Sinn für die stille Schönheit der Natur wohnen, ja deren Verachtung tritt ein. Solche Menschen zerstören dann aber auch ohne das Bewußtsein, daß sie unrecht tun. Mancher Käfer oder Schmetterling, manch seltene Pflanze fällt ihrem Spielen und Tändeln zum Opfer, ohne daß sich Gewissensbisse regen. Die Gleichgültigkeit hat ihren Grund vor allem darin zu suchen, daß der nicht mehr Bodenständige gewisser Pflichten enthoben ist. Dem Grundbesitzer ist es selbstverständliche Pflicht, z. B. den Wald zu schonen, der ihm Wasser speichert und sein Tal vor Stürmen schützt. So sorgte und sorgt noch in jedem Gebiet mit dünner, aber bodenständiger Besiedlung jeder für die Erhaltung der Heimatscholle; denn jeder hat teil daran, jeder weiß, daß seine Vorfahren hier saßen, seine Kinder hier sitzen werden. Die Enthebung von solchen ungeschriebenen – weil natürlichen – Gesetzen muß zu einer laxen staatsbürgerlichen Auffassung führen, was sich darin kund gibt, daß der Gemeinsinn mehr oder weniger verschwindet. Die Folge davon ist die Rücksichtslosigkeit im allgemeinen, angewandt auf die Heimat, das Sichgehenlassen in der Natur, das gedankenlose Zerstören, ohne daß damit[53] gesagt sein soll, daß solchen der Sinn für das Unrechte fehle. Aufmerksam gemacht, erkennen sie unter Umständen, daß ihr Verhalten falsch ist. Schlimmer als Gemütsverflachung und Gleichgültigkeit ist die Gemütsverderbnis. Sie gibt sich kund in einem brutalen Sichdurchsetzen. Sie sucht ihre Stärke in rohem Auftreten. Ein Zeichen verdorbenen Gemüts ist das mutwillige Zerstören, der böse Wille in der freien Natur. Solche Menschen können zufriedengestellt werden durch das Zerstören der Freude anderer Menschen. Gegen sie kann, wenn es Erwachsene sind, nur mit der strengsten Durchführung von Gesetzen eingeschritten werden. Schließlich muß sich als eine Folge der Entwurzlung bei vielen auch der Trieb zeigen, wieder Wurzeln zu schlagen, ein Trieb nach oben, entweder in geistiger oder materieller Beziehung. Dem entsprechend können sich ihm auch zwei Hemmungen entgegenstellen. Vielen fehlt das eigene geistige Gebiet. Wollen sie nun geistig etwas leisten, so werden sie die Hohlredner, die Lauten, die sich gern reden hören. Vermißt ein anderer mehr die materielle Grundlage, so führt das zur Unzufriedenheit. Unzufriedene können Nörgler werden, vor allem, wenn sie auch nach einem geistigen Gebiete streben, ohne es zu finden. Aus ihnen rekrutieren sich aber auch die Resignierten, die sich stets für betrogen ansehen, die in nichts mehr eine Freude erblicken zu können glauben. Sie werden darum auch wieder die Gleichgültigen. Schließlich gibt es die konsequenten Unzufriedenen, die Verbrecher. Alle die, denen in irgendeiner Weise der Trieb nach oben innewohnt, können für den Gedanken des Heimatschutzes gewonnen werden.
Nachdem nun die Hemmungen bekannt sind, die sich dem Natur- und Heimatschutz entgegenstellen, können die Wege gesucht werden, sie zu umgehen. Sie werden bestehen müssen in einem Führen, Erziehen des Volkes. Zeit und Ort dafür kann in wirksamster Weise die Schule sein; denn diese wird von allen durchlaufen. Ihr Einfluß trifft alle, während der Aufklärungsdienst – wie Presseaufsätze, Zeitschriften usw. – oft diejenigen nicht erreicht, die seiner am bedürftigsten sind. Zudem ist es eine schwere, oft kaum lösbare Aufgabe, den schon in festen Bahnen sich bewegenden Geist Erwachsener in für sie völlig neue Bahnen zu leiten, zumal sich da auch fast stets Voreingenommenheit, Eigensinn, falsches Selbstbewußtsein, und vor allem die Angst vor Bevormundung einstellen. Glaubt man wirklich, nach eifriger Werbetätigkeit dem Heimatschutz einen neuen Anhänger gewonnen zu haben, so wird sich bei näherer Untersuchung oft genug zeigen, daß er schon vorher aus natürlichem Gefühl heraus durchaus nicht zu den Naturverwüstern gehörte. Wohl bildungsfähig aber ist das Kind, sind es auch noch erwachsene Schüler, und vor allem kann durch die Kinder der Schutzgedanke in die Familie hineingetragen werden, wobei dann einige der genannten Hemmungen schon hinwegfallen oder doch leichter überwunden werden können. Um die Kinder für den Gedanken des Heimatschutzes zu gewinnen, bedürfen sie natürlich erst einer gewissen Kenntnis von der Heimat, die der Heimatkundeunterricht laut Lehrplan zu vermitteln hat. Dies ist aber nicht die alleinige Voraussetzung. Wer[54] schützen will, muß erst einmal wissen, warum und was. Er muß wissen, was überhaupt schön, was häßlich ist, was verloren, was gefährdet ist. Dem Schüler muß der Gedanke der Schönheit nahegebracht werden. Daß er nicht von vornherein in jedem Kinde wohnt, muß jeder Lehrer oft bei Klassenwanderungen erkennen, wenn die Kinder gerade an den schönsten Punkten die belanglosesten Gespräche führen und für die Erhabenheit der sie umgebenden Natur weder Auge noch Ohr zu haben scheinen. Das Schönheitsgefühl muß ihnen erst anerzogen werden. Als Vorstufe ist das Gefühl für Ordnung zu betrachten. Schon in Elementarklassen wird wohl von allen Lehrern darauf gehalten, daß die Kinder im Zimmer und auf dem Hofe Papier z. B. nicht nur deswegen nicht wegwerfen, weil es verboten ist, sondern sie müssen sehen lernen, daß es häßlich ist. Auf dasselbe ist vor allem bei Klassenausflügen zu achten. Hier kann der Lehrer noch weitergehen. Es ist von Freunden des Verfassers und auch von ihm selbst schon folgender Versuch gemacht worden: Die Klasse kommt an eine oft besuchte Raststätte. Für gewöhnlich sind solche arg verschmutzt mit Papier usw. Da darf sich nun die Klasse nicht ohne weiteres setzen. Erst hat sie einige Augenblicke diesen häßlichen Eindruck in sich aufzunehmen, diesen Gegensatz zwischen der Natur ringsum und ihrer Schändung. Dann bedarf es meist nur eines Wortes, und die Kinder säubern diese Stelle, soweit die Arbeit nicht ekelerregend ist. Der Lehrer weiß sicher, daß dieser Eindruck länger haften bleibt als das bloße Wort. Gerade auf Klassenwanderungen läßt sich in vielerlei Weise das Gefühl für Schönheit erziehen oder wenigstens der Boden bereiten, in dem es später wachsen kann. Der Lehrer, der einen Ausflug nicht nur körperlicher, sondern auch geistiger, seelischer Kraftbildung dienen läßt, wird es verstehen, seine Kinder an das Verweilen mit Fuß und Gedanke an gewissen Stellen zu gewöhnen, an das wortlose, aber innige Genießen einer erhabenen Aussicht, an das Lauschen auf das Rauschen des Waldes, an das Genießen der Stille des Tales. Leicht zu lösen ist diese Aufgabe nicht, wie jeder bezeugen kann, der Kinder in der Klassengemeinschaft auf Wanderungen beobachtet hat. Wie oft fragen die Kinder nur nach der nächsten Raststelle und wie weit sie noch zu laufen haben. Verfasser hat es bei seinen Klassenwanderungen auch immer für seine Pflicht gehalten, das schon oben erwähnte unnütze Vielreden der Kinder unterwegs auf ein gewisses Maß einzuschränken. Vielleicht erscheint dies manchem als eine Härte. Aber es ist meine Ansicht, spazierengehen können die Kinder allein oder mit den Eltern. Der Lehrer soll eine höhere Arbeit leisten, und es darf von ihm erwartet werden, daß er mehr ist als der Manager einer »Partie«, einer Vorstufe für Bierreise mit Leiterwagen, Ziehharmonika und Clown. Auf der Klassenwanderung soll das Kind lernen, wie es später allein wandern soll. Es wäre ganz gut, wenn auf der Erde weniger geredet, mehr erlebt würde. Warum sind Gebirgler und andere Naturkinder oft so wortkarg? Beobachten sollen die Kinder unterwegs auch die Folgen der Rohheit anderer: verschnitzte Bäume, zerstörte Quellen, weggeworfene Blumen, zertretene Rasenflächen. Aber auch im planmäßigen[55] Unterricht läßt sich in dieser Richtung arbeiten. In der Heimatkunde weist der Lehrer immer und immer wieder nicht nur darauf hin, wie die Heimat ist, sondern auch, wie sie war. An alten Bildern kann er ihre ursprüngliche Schönheit zeigen, wobei er besonders darauf hinweist, wo diese durch Menschen ohne harte Notwendigkeit verlorengegangen ist. Dabei wird er auf den Unterschied zwischen schön und häßlich bei Bauweise und Reklame aufmerksam machen, um darzulegen, wie der Mensch sehr wohl imstande ist, Schönheit zu wahren. Durch diese geistige Führung muß jeder Schüler zu der Überzeugung kommen: »Ich kann noch Schönheit genießen.«
Aber auch zu der Überzeugung muß er gebracht werden, daß es nicht notwendig ist, resigniert zuzuschauen, wenn uns ursprüngliche Schönheit verlorengeht. Der Lehrer kann Beispiele bringen, wie hier eine Gemeindevertretung aus vernünftigen Männern und Frauen die Errichtung eines Luxushotels auf ihrem Grund und Boden abgelehnt hat, wie da die Einwohner eines Ortes Naturdenkmäler schützen oder sich gegen Anbringung marktschreierischer Reklame wehren, wie ganze Volksteile mobil gemacht worden sind gegen eine Zerstörung oder geldgierige Ausnützung ihrer schönen Heimat. Das Kind muß aber auch schon als Kind wissen, daß es einmal mit reden und raten kann, und darum sind ihm auch schon in der Schule die Tore zu zeigen und zu öffnen, die nach oben führen, damit es später nicht nach oben hungern muß. Früh schon muß es hingewiesen werden auf Vereine mit edlen Bestrebungen, auf Büchereien und Volkshochschule. Dem kindlichen Eifer kann man gerecht werden, indem man die Kinder die Befriedigung fühlen läßt, wenn sie ihre Schul- und anderen Ausflüge ohne Blumensträuße durchführen und wenn man ihnen die Möglichkeit zeigt, daß sie durch ihr kindliches Wort schon den Schutzgedanken ins Elternhaus, zu Verwandten und Freunden tragen können. Dann wissen sie: »Ich kann beitragen, Schönheit zu erhalten.«
Gesteigert muß dieses Bewußtsein werden. Die Kinder werden bald erkennen, Menschen, Leute wie wir haben häßlich gebaut, haben aus Schönheit Kapital geschlagen, sind rücksichtslos gegen unsere Heimat – unser Eigentum – vorgeschritten. Aus unseren Kreisen auch stammen die Rohlinge, die Gleichgültigen, denen muß jeder einzelne ein Gegengewicht sein wollen, er muß der Naturschützer aus Grundsatz werden. Im Lehrplan von Kockel heißt es in § 6, Erl. 163: »Die Betrachtung der Natur soll den Menschen auch dahin führen, daß er einen rechten Gebrauch von den Naturkörpern macht. Er soll erkennen, daß in dem großen Haushalte der Natur ein Glied dem andern dient, daß aber nicht jedes Glied dazu da ist, dem Menschen unmittelbar zu dienen. Eben deshalb darf der Mensch nicht blind zerstörend in die Reihen der Wesen eingreifen. Eine sinnlose, mutwillige Verwendung von Naturgegenständen, eine solche, die nicht für unsere leibliche Existenz oder geistige Entwicklung vonnöten oder von Wichtigkeit ist, muß verurteilt werden« (nach Grüllich). Um nun das Gegengewicht gegen Gleichgültige und Rohe zu verstärken, muß jeder so Erzogene die Pflicht fühlen, die Schutzgemeinde zu vergrößern, vor allem zu denen zu gehen, die von Heimat- und Naturschutz noch nichts gehört haben:[56] »Ich muß beitragen zur Erhaltung der heimatlichen Schönheit!«
Aus den drei Überzeugungen: »Ich kann noch Schönheit genießen; ich kann beitragen, sie zu erhalten; ich muß beitragen, sie zu erhalten,« ergibt sich dann auch das Ziel. Edelmotive werden solche Menschen zu ihren Taten leiten, ein festes Gesamtbewußtsein wird sie erfüllen, ihr Gemüt wird eine Vertiefung erfahren, und ein neues Pflichtbewußtsein zeigt ihnen den neuen Boden, in dem sie Wurzeln schlagen können, der ihr Boden ist, den sie bearbeiten dürfen nach ihrer Kraft.
Ich kann es mir nicht versagen, ein rührendes Beispiel dafür anzuführen, wie ein elfjähriger Knabe diese Gedanken in sich verankert hatte. Schon fünfviertel Jahr war ich von der Schule versetzt worden, an der Lehrern und Schülern ein Direktor Döring ein leuchtendes Vorbild eines begeisterten Heimatschutzarbeiters gewesen war. Da besuchte mich ein ehemaliger Schüler, der in meinen Heimatkundestunden gesessen hatte. Acht Kilometer hatte er überwunden, um mir zu sagen, er befürchte, daß der Wilisch bei Dresden von neuem abgebaut werde. Seine Mitteilung bewirkte eine Untersuchung der Angelegenheit, die die Abstellung von gewissen kleinen Unregelmäßigkeiten zur Folge hatte.
Es ergibt sich also, daß die Schule den Gedanken des Heimatschutzes aus Erziehungsgründen in staatsbürgerlicher Hinsicht in jeder Weise fördern sollte, wenn der Gedanke nicht schon von sich aus seine Durchführung verlangte. In seinem Programm des Naturschutzes sagte Professor Guenther: »Der Naturschutz ist keine Liebhaberveranstaltung, sondern Lebensnotwendigkeit für das deutsche Volk. Deshalb muß er im Staate gerade so seinen Platz haben, seine Beobachtung und Unterstützung finden wie andere Teile der Volkswirtschaft und der Lehrfächer.« Aus dieser Erwägung heraus ist ja auch die oben erwähnte Ministerialverordnung vom 12. August 1908 erlassen worden. Aber auch in der Schule stößt der Schutzgedanke auf mancherlei Hemmungen. Nur ein Teil der Lehrerschaft wird vollständig im Heimatschutz aufgehen können, anderen dafür andere Interessensphären überlassend. Diese Verschiedenheit ist der Schule natürlich von großem Wert; erinnert sei nur daran, daß jede größere Schule Verwalter für Lehrmittel, für Schulgarten, einen Organisator als Schulleiter, einen Musiker als Leiter des Chorgesanges, einen Turner als Turnwart braucht. An kleineren Schulen auf dem Lande erfolgt eine gegenseitige Befruchtung und Ergänzung durch Bezirkskonferenzen. Eine Stellung, die derjenigen des Schulchorleiters parallel ist, kann nun auch ein Lehrer einnehmen, der auf dem Gebiete des Heimatschutzes zu Hause ist. Wie jene Aufgabe nur ein musikalischer Lehrer erfüllen kann, so diese nur ein heimatlich besonders veranlagter, der, vom Vertrauen des Lehrkörpers bestimmt, ihr seine Kraft widmet. Für den Heimatschutz kann kein besonderes Fach angesetzt werden. Der Gedanke ist den Kindern gelegentlich nahezubringen, bei Behandlung von Lesestücken, im Geschichts-, Naturgeschichts-, Deutsch-, Zeichen-, Gesangsunterricht außer natürlich im heimatkundlichen. Eine Durchdringung, Durchsetzung[57] des Volksganzen soll und kann durch die Schule erfolgen. Gelegentlich heißt nicht ohne System. Dieses hineinzubringen kann Aufgabe eines Schul- oder Bezirksvertrauensmannes sein, der selbst seine Heimat gründlich kennt, der beseelt ist von einer glühenden Liebe für sie, der erkennt, was im heimatlichen Bezirk not tut, der im Heimatschutz seine Lebensaufgabe erblickt und der von den Bestrebungen der Schutzorganisationen dauernd unterrichtet ist. Überall im Lande arbeiten Lehrer in dieser Richtung. Keine amtliche Bestätigung oder Verordnung schreibt ihnen ihre Aufgabe vor. Dennoch fühlen sie die Verantwortung in sich, daß an ihrer Schule, in ihrem Bezirke, die Kinder im oben dargelegten Sinne erzogen werden. Sie stellen fest, was im Schulbezirk schätzenswert ist, sowohl baulicher, als auch geologischer, botanischer und zoologischer Art. Sie forschen nach Geschichtsquellen des Ortes, sammeln Ortssagen. Sie achten auf lokale Unsitten der Kinder, wie z. B. Blumenverkauf an Fremde. Sie arbeiten neue Heimatkundelehrpläne aus, legen Heimatstuben oder Heimatmuseen an. In Konferenzen berichten sie und bringen Anregungen. Heimatliebenden Männern und Frauen ist diese Arbeit Notwendigkeit. In einem Dorfe des östlichen Erzgebirges ist durch die Arbeit der Schule der Schutzgedanke Allgemeingut der Kinder und auch der Erwachsenen geworden. Verstöße gegen die Schönheit der Heimat kommen dort kaum vor. Die geschützten und die anderen seltenen Pflanzen sind den Schülern alle bekannt, so daß diese in der Lage sind, an Sonntagen eine Art freiwilliger Bergwacht darzustellen. Und dieser Erfolg ist nicht mit einem großen Aufwand an Zeit erkauft worden, sondern nur durch die Persönlichkeit eines heimatliebenden Schulmannes.
Wenn nun auch diese Heimatschutzvertrauensmänner der Schulen oder Bezirke nicht amtlich bestätigt werden wie Chorleiter, Lehrmittelwarte und Schulgärtner, so wäre doch eine wirksamere amtliche Unterstützung des Heimatschutzgedankens in der Schule sehr zu wünschen. Schon bisher wiesen Schulämter und Ministerien von Zeit zu Zeit darauf hin, daß Fluren usw. geschont werden müssen und Obst nicht gestohlen werden darf. Dabei trat das Materielle zu sehr in den Vordergrund. Der Naturschutz gipfelte in Verboten, die oft nur wenig beachtet wurden. In der Schuljugend soll aber der eigene Wille zum Natur- und Heimatschutz geweckt werden. Aus ästhetischem und ethischem Idealismus heraus soll sich in sittlicher Freiheit ihr Handeln bestimmen, wozu ein hartes, kaltes Verbot nicht so beitragen kann, wie ein eindringliches Sehendmachen für das, was schön, was bedroht und was schon verloren ist. Vor allem sollten die amtlichen Stellen dafür sorgen, daß am Tage vor Ferienbeginn die Schüler mit einem Eindruck entlassen werden, der ihnen ein rücksichtsvolles Verhalten während der Ferienzeit erleichtert. Daß Naturschutz eine ernste Angelegenheit ist, würden sie fühlen, wenn anordnungsgemäß alle Klassen zu einem kurzen, aber eindringlichen Vortrage von einem begeisterten Heimatschützler unter der Lehrerschaft in den Schulsaal zusammengerufen würden. Vor allem aber ist zu wünschen, daß vom[58] Ministerium einmal ein unzweideutiges Verbot jeden Blumenpflückens bei Klassenwanderungen erlassen würde. Den Lehrern würde dies eine ganz bedeutende Erleichterung sein. Vielleicht mag es vielen Eltern als eine Härte erscheinen, wenn ihr Kind von der »Partie« ohne Strauß heimkehrt. Aber wie schwer schädigend kann eine Klasse in einen reichen Blumenbestand eingreifen! Zudem ist, wie jeder Lehrer immer wieder mit Seufzen feststellt, die Schularbeit mit viel Halbheit verbunden. Wo kommt man zu einem endgültigen Ziele? Hier ist einmal Gelegenheit, die Kinder das Gefühl empfinden zu lassen, das man hat, wenn etwas restlos konsequent durchgeführt worden ist. Durch ein Kompromiß erziehen wir die Kinder nicht zum Heimatschutz. Sie müssen durch die in diesem Falle starre Haltung des Lehrers stutzig gemacht werden, damit ihnen überhaupt einmal eine Ahnung davon aufdämmert, um was für eine große Sache es sich hier überhaupt handelt. Die Freude am schönen Blumenstrauß mag auf einer Wanderung ersetzt werden durch die höhere Freude an weiten Blumenflächen, auf denen erst die Masse wirkt, und durch das stolze Gefühl innerer Kraft.
Die Schule kann eine Schutztruppe schaffen für die Heimat, die genau weiß, wofür sie eintritt. Es ist ein Dienst an Land und Volk, wenn ursprüngliche Schönheit erhalten bleibt. Das Volk aber wird mit einem Ideal durchsetzt, das von innen heraus keine Gegner finden kann. Daß die Ziele zu erreichen sind, lehrt die Erfahrung. Wenn sich nämlich einerseits zeigt, daß Kinder den Gedanken der Schonung von vornherein nicht in sich tragen, den Unterschied zwischen schön und häßlich nicht kennen, so kann man anderseits nach entsprechender Beeinflussung feststellen, daß sie mit Begeisterung den Schutzgedanken aufnehmen, daß sie froh und stolz sind, schaffen, mit wirken zu können am Schicksal der sie umgebenden Heimat. – »Das ist der Heimatschule letzter Gesichtspunkt: Aus dem einzelnen auf das Lebensgesetz zu kommen und die Heimat als das wissenschaftliche und lebendige Ethos in der Schule anzusehen.« (Bl. f. Naturschutz, 1920, 1/2, S. 6.)
Von O. Seyffert
Wir bringen heute drei Abbildungen aus unserem Museum zur Weihnachtszeit. Tausende von Besuchern erlebten hier glückliche Stunden. Viele hilfsbereite Hände hatten dieses Weihnachtsglück geschaffen. In der vorhergehenden Nummer unserer Mitteilungen hat Richard Bürkner über Weihnachten im Landesmuseum geplaudert. Ich kann dieser anschaulichen Schilderung wenig hinzufügen. Es war dieses Jahr wie alle Jahre: es war alles so vertraut und bekannt und doch war alles neu. Die Christbäume erzählten lustige Kindermärchen, lange Papierketten schwebten von ihnen herab, dunkelblaue und goldne Blumen blühten, zarte Schnittarbeiten, Englein und seltsame Vögel, Sterne und allerhand Pfefferkuchen – nein, wie die verführerisch dufteten! –[59] schmückten die Fichten, die wie immer aus Pfaffroda im Erzgebirge gekommen waren. Und von einem feierlichen Adventsleuchter fielen buntfarbige Herzen herab auf die Erde, die so etwas gebrauchen kann – zu alledem sangen frohe Menschen:
Sicher hat gar mancher, der daheim das Fest aller Feste (so wurde auch das Gauklerfest in Dresden benannt) nicht feiern konnte, es im Landesmuseum in seiner Herrlichkeit erlebt.
Und beim Nachhausegehen klangen alte Lieder den Kindern in der Seele:
Unsere erste Abbildung zeigt einen geschmückten Baum in der kleinbürgerlichen Stube im Erdgeschoß des Museums. Dies Zimmer ist dem Gedenken eines im Weltkriege Gefallenen geweiht. Aus dem Fichtengrün glühen dunkelrote Herzen und leuchten goldne Nüsse. Leider sind auf unserem Bilde die Herzen, bedingt durch die photographische Aufnahme, schwer erkenntlich. In Wirklichkeit aber war ihr Rot gar wundersam, und der Dreifarbenklang Gold, Rot, Grün übte einen eigenen Zauber aus. Junge Mädchen der höheren Töchterschule in Dresden-Neustadt hatten diesen Baum geschaffen, der von Liebe und goldenen Träumen erzählte.

Nun will ich aber noch von wichtigen Neuerwerbungen unserer Sammlung berichten.
Zu unseren zwei Krippen sind zwei weitere gekommen. Das ist ein Reichtum, auf den ich stolz bin.

Erstens: Die keramische Krippe von Kurt Feuerriegel, dem bekannten Töpfermeister in Frohburg, der schon mit vielen Werken im Museum vertreten ist. Die Sächsische Landesstelle für Kunstgewerbe hat die Krippe uns überwiesen.
In einer Grotte erblicken wir Joseph und Maria, sich zu dem Kinde neigend. Ein Esel und ein Öchslein gucken vergnüglich links und rechts hervor. Engelsköpfe schauen aus den Wolken auf die Gruppe herab. Und die heiligen drei Könige bringen ihre Geschenke. Sie sind über alles Lob reich gekleidet, und viele bunte Glanzlichter glitzern auf ihren Gewändern. Ein Kamel lagert sich in ihrer Nähe. Sein schwarzer Führer hat sich demütig niedergeworfen, um das heilige Kind anzubeten. Aber auch weitere Gäste sind aus dem Orient gekommen. Auf einem Elefant reiten zwei Mohrenjungen, die kostbare Gaben[61] mit sich führen. Der eine ist leider im Begriff, von seinem Reittier herunterzurutschen und befindet sich in etwas besorgniserregender Verfassung. Das Lustigste, Volkskundlichste ist aber ein dritter kleiner Mohr, der keck auf einem Ziegenbock sitzt. Hier ist Feuerriegel etwas ganz Köstliches gelungen. Hirten mit ihrer Herde und ihren Schäferhunden haben sich der vornehmen, ausländischen Gesellschaft angeschlossen und vervollkommnen das Ganze.
Was uns dieses Werk aber besonders lieb und wert macht, ist seine Materialechtheit. Es ist aus Ton geschaffen und will nichts anderes vorstellen. Seine bunten Farben und die glänzende Glasur geben einen eigenen, seltsamen Reiz.

Zweitens: Die Krippe vom Bildhauer Burkhard-Ebe, die er gemeinsam mit seiner Frau hergestellt hat. Sie hatten ihre Kinder damit zur Weihnachtszeit erfreut, und nun erfreut sie im Museum alle Besucher. Die Figuren sind aus einer Tonmasse. Sie tragen aber stoffliche Gewänder, wie die Gestalten der Krippe von Hilda Schlüter, die schon seit Jahren dank der Freigebigkeit eines Gönners im Besitze unseres Museums ist. Ihr gegenüber hat die Neuerwerbung nun auch Aufstellung gefunden. Die blonde Maria, die ihr Kindlein sorgsam auswickelt, ist von wunderlieber Anmut. Joseph blickt zum Himmel empor. Rechts stehen die Könige. Der Mohr ist ein prächtiger Kerl. Eine Truhe, aus der die Geschenke für das Christkind hervorlugen, fordert ganze Aufmerksamkeit für sich. Zwei Hirten nahen betend, während der dritte seinen Dudelsack mit eifriger Hingebung bläst, um das liebe Jesulein zu ergötzen. Mit dem[62] linken Fuße tritt er den Takt zu seiner Musik, die sicherlich alle erfreut. Im Vordergrunde sind die Schafe, die mit den Hirten gekommen sind und ihre Anteilnahme dem Stroh in der Krippe entgegenbringen.
Das Werk hat eine feine, farbige Wirkung. Besonders volkstümlich sind die Wacholderbäumchen, die mit ihrem dunklen Gezweig das Ganze abschließen und an das Weihnachtsgrün der Tannen gemahnen.
Es ist eine alte Überlieferung, Krippenfiguren mit Stoffgewändern zu schmücken. Ich erinnere an die reiche Krippenausstellung im Nationalmuseum zu München. Es kommt in dieser Sitte eine volkskundliche Anschauung zum Ausdruck, die wir z. B. auch bei den Marionettenfiguren und beim Kasperle finden, die ja bekleidete Holzfiguren sind. Es ist das Loslösen vom rein Bildhauerischen der hohen Kunst.
Ein Vergleichen unserer neuen Krippe mit der ihr gegenüber aufgestellten Schlüterschen Anbetung gibt zu vielen Betrachtungen Anlaß.
Ist letztere aus katholischer Art erwachsen – die Jungfrau Maria thront als Himmelskönigin mit hoher goldener Krone, der arme Zimmermann Joseph fehlt – so ist die Neuerwerbung protestantisch. Die Maria ist keine Königin, sondern Mutter, und der Joseph ist ihr Mann und deshalb zur Stelle.
Ich wollte eigentlich noch viel erzählen. Da fällt mir eine Erinnerung ein. Du mein Gott! wenn man älter wird, hat man Erinnerungen.
Ich war auf einem Volksfest und stand neugierig vor einer Bude. Der Ausrufer rief: »Hereinspaziert, meine Herrschaften, hereinspaziert! Innen können Sie alles genau sehen, was ich Ihnen erzählt habe!«
So ist es auch mit dem Landesmuseum für Sächsische Volkskunst. Innen können Sie alles sehen, was ich zu schildern versucht habe. Und noch viel mehr.
Und ein vereidigter Rechnungsrevisor beglaubigt: Das Museum hat siebzehntausendeinhundertvierundzwanzig Nummern.
Und ein kleines dickes Mädel antwortete auf meine Frage, was ihm am besten gefallen habe, mit leuchtenden Augen: Alles hat mir am allerbesten gefallen!

Fußnote:
[5] Aus einem Christspiel aus Neufriedersdorf bei Neusalza.
[63]
Von O. Seyffert
Die Jahresschau »Wohnung und Siedelung« hat ihre Pforten schon längst geschlossen. Der Grundsatz, daß die Aussteller ihre eigenen Juroren sein mußten, da die Ausstellungsleitung wohl die Herstellung der Hallen übernahm, sich aber einer Aufnahmekritik enthielt, war auch bei ihr wie bei ihren Vorgängerinnen befolgt worden. Unsere Zeit diktierte diesen Grundsatz, und es läßt sich nicht leugnen, daß er vieles Gute zum Leben erweckte. Aber jedes Ding hat zwei Seiten.
Es mußte sich von selbst zeigen, daß die Dresdner Ausstellungen nicht die geschmackliche und künstlerische Höhe erreichen konnten, die andere Veranstaltungen mit strenger Aufnahme-Jury haben mußten. Es liegt uns fern, nachträglich eingehend Kritik üben zu wollen. Das Suchen und die Unklarheit unserer Zeit kamen wie überall zutage. Das Kunstgewerbe – das Wort fängt an, einen Beigeschmack zu bekommen – zeigte sich reichlich in den Wohnräumen und konnte, wenn es sich nur auf dekorative Äußerlichkeiten stützte, nicht befriedigen. Da, wo der Schmuck sich dem Ganzen unterordnete und wo er nicht wie eine tropische Schlingpflanze überwucherte, empfand man ihn als eine Bereicherung. Aber dieser Genuß wurde dem Beschauer nicht immer zuteil.
Wir wollen heute in Anschluß an diese Betrachtungen nur ein kurzes Wort über die Wohnräume der Ausstellung sprechen. Mir kam es vor, als ob der Geschmack Ludwig II. von Bayern noch lebendig sei und sich hier und da in die Zimmer der sogenannten besseren bürgerlichen Stände geflüchtet hätte.

Die Architektur, die Mutter aller Künste, wurde oft vom Beiwerk erstickt. Und das Schlimmste war, was den Volkskundler bedenklich machte, daß das Publikum staunend diese falsche Herrlichkeit bewunderte und sich innig danach sehnte, aus der »öden« Wirklichkeit in den berauschenden Prunk zu gelangen. Und das tat nicht nur die Unschuld vom Lande, sondern auch der Großstädter in seinen vielseitigen Schattierungen. Immer verständlicher wird der neuzeitliche Ruf, sich von überflüssigem Äußerlichen fernzuhalten und eine Sachlichkeit anzustreben, die aber durchaus nicht bar von jeder Schmuckform zu sein braucht. Denn wir teilen nicht die Ansicht derer, denen höchste Schmucklosigkeit höchstes Gebot ist. Wir wollen nicht das Kind mit dem Bade ausschütten. Wir wollen nicht arm von allen Gefühlswerten sein. Wir wissen nicht nur den ästhetischen, sondern auch den wirtschaftlichen Wert guten Kunstgewerbes einzuschätzen. Wir wollen aber auch nicht an Gefühlsduselei ersticken.

Der Landesverein Sächsischer Heimatschutz hatte nun, um diese wichtigen Fragen klären zu helfen, eine Anzahl Zimmer ausgestellt, die in seinem Auftrage Professor Dr. h. c. Heinrich Tessenow entworfen hatte, und die in den[67] Deutschen Werkstätten, Dresden-Hellerau, ausgeführt worden waren. Es erscheint hier überflüssig, auf die Eigenart Tessenows einzugehen. Er ist Architekt und nicht Kunstgewerbler. Er ist Architekt, der im Handwerklichen wurzelt.

Unsere Ausstellung zeigte einen Weg. Tessenow hatte absichtlich in seinen Räumen die kleinen Gebrauchsgegenstände, die hineingehören, weggelassen: Er gab uns einen Totaleinblick. Eine vornehme Harmonie in Form und Farbe, etwas Selbstverständliches war erreicht. Die Abwägung der Verhältnisse war höchstes Gesetz. Und so einfach das Ganze auch war, so machte es doch nicht den Eindruck des Armen, das »von der pauvreté kommt.« Es war der Ausdruck geläuterter Kultur. Freilich, in diese Räume gehörten auch Menschen, die sich schlicht und vornehm kleiden, gute Bücher lesen usw. und sich nicht putzen wie ein Pfingstmaienbaum. Die Familie Raffke mit ihrer Verwandtschaft fühlte sich, wenn sie zu Besuch war, höchst unwohl.

Ferne sei es, die Tessenowschen Zimmer als die einzige Lösung hinzustellen. Ich bekenne von neuem, sie zeigten uns aber einen Weg zur Gesundung. Sicher kann man auch reichlichere Ausdrucksmittel als Tessenow wählen, wenn nur die Gesinnung eine ehrlich künstlerische ist.
Wie war nun der Eindruck auf das große Publikum? Vernichtend.
Das heißt, für das liebe Publikum.
»Das soll Heimatschutzstil sein? Hahaha! Hihihi!«
[68]
Ich weiß nicht, was Heimatschutzstil ist – gibt es überhaupt einen solchen? Ist nicht der gute Geschmack auch Heimatschutzstil? Denken sich die Leute noch immer Butzenscheibenromantik in moderner Aufmachung? Die Fensterläden mit einem Herzchen versehen?
Wir sehen, die Schnörkel, Tapeziererunkünste und die Süßigkeiten der Nippes haben die Leute allzusehr beeinflußt. Aber gerade unsere Zeit mit ihren Nöten muß uns doch ganz von selbst zur Schlichtheit führen.
Ich war strebend bemüht, solche Gedanken zu verbreiten, denn oberflächliche Urteile wurden vernichtend und schnell geführt.
Das letzte Bild bringt einen weiteren Beitrag zu unserem Thema. Für das Deutsche Hygiene-Museum in Dresden hatte ich eine Stube zusammengestellt, wie sie nicht sein soll. Große Buchstaben verkündeten dies. Das war nötig, sonst hätte es wahrhaftig Menschen gegeben, die bei diesem Schreckensraum »ach, wie nett!« ausgerufen hätten. Waren hier in erster Linie auch hygienische, nicht ästhetische Gründe maßgebend, so vereinigte sich doch alles zu einem echten Bilde unserer Unkultur. Die drei Tage, an denen ich all die Sachen zusammengekauft habe, bleiben dunkle Punkte in meinem Leben. Ich habe mich geschämt, das Zeug zu erwerben und guckte beim Einkauf verstohlen nach links und rechts, ob meine Missetat von jemandem beobachtet würde.
Nun – es ist alles überwunden, und dieses abschreckende Beispiel hat seinen Zweck erfüllt. Es hat manchem die Augen geöffnet. Es wirkte erzieherisch. Und immer und immer wieder wollen wir uns den Satz ins Gedächtnis rufen:
Geschmack bilden, heißt den Charakter bilden.
Von Curt Guratztsch, Dresden
Mit Aufnahmen des Heimatschutzes
Wenn man auf der Straße von Wolkenstein nach Wiesenbad hinunterfährt – vielleicht, um noch die neun Kilometer bis Annaberg zurückzulegen –, so sieht man an einer Wegbiegung einen Augenblick ins Tal hinunter auf die Himmelmühle. Das ist an sich nichts Besonderes. Man hat solche Landschaftsbildchen ziemlich häufig im Obererzgebirge; in ihrer Sonderart könnten sie allenfalls einen Maler von der Art der Niederländer reizen, einen, den das schlichte Ineinander von Natur und Menschenwerk Wunders genug dünkte, um es in ein Bild einzufangen, ohne alle Zutat von Schwärmerei, mit niederdeutscher Sachlichkeit. Sein Bild müßte aber so sein: auf gegenüberliegenden Hängen steigen hohe Erzgebirgsfichten hernieder; dazwischen liegt ein Tal, und die tiefste Rinne darin wird von einem Flüßchen gebildet, das ziemlich rasch und in Schaumkreisen über Geröll hinwegstrebt. Es ist die Zschopau. Das Tal bildet natürlich eine grüne, im Sommer sehr saftig strotzende Wiese, und darin liegen um einen Fabrikschornstein etliche Gebäude. Da dieser Anblick sich im Erzgebirge so oft wiederholt, könnte man das Bild davon neben[70] die zahllosen Bilder von niederländischen Mühlenlandschaften stellen; es wäre ein Gleichnis dazu, denn beidemal wird ein Stück Landschaftstum aufgefangen. In unserem Falle könnte man dann »Himmelmühle« darunter schreiben.

So läßt sich der Ort, von dem hier die Rede sein soll, anspruchslos an, wie das Erzgebirge ja auch sonst. Es ist wohl möglich, daß er Vorbeifahrenden – am rechten Ufer der Zschopau läuft nämlich der Bahnstrang entlang – im Sommer und bis in den Spätherbst hinein aus dem besonderen Grunde aufgefallen ist, weil zwischen den Gebäuden jenseits des Flusses ein holder Rosenhag blüht. Der Besitzer der Himmelmühle hat ihn vor ein paar Jahren geschaffen, und er entfaltet sich in der milden Luft der Talsenke von Jahr zu Jahr reicher. Aber im übrigen wird man eben, wie gesagt, nur mit den Gefühlen auf das Anwesen geschaut haben, wie auf solche Gebäudereihen in Erzgebirgstälern überhaupt. Der Heimatfreund will ja auch gar nicht fortgesetzt etwas Neues, eine ewig aufhaspelnde Abwechslung. Diese Himmelmühle, im Grunde zwischen Wiesenbad und Wolkenstein, ist nur darum bemerkenswert, weil sie davor bewahrt geblieben ist, etwas geschmackswidrig »Neuzeitliches« zu werden, weil sie mit dem Stilgefühl wieder aufgebaut wurde, daß der Formwille der Landschaft nicht gekränkt wurde.
Aber wir wollen unseren Wagen doch einmal auf der breiten Talstraße oberhalb halten lassen und auf einem Fußwege zur Mühle hinuntersteigen.

Es ist eine Fläche von achtzigtausend Quadratmetern, die durch das Anwesen Himmelmühle umspannt wird. Wenn man hinzunimmt, daß insgesamt einhundertundzwanzig Seelen darauf wohnen, so findet man die stattliche Zahl der Gebäude nicht verwunderlich. Sie scheiden sich durch den Vorgarten des Herrenhauses und werden an beiden Enden des Raumes durch je eine Brücke über die Zschopau abgeschlossen. Auf unserem Fußwege gelangen wir gerade auf den Fabrikplatz zu. Mit breiter Front steht das »Schokoladenwerk Himmelmühle« links vor uns. Es ist ein Bau von acht Stockwerken und 17 Metern Tiefe; auf dem spitz zulaufenden Schieferdach sitzt ein Türmchen; die Bauweise ist ländlich; das Haus überragt wohl die Nebengebäude, bringt aber nicht etwa den Eindruck eines amerikanischen Riesen hervor. Drei von den Stockwerken sind nämlich in die zweifach gebrochene Dachlinie aufgenommen. Vor dem Schokoladenwerk liegt das Kesselhaus mit dem Schornstein. Rechts, nach dem Ufer der Zschopau zu, schließt das Herrenhaus an, ein Gebäude mit flachem Dach, und insofern herausgehoben aus der Zahl der übrigen. Schmuckwerk fehlt auch hier; die Bauten wirken insgesamt nur durch die Schönheit ihrer Sachlichkeit. Zwischen Herrenhaus und Fabrik hindurch kommt man auf einen viereckigen Platz, den drei erzgebirgische Fachwerkbauten, das Lange Haus[6], das Kurze Haus und das ehemalige Schulhaus umgeben; damit hat man nach der einen Seite zu das Ende erreicht. Man wendet also, geht am Vorgarten des Herrenhauses und einem hübschen Pavillon in seiner entferntesten[72] Ecke vorüber und kommt nach einem Weilchen zu der anderen Gebäudegruppe zschopauabwärts, der das Gasthaus Himmelmühle, ein Landwirtschaftsgebäude und ein Beamtenwohnhaus des Kraftwerkes Westsachsen, zugehören. Dahinter sieht man noch einen Wiesenrücken, der, wie am entgegengesetzten Ende, mit Obstbäumen bepflanzt ist; zur Höhe hinauf gewahrt man die viel begangene Talstraße, ein Notstandswerk aus den Jahren 1923 und 1924, dem die Ergänzung nach Wolkenstein heute noch fehlt.
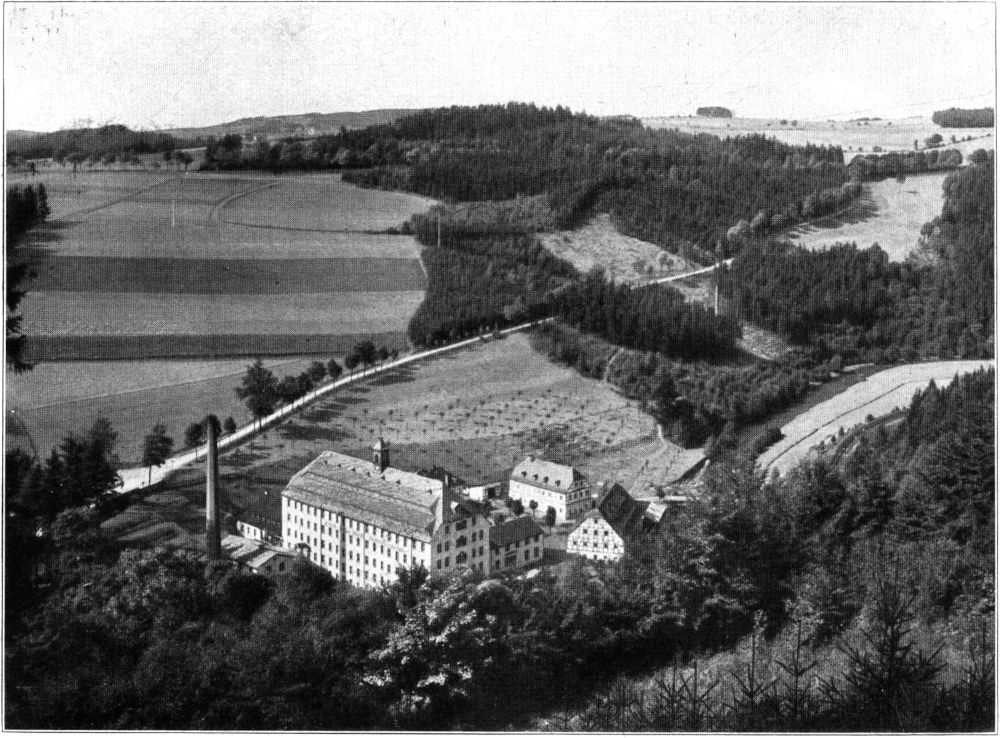
Was an Gebäuden zum Anwesen Himmelmühle gehört, ist nicht älter als etwa neunzig Jahre. Denn vordem soll, nach Ausweis der Grundbücher, nichts hier gestanden haben – außer dem Gasthaus jedenfalls. In eine viel tiefere Zeitferne führt freilich die Erzgebirgische Kriegschronik zurück, in der Mag. Christian Lehmann vom Jahre 1639 zu berichten weiß, daß »eine rotte loser bursch« den Vetter des schwedischen Obristen Göcking erschlagen habe, wobei auch ein gewisser Nicol Georg gewesen sei. Dieser, der eigentlich ein »Heußler« zu Falkenbach gewesen, habe sich darauf »mit seinen Viehe und mobilien in morrast bei der Norbsmühle zwischen Neudörfel und Falkenbach retterirt,« wo er aber von den Schwedischen gegriffen wurde. Wenige Tage später hat ihm der Obrist dann zu Annaberg »den Kopf abschmeißen« lassen. In der Norbsmühle ist die Himmelmühle wiederzuerkennen. Es ist dies die älteste Erwähnung der Örtlichkeit.
[73]
1834 hat der Chemnitzer Kaufmann G. F. Oehley die Gebäude des heutigen Schokoladenwerkes aufführen lassen. Sie dienten zuerst einer Spinnerei, und die Fabrikation ging einen guten Gang, als Richard Hartmann aus Chemnitz daran beteiligt war. Bis 1913. Während des Krieges brach der Verfall herein. Das Bekleidungsamt Chemnitz quartierte sich in den Gebäuden ein. Es wurde grundsätzlich nichts mehr auf die Erhaltung verwendet. 1921, als der gegenwärtige Inhaber, Herr Martin Schmidt aus Dresden, den Besitz übernahm, wuchsen schon lustige Birken aus dem heutigen Werksgebäude heraus: das Kurze Haus war polizeilich geschlossen; der Gesamtzustand derart, daß der neue Besitzer das Dach des Herrenhauses eines Tages – in der Zschopau wiederfand. So galt es durchgreifenden Neuaufbau, Aufwendung erheblicher Mittel, vornehmlich aber Verständnis für den Wert des Überkommenen und schonsame Rettung dieses Wertes in die Gegenwart hinein. Und mit diesem allen kommt man denn auf den jetzigen Besitzer.
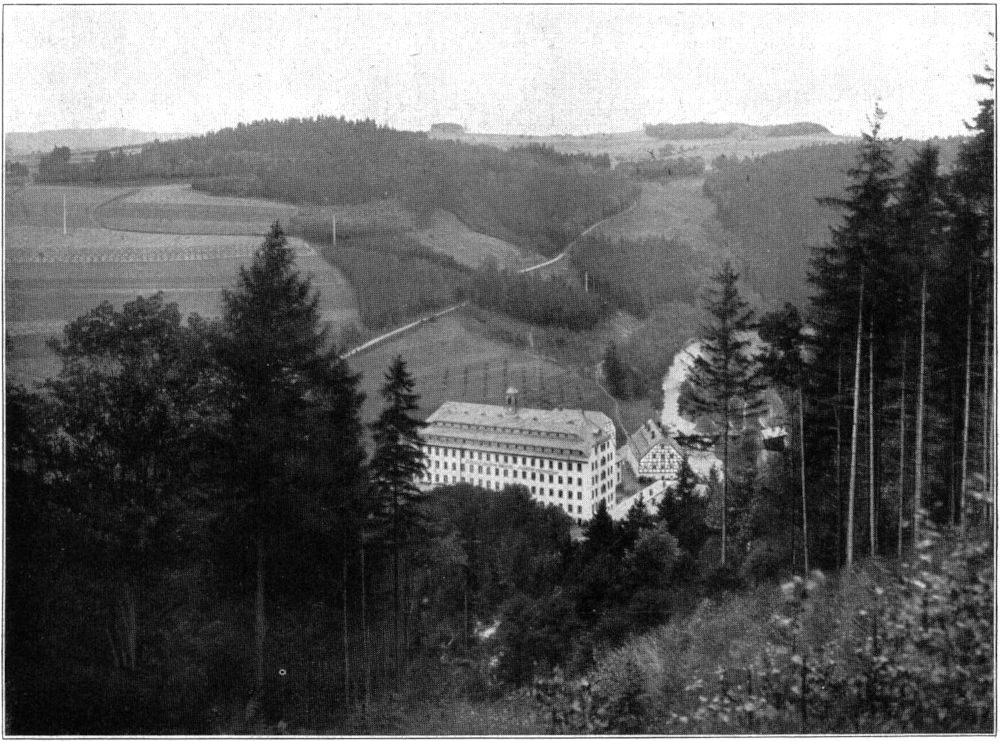
Wer ein Freund der Heimat ist, der hegt oft auch eine stille Schwärmerei für die Herrensitze alter Adelsgeschlechter. Wir erkennen Kultur darin, daß da das Herrenhaus organisch mit der Kirche verbunden zu sein pflegt; es gab noch ein anerkanntes Höchstes über dem Herrentum, und es gab nicht das, was Nietzsche als die Schrankenlosigkeit des modernen Fabrikherrentums in der Selbstsucht erkannte. Wäre der Herr auf der Himmelmühle von der Sorte[74] der zeitgemäßen Industrieritter, er wäre gewiß dem Ratgeber gefolgt, der ihm anno 1921 empfahl, das Spitzdach des Schokoladenwerkes in ein flaches umzuwandeln. Praktischer wäre das gewesen, denn im Winter hätten dann die Eiszapfen keine Ecken mehr gefunden, wo sie sich gefahrdrohend aufbaumeln konnten, – und billiger wäre es am Ende auch gewesen. Es ist nicht nach diesem Ratschlag gehandelt worden, denn der neue Inhaber empfand, daß mit dem Mansardendach der Landschaft ihre eingewurzelte Ländlichkeit verlorengegangen wäre.
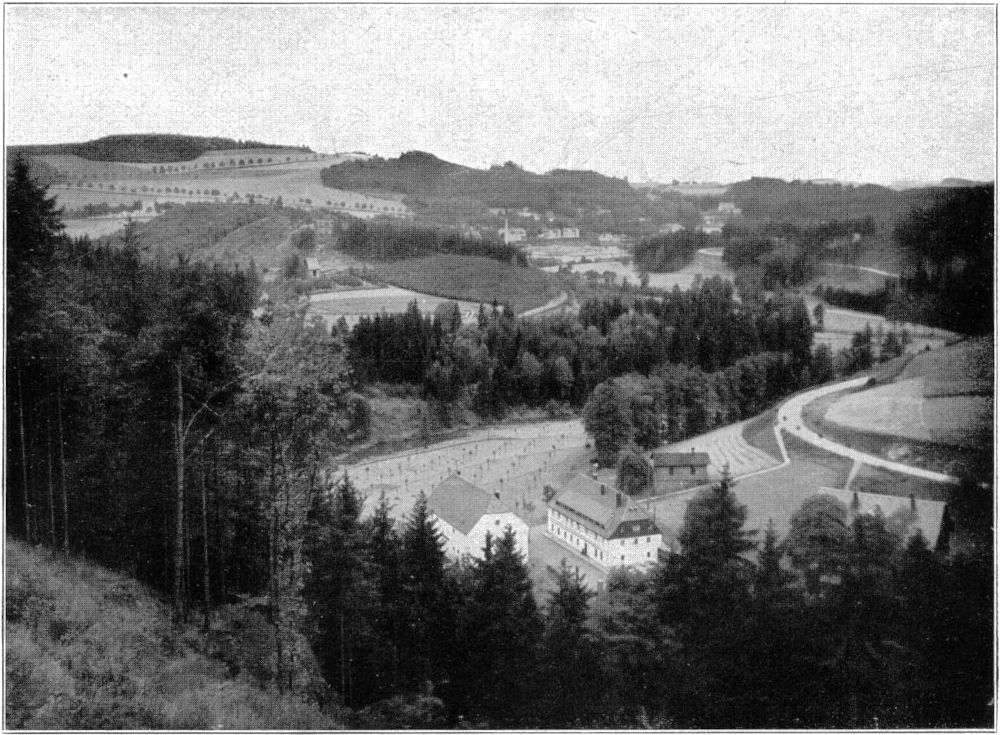
Und so ist aufgebaut worden in mühsamer, aber auch aufmunternder, erfreuender Arbeit. Der Dresdner Architekt Oskar Röhle, daneben der Dresdner Kunstmaler Paul Ricken, sind die verantwortlichen Werkmeister gewesen, und alle drei, Architekt, Maler und Bauherr, haben nach dem Grundgedanken geschafft, daß erst eine Wohnstätte für die Menschen, dann Wasser und Verpflegung und dann neuzeitliche Gesundheitlichkeit vorhanden sein müßten, ehe wieder Leben auf dem Himmelmühlhof einziehen dürfte. Wirklich, man ist betroffen, wenn man das fertige Werk betrachtet.
Überkommenes Stiltum ist mit neuem Stilverständnis erhalten und gepflegt. Die Baumeister von 1834 haben mit köstlicher Festigkeit gebaut. Wenn man die Mauern des Schokoladenwerkes sieht, in die zwei Kraftmeier[75] von heute ihre Brüste hineinstemmen könnten, so durchfährt einen Freude: Gott, muß das warm sein hier im Winter! Die Fabrik ist mit schlichter Farbeneinstimmung ausgemalt; Kontor und Werkräume sind in stillen Farben gehalten. Aber durchgängig bewegt man sich eben nicht in Fabriknüchternheit, sondern in bäuerlicher Breite und Behaglichkeit. Und dabei herrscht doch Zwecksinn. Die Verarbeitung ist so geregelt, daß die Rohstoffe mit Fahrstuhl in das oberste Stockwerk gefahren und von da, je nach dem Fortschreiten der Behandlung, Stockwerk um Stockwerk tiefer gefiltert werden. Es geht alles durch Falltrichter; Menschen brauchen sich nicht abzuhetzen.

Eine biologische Kläranlage versorgt jeden Bewohner mit den Grundvoraussetzungen neuzeitlicher Reinlichkeit. Eine helle Freude schafft der Anblick der Arbeiterwohnungen – z. B. im Kurzen Haus. In Riesenzimmern, riesenmäßig an Tiefe und Höhe, dabei so hell! liegen die Kinder in ihren Bettchen und schlafen sich stark in der gesunden Luft. Ich werde mich einmal aufmachen und forschen, wo es in der Großstadt eine gleiche Mittelstandswohnung gäbe; ich weiß schon im voraus: da forsche ich vergebens. Die Schule sieht sich von außen sehr sauber und fröhlich an, aber es darf leider zurzeit kein Schulunterricht darinnen gegeben werden. Das junge und rasch zunehmende Geschlecht muß erst groß werden. Eine besondere Beschreibung verdient dann das Gasthaus. Es ist in seinen drei Gaststuben mit wahrem Behagen als[77] ländliche Pfleg- und Erholungsstätte aufgerüstet, bauernbunt an den Wänden, mit starken, hölzernen Tischen und derben Stühlen, dazu großen, hellen Fenstern. Hier verzehren die Arbeitsleute ihr Mittagbrot. Steigt man aber die Stiege hinan, so bekommt man mit den Fremdenzimmern eine pure Lustigkeit zu sehen. Jegliches hat seinen Namen erhalten; dem einen steht auf der Türe »’s Herzel«, dem andern »Himmelschlüssel«, einem dritten »Vuglbeer«. Innen enthalten die Zimmer immer die nötigen Wandmalereien. Sie schauen solchergestalt sehr lieb drein und locken zum Dableiben. Gewaltige Böden über den Wohnungen sind ein Besitz aller Himmelmühl-Häuser.

Bliebe noch das Herrenhaus zu erwähnen, wenn man einiges andere wegstreichen wollte. Das Herrenhaus ist die Wohnung des Fabrikherrn. Es ist der eigentliche Adelsbau des ganzen, mit hohen, herrlichen Zimmern, von denen das Biedermeierzimmer ein Stück Liebhaberei verkörpert, indes die anderen im neuen Geschmack gehalten sind, ohne irgendwie Stil zu verleugnen.
Bleiben ein paar Wertstückchen – Nippes, sagt man gebildet. Ich meine vornehmlich den kleinen Pavillon im Garteneck. Über die moosübergangenen Steine einer Mauer sieht man zur Zschopaurinne durch; vor einem aber steht ein romantisches Tempelchen. Es ist rund gebaut, mit dorerartigen Säulen und einer weißgestrichenen Holzbalustrade herum, mit großen Fenstern voll Stabwerkes zum Stübchen inmitten. Und das Stübchen ist ein kleines festliches Gemach. Ringsherum sind bunte Bilder über die Fenster und in die Nischen gemalt; sie stellen im wesentlichen die vier Jahreszeiten dar – der Geschmack zwischen Ludwig Richter und Runge spielend. Wer waren die Künstler zu dem allen? Dies hübsche Häusel verdient noch weiteren Ausbau.
Wandert man aber noch einmal die breite Kastanienallee zum Herrenhaus zurück, so stockt man vor zwei alten runden Säulen am Eingang. Dem Charakter nach sind es Überreste des 18. Jahrhunderts, aus der Gleim- und Höltyzeit, der Überlieferung nach freilich nicht. Bescheiden wir uns beim Rätsel!
Und steigen wir so, Gedanken im Sinne, vom Tale zur Höhe zurück. Lassen wir das erste Schokoladenwerk des Erzgebirges – die Himmelmühle ist es! – liegen in der beschaulichen Friedlichkeit seines Bezirkes von Arbeit und Lebensgenuß. Wir sehen über den spitzen Tannen den Erzgebirgshimmel in hellblauem Flusse, und weiße Wölkchen flattern darüber hin. Die Einsamkeit will uns wieder fangen, und einsam scheint auch das Stück Menschenwerk im Grunde, einsam in seine Traulichkeit gehegt. Nichts weiter als ein Blick Heimat, aber eben Gott sei Dank, trotz vergangener Anfechtung: Heimat!

Fußnote:
[6] Dieses ist das Schmerzenskind des Besitzers, das Gebäude befindet sich im Verfall. Man sollte meinen, daß es auch höhere Stellen bekümmern müßte, hier keinen Schandfleck entstehen zu lassen.
[78]
Franciscus Nagler, »Ein lustiger Musikante« (Nummer 16 der Zellenbücherei im Verlage Dürr und Weber G. m. b. H., Leipzig-Gaschwitz).
Eine meist recht kindische Art Operette, die kunstlose Potpourriform der Kinomusik, Jazzbands, Schlagerlieder und Schlagertänze ohne Lebenskraft, nur einmal aufleuchtend und dann auf immer vergessen – wir wollen es deutlich sagen: das ist die Volksmusik von heute, die Musik, die das Volk aufnimmt. Kein Lied im Herzen; keine Melodie, die von Vater und Mutter zu Kindern und Enkeln weiterklingt! – Wir wollen versuchen, es besser zu machen und die Lebensfreude, die ja doch schließlich auch aus der gegenwärtigen Volksmusik spricht, in richtige, natürliche Bahnen zu lenken.
Das will der »Lustige Musikante«! Er ist uns daher herzlich willkommen! Heiteren Gemütes wird er uns vorgestellt. Er ist der rechte Musikante aus dem Volke mit dem reichen, warmen Herzen. »Er freuet sich mit den Fröhlichen und weinet mit den Weinenden.« Von allem, was zu ihm in Beziehung steht, plaudert der Verfasser: von fahrenden Sängern, Spielleuten, Stadtpfeifern, Dorf- und Bettelmusikanten; dann vom Dorf- und Kleinstadtkantor, von der Kirchenmusik, den Gesang- und Musikvereinen. Ein lustiges Leben mit Sang und Klang! – Inmitten des Frohsinnes aber taucht mancher ernsthafte Gedanke auf. Jeder würde eine Besprechung für sich fordern. Daher kann an dieser Stelle nur auf einzelne hingewiesen werden. Tapfer sagt uns der Verfasser seine trefflichen Meinungen über moderne und klassische Musik, über Gelegenheits-, Schul- und Hausmusik, über Einfachheit und Natürlichkeit auf musikalischem Gebiete, über den Geschmack des Publikums, über die Notwendigkeit einer deutschen volkstümlichen Oper, besonders der komischen Oper und des Singspiels usw.
Angenehm zu lesen ist diese (etwa neunzig Seiten umfassende) Plauderei über volkstümliche Musik. Das Buch ist inhaltlich wertvoll; es regt an zum Nachdenken und ist verständlich für jeden Laien, der nach Bildung strebt. Billig ist es zu erstehen; und lustig ist er auch, der ehrliche Musikante! Was wollt ihr mehr?
Günther Lamm.
Richard Schlegel, »Die Vogelwelt des nordwestlichen Sachsenlandes«. Versuch einer Avifauna der Leipziger Flachlandsbucht, zugleich ein Beitrag zur Zoogeographie des Freistaates Sachsen. V und 274 Seiten mit 5 Bildnistafeln. Zu beziehen: Heimatschutz, Dresden-A., Schießgasse 24. Geh. 11.50 M.
Heimatschutz setzt Heimatkenntnis voraus und Naturschutz ist nur möglich, wenn wir die Natur selbst kennen und über das Vorkommen und die Bedingungen des Vorkommens ihrer Geschöpfe unterrichtet sind. Veröffentlichungen, die diese Kenntnisse fördern, dienen immer auch dem Heimat- und Naturschutz, und der Förderer und Freund der Heimat- und Naturschutzbestrebungen wird sich daher auch mit ihnen befassen müssen. Dies trifft auf ein Buch zu, das mir zur Beurteilung vorliegt und das der »Vogelwelt des nordwestlichen Sachsenlandes« gewidmet ist. Sein Verfasser, Richard Schlegel in Leipzig, ist kein Neuling in der wissenschaftlichen Vogelkunde und im ornithologischen Schrifttum durch manche fleißige Arbeit rühmlichst vertreten. Die Erforschung der Vogelwelt seiner zweiten Heimat – die Wiege Schlegels hat im Erzgebirge gestanden und erzgebirgisches Erbe wohl auch ist seine Freude am Vogel, die Liebe zum gefiederten Volk – ist ihm dabei immer Hauptzweck gewesen, zur Lebensaufgabe geworden. Ein ganzes langes Menschenalter hat er sich dieser Aufgabe gewidmet, und daß sie nicht vergebens gewesen ist, daß Schlegels Tätigkeit reiche Früchte getragen hat, bezeugt sein vorliegendes Buch. Es führt uns in die Vogelwelt eines Gebietes ein, in dessen Bild der in Sachsen in größerer Ausdehnung ja sonst fehlende, der Entwicklung eines reichen Vogellebens aber ganz besonders förderliche Auwald noch einen breiten Raum einnimmt und dessen Vogelbild sich daher auch in manchen wesentlichen Zügen auffallend von den anderer Gegenden unseres sächsischen Vaterlandes unterscheidet, Arten sein eigen nennt, die anderwärts entweder ganz fehlen oder doch zu den Seltenheiten gehören. Der naturschützerischen Fragen nachgehende aufmerksame Leser wird aus den Schlegelschen sehr gründlichen und ins einzelne gehenden[79] Ausführungen bald auch den Einfluß der Kultur herausfühlen, den diese auf das ursprüngliche Vogelbild Nordwestsachsens bereits ausgeübt hat und der in einzelnen Fällen auch schon ein recht verhängnisvoller geworden ist. Machtlos stehen wir ihm meistens gegenüber – die Kultur läßt sich eben nicht zurückschrauben –, oft aber, so will es mir scheinen, könnten wir ihm doch noch Einhalt gebieten, könnten diese oder jene bedrohte Art retten. Nur dürfen wir uns nicht bloß in sentimentalen Klagen ergehen, nicht papierne Resolutionen fassen, sondern müssen handeln, den Stier fest bei den Hörnern packen und vor allem unsere Schutzmaßnahmen spezialisieren, dem Einzelfall Rechnung tragen und ihn nicht nach dem beliebten Schema F behandeln. Wir dürfen aber auch nicht davor zurückschrecken, zugunsten einer gefährdeten Art auch einmal ein paar Individuen einer nicht gefährdeten, häufigeren zu opfern. Die Nachtigall erhalten wir unserer Heimat nicht durch langatmende Zeitungsartikel und Vogelschutzgehölze, sondern einzig und allein durch die Pflege noch vorhandener, ihren Ansprüchen genügender Pflanzengemeinschaften und der Fernhaltung des der Nachtigall unwillkommenen lärmvollen übrigen gefiederten Volkes von diesen Stellen. Diese, mir hier nur so gekommenen Gedanken jedoch nur nebenbei, ich hoffe, sie später ausführlicher einmal bei einer anderen Gelegenheit behandeln zu können. – Dem Schlegelschen Buche wünsche ich die verdiente Verbreitung besonders auch unter den Lesern der Heimatschutz-Mitteilungen; des Verfassers auf die Arbeit verwandter Fleiß kommt besonders dem zum Bewußtsein, der zwei ähnliche, nach dem Schlegelschen Buche erschienene Arbeiten: »Krohns Vogelwelt Schleswig-Holsteins« und Genglers »Vogelwelt Mittelfrankens« kennengelernt hat – die »Vogelwelt des nordwestlichen Sachsenlandes« überragt beide um ein ganz gewaltiges, und in die Anerkennung der Schlegelschen Leistung darf sich daher auch die aufrichtige Freude des Sachsen über die vorbildliche Arbeit des Landsmannes mischen.
Rud. Zimmermann.
Mitteilungen des Vereins sächsischer Ornithologen. Sonderheft, der Deutschen Ornithologischen Gesellschaft zur Feier ihres 75jährigen Bestehens dargebracht. VIII und 72 Seiten mit 3 Textkarten, 2 Notenbeispielen und 5 Tafeln.
Der 1922 gegründete Verein sächsischer Ornithologen, der seine Hauptaufgabe in der Erforschung der sächsischen Vogelwelt erblickt und auf diese Weise die wissenschaftlichen Unterlagen für ihren Schutz zu schaffen versucht, hinsichtlich dessen zielbewußter Förderung er sich mit dem Landesverein Sächsischer Heimatschutz einig weiß – die gründliche und ja auch so erfolgreiche Bestandsaufnahme der heute noch in Sachsen horstenden Wanderfalkenpaare z. B. unternahm er mit Unterstützung des Landesvereins Sächsischer Heimatschutz – konnte im verflossenen Herbst seinen bisherigen, der Vogelkunde Sachsens gewidmeten »Mitteilungen« eine umfangreichere Veröffentlichung angliedern: ein Sonderheft, das er der Deutschen Ornithologischen Gesellschaft, der ältesten sich der Vogelkunde widmenden Körperschaft des Erdballs, zur Feier ihres 75jährigen Bestehens widmete. Das Heft eröffnet eine historische Studie; Rudolph Zaunick untersucht mit der ihm eigenen Gründlichkeit »F. A. L. Thienemanns Anteil am Zustandekommen der ersten Versammlungen deutscher Ornithologen« und liefert damit zugleich auch die erste eingehendere Lebensschilderung Thienemanns, diesen bei weitem nicht nach Gebühr gewürdigten älteren sächsischen Vogelkundigen. Dem Zaunickschen Beitrag schließt sich eine, vielleicht gerade den Lesern der Heimatschutz-Mitteilungen besonders willkommene, Untersuchung von Hans Förster »Beobachtungen über das Vorkommen der Wasseramsel als Brutvogel in der Sächsisch-Böhmischen Schweiz« an, in der der Genannte neunzehn Brutpaare, die sich aber wohl noch um eine Anzahl weiterer erhöhen werden, für unser Felsengebirge nachweist, eine Zahl, die zweifellos im Herzen jedes Vogelfreundes helles Entzücken auslösen muß. Faunistischer Natur, wie die Förstersche, ist auch die Erich Dittmannsche Arbeit »Zur Verbreitung des Brachpiepers in Ostsachsen nebst Mitteilungen über seine Lebensweise«, während Richard Heyder, der Sachsens Ornithofaun ist, dem wir ja die erste gründliche Gesamtdarstellung der sächsischen Vogelwelt verdanken, in einer Arbeit »Über die Durchzugsfrequenz nordischer Stelzvögel im Binnenlande« einer der heute umstrittendsten[80] Zugsfragen, dem Zugstraßenproblem, zu Leibe geht und überzeugend nachweist, daß auch der Zug der Stelzvögel nicht straßenförmig, sondern in breiter Front verläuft. Mit der »Stimme des Fichtenkreuzschnabels« befaßt sich Bernh. Hoffmann, den Lesern der Heimatschutz-Mitteilungen durch seine zahlreichen Beiträge auch in diesen ja längst kein Fremder mehr, brutbiologische Arbeiten haben Richard Schlegel (Über ein bei Röhrbach-Belgershain gefundenes und irrtümlich als Rohrdommelei bestimmtes Ei der Stockente) und P. Bernhardt (Eine zweite Brut des Eisvogels), beides ebenfalls wieder bekannte Mitarbeiter an den Heimatschutz-Mitteilungen, sowie der Unterzeichnete (Beobachtungen am »Rohrsänger«kuckuck; ein Beitrag zur Kuckucksfrage) beigesteuert, während E. Mayr die Vogelwelt Sachsens mit derjenigen Vorpommerns vergleicht. – Das in sauberem Druck hergestellte Heft, das auf seinen fünf Kunstdrucktafeln außer einem Bildnis Thienemanns Naturaufnahmen von P. Bernhardt und dem Unterzeichneten bringt, dürfte seines reichen und vielseitigen Inhaltes wegen manchem Vogelfreund Sachsens, der dem Verein sächsischer Ornithologen noch fern steht, einen willkommenen Lesestoff bieten; es ist aus diesem Grunde vom Verein auch in erhöhter Auflage herausgegeben worden und für 3.— M. portofrei durch den Unterzeichneten (Dresden-A., Marienstraße 32) oder die Geschäftsstelle des Heimatschutzes zu beziehen.
Rud. Zimmermann.
Göttliche Tat.
Menschliche Tat.
Folgen.
(Verfaßt und verbreitet vom Ring deutscher Jugend.)
Für die Schriftleitung des Textes verantwortlich: Werner Schmidt – Druck: Lehmannsche Buchdruckerei
Klischees von Römmler & Jonas, sämtlich in Dresden – Photographische Platten »Sigurd« und »Satrap«,
photographische, sowie kinematographische Aufnahme- und Wiedergabeapparate »Ernemann«
Photographische Aufnahmen: Max Nowak
Einbanddecken
Jahrgang 1925 (Band XIV)
Mark 1.50
und 30 Pfg. Postgeld und Verpackung
Landesverein
Sächsischer Heimatschutz
Dresden-A., Schießgasse 24
Bestellkarte inliegend!
Werbt
für unseren
Heimatschutz
Vergeßt die Beitragszahlungen nicht!
Anmeldekarte inliegend!
Zahlkarte inliegend!
Lehmannsche Buchdruckerei, Dresden-N.
Weitere Anmerkungen zur Transkription
Offensichtliche Fehler wurden stillschweigend korrigiert. Die Darstellung der Ellipsen wurde vereinheitlicht.
Korrekturen: